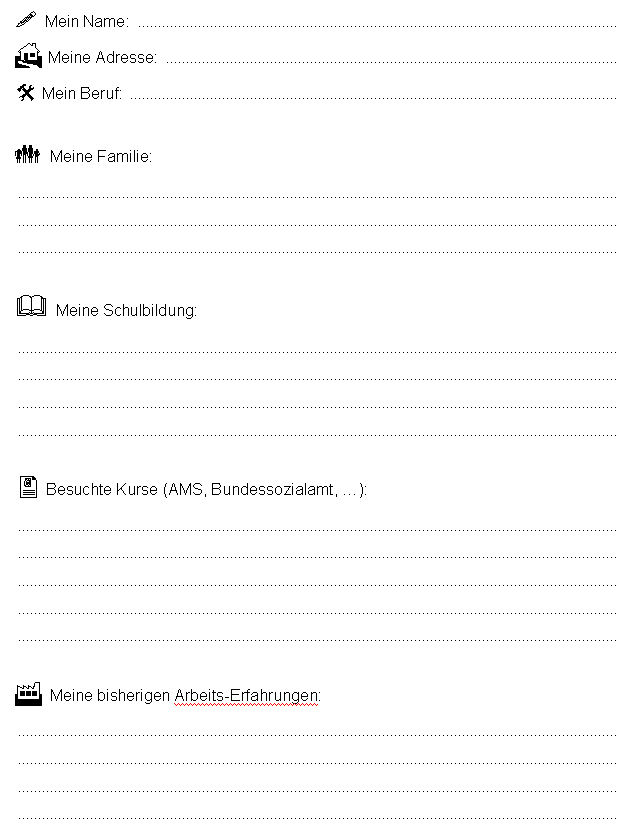Diplomarbeit an der Universität Wien, Diplomstudium Pädagogik, angestrebter akademischer Grad: Magister der Philosophie (Mag.phil.) Betreuerin: Univ.-Ass. Mag. Dr. Helga Fasching
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Erklärung
- Einleitung
- I Theoretischer Teil
- 1. Inklusion und Exklusion
- 2. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
- 3. Teilhabe als neue Entscheidungsdimension
- 4 Barrieren bei der berufliche Teilhabe
- 5. Unterstützung bei der beruflichen Teilhabe
- 6. Überlegungen zur Nachhaltigkeit
- II Empirischer Teil
- 7. Ausweisung der konkreten Fragestellungen
-
8. Methodisches Vorgehen
- 8.1 Methodisches Vorgehen bei der Datenerhebung
- 8.2 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung
- 8.3 Kommunikative Validierung
-
8.4 Vorstellung der Interviewpartnerinnen und -partner mittels Falldarstellung
- 8.4.1 Interview I: Herr Atter
- 8.4.2 Interview II: Fr. Berger
- 8.4.3 Interview III: Fr. Cyrer
- 8.4.4 Interview IV: Fr. Dietmaier
- 8.4.5 Interview V: Herr Erber
- 8.4.6 Interview VI: Fr. Fink
- 8.4.7 Interview VII: Fr. Gartner
- 8.4.8 Interview VIII: Fr. Händel
- 8.4.9 Interview IX: Fr. Inner
- 8.4.10 Interview X: Herr Jarmer
- 9. Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- 10. Diskussion der Ergebnisse
-
11. Zusammenfassung und Ausblick
- 11.1 Welche beruflichen Teilhabeerfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?
- 11.2 Wie nachhaltig ist eine Vermittlung junger Menschen mit Lernbehinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt?
- 11.3 Welche (pädagogischen) Unterstützungsmaßnahmen erhielten bzw. erhalten die jungen Frauen und Männer?
- 11.4 Wo zeigt sich zusätzlicher Bedarf an Unterstützung für diese Zielgruppe?
- 11.5 Welchen besonderen Unterstützungsbedarf weisen junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern mit Lernbehinderung auf?
- 11.6 Ausblick
- III Literaturverzeichnis
- IV. Abbildungsverzeichnis
- V. Anhang zur Diplomarbeit
- 12. Kurzfassung der Diplomarbeit
- 13. Abstract
- 14. Interviewleitfaden für die Befragung der jungen Frauen und Männer
- 15. Kurzfragebogen
- 16. Behindertenrechtliche Aspekte in Österreich
- 17. Lebenslauf
- 18. Zuordnungstabellen nach Mayring
Ich möchte mich bei folgenden Personen, welche am Zustandekommen dieser Diplomarbeit direkt oder indirekt beteiligt waren, bedanken:
Bei Univ.-Ass. Mag.a Dr.in Helga Fasching für ihre kompetente und äußerst engagierte Betreuung und Begleitung dieser Diplomarbeit.
Bei Mag.a Petra Pinetz, welche mir im Zuge einer Lehrveranstaltung bzw. eines wissenschaftlichen Praktikums die Auswertungsmethode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, kompetent und verständlich näher gebracht hat.
Bei meiner Familie und meinem Lebensgefährten Alexander für die moralische Unterstützung, für ihr Verständnis, ihre Geduld und ihre Liebe.
Bei Karina Schwarzbauer und Katja Karlovits für den gedanklichen Austausch, fürs Besprechen von Problemen und fürs Korrekturlesen dieser Arbeit.
Bei Sandra Surböck für die wertvollste Freundschaft, die ich mir vorstellen kann, sowie fürs Korrekturlesen dieser Diplomarbeit.
Ich versichere, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst, andere als die angeführten Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe.
Ich versichere darüber hinaus, dass ich diese Diplomarbeit bisher weder im In- oder Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe.
Datum Unterschrift
Inhaltsverzeichnis
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den beruflichen Teilhabeerfahrungen junger Menschen mit Behinderung sowie den Unterstützungsleistungen, die oftmals benötigt werden, um die Nachhaltigkeit beruflicher Teilhabe von Menschen mit Behinderung sicher zu stellen. Dadurch sowie durch den Fokus auf das subjektiv Erlebte trägt diese Diplomarbeit der derzeit hochaktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion im Sozialbereich Rechnung und leistet eben durch den Einbezug der Nutzer- und Nutzerinnensichtweise sozialer Angebote und Leistungen einen Beitrag zur Qualitätsdiskussion.
War es früher eine Demonstration von Macht, Ansehen und Vorrangstellung, nicht arbeiten zu müssen, so "ist es heute zum Privileg geworden, Arbeit zu haben" (Doose 2007, S. 66). Dabei befriedigt die Tatsache, einen Job zu haben bzw. arbeiten zu können / dürfen nicht nur das Bedürfnis des Menschen nach materieller Existenzsicherung, wie dies Doose (2007, S. 65) festhält. Erwerbsarbeit hat auch viele andere Funktionen (vgl. ebd.) wie die Gewährleistung sozialer Sicherheit oder die Sicherstellung sozialer Einbindung. Dies ist besonders für Menschen mit Behinderung von zentraler Bedeutung. Deshalb hat die Möglichkeit zu arbeiten für Menschen mit Behinderung vielleicht sogar noch größere Gewichtung als für nicht-behinderte Menschen (vgl. Spiess 2004, S. 52-55). Es ist bspw. feststellbar, "daß behinderte Menschen die Ausübung einer Arbeitstätigkeit als höheren Statusgewinn empfinden als Menschen ohne Behinderung" (Schubert 1996, S. 511, zit. n. Spiess 2004, S. 53). Durch die vermehrten Ausschlusserfahrungen, welche die meisten Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Lebens sammeln, bedeutet das Eingebunden-Sein in die Arbeitswelt, in einen Betrieb, in ein Kollegium von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer Firma für sie nicht nur ein fixes Einkommen und einen gewissen beruflichen Status, sondern auch die Erfahrung des Einschlusses und der Integration in die Gesellschaft, anstatt des ewigen Ausschlusses. Es bedeutet für sie eine Teilhabe am Erwerbsleben, welche jedoch in vielen Fällen einer Unterstützung durch unterschiedliche Stellen bedarf, um diese dauerhaft, d.h. nachhaltig zu sichern. Die Nachhaltigkeit einer solchen beruflichen Integration bzw. die konkreten beruflichen Teilhabeerfahrungen, gerade von jungen Menschen mit Lernbehinderung stehen als Forschungsfeld innerhalb der Beruflichen Rehabilitation jedoch, besonders auch in Österreich, nach wie vor weitgehend offen.
Zwar veröffentlichte Spiess (vgl. 2004) im Rahmen ihrer Dissertation ihre Forschungen zu den beruflichen Lebensverläufen und Entwicklungsperspektiven behinderter Personen, welche aus einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) den Schritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt gewagt haben. Sie führte dazu 36 Interviews mit Betroffenen, welche mindestens drei bis vier Jahre zuvor eine WfbM verlassen hatten. Jedoch war auch hierbei der Fokus auf Erwachsene gelegt, welche bereits Arbeitserfahrungen innerhalb eines WfbM sammeln konnten.
Auch Doose (vgl. 2007) beschäftigte sich im Rahmen seiner Dissertation mit der nachhaltigen beruflichen Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Er untersuchte im Rahmen einer Verbleibs- und Verlaufsstudie, wie das berufliche Leben seiner Probandinnen und Probanden innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahre verlaufen ist. Dabei legte er sein Hauptaugenmerk sowohl auf Menschen mit Werkstättenerfahrung, als auch auf solche, die durch Integrationsfachdienste in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt werden konnten. Er stellte u. a. Vergleiche zwischen diesen beiden Gruppen an und interessierte sich vor allem für die Nachhaltigkeit der vermittelten Arbeitsverhältnisse. Sein Vorgehen muss jedoch als quantitativ bezeichnet werden, da er seine Daten mittels Fragebögen erhoben und quantitativ ausgewertet hat. Dabei standen jedoch ebenfalls nicht Jugendliche, sondern allgemein Menschen mit Lernbehinderung im Mittelpunkt seiner Forschungsintention.
Neben diesen sehr aktuellen Studien wäre im thematischen Zusammenhang noch die Arbeit von Plath / König / Jungkunst aus dem Jahr 1996 zu nennen. In Form einer Fragebogenerhebung mit anschließender quantitativer Auswertung ist es die Intention der Autoren aufzuzeigen, wie es mit der beruflichen Konsolidierung junger Frauen und Männer mit Behinderung vier bis fünf Jahre nach erfolgreich abgeschlossener beruflicher Erstausbildung aussieht. Dabei wurde nach dem Verbleib der Jugendlichen sowie nach weiteren Aspekten ihrer beruflichen und sozialen Integration gefragt. Außerdem wurde der Fokus darauf gelegt, quasi eine Definition für den Erfolg beruflicher und sozialer Integration bzw. Kriterien zu finden, welche diesen beeinflussen können. Die subjektive Sichtweise der jugendlichen Probanden und Probandinnen, ihre konkreten Teilhabeerfahrungen, konnten dabei aufgrund des quantitativen Forschungsdesigns jedoch nur wenig bis gar nicht berücksichtigt werden.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes[1] der Universität Wien unter der Leitung von Univ.-Ass. Mag.a Dr.in Helga Fasching kam es zur Verfassung der vorliegenden Diplomarbeit. Dabei wird im theoretischen Teil die oben erwähnte Thematik genauer nachgezeichnet und um den Aspekt der Bedeutung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung bzw. um mögliche Barrieren für die Erlangung einer solchen Partizipation ergänzt. Im empirischen Teil werden, bezugnehmend auf die zentrale Forschungsfrage dieser Diplomarbeit:
Welche beruflichen Teilhabeerfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?
zehn Problemzentrierte Interviews mit jungen Menschen mit Lernbehinderung nach der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2007a) ausgewertet. Dabei werden die subjektiven Erfahrungen der Zielgruppe in den Vordergrund gerückt. Durch eben diesen Einbezug der Nutzer- und Nutzerinnensichtweise leistet diese Diplomarbeit einen eigenständigen Beitrag zur aktuellen Qualitätssicherung.
Grundsätzlich lässt sich die vorliegende Diplomarbeit in einen theoretischen sowie einen empirischen Teil gliedern, denen ein größer angelegter Anhang mit den für die Interviews notwendigen Mitteln (Interviewleitfaden, Kurzfragebogen) sowie mit weiterführenden kurzen Kapiteln zu in der Diplomarbeit zwar angeschnittenen, jedoch nicht ausgeführten Theorieimputs folgt.
Im ersten Kapitel des theoretischen Teils wird zunächst vom Verhältnis von Inklusion und Exklusion bzw. später im speziellen von unterschiedlichen Exklusionsmomenten nach Wansing (vgl. 2005a) ausgegangen, um die Bedeutung der Inklusion bzw. Teilhabe von Menschen mit Behinderung allgemein zu betonen.
Als eines der bedeutsamsten Dokumente der Teilhabe bzw. als Initiationspunkt eines Perspektiven- bzw. Paradigmenwechsels innerhalb der Behindertenarbeit wird im zweiten Kapitel die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) vorgestellt. Diese stellt den zentralen Bezugspunkt dieser Diplomarbeit dar, welchem alle weiteren Kapitel Folge leisten.
So wird im dritten Kapitel die Bedeutung der Teilhabe, respektive der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung Rechnung getragen, bevor es im vierten Kapitel um mögliche Barrieren einer beruflichen Teilhabe von jungen Menschen mit Behinderung geht. Dabei wird in Anlehnung an die ICF zwischen umwelt- und personbezogenen Faktoren, welche die Teilhabe beeinflussen können, unterschieden. Besonders die Geschlechtsproblematik wird hierbei hervorgehoben, um dadurch einer der Unterfragestellungen dieses Forschungsvorhabens zu genügen.
Im fünften Kapitel geht es dann um Unterstützungsleistungen, welche sowohl innerbetrieblich, als auch außerbetrieblich dazu beitragen können, die zuvor erwähnten Barrieren abzubauen und berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen bzw. zu sichern.
Im sechsten und letzten Kapitel des Theorieteils schließlich folgen einige Überlegungen zur Nachhaltigkeit, wobei zunächst das Konzept der Nachhaltigkeit, danach die Bedeutung der subjektiven und qualitativen Komponente dieses Konzeptes vorgestellt wird.
Der empirische Teil dieser Diplomarbeit stellt zunächst im siebten Kapitel die zugrunde liegenden Forschungsfragen sowie die Forschungsmethodik vor (achtes Kapitel), mit der an die Beantwortung dieser Fragestellungen herangegangen wurde. Dabei wird auch auf aufgetretene Probleme im Forschungsprozess sowie auf die Validierung der empirischen Daten eingegangen. Danach werden die zehn Interviewpartnerinnen und -partner kurz und formlos mittels Falldarstellungen narrativ vorgestellt, um ein besseres Verständnis ihrer derzeitigen beruflichen Situation und ihres Werdegangs geben zu können.
Den Hauptaspekt des empirischen Teils macht daran anschließend im neunten Kapitel die Darstellung der konkreten Untersuchungsergebnisse bzw. deren Diskussion und Interpretation (zehntes Kapitel) aus. Das elfte und letzte Kapitel schließlich geht auf die konkreten Fragestellungen der Diplomarbeit in Form einer Zusammenführung des bisher Gesagten sowie mittels eines Ausblicks ein.
Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage kann sowohl im täglichen Leben, als auch bspw. in der österreichischen Gesetzgebung überprüft werden[2].
Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Phänomen "Behinderung betrachtet, erhält man mehr oder weniger ausdifferenzierte Unterscheidungsmerkmale. Generell wird "Behinderung" meist zu allererst aus medizinischer Perspektive untersucht. Dabei wird die Art der Behinderung, d.h. die Art und Weise, in welcher eine negative Veränderung einer körperlichen Struktur oder Funktion vorliegt, sowie ihre Schwere, d.h. das Ausmaß, in welchem die jeweilige Körperfunktion beeinträchtigt ist, festgestellt. Danach wird versucht, die Behinderung der einzelnen Person einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, diese also zu klassifizieren. Auch hierbei spielen die verschiedensten Gesichtspunkte, wie die Entstehungsfaktoren (vgl. hierzu nachfolgendes Kapitel zur ICF) oder die Konsequenzen der Behinderung eine Rolle. Es werden pränatal von peri- oder postnatal entstandenen Behinderungen unterschieden, ebenso wie leichte von schwereren oder schwersten.
Im Laufe des Lebens eines Menschen mit Behinderung wird dieser immer wieder medizinisch getestet, diagnostiziert und klassifiziert. Oftmals ergeben sich deshalb unterschiedliche Diagnosen. Allen jedoch gemein, ist im Regelfall das Etikett der "Behinderung". Dieses kann sich zum einen negativ auf das Leben der betroffenen Person auswirken, bspw. durch damit verbundene Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrungen, welche die meisten Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Lebens machen (siehe dazu späteres Kapitel). Zum anderen ist das Etikett der "Behinderung" jedoch auch notwendig, um den Betroffenen die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen zusprechen zu können, welche es ihnen ermöglichen sollen, bestmöglich am Leben der Gesellschaft partizipieren zu können.
Da das österreichische Behindertenrecht eine so genannte "Querschnittsmaterie" darstellt, d.h. verschiedene Ministerien für die unterschiedlichen Belange behinderter Menschen zuständig sind, existieren in Österreich auch mehrere, neben einander bestehende Behindertendefinitionen, je nachdem, um welchen Gesetzestext bzw. um welche Materie es sich jeweils handelt (vgl. BMASK 2009, S. 4).
Die hier vorliegende Diplomarbeit orientiert sich an der seit 1.1.2006 gültigen Behindertendefinition des Behinderteneinstellungsgesetzes, da dieses für den Arbeitsbereich, um welchen es in dieser Arbeit geht, die meiste Bedeutung hat (vgl. hierzu das entsprechende Kapitel im Anhang dieser Diplomarbeit):
"Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilnahme am Arbeitsleben zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten" (BMASK 2009, S. 4).
Wie bereits angedeutet und auch in der Behinderungsdefinition des BEinstG ersichtlich, können Funktionsbeeinträchtigungen eines Menschen unterschiedlicher Natur sein. So werden zunächst körperliche, geistige, psychische sowie Beeinträchtigungen der Sinnesorgane von einander unterschieden. Doch auch innerhalb dieser Differenzierung existieren Verschiedenheiten. Generell gesehen, leben in Österreich 1,7 Mio. Menschen, welche eine wie auch immer geartete dauerhafte Beeinträchtigung aufweisen (vgl. BMASK 2009, S. 21). In vielen Fällen würde man jedoch im Alltag nicht von einer "Behinderung" sprechen, da in dieser Zahl bspw. auch Menschen mit leichten Seh- oder Hörbeeinträchtigungen enthalten sind.
Wird diese Gesamtanzahl nun nach unterschiedlichen Behinderungsarten differenziert, ergibt sich für den Bereich der geistigen Behinderung bzw. der Menschen mit Lernproblemen ein Prozentwert von rund 1,0 % der Gesamtbevölkerung (vgl. ebd., S. 24). Das bedeutet, dass rund 85.000 Menschen in Österreich von "geistigen Problemen oder Lernproblemen [...] dauerhaft betroffen" (BMASK 2009, S. 24) sind, wobei sich deren Anzahl jeweils ungefähr zur Hälfte aus Frauen und Männern zusammensetzt[3].
Wie allerdings aus den Angaben des Bundesministeriums ersichtlich, wird in der Anzahl der Menschen mit geistiger Behinderung nicht zwischen "geistigen Problemen" und "Lernproblemen" unterschieden. Tatsächlich stellt die genaue Definition bzw. Unterscheidung von geistiger Behinderung und Lernbehinderung nach wie vor einen Graubereich innerhalb der Diagnostik dar, wie dies auch schon Spiess (2004, S. 34-40) in ihrer Dissertation darstellte:
"Geistig behindert zu sein, kann sich niemand vorstellen. Die Denkweise eines anderen Menschen können wir nicht beobachten. Viele körperliche Behinderungen können durch bauliche Maßnahmen und durch den Einsatz von Hilfsmitteln in ihrer Funktionsfähigkeit weitgehend kompensiert werden, aber für geistige Behinderung gilt dies nicht" (Spiess 2004, S. 35).
"Verglichen mit anderen Behinderungsarten spielen medizinische Aspekte für die Diagnose Lernbehinderung eine untergeordnete Rolle. Lernbehinderung wird dann diagnostiziert, wenn Schüler/innen in ihrem schulischen Leben soweit im Rückstand sind, dass es in der allgemeinen Schule des deutschen Bildungssystems nicht mehr kompensierbar und tolerierbar erscheint" (ebd., S. 36).
"Auch die Begriffe geistige Behinderung und Lernbehinderung und ihre Abgrenzungen erfahren aktuell heftige Kritik wegen ihrer diskriminierenden Wirkung und der Ungenauigkeit, die ihre Verwendung beinhaltet. [...] Personen, bei denen die Lernbehinderung als besonders schwerwiegend oder die geistige Behinderung als relativ leicht eingeschätzt wird, ‚sind als Grenzfälle dem Überlappungsbereich von Lernbehinderung und geistiger Behinderung zuzurechnen' " (ebd., S. 38).
Wie aus diesen drei Zitaten ersichtlich, sind die Begriffe "geistige Behinderung" und "Lernbehinderung" schwer definier- und unterscheidbar. Immer wieder kommt es zu Überschneidungen und Ungenauigkeiten aufgrund der kaum nachvollziehbaren Funktionsbeeinträchtigung der betroffenen Personen. Gerade deshalb und aufgrund der Tatsache, dass zunehmend auch erwachsene Menschen, d.h. Personen außerhalb des Schulbereiches, im Zuge der Weiterbildungsbestrebungen der modernen Leistungsgesellschaft als "lernbehindert" bezeichnet werden, stellt diese Personengruppe eine bislang fast vernachlässigte Forschungszielgruppe dar.
Als noch weniger erforscht kann die Gruppe der jungen Frauen und Männer mit Lernbehinderung angesehen werden, welche ihre Schulzeit bereits abgeschlossen haben und nun ins Erwerbsleben einsteigen möchten bzw. diesen Einstieg bereits geschafft haben. Fasching (vgl. 2004a) beschäftigte sich im Zuge ihrer Dissertation mit dieser Zielgruppe und den Unterstützungsleistungen, welche die Maßnahme der Arbeitsassistenz für sie beim Berufseinstieg bereitstellen kann. In diesem Zusammenhang verweist die Autorin auch auf die 2002 von Kanter / Scharff geprägte Definition von Lernbehinderung im nachschulischen Bereich, welche auch als Verständnisgrundlage dieser Diplomarbeit gelten soll:
"Jugendliche sind dann als lernbehindert anzusehen und in besondere Rehabilitationsmaßnahmen einzubeziehen, wenn sie
-
umfänglich und lang andauernd in ihrem schulischen und berufsbezogenen Lernen beeinträchtigt sind,
-
deutlich von der Altersnorm abweichende Leistungs- und Verhaltensformen aufweisen
-
und trotz des Angebots besonderer vorbereitender Maßnahmen in anerkannten Ausbildungsberufen auf dem üblichen Weg keinen qualifizierten Abschluss erreichen können" (Kanter / Scharff 2002, S. 159; zit. n. Fasching 2004a, S. 33).
Der dritte und letzte Punkt der Definition ist im Hinblick auf die Interviewpersonen des empirischen Teils dieser Diplomarbeit zu überdenken, da es hier sehr wohl junge Menschen gibt, welche trotz ihrer Lernbehinderung einen beruflichen Abschluss erlangen konnten. Allerdings waren hierzu zumeist mehr oder weniger ausgeprägte Unterstützungsleistungen notwendig (vgl. empirischer Teil dieser Diplomarbeit).
[1] Titel des Forschungsprojektes: "Berufliche Teilhabe von jungen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen", Auftraggeber: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; Dauer: 2008 - 2009.
[2] Die vorliegende Diplomarbeit verwendet eine respektvolle und geschlechtsspezifische Sprache, sodass mit Ausnahme von Zitaten durchgängig von "Menschen mit Behinderung" gesprochen wird bzw. bei Hauptworten beide Geschlechter genannt werden.
[3] Diese Zielgruppe ist für die hier vorliegende Diplomarbeit besonders von Bedeutung, da alle interviewten Personen eine Lernbehinderung aufweisen, auch wenn hier in einigen Fällen bspw. eine körperliche Behinderung hinzukommt (vgl. Kapitel 8.4. - Vorstellung der Interviewpartnerinnen und -partner mittels Falldarstellungen).
Inhaltsverzeichnis
Bevor in der hier vorliegenden Diplomarbeit von der Exklusion von Menschen mit Behinderung ausgegangen wird, um später auf die Bedeutung deren Inklusion bzw. Teilhabe am Erwerbsleben und deren Teilhabeerfahrungen hinzuweisen, scheint es ratsam zu klären, was unter den Begriffen "Inklusion" und "Exklusion" zu verstehen ist, wie diese miteinander in Verbindung stehen und aus welchen Perspektiven diese betrachtet werden können.
Die Begriffe der "Inklusion" und "Exklusion" wurden erstmals durch die sog. "Salamanca-Konferenz" von 1994 für den Bereich der sonderpädagogischen Erziehung bedeutsam. Dort wurde in der englischsprachigen Originalfassung durchgehend von "inclusion" und "inclusive education" gesprochen. In der deutschsprachigen Übersetzung von 1996 jedoch wurden diese Begriffe nicht aufgegriffen, sondern mit "Integration" und "integrative Bildung" übersetzt, was zu einer Begriffsverwirrung und einer verspäteten Rezeption der deutschsprachigen Begriffe "Inklusion" und "Exklusion" geführt hat (vgl. Sander 2002; ders. 2006, S. 1).
Dabei stellt die Übernahme des Inklusionsbegriffes - wie innerhalb der Literatur proklamiert - den Beginn einer neuen Epoche sonderpädagogischen Denkens und Handelns dar (vgl. Bürli 1997; zit. n. ebd.). Der Schweizer Heilpädagoge Bürli gliederte die Geschichte der Sonderpädagogik in vier Epochen und zollt dadurch dem Begriff der "Inklusion" die notwendige Anerkennung: Exklusion - Separation - Integration - Inklusion. Während in der Phase der Exklusion Kinder und Jugendliche mit Behinderung von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen waren, wurden sie in der zweiten Phase ausgesondert und in Sondereinrichtungen unterrichtet. In der dritten Phase wurde begonnen, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in das Regelschulsystem einzugliedern, zu integrieren und sie gemeinsam mit nicht-behinderten Kindern und Jugendlichen zu unterrichten.
Inklusion als vierte und größtenteils zukünftige Epoche stellt "eine optimierte und umfassend erweiterte Integration (Sander 2006, S. 2) dar. Ihr geht es
"nicht [um] eine bloße Addition eines behinderten Kindes oder Jugendlichen mit persönlicher sonderpädagogischer Unterstützung in eine Regelschulklasse, sondern [um] die prinzipielle Berücksichtigung der Verschiedenheiten der Kinder im gemeinsamen Unterricht, [um] die Akzeptanz der natürlichen Vielfalt in der Klasse. [...] Weil die Unterschiedlichkeit des Kindes nicht mehr als störend empfunden wird, sondern als natürliche Ausgangslage und auch als Ziel der pädagogischen Arbeit gilt" (ebd., S. 3).
Legt man das hier Gesagte nun auf den gesellschaftlichen Bereich um, so bedeutet Inklusion von Menschen mit Behinderung schlichtweg, dass diese Gruppe von Menschen nicht mehr als Randgruppe bzw. als besondere Gruppe gesehen wird, sondern als Teil der natürlichen Vielfalt des menschlichen Lebens einfach gar nicht mehr besonders beachtet wird. Bei Inklusion geht es darum, die Besonderung von Menschen mit Behinderung aufzuheben, und sie als nur eine mögliche Ausprägung menschlichen Daseins anzusehen. Dasselbe gibt Hinz (vgl. 2006, o. S.) zu bedenken, wenn er als Kernpunkte von Inklusion u. a. auflistet, dass diese alle Ausprägungen von Heterogenität erfasse, Menschen mit Behinderung eben nur als "eine von vielen Minderheiten" (ebd.) verstehe und die derzeit vorherrschende dichotome Einteilung der Bevölkerung in männlich / weiblich, behindert / nicht behindert etc, "zugunsten eines ununterteilbaren Kontinuums" (ebd.) auflösen möchte.
Was aus heilpädagogischer Sicht ein entferntes Ziel der Zukunft darstellt, da wir uns - wie Sander (vgl. 2006, S. 2) dies feststellte - derzeit irgendwo zwischen der Phase der Separation und der Integration befinden, ist aus soziologischer bzw. systemtheoretischer Perspektive längst Realität. So schreibt Exner (vgl. 2007, S. 170) in Anlehnung an diverse Vorarbeiten, dass sich Menschen gar nicht außerhalb der Gesellschaft befinden können, da es dort nichts Gesellschaftliches gebe.
"Daran ändert auch der Tatbestand nichts, daß [sic!] etliche behinderte Menschen tatsächlich eingeschränkte und/oder keine Teilnahmemöglichkeiten im Hinblick auf verschiedene Sozialitäten haben und stattdessen in Sondereinrichtungen eingebunden sind. [...] auch derartige Einrichtungen gehören zur ‚sozialen Welt' (Exner 2007, S. 171).
In diesem Verständnis, welches vor allem durch die Systemtheorie Luhmanns geprägt ist, existiert demnach keine Exklusion von der Gesellschaft, sodass Menschen mit Behinderung folglich auch nicht in diese inkludiert werden müssen. Jeder / jede von uns ist beständiger Teil der Gesellschaft und kann auf gar keinen Fall aus dieser ausscheiden bzw. exkludiert werden, da es nichts gibt, was außerhalb der Gesellschaft existieren würde. Gesellschaft bildet damit sozusagen das Hauptsystem menschlichen Lebens, welches sich in viele Teil- oder Subsysteme gliedert. Der Autor gibt in dieser Hinsicht jedoch zu bedenken, dass es für "behinderte Menschen durchaus auch zur ‚Aussonderung' kommen [kann]. Entsprechende Aussonderungen und Ausschlüsse können sich jedoch nie auf die ganze Gesellschaft beziehen, sondern immer nur auf konkrete Teilbereiche oder Sozialsysteme der Gesellschaft" (ebd., S. 174). Eben solche Teilbereiche, aus denen Menschen mit Behinderung tagtäglich exkludiert, d.h. ausgeschlossen werden, beschreibt die Soziologin Wansing (vgl. 2005a; 2005b). Diese Ausschlussmomente sollen den Ausgangspunkt für die Überlegungen der hier vorliegenden Diplomarbeit darstellen und werden deshalb im Folgenden beschrieben.
Menschen mit Behinderung sind im Allgemeinen stark von Ausgrenzung betroffen. Diese Ausschlusserfahrungen beschränken sich dabei nicht auf einen konkreten Lebensbereich, sondern lassen sich in allen Lebensbereichen feststellen. Barton (2008, o. S.) postuliert ebendies folgender Maßen:
"The nature of exclusion and discrimination is complex and varied, including for example, being treated - as - [sic!] less than human; being viewed exclusively as objects of charity; being seen as in need of protection and control; being excluded from the work force; living on or below poverty line; being unable to experience the entitlements of citizenship resulting in a lack of real participation in social encounters and decisions over issues affecting their lives; being voiceless and thus seen as passive recipients of actions and intentions by those constituted as experts."
Wansing (vgl. 2005a, S. 83-99) nennt in diesem Zusammenhang ebenfalls verschiedene Ausschlussmomente für Menschen mit Behinderung und spricht in weiterer Folge von einer "Exklusionskarriere Behinderung" (Wansing 2005a, S. 99; dies. 2005b, S. 26), welche "an den institutionalisierten Nahtstellen von Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Rente [sogar beschleunigt wird]" (ebd.). Diese Ausschlussmomente lassen sich in den Bereichen "ökonomische Ausgrenzung", "Ausgrenzung im Bildungssystem", "soziale Isolation und Diskriminierung" sowie "Barrieren im Zugang zur Umwelt und zu Dienstleistungen" feststellen:
Unter "ökonomischer Ausgrenzung" subsumiert Wansing (vgl. 2005a, S. 83-89) sowohl den Bereich der Beschäftigung, als auch den damit verbundenen finanziellen Aspekt. Bezug nehmend auf die allgemein schlechte Arbeitsmarktlage, gibt die Autorin zu bedenken, dass
"sowohl die niedrige Erwerbsbeteiligung als auch die hohe und lang anhaltende Arbeitslosigkeit behinderter Menschen [...] deutliche Zeichen eines erhöhten Exklusionsrisikos [sind], das aufgrund der zentralen Beurteilung von Arbeit die Inklusionschancen auch anderer gesellschaftlicher Bereiche nachhaltig senkt" (ebd., S. 84).
Hier verweist Wansing auf die unterschiedlichen Funktionen, welche Erwerbsarbeit innehaben und erfüllen kann (vgl. Kapitel "Funktionen von Erwerbsarbeit" im Anhang). Ein Ausschluss vom Erwerbsleben bewirkt nicht nur ein Sinken des Lebensstandards einer Person aufgrund des niedrigeren Einkommens, sondern korreliert auch mit dem Fehlen sozialer Kontakte bzw. der Verschlechterung des eigenen Selbstwertgefühls (vgl. Spiess 2004; Doose 2007).
Besonders bei Menschen mit Behinderung, welche ohnehin einen zumeist eng begrenzten Bekanntschaftskreis aufweisen, spielt die soziale Komponente ihrer Erwerbsbeteiligung eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Die "Ausgrenzung im Bildungssystem" bezieht sich (vgl. Wansing 2005a, S. 89) nicht auf einen Ausschluss von der Schulpflicht bzw. gar einem Absprechen von Bildungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, wie dies in früheren Zeiten üblich war. Hierunter werden vielmehr die verminderten Bildungschancen verstanden, mit welchen Menschen mit Behinderung im Vergleich zu nicht-behinderten Menschen konfrontiert sind. Besonders für Absolventinnen und Absolventen von Sonderschuleinrichtungen stellen sich die Erfolgschancen im weiteren Lebensverlauf als stark minimiert dar. In einem anderen Textbeitrag aus dem Jahr 2005 verweist die Autorin unter Bezugnahme auf die Vorarbeiten von Schüller explizit auf diesen Umstand:
"Auch nach dem Schulabschluss bleibt [...] die Lebensführung für Jugendliche mit Behinderung risikoreich und mündet vor allem für Abgänger der Schule für Geistigbehinderte in eine Fortsetzung der organisationalen Ausgrenzung in Berufsbildungs- und -förderungswerke bzw. in den Arbeitsbereich der Werkstätten. Häufig sind die Werkstätten für sie das einzige Instrument zur beruflichen Bildung und zur Beschäftigung, Regelarbeitsplätze hingegen spielen für diesen Personenkreis immer noch eine marginale Rolle" (vgl. Schüller 2003; zit. n. Wansing 2005b, S. 26).
Eine Ausgrenzung im Bildungsbereich führt, so die Aussage des Zitats, unweigerlich zu einem weiterführenden Ausschluss im Erwerbsleben. Ohne ausreichende Bildung stehen heutzutage nur noch wenige Berufssparten offen. Auch Fasching (2004a) verweist auf diesen Umstand und die verminderte Teilhabe behinderter Jugendlicher aufgrund ihrer schlechteren Ausbildungslage.
"Bevor Jugendliche ihren Platz im Arbeitsleben suchen können, müssen sie zunächst den Übergang dorthin bewältigen. Dies gilt in gleichem Maße für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Für Jugendliche mit Behinderung scheint sich der Übergang ins Arbeitsleben jedoch schwieriger zu gestalten. Zum einen haben sie die schlechteren Ausgangschancen aufgrund eines geringerwertigen oder gar fehlenden Schulabschlusses. Zum anderen stehen ihnen bei weitem nicht so viele Möglichkeiten nach der Schule offen wie für Jugendliche ohne Behinderung" (Fasching 2004a, S. 34).
Jedoch ist auch im Bereich der Erwachsenenbildung die Lage für Menschen mit Behinderung als schlecht zu bezeichnen (vgl. Wansing 2005a, S. 90f.). Nicht nur, dass für diesen Personenkreis zu wenig Angebote existieren. Betrachtet man die wenigen angebotenen Inhalte, wird deutlich, dass diese, besonders für Menschen mit intellektuellen Einschränkungen, vor allem in den Bereichen der Freizeitgestaltung liegen und wenig Bezug zur beruflichen Weiterbildung aufweisen. Dadurch wird auch hier die Teilhabe behinderter Menschen am Erwerbsleben erschwert.
"Soziale Isolation und Diskriminierung" subsumiert ausschließende Erfahrungen, die Menschen mit Behinderung im Allgemeinen innerhalb ihrer Sozialstruktur sammeln. Es sind dies Erfahrungen des häufigen Fehlens intimer Beziehungen, enger Freundschaften und Bekanntschaften, sowie grundsätzlich "diskriminierende Erfahrungen im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen" (Wansing 2005a, S. 93). So wurden zwei Drittel der Probandinnen (nur weibliche Befragte) einer im Jahr 2000 durchgeführten Befragung "ungefragt geduzt oder angefasst, ignoriert oder einfach nicht für ‚voll' genommen, unverhohlen angestarrt oder gar direkt beschimpft" (Eiermann et al. 2000, S. 120, zit. n. ebd.). Besonders im Sozialleben tritt demnach die einschränkende und beeinträchtigende Komponente einer Behinderung besonders deutlich zum Vorschein. Auch dieser Aspekt wird, wie bereits dargelegt wurde, durch einen Ausschluss aus dem Lebensbereich der Erwerbsarbeit begünstigt und gefördert. Durch den Wegfall der sozialen Kontakte, welche zu Kolleginnen und Kollegen an der jeweiligen Arbeitsstelle bestehen, wird der Bekanntenkreis behinderter Menschen zumeist auf einige wenige, häufig Mitglieder der eigenen Herkunftsfamilie, beschränkt. Das Sozialverhalten dieser Menschen wird aufgrund des Fehlens sozialer Kontakte oft nur unzureichend ausgebildet, wodurch in weiterer Folge wiederum Auffälligkeiten in diesem Bereich entstehen. Diese führen in einer Art "Teufelskreis" wiederum zu einem Ausschluss der Betroffenen, da sie als nicht sozial verträglich erscheinen und von weiten Teilen der Bevölkerung gemieden werden. Einer Diskriminierung folgt somit eine weitere, sie reproduziert sich de facto selbst.
Auch Cloerkes (2007) kommt in dieser Hinsicht zu ähnlichen Ergebnissen. Er geht nämlich davon aus, dass soziale Kontakte nicht-behinderter Menschen ihre Einstellungen ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Behinderung gegenüber beeinflussen können. "Zwischen Kontakt mit behinderten Menschen und den Einstellungen gegenüber Behinderten existiert eine Kausalbeziehung" (Cloerkes 2007, S. 151), formuliert der Autor seine These. Um eine positive Einstellungsänderung hervorzurufen, sei jedoch nicht die bloße Tatsache des Kontakts entscheidend, sondern dessen Qualität und vor allem die freiwillige Bereitschaft beider Seiten, diesen Kontakt einzugehen. Ohne eine solche Bereitwilligkeit kann der soziale Kontakt zu Menschen mit Behinderung sogar zu einer Verschlechterung der Einstellungen ihnen gegenüber führen (vgl. Cloerkes 2007, S. 145-151).
Der soziale Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung kann es demnach begünstigen, dass Vorurteile abgebaut und sich negative Einstellungen behinderten Menschen gegenüber positiv verändern. Dadurch kann eine Diskriminierung behinderter Menschen gemildert werden, sodass die betroffenen Personen Einschlusserfahrungen machen und sich als Teil der Gesellschaft fühlen können. Wird dieser soziale Kontakt jedoch be- oder sogar verhindert, drohen Menschen mit Behinderung Ausschlusserfahrungen zu machen (vgl. Wansing 2005a, S. 93).
Unter "Barrieren im Zugang zur Umwelt und zu Dienstleistungen" werden sowohl Zugangsschwierigkeiten von Menschen mit Behinderung zu Gebäuden des öffentlichen Lebens, als auch Ausgrenzungs- und Diskriminierungstendenzen bei sozialen Dienstleistungen und innerhalb "der modernen Informationsgesellschaft" (Wansing 2005a, S. 96) verstanden, welchen Männer und Frauen mit Behinderung ausgesetzt sind. Im Sinne der baulichen Gegebenheiten werden die Zugangsbedingungen zu öffentlichen Gebäuden zwar zunehmend verbessert, sodass auch Menschen mit Behinderung diese barrierefrei nutzen können (vgl. hierzu § 6 Abs. 5 BGStG im Anhang dieser Arbeit). Dennoch bestehen immer noch unzählige Beispiele baulicher Ausgrenzungen. Auch der Mangel an persönlichen Kompetenzen behinderter Frauen und Männer, ihre eigene Mobilität betreffend, verstärkt die hier wirksamen ausschließenden Gegebenheiten.
In Bezug auf die sozialen Dienstleistungen, welche ein weiteres Exklusionsrisiko für Menschen mit Behinderung beinhalten, ist bspw. ein Kompetenzmangel der Medizinerinnen und Mediziner bei der Behandlung von und im Umgang mit Patientinnen und Patienten mit Behinderung festzustellen (vgl. Wansing 2005a, S. 94). Hierin stimmen die Autorin und der Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe e.V. (BeB) überein:
"Das System der medizinischen Regelversorgung (...) ist häufig nur ungenügend mit den gesundheitlichen Besonderheiten von Menschen mit [...] Behinderung vertraut und/oder nicht in der Lage, unter den bestehenden Erfordernissen und Besonderheiten ihrer gesundheitlichen Versorgung Rechnung zu tragen" (BeB 2001, S. 66; zit. n. ebd.; runde Klammern i. O.).
Besonders ältere Menschen mit Behinderung finden in unserem derzeitigen medizinischen Versorgungssystem wenige für sie passende Angebote, sodass sich hier eine starke Ausschlusstendenz behinderter Menschen zeigt (vgl. Wansing 2005a, S. 94).
Auch im Bereich der Daten- und Informationsvermittlung bzw. der Kommunikation stellt die Autorin Mängel in Bezug auf deren Nutzbarkeit seitens Frauen und Männern mit Behinderung fest. So sind viele moderne Technologien nicht an die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppe angepasst, sodass eine Teilhabe an der heutigen Informationsgesellschaft erschwert, in vielen Fällen sogar verhindert wird (vgl. ebd., S. 96-97).
In Anbetracht der von Wansing im Jahr 2005 zusammengetragenen Faktoren des sozialen Ausschlusses von Menschen mit Behinderung[4] kann festgehalten werden, dass dieser Personenkreis immer noch als zu den am stärksten Exklusion bedrohten bzw. betroffenen Personengruppen zählend angesehen werden kann. Die Autorin stellt dies wie folgt fest:
"In der internationalen Auseinandersetzung mit sozialer Exklusion wird Behinderung als einer der Hauptrisikofaktoren hervorgehoben; Menschen mit Behinderung werden deutlich als Bevölkerungsgruppe definiert, die potentiell von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht ist" (Wansing 2005a, S. 78).
Weiters kann jedoch mit der Autorin ausgewiesen werden, dass Behinderung nicht länger als rein individuumsbezogenes Problem angesehen werden kann und darf. Die symptomatischen Gegebenheiten einer Person sind nicht allein ausschlaggebend dafür, ob diese Person als "behindert" gilt oder nicht. Behinderung ist vielmehr ein gesellschaftliches Produkt, welches sich aus soziologischer Sichtweise aufgrund zahlreicher sozialer, ökonomischer und gesellschaftlicher Barrieren (vgl. die zuvor behandelten Ausschlussmomente) ergibt. Hier stimmt auch Cloerkes (2007) zu, wenn er davon spricht, dass "Behinderung [...] nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar [ist]. Nicht der Defekt, nicht die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum" (Cloerkes 2007, S. 9). Somit kann Behinderung als relative Größe verstanden werden.
Dieses Verständnis von Behinderung wurde bereits 2001 in der ICF, der International Classification of Functioning, Disability and Health, vertreten und festgehalten, welche als neue Denk- und Handlungsvorgabe der WHO die bis dahin gültige ICIDH (International Classification of Impairment, Disability and Health) abgelöst hat. Ausgehend von der Vielzahl der Exklusionsrisiken für Menschen mit Behinderung soll dieses richtungweisende Dokument mit seinen Konsequenzen sowohl für die theoretische und praktische Arbeit im Sozialbereich, als auch bspw. für die Politik nun im Anschluss dargestellt werden.
[4] Natürlich haben sich auch andere Autorinnen und Autoren mit dem Ausschluss behinderter Menschen intensiv befasst (vgl. Barton 2008). Die hier aufgezeigte Auflistung von Wansing (2005a) gibt jedoch in den Augen des Autors dieser Diplomarbeit eine sehr gute Übersicht über die Vielfalt der Ausschlussmomente, welchen sich Menschen mit Behinderung gegenüber gestellt sehen. Deshalb wurde die soziologische Arbeit von Wansing hier herangezogen, um den Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
Klassifikationen sind seit jeher sowohl notwendig, als auch umstritten. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz: ICF, stellt dabei keine Ausnahme dar. Sie wurde 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO beschlossen und gilt als eine Reformierung der seit 1980 gültigen ICIDH (International Classification of Impairment, Disability and Handicap). Diese definierte Behinderung als Dreiklang aus der körperlichen Schädigung (impairment), der sich daraus ergebenden Funktionsbeeinträchtigung (disability) sowie den damit einhergehenden sozialen Benachteiligungen (handicap) (vgl. Puschke 2005).
Bei der veralteten Klassifikation stand demnach die im Individuum angesiedelte körperliche Schädigung der einzelnen Person im Vordergrund. Durch diese war die Person in ihrer Funktionsfähigkeit bzw. in ihrem sozialen Leben beeinträchtigt. Dadurch bestand über lange Zeit hinweg der Eindruck, dass Menschen eben aufgrund ihrer körperlichen "Mängel" und "Defekte" als behindert anzusehen sein. Hollenweger (2006, S. 51) schrieb dazu: "[...] Die ICIDH [implizierte] einen direkten kausalen Zusammenhang: Aus einer Krankheit oder einem Gesundheitsproblem ergab sich eine Schädigung, die zu einer Leistungsminderung und deshalb auch zu einem Problem bezüglich der gesellschaftlichen Teilnahme führte." Folgende Grafik stellt dies optisch dar:
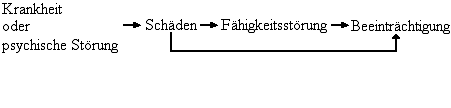
Abb.1: Krankheitsfolgemodell der ICIDH (vgl. Steingruber 2000)
Mit dem neuen Jahrtausend kam die Wende in der Behindertenarbeit. Wacker / Wansing / Hölscher (2003, S. 108) berichten von einem "Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe oder zumindest [von] einem Perspektivenwechsel", welcher durch den Beschluss der ICF im Mai 2001 durch die Vollversammlung der WHO eingeleitet wurde.
Auch die ICF geht, wie ihre Vorgängerin, von einem dreidimensionalen Verständnis von Behinderung aus. Die drei Komponenten sind jedoch nicht mehr Schädigung, Beeinträchtigung und Benachteiligung, sondern Körper, Aktivität und Partizipation. Diese drei Begriffe scheinen dabei nicht nur rein optisch einen positiveren Eindruck zu machen. Auch inhaltlich geht die neue Klassifikation nicht mehr von einem defizitären, individuumbezogenen Verständnis von Behinderung aus (dies war bei der ICIDH der Fall), sondern begünstigt eine ressourcen- und umweltorientierte Sichtweise. Dieser neuen Perspektive liegt das bio-psycho-soziale Modell der WHO zugrunde, welches die Soziologin Wansing mit folgenden Worten erklärt:
"Der ICF liegt ein bio-psycho-soziales Verständnis von Behinderung zugrunde, wonach Behinderung ein Oberbegriff ist für Schädigungen oder Beeinträchtigungen auf den Ebenen der Körperstrukturen [...] und Körperfunktionen [...], der Ebene der Aktivitäten [...] und der Ebene der Teilhabe [...]. Diese drei Bereiche beeinflussen sich wechselseitig und stehen in Abhängigkeit von Kontextfaktoren, womit der gesamte Lebenshintergrund eines Menschen gemeint ist" (Wansing 2005a, S. 79; Hervorhebung i. O.).
Es werden also sowohl die biologischen, als auch die psychischen und sozialen Aspekte der körperlichen Schädigung mit einbezogen. Diese stehen in Wechselwirkung mit den Komponenten der Aktivität und der Teilhabe sowie mit den Kontextfaktoren, welche zusätzlichen Einfluss auf alle anderen Aspekte des Modells ausüben. Im Zentrum dieser Klassifikation steht dabei der Begriff der "Funktionsfähigkeit", welcher über die funktionale Gesundheit eines Menschen Auskunft gibt. Dabei gilt:
"Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren -
-
ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körper-strukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und -strukturen),
-
sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten),
-
sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbereichen)" (DIMDI 2005, S. 4; Hervorhebung i. O.).
Die drei Faktoren, Körperfunktionen und -strukturen, Aktivität und Partizipation, stehen demnach in einem reziproken Verhältnis zueinander und bedingen einander. Nur in ihrem Zusammenwirken definieren sie Behinderung, sodass davon ausgegangen werden muss, dass Behinderung nicht allein durch eine körperliche Schädigung zustande kommt. Es muss immer auch deren potentiell beeinträchtigende Wirkung auf die Aktivitäten der jeweiligen Person und somit auf die Teilhabe dieses Menschen an einem bestimmten Lebensbereich berücksichtigt werden.
Die ICF stellt demzufolge den Körper eines Menschen mit seinen anatomischen Bestandteilen (Strukturen) und seinen Funktionen wie Wahrnehmen, Stoffwechsel etc. auf eine Ebene mit der Aktivität eines Menschen und seiner daraus resultierenden Partizipation. Diese Konstellation von Körper, Aktivität und Partizipation wird in der folgenden graphischen Darstellung sichtbar:
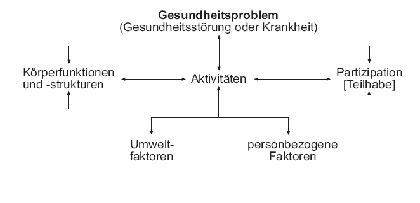
Abb. 2. Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (vgl. DIMDI 2005, S. 23)
Zusätzlich zu dem im Zentrum dieser Grafik stehenden Dreiklang werden innerhalb die ICF auch Kontextfaktoren in die Diskussion von Behinderung mit einbezogen. Diese stellen auf der einen Seite jene Faktoren der Umwelt einer Person dar, welche auf das Zustandekommen sowie die Auswirkungen einer Behinderung Einfluss nehmen können (wie bspw. Medikamente, technische Hilfsmittel, Unterstützung durch Freunde oder Familie etc.). Auf der anderen Seite werden unter dem Begriff "Kontextfaktoren" auch personbezogene Aspekte wie das Alter, das Geschlecht, die kulturelle und soziale Herkunft oder der Bildungsstand eines Menschen subsumiert (vgl. DIMDI 2005, S. 14). All diese Faktoren wirken zusätzlich in reziproker Weise auf das Dreigestirn aus Körper, Aktivität und Partizipation ein und umgekehrt, sodass Behinderung de-individualisiert und auf einer gesellschaftlichen Ebene gesehen wird. Nicht das Individuum mit seinen symptomatischen Gegebenheiten, sondern seine Aktivität und seine gesellschaftliche Teilhabe oder Nicht-Teilhabe bestimmen darüber, ob jemand als "behindert" gilt oder nicht. "Behinderung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichende Passung zwischen einer Person und den Umweltfaktoren vorliegt" (Wansing 2005a, S. 79).
Hier ist einer der großen Gegensätze zwischen ICIDH (1980) und ICF (2001) zu bemerken, welcher mitunter den Perspektivenwechsel innerhalb der Behindertenarbeit ausgemacht hat. Nicht mehr das Individuum mit seinen medizinischen und / oder psychiatrischen Symptomen zeichnet sich für seine Behinderung verantwortlich. Viel eher wird der Umwelt wesentliche Bedeutung beim Zustandekommen derselben beigemessen, wodurch sich Behinderung vom Individuum entfernt und ein "soziales Problem"[5] (Cloerkes 2007, S. 18) wird. Dabei lässt sich feststellen, dass soziale Probleme immer einem sozialen Wandel unterliegen, demnach nichts Statisches sind, sondern sich verändern können. Behinderung per se ist zu den alten, traditionellen sozialen Problemen wie Armut, Alkoholismus etc. zu zählen. Dennoch ist es nach Cloerkes hier zu "beachtliche[n] Entwicklungen im Problembewußtsein" (2007, S. 19) gekommen. Hollenweger (2006, S. 55) formulierte dieses neue Bewusstsein wie folgt: "Behinderungen werden zwar von Personen erfahren, aber sie sind ein durch soziale Prozesse bedingtes Phänomen".
Dieses neue Problembewusstsein, von welchem die Autorinnen und Autoren hier ausgehen, ist mitunter durch die Formulierung der ICF als neue Grundlage der Behindertenarbeit zustande gekommen, da durch sie Behinderung vom einzelnen Individuum weg und zur gesellschaftlichen Dimension hingeführt wurde.
"Heute können viele durch Körperfunktionen bedingte Einschränkungen der Aktivitäten so kompensiert werden, dass eine volle Partizipation [...] ermöglicht wird. Die individuellen Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen wirken dort auf die soziale Teilhabe, wo die Gesellschaft trotz Anstrengungen keine volle Partizipation gewährleisten kann" (Hollenweger 2006, S. 52).
Es geht demnach darum, dass die notwendigen und hinreichenden Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung bereitgestellt werden, um ihnen eine Teilhabe an den verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen. Dabei jedoch muss immer gemeinsam mit den Betroffenen agiert werden. Es muss zu einer Passung zwischen einer Person mit ihren persönlichen Faktoren und den Umweltfaktoren kommen.
Nicht die Defizite allein treten also in den Vordergrund, sondern die Möglichkeiten zur Aktivität und Teilhabe, welche die betroffene Person trotz oder sogar aufgrund ihrer Schädigungen wahrnehmen kann. Wenn die Aktivitäten bzw. die Partizipation dieses Menschen in einem oder mehreren Aspekten eingeschränkt sind, spricht die ICF in diesen Bereichen von einer Beeinträchtigung oder Behinderung. Doose (2003, o. S.) beschreibt diese neuen Möglichkeiten der ICF folgender Maßen:
"Die Behinderung einer Person in einer Situation ist bestimmt einerseits durch die Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen und andererseits die Beeinträchtigung der Aktivität und Partizipation (Teilhabe) der Person, die von wichtigen Kontextfaktoren wie z.B. Barrieren und Hindernissen in der Umwelt und personbezogenen Faktoren maßgeblich beeinflusst werden. So können beispielsweise positive personbezogene Faktoren wie eine hohe Motivation des behinderten Arbeitnehmers oder Umweltfaktoren, wie eine wirkungsvolle Antidiskriminierungsgesetzgebung und das Angebot von Unterstützter Beschäftigung, die Beeinträchtigung einer Person zur Teilhabe am Arbeitsleben beeinflussen und damit zwar nicht ihre Schädigung, aber insgesamt ihre Behinderung reduzieren. Die neue Definition der WHO ermöglicht also sehr differenziert, Bereiche zu definieren in denen Behinderung auftritt und wo Funktionsfähigkeit vorliegt und welche positiven und negativen Aspekte die Behinderung beeinflussen" (Doose 2003, o. S.).
Durch diese Beschreibung wird klar gelegt, welche Vorteile die neue Klassifikation der WHO innerhalb der Behindertenarbeit bieten kann: eine differenzierte Sichtweise auf von Behinderung bedrohte Lebensbereiche, eine genauere Darstellung von für die Aktivität und Teilhabe förderlichen und hemmenden Aspekten sowie ein Weggang vom Individuum hin zur sozialen Umwelt der betroffenen Personen. Diesen Leistungen und Forderungen der ICF kann in vielerlei Hinsicht Rechnung getragen werden, so auch im Bereich der Politik. Hier kam die entscheidende Veränderung unter anderem durch ein Dokument, welches für Menschen mit Behinderung erst vor kurzem unterzeichnet wurde.
Auf politischer Ebene wurden die Forderungen der ICF nach Teilhabe 2007 in der in New York unterzeichneten und bereits seit Jahren von Fachleuten geforderten[6] UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung festgehalten. Diese Übereinkunft der Vereinten Nationen stellt eine massive Veränderung für viele Staaten in Bezug auf deren Behindertenpolitik dar und zielt auf eine entscheidende Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung ab. So wurde angesichts der Vorgaben der ICF vor allem die Teilhabe behinderter Menschen bzw. deren Inklusion eingefordert:
"States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, employment, education and social services" (UN 2007, Artikel 26, S. 20).
Durch eben diese Forderungen nach voller Inklusion und Partizipation, welche alle Lebensbereiche mit einschließen soll, wird deutlich, dass dieses Dokument, durch den derzeitigen Zeitgeist bedingt, durch Vorarbeiten wie die ICF oder die Salamanca-Erklärung bestimmt ist. Unter anderem wird auch die Bedeutung und das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung herausgestrichen, welche für das Thema dieser Diplomarbeit am wichtigsten ist:
"States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work" (ebd., Artikel 27)
Um Teilhabe zu erlangen bzw. sich selbst als partizipierenden Menschen zu sehen, ist Erwerbsarbeit am ersten, allgemeinen Arbeitsplatz sehr wichtig. Sie ermöglicht es Menschen mit Behinderung, selbst aktiv zu werden und sich selbst und der Umwelt zu beweisen, was sie zu leisten im Stande sind. Zwar wird politisch hier lediglich das Recht auf Arbeit anerkannt (was nicht bedeutet, dass diesem Recht nachgekommen werden muss), allerdings verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten auch dazu, dieses Recht sicher zu stellen und deren Einhaltung zu fördern, was einen großen Schritt in Richtung Teilhabe behinderter Menschen am Erwerbsleben bedeutet.
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit brachte demnach den Wandel von einer defizitorientierten, medizinischen zu einer ressourcen- und unterstützungsorientierten Sichtweise von Behinderung, sowohl im Denken, als auch im Handeln der in diesem Bereich Tätigen und Forschenden. Sie kann mit Wacker / Wansing / Hölscher (2003, S. 108) als "Paradigmenwechsel" verstanden werden und begünstigte eine neue Perspektive auf das Thema Behinderung sowie eine Reihe neuer Entwicklungen. "Statt Selbstsorge Fürsorge zu planen und zu gestalten, war über viele Jahre das Ziel der ‚Sorge für behinderte Menschen', die - angemessene - Reaktion sozial verantwortungsvoll Handelnder auf erkannte Defizite" (Wacker 2005, S. 12). Dies scheint mit der ICF ein Ende gefunden zu haben. Aktivität und damit verbunden vor allem Teilhabe sind die neuen Richtschnüre, nach denen sich Behindertenarbeit ausrichtet. Nicht mehr die passive Abhängigkeit von Hilfeleistungen sollen das Leben von Menschen mit Behinderung bestimmen, sondern die Betroffenen selbst sollen als Experten in eigener Sache ihr Leben in die Hand nehmen und mit Hilfe der geeigneten Unterstützungsangebote selbstbestimmt ihr Leben gestalten bzw. am Leben der Gesellschaft aktiv teilhaben. Diesen Forderungen tragen auch Dokumente wie die neue UN-Konvention für Menschen mit Behinderung Rechnung.
[5] Solche "sozialen Probleme" sind "gesellschaftliche Erscheinungen, denen immer eine Diskrepanz zwischen sozialen Standards oder Wertvorstellungen und der Realität bzw. den tatsächlichen Abläufen zugrunde [... liegen]" (Cloerkes 2007, S. 18, Hervorhebung i. O.).
[6] Degener (vgl. 2003, o. S.) forderte bereits seit einigen Jahren eine eigene UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung, da die vorliegenden Konventionen nicht genügend Schutz für diese Zielgruppen bieten könnten.
Inhaltsverzeichnis
Wie bereits im vergangenen Kapitel dargestellt, nimmt der Aspekt der Teilhabe oder Partizipation seit der Verabschiedung der ICF durch die WHO im Jahr 2001 einen sehr prominenten Stellenwert im Denken und Handeln der im Bereich der Behindertenhilfe Tätigen und Forschenden ein. In der ICF wird Teilhabe als das "Einbezogensein in eine Lebenssituation" (DIMDI 2005, S. 95) definiert. Sie entspricht demnach genau dem Gegenteil des Ausschluss-Phänomens, welches in einem der vorherigen Kapitel in Anlehnung an die Ausschlussmomente nach Wansing (vgl. 2005a, S. 83-99) diskutiert wurde. Teilhabe von Menschen mit Behinderung lässt sich - eben wie deren Ausschluss - auf vielerlei Ebenen feststellen, untersuchen bzw. fordern.
Grundlage dieser Forderung nach Teilhabe stellt das "Selbstbestimmungsparadigma" - wie Wacker (2005, S. 11) es bezeichnet - dar. Dieses Paradigma geht auf die US-amerikanische "Independent living" - Bewegung aus den 1960er Jahren zurück, welche für Menschen mit Behinderung mit der Durchsetzung verschiedener gesetzlicher und politischer Veränderungen wie bspw. Antidiskriminierungsgesetzen, eine Verbesserung der Lebenssituation erreichte (vgl. Ommerle 1999). Die betroffenen Menschen sollten durch die gesetzliche Verankerung ihrer Rechte und Pflichten gestärkt werden um ihr Leben selbstbewusst und selbstbestimmt leben bzw. an der Gesellschaft in all ihren Ausprägungsstufen partizipieren zu können. Dieser Prozess der Emanzipation hatte jedoch nicht nur Konsequenzen für die "behinderungserfahrenen Menschen" (Wacker 2005, S. 11), sondern auch für diejenigen, die sie unterstützten bzw. auch für die Unterstützungsmaßnahmen per se. "Das neue Ziel der Unterstützungsmaßnahmen wurde Selbstverwirklichung: Selbstbestimmung auch unter den Bedingungen eingeschränkter Selbstständigkeit" (ebd., S. 12). Diese Selbstbestimmung sollte jedoch nicht bei der eigenständigen Auswahl von Speisen oder Kleidung enden, sondern in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen gelten. Die Forderung nach Selbstbestimmung wurde auf der Grundlage der Leitidee des Menschen mit Behinderung als Experte / Expertin in eigener Sache formuliert. Ommerle (1999, o. S.) formulierte dies folgendermaßen:
"Behinderte Menschen wissen selber am besten, was sie brauchen. Dienstleistungsangebote wie z.B. Beförderung oder Assistenz werden meist von nichtbehinderten Fachleuten konzipiert, kontrolliert und verwaltet. Wenngleich dies in guter Absicht geschieht, haben nichtbehinderte Menschen meist eine andere Vorstellung über die Bedürfnisse, den Lebensstil und die Ziele behinderter Menschen. So müssen sich dann behinderte Menschen in der Rolle des ‚Klienten' oder ‚Patienten' den vorgegebenen Strukturen der Dienstleistungen anpassen, obwohl diese vielleicht gar nicht ihren Bedürfnissen entsprechen."
Um eben solche Umstände in Zukunft vermeiden zu können, wurde in den letzten Jahren, besonders durch die Verabschiedung der ICF oder der neuen UN-Konvention, sowohl gesellschaftlich, als auch politisch die Forderung nach Teilhabe für Menschen mit Behinderung formuliert. Diese soll es nicht nur ermöglichen, dass die betroffenen Personen am gesellschaftlichen Leben in all seinen Ausprägungen teilnehmen dürfen, sondern dass sie auf Grundlage ihrer eigenen freien Entscheidung und ihrer Stärken und Kompetenzen auch tatsächlich partizipieren können. Aus dem mehr oder weniger passiven TeilNEHMEN wurde demnach ein aktives, selbstbestimmtes TeilHABEN. Wacker (2005, S. 13) schreibt hierzu:
"Teilhabe ist das Recht aller Bürger(innen), und Teilhabe ist zugleich der Weg dorthin. [...] Es [geht] darum, nach den individuellen Bedarfen und Bedürfnissen passende Unterstützungen bereitzustellen, um so Chancengleichheit zur gesellschaftlichen Teilhabe bei Verschiedenheit der Kompetenzen und Intentionen zu ermöglichen".
Dem Teilhabe-Konzept wohnt nämlich ein Aktivitätsgrundsatz inne, wie dies auch innerhalb der ICF durch die über lange Zeit hinweg "diffus gebliebene Unterscheidung zwischen einer Klassifikation der Aktivitäten und der Partizipation" (Hollenweger 2006, S. 65) deutlich wird. Obwohl diese beiden Konstrukte mittlerweile eindeutig voneinander getrennt und als "zwei verschiedene Perspektiven verstanden [werden], die zur Analyse menschlicher Tätigkeiten verwendet werden können" (Hollenweger 2006, S. 65), lässt sich ihre konzeptionelle Verbindung nach wie vor nicht leugnen. Teilhabe ist bestimmt durch Aktivität und umgekehrt. Dieses reziproke Verhältnis stellt Menschen mit Behinderung vor die Tatsache, dass sie selbst aktiv werden müssen, um an der Gesellschaft partizipieren zu können. Eben dies war auch die Intention der "Independent living" - Bewegung. Dennoch kann und darf nicht die ganze Verantwortung in den Händen der Betroffenen liegen. Damit Teilhabe behinderter Menschen tatsächlich gelingen kann, muss auch die Gesellschaft selbst ihren Beitrag dazu leisten. So können bspw., um nochmals auf die ICF zurück zu kommen, "viele durch Körperfunktionen bedingte Einschränkungen der Aktivitäten so kompensiert werden, dass eine volle Partizipation [...] ermöglicht wird" (Hollenweger 2006, S. 52). Die Umweltfaktoren bestimmen demnach maßgeblich - wie bereits verdeutlicht - darüber, ob ein Mensch mit einer Schädigung seiner Körperstrukturen und -funktionen fertig werden und damit mehr oder weniger unbehindert leben kann, oder ob er als "behindert" gilt. "Die individuellen Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen wirken dort auf die soziale Teilhabe, wo die Gesellschaft trotz Anstrengungen keine volle Partizipation gewährleisten kann" (ebd.).
Auch Wansing (vgl. 2005b, S. 27) argumentiert in diese Richtung, wenn sie zu bedenken gibt, dass es bei der gesellschaftlichen Teilhabe vor allem darauf ankommt, mittels einer geeigneten Dienstleistungsstruktur den Einbezug von Menschen mit Behinderung in die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme zu fördern. Vor allem die Paradoxie der "Gleichzeitigkeit des gesellschaftlichen ‚Drinnen' und ‚Draußen' von Menschen mit Behinderung" (ebd., S. 29) müsse verstanden und darauf adäquat reagiert werden. Diese stellt sich wie folgt dar:
"Einerseits sind der Rechtsanspruch auf bzw. die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Eingliederungshilfe und die soziale Bearbeitung ihrer [der Menschen mit Behinderung, Anm. F. S.] Exklusionsrisiken im Hilfesystem selbst Ausdruck ihrer Teilhabe an wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und Standards (=Inklusion). Andererseits begrenzt aber die separierende Leistungserbringung in Einrichtungen und die auf Behinderung und Hilfebedarf spezialisierte Kommunikation die Erwartbarkeit ihres Einbezogenseins in den verschiedenen (anderen) gesellschaftlichen Systemen nachhaltig - und zwar in doppelter Weise: Zum einen bleiben durch die pauschale Rund-um-Versorgung Zugänge und Gelegenheiten zur Übernahme gesellschaftlich relevanter Inklusionsrollen verschlossen. Zum anderen können nicht jene Fähigkeiten und Ressourcen erworben werden, welche Lebenssouveränität und Partizipation ermöglichen" (Wansing 2005b, S. 29f.; runde Klammern i. O.).
Noch heute ist die Meinung, dass Menschen mit Behinderung vor allem in Einrichtungen wie Wohnheimen oder Tagesstätten adäquat unterstützt werden können, seitens Professionistinnen und Professionisten nicht gänzlich abgelegt. Das damit zusammenhängende, immer noch großflächig angelegte Netz an solchen Institutionen dient auf der einen Seite somit der Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung bspw. am Erwerbsleben. Auf der anderen Seite werden diese Personen aufgrund des Sonderstatus dieser Einrichtungen von der restlichen Gesellschaft exkludiert. Einerseits partizipieren Menschen mit Behinderung also durch die Möglichkeit von Sonderinstitutionen am allgemeinen Versorgungsrecht. Jeder Mensch hat bspw. Anspruch auf adäquate medizinische Betreuung und Behandlung in der "Sondereinrichtung" Krankenhaus. Andererseits wird diesen Menschen durch die Endgültigkeit und Ausschließlichkeit dieser Besonderung das Etikett "Anderssein" aufgedrückt, von welchem sie sich zumeist Zeit ihres Lebens nicht mehr lösen können. Wie Wansing (vgl. 2005b, S. 29 f.) es im obigen Zitat ausdrückt, sind Menschen mit Behinderung dadurch oftmals gleichzeitig drinnen, das heißt sie partizipieren an gewissen Gesellschaftssystemen wie dem Wohlfahrtssystem, und draußen, da sie durch ihre ständige Teilhabe an diesem System von anderen gesellschaftlichen Systemen ausgeschlossen werden. Hieran wird die oftmalige Verquickung von Inklusion und Exklusion deutlich, sodass in diesem Fall quasi von einer Exklusion in der Inklusion gesprochen werden kann. Dies drückte auch Exner (vgl. 2007, S. 174) aus, wenn er aus systemtheoretischer Sicht schreibt, dass Menschen mit Behinderung immer als Teil der Gesellschaft in dieselbe inkludiert sein werden, dass es jedoch in einzelnen Lebensbereichen trotzdem zur Exklusion kommen könne.
Begünstigt wird ein Exklusionsrisiko oder gar eine "Exklusionskarriere Behinderung" (Wansing 2005a, S. 99; dies. 2005b, S. 26) demnach dadurch, dass gesellschaftliche Institutionen und Funktionssysteme selbst Ausgrenzungsrisiken produzieren. Diese verdichten sich besonders in den Übergangssituationen von Schule in Ausbildung und Beruf oder vom Erwerbsleben in den Ruhestand und können zu Ausgrenzungen führen (vgl. Wansing 2005b, S. 26). Junge Frauen und Männer mit Behinderung können durch "institutionelle Selektionen" (ebd.) nicht aus den Sonderwelten ausbrechen, welche für sie in Form von Sonderschulen oder Werkstätten als Ersatzarbeitsmarkt geschaffen werden. Dadurch verbleiben sie oft ihr ganzes Leben lang in diesem von der nicht-behinderten Gesellschaft abgesonderten Raum, ohne eine Chance zu haben, daraus ausbrechen zu können, wie folgendes Beispiel illustriert:
"Auch nach dem Schulabschluss bleibt [...] die Lebensführung für Jugendliche mit Behinderung risikoreich und mündet vor allem für Abgänger der Schule für Geistigbehinderte in eine Fortsetzung der organisationalen Ausgrenzung in Berufsbildungs- und -förderungswerke bzw. in den Arbeitsbereich der Werkstätten. Häufig sind die Werkstätten für sie das einzige Instrument zur beruflichen Bildung und zur Beschäftigung, Regelarbeitsplätze hingegen spielen für diesen Personenkreis immer noch eine marginale Rolle" (vgl. Schüller 2003, zit. n. Wansing 2005b, S. 26).
Ausgehend von diesen Exklusionsrisiken (vgl. Wansing 2005a; 2005b) und dem gleichzeitigen sowohl gesellschaftlichen, als auch politischen Bekenntnis zum Recht der Menschen mit Behinderung auf Teilhabe (vgl. UN 2007), ist es erforderlich, Unterstützungsmaßnahmen neu zu denken. Diese müssen individuell auf die Unterstützungsbedarfe des einzelnen Menschen zugeschnitten sein. Die Bedürfnisse können jedoch nur in Zusammenarbeit mit den Betroffenen als Nutzerinnen und Nutzer eruiert werden, sodass diese aktiv in den Umdenkprozess einzubeziehen sind.
"Behindertenhilfe und Menschen mit Behinderungserfahrungen stehen an dieser Schwelle zum neuen Zusammenspiel. Als Darsteller und Gestalter sind nicht mehr alleine diejenigen berechtigt, die bisher ihre Rolle als Akteure, als Macher, als Unterstützer, als Helfer mit großem Engagement und Erfolg gespielt haben. Neue Spieler(innen) betreten die Bühne, sie mischen sich ein, wollen nicht mehr nur die passive Rolle der Beobachtung gesellschaftlichen Lebens übernehmen. Sie fordern, mehr als nur dabei zu sein" (Wacker 2005, S. 17).
Ein solches Umdenken und Zulassen von "neuen Spieler(innen)" (ebd.) ist notwendig, um gemeinsam mit Menschen mit Behinderung als Nutzerinnen und Nutzer von Unterstützungsleistungen und in Anlehnung an das Konzept der Kontextfaktoren der ICF, die Möglichkeiten zu einer Teilhabe an den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen zu schaffen. "Erst das passende Zusammenspiel aller Beteiligten kann zum Gelingen des Zukunftsprojektes einer ‚inklusiven Gesellschaft' beitragen und Menschen mit Behinderung aus ihrer paradoxen Lage der Gleichzeitigkeit von Teilhabe und Ausgrenzung befreien" (Wansing 2005b, S. 32) [7]. Ein Lebensbereich, in welchem ein solches Umdenken und damit Teilhabe für Menschen mit Behinderung von besonderer Bedeutung zu sein scheint, ist der der Erwerbstätigkeit. Die Möglichkeit, arbeiten zu können, ist nämlich für jeden Menschen, egal ob behindert oder nicht, etwas ganz Entscheidendes.
Besonders die berufliche Teilhabe ist für Menschen mit Behinderung bedeutsam, da mit Erwerbsarbeit eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen des täglichen Lebens verbunden sind (vgl. Stadler 1996; Beisteiner 1997; Feuser 2001; Spiess 2004; Bieker 2005b; Hinz 2006; Doose 2007). Diese Faktoren wiederum zeichnen sich über weite Strecken hinweg verantwortlich für eine gelungene Partizipation an der Gesellschaft und deshalb soll die Bedeutung von Erwerbsarbeit für Menschen mit Behinderung im folgenden Unterkapitel zusammengefasst dargestellt und erläutert werden.
Grundsätzlich gilt die hohe Bedeutung von Erwerbsarbeit sowohl für Menschen mit, als auch ohne Behinderung in gleichem Maße. "Unterschiede sind aber in der individuellen Gewichtung einzelner Funktionen von Erwerbsarbeit zu erwarten" (Spiess 2004, S. 53). So ist davon auszugehen, "daß behinderte Menschen die Ausübung einer Arbeitstätigkeit als höheren Statusgewinn empfinden als Menschen ohne Behinderung" (ebd.). Das bedeutet also, dass bei Menschen mit Behinderung die Status gebende Funktion einer Erwerbstätigkeit besonders ausschlaggebend zu sein scheint. Dies wird auch in einer Untersuchung von Klicpera / Schabmann aus dem Jahr 1998 bestätigt. Hier wurden u. a. Beweggründe behinderter Menschen für einen Arbeitsversuch am ersten Arbeitsmarkt herausgearbeitet. Dabei waren die Faktoren der persönlichen Freiheit, welche Erwerbsarbeit und der neu gewonnene Status mit sich bringen, sowie die positiven Auswirkungen der Erwerbstätigkeit auf das eigene Selbstbild, die eigene Identität besonders markant ausgeprägte Aspekte. Aber auch andere Funktionen wie die der sozialen Kontaktmöglichkeiten oder die des Erwirtschaften des eigenen Lebensunterhalts waren unter den Antworten der befragten Personen häufig vertreten und schienen diesen wichtig zu sein (vgl. Klicpera / Schabmann 1998, Abb. 1.). Beisteiner (1997, S. 29) schreibt in diesem Zusammenhang:
"Ebenso wichtig ist es aber durch Arbeit die Akzeptanz und die Aufmerksamkeit der Umgebung zu spüren, stolz auf die eigene Leistung, das eigene Produkt sein zu können, sich dadurch als Mitglied der Gesellschaft zu fühlen und den marginalen Status des Allmosenempfängers [sic!] loszuwerden."
Hinz (2006, o. S.) argumentiert ähnlich, wenn er schreibt, dass Menschen mit Behinderung durch Erwerbsarbeit die Chance haben "angesichts der drohenden gesellschaftlichen Marginalisierung [...], ihr Können in den Mittelpunkt zu stellen und damit der drohenden Dominanz der gesellschaftlichen Wahrnehmung über Defizite entgegenzutreten". Menschen mit Behinderung gelingt es durch Erwerbsarbeit demnach, sich selbst und ihre Fähigkeiten einer breiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu präsentieren und dadurch das Etikett der Passivität und des Nichts-Könnens abzulegen. Dies trägt maßgeblich zur Konstituierung ihres eigenen Selbstbildes und Selbstwertgefühls bei, wie dies zuvor schon dargelegt wurde.
Besonders der Faktor der Integration, des Eingebunden-Seins scheint für Menschen mit Behinderung im Hinblick auf Erwerbsarbeit ein entscheidender Faktor zu sein. Während nicht-behinderte Menschen für gewöhnlich über einen mehr oder weniger großen Freundes- und Bekanntenkreis verfügen, sind die Möglichkeiten für soziale Kontakte für Menschen mit Behinderung zumeist eher begrenzt. Da viele Menschen behinderte Männer und Frauen immer noch meiden bzw. ihnen wenig Aufmerksamkeit schenken, beschränken sich die Freund- und Bekanntschaften von Menschen mit Behinderung zumeist auf ihre eigene Familie, auf Gleichgesinnte und auf den Kreis der sie professionell unterstützenden Personen. Deshalb und aufgrund anderer für gewöhnlich vielfach erlebter Ausschlussprozesse (vgl. Wansing 2005a) hat die soziale und gesellschaftlich integrierende Funktion von Erwerbsarbeit einen besonders hohen Stellenwert für Menschen mit Behinderung. Auch Hinz (2006, o. S.) betont dies in seiner Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit, indem er zu bedenken gibt, dass "Arbeit eine große Bedeutung haben [kann]: indem sie über tagtägliche Kontakte der Gefahr sozialer Isolation entgegenwirkt". Dabei kommt es jedoch entscheidend darauf an, welche Tätigkeit ein Mensch mit Behinderung verrichtet bzw. auf welchem Arbeitsmarkt diese zu lokalisieren ist.
Im Allgemeinen wird zwischen fünf verschiedenen Arbeitsmärkten unterschieden (vgl. Stadler 1996, S. 275 f.). Auf der einen Seite steht dabei der sog. erste oder allgemeine Arbeitsmarkt, welcher alle regulären sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse umfasst. Ihm gegenüber steht auf der anderen Seite der geschützte Arbeitsmarkt, auch dritter Arbeitsmarkt, Sonder- oder Ersatzarbeitsmarkt genannt. Dieser "beinhaltet Formen institutionalisierter Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, nämlich ‚Integrative Betriebe' und ‚Beschäftigungswerkstätten'" (Fasching 2004a, S. 65). Zwischen diesen beiden Arbeitsmärkten steht der sog. zweite Arbeitsmarkt als Zusammenfassung all jener Menschen, welche sich in nicht-sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden, seien es Qualifizierungs-, Weiterbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen. Darüber hinaus existieren noch ein vierter und fünfter Arbeitsmarkt. Der vierte oder graue Arbeitsmarkt "erfaßt die nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Schwarzarbeit als Form der illegalen Schattenökonomie" (Stadler 1996, S. 276). Dieser Sektor ist in behinderungsrelevanten Angelegenheiten zumeist nur soweit von Bedeutung, als dass es immer wieder vorkommt, dass Arbeitergeberinnen und Arbeitgeber ihre behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht anmelden, um sich dadurch die Kosten der Sozialversicherung zu ersparen. Dies fällt jedoch in den Bereich der Illegalität, sodass dieser Arbeitsmarktsektor kaum Bedeutung in der wissenschaftlichen Literatur findet. Der fünfte Arbeitsmarkt schließlich umfasst die sog. "Reservearmee" (ebd.), welche aus Langzeitarbeitslosen und Nichtbeschäftigten besteht. Dieser Bereich ist insofern von Relevanz, als Menschen mit Behinderung einem vielfach höheren Risiko ausgesetzt sind, über lange Zeit hinweg arbeitslos zu sein, als nicht-behinderte Menschen.
Rauch (2005, S. 28) skizziert die Lage behinderter Frauen und Männer auf dem deutschen Arbeitsmarkt wie folgt:
"Von den vier Millionen Behinderten im erwerbsfähigen Alter zählen laut Mikrozensus nur knapp zwei Millionen zu den Erwerbspersonen, also zu denjenigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sie suchen. [...] Die Erwerbsquote der Schwerbehinderten sank in den letzten Jahren. Lag sie 1995 für 15- bis unter 65-Jährige in der Bundesrepublik noch bei 36 Prozent, war sie im Jahr 2001 auf 33 Prozent gesunken. Damit zeigt sie sich gegenläufig zur allgemeinen Erwerbsquote in der Bundesrepublik, die im Zeitverlauf stetig ansteigt. Alles in allem liegt die Erwerbsquote der Schwerbehinderten nicht einmal halb so hoch wie die der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter" (Rauch 2005, S. 28).
Auch auf dem österreichischen Arbeitsmarkt verhält es sich ähnlich. Im Bericht der Bundesregierung zur Lage der behinderten Menschen in Österreich aus dem Jahr 2008 wird festgestellt, dass "die Beschäftigungsquote der behinderten Menschen im engeren Sinn [...] um die Hälfte niedriger [ist] als die der Nichtbehinderten" (BMASK 2009, S. 20). Darüber hinaus sind "bei den behinderten Männern und Frauen zwischen 16 und 64 Jahren [...] die Anteile der PensionsbezieherInnen zwischen 2 und 4 Mal höher als bei den nicht behinderten Personen" (ebd.). Der fünfte Arbeitsmarkt erscheint demnach für Menschen mit Behinderung von sehr großer Bedeutung[8].
Betrachtet man allein diese Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsmarktausprägungen, wird klar, dass Teilhabe nicht nur in ihrem Umfang, sondern auch ihrer Ausprägung und ihren individuellen Folgen für die / den Einzelne(n) variiert (vgl. Stöpel 2005, S. 18). Je nach Teilhabe an einem der potentiellen Arbeitsmärkte, ergeben sich demnach unterschiedliche Chancen für eine vollständige berufliche Partizipation. Menschen, welche am dritten Arbeitsmarkt integriert sind, erhalten für ihre Arbeit für gewöhnlich lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung in Form von Taschen- oder Belohnungsgeld, sodass diese Form der Arbeit keinesfalls die Funktion der Existenzsicherung erfüllen kann, was sich wiederum negativ auf die Identitätsbildung der meisten betroffenen Menschen auswirkt. Auch die Absonderung vom allgemeinen, nicht-behinderten Arbeitsmarkt kann negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, aber auch auf den Bereich der sozialen Kontakte von Menschen mit Behinderung haben.
Wenn man sich die unterschiedlichen Formen der beruflichen Teilhabe grafisch verdeutlichen will, kann dies bspw. in folgender Art und Weise geschehen:
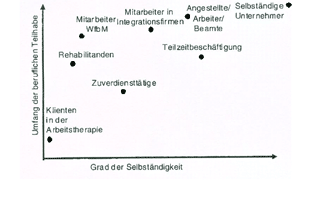
Abb. 3: Formen der beruflichen Teilhabe (in: Stöpel 2005, S. 20; bearbeitet durch F.S.)
Wie Stöpel (vgl. 2005, S. 20f.) schon andeutet, kann berufliche Teilhabe in vielerlei Ausprägung, je nach Grad der Selbstständigkeit und Umfang der beruflichen Teilhabe betrachtet werden. So sind Klientinnen und Klienten in der Arbeitstherapie, d.h. bspw. einer tagesstrukturierenden Maßnahme am wenigsten in den beruflichen Alltag integriert und auch am wenigsten selbstständig. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Werkstatt für behinderte Menschen hingegen haben bereits in weitaus größerem Maße am Berufsleben Anteil, und sind auch schon ein wenig selbstständiger. Menschen in einer regulären Teilzeitbeschäftigung sind noch selbstständiger, partizipieren jedoch wiederum durch ihre begrenzten Arbeitsstunden weniger am Erwerbsleben. Die größte berufliche Teilhabe genießen selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, wie dies an der Spitze der Grafik von Stöpel (vgl. 2005, S. 20) angezeigt wird. Sie sind jedoch weitgehend auf sich allein gestellt und erhalten die wenigste Unterstützung, während alle anderen genannten Gruppen auf mehr oder weniger ausgeprägte Unterstützungsleistungen zurückgreifen können. Auch in Bezug auf den Arbeitsumfang existieren - wie aus der grafischen Darstellung ersichtlich - Unterschiede. "Menschen, die einer Teilzeitbeschäftigung auf dem allgemeinen oder rehabilitativen Arbeitsmarkt nachgehen, haben eine geringere Teilhabe als Vollzeitbeschäftigte. [...] Die Abbildung soll illustrieren, dass Teilhabe kein absolutes, sondern ein relatives Konstrukt ist" (ebd.).
Zurückblickend auf das vorangegangene Kapitel wird ersichtlich, dass Teilhabe dem Konzept der Selbstbestimmung folgt und dieses ergänzt. Es geht nun nicht mehr nur um ein schlichtes TeilNEHMEN, sondern um aktives TeilHABEN von Menschen mit Behinderung, um das "Eingebundensein in eine Lebenssituation" (DIMDI 2005, S. 95) bzw. in alle Lebenssituationen. Dazu ist es erforderlich, bislang geschaffene Sonderwelten für Menschen mit Behinderung wie Beschäftigungswerkstätten aufzugeben bzw. abzubauen. Nur dadurch und mit Hilfe neuer Unterstützungsmaßnahmen bzw. eines generellen Umdenkens können gemeinsam mit den Betroffenen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ermöglichen. Wacker (2005, S. 16) konstatiert die derzeitige Lage folgendermaßen: "Wir haben gelernt, dass Veränderung möglich ist. Der Weg von den hilfebedürftigen ‚Sorgenkindern' zu respektierten Bürger(inne)n mit Teilhaberechten ist unumkehrbar eingeschlagen".
Eine Möglichkeit, um in den Augen der Gesellschaft als respektable(r) Bürger bzw. Bürgerin gelten zu können, ist die Partizipation am Erwerbsleben. Deshalb und aufgrund vieler anderer Aspekte scheint berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung derart bedeutend zu sein. Vor allem die Gesichtspunkte der eigenen Identität, der gesellschaftlichen Anerkennung sowie der sozialen Einbindung in ein Kollegium von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens sollten als besonders bedeutsam für behinderte Menschen herausgestrichen werden. Durch die Darstellung der fünf verschiedenen Arbeitsmärkte (vgl. Stöpel 2005) und die unterschiedlichen Ausprägungen der beruflichen Teilhabe von der Beschäftigung in einer WfbM über eine Teilzeitstelle bis hin zur selbstständigen Unternehmerin bzw. zum selbstständigen Unternehmer sollte im vorangegangenen Kapitel die Vielfalt beruflicher Teilhabe verdeutlicht werden.
Bevor es einem Menschen mit Behinderung jedoch gelingt, einen Fuß in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu setzen, sind zumeist viele Hürden zu überwinden, welche sich einerseits aus der Umwelt der jeweiligen Person ergeben, andererseits personbezogen sind, wie dies innerhalb der ICF (vgl. DIMDI 2005, S. 21) durch Klassifikation der Kontextfaktoren dargestellt wurde. Einige solcher Faktoren sollen im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt werden.
[7] Wie dieses Zusammenspiel aussehen muss, um berufliche Teilhabe junger Frauen und Männer mit Behinderung zu ermöglichen, soll innerhalb dieser Diplomarbeit erforscht werden. Die spezifischen Unterstützungssysteme, welche Menschen mit Behinderung speziell im Erwerbsleben erhalten bzw. benötigen, sollen dazu innerhalb dieser Arbeit anhand der Aussagen der interviewten jungen Frauen und Männer herausgearbeitet werden. Weiters soll nach den unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen von Männern und Frauen differenziert werden (vgl. Kapitel 7. - Ausweisung der konkreten Fragestellungen).
[8] In diesem Zusammenhang ist jedoch einzuwenden, dass die Bezeichnung "Arbeitsmarkt", wie sie Stadler (vgl. 1996, S. 275f.) für diesen Bereich verwendet, etwas irreführend ist. In Wirklichkeit ist die sog. "Reservearmee" tatsächlich das, was ihr Name aussagt, eine Ansammlung potentieller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche real jedoch keine bezahlte Erwerbsarbeit ausüben und ihren Lebensunterhalt durch Unterstützung von Angehörigen oder durch die Sozialhilfe "erwirtschaften".
Inhaltsverzeichnis
Wie bereits angedeutet, existieren unterschiedliche Faktoren, welche über den Erfolg oder Misserfolg von beruflicher Teilhabe von Menschen mit Behinderung mit entscheiden. Die Schwierigkeiten, vor welchen Menschen mit Behinderung im Bereich der beruflichen Teilhabe häufig stehen, sind vielfältig und immer abhängig von unterschiedlichen individuellen, aber auch gesellschaftlichen und (arbeits-) marktwirtschaftlichen Komponenten. Diese werden innerhalb der ICF als Kontextfaktoren bezeichnet und in zwei Gruppen geteilt: Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren.
"Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Leben gestalten. Diese Faktoren liegen außerhalb des Individuums und können seine Leistung als Mitglied der Gesellschaft, seine Leistungsfähigkeit zur Durchführung von Aufgaben bzw. Handlungen oder seine Körperfunktionen und -strukturen positiv oder negativ beeinflussen" (DIMDI 2005, S. 21f).
Es handelt sich hierbei um Aspekte der Umwelt eines Menschen, welche sich entweder förderlich oder hinderlich für seine persönliche Entwicklung auswirken können. Wichtig dabei scheint also vor allem der Zugang zu diesen Umweltfaktoren zu sein. Es stellt sich die Frage, ob sich diese eher als Barrieren oder als Ressourcen darstellen. Je nachdem kann ein und derselbe Mensch eher oder weniger gut seine Teilhabe am Erwerbsleben oder an anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen verwirklichen. Innerhalb der ICF (vgl. ebd., S. 22) werden zwei Ebenen von Umweltfaktoren unterschieden: die Ebene des Individuums und die Ebene der Gesellschaft. Die individuumsbezogene Ebene beinhaltet vor allem die Ressourcen, welche Menschen mit Behinderung aus ihrer direkten Umwelt, d.h. vor allem ihrer häuslichen, familiären oder freundschaftlichen Umgebung gewinnen können, bzw. die Barrieren, welche sich durch das Fehlen solcher Ressourcen ergeben. Die gesellschaftliche Ebene subsumiert "die formellen und informellen sozialen Strukturen, Dienste und übergreifenden Ansätze oder Systeme in der Gemeinschaft oder Gesellschaft, die einen Einfluss auf Individuen haben" (ebd.).
Betrachtet man nun die Ebene der Umweltfaktoren genauer, so wird - wie bereits angedeutet - klar, dass sich diese Aspekte sowohl positiv, als auch negativ auf die Entwicklung eines jeden Menschen auswirken können. Je nachdem, ob die Ressourcen, welche in diesen Faktoren stecken, in ausreichendem Maße vorhanden sind oder nicht, kann sich ein Erfolg oder Misserfolg von Teilhabe einstellen, im Falle dieser Diplomarbeit: von beruflicher Teilhabe. Besonders im Bereich der gesellschaftlichen Ebene ergeben sich für Menschen mit Behinderung immer noch Barrieren, welche es zu überwinden gilt, um partizipieren zu können. Einige solcher Hindernisse bzw. Problemlagen sollen hier nun aus Sicht der Betriebe, in welchen Menschen mit Behinderung arbeiten könnten, dargestellt werden:
Menschen mit Behinderung sind, wenn sie auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten, oft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Integrationsfirmen bzw. allgemein Arbeiterinnen und Arbeiter oder Angestellte, häufig auch Teilzeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bzw. aufgrund mangelnder bzw. fehlender Ausbildung und Qualifizierung Hilfskräfte oder ungelernte Arbeitskräfte. Aufgrund dieser oft fehlenden Qualifizierung bzw. aufgrund zu hoher Anforderungen regulärer Arbeitsplätze an diese Personengruppe, wurden für sie in den letzten Jahrzehnten vielfach eigene Aufgabenfelder geschaffen. Innerhalb der Fachliteratur wird hierbei von sog. "Nischenarbeitsplätzen" (vgl. bspw. Fasching 2004a; Stöpel 2005) gesprochen.
Im Zuge der immer weiter voranschreitenden Technologisierung und der derzeitigen weltweiten Wirtschaftsschwierigkeiten geraten jedoch immer mehr solcher Nischenarbeitsplätze ins Wanken. Stöpel (2005, S. 23f.) konstatiert diese Situation wie folgt: "In Folge des Kostendrucks wurden viele Nischen- und Schonarbeitsplätze wegrationalisiert. Durch technischen Fortschritt konnten einfache Arbeiten von Maschinen übernommen werden". Auch Fasching (2004a, S. 53) setzte sich mit dieser Problematik auseinander:
"Platzierungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden immer schwieriger, weil Nischenarbeitsplätze, einfache und ungelernte Tätigkeiten wegfallen. Es findet ein Verdrängungswettbewerb von oben nach unten statt. Die VerliererInnen sind die Schwächsten der Gesellschaft: niedrig qualifizierte Menschen sowie sogenannte Randgruppen ohne Lobby."
Durch das skizzierte Wegbrechen sog. Nischenarbeitsplätze kommt es jedoch zu einem regelrechten Engpass an einfachen Tätigkeiten, welche keiner spezifischen Ausbildung bedürfen. Dadurch entsteht eine Konkurrenz unterschiedlicher Personengruppen um die verbleibenden "Einfacharbeitsplätze" (Stöpel 2005, S. 24). Der Autor nennt als konkurrierende Gruppen zum einen Menschen mit Behinderung, zum anderen jedoch auch Studentinnen und Studenten, Benachteiligte und andere einfach Qualifizierte (vgl. ebd.).
Dieser große Wettbewerb bedingt u. a. die häufige Unterlegenheit von Menschen mit Behinderung gegenüber bspw. der Gruppe der Studentinnen und Studenten als Inhaberinnen und Inhaber dieser Einfacharbeitsplätze. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber suchen auch für einfache Aufgaben Personen, welche diese zu ihrer Zufriedenheit möglichst kostengünstig, jedoch schnell und effektiv erfüllen. Dies erwarten sie zumeist eher von nicht-behinderten Personengruppen wie bspw. Studentinnen und Studenten als von Menschen mit Behinderung. Niehaus (1997, S. 43) spricht in diesem Zusammenhang von "diskriminierende[n] Auswahlstrategien", welche vielfach bei der Entscheidung über die Einstellung eines behinderten Menschen zum Tragen kommen. Die Autorin geht damit auf die Vorurteile und diskriminierenden Ansichten vieler Personalverantwortlichen bzw. Führungskräfte ein, welche die Einstellungschancen von Menschen mit Behinderung beeinflussen können. Sie stützt ihre Aussagen dabei unter anderem auf eine Studie von Herpich / Steinle aus dem Jahr 1983 und fast eines ihrer Ergebnisse wie folgt zusammen:
"Obwohl man mit betriebseigenen Schwerbehinderten oft gute Erfahrungen machte und ihnen eine hohe Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zusprach, wurden betriebsfremde in ihrer Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit deutlich schlechter beurteilt. Hohe Fehlzeiten und soziale Probleme in den Arbeitsgruppen werden befürchtet" (Niehaus 1997, S. 44).
Hierbei ist erkennbar, dass Kontakt zu Menschen mit Behinderung alleine nicht vor Diskriminierung schützt. Dies ist in Fachkreisen ein umstrittenes Thema. "Direkter Kontakt mit behinderten Menschen wird von vielen Fachleuten als die wichtigste Determinante für die Qualität der Einstellungen Nichtbehinderter angesehen" (Cloerkes 2007, S. 145). Auch Leichsenring / Strümpel (vgl. 1997) gehen von einer solchen Korrelation zwischen Erfahrung und Einstellungsbereitschaft aus und beziehen sich dabei auf Studien von Brandt (1984) oder Trost / Schüller (1992), welche dieses belegen.
Obwohl erwiesenermaßen eine Kausalbeziehung zwischen dem Kontakt Nichtbehinderter mit behinderten Menschen und ihren Einstellungen besteht (vgl. Cloerkes 2007, S. 151), bezweifelt der Autor dennoch deren Allheilmittelfunktion. Wie in dem zuvor angeführten Zitat von Niehaus (1997, S. 44) ersichtlich wird, herrschen bzgl. der Akzeptanz und Wahrnehmung von Behinderungen große Unterschiede. Obwohl Menschen mit Behinderung im eigenen Betrieb arbeiten, anerkannt und geschätzt werden, sträuben sich viele Personalverantwortlichen dennoch, weitere behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen. Dabei regiert das Motto: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Gerade diese Man weiß ja nie! - Philosophie vieler Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, in der sich oftmals eine (übertriebene) Vorsicht ausdrückt, bereitet vielen Arbeit suchenden Menschen mit Behinderung große Schwierigkeiten, da sie deren Einstellungschancen drastisch verringert.
Mit dieser Problematik korreliert ein anderes Einstellungshindernis für Menschen mit Behinderung von Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Nicht nur die Angst vieler Vorgesetzter vor mangelnder Leistungsfähigkeit behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter marginalisiert deren Erfolgschancen auf berufliche Teilhabe, sondern auch die damit verbundenen Kosten-Nutzen-Rechnungen spielen dabei eine gewichtige Rolle. So schätzen Personalverantwortliche den Ertrag bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung im Verhältnis zu den entstehenden Kosten zumeist deutlich geringer ein als den nicht-behinderter Menschen (vgl. Niehaus 1997, S. 42f.).
Es wird also befürchtet, dass Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Beeinträchtigungen weniger wirtschaftlichen Ertrag für das Unternehmen bringen könnten als nicht-behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei spielt auf der einen Seite die bereits angesprochene defizitorientierte Leistungsbeurteilung seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer gegenüber Menschen mit Behinderung eine Rolle. Hier geht es um die mit der gegebenen Behinderung verbundene Funktionseinschränkung. Auf der anderen Seite sind bei einer solchen Kosten-Nutzen-Rechnung auch behinderungsspezifische Aspekte wie bspw. die Sichtbarkeit einer Behinderung für Unternehmen relevant. So beschreibt Niehaus (vgl. ebd., S. 45) die Tatsache, dass sich sichtbare Behinderungen gegenüber unsichtbaren bei einer Bewerbung um einen Job mit direktem Kundenkontakt oft negativer auf die Einstellungschancen und somit die Chancen auf berufliche Teilhabe auswirken. Bei anderen Arbeitsplätzen, an denen die betreffenden Personen keinen so exponierten Arbeitsbereich haben, hat der Faktor Sichtbarkeit weniger Einfluss. "Darüber hinaus haben Stellenbewerber mit sogenannten ‚klassischen Behinderungen' [z.B. Blindheit, Anm. F. S.] aber grundsätzlich größere Chancen, [...] eingestellt zu werden, als geistig Behinderte oder psychisch Behinderte" (ebd.)[9].
Als weiteres gravierendes Problem in Bezug auf die Einstellungsbereitschaft von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gegenüber Menschen mit Behinderung sehen Leichsenring / Strümpel (vgl. 1997, o. S.) den mangelnden Informationsstand vieler Unternehmen. Dieser bezieht sich zum einen auf die Behinderung ihrer potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen aber auch auf mögliche (staatliche) Förderungen und Unterstützungsleistungen, welche Unternehmen zustehen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen. Auch an Kenntnissen bzgl. Vergünstigungen für behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mangelt es häufig. (Niehaus 1997, S. 44) verdeutlicht dies anhand eines Beispiels: "Der mit dem Schwerbehindertenstatus gesetzlich verankerte Kündigungsschutz und Zusatzurlaub [wird] auf der Kostenseite des Beschäftigungskalküls verbucht".
Es herrscht demnach vielfach ein massives Defizit an Informationen bzgl. Rechten und Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sodass Sonderrechte behinderter Menschen wie ein vermehrter Kündigungsschutz oft als Unkündbarkeit fehl interpretiert werden. Dadurch geraten finanzielle und steuerrechtliche Vorteile der Unternehmen, welche diese mit der Einstellung behinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerben, ins Abseits und die Verantwortlichen sehen zumeist eher ihre Pflichten, als ihre Rechte. Dies be- bzw. verhindert vielfach die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Es wird demnach deutlich, dass umweltbezogene Faktoren auf gesellschaftlicher Ebene vielfach in der Lage sind, die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung negativ zu beeinflussen. Vorurteile, Nicht-Wissen und negative Einstellungen seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen vielen Betroffenen die Chance, am Erwerbsleben zu partizipieren. Hier bedarf es dringend der notwendigen Aufklärung und des nötigen Drucks seitens der Politik, welche sich durch die neue UN-Konvention verpflichtet hat, den Forderungen der ICF Folge zu leisten, sodass Umweltfaktoren, wie sie in der Klassifikation aufgezeigt wurden, weniger Barrieren für Menschen mit Behinderung darstellen, sondern eher als deren Ressourcen genutzt werden können.
"Zusammenfassend muß allerdings auch betont werden, daß sich die Beschäftigungschancen und -bartieren [sic!] behinderter Menschen in einigen Aspekten mit jenen nicht-behinderter Menschen decken: sie sind konjunktur- und qualifikationsabhängig, sie beziehen sich auf einen segmentierten Arbeitsmarkt und geraten in dem Maße unter Druck, in dem krisenhafte Erscheinungen der Gesamtökonomie auftreten" (Leichsenring / Strümpel 1997, o. S.).
Wie die beiden Autoren es bereits 1997 ausgedrückt haben, dürfen bei allen behinderungsspezifischen Chancen auf und Risken von beruflicher Teilhabe die allgemein gültigen Regeln des Arbeitsmarktes nicht übersehen werden. Nicht jedes Scheitern einer Jobbewerberin oder eines Jobbewerbers mit Behinderung ist in Verbindung zu bringen mit deren Beeinträchtigung. Auch die allgemeine Konjunkturlage, welche sich derzeit vergleichsweise schlecht darstellt, und der Qualifikationsstand, der zeitweise unabhängig von der Behinderung einer Person sein kann, bestimmen maßgeblich darüber, ob ein Arbeitsplatz gewonnen werden kann oder nicht.
Darüber hinaus existieren jedoch auch noch andere Einstellungshindernisse, welche sich nicht explizit auf die Behinderung eines Menschen, sondern auf andere Charakteristika dieser Person beziehen: solche zielgruppenspezifischen Beeinträchtigungen bestehen demnach über die Grenzen der behinderungsbedingten Symptomatik hinaus.
Solche Faktoren werden innerhalb der ICF unter dem Oberbegriff "Personbezogene Faktoren" (DIMDI 2005, S. 22) zusammengefasst. Diese
"sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind. Diese Faktoren können Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, andere Gesundheitsprobleme, Fitness, Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, sozialer Hintergrund, Bildung und Ausbildung, Beruf sowie vergangene oder gegenwärtige Erfahrungen (vergangene oder gegenwärtige Ereignisse), allgemeine Verhaltensmuster und Charakter, individuelles psychisches Leistungsvermögen und andere Merkmale umfassen" (ebd.).
Gesundheitliche Einschränkungen bzw. gesellschaftliche Barrieren alleine scheinen demnach nicht die einzigen potentiellen Hindernisse für Menschen mit Behinderung zu sein. Auch andere Faktoren, wie Geschlecht, Alter, Ausbildung bzw. Qualifikation etc. spielen eine nicht zu verachtende Rolle. Bezüglich der Fragestellungen der hier vorliegenden Diplomarbeit scheint besonders das Geschlecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bedeutung[10].
" ‚Ob nun ein Mädchen oder ein Junge behindert zur Welt kommt, das ist doch egal!', so auch heute noch eine durchaus gängige Alltagsmeinung. Entscheidend sei vielmehr die gesundheitliche Abweichung, die es zu beheben, zu lindern oder zu kompensieren gelte, so auch Praktiker/innen und Theoretiker/innen der Behindertenpädagogik. Dass diese Einschätzung falsch ist oder zumindest zu kurz greift, zeigen verschiedene statistische Erhebungen über die Personengruppe der ‚Behinderten'" (Schildmann 2001, S. 151).
Schildmann nimmt in ihrem Beitrag "Frauenforschung in der Behindertenpädagogik" zur nach wie vor weit verbreiteten Meinung Stellung, dass Männer und Frauen mit Behinderung scheinbar "nur" aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt werden und dass diese Benachteiligungen bei beiden Gruppen gleich oder zumindest ähnlich ausfallen. Dieser Ansicht erteilt sie jedoch eine Absage.
Ausgehend von der Frauenforschung, welche innerhalb der Behindertenpädagogik bereits seit mehr als 20 Jahren existiert, verweist die Autorin darauf, dass Frauen mit Behinderung bereits in den 70er und frühen 80er Jahren eine "doppelte Diskriminierung" (ebd., S. 152) attestiert wurde, welche zum einen von der körperlichen und / oder intellektuellen / psychischen Beeinträchtigung der Frau ausgeht, zum anderen jedoch von ihrem Frausein herrührt. Innerhalb der Fachliteratur wurde und wird auf die Frauenproblematik bereits vor mehreren Jahrzehnten hingewiesen (vgl. bspw. Ewinkel et al. 1985; Daoud-Harms 1986; Moser 1997 Born 1998; Arnade 2000; Bruner 2000; Schuchardt 2000; Niehaus 2004; Niehaus 2007; Fasching 2008). Die Geschlechterdifferenz innerhalb der Behindertenpädagogik ist somit nichts völlig Neues. Beiträge zur Frauenproblematik gibt es mittlerweile, solche zu spezifischen Problemlagen von Männern mit Behinderung dagegen nur vereinzelt (vgl. Exner 1997).
Die geschlechtsbedingte Diskriminierung - besonders von Frauen mit Behinderung - macht jedoch nicht nur eine Benachteiligung gegenüber Männern mit Behinderung aus, sondern auch gegenüber nicht-behinderten Frauen. Schuchardt (2000, S. 8) schreibt in diesem Zusammenhang folgendes: "Frauen kämpfen um Gleichstellung, behinderte Frauen dazu, dass sie durch die Gesellschaft überhaupt als Frau wahrgenommen werden".
Dieses Zitat weist auf die grundlegendste Diskriminierung behinderter Menschen innerhalb unserer Gesellschaft hin. Nicht nur, dass diese aufgrund ihrer Beeinträchtigungen als weniger intelligent, leistungsfähig oder kompetent eingeschätzt werden. Oftmals werden Menschen mit Behinderung von ihren nicht-behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch gar nicht in ihrer Geschlechtlichkeit wahrgenommen. Auch auf diese Problematik wurde bereits vereinzelt verwiesen (vgl. Ewinkel et al. 1985; Daoud-Harms 1986; Exner 1997; Bruner 2000; Schuchardt 2000). So wird von all diesen Autorinnen und Autoren einstimmig festgehalten, dass Menschen mit Behinderung zumeist nicht als Männer oder Frauen gesehen bzw. behandelt werden, sondern als "Behinderte". Exner schreibt dazu (1997, S. 67):
"Natürlich gibt es - wie jeder weiß - drei Geschlechter. Es gibt Männer, Frauen und Behinderte: Dieses wird z.B. deutlich, wenn man sich in neueren öffentlichen Gebäuden die Anordnung der öffentlichen WC's ansieht. Sofern dort überhaupt für behinderte Personen Toiletten vorhanden sind, findet man hier drei verschiedene Toiletten - eine für Frauen, eine für Männer und eine für Behinderte. Das WC für Behinderte ist dabei mit einem Symbol, das eine geschlechtsneutrale Person darstellt, gekennzeichnet. [...] [Dies zeigt,] wie die geschlechtsspezifische Rolle von behinderten Menschen im allgemeinen Bewußtsein eingeordnet wird. In der Regel werden sie als geschlechtslose Neutren betrachtet".
Dies rührt unter anderem daher, dass Menschen mit (vor allem intellektueller) Behinderung immer noch eher als bedürftige Kinder angesehen werden denn als Erwachsene. Dadurch wird auch ihr Geschlecht verkindlicht und somit neutralisiert (vgl. Daoud-Harms 1986).
Eine solche Diskriminierung behinderter Menschen betrifft alle Lebensbereiche, angefangen von alltäglichen Belangen wie einer Behindertentoilette, welche in vielen Fällen für behinderte Männer und Frauen gleichermaßen bestimmt ist, bis hin zur Arbeitswelt, in welcher Menschen mit Behinderung vielfach bis heute nicht als aktive, selbstständige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer akzeptiert und anerkannt werden, obwohl Selbstvertretungsgruppen, Fachleute und sogar die Politik (bspw. ICF, UN-Konvention) in den letzten Jahrzehnten vermehrt auf diese Problematik hinweisen. Bezugnehmend auf die Fülle von Beiträgen zu Schwierigkeiten, welchen sich Frauen und Männer mit Behinderung in ihrem Leben gegenüber gestellt sehen, scheint es demnach angebracht, diese ansatzweise darzustellen[11].
Wie bereits festgestellt, sehen sich Frauen mit Behinderung nicht nur einer Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung gegenüber, sondern werden auch wegen ihres Geschlechts benachteiligt (vgl. hierzu stellvertretend Arnade 2000; Niehaus 2004; Puschke 2006; Niehaus 2007; Fasching 2008). Arnade (2000, o. S.) präzisiert diese Feststellung: "Deutlich wird ihre doppelte Diskriminierung bei einem Blick auf die Erwerbssituation behinderter Frauen. Sie bilden auf dem Arbeitsmarkt das Schlusslicht und leben folglich häufig unter schwierigen finanziellen Bedingungen".[12]
Auch im "Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderung in Österreich 2008" des BMASK wird auf die übermäßige Benachteiligung von Frauen mit Behinderung im Erwerbsleben hingewiesen. Außerdem werden die bedeutendsten Problemlagen aufgezeigt:
"Für Frauen mit Behinderungen in Österreich ist es oft schwierig, die gewünschte Ausbildung absolvieren und einen bestimmten Beruf ergreifen zu können. Der Besuch höherer Schulen, der Erwerb eines Studienabschlusses und einer damit verbundenen Qualifikation für einen gehobeneren Beruf ist mit dem Überwinden von zahlreichen Hindernissen verbunden. Nach wie vor verfügen Frauen mit Behinderungen seltener über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Männer mit Behinderungen, was nicht nur negative Auswirkungen auf ihre Berufschancen und finanzielle Situation hat, sondern sich auch ungünstig auf die psychosoziale Befindlichkeit auswirkt. Es ist generell für Menschen mit Behinderungen schwierig, einen Arbeitsplatz zu erlangen und sich in einem Beruf zu behaupten, für Frauen mit Behinderungen gestaltet sich die Jobfindung und Berufsausübung noch schwieriger. Oft sind behinderte Frauen in unterbezahlten, frauentypischen Berufsfeldern und in niedrigeren Hierarchieebenen tätig" (BMASK 2009, S. 230f.).
Bei differenzierterer Auseinandersetzung mit dieser Feststellung werden zwei verschiedene Ebenen der beruflichen Benachteiligung behinderter Frauen deutlich:
-
Auf der ersten Ebene - der Ausbildungsebene - wird klar, dass Frauen mit Behinderung weniger häufig über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen als Männer mit Behinderung. Das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen mit Behinderung tritt demnach nicht nur im Erwerbsleben, sondern bereits zuvor in der Berufsausbildung bzw. der Umschulung oder Rehabilitation zu Tage, wie dies in der Literatur ebenfalls bereits Erwähnung findet und fand (vgl. hierzu Born 1998; Arnade 2000; Niehaus / Kurth-Laatsch 2000; Niehaus 2007; Fasching 2008)[13]. Es kommt bei den genannten Autorinnen zum Ausdruck, dass Frauen mit Behinderung auch schon innerhalb von Berufsausbildungs- bzw. innerhalb von Umschulungs- oder Rehabilitationsmaßnahmen deutlich weniger stark vertreten sind als Männer mit Behinderung. Die Frauenanteilszahlen bewegen sich in den meisten Studien zwischen 30 und 40 Prozent (vgl. Fasching 2008, S. 46). Niehaus / Kurth-Laatsch (vgl. 2000, S. 10) sprechen gar nur von einem 20%-igen Frauenanteil. Gründe dafür sind ebenso wie bei der mangelnden Erwerbsbeteiligung vor allem die Unvereinbarkeit beruflicher (Um)-Schulungsmaßnahmen mit Kinderbetreuungspflichten bzw. anderen familiären Verpflichtungen (wie Angehörigenpflege) sowie fehlende Information der Frauen mit Behinderung. Arnade (vgl. 2000, o. S.) expliziert dies, indem sie zu bedenken gibt, dass die meisten Umschulungs- und Rehabilitationsmaßnahmen eher auf männliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dadurch finden Frauen die Berufsberatungen bei Institutionen wie dem AMS oftmals wenig motivierend. Darüber hinaus können familiär gebundene Frauen viele Maßnahmen nicht besuchen, da diese wohnortfern und ganztägig abgehalten werden, worauf auch Niehaus / Kurth-Laatsch (2000) in ihrer Evaluationsstudie hinweisen. Weitere Benachteiligungen behinderter (vor allem junger) Frauen zeigt Fasching (vgl. 2008, S. 44-48) auf:
-
Zum einen ist die familiäre Sozialisation bei Männern und Frauen mit Behinderung zu differenzieren. Aufgrund traditioneller Rollenbilder werden Mädchen bzw. junge Frauen mit Behinderung von ihren Eltern weniger in ihren beruflichen Ambitionen bestärkt, unterstützt und gefördert als Burschen bzw. junge Männer mit Behinderung. Wenn eine berufliche Förderung passiert, dient diese zumeist als Lückenfüller zwischen der Zeit der Schulentlassung und der Familiengründung der jungen Frauen, da diesen vielfach nicht zugetraut wird, sich selbst dauerhaft finanziell erhalten zu können. Junge Frauen mit Behinderung erlernen dadurch oftmals irgendeinen Beruf, der weder ihrer Qualifikation, noch ihren Neigungen entspricht, nur um diese bereits erwähnte Lücke in ihrem Lebenslauf zu schließen (vgl. ebd., S. 44).
-
Dies jedoch erweist sich als äußerst problematisch, da die berufliche Erstplatzierung für die Berufskarriere junger Menschen sehr bedeutsam und prägend ist und einen "kaum zu kompensierenden Einfluß für den weiteren Berufsverlauf" (Blossfeld 1990; zit. n. Born 1998, S. 94) hat.
-
Zum anderen hemmt auch die schulische Sozialisation der Mädchen und jungen Frauen mit Behinderung ihre spätere berufliche Ausbildung, worauf Fasching (vgl. 2008, S. 44f.) ebenfalls hinweist. So erfahren Mädchen mit Behinderung zumeist weniger schulische Förderung, da sie aufgrund ihres angepassteren Verhaltens weniger Aufmerksamkeit erhalten als Burschen mit Behinderung.
"Zudem sind die Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmaterialien oft mehr auf männliche Lebensinhalte ausgerichtet [...], [wobei] die Unterrichtsmaterialien und -hilfen in der Sonderschule [...] noch wesentlich stärker von sexistischen Ideologien geprägt sind als diejenigen anderer Schultypen" (Fasching 2008, S. 45).
Dadurch weisen jungen Frauen mit Behinderung zumeist ein recht niedriges Bildungsniveau auf, sodass sich ihre beruflichen Chancen drastisch reduzieren. Fasching (vgl. 2008, S. 45f.) gibt in Anlehnung an diverse Vorarbeiten (vgl. Born 1998) weiters zu bedenken, dass viele Berufsausbildungen junger Frauen mit Behinderung bzw. deren tatsächliche Realisierung an den schlechten Arbeits(markt)bedingungen scheitern.
-
Die zweite wesentliche Ebene - die berufliche Ebene macht deutlich, dass Frauen mit Behinderung, wenn sie denn Arbeit finden, zumeist in frauentypischen Berufssparten, sog. "Frauenberufen"[14] beschäftigt sind. Diese werden auf der einen Seite schlechter bezahlt und bieten weniger Aufstiegschancen, auf der anderen Seite sind sie stärker von der Gefahr der Verausgabung und des Burn-outs bedroht.
"Typische Ausbildungsberufe für junge Frauen sind vornehmlich im einfachen Dienstleistungssektor (hauswirtschaftlich-technische Helferinnen, Verkäuferinnen, Friseurinnen) angesiedelt. Gewerblich-technische Berufe spielen bei jungen Frauen mit Behinderung kaum eine Rolle" (Fasching 2008, S. 46; Klammern i. O.).
Frauen mit Behinderung wählen solche Berufe zumeist aufgrund ihrer bereits erwähnten frauentypischen Sozialisation. Eine weitere Entscheidungsgrundlage für die Berufswahl junger Frauen ist die ebenfalls bereits angesprochene Vereinbarkeit des Berufs mit der Familie. Auch junge Frauen mit Behinderung haben zumeist den Wunsch, eine Familie zu gründen und binden diese Überlegungen in ihre Berufswahl mit ein, wobei die schon erläuterte Überbrückungsfunktion von Arbeit zum Vorschein kommt.
Frauen mit Behinderung können demnach als "doppelt benachteiligt" (Schuchardt 2000, S. 8) angesehen werden, wobei diese doppelte Benachteiligung in Anbetracht all der zuvor beschriebenen Problemlagen eigentlich noch verharmlosend erscheint. Man kann sogar davon sprechen, dass
"Frauen mit Behinderungen [...] im Erwerbsleben einer potenzierten Benachteiligung durch Geschlecht und Behinderung ausgesetzt [sind], die eine berufliche Schlechterstellung gegenüber Frauen ohne Behinderungen, aber auch gegenüber Männern mit Behinderungen mit sich bringt" (Fasching 2008, S. 48).
Auf der Basis der hier beschriebenen Ausgangslage wird demnach deutlich, warum diese Diplomarbeit mitunter auch der Frage nach geschlechtsspezifischen Teilhabeerfahrungen von Männern und Frauen mit Behinderung nachgeht.
Obwohl, wie bisher deutlich wurde, vor allem die prekäre Situation behinderter Frauen im Erwerbsleben unter Fachleuten Beachtung findet (vgl. zuvor genannte Beiträge), finden sich in der Literatur auch vereinzelt Beiträge zur geschlechtsspezifischen Lage behinderter Männer (vgl. Exner 1997) [15].
Auch Männer mit Behinderung begegnen in ihrem Leben dem Problem, dass sie zumeist nicht die typischen männlichen Rollenmuster erfüllen können und somit von der Gesellschaft nicht als Mann, sondern als Behinderter wahrgenommen werden (vgl. Exner 1997, S. 71ff.). Diese rollenbezogene Exklusion äußert sich in jeglicher Lebenslage und beeinflusst somit auch den Bereich der Erwerbstätigkeit der behinderten Männer.
"So machen behinderte Männer u.a. die Erfahrung, daß sie von nichtbehinderten Männern weder als Verbündete oder Kollegen und schon gar nicht als Konkurrenten um soziale Stellungen [...] ernst genommen werden. Mit einem ähnlichen Rollenbild treten auch nichtbehinderte Frauen behinderten Männern entgegen" (Exner, S. 72).
Männer mit Behinderung stehen demnach oft der Schwierigkeit gegenüber, als Mann akzeptiert und respektiert zu werden. Dies zeigt sich besonders auch innerhalb der Arbeitswelt, in der behinderte Männer nicht als vollwertige Kollegen angesehen, sondern eher verkindlicht bzw. als hilfe- und kontrollbedürftig betrachtet werden.
Der natürliche Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen ohne Behinderung wird dadurch erschwert und beeinträchtigt. Eben dieser soziale Kontakt innerhalb eines Betriebs ist aber den meisten Menschen mit Behinderung - unabhängig von ihrem Geschlecht - besonders wichtig, wie dies auch Spiess (2004) in ihrer Dissertation bestätigte (vgl. hierzu auch z.B. Klicpera / Schabmann 1998; Doose 2007):
"In den Gesprächen wird immer wieder deutlich, dass die Personen zwar in Tätigkeitsbereichen arbeiten wollen, die ihren Neigungen grundsätzlich entsprechen, dass sie die konkreten Arbeitstätigkeiten und das Arbeitsfeld aber nicht als entscheidende Variable für ein befriedigendes Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ansehen. Als wesentlich wichtiger erachten sie ein angenehmes Arbeitsklima. Sie wünschen sich, mit ihren Kolleg(inn)en und Vorgesetzten gut auszukommen und von ihnen akzeptiert, anerkannt zu werden" (Spiess 2004, S. 212).
Dadurch, dass Männer mit Behinderung von anderen oft nicht in ihrer Rolle als Mann bemerkt werden, wird auch ihre eigene Selbstwahrnehmung beeinflusst, sodass sie häufig nur ihre Defizite sehen und ihre Identität darauf aufbauen. Vielfach versuchen sie dann - besonders auch im Beruf - alles, um diese Defizite und Abweichungen vom Idealbild "Mann" zu kompensieren. Dadurch bauen sie zusätzlichen Stress auf, der vielfach für die Betroffenen nicht zu bewältigen ist (vgl. Exner 1997, S. 74f.), was zu Überforderung und Arbeitsplatzverlust führen kann. "Bründel & Hurrelmann beschreiben dieses Phänomen ebenfalls und kommen zu dem Schluss, dass Männer im Erwerbsalter ‚Raubbau mit ihrem Körper' [...] treiben" (Stecklina / Böhnisch 2004, S. 223).
Eben diese Tendenz von vor allem Männern, sich "in sozialen und personal-intimen Beziehungen" (ebd., S. 220) nach außen zu orientieren, ohne sich dessen bewusst zu sein, wird von den beiden Autoren als "Externalisierung" (ebd.) bezeichnet. Diese wird maßgeblich von der psychischen Befindlichkeit von Männern bestimmt, wobei "Stress, Unzufriedenheit mit der persönlichen Situation, fehlende Beziehungsstrukturen und fehlende Netzwerke für Männer entscheidende Faktoren [sind], die sie bestimmte Konfliktsituationen mit expressiven Handlungsangeboten bewältigen lassen" (ebd., S. 223).
Männer neigen demnach dazu - egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht -, in Stresssituationen oder bei Unzufriedenheit, wenig rational zu reagieren und Handlungen zu setzen, welche sich in weiterer Folge negativ auswirken können. Bei Männern mit Behinderung werden solche Aktionen oftmals auf die Beeinträchtigung zurückgeführt, sodass sich die negativen sozialen Einstellungen und Vorurteile seitens nicht-behinderter Mitmenschen noch verstärken.
Männer tendieren zudem - im Gegensatz zu Frauen - dazu, Beratungs- und Unterstützungsangebote eher auszuschlagen, nicht zuletzt aufgrund einer falsch verstandenen Vorstellung des Ideals "Mann" (vgl. hierzu auch Exner 1997).
"Die Kommunikations-, Konflikt- und Kooperationsfähigkeit, die wesentlich die Beratungssituation mitbestimmen, werden von Männern oft als weibliche Fähigkeiten angesehen. Zudem sind Beratungssituationen für Männer mit der Forderung verbunden, sich in der Beratung gegenüber einem Professionellen zu öffnen und über Probleme zu sprechen, die zwischen Männern bisher zum unhinterfragten Tabubereich gehörten" (Trio Virilent 1995, zit. n. Stecklina / Böhnisch 2004, S. 224).
Es ist demnach davon auszugehen, dass Männer mit Behinderung weniger häufig Hilfe und Unterstützung suchen - bspw. im Erwerbsleben - als Frauen mit Behinderung. Hier muss eine neue, männerspezifische Unterstützungsform gefunden bzw. die Sozialisation der jungen Männer derart angepasst werden, dass eben solche Beratungs- und Unterstützungsangebote auch von Männern mit Behinderung angenommen werden können, ohne ihnen gleichzeitig das Gefühl zu vermitteln, nun weniger "männlich" zu sein.
Bilanzierend lässt sich hier demnach feststellen, dass Frauen mit Behinderung aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zwar sicherlich als "doppelt" oder sogar "mehrfach behindert" angesehen werden können. Aber auch Männer mit Behinderung sehen sich - wie deutlich wurde - vor allem wegen einer im Laufe der Sozialisation erworbenen, übertriebenen Idealisierung der Kategorie "Mann" häufig geschlechtsspezifischen Schwierigkeiten gegenüber. Diese führen mitunter zu einer beeinträchtigten Sichtweise der eigenen Identität als Mann, welche die Betroffenen zuweilen durch vermehrte (berufliche) Leistungen zu kompensieren versuchen. Nur selten und ungern werden von Männern mit Behinderung freiwillig Unterstützungsangebote wahrgenommen, oft aufgrund falsch verstandener Männlichkeit, wie sie im Laufe der Jungensozialisation erworben und im Beitrag von Stecklina / Böhnisch (vgl. 2004) dargestellt wird.
Zurückblickend auf das vorangegangene Kapitel wird also klar, dass die in der ICF beschriebenen Kontextfaktoren maßgeblich dazu beitragen, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu sichern oder zu verhindern. Je nachdem, ob sich diese als Barriere oder als Ressource darstellen, können sie über Erfolg oder Misserfolg von Partizipationsbestrebungen entscheiden. Es scheint deshalb bzgl. des notwendigen Umdenkens innerhalb von Sozialwesen, Politik und Gesellschaft und der Kreation neuer Unterstützungsmaßnahmen bedeutsam, diese Kontextfaktoren mit einzubeziehen. Sie sollten als Vorteile genutzt werden, anstatt Hindernisse auf dem Weg zur Partizipation darzustellen.
[9] Auch Cloerkes (vgl. 2007, S. 105) weist auf diesen Zusammenhang von der Art und Sichtbarkeit und der sozialen Einstellung Nicht-Behinderter hin.
[10] Auch das jugendliche Alter und der damit oftmals einhergehende Mangel an Ausbildung und Qualifikation können sich als Einstellungshindernisse erweisen (vgl. hierzu Fasching / Niehaus 2004; Häfeli 2005).
Selbstverständlich gäbe es hier noch weitere Merkmale einer Person, welche Diskriminierungen nach sich ziehen können, wie bspw. ein Migrationshintergrund (vgl. bspw. Powell / Wagner 2002; Mecheril 2006), religiöse Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung. All diese und viele andere Aspekte eines Menschen können sich negativ auf die Einstellungen ihrer Mitmenschen auswirken und zu Benachteiligungen und Diskriminierung führen. Und all diese Aspekte können Menschen mit Behinderung genauso betreffen wie nicht-behinderte Männer und Frauen, sodass auch diese - genau wie das Geschlecht und das Alter - mit den negativen Auswirkungen einer Behinderung kumulieren und sich somit vervielfachen können. Die beiden behandelten Aspekte "Geschlecht" und "Alter" scheinen jedoch aufgrund der Zielgruppe dieser Diplomarbeit - junge Männer und Frauen mit Behinderung - am relevantesten.
[11] Auch die konkrete Forschungsfrage des empirischen Teils dieser Diplomarbeit nach geschlechtsspezifischem Unterstützungsbedarf von Frauen und Männern mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt bedingt eine Darstellung der unterschiedlichen Problemlagen von Frauen und Männern mit Behinderung. So muss zunächst klar sein, welchen unterschiedlichen Problemen sich die beiden Personengruppen gegenüber gestellt sehen, bevor nach geschlechtsspezifischen Unterstützungsmöglichkeiten gefragt werden kann.
[12] Obwohl behinderte Frauen natürlich aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit nicht nur im beruflichen Alltag, sondern auch in vielen anderen Kontexten benachteiligt sind, würde eine genaue Darstellung dieser Bereiche den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen und zu weit vom eigentlichen Themenbereich der beruflichen Teilhabe-Erfahrungen wegführen. Deshalb seien die folgenden Bereiche möglicher Diskriminierung hier stellvertretend für viele andere Aspekte lediglich erwähnt: Benachteiligungen bzgl. Ausbildung einer eigenen Identität und des Einnehmens gesellschaftlich anerkannter Geschlechterrollen, Diskriminierung im Bereich der Elternschaft oder die Problematik sexueller Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen mit Behinderung.
Für tiefgreifendere Informationen bzw. Recherchen zu diesem Thema eignet sich der Text von Schildmann aus dem Jahr 2001, welcher unter dem Titel "Frauenforschung in der Behindertenpädagogik" einen umfangreichen Überblick zur Thematik und den Ergebnissen der vergangenen mehr als 20 Jahre gibt (vgl. hierzu auch Ewinkel et al. 1985; Daoud-Harms 1986; Bruner 2000; Puschke 2006).
[13] Bzgl. der Schulabschlüsse zeichnet Puschke (2006, S. 52) ein etwas anderes Bild, wenn sie zu bedenken gibt, dass sich "bei Schulabschlüssen [...] ein ähnliches Bild wie bei der Bevölkerung ohne Behinderung [zeigt]. Behinderte Frauen haben bessere Schulabschlüsse als behinderte Männer".
[14] "Ein Frauenberuf ist in der Regel statistisch definiert als ein Beruf, der zu mehr als 70 % weiblich besetzt ist" (Born 1998, S. 100). Die Autorin tritt jedoch gegen diese Bezeichnung auf, da sie ihres Erachtens nach "die Strukturierungsdifferenzen innerhalb der (sic!) Spektrums von Frauenberufen [nivellieren]" (ebd.), wodurch diese Berufe in ihrer gesellschaftlichen Wertigkeit nur noch weiter geschmälert würden.
[15] Der Autor verweist in seinem Beitrag auf den Mangel an Literatur über die spezifischen Problemlagen von Männern mit Behinderung, wenn er sagt, "daß die Sonderpädagogik bis heute für Jungen keine überzeugenden Konzepte vorweisen kann, die ihren geschlechtsspezifischen Belangen gerecht werden, um sie so zu unterstützen, gleichberechtigte und selbstbewußte Männer zu werden" (Exner 1997, S. 71).
Auch Stecklina / Böhnisch (2004, S. 219) deuten in ihrem Beitrag zur Beratung von Männern auf eben diesen Bedarf an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit der Thematik "Mann" hin: "Speziell die sozialwissenschaftliche Forschungslage zu Männern [weist] weiterhin Lücken und wenig miteinander vergleichsfähige - empirisch abgesicherte Paradigmen auf".
Inhaltsverzeichnis
Die berufliche Teilhabe junger Frauen und Männer mit Behinderung erscheint also aufgrund vielfältiger Barrieren erschwert und bedarf in den meisten Fällen (professioneller) Unterstützung.
Im modernen Behindertenhilfssystem existiert derzeit dahingehend ein regelrechter Dschungel an Unterstützungsmaßnahmen, welche für unterschiedlichste Zielgruppen mit jeweils spezifischen Zielvorgaben angeboten werden. So zählt Ginnold (vgl. 2000, S. 114-120) mögliche Unterstützungsleistung in Deutschland auf. Auch in Österreich existieren unterschiedlichste Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung von Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung. Fasching (vgl. 2004a, 75f.) nennt exemplarisch Clearing, Outplacement, Job Coaching oder die Arbeitsassistenz, welche in Deutschland unter der Bezeichnung Integrationsfachdienst bekannt ist. Diese wiederum werden von vielen verschiedenen Trägerorganisationen angeboten und bilden somit einen regelrechten Angebotsdschungel, durch welchen sich Menschen, welche Unterstützung benötigen bzw. deren Angehörige erstmal "durchkämpfen" müssen, bis sie die für sie passenden Maßnahmen herausfiltern können.
Jedoch nicht nur die Unterstützungsangebote sind äußerst vielfältig und teilweise unübersichtlich, auch deren Bezeichnungen können bei Betroffenen zu Verwirrung führen. Besonders häufig bzw. gerade inflationär gebraucht wird, wie Lawner (vgl. 2006) oder Theunissen (vgl. 2006) dies in ihren Beiträgen feststellen, derzeit der Begriff "Assistenz", wie er auch in der Bezeichnung "Arbeitsassistenz" Anwendung findet. Hierbei ist jedoch zunächst zu hinterfragen, was Assistenz bedeutet und was eigentlich den Unterschied zwischen Unterstützung und Assistenz ausmacht.
Das Wort "Assistenz" leitet sich vom lateinischen Begriff "assistentia" her und kann mit "Beistand" oder "Mithilfe" übersetzt werden (vgl. DUDEN 1994, S. 149). "Assistenz und Unterstützung (support) sind somit Parallelbezeichnungen" (Theunissen 2006, S. 9). Bei beiden geht es darum, Menschen in welcher Weise auch immer behilflich zu sein. Dennoch existieren in der Literatur feine Unterschiede zwischen den beiden Begriffen, welche sie in ihrer grundlegenden Ausrichtung voneinander trennen. Lawner (vgl. 2005) plädiert in seinem Beitrag sogar für eine scharfe Trennung der beiden Begriffe.
In diesem Zusammenhang verweist der Autor auf das Deutsche Sozialgesetzbuch (SGB XI) bzw. das Bundessozialhilfegesetz (BSHG), wonach "die Assistenzleistungen einen kompensierenden (auf der Basis des SGB XI bzw. §§ 68/69 BSHG) und die Unterstützungsleistungen einen entwicklungsfördernden und entwicklungsorientierenden (auf der Basis der §§ 39/40 BSHG) Leistungscharakter haben" (ebd., S. 28; Hervorhebungen und Klammern i. O.). Der grundsätzliche Unterschied besteht demnach einerseits in der Zielrichtung der Leistungen, andererseits zumeist in der angesprochenen Zielgruppe. Assistenz zielt vor allem auf Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ab (vgl. persönliche Assistenz am Arbeitsplatz) und versucht, mit ihren Leistungen vor allem fehlende körperliche Funktionen bzw. die körperliche Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung auszugleichen bzw. durch Hilfsdienste nicht-behinderter Menschen zu ersetzen. Unterstützungsmaßnahmen hingegen richten sich vielfach an Menschen mit intellektuellen, psychischen und / oder Lernbehinderung. Ihnen geht es eher um ein Kompetenz erweiterndes und Leistung steigerndes Angebot für Menschen mit Behinderung. Diese sollen durch Unterstützungsleistungen in ihren eigenen Fähigkeiten gestärkt bzw. sollen neue entdeckt und ausgebildet werden, was zu einer (Weiter-)Entwicklung der eigenen Persönlichkeit führt. Frevert (2006; zit. n. Lelgemann 2009, S. 81f.) fasst diesen Umstand folgendermaßen zusammen: "Im Gegensatz zur Assistenzsituation liegt der aktive Part der Unterstützung in der Vor- und Nachbereitung von Aktivitäten. Während der eigentlichen Aktivität bleibt die Unterstützungsperson im Hintergrund". Somit sind Unterstützungsleistungen in ihrem Grundverständnis eher als (heil-)pädagogische Maßnahmen anzusehen, wenn man davon ausgeht, dass es der Pädagogik - und hier vor allem der Heilpädagogik - um eine Weiterentwicklung des Menschen und seiner ihm eigenen Fähigkeiten geht. Biewer (2009, S. 80) schreibt hierzu:
"Im Unterschied zur allgemeinen Pädagogik ist der Entwicklungsgedanke aber zentral für die Heilpädagogik. Die Erleichterung und Ermöglichung von Entwicklungsprozessen ist eine vorrangige Aufgabe heilpädagogischen Handelns [...] Für die Heilpädagogik hat der Begriff der Entwicklung keine geringere Bedeutung als Bildung und Erziehung."
Ein weiterer Unterschied besteht bei den Ausführenden, den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern. Während Assistenz zumeist von Laienhelferinnen und Laienhelfen durchgeführt wird, welche von den Assistenznehmerinnen und Assistenznehmern eingearbeitet und angeleitet werden, werden Unterstützungsleistungen zumeist von Professionistinnen und Professionisten erbracht. Das ursprüngliche Assistenzmodell (bspw. persönliche Assistenz) verlangt den Assistenz nehmenden Menschen demnach eine Menge an Eigenkompetenz und Eigenregie ab, was zum einen zu mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, mitunter aber auch zu einer Überforderung Personen führen kann (vgl. Lawner 2006; Theunissen 2006). Aufgrund dieser Tatsache könnte sich auch erklären, dass dieses Modell zumeist Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen anspricht.
Das Konzept der Assistenz scheint demnach zu einer gewissen Machtumkehr bzw. zu einem Rollentausch zu führen. Bei Unterstützungsmaßnahmen wird zumeist "fremdbestimmend" vorgegangen und Menschen mit Behinderung wird von Fachleuten der für sie beste Weg empfohlen und oft auferlegt, zumindest in der Hinsicht, wenn man an zuvor erwähnte Unterscheidung nach Frevert (vgl. 2006; zit. n. Lelgemann 2009, S. 81f.) denkt, dass für sie mittels Vor- und Nachbereitung die vollkommene Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und der Weg für die eigentliche Aktivität bereitet wird. Das Assistenzkonzept allerdings sieht die Betroffenen als "Experten in eigener Sache" (Lawner 2006, S. 10) an, welche selbstbestimmt Entscheidungen treffen können, für deren Umsetzung aufgrund ihrer Beeinträchtigungen jedoch auf die kompensierenden Leistungen anderer angewiesen sind. Lawner (2005, S. 30) macht, bezugnehmend auf eine Vorarbeit von Steiner (1999), in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, "dass die Assistenzleistungen weitestgehend unabhängig von Institutionen und deren fremdbestimmenden Zwängen und von fremdbestimmender, entmündigender Hilfe durch die so genannte Fachlichkeit von HelferInnen organisiert wird [sic!]" [16].
Es ist auf jeden Fall zu beachten, dass all diese Charakteristika von Assistenz und Unterstützung interpersonell variieren und stark abhängig sind von der individuellen Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit der begleiteten Menschen. So haben manche Personen mit Körperbehinderung vielleicht Schwierigkeiten damit, Assistenzmaßnahmen zu delegieren, während viele Menschen mit Lernbehinderung damit gut zurecht kommen. Eine wirkliche Differenzierung zwischen den beiden Begriffen bzw. den damit verbundenen Maßnahmen konnte bislang scheinbar noch nicht getroffen werden. Vielleicht auch deshalb, weil sie zu eng mit einander in Verbindung stehen, als dass sie hinlänglich vollständig zu trennen wären. Tatsache ist es, dass es viele Varianten der Hilfen für Menschen mit Behinderung gibt und alle ihre Vor- und ihre Nachteile mit sich bringen.
Ebenso unterschiedlich und individuell wie die Bedürfnisse der zu unterstützenden Personen müssen auch die Unterstützungsmaßnahmen und -angebote sein, welche Menschen mit Behinderung zur Teilhabe am Erwerbsleben in Anspruch nehmen können. Prinzipiell lassen sich dabei innerbetriebliche und außerbetriebliche unterscheiden Unterstützungsleistungen unterscheiden. Diese sind jedoch dann weiter zu differenzieren. Eine Möglichkeit, eine solche Differenzierung vorzunehmen, geben Bungart / Putzke (2001) in ihrem Beitrag "Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozess der betrieblichen Integration". Ausgehend von dieser Quelle lassen sich, werden gewisse Überarbeitungen bzw. einige Ergänzungen vorgenommen, folgende Differenzierungen von inner- und außerbetrieblichen Unterstützungsmaßnahmen[17] vornehmen:
-
Unterstützung im Betrieb:
-
Pädagogische, qualifizierende Maßnahmen
-
Arbeitsplatzanpassungen durch AASS, JobCoach etc.
-
Empowermentprozesse
-
fachliche Einarbeitung vor allem durch Mentoring
-
soziale Integration in den Kreis der MitarbeiterInnen
-
technische Hilfsmittel
-
psychosoziale Unterstützung
-
orientierende Angebote
-
finanzielle Förderungen?(als Unterstützung für den Betrieb)
-
Außerbetriebliche Unterstützung:
-
pädagogische, qualifizierende Maßnahmen
-
Ausbildung von Schlüsselqualifikationen
-
Persönlichkeitsbildung bzgl. Empowerment
-
emotionale Unterstützung
-
instrumentelle Hilfen
-
orientierende Angebote
-
materielle Unterstützung
Bei den verschiedenen Dimensionen der Unterstützung ist immer auch zu unterscheiden zwischen den konkreten Maßnahmen, den ausführenden Personen oder Dienste und der Art und Weise, wie sie dem betroffenen Menschen helfen. So kann Arbeitsassistenz nicht einfach als eingliedernde, pädagogische Maßnahme angesehen werden, sondern es handelt sich dabei um einen Dienst, welcher gewisse Maßnahmen für die zu unterstützenden Menschen leistet. Diese Leistungen können dann wiederum sowohl innerbetrieblich, als auch außerhalb des konkreten Unternehmens lokalisiert werden. Im Folgenden werden die für die Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung entscheidendsten Unterstützungsleistungen im und außerhalb des Betriebes dargestellt.
Ohne eine Gewichtung der unterschiedlichen Unterstützungsangebote innerhalb eines Betriebes vornehmen zu wollen, werden nun zunächst die pädagogischen bzw. professionellen Hilfestellungen dargestellt. Dabei ist grundsätzlich
"Unterstützung [...] als eine pädagogische Leistung zu verstehen, die jeweils in Abhängigkeit von den individuellen Erfordernissen des Betroffenen, inhaltlich als Kompetenz aufbauenden [sic!] und entfaltende Leistung zu gestalten wäre, d.h. dem zielorientierten Charakter einer Eingliederungshilfe [...] zu entsprechen hätte, um für den Einzelnen seine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft [bzw. im Erwerbsleben, Anm. F. S.] zu gewährleisten" (Lawner 2005, S. 32).
Der Autor geht davon aus, dass pädagogische Unterstützung eine Leistung darstellt, welche der jeweiligen Person bei deren persönlichen Weiterentwicklung Hilfestellung und Anleitung leistet. Dies soll eine Eingliederung in einen bestimmten Lebensbereich ermöglichen. Im Falle der beruflichen Unterstützung geht es demnach um eine Teilhabe am Erwerbsprozess. Diese zu gewährleisten bzw. zu ermöglichen, verlangt vielfach professioneller Mithilfe, besonders auch bei der Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung, wie dies Lilienthal / Behncke (vgl. 2004, o. S.) festgestellt haben. So ist es als eine Form pädagogischer Unterstützung häufig notwendig, die Anforderungen des Arbeitsplatzes an die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin anzupassen, d.h. Anforderungs- und Fähigkeitsprofil einander anzunähern. Hier muss man sich eben an den "individuellen Erfordernisse der Betroffenen" (Lawner 2005, S. 32) orientieren, wie es der Autor im oben genannten Zitat aussagte. Bungart / Putzke (vgl. 2001, S. 149) zählen verschiedene Möglichkeiten einer solchen Anpassung auf: Job-Stripping, Job-Carving, Veränderungen der Arbeitszeit- oder Pausenregelung, Gestaltung der Arbeitsumgebung u. a. Besonders das Job-Stripping, d.h. das Herauslösen von Tätigkeiten aus dem Gesamtaufgabenkomplex, wird oft praktiziert. Lilienthal / Behncke (2004, o. S.) sprechen von einer "Herunterbrechung der Tätigkeiten in einzelne Teilschritte". Dadurch sei es möglich, die Einzelheiten der zu leistenden Aufgaben detailliert kennen zu lernen und einzuüben, ohne den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin zu überfordern (vgl. ebd.).
Ähnlich geht auch die Integrative Berufsausbildung vor. Wenn sich junge Menschen mit Behinderung nämlich für eine solche entscheiden, können sie zwischen zwei Varianten wählen: zum einen die verlängerte Lehrzeit, bei der die Dauer der Lehre einfach um ein, maximal zwei Jahre verlängert wird, zum anderen die sog. Teilqualifizierung, bei der eine Stoffreduktion vorgenommen und so die Komplexität der zu erlernenden Fertigkeiten und Kompetenzen reduziert wird. Die jungen Menschen erlernen dabei nicht den kompletten Beruf, sondern spezialisieren sich auf Teilbereiche. Die Lerninhalte werden demnach an die Bedürfnisse der jeweiligen Person angepasst, sie werden quasi auf einzelne Teilaspekte heruntergebrochen (vgl. BMWFJ 2009, S. 32).
Arbeitsplatzanpassungen werden generell durch unterstützende Dienste wie Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz oder JobCoaching vorgenommen, wobei auch auf technische Hilfsmittel zurückgegriffen wird. So sind Zählhilfen, Listen mit den zu verrichtenden Arbeitsschritten, aber auch tatsächliche technische Apparaturen Mittel, um "neue Möglichkeiten zu öffnen" (Lilienthal / Behncke 2004, o. S.).
Diese Formen der Unterstützung ermöglichen es der jeweiligen Person, mehr Selbstständigkeit zu entwickeln, Dinge eigenständig erledigen zu können. Dadurch werden sie quasi empowert, d.h. sie werden befähigt - durch Anpassungen der Arbeitsplatzanforderung an ihre Leistungsfähigkeit oder auch durch technische Hilfsmittel - ohne fremde Hilfe berufliche Tätigkeiten zu verrichten. Empowerment, dessen Ziel "die Förderung der Fähigkeit der Menschen [ist], ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen" (Stark 2004, S. 536), wird damit zu einer essentiellen Zielgröße, welche es bei der pädagogischen Unterstützung im Betrieb, aber auch außerhalb des Betriebes zu erreichen gilt. Dabei ist zu beachten, dass ein professionelles Heranführen an Empowermentprozesse dem Grundgedanken dieses Konzeptes nicht widerspricht. Wichtig ist es nur, den Fokus auf die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der zu unterstützenden Person zu richten, sodass diese in ihrer Entwicklung gefördert werden (vgl. ebd., S. 537).
-
Häufig bedarf es jedoch auch anderer Hilfsangebote seitens der unterstützenden Dienste wie bspw. psychosozialer Unterstützung.
"Verunsicherung und Überforderung, die Erwartungen an sich selbst und die anderer, die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung und die gewachsenen Anforderungen an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung stellen auch Anforderungen an die psychosoziale Kompetenz der ArbeitsbegleiterInnen. [...] Auch im weiteren Verlauf des Arbeitslebens können Veränderungen im Betrieb eine integrationsgefährdende Belastung darstellen, [...] die durch die ArbeitsassistentInnen aufgefangen werden müssen" (ebd.).
Die psychosoziale Dimension der beruflichen Eingliederung an sich, aber auch der Teilhabe am Erwerbsleben im Allgemeinen stellt demnach einen nicht zu verachtenden Aspekt im Bereich der Unterstützung dar. Gerade in Übergangssituationen wie dem Eintritt in einen neuen Arbeitsbereich oder dem Übergang von der Schule ins Berufsleben treten bei jedem Menschen - egal ob behindert oder nicht - häufig Probleme zu Tage, welche für die einzelne Person mitunter nur schwer zu lösen sind, sodass hier professionelle Hilfe angezeigt und oft unentbehrlich ist[18]. Häufig können auch durch solche Beratungsangebote neuerdings Empowermentprozesse, wie zuvor bereits angesprochen, angestoßen werden.
-
Auch orientierende Unterstützung bzgl. der ungewohnten Arbeitsplatzumgebung könnte ein Thema für den neuen Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mit Behinderung sein. So ist es eventuell erforderlich, dass der JobCoach oder das Mitglied der Arbeitsassistenz mit der zu begleitenden Person zunächst einmal den neuen Arbeitsplatz erkundet, d.h. Hilfe beim Zurechtfinden am Arbeitsplatz anbietet. Auch persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist eine Maßnahme, welche Hilfe für Menschen mit vor allem körperlicher Behinderung bereitstellt. Eine solche Aufgabe könnte jedoch auch einem Kollegen bzw. einer Kollegin des behinderten Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin zufallen. Hier kommt die soziale Komponente der betrieblichen Unterstützung ins Spiel.
Beinahe immer ist in den Unterstützungsprozess innerhalb eines Betriebes auch zumindest ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin des Kollegiums involviert, welche als Fürsprecher bzw. Fürsprecherin für die neu einzugliedernde Person agiert. Dies wird häufig, besonders auch beim Modell der Arbeitsassistenz, welches als individuelles Betreuungsmodell gilt, durch sog. Mentorinnen und Mentoren erreicht.
Dieses Modell weist das höchste Integrationsniveau auf und wird somit zumeist bevorzugt. Es tritt in zwei unterschiedlichen Ausprägungen, je nach ausführenden Akteuren, auf (vgl. Schartmann 1995):
-
Bei der sog. "Job Coach-Variante" wird die neue Arbeitnehmerin bzw. der neue Arbeitnehmer in der Anfangszeit durch einen externen, d.h. betriebsfremden Arbeitsbegleiter angeleitet und eingearbeitet.
-
Die andere Variante, "natural support", basiert auf dem Verständnis, dass Menschen, die bereits jahrelang in einem Betrieb arbeiten, die Gepflogenheiten und Umgangsformen innerhalb eines Betriebs, die Arbeitsvorgänge bzw. die offizielle sowie die inoffizielle Unternehmenskultur und -philosophie kennen und diese besser vermitteln können als betriebsfremde Personen. Dies hat, wie Schartmann (vgl. 1995, o. S.) anführt, vor allem für Menschen mit Behinderung Vorteile, da diesen von Seiten nicht-behinderter Kolleginnen und Kollegen häufig mit Skepsis und Vorurteilen begegnet wird. Dies können langjährige, bereits in das Kollegium integrierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zerstreuen als externe Personen, welchen das Kollegium vielleicht ebenfalls misstrauisch gegenüber stehen.
Dies erleichtert es der neuen Arbeitnehmerin bzw. dem neuen Arbeitnehmer sowohl durch fachkundige Erklärung und Anleitung die Arbeitsabläufe und -aufgaben zu verstehen, als auch Kontakte am neuen Arbeitsplatz zu knüpfen und in die Sozialstruktur des Unternehmens einzusteigen. Dieses Modell wird jedoch nicht nur innerhalb der Behindertenarbeit angewandt. Auch neue nicht-behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden innerhalb großer Firmen zumeist einer erfahrenen Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter "anvertraut", um sie in die Arbeitsvorgänge einzuführen und sie "anzulernen". Dabei stehen zwar zumeist eher die arbeitsspezifischen Lernaspekte im Vordergrund. Dennoch treten auch hier soziale Aspekte auf. So lernen sog. "Anlehrlinge" die Kolleginnen und Kollegen ihrer Mentorin bzw. ihres Mentoren in deren natürlichen Umgang miteinander kennen, wodurch die erste Kennenlernphase verkürzt bzw. erleichtert werden kann. Auch bei den arbeitsspezifischen Komponenten erweist sich eine solche Einführung in die Tätigkeit durch eine erfahrene Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter häufig als effektiver und effizienter als eine Einarbeitung durch eine externe Kraft, welche zwar vielleicht theoretisch über die Arbeitsvorgänge Bescheid weiß, sich jedoch ebenfalls zunächst einarbeiten muss, bevor sie die neue Arbeitnehmerin bzw. den neuen Arbeitnehmer anleiten kann.
Es kommt beim individuellen Betreuungsmodell auch immer wieder zu Mischvarianten, wobei ein externer Job Coach im Anfangsstadium zwar anwesend ist und unterstützend zur Seite steht, nach kurzer Zeit jedoch diese Tätigkeiten des Job Coaches reduziert und auf eine betriebsinterne Mentorin bzw. einen Mentor übertragen werden. Dies ist zumeist auch bei der Unterstützung behinderter Menschen durch die Arbeitsassistenz der Fall. Hierbei zeigt sich demnach die Bedeutung von Unterstützung der behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seitens des Betriebes bzw. des Kollegiums. Die soziale Komponente innerhalb des Betriebes ist, obwohl bislang eher unzureichend qualitativ berücksichtigt, also nicht zu vernachlässigen. Auch Schartmann (1995, o. S.) stellt dies in Anlehnung an diverse Untersuchungen folgendermaßen fest:
"Aus diesen Studien zu Arbeitsplatzverlusten wurde die Schlußfolgerung gezogen, daß die Einbindung des neuen Arbeitnehmers in die sozialen Strukturen am Arbeitsplatz einen eminent wichtigen Baustein jeder Integrationsmaßnahme darstellt, der in dieser Relevanz für die berufliche Integration noch nicht erkannt worden ist. [...] Als externe, betriebsfremde Fachleute, mit dem Ziel der beruflichen Integration behinderter Menschen, waren Job Coaches oft von den informellen Kommunikationsprozessen unter den alt eingesessenen Mitarbeitern des Unternehmens ausgeschlossen und hatten aufgrund ihrer nicht vorhandenen Vorkenntnisse über das Unternehmen und die Mitarbeiter auch kaum eine Möglichkeit, an diesen informellen Kommunikationsprozessen sinnvoll zu partizipieren".
Obwohl externe Fachleute demnach das primäre Ziel der beruflichen Eingliederung der behinderter Frauen und Männer und somit das pädagogische Ziel der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung verfolgen, sind sie alleine oft nicht imstande, die Erreichung dieser Zielvorgabe zu garantieren. Viel zu komplex stellen sich dazu die sozialen und kollegialen Strukturen innerhalb eines Unternehmens dar.
Neben diesen offenkundigen Hilfeleistungen durch ProfessionistInnen und Laien, scheint eine weitere, verborgene Form der Unterstützung ebenfalls von Bedeutung zu sein: die finanziellen Förderungen, welche Betriebe erhalten, wenn sie Menschen mit Behinderung anstellen. Diese nämlich kommen indirekt wiederum den Betroffenen zugute, da Firmen es sich vielfach ohne diese Zuschüsse nicht vorstellen bzw. leisten könnten, Menschen dieser Zielgruppe zu beschäftigen. Im "Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen in Österreich 2008" werden in diesem Zusammenhang vor allem drei Arten von Lohnkostenzuschüssen genannt, welche es Unternehmen ermöglichen bzw. erleichtern sollen, Menschen mit Behinderung anzustellen (vgl. BMASK 2009, S. 169f.):
-
Integrationsbeihilfe, welche als klassischer Lohnkostenzuschuss über maximal drei Jahre anzusehen ist;
-
Entgeltbeihilfe, welche etwaige Leistungseinbußen durch Menschen mit Behinderung ausgleicht; sowie
-
Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe, welche ein Unternehmen für bis zu drei Jahre erhalten kann, um einen Arbeitsplatz eines Menschen mit Behinderung sichern zu können.
Diese drei Beihilfen, welche Unternehmen vom Bundessozialamt beziehen können, stellen einen ebenso wichtigen Eckpfeiler der Unterstützung für Menschen mit Behinderung dar. Da sie den Betrieben selbst zugute kommen, können sie durchaus als innerbetriebliche Unterstützung angesehen werden, obwohl die Leistungen eigentlich von außen an das Unternehmen herangetragen und die betroffenen Menschen mit Behinderung eher indirekt unterstützen. Allerdings sichern bzw. ermöglichen sie den Arbeitsplatz vieler Personen dieser Zielgruppe und sind deshalb unbedingt hier zu erwähnen[19]. Auch Koenig (2005, S. 59) gibt die Bedeutung finanzieller Unterstützung zu bedenken, wenn er schreibt: "Finanzielle Förderungen können beschäftigungsrelevant sein. Als beschäftigungsförderlich wirken sich finanzielle Zuschüsse eher bei kleineren Unternehmen aus, die diese bei Einstellung eines Menschen mit Behinderung erhalten können."
Ebenso bedeutsam wie die innerbetriebliche, sind auch die hier als "außerbetriebliche Unterstützung" bezeichneten Leistungen. Diese können ebenfalls sowohl von professioneller, als auch von sozialer Seite durch Familie, Freunden und das soziale Umfeld der einzugliedernden Menschen betrachtet werden.
Führt man sich nochmals das Zitat von Lawner vor Augen, welches Unterstützung als "pädagogische [,...] Kompetenz aufbauenden [sic!] und erweiternde Leistung" (Lawner 2005, S. 32) ansieht, so scheint eine Form der Unterstützung vor allem in der Qualifizierung der einzugliedernden Menschen zu liegen. Diese kann einerseits innerbetrieblich, mittels Einarbeitung in konkrete Tätigkeiten, andererseits auch außerbetrieblich und vorbereitend organisiert sein. Eine solche vorbereitende Qualifizierung findet bspw. in sog. Berufsvorbereitungskursen statt, welche von vielen unterschiedlichen Trägern angeboten werden. Hier geht es zumeist um allgemein bildende Inhalte sowie Fertigkeiten, welche für die jungen Menschen in ihrem späteren Berufsleben von Nutzen sein können. Daneben bieten viele derartige Kurse auch eine Möglichkeit zur Ausbildung bzw. zur Verbesserung sog. "Schlüsselqualifikationen" an. Diese sind Fähigkeiten, welche quasi Schlüsselfunktion für viele weiterführende Tätigkeiten haben. Sie wurden von Mertens (1974) wie folgt klassifiziert:
"Kataloge von Schlüsselqualifikationen enthalten etwa folgende Kategorien: Förderung der Fähigkeit zu lebenslangem Lernen und zum Wechsel sozialer Rollen, Distanzierung durch Theoretisierung, Kreativität, Relativierung, Verknüpfung von Theorie und Praxis, Technikverständnis, Interessenanalyse, gesellschaftswissenschaftliches Grundverständnis; Planungsfähigkeit; Befähigung zur Kommunikation, Dekodierungsfähigkeit; Fähigkeit hinzuzulernen, Zeit und Mittel einzuteilen, sich Ziele zu setzen, Fähigkeit zur Zusammenarbeit, zur Ausdauer, zur Konzentrationsfähigkeit, zur Genauigkeit, zur rationalen Austragung von Konflikten, zur Mitverantwortung, zur Verminderung von Entfremdung, Leistungsfreude" (Mertens 1974, S. 40).
Obwohl viele dieser Fähigkeiten für die Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung vielleicht weniger relevant erscheinen, können etliche davon für sie im Berufsleben von essentieller Bedeutung sein. Denn in der heutigen Zeit sind selbst bei ungelernten Tätigkeiten verschiedene dieser Qualifikationen wichtig. Lilienthal / Behncke (2004, o. S.) beschreiben die Tragweite des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen ebenfalls, wenn sie schreiben:
"Selbst in vergleichsweise einfachen Arbeitsbereichen wie z.B. denen einer Küchenhelferin werden mittlerweile hohe Anforderungen an Planungsvermögen und Kommunikationsverhalten gestellt. Eine KüchenhelferIn [sic!] muss in der Lage sein, innerhalb eines Teams mit ihren KollegInnen beispielsweise kurz abzusprechen, wer welche Aufgabe übernimmt."
Auch Schlüsselqualifikationen tragen zum zuvor erwähnten Empowerment von Menschen mit Behinderung bei, da auch sie ihnen ermöglichen, Arbeitsvorgänge selbstständig zu planen und auszuführen. Somit ist Kompetenz erweiternde, pädagogische Unterstützung außerbetrieblich ebenfalls von großer Bedeutung. Aber nicht nur diese Form der Hilfe außerhalb des Unternehmens ist für Menschen mit Behinderung notwendig. Auch hier spielt die soziale Komponente eine entscheidende Rolle.
Da kein Mensch für sich alleine lebt und immer Teil eines sozialen Netzwerkes ist und bleibt, wie dies auch Exner (vgl. 2007, S. 170) bezugnehmend auf Luhmanns Systemtheorie klarstellte, ist es entscheidend, die Vernetzungen, in welche ein Mensch eingebunden ist, sowie die damit einhergehenden Chancen und Risiken bei der beruflichen Eingliederung dieser Person zu berücksichtigen. Besonders die eigene Familie und dabei vor allem die Eltern behinderter Männer und Frauen haben einen großen Einfluss auf ihre Kinder, sodass ihnen bzgl. des Erfolges oder Misserfolges einer beruflichen Integrationsmaßnahme eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung zukommt.
Schartmann (vgl. 2000) erachtet die Kooperation mit den Eltern behinderter Menschen bei deren beruflicher Eingliederung aus zweierlei Gründen für besonders bedeutsam: Einerseits seien diese die eigentlichen Initiatoren der Integrationsbewegung behinderter Menschen gewesen[20], zum anderen lägen bei ihnen wichtige Unterstützungsressourcen, welche es zu nutzen gelte. Eltern und Familien behinderter Frauen und Männer können demnach die berufliche Integration nachhaltig fördern und sichern, indem sie
-
"praktische Unterstützung anbieten, die sich von einer Entlastung des behinderten Menschen [...] bis hin zu einer aktiven Mitgestaltung der Integrationsmaßnahme [...] erstrecken kann" (ebd.; Klammern i. O.). Eltern und Familien übernehmen demnach wichtige Tätigkeiten im beruflichen Integrationsprozess und entlasten dadurch sowohl die zu integrierenden Männer und Frauen mit Behinderung, als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Integrationsfachdienste. Diese müssen sich dann bspw. nicht mit Behördengängen aufhalten und haben somit mehr Zeit und Ressourcen für andere Angelegenheiten.
-
"Eltern können eine wichtige emotionale Unterstützung geben. Als oftmals primäre Bezugspersonen können sie Motivationshilfen geben, wenn im Laufe des Integrationsprozesses ‚Motivationslöcher' auftreten sollten" (Schartmann 2000, o. S.).
Eltern kennen ihre Kinder zumeist sehr genau, egal ob diese nun eine Behinderung aufweisen oder nicht. Dadurch bemerken sie zumeist auch, wann die Motivation ihrer Kinder nachlässt und können sich oft besser in ihre Gefühls- und Gedankenwelt hineinversetzen (vgl. ebd.). Sie erkennen so oftmals die Gründe für sog. "Motivationslöcher" ihrer Kinder und wissen vielfach auch, wie sie diese wieder schließen und ihre Sprösslinge aufbauen und erneut motivieren können. Das macht Eltern bzw. die Familien behinderter Menschen zu einem unverzichtbaren (Unterstützungs-)Bestandteil beruflicher Integrationsmaßnahmen.
-
"Eltern von geistig behinderten Kindern sind häufig [...] die offiziellen Ansprechpartner für einen Integrationsdienst; die einzelnen Integrationsschritte müssen dann mit der Betreuung abgestimmt werden" (ebd.).
Besonders an der Schwelle von der Schule ins Erwerbsleben leben junge Männer und Frauen mit Behinderung oftmals noch im Haus ihrer Eltern, was diese zu deren Betreuungspersonen sowie deren Sachwalterinnen und Sachwaltern macht. Sowohl von rechtlicher Seite, als auch aus Betreuersicht sind die Eltern demnach die offiziellen, d.h. von Rechtswegen befugten, Kontaktpersonen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Integrations-maßnahmen wie Clearing oder Arbeitsassistenz. Die Eltern tragen damit die rechtliche Verantwortung für alle Maßnahmen, an denen ihre Kinder teilnehmen sollen oder werden. Auch wenn die Betroffenen in den Entscheidungsfindungsprozess bzgl. der jeweiligen beruflichen Eingliederungsmaßnahme miteinbezogen werden, sind es oftmals letztendlich die Eltern als offizielle Rechtsvertreter ihrer Kinder, welche Vereinbarungen und Verträge unterschreiben und die rechtliche Entscheidungsverantwortung tragen. Insofern spielen sie eine wichtige Unterstützungsrolle im Prozess der beruflichen Rehabilitation.
-
"Die wichtigste Funktion von Eltern im Integrationsprozess ist jedoch die, den für die Integration benötigten Entwicklungsraum auch zu gewähren" (Schartmann 2000, o. S.).
Trotz all dieser bereits erwähnten Unterstützungsressourcen, welche Eltern ihren Kindern im beruflichen Eingliederungsprozess zur Verfügung stellen können, ist es dennoch essentiell, dass sie erkennen, dass ihre Kinder viele Schritte alleine tun müssen. Schartmann (2000, o. S.) beschreibt dies, in dem er davon spricht, dass "berufliche Integration [...] einen Abnabelungsprozess des Kindes von den Eltern [bedeutet]." Ohne den notwendigen Entwicklungsfreiraum, welchen nicht nur die Eltern behinderter Kinder, sondern auch deren andere Unterstützerinnen und Unterstützer (besonders auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Integrationsfachdiensten) gewährleisten müssen, kann Integration nicht gelingen[21]. So müssen bspw. auch Entscheidungen behinderter Männer und Frauen akzeptiert werden, welche den übrigen Beteiligten als fragwürdig oder vielleicht sogar als falsch erscheinen. Denn nur, indem man einem Menschen Fehler zugesteht, ist er in der Lage, daraus zu lernen. Ohne diesen Freiraum, welchen besonders die Eltern behinderter Kinder diesen gestatten müssen, kann es zu keiner (beruflichen) Entwicklung kommen. Es würde aus einer solchen Haltung lediglich ein lebenslanges Abhängigkeitsverhältnis resultieren.
Aufgrund der vier, hier dargestellten Unterstützungsbereiche behinderter Menschen durch deren Eltern und Angehörige wird ersichtlich, dass diese Art der Hilfestellung eine wichtige Säule im beruflichen Integrationsprozess behinderter Frauen und Männer ausmacht. Ohne die emotionale, orientierende, materielle und instrumentelle Unterstützung durch Eltern und Angehörige bzw. auch ohne deren Loslassen wäre es vielen Menschen mit Behinderung nicht möglich, beruflich Fuß zu fassen.
Rückblickend auf das vorangegangene Kapitel muss festgehalten werden, dass berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung durch die unterschiedlichsten Unterstützungs- und Hilfeleistungen ermöglicht werden kann. Eine Unterscheidung ist jedenfalls zwischen Assistenz- und Unterstützungsleistungen zu treffen. Während die einen kompensierend wirken, geht es bei den anderen um eine Entwicklungsförderung und Kompetenzerweiterung, sodass Unterstützung als (heil-)pädagogische Maßnahme anzusehen ist.
Zu unterscheiden gilt es aber auch verschiedene Dimensionen von Unterstützungsleistungen. Diese können sowohl direkten als auch indirekten Hilfscharakter haben: direkt bspw. indem Menschen mit Behinderung dazu befähigt werden, Arbeitsschritte selbstständig auszuführen oder aber indirekt durch Lohnkostenzuschüsse seitens des Bundes, welche Arbeitsplätze für diese Personengruppe sichern.
Alle Dimensionen greifen in ihrer Wirkungsweise ineinander und sind notwendig, um eine gelingende Eingliederung in die Arbeitswelt bzw. in die Gesellschaft zu ermöglichen. Natürlich ist eine solche Unterstützung auch noch nach der tatsächlich erfolgten beruflichen Platzierung von Menschen mit Behinderung erforderlich. Teilhabe definiert sich ja nicht nur durch das physische Dabei-Sein, sondern als ein "Einbezogensein in eine Lebenssituation" (DIMDI 2005, S. 95). Dafür ist es allerdings notwendig, über einen längeren Zeitraum einbezogen zu werden um auch wirklich an allen Facetten des jeweiligen Lebensbereiches partizipieren zu können. In diesem Zusammenhang fällt in heutigen Fachdiskussionen immer wieder der Begriff der "Nachhaltigkeit", welchem mittlerweile ein äußerst hoher Stellenwert zukommt.
Auch in dieser Diplomarbeit bzw. den dafür durchgeführten Interviews geht es unter anderem um die Nachhaltigkeit der Arbeitsverhältnisse der befragten jungen Männer und Frauen. Dies ist auch der Grund, warum bei der Auswahl der Probandinnen und Probanden darauf geachtet wurde, dass diese drei Jahre zuvor bereits durch die Arbeitsassistenz vermittelt wurden. Da es demnach im empirischen Teil dieser Arbeit auch um "Nachhaltigkeit" geht, soll nun der theoretische Input, welchem dem empirischen vorangeht, durch einige Überlegungen zu diesem sehr modernen Begriff abgerundet werden.
[16] Hier könnte auch der Versuch gemacht werden, Unterstützung und Assistenz anhand der Schlagworte "Selbstbestimmung" und "Selbstständigkeit" trennen zu wollen. So könnte argumentiert werden, dass Assistenz durch seine ExpertInnen-in-eigener-Sache-Charakter eher zu Selbstbestimmung führt als Unterstützung. Diese wiederum könnte aufgrund ihres Kompetenz erweiternden Charakters zu mehr Selbstständigkeit führen. Da dies jedoch reine Spekulation wäre und sich von Einzelfall zu Einzelfall anders darstellt, scheint ein diesbezüglicher tatsächlicher Unterscheidungsversuch zu gewagt.
[17] Die vorliegende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da Unterstützungsleistung nie generalisiert werden können, sondern sich immer nach den individuellen Bedürfnisse der zu unterstützenden Person richten müssen. Vielfach treffen viele der erwähnten Unterstützungsaspekte zu, häufig jedoch kommen einige andere hinzu bzw. fallen andere weg. Deshalb ist es unmöglich, eine vom Subjektiven abstrahierte und somit verallgemeinerbare Auflistung von Unterstützungsmöglichkeiten zu erstellen.
Eine andere Möglichkeit der Differenzierung könnte - wie es derzeit innerhalb eines anderen Forschungsprojekts der Universität Wien gemacht wird ("Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Behinderung") - auch bzgl. Faktoren auf verschiedenen Ebenen angestellt werden: So könnten unterstützungssystembezogene von betriebsbedingten, arbeitnehmerbedingten und politisch-strukturellen Faktoren unterschieden werden. Da jedoch diese Differenzierung die Grenzen dieser Diplomarbeit sprengen und den Verständnishorizont der Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung übersteigen würde, beschränkt sich diese Arbeit auf eine Differenzierung von inner- und außerbetrieblicher Unterstützung.
[18] Filipp (vgl. 1981) spricht in diesem Zusammenhang von sog. "kritischen Lebensereignissen", welche als "Eingriff[e] in das zu einem gegebenen Zeitpunkt aufgebaute Passungsgefüge zwischen Person und Umwelt" (ebd., S. 9) zu sehen sind und dieses Gefüge durcheinander bringen können.
[19] Natürlich gebe es in Hinblick auf finanzielle Förderungen bzw. deren Träger noch andere wie das AMS oder in Wien den FSW zu nennen, welche maßgeblich an der Finanzierung beruflicher Eingliederungsmaßnahmen beteiligt sind. Allerdings soll hier lediglich eine kleine Übersicht zu finanziellen Unterstützungsleistungen gegeben werden, um diese in deren Bedeutung nicht zu vernachlässigen. Auch andere rechtliche Unterstützungsformen wie bspw. dem Status des / der "Begünstigten Behinderten" sowie Antidiskriminierungsgesetzen könnten hier genannt werden. Dies würde hier jedoch zu weit von den konkreten Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung fortführen. Deshalb wurden die wichtigsten gesetzlichen Regelungen in Österreich im Anhang dieser Diplomarbeit angeführt (vgl. Anhang, Kapitel 14).
[20] In diesem Zusammenhang sei besonders auf die historische Entwicklung der österreichischen Integrationsbewegung verwiesen, welche u. a. von Forcher / Schönwiese 1989 dargestellt wird. Diese wird in Anbetracht der Thematik dieser Diplomarbeit hier nicht dargestellt.
[21] Bereits in einem früheren Kapitel dieser Arbeit (vgl. Kapitel 3) wurde in Anlehnung an Wacker (vgl. 2005) und Ommerle (vgl. 1999) darauf hingewiesen, dass Selbstbestimmung als Grundlage für jegliche Teilhabe fungiert. Ohne eigene Entscheidungen behinderter Menschen bzw. ohne, dass ihnen ein gewisser Entwicklungsraum geboten wird, können Integration und Teilhabe in keinerlei Lebensbereich funktionieren.
Trotz der Tatsache, dass "Nachhaltigkeit" derzeit ein sehr populärer Begriff ist, wurde ihr aufgrund des uneinheitlichen Begriffsverständnisses bislang in Bezug auf wissenschaftliche Forschungen wenig Beachtung gezollt. Zwar gewinnt der Begriff nach und nach an Wichtigkeit und wird heutzutage beinahe inflationär gebraucht, jedoch ist die scientific community bzgl. seiner Bedeutung und Definition immer noch uneins. Dies wird auch von Albrecht (2007, S. 48) bestätigt, wenn sie schreibt: "Nimmt man sich aber etwas Zeit und denkt über den Begriff der Nachhaltigkeit etwas tiefer nach, so zeigt sich, dass allein in der Auslegung des Begriffes ‚Nachhaltigkeit' wesentlich mehr enthalten ist, dass Denkansätze in ganz verschiedene Richtungen gehen können".
Die Geschichte zeigt, dass der Begriff der "Nachhaltigkeit" ursprünglich aus dem Bereich der Forstwirtschaft stammt und von Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde (vgl. Albrecht 2007, S. 47). Dem Urheber dieses Begriffes ging es um die langfristige und beständige Aufforstung von Wäldern zur Sicherung des Holznachschubs. Ein sozialer Aspekt von Nachhaltigkeit, wie er in heutigen Kontexten zu verzeichnen ist, kam ihm damals vermutlich nicht in den Sinn. Wenn man den Begriff der "Nachhaltigkeit" in seinen heutigen Anwendungsbereichen betrachtet, lassen sich generell - wie Albrecht (vgl. ebd.) dies feststellt - drei Konzepte ausmachen:
-
Zum einen hat der Begriff "Nachhaltigkeit" ökologische Aspekte, welche der ursprünglichen Bedeutung des Begriffes am nächsten kommen. So ist damit gemeint, dass der Abbau natürlicher Rohstoffe in gemäßigter Art und Weise erfolgen soll, um eine Sicherstellung von natürlichen Ressourcen langfristig gewährleisten zu können.
-
Die zweite Konzeption der "Nachhaltigkeit" liegt im Bereich der Ökonomie. Auch hier kann an die anfängliche Bedeutung des Wortes angeknüpft werden. Albrecht (2007, S. 47) definiert dieses Konzept des Begriffes, in dem sie schreibt: "Eine Gesellschaft sollte nicht über ihre Verhältnisse leben." Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang also ebenfalls ein Haushalten mit den eigenen Ressourcen, um ein Auskommen und eine Versorgung dauerhaft sicherstellen zu können.
-
Der dritte Aspekt der "Nachhaltigkeit", unter welchem der eigentlich inflationäre Gebrauch des Begriffes stattfindet, ist im sozialen Bereich festzustellen. So definiert Albrecht (vgl. ebd.) diesen Teilaspekt des Begriffes, indem sie davon ausgeht, dass eine Gesellschaft dafür Sorge zu tragen hat, dass Konflikte gar nicht erst entstehen bzw. zumindest friedlich und kultiviert beigelegt werden können. Hier wurde demnach die sozialrechtliche Perspektive an den Begriff der "Nachhaltigkeit" gelegt.
Dieser Blickwinkel wird in letzter Zeit jedoch immer mehr ergänzt bzw. vielleicht sogar verdrängt durch die Perspektive der langfristigen (Qualitäts-)Sicherung der Ergebnisse von (sozialen) Maßnahmen wie etwa von beruflichen Eingliederungsmaßnahmen.
In ihrem Beitrag "Das doppelte Gesicht der Nachhaltigkeit - kritische Diskussion aktueller Entwicklungen" verzeichnet Albrecht (2007, S. 48) folgende allgemeine Ergebnisse als nachhaltige Konsequenzen eines sozialen Projektes:
"- Nachhaltigkeit betrachtet die Weiterführung eines sozialen Projektes mit besonders innovativen Ansätzen und/oder besonders guten Projektergebnissen,
-
Nachhaltigkeit betrachtet den dynamischen Prozess der Übernahme tragfähiger Projektergebnisse durch andere Träger, in anderen Regionen oder mit anderen Klienten,
-
Nachhaltigkeit beinhaltet die Möglichkeit, Inhalte, ganze Programme und Methoden in andere Projekte und Maßnahmen zu implantieren,
-
Nachhaltigkeit gibt Auskunft über den Wert entstandener Netzwerke,
-
Nachhaltigkeit betrachtet die Entwicklung eines einzelnen Projektteilnehmers nach Beendigung der Projektteilnahme, seine persönlichen Projektergebnisse und seine weitere Entwicklung".
In der Fachliteratur wird häufig kritisiert, dass es kaum Forschungen zur Nachhaltigkeit bestimmter sozialer Maßnahmen gebe. Koenig (vgl. 2005, S. 68) etwa listet in seiner Diplomarbeit einige Studien auf, in welchen die Forderung nach solchen Nachhaltigkeitsuntersuchungen geäußert wird. Besonders im Bereich der beruflichen Eingliederung bzw. beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung sind, laut dem Autor (vgl. ebd.), Forschungsdefizite zu verzeichnen. Auch Gerdes (2004, o. S.) argumentiert in dieselbe Richtung, wenn sie schreibt:
"Wie gut es den Diensten [gemeint sind Integrationsfachdienste, Anm. F. S.] gelingt, tatsächlich die dauerhafte berufliche Integration ihrer Kundinnen und Kunden zu erreichen und damit die Qualität der Vermittlungserfolge langfristig zu sichern, wird von den IFD nicht systematisch erfasst und ist bislang nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht".
Die Autorin beschreibt in diesem Statement den Bedarf an wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf die dauerhafte berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Dieser Bedarf geht jedoch über eine bloß quantitative Feststellung von Vermittlungs- und Verbleibsergebnissen hinaus, da Nachhaltigkeit nicht nur durch Quantität, sondern vor allem auch durch Qualität dargestellt werden kann und sollte. Eine reine Messung anhand der Vermittlungsquote einer Maßnahme scheint in dieser Hinsicht zu eng (vgl. Albrecht 2007, S. 53). Deshalb stellt die Forschungsarbeit von Gerdes (vgl. 2004) durch ihren qualitativen Zugang das Individuum, in diesem Fall den erwachsenen Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in den Mittelpunkt. Die Autorin intendiert herauszufinden, wie die beruflichen Werdegänge dieser Menschen aussehen und welche Unterstützungsbedarfe es am Arbeitsplatz gibt. Außerdem wird der Fokus stark auf eine Herausarbeitung von "Ansätze[n] für eine effektivere Arbeit der IFD" (Gerdes 2004, o. S.) gelegt.
Durch diese beispielhafte Darstellung soll verdeutlicht werden, dass Nachhaltigkeit nicht einzig quantitativ mittels Vermittlungsquoten gemessen werden kann, sondern zur Feststellung von Nachhaltigkeit auch andere, qualitative Kriterien herangezogen werden können. Albrecht (2007, S. 54) präsentiert solche qualitativen Nachhaltigkeitsfaktoren im Zuge ihrer Darstellung des EQUAL-Projektes wie folgt:
"- die Aufarbeitung der eigenen Lebenssituation und die Erarbeitung weiterer Entwicklungsschritte,
-
ein Anerkenntnis von Persönlichkeitsproblemen (z. B. ein Suchtproblem) und die Bereitschaft, etwas dagegen zu tun,
-
die Klärung der eigenen Schuldensituation und die Erarbeitung einer Gegenstrategie,
-
die Klärung schwieriger Familiensituationen,
-
die Festlegung von Schritten zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit (z. B. durch Ausführung einer gemeinnützigen Tätigkeit oder eines 1 € Jobs),
-
die Anbindung an eine Interessensgemeinschaft, eine Selbsthilfegruppe oder einfach das häufigere Kontaktieren eines Jugendclubs".
Wie hier ersichtlich wird, kann auch das Erreichen kleinerer Teilschritte als Nachhaltigkeitskriterium herangezogen werden. Selbstverständlich stehen bei sozialen Maßnahmen wie etwa beruflicher Eingliederungsmaßnahmen vorwiegend langfristige und stabile, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Vordergrund. Jedoch dürfen in Anbetracht der vielfältigen Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu definieren und erreichen, bzw. in Anbetracht der Schwierigkeiten, welche bei der Vermittlung von Frauen und Männern mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auftreten können, jene zwar kleinen, aber entscheidenden Schritte nicht vergessen werden. Nachhaltigkeit entsteht nicht lediglich durch Quantität an Vermittlungen (Beispiel hierzu: vgl. BMSG 2004, S. 109; Beispiel gegen eine bloße Quantität: vgl. Doose 2005, S. 31). Auch qualitative Kriterien tragen dazu bei, dass soziale Maßnahmen langfristige und beständige Erfolge verzeichnen können.
Die vorliegende Diplomarbeit orientiert sich an eben diesem Verständnis von Nachhaltigkeit und versucht auch kleine Faktoren, welche zu beruflichen Teilhabeerfahrungen junger Menschen mit Behinderung beitragen, aufzuzeigen und zu diskutieren. Nachhaltigkeit wird hier eben nicht nur anhand von Vermittlungszahlen bzw. Arbeitszeiträumen gemessen, sondern anhand der beruflichen Teilhabeerfahrungen, welche die jungen Frauen und Männer für sich machen konnten.
Aufgrund der Relevanz des Themas, welche im Theoriekorpus dieser Diplomarbeit hinlänglich dargestellt wurde, verfolgt diese Arbeit das Ziel, folgende Fragestellungen zu beantworten:
Welche beruflichen Teilhabeerfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?
Aus dieser Fragestellung ergeben sich vier weitere Problemstellungen, welche in Form von Unterfragestellungen ebenfalls aus dem gewonnenen qualitativen Datenmaterial heraus beantwortet werden sollen:
-
Wie nachhaltig ist eine Vermittlung junger Menschen mit Lernbehinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt?
-
Welche (pädagogischen) Unterstützungsmaßnahmen erhielten bzw. erhalten die jungen Frauen und Männer?
-
Wo zeigt sich zusätzlicher Bedarf an Unterstützung für diese Zielgruppe?
-
Welchen besonderen Unterstützungsbedarf weisen junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern mit Lernbehinderung auf?
Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen soll zum einen ein wissenschaftlicher Beitrag zur Qualitätssicherung geleistet werden, indem die Sichtweise der Betroffenen, d.h. der Nutzerinnen und Nutzer von rehabilitativen und integrativen Maßnahmen erfragt wird. Zum anderen ist intendiert, einen Vergleich zwischen dem Unterstützungsbedarf der jungen Menschen bzw. den tatsächlich angebotenen Unterstützungsleistungen zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 8.1 Methodisches Vorgehen bei der Datenerhebung
- 8.2 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung
- 8.3 Kommunikative Validierung
-
8.4 Vorstellung der Interviewpartnerinnen und -partner mittels Falldarstellung
- 8.4.1 Interview I: Herr Atter
- 8.4.2 Interview II: Fr. Berger
- 8.4.3 Interview III: Fr. Cyrer
- 8.4.4 Interview IV: Fr. Dietmaier
- 8.4.5 Interview V: Herr Erber
- 8.4.6 Interview VI: Fr. Fink
- 8.4.7 Interview VII: Fr. Gartner
- 8.4.8 Interview VIII: Fr. Händel
- 8.4.9 Interview IX: Fr. Inner
- 8.4.10 Interview X: Herr Jarmer
Die Erhebung der für diese Diplomarbeit benötigten qualitativen Daten wurde mittels zehn problemzentrierter Interviews nach Witzel (1982; 1985) durchgeführt. Da die Zielgruppe dieser Diplomarbeit als eher heterogen einzustufen ist, weil "Lernbehinderung [...] nicht eindeutig definiert [ist]" (Fasching 2004a, S. 20), scheint eine Datenerhebung mittels Interviews angezeigter als eine Fragebogenerhebung. In einer Interviewsituation kann den unterschiedlichen Bedürfnissen der Befragten nämlich weitaus flexibler begegnet werden. Darüber hinaus scheint eine Interviewsituation geeigneter, um im Zuge einer qualitativen Erhebung an Daten zum subjektiven Empfinden der Probanden und Probandinnen bzw. deren subjektiven Teilhabeerfahrungen zu gelangen, wie es die Forschungsfrage verlangt. Obwohl es auch Ziel dieser Diplomarbeit ist, repräsentative Ergebnisse im Sinne von Aussagen über tatsächliche bzw. eventuell benötigte (pädagogische) Unterstützungsmaßnahmen hervorzubringen (siehe Fragestellungen), steht dennoch der Aspekt der subjektiven Teilhabe im Vordergrund. Dieser kann durch offene Verfahren besser erhoben werden als durch mehr oder weniger stark strukturierte Fragebögen.
Auch Witzel erkannte dieses Potenzial von offenen, halbstrukturierten Interviews. Er prägte die Erhebungsmethode des problemzentrierten Interviews. Dieses lässt sich aufgrund seines Fokus auf ein bestimmtes gesellschaftliches "Problem", sowie aufgrund seiner Gegenstands- und Prozessorientierung und seiner Offenheit bestens überall dort einsetzen, "wo schon einiges über den Gegenstand bekannt ist, [...] wo [aber] dezidierte, spezifischere Fragestellungen im Vordergrund stehen" (Mayring 1996, S. 52). Dies ist bei der Thematik der hier geplanten Diplomarbeit der Fall. Deshalb scheint die Erhebungsmethode des problemzentrierten Interviews hier passend. Der Interviewleitfaden, welcher bei dieser Erhebungsmethode nach vorangegangener Analyse des vorliegenden "Problems" erstellt wird, dient eher als Orientierungshilfe für den Interviewenden innerhalb der Gesprächssituation, denn als strukturierende Maßnahme. Er lässt sowohl situationsbedingte Fragevarianten, als auch Ad-hoc-Fragen zu (vgl. Mayring 1996, S. 50-54).
"Am Beginn der konkreten Durchführung des Interviews steht die Beschäftigung mit der einschlägigen Fachliteratur zum Thema und der in Bezug auf die Forschungsfrage stehenden Konstruktion des Gesprächsleitfadens" (Scheibelhofer 2004, S. 80; Hervorhebung i. O.). Dieser Prämisse folgend, wurde nach der größtenteils erfolgten Erarbeitung des Theorieteils dieser Diplomarbeit damit begonnen, einen Interviewleitfaden für die Datenerhebung zu konzipieren. Dabei wurde jedoch darauf geachtet, diesen nicht allzu starr zu designen um genügend Spielraum für Variationen während der Interviewsituation zu erlauben. Zu Beginn stand eine relativ offen formulierte Frage, welche es den Interviewten ermöglichen sollte, all das zu erzählen, was für sie relevant erscheint. Diese lautete: "Wie sehen Ihre derzeitigen beruflichen Erfahrungen aus?" Daran anschließend wurde zunächst Themenfelder konzipiert, welche in der vorliegenden Diplomarbeit bzw. für die Beantwortung deren Forschungsfragen von Bedeutung zu sein schienen: Erfahrungen derzeit, Unterstützungsmaßnahmen, geschlechtsspezifische Fragen, Zukunft. Der Bereich der Vergangenheit der Interviewpersonen wurde nach anfänglichen Überlegungen in den Kurzfragebogen (siehe später) verschoben, um den offenen Einstieg und den Bezug auf die derzeitigen beruflichen Teilhabeerfahrungen nicht zu gefährden.
Da es sich bei der Zielgruppe jedoch um Menschen mit Lernbehinderung handelt und aufgrund dessen mit möglicherweise eingeschränkten kognitiven bzw. kommunikativen Fähigkeiten der Interviewpersonen zu rechnen war, wurden von vornherein für die einzelnen Themenbereiche konkret formulierte Fragestellungen überlegt, welche bei Bedarf zum Einsatz kamen. Dies wird auch von Scheibelhofer (vgl. 2004, S. 88) empfohlen. Wegen der als eingeschränkt zu erwartenden kognitiven bzw. kommunikativen Fähigkeiten der Interviewpersonen musste darüber hinaus darauf geachtet werden, die Interviewfragen so präzise und kurz als möglich zu formulieren. Dabei bestand jedoch die Gefahr, in Suggestivfragen bzw. Frageformen zu verfallen, welche lediglich Ja- / Nein- Antworten zulassen. Solche Fragestellungen wurde nach den ersten durchgeführten Interviews überarbeitet, sodass diese Problematik zumindest theoretisch minimiert werden konnte[22].
Die Interviews wurden alle vom Verfasser dieser Diplomarbeit durchgeführt, wobei als Interviewort in neun Fällen die Wohnung der befragten Personen und in einem Fall ein vom Probanden selbst gewähltes Kaffeehaus in seiner Herkunftsgemeinde ausgesucht wurde.
Die Interviewpersonen wurden zunächst vom Interviewer begrüßt. Daraufhin erhielten sie als kleines Dankeschön für ihre freiwillige Teilnahme eine Bonboniere. Danach wurde der Zweck des Interviews, die Anonymität der Befragten und das weitere Vorgehen bzgl. Transkription, Auswertung, Validierung und Publikation besprochen, sodass das Interview dann mit der offenen Einstiegsfrage begonnen werden konnte. Nach Beendigung der Erzählung durch die Interviewten, wurden durch den Interviewer nicht erwähnte bzw. unklare Aspekte nachgefragt. Dabei kam sowohl die Strategie des immanenten, vor allem aber auch des exmanenten Nachfragens (vgl. Scheibelhofer 2004, S. 83) zum Einsatz. Dabei wurden Ad-hoc Fragen, welche sich aus der Interviewsituation ergeben haben, sowie die vorbereiteten Leitfadenfragen gestellt.
Nach hinreichender Beantwortung aller Fragestellungen durch die jungen Menschen gab es die Möglichkeit für sie, Dinge zu erzählen, welche sie über den Rahmen der Befragung hinaus noch beschäftigten. Dies wurde mit folgender Frage initiiert: "Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Sie gerne erzählen möchten?" Nachdem auch diese Erzählung abgeschlossen waren, wurde ein Kurzfragebogen, welcher im Rahmen des Problemzentrierten Interviews empfohlen wird, gemeinsam mit den befragten Personen bearbeitet[23]. Scheibelhofer (vgl. 2004, S.81) diskutiert in ihrem Betrag den bestmöglichen Zeitpunkt für einen solchen Kurzfragebogen und kommt zu dem Schluss, dass dieser nach Beendigung des qualitativen Interviews geführt werden sollte. Eine Bearbeitung vor dem Interview könnte die Probandinnen und Probanden dazu verleiten, auch während der Interviewsituation in ein Frage-Antwort-Schema zu verfallen, sodass es zu keinem Erzählfluss komme, der im Problemzentrierten Interview erwünscht ist. Im Falle dieser Befragung wurden in diesen Kurzfragebogen auch Fragen zur schulischen bzw. zur rehabilitativ-integrativen Vorgeschichte der Probandinnen und Probanden aufgenommen.
Nach der konkreten Gesprächssituation empfiehlt Witzel (vgl. 1982, S. 91; zit. n. Scheibelhofer 2004, S. 82), ein Postskriptum zu verfassen, in welchem die situationsbedingten Erfahrungen und Erlebnisse des Interviewers während der Interviewsituation zusammengefasst werden. Ein solches kann bei der späteren Auswertung helfen, manche Antworten besser zu verstehen. Im Fall der vorliegenden Diplomarbeit waren diese Postskripta kaum gebraucht, da sich aus den Interviews eigentlich alles erklären ließ.
Bei der Datenerhebung für die vorliegende Diplomarbeit kam es immer wieder zu Schwierigkeiten. So war schon das Ausfindigmachen potentieller Probandinnen und Probanden mit einigen Problemen verbunden. Dazu wurden innerhalb des Forschungsprojektes, in dessen Rahmen diese Arbeit verfasst wurde, die Arbeitsassistenzstellen von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland angeschrieben bzw. angerufen und um Mithilfe bei der Identifikation betreffender Personen gebeten. Diese Mithilfe wurde von den meisten Projektträgern auch bereitwillig zugesichert. Anschließend wurden Briefe an die jungen Menschen verfasst und durch die Arbeitsassistentinnen und -assistenten versandt. Dieses Vorgehen war notwendig, um den Datenschutz, welchem die Verantwortlichen bzgl. der Kontaktdaten ihrer vermittelten Klientinnen und Klienten unterliegen, zu wahren. Hier kann von der sog. "information drop"-Methode gesprochen werden, welche Buchner (2008, S. 519) in Anlehnung an Griffin / Baladin (2004) vorstellte. Dabei lässt man Informationen zu einem Forschungsvorhaben plus Kontaktinformationen möglichen Probandinnen und Probanden zukommen und diese können sich dann aus freien Stücken entscheiden, daran teilzunehmen oder nicht (vgl. Buchner 2008, S. 519f.).
Eine nächste Schwierigkeit, mit welcher jedoch von Beginn an gerechnet werden musste, war der nur schleppend vor sich gehende Rücklauf der Einverständnis-erklärungen der jungen Männer und Frauen. Da dieses Projekt der Freiwilligkeit der Probandinnen und Probanden verpflichtet war und ist, konnte niemand sagen, ob und wie viele junge Menschen sich bereit erklären würden, an einer Befragung teilzunehmen. Schließlich wurden potentielle Interviewpersonen zum Teil von den Arbeitsassistentinnen und -assistenten angerufen und gefragt, ob sie sich interviewen lassen würden. Dabei ergab sich das Problem der Vorselektiertheit der Interviewpersonen. Innerhalb der Literatur wird hier vom sog. "Gatekeeping" (vgl. Buchner 2008, S. 517ff.; Reinders 2005, S. 139ff.) gesprochen. Für den Autor dieser Diplomarbeit bzw. für die Projektgruppe waren die Selektionsmechanismen, welche die Arbeitsassistenzprojekte (die Gatekeeper) anwandten, nicht nachvollziehbar. Das gewählte Vorgehen war jedoch erforderlich, um überhaupt passende Interviewpersonen rekrutieren zu können.
Doch selbst nach Rekrutierung war es nicht immer einfach, mit den jungen Menschen in Kontakt zu treten. Vielfach musste wochenlang versucht werden, die Personen telefonisch zu erreichen, bevor überhaupt ein Erstkontakt zustande kam und eine Terminvereinbarung getroffen werden konnte. Diese Termine wurden des Öfteren dann auch kurzfristig von den Probandinnen und Probanden abgesagt oder verschoben, sodass sich die Phase der Datenerhebung empfindlich verzögerte.
In der Interviewsituation selbst wiederum traten zweierlei unvorhergesehene Aspekte auf: Zum einen baten in drei Fällen Elternteile den Interviewer, ob sie während des Interviews anwesend sein dürften, um ihre Kinder zu unterstützen. In allen Fällen wurde dieser Bitte aufgrund der kommunikativen Fähigkeiten der befragten Personen stattgegeben. Hier handelt es sich demnach um Doppelinterviews, wobei die Elternteile in vor allem beratender bzw. ergänzender Weise fungierten. Zum anderen traten bereits in den ersten Interviews Verständnisschwierigkeiten der Probandinnen und Probanden bzgl. des geschlechtsspezifischen Fragenkomplexes auf. Dies könnte daran liegen, dass die jungen Menschen es nicht gewohnt sind, in ihrer Geschlechtlichkeit wahrgenommen zu werden bzw. sich selbst in dieser zu sehen (vgl. hierzu Kapitel 4.3.1 des Theorieteils bzw. die Kapitel 9.5. bzw. 10.5. im Empirieteil). Deshalb mussten einige Fragen umformuliert bzw. gänzlich gestrichen werden, was in Anbetracht der Zielgruppe dieser Diplomarbeit zwar bedauerlich, jedoch gewissermaßen vorhersehbar war.
Als Auswertungsmethode wurde die zusammenfassende Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2007a) gewählt.
Inhaltsanalysen zielen darauf ab, fixierte Kommunikation, egal in welcher Form sie vorliegen mag - schriftlich, als Tonbandaufnahme, als Filmdokument etc. -, zu analysieren. Dabei gehen sie systematisch und damit regelgeleitet vor, wodurch sie sich von vielen hermeneutischen Verfahren klar abgrenzen. Dadurch wird die Analyse für Außenstehende nachvollziehbar und genügt dem sozialwissenschaftlichen Methodenstandard der intersubjektiven Nachprüfbarkeit. Zudem arbeitet die Inhaltsanalyse immer theoriegeleitet, sodass alle Analyseschritte stets auf der Grundlage eines festen Theoriehintergrunds basieren. Zuletzt intendiert die Inhaltsanalyse auch stets, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen, wie bspw. auf den Kommunizierenden, also den "Sender" einer Botschaft (vgl. Mayring 2007a, S. 12f.).
Als entscheidende Vorteile lassen sich durch die Regelgeleitetheit der Qualitativen Inhaltsanalyse die wissenschaftliche Vorgehensweise rechtfertigen und Gütekriterien zu deren Überprüfung gut einsetzen. Darüber hinaus werden die einzelnen Analyseschritte immer wieder in Rückkopplungsschleifen überarbeitet, sodass die Auswertung flexibel an das Material angepasst werden kann. Auch größere Datenmengen sind so zu bearbeiten (vgl. Mayring 2007b, S. 474).
Bei der konkreten Vorgehensweise lassen sich drei Kernbestandteile der Analyse unterscheiden: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung.
Das Ausgangsmaterial dieser Diplomarbeit bilden zehn problemzentrierte Interviews, welche im Zeitraum von Dezember 2008 bis März 2009 mit jungen Menschen mit Behinderung in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland geführt wurden. Die zehn jungen Menschen, drei Männer und sieben Frauen im Alter von 20 - 26 Jahren , haben sich alle freiwillig zu einer Befragung zu ihren beruflichen Teilhabeerfahrungen gemeldet, nachdem sie durch die Arbeitsassistenzstellen, welche die Personen im Jahr 2005 begleitet haben, eine schriftliche Bitte zur Teilnahme erhalten hatten. Da es sich um ein Forschungsprojekt der Universität Wien handelt und deshalb mehr als zehn junge Menschen interviewt wurden, wurden für diese Diplomarbeit die ersten zehn jungen Menschen ausgewählt, welche sich zu einem Interview bereit erklärt hatten.
Die Befragungen wurden vom Verfasser dieser Diplomarbeit in den Wohnhäusern der jungen Menschen bzw. in einem Fall in einem Kaffeehaus im Herkunftsort eines Probanden durchgeführt. Beteiligt waren in sieben Fällen der Interviewer und die Interviewperson, in den drei übrigen Fällen war zusätzlich ein Elternteil der jungen Menschen anwesend um sein Kind beim Interview zu unterstützen. Bei diesen Gesprächen wurden vorwiegend die Interviewpersonen befragt. Wenn diese manche Fragen nicht beantworten konnten, halfen die Eltern etwas nach bzw. wurde von ihnen manches ergänzt, was ihre Kinder in ihren Augen ausgelassen hatten.
Die Interviews wurden mittels eines elektronischen Diktiergerätes aufgezeichnet, dann auf CD-Rom gespeichert und an vier Forschungspraktikantinnen geschickt, welche im Rahmen des oben erwähnten Forschungsprojekts ihr im Studienplan Pädagogik vorgeschriebenes, wissenschaftliches Praktikum absolvieren. Diese hatten die Aufgabe, die aufgenommenen Interviews wortwörtlich nach den Transkriptionsregeln nach Mayring (vgl. 2007a, S. 49), welche in einer vorbereitenden Besprechung erläutert und für das Projekt adaptiert wurden, zu transkribieren. Danach wurden die Transkripte wiederum in elektronischer Form an den Autor dieser Diplomarbeit rückübermittelt. Außerdem wurde nach Abschluss jedes Interviews ein sog. "Postskriptum" verfasst, wie es im Rahmen des problemzentrierten Interviews Anwendung findet (vgl. Kapitel 8.1.2). Dieses hält die Rahmenbedingungen und persönlichen Eindrücke des Interviewers bzgl. der Entstehungssituation der Interviews fest.
Das Forschungsprojekt, aus dem das vorliegende Interviewmaterial stammt, hat eine reha-pädagogische Ausrichtung und intendiert, die subjektive Sichtweise der beruflichen Partizipation von jungen Menschen mit Behinderung herauszuarbeiten. Die beruflichen Teilhabeerfahrungen der zehn jungen Menschen mit Behinderung sowie ihre individuellen Unterstützungsbedarfe stellen deshalb bei dieser Diplomarbeit den Gegenstand der Analyse dar. So ist es Ziel dieser Arbeit, die subjektiven beruflichen Teilhabeerfahrungen der jungen Frauen und Männer mit Behinderung zu erheben sowie herauszufinden, welchen Unterstützungsbedarf diese Personen aufgewiesen haben, wie und durch wen darauf reagiert wurde und wie ihre derzeitige Bedürfnisse bzgl. Hilfeleistung aussehen. Darüber hinaus ist es intendiert, geschlechtsspezifische Unterschiede in den Unterstützungsbedarfen der jungen Menschen herauszuarbeiten.
Die Hauptfragestellung, welcher diese Analyse folgt, wurde aufgrund des im ersten Teil dieser Diplomarbeit ausgearbeiteten Theoriekorpus und dem daraus hervorgehenden Mangel an subjektiven beruflichen Teilhabeberichten junger Frauen und Männer mit Lernbehinderung wie folgt gewählt:
-
Welche beruflichen Teilhabe-Erfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?
Der Autor der vorliegenden Diplomarbeit wählte die Methode der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse, da bei zehn Interviews mit großen Datenmengen zu rechnen war, welche es zu bearbeiten galt. Bei der Zusammenfassung handelt es sich grundsätzlich um einen Vorgang der Reduktion und Abstraktion, wobei sog. "Makrooperatoren" (Mayring 2007a, S. 59) zum Einsatz kommen. Mayring nennt sechs Möglichkeiten, welche zur Reduktion des Materials herangezogen werden können: Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung. Das Datenmaterial wird mit Hilfe von zuvor definierten Kategorien immer weiter paraphrasiert und gekürzt, ohne dabei jedoch an Inhalt zu verlieren, bis das von vornherein festgelegte und gewünschte Abstraktionsniveau erreicht ist. Die Kategoriebildung erfolgt dabei teils induktiv, d.h. mittels des vorliegenden Materials, teils deduktiv, also aus theoretischen Überlegungen heraus. Im Zuge der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das vorliegende Datenmaterial demnach auf ein immer abstrakteres Niveau angehoben (vgl. Mayring 2007a, S. 59), sodass sich Schlussfolgerungen abseits von Einzelfällen ziehen und Vergleiche zwischen unterschiedlichen Daten anstellen lassen.
Als Analyseeinheiten werden einzelne Passagen aus den Interviews herangezogen. Diese beinhalten prägnante Aussagen, welche die Befragten im Laufe des Gesprächs gemacht habe. Dabei kann es sich um einzelne Sätze, aber auch um inhaltlich zusammenhängende Satzgruppen handeln. Diese werden den einzelnen im Kategoriesystem der Auswertung festgelegten Kategorien zugeordnet, anschließend paraphrasiert und zusammengefasst. Im Falle der Zielgruppe dieser Diplomarbeit wurde entschieden, auch Ja / Nein - Aussagen als Analyseeinheit zuzulassen und diese im größeren Zusammenhang auszuwerten. Andernfalls wären wichtige Inhalte verloren gegangen, da die Befragten in vielen Fällen ihre Aussagen nicht weiter spezifizieren konnten und deshalb nur mit Ja oder Nein geantwortet haben. In einem solchen Fall wurden zum besseren Verständnis auch die vom Interviewer gestellten Fragen in den Kategorienraster übernommen und gemeinsam paraphrasiert.
Die einzelnen Analyseeinheiten wurden systematisch den zuvor definierten Kategorien zugeordnet. Dabei wurde planvoll vorgegangen, d.h. die einzelnen Interviews wurden Zeile für Zeile durchgegangen. Dabei wurde nach für die einzelnen (Unter-)Kategorien relevanten Inhalten gesucht, diese wurden herausgefiltert und in ein zuvor festgelegtes, an Mayring (vgl. 2007a, S. 64-70) angelehntes Kategorienraster übertragen. Es wurde genau darauf geachtet, keine inhaltlich relevanten Aussagen zu verlieren. Doppelzuordnungen, d.h. Zuordnungen ein- und derselben Interviewpassage zu mehreren (Unter-)Kategorien waren nicht zugelassen. Es ging darum, die Kategorie zu finden, in welche die betreffende Aussage inhaltlich am besten passt. Die oft längeren Interviewpassagen wurden anschließend paraphrasiert, um ein inhaltliches Sprachniveau zu erreichen. Nicht inhaltstragende Textbestandteile wurden dabei in einem ersten Abstraktionsschritt gestrichen. Solche Bestandteile stellten bspw. Füllwörter oder ausschweifende, nicht inhaltsrelevante Erzählungen der Interviewten dar. Danach erfolgte eine unterkategorienweise Zusammenfassung der einzelnen Paraphrasen. Dabei wurden die Paraphrasen gesichtet und sinngemäß zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen der einzelnen Unterkategorien aller Interviews wurden in einem weiteren Schritt zusammengeführt und kategorienweise gebündelt. Hier ging es darum, Ergebnisse der einzelnen Kategorien aller Interviews zu erhalten und diese genau darzustellen. Dabei galt es sowohl den quantitativen Anteil der Aussagen, d.h. wie oft eine Aussage von den zehn Befragten getätigt wurde, als auch die qualitativen Aspekte aufzuzeigen. Bei all diesen Paraphrasierungen und Zusammenfassungen wurde jedoch nicht aus den Augen verloren, dass es Ziel der Analyse war, "das Material so zu reduzieren, daß [sic!] die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, [und] durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist" (Mayring 2007a, S. 58).
Die Ergebnisse wurden anschließend bzgl. des Interviewkontextes bzw. in einzelnen Fällen bzgl. des Wissens über die Lebensverhältnisse der einzelnen Interviewpartner, welches sich aus dem Gespräch ergeben hatte und im Postskriptum festgehalten wurde, interpretiert. Eine weitere Interpretation erfolgt hinsichtlich der Fragestellungen dieser Diplomarbeit, sodass diese beantwortet werden konnten. Aus diesen Antworten konnte schließlich weiterer Forschungsbedarf abgeleitet werden. Außerdem lieferten sie erste Ergebnisse für das Forschungsprojekt, in dessen Rahmen diese Diplomarbeit verfasst wurde.
Wie jede Forschungsarbeit, unterliegt auch diese qualitative Diplomarbeit gewissen Gütekriterien, welche es sowohl für quantitative, als auch für qualitative Forschung gibt. Hierbei unterscheidet Steinke (vgl. 2007, S. 319ff.) drei Positionen innerhalb der scientific community: Die Vertreter der ersten möchten quantitative Kriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität auf qualitative Forschung übertragen, um sog. "Einheitskriterien" (ebd., S. 319) zu kreieren. Die Vertreter der zweiten Position stellen sich gegen eine solche Übertragung und postulieren eigene Kriterien wie Authentizität der Forschung, Triangulation oder kommunikative Validierung (vgl. ebd., S. 320f.). Die dritte Position besteht in einer generellen Ablehnung von Kriterien (vgl. ebd., S. 321).
Diese Diplomarbeit orientiert sich an der zweiten Position, dem goldenen Mittelweg und legt deshalb großen Wert auf eine kommunikative Validierung der gewonnenen Daten und Ergebnisse der Forschung, wobei diese "den Untersuchten mit dem Ziel vorgelegt [wurden], dass sie von ihnen hinsichtlich ihrer Gültigkeit bewertet werden" (Steinke 2007, S. 320). Dies "ermöglicht eine Rückbindung der im Forschungsprozess entwickelten Theorien an die Untersuchten" (ebd., S. 329) und damit einen Einbezug der Interviewpersonen, deren Sichtweise als Nutzerinnen und Nutzer von Unterstützungsleistungen hier erfragt wurde.
Die kommunikative Validierung wurde im Falle dieser Diplomarbeit anhand zweier Validierungstreffen in Wien und dem Burgenland bzw. anhand telefonischer Kontakte zu den Interviewpersonen in Niederösterreich durchgeführt. Ein Validierungstreffen mit den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern kam aufgrund der großen Entfernungen, welche die Interviewpersonen hätten zurücklegen müssen, nicht zustande. Auch bei den Treffen in Wien und dem Burgenland waren jeweils nicht alle Interviewpartnerinnen und -partner anwesend, da diese teilweise verhindert bzw. nicht mehr erreichbar waren. Die Validierung wurde in allen Fällen derart durchgeführt, dass den jungen Menschen mit Lernbehinderung jeweils ihre eigenen Interviewtranskripte zur Durchsicht vorgelegt wurden. Die Betroffenen konnten diese durchlesen und gegebenenfalls Änderungen oder Anmerkungen vorbringen. Außerdem wurde nach Veränderungen in ihrem beruflichen Leben seit dem Zeitpunkt des Interviews gefragt. Bei den telefonischen Kontakten mit den Personen aus Niederösterreich wurden diese Aspekte ebenfalls erfragt. Die Transkripte wurden den jungen Menschen dann per Post zugesandt mit der Bitte um Durchsicht und etwaiger telefonischer Korrektur.
Bei der Validierung ergab sich folgendes[24]:
Von den ursprünglich zehn Interviewpersonen nahmen insgesamt sieben an der Validierung teil. Lediglich drei Personen konnten nicht mehr erreicht werden bzw. waren verhindert. Von diesen sieben Personen hatten sich für drei seit dem Interview berufliche Veränderungen ergeben. So waren zwei junge Frauen, welche zuvor Arbeit hatten, nun arbeitslos. Bei einer jungen Frau sei der Job ohnehin von Beginn an befristet gewesen und nun sei kein Bedarf mehr für eine weitere Arbeitskraft. Die andere junge Frau äußerte selbst den Verdacht, dass ihr Vorgesetzter, mit dem sie seit Schwierigkeiten hatte, sie nach dem Auslaufen der finanziellen Förderungen nun gekündigt hat. Dieser Verdacht bestätigt sich, da sie erzählte, dass angeblich auch hier kein Bedarf für eine weitere Arbeitskraft gewesen sei, jedoch vor kurzem wieder ein neuer Kollege aufgenommen wurde. Beide jungen Frauen sind zur Zeit mit Hilfe der Arbeitsassistenz erneut auf Arbeitsplatzsuche. Die dritte Person, bei welcher sich beruflich etwas verändert hat, ist ein junger Mann, welcher nun seit April 2009 für seine Heimatgemeinde als Gemeindearbeiter und Garten- und Grünflächengestalter arbeitet. Auf die telefonische Nachfrage, ob es sich dabei um eine Fixanstellung handle, sagte er aus, dass es bei der Gemeinde noch nicht entschieden worden sei, ob der junge Mann langfristig oder nur saisonal für die Stadt arbeiten könne. Bei den übrigen vier Interviewpartnerinnen und -partner hatten sich seit dem Zeitpunkt des Interviews keine relevanten beruflichen Veränderungen ergeben. Eine junge Frau äußerte, dass sie noch in diesem Jahr mit den Kursen beginnen möchte, um ihren Hauptschulabschluss nachzuholen, ein anderer junger Mann berichtete, dass sein Status als "Begünstigter Behinderter", welchen er bereits zum Zeitpunkt der Befragung inne hatte, nun dauerhaft bestätigt worden sei.
Bei einer anderen jungen Frau wurde durch die Vorlage und die Durchsicht des Transkriptes erkannt, dass es hier zu Aufnahmeschwierigkeiten des Diktiergerätes gekommen war und deshalb die letzten Minuten des Interviews im Transkript fehlten. Dieses Fehlen wurde von der studentischen Transkriptionskraft nicht bemerkt. Es handelte sich jedoch um Daten, welche für die Thematik dieser Diplomarbeit nicht relevant waren, sodass darauf verzichtet wurde, sie zu rekonstruieren.
Um den beruflichen Werdegang der jungen Menschen besser verstehen und sich in deren Situation leichter hineinversetzen zu können, wurde entschieden, die zehn interviewten Personen kurz mittels narrativer Fallbeschreibung vorzustellen. Dabei wurde pragmatisch vorgegangen. Anhand der Kurzfragebögen des Problemzentrierten Interviews wurden die wesentlichsten Details aus dem Leben der Probandinnen und Probanden zusammengefasst und chronologisch dargestellt. Bei diesen Falldarstellungen wurden die Namen der jungen Menschen verändert, sodass ihre Anonymität gewahrt bleibt. Auch ihre Wohnorte wurde nicht genannt.
Die zehn befragten Personen sind alle Menschen mit Lernbehinderung, wie sie im einleitenden Teil dieser Diplomarbeit definiert und beschrieben wurde. Eine junge Frau weist überdies eine körperliche Beeinträchtigung auf, eine andere eine chronische Erkrankung. Lediglich ein junger Mann scheint den Status eines "Begünstigten Behinderten" aufzuweisen (siehe Kapitel 9.4. im Empirieteil).
Hr. Atter ist 24 Jahre alt und lebt im nördlichen Niederösterreich, im Waldviertel. Er wohnt dort im Hause seiner Eltern, gemeinsam mit diesen, seinem Bruder und dessen Freundin sowie seiner Großmutter. Hr. Atter weist eine Lernbehinderung auf und wirkt etwas verschlossen.
Nach Abschluss der Volksschule, absolvierte Hr. Atter den Rest seiner Schulpflicht in der Sonderschule. Noch während seiner Schulzeit wurde Hr. Atter von der Maßnahme "Clearing" begleitet und beraten. Diese vermittelte ihn nach seinem Schulabschluss zu einem AMS-Projekt, welches Berufsvorbereitung, Praktika und Allgemeinbildung verband. Daran anschließend absolvierte Hr. Atter einen Berufsorientierungskurs des AMS, welcher ca. ein ¾ Jahr dauerte. Danach verbrachte Hr. Atter einige Zeit in einem Lehrlingsprojekt im Waldviertel, bevor er für 14 Monate eine Stelle als Gärtner in einer großen Gärtnerei bekommen hat. Dort konnte er solange arbeiten, bis die finanziellen Förderungen für seinen Arbeitsplatz ausgelaufen waren. Danach musste er seinen Arbeitsplatz verlassen und kam zur Arbeitsassistenz der Caritas St. Pölten. Diese vermittelte Hrn. Atter zu einem Verein, welcher Menschen mit Behinderung beschäftigt, die in unterschiedlichen Beschäftigungsprojekten in ganz Niederösterreich tätig sind. Dieser stellte Hrn. Atter drei Jahre lang geringfügig an, vermittelte ihm diverse Berufspraktika und bezahlte ihm ein monatliches Gehalt, unabhängig davon, ob dieser gerade ein Praktikum absolvierte oder arbeitssuchend war. Während dieser Zeit konnte Hr. Atter viele verschiedene Praktikumserfahrungen sammeln: zweimal wurde er als Praktikant wieder bei der Gärtnerei angestellt, bei der er bereits für 14 Monate gearbeitet hatte. Einmal war Hr. Atter als Gemeindearbeiter in seiner Heimatgemeinde angestellt und zweimal konnte er Erfahrungen in einer Filiale einer großen Baumarktkette sammeln. Diese war mit seiner Arbeit schließlich so zufrieden, dass sie ihn dauerhaft als Lagerarbeiter im Gartencenter ihrer Filiale anstellten. Dort arbeitet Hr. Atter nun bereits ca. eineinhalb Jahre lang. Er ist für das Gießen und die Pflege der Pflanzen, für das Zurückbringen der Einkaufswagen und in der Adventzeit für den Christbaumverkauf zuständig. Alle diese Arbeiten machen ihm Freude.
Fr. Berger ist 23 Jahre alt und lebt in Eisenstadt in einer betreuten Wohngemeinschaft von Menschen mit Behinderung. Ihre Mutter und ihr jüngerer Bruder unterstützen sie zusätzlich, während ihr Vater weit von ihr entfernt lebt und nur wenig Zeit für Fr. Berger hat. Dies bedauert die junge Frau sehr. Fr. Berger weist eine Lernbehinderung auf.
Nach ihrem Volks- und Hauptschulabschluss absolvierte die junge Frau den Rest ihrer Pflichtschulzeit im Polytechnischen Lehrgang. Danach wurde sie von der Arbeitsassistenz begleitet und unterstützt. Diese vermittelte ihr einige Berufspraktika, welche jeweils nicht länger als eine Woche andauerten. So schnupperte Fr. Berger in der Küche des städtischen Altersheims, in einer Bäckerei und in der Küche eines Winzerbetriebes. All diese Arbeiten waren für sie nicht geeignet. Besonders ihre Tätigkeit in der Bäckerei war ihr aufgrund der frühen Arbeitszeiten und des damit verbundenen Schlafmangels zu anstrengend.
Derzeit arbeitet die junge Frau in der Küche eines großen Unternehmens in Eisenstadt. Sie ist dort als Teilzeitkraft seit beinahe sieben Jahren beschäftigt und ihre Arbeit gefällt ihr so gut, dass sie auch weiterhin in dem Betrieb tätig sein möchte.
Fr. Cyrer ist 22 Jahre alt und lebt im Burgenland in der Nähe von Eisenstadt. Sie wohnt dort im Hause ihrer Eltern, gemeinsam mit ihrer Schwester. Fr. Cyrer weist eine Lernbehinderung auf.
Ihre Schullaufbahn begann Fr. Cyrer in der Volksschule. Da sie allerdings einen höheren Unterstützungsbedarf als ihre Mitschülerinnen und -schüler auswies, wechselte sie nach einem Jahr in die Sonderschule, in der sie schnell Fortschritte machte. Nach Abschluss der Sonderschule, absolvierte sie daher noch den einjährigen Polytechnischen Lehrgang. Bereits während dieses Lehrgangs kam Fr. Cyrer in Kontakt mit der Maßnahme "Clearing". Diese betreute und begleitete die junge Frau und ihre Familie und vermittelte Fr. Cyrer zum einen eine Arbeitsstelle in einem Krankenhaus als Raumpflegerin, wobei sie diese nach sieben Monate aufgeben musste, da ihre die Arbeit zu anstrengend war. Zum anderen wurde Fr. Cyrer eine einjährige hauswirtschaftliche Kursmaßnahme in einem Umschulungszentrum vermittelt. Während dieser Zeit wohnte die junge Frau in einem Internat. Danach war sie für weitere eineinhalb Jahre in einer anderen Kursmaßnahme, welche ebenfalls hauswirtschaftliche Fertigkeiten trainierte. Diese fand in einem Seniorenheim statt, wo die junge Frau kochen und die Zimmer zusammenräumen sollte. Das Kochen machte ihr Spaß, jedoch war das Saubermachen weniger für sie geeignet. Deshalb verließ Fr. Cyrer die Kursmaßnahme und wurde von der Arbeitsassistenz, welche sie nach dem Clearing übernommen hatte, in ein reguläres Arbeitsverhältnis in einer Verpackungsfirma in der Nähe ihres Heimatortes vermittelt. Dort war Fr. Cyrer für das Verpacken der unterschiedlichsten Dinge wie Geschenkkörbe zuständig. In diesem Unternehmen blieb die junge Frau für dreieinhalb Jahre. Vor kurzem jedoch musste sie den Betrieb aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens und damit einhergehender Schließung einer Partnerfirma verlassen. Fr. Cyrer kehrte daraufhin zur Arbeitsassistenz "Rettet das Kind" zurück und war für einige Monate arbeitslos. Nun jedoch hat die junge Frau eine neue Anstellung als Küchengehilfin in einem Kurhotel in der Nähe ihrer Herkunftsgemeinde gefunden. Bevor sie dort angestellt wurde, machte sie zunächst ein mehrwöchiges Praktikum, mit welchem die Personalverantwortlichen derart zufrieden waren, dass sie dieses in ein reguläres Dienstverhältnis umwandelten, welches allerdings derzeit noch auf ein Jahr befristet ist.
Fr. Dietmaier ist 20 Jahre alt und lebt in der Wohnung ihrer Mutter in Wien. Die junge Frau hat drei Brüder. Die Mutter scheint alleinerziehend und die Verhältnisse, aus denen die junge Frau stammt, scheinen eher einfach zu sein. Fr. Dietmaier weist eine stark ausgeprägte Lernbehinderung auf.
Die junge Frau besuchte die Sonderschule, schloss diese jedoch nicht ab. Danach kam sie zum Projekt PRIMA DONNA des Trägers "Jugend am Werk". Dort gefiel es ihr sehr gut und sie konnte in diversen Beschäftigungstherapiegruppen schnuppern. So war sie einmal in einer Arbeitsgruppe, in der gekocht wurde, ein anderes Mal in einer Schneidereigruppe. Beide jedoch gefielen ihr nicht. Derzeit ist die junge Frau in einer anderen Gruppe von "Jugend am Werk". Auch dort ist sie allerdings unglücklich und möchte am liebsten zum PRIMA DONNA-Projekt zurückkehren. Der Berufswunsch der jungen Frau wäre Automechanikerin.
Hr. Erber ist 26 Jahre alt und lebt im Burgenland. Seit seiner Geburt weist Hr. Erber eine Lernbehinderung auf, welche mit einer leichten Sprach-beeinträchtigung einhergeht. Dadurch und seinen starken burgenländischen Dialekt ist Hr. Erber oft schwer zu verstehen. Hr. Erber lebt im Hause seiner Eltern, gemeinsam mit seinem Vater, welcher derzeit arbeitslos ist und seiner Mutter, die im Rathaus als Reinigungskraft arbeitet. Hr. Erber hat außerdem noch zwei Schwestern, welche nicht mehr im Hause der Eltern wohnen.
Hr. Erber absolvierte die Volksschule und die Hauptschule in seinem Heimatort. Danach hatte er seine Schulpflicht erfüllt und wollte zu arbeiten beginnen. Aufgrund seiner Behinderung jedoch fand er keinen Arbeitsplatz und machte im Jahr 2000 zunächst eine Weiterbildung beim BFI. Im Zuge dieses Kurses konnte er auch ein Praktikum als Maurer absolvieren. Im weiteren Verlauf kam Hr. Erber noch zwei weitere Male beim BFI unter. Beide Male war er bei der Sanierung von zwei Burgen im seinem Heimatbundesland beschäftigt. Bei diesen Sanierungsarbeiten wurden viele Helfer gebraucht und auch mehrere Menschen mit Behinderung wurden dabei beschäftigt. Hr. Erber war für die Ordnung auf der Baustelle zuständig.
Nach diesen Kursen beim BFI kam Hr. Erber zur Arbeitsassistenz "Rettet das Kind". Von dieser wurde er mehrere Jahre lang unterstützt und begleitet. In dieser Zeit konnte er mehrere Praktika absolvieren. So war er bei zwei verschiedenen Maler- und Anstreicherbetrieben jeweils ein Monat lang beschäftigt. Danach wurde er durch die Arbeitsassistenz als Lehrling zur Straßenverwaltung vermittelt. Dort machte er für eineinhalb Jahre lang eine Lehre zum Straßenbaufachmann. Diese brach er dann jedoch ab. Gründe dafür nannte Hr. Erber keine. Nach seiner Lehrzeit als Straßenbaufachmann arbeitete der junge Mann für zwei Jahre als Kellereiarbeiter in einem Winzerbetrieb. Auch dieses Arbeitsverhältnis wurde dann jedoch beendet. Zuletzt war Hr. Erber für dreieinhalb Jahre saisonal bei seiner Heimatgemeinde beschäftigt, da dort die Kanalanlagen erneuert wurden. Diesen Job erlangte Hr. Erber über die Vermittlung seines Vaters, welcher als Feuerwehrkommandant gute Beziehungen zur Gemeinde hatte. Hr. Erber war als Gemeindearbeiter sowohl für die Kanalarbeiten, als auch für die Friedhofspflege zuständig. Diese Arbeit machte ihm sehr viel Freude, da er sich sehr für Gartenarbeiten interessiert. Nach drei Jahren jedoch wurde sein Arbeitsplatz nicht mehr finanziell gefördert. Sein Vater, mittlerweile Gemeinderat, konnte den Job seines Sohnes noch ein halbes Jahr aufrecht erhalten. Dann jedoch, als die Kanalarbeiten in der Gemeinde endgültig abgeschlossen waren und auch die Hauptschule in der Gemeinde geschlossen wurde, wurde der Arbeitsvertrag des jungen Mannes gelöst.
Seither ist Hr. Erber auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Er wird nun wieder von der Arbeitsassistenz unterstützt. Auch sein Vater möchte seinen Sohn fördern und drängt diesen, endlich den Führerschein zu machen. Bislang ist Hr. Erber mit seinem eigenem AIXAM unterwegs, auf welches er sehr stolz ist, doch sein Vater würde gerne, mit seinem Sohn gemeinsam, eine eigene Gartenpflege- oder Transportfirma eröffnen. Dies jedoch hänge davon ab, ob der Sohn einen eigenen Führerschein habe. Ohne diesen sei ein solches Unterfangen nicht zu verwirklichen.
Fr. Fink lebt in einem Ort südlich von Eisenstadt im Burgenland. Sie wohnt dort im Hause ihrer Eltern. Fr. Fink hat zwei Schwestern, mit denen sie sich gut versteht. Die junge Frau weist eine Lernbehinderung auf und ist sehr schüchtern, Fremden gegenüber.
Fr. Fink verbrachte ihre gesamte Schulpflichtzeit in der Sonderschule. Nach ihrem Abschluss kam die junge Frau für ca. ein Jahr in eine Werkstätte für arbeitslose Jugendliche. Danach absolvierte sie einen Reinigungskurs beim Bfi. Im Jahr 1999 wurde die junge Frau bei der Caritas in einem Warenlager für ein Jahr angestellt und sortierte dort Altkleider für die Weiterverwertung. Seit dem Jahr 2000 kam eine geringfügige Beschäftigung bei der städtischen Feuerwehr als Reinigungskraft hinzu. Dieses Arbeitsverhältnis dauerte acht Jahr lang. Daneben arbeitete die junge Frau für drei Jahre in einem Imbiss als Servierkraft. Diese Tätigkeit jedoch gefiel ihr nicht und hielt nur solange an, solange es für den Arbeitsplatz finanzielle Förderungen gab. Seit dem Jahr 2004 ist die Fr. Fink als Reinigungskraft bei "Rettet das Kind" angestellt. Ihr Tätigkeitsfeld sieht dabei die Reinigung der Werkstätte für behinderte Menschen vor. Fr. Fink bezeichnet diesen Job nicht als ihren Traumberuf, ist jedoch damit zufrieden und möchte in Zukunft ihre Wochenstundenanzahl noch erhöhen.
Fr. Gartner lebt in der Nähe von Eisenstadt im Burgenland. Sie wohnt bei ihren Eltern. Die junge Frau weist eine sehr wenig ausgeprägte Lernbehinderung und eine schwerwiegende körperliche Erkrankung auf. Sie hat sich allerdings bewusst gegen den Status einer "Begünstigten Behinderten" entschieden, da ihre Arbeitsassistentin ihr davon abgeraten hat. Mit einem solchen Status sei die Arbeitssuche schwieriger.
Nach dem Abschluss der Volks- und Hauptschule besuchte Fr. Gartner die dreijährige Handelsschule. Dieser wurde seitens des AMS ein Absolvententraining für HAK / HAS - Absolventinnen und - Absolventen angeschlossen sowie ein Personal-verrechnungskurs durch das Wifi. Seit Kursende im Jahr 2005 ist für Fr. Gartner nun durchgehend in einem Unternehmen mittlerer Größe als Büroangestellte beschäftigt. Trotz Schwierigkeiten mit ihrem Vorgesetzten blieb die junge Frau in dem Unternehmen, aus Angst arbeitslos zu werden.
Derzeit jedoch zweifelt sie sehr daran, weiterhin für den Betrieb arbeiten zu wollen und ist deshalb in Eigenregie auf Jobsuche. Sie schreibt und verschickt Bewerbungen und hofft, so den Arbeitsplatz, der ihr durch ihren Vorgesetzten erschwert wird, bald verlassen zu können.
Fr. Händel ist 23 Jahre alt und pakistanischer Herkunft, lebt jedoch schon sehr lange in Österreich. Sie ist seit kurzem verheiratet, wohnt jedoch in Wien in der Wohnung ihrer Eltern, da ihr Ehemann noch keine Aufenthaltsbewilligung für Österreich hat und deshalb noch in Pakistan lebt. Sie hofft jedoch, ihren Mann sobald als möglich nach Österreich holen zu können. Sie hat überdies einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, welche Marketing-Managerin ist. Fr. Händel weist eine psychische Beeinträchtigung sowie eine wenig ausgeprägte Lernbehinderung auf. Zusätzlich leidet sie an einer Hebeschwäche ihrer Arme.
Fr. Händel absolvierte die Volksschule und machte danach ihren Hauptschulabschluss. Anschließend beendete sie ihre Schulpflichtzeit mit dem Polytechnischen Lehrgang. Danach kam Fr. Händel für ca. fünf Jahre zum "ÖVBauWK", zum Verein für berufsspezifische Annäherung und Weiterbildung von Körperbehinderten. Dort allerdings gefiel es ihr nicht besonders, da ihr die Beschäftigung und Berufsvorbereitung dort zu langweilig war. Nach einer kurzen Phase der Beschäftigungslosigkeit vermittelte ihr Vater Fr. Händel dann zum Projekt PRIMA DONNA des Trägers "Jugend am Werk". Durch dieses Projekt konnte Fr. Händel diverse Praktika absolvieren. So war sie einige Monate lang in einem Altersheim tätig, was ihr sehr gefallen hat. Durch Probleme mit den Kolleginnen und Kollegen jedoch wurde ihr Praktikumsvertrag nicht verlängert. Danach machte Fr. Händel für jeweils ca. eine Woche Praktika in einem Kaffeehaus, wo sie aufgrund der zu starken körperlichen Belastung nicht bleiben konnte, und in einem Büro als Hilfskraft. Diese Arbeit jedoch war nicht das Richtige für die junge Frau. Nun ist sie in einem Beschäftigungstherapie- und Berufsvorbereitungsprojekt, in dem sie ebenfalls Berufspraktika machen kann. So hat sie in einem Kindergarten in die Sparte Reiningungsarbeiten hineinschnuppern können. Jedoch war auch diese Arbeit für die junge Frau körperlich zu anstrengend. Derzeit arbeitet sie in einer "Trainingscafeteria" um den richtigen Umgang mit Geld zu erlernen.
Fr. Händel möchte gerne arbeiten und betreibt derzeit intensive Internet-recherchen um einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden.
Fr. Inner ist 26 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern in St. Pölten in Niederösterreich. Ihre Eltern sind beide pensionierte Fleischhauer, welche ein eigenes Fleisch- und Wurstwarengeschäft geführt hatten. Fr. Inner hat einen Bruder und eine Schwester, welche beide älter sind als sie und nicht mehr im Hause der Eltern wohnen. Fr. Inner weist eine wenig ausgeprägte Lernbehinderung auf.
Die junge Frau begann ihre Schullaufbahn in der Volksschule, wechselte dann jedoch in die Sonderschule. Danach absolvierte sie die Hauptschule, welche sie auch abschloss. Nach ihrem Schulabschluss wurde sie von der Maßnahme "Clearing", welche später in die Arbeitsassistenz überging, begleitet. Sie absolvierte zwei Berufsorientierungskurse des AMS und einen Lehrgang der Caritas St. Pölten, namens "BBO - Beschäftigung und Berufsorientierung". Im Rahmen dieses dreijährigen Kurses arbeitete sie als Bekleidungsverkäuferin in einem Second Hand - Shop. Bei diesem Dienstverhältnis handelte es sich um eine Form der Beschäftigungstherapie, welche den jungen Menschen zusätzlich Arbeitserfahrungen vermitteln soll. Nach den drei Jahren beim BBO kam Fr. Inner durch Vermittlung der Arbeitsassistenz zu ihrer derzeitigen Arbeits- bzw. Lehrstelle in einem Supermarkt. Hier arbeitet sie ebenfalls bereits drei Jahre lang und steht nun kurz vor der Lehrabschlussprüfung.
Nach Beendigung ihrer Lehre wird die junge Frau ihren Arbeitsplatz jedoch verlassen müssen, da derzeit keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt werden. Deshalb ist Fr. Inner derzeit wieder bei der Arbeitsassistenz und sucht mit ihr gemeinsam einen neuen Arbeitsplatz, vorzugsweise als Kassiererin oder Verkäuferin in einer Filiale einer großen Lebensmittelkette.
Herr Jarmer ist 20 Jahre alt und lebt in einer größeren Stadt in Niederösterreich. Er wohnt dort in der Wohnung seiner Eltern, gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester, die noch zur Schule geht. Sein Vater arbeitet in der Saatgutproduktion, seine Mutter ist Reinigungskraft. Hr. Jarmer weist eine sehr wenig ausgeprägte Lernbehinderung auf, welche man ihm beinahe nicht anmerkt.
Nach dem Abschluss der Volksschule, ging Hr. Jarmer in eine Hauptschule mit europäischem Schwerpunkt. Nach seinem Hauptschulabschluss machte er den Polytechnischen Lehrgang, bevor er sich auf die Suche nach einer Lehrstelle machte. Zunächst dachte Hr. Jarmer an eine Lehre zum Koch und Kellner und arbeitete praktikumsweise in mehreren Restaurants in der Umgebung. Da er sich jedoch dem hohen Leistungsdruck nicht gewachsen fühlte, legte Hr. Jarmer beim AMS einen Eignungstest ab. Dieser ergab, dass er für den Beruf des Koch / Kellners nicht geeignet sei. Man legte ihm nahe, sich einen anderen Lehrberuf auszusuchen. Da Hr. Jarmer nicht so recht wusste, welchen Beruf er ergreifen solle, schnupperte er zunächst in einem Lehrlingsprojekt im Waldviertel, welches ihm aufgrund vieler gewaltbereiter und drogenabhängiger Jugendlicher nicht gefiel. Auf den Rat eines Bekannten hin bewarb er sich um eine Lehre zum Garten- und Grünflächengestalter in einem Lehrbetrieb in seiner Umgebung. Dort absolvierte er seine dreijährige Lehre und schloss diese vor ca. einem Jahr ab. Während seiner Lehrzeit arbeitete Hr. Jarmer bereits als Hilfskraft bei seiner Herkunftsgemeinde. Als er seine Gesellenprüfung jedoch abgelegt hatte und die Stadtgemeinde mehr für seine Arbeitskraft hätte zahlen müssen, wurde der junge Mann gekündigt.
Seither ist Hr. Jarmer arbeitslos. Er hofft jedoch bald wieder Arbeit zu finden. Derzeit macht er den PKW-Führerschein, um durch die damit gewonnene Mobilität mehr Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Er könnte sich auch vorstellen, den LKW-Führerschein zu machen.
[22] Interviewleitfaden im Anhang dieser Diplomarbeit!
[23] Kurzfragebogen im Anhang dieser Diplomarbeit!
[24] Aufgrund der methodischen Relevanz der kommunikativen Validierung und aufgrund der Tatsache, dass es für den Leser verwirrend sein könnte, die theoretische Begründung der Validierung von deren tatsächlichen Ergebnissen zu trennen, wurde beschlossen, die Daten der kommunikativen Validierung bereits an dieser Stelle zu besprechen. Diese waren für die Auswertung der Interviews ohnehin nicht mehr relevant, da diese bereits zuvor stattgefunden hatte. Keiner der jungen Menschen hatte einen Einspruch gegen die gewonnenen Daten erhoben, sodass sich auch in dieser Hinsicht an den Ergebnissen der Diplomarbeit nichts verändert.
Inhaltsverzeichnis
In der Kategorie "Vorgeschichte" werden alle Aussagen der interviewten Personen zu deren früherem Leben gesammelt. Da es sich um junge Frauen und Männer mit Behinderung handelt, werden hier Äußerungen über schulische, Reha- und über frühere Berufserfahrungen subsumiert. Diese Kategorie umfasst zwei Unterkategorien: "Schulische Vorgeschichte" und "Rehabilitative / integrative Vorgeschichte".
Die Unterkategorie "Schulische Vorgeschichte" beinhaltet Aussagen der jungen Frauen und Männer bzgl. der von ihnen besuchten Schulformen, ihrer Schulabschlüsse sowie etwaige Statements zu ihren Erfahrungen in der Schule.
Aus den Interviews geht hierzu hervor, dass die Hälfte der befragten Personen eine reguläre, d.h. nicht behinderungsspezifische Schulbildung genossen haben. Sie haben ihre gesamte Pflichtschulzeit in Regelschulen verbracht, wobei diese immer Volks- und Hauptschulen waren. In drei dieser Fälle wurde das letzte Pflichtschuljahr in Form des Polytechnischen Lehrgangs absolviert, eine junge Frau musste in einer Schulstufe repetieren und beendete ihre Pflichtschulzeit somit mit dem Hauptschulabschluss. Lediglich eine Befragte kann auf eine schulische Bildung jenseits des Pflichtschulzeitraums zurückblicken. Sie absolvierte nach ihrem Hauptschulabschluss zusätzlich eine dreijährige Handelsschule. Ein junger Mann wiederum kann eine abgeschlossene Lehre zum Garten- und Grünflächengestalter vorweisen.
Die andere Hälfte der befragten jungen Männer und Frauen sammelten innerhalb ihrer Pflichtschulzeit bereits erste Erfahrungen mit behinderungsspezifischen "Aussonderungen". Alle fünf Personen besuchten eine Sonderschule, wobei zwei junge Frauen ihre gesamte Schulzeit ausschließlich in dieser Schulform absolvierten. Für zwei andere Frauen stellte die Sonderschule lediglich eine Art "Übergangs- bzw. Lernstufe" dar. Eine davon absolvierte nach ihrem Austritt aus der Sonderschule, wo sie sehr gut gelernt hat, noch den Polytechnischen Lehrgang, eine zweite erlangte den Hauptschulabschluss und beendet in Kürze ihre dreijährige Lehrzeit.
Die meisten der zehn befragten Personen haben gute bzw. keine außergewöhnlichen Erinnerungen an ihre Schulzeit. So wird von der jungen Frau, welche die Handelsschule abschließen konnte, hervorgehoben, dass sie während ihrer Schulzeit viele wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben konnte. Lediglich zwei junge Frauen haben negative Erinnerungen, wenn sie auf ihre schulische Vorgeschichte zurückblicken. In beiden Fällen absolvierten die Interviewten ihre gesamte Pflichtschulzeit in der Sonderschule, wobei eine der beiden jungen Befragten diese gar nicht abschloss. Die andere junge Frau berichtete, dass sie gerne in die Volksschule gegangen wäre, der Direktor dieser Einrichtung sie jedoch sofort in die Sonderschule verwiesen hat.
Folgende beiden Ankerbeispiele verdeutlichen die Aussagen der befragten Personen zur Unterkategorie "schulische Vorgeschichte":
"Nein. Ich bin vom Kindergarten gleich in die Sonderschule gekommen, weil der Direktor mich nicht wollte, weil ich so langsam bin und mit dem reden Probleme gehabt habe. Ich bin gleich in die Sonderschule gegangen" (Interview VI - 1, Z. 5 - 7) sowie
"Sie ist in die Sonderschule, war super, was sie gemacht hat, ist immer gegangen. Sie hat dann Zahlenraum und das hat sie geschafft und lesen kann sie. Dann ist sie in die Polytechnische" (Interview III - 3, Z. 85 - 87).
Die zweite Unterkategorie, "Rehabilitative / integrative Vorgeschichte", subsumiert Äußerungen bzgl. der beruflichen Orientierungs-, Vorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, welche die jungen Menschen durchlaufen haben, sowie zu den Erfahrungen, welche die Interviewten damit gemacht haben. Dazu zählen alle Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation wie bspw. AASS, Clearing, diverse AMS-Kurse etc.
Die interviewten Personen geben zu dieser Unterkategorie folgende Auskünfte: Abgesehen von der Maßnahme der Arbeitsassistenz, von welcher bis auf eine befragte junge Frau alle Interviewten durch unterschiedliche Trägerorganisationen unterstützt und begleitet wurden, gibt es einige andere rehabilitative Maßnahmen bzw. Orientierungs-, Vorbereitungs- und Qualifizierungsprojekte, welche die jungen Menschen mit Behinderung durchlaufen haben. So wurde die Hälfte der Befragten im Laufe ihrer bisherigen Berufskarriere bislang zumindest einmal durch das Arbeitsmarktservice (AMS)[25] unterstützt bzw. in Kursen oder Projekten untergebracht. Zwei weitere Personen wurden schon während ihrer Pflichtschulzeit durch die Maßnahme "Clearing"[26] betreut und anschließend an die Arbeitsassistenz quasi weitervermittelt. Zwei der jungen Frauen wurden über mehrere Jahre hinweg vom Projekt "PRIMA DONNA" des Trägers Jugend am Werk[27] begleitet, wobei eine davon nach wie vor in diesem Projekt steht, die andere an die Arbeitsassistenz weitervermittelt wurde. Weitere Trägerorganisationen, welche von den jungen Frauen und Männern genannt wurden, sind der Verein 0>Handicap[28], der Österreichischer Verein für bürospezifische Anlehre und Weiterbildung für Körperbehinderte (ÖV-bAuWK)[29], das bfi[30] sowie das WIFI[31]. Lediglich eine junge Frau sagte aus, außer der Arbeitsassistenz keinerlei rehabilitative oder integrative Maßnahmen durchlaufen zu haben und auch die Arbeitsassistenz nur wenige Male aufgesucht zu haben.
Alle diese Projekte versuchten, die jungen Frauen und Männer entweder hinsichtlich ihrer Neigungen und Eignungen zu beraten, wie dies bspw. bei einem jungen Mann in Form eines AMS-Eignungstests der Fall war, oder sie weiter zu qualifizieren, indem sie ihnen bspw. Berufsvorbereitungskurse anboten. Auch die Vermittlung von Berufspraktika wurde von den meisten jungen Menschen hierzu angegeben.
Das folgende Ankerbeispiel verdeutlicht die hier gemachten Aussagen: "Und dann habe ich durch die Arbeitsassistenz von Prima Donna sehr viel Hilfe bekommen. Ich war dann also auch beim AMS" (Interview VIII - 2, Z. 24-26).
Die Kategorie "Arbeitsplatzwechsel / -verlust" beinhaltet Äußerungen der jungen Frauen und Männer zu bereits gemachten Arbeitserfahrungen in früheren Jobs, zu den Beweggründen für einen Wechsel bzw. Ursachen für den Verlust des vorangegangenen Arbeitsplatzes sowie zum Vorgang der Kontaktaufnahme zum jetzigen Arbeit gebenden Betrieb. Die Kategorie umfasst die drei Unterkategorien: "Allgemeine Berufserfahrungen", "Gründe für Wechsel" und "Kontaktaufnahme zum jetzigen Betrieb".
Die Unterkategorie "Allgemeine Berufserfahrungen" erfasst die Ausführungen der Befragten zu ihren bisherigen Erfahrungen im Arbeitsleben. Darunter fallen bspw. Erzählungen über Berufspraktika, welche während einer beruflichen Orientierungsmaßnahme absolviert wurden. Auch Aussagen zu früher ausgeführten Jobs werden in dieser Unterkategorie subsumiert, wobei besonderes Augenmerk auf die letzte ausgeübte Tätigkeit vor der jetzigen gelegt wird. Neben den subjektiven Erfahrungen, welche die jungen Menschen an ihren Arbeitsplätzen gesammelt haben, sowie etwaigen Problemen in bisherigen Betrieben sind hier speziell die Branche, die konkreten Tätigkeiten und etwaige Aussagen zum sozialen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen von Relevanz.
Zu dieser Unterkategorie äußerten sich acht der zehn befragten Personen. Die beiden übrigen konnten hierzu keine Angaben machen, da sie entweder noch nie am ersten Arbeitsmarkt tätig waren oder sich seit ihrer Vermittlung durch die Arbeitsassistenz immer noch in ihrem ersten Arbeitsverhältnis befinden. In diesem Fall kann von einer tatsächlichen Ersteingliederung gesprochen werden.
Die achten Befragten, die zu dieser Unterkategorie Angaben machten, berichteten einheitlich von sehr vielen unterschiedlichen Berufserfahrungen, welche sie im Laufe ihrer zumeist aufgrund ihres Alters sehr kurzen Berufskarriere sammeln konnten. Alle berichteten von mehreren Berufswechseln.
Die drei männlichen Befragten erzählen von Arbeitserfahrungen in den Bereichen Gastronomie und Gartenarbeit sowie im Bereich Hilfsarbeit auf Baustellen und Gemeindearbeit. Alle drei haben schon einmal als Gärtner oder Landschaftspfleger gearbeitet. Einer davon hat sogar die Lehre zum Garten- und Grünflächengestalter abgeschlossen. Ein anderer hat einige Jahre zusätzlich in einem Winzerbetrieb als Hilfsarbeiter Tätigkeiten verrichtet. Alle drei Männer waren darüber hinaus bereits saisonal bzw. über einen von vornherein abgesteckten Zeitraum hinweg in ihrer jeweiligen Herkunftsgemeinde als Gemeindearbeiter beschäftigt, wobei es sich hierbei zumeist um Hilfsarbeitertätigkeiten in Form von Kanalgrabungs- und Straßenbauarbeiten sowie Friedhofspflege gehandelt hat. Ein junger Mann konnte darüber hinaus Erfahrungen im Bereich der Gastronomie in Form einer abgebrochenen Lehre sowie mehrerer Praktika als Koch und Kellner sammeln. Ein anderer kann sich an seine Zeit als Lagerarbeiter in einem Lagerhaus erinnern, ein dritter an zwei begonnene, jedoch abgebrochene Lehren zum Maurer bzw. Maler und Anstreicher.
Die befragten jungen Frauen berichten beinahe ausschließlich von Arbeitserfahrungen in sog. "typischen Frauenberufen". So waren drei der fünf Frauen, welche bereits Erfahrungen am ersten Arbeitsmarkt sammeln konnten, vor ihrem derzeitigen Beruf schon ein- oder mehrere Male als Reinigungskraft in Krankenhäusern, Kindergärten oder bei der Feuerwehr tätig. Diese Beschäftigungsverhältnisse variierten in ihrer Dauer von einigen Tagen bis hin zu mehreren Jahren. So berichtete eine junge Frau, dass sie über einen Zeitraum von acht Jahren bei der städtischen Feuerwehr als Reinigungskraft beschäftigt war. Ebenso haben drei junge Frauen Erfahrungen im Bereich Gastronomie. Diese gliedern sich in die Berufe Köchin, Bäckerin, Servierkraft in einem Imbiss bzw. Kellnerin in einem Kaffeehaus. Eine junge Frau konnte vor ihrem derzeitigen Beruf auch schon Erfahrungen im Bereich Büroarbeit sammeln, welche sie jedoch als nicht erfreulich beschrieb, da sie mit einer Kollegin ernsthafte persönliche Probleme hatte. Zwei weitere Interviewte waren im Textilbereich als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft bzw. als Sortier- und Aufbereitungskraft von Altkleidern. Eine der Befragten arbeitete in ihrem letzten Arbeitsverhältnis im Altenpflegebereich, wo sie den älteren Menschen vor allem ihr Essen gebracht bzw. sie dabei unterstützt hat, eine weitere war in einem großen Verpackungsunternehmen für mehrere Jahre beschäftigt.
Sieben der befragten Personen waren in einem oder mehreren ihrer früheren Arbeitsverhältnisse zumindest mehrere Monate lang durchgehend sozialversicherungspflichtig angemeldet, sechs davon mindestens ein Jahr, vier sogar mindestens drei Jahre lang. Alle befragten Personen konnten bereits auch Erfahrungen mit Zeiten der Arbeitslosigkeit sammeln. Drei junge Frauen waren bzw. sind auf dem tertiären Arbeitmarkt in Form von Beschäftigungstherapien tätig.
Folgende Ankerbeispiele illustrieren die getätigten Aussagen der Interviewten:
"Bei der Verkehrstechnik habe ich Verkehrsschilder ausgewechselt oder teilweise ganze Verkehrsschilder mit der ganzen Stange abgeschnitten und dann erneuert, also einen neuen Betonsockel gemacht, dann Gehsteigbegrenzungen, also Gehsteigpflöcke ausgewechselt ..." (Interview X - 2, Z. 67 - 69) sowie
"Ja mir hat es dort schon gefallen, also ich habe die älteren Menschen betreut. Also ich bin immer in das Zimmer hineingegangen, habe sie hinunter gebracht zum Essen, habe das Essen hinauf gebracht, habe Essen ausgeteilt, die Tische gedeckt, habe in der Küche mitgeholfen bei verschiedenen Tätigkeiten" (Interview VIII - 2/3, Z. 43 - 46).
In der Unterkategorie "Gründe für Wechsel" werden alle Äußerungen der befragten Frauen und Männer gesammelt, welche die Ursachen eines etwaigen vorangegangen Jobwechsels / -verlusts ausdrücken. Es geht hier darum, warum der Arbeitsplatz gewechselt wurde bzw. gewechselt werden musste. Außerdem ist hier die Art und Weise des Jobwechsels / -verlusts von Bedeutung. Das heißt, es wird bspw. darauf geachtet, ob das Arbeitsverhältnis von ArbeitgeberInnen- oder ArbeitnehmerInnenseite gelöst wurde oder ob die Kündigungsfrist eingehalten wurde.
Auch zu dieser Unterkategorie konnten sich nur acht der zehn befragten Personen äußern. Davon berichteten drei junge Menschen, dass es sich bei ihren bisherigen Arbeitsverhältnissen um von vornherein befristete Stellen bzw. Praktika gehandelt habe, die nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne einfach ausgelaufen sind. Vier junge Frauen gaben Schwierigkeiten in vorigen Berufen als einen Grund für ihren Berufswechsel an. So wurden hier Überforderung durch zu schwierige bzw. körperlich anstrengende Tätigkeiten genannt ebenso wie Probleme mit Kolleginnen und Kollegen bzw. Vorgesetzten. Eine junge Frau bspw. berichtete, dass sie ihren Aufgaben als Servierkraft in einem Kaffeehaus körperlich nicht gewachsen war, da sie ständig Treppen steigen musste, was sie sehr angestrengt hat. Eine andere Interviewte, welche als Bäckergehilfin für kurze Zeit gearbeitet hat, kam mit den Arbeitszeiten und dem damit verbundenen massiven Schlafmangel nicht zurecht und musste deshalb ihren Beruf wechseln. Von einer jungen Frau wurden finanzielle Schwierigkeiten aufgrund geringer Bezahlung und hoher Eigenkosten an Versicherungsbeiträgen als Berufswechselgrund angegeben. Eine andere junge Frau berichtete von Problemen mit Kolleginnen und Kollegen bzw. von Missverständnissen mit den Vorgesetzten, die von ihr Tätigkeiten verlangten, welche sie körperlich nicht zu leisten imstande war und welche nicht in ihrem Dienstvertrag geregelt waren. Die drei jungen Männer wiederum konnten an ihren Arbeitsplätzen nicht bleiben, da finanzielle Förderungen, mit denen die Arbeitsstellen bezahlt wurden, ausgelaufen waren und die Arbeit gebenden Betriebe sich ihre Arbeitskräfte somit nicht mehr leisten konnten bzw. wollten. Davon berichtete ein junger Mann, dass er seinen Posten binnen zwei Tage, nachdem die finanziellen Förderungen ausgelaufen waren, verloren hatte. Lediglich eine junge Frau verlor ihren Arbeitsplatz aufgrund von Firmenschließungen. Dieses Arbeitsverhältnis wurde über mehrere Jahre hinweg finanziell gefördert, bestand jedoch aufgrund der zufrieden stellenden Arbeitsleistung der Interviewten noch einige Zeit darüber hinaus.
In vier Fällen wurden Arbeitsverhältnisse von den Befragten selbst gelöst, da diese den Anforderungen nicht gewachsen bzw. mit den ihnen aufgetragenen Tätigkeiten nicht zufrieden waren. In den meisten Fällen jedoch wurde den jungen Menschen mit Behinderung aufgrund von auslaufenden Förderungen, zeitlichen Begrenzungen oder Firmenschließungen gekündigt.
Die beiden Ankerbeispiele unterstreichen die Aussagen der Interviewten:
"Sie haben geglaubt, dass das dann so weiterläuft. Ich habe dann am 22. Oktober letztes Jahr meine Gesellenprüfung gemacht und am 24. war ich dann arbeitslos gemeldet" (Interview 10 - 2, Z. 54 - 55) sowie
"Das waren alles halt immer nur so Praktikum eben. Und bei der Gemeinde, da war er ja in der Saison, Laubrechen und die Gartenpflege und so was und dann war's halt wieder vorbei das Praktikum. Also das war dann nicht so Kündigung in dem Sinn" (Interview I - 1, Z. 28 - 30).
Die dritte Unterkategorie "Kontaktaufnahme zum jetzigen Betrieb" umfasst alle Bereiche vom Finden der derzeitigen Arbeitsstelle bis zum Ende einer etwaigen Probezeit. Die Unterkategorie subsumiert somit Aussagen der befragten Personen zur Art und Weise, wie der jetzige Arbeit gebende Betrieb gefunden wurde, wie und durch wen Kontakt zum derzeitigen Arbeitgeber bzw. zur derzeitigen Arbeitgeberin aufgenommen wurde und ob oder durch wen die jungen Menschen mit Behinderung dabei unterstützt wurden. In diese Unterkategorie fallen ebenfalls Äußerungen über ein etwaiges Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch und über eine möglicher Weise vereinbarte Probezeit. Zusätzlich werden in dieser Unterkategorie auch die damaligen Erwartungen der jungen Frauen und Männer an ihre neue Arbeitsstelle erfasst.
Zu dieser Unterkategorie äußerten sich neun der zehn befragten jungen Menschen. Ein junger Mann, der derzeit ohne Beschäftigung ist, machte hierzu keine Angaben. Sechs der interviewten Personen gaben zur Kontaktaufnahme zu ihrem jetzigen bzw. ihrem letzten Arbeit gebenden Betrieb an, dass diese mit Hilfe der Maßnahme Arbeitsassistenz erfolgt sei. Bei zwei dieser Personen war es eine Kooperation zwischen der Familie und der Arbeitsassistentinnen und -assistenten, welche eine Anstellung möglich gemacht hat. Auch bei einem anderen jungen Mann kam es bei der Arbeitsplatzsuche zu einer Zusammenarbeit zwischen seiner Familie und dem ihn unterstützenden Verein. In diesem Fall wurde jedoch ausdrücklich ausgesagt, dass die Arbeitsassistenz mit dem Zustandekommen des bestehenden Arbeitsverhältnisses nichts zu tun gehabt hat. In zwei weiteren Fällen wurde das derzeitige Arbeitsverhältnis durch andere Institutionen, wie das AMS vermittelt bzw. der Kontakt zu den Personalverantwortlichen hergestellt.
Zu einem etwaigen Bewerbungsgespräch machten fünf der Interviewten dezidierte Aussagen. Drei davon wurden bei diesem durch ihre damalige Arbeitsassistentin bzw. ihren -assistenten begleitet und unterstützt. In einem Fall ging der Vater des jungen Mannes mit zum Vorstellungsgespräch. Eine junge Frau sagte aus, alleine einen Termin mit ihrem Vorgesetzten vereinbart und wahrgenommen zu haben. Mit sechs der befragten jungen Menschen wurde zunächst eine zeitliche Befristung ihres Arbeitsverhältnisses, z.B. in Form eines Praktikums oder einer Krankenstandsvertretung vereinbart, wovon vier nach Ende dieser Frist in ein reguläres Dienstverhältnis umgewandelt und zwei Arbeitsverhältnisse wieder gelöst wurden, sodass die betroffenen Personen derzeit arbeitslos sind.
Bzgl. Erwartungen an den neuen Job sagten vier Personen aus, sich eigentlich nichts Besonderes von ihrer zukünftigen Arbeitsstelle erwartet, sondern alles auf sich zukommen lassen zu haben. Eine Person erhoffte sich eine dauerhafte Anstellung, wobei diese Erwartung nicht erfüllt wurde. Eine junge Frau wollte ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau in ihrem Arbeit gebenden Betrieb abschließen. Diese Hoffnung steht nun kurz vor der Realisierung. Eine andere junge Frau wollte ihre ersten Berufserfahrungen sammeln und sich im Erwerbsleben etablieren, eine weitere hatte sich ein gutes Arbeitsklima und ansprechende Tätigkeiten gewünscht.
Als Verdeutlichung der hier genannten Aussagen dienen folgende Ankerbeispiele:
"Ich hab mir gedacht, dass ich dort fix bleiben kann, aber daraus ist nichts geworden" (Interview V - 4, Z. 116) sowie
"...eben dass ich eine Lehre machen kann, darum ist es mir gegangen" (Interview IX - 2, Z. 63).
Die Kategorie "(Derzeitige) Subjektive Erfahrungen" subsumiert Ausführungen der interviewten Personen zu ihren momentanen beruflichen Erlebnissen und Erfahrungen. Es geht in dieser Kategorie um alle Bereiche des gegenwärtigen Berufes, sodass sich drei Unterkategorien ergeben: "Tätigkeiten", "soziales Umfeld / Betriebsklima" und "Probleme". Sollte die interviewte Person gerade ohne Beschäftigung sein, werden hier die Erfahrungen aus der vorherigen Berufstätigkeit herangezogen.
Die Unterkategorie "Tätigkeiten" erfasst Aussagen der jungen Frauen und Männer mit Behinderung zu ihren derzeitigen beruflichen Aufgaben. Von Bedeutung sind somit sowohl die Art der ausgeführten Aktivitäten, als auch subjektive Bewertungen und Einschätzungen der Betroffenen, d.h. ob diese Tätigkeiten für sie adäquat sind und ob sie damit zufrieden sind.
Die interviewten Personen äußerten sich zu dieser Unterkategorie wie folgt: Vier der zehn Personen gaben an, zum Zeitpunkt der Befragung ohne Anstellung bzw. in einer Beschäftigungstherapie gewesen zu sein, wobei zwei davon männlich und arbeitslos und zwei weiblich und in Beschäftigungstherapie waren. Vier der Befragten sind bereits länger als eineinhalb Jahre im selben Betrieb beschäftigt. Eine junge Frau befindet sich derzeit kurz vor dem Abschluss ihrer dreijährigen Lehrzeit. Sie berichtete über ihre Arbeitserfahrungen während ihrer Lehre zur Einzelhandelskauffrau.
Von den drei jungen Männern sind zwei derzeit arbeitslos. Alle drei können auf Erfahrungen im Gärtnereibereich zurückblicken, einer hat eine Lehre zum Garten- und Grünflächengestalter abgeschlossen. Dennoch ist dieser junge Mann derzeit ohne Beschäftigung. Der andere junge Mann hat früher als Gemeindearbeiter bei Kanalbauarbeiten geholfen bzw. Friedhofspflege betrieben. Einzig einer der drei männlichen Befragten steht derzeit in einem regulären, sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnis und arbeitet in einem Gartencenter einer großen Baumarktkette. Dort verrichtet er Hilfstätigkeiten wie Blumen gießen und pflegen, Einkaufswagen zurückbringen oder Müll beseitigen. Mit all diesen Aufgaben ist er sehr zufrieden und bezeichnet sie als interessant und für ihn angemessen.
Die jungen Frauen sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Zwei davon befinden sich derzeit in Beschäftigungstherapieeinrichtungen und somit nicht am allgemeinen, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsmarkt. Eine der beiden war zuvor in einem Altersheim für mehrere Monate tätig, konnte diese Anstellung dann jedoch aufgrund von persönlichen Problemen mit Kolleginnen und Kollegen bzw. Vorgesetzten nicht erhalten. Derzeit ist sie in einer "Trainingscafeteria" tätig, um den Umgang mit Geld zu erlernen und Erfahrungen in diesem Berufsfeld sammeln zu können. Die andere junge Frau war noch nie am ersten Arbeitsmarkt tätig. Sie wechselte von einer Beschäftigungswerkstätte in die nächste. Ihre derzeitige Arbeitsgruppe gefällt ihr nicht, da sie keine für sie ansprechenden Tätigkeiten bietet. Auch mit ihren Arbeitszeiten ist diese junge Frau unzufrieden.
Von den verbleibenden fünf Frauen arbeiten zwei derzeit als Köchin bzw. Kochgehilfin in großen Betrieben. Für eine Frau ist dies ein ganz neues Arbeitsverhältnis, bei der anderen besteht es bereits seit sieben Jahren. Die beiden Frauen sind sowohl für die Kochvorbereitungen, für die Zubereitung bestimmter Speisen, als auch für die Reinigung nach den Kochaktivitäten zuständig. Beide Befragten sind mit diesen Tätigkeiten zufrieden und arbeiten gerne in diesem Bereich.
Eine andere junge Frau arbeitet seit mehreren Jahren als Reinigungskraft einer Werkstätte. Auch sie ist mit ihren Aufgaben prinzipiell zufrieden, hätte jedoch gerne andere Dienstzeiten, da sie derzeit erst ab 16 Uhr mit der Reinigung beginnen kann und zu dieser Zeit zumeist schon sehr müde ist. Außerdem wäre ihr ein anderer Reinigungsbereich, etwa die Säuberung und Pflege von Büroräumen lieber.
Eine weitere Befragte ist bereits seit vier Jahren im Büro eines großen Baubetriebes tätig und dort für Bestellungen, Rechnungen, Archivierungen, Kostenvoranschläge sowie den Kontakt zu den Kunden zuständig. Diese Tätigkeiten hält sie für angemessen. Trotz großer persönlicher Probleme mit ihrem Vorgesetzten, ist sie im Betrieb geblieben, da sie andernfalls weniger Geld zur Verfügung hätte und von einer Schulung in die nächste geschickt würde. Auch war sie immer sehr froh, trotz ihrer körperlichen Erkrankung einen Job gefunden zu haben.
Die letzte Interviewte absolviert seit knappen drei Jahren in einem Supermarkt ihre Lehrzeit zur Einzelhandelskauffrau. Sie ist zumeist als Kassiererin oder im Verkauf von Gebäck und Mehlspeisen tätig und hält diese Tätigkeiten für angemessen. Nun steht sie kurz vor ihrer Lehrabschlussprüfung, weiß jedoch, dass sie danach nicht in ihrem Unternehmen weiter beschäftigt wird, da der Betrieb derzeit keine zusätzlichen MitarbeiterInnen benötigt. Sie muss sich einen neuen Arbeitsplatz suchen.
Die folgenden Ankerbeispiele verdeutlichen das zuvor Dargestellte:
"In der Gärtnerei, im Gartencenter. Blumen gießen, auspflücken, Mist hinaus führen, Christbäume jetzt dann verkaufen, Mist hinausführen, alles, was halt so anfällt. Plastik wegführen und sonst. [...] Die [Arbeiten, Anm. F. S.] passen voll. Nein, gar nix, passt alles" (Interview I - 3, Z. 90 - 98) sowie
"Ja, bei mir ist das so, die Fakturierungen, Rechnungen, Bestellungen, dann ist es auch so, dass ich das Material eben für die Baustelle ausrechne quasi, dann mit die Mieter in Kontakt trete" (Interview VII - 4, Z. 105 - 107).
Die zweite Unterkategorie "soziales Umfeld / Betriebsklima" beinhaltet alle Äußerungen zum sozialen Umgang mit den momentanen Kolleginnen und Kollegen und den Vorgesetzten bzw. zum allgemeinen Betriebsklima. Darunter fallen sowohl Einschätzungen zur Art des Umgangs (bspw. freundschaftlich, distanziert, respektvoll o. Ä.), als auch subjektive Ansichten zu den Gründen für die jeweilige Art des Umgangs. So könnten hier bspw. Aussagen zur Bedeutung der jeweiligen Beeinträchtigung der befragten Personen relevant sein. Auch die Form, in welcher sich der jeweilige soziale Umgang am Arbeitsplatz äußert, wird hier analysiert. So werden hier bspw. Ausführungen zur Mittagspausengestaltung der jungen Frauen und Männer mit Behinderung gesammelt.
Zu dieser Unterkategorie äußerten sich alle zehn Befragten, acht davon äußerst positiv, eine junge Frau sehr negativ und eine machte ambivalente Aussagen:
Acht interviewte Personen fühlen sich in ihrem Kollegium wohl und verstehen sich gut mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Bei einer jungen Frau ist dies auch der Fall, allerdings hat sie große persönliche Schwierigkeiten mit ihrem Vorgesetzten, was das allgemeine Betriebsklima trübt. Die übrigen sieben Befragten äußerten sich auch zum Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten positiv und betonen das gute soziale Umfeld, welches in ihrem Betrieb herrscht. Sechs dieser acht jungen Menschen machten Angaben zu ihrem persönlichen Umgang mit ihren Kolleginnen und Kollegen, wobei vier ihre Pausenzeiten mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbringen. Ebenfalls vier der sechs Personen besprechen rein Berufliches, während die beiden anderen sowohl über Berufliches, als auch über Privatangelegenheiten mit ihren Arbeitskameradinnen und -kameraden plaudern. Außerhalb der Arbeit verbringen lediglich zwei junge Menschen Zeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen, wobei dies immer nur in Form von Betriebsausflügen oder Firmenfeierlichkeiten stattfindet. Ein junger Mann wird darüber hinaus ab und zu von zwei Bekannten aus seinem Herkunftsort, die auch in dem Betrieb arbeiten, mit dem Auto mitgenommen. Die übrigen jungen Menschen geben an, jenseits ihrer Arbeitszeiten keinen Kontakt zu anderen Angestellten des Betriebes zu haben. Eine junge Frau meidet Betriebsausflüge und Ähnliches sogar, da sie sich unter ihr fremden oder weniger bekannten Menschen unwohl fühlt.
Lediglich eine junge Frau berichtet über regelmäßig stattfindende MitarbeiterInnengespräche zwischen ihr und ihrem Vorgesetzten, wobei es um die beruflichen Vorstellungen beider Seiten geht.
Eine junge Frau jedoch ist mit ihrem derzeitigen Betriebsklima alles andere als zufrieden, da sie sowohl Schwierigkeiten mit ihren Kolleginnen und Kollegen, als auch mit den Betreuerinnen und Betreuern ihrer Arbeitsgruppe hat. Sie fühlt sich in ihrer Arbeit überhaupt nicht wohl und möchte diese so rasch als möglich wechseln. Auch ihre Pausenzeiten verbringt sie alleine im Hof, da sie mit niemandem in ihrer beruflichen Umgebung sprechen könne.
Die zehnte interviewte Person machte ambivalente Aussagen zu ihrem früheren Betriebsklima. Zum einen erzählte sie, dass sie sich mit all ihren Kolleginnen und Kollegen und auch ihren Vorgesetzten gut verstanden, mit ihnen gelacht und gescherzt und vorwiegend über Privates geplaudert hätte. Zum anderen berichtet sie über vermehrte Missverständnisse, Startschwierigkeiten mit Arbeitskameradinnen und -kameraden und über Mobbing ihr gegenüber, was mitunter ein Grund gewesen sei, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren hätte. Auch sagt sie aus, dass ihre damaligen Kolleginnen und Kollegen dezidiert keinen privaten Kontakt zu ihr gewünscht hätten.
Folgende Ankerbeispiele illustrieren die gemachten Aussagen der interviewten Personen:
"Naja, im Aufenthaltsraum halt, und da sitzen andere auch dort. Also, nicht alleine praktisch, mit den anderen auch" (Interview I - 4, Z. 111 - 112) sowie
"Ja schon. Ich habe mich schon wohl gefühlt. Ich bin mir vorgekommen, wie zuhause" (Interview VIII - 4, Z. 118).
In der dritten Unterkategorie "Probleme" werden Äußerungen zu den subjektiv erlebten Schwierigkeiten am derzeitigen Arbeitsplatz aufgelistet. Darunter fallen sowohl Probleme mit den Kolleginnen und Kollegen bzw. den Vorgesetzten, welche sich durch die jeweilige Beeinträchtigung der befragten Personen ergeben wie bspw. Verständnis- oder Sprachbarrieren, als auch Schwierigkeiten bei der Ausführung der beruflichen Tätigkeiten. Ebenso werden hier persönliche Probleme wie Motivationsschwierigkeiten der befragten Personen und Barrieren bei den Rahmenbedingungen des derzeitigen Berufes (z.B. zu lange Arbeitszeiten, schwierige Anfahrtsbedingungen etc.) subsumiert.
Die interviewten Personen nahmen hierzu folgender Maßen Stellung:
Die Hälfte der jungen Menschen mit Behinderung hatte bislang noch nie berufliche Probleme, weder in Bezug auf ihre auszuübenden Tätigkeiten oder die Rahmenbedingungen ihres Arbeitsverhältnisses, noch bzgl. ihres sozialen Umfelds am Arbeitsplatz oder mit ihrer eigenen Motivation, wobei eine junge Frau angab, noch nicht lange im Betrieb zu arbeiten und deshalb diesbezüglich nicht allzu viel aussagen zu können.
Bei der anderen Hälfte der Interviewten kam bzw. kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, wobei diese - wie bei einer Frau - von leichten Meinungsverschiedenheiten bzw. Streitigkeiten über Belangloses bis hin zu regelrechten "Kämpfen" mit dem Arbeitgeber reichen, wie dies bei einer anderen jungen Frau der Fall ist. Diese berichtete von schwerwiegenden Kommunikationsschwierigkeiten zwischen ihr und ihrem Vorgesetzten, welche sich jedoch nicht auf ihre Behinderung zurückführen lassen. Diese sei nie ein Problem im Betrieb gewesen. Auch der zweimalige Versuch einer Aussprache zwischen dem Arbeitgeber und seiner Angestellten brachten keine Besserung der Situation, sodass die junge Frau nun entschlossen ist, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Auch zwei andere Frauen berichten von sozialen Problemen bei ihrer Arbeit. Eine junge Frau versteht sich weder mit ihren Kolleginnen und Kollegen, noch mit ihren Betreuerinnen und Betreuern und fühlt sich ständig missverstanden und genervt. Dadurch kommt es auch des Öfteren zu Wutausbrüchen ihrerseits. Die zweite Befragte berichtet von Mobbing seitens ihrer Arbeitskameradinnen und -kameraden. Ihr wären Fehler unterstellt worden, welche nicht sie, sondern eine andere Kollegin gemacht hätte.
Die letzte Interviewte hat ebenfalls Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Diese beziehen sich jedoch auf ihre Arbeitsumgebung. Die junge Frau reinigt eine Werkstätte, in der Menschen mit intellektueller Behinderung arbeiten. Diese schreien immer wieder laut oder laufen umher, sodass die junge Frau Angst bekommt und sich am Arbeitsplatz nicht wohl fühlt. Dieses Problem hat sie auch schon mit ihrer Arbeitsassistentin bzw. auch mit Kolleginnen besprochen. Es wurde jedoch noch keine Lösung dafür gefunden.
Als Ankerbeispiele für diese Unterkategorie sind folgende Aussagen anzusehen:
"Naja ich habe vor den behinderten Leuten Angst. [...] Da sind ein paar dabei, die schreien so laut und das Schreien macht mich irgendwie nervös, oder so, da bekomme ich Angst (Interview VI - 6, Z. 198 - 203) sowie
"Es ist so, es hat, es war am Anfang ich habe mich mit dem Chef eigentlich sehr gut verstanden. Es war aber dann so, es hat immer wieder, ja wie soll ich sagen, Reiberein zwischen uns, aber es war irgend solche Ungereimtheiten, Unklarheiten immer da, wir verstehen uns einfach, wir reden einfach aneinander vorbei" (Interview VII - 3, Z. 67 - 70).
Die Kategorie "Unterstützung" subsumiert alle Aussagen der befragten jungen Menschen zu deren subjektivem Unterstützungsbedarf bzw. den Unterstützungsmaßnahmen, welche ihnen geboten werden oder welche für sie zusätzlich nötig wären. Die Kategorie umfasst folgende drei Unterkategorien: "Unterstützung im Betrieb", "außerbetriebliche Unterstützung" und "Zusätzlicher Unterstützungsbedarf".
Die Unterkategorie "Unterstützung im Betrieb" beinhaltet Äußerungen der Interviewten zu Hilfestellungen und Unterstützungsangeboten, welche sie während ihrer Arbeit im jeweiligen Betrieb erhalten. Auch Aussagen über ihre persönliche Einschätzung ihrer Unterstützungsbedarfe innerhalb des Betriebes fallen in diese Unterkategorie. Dies können auf der einen Seite Hilfen bei der Ausübung der jeweiligen Tätigkeiten sein (z.B. durch JobCoaching oder Mentoring), auf der anderen Seite jedoch auch Beistand bei der sozialen Integration in den Betrieb (durch Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte).
Die zehn befragten Personen äußerten sich zur Unterstützung im Betrieb folgender Maßen: Acht der zehn Interviewten nahmen in recht ähnlicher Weise Stellung zu den Unterstützungsleistungen, welche sie seit Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit in ihrem jeweiligen Betrieb erhalten haben. Alle acht jungen Menschen wurden während der Anfangszeit im Unternehmen von der Arbeitsassistenz bzw. Berufsausbildungsassistenz unterstützt. In der Hälfte dieser Fälle stellte sich dies seitens der Arbeitsassistentinnen und -assistenten vor allem als moralischer Beistand bzw. Hilfe auf Abruf dar, welche bei Problemen oder Unklarheiten von den jungen Menschen selbst - zumeist telefonisch - eingefordert werden konnte. Auch die anderen vier Personen konnten jederzeit telefonisch Kontakt zur Arbeitsassistenz aufnehmen, wurden jedoch zusätzlich von ihren Assistentinnen und Assistenten ein oder mehrere Male besucht. Dabei wurde nachgefragt, wie es den jungen Menschen gehe und ob sie sich in ihrem Betrieb wohl fühlten bzw. irgendeine Form der Unterstützung benötigen. Eine junge Frau sagte dezidiert aus, dass sie in den ersten Tagen ihres Arbeitsverhältnisses von ihrem Arbeitsassistenten begleitet und in ihre neuen Tätigkeiten eingearbeitet wurde. Als sie ihre Aufgaben alleine bewältigen konnte, zog sich der Assistent zurück und war ab diesem Zeitpunkt telefonisch für sie erreichbar.
Alle diese acht jungen Menschen erhalten bzw. erhielten zusätzlich Unterstützung durch ihre Kolleginnen und Kollegen. So geben alle an, jederzeit ihre Arbeitskameradinnen und -kameraden bzw. ihre Vorgesetzten um Rat und Hilfe bitten zu können, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Ein junger Mann berichtet, dass es sich bei seinem letzten Arbeitsverhältnis um sog. "Kompagnonarbeit" gehandelt habe. Dies sei eine Arbeitsform, bei der immer zwei Menschen ein gemeinsames Team bilden und besonders eng zusammen arbeiten. Ein dezidiertes Mentoring-System bzw. fixe Ansprechpersonen, an welche sich die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderung in ihrem Betrieb wenden können, wird von keiner der befragten Personen erwähnt. Allerdings berichten zumindest vier junge Menschen, dass sie sich bei Schwierigkeiten bzw. Unklarheiten vermehrt an ein und dieselbe Person wenden. In zwei Fällen ist dies eine Kollegin, bei den anderen beiden Interviewten der / die unmittelbare Vorgesetzte bzw. Lehrmeister, welche(r) mit Rat und Hilfe unterstützend wirkt.
Bezüglich spezieller Vereinbarungen im Dienstvertrag geben alle acht Personen an, dass es sich bei ihrem Dienstverhältnis um ein reguläres ohne besondere Vergünstigungen oder behinderungsspezifische Einschränkungen handle bzw. gehandelt habe. Die meisten haben weder bzgl. Arbeitszeiten, noch in Hinblick auf ihren Urlaubsanspruch nennenswerte Boni. Eine junge Frau kann sich ihre Dienstzeiten frei einteilen, muss jedoch ihre Wochenstundenanzahl immer erreichen. Ein anderer Interviewter kann für gewöhnlich etwas früher zu arbeiten aufhören, da er andernfalls seinen Autobus verpassen würde. Dies jedoch sind die einzigen Unterschiede, welche zwischen ihren und den Arbeitszeitenregelungen anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehen.
Die letzten beiden Interviewten äußerten sich anders bzgl. der Unterstützung innerhalb ihres Betriebes. Eine junge Frau gab an, überhaupt keine Unterstützung in ihrer Arbeitsgruppe zu erhalten, weder von ihren Kolleginnen und Kollegen, noch von ihren Betreuerinnen und Betreuern. Oft wird mit ihr nicht einmal gesprochen, wenn sie nicht gut gelaunt ist.
Die andere junge Frau bekam nach ihrem Berufseinstieg in die Firma ebenfalls keinerlei Unterstützung mehr, mit Ausnahme von ihren Kolleginnen und Kollegen. Weder ihre Arbeitsassistentin, noch ihr Vorgesetzter, mit dem sie nach wie vor Schwierigkeiten hat, haben sie weiterhin unterstützt. Die Arbeitsassistenz sei weder in der Einarbeitungs-, noch in der Nachbetreuungsphase je wieder mit ihr in Kontakt getreten. Lediglich die Kolleginnen und Kollegen unterstützen die junge Frau, hier vor allem eine Kollegin, welche sie schon seit längerem kennt. Von einem Mentoring-System kann jedoch auch hier nicht gesprochen werden. Bzgl. des Dienstverhältnisses betonte die junge Frau, dass sie nach dem in ihrem Beruf allgemein gültigen Kollektivvertrag angestellt sei.
Als Ankerbeispiel für diese Unterkategorie kann folgende Aussage angesehen werden:
"Weil es ist in der Firma so, da hat niemand Zeit, dass ihr irgendwer was zeigt und wenn sie ihre Arbeit nicht hat machen können, dann haben sie dich angerufen und kommst du, die Fr. Cyrer kann das nicht, zeig ihr das und solange haben sie ein bis zwei Tage mit ihr mitgearbeitet und dann haben sie gesehen sie kann es und dann sind sie wieder gegangen" (Interview III - 5, Z. 172 - 176).
In der zweiten Unterkategorie, "Außerbetriebliche Unterstützung" werden Angaben der jungen Frauen und Männer mit Behinderung zu Unterstützungsangeboten außerhalb des Arbeit gebenden Betriebes subsumiert. Hierunter fallen bspw. emotionale oder orientierende Hilfestellungen von Seiten der Eltern und Angehörigen, aber auch pädagogische Unterstützung seitens der Arbeitsassistenz sowie finanzielle oder rechtliche Zugeständnisse, bspw. vom Bundessozialamt in Form der Klassifizierung als "Begünstigte(r) Behinderte(r)".
Die Unterkategorie "Außerbetriebliche Unterstützung" ergab folgende Aussagen: Alle zehn Interviewten erwähnen zunächst die Arbeitsassistenz, welche ihnen bei ihrer Arbeitssuche geholfen habe. Diese Unterstützung sah in den meisten Fällen eine Abklärung der beruflichen Vorstellungen und ein Ausfindigmachen und Aufzeigen möglicher freier Arbeitsplätze vor. Darüber hinaus konnten drei Personen Trainingsangebote in unterschiedlichen Richtungen annehmen. Einer jungen Frau wurde ein eineinhalbjähriger hauswirtschaftlicher Kurs vermittelt, welcher ihr für ihre derzeitige Arbeit als Küchengehilfin zugute kam. Eine andere junge Frau erhielt ein Training ihrer mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten. Mit einer dritten Frau wurden Schlüsselqualifikationen wie Pünktlichkeit und Ordentlichkeit trainiert.
Andere Unterstützungsangebote seitens der Arbeitsassistenz wie Unterstützung bei familiären Problemen wurden von acht der zehn Befragten abgelehnt, weil der Bedarf nicht vorhanden war. Lediglich zwei junge Frauen sagen aus, mit der Arbeitsassistenz auch außerberufliche Schwierigkeiten besprochen zu haben. So ging es bei einer jungen Frau dezidiert um private Probleme, bei der anderen um eine überhöhte Handyrechnung, welche aufgrund eines Lockangebotes mit Klingeltönen zustande gekommen war. Auch bei diesem Problem stand der jungen Frau ihre Arbeitsassistentin zur Seite.
Drei junge Menschen machten dezidierte Aussagen zu finanziellen Förderungen, welche sie von unterschiedlicher Stelle erhalten bzw. nicht erhalten. So erwähnte ein junger Mann, dass er den Status eines "Begünstigten Behinderten" innehat und somit über einen gewissen Kündigungsschutz verfügt. Außerdem wird sein Arbeitsplatz seitens des Bundessozialamts und des AMS gefördert. Eine junge Frau wiederum hat sich bewusst gegen die Zugehörigkeit zur Begünstigten-Gruppe entschieden, da ihre damalige Arbeitsassistentin ihr davon abgeraten hat. Dadurch sei die Arbeitssuche noch komplizierter. Die Lehrstelle einer dritten Interviewten wird nach ihren Aussagen ebenfalls finanziell unterstützt. Alle anderen jungen Menschen machten zu derlei Förderungen keine expliziten Angaben, allerdings weist bis auf den einen jungen Mann keiner den Status eines "Begünstigten Behinderten" auf.
Die zweite wichtige Unterstützungskategorie neben der Arbeitsassistenz ist im Bereich außerbetrieblicher Hilfe für alle zehn Befragten die Hilfe durch Familie und Freunde. Das private soziale Umfeld wird von allen zehn Personen erwähnt, wobei sich nur eine junge Frau negativ darüber äußert. Sie erhält von ihrer Familie nur mentale Unterstützung, wird jedoch bei ihrer Arbeitssuche nicht von ihrer Mutter unterstützt. Alle anderen jungen Menschen äußern sich sehr positiv zu familiären Hilfestellungen und bezeichnen diese auch als sehr wichtig für sie und ihren beruflichen Erfolg. Die Unterstützungsleistungen, welche Freunde und Familie dabei vollbringen, variieren von Person zu Person. Es gibt jedoch auch einige Gemeinsamkeiten: Bis auf eine junge Frau leben alle Befragten noch im Hause ihrer Eltern. Ein junger Mann erwähnt, dass er auch seine Jause von zu Hause mit in die Arbeit nimmt und dadurch Geld sparen kann. Auch geben sechs Interviewte an, dass sie von ihrer Familie bei der Arbeitsplatzsuche unterstützt werden bzw. worden sind, als sie noch keine Arbeitsstelle hatten. In drei Fällen waren es sogar Familienmitglieder bzw. Freunde, welche den jungen Menschen die ausschlaggebenden Informationen gegeben hatten, die zu einer späteren Anstellung geführt haben. Vier Personen besprechen darüber hinaus auch berufliche Probleme mit Verwandten und suchen Rat bei ihnen. Sie geben außerdem an, von ihrer Familie bzw. von Freunden motiviert zu werden bzw. worden zu sein, bspw. sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen oder für die Lehrabschlussprüfung zu lernen. Ein junger Mann wird regelmäßig von seiner Familie zu seinem Arbeitsplatz mit dem Auto gebracht oder abgeholt, ein anderer wird von seiner Familie bei seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. So wird ihm von seinen Eltern geraten, wie er sich im Leben besser durchsetzen kann. Alles andere jedoch, wie Arbeitsplatzsuche, macht er lieber selbstständig.
Eine junge Frau, welche bereits weiß, dass sie nach ihrer Lehrabschlussprüfung nicht in ihrem derzeitigen Betrieb bleiben kann, erhält zudem Unterstützung von ihren derzeitigen Kolleginnen und Kollegen. Diese geben ihr Bewerbungstipps und suchen potentielle Stellenangebote für sie.
Die folgenden Ankerbeispiele verdeutlichen die zu dieser Unterkategorie gemachten Aussagen:
"Ja, mein Vater steht hinter mir. Ich bin die Jüngste in der Familie und er schaut sehr auf mich" (Interview VIII - 8, Z. 288 - 289) sowie
"Das ist, da gehört er zum Kreis der "Begünstigten Behinderten" und durch das hat er aber auch einen Kündigungsschutz von dem Bundessozialamt" (Interview I - 9, Z. 298 - 299).
Die dritte Unterkategorie, "Zusätzlicher Unterstützungsbedarf" erfasst die subjektive Beurteilung der jungen Menschen bzgl. eines Mangels an Unterstützung in einem oder beiden der zuvor behandelten Bereiche. Dazu ist zunächst eine Erhebung der jeweiligen subjektiven Erwartungen an die Unterstützungsbereiche vorzunehmen, welche in diese Unterkategorie fällt, sowie eine Einschätzung darüber, ob diese Erwartungen erfüllt wurden. Außerdem beinhaltet die Unterkategorie Aussagen zu Bereichen, in denen sich die Interviewten zusätzliche Unterstützung wünschen bzw. vorstellen würden bzw. durch wen diese Angebote kommen und verwirklicht werden sollen. Zielrichtung bei all diesen Aussagen ist immer eine möglichst hohe berufliche Teilhabe der jungen Frauen und Männer mit Behinderung, d.h. ein Abbau von etwaigen Problemlagen und Schwierigkeiten, um Erfolg versprechende Arbeitserfahrungen herbeizuführen.
Die zehn Interviewten äußerten sich zu dieser Unterkategorie wie folgt: Neun der befragten Personen hatten bzw. haben konkrete Erwartungen an unterstützende Stellen, lediglich eine Person konnte keine Erwartungshaltung spezifizieren, da sie nicht genau wusste, was auf sie zukommen würde. Ein junger Mann erwartete sich allgemein Unterstützung während seiner Lehrzeit und gab an, diese auch erhalten zu haben. Die verbliebenen acht Personen äußerten sich dezidierter zu ihren Erwartungen: So haben sich sechs junge Menschen in erster Linie von der Arbeitsassistenz Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche erwartet. Dies war ihr größtes Anliegen, welches bei allen sechs Personen erfüllt wurde. Ein junger Mann hat sich vor allem eine Dauerbeschäftigung für sich als Gärtner oder Elektriker erhofft, wobei sich diese Erwartung nicht erfüllen ließ, weder in seinen Wunschberufen, noch in einem anderen. Als Gründe hierfür wurde zum einen angegeben, dass es derzeit keine freien Stellen in der Umgebung gebe, zum anderen wurde dem jungen Mann von seinem Vater zu wenig Engagement vorgeworfen. Auch die Erwartungen einer jungen Frau, länger in dem sie unterstützenden Projekt bleiben bzw. im Wiener Prater als Schaustellerin arbeiten zu können, erfüllten sich nicht.
Besonders die professionelle Begleitung und Unterstützung durch Unterstützungsmaßnahmen wie Arbeitsassistenz oder Clearing wurden von allen zehn Interviewten gelobt, unabhängig davon, ob diese zur Zeit der Befragung einen Arbeitsplatz hatten oder nicht. Alle zehn sind froh darüber, dass es solche Hilfen gibt und sie sind auch prinzipiell mit deren Leistungen zufrieden. Für die Beurteilung dieser Zufriedenheit mit den erhaltenen Unterstützungsleistungen werden unterschiedliche Maßstäbe seitens der interviewten Personen mit Behinderung herangezogen. So gibt die Hälfte der Interviewten explizit Beurteilungskriterien an, während die andere Hälfte ihre Zufriedenheit zwar ausdrücken, jedoch nicht dezidiert begründen kann. Zwei Personen sind besonders zufrieden, da sie durch die Arbeitsassistenz berufsvorbereitende Maßnahmen durchlaufen konnten bzw. zu einem solchen Projekt vermittelt wurden. Ein junger Mann berichtet dezidiert, dass er im Speziellen damit zufrieden war, dass er zu einem Verein vermittelt wurde, welcher für ihn auf der einen Seite Praktika gesucht und Berufsvorbereitung angeboten, ihn jedoch auf der anderen Seite in Zeiten von Arbeitslosigkeit direkt finanziell unterstützt hat. Eine andere junge Frau lobt bspw. die Möglichkeit, sich mit ihrem Arbeitsassistenten austauschen zu können. Eine dritte Befragte gab an, von der Arbeitsassistenz bei allen beruflich wichtigen Schritten begleitet worden zu sein. Eine weitere Frau hob die allgemein bildenden Vorbereitungen einer Maßnahme hervor sowie die Tatsache, dass sie sich nun selbstständiger fühle als zuvor.
Aufgrund der hohen Zufriedenheitsrate mit den professionellen Unterstützungsangeboten ergibt es sich, dass nur sechs der zehn befragten Personen Aussagen zu etwaigem Veränderungspotenzial gemacht haben. Dabei äußerten vier dieser sechs jungen Frauen und Männer, dass sie nichts an den angebotenen Unterstützungsleistungen verändern würden, da sie ohnehin sehr zufrieden damit seien. Von diesen vier Personen befinden sich drei derzeit in Arbeit, während ein junger Mann zur Zeit arbeitslos ist. Von den übrigen zwei jungen Menschen, welche sich zu potentiellen Veränderungen geäußert haben, gab eine junge Frau an, dass sie sich mehr Zeit und Engagement seitens ihrer Arbeitsassistentin gewünscht hätte, da dies viele anfängliche Probleme verringert hätte können. Auch der zweiten jungen Frau fehlte besonders in der Anfangszeit notwendige Unterstützung. Da sie nun jedoch einem anderen Arbeitsassistenten zugeteilt wurde, wünscht sie sich, dass dieser mit ihr gemeinsam die Kommunikation zwischen ihr und ihrem derzeitigen Arbeitsgeber wieder forciert, sodass ihre derzeitigen beruflichen Schwierigkeiten behoben werden können. Ihre vorherige Arbeitsassistentin hätte sie in dieser Hinsicht nicht unterstützt. Bei dieser jungen Frau ist also der Veränderungsprozess in puncto Unterstützungsleistungen bereits im Gange.
Auch mit den anderen Unterstützungsformen, bspw. durch Familien und Angehörige oder durch Arbeitskolleginnen und -kollegen sind sieben der zehn jungen Menschen zufrieden. Sie geben an, insgesamt genügend Unterstützung zu erhalten. Lediglich drei Frauen wünschen sich von einer und mehreren Seiten mehr Hilfe. Eine junge Frau sagte dabei aus, zwar prinzipiell genügend Unterstützung zu erhalten, sich jedoch von Seiten ihres Vaters mehr Beistand und Interesse zu wünschen. Dieser nämlich wohne weit von ihr entfernt und hätte nur wenig Zeit für sie. Eine zweite junge Frau erhält nach ihrem Ermessen generell nicht ausreichend Unterstützung, weder seitens ihrer Betreuerin, noch seitens ihrer Arbeitskolleginnen und -kollegen oder seitens ihrer Familie. Sie befindet sich derzeit in Beschäftigungstherapie und fühlt sich dort allerdings nicht wohl. Ihre Mutter versteht zwar ihre Anliegen, hilft ihr jedoch über diesen moralischen Beistand hinaus nicht bei beruflichen Problemen. Die dritte junge Frau äußerte sich am konkretesten zu ihren Unterstützungsbedarfen. So gab sie an, nach ihrem Berufseinstieg keinerlei Unterstützung seitens der Arbeitsassistenz mehr erhalten zu haben. Diese wäre jedoch ihres Erachtens nach entscheiden gewesen, um den derzeitigen Kommunikationsproblemen, welche die junge Frau mit ihrem Arbeitgeber hat, vorzubeugen. Darüber hinaus sei es generell für Menschen mit Behinderung schwierig, in Österreich einen Arbeitsplatz zu finden, sowohl in der Privatwirtschaft, als auch im öffentlichen Dienst. Die bestehenden Behindertengesetze seien dabei nach Meinung der jungen Frau zu wenig, wenn es nicht die geeigneten Hilfemaßnahmen vor Ort gebe. Diese hätten in ihrem Fall gefehlt, sodass sie derartige Probleme an ihrem Arbeitsplatz habe.
Als Ankerbeispiele zu dieser Unterkategorie lassen sich folgende Zitate aus den Interviews ansehen:
"Ja, von meinem Papa. [...] Weil der ist, der wohnt woanders und - - wie soll ich sagen - ist immer nicht da für mich wenn ich ihn einmal brauche und da hat auch diese väterliche Unterstützung gefehlt" (Interview II - 9, Z. 315 - 318) sowie
"Da ist schon genug Unterstützung vorhanden" (Interview IX - 6, Z. 210).
Die Kategorie "Geschlechtsspezifik" sammelt Äußerungen der interviewten Personen zu ihren geschlechtsabhängigen subjektiven Erfahrungen. Diese Kategorie wird in zwei Unterkategorien unterteilt: "Vorerfahrungen als Mann / Frau" und "Geschlechtsspezifischer Umgang mit KollegInnen".
Die Unterkategorie "Vorerfahrungen als Mann / Frau" beinhaltet Aussagen der jungen Menschen mit Behinderung zu ihren subjektiven Erlebnissen als Mann oder Frau in der Arbeitswelt. Hierunter fallen u. a. Ausführungen zu etwaigen Erfahrungen des Nicht-Erlangens eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes aufgrund des jeweiligen Geschlechts der befragten Person. Darüber hinaus werden hier auch subjektive Einschätzungen dazu gesammelt, ob der / die InterviewpartnerIn glaubt, mehr Unterstützung in seinem / ihrem Beruf zu brauchen als seine / ihre weiblichen / männlichen Kollegen. Auch Äußerungen zum Ergreifen eines "typischen Frauenberufes" wie Köchin, Friseuse oder Reinigungsfachfrau fallen in diese Unterkategorie.
Zu dieser Unterkategorie äußerten sich zwei junge Männer nicht. Der dritte junge Mann gab lediglich an, noch nie geschlechtsspezifische Schwierigkeiten im Berufsleben gehabt zu haben. Die sieben jungen Frau äußerten sich etwas umfangreicher zu dieser Unterkategorie. Sechs der weiblichen Interviewten gaben an, ebenfalls bislang keine geschlechtsbedingten Probleme im Beruf gehabt zu haben. Sie hatten noch nie den Eindruck aufgrund ihres Geschlechts in der Berufswelt diskriminiert zu werden. Eine Interviewte gab dabei dezidiert an, dass sie sich aufgrund ihres Geschlechts noch nie in ihrer Autorität im Betrieb untergraben gefühlt habe. Diskriminierungen wurden von einer anderen Frau explizit nicht auf ihr Frausein, sondern auf ihre Behinderung zurückgeführt. Lediglich eine junge Befragte gab an, schon einmal geschlechtsbedingte Probleme gehabt zu haben, wobei es nicht mit einem männlichen, sondern mit einer weiblichen Kollegin zu Schwierigkeiten gekommen war. Die Kollegin war, laut Angaben der befragten jungen Frau, damals eifersüchtig auf ihre neue Mitarbeiterin und versuchte ihr durch Gehässigkeiten das berufliche Leben schwer zu machen. Mit männlichen Kollegen hatte noch nie eine der befragten jungen Frauen irgendwelche Probleme. Zwar berichtet eine Interviewte, dass sie von ihren männlichen Mitarbeitern schon des Öfteren gekitzelt wurde, allerdings habe sie das nie als Belästigung empfunden. Dies seien lediglich Scherze gewesen, welche sich die Männer mit ihr erlaubt hätten.
Auch wenn sie an ihre Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzsuche zurückdenken, konnten sich die jungen Frauen nicht daran erinnern, dass ihr Geschlecht dabei eine Rolle gespielt hätte. In puncto vermehrter Unterstützungsbedarf sagten drei der sieben jungen Frauen aus, dass sie der Meinung sind, dass Frauen mit Behinderung prinzipiell etwas mehr Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung bzw. bei beruflichen Tätigkeiten benötigen, als männliche Arbeitnehmer mit Behinderung. Eine Interviewte verweist in diesem Zusammenhang vor allem auf die Anfangsphase an einem neuen Arbeitsplatz. Eine andere junge Frau gab an, dass dieser vermehrte Unterstützungsbedarf vor allem bei körperlich anstrengenden und schweren Arbeiten gegeben sei. Die übrigen vier Befragten glauben nicht, dass es einen Unterschied beim Unterstützungsbedarf von Frauen und Männern mit Behinderung gibt.
Bzgl. "frauentypischer" Berufe machte lediglich eine Befragte bzw. deren Mutter Aussagen. Sie gab an, dass sie für ihre Tochter immer frauentypische Berufe gesucht hat, da diese am besten zu der jungen Frau passen und ihr am besten gefallen würden. Generell fällt jedoch bei den beruflichen Vorerfahrungen der jungen Menschen auf, dass alle Männer bislang eher in männertypischen und alle Frauen eher in frauentypischen Berufen gearbeitet haben bzw. arbeiten.
Die beiden folgenden Aussagen bringen das bisher Dargestellte zum Ausdruck:
"Nein wir haben eigentlich immer geschaut, dass sie Tätigkeiten macht, die eine Frau macht" (Interview III - 10, Z. 354 - 355; Mutter einer Befragten) sowie
"Ich glaube das ist nicht deswegen, sondern weil manche Chefs die Leute, die eine Beeinträchtigung haben, nicht aufnehmen wollen. Weil, sie sagen, sie hat eine Beeinträchtigung und wird das deshalb nicht schaffen" (Interview VIII - 9, Z. 327 - 329).
In der zweiten Unterkategorie "Geschlechtsspezifischer Umgang mit KollegInnen" werden subjektive Beurteilungen zum geschlechtsabhängigen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten subsumiert. So wird hier bspw. festgestellt, ob die befragten Personen die Mittagspausen oder Arbeitszeiten lieber mit Kolleginnen und Kollegen ihres eigenen oder des anderen Geschlechts verbringen, mit wem sie sich lieber unterhalten, wen sie eher um Rat / Hilfe fragen oder zu wem sie eine allgemein bessere Beziehung unterhalten (z.B. ob der Umgang mit Kolleginnen und Kollegen des eigenen Geschlechts eher von Respekt geprägt ist).
Zu dieser Unterkategorie äußerten sich wieder alle zehn Befragten: Drei der jungen Menschen (zwei davon männlich) gaben dabei an, sich sowohl mit ihren männlichen, als auch mit ihren weiblichen KollegInnen gut verstanden und dabei keine Unterschiede gemacht zu haben. Fünf der übrigen sieben Interviewten haben zwar auch mit beiden Geschlechtern, wenn in ihrem Betrieb vertreten, ein gutes Verhältnis, weisen jedoch gewisse Präferenzen im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen auf. So geben fünf junge Frauen an, sich besser mit ihren weiblichen Mitarbeiterinnen zu verstehen bzw. ein besseres und vertrauensvolleres Verhältnis zu diesen zu haben. Eine junge Frau nennt als Grund dafür das Alter ihrer Kolleginnen. Diese sind alle noch ziemlich jung, während ihre männlichen Kollegen alle um vieles älter als sie selbst sind. Jedoch wirkt sich das Geschlecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weder in diesem, noch in einem der anderen Fälle auf die Pausengestaltung oder das Kommunikationsverhalten der jungen Befragten aus. Alle verbringen die Pausen jeweils mit den Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls gerade freie Zeit haben, unabhängig von deren Geschlecht. Auch bei Unterhaltungen bzw. beim Einholen von kollegialer Unterstützung gibt es keine geschlechtsspezifischen Präferenzen.
Lediglich zwei befragte Personen, ein junger Mann und eine junge Frau, weisen tatsächliche "Vorlieben" auf, wenn es um das Geschlecht ihrer Arbeitskolleginnen und -kollegen bzw. ihrer Gesprächspartner geht. Beide unterhalten und verstehen sie dabei besser mit männlichen Kollegen. Die junge Frau gibt dabei an, mit Männern besser sprechen zu können, da diese unkomplizierter seien, der junge Mann erzählt, noch nie weibliche Kolleginnen gehabt zu haben, sich allerdings generell mit Männern besser zu verstehen.
Die folgende Aussage verdeutlicht als Ankerbeispiel die Angaben der jungen Menschen zu dieser Unterkategorie:
"Das ist ganz verschieden. Manchmal gehe ich auch alleine in die Mittagspause, das ist nur eine Viertelstunde, in der man sich kurz hinsetzt und etwas isst ... wir haben ein Kaffeehaus bei uns ... aber schon eher mit den Kolleginnen" (Interview IX - 7, Z. 236 - 238).
Die Kategorie "Zukunftsvorstellungen" beinhaltet Aussagen der befragten Personen, ihre Zukunft betreffend. Darunter fallen Beurteilungen des weiteren beruflichen Weges, aber auch Äußerungen über Veränderungen, welche sich durch die derzeitige Arbeitssituation bereits ergeben haben bzw. Aussagen über etwaige Weiterbildungsabsichten der Interviewten. Die Kategorie umfasst zwei Unterkategorien: "Veränderungen seit Arbeitsbeginn", "Weiterbildung" und "Berufliche Zukunft".
Die Unterkategorie "Veränderungen seit Arbeitsbeginn" subsumiert alle Einschätzungen der jungen Frauen und Männer mit Behinderung darüber, ob und was sich an ihrem Leben verändert haben könnte, seit sie zu arbeiten begonnen haben. Diese Veränderungen umfassen sowohl persönliche Entwicklungen (z.B. könnte jemand durch die Arbeit selbstständiger geworden sein), als auch Verbesserungen oder Verschlechterungen in finanzieller Hinsicht sowie etwaige Veränderungen bzgl. der eigenen Wohn- oder Familiensituation oder Statusumbrüche (bspw. vom / von der SozialhilfeempfängerIn zum / zur Erwerbstätigen).
Zu dieser Unterkategorie nahmen die Interviewten folgender Maßen Stellung:
In sieben Interviews wurden positive Veränderungen im Leben der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund ihrer Arbeit genannt. In drei dieser Fälle wurden diese jedoch von den Eltern der Befragten aufgezählt, da die jungen Menschen selbst kaum oder gar keine Veränderungen in ihrem Leben bemerken. Zwei dieser Interviewten nannten den Faktor "Anerkennung". Durch ihre Arbeit sei es für sie nun möglich, eine Bestätigung für die Qualität ihrer Arbeitsleistungen zu erhalten, was wiederum ihr eigenes Selbstwertgefühl steigert. Zwei andere Personen konnten aufgrund ihrer Arbeit neue soziale Kontakte knüpfen und haben nun einen größeren Bekannten- oder sogar Freundeskreis. Drei der jungen Menschen sagten außerdem aus, dass sich ihre finanzielle Situation durch ihre Erwerbstätigkeit erheblich verbessert habe und sie sich nun mehr leisten könnten. Drei andere Personen machten Aussagen zu persönlichen Veränderungen, welche sich aufgrund ihrer Beschäftigungssituation ergeben haben. So wirkten zwei dieser jungen Menschen nun ausgeglichener auf ihre Umwelt und fühlen sich wohler und mit ihrem Leben zufriedener. Eine dritte junge Frau gab an, nun wesentlich selbstständiger, selbstbewusster und mutiger geworden zu sein und sich mehr Dinge zuzutrauen. Außerdem sei es ihr nun möglich, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehe. Dies habe sie sich zuvor nicht getraut. Sechs Befragte erzählten, dass sie nun einen geregelteren Tagesablauf bzw. eine sinnvolle Beschäftigung haben, die sie von zu Hause fort führt und bei der sie gebraucht würden. Darüber sind sie froh, da es langweilig sei, den ganzen Tag nur zu Hause zu sitzen und keine Aufgaben zu haben. Eine junge Frau meinte dazu dezidiert, dass ihr Leben nun wesentlich abwechslungsreicher sei als zuvor.
Eine junge Frau berichtete im Interview über negative Veränderungen ihres Lebens, seit sie in ihrer Beschäftigungstherapiewerkstätte zu arbeiten begonnen hat. Sie fühlt sich dort nicht wohl, ist über ihre Arbeitszeiten unglücklich, da sie nun so früh aufstehen müsse und ist allgemein wesentlich unzufriedener mit ihrem Leben als zuvor.
Eine andere Frau berichtete sehr neutral über ihre Lebensveränderungen. Sie arbeite nicht in ihrem Traumberuf, dennoch gefalle es ihr in ihrem Betrieb. Die Arbeit mache sie allerdings nur, um nicht arbeitslos zu sein. Ein junger Mann, der derzeit nicht erwerbstätig ist, wünschte sich, einen Arbeitsplatz zu finden, da er viel lieber arbeite, als arbeitslos zu sein. Sein Leben langweile ihn derzeit, außerdem könne er nun nicht zeigen, was er zu leisten vermag. Deshalb hofft er, sobald als möglich, Arbeit zu finden.
Die beiden folgenden Aussagen verdeutlichen das zu dieser Unterkategorie Ausgesagte:
"Ja, und so hat er halt auch seine Bestätigung und kommt hinaus und ist abgelenkt und erlebt Dinge und. Also von daheim, von meiner Sicht aus, hat sich schon sehr viel verändert" (Interview I - 11, Z. 363 - 364; Mutter des Befragten) sowie
"Also ich habe sehr viele Kontakte, ich habe ja auch Freundinnen gefunden" (Interview IX - 9, Z. 301).
"Weiterbildung" erfasst als zweite Unterkategorie alle Aussagen der befragten jungen Frauen und Männer, die eine etwaige Weiterbildung oder Umschulung Ihrerseits betreffen. So werden hier bspw. Äußerungen gesammelt, die den Wunsch nach einer zusätzlichen Ausbildung bzw. Weiterbildung oder Umschulung der jungen Menschen erkennen lassen. Auch Angaben, ob sie bspw. durch Unterstützungsmaßnahmen wie die Arbeitsassistenz Weiterbildungen angeboten bekommen haben bzw. ob es in ihrem derzeitigen Betrieb die Chance auf Weiterbildungsangebote gibt, werden hier erfasst.
Neun der befragten jungen Menschen äußerten sich zu dieser Unterkategorie, eine junge Frau konnte hierzu keine Angaben machen, da sie seit ihrem Handelschulabschluss durchgehend beim selben Betrieb beschäftigt ist und sich die Frage nach Weiterbildung oder Umschulung für sie daher noch nicht gestellt hat. Die übrigen neun Personen äußerten sich zu dieser Unterkategorie wie folgt:
Fünf der Befragten gaben an, von der Arbeitsassistenz bzw. anderen unterstützenden Stellen nie Schulungs- oder Weiterbildungsangebote erhalten oder diese selbst eingefordert zu haben. Zwei junge Menschen wussten, dass sich die Arbeitsassistenz um solche Weiterbildungen bemüht hätte, dies jedoch für sie sehr schwierig gewesen sei. Bei einem jungen Mann wurde deshalb auch nichts aus den Bemühungen der unterstützenden Dienste. Die andere Interviewte befindet sich derzeit in einer Trainingsmaßnahme, einem Projekt für Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50%, in dem verschiedene Arbeitsbereiche wie Küche, Reinigung etc. geübt und erprobt werden können. Sie selbst wird momentan im richtigen Umgang mit Geld geschult. Sollte sie nach dieser Maßnahme keinen Arbeitsplatz finden, möchte sie gerne eine Lehre im Verkaufsbereich beginnen. Eine junge Frau erzählte, dass sie im Projekt "Prima Donna" allgemein bildende Angebote im Bereich Mathematik und Deutsch erhalten hat, welche für sie interessant und hilfreich waren. Der neunte Befragte machte selbst zur Weiterbildung keine Angaben, sein Vater jedoch wünschte sich, dass der junge Mann zusätzlich zum Moped- auch noch den PKW-Führerschein machen solle, um damit eine weitere Zusatzqualifikation für das Arbeitsleben zu erwerben.
Prinzipiell sagten drei junge Menschen aus, dass sie sich eine Weiterbildung derzeit vorstellen könnten. Zum einen war dies eben die oben erwähnte junge Frau, welche, sollte sie keinen Arbeitsplatz finden, eine Lehre im kaufmännischen Bereich beginnen möchte. Zum anderen konnte sich eine zweite junge Frau nach Abschluss ihrer derzeitigen Lehre ebenfalls eine Weiterbildung vorstellen. In welche Richtung diese jedoch gehen könnte, wusste die junge Frau noch nicht. Auch ein junger Mann hegt zur Zeit den Wunsch nach Fortbildung. Er möchte - ebenso wie der Vater des zuvor erwähnten Mannes sich dies von seinem Sohn wünschte - den PKW-Führerschein machen, um damit für Jobangebote außerhalb seiner Herkunftsgemeinde flexibler zu sein.
Bzgl. Weiterbildungsangebote im derzeitigen Job wusste nur eine Befragte Bescheid. Alle anderen konnten dazu keine Angaben machen bzw. wussten dezidiert nicht, ob ihr Arbeit gebender Betrieb für seine Angestellten Weiterbildungsangebote bereit hält und in welche Richtung diese gehen könnten. Die junge Frau, welche sich darüber im Klaren war, dass es in ihrem Unternehmen bspw. Kochkurse für Küchenangestellte gäbe, sagte allerdings aus, dass sie noch nie an einer solchen Veranstaltung teilgenommen habe. Gründe dafür konnte sie jedoch keine nennen.
Als Ankerbeispiel für diese Unterkategorie kann folgende Aussage herangezogen werden:
"Schulung, glaub ich, von dem her eher nix. Aber sie war auf jeden Fall wirklich bemüht, weil da war von der Gemeinde mit so einem Projekt, war da, war das Ausbildung oder irgendwas, und da hat sie sich auch bemüht, ob unser Sohn net, aber das ist dann auch aus irgendeinem Grund nix worden. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber sie hat sich schon bemüht, verschiedene andere Sachen anzubieten und nachzufragen und ja" (Interview I - 7/8, Z. 237 - 241).
Die dritte Unterkategorie "Berufliche Zukunft" erfasst Ausführungen der Interviewten zu ihren eigenen beruflichen Vorstellungen, Ängsten und Wünschen. Hier sind vor allem Bewertungen der eigenen beruflichen Situation in Hinblick auf mögliche zukünftige Veränderungen von Relevanz - so z.B. der Wunsch nach einem neuerlichen Jobwechsel aufgrund derzeitiger Unzufriedenheit. Auch Aussagen zu einem etwaigen Traumberuf fallen in diese Unterkategorie sowie zu Aufstiegsmöglichkeiten in dem bestehenden Arbeitsverhältnis.
Alle zehn Befragten äußerten sich zu ihren zukünftigen beruflichen Vorstellungen: Acht der jungen Menschen möchten prinzipiell in ihrem derzeit bzw. vormals ausgeübten Beruf bleiben, da er ihnen Freude bereitet bzw. für sie am meisten geeignet erscheint oder sie derzeit keinen anderen Berufswunsch hegen. Davon möchten vier Personen auch weiterhin für ihren momentanen Betrieb arbeiten. Eine junge Frau gab dabei als zusätzlichen Grund an, dass sie zur Zeit einen geschützten Arbeitsplatz und somit einen gewissen Kündigungsschutz habe und diesen durch einen Betriebswechsel nicht verlieren möchte. Zwei Befragte möchten innerhalb ihres Unternehmens ihre Wochenstundenanzahl erhöhen und dadurch mehr arbeiten. Eine andere junge Frau, welche mit ihrem Vorgesetzten persönliche Probleme hat, möchte das Arbeit gebende Unternehmen verlassen und ist deshalb auf der Suche nach einem anderen Arbeitsplatz. Zwei junge Männer möchten zwar weiterhin in ihrem Beruf bleiben, suchen jedoch derzeit eine Anstellung als Gärtner oder Hilfsarbeiter. Einer der beiden wäre, sollte es nötig sein, auch bereit, einen anderen Beruf zu ergreifen, obwohl ihm die Vielseitigkeit und der Abwechslungsreichtum seiner Branche gefalle. Eine junge Frau wusste, dass sie nach ihrer bevorstehenden Lehrabschlussprüfung nicht in ihrem Lehrbetrieb bleiben kann, möchte jedoch weiterhin im Lebensmittelverkauf arbeiten. Am liebsten wäre ihr dabei eine Anstellung in einer Filiale einer großen Handelskette.
Zwei junge Frauen möchten definitiv ihren Beruf wechseln. Eine der beiden befindet sich derzeit in Beschäftigungstherapie, fühlt sich innerhalb ihrer Arbeitsgruppe jedoch nicht wohl und mit der Beschäftigung zu wenig ausgelastet. Ihr Berufswunsch wäre Automechanikerin. Ihr ist bewusst, dass dies kein frauentypischer Berufswunsch ist, sie möchte jedoch lieber mit männlichen Kollegen zusammen arbeiten. In der nächsten Zukunft möchte sie gerne ihre Arbeitsgruppe so rasch als möglich verlassen und ins Projekt PRIMA DONNA zurückkehren, um dort eine Ausbildung zur Automechanikerin beginnen zu können.
Die zweite junge Frau durchläuft gerade eine Trainingsmaßnahme und möchte danach Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft werden. Dieser Beruf interessiert sie vor allem deshalb, weil ihre Schwester Marketing-Managerin ist und ihr viel Interessantes aus dem Handelsbereich erzählt. Darüber hinaus gefällt es ihr, mit Menschen zu arbeiten und Kundinnen und Kunden zufrieden zu stellen. Eventuell könnte sie sich jedoch auch einen Job in einem Altersheim vorstellen. Da hätte sie bereits Erfahrungen sammeln können und auch dieser Beruf hätte ihr gefallen. Für den Anfang möchte die junge Frau als Teilzeitkraft, später jedoch Vollzeit arbeiten.
Bzgl. Veränderungsbedarf im derzeitigen oder vormaligen Beruf machten vier Befragte Aussagen. Ein junger Mann fühlt sich in seinem Betrieb sehr wohl und kann sich deshalb nicht vorstellen, was es zu verändern gebe. Auch eine zweite Arbeitnehmerin hat bislang keine Veränderungsvorschläge gemacht, da ihre Arbeit für sie angemessen sei und ihre Kollegin für gewöhnlich die besseren Ideen hätte. Zwei junge Frauen haben bereits Vorschläge unterbreitet, wie man die Arbeitssituation an ihren Arbeitsplätzen verbessern könnte. In beiden Unternehmen wurden diese Vorschläge auch aufgegriffen und zumindest teilweise realisiert. Beide junge Frauen konnten oder wollten allerdings keine Beispiele für solche Verbesserungen geben. Aufstiegschancen in ihrem Beruf sah lediglich eine junge Frau. Sie möchte - wie bereits zuvor erwähnt - ihre Wochenstundenanzahl als Reinigungskraft erhöhen und sieht dies als beruflichen Aufstieg an. Alle anderen Personen konnten zu dieser Thematik keine Aussagen machen bzw. wussten über etwaige Karrieresprünge innerhalb ihres Unternehmens dezidiert nicht Bescheid.
Folgende Zitate verdeutlichen als Ankerbeispiele das hier Gesagte:
"Wenn es notwendig ist, dann würde ich wechseln" (Interview X - 7, Z. 239) sowie
"Nein - mir gefällt das, also man zieht so eine, so eine blaue Arbeitshose an und dann tut man so mit Werkzeug oder so mit kaputten Autos und da muss man die Räder und so was richten und dann muss man da irgendwer helfen dass du da oben sitzen, da hilft dir irgendwer rauf steigen, da hilft dir ein Bursch oder ein Chef da rauf helfen, dass du da zu dem kaputten Auto und da musst du da drinnen was reparieren beim Lenkrad und so" (Interview IV - 12, Z. 431 - 435).
[25] URL: http://www.ams.or.at [Stand: 16.5.2009]
[26] "Die Leistung des ‚Clearing' dient dazu, jugendliche Menschen mit Behinderung den bestmöglichen Übergang zwischen Schule und Beruf zu ermöglichen und die Zielgruppe an den Arbeitsmarkt heranzuführen" (BMSK 2008, S. 21).
[27] "Das Projekt PRIMA DONNA bietet jungen Frauen mit Behinderung im Alter zwischen 15 und 25 Jahren die Chance zur persönlichen Nachreifung und zur Vorbereitung auf eine berufliche Laufbahn" (online unter URL: http://www.jaw.at/typo3/index.php?id=88, Stand: 16.5.2009).
[28] "Der Verein 0>Handicap beschäftigt Menschen mit besonderen Bedürfnissen (physisch, psychisch und geistig Behinderte, sowie Sinnesbehinderte), die in unterschiedlichen Beschäftigungsprojekten in allen Regionen des Landes Niederösterreich tätig sind" (online unter URL: http://www.0handicap.at, Stand: 16.5.2009).
[29] URL: http://www.oevbauwk.at [Stand: 16.5.2009]
[30] URL: http://www.bfi.at [Stand: 16.5.2009]
[31] URL: http://www.wifi.at [Stand: 16.5.2009]
Inhaltsverzeichnis
Diese Kategorie bietet einen ersten Einblick in das Leben der Befragten. Sie gibt Aufschluss über ihre Schul- und Ausbildung und ihren rehabilitativen und integrativen Hintergrund. Dies macht das bisherige Leben der Befragten transparenter und lässt Rückschlüsse von späteren Erfolgen bzw. Misserfolgen zu.
Die Tatsache, dass die Befragten jeweils zur Hälfte eine behinderungsspezifische Schulbildung erhalten und zur Hälfte Regelschulen besucht haben, scheint sich nicht sonderlich auf den weiteren rehabilitativen bzw. integrativen und beruflichen Verlauf der jungen Menschen auszuwirken. Betrachtet man nämlich den weiteren Werdegang der einzelnen Personen, so fallen keine zwangsläufigen Korrelationen zwischen einer behinderungsspezifischen Schulbildung und späteren Schwierigkeiten oder Misserfolgen in der integrativen und beruflichen Entwicklung auf. So zählen drei der fünf Personen, welche die Sonderschule absolviert haben, zu den derzeit aktiv im Erwerbsleben stehenden Interviewpartnern und -partnerinnen, wobei hiervon zwei junge Menschen schon mehr als ein Jahr, eine junge Frau sogar bereits das fünfte Jahr für ein- und dasselbe Unternehmen arbeitet. Dem gegenüber stehen drei Personen, welche nur in Regelschulen unterrichtet wurden und dennoch derzeit arbeitslos bzw. in Berufsvorbereitungsmaßnahmen sind. Eine Schlussfolgerung in dem Sinne, dass Sonderschulbesuch zwangsläufig zu schlechteren Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt führe, scheint demnach aufgrund der vorliegenden Interviewergebnisse hier nicht angestellt werden zu können. Vielmehr dürfte es auf individuelle Faktoren der jungen Frauen und Männer mit Behinderung ankommen, wie bspw. die Wahl eines für sie geeigneten Berufes oder ihre eigenen Coping-Strategien, wenn es darum geht, ihre Behinderung und damit verbundene Schwierigkeiten anzunehmen, damit umzugehen und daraus zu lernen. Wenn man als Beispiel die junge Frau hernimmt, welche von dem damals amtierenden Volksschuldirektor sofort in die Sonderschule verwiesen wurde, fällt zwar auf, dass diese über die Entscheidung des Pädagogen nicht glücklich zu sein scheint, da sie davon spricht, dass dieser sie nicht "wollte"[32]. Allerdings sieht es so aus, dass die junge Frau es geschafft hat, mit dieser Aussonderung und der damit verbundenen Zurückweisung umzugehen und das Beste aus ihrer Situation zu machen. Immerhin gehört sie zu den Personen, welche bereits am längsten für ein- und dasselbe Unternehmen tätig sind (bereits das fünfte Jahr) und auch zuvor jeweils für mehrere Jahre durchgehend gearbeitet haben.
Auch eine Schlussfolgerung, dass der Abschluss einer beruflichen Ausbildung (bspw. einer Lehre) die Chancen für Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt erhöht, muss im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Befragung zurückgewiesen bzw. revidiert werden. So sind die einzigen beiden Personen, welche eine Lehre absolvierten bzw. kurz davor sind, diese zu beenden, beide arbeitslos bzw. wissen, dass sie nach ihrem Lehrabschluss nicht in ihrem derzeitigen Unternehmen bleiben können. Ein junger Mann sagte sogar dezidiert aus, dass er gleich nach seinem Lehrabschluss gekündigt wurde, da er als ausgelernte Arbeitskraft finanziell teurer für das Unternehmen geworden wäre[33].
Auch die Anzahl der absolvierten berufsvorbereitenden, -orientierenden oder -vermittelnden Maßnahmen gibt keinen Aufschluss über den tatsächlichen beruflichen Erfolg. Betrachtet man die Verläufe der jungen Frauen und Männer, fällt auch, dass vor allem eine kontinuierliche Unterstützung, z.B. zunächst durch Clearing und später durch die Arbeitsassistenz Erfolg versprechend zu sein scheint. Hier gilt auf jeden Fall der Grundsatz: Qualität vor Quantität. Es ist in diesem Fall nicht die Anzahl der absolvierten Kurse oder Maßnahmen von Bedeutung, sondern es ist entscheidend, das für den jungen Menschen richtige Angebot zu finden. Um dies zu erreichen, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden, natürlich nicht zuletzt die Art und Schwere der Beeinträchtigung und damit der individuelle Unterstützungsbedarf, allerdings viel mehr noch die Qualität der unterstützenden Umgebung und die Eignungen, Wünsche und Anliegen der Betroffenen. Es müssen demnach sowohl personenbezogene, als auch Umweltfaktoren, wie in der ICF definiert, herangezogen werden. So scheint es bspw. bedenklich, einen jungen Mann, welcher mit einer Lehre zum Koch und Kellner begonnen hat, und welchem diese Arbeit sehr viel Freude bereitete, aufgrund eines Eignungstests, welcher ihm die Fähigkeiten für diesen Beruf abspricht, umzuschulen[34]. Der junge Mann hat daraufhin einen anderen Lehrberuf gewählt und die Ausbildung zum Garten- und Grünflächengestalter abgeschlossen. Seit seinem Lehrabschluss jedoch hat er lediglich saisonal gearbeitet bzw. war überhaupt arbeitslos. Natürlich ist bei solcherlei Information immer zu beachten, dass es sich um eine subjektive Perspektive handelt, aus welcher die Fakten dargestellt wurden. Um wirklich fundierte Rückschlüsse ziehen zu können, müsste zumindest die Sichtweise der Person eingeholt werden, welche den Eignungstest mit dem jungen Mann damals durchgeführt und ihn beraten hat. Da innerhalb dieser Diplomarbeit allerdings die subjektive Einschätzung und Erfahrung im Mittelpunkt steht, ist dieser auch zu folgen. Sollte dem jungen Mann damals wirklich nur aufgrund des Eignungstests geraten worden sein, sich für einen anderen Beruf zu entscheiden, da beruflicher Erfolg für ihn in seiner Branche unmöglich sei, scheint dies, eine verkürzte Anschauungsweise gewesen zu sein. In einem solchen Fall wäre es vielleicht zielführender gewesen, dem jungen Mann, der sicherlich Probleme in seiner Lehrzeit hatte, eine Teilqualifizierungslehre oder eine verlängerte Lehrzeit anzubieten, um ihm eine Ausbildung in dem von ihm gewünschten Beruf zu ermöglichen. Vielleicht hätte der Betroffene mit dieser Form der Lehre bessere Erfolge erzielen können.
Diese Kategorie gibt Aufschluss über den bisherigen beruflichen Verlauf der jungen Frauen und Männer mit Behinderung, über Schwierigkeiten und erste Unterstützungsressourcen, bspw. bei der Kontaktaufnahme zu den einzelnen Unternehmen.
Neun der jungen Menschen scheinen eine sehr bewegte, wenn auch zumeist aufgrund ihres Alters recht kurze Berufskarriere gehabt zu haben. So berichteten alle neun von vielen unterschiedlichen Praktika und Kurzzeitjobs, von Zeiten der Arbeitslosigkeit, vereinzelt auch von länger andauernden Beschäftigungsverhältnissen. Eine richtige Kontinuität, wie sie im Sinne der nachhaltigen Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollte, ist lediglich bei einer jungen Frau festzustellen. Diese wurde 2005 von der Arbeitsassistenz erstmals in ein Arbeitsverhältnis als Büroangestellte vermittelt und ist seither immer noch in diesem Unternehmen tätig. Aus diesem Grund konnte sie sich auch zu bisherigen Berufserfahrungen nicht äußern. In diesem Fall kann demnach tatsächlich von einer "Ersteingliederung" in den allgemeinen Arbeitsmarkt und von einer "nachhaltigen Integration" gesprochen werden. Alle anderen jungen Frauen und Männer scheinen mit ihren Arbeitserfahrungen weniger Glück gehabt zu haben. Zwar gibt es einige Personen, welche von mehr- und langjährigen Beschäftigungsverhältnissen am ersten Arbeitsmarkt berichten, allerdings sind diese lediglich einige Stationen von vielen in ihrem bisherigen Berufsleben. Besonders zwei der befragten jungen Menschen stechen in diesem Zusammenhang hervor. So ist dies zum einen eine junge Frau, welche für drei Jahre in einem Imbiss als Servierkraft tätig war, während sie teilweise gleichzeitig über einen Zeitraum von acht Jahren als Reinigungskraft bei der städtischen Feuerwehr geringfügig arbeitete. Diese Arbeitnehmerin scheint ebenfalls einigermaßen gut ins Erwerbsleben integriert gewesen zu sein, zumal sie sogar zwei Dienststellen hatte, welche sie über mehrere Jahre hinweg, teilweise gleichzeitig, aufrecht erhalten konnte. Dass weder die eine, noch die andere Tätigkeit wirklich dem entsprach, was sie sich vorgestellt hat, sei in diesem Fall dahin gestellt, obwohl im Sinne der Nachhaltigkeitsüberlegungen, welche in dieser Diplomarbeit zusammengetragen und angestellt wurden, besonders auch qualitative Kriterien wie die Zufriedenheit der betroffenen Personen in ihren jeweiligen Jobs zu beachten sind. Dies ist besonders dahingehend Ernst zu nehmen, da die junge Frau eines der beiden Arbeitsverhältnisse selbst gelöst, im anderen nach Ablauf der finanziellen Unterstützung für das Unternehmen gekündigt wurde. Bloße Vermittlungsergebnisse bzw. Arbeitsdauer reichen bei näherer Betrachtung scheinbar nicht aus, um von einer nachhaltigen Integration und Teilhabe am Erwerbsleben sprechen zu können.
Als zweiter Fall dafür, dass eine langjährige Anstellung nicht zwangsläufig mit einer nachhaltigen Teilhabe gleichzusetzen ist, kann der eines jungen Mannes angesehen werden, der früher zunächst für eineinhalb Jahre im Straßenbau, dann für zwei Jahre in einem Weinbaubetrieb und schlussendlich für dreieinhalb Jahre bei seiner Stadtgemeinde als Kanalarbeiter beschäftigt war. Alle diese Dienstverhältnisse dauerten über ein Jahr und sind, geht es um eine zahlenmäßige Definition einer nachhaltigen Integration ins Erwerbsleben durchaus als eine solche zu betrachten. Allerdings scheint es in einem solchen Fall auch ratsam, den gesamten beruflichen Verlauf des jungen Mannes heranzuziehen. Hier wird nämlich ersichtlich, dass diese Arbeitsverhältnisse ebenfalls nur Stationen im Leben des jungen Mannes waren, zumeist bedingt durch finanzielle Förderungen. Sobald diese ausgelaufen waren, endete auch das Arbeitsverhältnis. Einzig das letzte bei der Stadtgemeinde konnte noch für ein halbes Jahr darüber hinaus durch Intervention seines Vaters, welcher als Gemeinderat fungiert, aufrecht erhalten werden.
Betrachtet man diese beiden Fälle sowie die anderen, bei welchen die vorherigen Arbeitsverhältnisse nicht so lange angehalten, sondern nur Praktika oder Schnupperwochen dargestellt haben, kann bzgl. der bisherigen Arbeitserfahrungen der jungen Frauen und Männer eigentlich kaum von einer Nachhaltigkeit gesprochen werden. Vielmehr kam es in der beruflichen Vergangenheit der jungen Menschen immer wieder zu Kontinuitätsbrüchen.
Was darüber hinaus in dieser Kategorie bemerkenswert gut zum Ausdruck zu kommen scheint, sind die Berufswahltendenzen der jungen Männer und Frauen. So gibt es bei den jungen Männern keinen einzigen, welcher einen Beruf gewählt hätte, der nicht als "männlich" bezeichnet werden kann. Alle Berufe können als Handwerksberufe angesehen werden, keiner davon - mit Ausnahme der kurzen Berufstätigkeit eines jungen Mannes als Kellner - liegt im Dienstleistungsbereich. Ebenso wählten auch beinahe alle jungen Frauen Berufe, welche zu den "typischen Frauenberufen" zählen, wie diese von Born (1998, S. 100) und Fasching (2008, S. 46) definiert wurden. Zwar hatte keine einzige junge Frau Erfahrungen als Friseurin, jedoch waren die übrigen frauentypischen Berufe im hauswirtschaftlichen Bereich sowie im Verkaufsbereich stark vertreten.
Zu hinterfragen wäre nun, warum so viele Männer scheinbar zu typisch männlichen und so viele Frauen zu Frauenberufen tendieren. Einer der Gründe, der auch schon in der Literatur diskutiert wurde, scheint tatsächlich die Herkunftsfamilie bzw. die Sozialisation der jungen Menschen zu sein. Diese Thematik wird aber bei der entsprechenden Kategorie näher zu diskutieren sein.
Neben diesen beiden bereits besprochenen Aspekten, gibt auch die Tatsache, dass viele Arbeitsverhältnisse lediglich für die Dauer der finanziellen Unterstützung an das Unternehmen bestanden, Anlass zum Nachdenken. Dieses Phänomen ist zwar bereits seit längerem bekannt, allerdings scheint besonders der Fall des jungen Mannes bemerkenswert, welcher nur zwei Tage nach Ablegung seiner Gesellenprüfung zum Garten- und Grünflächengestalter und somit nach Ablauf der finanziellen Förderung seitens der Berufsausbildungsassistenz seinen Arbeitsplatz verloren hat, obwohl der Dienstgeber mit seinen Arbeitsleistungen zufrieden gewesen zu sein scheint. Hier spielten, laut Angaben des jungen Mannes, ausschließlich finanzielle Beweggründe eine Rolle[35].
Finanzielle Beweggründe scheinen für die meisten Firmen im Vordergrund zu stehen, wenn es darum geht, einen Menschen mit Behinderung in ein Arbeitsverhältnis aufzunehmen[36]. Deshalb begrenzen viele die Dienstverhältnisse von vornherein, um sicher zu gehen, dass sie diese im Falle des Falles möglichst unkompliziert wieder auflösen können. Dies könnte ein Erklärungsversuch sein, warum drei der jungen Menschen ihre Dienststellen verloren haben, dies jedoch gar nicht wirklich als Kündigung angesehen haben, wie dies von einer Mutter dezidiert ausgesagt wurde: "Das waren alles halt immer nur so Praktikum eben. Und bei der Gemeinde, da war er ja in der Saison, Laubrechen und die Gartenpflege und so was und dann war's halt wieder vorbei das Praktikum. Also das war dann nicht so Kündigung in dem Sinn" (Interview I - 1, Z. 28 - 30).
Dass von den zahlreichen Beschäftigungsverhältnissen der jungen Menschen nur vier von den Befragten selbst gelöst wurden, bestätigt den Arbeitswillen der Interviewpersonen. Alle jungen Frauen und Männer sagen nämlich aus, arbeiten zu wollen und unter Zeiten der Arbeitslosigkeit zu leiden.
Als wichtigste Unterstützungsressource wird von den jungen Menschen die Arbeitsassistenz angegeben, wenn es um Hilfe bei Bewerbungsgesprächen und -vorbereitungen geht. Obwohl lediglich drei der Befragten diese Unterstützung dezidiert angaben, kam dennoch bei den meisten Interviewpersonen während des Gesprächs heraus, dass sie in dieser Hinsicht von ihrer Arbeitsassistentin bzw. ihrem -assistenten unterstützt worden sein dürften. Als zweite Ressource werden hier die Eltern der jungen Menschen genannt. Diese beiden Hilfsquellen, Arbeitsassistenz und Angehörige, scheinen überhaupt die wichtigsten zu sein, wenn es um die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht. Dies soll jedoch bei der entsprechenden Kategorie näher diskutiert werden.
Diese Kategorie gibt die derzeitigen beruflichen Teilhabeerfahrungen der jungen Menschen wieder und reflektiert somit die eigentliche Intention dieser Diplomarbeit. Berufliche Teilhabe kann, wie im Theorieteil dieser Arbeit bereits erläutert, über vielerlei Faktoren bestimmt werden. So kann dies zum einen über das Bestehen bzw. das Ausmaß oder die Art des Dienstverhältnisses geschehen (z.B. geringfügige Beschäftigung vs. Vollzeitjob; vgl. hierzu Stöpel 2005). Auf der anderen Seite jedoch existieren, wie andere Autorinnen und Autoren (vgl. Spiess 2004; Hinz 2006) dies herausgearbeitet haben, auch andere, subjektive Gesichtspunkte, welche über berufliche Teilhabe oder Nicht-Teilhabe entscheiden. Es ist nicht das bloße Bestehen eines Arbeitsverhältnisses bzw. die Ausübung einer erwerbsmäßigen Tätigkeit für bspw. ein Unternehmen, welche berufliche Teilhabe ausmachen. Wäre dem so, könnte in Bezug auf die zehn für die Diplomarbeit befragten Personen schlicht und einfach ausgesagt werden, dass diejenigen sechs Personen, welche derzeit im Berufsleben stehen, beruflich teilhaben und alle anderen nicht. Doch ganz so einfach ist dies nicht, wie es auf den ersten Blick erscheint. Auch die soziale Komponente bspw. bestimmt maßgeblich darüber, ob berufliche Teilhabe erreicht wird oder nicht. Werden die Arbeitsverhältnisse nun aus dieser Perspektive betrachtet, so erscheinen sie nicht mehr ganz so eindeutig wie zuvor. Zur einer gelungenen beruflichen Teilhabe zählt - wie gerade festgestellt - neben dem Ausüben von bestimmten Tätigkeiten gegen eine gewisse Entlohnung etwa auch das Eingebunden-Sein in ein Kollegium von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens. Diejenigen Menschen nämlich, welche in einem Betrieb arbeiten, gestalten gemeinsam den beruflichen Alltag. Eben diesen Alltag zu erleben und daran tatsächlich teilzuhaben, scheint Hauptziel beruflicher Partizipation zu sein. Nun ist in Hinblick auf die zehn interviewten Personen zu fragen, ob diese es geschafft haben oder ob es ihnen ermöglicht werden konnte, in ihrem derzeitigen - bzw. im Falle von momentaner Arbeitslosigkeit in ihrem letzten - Arbeitsverhältnis zu partizipieren:
Zum einen scheinen die meisten Befragten sich innerhalb ihres Unternehmens wohl zu fühlen bzw. wohl gefühlt zu haben. Dies betrifft nach eigenen Angaben sowohl die auszuführenden Tätigkeiten, als auch das soziale Umfeld innerhalb des Betriebes. Was den sozialen Kontakt anbelangt, eine der Hauptkategorien für berufliche Teilhabe bei Menschen mit Behinderung (vgl. Beisteiner 1997; Hinz 2006), scheint dieser für viele der Befragten über das beruflich Notwendige nicht hinaus zu gehen. Lediglich drei junge Menschen berichteten, mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht nur Berufliches, sondern auch Privates besprochen zu haben, wobei eine dieser Personen sich generell sehr ambivalent zu diesem Thema geäußert hat. Ebenfalls nur zwei junge Befragte nehmen regelmäßig gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen an außerbetrieblichen Aktivitäten teil. Dies mag zum einen daran liegen, dass viele der Interviewten selbst nur eingeschränkt mobil sind und somit vielleicht an Abfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel gebunden sind, um nach einer solchen Veranstaltung nach Hause zu kommen. Da Firmenfeiern und Betriebsausflüge jedoch für gewöhnlich bis spät in den Abend bzw. in die Nacht hinein dauern, könnte eine solche Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln mit ein Grund dafür sein, dass die befragten Personen nicht daran teilnehmen (können). Zum anderen könnte jedoch auch der wenig ausbildete persönliche Umgang mit Kolleginnen und Kollegen ein Grund dafür sein, dass außerberufliche Veranstaltungen lediglich von zwei Personen regelmäßig frequentiert werden. So sagte eine junge Frau dezidiert aus, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen außerbetrieblichen Kontakt zu ihr wünschten, obwohl sie selbst sich darüber gefreut hätte.
Die meisten jungen Menschen mit Behinderung scheinen also von ihren Kolleginnen und Kollegen im Betrieb akzeptiert und als Arbeitskameradinnen und -kameraden angesehen zu werden, ansonsten würde man nicht mit ihnen über berufliche Belange sprechen. Im Hinblick auf tatsächliche soziale Integration jedoch dürfte bei den meisten Arbeitsverhältnissen der jungen Menschen einiges an Nachholbedarf bestehen. Auch die Tatsache, dass lediglich ein Vorgesetzter mit seiner Mitarbeiterin regelmäßig ein MitarbeiterInnengespräch führt, wie dies in vielen Unternehmen vorgeschrieben ist, bestätigt diese These. Die jungen Menschen werden generell zwar als Arbeitskräfte anerkannt, oft wird ihnen auch gute oder zufrieden stellende Leistung attestiert, jedoch scheinen einige von ihnen nicht als wirklicher Bestandteil des Kollegiums angesehen zu werden. Eine Ausnahme hierbei scheint besonders ein junger Mann darzustellen. Er wird von seinen Arbeitskolleginnen und -kollegen nicht nur beruflich, sondern auch privat anerkannt und geschätzt. Zwar gibt er selbst an, eher über berufliche Belange mit den anderen Arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern zu sprechen. Dies jedoch scheint - in Bezug auf sein Verhalten während des Interviews - eher auf seine Schüchternheit zurückgeführt werden zu können. Seine Mutter, welche ihn aus diesem Grund beim Interview unterstützte, berichtete nämlich, dass ihr Sohn sehr gerne an außerbetrieblichen Aktivitäten teilnehme und von zwei Kolleginnen daran anschließend immer wieder nach Hause gebracht würde. Diese nehmen ihren Kollegen des Öfteren mit dem Auto mit und generell verstehen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut mit ihm. Sie scheinen ihn sogar liebevoll als "ihr Schatzi" zu bezeichnen, was nach Angaben der Mutter als ein wirklich gutes Betriebsklima und nicht als eine Form des Sich-Lustig-Machens zu verstehen ist. Dieser junge Mann scheint, bezogen auf seine berufliche Tätigkeit, die Dauer seines Arbeitsverhältnisses (fast zwei Jahre) und die betriebliche Integration tatsächlich berufliche Teilhabe erreicht zu haben.
Als zweiten Fall könnte man hier bspw. auch die junge Frau nochmals erwähnen, bei welcher eine wirkliche Ersteingliederung in den Arbeitsmarkt vorliegt. Sie wurde 2005 von der Arbeitsassistenz in einen Bürojob vermittelt und arbeitet seither dort als Büroangestellte. Auch sie berichtet von guten sozialen Kontakten zu ihren Kolleginnen und Kollegen, welche einzig vom schlechten Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten getrübt werden. Doch auch in dieser Hinsicht kann von beruflicher Teilhabe gesprochen werden. Diese bezieht sich ja nicht auf ein positives Verhältnis zu allen betriebsangehörigen Personen. Auch eine schlechte Beziehung ist ein sozialer Kontakt und auch eine solche kann etwas über berufliche Partizipation aussagen, zumal sich sowohl die Angestellte, als auch der Vorgesetzte bereits zweimal die Zeit genommen haben, in mehrstündigen Gesprächen die Differenzen beizulegen. Dies zeigt beiderseitiges Interesse an dem Arbeitsverhältnis, obwohl dieses bei der jungen Frau derzeit nach dem Scheitern beider Schlichtungsversuche schon etwas nachzulassen scheint. Sie spielt intensiv mit dem Gedanken eines Jobwechsels.
Es scheint sich also abzuzeichnen, dass bei einigen interviewten Personen berufliche Teilhabe bestehen dürfte. Bei anderen kann eher von einer Integration ins Erwerbsleben gesprochen werden, bei welcher jedoch noch einige Schritte hin zur wirklichen Partizipation zu fehlen scheinen. Besonders der soziale Bereich am Arbeitsplatz ist in dieser Hinsicht noch zu forcieren. Bei einer jungen Frau kann nur in sehr geringem Ausmaß von beruflicher Teilhabe gesprochen werden, nämlich bei der Befragten, welche noch nie am ersten Arbeitsmarkt tätig, sondern immer in Beschäftigungstherapie gewesen ist. Dabei zählt jedoch nicht so sehr die Tatsache der ausschließlichen Werkstättenerfahrung, denn auch eine solche ist nach Stöpel (vgl. 2005) als Form der beruflichen Teilhabe anzusehen, als vielmehr die Tatsache, dass die junge Frau sich in keiner dieser Werkstätten wohl gefühlt bzw. von niemandem ihr eigentlicher Berufswunsch, nämlich Automechanikerin zu werden, aufgegriffen und Ernst genommen zu werden scheint. Hier dürfte es sich um ein Beispiel für einen Menschen handeln, welcher durch seine Umwelt an seiner beruflichen Teilhabe behindert wird. Auch wenn die junge Frau eine intellektuelle sowie psychische Beeinträchtigung zu haben scheint, könnte sie immerhin versuchen, zumindest eine Teilqualifizierungslehre in ihrem Traumberuf, Automechanikerin, zu absolvieren. Sollte dies ebenfalls nicht funktionieren, wäre auch eine Hilfsarbeitertätigkeit in diesem Bereich für sie vorstellbar. Hier scheint die notwendige Unterstützung zu fehlen um diesen Traum realisieren zu können und berufliche Teilhabe für die junge Frau zu ermöglichen.
Diese Kategorie behandelt alle Aussagen zu Unterstützungsleistungen und -bedarfen der jungen Frauen und Männer, wobei hier zwischen Hilfen am Arbeitsplatz und Behelfen außerhalb des Betriebes zu unterscheiden ist. Weiters lassen sich diese wiederum trennen in professionell geleistete Unterstützungsmaßnahmen und Hilfen durch Laien sowie in viele unterschiedliche Unterstützungsklassen. Aspekte pädagogischer Unterstützung, wie im Theorieteil dieser Diplomarbeit diskutiert (vgl. Kapitel 5), sind sowohl in den Aussagen der jungen Menschen zu innerbetrieblichen, wie auch zu außerbetrieblichen Hilfestellungen enthalten.
Führt man die Betrachtung der Unterstützungsleistungen chronologisch aus, scheint es ratsam mit den außerbetrieblichen und berufsvorbereitenden Maßnahmen zu beginnen. Bei diesen scheinen die Leistungen der Arbeitsassistenz ganz besonders bedeutsam für die interviewten Personen zu sein. Sieht man sich hier zunächst die Erwartungshaltung der Befragten an, so scheint für die meisten jungen Menschen die Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche von zentraler Bedeutung zu sein. Hieran dürfte man wieder den Arbeitswillen der jungen Frauen und Männer erkennen. Auch in punkto Zufriedenheit mit den erbrachten Unterstützungsleistungen lassen die Aussagen der befragten Personen wenig Zweifel übrig. Alle sind prinzipiell mit den Leistungen der Arbeitsassistenz zufrieden und loben die sie unterstützenden Stellen. Auch im Hinblick auf pädagogische Leistungen wie Persönlichkeits- und Weiterbildung (siehe Diskussion der Kategorie "Zukunftsvorstellungen") und im Hinblick auf die Unterstützung durch Freunde und Angehörige scheinen die jungen Menschen zufrieden.
Betrachtet man die innerbetriebliche Unterstützung, welche wiederum von unterschiedlicher Seite erbracht und verschieden klassifiziert werden kann, scheint auch hier unter den Befragten allgemein ein hohes Einverständnis mit den Leistungen zu herrschen. Sowohl die Unterstützung durch Arbeitsassistenz und JobCoaching während der Einarbeitungs- und Nachbetreuungszeit scheint - bis auf einen Fall - ausreichend gewesen zu sein, als auch die Hilfen durch Kolleginnen und Kollegen dürften im Großen und Ganzen im Hinblick auf die Aussagen der jungen Menschen zufrieden stellend sein. Dies scheint sich auch daran zu zeigen, dass sie nichts oder nur wenig an diesen verändern oder verbessern möchten, und dass die meisten befragten Männer und Frauen angeben, genügend Unterstützung in ihrem Berufsleben zu erhalten.
In dieser Hinsicht stellen sich nun jedoch die Fragen, warum dennoch nur die Hälfte der Interviewten derzeit Arbeit hat und wie es dazu kommen kann, dass auch die derzeit arbeitslosen Männer und Frauen angeben, keine weitere Unterstützung zu benötigen?
-
Eine Vermutung hierbei liegt in dem Phänomen, dass vor allem Männer (und bei zwei der fünf derzeit arbeitslosen Befragten handelt es sich um junge Männer) - wie im Theorieteil dieser Arbeit dargestellt (vgl. Kapitel 4.3.4) - es oft als Schwäche ansehen, Hilfeleistungen zu benötigen, und diese deshalb nicht einzufordern oder anzunehmen (vgl. Exner 1997). Hier dürfte demnach wieder die falsche bzw. oft geschlechtsspezifische Sozialisation und Erziehung der jungen Menschen zum Ausdruck kommen, welche ihnen weismacht, dass Unterstützung für Männer nicht notwendig sei. Im Gegenteil: Männer müssten alles alleine schaffen. Hierzu würde auch die Aussage eines jungen Mannes passen, welcher gemeint hat, dass er von seiner Familie vor allem moralische Hilfe bzw. Unterstützung bei seiner Persönlichkeitsentwicklung erhalte, den Rest - wie Arbeitsplatzsuche - jedoch alleine erledige (vgl. Interview X).
-
Eine weitere Vermutung legt nahe, dass viele der jungen Menschen, welche derzeit ohne Beschäftigung sind und dennoch aussagen, genügend Unterstützung zu bekommen, sich (vielleicht aufgrund ihrer Beeinträchtigung) keine weiteren Hilfeleistungen vorstellen können und somit mit dem zufrieden sind, was sie an Unterstützung erhalten. Viele dieser Personen kennen vermutlich das Angebot an Hilfemaßnahmen, welche es in Österreich für junge Menschen mit Behinderung gäbe, gar nicht. In dieser Hinsicht wäre es vermutlich notwendig, den betreffenden Personen die Hilfeleistungen besser und verständlicher darzulegen und ihnen somit zu helfen, den Durchblick im Maßnahmendschungel zu behalten. Eine Stelle, welche derzeit versucht, dies für den Großraum Wien zu ermöglichen, ist die Koordinationsstelle des Bundessozialamtes, des Arbeitsmarktservices und des Fonds Soziales Wien. Deren Ziel ist "das Schnittstellenmanagement zwischen Arbeitsmarktservice (AMS), Bundessozialamt (BSB) und Fonds Soziales Wien (FSW) mit dem Schwerpunkt der beruflichen Integration behinderter und benachteiligter Jugendlicher in Wien"[37]. Solche Unterstützungsleistungen österreichweit auszubauen und Menschen mit Behinderung ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, sollte sicherlich Ziel weiterführender Überlegungen sein.
Die Tatsache, dass lediglich die Hälfte der für diese Arbeit befragten Personen derzeit im Erwerbsleben steht, gibt darüber hinaus Anlass zur Frage, ob die Unterstützungsleistungen, welche die jungen Menschen erhalten bzw. erhielten, wirklich derart ausreichend und gut sind, wie es den Interviewten scheint.
Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst herauszufinden, von welchen Seiten die jungen Frauen und Männer überhaupt Unterstützung erhalten. Hier scheint es sich vor allem um drei große Hilfeträger zu handeln: Auf der einen Seite steht die professionelle Unterstützung durch dafür zuständige Dienste wie Arbeitsassistenz und JobCoaching, welche den jungen Menschen wichtig zu sein scheint. Dies zeigt sich vor allem daran, dass alle zehn Befragten diesen Unterstützungsträger erwähnt und gelobt haben. Auf der anderen Seite scheint auch die Hilfe durch Kolleginnen und Kollegen bzw. Vorgesetzte für die jungen Frauen und Männer von großer Bedeutung. Auch diese wird von fast allen Befragten erwähnt und gelobt, wobei es hie und da natürlich auch zu Problemen und Meinungsverschiedenheiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt. In punkto Unterstützung jedoch verlor - bis auf eine junge Frau, welche Schwierigkeiten mit ihrem Vorgesetzten hat und sich deshalb von ihm nicht unterstützt fühlt -, niemand ein schlechtes Wort über seine / ihre Kolleginnen und Kollegen bzw. Vorgesetzten. Der dritte Unterstützungspfeiler, welcher den jungen Menschen als besonders bedeutsam erscheint, sind ihre Angehörigen und Freunde. Auch diese Form der Unterstützung wird einstimmig hervorgehoben und - bis auf eine junge Frau - von allen Befragten gelobt.
Diese drei Unterstützungsformen scheinen für die jungen Befragten am wichtigsten. Andere wie bspw. finanzielle Unterstützung, Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Behindertengesetzen bzw. technische Hilfen scheinen für sie schon von Bedeutung - zumindest werden vor allem finanzielle Förderungen von einigen Personen erwähnt. Allerdings dürften diese Hilfeleistungen gerade für die Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung im Vergleich zu den anderen dreien eher in den Hintergrund zu treten. Die drei erwähnten Formen jedoch - Arbeitsassistenz, Kolleginnen und Kollegen, Angehörige - sind für die Befragten von großer Wichtigkeit. Nun ist jedoch zu überlegen, inwieweit diese drei ausreichend sind, um den jungen Menschen berufliche Teilhabe zu ermöglichen bzw. sie zu fördern.
-
Die Leistungen der Arbeitsassistenz werden von den meisten Befragten als Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche, bei Bewerbungsgesprächen und in der Anfangszeit des neuen Arbeitsverhältnisses beschrieben. Besonders dieser dritte Bereich scheint jedoch in manchen Fällen zu wenig ausgeprägt gewesen zu sein. So sagt fast die Hälfte der jungen Menschen aus, dass diese Hilfe für sie lediglich auf Abruf bereit stand. Gerade bei der Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung jedoch scheint es überlegenswert, ob diese die Notwendigkeit von Unterstützung zum gegebenen Zeitpunkt überhaupt abschätzen können. Fällt es schon vielen nicht-behinderten Menschen schwer, sich einzugestehen, dass sie Hilfe benötigen, könnte dies für Menschen mit Lernbehinderung noch schwieriger sein. In vielen Fällen könnte dadurch der richtige Zeitpunkt, Unterstützung einzuleiten, verpasst und das bestehende Arbeitsverhältnis dadurch belastet werden. Wäre die Arbeitsassistenz, der JobCoach oder eine andere professionell unterstützende Stelle in der Einarbeitungszeit regelmäßiger vor Ort, könnte das Problem einer solche zu spät ansetzende Unterstützung minimiert oder ganz vermieden werden. Natürlich ist es immer eine Frage der personellen und zeitlichen Ressourcen, allerdings wäre im Hinblick auf die Nachhaltigkeit von Vermittlungen zu überlegen, ob es den zusätzlichen Aufwand nicht doch wert sei.
Eine solche zusätzliche Unterstützung vor Ort könnte bspw. in Form einer verpflichtenden ersten Einarbeitungswoche durch einen JobCoach oder aber durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des jeweiligen Betriebs passieren, welche(r) während dieser Zeit für den einzuarbeitenden neuen Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin zur Verfügung steht und diese(n) betreut. Sollte es sich um einen Mentor / eine Mentorin des Unternehmens handeln, müsste die Einarbeitung unter Anleitung bzw. unter quasi "Supervision" der Professionistenseite geschehen. D.h. zunächst müsste der Mentor bzw. die Mentorin von einem Fachmann bzw. einer Fachfrau über die Behinderung und die daraus resultierenden Einschränkungen des neuen Arbeitnehmers / der neuen Arbeitnehmerin aufgeklärt und über mögliches "unangemessenes" Verhalten oder etwaig auftretende Probleme informiert werden. Daran anschließend wäre eine mit der Zeit nachlassende intensive Betreuung beider, sowohl des Mentors / der Mentorin, als auch der behinderten Person notwendig. Bei Problemen müsste die Arbeitsassistenz so schnell als möglich wieder vor Ort sein, um klärend und unterstützend eingreifen zu können. Die bloße Möglichkeit für den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin mit Behinderung, die Arbeitsassistenz bei Bedarf selbst kontaktieren zu können bzw. sporadische Besuche alle paar Wochen oder Monate, scheinen jedenfalls zu wenig, obwohl aus ökonomischer Sicht verständlich.
-
Im Bezug auf die soziale Integration des jungen Menschen mit Behinderung scheint vor allem das Kollegium gefordert zu sein. Zwar gaben die meisten Befragten an, sich bei Problemen an ihre Kollegen und Kolleginnen wenden zu können, jedoch könnte die soziale Komponente der beruflichen Teilhabe bei vielen - wie bereits in der Diskussion der Kategorie "(Derzeitige) subjektive Erfahrungen" erwähnt - verbessert werden. Hier wiederum könnte mittels eines gesetzlich verpflichtenden MentorInnensystems Abhilfe geschaffen werden. Würde man dieses System nämlich gesetzlich verankern oder zumindest eine allgemeine Empfehlung dafür aussprechen bzw. dieses vielleicht nach stärker finanziell fördern, würde es sich sicherlich besser durchsetzen. Derzeit scheint es nämlich nur vereinzelt Anwendung zu finden. Wenn man nämlich bedenkt, dass für diese Diplomarbeit zehn Menschen aus drei Bundesländern und ganz unterschiedlichen Branchen befragt wurden und kein(e) Einzige(r) angibt, einen Mentor / eine Mentorin zu haben, weist dies zumindest ansatzweise darauf hin, dass das System bislang nicht funktioniert. Dabei bietet das Mentorinnensystem, wie dies Schartmann bereits 1995 erwähnt hat und es in dieser Arbeit auch schon diskutiert wurde (vgl. Kapitel 5.3.2) besonders für die soziale Komponente der beruflichen Teilhabe beinahe unverzichtbare Vorteile. Auch von den interviewten Personen sagten diejenigen, welche zumindest ansatzweise einen Mentor bzw. eine Mentorin hatten, aus, dass sie diese Form der Unterstützung als angenehm und hilfreich empfunden haben.
-
Die dritte Unterstützungsform, nämlich die durch die Angehörigen der jungen Menschen mit Behinderung, scheint gerade für die Motivation der Interviewten von besonderer Bedeutung zu sein[38]. Auch scheinen Angehörige vielfach instrumentelle und materielle Hilfe für ihre Kinder zu leisten (siehe hierzu Kapitel 5.4.2 im Theorieteil sowie die Kapitel 9.4 bzw. 10.4. im Empirieteil). Dennoch könnten gerade die Familie und die Freunde als weitaus wichtigere und bedeutsame Ressource genutzt werden, als es derzeit vielfach passiert. Besonders als integrierende Unterstützung könnten sie einen wertvollen Beitrag leisten. Dazu müsste jedoch die Vernetzung zwischen den Unternehmen und den Familien besser ausgebaut werden. Auch die Familien könnten bspw. einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass die jungen Menschen mit Behinderung besser am Arbeitsplatz integriert werden und Problemen vorgebeugt wird. So könnten auch sie in der Anfangszeit ihre Kinder einarbeiten. Aufgrund ihres speziellen Fachwissens, die Eigenheiten ihrer Söhne und Töchter betreffend, bzw. aufgrund ihrer besonders vertrauensvollen Beziehung zu ihren Kindern könnte für die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Lernphase im neuen Beruf erleichtert werden. Sie könnten auch die betrieblichen Mentoren und Mentorinnen im Umgang mit ihren Kindern schulen oder mit diesen zumindest telefonisch in Verbindung stehen und bei etwaigen Problemen unterstützen. Andererseits wiederum könnte es natürlich vielen jungen Menschen nicht Recht sein, wenn ihre Eltern an ihrem Arbeitsplatz vor Ort wären, da dies den Abnabelungsprozess, wie ihn Schartmann (vgl. 1995) ebenfalls beschrieb gefährden könnte. Auch aus Sicht der "normalen" Trennung von Privatem und Beruflichem könnte dies problematisch wirken. Allerdings wäre es eine Überlegung wert, wie man alle diese Argumente berücksichtigen und die Angehörigen dennoch mehr ins Erwerbsleben ihrer Kinder mit einbeziehen könnte. Die jungen Menschen selbst nämlich sehen gerade diese Ressource als äußerst wichtig an. Außerdem wäre dies eine Möglichkeit, die vielfach sehr geringen personellen und zeitlichen Ressourcen der Arbeitsassistenz zu schonen und dennoch eine optimale Einarbeitung für die jungen Menschen mit Behinderung zu gewährleisten.
In dieser Kategorie werden die Aussagen der jungen Menschen zu geschlechtsspezifischen Aspekten ihrer Berufserfahrungen diskutiert. Hierzu zählen unterschiedliche Berufswahltendenzen je nach Geschlecht oder auch Erfahrungen mit geschlechtsbedingter Diskriminierung.
Diese Kategorie scheint den meisten Befragten Schwierigkeiten bereitet zu haben, da hier äußerst wenig Ergebnisse zu verzeichnen sind. So scheinen viele der jungen Menschen es nicht gewohnt zu sein, nach ihrem Geschlecht bzw. nach Angelegenheiten gefragt zu werden, welche dieses betreffen. Einige dürften die Fragen auch nicht ganz verstanden haben, da besonders bei dieser Kategorie sehr viel nachgefragt wurde, wie die Interviewfragen zu verstehen sind. Besonders die jungen Männer konnten damit nicht viel anfangen, was sich daran zeigt, dass sie sich zu diesem Themenbereich nur sehr spärlich äußerten.
Als herausragendstes Ergebnis zum Fragenkomplex "Geschlechtsspezifik" kann die geschlechtstypische Verteilung der Berufe zwischen den jungen Frauen und Männern angesehen werden. So arbeitet kein einziger Mann - wie bereits bei der Diskussion der Kategorie "(Derzeitige) subjektive Erfahrungen" erwähnt - in einem "Frauenberuf" und keine einzige Frau in einer Branche, welche nicht dem hauswirtschaftlichen bzw. dem Verkaufsbereich zuzuordnen wäre. Der Grund hierfür scheint vor allem in der Sozialisation der jungen Menschen zu liegen. Dies bestätigt sich, wenn man die Aussage einer Mutter heranzieht, welche ihre Tochter bei deren Interview unterstützt hat: "Nein wir haben eigentlich immer geschaut, dass sie Tätigkeiten macht, die eine Frau macht" (Interview III - 10, Z. 354 - 355; Mutter einer Befragten). Die Eltern scheinen demnach wirklich darauf zu achten, dass ihre Kinder in Berufen arbeiten, welche angeblich ihrem Geschlecht entsprechen bzw. welche seit Generationen einem Geschlecht besonders vorbehalten sind. Durch diese geschlechtsspezifische Erziehung dürfte es auch dazu kommen, dass sich die jungen Menschen in ihren jeweiligen Berufsbranchen auch wohler fühlen als in anderen. Lediglich eine junge sticht in diesem Zusammenhang aus der Menge hervor. Als sie nämlich nach ihrem Traumberuf gefragt wurde, gab sie an, entweder Schaustellerin im Wiener Prater oder Automechanikerin werden zu wollen. Sie gab auch an, sich allgemein mit Männern besser zu verstehen, da diese unkomplizierter seien als Frauen. Auffallend ist in Bezug auf diese junge Frau, dass sie von ihrer Familie beinahe keine Unterstützung im Hinblick auf ihre berufliche Laufbahn bekommen zu scheint. Ihre Mutter versteht zwar ihren Wunsch, ihre derzeitige Arbeitsgruppe zu wechseln, scheint sich allerdings sonst - nach Aussagen der jungen Frau - nicht um die beruflichen Belange ihrer Tochter zu kümmern. Hier könnte ebenfalls ein Beweis dafür liegen, dass die Familie maßgeblich die Berufswahltendenzen der Kinder beeinflusst. Alle jungen Menschen, welche von ihren Angehörigen Unterstützung bei ihrer Berufssuche erhielten bzw. derzeit erhalten, scheinen sich für geschlechtstypische Berufe zu interessieren. Einzig die junge Frau, welche nach eigenen Angaben keinen derartigen familiären Beistand bekommt, wünscht sich, in einem geschlechtsuntypischen Beruf zu arbeiten und meint auf die Frage, ob ein typischer Frauenberuf etwas für sie wäre, dass sie lieber mit Männern zusammenarbeite[39].
Als zweites entscheidendes Ergebnis aus dem Komplex "Geschlechtsspezifik" kann hervorgehoben werden, dass beinahe alle Befragten der Meinung sind, dass es bzgl. des individuellen Unterstützungsbedarfs einer Person nicht auf deren Geschlecht ankommt. Lediglich drei junge Frauen schätzen diesen Bedarf höher ein als bei männlichen Kollegen und nennen einmal die Anfangsphase im Beruf, ein anderes Mal schwere körperliche Arbeit. Während der zweite Punkt als selbsterklärend erscheint, bedarf der erste offenbar einiger Überlegung. Warum sollten junge Frauen mit Behinderung besonders in der Anfangsphase in einem neuen Beruf mehr Unterstützung benötigen als ihre männlichen Kollegen.
-
Ein Grund könnte hierbei sein, dass es Frauen mit Behinderung ohnehin aufgrund von Doppelbelastung durch Beruf und Familie bzw. wegen doppelter Diskriminierung aufgrund einer Kumulation von Geschlecht und Behinderung generell schwerer im Berufsleben und beim Berufseinstieg haben als Männer (siehe hierzu Theorieteil, Kapitel 4.3.2). Auch im aktuellen "Bundesweiten arbeitsmarktpolitischen Behindertenprogramm" (BABE) wird darauf verwiesen und bei der Gestaltung von beruflichen Maßnahmen für Menschen mit Behinderung Rücksicht genommen: "Im Sinne des Gender Mainstreaming sollte daher als Förderziel in der beruflichen Integration von Frauen mit Behinderung eine Quote von 50% determiniert werden" (BMSK 2008, S. 12).
-
Ein anderer Anlass dafür könnte die Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens ihren weiblichen Kolleginnen mit Behinderung gegenüber sein. Besonders in Berufen, welche vermehrten körperlichen Einsatz erfordern, könnten Frauen mit Behinderung von ihren nicht-behinderten Kolleginnen und Kollegen als weniger kompetent empfunden werden, da sie vielfach aufgrund ihrer Beeinträchtigung einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Auch könnten männliche Kollegen versucht sein, mit ihren neuen behinderten Kolleginnen ihre Scherze zu treiben, wie dies von einer jungen Frau auch dezidiert ausgesagt wurde: "Ich bin sehr oft gekitzelt worden von den männlichen Kollegen, aber das ist eigentlich schon lustig"(Interview IX - 6, Z. 218 - 219). In diesem Fall konnte die Betroffene das Ganze mit Humor nehmen, allerdings geschehen solche und ähnliche Dinge sicherlich öfter, als man denkt, wobei sich viele junge Frauen mit Behinderung dagegen nicht wehren können, obwohl sie mit solcherlei Belästigungen nicht einverstanden sind. Deshalb scheint es gerade in der Anfangsphase in einem neuen Job für junge Frauen wichtig, sich bei Problemen an eine für sie zuständige Stelle, sei dies die Arbeitsassistenz, ein Kollege oder eine Kollegin, der oder die Vorgesetzte oder Ähnliches wenden und solche Schwierigkeiten besprechen zu können. Gerade im Hinblick auf weibliche Arbeitnehmerinnen mit Behinderung, welche vielleicht weniger durchsetzungsfähig sind als ihre männlichen Kollegen, scheint eine solche Vertrauensperson in der Anfangszeit besonders wichtig. Vielleicht wäre es besonders im Bezug auf diese Thematik deshalb möglich, eventuell im Rahmen eines "Bundesweiten arbeitsmarktpolitischen Behindertenprogramms", fixe Ansprechpersonen für Frauen mit Behinderung im Betrieb bzw. eine koordinierende Anlaufstelle zu errichten, welche den jungen Frauen bei ihren geschlechtsspezifischen Problemlagen zur Seite steht und diese besonders unterstützt. Auch, wenn geschlechtsspezifische Schwierigkeiten - wie aus den Interviews hervorgeht - nur selten vorkommen, könnten besonders diejenigen Frauen, welche sie dagegen selbstständig nicht wehren können, durch eine solche Anlaufstelle unterstützt und beraten werden. Auch Niehaus (vgl. 2001) appellierte in ihrem Beitrag "Netzwerkarbeit von und für Frauen mit Behinderung" für eine derartige Vernetzung behinderter Frauen, "zur Stärkung der vernachlässigten Interessen von Mädchen und Frauen mit Behinderung" (ebd., o. S.).
In dieser Kategorie werden die Veränderungen im Leben der Befragten durch ihre Erwerbstätigkeit ebenso diskutiert, wie die Veränderungen, welche sie in ihrem Berufsleben gerne vornehmen würden.
Ein sehr auffälliges Ergebnis dieser Kategorie scheint die Tatsache zu sein, dass beinahe alle jungen Menschen in ihrer Berufsbranche bleiben möchten. Dies scheint eine hohe Zufriedenheit mit den bisher gemachten beruflichen Erfahrungen widerzuspiegeln. Lediglich zwei junge Frauen möchten ihren Beruf wechseln, wobei sich beide derzeit in Beschäftigungstherapie- bzw. Berufsvorbereitungsmaßnahmen befinden. Alle jungen Menschen, welche bereits Erfahrungen am ersten Arbeitsmarkt gesammelt haben bzw. momentan in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehen, scheinen ihren Weg gefunden zu haben und zu wissen, welchen Beruf sie ausüben möchten. Allerdings scheinen sie auch realistisch genug zu sein um zu wissen, dass es in der heutigen Arbeitswelt nicht immer einfach und dass es manchmal nötig ist, den Beruf zu wechseln um einen Arbeitsplatz zu finden. Darauf deutet zumindest die folgende Aussage eines jungen Mannes hin: "Wenn es notwendig ist, dann würde ich wechseln" (Interview X - 7, Z. 239).
Ein zweites Ergebnis, welches beachtenswert scheint, hier jedoch nur kurz andiskutiert werden soll, ist, dass die jungen Menschen unwissentlich ziemlich alle Funktionen der Erwerbsarbeit bestätigt haben, die innerhalb der Literatur diskutiert werden (vgl. Kapitel 14 im Anhang zu dieser Diplomarbeit). So werden sowohl die Funktionen der Zeitstrukturierung, der Anerkennung, der Identitätsbildung, als auch die sozialen Funktionen von Arbeit genannt und von den befragten Personen als wichtig erachtet. Die Möglichkeit zu arbeiten, scheint demnach für alle Interviewten aus dem einen oder anderen Grund von zentraler Bedeutung zu sein.
Aus pädagogischer Sichtweise als entscheidendstes Resultat dieser Kategorie dürfte jedoch der Mangel an Weiterbildungsmöglichkeiten für junge Menschen mit Behinderung hervorgehen. Dabei scheint es beachtenswert, dass weder die unterstützenden Stellen wie Arbeitsassistenz, noch die Betriebe oder die jungen Frauen und Männer selbst großen Wert auf Weiterbildung zu legen scheinen. Entweder wussten die Befragten gar nicht, dass es für sie Schulungs- und Bildungsmaßnahmen geben könnte oder es wurde ihnen von Seiten der unterstützenden Stellen gesagt, dass es sehr schwer sei, solche für sie zu finden[40]. Dies könnte und sollte in Hinkunft verbessert werden, da sich die derzeitige Situation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt immer mehr in Richtung "Weiterbildungsgesellschaft" zu entwickeln scheint und es heute wichtiger denn je ist, über ausreichend Qualifikationen für seinen Beruf zu verfügen. Deshalb ist auch das Begehren des Vaters verständlich, welcher seinen Sohn dazu drängt, den B-Führerschein zu machen: "Aber er, schuld daran ist er, weil ich sekkiere ihn er soll für die Fahrschule lernen und wenigstens den B Schein machen. [...] Er braucht nur lernen, Mopedführerschein hat er auch gemacht. Er braucht sich nur bemühen" (Interview V - 12 / 13, Z. 419 - 427).
Es bedarf demnach offensichtlich sowohl einer Bewusstseinsbildung der jungen Menschen darüber, wie wichtig Weiterbildung in der heutigen Zeit ist, als auch geeigneter Schulungsangebote, welche die unterstützenden Stellen ihren Klientinnen und Klienten anbieten können. Auch ihnen sollte klar gemacht werden, dass junge Menschen mit Behinderung heutzutage gar nicht über genug Zusatzqualifikationen verfügen können, um sich im Berufsleben zu etablieren. Ebenso sollte von Seiten der finanzierenden Stellen die für jedes Projekt vorgegebene Vermittlungsquote auch auf Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote ausgeweitet werden, wie dies teilweise heute auch schon gemacht wird. So scheint aus pädagogischer Perspektive eine zusätzliche Ausbildung für einen jungen Menschen zumeist sinnvoller, als eine Vermittlung in eine Hilfsarbeitertätigkeit, welche nach Ablauf der finanziellen Förderfrist aufgekündigt wird.
[32] "Ich bin vom Kindergarten gleich in die Sonderschule gekommen, weil der Direktor mich nicht wollte, weil ich so langsam bin und mit dem reden Probleme gehabt habe" (Interview VI - 1, Z. 5-6).
[33] "Ich habe dann am 22. Oktober letztes Jahr meine Gesellenprüfung gemacht und am 24. war ich dann arbeitslos gemeldet" (Interview X - 2, Z. 54-55).
[34] "Also von der Caritas aus habe ich dann geschaut bzgl. Koch und Kellner, aber das ist dann zum Schluss nichts geworden. Da das dann nichts geworden ist, war ich dann beim AMS und habe einen Eignungstest gemacht, eben für diesen Beruf und dort ist mir dann gesagt worden, dass ich nicht die nötige Eignung dafür habe. [...] Darauf hat das AMS gesagt, dass ich mir einen anderen Beruf aussuchen soll" (Interview X - 1, Z. 6-12).
[35] "Naja, man kann nicht sagen, dass sie mich gekündigt haben, aber sie wollten mich nicht mehr haben. Die Begründung war, dass sie sich mich nicht mehr leisten können, d.h. wenn sie mich aufgenommen hätten, dann hätten sie einen anderen kündigen müssen und das wollten sie nicht" (Interview X - 2, Z. 43 - 46).
[36] In dieser Hinsicht sei auf die Arbeit von Schwarzbauer (2009) verwiesen, welche derzeit zu eben dieser Thematik erstellt wird.
[37] Mehr Informationen dazu online im WWW unter der URL: http://www.koordinationsstelle.at/ [Stand: 30. 5. 2009].
[38] "Wie gesagt, die geben mir auch die Kraft, dass ich das jetzt noch durchhalte und ich es bis jetzt auch durchgehalten habe, muss ich sagen. Also sie stehen voll hinter mir. [...]also eher mental, dass sie sagen, das schaffst du schon irgendwie. Also von dem her, wie mich die kennen das passt und, ja" (Interview VII - 10 / 11, Z. 351 - 361).
[39] "I: Und welche Arbeit würden Sie gerne machen einmal?
IP: Automechaniker. [...]
I: Das gefällt Ihnen? Das hat Sie interessiert?
IP: Ja.
I: Das ist ja kein Beruf, den Frauen nun oft haben.
IP: Ja. Genau.
I: Aber das macht Ihnen nichts?
IP: Nein.
I: Das gefällt Ihnen trotzdem.
IP: Ja.
I: Also so ein typischer Frauenberuf wie Frisörin oder Köchin oder so das wäre nichts für Sie?
IP: Nein" (Interview IV - 11 / 12, Z. 426 - 447).
[40] "So Schulungen, hat sie gesagt, ist momentan schwer für mich. Weil ich wollte auch eine Schulung machen, weil es mich sehr interessiert, eine Lehre wollte ich auch machen als Bürokauffrau - dann ist heraus gekommen, das ist schwierig für mich im Büro zu arbeiten" (Interview VII - 7, Z. 213 - 215).
Inhaltsverzeichnis
- 11.1 Welche beruflichen Teilhabeerfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?
- 11.2 Wie nachhaltig ist eine Vermittlung junger Menschen mit Lernbehinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt?
- 11.3 Welche (pädagogischen) Unterstützungsmaßnahmen erhielten bzw. erhalten die jungen Frauen und Männer?
- 11.4 Wo zeigt sich zusätzlicher Bedarf an Unterstützung für diese Zielgruppe?
- 11.5 Welchen besonderen Unterstützungsbedarf weisen junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern mit Lernbehinderung auf?
- 11.6 Ausblick
In diesem abschließenden Kapitel soll nun durch die konkrete Beantwortung der Fragestellungen das bisher Gesagte zusammengeführt und verbunden werden. Außerdem wird ein Ausblick bzgl. einer weiterführenden Forschung bzw. aus Sicht des Autors notwendiger Veränderungen in Praxis und Politik gegeben.
Die Hauptfrage dieser Diplomarbeit ließ sich, rückblickend auf die vorangegangenen Kapitel, mit Hilfe der Forschungsmethoden des Problemzentrierten Interviews sowie der Qualitativen Inhaltsanalyse gut beantworten. So konnten alle Befragten über ihre derzeitige berufliche Situation erzählen und glaubhaft ihre Erfahrungen schildern. Die subjektive Sichtweise der Interviewten konnte durch die halb-offene Interviewmethode dargestellt, fehlende relevante Informationen durch Heranziehung der im Leitfaden vorbereiteten Fragenkomplexe ergänzt werden.
Dabei zeichnete sich ein ambivalentes Bild der beruflichen Teilhabe junger Menschen mit Lernbehinderung ab. Zum einen gibt es einige Personen, bei denen von beruflicher Teilhabe gesprochen werden kann. Sie arbeiten bereits einige Jahre lang in ein- und demselben Betrieb, sind mit ihren Tätigkeiten zufrieden, werden von Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten sowohl beruflich, als auch außerberuflich anerkannt und fühlen sich in ihrer Arbeit wohl. Dies trifft bei einem der Befragten vollauf zu, bei einigen anderen in weiten Teilen. Insgesamt standen zum Zeitpunkt der Befragung fünf der zehn interviewten Personen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis und eine junge Frau am Ende ihrer Lehrzeit.
Zum anderen jedoch wurden Personen befragt, welche trotz eines konkreten Berufswunsches bzw. trotz einer abgeschlossenen regulären Lehrzeit (noch) nicht im Erwerbsleben Fuß fassen konnten, wodurch hier nicht von beruflicher Teilhabe im eigentlichen Sinne gesprochen werden kann. Vier der befragten Personen waren zum Zeitpunkt der Befragung entweder auf der Suche nach einem Arbeitsplatz oder in einer vorbereitenden Maßnahme bzw. in Beschäftigungstherapie. Von diesen stachen besonders zwei junge Menschen hervor, da sie bisher von ihrer Umwelt in ihrer beruflichen Teilhabe behindert worden zu sein schienen. So wurde einem jungen Mann einerseits eine Umschulung angeraten, nach der er schließlich seine Lehre zum Garten- und Grünflächengestalter absolvierte, obwohl ihn sein vorheriger Beruf sehr interessiert hatte. Seit seiner Umschulung jobbte er nur saisonal bzw. war er arbeitslos. Andererseits wurde einer jungen Frau, welche bislang noch nie am ersten Arbeitsmarkt tätig war, jedoch unbedingt Automechanikerin werden möchte, laut ihren eigenen Angaben nie die Chance gegeben, sich in diesem Beruf zu bewähren. Beiden Personen hätte zumindest eine Teilqualifizierungslehre angeboten werden können, um ihnen eine Ausbildung und eine berufliche Teilhabe in der sie interessierenden Branche zu ermöglichen. In beiden Fällen kann festgestellt werden, dass das Verständnis der Selbstbestimmung und des Empowerment von Menschen mit Behinderung, wie sie im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt wurden, bei den jeweils Beratenden nicht gegeben gewesen zu sein scheint. In beiden Fällen scheinen die Umweltfaktoren der jeweiligen Personen (die mangelnde Beratungs- und Unterstützungskompetenz der jeweiligen Unterstützungsstellen) dazu geführt zu haben, dass berufliche Teilhabe für sie bislang nicht möglich war. Bei der jungen Frau, welche gerne Automechanikerin werden möchte, könnte zusätzlich ihr Geschlecht, d.h. ein personbezogener Faktor mitgespielt haben. Wäre sie ein Junge gewesen, wären ihre Berufsberater und -beraterinnen bzw. ihre Arbeitsassistenten und -assistentinnen vielleicht eher auf die Idee gekommen, ihr eine Teilqualifizierungslehre in ihrem Wahlberuf ausprobieren zu lassen.
Beinahe alle Befragten hatten auch Erfahrungen mit Zeiten der Arbeitslosigkeit, was darauf zurück zu führen ist, dass bis auf eine junge Frau, welche tatsächlich seit ihrem Schulabschluss in ein- und demselben Unternehmen tätig ist, wodurch eine Ersteingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt vorliegt, alle Personen bereits ein oder mehrere Male ihren Arbeitsplatz und / oder Beruf gewechselt haben. Im Sinne der Nachhaltigkeitsüberlegungen, welche im Theorieteil dieser Arbeit angestellt wurden, kann deshalb hier zwar von nachhaltiger Betreuung und Unterstützung durch diverse Dienste und Maßnahmen (Arbeitsassistenz, JobCoaching, berufsvorbereitende Projekte wie PRIMA DONNA etc.) gesprochen werden, wie dies Albrecht (vgl. 2007) gemacht hat, jedoch kaum von einer nachhaltigen beruflichen Teilhabe. Die jungen Menschen durchliefen eine Maßnahme nach der anderen bzw. absolvierten sie diverse Praktika und wechselten häufig den Job, ohne jedoch eine dauerhafte Fixanstellung zu bekommen. Vielfach wurden sie nur solange angestellt, solange die Unternehmen finanzielle Förderungen dafür erhielten und sie somit als billige Arbeitskräfte anzusehen waren. Eine Nachhaltigkeit im Sinne kleiner Teilschritte konnte demnach zwar in den meisten Fällen erreicht werden. Allerdings kann von einer dauerhaften beruflichen Teilhabe und somit von wirklicher Nachhaltigkeit, wie bereits erwähnt, nur in den wenigsten Fällen gesprochen werden.
Hier bliebe herauszufinden, welche Faktoren tatsächlich in vielen Fällen dagegen gesprochen bzw. gewirkt haben, dass diese Teilhabe bzw. Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Es ginge in einer solchen Untersuchung demnach um die Barrieren der beruflichen Teilhabe. So wäre es sicherlich interessant, die unterstützenden Stellen der beiden oben explizit erwähnten Personen dazu zu befragen, warum aus ihrer Sicht eine Teilqualifizierungslehre oder ähnliche Angebote für ihre KlientInnen nicht infrage gekommen sind.
Auch die Frage nach den Unterstützungsmaßnahmen konnte durch die angegebenen Forschungsmethoden ansatzweise geklärt werden. Allerdings ist bei dieser Fragestellung zu beachten, dass die jungen Menschen selbst sich oftmals scheinbar schwer getan haben, das tatsächliche Ausmaß an Unterstützung, welches sie erhalten (haben), zu identifizieren und zu benennen. Um dies heraus zu finden, hätte sich vermutlich eine Befragung der Angehörigen der jungen Menschen besser geeignet. Dies kann auch daraus geschlussfolgert werden, dass bei den drei Interviews, bei denen Elternteile der Befragten anwesend waren, durch diese ein wesentlich differenziertes Bild über die Art und den Ablauf der Unterstützung und den beruflichen Werdegang ihrer Kinder gezeichnet wurde. Aber auch ein anderes Forschungsdesign hätte hier sicherlich zu anderen Ergebnissen geführt. So hätte sich eine Längsschnittuntersuchung vielleicht besser geeignet, um eine solche Fragestellung hinlänglich zu beantworten. Dies jedoch war aufgrund des begrenzten Zeitrahmens für diese Diplomarbeit nicht möglich.
Die drei großen Unterstützungsträger bei allen interviewten Personen sind die Arbeitsassistenz bzw. ein ähnlicher Dienst (Projekt PRIMA DONNA), das Kollegium bzw. die Vorgesetzten im jeweiligen Betrieb sowie die Eltern und Angehörigen der jungen Menschen. Alle leisten dabei Unterstützung unterschiedlicher Art und Ausprägung. So wurde von den jungen Menschen bzgl. der Arbeitsassistenz vor allem eine Hilfestellung bei der Arbeitsplatzsuche bzw. eine Einarbeitung durch einen JobCoach sowie Hilfe bei Bedarf erwähnt. Eine typisch pädagogische Unterstützung wie Angebote zur Weiterbildung, Ausbildung von Schlüsselqualifikationen, Arbeitsplatzanpassung an die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen oder eine Entwicklung der jungen Menschen bzgl. des Empowerment-Konzeptes wurde von den wenigsten Befragten erwähnt. Wenn eine erhöhte Selbstständigkeit seitens der Befragten bei sich festgestellt worden ist, resultierte diese zumeist nicht aus einer konkreten Schulung diesbezüglich, sondern eher aus den allgemeinen Arbeitserfahrungen, welche die jungen Menschen gemacht haben. Dies könnte zum einen daran liegen, dass die Zielgruppe dieser Diplomarbeit über pädagogische Unterstützung per se zu wenig Bescheid bzw. sie zu wenig zu schätzen weiß und deshalb nicht als erwähnenswert empfindet. Zum anderen könnte es, in Anbetracht der Tatsache, dass nach einigen dieser Leistungen durch den Interviewer dezidiert gefragt wurde, daran liegen, dass diese Form der Unterstützung auch von LeistungserbringerInnenseite als nicht so entscheidend angesehen wird, wie eine konkrete Suche nach potentiellen Arbeitsplätzen.
Seitens der Unterstützung durch das Kollegium bzw. die Vorgesetzten der jungen Menschen scheint eine Hilfe bei Bedarf bzgl. beruflicher Fragen gegeben. Allerdings mangelt es hier an der sozialen Komponente der Unterstützung. Sobald es um eine soziale Teilhabe der jungen Menschen geht, lassen die Unterstützungsmaßnahmen seitens der Kolleginnen und Kollegen bzw. der Vorgesetzten zumeist nach. Dadurch werden die befragten Personen zwar zumeist als Arbeitskräfte und Kollegen bzw. Kolleginnen akzeptiert, im privaten Bereich jedoch scheinen sich kaum Kontakte zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit und ohne Behinderung zu entwickeln. So geht es bspw. bei den meisten ihrer Gespräche rein ums Berufliche.
Die Unterstützung durch die Angehörigen der Befragten wird von diesen ebenfalls als sehr wichtig beurteilt. Dabei leisten die Eltern vor allem instrumentelle und materielle sowie emotionale Unterstützung. Sie bieten ihren Kindern ein Zuhause, fahren sie mit dem Auto zur Arbeit und motivieren sie.
Geht es nach den Interviewten, benötigt kaum jemand von ihnen zusätzliche Unterstützung, egal, ob sie nun Arbeit hatten oder zur Zeit der Befragung arbeitslos waren. Allerdings könnte es möglich sein, dass es der Zielgruppe dieser Diplomarbeit oft nur schwer möglich ist, ihren realen Unterstützungsbedarf einzuschätzen, wie dies auch schon in der Diskussion der Ergebnisse (vgl. Kapitel 10.4) angeklungen ist. In dieser Hinsicht ist zunächst zu fragen, was gute Unterstützung eigentlich bedeutet? Was genau brauchen die jungen Menschen, welche für diese Diplomarbeit befragt wurden? Die Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung scheint vor allem Unterstützungsleistungen zu benötigen, welche individuell und langfristig angelegt sind und sich an den tatsächlichen Bedarfen der einzelnen Personen orientieren. Eine solche Unterstützung, welche den Grundsätzen der Unterstützten Beschäftigung entsprechen würde (vgl. Ginnold 2000, S. 158f.; Doose 2007, S. 116f.) [41], scheint jedoch derzeit in Österreich vielfach noch zu fehlen. Wenn man bspw. an die Aussagen der jungen Menschen denkt, welche die bedarfsweise telefonische Unterstützung seitens der Arbeitsassistenz betreffen, gilt es zu überdenken, ob eine solche Form der Hilfestellung, welche zwar aufgrund der derzeitigen politischen und finanziellen Rahmenbedingungen oft kaum anders realisierbar scheint, für die Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung zielführend ist. Hier scheinen neue zukunftsorientierte Konzepte von Nöten.
Aus den Aussagen der Interviewten kann folgender zusätzlicher Unterstützungsbedarf festgestellt werden:
-
Besonders in der Anfangsphase eines neuen Arbeitsverhältnisses scheint massiver Unterstützungsbedarf zu bestehen. Die oftmalig angebotene Hilfe auf Abruf seitens der unterstützenden und eingliedernden Dienste wie der Arbeitsassistenz dürfte diesen Bedarf jedoch nicht decken können. Gerade Menschen mit Lernbehinderung bedürfen oft langfristiger Anleitung und Erklärung, sodass eine ein bis zwei Tage dauernde Einweisung durch einen JobCoach, wie sie im Falle der zehn befragten Personen oftmals erfolgt ist, nicht ausreichen dürfte. Hier wäre es vielleicht überlegenswert, ob es nicht eine gesetzliche Neuregelung oder zumindest Empfehlung für eine bedarfsorientierte und individuell angelegte Unterstützung und Einarbeitung für Menschen mit Lernbehinderung geben sollte, welche durch die Maßnahme der Arbeitsassistenz beraten und begleitet werden. Eine solche könnte bspw. auf der Grundlage neuer Finanzierungsansätze wie des Persönlichen Budgets (vgl. Wacker / Wansing / Schäfers 2005) oder des Perfomance-Based Funding (vgl. O'Brien / Revell 2007) realisiert werden. Zur Bedarfsanalyse wäre zusätzlich die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung geeignet, deren Wirksamkeit im englischsprachigen Raum bereits durch zahlreiche Studien dokumentiert ist (vgl. Koenig 2008). Dies würde eine massive Erhöhung der damit verbundenen Kosten verhindern und könnte die Nachhaltigkeit der Vermittlung sehr positiv beeinflussen und deshalb auf lange Sicht sogar Kosten für Arbeitslosigkeit, Umschulung und Eingliederung reduzieren.
-
Auch die weitere Verankerung des MentorInnensystems innerhalb von Unternehmen sollte forciert werden, da dieses nicht nur positive Auswirkungen auf die fachliche Einarbeitung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kann, sondern auch auf deren soziale Teilhabe. Auch hier könnte zumindest eine Empfehlung durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ausgesprochen werden, zumal dieses nun eben nicht nur den Sozialbereich, sondern seit kurzem auch den Bereich Arbeit vereint. Auch eine weiter ausgebaute finanzielle Förderung solcher MentorInnensysteme dürfte hier Abhilfe schaffen. Dies jedoch ist wieder eine Frage der Finanzierung.
-
Auf Seiten der Angehörigen wäre eine zusätzliche Vernetzung zwischen diesen und den Arbeit gebenden Unternehmen wünschenswert. Eine solche könnte nämlich dazu führen, dass Angehörige einige wertvolle Dienste übernehmen, welche nun durch unterstützende Stellen wie die Arbeitsassistenz geleistet werden. Dadurch könnten diese Stellen entlastet werden und die Angehörigen, welche ihre Kinder zumeist am besten kennen, könnten einen wesentlich stärkeren Beitrag zur beruflichen Teilhabe ihrer Kinder leisten. Hierzu wäre es seitens der Forschung notwendig, Konzepte zu entwickeln und diese unter Mithilfe von Praktikerinnen und Praktikern zu testen, damit eine solche verstärkte Einbindung der Angehörigenseite nicht zu einer zusätzlichen Abhängigkeit bzw. einem verzögerten Abnabelungsprozess führt, was zweifelsfrei eine Gefahr einer solchen Vernetzung darstellen würde. Ein erfolgreiches Beispiel für eine solche Vernetzung stellt das im Bundesland Vorarlberg realisierte Projekt "SPAGAT" dar, bei welchem Familien einen Vertrag unterzeichnen und sich somit zur aktiven Mitarbeit an den Zielen des Projektes zum Wohle ihrer Angehörigen mit Behinderung verpflichten müssen (vgl. Koenig 2008, S. 79).
Die zehn interviewten Personen konnten allgemein auf die Frage nach der Geschlechtsspezifik im Unterstützungsbedarf kaum Antworten geben, was auf ein wenig ausgeprägtes Verständnis von geschlechtsspezifischen Angelegenheiten schließen lässt. Vielfach scheinen es die jungen Menschen nicht gewohnt zu sein, nach ihrem Geschlecht gefragt zu werden. Dies bestätigt die Ausführungen zahlreicher Vorarbeiten zur Geschlechtlichkeit von Menschen mit Behinderung (vgl. Kapitel 4.3.1 im Theorieteil dieser Arbeit). Als einzig wirklich unterschiedlichen Unterstützungsbedarf nennen einige junge Frauen, dass sie Hilfe bei körperlich schweren Arbeiten benötigen. Eine junge Frau sagte zusätzlich aus, dass in ihrem Fall mehr Unterstützung in der Anfangsphase in ihrem neuen Job nötig gewesen wäre.
In welcher Form zusätzliche geschlechtsspezifische Unterstützungsleistungen nun generell für junge Männer bzw. junge Frauen mit Lernbehinderung konkret aussehen könnten, kam aus den Interviews nicht heraus, was zum einen an der Zielgruppe, zum anderen am Forschungsdesign liegen könnte. Die Fragestellung nach der Geschlechtsspezifik stand nicht im Fokus dieser Diplomarbeit, sondern sollte am Rande der eigentlichen Untersuchung nach Möglichkeit beantwortet werden. Ein anderes Design, in welchem je gleich viele Männer und Frauen mit Behinderung in vergleichsweise ähnlichen Beschäftigungssituationen befragt werden, verbunden mit einer zuvor erfolgten Aufklärung bzgl. der Thematik der Geschlechtsspezifik, könnte hier vermutlich zu anderen, aussagekräftigeren Ergebnissen führen. Darüber hinaus muss auch in dieser Hinsicht der Grundsatz der Individualität der Unterstützungsbedarfe und entsprechenden -leistungen gelten. Eine pauschalisierte Aussage über geschlechtsspezifische Bedarfe scheint im Hinblick darauf ohnehin riskant.
Empfehlenswert scheint jedoch aufgrund der Ergebnisse dieser Diplomarbeit, dass im Rahmen von berufsorientierenden Maßnahmen noch mehr Bedacht als bisher darauf gelegt wird, den jungen Menschen, besonders den jungen Frauen geschlechtsuntypische Berufe zu vermitteln, um ihnen so die Möglichkeiten zu geben, neue Branchen zu entdecken und ein breiteres Berufsspektrum zu erlangen. Das könnte ihre Chancen erhöhen, einen Arbeitsplatz zu finden. Darauf weist auch ein aktueller Gender-Bericht des Bundessozialamts Oberösterreich in seinen abschließenden Empfehlungen hin (vgl. Auinger / Gütlinger 2009, S. 87f.).
Darüber hinaus wäre eine erhöhte Netzwerkbildung von Frauen mit Behinderung günstig, wie es Niehaus (vgl. 2001) forderte, um geschlechtsspezifische berufliche Probleme besprechen und lösen zu können. In diesem Fall wäre eine zentrale Anlaufstelle in jedem Bundesland eine Möglichkeit, diese Forderungen zu erfüllen. Eine solche könnte sich am Beispiel der Koordinationsstelle des BASB, AMS und FSW orientieren und wäre für die beruflichen Belange von Frauen mit Behinderung zuständig. Dazu könnten bspw. Information und Beratung in Aus- und Weiterbildungs-, Umschulungs-, aber auch in rechtlichen Fragen und Soforthilfe in Krisenfällen zählen. Die finanziellen Mittel für eine solche zentrale Beratungs- und Koordinationsstelle könnten z.B. vom Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst sowie aus dem Etat des Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kommen, welches in seinem "Bundesweiten arbeitsmarktpolitischen Behindertenprogramm 2008 und 2009" explizit Maßnahmen für vor allem sinnesbehinderte Frauen (vgl. BMSK 2008, S. 11) bzw. zur "Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern" (ebd., S. 11f.) vorschlägt.
Die Fragestellungen der vorliegenden Diplomarbeit konnten beantwortet werden, obwohl manchmal gewisse Verständnisschwierigkeiten seitens der jungen Befragten mit Lernbehinderung zu erkennen sind, welche sich an der Qualität der gegebenen Antworten zeigt. Besonders der Bereich der Geschlechtsspezifik scheint den jungen Menschen Schwierigkeiten bereitet zu haben. Hier wäre sicherlich eine vermehrte Aufklärungsanstrengung seitens unterschiedlicher Stellen (Schulen, Berufsorientierungs- und -vorbereitungsmaßnahmen wie Clearing, etc.) von Nöten. Diese sollten dem sog. Gender Mainstreaming noch mehr Beachtung schenken als bisher. Außerdem wäre es günstig, diese Thematik auch bereits in den ausbildenden Stellen für zukünftige Fachkräfte wie Pädagogische Hochschulen, Fachschulen und Universitäten noch stärker als bisher zu verankern, um so der immer noch vorherrschenden Ansicht, es gäbe drei Geschlechter: Männer, Frauen und Behinderte (vgl. Exner 1997, S. 67) entgegen zu wirken.
Denn (berufliche) Teilhabe von Menschen mit Behinderung kann nur gewährleistet und einer "Exklusionskarriere Behinderung" (Wansing 2005a, S. 99; dies. 2005b, S. 26) vorgebeugt werden, wenn solche personbezogenen Faktoren, wie das Geschlecht, bzw. Umweltfaktoren, wie die notwendigen Unterstützungsressourcen für Menschen mit Behinderung, auch tatsächlich mit deren bestehenden Bedarfen übereinstimmen und diese decken. Obwohl nämlich auch Menschen mit Behinderung aus systemtheoretischer Sicht nie aus der Gesellschaft exkludiert sein können (vgl. Exner 2007, S. 170), werden sie nach wie vor in vielen Bereichen, besonders auch im Erwerbsleben benachteiligt und ausgeschlossen. Dies zeigen auch die Ergebnisse der vorliegenden Diplomarbeit. Tatsächliche berufliche Teilhabe haben nur die wenigsten der Befragten erreicht. Um dies zu ermöglichen, muss das Umdenken bei den Unterstützungsleistungen noch weiter als bisher fortschreiten und die Betroffenen müssen noch stärker als Nutzer und Nutzerinnen der neu entstehenden Angebote in den Diskurs mit einbezogen werden.
Dazu bedarf es einiger konkreter Teilschritte, welche zunächst zu realisieren wären. So ist vorerst zu definieren, wie gute Unterstützung für Menschen mit Lernbehinderung aussieht? Diese Frage scheint sich mit den Forderungen der Unterstützten Beschäftigung (vgl. Ginnold 2000; Doose 2007) nach Individualisierung der Unterstützung, nach langfristigen und bedarfsorientierten Leistungen beantworten zu lassen. Zu diesen Ergebnissen gelangt auch diese Diplomarbeit. Weiters wäre zu überdenken, dass optimale Unterstützung nur dann gewährleistet werden kann, wenn die dazu notwendigen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dies auch zulassen. Es bedarf demnach einer Veränderung auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Koenig (2008, S. 82) spricht in diesem Zusammenhang in Anlehnung an eine US-amerikanische Vorarbeit davon, dass "eine positive und wertegeleitete Philosophie auf der Ebene aller relevanter Stakeholder" entstehen müsse. Es muss demnach von Seiten der politisch Verantwortlichen zunächst erkannt werden, dass es überhaupt eines Umdenkens in der österreichischen Unterstützungssystemstruktur bedarf. Betrachtet man die österreichische Gesetzgebung in Hinblick auf die Behindertenhilfe, welche sich als Querschnittsmaterie durch viele Ministerien zieht (vgl. BMASK 2009, S. 4), so wird deutlich, dass diese immer noch mehr dem älteren Konzept der Integration verpflichtet ist als dem neueren Teilhabekonzept. Dies wird auch im aktuellen "Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen in Österreich" deutlich, wenn es als wichtigstes Ziel österreichischer Sozialpolitik verstanden wird,
"benachteiligte Gruppen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen in den offenen Arbeitsmarkt oder in spezielle Einrichtungen spielt dem gemäß eine wichtige Rolle in der Behinderten- und Beschäftigungspolitik" (BMASK 2009, S. 160; Hervorhebung F.S.).
Dem gegenüber stehen bspw. die gesetzlichen Richtlinien, welche im deutschen Sozialgesetzbuch (SGB) IX getroffen wurden:
"Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken" (§ 1 SGB IX; zit. n. BIH 2007, S. 14; Hervorhebung F.S.).
So wären demnach zunächst die notwendigen Anpassungen an aktuelle Konzepte wie das Teilhabekonzept erforderlich, bevor in einem weiteren Schritt die politischen Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße Finanzierung individueller, bedarfsorientierter und langfristiger Unterstützungssysteme festgelegt werden müssten. Wie bereits angeklungen, könnten die im deutschsprachigen, besonders jedoch im österreichischen Raum derzeit noch weitgehend unbekannten bzw. wenig rezensierten Konzepte der Persönlichen Zukunftsplanung, des Persönlichen Budgets und des im US-amerikanischen Raum bereits verbreiteten Perfomance-Based Funding hier Abhilfe schaffen.
So könnte die Persönliche Zukunftsplanung als Ausgangspunkt einer bedarforientierten und individuellen Unterstützungsplanung herangezogen werden. Auch innerhalb der Literatur wird darauf hingewiesen, dass "sich vor allem der methodische Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung ("Person Centered Planning") als effektiver Weg dargestellt hat, Menschen mit Behinderung bei der Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens zu unterstützen" (Koenig 2008, S. 75; runde Klammern i. O.). In Großbritannien wurde sie sogar "als die Methode zum Umbau und zur Ambulantisierung des Hilfesystems für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dargelegt" (ebd.; Hervorhebung i. O.). In Österreich wurde ihre Rolle zumindest bereits in einem Bundesland erkannt und in Vorarlberg in Form des Projekts "SPAGAT" realisiert. Gemeinsam mit dem Land Vorarlberg konnten hier die "optimalen gesetzlichen und finanzielle Rahmenbedingungen" (ebd., S. 79) geschaffen werden, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung nachhaltig zu fördern und zu unterstützen.
"So müssen die Betriebe nur die real erbrachten Leistungen der bei Ihnen kollektivvertraglich beschäftigten Personen übernehmen. Die Differenz wird von der Landesregierung ebenso wie die Leistungseinbußen der MentorInnen dauerhaft und unbürokratisch subventioniert. Zudem bewegen sich die Kosten, laut Angaben des zuständigen Fachbereichsleiters der Vorarlberger Landesregierung - Hermann Böckle - nicht über denen einer vergleichbaren und weit weniger integrativen Unterbringung in einer Beschäftigungswerkstätte" (ebd.).
In diesem Zusammenhang muss demnach die Vorreiterrolle Vorarlbergs bei innovativen Unterstützungs- und Finanzierungssystemen hervorgehoben werden. Durch gut durchdachte politische und finanzielle Rahmenbedingungen können individuelle Unterstützungssysteme (wie bspw. auch das MentorInnensystem) realisiert werden, ohne eine Erhöhung der Kosten befürchten zu müssen.
Einer solchen Kostenerhöhung kann aber bspw. auch durch andere Finanzierungskonzepte, wie dem Persönliche Budget (vgl. hierzu Wacker / Wansing / Schäfers 2005; Lelgemann 2009) oder dem Performance-Based Funding (vgl. hierzu O'Brien / Revell 2007), vorgebeugt werden. Beide Konzepte stellen innovative Möglichkeiten der Finanzierung von sozialen Leistungen dar.
Lelgemann (2009, S. 75) sieht das Persönliche Budget nicht als "neue oder zusätzliche Finanzierungsquelle", sondern als "ein neues Instrument der Sozialverwaltung" (ebd.), mit welchem "eine höhere Stimmigkeit der Unterstützungen und Hilfen bezogen auf die individuelle Lebenssituation der betroffenen Menschen" (ebd.) erreicht werden kann. Mit Hilfe des Konzeptes des Persönlichen Budgets soll es möglich sein, individuelle Unterstützung für Menschen mit Behinderung bei gleichzeitig erhöhter Selbstbestimmung zu ermöglichen, ohne jedoch die dazu notwendigen Kosten zu erhöhen. Der Autor verweist in dieser Hinsicht auf Erfahrungen aus den Niederlanden (vgl. ebd., S. 76).
Auch der Ansatz des Performance-Based Funding scheint sowohl in Hinblick auf die Individualisierung der Unterstützung, aber auch hinsichtlich einer Vermeidung erhöhter Kosten, Erfolg versprechend zu sein. Im Gegensatz zu einem "hour-based purchase-of-service approach" (O'Brien / Revell 2007, S. 305), also einer stundenbezogenen Unterstützungsfinanzierung, sehen die Autoren den Fokus des Performance-Based Funding nicht auf dem Unterstützungsprozess, sondern auf dem Ergebnis dieses Prozesses. Dies geschieht in der Vernetzung von Zahlungen mit dem Erbringen und Erreichen von zuvor definierten Leistungen und Zielen (vgl. ebd., S. 308). Dadurch und durch die Tatsache, dass die betroffenen Menschen mit Behinderung selbst entscheiden müssen, ob die vorgegebenen Ziele erreicht wurden und somit eine Zahlung fällig ist, kommt es zu einer Verschiebung des Machtverhältnisses und zu einer Erweiterung der Entscheidungsgewalt der Betroffenen. Koenig (2008, S. 82) spricht von einer "Aufwertung der Rolle der KundInnen", O'Brien / Revell (2007, S. 310) drücken dies folgender maßen aus: "The final requirement - that the job meet [sic!] the goal in the career plan - puts the individual with disabilities in the driver's seat like never before."
Die kurzen Darstellungen der drei zukunftsrelevanten Unterstützungs- und Finanzierungskonzepte zeigen, dass auch in Österreich eine individuelle, langfristige und bedarfsorientierte Unterstützung für Menschen mit (Lern-)Behinderung zur Erlangungen deren Teilhabe am Erwerbsleben möglich wäre, wenn nur die dafür notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen würden. Eine damit einhergehende Kostenerhöhung ist nicht zu befürchten, wenn die Unterstützung nur genau genug geplant und die erforderlichen politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen erfolgen.
[41] Die historische Entwicklung sowie die genauen Grundsätze des Konzepts des "Supported Employment" werden hier aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Diplomarbeit nicht dargestellt. Außerdem wurden diese in der Literatur bereits ausführlich beschrieben (vgl. hierzu zusätzlich bspw. Barlsen / Hohmeier 2001; sowie vor allem die Texte von Stefan Doose: ebd. 2003; ebd. 2004). Auch Wehman / Bricout (o. J.) stellen in ihrer Onlineveröffentlichung die Geschichte des Supported Employment in Form eines Zeitstrahls sehr übersichtlich dar.
Albrecht, Ingrid (2007): Das doppelte Gesicht der Nachhaltigkeit - kritische Diskussion aktueller Entwicklungen. In: Baudisch, Wilfried / Albrecht, Ingrid / Stiller, Jens (Hrsg.) (2007): Von sozialer Ausgrenzung zu selbstbestimmter Teilhabe - Möglichkeiten und Grenzen ganzheitlicher Förderung. Berlin: Lit Verlag, S. 47-54.
Arnade, Sigrun (2000): Schlusslicht auf dem Arbeitsmarkt. Die berufliche Situation behinderter Frauen. In: impulse (2000) Nr. 15. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp15-00-frauen.html [Stand: 13.11.2008].
Auinger, Margit / Gütlinger, Eva (2009): Projektstudie Gender-Mainstreaming. Analyse der bestehenden Maßnahmen des Bundessozialamtes Oberösterreich und Erarbeitung von Maßnahmenrichtlinien zur Optimierung für die bessere Integration von Mädchen und Burschen (13 - 24) mit sozialen, körperlichen und begabungsmäßigen Benachteilungen. Linz.
Barlsen, Jörg / Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderung. Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation - Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
Barton, Len (2008): From Exclusion to Inclusion: Barriers and Possibilities in Relation to Disabled Learner. Paper presented at the Erasmus Mundus Conference in Prague from 13th - 16th March 2008. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/barton-inclusion.dbk [Stand: 7. 6. 2009].
Baudisch, Wilfried / Albrecht, Ingrid / Stiller, Jens (Hrsg.) (2007): Von sozialer Ausgrenzung zu selbstbestimmter Teilhabe - Möglichkeiten und Grenzen ganzheitlicher Förderung. Berlin: Lit Verlag.
Beck, Iris (2003): Lebenslagen im Erwachsenenalter angesichts behindernder Bedingungen. In: Leonhardt, A. / Wember, F.B. (Hrsg.) (2003): Grundfragen der Sozialpädagogik. Bildung - Erziehung - Behinderung. Basel, Berlin, Weinheim: Beltz-Verlag, S. 848-875.
Beckmann, Franziska (2005): Arbeit als Glücksquelle? - Arbeitszufriedenheit und Lebensqualität. Eine Sekundäranalyse des Eurobarometer 56.1.. Wien: Universität, Diplomarbeit.
Beisteiner, Karin (1997): Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten für geistigbehinderte Menschen. Wien: Universität, Diplomarbeit.
Bieker, Rudolf (Hrsg.) (2005a): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer.
Bieker, Rudolf (2005b): Individuelle Funktionen und Potentiale der Arbeitsintegration. In: Bieker, Rudolf (Hrsg.) (2005a): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 12-24.
Biewer, Gottfried (2009): Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
Born, Claudia (1998): Bildung und Beruf - für Männer und Frauen gleiche Kategorien? In: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) (Hrsg.) (1998): Was prägt Berufsbiographien? Lebenslaufdynamik und Institutionenpolitik. Nürnberg, S. 89-105.
Bruner, Claudia Franziska (2000): Die Herstellung von Behinderung und Geschlecht. Sozialisations- und Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen mit (Körper-) Behinderungen. In: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung, Heft 2, o. S. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-00-geschlecht.html [Stand: 23.11.2008].
Buchner, Tobias (2008):Das qualitative Interview mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung - Ethische, methodologische und praktische Aspekte. In: Biewer, Gottfried et al. (Hrsg.) (2008): Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 516-528.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) (2007): Sozialgesetzbuch (SGB) IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Karlsruhe.
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGStG): online im www unter URL: http://www.bizeps.or.at/gleichstellung/rechte/bgstg.php [Stand: 28.01.2009].
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) (2009): Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderung in Österreich 2008. Wien. Online im www unter URL: http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/7/1/3/CH0009/CMS1223469809237/behindertenbericht_09-03-17.pdf [Stand: 23.03.2009].
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) (2003): Bericht der Bundesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Österreich. Wien.
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) (2004): Maßnahmen für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen - Evaluierung, Analyse, Zukunftsperspektiven. Wien. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/bmsg-jugendliche.html [Stand: 10.09.2008].
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) (2006): Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG). Wien. Online im www unter URL: http://www.salzburg.gv.at/beinstg2006.pdf [Stand: 02.03.2009].
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK) (2008): Bundesweites arbeitsmarktpolitisches Behindertenprogramm (BABE) 2008 und 2009. Wien.
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) (2009): Berufsausbildungsgesetz. Berufsausbildung in Österreich. Wien. Online im www unter URL: http://www.bmwfj.gv.at/NR/rdonlyres/2C1A388A-D81D-478E-9441-F0558EB11609/0/Kern_BAG09.pdf [Stand: 12.06.2009].
Bungart, Jörg / Putzke, Susanne (2001): Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozess der betrieblichen Integration. In: Barlsen, Jörg / Hohmeier, Jürgen(Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderung. Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation - Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 111-160.
Cloerkes, Günther (2007): Soziologie der Behinderten: eine Einführung. Heidelberg: Winter, 3., neu bearb. und erw. Auflage.
Daoud-Harms, Mounira (1986): Behinderung und Frauenproblematik. In: Behindertenpädagogik, 25. Jg., Heft 1, S. 64-68. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/daoud_harms-frauen.html [13.11.2008].
Dederich, Markus et al. (Hrsg.) (2006): Inklusion statt Integration? Heilpädagogik als Kulturtechnik. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Degener, Theresia (2003): Eine U.N. - Menschenrechtskonvention für Behinderte als Beitrag zur ethnischen Globalisierung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, o. S.. Online im www unter URL: http://www.netzwerk-artikel-3.de/un-konv/doku/alsbeitrag.pdf [Stand: 8. 6. 2009].
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.) (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Genf.Online im www unter URL: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [Stand: 10. 7. 2008].
Doose, Stefan (2003): Unterstützte Beschäftigung im Kontext von internationalen, europäischen und deutschen Entwicklungen in der Behindertenpolitik. In: Impulse, HEFT 27, S. 3-13. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-kontext.html [Stand: 1. 10. 2008].
Doose, Stefan (2004): Die Phasen der Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung, Integrationsfachdiensten und Arbeitsassistenz in Deutschland. Eine Analyse des Prozesses und des Beitrages des zehnjährigen Wirkens der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB). In: Impulse (2004), Heft 32, S. 3-14. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-entwicklung.html [Stand: 27. 12. 2008].
Doose, Stefan (2007): Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 2. durchgesehene und aktualisierte Auflage.
Ewinkel, Carola et al. (Hrsg.)(2002): Geschlecht: behindert - besonderes Merkmal: Frau. Ein Buch von behinderten Frauen. Neu-Ulm: AG SPAK, 3. Auflage.
Exner, Karsten (1997): Deformierte Identität behinderter Männer und deren emazipatorische Überwindung. In: Warzecha, Birgit (1997): Geschlechterdifferenz in der Sonderpädagogik: Forschung - Praxis - Perspektiven. Hamburg: Lit Verlag, S. 67-87.
Exner, Karsten (2007): Kritik am Integrationsparadigma im ‚Behindertenbereich'. Von der Notwendigkeit soziologischer Theoriebildung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Fasching, Helga (2004a): Qualitätskriterien in der beruflichen Integrationsmaßnahme Arbeitsassistenz. Unter besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen mit Lernbehinderung. Münster: Lit Verlag.
Fasching, Helga (2004b): Problemlagen Jugendlicher mit Behinderungen in Bezug auf die berufliche Integration. In: Sasse, A. / Vitková, M. / Störmer, N. (Hrsg.) (2004): Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 359-372. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/fasching-problemlagen.html [Stand: 21. 3. 2008].
Fasching, Helga (2008): Drinnen oder Draußen? Junge Frauen mit Behinderungen in Ausbildung und Erwerbstätigkeit. In: Behinderte Menschen, Heft 5, S. 42-51.
Fasching, Helga / Niehaus, Mathilde (2004): Berufliche Integration von Jugendlichen mit Behinderungen: Synopse zur Ausgangslage an der Schnittstelle von Schule und Beruf. Online im www unter URL: www.bwpat.de [Stand: 4. 6. 2008].
Feuser, Georg (2001): Arbeit - und Bildung für geistig schwerbehinderte Menschen. In: Jantzen, Wolfgang (Hrsg.) (2001): Jeder Mensch kann lernen - Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-)Pädagogik. Berlin, Neuwied: Luchterhand Verlag, S. 300-323.
Filipp, Sigrun-Heide (Hrsg.) (1981): Kritische Lebensereignisse. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg.
Flick, Uwe / Kardorff, Ernst von / Steinke, Ines (Hrsg.)(2007): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verl., 5. Auflage.
Forcher, Heinz / Schönwiese, Volker (1989): Zur Geschichte der schulischen Integration in Österreich. In: Meister-Steiner et al.(Hrsg.) (1989): Blinder Fleck und rosarote Brille. Behinderung und Integration als Herausforderung für Familie, Kindergarten und Schule. Thaur / Tirol: Österreichischer Kulturverlag. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/wieser-fleck.html [Stand: 24.01.2009].
Gerdes, Tomke Sabine (2004): Der Verbleib nach der Vermittlung durch Integrationsfachdienste in den allgemeinen Arbeitsmarkt: Werdegänge von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Eine Untersuchung zur langfristigen Qualität von Integrationsfachdiensten. In: impulse (2004) Nr. 31, S. 17-23. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp-31-04-gerdes-verbleib.html [Stand: 21. 3. 2008].
Ginnold, Antje (2000): Schulende - Ende der Integration? Integrative Wege von der Schule in das Arbeitsleben. Berlin, Neuwied: Luchterhand Verlag.
Häfeli, Kurt (2005): Erschwerter Berufseinstieg für Jugendliche mit Behinderungen. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (2005), Heft 3, S. 17-21.
Hermes, Gisela / Rohrmann, Eckhard (Hrsg.) (2006): Nichts über uns - ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung. Neu-Ulm: AG Spak.
Hinz, Andreas (2006): Inklusion und Arbeit - wie kann das gehen? In: impulse (2006), Nr. 39, S. 3-12. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp-39-06-hinz-inklusion.html [Stand: 03. 11. 2008].
Hofer, Hansjörg et al. (2006): Behindertengleichstellungsrecht. Kommentar. Wien, Graz: Neuer wissenschaftlicher Verlag.
Hollenweger, Judith (2006): Der Beitrag der Weltgesundheitsorganisation zur Klärung konzeptueller Grundlagen einer inklusiven Pädagogik. In: Dederich, Markus et al. (Hrsg.) (2006): Inklusion statt Integration? Heilpädagogik als Kulturtechnik. Gießen: Psychosozial-Verlag, S.45-61.
Jantzen, Wolfgang (Hrsg.) (2001): Jeder Mensch kann lernen - Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-)Pädagogik. Berlin, Neuwied: Luchterhand Verlag.
Klicpera, Christian / Schabmann, Alfred (1998): Erleben von Berufstätigkeit. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft (1998), Nr. 4/5, Graz: Reha Druck. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-98-erleben.html [Stand: 21. 3. 2008].
Koenig, Oliver (2005): Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung. Dargestellt an einem Vergleich zwischen Integrationsfachdiensten in Deutschland und der Arbeitsassistenz in Österreich. Universität Wien: Diplomarbeit.
Koenig, Oliver (2008): Persönliche Zukunftsplanung und Unterstützte Beschäftigung als Instrumente in institutionellen Veränderungsprozessen. Auch ein Thema für Beschäftigungstherapie-Werkstätten? In: Behinderte Menschen, Heft 5, S. 72-89.
Lawner, Willehad (2005): Assistenz und Unterstützung zwischen Teilhabe und Ausgrenzung - Überlegungen zur Klärung dieser Begriffe aus pädagogischer Sicht und zu deren Relevanz für Menschen, die als behindert bezeichnet werden. In: Behindertenpädagogik (2005), Heft 1, 44. Jg., S. 23-37.
Lawner, Willehad (2006): Pädagogische Unterstützung ist keine Assistenz. In: Orientierung (2006), Heft 3, S. 10-12.
Lelgemann, Reinhard (2009): Ein Leben mit Assistenz gestalten.In: Stein, Roland / Orthmann, Dagmar (Hrsg.) (2009):Basiswissen Sonderpädagogik. Band 5: Lebensgestaltungen bei Behinderungen und Benachteiligungen im Erwachsenenalter und Alter. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 66-87.
Leichsenring, Kai / Strümpel, Charlotte (1997): Berufliche Rehabilitation und soziale Integration - Problembereiche und Entwicklungstendenzen. In: BMAGS (Hrsg.) (1997): Berufliche Integration behinderter Menschen - Innovative Projektbeispiele aus Europa, Schriftenreihe "Soziales Europa", Band 6. Online im www unter URL: http:// bidok.uibk.ac.at/library/leichsenring-beruflicHefthtml [Stand: 06.11.2008].
Lemmerer, Bernadette Johanna (2008): Veränderungen in der persönlichen Entwicklung benachteiligter Jugendlicher durch Eingliederung in den Arbeitsprozess. Wien: Diplomarbeit.
Lilienthal, Ilja / Behncke, Rolf (2004): Qualifizierung am Arbeitsplatz - Kernelement im Konzept der Unterstützten Beschäftigung. In: impulse (2004), Heft 30, S. 3-7. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp30-04-lilienthal-qualifizierung.html [Stand: 11. 6. 2009].
Mayring, Philipp (1996): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim: Psychologieverlags Union, 3. Auflage.
Mayring, Philipp (2007a): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 9. Auflage.
Mayring, Philipp (2007b): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, Uwe / Kardorff, Ernst von / Steinke, Ines(Hrsg.)(2007): Qualitative Forschung. Ein HandbucHeft Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verl., 5. Auflage, S. 468-475.
Mecheril, Paul (2006): Beratung in der Migrationsgesellschaft. Paradigmen einer pädagogischen Handlungsform. In Norbert Cyrus & Andreas Treichler (Hrsg.) (S. 371-387). Soziale Arbeit in der Einwanderungsgesellschaft. Grundlinien, Konzepte, Handlungsfelder, Methoden. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel. Online im www unter URL: http://www.uibk.ac.at/ezwi/mitarbeiterinnen/paul_mecheril/treichler.pdf [Stand: 03.12.2008].
Meister-Steiner et al. (Hrsg.) (1989): Blinder Fleck und rosarote Brille. Behinderung und Integration als Herausforderung für Familie, Kindergarten und Schule. Thaur / Tirol: Österreichischer Kulturverlag. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/wieser-fleck.html [Stand: 24.01.2009].
Mertens, Dieter (1974): Schlüsselqualifikationen. In: MittAB, 7. Jg., S. 36-43. Online im www unter URL: http://doku.iab.de/mittab/1974/1974_1_MittAB-Mertens.pdf [Stand: 10.11.2008].
Metzler, Heidrun / Rauscher, Christine (2003): Teilhabe als Alltagserfahrung. Eine ergebnisorientierte Perspektive in der Qualitätsdiskussion. In: Geistige Behinderung 3 / 03, 42. Jg., S. 235-243.
Niehaus, Mathilde (1997): Barrieren gegen die Beschäftigung langfristig arbeitsloser Behinderter. In: Niehaus, Mathilde / Montada, Leo (Hrsg.) (1997): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Wege aus dem Abseits. Frankfurt / Main, New York: Campus Verlag, S. 28-53.
Niehaus, Mathilde (2001): Netzwerkarbeit von und für Frauen mit Behinderung. Ein Plädoyer. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 1. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-01-niehaus-netzwerkarbeit.html [Stand: 27.6.2009].
Niehaus, Mathilde (2007): Arbeiten unter erschwerten Bedingungen - Frauen mit Behinderung. In: Cloerkes, Günther / Kastl, Jörg Michael (Hrsg.) (2007): Leben und Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Menschen mit Behinderungen im Netz der Institutionen. Heidelberg: Univ. Verl. Winter, Edition S, S. 171-186.
Niehaus, Mathilde / Kurth-Laatsch, Sylvia (2000): Synopse der Evaluationsergebnisse zum Modellprojekt "Wohnortnahe berufliche Rehabilitation von Frauen". Universität Oldenburg / Universität Wien.
Niehaus, Mathilde / Montada, Leo (Hrsg.) (1997): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Wege aus dem Abseits. Frankfurt / Main, New York: Campus Verlag.
O'Brien, Daniel E. / Revell, W. Grant Jr. (2007): Current Trend in Funding Employment Outcomes. In: Wehmann, Paul / Inge, Katherine J. / Revell, W. Grant Jr. / Brooke, Valerie A. (Hrsg.) (2007): Real Work for Real Pay. Inclusive Employment for People with Disabilities. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co., S. 305-322.
Ommerle, Monika (1999): Normalisierungsprinzip und Parteilichkeit als Leitideen in der Behindertenarbeit. Begleitung und Unterstützung körperbehinderter Menschen am Beispiel der Caritas Tagesstätte für schwerst körperbehinderte Erwachsene. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/ommerle-normalisierung.html [Stand: 15. 10.2008].
Plath, Hans-Eberhard / König, Paul / Jungkunst, Maria (1996): Verbleib sowie berufliche und soziale Integration jugendlicher Rehabilitanden nach der beruflichen Erstausbildung: In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2, S. 247-278.
Powell, Justin / Wagner, Sandra (2002): Zur Entwicklung der Überrepräsentanz von Migrantenjugendlichen an Sonderschulen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1991. In: Gemeinsam Leben 10, Heft 2, S. 66-71. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/powell-migranten.html [Stand: 03.12.2008].
Puschke, Martina (2005): Die Internationale Klassifikation von Behinderung der Weltgesundheitsorganisation. In: WeiberZEIT, Ausgabe Nr. 07, S. 4-5. Online im www unter URL:http://bidok.uibk.ac.at/library/wzs-7-05-puschke-klassifikation.html [Stand: 29. 9. 2008].
Puschke, Martina (2006): Gender Aspekte der Disability Studies. In: Hermes, Gisela / Rohrmann, Eckhard (Hrsg.) (2006): Nichts über uns - ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung. Neu-Ulm: AG Spak, S. 50-58.
Rauch, Angela (2005): Behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt. In: Bieker, Rudolf (Hrsg.) (2005a): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 25-43.
Sander, Alfred (2002): Von der integrativen zur inklusiven Bildung. Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland. In: Hausrotter / Boppel / Meschenmoser (Hrsg.): Perspektiven Sonderpädagogischer Förderung in Deutschland. Dokumentation der Nationalen Fachtagung vom 14.-16. Nov. 2001 in Schwerin. Middelfart (DK), European Agency etc., S. 143-146. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/sander-inklusion.html [Stand: 6. 6. 2009].
Sander, Alfred (2006): Interdisziplinarität in einer inklusiven Pädagogik. Vortrag gehalten im Rahmen des ANCE-Symposiums in Luxemburg am 12. Okt. 2006. Online im www unter URL: http://www.ance.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=83:profdr-a-sander-interdisziplinaritaet-in-einer-inklusiven-paedagogik&catid=31:online-dokutheik&Itemid=36 [Stand: 7. 6. 2009].
Schartmann, Dieter (1995): Soziale Integration durch Mentoren. Das Konzept des "Natural Support" als Aktivierung innerbetrieblicher Unterstützungsressourcen in der beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft (1995), Heft 4. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schartmann-mentoren.html [Stand: 30.12.2008].
Schartmann, Dieter (2000): Der Übergang von der Schule in das Erwerbsleben - Möglichkeiten, Chancen und Risiken. In: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung (2000), Heft 1. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-00-chancen.html [Stand: 24.01.2009].
Schildmann, Ulrike (2001): Frauenforschung in der Behindertenpädagogik. In: Sonderpädagogik, 31. Jg., Heft 3, S. 151-160.
Schuchardt, Diana (2000): Frauen mit Behinderung - doppelt benachteiligt?! Ein theoretischer Exkurs und praktische Anregungen. In: Erwachsenenbildung und Behinderung, Heft 1, S. 8-10.
Spiess, Ilka (2004): Berufliche Lebensverläufe und Entwicklungsperspektiven behinderter Personen. Eine Untersuchung über beruflichen Werdegänge von Personen, die aus Werkstätten für behinderte Menschen in der Region Niedersachsen Nordwest ausgeschieden sind. Paderborn: Eusl Verlag.
Stark, Wolfgang (2004): Beratung und Empowerment - empwerment-orientierte Beratung? In: Nestmann, F. / Engel, F. / Sickendiek, Ursel (Hrsg.) (2004): Das Handbuch der Beratung. Band 1. Disziplinen und Zugänge. Tübingen: dgvt Verlag, S. 535-546.
Stecklina, Gerd / Böhnisch, Lothar (2004): Beratung von Männern. In: Nestmann, Frank / Engel, Frank / Sickendiek, Ursel (Hrsg.) (2004): Das Handbuch der Beratung. Band 1. Disziplinen und Zugänge. Tübingen: dgvt Verlag, S. 219-230.
Steingruber, Alfred (2000): Der Behindertenbegriff im österreichischen Recht. Graz: Diplomarbeit. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/steingruber-recht.html [Stand: 1.10.2008].
Steinke, Ines (2007): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, Uwe / Kardorff, Ernst von / Steinke, Ines(Hrsg.)(2007): Qualitative Forschung. Ein HandbucHeft Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verl., 5. Auflage, S. 319-331.
Stöpel, Frank (2005):Bedingungen des Arbeitsmarktes für die berufliche Teilhabe. In: Sonderpädagogik, 35. Jg., Heft 1, S. 18-32.
Theunissen, Georg (2006): Assistenz und Unterstützung. Zwei Schlüsselbegriffe moderner Behindertenarbeit. In: Orientierung, Heft 3, S. 8-10.
Tröster, Heinrich (1996): Einstellungen und Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen. In: Zwierlein, Eduard (Hrsg.) (1996): Handbuch Integration und Ausgrenzung. Behinderte Mitmenschen in der Gesellschaft. Neuwied u.a.: Luchterhand, S.187-195.
United Nationes (2007): Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. Online im www unter URL: http://www.un.org/disabilities/ documents/convention/convoptprot-e.pdf [Stand: 8. 6. 2009].
Wacker, Elisabeth (2005): Selbst Teilhabe bestimmen? In: Wacker, Elisabeth et al.(Hrsg.): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Wacker, Elisabeth et al. (Hrsg.) (2005): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Wacker, Elisabeth / Wansing, Gudrun/Hölscher, Petra (2003): Maß nehmen und Maß halten - in einer Gesellschaft für alle (1). Von der Versorgung zur selbstbestimmten Lebensführung. In: Geistige Behinderung 2003, Heft 2, 42. Jg., S. 108-118.
Wacker, Elisabeth / Wansing, Gudrun / Schäfers, Markus (2005): Personenbezogene Unterstützung und Lebensqualität - Teilhabe mit einem persönlichen Budget. Wiesbaden: DUV.
Wansing, Gudrun (2005a): Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Wansing, Gudrun (2005b): Die Gleichzeitigkeit des gesellschaftlichen »Drinnen« und »Draußen« von Menschen mit Behinderung - oder: zur Paradoxie rehabilitativer Leistungen. In: Wacker, Elisabeth et al. (Hrsg.) (2005): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 21-33.
Wehman, Paul / Bricout, John: Supported Employment: Critical issues and new directions. Online im www unter URL: http://www.worksupport.com/ Main/downloads/article1.pdf [Stand: 27.12.2008].
Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1994): DUDEN. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. Mannheim, Leipzig [u.a]: Dudenverlag.
Homepages erwähnter Organisationen / Projekte:
Berufsförderungsinstitut Österreich (Bfi): http://www.bfi.at [Stand: 16.5.2009].
Koordinationsstelle des Arbeitsmarktservices, Bundessozialamtes und des Fonds Soziales Wien:http://www.koordinationsstelle.at [Stand: 16.5.2009].
Österreichischer Verein für bürospezifische Anlehre und Weiterbildung für Körperbehinderte (OE-VBauWK): http://www.oevbauwk.at [Stand: 16.5.2009].
Projekt PRIMA DONNA des Trägers Jugend am Werk: http://www.jaw.at/typo3/index.php?id=88 [Stand: 16.5.2009].
Verein 0>Handicap: http://www.0handicap.at [Stand: 16.5.2009].
WIFI Österreich: http://www.wifi.at [Stand: 16.5.2009].
Abb. 1. Krankheitsfolgenmodell der ICIDH. In: Steingruber, Alfred (2000): Der Behindertenbegriff im österreichischen Recht. Graz: Diplomarbeit. Online im www unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/steingruber-recht.html [Stand: 1.10.2008].
Abb. 2. Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF. In: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.) (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Genf, S. 23.Online im www unter URL: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [Stand: 10. 7. 2008].
Abb. 3. Formen der beruflichen Teilhabe. In: Stöpel, Frank (2005):Bedingungen des Arbeitsmarktes für die berufliche Teilhabe. In: Sonderpädagogik, 35. Jg., Heft 1, S. 20; bearbeitet durch F.S..
Diese Diplomarbeit geht der Frage nach, wie die beruflichen Teilhabeerfahrungen junger Menschen mit Lernbehinderung drei Jahre nach ihrer Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aussehen. Weiters wird nach den Unterstützungsleistungen, welche die jungen Männer und Frauen tatsächlich erhalten bzw. benötigen würden, gefragt.
Die Literaturrecherche für den theoretischen Teil dieser Diplomarbeit hat ergeben, dass für das Zustandekommen beruflicher Teilhabe von Menschen mit Behinderung viele verschiedene sowohl person-, als auch umweltbezogene Faktoren entscheidend sind. Einen entscheidenden persönlichen Faktor stellt dabei das Geschlecht der Personen dar, den wichtigsten umweltbezogenen Aspekt die Qualität der erhaltenen Unterstützung. Zur Schließung einer bestehenden Forschungslücke betreffend die subjektiven Sichtweisen junger Menschen mit Lernbehinderung, wurden zehn problemzentrierte Interviews mit jungen Männern und Frauen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geführt und nach der Forschungsmethode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass eine tatsächliche berufliche Teilhabe junger Menschen mit Lernbehinderung zumeist nur selten besteht, Formen von Teilhabe jedoch bei vielen zumindest in Teilen realisiert sind. Hinsichtlich des Unterstützungsbedarfs der Zielgruppe zeigte sich die Bedeutung speziell dreier verschiedener Hilfskreise: erstens der Unterstützung durch professionelle Dienste wie der Arbeitsassistenz, zweitens jener durch Kolleginnen und Kollegen und drittens der Hilfe durch Eltern und Angehörige der befragten Personen. Es zeigt sich allerdings auch, dass die Unterstützungsleistungen für die Zielgruppe der Menschen mit Lernbehinderung vor allem individuell, langfristig und bedarfsorientiert sein müssen. Dies scheint in Österreich vielfach aufgrund der bestehenden gesellschaftlichen, politischen und finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht realisierbar. Zukunftsorientierte Konzepte wie die Persönliche Zukunftsplanung, das Persönliche Budget oder der Ansatz des Perfomance-Based Funding könnten Abhilfe schaffen.
This diploma thesis scrutinizes the experiences of inclusion in work of young people with learning disabilities three years after they had found their place with the public labour market. Furthermore, it answers the question which types of support these young people really get and which types they would actually need.
The thorough literature research for the theoretical part of this diploma thesis revealed that many different personal aspects and environmental factors are responsible for the success of inclusion in work of people with disabilities. While a decisive personal aspect could be seen in the sex of the person, the most important environmental factor is the quality of support, people receive. To fill a lack of research concerning the individual points of view of young people with learning disabilities, ten young men and women in Vienna, Lower Austria and the Burgenland were interviewed. The interviews then were evaluated according to Mayring's Qualitative Content Analysis. The results showed that full inclusion in work is hardly ever recieved by young people with learning disabilities, whereas different aspects of it could at least be realized by a couple of them. As far as the measures of support for this target group are concerned the importance of three different circles of supporters could be demonstrated: firstly support offered by professional services like Austrian Job Assistence, secondly cooperative support of workmates and thirdly the help of the young workers' parents and relatives. Analysis also showed that in any case the supporting measures for the target group of people with learning disabilities have to be individual, long-term and focused on the people's actual needs.
In Austria this required form of support in many aspects could not be realized at the moment due to existing social, political and financial basic conditions. Future-orientated concepts like Person-Centered Planning, Personal Budgetting or Perfomance-Based Funding could contribute to compensate this deficit.
Gesprächseinstieg
Vielen Dank, Herr / Frau ..., dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Sie wissen ja bereits, dass wir dieses Gespräch im Rahmen einer Untersuchung durchführen. Wir wollen herausfinden, wie es jungen Frauen und Männern, die vor einigen Jahren gemeinsam mit der Arbeitsassistenz einen Arbeitsplatz gefunden haben, heute geht. Wir wollen auch wissen, welchen Unterstützungsbedarf die jungen Frauen und Männer mit Behinderung haben. Außerdem wollen wir erfahren, welche Art von Hilfen die Betriebe benötigen, damit junge Frauen und Männer mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt teilhaben können. Deshalb befragt meine Kollegin Ihren Arbeitgeber / ihre Arbeitgeberin zu diesem Thema. Das habe ich Ihnen ja schon erzählt und Sie waren damit einverstanden.
Da ich nicht so schnell mitschreiben kann, werde ich das Gespräch auf Tonband aufzeichnen. Die Aufzeichnung brauchen wir später auch für die Auswertung Ihres Interviews. Alles, was Sie sagen, bleibt anonym und deshalb absolut geheim.
Das Interview wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Im Gespräch wird es um Ihre bisherigen und Ihre aktuellen Berufserfahrungen gehen. Außerdem werde ich Sie fragen, wie Sie in Ihrem Betrieb unterstützt werden und ob Sie genug Hilfe bei Ihrer Arbeit bekommen. Ich werde dann noch von Ihnen wissen wollen, ob Sie als Mann / Frau gut in Ihrem Beruf zurecht kommen und wie Sie sich Ihre berufliche Zukunft vorstellen.
Dazu werde ich Ihnen einige Fragen stellen. Ich werde auch versuchen, im Verlauf des Interviews das, was Sie mir erzählen, immer wieder mit meinen Worten zusammenzufassen, um sicherzugehen, dass ich Sie auch richtig verstanden habe.
Wenn Ihnen eine Frage unklar sein sollte, fragen Sie bitte nach! Wichtig ist, dass es kein "richtig" oder "falsch" gibt! Alles, was Sie erzählen bzw. berichten wollen, ist für die Untersuchung wichtig.
Erfahrungen derzeit
-
Wie sehen Ihre derzeitigen beruflichen Erfahrungen aus?
-
Warum sind Sie mit Ihrem Arbeitsplatz (nicht) zufrieden?
-
Für welche Tätigkeiten sind Sie zuständig?
-
Sind diese Arbeiten für Sie angemessen?
-
Warum fühlen Sie sich in Ihrem Betrieb (nicht) wohl?
-
Wie ist Ihr Umgang mit Ihren KollegInnen?
-
Wie ist Ihr Umgang mit Ihren Vorgesetzten?
-
Wie verbringen Sie Ihre Mittagspausen?
-
Worüber reden Sie mit Ihren KollegInnen und Vorgesetzten?
-
Sind Sie bei Betriebsversammlungen und Betriebsausflügen dabei?
-
Hatten Sie schon einmal ein persönliches Gespräch bzgl. Ihrer Arbeit mit einem/r Vorgesetzten?
-
Haben Sie irgendwelche Probleme in Ihrem Beruf?
Unterstützungsmaßnahmen
-
Wie lange haben Sie sich mit Ihrem Berater od. Ihrer Beraterin von der Arbeitsassistenz XY getroffen?
-
Welche Erwartungen hatten Sie an die Arbeitsassistenz?
-
Wurden diese Erwartungen erfüllt?
-
Wie wurden Sie von der Arbeitsassistenz unterstützt?
-
Stichwort: Berufssuche
-
Stichwort: Anfangs- / Einarbeitungszeit
-
Stichwort: Nachbetreuung
-
Stichwort: Schwierigkeiten außerhalb der Arbeit (familiär, Wohnungssuche, ...)
-
Wie hat Ihnen die Arbeitsassistenz bzgl. Ihrer persönlichen / beruflichen Entwicklung weitergeholfen?
-
Stichwort: Persönlichkeitsentwicklung (bspw. Schlüsselqualifikationen)
-
Stichwort: Schulungen / Weiterbildung
-
Stichwort: außerberufliche Entwicklung
-
Warum sind Sie mit den Tätigkeiten der Arbeitsassistenz (nicht) zufrieden (gewesen)?
-
Hätten Sie sich mehr von der Arbeitsassistenz gewünscht?
Wenn ja:
-
Was hätten Sie sich an zusätzlicher Unterstützung gewünscht?
(mehr Zeit, mehr Engagement, spezielle Unterstützungsmaßnahmen, ...?)
-
Bekommen Sie von Seiten Ihres Betriebes irgendeine Unterstützung?
-
Stichwort: offizielle MentorIn / fixe Ansprechperson im Betrieb
-
Stichwort: Hilfe durch KollegInnen, Vorgesetzte
-
Wen können Sie um Hilfe bitten?
-
Stichwort: Besondere Vereinbarungen mit Betrieb
(kürzere oder flexiblere Arbeitszeit, mehr Urlaubstage, ...?)
-
Wie werden Sie von Ihrer Familie oder Ihren Freunden unterstützt?
-
Bekommen Sie genügend Unterstützung im Beruf?
Wenn nein:
-
Was fehlt Ihnen?
-
Was könnte besser sein?
-
Von wem würden Sie sich mehr Unterstützung erwarten?
Geschlechtsspezifische Fragen
-
Haben Sie als Mann / Frau schon einmal Probleme an Ihrem Arbeitsplatz gehabt?
-
Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz nicht bekommen haben, weil Sie ein Mann / eine Frau sind?
-
Wie verhalten sich Ihre KollegInnen gegenüber Ihnen als Mann / Frau?
(Stichwort: Respekt / Anerkennung / ev. spezielle Unterstützung etc.)
-
Was denken Ihre KollegInnen darüber, dass Sie als Mann / Frau in diesem Beruf arbeiten?
-
Zu welchen KollegInnen habe Sie ein besseres Verhältnis: den Männern oder den Frauen?
-
Mit wem verbringen Sie lieber Ihre Mittagspausen?
-
Mit wem sprechen Sie lieber?
-
Wen fragen Sie lieber um Hilfe?
Zukunft
-
Wie hat sich Ihr Leben durch die Arbeit verändert?
-
Haben Sie schon einmal Verbesserungsvorschläge in Ihrer Arbeit eingebracht?
-
Wie sehen Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten im Betrieb aus?
-
Wie sehen Ihre Aufstiegschancen im Betrieb aus?
-
Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor?
-
Möchten Sie weiterhin in diesem Beruf arbeiten?
Wenn nein:
-
Welchen anderen Beruf möchten Sie gerne ergreifen?
-
Warum möchten Sie den Beruf wechseln?
Gibt es noch etwas, was Sie mir gerne erzählen möchten?
Inhaltsverzeichnis
Als dritte relevante Unterstützungskategorie sei hier die rechtliche Unterstützung durch Gesetze und Verordnungen zum Schutz behinderter Menschen vor Diskriminierung genannt. Diese betrifft sowohl die Männer und Frauen mit Behinderung selbst, als auch ihre Arbeit gebenden Betriebe. Auf beiden Seiten herrschen diesbzgl. häufig große Informationsmängel, welche nicht selten zu einer Be- oder Verhinderung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung führen (vgl. Kapitel Teilhabe!). Die beiden für den Kontext dieser Arbeit wichtigsten Gesetze in Österreich sind das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGStG) und das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), welche beide mit dem 1.1.2006 in Kraft getreten sind. Als deren Grundlage ist der allgemeine Gleichheitsgrundsatz in der österreichischen Verfassung anzusehen, welcher seit dem Jahr 1997 wie folgt lautet:
"Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. [...] Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten" (BGBl. I Nr. 87/1997; zit. n. Hofer et al. 2006, S. 16; Klammern i. O.).
Dieser Artikel der österreichischen Verfassung garantiert allen österreichischen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern zunächst Rechtsgleichheit. Diese wurde 1997 in Bezug auf Menschen mit Behinderung zu einer Gleichbehandlung ausgeweitet, welche sich gegen die Diskriminierung dieser Personengruppe richten sollte. Dieses grundlegende Diskriminierungsverbot gilt im Gegensatz zu allgemeinen Gleichheitsgrundsatz jedoch nicht nur für Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, sondern für alle behinderten Frauen und Männer, unabhängig von ihrer Staatszugehörigkeit (vgl. Hofer et al. 2006, S. 16).
"Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern und damit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen" (§ 1 BGStG).
Mit dem BGStG bekennt sich die österreichische Bundesregierung einmal mehr zur internationalen Bestrebung, für Menschen mit Behinderung gesellschaftliche Teilhabe und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen und folgt somit der ICF, welche eine ebensolche Teilhabe auf der Grundlage der Konstellation Körper - Aktivität - Partizipation postuliert. "Die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft setzt oft aktive Maßnahmen voraus, die es den Betroffenen erst ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben voll teil zu haben" (Hofer et al. 2006, S. 31; Hervorhebung i. O.). Die Rahmenbedingungen für die Gewährung ebensolcher Maßnahmen werden durch das BGStG gewährleistet.
Darüber hinaus wird innerhalb dieses Bundesgesetzes ein Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behinderung erlassen (vgl. §§ 4 und 5 BGStG), welches diese Personengruppe sowie ihre Eltern, betreuenden Angehörigen und Ehe- oder Lebenspartner sowohl vor unmittelbarer, als auch vor mittelbarer Diskriminierung[42] schützen soll. Auch Belästigungen in Form unangebrachter, anstößiger und entwürdigender Äußerungen oder Handlungen fallen nach dem BGStG unter den Tatbestand der Diskriminierung und sind somit verboten.
Es geht in diesem Bundesgesetz demnach um das Verbot allgemeiner Diskriminierungen, unabhängig davon, ob diese durch Wort, Tat oder gegebene Bedingungen zustande kommen. Außerdem wird der Begriff der "Barrierefreiheit" für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes definiert (vgl. § 6 Abs. 5 BGStG).
Barrierefrei sind demnach
"bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind" (§ 6 Abs. 5 BGStG).
Dadurch, dass bspw. bauliche Barrieren als mittelbare Diskriminierung behinderter Menschen angesehen werden (vgl. Hofer et al. 2006, S. 54), wurde durch das BGStG eine rechtliche Grundlage für die Beseitigung ebensolcher Hürden geschaffen. Obwohl es auch Inhalt dieses Bundesgesetz ist, dass für bauliche Veränderungen öffentlicher Infrastruktur gewisse Übergangsfristen (teilweise bis ins Jahr 2015, je nach Höhe der daraus entstehenden Kosten) gewährt werden, ist dennoch durch das Gesetz ein Grundstein für eine barrierefreie Infrastruktur in Österreich gelegt worden.
Das BGStG regelt in Anbetracht der hier dargestellten Paragraphen den juristischen Umgang mit Diskriminierungen im Alltag von Menschen mit Behinderungen. Arbeitsrechtliche Benachteiligungen werden von diesem Bundesgesetz jedoch ausdrücklich ausgespart (vgl. § 2 Abs. 3 BGStG). Dafür ist ein eigenes Gesetzeswerk zuständig: das Bundesbehinderteneinstellungsgesetz.
Das BEinstG stellt ein Gesetz zur "möglichst weitgehende[n] Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in das Erwerbsleben [dar], wobei dem Gesetz eine unmissverständliche Präferenz für die Integration auf den offenen Arbeitsmarkt zu entnehmen ist" (Hofer et al. 2006, S. 103; Hervorhebungen i. O.). Es umfasst auf der einen Seite eine neue Definitionskategorie von Behinderung, nämlich "begünstigte Behinderte" (§ 2 BEinstG; zit. n. BMSG 2006, S. 8)[43], auf der anderen Seite eine Beschäftigungspflicht für eben solche begünstigte Behinderte und darüber hinaus ein auf die Arbeitswelt bezogenes Diskriminierungsverbot von Männern und Frauen mit Behinderung. Außerdem werden in diesem Gesetz Förderungen und der erhöhte Kündigungsschutz für behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geregelt.
Das BEinstG verpflichtet Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wie bereits erwähnt, dazu eine gewisse Zahl an begünstigten Behinderten in ihrem Betrieb zu beschäftigen. So wird durch dieses Bundesgesetz bestimmt, dass ein Unternehmen pro 25 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer eine(n) begünstigte(n) Behinderte(n) einzustellen hat (vgl. § 1 BEinstG; zit. n. BMSG 2006, S. 8). Erfüllt ein Unternehmen diese Einstellungspflicht nicht, so ist es dazu verpflichtet für jede(n) nicht beschäftigte(n) begünstigte(n) Behinderte(n) einen gewissen Betrag quasi als Strafzahlung in den sog. Ausgleichstaxfonds einzuzahlen, dessen Verwendung ebenfalls innerhalb dieses Gesetzeswerks geregelt ist (vgl. § 10a BEinstG; zit. n. ebd., S. 41-47). Mithilfe dieses Fonds können Förderungen und Unterstützungsleistung für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung gewährleistet werden.
Die Pflichtzahl der zu beschäftigenden Menschen mit Behinderung (begünstigte Behinderte) errechnet sich nach der Gesamtzahl aller Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, welche ein Unternehmen innerhalb des Bundesgebietes beschäftigt, ausgenommen der begünstigten Behinderten (vgl. § 4 Abs. 2 und 3 BEinstG; zit. n. ebd., S. 11). Unter gewissen Umständen können jedoch behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dennoch zur Bestimmung der Pflichtquote herangezogen werden. So werden nämlich u. a. blinde Menschen sowie Menschen, welche auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen sind, junge Menschen bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem abgeschlossenen 55. Lebensjahr doppelt angerechnet (vgl. § 5 Abs. 2 und 3 BEinstG; zit. n. ebd., S. 11f.). Das bedeutet, dass Unternehmen, welche bspw. einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin beschäftigen, welche(r) das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, quasi zwei begünstigte Behinderte eingestellt haben, da diese(r) in der Statistik doppeltes Gewicht hat.
Zusätzlich zu dieser Pflichtquote, welche dafür sorgen soll, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, Menschen mit Behinderung einzustellen, unterstützt das BEinstG seine Zielgruppe u. a. auch dadurch, dass es sie vor Diskriminierungen jeglicher Art an ihrem Arbeitsplatz schützt. Dieses Antidiskriminierungsgebot erstreckt sich auf alle Bereiche der Erwerbstätigkeit, von der Begründung eines Dienstverhältnisses, über die Festsetzung des Lohns, die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung sowie zum beruflichen Aufstieg, bis hin zur Beendigung eines Dienstverhältnisses bzw. zum Zugang zu selbstständiger Erwerbstätigkeit (vgl. § 7b BEinstG; zit. n. BMSG 2006, S. 17ff.).
Ebenso wie beim BGStG wurde dieses Diskriminierungsverbot auch auf Eltern, Angehörige sowie Ehe- und Lebenspartner behinderter Menschen ausgedehnt und umfasst sowohl mittelbare, als auch unmittelbare Diskriminierungen sowie Belästigungen jeglicher Art.
Als weiterer, unterstützungsrelevanter Aspekt, welcher durch das BEinstG reguliert wird, ist der erhöhte Kündigungsschutz von begünstigten Behinderten zu nennen.
"Das Dienstverhältnis eines begünstigten Behinderten darf vom Dienstgeber, sofern keine längere Kündigungsfrist einzuhalten ist, nur unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. [...] Die Kündigung eines begünstigten Behinderten (§ 2) darf von einem Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden, wenn der Behindertenausschuss (§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates oder der Personalvertretung [...] sowie nach Anhörung des zur Durchführung des Landes-Behindertengesetzes jeweils zuständigen Amtes der Landesregierung zugestimmt hat; [...] Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Behindertenausschusses ist rechtsunwirksam" (§ 8 BEinstG; zit. n. ebd., S. 33f.; runde Klammern i. O.).
Durch den besonderen Kündigungsschutz in Form der Zustimmungsnotwendigkeit durch den sog. Behindertenausschuss, welcher in jeder Landesstelle des Bundessozialamtes eingerichtet ist und unter anderem aus Vertretern der ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenseite sowie aus Vertretern der organisierten Behinderten und der zuständigen Landesstelle besteht (vgl. § 12 BEinstG; zit. n. BMSG 2006, S. 50-53), sollen behinderungsbedingte und damit diskriminierende Kündigungen verhindert werden.
Dieser besondere Kündigungsschutz hat jedoch nicht nur positive Seiten. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer interpretieren ihn fälschlicher Weise als Unkündbarkeit und stellen deshalb weniger bzw. gar keine begünstigten Behinderten ein aus Angst, sie im Falle des Falles nicht kündigen zu können (vgl. Kapitel 4.1.3). Eben eine solche Unkündbarkeit soll der Kündigungsschutz jedoch gerade nicht sein. "Der Kündigungsschutz soll daher als Korrektiv wirken, der diese Nachteile am Arbeitsmarkt ausgleichen, aber nicht dazu führen soll, den behinderten Menschen unkündbar zu machen" (BMSG 2003, S. 109; BMSK 2008, S. 164).
[42] "Eine unmittelbare Diskriminierung [...] liegt dann vor, wenn eine Person auf Grund einer Behinderung in einer vergleichbaren Situation weniger günstig behandelt wird, [sic!] als eine andere Person (geschieht meist mit Absicht). [...] Eine mittelbare Diskriminierung kann durch scheinbar neutrale Vorschriften (z. B. Hausordnungen, allgemeine Geschäfts- oder Beförderungsbedingungen [...]) auftreten, durch die behinderte Menschen gegenüber anderen Menschen benachteiligt werden. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist die Diskriminierung durch Barrieren jeglicher Art" (Lemmerer 2008, S. 82; runde Klammern i. O.).
[43] "Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind österreichische Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH" (§ 2 BEinstG; zit. n. ebd.). Innerhalb dieses Gesetzes rückt demnach der GdB (Grad der Behinderung) oder Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit als Messwert in den Mittelpunkt. Dieser wird mittels des Rechtsmittels des Bescheides vor allem entweder durch das Bundessozialamt, einen Träger der Unfallversicherung oder das jeweilige Bundesland nach Prüfung aller medizinisch relevanter Befunde und Unterlagen bescheinigt (vgl. § 14 BEinstG; zit. n. ebd., S. 59).
Name: Florian Stangl
Geb.datum: 17.07.1985, Wien
Wohnort: Stützenhofen 77, 2165 Drasenhofen
eMail: florian.stangl@gmx.at
Schulbildung und Berufserfahrung:
1991 - 1995: Volksschule
1995 - 2003: BG / BRG Hollabrunn
01.10.2003 -
30.09.2004: ordentlicher Zivildienst im Johanneshaus Hollabrunn
01.10.2004 -
31. 01. 2005: Lehramtsstudium der Germanistik und Katholischen Theologie
seit SS 2005: Diplomstudium Pädagogik
seit 2005: Besuchsdienst für Menschen mit intellektueller Behinderung
01.07.2005 -
31.08.2005: Ferialjob als Behindertenbetreuer (Tagesbereich; Hollabrunn)
01.07.2006 -
31.08.2006: Ferialjob als Behindertenbetreuer (Wohnbereich; Hollabrunn)
01.11.2006 -
30.03.2009: geringfügig angestellt als Behindertenbetreuer (Wohnbereich; Hollabrunn)
2007 - 2008: Projektmitarbeiter bei der Evaluation des Lehrgangs "Brücken schlagen - von der Schule in den Beruf" im Rahmen eines wissenschaftlichen Praktikums
2008 - 2009: Projektmitarbeiter im Forschungsprojekt "Berufliche Teilhabe junger Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen" der Universität Wien
seit April 09: Behindertenbetreuer (Tagesbereich; Laa / Thaya)
Die Zuordnungstabellen, welche zur Auswertung der durch die Interviews gewonnenen, empirischen Daten herangezogen wurden, sind auf der beiligenden CD-Rom gespeichert und können von dort aus abgerufen werden.
Quelle:
Florian Alexander Stangl: Berufliche Teilhabeerfahrungen junger Menschen mit Lernbehinderung am ersten Arbeitsmarkt
Diplomarbeit an der Universität Wien, Diplomstudium Pädagogik, angestrebter akademischer Grad: Magister der Philosophie (Mag.phil.) Betreuerin: Univ.-Ass. Mag. Dr. Helga Fasching
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 30.01.2012