Behinderung als soziale Konstruktion
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie am Institut für Erziehungswissenschaften der bildungswissenschaftlichen Fakultät der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck. Eingereicht bei: A. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese. Innsbruck, April 2008
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Wissenschaftliche Ausgangspositionen
- 2. Die Betrachtung des Menschen aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive - eine Herausforderung für die Pädagogik
- 3. Wie wird ‚Behinderung' konstruiert? Vom Wandel eines Begriffs und seinen Auswirkungen auf die Bezeichneten.
- 4. Enthinderung der Begegnung - wir alle können lernen
- 5. Abschließende Gedanken
- 6. Literatur
Den Gedankenspuren in dieser Arbeit ging eine Erfahrung voraus. Genauer gesagt eine Tanzerfahrung, die mich nachhaltig ‚verstörte'. Am Anfang war also der Tanz. Vielleicht, weil Tanz seit Jahren für mich einen Zugang bietet, neue Räume und Möglichkeiten zu erforschen. Innen wie außen. Ich nahm an einem zweistündigen Dance Ability-Workshop teil. Zuvor kannte ich kaum ‚behinderte' Menschen und interessierte mich auch nicht besonders für sie. Mich interessierte aber Tanz mit unterschiedlichsten Menschen. Ich erinnere mich an meine anfängliche Unsicherheit und Zurückhaltung, bis ich im wahrsten Sinne des Wortes ‚an der Hand genommen wurde' von einem ‚Behinderten'. Ich war angekommen in der Begegnung. Die ‚Behinderungen' der Menschen, auch meine eigenen Ängste traten völlig in den Hintergrund. In der je individuellen Bewegungssprache teilten wir, was uns verband - das Interesse und den Spaß an den vielfältigen Ausdrucksweisen und den daraus entstehenden Begegnungsbildern. In diesem kurzen Workshop geschah etwas, das ich kognitiv nicht ganz zu fassen vermag. Das ist nichts Ungewöhnliches im Tanz. Die Folge dieser Tanzbegegnungen und -erfahrungen waren jedenfalls Irritation und Interesse. Ich war gezwungen, mein Bild über ‚behinderte' Menschen zu hinterfragen - Bewegung also auch im Kopf - und ich wollte mehr erfahren. Zwei Jahre darauf begann ich selbst eine Tanzgruppe mit sog. ‚geistig behinderten' Menschen zu leiten. Eine Grenzerfahrung. Ich musste meinen Fundus an Tanzerfahrungsangeboten erweitern, weil vieles nicht ‚funktionierte'. Mit einer sehr begabten, jungen Frau erarbeitete ich für eine Ausstellungseröffnung eine kurze Performance. Ich hatte Angst. Kann ich ihr das zutrauen? Wird sie sich den Ablauf merken können? Wie wird sie sich vor Publikum verhalten? (Wie wir sehen werden typische Vorstellungen einer ‚Nichtbehinderten' über eine ‚Behinderte'.) Es wurde ein Erfolg. Nicht, weil es so spektakulär war, sondern weil wir einfach spürbar waren in unserer eigenen Körpersprache und in unserer Beziehung zueinander.
Mit diesen Interaktionserfahrungen begann mein Interesse am Austausch mit ‚behinderten' Menschen; dabei entstand auch die Motivation und die Dringlichkeit, mich mit dem Phänomen Behinderung auch theoretisch auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt auch, um meine eigenen Erfahrungen und Ängste besser zu verstehen. Die vorliegende Arbeit ist Ausdruck dieser Auseinandersetzung.
Mit Gstettner teile ich die Ansicht, dass es irgendwie paradox ist, über Behinderung zu schreiben, "insbesondere dann, wenn einen selbst die gesellschaftliche Klassifikationslotterie so aussortiert hat, dass man zu den sogenannten Nichtbehinderten (...) zählt; paradox auch, wenn man nicht glaubt, selbst alle zugedachten (Leistungs-) Normen optimal erfüllen zu können (...). (Gstettner 1982)
Aufschlussreicher ist es, die Umgangsformen zu analysieren, durch welche Behinderung organisiert wird. (vgl. ebd.) Diese Umgangsformen sind, wie ich aufzeigen werde, zutiefst verknüpft mit dem Bild, das wir von den jeweiligen Menschen haben, die wir ‚umgehen'. Und dieses Bild wiederum hängt mit unserem impliziten Wissen über ‚Mensch sein' zusammen; mit dem Menschenbild, von dem unsere Betrachtungen und unsere Handlungsweisen ausgehen.
Der Ausgangspunkt, von welchem ich mich dem Phänomen ‚Behinderung' annähern werde, ist die systemisch-konstruktivistische Perspektive. Da es mir für den Begründungszusammenhang wichtig erschien, wird dieser Blickwinkel durch neurobiologische Erkenntnisse und psychoanalytische Perspektiven erweitert.
In diesem ersten Abschnitt geht es um die Frage, wie wir wahrnehmen und Begriffe bilden und dadurch versuchen der Welt, in der wir leben, eine Ordnung abzuringen. Einer Welt, zu der es keinen direkten Zugang gibt. Aus dieser erkenntnistheoretischen Position heraus ist jede Wahrnehmung ‚richtig', auch wenn sie für andere schwer nachvollziehbar ist. Das heißt, es gibt kein ‚Falschnehmen', wie es manchen Menschen durch Etikettierungen wie ‚Wahrnehmungsstörung', ‚geistige Behinderung' usw. unterstellt wird.
Der Aufbau interner Strukturen geschieht eigengesetzlich. Wir lernen unaufhörlich, sind aber gleichzeitig von außen nicht direkt steuerbar. Wie Informationen auf Menschen einwirken, lässt sich nicht beobachten oder voraussagen.
Von diesem herangezoomten, wahrnehmenden Subjekt nehme ich dann im Weitwinkel das Subjekt im sozialen Umfeld in den Blick, ohne das es gar keine Subjektwerdung gibt. Die Anerkennung durch andere ist also existentiell; das Soziale ist konstitutiv für uns Menschen. Ein Paradoxon: wir sind autonom und gleichzeitig angewiesen auf andere.
Im nächsten Schritt kehre ich die Blickrichtung um. Habe ich im Vorangegangenen das Subjekt im sozialen Umfeld betrachtet, frage ich jetzt im Sinne der Komplexitätssteigerung nach der Dynamik sozialer Systeme, deren kleinste Einheit die einzelnen Subjekte sind.
Diese theoretischen Ausführungen werden im zweiten Abschnitt zu einem Menschenbild zusammengefasst, das meines Erachtens eine Herausforderung für die Pädagogik darstellt. Hier setze ich mich weiters mit der Frage auseinander, wie die theoretischen Erkenntnisse für pädagogisches Handeln nutzbar gemacht werden können.
Gleichzeitig bilden diese im dritten Abschnitt den Ausgangspunkt für die Argumentation, dass Behinderung kein individuelles Problem per se ist, sondern eine soziale Konstruktion, die durch eine normative Setzung des Menschen zustande kommt. Da diese Setzungen je nach Gesellschaftsform (kulturelle, ökonomische und soziale Kontexte) variieren, wird Behinderung als eine historisch wandelbare Kategorie betrachtet.
Es wird hier auch um die Frage gehen, wem diese Dichotomie ‚behindert' vs. ‚nichtbehindert' nützt und weshalb sie fortwährend rekonstruiert wird. Was trennt uns da? Weiters wird die Bezeichnung ‚geistige Behinderung' in Frage gestellt.
Davon ausgehend, dass Behinderung ein interaktives Geschehen ist, das stattfindet, geht es mir im vierten Abschnitt um Enthinderung als Ziel und Perspektive. In diesem Zusammenhang wird Dance Ability als Modell vorgestellt, das durch seine offene Struktur enthinderte Begegnungen möglich macht.
Formale Anmerkungen
Da es meines Erachtens die Lesbarkeit der Arbeit nicht beeinträchtigt, habe ich mich für eine gleichberechtigte Schreibweise entschieden. Davon ausgenommen ist der von Maturana geprägte Terminus "der Beobachter", den ich beibehalte.
Wenn der Begriff Behinderung auf Menschen zugreift, setze ich ihn in Anführungszeichen, da es sich um eine Zuschreibung von außen handelt, z.B. Menschen ‚mit Behinderung'.
Dank an
-
die unterschiedlichsten Menschen ‚mit Behinderung', denen ich begegnet bin, für den Austausch, für eure Kritik, für eure Geduld, für eure Wut, für eure Hartnäckigkeit, für euren Mut, für euren Humor, für euren Tanz...
-
Prof. Schönwiese und Prof. Ziemen für das theoretische Fundament und neue Sichtweisen
-
Prof. Schönwiese für die geduldige und kritisch anregende Begleitung dieser Arbeit
-
Alito Alessi für die Öffnung des Tanzes für alle Menschen
-
meinen Lebensgefährten Andi für sein Verständnis und seine ‚stille' Unterstützung
-
meine Eltern für die gute Basis und ihre Akzeptanz für meinen Weg
Inhaltsverzeichnis
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Albert Einstein
In diesem Abschnitt gebe ich einen Einblick in den Konstruktivismus, die Systemtheorie und die Erkenntnisse der Hirnforschung als Basis und Argumentationsgrundlage für die weiteren Ausführungen.
"Niemand vermag einen privilegierten Zugang zu einer externen Wirklichkeit oder Wahrheit zu beanspruchen."
Humberto Maturana in Maturana/Pörksen 2002, 24
Die Grundannahme konstruktivistischer Theorien liegt darin, dass allem Erkennen und Wissen ein Konstruktionsprozess vorausgeht und wir somit keinen voraussetzungsfreien, unmittelbaren Zugang zur Realität haben. Die von uns erfahrene, also über die Wahrnehmung vermittelte Wirklichkeit bildet die Welt nicht ab, wie sie ‚an sich ist', sondern ist Ergebnis dieses Prozesses.
Begründet wird diese Position u.a. damit, dass unsere Sinnesorgane und das Gehirn weder darauf ausgerichtet noch in der Lage sind, die Welt in ihrer ureigentlichen Gestalt zu erkennen. Denn der einzig mögliche Zugang zur Welt beruht auf zwei bedeutenden Schnittstellen. Unsere Erfahrungsschnittstelle zur Außenwelt sind die Sinnesorgane. Aufgrund der Beschaffenheit der Sinnesorgane und der Ereignisselektion gibt es nur wenige Umweltereignisse, die die Sinnesorgane überhaupt wahrnehmen. (vgl. Roth in Pörksen, 2002, 140/141)
Da das Gehirn keinen direkten Umweltkontakt hat, besteht eine weitere Schnittstelle zwischen Sinnesorganen und Gehirn. Wahrgenommene Ereignisse müssen ‚übersetzt' werden, indem die zum Gehirn gelangenden neuronalen Impulse interpretiert und in Begriffe gefasst werden. Diese Interpretation ist wiederum von subjektiven Erfahrungen abhängig.
"Wahrnehmen und Interpretieren fallen in einem Prozess zusammen; es ist unmöglich sie im Erleben voneinander zu trennen." (Lindemann/Vossler 1999, 3)
Die ‚Aneignung' von Wissen über die Welt ist in diesem Sinne wörtlich zu nehmen. Sie kann nicht als passive Informationsaufnahme verstanden werden, sondern stellt eine aktive, kreative Tätigkeit dar. Wir machen uns die Welt ‚zu eigen', indem wir sie aufgrund subjektiver, interner Kriterien konstruieren.
Da nun all unsere Erfahrungen mit der Welt und die daraus entstandenen Vorstellungen über sie auf Wahrnehmung und Interpretation zurückgehen, ist die Frage nach einer Korrespondenz zwischen einer wahrnehmungsunabhängigen, objektiven Realität und erlebter Wirklichkeit letztlich unentscheidbar. Denn dazu müssten wir das Original (Realität/Welt) mit unseren Konstruktionen vergleichen können, ohne auf die Wahrnehmung zurückgreifen zu müssen. Dies ist jedoch nicht möglich, da Wahrnehmung unser einziger, unhintergehbarer Zugang zur Welt ist. (vgl. ebd., 3/4)
Ernst von Glasersfeld, der Begründer des radikalen Konstruktivismus, weist darauf hin,
"dass sich niemals feststellen lässt, ob sich jemand ein völlig richtiges Bild von der Realität macht - denn es ist unmöglich, diese Richtigkeit, selbst wenn sie gegeben sein sollte, zu verifizieren: Man kann ja zu keinem Zeitpunkt aus seinen Wahrnehmungs - und Begriffsfunktionen heraus; alle Überprüfungen und Versuche, das Bild des Wirklichen mit der Wirklichkeit selbst zu vergleichen, werden in jedem Fall durch unsere Erlebensinstrumente geprägt." (Glasersfeld in Pörksen 2002, 48)
In Anlehnung an die Skeptiker der griechischen Antike, die das unauflösbare Paradoxon dieser Rückbezüglichkeit bereits erkannten, versucht der radikale Konstruktivismus die Begriffe Erkenntnis, Wissen und Wahrheit von ihrer Verknüpfung mit der Ontologie zu lösen. (vgl. Glasersfeld in Gumin/Mahler Hg. 1992, 38)
Aufgrund der konstatierten Unentscheidbarkeit einer Übereinstimung zwischen Welt und erfahrener Wirklichkeit lässt Glasersfeld die Frage nach dem Sein (Ontologie) außen vor und entwickelt eine Erkenntnistheorie (Epistemologie), die sich mit der Entstehung von Wissen auseinandersetzt; also eine Epistemologie (griech.: episteme = Wissen) ohne Ontologie.
Damit verabschiedet er sich von einer Erkenntnislehre, die nach einem ikonischen Abbild der Realität sucht und auch von einem absoluten, objektiven Wahrheitsanspruch jeglicher Erkenntnis. Gäbe es nämlich einen unmittelbaren Zugang zur Realität, so könnte es auch nur eine richtige Abbildung von ihr geben. Im Gegensatz zum Realismus, der von einer objektiven Erkennbarkeit der Realität ausgeht, verzichtet die konstruktivistische Epistemologie auf den Objektivitätsanspruch.
"Der radikale Konstruktivismus ist also vor allem deswegen radikal, weil er mit der Konvention bricht und eine Erkenntnistheorie entwickelt, in der die Erkenntnis nicht mehr eine ‚objektive', ontologische Wirklichkeit betrifft, sondern ausschließlich die Ordnung und Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres Erlebens." (Glasersfeld 1987, 203)
Die "Existenz einer ontischen Realität" kann bei "konsequenter Selbstanwendung" im Konstruktivismus weder bestritten (wie im Solipsismus) noch bestätigt werden, sie ist vielmehr unentscheidbar. Deshalb wird auch nicht mehr versucht, die Welt zu erklären, wie sie an sich ist, sondern "was kognitiv und kommunikativ geschieht, wenn wir wahrnehmen, erkennen, interagieren und kommunizieren". (Lindemann /Vossler 1999, 6/7)
Ausgangspunkt ist also die Frage danach, wie unser Wissen über die Welt entsteht. Es geht darum, die Operationen zu verstehen, die unsere Wirklichkeit hervorbringen, also zu erkennen, wie wir erkennen.
Der Konstruktivismus ist keine einheitliche Theorie, sondern eher ein heterogener interdisziplinärer Diskurs, in dem erkenntnistheoretische Fragen sowohl aus natur- wie aus geisteswissenschaftlicher Perspektive diskutiert werden. Für meine Ausführungen sind neben Glasersfeld als weitere Mitbegründer bzw. Vertreter der Physiker und Kybernetiker Heinz von Foerster, die Biologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela, der Hirnforscher Gerhard Roth, der Kommunikationswissenschaftler Siegfried J. Schmidt, der Sozialwissenschaftler Peter M. Hejl und der Erziehungswissenschaftler Kersten Reich von Bedeutung.
Zum Status der ontischen Wirklichkeit sowie zum Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft in Bezug auf die Entstehung von Wirklichkeitskonstruktionen sind konstruktivistische Autoren unterschiedlicher Auffassung.
Einigkeit besteht jedoch in der steten "Rückbindung des Erkennens an den Erkennenden" (Pörksen 2002, 12), also in der Beobachterabhängigkeit allen Erkennens. Der Begriff des ‚Beobachters', der auf Humberto Maturana zurückgeht, ist im Konstruktivismus zentral.
"Alles Gesagte ist von jemandem gesagt." (Maturana/Varela 1987, 32)
Dieser Schlüsselsatz des Konstruktivismus mag im ersten Moment trivial klingen. Er ist jedoch deshalb von besonderer Tragweite, weil er das unhintergehbare Einbezogen sein der/des Erkennenden (als historisch und kulturell verortete Persönlichkeit mit einer bestimmten Intentionalität) in das Phänomen des Erkennens beschreibt und damit die Zirkularität von Erkenntnisprozessen unterstreicht. Der Beobachter ist die Quelle aller Beschreibungen.
"Nicht die Ontologie steht am Anfang, sondern die Erfahrung." (Maturana in Pörksen 2002, 74) "Sie (die Erfahrung, Anm. der Verf.) handelt von dem, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt als wahrnehmbares Geschehen erfährt und genau in diesem Moment unterscheidet." (Maturana/Pörksen 2002, 32)
Konsequent in dieser Zirkularität zu verbleiben und das Erkennen durch das Beobachten des Erkennens, ohne Rückgriff auf die Ontologie zu erklären, ist das Anliegen konstruktivistischer Autoren. (vgl. Maturana/Varela 1987, 7ff; Glasersfeld 1992, 22; Maturana/Pörksen 2002, 13/26)
Die Beobachterabhängigkeit allen Erkennens kann auch als "Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung" (Pörksen 2002, 109) und als Aufhebung der "Trennung von Naturwissenschaft und Philosophie" (Maturana/Pörksen 2002, 19) interpretiert werden und bedingt die Verabschiedung vom Anspruch auf Objektivität. Denn Objektivität fordert ja die Unabhängigkeit des Beobachteten von den Eigenschaften des Beobachters.
An dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass manche Autoren zur Verdeutlichung eine begriffliche Trennung zwischen Realität (= wahrnehmungsunabhängige Welt, über die keine gesicherte Aussage getroffen werden kann) und Wirklichkeit (= das auf Wahrnehmung und Erfahrung zurückgehende subjektive Bild der Welt) empfehlen. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 8; Wagner 2000, 57/58) Andere wiederum finden solche Unterscheidungen wenig sinnvoll, da sie wiederum in einen Dualismus münden, der eigentlich überwunden werden wollte. (vgl. Varela und Schmidt in Pörksen 2002, 119/169)
Wie ist es nun aber erklärbar, dass wir eine relativ stabile und verlässliche Welt erleben, wenn wir jene Ordnung, die Glasersfeld beschreibt, nicht einer, außerhalb von uns selbst gelegenen Realität zuschreiben können?
In der Auseinandersetzung mit dieser Hauptfrage des Konstruktivismus werde ich mich zunächst mit den erkenntnistheoretischen Ausführungen von Glasersfeld beschäftigen, der sich wiederum zu großen Teilen auf die entwicklungspsychologischen Arbeiten von Jean Piaget bezieht. Daraufhin erweitere ich diese Sichtweise durch systemtheoretische und neurobiologische Grundlagen.
1.1.1.1. Unterscheidung und Begriffsbildung
Alles Wissen entspringt Handlungen. "Entweder physischen Handlungen oder mentalen Operationen". Auf der mentalen Ebene der Begriffsbildung "entsteht Wissen durch Reflexion und Abstraktion." (Glasersfeld 1998, 31) Im physischen Bereich bilden sich Handlungsmuster heraus.
Menschen haben aufgrund des ähnlichen Aufbaus der Sinnesorgane und des Nervensystems potentiell die gleichen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Die Ausdifferenzierung der Wahrnehmung geschieht jedoch in Wechselwirkung mit der jeweils erfahrenen Umwelt. Durch wiederholte Handlungen, die wir zueinander in Beziehung setzen, werden Vergleiche und damit Unterscheidungen und Bewertungen möglich. Diese Unterscheidungen haben funktionellen Charakter, d.h. sie müssen im jeweiligen Erfahrungsbereich sinnvoll erscheinen und für das subjektive Leben von Bedeutung sein. Die Identität von etwas ist demnach die Folge von Differenzwahrnehmung und Bedeutungszuschreibung.
Hier ist wichtig festzuhalten, dass wir diese Unterscheidungen infolge wiederholter subjektiver und intersubjektiver Erfahrungen in die Welt hineinschreiben, um sie zu ordnen und uns zu orientieren. (vgl. Pörksen und von Foerster 2002, 37) Ob sie sich wirklich in der Welt befinden, können wir nicht entscheiden. Gemachte Unterscheidungen eröffnen Sinn-/Bedeutungs-Räume und wirken wieder zurück auf die Wahrnehmung. "Das Wahre ist dasselbe wie das Gemachte." (Glasersfeld 2000, 26) Glasersfeld bezieht sich hier auf Giambattista Vico, einen Vordenker konstruktivistischer Theorien. Vico stellte heraus, dass ‚Tatsache' (factum) von ‚tun' (facere = komponieren, zusammenfügen) kommt, somit als ein durch Handeln geformtes Wissen zu verstehen ist.
Unterschiedliche Lebens - und Erfahrungsbereiche führen zu unterschiedlich differenzierter Wahrnehmung und bringen demnach auch verschiedene Unterscheidungen und Begriffe hervor. (vgl. Glasersfeld 1998, 13-15) Angehörige indigener Völker verfügen beispielsweise nach wie vor über eine sehr differenzierte Wahrnehmung in der Interaktion mit ihrem Lebensraum, weil sie für ihr Überleben von Bedeutung ist, während Angehörige westlicher Kulturen diese Unterscheidungen kaum mehr wahrnehmen können (z.B. zahlreiche Begriffe für Schnee bei den Inuit oder für Grünschattierungen bei Urwaldvölkern). Diese Differenzierungen in der Wahrnehmung und Begriffsbildung sind somit Bestandteil der Erfahrungswirklichkeit von Menschen und erhalten Sinn und Gültigkeit im jeweiligen Lebensraum und gesellschaftlichen Kontext. Es gibt also nicht eine richtige Wahrnehmung und Begriffsbildung, sondern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Begriffe und Bedeutungen existieren nicht an sich. Wahr ist, was wahrgenommen wird und für die Subjekte im jeweiligen Kontext Sinn macht.
Wiederholte Erfahrungen, die aufeinander bezogen und verglichen werden können, "liefern Unterscheidungen oder Gleichheiten und Invarianten; (...) Wiederholung ist der grundlegende Baustein der erlebten Wirklichkeit." (Glasersfeld 1992, 32) Erst wiederholtes Erleben lässt Vergleich, Unterscheidung, Bewertung und Konstanzerfahrung zu. Bedeutsam in diesem Konstruktionsprozess ist dabei nicht nur die Konsistenz der aktuellen Wahrnehmung mit früheren Erfahrungen, sondern auch die Konsistenz zwischen den verschiedenen Sinneswahrnehmungen. D.h. kombinierte, aus verschiedenen Sinnesorganen gespeiste Erlebnisse wirken nachhaltiger (z.B. gleichzeitiges Sehen und Hören).
Wiederholbare Erlebnisse erwecken den Eindruck kohärenter Wirklichkeit.
"Die Erlebenswelt erhält Struktur und Organisation einzig und allein durch die Regelmäßigkeiten und Invarianten, die es dem Erlebenden im Fluß seines Erlebens zu abstrahieren gelingt." (ebd., 34)
Nach konstruktivistischem Verständnis geschieht dieser Aufbau von Struktur und Konstanz in der Erlebniswelt "fast ausschließlich unwillkürlich", sodass uns die wahrgenommenen Regelmäßigkeiten nicht als interne, kognitive Operationen, sondern "als Gegebenheit einer unabhängigen, selbständig ‚existierenden' Welt" erscheinen. (Glasersfeld 1987, 211)
Mit anderen Worten - aufgrund wiederholter intern erlebter Sinneswahrnehmungen schließen wir auf außerhalb liegende Ursachen. Diesen Prozess nennt Glasersfeld Externalisierung. (vgl. Glasersfeld 1987, 209) Hier wird die Parallele zu Piaget`s entwicklungspsychologischem Terminus der Objektpermanenz deutlich. (vgl. Wagner 2000, 61)
Glasersfeld geht also davon aus, dass die erlebte Wirklichkeit ausschließlich das Resultat subjektiver Konstruktionsleistung ist. Was wir aus unseren Erfahrungen folgern (Induktion), bezieht sich auf unsere Erfahrungen und nicht auf eine, von unserer Erfahrung unabhängige Welt. Er bezeichnet "dies als eine rekursive Anwendung der Induktion: Die Induktion beruht darauf, dass man aus dem jeweiligen Erleben gewisse Regelmäßigkeiten abstrahiert." (Glasersfeld in Pörksen 2002, 56; vgl. auch Glasersfeld 1987, 208)
1.1.1.2. Viabilität als Konstruktionskriterium
Gleichzeitig hält Glasersfeld fest, dass die Konstruktionsprozesse keineswegs der Gestaltungsfreiheit oder Willkür des Subjekts unterliegen, was der Begriff der Konstruktion nahe legen könnte. Um dies deutlich zu machen, hat er als tragendes Kriterium und Bedingung von Wirklichkeitskonstruktionen deren Brauchbarkeit oder Viabilität vorgeschlagen. Der Begriff der Viabilität stellt weder auf Objektivität noch auf Beliebigkeit ab, sondern setzt den Akzent auf Gangbarkeit, Brauchbarkeit oder Durchhaltbarkeit. Er bezeichnet das Funktionieren einer bestimmten Vorgehensweise. ‚Wahr' ist, was sich ‚bewährt'.
Viabilität steht für Glasersfeld in direktem Zusammenhang mit dem evolutionstheoretischen Begriff der Anpassung. (vgl. Glasersfeld in Pörksen 2002, 52) Auf der biologischen Ebene bezieht sich Viabilität darauf, dass es einem Organismus gelingt, unter den einschränkenden Bedingungen und Hindernissen seiner Umwelt sein Gleichgewicht zu erhalten, d.h. zu überleben.
Mit ‚passen' meint Glasersfeld jedoch nicht ein Angleichen an die Umwelt, sondern ein ‚Durchkommen' (Glasersfeld in Pörksen 2002, 51), also mit den einschränkenden Bedingungen fertig zu werden. Darwins Ausdruck ‚survival of the fittest' hat jedoch zu Missverständnissen geführt.[1] Er suggeriert fälschlicherweise, dass es eine Exklusivität im Sinne einer Steigerung der fitness geben könnte. Die ‚natürliche Auslese' der Arten funktioniert jedoch nicht positiv, im Sinne der Tüchtigsten oder am besten Angepassten (Konkurrenzmetapher), sondern negativ. "Entweder passt eine Art in ihre Umwelt, oder sie passt nicht; d.h. sie überlebt oder sie stirbt aus." (Glasersfeld 1987, 201) Es gibt in der Natur nicht eine richtige Art des Durchkommens, sondern viele mögliche, viable Lebensweisen. Für Glasersfeld stellt dies eine "wertvolle Analogie" (ebd.) zum Aufbau kognitiver Strukturen dar, der ebenfalls negativ funktioniere.
Auf der kognitiven Ebene geht es um die Erzeugung eines Gleichgewichts durch viable Verhaltensweisen.
Ausgehend von der bisherigen Erfahrung und der aktuellen Wahrnehmung überprüfen wir fortwährend den Erfolg unserer Handlungen und Denkweisen. Sind diese erfolgreich, so werden sie als passender, viabler Weg erfahren und beibehalten. Wirklichkeitskonstruktionen sind also solange viabel, als sie unsere Erwartungen erfüllen und im Einklang mit dem aktuellen Erleben stehen. Geraten sie jedoch mit wahrgenommenen Beschränkungen der Welt in Konflikt, indem das erwartete Resultat ausbleibt, so veranlasst uns dies zu handeln und eine Änderung der Wirklichkeitskonstruktionen vorzunehmen. In Anlehnung an Piaget nennt Glasersfeld diesen Ausgleichsprozess ‚Äquilibration'. Im Laufe der kognitiven Entwicklung dient dieser Prozess dazu, "Widersprüche zwischen neuen und schon gemachten Erfahrungen aufzulösen und somit ein Gleichgewicht (Äquilibrium) herzustellen." (Lindemann/Vossler 1999, 191) Diesen "Vorgang der Korrektur und der Erweiterung" von Wirklichkeitskonstruktionen leisten wir in den Begrifflichkeiten Piaget`s durch "'Assimilation' und ‚Akkommodation'." (Glasersfeld 1992, 35) Mit diesen Begriffen wird die Fähigkeit beschrieben, auf der Grundlage subjektiver Erfahrungen zu lernen und dadurch letztlich handlungsfähig zu sein.
Die Assimilation bezeichnet dabei die Anschlussfähigkeit von neuen Erfahrungen an die bisher vom Subjekt aufgebauten, begrifflichen Strukturen und Handlungsschemata. Die subjektiv entstandenen Strukturen bestimmen jeweils alle weiteren Wahrnehmungen, Handlungs- und Denkweisen.
Wirklichkeitskonstruktionen werden als viabel empfunden, wenn sie sich im gegenwärtigen Handeln und Denken bewähren, indem das Erreichen erstrebter Ziele gelingt und Neues an schon Bekanntes assimiliert werden kann. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 66f)
Wenn das erwartete Ziel nicht erreicht wird, also eine Differenz zwischen Erwartung und Ergebnis der Handlung wahrgenommen wird, so wird das als Irritation oder Störung empfunden. Diese Störung kann das Subjekt zu einer Abwandlung oder Erweiterung (Akkommodation) seiner bisherigen Konzepte veranlassen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. "Die Änderung kann die Zuteilung des fraglichen Dings zu einer anderen Kategorie sein oder die Schaffung einer neuen Kategorie." (Glasersfeld 1992, 35)
Assimilation und Akkommodation bedingen einander wechselseitig.
"Jede Akkomodation geht auf eine gescheiterte Assimilation zurück, und ohne Akkommodation werden keine Schemata angelegt oder verändert, die wiederum Grundlage der Assimilation sind." (Lindemann/Vossler 1999, 69)
Entscheidend in diesem Prozess ist, dass die Bewertung über Gelingen oder Scheitern der Ziele allein auf subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen zurückgeht.
"Die Erfahrung dient nicht nur als Grundlage zur Überprüfung der Vereinbarkeit des aktuellen Erlebens mit den momentanen Konstruktionen des Subjekts, sondern bestimmt auch, was und wie es überhaupt wahrnimmt oder erlebt." (ebd., 67)
Unser Wissen ist
"brauchbar, relevant, lebensfähig (...), wenn es der Erfahrungswelt standhält und uns befähigt Vorhersagen zu machen (...). Logisch betrachtet, heißt das aber keineswegs, dass wir nun wissen, wie die objektive Welt beschaffen ist; es heißt lediglich, dass wir einen gangbaren Weg zu einem Ziel wissen, das wir unter von uns bestimmten Umständen in unserer Erlebenswelt gewählt haben. (...) Was wir von jener ‚absoluten' Wirklichkeit erleben, sind bestenfalls ihre Schranken (...)." (Glasersfeld 1987, 202/203)
Hier wird verständlich, was Glasersfeld mit dem ‚negativen Funktionieren' in der Gegenüberstellung von biologisch-organischen und kognitiven Strukturen meint. Auch Handlungs- und Denkweisen werden nur losgelassen bzw. verändert, wenn sie der Erfahrungswelt nicht standhalten.
Auf kognitiver Ebene gilt es aber festzuhalten, dass wir selbst diese Schranken bzw. das Scheitern von Konstruktionen nur von innen erleben, "da wir das Scheitern (...) immer nur in eben jenen Begriffen beschreiben und erklären können, die wir zum Bau der scheiternden Strukturen verwendet haben." (ebd., 212) "Die Schranken der Welt, an denen unsere Unternehmen scheitern, bekommen wir nie zu Gesicht." (ebd., 211) Denn auch in Bezug auf die Schranken reagiert der Organismus "ausschließlich auf Wahrnehmungen, die mit seinen inneren Referenzwerten nicht im Einklang sind." (Glasersfeld 1998, 33) D.h. der Organismus reagiert nicht auf die Umwelt, sondern ausschließlich auf seine Wahrnehmung der Umwelt. Auf eine Kausalbeziehung zwischen Welt und erlebter Wirklichkeit kann also nicht geschlossen werden.
Vom funktionalen, pragmatischen Standpunkt aus ist es auch völlig irrelevant, ob unsere Vorstellungen von der Welt ‚wahr' sind oder nicht. Sie müssen nur ihren Dienst leisten und uns zu erfolgreichem Handeln befähigen. (vgl. Glasersfeld 1992, 22)
Viabilität könnte also als Navigationssystem verstanden werden; ein Weg, der durch Beschränkungen und Hindernisse hindurch führt.
Der Begriff der Viabilität legt nahe, dass es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten von Wirklichkeitskonstruktionen geben kann und die eigene Konstruktion nur eine gangbare, auf unseren Erfahrungen beruhende Möglichkeit ist, die sich bisher als viabel erwiesen hat. Er sagt nichts aus über mögliche andere Wege jenseits unserer Erfahrung.
Der Begriff der Viabilität ersetzt somit den herkömmlichen Wahrheitsbegriff, der mit objektiver Gültigkeit verknüpft war und von einer Korrespondenz zwischen erfahrbarer Wirklichkeit und Ontologie ausging.
1.1.1.3. Intersubjektivität - zum Verhältnis des ‚Ich' und der ‚Anderen'
Glasersfeld hebt hervor, dass "der Konstruktivismus eine Wissenstheorie des einzelnen ist" (Glasersfeld 1998, 37) und wir Begriffsstrukturen selbst aufbauen müssen. Es finden sich bei ihm nur wenige Hinweise bezüglich des Einflusses der sozialen Komponente auf unsere Wirklichkeitskonstruktion. Und auch dort bleibt er konsequent bei der subjektiven Erfahrung. "Es geht also um das Phänomen des ‚Anderen' in der subjektiven Erlebenswelt, nicht um seinen ontologischen Status als ‚Ding an sich'." (Glasersfeld 1992, 34)
Sowohl das ‚Ich' als auch der/die ‚Andere' sind Konstrukte und werden im Laufe der kognitiven Entwicklung als permanente, voneinander unterschiedene Objekte aus der Erfahrung abstrahiert. Identität ist demnach auch hier die Folge von Differenzwahrnehmung. Während wir ein Bild von uns selbst aufbauen, uns also bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten und Funktionen zuschreiben, beginnen wir auch aufgrund unserer Erfahrungen in Interaktionen mit anderen Menschen ihnen ähnliche Verhaltenweisen zuzuschreiben oder ‚unterzuschieben'. (vgl. ebd.) Diese Externalisierung muss sich wiederum als viabel erweisen und wird infolge weiterer Interaktionserfahrungen durch den oben beschriebenen Prozess der Assimilation und Akkommodation fortlaufend modifiziert.
Ein wesentliches Moment in der Interaktion mit anderen Menschen ist die Sprache. "Sprache ist nicht monologisch, sondern immer dialogisch" (Foerster in Pörksen 2002, 32), in ihrer Funktion greift sie nach den Anderen. Als menschliche Wesen leben wir ‚in der Sprache' und bringen die Welt durch das In-der-Sprache-sein (Begriffsbildung) hervor. (vgl. Maturana/Varela 1987, 253)
Sprache dient uns "als Bezeichnungssystem zum Aufbau begrifflicher Strukturen" (Lindemann/Vossler 1999, 77) und zur Verständigung über diese.
Begriffsbildung sowie Bedeutung/Sinn entstehen durch sprachliche Unterscheidungen und sind "das Ergebnis von Erfahrungen, die jemand in interaktiven Situationen mit anderen Sprechern macht." (Glasersfeld in Pörksen 2002, 61) "Von der Position eines Subjekts aus betrachtet kann Sprache nur solche Elemente bezeichnen, die das Subjekt in seiner Erfahrung als eigenständig isoliert hat." (Lindemann/Vossler 1999, 75) Differenzwahrnehmung geht der Sprache also voraus. Sprache und deren Semantik stehen gleichzeitig in unmittelbarem Zusammenhang mit unseren Erfahrungen und den daraus entstandenen, individuellen Wirklichkeitskonstruktionen.
Wenn sich unsere Konstruktionen, Begriffsbildungen und Bedeutungen in der sprachlichen Interaktion mit anderen bewähren, wir ihnen also ähnliche Sinnstrukturen ‚unterschieben' können, erfahren wir dies als "Steigerung der Viabilität", im Sinne einer intersubjektiven Gültigkeit und Plausibilität. (Glasersfeld 1992, 37)
"Die Notwendigkeit der Verständigung in den sozialen Interaktionen, auf die wir ja schon als kleines Kind angewiesen sind, sorgt dafür, dass unsere Begriffe und somit die Bedeutungen, die wir Wörtern zuteilen, sich in der Praxis weitgehend an jene der anderen anpassen." (Glasersfeld 1998, 38)
Diese weitgehende Vereinbarkeit von Bedeutungen innerhalb einer Sprachgemeinschaft ist eine wirksame Bestätigung für unser subjektives Erleben, jedoch kein Beweis für die Widerspiegelung der äußeren Welt.
Auch die Einschränkung, die Glasersfeld bezüglich der Intersubjektivität macht, ist von Bedeutung. ‚Weitgehend' meint eben nicht ganz, denn wir können die eigenen Bedeutungen mit denen der anderen nicht vergleichen. Selbst innerhalb einer Sprache gibt es "verschiedene gruppenspezifische Semantiken. (...) Kommunikation ist nie Transport" (Glasersfeld in Pörksen 2002, 64) oder Übertragung von Information. Welche Bedeutung eine Äußerung in einem anderen Menschen erweckt, hängt mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen. Selbst wenn die "Unschärfe der Wortbedeutungen" (ebd.) durch eine gemeinsame Sprache und Kultur reduziert wird, können wir nie sicher sein, ob wir uns verstehen.
Für Glasersfeld ist Begriffsbildung also das Ergebnis interaktiver Erfahrungen. Dennoch scheinen mir andere Autoren die Bedeutung des Zusammenwirkens von Menschen mehr herauszuheben. Zudem bezieht sich Glasersfeld in seinen Ausführungen zur Erkenntnis ausschließlich auf die Vernunft (vgl. Glasersfeld 2000, 27) und lässt Emotionen und unbewusste Anteile an den Wirklichkeitskonstruktionen unberücksichtigt.
Heinz von Foerster meint beispielsweise, dass wir durch die Eingebundenheit in ein soziales Netzwerk "Wirklichkeit in der Gemeinsamkeit konstruieren." (Foerster in Pörksen 2002, 40) In Anlehnung an die Aussage des Dialogphilosophen Martin Buber: "Der Mensch wird am Du zum Ich" (Buber 1992, 32) hält er fest: "Der Mensch ist der Mensch mit dem anderen Menschen (...). Ich bin durch das Du, ich sehe mich selbst durch die Augen des anderen (...)." (von Foerster in Pörksen, 33) Wörtlich genommen würde diese Position der konstruktivistischen Sichtweise widersprechen. Doch von Foerster meint eine ‚erlebte Gemeinsamkeit', die die ‚Separierung' zwischen dem Ich und der/dem Anderen als ‚getrenntes Gegenüber' aufhebt (vgl. ebd.). Die Interaktionen mit anderen Menschen wirken auf uns zurück; natürlich in der Weise, wie wir sie erfahren. Durch die Augen der anderen können wir nie blicken.
"Es geht um den Dialog zwischen mir und dem anderen, der auf die Referenzen nach außen verzichtet." (ebd., 26) Bei gegenseitiger Anerkennung wird ein Rückgriff auf eine objektive Wirklichkeit unnötig.
Diese Wechselwirkung gegenseitiger Anerkennung kommt bei Glasersfeld zu wenig oder nur implizit zum Ausdruck. Sowohl auf diesen Aspekt als auch auf die von Maturana hervorgehobene fundamentale Bedeutung der Emotionen im Hinblick auf unsere Entscheidungen werde ich in den folgenden Kapiteln noch eingehen.
Während Glasersfeld die Subjektseite stark betont, schlägt Varela einen "mittleren Weg" (Varela in Pörksen 2002, 118) vor, der die Extrempositionen Subjekt und Objekt aufhebt. "Beide existieren in wechselseitiger Abhängigkeit und in gegenseitiger Bestimmung." (ebd., 119) Aus diesem dialogischen Raum der Koexistenz geht Wirklichkeit als "emergierendes Muster" hervor. Varela ist der Ansicht, dass es sich beim ‚Ich' nicht um eine "wesenhafte, sondern um eine relationale Identität" (ebd., 127/128) handelt:
"Neuere Untersuchungen von Kleinkindern zeigen, dass die ersten kindlichen Handlungen nicht primär darauf abzielen, die eigene Persönlichkeit zu festigen, sondern konstant dazu dienen, eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Man bildet das eigene Selbst in dem Maße aus, in dem andere Menschen bereits ein solches Ich oder Selbst ausgebildet haben; die Spiegelung im anderen macht das Bewusstsein dieses anderen zum eigenen Bewusstsein. (...) Es existiert eine wechselseitige Bestimmung; man kann nicht sagen, wer oder was am Anfang stand." (ebd., 129)
Zu einer ähnlichen Auffassung kam Martin Buber: "Das Beziehungsstreben ist das erste (...)." (Buber 1992, 31) Hier klingt wieder jene Eingebundenheit und Wechselwirkung an, die eine Separierung nicht mehr zulässt.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass auch die Ergebnisse der entwicklungspsychologischen Säuglingsforschung in diese Richtung weisen: Die Psychoanalytiker Bowlby und Stern verstehen die Fähigkeit und Bereitschaft von Säuglingen aktiv an der Interaktion mit Bezugspersonen teilzunehmen als primäres Verhaltensphänomen. (vgl. Benjamin 1996, 19-22)
Die sozialpsychologischen Theorien von G.H. Mead und C.H. Cooley betonen "die zentrale Bedeutung der Beziehung zum Anderen bei der Entstehung des Selbst (...)." (ebd., 222)
Und Varela weiter:
"In einem hoch interessanten Sinn ist das Bewusstsein, das wir einem Einzelnen zuschreiben, bereits kollektiver, intersubjektiver Natur: Was wir sind, (...) ist in gleichem Ausmaß individuell und nichtindividuell. Es gehört in die Sphäre der Intersubjektivität." (Varela in Pörksen 2002, 130)
Auch Schmidt spricht sich bezüglich der Einflüsse auf unsere Wirklichkeitskonstruktionen für einen "integrativen Konstruktivismus" aus. Statt einer erneuten Polarisierung sei eine "Gesamtschau notwendig, die das Individuum und die Gesellschaft in einem vollständig prozessual orientierten Zugriff aufeinander bezieht." (Schmidt in Pörksen 2002, 172)
"Wir beginnen nie am Anfang und kommen immer schon zu spät. Alles, was bewusst wird, setzt neuronale Aktivitäten voraus, die vom Bewusstsein unabhängig sind; alles, was gesagt wird, setzt voraus, dass man eine Sprache beherrscht. Wirklichkeitskonstruktion ist zahlreichen biologischen, kognitiven, sozialen und kulturellen Bedingungen unterworfen, über die man überhaupt nicht frei verfügen kann; sie widerfährt uns mehr, als dass wir sie bewusst vollziehen." (ebd., 179/180)
Obwohl es also letztlich "kaum Willkürchancen" (ebd., 179) gibt, wurde der Konstruktionsbegriff oft dahingehend missverstanden, dass Konstruktionen willkürlich, planvoll und gezielt aufgebaut werden könnten. Aus diesem Grund überlegt Schmidt, auf den Begriff der Konstruktion zu verzichten und Wirklichkeit eher als etwas zu sehen, das "emergiert, sich allmählich und auf der Basis von Geschichten und Traditionen herausbildet. Natürlich ist der Emergenzbegriff ähnlich vage, aber ihm fehlt - das ist entscheidend - das intentionalistische und voluntaristische Moment." (ebd., 180)
Die Positionen von Varela und Schmidt erscheinen mir nicht als Widerspruch zu den Ausführungen von Glasersfeld, sie nehmen aber den Einfluss soziokultureller Eingebundenheit für die ‚Herausbildung' subjektiver Wirklichkeit mehr in den Blick. In den nächsten Kapiteln führe ich diese Sichtweise noch weiter aus.
"(...) Jedes Individuum wird schon in eine sinnhaft konstituierte Umwelt hineingeboren und auf sie hin sozialisiert und geht nie mit ‚der Realität als solcher' um." (Schmidt, zit. nach Lindemann/Vossler 2002, 12)
Gleichwohl gilt, dass die sozialen Sinnkonstruktionen für das Individuum nur in dem Maße verbindlich sind, als sie mit den eigenen Erfahrungen in Einklang gebracht werden können, sich also als viabler Weg erweisen.
In diesem Sinn schlägt Reich drei Perspektiven vor (vgl. Reich 2005, XI):
-
die Konstruktion, als Basis allen Lernens, d.h. Sinnstrukturen müssen immer selbst aufgebaut werden;
-
die Rekonstruktion, als aktive Übernahme bereits vorhandener Konstruktionen von anderen, d.h., wir sind immer schon eingebunden in eine soziokulturelle Gemeinschaft, was sich auf unsere Konstruktionen (= aktive Rekonstruktion) auswirkt;
-
die Dekonstruktion, als Potential kritischer Neuorientierungen, d.h., es könnte auch anders sein; Dekonstruktion setzt weitere, nicht bedachte Perspektiven von Konstruktionen frei; Dekonstruktion wird meist durch Störung bisheriger Konstruktionen ausgelöst und führt zu Abwandlung, Erweiterung oder neuen Konstruktion, was eine Parallele zu Piaget`s Begriff der Akkomodation nahelegt. (vgl. Kap. 1.1.1.2 i.d.A.)
Der Konstruktivismus ist eine Denkrichtung, die jeglichen Dogmatismus sowie überzeitliche absolute und endgültige Wahrheiten ablehnt und Erkenntnis jeweils rückbezieht auf den Entstehungsprozess, d.h. auf die Erkennenden und deren Kontext und Intention.
Die konstruktivistische Sichtweise verunsichert in zweifacher Weise. Zum einen erklärt sie, weshalb ein unmittelbarer Zugang zur Realität und damit ein Rückgriff auf eine objektive Wahrheit nicht zu haben ist. Zum anderen weist sie auf die Unsicherheit hinsichtlich gegenseitigen Verstehens hin.
In Anlehnung an Freud spricht Reich in diesem Zusammenhang von "Kränkungsbewegungen". (Reich 2005, 169) Eine Kränkung liege eben in der Relativierung universeller Werte und Wahrheiten, die nunmehr in unterschiedliche Konstruktionen von Wirklichkeiten zerfallen. Für das Zusammenleben von Menschen bleiben sie dennoch bedeutsam: "als Ausdruck der Einigung einer Verständigungsgemeinschaft auf Zeit" (ebd., 170), wie beispielsweise Sprache, Traditionen, Lebensformen etc. Sie wurden aber als soziale Konstruktionen und somit als veränderbar enttarnt.
Eine weitere Kränkung werde im Verhältnis von Individuum und anderen erkennbar. Die Behauptung eines unabhängigen Subjekts, eines freien Ichs relativiere sich dadurch, "dass dieses Ich eine Konstruktion ist, die ohne gleichzeitige Konstruktion von Anderen nicht gelingen kann. Behaupten wir ein Selbst, so müssen wir einen Anderen schon mitdenken." (ebd.) Mit diesem "Paradoxon der Anerkennung" (Benjamin 1996, 34) werde ich mich im nächsten Kapitel ausführlicher auseinandersetzen.
Die Einsicht, dass niemand einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben kann, ist aber auch eine Einladung, Selbstverständliches und scheinbar Gültiges wieder in Bewegung zu bringen. Gewissheiten sind zwar attraktiv, Alternativen werden dadurch aber unsichtbar, denn eine ‚objektive Gegebenheit' wird meist nicht mehr diskutiert oder in Frage gestellt. Der Entstehungszusammenhang tritt in den Hintergrund und sie verliert damit ihren Charakter als menschliches Produkt oder Konstrukt. Wer in seinen Verhaltens- oder Denkweisen davon abweicht, muss sich begründen oder wird ausgeschlossen.
Maturana weist darauf hin, dass Gewissheiten nicht nur hemmend auf weiteres Nachdenken, Reflexion und die Offenheit für andere Sichtweisen wirken, sondern dass Begriffe wie ‚Wahrheit' und ‚Realität', die mit objektiver Gültigkeit verknüpft sind, auch viel mit Macht zu tun haben und die Gefahr bergen, Gewalt über Andersdenkende auszuüben. Die Vorstellung einer von uns unabhängigen Realität und die daraus abgeleiteten, allgemein gültigen Aussagen lassen sich zur Diskreditierung, Negierung und Unterwerfung von jenen, die dieser nicht zustimmen, benutzen. (vgl. Maturana in Pörksen 2002, 79)
Der Hinweis auf die Relativität eigener Wirklichkeitskonstruktionen, geschichtet aus individuellen Erfahrungen und verortet in einem spezifischen sozialen und kulturellen Umfeld, hebt die Verantwortung für die eigenen Denk- und Handlungsweisen hervor. Anstelle einer für alle geltenden Definitionsmacht tritt die Öffnung für eine Vielfalt vonMöglichkeiten, die Respekt und Akzeptanz anderer, auch widersprüchlicher Sichtweisen nahe legt. Anstelle der Unterwerfung unter eine allgemein gültige, objektive Wahrheit tritt der Dialog als Raum und Brücke der Verständigung über unterschiedliche ‚Weltsichten', in dem auf die Autonomie der anderen und die Autonomie der eigenen Person Wert gelegt wird und der Konsensbildungsprozesse und Meinungsvielfalt gleichermaßen ermöglicht.
Diese Haltung hat dem Konstruktivismus allerdings auch den Vorwurf eingebracht, alles zu legitimieren, kulturgeschichtliche Kontexte zu vernachlässigen und die Ungleichverteilung von Macht zu verschleiern bzw. ihr unpolitisch gegenüber zu stehen. Es stellt sich die Frage, wie mit einem Missbrauch von Pluralität und Toleranz umzugehen ist und ob der Konstruktivismus notwendig einem moralischen Relativismus verpflichtet ist. (vgl. Schmidt in Pörksen 2002, 176)
Schmidt meint dazu, dass es wichtig sei, die verschiedenen Ebenen der Beobachtung nicht zu vermischen. In konkreten Situationen des Alltags, also auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung, handeln und entscheiden wir alle als Realisten "in der Kontinuität aller bisher getroffenen Entscheidungen" (ebd., 177) und auf der Basis eigener Überzeugungen, für die wir die Verantwortung tragen. Diese sind wiederum beeinflusst von Geschichten, Diskursen, Normen und moralischen Haltungen als Ergebnis komplexen Zusammenwirkens und historischer Entwicklung. Wenn wir auf dieser Ebene zweifeln würden, wären wir nicht handlungsfähig. Ein Relativismus ist hier ausgeschlossen.
Er versteht den Konstruktivismus jedoch "konsequent als eine Beobachtertheorie der zweiten Ordnung, als eine Beobachtung von Beobachtern (...)." (ebd., 178) Erst auf dieser Ebene kann reflektiert und zum Thema gemacht werden, weshalb bzw. unter welchen Bedingungen sich bestimmte Ideologien und Normen durchgesetzt haben und kann auch festgestellt werden, "dass es in moralischen Fragen alternative Entscheidungsmöglichkeiten gibt." (ebd., 177)
Eine weitere Konsequenz der konstruktivistischen Perspektive ist, dass die postulierte Unentscheidbarkeit einer Korrespondenz zwischen wahrgenommener Wirklichkeit und Ontologie nicht nur für subjektive Konstruktionen gilt, sondern auch für wissenschaftlicheTheorien. Nichts, was sich beschreiben lässt, ist unabhängig von der Wahrnehmung und dem Blickwinkel der/des Beschreibenden. Ohne ‚Beobachter' gibt es keine Beobachtungen, er kann also aus keinem Prozess des Erkennens herausgekürzt werden. "Jedes Experiment (enthält, d.Verf.) eine besondere Weltbetrachtung (...), eine ganze Epistemologie oder Kosmologie, ein Bündel von Erwartungen und Prämissen, die das Vorgehen leiten." (Maturana/Pörksen 2002, 59)
"Jede Beobachtung (...) setzt mit einem Akt des Unterscheidens ein. (...) Die Wahl der Unterscheidung bestimmt, was überhaupt gesehen werden kann." (Pörksen 2002, 34)
Wie Albert Einstein schon sagte, bauen sich Theorien nicht auf Beobachtungen auf, sondern die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. (vgl. Watzlawick in Pörksen 2002, 213; Lindemann/ Vossler 1999, 12/13)
Das bedeutet, dass auch wissenschaftliche Erkenntnisse und ‚Wahrheiten' sich aus konstruktivistischer Sicht nicht direkt "von der Natur ablauschen" (Reich 2005, 4) lassen. Die eigene Beteiligung an Behauptungen und Aussagen von WissenschaftlerInnen muss reflektiert werden. (ebd., 14)
Von Foerster hält die Berufung auf Objektivität für einen "beliebten Kunstgriff (...), um der Verantwortung zu entgehen." (von Foerster 1990) Auch Maturana weist darauf hin, dass Wissenschaft nicht wertneutral ist und Wissenschaftler sich mit den Konsequenzen ihrer Arbeit beschäftigen und sich der Verantwortung für ihre Aussagen bewusst sein sollten. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 208) Diese Verantwortlichkeit für die eigenen Aussagen würde auch in einer wissenschaftlichen Sprache zum Ausdruck kommen, die das tabuisierte Personalpronomen ‚Ich' wieder verwendet, das bislang den Darstellungsregeln der Objektivität zum Opfer gefallen ist. (vgl. Schmidt in Pörksen 2002, 185)
Die Aufgabe der Wissenschaft sei nicht Wahrheitserkenntnis im Sinne einer Korrespondenz zwischen Theorie und Ontologie. Welchen Stellenwert hat Wissenschaft aber, wenn sie den Anspruch, objektiv zu sein, nicht erfüllen kann?
Für Glasersfeld gilt auch hier das Kriterium der Viabilität und der intersubjektiven Plausibilität. (vgl. Glasersfeld in Pörksen 2002, 52, 55) Eine Theorie muss brauchbar sein, indem sie einen bestimmten Sachverhalt in einer Weise erklärt, der in sich stimmig und widerspruchsfrei und auch für andere nachvollziehbar ist. Empirisch gut begründbare Annahmen, Viabilität und Intersubjektivität reichen jedoch nicht an die Ontologie heran. Auch empirisches Wissen ist nur Wissen von der Welt, wie sie von uns erfahren und formuliert wird.
Konstruktivistische Methodologie unterscheidet sich nicht total von anderen. Es handelt sich auch hier um eine "kontrollierte Herstellung von Fakten" unter Einhaltung bestimmter Verfahrensschritte. "Allein die Ausgangsvoraussetzungen und die Bewertungen sind entschieden anders." (Schmidt in Pörksen 2002, 183)
Nachdem jede Theorie auf sich selbst anwendbar sein muss, kann auch der Konstruktivismus keinen Anspruch auf Wahrheit erheben, sondern ist lediglich eine Konstruktion und ein mögliches Erklärungsmodell für das Phänomen der Erkenntnis. (vgl. Glasersfeld 2000, 37)
Die bisher beschriebenen konstruktivistischen Annahmen über Wahrnehmung und Wissen stehen in engem Zusammenhang mit systemtheoretischen und neurobiologischen Erkenntnissen, mit denen ich mich in diesem Abschnitt auseinandersetze.
Maturana und Varela spannen in ihren Ausführungen zur Biologie der Erkenntnis einen weiten Bogen von der Zellbiologie über die Arbeitsweise des Nervensystems bis zu sozialen Phänomenen.
Ein ‚System' lässt sich vereinfacht "als ein Netzwerk von Beziehungen" (Maturana/Pörksen 2002, 124) definieren. Es ist immer ein Beobachterkonstrukt, das 3 Komponenten aufweist:
-
Grenze (der Beobachter unterscheidet dadurch das System von seinem Hintergrund, seiner Umgebung)
-
Inhalt (der Beobachter definiert die Bestandteile, die zum System gehören),
-
Beziehungen (der Beobachter stellt die Beziehungen zwischen den Bestandteilen fest).
Die Klasse der lebenden Systeme zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in ihrer geschlossenen Dynamik durch interne Prozesse "andauernd selbst erzeugen" (Maturana/ Varela 1987, 50) und erhalten. Das gemeinsame Merkmal aller Lebewesen, vom Einzeller bis zum Menschen, ist deren "autopoietische Organisation." (ebd.) Mit dem von Maturana kreierten Begriff der Autopoiese (griech: autos = selbst; poein = machen, produzieren) als Grundprinzip des Lebens wird die Fähigkeit lebender Systeme zur Selbststeuerung und Selbstorganisation herausgestellt. Sie sind eigenständige, abgrenzbare Einheiten, die durch interne, zirkulär verwobene Produktionsprozesse jene Bestandteile immer wieder hervorbringen, aus denen sie selbst bestehen. Es ist
"Lebewesen eigentümlich, dass das einzige Produkt ihrer Organisation sie selbst sind, das heißt, es gibt keine Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis." (ebd., 56)
In diesem Zusammenhang unterscheidet Maturana zwischen Organisation und Struktur eines lebenden Systems. Bei der Organisation handelt es sich "um die Relationen zwischen den Bestandteilen, die erkennbar machen, dass (...) ein System einer bestimmten Klasse zugehörig ist." (Maturan/Pörksen 2002, 74) Sie ist invariant.
"Die Struktur, die sich ändern kann und deren Modifikation mit der Bewahrung oder der Zerstörung der Organisation einhergeht, bezeichnet die konkret gegebenen Bestandteile und die Relationen dieser Bestandteile, die eine zusammengesetzte Einheit als eine Einheit besonderer Art konstituieren. Die Struktur einer Einheit macht sie zu einem Einzelfall einer Klasse von Einheiten."(ebd.)
Alle Lebewesen sind autopoietisch organisiert, unterscheiden sich jedoch durch ihre Struktur, was die Vielfalt an Existenzmöglichkeiten erklärt.
Autopoietische Systeme sind selbstreferentiell und operational geschlossen, d.h. sie beziehen sich in ihren internen Prozessen zur Aufrechterhaltung ihrer Organisation ausschließlich auf sich selbst.
Gleichzeitig sind sie energetisch offen, stehen also in Energie- bzw. Materieaustausch mit ihrer Umwelt. Die "implizite konstitutive Bedingung der Autopoiese" ist, dass autopoietische Systeme immer in einem "physikalischen Raum" oder "Medium" (Maturana zit. nach Wagner 2000, 73) leben, das jene "Elemente bereitstellt, die dem Lebewesen die Produktion seiner Bestandteile ermöglicht." (Wagner, ebd.) Die Maßstäbe der Verarbeitung setzt es jedoch selbst.
Zum Verständnis dieser notwendigen Interaktion zwischen Lebewesen und Medium / Milieu sind die Begriffe Perturbation, Determiniertheit, Strukturkoppelung und Plastizität von Bedeutung, die ich im Folgenden erkläre.
Wie schon erwähnt kann sich die Struktur eines lebenden Systems verändern, sie ist plastisch. Jeder strukturelle Wandel ist jedoch der Aufrechterhaltung der Autopoiese untergeordnet bzw. durch sie eingeschränkt, denn der Verlust der Organisation würde zur Auflösung der Einheit führen.
Die "Geschichte des strukturellen Wandels einer Einheit ohne Verlust ihrer Organisation" ist ihre "Ontogenese." (Maturana/Varela 1987, 84) Dieser Wandlungsprozess, das Pulsieren des Lebens findet unaufhörlich statt und kann durch die innere Dynamik des Systems oder durch die Interaktion mit der Umwelt ausgelöst werden. Strukturveränderungen, die mit Interaktionen zusammenhängen, nennen die Autoren Perturbationen. Lebewesen und Umwelt perturbieren sich wechselseitig, wobei diese Perturbationen die jeweiligen Strukturveränderungen nur auslösen, nicht aber instruieren oder die darauffolgenden Effekte vorschreiben. "Es ist vielmehr die Struktur des Lebewesens, die determiniert, zu welchem Wandel es infolge der Perturbation in ihm kommt." (ebd., 106)
Dabei beginnt jedes Lebewesen mit einer spezifischen "Anfangsstruktur, welche den Verlauf seiner Interaktionen bedingt und zugleich die Möglichkeit der strukturellen Veränderungen einschränkt, die durch diese Interaktionen in ihm ausgelöst werden." (ebd. 105) Die gegebene Strukturdeterminiert also die möglichen Interaktionen und die Veränderung durch sie! So bestimmt beispielsweise die Struktur eines Lebewesens den Lebensraum, mit dem es interagieren kann (z.B. Wasser, Land), d.h. die Strukturen müssen verträglich bzw. kompatibel sein.
Wenn diese Interaktionen "einen stabilen Charakter erlangt haben", sprechen die Autoren von "struktureller Koppelung" (ebd., 85). Die Folge der Strukturkoppelung ist die ontogenetische Anpassung. Ähnlich wie bei Glaserfeld bedeutet Anpassung auch in der Begrifflichkeit von Maturana/Varela nicht eine einseitige Anpassung des Organismus an das Milieu, sondern beschreibt ein reziprokes Verhältnis, einen Prozess wechselseitiger Perturbationen, der zu strukturellen Koppelungen führt.
"Die Strukturkoppelung ist immer gegenseitig; beide - Organismus und Milieu - erfahren Veränderungen.
Wenn wir vor dem Hintergrund der Strukturkoppelung zwischen Organismus und Milieu, die wir als operational unabhängige Systeme ansehen, unser Augenmerk auf das Fortbestehen der Organismen als dynamische Systeme im Milieu richten, dann erscheint uns die Grundlage dieses Fortbestehens die strukturelle Verträglichkeit des Organismus mit dem Milieu zu sein, also das, was wir Anpassung nennen. (...) Die Anpassung einer Einheit an ihr Milieu ist deshalb eine notwendige Folge der strukturellen Koppelung dieser Einheit mit ihrem Milieu." (ebd., 113)
Wie verhält sich aber die Strukturkoppelung zwischen lebenden Systemen?
Für das autopoietische System sind andere lebende Systeme ebenfalls eine "Quelle von Interaktionen", die es im Sinne seiner "eigenen Struktur betrachtet" (ebd., 85). Durch fortlaufende Interaktionen, die wechselseitige Strukturveränderungen auslösen, kreieren interagierende lebende Systeme gemeinsam einen "konsensuellen Bereich". Das ist ein Verhaltensbereich "ineinander verzahnter und aufeinander abgestimmter Interaktionen von zwei strukturell plastischen Organismen." (Maturana/Pörksen 2002, 89)
Die Basis einer Beziehungsgeschichte ist die strukturelle Kongruenz der interagierenden Systeme. Der Strukturwandel im Fluss dieser Interaktionen wird jedoch durch die aktuelle interne Struktur des autopoietischen Systems festgelegt. Eine Perturbation kann also nie Instruktion sein.
"Nur auf der Ebene ihrer Struktur vermögen sich zwei Systeme zu begegnen; und ihre besondere Struktur - die Bestandteile und die Beziehungen zwischen diesen Bestandteilen - bestimmen, was in dem jeweiligen System in der Folge einer solchen Begegnung vor sich geht." (ebd., 76)
Dass lebende Systeme strukturdeterminiert sind, meint also, dass sie sich zwar verändern können, die mögliche Veränderung aber durch die momentane Struktur, also durch die eigenen Bedingungen determiniert ist. "Das lebende Wesen (...) funktioniert deshalb immer in seiner strukturellen Gegenwart." (Maturana/Varela 1987, 136)
Die Interaktionsgeschichte eines Organismus ist eine Geschichte von Strukturveränderungen, die die Ausgangsstruktur "transformiert" und "den Bereich der möglichen Zustände ausweitet." (ebd., 139)
Lebewesen mit einem Nervensystem schreiben die Autoren aufgrund der strukturellen Plastizität des Nervensystems einen sehr reichen und flexiblen Verhaltensbereich zu.
"Was das Vorhandensein eines Nervensystems bewirkt, ist, den Bereich möglicher Verhaltensweisen zu erweitern, in dem es den Organismus mit einer ungeheuer vielfältigen und plastischen Struktur ausstattet." (Maturana/Varela 1987, 151)
Das im Organismus eingebettete Nervensystem besteht aus einer Vielzahl von Neuronen, die wiederum miteinander und mit anderen Zellen des Organismus in vielfältigen Verbindungen stehen. An diesen Verbindungsstellen, den Synapsen, geschieht die gegenseitige Beeinflussung. Die Organisation dieses neuronalen Netzwerkes ist bei allen Lebewesen mit einem Nervensystem gleich, variiert aber in seiner Struktur. Beim Menschen beispielsweise gibt es allein im Gehirn "mehr als 1010 (...) Neuronen." (ebd., 173) Denkt man deren Verbindungen untereinander mit (jede Nervenzelle ist mit bis zu 10 000 Synapsen mit anderen Nervenzellen verschaltet), so kommt man auf eine astronomische Zahl möglicher Kombinationen.
Die Erweiterung im Interaktionsbereich ist also durch diese unermessliche Vielfalt an möglichen Verkoppelungen bedingt. Die permanenten Strukturveränderungen geschehen nämlich im Allgemeinen nicht an den großen Hauptverbindungsbahnen, die bei allen Menschen gleich sind, sondern sie finden an den Endverzweigungen und Synapsen statt.
Die strukturellen Veränderungen, ausgelöst durch Interaktionen mit der Umgebung auf der Basis von Strukturkoppelung, kann man als Lernen bezeichnen. Die Perturbationen werden vom Nervensystem im Lichte der gegenwärtigen Struktur bewertet.
Jede Erfahrung hat eine Wirkung auf das Nervensystem. "Insbesondere wir Menschen werden durch jede Erfahrung modifiziert, obwohl diese Veränderungen zuweilen nicht vollständig sichtbar sind." (ebd., 184) Welche Erfahrungen uns jedoch in welcher Art modifizieren, hängt aufgrund der Geschlossenheit und Strukturdeterminiertheit eben davon ab, ob und wie sie anschlussfähig sind. (vgl. Kap. 1.1.1.3 i.d.A.)
"Das Nervensystem ‚empfängt' keine ‚Information', wie man häufig sagt. Es bringt vielmehr eine Welt hervor, indem es bestimmt, welche Konfigurationen des Milieus Perturbationen darstellen und welche Veränderungen diese im Organismus auslösen." (ebd., 185)
Aufgrund dieser Selbststeuerung, die mit den Systemeigenschaften der operationalen Geschlossenheit, Strukturdeterminiertheit und Selbstreferentialität (Selbstbezüglichkeit) veranschaulicht wurde, lässt sich folgern, dass autopoietische Systeme autonom sind.
Unter Autonomie versteht Maturana "Eigengesetzlichkeit" und nicht Unabhängigkeit, wie der Begriff auch häufig konnotiert ist, denn Lebewesen existieren nur in einer Umwelt, mit der sie interagieren. "Was immer dieses System jedoch beeinflusst, wird von einer internen Dynamik bestimmt, die diesen Einflüssen erst ihre besondere Prägung verleiht." (Maturana/Pörksen 2002, 77) Strukturveränderungen, die durch Perturbationen ausgelöst sind, werden in ihrer Ausformung durch das System gesteuert und sind somit lediglich der eigenen Gesetzlichkeit unterworfen.
"Das heißt, ein System ist autonom, wenn es dazu fähig ist, seine eigene Gesetzlichkeit beziehungsweise das ihm Eigene zu spezifizieren." (Maturana/Varela 1987, 55)
Diese Autonomie ist unteilbar. Sie lässt "keine Zwischenstadien oder qualitative Unterscheidungen" zu. "Ein lebendes System ist solange autopoietisch bzw. autonom, wie es seine Organisation aufrecht erhalten kann." (Lindemann/Vossler 1999, 23) Erst wenn das System stirbt, hat es seine Selbstorganisation und somit seine Autonomie verloren.
Maturana weist darauf hin, dass sich der Begriff der Autopoiese ausschließlich auf biologische Phänomene bezieht. Die autopoietische Organisation zur Beschreibung von Gesellschaften (wie beim Soziologen Niklas Luhmann) zu verwenden, erweise sich als problematisch und stehe im Widerspruch zu seiner Definition. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 109-115)
Wie schon erwähnt, ist der Beobachter ein Schlüsselbegriff Maturanas. Durch Unterscheidungen verleihen Beobachter den unterschiedenen Einheiten Existenz (vgl. Maturana/Varela 1987, 13). Damit wird auf den Konstruktionscharakter von Unterscheidungen hingewiesen, denn sie existieren nicht an sich. So sind auch die Termini ‚System', ‚Medium', ‚Interaktionsbereich' etc. Beobachterkonstrukte.
Vom lebenden System aus gesehen, gibt es kein Innen und Außen, "sondern nur einen endlosen Tanz interner Korrelationen" (Maturana/Pörksen 2002, 62) und Veränderungen, die vom System selbst erzeugt werden. Maturana veranschaulicht das am Phänomen der Farbwahrnehmung. Die Farbe, die wir sehen, "ist nichts Externes, sondern etwas, das in einem Organismus - lediglich durch eine äußere Lichtquelle ausgelöst - geschieht." Die "Aktivitäten der Retina" korrelieren dabei mit der internen "spezifischen Erfahrung, für die der Farbname steht." (ebd., 60/61)
Innen und Außen existieren nur für den Beobachter. Feststellungen wie ‚Interaktionen zwischen System und Umwelt' und damit in Zusammenhang gebrachte wechselseitige Strukturveränderungen sind das Resultat eines beobachtenden "doppelten Blicks" (ebd., 65).
Es gilt jedoch, diese zwei Beobachterperspektiven auseinander zu halten. Ereignisse im Bereich der Beziehungen lassen sich nicht direkt mit der geschlossenen, internen Dynamik verknüpfen, wenngleich sie auch nicht unabhängig voneinander sind. (vgl. ebd., 86-88)
Ein System kann einerseits aus der Innenperspektive betrachtet werden, "also im Bereich seiner inneren Zustände und seiner Strukturveränderungen" (Maturana/Varela 1987, 148), wobei die Umgebung irrelevant ist. Andererseits kann ein Beobachter die Außenperspektive einnehmen und Interaktionen zwischen System und Umgebung beschreiben, indem er "Beziehungen zwischen bestimmten Eigenschaften des Milieus und dem Verhalten der Einheit" (ebd.) feststellt. Dabei ist die innere Dynamik irrelevant.
Beide Perspektiven sind zum Verständnis lebender Systeme notwendig, überlappen sich jedoch nicht und dürfen deshalb nicht vermischt werden.
Beobachterkonstrukte wie die Begriffe ‚Reiz und Reaktion' oder ‚Input und Output', bei denen der Beobachter die Operationsweise des Systems "in Abhängigkeit von einem Input interpretiert", sind nach Maturana irreführend. (Maturana/Pörksen 2002, 66)
"Das, was er (der Beobachter, Anm. d. Verf.) in der Außenwelt als einen externen Reiz erkennt, bekommt eine enorme Wichtigkeit und führt ihn dazu, die Eigendynamik des Systems zu übersehen und den Bereich seiner Beschreibungen mit dem Bereich der internen Dynamik des Systems zu vermengen." (ebd.)
In Abgrenzung dazu und zur sorgfältigen Trennung dieser beiden Bereiche, verwenden Maturana und Varela die Termini ‚Perturbation' und ‚Verhalten', die konsequent der Außenperspektive zugeordnet sind. Wie beschrieben, bezieht sich der Begriff Perturbation immer auf die Beobachtung eines äußeren Ereignisses (Interaktion), das der Beobachter als Auslöser einer Veränderung (Strukturveränderung) im System betrachtet. Ebenso ist Verhalten nicht etwas, das ein Lebewesen an sich tut, ist nicht seine tatsächliche innere Operation, sondern eine Korrelation, die ein Beobachter zwischen Milieu und Einheit konstatiert! (vgl. Maturana/Varela 1987, 148-151)
"Unter ‚Verhalten' verstehen wir die Haltungs- und Standortveränderungen eines Lebewesens, die ein Beobachter als Bewegungen oder Handlungen in Bezug auf eine bestimmte Umgebung (Milieu) beschreibt." (ebd. 150)
Lindemann und Vossler führen weiter aus:
"Der Begriff ‚Verhalten' bezieht sich immer auf die (äußere) Beobachtung eines Systems, also auf die Beschreibung durch einen Beobachter. Aus der Perspektive des Systems selbst kann daher nicht von Verhalten gesprochen werden. Bezieht sich eine Beschreibung auf diese innere Perspektive, so sprechen wir von ‚Handeln'. Während Handeln für das System immer Motive und Beweggründe hat, die aus seiner inneren Dynamik hervorgehen, können Motive oder Beweggründe für das Verhalten eines Systems immer nur von einem Beobachter unterstellt werden." (Lindemann/Vossler 1999, 19)
Wenn Beobachter mit dem doppelten Blick spielen, können sie den inneren und äußeren Phänomenbereich zwar in Zusammenhang bringen, die Grenzen bleiben jedoch erhalten.
"Der Phänomenbereich der Physiologie bzw. der internen Dynamik und der des Verhaltens bzw. der beobachtbaren Bewegungen in einer Umgebung überlappen sich nicht (..). Man kann die Phänomene des einen Bereichs nicht aus denen des anderen ableiten." (Maturana/Pörksen 2002, 64)
Die folgende Grafik verdeutlicht die beiden getrennten Bereiche:
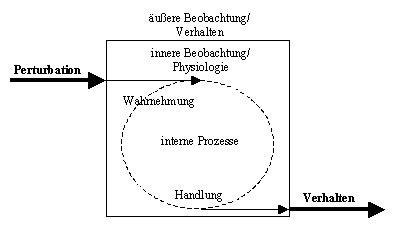
Abbildung 1: Innere und äußere Beobachtung (entnommen aus Lindemann/Vossler 1999, 20)
Beobachter sind nicht imstande, alle Variablen der internen Dynamik eines lebenden Systems zu erkennen und zu verstehen. Zudem gibt es Systeme, "die ihren Zustand verändern, wenn sie beobachtet werden." (Maturana/Varela 1987, 135) Deshalb ist es wesentlich, im Blick zu behalten, dass alle Beschreibungen, Aussagen und Voraussagen bzgl. der Beziehung eines Systems und seiner Umgebung immer auf einen Beobachter zurückgehen.
"Es gibt nicht Existenz, es gibt nur Ko-Existenz. Der Mensch alleine ist nicht zu denken."
H. Maturana
Während Maturana und Varela im Nervensystem eine Erweiterung der Interaktionsmöglichkeiten eines Systems sehen, empfiehlt Gerhard Roth, es gesondert zu behandeln.
Er begründet dies damit, dass das Nervensystem zwar Teil des autopoietischen Systems, in seiner internen Dynamik der Verarbeitung jedoch vollständig abgeschlossen ist. Autopoietische Systeme sind in ihrer Selbsterhaltung auf eine Wechselwirkung mit der Umwelt angewiesen und somit eingeschränkt. Im Gegensatz dazu zeichne sich das Nervensystem gerade durch die hohe Variabilität und Unspezifität seiner Zustände aus, weil es sich nicht selbst erhalten muss. (vgl. Roth, zit. nach Wagner 2000, 92)
In seiner Abgeschlossenheit und Variabilität ist es deshalb a ls funktional eigenständiges und selbstreferentielles System zu bezeichnen, dessen Zustände zyklisch miteinander interagieren. Das bedeutet, "dass jeder Zustand des Systems an der Hervorbringung des jeweils nächsten Zustandes konstitutiv beteiligt ist. Selbstreferentielle Systeme sind daher intern zustandsdeterminiert." (Roth, zit. nach Lindemann/Vossler 1999, 22) Sie sind durch Ereignisse in der Umwelt zwar modulierbar, aber nicht steuerbar.
Zum Verständnis soll hier nochmals der Zusammenhang von Wahrnehmung und Konstruktion (vgl. dazu Kap. 1.1 i.d.A.) aufgegriffen und erweitert werden. Wie erwähnt, beginnt die Subjektivität der Wirklichkeit aufgrund des Relevanzproblems und der Beschaffenheit der Sinnesorgane bereits bei der Wahrnehmung. Wahrnehmung dient in erster Linie dem Überleben und muss deshalb nur ausreichend, aber nicht umfassend sein.
Das Gehirn hat keinen direkten Umweltkontakt. Die verschiedenen Sinnesreize (sehen, hören riechen etc.) werden in relativ gleichartige, neuronale Impulse umgewandelt. Durch diese Transduktion in die neutrale, unspezifische neuronale Einheitssprache geht die Spezifität der sensorischen Erregung verloren; sie stellt einen radikalen Bruch dar. (vgl. Wagner 2000, 94/95)
Wie ist es dann aber möglich, dass wir dennoch eine bunte, vielfältige Welt konstruieren können, wenn für das Gehirn weder die Sinnesorgane noch die Umwelt existieren, sondern lediglich diese neuronalen Botschaften, die zu ihm gelangen?
Das Geheimnis liegt darin, dass das Gehirn strikt nach einem topologischen Prinzip arbeitet. Je nachdem, an welchem Ort ein an sich neutraler und bedeutungsfreier Impuls im Gehirn eintritt, erhält er seine modale Bedeutungszuweisung. Ein Impuls, der beispielsweise im Sehcortex eintrifft, wird als Seheindruck bewertet, und zwar unabhängig davon, ob er von der Retina oder von einer elektrischen Stimulation (z.B. Imagination, Träume) kommt. Dies gilt für alle Sinnesmodalitäten. Unterschiedliche Sinneseindrücke werden also parallel und räumlich verteilt in den verschiedenen Zentren gesondert verarbeitet und bewertet. Da diese Verarbeitungszentren untereinander in Verbindung stehen und Informationen austauschen, kann ein Gesamteindruck entstehen. Dieser Integrationsprozess des Kombinierens und Vergleichens wird von Gerhard Roth als parallel, konvergent, divergente Erregungsverarbeitung bezeichnet.
"Bereits bestehende Informationen werden zusammengefügt (Konvergenz), so daß neue Information entsteht, die dann auf weitere informationserzeugende Zentren verteilt wird (Divergenz). Jede einmal erzeugte Information muß jedoch, wenn sie nicht wieder durch Konvergenz vernichtet werden soll, gesondert weitergeführt werden (Parallelverarbeitung)." (Roth, zit. nach Lindemann/Vossler 1999,36).
Ein wichtiges Moment hinsichtlich der Konstruktivität ist, dass, im Gegensatz zu Säuglingen und Kleinkindern, die Wahrnehmung erwachsener Menschen vorwiegend aus der Erinnerung gespeist wird.
"Man weiß heute, dass die unser Bewusstsein produzierende Großhirnrinde sich in ihren Verdrahtungen wesentlich mit sich selbst beschäftigt. Auf eine Erregung, die erkennbar von außen kommt, folgen 100 000 Erregungen im Innern des Gehirns (...). Wahrnehmungen beruhen bei erwachsenen Menschen nur noch zum geringen Teil überhaupt auf äußeren Sinnesreizen, sie werden zunehmend dem Gedächtnis entnommen." (Roth in Pörksen 2002, 153)
Unsere Wahrnehmung hängt also wesentlich von unseren Vorerfahrungen und deren Bewertungen ab und kann schon deshalb nicht eine objektive Abbildung der Welt sein.
Wirklichkeit konstruiert sich demnach aufgrund zweierlei Konsistenzprüfungen: dem Vergleich zwischen Informationen der interagierenden Verarbeitungszentren und dem Vergleich aktueller Wahrnehmung mit früherer Erfahrung und Bedeutungszuweisung. Wir sind Erinnerung. In dieser sind wesentlich auch unsere emotionalen Erfahrungen gespeichert, die wiederum aufs Engste mit Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen verknüpft sind.
Die neuere Hirnforschung widerspricht der traditionellen Auffassung von der Dominanz der Großhirnrinde, der alle bewussten Prozesse, die ‚höheren' Wahrnehmungs- und Steuerungsfunktionen, unsere intellektuelle Intelligenz zugeordnet wird. Hirnforscher wie Gerhard Roth und Wolf Singer bestätigen, was spätestens seit Freud bekannt ist, nämlich, dass unser Denken und Handeln vorwiegend von unbewussten Motiven und Emotionen bestimmt wird und die Rationalisierung der Entscheidungen erst im Nachhinein vom Cortex erfolgt. Lediglich "Ergebnisse von Rechenoperationen", die "zu etwas Kohärentem und Konsistentem"[2] geführt haben, werden uns bewusst, erreichen also die Großhirnrinde.
Ebenso weist Maturana darauf hin, dass Emotionen die eigentlich bestimmende Kraft sind, die uns leiten. Sie sind die Basis sämtlicher Handlungen und das Fundament, auf dem unsere rationalen Entscheidungen beruhen. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 218)
Laut Jantzen hat auch Vygotskij (Vertreter der kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie) schon diese dialektische Einheit von Emotion und Kognition, von Affekt und Intellekt hervorgehoben; sie könne nicht zerlegt und die Elemente gesondert betrachtet werden, weil dadurch die Eigenheit des Zusammenwirkens des Ganzen verloren geht. Handlungen und Denken sind von dynamischen Prozessen, wie Bedürfnisse, affektive Antriebe usw., motiviert. (vgl. Jantzen 2001, 236)
Das bedeutet, dass unsere Wirklichkeitskonstruktionen und die daraus resultierenden Entscheidungen und Handlungen zu einem großen Teil von Instanzen in unserem Gehirn beeinflusst werden, die dem Bewusstsein gar nicht zugänglich und somit präreflexiv sind. Aufgrund der Möglichkeit, die Aktivität von Hirnarealen durch nicht invasive bildgebende Verfahren feststellen zu können, konnte heute gerade die Bedeutung der tieferen, großteils nicht bewusstseinsfähigen Hirnregionen für Entscheidungsprozesse nachgewiesen werden.
Mit der Hirnrinde aufs Engste verbunden ist das limbische System, das für unsere Gefühle zuständig ist und wiederum in Kontakt mit Hirnzentren steht, die ihm Informationen über das Körperbefinden ‚liefern'. (vgl. Bauer 2004, 52).
Der Mandelkern (Amygdala), ein Teilorgan des limbischen Systems, speichert Erfahrungen in Bezug darauf, ob sie für den Organismus angenehm oder unangenehm waren. Schädliche oder angstbesetzte Erfahrungen werden dabei besonders intensiv eingeprägt. Die Amygdala unterliegt nicht der Kontrolle des Bewusstseins, beeinflusst aber durch ihr implizites Wissen "und der Fähigkeit, bei Bedarf tiefer gelegene Hirnzentren zu alarmieren" (ebd., 52), entscheidend die Bewertung neuer Situationen. Ein weiterer Teil des limbischen Systems ist die Gürtelwindung, der das Selbstgefühl zugeordnet wird. Hier findet auch die "Zusammenführung von Signalen aus der Körper-Innensphäre und der Welt der äußeren Situationen" (ebd., 55) statt.
Die Verarbeitung von Ereignissen geschieht in verschiedenen Hirnarealen, die jedoch durch die Verbindungsarchitektur des Gehirns miteinander interagieren.
Wahrnehmung und Bewertung einer neuen Situation werden von der Großhirnrinde und dem limbischen System geleistet, wo in Sekundenbruchteilen ein "Abgleich der aktuellen Lage mit abgespeicherten Erinnerungen an ähnliche Situationen" (ebd., 37) vollzogen wird.
Die Repräsentation von Objekten oder Ereignissen findet bei allen Menschen in vergleichbaren Arealen statt, weil wir ähnliche Hirnstrukturen haben. Die präzise Ausformung der neuronalen Erregungsmuster bei der Wahrnehmung ist aber aufgrund unterschiedlicher individueller Vorerfahrungen, die dort gespeichert sind, von Mensch zu Mensch verschieden.
Bedeutung ist demnach individuell; aufgrund der Koexistenz mit anderen Menschen aber auch gleichzeitig überindividuell. Nach Jantzen weist auch Vygotskij auf diese Wechselwirkung hin. Er führt aus, dass
"durch die Einwirkungen des Sozialen, vermittelt über die Eigentätigkeit des Gehirns (...), das Gehirn sich neu organisiert, indem es sich einen Inhalt schafft, der nicht ihm selbst angehört, sondern der Welt. Dies geschieht, wie wir wissen, in Form von sozialen (Wort-) Bedeutungen, die, vermittelt über das Erleben der Person, es dieser ermöglichen, zu werden, was sie von Anfang an ist." (Jantzen 2001, 236/237; eigene Hervorh.)
Weshalb sich Eigengesetzlichkeit und Angewiesensein auf andere nicht widersprechen erklärt Gerhard Roth folgendermaßen:
"Alles, was unsere Weltkonstruktion betrifft - so lautet das erste Axiom - geht durch unser individuelles Gehirn. Das zweite Axiom heißt aber: Das individuelle Gehirn eines Primaten würde niemals in der ‚normalen' Weise außerhalb einer Gruppe von anderen Primaten ausreifen. Damit wir überhaupt zum Menschen werden, benötigen wir (...) die unmittelbare Nähe und Schlüsselreize anderer Primaten. Deshalb muss man Individuum und Sozialverband zusammen sehen. Das individuelle Gehirn braucht die Gegenwart der Gruppe unbedingt und existenziell." (Roth in Pörksen 2002, 157; vgl. dazu Varela, Kap. 1.1.1.3 i.d.A.)
Maturana und Varela veranschaulichen dies am dramatischen Beispiel der zwei indischen Mädchen, die völlig isoliert von jeglichem menschlichen Kontakt in einer Wolfsfamilie aufwuchsen. "Obwohl sie in ihrer genetischen Ausstattung und in ihrer Anatomie und Physiologie menschlich waren", haben sie "sich nie ganz dem menschlichen Kontext angekoppelt." (Maturana/Varela 1987, 143)
Das soziale Phänomen ist also konstitutiv für das, was uns Menschen ausmacht. Das Schicksal der indischen Mädchen macht deutlich, welche Auswirkung Isolation bzw. Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft hat. Wir sind vor allem soziale Wesen und auf die Anwesenheit anderer angewiesen, um uns selbst zu entwickeln.
Nach Maturana und Varela entsteht durch Strukturkoppelung jener konsensuelle Bereich, in dem Interaktionen einen rekursiven Charakter annehmen, also zu gegenseitigen Strukturveränderungen führen; durch diese rekursiven Interaktionen wird eine soziale Koppelung erzeugt, eine Ko-Ontogenese aller Mitglieder. Ontogenese und Ko-Ontogenese hängen in dem Sinne zusammen, als die Interaktionen die Strukturveränderungen selektieren, jedoch immer auf der Basis der gegenwärtigen Struktur!
"Wir Menschen existieren als Menschen im Netzwerk von Strukturkoppelungen (...)." (ebd., 253) "Ohne eine geeignete Geschichte von Interaktionen ist es unmöglich, an diesem menschlichen Bereich teilzuhaben (...)." (ebd., 252)
"Was die Biologie uns zeigt, ist, dass die Einzigartigkeit des Menschseins ausschließlich in einer sozialen Koppelung besteht, die durch das In-der-Sprache-Sein zustande kommt. Dadurch werden (...) die Regelmäßigkeiten erzeugt, die der menschlichen sozialen Dynamik eigen sind, wie zum Beispiel individuelle Identität und Selbstbewußtsein." (ebd., 265)
Identität entwickelt sich also wesentlich im zwischenmenschlichen Bereich, ist individuell und relational. (vgl. Kap. 1.1.1.3 i.d.A.)
Wie schon erwähnt, ist eine wesentliche Eigenschaft unseres Nervensystems seine unglaubliche Plastizität; d.h. die Mikrostruktur ist nicht fix verdrahtet, sondern verändert und entwickelt sich ständig im Verlauf unserer Interaktionsgeschichte und Umweltbedingungen.
Dabei beginnen wir mit einer bestimmten Anfangsstruktur, unserer neurobiologischen Grundausstattung an Nervenzellen und Synapsen.[3] Welche der vorhandenen Verknüpfungen jedoch aufrecht erhalten und stabilisiert werden, hängt von deren Gebrauch ab, was in der Fachsprache "use-dependent-plasticity"[4] genannt wird.
"Die grundlegende Fähigkeit des Gehirns, durch sein Tätigwerden seine synaptischen Verschaltungen zu verändern und damit seine eigene Feinstruktur umzubauen, wird als ‚synaptische Plastizität' bezeichnet." (Bauer 2004, 59)
Über Synapsen verbundene Nervenzellen, die durch ein Signal gemeinsam und gleichzeitig aktiviert werden, verstärken dabei ihre Verknüpfung: "Cells that fire together wire together (Zellen, die zusammen feuern, verkabeln sich stärker miteinander)." (ebd., 58) Das bedeutet, dass Nervenzellnetzwerke, die bei wiederholten Wahrnehmungen, Handlungen oder Denkvorgängen aktiviert werden, sich verstärken und stabilisieren, während weniger aktivierte Nervenzellen und Synapsen abgebaut werden. Dieses Prinzip der Ökonomisierung (use it or loose it) ist gleichzeitig durch die Verstärkung auch eine Automatisierung; es bilden sich Muster heraus.
Entscheidend für die Ausdifferenzierung des Gehirns sind somit die jeweiligen Erfahrungen, die Menschen in ihrer Entwicklung machen. Das Gehirn ist nur wenig genetisch geprägt.
"Geistige Tätigkeit, Lernen, aber auch Gefühle und Erlebnisse in zwischenmenschlichen Beziehungen haben im Gehirn biologische Veränderungen zur Folge (...)" (ebd., 7), die bis hin zur Neubildung von Nervenzellen und zur Genaktivität reichen. Diese neurobiologischen Erkenntnisse stehen im Widerspruch zur Lehrmeinung, dass sich Nervenzellen nicht vermehren können, aber auch zur traditionellen Auffassung des genetischen Determinismus. Wenn Nervenzellen wachsen, müssen auch die Gene aktiv werden. Die Information in den Genen ist unwandelbar. Ob diese aber aktiv werden, wodurch die Information erst zum Tragen kommt, hängt jedoch von unseren Erfahrungen und Umweltbedingungen ab. "Gene steuern nicht nur, sie werden auch gesteuert." (ebd., 7) Die Debatte, ob nun die Gene oder die Umwelt für unsere Entwicklung verantwortlich sind, erscheint im Hinblick auf diese Wechselwirkung unsinnig.
"Tatsächlich haben Beziehungserfahrungen und Lebensstile, die immer auch mit einer Aktivierung bestimmter neurobiologischer Systeme einhergehen, einen gewaltigen Einfluss sowohl auf die Regulation der Genaktivität als auch auf Mikrostrukturen unseres Gehirns." (Bauer 2005, 59)
Das Gehirn ist in Wechselwirkung mit Interaktionen mit der Umwelt ein permanent lernendes und sich veränderndes System.
Es verfügt auch über ein enormes kompensatorisches Potenzial. Vor allem in frühen Stadien der Entwicklung, wo elementare Hirnleistungen örtlich noch nicht völlig festgelegt sind, kann es beispielsweise bei Verletzung einer Cortexhemisphäre "zu einer Umstrukturierung des gesamten Systems kommen" (Wagner 2000, 101), sodass die sensomotorischen Leistungen von anderen Hirnarealen übernommen werden.
Ebenso gelangen bei gehörlosen Menschen, da die Impulse im Hörzentrum ausfallen, kompensatorisch mehr Impulse vom Sehzentrum ins Hörzentrum (kreuzmodale Verarbeitung). Auch wird die Gebärdensprache in Hirnarealen verarbeitet, wo sonst die Sprache verarbeitet wird. Die Kommunikationsmöglichkeit wird in den Arealen aufrecht erhalten, die zur Verfügung stehen. Auch Kinder, die keine Großhirnrinde haben, sind fähig zu kommunizieren; wir verstehen nur noch nicht warum und wie.[5] Durch die enorme Plastizität des Gehirns (Umbau und Neuverzweigung) kann vieles kompensiert werden.
Deshalb erscheint es wichtig, die verschiedenen Hirnzentren nicht isoliert zu betrachten. Es gibt diese Zentren, aber durch die Vernetztheit und Plastizität können die entsprechenden Leistungen nicht allein diesen Regionen zugeordnet werden. Der Mandelkern ‚macht' keine Gefühle; im Gehirn lassen sich nur Potenzialschwankungen feststellen. An den inneren Zuständen ist immer der ganze Mensch beteiligt.
Hier möchte ich anmerken, dass Vygotskij schon 1934 die Vernetztheit des Gehirns thematisierte und sich gegen Lokalisationstheorien aussprach:
"Eine Funktion ist niemals mit der Tätigkeit irgendeines einzelnen Zentrums verbunden, sondern stets das Produkt der integrierenden Tätigkeit streng differenzierter, hierarchisch miteinander zusammenhängender Zentren. (...) Wir haben es mit Gliederung und Einheit zu tun, mit einer integrierenden Tätigkeit der Zentren und ihrer funktionellen Differenzierung sowohl in der Funktion des Ganzen als auch in der Funktion des Teils. Differenzierung und Integration schließen einander keinesfalls aus; eher setzen sie einander voraus und verlaufen in gewisser Hinsicht parallel." (Vygotskij, zit. nach Jantzen 2001, 237)
In unserer menschlichen Entwicklung sind wir notwendig und existenziell auf "ein wechselseitiges Aufnehmen und spiegelndes Zurückgeben von Signalen" (Bauer 2005, 58) mit anderer Menschen angewiesen und wohl deshalb mit der unwillkürlichen Fähigkeit zur gegenseitigen Spiegelung ausgestattet. Dieses Phänomen der Resonanz ist schon lange bekannt und wir erleben es auch täglich in der Begegnung mit anderen Menschen. Vor kurzem konnte durch Giacomo Rizzolatti und seine Arbeitsgruppe in Parma (vgl. ebd., 21) die neurobiologische Grundlage dafür wissenschaftlich erforscht werden: Nervenzell-netzwerke im Gehirn, die für Handlungsplanung, Körperempfindung und Emotionen zuständig sind, sind gleichzeitig auch Spiegelnervenzellen. (vgl. ebd., 85) Das bedeutet, dass diese Netzwerke nicht nur aktiv werden, wenn wir selbst handeln, empfinden oder fühlen, sondern sie ‚feuern' auch dann, wenn wir andere Menschen in ihren Handlungen, Empfindungen und Gefühlen wahrnehmen. Dies ist neurobiologisch gesehen eine verwirrende Konstellation:
"Nervenzellnetze, mit denen wir uns selbst als Person wahrnehmen, dienen - in ihrer Eigenschaft als Spiegelsysteme - zugleich dazu, in uns Vorstellungen von anderen Personen zu erzeugen." (ebd., 88)
Im System der Spiegelneurone begegnen sich also Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Es ist die Grundlage für das Vermögen, sich in andere hineinversetzen zu können, intuitiv erfassen zu können, was in anderen Menschen vorgeht und dadurch, im Hinblick auf die bisher abgespeicherten Interaktionserfahrungen, ihr weiteres Verhalten antizipieren zu können. In der Fachsprache wird dies "als das Vermögen bezeichnet, eine ‚Theory of mind'" (ebd., 50) zu entwickeln. (vgl. auch Roth in Pörksen 2002, 142)
Aber auch Lernen basiert darauf. Was wir sehen und erleben, wird in jenen Nervenzellnetzwerken als Modell abgespeichert, "die die Programme für eigene Handlungsmöglichkeiten kodieren." (Bauer 2005, 121) Diese Resonanz bedeutet also nicht nur eine innere Mitreaktion, sondern bahnt auch Handlungsbereitschaften.
Selbst beim Sprechen über eine Handlung resonieren beim zuhörenden Menschen jene Nervenzellen, die bei der Ausführung der Handlung aktiv werden würden. Sprache ist somit auch Teil dieses Resonanzsystems und steht in engem Zusammenhang mit der Handlungsfähigkeit.
Spiegelphänomene geschehen spontan, unwillkürlich und ohne Nachdenken; interessanterweise aber nur bei der Wahrnehmung "lebender, handelnder Akteure."(ebd., 54)
Aber auch in Bezug auf die Spiegelsysteme gilt die ökonomische Spielregel des Gehirns. Sie müssen eingespie(ge)lt werden und können sich nur entfalten, wenn sie benutzt werden. Dafür bedarf es echter Mitspieler. Spiegelungen sind ein emotionales und neurobiologisches Grundbedürfnis.
Durch Beobachtung und Imitation bilden sich in der frühen Kindheit Handlungsschemata heraus, die durch die neuronale Vernetzung immer mit Körperempfindungen und Emotionen verbunden sind. Eine Handlung ist also gekoppelt mit entsprechender Eigenbefindlichkeit, sie steht "in einem emotionalen bzw. affektiven Kontext." (ebd., 67)
Resonanz entsteht durch Beobachtung bzw. Wahrnehmung; Bedeutung durch die Rückmeldung in Form von Sprache, Körperbewegungen, Gesichtsausdruck, vor allem aber von Blicken der Bezugspersonen. Sie signalisieren das Erkannt-werden im Tun. Der Blick ist "die unmittelbarste Form, mit der sich Menschen anzeigen, dass sie dem anderen eine Bedeutung geben und dadurch mit ihm in innerem Kontakt stehen." (ebd., 103) Erst durch diese Spiegelungen können wir ein Selbstbild entwickeln.
In den ersten Lebensjahren orientiert sich das Kind nicht nur bei der Einschätzung von Situationen an der Beurteilung der Eltern, sondern übernimmt auch ihre Bewertungen über die eigene Befindlichkeit. "Was Bezugspersonen dem Kind zurückspiegeln, beinhaltet für das Kind eine Botschaft über sich selbst." (ebd., 119) Diese Rückspiegelungen sind immer auch verbunden mit Einstellungen, Erwartungen und Zutrauen der Eltern, die im Kind Resonanz auslösen.
Die Spiegelnervenzellen stellen also die neurologische Basis für die Wahrnehmung und Konstruktion der äußeren Welt (Handeln, Interaktionen) dar. Gleichzeitig bilden sie aber auch die Basis für die Konstruktion des eigenen Selbst, das sowohl die soziale Identität des sich der Welt der anderen zugehörig Fühlens als auch die Identität als Individuum, des sich Unterscheidens von den anderen, beinhaltet. (vgl. ebd., 69)
Die wiederholten Spiegelungserfahrungen werden in den entsprechenden Nervenzellnetzwerken gespeichert, wodurch sich innere Schemata des Erlebens und Verhaltens herausbilden; ein für die soziale Gemeinschaft, in der wir leben, prinzipiell mögliches und gangbares Handlungs- und Interaktionsvokabular. Wenn wir Abläufe in der Welt verstehen, uns wahrgenommen fühlen und das Verhalten anderer Menschen weitgehend einschätzen und antizipieren können, werden Situationen überschaubar, es bildet sich Vertrauen. Dieses Vertrauen in uns selbst und andere ist die "fundamentale Bedingung der Existenz." (Maturana/Pörksen 2002, 211)
Das neuronale Format der Spiegelneurone ist somit zugleich individuell und überindividuell. (vgl. Varela, Kap. 1.1.1.3 i.d.A.) Es stellt einen sozialen Resonanz- und Verständnisraum dar, der uns Orientierung und Sicherheit bietet.
Damit wir uns darin selbstverständlich bewegen können, muss uns das soziale Umfeld Signale zur Verfügung stellen. "Selbstgefühl, Kommunikationsfähigkeit, Wissen und Kompetenz entwickeln sich (...) nicht von selbst (...)." (Bauer 2005, 118) Zur Entfaltung der genetischen Grundausstattung sind wir notwendig auf Handlungs- und Interaktionserfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen angewiesen. Wenn diese fehlen, nützt selbst die beste genetische Voraussetzung nichts. (vgl. Bauer 2004, 211).
"Die Entdeckung eines im Gehirn vorhandenen Systems von Spiegel-Neuronen (Spiegel-Nervenzellen) zeigt, dass unsere Gehirnstrukturen spezialisierte Systeme besitzen, die auf Beziehungsaufnahme und Beziehungsgestaltung angelegt sind." (ebd., 19)
Damit wird durch die Neurobiologie bestätigt, was aus entwicklungspsychologischer (z.B. Vygotskij, Stern, Benjamin) und dialogphilosophischer (Buber) Sicht bereits erkannt worden war. Interessanterweise sprach Buber vom "eingeborenen Du". (Buber 1992, 31)
"Im Antlitz des anderen Menschen begegnet uns unser eigenes Menschsein. Erst indem wir uns gegenseitig als Menschen erkennen und anerkennen, werden wir zum Mitmenschen, und erst dadurch erleben wir uns als Menschen." (Bauer 2005, 115)
Ähnlich schreibt Jantzen, in Anlehnung an Vygotskij, von der
"Verwandlung sozialer Prozesse in individuelle: indem eine Geste, eine Tätigkeit ‚an sich' zur Tätigkeit ‚für andere' wird, wird sie durch deren Erwiderung (im sozialen Verkehr, in Kooperation und Kommunikation) zur Tätigkeit ‚für sich', für das Subjekt." (Jantzen 2001, 228)
"Indem der Mensch ‚an sich', zum Menschen ‚für andere' wird, wird er durch deren Reaktion Mensch, Persönlichkeit ‚für sich'." (ebd., 240)
Auch für Wolf Singer ist die Einbettung in das reiche soziale Umfeld und das Vermögen, sich gegenseitig reflektieren zu können, die Voraussetzung für die Bildung eines Ich-Konzepts. Mit anderen Worten macht er die Aussage von Foersters, dass wir uns durch die Augen der anderen sehen, sowie Bubers, dass wir am Du zum Ich werden, verständlich:
"Mein Ich konstituiert sich ja nur in der Spiegelung der anderen Personen, die mich wahrnehmen und mir mein Sein zurückspiegeln, das ich wieder wahrnehme und auf diese Weise ein Ich-Konzept entwickle."[6]
Die personale Identität bildet sich somit aus den sich aufbauenden intersubjektiven Strukturen. In gegenseitiger Bejahung und Spiegelung finden wir zu uns selbst.
Die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin nennt dies das "Paradoxon der Anerkennung." (Benjamin 1996, 34) Das Bedürfnis nach Anerkennung ist für sie die übergeordnete Konzeption, die die verschiedenen Ansätze einer intersubjektiven Theorie der Selbstentwicklung vereinigt. (vgl. ebd., 24) Ihre Ausführungen widersprechen dem Konstrukt eines selbstbezogenen, monadischen Ich, das u.a. die klassische Psychoanalyse unterstellt hat, das aber auch in vielen Entwicklungstheorien als reifes Stadium mit Bezeichnungen wie ‚Ablösung' oder ‚Unabhängigkeit' beschrieben wird. Jedes Selbst "existiert nur, indem es für das andere existiert, das heißt, indem es Anerkennung findet." ( ebd., 34)
"Denn Anerkennung ist jene Reaktion der anderen, die die Gefühle, Intentionen und Aktionen des Selbst überhaupt erst sinnvoll macht. Sie ist die Bedingung für die Entwicklung von Selbsttätigkeit und Urheberschaft." (ebd., 16)
"Anerkennung ist keine Sequenz von Ereignissen, wie es zum Beispiel die Phasen der Reifung und Entwicklung sind, sondern ein konstantes Element, das alle Ereignisse und Phasen des Lebens durchzieht." (ebd., 25)
Wir können uns deshalb aus Beziehungen und wechselseitiger Anerkennung nicht ablösen oder herausentwickeln. Nach Benjamin geht es darum, immer aktiver und selbständiger in ihnen zu werden. (ebd., 21) Entgegen dem traditionellen Differenzierungsdenken der Psychoanalyse, das auf "einem rigiden Dualismus von Einssein und Ablösung, von Unterschied und Gleichheit" (ebd., 51) beruht, entwirft sie das Bild einer konstanten Spannung, eines paradoxen Gleichgewichts "zwischen der Anerkennung der anderen und der Selbstbehauptung" als "wesentliches Moment der Differenzierung." (ebd., 48) "In der gegenseitigen Anerkennung können Gleichheit und Unterschied koexistieren." (ebd., 49).
Resonanzerfahrungen und Spiegelungen haben nachgewiesene psychische und neurobiologische Auswirkungen. Sie justieren nachhaltig "die Empfindlichkeit des biologischen Stresssystems." (Bauer 2004, 46) Anregende Umweltbedingungen bewirken eine Zunahme neuronaler Verschaltungen. Liebevolle Zuwendung, verlässliche Bindung und Anerkennung führen zur Ausschüttung von Opioiden, die sich schützend auf die weitere Sensibilität des Stresssystems auswirkt.
Wenn durch länger dauernden Mangel an Zuwendung Signale spiegelnder Resonanz ausbleiben, kommt es zu einer "massiven Hochregulation" und zu einer "dauerhaften Empfindlichkeitserhöhung" (Bauer 2005, 107) der Stress-Gene. Fehlende Spiegelung führt außerdem zu emotionalem Rückzug. Die Suche nach Signalaustausch wird nach und nach aufgegeben.
In einer Untersuchung mit bildgebenden Verfahren konnte gezeigt werden, "dass ein rein sozialer Ausschluss eindeutig biologische Effekte nach sich zieht" (ebd., 109), nämlich die Aktivierung des Schmerzzentrums, wie sie normalerweise nur bei körperlichen Schmerzen auftritt.
"Ausgrenzung bedeutet die systematische Verweigerung der spiegelnden Verhaltensweisen im Alltag, mit denen wir uns unwillkürlich gegenseitig anzeigen, dass wir den anderen als zugehörig zum gemeinsamen sozialen Bedeutungsraum betrachten." (ebd., 105)
Aus dem sozialen Resonanzraum herauszufallen, hat deshalb so verheerende Auswirkungen, weil durch das Ausbleiben der Spiegelung sowohl das Gefühl der sozialen Zugehörigkeit als auch der Identität in Frage gestellt ist. Es wirkt sich nachhaltig auf die Mikrostrukturen des Gehirns und die Genregulation aus, indem es zu einer Stabilisierung der betroffenen Netzwerke (Stressachse, Schmerzzentrum) kommt. Die fortwährende Negation eines Menschen führt also zu physischen und psychischen Krankheiten. (vgl. auch Maturana/ Pörksen 2002, 128 u.211)
Wechselseitige Spiegelungsvorgänge sind die neurobiologische Grundlage für intuitives Wahrnehmen und Verstehen. Was wir in zwischenmenschlichen Beziehungen über die Welt und über uns selbst erfahren, wird aufgrund der Selbstorganisation in biologische Signale umgewandelt und in die eigene Mikrostruktur eingeschrieben. Dieses teilweise bewusste, teilweise unbewusste implizite Wissen in Form von Denkweisen, Handlungsprogrammen, Empfindungen und Emotionen ist demnach individuell verarbeitet und bewertet, hat aber gleichzeitig eine soziale Dimension. "Jedes Verhalten (ist, d.Verf.) ein relationales Phänomen (...)." (Maturana/Varela 1987, 187) "Bewußtsein und Geist gehören dem Bereich sozialer Koppelung an (...)." (ebd., 252)
Da alle Verstehensprozesse auf Spiegelungsvorgänge in zwischenmenschlichen Erfahrungen zurückgehen, sind sie "in den intersubjektiven Raum gehoben." (Bauer 2005, 167)
Die abgespeicherten Handlungs- und Interaktionserfahrungen bilden Reaktionsmuster als Grundlage für die Bewältigung zukünftiger Ereignisse.
"Die sekundenschnelle, automatische und großenteils unbewusste Bewertung aktueller Ereignisse erfolgt also durch einen Abgleich mit den individuellen Vorerfahrungen eines Menschen. (...) Damit folgt das Gehirn einer inneren ‚Weisheit' aller lebenden Systeme, nämlich bei der Bewertung neuer Situationen als einzig sinnvollen Bewertungsmaßstab die bisherigen Erfahrungen heranzuziehen, die der Organismus in ähnlichen Situationen bereits gemacht hat." (Bauer 2004, 88)
Das heißt, wir handeln in der Kontinuität aller bisherigen Erfahrungen und Entscheidungen. Aus diesem Grund kann die Interpretation einer Situation niemals objektiv, sondern wird immer unterschiedlich sein. Sie hängt mit jeweiligen biografischen Erfahrungen zusammen, die dort abgespeichert sind, wo auch die Bewertung der aktuellen Situation stattfindet: in der Großhirnrinde und im Limbischen System.
Auch für die Wahrnehmung anderer Menschen greift das Gehirn auf diese eigenen Schemata zurück. Nervenzellnetzwerke für Handlungsprogramme, Körperempfindungen und Emotionen in der Großhirnrinde und im Limbischen System, die die eigene Person repräsentieren, werden, da sie gleichzeitig Spiegelneurone sind, unwillkürlich aktiv, wenn wir anderen Menschen begegnen und sie in ihrem Handeln, Empfinden und Fühlen wahrnehmen. Dieses Resonanzphänomen, das unwillkürliche Mitschwingen ist die neurobiologische Grundlage und das Instrumentarium für intuitives emotionales Verstehen, aber auch für kognitive Lernprozesse.
Als Mitglied einer sozialen Gemeinschaft verfügen wir (sofern keine Ausgrenzung vorliegt) über ähnliche Erfahrungen. Dennoch sind Alltagsszenen und Kommunikation immer mehrdeutig. Und die Interpretationen sind immer mit eigenen Vorerfahrungen und der individuellen Geschichte verbunden. Die eigene Wahrnehmung bzw. Repräsentation eines anderen Menschen ist somit nicht mit ihm identisch, sondern ist immer ein Konstrukt; eine Hypothese, deren Basis unsere bisherigen Interaktionserfahrungen sind. Die ‚Theory of mind' kann durch vergleichbaren Erfahrungshintergrund gelingen. Dass jedoch Resonanz-phänomene nicht vor Irrtümern schützen, ist eine ebenso alltägliche Erfahrung wie die Resonanzphänomene selbst. Um zu vermeiden, dass aus unseren Hypothesen Gewissheiten und Zuschreibungen werden, muss dem intuitiven Verstehen durch wechselseitige Spiegelungen immer der persönliche Dialog zur Seite gestellt werden.
Der subjektiven, psychischen Erlebniswelt des Fühlens und Denkens anderer Menschen können wir uns nur in der zwischenmenschlichen Begegnung immer wieder ‚annähern'.
Wenngleich Geist, Gefühl und Interaktion eng mit Gehirnprozessen verflochten sind, haben sie doch noch eine andere Dimension, die sich nicht mit neurobiologischen Begriffen beschreiben oder auf bestimmte Regionen reduzieren lässt. Das ‚Feuern' von Nervenzellen ist keine Erklärung für Kommunikation und Verstehen, obwohl diese Erkenntnisse, dass unsere Physiologie auf Beziehung ausgerichtet ist, interessant sind. Geist, Gefühle und der Bereich des Zwischenmenschlichen werden durch die Rede über Neurotransmitter und systemisch-biologische Prozesse nicht erreicht. (vgl. Maturana in Pörksen 2002, 108) Die Psyche lässt sich aus der Neurophysiologie nicht erklären. In ihrer Ganzheitlichkeit sind Menschen nicht messbar, weder durch Tests, noch durch EEG oder bildgebende Verfahren; Maßstab kann nur das mitgeteilte subjektive Befinden sein.
Wolf Singer und Gerhard Roth weisen darauf hin, dass wir noch weit davon entfernt sind, die Komplexität des Gehirns zu verstehen. Es "weiß gegenwärtig noch niemand, wie sich aus den Prozessen im Gehirn das Geistige bildet." (Roth in Pörksen 2002, 163) Trotz des Zusammenhangs zwischen physiologischen Hirnprozessen und dem Phänomen des Geistigen lassen sich Geist, Bewusstsein und Resonanz nicht auf feuernde Nervenzellen reduzieren.
"Eine enge Korrelation zwischen dem Neuronalen und dem Mentalen bedeutet keine Identität, auch wenn die neuronale Aktivität unzweifelhaft eine notwendige Bedingung für Geistes- und Bewusstseinszustände darstellt." (ebd. 159)
Das Gehirn ist ein sich selbst organisierendes, "hoch nicht lineares System, mit all den Eigenschaften, die solche Systeme haben; d.h. es ist in die Zukunft hinein völlig offen, es bewegt sich in einem hoch dimensionalen Zustandsrahmen von einem Punkt zum nächsten"[7]; es erzeugt also unter Hinzunahme von Signalen aus der Umwelt immer neue Zustände, kann verschiedene Zustände gleichzeitig repräsentieren und sich mit unglaublicher Geschwindigkeit auf einen von ihnen einigen, wobei die verschiedenen Regionen reziprok gekoppelt sind und auf höchst komplexe Weise zusammenspielen.
Interaktionen selektieren die Strukturveränderungen, ausgehend von der gegenwärtigen Struktur. Wenn die bisherigen Beziehungserfahrungen sich ‚prägend' auf die Mikrostrukturen des Gehirns ausgewirkt haben, tun es alle weiteren auch. Neue Erfahrungen führen aufgrund der Plastizität zu Umstrukturierungen (vgl. Kap. 1.2.1 i.d.A.). Veränderungen lassen sich jedoch nicht auf bestimmte Erfahrungen rückschließen. "Der Fluß unserer Erfahrungen" wird gelenkt "von Zusammenhängen von Operationen unseres Nervensystems, zu denen wir als Beobachter keinen Zugang haben." (Maturana/Varela 1987, 250)
Lebende Systeme sind weder berechenbar noch steuerbar.
Von der Position des einzelnen Subjekts und seiner Interaktionen aus gesehen, habe ich in den vorangegangenen Kapiteln zu charakterisieren versucht, wie aus systemisch - konstruktivistischer Sicht Biologie und Sozialität ineinander greifen.
Wie lassen sich nun vor dem Hintergrund der Selbstorganisation und Selbstreferentialität des Individuums soziale Systeme und die sozialen Konstruktionen von Wirklichkeit verstehen?
Die Betrachtung sozialer Systeme ist weitaus schwieriger als die Auseinandersetzung mit einzelnen lebenden Systemen. Während nämlich ein lebendes System eine genau definierte Grenze hat, die es von seiner Umgebung unterscheidet, ist die Grenze eines sozialen Systems nicht in der Weise definierbar. Die Definition eines sozialen Systems ist nach dem Sozial-wissenschaftler Peter Hejl wesentlich die Konstruktion eines Beobachters, der auswählt und entscheidet, welche Gruppe von Individuen er als ein soziales System beschreiben möchte. (vgl. Hejl 1992, 129) Die kleinste Einheit, die ein soziales Systems konstituiert, ist immer und unhintergehbar das einzelne Subjekt (vgl.ebd., 144), das als selbstreferentielles, lebendes System definiert wurde, wobei es gleichzeitig mehreren sozialen Systemen angehört, welche dadurch gegenseitig beeinflusst werden. (vgl.ebd., 139) Gesellschaft kann nach Hejl als "ein Netzwerk sozialer Systeme" beschrieben werden, in dem die Individuen die "Schnittpunkte" der verschiedenen Systeme bilden. (ebd., 129/130)
Wie Maturana weist auch Hejl darauf hin, dass zur Charakterisierung sozialer Systeme ein Modelltransfer aus der Biologie nicht möglich ist, da es hier keine Entsprechung zu Selbsterhaltung und Selbstreferentialität gibt. (vgl. ebd., 133/134) Stattdessen schlägt er vor, soziale Systeme als "'synreferentiell' zu bezeichnen." (ebd., 136)
"Während ‚Selbstreferentialität' den Bezug auf die Zustände eines kognitiven Systems bezeichnet...hebt Synreferentialität den Bezug auf im Sozialsystem ausgebildete oder/und für es konstitutive Zustände hervor." (Hejl zit. nach Siebert 1998, 281)
Soziale Prozesse sollten als Prozesse der "Erzeugung von Realitätskonstrukten" (Hejl 1992, 111) und "auf sie abgestimmte Handlungen" (ebd., 112) verstanden werden.
Durch wechselseitige Interaktionen (mit entsprechenden wechselseitigen Veränderungen), die "zu einer partiellen ‚Parallelisierung' " der selbstreferentiellen, interagierenden Subjekte im Sinne von unterstellten, vergleichbaren Realitätskonstrukten führen, entstehen "soziale Bereiche." (ebd., 124)
Soziales Verhalten versteht Hejl als "jedes Verhalten, das auf der Basis einer sozial erzeugten Realitätsdefinition oder -konstruktion hervorgebracht wird oder das zu ihrer Bildung oder Veränderung führt." (ebd., 125) Als Merkmal sozialer Systeme zur Abgrenzung von anderen Systemen hebt er "die notwendige Ausbildung parallelisierter Zustände in den interagierenden lebenden Systemen" hervor:
"Diese parallelisierten Zustände lebender Systeme, die man als physiologische Basis sozial erzeugter gemeinsamer Realitäten, von Sinn und Bedeutung, annehmen kann, sind Resultat sozialer Interaktionen und die Bedingung weiterer Interaktionen der gleichen Art." (ebd., 135/136)
Während nach Hejl bei einem ‚sozialen System' die Möglichkeit zur Mitgestaltung an den Konstruktionen sowie direkte Interaktionen gegeben sein müssen, ist bei einem ‚sozialen Bereich' lediglich das Handeln auf die gemeinsam geteilten Realitätskonstruktionen (z.B. Regeln beim Fußball etc.) hin ausreichend. (vgl., ebd. 128)
Lindemann und Vossler weisen wiederholt darauf hin, dass die ‚Gemeinsamkeit' von Realitätskonstruktionen der Systemmitglieder eine unterstellte ist. Diese unterstellten Gemeinsamkeiten in Form von Sprache, Konventionen, Handlungen usw., von denen wir annehmen, dass die anderen Systemmitglieder sie zumindest ähnlich konstruieren, ermöglichen uns u.a. Handlungsplanung und das Abschätzen von Handlungsfolgen. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 87)
Je mehr Systemmitglieder bestimmte Handlungs- und Denkweisen ‚teilen', desto stabiler werden diese. Von Kultur sprechen Maturana und Varela bei typischen "Verhaltenskonfigurationen" einer sozialen Gemeinschaft, die in einer langen Interaktionsgeschichte vieler Subjekte über Generationen entstanden sind. (Maturana/Varela 1987, 218)
"Kultur reproduziert einmal gefundene Problemlösungen über Sozialisation, Riten und Feiern, Mythen, Tabus usw. und sichert damit die Identität einer Gesellschaft. Kultur kontrolliert die Handlungsmöglichkeiten der Individuen und ermöglicht damit die soziale Integration - oder eben auch ihren Ausschluß aus sozialen Systemen. Insofern ist der Mensch Schöpfer aller Kultur, aber jeder Mensch Geschöpf einer spezifischen Kultur." (Schmidt in Lindemann/Vossler 1999, 88)
Individuelle Konstruktionen sind also immer eingebettet in die kulturellen Konstruktionen, stehen in Bezug zu ihnen, sind aber nicht identisch.
Hejl konstatiert bei synreferentiellen Systemen eine Tendenz zum Konservatismus (vgl. Hejl 1992, 136), die darauf zurückzuführen ist, dass deren Komponenten, die einzelnen Individuen, ihre Denk- und Handlungsweisen nur ändern, wenn sie keine befriedigenden Ergebnisse mehr bieten. (vgl. Kap. 1.1.1.2 i.d.A.) Ist dies nur für wenige Subjekte der Fall, kommt es kaum zu Veränderungen im sozialen System, da die anderen Subjekte ihr Verhalten, das ihnen als sinnvoll und angemessen erscheint, beibehalten.
Reich nennt dies die "Macht von Rekonstruktionen." (Reich 2005, 146) Rekonstruktionen als bereits vorhandene "Strukturen, Lebensformen, als Zivilisation, Kultur, als Denk- und Verhaltensmuster" (ebd.), in die wir hineingeboren sind und die wir uns konstruktiv aneignen (vgl. Kap. 1.1.1.3 i.d.A.), beschränken und bestimmen gleichzeitig die weiteren Konstruktionen. Da wir unsere Welt durch Begriffe ordnen und uns gegenseitig "über Sprache verständigen, wird die Sprache als rekonstruktiver Ort von Verständigungsleistungen wesentlich." (Reich 2005, 169, eigene Hervorh.)
Gleichzeitig ist aber auch der soziale Wandel ein Phänomen sozialer Systeme. Nach Hejl kann er dadurch erklärt werden, dass Menschen unterschiedlichen sozialen Systemen angehören und dabei unterschiedliche Erfahrungen machen, die sie jeweils wieder (bewusst oder unbewusst) in die verschiedenen Systeme hineintragen. Neue Blickwinkel und kreative Handlungen lösen Irritation und möglicherweise Veränderung (Dekonstruktion) aus. Letztlich entscheidet die Anzahl der Systemmitglieder, die ihr Verhalten ändern oder neue Denkmuster entwickeln, darüber, ob es zu einem Wandel im gesamten System kommt. Gleichzeitig ist eine Veränderung von Realitätsdefinitionen von den Gestaltungsmöglichkeiten der Systemmitglieder abhängig und in diesem Sinne eine Frage der Machtverhältnisse innerhalb des Systems. (vgl. Hejl 1992, 139 - 142)
Die Dynamik sozialer Systeme entsteht "aus dem Zusammenwirken der sie konstituierenden Subjekte":
"Die Konstruktion sozialer Wirklichkeit, wie sie von einzelnen durchgeführt wird und die soziale Konstruktion von Wirklichkeit, wie sie in der Interaktion der einzelnen Gesellschaftsmitglieder entsteht, sind nicht von einander zu trennen." (Lindemann/Vossler 1999, 89)
[1] Lt. Glasersfeld wurde der engliche Ausdruck fit statt mit ‚passen', mit ‚tüchtig' übersetzt (vgl. Glasersfeld 1987, 200/201)
[2] Wolf Singer in der Ö1 Rundfunk Sendung: "Im Gespräch" am 27.10.2005; er ist Direktor des Max Planck Instituts in Frankfurt und einer der herausragenden Neurophysiologen und Hirnforscher Europas;
[3] Die größte Anzahl von Nervenzellen haben menschliche Embryonen mit drei Monaten (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 27). Lt. Bauer kommt es gegen Schluss der Schwangerschaft zu einer "explosionsartigen Vermehrung von Synapsen im Gehirn des Föten, die sich nach der Geburt noch fortsetzt und erst am Ende des ersten Lebensjahres abgeschlossen ist." (Bauer 2004, 62)
[4] Joachim Bauer in seinem Vortrag: "Das Gedächtnis des Körpers" am 18.11.2005 im ORF Studio in Dornbirn (Vlbg.).
[5] Aus eigener Mitschrift bei der LV "Entwicklung im Netzwerk" von Dr. Hans A. von Lüpke, WS 2005/2006, Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck
[6] Wolf Singer in der Ö1 Rundfunk Sendung "Im Gespräch" 27.10.2005
[7] Wolf Singer in der Ö1 Rundfunk Sendung "Im Gespräch" 27.10.2005
Inhaltsverzeichnis
Seit Newton haben wir uns daran gewöhnt, Wirklichkeit mit der Sichtweise der Mechanik zu interpretieren, nach der die Welt und Menschen überschaubar, berechenbar und somit scheinbar ‚regelmäßig' funktionieren. Ein sicheres Terrain, das im Alltag auch durchaus relative Gültigkeit hat.
Die Erkenntnisse des Konstruktivismus, der Systemtheorie und der Neurophysiologie sind eine Anregung zum Wagnis eines Brillenwechsels und eine Einladung zu einem radikal (im Sinne von radix = Wurzel) anderen Denken, das unsere vertrauten, alltäglichen Gewohnheiten verrücken, etablierte Ordnungen stören und neue Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsräume eröffnen kann. Sie sind aber gleichzeitig mit Risiko verbunden - denn hier lauern Unsicherheiten und Paradoxien.
Sie als Ausgangspunkt und Bezugsrahmen zu nehmen, beinhaltet nicht nur eine grundlegend andere Sichtweise wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, Lernprozesse und pädagogisches Handeln, aber auch unsere Beziehungen im täglichen Leben aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wahrzunehmen und zu gestalten.
Indem die Systemtheorie die Beziehungen zwischen Lebewesen und Lebensraum thematisiert, weist sie außerdem über einen verkürzten anthropozentrischen Blickwinkel hinaus auf die Vernetzung alles Lebendigen. In der Anerkennung der Komplexität der Koevolution, die lebende Systeme in ihrer Eigendynamik und ihren Wechselwirkungen miteinander als nicht durchschaubar und somit als nicht berechenbar, nicht steuerbar und unvorhersehbar begreift, liegt auch ein Verweis auf die Anerkennung der Begrenztheit unseres Wissens.
Hier lässt sich eine Parallele mit den Einsichten der Quantentheorie beobachten, die das Universum als "ein ungeheuer komplexes und labiles, multikausales Netzwerk" erahnt. "Alles scheint mit allem auf rätselhafte Weise verwoben."[8]
"Die alte Vorstellung war ja die, dass die Wirklichkeit da draußen eine objektive Realität ist und dass es nur darauf ankommt, sie genauer eben zu erkennen und in ihrer Gesetzmäßigkeit zu sehen." [9]
Dieser erhoffte deterministische Gesamtzusammenhang, der als Ganzes zu erfassen und zu beschreiben wäre, scheint jedoch nicht zu gewährleisten zu sein. Man könnte vielleicht sagen, mit dem Erkennen, wie wir erkennen, schwindet die Hoffnung auf objektive Erkennbarkeit. Denn der Konstruktivismus erklärt uns, dass uns Erkennen nur durch Unterscheidungen möglich ist, die wir in die Welt hineinschreiben. Ähnlich hört sich Hans-Peter Dürr an:
"Wir sind verliebt in die Schärfe, aber wir übersehen dabei, dass jede Aussage über die Schärfe bedeutet, dass ich das, was ich scharf sehen will, isolieren muss, aus dem Kontext reißen muss. Nämlich nur das Isolierte kann man scharf fassen. Wenn ich es aber aus dem Kontext reiße, dann verlier' ich die Sichtweise seiner Beziehung zum Umfeld, also die Vernetzung" [10] "und zerstöre damit den unsichtbaren Zusammenhang der Welt."[11]
Vom Beobachter favorisierte Teilaspekte des Erkannten, die nicht durch die ‚Unschärfe' der Nichtdurchschaubarkeit des Gesamtbildes ergänzt werden, haben Fragmentierung, Polarisierung und Zersplitterung zur Folge. Eine objektive Sicht der Dinge ist nicht möglich. Ordnung, lineare Kausalketten und Kontrolle gehören eher zu den Ausnahmeerscheinungen im Universum.
Sowohl die moderne Biologie wie die Quantentheorie weisen auf die Grenzen des traditionellen materialistisch-mechanistischen Weltbildes von Machbarkeit, Berechenbarkeit, Kontrollierbarkeit und Prognostizierbarkeit hin, das mit dem menschlichen Wunsch nach Objektivität und Sicherheit verbunden ist.
"Die Zukunft liegt nicht fest, die Zukunft ist offen. Das alte Schöpfungswerk ist nicht abgeschlossen"[12], sondern hält unendlich viele Möglichkeiten der Ausprägung bereit. In der Anerkennung, dass wir Menschen im dynamischen und letztlich unkontrollierbaren Netzwerk des Lebens nur ein Teil sind, können wir diese Möglichkeiten mit kreativen Impulsen mitgestalten. Diese Haltung würde allerdings eine Gesundschrumpfung des überhöhten menschlichen Selbstbildes voraussetzen, die aber ein Bewusstsein für die Fragilität des Gleichgewichts und eine Sensibilisierung für den notwendig respektvollen Umgang mit allen Lebensformen begünstigt.
Denn sowohl auf der Ebene der Quanten als auch in der Struktur des Lebendigen hat sich dieses dynamische Netzwerk seit Jahrmillionen nicht nur im Kampf und in der Konkurrenz erhalten und weiterentwickelt, sondern vor allem durch eine fein austarierte Kooperation, von der die Wissenschaftler der Potsdamer Erklärung den Mut haben, sie mit dem, im wissenschaftlichen Jargon unüblichen Begriff der ‚Liebe' zu verbinden.[13]
Um nun auf die Ebene des menschlichen Bereiches zurückzukommen, auch Maturana und Varela verwenden in Bezug auf die konstitutive soziale Struktur der Menschen den Begriff Liebe, im Sinne der Anerkennung des anderen Menschen.
"Dies ist die biologische Grundlage sozialer Phänomene: Ohne Liebe, ohne daß wir andere annehmen und neben uns leben lassen, gibt es keine Menschlichkeit. Alles, was die Annahme anderer untergräbt - vom Konkurrenzdenken über den Besitz der Wahrheit bis hin zur ideologischen Gewißheit - unterminiert den sozialen Prozess, weil es den biologischen Prozess unterminiert, der diesen erzeugt." (Maturana/Varela 1987, 266)
Die Autoren plädieren nicht für Liebe im Sinne eines Imperativs. Sie machen aber darauf aufmerksam, "daß es biologisch gesehen, ohne Liebe, ohne Annahme anderer, keinen sozialen Prozess gibt." (ebd.)
Meines Erachtens steht diese Definition sozialer Prozesse nicht unbedingt im Widerspruch zu den Ausführungen Hejls. Während er sich jedoch ausschließlich auf die kognitive und die Handlungsebene bezieht (Erzeugung von Realitätskonstruktionen und auf sie abgestimmte Handlungen, vgl. Kap. 1.2.3 i.d.A.) verstehen Maturana/Varela Emotionen als Fundament und bestimmende Kraft sozialer Koppelung; bilden sozusagen Emotionen bei ihnen die Voraussetzung für die Hervorbringung vergleichbarer Realitätskonstruktionen. Natürlich "finden sich im gemeinschaftlichen Leben" verschiedenste Emotionen. Jedoch, "die Emotion, die soziales Leben konstituiert, ist nicht Hass, ist nicht das Eigeninteresse und die Gier, nicht die Konkurrenz und die Aggression, sondern die Liebe", so Maturana. (Maturana/Pörksen 2002, 215)
Unser Handeln in zwischenmenschlichen Beziehungen ist immer rückgebunden an das Bild, das wir vom anderen Menschen haben. Während diese Menschenbilder, entstanden in unseren Interaktionserfahrungen, meist implizit und nicht hinterfragt sind, finden sich in den bisher ausgeführten Theorien explizite Aussagen über den Menschen. Bevor ich versuchen werde, diese Aussagen in einem Menschenbild zusammenzufassen, gilt es den Begriff Mensch zu klären. Dabei schließe ich mich der Definition von Lindemann und Vossler an:
"Die Bezeichnung ‚Mensch' stellt für uns einen Gattungsbegriff dar. Mensch sein bedeutet daher lediglich die Zugehörigkeit zu dieser Gattung. Die Voraussetzung dafür besteht darin, von anderen Menschen gezeugt worden zu sein, so daß ab dem Zeitpunkt der Zeugung alle Kriterien des Menschseins gegeben sind." (Lindemann/Vossler 1999, 91)
Diese Definition bezieht sich auf die Theorie lebender Systeme, bei welcher die Zuordnung zu einer Gattung, wie beispielsweise der des Menschen, nach Merkmalen der Organisation erfolgt, unabhängig davon, wie sie konkret verwirklicht wird. (vgl. Kap. 1.2.1 i.d.A.) Selbstreferentielle Systeme haben "keinen, außerhalb ihrer selbst liegenden Zweck." (Maturana/Pörksen 2002, 100)
Diese Definition grenzt sich damit gegen Konzepte ab, die weitere Bedingungen, wie bestimmte Fähigkeiten, Nützlichkeit, Gesundheit, Bewusstheit usw. stellen, um das Recht zu haben, als vollwertiger Mensch betrachtet zu werden.
Jegliche Aussagen, die sich auf das subjektive Empfinden eines anderen Menschen, dessen Lebenswirklichkeit (Sinn, Leid, etc.), kognitive Fähigkeiten oder Lebenswert beziehen, sind aus systemisch-konstruktivistischer Sicht nicht möglich und werden konsequent als Zuschreibungen eines Beobachters (ausgehend von dessen Werteskala und Präferenzen) herausgestellt.
Solche Bewertungen sind mit der Autonomie des Menschen unvereinbar. Es lassen sich weder qualitative noch quantitative Unterschiede in der Eigengesetzlichkeit verschiedener Subjekte festsetzen. Sie ist unteilbar.
Nach Maturana kann niemand einen privilegierten Zugang zu einer externen Wirklichkeit oder Wahrheit für sich beanspruchen. Wirklichkeit ist immer etwas durch Kommunikation und Konstruktion Gestaltetes. Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit nach internen Prinzipien (Selbstorganisation, Zustandsdeterminiertheit) und Kriterien (Konsistenz, Plausibilität, Viabilität) und in Bezug auf ihren sozialen Kontext (Perturbationen, Spiegelphänomene, Anerkennung). Ihre Sichtweise und ihr Handeln ist für sie auf der Basis ihrer Lebenswirklichkeit und ihrer Lebenserfahrungen subjektiv sinnvoll. Unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen von Menschen sind somit als gleichwertig zu betrachten. Jene der anderen als falsch oder die eigene aufgrund größerer Nähe zur Realität als höher oder richtiger zu bewerten, lässt sich von einem konstruktivistischen Standpunkt aus nicht begründen, da wir zu ihr keinen Zugriff haben. Die Argumentation, dass die eigene Ansicht auch von anderen Menschen vertreten werde, bezieht sich lediglich auf deren intersubjektive Plausibilität. Mit Glasersfeld reicht diese aber nicht an die Ontologie heran.
"Alle Wirklichkeitskonstruktionen sind weder ‚richtig' noch ‚falsch' im Sinne eines ‚richtigen' Erfassens einer unabhängig existierenden Wirklichkeit. Sie sind mögliche, passende, ‚viable' (...) Sichtweisen (...)." (Voß 1998, 19)
Gleichwertigkeit bedeutet allerdings nicht Beliebigkeit oder wertfreie Akzeptanz aller Wirklichkeitskonstruktionen. Sie bedeutet vielmehr relative Gültigkeit hinsichtlich der Viabilität in dem jeweiligen Bezugsrahmen. Es geht um die grundlegende Wertschätzung und Anerkennung der individuellen Lebenswirklichkeit, die aus der Sicht des Subjekts zu der Zeit, in dem entsprechenden Bereich und aufgrund der jeweiligen Geschichtlichkeit plausibel ist.
Auf dieser subjektiven Ebene sind wir auch für unsere eigenen Konstruktionen und den damit verbundenen Handlungen verantwortlich. Diese Verantwortung bezieht sich nicht auf die Umstände, unter denen die Konstruktionen entstanden sind, sondern auf die Konsequenzen, die ein Subjekt - bewusst oder unbewusst - daraus gezogen hat, also auf den Prozess der eigenen Entwicklung und deren Ergebnisse.
Da wir zwar ähnliche Strukturen zum Aufbau von Wirklichkeitskonstruktionen haben, deren Ausdifferenzierung aber von unseren Erfahrungen abhängt, die selbst dann unterschiedlich sein werden, wenn wir in der gleichen Familie aufgewachsen sind, ist die logische Konsequenz die lebensgeschichtlich entstandene Verschiedenheit und Vielfalt von Wirklichkeitsentwürfen und Denkstilen.
In dieser spannenden Vielfalt liegt auch eine fundamentale Unsicherheit des gegenseitigen Verstehens in der Begegnung mit anderen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Verstehen die Ebene der Unterstellung nie verlässt.
Gleichzeitig bedürfen wir aber dieser Begegnung dringend. Denn trotz bzw. neben Selbstreferentialität und Autonomie ist jeder Mensch gleichzeitig in hohem Maß auf die Bestätigung und Anerkennung durch andere Menschen angewiesen, und zwar so sehr, dass wir uns überhaupt nicht ohne positive Beziehungen, im Sinne von gegenseitiger Anerkennung, entwickeln können. (vgl. Kap. 1.2.2 i.d.A.) Wenn Autonomie jedoch als Eigengesetzlichkeit und nicht als getrennt sein oder unabhängig sein betrachtet wird, ist die Paradoxie, die im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Interdependenz gesehen werden könnte, nur noch eine scheinbare.
Das typische Phänomen lebender Systeme ist, dass sie aufgrund ihrer Selbstorganisation und im Wechsel zwischen Stabilität und Veränderung nicht regelhaft, nicht linear und nicht steuerbar sind, sondern unberechenbar und unvorhersagbar. Auch hier gilt - der menschliche Entwicklungsprozess ist nicht abzuschließen - die Zukunft ist offen!
Verschiedene Betrachtungsweisen von Menschen führen zu unterschiedlichen Aussagen über sie. Diese Menschenbilder bilden wiederum die Grundlage dafür, wie wir uns gegenseitig begegnen und welche Schlüsse wir aus diesen Begegnungen ziehen.
Den Perspektivenwechsel im Menschenbild systemisch-konstruktivistischer Theorien im Gegensatz zu anderen Menschenbildern möchte ich deshalb mit einem Erklärungsmodell von Heinz von Foerster verdeutlichen.
In seiner kybernetischen Erkenntnistheorie[14] nutzt Heinz von Foerster die konzeptionelle Unterscheidung von trivialenundnicht-trivialen Maschinen um unterschiedliche Stufen der Komplexität von Systemen zu bezeichnen. Da es sich um ein abstraktes Modell handelt, wird der Begriff Maschine auch für Menschen verwendet.
Triviale Maschinen operieren in einer bekannten und eindeutigen Beziehung zwischen Ursache und Wirkung immer auf die gleiche Weise. Sie reagieren auf einen bestimmten Input fehlerfrei mit einem bestimmten Output. Unabhängig von ihrer Struktur setzen sie eine spezifische Ursache in eine entsprechende Wirkung um. Nach der Eingabe eines Inputs kann also kausal und linear mit dem gewünschten Output gerechnet werden. Triviale Maschinen sind somit vergangenheitsunabhängig, verlässlich, berechenbar und somit prognostizierbar. Sie sind der Inbegriff unserer Sehnsucht nach Sicherheit. Die meisten mechanischen Apparate, die wir im Alltag verwenden, funktionieren so, obwohl sie nicht gänzlich trivial sind, weil sie sich abnützen. (vgl. von Foerster 1992, 61-66)
Fragt sich, was eine derart mechanistische Darstellung mit Menschen zu tun hat. Dennoch glaube ich, dass im Umgang mit Menschen manchmal ähnlich gehandelt wird. In jeder Situation beispielsweise, in der wir bei einem Gegenüber mit Hilfe eines Inputs (Information) einen bestimmten Output (Verhalten) erreichen wollen, erwarten wir von einem Menschen dieselbe Funktionsweise. In einer ironischen und gleichzeitig berührenden Weise erklärt Heinz von Foerster:
"Eine triviale Maschine besteht darin, dass sie immer wieder brav dasselbe macht, was sie ursprünglich macht (...). Das ist das nette an einer trivialen Maschine. (...) Das geht so weit mit unserer Verliebtheit in triviale Maschinen, dass wir die sehr unvoraussagbaren und völlig überraschenden Menschen, die gewöhnlich unsere Kinder sind, in Trivialisationsinstitute schicken, sodass, wenn man das Kind fragt, 2 mal 2, wieviel ist das, sagt es nicht grün, sondern sagt brav 4. Dann wird es ein Mitglied der Menschengesellschaft."[15]
Heinz von Foerster thematisiert hier unverblümt traditionelles pädagogisches Handeln und gleichzeitig indirekt dessen implizite Defektlogik. Nur wer die Kriterien erfüllt, also das erwartete Verhalten nach als richtig definierter pädagogischer Maßnahme zeigt (in der Extremform stellt dies der Frontalunterricht dar, der mit einem Input bei allen Anwesenden den gleichen Output erreichen will), ist berechtigt, in dieser sozialen Gemeinschaft (Schule) zu bleiben. Da diese Sichtweise das Wissen um den richtigen Input für sich beansprucht, wird die Ursache für ein als falsch angesehenes Verhalten der Person angelastet, die das erwartete Verhalten nicht zeigen kann oder will. Sie ist folglich weniger intelligent oder sogar gestört bzw. behindert. Überspitzt formuliert, oder in der Ausdrucksweise Heinz von Foersters, wird diese Person dann zur Korrektur in für den jeweiligen Defekt spezialisierte ‚Trivialisationsinstitute' geschickt, in der Hoffnung, mit der wiederum als richtig definierten Methode doch noch irgendwann die gewünschte Leistung der Maschine (des Menschen) heraus zu bekommen.
Von einer ähnlichen Denkweise scheint mir auch der Behaviorismus auszugehen, wenn er sich ausschließlich auf die beobachtbaren Elemente der Interaktion (Stimulus und Verhalten) konzentriert und die Berücksichtigung innerer Prozesse aufgrund ihrer Unbeobachtbarkeit ablehnt. Auch hier wird ein Menschenbild vertreten, das von einer direkten Beeinflussbarkeit von außen ausgeht. Diese Haltung zeigt sich in den Methoden der positiven und negativen Verstärkung, Konditionierung usw. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 98; sowie Hejl 1992, 116) Ein geschlossener Kreis von Reiz/Stimulus/Input und Reaktion/Verhalten/Output. Der Mensch als Reaktionswesen.
Die innere Dynamik der Zustände ist zwar nicht beobachtbar, sie deshalb aber unberücksichtigt und ungewürdigt zu lassen, ist nach Maturana irreführend (vgl. Kap. 1.2.1 i.d.A.) und kann die Grundlage für folgende Annahmen bilden: dass Menschen von außen direkt beeinflussbar sind; dass Außenstehende (Beobachter) wissen können, welches ein richtiger Input ist und dass durch dessen Anwendung auch der erwartete (richtige) Output erreicht werden kann.
Mit der Darstellung des Modells trivialer Maschinen soll niemandem unterstellt werden, bewusst auf der Basis eines derart reduktionistischen Menschenbildes zu handeln. Sie soll lediglich verdeutlichen, dass sich auf der Grundlage dieses Modells Annahmen beschreiben lassen, die sich vom folgenden Menschenbild radikal unterscheiden.
Im Unterschied zu trivialen Maschinen ist die Operationsweise nicht-trivialer Maschinen nicht festgelegt. Sie hängt "von ihren jeweiligen ‚inneren Zuständen'" ab, "die selbst wieder von den vorangegangenen Operationen beeinflusst werden." (von Foerster 1992, 62) Sie ist somit vergangenheitsabhängig und kann ständig neue, unterschiedliche Ursache-Wirkungs- Verbindungen herstellen. Denn mit jedem Input, aber auch jedem Output, den diese Maschine erzeugt, verändert sich ihr innerer Zustand und damit auch die Grundlage für die weiteren Prozesse. Da diese inneren Zustände also variabel sind, ist es unmöglich, die Auswirkungen eines bestimmten Inputs vorherzusagen. Kausalität und Finalität sind durch die Rekursivität aufgehoben bzw. relativiert. Die Operationsweise nicht-trivialer Maschinen ist somit wesentlich komplexer als jene trivialer Maschinen und folgedessen der Umgang mit ihnen auch weitaus schwieriger.
Das Modell nicht-trivialer Maschinen entspricht dem Modell lebender selbstreferentieller Systeme (vgl. Kap. 1.2 i.d.A.). Solche Systeme haben gar keinen Input im Sinne trivialer Maschinen. Äußere Ereignisse, Perturbationen genannt, stellen lediglich Auslöser für interne Zustandsmodifikationen und Veränderungsprozesse dar, die auf der Basis der momentanen inneren Struktur und der Systemvergangenheit rekursiv verarbeitet werden. Da diese Struktur als nicht beobachtbar beschrieben wurde und sie sich zudem fortlaufend verändert, ist es unmöglich vorauszusagen, welche Auswirkungen ein Ereignis für ein solches System hat und folglich auch, welches Verhalten es darauf erzeugen bzw. zeigen wird. Aufgrund der operationalen Geschlossenheit ist es nicht einmal möglich zu bestimmen, ob ein bestimmtes Ereignis überhaupt systemrelevant und anschlussfähig ist und somit eine Perturbation für das selbstreferentielle System darstellt. Menschen als selbstreferentielle Systeme sind demnach von außen nicht in eine gewollte Richtung steuerbar. Sie können nicht kausal instruiert, sondern nur angeregt werden. (vgl. Voß 1998, 19)
Diese Sichtweise betrachtet Menschen als GestalterInnen ihrer eigenen Lebenswelt und Lebenswirklichkeit und ihrer Entwicklung. Welche Folgen hat sie aber für den Umgang mit Menschen?
Meines Erachtens begünstigt sie eine Haltung, die Wirklichkeitskonstruktionen und Handlungsmuster im Lichte der jeweiligen Lebens- und Interaktionserfahrungen innerhalb eines spezifischen sozialen Kontextes sieht und als bisheriges Ergebnis der Entwicklung respektiert und ernst nimmt. Was Menschen sagen und tun, ist für sie sinnvoll und kann deshalb nicht als falsch bezeichnet werden. Wenn es für andere merkwürdig erscheint, bedeutet dies nur, dass es in einen anderen Bereich der Logik gehört als dem, auf dessen Grundlage die Beurteilung vorgenommen wird. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 140) Das Gesagte als falsch zu bezeichnen, würde eine Beleidigung darstellen (vgl.Glasersfeld zit. nach Lindemann/Vossler 1999, 173), da es die subjektive Wirklichkeit der/des Anderen negiert und ihre/seine eigenen Leistungen und Erfahrungen abwertet.
Veränderung geschieht, wenn für das Subjekt selbst die momentanen Konstruktionen und Handlungsweisen aufgrund eines Perspektivenwechsels nicht mehr passen oder hinderlich sind. Gleichzeitig kommen die Anregungen anderer, wenn sie attraktiv und anschlussfähig sind, dabei aber ins Spiel. Veränderung ist ein koevolutiver Prozess, individuelle Wirklichkeit ist immer auch soziale Wirklichkeit. Wir sind in komplexer und dynamischer Weise mit unserem Umfeld verwoben.
Es wird in dieser Sichtweise berücksichtigt, dass lediglich das Verhalten beobachtbar ist, dieses aber noch nichts über die inneren Strukturen aussagt. Nach Maturana dürfen diese beiden Bereiche nicht vermischt werden (vgl. Kap. 1.2.1 i.d.A.). Es gibt für einen Beobachter keinen direkten Zugang - weder die emotionalen Prozesse noch die kognitiven Funktionen sind beobachtbar und können deshalb keinem Menschen abgesprochen werden. Zudem wird das Verhalten eines Menschen vom Beobachter immer auf der Grundlage seiner eigenen Struktur und der favorisierten Unterscheidungen wahrgenommen und bewertet. Das bedeutet, dass die eigenen Denk- und Handlungsweisen reflektiert und in die Wahrnehmung anderer mit einbezogen werden müssen.
Weiters ist Verhalten immer auf die Umwelt gerichtet, es ist relational. "(...) Jede Handlung (ist, d.Verf.) in eine Dynamik der Beziehungen eingebettet." (Maturana/Pörksen 2002, 127) Das gezeigte Verhalten ist somit kontextbezogen und die Wechselwirkung der in Beziehung stehenden Menschen stellt einen wesentlichen Faktor dar. Es könnte sein, dass sich ein Mensch in einem anderen Kontext ganz anders verhalten würde.
Diese Sichtweise begünstigt gerade aufgrund der Unbestimmbarkeit und nie ganz durchschaubaren Rätselhaftigkeit der/des Anderen den Dialog, das Kennenlernen, Hinhören und sich Öffnen für diese andere Wirklichkeit, statt sich des anderen Menschen zu bemächtigen, ihn zu verdinglichen und Angleichungsprozessen zu unterwerfen.
Maturana und von Foerster wählen für dieses Phänomen des Inter - esses (Zwischen sein), das einem Dialog zugrunde liegt, die Metapher des Tanzes.
"Man begegnet einem anderen stets in einem Bereich fundamentaler Unsicherheit; und alles was bleibt, ist der Versuch, eine Form der Existenz zu kreieren, die einen gemeinsamen Tanz ermöglicht." (Maturana/Pörksen 2002, 132)
In dieser Art des Dialogs geht es nicht mehr um die "prinzipiell unentscheidbare Frage", wer Recht hat, weil sie auf Referenzen nach außen, da nicht verfügbar, verzichtet. Die Frage ist vielmehr: "Mit wem tanzt du deine Geschichte." (von Foerster 1990)
Beide Autoren bemerken, dass es aus systemisch-konstruktivistischer Sicht jedoch unmöglich ist, subjekt- und situationsunabhängige, allgemein gültige Empfehlungen für ethisches Handeln zu formulieren. Diese Erkenntnistheorien erklären Prozesse der Wahrnehmung, des Wissenserwerbs und der Interaktion. Wie wir diesen Erkenntnissen aber im Handeln und im Umgang mit Menschen Rechnung tragen können, ist eine persönliche Entscheidung und Verantwortung. Ein unabhängig vom Kontext voraussagbares ‚richtiges' Handeln müsste sich ja wieder auf eine äußere Referenz beziehen und stünde somit im Widerspruch zur Theorie, der es gerade darum geht, wach zu sein gegenüber der Versuchung von Gewissheiten.
Der ethische Wert einer Handlung kann nicht vorweggenommen oder generell geklärt werden, wie es in Imperativen zum Ausdruck käme.
"Gebote irgendwelcher Art haben die fatale Eigenschaft, einen immer an den Rand des Missionarischen und Tyrannischen zu manövrieren." (Maturana/Pörksen 2002, 214)
Allgemein gültige ethische Forderungen mit dem Anspruch auf Wahrheit nähmen den Menschen die Verantwortung für ihr Handeln ab, indem sie sich auf die formulierte Objektivität stützen könnten.
Nach Buber verstellt Moral das gegenwärtige Antlitz des Mitmenschen. In der "'objektiven' Dichtigkeit" eines moralischen Prinzips "lauert das Ein-für-alle-mal, das dem unvorhersehbaren Augenblick widersteht." (Buber 1992, 165)
"Jede lebendige Situation hat (...) trotz aller Ähnlichkeit ein neues Gesicht, nie dagewesen, nie wiederkehrend. Sie verlangt eine Äußerung (...), die nicht schon bereitliegen kann. (...) Sie verlangt Gegenwart, Verantwortung, dich." (Buber 1995, 84)
Mit Bezug zur Aussage Wittgensteins: "Es ist klar, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt" (Wittgenstein zit. nach von Foerster 1990) geht von Foerster davon aus, dass es nur möglich sei, Ethik in der Sprache und in jeder Handlung offenbar werden zu lassen. "Ich möchte Sprache und Handeln auf einem unterirdischen Fluß der Ethik schwimmen lassen (...), sodass Ethik nicht explizit zu Wort kommt und Sprache nicht zur Moralpredigt degeneriert", Sprache und Handeln aber dennoch durch sie bestimmt sind. (von Foerster, ebd.)
Die Unsicherheit bleibt also und die Verantwortung liegt bei jeder/m Einzelnen. Diese Verantwortlichkeit, die aus der Reflexion der eigenen Handlungen und der Akzeptanz der für sie angenommenen Konsequenzen entsteht, nennt von Foerster ‚implizite Ethik'.
Ähnlich äußert sich Maturana:
"Die Biologie sagt uns nicht, was wir tun müssen."(Maturana/Pörksen 2002,220) Sie erklärt uns lediglich die biologische und soziale Struktur des Menschen; nämlich, dass wir nur im Netzwerk von Strukturkoppelungen existieren und es "ohne Annahme anderer, keinen sozialen Prozeß gibt". (Maturana/Varela, 1987, 266) Die implizite Ethik in den Erkenntnissen der Biologie stellt "die Reflexion, die das Menschliche ausmacht, als ein konstitutives soziales Phänomen in den Mittelpunkt." (ebd., 264)
"(...) aber wer einen Imperativ formuliert, der verkehrt Ethik in Moral. (...) Ein Moralist tritt für die Einhaltung von Regeln ein, sie erscheinen ihm als eine externe Referenz (...). Es fehlt ihm ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung. Wer als Moralist agiert (...), weiß mit Gewissheit, was zu tun ist und wie sich die anderen eigentlich verhalten müssten. Wer dagegen als Ethiker handelt, der nimmt den anderen wahr. (...)
In jedem Fall taucht die Möglichkeit der Ethik (...) erst dann auf, wenn man den anderen Menschen als einen legitimen anderen sieht und sich mit den Konsequenzen befasst, die das eigene Handeln für ihn und sein Wohlbefinden haben könnte. Ethik gründet sich auf Liebe." (Maturana/Pörksen 2002, 221)
Pädagogisches Handeln bezieht sich immer auf andere Menschen. Der, den unterschiedlichen Menschenbildern immanenten, Logik des Handelns, die ich in diesem Kapitel thematisiert habe, werde ich nun mit Bezug auf die Pädagogik weiter nachgehen.
Gleichzeitig möchte ich mich mit der Frage auseinander setzen, wie trotz nicht erhaltener expliziter Handlungsanleitungen die systemisch-konstruktivistische Sichtweise für pädagogisches Handeln fruchtbar werden kann.
2.2 Pädagogik[16] im Hinblick auf die Nichtsteuerbarkeit und Nichtprognostizierbarkeit von Entwicklungsprozessen
"Pädagogik (...) bezeichnet die Lehre, Theorie und die Wissenschaft von Erziehung und Bildung (...)." (Lenzen 1989, 1107) Sie hat ihre Wurzeln in der Tradition der Geisteswissenschaften. Das zentrale Thema pädagogischer Forschung und Theoriebildung kann mit dem ‚Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft' grob umrissen werden. Die Sichtweise dieses Verhältnisses ist eng verknüpft mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Das zeigt sich auch im Ringen der Pädagogik um die Definition der Begriffe ‚Erziehung' und ‚Bildung'.
Ebenso ist die pädagogische Praxis der Erziehung und Bildung von Menschen mit dieser Wechselwirkung konfrontiert. Wenngleich sich die Bedeutung des Begriffs Erziehung im Lauf der Geschichte verändert hat, scheint ihm die Vorstellung der Einflussnahme auf Menschen und damit der Machbarkeit des Menschen immanent zu sein: Unter Erziehung sind "Handlungen zu verstehen, die in der Absicht erfolgen (oder: die den Zweck haben), in anderen Menschen gemäß für sie gesetzten Normen (Sollensforderungen, Idealen, Zielen) psychische Dispositionen hervorzubringen, zu fördern, zu ändern, abzubauen oder zu erhalten." (Brezinka, zit. nach Schwenk 1989, 430)
Foucault nimmt an, "dass eine Gesellschaft in ihrer Pädagogik ihr Goldenes Zeitalter träumt" (Foucault 1968, 123), sich in ihren Formen der Kindererziehung ihre Wunschträume verbergen, die in Konflikt stehen zu den realen Lebensbedingungen der Erwachsenen.
Die verschiedenen pädagogischen Orientierungen und Stile unterscheiden sich durch ihre Grundannahmen in Bezug auf Normen und durch die Art und Weise, wie diese den zu Erziehenden vermittelt werden sollen. "Selbst antiautoritäre oder non-direktive Vorstellungen von Erziehung beinhalten Ziele für das pädagogische Gegenüber." (Lindemann/Vossler 1999, 143)
Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder Strömungen, die nicht die hervorzubringenden Normen, sondern die Beziehung zwischen pädagogisch Handelnden und ihren Anvertrauten in den Mittelpunkt stellten. Beispielsweise Krieck (1930): "Von jeder Wechselwirkung zwischen den Menschen einer Gesellschaft, ob bewußt oder unbewußt, gewollt oder nicht gewollt, gehen auf alle Beteiligten erzieherische Wirkungen aus." (Krieck, zit. nach Schwenk 1989, 437) Erziehung wird hier als Geschehen konnotiert, als Begleiterscheinung zwischenmenschlicher Erfahrungen und nicht unbedingt als direkte Einflussnahme.
Ein wesentlicher Beitrag zur Veränderung des hierarchischen Subjekt (= PädagogIn) - Objekt (= Kind) - Gefälles in ein dialogisches Subjekt - Subjekt - Verhältnis leistete Martin Buber. In seinen ‚Reden über Erziehung' hält er fest:
"Pädagogisch fruchtbar ist nicht die pädagogische Absicht, sondern die pädagogische Begegnung." (Buber 1995, 71) Die Verhältnisse erziehen das Kind. Das erzieherische Verhältnis ist ein "rein dialogisches" (ebd., 40), der Teilnahme aneinander, in der wir zu Anerkennenden werden. Nur in dieser Gegenseitigkeit kann Vertrauen wachsen, in das, als Grundlage und Eigenkraft, alles Erzieherische eingebettet ist.
Erziehung als Versuch der Einflussnahme geht mit der Annahme externer Steuerbarkeit einher und impliziert teleologisches (telos = Ziel), zeitliches (kontinuierlich, linear) und didaktisches ‚Wissen'; also das wohin, das als ‚richtig' definierte Ziel, das für alle gleichermaßen gelte; das wann, die ‚richtige' Zeit, innerhalb der alle das Ziel erreichen sollten; und das wie, die ‚richtige' Instruktion, die alle zum Ziel führe. Sie impliziert somit den Bezug auf eine externe Referenz, auf einen Normenkatalog ‚objektiver' Wissensbestände (Stoffpläne) und auf von außen vorgegebene Maßstäbe menschlicher Fähigkeiten (Intelligenzquotienten, Mindestnoten, auch diagnostische Verfahren), die immer schon feststehen. Da das Schulsystem Teil der Gesellschaft ist, steht diese externe Referenz definierter Entwicklungsziele auch in Bezug zu den (sich verändernden) gesellschaftlichen Idealvorstellungen ihrer Mitglieder, die für den Erhalt der jeweiligen Gesellschaft als relevant und nützlich gelten.
Häufig wird im Zusammenhang mit diesem pädagogischen ‚Wissen' auf Entwicklungstheorien Bezug genommen. Ohne hier auf die verschiedenen Entwicklungstheorien eingehen zu wollen, möchte ich doch drei Aspekte zu bedenken geben: ihr Konstruktionscharakter, ihre fortlaufende Revision und Veränderung durch weitere Forschungen und damit die häufige Kurzlebigkeit ihrer ‚objektiven' Gültigkeit und - die dieser vermeintlichen Objektivität innewohnende Defektlogik.
Entwicklungstheorien unterscheiden sich durch ihre theoretischen Vorannahmen. Diese sind wiederum verbunden mit dem impliziten Menschenbild der Theorie, das in unterschiedlich favorisierten Zielen menschlicher Entwicklung zum Ausdruck kommt. So wertet Erikson beispielsweise Unabhängigkeit als höchste Stufe der Entwicklung, während Gilligan soziale Kompetenz und Verantwortung in Beziehungen als Reife definiert. (vgl. Benjamin 1996, 187) Entwicklungstheorien sind somit keine objektiven, neutralen Beschreibungen, sondern immer Konstrukte, die aus Bewertungen und Zuschreibungen von Beobachtern hervorgehen.
Entwicklungstheorien verändern sich. So wurde beispielsweise die Fähigkeit zu emotionalem Ausdruck (wie das Lächeln des Säuglings) im Laufe der Forschungen immer früher angesetzt; heute wird dem Kind im Mutterleib schon eine gewisse Emotionalität ‚zugestanden'.
Weitere Beispiele wären: aus primärer Bedürfnisbefriedigung wurde primäre Bindung und die sehr frühe Tendenz zur Beziehungsaufnahme; aus dem passiven wurde der kompetente Säugling. (vgl. ebd, 19-24)
In Bezug auf das Thema dieser Arbeit möchte ich vor allem auf die mit einem definierten Ziel oder einer Normvorstellung verbundene Defektlogik hinweisen. Jede vorgegebene Norm erschafft gleichzeitig Nichtnorm, also ihre Abweichung oder Nichtentsprechung, die vorwiegend mit Negativzuschreibungen verbunden ist und, wie schon erwähnt, der Person angelastet wird, die dieses Ziel nicht oder nicht so schnell erreichen kann oder will. Erst dadurch bekommen Bewertungen wie verzögerte oder gestörte Entwicklung überhaupt Relevanz. Die Extremform solcher Zuschreibungen stellen Bezeichnungen wie ‚Behinderung' und ‚psychische Störung' dar, die in der Regel Aussonderung zur Folge haben.
Hier soll nicht prinzipiell gegen Entwicklungstheorien argumentiert werden. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass, wenn sie isoliert betrachtet und ohne Bezug zum jeweiligen konkreten Subjekt und dessen Kontext auf Menschen ‚angewendet' werden, Gefahr laufen, in eine triviale Sichtweise von Menschen und ihrer Entwicklung zu münden. Es geht mir um ein Bewusstsein für die Komplexität von Entwicklungs- und Verstehensprozessen (Selbstorganisation im Zusammenwirken mit Anregung und Spiegelung aus dem Umfeld). Entwicklungstheorien als objektive Daten zu sehen, kann die gegenwärtige situative Wahrnehmung des Menschen, mit dem wir es zu tun bekommen haben, verstellen. Natürlich ist es nicht möglich, ganz unvoreingenommen zu sein, denn wir beobachten immer vor dem Hintergrund eigener Konstruktionen und Unterscheidungen. Dennoch kann es hilfreich sein, den Konstruktionscharakter von Entwicklungstheorien mit einzubeziehen und zu bedenken, dass es auch anders sein könnte. Es kommt also wesentlich darauf an, wie sie verwendet werden.
Bezüglich Entwicklungstheorien bemerkt Huschke-Rhein:
"Die bisherige Entwicklungspsychologie war vorwiegend an den linearen, berechenbaren, voraussagbaren, kontinuierlichen, messbaren und erwartungskonformen Verläufen interessiert." (Huschke-Rhein 2000, 36)
Wie beschrieben folgen lebende Systeme jedoch radikal anderen "Entwicklungsgesetzen (...), als sie bisher in der Entwicklungspsychologie angenommen wurden." (ebd.)
Um dies zu verdeutlichen, unterscheidet er den "'externen' Entwicklungsbegriff", der mit der Vorstellung notwendiger Einflussnahme in den Entwicklungsprozess einhergeht vom "'internen' Entwicklungsbegriff" (ebd., 24) der Selbststeuerung.
Diese Unterscheidung verweist auf die Paradoxie pädagogischen Handelns: den Versuch der Fremdsteuerung von selbstreferentiellen, sich selbst steuernden Systemen. Nach Huschke-Rhein ist ‚Selbstorganisation' der interessanteste Begriff für die Pädagogik, weil er den Fokus von gezielter Einflussnahme auf ermöglichende Selbstbestimmung verschiebt. (vgl. 1998, 58) Die Perspektive der Selbstorganisation bedeutet nämlich nicht ein ‚Sich selbst überlassen' und damit das Ende pädagogischen Handelns, sondern definiert einen neuen Ausgangspunkt.
Entwicklung als Selbstorganisation impliziert nach Maturana die Wechselwirkung mit der Umwelt und meint eben nicht Unabhängigkeit. Die Anregungen (Perturbationen) werden jedoch eigengesetzlich verarbeitet. Aufgrund unserer sozialen Struktur sind wir in der Entwicklung notwendig auf den Austausch mit anderen angewiesen. (vgl. Kap. 1.2.2 i.d.A.) Lernen geschieht in struktureller Koppelung und der Ausbildung konsensueller Bereiche und ist somit immer mit Beziehungen verflochten. Entwicklung ist ein Prozess der Transformation im Zusammenleben mit anderen. Damit bewegt sich pädagogisches Handeln in einer weiteren (scheinbaren) Paradoxie, auf die ich in den letzten Abschnitten mehrfach hingewiesen habe: dass selbstreferentielle Systeme in hohem Maße auf eine positive Beziehung (Anerkennung) zu anderen selbstreferentiellen Systemen angewiesen sind.
Der Gegenpol von Zwang (Fremdeinwirkung) ist nach Buber nicht Freiheit (frei sein von Menschen), sondern Verbundenheit und Einbezogen sein. (vgl. 1995, 26)
Neben der Selbstorganisation geht es also auch darum, "die vernachlässigten Beziehungs-ebenen pädagogischen Handelns" (Voß 1998, 22) zu akzentuieren.
Wie unterscheidet sich nun die systemisch-konstruktivistische Sichtweise in ihren Prämissen von einem externen Entwicklungsbegriff und welche Konsequenzen für pädagogisches Handeln können sich daraus ergeben?
Die Entwicklung eines selbstreferentiellen Systems wird als dynamischer Prozess "von unvorstellbar hoher Komplexität, Vernetzung und Zyklisierung" (Huschke-Rhein 2000, 40) verstanden. Er verläuft in einem Wechsel zwischen Konstanz und Wandel, Kontinuität und Diskontinuität. Stillstand, Krisen und Rückschritt werden nicht als Störung, sondern als zur Entwicklung gehörend interpretiert.
Aus der Selbstorganisation im Kontext folgt auch, dass Entwicklung ein differentieller Prozess ist. Die lebensgeschichtlich entstandene Vielfalt unterschiedlicher Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstile ist somit eine notwendige Erscheinung und kein Störfaktor. Da wir uns ohnehin unterschiedlich entwickeln und niemand Realität unmittelbar zu fassen vermag, verlieren Dualismen wie richtig/falsch, gesund/krank, behindert/nicht behindert ihre Schärfe und vermeintliche Objektivität, werden aufgehoben oder zumindest relativiert und (wieder) fragwürdig.
Aufgrund der Plastizität und Veränderbarkeit interner Strukturen ist Entwicklung als lebenslanger Prozess zu sehen. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit Entwicklungsprozessen auch für die Begleitung Erwachsener relevant, obwohl sich Entwicklungstheorien vor allem auf das Kindes- und Jugendalter beziehen. Entwicklung ist nicht abzuschließen. Auch die eigene nicht (die der PädagogInnen).
Selbstreferentielle Systeme nehmen Ereignisse stets im Hinblick auf ihren derzeitigen Zustand und ihre bisherigen Erfahrungen wahr und prüfen sie auf Anschlussfähigkeit. Das bedeutet, dass nur die momentanen kognitiven und emotionalen Zustände und Strukturen Bezugspunkt und Basis für die weitere Entwicklung sein können.
Um irgendwo hinzugelangen, genügt es nicht, auf etwas zuzugehen, man muss auch von etwas ausgehen. (vgl. Buber 1995, 53)
Deshalb kann es nicht um einen ‚richtigen' Input gehen, sondern es geht eher darum, Individualitäten und Eigenheiten als Grundlage zu akzeptieren, ernst zu nehmen und herauszufinden, was für ein System überhaupt eine Perturbation darstellt. Die Entwicklung selbstreferentieller Systeme wird nicht von "Faktoren", sondern von "Attraktoren" angeregt, die aber meist im Voraus nicht erkennbar sind. (Huschke-Rhein 2000, 36) Mit den herangeführten Anregungen kann nur operativ umgegangen werden, wenn sie anschlussfähig sind, dh. mit den momentanen Strukturen und Bedeutungen in Verbindung gebracht werden können. Sinn und Bedeutung liegen nicht in Ereignissen oder Lerninhalten ‚an sich', sondern müssen in Eigenregie aufgebaut werden. Motivation und Aufmerksamkeit hängen wesentlich mit der lebensnahen Ausrichtung des Angebotes, der Beziehung (Anerkennung) zwischen den Beteiligten und der Lernatmosphäre zusammen. ‚Aufmerksamkeitsdefizite' können deshalb nicht einseitig dem Individuum angelastet werden.
Aufgrund der Unbeobachtbarkeit innerer Zustände können nach systemisch-konstruktivistischem Modell weder Aussagen über den genauen Zeitpunkt noch über das genaue Ziel oder den jeweils ‚richtigen' Weg einer Entwicklung gemacht werden.
"Das Ziel steht nicht fest und wartet;" das Ziel, das erreicht werden kann, wird nicht anders aussehen als der Weg, der gegangen wird. (Buber 1995, 62)
Trotz dieser Unbestimmtheit, Unanalysierbarkeit und Unvoraussagbarkeit muss pädagogisches Handeln jedoch nicht in Beliebigkeit münden. Der kommunikative Austausch führt in die lebendige Konkretheit von Person und Situation. Wenngleich berücksichtigt werden muss, dass Kommunikation immer mehrdeutig ist, kann sie im Prozess der Verständigung Referenzebenen der Lernenden erkennen lassen und so einen ersten Bezugspunkt herstellen.
Das Modell des Dialogs von Milani Comparetti (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 162; sowie Lüpke/Voß 2000, 5) ist ein Beispiel dafür. Statt des geschlossenen Kreises von Reiz/Input und erwarteter Reaktion/Output, der lediglich den Grad der Übereinstimmung mit den eigenen Auffassungen überprüft, schlägt er eine Form des Dialogs vor, dessen Entwicklung für die Beteiligten unbekannt und offen ist. Sie geht gerade nicht von einer Homogenität der Menschen aus. Sie braucht weder ein vorgegebenes Ziel noch eine vorgegebene Zeit. Ausgangspunkt sind die subjektiven Erfahrungen und Interessen der Beteiligten, die über den Dialog ins Spiel gebracht werden. Dabei wird jedes Verhalten als Vorschlag verstanden und ernst genommen, da es offenbar dem Betreffenden in dieser Situation als sinnvoll erscheint. Es bildet die Basis, auf dem sich der weitere Dialog über Gegenvorschlag und Anregungen aufbauen kann. Diese können angenommen (weil plausibel) oder abgelehnt (weil nicht anschlussfähig) werden. So wird eine offene, kreative Lernumgebung geschaffen, die nach Kompetenzen fragt, die jeweiligen Konstruktionen (Vorwissen) als Ergebnis bisheriger Erfahrungen erst einmal als viabel und gültig respektiert und in den Entwicklungsprozess konstruktiv einbaut; die unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, individuelle Logik, Interessen und Ziele zulässt und gleichzeitig Alternativen anbietet. Differenz bzw. Heterogenität ist in dieser Form des Dialogs nicht nur willkommen, sondern für die weitere Entwicklung sogar notwendig. Bewertungen von außen sind dagegen unnötig und unmöglich. Sogenannte ‚Fehler' werden in Bezug zum jeweiligen Wirklichkeitsbereich gesetzt, indem danach gefragt wird, unter welchen Bedingungen das Gesagte oder die Handlung Gültigkeit hat. Sie sind so lange gültig, bis sie durch andere Erfahrungen entkräftet werden. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 141) Die Aufmerksamkeit liegt auf dem Weg der Aneignung von Wissen, nicht auf dem Resultat.
Das Modell von Milani Comparetti kann widerspruchsfrei mit der systemisch-konstruktivistischen Sichtweise verknüpft werden.
Wahrnehmen und Erkennen sind untrennbar mit (gemeinsamem) Handeln (Spiegelphänomene) verbunden. "Das Gehirn betrachtet die Welt aus dem Blickwinkel möglicher Handlungsstrategien."(Bauer 2005, 123) Es "speichert Wissen am optimalsten, wenn es ihm zusammen mit lebensnahen praktischen Handlungserlebnissen angeboten wird." (ebd., 124) Wissen = Tun, Lernen = Leben. Es geht also darum, kognitive Prozesse mit personalen Erfahrungen zu verknüpfen und damit zu vitalisieren.
Ein "gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus" (joint attention) gehört zudem "zu den wichtigsten Voraussetzungen für den Aufbau einer emotionalen Bindung" (ebd., 55), die wiederum die Basis für Lernprozesse bildet.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Aneignungspsychologie/Tätigkeitstheorie, die aus der schon erwähnten kulturhistorischen Schule hervorgegangen ist, Bezug nehmen, da sie meines Erachtens ebenfalls ein Modell darstellt, das mit der systemisch-konstruktivistischen Sichtweise vereinbar ist.
Die Tätigkeitstheorie hat, im Gegensatz zu anderen Entwicklungstheorien, das "Verhältnis von Subjekt und gegenständlicher/sozialer Realität in seiner Dynamik, Struktur und Geschichtlichkeit" (Ziemen 2002, 45; eigene Hervorh.) im Blick, mit dem Anliegen, den Dualismus zwischen Subjekt und Objekt zu überwinden. Bewusstsein/Persönlichkeit sind weder ‚naturgegebene' Eigenschaften noch ausschließlich das Ergebnis ‚äußerer' Umstände, sondern entwickeln sich in dieser Berührung und Wechselwirkung von Individuum und Umwelt; in diesem intermediären Raum der Begegnung, aus der der Eigen-Sinn durch interne Operationen mit der Zeit emergiert. Bewusstsein und Tätigkeit jeglicher Art stellen eine Einheit dar. Gesellschaftliche Bedeutungen werden im Prozess der Aneignung/Tätigkeit durch kommunikativen Austausch und in Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit aufgebaut. Sinnstiftend ist somit die eigene Bedeutungszuschreibung im Sinne "integrierter affektiver Bewertung." (ebd., 49) Sinn steht in einem dialektischen Zusammenhang zur Bedeutung. Darin eingebettet ist auch die Motivation zu lernen, das Bedürfnis nach neuen Anregungen und das Bedürfnis nach Spiegelung in anderen Menschen.
Die Tätigkeitstheorie versucht somit, ähnlich der Systemtheorie, "auf Einseitigkeiten basierende Denkweisen aufzulösen" (ebd., 54) und auf die Relationen und Wechselwirkungen hinzuweisen. Gleichzeitig wird anerkannt, dass zwar in Relationen gedacht werden kann, diese aber nicht beobachtbar sind. Beobachtbar ist nur das Verhalten in Form von gezeigten Fähigkeiten und Kenntnissen, die inneren Prozesse, Bedürfnisse, Emotionen und Motive jedoch nicht. Dennoch bleiben sie nicht unberücksichtigt. Denn es wird von der prozesshaften Wechselwirkung der biologischen, psychischen und sozialen Ebene (vgl. Kap.1.2.2 i.d.A.) ausgegangen, "die das Psychische...als sinnhafter und systemhafter Aufbau der Lebenstätigkeit" (Ziemen 2002, 58) erst entstehen lässt.
Tätigkeit wird als motivierte, bedürfnisgeleitete, emotionsgesteuerte Aktivität verstanden, von der angenommen wird, dass sie im Subjekt Veränderung und Entwicklung bewirkt. Dies jedoch nur, wenn die angebotenen Anregungen "mit der ‚Zone der aktuellen Entwicklung' bzw. der ‚Zone der nächsten Entwicklung' (Wygotski) abgestimmt sind und die Bedürfnisse bzw. Motive des Subjekts berücksichtigen." (ebd., 55)
In den Ausführungen von Iris Mann (synonym: Christel Manske) wird die praktische Umsetzung der Aneignungstheorie nachvollziehbar. Sie gibt Einblick in die Begleitung von Lernprozessen erwachsener Menschen ‚mit Lernschwierigkeiten'.
Neben der Kategorie der Tätigkeit, des gemeinsamen Handelns ist bei ihr die Kategorie der Anerkennung fundamental. In diesem Zusammenhang verweist sie auf ein in der traditionellen Pädagogik bestimmendes Moment des Verhältnisses zwischen Lehrenden und Lernenden: das Prinzip von Lob und Tadel, das sie als Herrschaftsverhältnis demaskiert.
"Anerkennung ist die Überwindung von Lob und Tadel. Anerkennung bedeutet, dass sich ein Mensch am anderen Menschen erkennen kann." (Mann 1999, 25)
Indem sie, noch bevor die Unterrichtseinheiten beginnen, mit den ArbeiterInnen in der Werkstatt tätig ist, stellt sie einen ersten Kontakt her und erhält gleichzeitig einen Eindruck über deren Lebenssituation und Bedürfnislagen. Zudem findet ein Austausch über die Motivation, z.B. Lesen oder Schreiben lernen zu wollen, statt. Anschließend zeigt sie den didaktischen Weg auf, den sie mit ihnen gemeinsam gehen möchte. Mit dieser Orientierung und Transparenzwird Eigenkontrolle möglich.
Sie schickt voraus, dass für den Prozess des handelnden Erlernens der (Schrift)SpracheVorerfahrungen notwendig sind: Schriftsprache setzt Lautsprache voraus und die Lautsprache wiederum die Aneignung der Bedeutung der gegenständlichen Welt. Denn wenn die Dinge in der Umwelt keine Bedeutung für die Lernenden haben, so haben deren Bezeichnungen erst recht keine und können auch nicht erinnert werden - die Begriffe bleiben leer. Aneignung hat nur Bestand, wenn sie in das persönliche Bedeutungssystem integriert werden kann. Und Bedeutung ist wiederum an die zwischenmenschlichen Beziehungen gekoppelt.
"Nichts kommt in den Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war. Aber der Verstand kann nichts aufnehmen, was nicht durch die Beziehung auf andere für ihn sinnvoll ist." (Locke, zit. nach Mann 1999, 33)
Während man früher geglaubt habe, dass Dummheit und Klugheit angeboren sei, wisse man heute, dass beides gelernt ist. Wenn die Pädagogin beobachte, dass die Lernenden die angebotenen Inhalte nicht bewältigen können, sei es angebracht, ihnen einzugestehen, aus "Unwissenheit, Unachtsamkeit oder falschem Ehrgeiz einen Fehler gemacht" (Mann 1999, 28) und die Situation (Zone der vergangenen und aktuellen Entwicklung sowie Zone der nächsten Entwicklung) anders eingeschätzt zu haben. Misserfolge werden also nicht den Lernenden angelastet.
Das unsichtbare Band gegenseitiger Anerkennung ist die Basis, die Entwicklung und Lernen ermöglicht. In diesem geheimnisvollen, intermediären Raum entsteht Inter - esse (Zwischen- sein); macht Verstehen Sinn; kann erst nachvollzogen werden, was Mensch sein in der jeweiligen Kultur bedeutet. Indem Anerkennung als Grundkategorie für Lern- und Verstehensprozesse verstanden wird, wird auch hier, wie im systemisch-konstruktivistischen Ansatz, der soziale Aspekt von Intelligenz deutlich.
Deshalb ist es hilfreich, die Lernsituation mit Beziehungsaufnahme zu beginnen. Durch Wahrgenommen und Akzeptiert werden in der gegenwärtigen Kompetenz als auch in den noch offenen Möglichkeiten und Potenzialen kann Selbstbewusstsein und Selbstachtung wachsen. Lernen braucht persönliche Beziehung, gegenseitigen Respekt, Vertrauen und Zutrauen. Emotionale Prozesse sind in der Entwicklung ebenso wichtig wie kognitive.
Dialog und gegenseitige Anerkennung ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Harmonie. Im Umgang mit der Vielfalt werden auch immer wieder Konflikte ausgetragen werden müssen (nicht unterbunden). Für Konsensbildungsprozesse ist es jedoch notwendig, dass Menschen eine grundlegende Gleichwertigkeit erfahren können. Auf diesem Weg werden auch soziale Kompetenzen erworben.
Vygotskij sieht Konflikte im Kollektiv der Lernenden noch aus einer anderen Perspektive, nämlich als Beitrag zur Entwicklung logischen Denkens, der "Methode zur Begründung von Schlüssen", da sie eine "Notwendigkeit zum Argumentieren" darstellen. (Vygotskij 2001, 120) Heterogenität und Differenz werden so zur Quelle der Entwicklung.
Bourdieu weist darauf hin, dass die in der traditionellen Pädagogik unterstellte Homogenität der Lernenden der Leistungs- und Begabungsideologie zuarbeitet. Indem sie nämlich die, aufgrund der Primärsozialisation unterschiedlichen, ungleichen Bildungsvoraussetzungen ignoriert und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und schulischem Erfolg nicht herstellt, lässt sie Talent und Begabung als naturhaft erscheinen, obwohl sie vorwiegend kulturelles Privileg (Umgang mit Bildungsgütern in der Familie, Sprache, Stil, Verhaltensweisen, die unbemerkt auf ‚osmotische Weise' in den Habitus eingehen) und ohne den Rückgriff auf angeborene Unterschiede begründbar sind. Die bekannten Selektionsmechanismen des Bildungssystems sind die Folge dieser Nichtbeachtung sozialer Ungleichheit. Er weist außerdem darauf hin, dass das Wissen um die Herkunftsfamilie, aber auch die lebensgeschichtlich entstandene unterschiedliche Ausdruckweise der SchülerInnen unbewusst Einfluss auf das Urteil der PädagogInnen hat.
Im Wesentlichen geht es ihm darum, den unsichtbaren Zusammenhang zwischen subjektiven Eigenschaften und sozialen Verhältnissen explizit herzustellen. Die Konsequenz für pädagogisches Handeln wäre dann, nichts als selbstverständlich vorauszusetzen, und allen einen Zugang zu den kulturellen Praktiken der Gesellschaft zu ermöglichen, die die Voraussetzung für Partizipation und Verstehen sind. (vgl. Bourdieu 2001, 14-84)
Nicht alle subjektiven Konstruktionen sind gesellschaftlich viabel.
"In einer nicht-trivialen Sichtweise von Entwicklung befindet man sich (...) in einem Spannungsfeld zwischen subjektiven Entwicklungswegen und Lerninteressen auf der einen Seite und pädagogischen Ansprüchen nach sozialer Orientierung und einer gesellschaftlichen Relevanz von Erlerntem auf der anderen Seite." (Lindemann/Vossler 1999, 156)
Die Herausforderung der Pädagogik liegt darin, in der Begleitung und Koordination unterschiedlicher Entwicklungswege für alle Beteiligten ein akzeptables Gleichgewicht zu finden.
Durch die systemisch-konstruktivistische Sichtweise kann sich das Selbstverständnis pädagogischen Handelns verändern. Bezüglich der Kontroll- und Steuerungsvorstellung ist Bescheidenheit angesagt. Auch die herkömmliche Leistungsbeurteilung ist zu hinterfragen:
"Der durch Tests, Prüfungen und diagnostische Verfahren hergestellte Zusammenhang zwischen beobachtbarem Verhalten und der generellen Fähigkeit, dieses hervorzubringen, geht mit der Auffassung einher, allgemeingültige Bewertungen aufgrund von Beobachtungen erstellen zu können." (ebd.,171)
Leistungsbeurteilungen entsprechen somit einer trivialen Sichtweise des Menschen, denn die "als entscheidend angenommenen inneren Zustände" (ebd.) bleiben dabei unberücksichtigt.
PädagogInnen sind nicht die MacherInnen der Entwicklung (‚Trivialisateure'), sondern partnerschaftliche BegleiterInnen und BeobachterInnen und als selbstreferentielle Systeme mit ihrer eigenen inneren Dynamik Teil des Spielraumes bzw. der interaktiven Prozesse.
"Der Schüler lernt den Lehrer." (Maturana/Pörksen 2002, 136) Die Aufmerksamkeit liegt nicht in der Lenkung der Entwicklung, sondern in der Ermöglichung der Selbstorganisation in der Bezogenheit. Durch die Gestaltung einer offenen Lernumgebung und der Offenheit der Bezugspersonen, die ihre Wahrnehmung nicht durch vorschnelle Urteile verstellen und nicht nur einzelne Funktionen, sondern den ganzen Menschen sehen, kann Wirk-lichkeit emergieren. Zugespitzt formuliert: "Wir sind alle lernfähig, aber unbelehrbar." (Woltmann-Zingsheim 1998, 285)
Buber beschreibt die pädagogische Haltung als "Kontrapunktik von Hingabe und Zurückhaltung." (Buber 1995, 34)
Die systemisch-konstruktivistische Sichtweise nimmt Theorien ihre Ausschließlichkeit. Sie ist eine Einladung, scheinbare Gegebenheiten zu hinterfragen, denn die Praxis hängt letztlich nicht von den Theorien ab, sondern von den Menschen, die sie gestalten.
Das Modell von Milani Comparetti und das der Aneignungstheorie wurden bewusst in diesen Abschnitt der allgemeinen Ausführungen über Pädagogik gestellt, weil die Ermöglichung der Selbstorganisation einen Perspektivenwechsel für die gesamte Pädagogik darstellen könnte und nicht nur für die integrative Pädagogik bzw. die Begleitung von Menschen ‚mit Behinderung'. Menschen ‚mit Behinderung' bedürfen in diesem Sinne keiner eigenen Pädagogik, da sie sich, wie alle anderen Menschen, selbstorganisierend in Wechselwirkung mit ihrem sozialen Umfeld entwickeln.
Im Folgenden werde ich nun den Begriff ‚Behinderung' aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive betrachten und anschließend versuchen, mich der Wirklichkeit jener Menschen anzunähern, bei denen wir uns angewöhnt haben, sie als behindert zu bezeichnen.
[8] Aus der Ö1 Rundfunk Sendung Dimensionen: "Was Einstein heute fordern würde." Leitbilder verantwortlicher Wissenschaft. Zur Potsdamer Erklärung internationaler Wissenschaftler. 16.11. 2005
[9] Hans-Peter Dürr, Astrophysiker, in derselben Sendung
[10] ebd.
[11] Vandana Shiva, Quantenphysikerin, ebd.
[12] Hans-Peter Dürr, ebd.
[13] Vgl. ebd.
[14] Kybernetik ist die Wissenschaft der Steuerung und Kommunikation in Maschinen und Lebewesen
[15] Aufnahme Heinz von Foersters in der Ö1 Rundfunk Sendung "Dimensionen" 15.11.2005 zum 2. Internationalen Heinz von Foerster - Kongress.
[16] Von griech. "pais" (=Kind), "paideia" (= Erzeihung, Bildung)
Inhaltsverzeichnis
"...es gibt keinen Zustand, der so viel Namen verschlissen hat wie dieser; jedes Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts hat das alte, hässliche Wort verworfen und ein neues, freundlicheres gesucht. So wurde aus dem Krüppel ein Schwerbeschädigter und aus dem Schwerbeschädigten ein Behinderter, aus dem Behinderten ein Invalide und aus dem Invaliden wurde schließlich eine Person mit Funktionsstörungen.
Hinter jedem dieser Worte liegt eine wahnsinnige Hoffnung."
Maigull Axelsson: Die Aprilhexe, 22, München: Bertelsmann 2000
Zu Beginn dieses Abschnitts über den Begriff ‚Behinderung' soll auf die wirklichkeitsschaffende Macht von Sprache und Bezeichnungen hingewiesen werden.
Die konstruktivistische Erkenntnistheorie geht davon aus, dass weder Dinge noch Begriffe ‚an sich' existieren oder sich in der Welt befinden, sondern durch Wahrnehmung, Unterscheidung und Vergleich gebildet und in die Welt hineingeschrieben werden. Durch die Unterscheidung verleihen Beobachter den unterschiedenen Einheiten Existenz. Das ist der Weg des Erkennens; anders können wir uns in der Welt nicht orientieren. Was wir nicht wahrnehmen und unterscheiden, existiert nicht für uns.
Begriffe sind somit Abstraktionen, wobei jene, die den Begriff bilden oder gebildet haben, aus einer Menge von Eigenschaften des Bezeichneten einige hervorheben, die das Bezeichnete meint, von den übrigen aber absehen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, bringt Sprache Wirklichkeit hervor. Sie gibt aber gleichzeitig Auskunft über die Präferenzen und Neigungen der SprecherInnen (vgl. Kap. 1.1 i.d.A.- Maturana: "Alles Gesagte ist von jemandem gesagt"), die wiederum mit kulturellen Werturteilen verbunden sind.
"Entscheidend ist die Einsicht, dass ein Beobachter das von ihm Wahrgenommene durch seine Unterscheidungen spezifiziert (...)." (Maturana/Pörksen 2002, 203)
Die Beschreibung weist somit auf die Beziehung des Beobachters zum Objekt hin; auf das, was er oder sie in das Objekt hinein- oder aus ihm herausliest. In von uns gemachte Unterscheidungen sind wir also immer selbst verstrickt. Zum Objekt selbst gibt es ja keinen direkten, unmittelbaren Zugang. Ein Umstand, der selten berücksichtigt wird, der aber folgenschwer für das Benannte ist, weil dadurch häufig aus Hypothesen Gewissheiten werden. Der Akt der Unterscheidung und Benennung erzeugt Wirklichkeit. Dieser Verantwortung sollten wir uns bewusst sein.
Begriffe sind also weder wertneutral (objektiv) noch können sie deckungsgleich mit der Realität sein. Wesentliche Momente für die Begriffsbildung sind daher, aufgrund welcher Intention (Absicht, Motivation) und mit Hilfe welcher konstruierter Kriterien wir über den Prozess der Externalisierung welche Elemente unterscheiden. (vgl. Kap. 1.1.1.1 i.d.A.)
Im folgenden Zitat wird die Doppelfunktion von Ein- und Ausschluss, aber auch von Existenz oder Nichtexistenz, die der Sprache immanent ist, deutlich:
"Jede Benennungshandlung teilt die Welt in zwei Teile: in Einheiten, die auf den Namen hören; und in alle übrigen, die dies nicht tun. Bestimmte Einheiten können nur insoweit in eine Klasse eingeschlossen - zu einer Klasse gemacht - werden, wie andere Einheiten ausgeschlossen werden, draußen bleiben." (Baumann, zit. nach Pohl 1999, 35)
Ebenso wurde in den bisherigen Ausführungen schon aufgezeigt, dass diese konstruierten Unterscheidungen auf unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln zurückwirken bzw. dieses bestimmen. Das heißt, die Wahl der Unterscheidung bestimmt, was überhaupt weiterhin wahrgenommen werden kann. Durch diese Rückbezüglichkeit werden einmal gemachte Unterscheidungen, sofern sie nicht mehr weiter hinterfragt werden, aufrecht erhalten, ständig reproduziert und dadurch manifestiert. (vgl. Kap. 1.2.3 i.d.A. - Sprache als rekonstruktiver Ort)
"Die Erkenntnis der Erkenntnis verpflichtet.
Sie verpflichtet uns zu einer Haltung ständiger Wachsamkeit gegenüber der Versuchung der Gewißheit." (Maturana/Varela 1987, 263)
Sie verweist auf die Notwendigkeit, gebräuchliche Begriffe zu hinterfragen, sie auf deren Funktion hin abzutasten und sich mit ihnen auseinander zu setzen.
Die individuelle und soziale Wirklichkeit ist keine von uns unabhängige Gegebenheit, sondern Resultat von sich immer wieder aufs Neue vollziehenden Konstruktionshandlungen (Konstruktion, Rekonstruktion, Dekonstruktion), die sich in allgemeinen Begriffen niederschlagen. Begriffe sind somit Produkte sozialer Ordnung und bringen diese gleichzeitig weiter hervor. Soweit, so gut. Fatal wird es allerdings, wenn allgemeine und vermeintlich objektive Begriffe auf Menschen zugreifen, wie es beim Begriff ‚Behinderung' beispielsweise der Fall ist. Er ist u.a. so ein allgemeiner Begriff, der aus einer konstruierten Unterscheidung (behindert vs. nicht behindert) entstanden ist, und somit erst jene Gruppe als zu unterscheidende erschafft, die er bezeichnet. Bestimmte Menschen werden aufgrund bestimmter Kriterien dieser ‚Gruppe' zugeordnet. Begriffe sind auch immer mit bestimmten Emotionen und Bewertungen konnotiert, die, bezogen auf Behinderung, großteils negativ sind.
Aufgrund dieser Zuordnung stellt sich auch die Frage, wer bestimmt, zuordnet und bewertet. In Bezug auf Menschen, die als behindert bezeichnet werden, lässt sich feststellen, dass diese Zuordnung ein Zugriff und Übergriff auf die so Bezeichneten darstellt, da sie aufgrund einer Außensicht und Zuschreibung (durch Medizin, Psychologie und Pädagogik) zustande kommt. Denn unterschiedliche Selbstdefinitionen der Betroffenen vermögen sich noch gar nicht so lange öffentlich Gehör zu verschaffen (was ein Licht auf die Machtverhältnisse wirft) und dadurch diese (un-) heimliche Wand des ‚objektiven Begriffs' zu durchbrechen, ihn zu relativieren und zu entschärfen, ihm die Vielfalt individueller Gesichter, Geschichten und Bedeutungen entgegenzuhalten und ihn dadurch in seiner vermeintlichen Eindeutigkeit zu konterkarieren.
Diese angenommene Grenze zwischen sog. behinderten und sog. nichtbehinderten Menschen ist paradox; mit ihr tut sich einerseits eine tiefe Kluft zwischen Menschen auf, die Gemeinsames nur noch schwer erkennen lässt; andererseits ist der Grat sehr schmal und es genügt ein kleinstes Ereignis, das uns zustößt, um der negativ beschriebenen Seite, nämlich der Behinderung zugeordnet zu werden. Auf diesen Umstand, der zugleich die tiefe Kluft schürt, werde ich noch zurückkommen.
Letztlich stellt sich die Frage, wofür wir den Begriff ‚Behinderung' brauchen, wem dieser Dualismus behindert vs. nicht behindert nützt, an welchen Kriterien er festzumachen versucht wird und ob er überhaupt noch brauchbar ist? Zumindest jedoch denke ich, ergibt sich aus systemisch-konstruktivistischer Sicht die Möglichkeit und die Verpflichtung, den Konstruktionscharakter hervorzuheben und damit die heimliche Ontologie, die der Begriff suggeriert, aufzudecken und unschädlich zu machen. Auf diese Weise tritt die Relativität und Veränderbarkeit von Bezeichnungen wieder in den Vordergrund und somit auch die Chance, Handlungsweisen und Haltungen zu reflektieren und zu überdenken.
Welche Funktionen bzw. Vorteile hat die Zuschreibung ‚Behinderung' für die sich davon abgrenzenden ‚Nichtbehinderten'? Welche Auswirkungen hat diese Zuschreibung auf das Selbstbild und die Lebensgestaltung der so Bezeichneten? Mit diesen Fragen werde ich mich in den nachfolgenden Kapiteln auseinandersetzen. Es geht mir darum, die Mechanismen, die sich hinter der Unterscheidung ‚behindert' vs. ‚nicht behindert' verbergen, offenzulegen.
Um diese Mechanismen verstehen zu können, erscheint mir auch ein historischer Exkurs bzgl. der Entwicklungen und Wechselwirkungen von Gesellschaft und ‚Behinderung' notwendig und aufschlussreich.
Mit den im Eingangszitat angedeuteten Bezeichnungsentwürfen und -verwürfen ist ja immer auch eine spezifische Haltung in der Begegnung mit den als behindert bezeichneten Menschen verbunden. Der Wandel des Begriffs kann jedoch nicht als lineare Entwicklung hin zu Anerkennung und Selbstbestimmung von Menschen gesehen werden. So unmittelbar wirken sich Veränderungen von Bezeichnungen nicht auf Haltungen aus, weil diese Haltungen mit innerpsychischen Konstellationen verbunden sind, welche die Zuschreibungen großteils hervorbringen oder zumindest stützen. Eine Veränderung der Haltung ginge zwangsläufig mit einer Erschütterung dieser Konstellationen, die Wegbereiter der Zuschreibungen sind, einher, die es zuzulassen gälte. Nur weil ‚man' etwas nicht mehr sagt, ist noch keiner Einsicht in die Zusammenhänge verholfen. Ich denke, dass die den Bezeichnungen entsprechenden Bilder über Menschen ‚mit Behinderung' nach wie vor in vielen Variationen durch unsere Köpfe ‚geistern' und noch nicht überwunden sind. Woher kommen diese Bilder und weshalb halten sie sich so hartnäckig? Einigen Aspekten dieser Frage möchte ich in den folgenden Kapiteln nachgehen.
3.1 Die Behinderung liegt in den Augen der BetrachterInnen[17]
"Was ich meine (...) ist, daß ein Phänomen in dem speziellen Betrachtungsrahmen des betreffenden Beobachters gesehen wird. Vieles von dem, was Sie sehen, wenn Sie mich anschauen, (...) ist eine Projektion Ihres eigenen Bewußtseins. In einem anderen Betrachtungssystem würde ich ganz anders erscheinen. (...) Es gibt so viele Anschauungen, wie es empfindende Kreaturen gibt."
Philip K. Dick: Joe von der Milchstrasse, 48, Rastatt: Moewig 1984
Jede gesellschaftliche Epoche birgt in Verbindung mit ihrer kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen Ausrichtung ihre impliziten Menschenbilder, Anthropologien und ihnen entsprechende Ideal- und Normvorstellungen von ihren Mitgliedern und Wünsche und Erwartungen an ihre Mitglieder. Diese, von den Definitionsmächtigen zur Norm erklärten Menschenbilder wurden häufig mit der ‚Natur' des Menschen gleichgesetzt. Mit dieser Gleichsetzung konnten der Konstruktionscharakter und die Machtinteressen verschleiert werden.
"Reduzierungen auf Natur erfolgen als Normalitätsurteile. Insofern sind sie ebenso Urteile über Normalität wie Verurteilungen durch Normalität. Durch sie wird eine veränderte Normalität als veränderte ‚Natur' eines Individuums identifiziert." (Jantzen 2001 b, 327)
Jede wie auch immer geartete Festlegung des Menschen auf eine definierte Norm bringt erst deren Schatten, die Nichtnorm, hervor. Umgekehrt dient die Nichtnorm der Norm als Definitionsgrundlage, sie kann sich dadurch abheben. Die gegenseitige Abhängigkeit dieser Polaritäten ist offensichtlich.
Diese Abhebung oder (Ab)Trennung geschieht sowohl im Kollektiv als auch intrapsychisch. C.G. Jung nennt beispielsweise Persönlichkeitsanteile, mit denen wir uns nicht identifizieren können und die deshalb nicht integrierbar und bewusst sind, aber dennoch wirken, den ‚Schatten'. Die Wirkung geschieht in der Weise, dass diese ‚dunkle Seite', diese angstmachenden, bedrohlichen, abgelehnten Anteile unbewusst ‚hinausgeworfen' und auf andere Menschen übertragen, in sie hineingelegt, auf sie projiziert werden. Diese Projektionen erscheinen uns dann als die Wünsche, Ängste usw. des Anderen. (vgl. Jakobi 1978, 111-115) Auf diese unbewussten Mechanismen werde ich noch ausführlicher eingehen.
Hier ist mir wichtig festzuhalten, dass in Bezug auf ‚Behinderung' eine spezifische Struktur, die als Nichtnorm bezeichnet wird, überhaupt erst durch eine gesellschaftlich gesetzte Norm, durch "abstrakte gesellschaftliche Vorstellungen über ein durchschnittliches Individuum" (Jantzen 1980, 61) sichtbar wird. Der Erhebung zur Nichtnorm geht also ein Interpretations- bzw. Selektionsprozess voraus. Sie steht immer in Verbindung mit Interaktions- und Vermittlungsprozessen gesellschaftlicher Werte und besteht nicht ‚an sich'. Normen haben gesellschaftliche Funktionen. Sie dienen der Absicherung der jeweiligen Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Wenn diese sich ändern, ändert sich auch das Normensystem, d.h. Normen sind relativ. Diese Relativität wird jedoch im Eingebundensein in den Geltungsbereich der Normen oft nicht wahrgenommen, sodass Normen im Sinne von "Kollektivvorstellungen schließlich als Dinge erfahren werden, außerhalb von jedermann. Sie nehmen Macht und Charakter partiell autonomer Realitäten an, die ein Eigenleben führen." (Laing 1981, 69)
Normalität und Anomalität sind folglich keine individuellen Eigenschaften, sondern eine Sichtweise derjenigen, die bestimmen, was normal ist. Eine individuelle Struktur wird erst zur Nichtnorm und damit zur Schädigung, wenn sie in die Variationsbreite menschlichen Seins einer Gesellschaft oder Kultur nicht eingeschlossen ist; mit anderen Worten, wenn sie "nicht in ein gesellschaftlich approbiertes Standardformat" (Fenz 2004, 258) passt. Sogenannte Defizite werden erst durch eine vorab definierte Normschablone existent und auf sie hin konstruiert. Die Folge der Nichtpassung sind dann Klassifikation, Etikettierung und Stigmatisierung, z.B. als ‚behindert'.
Es gilt allerdings zu differenzieren, dass die Stigmatisierung nicht aufgrund bestimmter, individueller Eigenschaften oder Merkmale selbst erfolgt, sondern aufgrund der negativen Definition dieser Merkmale. Zudem werden dem Merkmalsträger dann noch weitere negative Eigenschaften zugeschrieben, die mit dem gegebenen Merkmal an sich nichts zu tun haben.
"Es findet eine Übertragung von einem Merkmal auf die gesamte Person statt. (...) Diese Zuschreibung weiterer Eigenschaften kennzeichnen Stigmatisierungen als Generalisierungen, die sich auf die Gesamtperson in allen ihren sozialen Bezügen erstrecken. Das Stigma wird zu einem ‚master status', der wie keine andere Tatsache die Stellung einer Person in der Gesellschaft sowie den Umgang anderer Menschen mit ihr bestimmt." (Hohmeier 1975)
Bezüglich Defizite und Nichtpassung fokussiert Matt eine weitere Differenzierung bzw. Graduierung. In Anlehnung an Arnold Gehlen, der in Bezug auf die "Verfasstheit menschlicher Existenz" (Matt 2004, 140) den Menschen als ein Mängelwesen beschreibt, bemerkt er die eigenartige Unterscheidung von allgemeinen Defiziten bzw. Mängeln und spezifischen Mängeln. Allgemeine Mängel oder Begrenzungen des Menschen waren beispielsweise Motor für technischen Fortschritt (Auto, Flugzeug, Schiff etc.). Weiters verwenden wir selbstverständlich Hilfsmittel wie Brillen, Herzschrittmacher, künstliche Gelenke etc. "Was aber meinen wir, wenn wir von Behinderung sprechen?" (ebd.,144) Woran wird dieser ‚spezifische' Mangel festgemacht, der als Behinderung bezeichnet wird? Es sind nichts anderes als kulturelle Einschreibungen und Bewertungen, die die Differenz von allgemeinem und spezifischem Mangel bestimmen:
"Wir leben also mit einer impliziten Unterscheidung zwischen Mängeln, von denen wir annehmen, dass sie sozusagen normal sind, und spezifischen Mängeln, von denen wir annehmen, dass sie die Ausnahme sind." (ebd.)
Diesen Umstand, nämlich dass allgemeine Mängel im Sinne von mehrheitsfähig als Normalität aufgefasst werden, bezeichnet Matt als "Quotenanthropologie". (ebd., 150)
Das gleiche Verhältnis lasse sich bei der Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft feststellen:
"Partizipation scheint dem Prinzip des Mengenrabatts zu folgen. Je mehr Menschen einen Mangel teilen, desto wahrscheinlicher stellen sich die Partizipationsdefizitüberwindungsapparaturen auf diese Mängel ein." (ebd.)
Matt stellt auch die Frage, "inwieweit die spezifische Definition von Behinderung eine Art negative Anthropologie" bilde:
"Die Schwierigkeit einer positiven Bestimmung dessen, was den Menschen in seinem Sein ausmacht, würde dann kompensiert durch negative Abgrenzungen gegen das Nichtmenschliche oder Nichtmehrmenschliche." (ebd., 140)
In Anlehnung an Boutroux schreibt Foucault zum Verhältnis von Gesellschaft und Wahrnehumung von Anomalität, dass "die psychologischen Gesetze, selbst die allgemeinsten, (...) zu einer ‚Phase der Menschheit' relativ" seien;
"es ist längst ein Gemeinplatz der Soziologie und der Pathologie geworden, dass die Krankheit ihre Wirklichkeit und ihren Wert als Krankheit nur innerhalb einer Kultur hat, die sie als solche erkennt." (Foucault 1968, 93)
Aus der Sicht der Biologie konstatiert Maturana:
"Im Bereich des Biologischen finden sich keine Pathologien. (...) Alle Formen des Lebens müssen als legitim gelten. (...) Es gibt keine Pathologie an sich, keine Probleme an sich, keine von den Wünschen und Vorlieben eines Beobachters unabhängige Erkrankung." (Maturana/Pörksen 2002, 129)
"In der Natur ist nichts gut oder schlecht. Die Dinge sind. Erst im menschlichen Bereich der Rechtfertigung und der Ablehnung eines bestimmten Verhaltens - d.h.: wenn es um unsere jeweiligen Präferenzen geht - tauchen wertende Attribute und Unterscheidungen wie gut und schlecht auf." (ebd., 220)
Eine Individualisierung von Behinderung ist von diesem Standpunkt aus nicht mehr haltbar, da der Begriff durch soziale Konstruktionshandlungen im gesellschaftlichen Bewertungssystem zustande kommt. Behinderung kann deshalb nur im Verhältnis zu diesem, sie einzig hervorbringenden Bezugspunkt betrachtet werden.
Es erscheint mir wichtig dies vorauszuschicken, wenn ich nun aus der Vielzahl (ver)urteilender (Außen)Sichtweisen auf ‚Behinderung' exemplarisch auf einige ‚Inszenierungen' eingehe. Mit dem Diktat der Normalität als Drehbuch im Hintergrund erscheinen in der Dramaturgie des Lebens die Rollen klar verteilt. Die Protagonisten versichern und stärken sich gegenseitig im Rampenlicht der Normalität und bemessen mittels Arroganz, Mitleid oder Angst ihre Distanz zu den Antagonisten, die es aufrechtzuerhalten gilt. Den in dieser Inszenierung zu Antagonisten erklärten, bleibt (sofern die Dramaturgie nicht deren Tötung bestimmt) unter diesen Bedingungen nur entweder die verzweifelt versuchte Anpassung in der Hoffnung, die Distanz mindern zu können; der Rückzug in die zugeteilte Rolle oder aber der Widerstand gegen sie. Letztlich sind beide gefangen. Polaritäten/Dualismen bedingen einander.
Die Problematik liegt eben darin, dass aus einigen konstruierten und als abweichend empfundenen ‚Merkmalen' eine generalisierende Beschreibung von unterschiedlichen Menschen wird; eine konstruierte ‚Gruppenzuteilung', die einer Vielheit aufgezwungen wird. Durch diese (Ab)Spaltung ergibt sich vom Standpunkt der sog. Nichtbehinderten aus ein ‚Wir' und ‚Sie'. Nach Laing ist das ‚Sie' aber
"eine Art soziale Täuschung (...). Auf der menschlichen Szene jedoch können solche Täuschungen sich selbst verwirklichen. Die Erfindung des ‚sie' schafft ‚uns', und vielleicht brauchen ‚wir' die Erfindung des ‚sie', um ‚uns' selbst neu zu erfinden." (Laing 1981, 82)
In Bezug auf eine mögliche Transformation des Dilemmas fragt er:
"Werden wir realisieren, daß ‚wir' und ‚sie' Schatten voneinander sind? ‚Wir' sind ‚sie' für ‚sie', wie ‚sie' für ‚uns' ‚sie' sind. Wann wird der Schleier gelüftet? (...) Heilige mögen immer noch Aussätzige küssen. Es ist hohe Zeit, daß der Aussätzige den Heiligen küßt." (ebd., 90)
Der Hinweis auf die gegenseitige ‚Erfindung' macht deutlich, dass ‚wir' das Problem nicht abschieben können auf ‚sie', da das, wovon wir uns äußerlich distanzieren, uns unbewusst auch innerlich spaltet. Es betrifft uns also alle. Ein Blick in die Geschichte dieser Spaltungen kann dazu beitragen, sie zu überwinden.
Die Geschichte von ‚Behinderung' und die heutige Situation in unserem Kulturraum kann nur im Verhältnis zur Geschichte der Transformation normativer Menschenbilder im Zuge soziohistorischer Umbruchphasen gesehen werden. Die zeitlich und kulturell determinierte Wahrnehmung des Nichtnormalen ist mit bestimmten Haltungen, Bewertungen und Umgangs- und Reaktionsweisen verbunden und hat somit direkte Auswirkungen auf die Lebensmöglichkeiten und das Lebensrecht der Betroffenen. Wichtige Faktoren, die die Einstellungen gegenüber ‚behinderten' Menschen und deren sozialen Status beeinflussen, sind nach Hofmüller und Stekl die jeweilige Wirtschafts- und Gesellschaftsform (z.B. Favorisierung der Leistungsfähigkeit, Nützlichkeit und Unabhängigkeit vs. Anerkennung gegenseitiger Abhängigkeit), das jeweilige ‚Wissen' um die Ursachen von Behinderung (z.B. magisch-religiös, statisch-biologistisch/medizinisch, relational-systemisch) und auch die eingeräumten Toleranzspielräume bzgl. der Lebensentwürfe der Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft (Homogenität vs. Heterogenität). (vgl. Hofmüller/Stekl 1982, bidok)
"Seit Jahrhunderten hat unsere Kultur die Behinderten ausgesondert und kulturell zu den Antipoden gemacht." (Rommelspacher, 1995, 55)
Die griechische Antike hat "aus Schönheit und Gesundheit eine Metapher für das Gute geformt." Menschen ‚mit Behinderung' "wurden vielfach ‚ausgesetzt', das heißt getötet." (ebd., 56)
Das Christentum war in seiner Sicht gespalten. "Behinderte Menschen wurden (...) als Quelle zum Heilserwerb gesehen" und mitleidig in Anstalten gepflegt und verwahrt. Andererseits wurden sie auch "einer religiösen Dämonisierung unterworfen" und im Zuge der Inquisition manchmal auch verbrannt. (Schönwiese 2003, 5)
Unter den Bedingungen feudaler Landwirtschaft wiederum ist möglicherweise (geistige) Behinderung nicht notwendig als abweichend definiert worden. (vgl. ebd., 6)
Im späten Mittelalter wurden von der Norm abweichende Menschen zur Belustigung öffentlich zur Schau gestellt.
Aufklärung und Industrialisierung erhoben die Prinzipien der Vernunft, der Leistungsfähigkeit/Nützlichkeit und der Autonomie des Individuums zur Norm, an der der Wert des Menschen gemessen wurde. Soziale Abhängigkeit wurde entwertet und damit die grundsätzliche gegenseitige Abhängigkeit von Menschen geleugnet. Behinderung und das Angewiesen sein auf Unterstützung wurde im Zuge dieser Leugnung zum Negativbild gegenüber der postulierten Autonomie (verstanden als Unabhängigkeit). Mit dem Humanismus rückte das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung. Für behinderte Menschen bedeutete dies zwar die Überwindung der Dämonisierung, hatte jedoch nicht deren Akzeptanz zur Folge.
Während Behinderung im Mittelalter als etwas gesehen wurde, das jeden treffen konnte, sollte sie nun aus der sicheren Distanz sachlich beobachtender, wissenschaftlicher Forschung betrachtet werden. Behinderte Menschen wurden zum Problem der Wissenschaft und damit zum Objekt von Medizin und Pädagogik und in Einrichtungen untergebracht. "Behinderung entwickelte sich zu etwas Wesensfremdem, Andersartigem, das gemieden und aus dem Bewusstsein der Allgemeinheit verdrängt wurde." (ebd., 6)
Die (vermeintliche) Objektivität des medizinisch-wissenschaftlichen Blicks musste kommen, damit die ‚Schädigung der Natur' im Individuum entdeckt und als pathologische Abweichung von der Norm identifiziert werden konnte. Hier scheint die Wurzel für die Ontologisierung und Individualisierung zu liegen, die den Zusammenhang mit den soziokulturellen Strukturen und damit die Relativität unsichtbar macht. Krankheit oder Behinderung erhielten ihre rein negative "Bedeutung der Abweichung" (Foucault 1968, 98) und wurden mit abstrakten "Begriffen für außer Kraft gesetzte Funktionen" (ebd., 31) beschrieben. Die Vielgestalt von Symptomen und Verhaltensweisen werden in angenommenen Einheiten zusammengefasst, die als Folie der ‚Erkenntnis' dienen. Foucault hebt die mit der Negativbesetzung und der Bloßstellung als Fremdem verbundene gesellschaftliche Rolle von Krankheit hervor: "unsere Gesellschaft will im Kranken, den sie verjagt oder einsperrt, nicht sich selbst erkennen; sobald sie die Krankheit diagnostiziert, schließt sie den Kranken aus." (ebd., 97). Dasselbe gilt m.E. für Behinderung. Der postulierte Unterschied "ruft Unterscheidung hervor." (ebd., 117) Isolierverfahren und "Abwehrmaßnahmen kommen ins Spiel; Schranken werden errichtet, alle Rituale der Exklusion bilden sich heraus." (ebd., 119) Das Nichtpassende, das eigentlich eine Projektion kultureller Themen ist, wird "in den Bereich der Innerlichkeit" (ebd., 112) verlegt, und erlaubt damit die Suche nach dem Ursprung der Krankheit in der ‚Anomalie' des Individuums, das in der Folge ausgebürgert wird. Die Institutionalisierung beginnt und damit auch die Professionalisierung der Helfersysteme. (vgl. Dörner 2007)
"(...) die Internierung, die im Zeitalter der Klassik über die Irren und so viele andere verhängt wird", spiegelt "das Verhältnis der Gesellschaft zu sich selbst, zu dem, was sie im Verhalten der Individuen anerkennt oder nicht anerkennt," (Foucault 1968, 105) ein Verhältnis zwischen Freiheit und Zwang.
"Die gemeinsame Kategorie, unter der alle Insassen der Internierungshäuser zusammengefaßt werden, ist die Unfähigkeit, an der Produktion, am Umlauf oder an der Akkumulierung der Reichtümer mitzuwirken." (ebd.)
Das Abstandnehmen der Gesellschaft von den Grunderfahrungen des Irrsinns, aber auch der gegenseitigen Abhängigkeit oder von Behinderung als Variante des Menschseins ging Hand in Hand mit der Ausrufung derselben als pathologische Form durch die Medizin. "Die Erkenntnis, die zu sagen erlaubt: dies ist ein Irrer", ist jedoch "weder ein einfacher noch ein unmittelbarer Akt. Er beruht in der Tat auf einer Anzahl vorgängiger Operationen und vor allem dem Abstecken des sozialen Raums nach den jeweiligen Grenzlinien der Wertung und des Ausschlusses." (ebd., 119) Nach Foucault drückt sich eine Kultur in den Phänomenen, die sie verwirft, gleichzeitig positiv aus; sie ist jedoch von sich aus nicht in der Lage, "eine Lösung anzubieten für die Widersprüche, die (...) (sie, d.Verf.) selbst hat entstehen lassen." (ebd., 127)
Er weist auch darauf hin, dass nicht vergessen werden darf, dass die ‚objektive' oder ‚positive' oder ‚wissenschaftliche' Psychologie ihren historischen Ursprung in der Psychopathologie hat: "eine Analyse der Persönlichkeitsspaltungen hat eine Psychologie der Persönlichkeit zugelassen; (...) eine Analyse der Defizite eine Psychologie der Intelligenz ausgelöst." (ebd., 113)
Die Definitionsmacht von Medizin und Psychologie ist bis heute ungebrochen.
Wie nieder die Hürde von Andersartigkeit zur Abartigkeit und lebensunwertem Leben ist, machte uns der Nationalsozialismus erschreckend bewusst. ‚Rassenhygiene' und ein zynisches Kosten-Nutzen-Modell wurden benutzt, um behinderte Menschen zur Negativfolie des ‚Volkskörpers' und der ‚Volksgesundheit' zu erklären. Sie waren die ersten Opfer; an ihnen wurde die "Vergasung ‚erprobt'" (Rommelspacher 1995, 60). 700.000 Menschen ‚mit Behinderungen' oder psychischen Erkrankungen wurden als ‚Ballastexistenzen' ermordet.
Herabwürdigung, Aussonderung und Ermordung von Menschen ‚mit Behinderung' lassen sich von der Antike über Mittelalter und Neuzeit bis in die Moderne nachweisen. Sie waren keine Besonderheit der Faschisten, fanden hier aber ihre Zuspitzung. "Da standen sie mitten im Weg zwischen der Ordnung und dem Fleiß der anderen." In diesem "gemessenen Schritt der Machbarkeit des Lebens (...)." (ebd., 67)
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte kann uns zeigen, welche Gefahr in der Formulierung allgemeiner, normativer, naturalistischer, abstrakter anthropologischer Entwürfe und Menschenbilder verborgen ist. Sie werden meist dazu missbraucht, die Gültigkeit eines herrschenden Wertesystems zu festigen. Die Sehnsucht nach Gewissheit verführt uns immer wieder, Antworten auf letztlich wohl unentscheidbare Fragen finden zu wollen. Schon bei der Fragestellung, was ‚der Mensch' sei, ist Skepsis geboten, denn sie zielt auf eine ontologische Festlegung und auf eine Homogenisierung im Sinne der Vereinheitlichung und Vereinnahmung von Verschiedenem ab. Die Suche nach einem allgemeinen Gleichen, nach einer Norm, ist unter Ideologieverdacht zu stellen. Sie meint meistens nicht das Gemeinsame in der Verschiedenheit. Was macht es uns so schwer, die lebendige Vielfalt und Verschiedenheit anzuerkennen?
Nach Rommelspacher gehört das "Leugnen von Ungleichheit" zum westlichen Selbstverständnis. (ebd., 30)
"Diese Grundidee von der Gleichförmigkeit der Welt steht in der Tradition des Eurozentrismus, der alles durch die Vorstellungen vom ‚Westen' wahrnimmt. (...) Kernpunkt dieses Konstrukts ist das Selbstverständnis der Europäer, die sich seit der Neuzeit als den fortgeschrittensten Teil der Welt definierten und zum Zentrum der Welt machten." (ebd., 17/18)
Die Welt wurde in "the west and the rest" (Hall, zit. nach ebd.) eingeteilt und in der Folge fast der gesamte ‚Rest' der Welt durch Kolonialisierung unterworfen.
Das ‚gefundene' Gleiche galt also nur für die (sich dafür haltenden) Gleichen und führte nicht zur Gleichstellung oder Gleichwertigkeit aller, sondern zur Abhebung vom Nichtgleichen, zu dessen Fremdmachen und Ausschluss oder Unterwerfung. Egalitarismus wurde mit Elitarismus verknüpft. Die Dominanz äußert "sich gerade im Anspruch auf Vorbildlichkeit." (ebd.)
"In der Überzeugung, man selbst besitze die Wahrheit im Gegensatz zu den anderen, ist die Gewalt angelegt. Der missionarisch verstandene Entwicklungsgedanke will nun mit aller Gewalt die Differenz aufheben bis hin zur Vernichtung." (ebd., 19)
Nach Rommelspacher ist "unsere Lebensweise und sind unsere Diskurse durchdrungen von den Erfahrungen von Herrschaft und Unterwerfung." (ebd., 22) Erzwungene Assimilation und Kolonialisierung reichen bis tief in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen hinein. Denn der Herrschaftsanspruch gegenüber anderen Kulturen unter dem Banner eines Ideals wirkt sich auch auf die ‚Innenseite' und das ‚Innenleben' einer Gesellschaft aus. Nichtkonforme und diesem Ideal nicht entsprechende Menschen müssen ebenfalls abgewertet, unterworfen oder möglichst unsichtbar gemacht werden, weil sie im Wege stehen. Treten sie dennoch in Erscheinung, sind sie
" allenfalls dazu da, um Erlebnisanlässe zu liefern und als Spiegel für die eigene Selbstdarstellung zu dienen. Sie sind in ihrer Funktionalisierung für die eigene Person interessant, womit sie ihre eigene Identität und Authentizität verlieren." (ebd., 15)
Im Anspruch des sog. Normalen auf Vorbildlichkeit, im ‚missionarischen Entwicklungs-gedanken', jedem Menschen diese konstruierte Norm aufzuzwingen und in der Funktionalisierung ‚behinderter' Menschen für die Bestätigung der vermeintlichen eigenen Normalität liegt in erster Linie die Enteignung des Selbst von Menschen ‚mit Behinderung'. In letzter, zu Ende gedachter Konsequenz wirkt diese Dynamik jedoch auf uns selbst zurück und führt auch zur Selbstenteignung der ‚Normalen'.
Rommelspacher greift in Anlehnung an Hegel dieses "Paradox der Herrschaft" auf, das darin liegt, "daß die Macht sich in dem Maße selbst untergräbt, in dem sie auf der Abwertung des Anderen beruht. (...) Ein Selbstwert, der auf der Unterwerfung des anderen basiert, ist äußerst labil" (ebd.), vor allem, wenn aufgrund der Selbsterhebung andere bedeutungslos gemacht werden, wodurch sie den Status des Gegenübers verlieren. Denn, wer bleibt dann noch zur Bestätigung der Überlegenheit?
"Das Selbst hat seinen Ursprung nicht in einer unergründlichen Natur, sondern ist Produkt der Interaktion mit Anderen. Von daher ist im Selbstwert auch der Wert der Anderen enthalten." (ebd.)
In der Anerkennung der Anderen liegt paradoxerweise der Freiraum des eigenen Selbstseins. (vgl. zu dieser Rückbezüglichkeit Kap. 1.2.2 i.d.A.; das ‚Paradoxon der Anerkennung')
Nach diesem Exkurs über mögliche Zusammenhänge bzgl. der Schwierigkeit Vielfalt und Verschiedenheit als gleichwertig anzuerkennen, gehe ich nun wieder zurück zur historischen Aufarbeitung.
Die Betreuung bzw. Begleitung behinderter Menschen nach 1945 bis heute kann fragmentarisch überschrieben werden als Perspektivenwechsel "von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung." (Hähner 1997, 25)
Zunächst wurden behinderte Menschen immer noch von der Teilnahme am sozialen Leben ausgeschlossen. Entweder lebten sie bei den Eltern oder aber die Unterbringung in Anstalten und psychiatrischen Kliniken schien die einzig denkbare Form des Umgangs mit den als unveränderbar bzw. als bildungsunfähig angesehenen Menschen, denen Entwicklung nicht zugestanden wurde. Heute wird dieser Ausschluss und die Situation der Anstaltsunterbringung mit den Begriffen ‚strukturelle Gewalt' (Galtung) und ‚totale Institution'(Goffman) bezeichnet.[18] Die Gewalt drückt sich darin aus, dass der einzige Lebensbereich die Pflegestation war (und teilweise noch ist). ‚Satt und sauber', aber ausgeschlossen von den existentiell so notwendigen Spiegelungen und unterschiedlichen Anregungen in alltäglichen zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen; der Reglementierung der Anstaltsorganisation unterworfen und damit ohne eigene Entscheidungsmöglichkeiten.
Die Grundkategorie von Behinderung, also das Gemeinsame all dieser konkreten, mit unterschiedlichen Etikettierungen versehenen Menschen (körperbehindert, sinnesbehindert, geistig behindert...) ist nicht deren ‚Behinderung', sondern die Isolation, so Jantzen. Im Hospitalismus, dessen Folge die Deprivation ist, liegt der "Kern von Behinderung." (Jantzen 1980, 64) Die weitgehende Versagung emotionaler Zuwendung und Nähe, sensorischer Anregung und persönlicher Freiräume hat persönlichkeitsschädigende Folgen (vgl. Kap. 1.2.2 i.d.A.), die sogar zum Tod führen können. Die Exklusion aus dem sozialen Resonanzraum wirkt sich verheerend auf das Selbstgefühl und die weitere kognitive und emotionale Entwicklung aus.
Kompensatorische Leistungen und Bewältigungsstrategien der Betroffenen, wie beispielsweise Rückzug und Regression (Rückfall in entwicklungsmäßig frühere Verhaltensmuster), Stereotypien, aggressives Verhalten oder die Anpassung im Sinne der Annahme der zugeteilten Rolle, werden dabei meist nicht mehr als adäquate Reaktion auf die Gewalt, sondern als der Behinderung zugehöriges Symptom interpretiert.
In der Aufbruchstimmung der 60er Jahre kam es vor allem durch die Initiative der Eltern behinderter Kinder zu sozialpolitischen Veränderungen bis hin zur Verabschiedung von Gesetzen, die (Bürger!)Rechte behinderter Menschen festhielten und dadurch auch einforderbar machten.
Im Zuge der von Italien ausgehenden Psychiatriereform (1975) wurde erstmals öffentlich auf die menschenunwürdigen Lebensbedingungen in den Anstalten hingewiesen und eine Dezentralisierung im Sinne des Aufbaus kleiner, gemeindewesenorientierter Hilfsangebote und Wohneinheiten gefordert. Diese Enthospitalisierung stellte einen wesentlichen Schritt zur Humanisierung und zur Integration dar. Der Prozess der Umsetzung dauert immer noch an.
Mit ähnlichem Anspruch formulierten in Skandinavien Bank-Mikkelsen und Nirje das Reformkonzept des ‚Normalisierungsprinzips'.[19] Es richtet sich ebenfalls gegen die strukturelle Gewalt in Großinstitutionen und fordert für behinderte Menschen eine Trennung der Lebensbereiche Arbeit - Freizeit - Wohnen, altersentsprechende Aktivitäten und das Leben in einer bisexuellen Welt. Insgesamt also einen normalen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus, einen normalen Lebenslauf, angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern und einen normalen wirtschaftlichen Standard (Taschengeld bekommen Kinder). Diese Forderungen wollten gleichzeitig verdeutlichen, dass sich die Entwicklung und die Bedürfnisse von Menschen ‚mit Behinderung' grundsätzlich nicht unterscheiden von jenen der sog. Normalen, sondern dass ihre Möglichkeiten behindert werden.
In Schweden ist es heute "gesetzlich verboten, Menschen wegen einer Behinderung im Heim unterzubringen. Weil Massenhaltung mit der Menschenwürde nicht vereinbar ist." (Dörner 2003)
Heim unterzubringenH
"Die Frage der Normalisierung der Beziehung der Gesellschaft gegenüber den Menschen mit Behinderung" (Hähner 1997, 33) blieb jedoch eher im Hintergrund. Das heißt, die Normalisierung führte nicht zu einem Menschenbild, das "Behinderung als normale Ausprägung menschlicher Existenz (beinhaltet, d. Verf.), die keine Aussonderung duldet ..." (Thimm, zit. nach ebd., 33/34). Normalisierung wurde im Gegenteil oft missverstanden als ‚Normalisierung der Behinderten' im Sinne einer Zurichtung auf die Norm hin. Das "biologistisch-nihilistische Menschenbild" (Theunissen, zit. nach ebd., 30) wurde aufgrund der neuerdings zugestandenen Bildungsfähigkeit, das die PädagogInnen wieder auf den Plan rief, ersetzt durch ein "pädagogisch optimistisches Menschenbild." (Niehoff, zit. nach ebd.) "Menschen mit Behinderungen wurden nicht mehr verwahrt und gepflegt, man begann sie zu behandeln, zu fördern. Förderung wurde zum zentralen Begriff in der Behindertenpädagogik." (ebd., 30)
Es kam zur "Gründung vieler Förder-, Rehabilitations- und Sondereinrichtungen." (ebd., 29) ‚Behinderte' Menschen wurden zum "'Sonder'fall der Pädagogik". (Lindemann/Vossler 1999, IX) Einerseits wurde dadurch das Recht auf Bildung und Schulbesuch (dieses erkämpfte Recht ist vor allem ein Verdienst der Elternvereinigungen) durchgesetzt, was einen Fortschritt bedeutete. Er hatte andererseits aber auch seinen Preis, denn Besonderung und Aussonderung sind Synonyme. Der Rehabilitationsgedanke führte wiederum zu "Isolationskarrieren" (ebd., 31) im Sinne eines nahtlosen Übergangs von der Frühförderung über Sonderkindergärten und Sonderschulen in den ‚Hafen' der Behindertenwerkstätten. Durch diese Segregation wurde (und wird) die Partizipation an der sozialen Gemeinschaft also wieder behindert und die Trennung zementiert, indem die Förderung behinderter Menschen spezialisierten Fachleuten in spezialisierten Institutionen übertragen wurde. Normalisierende Beziehungen zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen wurden dadurch verunmöglicht.
Bedeutend ist dabei, dass die Heil- und Sonderpädagogik in der Tradition der Psychiatrie steht und sich daher wesentlich an der defizitorientierten, ontologisierenden und individualisierenden medizinischen Sichtweise von Behinderung anlehnte und anlehnt.
"Die Behinderung wird vorwiegend mit medizinischen Begriffen als ‚empirische Realität' analysiert, als statischer und objektivierbarer Defekt verstanden und an der betroffenen Person festgemacht. Die neutrale Beobachtersprache ist Werkzeug objektiv-wissenschaftlicher Erkenntnis." (Greiner 2003, 29)
Festgelegt auf einen normativen Begriff "von Gesundheit und Funktionsfähigkeit", geht es darum, "eine genaue Systematik von Abweichungen zu erstellen." (Schönwiese 2003, 9/10) Genormte Körper, genormte Persönlichkeitsstrukturen. Abweichungen müssen mit spezieller Behandlung und Förderung in Bezug auf diese Norm vermindert werden. Durch die Konzentration auf sog. Defizite wird nicht mehr dem konkreten Menschen in seiner Ganzheitlichkeit begegnet. Kompetenzen und Stärken werden dadurch nicht wahrgenommen. Das Problem der Medizin ist, dass sie, um scharf sehen zu können, zergliedern muss. (in Anlehnung an H.P.Dürr, Kap.2. i.d.A.) Dabei reißt sie den Menschen aber aus seinem Lebenszusammenhang.
Ein Beispiel für den sonderpädagogischen Blick auf Behinderung ist folgende Definition:
"Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, in ihrem sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förderung." (Deutscher Bildungsrat, zit. nach Steingruber 2000, bidok)
Behinderung wird hier als personinhärentes Problem und als Hauptbestimmungsmerkmal eines Menschen beschrieben. Dass Lernen, soziales Verhalten und Kommunikation, aber auch psychomotorische Fähigkeiten sich nur im intermediären Raum zwischenmenschlicher Beziehungen entwickeln können und Behinderung (im Sinne von behindert werden) demnach auch dort stattfindet, scheint nicht auf. Mit Gesellschaft scheinen die ‚Nichtbehinderten' gemeint zu sein, nach deren Kommunikationsbereitschaft und Kommunikations(un)fähigkeit nicht gefragt wird.
Stattdessen gilt es, den individualisierten Defekt durch besonder(nd)e Erziehung und ‚missionarische' Förderung in vom sozialen Leben abgetrennten ‚Schonräumen' so weit wie möglich zu beheben und eine Annäherung an die ‚Durchschnittsnormalen' zu erreichen. Denn, "die Aufnahme und Akzeptanz in die ‚normale' Gesellschaft erfolgt erst, wenn ein bestimmtes Maß an Hilfebedarf abgebaut und ein gesellschaftlich akzeptierter Grad an Selbständigkeit erreicht ist (...)." (Hähner 1997, 31) Das Recht auf Teilhabe am sozialen Leben wurde und wird an Bedingungen geknüpft.
Übersehen wird dabei auch, dass Defizitorientierung und gezielte Förderung eine permanente Untergrabung des Selbstwertgefühls bedeuten. Durch den hartnäckig fixierten Blick auf das ‚Nicht-können' wird Menschen vermittelt, dass sie, so wie sie sind, nicht richtig und nicht gewollt sind und sie sich zuerst verändern müssen, bevor sie als vollwertige Menschen, als DialogpartnerInnen und Mitglieder der Gesellschaft ernst genommen werden.
Unter diesem "Ticken der Norm" (Müller, zit. nach Rommelspacher 1995, 67) werden ‚behinderte Menschen' zu ‚Auch-Menschen', "zum Sonderfall von Menschsein" (Greiner 2003, 29):
"ja deren Menschsein muss nachträglich noch in irgendeiner Weise innerhalb einer normativ-geschlossenen alltagspraktischen Anthropologie individuellen Lebensglücks legitimiert werden. (Er/Sie sei dennoch genauso glücklich, lebensfroh etc..., wie auch immer die Zuschreibungen lauten)." (ebd.)
Solange Menschen ‚mit Behinderung' sich ihre Existenz- und Partizipationsrechte durch Anpassung sowie Beteuerungen und Rechtfertigungen darüber, dass sie auch gerne leben, ‚verdienen' müssen, können sie auch jederzeit abgesprochen werden. Dazu schreibt Fredi Saal aus der Betroffenenperspektive:
"Von einem Augenblick zum anderen kann die Geschäftsordnung entfallen, die die Unanfechtbarkeit unserer Existenz garantiert.
Der Behinderte gehört zu jenen Gruppen, dessen Existenzberechtigung immer wieder in Frage steht. Man mag ihm schwer ein sinnvolles Dasein zubilligen. Weit eher verweist man auf die Last, die er sich und den anderen bedeutet. Schnell kommt der Gedanke an ‚Erlösung' auf." (Saal 1998)
Dass Auch-Menschen nur allzu schnell zu Nicht-Menschen werden, zeigt die Euthanasie-Debatte, die u.a. der australische Ethik-Philosoph Peter Singer 1984 mit seiner Theorie der ‚praktischen Ethik' ausgelöst hat. Behinderte Menschen und Menschen im Koma sollen ‚in ihrem eigenen Interesse'(?!) dem ‚schönen Tod' preisgegeben werden, da ihr Leben von "Singer und anderen Universitätsgrößen" (Saal, ebd.) als ‚glücklos', ‚unnütz' und deshalb ‚lebensunwert' bezeichnet wird.
Argumentiert wird vordergründig mit der Unterstellung von Leid, Sinnlosigkeit und Unfähigkeiten wie: kein Empfindungsvermögen, keine Beziehungsfähigkeit, keine Präferenzen auf ein zukünftiges Leben etc. (vgl. Schönwiese 2003, 65) Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht beziehen sich diese Zuschreibungen jedoch auf Fähigkeiten, die von außen nicht beobachtbar oder aber, wie Leid oder Sinn, nur von den Betroffenen selbst beurteilbar sind. Menschen mit Behinderung wurden jedoch, mit dem Argument der ‚Befangenheit', von der Debatte praktisch ausgeschlossen. Die Aussagen beziehen sich deshalb wohl eher auf unreflektierte Präferenzen und Phantasien der Theoretiker (‚nichtbehinderte' PhilosophInnen, ÄrztInnen). (vgl. Rommelspacher 1995, 73/74)
Aufgrund Singers Argumentationsweise vermutet Niedecken, dass er höchstwahrscheinlich gar keine Menschen ‚mit Behinderung' kenne, eine emotionale Begegnung mit konkreten Menschen also ausgespart habe. (vgl. Niedecken, zit. nach Schönwiese 2003, 70) Aus theoretischer Distanz argumentiere er mit fiktiven Figuren, mit Hilfe derer er den Behinderten den "altruistischen Suizid"[20] nahe legt.[21]
Da diese Botschaft möglicherweise nicht verstanden oder angenommen werden könnte, wird mit wissenschaftlicher Theoriebildung, die versucht, den Lebenswert von Menschen theoretisch zu definieren, nachgedoppelt. Wer auf theoretischer Ebene allgemein gültige Kriterien bzgl. des Lebenswertes von Menschen bzw. der Zulassung zum Leben definiert, kann sich leicht der persönlichen Verantwortung entziehen.
Hintergründig basiert die Debatte auf utilitaristischem Gedankengut, einem konsequenten Nützlichkeitsdenken; auf einer "ökonomisch begründeten und moralphilosophisch legitimierten Bemessung des Wertes menschlichen Lebens an seiner (ökonomischen) Brauchbarkeit." (Jantzen, zit. nach Ziemen 2002, 18).
Dass diese Debatte nur 40 Jahre nach der Nazi-Euthanasie schon wieder aufkommen konnte, weist auf den in der Psychoanalyse beschriebenen Mechanismus der Wiederholung des (kollektiv) Verdrängten und ‚Vergessenen' und auf die nach wie vor bestehende Ambivalenz in uns allen hin. Der Lebenssinn und Lebenswert eines Menschen ist zutiefst subjektiv. Appelle greifen jedoch nicht.
"Wir haben nur eine Chance, dieser neuen ‚Euthanasie'-Diskussion entgegenzuwirken, wenn wir das, was Peter Singer sagt, in uns wiedererkennen und aushalten." (Niedecken, zit. nach Schönwiese 2003, 70)
Seine Logik von der ‚Erlösung von Leid' ist verführerisch. Zudem verwendet er eine Strategie, die Maturana ‚Dehumanisierung' nennt. Bei Singer wird die Aufzählung der Unfähigkeiten zur Erklärung herangezogen, dass ‚diese Menschen' keine Personen seien und es deshalb ethisch unbedenklich ist, sie zu töten.
"Eine Möglichkeit, ethische Regungen (...) zu zerstören, besteht darin, dem jeweiligen Gegner die Merkmale eines Menschen abzusprechen: Der Feind wird dehumanisiert, er erscheint als ‚Untermensch' (...)." (Maturana/Pörksen 2002, 213)
Durch diese ‚Zurichtung' der ‚Anderen' können wir uns am anderen Menschen nicht mehr erkennen; derart fremd gemacht, entstehen tiefe Gräben, die das Gemeinsame unkenntlich machen.
Hinter den Gen- und Reproduktionstechnologien, in deren Weiterentwicklung gigantische Summen investiert werden, steckt die Vision der Züchtung des ‚idealen Menschen'; eine Art triviale Maschine, die voraussagbar ist und das erzeugt, was dem konstruierten Ideal entspricht. Somatische Erkrankungen und Behinderungen, aber auch Verhaltensab-weichungen und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gelten im Modell der ‚Bio-Ethik' als vermeidbares Übel. Sie sind zu widerständig und passen nicht in die ‚schöne neue Welt' des machbaren Menschen. Diese gefährliche "Biologisierung des Sozialen durch eine genetisch fixierte Medizin" (Schönwiese 2003, 73) würde sich aus dem Blickwinkel der Vernetztheit und Wechselwirkung von biologischen/genetischen Strukturen und sozialen Beziehungserfahrungen selbst ad absurdum führen. (vgl. dazu die Ausführungen im Kap. 1.2.2 i.d.A.)
Die mittlerweile zur breiten Routine gewordene pränatale Diagnostik (auch humangenetische Beratung oder Vorsorgeuntersuchung genannt) dient der Selektion behinderter Föten. Ein ungeborenes, als voraussichtlich behindert diagnostiziertes Kind ist gesetzlich nicht geschützt. Es darf bis zur Geburt jederzeit (!) abgetrieben werden.
Der Gynäkologe und Experte für Pränatalmedizin Peter Schwärzler nennt die Fruchtwasseruntersuchung (= invasive Pränataldiagnostik) eine "Rasterfahndung nach behindertem Leben" [22]. Sie ist medizinisch nicht gerechtfertigt, weil sie kein medizinisches Handeln zur Folge hat. Sie bringt Eltern aber in eine schwierige Entscheidungssituation. Laut Statistik wurde in Vorarlberg 2002 kein Kind mit der Diagnose ‚Trisomie 21' mehr geboren. Frauen, die ihr als behindert diagnostiziertes Kind ‚dennoch' zur Welt bringen wollen, geraten unter erheblichen Rechtfertigungsdruck.
Klare Worte findet auch Peter Radtke zu dieser Thematik:
"Es steht außer Zweifel - und ich will es hier bewusst kraß formulieren - der sogenannte Nichtbehinderte betrachtet den behinderten Mitmenschen als eine Art Fehlmuster der Natur. Wie sonst ließe sich das Bemühen erklären, eben diese Natur zu überlisten, indem man gewissermaßen vor dem Produktionsausstoß die defekten Stücke analysiert, sie aussondert und auf diese Weise gar nicht erst in den Handel kommen lässt. Auch deuten sich bereits Möglichkeiten an, bei nachweislich fehlerhafter Konstruktionszeichnung das ganze Modell einzuziehen (...). Verzeihen sie mir diese zugegeben despektierliche Ausdrucksweise. Die Form, mit der man (...) Fragen genetischer Beratung, des Schwangerschaftsabbruchs oder der Gentechnologie behandelt, legt jedoch in der Tat den Vergleich mit Massenprodukten nahe. (...) Mit unserem Ansatz, Leben, insbesondere behindertes Leben, verfügbar zu machen, haben wir den Menschen zu einem Produkt degradiert. Doch wir vergessen dabei, dass wir uns damit gleichzeitig selbst den Warencharakter anheften." (Radtke 1994)
Dem gesellschaftlich produzierten und sich in der Gentechnik rekonstruierenden Fremd- und Feindbild ‚Behinderung' können wir nur entgegen wirken, wenn wir bereit sind, das fremd Gemachte, das ängstlich Abgewehrte und Projizierte wieder hereinzunehmen und in uns selbst zu integrieren.
Nur in der Wahrnehmung der eigenen Ambivalenz und inneren Spaltung liegt die Möglichkeit, Leidensprojektionen als Spiegelbilder der Spaltung zu erkennen und zurückzunehmen und damit die personale Integrität (die eigene und auch die, der zu Projektionsträgern vernutzten Menschen) wieder herzustellen.
Gerade in Zeiten der Verknappung kommen ökonomische Kalkulationen wieder auf. Besonders dann wird deutlich, dass die postulierte Unantastbarkeit der Würde des Menschen immer wieder zur Diskussion gestellt und durch "kalte Rechner und quere Ideologien"[23] sehr wohl angetastet werden kann.
Auch der heutige Zeitgeist misst den Wert von Menschen wesentlich an den Eigenschaften, wie intelligent, leistungsfähig, ästhetisch perfekt und gesellschaftlich nützlich sie sind.
Menschen ‚mit Behinderung' kratzen auf unterschiedliche Weise an diesem Bild der Vollkommenheit, das wir zwar anstreben, aber zum großen Teil selbst nicht erfüllen können. Sie stören in diesem favorisierten Bild des Menschen und werden dadurch zur Provokation und zur Projektionsfläche für die eigene, nicht eingestandene Unvollkommenheit und Abhängigkeit. Oder aber, sie werden von vornherein ferngehalten, um uns nicht zu irritieren.
Die gesellschaftliche Integration von Menschen ‚mit Behinderung', auf die ich anschließend eingehen möchte, kann nur nachhaltig sein, wenn wir uns mit den eigenen Abwehrmechanismen selbstreflexiv auseinander setzen. In dieser Bewusstwerdung können wir abtragen, was zwischen uns steht. Dieses Abtragen ist wiederum nur in integrativen Situationen überhaupt möglich, denn dazu brauchen wir uns gegenseitig. Die Berührungsängste sind ja u.a. auch den fehlenden Interaktionserfahrungen (Struktur-koppelungen) geschuldet. Die Segregation zementierte die inneren Spaltungen. Kontakte wurden durch sie verunmöglicht und der zwischenmenschliche Dialog verhindert. Dieser könnte uns aber helfen, die Projektionen zurückzunehmen. Unsere Wahrnehmung hängt ja von Vorerfahrungen und deren Bewertungen ab. Wenn wir auf keine persönlichen Interaktionserfahrungen mit Menschen ‚mit Behinderung' zurückgreifen können, wird das Bild, das wir uns von ihnen machen, von unseren Phantasien gespeist, die eben mehr mit uns selbst zu tun haben, als mit den jeweils konkreten Menschen, ihren Sinnkonstruktionen und Lebensentwürfen. Schönwiese hat dazu folgende These aufgestellt:
"Behindert ist, wer gesellschaftlichen Projektionen ausgesetzt ist, die ihn zum symbolischen Träger allgemeiner, gesellschaftlicher oder existentieller Probleme macht." (Schönwiese 2003, 43)
"Behindert sein wird mit allem Elend der Welt, das einen selbst betreffen kann, identifiziert." (ebd., 44)
Er beschreibt damit die gesellschaftliche Funktion von ‚Behinderten' als Rollenträger der delegierten, abgespaltenen und verdrängten, individuellen und kollektiven Ängste. Diese betreffen vor allem unsere Vulnerabilität, die potentielle Möglichkeit von Verletzung oder Behinderung in jeder Lebensgeschichte und das damit verbundene "Skandalon der Bedrohtheit und Abhängigkeit der menschlichen Existenz" (Greiner 2003, 31), eben unsere Hilfsbedürftigkeit und das Angewiesensein auf Andere.
Es geht um das Wagnis, sich gegenseitig mit und trotz der Berührungsängste, in unserer lebendigen Unvollkommenheit und in unserem Angewiesensein auf die Hilfe und Unterstützung anderer zu begegnen.
In der Anerkennung der Autonomie jedes Menschen (im Sinne von Eigengesetzlichkeit) bei gleichzeitiger gegenseitiger Abhängigkeit liegt ein Potential, das uns Gemeinsames entdecken und Verschiedenes respektieren lässt. Dieses Menschenbild ist sehr offen und lässt keine weitere Festlegung auf spezifische menschliche Eigenschaften zu, sondern verweist auf die konkrete menschliche Begegnung.
"Als historisch neueste reformpädagogisch und sozialreformerisch orientierte Perspektive entstand die integrative Pädagogik (...)." (Schönwiese 2003, 9)
Einen wesentlichen Beitrag zur Integrationsbewegung leisteten wieder die Elternvereinigungen, die sich gegen die Besonderung und die Selektionsmechanismen zur Wehr setzten und die Integration ihrer Kinder ins allgemeine Bildungssystem forderten.
Ebenso war das "sich wandelnde Selbstbewußtsein, vor allem körperbehinderter Menschen" (Hähner 1997, 31) von Bedeutung. Sie wehrten sich u.a. in Demonstrationen und Kundgebungen gegen die alltäglichen Barrieren und Behinderungen, die ihre Teilnahme am sozialen Leben verhinderten.
Durch dieses Aufzeigen des ‚Behindert werdens' kam es zu Umorientierungen.
"Es ist nicht mehr der behinderte Mensch allein, der im Mittelpunkt der Betrachtungen steht, sondern ‚der behinderte Mensch in unserer Lebenswelt'." (ebd., 32)
Unsere behindernde Lebenswelt trat damit ins Blickfeld.
Zu dieser veränderten Sichtweise von ‚Behinderung' trugen auch unterschiedliche Theorien bei, wie z.B. die in dieser Arbeit thematisierte Erkenntnistheorie des Konstruktivismus oder die Systemtheorie, die Menschen als höchst komplexe und variable, nicht voraussagbare, sich im notwendigen Austausch mit der Umwelt selbst organisierende und ständig verändernde Systeme begreift. Aber auch die historisch-kritische Anthropologie lehnt normative Wesensbestimmungen des Menschen ab und beschreibt stattdessen den Wandel und die "Vielfalt gesellschaftlich-historischer Lebensformen" innerhalb geschichtlicher Bewegungen. Sie betont "die Differenzen der Menschen (...), und zwar in konkreten Kontexten." (Greiner 2003, 31). Beeinflusst von diesen Theorien fand auch in der Pädagogik ein Perspektivenwechsel statt, der zur Abwendung von traditionellen Ansätzen und zu einer Neuorientierung führte. Beispiele dafür sind die 'allgemeine Pädagogik' im Sinne einer Pädagogik für alle, wie sie Feuser, Sander u.a. vertreten; oder die ‚Pädagogik der Vielfalt' (z.B. Hinz, Prengel u.a.). Ihnen gemeinsam ist, dass sie eine Normorientierung ablehnen und der Gleichwertigkeit in der Heterogenität von Menschen Rechnung tragen wollen. Von diesem Standpunkt aus kann nicht mehr grundlegend zwischen ‚behinderten' und ‚nichtbehinderten' Menschen unterschieden werden. Behinderung wird als soziale (Re)Konstruktion und somit als gesellschaftliches Phänomen identifiziert.
Auch die Betrachtungsweise des Soziologen Günther Cloerkes greift diesen gesellschaftlichen Aspekt auf:
"Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. ‚Dauerhaftigkeit unterscheidet Behinderung von Krankheit, ‚Sichtbarkeit' ist im weitesten Sinne das ‚Wissen' anderer Menschen um die Abweichung.
Ein Mensch ist ‚behindert', wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist." (Cloerkes, zit. nach Steingruber 2000)
Diese Definition nimmt sowohl Bezug auf eine gegebene Norm, die Behinderung erst hervorbringt, als auch auf die negative Bewertung. Behinderung ist somit kein objektives, absolutes Faktum, sondern eine gesellschaftliche Zuschreibung, die sich auf eine Diskrepanz zur Erwartung bezieht. Es hängt von der sozialen Umwelt und ihren Bewertungen ab, ob eine bestimmte Daseinsweise oder Verhaltensweise als so grundlegend anders und negativ empfunden wird, dass sie zum Stigma gemacht wird.
"Das Konstrukt des Andersseins der Anderen wird zum Kriterium der hierarchischen Abgrenzung von ‚die' und ‚wir'." (Thürmer-Rohr, zit. nach Pohl 1999, 57)
Behinderung ist eine "fremdbestimmte Zurücksetzung" (Lindmann/Vossler 1999, 175)
Integration meint die Gemeinsamkeit von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Lebensbereichen; ein gemeinsames Leben und Lernen von Anfang an. Sie fordert die Teilhabe von Menschen ‚mit Behinderung' an allen gesellschaftlichen und sozialen Prozessen. Dazu ist es notwendig, an den behindernden Rahmenbedingungen anzusetzen. Denn ein System besteht so lange, "wie die Bedingungen, die es konstituieren, erhalten bleiben." (Maturana/Pörksen 2002, 214)
Integrative Pädagogik versucht die segregierenden Mechanismen aufzuzeigen und diese Be- und Verhinderungsstrategien zu überwinden.
Häufig wurde jedoch die ‚Integrationsfähigkeit' wieder nur am ‚Schweregrad' der ‚Behinderung' von Menschen festgemacht, sodass die Integrationsunfähigkeit der sie umgebenden Systeme verdeckt blieb. So erreicht beispielsweise eine "lediglich räumliche Verlagerung von Sonderpädagogik in die Allgemeine Schule ohne weitere Veränderung" (Hinz 2002, 354) nicht die gewünschte integrative Situation gemeinsamen Lernens. Wenn behinderte Menschen in manchen Unterrichtsfächern mit dem Argument ‚spezieller Bedürfnisse' wieder von der Gemeinschaft getrennt werden, wird die Selektion intern fortgesetzt, statt die noch ausstehende Krise der Sonderpädagogik sowie eine notwendige Veränderung des Schulsystems herbeizuführen.
"...denn ‚special' sind die Bedürfnisse nur, weil die Pädagogik bislang nicht in der Lage war, diesen Bedürfnissen zu entsprechen" (ebd., 357)
Integration als ‚Hereinnahme behinderter Menschen' in die Gemeinschaft ohne Veränderung der Bedingungen wird rasch zum ‚Gnadenakt', der gewährt oder nicht gewährt werden kann; die behindernden Bedingungen treten dadurch in den Hintergrund.
Hinz konstatiert den inflationären Gebrauch des Integrationsbegriffs, da schon ein Bei- und Nebeneinander als integrativ bezeichnet wird. Bezüglich des Systems Schule kritisiert er, dass die zugestandenen Ressourcen vom Förderbedarf der Kinder abhängig gemacht werden, was wieder dem veralteten medizinischen Modell der individualisierten Etikettierung von Menschen zuarbeite (je mehr ‚I-Kinder'!, desto mehr Ausstattung und Personal).
Er differenziert Integration und Inklusion. Mit Inklusion soll nun forciert werden, was die Integration nicht vermochte, und dies nicht nur im Bildungsbereich. Während Integration die Eingliederung von Menschen ‚mit Behinderung' in die Gesellschaft anstrebte, setze Inklusion den Fokus auf die Veränderung gesellschaftlich bestehender Strukturen mit dem Ziel, allen Menschen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie zur Teilhabe am sozialen Leben brauchen. Das heißt, dass die Teilhabe nicht an Bedingungen geknüpft werden darf.
Für die Verwirklichung dieser Forderung im alltäglichen Leben braucht es einen langen Atem und die Bereitschaft, sich mit den behindernden Widerständen und Ängsten der ‚Nichtbehinderten' (die Begriffe geraten durcheinander) auseinander zu setzen. Wir fürchten uns vor allem, was wir nicht verstehen. Alles, was man nicht kennt, schürt Mythen.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle selbstreferentielle Systeme sind, die die Wirklichkeit vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen deuten, geht es in Bezug auf das Phänomen ‚Behinderung' notwendig darum, die bislang durch die Segregation verhinderten Begegnungsmöglichkeiten zu kreieren. Appelle nützen wenig; Interaktionen selektieren die Strukturveränderungen. Wir verändern unsere Denk- und Handlungsweisen nur, wenn sie aufgrund neuer, anderer Erfahrungen nicht mehr brauchbar sind. Das "Schaffen realer Begegnungsmöglichkeiten" (Schönwiese 2003, 43) kann dazu beitragen. Ich denke dabei nicht so sehr an groß angelegte Veranstaltungen, die immer noch den Beigeschmack des Caritativen und Gönnerhaften haben. Eher meine ich, sind es ganz unspektakuläre, normale Begegnungssituationen im Alltag, die vielleicht durch gemeinsame Interessen zustande kommen, die unsere Denkstrukturen perturbieren und so zu einer Normalisierung der Beziehungen führen können.
Auf der Ebene sozialer Wirklichkeitskonstruktionen gilt dasselbe, da sie ja in Wechsel-wirkung mit den individuellen Wirklichkeiten stehen. Die im Abschnitt über soziale Systeme beschriebene Tendenz sozialer Bereiche zum Konservatismus ist nicht zu unterschätzen. Die Langlebigkeit historisch gewachsener sozialer Wirklichkeitskonstruktionen drückt sich in Bezug auf Behinderung darin aus, dass Behinderung nach wie vor häufig individualisiert und dabei als Hauptmerkmal des betreffenden Menschen gesehen wird und die sozialen Prozesse, die zur Formierung von Behinderung führen, dadurch aus dem Blickfeld geraten. Das Festhalten sozialer Bereiche an einmal gefundenen ‚Problemlösungen' zeigt sich in der Exklusion oder Segregation, in der Vermeidung von Kontakt.
Eine mögliche Veränderung gesellschaftlicher Konstruktionen und Definitionen ist auch mit den sozialen Gestaltungsmöglichkeiten der Systemmitglieder und der Machtverhältnisse in den sozialen Systemen verbunden. Hier scheint, zumindest in Teilbereichen, mit der Independent-Living-Bewegung, in der sich vorwiegend körperbehinderte Menschen formieren, und der People-First-Bewegung (d.h.zuerst sind wir Menschen), in der sich Menschen ‚mit geistiger Behinderung' zusammenschließen und für sich selbst sprechen, eine Verschiebung stattzufinden.
Ganz wesentlich erscheint mir auch das Anliegen der Behindertenbewegung, sich vermehrt in die Wissenschaft einzubringen "und die Forschung zu Behinderung von einer Forschung über Objekte zu einer Forschung von Subjekten zu machen" (Tervooren 2002), was die Möglichkeit bietet, Zuschreibungen und Fremdbilder zu korrigieren.
Menschen ‚mit Behinderung' kommen uns also entgegen, indem sie sich selbstbewusst einbringen, mit ihrer Kompetenz unsere Vor-Urteile und Vor-Stellungen von Behinderung irritieren und uns ihre eigenen Lebensentwürfe und Wirklichkeitskonstruktionen entgegenhalten.
"Schönwiese sieht die Notwendigkeit, daß Behinderte auf die Nichtbehinderten zugehen müssen, in der Behinderung der Nichtbehinderten (...)."(Klee 1980)
"Man kann niemals vertrauen, daß ein Nichtbehinderter auf einen Behinderten zugeht - da erwartet man als Behinderter wirklich zuviel; die Nichtbehinderten sind da so behindert, das ist schrecklich." (Schönwiese, zit. nach ebd.)
Dass diese Annäherungen sich gegenseitig Entfremdeter nicht glatt und reibungslos ‚funktionieren', sondern mit Verunsicherungen und Krisen einhergehen, ist anzunehmen. Auch Peter Radtke erahnt Turbulenzen:
"Der mündige, ich bewußte behinderte Bürger ist, trotz entgegenlaufender Beteuerungen, für die meisten Mitmenschen nicht der Idealfall. Vielmehr wird er zum Stein des Anstoßes. In seiner relativen Selbstsicherheit stellt er die eigene Daseinsform auf eine Stufe mit derjenigen des sogenannten Nichtbehinderten. Dies wiederum bedeutet eine Infragestellung der Normen und Werte unserer heutigen Gesellschaft, die ja fast ausschließlich von nichtbehinderten Menschen geprägt werden. Wer aber will schon die eigenen Grundsätze hinterfragt sehen?" (Radtke 1994)
Wenn nach Heijl wechselseitige Interaktionen zu einer ‚partiellen Parallelisierung' im Sinne vergleichbarer Realitätskonstruktionen der interagierenden Subjekte führen (vgl. Kap. 1.2.3 i.d.A.), wird noch einmal verständlich, welchen Stellenwert Interaktionserfahrungen zwischen noch als ‚behindert' und ‚nichtbehindert' bezeichneten Menschen für eine Veränderung haben. Intersubjektives Verstehen und wechselseitige Veränderung ist nur durch die Regelmäßigkeit von Interaktionen (= strukturelle Koppelung), die zur Ausbildung konsensueller Bereiche im Sinne gemeinsamer Bedeutungsräume führt, möglich. Auch die ‚theory of mind' kann sich nur auf der Basis vergleichbaren Erfahrungshintergrundes entwickeln. Bewusstsein und Verhalten sind relationale Phänomene.
Bezüglich des Integrations- bzw. Inklusionsgedankens gilt: je mehr Systemmitglieder bestimmte Handlungs- und Denkweisen teilen, desto stabiler werden sie.
Wesentlich sind auch internationale Deklarationen (UNO-Menschenrecht) und Bestimmungen auf Gesetzesebene, die die Rechte von Menschen ‚mit Behinderungen' einforderbar machen und sozusagen ‚von oben' die Veränderungen an der Basis unterstützen (z.B. Benachteiligungsverbot, Gleichstellungsgesetz).
Dieser Rückblick (und teilweise schon angedachte Ausblick) mit den exemplarisch eingeflochtenen, unterschiedlichen Definitionen von Behinderung sollte die Relativität des Begriffs in seiner Abhängigkeit von der jeweils geltenden gesellschaftlichen Norm deutlich machen. Gleichzeitig sollten die Auswirkungen dieser konstruierten Dichotomie ‚behindert' vs. ‚nichtbehindert' auf uns alle thematisiert werden. Noch besteht dieser Dualismus. Und unsere Ambivalenz.
"Die Zwiespältigkeit aller Fortschritte in der Entwicklung von Hilfen für behinderte Menschen kann dadurch charakterisiert werden, dass auch heute Akzeptanz, Entwicklungsbegleitung und Integration neben korrektiven, abwehrenden, aussondernden und auch neuen eugenischen Denkformen (...) bestehen." (Schönwiese 2003, 6)
Menschen mit sog. geistiger Behinderung befinden sich bzgl. dem Ansehen und der Achtung in unserer Gesellschaft in der ‚Hierarchie der Behinderungen' im untersten Feld. In den folgenden Kapiteln gehe ich auf die subtilen Formierungsprozesse von ‚geistiger Behinderung' ein. Als Analysekriterium dienen mir dabei die herausgearbeiteten Folien der trivialen und nicht trivialen Sichtweise von Menschen (vgl. Kap. 2.1 i.d.A.) sowie der psychoanalytische Blickwinkel.
"Unter den Kindern in der Behindertenanstalt herrschte nämlich eine strenge Hierarchie: Ganz oben im Rang standen diejenigen, die am wenigsten behindert waren, ganz unten diejenigen, die sowohl Bewegungsbehinderungen hatten als auch geistig behindert waren. Für die nicht geistig Behinderten war nichts wichtiger, als den Abstand zu den Idioten deutlich zu machen. Das war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Alle wussten, dass wir außerhalb des Zauns alle Gefahr liefen, als Idioten angesehen zu werden, und das war gefährlich, weil jemand, der als Idiot angesehen wurde, auch eine Tendenz in sich hatte, der Rolle gerecht zu werden."
Maigull Axelsson: Die Aprilhexe, 248/249, München: Bertelsmann 2000
Dass ‚Behinderung' nicht ein Fakt ‚an sich' ist, sondern immer nur im Verhältnis zu einer vorab bestimmten und gewünschten gesellschaftlichen Norm gesehen werden kann und erst dadurch existent wird, wurde im letzten Abschnitt aufgezeigt.
Während jedoch bei Menschen ‚mit körperlichen Behinderungen' diese soziale Einwirkung des ‚Behindert - werdens' durch z.B. bauliche Barrieren heute relativ geläufig ist, erscheint uns dieser soziale Zusammenhang bei Menschen ‚mit geistigen Behinderungen' weniger gut nachvollziehbar.
Nach Lindemann und Vossler mag dies daran liegen, dass Funktionseinschränkungen im körperlichen Bereich beobachtbar und zumindest ansatzweise gedanklich vorstellbar sind. Kognitive Fähigkeiten sind dagegen nicht direkt beobachtbar und es ist auch schwer vorstellbar, sie nicht oder nur eingeschränkt zu haben, wie es Menschen mit ‚geistiger Behinderung' unterstellt wird. Die ‚eigentliche Ursache' der geistigen Behinderung werde deshalb umso vehementer und nachdrücklicher dem betroffenen Menschen zugeschrieben. In der Folge scheint es auch unumgänglich, durch gesonderte Beschulung eine Veränderung im betroffenen Menschen zu forcieren, statt die Umgebung auf die Heterogenität von Menschen auszurichten. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 107)
Wie bei der körperlichen, wird auch bei der geistigen Behinderung davon ausgegangen, dass sie ihren ‚Ursprung' in einer physischen Normabweichung hat.
"Bei geistiger Behinderung wird eine Verbindung zwischen organischen, neurologischen, genetischen oder biochemischen Zuständen und‚charakteristischen' Verhaltensweisen und Entwicklungsverzögerungen hergestellt." (ebd., 106)
Die Beschreibungen oder Zuschreibungen gründen sich jedoch auf Vermutungen, die sich auf die, mit der physischen Abweichung in Verbindung gebrachten kognitiven Funktionen beziehen. Im Gegensatz zu körperlichen Behinderungen sind nämlich hier die Funktionen, die durch die ‚Schädigung' eingeschränkt sein sollen, nicht direkt beobachtbar. Lediglich das Verhalten ist beobachtbar. Dieses steht jedoch, wie ich schon mehrfach hingewiesen habe, in unlösbarem Zusammenhang mit der aktuellen Interaktion und allen vorangegangenen zwischenmenschlichen Erfahrungen und Beziehungen. Eine kausale Schlussfolgerung von gezeigtem kognitiven und sozialen Verhalten auf tatsächliche kognitive Fähigkeiten ist aus systemisch-konstruktivistischer Sicht nicht möglich, da Beobachtungen des inneren Bereichs (Schädigungen) mit Beobachtungen des äußeren Bereichs (Verhalten) nicht direkt in Zusammenhang gebracht werden können. (vgl. Kap. 1.2.1 i.d.A.) Der Begriff ‚geistige Behinderung' entspricht somit einer trivialen Sichtweise des Menschen.
Die Zuschreibung ‚geistige Behinderung' kommt durch zwei verschiedene Konstruktions-modi zustande: entweder wird "aufgrund beobachtbarer Schädigungen eine Prognose über zu erwartende Auffälligkeiten gestellt" (Lindemann/Vossler 1999, 108/109) oder es wird "von beobachtetem (abweichendem) Verhalten auf Schädigungen geschlossen". (ebd., 109) Die implizite Logik ist also: "Wer eine Schädigung hat wird sich auffällig verhalten, und wer sich auffällig verhält hat möglicherweise eine Schädigung." (ebd.) Lindemann und Vossler zeigen diese Kausalität an zwei Beispielen auf:
Bei der Behinderungsform ‚Down-Syndrom' (Trisomie 21) wird die chromosomale Abweichung (dreifaches Vorhandensein des einundzwanzigsten Chromosoms) mit mehr oder weniger ‚eindeutigen', zu erwartenden Entwicklungsdefiziten und Entwicklungsprognosen in Zusammenhang gebracht. Diese prognostizierte Zukunft stellt sich dem Kind also in den Weg, noch bevor es die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln.
"Bei der ‚Minimalen Cerebralen Dysfunktion' (MCD) wird aufgrund von Beobachtungen des Verhaltens eines Menschen eine Schädigung unterstellt" (ebd., 109), wenn sich vom Beobachter keine Erklärungen für das abweichende Verhalten im sozialen Umfeld feststellen lassen. Der logische Schluss ist hier, dass es sich demnach um eine organische Schädigung handeln muss, wenngleich sie medizinisch nicht nachgewiesen werden kann, weshalb sie als minimal bezeichnet wird.
Diese Schlussfolgerungen oder linearen Denkmuster bilden die Grundlage für Diagnostik und standardisierte Testverfahren.
Aus medizinisch-psychiatrischer Sicht handelt es sich bei der geistigen Behinderung um eine angeborene oder früh erworbene Intelligenzminderung, die ‚charakterisiert' ist durch eine mangelhafte oder verzögerte Entwicklung. Die Einteilung der verschiedenen Formen geistiger Behinderung erfolgt nach dem Intelligenzgrad (IQ), nach der Bildungsfähigkeit oder nach der Ätiologie.
Ätiologisch steht jedoch "den Intelligenzminderungen mit bekannter Ursache (etwa 25%) (...) ein hoher Prozentsatzanteil ursächlich unklarer Fälle (etwa 75%) gegenüber." (Hackenberg 1997, 163)
Trotz dieser Unsicherheit wird an der Kausalität von Schädigung und daraus folgender Verhaltensauffälligkeit und damit an der Individualisierung von Behinderung festgehalten.
Die Feststellung des Intelligenzgrades wird mittels Intelligenztests vorgenommen, wobei mit bestimmten Fragen (Input) überprüft werden soll, ob die untersuchte Person fähig ist, die erwarteten Lösungen (Output) zu liefern. Die Verfahren erheben den Anspruch, ‚objektiv' zu sein, sofern der Diagnostiker das Ergebnis nicht beeinflusst. Intelligenztests gelten nach wie vor als "eine verlässliche Schätzung des Gesamtpotentials eines Menschen." (Jackson zit. nach Lindemann/Vossler 1999, 116) Diese triviale Sichtweise vom messbaren, "analysierbaren Menschen bildet die unhinterfragte Grundannahme der meisten diagnostischen Klassifikationssysteme." (Lindemann/Vossler 1999, 111)
Vom Standpunkt einer nicht-trivialen Sichtweise gibt es keine Möglichkeit, diese Ansprüche zu erfüllen. Abgesehen davon, dass nur das beobachtete Verhalten, nicht aber die Motivation und die tatsächlichen Fähigkeiten bewertet werden können, sich die getestete Person zudem nicht selbst kreativ einbringen, sondern nur auf die Anforderungen reagieren kann, hat Maturana auch eine andere Definition von Intelligenz:
"Intelligenz manifestiert sich in der Möglichkeit, das eigene Verhalten in einer sich verändernden Welt zu variieren." (Maturana/Pörksen 2002, 143)
Aus diesem Blickwinkel geht er davon aus, dass "alle Menschen in gleicher Weise intelligent sind" (ebd.) und ausgehend von ihrem Erfahrungshintergrund und dem eigenen Realitäts-bereich nur selten logische Fehler machen. Wir unterscheiden uns durch unsere Struktur, die wiederum abhängig ist von der Anfangsstruktur und den lebensgeschichtlichen Interaktionserfahrungen. Wir unterscheiden uns auch durch unsere Vorlieben und Interessen, die unterschiedliche Entfaltungen unserer Struktur zur Folge haben. Die Selbstorganisation im Austausch mit anderen geschieht jedoch auf ähnliche Weise.
Was in Intelligenztests abgefragt wird, ist lediglich "der Grad der Inklusion in eine Kultur" (ebd., 144), womit Maturana wieder auf den sozialen Aspekt von Intelligenz verweist.
Zudem sind es "die Emotionen, die bestimmen, ob und in welchem Ausmaß man seine eigenen Fähigkeiten und seine fundamentale Intelligenz zu nutzen vermag." (ebd.) Gesellschaftliche Bedeutungen werden im Prozess der Aneignung/Tätigkeitdurch kommunikativen Austausch und in Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit aufgebaut.
Nimmt man in den Blick, dass Menschen mit ‚geistiger Behinderung' bis heute von unserer Kultur ausgegrenzt, fern gehalten und herabgesetzt werden und dadurch viele Bedeutungen nicht lernen durften, gleichen diese Testverfahren einem zynischen ‚doublebind': Du darfst es nicht lernen, aber du solltest es wissen. Sie geben Aufschluss auf die erfahrene Isolation, nicht aber auf kognitive Fähigkeiten.
Auch Jantzen weist darauf hin, dass "der wesentliche Inhalt von Behinderung" der ist, "von Gesellschaft und Natur isoliert zu sein, sich gesellschaftlich kumuliertes Erbe nicht aneignenzu können (...)." (Jantzen 1980, 19)
"Aber wir testen einen Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Lebensgeschichte und meinen dann zu wissen, welchen weiteren Lebensweg er einzuschlagen hat und welche Bildung ihm zu ermöglichen oder vorzuenthalten ist." (Feuser zit. nach Schönwiese 2003, 26)
Letztlich ist die Unterscheidung behindert vs. nicht behindert nur möglich, wenn die Ursache für das beobachtete, auffällige Verhalten ausschließlich im betreffenden Menschen gesehen wird. Aus der Vorstellung klarer Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die der Sichtweise trivialer Maschinen entspricht, ist die Individualisierung von Behinderung eine logische Konsequenz. ‚Geistige Behinderung' wird als Wesensmerkmal aufgefasst, dem geklärte oder ‚noch' ungeklärte Schädigungen zugrunde liegen. Mögliche andere Wirkfaktoren werden als sekundär betrachtet.
Die Diagnose ‚geistige Behinderung' unterstellt, dass die so etikettierten Menschen Wirklichkeit nicht in ‚adäquater Weise' wahrnähmen. Ihr Verhalten wird als Ausdruck des Defizits betrachtet und nicht als für sie sinnvolles Handeln im Kontext und auf der Basis interner Ordnungsprozesse. Sie impliziert somit, dass die Diagnostiker einen ‚wirklicheren' Zugang zur Wirklichkeit hätten.
Da alle Menschen ihre Wirklichkeit in der Einbettung in ihr Umfeld auf eigene Weise konstruieren und niemand Anspruch auf einen ‚richtigen' Zugang zur Realität haben kann, ist diese Haltung aus konstruktivistischer Sicht nicht begründbar. Es kann allenfalls eine größere Intersubjektivität konstatiert werden. Diese reicht aber nicht an die Ontologie heran.
Maturana, Watzlawick (vgl. Watzlawick in Pörksen 2002, 226), von Foerster[24] u.a. weisen auf die Gefahr diagnostischer Formeln hin, da sie ontologisch konnotiert sind. Diagnosen treten als beobachterunabhängige Wahrheit auf; sie suggerieren die Erkennbarkeit von Wirklichkeit. Das medizinische Interesse an der Bewahrung von Prinzipien (wie Ursache-Wirkung, Kausalität) und ihrer Kohärenz erlaubt es, auf weitere Beobachtungen zu verzichten. (vgl. Maturana in Pörksen 2002, 87)
"Die Zuschreibung von Krankheit bildet die Begründung, um jede weitere Diskussion zu beenden." (Maturana/Pörksen 2002, 130)
Einen "Zustand als krank oder als nicht normal" zu bezeichnen, ist jedoch die Wahl eines Beobachters, der diesen Zustand für unerwünscht hält. "Es gibt für eine solche Entscheidung (...) keine absolut gültige Begründung und keine beobachterunabhängige Rechtfertigung." (ebd.)
"Defizite entstehen immer in einem Vergleich, wobei erst durch eine Bewertung festgelegt wird, welche Fähigkeiten als so wichtig erscheinen, dass ihr Fehlen als Mangel betrachtet wird." (Lindemann/Vossler 1999, 115; vgl. auch die Differenzierung von Matt in allgemeine Mängel und spezifische Mängel, Kap. 3.1 i.d.A.)
Der Begriff ‚geistige Behinderung' erklärt somit lediglich, dass bestimmte Menschen nicht nach den Erwartungen ihres Umfeldes funktionieren. Behinderung existiert nur als diese Diskrepanz und wäre somit im zwischenmenschlichen Bereich anzusiedeln und nicht im Individuum.
Dass der Begriff durch eine triviale Sichtweise des Menschen zustande kommt und aus systemisch-konstruktivistischer und neurobiologischer Sicht nicht haltbar ist, soll folgende Zusammenfassung der in dieser Arbeit ausgeführten Annahmen noch einmal vor Augen führen:
Lernen, Verstehensprozesse und Entwicklung sind nur über Strukturkoppelung möglich, d.h. wir sind dabei notwendig auf Signale, Spiegelungsvorgänge, Anerkennung und Resonanz in zwischenmenschlichen Beziehungen angewiesen. Unser Gehirn ist aufgrund seiner Plastizität in der Interaktion mit der Umwelt ein permanent lernendes System; die Ausdifferenzierung der Anfangsstruktur hängt wesentlich mit den Anregungen aus dem Umfeld zusammen (use-dependent-plasticity). Die Strukturveränderungen sind jedoch nicht direkt beobachtbar und können auch nicht vorausgesagt werden.
Isolation behindert diese Prozesse und führt zudem nachweislich zu Schmerzerfahrungen, die kognitive Fähigkeiten zusätzlich blockieren. Was die Isolation erst anrichtet, beschreibt das ‚medizinische Modell' jedoch als unmittelbare Folge des Defekts. (vgl. Jantzen 1980, 9)
Alle Menschen entwickeln sich aufgrund verschiedener Erfahrungen unterschiedlich, erschaffen auf der Basis der Selbstorganisation im Kontext Denkweisen und Handlungsstrategien, die dem subjektiven Erleben nach sinnvoll sind, selbst wenn sie Beobachtern seltsam, widersinnig und nicht nachvollziehbar erscheinen. Alle Wirklichkeitskonstruktionen und Verhaltensweisen sind somit zu respektieren und in den Bezug zur Lebensgeschichte zu stellen, da sie sich "ursprünglich als viable Wege herausgebildet haben, das eigene Erleben zu organisieren." (Lindemann/Vossler 1999, 113)
Während wohl niemand bei sog. nichtbehinderten Menschen auf die Idee käme, aus der Ähnlichkeit unserer Grundstrukturen auf eine Gleichheit unseres Verhaltens zu schließen, wird diese Kausalität bei Menschen ‚mit gleichen oder ähnlichen Schädigungen' unterstellt, indem ‚charakteristische' Entwicklungsverläufe und -einschränkungen aufgrund des ‚Defektes' beschrieben und erwartet werden. Diese Annahme "ist ein weiterer Ausdruck für eine triviale Beschreibung des Menschen und seiner Entwicklung." (ebd., 115/116)
Eine ‚Schädigung' oder Normabweichung hat jedoch aufgrund der Selbstorganisation bei unterschiedlichen Individuen auch unterschiedliche Folgen, entsprechend der Ausformung der Hirnstruktur durch den Sozialisationsprozess. (vgl. Jantzen 1980, 60)
Die neue Hirnforschung weist darauf hin, dass gegenwärtig noch niemand weiß, wie sich aus den Prozessen des Gehirns das Geistige bildet. (vgl. Kap. 1.2.2 i.d.A.) Im Hinblick darauf erscheint die Zuschreibung ‚geistige Behinderung' als Willkür.
Bewusstsein, Geist und Identität sind individuell und relational; sie sind durch die soziale Koppelung in den intersubjektiven Raum gehoben. Eine Abhebung des individuellen vom sozialen Bereich erscheint aufgrund dieser Wirkzusammenhänge unmöglich.
Verhalten ist relational, also immer auf die Umwelt, auf ein Du, gerichtet; d.h. der Kontext, das zwischenmenschliche Verhältnis, in dem ein Verhalten gezeigt wird, ist von großer Bedeutung.
Laing konstatiert jedoch bei psychologischen Theorien ein Manko, das m.E. auch für die medizinische Sicht gilt und die Individualisierung erklärt. Diese Theorien haben "keine Kategorie des ‚Du' (...), keine Möglichkeit, die Begegnung eines ‚Ich' mit ‚dem anderen' und die Wirkung einer Person auf eine andere auszudrücken." (Laing 1981, 42)
Mit diesen Ausführungen soll nicht angezweifelt werden, dass gewisse Verhaltensweisen von einer gesetzten Norm abweichen oder für andere seltsam sind. Möglicherweise sind Normalität und Anomalität aber weniger eindeutig als meist geglaubt wird.
Es soll auch nicht angezweifelt werden, dass z.B. eine Trisomie oder eine Hirnschädigung Auswirkungen auf die Entwicklung eines Menschen haben. Diese ist jedoch weder voraussagbar noch ergibt sie sich kausal aus der Struktur oder der Schädigung, sondern sie gestaltet sich aufgrund der vorhandenen und sich verändernden Struktur in Wechselwirkung mit den Interaktionserfahrungen des Subjekts. Sie ist somit sicherlich weniger eindeutig, als es die medizinische Sichtweise unterstellt.
"In einer nicht-trivialen Sicht kann weder eine eindeutige Ursache für ein beobachtetes Verhalten definiert werden, noch ist es möglich, das Maß zu bestimmen, in dem organische, neurologische, genetische oder biochemische Merkmale überhaupt eine konkrete Auswirkung auf das Verhalten haben." (Lindemann/Vossler 1999,113)
Zudem geht Maturana davon aus, "dass es so etwas wie eine ‚genetische Determination' nicht gibt. Um überhaupt irgendwelche Eigenschaften ausbilden zu können, ist der Organismus auf seine individuelle Lebensgeschichte angewiesen (...)." (Maturana, zit. nach ebd., 116)
Diese Offenheit und Nichtvoraussagbarkeit der Entwicklung wird Menschen mit einer diagnostizierten ‚geistigen Behinderung' jedoch abgesprochen. Denn mit der Diagnose wird von den Fachleuten immer auch eine Entwicklungsprognose erstellt, die die Begrenzung festlegt, die bzgl. der kognitiven Entwicklung des etikettierten Menschen erwartet wird. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 112) Diese Erwartung wiederum lenkt unsere Wahrnehmung.
Diagnosen und Prognosen konstruieren Wirklichkeit. Einerseits verhindern sie vom Standpunkt der Beobachter aus etwas anderes zu sehen, als das für möglich gehaltene. Andererseits werden, wie im Eingangszitat angedeutet, die Betroffenen durch Zuschreibung und Besonderung oft zu dem, wofür man sie hält.
Welche folgenschweren Auswirkungen sich durch die aus systemisch-konstruktivistischer Sicht unzulässige Koppelung diagnostizierter oder vermuteter Schädigung und erwarteter Entwicklung ergeben können, werde ich im Folgenden aufzeigen.
Da gerade bei Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, der Prozess des ‚Behindert - werdens' noch viel zu wenig berücksichtigt wird, soll dieser hier aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.
Um die wirklichkeitsschaffende Macht von Zuschreibungen verstehen zu können, erscheinen mir Watzlawick`s Ausführungen über die selbsterfüllende Prophezeiung aufschlussreich. Sie zeigen auf, wie die Zukunft durch die Gegenwart (Annahmen, Erwartungen) vorweggenommen wird; wie durch Reden über künftige Entwicklungen (Prognosen) und den Glauben an sie, diese mitgestaltet oder auch erst hervorgerufen werden.
Die Macht dieser Zuschreibungen, die unseren Blick rastern und unsere Wahrnehmung strukturieren, wird auch von Johannes Elbert und Dietmut Niedecken aufgegriffen. Diese Dynamik wird von ihnen als ‚Formierungsprozesse' bzw. ‚Organisierung von geistiger Behinderung' beschrieben. Sie haben die kulturelle Dimension von ‚geistiger Behinderung' herausgearbeitet.
Aus ihrer psychoanalytischen Sichtweise heraus erklärt Niedecken zudem, weshalb diese Dynamik so schwer zu durchbrechen ist. Mit den psychoanalytischen Begriffen Angstabwehr,Projektion und Gegenübertragung, die sie in die theoretische Betrachtung von ‚Behinderung' einführt, kann aufgezeigt werden, wie Probleme zum Verschwinden gebracht werden, indem sie ins Unbewusste verbannt werden. Diese schon angedeuteten Mechanismen (vgl. Kap. 3.2 i.d.A.) sollen hier genauer beleuchtet werden, da sie wesentlich zur Aufrechterhaltung unserer ‚Behindertenbilder' beitragen.
3.3.1.1. Selbsterfüllende Prophezeiungen
"Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist eine Annahme oder Voraussage, die rein aus der Tatsache heraus, daß sie gemacht wurde, das angenommene, erwartete oder vorhergesagte Ereignis zur Wirklichkeit werden lässt und so ihre eigene ‚Richtigkeit' bestätigt." (Watzlawick 2000, 91)
Der Glaube an das vorausgesagte Ereignis beeinflusst unsere Wahrnehmung und unsere Handlungen. Zur Veranschaulichung dieser Dynamik greift Watzlawick u.a. die 1973 veröffentlichte Studie des amerikanischen Psychologen David Rosenhan[25] auf.
In diesem Forschungsprojekt ließen sich acht Frauen und Männer, die keinerlei psychische Beschwerden hatten, freiwillig in verschiedene psychiatrische Kliniken einweisen. Sie gaben vor, ‚Stimmen zu hören', was in der klassischen Psychiatrie als Symptom einer Psychose gilt. Nach der Aufnahme benahmen sie sich völlig normal und erklärten auch, dass das Symptom nicht mehr vorhanden sei. Ihre Verhaltensweisen wurden jedoch als "Beweis für die Richtigkeit der Diagnose gewertet." (Watzlawick 1992, 89) Sie wurden nach unterschiedlicher ‚Behandlungsdauer' mit der Diagnose ‚Schizophrenie in Remission' entlassen!
"Sobald eine Person als abnorm gekennzeichnet ist, werden ihre ganzen übrigen Verhaltensweisen und Charakterzüge durch diese Klassifizierung gefärbt." (Rosenhan 2000, 119) "Trotz ihrer öffentlichen ‚Zurschaustellung' von geistiger Gesundheit" (ebd., 116) wurden sie vom Personal nicht als Scheinpatienten entlarvt, wohl aber von mehreren ‚wirklichen' Patienten, die vermuteten, dass sie Journalisten oder Prüfer der Klinik seien.
Rosenhan berichtet auch von einem umgekehrten Experiment. In einem Lehr- und Forschungskrankenhaus wurden die Mitarbeiter darüber informiert, dass sich Scheinpatienten einweisen lassen werden. In dem vereinbarten Zeitraum, in dem 193 Patienten zur Aufnahme kamen, um psychiatrisch behandelt zu werden, wurden dann 41 Patienten von mindestens einem Mitglied des Personals für Scheinpatienten gehalten, obwohl kein einziger Scheinpatient zur Einweisung geschickt wurde! (vgl. Rosenhan 2000, 118)
Diese Beispiele zeigen, wie verflochten ‚Wissen' und Wahrnehmung sind. Sie weisen auch auf die Relativität von Normalität und Anomalität hin, die wir oft mit Sicherheit glauben unterscheiden zu können.
Watzlawick berichtet auch von einer Untersuchung, die der Psychologe Robert Rosenthal an einer Volksschule durchführte. Dabei erhielten die LehrerInnen, noch bevor sie die neuen SchülerInnen kannten, eine Liste derer, die aufgrund eines Intelligenztests im kommenden Jahr mit Sicherheit überdurchschnittliche Leistungen erbringen werden. Die Namen waren jedoch wahllos aus der Schülerliste entnommen. Der Unterschied zwischen den Kindern bestand also nur in den Köpfen der LehrerInnen. Am Ende des Schuljahres bestätigte ein erneuter Intelligenztest tatsächlich die Annahme der LehrerInnen (vgl. Watzlawick 2000, 97/98). "Die Prophezeiung erfüllte sich also erst durch die Erwartungen der Lehrerinnen und die Aufmerksamkeit, die sie den ausgewählten Kindern entgegenbrachten." (Lindemann/Vossler 1999, 119)
Dieses Beispiel zeigt, wie sehr sich Erwartungen und entsprechendes Handeln von PädagogInnen auf die kognitiven Leistungen von Menschen auswirken und somit wie Prophezeiungen Wirklichkeit schaffen. Wem etwas zugetraut wird, der kann sich auch selbst etwas zutrauen. Umgekehrt gilt jedoch dasselbe:
"Wenn einem Menschen das Behindertsein durch Prognosen und das Verhalten ihm gegenüber nahegelegt wird, er mit Ängsten und Abwehrreaktionen konfrontiert wird, ist es sehr wahrscheinlich, daß er das Bild als Behinderter für sich akzeptiert, sich entsprechend entwickelt und handelt." (ebd., 121)
3.3.1.2. Das gesellschaftliche Phantasma ‚geistige Behinderung'
"Maria hat Down-Syndrom, schwere Epilepsie und ein Lächeln, das aussieht wie ein Gnadengesuch."
"Vier Jahre lang lebte ich neben so einem Lächeln. Ich kenne es nur zu gut. Es ist der einzige Schutz der geistig Behinderten gegen die Welt: ein Bittstellerlächeln, ein Bettlerlächeln."
Maigull Axelsson: Die Aprilhexe, 196/245, München: Bertelsmann 2000
Mit dem Wissen um die Wirksamkeit selbsterfüllender Prophezeiungen könnte man sich dazu entschließen, sie einfach nicht mehr zu tätigen. Zum Verständnis, weshalb dieses Umdenken in Bezug auf ‚geistige Behinderung' so schwer zu erreichen ist, trägt die Psychoanalytikerin Dietmut Niedecken mit ihrem Konzept des ‚Phantasmas von geistiger Behinderung' bei. In Anlehnung an Erdheim formuliert sie:
"Phantasmen sind (...) Instrumente der Unbewußtmachung von gesellschaftlichen Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen. Sie (...) sorgen dafür, daß bestimmte Mechanismen ‚von einem Schein von Natur umstrahlt' sind, der ‚diese Normen gegen Verlust und Eingriffe' absichert." (Niedecken 1998, 42)
Durch das so tief in uns verwurzelte aufgeklärt-bürgerliche Selbstverständnis, das die Eigenschaften Unabhängigkeit, Leistungsfähigkeit und Vernunft zur menschlichen Norm bzw. Natur und zur unhintergehbaren Eintrittskarte in diese Gesellschaft erhob, mussten wir alle widersprüchlichen Regungen und Wünsche abspalten und ins Unbewusste verbannen. Menschen mit ‚geistiger Behinderung' stellen (scheinbar) das Negativextrem dieses Ideals dar. In einer "Kultur, in der man sich durch Leistung ausweist" (ebd., 22), fehlt ‚diesen Menschen' "etwas für uns Essentielles (...): die körperliche und geistige Unversehrtheit und volle Leistungsfähigkeit." (ebd., 24) Das erklärt auch unsere Angst, die in unserer Betonung ihres Andersseins zum Ausdruck kommt. Ihr Anblick konfrontiert uns mit der Angst selbst diesem Ideal nicht entsprechen zu können, zu versagen, aus der Durchschnittsnorm herauszu- fallen. Sie erinnern uns aber auch an all das, was wir um des Funktionierens willen aufgeben mussten - an "alles Ungebärdige und Triebhafte" - "sie sind das vergessene Menschliche in uns." (ebd., 25)
Auf diese Zwiespältigkeit weist auch Johan de Groef hin. Er nennt das Phänomen der ‚geistigen Behinderung' einen ‚dunklen Kontinent'[26], "ein Afrika für unsere ‚condition humaine'." (de Groef 1997, 15) Dunkle Kontinente zeichnen sich durch ihre Doppeldeutigkeit aus. Himmel und Hölle in einem - faszinierend und ängstigend zugleich; unheimliche Orte, vertraut, aber "durch einen Prozess der Verdrängung fremd geworden (...). Dunkle Kontinente appellieren an das Phantasma einer Rückkehr zur Quelle des Lebens, zum Urgrund unserer Existenz." (ebd.)
Unsere Kultur "greift allen ursprünglichen Kulturen gegenüber zum Basismechanismus der negativen Selbstdefinierung. (...) Selbstbild und Bild des anderen sind dialektisch miteinander verwoben." (ebd., 16) Das in unserer Gesellschaft allgemein vorhandene Bild von ‚gesitiger Behinderung' berge denselben Mechanismus.
Während ‚geistig behinderte' Menschen, bezogen auf ihre ‚sonnige' Seite, als (Glücks) Engel, spontan, authentisch, natürlich, anhänglich, willig und emotional gelten, sehe man sich selbst in der Gegenüberstellung als sorgenvoll, gehemmt, künstlich, ‚kulturlich', egoistisch, eigenwillig, rational.
Zur ‚höllischen' Seite der Behinderung gehören die Zuschreibungen Monstrum, animalisch, enthemmt/triebhaft, kindisch, körperlich abnorm, verletzlich; während man sich selbst als Mensch, beherrscht, erwachsen, schön und stark sehe. (vgl. ebd., 17)
Es handelt sich um eine doppelte Gespaltenheit; um Metaphern, die früher für andere Randgruppen oder auch für ‚primitive' Kulturen verwendet wurden.
Durch Projektion, durch die unbewusste Übertragung abgewehrter Inhalte in das auslösende Objekt, können wir die eigene, Unruhe stiftende Gespaltenheit loswerden und unsere Gewissheit wieder herstellen. Das durch Verdrängung fremd Gemachte und Ängstigende wird nun im Außen gefahndet. Der Hass und die hohe Abwehr gegen die Anwesenheit von Menschen mit ‚geistiger Behinderung' nährt sich aus den Opfern, die wir erbringen mussten und müssen, um in den Rahmen der Normalität zu passen.
"Mord wird nicht mehr manifest verübt" (Niedecken 1998, 21), die gesellschaftlichen Tötungstendenzen sind nach Niedecken jedoch in Form von Tötungsphantasien in uns allen lebendig.
"Dieses Phantasma bestimmt als wohl zentralstes Motiv unsere Haltung gegenüber geistig Behinderten - und ihren Müttern; es ist die Zuweisung, Abschiebung der ungeheuerlichen Kollektivschuld, des unsäglichen Versagens unseres aufgeklärten Bewußtseins, an einzelne." (ebd., 22)
Das Phantasma vom ‚lebensunwerten Leben' begründet die Institution ‚Geistigbehindertsein', wie es Niedecken in Anlehnung an Maud Mannoni formuliert. Die kollektiven Tötungs-tendenzen gegenüber weniger Leistungsfähigen oder Leistungswilligen werden dadurch auf Einzelne (Mütter/Eltern, Förderungsinstitutionen) abgeschoben; die Tötungsimpulse, die sich auf Menschen mit ‚geistiger Behinderung' richten, unbewusst gemacht.
Mit der Abgrenzung ‚ihnen' gegenüber (postuliertes Anderssein) geht der Versuch einher, sie entweder ins Abseits zu schieben oder - koste es, was es wolle - hinzurichten und anzupassen an unsere Norm. In jedem Fall müssen wir uns des Spiegels entledigen, der unsere unterdrückten Sehnsüchte und Ängste zum Vorschein bringen würde. In ihrem teilweise offensichtlichen Angewiesensein auf Andere (welches wir verdrängt haben) sind sie uns unerträglich. Diese allgegenwärtigen unbewussten Tötungsphantasien spüren die Betroffenen; sie spüren, dass sie, so wie sie sind, nicht akzeptiert werden und nicht leben dürfen. Sie entwickeln Ängste und/oder antworten darauf mit einem ‚Bittstellerlächeln' als eine Art "Tribut, um am Leben zu bleiben." (Sinason 2000, 96)
Mannoni vermutete,
"dass sich hinter den fatalen Diagnosen, mit welchen geistig behinderte Menschen belegt werden, Abwehren verbergen. Indem diese Abwehren als erstarrte Diagnostik-Schemata unhinterfragt angewendet werden, (...) wird Krankheit zur Institution'." (Niedecken 1997)
"Institutionen sind zu festen Regelsystemen verdinglichte hierarchische Interaktionsstrukturen, die nicht mehr in ihrer interaktiven Bedeutung gesehen werden, sich vielmehr naturhaft-unabänderlich darstellen." ( Niedecken 1998, 20)
Niedecken greift die Hypothese von Mannoni auf und führt weiter aus, dass sich die Institution‚Geistigbehindertsein'in drei Stufen organisiere: der Diagnose, den gesellschaftlichen Phantasmen vom ‚Geistigbehindertsein' sowie den institutionalisierten Förderungs- u. Rehabilitationsmethoden.
Die Institution ‚Geistigbehindertsein' setzt sich in Form institutioneller Gegenübertragung[27] durch, d.h. in bestimmten Gegenübertragungen, die in Rollenmustern institutionell fixiert sind. Hinter Betreuung, Diagnostizierung, Therapie und Förderung können sich solche Rollenmuster verbergen.
"Institutionelle Gegenübertragung sind all jene Reaktionsschemata, die von der Institution festgelegt sind als Entgegnung auf das Inkongruente, Inkommensurable, schwer Integrierbare im Agieren der Geförderten." (Niedecken 1998, 27)
"Geistig behindert kann niemand geboren werden" (ebd., 29), so Niedecken, da bei keinem Säugling von einer geistigen Differenzierung gesprochen werden kann; jedes Kind muss sich erst entwickeln - auf der Basis seiner spezifischen Möglichkeiten und Begrenzungen und in Wechselwirkung mit seinem Umfeld.
Aber gerade jene Kinder, deren Bedingungen aufgrund einer organischen Beeinträchtigung erschwert sind, werden durch die auf sie gerichteten Ängste und Abwehrreaktionen in ihrer Entwicklung schwerst behindert.
Mit diesen Mechanismen werde ich mich nun aus der Perspektive von Elbert und Niedecken auseinandersetzen. Die beiden Autoren stellen das Phänomen ‚geistige Behinderung' in den gesellschaftlichen Kontext und weisen es "als Produkt eines spezifischen Sozialisations-vorgangs zwischen einem Kind mit spezifisch beeinträchtigten körperlichen Voraussetzungen und einer dazu in spezifisch pathogenen Weise sich verhaltenden Umwelt" (ebd., 28) aus. Diese Sichtweise leugnet nicht die organische Beeinträchtigung, sondern sieht sie, ebenso wie die systemtheoretische Perspektive, in ihrer komplexen Verwobenheit mit den zwischenmenschlichen Interaktionsprozessen und gesellschaftlichen Bedingungen.
3.3.1.3. Formierungsprozesse ‚geistiger Behinderung' - die Behinderung des Selbstbildes
"So können zwei Beobachtungen desselben Subjekts unter denselben Bedingungen, die aber mit unterschiedlichen Fragestellungen gemacht worden sind, zu unterschiedlicher Bewertung des kognitiven Verhaltens des Subjekts führen."
Maturana/Varela 1987, 190
Nach Elbert genügt es nicht, die Lebensbedingungen von Menschen mit ‚geistiger Behinderung' zu verbessern, sondern es geht in erster Linie darum, "das vorgefertigte abstrakte Wissen über die Persönlichkeit des ‚Geistigbehinderten' zu eliminieren" (Elbert 1982), welches die Wahrnehmung filtert, die Kommunikation prägt und so wesentlich an der Entstehung des Erscheinungsbildes ‚geistiger Behinderung' beteiligt ist. Dabei sind mit Niedecken zudem die unbewussten Abwehren, die diesen Bildern zugrunde liegen und sie immer wieder neu hervorbringen, mitzubedenken.
Psychiatrie und Pädagogik, mit ihren an der Norm ausgerichteten, totalen Menschenbildern geben vor, "das Wesen des ‚geistig behinderten Menschen' zu kennen" und deshalb Entwicklungsverläufe bestimmen zu können. Sie sprechen ihm/ihr meist autonomes Handeln ab und degradieren ihn/sie "zum Objekt korrigierender Erziehungseinflüsse". (ebd.)
Nur mit Hilfe eines statistischen Normwertes, den die psychiatrische Wissenschaft der Vielfalt menschlicher Erscheinungsformen überstülpt, können Abweichungen überhaupt selektiert, kategorisiert und als Krankheitsbilder und Symptome gedeutet werden.
"Dieses von Fehlleistungen, Defiziten und Defekten überladene psychiatrische Konstrukt gewinnt aber erst seine volle, folgenreiche Wirkung" (ebd.), wenn die Ursache dafür gefunden ist. Hier liegt die Wurzel der Individualisierung, die Sozialisationsprozesse unsichtbar macht. Denn, in ihrer Koppelung an die Medizin konzentriert sich die Psychiatrie bei der Suche nach den Ursachen auf das Individuum als ‚organisches Wesen' (vgl. Foucault 1968, 10) und nicht als ‚Beziehungswesen'. Im Falle der ‚geistigen Behinderung' liegt die psychiatrische ‚Wahrheit' somit im hirnorganischen bzw. genetischen Defekt.
Von hier aus wird nun das Bild eines gleichförmigen, unabänderlichen, da ja in seiner Substanz geschädigten, defizitären Menschentyps konstruiert; d.h. der Diagnose wird stets eine Prognose an die Fersen geheftet, die das Ausmaß der Entwicklungs(un)möglichkeiten mit großteils negativen Beschreibungen (Nicht-können) vorab festlegt, ohne der individuellen Entwicklung Raum zu geben. Ist ein Kind also durch den ‚Initiationsritus' Diagnosestellung einmal in den magischen Verdachtkreis ‚geistiger Behinderung' geraten, wird der werdenden Persönlichkeit eine ver-‚nicht'-ende Zukunft vorausgesagt.
Ausgehend vom Leitsymptom der Intelligenzminderung, das "alle anderen Dimensionen der Person" (Arns, zit. nach Elbert 1982) durchdringe[28], wird eine verlangsamte oder eingeschränkte Gesamtentwicklung erwartet. Die Negativzuschreibungen ranken sich neben der "Entwicklungsbeschränkung im Bereich des Denkens" (Hackenberg/Hinterhuber 1997, 164) auch um eine "Verlangsamung im Ablauf der psychischen Funktionen, Affektverflachung, Neigung zu Primitivreaktionen" (Elbert 1982), "erhöhte Suggestibilität (...), Fehlen von Spontaneität (...)", Einschränkung der "Abstraktionsfähigkeit und Phantasie" (Hackenberg/Hinterhuber 1997, 164/165) usw.
Mit psychiatrisch geschultem Blick wird versucht, bestimmte konstruierte Symptomkombinationen im Objekt wiederzufinden, um das eigene Wissen zu bestätigen.
Mit der systemisch-konstruktivistischen Sichtweise (Nichtbeobachtbarkeit interner Prozesse; relationales Verhalten) im Hintergrund und einer gleichzeitigen Erinnerung an Erfahrungen im Austausch mit konkreten Menschen, die als ‚geistig behindert' bezeichnet werden im Vordergrund, ist es ‚interessant', sich diese Zuschreibungen einmal Wort für Wort auf der Zunge zergehen zu lassen.
Diese, vor und in den Entwicklungsweg eines Menschen gestellte Prognose hat weitreichende Folgen. Sie ist "der entscheidende Knotenpunkt", die Schlüsselstelle, "an dem die psychiatrische Wahrheit ihren institutionellen Rahmen verläßt, in alle Lebensbereiche eindringt und diese umformt." (Elbert 1982) Die defektorientierte Sichtweise kann zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden, indem sie mit ihrem Pessimismus und ihren Vorurteilen die Wahrnehmung sowohl der Eltern des Kindes als auch der PädagogInnen bestimmt, die Interaktionen prägt und andere Perspektiven verhindert. Die Entwicklungs-möglichkeiten eines Menschen sind zwar nicht unabhängig von seiner Struktur allein durch den Umgang mit ihm bestimmt. Die Beispiele von Rosenhan und Rosenthal zeigen jedoch, wie sehr ein vorgefertigtes Wissen die Wahrnehmung der InteraktionspartnerInnen färbt und überschattet bzw. wie die Leistungserwartung (oder Nichterwartung) sich auf die Betroffenen auswirkt, sodass die Möglichkeit, sich überhaupt in eine andere Richtung entwickeln zu können, wesentlich erschwert oder behindert wird.
Indem die Heil- und Sonderpädagogik das psychiatrische ‚Wissen' übernimmt, welches die Betreuung in Sondereinrichtungen zum Zwecke optimaler Förderung empfiehlt, wird die "Errichtung einer abgesonderten Welt" (ebd.) jenseits der sozialen Gemeinschaft (der ‚Normalen') legitimiert. Widersprüchlicherweise soll dort die Kompensation der ‚Defekte' und damit eine Angleichung an die Norm (zu der der Kontakt jedoch verwehrt wird) erreicht werden.
Zudem wird selbstverständlich angenommen, dass die festgestellte Beeinträchtigung ein Übel ist und deshalb beseitigt werden müsse.
"Wir unterstellen, daß das Kind wünschen müsse, nicht oder weniger behindert zu sein, bevor ihm noch dieser Wunsch auf dem Wege der Stigmatisierung aufgezwungen wurde." (Niedecken 1998, 22)
Das Kind hat ja kein Problem per se, keinen Begriff von Behinderung, es erlebt sich selbst als normal. Das Problem kommt erst durch die Zuschreibung und Abwertung, durch die Spannung mit dem Außenbild zustande und (zer)stört die Integrität.
Betroffene beschreiben auch, dass die Auseinandersetzung mit der Zuschreibung ‚geistig behindert' schwierig ist, sie selbst sich aber nicht so erleben:
"Ich kann eigentlich mit meiner Behinderung gut umgehen. Ich sehe mich nicht als behinderten Menschen, ich bin ein ganz normaler Mensch."(Köbler et.al. 2003)
Wider der häufigen Auffassung, ‚behinderte' Menschen müssten wünschen, nicht behindert zu sein, fragt Fredi Saal als Titel seiner Autobiographie: "Warum sollte ich jemand anders sein wollen?" (Saal, zit. nach Dörner 2007)
Die Konzentration auf die Behebung der Defizite verstellt den Blick auf den Menschen selbst. Elbert stellt das Fremdbleiben der InteraktionspartnerInnen als wesentliches Moment einer solchen pädagogischen Beziehung heraus, da sie auf Korrektur und Veränderung der Anvertrauten abzielt und ihnen damit gleichzeitig die Nichtakzeptanz ihres So-seins vermittelt.
Auch Thalhammers Umdeutung der Intelligenzminderung in ‚kognitives Anderssein' der ‚geistig Behinderten', das "besondere mitmenschliche Hilfe zur Selbstverwirklichung in individuellen Dimensionen und kommunikativen Prozessen notwendig" (Thalhammer zit. nach Elbert 1982) mache, bleibt dieser Denk- und Handlungsweise verhaftet.
Zum einen ist dieser Sichtweise entgegenzuhalten, dass das ‚Auf-Hilfe-angewiesen-sein' eines der fundamentalsten Prinzipien der Systemtheorie ist; wir uns also alle nur in zwischenmenschlichen Beziehungen entwickeln können. Erst im Austausch mit der Welt definiert sich das Eigene.
Zum anderen wird auch hier ‚geistige Behinderung' statisch, im Sinne ‚wesentlichen Andersseins' beschrieben und nicht als Prozess im Zusammenspiel biologischer und gesellschaftlicher Faktoren verstanden. Der Erklärungsansatz verschließt sich damit einem kommunikationstheoretischen Zugang und einer dynamischen Sichtweise von Behinderung. (vgl. Elbert 1982)
Eine pädagogische Haltung, die das Wesen der ‚geistig behinderten' Menschen zu kennen glaubt und deshalb beansprucht, über die ‚richtigen' Hilfestellungen Bescheid zu wissen, gleicht einer Bemächtigung, die den Menschen seiner/ihrer selbst enteignet. Das Fremde, Unakzeptable wird mittels vorgefertigten Wissens kolonialisiert und angeeignet. (vgl. de Groef 1997, 23) Verzweifelte Versuche der Selbstdarstellung und Mitgestaltung der Interaktion werden überhört oder missverstanden. Menschen werden so zu einem "sonder-pädagogisiertes Objekt" (Elbert 1982), zu einem Abbild der Theorie gemacht, ohne Eigen-Name, ohne Recht auf Selbstdefinition.
Die zum Zwecke der optimalen Entwicklungsförderung eingerichtete Sonderbehandlung schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten der Betroffenen gerade ein und verhindert die Selbstverwirklichung und Subjektwerdung, da ein Raum für eigenständige Äußerung und Entwicklung sowie für eine Begegnung in gegenseitiger Anerkennung vorenthalten wird.
Nach der psychiatrischen Diagnose und Prognose wird so
"die Produktion eines ‚geistigbehinderten Selbst' durch sonderpädagogische Fördermaßnahmen fortgeführt. Es entsteht der pädagogisierte ‚geistigbehinderte' Mensch, die Imagination wird sozial wirklich. Möglichkeiten alternativer Produktionen werden negiert. Die geschaffene soziale Wirklichkeit, die Erscheinungsform ‚Geistige Behinderung' wird als natürlich, als ‚Behinderung an und für sich', begriffen und erlebt." (ebd.)
Die Inszenierung ist derart perfekt und kommt uns wohl im Sinne der eigenen Abwehr so entgegen, dass eine andere Annäherung an das Phänomen gar nicht in Erwägung gezogen wird. Beunruhigende Fragen, weshalb sich ein Mensch ‚geistigbehindert' verhält oder welchen Sinn dieses Verhalten innerhalb eines bestimmten Kommunikationsbereiches haben könnte, werden dadurch verhindert. Das meint Niedecken mit institutionalisierten Rollenmustern: wir beschäftigen uns mit ‚geistig behinderten' Menschen "aus sicherer Distanz mit wissenschaftlichem oder fördern wollendem Interesse" (Niedecken 1998, 23). Mit dieser Geschäftigkeit können die eigenen Ängste abgewehrt werden.
Solche Fragen zuzulassen, würde bedeuten, sich selbst in Frage stellen und verunsichern zu lassen und würde vielleicht dazu führen sich dem Wagnis einer Begegnung in Gegenseitigkeit auszusetzen, in der offensichtlich würde, dass man trotz theoretischem Wissen von dem konkreten Menschen "praktisch nichts weiß und nur das Kind den Sinn und die Funktion seines Verhaltens zusammen mit einem Anderen entschlüsseln könnte." (ebd.)
Die Sonderstellung von Menschen mit einer diagnostizierten Behinderung besteht von Geburt an. Auch am wichtigsten Ort, der Familie, wird die positive Erwartungshaltung und das Vertrauen der Eltern in die Entwicklungsfähigkeit des Kindes durch die Diagnose ‚geistige Behinderung' unterminiert. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft wird die in Aussicht gestellte, nicht volle Leistungsfähigkeit ihres Kindes wahrscheinlich Schock und Kränkung auslösen und erst einmal verarbeitet werden müssen.
Der erste Spiegel, der uns ein Bild über uns selbst und unseren Wert vermittelt, sind die Augen der primären Bezugsperson(en). Hier erfahren wir, ob wir geliebt und angenommen sind. Wenn einem Kind (ob behindert oder nicht behindert) statt Freude und gespannter Erwartung aus diesem Spiegel Angst, Scham, Enttäuschung oder Ablehnung entgegenkommt, erfährt es in einem höchst verletzlichen Alter, dass es, so wie es ist, nicht erwünscht ist. (vgl. Sinason 2000, 204)
Wie sehr sich Spieglungsvorgänge auf alle psychischen Bereiche (kognitive und emotionale Entwicklung) auswirken und wir sehr wir auf das Zutrauen der anderen in unserer Entwicklung angewiesen sind, habe ich im Kapitel 1.2.2 beschrieben.
Im Bemühen, den ersten Schock zu überwinden und den auf sie abgewälzten gesellschaftlichen Mordauftrag abzuwehren, bilden die Mütter (geistig behinderte Kinder sind meist ‚Müttersache'!), aufgrund der eigenen Unsicherheit und Ambivalenz und in der Sorge um ihr Kind häufig eine Allianz mit ÄrztInnen und TherapeutInnen. Retten, was zu retten ist, ist dann der Auftrag, der die Normalität im Auge hat und das ‚behinderte' Kind so nahe wie möglich an diese anpassen möchte. Dadurch wird jedoch eine Distanz geschaffen, die die wechselseitige Mutter - Kind - Beziehung beeinträchtigt und den Spielraum zerstört.
Die übernommene gesenkte Erwartungshaltung stört das kindliche Selbstbild. Wenn zielgerichtetes Handeln und eine adäquate Auseinandersetzung mit der Umwelt nicht erwartet werden, werden eigenständige Äußerungen des Kindes oft nicht gesehen oder verstanden und beantwortet. Ohne Antwort verliert das Kind jedoch den Glauben an die eigene Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit, verliert das Vertrauen in sich und seine Mutter. Angstreaktionen und Rückzug aus zwischenmenschlichen Beziehungen können die Folge sein.
Schuldgefühle und Angstabwehr können sich auch in Überbehütung ausdrücken und die spätere Loslösung erschweren. Indem beispielsweise selbstverständliches Handeln, da nicht erwartet, durch Lob entwertet wird, erhält das Kind keine adäquate Rückmeldung auf sein Verhalten.
Der Einfluss psychiatrischen und pädagogischen ‚Wissens' schürt die Angst vor dem Kind, lässt es als jemand Besonderen, der anders ist, erscheinen. Er verändert so die Interaktion zwischen Mutter und Kind. Das Kind wird sich demzufolge auch in immer stärkerem Maße selbst als anders und nicht normal erleben.
Es kann jedoch nicht darum gehen, die Eltern in Ungewissheit allein zu lassen, sondern einen diagnostischen Dialog zu führen, der einer eigengesetzlichen Entwicklung des Kindes Raum lässt, statt die Wahrnehmung durch voreilige Prognosen zu verzerren und damit die wechselseitige Interaktion zu gefährden.
Elbert bietet hier einen anderen Zugang, der Menschen mit ‚geistiger Behinderung' "sinnkonstituierendes Handeln zutraut". Er versteht beispielsweise die ‚abweichenden' bzw. als Symptome der ‚Geistigen Behinderung' definierten Verhaltensweisen "als vielfältige Formen sinnvoller Gegenwehr" gegen die total vereinnahmenden und lebensbedrohenden Formierungsprozesse durch die Umwelt. Damit stellt er dem folgenschweren Postulat des organischen ‚Schadens' eine Sichtweise gegenüber, die die gestörte Interaktionswelt in den Vordergrund rückt, welcher Menschen mit ‚geistiger Behinderung' ausgeliefert sind. Es geht ihm darum, "hinter den Symptomen psychische Ursachen bzw. eine Wahrheit in der behinderten Geschichte des Individuums zu suchen (...)" (Elbert 1982). So führt z.B. die Zuschreibung lebenslangen Schutz- und Hilfsbedürfnisses häufig zu Infantilisierung und Bemächtigung, wodurch das Recht auf und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit untergraben und das Vertrauen sich selbst und der Welt gegenüber zerstört wird.
Elbert beschreibt u.a. folgende Formen der Gegenwehr oder Flucht, um die Umwelt doch noch einigermaßen zu kontrollieren:
Eine Möglichkeit besteht darin, die unterstellten Mängel anzunehmen oder sie auch zu übertreiben, um die Außenwelt zufrieden zu stellen. Fremdeliminierung wird dann zur Selbsteliminierung, die möglicherweise das reale Sprachvermögen, die Intelligenz oder das Können herabmindert oder sich selbst nicht mehr zutraut. Dieses Selbstbild der (erlernten) Hilflosigkeit verstärkt jedoch die Abhängigkeit und Ausgrenzung.
Wenn Interaktionen wirkungslos und ohne Antwort bleiben, wird sich ein Mensch vielleicht gänzlich in sich selbst zurückziehen, um von der Zuwendung anderer Menschen nicht mehr abhängig zu sein. Selbststimulation in Form stereotyper Bewegungsmuster (Schaukeln, Manipulieren an Körperteilen sowie selbstverletzendes Verhalten) kann dann möglicherweise die letzte sichere und vertraute Insel darstellen, die noch Selbstkontrolle gewährt und der Minderung der Angst und Unsicherheit dient. Solche sogenannten Symptome sind ein wertvoller Besitz und "können als sinnausgerichtete Verarbeitung dieser Konfliktsituation mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der biologischen Existenz und psychischen Organisation verstanden werden." (Lindemann/Vossler 1999, 123) Statt dieses Verhalten ‚wegtherapieren' zu wollen, was dem betroffenen Menschen die letzte Möglichkeit nähme, sich selbst ins Gleichgewicht zu bringen, ginge es darum, es zu verstehen und zu respektieren und gemeinsam mit ihm/ihr neue alternative Handlungsmöglichkeiten zu suchen bzw. die Umgebung so zu gestalten, dass Selbststeuerung beispielsweise ohne Selbstverletzung möglich wird.
Als Möglichkeit der Gegenwehr gegen die Übergriffe von außen verstecken nach Elbert manche als ‚geistig behindert' diagnostizierte Menschen ihr Wissen, das sie sich heimlich und autodidaktisch angeeignet haben. Denn, das Zeigen von Wissen, von Fähigkeiten, von Sprache ist für Erwachsene häufig ein Anlass, um in Kontakt zu treten. Da Interaktionen jedoch als bedrohliche, unkontrollierbare Vereinnahmung erlebt wurden, ist das Verbergen von Wissen eine sinnvoll erscheinende Strategie, sich vor Bemächtigungsversuchen und Einmischung zu schützen, Umweltkontrolle zu gewinnen und die eigene Autonomie zu verteidigen.
Was der Umgebung als ‚typisch geistig behindert' erscheint (nichts wissen, nicht sprechen, nichts können) und in traditionellen Testsituationen auch so gewertet werden würde, ist ein problemlösendes Handeln des Kindes oder Erwachsenen und somit ein intelligentes Verhalten. Dieses Beispiel zeigt sehr eindrücklich, dass Verhalten immer auf die Umwelt gerichtet ist und nichts über die tatsächlichen Fähigkeiten aussagt. Im Beispiel von Elbert wurde das Wissen nur in einer speziellen Funktionsprobe preisgegeben, die die Errichtung einer Beziehungsebene, weil Angst machend, absichtlich vermied und bei der sich die Interaktionen ausschließlich auf die Inhaltsebene, auf die Lösung der Aufgaben bezog.
Unsere Ignoranz und Unwissenheit wird zum Dilemma der ‚Geistigbehinderten'. Da Symptome oder die gezeigte ‚Unfähigkeit' meist nicht als Gegenwehr gesehen und verstanden werden, erhalten sie von den ‚Normalen' "nie die Anerkennung, daß sie die Welt kontrollieren können" (Elbert 1982). Dies treibt sie verstärkt "in das ‚ichbezogene' Agieren, in ‚abnorme' Verhaltensweisen" (ebd.) und damit in die Isolation.
"Aber zur Bewußtwerdung seiner selbst und zur Errichtung eines positiven Selbstbildes ist gerade die gelungene wechselseitige Interaktion notwendige Voraussetzung. Es bedarf der von außen vermittelten emotionalen Erfahrung von ‚Ich-kann-Erlebnissen'. (...) Dies sind die ersten Schritte zur Zerstörung des ‚geistigbehinderten Selbst', zur Transformation des ‚ichbezogenen' Agierens in die wechselseitige Interaktion. Es beginnt mit dem Akzeptieren der Symptome als funktionalem und somit vernünftigem Verhalten, das es zu respektieren gilt." (ebd.)
[17] Nach dem Buchtitel von Lindemann/Vossler
[18] Aus eigener Mitschrift zur LV "Grundlagen der integrativen Pädagogik" bei Volker Schönwiese, SS 2003
[19] Die Bewegung der De-Institutionalisierung ging ursprünglich (schon 1948!) von den skandinaischen Staaten aus und ist auch nur dort "durchgreifend wirksam:" (Dörner 2007)
[20] Lingg Albert in seinem Vortrag "Herausforderungen in der Zukunft", gehalten beim Symposium der Lebenshilfe Vorarlberg "Aufbruch in eine neue Zeit. Für alle?" 17.10.2005
[21] Bezugnehmend auf den Moralphilosophen Richard Hare lässt er beispielsweise in einem fiktiven ‚Gespräch' zwischen einem behinderten und einem nichtbehinderten Fötus die beiden sich darauf einigen, dass der behinderte Fötus ‚freiwillig' sein Lebensrecht aufgibt, damit der nichtbehinderte Fötus leben kann. (vgl. Schönwiese 2003, 66/67)
[22] Prim. Dr. Peter Schwärzler (LKH Feldkirch) in seinem Vortrag beim Symposium "Schöne neue Welt", 16.9.2005, Bildungshaus Batschuns, Vorarlberg.
[23] Lingg Albert in seinem Vortrag "Herausforderungen in der Zukunft", gehalten beim Symposium der Lebenshilfe "Aufbruch in eine neue Zeit. Für alle?" 17.10.2005
[24] Heinz von Foerster: "Theoriebildung in der Psychiatrie ist gefährlich" (aus einer Aufnahme Heinz von Foersters in der Ö1 Rundfunk Sendung "Dimensionen" 15.11.2005 zum 2. Internationalen Heinz von Foerster - Kongress)
[25] Diese ist ausführlich beschrieben in Rosenhan : Gesund in kranker Umgebung. In: Watzlawick 2000, 113 ff
[26] In Anlehnung an Freud, der das Geschlechtsleben der Frau als dunklen Kontinent bezeichnete.
[27] Gegenübertragungen sind Gefühlsreaktionen der Therapeutin/des Therapeuten auf die angebotenen Interaktionsmuster von PatientInnen; sie sind ein wichtiges Instrument der Therapie, sofern sie von der TherapeutInnenseite verstanden und dadurch den PatientInnen zurückgespiegelt werden können. (vgl. Niedecken 1998, 26)
[28] Diese Ansicht steht im Widerspruch zu den Ausführungen Maturanas, der beschreibt, dass die Emotionen bestimmen, inwieweit wir unsere Intelligenz nutzen können.
Inhaltsverzeichnis
"Er ahnt: diese Ordnung ist nicht so fest, wie sie sich gibt; kein Ding, kein Ich, keine Form, kein Grundsatz sind sicher, alles ist in einer unsichtbaren, aber niemals ruhenden Wandlung begriffen, im Unfesten liegt mehr von der Zukunft als im Festen, und die Gegenwart ist nichts als eine Hypothese, über die man noch nicht hinausgekommen ist."
Robert Musil, zit. in Pohl 1999, 18
Integration verstehe ich u.a. als Enthinderung der Begegnung von Menschen. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Begegnungen zwischen ‚(geistig)behinderten' und ‚nichtbehinderten' Menschen nach wie vor kaum stattfinden; dass sich trotz Integrationsbemühungen deren alltägliche Lebensbereiche wenig bis gar nicht berühren; dass ‚behinderte' Menschen noch immer vom gesellschaftlichen Leben vielfach ausgeschlossen werden bzw. in der Öffentlichkeit wenig präsent sind. Es scheint wenig Interesse am alltäglichen Zusammenleben mit ‚behinderten' Menschen zu geben.
Mit Musil könnte gefragt werden: Über welche Hypothese bezüglich des Phänomens Behinderung sind wir also gegenwärtig noch nicht hinausgekommen?
Das Interesse an der Begegnung mit anderen Menschen und die Gestaltung dieser Begegnung hängen wesentlich mit den Bildern zusammen, die wir uns von ihnen machen.
Mit den erwähnten Konstruktionen und Projektionsmechanismen, die das Phänomen Behinderung konstituieren, wird verständlich, was zwischen uns steht, welcher Ballast die Begegnung zwischen ‚Behinderten' und ‚Nichtbehinderten' erschwert bzw. verhindert.
Die Konstruktionen können als Folge gesellschaftlich-historischer Einigungsprozesse verstanden werden (vgl. Schönwiese 1995a, bidok), an denen die wissenschaftlichen Fachdisziplinen Medizin und Heilpädagogik mit ihrer enormen Definitionsmacht wesentlich beteiligt waren und sind. Mit ihrer Polarisierung zwischen Normalität und Anomalität und der Verknüpfung von Behinderung mit den Vorstellungen von Abweichung und Defizit wurde sie zum persönlichen Schicksal, das die Aussonderung der Betroffenen legitimiert.
Die Ausgrenzung nützt den vorherrschenden gesellschaftlichen Machtstrukturen. Sie erzeugt aufgrund der fehlenden Interaktionserfahrungen Angst- und Abwehrreaktionen. Wir ‚Professionellen' können der Bevölkerung nicht die Vermeidung von Kontakt oder die Unsicherheit und Unkenntnis im Umgang mit ‚behinderten' Menschen vorwerfen, wenn dieser durch Besonderung und Ghettoisierung verhindert wird. Stattdessen wäre es notwendig, die Beteiligung an der Behinderung von Menschen kritisch zu reflektieren.
Die zur Gewissheit gewordene Hypothese, die es zu überwinden gilt, scheint mir die Individualisierung von Behinderung im Zusammenhang mit Normvorstellungen zu sein. Wenn verständlich wird, dass die Zuschreibung ‚Behinderung' durch das soziale Umfeld und seine Bewertungen zustande kommt, also (wie die Konstrukte ‚Rasse', ‚Klasse') kulturell konstituiert ist, werden vielleicht einmal nicht mehr Menschen als ‚behindert' bezeichnet. Dann kann ‚Behinderung' "als Beschreibungswort für einen zwischenmenschlichen Prozess" (Greiner 2003, 30), für ein Ereignis, ein situatives Geschehen, das immer wieder stattfindet (im Sinne von ‚behindert werden, in der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit') benutzt und somit als sozial hervorgebrachtes Phänomen erkannt werden.
Auf theoretischer Ebene ist mit dieser systemischen Sichtweise eine Zurückweisung normativer Menschenbilder verbunden. Und dies nicht nur der ‚Behinderten' wegen, sondern weil diese Nadelöhr-Norm nach uns allen greift und uns unterwirft. Gleichzeitig werden auf der Ebene pädagogischen Handelns Begleitformen kritisch betrachtet werden müssen, damit eine Enthinderung der Begegnung und die Selbstbestimmung von Menschen möglich wird.
Es kann nicht darum gehen, Menschen in jenes Gesellschaftssystem integrieren zu wollen, dessen strukturelle Bedingungen und Normvorstellungen gerade ihren Ausschluss bewirkten, das ihnen Anerkennung verweigert und sogar ihr Mensch sein und Lebensrecht immer wieder in Frage stellt. Integration in diesem Sinne würde zum Lippenbekenntnis verkommen oder als Assimilation von ‚behinderten' Menschen missverstanden, die ihnen wieder eine eigene Identität verwehrt. Es sind die überzogenen Normvorstellungen, die ‚behinderte' Menschen unterwerfen und die Dichotomie behindert/nichtbehindert hervorbringen. "Normalität und Behinderung sind Teile des gleichen Systems" (Tervooren 2002), sie bedingen einander.
‚Geistige Behinderung' ist in diesem System ein Label für menschliche Vulnerabilität, Fragilität und Hilfsbedürftigkeit, ein Produkt eines symbolischen Systems. Ein Gegenbild zur Ideologie des autonomen, kompetenten aufgeklärten, bürgerlichen Subjekts; einem Konstrukt, von dem wir alle mehr oder weniger abweichen.
Diese äußere Trennung spaltet uns auch innerlich. Um mithalten zu können, dürfen wir die eigene Unvollkommenheit (das vergessene Menschliche) nicht mehr wahrnehmen und verschieben sie projektiv auf jene Menschen, deren Grenzen durch die Beeinträchtigung sichtbarer sind. Die Funktionalisierung ‚behinderter' Menschen für die eigene Psychohygiene dient der Selbstidealisierung (vgl. Mürner 2000, 101) und verhilft uns letztendlich auch nicht zur Integrität, sondern behindert die menschliche Selbstentfaltung aller Beteiligten.
Ein Ausweg ist nur möglich, wenn lebensfeindliche kulturelle Werte und Systembedingungen sowie normative Menschenbilder, die die Unterschiedlichkeit von Menschen negieren, problematisiert und abgelehnt werden. Es wird darum gehen, die umfassende wechselseitige Abhängigkeit und gleichzeitig die Verschiedenheit von Menschen anzuerkennen, sie als etwas Selbstverständliches und als Ressource zu begreifen. In der Achtung und Anerkennung der Differenz ohne Wertung werden Zuschreibungen wie ‚behindert' sinnlos.
"Das Fundament der Integration ist nicht die Caritas, die christliche Liebe als Mitleid, und nicht die aufklärerische Idee der Toleranz. Denn Caritas und Duldung sind Formen der Macht. (...) Sie sind keine Grundlage für humane Verhältnisse der Gegenseitigkeit." (Saner 1998, 50)
Wenn Integration aber als erwünschte Koexistenz unterschiedlicher Lebensformen verstanden wird, kann sie "eine emanzipatorische Funktion für Behinderte und Nichtbehinderte haben und beiden nützen."(Initiativgruppe 1982) Die Begegnung mit sog. behinderten Menschen kann als Chance gesehen werden, Gewaltmechanismen zu erkennen und die gesellschaftliche Gesamtstruktur zu verändern. (vgl. Greiner 2003, 32)
"Es kehren dabei zentrale Fragen der kulturellen Ordnung wieder: Die Fragen nach der Macht, nach der Ethik, nach der (wissenschaftlichen und narrativen) Sprache, nach der Strukturierung von Zeit und Raum, nach einer neuen Ästhetik (...).
In diesem Kontext kehren auch exkludierte anthropologische Kategorien wieder, wie etwa Heteronomie, Verletzbarkeit, (...), Abhängigkeit und Schmerzfähigkeit (...), Fragmentierung und Diskontinuität (...) - also insgesamt eine Anthropologie eines fragmentierten und hilfsbedürftigen Subjekts an der Grenze, die aber eben nur als allgemeine Anthropologie (!) denkbar ist."(ebd.)
‚Behinderung' ist damit "mehr und anders, als nur verschieden zu sein, es ist eine Provokation für ein geschlossenes identifikatorisch funktionierendes System" (ebd.) und die Begegnung zwischen ‚Behinderten' und ‚Nichtbehinderten' birgt die Chance der gegenseitigen Befreiung.
Mit der schmerzlichen Anerkennung der Begrenztheit und Fragilität unserer Existenz können Projektionen zurückgenommen und dadurch der Blick auf den anderen Menschen frei werden, kann sich Angst und Ablehnung in Inter-esse (Zwischen sein) verwandeln.
"Gemeint ist eine Haltung des inter-esse, was ‚Leben' im Sinne von ‚unter Menschen weilen' heißt - mit Menschen zu tun haben, zwischen Menschen sein, zwischen Menschen handeln, Leben als politische Existenz verstehen." (Thürmer-Rohr zit. nach Pohl 1999, 68)
Eine gleichberechtigte Beziehung zwischen ‚Behinderten' und ‚Nichtbehinderten' kann jedoch nicht verordnet werden. Sie emergiert vielleicht eher, wenn vielfältige und vielzählige zwischenmenschliche Begegnungen und Interaktionsprozesse durch enthinderte Strukturen ermöglicht werden.
In einer Gesellschaft, die Markt und Konkurrenz verherrlicht, sind allerdings die Fähigkeit zu Fairness, wechselseitiger Anerkennung und sozialer Verantwortung eher hinderliche menschliche Potentiale. Ohne gemeinsame Anstrengung, Öffentlichkeitsarbeit, beständigen Dialog und Konfliktbereitschaft wird die Enthinderung der Strukturen nicht zu haben sein. Visionen, die als Movens der Wirklichkeit vorgreifen, sind jedoch wichtig, um konkrete Wirklichkeit miteinander kreativ und vielfältig gestalten zu können.
Letztlich geht es bei der Forderung nach integrativen Bedingungen nicht um "Sonder-forderungen für Behinderte" (Alternativgruppen 1982), sondern vielmehr um die Frage nach Lebensqualität, demokratischen Strukturen und Bürgerrechten für alle Menschen. Integration impliziert die selbstverständliche Bereitstellung "von Begleit- und Hilfssystemen (...) in allen Lebensbereichen und Lebenswelten ohne Trennung." (Schönwiese 1995 b)
"Sprache / abgehetzt / mit dem müden Mund / auf dem endlosen Weg / zum Hause des Nachbarn"
Bobrowski, zit. nach Pohl 1999, 30
Auch die Begleitung von Menschen hängt wesentlich vom Bild ab, das wir von ihnen haben, welches wiederum beeinflusst ist von dem Menschenbild, das unserem Denken und Handeln zugrunde liegt.
Wir dürfen nicht vergessen, dass bis vor wenigen Jahren die Begleitung der meisten Menschen, die wir als ‚geistig behindert' bezeichnen, von einem trivialen, defizitären Menschenbild und förderzentrierten Modellen geprägt war. Sie mussten sich unter sozialen Bedingungen der Isolation, in einer von Fachleuten vorfabrizierten Welt, auf deren Gestaltung sie wenig bis keinen Einfluss hatten, entwickeln. Ihr Wesen und ihr Werden wurde von fremden Menschen vorweg bestimmt. Eigenständige Entscheidungen und Handlungen wurden ihnen nicht zugetraut. Sie wurden zur Passivität erzogen, ihrer selbst enteignet und lernten hilflos und dumm zu sein bzw. die Zuschreibungen selbst zu glauben oder zumindest nach außen zu zeigen. Elbert nennt es die soziale Produktion eines ‚geistigbehinderten Selbst'.
Geist, Identität, Bewusstsein und Handlungsweisen sind keine statischen Zustände, sondern Prozesse; sich ständig im Wandel befindliche Elemente der eigenen Persönlichkeit. Sie entwickeln und entfalten sich nur über Interaktionsprozesse und Resonanzerfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen. (vgl. Kap. 1.2.2 i.d.A.) Aber gerade jenen Menschen, die ohnehin schon mit erschwerten Bedingungen zurecht kommen müssen, wurden diese vielfältigen Austauschprozesse und Lernerfahrungen durch die Isolation vorenthalten. Es gilt daher in erster Linie strukturelle Veränderungen in den verschiedenen gesellschaftlichen Lebensbereichen (Schule, Arbeit, Wohnen, Freizeit etc.) zu forcieren und politisch einzufordern, sodass Unterstützung ohne Ausgrenzung innerhalb der komplexen sozialen Systeme gewährleistet ist. Dass dies, obwohl in aller Munde und auf aller Fahnen, noch lange nicht selbstverständlich ist, schreibt der Betroffene Süleyman Kurt:
"Vielen von uns fehlt es an Gelegenheiten, andere Menschen kennenzulernen.
Auch heute noch gilt, dass viele behinderte Menschen in Sondereinrichtugnen leben, leben müssen, dort ihre Schul- und Berufsausbildung erhalten und den aktiven Teil ihres Lebens in beschützenden Werkstätten verbringen. Dort leben sie in einer Art Ghetto, haben wenig Kontakt zur Außenwelt." (Kurt 2007, 75)
"Schöne Lage im Abseits, statt Perspektiven zum Leben (...)." (ebd., 67)
Die Prämisse der Plastizität lässt hoffen, dass, wenn es Menschen trotz Gewalterfahrung gelingt, wieder Vertrauen zu fassen, durch neue, andere Beziehungserfahrungen (wieder) angeeignet werden kann, was verletzt oder zerstört wurde. Jede Kommunikation stellt für ein lebendes System eine Störung bzw. Perturbation dar. Um sich ‚stören' lassen zu können, bedarf es jedoch einer angstfreien Beziehung. Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild kann sich durch Eigenaktivität und die Erfahrung der Eigenwirksamkeit bei gleichzeitigem Vertrauen und Zutrauen durch ein anerkennendes Gegenüber entwickeln. Die Ermöglichung der (Wieder) Aneignung setzt jedoch eine Veränderung im beruflichen Selbstverständnis professioneller BegleiterInnen voraus.
Es geht darum, der Entwicklung und Selbststeuerung von Menschen nicht mehr durch abstraktes Wissen, pädagogischen Kolonialismus und Angstabwehr im Wege, sondern ihnen bei der Entfaltung des individuellen Entwicklungsweges dialogisch zur Seite zu stehen. Selbstbestimmung, Anerkennung,Dialog und Verstehen als handlungsleitende Begriffe der integrativen Pädagogik weisen auf eine Neuorientierung hin.
Wenn das Potential der Selbstorganisation allen lebenden Systemen eigen ist, kann es auch keinem Menschen, wie sehr er auch beeinträchtigt sein mag, abgesprochen werden. Selbststeuerung als anthropologische Kategorie ist nicht zu verwechseln mit Unabhängigkeit oder Selbständigkeit. Wir alle sind selbstorganisiert und angewiesen auf unser Umfeld. Selbstbestimmung meint, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben, inklusive der Würde des Risikos; meint Emanzipation im Angewiesen sein auf andere. Sie bezieht sich sowohl auf die vielen kleinen Entscheidungen des Alltags als auch auf die großen Themen der Lebensgestaltung wie Ausbildung, Beruf, Familienstand, Wohnen usw.
Es geht darum, sich an der Eigenaktivität, der Kompetenz, den Interessen und Fähigkeiten der Menschen zu orientieren, sie anzuerkennen und die gewünschte Form der Alltagsbewältigung und des individuellen Lebensstils assistierend zu unterstützen.
Es ist zutiefst heilsam, gesehen und gehört, also wahr- und ernst genommen und nach der eigenen Weltsicht gefragt zu werden. Genauso wichtig ist es, die Sicht- und Handlungsweise anderer Menschen als möglichen Gegenvorschlag (vgl. Kap. 2.2 i.d.A.), in einer Weise vermittelt zu bekommen, die aufgenommen werden kann (verbal oder nonverbal) und sich dadurch als wertvolles Gegenüber erleben zu können, mit dem etwas geteilt wird.
Die Selbstbestimmung von Menschen impliziert für die BegleiterInnen, sich in einen Dialog einzulassen. Aushandeln statt behandeln, fragen, zuhören, sich als eigene Persönlichkeit einbringen, gemeinsam reflektieren. Wir brauchen ein ‚Du', das uns neben sich gelten lässt, so wie wir sind; einen Raum eröffnet, uns bestätigt und das wir wiederum bestätigen können (wider dem ich-bezogenen Agieren).
Das ist eben dieses Paradoxon, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns zeitlebens bewegen: da ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und gleichzeitig das Bedürfnis, Bedeutung für andere zu haben. Wir brauchen die wechselseitige Anerkennung und Spiegelung, um Selbstachtung (wieder) entwickeln und die Anderen achten zu können. Mit der Ermöglichung der Selbstbestimmung machen sich Begleiter also keineswegs überflüssig. Denn ein Laissez faire - Stil meidet genauso den Dialog und die Auseinandersetzung wie distanzierte, ‚organisierte', fördern wollende Interaktionsmuster, die eine wechselseitige Beziehung nicht zulassen. (vgl. Niedecken 1998, 23; sowie Gstettner, zit. nach Schönwiese 2003, 18)
Dialog ist nicht an Sprache gebunden, aber er setzt Interesse voraus. Jedes Verhalten ist Mit-teilung - Ausdruck subjektiver, viabler Wirklichkeit - an die Welt gerichtet - in der Hoffnung auf Antwort.
"Jedes Verhalten trachtet danach zu (über) leben, zu wachsen und nahe bei anderen zu sein. Alles Verhalten drückt dieses Ziel aus, unabhängig wie gestört es erscheinen mag." (Satir, zit. nach Hähner 1997, 136)
Verhalten ist ein soziales Phänomen und ist als Ergebnis bisheriger Entwicklung in Interaktionsprozessen in einen biographischen Zusammenhang zu stellen. Das Problem liegt "nicht im Defekt, sondern im Fehlen von Alternativen." (Jantzen 1998, 82)
Wir müssen lernen, Verhaltensauffälligkeiten oder sog. Symptome als Kompetenzen und Überlebensstrategien zu begreifen, d.h. sie im Sinne von Elbert in Bezug zu den vereinnahmenden Formierungsprozessen durch die Umwelt zu stellen und als sinnvolle, subjektive Leistung (Gegenwehr), als Mittel, Widersprüche aufzulösen, sich zu ordnen und die Umwelt zu kontrollieren, anzuerkennen. Das fundamentale Bedürfnis nach Anerkennung ist die Grundlage dialogischer Begleitung.
Diese Haltung versucht nicht in erster Linie Symptome oder Stereotypien wegzutherapieren, sondern ihre "Funktion im Balance-Akt zwischen Sicherheit und Bewegungsfreiheit" zu verstehen. (von Lüpke, zit. nach Huschke-Rhein 2000, 36) Sie versucht zu erkennen, aufgrund welcher Erfahrungen und innerhalb welchen Bedeutungssystems das Verhalten sinnvoll ist.
Die Wahr-nehmung des Gegenübers in der sozialen Situation sowie die Wahrnehmung und das Verstehen eigener Gegenübertragungsgefühle sind entscheidende Werkzeuge, um Hypothesen über Sinn und Bedeutung eines Verhaltens erstellen zu können. Da das Verstehen die Ebene der Unterstellung jedoch nie verlässt, sind die Hypothesen an der Reaktion des Gegenübers bzw. im Dialog mit ihm/ihr zu überprüfen.
Die Schwierigkeit der Artikulierung oder des Nichtsprechens von manchen Menschen verführt im Alltag dazu, ihnen nicht zuzuhören bzw. ihre Äußerungen zu übergehen und sie dadurch zu ent - mündigen.
"Ohne Zuhören bleibt das Sprechen leer, ohne Resonanz bleibt es bloße Selbstdarstellung oder verzweifeltes Agieren. Das Zuhören ebenso wie das Sprechen ist Ausdruck eines Interesses, mit dem das Individuum sich aussetzen und das eigene System überschreiten will." (Thürmer-Rohr, zit. nach Pohl 1999, 68)
Sprache (verbal oder nonverbal) ist dialogisch! Sie ist auf dem Weg ‚zum Hause des Nachbarn' und ich denke, dass wir alle über unausgeschöpfte Potentiale empathischen Verstehens verfügen. Wir alle können lernen, geeignete InteraktionspartnerInnen zu werden.
Dialog, verstanden als konfliktbereite Auseinandersetzung gleichberechtigter Partner, thematisiert auch Grenzen der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist nie absolut, sondern reibt sich im sozialen Zusammenleben immer an jener der anderen Menschen. Aber erst in der Erfahrung der Eigenwirksamkeit durch Selbstbestimmung, Handlungsspielräume und Wahlmöglichkeiten können die Auswirkungen von Handlungen und Entscheidungen auf sich selbst und andere überhaupt erlebt werden.
"Selbstbestimmung lässt eigene Verantwortlichkeit erleben. (...) Verantwortlichkeit tritt nicht plötzlich auf. Ihr liegen Lernprozesse zugrunde. Selbstverantwortete Ereignisse lassen erkennen, ob unser Wirken sinnvoll ist." (Hahn 1998, 24)
Verantwortlichkeit für das eigene Handeln entwickelt sich bei allen Menschen nur durch "ungezählte Akte der Selbstbestimmung" und durch "diskursives interaktives Aushandeln von Grenzen." (Hahn 1998, 25) Die Spannung zwischen der Selbstbestimmung ‚geistig behinderter' Menschen und der Verantwortung ihrer BegleiterInnen kann durch Verstehen der Situation und durch das Aufzeigen und Aushandeln von Toleranzgrenzen (wie Selbst- oder Fremdverletzung) möglicherweise aufgelöst werden.
Die Forderung von Menschen mit ‚geistiger Behinderung' nach Selbstbestimmung und Demokratisierung der Begleitprozesse (vgl. Körbler et.al. 2003) rüttelt am Selbstverständnis professioneller BegleiterInnen. Die Haltungsänderung von der Förderung zur Begleitung und Assistenz, von der defektologischen zur dialogischen Haltung stellt zwar einen Machtverlust dar, ist aber gleichzeitig mit hohen Anforderungen an die Selbstreflexivität und das Selbstbewusstsein der BegleiterInnen verbunden. Wir sollten uns darin üben, unsere theoretischen Konzepte und unser Handeln immer wieder radikal in Frage zu stellen und im Dialog mit den Betroffenen als Experten in eigener Sache weiterzuentwickeln.
Macht und Gewalt müssen immer wieder thematisiert werden. Denn das "Mehr an sozialer Abhängigkeit, das Behinderung ausmacht, stellt ein Mehr an Macht dar, das die soziale Umwelt über Menschen mit Behinderung hat." (Hahn 1998, 17)
Weiters ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten, der Abwehr, den vorhandenen Phantasmen bzgl. ‚Behinderung' eine der wichtigsten Voraussetzungen, um die Begegnung zu enthindern, sich in einen gleichberechtigten Dialog einlassen zu können und somit pädagogisch handlungsfähig zu sein. (vgl. Schönwiese 2003, 23)
Mit der Anerkennung der Differenz und vor dem Hintergrund eines nichttrivialen Menschenbildes wird gleichzeitig der Begriff Erziehung in der Begleitung von Menschen mit ‚geistiger Behinderung' grundlegend zu problematisieren sein. Die Unterstellung lebenslanger Erziehungsbedürftigkeit die damit verbundene Pädagogisierung und Therapeutisierung ihres Alltags trägt ständig Erwartungen nach Persönlichkeitsveränderungen an sie heran. Sie impliziert die Nichtakzeptanz ihres Soseins und verhindert die Entwicklung einer eigenen Identität und Lebensform. Erziehung ist immer unzufrieden mit dem Status quo und respektiert Menschen nicht in ihrer Unterschiedlichkeit. Menschen mit ‚(geistiger) Behinderung' sind schon vollständig und vollwertig. Sie haben ein Recht auf erziehungs- und therapiefreien Raum.
Wir müssen außerdem endlich aufhören, ihre kreativen Leistungen "als Kompensations-leistungen ihres ‚Mangels'"(Initiativgruppe 1982) oder als Ausdruck davon, was PädagogInnen aus ihnen ‚herausgeholt' haben (vgl. Niehoff 1997, 175), zu betrachten.
Dialogische Begleitung impliziert die Entpädagogisierung des Alltags und den Abschied von einer paternalistischen Haltung im Sinne von Bevormundung. Sie ist ein Balanceakt zwischen Nichteinmischung und Unterstützung.
Im Erleben der Eigenwirksamkeit und der Entdeckung der eigenen Fähigkeiten im wechselseitigen Austausch mit anderen innerhalb des komplexen sozialen Systems ergeben sich Vorlieben und Interessen, die aus eigenem Bedürfnis und mit eigener Initiative weiter- entwickelt werden möchten. Das Zurückerobern des verbotenen Terrains ‚Selbstsein' kann nur durch Wahlmöglichkeiten, Entscheidungsfreiheit und Anerkennung gelingen.
Selbstbewusste (‚geistig behinderte') Menschen fordern heute vermehrt das Recht auf Arbeit im Sinne einer sinnvollen Tätigkeit nach eigenen Neigungen und Fähigkeiten in der Gemeinschaft (also auch außerhalb der Beschäftigungsghettos), mit entsprechender Ausbildung und Unterstützung (persönliche Assistenz) und auch entsprechendem Lohn. (vgl. Köbler et.al. 2003)
Ein herrschaftsfreier Dialog lebt von Gegenseitigkeit, Anerkennung und Respekt. Dass die BegleiterInnen keinesfalls nur Gebende sind, sondern das Zusammensein mit Menschen, die wir als ‚geistig behindert' bezeichnen, durch deren oft unkomplizierte und unkonventionelle Art emotional bereichernd ist (oder sein darf) und uns persönlich gut tut, hat Rudi Sack in die Fachdebatte eingebracht und damit eine heftige Kontroverse (!) ausgelöst, die sich vor allem auf die Gefahr der Ausbeutung bezog. (vgl. Sack 1997, 114/115) Ich teile jedoch mit ihm die Ansicht, dass das ‚Zugeständnis' emotionaler Bereicherung eine wichtige Voraussetzung für eine Beziehung der Gegenseitigkeit ist. Das Thema Ausbeutung muss in der Begleitung von ‚geistig behinderten' Menschen ohnehin immer im Auge behalten werden. Jedoch die Zurückhaltung, sie als interessante InteraktionspartnerInnen anzuerkennen und das Zusammensein gewissermaßen auch genießen zu dürfen, scheint mir eher im Dienste der Abwehr zu stehen. Damit wird ein Bild des ausschließlichen Nehmens aufrechterhalten; möglicherweise, wie Sack vermutet, um die berufliche Leistung der PädagogInnen aufzuwerten. Auch das wäre eine Form der Ausbeutung. Fatalerweise stützt diese negative Darstellung von ‚geistig behinderten' Menschen als nur Nehmende ihr ohnehin geringes Sozialprestige.
Nicht zu Unrecht fragt die Erziehungswissenschaftlerin Marianne Gronemeyer:
"Wir pochen auf Partizipation, auf das Teilnahmerecht in der Gesellschaft; was ist stattdessen mit der Teilgabemöglichkeit, mit dem Teilgaberecht?"[29]
Kein Mensch nimmt nur, jeder Mensch kann in seiner Einzigartigkeit auch etwas geben. Die Frage ist, ob diese Gabe wahrgenommen, angenommen und wertgeschätzt wird. Kleben wir noch so sehr am Defizitdenken bzw. am normierten Leistungsdenken, dass wir die Teilgabefähigkeit von Menschen mit (‚geistiger') ‚Behinderung' übersehen? Oder würde die Anerkennung ihrer Kompetenz unser Selbstbild zu sehr irritieren?
Die Perspektive der Teilgabe ist immer noch so ungewohnt, dass es uns in Erstaunen versetzt, wenn sich Menschen mit sog. geistiger Behinderung selbst artikulieren, ihren eigenen Standpunkt, ihre Weltsichten und ihre Fähigkeiten und Begabungen in die soziale Gemeinschaft einbringen (in der Arbeit, Freizeit, zwischenmenschlichen Begegnung), sich gegenseitig beraten und Professionelle schulen. Sie weisen uns auf die nach wie vor bestehenden gesellschaftlichen Defizite im Sinne von Barrieren hin. Innere (Haltungen, Vorstellungen über Behinderung, Ängste) und äußere. Denn noch nicht einmal die technische Egalisierung der Partizipationsmöglichkeit ist bislang weitreichend genug (Abschrägung der Gehsteige, Tastleisten für Blindenstöcke in öffentlichen Gebäuden usw.). Barrierefreiheit bedeutet auch die Selbstverständlichkeit von Gebärdensprache und -dolmetscherInnen. Weiters gab Josef Ströbl, Vertreter von People first in Deutschland, in seinem Vortrag zu bedenken, wie wichtig leichte Sprache ist: "Was für die einen die Treppen sind, sind für uns die Fremd- und Fachwörter - meist zu lang, zu kompliziert."[30]
Auch wird die Forderung von Menschen ‚mit Behinderung' nach persönlicher Assistenz in den verschiedenen Lebensbereichen (Arbeit, Freizeit, Wohnen etc.), welche ihnen das Recht auf Teilhabe und Teilgabe nicht nur gesetzlich bescheinigt, sondern auch praktisch ermöglicht, erst in Ansätzen umgesetzt.
Nur der soziale Kontakt kann die Fremdbilder über Behinderung korrigieren, die Ängste abbauen und zu einem ‚normalen' Umgang miteinander führen.
Deshalb möchte ich mich nach diesem theoretischen Bogen mit dem folgenden letzten Kapitel spiralförmig wieder in Richtung Tanz bewegen und damit die Verbindung zum Anfang knüpfen. Nicht zuletzt, weil dort meine eigenen Dekonstruktionsbewegungen von Behinderung ausgelöst wurden und ich aus dieser Erfahrung heraus in dem speziellen Tanzangebot DanceAbility ein Potential für wertfreie, soziale Kontakte sehe, die Vorurteile abbauen können. Ich werde DanceAbility als ‚Begegnungsraum' für Menschen ‚mit und ohne Behinderung' vorstellen, in dem über das Medium Tanz als gemeinsamem Interesse und gemeinsamem Aufmerksamkeitsfokus kommuniziert wird. Wie erwähnt (vgl. Kap. 1.2.2 und 2.2 i.d.A.) gehört ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus (joint attention) "zu den wichtigsten Voraussetzungen für den Aufbau einer emotionalen Bindung." (Bauer 2005, 55)
Die Teilhabe ist zudem an keine Bedingungen geknüpft, wie es bei der Definition von Inclusion gefordert ist. (vgl. Hinz, Kap. 3.2.) Jeder Mensch ist willkommen, so wie er/sie ist.
DanceAbility wurde von Alito Alessi und Karen Nelson in den Jahren zwischen 1987 und 1990 begründet und entwickelt sich fortlaufend weiter. Zeitgenössischer Tanz (contemporary dance) und Kontaktimprovisation (Steve Paxton), beides Wurzeln von DanceAbility, hatten damals bereits die traditionelle Auffassung von Tanz als Privileg des idealen Körpers zu durchbrechen begonnen, aber noch nicht bis in die Tiefe dekonstruiert und auch für ‚behinderte' Menschen geöffnet. DanceAbility ist sowohl eine Kunstform als auch eine Form des Community-Dance. Auf letztere möchte ich hier eingehen.
Die Philosophie von DanceAbility[31] ist, Tanz für alle Menschen zugänglich zu machen und somit niemanden auszuschließen. Alessi bezeichnet sein erweitertes Bild von Tanz folgendermaßen: if you can breathe, you can dance.
"You've heard of thinking outside the box. This is dancing outside the box." (McCowan, 1999)
DanceAbility ist nicht für 'Behinderte' konzipiert, sondern für alle Menschen von AnfängerInnen bis zu professionellen TänzerInnen. Es geht um eine lebendige Koexistenz, in der alle voneinander lernen können. Es geht um die Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit.
"The intention of DanceAbility is to work with all people in the study of dance and movement improvisation, and bring more diversity, equality and self-empowerment into contemporary dance, and by extension, into our greater culture." (Alessi, Teacher Certification Course Manual, 5)
Die gemeinsame Basis (common denominator), die allen die Teilgabe ermöglicht, ist der Ausgangspunkt, von dem aus sich dann die Vielfalt durch die Verschiedenheit der TeilnehmerInnen entfaltet. Die Intention ist, diese Diversität wahrzunehmen, zu respektieren und zu kultivieren und sich über den Austausch in der Bewegung von Barrieren, die unser Potential behindern und uns voneinander trennen, zu befreien. Die Gleichwertigkeit in der Verschiedenheit drückt Alessi folgendermaßen aus:
"I don't think you are a better person if you can walk, than if you can't walk. I don't think you are a better person if you can talk, than if you can't talk. I don't think you are a better person if you can organize your thoughts, than persons who are not shure how they organize their thoughts. I believe in the diversity, the unique characteristic of each and every person, and that there everybody has something to offer and something to learn from somebody else, and every person can make an action and every action can have an effect on people around them, their community and on the environment." (eigenes Interview mit Alessi 2007, 92-99)
Jeder Ausdruck eines Menschen ist an die Welt gerichtet und bereichert sie. Alessi sieht Bewegung als Sprache, als Ausdruck und Kommunikation. Er ist überzeugt, dass über diese Sprache des Körpers und seiner Bewegung andere Wege der Beziehungsaufnahme und Beziehungsgestaltung möglich sind als über die verbale Sprache.[32] Ohne Worte ist die Begegnung ‚unmittelbarer' - bewegen wir uns in der Dichte dieses Wirkfeldes ‚Zwischen'. Auch Menschen, die nicht sprechen, können an diesem Dialog teilnehmen, werden ‚gehört', wahrgenommen, können sich einbringen und in Wechselwirkung mit den anderen ihre Wirksamkeit erleben. Denn auch diese nonverbale Sprache der Bewegung ist dialogisch; ist an ein Du gerichtet - in der Hoffnung auf Antwort. (vgl. Kap. 4.2 i.d.A.) Gerade die Arbeit mit Menschen, die nicht sprechen und auch auf Bewegungsangebote ‚nicht' reagieren, verunsichert häufig. Wie kann sich Begegnung da ereignen? Wie lässt sich in diesem Zusammenhang Kommunikation verstehen? Kommunikation geschieht auf viel mehr Ebenen, als wir uns bewusst sind. Alessi beschreibt einen nonverbalen Dialog mit einer Frau:
"(...) the goal is to find an element of communication that is happening and then follow her into that way (...). The goal is not one of understanding. You really need to wake up your intuition. You have to be in sensory awaereness (...). You have to meet her. (...) If I listen enough, between the two of us an idea will arise." (Alessi, im Interview mit Horwitz 1998, eigene Hervorh.)
In der Improvisation wird die Körper- und Bewegungsqualität jeder/s Einzelnen als Teilgabe gesehen und gleichermaßen wertgeschätzt. In dieser Vielfalt ist es leichter neue Bewegungen zu finden und über die eigenen Begrenzungen und Muster hinauszuwachsen. Wie im Modell von Milani Comparetti (vgl. Kap. 2.2 i.d.A.) gilt Diversität auch hier als Wert und wichtige Anregung. Improvisation
"continuously presents us with new situations and new ways of moving, to respond to and be influenced by. It's especially easy to go beyond habit and find new ways to move and express yourself when there are many kinds of bodies and ways of moving and thinking in the room." (Alessi, im Interview mit Malarkey 2003)
Bei DanceAbility geht es nicht um Therapie oder forcierte Veränderung von Menschen. Jede/r ist akzeptiert wie sie oder er ist. Es geht um Tanz in der Gemeinschaft. Durch diese Vielfalt geschieht die Erweiterung der Grenzen von selbst. (vgl. Kap. 1.2.2 i.d.A., die Ausführungen über die Spiegelneurone)
"When we isolate people, we lose the ability to benefit from their perspective.
People actually learn the most about improvisation by working with as much diversity as possible, because working beyound familiarity teaches people to be more creative. So not only do people with disabilities benefit from diverse, accessable dance, but the dance world also benefits and expands by including more diversity." (Alessi, Teacher Certification Course Manual, 6/7)
Alessi's Erfahrung ist, dass durch den ‚Dialog in Bewegung' auch vorgefasste Meinungen über Behinderung und über Menschen, die ‚anders' scheinen, in Bewegung kommen und sich verändern und erhofft sich, dass dies Kreise zieht; sich diese ‚Bewegung' in die Gesellschaft fortsetzt.
Methodisch beginnt jeder Danceability-Workshop damit, erst einmal bei sich selbst anzukommen. Die Aufmerksamkeit wird auf die Erforschung und Wahrnehmung des eigenen Körpers (sensation) und seiner Bewegungsmöglichkeiten und -qualitäten, unabhängig von herkömmlichen Vorstellungen von Norm und Ästhetik (basic sensuality, not clouded by aesthetic concern), gelenkt. Dieses wertfreie Erspüren, ohne Vorgaben, wie es auszusehen oder sich anzufühlen hat, eröffnet bzw. vertieft die Beziehung zum eigenen Körper, so wie er ist. Es macht den Blick frei für das eigene Potential. Gerade ‚behinderte' Menschen wurden häufig durch den vermessen(d)en, klinischen Blick auf eine (Geh) Norm hin behandelt und gedrillt und dadurch ihres Körpers entfremdet und enteignet. Durch eine wertfreie Hinwendung, wie es bei DanceAbility geschieht, kann der fremdgewordene Körper wieder zurückerobert, wieder angeeignet werden. Dies bezeichne ich auch als eine Form der Enthinderung und Emanzipation. Wie ein Teilnehmer beschreibt, liegt der Fokus nicht auf ‚Defizit' oder Begrenzung, sondern auf den Möglichkeiten:
"We people with handicaps are not used to people loving our bodies. Normally what you learn as handicapped people is that people look at what is missing, what doesn't work, and nobody is looking at what is here and what we can do. So this work really supports a different view than what most people have. (...) You give people back love for their bodies, and do that by moving, by playing and developing more possibilities to move." (Teacher Certification Course Manual, Indroduction)
Jeder Körper hat Möglichkeiten und Begrenzungen. Deshalb kann diese wertfreie Zuwendung ein Akt der Befreiung für alle Menschen sein, auch für sog. Nichtbehinderte, denn auch diese Körper sind überfrachtet von kulturellen Zuschreibungen und Schönheitsnormierungen.
Wenn man dem Ausgangsort inne, also im eigenen Körper angekommen ist, beginnt die Tanzimprovisation im Raum und im Dialog miteinander, einzig geleitet durch das eigene Bewegungs- und Begegnungsbedürfnis.
"There are no specific steps to follow and no external aesthetic rules." (Alessi, Teacher Certification Course Manual, 2)
Auch in dieser Form des Dialogs ist die Entwicklung unbekannt. (vgl. Kap. 2.2 i.d.A.) Niemand weiß, was im nächsten Moment geschehen wird. Keine Entscheidung ist richtig oder falsch. Durch diese Offenheit entsteht eine enorme Präsenz und Achtsamkeit im Raum. Neue ungeahnte Bewegungen und Situationen können entstehen. In jeder Entscheidung begegne ich mir selbst und den anderen. Die Bewegungsqualität der anderen erlaubt mir ein bisschen von deren Welt kennenzulernen und kann im Austausch auch die eigene transformieren und dadurch mitwirken, Bewegungsmuster und Gewohnheiten zu überwinden.
"Moving, dancing and improvising with people with diverse physicalities gives people a chance to move in ways they hadn't considered. Really meeting a person you're dancing with in this moment allows you to experience somebody else's world movement view. You can feel it in the air, the ambience of a group bonding (...)." (Alessi, Teacher Certification Course Manual, 5, eigene Hervorh.)
Um Inclusion zu gewährleisten arbeitet Alessi mit dem ‚common denominator'.
"The common denominators are the elements of movement and principals of movement that each person can do. And so you base the exercises that you teach to people on what they can do and what allows each person to be involved in the workshop all the time." (eigenes Interview mit Alessi 2007, 7-10)
Die ‚Common denominaters' sind also Bewegungsthemen, an denen alle TeilnehmerInnen partizipieren können, auf je individuelle Weise (z.B. ‚action and response' oder ‚fast, slow and still'). Es geht nicht darum, dass jeder Mensch sozusagen äußerlich in der Größe der Bewegung gleich viel beiträgt zur Kommunikation, sondern um die Anwesenheit und die Intensität, in der eine Bewegung ausgeführt wird; es geht um die Qualität der Verbindung in der Kommunikation. Wir sind schon gleichwertig. Jede Person tut, was sie kann und was die Situation aus ihrer Perspektive braucht. Schönheit des Tanzes ist nicht äußerlich. Visuelle Ästhetik ist leer, wenn sie nicht durch die Tiefe der Kommunikation gespeist wird.
Zudem ist Alessi überzeugt, dass die Bewegungen von Menschen, die vielleicht nur die Augen oder nur eine Extremität bewegen können, für sie genauso reichhaltig und erfüllend sein können wie die Bewegungserfahrungen sog. nichtbehinderter Menschen.
Ziel der Arbeit ist es, die gemeinsame Basis einer Gruppe zu finden und Beziehung und Gemeinschaft durch Tanz und Improvisation darauf aufzubauen.
Behindernde Haltungen und Vorurteile, die Menschen mit und ohne ‚Behinderung' über sich selbst und die anderen haben zu überwinden, hält auch Alessi für die schwierigste Herausforderung in seiner Arbeit. Beispielsweise, dass ‚behinderte' Menschen nicht tanzen können oder ihre Bewegung nichts wert ist und nichts bedeutet. Auch sie selbst glauben das häufig noch, denn sie wurden gelehrt, dass sie da nicht dazugehören. Die Fremdexclusion wurde zur Selbstexclusion.
DanceAbility ist nicht die Lösung für so komplexe Probleme wie Ausgrenzung
"but I think it can serve as a model for more inclusive and integrated society." (Alessi, Teacher Certification Course Manual, Indroduction)
[29] Statement von Dr. Marianne Gronemeyer, Erziehungswissenschaftlerin, Kulturanthropologin, Wiesbaden; beim Symposium "Schöne neue Welt" 16.9.2005 Bildungshaus Batschuns, Vorarlberg
[30] Josef Ströbel, Vortragender bei der Fachtagung: "Selbstbestimmt leben", 23./24. 11. 2007, Kathi Lampert Schule Götzis, Vorarlberg.
[31] Die Ausführungen basieren auf meiner Mitschrift beim DanceAbility Teacher Training 2007 mit Alito Alessi in Wien und dem Teacher Certification Course Manual. Andere Angaben werden jeweils gekennzeichnet.
[32] Dies kann ich aus meinen Erfahrungen in der tanztherapeutischen Praxis nur bestätigen.
"Wizards had always known that the act of observation changed
the thing that was observed, and sometimes forgot that it also
changed the observer too."
(Pratchett, zit. nach Lindemann/Vossler 1999, 143)
Die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema hinterlässt Spuren, eröffnet neue Blickwinkel, bewegt.
Der Konstruktivismus und die Systemtheorie sind keine neuen Dogmen, denn damit würden sie sich selbst widersprechen. Sie zeigen lediglich auf, wie wir wahrnehmen und erkennen und wie wir im Austausch und Angewiesen-sein auf andere die Welt oder Wirklichkeit gemeinsam hervorbringen. Diese Welt ist somit nicht so festgefügt, wie sie oft scheint, sondern veränderbar. Das Schöpfungswerk ist nicht abgeschlossen - die Zukunft ist offen.
Die systemisch-konstruktivistische Perspektive bedeutete für mich Verlust und Gewinn zugleich. Einerseits lernte (und lerne) ich das Verlangen nach endgültigen Wahrheiten aufzugeben; der Versuchung von Letztbegründungen zu widerstehen. Damit wurden Unsicherheit und Ungewissheit zu (nicht immer angenehmen) Wegbegleiterinnen, mit denen ich mich erst anfreunden musste. Andererseits ermutigt diese Sichtweise Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster in Frage zu stellen und auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen, Standpunkte zu wechseln, um neue ‚Einblicke' zu gewinnen (wer anders schaut, sieht anderes) und Dekonstruktionsbewegungen zu wagen.
Auch für die pädagogische Praxis bietet diese Sichtweise keine ethischen Rezepte an. Sie hält uns lediglich das Paradoxon von Selbstorganisation und dem gleichzeitigen Bedürfnis nach Anerkennung sowie die Komplexität des nie ganz durchschaubaren Geheimnisses zwischenmenschlicher Interaktionen vor Augen. Die Weigerung allgemeingültige Richtlinien zu entwerfen, endet jedoch meines Erachtens nicht in Beliebigkeit, sondern wirft uns zurück auf eigenverantwortliches, selbstreflexives Handeln und Entscheiden in der jeweiligen Situation.
Mit der systemisch-konstruktivistischen Sichtweise kann die statisch-biologistische (Schädigung) und damit individualisierende Sichtweise von Behinderung dekonstruiert und Behinderung stattdessen als soziale (Re)Konstruktion erkannt werden. Einerseits sind hier gesellschaftliche Strukturen am Werk, die Behinderung als Stigma (re)produzieren. Andererseits bzw. damit in Zusammenhang stehend sind es die "alltagspraktisch gebildeten Reaktionsmuster (...), mit denen wir Behinderten ‚begegnen' bzw. ihnen auf eine Art ausweichen" (Gstettner 1982), die das Phänomen Behinderung immer wieder hervorbringen. Dieses Vermeidungsverhalten steht im Dienste der Abwehr. Die Trennung von Menschen in ‚Behinderte' und ‚Nichtbehinderte' ist einem normativen Menschenbild geschuldet, das Behinderung abwertet und ausschließt. Wir ‚Nichtbehinderten' parasitieren an ‚Behinderten' um selbst in den Genuss der Überlegenheit zu kommen.
Wie kann hier eine öffentliche Bewusstseinsbildung vorangetrieben werden? Ein Wechsel der Sichtweise ist nicht zu verschreiben. Nur durch konkrete Interaktionserfahrungen und narrative Beschreibungen und Gegenkonstruktionen von Betroffenen können die Phantasien vertrieben, die Projektionen zurückgenommen und damit die gewohnten Bilder und Symbolvorräte von Behinderung irritiert werden und sich verändern. Beispielsweise wären Rollstühle dann vielleicht keine Fessel mehr oder ein Symbol für Leid, sondern vielleicht Glücksräder - "wheels of fortune"[33], die Fortbewegung ermöglichen. Süleyman Kurt dazu schreibt aus der Betroffenenperspektive:
"Unsere Normalität ist eine andere als die der Nichtbehinderten. Für mich ist es z.B. nichts Besonderes, dass ich mich rollend fortbewege. Und ich habe mein Leben dementsprechend organisiert. Aber von außen wird das für mich Selbstverständliche nicht erkannt. Da bin ich besonders tapfer, und es ist schön, dass ich noch so fröhlich bin, obwohl ich doch so ein schweres Schicksal habe." (Kurt 2007, 72)
"Wir Menschen mit Behinderungen werden auf unsere Behinderung reduziert, werden als Mangelwesen betrachtet. Dem muss ein Bild des behinderten Menschen entgegengesetzt werden, das so vielfältig und bunt ist wie das Bild vom nicht behinderten Menschen." (ebd., 27)
Es kommt ja immer darauf an was wir in der Betrachtung scharfstellen: die Gemeinsamkeit, das Verbindende oder den Unterschied, und - wie wir den Unterschied bewerten. Wenn wir Unterschiedlichkeit und Vielfalt als Reichtum und Ressource der menschlichen Gemeinschaft verstehen, brauchen wir die Trennung vielleicht nicht mehr. Bezogen auf die innere Spaltung (vgl. Kap. 3.2 i.d.A.) wäre das ein Akt der Befreiung für uns alle. Denn dann könnten wir "ohne Angst verschieden sein" (Adorno, zit. nach Pohl 1999, 50).
Im Hinblick darauf, dass Unterscheidungen Wirklichkeit hervorbringen, könnte es dann gelingen, unter dem "Operator: ‚Drop a distinction!" (von Foerster in Pörksen 2002, 43) die Dichotomie ‚behindert' vs. ‚nichtbehindert', die so belastet ist von defizitärem Denken, fallen zu lassen. Die Frage ist, ob wir schon so weit sind. Denn in verantwortlicher Weise wäre dies nur möglich, wenn die Unterstützung von Menschen ‚mit Behinderung', die noch an den Begriff gebunden ist, selbstverständlich gewährleistet wird.
Diese Vision hatte Wygotski allerdings schon 1924:
"Möglicherweise ist die Zeit nicht mehr fern, da die Pädagogik es als peinlich empfinden wird, von einem defektiven Kind zu sprechen, weil das ein Hinweis darauf sein könnte, es handle sich um einen unüberwindlichen Mangel seiner Natur... In unseren Händen liegt es, so zu handeln, daß das gehörlose, das blinde und das schwachsinnige Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unserern eigenen Defekt." (Wygotski, zit. nach Jantzen 1980, 109)
Es stellt sich ja auch die Frage, was wir an gesellschaftlichen Prozessen aufgrund des Ausschlusses und der Nichtpartizipation von Menschen verlieren? Wir verlieren die Möglichkeit, an ihrer Perspektive teilzuhaben und damit an der Vielfalt menschlicher Sicht- und Ausdrucksweisen. (vgl. Alessi, Kap. 4.3 i.d.A.)
Interessanterweise ist bezüglich der Teilgabe seit den 90er Jahren ein neues Phänomen zu beobachten: Die Kunst beginnt sich für die Ausdrucksfähigkeit ‚(geistig) behinderter' Menschen zu interessieren. Inwieweit sich hier für Menschen ‚mit Behinderung' ein Feld auftut, in dem sie sich selbstbestimmt einbringen können und welche Wechselwirkungen dies möglicherweise sowohl auf ihr Selbstbild als auch auf die jeweiligen Kunstbereiche und die Enthinderung im sozialen Austausch hat - mit diesen Fragen möchte ich mich im Rahmen einer Dissertation auseinandersetzen.
Festhalten möchte ich hier jedoch, dass das Interesse der Kunst / Ästhetik als einem anderen Gesellschaftssystem und auch anderen Wissenschaftszweig auch eine neue Perspektive und eine andere Art der Auseinandersetzung zum Thema Behinderung eröffnet, als dies im Würgegriff der Definitionsmacht von Medizin und Sonderpädagogik (Verknüpfung von Behinderung mit individuellem Defizit) der Fall war. Wenn man Behinderung anders sieht, sieht man anderes.
Die Anerkennung, die ‚behinderte' Menschen als Kulturschaffende in den unterschiedlichen Kunstsparten erhalten, scheint auf eine veränderte Wahrnehmung von Behinderung hinzuweisen. Auf dass die Bilder in unseren Köpfen in Bewegung kommen.
Denn, bezogen auf die relationale Seite der Identitätsbildung (vgl. Kap. 1.1.1.3 sowie 1.2. i.d.A.): wir haben wenig bis keine Erfahrung damit, wie Menschen mit Behinderungserfahrungen sich entwickeln und entfalten, wenn sie nicht behindert werden durch unser einschlägiges Wissen und unsere Ängste, sondern ebenso freudig erwartet und herausgefordert werden vom Leben wie andere Menschen auch.
Da ich in der gesellschaftlichen Gruppenzuordnung (derzeit) den ‚Nichtbehinderten' zugeteilt bin, ist dies meine Sozialisation. Es ist mir bewusst, dass ich trotz Begegnungen und Austausch nicht weiß, wie es wirklich ist, mit Behinderungserfahrungen zu leben. Meine Sicht wird immer eine Außenperspektive sein und damit die Gefahr von Projektionen bergen. Ich hoffe aber, dass mir meine Reflexionsfähigkeit hilft, diese zu erkennen sowie die Sinne zu schärfen und wach zu werden für die ganz alltäglichen Diskrimminierungen und Behinderungen von Menschen, um diese aufzuzeigen.
ALESSI, Alito / Sara M. ZOLBROD (2007): Teacher Certification Course Manual. unveröffentlicht
ALTERNATIVGRUPPEN (1982): Forderungskatalog der Alternativgruppen von Behinderten und Nichtbehinderten Österreichs. http://bidok.uibk.ac.at/library/alternativgruppen-forderungskatalog.html Stand: 30.05.2005
BAUER, Joachim (2004): Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. München: Piper
BAUER, Joachim (2005): Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Hamburg: Hoffmann und Campe
BENJAMIN, Jessica (1996): Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. Frankfurt am Main: Fischer
BOURDIEU, Pierre (2001): Wie die Kultur zum Bauern kommt. Hamburg: VSA
BUBER, Martin (1992)6:Das dialogische Prinzip. Gerlingen: Schneider
BUBER, Martin (1995)8: Reden über Erziehung. Heidelberg: Schneider
DÖRFLER, Willibald / Josef MITTERER (Hg.)(1998):Ernst von Glasersfeld -Konstruktivismus statt Erkenntnistheorie. Klagenfurt: Drava
DÖRNER, Klaus (2003): Ein gelingendes Leben bedarf auch der Last. Interview. In: Die Zeit 06.03.2003 Nr. 11 http://images.zeit.de/text/2003/11/D_9arner-interview Stand: 14.12.2007
DÖRNER, Klaus (2007): De-Institutionalisierung im Lichte von Selbstbestimmung undSelbstüberlassung - Absichten, einsichten und Aussichten entlang der Sozialen Frage. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung: "Behinderung ohne Behinderte!? Perspektiven Der Disability Studies." ZeDiS, Universität Hamburg http://www.zedis.uni-hamburg.de Stand: 29.03.2008
ELBERT, Johannes (1982):Geistige Behinderung - Formierungsprozesse und Akte der Gegenwehr. http://bidok.uibk.ac.at/library/elbert-formierungsprozesse.htmlStand: 18.07.2005
FENZ, Werner (2004):Der Blick auf den eigenen Körper und die anderen Körper. In: E. Kraus / W. Temmel (Hg.): Sinnlos. Wider die Methoden der Behinderung. Wien: Springer
FOERSTER, Heinz von (1990): Ethik und Kybernetik zweiter Ordnung. Vortrag, gehalten auf dem Internationalen Kongress Systeme et therapie familiale in Paris am 4. Oktober 1990; aus dem Amerikanischen übersetzt von Birge Olrogge http://meta.influgs.hdk-berlin.de/metaflux/archive/hvf_ethik.htm Stand: 31.06.2005
FOERSTER, Heinz von (1992): Entdecken oder Erfinden. Wie lässt sich Verstehen Verstehen? In: H. Gumin / A. Mohler (Hg.): Einführung in den Konstruktivismus. München: Piper
FOUCAULT, Michel (1968): Psychologie und Geisteskrankheit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
GLASERSFELD, Ernst von (1987): Wissen, Sprache und Wirklichkeit. Braunschweig / Wiesbaden: Vieweg
GLASERSFELD, Ernst von (1992): Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität. In H. Gumin / A. Mohler (Hg.): Einführung in den Konstruktivismus.München: Piper
GLASERSFELD; Ernst von (1998): Konstruktivismus statt Erkenntnistheorie. In W.Dörfler/ J. Mitterer (Hg.): Ernst von Glasersfeld - Konstruktivismus statt Erkenntnistheorie. Klagenfurt: Drava
GLASERSFELD, Ernst von (2000)12: Einführung in den radikalen Konstruktivismus. In: P. Watzlawick (Hg.): Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper
GREINER, Ulrike(2003): Transformationen der Menschenbilder in der Integrationsbewegung. Vom imaginären Phantasma der Vollkommenheit zum Realendes Mangels: Eine Lacansche Lektüre. In: Behinderte. 4/5 2003
GREVING, Heinrich von / GRÖSCHKE Dieter (Hg.) (2000): Geistige Behinderung: Reflexionen zu einem Phantom: ein interdisziplinärer Diskurs um einenProblembegriff. Bad Heilbronn/Obb.: Klinkhardt
GROEF, Johan de (1997): Geistige Behinderung : ein dunkler Kontinent. In: E. Heinemann/ J. de Groef (Hg.) : Psychoanalyse und geistige Behinderung. Mainz: M.- Grünemald
GSTETTNER, Peter (1982): Die nicht stattgefundene ‚Begegnnung' oder: Zur fortgesetzten Abwertung von Abweichenden. http://bidok.uibk.ac.at/library/gstettner-begegnung.html Stand: 09.03.2006
GUMIN, Heinz / Armin, MOHLER (Hg.) (1992): Einführung in den Konstruktivismus. München: Piper
HACKENBERG Brigitte / Hartmann HINTERHUBER (1997): Kinder - und Jugendpsychiatrie. In: H. Hinterhuber/ W. Fleischhacker: Lehrbuch der Psychiatrie. Stuttgart: Thieme
HAHN, Martin Th. (1998): Vom Machen zum Ermöglichen: neue Wege der Heilpädagogik. In: O. Lutz / R. Haltiner (Hg.): Zu-Mutung statt Aus-Grenzung. Luzern: Ed. SZH/SPC
HÄHNER, Ulrich (1997): Überlegungen zur Entwicklung einer Kultur der Begleitung. In: U. Hähner, U. Niehoff, R. Sack, H. Walther: Vom Betreuer zum Begleiter. Hrsg. von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg: Lebenshilfe Verl.
HÄHNER U. / NIEHOFF U. / SACK R / WALTHER H.(1997): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Hrsg. von derBundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.Marburg: Lebenshilfe Verl.
HÄHNER, Ulrich (1997): Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung. In: U. Hähner, U. Niehoff, R. Sack, H. Walther: Vom Betreuer zum Begleiter. Hrsg. von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg: Lebenshilfe Verl.
HEINEMANN, Evelyn / Johan de GROEF (Hg.) (1997): Psychoanalyse und geistige Behinderung: Fallstudien aus Belgien, Deutschland, England Frankreich und den USA. Mainz: M.-Grünewald
HEJL, Peter M. (1992): Konstruktion der sozialen Konstruktion. Grundlinien einer konstruktivistischen Sozialtheorie. In: H. Gumin / A. Mohler (Hg.): Einführung in den Konstruktivismus. München: Piper
HINTERHUBER Hartmann / W.Wolfgang FLEISCHHACKER (1997):Lehrbuch der Psychiatrie. Stuttgart: Thieme
HINZ, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? In: Zeitschrift für Heilpädagogik 9/2002
HOFMÜLLER, Gertha/ Hannes, STEKL (1982): Ausschließung, Förderung, Integration.http://bidok.uibk.ac.at/library/hofmueller-ausschliessung.html Stand: 27.01.2006
HOHMEIER, Jürgen (1975): Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozess. http://bidok.uibk.ac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html Stand: 02.03.2005
HORWITZ, Carol (1998): Manifesting DanceAbility. Interview with Alito Alessi. Http://www.danceability.com/articles_interviews/manifesting_danceability.html Stand: 07.11.2007
HUSCHKE-RHEIN, Rolf (1998): Neue Schulen mit kleineren pädagogischen Lasten. In: R. Voß (Hg.): Schulvisionen: Theorie und Praxis systemisch-konstruktivistischer Pädagogik. Heidelberg: Auer
HUSCHKE-RHEIN, Rolf (2000): Entwicklung als Aufgabe ökosystemischer Selbststeuerung. In: H.v.Lüpke / R. Voß (Hg.): Entwicklung im Netzwerk. Neuwied; Kriftel: Luchterhand
INITIATIVGRUPPE von Behinderten und Nichtbehinderten, Innsbruck (1982): Befreiungsversuche und Selbstorganisation. http://bidok.uibk.ac.at/library/initiativgruppe-befreiungsversuche.html Stand: 27.07.2005
JACOBI, Jolande (1978): Die Psychologie von C.G. Jung. Eine Einführung in das Gesamtwerk. Frankfurt am Main: Fischer
JANTZEN, Wolfgang (1980): Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medizin, Psychologie und Sonderpädagogik. Bern: Huber
JANTZEN, Wolfgang (1998): Enthospitalisierung und institutioneller Kontext: Einrichtungen für Behinderte in der modernen Gesellschaft. In: O. Lutz / R. Haltiner (Hg.): Zu-Mutung statt Aus-Grenzung. Luzern: Ed. SZH/SPC
JANTZEN, Wolfgang (Hg.) (2001)a: Jeder Mensch kann lernen: Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Berlin: Luchterhand
JANTZEN, Wolfgang (2001)a: Vygotskij und das Problem der elementaren Einheit der psychischen Prozesse. In ders. (Hg.): Jeder Mensch kann lernen:Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Berlin: Luchterhand
JANTZEN, Wolfgang (2001)b: Nelly - oder die freie Entwicklung eines jeden. In: Geistige Behinderung. 4/2001
KLEE, Ernst (1980): Behindert. Über die Enteignung von Körper und Bewusstsein. http://bidok.uibk.ac.at/library/klee-behindert.html Stand: 29.03.2006
KÖBLER R. / NIEDERMAYER Ch. / PFRETSCHNER K. / PITTL D. / GENSLUCKNER L. (2003): Ich sehe mich NICHT als behindert. Studie über die Lebensbedingungen von Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Hg. von Verein Tafie. Innsbruck: Athesia
KRAUS, Evelyn / TEMMEL, Wolfgang (2004): Sinnlos. Wider die Methoden der Behinderung. Wien: Springer
KURT, Süleyman (2007): Dialog mit mir. Das Recht auf Intimität. Norderstedt: Books on Demand
LAING, Ronald D. (1981)11:Phänomenologie der Erfahrung. Frankfurt/a.M.: Suhrkamp
LENZEN, Dieter (Hg.) (1989): Pädagogische Grundbegriffe. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt
LINDEMANN, Holger / VOSSLER, Nicole (1999): Die Behinderung liegt im Auge des Betrachters. Neuwied, Kriftel: Luchterhand
LUTZ, Olivia / Ruedi HALTINER (Hg.) (1998): Zu-Mutung statt Aus-Grenzung: Tragfähige Lebensräume für Menschen mit geistiger Behinderung. Luzern: Ed. SZH/SPC
LÜPKE, Hans von / VOSS, Reinhard (Hg.) (2000)3:Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. Neuwied; Kriftel: Luchterhand^
MALARKEY, Jenni (2003): Interview of Alito Alessi by Jenni Malarkey. http://www.danceability.com/articles_interviews/feb_03_inter.html Stand: 07.11.2007
MANN, Iris (1999): Lernen können ja alle Leute. Weinheim/Basel: Beltz
MATT, Hubert (2004): Versuch über Mangel und spezifischen Mangel. In: E. Kraus / W. Temmel (Hg.): Sinnlos. Wider die Methoden der Behinderung. Wien: Springer
MATURANA, Humberto R. / Francisco J. VARELA (1987)11: Der Baum der Erkenntnis. Die Biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. München: Goldmann
MATURANA, Humberto R. / Bernhard PÖRKSEN (2002): Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens. Heidelberg: Auer McCOWAN, Karen (1999): When Dance Defies Barriers. http://www.danceability.com/articles_interviews/register_guard_art.html Stand: 07.11.2007
MÜRNER, Christian (2000): Erscheinungsbild und Dominanz. Historisch-kritische Betrachtungen zum Ansehen geistig behinderter Menschen. In: H.v. Greving/ D. Gröschke (Hg.): Geistige Behinderung: Reflexionen zu einem Phantom. Bad Heilbronn/Obb.: Klinkhardt
NIEDECKEN, Dietmut (1997): Namenlos. http://bidok.uibk.ac.at/library/niedecken-namenlos.html Stand: 24.01.2006
NIEDECKEN, Dietmut (1998)3 : Namenlos. Geistig Behinderte verstehen. Berlin: Luchterhand
NIEHOFF, Ulrich (1997):Einführende Überlegungen zum Handeln der Begleiter. In: U. Hähner, U. Niehoff, R. Sack, H. Walther: Vom Betreuer zum Begleiter. Hrsg. von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg: Lebenshilfe Verl.
POHL, Annet (1999): Frausein mit Behinderung. Identität und postmoderne Denkfiguren. Butzbach/Griedel:Afra
PÖRKSEN, Bernhard (2002): Die Gewissheit der Ungewissheit. Gespräche zum Konstruktivismus. Heidelberg: Auer
RADTKE, Peter (1994): Warum unsere Gesellschaft behinderte Menschen braucht. http://www.peter-radtke.de/sammel.htm Stand: 14.12. 2007
REICH, Kersten (2005): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik. Weinheim und Basel: Beltz
ROMMELSPACHER, Birgit (1995): Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit und Macht. Berlin: Orlanda
ROSENHAN, David L. (2000)12Gesund in kranker Umgebung. In: P.Watzlawick (Hg.): Die erfundene Wirklichkeit. München:Piper
SAAL, Fredi (1998): Bedeutung und Würde aus eigenem Recht.http://bidok.uibk.ac.at/library/beh6-98-behindertsein.html Stand: 28.2.2005
SANER, Hans (1998):Zur Integration der Behinderten. In: O. Lutz / R. Haltiner (Hg.): Zu-Mutung statt Aus-Grenzung. Luzern: Ed. SZH/SPC
SACK, Rudi (1997): Normalisierung der Beziehungen. Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Begleiter. In: U. Hähner, U. Niehoff, R. Sack, H. Walther: Vom Betreuer zum Begleiter. Hrsg. von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.Marburg: Lebenshilfe Verl.
SCHÖNWIESE, Volker (1995)a: Behinderung - Rehabilitation - Integration.http://bidok,uibk.ac.at/library/schoenwiese-rehabilitation.html Stand: 22.08.2005
SCHÖNWIESE, Volker (1995)b: Diktat der Funktionalität. http://bidok.uibk.ac.at/library/haidlmayr-enthinderung.html Stand: 22.08.2005
SCHÖNWIESE, Volker (2003): Grundlagen integrativer Pädagogik. Skriptum zur Lehrveranstaltung. Sommersemester 2003
SCHWENK, Bernhard (1989): Erziehung. In: D. Lenzen (Hg.): Pädagogische Grundbegriffe. Reinbek b. Hamburg: Rohwolt
SIEBERT, Horst (1998): Ein konstruktivistisches "Reframing" der Pädagogik? In: R. Voß (Hg.): SchulVisionen: Theorie und Praxis systemisch-konstruktivistischer Pädagogik. Heidelberg: Auer
SINASON, Valerie (2000): Geistige Behinderung und die Grundlagen menschlichen Seins. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand
STEINGRUBER, Alfred (2000): Der Behindertenbegriff im österreichischen Recht. http://bidok.uibk.ac.at/library/steingruber-recht.html Stand: 31.5.2005
TERVOOREN Anja (2002): Den Diskurs anreizen.http://bidok.uibk.ac.at/library/tervooren-differenz.html Stand: 13.10.2005
VOSS, Reinhard (Hg.) (1998): SchulVisionen: Theorie und Praxis systemisch-konstruktivistischer Pädagogik. Heidelberg: Auer
VOSS, Reinhard (1998): Mit fremden Blicken zu eigenen Visionen. In: ders. (Hg.): Schulvisionen: Theorie und Praxis systemisch-konstruktivistischer Pädagogik. Heidelberg: Auer
VYGOTSKIJ, Lev S. (2001): Zur Frage kompensatorischer Prozesse. In: W. Jantzen (Hg.): Jeder Mensch kann lernen:Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Berlin: Luchterhand
WAGNER, Michael (2000)2: Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Lebenswelten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
WATZLAWICK, Paul (1992): Wirklichkeitsanpassung oder angepaßte ‚Wirklichkeit'? Konstruktivismus und Psychotherapie. In: H. Gumin/ A. Mohler (Hg.): Einführung in den Konstruktivismus. München: Piper
WATZLAWICK, Paul (Hg.) (2000)12: Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. München: Piper
WOLTMANN-ZINGSHEIM, Bernd (1998): Unterrichten: Irritation als Plan - Drei Konsequenzen und ein Haken. In: R. Voß (Hg.): Schulvisionen: Theorie und Praxis systemisch-konstruktivistischer Pädagogik. Heidelberg: Auer
ZIEMEN, Kerstin (2002): Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz. Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder. Butzbach-Griedel: Afra
Weitere Quellen:
-
"Hirnforschung". Michael Kerbler im Gespräch mit dem Neurophysiologen Wolf Singer, Direktor des Max Planck Instituts in Frankfurt.
Ö1 Rundfunk Sendung: "Im Gespräch" 27.10.2005 http://oe1.orf.at
-
"Heinz von Foerster". Eine Sendung von Franz Zeller zum 2. Internationalen Heinz von Foerster - Kongress vom 11. - 13. 11. 2004 in Wien
Ö1 Rundfunk Sendung: "Dimensionen" 15.11.2005 http://oe1.orf.at
-
"Was Einstein heute fordern würde." Leitbilder verantwortlicher Wissenschaft. Eine Sendung zur Potsdamer Erklärung internationaler Wissenschaftler von Geseko von Lüpke.
Ö1 Rundfunk Sendung: "Dimensionen" 16.11.2005 http://oe1.orf.at
Quelle:
Maria King: Behinderte Wirklichkeit? Behinderung als soziale Konstruktion
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie am Institut für Erziehungswissenschaften der bildungswissenschaftlichen Fakultät der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck. Eingereicht bei: A. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese. Innsbruck, April 2008
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 19.05.2008
