erschienen in: Beltz GmbH, Julius, ISBN: 3-407-56162-8
Inhaltsverzeichnis
-
1. Ambulantes Arbeitstraining, Integrationspraktikum und das System der beruflichen Rehabilitation
- 1.1 Das System der beruflichen Rehabilitation
- 1.2 Paradigmenwechsel in Behindertenhilfe und -politik
- 1.3 Supported Employment - Unterstützte Beschäftigung
- 1.4 Arbeit, Krise der Arbeit und Umbruchssituation in der Landschaft der beruflichen Rehabilitation
- 1.5 Lokalisierung des Ambulanten Arbeitstrainings und Integrationspraktikums
- 1.6 Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz
- 2. Anlage der Evaluation
- 3.Befragung der TeilnehmerInnen
-
4. Intensivbefragung zur Situation von TeilnehmerInnen
- 4.1 Anliegen und Fragestellung
- 4.2 Methodische Überlegungen
- 4.3 Stichprobe
-
4.4 Ergebnisse
- 4.4.1 Frau A: »Das macht voll Bock!«
- 4.4.2 Herr B: »Ich muss das alles besser in Griff kriegen«
- 4.4.3 Frau C: »Dass ich jetzt in dem Call-Center sitze, das finde ich richtig gut«
- 4.4.4 Herr D: »Ich bin auch bereit, meinen Traum so in Wirklichkeit umzusetzen«
- 4.4.5 Herr E: »Wie mich jemand reingeschoben hat - hab' ich richtig Horror gehabt«
- 4.4.6 Frau F: »Also eigentlich allgemein bin ich ja zufrieden ... und irgendwann werd' ich auch versuchen, hier rauszugehen«
- 4.4.7 Herr G: »Ich weiß gar nicht, was ich will - entweder ich bleib' in der Töpferei oder ich werd' draußen arbeiten«
- 4.4.8 Herr H: »Ich hab' mir eigentlich was anderes gewünscht«
- 4.4.9 Frau I: »Ich bin an der richtigen Stelle eigentlich«
- 4.4.10 Frau J: »Letztendlich bin ich nicht unzufrieden, aber ... wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, dann würde ich auch gern was anderes machen, und auch gern außerhalb der Werkstatt«
- 4.5 Zusammenfassende Bemerkungen
-
5. Befragung der AssistentInnen und GruppenleiterInnen
- 5.1 Anliegen und Fragestellung
- 5.2 Stichprobe und methodische Überlegungen
-
5.3 Ergebnisse
- 5.3.1 Konzept und Praxis der Maßnahmen
- 5.3.2 Eigene Tätigkeit und Rolle
- 5.3.3 Personenkreis der BewerberInnen
- 5.3.4 Einbindung in Kooperationsstrukturen
- 5.3.5 Vermutete Sichtweisen von ArbeitgeberInnen und die Situation in den Betrieben
- 5.3.6 Berufsberatung durch das Arbeitsamt
- 5.3.7 Berufsschulunterricht
- 5.3.8 Perspektiven
- 5.3.9 Resümees
- 5.4 Zusammenfassung
-
6. Befragung von Vorgesetzten in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes
- 6.1 Anliegen und Fragestellung
- 6.2 Methodische Überlegungen und Stichprobenbildung
-
6.3 Ergebnisse
- 6.3.1 Chefin A: »Ich habe in der Anfangsphase auch jeden Tag gemerkt, wie wir lernen, sensibler zu werden«
- 6.3.2 Chef B: »Ich tue es eigentlich gerne, auch wenn ich deswegen Schwierigkeiten habe«
- 6.3.3 Chefin C: »Für mich ist es ein schönes Gefühl, sie ist hier, und ich weiß, dass es auch anderen so geht - und das ist es halt«
- 6.3.4 Chef D: »Er ist ein fester Bestandteil durch das, was er kann«
- 6.3.5 Chef E: »Das sehe ich auch als wirkliche Hilfe an, nicht nur als kleine soziale Gefälligkeit, sondern als echte Hilfe für uns«
- 6.3.6 Chefin F: »Sie ist so mit im Team integriert, das macht keinen Unterschied«
- 6.3.7 Chefs G: »Der eine hat vielleicht geistig nicht so viel drauf, aber bringt tolle Arbeit, und den kann man besser integrieren als jemanden, der vielleicht viel mehr drauf hat, aber nichts leistet«
- 6.4 Zusammenfassung
- 7. Befragung der Reha-BeraterInnen des Arbeitsamtes
-
8. Befragung der BerufsschullehrerInnen
- 8.1 Anliegen und Fragestellung
- 8.2 Methodische Überlegungen
-
8.3 Ergebnisse
- 8.3.1 Zugänge zur Tätigkeit
- 8.3.2 Konzeptmerkmale und Profile des Berufsschultages und Passung mit dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings
- 8.3.3 Kooperationsbeziehungen
- 8.3.4 Blick auf die SchülerInnen und Effekte von Unterricht und Arbeitstraining
- 8.3.5 Kritische Stellungnahmen und Würdigungen
- 8.3.6 Zusammenfassung
-
9. Gesamtbetrachtung der Untersuchungsergebnisse
-
9.1 Wesentliche Ergebnisse
- 9.1.1 Langfristige Orientierungen der TeilnehmerInnen und ihres Umfeldes
- 9.1.2 Prozesse in Arbeitstraining und Integrationspraktikum und Effekte
- 9.1.3 Rolle und Arbeitssituation von ArbeitsassistentInnen und GruppenleiterInnen
- 9.1.4 Erfolgsfaktoren und Erfolgshemmnisse
- 9.1.5 Berufsberatung aus der Perspektive des Ambulanten Arbeitstrainings
- 9.1.6 Berufsschulunterricht aus der Perspektive des Ambulanten Arbeitstrainings
- 9.1.7 Individualorientierung versus Gruppenorientierung
- 9.1.8 Entwicklungslogik versus Zuweisungslogik
- 9.2 Positionen zum Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum
- 9.3 Diskussion unter theoretischen Perspektiven
- 9.4 Handlungsbedarfe und offene Fragen
- 9.5 Schluss
-
9.1 Wesentliche Ergebnisse
- Literatur
- 11. Anhang I
- 12. Anhang II
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Das System der beruflichen Rehabilitation
- 1.2 Paradigmenwechsel in Behindertenhilfe und -politik
- 1.3 Supported Employment - Unterstützte Beschäftigung
- 1.4 Arbeit, Krise der Arbeit und Umbruchssituation in der Landschaft der beruflichen Rehabilitation
- 1.5 Lokalisierung des Ambulanten Arbeitstrainings und Integrationspraktikums
- 1.6 Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz
Im einleitenden Kapitel dieser Untersuchung wird zunächst dargestellt, innerhalb welchen Systems mit welchem Aufbau sich die beiden zu evaluierenden Maßnahmen befinden. Dabei ist von hoher Bedeutung, dass sich in den letzten Jahren in diesem Feld beachtliche Veränderungen ereignet haben; nicht zuletzt durch neue Projekte zur beruflichen Integration mit einer veränderten Sichtweise und einem unterschiedlichen Vorgehen in Relation zum Bisherigen haben offensichtlich neue Möglichkeiten geschaffen. Dies hat sich innerhalb von nur zehn Jahren bis in die gesetzliche Ebene hinein ausgewirkt und ist etwa an der Neufassung des Schwerbehindertengesetzes vom Jahr 2000 abzulesen (vgl. ARBEITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN 2000).
Mit diesen Veränderungen zeigt sich nun auch im System der beruflichen Rehabilitation eine grundlegende Umbruchssituation, wie sie schon seit längerer Zeit im Bereich von Frühförderung, Schule und Wohnen zu sehen ist. Zurückgeführt werden kann sie auf einen - seit langem diskutierten - Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe (vgl. hierzu u.a. GRUBMÜL-LER, HINZ, LOEKEN & MOSER 1999, ALBRECHT, HINZ & MOSER 2000). Eine besondere Bedeutung hat dabei für den Bereich der Arbeit der Ansatz der Unterstützten Beschäftigung, der als ›Supported Employment‹ in Nordamerika schon seit längerer Zeit praktiziert wird (vgl. PERABO 1993, BARLSEN & BUNGART 1995, SCHARTMANN 1995b, DOOSE 1997b, FEHRE 1997, JUNKER 1997).
Im folgenden wird daher zunächst in das System der beruflichen Rehabilitation eingeführt, im zweiten Schritt auf den Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe eingegangen, zum dritten der Ansatz von Supported Employment als wesentlichem Anstoß im Bereich der Beschäftigung nachgezeichnet, viertens die Umbruchssituation in der Landschaft der beruflichen Rehabilitation umrissen, fünftens der Lokalisierung der beiden Maßnahmen nachgegangen, die in der vorliegenden Studie evaluiert werden, und schließlich sechstens die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz skizziert.
Berufliche Rehabilitation ist Teil des umfassenden Systems der Rehabilitation, das Prozesse der Wiederherstellung körperlichen und seelischen Wohlbefindens und weitestgehender sozialer Reintegration zum Ziel hat. Dabei stehen personale und soziale Anteile gleichwertig nebeneinander: Ein »Leben nach ihren Neigungen und Fähigkeiten gestalten« (BMA 2000, 17) zu können, ist ebenso wichtig wie das Ziel der »vollen sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben« (ebd.). Innerhalb dieses Gesamtprozesses wird zwischen medizinischen, beruflichen, schulischen und sozialen Anteilen unterschieden (vgl. CLOERKES 1997, 34).
Das System der Rehabilitation stellt vielfältige Hilfen und Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen bereit. Dabei handelt es sich entsprechend den juristischen Festlegungen der Bundesanstalt für Arbeit (BA) bei »Behinderten im Sinne der A Reha (Anordnung Reha der BA, § 2; d. Verf.) um körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, deren Aussichten, beruflich eingegliedert zu werden oder zu bleiben, infolge der Behinderung nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind, und die deshalb besonderer Hilfe bedürfen. Gleichgestellt sind Menschen, denen eine Behinderung mit den genannten Folgen droht« (BA 1997, 43). Als benachteiligt gelten ausländische Auszubildende, lernbeeinträchtigte deutsche Auszubildende, sozial benachteiligte deutsche Auszubildende, junge Spätaussiedler mit Sprachschwierigkeiten und im Ausnahmefall auch weitere Personen, »wenn sich eine soziale Benachteiligung stichhaltig begründen lässt« (BA 1997, 79).
Die Maßnahmen und Hilfen für Menschen mit Behinderungen werden im folgenden den administrativen Regelungen und Begrifflichkeiten entsprechend überblickartig dargestellt (vgl. BA 1997 sowie FORSTER 1998, Kap. 4). Damit wird das Nachvollziehen der Wege der TeilnehmerInnen am Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum erleichtert.
Menschen mit Behinderungen stehen im Prinzip alle Ausbildungs-, Umschulungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten offen. Um ein Ausbildungsverhältnis einzugehen, ist jedoch in der Regel ein anerkannter Schulabschluss notwendig (Haupt- oder Realschulabschluss, z.T. auch fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife). Da die Abschlüsse der Schulen für Lern- und Geistigbehinderte keine anerkannten Schulabschlüsse sind, erfüllen ihre AbgängerInnen diese Zugangsvoraussetzung nicht. Spezielle berufsvorbereitende Maßnahmen sollen daher Jugendlichen mit Behinderungen den Einstieg in berufliche Bildung und Beschäftigung er-leichtern; dabei wird zwischen der schulischen Berufsvorbereitung und den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen unterschieden.
Zur schulischen Berufsvorbereitung gehören das überwiegend an Berufsschulen angebotene Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), die sich jedoch in den Bundesländern in ihren Regelungen, Bezeichnungen und Formen unterscheiden. Zielgruppen sind in der Regel SchülerInnen ohne Hauptschulabschluss oder AbgängerInnen der Förderschule. Darüber hinaus gibt es auch schulische Vollzeitlehrgänge im elften und zwölften Schuljahr nach Ablauf der Pflichtschulzeit (vgl. BA 1997, 108, 119 sowie GINNOLD 2000, 139).
Als berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen werden verschiedene Möglichkeiten angeboten:
-
Förderlehrgang (F): Der F-Lehrgang dient der intensiven Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf. Er ist in verschiedene Formen ausgestaltet, um dem differenzierten Förderbedarf des Personenkreises Rechnung zu tragen, auch in zeitlicher Hinsicht:
-F1 für Menschen mit Behinderung, für die eine Berufsausbildung in Betracht kommt, die jedoch wegen ihrer in einer nicht nur vorübergehenden Behinderung begründeten Lernerschwernis einer besonderen Förderung bedürfen (bis 12 Monate),
-F2 für Menschen mit Behinderung, die aufgrund deren Art und Schwere für eine Berufsausbildung nicht in Betracht kommen (bis 24 Monate),
-F3 für Menschen mit Behinderung, die durch die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unterfordert wären (bis 36 Monate) und
-F4: für Menschen mit Behinderung, die wegen ihrer medizinischen Rehabilitation nicht mehr wettbewerbsfähig sind (bis 6 Monate) (vgl. BA 1997, 168)
-
Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE)
-
tip-Lehrgang (testen, informieren, probieren)
-
Grundausbildungslehrgang (G)
-
Maßnahmen im Eignungsverfahren und Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte; dabei wird der Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte seitens der Berufsberatung denjenigen angeboten, »die wegen Art und Schwere einer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können.« Dies betrifft in der Regel vor allem Menschen mit geistiger, psychischer oder umfänglicher Lernbehinderung. Das Ziel ist dabei, nach dem Durchlaufen eines Grund- und Aufbaukurses von insgesamt maximal zwei Jahren Dauer eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt für Behinderte oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen (vgl. BAG UB 1999, 56).
-
Blindentechnische und vergleichbare Grundausbildung
Für die Berufsvorbereitung junger Erwachsener mit Behinderung stehen meist nur die F2- und F3-Lehrgänge und der Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte offen (vgl. auch GINNOLD 2000, 118). Berufliche Trainingszentren (BTZ) bieten darüber hinaus Berufsvorbereitungsmaßnahmen für Menschen mit psychischen Behinderungen an (vgl. ebd.).
Für Berufsausbildung und Umschulung stehen Menschen mit Behinderungen unter-schiedliche Wege offen:
-
betriebliche Berufsausbildung im dualen System;
-
Berufsausbildung für SchulabgängerInnen in Berufsbildungswerken (BBW); Zielgruppe sind Jugendliche mit Lernbehinderungen, aber auch körperlichen, neurologischen, sensorischen oder psychischen Behinderungen, die in dieser Ausbildungsstätte eine Erstausbildung in unterschiedlichen Berufsbereichen absolvieren;
-
Fortbildung und Umschulung in Berufsförderungswerken (BFW); dies sind Einrichtungen zur beruflichen Wiedereingliederung, also für Menschen mit Behinderungen, die aufgrund des Eintritts einer Behinderung bzw. einer zunehmenden Einschränkung durch eine Behinderung nicht mehr in der Lage sind, den erlernten Beruf auszuüben; in begründeten Einzelfällen kann auch eine berufliche Erstausbildung in einem BFW bewilligt werden;
-
Berufsausbildung in anderen überbetrieblichen Einrichtungen (BüE); die Zielgruppe sind benachteiligte Auszubildende, der die Aufnahme einer Berufsausbildung im Sinne des dualen Systems und deren Fortsetzung in einem Ausbildungsbetrieb ermöglicht werden soll;
-
Berufsausbildung an Berufsschulen, z.B. für Pflege- und Erziehungsberufe (vgl. BA 1997, 82, 85, 90, 100, 105 sowie BAG UB 1999, 57-59).
An die Berufsvorbereitung und Berufsausbildung soll sich möglichst die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anschließen. Die staatliche Gesetzgebung hält eine Vielzahl von Eingliederungshilfen bereit, die dies erleichtern sollen. Grundsätzlich sind die folgenden Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu unterscheiden: Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Beschäftigung in Integrationsfirmen oder Integrationsabteilungen, Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte und Betreuung in Tagesförderstätten.
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
Mit der Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stehen den Menschen mit Behinderungen verschiedene Eingliederungshilfen zur Verfügung. Zunächst einmal sind dies finanzielle Hilfen (vgl. GINNOLD 2000, 126f.): Zuschüsse an ArbeitgeberInnen für Probebeschäftigungen von Menschen mit Behinderungen, auf maximal drei Jahre befristete Lohnkostenzuschüsse, Übernahme der Kosten für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze und Finanzierung von Maßnahmen zur Fortbildung und Umschulung (vgl. BMA 2000).
Die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt wird von Integrationsfachdiensten vorbereitet und begleitet (vgl. Kap. 1.4). Diese Dienste unterscheiden sich in ihrer Ausstattung und Arbeitsweise (Personalschlüssel und Dauer der Begleitung), in ihrer Einbindung in das regionale Rehabilitationssystem und in der Qualifikation der MitarbeiterInnen. Auch ihre Zielgruppen sind mitunter sehr verschieden; während einige Dienste sich auf einzelne Formen von Behinderungen konzentrieren (müssen), stehen andere für alle Menschen mit Behinderungen offen.
Beschäftigung in Integrationsfirmen und Integrationsabteilungen
Als Integrationsfirmen werden Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes bezeichnet, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten, »wobei der Anteil der Menschen mit Behinderung je nach Branche und Größe des Betriebes zwischen 40 und 80 Prozent liegt« (GINNOLD 2000, 129). Neben der Bezeichnung ›Integrationsfirmen‹ werden auch die Begriffe ›integrative Zweckbetriebe‹, ›Selbsthilfefirmen‹ oder ›soziale Betriebe‹ (vgl. CHRISTE 1997) verwandt. Ziel ist es, durch den Absatz von Dienstleistungen und Produkten unter Einbeziehung von zur Verfügung gestellten Zuschüssen wirtschaftlich zu arbeiten. Im Vordergrund steht dabei nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit und ohne Behinderung. Häufig halten diese Betriebe spezifische »Angebote in Marktnischen« (HINZ & LÜTTENSEE 1997, 2) bereit. Üblicherweise werden reguläre Arbeitsverhältnisse unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eingegangen, es gibt eine ortsübliche Tarifentlohnung und es bestehen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Integrationsfirmen sind seit den 70er Jahren als Folge der Psychiatriereform zu-erst vor allem für Menschen mit psychischen Behinderungen gegründet worden und später auch auf andere Personenkreise ausgeweitet worden (vgl. GRAUMANN 1998). Ein bekanntes Beispiel für einen Integrationsbetrieb ist das rollstuhlgerechte ›Stadthaus-Hotel‹ in Hamburg, das von einer Elterninitiative 1993 gegründet wurde und Arbeitsplätze für Menschen mit (geistiger) Behinderung bietet (vgl. BOBAN & HINZ 1995, BOBAN, HINZ, LÜTTENSEE & POKO-JEWSKI 1997) und seit 2000 im Rahmen eines größeren Trägers auch ein Café gemeinsam mit suchtkranken Menschen betreibt.
Weitere Arbeitsformen im Bereich der Integrationsfirmen stellen Zuverdienstarbeitsplätze, also Arbeitsangebot im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung oder Teilzeitarbeit, und gemeinnützige Leiharbeit dar, deren Intention es ist, Hemmschwellen für ArbeitgeberInnen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen zu senken, indem sie das ›Risiko‹ bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit, Krankheiten etc. übernehmen. Ziel ist dabei die Übernahme in eine Daueranstellung.
Von den Integrationsfirmen sind die Integrationsabteilungen zu unterscheiden. Bei ihnen handelt es sich um geschützte Abteilungen in Betrieben, »in denen Menschen mit Behinderungen unter besonderer Anleitung im Rahmen regulärer Arbeitsverhältnisse arbeiten« (BAG UB 1999, 62). In der DDR stellten Integrationsabteilungen eine weit verbreitete Form von ›geschützter Arbeit‹ dar, nach dem Beitritt zur Bundesrepublik wird ein Großteil dieser Abteilungen geschlossen, im Gegenzug dazu werden die Werkstätten für Behinderte in großem Maße ausgebaut. Nach Angabe des BMA gibt es im Jahre 1996 in Deutschland lediglich 25 solcher Integrationsabteilungen (vgl. ebd.).
Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte
Für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr oder noch nicht eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben können, ist die berufliche Rehabilitation in einer Werkstatt für Behinderte vorgesehen. Dabei müssen die behinderten MitarbeiterInnen »gemeinschaftsfähig,« und sie dürfen »nicht außerordentlich pflegebedürftig« sein (SEYL 1996, 538). Zunächst wird ein bis zu zwei Jahre dauernder Förderungsprozess, der Arbeitstrainingsbereich, durchlaufen mit dem Ziel, »ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich der Werkstatt zu erbringen« (BMA 1998, 76f.). Der Arbeitstrainingsbereich soll darüber hinaus berufliche Bildung vermitteln. Die MitarbeiterInnen haben einen Rechtsanspruch auf »Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes am Arbeitsleben, insbesondere in einer anerkannten Werkstatt für Behinderte« (BSHG §40, 41) mit der entsprechenden Betreuung und Begleitung durch qualifiziertes Personal. Die Werkstatt für Behinderte muss, da sie nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert ist und ein unter-nehmerisches Profil aufweist, wirtschaftliche Arbeitsergebnisse erzielen. Ihre Wirtschaftlichkeit ist Voraussetzung, um den »behinderten Beschäftigten im Arbeitsbereich ein ihren Leistungsvoraussetzungen möglichst angemessenes Entgelt zahlen zu können« (BA 1997, 411). Dabei stützen sich die Werkstätten für Behinderte auf drei ökonomische Standbeine: Auftragsarbeiten, Eigenproduktionen und Dienstleistungen. Ihre typischen Arbeitsfelder liegen in den Bereichen Verpackung, Montage, Versand, Druck, Holzverarbeitung, aber auch Garten- und Landschaftspflege sowie Küchenservice und Wäscherei (vgl. ebd.).
Für die behinderten Beschäftigten in der Werkstatt für Behinderte werden Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, nicht jedoch Arbeitslosenversicherung, da davon ausgegangen wird, dass sie nicht arbeitslos werden können. Sie haben keinen Arbeitnehmerstatus, seit 1996 befinden sie sich in einem »arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis« (SchwbG § 54b). Gesetzliche Aufgabe der Werkstatt für Behinderte ist es, behinderte oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen für einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten (SchwbG § 52) und dorthin zu vermitteln (SchwbG § 54). Damit ist das Ziel der Werkstatt für Behinderte, »Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben einzugliedern, ihnen die Möglichkeiten zu bieten, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen« (BA 1997, 408). Die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kann auch durch die Einrichtung ausgelagerter Arbeitsplätze vorbereitet werden. So wird als Erfolg angesehen, dass im Jahr 1994 »mehr als 2.300 Werkstattbeschäftigte auf Außenarbeitsplätze vermittelt werden konnten, auf Arbeitsplätze also, die die Erwerbswirtschaft den Werkstätten zeitweise zur Verfügung stellt« (ANDERS 1996, 558). Einigen Werkstätten sind Vermittlungsdienste angegliedert, die die behinderten MitarbeiterInnen bei der Suche nach einem regulären, tarifentlohnten Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt für Behinderte durch eine entsprechende Fachkraft unterstützen (vgl. KRATZER-MÜLLER 1997, perspektivisch auch HANNEMANN 2001).
Betreuung in Tagesförderstätten
In Tagesförderstätten werden Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen betreut, die nicht im Arbeitsbereich einer Werkstatt für Behinderte beschäftigt werden: »Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein außerordentlicher Pflegebedarf besteht und ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann. Vielfach sind die Förderstätten der WfB angegliedert« (BA 1997, 382). Tagesförderstätten haben vor allem die soziale Integration von Menschen mit Behinderungen als Aufgabe, sie bieten eine feste Tagesstruktur im Sinne des Normalisierungsprinzips. Menschen, die in Tagesförderstätten betreut werden, haben keinen Anspruch auf Arbeitsentgeld, sie besitzen auch keinen arbeitnehmerähnlichen Status und sind somit auch nicht in das System der Sozialversicherung einbezogen. Nach Möglichkeit sollen sie auf eine Beschäftigung in der Werkstatt für Behinderte, z.B. eine Maßnahme im Arbeitstrainingsbereich, vorbereitet werden. Die Angliederung an die Werkstatt für Behinderte soll diese Möglichkeiten erleichtern.
Die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen ist entsprechend dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMA) Ausgangspunkt für die gesellschaftliche Integration, da die Arbeit Menschen mit Behinderungen ermöglicht, »entsprechend ihrer Fähigkeiten zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen« (BMA 1998, 74). Dennoch hat sich, wie von mancher Seite kritisiert wird, das System der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Beschäftigungssystems zu einem eigenständigen, abgegrenzten Bereich entwickelt. Ausgehend vom Prinzip ›erst qualifizieren, dann platzieren‹ findet die Ausbildung von Menschen mit Behinderungen, so diese Kritik, zumeist in speziellen Institutionen, wie Berufsbildungswerken, Berufsförderungswerken oder Werkstätten für Behinderte, getrennt vom realen Arbeitsleben statt. Von diesen verschiedenen besonderen Institutionen aus sind zwar prinzipiell Möglichkeiten zur Integration vorgesehen (vgl. ZINK & DIERY 1996) und es gibt vielfältige Bemühungen um integrative Anschlüsse (vgl. ELLGER-RÜTTGART & BLUMENTHAL 1997), jedoch in der Realität mit eher zweifelhaftem Erfolg. Zudem wird an den Arbeitsfeldern, die z.B. von Werkstätten für Behinderte angeboten werden, kritisiert, dass sie auf einige wenige ›behinderungsspezifische‹ Bereiche beschränkt sind und in der überwiegenden Zahl einseitige und wenig komplexe Arbeitstätigkeiten, z.B. Montage-, Verpackungs-, Tischler- und Näharbeiten bieten. Diese standardisierten Beschäftigungsmöglichkeiten erscheinen KritikerInnen jedoch kaum geeignet, die Lern- und Entwicklungsfähigkeiten der dort arbeitenden Menschen anzuregen und zu fördern, geschweige denn, sie auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten (vgl. TROST & SCHÜLLER 1992, 46).
Zudem wird kritisch gesehen, dass der Lohn, den die Beschäftigten in der Werkstatt für Behinderte erhalten, sehr gering ist, denn er entspricht »eher einem Taschengeld als einem Beitrag zur Sicherung der Existenzgrundlage« (JACOBS 1988, 193). Für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung führt der Weg der beruflichen Rehabilitation fast alternativlos in die Werkstatt für Behinderte: »Ganz gleichgültig, welche individuellen Eigenheiten und Entfaltungsmöglichkeiten eine Persönlichkeitsstruktur mit besonderen Lebenserschwernissen hat, wirkt die institutionelle Zwangsläufigkeit und trägt gleichzeitig die Rehabilitationslogik in sich: Schülerschaft auf der Schule für Geistigbehinderte zieht Mitarbeiterschaft in der WfB nach sich« (ebd., 183; vgl. auch empirische Belege bei TROST 1997).
Die Werkstätten für Behinderte sind innerhalb des Arbeitsmarktes ein eigener »geschlossener Arbeitsmarkt« geworden (WAGNER 1993, 269, vgl. auch TROST & SCHÜLLER 1992, 46). Das Ausbilden von individuellen Fähigkeitsprofilen und dementsprechende Arbeitsplätze wird, so die Kritik, weitgehend verfehlt. Damit ist der Übergang in Arbeitsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur schwer möglich, und die angestrebte berufliche Eingliederungsmaßnahme führt real in die gesellschaftliche Ausgliederung - mit einer Übergangsquote aus der Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt von unter einem Prozent (vgl. DÜRR 1996, 209, JÄHNERT 1997a). Seit die Werkstatt für Behinderte betriebswirtschaftlich orientiert arbeiten soll (vgl. JACOBS 1988, 184), gerät sie zunehmend in einen Interessenkonflikt, denn gerade »leistungsfähige Beschäftigte, die fähig wären, auf dem freien Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden, erhöhen die Wirtschaftlichkeit der WfB« (ebd., 193).
Die etablierten Angebote des Systems der beruflichen Rehabilitation, so die Kritik zusammenfassend, könnten lediglich in dem Sinne als integrativ bezeichnet werden, als sie ein entsprechendes Ziel formulieren; sie gehen jedoch nicht einen integrativen Weg, sondern wählen in der Regel den Weg durch spezielle Institutionen mit je unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen und Anschlüssen. Dies geschieht in Abhängigkeit von der jeweiligen Schädigung der RehabilitandInnen, und es geschieht mit eher geringem Erfolg, wenn man die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zum Ziel erklärt. Zudem stellt sich die Problematik, dass konkrete Personen nicht immer in die institutionell vorgegebenen Kategorien ›passen‹, sondern als »schwer vermittelbar« (SPECK 1992) in einer »Grauzone« (ebd., 11) oder als ›Grenzfälle‹ zwischen die Stufen des differenzierten - man könnte auch sagen: separierten - Systems beruflicher Rehabilitation geraten. Dieser Weg und seine Gestaltung auf der Grundlage eines ›Defizit-Modells‹ von Behinderung tragen KritikerInnen zufolge sogar eher dazu bei, das Erreichen dieses Ziels zu verhindern: »Das in der institutionalisierten Heil- und Sonderpädagogik und für den Sonderarbeitsmarkt typische leitende Bemühen, ›Defekte‹ zu kompensieren, schafft und konserviert durch die Bedingungen und Art und Weise, wie dies geschieht, genau das, was zu bessern oder gar aufzuheben vorgegeben wird« (FEUSER 2000b, 7f.). So wird von KritikerInnen die von EBERWEIN auf die Schule bezogene Feststellung auf die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen übertragen: »Die Auffassung, soziale Integration durch schulische Separation bewirken zu können, wurde empirisch widerlegt. Eingliederung kann nicht durch Ausgliederung erreicht werden« (1999b, 54). Gleichzeitig wird auch der - gerade für den hier diskutierten Bereich - »z.T. zum nichtssagenden Schlagwort verkommene Begriff der Integration« kritisch beleuchtet (FORSTER 1998, 348). Solche Begriffsunklarheiten und -verwirrungen können u.a. auch Ausdruck einer Umbruchssituation sein, um die es im folgenden Abschnitt geht.
Seit etwa 25 Jahren wird in Behindertenhilfe und -politik darüber diskutiert, ob es einen Paradigmenwechsel gebe, er sich schon vollzogen habe oder notwendig sei. Dies scheint Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels zu sein, der von Krisenphänomenen und Verunsicherung begleitet ist (vgl. SPECK 1996, BLEIDICK 1999); von anderen wird dagegen vermutet, es könnte sich eher um ›Krisengerede‹ handeln (vgl. FEUSER 2000a).
Worum geht es dabei? Ein Paradigma besteht nach KUHN (1973), der in der Regel zu dieser Frage herangezogen wird, in einem grundlegenden gemeinsamen Verständnis, das eine wissenschaftliche Gemeinschaft hat und das für eine gewisse Zeit nicht mehr diskutiert werden muss. Es handelt sich also quasi um ein gemeinsames, geklärtes Grundverständnis über die wissenschaftliche Sicht einer Disziplin. Wissenschaft entwickelt sich nicht durch ein kontinuierliches additives Mehr an Erkenntnis, sondern durch grundsätzliche Revisionen, also durch »wissenschaftliche Revolutionen« (KUHN 1973), also jene »Wendepunkte in der wissenschaftlichen Entwicklung, die mit den Namen Kopernikus, Newton, Lavoisier und Einstein verbunden sind« (ebd., 23). Diese Beispiele machen deutlich, dass die Ablösung eines Paradigmas nur über den Entwurf eines neuen erfolgen kann (ebd., 90).
Ein Paradigma ist also etwas weitaus Grundlegenderes als eine Theorie; insofern ist die auf BLEIDICK zurückgehende, zunehmende Inflationierung des Paradigmabegriffs in der Sonderpädagogik als zunehmend sinnentleerte Übernahme einer Begriffshülse zu sehen, mit der anscheinend für jeden neuen Ansatz Bedeutung erlangt werden soll (vgl. auch FEUSER 2000a). Vor dem KUHNschen Hintergrund erscheinen die Plädoyers verschiedener AutorInnen für Paradigmenpluralismus (SPECK 1996, 32) und Paradigmenverknüpfung (BLEIDICK 1999, 67) wenig überzeugend.
Ein Blick in die Geschichte der Heil-/Sonder-/Behinderten- oder Rehabilitationspädagogik zeigt, dass sie sich seit ihrer Entstehung auf ein Paradigma bezieht: die Spezifik ihrer Klientel und die Spezifität ihrer Institutionen (vgl. GRUBMÜLLER, HINZ, LOEKEN & MOSER 1999). Der Begriff der Behinderung bzw. seine Vorläuferbegriffe wie ›Seelenschwäche‹ oder der ›innere Halt‹ bilden die individuumsbezogene Dimension und die Sonderinstitution wie die Hilfsschule die institutionelle Dimension des sonderpädagogischen Paradigmas, das sich in erster Linie aus dem Bereich der Schule herleitet. Dieses individuums- und institutionsbezogene Paradigma ist seit den 70er Jahren zunehmend irritiert worden, vor allem durch die Integrationsbewegung und die sich entwickelnde Integrationspädagogik. Das institutionelle Paradigma ist spätestens mit den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz »zur sonderpädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schulen der Bundesrepublik Deutschland« (KMK 1994) stark verunsichert, mit der das institutionelle Monopol der Sonderschulen für die spezielle Förderung der Klientel auch administrativ gebrochen wurde; lediglich durch die modernisierte Institution des sonderpädagogischen Förderzentrums kann es möglicherweise weitergeführt werden. Ob die Ablösung des Begriffs der Sonderschulbedürftigkeit durch den des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die Ablösung des Begriffs der Behinderungs- bzw. Sonderschulart durch den des Förderschwerpunktes eher als paradigmatische Modernisierung oder als Veränderungen zu sehen sind, wird sich zeigen müssen.
Wesentliche Impulse für das Aufweichen bisher selbstverständlicher Orientierungen verbinden sich nicht nur mit den zunehmenden institutionellen Veränderungen im Zuge der Gemeinsamen Erziehung, sondern auch mit den zunehmenden Diskussionen um Dekategorisierung und Nichtetikettierung, also um die individuumsbezogene Dimension (vgl. BENKMANN 1994, WOCKEN 1996). Es geht dabei um die Kritik an den bisherigen Kategoriensystemen in Fachrichtungen bzw. Behinderungsarten und ihrer Orientierung an tradierten medizinischen Vorstellungen, meist verbunden mit einer deutlichen Defizit- und Defektorientierung. Hierbei stehen weniger die Probleme der Zuordnung im Zentrum der Diskussion, sondern vielmehr die Frage nach ihrer Sinnhaftigkeit.
Wie sich indessen ein neues, konkurrierendes Paradigma gestalten könnte, ob es angesichts der Diskussionen im englischsprachigen Raum um ›Integration‹ und ›Inclusive Education‹ (vgl. HINZ 2000a) in der institutionellen Dimension als ›Schule für alle‹ bzw. als allgemeine, d.h. für alle offene Institution und in ihrer individuumsbezogenen Dimension als ›Sicherung von Heterogenität‹ beschrieben werden kann, es demnach also als Integrations- bzw. Heterogenitätsparadigma zu verstehen ist, erscheint eher noch als Option (vgl. GRUBMÜLLER, HINZ, LOEKEN & MOSER 1999, 292).
Es scheint jedoch in der Literatur eine deutliche Tendenz zu geben, von einer Paradigmenkonkurrenz bzw. einem Paradigmenwechsel zwischen zwei unterschiedlich bezeichneten Paradigmata auszugehen: von der selektierenden und segregierenden Behindertenarbeit zur bio-graphisch und subjektwissenschaftlich orientierten Behindertenpädagogik (FEUSER 2000b, 14), von einer defektologischen zur dialogischen Haltung (BOBAN & HINZ 1993, HINZ 1996a) oder vom sonderpädagogisch-rehabilitativen zum Integrationsparadigma (vgl. BARLSEN & HOHMEIER 1997). Diese beiden abgrenzbaren Grundverständnisse werden immer wieder in Gegenüberstellungen beschrieben, sie implizieren auch unterschiedliche Verständnisse von Behinderung und Integration (vgl. etwa BOBAN & HINZ 1993, HINZ 1996a). Gleichwohl sind beide Grundverständnisse in der Regel in widersprüchlichen alltagstheoretischen Anteilen in einer Person vorhanden. Das Polaritätenmodell mit rehabilitativ-sonderpädagogischem und integrativem Paradigma (Tab. 1.1) schließt an die genannten Gegenüberstellungen an.
Tab. 1.1: Sonderpädagogisch-rehabilitatives und integratives Paradigma
|
Rehabilitativ-sonderpädagogisches Paradigma |
Integratives Paradigma |
|
|
Grundlage |
-Theorie der Andersartigkeit |
dialektische Theorie von Gleichheit und Verschiedenheit |
|
Menschenbild |
-Anderswertigkeit -Primat v. Defizit und Passivität -›behindert‹ sein (und bleiben) -(Hirnorganischer) Defekt, Schaden, ('IQ'-) Mangel, (Entwicklungs-)Defizit -ganz andere Bedürfnisse -Fürsorge, Stellvertretung, Abhängigkeit |
-Gleichwertigkeit -Primat v. Kompetenz und Aktivität -(in der Entwicklung) ›behindert‹ werden -auf sich wechselseitig beeinflussenden inneren und äußeren Bedingungen basierende Entwicklung -gleiche und verschiedene Bedürfnisse -Selbstbestimmung und Abhängigkeit (bei allen) |
|
Lernen und Entwicklung |
-Primat der Förderbedürftigkeit -pädagogische Führung und Betreuung -pädagogische Aggressivität -Lernen nur von spezialisierten Erwachsenen -Arbeit an Problemen, Therapie -Ticks, Stereotypien |
-Balance von Akzeptanz und Entwicklungspotential -pädagogische Assistenz und Begleitung -pädagogische Zurückhaltung -Anregung durch Gleichaltrige und Erwachsene -Unterstützung von Entwicklung, evtl. auch durch Therapie -sinnvolle, logische (Re-)Aktion |
|
Folgen für Bildung und Erziehung |
-Schutz in der Gruppe Gleicher -möglichst homogene Lerngruppen -Verpflichtung zu zielgleichem Lernen -gezielte, individuelle optimale Förderung -Wissen, was das Beste ist -didaktische Reduzierung, ›Prinzip der kleinen Schritte‹ -Maßnahmen und Regelungen durch andere |
-Reibung in der Gruppe Verschiedener -möglichst heterogene Lerngruppen -Offenheit für zielgleiches und zieldifferentes Lernen -gemeinsame Lernsituationen mit individualisierten Angeboten -Beobachten, auf der Welle mitgehen -Offenheit für gemeinsame Situationen und Erfahrungen -individuelle Maßstäbe, individuelle Schritte |
|
Folgen für das Bildungssystem |
-(differenzierte) Integration von Behinderten in die allgemeine Schule -Sonderpädagogische Förderzentren mit stationären und ambulanten Aufgaben -sonderpädagogischer Förderbedarf als individueller Begriff -Zuweisung von Ressourcen zu Personen -Sonderpädagogik als spezielle, ausdifferenzierte Pädagogik |
-gemeinsames Leben und Lernen für alle in heterogenen Lerngruppen -Sonderpädagogische Förderzentren als ambulanter integrationsunterstützender Dienst -sonderpädagogischer Förderbedarf als systemischer Begriff -Zuweisung von Ressourcen zu Institutionen -Sonderpädagogik als spezielle, komplementäre und subsidiäre Pädagogik |
|
Folgen für Interaktion |
-klare Machtverteilung -Denken und Arbeiten für... -Entscheidungen durch Fachleute -Stellvertretung, Fremdbestimmung -Tabuisierung des Themas ›Behinderung‹ -Elternarbeit |
-Empathie und Dialog -Reflexion und Gespräch mit... -gemeinsame Entscheidungen -Unterstützung bei Selbstbestimmung -Zeugenschaft für Bearbeitung des Themas ›Behinderung‹ -Kooperation mit Eltern |
|
Folgen für Diagnostik |
-Feststellung objektiver Gegebenheiten -Status klären -Entwicklung erfassen -hierarchische Testsituation -Planung von Maßnahmen Plazierungsentscheidungen |
-Einigung über Erfahrungen -Zugang finden -Logik verstehen -Einschätzung des Unterstützungsbedarfs -Planung von Aktivitäten -persönliche Zukunftsplanung |
Auf die jeweils grundlegende Theorie der Andersartigkeit von Menschen mit Behinderungen oder eine dialektischen Theorie von Gleichheit und Verschiedenheit aller Menschen bauen unterschiedliche Orientierungen und Rollenvorstellungen in vielen Bereichen auf. So finden sich auch unterschiedliche Behinderungsbegriffe: auf der einen Seite ein - wissenschaftlich veralteter - psychiatrisch-medizinischer, der sich ausschließlich an der Person selbst festmacht, auf der anderen Seite ein ökosystemischer Begriff, der nicht nur die Person und ihre inneren Voraussetzungen, sondern ebenso die Beziehungen zwischen Person und Umwelt in die Betrachtung einbezieht (vgl. SANDER 1999). Dies führt zu Folgen für Erziehung und Bildung, auch für die Struktur des Bildungswesens im Spannungsfeld von Generalisierung und Differenzierung, und das jeweilige Verständnis hat auch unmittelbare Folgen für Interaktion und Diagnostik. Zentral ist dabei jeweils eine unterschiedliche Gestaltung von Prozessen: im ersten Fall hierarchische Strukturen, die Menschen mit Behinderungen zum Objekt von Förderung, Therapie, Zuweisungen und Förderplänen machen, im zweiten Fall der Versuch, zu gleichberechtigter, kooperativer Beratung mit Unterstützung, Assistenz und Begleitung zu kommen.
Aufschlussreich ist bei der Paradigmendiskussion, dass über die institutionelle Dimension vehement gestritten wird - etwa am Beispiel der sonderpädagogischen Förderzentren und ihres weiten konzeptionellen Spektrums - und auf dieser Ebene Veränderungen deutlich sichtbar sind (vgl. z.B. WOCKEN 1996). Man könnte fast sagen, dass auf dieser Ebene paradigmatische Veränderungen in Gang gekommen sind. Auf der individuumsbezogenen Ebene dagegen stehen Veränderungen - wenn man über die allseitigen Lippenbekenntnisse, natürlich nicht mehr defektologisch und defizitorientiert zu denken und zu handeln, sondern zu dialogischem Denken und Handeln überzugehen (vgl. BOBAN & HINZ 1993) hinaussieht - bestenfalls am Beginn. Die Diskussion erscheint mitunter in einem Licht, als ob man sich über die individuumsbezogene Dimension so lange wenig Gedanken machen zu müssen glaubt, wie man über institutionelle Gegebenheiten und Strukturen hoch engagiert streiten kann.
Die Paradigmendiskussion im Bereich der Disziplin Sonderpädagogik hat eine hohe Bedeutung für die Behindertenhilfe und -politik insgesamt, denn auch für sie geht es um Fragen grundsätzlicher Orientierungen: Wie werden Menschen mit Behinderungen gesehen - als primär aktive Subjekte ihrer Entwicklung, die eigene Interessen und Wünsche einbringen, oder eher als passive Objekte der Zuweisungsmechanismen von nichtbehinderten ExpertInnen, die vor allem mit Blick auf ihre Schädigung entsprechenden Maßnahmen zugewiesen werden? Wie gestaltet sich die Rolle der nichtbehinderten Professionellen - eher als fördernde und betreuende Instanz oder eher als assistierende und begleitende Unterstützung? Dies sind Fragen, die auch für die vorliegende Evaluation von zentralem Interesse sind.
Kontroversen darüber, welche Unterstützungsleistungen konkrete Menschen mit Behinderungen brauchen, sind auch immer vor diesem Hintergrund des Wandels grundsätzlicher Orientierungen zu sehen. Ein wesentlicher Impuls für die berufliche Rehabilitation ist im amerikanischen Ansatz des ›Supported Employment‹ zu sehen, das - neben allgemeinen krisenhaften Entwicklungen in der Arbeitsgesellschaft - maßgeblich zu einer Umbruchssituation im Feld der beruflichen Rehabilitation beigetragen hat. Deshalb beschäftigen sich die beiden nächsten Abschnitte mit diesen beiden Fragen.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die Entstehung des Ansatzes Unterstützter Beschäftigung eingegangen, bevor seine Grundprinzipien und Erfahrungen in Deutschland dargestellt werden.
Unterstützte Beschäftigung ist die deutsche Übersetzung für den amerikanischen Begriff ›Supported Employment‹. Dieser Begriff bezeichnet ein Konzept, das in den USA in der Folge von Bürgerrechtsbewegungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt wurde. Dabei ist dieser Begriff nicht mit der Lernbehinderung im deutschen Sprachraum gleichzusetzen, sondern umfasst darüber hinaus auch Menschen, die hier als geistig behindert bezeichnet werden - was in den USA als diskriminierender Begriff abgelehnt wird. Supported Employment ist dort nach einer Reihe von Modellprojekten seit 1984 gesetzlich verankert (vgl. hierzu DOOSE 1997b, 266f.). Es ist
-
bezahlte Beschäftigung für Menschen mit Lernschwierigkeiten (developmental disabilities), für die eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für oder oberhalb des Mindestlohnes unwahrscheinlich ist, und die langfristige Unterstützung benötigen, um arbeiten zu können,
-
in einer Vielzahl von Konstellationen möglich, in denen Menschen ohne Behinderung beschäftigt sind,
-
Unterstützung durch alle Aktivitäten, die dazu beitragen, bezahlte Arbeit zu erhalten, einschließlich Anleitung, Qualifizierung und die Fahrt von und zur Arbeit« (Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 1984, Public Law 98-527; zit. in BAG UB 1999, 70).
Das Konzept des Supported Employments wird inzwischen in vielen anderen Ländern rezipiert (etwa in Kanada, Australien, Großbritannien, Norwegen, Holland, Italien, Spanien, Österreich; vgl. SCHÖLER 1996, LEICHSENRING & STRÜMPEL 1997, WETZEL & WETZEL 2001 sowie IMPULSE 1999). So wurden die World Association of Supported Employment (WASE), die European Union of Supported Employment (EUSE) und in Deutschland 1994 die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) gegründet. Ihr gehören vor allem jene Integrationsfachdienste an, die sich um die Fortsetzung »integrativer Prinzipien und Prozesse aus der Schule in das Arbeitsleben« bemühen (GINNOLD 2000, 154).
Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung wird als Teil der Bewegung für Integration und gegen Aussonderung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen verstanden: »Unterstützte Beschäftigung basiert auf der Überzeugung, dass Arbeit ein wesentlicher Teil unseres Lebens und unseres sozialen Status ist. Gleichwertige, gleichberechtigte Teilhabe an den zentralen Lebensbereichen setzt ein kommunikatives, zwischenmenschliches Miteinander voraus. Ausgrenzung, egal in welchem Lebensbereich, macht diese Kommunikation unmöglich. Menschen mit Behinderung dürfen daher nicht gegen ihren Willen von diesem wichtigen Lebensbereich ausgeschlossen werden« (DOOSE 1997b, 264).
Ähnlich wie in den USA, wo die Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten den Ausgangspunkt von Supported Employment bildet, wendet sich das Konzept der Unterstützten Beschäftigung insbesondere an Menschen mit Behinderungen, die im gängigen Rehabilitationssystem bisher als nicht vermittlungsfähig gelten. »Die Möglichkeit, Menschen mit einer Behinderung durch individuelle Unterstützung und Begleitung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist aber nicht auf eine Behinderungsart beschränkt« (DOOSE 1997b, 275). Als Zielgruppen von erfolgreicher Unterstützter Beschäftigung werden mittlerweile folgende Personengruppen genannt:
-
Menschen mit einer Lern- oder geistigen Behinderung, einschließlich Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung,
-
Menschen mit psychischen Behinderungen,
-
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung,
-
Menschen mit Autismus,
-
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen (vgl. BAG UB 1999, 73).
Durch die erfolgreiche Vermittlung von Menschen mit schweren Behinderungen in integrative Arbeitsverhältnisse soll auch die berufliche Integration von Menschen mit leichteren Behinderungen bedeutende Impulse erhalten (vgl. DOOSE 1997b, 275f.).
Für die Aufnahme und Weiterentwicklung des amerikanischen Ansatzes des ›Supported Employments‹ als deutsches Modell der Unterstützten Beschäftigung lassen sich mit DOOSE vier verschiedene Herkunftsbereiche unterscheiden (vgl. BAG UB 1999, 77f.):
-
Die Entwicklung im Bereich der beruflichen Integration ist auf das Engagement der Elternbewegung für Integration zurückzuführen, die sich für ihre Kinder für Möglichkeiten zur Fortsetzung der schulischen Integration im Arbeitsleben einsetzt. Diese Elternbewegung findet im Supported Employment in den USA und im Projekt ›Open Road‹ in Irland ihre Vorbilder. Dies gilt etwa für die Hamburger Arbeitsassistenz (vgl. BEHNCKE, CIOLEK & KÖRNER 1993) und den Verein ›Cooperative Beschützende Arbeitsstätten‹ (CBA) in München.
-
Eine weitere Bewegung kommt aus dem Bereich der Sonderschulen, die die Situation ihrer Schüler im Hinblick auf das Leben und den Übergang in die Arbeitswelt verbessern wollen (so Projekte in Donaueschingen und Pforzheim; vgl. TROST 1994, BÖHRINGER 2000).
-
Eine dritte Herkunftsrichtung leitet sich von engagierten Trägern aus dem Bildungsbereich ab, die nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Werkstatt für Behinderte suchen, wie etwa das Modellprojekt der Evangelischen Fachhochschule in Reutlingen, Arbeit und Bildung in Marburg und die Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik (ISB) in Berlin (vgl. SCHUMANN 1995, 1998, GEHRMANN 1998).
-
Eine vierte Bewegung kommt von den Psychosozialen Diensten (PSD), die seit Mitte der 80er Jahre im Auftrag der Hauptfürsorgestellen zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit zumeist psychischen Behinderungen gegründet werden.
Von daher ist festzustellen, dass es »kein einheitliches Konzept und keine einheitliche Praxis der hier tätigen Integrationsfachdienste« gibt (GINNOLD 2000, 156, vgl. auch BUNGART 1997). Darüber hinaus unterscheiden sie sich auch im Hinblick auf ihre Trägerschaft. Neben den Diensten, die den etablierten Einrichtungen der Behindertenhilfe angehören, insbesondere der Werkstatt für Behinderte, gibt es Integrationsfachdienste in unabhängiger Trägerschaft, die sich, wie GINNOLD (2000, 157) betont, in bewusster Abgrenzung von etablierten Sondereinrichtungen gründen - so auch die Hamburger Arbeitsassistenz, die von dem Verein ›Eltern für Integration‹ 1992 initiiert wird.
Unterstützte Beschäftigung ist ein Synonym für »integrierte Arbeitsplätze in regulären Betrieben geworden, in denen Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten und die notwendige individuelle Unterstützung erhalten, um dauerhaft er-folgreich arbeiten zu können« (BAG UB 1999, 71). Diesem Konzept folgend verläuft die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen in einem Prozess, der sich in fünf Phasen teilen lässt (BEHNCKE & CIOLEK 1997, 223, vgl. auch HORIZON-ARBEITSGRUPPE 1995, BARLSEN & HOHMEIER 1997, DOOSE 1997b):
1. Erstellen eines Fähigkeitsprofils als individuelle Berufsplanung,
2. Akquisition eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
3. Arbeitsplatzanalyse,
4. Arbeitsbegleitung und Qualifizierung und
5. Krisenintervention, Nachsorge und dauerhafte Begleitung
In allen Phasen werden die Menschen mit Behinderungen von ArbeitsassistentInnen beraten und unterstützt.
Darüber hinaus lassen sich folgende Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen nennen (vgl. BAG UB 1999, 97f.):
Integration
Unterstützte Beschäftigung ist nicht nur auf die Vermittlung eines Beschäftigungsverhältnisses auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begrenzt, sie bemüht sich darüber hinaus um die Integration von Menschen mit Behinderungen in innerbetriebliche Abläufe und das Zustandekommen persönlicher Beziehungen zu ArbeitskollegInnen, d.h. um die Teilhabe der unterstützten ArbeitnehmerInnen an Pausen, Betriebsfeiern und -ausflügen und außerbetrieblichen Unternehmungen sowie um die Bewältigung gemeinsamer Arbeitswege. Intendiert ist somit auch ihre soziale Integration (vgl. GINNOLD 2000, 158). Dabei ist wichtig, dass Unterstützte Beschäftigung allen Menschen mit Behinderungen offen stehen soll.
Bezahlte und reguläre Arbeit
Im Unterschied zu den Beschäftigungsverhältnissen in der Werkstatt für Behinderte und den Tagesförderstätten wird bei Unterstützter Beschäftigung versucht, eine tarifliche Entlohnung - häufig in Teilzeitform - in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu ermöglichen. Etwaige Minderleistungen können dabei durch Lohnkostenzuschüsse oder durch Angleichung der Löhne an die reale Arbeitskraft ausgeglichen werden.
Training on the Job - ›erst platzieren, dann qualifizieren‹
Dieses Prinzip steht im Gegensatz zum gängigen Ansatz der Rehabilitationspraxis, die die Menschen mit Behinderungen ›erst qualifizieren, dann platzieren‹ will; in einer langfristigen Vorbereitungsphase außerhalb der realen Situation von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, auf deren Anforderungen hin qualifiziert werden soll, können Sinn und Bedeutung der Qualifizierungsmaßnahme kaum vermittelt werden. Bei Unterstützter Beschäftigung wird dagegen im Prozess der Arbeitsplatzanalyse nicht der Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz, sondern der Arbeitsplatz an dessen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst und entsprechend modifiziert. Gemäß des ›Trainings on the job‹ setzen sich Menschen mit Behinderungen mit den Anforderungen eines Arbeitsplatzes in der betrieblichen Realität auseinander und lernen dabei direkt in ihrer Arbeitstätigkeit. Es werden dabei verschiedene Organisationsformen von Unterstützter Beschäftigung unterschieden:
-
Beschäftigung in Integrationsfirmen oder Integrationsabteilungen, wobei die Anzahl nicht mehr als acht Personen mit Behinderungen umfassen darf, um als Unterstützte Beschäftigung zu gelten. Die Begrenzung der Gruppengröße ist für den Erfolg der beruflichen Integration von entscheidender Bedeutung, um innerbetriebliche Separierung zu vermeiden.
-
Beschäftigung in mobilen Dienstleistungsgruppen, die bestimmte Arbeiten in Regionen anbieten, etwa Gartenarbeiten oder das Reinigen von Sammelcontainern.
-
Unterstützte Einzelarbeitsplätze als häufigste Form Unterstützter Beschäftigung (80% der unterstützten Arbeitsplätze in den USA); dies sind Arbeitsplätze in regulären Betrieben, an denen Arbeitnehmer mit Behinderungen durch ArbeitsassistentInnen (›job coaches‹) oder KollegInnen (›natural support‹, vgl. SCHARTMANN 1995a) unterstützt werden (vgl. DOOSE 1997b, 276-278).
Flexible, individuelle und zeitlich unbegrenzte Unterstützung
Menschen mit Behinderungen haben unterschiedliche Bedarfe nach individuellen Hilfen und Unterstützungen. Diese individuelle und flexible Unterstützung beinhaltet »alle Hilfen, die für eine erfolgreiche Arbeit im Betrieb notwendig erscheinen« (GINNOLD 2000, 159). Dabei muss die zeitliche Unbegrenztheit dieser Unterstützung gewährleistet sein.
Wahlmöglichkeiten und Förderung der Selbstbestimmung
Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung versucht, Menschen mit Behinderungen ein breites Spektrum alternativer Arbeitsmöglichkeiten anzubieten und so Wahlmöglichkeiten bei der Aufnahme einer Beschäftigung zu schaffen. Sie tragen bei zur Förderung der Selbstbestimmung, der zufolge die Menschen mit Behinderungen selbst in den beruflichen Integrationsprozess aktiv mit einbezogen werden; dabei spielen die Partizipation an der Entscheidung über die Verwendung von Eingliederungshilfen und die Berücksichtigung persönlicher Interessen und Neigungen durch individuelle Berufsplanung und »persönliche Zukunftskonferenzen« (BOBAN & HINZ 1999, vgl. auch VAN KAN & DOOSE 1999) eine zentrale Rolle. »In diesem Sinne eröffnet das Konzept Unterstützte Beschäftigung Menschen mit Beeinträchtigungen die Selbstbestimmung und steht in engem Zusammenhang mit den Forderungen nach Integration und Gleichberechtigung« (TROST 1997, 45).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Konzept der Unterstützten Beschäftigung Menschen mit Behinderungen Alternativen vor allem zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte bieten will, indem es ihnen Perspektiven der beruflichen Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet. Das ist nach dem Verständnis seiner VertreterInnen »mehr als eine neue Rehabilitationsmaßnahme. Es ist eine veränderte Sichtweise, die zu einer veränderten Praxis führt. Gemeinsames Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen als Ziel, die Fähigkeiten und Wünsche eines Menschen als Ausgangspunkt, echte Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung und Kontrolle des Menschen mit Behinderung als Wegweiser und ambulante, individuelle, flexible Unterstützung als Methode sind Eckpfeiler von Unterstützter Beschäftigung« (DOOSE 1997a, 88). Dezidiert wird die Veränderung der grundsätzlichen Orientierung betont: »Ohne eine derart veränderte Perspektive werden auch Integrationsfachdienste nur eine Fortsetzung des alten Maßnahmeparadigmas mittels einer neuen Maßnahme sein« (DOOSE 1997b, 286). Hierauf gilt es die Evaluation des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums zuzuschneiden.
Eine erste übergreifende Untersuchung in Deutschland von 80 Menschen mit Lernschwierigkeiten auf unterstützten Arbeitsplätzen, die von fünf Integrationsfachdiensten unterstützt werden, fördert folgende Ergebnisse zutage (vgl. DOOSE 1996, 1997b, 282-285):
-
»Die in die Untersuchung einbezogenen unterstützten Arbeitnehmer haben zu über 80% eine Lern- oder geistige Behinderung.
-
Für zwei Drittel der unterstützten Beschäftigten ist dies das erste reguläre Arbeitsverhältnis.
-
Die Hälfte der unterstützten Arbeitnehmer wird mindestens einmal wöchentlich am Arbeitsplatz direkt vom Fachdienst unterstützt. Meist ist die direkte Unterstützung am Arbeitsplatz am Anfang stärker und lässt im Laufe der Zeit nach.
-
Die Arbeitsplätze werden am häufigsten im Produktions- und Montagebereich, im Gastronomie- und Küchenbereich und im Lagerbereich gefunden.
-
Die unterstützten Arbeitsplätze werden überwiegend in kleineren Betrieben gefunden. So haben 72% der Betriebe weniger als 50 Beschäftigte und 46% sogar weniger als 15 Angestellte« (DOOSE 1997b, 282).
Seiner Untersuchung zufolge sieht DOOSE folgende wesentliche Barrieren für die berufliche Integration in Deutschland:
-
»Wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit,
-
mangelndes Interesse von Arbeitgebern, Menschen mit einer erheblichen Behinderung einzustellen,
-
geringe Qualifikation der Bewerber mit Behinderungen (Lücke zwischen der benötigten Qualifikation und der in der Schule und WfB erhaltenen),
-
inflexibles Förderungsrecht,
-
keine Unterstützung von Werkstätten für Behinderte« (1997b, 283).
Als Erfolgsfaktoren für berufliche Integration erscheinen demgegenüber:
-
»Individuelle Unterstützung am Arbeitsplatz durch den Arbeitsbegleiter,
-
Lohnkostenzuschüsse,
-
gute regionale Kontakte der Fachdienstmitarbeiter,
-
hohe Motivation der Menschen mit Behinderung,
-
positive Einstellung von Arbeitgebern« (DOOSE 1997b, 284).
In Deutschland wird Unterstützte Beschäftigung von vielen als ein Konzept zur Ergänzung des klassischen Systems der beruflichen Rehabilitation betrachtet, nicht aber »als grundlegende Veränderung dieses Systems begriffen« (GINNOLD 2000, 167). Dies macht einen wichtigen Unterschied zu den USA aus, wo die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen als notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Integration von Menschen mit geistiger Behinderung geschaffen worden sind (vgl. SCHARTMANN 1995b, 73). VertreterInnen des Konzepts der Unterstützten Beschäftigung monieren, dass seine Umsetzung sich nicht auf systemimmanente Bemühungen im Sinne einer Weiterentwicklung bereits bestehender organisatorischer und methodischer Formen der Rehabilitation beschränken darf. Sie fordern dagegen, dass es vielmehr eine »selbstverständliche und wählbare Alternative für alle Menschen mit Behinderungen werden sowie gesetzlich verankert sein« muss (GINNOLD 2000, 168, vgl. auch BARLSEN & HOHMEIER 1997, 56). Dabei werden über bisherige konzeptionelle Entwicklungen hinaus im Berliner Projekt »SprungBRETT« die Konzepte der Unterstützten Beschäftigung und der Alltagsbegleitung (HILLER) kombiniert, so dass die berufliche und die soziale Seite des Erwachsenenlebens für junge Menschen mit Behinderungen zusammengeführt werden (vgl. GINNOLD & RADATZ 2000).
Mit dem Verständnis Unterstützter Beschäftigung als grundlegend neuem Weg zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen und in Anlehnung an die Entwicklung in den USA wird für Deutschland eine Reihe konkreter Maßnahmen gefordert:
-
Gesetzliche Förderbestimmungen müssen flexibler gestaltet werden.
-
Finanzielle Mittel für eine lebenslange Beschäftigung innerhalb einer Werkstatt für Behinderte müssen auch im Rahmen Unterstützter Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
-
Eine Absicherung des Lebensunterhaltes von Arbeitnehmern mit Behinderung durch Sozialhilfe oder Erwerbsunfähigkeitsrente ist sicherzustellen (vgl. GINNOLD 2000, 168).
-
Finanzierung darf nicht zeitlich begrenzt werden, nur weil sie nicht an eine bestimmte Institution gebunden ist.
-
Sämtliche Hilfen müssen Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen Unterstützter Beschäftigung tätig sind, direkt zugute kommen, um ihnen volle Selbstbestimmung in Bezug auf ihre Arbeitsplatzwahl zu ermöglichen.
Abschließend ist somit aus der Perspektive der VertreterInnen Unterstützter Beschäftigung festzuhalten: Mit diesem Konzept scheint »das integrative Leitbild nun auch den Bereich der beruflichen Eingliederung und Rehabilitation erreicht zu haben, insofern es hier nicht mehr ausschließlich um die Ausdifferenzierung des vorhandenen Systems geht, sondern eher um die Suche nach alternativen Lösungswegen für gewiss nicht neue Probleme« (BARLSEN & HOHMEIER 1997, 57). Damit können die Forderungen von VertreterInnen des Konzepts Unterstützter Beschäftigung als Forderungen nach einem Paradigmenwechsel im System der beruflichen Rehabilitation begriffen werden. Das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum müssen in diesem Zusammenhang betrachtet werden.
Um einen weiteren allgemeinen Hintergrund zumindest andeutungsweise zu beleuchten, widmet sich der folgende Abschnitt der Frage nach der Bedeutung von Arbeit, die diesbezüglichen Entwicklungen der letzten Jahre, die mit dem Begriff der Krise der Arbeitsgesellschaft verbunden werden, und dem Zusammenhang mit Veränderungen im Feld der beruflichen Rehabilitation und seiner Widersprüchlichkeit.
Unter dem Begriff ›Arbeit‹ wird heute die Lohn- und Erwerbsarbeit in Form von Berufen verstanden. Erwerbsarbeit ist dabei eine auf die Einkommenserzielung gerichtete Tätigkeit, sei es in einem abhängigen Arbeitsverhältnis als monetäre Erwerbsarbeit oder in selbständiger Tätigkeit. Erwerbsarbeit bzw. Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat in unserer Gesellschaft große Bedeutung gewonnen. Als ›arbeitslos‹ bezeichnet man gewöhnlich nur denjenigen, der keiner Erwerbsarbeit nachgeht, auch wenn er stattdessen noch so viel unentgeltliche Arbeit erbringt. Diese Formen von Arbeit, die vor allem in Familien oder als ehrenamtliche Tätigkeit erbracht wird, können auch im Rahmen von Erwerbsarbeit durchgeführt werden, so kann etwa die Pflege eines Kranken zu Hause von einem Familienangehörigen (unentgeltliche Arbeit) oder von bezahltem Pflegepersonal (Erwerbsarbeit) durchgeführt werden.
Der Motivation, eine Arbeit aufzunehmen und auszuüben, liegen Bedürfnisse zugrunde, die in der Arbeit zu befriedigen versucht werden und die Arbeit einen individuellen Sinn verleihen. ZWIERLEIN (1997, 20) stellt im Anschluss an das bedürfnistheoretische Modell der ›MASLOW-Pyramide‹ für die Arbeit fünf Motiv- und Sinndimensionen heraus, die verschiedenen Bedürfnissen zugeordnet sind:
-
Physiologische Bedürfnisse: Auf dieser Ebene entspricht Arbeit dem Bedürfnis nach materieller Existenzsicherung, d.h. Arbeit dient zur Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse.
-
Sicherheitsbedürfnisse: In Bezug auf Bedürfnisse nach Schutz, Ordnung, Stabilität, Vorsorge und Angstfreiheit soll Arbeit zur Sicherung des Lebens beitragen. Aber erst ein gesicherter Arbeitsplatz wird dieses Bedürfnis erfüllen.
-
Bedürfnisse nach Kommunikation und Kooperation: Die Arbeit konstituiert und strukturiert zwischenmenschliche Kontakte und Begegnungen.
-
Bedürfnisse nach Anerkennung und Geltung: Durch Möglichkeiten von Leistungserfolgen und Leistungsachtung ergeben sich Chancen zur Steigerung der Selbstachtung.
-
Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung: Der Mensch hat das Verlangen, seine potentiellen Fähigkeiten und Möglichkeiten entfalten zu können. Er kann sich durch Arbeit in dem Produkt widerspiegeln, das er durch seine Anstrengung und persönliche Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt hervorgebracht hat.
Aus den genannten Motiv- und Sinndimensionen ergeben sich die Bedeutungs- und Erlebnisinhalte von Arbeit, die für den Menschen durch das alltägliche Nachgehen einer Arbeit relevant sind. JAHODA beschreibt diese Bedeutungs- und Erlebnisinhalte in fünf Kategorien, un-abhängig von der Qualität und Art der Arbeitserfahrung (1984, 11ff.):
-
Arbeit konstituiert ein für sie charakteristisches Zeiterlebnis, sie teilt die Zeit und das Leben in Perioden von Freizeit und Arbeitszeit ein.
-
Arbeit erweitert den sozialen Horizont über Familie, Nachbarschaft und Freunde hinaus.
-
Da Arbeit kollektiv organisiert ist, bringt sie den Menschen dazu, sich als soziales Wesen zu erleben, in Kooperation mit anderen tätig zu sein, in Arbeitsabläufe eingebunden zu sein und Zusammenhänge zu erkennen.
-
Arbeit beeinflusst maßgeblich die Identität und den Status eines Menschen in der Gesellschaft. Zwischen der im Arbeitsleben eingenommen Position und der gesellschaftlichen Position besteht eine enge Korrelation.
-
Erwerbsarbeit ermöglicht dem Menschen eine »regelmäßige, systematische Tätigkeit, deren Zweck über persönliche Zwecke hinausgeht und den Arbeitenden an die soziale Realität bindet« (JAHODA 1984, 13).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass den verschiedenen Erlebnisinhalten und Funktionsbereichen von Arbeit prinzipiell sowohl positive als auch negative Qualitäten zueigen sein können (hoch und niedrig bezahlte Arbeit, erfreuliche und unerfreuliche soziale Kontakte). Diese »Ambivalenz, die Zwiespältigkeit und Janusköpfigkeit« (ZWIERLEIN 1997, 18) der Arbeit ist immer in jeder Erwerbsarbeit enthalten.
Aus den bisher genannten Bedeutungen von Arbeit ergibt sich, dass dem Wert der Arbeit eine zentrale Stellung in der heutigen Gesellschaft zukommt und sie zu Recht als ›Arbeitsgesellschaft‹ bezeichnet wird. Dabei hat sich im Laufe der Zeit ihre Bedeutung gewandelt: »Früher galt es häufig als Privileg, nicht arbeiten zu müssen, heute gilt es eher als Privileg, arbeiten zu dürfen« (ZWIERLEIN 1997, 18). Erwerbsarbeit wird zunehmend zum knappen Gut, und immer mehr Menschen, die nicht den sich rasant ändernden Anforderungen der Arbeitswelt entsprechen, werden aus ihr hinausgedrängt. Aufgrund von Automatisierung und Computerisierung wird eine geringere Arbeitsmenge für die gleiche Produktionsmenge gebraucht, Konsumbedürfnisse sind im Vergleich zur Nachkriegszeit zu weiten Teilen befriedigt, die Nachfrage ist nicht mehr unbegrenzt steigerbar. Jedoch gehört der Mechanismus, immer mehr zu produzieren, um mehr zu arbeiten, zur Basis der Arbeitsgesellschaft, um Vollbeschäftigung für alle zu ermöglichen (vgl. GORZ 1989, 308). Die Arbeitsgesellschaft steckt in einer Krise: Nach STORZs ›These von der Einfünftelgesellschaft‹ kommt das globale Wirtschaftssystem mittelfristig mit einem Fünftel aller Arbeitssuchenden aus, »um alle Waren zu produzieren und die hochwertigen Dienstleistungen zu erbringen, die die Weltgesellschaft benötigt. (...) Die Ausgrenzungsbewegungen richten sich schon jetzt gegen die wirtschaftlich schwachen Gruppen: Ausländer, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte, Jugendliche ohne Ausbildung und Frauen« (STORZ 1997, 400).
Diese Krise bewirkt eine Veränderung der Bedeutung und des Wertes der Arbeit in der Gesellschaft. Bereits BECK (1986, 220ff.) weist darauf hin, dass durch den Mangel an klassischer Erwerbsarbeit Normen aufgebrochen und die Formen der Erwerbsarbeit vielfältiger werden (müssen). Die herkömmliche Form der Erwerbsbiographie ändert sich zunehmend, und eine immer größer werdende Menge an Menschen ist von partieller Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit in ihren Biographien betroffen. Diese Prozesse werden durch neoliberale Tendenzen der Deregulierung maßgeblich verstärkt. Auch wenn GORZ betont, dass die Krise der Arbeitsgesellschaft dazu zwinge, »woanders als in der Arbeit Quellen für persönliche Identität und soziale Zugehörigkeit zu suchen« (1989, 147), treten heute bestenfalls schemenhaft »Konturen einer neuen Tätigkeitsgesellschaft« (STORZ 1999, 39) hervor, die »als Tätigkeitsgemisch marktentlohnter und nicht marktvermittelter Arbeit, aus formeller und informeller Arbeit, aus Erwerbs-, Bürger- und Eigenarbeit« (ebd.) gedacht wird.
Die Situation auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt verschärft sich seit Beginn der 90er Jahre alarmierend. Immer mehr Menschen sind - vorübergehend oder dauerhaft - von Arbeitslosigkeit betroffen. Die wichtigsten Verursachungsdimensionen sind die schnell wachsende Internationalisierung der Wirtschafts- und Wettbewerbsverflechtungen (Globalisierung) sowie die sich dadurch verschärfende Standortkonkurrenz einerseits und die durch den Einsatz neuer Technologien bewirkten Rationalisierungsmaßnahmen und Freisetzungseffekte andererseits: »Überall in der westlichen Welt wurde Arbeit in den letzten Jahrzehnten zu einem unsicheren Faktor, da die alten Arbeitsstrukturen zerfielen: Vollzeit-Arbeitsplätze werden abgebaut, es gibt ein dramatisches Anwachsen von (schein-)selbständiger Arbeit und Teilzeitarbeit; viele Unternehmen bieten zeitlich begrenzte Verträge an« (WILKINSON 1997, 104, zit. in JÄHNERT 1997b, 34).
Dabei ist eine Verschiebung der Arbeit in den ökonomischen Sektoren und zwischen Betriebsgrößen festzustellen: »Industrielle Großunternehmen im produzierenden Gewerbe haben rapide Arbeitsplätze abgebaut, während Klein- und Mittelbetriebe ihr Arbeitsplatzangebot im wesentlichen aufrechterhalten haben. Im Dienstleistungsbereich hat es ein mildes Wachstum gegeben, das vor allem von der positiven Entwicklung im Gesundheitswesen ..., in der Rechts- und Wirtschaftsberatung ... und bei den sonstigen Dienstleistungen getragen wird« (SEYD 1997, 18). Auf der Basis dieser Situation sind prognostische Aussagen über weitere Perspektiven höchst unsicher, da einerseits eine Verlagerung von Arbeit in den tertiären und quartären Sektor angenommen wird, andererseits auch in jenen Bereichen zumindest in Großunternehmen massive Rationalisierungswellen zu beobachten sind (vgl. SEYD 1997, 20-22).
In Deutschland gibt es fast vier Millionen Arbeitslose, die Arbeitslosenquote beträgt im Dezember 2000 bundesweit 9,3%. Unter diesen schwierigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt erscheint es beinahe aussichtslos, eine Gruppe von Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt integrieren zu wollen, die anscheinend in einer schlechten Ausgangslage sind und somit wenig Chancen haben: Menschen mit Behinderungen. Ende 1996 gibt es in Deutschland etwa 6,6 Millionen anerkannte Schwerbehinderte, d.h. acht Prozent der Bevölkerung. Davon sind 5,5 Millionen aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr im Arbeitsleben. Im Oktober 1997 liegt die Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten bei 17,9 Prozent, rund 196.260 Menschen sind arbeitslos gemeldet (BMA 1998, 69f.). Die Arbeitslosenquote Schwerbehinderter übersteigt damit deutlich die der allgemeinen Arbeitslosigkeit von Menschen ohne Behinderungen (ebd., 70). In Hamburg etwa liegt 1996 die Vermittlungschance für schwerbehinderte Arbeitslose nur bei etwa einem Sechstel der allgemeinen Vermittlungschancen; diese Differenz ist lang-jährig zu beobachten (vgl. RITZ 1997, 50f.).
Eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, wird immer schwieriger, »weil Nischenarbeitsplätze, einfache und ungelernte Tätigkeiten wegfallen. Es findet ein Verdrängungswettbewerb von oben nach unten statt. Die Verlierer sind die ›Schwächsten der Gesellschaft‹: niedrig qualifizierte und ungelernte Menschen sowie sogenannte Randgruppen ohne Lobby. Das trifft gerade auch Menschen mit Behinderungen« (GINNOLD 2000, 17).
Angesichts dieser schwierigen Situation versucht der Staat über eine Reihe von Maßnahmen, die Integration von Menschen mit Behinderungen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu fördern, insbesondere über Regelungen des bisherigen Schwerbehindertengesetzes. Nach MONTADA (1997, 4f.) gehören dazu
-
die Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderungen, d.h. 6% der Arbeitsplätze in Betrieben über 16 MitarbeiterInnen müssen mit Schwerbehinderten besetzt sein. Ist dies nicht der Fall, müssen die Betriebe eine monatliche Ausgleichsabgabe von 200 DM pro unbesetzter Stelle zahlen;
-
der besondere Kündigungsschutz, d.h. der Arbeitgeber darf nur mit vorheriger Zustimmung der Hauptfürsorgestelle eine Kündigung aussprechen, sowie eine Reihe weiterer Schutzvorschriften (Zusatzurlaub, Befreiung von Mehrarbeit); entstehende Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen;
-
die Förderung von Einstellung und Beschäftigung Schwerbehinderter durch finanzielle Zuschüsse oder in Form von Leistungen der begleitenden Hilfe;
-
die besondere Interessenvertretung der Schwerbehinderten im Betrieb (vgl. BMA 1998, 69ff.).
Trotz dieser Regelungen und Maßnahmen sinkt die Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten kontinuierlich von 5 % im Jahr 1982 auf 3,9 % im Jahr 1986 (TROST & SCHÜLLER 1992, 40; vgl. auch ECKERT 1996). Der private Sektor erfüllt im Oktober 1996 die Quote mit 3,5 % noch weniger als der öffentliche Sektor mit 5,2 % (BMA 1998, 69ff.). Lediglich der öffentliche Dienst des Bundes erfüllt 1996 mit 6,9 % seine Beschäftigungspflicht und nimmt im öffentlichen Sektor eine Vorbildfunktion ein.
Die Zahlen und Quoten zur Beschäftigungspflicht relativieren sich weiter, wenn man berücksichtigt, dass 80% der beschäftigten Schwerbehinderten nicht als Schwerbehinderte neu eingestellt werden, sondern während eines bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung stellen, zumeist mit dem Einverständnis ihrer Arbeitgeber, die damit Ausgleichszahlungen vermeiden wollen. »So entsteht eine große Gruppe beschäftigter Schwerbehinderter - ›intern rekrutierte Schwerbehinderte‹ oder auch ›schwerbehinderte Insider‹ genannt - , ohne dass viele Menschen von außen eine Chance auf Einstellung bekommen« (GINNOLD 2000, 19). Offensichtlich können weder finanzielle Anreize noch gesetzliche Auflagen wie die Ausgleichsabgabe, die eigentlich der Unterstützung der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt dienen sollen, dazu beitragen, in nennenswertem Maße schwerbehinderte Menschen einzustellen. Zu diesem Bild steht die Feststellung von FRICK & SADOWSKI mit Blick auf die ›intern rekrutierten Schwerbehinderten‹ in einem eigentümlichen Kontrast, es könne nicht von einer systematischen Benachteiligung gesprochen werden, sondern es sei vielmehr so, »dass eine erfolgreiche Integration nicht nur möglich, sondern auch bereits in großem Umfang realisiert ist« (1996, 477).
Im Oktober 2000 kommt es zu einer Novellierung des Schwerbehindertengesetzes, demzufolge die Pflichtquote befristet auf 5 % abgesenkt und die Ausgleichsabgabe gestaffelt wird (vgl. BMA 2000, 78):
-
200 DM monatlich bei einer Beschäftigungsquote von 3% bis unter 5%,
-
350 DM monatlich bei einer Beschäftigungsquote von 2% bis unter 3%,
-
500 DM monatlich bei einer Beschäftigungsquote von 0% bis unter 2%.
Es bleibt abzuwarten, ob mit diesen Neuregelungen das ehrgeizige Ziel von 50.000 neuen Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte erreicht werden kann.
Im Schwerbehindertengesetz von 2000 werden erstmalig auch Integrationsfachdienste gesetzlich verankert (vgl. AG DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN 2000). Nach §37a sollen sie im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit mit Mitteln der Ausgleichsabgabe vor allem für Schwerbehinderte tätig werden. So sollen sie nach § 37b (1) »die Schwerbehinderten beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln und die Arbeitgeber informieren, beraten und Hilfe leisten.« Zu ihren weiteren Aufgaben nach § 37b (2) »gehört es,
-
die Fähigkeiten der zugewiesenen Schwerbehinderten zu bewerten und einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit dem Schwerbehinderten, dem Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung, Rehabilitation oder Eingliederung zu erarbeiten,
-
geeignete Arbeitsplätze ... auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
-
die Schwerbehinderten auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
-
die Schwerbehinderten solange erforderlich am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,
-
die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienststelle über Art und Auswirkung der Behinderung und über entsprechende Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,
-
eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie
-
als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen« (AG DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN 2000, 70f.).
Weiterhin werden Beauftragung und Verantwortlichkeit, fachliche Anforderungen, finanzielle Leistungen und Ergebnisbeobachtung geregelt. Wie die zitierten Passagen deutlich machen, finden sich im neuen SchwbG Begrifflichkeiten und konzeptionelle Merkmale der Unterstützten Beschäftigung wieder. Letztlich werden für die Praxis vor allem die finanziellen Bedingungen darüber entscheiden, welcher Personenkreis in welchem Umfang und mit welchen Rahmenbedingungen auf dieser Rechtsgrundlage unterstützt werden kann.
Gleichwohl gibt es keinen Konsens darüber, auf welcher konzeptionellen Grundlage und mit welchem Selbstverständnis Integrationsfachdienste tätig werden sollen. Vielmehr scheinen sich zwei recht unterschiedliche Modelle abzuzeichnen, wie mehrfach in der Literatur gezeigt wird (vgl. DEUSCH 1998, BURTSCHER 2001, 40-45). So stellt BURTSCHER zwei Arbeitsassistenz-Modelle in Österreich gegenüber (vgl. Tab. 1.2).
Tab. 1.2: Zwei Modelle von Arbeitsassistenz (BURTSCHER 2001, 40)
|
Modell A |
Modell B |
|
Fürsorgeeinrichtung; Anlehnung an Versorgungseinrichtungen |
Anbieten von Dienstleistungen; Anlehnung an Selbstbestimmt-Leben-Grundsätze |
|
Begünstigte bzw. begünstigbare Behinderte; Eingegrenzte Zielgruppe |
Menschen mit besonderen Bedürfnissen; keine Einschränkung |
|
Pflicht zur Arbeit |
Recht auf Arbeit |
|
Mindestleistungspotentiale beim Behinderten |
gemeinsam 100 % Leistungsfähigkeit |
|
Beratung primär im Bereich Erwerbsarbeit |
erweitertes Beratungsverständnis |
|
Diagnostik - Vergangenheit: Was konnte bisher geleistet werden? Anpassung an vorhandene Leistungen/Erfahrungen |
Schwerpunkt Zukunft: Welche Wünsche hat der/die Betroffene? Entwicklung von neuen Perspektiven/Utopien |
|
Qualifizierung ergibt Arbeit |
erst plazieren, dann qualifizieren |
|
Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen (z.B. Geschützte Werkstätten) |
Alternative zu Geschützten Werkstätten |
|
unpolitisch |
aktiv politische Arbeit |
|
Erfolgsmessung: quantitativ |
Erfolgsmessung: qualitativ |
|
Vermittlungsdruck |
Bedürfnisorientiert; Versuch eines flexiblen Zeitrahmens, auch längerfristig |
Modell A steht in der Tradition von Versorgungseinrichtungen, die für eine definierte bzw. abgrenzbare Zielgruppe arbeiten, meist in einem großinstitutionellen Rahmen, wodurch schon strukturell Phänomene der Fremdbestimmung immanent sind. Hier dominieren ein Verständnis von einer Pflicht zur Arbeit und Erwartungen an Mindestleistungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung, da sie nach Beratung und Vermittlung möglichst schnell ohne weitere Unterstützung am Arbeitsplatz zurechtkommen sollen; Hilfen für andere Lebensbereiche sind nicht vorgesehen. Hohen Stellenwert hat die Diagnostik vorhandener Qualifikationen, um daraufhin gezielt einen Arbeitsplatz zu akquirieren. Als Ergänzungsleistung zur Werkstatt für Behinderte (in Österreich: Geschützte Werkstätten) oder zusätzliche Maßnahme im System der beruflichen Rehabilitation gesehen, stellt Modell A das System nicht in Frage, sondern stabilisiert es. Da der Erfolg solcher Arbeitsassistenz nach Vermittlungszahlen gemessen wird, steht man hier unter einem Druck, der dazu führt, dass Menschen mit schwierigeren Startbedingungen eher nicht unterstützt werden.
Modell B bietet demgegenüber Dienstleistungen an und agiert den Kundeninteressen entsprechend: Die Selbstbestimmung der Menschen - unabhängig von Form und Ausmaß von Behinderungen und Unterstüzungsbedarfen - definiert die Formen und Dauer der Unterstützung. Das Recht auf ungeteilte Integration und Arbeit für alle Menschen wird als politisches Leitmotiv gesehen, das intensive, langfristige und u.U. dauerhafte Begleitungsformen erfordert. Gegebenenfalls führt nur die durchgängige Assistenz zur Ergänzung von 100 % der Arbeitsleistung; ein erweitertes Beratungsverständnis nimmt umfassend alle Lebensbereiche mit in den Blick. Über die individuelle Zukunftsplanung, bei der Wünsche, Stärken und Entwicklungspotentiale, aber auch das soziale Netz im Vordergrund stehen, wird die Arbeitsplatzakquisition vorbereitet. Ohne Qualifikationen als Bedingung vorauszusetzen, wird ein geeignetes Arbeitsumfeld zur Platzierung und dann erfolgenden Qualifizierung in regulären Kontexten geschaffen. Modell B wird als Alternative zur Werkstatt für Behinderte verstanden; politisches Ziel ist es, Partizipation und tarifliche Entlohnung zu ermöglichen und auch arbeits-marktpolitisch innovativ zu wirken. Arbeitsassistenz nach diesem Modell verlangt nach einer Erfolgsmessung, die die Qualität von Prozessen statt reiner Vermittlungszahlen beachtet und bewertet. Die Heterogenität der Situationen, Personen und Entwicklungsverläufe benötigt veränderte Förderregelungen, die flexible Formen und Intensitäten der Begleitung zulassen. BURTSCHER bezieht deutlich Stellung für das Modell B, denn »Unterstützte Beschäftigung ohne Emanzipation ist ein Missverständnis« (BURTSCHER 1998).
In diese konzeptionelle Kontroverse ist ein Aspekt eingebunden, der in Deutschland im Vorfeld der gesetzlichen Regelung heftig diskutiert wird: Ob Integrationsfachdienste eher als ergänzendes Element im bestehenden Rehabilitationssystem agieren und sich vorwiegend den Personen im Übergangsbereich zwischen Förderlehrgängen und Werkstatt für Behinderte, also den ›schwer vermittelbaren Grenzfällen‹ widmen sollen oder ob sich eher als alternatives Angebot zum gestuften Rehabilitationssystem, insbesondere zur Werkstatt für Behinderte, verstehen und für alle Personen offen sein wollen, die sich für Unterstützte Beschäftigung entscheiden (vgl. hierzu ERNST 1998, BAG INTEGRATIONSFIRMEN, BAG UB, SOZIALVERBAND REICHSBUND 1998).
Für die schon länger etablierten Institutionen bringen neue Entwicklungen und Umbrüche Verunsicherung und neue Herausforderung mit sich. Wie üblich bei Veränderungen wird darauf unterschiedlich reagiert: Erfolge auf neuen Wegen werden geleugnet (so etwa LÜHR 2000) oder es werden Schreckensszenarien gemalt, etwa mit dem Motto: ›Sich ändern oder untergehen.‹ (ELBE-WERKSTÄTTEN 1999, sicherlich eine der innovativen Werkstätten für Behinderte in Hamburg). Gemeinsamkeit und Differenzen von verschiedenen Konzepten und Institutionen auslotende Betrachtungen werden in der Regel erst später formuliert (so z.B. bei HANNE-MANN 2001, der Potentiale von Integrationsfachdiensten und Werkstätten für Behinderte in einem gestuften Gesamtkonzept zu verbinden versucht). Dies sind exakt die Reaktionen, die im Sonderschulbereich in der Anfangsphase der schulischen Integration auftraten und die in der Regel verständlicherweise auf Innovationen folgen (vgl. SCHLEY 1990).
Ebenso wie nach einiger Zeit der Verunsicherung und Abwehr Sonderschulen begannen, durch kooperative Modelle mit allgemeinen Schulen mit eigener institutioneller Weiterentwicklung auf die kritische Herausforderung durch integrative Entwicklungen in allgemeinen Schulen identitätssichernd zu reagieren, sichern nun auch Werkstätten für Behinderte auf die von außen herangetragene Herausforderung der beruflichen Integration ebenfalls mit eigener institutioneller Weiterentwicklung ihre Identität: Sie bemühen sich, von der Sozialverwaltung unterstützt, verstärkt um Außenarbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter dem rechtlichen Dach der Werkstatt für Behinderte. So wird im Hamburger ›Aktionsprogramm zur Integration von Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt‹ (BAGS 1999b) an erster Stelle genannt, dass »die Beschäftigung von möglichst vielen Menschen mit Behinderungen aus den Werkstätten für Behinderte in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes auf ausgelagerten Arbeitsplätzen (Außengruppen) erfolgen« soll (ebd., 17).
Die Werkstätten für Behinderte in Hamburg haben bereits auf diese Herausforderung insofern reagiert, in dem sie eine Reihe von ausgelagerten Projekten begonnen haben, etwa ein Café, eine Fahrradwerkstatt oder eine Maßnahme für HelferInnen in Kindertagesstätten. Nicht abzusehen ist allerdings, wie es um die Qualität dieser Projekte bestellt ist, ob sie etwa bei der Strukturqualität entsprechend den Prinzipien Unterstützter Beschäftigung den Status als ArbeitnehmerIn, tarifliche Bezahlung und Sozialversicherung enthalten oder ob nach wie vor der Status von MitarbeiterInnen der Werkstatt mit der dortigen geringen Bezahlung gilt und ob im Sinne von Prozessqualität eine entsprechende Unterstützungsdichte wie bei den Praktika der Arbeitsassistenz gewährleistet werden kann. Es scheint sich bisher eher um ein freies Feld pragmatischer Schritte als um eine konzeptionell ausgearbeitete Entwicklung zu handeln - obwohl die entsprechenden Konzepte seit vielen Jahren in Hessen entwickelt sind und praktiziert werden (vgl. etwa ARBEITSGRUPPE AUSSENARBEITSPLÄTZE IN HESSEN 1989, KRATZER-MÜLLER 1997).
Ebenso wie bei schulischen Kooperationsmodellen stellt sich auch im Arbeitsbereich eine gewisse Ambivalenz ein, da einerseits die Öffnung in Richtung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eine positive und zu unterstützende Tendenz ist, andererseits diese Schritte in ihrer Tragweite und Tragfähigkeit deutlich begrenzter sind als andere Formen mit den genannten Qualitätsmerkmalen. Hier können neue Konkurrenzsituationen entstehen, etwa wenn einem Arbeitgeber einerseits ein unterstütztes Arbeitsverhältnis mit ortsüblichem Tariflohn und Kündigungsschutz und andererseits ein ausgelagerter Werkstatt-Arbeitsplatz mit Taschengeld und ohne weitere rechtliche Verpflichtung angeboten wird - dessen Entscheidung ist sicherlich absehbar (vgl. auch HANNEMANN 2001). Dies kann in der Realität zum Ende innovativer Maßnahmen mit höherer Strukturqualität führen, jedenfalls dann, wenn der Außenarbeitsplatz das Ziel der Bemühungen bildet und nicht als eine Übergangsform in ein tarifentlohntes Arbeitsverhältnis verstanden wird.
Festzuhalten bleibt, dass im Bereich der beruflichen Rehabilitation ein Entwicklungsprozess begonnen hat, der von innovativen Projekten mit dem Ansatz der Unterstützten Beschäftigung ausgegangen ist und inzwischen das System der beruflichen Rehabilitation als Ganzes in Bewegung gebracht und auf verschiedenen Ebenen, auch in den etablierten Institutionen, Veränderungen nach sich gezogen hat. Dies ist insofern als widersprüchliche Entwicklung zu verstehen, als einerseits die tradierten Strukturen, Institutionen und Finanzierungswege weiterbestehen, andererseits jedoch neue hinzukommen, die eigentlich nicht bruchlos in die bisherigen Strukturen hineinpassen. So entstehen diverse Widersprüche, die nur historisch zu erklären sind, etwa die Dauersubventionierung der Werkstätten für Behinderte und deren zeitliche Befristung bei betrieblichen Maßnahmen oder die Bildung des Rentenversicherungsbetrages bei realer Anrechnung des höheren Verdienstes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegenüber einer fiktiven Anrechnung des geringeren Verdienstes in der Werkstatt für Behinderte - beides führt real zu Benachteiligungen von Personen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten, und es stellt den rehabilitativen Grundsatz des Vorrangs ambulanter vor stationären Maßnahmen auf den Kopf.
Um die beiden Maßnahmen einordnen zu können, ist es sinnvoll, das strukturelle Umfeld und die Zugangs- und Anschlussmodalitäten in die Betrachtung einzubeziehen.
Wenn die jungen Menschen aus den verschiedenen Formen allgemeinbildender Schulen in Hamburg kommen - seien es Integrationsklassen in Gesamt- bzw. Haupt- und Realschulen, seien es die verschiedenen Sonderschulen - , stehen ihnen unterschiedliche schulische und außerschulische Möglichkeiten der Berufsvorbereitung zur Verfügung (vgl. BSJB 1997 sowie Kap. 1.1.1):
Das Berufsvorbereitungsjahr kann in verschiedenen Formen absolviert werden (BSJB 1997, 6-11):
-
als in der Regel einjähriges BVJ für AbgängerInnen aus Haupt-, Gesamt- und Förderschulen (für Lernbehinderte) mit verschiedenen Schwerpunkten,
-
als in der Regel einjähriges behinderungsspezifisches BVJ für Blinde und Sehbehinderte oder für Körperbehinderte mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung,
-
als behinderungsspezifisches BVJ-TQ für lern- und geistigbehinderte Jugendliche mit Teilqualifizierung, das mit den Schwerpunkten Ernährung, Hauswirtschaft und Gesundheit speziell auf die Perspektive integrativer Zweckbetriebe ausgerichtet ist (vgl. KINDT & KÜHL 1997) und zwei vollzeitschulische Jahre und ein drittes Jahr in Teilzeitform umfasst, oder
-
als integratives BVJ-i für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag (einjährig, vollzeitschulisch) und für Jugendliche mit Behinderungen aus Integrationsklassen (dreijährig), das mit den Schwerpunkten Gartenbau und Floristik (vgl. KROHN 1997) oder Wirtschaft und Verwaltung angeboten wird.
Mit Zuweisung durch das Arbeitsamt können verschiedene von ihm finanzierte Maßnahmen durchlaufen werden (BSJB 1997, 14-19):
-
F-Lehrgänge mit den üblichen zeitlichen Abstufungen (vgl. Kap. 1.1.1) als duale Maßnahmen mit wöchentlich drei Tagen in Betrieben und zwei Tagen Berufsschule, wenn eine Körper-, Sinnes oder Lernbehinderung festgestellt worden ist,
-
die duale Berufsvorbereitung ›Qualifizierung und Arbeit für Schulabgänger‹ (QuAS), die als gemeinsame Maßnahme von Arbeitsamt und Schulbehörde die Chancen auf einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag verbessern soll,
-
einjährige Lehrgänge zur beruflichen und betrieblichen Eingliederung (BBE) für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen mit wöchentlich drei Tagen im Betrieb und zwei Tagen Berufsschule; auf diese Lehrgänge gibt es keinen Rechtsanspruch,
-
eine integrative Berufsvorbereitung (BBE-i), in der BBE-TeilnehmerInnen (einjährig) gemeinsam mit AbgängerInnen mit geistiger Behinderung aus Integrationsklassen (zweijährig sowie drittes Förderungsjahr nach Einzelfallprüfung) in Projekten mit Ernstcharakter in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Hauswirtschaft tätig sind (vgl. GLENZ, SCHULZE & STURM 1997); verzahnt ist das BBE-i mit der Berufsorientierung in einer Gesamtschule (vgl. ROGAL, STURM & VONDAY 1997) sowie nach dem Jahrespraktikum im dritten Jahr mit dem Integrationspraktikum der Hamburger Arbeitsassistenz.
-
Ein maximal zweijähriges Arbeitstraining für Jugendliche mit Behinderungen in Trägerschaft der Werkstätten für Behinderte mit einem wöchentlichen Berufsschultag; entweder in der Form des Arbeitstrainingsbereichs der Werkstätten für Behinderte oder in der Form des Ambulanten Arbeitstrainings in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, durchgeführt von der Hamburger Arbeitsassistenz.
Die Einbindung beider Maßnahmen in den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt stellt sich zusammenfassend folgendermaßen dar (vgl. Abb. 1.1):
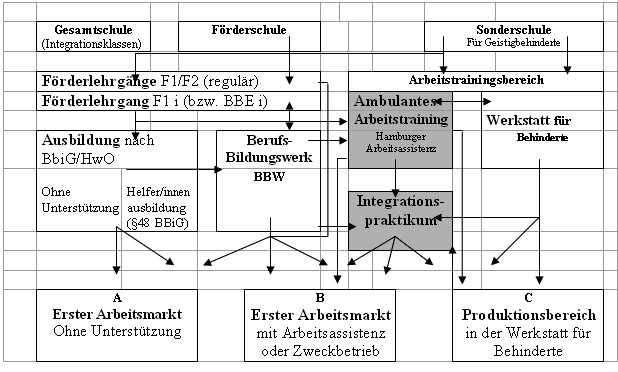
Abb. 1.1: Übergang von der Schule in die Arbeitswelt in Hamburg (HAA 2001, 8)
Die Hamburger Projekte der integrativen Berufsvorbereitung haben bundesweit Orientierung für Anschlüsse an allgemeine integrative Schulen gegeben (vgl. z.B. MOHR-HERRLITZ & GÖRGEN 1997, WIENERS & DECKERS 1997).
Zugänge zum Ambulanten Arbeitstraining können also erfolgen von verschiedenen Sonderschulformen oder aus Integrationsklassen und Berufsschulprojekten (BVJs), aber auch als Wechsel aus Förderlehrgängen oder aus dem Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte. In das Integrationspraktikum können im Anschluss an die berufliche Ersteingliederung also AbsolventInnen des BBE-i oder des Ambulanten Arbeitstrainings übergehen, die noch keinen Arbeitsvertrag bekommen haben, aber auch MitarbeiterInnen aus dem Beschäftigungsbereich der Werkstatt für Behinderte.
Im abschließenden Abschnitt des einführenden Kapitels wird die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz unter zwei Aspekten beschrieben: zum einen unter dem Aspekt der angebotenen Maßnahmen und zum anderen unter dem Aspekt der erzielten Effekte, so wie sie von der Arbeitsassistenz selbst beschrieben werden.
Die Hamburger Arbeitsassistenz wurde 1992 von der Landesarbeitsgemeinschaft ›Eltern für Integration‹ gegründet, einer Interessengruppe, die sich für die Integration von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen einsetzt (vgl. CIOLEK 1995). Sie bietet inzwischen vier unterschiedliche Maßnahmen zur beruflichen Integration an (da die Maßnahmen vor den gesetzlichen Veränderungen begonnen haben, wird hier die bisherige Rechtskonstruktion angegeben):
-
Eingliederungspraktika stehen für Personen zur Verfügung, die aufgrund Art und Schwere ihrer Behinderung als auf dem Arbeitsmarkt nicht, noch nicht oder nicht mehr als vermittelbar gelten (BSHG § 39ff.). Diese Praktika können einen bis sechs Monate dauern und werden vom überörtlichen Sozialhilfeträger auf der Grundlage von BSHG § 39ff. und Leistungsvereinbarungen nach BSHG § 93 finanziert. Die Leistungsvereinbarungen enthalten eine Vermittlungserfolgsquote (50 %) und Kooperationsvereinbarungen mit den Werkstätten für Behinderte. Die Leistungsvereinbarungen beinhalten die Erstellung individueller Fähigkeitsprofile, die Akquisition von Praktikumsstellen mit Option der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis und die personelle Unterstützung während des Praktikums.
Mittels dieser Maßnahme werden in der Modellphase 1992 - 1994 54 Personen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt (vgl. BAGS 1999a, 130-135, HAA 2001, 6).
-
Unterstützung am Arbeitsplatz wird für anerkannte Schwerbehinderte gewährt, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und Bedarf an Unterstützung am Arbeitsplatz haben. Diese Maßnahme dauert in der Regel zwei, maximal drei Jahre mit degressivem Stundeneinsatz. Finanziert wird diese Maßnahme über die Hauptfürsorgestelle (SchwbG § 31 in Verbindung mit SchwbG AV § 27) mittels einer Vereinbarung über Intensität, Dauer und Stundenhonorare für die Arbeitsbegleitung.
1994 werden insgesamt 7.142 Stunden Betreuung geleistet, 1995 10.650 Stunden, der Kostenaufwand liegt dabei individuell zwischen 16.500 DM und 39.500 DM (BAGS 1999a, 135).
-
Das Ambulante Arbeitstraining bezieht sich seit April 1996 auf Personen, die von der Berufsberatung des Arbeitsamtes für den Arbeitstrainingsbereich einer Werkstatt für Behinderte empfohlen werden. Es dauert maximal zwei Jahre und wird als Maßnahme zur beruflichen Ersteingliederung finanziert über die Bundesanstalt für Arbeit (SGB III) und über Vereinbarungen mit den regionalen Werkstätten für Behinderte über Quoten und Kostensätze (90 %; vgl. hierzu HAA 1997a, 2000, 4f.). Die Hamburger Arbeitsassistenz kann wegen der Bedingungen des SGB III § 107, der diese Förderungsmaßnahme in Folge der Werkstättenverordnung an eine anerkannte Werkstatt für Behinderte bindet, nicht direkter Träger der Maßnahme sein. Somit sind die TeilnehmerInnen am Ambulanten Arbeitstraining rechtlich MitarbeiterInnen einer Werkstatt für Behinderte, ohne jedoch in ihr tätig zu sein. Wechsel zwischen beiden Formen des Arbeitstrainings sind jederzeit möglich.
In einem ersten Bericht (GRUND & BEHNCKE 1996) wird ausgesagt, dass die Unterstützung durch ArbeitsassistentInnen aufgrund des Kostenrahmens etwa ein Drittel der Arbeitszeit des unterstützten Praktikanten ausmacht.
-
Das Integrationspraktikum kann seit August 1998 von Personen genutzt werden, die einen Förderungsanspruch nach BSHG § 39ff. und einen Bedarf an betrieblicher Orientierung und Qualifizierung haben. Es folgt also auf eine Förderung zur beruflichen Ersteingliederung, etwa für AbsolventInnen des BBE-i nach dem dritten Förderungsjahr oder des Ambulanten Arbeitstrainings, kann aber auch von BewerberInnen aus der Werkstatt für Behinderte in Anspruch genommen werden, die noch keine hinreichenden Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben machen können. Mit maximal einjähriger Dauer wird es vom überörtlichen Sozialhilfeträger nach BSHG § 39ff. mittels einer Leistungsvereinbarung nach BSHG § 93 über Tageskostensätze finanziert (vgl. hierzu HAA 2000, 6f.). Die Zugangsvoraussetzungen und die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen sind analog zu dem sogenannten Arbeits- bzw. Produktionbereich in einer Werkstatt für Behinderte.
Das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum werden strukturell als duale Maßnahmen durchgeführt: Die Qualifizierung erfolgt in der betrieblichen Situation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe von ArbeitsassistentInnen, zusätzlich findet beim Ambulanten Arbeitstraining ein wöchentlicher Berufsschultag statt (vgl. hierzu ROGAL 2000). Im Unterschied zur beruflichen Ausbildung wird eine berufliche Orientierung mit Erfahrungen in verschiedenen Feldern angestrebt, die notwendigerweise Wechsel von Praktikumsplätzen einschließt; zudem schließen die Maßnahmen mit einem Zertifikat ab, in dem die individuellen Teilqualifikationen beschrieben werden (vgl. HAA 2001, 8).
Die Effekte bei der beruflichen Integration insgesamt werden offenbar sehr unterschiedlich wahrgenommen. So wird die Tätigkeit der Hamburger Arbeitsassistenz von der Hamburger Sozialbehörde als »erfolgreich auf einem sehr hohen Niveau« bezeichnet (BAGS 1999a, 139): »Im Laufe der Jahre seit 1992 wurde eine differenzierte Förder- und Betreuungsstruktur entwickelt, in der Sozialhilfeträger, Hauptfürsorgestelle und Arbeitsamt mit der Hamburger Arbeitsassistenz zusammenarbeiten. Jährlich werden mit Hilfe von Praktika, befristeter Lohnkostenförderung und Job-Coaching jeweils etwa 20 schwerbehinderte Menschen aus der Werkstatt für Behinderte oder vergleichbarer Vorbeschäftigung in den Hamburger ersten Arbeitsmarkt auf sozialversicherungspflichtige und ortsüblich entlohnte Arbeitsverhältnisse integriert. Erfreulich ist die relativ hohe Stabilität der Integration: Von den seit 1992 so vermittelten ca. 200 schwerbehinderten Menschen sind Anfang 2001 noch 119 in einem Arbeitsverhältnis des ersten Arbeitsmarktes« (BAGS 2001, 10). Andererseits stellt der Vorsitzende der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte fest: »Echte Fortschritte sind, nachhaltig ideellen und finanziellen Förderungen sowie vielfachen Appellen zum Trotz, nicht zu verzeichnen« (LÜHR 2000, 2).
Wie steht es also mit den Effekten der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz bei den beiden zu evaluierenden Maßnahmen? Nach deren neuesten Angaben beginnen von April 1996 bis Ende des Jahres 2000 65 Personen das Ambulante Arbeitstraining; dabei überwiegen männliche Teilnehmer deutlich (40 gegenüber 25 weiblichen). Dies hat für die Arbeitsassistenz mit den Anteilen bei den BewerberInnen zu tun, jedoch auch aufgrund der Quotierung durch die Kooperationsverträge mit den Werkstätten für Behinderte mit den engen Grenzen des Aufnahmeverfahrens (vgl. HAA 2001, 15f.). Die Nachfrage liegt nach Angaben der Arbeitsassistenz weit über den durch die Kooperationsverträge mit den Werkstätten für Behinderte definierten Aufnahmemöglichkeiten von 15 TeilnehmerInnen pro Jahr; am Ende der Modellversuchsphase liegen der Arbeitsassistenz etwa 20 Bewerbungen für diese Maßnahme vor (vgl. HAA 2001, 17).
Ein Integrationspraktikum beginnen von August 1998 bis Ende des Jahres 2000 35 Personen, 23 von ihnen haben es bereits beendet; hierbei bilden 19 weibliche gegenüber 16 männlichen TeilnehmerInnen die Mehrheit. Dass der geplante Verlauf der Teilnehmerzahlen - jährlich zehn TeilnehmerInnen - zu verschiedenen Zeitpunkten nicht erreicht werden kann, führt die Arbeitsassistenz auf verschiedene äußere Bedingungen zurück, die phasenweise die notwendige Planungssicherheit beeinträchtigen (vgl. HAA 2001, 19).
Die Zugänge zum Ambulanten Arbeitstraining erfolgen bei 31 Personen direkt aus dem schulischen Bereich (49%), 16 Personen kommen aus dem Arbeitstraining der Werkstätten für Behinderte (25%), sieben Personen wechseln aus Förderlehrgängen (11%), zehn kommen aus mindestens einjähriger Arbeitslosigkeit (15%; vgl. HAA 2001, 20f.). Ins Integrationspraktikum kommen neun TeilnehmerInnen nach Beendigung des Ambulanten Arbeitstrainings (26%) und sieben aus dem BBE-i (20%), zehn sind vorher nach einer Empfehlung zur Werkstatt für Behinderte, in der sie jedoch nicht zu arbeiten begonnen haben, erwerbslos gewesen (29%), jeweils vier (11%) wechseln vom Produktionsbereich der Werkstätten für Behinderte oder aus Förderlehrgängen ins Integrationspraktikum und lediglich eine Person (3%) kommt aus einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis (vgl. HAA 2001, 21).
Für beide Maßnahmen stellt die Hamburger Arbeitsassistenz bis Ende 2000 bei 89 TeilnehmerInnen Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an etwa 200 Orten in verschiedenen Branchen bzw. Arbeitsbereichen bereit, die bei extremer Variabilität durchschnittlich fünf Monate dauern (vgl. HAA 2001, 22). Das Spektrum der Qualifizierungsorte erstreckt sich vom Garten- und Landschaftsbau über Büro-, Hausmeister-, Lager- und Pförtnertätigkeiten, Arbeiten in Einzelhandel, Wäscherei und an Tankstellen, weiter über Recycling, Metallbau, Lackiererei, Tischlerei, Bäckerei und E-Montage bis hin zu Hauswirtschaft, Küche, Restaurant und Hotel.
Was den Verbleib der TeilnehmerInnen angeht, so zeigen die neuesten Angaben der Hamburger Arbeitsassistenz für das Ambulante Arbeitstraining folgendes Bild (vgl. HAA 2001, 27): Von 65 TeilnehmerInnen befinden sich 14 noch in der Maßnahme, 51 haben sie abgeschlossen. Von ihnen wiederum sind 29 in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse eingetreten (57%), zehn in das Integrationspraktikum gewechselt (20%), je vier in das Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte oder in die Erwerbslosigkeit gegangen (je 8%) und je zwei in schulische Qualifizierungsmaßnahmen des BVJ und auf einen Außenarbeitsplatz einer Werkstatt für Behinderte übergegangen (je 4%). Welche Aspekte dabei eine Rolle gespielt haben, wird von der Hamburger Arbeitsassistenz detailliert dargestellt (vgl. HAA 2001, 28f.).
Bedeutsam erscheint dabei, dass bei sechs Arbeitsverhältnissen die Lohnkostenförderung bereits ausgelaufen ist und sie alle weiterbestehen. Von den 29 unterstützten Arbeitsverhältnissen insgesamt bestehen 25; bei den vier beendeten Arbeitsverhältnissen handelt es sich um zwei Kündigungen durch die MitarbeiterInnen zugunsten von berufsschulischen Maßnahmen mit dem Angebot der Wiedereinstellung durch den Arbeitgeber, eine Kündigung in beiderseitigem Einvernehmen, auf die der Übergang in eine Werkstatt und zwischenzeitlich ein Eingliederungspraktikum mit der Option auf Einstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt folgt, sowie eine Kündigung in beiderseitigem Einvernehmen mit dem Anschluss eines Integrationspraktikums sowie eines neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses (vgl. hierzu die detaillierte Darstellung in Kap. 4.4.4).
Der Verbleib der TeilnehmerInnen des Integrationspraktikums stellt sich nach Angaben der Hamburger Arbeitsassistenz dar wie folgt (vgl. HAA 2001, 30): Von 35 TeilnehmerInnen befinden sich Ende des Jahres 2000 zwölf noch in der Maßnahme, 23 haben sie abgeschlossen. Von ihnen sind 18 (78%) in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse übergegangen, vier sind erwerbslos geworden (17%), ein Teilnehmer ist in die Werkstatt für Behinderte gewechselt (5%). Dabei wird lediglich eine durchschnittliche Förderdauer von acht Monaten in Anspruch genommen; bei drei TeilnehmerInnen schließt sich allerdings ein Eingliederungspraktikum an, bevor es zu einem unterstützten Arbeitsverhältnis kommt.
Zusammenfassend geht die Hamburger Arbeitsassistenz davon aus, dass insofern »von einer Vermittlungserfolgsquote in (unterstützte) Arbeitsverhältnisse aus den Maßnahmen von über 85% gesprochen werden« (HAA 2001, 32) kann, als zusätzlich zu den direkten Vermittlungen von 57% beim Ambulanten Arbeitstraining und von 78% beim Integrationspraktikum zu berücksichtigen ist, dass
-
weitere 20% der TeilnehmerInnen aus dem Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum wechseln,
-
die Hälfte der TeilnehmerInnen, die in die Erwerbslosigkeit gegangen sind, nur kurz in den Maßnahmen gewesen sind,
-
einige TeilnehmerInnen durch den Übergang in vollzeitschulische Qualifizierungsmaßnahmen ihre Ansprüche auf berufliche Erstrehabilitation weiterhin behalten.
Nach Angaben der Hamburger Arbeitsassistenz verdienen die ehemaligen TeilnehmerInnen bei ihren ortsüblich bzw. tarifentlohnten, unterstützten Arbeitsverhältnissen durchschnittlich im Monat etwa 1750 DM (vgl. HAA 2001, 32). Der überwiegende Teil der unterstützten ArbeitnehmerInnen arbeitet im Rahmen von Teilzeitverhältnissen, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt etwa 27 Stunden, der durchschnittliche Stundenlohn liegt bei etwa 14,50 DM brutto (vgl. ebd.).
Bis auf zwei Ausnahmen werden alle unterstützten Arbeitsverhältnisse durch Lohnkostenzuschüsse und durch begleitende Hilfen am Arbeitsplatz gefördert. Letzteres geschieht in einem individuell sehr unterschiedlichen Maße, jedoch im Vergleich zu den Eingliederungspraktika auf insgesamt niedrigerem Niveau, da die Phase intensiver Einarbeitung bereits im Ambulanten Arbeitstraining und/oder Integrationspraktikum erfolgt ist. Die Hamburger Arbeitsassistenz gibt als durchschnittliche monatliche Förderungskosten bei den unterstützten Arbeitsverhältnissen insgesamt - also für Lohnkostenzuschüsse und arbeitsbegleitende Hilfen am Arbeitsplatz - für das erste Beschäftingungsjahr ca. 2.300 DM, für das zweite 1.900 DM und für das dritte Beschäftigungsjahr ca. 1.000 DM an. »Im Vergleich zur Förderungshöhe in der Werkstatt für Behinderte (Kostensatz BSHG + Sozialversicherungsbeiträge nach SGB V) ist dieser finanzielle Mitteleinsatz sehr gering« (HAA 2001, 36). Zusätzlich wäre ein höheres Nettoeinkommen der unterstützten Personen zu berücksichtigen, was wiederum Spareffekte für Sozialhilfe- und Wohngeldleistungen mit sich bringt (vgl. hierzu auch die Berechnungen der Hamburger Arbeitsassistenz zum Finanzeinsatz bei ihren Maßnahmen Unterstützter Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in den ersten fünf Jahren ihrer Tätigkeit in HAA 1997c).
Inhaltsverzeichnis
Mit dem Ambulanten Arbeitstraining und dem Integrationspraktikum, den beiden Maßnahmen der Hamburger Arbeitsassistenz, die hier evaluiert werden, werden nicht nur zwei weitere Elemente innerhalb des Systems der beruflichen Rehabilitation für AbgängerInnen aus Sonderschulen und Integrationsklassen erprobt, sondern es wird auch die bisher bestehende Lücke zwischen dem Gemeinsamen Unterricht in allgemeinen und berufsbildenden Schulen und der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt geschlossen (vgl. HINZ 1998, BAGS 1999a, 136). Damit ist Hamburg das einzige Bundesland, das ein durchgängig gemeinsames Aufwachsen, Lernen und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen strukturell ermöglicht. Mittlerweile gibt es am Ambulanten Arbeitstraining orientierte Projekte in Bremen auf Landes- und in Erlangen auf städtischer Ebene. Von bundesweiter Bedeutung ist an diesem Vorhaben darüber hinaus, dass erstmalig ein Vergleich zwischen schon länger etablierten, separierten Ansätzen (Arbeits- und Trainigsbereich der Werkstatt für Behinderte) und neuen, integrativen Ansätzen (Ambulantes Arbeitstraining, Integrationspraktikum) des Übergangs Schule-Beruf bei Menschen mit Behinderungen vorgenommen werden kann.
Mit dem Aufbau entsprechender Strukturen ist allerdings noch nicht ihre Funktionalität gegeben, d.h. es ist noch nicht gesichert, dass sie auch zu den gewünschten Prozessen und Effekten führen. In welchem Maße die entwickelten Strukturen ihren Auftrag auch erfüllen, dies ist Gegenstand der vorliegenden Evaluation.
Wünschenswert wäre es gewesen, die beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum tatsächlich begleitend verfolgen zu können, so wie es ursprünglich mit der Zeitspanne 1998-2000 vorgesehen war. Dies ist aufgrund der äußerst späten Vergabe des Auftrags zur externen Evaluation im April 2000 nicht möglich (vgl. HAA 2000, 36f.). Stattdessen kann Evaluation in der verbleibenden Zeit nur bedeuten, aus einer distanzierten, nicht direkt beteiligten Perspektive die beobachtbaren Effekte zu erheben und die zugrunde liegenden Prozesse retrospektiv zu erschließen.
Nachdem bereits nach fünf Monaten in einem internen Zwischenbericht im September 2000 erste Ergebnisse präsentiert wurden (vgl. HINZ 2000b sowie 2001), basiert der vorliegende Endbericht auf dem Zeitrahmen von Mai 2000 bis Ende März 2001, also einem Zeitraum von elf Monaten. Innerhalb dessen wurden die verschiedenen Teiluntersuchungen geplant, durchgeführt und ausgewertet. Realisiert werden konnte dies nur mittels eines Werkvertrages mit einer Person, die sich in der entsprechenden ›Hamburger Szene‹ auskennt und insofern keine Einarbeitungszeit mehr benötigte. Darüber hinaus wäre die Untersuchung in dieser Form auch nicht möglich gewesen ohne zwei Forschungsseminare an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in deren Rahmen eine ganze Reihe von Studierenden sich mit hohem Engagement einschließlich mehrerer Reisen nach Hamburg und eminentem Zeitaufwand an den Untersuchungen beteiligt und so nicht nur über Forschung gesprochen, sondern sie real erlebt und betrieben haben - mit allen Untiefen und Schwierigkeiten, aber auch mit Erfolgserlebnissen und Spaß. Unter anderem sind im Zusammenhang dieses Evaluationsvorhabens zwei Examensarbeiten entstanden, deren Ergebnisse sich im wesentlichen in den Kapiteln 6 und 7 wiederfinden, jedoch auch in das erste Kapitel eingeflossen sind (vgl. BÖGER 2001, WEZEL 2001).
Bei dieser Evaluation wird von einem systemischen Ansatz ausgegangen, dem entsprechend die TeilnehmerInnen der beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum innerhalb ihres Umfeldes betrachtet werden (vgl. BRONFENBRENNER 1989). Somit stellt sich die Notwendigkeit, die TeilnehmerInnen selbst zu Wort kommen zu lassen. Damit wird sowohl inhaltlich als auch methodisch Neuland betreten, denn es gibt bisher in der Literatur nur sehr wenige Beispiele, in denen Interviews mit Menschen mit geistiger Behinderung einen hohen Stellenwert haben. Zudem muss auch ihr Umfeld eruiert werden. Erst wenn diese u.U. unterschiedlichen Wahrnehmungen der gleichen Situationen und ihrer Vorgeschichten in Beziehung gesetzt werden, kann davon ausgegangen werden, dass ein einigermaßen vollständiges und durch die unterschiedlichen Perspektiven validiertes Bild entsteht.
Der Ansatz dieser Evaluationsstudie misst notwendigerweise subjektiven Theorien einen hohen Stellenwert bei, denn aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen sind keine Verfahren realisierbar, mit denen z.B. aus der Außenperspektive strukturierte Beobachtungen erhoben werden könnten. Die wesentlichen Erkenntnisquellen sind somit die subjektiven Wahrheiten der Beteiligten, ihre Bewertungen und Einschätzungen. Sie werden jeweils in zwei Richtungen befragt: in Richtung auf die wahrgenommenen Prozesse und Effekte und in Richtung auf ihre Haltungen zu wahrgenommenen Prozessen und Effekten. Dies ist wissenschaftlich in der Tradition des Symbolischen Interaktionismus auch insofern legitim und aus-sagefähig, als insbesondere in den letzten Jahren in der Soziologie wie in der Psychologie die hohe Bedeutung subjektiver Theorien mehr und mehr erkannt worden ist, denn sie sind letztlich für alle Beteiligten handlungsleitend (vgl. FLICK 1995, 29-32).
Im Rahmen des Gesamtkonzepts der Evaluation (vgl. Abb. 2.1) wird zunächst von der Gesamtheit der aktuellen und ehemaligen TeilnehmerInnen an den beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum ausgegangen. Sie werden ebenso wie eine Vergleichsgruppe in Werkstätten für Behinderte befragt (vgl. Kap. 3). Dies geschieht mittels eines im Gespräch ausgefüllten Fragebogens und ist eher quantitativ orientiert. Das Anliegen richtet sich hierbei auf die Repräsentativität der Aussagen von möglichst allen TeilnehmerInnen.
Aus den Ergebnissen wird im zweiten Schritt eine kleine Stichprobe von RepräsentantInnen für verschiedene Subgruppen ausgewählt, die dann exemplarisch mittels qualitativer Interviews intensiver befragt werden und ihre spezifische Sicht der Dinge differenzierter darstellen können (vgl. Kap. 4). Dies sind in beiden Gruppen jeweils sechs Personen, die nach inhaltlichen Kriterien als »typische Fälle« (LAMNEK 1988, 178) ausgewählt werden. Ihre Sichtweisen und Aussagen werden dabei mit denen weiterer unmittelbar Beteiligter in Beziehung gesetzt: mit denen von Eltern bzw. anderen Vertrauenspersonen wie Wohngruppenbetreuer oder Ehepartner, weiter mit denen ihrer AssistentInnen und mit denen ihrer Vorgesetzten bzw. in der Werkstattgruppe mit den Aussagen von Eltern oder Vertrauenspersonen und mit denen der GruppenleiterInnen. Diese zweite, intensivere Befragungsrunde wird in der Grafik als jeweils sechs kleine Kreise dargestellt.
Flankierend werden darüber hinaus weitere Personengruppen zu ihrer Einschätzung der beiden Maßnahmen, zur Tragfähigkeit, zu Stärken und Problemen etc. befragt:
-
Die AssistentInnen selbst sind eine wichtige Gruppe, die Aussagen zur Qualität der beiden Maßnahmen machen kann. Diese 17 Personen werden alle befragt, und zwar in schriftlicher Form mittels eines umfangreichen Fragebogens, der eine Mischung aus geschlossenen und offenen Fragen enthält (vgl. Kap. 5). Ergänzend wird auch wiederum eine Parallelgruppe von GruppenleiterInnen aus dem Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten einbezogen, wohl wissend, dass sich institutionelle Rahmenbedingungen, Funktionen und Rollen beider Gruppen deutlich unterscheiden. Dass dies schriftlich geschieht, ist dem engen Zeitbudget geschuldet und scheint dieser Gruppe auch am ehesten zumutbar; zudem kommen auch eine Reihe von Personen aus beiden Gruppen bei der Intensivbefragung in Interviews zu Wort (vgl. Kap. 4).
-
Als quasi zweite Kundengruppe der Arbeitsassistenz müssen auch Vorgesetzte zu Wort kommen. Dies geschieht anhand einer kleinen Auswahl von sieben Betrieben, die über die eigenen Erfahrungen mit beruflicher Integration wie über die Kooperation mit der Arbeitsassistenz mündlich Auskunft geben (vgl. Kap. 6).
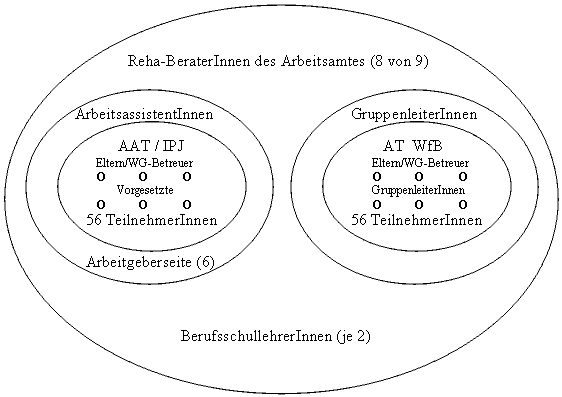
Abb. 2.1: Konzept der Evaluation des Ambulanten Arbeitstrainings und Integrationspraktikums (HINZ 2001, 21)
Über diese beiden unmittelbar beteiligten Gruppen hinaus werden (im größten Kreis auf der Grafik) zwei weitere in die Untersuchung einbezogen:
-
Die Reha-BeraterInnen des Arbeitsamtes für die Ersteingliederung sind als zuweisende Stelle die Gruppe, die ein Bild von den Möglichkeiten des Ambulanten Arbeitstrainings - das vom Arbeitsamt finanziert wird - sowie eine Einschätzung von deren bisherigen Erfolgen und Problemen hat. Die Reha-BeraterInnen werden alle mündlich befragt. Hinzu kommt ein Gespräch mit dem psychologischen Fachdienst, der an der Berufsberatung über Fachgutachten beteiligt ist (vgl. Kap. 7).
-
Eine weitere Gruppe, die direkt mit der Arbeitsassistenz kooperiert und die über deren Arbeit als kritische BegleiterInnen Auskunft geben kann, sind die BerufsschullehrerInnen, die die TeilnehmerInnen am Ambulanten Arbeitstraining an einem Tag in der Woche in Be-rufsschulklassen unterrichten. Hier werden je zwei KollegInnen aus den beiden beteiligten Berufsschulen mündlich befragt, wobei zwei von ihnen nur über Klassen im Ambulanten Arbeitstraining und zwei auch über Klassen im Arbeitstraining der Werkstätten Auskunft geben können, so dass auch hier eine gewisse Parallelisierung der Erfahrungen möglich ist (vgl. Kap. 8).
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Evaluation ihren Schwerpunkt auf die Wahrnehmung der Beteiligten legt, und dies größtenteils in der Form von Interviews. Dadurch soll auch gesichert werden, dass nicht nur Fragen der Untersuchenden, sondern auch die Anliegen und Botschaften der Untersuchten in die Untersuchungsergebnisse eingehen. Schriftliche Formen der Befragung werden nur an den Stellen eingesetzt, wo dies einerseits der Personengruppe zumutbar erscheint und andererseits der Arbeitsaufwand aufgrund größerer Befragtenzahlen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen nicht mehr leistbar ist.
In der Durchführung dieser Evaluationsstudie kommt es insofern zu geringen Veränderungen bei der Intensivbefragung, als zwei der zwölf Personen bekunden, nicht befragt werden zu wollen. Da dies natürlich zu akzeptieren ist, gibt es in der Intensivbefragung der TeilnehmerInnen und ihres Umfeldes lediglich zehn Einzelstudien. Somit werden die Ergebnisse dieser Studie gespeist aus der Kombination der Aussagen von insgesamt
-
112 TeilnehmerInnen an den beiden Formen des Arbeitstrainings bzw. Integrationspraktikums in mündlich erhobener Fragebogenform, sowie
-
zehn TeilnehmerInnen in mündlicher Form, die gekoppelt werden mit den ebenfalls mündlichen Aussagen von
-
sechs Elternteilen,
-
einem Ehemann,
-
fünf ArbeitsassistentInnen,
-
vier Vorgesetzten aus Betrieben des ersten Arbeitsmarktes sowie
-
sechs GruppenleiterInnen in Werkstätten, zudem den Interviews mit
-
sieben Vorgesetzten (hier sind die vier schon genannten enthalten),
-
acht BerufsberaterInnen und zwei Psychologen,
-
vier BerufsschullehrerInnen und den schriftlichen Äußerungen von
-
14 ArbeitsassistentInnen mit Erfahrungen im Ambulanten Arbeitstraining / Integrationspraktikum und
-
11 GruppenleiterInnen des Arbeitstrainingsbereiches der Werkstätten.
Methodisch ist eine Kombination quantitativer und qualitativer Verfahren notwendig, um einerseits die Breite der Erfahrungen erfassen und aufgrund harter empirischer Daten allgemeine Aussagen machen zu können, andererseits aber auch die Spezifik und Tiefe subjektiver Erfahrung abbilden zu können (vgl. LAMNEK 1988, FRIEDRICHS 1990, FLICK 1995).
Dabei stellte sich eine zweifache Herausforderung: Zum einen sind keine Befragungen zu diesem Thema bekannt - denn es gibt diese konkreten Maßnahmen in der Republik außer in Hamburg erst seit kurzer Zeit in Bremen und Erlangen. Zum anderen sind auch Befragungen des im Mittelpunkt der Betrachtung stehenden Personenkreises sehr wenig verbreitet: In der Literatur finden sich im wesentlichen zwei Beispiele, in denen Menschen mit geistiger Behinderung selbst zu Wort kommen, beide Male Frauen: zum einen Interviews (vgl. FRISKE 1995), zum anderen ein Bericht über eine Diskussionsgruppe (vgl. HOFMANN U.A. 1996), der jedoch eine bemerkenswert defizitorientierte Beschreibung der beteiligten Frauen enthält. Darüber hinaus findet sich eine Reihe von internen Befragungen von MitarbeiterInnen in Werkstätten für Behinderte, meist mit geschlossenen Fragen zur Zufriedenheit mit einem ›ja-nein-?-Modus‹ oder einem ›1-2-3-Antwortmodus‹ (vgl. WERKSTATT BREMEN 1999, BUNDESVEREI-NIGUNG LEBENSHILFE 2000, deutlich differenzierter OPPOLZER o.J.).
Die vorliegende Evaluation bewegt sich also in gewisser Weise auf dünnem Eis, jedenfalls dann, wenn man massive Schwierigkeiten sieht, die befragten Personen, die in traditioneller Kategorisierung als geistig behindert bezeichnet werden, als kompetente ExpertInnen für ihre Situation anzuerkennen. In dieser Studie wird davon ausgegangen, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung fähig dazu sind, über ihre Erfahrungen und Situation Auskunft zu geben und sie zu reflektieren; eine Sicht, die durch Erfahrungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gemeinsamen Unterrichts bestärkt worden sind (vgl. BOBAN & HINZ 1993, HINZ 1996a). In Zeiten der Betonung von Selbstbestimmung (BUNDESVEREINIGUNG LEBENS-HILFE 1996) kann nicht mehr in Zweifel gezogen werden, dass Menschen, auch wenn sie als geistig behindert bezeichnet werden, über sich und ihre Vergangenheit, ihre Erfahrungen, ihre gegenwärtige Situation und ihre Hoffnungen und Befürchtungen für die Zukunft kompetent Auskunft geben können. Vielmehr besteht die Herausforderung darin, wie weit Menschen ohne die Zuschreibung einer Behinderung - gerade als forschende WissenschaftlerInnen - in der Lage sind, Zugänge zu diesem kompetenten Wissen zu finden, es wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen sichtbar zu machen.
Aufgrund der beschriebenen, vor allem der zeitlichen Rahmenbedingungen können eine Reihe von ursprünglich gewünschten Fragestellungen nicht bearbeitet und beantwortet werden (vgl. HAA 1999, 30 sowie 2000, 36f.):
-
Die Entwicklung der Bedarfsstrukturen auf schulischem Hintergrund - im Sonderschul- wie im Integrationsbereich - muss sowohl im Rückblick als auch perspektivisch außer Acht bleiben, da nach Rückmeldung durch die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung keine nutzbaren Statistiken vorliegen und ihre Erstellung arbeitsökonomisch nicht leistbar ist.
-
Gleiches gilt für Aussagen über Zuweisungen des Arbeitsamtes zu verschiedenen Rehabilitationsmaßnahmen und Trägern in den vergangenen Jahren. Auch hierzu liegen nach Aussagen des Arbeitsamtes keine nutzbaren Statistiken vor.
-
Ebenso können keine konzeptionellen oder empirischen Aussagen gemacht werden über die Entwicklung der Förderung von Außenarbeitsplätzen in den Werkstätten für Behinderte. Eine Anfrage zu diesem Themenbereich, insbesondere zur Leistungsvereinbarung nach BSHG § 39, an die Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales blieb unbeantwortet.
Insofern ist die Bestandsaufnahme der regionalen Gesamtstruktur des Rehabilitationsangebotes im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt nicht nur unter zeitlichen Aspekten deutlichen Einschränkungen unterworfen.
Trotzdem wird mit dieser Evaluationsstudie eine Fülle von Ergebnissen vorgelegt, die sich in weitestgehendem Neuland bewegen und hoffentlich Nahrung für weiterführende Diskussionen geben werden.
Inhaltsverzeichnis
Mit der Befragung der TeilnehmerInnen des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums wird deren Beurteilung der Maßnahmen erhoben. Die Aussagen derer, für die diese Maßnahmen angeboten werden, sind ein wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste Datum. Dies gilt um so mehr, als in den letzten Jahren mit dem Paradigmenwechsel (vgl. Kap. 1.2) von einer institutionellen zur personalen Orientierung (u.a. in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen) eine deutliche Aufwertung der Fähigkeiten und Kompetenzen des Personenkreises verbunden ist, seine Situation einzuschätzen, sie auch kritisch zu reflektieren und sich Gedanken über Zukunftsperspektiven zu machen. Die Einschätzung der TeilnehmerInnen ist also ein hartes Erfolgskriterium der Maßnahmen; sollten sie durch die Bank mit der Situation unzufrieden sein, wäre dies ein hartes Argument gegen die weitere Existenz der Maßnahmen, eine positive Stellungnahme würde die Maßnahmen deutlich bestätigen und Überlegungen zu zukünftigen Perspektiven wie einen quantitativen und/oder qualitativen Ausbau nahelegen.
Die anstehende Fragestellung, wie die TeilnehmerInnen die Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum einschätzen, kann sinnvoll nur in einer Vollbefragung beantwortet werden. So sollen möglichst alle Personen befragt werden, die jemals an einer der beiden Maßnahmen teilgenommen haben. Um einen zusätzlichen Bezugspunkt zu haben, mit dem die Aussagen der MaßnahmeteilnehmerInnen verglichen werden können, bietet es sich an, eine Parallelgruppe von TeilnehmerInnen am Arbeitstraining in den Werkstätten für Behinderte zu befragen, denn es ist die seit langem etablierte Form der beruflichen Vorbereitung für Menschen mit Behinderungen, zu der das Ambulante Arbeitstraining nun eine Alternative bietet. Bei dem Vergleich werden an sehr vielen Stellen statistische Signifikanzprüfungen durchgeführt. Dabei wird überprüft, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass vorhandene Unterschiede zufällig oder systematisch bedingt und damit überzufällig sind. Mit Hilfe des nichtparametrischen Chi-Quadrat-Tests wird differenziert zwischen nicht signifikanten, also zufälligen Unterschieden (p > 0.10), tendenziell statistisch bedeutsamen Unterschieden (p < 0.10), signifikanten Unterschieden (p < 0.05), die mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht zu-fällig sind, und schließlich sehr signifikanten Unterschieden (p < 0.01), die mit 99%iger Wahrscheinlichkeit systematisch bedingt sind. Im folgenden Text werden die Wahrscheinlickeiten nur angegeben, wenn Tendenzen oder Signifikanzen vorliegen.
Noch eine begriffliche Anmerkung: Wenn im folgenden Text von ›den beiden Maßnahmen‹ gesprochen wird, so sind das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum gemeint. Wenn dagegen von ›den beiden Gruppen‹ die Rede ist, dann bezieht sich dies auf eben den Vergleich zwischen der von der Assistenz unterstützten Personen einerseits und auf behinderte MitarbeiterInnen in den Werkstätten für Behinderte, denn der Vergleich der Situationen dieser beiden Gruppen ist ein zentraler Teil dieser Evaluation.
Eine Befragung in schriftlicher Form droht an den (nicht) vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der zu befragenden Personengruppe zu scheitern. Von daher muss es sich in der Praxis um eine Mischform handeln, die zwar in Form eines Fragebogens erhoben wird, jedoch mündlich erfolgt. Das hat drei Vorteile: Zum ersten ist mit dem Vorlesen und Aufschreiben durch andere die Abhängigkeit von den Lese- und Schreibfähigkeiten der Befragten aufgehoben, zum zweiten kann in der Befragungssituation nachgefragt werden, wenn die Vermutung besteht, dass etwas nicht verstanden worden ist, und zum dritten können zusätzliche Kommentare mit aufgezeichnet werden.
Darüber hinaus ergibt sich die Herausforderung, dass einerseits die Fragen einfach formuliert sein müssen, andererseits bei einer stark strukturierten Befragung im wesentlichen jedoch nur die Fragen in den Köpfen der BefragerInnen zur Sprache kommen. Insofern wird im Fragebogen eine Mischung aus drei Fragetypen versucht (vgl. Fragebögen für die Assistenz- und die Werkstatt-Gruppe in Anhang 11.1 und 11.2):
-
Ein Fragetypus zielt auf den Antwortmodus: ja - nein - Fragezeichen.
-
Ein zweiter Typus zielt auf die Einschätzung diverser Sachverhalte mittels einer fünfstufigen Skala: sehr gut, gut, mittel, schlecht und sehr schlecht. Diese Skala wird illustriert mit einer Figur, die von einem breiten Lachen bis zum Entsetzen unterschiedliche Gesichtsausdrücke zeigt.
-
Ein dritter Fragetypus besteht aus offenen Informationsfragen, deren Antworten stichwort-artig notiert werden.
Durch die Mischung dieser drei Fragetypen wird versucht, einerseits von möglichst allen Befragten Antworten zu erhalten und andererseits ihre Aussagen, Sichtweisen und Einschätzungen deutlich werden zu lassen. Möglicherweise entstehende größere Anteile von fehlenden Angaben werden in Kauf genommen zugunsten differenzierterer Aussagen.
Die Befragung von TeilnehmerInnen wird in Tandems durchgeführt, so dass eine Person die Fragen vorlesen und Blickkontakt halten kann, während die zweite die Antworten notiert. Die jeweils zweite Person sind Studierende der Rehabilitationspädagogik an der Universität Halle-Wittenberg, die im Rahmen eines Forschungsseminars den Fragebogen mit erarbeitet haben, also in das Projekt eingearbeitet sind und die Befragungssituation trainiert haben (vgl. Kap. 2.1). Aus Zeitgründen ist leider kein Probelauf möglich, so dass die Befragung unmittelbar erfolgen muss, auch wenn dies mit einem gewissen Risiko verbunden ist.
Die Befragung findet in der Zeit vom 19. 6. bis 25. 8. 2000 statt, der größte Teil vor Beginn der Sommerferien bzw. der Urlaubszeit; die meisten Befragungen erfolgen in den Räumen der Hamburger Arbeitsassistenz, eine Reihe am Arbeitsplatz oder in den Wohnungen der Befragten. Die Befragung der Vergleichsgruppe wird vom 17. bis 26. 7. in den vier Werkstätten durchgeführt.
Wie bereits oben gesagt, soll es sich um eine Vollbefragung aller aktuellen und früheren TeilnehmerInnen der beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum handeln. Da eine Vergleichsgruppe in den Werkstätten für Behinderte befragt werden soll, müsste diese Gruppe ebenso groß sein wie die Untersuchungsgruppe.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Kreis der Befragten in beiden Gruppen beschrieben, nachfolgend werden allgemeine Merkmale zur Einordnung betrachtet unter Fragestellungen, wie hoch etwa der Anteil der TeilnehmerInnen aus anderen Kulturen bzw. mit anderer Erstsprache ist, aus welcher sozialen Situation die TeilnehmerInnen kommen und anderes.
Bis zum Beginn der Befragung haben am Ambulanten Arbeitstraining und am Integrationspraktikum insgesamt 68 Personen teilgenommen (Stand Juni 2000; vgl. HAA 2000, 22). Von ihnen können 56 Personen, d.h. 82 % befragt werden. Sechs Personen verweigern die Befragung und weitere sechs Personen sind entweder extrem kurz im Arbeitstraining gewesen (vier Personen, ein bis drei Monate) oder es scheint entsprechend der Einschätzung der Arbeitsassistenz bzw. einer Werkstatt für Behinderte aufgrund einer sehr labilen psychischen Verfassung eine Befragung nicht angebracht (bei zwei Personen). Die Stichprobe der Arbeitsassistenz zeigt Tab. 3.1.
Tab. 3.1: Stichprobe der Hamburger Arbeitsassistenz
|
Hamburger Arbeitsassistenz |
Anzahl der Unterstützten |
|
Befragt Verweigert gestrichen |
56 6 6 |
|
Summe |
68 |
Für eine Vergleichsgruppe von MitarbeiterInnen aus den Werkstätten für Behinderte können nach Einzelgesprächen mit den Reha- oder Abteilungsleitungen alle vier Hamburger Werkstätten gewonnen werden. Dabei erweist sich das zunächst angestrebte Zufallsprinzip als nicht durchführbar, da der Aufwand an Vorbereitungen und die Störungen im Betriebsablauf als zu hoch angesehen wird. Insofern wird den Werkstätten die Auswahl der Befragten überlassen, verbunden mit einigen Bitten, nämlich
-
dass das Arbeitstraining nicht zu lange her sein sollte,
-
dass Männer und Frauen zu gleichen Teilen vertreten sein sollten,
-
dass je ein Mitglied des Werkstattrates beteiligt sein sollte,
-
dass Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und aus verschiedenen Produktionsbereichen bzw. Abteilungen vertreten sein sollten und
-
dass in jeder Werkstatt drei Personen des Arbeitstrainingsbereichs beteiligt sein sollten.
Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Befragung freiwillig. Aus Datenschutzgründen tragen die BefragerInnen in den Werkstätten nicht die Namen der Befragten auf den Fragebögen ein, sondern nur eine Nummer, zu der die Liste mit den entsprechenden Namen in den Werkstätten bleibt, so dass die Rekonstruktion für die zweite Befragung gesichert ist.
Entsprechend der Stichprobe der Arbeitsassistenz muss die Stichprobe der Werkstätten für Behinderte ebenfalls 56 Personen umfassen. Da die dortige Befragung zur Befragung der Arbeitassistenzgruppe zeitlich parallel erfolgt, werden gemäß Tab. 3.2 folgende Personen in folgenden Werkstätten befragt und folgende Fragebögen ausgewertet:
Tab. 3.2: Stichprobe der Werkstätten für Behinderte
|
Werkstatt für Behinderte |
befragt |
ausgewertet |
|
Alsterdorfer Werkstätten Elbe-Werkstätten Hamburger Werkstätten Winterhuder Werkstätten |
15 15 15 16 |
13 14 15 14 |
|
Summe |
61 |
56 |
Zur Angleichung der Stichprobengröße werden nach den Kriterien Alter (lange zeitliche Distanz zum Arbeitstraining; Alter 50 - 64) und Informationsgehalt (Häufigkeiten von ›keine Angabe‹, ›weiß ich nicht‹ u.ä.; zwei Befragte waren gar nicht im Arbeitstraining gewesen, wie sich während der Befragung herausstellte) fünf Befragte aus der Auswertung herausgenommen, so dass die Kontrollgruppe ebenfalls 56 Befragte umfasst.
Zwar ist mit dieser Kontrollgruppe statistisch keine Repräsentativität für alle MitarbeiterInnen in Werkstätten für Behinderte gegeben, jedoch sind die Untersucher an der Stichprobenbildung nicht beteiligt, so dass von ihrer Seite keine systematischen Verzerrungseffekte vorliegen und von dieser Befragtengruppe sehr wohl vorsichtig verallgemeinerbare Hinweise auf ihre Wahrnehmung der Situation in den Werkstätten und das dortige Arbeitstraining zu erhalten sind.
Im Fragebogen sind einige Fragen enthalten, die zusätzliche Informationen über den Hintergrund der Befragten ermöglichen. Sie werden im folgenden unter den Begriffen geschlechtliche, biographische, kulturelle und soziale Heterogenität sowie die Heterogenität der Interessen und Freizeitaktivitäten zusammengefasst. Mit ihrer Hilfe lässt sich zudem vergleichen, ob es strukturelle Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt, die sich systematisch auf die Ergebnisse auswirken könnten.
Die geschlechtliche Heterogenität der Befragten stellt Tab. 3.3 dar (alle folgenden Tabellen sind im Internet nachzulesen; die Adresse findet sich im Vorwort). Demnach besteht die Assistenz-Gruppe aus gleich viel Männern und Frauen, bei der Werkstatt-Gruppe ist ein Übergewicht von Männern zu sehen, das etwa 5 % nach oben ausmacht; dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant.
Biographische Heterogenität leitet sich aus der Altersstruktur der Befragten ab. Die Ergebnisse in fünfjähriger Gruppierung hierzu zeigt Tab. 3.4. Während bei der Assistenz-Gruppe die größte Gruppe der Befragten zwischen 21 und 25 Jahre alt ist, gibt es bei der Werkstattgruppe keine so deutliche Dominanz einer Altersgruppe. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen ist signifikant (chi2 = .033).Vergleicht man die Mittelwerte (Arbeitsassistenz: 24,5 Jahre, Werkstätten: 28,3 Jahre), so wird das Ergebnis bestätigt, dass die Werkstatt-Gruppe älter ist als die Assistenz-Gruppe. Überdies ist die Werkstatt-Gruppe deutlich jünger als die Gesamtgruppe aller Beschäftigten in Werkstätten für Behinderte in Hamburg, deren Altersdurchschnitt 1997 mit 38,4 Jahren mehr als zehn Jahre höher liegt (BAGS 1999a, 121) - eine Differenz, die durch die Stichprobenkriterien bedingt und gewollt ist.
Kulturelle Heterogenität wird abgeleitet aus den Fragen nach dem Geburtsort der Befragten und ihrer Eltern sowie nach der Sprache, die in der Familie gesprochen wird. Tab. 3.5 zeigt die Ergebnisse (4 = deutsche Familie, 8 = im Ausland geborene Familie mit anderer Erstsprache): In beiden Gruppen ist der größte Teil der Befragten deutscher Herkunft, die Anteile der aus dem Ausland zugezogenen Familien liegen bei beiden Gruppen unter 10 %. Es gibt keine überzufälligen Unterschiede zwischen den Gruppen. Vergleicht man die Mittelwerte, so gibt es auch hier keine deutlichen Unterschiede (Arbeitsassistenz: 4,79, Werkstätten: 4,46). Folgte man der Hypothese, dass ausländische Jugendliche größere Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche hätten, so ergäbe sich hier ein Nachteil für die Arbeitsassistenz-Gruppe, der jedoch kein gravierender sein dürfte.
Soziale Heterogenität ist in diesem Zusammenhang eine Sache eher ungenauer Einschätzungen. Sie macht sich fest an den Berufen von Vater und Mutter sowie den Berufen der Geschwister, so weit sie in die Skalierung von ungelernten ArbeiterInnen, FacharbeiterInnen, Angestellten, AkademikerInnen einzuordnen sind. Die entsprechenden Mittelwerte für die beiden Gruppen zeigen einen geringen, nicht gegen den Zufall zu sichernden Vorteil für die Assistenz-Gruppe (Mittelwert: 2,41) gegenüber der Werkstatt-Gruppe (Mittelwert: 2,32).
Die Heterogenität der Freizeitaktivitäten schließlich ergibt sich aus den genannten Lieblingsbeschäftigungen während der Freizeit. Die Antworten werden dabei systematisiert nach den Kriterien der Außengerichtetheit und des Aktivitätsgrades: An erster Stelle stehen Bildungstätigkeiten (Lesen, Schreiben, PC- und andere Kurse), gefolgt von Treffen mit FreundInnen (Ausgehen, Kino, Tanzen), eher aktiven Tätigkeiten (Sport, Musik machen, Basteln, kreativ sein), eher passiven Tätigkeiten (Fernsehen, Video, Musik hören), Erholung (Entspannung, Ausruhen, mit Haustier spielen) und schließlich sonstigem. Entsprechend dieser Reihung werden Werte von 1 - 6 vergeben und durch die Anzahl der angegebenen Aktivitäten geteilt, so dass sich vergleichbare Werte ergeben. Der Vergleich der Mittelwerte der Gruppen zeigt, dass es nur einen sehr kleinen, nicht signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen gibt zugunsten der Assistenz-Gruppe (Mittelwert: 3,29) gegenüber der Werkstatt-Gruppe (Mittelwert: 3,39). Was den Grad von Freizeitaktivitäten angeht, gibt es praktisch keinen Unterschied zwischen den Gruppen.
Insgesamt lässt sich also feststellen, dass hinsichtlich verschiedener Heterogenitätsdimensionen wenig Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von Befragten finden. Lediglich ein Altersunterschied von knapp vier Jahren ist signifikant, ansonsten enthält die Assistenz-Gruppe etwas mehr Frauen, etwas mehr Mitglieder ausländischer Herkunft, ihre Mitglieder haben einen etwas höheren sozialen Status und sie sind etwas freizeitaktiver als die der Werkstatt-Gruppe. Systematische verzerrende Einflüsse durch die hier betrachteten strukturellen Hintergründe dürften nicht gegeben sein, zumal die geringen Unterschiede auch nicht gleichsinnig wirksam sind.
Wichtig ist als Voraussetzung für das Arbeitstraining, welchen schulischen Weg die Befragten hinter sich haben und wie sie ihre Schulzeit einschätzen. Dabei wird nach den üblichen zeitlichen Abschnitten vorgegangen: Zuerst wird die allgemeinbildende Schule beleuchtet, dann nach Zukunftsperspektiven und der Beratung im Arbeitsamt gefragt und schließlich die Zeit zwischen allgemeiner Schule und Arbeitstraining betrachtet.
3.3.1.1 Allgemeinbildende Schule, Betriebspraktika und Zukunftswünsche
Zunächst ist von Interesse, welche allgemeinbildenden Schulen die Befragten besucht haben. Da hier erhebliche Bewegungen zwischen verschiedenen Schulformen zu verzeichnen sind, beschränkt sich die Darstellung auf den zuletzt besuchten allgemeinbildenden Schultyp (vgl. Tab. 3.6). Von den 56 Befragten der Assistenz-Gruppe hat ein Viertel Integrationsklassen besucht, jeweils ein Fünftel Schulen für Geistigbehinderte und Förderschulen, kleinere Anteile Schulen für Körper- und für Sinnesbehinderte und schließlich 15 % allgemeine Schulen ohne Integration - hierbei handelt es sich um Personen mit später entstandenen Behinderungen. Bei der Werkstatt-Gruppe dominiert dagegen die Schule für Geistigbehinderte mit einem Drittel der Befragten, gefolgt von je einem Viertel aus Körperbehinderten- und Förderschulen. Diese Unterschiede könnten statistisch nicht größer sein (chi2 = .000). Ein Stück mehr vergleichbar wären sie, wenn bei den früheren SchülerInnen aus Integrationsklassen bekannt wäre, welcher Sonderschulform sie sonst zuzuordnen gewesen wären. Dies lässt sich jedoch nicht genau rekonstruieren; ein sehr hoher Anteil von SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist jedoch anzunehmen (vgl. KÖBBERLING & SCHLEY 2000).
Die Frage nach der Schulfreude wird von beiden Gruppen übereinstimmend (Tab. 3.7) beantwortet: Zwei Drittel der Befragten sind gern zur Schule gegangen, 17 % dagegen nicht, der Rest hat keine Angaben gemacht oder konnte sich nicht entscheiden. Die weitere Frage nach noch vorhandenen FreundInnen aus der Schulzeit beantworten die Befragten ebenfalls sehr ähnlich (Tab. 3.8): Knapp die Hälfte haben noch Kontakt zu SchulfreundInnen, die andere Hälfte verneint dies oder kann sich nicht entscheiden. Sehr große Unterschiede (chi2 = .000) gibt es jedoch bei der Schulfreude in den verschiedenen Schulformen (vgl. Tab. 3.9). Hier geben etwa drei Viertel der ehemaligen SchülerInnen aus Integrationsklassen, etwa die Hälfte aus Förderschulen und Schulen für Geistigbehinderte, jedoch nur ein Viertel aus Schulen für Körperbehinderte an, gern zur Schule gegangen zu sein.
Etwas anders sieht es bei den Betriebspraktika aus, auch wenn hier keine signifikanten Unterschiede vorliegen (Tab. 3.10): Hier sind es etwas über 10 % der Befragten mehr, die in der Assistenz-Gruppe angeben, ein Betriebspraktikum während der Schulzeit gemacht zu haben, als dies in der Werkstatt-Gruppe der Fall ist. Sehr deutlich werden die Unterschiede bei der Frage nach dem Ort des Betriebspraktikums (Tab. 3.11; chi2 = .000): Der deutlichste Unterschied liegt darin, dass fast die Hälfte der Werkstatt-Gruppe ihr Betriebspraktikum ausschließlich in der Werkstatt für Behinderte gemacht hat, während die Assistenz-Gruppe höhere Anteile von Praktika im Dienstleistungsgewerbe und an verschiedenen Orten aufweist. Dies legt die Annahme nahe, dass die Assistenz-Gruppe schon während der Schulzeit stärker auf den ersten Arbeitsmarkt orientiert war als die Werkstatt-Gruppe, es sich also nicht um kurzfristige Entscheidungen handelt, sondern um langfristige Orientierungen, wer in das Ambulante Arbeitstraining oder in das Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte geht.
Die Frage, ob die Befragten während der Schulzeit eine Idee ihrer beruflichen Zukunft hatten, fördert ebenso sehr signifikant unterschiedliche Ergebnisse zutage (Tab. 3.12; chi2 = .007): Während etwas mehr als die Hälfte der Werkstatt-Gruppe dies bejaht, tun dies mehr als drei Viertel der Assistenz-Gruppe. Auch bei den Ideen selbst gibt es Unterschiede zwischen den Gruppen (Tab. 3.13, chi2 = .010): Während in der Assistenz-Gruppe der Schwerpunkt mit fast der Hälfte der Ideen im Dienstleistungsbereich liegt und Industrie/Handwerk, Landwirtschaft und Sonstiges mit je reichlichen 10 % vertreten sind, rangieren bei der Werkstatt-Gruppe Industrie/Handwerk und Dienstleistung mit je 20 % ganz vorn; weitere Alternativen dazu werden kaum gesehen.
Diese Ergebnisse können verstanden werden als deutliche Tendenz zu ausgeprägteren Wünschen der Befragten der Assistenz-Gruppe bezüglich ihrer späteren Tätigkeit; das breitere Spektrum entspricht dabei dem breiteren Erfahrungsfeld der betrieblichen Praktikumserfahrungen.
Eine weitere Frage zielt auf GesprächspartnerInnen bezüglich der Zukunft und ihre Empfehlungen. Hier finden sich eher ähnliche Antworten in beiden Gruppen (vgl. Tab. 3.14): Eltern und LehrerInnen in der Schule sind die dominierenden GesprächspartnerInnen, wobei der Anteil von Empfehlungen, die nur durch LehrerInnen erfolgen, bei der Werkstatt-Gruppe etwas höher ist als bei der Assistenz-Gruppe.
Hinsichtlich der Empfehlungen selbst gibt es jedoch sehr signifikant unterschiedliche Angaben bei beiden Gruppen (vgl. Tab. 3.15; chi2 = .000): Bei fast 70 % fehlenden Angaben teilt sich der Rest der Empfehlungen sehr polarisiert auf: Bei der Assistenz-Gruppe findet sich keine einzige Empfehlung von Eltern und/oder LehrerInnen für den Sonderarbeitsmarkt, sondern meist wird für den ersten Arbeitsmarkt votiert oder für eine Qualifizierungsmaßnahme, während die Eltern und/oder LehrerInnen der Werkstatt-Gruppe fast ausschließlich für den Sonderarbeitsmarkt votieren.
Es scheint eine Tendenz zu zwei getrennten Gruppen mit langfristigen Orientierungen zu geben: Angehörige der Assistenz-Gruppe sind während der Schulzeit bereits breiter auf den ersten Arbeitsmarkt orientiert, stellen sich mehr und unterschiedlichere Tätigkeiten im späteren Berufsleben vor und werden vom Umfeld darin bestärkt; Angehörige der Werkstatt-Gruppe werden dagegen während der Zeit in Sonderschulen eher auf die Werkstatt für Behinderte orientiert und ebenfalls von ihrem Umfeld darin unterstützt. Andersherum formuliert hieße dies, dass die entsprechenden schulischen und umfeldbezogenen Orientierungen dazu führen, dass die Befragten sich dann auch im jeweiligen Arbeitstraining befinden.
3.3.1.2 Berufsberatung durch das Arbeitsamt
Eine wichtige Etappe für die Berufsfindung dürfte die Berufsberatung des Arbeitsamtes darstellen. Hierzu werden verschiedene Fragen gestellt. Zunächst wird nach der Berufsberatung überhaupt gefragt (vgl. Tab. 3.16): Während bei der Assistenz-Gruppe 77 % bejahen und 13 % verneinen, bei der Berufsberatung gewesen zu sein, liegen die Anteile bei der Werkstatt-Gruppe bei 61 % und 25 % - kein signifikanter Unterschied. Offenbar sind - da alle Befragten bei der Berufsberatung gewesen sein müssen - die Erinnerungen unterschiedlich.
Sehr signifikante Differenzen zwischen den Gruppen gibt es bei dem Inhalt der Empfehlung durch die BerufsberaterInnen (vgl. Tab. 3.17; chi2 = .001): Zwar liegen die fehlenden Angaben bei etwas über der Hälfte der Befragten, weshalb die Ergebnisse mit Vorsicht zu werten sind, jedoch unterscheiden sich die angegebenen Empfehlungen derart, dass für die Werkstatt-Gruppe die Empfehlungen in Sonderinstitutionen wie die Werkstatt für Behinderte dominieren, während bei der Assistenz-Gruppe der größte Anteil der Empfehlungen sich auf den ersten Arbeitsmarkt bezieht und von Qualifizierungsmaßnahmen und relativ wenig Sonderinstitutionen gefolgt wird. Die Reha-BeraterInnen des Arbeitsamtes haben offenbar von den beiden Gruppen ein unterschiedliches Bild, dem die unterschiedlichen Zuweisungen dann auch entsprechen.
Die Frage danach, wie die Beratung den Befragten gefallen hat, weist ebenfalls einen hohen Anteil von über 40 % fehlender Angaben auf. Dennoch können die gegebenen Antworten, wenngleich die Mittelwerte zwischen ›gut‹ und ›mittel‹ dicht beieinander liegen (bei der Assistenz-Gruppe mit 2,68 geringfügig besser als bei der Werkstatt-Gruppe mit 2,77), signifikant unterschiedliche Tendenzen deutlich machen (vgl. Tab. 3.18; chi2 = .020): Während die Angaben der Werkstatt-Gruppe sich der Normalverteilung entsprechend im mittleren Bereich konzentriert und nur vereinzelte Extremvoten (›sehr gut‹, ›sehr schlecht‹) vorkommen, weicht das Profil der Assistenz-Gruppe insofern davon ab, als die mittleren Voten (›mittel‹, ›schlecht‹) weniger vorkommen, dafür aber das Votum ›sehr schlecht‹ häufiger vertreten ist. Die Streuung der Antworten ist bei der Assistenz-Gruppe deutlich größer als bei der Werkstatt-Gruppe, die Zufriedenheit ist eher extrem hoch oder extrem niedrig.
Die letzte Frage zur Berufsberatung bezieht sich schließlich auf die Information durch die BeraterInnen über die Existenz der Arbeitsassistenz und des Ambulanten Arbeitstrainings. Hierbei zeigen sich keine großen Unterschiede zwischen den Gruppen, jedoch zeigen die Antworten kein positives Bild der gegebenen Informationen (Tab. 3.19): Lediglich 20 % der Befragten können sich erinnern, über die Existenz von Arbeitsassistenz und Ambulantem Arbeitstraining informiert worden zu sein, fast 40 % verneinen dies explizit. Wenngleich hier mit über 40 % ein erheblicher Unsicherheitsfaktor über die Repräsentativität der Antworten gegeben ist und in Betracht gezogen werden muss, dass das Ambulante Arbeitstraining erst seit 1996 besteht und vor dieser Zeit nicht darüber informiert werden konnte, so ist dies doch kein positives Ergebnis, wenn man der Information über alle Möglichkeiten innerhalb der Reha-Beratung einen hohen Stellenwert gibt.
Zusammenfassend kann aus den Ergebnissen zur Berufsberatung geschlossen werden, dass sie beiden getrennten Gruppen aus der Schulzeit sich auch bei der Berufsberatung fortsetzen: Wer auf den ersten Arbeitsmarkt will, bekommt offenbar auch in der Regel den Hinweis auf das und die Zuweisung zum Ambulanten Arbeitstraining, jedoch teilweise nach einer als extrem gut oder schlecht wahrgenommenen Beratung. Wer dagegen aus verschiedenen Sonderschulen den bewährten Weg in das Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte wählt, hat bei der Beratung weder extreme Probleme noch extreme Freude - er läuft allerdings Gefahr, gar nicht zu erfahren, dass es auch das Ambulante Arbeitstraining der Hamburger Arbeitsassistenz gibt.
3.3.1.3 Berufsorientierung
Eine weitere Frage richtet sich auf den unmittelbaren Anschluss nach Ende der Schule. Die Antworten sind sehr vielfältig, so wie offenbar auch die Wege der Befragten (vgl. Tab. 3.20): Innerhalb der Assistenz-Gruppe geht ein Drittel in integrative Berufsschulprojekte (BVJ-i bzw. BVJ-TQ und BBE-i; vgl. hierzu Kap. 1.5), ein weiteres Drittel geht in andere berufs-schulische Qualifizierungsmaßnahmen, während jeweils unter 10 % direkt in das Ambulante oder das Arbeitstraining der WfB oder in die Arbeitslosigkeit gehen oder Sonstiges tun. In der Werkstatt-Gruppe dominiert demgegenüber mit fast zwei Dritteln das Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte, gefolgt von einem Achtel berufsschulischer Qualifizierungsmaßnahmen und Sonstigem. Integrative Angebote der Berufsschulprojekte oder das Ambulante Arbeitstraining sind hier nur wenig vertreten - was wiederum für zwei fast getrennte Gruppen und Wege spricht, was aber auch die Folge davon sein kann, dass ehemalige SonderschülerInnen in der Regel bereits 13, ehemalige IntegrationsklassenschülerInnen dagegen meist erst zehn Schulbesuchsjahre hinter sich haben.
Diese eher berufsvorbereitend orientierte Phase bekommt überwiegend positive Rückmeldungen von den Befragten, ohne nennenswerte Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.21): Die gleichsinnige Richtung der Beurteilung gilt, wenngleich die Mittelwerte der Gruppen zwischen ›gut‹ und ›mittel‹ zeigen, dass die Werkstatt-Gruppe ihre nachschulischen Angebote etwas positiver wahrnimmt (Mittelwert: 2,17) als die Assistenz-Gruppe (Mittelwert: 2,42). Dies dürfte auf den etwas höheren Anteil der sehr guten Beurteilungen bei der Werkstatt-Gruppe zurückzuführen sein. Auch die Betrachtung der wahrgenommenen Qualität der verschiedenen Angebote führt nicht zu signifikanten Ergebnissen; negative Stellungnahmen sind ohnehin die Ausnahme, und selbst die Arbeitslosigkeit wird mit dem gesamten Spektrum von sehr gut bis sehr schlecht wahrgenommen.
Die bisher dargestellten Ergebnisse lassen das folgende Zwischenfazit zu: Wir haben es mit zwei unterschiedlich orientierten Gruppen zu tun, was während der Schulzeit bereits in unterschiedlichen Berufspraktika deutlich wurde, deren Zufriedenheit mit der Berufsberatung sich durchaus unterschiedlich darstellt, die jedoch mit den verschiedenen Möglichkeiten der Berufsorientierung ähnlich zufrieden sind (vgl. Kap. 1.5).
Ein zentraler Teil der Befragung beschäftigt sich mit dem Arbeitstraining selbst. Hierzu werden insgesamt 27 Fragen gestellt, die in der folgenden Darstellung teilweise zusammengefasst werden.
Im Vorgriff auf Kap. 3.3.2.8 erscheint es bereits hier wichtig darauf hinzuweisen, dass trotz unterschiedlicher Funktion und Finanzierung beide Maßnahmen, das Ambulante Arbeitstraining wie das Integrationspraktikum, von den TeilnehmerInnen in sehr ähnlicher Weise wahrgenommen werden und sehr ähnliche Strukturen aufweisen. Da für beide Maßnahmen die gleichen Fragen gestellt werden, werden sie im folgenden zusammengefasst und mit dem Arbeitstraining der Werkstätten für Behinderte vergleichen. Lediglich die Einschätzung des Berufsschulunterrichts, der während des Integrationspraktikums nicht angeboten wird, bezieht sich ausschließlich auf das Ambulante Arbeitstraining. Die bestehenden Unterschiede zwischen Ambulantem Arbeitstraining und Integrationspraktikum werden im Kap. 3.3.2.8 aufgeführt.
3.3.2.1 Vorkenntnisse und Startsituation
Begonnen wird mit zwei Fragen nach der Kenntnis der beiden Möglichkeiten des Arbeitstrainings. Demnach kennen alle Befragten der Werkstatt-Gruppe und ein großer Teil der Assistenz-Gruppe (88 %) die Werkstätten für Behinderte - 10 % der Assistenz-Gruppe kennen sie jedoch nicht (vgl. Tab. 3.22). Auf die Frage, wie sie sie kennengelernt haben, gibt es sehr signifikant unterschiedliche Antworten (vgl. Tab. 3.23; chi2 = 000): Angehörige der Assistenz-Gruppe kennen die Werkstatt für Behinderte zu jeweils etwa einem Viertel von dortiger Arbeit, vom Praktikum oder von Besuchen; die Werkstatt-Gruppe hat die Werkstatt für Behinderte demgegenüber ebenfalls zu je einem Viertel durch Praktika und BerufsberaterInnen sowie zu je einem Zehntel durch Schule und das persönliche Umfeld kennengelernt - all dies sind keine überraschenden Ergebnisse.
Die Arbeitsassistenz und das Ambulante Arbeitstraining kennt die Assistenz-Gruppe logischerweise vollständig, jedoch nur 60 % der Werkstatt-Gruppe - ein sehr signifikanter Unterschied (vgl. Tab. 3.24; chi2 = .000) und wiederum kein Zeichen für einen guten Kenntnisstand über die Arbeitsassistenz.
Auch bei der Frage, woher die TeilnehmerInnen die Arbeitsassistenz kennen, gibt es sehr signifikant unterschiedliche Antworten, was schon im hohen Anteil der Werkstatt-Gruppe ohne Kenntnis begründet ist (vgl. Tab. 3.25; chi2 = .000): Bei der Assistenz-Gruppe fällt die breite Verteilung der Informationswege auf: Zu etwa gleichen Teilen sind die TeilnehmerInnen in den Schulen, über die BerufsberaterInnen, durch die Eltern, durch Personal der Werkstätten für Behinderte, durch Eigenaktivitäten der Arbeitsassistenz und auf sonstigen Wegen auf die Arbeitsassistenz gestoßen. Dagegen sind für die Werkstatt-Gruppe das Personal der Werkstatt für Behinderte und Sonstige die primären Informationswege.
Darüber hinaus werden die TeilnehmerInnen nach ihren Hoffnungen und nach ihrem Gefühl am Beginn des Arbeitstrainings befragt.
Die Gefühle am Beginn sind in beiden Gruppen sehr vielfältig und zwischen ihnen signifikant unterschiedlich (Tab. 3.26; chi2 = .026): Fasst man sie in positiven und negativen Kategorien zusammen, so überwiegen in beiden Gruppen die positiven gegenüber den negativen Gefühlen. Für beide Gruppen gilt, dass sie mit gemischten Gefühlen in das Arbeitstraining gehen.
Ähnliches gilt auch für die Hoffnungen am Beginn des Arbeitstrainings, nach denen offen gefragt wird (Tab. 3.27; chi2 = .004): Am häufigsten wird ›nichts Konkretes‹ genannt; bei der Assistenz-Gruppe gefolgt von der Hoffnung auf einen Arbeitsplatz und darauf, sich zu bewähren, während in der Werkstatt-Gruppe das Dazulernen und der Arbeitsplatz, möglichst außerhalb der Werkstatt für Behinderte eine Rolle spielt. Sicher tragen die hohen Anteile nicht gegebener Antworten zum sehr signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen bei.
3.3.2.2 Tätigkeiten
Die Fragen nach den Tätigkeiten im Arbeitstraining umfasst die unmittelbaren Bereiche der Arbeit.
Die erste, offen gestellte und nachträglich systematisierte Frage richtet sich auf den Beschäftigungsbereich des Arbeitstrainings, wobei die beiden Gruppen ein äußerst unterschiedliches Beschäftigungsprofil zeigen (vgl. Tab. 3.28; chi2 = .000): Demnach arbeitet fast die Hälfte der Assistenz-Gruppe im weitesten Sinne in der Gastronomie (z.B. Restaurant, Hotel, Küche, Kantine), gefolgt von einem Viertel im Dienstleistungsgewerbe (Call-Center, Kindergarten, Altersheim, Gericht, Hausmeisterei etc.). Büro, Industrie und Handwerk spielen eine untergeordnete Rolle. Deutliche Unterschiede zur Werkstatt-Gruppe bestehen zum einen in der dortigen Dominanz der Bereiche Industrie und Handwerk und dem relativ hohen Anteil verschiedener Bereiche im Arbeitstraining.
Hieraus lässt sich zweierlei folgern: Zum einen nennen die Befragten offenbar häufig die eine dominierende, evtl. schönste oder längste Tätigkeit, obwohl sie zumindest in der Werkstatt alle durch verschiedene Abteilungen laufen dürften, zum anderen gibt es aber auch zwei sehr deutlich unterschiedliche Profile der Tätigkeitsbereiche.
Ein weiterer sehr signifikanter Unterschied zeigt sich in den Antworten auf die Frage, ob der Arbeitsplatz den eigenen Wünschen entsprochen hat (vgl. Tab. 3.29; chi2 = .001). Während der Arbeitsplatz in der Assistenz-Gruppe zu 60 % eigenen Wünschen entspricht, ist dies in der Werkstatt-Gruppe nur zu 40 % der Fall; bestärkt wird dies durch die negativen Aussagen, die bei 25 % und 55 % liegen. Offenbar folgen die Arbeitstrainingsplätze in der Assistenz-Gruppe in höherem Maße den individuellen Wünschen, was dem Vorgehen der Arbeitsassistenz mit der Entwicklung eines individuellen Interessen- und Fähigkeitsprofils auch entspricht.
Aufgrund der möglichen Kritik am Ambulanten Arbeitstraining, dort werde nur mit einer sehr geringen Breite auf einen spezifischen Arbeitsplatz hin qualifiziert, wird nach verschiedenen Arbeitsbereichen gefragt, in denen im Arbeitstraining Erfahrungen gemacht werden - mit einem überraschenden Ergebnis, da die Gruppen keine deutlichen Unterschiede zeigen (vgl. Tab. 3.30): Die Befragten geben tendenziell die gleiche Anzahl von unterschiedlichen Bereichen an, in denen sie Erfahrungen sammeln, wobei die Häufigkeit bei mehr als drei Bereichen stark abnimmt. Bei einem Vergleich der Mittelwerte zeigt sich, dass die Assistenz-Gruppe in etwas weniger Bereichen Erfahrungen gesammelt hat als die Werkstatt-Gruppe (Assistenz: 2,1 Bereiche, Werkstatt: 2,4 Bereiche), jedoch ist auch dies statistisch nicht signifikant. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass eine Reihe von Befragten ihre Arbeitstrainings noch nicht beendet hat, die Erfahrungsbreite über den Gesamtzeitraum also noch zunehmen dürfte. Die Kritik an einer schmalen Qualifizierung im Ambulanten Arbeitstraining geht diesen Aussagen zufolge ins Leere.
Sehr signifikant unterschiedliche Aussagen gibt es jedoch auf die Frage nach der Anzahl der Betriebe, in denen Arbeitstraining stattgefunden hat - was angesichts der verschiedenen Konstellationen nicht überrascht (vgl. Tab. 3.31; chi2 = .000): Während drei Viertel der Werkstatt-Gruppe das Arbeitstraining - wie vorgesehen - in einem Werkstatt-Betrieb absolviert hat und immerhin ein Viertel die Werkstatt für Behinderte gewechselt hat, ist es bei der Assistenz-Gruppe - ebenfalls wie vorgesehen - umgekehrt: Je ein Viertel ist in einem, in zwei, in drei und in vier Betrieben im Arbeitstraining gewesen. Dies bestätigen auch die Mittelwerte, nach denen das Arbeitstraining in der Werkstatt durchschnittlich in 1,37 Betrieben, das Ambulante Arbeitstraining dagegen in 2,41 Betrieben stattfindet - ein sehr signifikanter Unterschied (.000). Für die Assistenz-Gruppe wird weiter ausgesagt, dass in den verschiedenen Betrieben darüber hinaus zu zwei Dritteln unterschiedliche Tätigkeitsbereiche anzutreffen sind (vgl. Tab. 3.32).
In einer weiteren Frage geht es um die Unterstützungspersonen am Arbeitsplatz; hierbei gibt es ebenfalls ein signifikant unterschiedliches Bild (vgl. Tab. 3.33; chi2 = .072): Wenig überraschend erscheint die hohe Dominanz der GruppenleiterInnen mit über 80 % Anteil in den Werkstätten für Behinderte, die nur in geringem Umfang durch andere - wie die KollegInnen - ergänzt wird; hier ergibt sich bei der Assistenz-Gruppe insofern ein anderes Bild, als die AssistentInnen zwar mit zwei Dritteln ebenfalls dominieren, jedoch andere Beteiligte wie Chefs und KollegInnen in höherem Maße unterstützend wahrgenommen werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Tätigkeiten weisen in beiden Gruppen höchst unterschiedliche Profile auf, die beim Ambulanten Arbeitstraining in höherem Maße den individuellen Wünschen entsprechen als in der Werkstatt für Behinderte. Das Ambulante Arbeitstraining bietet ein ebenso breites Erfahrungsfeld wie die Werkstatt für Behinderte, keine Schmalspurqualifizierung, und umfasst mehr unterschiedliche Betriebe; zudem sind die Unterstützungspersonen im Ambulanten Arbeitstraining weiter gefächert, während es sich in der Werkstatt vor allem um die GruppenleiterInnen handelt.
3.3.2.3 Soziale Situation
Mit der sozialen Situation im Arbeitstraining beschäftigen sich zwei Fragen: das Auskommen mit den KollegInnen und die Frage nach neu gewonnenen FreundInnen.
Das Auskommen mit den KollegInnen wird in einer fünfstufigen Skala eingeschätzt; dabei weichen die Ergebnisse wenig voneinander ab (vgl. Tab. 3.34): Zunächst ist festzuhalten, dass etwa drei Viertel der TeilnehmerInnen ihr Auskommen mit den KollegInnen - einerseits in der Werkstatt für Behinderte, andererseits im Betrieb des ersten Arbeitsmarktes - als ›gut‹ oder ›sehr gut‹ bezeichnen, der Rest verteilt sich auf die übrigen Antwortmöglichkeiten. Dabei ergeben die Mittelwerte, die bei beiden Gruppen zwischen ›sehr gut‹ und ›gut‹ liegen, ein etwas günstigeres, jedoch nicht signifikant unterschiedliches Bild für die Werkstatt- als für die Assistenz-Gruppe (1,85 gegenüber 1,91). Dennoch, dass die TeilnehmerInnen das Auskommen mit KollegInnen in den Betrieben des ersten Arbeitsmarktes sehr ähnlich gut wahrnehmen wie es in den Werkstätten für Behinderte geschieht, ist ein Beleg für die Tragfähigkeit sozialer Netzwerke auf dem ersten Arbeitsmarkt und ein Beleg gegen die These, dass dort Hänseleien und Mobbing durchgängig an der Tagesordnung wären.
Sehr signifikante Unterschiede (chi2 = .000) zeigen sich dagegen bei der Frage nach neuen FreundInnen (vgl. Tab. 3.35): Zwar sagt jeweils ein Viertel beider Gruppen, dass die TeilnehmerInnen keine neuen FreundInnen gewonnen hätten. Die Frage wird dagegen von zwei Dritteln der Werkstatt-Gruppe, jedoch nur von einem Drittel der Assistenz-Gruppe bejaht, von der sich ein weiteres Drittel nicht festlegt. Auffällig sind an dieser Stelle eine Vielzahl von nachfragenden Kommentaren, woran sich denn ein Freund festmachen würde u.ä. Festzuhalten bleibt das Ergebnis, dass ein fast doppelt so großer Teil der Werkstatt-Gruppe neue Freundschaften bestätigt.
Die Ergebnisse zur sozialen Situation legen nahe, von einem Gefühl guten Eingebundenseins in die Betriebe auszugehen, die jedoch auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht in gleichem Maße wie in den Werkstätten zu neuen Freundschaften führt.
3.3.2.4 Verhältnis zu AssistentInnen und GruppenleiterInnen
Der Bezug zu ArbeitsassistentInnen bzw. GruppenleiterInnen ist ein weiterer Schwerpunkt der Befragung. Hier schätzen die TeilnehmerInnen in einer dreistufigen Skala ein, in welchem Maß sie ihre AssistentInnen bzw. GruppenleiterInnen als freundlich, unterstützend und erreichbar wahrnehmen. Bei keinem der Werte gibt es signifikante Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der AssistentInnen und der GruppenleiterInnen. Mal sind die AssistentInnen etwas freundlicher und unterstützender, mal sind die GruppenleiterInnen besser erreichbar, auch das Gegenteil kommt vor; von daher kann auf die detaillierte Darstellung verzichtet werden, zumal diese Werte gemeinsam mit anderen in einen AssistentInnen-/GruppenleiterInnen-Index eingehen, der später dargestellt wird.
Ergänzend werden drei Fragen gestellt: nach vorkommendem Ärger, nach Wünschen und nach der Rolle der unterstützenden Personen.
Bei vorkommendem Ärger zeigt sich ein gerade eben signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.36; chi2 = .097): Hier gibt es einen 10%-Unterschied zwischen beiden Gruppen, mit einem guten Drittel wird in der Assistenz-Gruppe mehr Ärger angegeben als mit einem Viertel in der Werkstatt-Gruppe. Die unentschiedenen und unterbliebenen Antworten können jedoch das Bild deutlich verändern, je nachdem, in welche Richtung tendiert würde; von daher sollten diese Unterschiede nicht überbewertet werden.
Einen gewissen Widerspruch bilden die geäußerten Wünsche an die UnterstützerInnen (vgl. Tab. 3.37), wo zwar 10% der Werkstatt-Gruppe mehr keine Angaben machen, die Assistenz-Gruppe jedoch mit einem Drittel explizit Wunschloser vorne liegt. Sie wünscht sich Diverses von ihren UnterstützerInnen - u.a. mehr und weniger Unterstützung, besseres Eingehen - in eher geringem Maße, wogegen bei der Werkstatt-Gruppe der Wunsch nach besserem Eingehen mit fast 30 % dominiert. Zwar fällt hier die Signifikanz deutlicher aus (chi2 = .047), jedoch sollten auch hier die hohen Anteile unterbliebener Antworten vor vorschnellen Interpretationen bewahren.
Als weiterer Aspekt wird nach der Rolle der Unterstützenden gefragt, ob sie eher wie Berater, Lehrer, Chefs oder Freunde seien. Hierauf geben die Gruppen sehr signifikant unter-schiedliche Antworten (vgl. Tab. 3.38; chi2 = .000): Da das Spektrum der Antworten deutlich über die vorgeschlagenen Rollen hinausgeht, tauchen in der Tabelle weitere Kategorien auf. In der Assistenz-Gruppe werden die AssistentInnen vor allem - mit der Hälfte der Nennungen - in einer beratenden, begleitenden, unterstützenden und betreuenden Rolle wahrgenommen. Andere Rollen wie FreundIn oder ChefIn kommen weitaus seltener vor. In der Werkstatt-Gruppe finden sich dagegen zwei dominierende Rollendefinitionen: Zu einem reichlichen Drittel werden die GruppenleiterInnen als ChefInnen wahrgenommen, gefolgt von der Rolle von FreundInnen mit einem Viertel; begleitende und beratende Rollen kommen demgegenüber weitaus weniger vor.
Damit können deutlich unterschiedlich wahrgenommene Rollen festgehalten werden, die mit den unterschiedlichen Konstellationen zu tun haben dürften: GruppenleiterInnen sind real die Chefs ihrer MitarbeiterInnen, sie können dies allerdings auf der Beziehungsebene unter-schiedlich ausgestalten, während dies für AssistentInnen explizit nicht zutrifft - sie sind von der Stellung im Betrieb her keine ChefInnen, von daher sollten sie es auch nicht im Verhältnis zu den Unterstützten sein, und sie werden auch nicht so wahrgenommen.
Zum Komplex des Verhältnisses zu den unterstützenden Personen wird zusammenfassend ein Index gebildet, in den die Fragen nach Freundlichkeit, Unterstützung und Erreichbarkeit sowie vorhandene oder nicht vorhandene Wünsche und unterschiedliche Rollenwahrnehmungen - eher hierarchisch oder beratend - eingehen. Wenn man aus jedem Fragebogen diesen Index extrahiert, lassen sich Mittelwerte für die beiden Gruppen bilden. Diesem Index zufolge gibt es einen gerade noch signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen (.091) zugunsten der Assistenz-Gruppe (Mittelwert: 1,38) gegenüber der Werkstatt-Gruppe (Mittelwert: 1,51). Die Rollendefinition der AssistentInnen wird also in einem gewissen, nicht mehr ganz zufälligen Maß von den TeilnehmerInnen als partnerschaftlicher und positiver als die der GruppenleiterInnen wahrgenommen.
Zusammengefasst zeigen sich im Verhältnis zu AssistentInnen und GruppenleiterInnen tendenzielle Unterschiede, insgesamt ist jedoch ein gutes Verhältnis zu attestieren. In der Assistenz-Gruppe gibt es im Arbeitstraining mehr Ärger, dagegen aber weniger Veränderungswünsche, die sich zudem auf Diverses beziehen. In der Werkstatt-Gruppe gibt es weniger Ärger, aber die vorhandenen Veränderungswünsche konzentrieren sich vor allem auf ein besseres Eingehen der GruppenleiterInnen. Die Rollen des Personals sind sehr verschieden, dies hat einen realen Hintergrund aufgrund unterschiedlicher Konstellationen: GruppenleiterInnen werden vor allem als Chefs oder FreundInnen wahrgenommen, AssistentInnen vor allem als beratend und begleitend.
3.3.2.5 Einschätzung des Berufsschulunterrichts
Zum Berufsschulunterricht werden nur die aktuellen oder früheren AbsolventInnen des Arbeitstrainings befragt; die TeilnehmerInnen des Integrationspraktikums haben keinen Anspruch mehr auf Berufsschulunterricht. Die drei Fragen zu diesem Thema beziehen sich auf Stellungnahmen zum Berufsschultag, zu bestehender Vorfreude und zu den BerufsschullehrerInnen.
Die erste Frage zielt auf eine Einschätzung des Berufsschultages anhand einer fünfstufigen Skala. Nimmt man die Mittelwerte zur Hilfe, so gibt es eine Einschätzung, die im Durchschnitt einen guten Berufsschultag rückmeldet (Assistenz-Gruppe: 2,20, Werkstatt-Gruppe: 2,14). Dabei erstreckt sich die Bewertung durchaus über alle Bewertungsmöglichkeiten, jedoch ohne feststellbare Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.39): Wie die Mittelwerte bereits gezeigt haben, liegen die meisten Bewertungen im Bereich von ›sehr gut‹ bis ›mittel‹, kritische Bewertungen sind eher selten.
Mit der gleichen Konstruktion schätzen die Befragten auch ihre BerufsschullehrerInnen ein; sie bekommen bessere Mittelwerte als der Berufsschultag, vor allem von der Assistenz-Gruppe (Assistenz-Gruppe: 1,87, Werkstatt-Gruppe: 2,06). Das Bild der einzelnen Antworten entspricht in weiten Strecken dem der Einschätzung des Berufsschultages, wiederum ohne feststellbare Gruppenunterschiede (vgl. Tab. 3.40): Auch hier kommen kritische Bewertungen eher selten vor; bemerkenswert ist, dass immerhin 40 % der Assistenz- und 30 % der Werkstatt-Gruppe ihren BerufsschullehrerInnen attestieren, sie seien ›sehr gut‹.
Auch auf die Frage, worauf sich die TeilnehmerInnen beim Berufsschultag freuen, gibt es eher einheitliche Antworten (vgl. Tab. 3.41). Die Botschaft ist eindeutig: Die Befragten freuen sich auf MitschülerInnen und Unterricht, nur wenige freuen sich weder auf das eine noch auf das andere.
Abschließend werden die beiden Fragen nach dem Gefallen des Berufsschultages und nach der Einschätzung der LehrerInnen zu einem Berufsschulzufriedenheits-Index zusammengefasst. Beide Fragen werden auf einer fünfstufigen Skala beantwortet, so dass sich ein Ge-samtwert zwischen 1 und 5 ergibt. Die Mittelwerte der Gruppen liegen auch hier wieder dicht beieinander (Assistenz-Gruppe: 2,04, Werkstatt-Gruppe: 2,08).
Insgesamt wird dem Berufsschultag ein ›gutes‹ Zeugnis ausgestellt, die LehrerInnen schneiden dabei noch besser ab als der Berufsschultag selbst.
3.3.2.6 Einschätzung des Arbeitstrainings
Eine Reihe von Frage beziehen sich auf die Einschätzung des Arbeitstrainings durch die TeilnehmerInnen, teils bezogen auf konkrete Tätigkeiten und Arbeitsplätze, teils bezogen auf das Arbeitstraining insgesamt.
Zunächst wird anhand einer fünfstufigen Skala gefragt, wie gut oder schlecht den TeilnehmerInnen der konkrete Arbeitsplatz gefällt; dies ergibt signifikant unterschiedliche Antworten (vgl. Tab. 3.42; chi2 = .014): Die Antworten zeigen, dass die Arbeitsplätze den TeilnehmerInnen im Ambulanten Arbeitstraining deutlich besser gefallen als denen im Arbeitstrainings-Bereich der Werkstätten für Behinderte. Nimmt man die Mittelwerte der Antworten, so schneidet das Ambulante Arbeitstraining hoch signifikant besser ab (1,73 gegenüber 2,22 bei einem Spektrum von 1 bis 5; .004).
Diese Linie setzt sich bei den beiden offenen Fragen nach den gern und ungern ausgeführten Tätigkeiten fort (vgl. Tab. 3.43, 3.44; in beiden Fällen chi2 = .000): In der Assistenz-Gruppe machen gern ausgeübte ›zentrale Tätigkeiten‹ und ›alles‹ zwei Drittel aller Antworten aus, ungern wird bei einem Drittel ›nichts‹ getan. Positiv wichtig sind darüber hinaus bei einem Fünftel die Kontakte, negativ werden Reinigungsarbeiten sowie seltener die Monotonie der Arbeit empfunden. Demgegenüber sind bei der Werkstatt-Gruppe gern ausgeübte ›zentrale Tätigkeiten‹ mit der Hälfte der Voten vertreten sowie ›Verschiedenes‹, also nicht so zentrale Tätigkeiten, die auch anfallen; Verschiedenes taucht ebenso negativ als ungern ausgeübte Tätigkeiten bei 30 % der Voten auf, jedoch werden hier auch ›zentrale Tätigkeiten‹ mit 15 % genannt.
Ableitbar erscheint hier zweierlei: Die Assistenz-Gruppe sagt dezidierter, mit welchen Tätigkeiten sie sehr zufrieden und sehr unzufrieden ist, als die Werkstatt-Gruppe dies tut, wobei ihr Gesamtbild deutlich positiver ausfällt.
Auf das Arbeitstraining als Ganzes bezogen wird pauschal gefragt, ob es Spaß macht bzw. gemacht hat. Auch hier gibt es sehr signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.45; chi2 = .006): Spaß haben 90 % der Assistenz-, jedoch nur 60 % der Werkstatt-Gruppe; dezidiert verneinen dies 2 % der Assistenz- und 18 % der Werkstatt-Gruppe, von der sich 18 % nicht entscheiden. Dies ist insgesamt ein überaus positives Bild, für die Assistenz-Gruppe noch ein ganzes Stück positiver als für die Werkstatt-Gruppe.
Einen gewissen Kontrast zu diesem Bild zeigen die Antworten auf die Frage, ob auch Probleme im Arbeitstraining vorkommen; hier gibt es keine überzufälligen Unterschiede zwischen beiden Gruppen (vgl. Tab. 3.46): Hier zeigen die Antworten der Werkstatt-Gruppe mit fast je 10 % mehr Verneinungen und weniger Bejahungen, dass das Arbeitstraining von der Werkstatt-Gruppe insgesamt als weniger problematisch wahrgenommen wird, nämlich von einem Drittel als problematisch und von mehr als der Hälfte als unproblematisch, als von der Assistenz-Gruppe, die diese Frage zu fast gleichen Teilen bejaht und verneint.
Die offene Antwortmöglichkeit zu den Problemen nutzen sehr viel mehr Befragte der Assistenz- als der Werkstatt-Gruppe (vgl. Tab. 3.47; chi2 = .000): Dort wird deutlich, dass Probleme mit KollegInnen in der Werkstatt doppelt so häufig wahrgenommen werden wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (14 % bzw. 7 %), dagegen werden von dort mehr Probleme mit Stress (12 % bzw. 2 %) und eigenen Fehlern (7 % bzw. 4 %) berichtet. Vergleicht man die Probleme mit den GruppenleiterInnen mit denen von AssistentInnen und ChefInnen, dann ergibt sich ein genauer Gleichstand der Anteile dieser Probleme - in der Werkstatt für Behinderte und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Ein genau entsprechendes Bild zeichnen die Antworten auf die Frage, ob es im Arbeitstraining manchmal zu anstrengend (gewesen) sei (vgl. Tab. 3.48): Zwar gibt es statistisch keinen signifikanten Unterschied, jedoch findet sich hier der gleiche 10 %-Unterschied wie bei den Problemen: Das Arbeitstraining sehen mehr TeilnehmerInnen der Assistenz-Gruppe zeitweilig als zu anstrengend an als in der Werkstatt-Gruppe. Dies entspricht auch den Problembenennungen aus Tab. 3.46.
Zusammenfassend zeichnet sich die Einschätzung des Ambulanten Arbeitstrainings in Relation zum Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte durch zwei Charakteristika aus: Es macht mehr Spaß und gefällt noch besser, und es ist ein Stück weit anstrengender und schwieriger; dabei gibt es weniger Probleme mit KollegInnen als in der Werkstatt und gleich viel mit AssistentInnen und ChefInnen, aber mehr Stress.
3.3.2.7 Fazit und Änderungswünsche
Als Fazit wird zum einen herangezogen, welche der anfänglichen Hoffnungen sich im Arbeitstraining erfüllt haben. Zum anderen wird ein Zufriedenheits-Index gebildet, in den alle Aspekte der Zufriedenheit mit dem Arbeitstraining eingehen.
Bezüglich der erfüllten Hoffnungen zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.49). Gleichwohl zeigt sich doch, dass fast die Hälfte der Assistenz-Gruppe ihre Hoffnungen erfüllt sieht, während dies nur bei einem knappen Drittel der Werkstatt-Gruppe der Fall ist - trotz garantierten Übergangs in den Beschäftigungsbereich der Werkstatt für Behinderte, jedoch ohne Garantie auf einen Arbeitsvertrag nach dem Ambulanten Arbeitstraining. Hier spielen sicherlich auch die hohen Werte unentschiedener oder ausgebliebener Antworten eine Rolle. Klammert man sie aus, dann zeigen auch die Mittelwerte der verbleibenden Antworten (1 = ja, 2 = teilweise, 3 = nein), dass sich die Hoffnungen der Assistenz-Gruppe (Mittelwert: 1,39) in höherem Maße erfüllt haben als bei der Werkstatt-Gruppe (Mittelwert: 1,67), was allerdings ebenfalls nicht statistisch signifikant ist.
Am Schluss dieses Fragebogenteils wird die offene Frage danach gestellt, was anders oder besser werden müsste beim Arbeitstraining, worauf lediglich etwa zwei Drittel der Befragten, gleichwohl in beiden Gruppen recht unterschiedlich, antworten (vgl. Tab. 3.50; chi2 = .023): An den Antworten fällt zunächst auf, dass ein Drittel der Assistenz-Gruppe ›nichts‹ antwortet, dagegen nur ein Sechstel der Werkstatt-Gruppe. Letztere äußert dagegen als wichtigsten Wunsch, mehr Bereiche kennenzulernen - ein bemerkenswertes und verwunderliches Votum angesichts des Konzepts, ihnen verschiedene Arbeitsbereiche in der Werkstatt für Behinderte zu erschließen. Aus den verbleibenden Angaben erscheint ein Datum als bedeutsam, dass nämlich nur ein sehr geringer Teil beider Gruppen von je 4 % ›weniger Stress‹ wünscht - angesichts der 12,5 %, die in der Assistenz-Gruppe Stress und Überforderung als Problem angeben. So dramatisch scheint die Situation doch nicht zu sein, denn mit mehr Leidensdruck hätte sich ein höherer Anteil von Wünschen nach Stressabbau ergeben müssen.
Verrechnet man abschließend alle generell einschätzenden Antworten der TeilnehmerInnen in einem gemeinsamen Index, so lässt sich eine generelle Aussage über deren Zufriedenheit mit dem Arbeitstraining machen. Hier gehen also die Antworten über das Gefallen, den Spaß, bestehende Probleme, übergroße Anstrengung und das Auskommen mit den KollegInnen ein. So ergibt sich lediglich eine kleine, nicht signifikante Differenz zwischen den Gruppen: Die Assistenz-Gruppe ist im Durchschnitt ein kleines bisschen zufriedener (Mittelwert: 1,49) als die Werkstatt-Gruppe (Mittelwert: 1,56). Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass beide Gruppen in einem recht hohen Maße mit ihrem Arbeitstraining zufrieden sind.
3.3.2.8 Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum im Vergleich
Wie bereits angedeutet, gibt es in der Praxis wie in der Einschätzung zwischen dem Ambulanten Arbeitstraining und dem Integrationspraktikum wenig bedeutende Unterschiede. Dies ist der Grund dafür, dass beide Maßnahmen gemeinsam ausgewertet werden. In diesem Abschnitt kommen nun jedoch die Unterschiede zur Sprache.
Einen ersten Unterschied gibt es bei dem Weg des Kennenlernens der Arbeitsassistenz (vgl. Tab. 3.51; chi2 = .054): Während die Personen im Ambulanten Arbeitstraining vor allem durch BerufsberaterInnen, Werkstatt-MitarbeiterInnen, Sonstige und die Schule mit der Arbeitsassistenz bekannt wurden, sind für die Personen im Integrationspraktikum vor allem die Eltern und die Schule wichtig, während BerufsberaterInnen und Werkstatt-MitarbeiterInnen an Bedeutung verlieren.
Weiter gibt es einen Wechsel in der Bedeutung von Hoffnungen (vgl. Tab. 3.52): Steht im Ambulanten Arbeitstraining neben anderem das Dazulernen im Vordergrund, so kommt dies im Integrationspraktikum gar nicht vor; dafür steht das Sich-Bewähren stark im Vordergrund - ein nachvollziehbarer Wechsel, da in vielen Fällen das Integrationspraktikum eine zusätzliche Bewährungszeit bedeutet, die zum Arbeitsvertrag führen soll.
Auch die Arbeitsplätze gestalten sich unterschiedlich (vgl. Tab. 3.53; chi2 = .086). Im Ambulanten Arbeitstraining gibt es deutlich mehr von ihnen im Dienstleistungsbereich, dagegen weniger als im Integrationspraktikum im Handwerk und in der Gastronomie. Dies kann als Beleg für eine individuellere Suche für einzelne Personen im Integrationspraktikum genommen werden.
An mehreren Stellen drängt sich der Eindruck auf, dass die Situation im Integrationspraktikum gezielter sowie integrativer gestaltet ist und differenzierter wahrgenommen wird als die im Ambulanten Arbeitstraining: So führt die Gruppe im Integrationspraktikum tendenziell mehr ›zentrale Tätigkeiten‹ gern durch, mag aber weniger ›alles‹ am Arbeitsplatz (vgl. Tab. 3.54), lehnt entsprechend auch mehr Tätigkeiten wie Reinigungsarbeiten ab, tut deutlich weniger ›nichts‹ ungern (vgl. Tab. 3.55). Was den Rahmen von Unterstützung im Betrieb angeht, so nimmt bei der Gruppe im Integrationspraktikum die Bedeutung von anderen zu, während die der AssistentInnen tendenziell abnimmt (vgl. Tab. 3.56). In der Wahrnehmung der Gruppe im Integrationspraktikum gibt es darüber hinaus weniger Probleme im Betrieb als beim Ambulanten Arbeitstraining (vgl. Tab. 3.57), sie kommt mit den KollegInnen etwas schlechter aus (vgl. Tab. 3.58), gibt auch mehr Probleme mit ihnen an, dagegen keine Probleme mehr mit Chefs, AssistentInnen und keine eigene Unsicherheit mehr (vgl. Tab. 3.59). Dies wird dadurch bestätigt, dass die Gruppe im Integrationspraktikum weniger Ärger mit den AssistentInnen anzeigt (vgl. Tab. 3.60). Allerdings nimmt die Gruppe im Integrationspraktikum die Arbeitssituation als anstrengender wahr (vgl. Tab. 3.61), und sie bezieht sich auch auf weniger Erfahrungsbereiche und signifikant weniger Betriebe als im Ambulanten Arbeitstraining (vgl. 3.62, 3.63).
Die Gruppe im Integrationspraktikum meldet weniger Wünsche für Veränderungen an (vgl. Tab. 3.64), ist mit ihren AssistentInnen noch etwas zufriedener (vgl. Tab. 3.65; Mittelwert 1,35 gegenüber 1,39) und meint, dass sich die Hoffnungen in höherem Maße realisieren als die Gruppe im Ambulanten Arbeitstraining angibt (vgl. Tab. 3.66). Insgesamt ist die Gruppe im Integrationspraktikum mit ihrer Maßnahme etwas weniger zufrieden als die Gruppe im Ambulanten Arbeitstraining mit ihrer (vgl. Tab. 3.67; Mittelwert 1,54 gegenüber 1,47) - hier mag sich auch der zunehmende Erfolgsdruck mit der kürzeren Förderungsdauer auswirken.
Die Unterschiede sind durchweg eher gradueller Natur, als dass sie substantiell wären. Die andere Unterstützungssituation im Betrieb und die Verschiebung der Problembeziehungen zeigen ein höheres Maß an betrieblicher Normalität und Gewöhnung an. Hier mag sich auch auswirken, dass die TeilnehmerInnen am Integrationspraktikum älter und erfahrener sind als die am Ambulanten Arbeitstraining. Das positive Bild, das sich bei der Betrachtung im bisherigen Abschnitt ergibt, gilt in ähnlichem Maße für das Ambulante Arbeitstraining wie für das Integrationspraktikum.
Ein großer Teil der AbsolventInnen des Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums sind zum Zeitpunkt der Befragung bereits in Beschäftigungsverhältnisse übergegangen. Im folgenden werden deren Rahmenbedingungen, die konkreten Tätigkeiten, die dortige soziale Situation, die Zufriedenheit, bestehende Änderungswünsche und schließlich zukünftige Perspektiven betrachtet. Zunächst wird jedoch insgesamt die aktuelle Situation im Sommer 2000 betrachtet.
3.3.3.1 Aktuelle Situation
Die aktuelle Situation zum Zeitpunkt der Befragung zeigt, mit welchem Status die Befragten tätig sind - mit sehr signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.68; chi2 = .000): Während drei Viertel der Werkstatt-Gruppe einen Arbeitsplatz in der Werkstatt für Behinderte und das vierte Viertel einen Arbeitsplatz in dessen Arbeitstrainingsbereich hat, stellt sich die Situation in der Assistenz-Gruppe deutlich heterogener dar: Über die Hälfte der Gruppe arbeitet in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Knappe 10 % sind noch im Integrationspraktikum, knappe 20 % befinden sich noch im Ambulanten Arbeitstraining. Geringe Anteile der Gruppe sind in die Werkstatt für Behinderte übergegangen, ein Teil zudem auf einen Außenarbeitsplatz der Werkstatt, in eine vollzeitschulische Qualifizierung, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder in die Arbeitslosigkeit.
Es wäre eine differenziertere Betrachtung notwendig, um genauer einschätzen zu können, wie die Übergänge in die Werkstatt für Behinderte, in eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder in die Arbeitslosigkeit zu bewerten sind; dies erfolgt teilweise in Kap. 4. Dominierend ist jedoch das positive Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Personen aus dem Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis aufnehmen konnte. Damit ist zum einen noch nicht gesagt, dass die Betreffenden auch über Jahre dort bleiben und in diesem Betrieb zufrieden sind - ebenso wie für nicht behinderte MitarbeiterInnen auf dem ersten Arbeitsmarkt und für behinderte MitarbeiterInnen in der Werkstatt. Zum anderen muss auch gesehen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, die unter Umständen schnellen Veränderungen unterworfen ist; dies machen auch die Einzelstudien in Kap. 4 deutlich, bei denen sich teilweise die Situation innerhalb weniger Wochen - auch zwischen der ersten und zweiten Befragung - massiv verändert hat.
3.3.3.2 Rahmenbedingungen
Die erfragten Rahmenbedingungen beziehen sich auf die Fahrt zum Arbeitsplatz, die Wohnsituation, die wöchentliche Arbeitszeit, den Monatsverdienst und die Zufriedenheit mit ihm.
Bei der Fahrt zum Arbeitsplatz gibt es sehr signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.69; chi2 = .002): Während 90 % der Assistenz-Gruppe mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, sind es bei der Werkstatt-Gruppe zwei Drittel. Von ihr fährt ein Viertel mit dem Fahrdienst zur Werkstatt, was nur für eine Person aus der Assistenz-Gruppe gilt, die inzwischen in einer Werkstatt arbeitet. Dieser Befund kann nur in Teilen geklärt werden. Eine Rolle spielt sicherlich dabei, dass im Ambulanten Arbeitstraining und im Integrationspraktikum kein Fahrdienst finanziert werden kann - im Gegensatz zur Situation im unterstützten Beschäftigungsverhältnis, bei dem die Kosten vom Arbeitsamt übernommen werden. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wäre, dass die Assistenz-Gruppe insgesamt über höhere Fähigkeiten im öffentlichen Verkehr verfügt, es könnte auch einen höheren Anteil von RollstuhlfahrerInnen und/oder weitere Wege durch die Stadt in der Werkstatt-Gruppe geben.
Sehr signifikante Unterschiede gibt es auch bei der Wohnsituation der Befragten (vgl. Tab. 3.70; chi2 = .004): Der Anteil der Assistenz-Gruppe, der noch bei den Eltern wohnt, ist mit 60 % fast doppelt so hoch wie in der Werkstatt-Gruppe. Dafür wohnt mit 40 % ein mehr als doppelt so hoher Anteil der Werkstatt-Gruppe in einer Wohngruppe. Es kann wiederum nur spekuliert werden, ob sich hier der Altersunterschied von vier Jahren bemerkbar macht oder welche Faktoren sonst zu diesen Unterschieden führen. So mag es eine Rolle spielen, dass beim Wohnen integrative Formen erst entwickelt werden müssen.
Zentral ist die Betrachtung der wöchentlichen Arbeitszeit. Auch hier gibt es sehr signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.71; chi2 = .004): Auf den ersten Blick wird eine deutlich flexiblere Wochenarbeitszeit bei der Assistenz-Gruppe deutlich. Ein Zehntel liegt bei einer halben Stelle, ein Viertel bei einer drei-Viertel-Stelle (hier sind auch Personen mit ihrem zusätzlichen Berufsschultag enthalten), und lediglich ein Viertel gibt eine volle Stelle als Arbeitszeit an - abgesehen von einem Drittel, das sich nicht geäußert hat. In der Werkstatt-Gruppe kommt nur die dreiviertel Stelle - ebenfalls mit dem zusätzlichen Berufsschultag - und die volle Stelle vor.
Ebenfalls zentral ist auch der monatliche Verdienst für die Arbeit; hierbei wurde dies nicht mit der Wochenarbeitszeit in Bezug gesetzt, sondern als real zur Verfügung stehender Betrag genommen. Auch hier gibt es extrem signifikante Unterschiede (vgl. Tab. 3.72; chi2 = .000): Auch hier fällt auf den ersten Blick das große Gefälle zwischen den Gruppen ins Auge: Während der Verdienst bei der Werkstatt-Gruppe unter 200 DM beginnt und bei unter 1000 DM endet, beginnt er bei der Assistenz-Gruppe unter 500 DM und reicht bei 15 % der TeilnehmerInnen bis über 1500 DM. Lediglich der Teilnehmer am Ambulanten Arbeitstraining, der in die Werkstatt übergegangen ist, verdient unter 200 DM. Auch wenn kein Zweifel darüber bestehen dürfte, dass der Bedarf des täglichen Lebens auch mit den höheren Verdiensten der Assistenz-Gruppe nicht vollständig zu bestreiten ist und die Abhängigkeit von Leistungen der Sozialhilfe weiterbesteht, so ist dieses Ergebnis ein dramatisches. Auffällig ist darüber hinaus, dass ein Drittel der Werkstatt-Gruppe keine Angaben über ihr Einkommen macht, der größte Teil davon weiß nicht, wieviel Geld er verdient.
Dieses Gefälle spiegelt sich in der Zufriedenheit mit dem Verdienst wider, die sich ebenfalls zwischen den Gruppen sehr signifikant unterscheidet (vgl. Tab. 3.73; chi2 = .003): Während zwei Drittel der Assistenz-Gruppe mit ihrem Verdienst zufrieden sind, ist es bei der Werkstatt-Gruppe knapp die Hälfte. Dagegen ist ein Drittel der Werkstatt-Gruppe und ein Sechstel der Assistenz-Gruppe unzufrieden. Ein gewisser Anteil der Werkstatt-Gruppe ist offenbar mit dem Verdienst zufrieden, obwohl er ihn nicht kennt.
Zusammenfassend gibt es bezüglich der Rahmenbedingungen der Beschäftigung im Anschluss an das Arbeitstraining und Integrationspraktikum durchgängig deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen: Ein wesentlich höherer Anteil der Assistenz-Gruppe fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit und nicht mit einem Fahrdienst. Ebenfalls wohnt ein wesentlich größerer Anteil der Assistenz-Gruppe noch bei den Eltern, nicht in Wohngruppen. Die Arbeitszeiten gestalten sich im Anschluss an das Ambulante Arbeitstraining und Integrationspraktikum wesentlich flexibler und der Verdienst ist wesentlich höher; und auch die Zufriedenheit mit dem Verdienst ist deutlich höher.
3.3.3.3 Tätigkeiten und soziale Situation
Aufgrund der wenigen Fragen werden die beiden Aspekte der Tätigkeiten und der sozialen Situation zusammen dargestellt.
Ebenso wie beim Arbeitstraining werden auch die Tätigkeiten im Beschäftigungsverhältnis erhoben, wiederum im Vergleich der Gruppen, der hoch signifikante Unterschiede zeigt (vgl. Tab. 3.74; chi2 = .000): Während die Tätigkeiten der Werkstatt-Gruppe sich fast ausschließlich auf den Bereich Industrie/Handwerk konzentrieren, zeigt sich bei der Assistenz-Gruppe das aus dem Arbeitstraining bekannt Profil, bei dem 80 % in Dienstleistung und Gastronomie liegen. Alle anderen Bereiche haben nur kleine Anteile.
Auch im Beschäftigungsbereich wird zum einen nach neu gewonnenen Freunden gefragt, wiederum mit sehr signifikantem Unterschied (vgl. Tab. 3.75; chi2 = .001): Hier zeigt sich das Bild, das schon im Arbeitstraining anzutreffen war: 80 % der Werkstatt-Gruppe bejahen die Frage, 10 % verneinen sie und 10 % entscheiden sich nicht. Dagegen verneinen fast 20 % der Assistenz-Gruppe die Frage, lediglich fast die Hälfte bejaht sie, und ein Viertel beantwortet sie gar nicht.
Zum anderen wird hier auch nach subjektiv wahrgenommenen Unterstützungsstrukturen gefragt, von wem sich nämlich die Befragten Hilfe erwarten, wenn es Schwierigkeiten gibt oder sie Probleme haben. Hier gibt es wiederum sehr signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.76; chi2 = .001): Für über die Hälfte der Werkstatt-Gruppe sind die GruppenleiterInnen primäre AnsprechpartnerInnen, jedoch werden auch von einem Drittel mehrere Personen angesprochen. In der Assistenz-Gruppe wird von fast der Hälfte ebenfalls auf mehrere Personen gesetzt, dem folgt jedoch eine differenziertere Aufstellung von möglichen HelferInnen: Von jedem sechsten Befragten der Gruppe werden die AssistentInnen genannt, von einigen auch Sonstige, ChefInnen und KollegInnen, vereinzelt Eltern und Geschwister. Einige wollen Schwierigkeiten ohne Unterstützung durchstehen und niemanden zur Hilfe holen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich hier das aus dem Arbeitstraining bekannte Bild fortsetzt: Die Tätigkeitsprofile beziehen sich in der Werkstatt für Behinderte wiederum auf Industrie und Handwerk, auf dem ersten Arbeitsmarkt liegen sie im Dienstleistungs- und Gatronomiebereich. Freunde werden in der Werkstatt für Behinderte mehr gefunden, und Unterstützung erhoffen sich die Befragten in der Werkstatt für Behinderte vor allem von den GruppenleiterInnen, während auf dem ersten Arbeitsmarkt auf viele verschiedene UnterstützerInnen gesetzt wird.
3.3.3.4 Zufriedenheit und Änderungswünsche
Drei Fragen beziehen sich auf die Zufriedenheit der Befragten mit ihrer Beschäftigung, zum einen die allgemeineren Frage, ob sie gern dort sind und wie gut oder schlecht sie ihre momentane Situation finden, und zum anderen die speziellere Frage, ob sie ihre Tätigkeiten dort mögen. Hier schließt sich dann auch gleich die Frage nach Änderungswünschen an, die indirekt ebenfalls Aussagen zur Zufriedenheit ermöglicht.
Zunächst einmal ist für beide Gruppen festzuhalten, dass mehr als vier Fünftel der Befragten gern am Ort ihrer Beschäftigung sind (vgl. Tab. 3.77). Die Zufriedenheit ist also in beiden Gruppen sehr hoch. Dabei ist die Assistenz-Gruppe insofern ausgeprägter in den Antworten, als die Anteile von Bejahung wie Verneinung höher sind als in der Werkstatt-Gruppe. Der gerade noch signifikante Unterschied zwischen den Gruppen dürfte auf die unterschiedlichen Anteile der Unentschiedenen zurückgehen (chi2 = .094).
Bestätigt wird die unterschiedlich ausgeprägte Prägnanz bei der Frage, wie die momentane Situation eingeschätzt wird (vgl. Tab. 3.78): Die Anteile der extremen Bewertungen sind bei der Assistenz-Gruppe höher als bei der Werkstatt-Gruppe. So kommt es zu einem signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen (chi2 = .060), der jedoch bei deren Mittelwerten nicht mehr vorhanden ist. Die Assistenz-Gruppe schätzt ihre Situation im Durchschnitt - allerdings nicht signifikant - besser ein als die Werkstatt-Gruppe (Assistenz-Gruppe: 2,05, Werkstatt-Gruppe: 2,26), was auch daran deutlich wird, dass die positiven Voten bei der Assistenz-Gruppe fast drei Viertel ausmachen, bei der Werkstatt-Gruppe knapp zwei Drittel.
Die dritte Frage nach der Zufriedenheit richtet sich auf die konkreten Tätigkeiten (vgl. Tab. 3.79): Auch bei den konkreten Tätigkeiten zeigt sich ein Bild großer Zufriedenheit - und das ohne signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. Drei Viertel der Werkstatt- und sogar 85 % der Assistenz-Gruppe mögen ihre konkreten Aufgaben. Die unzufriedenen Aussagen kommen jeweils von unter 10 % der Befragten in den Gruppen.
Bei allgemein hoher Zufriedenheit gibt es bei vier Fünfteln der Befragten ein Potential an Wünschen nach Veränderungen am Arbeitsplatz, ohne Unterschiede zwischen den Gruppen. Die Antworten auf diese offene Frage werden systematisiert (vgl. Tab. 3.80): Ein Drittel der Assistenz- und ein Viertel der Werkstatt-Gruppe meinen, es solle nichts verändert werden - dies ist die Gruppe der Hochzufriedenen. Bei den angegebenen Wünschen der Assistenz-Gruppe dominieren die nach einer anderen Arbeit und nach Weiterqualifizierung mit zusammen fast einem Viertel der Voten vor anderen Dingen wie mehr Unterstützung, mehr Geld, mehr Arbeit (mit mehr Wochenstunden), ein anderer Betrieb und personelle Veränderungen (hier geht es um einen Vorgesetzten). In der Werkstatt-Gruppe gibt es sehr ähnliche Wünsche: zu etwa 10 % jeweils eine andere Arbeit, Weiterqualifizierung, mehr Geld, personelle Veränderungen (hier geht es um behinderte KollegInnen) und eine Arbeit außerhalb der Werkstatt. Diese Wünsche sind durch die Bank nachvollziehbar, sie bewegen sich - bis auf die Arbeitsplätze außerhalb der Werkstatt - im Rahmen dessen, was auch sonst ArbeitnehmerInnen als Forderungen aufstellen.
3.3.3.5 Perspektiven
Zu möglichen zukünftigen Perspektiven werden drei Fragen gestellt, zwei davon als offene, die im nachhinein kategorisiert werden. Zunächst geht es darum, in welchem Tätigkeitsbereich die Betreffenden später einmal arbeiten möchten - diese Frage wird bewusst in sehr offener Formulierung gestellt, so dass die Befragten alle Freiheiten für ihre Ideen für weitere Perspektiven haben (vgl. Tab. 3.81): Ein Drittel der Assistenz- und ein Fünftel der Werkstatt-Gruppe möchte da bleiben, wo es heute arbeitet. Dies dürften wiederum zum großen Teil die Hochzufriedenen sein, die auch keine Änderungswünsche haben. Soweit jedoch andere Perspektivwünsche geäußert werden, fallen besonders zwei Daten auf, die sicherlich auch maßgeblich für den insgesamt sehr signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen sind (chi2 = .000): Bei der Assistenz-Gruppe will ein knappes Viertel in den Dienstleistungsbereich gehen, und in der Werkstatt-Gruppe gibt ein Drittel an, außerhalb der Werkstatt arbeiten zu wollen, obwohl dies keineswegs durch die Frage provoziert war.
Ergänzend sollen die Befragten angeben, von wem sie sich Unterstützung bei der Realisierung dieser Perspektiven erhoffen - wiederum mit sehr signifikant unterschiedlichen Ergebnissen (vgl. Tab. 3.82; chi2 = .006): Die Unterschiede beginnen bereits dort, wo keine Angaben gemacht werden - bei einem Viertel der Assistenz- und knapp der Hälfte der Werkstatt-Gruppe. Soweit jedoch Aussagen dazu gemacht werden, fällt auf, dass die Werkstatt-Gruppe zu einem Fünftel auf die GruppenleiterInnen, einem Zehntel auf sich selbst und zu weiteren kleinen Teilen auf den sozialpädagogischen Dienst und Sonstige vertraut - die Personengruppen vor allem, die in der Werkstatt vor Ort anwesend sind. Die Assistenz-Gruppe geht über diesen Rahmen, innerhalb dessen die AssistentInnen mit über einem Viertel am wichtigsten sind, hinaus, indem auch Geschwister, Eltern und Sonstige einbezogen werden.
Schließlich wird als letzte Frage des Bogens ganz allgemein nach sonstigen Wünschen für die Zukunft gefragt, eine Frage, die von 85 % der Befragten beantwortet wird, mit signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 3.83; chi2 = .027): Hier kommen sehr unterschiedliche Wünsche zur Sprache, die zu Kategorien zusammengefasst werden. Dies beginnt mit einem sehr zufriedenen knappen Fünftel in beiden Gruppen, das explizit keine Wünsche für die Zukunft hat. Nimmt man die Voten dazu, nach denen alles so bleiben soll wie es ist, steigt dieser Anteil bei der Assistenz-Gruppe auf über ein Viertel, das offenbar den ›harten Kern‹ der äußerst Zufriedenen ausmacht.
Einige Relevanz haben Wünsche wie die eigene Weiterentwicklung, so der Auszug von den Eltern, der Aufbau einer Partnerschaft. Die eigene Weiterbildung ist überwiegend, einen Führerschein zu machen, ist fast nur in der Assistenz-Gruppe wichtig, außerhalb der Werkstatt für Behinderte arbeiten zu können, logischerweise nur in der Werkstatt-Gruppe. Vereinzelt kommen auch Wünsche vor, die eher allgemein sind und über das Individuelle hinausgehen, so beispielsweise der Wunsch, dass es keine Kriminalität und keine Kriege mehr geben soll oder dass es eine bessere Unterstützung für Obdachlose und Drogenabhängige geben müsste.
Dass bei dieser Frage wiederum fast 10 % der Werkstatt-Gruppe den Wunsch nach einer Arbeit außerhalb der Werkstatt für Behinderte äußern und dies schon bei zwei anderen Fragen auftaucht, veranlasst dazu nachzuprüfen, ob es die gleichen Personen sind, die diesen Wunsch als ›harter kritischer Kern‹ mehrfach äußern, oder ob es sich um verschiedene Personen handelt. Dabei wird deutlich, dass lediglich drei Personen diesem Wunsch an zwei Stellen Ausdruck geben, es sich also insgesamt um 23 Personen handelt, d.h. 41 % der Werkstatt-Gruppe möchten eines Tages außerhalb der Werkstatt für Behinderte arbeiten.
Dabei werden Aussagen mit unterschiedlichem Konkretheitsgrad gemacht: Während die von zwei Personen eher auf diffuser Ebene anzusiedeln sind (»außerhalb der WfB, Bereich ist relativ egal«), beziehen sich die Aussagen von neun Befragten auf Branchen (»Büroarbeit«, »Maler«, »Metall« etc.) und die von zwölf Befragten auf konkrete Arbeitsplätze (»Altersheim«, »bei Lau«, »bei Papa in der Druckerei«, »Videothek« usw.); aus jeder dieser drei Ebenen hat eine Person sich bereits bei der Arbeitsassistenz beworben und steht auf deren Warteliste. Dies ist ein Ergebnis, das so nicht zu erwarten war, und das nach Interpretationen verlangt, die auf der vorliegenden Datenbasis jedoch nicht sicher geleistet werden können.
Leitungspersonen aus den Werkstätten zeigen sich im Gespräch über diesen Punkt teilweise ebenfalls überrascht von diesem Ergebnis. Dabei werden verschiedene Erklärungstendenzen genannt, nach denen ein Teil der MitarbeiterInnen tatsächlich auf der Warteliste der Arbeitsassistenz steht, ein zweiter Teil zwar den Wunsch hat, außerhalb zu arbeiten, jedoch bei konkreten Perspektiven eher zurückweicht, wenn etwa für Außenarbeitsplätze geworben wird; bei einem dritten Teil werden die Wünsche eher für unrealisierbare Traumvorstellungen nach dem Muster von Lokomotivführer oder Pilot gehalten.
Von den bisher insgesamt 68 TeilnehmerInnen am Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum wurden 56 über ihre Erfahrungen in den Maßnahmen sowie vorherige und nachfolgende Wege befragt. Als Parallelgruppe dazu wurden in allen vier Hamburger Werkstätten für Behinderte ebenfalls 56 Personen befragt. Die Ergebnisse lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:
-
Was den von ihnen angegebenen sozialen, kulturellen Status und das Freizeitverhalten der Befragten angeht, so ergeben sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Gruppen. Es gibt lediglich zwei andere Unterschiede: Die Werkstatt-Gruppe ist im Durchschnitt knappe vier Jahre älter und zu ihr gehören mehr Männer ist als zur Assistenz-Gruppe. Diese Unterschiede haben jedoch keinen systematisch und gleichsinnig verzerrenden Einfluss auf die Ergebnisse.
-
Während der aktuelle Status der Befragten (Stand: Juli 2000) in der Werkstatt-Gruppe sich ausschließlich auf einen Platz im Arbeitstrainings- oder Beschäftigungsbereich der Werkstatt für Behinderte bezieht, zeigt sich bei der Assistenz-Gruppe ein breiteres Spektrum: Über die Hälfte ihrer Mitglieder befindet sich inzwischen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen, ein Viertel ist noch im Ambulanten Arbeitstraining oder Integrationspraktikum, kleinere Gruppen sind in die Werkstatt übergegangen oder arbeitslos, befinden sich in Arbeitsbeschaffungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen oder haben einen Werkstatt-Außenarbeitsplatz. Für über die Hälfte der AbsolventInnen der beiden Maßnahmen ist also die Eingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt gelungen, bei einem Fünftel ist dies vorerst nicht der Fall, bei einem Viertel ist dies noch offen, da die Maßnahmen noch laufen. Diese Momentaufnahme verändert sich allerdings sehr schnell, da inzwischen u.a. eine Reihe von Arbeitsverträgen abgeschlossen worden sind.
-
Es gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass unterschiedliche langfristige Orientierungen bei den Gruppen bestehen: Bereits während der Schulzeit orientieren sich die Mitglieder der Assistenz-Gruppe auf den ersten Arbeitsmarkt, indem sie eher dort ihre Betriebspraktika machen und darin auch vom Umfeld (Eltern, LehrerInnen) bestärkt werden. Demgegenüber machen die Mitglieder der Werkstatt-Gruppe ihre Betriebspraktika eher - und zum Teil ausschließlich - in der Werkstatt für Behinderte, auch sie werden darin vom Umfeld bestärkt.
-
Die unterschiedlichen Orientierungen setzen sich durch die Berufsberatung hindurch fort, indem die jungen Leute auch die entsprechenden Zuweisungen bekommen. Dabei fällt die Zufriedenheit mit der Berufsberatung durchaus unterschiedlich aus: In der Assistenz-Gruppe findet sich sehr große Zufriedenheit, aber auch sehr große Unzufriedenheit, wobei die Gründe offen bleiben; in der Werkstatt-Gruppe finden sich dagegen vor allem mittlere Bewertungen, allerdings läuft man in dieser Gruppe Gefahr, über die Existenz des Ambulanten Arbeitstrainings nichts zu erfahren.
-
Über die Phase der Berufsorientierung in unterschiedlichsten Maßnahmen - von integrativen oder anderen Berufsschulprojekten über die beiden Formen des Arbeitstrainings bis zu sonstigen Maßnahmen - äußern sich die Befragten größtenteils positiv.
-
Generell zeigen die Aussagen in den verschiedenen Maßnahmen und Phasen - Arbeitstraining, Integrationspraktikum und Beschäftigung - einen recht hohen Grad von Zufriedenheit.
-
In einer Reihe von Bereichen gibt es breite Übereinstimmung oder vergleichbare Angaben der Gruppen: im positiven Verhältnis zu den AssistentInnen bzw. GruppenleiterInnen, bei der positiven Einschätzung des Berufsschultags und der BerufsschullehrerInnen, beim Auskommen mit den KollegInnen und in der Breite der Erfahrungsmöglichkeiten im Arbeitstraining. Die beiden letzten Punkte erscheinen insofern bedeutsam, als hiermit zwei kritische Vorbehalte gegenüber dem Ambulanten Arbeitstraining deutlich in Frage gestellt werden: Die TeilnehmerInnen bestätigen weder eine Schmalspurqualifizierung im Arbeitstraining, noch fühlen sie sich im Betrieb von ihren KollegInnen gemobbt oder ausgeschlossen; im Gegenteil werden sogar nur halb so viel Probleme mit KollegInnen angegeben wie in der Werkstatt für Behinderte.
-
Im Vergleich zwischen den beiden Gruppen zeigen sich eine Reihe von positiveren Bewertungen bei der Assistenz-Gruppe: Ihre Mitglieder lernen im Arbeitstraining mehr Betriebe kennen, haben mehr Spaß, finden ihre Tätigkeiten besser, führen mehr von ihnen gern und weniger ungern aus, schätzen ihre AssistentInnen etwas positiver ein, geben ein höheres Maß an erfüllten Hoffnungen an und sind insgesamt zufriedener. In der nachfolgenden Beschäftigung haben sie flexiblere Arbeitszeiten, verdienen wesentlich mehr und sind zufriedener damit (ein erheblicher Anteil der Werkstatt-Gruppe weiß dagegen nicht, was er verdient), sind auch insgesamt mit der Beschäftigungssituation zufriedener, haben zu einem höheren Anteil keine Änderungswünsche und setzen auf ein breiteres Spektrum von unterstützenden Personen für die Realisierung ihrer gewünschten Zukunftsperspektiven.
-
Dagegen finden sich positivere Bewertungen bei der Werkstatt-Gruppe in den Punkten, dass sie im Arbeitstraining weniger Ärger und Probleme haben, es als weniger anstrengend empfinden und sie im Arbeitstraining und in der Beschäftigung mehr Freunde gewinnen.
-
Unterschiedliche Profile zeigen beide Gruppen bei mehreren Punkten, ohne dass von einem Mehr oder Weniger gesprochen werden könnte: In den Tätigkeiten des Arbeitstrainings und der Beschäftigung dominiert bei der Assistenz-Gruppe der Bereich von Dienstleistung und Gastronomie, während dies bei der Werkstatt-Gruppe für Industrie und Handwerk gilt. Weiter wird die Rollen der unterstützenden Personen unterschiedlich wahrgenommen: AssistentInnen werden vorwiegend als BeraterInnen und BegleiterInnen, GruppenleiterInnen teils als FreundInnen und teils als ChefInnen gesehen. Und während die Unterstützung in der Werkstatt nahezu ausschließlich durch die GruppenleiterInnen erfolgt, bezieht sie sich auf dem ersten Arbeitsmarkt auch zunächst auf die AssistentInnen, bezieht aber stärker ChefInnen und KollegInnen im Betrieb mit ein. Dies setzt sich bei Änderungswünschen für das Arbeitstraining fort, bei denen in der Werkstatt für Behinderte ein besseres Eingehen auf die MitarbeiterInnen dominiert, dagegen auf dem ersten Arbeitsmarkt Unterschiedliches ohne deutlich Dominanz gewünscht wird. Hier zeigt sich ein vielfältigeres soziales Netz in der Arbeitssituation auf dem ersten Arbeitsmarkt.
-
Praxis und Einschätzung des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums durch die TeilnehmerInnen zeigen große Übereinstimmungen; es gibt lediglich graduelle Unterschiede in der insgesamt ausgesprochen als positiv wahrgenommenen Praxis und Einschätzung, die in einer Tendenz zu größerer individueller Gezieltheit und Integriertheit, Gewöhnung und betrieblicher Normalität sowie noch größerer Zufriedenheit zusammengefasst werden kann.
-
Von den 56 Befragten der Werkstatt-Gruppe äußern 23 (= 41 %) bei drei allgemein gestellten, offenen Fragen (›Was würden Sie am liebsten an Ihrer Situation verändern?‹ - ›In welchem Tätigkeitsbereich möchten Sie später arbeiten?‹ - ›Welche Wünsche haben Sie sonst für die Zukunft?‹) von sich aus, dass sie die Werkstatt verlassen und auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln wollen.
Inhaltsverzeichnis
- 4.1 Anliegen und Fragestellung
- 4.2 Methodische Überlegungen
- 4.3 Stichprobe
-
4.4 Ergebnisse
- 4.4.1 Frau A: »Das macht voll Bock!«
- 4.4.2 Herr B: »Ich muss das alles besser in Griff kriegen«
- 4.4.3 Frau C: »Dass ich jetzt in dem Call-Center sitze, das finde ich richtig gut«
- 4.4.4 Herr D: »Ich bin auch bereit, meinen Traum so in Wirklichkeit umzusetzen«
- 4.4.5 Herr E: »Wie mich jemand reingeschoben hat - hab' ich richtig Horror gehabt«
- 4.4.6 Frau F: »Also eigentlich allgemein bin ich ja zufrieden ... und irgendwann werd' ich auch versuchen, hier rauszugehen«
- 4.4.7 Herr G: »Ich weiß gar nicht, was ich will - entweder ich bleib' in der Töpferei oder ich werd' draußen arbeiten«
- 4.4.8 Herr H: »Ich hab' mir eigentlich was anderes gewünscht«
- 4.4.9 Frau I: »Ich bin an der richtigen Stelle eigentlich«
- 4.4.10 Frau J: »Letztendlich bin ich nicht unzufrieden, aber ... wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, dann würde ich auch gern was anderes machen, und auch gern außerhalb der Werkstatt«
- 4.5 Zusammenfassende Bemerkungen
Bei der Vollbefragung der aktuellen und ehemaligen TeilnehmerInnen des Ambulanten Arbeitstrainings und Integrationspraktikums sowie der entsprechenden Parallelgruppe in den Werkstätten für Behinderte steht die Breite der erhobenen Daten im Vordergrund. Von möglichst vielen Menschen sollen Daten zu bestimmten Fragen erhoben werden. Dies geht jedoch unter Umständen auf Kosten der Tiefe der erhobenen Informationen. Bei der ersten Befragung werden dem konzipierten Fragebogen folgend die gleichen Informationen abgerufen - es wird aber nicht im Einzelfall nachgefragt, worum es im einzelnen und genau dabei geht.
An dieser Begrenzung setzt die zweite Befragung an. Am Beispiel einzelner Personen aus der ersten Befragung wird nun genauer eruiert, womit genau die Person zufrieden oder unzufrieden ist, wie sich das Verhältnis zu den AssistentInnen oder GruppenleiterInnen im einzelnen gestaltet, welche individuellen Entwicklungen zu verzeichnen sind und ähnliches mehr. Dabei wird auch die zeitliche Perspektive geweitet, denn sowohl die Wege vor als auch nach dem Arbeitstraining bzw. Integrationspraktikum werden in die Betrachtung einbezogen. Damit kann die Bedeutung der beiden Maßnahmen in der Biographie der TeilnehmerInnen ausgelotet werden. Die Zielsetzung dieser Befragung ist somit eine andere als bei der Vollbefragung: Nicht allgemeine, repräsentative Aussagen für die Gesamtgruppe gilt es zu treffen, sondern am Beispiel einzelner RepräsentantInnen gilt es bestimmte Verläufe oder bestimmte Positionen nachzuvollziehen - statt quantitativer Repräsentanz wird also qualitative Repräsentanz angestrebt.
Hierbei haben die Aussagen der Personen selbst wiederum einen hohen Stellenwert. Sie werden ergänzt durch die Sichtweisen anderer, die an der Situation in unterschiedlichen Funktionen beteiligt sind: Dies betrifft selbstverständlich die AssistentInnen bzw. GruppenleiterInnen, unter Umständen - und so weit die Personen selbst dies befürworten - auch Elternteile oder andere Vertrauenspersonen, bei der Assistenz-Gruppe gilt dies auch für die Vorgesetzten, so weit die Befragten sich inzwischen in Arbeitsverhältnissen befinden.
Zielsetzung dieser zweiten Befragung ist also eine differenziertere Betrachtung unter-schiedlicher Situationen und Verläufe. Mit ihrer Hilfe soll geklärt werden, was die zentralen Herausforderungen bei eher problematischen wie bei eher erfolgreichen Verläufen sind und welche Faktoren entscheidend zu ihnen beitragen.
Für die Interpretation der Studien werden zwei theoretische Folien genutzt: Die Stigma-Theorie GOFFMANs (1967) und die Theorie integrativer Prozesse (REISER 1991, HINZ 1993, 1996b). Sie heranzuziehen liegt insofern nahe, als beide Theorien spezifische Aspekte der zu interpretierenden Situationen beleuchten: Zum einen geht es zentral um Prozesse, die mit Stigmata, Stigmatisierung und Entstigmatisierung zu tun haben, also um gesellschaftliche Zuschreibungsprozesse, zum anderen besteht das Ziel der beruflichen Integration, für dessen Erreichung integrative Prozesse notwendig sind.
Gemäß der Stigma-Theorie besteht ein Stigma nach GOFFMAN (1967, 11) in einer zugeschriebenen »Eigenschaft einer Person, die zutiefst diskreditierend ist,« also einem »Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, daß wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden,« denn »es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten« (ebd., 13). Damit ist nicht die Eigenschaft an sich, sondern unsere Sichtweise von ihr - oder unser negatives Vorurteil ihr gegenüber - entscheidend.
Nach GOFFMAN (ebd., 14) bedeutet es einen wichtigen Unterschied, ob eine Person entweder eine Diskreditierte ist, also jemand, dessen Stigma für jeden sofort offensichtlich ist, etwa bei einer physischen Auffälligkeit oder einem definierten Syndrom. Von diesem äußerlichen Merkmal wird dann auf die ganze Person geschlossen, das Stigma also als ›master-status‹ generalisiert. Oder eine Person gehört zu den Diskreditierbaren, also zu jenen, deren Stigma sich nicht jedem sofort erschließt, sondern jeweils situativ entdeckt werden kann. Die jeweilige Zuordnung legt unterschiedliche Strategien des Stigma-Managements nahe: So birgt die notgedrungene ständige Auseinandersetzung mit dem Stigma einer diskreditierten Person eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich regressiv zurückzieht, evtl. im Rahmen einer Institution, oder dass sie gerade offensiv mit diesem Stigma umgeht - im Kontext des Umfeldes, in dem sie sich befindet. Eine diskreditierbare Person hingegen hat sich stärker mit der Frage des Entdeckt-Werdens auseinanderzusetzen, ihr liegen Strategien des Geheimhaltens und Kompensierens näher. Die Grundsituationen und damit die Startpunkte für die aktive Verarbeitung des Stigmas sind also durchaus verschiedene.
HOHMEIER unterschiedet auf der individuellen Mikroebene und auf der gesellschaftlichen Makroebene unterschiedliche Funktionen von Stigmata. Da hier die individuelle Ebene von Zuschreibungsprozessen im Vordergrund steht, wird die Makroebene vernachlässigt. Auf der Mikroebene sieht HOHMEIER (1975, 10-12, vgl. auch CLOERKES 1997, 148f.) drei Funktionen:
-
Die Orientierungsfunktion ermöglicht die Vorausstrukturierung sozialer Situationen und dadurch die Verringerung von Unsicherheiten.
-
Die Entlastungsfunktion ermöglicht die Projektion eigener verdrängter Bedürfnisse auf selektiv und verzerrt wahrgenommene ›Sündenböcke‹.
-
Die Identitätsstrategie schließlich ermöglicht die Wiederherstellung des gefährdeten psychischen Gleichgewichts durch Abgrenzung gegenüber Andersartigkeit.
Unter diesem Aspekt stehen alle Menschen in der Gefahr, zum Objekt von Stigmatisierungsprozessen zu werden. Am geringsten, so GOFFMAN (1967, 158), ist diese Gefahr in den USA für das einzig voll akzeptierte Wesen: »ein junger, verheirateter, weißer, städtischer, nord-staatlicher, heterosexueller, protestantischer Vater mit Collagebildung, voll beschäftigt, von gutem Aussehen, normal in Gewicht und Größe und mit Erfolg im Sport« - und natürlich nicht behindert.
Wie HOHMEIER aufzeigt, sind die Folgen für Stigmatisierte tiefgreifend (1975, 12-14): Die Interaktion orientiert sich am Stigma, wird so durch Spannungen, Unsicherheit und Angst erschwert, und die Biographie wird unter diesem Vorzeichen umdefiniert. Gesellschaftliche Teilhabe wird massiv erschwert, stattdessen droht Diskriminierung, Kontaktverlust, Isolation und Aussonderung.
Der Prozess der Stigmatisierung kann bei sichtbaren Stigmata bereits die Kindheitssozialisation bestimmen, setzt sich in der Interaktion mit den ›Normalen‹ fort und führt zur Rolle als Klient in speziellen Organisationen, in denen eine neue soziale Identität konstruiert wird. Diese Einrichtungen fungieren als »Instanzen sozialer Kontrolle« (CLOERKES 1997, 150), in denen »Experten, die in der kritischen Literatur auch als ›Zuschreibungsspezialisten‹ bezeichnet werden,« das offizielle Ziel einer möglichst effektiven »Rehabilitation bzw. Resozialisierung innerhalb eines zweckbestimmten, formalisierten und bürokratisierten Rahmens« (ebd.) verfolgen - genau das also, was GOFFMAN als ›totale Institution‹ bezeichnet. In ihr wird vom Einzelfall abstrahiert und das Individuum wird alltagstheoretisch pathologisiert, so dass »Eigenschaften ..., die man in unserer Gesellschaft als besonders negativ bewertet (personorientiertes Paradigma, medizinisches Modell)« in den Vordergrund rücken. »Der Definitionsmacht der Organisationen haben die Betroffenen im allgemeinen nichts entgegenzusetzen. Der meist niedrige sozioökonomische Status unterstreicht noch die Aussichtslosigkeit, sich den Zuschreibungen der Kontrollinstanzen zu entziehen« (ebd.). So übernehmen sie selbst angesichts der bestehenden Machtverhältnisse das zugeschriebene Stigma als Teil ihrer Identität, und gemäß dem Prozess der selbst erfüllenden Prophezeiung realisiert es sich dann auch und verhindert andere Entwicklungschancen.
Im Feld der Unterstützten Beschäftigung liegt eine zentrale Funktion von Integrationsfachdiensten darin, das Stigma-Management, also das Bemühen um Normalität, mit der unterstützten Person gemeinsam zu reflektieren und möglichst Prozesse der Entstigmatisierung einzuleiten (vgl. GEHRMANN & RADATZ 1997, MARKOWETZ 2000).
Zum anderen kann mit Hilfe der Theorie integrativer Prozesse - ursprünglich für den Bereich des Kindergartens und der Schule entwickelt - beleuchtet werden, in welchem Maße es gelingt, Integration zu realisieren. Dabei wird Integration nicht als ein Zustand verstanden, der irgendwann erreicht wird, sondern es geht um Prozesse, die sich zwischen den widersprüchlichen Polen der Gleichheit und der Verschiedenheit in einer dynamischen Balance von Annäherung und Abgrenzung vollziehen sollen. Bei diesen Prozessen lassen sich in Anlehnung an die Themenzentrierte Interaktion verschiedene Ebenen unterscheiden, die miteinander verwoben sind und aufeinander einwirken (vgl. Tab. 4.1; zum folgenden vgl. HINZ 1993, 42-54, 1996b).
Tab. 4.1: Ebenen integrativer Prozesse auf der Basis einer dynamischen Balance von Gleichheit und Verschiedenheit (HINZ 1993, 53)
|
Spannungsfeld -> |
Verschiedenheit |
<---Balance---> |
Gleichheit |
|
|Ebenen| Prozesse -> |
Abgrenzung |
<---Einigung---> |
Annäherung |
|
Innerpsychisch |
Verfolgung |
Akzeptanz |
Verleugnung |
|
Interaktionell |
Distanzierung |
Begegnung |
Verschmelzung |
|
Handlungsbezogen |
Verweigerung |
Kooperation |
Vereinnahmung |
|
Institutionell |
Aussonderung |
Gemeinsamkeit |
Anpassung |
|
Gesellschaftlich |
Exotisierung |
Normalisierung |
Kolonialisierung |
Auf der innerpsychischen Ebene geht es um die Herausforderung, nicht nur die ›Hochglanz-Seiten‹ der eigenen Person wahrzunehmen, mit denen wir uns gerne nach außen präsentieren, sondern sich auch den ›dunklen Seiten‹, den eigenen Seiten der Kleinheit, des Zweifelns, des Nicht-Könnens, der Ratlosigkeit zuzuwenden. Häufig versuchen wir diese Seiten aggressiv von uns zu weisen (und bei anderen um so schärfer zu verfolgen) oder sie zu verleugnen und uns auf die ›angenehmen Seiten‹ zu fixieren. Beide Strategien ermöglichen jedoch nicht Akzeptanz der eigenen Person. Es gilt also, sich hinzuwenden zum ›Fremden‹ in der eigenen Person und es als zu uns zugehörig zu akzeptieren.
Auf der interaktionellen Ebene liegt die Herausforderung entsprechend der innerpsychischen Ebene darin, zu einer Begegnung, zu einem Dialog zu kommen, in dem wir uns der anderen Person in ihrer Ganzheit und Widersprüchlichkeit zuwenden und in diesem Dialog die andere verstehen und uns selbst treu bleiben. Häufig tendieren wir dazu, uns bei Kontroversen schnell voll und ganz von anderen zu distanzieren und uns bei Übereinstimmungen mit anderen stark zu verbinden und individuell Unterschiedliches verschmelzend zu übersehen. Beide Verhaltensstrategien sind gleich darin, dass sie Homogenität anstreben. Ein ganzheitlicher Dialog im Sinne BUBERs wird so nicht entstehen können, denn wenn wir gleich und verschieden sind, gehören zu ihm immer Konsens und Dissens und damit auch harmonische und konflikthafte - oder zumindest nicht verstehende - Anteile.
Auf der handlungsbezogenen Ebene stellt sich die Herausforderung, zwischen den beteiligten Personen Kooperation zu ermöglichen - in Kindergarten und Schule zwischen Kindern und PädagogInnen, bei der Arbeit zwischen KollegInnen. Weder sollen sie in Situationen der Verweigerung noch in Situationen der Vereinnahmung geraten. Gemeinsames Handeln soll bei gleichzeitiger Wahrung der Gemeinsamkeit auf die Voraussetzungen und Möglichkeiten aller Beteiligten eingehen. Dementsprechend kann es nicht darum gehen, verschiedene individuelle Anteile zu entwickeln, sondern die Herausforderung liegt vielmehr gerade im gemeinsamen Tun, die die Unterschiedlichkeit der Beteiligten berücksichtigt.
Auf der institutionellen Ebene gilt es, ein Höchstmaß an Gemeinsamkeit in Unterschiedlichkeit zu ermöglichen und Anpassungsdruck und Aussonderungsdrohung zu überwinden. Dazu bedarf es vielfältiger Prozesse administrativer Öffnung durch die Überwindung von zeitlichen, räumlichen und effektbezogenen Begrenzungen durch individuelle Unterstützung sowie der Erweiterung der Möglichkeiten zur Entwicklung eines integrativen Profils und eines integrativen Selbstverständnisses für die einzelne Institution. Generell gilt es, in Konflikten zwischen hierarchischen Entscheidungs- und Verkündungsstrukturen einerseits und kooperativen Beratungsprozessen unmittelbar Beteiligter andererseits den kooperativen Beratungsergebnissen den Vorrang zu geben.
Auf der gesellschaftlichen Ebene und ihrer Normen schließlich stellt sich die Herausforderung der Normalisierung - nicht etwa in dem Sinne, dass alle ›normal werden‹ sollen, sondern dass der Begriff von Normalität ein erweitertes Spektrum von Menschen, ihren Verhaltensweisen, Einstellungen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten umfasst. Hier gilt es, normativ ausgrenzende Prozesse der Exotisierung wie unterdrückende Prozesse der Kolonialisierung zu überwinden. Dieses schließt insbesondere die Kritik an allen Konzepten von Normalität ein, die alle Menschen an einem Maßstab messen, damit eine ›Normalität‹ und gleichzeitig damit eine Hierarchie von Wertigkeiten schaffen und Ausgrenzung und Abwertung produzieren.
Den Aussagen Beteiligter in den Studien können Hinweise entnommen werden, in welchem Maße deren jeweilige berufliche Situationen integrative Momente enthalten in dem Sinne, dass auf der Basis prinzipieller Gleichheit individuelle Unterschiede wahrgenommen und akzeptiert werden (vgl. hierzu auch HINZ & LÜTTENSEE 1997).
Damit Situationen und Verläufe differenziert erfasst werden können, kommt methodisch nur das Interview in Frage (vgl. FLICK 1995, 94ff.). Nur bei ihm gibt es die Möglichkeit, in ein Gespräch einzusteigen, so dass sich bei den BefragerInnen ein Bild von der Situation ergibt. Wichtig ist darüber hinaus, dass den Befragten »das Wort gegeben wird« (BOURDIEU 1997), d.h. nicht die Fragen der BefragerInnen sind vorrangig wichtig, sondern die Sicht, die Akzente und die subjektive Wahrheit der Befragten sollen im größtmöglichen Maße zur Geltung kommen können. Das bedeutet u.a., dass die BefragerInnen das Machtgefälle in der Interviewsituation, bei der sie die Regeln bestimmen, reflektieren müssen (vgl. BOURDIEU 1997, 781). Die Interviews orientieren sich also an dem Gütekriterium von BOURDIEU, das darin besteht, »eine Beziehung des aktiven und methodischen Zuhörens zu schaffen, das vom reinen Laisser-faire des nicht-direktiven Interviews genauso weit entfernt ist wie vom Dirigismus eines Fragebogens« (1997, 782). Da es außerordentlich schwierig werden würde, einem weiteren anzustrebenden Arrangement BOURDIEUs nachzukommen, nämlich die Befragten von gesellschaftlich möglich nahestehenden Personen interviewen zu lassen - also etwa Schwarze in Harlem durch Schwarze in Harlem (vgl. 1997, 784) oder in diesem Feld z.B. Menschen mit geistiger Behinderung durch Menschen mit geistiger Behinderung - , ist die Fähigkeit des Interviewers um so zentraler, seinem Gegenüber »das Gefühl (zu) geben, mit gutem Recht das zu sein, was er ist, wenn er ihm durch seinen Tonfall und vor allem durch den Inhalt seiner Fragen vermittelt, daß er sich gedanklich in ihm hineinversetzen kann« (1997, 786, Hervorhebung i. O.), auch wenn dadurch die bestehende gesellschaftliche Distanz und die damit verbundene Asymmetrie der Situation nicht verleugnet werden soll.
Die folgenden Interviews versuchen, - mit BOURDIEU gesprochen - Menschen eine Stimme zu geben, die in der Öffentlichkeit bisher nicht gehört werden und auch in der Fachdiskussion, trotz aller Beschwörungen der Selbstbestimmung, nur eingeschränkt zu Wort kommen - Menschen mit Behinderung.
Obwohl es wünschenswert und nach BOURDIEU (1997, 797-802) notwendig wäre, können aus Raumgründen nicht die vollständigen Interviews wiedergegeben werden. Vielmehr werden ihre zentralen Aussagen zusammengefasst, weitestmöglich mit wörtlichen Zitaten. Grundlagen hierfür sind zum einen die vollständig transkribierten Interviews und zum anderen ein Katalog von neun Leitfragen:
-
Welche Sätze charakterisieren die Situation und eignen sich für den Titel?
-
Welches sind Stärken und Schwächen der Person?
-
Was sind wichtige Entwicklungen (Erfolge, Probleme)?
-
Was macht die Person (und ihr Umfeld) zufrieden und was macht sie unzufrieden?
-
Welche Rolle spielt für die Person die Arbeitsassistenz bzw. die Gruppenleitung?
-
Was wäre, wenn es die Arbeitsassistenz nicht gäbe? (nur Assistenz-Gruppe)
-
Welche Rolle spielt die Person in dem Betrieb (oder Betrieben)?
-
Welche Zukunftsperspektiven hat die Person?
-
Was sind spezifische Aspekte bei dieser Person und Situation?
Dieses geschieht aufgrund des Studiums der Interviews als kommunikativer Prozess im Rahmen eines Forschungsseminars, in dem die jeweils vorhandenen bis zu vier Perspektiven mit dem Blick auf eine Situation - die der Person selbst, die eines Elternteils, die einer Assistentin und die eines Vorgesetzten - von unterschiedlichen Personen studiert und gemeinsam diskutiert werden; so treten Übereinstimmungen und Differenzen zwischen den verschiedenen Perspektiven deutlicher hervor.
Eine weitere wichtige methodische Voraussetzung ist, dass die Menschen mit den vier verschiedenen Perspektiven zum großen Teil mit den gleichen Impulsen konfrontiert werden - wenngleich sie in den Interviews primär zunächst von je ihnen wichtigen Fragestellungen und Erfahrungen berichten können sollen. Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang 11.3) umfasst insofern für alle Befragten einen großen Teil gleicher Stichwörter, zu einzelnen Perspektiven kommen spezifische Aspekte hinzu.
Die Interviews werden im Zeitraum von Oktober 2000 bis Februar 2001 von der gleichen Person geführt, jeweils mit Einverständnis der Befragten auf Kassette aufgezeichnet, voll-ständig transskribiert, in der Forschungsgruppe diskutiert und schließlich in einer Kurzfassung dokumentiert. Ein in der Gruppe als zentral empfundenes Originalzitat bildet den Titel der Einzelstudien (vgl. BOURDIEU 1997, 800). Sie werden in der folgenden Darstellung durch einen kurzen Text mit äußeren Daten eingeleitet, am Schluss zusammengefasst und mit Hilfe der beiden Bezugstheorien analysiert. Den Schluss des Kapitels bildet eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse aller zehn Studien.
Um die Bedeutung der beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum retrospektiv betrachten zu können, werden nur Personen ausgewählt, die sie bereits hinter sich haben und mit folgender Praxis vergleichen können. Darüber hinaus sind Auswahlkriterien in der Assistenz-Gruppe die Anschluss- und Zugangswege der TeilnehmerInnen: Es sollen erfolgreich erscheinende Beispiele (im Sinne eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses), weniger erfolgreich erscheinende Beispiele (im Sinne von Arbeitslosigkeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Abbruch und Übergang in die Werkstatt für Behinderte) sowie ein Beispiel eines Schwebezustandes (Beendigung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses und Einstieg in das Integrationspraktikum) enthalten sein. Darüber hinaus sollen verschiedene Einstiegswege repräsentiert sein (aus der Werkstatt für Behinderte, aus Sonderschulen und aus Integrationsklassen). Dementsprechend werden die in Frage kommenden Personen gruppiert. Ergänzend werden andere Merkmalen hinzugezogen: unterschiedliche soziale Hintergründe und Geschlechtszugehörigkeit, verschiedene Grade von Zufriedenheit mit dem Arbeitstraining und - bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen - mit der Beschäftigungssituation sowie unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Nach diesen Kriterien werden sechs Personen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgewählt (vgl. Tab. 4.2).
Tab. 4.2: KandidatInnen der Assistenz-Gruppe für die Intensivbefragung
|
Vorwege |
Geschlecht |
Sozialer Status |
Zufriedenheit AT/IP |
Bereich Beschäftigung |
Zufriedenheit Beschäftigung |
|
Arbeitslosigkeit |
männlich |
mittel |
hoch |
- |
- |
|
Übergang in WfB |
männlich |
niedrig |
sehr hoch |
Handwerk |
mittel |
|
Abbruch d. Arbeitsverhältnisses |
männlich |
hoch |
hoch |
Handwerk |
mittel |
|
aus Int.-Klasse |
weiblich |
niedrig |
hoch |
Gastronomie |
hoch |
|
Aus WfB |
männlich |
mittel |
hoch |
Dienstleistung |
sehr hoch |
|
Aus Sonderschule |
weiblich |
mittel |
hoch |
Dienstleistung |
sehr hoch |
Mit dieser Auswahl sind die wesentlichen Verläufe vertreten. In der Durchführung zeigt sich allerdings, dass die vorgesehene Person, die zur Zeit arbeitslos ist, mehrfach zu verabredeten Terminen nicht erscheint, bevor sie schließlich mitteilt, dass sie sich nicht interviewen lassen möchte; insofern muss dieses Beispiel außerhalb der Betrachtung bleiben.
Bei der Werkstatt-Gruppe gibt es keine explizit qualitativen Kriterien im Sinne spezifischer Zugangs- oder Anschlusswege. Insofern ist das entscheidende Kriterium die Zufriedenheit mit der Situation in Arbeitstraining und Beschäftigung.
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Subgruppe für die zufriedenen Befragten sind mindestens zwei der folgenden vier Aussagen, wenngleich die vierte Aussage auch Ausdruck einer fatalistischen und nicht unbedingt einer zufriedenen Grundhaltung sein könnte:
-
eine sehr hohe Zufriedenheit mit Arbeitstraining und Beschäftigung,
-
der Wunsch, dass explizit nichts bei der aktuellen Beschäftigung verändert werden soll,
-
der Wunsch, dass die Person im Hinblick auf spätere Beschäftigungsperspektiven bleiben will, wo sie ist und/oder
-
die Aussage, dass die Person keinerlei Zukunftswünsche hat.
Unzufriedene qualifizieren sich für die Aufnahme in die Subgruppe entsprechend durch zumindest zwei von vier Aussagen:
-
eine sehr niedrige Zufriedenheit mit Arbeitstraining und Beschäftigung,
-
der Wunsch, die aktuelle Beschäftigung so zu verändern, dass die Person außerhalb der Werkstatt für Behinderte arbeitet,
-
der Wunsch, dass die Person im Hinblick auf spätere Beschäftigungsbereiche außerhalb der Werkstatt für Behinderte arbeiten will und/oder
-
die Aussage, dass die Person als Wunsch für die Zukunft eine Arbeit außerhalb der Werkstatt für Behinderte formuliert.
Aus diesen beiden Gruppierungen, den extrem Zufriedenen und den extrem Unzufriedenen, werden je zwei Personen ausgewählt, die ein möglichst weites Spektrum bei den ergänzenden Merkmalen (besuchte Schulform, Geschlecht, sozialer Status) abbilden sollen. Zu diesen vier Personen kommen zwei mit mittlerer Zufriedenheit hinzu, davon eine Person, die eine Zeit lang von der Arbeitsassistenz unterstützt wird und danach in die Werkstatt für Behinderte zurückkehrt (vgl. Tab. 4.3).
Tab. 4.3: KandidatInnen aus der Werkstatt-Gruppe für die Intensivbefragung
|
aus der Schule für |
Geschlecht |
Sozialer Status |
Zufriedenheit Arbeitstraining |
Zufriedenheit Beschäftigung |
|
Geistigbehinderte |
weiblich |
niedrig |
hoch |
sehr hoch |
|
Geistigbehinderte |
weiblich |
niedrig |
sehr hoch |
hoch |
|
Körperbehinderte |
männlich |
mittel |
niedrig |
niedrig |
|
Geistigbehinderte |
männlich |
niedrig |
niedrig |
mittel |
|
Körperbehinderte |
weiblich |
hoch |
mittel |
mittel |
|
Lernbehinderte |
männlich |
niedrig |
mittel |
mittel |
In der Durchführung der Untersuchung stellt sich heraus, dass die letztgenannte Person ebenfalls nicht interviewt werden möchte; insofern muss auch hier ein Beispiel außerhalb der Betrachtung bleiben.
Damit ergibt sich eine Stichprobe von insgesamt zehn Personen, die mündlich befragt werden, sowie eine davon abhängig große Gruppe von Personen, die in die Situation der zehn Befragten involviert sind (vgl. Tab. 4.4).
Tab. 4.4: In terviews im Rahmen der zweiten Befragung
|
Person |
Eltern |
Assistent |
Vorgesetzter |
|
|
1 |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
X |
X |
X |
X |
|
3 |
X |
X |
X |
X |
|
4 |
X |
X |
X |
X |
|
5 |
X |
X |
X |
Gruppenleiter |
|
6 |
X |
X |
Gruppenleiter |
Gruppenleiter |
|
7 |
X |
Gruppenleiter |
Gruppenleiter |
|
|
8 |
X |
Gruppenleiter |
Gruppenleiter |
|
|
9 |
X |
Gruppenleiter |
Gruppenleiter |
|
|
10 |
X |
Ehemann |
Gruppenleiter |
Gruppenleiter |
Im Folgenden werden die Studien einzeln vorgestellt, jeweils eingeleitet von einem kurzen Text, der den Weg der betreffenden Person und weitere Informationen umfasst. Die Darstellung der Einzelstudien orientiert sich an den Leitfragen (vgl. Kap. 4.2), anhand derer die unterschiedlichen Perspektiven diskutiert worden sind. Bei dem folgenden Text werden die wörtlichen Zitate kursiv wiedergegeben, darüber hinaus gibt es in Klammern gesetzte
-
kursive Wörter, die grammatikalische Ergänzungen sind,
-
Wörter in Normalschrift, die Situationsattribute wie (seufzend) oder erklärende Kommentare enthalten sowie
-
kursive Namen, die die konkreten Namen der Person anonymisieren.
Für jede einzelne Studie werden die wesentlichen Aspekte zusammengefasst und unter den beiden theoretischen Blickwinkeln betrachtet.
Frau A, 20 Jahre alt, befindet sich seit kurzem in einem tarifentlohnten, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis und arbeitet mit ca. 30 Wochenstunden in einem Gästehaus. Dort ist sie im Küchenbereich tätig, betreut einen als Cafeteria bezeichneten Aufenthaltsraum und pflegt die Grünpflanzen im ganzen Haus. Aus einer Familie stammend, in der die Eltern FacharbeiterInnen sind, besucht Frau A Integrationsklassen in der Grund- und Gesamtschule und verbringt danach zwei Jahre in einem integrativen Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-i). Von dort wechselt sie in das Ambulante Arbeitstraining, das sie 18 Monate in vier verschiedenen Betrieben, jeweils im Küchenbereich, absolviert. Frau A's eigentlicher Berufswunsch ist laut Aussagen ihrer Mutter »immer Kindergarten. Sie wollte immer mit Kindern irgendwie was zu tun haben. Und da waren wir beide eigentlich sehr fixiert drauf. Aber mit (dem Gästehaus) ... hat sie alles bekommen was sie wollte.«
Mit Ausnahme des Berufsschulunterrichts äußert sich Frau A in der ersten Befragung hoch zufrieden über ihren bisherigen Weg und ihre gegenwärtige Situation: die integrative schulische Laufbahn, den Berufsberater, das Arbeitstraining und ihre Beschäftigung. An ihrer Situation möchte Frau A nichts verändern, es ist »alles in Ordnung«, »ich will da bleiben.«
Im Rahmen der zweiten Befragung findet das Interview mit Frau A zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in der kürzlich neu bezogenen eigenen Wohnung bei Kaffee und Kuchen statt, separat werden ihre Vorgesetzte, ausgebildete Hauswirtschaftsmeisterin, im Betrieb und ihre Assistentin, ausgebildete Krankenschwester und Arbeitserzieherin, in den Räumen der Arbeitsassistenz befragt.
Über ihre Stärken und Schwächen äußert sich Frau A nicht explizit, ihre differenzierte Wahrnehmung von Situationen und das selbständige Wohnen lässt den Rückschluss zu, dass sie zu realistischen Einschätzungen fähig ist und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten besitzt. Dies wird auch in ihrer Reflexion über Unterschiede der Situation von ihr und den Zivildienstleistenden im Betrieb deutlich, wenn sie u.a. sagt: »Ich sehe: Das ist mein Arbeitsplatz, und die bleiben nur 'ne kurze Zeit. Nett sind die aber.« Dieses Reflexionsvermögen wird auch von ihrer Mutter angesprochen in dem Zusammenhang, dass Frau A bei früheren Praktikumsstellen zu Hause genau beschreibt, was ihr etwa am Verhalten eines Küchenchefs nicht passt oder wie sie die problematische Kommunikationsstruktur in einem Kindergarten wahrnimmt: »Es wurde da immer über Personen gesprochen, die gerade nicht anwesend waren, und sie stand da immer irgendwie zwischen.« Ansonsten schildert die Mutter ihre Tochter im vertrauten Rahmen als redefreudig, bei Fremden dagegen »richtig ruhig und still.« Den Äußerungen der Mutter zufolge ist Frau A in der Großstadt mobil: »Sie düst quer durch Hamburg, das kann sie richtig gut.«
Auch die Chefin und die Assistentin sehen viele Stärken: Frau A wird als »sehr lern- und leistungsbereit erlebt« (Assistentin), »sie entwickelt Ehrgeiz in ihrer Arbeit« (Chefin), arbeitet nach Anweisungen sehr systematisch und konsequent: »Sie ist die einzige, bei der sich das Einräumen von Tellern so anhört, als wenn jemand rhythmisch Schreibmaschine schreiben kann« (Chefin), was insofern erstaunlich erscheint, als sie zudem als Linkshänderin Abläufe bewältigt, die »für einen Rechthänder eigentlich konzipiert« sind. Die Assistentin beschreibt Frau A's Haltung, die sie als »großes Plus« empfindet: »Ich will das! Ich finde das klasse! Ich will auch was lernen! ... Da sticht sie total raus, fast unheimlich.« Ihre Chefin bemerkt darüber hinaus bereits während eines ersten Praktikums direkt nach der Schulzeit, als Frau A ihr »sehr schüchtern, scheu und unerfahren« erscheint: »Sie hat aber eine ganz tolle Stärke da schon gehabt, das war ihr soziales Engagement, dass sie nämlich das Nicht-Können von der S. (eine ebenfalls unterstützte Kollegin, d. Verf.) durch so viel Mehrarbeit kompensiert hat, dass wir nicht gemerkt haben, wie schlecht es S. geht.« Zudem beschreiben mehrere Gesprächspartnerinnen eine große »verbale Stärke« (Assistentin): Der Chefin hat Frau A »neulich sehr schön von ihrer Schulzeit erzählt, was das so für sie bedeutete, eine Gesamtschule zu besuchen und eine Integrationsklasse zu haben. Sie kann ja auch sehr gut mit der Sprache umgehen, das ist natürlich beeindruckend, dass sie frei erzählen kann, Situationen beschreiben kann.«
In früheren Praktikumsstellen gerät Frau A, wie sie berichtet, bei Stress- und Konfliktsituationen unter Druck, reagiert psychosomatisch und zieht sich zurück: »Also der Küchenchef, der war widerlich. ... Ich hab morgens Magenschmerzen gehabt, Kopfschmerzen gehabt. Also wenn ich schon wusste, ich muss da hin, und dann hat der nur rumgeschimpft da.« Mit ihrer jetzigen Chefin ist Frau A in gutem Kontakt, aber »mit dem konnte man überhaupt nicht sprechen. ... Und ich dann mit Magenschmerzen wieder nach Hause und meiner Mutter erzählt.« Die Mutter stellt dies ebenfalls fest: »Sie brachte es einfach nicht fertig zu sagen, also das und das ist nicht richtig.« Auch die Assistentin sieht die regressive Reaktion bei Konflikten als Problem: Zunächst meldet Frau A entsprechend einem eigenen »Erfolgsdruck« zurück, es sei »prima, alles wunderbar: ›Ich bin toll.‹ Kommt mit allem klar. Und dann war das im Kindergarten so: Zack - sprang das um, von einem Tag auf den anderen sagte sie, sie will das hier nicht weitermachen, sie hält das nicht aus.« Der Assistentin erscheint Frau A's Wahrnehmung in einem Dualismus gefangen: »Nett und nicht nett, und wenig Differenzierungsmöglichkeiten so zwischendrin oder so differenziertere Wahrnehmung.« Die Assistentin vermutet, »dass sie sehr abhängig von Urteilen von außen ist.« Ihrer Wahrnehmung nach braucht Frau A viel Bestätigung und Anerkennung, so dass »sie in sich dann doch wenig Sicherheit hat, was sie kann. ... Und wenn eine sagt, du bist zu langsam, dann ist sie verzweifelt.«
Die Assistentin benennt als zweites Problem das Phänomen, dass bei Frau A die äußere Wirkung teilweise nicht der inneren Haltung entspricht: Die Assistentin erlebt sie zunächst als »reserviert, aber sehr zugänglich trotz allem.« Frau A ist darauf angewiesen, dass Menschen »sie locken und Fragen stellen. Sie ist nicht so eine, die drauflosplappert.« Bedingt mag dies auch sein durch das eher »amimische« Verhalten, also eine wenig ausdrucksvolle Mimik, und verstärkt noch durch ein sehr langsames Arbeitstempo, was ihr in früheren Praktikumsstellen »ausgelegt worden (ist) als: ›Die ist ja unlustig, die will ja gar nicht.‹ Und wir (die AssistentInnen; d. Verf.) dachten: ›Das ist doch genau das Gegenteil: Die will doch total! Sehen die das denn gar nicht?‹«
Ein drittes Problem bildet das anfänglich »fehlende räumliche Empfinden«, wie die Chefin dies formuliert, bzw. das »Figur-Grund-Problem«, das die Assistentin vor allem im Hinblick auf das Abwischen von Tischen als bedeutsam ansieht: »Sie hat keine Vorstellung von der Fläche und kann nicht sagen: ›Das ist rund, das macht den Kreis oder diese runde Fläche aus, und da gehe ich jetzt so heran und strukturiere mir das.‹« Die Assistentin sieht dies als große Herausforderung: »Da haben wir uns manchmal die Zähne ausgebissen, so einen Raum wischen oder einen Tisch abwischen. Sechs Wochen haben wir qualifiziert, und dann konnte sie einen trapezförmigen Tisch abwischen. Einen runden Tisch - da mussten wir dann wieder neu anfangen. Das war wirklich ganz harte Arbeit. Und das wird eine Grenze bleiben, denke ich.« Die Chefin bestätigt und widerspricht zugleich: »Die waren manchmal ganz kaputt, die Arbeitsassistentinnen, weil sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie irgendwann in der Lage sein wird, diesen Raum so folgerichtig zu reinigen - und das kann sie jetzt.«
Deutliche Entwicklungen zu mehr Selbstsicherheit und Offenheit bestätigt Frau A: »Ja, das hat das gebracht.« Auch ihre um einige Jahre jüngere Schwester sieht deutliche Entwicklungen: »Ja, also sie hat sich total geändert, vom Typ her auch, höflicher. ... Also das ist schon, was sie alles da gelernt hat, weil früher, da hab ich denn gesagt: ›Lass mich das mal machen.‹ Und ich hab sie da immer unterschätzt. Und jetzt sagt sie: ›Ich kann das selber!‹« Die Mutter sieht, dass ihre Tochter »fröhlicher, selbstbewusster und ordentlicher« geworden ist: »Dieses Training, was sie da gehabt hat, das hat sie in Einigem weitergebracht. ... Das sehe ich auch hier jetzt an ihrer Wohnung, also sie macht das alleine und das hätte sie zu Hause nicht so gebracht.«
Die Assistentin sieht zunächst eine massive Veränderung der eigenen Wahrnehmung: »Als Vorinformation hörte ich, sie sei schwach.« Zumal nach einem Fachgutachten des Arbeitsamtes denkt sie: »O je, was erwartet mich da für eine Frau?« Dort heißt es unter anderem, Frau A sei »deutlich unter dem Durchschnitt der Population einer WfB.« Im Gespräch über die Situation beim psychologischen Dienst des Arbeitsamtes erkennt die Assistentin nach den Schilderungen von Mutter und Tochter: »Das muss ja zu so einem Ergebnis führen, das ist ja grässlich. Sie war von vornherein verschreckt.« Trotzdem ist Frau A vom Berufsberater zum Ambulanten Arbeitstraining der Arbeitsassistenz zugewiesen worden, worüber Frau A's Mutter sehr froh ist. Der Berater »ist wirklich ein Mann, der sich auch einsetzt, muss ich sagen. Also der hat uns auch Tipps gegeben, wie wir das angehen können, damit das alles klappt. Also der ist wirklich am richtigen Punkt da im Arbeitsamt.« Um so mehr hat die Assistentin im Rückblick das Bedürfnis, einen Film zu drehen und dem Gutachter zu zeigen, wie Frau A beispielsweise »diese riesengroße Spülmaschine« bedient, »die ist schon kompliziert. Und die muss man auf- und abbauen jeweils vor und nach dem Spülen - und das kann sie!« Gleichwohl räumt die Assistentin ein: »Ja, das ist wirklich manchmal so, dass du als Assistentin vor einem Ding stehst und denkst: ›O Gott, ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen, versuchen wir es - versuchen wir unser Glück.‹« Sie resümiert: »Du kannst ja lange irgendwie sagen: ›kognitiv schwach‹ oder was weiß ich, aber was das im einzelnen bedeutet - das sagt eigentlich nix.« Ansonsten ist Frau A den Aussagen der Assistentin zufolge in die betriebliche Situation hineingewachsen, auch hat sie eine andere soziale Rolle erlangt in Relation zu den KollegInnen, und sie ist mittlerweile »eine absolut wertvolle Mitarbeiterin.«
Die Chefin stellt fest: »Es ist wirklich schön, jetzt ist sie vier Monate an Bord und ich denke, dass sie zunehmend lernt und wächst.« Aber auch die Akzeptanz von Frau A im Betrieb hat »sich also sehr gut entwickelt.« Sie profitiert wie jeder Mensch auch davon, »für Menschen tätig zu sein, der (Dienstleistungsbereich) gibt ja eine ganz starke Selbstbestätigung so in der sozialen Entwicklung. Und das ist bei ihr so auffällig, dass sie da wirklich jeden Tag ein Stückchen wächst.« Die Chefin ist »überrascht: Das hat eigentlich die Erwartungen übertroffen, was in ihr steckt.« Frau A ist inzwischen nicht mehr nur eine Kollegin, die Anweisungen entgegennimmt, sondern sie gibt auch welche: »Ich habe sie heute morgen gebeten, bei dem neuen Zivildienstleistenden doch darauf zu achten, dass er ordentlich aufräumt.«
Frau A's Zufriedenheit resultiert ihren eigenen Aussagen zufolge vor allem daraus, dass sie diesen Arbeitsplatz hat. Weder fehlt ihr etwas, noch macht sie sich wegen irgend etwas Sorgen, noch wünscht sie sich etwas Spezifisches für die Zukunft. Ihr Leben findet sie insgesamt »so jetzt in Ordnung, mit dem Arbeitsplatz.« Frau A ist so zufrieden, dass ihre Assistentin eine andere Frau im Ambulanten Arbeitstraining bei ihr hospitieren lässt, »weil ich dachte, also diesen Drive, den sie so hat, so nach dem Motto: Ich will hier irgendwie was machen und ich finde das auch ganz klasse so.« Nach einer eigentlich unlösbaren Aufgabe - es geht um das Eindecken von 60 Plätzen, wobei Frau A nicht bis 60 zählen kann - , die sie mit Assistenz bewältigt, sagt Frau A: »›Das macht voll Bock!‹ - so richtig aus dem Bauch heraus.«
Maßgeblich für die hohe Zufriedenheit ist sicherlich auch die Chefin, mit der Frau A, wie sie betont, im Unterschied zu früheren Chefs »sprechen« kann. Auch die Mutter hält die Rolle der Chefin für wichtig: »Das ist ja auch eine ganz liebe.« Bestätigt wird dies durch die Assistentin, für die die Chefin »das einfach super kompetent« macht. Eine Schlüsselstellung hat dabei nach den Beobachtungen der Assistentin das morgendliche »Arbeitsfrühstück, das wird auch bezahlt. Also das gilt als Arbeitszeit, nicht als Pause. Und dann macht sie da so Ansagen. ... So habe ich noch nie eine Chefin oder Chef agieren sehen mit seinem Team.« Die Chefin ihrerseits ist mit Frau A sehr zufrieden, »in jedem Fall über 90 % und ausbaufähig.« Wie stark die Überzeugung ist, auf einem erfolgreichen Weg zu sein, wird auch darin deutlich, dass die Chefin überlegt, die Zivildienststellen nach und nach in unterstützte Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln: »Es ist auf Dauer sinnvoller, es so zu besetzen als durch diese ständig wechselnden und Unruhe stiftenden anderen jungen Mitarbeiter, die immer in einer großen Mehrzahl auftreten und auch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis vom Staat haben und so selbstgewählt nicht an die Arbeit herangehen.«
Zur Rolle der Arbeitsassistenz merkt Frau A an, sie habe »mitgeholfen und gesagt, wie ich was machen muss. ... Das hat mich weitergebracht. Also es hat mich wirklich weitergebracht.« Für die Mutter ist die Arbeitsassistentin vor allem wichtig als Ansprechpartnerin, »also die hatte wirklich Zeit und hat sich mit mir auch unterhalten. ... Das läuft schon sehr gut, muss ich sagen. Nun mag ich sie auch gerne, das ist eine ganz niedliche, und ich denke auch, das könnte gar nicht besser laufen.«
Die Assistentin selbst sieht einen Schwerpunkt ihrer Rolle darin, zunächst Situationen zu analysieren: »Wo ist das Problem eigentlich, was macht es ihr jetzt schwer?« Nachfolgend ist es die Aufgabe der Assistentin, konkrete Abläufe und Tätigkeiten zu systematisieren, kleinschrittig zu üben und Transferleistungen zu ermöglichen. Dies gilt für das Abwischen der Tische oder bei der Bedienung der Spülmaschine, aber auch sonst: »Wenn du ein Teil in der Hand hast, und gehst dann damit rüber, und da stehen noch sieben Teile, die auch mit rüber müssen, und wenn du die andere Hand dann frei hast, dann musst du sagen: ›Hier ist etwas falsch.‹ So habe ich versucht, ihr das beizubringen: ›Das muss dir ein Signal sein, da fehlt noch etwas und da muss jetzt auch etwas rein, dann kann ich losgehen.‹« Dass Transfers möglich sind, stellt die Assistentin z.B. fest, als Frau A genau dieses wörtlich so an ihre hospitierende Kollegin weitergibt. Der zweite Schwerpunkt der Arbeit mit Frau A ist »die Geschichte mit der sogenannten sozialen Wahrnehmungsfähigkeit.« Hier geht es darum, gemeinsam Alternativen zum bestehenden Dualismus (nett - nicht nett) zu entwickeln.
Für die Chefin sind die Arbeitsassistentinnen vor allem wichtig, »weil sie detaillierter auf den Menschen eingehen können. Also die Einarbeitung in dem Umfang, wie sie wichtig ist bei jemandem, der kein räumliches Empfinden hat, das zu trainieren, das habe ich auch gelernt in der Zusammenarbeit, welche Schritte notwendig sind, um das jemandem deutlich zu machen. Das halte ich schon für immens wichtig, dieses Trainieren, das Bestätigen.« Im Fall von Frau A schafft dies »eine Präzision in den Arbeitsabläufen, wie sie wünschenswert sind, wie sie aber kein herkömmlicher Mitarbeiter eigentlich abgeben will.«
Ohne die Arbeitsassistenz, sagt Frau A sehr klar, wäre sie in der Werkstatt für Behinderte: »Es gab ja nichts anderes und da hatte man immer gesagt: ›Ja, in die Werkstätte.‹ ... Ich weiss das gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber auf jeden Fall ...« Dazu meint die Mutter: »Ich habe dann immer gesagt: ›Also Werkstätte nicht.‹ Dann hätte ich sie zu Hause behalten. Weil sie schon als kleines Kind - sie ist sich ja ziemlich spät bewusst geworden, dass sie anders ist als andere Kinder - und da hat sie dann immer gesagt: ›Also wenn ich mal groß bin, da will ich nicht hin.‹ Das hat sie schon immer gesagt. Und da habe ich zu ihr gesagt: ›Musst du auch nicht.‹«
Die Assistentin erinnert sich mit verblüfftem Gesichtsausdruck an eine Besuchssituation, in der Frau A die Frage, ob sie das auch ohne die Arbeitsassistenz geschafft hätte, bejaht. »Da habe ich gedacht: Ah ja, gut, okay.« Angesichts des psychologischen Fachgutachtens vom Arbeitsamt wäre Frau A jedoch nach Meinung der Assistentin bestenfalls in die Werkstatt für Behinderte aufgenommen worden, da sie wie schon erwähnt in dessen Wahrnehmung »so deutlich unter dem Durchschnitt der Population der WfB« gelegen hätte.
Zur konkreten Konsequenz für Frau A äußert sich deren Chefin nicht, jedoch steht auch ihr die Werkstatt für Behinderte vor Augen, da eine frühere Mitarbeiterin aufgrund einer Erkrankung dorthin freiwillig zurückgewechselt ist, obwohl »sie es draußen sehr schön fand. Draußen - so ein Begriff. ... Also draußen ist wirklich jenseits alles Trennenden. Ich denke, dass da einfach zu große Zäune gezogen sind über Jahrzehnte. Und: Das ist eure Welt, das ist unsere Welt - und das ist nicht in Ordnung.«
Zur eigenen Rolle im Betrieb lässt sich aus Frau A's Aussagen schließen, dass sie sich in früheren Praktikumsbetrieben vorgekommen ist wie ein Störfaktor, der nicht schnell genug ist, oder teilweise wie ein Sündenbock, bei dem allgemeiner Frust abgeladen wird. Im jetzigen Betrieb wird sie dagegen akzeptiert und respektiert: »Das klappt alles, wie das jetzt läuft.« Weder mit KollegInnen noch mit Gästen sind kränkende Situationen vorgekommen: »Nee, habe ich noch nicht erlebt.« Ihre Mutter zieht die Parallele: »Wie eine Familie ist das da.«
Im Kolleginnenkreis hat die Assistentin Frau A »als zwar still, aber dann doch offen für Kontakt erlebt. So eine ganz ruhige Art irgendwie und so abwartend freundlich.« Weiter betont sie wiederum die steuernde Funktion der Chefin, die die Rollen klärt: »Sie sagt dann: ›Das ist eine Praktikantin und die ist von der Arbeitsassistenz, und was das ist, erkläre ich auch noch mal gerne; und dann wird sie hier sein für so und so lange und sie möchte auch einen Arbeitsvertrag‹. ... So 'n bisschen: ›Dass euch das klar ist und dass ihr da alle mit in die Verantwortung gerufen seid.‹ Das fand ich ganz gelungen immer, ja wirklich, das öffnet auch die Leute.« Diese eindeutige Klärung stärkt auch Frau A darin, sich gegenüber mütterlichen Ambitionen anderer Mitarbeiterinnen abzugrenzen: Wenn jemand »so mütterlich: ›Ach dutschi dutschi ..., unsere kleine Behinderte‹« eingestellt ist, das lässt sich Frau A »natürlich gar nicht gefallen.« Und so »ist sie anders angesprochen. Das macht die (Chefin) klasse. Und die hat dann auch gleich gesagt: ›Das ist Arbeitsassistenz und darum geht es. Die sind auch hier und arbeiten mit, aber nicht um mitzuarbeiten, sondern um (Frau A) einzuarbeiten oder zu qualifizieren und so weiter.‹ Also sie hat das gut erklärt und wir haben unseren Platz an dem Tisch.« Frau A nimmt nach Meinung der Assistentin einerseits die Rolle einer kompetenten »Mitarbeiterin, wie die anderen auch« ein, mit einem eigenen »Aufgabenbereich, von dem auch alle wissen, den sie hundert Prozent erledigt.« Andererseits ist sie »auf jeden Fall schon eine, auf die man aufmerksam wird. Sie ist schon eine besondere - klar, das schon.«
Die Chefin sieht nicht nur die Assistentinnen und sich als Anleiterinnen, sondern »in der Küche, denke ich, machen das alle Kollegen, auch auf einer sehr netten kollegialen Ebene.« Für neue KollegInnen ist »sie ja diejenige, die schon da ist. Und damit behauptet sie ihren Arbeitsplatz ganz stark.« Auch »Menschen, die bisher selten mit behinderten Menschen, geistig behinderten Menschen, zusammengearbeitet haben, ... merken sehr schnell, dass (Frau A) einfach mehr praktische Erfahrungen hat. (Sie) macht das auch deutlich. Doch, das macht sie außergewöhnlich gut.« Frau A »wird von allen sehr geschätzt, weil sie auch jemand ist, der sehr lieb ist, sie ist sehr gleichmäßig, nie launisch. Diesen Arbeitsbereich füllt sie als ganzer Mensch aus, sie ist immer sachlich und nett zu allen Kollegen. ... Alles solche Dinge, also solch eine Loyalität, die ist ja so viel ausgeprägter als bei vielen anderen Menschen. Das schätze ich auch sehr, das schafft auch eine Ruhe im Arbeitsbereich, wenn da (Frau A) steht wie ein Fels in der Brandung.«
Dezidierte Zukunftsperspektiven hat Frau A nicht: »Weiß ich nicht, lass ich auf mich zukommen.« Ihre Schwester hofft, »dass für sie alles so weiterläuft, wie es jetzt ist. Ja, und dass sie halt auch mehr Kontakt hat.« Auch Frau A will die neuen Freundschaften aus dem Berufsschulunterricht des Ambulanten Arbeitstrainings weiter pflegen. Die einzige Zukunftsangst der Mutter war, »dass sie wirklich in der Behindertenwerkstätte hätte landen müssen, was ich nicht gemacht hätte. Ja, die Zukunftsträume an sich, dass sie das weiterhin so meistert wie jetzt auch und dass sie vielleicht auch noch irgendwann noch mal mehr Kontakt zur Außenwelt kriegt. Da ist sie noch nicht so bereit zu. ... Und dass vielleicht irgendwann noch mal eine Partnerschaft oder so da ist, dass du (zu Frau A, die lacht; d. Verf.) nicht immer alleine bleiben musst. Das wäre noch mal so eine Krönung.«
Die Assistentin sieht als Problem heraufziehen, dass Frau A »keine rückenschonende Arbeitsweise« praktiziert; hier besteht Handlungsbedarf. Weiter betreibt sie die Flexibilisierung der Arbeitsprozesse für Frau A: Neben der Grünpflanzenpflege und der Spülküche soll sie verstärkt in die Bereiche der Wäscherei und der Zimmerpflege eingeführt werden, so dass sie vielseitiger und »flexibler einsetzbar ist.« Auch wenn es mal zu einem Wechsel der Leitung kommen sollte und mit dem Chef vieles »steht und fällt«, sieht die Assistentin deutlich mehr Chancen als Gefahren. Hierfür stehen auch vermehrte Assistenzstunden zur Verfügung.
Für die Chefin ist letztlich entscheidend: »Die Behinderung, wie auch immer sie geartet ist, tritt ja irgendwann zurück, die nimmt man ja gar nicht mehr wahr. Man hört die Stimme von demjenigen oder merkt eben sein angenehmes Auftreten, die Beständigkeit in der Arbeit, ja, die Ruhe und die Identifizierung mit dem Arbeitsplatz. Das sind alles so Dinge, die in den Vordergrund gehen.« Darüber hinaus setzt sich die Chefin dafür ein, dass sie keine Ausgleichsabgabe mehr abführen muss: »Wenn ich als kleine Einrichtung in meinem Betrieb drei Menschen mit Behinderung beschäftige, dann möchte ich nicht, dass ich zusätzlich an der Ausgleichsabgabenumlage beteiligt werde.«
Wichtige Aspekte bei Frau A
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Frau A lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Es wird eine sehr frühe, klare integrative Orientierung deutlich, die bereits in der Jugendzeit besteht und von der Familie und dem Umfeld getragen wird.
-
Die Berufsberatung im Arbeitsamt wird von Frau A und ihrer Mutter als extrem gut und kundenorientiert beschrieben, obwohl ein anders orientierendes psychologisches Fachgutachten zumindest die Assistentin stark irritiert.
-
Herausragend erscheint die hohe, für die Assistentin fast unheimliche Arbeitsmotivation von Frau A.
-
Ein Widerspruch zwischen unterschiedlichen Sichtweisen besteht darin, dass die Assistentin Frau A als Folge wenig differenzierter sozialer Wahrnehmungsfähigkeit eine hohe Abhängigkeit von der Bestätigung bei anderen zuschreibt, während die Chefin gerade das differenzierte Einfühlungsvermögen von Frau A heraushebt.
-
Hoch bedeutsam schließlich ist auch die deutlich steuernde Funktion der Chefin im Betrieb, die in ihrer sozial-integrativen Grundhaltung für ihren Betrieb die soziale Erfahrung von Unterschiedlichkeit bewusst als Bereicherung anstrebt. Die Veränderungen betrieblicher Abläufe und Aufgaben nach Maßgabe von Frau A's Interessen, Zeit- und Rückzugsbedarfen zeugen davon.
-
Schließlich ist festzustellen, dass - anders als in der ersten Befragung - bei Frau A nicht nur eine hohe, sondern eine sehr hohe Zufriedenheit mit der momentanen Situation besteht, die auch von allen Beteiligten geteilt wird.
Ansätze zur Interpretation
Gemäß der Stigma-Theorie ließe sich Frau A als Diskreditierte beschreiben. Offenbar hat sich dies jedoch trotzdem nur in geringem Maße auf ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt; welchen Stellenwert dabei der integrative Weg durch die Schule hat, muss offen bleiben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sie in der ersten Befragung lediglich den Berufsschulunterricht während des Ambulanten Arbeitstrainings, also diejenige schulische Situation als schlecht angibt, bei der sie ausschließlich mit anderen Menschen mit Behinderung unterrichtet wird. Da das Stigma von Frau A in diesem Umfeld, im Unterschied zu früheren Praktikums-betrieben, keine negativen Auswirkungen nach sich zieht, können sich die Assistentinnen ganz auf die Unterstützung von Lernprozessen im Tätigkeitsfeld von Frau A konzentrieren, denn Entstigmatisierungsprozesse sind nicht notwendig.
Der Theorie integrativer Prozesse zufolge ließe sich Frau A als Person mit hoher Selbstakzeptanz beschreiben, die weiß, was sie will und was sie nicht will. Die Dialektik zwischen Gleichheit und Differenz kommt hier voll zum Tragen, wenn sie einerseits anerkannte Kollegin ist, zugleich aber mit besonderem Augenmerk gesehen wird. Es wird eine Situation echter Begegnung deutlich. Integrative Prozesse auf der institutionellen Ebene, dass also ›zwei Seiten‹ sich aufeinander beziehen und aufeinander zu bewegen und so ein neues Ganzes werden, sorgt für die hohe Zufriedenheit aller Beteiligten. Hier können durch die Balance von Verschiedenheit und Gleichheit Einigungsprozesse auf allen Ebenen als gelungen als gelingend wahrgenommen werden. Aufgrund der stabilen, willensstarken Haltung von Frau A, der deutlichen Integrationsorientierung der Chefin und dem offenen und veränderungsbereiten Arbeitsumfeld kommt den Arbeitsassistentinnen in diesem Betrieb also vorrangig eine auf Fertigkeiten hin qualifizierende Aufgabe zu.
Herr B, 18 Jahre alt, arbeitet seit drei Monaten auf der Grundlage eines befristeten Probevertrages mit ca. 30 Wochenstunden auf einer Esso-Tankstelle. Dort ist er dafür zuständig, Regale und Kühlgeräte im Ladenbereich zu bestücken und den Hof und den Sanitärbereich in Ordnung zu halten. Die über lange Zeit alleinerziehende Mutter von Herrn B arbeitete als Erzieherin in Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen. Sie erkämpft eine Integrationsklasse in Schleswig-Holstein für die Grundschulzeit, die jedoch nicht im Sekundarbereich fortgesetzt wird. Vom Ministerium wird ihr Sohn amtlich für geistig behindert erklärt und soll in die entsprechende Sonderschule eingewiesen werden. Nachdem die Mutter sich massiv, aber vergeblich dagegen wehrt, geht er ab dem fünften Schuljahr in eine Hamburger Förderschule. Von dort wechselt er - eigentlich wieder gegen den Willen seiner Mutter, die im Rückblick immer für alles hat kämpfen müssen und sich von Professionellen allein gelassen fühlt - in ein Berufsbildungswerk und schließlich in den Arbeitstrainingsbereich einer Werkstatt für Behinderte. Für die vier letzten Monate geht er, nachdem die Arbeitsassistenz in der Werkstatt für Behinderte über ihre Möglichkeiten informiert hat, in deren Ambulantes Arbeitstraining über, in dem er zunächst im Hol- und Bringedienst eines Krankenhauses und später auf der Esso-Tankstelle arbeitet. Diese Tätigkeit setzt er acht Monate in der Form des Integrationspraktikums fort, das in einen sechsmonatigen Probevertrag mündet. Herrn B's eigentlicher Berufswunsch ist, Kfz-Mechaniker zu werden, zumal er während der Schulzeit ein Betriebspraktikum in einer Kfz-Werkstatt gemacht hat.
In der ersten Befragung äußert sich Herr B über seine Schulzeit eher negativ, seine Zeit in der Werkstatt für Behinderte lässt er unkommentiert und die Berufsschule bekommt ein mittelmäßiges Prädikat. Das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum schätzt Herr B positiv, seine Beschäftigungssituation sogar sehr positiv ein.
Die zweite Befragung findet mit Herrn B und seiner Mutter in deren Wohnung statt, der Assistent, ausgebildeter Sozialpädagoge, wird im Büro der Arbeitsassistenz und der Vorgesetzte und seine Frau, die Pächter der Tankstelle, im Verkaufsraum ihres Betriebes interviewt. Zum Zeitpunkt der Interviews wird der Probevertrag zwar nicht in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergeleitet, aber nach vielen Schwierigkeiten auch nicht beendet, sondern vielmehr um ein weiteres halbes Jahr verlängert.
Stärken und Schwächen werden von Herrn B, der eher wortkarg und auf den ersten Blick um Coolness bemüht wirkt, selbst nicht explizit als solche thematisiert. Vielmehr betont er Tätigkeiten, die den Zuhörer dann auf Fähigkeiten schließen lassen können, wie das Mofa-, Trecker- oder Rasenmäher-Fahren oder seine Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem demonstriert er - zumal während der Befragungen im Betrieb - durch sehr schnelle Zwischendurch-Aktivitäten (diverse kleine Erledigungen), dass er vieles im Blick hat, Bescheid weiß und sehr schnell ist. Anderseits antwortet er auf die Frage nach Wünschen für die nächste Zeit, »dass alles klappt, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe ... Aber das wird irgendwie nix.«
Seiner Mutter fällt auf, dass er bei diesen Äußerungen Tränen in den Augen hat. Sie ist überrascht, »dass er überhaupt etwas gesagt hat hier auf diese Fragen. Als wir die ersten Gespräche bei der Hamburger Arbeitsassistenz geführt haben, hat er gar nichts gesagt. Da hat er gegähnt und dann nicht geantwortet und so, war ganz unsicher. Also, das ist schon erstaunlich, dass er überhaupt etwas gesagt hat, und dann auch noch passend ... Das fand ich schon ganz toll.« Sie beschreibt eine grundsätzliche Ambivalenz, die »sich so durch sein ganzes Leben zieht: Er ist ein sehr herzlicher Mensch, so liebevoll. Er unterstützt mich zum Beispiel hier jetzt sehr.« Sie weist auf den Säugling in ihrem Arm. »Da ist er rührend: ›Kann ich dir etwas abnehmen, kann ich dies, kann ich das?‹ Aber sowie ich etwas von ihm fordere, ... das kriegt er nicht hin. Und wenn ich dann aber einen festen Termin mit ihm abmache, ... dann rast er durch das Haus wie ein wildgewordener Handfeger ... anstatt das mal kontinuierlich zu machen ... Nein, fünf Minuten vor Toresschluss rast er wie ein Irrer hier rum«. Weiter stellt sie heraus: »Das Schwierige ist mit Sicherheit, eine Konstanz zu halten. Er ist hochmotiviert, wenn eine Männlichkeitsseite in ihm angesprochen wird, also ... zum Beispiel hier, als mein Mann damals auszog, war er der Mann im Haus und dann lief alles bestens. Und kaum war er jetzt die zweite Geige wieder, ... lässt er das fallen. Und genauso ist das auch in der Firma, habe ich das Gefühl. Also, als (der Chef) mal nicht da war und er von dieser Seite so angesprochen wird: ›Du bist jetzt hier eine wichtige Kraft, Du musst (der Chefin) helfen‹, dann ging das gut. Da hat er ganz toll drei Wochen durchgehalten, aber dann kommen Einbrüche aus unerfindlichen Gründen.« Sie bedauert, »das ist leider so der Punkt, dass er dann glaubt, er muss dann vor irgendwelchen Leuten irgend etwas beweisen ... Wenn er so ein bisschen Kontinuität leisten könnte. Das kriegt er nicht hin.« Und bezogen auf seine Arbeitsassistenten und seine KollegInnen sieht sie bei ihrem Sohn das Problem, dass er deren Haltung »auch nicht richtig einschätzen« kann: »Er denkt immer, die wollen ihm irgendwie seinen Job ankreiden oder sie wollen ihm sagen, dass er das nicht gut macht. Er hat eine sehr geringe Frustrationstoleranz, ausgesprochen gering. Und er versteht anscheinend nicht, dass die eigentlich helfen wollen oder seine Hilfe brauchen. Nun muss ich sagen, schon seit mein Sohn auf der Welt ist, muss man immer den richtigen Ton treffen.« Einen anderen Aspekt sieht die Mutter von Herrn B darin, das richtige Maß zu finden, zum Beispiel wenn es darum geht, KollegInnen oder FreundInnen etwas zu spendieren. Ihr Sohn »ist in solchen Sachen so unsicher, ... überhaupt all diese Dinge, die damit zu tun haben, mit der Lebensveränderung durch diesen Job. ... Es verändert sich das Leben nämlich, weil sie mit einem Mal Geld in den Händen haben. Also mindestens die Hälfte seines Geldes lässt er dort auf der Tankstelle, weil er sich dort ernährt.« In seinem Freizeitumfeld lässt er »sich das Geld von anderen aus der Tasche ziehen. Für ... Big Macs und solche Sachen.« Für die Mutter ist klar, »er wird jetzt 19, aber er ist ja nicht 19. Das ist es ja. Vielleicht ist er so wie sein Bruder mit 14. Und die sind einfach noch unreif und unsicher in vielen Sachen, sehr jung halt noch.«
Dieses bestätigt auch der Assistent von Herrn B, wenn er seinen ersten Eindruck von ihm erinnert: »O Gott, der soll jetzt schon arbeiten?« Zu Beginn »war er ein sehr ruhiger, sehr stiller, noch Junge. ... Trotz seiner Ruhe auch noch irgendwie sehr verspielt.« Als weiteres Grundproblem nimmt er an, »vielleicht ist es das ›zwischen-Baum-und-Borke-Hängen‹.« Er sieht ihn eher als »Grenzfall«, bei dem einerseits die Kompetenzen klar im Machen liegen. Während der Assistent anderen genau zeigen muss, »wie dieser Arbeitsschritt zu machen ist,« braucht er das bei Herrn B nicht. »Da muss man sagen: ›Okay, das steht jetzt an, das musst du irgendwie so machen, leg mal los‹. Dann hat er losgelegt.« Die Schwächen aber liegen bei Herrn B andererseits darin, »dass er wirklich Kleinigkeiten zu etwas Großen macht, um da irgendwie so 'n Selbstwert anderen gegenüber aufzubauen.« Das führt mehr und mehr dazu, »dass er auf andere und auch auf uns immer unglaubwürdig wirkt.« Eigentlich hätte er es nicht nötig, »Geschichten zu so etwas Tollem zu machen, denn was er kann und was er leistet, ist schon toll genug. Aber das ist für ihn ganz schwierig umzusetzen.« In Hinblick auf Kooperationsprobleme im Betrieb überlegt der Assistent, »ob 's wirklich so was Behinderungsbedingtes ist, wo er dann auch wirklich nicht was dafür kann in solchen Situationen, dass er dann irgendwie ganz schräg reagiert, wenn seine Kollegen ihn bitten, irgend eine Arbeit zu machen und er dann sagt: ›Nö, mach' ich nicht!‹« Dies führt immer wieder zu Schwierigkeiten, denn Herr B »wirkt ja erst mal in seinem Auftreten sehr souverän und dem sieht man erst mal nicht an, dass er vielleicht irgendwo Defizite hat. So war das dann auch schon mal irritierend.«
Der Chef von Herrn B konstatiert: »Er ist interessiert, ja, wir sind noch dabei, ihn weiter zu interessieren. ... Wir haben ihm einen Tätigkeitsbereich gegeben, und den hat er auch ganz gut gemacht. Und dann haben wir gesagt, gut, darauf können wir möglicherweise aufbauen für weitere Tätigkeiten, denn er ist ein junger Mann, machte auf uns den Eindruck, dass er plietsch (schlau, d. Verf.) ist, gar nicht so doof aussieht oder so eine Behinderung hat, wie man es sich vorstellen kann.« Im Kundenkontakt spielt es auch eine Rolle für den Chef, dass Herr B »ja auch so vom Äußerlichen her nicht gerade den behinderten Eindruck« macht: »Jeder, der esso-mäßig aussieht, der wird von den Kunden auch angesprochen. Das bekommt er hin. Er wird angesprochen und sagt dann immer gleich: ›Ich hole mal jemanden, der ihnen weiterhelfen kann!‹ Und das kommt eigentlich sehr gut rüber. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, das kriegt er gut hin.« Wegbeschreibungen zu Straßen in unmittelbarer Nähe gibt er Kunden eigenständig, »das kann er ihnen gut erklären.« Die Kooperation mit den KollegInnen dagegen funktioniert aus Sicht der Vorgesetzten nicht angemessen, denn »wenn die irgendwelche Anweisungen für ihn haben, dann sind die über seine Routinearbeiten hinaus. Er hat Routinearbeiten und ... auch freie Zeit, und die nutzen wir für andere Dinge, für einfache Dinge, die er dann auch bewältigen kann. So, und diese Anweisungen kommen dann von den Mitarbeitern. Sie sind von uns ja auch aufgefordert, ihn da zu integrieren ... es geht ja auch immer darum, seinen Arbeitsplatz zu sichern ... nur der liebe (Herr B) versteht es nicht.« Der Chef vermutet dahinter eine Strategie: Herr B »ist intelligent. Er weiß sehr genau, was er tun muss, damit ihn keiner anspricht - nach dem Motto: Wenn ich mich jetzt doof anstelle, dann sprechen die mich nicht an und ich bekomme keine weitere Arbeit.«
In den voranstehenden Beschreibungen werden bereits wichtige Entwicklungen im Positiven wie im Negativen und auch Stagnationen sichtbar. Herr B ist zwar der Meinung, »viel« gelernt zu haben, seit er auf der Tankstelle tätig ist, denn »ich hab nie gewusst, wie ich Kisten zum Beispiel stapele oder Paletten oder sowas in der Art« und auch »mit Kunden nett umzugehen.« Gleichwohl stellt er resümierend fest: »Ich muss das alles besser in Griff kriegen.« Seine Mutter meint, »dass er, als er das Arbeitstraining begonnen hat, sehr unreifwar und nichtsahnend, was Berufswelt meint oder was es bedeutet, ... einmal im Krankenhaus und einmal in der Tankstelle. Dass es ihn reifer gemacht hat, so mit Menschen umzugehen, die - er sagt immer - nicht behindert sind. Das hat bei ihm also wirklich einen großen Schub ausgelöst, muss ich sagen. Auch so, dass er teilweise wortgewandter geworden ist.« Sie findet auch, dass der selbständige Umgang mit dem selbstverdienten Geld ihn stärkt und dass er in letzter Zeit anders damit umgeht, denn »jetzt ist er großartig mal losgegangen und hat sich Pullover gekauft und: ›Mama, du brauchst das nicht zahlen‹ und ... hat sich ganz stolz zwei neue Paar Schuhe gekauft. Er schleudert sein Geld nicht raus, sondern guckt wirklich, ... kauft dann auch nicht merkwürdige Sachen.«
Der Assistent von Herrn B sieht anfänglich klare Entwicklungsschritte, denn am Anfang gibt es häufig »Situationen, wo er ... überfordert war, vielleicht kurz 'n Ausraster hatte, so gegen irgendwas gegengetreten ist oder irgendwas von sich geschmissen hatte, sich zehn Meter entfernte und dann still ins Nichts guckte. ›Solche Situationen‹ haben sich deutlich minimiert, ... noch so zwei bis drei am Tag vielleicht.« Seitdem sieht der Assistent jedoch eher eine generelle Stagnation, die er in vier Facetten beschreibt: Zum ersten wendet Herr B bei Konflikten nach Meinung des Assistenten immer wieder die gleiche Strategie an, »in dem Moment aus der Situation herauskommen zu wollen mit der Methode, alles andere zu versprechen, Besserung zu geloben oder was auch immer. Das ist genau der Punkt, mit dem er arbeitet und mit dem er offensichtlich auch immer durchgekommen ist. ... Er hat nie gelernt, für sein Verhalten auch mal eine negative Konsequenz zu spüren. ... Er hat heute alles das bekommen, was er wollte: sein Mofa, sein Handy, sein neues Handy, den Pullover oder weiß der Geier was, ohne wirklich was dafür tun oder seine Versprechungen einlösen zu müssen.« Zum zweiten wird Herr B »immer lockerer und fing dann an, immer mehr zu erzählen von sich und eben diesen Geschichten. Und vieles war für uns dann auch erst mal schwierig, ihm da noch zu glauben, wenn man weiß, im Grunde genommen stimmt davon - wenn überhaupt - die Hälfte nur.« Diese zunehmenden Schwierigkeiten in der Kommunikation wirken sich zum dritten auch auf die Kooperation mit den KollegInnen aus: »Die anderen haben sich zunehmend zurückgezogen. ... Und ich glaube schlicht und einfach, er hat ab da auf sein Glück vertraut, wie er es ja immer hatte.« Im Betrieb macht sich gerade auch auf dem Hintergrund der problematischen Situationen, wenn KollegInnen Herrn B Anweisungen geben, eine fast resignierte Haltung breit: »Es sind von den Kollegen Rückmeldungen: ›Dem brauchst du nichts zu sagen, der macht das eh nicht, mit dem hab ich gar kein Bock mehr zusammenzuarbeiten.‹ ... Das bricht ihm da das Genick.« Und viertens auch »diese Kavalier-Masche, gentlemanlike da irgendwie den weiblichen Kollegen mal zur Hilfe zu gehen, ... also ich hab das auch so nicht immer erlebt und auch nicht von den Kollegen gehört.« Hier gibt es eine Diskrepanz zu den Schilderungen der Mutter.
Der Chef bestätigt die zunehmenden Schwierigkeiten: »Zu Beginn hatten wir natürlich einen guten Kontakt. ... Das sage ich ganz ehrlich: Viele Dinge unterschätzt man auch bei solchen Leuten, und es ist eine große Erfahrung gewesen, wie man mit sowas umgeht und händelt. Und wie geht der Betrieb, das heißt die anderen Mitarbeiter, mit solchen Menschen um? Wie wird er integriert? ... Das war erst sehr gut. Aber es gab doch Schwierigkeiten mit Arbeitsanweisungen, also er hat angefangen, nur Arbeitsanweisungen von uns (Chefs, d. Verf.) anzunehmen. ... Das stört sehr stark.«
Zu seiner eigenen Zufriedenheit äußert sich Herr B im Unterschied zur ersten Befragung nicht; ob dies mit einer Veränderung der Arbeitssituation zu tun hat oder worin dies sonst begründet sein mag, muss offen bleiben. Im Gespräch zuckt er eher etwas ratlos mit den Schultern: »Mir springt nichts ins Gehirn.« Nach Meinung seiner Mutter resultiert die Zufriedenheit bei Herrn B vor allem aus der Selbständigkeit, der finanziellen Unabhängigkeit und dem damit verbundenen Status, vor allem vor seinen 13- bis 16jährigen Freunden: »Er hat es geschafft, da als Tankwart unterzukommen.« Müsste Herr B zurück in die Werkstatt für Behinderte, hätte er »Panik, dass sie ihn dann fallen lassen. ... Das bedeutet für ihn ja auch wieder eine ganz starke Lebensveränderung, d.h. er muss sein MofaFahren aufgeben, er kann nicht mehr rauchen, das Geld hat er ja alles nicht mehr.« Allerdings ist er von seinem Chef begeistert, denn der »hat den richtigen Ton, der hat eben dieses Herzliche, männliche Derbe, so, das gefällt ihm, mit solchen Leuten kommt er super klar.« Und auch über seine KollegInnen »erzählt er immer furchtbar nette Sachen.«
Dass sich die Zufriedenheit von Herrn B dennoch vorwiegend aus dem Status herleiten könnte, auf der Tankstelle zu arbeiten, legen auch die Schilderungen seines Assistenten nahe. Da sich dies jedoch nicht in konkreten Handlungen zeigt, fällt es dem Assistenten zunehmend schwer, Herrn B über konkrete Tätigkeiten zu motivieren. Auch übergeordnete Aspekte wie »ein Mofa unterhalten zu können oder sich mal eine eigene Wohnung leisten zu können, ... diesen normalen Weg halt zu gehen, wie seine anderen Feuerwehrkumpels halt auch«, zeigen immer weniger die erhoffte Wirkung. Letztlich kommt der Assistent zu dem Punkt, an dem er Herrn B sehr ernsthaft mit Konsequenzen konfrontiert: »›Wenn du nicht annähernd das zeigst, was du kannst, was du hier schon gezeigt hast‹ - dann kann er davon ausgehen, dass er die Probezeit nicht überlebt, so, und er hat uns da nicht sehr ernstgenommen.« Die Zufriedenheit des Chefs liegt sowohl bei den Leistungen von Herrn B als auch bei seiner eigenen Entscheidung, sich auf das unterstützte Beschäftigungsverhältnis einzulassen, bei jeweils 50%.
Die Rolle der Arbeitsassistenz scheint für Herrn B keine eindeutige oder aber eine ambivalente zu sein: Einerseits haben sie »mir sehr viel geholfen, ... dass ich jetzt an der Tankstelle bin halt.« Dies sieht auch die Mutter, z.B. auch dadurch, dass sich die Assistenten mit Herrn B geduzt und ihn so gestärkt haben. Andererseits hat Herr B erst »ziemlich spät erkannt, dass die beiden Herren von der Hamburger Arbeitsassistenz auf seiner Seite sind. Ich glaube, er hat zuerst immer gedacht, sie wollen ihm das Leben da schwer machen. ... Er hat dann einfach so gesagt: ›Ja, der war schon wieder da, und heute mussten wir schon wieder einen neuen Plan ändern.‹ Die haben halt alles immer auf den Kopf gestellt. ... Und er kam dann: ›Oh, schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich schon wieder - dann reden sie immer mit dem Chef.‹ ... Er hat nicht verstanden, dass sie ihm eigentlich so helfen wollen und dass sie ihn so auf den Weg bringen.« Gleichwohl zieht die Mutter ein positives Fazit über die beiden von ihr als »nett«, »herzlich«, »ausgesprochen liebevoll«, »freundlich« und »sympathisch« beschriebenen Assistenten: »Die haben bestimmt den richtigen Weg gefunden zu ihm. Aber sie müssen eben auch hart sein, und das ist eben der Punkt, deshalb sind sie natürlich nicht ganz so beliebt, ganz klar. Und für mich waren sie ... ganz tolle Berater. ... Sie hatten sehr viel Verständnis dafür, dass ich manchmal gesagt habe: ›Ich kann einfach nicht mehr.‹ ... Da haben sie sehr viel Einfühlungsvermögen für Eltern gezeigt, das muss ich sagen.«
Der Assistent hebt drei Aspekte hervor, die im Vordergrund stehen: Zum ersten braucht Herr B ihn, »um dort eine Struktur hinzubekommen, ... also Aufgaben, denen er gewachsen ist,« zum zweiten versuchen die Assistenten »ihn daran zu erinnern, dass er jetzt ja auch erwachsen ist oder erwachsen wird, (sich) in dem Prozess auch mal anders mit schwierigen Situationen auseinandersetzen sollte ... und dass wir dann auch da sind und dass er sich nicht irgendwie schämen bräuchte.« In Problemsituationen, wenn es etwa etwas zu Lesen gilt, will Herr B »nicht als dummer Junge dastehen« und vermeidet es, um Hilfe zu bitten, was mitunter bei Abwesenheit der Assistenten dazu führt, »dass er sich heulend auf den Boden« wirft. Zum dritten bilden sie auch ein Stück weit die Brücke zu den KollegInnen: »Das war schon ein Schwerpunkt, den wir am Anfang gesetzt haben, ... die auch auf ihn einzustellen. ... Obwohl die offen waren, hatten die auch schon Fragen.« Die Arbeitsassistenten sind dort »eher so quasi wie Kollegen für die anderen, also das war nicht so wie: ›Ach, (Herrn B's) Betreuer ist wieder da‹, sondern: ›Ach, hallo, wie geht es dir, alles klar?‹« Diese Atmosphäre ist etwas, »was ich sonst an Arbeitsplätzen selten erlebe, dass wir, wenn wir kommen, erst mal gefragt werden, wie es uns geht.« Später verlagern sich die Schwerpunkte mehr auf die zunehmenden Konfliktsituationen.
Für den Chef ist die Arbeitsassistenz zunächst der Initiator dieses unterstützten Beschäftigungsverhältnisses, der auf ihn zugegangen ist und ihn informiert hat. Danach bildet sie eine zeitlich abnehmende Begleitung - erst täglich, später zweimal in der Woche - , die er als hilfreich empfindet: »Die haben sich schnell eingefuchst in das Tankstellenleben.« Ihre wichtigste Leistung liegt für ihn in der »Unterstützung bei der täglichen Arbeit in der Einweisung der Arbeiten, die (Herr B) ausführen müsste.«
Ohne die Arbeitsassistenz wäre Herr B seiner eigenen Einschätzung nach »immer noch in der WfB«, das wäre »beschissen, würde ich sagen, ja, aber volles Pfund.« Seine Mutter hätte zwar, wie sie meint, als »sehr aktiver Mensch ... versucht, irgendwie einen Job zu finden für (Herrn B). Jemanden zu finden, der sich den Behinderten verschreibt wie (sein Chef) zum Beispiel, und sagt, also er möchte das probieren, und sich darauf einlässt, auf dieses Experiment. ... Und ob das geklappt hätte, das ist eine zweite Frage, weil ich hätte ihn ja nicht begleiten können.« Von seiner ersten Zeit in der Werkstatt für Behinderte erinnert seine Mutter, dass er sich »zurückentwickelt« hat, »da hat er sich häufig an die Wand gestellt und hat dann so gemacht, so wie die Mongoloiden zum Beispiel. Er hat Verhaltensweisen angenommen von denen und war eben nicht so weit, wie er jetzt ist.« Für seinen Chef ist vollkommen klar, dass ohne die Arbeitsassistenz und ohne die finanziellen Zuschüsse kein Mensch mit Behinderung bei ihm im Betrieb tätig wäre.
Herr B selbst sagt wenig zu seiner Rolle im Betrieb. Er sieht jedoch, dass die Situation auf der Kippe steht: »Ich muss das alles besser in den Griff kriegen.« Gleichzeitig bezweifelt er jedoch selbst, ob das gelingen kann: »vielleicht, vielleicht auch nicht.« Der Assistent betont, dass die KollegInnen Herrn B »anfangs eben auch sehr offen aufgenommen haben, sehr freundlich mit ihm waren, also mehr als ich das je an Arbeitsplätzen kannte, auch in seinem Alter sind ... , sich für ihn interessiert haben. ... Also von daher waren die Voraussetzungen gut gegeben. Er selbst ist da auch schnell reingekommen und hat sich auch von seiner Seite sehr schnell geöffnet, leider auch mit dem Problem dieser Geschichten, oder dass er so kleine Punkte immer wiederholt hat und die Kollegen dann irgendwann tierisch genervt hat, so dass der Stand heute ist, dass sie eigentlich eher mit (Herrn B) nicht so gerne zusammenarbeiten wollen. ... Gekippt ist das wirklich mit dem Punkt, wo er sich zunehmend verweigerte, in diesem Team mitzuarbeiten. So nenne ich das, was der Chef als Anweisungen meint. Ich nenne das Verweigerung von Teamarbeit.« Herr B zeigt seinen KollegInnen gegenüber ein widersprüchliches Verhalten: Immer wieder versucht er, mit ihnen in Kontakt zu kommen und nimmt an ihnen und ihrer Situation Anteil. Er weigert sich einerseits zunächst, ihnen zu seinem Einstand »einen auszugeben«, schwenkt dann jedoch um und will kalte Platten und zehn Flaschen Sekt mitbringen - für fünf Personen. »Dieses Fingerspitzengefühl, das fehlt ihm da so ein bisschen,« findet die Mutter. Zum 18. Geburtstag lädt Herr B alle KollegInnen zu einer Feier ein, aber, so der Assistent, »das Problem war, dass er jeden Tag die Leute genervt hat mit seinem 18. Geburtstag, ... und ob sie nun kommen. ... Die waren alle so abgegessen nachher, dass sie keine mehr Lust hatten, zu diesem Geburtstag zu gehen, und sich nicht mehr trauten, ihm das auch noch zu sagen. Die Folge war: Keiner ist gekommen und keiner hat abgesagt.« Der Chef vertritt Herrn B gegenüber einen klaren Gleichheitskurs: »Den können wir wirklich behandeln wie jeden anderen Mitarbeiter eigentlich auch. Das tun wir auch. Er wird nicht bevorzugt, er kriegt genau so zwischen die Hörner wie die anderen und er muss auch seine Leistung bringen. Heute wissen wir, wenn er den Traurigen macht, das könnte Absicht sein.«
Bezüglich seiner Zukunftsperspektiven macht Herr B sich »Sorgen, ja, dass ich da bleiben darf.« Alle anderen Beteiligten bestätigen diesen Grund zur Sorge. So sagt der Chef: »Er ist schon zu lange hier, behaupte ich mal, er weiß gar nicht mehr, wie schwer es ist, etwas zu bekommen. ... Es ist unheimlich schwierig, ihn dazu zu bekommen, dass er das Verständnis bekommt, dass das nicht so einfach ist, einen Job zu bekommen und dass er was tun muss, mehr tun muss.« Dennoch gibt ihm der Chef die Verlängerung des Probevertrages, bei der auch der Assistent sehr »zwiegespalten« ist, da er sich einerseits für Herrn B freut, andererseits »habe ich manchmal gedacht: Er hat diese Chance nicht verdient, weil er hat alles dafür getan, sie nicht zu bekommen.« Der Assistent sieht schon die Probezeit ambivalent: »Natürlich mag ich (Herrn B) gerne und denk, mein Gott, ist auch schön, dass er die Chance doch noch mal hat, sich zu bewähren - allein, ich glaub nicht mehr so richtig dran.« Obwohl noch Förderzeiten im Integrationspraktikum zur Verfügung stehen und auch ein Eingliederungspraktikum möglich wäre, würde der Assistent es befürworten, »dass er zuhause (bleiben) bzw. schon auch mal in die Werkstatt gehen sollte. Sonst, wenn wir ihm gleich wieder was anbieten, dann bestätigt sich ja wieder, was er immer auch schon gelernt hat. ... Letztendlich, klar, soll das der Abschreckung dienen. Logisch, das soll schon auch für ihn so etwas Motivationsstiftendes sein.« Diese letzte Möglichkeit findet der Assistent selbst »schrecklich, irgendwie eine Werkstatt dazu - in Anführungsstrichen - zu benutzen, jemandem so was Negatives zu verkaufen, aber ich bin ehrlich gesagt inzwischen an so einem Punkt, weil mir fällt da nichts anderes mehr ein.« Diese Konsequenz würde Herrn B »sehr hart ankommen, wäre für ihn sehr schlimm«, meint dazu die Mutter, die diese Überlegung der Assistenten nicht mittragen will. »Ich weiss - im Gegensatz zu den Herren - , wie er war« in der Werkstatt für Behinderte. »Deshalb glaube ich, ... da bricht eine Welt zusammen. Ja, also das weiß ich mit Sicherheit, weil er fühlt sich da so wohl und redet da nur von dieser Tankstelle und wie toll das ist.« Auch träumt die Mutter eigentlich davon, dass ihr Sohn »irgendwann mal für sich selbst sorgen kann.« Realistischerweise wird er ihrer Einschätzung nach jedoch »in irgendeiner Behindertenwohneinheit leben und wird wahrscheinlich auch keinen festen Job haben. ... Weil diese Betreuungskapazität eben einfach zu gering ist. Nicht dass sie das falsch verstehen, die beiden haben ihren Job super gemacht, aber es müsste halt weitergehen, die brauchen länger Zeit. ... Oder es muss eben anders herum sein, dass man noch mal - gerade wenn die jungen Leute noch so jung sind wie (Herr B) - eine Zwischenstation hat, bevor sie zur Arbeitsassistenz kommen können und in die Arbeitswelt geworfen werden.« In der Werkstatt für Behinderte, so befürchtet die Mutter, ist dann für jemanden wie ihren Sohn mit seiner Behinderung »nämlich ein Rückschritt wieder da, und sie lassen dann wieder alle Fünfe gerade sein und sagen: ›Na ja, brauch' ich ja nicht - hier kommt es ja nicht so darauf an.‹ Das merken die ja sofort und haben einen Riecher dafür.« Und die Rückkehr in die Werkstatt für Behinderte wirkt sich auf sein ohnehin geringes Selbstwertgefühl nochmals kränkend aus: »Wenn er da in der beschützenden Werkstatt ist, dann kriegt er da seine 103 oder 105 Mark. ... Das bedeutet ja auch wieder für ihn: Nichts ist. ... Alle selbständigen Sachen, die gehen wieder zurück.«
Wichtige Aspekte bei Herrn B
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Herrn B lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Die Mutter von Herrn B kämpft im Laufe der Jahre immer wieder für integrative Wege für ihren Sohn. Dabei verliert sie diese Kämpfe mehrfach: bei der Einweisung in die Schule für Lernbehinderte und beim Arbeitstraining in der Werkstatt für Behinderte. Vor diesem Hintergrund sähe sie ein von ihr so empfundenes ›Ende‹ ihres Sohnes in der Werkstatt für Behinderte als Fiasko.
-
Herr B wird als Grenzfall empfunden, dem man seine Behinderung nicht ansieht.
-
Die primären Interessen von Herrn B gehen nicht in Richtung Arbeitswelt, sondern eher in Richtung attraktiver Freizeitbeschäftigungen, für die er durch Arbeit einen notwendigen finanziellen Hintergrund schaffen kann.
-
Die Personen im Betrieb gehen zunächst sehr aufgeschlossen auf Herrn B zu, ziehen sich aber mehr und mehr zurück, nachdem Herr B sich immer wieder eigentümlich verhält, bis Chefs und KollegInnen schließlich eher von ihm genervt sind. Wie weit die Motivation von Herrn B - sein Berufswunsch ist Kfz-Mechaniker - mit seinen konkreten Tätigkeiten in einem Missverhältnis steht, das ihn frustriert und so zu seinen Verhaltensweisen maßgeblich beiträgt, kann nur als Frage gestellt werden.
-
Herr B pendelt zu Hause wie im Betrieb zwischen einem jungenhaften (›dummer Junge‹) und einem eher erwachsenen Verhalten (›großer Kavalier‹) - mit allen Brüchen und Verwerfungen.
-
Der Arbeitsassistent ist angesichts dieser immer schwierigeren und nach wie vor inkonsistenten Situation zunehmend ratlos. Ebenso wie die anderen Beteiligten ist er unsicher, welche Anteile von Herrn B's Verhalten behinderungsbedingt, altersbedingt oder sozialisationsbedingt sind - oder wie weit Herr B sein Verhalten bewusst einsetzt.
-
Das überaus positive Bild hoher Zufriedenheit, das Herr B in der ersten Befragung gezeichnet hat, muss angesichts der verschiedenen Perspektiven der Beteiligten deutlich revidiert werden, denn es handelt sich hier vielmehr um eine Situation hoher Problematik.
Ansätze zur Interpretation
Ein mögliches Erklärungsmodell wäre gemäß der Stigma-Theorie, dass es sich bei Herrn B um einen Diskreditierbaren handelt: Sein Stigma ist für ihn und andere nicht eindeutig definierbar und sein ganzes Handeln ist insofern auf die Geheimhaltung dieses Stigmas ausgerichtet. Seine größte Angst besteht in der Entdeckung - offenbar weniger im Kundenkontakt, eher im Kontakt zu den fast gleichaltrigen Kolleginnen und in spezifischer Weise gegenüber männlichen Kollegen und Assistenten. Damit wäre die eher negative Einschätzung der (Förder-)Schulzeit und des Berufsbildungswerkes, das positive Bild der Zeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt in der ersten Befragung, seine Wahrnehmung der Arbeitsassistenz als Kontrolle in der ersten Zeit und die Scham, um Hilfe zu bitten, schlüssig zu erklären. Dieses auf das Kaschieren setzende Stigma-Management führt so auch bei einer Befragungssituation wie der ersten zu einem Hochglanzbild; erst durch die Einbeziehung des Umfeldes kann aus der Oblate eine realistischere Situationsbeschreibung entwickelt werden, zu der Herr B sich in der zweiten Befragung vorsichtig bekennt. Die Versuche der Arbeitsassistenten, eine Vertrauensbasis aufzubauen und gemeinsam mit Herrn B ein adäquateres Stigma-Management zu entwickeln, beispielsweise über eine Vielzahl von Gesprächen, führen nicht zu einem Erfolg, der sich in einer Verhaltensveränderung bei Herrn B zeigt.
Der Theorie integrativer Prozesse folgend wird die Selbstakzeptanz in seiner gesamten Biographie neben anderen Faktoren immer wieder durch widersprüchliche, ihn verwirrende direkte und indirekte Rückmeldungen erschwert, wenn er nach dem Besuch einer Integrationsklasse amtlich als geistig behindert erklärt wird und damit seine Überweisung in die Sonderschule begründet wird, er in Gegengutachten lediglich Wahrnehmungsprobleme attestiert bekommt, auf Umwegen in die Förderschule, später dennoch in die Werkstatt für Behinderte kommt und dann doch die Chance zur Arbeit im regulären Betrieb bekommt. Prozesse der Verfolgung der ›fremden/anderen/unterscheidenden‹ Anteile und die Fixierung auf die ›guten/gleichen‹ wären so eine logische Folge auf der innerpsychischen Ebene. Chefs und KollegInnen gehen zu Beginn mit Enthusiasmus auf Herrn B zu, reagieren aber zunehmend auf Verschmelzungswünsche von ihm mit Abgrenzung und Abstoßung, und je mehr bei Herrn B Schwierigkeiten, zu angemessener Kooperation zu kommen, deutlich werden, nehmen auf beiden Seiten Verweigerungstendenzen zu. Eine Schieflage der Balance zum Pol der Gleichheit zeigt sich beispielsweise deutlich, wenn Herr B behandelt werden soll wie andere auch; wie und in welchem Maß aber Differenz zur Geltung kommen können sollte, ist für das Umfeld unsicher. In diesem Fall zeigt sich die Gefahr eines Anpassungsdrucks, der zu Kolonialisierung führen könnte - und bei deren Nichtgelingen als deren Gegenpol Aussonderung und Exotisierung droht. So wäre ggf. ein ›Ende‹ in der Werkstatt für Behinderte für Herrn B tatsächlich ein Fiasko, da er dann erneut eine Bezugsgruppennorm nahegelegt bekommt, die ihm aufzeigt, dass sein Ringen um Normalisierung gescheitert und er demnach folgerichtig - da man ihm ja viel zusätzliche Zeit eingeräumt hat, ein erwünschtes Verhalten zu zeigen - selbstverschuldet auszuschließen ist. Auszuloten bliebe, inwieweit hier auch auf Seiten der Arbeitsassistenten die Arbeit an Herrn B, die vom Betrieb erwünschten Verhaltensweisen zu zeigen, ein Übergewicht hat gegenüber der Arbeit an einem anderen Zuschnitt der Tätigkeiten und an Erwartungshaltungen innerhalb des Betriebes, also ob es mehr Bemühungen bedurft hätte, Teambildungsprozesse mit ihren logischen, immanenten Krisen zu unterstützen - und ob diese Ausrichtung dem Repertoire der Tätigkeiten von ArbeitsassistentInnen entspricht.
Frau C, 24 Jahre alt, hat vor vier Monaten einen Arbeitsvertrag bekommen und ist mit knappen 30 Wochenstunden in einem Call-Center beschäftigt. Dort nimmt sie Anrufe für Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements entgegen und gibt die Daten in einen Computer ein. Aus einer Angestelltenfamilie stammend, besucht sie den Lernbehindertenzweig der Schule für Sehbehinderte und Blinde. Während der Schulzeit absolviert sie ein Betriebspraktikum in einer Werkstatt für Behinderte. Die Berufsberatung hält aufgrund von Berichten der Schule für Frau C nur die Werkstatt für Behinderte für möglich; darüber kommt es mit der Familie C zu heftigen Kontroversen. Für zwei Jahre geht Frau C in ein Berufsbildungszentrum in einer anderen Stadt, kehrt dann nach Hamburg zurück, nimmt privat PC-Kurse, lernt Punktschrift, macht auf Initiative des Vaters etwa acht unbegleitete Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt - auch im Betrieb, in dem er selbst tätig und der gleichzeitig von Schließung bedroht ist. Dazwischen hat Frau C, wie sie sagt, »die ganze Zeit zuhause rumgehangen.« Nach einem zweiten Anlauf beim Arbeitsamt, bei dem ihr Wunsch, eine Telefonistenausbildung zu machen, abgelehnt und wiederum nur die Werkstatt für Behinderte für möglich gehalten wird und sie dies erneut verweigert, meldet sich eine Arbeitsassistentin bei Frau C, woraufhin es zu einem gemeinsamen Termin mit dem Berufsberater kommt, bei dem Frau C zunächst misstrauisch bleibt, weil sie sich nun doch offiziell bei einer Werkstatt für Behinderte anmelden soll. Sie durchläuft zwei Jahre das Ambulante Arbeitstraining in vier Betrieben und erhält danach den Arbeitsvertrag im Call-Center. Ihr ursprünglicher Berufswunsch ist Bürotätigkeit oder Phonotypistin; ihre jetzige Tätigkeit liegt also im gleichen Bereich. Bei den äußeren Daten gibt es allerdings eine Uneindeutigkeit insofern, als nach anderen Informationen das Arbeitsamt durchaus für das Ambulante Arbeitstraining votiert hat, dagegen der Sozialhilfeträger Frau C massiv zur Werkstatt für Behinderte gedrängt hat.
In der ersten Befragung zeichnet Frau C über ihre Schulzeit ein ambivalentes Bild, die Berufsberatung empfindet sie als sehr schlecht (s.o.), das Berufsbildungswerk zunächst als gut, jedoch mit stark abfallender Tendenz. Das Ambulante Arbeitstraining gefällt Frau C sehr schön, es erscheint aber auch als sehr komplex und anstrengend; auch den Berufsschulunterricht bewertet sie sehr positiv. Ihre AssistentInnen nimmt Frau C sehr unterschiedlich wahr, ihre Beschäftigungssituation bewertet sie als sehr gut und verändern will sie »erstmal nix.«
Bei der zweiten Befragung findet das Interview mit Frau C allein bei ihr zu Hause statt, der Vater wird an seinem Arbeitsplatz, die Assistentin, gelernte Heilerzieherin, in den Räumen der Arbeitsassistenz, und die Chefin, gelernte Friseurin und Teamleiterin des betreffenden Projekts im Call-Center, in den Räumen des Betriebes befragt.
Von ihren Stärken und Schwächen hat Frau C ein dezidiertes Bild, das im übrigen mit allen anderen Beteiligten übereinstimmt: Stärken sieht sie darin, dass sie »ziemlich viel« macht, vielseitig interessiert und kontaktfreudig ist, genau ihre Wünsche kennt und sie auch gegen andere verteidigt. Dies tut sie etwa bei dem Berufsberater bzw. Sozialhilfeträger, der »gesagthat, ich soll in die behinderte Werkstatt gehen und sonst kann er nichts für mich tun. Und da habe ich gesagt, dass ich das nicht mache. Und das hat er ja in die Unterlagen reingeschrieben und dann hat sich (eine Arbeitsassistentin) bei mir gemeldet.« In der Werkstatt für Behinderte hat Frau C drei Wochen im Schreibbüro gearbeitet, das fand sie auch »eigentlich ganz gut, aber dann waren wir in der Pause mit ganz vielen anderen Behinderten zusammen, die richtig stark behindert waren, und dann haben sie rumgeschrien. ... Da stand jemand neben mir und - das konnte ich nicht sehen - hat auf einmal laut geschrien. Ich habe mich so fürchterlich erschrocken und die konnte ja nichts dafür, weil die war wirklich geistig krank. ... Da habe ich gleich gesagt: ›So. Nee, das mache ich nicht, das ist für mich zu schrecklich, ich habe Angst vor den Leuten.‹ ... Die taten mir auch leid, natürlich.« Schulisch sieht sich Frau C als gut in Mathe, »da war ich in der Hauptschulgruppe«, jedoch zwei Klassenstufen tiefer, und »in Deutsch war ich eigentlich auch ganz gut.« Ihre schulischen Schwächen sieht sie in den sachkundlich-gesellschaftlichen Fächern, und generell meint Frau C: »Ich weiß, dass ich eine Lernbehinderung habe, und ich weiß, dass ich Sachen auch leicht vergesse. Und ich hab' ein gutes Langzeitgedächtnis, aber ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis.«
Ähnlich sieht dies auch der Vater von Frau C, der seine Tochter als selbstsicher, mutig, offensiv und zunehmend selbständig beschreibt, bei ihr eine verbale Stärke und ein gutes Durchhaltevermögen sieht, also die Fähigkeit, »sich irgendwo durchzuboxen. ... Sie wollte es auch durchstehen, sie wollte was schaffen.« Zudem betont er eine hohe kommunikative und sprachliche Kompetenz: »Ihre Ausdrucksweise, die war immer sehr gewählt. ... Fremde, die stellen schon fast hohe Ansprüche, was sie denn ist und ob sie die höhere Schule getätigt hat oder ob sie studiert und so.« Zudem ist Frau C »sehr höflich und zuvorkommend«, was für ihre Tätigkeit besonders hilfreich ist. Andererseits ist sie insgesamt eher langsam im Lernen, auch im Schreiben »nicht so gewandt. ... Aber das Zehn-Finger-System hat sie trotzdem gelernt. Nicht schnell, aber sie kann mit zehn Fingern schreiben.«
Die Langsamkeit im Lernen bestätigt auch die Assistentin: »Es dauert sehr sehr lange, bis sie Sachen verinnerlicht hat. Sie vergisst häufig Sachen wieder, Dinge, die sie sich eigentlich merken sollte.« Die Assistentin erklärt sich »die große Vergesslichkeit« wie »ein Loch, wo diese ganzen Informationen immer durchfallen. Und es ist so wie eine Vene, die sich langsam zusetzt. Es bleibt aber irgendwann mal ein Stück hängen und irgendwann ist dieses Loch zu und dann sitzt es und es geht nie wieder auf.« Die berufliche Tätigkeit wird durch einen Tunnelblick erschwert, der nur ein Feld von der Größe eines Stecknadelkopfes scharf sehen lässt und jedes räumliche Sehvermögen verhindert. So muss Frau C »eine Bildschirmmaske auswendig« lernen, die »sie dann systematisch abtastet.« Als besonders wesentliche Stärke sieht die Assistentin: »Sie ist unheimlich willig und stark. Sie will etwas schaffen und sie hat sich das vorgenommen mit Unterstützung, und ja, die Unterstützung von zuhause ist auch ganz wichtig. ... Sie kann sich auch ziemlich gut selber einschätzen und sagen: ›Okay, ich schaff' das‹, oder dann auch sagen: ›Ich schaff' es nicht.‹« Auch die Assistentin hebt hervor, dass Frau C »sich auch gut präsentieren (kann), sie kann sehr gut reden.« Aufgrund der vielen Etappen und Institutionen, mit denen sie zu tun hatte, ist Frau C sehr flexibel, und »sie ist ein neugieriger Mensch, sie lernt gerne Menschen kennen, sie lernt gerne Umgebungen kennen.«
Die Chefin nennt als herausragende Eigenschaft von Frau C »Freundlichkeit auf jeden Fall, dann hat sie wirklich eine sehr schöne Stimme und sie ist ruhig, also sie würde ja nie austicken. Also das würde ja nie passieren. Sie hat einfach eine bestimmte Ruhe.« Auch würde Frau C nie eine falsche Auskunft geben. Als unbedingte Voraussetzung für ihre Tätigkeit im Call-Center sieht die Chefin, dass Frau C lesen und schreiben kann. Schwierigkeiten gibt es anfangs, als der große Bildschirm mit den großen Buchstaben für sie eingerichtet wird, aber den Notwendigkeiten ihres Tunnelblicks widerspricht: »Dann habe ich natürlich alles erst in großen Buchstaben daran gehängt, das war ja völlig falsch, weil (Frau C) sieht ja eher die kleinen als die großen, aber ich dachte, mach sie mal lieber groß. Dann musste ich alles wieder klein machen.«
Entwicklungen sieht Frau C vor allem in einer zunehmenden Zufriedenheit bei angemesseneren Anforderungen: Während es in den ersten Praktikumsstellen aufgrund hoher Komplexität zeitweise Überforderungen gibt und sie nur noch Teilarbeiten ausführen darf, passen die Arbeiten später immer besser zu ihren Fähigkeiten. Zudem entwickelt Frau C eine größere Flexibilität und Adäquanz in der Telefoniersituation. Problematische, total verpatzte Situationen hat sie noch nicht erlebt, stattdessen fallen ihr »gute Situationen« ein.
Diese stetige Aufwärtsentwicklung bestätigt auch der Vater, der bemerkt, dass Frau C »eigentlich immer sehr gerne zur Arbeit gegangen ist. ... Ja, sie hat es mit Liebe und richtig Lust getan, und jetzt, seitdem sie (im Call-Center) angefangen ist, hat sie für meine Begriffe ein humorvolles Wesen oder Auftreten und auch ein gutes Selbstvertrauen bekommen, also ein stärkeres, sage ich mal.«
Die Assistentin betont: »Sie ist ein Stück weit selbstsicherer geworden. ... Sie hat inzwischen gelernt, auch aufgrund der Vielfalt ihrer Arbeit, sich Kunden besser zu erwehren. Sie ist sehr geduldig am Telefon, sie lässt es auch nicht zu nah herankommen, wenn Kunden mal meckern, die dort anrufen. Aber sie sagt dann auch schon mal: ›Nein, nein, so ist das nicht, ich weiß genau, dass das so ist.‹ ... Und - ganz wichtig - sie holt sich Hilfe auch von Kollegen.« Diesen Stand zu erreichen, ist jedoch ein äußerst mühsamer Prozess mit vielen kleinen Schritten, bei dem es vor allem um das »schlichte Erlernen des Arbeitsinhaltes (geht). Weil die ganzen sozialen Kompetenzen, das alles hat sie mitgebracht, und bei ihr ist es wirklich der Inhalt der Arbeit, dass sie einfach Kunden so beraten kann, wie es sein soll.«
In der Anfangszeit stellt auch die Chefin einen sehr großen Unterstützungsbedarf fest: »Ich hatte zu dem Zeitpunkt viel Zeit und einer von den Betreuern war ja auch immer da. Wir haben sehr viel trainiert. ... Wir haben eine Woche bestimmt trainiert, also, dass sie noch kein Kundengespräch hatte, mit den Trainern halt, also mit den Arbeitsassistenten. Na ja, dann haben wir halt geguckt, was können wir machen, um ihr die Sache zu erleichtern.« Später, dies bestätigt auch die Chefin, agiert Frau C souverän und holt, wenn nötig, Hilfe von KollegInnen: »Früher saßen wir fast zusammen, jetzt sitze ich ein bisschen weiter weg und habe auch nicht so unbedingt die Zeit. Aber da fragt sie dann die Kollegen, das macht sie.«
Als Gründe für die eigene Zufriedenheit nennt Frau C vor allem das positive Betriebsklima und die sozialen Kontakte. Mit einer Kollegin hat Frau C sehr viel Kontakt, die von der Chefin als ihre »Lieblingskollegin« bezeichnet wird: »Die hängen den ganzen Tag zusammen und mögen sich ganz gern.« Frau C mag es auch, wenn mal Leerlauf ist, »dann kann ich schön mit Kollegen klönen.« In der Vergangenheit ist Frau C manchmal unzufrieden gewesen aufgrund von Stress und durch den Druck, Arbeiten fertigzumachen - »da habe ich schon Schiss gehabt.« Weiter ist Frau C unzufrieden mit ihren visuellen Möglichkeiten, daher hat sie sich auf die Warteliste für eine Netzhautoperation setzen lassen. »Dass ich nicht so gut sehen kann, das kann ich ja noch akzeptieren.« Trotzdem: Besser sehen zu können »wäre cool.«
Für den Vater ist nach wie vor die Vergangenheit mit der auswärtigen Zeit im Internat, der drohenden Einweisung in die Werkstatt für Behinderte und der Arbeitslosigkeit sehr gegenwärtig. Er gibt Aussagen von Frau C aus der Zeit in der Werkstatt für Behinderte wider: »Und sie sagt: ›Ich bin behindert, aber ich bin anders behindert. Ich hab Angst da hinzugehen.‹ ... ›Helft mir bitte, dass ich da nicht hin brauch!‹ Dann haben wir auch gesagt: ›Du musst gar nichts. Dich darf und kann keiner zwingen. Und du kannst darauf zählen, dass wir dir helfen und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wie auch, wissen wir nicht, aber wir schaffen das irgendwo.‹« Die Internatszeit resümiert der Vater mit dem Satz: »Da haben wir ihr ganz schön was angetan. ... Sie war froh, als das zu Ende war.« Den Berufsberater (bzw. den Mitarbeiter des Sozialhilfeträgers) erinnert der Vater geradezu traumatisch: »Der hat gesagt: ›(Frau C), du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Du wirst, äh, du musst in die Werkstatt gehen und wenn du dich bis dahin (klopft mit der Faust auf den Tisch) nicht entscheidest, dann kannst du nicht mehr in die Werkstatt kommen, dann ist es ganz aus für dich!‹ So! ... Das war eine Erpressung.« Dass es die Möglichkeit mit der Arbeitsassistenz gibt, »das hätte man uns schon viel früher sagen müssen und können.« Vor diesem Hintergrund sitzt Frau C ohne Beschäftigung zu Hause: »Ich hab' gemerkt, sie war verzweifelt zuletzt und sie wollte unbedingt arbeiten. Es ging ihr gar nicht um das Geld, es ging ihr wirklich um die Tätigkeit, um gleichwertig zu sein. ... Sie wollte sagen: ›Ich hab' Arbeit.‹ Was meinen Sie, wie stolz sie jetzt darauf ist, das jetzt zu verkünden? Das hat sie allen geschrieben und erzählt und telefoniert: ›Ich hab' Arbeit!‹«
Nach Eindruck der Assistentin findet Frau C es »unheimlich wichtig, selbständig zu sein.« Da die Arbeit relativ anstrengend ist und eine hohe Konzentration erfordert, arbeitet sie sechs Stunden pro Tag. Auch die sozialen Kontakte machen Frau C zufrieden: »Sie hat einen un-heimlich guten Draht zu Menschen überhaupt.«
Die Rolle der Arbeitsassistenz beschreibt Frau C vor allem als Unterstützung durch technische Hilfen und als konkretes Üben des Telefonierens am Beginn der Tätigkeit: »Da hat er immer die Frauenstimmen nachgemacht, da konnte ich mich immer amüsieren, und sie immer die Männerstimmen, das fand ich immer lustig.« Sie resümiert: »Nein, also ich muss sagen, ich habe nie gedacht, dass ich mal in einer Telefonzentrale arbeiten werde, und dass ich jetzt in dem Call-Center sitze, das finde ich richtig gut! ... Das hätte ich, also ganz ehrlich gesagt, mir nicht zugetraut.«
Für den Vater ist - vor dem Hintergrund der vorangegangenen Entwicklungen - entscheidend, »dass die Arbeitsassistenz das Gefühl für (Frau C) entwickelt hat, dass sie einen Job schaffen könnte.« Für den Vater ist es ein Phänomen, dass dieses Vertrauen besteht trotz einer gemeinsamen Gesprächsrunde mit dem Berufsberater (s.o.), der »immer noch auf dem Standpunkt (beharrt): ›(Frau C) schafft das nicht.‹« Die Arbeitsassistenz strahlt jedoch die Zuversicht aus, »irgendwas Passendes zu finden.« Er resümiert: »Ich bin angetan von der Arbeitsassistenz.«
Die Assistentin sieht es als ihre vordringliche Funktion, mit Frau C die Inhalte der Tätigkeit zu erarbeiten: »Wir haben mit ihr angefangen, eine Textvorgabe zu lesen, wie es ablaufen soll. Der nächste Schritt war, dass sie mit uns im Rollenspiel geübt hat, also wir waren dann der Kunde ... Die nächste Stufe war dann, diese Telefonanlage zu benutzen. ... Ich habe es bei ihr klingeln lassen, dann musste sie mich beraten. ... Wir mussten ganz häufig abbrechen, weil es ging nicht weiter, sie wusste es einfach nicht mehr. Wir haben es noch einmal ausgewertet, haben es noch einmal durchgesprochen und es ging wochenlang so. Die nächste Stufe war dann, dass ich hier (in der Arbeitsassistenz, d. Verf.) Kollegen gebeten hab, doch mal so ein Schein-Abo zu bestellen. ... Wir haben dann weitergemacht, indem wir mitgehört haben, wenn sie telefoniert hat ... und konnten ihr dann jederzeit Hilfestellung geben. ... Genauso schrittweise haben wir die EDV erlernt, also geübt, wo ist welcher Punkt auf dem Bildschirm, wie arbeite ich die Maske am besten ab.« Ergänzend gehört auch ein Fahrtraining zur Qualifizierung sowie die Vorbereitung für die KollegInnen, »die Leistungsanforderungen einfach nicht so hoch zu setzen.«
Für die Chefin ist die Arbeitsassistenz der eindeutige Initiator: »Ohne die wären wir da nicht so drauf gekommen.« Am wichtigsten aber ist die Unterstützung am Anfang, an dem die Arbeitsassistenten ihr das Gefühl vermitteln: »Guck mal, kann ja nicht viel passieren, (Frau C) kann nicht viel passieren und mir halt auch nicht.« Wenn es die Arbeitsassistenz nicht gäbe, sieht Frau C selbst »zwei Möglichkeiten nur: Also entweder ich wäre wirklich in der Werkstatt gelandet oder ich hätte zu Hause gesessen - oder vielleicht ... durch meinen Vater wirklich eine Arbeit gefunden, das weiß ich ja nicht.« Die Werkstatt für Behinderte sieht Frau C als schlechteste Alternative: »Ich weiß ja, wie es dort war, ich kenne das ja, drei Wochen haben mir gereicht.« Auch der Vater, der sich als »Verfechter (bezeichnet), dass diese Fehlabgaben drastisch erhöht werden müssten, um auch Behinderte wirklich in Arbeit zu bringen,« denkt in diese Richtung. Selbst nach der Kontaktaufnahme mit der Arbeitsassistenz bemüht er sich um andere Möglichkeiten: »Ich hatte schon ganz blöde Ideen gehabt, um meine Tochter irgendwie in Arbeit und Brot zu kriegen, um ihr irgendwas zu geben, wo sie für sich auch Zufriedenheit findet. ... Ich hatte mir eine Firma gesucht und hab gesagt: ›Passt mal auf, versucht sie einzustellen, es geht nicht um das Geld, aber dass sie eine Beschäftigung hat und dass sie Erfahrungen sammelt.‹« Die Assistentin traut den Eltern durchaus zu, für ihre Tochter etwas zu bewegen, denn sie »sind sehr ideenreich und stehen voll hinter (Frau C). Also ich denke, die Eltern hätten eine Möglichkeit gefunden für (Frau C), außerhalb der Werkstatt zu arbeiten. Sie haben ja auch ihre Leistungsgrenzen ganz stark kennengelernt.« Die Chefin sagt, sie hätte nicht die Zeit gehabt, die die Arbeitsassistenz hat; so kann man schließen, dass Frau C ohne die Arbeitsassistenz keine Chance in diesem Betrieb gehabt hätte.
Zu ihrer Rolle im Betrieb sagt Frau C selbst wenig. Wichtig sind die guten sozialen Kontakte, auch zu einem neuen Chef: »Manchmal wenn ich Pause - wir dürfen ja auch jede Stunde fünf Minuten Pause machen, dann gehe ich manchmal und sage Hallo. Und dann sagt er: ›Und, erzählen Sie mal, Frau (C)!‹ Und dann soll ich immer erzählen.«
Für die Assistentin ist Frau C »so offen auch, und (sie) erzählt auch von zu Hause und von ihren Freizeitgestaltungen und schafft sich da einen guten Zugang zu den Kollegen, indem sie drauf zu geht und sagt: ›Hallo, da bin ich!‹ Und es kommt unheimlich gut an und sie ist ja unheimlich freundlich und kennt auch ihre Kollegen einfach. Also, manchmal hapert es mit den Namen, aber sie weiß genau, wer dazugehört, ... und kriegt mit, wer da ist an dem Tag.« Auch im Kreis der KollegInnen ist Frau C eine anerkannte Kollegin: »Wenn's halt 'ne Teamsitzung gibt oder 'ne Party oder sonst irgendwas, ist (Frau C) natürlich auch mit eingeladen und weiß, wenn sie jetzt zum Beispiel zur Teamleiterin gehen würde und sagen: ›Ich weiß gar nicht, wie ich hinkommen soll‹, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass man sich mit ihr auch irgendwo trifft. Also die Kollegen sind auch sehr kooperativ, sie da auch einfach mitzunehmen oder reden ihr auch zu. ... Sie gehört mit dazu.« Dabei spielt wohl auch eine Rolle, »dass dort Leute arbeiten, die einen größeren Weitblick in der Gesellschaft haben.« Sie als Assistentin bekommt von ihnen Rückmeldungen wie: »Es ist toll, was ihr macht, so, dass ihr es versucht« und gleichzeitig ist da auch »dieser Wille von Kollegen, dass sie es schafft.« Insbesondere eine Kollegin ist zu einer »Ansprechpartnerin geworden. Sie ist der Integrationssache gegenüber sehr aufgeschlossen und ist auch neugierig und hinterfragt, was wir noch so machen, und ist auch immer bereit, (Frau C) Hilfestellung zu geben. Sie tauschen sich beide ganz gut aus.« Und gleichzeitig kann diese Kollegin, die noch »andere Projekte« bearbeitet, sich auch »sehr gut abgrenzen« von Frau C, denn würde sie über andere Projekte sprechen, würde es Frau C »völlig verwirren, es ist zu viel an Informationen, sondern sie redet mit ihr dann wirklich bloß über diese Sachen«, die mit Frau C's Arbeit oder ihnen als Personen zu tun haben.
Die Chefin sieht die Rolle von Frau C als die einer vollwertigen Kollegin. Die Kontakte mit anderen schätzt sie als unterschiedlich ein: »Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Einige verstellen sich total und andere, also wir haben auch sehr viele lustige Leute hier, Gott sei Dank, die reden mit jedem super lustig. ... Also manche verstellen sich, manche reden gar nicht. ... Aber im großen und ganzen hat sie hier auch - wir haben hier auch so ein paar ältere Damen, und da ist (Frau C) natürlich irgendwie total beliebt. Sie zählt dazu, keine Frage. ... Also sie sucht sich, wie im normalen Leben auch - einen mag man, einen mag man nicht - und so ist das dann hier auch. Also ich würde nicht sagen, dass einer irgendwie sagt: ›O Gott, was will die hier?‹ Das nicht.« Ihrer Wahrnehmung nach hat Frau C in gewisser Weise eine besondere Rolle, denn »es wird schon sehr viel auf sie geachtet. Wenn sie überfordert ist, kommt gleich einer zu mir und sagt: ›Hallo, das musst du noch mal oder hier und da müssen wir noch mal gucken und so.‹ Aber das ist normal, würde ich sagen, das ist ein ganz normales Verhältnis.« Die Chefin ist im diesen Zusammenhang »immer ganz stolz«, und sie bezeichnet es als »ein schönes Gefühl, dass (Frau C) anstatt in der Werkstatt zu sitzen hier ist, und das ist eigentlich das Schöne, da hatte sie ja tierische Angst vor. Also wir sind hier sehr nett alle, also von daher - für mich ist es ein schönes Gefühl, dass ich weiß, sie ist hier, und ich weiß, dass es auch anderen so geht. Und das ist es halt.«
Bei ihren Zukunftsperspektiven ist Frau C am wichtigsten: »Hauptsache, ich behalte meine Arbeit« - sie würde mit dem Betrieb auch umziehen; ob sie in einigen Jahren dort noch tätig ist, darüber macht sie sich jetzt noch keine Gedanken, geht aber eher offen und zuversichtlich darauf zu. Der Vater bezieht sich darauf, dass Frau C einen Vertrag für drei Jahre hat (hier irrt er, denn der Vertrag ist unbefristet), die Zeit, für die die Firma auch staatliche Zuschüsse erhält. »Ich hoffe, dass sie sich bis dahin so festigt dort. ... Es gibt ja auch andere Tätigkeiten, beratende Funktion oder sonst irgendwie. Dass sie irgendwie Fuß fasst irgendwie, dass sie dies so regulieren könnte, dass sie nicht immer Angst haben müsste, den Job zu verlieren. Das wird für sie auch wieder eine Phase, wo sie ein Problem kriegen könnte.« Die Assistentin sieht Frau C auch zukünftig »an einem solchen Arbeitsplatz eigentlich, wenn sich dieser Arbeitsplatz nicht allzu massiv verändert.« Bei kleineren, projektimmanenten Veränderungen sieht sie jetzt keine Probleme mehr: »Das kriegt sie hin. ... Schwieriger wird es sein, wenn (Frau C) in ein neues Projekt eingearbeitet werden muss. Also das ist auch unser Ziel für das kommende Jahr, dass sie ein weiteres Projekt dazunimmt, weil eben nicht garantiert werden kann, dass die Projekte, die sie jetzt telefoniert, auch weiter laufen.« Für die Chefin stellt sich die Frage, ob Frau C weiter unterstützt werden kann, wenn dieses Projekt ausläuft.
Wichtige Aspekte bei Frau C
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Frau C lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Zentraler Angelpunkt ist die hohe Motivation von Frau C zum Arbeiten und vor allem die positive Art des offenen und offensiven Zugehens auf andere Menschen.
-
Der zentrale Unterstützungsbereich durch die Arbeitsassistenz liegt in der kleinschrittigen und langfristigen Einarbeitung in die Inhalte der Tätigkeit, und dieses in einem Maß, zu dem der Betrieb selbst nicht in der Lage wäre.
-
Dadurch kommt es zu einer Arbeitssituation, in der Frau C als Kollegin wahrgenommen wird und in einem dialektischen Sinne als gleich - also nicht in einer Sonderrolle mit Distanzierung von anderen - und als verschieden - mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht - gesehen wird.
-
In ihrer aktuellen Arbeitssituation werden gelingende integrative Prozesse insbesondere mit einer Kollegin deutlich, bei der es zu einer stabilisierenden Balance von Annäherung und Abgrenzung kommt.
-
Im Hintergrund steht eine unumstößliche Sicherheit, von den Eltern unterstützt zu werden, und das in dieser hoch engagierten Form, etwa in den Bemühungen um Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt - nicht zuletzt im Betrieb, in dem der Vater selbst beschäftigt ist.
-
Frau C weiß nach dem Praktikum in der Werkstatt für Behinderte, dass sie dort nicht hin möchte, da sie dort Verhaltensweisen von KollegInnen erlebt hat, die sie erschreckten und ängstigten. Sie ist auf ein sicheres Umfeld mit verlässlichen Verhaltensweisen angewiesen; dies steht im Gegensatz dazu, dass mehrere Institutionen mit Fachleuten (Schule, Berufsbildungszentrum, Mitarbeiter des Sozialhilfeträgers) sie nur auf die Werkstatt für Behinderte orientieren wollen. Dieser Konflikt entwickelt sich zu einem harten Kampf zwischen grundsätzlich unterschiedlichen Orientierungen und nimmt fast traumatische Formen an - für Frau C und für ihren Vater.
Ansätze zur Interpretation
Unter dem Blickwinkel der Stigma-Theorie wäre Frau C mit ihrer klar diagnostizierten Schädigung der Gruppe der Diskreditierten zuzuordnen, was u.a. zu den heftigen Auseinandersetzungen mit fachkompetenten Stellen maßgeblich beigetragen haben dürfte. Sie wehrt sich vehement gegen ein Umfeld, in dem sie in einer Zusammenballung diskreditierter Personen deren vielen, für sie unwägbaren Verhaltensweisen ausgesetzt wäre - und damit würde ihre eigene Behinderung als Ausgegrenzte potenziert. Nun bewegt sich in einem Umfeld, in dem diese Zuschreibung wenig zum Tragen kommt. Ihre freundlich-offensive Grundhaltung erübrigt zudem weitgehend eine Unterstützung der Entstigmatisierung, so dass die ArbeitsassistentInnen sich ganz auf den Zuschnitt für sie bewältigbarer Arbeitsabläufe und die fachliche Qualifizierung hierin konzentrieren können.
Der Glaube an sich und die eigenen Möglichkeiten zeugt von einer hohen Selbstakzeptanz von Frau C, die ihr in einem offenen Umfeld gelingende Begegnungen und gute Kooperationsmöglichkeiten im Sinne der Theorie integrativer Prozesse ermöglichen. Ihre massive Gegenwehr gegen die Orientierungen, die bei ihr den Pol der Andersartigkeit und Schonbedarf betonen und sie auch nach der Sonderschulzeit in Sonderstrukturen verorten wollen, scheint gespeist zu sein von für sie erschreckenden Erfahrungen. Da sie ihre Schulzeit in der Schule für Blinde und Sehbehinderte nicht in Frage stellt, ist der Rückschluss möglich, dass sie die eigene individuelle Verschiedenheit nicht verleugnet, verfolgt und damit abspaltet zugunsten einer Fixierung auf ein Gleich-Erscheinen. Die AssistentInnen nutzen den von betrieblicher Seite gewährten langen Atem bei der Entwicklung und Einarbeitung der geeigneten Arbeitsabläufe, sind aber so auch Modelle für KollegInnen und zugleich GarantInnen für ein komplikationsloses Hineinwachsen in das Gesamtteam und das Betriebsgeschehen. Die Balance, in der Anerkennung und Akzeptanz von Gleichheit und Besonderheit in diesem Betrieb bei Vorgesetzten und TeamkollegInnen vorhanden sind, ermöglicht ihrerseits echte Begegnung, gelingende Kooperation, auch über das Sachliche hinausgehende Gemeinsamkeit und eine Normalisierung im Sinne dessen, dass sich das Spektrum von Normalität in diesem Team vergrößert hat.
Herr D, 23 Jahre alt, befindet sich seit zwei Monaten im Integrationspraktikum in einer Konditorei in der Konfisserie, in der er vier Stunden täglich arbeitet. Nachdem er bereits nach 17 Monaten im Ambulanten Arbeitstraining in einer Bäckerei einen Arbeitsvertrag bekommt, steht er dort 2 1/4 Jahre in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, das dann jedoch abgebrochen wird. Herr D stammt aus einer Arztfamilie und hat die Schulzeit in Integrationsklassen durchlaufen, zunächst in der Grundschule, dann in der Gesamtschule, schließlich im BVJ-i einer Berufsschule, von dem er in das Ambulante Arbeitstraining wechselt. Da Herr D bereits, »seitdem er mit der Nase über'n Tisch guckt«, wie die Mutter sagt, klar äußert, dass er Bäcker werden will - »das war auch immer mein Traum« - , macht er auch sein Betriebspraktikum in einer Bäckerei und sammelt weitere Erfahrungen während der Gesamt- und Berufsschulzeit in einer Bäckerklasse des Berufsschulzentrums. Vom Ambulanten Arbeitstraining erhofft sich Herr D laut der ersten Befragung, »dass ich die Arbeit gut mache, dass mein Traum in Wirklichkeit kommt.«
In der ersten Befragung äußert sich Herr D weitgehend sehr zufrieden über seinen bisherigen Weg: Über die Schulzeit insgesamt und das Ambulante Arbeitstraining, das er die ganze Zeit in der Bäckerei verbringt, in der er auch angestellt wird, äußert er eine hohe Zufriedenheit, wenngleich es auch manchmal für ihn sehr anstrengend wird. Lediglich bei der Beschäftigung gibt er nur mittlere Zufriedenheitswerte an, da es vermehrt Probleme mit den Kollegen gibt. Im Integrationspraktikum im neu gefundenen Betrieb dagegen ist er sehr zufrieden, es gibt nichts, was er ungern täte.
Im Rahmen der zweiten Befragung findet das Interview mit Herrn D bei ihm zuhause statt, bei dem anschließenden Gespräch mit der Mutter bleibt er als aktiver Zuhörer anwesend. Sie resümiert seinen Lebensweg: »Ich muss sagen, also von Profis, vom Kindergarten an, hatten wir eigentlich nie ein Problem. Es hat auch nie irgendwer diese Dinge gesagt wie: ›Vergessen Sie 's lieber.‹ Das war davor, das war gleich ganz akut nach seiner Geburt, ... aber das zählt jetzt eigentlich nicht. Sonst haben wir eigentlich mit Profis und sogenannten Profis keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir haben also im Kindergarten eine tolle Kindergärtnerin gehabt, die damals die ganzen Anfangsgeschichten mit der Integration heftig unterstützt hat. Dann kam die Schule ... das war ein Selbstgänger bis zum Ende. Dann kam nachher die (Berufsschule) ... und da haben wir nie Probleme gehabt. Berufsberatung - bin ich nie gewesen, hab' ich machen lassen von den Profis und ich hab' auch nie gehört, dass da so etwas gefallen ist ... ist ja auch ein toller Sohn.« Herr D hat also tatsächlich nie eine Werkstatt für Behinderte kennengelernt. Als die Sprache auf den Schwebezustand nach dem Abbruch des ersten Arbeitsverhältnisses kommt, stellt sich heraus: Herr D hat in der Konditorei inzwischen, nach fünf Monaten Integrationspraktikum, einen Arbeitsvertrag als »Backstubenhelfer« bekommen. Das Interview mit der Assistentin, ursprünglich Sozialarbeiterin, findet in den Räumen der Arbeitsassistenz, das mit dem - neuen - Chef und zeitweilig auch mit dessen Gesellen in der Konditorei statt.
Bezüglich seiner Stärken und Schwächen macht Herr D an mehreren Stellen deutlich, dass er weiss, was er will, und bereit ist, viel dafür zu tun: »Ich bin auch bereit, meinen Traum so in Wirklichkeit umzusetzen.« Er betont: »Also ich arbeite immer im Team, in Teamwerk.« Gleichzeitig weiss Herr D auch um seine Notwendigkeiten für eine gute Arbeit. Als die Mutter sagt, der Geselle im zweiten Betrieb habe einen »guten Blick« dafür, was Herrn D überfordert, betont der: »Ich hab' auch diesen Blick.« Im Vordergrund steht für ihn, dass »ich Zeit brauche, äm, und Zeit brauche.«
Seine Mutter sieht vor allem, dass er »ja auch von Haus aus ein großes Durchhaltevermögen gehabt« hat. »Erstmal war's sein Traumjob, und er hat immer, auch schon in der Schule, ja so eine Form von: ›Das schaff ich‹ ... an den Tag gelegt. ... Und auch so: ›Ich lass mich nicht kleinkriegen‹, so in diese Richtung. Und das hat er dann jetzt auch im Betrieb sehr gut gebrauchen können. ... Das war ja eben schon tatsächlich von ganz klein auf an.« Auch seine unangepassten Verhaltensweisen sieht seine Mutter eher als Stärke, wenngleich ihr das Dilemma bewusst ist, dass von ihm andererseits im Arbeitsleben »viel Anpassungsleistung« erwartet wird, und »er hat das ganz toll gelernt.«
Für die Assistentin hat Herr D »eine hohe Motivation (mitgebracht), grundsätzlich zu arbeiten, grundsätzlich auch außerhalb der Werkstatt ... und in einer Bäckerei zu arbeiten. Also da ist (Herr D) auch wirklich eine Ausnahme gewesen, jemand, der mit einer so klaren beruflichen Orientierung zu uns kommt und, ja, auch alternativen Vorschlägen gegenüber gar nicht offen ist.« Was er weiter mitgebracht hat, »ist durchaus so etwas wie Fachkompetenz, die er in der Bäckerei der (Berufsschule), also in der berufsvorbereitenden Geschichte« erworben hat und er von daher auch schon »eine Fachsprache kannte.« Die Assistentin nimmt ihn wahr als »jemanden, der sehr selbstbewusst ist und formulieren kann oder deutlich machen kann, was er will und was nicht, also wozu er Lust und wozu er keine Lust hat.« Zu Beginn hat Herr D jedoch noch nicht gelernt, »die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen hinter diesen ... Arbeitswerten wie: ›Ich muss auch Arbeiten machen, die mir keinen Spaß machen, ich muss Arbeiten zu Ende machen, auch wenn sie mir zu lang erscheinen und auch nicht schön erscheinen, ich bin plötzlich eingebunden in eine Hierarchie.‹ Das war ja auch etwas, das er sicher so in der Schule nicht gelernt hatte.« Auch später sind, wie die Assistentin feststellt, »seine Möglichkeiten, sich selber durch einen Tag zu pushen, wenn er nicht gut drauf ist, ... wirklich relativ gering, und da braucht er dann Unterstützung von außen.«
Herr D ist für den Chef »ein netter Mann«, der, wie der Geselle ergänzt, »gute Vorkenntnisse gehabt« hat. Der Chef meint: »Er macht seine Arbeit eigentlich ordentlich und zieht das durch.« Manchmal kommt es jedoch auch vor: »Wenn er eine Arbeit machen soll, zu der er keine Lust hat, dann sagt er: ›Oh, ich mache jetzt Pause.‹ Dann gucken die anderen alle, aber dann geht er eben in die Pause. Wir lassen ihn ja auch so ein bisschen. Dann ist er nachher wieder fit und ist wieder da.« Bedeutsam erscheint auch dem Chef ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein bei Herrn D: »Wenn ein Praktikant neu da ist, dann passt er auch auf, dass der die (Sachen) ordentlich macht, wie er sie gemacht hat. Dann sagt er: ›Hier, das musst du so machen.‹ ... Da haben wir dagestanden und nur gestaunt. Er lässt sich da auch nicht wegdrängen, sondern sagt dann: ›Das ist meine Arbeit.‹ Wie wir das dann gemerkt haben, dann muss der Praktikant eben was anderes machen und nicht er, er gehört ja - er ist ja schon länger da.«
Die wichtigste Entwicklung ist für Herrn D der Wechsel in den neuen Betrieb; im vorigen ist immer eine »schlechte Stimmung«: »Aufgeladen war ich« dadurch. Dort herrscht »nicht der richtige Umgehston«, meint er. Wichtig sind seinem Empfinden nach dafür im neuen Betrieb auch »die Ladies«, die es im ersten Betrieb mit reiner Männerbelegschaft nicht gab: »Das ist freundlicher.« Im neuen Betrieb ist darüber hinaus »mehr Ruhe und Zeit.« Auch wenn er seine jetzige Arbeit »prima« findet, stellt Herr D fest: »In meinem Arbeitsleben fehlt noch Zeit, Zeit, viel Zeit und Ruhe und viel Ruhe.« Im zweiten Betrieb hat er schließlich auch neue Abläufe und neue Fähigkeiten gelernt: »Da ist auch eine Waschmaschine, die bediene ich.« Und das allerwichtigste ist für Herrn D: »Also den Arbeitsvertrag habe ich schon. ... Ich bin froh darüber, dass ich den wirklichen Arbeitsvertrag bekomme.«
Die Mutter stellt fest: »Der junge Mann hat am Anfang seines Arbeitslebens ... unheimlich viel gelernt in der Form, dass er seine Arbeiten, die er macht, ganz konzentriert machen kann. Zu Anfang war das immer nur in kurzen Phasen möglich, und er hat Arbeiten auch nicht zu Ende machen können, weil auch die Konzentration fehlte. Das hat er also unheimlich toll gelernt. Er macht jetzt eine Arbeit von Anfang bis zu Ende richtig durch. Er hat gelernt, mit komplizierten ... Konstellationen innerhalb des Betriebes fertig zu werden. Zu Anfang, muss man zugeben, waren die Bedingungen auch nicht so kompliziert, die wurden zum Schluss im ersten Betrieb komplizierter, und er hat ganz toll gelernt, mit diesen Dingen in irgend einer Form klarzukommen. Er hat am Anfang oft mal auch Arbeit verweigert - das geht einfach nicht, dass man das nicht tut, und dass Arbeitgeber darauf auch sehr sauer reagieren. Er hat gelernt, in diesem doch sehr harten Arbeitsleben auch viel einzustecken, was zu Anfang eben zu Wutausbrüchen trieb, und auch Arbeitsverweigerung teilweise. Er hat also gelernt, doch zu kompensieren und hat ... runtergeschluckt, hat ganz viel gelernt, dass man eben zu vielen Dingen besser nichts sagt, ... hat unheimlich viel Anpassungsleistung gelernt. Was aber eigentlich ja gar nicht so unser Ding ist: Anpassungsleistung ist ja ein furchtbares Wort, wirklich schrecklich, aber es ist einfach im Arbeitsleben notwendig - man muss sie haben, wenn man sie nicht hat, kommt man nicht klar. Und er hat das ganz toll gelernt.«
Rückblickend sieht die Assistentin die gleiche Ambivalenz: Im ersten Betrieb sind »die Erwartungshaltungen immer weiter gestiegen, und zwar in einem Maße, das (Herr D) sicher nicht erfüllen konnte.« Er »hat - und das finde ich nämlich eher, das finde ich halt nicht nur positiv, sondern als Problem: Ich denke, er hat auf jeden Fall gelernt, sich selber zurückzunehmen und sich anzupassen und sich auch ein Stück in seiner Persönlichkeit (flüsternd) brechen zu lassen. ... Das ist ein grundsätzliches Problem, ob wir es wirklich gut finden, Leute in unsere Definition von Arbeit mit hineinzupressen.« Gleichwohl sieht die Assistentin als sehr positiv, »dass es ihm durchaus gelungen ist, von dem, was er dort gelernt hat - und nicht nur an sogenannten Schlüsselqualifikationen, sondern auch an Arbeitsfertigkeiten - , dass er durchaus in der Lage ist, diesen Transfer zu machen. Und das, finde ich, sollte auch immer wieder betont werden, weil ja in der Regel unterstellt wird, dass dieser Transfer nicht geleistet wird durch Menschen mit einer geistigen Behinderung.«
Sein neuer Chef ist hundertprozentig mit der Situation zufrieden: »Das läuft alles.« Schon am Anfang, erzählt die Mutter, fällt denen »immer nur der Unterkiefer runter: ›Was der alles kann, Donnerwetter!‹ Nach drei oder vier Tagen sagte der (Geselle) schon: ›Den behalten wir hier.‹« Der bestätigt dies: »Ja, er redet nicht viel. Aber man braucht oft nichts mehr sagen. Er hatte gute Vorkenntnisse gehabt.« Zudem beschreibt der Geselle seine eigene Entwicklung vom anfänglichen Erschrecken zur selbstverständlichen Zusammenarbeit: »Er ist nicht dumm auf der einen Seite, gerade das mit der Zeit behält er eigentlich sehr gut. Für mich war das auch der erste Fall ›mongoloide Behinderung‹. Wo wir die Scheu überwunden hatten, und es war eine Scheu zuerst, erst sieht man die Leute immer und sagt: ›Bloß nichts damit zu tun haben.‹ ... Ja, ist doch so. ... Hier stand er, ohne dass ich die Mutter kannte oder so, und irgend wie habe ich gedacht, kannst dich freuen, dass dein eigenes Kind nicht so ist. Und dass das so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. ... Das Mongoloide siehst du nachher nicht mehr. Es sind keine unangenehmen Sachen dabei.«
Seine Zufriedenheit zieht Herr D daraus, dass er seinen neuen Arbeitsvertrag hat und die Arbeit - gerade im Vergleich mit dem früheren Betrieb - insgesamt »prima« ist: »Da ist mehr Ruhe und Zeit. ... Das ist mir wichtig.« Auch seine hohe Zufriedenheit über sein neues Team betont Herr D mehrfach, indem er die Namen der KollegInnen nennt. Und auch die ArbeitsassistentInnen »haben ein Lob verdient.« Obwohl Herr D im neuen Betrieb etwas weniger verdient als vorher, äußert er sich auch darüber zufrieden: »Mit meinem Konto bin ich auch einverstanden.« Er nimmt besonders die eine Stunde später beginnende Arbeitszeit positiv wahr: »Da ist schon hell draußen. ... weil Dunkelheit sehr viel müde macht.«
Auch seine Mutter ist mit der gegenwärtigen Situation hoch zufrieden: »Also was er jetzt macht, ist sowieso schon mal traumhaft. Das hätte ich mir natürlich eigentlich in meinen kühnsten Träumen nie vorgestellt, aber natürlich war's schon irgendwo im Hinterkopf, dass mal irgendwas in diese Richtung passiert, aber das übertrifft eigentlich alle Erwartungen.« Sie ist froh darüber, dass auch im neuen Betrieb wiederum Lohnkostenzuschüsse gezahlt werden und der neue Chef ihr gegenüber ganz offen sagt: »Weißt du, wenn ich jetzt bedenke, nach neuem Gesetz, was ich zahlen müsste, wenn ich keinen Behinderten einstellen würde, da stehe ich mich ja noch viel besser bei.« Andererseits - und darüber freut sie sich noch mehr - sagt er zum Mitarbeiter des Arbeitsamtes: »Den würd' ich auch einstellen ohne Förderung.«
Der Chef selbst sieht insgesamt »gar keine« Probleme bei der Beschäftigung von Herrn D: »Er ist glücklich in der Backstube.« Auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht ist der Chef mit seiner Entscheidung und zumal mit Herrn D zufrieden: »Ich sehe das so: Weil wir sind ja auch ein bisschen geschrumpft und man sollte ja auch einen Schwerbeschädigten oder so beschäftigen, das würde ja den Status - ... nicht dass ich hinterher die Schwerbeschädigtengebühr da noch extra abführen muss. Da kann ich auch jemanden, der wirklich Lust hat, dann beschäftigen. Der soll um acht Uhr hier sein, er ist manchmal schon um sieben Uhr dreißig da.« Der Geselle stellt als direkter Kooperationspartner fest: »Für (Herrn D) ist das bereichernd, dass er Arbeit hat. Ich denke, das wird ihn glücklich machen.«
Die Assistentin findet die Tatsache, dass Herr D den zweiten Arbeitsvertrag bekommen hat, »so geil, echt! Das ist so geil! Oh! ... Ich glaub', die stehen irgendwie total dahinter. ... Er ist sehr zuverlässig, er kann auch ganz viel, er nimmt ihnen ja durchaus auch viele Arbeiten ab, an manchen Tagen nicht so gründlich, aber das ist inzwischen auch okay. Dann kriegt er deutliche Worte, aber mit denen kann (er) auch umgehen.«
Zur Rolle der Arbeitsassistenz sagt Herr D, »die Arbeitsassistenten, die sind wichtig, weil sie begleiten. ... Das schätze ich.« Sie sind auch seine »Ansprechpartner«, mit denen er alles besprechen kann und die für ihn »einen neuen Arbeitsplatz finden. ... Das habe ich, ich hab' die angesprochen, ... den Arbeitspunkt angesprochen.«
Für die Mutter nehmen die AssistentInnen »dem Arbeitnehmer in dem Betrieb natürlich viele Dinge ab, die er lernen muss, die die aber (im Betrieb) zeitlich gar nicht auf die Reihe kriegen würden, ihm das beizubringen, weil er natürlich länger braucht. ... Die trainieren ihn also, alleine die Fertigkeit, Dinge zu machen. Es wird natürlich geguckt, was und wo's hapert. Auch durch ihre berufliche Qualifikation (haben die) ... einen guten Blick: Wie bring' ich jemanden was bei, was kann ich ihm für Hilfsmittel an die Hand geben? Zum Beispiel dieses Gitter, das er da hat - das mit dem Zählen ist ja für ihn wirklich eine absolute Katastrophe - mit diesem Gitter: kein Problem. ... Das sind so Sachen, diese Ideen haben sie dann, setzen sie auch um. Zu Anfang hatte er zwei so Leisten, die er sich immer angelegt hat, um Schokis aufzunehmen. Da konnte er sich auch toll dran orientieren, die Bleche waren immer genau belegt, war super. Das ist das eine, ihm also Fertigkeiten an die Hand zu geben, die ihn in den Stand setzen quasi, die Dinge zu machen, die er machen muss: Franzbrötchen drücken und dieser ganze Quark, den die da machen. ... Und das zweite ist eben, dass sie diese Vermittlung zwischen dem Arbeitnehmer, dem Chef und ihm, eben dieses Bindeglied irgendwo sind, und eben auf der anderen Seite zu den anderen Mitarbeitern.« Letzteres war im ersten Betrieb offenbar eine Hauptschwierigkeit, »aber jetzt klappt das wunderbar, die Mitarbeiter in Stand zu setzen, (ihn) besser einzuordnen, ihn zu verstehen und mit ihm besser umzugehen, Dinge, die er anders macht als andere, richtig einzuordnen, nicht in den sogenannten falschen Hals zu kriegen, Eigenarten, die er hat, einzuschätzen und damit umgehen zu lernen.« All das hat man im neuen Betrieb »so schnell begriffen, dass ich dachte: ›Wie kann das nur angehen?‹« Sie ermutigt angesichts der zunehmend schwierigen Erfahrungen im ersten Betrieb alle Beteiligten zu mehr Selbstbewußtsein, kritisch zu prüfen, ob ein Betrieb wirklich der richtige ist, auch »wenn er da hundert Mal viel gelernt hat vom Handwerklichen und von den Fertigkeiten her, wirklich unheimlich viel. ... Das ist das eine. Aber es muss beides gut laufen: Er muss gewisse Dinge lernen, aber das Lernen - oder was er da lernt, ist, denke ich, zweitrangig zu dem, atmosphärisch, wie er das lernt! Denn wenn er es gut lernt, lernt er auch sehr viel. Und deshalb ist es um so erstaunlicher, dass er da so viel gelernt hat. Das wiederum ist der Arbeitsassistenz ... auch wieder positiv anzumerken. Die haben sich da wirklich unheimlich reingehängt, die haben ja (ihn) begleitet und begleitet, und zum Schluss waren sie ja vier Mal die Woche da!«
Die zunächst genannten Funktionen werden auch von der Assistentin bestätigt, wenngleich, »was die Fertigkeiten angeht, das ... häng' ich inzwischen auch eh nicht mehr so hoch. Also Fertigkeiten zu qualifizieren ist das geringste Problem hier. Das kann man tun, das ist was sehr Handfestes und Greifbares.« Die eigentlich zentrale Funktion der Arbeitsassistenz sieht sie hier dagegen in Folgendem: »Ganz wichtig ist es gewesen, dass wir dahintergestanden haben. ... Wir konnten es uns vorstellen und wir mussten das auch immer wieder transportieren. Also eine gewisse Hartnäckigkeit unsererseits ist sehr wichtig gewesen.« Es ist für die Assistentin sehr anstrengend, »dieses immer wieder dranbleiben und nicht aufgeben, selbst wenn alle Seiten - oder was heißt alle Seiten? - alle Kollegen, ich weiß nicht, wer alles sagt: ›Das geht doch alles nicht.‹ ... Durchhalten war ein großes Thema für diesen Integrationsprozess.« Sie bekräftigt, »dass es sowohl Herrn D als auch alle Beteiligten sehr viel Kraft gekostet hat. Ihn auch immer wieder zu motivieren, war ein ständiger Prozess, einfach zu gucken: ›Mensch, Junge, was brauchst du denn jetzt eigentlich, damit du das durchhältst? Oder bis wohin hältst du durch? Bis wohin nicht mehr? Also wo sind deine Grenzen? Aber wo können wir dich auch noch mal schubsen?« Die Kraftquelle dafür ist für die Assistentin »ein ungeheurer Wille gewesen, dass ich wollte, dass es funktioniert. Das hat ja auch was mit der eigenen Motivation zu tun.« Die Schattenseite dieser hohen Identifikation mit dem Projekt und des hohen Erfolgdrucks, überlegt die Assistentin, könnte sein, »es dadurch vielleicht auch ein bisschen überreizt zu haben in der Länge, das kann schon sein, also in der Länge dieses Beschäftigungsverhältnisses.« Auch die Frage nach der Alternative lässt sie zögern: »Ich habe gedacht, wir finden nicht so schnell einen vergleichbaren Arbeitsplatz, denn von den Tätigkeiten her war es ein guter. Man muss sich letzten Endes nicht vormachen, dass die ... Arbeitswelt darauf wartet, dass wir mit Arbeitskräften wie zum Beispiel mit (Herrn D) kommen. Also das war meine große Angst, so zu sehen: Wir scheitern, also (er) scheitert und wir natürlich damit auch, das ist klar. Und er muss halt doch in die Werkstatt, was für ihn, denke ich, absolut niederschmetternd gewesen wäre, weil er ist ja nun mal auch ein Integrationskind.«
Für den neuen Chef im zweiten Betrieb liegt die Funktion der Assistenz vor allem in der konkreten Anleitung: »Die passen ja so ein bisschen auf ihn auf, dass er das richtig macht. ... Und wenn er dann im Moment nicht so weiß, dann sagen die: ›Komm her, das muss so sein.‹ Und passen auf ihn auf.« So besorgen zum Beispiel die AssistentInnen - nicht nur zu Herrn D's Nutzen - »so ein Gitter (...), wo er die Brötchen reinlegt. Das haben sie mitgebracht. Das fand ich ganz toll, das konnte selbst unsere Putzfrau nachher benutzen, damit die Brötchen richtig draufliegen, oder Lehrlinge, die nicht gerade gucken können. Da gehen 35 Brötchen auf das Blech, die liegen alle an einer Seite zusammen, das geht ja nicht. Die müssen ja richtig nach Schema verteilt werden. Und da hat er so Holzleisten, das Gitter macht er drauf und dann legt er die da rein. ... Wir haben selbst gestaunt, warum wir nicht auf die Idee gekommen sind. ... Da gibt es auch verschiedene Größen, da hat sich die Arbeitsgemeinschaft echt Gedanken gemacht.«
Ohne die Arbeitsassistenz - da sind sich fast alle einig - wäre klar, wo Herr D sich befände: »Kurz und trocken: Werkstatt«, meint die Mutter, »das wäre ohne Arbeitsassistenz gar nicht möglich, völlig undenkbar.« Und dort, so die Assistentin, hätte Herr D »nicht ein Viertel von dem gelernt, was er heut' kann.« Auch der Chef meint, ohne die Assistenz »würde es auch nicht gehen, denke ich mal.« Nur Herr D ist der Meinung, er würde sich »selbst darum sorgen«, dass er seinen Traum verwirklicht.
Die Rolle im Betrieb unterscheidet sich bei Herrn D, so Mutter und Assistentin übereinstimmend, eklatant zwischen den beiden Betrieben, in denen er tätig ist. Im ersten Betrieb schildert die Assistentin seine »Realsituation: ›Ich hab' 'n Chef, ich hab' 'n Meister, ich hab' 'n Gesellen, ich hab' Auszubildende und ich, (Herr D), steh da ganz unten! So!‹ Also gut, ich denke, man kann da unten schon auch noch andere Leute mit ansiedeln, aber sicherlich ist (er) erstmal derjenige, der - allein von seinem Äußeren, also aufgrund der sichtbaren Behinderung - prädestiniert dafür ist, unten zu bleiben.« So steht es jedenfalls - auch im Kontrast zu Herrn D's schulischen Erfahrungen - in diesem Betrieb, »der nicht dazu in der Lage gewesen ist, anders zu denken, eine andere Sicht zu bekommen.« Hier gibt es zum Schluss »überhaupt keine Anerkennung mehr von wirklich existenten Grenzen, dass (er) zum Beispiel nicht zählen kann, und es wurde alles, was sie von ihrer Seite aus hätten tun müssen, was meiner Ansicht nach nicht zu viel gewesen wäre, ... als eine wahnsinnige Überbelastung von seiten der Kollegen beschrieben. Dafür sind auch betriebliche Zusammenhänge verantwortlich. ... Das ist kein Spiel, das dort zwischen (ihm) und den Kollegen alleine stattgefunden hat.« Hier sieht sie auch das Verhalten des Chefs und betriebsinterne Spannungen als wichtige Anteile. Herr D »war halt ein geeignetes Objekt, diesen ganzen Frust abzulassen und Arbeitsassistenz eignet sich dann auch dazu, den Frust abzulassen. ... Und das Schlimmste war, fand ich, dass (ihm) diese große Lustlosigkeit unterstellt wurde und dieses: ›Wenn er will, dann kann er ja!‹ Wo ich gedacht hätte, sie müssten doch längst verstanden haben, dass das so nicht stimmt. Dass sie es zum einen nicht gelernt haben, ihn wirklich zu motivieren, was auch mit einem relativ geringen Aufwand ganz gut funktioniert, so. Und sie hätten eigentlich wissen müssen: Er kann es zum Teil nicht wirklich alleine.«
Die Mutter schildert die Situation, die zunehmend Züge des Mobbings enthält: »Der Druck wurde ja zum Schluss ja so gross, dass (er), trotz aller Möglichkeiten, die er gefunden hat, das irgendwie für sich klarzukriegen, doch solche massiven ... Erscheinungen bot, dass wir einfach nicht mehr umhin konnten, da drum herum zu gucken, und zu sagen also: ›Komm, halt durch, das wird schon‹ und sowas - solche Durchhalteparolen haben wir ja zum Schluss viel gebraucht. Also nachher war's so, dass ihm morgens übel wurde, wenn er hin musste ..., dass er auch im Betrieb gebrochen hat. ... Nachher ging es ihm so auf den Magen, und er hatte so einen Widerwillen, dass dann bei uns natürlich also ab einem gewissen Zeitpunkt alle Alarmglocken angingen. Und dann hieß es nur noch: Wie regeln wir's jetzt? Er muss da weg! Denn sonst wird er krank, er wäre, glaub' ich, krank geworden. Denn der Druck war einfach so unerträglich nachher, die Atmosphäre in diesem Betrieb, die war so geladen von Aggression und Antipathie - also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätt' schon viel eher aufgesteckt. Also wie er das gemacht hat, ist uns nach wie vor ein Rätsel. Er hat also irgendwie für sich immer noch wieder eine Möglichkeit gefunden.« Nun finden entsprechende Absprachen mit der Arbeitsassistenz statt: »Die haben dann nachher nach längerem anfänglichen Zögern, will ich mal sagen, weil immer noch bei denen im Hintergrund stand, so 'n tollen Betrieb kriegen wir nicht wieder, dann aber auch uns beigepflichtet und gesagt: ›Also das geht nicht, wir suchen 'nen neuen Betrieb.‹ Das war erst mal so intern unter uns, da wusste der Betrieb noch gar nichts von.« Nachdem die Situation in den letzten drei Monaten eskaliert, ist Herr D soweit, eine »Kündigung aus(zu)sprechen.« Als »Tüpfelchen auf dem i« und »ganz mies« empfindet die Mutter das Verhalten beim Abschied: Als Herr D mit den beiden AssistentInnen ein letztes Mal zur Verabschiedung kommt, »morgens um neun, an einem Freitag, war keiner mehr da. ... Die hatten fluchtartig offensichtlich diesen Betrieb verlassen, da hat sich bis auf die Konditoren, die immer sowieso aussen vor waren, keiner von ihnen verabschiedet, die waren alle weg.« Herr D ergänzt: »Der Chef hat geschlafen.« Und zusammenfassend stellt er fest: Das war »ein Pech in Tüten.«
Nachdem Herr D dazwischen lediglich einen Vorstellungstermin in der hauseigenen Bäckerei eines Nobelhotels hat, gestaltet sich die Situation im zweiten Betrieb - wie beschrieben - ganz anders. Herr D selbst betont, dass er mit zwei Männern und den »Ladies ein Team« ist. Seine Assistentin hebt hervor: »Die betriebliche Atmosphäre dort ist besser, d.h. sie sind offener und gerade der (Geselle) ... ist sehr neugierig gewesen auf dieses Projekt, so eine Offenheit einfach, und war sicherlich auch so 'n bisschen in seinem Gefühl gekitzelt: Er kriegt das schon hin.« Auch die Mutter bestätigt eine andere Grundhaltung. So sagt der Geselle »einmal: ›Ja, ... den kann man ja gar nicht überfordern oder so, das wäre ja wahnsinnig, der würde dann ja gnatzig werden.‹ Und das müsste man dann ja auch respektieren, denn das wäre dann wohl zu viel für ihn. ... Und das habe ich in dem anderen Betrieb nicht einmal gehört.« Dass das Team in der Konditorei aus Frauen und Männern in unterschiedlichem Alter besteht, die teilweise auch Eltern sind, empfindet die Mutter als »unheimlich gute Mischung.« Bei »zu lieben« Frauen sieht die Mutter die Gefahr, dass Herr D sie »für sich losschickt.« Jedoch betont er: »Das ist abgestellt.« Hilfreich mag auch gewesen sein, dass die AssistentInnen beim zweiten Betrieb »anders gestartet sind als beim ersten, also von den Erfahrungen heraus noch mal klarer und deutlicher auch wirklich Grenzen formuliert haben. ... Schon zu betonen: ›Guck mal, was er alles kann!‹ Aber durchaus auch zu sagen: ›So, und das war jetzt eine Situation, die werdet ihr häufiger erleben wahrscheinlich. Das ist normal, das gehört zu (ihm), und dann könnt ihr das und das machen.‹ Das, denke ich, war der bessere Weg.«
Der Chef sieht Herrn D in seinem Betrieb im Unterschied zu anderen, vermutlich auch zum vorigen Betrieb als akzeptierteren Mitarbeiter: »Das ist hier wahrscheinlich mehr wie in einem anderen Betrieb.« Dies ist so, obwohl die MitarbeiterInnen nicht auf Herrn D vorbereitet wurden: »Gar nicht, nein. Die haben zwar alle geguckt ...« Eher entsteht, so der Geselle, Überraschung darüber, »dass das so gut läuft in der Zusammenarbeit.« Wie auch die Assistentin schildert, betont auch der Geselle einen sehr normalen Umgang mit Herrn D: »Wenn ich ihm sage, mach das sauber, dann sehe ich, dass er nach einem aufhört, und wenn ich ihm dann sage, da sind noch drei, dann fängt er wieder an. Nö, aber so muss das auch laufen.«
Zu seinen Zukunftsperspektiven bemerkt Herr D entschlossen: »Die halte ich auch, die zweite Chance.« Seine Mutter erwartet, »dass der Job jetzt weiter gut läuft, dass das auch weiter gut klappt, und dass (er) irgendwann dann auch diesen Job ganz alleine ausführt, ohne Arbeitsassistenz, dass das vielleicht auch noch irgendwann wird, und dass er dann natürlich ganz auf eigenen Füßen steht, irgendwann mit Ausziehen und Wohnen.« Nur wenn der Inhaber seinen Betrieb aufgibt oder verkauft, dann stellen sich neue Fragen. Auch die Assistentin sieht Herrn D in einiger Zeit ohne Unterstützung in diesem Betrieb arbeiten: »Dieser Betrieb kriegt das alleine hin!« Und der Geselle sieht dies genau so: »Wenn die mal nicht mehr kommen, dann ist er hier ein fester Bestandteil durch das, was er kann, und das verdient er dann auch. Und dann muss das auch gehen.«
Wichtige Aspekte bei Herrn D
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Herrn D lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Bei Herrn D und seinem Umfeld kommt eine langfristige integrative Orientierung zum Tragen. Dieser Weg wird konsequent seit dem Kindergarten gegangen.
-
Wenn wie bei Herrn D das Arbeitsverhältnis in einem Betrieb beendet werden muss, bedeutet das nicht den Absturz unterstützter Beschäftigung und das Ende aller integrativen Perspektiven; vielmehr gelingt es hier innerhalb kurzer Zeit, über das Integrationspraktikum einen anderen Betrieb zu finden und einen neuen Arbeitsvertrag zu erreichen.
-
Herr D ist sehr deutlich in der Lage, Fähigkeiten auf der Grundlage der Arbeit im ersten Betrieb auf den zweiten Betrieb zu transferieren, und zwar nicht nur allgemeine Arbeitstugenden oder Schlüsselqualifikationen, sondern auch konkrete berufsfeldbezogene Fertigkeiten. Dies kann er als jemand, dem eine geistige Behinderung zugeschrieben wird. Auch das Phänomen, dass Herr D seit langer Zeit ein Bild seiner Zukunft antizipiert, steht in einem Spannungsverhältnis zu den Attributen, die einer geistigen Behinderung zugeschrieben werden.
-
Herr D kann als Beispiel gelten, bei dem großes Selbstbewusstsein und starker Durchhaltewille, also ein Glaube an sich und seine Möglichkeiten viele Schwierigkeiten überdauert und überwindet. Deutlich ist auch seine Teilnahme an und seine Fähigkeit zu Reflexionsprozessen, die im Gespräch mit der Mutter immer wieder aufblitzt mit seinen kurzen, einfachen Sätzen. Es ist möglich, dass sich in beidem auch die Sozialisation im integrativen Schulkontext widerspiegelt (vgl. Herrn D als Markus in der Nanu-Geschichte »Differenzierte Wahrnehmung sozialer Prozesse - oder: ›Du lügst!‹«, in BOBAN & HINZ 1993, 330f.).
-
Angesichts dieses starken Durchhaltewillens und Standhaltens wird um so mehr der Druck zur Anpassung an betriebliche Strukturen und ggf. an Hierarchien deutlich - vor allem im ersten Betrieb.
-
Wenn der Chef eines Betriebes unterstützte Beschäftigung ermöglicht, bedeutet dies noch nicht, dass dieses Beschäftigungsverhältnis auf der Ebene der KollegInnen erfolgreich verläuft - ohne dass der Grund des Scheiterns bei der unterstützten Person liegen müsste. Entscheidend ist das vorherrschende Menschenbild, das sich im Betriebsklima ausdrückt, und hier insbesondere das Bild von Menschen mit Behinderung und damit verbunden die Fähigkeit, individuelle Fähigkeiten und Begrenztheiten realistisch wahrzunehmen.
-
Im zweiten Betrieb wird am Beispiel der Gitter für Backbleche deutlich, dass die Arbeitsassistenz nicht nur für die unterstützte Person produktive Prozesse in Gang setzt, sondern für den Betrieb insgesamt; dies erfährt dort hohe Wertschätzung.
-
Die Arbeitsassistenz steht, das macht die Situation von Herrn D deutlich, vor der Herausforderung, zumindest zwei Gratwanderungen zu bewerkstelligen: zum einen zwischen dem Herauslocken von Potentialen und der Überforderung der unterstützten Person sowie zum anderen zwischen dem Standhalten angesichts von Schwierigkeiten einer Situation und deren Beenden.
Ansätze zur Interpretation
Herr D hat sein offenkundiges Stigma unter den Bedingungen (vor-)schulischer integrativer Kontexte offenbar einschätzen und Strategien des Umgangs damit gelernt, denn er zeigt eine spezifische Gelassenheit und Souveränität. Unter dem Blickwinkel der Stigma-Theorie kann die Geschichte von Herrn D interpretiert werden als Beispiel dafür, in welchem Maße ein offensichtliches Stigma in verschieden Umfeldern unterschiedlich bedeutsam wird. Der Zuschreibungscharakter wird überdeutlich: Im einen Betrieb wird der Frust aufgrund eines offenbar schlechten Betriebsklimas am ›letzten Kollegen‹ abgelassen. Geradezu klassisch erkennbar ist hier die Aufrechterhaltung negativer Stigmatisierung durch selektive und verzerrte Wahrnehmung, um durch Projektion verdrängte Aggressionen und verschobene Frustrationen auf einen Sündenbock abzuschieben. Neben dieser Entlastungsfunktion der fortgesetzten Diskreditierung könnte hier auch die Strategie der Erhöhung der eigenen Identität und die Wiederherstellung des gefährdeten seelischen Gleichgewichts sich sonst minderwertig fühlender Kollegen durch die betonte Abgrenzung von der zugeschriebenen Andersartigkeit und Unzulänglichkeit eine Rolle spielen. Es ist zudem davon auszugehen, das die Visibilität des Down-Syndroms die Stigmatisierung verstärkt: Auf der Grundlage eines Stigmas tendieren die Stigmatisierer dazu, weitere negative Eigenschaften und Unvollkommenheiten zu unterstellen. Dieser Prozess ist ein überaus kränkender, den Herr D jedoch lange aushält und kompensiert, auf den er aber schließlich psychosomatisch reagiert.
Im anderen Betrieb wird Kollege D zunächst zwar als Diskreditierter gesehen, nach dem Kennenlernen jedoch mit Interesse und Sympathie und einer Portion Überraschung ob seiner gezeigten Fähigkeiten wahrgenommen. Hier besteht das negative Stigma vor allem in der Phase des Einstiegs und hat vorwiegend eine Orientierungsfunktion, die der Vorausstrukturierung sozialer Situationen dient; durch die Zuschreibung soll eigene Unsicherheit verringert und Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten sollen aufrechterhalten werden.
Die AssistentInnen von Herrn D fungieren im ersten Betrieb als Stigma-Manager in dem Sinne, dass sie zum einen am Können und Verhalten (später zunehmend dem Durchhaltevermögen und Stärken von Verarbeitungsstrategien) von Herrn D arbeiten, zum anderen, indem sie - zunehmend verzweifelt - versuchen, an den Zuschreibungen des Umfeldes anzusetzen, um hier positive Veränderungen zu bewirken. Erst als dies aus Gründen, die gar nicht direkt mit Herrn D zu tun haben, immer weniger als möglich erscheint, suchen sie nach einem neuen Betrieb, wo sie es wiederum als eigentliche Aufgabe sehen, die Haltung des Umfelds zu Herrn D konstruktiv zu beeinflussen und zu Entstigmatisierung beizutragen.
Aus Sicht der Theorie integrativer Prozesse gerät das Spannungsfeld im ersten Betrieb immer mehr zu einer Schieflage zum Pol der Gleichheit, wenn auf der interaktionellen Ebene unangemessene Forderungen der Kollegen an Herrn D gestellt werden, er also nur eine Chance auf Akzeptanz hätte, wenn er es ihnen gleichtun könnte. Dieser Versuch der Gleichmacherei kann jedoch unmöglich gelingen, auch wenn die AssistentInnen zunächst überwiegend an Anpassungsmöglichkeiten von Herrn D arbeiten und erst in zweiter Linie auch um Anpassungsleistungen des Betriebes ringen. So kippt das Kollegenverhalten von der nicht gelingenden Vereinnahmung zur Kooperationsverweigerung. Der eigentlich in sich ruhende Herr D, der nach Wahrnehmung seiner Assistentin und seiner Mutter mit sich selbst bricht, um die gewünschte Anpassungsleistung zu erbringen, erfährt nur partielle Gemeinsamkeit mit den Konditoren, aber Aussonderung und Exotisierung im Kreise seiner eigentlichen Kollegen - und den mit ihm identifizierten AssistentInnen geht es genauso. Als diese Verhältnisse sich schließlich als Symptom somatisieren - er erbricht sich in die Backstube -, erreicht Herr D endlich den Punkt, das Verhältnis zu brechen und selbst zu kündigen.
Im neuen Betrieb, in den Herr D seine erworbene Fachkompetenz transferiert, dominiert hingegen Überraschung über seine ihm so nicht zugetrauten Fähigkeiten und deren uneingeschränkte Anerkennung. Er darf aber auch seine Fähigkeits- und Belastungsgrenzen haben: Rückzugsverhalten wird ihm zugestanden und Ungewöhnliches, wie das zu frühe zur Arbeit Kommen, wohlwollend angenommen. Damit ist hier eine tragfähige Balance von Gleichheit und Verschiedenheit, von Annäherung und Abgrenzung gegeben, die die Assistentin zuversichtlich an die sukzessive Verringerung ihrer Präsenz und Assistenz ins Auge fassen lässt.
Herr E, 20 Jahre alt, arbeitet seit 1 1/2 Jahren mit voller Stelle in der Druckerei einer Werkstatt für Behinderte, zu der er aufgrund eines Weges durch die halbe Großstadt mit dem Fahrdienst gebracht wird. Dort ist er mit Sortier- und Faltarbeiten beschäftigt. Herr E kommt aus einer Facharbeiterfamilie, seine Mutter ist seit langem allein erziehend, es gibt aber ein enges, großfamiliäres Netz mit vielen pädagogisch ausgebildeten Personen. Herr E hat eine Geschichte als Integrationsklassenschüler in Grund- und Gesamtschule hinter sich. Danach geht er über in den BBE-i, zu dem er mit dem Fahrrad fährt. Da zu diesem Zeitpunkt das Integrationspraktikum noch nicht existiert, wird Herr E zunächst ein Jahr lang als Mitarbeiter auf einem Werkstatt-Außenarbeitsplatz geführt, bevor er dann offiziell für vier Monate ins Integrationspraktikum kommt. Dies wird jedoch abgebrochen, und es erfolgt der Übergang in die Werkstatt für Behinderte.
In der ersten Befragung äußert sich Herr E über seinen bisherigen Weg sehr positiv, was die Schulzeit, den BBE-i und das Integrationspraktikum angeht. Während Herr E angibt, dass sein ursprünglicher Berufswunsch Tischler ist, sieht er die Berufsberatung als sehr positiv, die ihm Perspektiven wie die Arbeit in einer »Kantine oder in anderen Bereichen« aufzeigt. Lediglich bei seiner Beschäftigungssituation gibt es nur eine mittlere Zufriedenheit; obwohl er die Tätigkeit »Papier falten« selbst mag, wünscht er sich doch eine »neue Arbeit«, zumal er in der Werkstatt für Behinderte, wie er betont, keine neuen Freunde gefunden hat.
Im Rahmen der zweiten Befragung findet ein gemeinsames Interview mit Herrn E und seiner Mutter in deren Wohnung statt. Seine damalige Arbeitsassistentin, ursprünglich Lehrerin, die Deutsch als Zweitsprache spricht, wird in den Räumen der Arbeitsassistenz und sein derzeitiger Gruppenleiter in der Druckerei der Werkstatt für Behinderte befragt.
Seine Stärken und Schwächen benennt Herr E nicht direkt, er legt aber großen Wert darauf zu zeigen, was er am Computer tut. Als seine Mutter - ebenso wie dies auch die Assistentin sieht - erklärt, er schreibe nur ab, weil er nicht lesen könne, betont er: »So manches kann ich schon.« Ansonsten gehen Aussagen von anderen Beteiligten über Stärken und Schwächen von Herrn E auseinander: Seine Mutter meint, er »kann ... ganz schlecht so Kontakt knüpfen.« Der Gruppenleiter führt aus, »er sucht den Kontakt, manchmal schon so, dass es schon die anderen stört und nervt. ... Er hat ab und zu so eine plumpe Art auf jemanden zuzugehen und das stößt so einige - nicht ab, aber die mögen das dann halt nicht so. ... Er geht auf die anderen zu, aber irgendwie ... nicht so ... zurückhaltend: ›Hallo‹ und so, sondern: ›Wuff - da bin ich!‹ Das bezeichne ich jetzt so als plump.« Dagegen sieht die Assistentin bei Herrn E ein hohes kommunikatives Potential: Er »ist super sympathisch, also wirklich Sympathieträger ohne Ende. ... Wenn man mit ihm privat was unternimmt, was wir auch ganz oft gemacht haben, dann öffnet er sich und erzählt und sagt Sachen, wo man das überhaupt von den Leuten nicht erwartet.« So macht Herr E Begeisterung und Sympathie deutlich: »Das ist unglaublich, sowas zu erleben, wie man das auch wirklich zeigt und sagt - ganz offen und unproblematisch, und das war schön. Und das war das Positive bei ihm.« Dabei »braucht (er) Zeit, um Kontakte« zu knüpfen. »Er kann Freunde haben und er macht das auch gerne, ... und es ist unglaublich, was du alles mit ihm erleben kannst, wenn du nicht da am Arbeitsort bist. ... Er kann auch anders reden dann.«
Die Assistentin vermutet weiter, dass »wenn (Herr E) Sachen gemacht hätte, die ihm Spaß gemacht haben, dann konnte er auch, glaube ich, kontinuierlich arbeiten. Er hat großes Interesse gehabt, am Computer zu arbeiten. Und da konnte er stundenlang dasitzen. ... Er gehört zu den Leuten, die nicht lesen und schreiben können, aber er schreibt gerne nach, also Buchstaben abschreiben, das hat ihm super viel Spaß gemacht. ... Also da kriegst du mit ihm wirklich sofort einen Kontakt und kannst was machen.« Auch in einem Kindergarten, in dem sich auch zwei Kinder mit Down-Syndrom befinden, hat Herr E »sofort natürlich Kontakt aufgenommen, ... und die haben ihn auch verstanden, weil das war noch ein Problem, (ihn) zu verstehen, was er gerade sagte. Man musste sich da schon ziemlich viel Mühe geben.« Jedoch »alleine Entscheidungen zu treffen, war für ihn schwierig.« Generell will die Assistentin aber »das nicht so sagen, dass er schwach oder schwierig ist.« Sie benennt als für sie zentralen Punkt bei Herrn E, zumal an einem für ihre Begriffe falsch gewählten Arbeitsort: »Er ist überhaupt nicht motiviert zu arbeiten, und das ist das Problem. Ich kann jetzt nicht sagen, was wäre, wenn er wirklich motiviert ist. ... Das war das einzige Problem.« So ist Herr E von allein nie »auf die Idee gekommen, jetzt was Neues anzufangen. Also da muss immer jemand kommen.« Überhaupt ist Herr E »sehr behütet von Anfang an. ... Die (Herr E und seine Mutter) haben alles zusammen unternommen. ... Zum Schwimmen ist sie mit ihm und da und hier und so.«
Der Gruppenleiter in der Werkstatt für Behinderte sieht ebenfalls eine starke häusliche Behütung: »Ich hab' das Gefühl, als wenn sie ihm sehr sehr viel abnimmt. Dass er zuhause also kaum was machen braucht. ... Er muss selbständiger werden.« Überhaupt hat Herr E für den Gruppenleiter »weder Stärken noch Schwächen. Wie gesagt, seine Schwäche ist seine Verspieltheit - und Stärken? Er ist relativ langsam in seiner Arbeit, obwohl er dabei dann auch sehr genau ist.« Der Gruppenleiter sieht das gleiche zentrale Problem bei Herrn E wie die Assistentin, nämlich »dass er gar nicht so richtig realisiert, dass er hier auf der Arbeit ist. Für ihn ist das ... ein Spiel. Das ist nicht ... Arbeit und damit verdiene ich Geld. ... Wir haben auch schon manches Mal gedacht, dass er in der Werkstatt so in der Art, wie er sich dann gibt, gar nicht so richtig aufgehoben ist - in der Tafö (Tagesförderstätte, d. Verf.) vielleicht etwas besser. ... Weil hier ist Arbeit gefordert. Und hier muss er auch ab und zu mal unter Druck gesetzt werden, wenn irgend etwas Eiliges da ist, und da ist er sehr mit überfordert.« Im großen und ganzen resümiert der Gruppenleiter zur Arbeitsleistung: Herr E »muss sich da sehr sehr drauf konzentrieren. Und Konzentration ist nicht irgendwas, was er gerne mag. Er macht auch seine Arbeit, so ist das ja nicht. Nur er liegt also... irgendwo unter dem Durchschnitt. ... Er sitzt immer so am untersten Minimum, was die Arbeit angeht.« Auch die Mutter zweifelt daran, ob ihr Sohn eine Idee von Arbeit hat: »Arbeitsbegriff - ich weiß nicht, ob er da überhaupt Vorstellungen davon hat, was das alles so bedeutet.« Sie resümiert: »Das ist ja das Problem. ... Man kriegt nie klar raus, was er im Leben möchte überhaupt.«
Entwicklungen thematisiert Herr E selbst nicht, lediglich sein Satz »so manches kann ich schon« mag ein Hinweis auf seine Sicht seiner Entwicklung sein. Obwohl seine Mutter nie Zweifel über die Richtigkeit des integrativen Weges für ihren Sohn gehabt hat, zieht sie rückblickend ein sehr kritisches Resümee über die Professionellen: »Seine ganze Integration hab ich keinen Menschen gefunden, der ihn 'n bisschen mal so als Betreuer ... richtig gefördert hat, da war nie einer, ... auch während der Schulzeit. Er hatte nie eine richtige Betreuung, von Anfang an nicht. ... Ich bin keine Pädagogin, ich konnte ihm auch nicht dies beibringen: Lesen, Schreiben. ... Auch in der Gesamtschule, da lief das mit dem Personal - die wechselten sehr häufig, ne, und der letzte (Sonderpädagoge) hat gesagt: ›Da ist der Zug abgefahren. Die lernen nix mehr.‹ ... Ja, mit Lesen, Schreiben.« Auch insgesamt findet sie, »die Schulzeit war weniger schön, da hatte er kaum Freunde. Da ist auch nie irgend jemand mitgekommen.« Dies ist im BBE-i anders: »Er hat noch zwei Freunde aus 'm Förderlehrgang, nichtbehinderte, die kommen ab und zu mal und besuchen ihn. ... Da hat er auch mehr Kontakt gehabt.« Den BBE-i erinnert sie als »Traumzeit für ihn, also da schwärmt er immer noch von.« Bei der Arbeit im Bistro, einem Projekt mit Ernstcharakter, »da ist er richtig aufgelebt.«
Eigentlich, meint seine Mutter, wollte Herr E »immer ins Büro, er wollte Akten sortieren oder Akten tragen und mit Papier wollte er was arbeiten. ... Aber da das sehr schwer ist, einen Praktikumsplatz zu bekommen, waren sie alle froh, wenn sie irgendwas gefunden haben.« Im Kindergarten zu arbeiten, »von ihm persönlich war das nicht sein Traum.« Die Mutter von Herrn E sieht dort Schwierigkeiten, die mit dem Auftauchen der Arbeitsassistenz rapide zunehmen: Ihr wird vermittelt, dass ihr Sohn »jetzt schneller arbeiten müsste, und es ist zu langsam. ... Man könnte ihn nirgendswo anders reinsetzen in eine Arbeitsstelle, nicht vermitteln, weil er das Pensum nicht schafft.« Dieser zunehmende Stress führt zu Konflikten: »Dann waren sie früher fertig mit der Küche oder was und dann sollte er die Schränke noch mal putzen und das hat er dann verweigert, und dann kriegte er 'ne Abmahnung ... von der Arbeitsassistenz, sowas kannte ich gar nicht. ... Nur so 'ne Dinger liefen da und, na, zumindestens ich hab' sehr darunter gelitten, weil er mit Angst da hingegangen ist. ... Und welcher Mensch mag mit Angst zur Arbeit gehen?« Dies berichtet Herr E auch seinen Verwandten, die in diesem Kindergarten arbeiten. Nachdem die Mutter eine Zeit lang nichts mehr hört, gibt es »ein großes Treffen im Büro der Arbeitsassistenz und dann hieß es also: Das geht nicht mehr da im Kindergarten, er müsste in die Werkstatt. Und in der Werkstatt sollte er sein Training machen.« Als diese Erprobung nach einem Monat endet, gibt es keinen freien Werkstattplatz für Herrn E. »Und da hab ich gesagt: ›Wie kann man ihn da aus dem Kindergarten nehmen und es gibt überhaupt keine Werkstatt für ihn?‹ Und weißt', wo er hin sollte? Er sollte in so 'n Tagesheim rein zur Aufbewahrung. ... Ja, so 'ne Dinger haben die mit uns gemacht. ... Und da hab ich gesagt, mein Sohn kommt da nicht rein in die Tagesstätte. Und dann habe - die mochten ihn ja sehr gerne im Kindergarten, er war ja beliebt und alles - und da habe ich da nachgefragt, ob er nicht da wieder arbeiten könnte ohne Arbeitsassistenz.« So arbeitet Herr E dort mehrere Monate unversichert, bevor sich die Möglichkeit eröffnet, in einer weiter entfernten Werkstatt für Behinderte einen Platz zu bekommen. »Zum Anfang war ihm das ein bisschen unangenehm, die Masse da, ... weil da so viele auf einen Haufen sind. Da hatte er so ein bisschen Schwierigkeiten.« Nach einem Jahr hat die Mutter das Gefühl, »dass es ihm da gut geht. ... Er kommt immer ganz fröhlich nach Hause: ›War toll‹, ›war gut.‹« Insofern möchte seine Mutter »nun mal gar nix« ändern: »Was soll ich mich da immer wieder neu, wenn es da nicht klappt, dann muss ich wieder suchen und - er ist jetzt da fest. Jetzt haben wir den Sprung leider machen müssen, was ja nie uns im Traum einfiel, dass er da in 'ne Werkstatt kommt. Da war ich ja vom ersten Moment an, wie er geboren wurde, hab ich gedacht: ›Da kommt er nie rein!‹ ... Nee, ich hab mich abgefunden.« Dabei sieht sie die Werkstatt für Behinderte jetzt nicht anders als vorher: »Nein, das kannst du (dort) nicht, ein anderes Licht sehen.«
Die Assistentin versucht, die Etappen der Entwicklung von Herrn E zu rekonstruieren, was sie selbst als schwierig ansieht. »Wir kennen auch die Vorgeschichte nicht. Wir haben das bis zum Schluss nicht rausgefunden, wie das, warum das passiert ist.« Eigentlich steht Herr E im dritten Jahr des BBE-i kurz vor einem Arbeitsvertrag. Nach ihrem Wissen sorgen jedoch PädagogInnen aus dem familiären Umfeld dafür, dass er stattdessen in einen Kindergarten wechselt, an dem diese selbst beteiligt sind. Für die Assistentin ist »er da unterfordert, als wir gekommen sind, haben wir sofort festgestellt. ... Er hat dort von acht bis halb vier gearbeitet. Das ist unglaublich viel Zeit, wo da nur 20, 30 Becher abzuwaschen waren, und das wirklich eigentlich für mich ... Arbeit für eineinhalb Stunden« war. Ein Verwandter, der dort arbeitet, »hat alles gemacht ... und (Herr E) hat sich da um Kleinigkeiten gekümmert.« Herr E hat also »dort ein Jahr Praktikum gemacht und er hat sich geekelt, aber ohne Ende, zum Beispiel vor schmutzigem Wasser, diesem Abwaschwasser. Da wollte er gar nicht rein. ... Das sind die einfachen Sachen, die er dort ein Jahr gemacht hat - ich weiß nicht wie.« Im Kindergarten hat man Herrn E in den Augen der Assistentin »auch nicht als jungen Erwachsenen gesehen, ..., sondern mehr so wie alle Kinder da. Dass man Raum hat für Entwicklungen, die man alleine macht. Erfahrungen alleine zu machen - ich fand die Idee super, aber da braucht man wirklich viel Zeit. Und wie gesagt: (Er) ist nicht sieben und nicht fünf, sondern er war 20 ... damals und da muss man etwas anders mit solchen Menschen umgehen und nicht alles aus den Händen wegnehmen und sagen: ›Du kannst jetzt nachdenken, wie lange du willst, ob du die Arbeit machst oder nicht.‹ Das ist unrealistisch.«
Für die Assistentin ist es sehr schwierig, einen motivationalen Ansatzpunkt auszumachen, den sie sonst in der Regel schnell findet: »Bei (ihm) nach einem Monat unserer Arbeitsbegleitung kam gar nichts. Nicht ein einziges positives Wort.« Am Anfang, so schätzt sie, hat Herrn E die Zusammenarbeit mit seinem Verwandten interessiert, er hat »das einfach gemacht, um (ihn) zu entlasten.« Vermutlich hat er dieses direkte gemeinsame Arbeiten von der betreuenden Kollegin aus der Werkstatt für Behinderte übernommen, die Herrn E in diesem Praktikum auf deren Außenarbeitsplatz unterstützt hat: Sie »hat die Schränke aufgeräumt und hat alle Sachen mit ihm zusammen gemacht. Das hat auch Sinn am Anfang, aber nicht ein Jahr lang.« Nachdem die Assistentin jedoch darauf dringt, dass Herr E seinen eigenverantwortlichen Bereich bekommt, »waren wir natürlich die Schlechtesten.« Nun gibt es Spannungen mit dem Kindergarten, »wo die Leute uns überhaupt nicht verstanden haben am Anfang, warum wir (ihn) so quälen, und die haben gedacht, wir machen dem jetzt was Böses und - wie kann man überhaupt so vorgehen, dass man von (ihm) erwartet, dass er fegt und solche Sachen macht?« Die Assistentin beobachtet einerseits: »Er hat Pausen mit den Kindern gemacht, da war er auch sehr lieb zu denen.« Andererseits ist die Arbeit in der Gruppe keine Alternative: »Bloß das nicht! Er saß dort so (hält sich die Ohren zu), es war ihm zu laut.« Also beginnt die Arbeitsassistenz mit dem Aufbau von Arbeitsplänen im Küchenbereich und mit dem Qualifizieren: »Er hat sich super entwickelt, also echt, aber das war alles unter Druck. ... Oder dass wir auch mit Spaß Sachen gemacht haben, zum Beispiel Fegen mit Tanzen und sowas. Anders kannst du ihm das nicht vermitteln. Das war super.« Zwar sind dies »Methoden, die ich eigentlich normalerweise nicht verwende, weil ... entweder er ist mindestens 16 und nicht vier, dass ich mit ihm so einen Tanz machen muss. Aber wenn das hilft, dann mache ich das auch gerne, wenn er sich danach wie ein 19jähriger benimmt.« Immer deutlicher stellt sich jedoch heraus: »Das war für (ihn) nicht der Arbeitsplatz, was er gerne machen wollte.« Der zuständige Ansprechpartner im Kindergarten betont schließlich, dass man ihm keinen Arbeitsvertrag geben würde, »so lange er nicht woanders Erfahrungen sammeln kann für sich alleine. Und die haben, die haben vorgeschlagen, ein Praktikum zu machen in Werkstatt.« Da Herr E anscheinend keinen Begriff von Arbeit hat und eher die Rolle eines Praktikanten im Kindergarten einnimmt, der mal mehr und mal weniger mithilft, wird darauf gesetzt, dass er im Rahmen der Werkstatt für Behinderte lernt, was es bedeutet zu arbeiten, und auch unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenlernt, um so besser seine Interessen entwickeln zu können. Dies wird von der Assistentin unterstützt, die so zum einen die restliche Förderungsdauer des einen Integrationspraktikumsjahres bewahren will, um ihn später gezielt qualifizieren zu können. Sonst »machen wir ein Jahr Erfahrungen mit (ihm) und was danach? Dann hat er keine Chance mehr.« Zum anderen sieht sie ebenso wie der Kindergarten die Chance, dass Herr E durch die unterschiedlichen Situationen deren verschiedene Vor- und Nachteile abschätzen lernt: »Wir haben gedacht, wenn er jetzt Praktikum macht, dann wird er feststellen, wie gut es hier ist, und dann fängt er an mit neuer Motivation.« Herr E, seine Mutter, die Kindergartenleitung und die Assistentin sehen sich also gemeinsam die Werkstatt für Behinderte an mit der Perspektive dieser zeitlich begrenzten Erfahrung, und Herr E zeigt sich ihrem Eindruck nach »begeistert und hat gesagt: ›Ich möchte das versuchen.‹« Er beginnt dort in der »Verpackungsabteilung und war eigentlich sehr zufrieden. ... Die Arbeiten hat er da sehr schön alle gemacht.« Nur »jetzt mit Behinderten was zu tun zu haben, das konnte man sehen, dass er da ... auf Distanz war - ich weiß nicht, war so.« Es entsteht der Eindruck, dass Herr E denkt: »Gut, ich bin hier, ich mache das gerne. Das ist auch das, was ich möchte.« Jedoch steht er in der Werkstatt für Behinderte, zu der er zu Fuß geht, auf Warteplatz 13, so dass er für zwei Monate nochmals, nun unbegleitet, in den Kindergarten zurückkehrt in »ein privates Praktikum«, bis das Transportproblem zu der weit entfernten Werkstatt für Behinderte gelöst ist, die einen freien Platz hat. Herr E zeigt nun klare Wünsche, was er arbeiten möchte: »entweder gerne diese Lichtpausen ... oder Druckerei, wo man auch mit Buchstaben und solchen Sachen zu tun hat. Da war er fixiert.« Mit der Arbeit in der Druckerei - dort hat er »viele Kästchen gehabt und musste da so Formulare ordnen« - ist er »ganz happy da, aber die haben gesagt, dass er der Schwächste dort ist in dieser ganzen Gruppe, und dass die jetzt für ihn eine persönliche Begleitung organisieren wollen. ... Die haben da solche Möglichkeiten.« Für die Assistentin ist sehr wichtig: »Wir haben gesagt, Werkstatt ist wirklich nur Übergangsphase. Das war von uns ganz deutlich gesagt, um ihm die Chance zu geben, sich zu entwickeln.« Dass Herr E mit neuer Motivation auf den ersten Arbeitsmarkt zurück will und sich bei der Arbeitsassistenz meldet, »das war aber überhaupt nicht der Fall. ... Aber ich finde das auch gut so, weil sonst hätte er keine andere Möglichkeit und auch keine andere Chance, sich dagegen zu wehren, etwas zu machen, was er überhaupt nicht wollte.« Seitdem besteht zwischen der Assistentin und Herrn E kein Kontakt mehr.
Der Gruppenleiter sieht bei Herrn E in der Zeit innerhalb der Werkstatt für Behinderte »im Prinzip gar keine« Entwicklung: »Es hört sich komisch an, aber er hat praktisch noch fast den selben Stand, als er hier angefangen ist. ... Man kann ihm wirklich etwas hinlegen und sagen: ›In der Reihenfolge musst du es machen.‹ Und er fängt an irgendwann, wenn er sich unbeobachtet fühlt, das wieder irgendwie anders zu machen, bis man ihn dann erwischt, dass er das anders macht wie man ihm das gesagt hat. Also er ist sehr verspielt und in der Beziehung hat er also kaum irgendeinen nachweisbaren Erfolg oder so.«
Zur eigenen Zufriedenheit meint Herr E, er sei froh über »mich selber«. Dies leitet er vor allem aus dem Schreiben am Computer in der Freizeit her, wo er besonders gern Texte aus einer Zeitschrift über den Wrestler Sting abschreibt, dessen Fan er ist. Unzufriedenheit äußert er mit der Kindergartensituation, denn es »war zu laut da.« Er erinnert auch, zwei Abmahnungen bekommen zu haben, was ihn anscheinend belastet. Auf die Frage, wie es ihm bei seiner Arbeit in der Werkstatt für Behinderte gefällt, sagt Herr E: »Ich weiß nicht.« Einerseits gefallen ihm »die Leute da«, andererseits beklagt er: »Die tun immer verarschen und so.« An der Stelle, an der seine Mutter darstellt, dass sie sich mit der Arbeit in der Werkstatt für Behinderte abgefunden hat, ergreift Herr E das Wort: »Ich hatte 'n Horror gehabt. ... Wie mich jemand reingeschoben hat, ... die Behörde, ... hab' ich richtig Horror gehabt.« Gefragt, ob der Horror vorbei sei, führt er aus: »Nee, äh, da hab' ich immer die gleiche Arbeit und so. Genau dasselbe.« Als das Gespräch auf Möglichkeiten eines Cafés kommt und seine Mutter meint, das sei »nicht sein Ding«, meldet sich Herr E wiederum zu Wort: »Doch! Servieren schon! ... Bedienen alles!« Zudem macht Herrn E unzufrieden, dass er aufgrund der langen Arbeits- und Fahrdienstzeiten keinen Sport mehr machen kann: »Hab' ich damals Sport gemacht.« Auch wenn er sich »meine, zwei Freund« wünscht, bewertet er seine Situation insgesamt aber doch als »gut«.
Die Mutter sieht die Situation von Herrn E im integrativen Kindergarten, den sie als »offen und locker« beschreibt, ambivalent: »So wie er jetzt erwachsen wird, sollte er auch selbst bestimmen, was er macht und wie er zurechtkommt, und das war einerseits ganz gut, auf der anderen Seite braucht er auch 'ne feste Betreuung. ... So was hätte er ja haben müssen, nicht, also dass er richtig den Weg lernt, ne. Und das war alles so 'n bisschen - weil er ja nie richtig so die Hand hatte, wo er geführt wird.« Andererseits sieht sie die Arbeitsassistenz als angstmachend: »Und da ist er bis zuletzt mit Angst da hingegangen ... wegen der Betreuung.« Die Arbeitsassistenz habe »darauf bestanden, dass er nur einen Bereich, ... nur in der Küche« tätig ist, »daher wurde das so bestimmt.« Nachdem Herrn E nichts anderes als die Werkstatt für Behinderte »übrigbleibt«, meint seine Mutter: »Er wurde überall nur reingeschubst.« Sie findet, dass Herr E in der Werkstatt für Behinderte auch »an den Maschinen« arbeiten können sollte: »Er möchte auch mal wohl was anderes machen und nicht nur sortieren.«
Die Assistentin sieht - wie alle anderen Beteiligten auch - die große Schwierigkeit, herauszufinden, was Herr E mag, was er möchte und was ihn also zufrieden macht. Bei Menschen mit Down-Syndrom sieht sie eine generelle Tendenz: »Die passen sich an dort, wo sie gerade sind. Sie reden wie die Leute reden. ... Die machen Sachen, wie die Leute es machen.« Im Kindergarten ist er »so verkrampft ... Er konnte sich da nicht äußern, ob er das gerne macht oder nicht. Er konnte das erst machen, als wir da draußen waren. ... Also haben wir so Wege gemacht. ... Und dann hat er sich geäußert, dass er das (diese Arbeit, d. Verf.) nicht will.« Zudem braucht Herr E nach Meinung der Assistentin »Leute, die ihn wirklich als 20jährigen sehen, die ihn so akzeptieren, wie er ist, - er kann sich bestimmt entwickeln - , die auch sein Potential sehen.«
Für den Gruppenleiter in der Werkstatt für Behinderte spielt die Frage, was Herrn E zufrieden oder unzufrieden macht, eine geringere Rolle als die Frage, wie weit er belastbar und in den Produktionsprozess einzubinden ist: »Er spielt teilweise mit den Materialien und kriegt das dann irgendwo durcheinander und steht dann mit einem Mal vor einem Scherbenhaufen. Und wenn er dann vier Blätter zusammentragen soll, dann ist das natürlich fatal, also vier Blätter kriegt er dann meistens schon gar nicht mehr, weil er dann damit überfordert ist.« Auch der Gruppenleiter weiß, dass Herr E zuhause »ganz oft am Computer sitzt.« Ihn aber an Maschinen heranzulassen, sieht er als Problem: »Also wir haben viele Maschinen, nur ... wenn der die Druckmaschine meint, da können wir ihn einfach nicht ranlassen, das geht nicht. ... So lange er noch so unselbständig ist, ... so lange können wir ihn auch nicht an irgendwelche Maschinen setzen.«
Herr E äußert sich über die Rolle der Arbeitsassistenz nur wenig, vor allem sieht er sie als Instruktoren: »Musst' ich immer abwaschen. ... Und schön saubermachen.« Deutlich unterscheidet er zwischen den beiden Assistentinnen, wobei Herr E und seine Mutter unterschiedliche Erinnerungen formulieren, welche von beiden ihn »angeschrien« habe.
Seine Mutter empfindet das Auftauchen der Arbeitsassistenz im Kindergarten also als störend, ihr Sohn bekommt Angst, dorthin zur Arbeit zu gehen. Dabei sieht sie bei einer der beiden Assistentinnen mangelnde Professionalität, wenn die »gerade erst vom Lehrgang runterkommt, ... das war für mich schon ein Alarmzeichen, dass sie erst da aus der Lehre kommt, ... aber mit Behinderten hatte sie früher wohl nicht, ... und das merkte man auch, dass sie mit Behinderten, also zumindest mit Down-Syndrom, die etwas träger sind, langsamer,« keinerlei Erfahrungen hat. Aus den Schilderungen der Entwicklung bleibt der Eindruck, dass in ihrer Wahrnehmung die Arbeitsassistenz den Integrationsprozess ihres Sohnes im Kindergarten eher gestört, zusätzlichen Druck in die Situation gebracht und letztlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ihr Sohn in die Werkstatt für Behinderte gekommen ist - entgegen ihrer eigenen integrativen Grundüberzeugung.
Die Assistentin wiederum sieht ihre Rolle geradezu entgegengesetzt: In einem Umfeld, das Herrn E nicht altersgemäß anspricht, sorgt sie dafür, dass sinnvolle Strukturen für den Aufbau von Arbeitsabläufen geschaffen werden. Da dort zudem u.a. aufgrund finanzieller Probleme ohnehin keine Chance besteht, einen Arbeitsvertrag zu erhalten, provoziert sie eine Entscheidung, wie es weitergehen soll, denn »wir sind nicht da, um die Sachen zu entwickeln, sondern um einen Arbeitsplatz zu schaffen. ... Ich möchte da besser etwas früher eine kleine Enttäuschung bei jemandem machen als danach eine große. ... Und das Jahr wäre auch weg.« Ihre Aufgabe bei Herrn E ist, ihm »zu zeigen: ›Das ist Dein Arbeitsplatz, und so und so viel hast Du hier zu tun.‹ Und die Liste, was er da in einem Jahr gemacht hat, das waren fünf Punkte. Und das, was wir mit ihm zusammen in zwei Monaten geschafft haben, das war eine ganze Seite mit festen Strukturen, und er hat mitgemacht. Er hat das mit uns zusammen da festgestellt, das und dies muss gemacht werden. Egal ob er es danach gemacht hat. Aber das ... wusste er, dass das eigentlich dazu gehört. Und das war für ihn, glaube ich, schon ein Schreck. Und hat sich doch entschieden, das nicht zu machen - was ich überhaupt nicht negativ sehe. Ich finde, er hat dadurch auch positive Erfahrungen gemacht.« Gleichwohl sieht die Assistentin, dass sie die Hoffnungen der Mutter massiv enttäuscht hat, »weil sie hat sich gedacht, (er) ist durch das ganzes Leben als Integrationskind ... so geführt worden, Kindergarten, Schule, das und dies, und wir sind diejenigen, die ihm jetzt ins Werkstatt gesteckt haben - und das hat mit Integration nichts zu tun.« Trotz aller Bemühungen sind die Positionen und Einschätzungen unüberbrückbar geblieben: »Wir haben hunderte Gespräche mit allen geführt. Mit der Familie und mit Kindergarten und alle zusammen und hier im Büro und immer wieder und ... das hat kein Ende gehabt, um überhaupt etwas festzustellen, wo liegt jetzt das Problem und warum wir das nicht so sehen wie die anderen. Also unsere Art und Weise zu arbeiten, hat sich wirklich mit den ganzen Vorgeschichten überhaupt nicht« verbinden lassen. Dennoch resümiert sie: Herr E »ist keine Enttäuschung. ... Ich war eigentlich froh, dass wir (ihm) da wirklich die Augen geöffnet haben, und dass er uns noch ... freundschaftlich akzeptiert hat und in Freundschaft bleibt bis jetzt. Das ist auch was ganz ganz Wichtiges. Und ich denke, wir waren wirklich die ersten ..., die ihn als erwachsenen Mensch da gesehen haben, ... kein Kind.«
Auf seine Rolle in den verschiedenen Betrieben lässt sich bei Herrn E nur aufgrund seiner bereits beschriebenen Äußerungen indirekt schließen, etwa dass er mit seinen Ängsten im Kindergarten zu seinem verwandten Mitarbeiter geht oder dass er sich in der Werkstatt für Behinderte nicht wirklich wohlfühlt. Auch seine Mutter macht zu diesem Punkt keine konkreteren Aussagen. Für die Assistentin ist das Konzept des Kindergartens ein gutes, jedoch trägt dieses Konzept nicht für Herrn E, der von der Rolle her eben kein Kindergartenkind mehr, sondern Kindergartenküchenhelfer sein sollte. Insbesondere die Entlastung durch den verwandten Mitarbeiter und die Mitarbeiterin der Werkstatt für Behinderte im einen Jahr der Außenarbeitsplatz-Konstruktion trägt nicht zum Ernst-Charakter der Arbeitssituation bei, sondern scheint eher ein Verhalten nach dem Lustprinzip zu bestärken.
Der Gruppenleiter hebt zum einen die Überforderung von Herrn E hervor: »Wenn irgendwo ein eiliger Auftrag ist, dann können wir (ihn) nicht drinne einbetten. ... Also wir müssen immer etwas haben, wo Zeit ist für (ihn).« Dabei sieht er auch die Werkstatt für Behinderte überfordert, Herrn E einen Begriff von Arbeit zu vermitteln: »Das können wir auch gar nicht leisten, weil wir eben auch mit der Arbeit drinne stecken. Also wir können uns nicht mit ihm beschäftigen, um ihm klarzumachen, dass das Arbeit ist und nicht eben wie Spielkram oder Kindergarten oder sonst irgendwas.« Herr E trägt zur Störung geregelter Abläufe bei, denn »er verzettelt sich manchmal und dann kommt er vollkommen durcheinander, und dann müssen wir erst wieder anfangen, alles wieder neu zu sortieren. ... Dann heißt das: Alles auseinanderpuhlen und noch mal machen. Und das geht natürlich nicht, weil der Kunde sitzt auf der Treppe und wartet, weil er das noch nicht kriegt, so ungefähr. Und das ist aber (Herr E)!« Zum anderen hat Herr E sozial eine eigentümliche Rolle: Seine Art der Kontaktaufnahme »mögen die anderen nicht so.« Wenn Herr E mit anderen Kontakt aufnehmen möchte, wie er es aus integrativen Situationen gewöhnt ist, mag es nach Auffassung des Gruppenleiters sein, dass Nichtbehinderte damit angemessen umgehen können, »aber das können unsere Leute teilweise nicht. Die haben selbst Schwierigkeiten, irgendwo auf andere zuzugehen.« Problematisch wird es etwa dann, wenn saubergemacht wird: »Hier auf dem Fußboden laufen immer so graue Dehnungsfugen längs. ... Und das ist so eingeteilt, dass hinten an der äußersten Wand ein Mitarbeiter sein Revier hat. Das verteidigt er auch wirklich. Also, wenn da jemand anders reingeht und mit ausfegt, dann wird er schon etwas laut. Das ist sein Revier, das macht er sauber. Das haben wir mal so eintgeteilt und da darf keiner dabei. Und (Herr E) kam dann dazu und fegt da mit aus, und ja, seitdem hat er bei dem Herrn schlechte Karten. Und wenn er dann eben halt so hingeht und sagt: ›Da bin ich‹, dann stößt er sofort auf Ablehnung.«
Was Zukunftsperspektiven angeht, meint der Gruppenleiter, Herr E müsse am besten »von Zuhause 'ne Anleitung kriegen, dass er eben halt (weiß), das geht nicht zur Spielgruppe oder sonstwas, es geht zur Arbeit.« Eine Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt wäre nicht vollkommen ausgeschlossen, wenn »es eine Firma gibt, die sowas macht, dann wäre das vielleicht was für ihn. Also unsere Einschätzung ist, dass wenn er noch so eine Tagesförderung, wo ja auch teilweise auch ein bisschen mit Arbeit gehandhabt wird oder eben auch etwas gemacht wird, nur wo er dann nicht so unter Druck steht wie hier, ich sag mal, der Zeitraum fünf Jahre oder drei Jahre in so einer Tagesförderung ist, wo man ihm auch langsam beibringen kann, was Arbeit bedeutet, ... dass Arbeit eben halt auch Verantwortung bedeutet für seinen Arbeitsplatz, für seine Arbeit, die man macht. ... Das können wir hier nicht leisten, weil wir stehen im Produktionsprozess hier.« Andererseits betont er, »wir haben ihn jetzt bei uns in der Gruppe, und so lange er nicht den Wunsch äußert, hier rauszuwollen, bleibt er auch hier. Nicht dass wir ihn nicht haben wollen oder so. Nur wir können ihn halt nicht mit allen Arbeiten beschäftigen.« Auch die Assistentin ist »nicht so optimistisch. ... Wir haben gesagt, wir müssen zusammenarbeiten, aber das ist immer so: Wir sind immer diejenigen, die sich melden müssen. Es kommt nichts zurück. Das war auch genau bei diesem Prozess, also die Mutter hat sich nicht einmal gemeldet.« Trotzdem äußert die Assistentin die Hoffnung, »dass er da nicht bleibt, also wirklich.« Sie plant, sich dort zu melden, um über nächste Schritte zu beraten. »Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er da weiter machen soll. Ich habe keine Ahnung.« Die Mutter hat ihren Kampf um eine integrative Arbeitssituation nunmehr aufgegeben: »Er ist jetzt da fest.« Sie wünscht sich für Herrn E, dass er »eine Freundin mal findet, dass er sein Glück und seine Freude hat, das ist das Wichtigste.« Obwohl seine Mutter reserviert reagiert und viele Bedenken äußert, stimmt Herr E einer Reihe von konkreten Vorschlägen und Ideen spontan, teilweise lachend, zu, etwa der Idee, ob nicht in einer benachbarten Behörde ein Teilzeitjob als Bürogehilfe denkbar wäre. Als explizite Zukunftswünsche äußert er, er möchte »eine eigene Frau. ... Aber Wohngruppe nicht so, nee, das möchte ich nicht.«
Wichtige Aspekte bei Herrn E
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Herrn E lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Das zentrale Problem der Situation von Herrn E ist, dass er - wie sein Umfeld übereinstimmend meint - keine Vorstellung davon hat, was Arbeit bedeutet, und was eine für ihn angemessene und interessante Arbeit wäre.
-
Die bisherigen Erfahrungsmöglichkeiten für ihn haben anscheinend zu keiner hinreichenden Klarheit geführt; warum dies so ist, lässt sich jedoch nicht sicher sagen, da teilweise nicht mehr sicher rekonstruiert werden kann, was in den einzelnen Phasen der Berufsorientierung und -vorbereitung abgelaufen ist.
-
Der Weg von Herrn E wird zusätzlich dadurch erschwert, dass diverse institutionelle Übergänge in kurzer Zeit zu bewältigen sind: vom einen zum anderen Kindergarten, vom BBE-i zum Außenarbeitsplatz, vom Außenarbeitsplatz zum Integrationspraktikum, vom Integrationspraktikum zur einen Werkstatt, dann zur anderen Werkstatt. Dies bedeutet nicht nur für Herrn E eine Vielzahl von unterschiedlichen Institutionen und Situationen, sondern erschwert auch jede Form von kontinuierlicher Arbeit in eine Richtung. So wird in der unklaren Situation von Herrn E strukturell nicht zu mehr Klarheit beigetragen. Erschwert wird die Situation auch dadurch, dass das Integrationspraktikum im August 1998 erst weit nach Beginn des Jahres mit der Konstruktion eines Außenarbeitsplatzes der Werkstatt für Behinderte eingerichtet wird.
-
Die Einschätzungen von Verläufen und Erfahrungen differieren zwischen den Beteiligten zum Teil beträchtlich. Insbesondere zwischen der Mutter und der Assistentin, aber auch zwischen der Mutter und dem Sohn sowie zwischen der Assistentin und dem Gruppenleiter werden Widersprüche deutlich.
-
Die Strategie der Arbeitsassistenz, notwendige Erfahrungen in der beruflichen Realität im Rahmen der Werkstatt für Behinderte zu ermöglichen, um dann mit neuem Horizont betriebliche Maßnahmen weiterzuführen, ist aus mehreren Gründen zu hinterfragen. Zu-nächst stellt sich die Frage, ob die Werkstatt für Behinderte ein geeigneter Ort für die Erfahrung beruflicher Realität im Sinne der Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt ist. Zudem wird sie von der Mutter abgelehnt, zumal mit der von ihr so aufgefassten Zumutung, dass ihr Sohn möglicherweise in eine Tagesförderstätte gegeben werden soll. Und schließlich ist sie im Fall von Herrn E offensichtlich auch nicht erfolgreich.
-
Die Zuständigkeit dafür, dass Herr E lernen soll, was Arbeit bedeutet, wird immer weitergereicht: von der Mutter an den Kindergarten und an die Arbeitsassistenz, von dort an die Werkstatt für Behinderte, und von dort soll sie an eine Tagesförderstätte oder ›an Zuhause‹ weiterdelegiert werden - so ist sie schließlich einmal im Kreis herumgereicht worden.
-
Die Arbeitsassistenz wird durch eine Umfeldsituation, die beträchtlich durch eine teils überbehütend-eigenaktive, teils enttäuscht-resignative Haltung definiert ist, an die Grenzen ihrer Möglichkeiten geführt. Solche Probleme und Konstellationen können nicht durch Arbeitsassistenz gelöst werden, hier sind eher soziale und therapeutische Dienste erforderlich.
-
Bei der Arbeit in der Werkstatt für Behinderte deutet sich eine mögliche Zwickmühlensituation an: Herr E erfüllt nicht die an ihn gestellten Anforderungen bei einfachen Sortierarbeiten; gerade sie interessieren ihn jedoch nicht sonderlich, und er wäre stärker motiviert für komplexere Arbeiten, etwa mit Maschinen. An die wird er jedoch nicht herangelassen, da er die einfachen Arbeiten nicht zur Zufriedenheit ausführt - so entsteht möglicherweise ein Teufelskreis, den möglicherweise die Tagesförderstätte auflösen soll.
-
Die spontanen positiven Reaktionen von Herrn E auf konkrete Vorschläge legen nahe, dass er im Unterschied zu seiner Mutter offenbar seinen Traum von einer wohnungsnahen, integrativen Beschäftigung noch nicht aufgegeben hat.
Ansätze zur Interpretation
Unter dem Blickwinkel der Stigma-Theorie könnte Herr E ein Beispiel dafür sein, wie ein Diskreditierter von seinem Umfeld unter dem Banner der Integration harmonistisch-fürsorglich überbehütet und damit letztlich behindert wird. Herr E hätte in dieser Logik wenig Chancen, eigene Interessen zu entwickeln und sich als selbständiger, unabhängiger und erwachsener Mann zu erleben. Da auch das berufliche Umfeld des Kindergartens zumindest an der Zuschreibung unerwachsener, weil lustgeleiteter Aktionsmöglichkeiten für Herrn E festhält, also eine unrealistische Arbeitssituation repräsentiert und so das Stigma des Kindlichen fortschreibt, betreiben die Arbeitsassistentinnen hier ein Stück Entstigmatisierung, indem sie Herrn E als 19jährigen Mann ansprechen und angemessenere Anforderungen aufzeigen, die ihm eine Entscheidung für oder gegen eine Tätigkeit ermöglichen sollen. Es ist jedoch schwer auszumachen, welcher konkrete Effekt daraufhin eintritt, denn es kommt schließlich zu einer Art der Regression, die zur Probezeit in einer Werkstatt für Behinderte führt, aus der ein Beschäftigungsverhältnis in einer anderen Werkstatt entsteht, in der die Zuschreibung des Unreifen, Unmotivierten, Unkonzentrierten für Herrn E als Stigma verstärkt fortgeschrieben wird.
Es entsteht der Eindruck, dass Herr E bisher wenige Situationen von Balance und Einigungen im Sinne der Theorie integrativer Prozesse erfahren hat. Vielmehr scheint es so, als ob das Pendel für ihn immer zu den Extremen tendiert, so dass er sich einerseits am einen Pol mit Verschmelzungstendenzen, - wenn vielleicht auch freundlicher - Vereinnahmung und Anpassung, andererseits am Gegenpol mit Abstoßung, Verweigerung und Aussonderung wiederfindet und so keine eigentliche Chance auf Orientierung und echte Selbstakzeptanz hat. Stattdessen kompensiert er dies durch seine Fixierung auf den Wrestler Sting - ein gewaltiges, gewalt-tätiges Männlichkeitssymbol. Um so mehr bedarf es für Herrn E der Chance auf Normalisierung durch Gemeinsamkeit und Kooperation, die auf Begegnung und Akzeptanz beruht. In welchem Maße dies in der Werkstatt für Behinderte geleistet werden kann, muss aufgrund der Schilderungen von dort - beginnend bereits bei den Problemen der Kontaktaufnahme mit den KollegInnen und seiner dortigen Einstufung als extrem schwach - skeptisch betrachtet werden. Die Assistentinnen haben große Probleme, eine Passung herzustellen zwischen seinem Assistenzbedarf und ihren Assistenzpotential; ihr Bedarf an seiner Motivation zur beruflichen Tätigkeit und sein geringes Potential dazu lassen Kooperation scheitern. Nach dem Aufgeben des gemeinsamen Weges wird in der Werkstatt für Behinderte ein sinnvoller nächster Schritt seiner Weiterentwicklung erhofft. Wenn Herr E jedoch selbst dort die Betonung der Differenz erfährt und sein Gruppenleiter ihn eigentlich in einer Tagesförderstätte besser plaziert sieht, wäre die Exotisierung der vorläufige Tiefpunkt eines Lebenswegs, für den einmal Integration erträumt und erkämpft wurde.
Frau F, 21 Jahre alt, arbeitet seit wenigen Wochen in der Tischlerei einer Werkstatt für Behinderte. Aus einer Facharbeiter-Familie stammend, besucht Frau F die Schule für Geistigbehinderte, in deren Verlauf sie ein Praktikum in der Werkstatt für Behinderte macht, in deren Arbeitstrainingsbereich sie nach Schulende übergeht. Nach dem Arbeitstraining wechselt sie in die Tischlerei. Als ursprünglichen Berufswunsch nennt Frau F ist eine Arbeit im Friseursalon, ihre Mutter erinnert, dass sie »Kindergärtnerin« werden wollte.
Über ihre bisherige Zeit in der Schule und in der Werkstatt für Behinderte äußert sich Frau F in der ersten Befragung durchgängig sehr positiv. Die Berufsberatung erinnert sie nicht, den Berufsschultag findet sie nur teilweise positiv; da hofft sie, »dass der Tag schnell rumgeht.« Aber sonst hat sie keine Veränderungswünsche, es ist »alles okay.«
Im Rahmen der zweiten Befragung finden alle Gespräche in der Werkstatt für Behinderte statt, zunächst mit den zwei Gruppenleitern, Tischlermeister und Anlagenbauer, deren Aussagen wegen eines durchgängigen Konsenses zusammengefasst wiedergegeben werden, dann mit Frau F und nachfolgend mit ihrer Mutter, die in der Altenpflege arbeitet und sich erstmalig in der Tischlerei befindet. Frau F bleibt dabei anwesend und schaltet sich einige Male in das Gespräch ein.
Auf Stärken und Schwächen angesprochen, nennt Frau F zunächst ihre Tätigkeiten in der Tischlerei, aber dann auch Allgemeineres: »Schleifen, abnehmen jemand was und so. Schleiftunnel. Also abnehmen kann ich. ... Zusammenarbeiten kann ich sehr gut, und dann: Ich hör so gut zu, hör ich, was man alles zu mir sagt und so, und das ist auf jeden Fall wichtiger und so, wenn man zuhört und so, alles mögliche.« Schwächen sieht sie nicht: »Eigentlich hatte ich keine Schwierigkeiten noch nicht gehabt.«
Ihre Mutter sieht im Vordergrund: »Zuverlässig ist sie eigentlich. Wenn sie was sagt, dann macht sie das auch. ... Sie kann zuhören, kann sie auch. Also das kann sie.« Engeren Kontakt zur Werkstatt für Behinderte sieht die Mutter als nicht notwendig an, denn es »ist ja weiter gar nichts, weil sie kann alles so in dem Sinne.«
Die Gruppenleiter sehen als ihre Stärken: »Sie ist sehr selbstbewusst, selbstsicher auch und sabbelt sehr viel, redet sehr viel.« Als weitere Eigenschaften nennen sie: »Sie ist sehr kindisch noch. ... Sie albert viel rum und ärgert die Leute teilweise. Macht viel Spaß und macht auch viel damit kaputt - bei anderen Kollegen, die keinen Spaß verstehen. ... Und vor allen Dingen hat sie dadurch natürlich auch Konzentrationsschwächen. Das merkt man ganz deutlich, weil sie eben sich sehr leicht ablenken lässt.« Die Arbeit in der Tischlerei sehen die Gruppenleiter »in begrenztem Rahmen schon« als angemessen: »Also maschinenmäßig kann ich das nicht sagen, da ist sie nicht so für ... , da fehlt ... die Sorgfalt. Ja, aber was Schliff angeht und Oberfläche und die kleinen Sachen zusammenzubauen und sowas, da sehe ich das schon.« Bei den Maschinen »ist sie auch mehr ängstlich dann.« Ansonsten »nimmt sie auch selten Kritik entgegen, sie denkt immer, sie hat Recht und muckt dann auf und schreit rum, weint ... und sieht keine Fehler ein. Das ist ganz oft so. Sie stiftet auch Leute oft an, so kleine Sticheleien, und merkt sie gar nicht so selber.« Verglichen mit der Gesamtgruppe der WerkstattmitarbeiterInnen ist sie »eigentlich so 'n Mittelding. ... Sie ist eigentlich der Durchschnitt. ... Sie ist nicht berauschend, und aber auch nicht schlecht.« Ansonsten finden die Gruppenleiter Frau F, »wenn man sie anspricht, sehr hektisch und schnell, und (sie) verheddert (sich) und hat Angst.« Dann wirkt sie wie unter einem inneren Druck, »aber während der Arbeit hat sie den nicht. Da ist sie ganz locker und selbstsicher.« Nur »wenn sie mal 'ne Phase hat, wo sie keine Lust hat - sie kommt immer pünktlich - , aber das merkt man dann eben auch, dass sie keine Lust hat, aber sie kommt - das ist doch schon mal was. ... Ja, in der Hinsicht ist sie echt gut.«
Als wichtigste Entwicklung sieht Frau F selbst: »Also früher war ich immer hibbelig früher. ... Und meine Mutter musste mich immer ruhig stellen und meine Oma. ... Ja, dann hätten sie mir was zum Spielen gegeben und so und das alles mögliche. ... Im Kindergarten auch war ich hibbelig gewesen und so. Ich hab' Brille kaputt gemacht und so. ... Tja, das hab' ich alles früher gemacht, wo ich klein war. Wo ich klein war, hab' ich mit den Eiern gespielt und so. Meine Oma musste ja was ... Brief ja zum Briefkasten, zur Post gehen so, und meine Oma hat Opa gesagt: ›Pass auf (sie) auf! Pass auf (sie) auf!‹ ... Das kommt auf einmal plötzlich und wo ich zehn Jahre alt war, war ich auch ein bisschen hibbelig und auf einmal - bimm - war es weg. ... Bimm - war das ›hibbelig‹ auf einmal weg. Das ist nervöse Tätigkeit gewesen, bei mir innen drin steckt oder ich hab es im Kopf gefreut. ... Jetzt bin ich selbstbewusst und ich bin ganz ruhiger, ich bin auch ganz ruhig bin ich. Aber man merkt's: ... nicht hibbelig, nicht so richtig. ... Ich bin auch ganz ruhig, aber wenn ich mich freue, dann temperamentvoll bin ich dann. ... Bin ich, o jo. Sagenhaft. Nein so. Und meine Oma hatte gesagt: ›So, pass auf (sie) auf, dass sie nix kaputt macht und so und nix runterschmeißt alles so.‹ Und dann kommt meine Oma wieder: ›Wo ist (sie) denn? Die ist ja so ruhig.‹ Ja, wenn ich gerade so ruhig bin, dann stellt die so richtig was an. Ich hab' meine Eier gemanscht hab' ich, jo, immer kräftig durch und so. ... Da hat sie Eier, weil sie braucht ja für Kuchen und so und für die Gäste und so brauchen sie so. Und dann war sie zur Post gegangen so und dann hat sie gesagt: ›Pass auf (sie) auf, dass sie keinen Unsinn macht mit den Eiern oder mit sonst irgendwas!‹ ... Schon war's passiert. Matsch, matsch, matsch, maaatsch.«
Die Mutter bestätigt: »Also sie muss noch viel betreut werden, davon abgesehen. Aber sie hat sich so entwickelt - vernünftiger geworden, ne. Muss ich mal dazu sagen, meine Tochter war immer ein Wildfang, ne, also die hat alles ... und sie ist schon gedämpft. ... Ja, wo soll ich denn anfangen? Man muss sie immer noch steuern, wenn man es so will, ne. Also das geht ja morgens schon los, wenn ich denn sag: ›Zieh Dich doch bitte an.‹ Also da muss ich ihr manchmal noch helfen. Das sind also die Dinge ... ›Ja, dann schaffen wir das nicht, sonst kommst Du zu spät!‹« Die Mutter hätte es am Ende der Schulzeit »gerne noch gesehen, dass sie noch ein Jahr länger gegangen wäre. Also ich wollte eigentlich noch nicht loslassen. Aber ich hab gedacht: ›Das packt die nicht.‹ Aber ... das hat doch getäuscht.« Dass ihre Tochter direkt in die Werkstatt für Behinderte übergeht, das »wurde uns so praktisch aufgetragen, also in der Werkstatt. Sie hatte ihr Praktikum auch hier gemacht und da hat sie auch gesagt - ne, hat dir gefallen, ne?« Die Berufsberatung, die in der Schule stattfindet, stellt zwei verschiedene Werkstätten zur Auswahl, zwischen denen sich Frau F und ihre Mutter entscheiden können. Gleichwohl sieht die Mutter in der Kooperation mit Professionellen eine durchgängige Linie: »Ich hab' mich so weit immer durchgesetzt, wie ich das gerne hätte. Also ich hab' für meine Tochter eigentlich gekämpft. Wir haben schon damals, also mir ging das damals nicht so gut, und dann haben die immer gesagt: ›Ach, schicken sie doch Ihr Kind ins Heim.‹ Und das wollte ich nicht. ... Nee, da hab ich gesagt, nee.« Durch diesen Punkt angeregt, äußert sich auch Frau F dazu: »Also ich möchte mal wissen, ob die auch ihr Kind irgendwo im Heim stecken, später. ... Ich habe auch für meine Mutter auch gekämpft für meine Mutter und so. Ich steh' auch gerade für meine Mutter. ... Ja, zum Beispiel, wenn ich sie nicht unterstütze - zum Beispiel meine Oma, also irgendwann, also weil meine Oma ist ja alt, ... und sie geht ja mal oben in den Himmel irgendwann also später oder sonst irgendwas so. Und dann, wenn keiner da ist, dann ist sie bewusst alleine so, und unterstützen werde ich sie auf jeden Fall und so. Weil ich bin ja die Älteste, ich, und ich bin groß.«
Da Frau F ist erst seit kurzem in der Tischlerei ist, können die Gruppenleiter zu ihrer Entwicklung wenig sagen. Sie haben nur wenig Informationen über die Zeit in der Schule und im Arbeitstraining, denn »leider ist es sehr rar, die Auskunft, die wir hier haben. Wir kriegen immer eine Mappe mit dann, ... mehr oder weniger ihr Lebenslauf, sage ich mal, aber da steht an sich nur, welche Schule sie besucht hat, nicht Notenstand oder so was - das steht überhaupt nicht drinne. Da müssen sie noch mal einen Test machen hier. Da ... kriegen wir Sachen mit und selbstverständlich von der Arbeitsvorbereitung hier, da kriegen wir auch 'ne Beurteilung, aber mehr ist da nicht. Also das ist eigentlich ein bisschen wenig, finde ich.« Bei Frau F haben die Gruppenleiter »an sich nur mehr Sorgen, dass sie zusehends dicker wird. Also ich denke, dass sie auf ihre Figur nicht achtet. Das ist so meine Sorge, wo ich sage ... : ›Mensch, pass mal ein bisschen auf, ne!‹ Das fiel mir auch auf, wenn wir hier so Essen haben - die knallt ganz schön rein, ne. Sie achtet da überhaupt nicht drauf. Und das sieht man auch. Also ich finde, sie hat zugelegt. Aber sonst - sonst, denke ich, ist alles in Ordnung, finde ich.« Im Zuge des Arbeitstrainings hat Frau F bereits ein Praktikum in der Tischlerei gemacht, »und da hat man dann gesagt: ›Jo, okay, kann man machen, wäre tischlertauglich!‹ Und ja, so ergibt sich das eigentlich, und wenn sie natürlich nur ein Praktikum macht, bleibt sie meistens auch da dann hängen, oder bei den meisten ist es jedenfalls so, dass sie da dann bleiben.«
Über ihre Zufriedenheit berichtet Frau F im Zusammenhang mit dem Arbeitstraining: »Das war erfolgreich für mich. Mit Begeisterung war ich da drinne gewesen, so war ich - echt begeistert, weil ich will ja hier auch was schaffen natürlich da. ... Ich bin hier zufrieden. Hier bei der Tischlerei kann man ja Möbel machen, Stühle machen, Wiegen machen, Schlüsselanhänger kann man daraus machen oder Schild oder einen Würfel kann man daraus machen. Alles mögliche, was da gibt und so.« Dass Frau F in der Werkstatt für Behinderte arbeitet, »da bin ich da froh darüber. ... Es gibt auch welche, die sind nicht so glücklich ... darüber und sagen: ›Äeh was soll ich denn hier? Ich gehör' doch gar nicht hier her.‹ Das gibt es, ... und ich bin so eine Person, ich nehm das ja nicht so übel. Ich kann das mehr verkraften und so. Und das Verkraften kann ich und auch ausbaden und so ... und das kann ich mehr und das musst du schaffen noch und so und das musst du gut hinkriegen und so. ... Ich bin hier zufrieden, bin ich hier. Also eigentlich allgemein bin ich ja zufrieden. ... Na klar wohl, alles bestens, klar.«
Sorgen macht sie sich um ihren Bruder, »weil mein Bruder weiß nicht mal, was er vor sich hat und so. ... Das belastet mich auch und meine Mutter auch und so und meine Oma auch. ... Manchmal sag ich zu meinem Bruder: ›Das darfst du nicht machen, so was, das ist gefährlich und so was und dann hol ich meine Mutter.‹ ... Manchmal benimmt er sich (wie) vier. ... 17 ist er. ... Nein, aber die Jungs können sich entwickeln, die Jungs. Aber viele Jungs sind noch nicht entwickelt noch nicht. So richtig. ... Manchmal benehmen sie sich so wie Zweijährige oder drei oder vier.« Auch beschäftigen Frau F ökologische Fragen: »Viele schmeißen alles in Müll so hin so und sagen auch, wieso in den Müll schmeißen, werfen wir einfach so hin so, als wenn das nichts ist so. Müll gehört das in den Papierkorb rein und irgendwann sieht das mal so - so hoch aus und dann können wir nicht mehr atmen nicht mehr, und dann sind wir irgendwann tot. ... Umweltverschmutzung, und das ist nicht angenehm, so was. Und viel mehr Leute müssen drauf achten und so, und darum will ich auch immer versuchen zu sorgen, dass das nicht immer passiert nicht. Soviel Müll nich so alles.«
Demgegenüber äußern sich ihre Mutter und ihre Gruppenleiter nicht so detailliert. Lediglich stellen die Gruppenleiter fest: »Sie schätzt sich so ein, ... für sie reicht das, dass sie hier ist, ... dass sie gebraucht wird, einfach mal, das reicht ihr.«
Die Rolle der Gruppenleiter fasst Frau F kurz zusammen: »Meine Chefs finde ich klasse.« Und sie beschreibt Tätigkeiten von GruppenleiterInnen aus dem Arbeitstraining: »Wir haben Weben gemacht und so Brot geschmiert und Brötchen geschmiert und so. Und das haben sie offiziell so gemacht und so. Das ist ja klar, wenn man so jahrelang das gemacht hat und so, dann kommt man ja in die Übung, ja nicht mehr raus, und das verlernt man ja wohl auch nicht und so.« Frau F beschreibt das Verhalten ihrer jetzigen Gruppenleiter: »Mein Betreuer kann dazu sagen: ›Ja, mach deine Arbeit!‹ und so. Das braucht er gar nicht, das mach ich, von ganz alleine mach ich das.« Ihre Mutter kann die Rolle der Gruppenleiter nicht einschätzen, denn »ich war auch noch nie hier hinten so drin. Also ... wie sie gearbeitet hat, habe ich noch nie gesehen.« Die Gruppenleiter selbst »möchten natürlich auch ganz gerne, dass sie auch was kann, und bei ihr merkt man das auch ganz deutlich: Wenn sie motiviert wird oder wenn sie gut motiviert ist, dann kann sie auch Leistung zeigen.« Sie beschreiben die Praxis der Werkstatt für Behinderte, »sei es Verpackung oder wirklich Tischlerei oder Töpferei oder wie auch immer oder metallverarbeitendes Handwerk oder Druckerei oder so - das ist wirklich, das ist wie draußen in der freien Wirtschaft: richtig malochen, richtig was schaffen.« Der Werkstatt für Behinderte sprechen sie spezifische Stärken zu: »Ich denke, dass hier der Vorteil ist, dass das vielseitiger ist und man dadurch auch die Trainingsmöglichkeiten verlegen kann: Wenn ich sehe, dass einer fähiger ist, den nehme ich lieber in die Tischlerei oder im Handwerklichen als wie in Dienstleistung, ich denke schon, das ist wichtig.« Und ob die MitarbeiterInnen gut qualifiziert in den Arbeitsbereich kommen, »das ist letzten Endes abhängig, in welchem Trainingsbereich sie sind, aber wenn sie im Trainingsbereich Holz sind, sind sie auf jeden Fall gut vorbereitet, das kann ich schon sagen. Und selbst wenn sie ... aus der Töpferei kommen zum Beispiel, dann sind sie auch ganz gut vorbereitet. ... Und die trainieren ja nicht nur Töpfern oder so, sondern ganz alltägliche Sachen bis pünktlich kommen, auf Toilette gehen, waschen, Uhrzeiten lesen und eben alles.«
Zur Rolle im Betrieb macht Frau F deutlich, dass sie Anteil nimmt an den Gedanken und Überlegungen ihrer KollegInnen: »Einige sind auch gegangen. Einige hatten auch keine Lust hier gehabt, weil sie hier so wenig Geld verdienen und so wenig und so. Und viele sagen ja: ›Außerhalb kriegt man mehr Geld und so und außerhalb kriegt man mehr Kohle und so.‹ Das ist wohl wahr, aber bloß, es gibt auch viele, die sagen: ›Äeh, was soll ich denn noch länger verhocken hier länger, hier braten, ich geh doch hier raus. Was soll ich denn noch hier?‹ ... Ich hab da 'ne andere Einstellung.« Nach Aussagen der Gruppenleiter ist Frau F »kontaktfreudig, ... auch der Mittelpunkt hier in der Werkstatt. ... Da hinten die Runde, die hören alle auf (sie). ... Sie ist auch so der Jungsschwarm und das weiß sie auch.« Andererseits könnte sie im Moment kein Praktikum im hauswirtschaftlichen Bereich machen, »wegen den anderen Leuten, mit denen sie nicht so klarkommt. ... Also sie (ist) ja auch sehr konfliktfreudig, muss ich sagen.«
Bezüglich ihrer Zukunftsperspektiven beschreibt Frau F, dass sie eigentlich doch einen beruflichen Traum hegt: »So ich hatte mir vorgestellt - so im Laden alles einpacken und so. Die anderen, die geben das Geld und so, die anderen sind bei den Kassen und so, ich pack' das ein und das Geschenk und so und wickel das.« Bedauernd stellt sie fest, dass diese Idee sich bisher nicht hat realisieren lassen: »Nee, leider nicht. Aber irgendwann krieg' ich den Traum irgendwann mal. Später mal, wenn ich hier fest hier drinne bin, so. Ich bin ja erst im Sommer erst hier reingekommen erst. ... Erst mal warte ich erst mal ein paar Jahre, und irgendwann werd' ich auch versuchen, hier rauszugehen irgendwann mal, später irgendwann, wenn es so weit ist, irgendwann mal. ... Also das mit Einpacken, mit Geschenkpapier, das kann ich so gut mit Geschenkpapier einpacken. ... Weil ich pack' jetzt zuhause auch viel ein und so mit Geschenkpapier und so und darum kann ich das auch besser im Griff haben.« Bei KollegInnen sieht Frau F: »Natürlich können sie sich was anderes suchen, aber sie müssen das erst im Griff haben richtig alles, richtig alles im Griff haben und richtig gucken können und so. Dass sie Fehler sehen und so, und das geht auch auf Grund.« Und sie fügt hinzu: »Träume - die Träume, sagt man so schön, sind Schäume, sagt man natürlich. Aber Träume kann man ja leider nicht erfüllen, leider nicht, weil bei sowas nicht. Also viele Menschen kann man das erfüllen, viele Menschen. Und viele Menschen nicht.«
Bei dem Gedanken an die Zukunft von Frau F steht für die Mutter im Vordergrund, »'ne eigene Wohnung soll sie haben. Und mir hat immer so vorgeschwebt, dass sie also irgendwo in 'nem Hotel arbeitet, also so - gibt es ja für Behinderte so ein Hotel. ... Da möchte ich, dass ich da meine Tochter so gerne hin hätte.« Nun mischt sich Frau F ein: »Halt! Stop! Tschuldigung, dass ich unterbreche. Weil das gibt es auch für also normale Menschen. Da können auch Behinderte arbeiten, weil das war im Fernsehen gewesen. ... Bei mir sieht man das ja nicht so an, dass ich behindert bin. Bei mir sieht man das nicht so an, bei mir nicht, so richtig.« Die Mutter, die das Hamburger Stadthaus-Hotel meint (vgl. Kap. 1.1.2), bestätigt: »Ist alles machbar.«
Die Gruppenleiter glauben, »dass sie nicht hervorragend, aber ... dass sie einen guten Durchschnitt ergeben wird.« Sie glauben nicht, dass Frau F nach anderem strebt, sondern dass sie in der Werkstatt für Behinderte bleibt: »Das glaube ich schon, das sieht so aus.« Prinzipiell halten sie eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt für möglich: »Wir haben auch schon einige nach draußen gebracht. Bei (ihr) kann ich mir das noch nicht so vorstellen. ... Es kommt ja auch darauf an, in welchem Bereich. ... Ja ja, also das ist schon unser Ziel, also in der Tischlerei könnte ich mir das nicht vorstellen. Das ist zu umfangreich. Es sei denn, es ist wirklich eine sehr große Tischlerei, wo man sie speziell auf irgendwelche Sachen hin trainiert. Aber nicht allgemein Tischlerei, das kann ich nicht sagen, das mit Sicherheit nicht. Aber einige eben doch. Also hier sind welche bei, die man richtig fit hinkriegt.« Betriebe, die zur beruflichen Integration bereit sind, »muss man lange suchen. Alle Betriebe sind dafür nicht zugänglich, mit Sicherheit nicht. Aber ich meine, das ist natürlich nicht ganz so unsere Aufgabe mit, aber ich könnte (mir) sowas vorstellen, da auch mehr Werbung für zu machen. Das, denke ich, wäre sehr wichtig.« Die Gruppenleiter verweisen auf eigene Erfahrungen: »Wir haben einen Mitarbeiter rausgefördert. ... Die haben uns angesprochen, ob ... wir so einen hätten. Den haben wir da angelernt und ohne Hilfe arbeitet der jetzt draußen. ... Also wir haben ... in den letzten zwei Jahren fünf oder sechs Leute - da sind auch zwei oder drei mit der Hamburger Arbeitsassistenz raus. Aber ich glaube, zwei oder drei haben wir auch, die selbständig da sind.«
Wichtige Aspekte bei Frau F
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Frau F lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Frau F gehört zu den zufriedensten Personen aus der ersten Befragung. Dies bestätigt sie auch im Gespräch - für ihre schulische Zeit, für das Arbeitstraining und für die Beschäftigung. Zudem nimmt sie auch nach Angaben der Gruppenleiter eine zentrale Stellung im Betrieb ein.
-
Dennoch äußert Frau F in der zweiten Befragung, dass sie später ›draußen‹ arbeiten möchte, und sie hat auch relativ konkrete Vorstellungen davon, was sie möchte. Sie gehört also nicht zu den 41 % der Befragten, die dieses in der ersten Befragung äußern. Gleichzeitig mit ihrem Wunsch reflektiert sie auch die Frage, wie weit Träume von Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt realisierbar sind.
-
Obwohl es durch Schule und Berufsberatung durchgängig eine Orientierung auf die Werkstatt für Behinderte hin gegeben hat, schwebt auch der Mutter eine alternative Arbeitssituation vor, für die sie einen integrativen Zweckbetrieb wie das Stadthaus-Hotel favorisiert.
-
Wenngleich die Gruppenleiter Frau F wichtige Eigenschaften wie Lockerheit, Selbstsicherheit, Kontaktfreudigkeit und Konfliktfreudigkeit bescheinigen, halten sie sie eher noch nicht für fähig, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln, obwohl sie dieses Ziel all-gemein für wichtig halten und eigene Erfahrungen damit schildern.
Ansätze zur Interpretation
Da man Frau F ihre Behinderung nicht ansieht, wäre sie gemäß der Stigma-Theorie der Gruppe der Diskreditierbaren zuzuordnen. Im Rahmen der Werkstatt für Behinderte kann sie sich in der Gemeinschaft der Diskreditierten stabilisieren, indem sie dort tonangebender Mittelpunkt ist. Ihre Gruppenleiter finden, dass Frau F in ihrer Institution richtig plaziert ist, wobei nicht eindeutig klar wird, ob sie damit die Berechtigung der Zuschreibung stabilisieren und an Frau F festmachen oder ob sie einer anderen Umgebung als der Werkstatt für Behinderte nicht zutrauen, Frau F zu akzeptieren und mit ihr zusammenzuarbeiten.
Unter dem Blickwinkel der Theorie integrativer Prozesse erweckt Frau F auf den ersten Blick den Anschein, als sei sie ganz im Lot mit sich und sie tendiere nur einerseits ein wenig zur Verleugnung, wenn sie betont, bei ihr sehe man ja die Behinderung nicht und sie sei auch nicht mehr hibbelig, und andererseits zur Abgrenzung, wenn sie ausführt, dass die anderen gehen wollten, aber sie sei so robust, dass es ihr nichts ausmache, in der Werkstatt für Behinderte zu sein - jedoch will sie in einigen Jahren auch ›draußen‹ arbeiten. Ihre Mutter erklärt keine näheren Hintergründe für ihren Traum einer Arbeit in einem integrativen Zweckbetrieb für ihre Tochter. Dies legt jedoch nahe anzunehmen, dass sie ihre Tochter für so besonders im Sinne der Andersartigkeit hält, dass sie auch nur besondere Arbeitsorte für sie für möglich hält, nicht aber Passungs- und Einigungsmöglichkeiten zwischen ihrer Tochter und regulären Betrieben. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie wichtig die Vorstellungskraft des Umfeldes als Botschaft an die Person ist, wird deutlich, wie sehr es hier einer Instanz bedürfte, die Möglichkeiten von Dialog, Begegnung, Kooperation und Gemeinsamkeit transportiert und so die Realisierung beruflicher Veränderungen von Frau F befördert.
Herr G, 22 Jahre alt, arbeitet in der Töpferei einer Werkstatt für Behinderte. Dort ist er mit allen Formen und Teilbereichen des Töpferns beschäftigt. Aus einer Handwerkerfamilie stammend, besucht Herr G eine Schule für Geistigbehinderte. Sein Betriebspraktikum macht Herr G in der Töpferei, in der er jetzt auch arbeitet. In dieser Werkstatt tritt er nach Schulende sein Arbeitstraining an, obwohl er eigentlich gern Mechaniker, Elektroniker oder Busfahrer werden möchte.
In der ersten Befragung äußert sich Herr G über seine Schulzeit positiv; dass es eine Berufsberatung gegeben hat, erinnert er nicht mehr. Seine Zeit im Arbeitstraining sieht Herr G überwiegend negativ. Schon dass er in verschiedene Abteilungen muss, ärgert ihn, weil er nur in der Töpferei arbeiten möchte. Insgesamt macht ihm das Arbeitstraining keinen Spaß, vielmehr betont er, die »Langeweile war anstrengend«, und zudem hat er »auf 'n Sack gekriegt, obwohl ich alles richtig gemacht habe.« Den Berufsschultag, vor allem das Essen dort, hat er positiv in Erinnerung. Seine nachfolgende Beschäftigung bewertet er einerseits als gut, andererseits möchte er außerhalb der Werkstatt für Behinderte arbeiten und hat auch einen konkreten Betrieb im Auge, bei dem er bereits im Praktikum war, um das er sich »selber gekümmert« hat.
Im Rahmen der zweiten Befragung wird Herr G als einer der beiden unzufriedenen Mitarbeiter des Arbeitstrainings in der Werkstatt für Behinderte befragt. Das Gespräch mit seinem Gruppenleiter, ursprünglich Designer, findet im Anschluss daran ebenfalls dort statt. Auf Wunsch von Herrn G wird kein weiteres Interview geführt.
Seine Stärken und Schwächen sieht Herr G in Abgrenzung von seinen KollegInnen in den Kulturtechniken: »Lesen kann ich, schreiben kann ich, rechnen kann ich, was die anderen wohl nicht können.« Er sieht sich nicht als behindert, sondern als »ganz normaler Mensch«: »Ich bin immer noch ein Technik-Freak, also besser gesagt: Ich bastel' viel mit rum mit Batterie und Kabel und alles, was Elektronik ist, über PC, und ... in der Freizeit mache ich das.« Herr G besucht einen Kurs, »das ist so Texte schreiben, aus dem Menü rauszugehen, verlassen. ... Und da darf man keine Fehler machen, das ist richtig schwer ist das. Wenn man Fehler macht, dann stürzt der PC ab.« Außerdem stellt er fest: »Ich bin sehr gut beim Autowaschen.« Zwar hat er noch keinen Führerschein, »aber ich kann auch Autofahren. Bin ja nicht blöd.«
Sein Gruppenleiter sieht die Situation ähnlich: »Er kennt sich in Elektrik ein bisschen aus, also er kann Autoradios ein- und ausbauen, kann Lautsprecher installieren, kann Kabel verlegen; so was kriegt er hin. ... Und er ist eben Bastler, und da würde ich ihm wünschen, dass er seine Stärke auch irgendwie nutzen kann, ne, dass er in irgend sowas Technisches mit reinkommt. Es gab ja auch mal solche Arbeitsangebote für WfBs, wo elektronische Geräte recycled wurden und so was. Ist zwar destruktiv, aber immerhin, es ist ja nicht nutzlos und das wird zumindest seinem Interesse entgegenkommen. Hier nimmt er auch alles mit, den Computerkurs, den er mitnimmt, drei mal in der Woche, wo er sehr intensiv dabei ist. Dann was im Förderbereich ... angeboten innerhalb der Werkstatt passiert, ist er auch sehr interessiert.« Die Fähigkeiten und Initiativen von Herrn G gehen jedoch weit über das Übliche hinaus: »Er hat zum Beispiel die Aufnahme eines Kursprogramms initiiert, wo man einen Schaltkreis aufbaut, also wo er sich als Assistent praktisch anbietet, den anderen ein bissl zu zeigen, wie es geht und der Kursleiterin damit Unterstützung anbietet, ... und aufgrund seiner Initiative ist das eben mit aufgenommen worden.« Gleichwohl sieht der Gruppenleiter auch problematische Aspekte bei Herrn G: »Also, er hat sich erst mal besser eingeschätzt, als dass er Werkstatt für Behinderte nötig hätte, das ist aber auch stark vom Vater beeinflusst, der offen-sichtlich unter diesem Stigma leidet, dass sein Sohn nun nicht höher hinaus kann, ne. Nun hat er gewiss auch einige Defizite, die man, wenn man mit ihm länger zusammen ist, auch erkennen kann. Im Kognitiven, dass er manche Dinge, die er skizziert, um sie nachher zu bauen, dass er da nicht das richtige Vorstellungsvermögen hat, wo man jetzt Funktionsteile unterbringt, dass ihm das nebulös ist. Er ist ein Augenmensch, er braucht das anschaulich, also ist nicht so der Theoretiker. Aber im Praktischen hat er schon seine Stärken.« Vom Praktikum in der Kfz-Werkstatt hat der Gruppenleiter gehört, »dass er wohl verständig ist und anstellig, dass er Arbeiten ausführen kann, die man von ihm dort erwartet, aber dass er natürlich auch da steht und, tja, Anweisungen erwartet und nicht sehr selbständig ist, ne. Er brauchte praktisch jemand, der ihn ständig führt.« Auch ist Herrn G wohl noch nicht ganz bewusst, »wenn er dort seine Arbeitskraft verkauft, dass er auch den Gegenwert erbringen muss an Leistung.«
Bezüglich seiner Entwicklung hebt Herr G hervor, dass er zwar in eine Schule für Geistigbehinderte gegangen ist, jedoch lediglich einen »Sprachfehler« als Grund dafür sieht: »Ich hab einen kleinen Sprachfehler, aber ich - manchmal hab ich das, aber nicht mehr so oft. Früher hab ich Sprachfehler gehabt - Zungenbrecher oder sowas.« Später im Arbeitstraining, »das war - wie soll ich das erklären - das waren schlechte Zeiten. ... Wenn man Probleme, also besser gesagt mit den anderen Leuten da versteht man sich eigentlich nicht so gut. ... Die Gruppenleiter, da sind nämlich drei Leute drin, ich weiß noch ganz genau, wie die heißen. ... Da wurde ich immer so angequakt, so angemeckert. Das fand ich überhaupt nicht komisch oder witzig (lachend). Das fand ich irgendwie blöd. ... Ja, ich hasse dieses Labor, das sind diese Mixerstäbchen mit der Tasse mit den ganzen Magnetteilen drinne, mit der Schere da so einzeln reinzustecken, für Labor.« Herr G schildert andere Bereiche des Arbeitstrainings, in denen er ebenso unzufrieden ist: »Das gefiel mir auch nicht so, weil da auch, naja, die Leute, die Gruppenleiter, die da gearbeitet haben, joaar, der andere hat so rumgemeckert - weiß ich, wer das war, das war bestimmt der Chef - aber sonsten wollte ich zurück in die Töpferei gehen.« Als er diesen Wunsch äußert, wird ihm entgegnet: »›Du gehst bitte nicht in die Töpferei, Du bleibst hier bitte bei uns!‹ hat sie gesagt. ... Und ich hab mich schon erschrocken.« Er schaltet den zuständigen Sozialpädagogen ein, und es gelingt ihm, einen anderen Verlauf herbeizuführen: »Also hat das zack-zack schnell gegangen und ich bin in die Töpferei gekommen.«
Ebenso ergreift Herr G die Initiative für das vierwöchige Praktikum beim »Kfz-Service. ... Automechaniker. Das hab' ich selber meinem Gruppenleiter gesagt, ... und sie (eine Sozialpädagogin, d. Verf.) hat mich draußen vermittelt, ein Praktikum zu machen, und die wollten mich unbedingt wieder haben, die Leute. ... Joa, eben wir haben so 'ne Sozialpädagogin, find' ich eigentlich auch nicht so ganz gut, hab' ich schon mal angesprochen, ich würd' da gerne draußen arbeiten und da meint sie so: ›Im Moment nicht!‹ Und da war ich ein bißchen sauer, aber macht ja nix. ... Und das finde ich irgendwie schade, vielleicht klappt das mal, nächstes Mal, ein zweites Praktikum zu machen. ... Die Leuten, die wollten mich gerne haben, das ist der Chef. ... Da gab's auch ein Meister, ... der hat wohl aufgehört, schade. Der mochte mich eigentlich auch ganz gerne, ich mag ihn auch ganz gerne. Der Chef genauso, der will mich auch ganz gerne wieder haben. ... Die wollten mich ganz haben! Also besser gesagt: Die wollen mich jetzt ganz - total haben!«
Auch mit der Hamburger Arbeitsassistenz hat Herr G sich beraten, allerdings die »hat sich noch nicht bei mir gemeldet, die wollten sich auch normalerweise melden, das ist schon drei Jahre her. Und haben sicher auch immer noch nichts gefunden. Ich hab' gesagt, ich wollte gerne Busfahrer werden.« Zwar hat Herr G keinen Führerschein, »aber ich hab' auch ohne Führerschein gefahren auf 'n Übungsplatz mal. ... Da würd' ich schon zutrauen, aber für meinen Verdienst, Gehalt, was ich verdiene hier in der Werkstatt, langt nicht aus! ... Nee, dann kann ich das auch nicht leisten, weil Lappen, das heißt Führerschein kost' 3000 Mark. ... Und dann noch mal ein Auto: 18 000 Mark, 400 oder 500 Mark, sowas kann ich nicht leisten.« Schon in der Schulzeit hat Herr G in der Tonwerkstatt gearbeitet und »Stövchen gebaut, das ist so Duftlampen mit Kerze drinnen, wo das dann überall der Duft rumduftet, ... und das fanden die ganz gut, die Lehrers da.« In der Töpferei der Werkstatt für Behinderte hat er im Laufe der Zeit »viel zugelernt. Da hab ich anne Töpferscheibe gedreht, Vasen hochge- zentriert, dann habe ich einen Brunnen gemacht. Selbst gebastelt, dann geh' ich nachmittags ... und hab' mir ein paar Pumpen geholt und dann hab' ich sie auch eingebaut. Solche Ideen muss man haben und ich hab' solche Ideen auf 'n Kasten.«
Sein Gruppenleiter beginnt seine Schilderung ebenfalls in der Schule: »Er wird in der Schule von den Lehrern natürlich auch schonend behandelt worden sein im Hinblick auf seine Lebenszufriedenheit. Man wird ihm nicht gesagt haben, dass er nun einige geistige Voraussetzungen zum Verstehen von Lehrstoffen eben nicht mitbringt, also er hat - er ist auch Legastheniker. Vielleicht ist das Sprachverständnis gemeint, schriftsprachlich, denn so umgangssprachlich ist er natürlich nicht auffällig. ... Er kann sich ausdrücken, sogar recht gewählt, und hat einen Wortschatz, der jetzt im Vergleich zu den anderen im Durchschnitt ist oder überdurchschnittlich.« Auch der Gruppenleiter berichtet, Herr G hatte im Arbeitstraining »immer die Ambitionen, gleich bei uns in der Regelgruppe in der Töpferei zu arbeiten, weil er ... sich aufgrund des mit Begeisterung absolvierten Schülerpraktikums dann gleich für die Töpferei entschlossen hatte. Und das hier noch, das Arbeitstraining mit allen Einübungen hier von Pünktlichkeit, Sauberkeit, Kontinuität, die Werkstatt in ihrer Struktur und Funktion kennenzulernen - das war ihm alles zu fern, zu theoretisch. Er wollte eben gerne in der Töpferei sein Praktikum machen. Das hat nach einigen Schwierigkeiten auch funktioniert, dass wir uns dann eingesetzt haben, dass wir ihn dann praktisch mit den Kollegen vom (Arbeitstraining) betreuen, dass das einfach mal flexibilisiert worden ist. Er hätte sonst die Werkstatt wieder verlassen, das hat er so gesagt: Also wenn er nicht in die Töpferei darf, dann möchte er drauf verzichten, weil er ist ... ja sehr frustriert gewesen, dass er dann auch solche Konfektionierungsarbeiten ausüben musste, ne. Dass er irgendwie mit einer kleinen Pinzette in irgendwelche Küvetten kleine Nädelchen einsortieren musste, also endlos in der Menge und sehr einförmig - und das war ihm gar nichts. Er hat eben gerne komplexere Aufgaben, wo er eben seine Verantwortung übernimmt, dass er sich eben was ausdenkt, das herstellt und das bis zur Vollendung dann auch bringt, das ist für ihn irgendwie das Interessante.«
Bei der erwünschten Arbeit in der Töpferei macht Herr G Fortschritte: »Durch den Umgang mit technologischen Arbeitsschritten in der Töpferei und auch durch die Kenntnis der Maschinen, an denen er arbeitet, ist er da natürlich sicher geworden und kann eben auf der Scheibe töpfern.« Was Herr G sich vornimmt, realisiert er auch: »Sagt er, er macht 'ne flache Schüssel, dann wird's auch eine, macht er 'ne Tasse, dann wird's auch eine. So Form und Kaliber lässt sich natürlich nicht so ganz gezielt vorplanen, da kann man sich freuen, wenn er überhaupt was Brauchbares zustande bekommt. Aber es geht schon in die Richtung, also es ist nicht so notdumpf-triebhaft, es ist schon ein bisschen gezielt, ne, was er so tut. Das wäre positiv zu vermerken.« Als problematisch sieht der Gruppenleiter bei Herrn G »die Motivationsschwäche, auch mal sich was auftragen zu lassen, was er sich nun nicht ausgesucht hat. Er muss ja auch ein Äquivalent zu seiner Entlohnung bringen, er muss auch in der Gruppe nützlich sein und da hapert's dann manchmal und dann flieht er auch manchmal der Arbeit.« Der Gruppenleiter stellt den Zusammenhang her, dass Herr G »nach dem Praktikum in der Autowerkstatt nun auch die Hoffnung hat, dass das mal irgendwann noch 'ne Fortsetzung erfährt, dass er dann möglicherweise noch mal ein Praktikum dort eingeräumt bekommt. Wir bremsen ihn gar nicht, wir würden seine Initiative unterstützen und er müsste bloß sagen, wann das sein soll. Man müsste dann den zuständigen Sozialarbeiter hier im Hause bitten, dass er das Formale in die Wege leitet.« Ein weiterer schwieriger Punkt ist seine Abhängigkeit von persönlichen Beziehungen, die nach Meinung des Gruppenleiters »in die zweite Reihe gehören. Es geht hier um Arbeitsplätze, und das kann er schlecht trennen. ... Das hat aber eben auch mit seinen Defiziten zu tun. Das muss er eben verstehen lernen, dass Arbeit was ist zum Geldverdienen und um, tja, eine Zufriedenheit über die Tätigkeit zu erwerben. Und 'ne Zufriedenheit über 'ne Sympathie und 'ne Partnerschaft - das ist eben was, das gehört in den Freizeitbereich und nicht unbedingt in den Arbeitsbereich. Und das muss man ihm sicher deutlich machen.«
Als prägend für das verunsicherte Selbstbild von Herrn G sieht der Gruppenleiter widersprüchliche Haltungen der Eltern zu ihrem Sohn: Während der Vater, »der offensichtlich unter diesem Stigma leidet, dass sein Sohn nun nicht höher hinaus kann«, eine harte Haltung einnimmt, die Herr G als Ablehnung deutet, erscheint die Mutter als sehr weichherzig: »Sie liebt ihn, er liebt sie, aber sie ist sehr nachgiebig. Sie verschafft ihm auch Ausreden, dass er zu Hause bleibt, wenn er sagt, er hat so psychische Probleme oder mit dem Kreislauf, diese Dinge, also sie hilft ihm praktisch auch zu flüchten, sich der Realität und der Verantwortung zu entziehen. Das ist kontraproduktiv, das ist schade. Aber da können wir nichts daran ändern. ... Er lässt sich ja auch vieles versorgen, die Mutter schmeißt den Haushalt, während er eben auf Arbeit ist und seine Kurse besucht. Und - so ist er eben noch Muttis Kind und er ist ja nun schon ein ausgewachsener Erwachsener und müsste nun auch einige Dinge noch erlernen, die ihm noch fehlen.« Dass sich diese Diskrepanz auf die Psyche von Herrn G auswirkt, »würde ich nicht verneinen.« Insbesondere die Kritik des Vaters an der Werkstatt für Behinderte, die er für »keine angemessene Lösung« und als »Tagesverwahrung« ansieht und in der sich keiner »irgendwie entwickeln kann«, und die gleichzeitige Verweigerung, den Sohn im eigenen Betrieb zu beschäftigen, ist »keine Unterstützung für ihn.«
Herr G leitet seine Zufriedenheit vor allem von der Töpferei her, »weil die Gruppenleiter sehr nett zu mir sind. Auch die Arbeitskollegen, und es macht Spaß, ... mit Ton zu arbeiten.« Andererseits betont er, »aber hier viele Freunde hab' ich nicht gefunden. ... Nee. Das gibt solche Leute, da kann ich noch mehr Leute aufzählen, die so blöd sind, die hier gleich rummeckern« - ArbeitskollegInnen und GruppenleiterInnen. Zudem ist eine Freundschaft mit einer Kollegin in einer anderen Arbeitsgruppe in die Brüche gegangen, und »das ist alles eben blöd, und die ganzen Leute unterstützen sie noch. Und ich werd' an letzter Dreck weggeworfen, aber so auf Deutsch gesagt: Scheiße - für mich, ne.« Seit einem Monat hat Herr G jedoch eine neue Freundin.
Sein Gruppenleiter sieht Herrn G als hoch zufriedenen Mitarbeiter, wenn er seinen eigenen Vorhaben nachgehen kann: »Er ist eben hauptsächlich zu motivieren, indem er die Arbeiten ausführen kann, die ihm gefallen, und bei anderen Dingen, da geht er nicht so leicht ran, da ist er schwer zu motivieren, da kommt es auch mal zu Auseinandersetzungen, dass er auch nichts annehmen möchte, was man ihm anträgt.«
Die Rolle des Gruppenleiters liegt Herrn G gegenüber darin, dass er »das ein bissel steuern (muss), dass er immer mal wieder zur Zufriedenheit was zu tun bekommt, ne. Aber es ist eben nicht immer möglich.« Darüber hinaus sorgt die Gruppenleitung auch für immer wiederkehrende Reflexionsprozesse über die Leistungsfähigkeit und den Einsatz bei Herrn G: »Einerseits ist er nicht ganz zufrieden mit dem, was er hat, es ist ihm aber auch nicht klar, dass es einer Anstrengung bedarf, die von ihm kommen muss, darüber hinwegzukommen, ne. Wir besprechen das immer dann, wenn es um neue Punktung geht, ... das sind die Leistungseinschätzungen zur Erlangung des Steigerungsbetrages zur Grundentlohnung. ... In dem Zusammenhang werden Ziele besprochen, die er erreichen kann, die im Rahmen der Möglichkeiten sind, die wir erkennen. Und das wird nicht von uns alleine gemacht, sondern im Zwiegespräch mit ihm, also er kann mit gestalten und auch in so 'nem Gespräch. Und in der Auswertung der letzten Beobachtungsperiode wird dann eben besprochen, wie uns das vorkam, wie er gearbeitet hat, was wir zu kritisieren haben. ... Das ist also 'ne sehr intensive Auseinandersetzung - und 'ne sehr persönliche, und da geht es dann wirklich um die Dinge, die man sich wünscht, die man sich vorstellen kann, die man erreicht hat, die man nicht erreicht hat. Und letztendlich das Äquivalent ist dann auch die Einschätzung, die sich in Geld auszahlt so. Und das ist vielen über die Strecke des Jahres sicherlich nicht immer so bewusst, rückt dann wieder ins Bewusstsein, wenn man das vorbereitet und bespricht, so paar Wochen vorher, dass das wieder ins Haus steht. Dass dann vielleicht noch mal alle Tugenden gezeigt werden und ... so ein bissel neue Vorhaben für sich selbst erst mal auch dann formuliert werden.«
Der Gruppenleiter reflektiert auch grundsätzlich Nachteile und Vorteile der Beschäftigung in der Werkstatt für Behinderte: »Zunächst ist es natürlich problematisch, so einen Konzentrationspunkt hier zu schaffen, wo nun hunderte von Leuten mit sozialem oder auch einem geistigen oder körperlichen Defizit oder Handikap arbeiten müssen. Es ist ja auch dann eine Verstärkung der Problematik, auch im Bewusstsein der Leute auch 'ne starke Stigmatisierung bei vielen, die das dann eben auch empfinden und sich dann wirklich auf dem Abstellgleis fühlen. Andererseits ist es auch 'ne Sicherheit, die denen, die sich nun aufgrund der Möglichkeiten, die ihnen die Werkstatt bietet, gut entwickelt haben. Wir haben da in der Töpferei einige aufzuweisen, die richtig gut handwerklich geworden sind, also die töpfern können und es auch gerne tun, die Praktika in einer Großküche von einem Altersheim - wo die Arbeitsassistenz ein Praktikum vermittelt hat - dann wieder gelassen haben, weil ihnen diese Anforderungen doch nicht so angemessen erschienen, und dann sind sie gerne wieder zurückgekommen und sind gerne bei uns. Also diese Möglichkeit gibt es auch, man kann überhaupt nichts pauschal sagen, es hängt immer von der Person ab, die man betrachtet. Es gibt Leute, die werden hier nie zufrieden sein, die drängen immer wieder nach außen und würden lieber gerne sich ihr Geld selbst verdienen, als nun mit dieser Werkstattentlohnung und der Aufstockung Sozialhilfe dann praktisch versorgt zu sein, und andere, die haben aber herausgefunden, dass sie sich so in ihrem Lebensstandard gar nicht verändern können, wenn sie jetzt mit einer Arbeitsaufgabe in der freien Wirtschaft betraut sind, die ihnen nicht gefällt, und wo sie dann auch gerade mal so viel verdienen - unter Abzug der Miete und der Lebenshaltungskosten - wie sie es hier auch haben. Also die wägen dann schon so ab: Wo bin ich zufriedener? Wo werde ich mehr geachtet? Wo kann ich mich auch entwickeln? Bin unter meines Gleichen, hab' da auch meine sozialen Kontakte, die sie zumeist ... auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht haben. Und entscheiden sich dann dafür.«
Über seine Rolle im Betrieb äußert sich Herr G indirekt. Wie aus den bisherigen Schilderungen hervorgeht, fühlt er sich in der Werkstatt für Behinderte fehlplaziert und hat eine deutliche Orientierung nach ›draußen‹: »Am liebten, wenn ich dann nicht so behindert wäre wie die anderen da, wenn man eigentlich nicht behindert ist, dann hat man 'ne Chance, nach draußen zu kommen. ... Der soll nicht zu spät kommen oder der soll richtig arbeiten. Und wenn er das jeden Tag macht, ohne mal fehlen zu lassen, dann wird er irgendwann draußen zuvermittelt.« Sozial lehnt er sich vor allem an die Gruppenleiter in der Töpferei und an seine Freundin an.
Der Gruppenleiter merkt ergänzend eine spezifische soziale Rolle an: »Da gibt's Leute, die auch so tüchtig sind in ähnlicher Weise, ... also es gibt welche, die sind im Töpfern geschickter als er, aber kommen dann mit ihrem Kassettenrecorder zu ihm und lassen sich den bei ihm reparieren, weil er das kann.«
Zukunftsperspektiven entwickelt Herr G dennoch nicht ganz eindeutig, auch wenn seine Eltern die Tendenz zum ersten Arbeitsmarkt unterstützen: »Mein Vater hat gesagt, das findet er gut, was ich bei Automechaniker, bei Kfz-Service im Praktikum gemacht hatte. Das findet er gut, und meine Mutter hat auch gesagt, das findet sie gut ... : ›Dann kannst Du Dir ja alles leisten, dann kannst Dir ja 'nen Führerschein leisten, erstmal das, ein Auto leisten, ein Haus leisten. Und sonstiges, oder zum Beispiel PC oder so was.‹« Trotzdem ist Herr G sehr hin- und hergerissen, was seinen weiteren Weg angeht: Einerseits wünscht er sich sehr klar, »dass ich draußen arbeiten kann, ... weil hier ist wirklich Chaos und ich bin wie ein normaler Mensch, ich habe keine Behinderung, ich nehme keine Tabletten oder so, bin 'n ganz normaler Mensch.« Trotzdem, »hau, weiß ich nicht, was ich dann mach', aber ich werd' mir schon was einfallen lassen, also, ich weiß gar nicht, wohin ich mein Gedächtnis hin lassen tue, das ist eigentlich Katastrophe für mich. ... Ich weiß gar nicht, was ich will - entweder ich bleib' in der Töpferei oder ich werd' draußen arbeiten. Das ist sehr schwierig für mich, also wenn ich dann mal nach draußen gehe und arbeite draußen, dann vermisse ich die Töpfereigruppe. So, und wenn ich denn wieder zurückkomme, ach, dann vermissen mich meine Leute vom Kfz-Service. ... Man kann sich nicht auseinanderreißen oder irgendwas.« Einen Kompromiss mit zwei Teilzeitjobs kann Herr G sich nicht vorstellen: »Ich weiß gar nicht, was die Leute dazu sagen. Die würden bestimmt sagen: ›Ach, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. ... Du musst eigentlich mal entscheiden, entweder nimmst du das oder das.‹ Und ich kann nicht hier aus ein Teil eine Eins, 'ne krumme Eins machen - so teilen oder so. ... (lachend) Das geht bestimmt nicht.«
Für den Gruppenleiter hängt der weitere Weg von Herrn G »sehr davon ab, wie jetzt die Weichen gestellt werden. Wird er noch ein Praktikum in der (Kfz-, d. Verf.) Werkstatt bekommen, dann kann ich da nichts vorwegnehmen, da muss man das abwarten. Ich würde ihm natürlich wünschen, dass er da anwächst und sich da nützlich machen kann, solange die Werkstatt in dieser Form existiert, also, dass er hier noch in der Nähe zu uns ist, auch in der Nähe zu seiner Freundin. Uns auch um Rat und Vermittlung bitten kann.« Denn der Gruppenleiter kann sich gut vorstellen, »dass das in so einer Werkstatt, die ein Kleinbetrieb ist, wo der Meister eben auch mal auf Tour ist, Material holen, mal 'ne Probefahrt zu machen oder gerade mit was anderem beschäftigt ist, dass er dann eben viel Leerlauf hat. Und wie dann 'ne Organisation gefunden wird, dass er nun in der Zeit, wo er nicht unter Betreuung ist, was tut, bis er sich eben vielleicht eine Routine angewöhnt hat, dass er weiß, was zu tun ist, wenn der Meister nicht da ist, dass das besprochen wird. Da können wir ja noch Einfluss nehmen. Das wäre dann praktisch unser Angebot von Arbeitsassistenz, weil 's gleich um die Ecke ist und weil wir sowohl der (Kfz-, d. Verf.) Werkstatt wie unseren Mitarbeitern irgendwie verpflichtet sind. Und wenn wir ihn da stärken«, sieht er eine realistische Chance. »Wenn er hier bleibt, hätte er nur Entwicklungschancen, wenn es uns gelingt, ihn noch besser zu motivieren oder er sich besinnt und ein bisschen mehr Initiative zeigt, sonst wird's wohl stagnieren. Denn die Tendenzen zeigen manche - er zum Teil - , dass sie sich mit dem, was sie haben, schon zufriedengeben.«
Wichtige Aspekte bei Herrn G
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Herrn G lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Herr G hat einen geradlinigen und bruchlosen Weg hinter sich: Von der Schule für Geistigbehinderte wechselt er nach einem Praktikum in der Werkstatt für Behinderte in diese Werkstatt. Diese Entwicklunglinie steht im Widerspruch zu den Wünschen, die sein Vater für ihn hat.
-
Herr G fühlt sich weder in dieser Schulform noch in dieser Institution richtig aufgehoben. Sein Wohlbefinden leitet sich zu einem Teil von der konkreten Tätigkeit des Töpferns, zum anderen Teil von guten Beziehungen mit wenigen Personen ab. Gleichwohl ist in dieser Zufriedenheit eine resignative Tendenz wahrnehmbar, die auf der anderen Seite durch unzufriedenes Hadern relativiert wird.
-
Seine Erfahrungen im Arbeitstraining sieht Herr G sehr negativ; nach den Schilderungen ist dies eine Folge davon, dass er dort einem - für ihn unterfordernden und langweiligen - Standardprogramm folgen muss und nicht seinen individuellen Interessen nachgehen kann und dass die soziale Situation ihn nervt.
-
Herr G befindet sich in einer ambivalenten Situation. Der zentrale Zielkonflikt besteht darin, dass er einerseits draußen viel Geld verdienen und seinen technischen Interessen entsprechend arbeiten möchte, andererseits aber zögert, auf die emotionale und soziale Sicherheit seines engsten aktuellen Umfeldes (Töpfergruppe) zu verzichten. Für dieses Dilemma hat Herr G keine Lösung.
-
Sein Gruppenleiter sieht das Problem ebenso, tendiert jedoch dazu, die Chance zu einem zweiten Praktikum im bekannten Betrieb ergreifen zu helfen. Diesen Prozess zu begleiten und zu stützen, definiert er als seine Form von Arbeitsassistenz.
-
Der Gruppenleiter stellt heraus, dass Herr G immer eine hohe Arbeitsmotivation zeigt, wenn er selbst gewählten und für ihn zufriedenstellenden Aufgaben nachgehen kann, es aber noch lernen müsse, auch fremdbestimmten Aufgabenstellungen nachzukommen.
-
Grundsätzlich sieht der Gruppenleiter Dilemmata für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben - in der Werkstatt für Behinderte wie auf dem ersten Arbeitsmarkt. Er plädiert daher für ein individuumsbezogenes Vorgehen, das bei jeder Person mit abwägen hilft, ob einerseits das Problem des verstärkten Stigmas in einer Institution und der Vorteil der sicherheitgebenden Umgebung dort oder andererseits das Problem der letztlich nicht wesentlich verbesserten finanziellen und sozialen Situation mit einer evtl. nicht interessanteren Aufgabe und der Vorteil reeller Arbeit und reellen Verdienstes auf dem ersten Arbeitsmarkt stärker gewichtet wird.
Ansätze zur Interpretation
Unter dem Blickwinkel der Stigma-Theorie könnte Herr G aufgrund einer auch für ihn selbst nicht fassbaren Behinderung als ein Diskreditierbarer gesehen werden, der seine Zugehörigkeit zu einer diskreditierten Gruppe zu verleugnen versucht. So lange er sich in der Subkultur der Diskreditierten bewegt, bestehen dafür vielleicht bessere Chancen als in der direkten Konfrontation mit gesellschaftlicher Normalität. Zögern lässt ihn möglicherweise zudem die abwertende Sichtweise seines Vaters, die sich auf die Institution bezieht, latent aber auch auf ihn. Dies mag ebenso wie das nicht sichtbare Stigma bei Herrn G die Gegenwehr gegen die Konstruktion einer behinderten Identität erhöhen, die ihm die Zugehörigkeit zu einer speziellen Institution nahelegt. Sein Gruppenleiter gehört dabei nicht zu den Zuschreibungsspezialisten, zu denen mit Autorität und sozialer Kontrolle ausgestattete Instanzen in Institutionen häufig werden. Er ist vielmehr bemüht, ein positives Selbstbild und eine in die eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten vertrauende Haltung von Herrn G zu unterstützen und ihn zu bestärken, Schritte in einen anderen Arbeitskontext zu unternehmen, da er um die stigmatisierende Wirkung der Konzentration von Menschen mit Handikaps weiß.
Der Theorie integrativer Prozesse entsprechend lässt sich bei Herrn G vermuten, dass er - zumal auf der Grundlage der Überbehütung der Mutter und der abwertenden Distanzierung des Vaters - einerseits sehr zum Pol der Gleichheit strebt und andererseits über die Verleugnung der eigenen unerwünschten Anteile und deren Verfolgung durch ihre Projektion auf die anderen KollegInnen mit Behinderung latent zur Abstoßung und zur Verweigerung der weiteren (Zusammen-)Arbeit getrieben wird. Er möchte sich quasi aus der Aussonderung einer speziellen Institution absondern, befürchtet aber zugleich, außerhalb des Schutzes der Werkstatt für Behinderte als Gemeinschaft der als andersartig Definierten, Formen der Anpassung leisten zu müssen, zu denen er vielleicht doch nicht in der Lage sein könnte. Einzig von dem aus einem Praktikum bekannten Betrieb erhofft er sich Angenommen- und Gemochtwerden und Einigungen auf allen Ebenen, die ihm Normalisierung und Integration ermöglichen. Der Gruppenleiter versucht eine Balance zu realisieren zwischen der Akzeptanz des Soseins von Herrn G und der Herausforderung und Beförderung seiner Entwicklungsmöglichkeiten. In diesem dialektischen Spannungsfeld unterstützt er alle Ambitionen zu mehr Autonomie, da er Stagnation und negative Verstärkungs-Effekte der Konzentration von problematischen Aspekten in der Großinstitution sieht.
Herr H, 35 Jahre alt, arbeitet seit Jahren mit ca. 30 Wochenstunden in einer Werkstatt für Behinderte. Dort ist er in einer Verpackungs- und Montagegruppe tätig; zur Zeit montiert er abgelängtes Schnurmaterial, das als Segelzubehör verwendet wird. Aus einer Familie mit Angestellten und Beamten stammend, besucht Herr H eine Schule für Körperbehinderte. Während er von keinem Betriebspraktikum mehr weiß, hat er die Berufsberatung in Erinnerung: Er soll die »Papiere einschicken für die Werkstatt.« Auch die Lehrer raten ihm zur »WfB natürlich.« In deren Arbeitstrainingsbereich geht er dann auch über. Später wechselt Herr H in eine andere Werkstatt für Behinderte.
In der ersten Befragung äußert sich Herr H weitgehend negativ über seinen bisherigen Weg: In die Schule geht er ungern, die Berufsberatung gefällt ihm sehr schlecht, auch das Arbeitstraining mit den Schwerpunkten Verpackung, Holz und Küche stellt ihn nur teilweise zufrieden. Während er die GruppenleiterInnen unterschiedlich bewertet, meint er mit seinen ArbeitskollegInnen eher schlecht auszukommen. Einmal wird ein Praktikum in der Post vorgeschlagen, zu dem es jedoch nicht kommt. Lediglich den Berufsschultag findet Herr H gut. Mit seiner Beschäftigung ist er unzufrieden, er möchte in verschiedenen Gruppen arbeiten. Richtige Freunde gefunden hat er im Arbeitsbereich auch nicht. Wiederholt äußert Herr H den Wunsch, außerhalb der Werkstatt für Behinderte zu arbeiten, vielleicht am Computer.
Im Rahmen der zweiten Befragung wird Herr H als einer von zwei Unzufriedenen in der Werkstatt für Behinderte befragt, ein Interview mit seinen Eltern lehnt er ab: »Ich kann schon für mich selber sprechen.« Das Gespräch mit der Gruppenleiterin, die vor der Arbeit in der Werkstatt die Abteilung eines Betriebes geleitet hat, findet ebenfalls in der Werkstatt für Behinderte statt.
Herrn H fällt es schwer, eigene Stärken zu formulieren. Vielmehr äußert eigene Probleme und Schwächen: »Meine besonders guten Stärken sind eigentlich: mitarbeiten. Mit ein paar Leuten mitarbeiten, aber manchmal merke ich schon, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Aber so ab und zu muss ich mich selber aufmuntern und sagen: ›Das schaffst du schon.‹ ... Doch, ich könnte schon was schaffen, aber wenn ich mit mehreren zusammen bin, dann würde ich mich schon riesig freuen, wenn man solche Clique finden würde mit anderen schwachen Leuten und sagen würde: ›Wir schaffen das.‹ ... Und ich möchte auch mit mehreren Leuten Kontakt kriegen, aber es fällt mir manchmal schwer.«
Seine Gruppenleiterin bestätigt dieses Bild: »Also, wir arbeiten knappe zwei Jahre zusammen. Tja, seine Schwächen; ich kann eher die Schwächen nennen. Die sind, dass sich Herr H also alles reinzieht, was in seinem Umfeld Negatives passiert. Das zieht er sich rein und das schlägt sich auch auf seine Arbeit nieder. Positives kann ich kaum Arbeitsmäßiges sagen.« In seiner Gruppe »ist er der Schwächste. ... Er wollte mal bei mir an die Säge. ... Da ist es erst mal nicht machbar, von der Höhe vom Rollstuhl gar nicht, dann sind das Stangen, die hin- und hergetragen werden müssen und sechs Meter Länge - ist das auch gar nicht möglich, so dass ich ihn da irgendwo mit einsetzen könnte. Außerdem ist (er) auch noch - er schläft zwischendurch ein und da kann ich ihn nicht an die Maschine setzen, ne. Er nickt dann einfach so beim Arbeiten mittendrin weg. Das ist einfach zu gefährlich. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen.« Das Interesse am Computer bei Herrn H sieht die Gruppenleitern ebenfalls als problematisch, denn er »kann auch nicht lesen und schreiben. Das fehlt dann auch noch. Wenn er am Computer arbeiten will, dann muss er das können. Das ist ja eigentlich die Voraussetzung für so was, wenn er effektiv dran arbeiten möchte.« Nach Meinung der Gruppenleiterin gibt es ein weiteres Problem: »Er blufft wohl auch ein bisschen, ja. Ich glaube, er möchte mehr, als er überhaupt kann. Er kann das gar nicht so richtig einschätzen, wo seine Grenzen überhaupt sind.« Weiter stellt die Gruppenleiterin fest: Herr H »mag umsorgt werden. ... Aber ich denke auch mal, dass das gut ist, wenn er die Dinge alleine macht, die er auch kann.«
Bezüglich seiner Entwicklung hadert Herr H mit seiner Behinderung. Wenn er nicht im Rollstuhl säße, dann »hätte ich einen richtigen Beruf begriffen, ergriffen und dann hätte ich sogar an Maschinen gearbeitet. ... Schlosser oder so. ... Ja, das wäre absolut meins.« Gegen Ende der Schulzeit, blickt Herr H zurück, »hatte ich 'ne Berufsberatung, aber damals hat man mir so'n bisschen keine so wahre Hoffnung gemacht. Aber: Man kann das ja auch mal im Auge behalten. ... Die kam zu mir in die Schule und sagte: ›(Herr H), würdest du dich in (einer Werkstatt) eigentlich wohl fühlen?‹ Habe ich zu ihr gesagt: ›Ja, wenn da ein paar Leute sind, die auch verständnisvoll sind.‹ Aber«, so formuliert er die beginnenden Schwierigkeiten, »ein Behinderter, der musste mich andauernd auf Klo setzen. Für den war das ein Bereich, mit Männern zusammen zu arbeiten. ... Der konnte das nicht so schnell. Also er hat auch manchmal gesagt: ›Ich kann das nicht so schnell.‹ Aber was ich nicht so kapiert habe, dass (die Werkstatt) nicht mit ihm zusammengearbeitet hat.« Herrn H's Schilderung nach ist eine Arbeitsassistentin gekommen, »die hat mich erst mal gefragt, ob ich nicht wo anders Interesse hätte, Lust hätte. Und jetzt hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass ich so ein bisschen Interesse hab', was am Computer zu machen.« Gleichwohl ist Herr H insgesamt reserviert: »Die Umsetzung, die würde ich lieber mit meinem Vater erst mal ausdiskutieren. Wenn mein Vater jetzt mich irgendwie unterstützen würde.« Sein Vater ist für Herrn H die Person, von der er sich am meisten Unterstützung erhofft - in jeder Hinsicht, aber insbesondere bei Zukunftsperspektiven. So bleibt Herr H in der Werkstatt für Behinderte. Er kritisiert dort zum einen den zeitweiligen Leerlauf: »Ab und zu kriegen wir nur noch Arbeit, aber ab und zu muss ich mich auch gedulden.« Zum anderen findet er auch »die Arbeitseinteilung nicht so gut, ... diese Sei-le-Einteilung da.« Herr H wünscht sich nach wie vor eine Veränderung und hofft auch dabei auf die Unterstützung seines Vaters: »Der würde sich auch riesig drum bemühen, dass ich auch am Computer arbeite. Also ab und zu möchte ich auch mal was anderes machen.« Auch in Bezug auf Maschinen würde sich Herr H »riesig freuen, wenn (die Gruppenleiterin) sagen würde: ›Okay, ich bilde dich aus.‹ ... Also ich wäre ganz gerne bereit, sowas zu machen, aber ob das möglich ist, das weiß ich noch nicht.«
Seine Gruppenleiterin blickt zurück: »Wo ich ihn übernommen hab', da war er schon eine Zeit hier im Haus, in einer anderen Gruppe. Ich hab' auch oder die Werkstatt hat auch keine Beurteilung oder so von der (anderen) Werkstatt. Wir wissen gar nicht, was er da gemacht hat. Er erzählt manchmal ganz viel. Manche Dinge, da kann ich gleich sagen: ›Das kannst du nie dort gemacht haben, diese Arbeiten machen die da gar nicht.‹ Dann weiß ich manchmal auch nicht: Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich weiß es ganz einfach nicht.« Sie bestätigt die Stagnation: »Also ich beschäftige mich mit keinem Mitarbeiter so viel wie mit (ihm) und letztendlich ohne Erfolg, ne. Das ist schon irgendwo deprimierend, wenn man sich da wirklich so viel Zeit nimmt und sich nur mit diesem einen Mitarbeiter so viel beschäftigt, und da kommt keine Entwicklung zustande.« Konkret beschreibt sie: »In diesen zwei Jahren haben wir es immer noch nicht geschafft, obwohl wir bei (ihm) sehr viel und auch sehr lange immer wieder Einzelförderung machen in der Gruppe, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass der Herr (H) wirklich - ob es drei oder fünf oder zehn Teile mit Schablone, die er darauf gelegt kriegt - , das schafft er einfach nicht. Also innerhalb dieser zwei Jahre haben wir das nicht gepackt, ne. Und das ist nun eine der leichtesten Arbeiten hier in der Werkstatt.« Auch mit der Arbeit am Computer hat sich nichts weiterentwickelt: »Wir haben jedes Jahr innerbetriebliche Förderung und unter anderem auch am PC, und da hatten ich (ihn) auch mit angemeldet. Er wollte es auch. Aber der lief da irgendwie in diesem Jahr - dann war kein Raum da, dann waren die Mitarbeiter nicht da und nun ist das Jahr zu Ende. Es soll im nächsten Jahr noch mal ein Anlauf gestartet werden.« Die Gruppenleiterin sieht Herrn H auch durch seine familiäre Situation als belastet an: Das »war eine ganz enge Beziehung zur Mutter, und die ist an Krebs sehr früh gestorben. Er spricht noch sehr viel von seiner Mutter. ... Obwohl er in einer Wohngruppe ist und gar nicht so oft beim Vater, alle 14 Tage vielleicht mal, ... aber die telefonieren wohl viel. Ich denke, das ist auch (er), der nicht loslassen kann. Das ist gar nicht mal der Vater.« Als der Vater wieder heiratet, spricht Herr H den ganzen Tag davon, so dass die Gruppenleiterin den Eindruck hat, »er wird einfach nicht damit fertig, dass der Vater wieder heiratet.« Nach Rücksprache mit dem sozialpädagogischen Dienst lädt die Werkstatt für Behinderte den Vater zu einem Gespräch ein und macht den Vorschlag, »dass er doch vielleicht eine Therapie (machen könnte), dass es vielleicht da noch was wird. Und er: ›Doch keine Therapie! Er akzeptiert das voll!‹ Und also voll vor seinen Sohn gestellt, wo das nicht unbedingt gut ist, sag' ich mal.«
Aspekte von Zufriedenheit sieht Herr H nur im Bereich seiner Wünsche, denn seine gegenwärtige Tätigkeit, »das ist eigentlich nicht mein großes Ding. Am liebsten möchte ich immer am Computer sitzen.« Eine Ursache seiner grundsätzlichen Unzufriedenheit sieht Herr H bei seiner Mutter: »Die hat mich immer maßlos gemaßregelt, und das konnte ich absolut nicht ab.« Dieses hat Aus- und Nachwirkungen auf sein Selbstwertgefühl: »Das ist heute noch so ein bisschen schwierig. Ich möchte zwar nicht sagen: ›Ich geb' auf‹, aber irgendwie möchte ich eine Tätigkeit finden für mich am Computer.« Dieser Gedanke verfolgt Herrn H insbesondere, wenn in der Werkstatt für Behinderte nichts zu tun ist: »Dann möchte ich mich am liebsten zu Hause hinsetzen an den Computer.« Seine Zufriedenheit könnte entsprechend erhöht werden: »Wozu ich Lust hätte, ist einen Maschinenkurs zu machen.« Seine Lebenssituation insgesamt bewertet er indifferent: »Ich bin manchmal so ein bisschen unzufrieden. ... Zum Beispiel am Anfang hieß es: Lebenshilfe, da sollte ich mal reinschnuppern. Und jetzt heißt es: Leben mit Behinderung GmbH. Eigentlich bin ich sehr damit zufrieden, aber es könnte etwas besser werden und besser sein. ... Ich bin froh über meine WG da drüben, aber so ein bisschen auch nicht.« Mehrfach bedauert Herr H seine Kontaktsituation, denn einige Beziehungen »sind so ein bisschen abgebrochen. Ich hatte auch mehr Kontakt mit 'nem Behinderten, der etwas schwerstbehindert war, zwei Hörgeräte im Ohr hatte. ... Aber mit dem kam ich sehr gut aus. ... Das war mein bester Freund, und leider habe ich den Kontakt nicht mehr. Die Mutter ist auch schon früh gestorben und er lebt mit seiner Oma zusammen.«
Auch die Gruppenleiterin meint: »Also zufrieden ist er nicht. Er ist auch nicht damit zufrieden, dass das mit der Arbeit nicht klappt und dass er selber das nacharbeiten muss - oder wir arbeiten nach, ne. Ich sag' ihm das auch. Er kriegt das ja auch mit, wenn ein anderer Mitarbeiter seine Arbeit übernimmt, die schimpfen dann auch, wenn sie alles nacharbeiten müssen. Also damit ist er überhaupt nicht zufrieden, aber er kriegt es eben nicht auf die Reihe. ... Nein, nein. Überhaupt nicht. Er sagt auch, er will anspruchsvollere Arbeit, nur wenn er nicht mal die leichtesten auf die Reihe kriegt - wir wollen es versuchen. Er möchte gern ein Praktikum in der Druckerei machen. Wir werden das auch versuchen, aber ich denke, er ist dann ganz einfach überfordert. Aber er will das selber. Ja, nun sag ich: ›Dann soll er es probieren.‹ Ich hab' mit dem Gruppenleiter auch gesprochen, aber ich glaube, er wird dann überfordert sein.« Die Belastung von Herrn H wird der Wahrnehmung der Gruppenleiterin nach noch durch private Sorgen unnötig gesteigert: »Ich verstehe auch nicht, warum der Vater, der ist ja einer der (gesetzlichen, d. Verf.) Betreuungskräfte, warum der Vater ihm das immer alles erzählt, ne, was noch gar nicht mal so doll akut ist. (Er) ist dann - er kriegt dann gar nichts mehr auf die Reihe, gar nichts mehr.«
Die Rolle seiner Gruppenleitung kommentiert Herr H mit widersprüchlichen Wünschen und Hoffnungen: Früher war er »noch in der anderen Gruppe bei (einer anderen Gruppenleiterin), das war eine sehr nette, ... und von der habe ich einiges gelernt, und würde mich riesig freuen, wenn das (seine jetzige Gruppenleiterin) weitermachen würde. ... Irgendwas mit Maschinen oder so. ... Was ich Lust hätte, das macht sie auch möglich. Aber immer die Bänder durchziehen habe ich auch keine so riesige Lust.«
Die Gruppenleiterin selbst sieht sich angesichts der Stagnation bei Herrn H vor der Herausforderung, für ein Gleichgewicht von Forderung und Unterstützung zu sorgen: »(Er) mag umsorgt werden. Ich weiß, das erste Vierteljahr: Ich hab ihm morgens immer die Jacke ausgezogen. Er kam rein, hat sich hingestellt mit seinem Rollstuhl und dann gewartet, bis ich ihm die Jacke ausgezogen habe. Bis ich irgendwann - kam ich später und dann war er dabei, seine Jacke auszuziehen. Da hab' ich erst mal mitgekriegt, dass er das überhaupt alleine kann. Also er mag das gerne, umsorgt werden. ... Also Dinge, die (er) alleine kann, die muss er bei mir alleine machen.«
Seine Rolle im Betrieb beschreibt Herr H in der Weise, dass er den Zusammenhalt in seiner Gruppe »ein bisschen mau« findet. Dennoch würde Herr H seine KollegInnen bei einem Weggang aus der Werkstatt »doch schon« vermissen.
Den geringen Zusammenhalt in der Gruppe relativiert die Gruppenleiterin: »Aber ich weiß, dass viele gleich aufspringen. Einerseits find' ich es gut. Ich hatte vor zwei Jahren, wo (er) auch zu mir kam, die Gruppe neu aufgemacht und da habe ich auch einen Mitarbeiter beigehabt: Dem (Herrn H) war was runterfallen, da sag' ich zu dem anderen Mitarbeiter: ›Heb' das dem (Herrn H) doch mal auf, der kann doch nicht.‹ - ›Da kann ich doch nichts dafür!‹ hat der zu mir gesagt. Na ja, da bin ich natürlich drauf eingegangen, dass dem (Herrn H) auch geholfen wird, ne. Aber jetzt wird das mittlerweile so viel, dass ich dann wirklich sagen muss: ›Halt, Stop! Das kann er alleine.‹ ... Ich schreite dann auch ein.« Seine Rolle in der Gruppe ist, wie bereits geschildert, auch dadurch stark beeinflusst, dass die KollegInnen bei Fehlern von Herrn H nacharbeiten müssen und dann »schimpfen«.
Die Zukunftsperspektiven sind davon bestimmt, dass Herr H eine zufriedenstellende Tätigkeit haben möchte und dass er eine anerkannte soziale Rolle sucht. Hierfür spricht schon seine Eröffnung des Gesprächs: »Guten Morgen, aber ich arbeite jetzt auch manchmal in der Kirche, ... so als Nebenbei-Job. ... In der Kirchengemeinde so ein bisschen mitarbeiten, ... es gibt da Gottesdienste, und dazu hätte ich Lust, so richtig mal mitzumachen. ... So ein bisschen bin ich da schon am Gange. Mein Vater würde das eigentlich sehr unterstützen.« Für ersteres gibt es zahlreiche Belege durch seine gegenwärtige Unzufriedenheit, aber auch Aussagen wie die, dass er arbeiten möchte, »wo ich das umsetzen kann, am Computer dann zu arbeiten und wo ich auch Spaß habe.« Schon bei der Berufsberatung hat er sich »eigentlich was anderes gewünscht. Ich hab' jetzt einen Computer, aber noch keine festen Programme. Und ich würde mich riesig freuen, Bekanntschaft zu machen mit einem anderen Kollegen, der genau dieses System hat wie ich, das wär mal ganz gut.« Überhaupt »hab' ich ein klares Ziel und das möchte ich gerne ausbessern noch. ... Das möchte ich eigentlich, dass ich das in der Schule lerne, ... in so einem Kurs, Volkshochschule, da möchte ich schon hin, am Computer. Ich möchte zum Beispiel bei meinem Vater so ein bisschen arbeiten.« Der Vater arbeitet in einer großen Versicherung, und Herr H stellt sich vor: »Er hat da so Post, Postmänner, die werden da so eingeteilt, so in Bezirken. Und dann kommt da manchmal Post hin und Post wieder zurück. Aber manches Mal fällt das ... ganz schön schwer, so die Menschen zu motivieren. Er hat einen, der hat sogar ein Tonbandgerät, das muss er jeden Tag anmachen, einen schwerhörig Behinderten. Aber er setzt sich für ihn ein. ... Der arbeitet mit einigen Leuten zusammen, aber manches Mal fällt das ihm ganz schön schwer, das zu machen. ... Aber was ich Lust hätte: Bei meinem Vater so ein bisschen zu arbeiten, bisschen sein' Betrieb kennenzulernen. ... Für mich wäre dort ein anderer Arbeitsplatz. Und für meinen Vater wäre das ein bisschen leichter.«
Für die Gruppenleiterin entsteht auch auf längere Sicht »kein anderes Bild. Das ist ... schon irgendwo deprimierend, und dadurch sehe ich auch nicht, dass die Entwicklung da weiter geht, dass sie anders geht in fünf Jahren. Ich werde natürlich weiterhin mit (ihm) arbeiten. Letztendlich ist es ja, wenn er sich weiterentwickeln würde, auch für mich 'ne Entlastung. Ich muss so seine Teile hundertprozentig nachgucken und nacharbeiten. Wenn er sich weiter entwickeln würde, wäre das für mich eine Entlastung.« Auch der PC als Perspektive ist für sie unrealistisch, da Herr H nicht lesen und schreiben kann, und »das ist ja eigentlich die Voraussetzung für sowas, wenn er effektiv dran arbeiten möchte.« Vor diesem Hintergrund ist seine Idee, ›draußen‹ zu arbeiten, für sie kein Thema. Sie hält nur für wichtig, dass Herr H bei aller Stagnation weiter im Arbeitsprozess bleibt, denn »wenn er gar nichts macht, dann entsteht eine Rückentwicklung.«
Wichtige Aspekte bei Herrn H
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Herrn H lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Herr H blickt auf seinen bisherigen Weg und auf seine Gegenwart unter weitgehend negativen Vorzeichen zurück, damit bestätigt er das Bild der ersten Befragung.
-
Das zentrale Dilemma besteht darin, dass er berufliche Tätigkeiten ausführen möchte, für die aus der Sicht der Gruppenleiterin seine Fähigkeiten bei weitem nicht ausreichen.
-
Es könnte sich um die Situation einer Zwickmühle handeln: Für seine gegenwärtigen Tätigkeiten ist Herr H nicht motiviert; er interessiert sich für andere, an die er aber aufgrund seiner schwachen Leistungen bei den gegenwärtigen Arbeiten nicht herangelassen wird.
-
Zusätzlich belastend wirkt in der Wahrnehmung der Gruppenleiterin das private Umfeld, das dazu beiträgt, dass Herr H sich nicht als unabhängiger, erwachsener Mensch fühlen kann. Andererseits ist sein Vater eine Person, von der Herr H sich Unterstützung erhofft und auf die er setzt. Wie weit dies reale Hintergründe hat oder eher eine Projektion ist, muss dahingestellt bleiben; zumindest erscheint es als subjektive Wahrheit von Herrn H.
-
Es entsteht der Eindruck, dass die Selbstwahrnehmung von Herrn H dominiert wird vom Hadern mit institutionellen Bedingungen, denen er ausgesetzt ist. Das Bild ist durchsetzt von indifferenten und widersprüchlichen Aussagen.
Ansätze zur Interpretation
Unter dem Blickwinkel der Stigma-Theorie könnte Herr H als Diskreditierter gesehen werden, der viele Jahre in Institutionen lebt, und dessen persönliche Entwicklung durch die Auswirkungen totaler Institutionen massiv beeinflusst ist. Jedoch erhält er seine individuellen Wünsche aufrecht und gibt seinen Widerstand gegen die Logik der Institution noch nicht auf. Die Gruppenleiterin von Herrn H könnte im Sinne einer kritischen Reflexion der Stigmatisierungsprozesse im Rahmen von Institutionen und Organisationen, die die Definitionsmacht haben, einen Beleg dafür geben, wie machtvoll diese Logik ist: Sie sieht den eigentlichen Rehabilitationsauftrag als unerfüllbar an, da sie auch nach zwei Jahren intensiven Bemühens ihrerseits um Herrn H eher Stagnation und eine umfassende Schwäche erlebt. Dies hat in der Konsequenz des personorientierten Paradigmas und des medizinischen Modells die tendenzielle Pathologisierung des stigmatisierten Individuums zur Folge; Therapiebedarf wird konstatiert. Orientiert an Alltagstheorien über die Probleme und die verzerrten und unrealistischen Perspektiven von Herrn H und unter dem gleichzeitigen Druck, vom Einzelfall zugunsten der Gruppe zu abstrahieren, schreibt sie ihm eine Sonderrolle zu. In der Interaktion zwischen Gruppenleiterin und Herrn H dürfte die eher frustrierte und etwas resignativ-ratlose Haltung der eigentlichen Autoritätsperson dem eher desorientiert und trotzig-verunsichert wirkenden Herrn H zu einer Fortschreibung des Stigmas beitragen - ein Teufelskreis, aus dem sich beide schwer, Personen mit seinem Status schon kaum befreien können.
Die Theorie integrativer Prozesse lässt bei einer Analyse der Ebenen den Rückschluss zu, dass Herr H nur wenig Einigungsprozesse in seinem Leben erfahren hat. Es hat den Anschein, als wenn sein primäres Thema, der Computer, eine Funktion des Haltgebens hat und er aus der Fixierung hierauf die Kraft zu Wünschen und zum Aufrechterhalten von Perspektiven schöpfen kann. Ansonsten pendelt Herr H zwischen Abgrenzung und Annäherung in seiner Haltung zu sich selbst und zu anderen. In der Wahrnehmung seiner Gruppenleiterin ergibt sich das gleiche Bild - mit einer duldsam schonenden, resignativen Tendenz. Da er selbst in seinem Umfeld der Stigmatisierten als besonders schwach gilt, ist seine Situation eine extrem exotisierte.
Frau I, 44 Jahre alt, arbeitet seit etwa 15 Jahren in einer Werkstatt für Behinderte, heute mit Teilzeitarbeit in der Schlosserei, wo sie Gewinde schneidet. Seit früher Kindheit lebt Frau I in der Institution, aus der sie erst vor wenigen Jahren in eine eigene Wohnung gezogen ist und zu der auch die Werkstatt für Behinderte gehört, in der sie tätig ist. Dort besucht sie vorher auch die Sonderschule und wechselt danach in die Beschäftigungstherapie über, die später als Werkstatt für Behinderte anerkannt wird. Einen konkreten Berufswunsch hat Frau I nicht. In der Werkstatt ist sie in unterschiedlichen Bereichen tätig: Töpferei, Verpackung, Metall, Textil. Sie wird mit dem Fahrdienst gebracht.
In der ersten Befragung äußert sich Frau I über ihren gesamten Weg positiv. Die Sonderschule kommentiert sie mit dem Satz, das »heißt, dass ich nicht alles richtig machen kann.« Wie es danach weitergeht, hat im Kinderheim die »Abteilung bestimmt«. Auch die zum Arbeitstraining analoge Beschäftigungstherapie sieht Frau I positiv und kommentiert, dass die Gruppenleiter »gar nicht mehr machen können.« Zu verbessern gebe es nichts, denn da »kann man ja nichts machen, kann man ja nicht nur auf uns hören und kann nicht allen es recht machen.« Obwohl sie ihre Tätigkeit nicht immer mag (»schlafe dabei ein«), will sie »hier nicht weg«, sondern »hier bleiben, ... gesund bleiben, arbeiten können, wohnen in eigener Wohnung.«
Im Rahmen der zweiten Befragung findet das Gespräch mit Frau I und ihrem Gruppenleiter, der ursprünglich als Kfz-Mechaniker gearbeitet hat, nacheinander in der Werkstatt für Behinderte statt. Da zu den Eltern kein Kontakt mehr besteht, ihre gesetzliche Betreuerin wenig Zeit hat und zudem momentan krank ist, sieht Frau I keine sinnvollen weiteren GesprächspartnerInnen.
Bevor Frau I zu eigenen Stärken und Schwächen Stellung nimmt, überlegt sie, ob sie das Gespräch sinnvoll allein führen kann: »Das ist es ja gerade. Naja, alleine kann ich das auch sagen. Eigentlich wollte ich ja (den Gruppenleiter) auch dabei haben, aber ...« Darin bestärkt, ihre eigene Sicht deutlich zu machen, fragt sie zurück: »Was ich arbeite? ... Oder was ich kann? ... Na, was kann ich? Ich kann Gewinde schneiden, ich kann eigentlich auch nieten, senken kann ich auch eigentlich, aber das ist auch nicht - das Senken geht mal gut und mal nicht so gut, weil ich es 'ne ganze Zeit lang nicht gemacht hab'. Gewinde bohren, das geht schon mal wieder.«
Ihr Gruppenleiter stellt fest: »Sie ist ein ganz nettes Mädchen.« Und er kennt ihre Unsicherheit, ihre Frage: »›Hab ich das richtig gemacht?‹ ist glaube ich auch so ein Großwerden in (dieser Institution). Das ist so dieses Heranziehen, ne, weil früher wurde viel gegängelt. Macht man heute nicht mehr. Aber früher, ja, war es bestimmt so.« Im Vergleich mit anderen MitarbeiterInnen sieht er: »Es gibt viele, die so sind wie sie. (Frau I) hat ein Problem: Bei ihr muss man ganz wahnsinnig aufpassen, dass man sie nicht überfordert, weil sie das sofort auf sich selber bezieht: ›Ich kann ja sowieso nichts!‹ Und dann kommt sie in 'ne Krise. Da muss man wahnsinnig aufpassen, weil es gibt eben Sachen, die können sie halt nicht. Das ist nun mal so. Damit muss man leben und man muss aufpassen, dass sie es eben nicht so merkt, dann muss man sehen, dass man sie vorher von der Arbeit wegnimmt oder irgendwann vorwarnt und sie was anderes machen lässt, bevor sie es selber merkt.«
Auf ihre Entwicklung blickt Frau I mit folgenden Sätzen zurück: »Ich hab ja noch in (der Institution) hier gewohnt, hier im Gelände. Ich bin seit dem dritten Lebensjahr in (der Institution) - hab ich gewohnt, seit dem dritten, vierten Lebensjahr.« Im Rahmen dieser Großinstitution besucht sie auch die »Sonderschule. Das war hier, wo das Haus jetzt steht. ... Gleich nach der Schule« wechselt sie in die Beschäftigungstherapie. »Das habe ich mir nicht ganz alleine ausgesucht. Ich wurde einfach dahin geführt, ... und dann sollte ich das und das mal machen, einfach um zu sehen, ob ich das kann, und dann bin ich da hingekommen und habe sechs Wochen Probezeit gehabt noch und war ich da 'ne ganze Zeit. Aber zuerst habe ich in der Töpferei gearbeitet. ... Habe ich auch mit Ton an der Töpferscheibe gearbeitet und so. Ich habe eine Töpferscheibe gehabt, die konnte man direkt an den Rollstuhl stellen und dann konnte ich damit arbeiten.« Sie verlässt die Töpferei jedoch, denn »da war ein Mitarbeiter, der bei uns reingeguckt hat, wie wir arbeiten, und bei mir hat er besonders geguckt und hat dann oft gesagt: ›Ja, so musst du das machen und das ist ja ganz schief!‹ (knurrt) und dann hab ich irgendwann das Handtuch geworfen. ... Ich hab in der Beschäftigungstherapie gearbeitet, da hab ich angefangen. Ja, und dann bin ich zur Töpferei und dann, dann nachher Schlosserei. Aber früher hieß das noch E-Metall - E und dann Metall. ... Und jetzt heißt das Schlosserei, seit das Haus hier gebaut ist.« Vor einiger Zeit hat Frau I eine schwere Operation gehabt: »Ich hatte so eine Stelle am Achtersten und das wurde operiert. Ich merk das ja nicht. Ich bin ja querschnittsgelähmt seit Geburt ... und weiß auch nicht, wie das Laufen ist.« Das ist der Grund dafür, dass »ich ja nur drei Tage arbeite. Ich arbeite jetzt im Augenblick nur montags und dienstags und dann donnerstags. Mittwochs arbeite ich nicht und freitags auch nicht.« Zu ihrer familiären Situation führt Frau I aus: Mit ihrer Mutter hat sie noch Kontakt, »aber wenig. Weil die nicht so kommt mehr. ... Aber ich kann damit leben. Ich wohne alleine jetzt und fühl' mich ganz wohl. ... Mein eigenes Reich. Ich kann machen was ich will so weit.« Assistenz bekommt Frau I von ihrer Betreuerin, »mittwochs, wenn sie nicht gerade krank ist. ... Ich krieg' auch Hilfe - beim Duschen, wenn ich dusche, dann krieg' ich Hilfe, weil ich ja noch 'n Klostuhl hab', ne, und ich muss ja vom Rollstuhl aus ins Bett und dann vom Bett aus auf den Klostuhl und dann ins Bad. ... Und sonst waschen oben mach' ich alleine.«
Der Gruppenleiter bezieht sich als erstes auf die schwere Operation von Frau I: Sie »hat sich wieder hochgerappelt, das muss man ganz klar sagen, weil die war sehr schwer krank. Wir haben nicht gewusst, ob sie das überleben wird oder nicht, und wir waren uns nicht sicher, ob sie das schaffen wird am Arbeitsprozess, ob sie wieder daran teilnehmen kann, denn sie war völlig unten und sie hat sich wirklich wieder hochgerappelt. ... Und sie ist ja jetzt immer noch nicht vollzeitbeschäftigt, d.h. also sie hat immer noch ihre Freitage, damit sie sich dann auch ein bisschen erholen kann. ... Aber sonst also - also mich hat es überrascht, dass sie das wirklich noch so wieder hingekriegt hat, überhaupt, wie sie so ihr Leben meistert mit ihrer eigenen Wohnung, was sie noch alles macht und tut. Sie ist ja schon zweimal umgezogen, weil sie mit der ersten Wohnung nicht zurechtkam, weil die baulich so dermaßen daneben lag, dass sie da nicht zurechtkommen konnte, und sie kriegt es irgendwie hin.« Zu der Anfangszeit von Frau I führt er aus: Sie war in der Beschäftigungstherapie, »das gab es vorher schon, und die WfB wurde ja aufgebaut. Wo ich anfing, da war sie gerade im Werden, da war sie gerade fünf Jahre alt. Das ist jetzt 15 Jahre her ungefähr. Und die musste ja auch anerkannt werden und dann kamen einige Leute aus der BT gleich in die WfB, weil sie diesen Aufbau für das Arbeitsamt nicht mitmachen brauchten. Da gehört (sie) auch zu.« Genaueres aus der Vergangenheit von Frau I ist ihm nicht bekannt: »Ich kenne die ganzen Unterlagen nicht, weil die unter Datenschutz fallen, und nur das, was ich wirklich brauche, bekomme ich und mehr nicht.«
Frau I schildert ihre Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit als hoch: »Ich bin an der richtigen Stelle eigentlich, weil ich mit (dem Gruppenleiter) und so und dann noch andere Mitarbeiter da, andere Kollegen, die bei mir da arbeiten und dann bin ich da eigentlich schon zufrieden. Nur nicht, wenn man mich auf den Kopf schlägt.« Ein Kollege »wohnt aber draußen und der hat mir einmal auf den Kopf geschlagen. Das mag ich nicht haben. Ich bin empfindlich am Kopf.« Ihre Gruppenleiter mag Frau I sehr gern: »Ja, doch. Aber es gibt aber immer wieder mal so kleine Differenzen, aber es geht. Nicht jeder hat Lust mal irgendwas zu machen oder kann das direkt nicht richtig sehen. Aber sonst mach' ich eigentlich alles, was ich kann.« Auch mit ihrem Verdienst ist Frau I zufrieden, zumal »weil ich ja nur drei Tage arbeite.« Stolz ist Frau I auch darauf, dass es ihr gelingt, selbständig zu wohnen: »Vier Jahre hab' ich es schon geschafft. ... Ich hab' auch zwei Wellensittiche, ist noch schöner, ... zwei Krachmacher, zwei ganz junge noch.« Als sie gebeten wird, Satzanfänge zu vollenden, zeigt Frau I Unsicherheit: »Weiß nicht, ob ich das kann.« Ich bin froh über ... »die Arbeit. ... Stimmt's?« Sorgen mache ich mir manchmal wegen ... »wenn es nicht klappt - oder ist das nicht richtig? Na, wenn man 'ne Arbeit kriegt und man sitzt da so lange dran, weil man das und das nicht hinkriegt und ist vielleicht sauer oder wütend. ... Oder ehe man aus der Haut fährt, dann sagt man lieber Bescheid und lässt sich das noch mal zeigen oder probiert das selbst aus, ob es klappt.« Es fehlt noch ... »Ausdauer.« Für die nächste Zeit wünsche ich mir ... »Gehört Gesundheit auch da rein? ... Gut. Klar!« Insgesamt finde ich meine Situation ... »mal so, mal so. Also weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß ja nicht, was du genau meinst damit.« Es geht um die Arbeitssituation, wie es insgesamt geht mit der Arbeit - »mal so, mal so. Heute so, morgen so (lachend).«
Der Gruppenleiter bestätigt eine gewisse Instabilität, denn »sie hat ja auch ab und zu ihre Krisen und dann ist das sehr schlimm. Dann legt sie jedes Wort auf die Goldwaage und dann muss man gucken, dass man sie da irgendwie wieder rausholt, ne.«
Für Frau I besteht die Rolle der Gruppenleitung vor allem in der Zuweisung angemessener Tätigkeiten: »Es kriegt ja jeder von uns die Arbeit, die er machen kann. Und wenn es mal was Neues ist, dann auch.« Zu ihrem Gruppenleiter macht sie eine vertrauensvolle Beziehung deutlich: »Der kennt mich am längsten.«
Er wiederum bestätigt: »Ich kenne (Frau I), seitdem ich hier bin.« Der Gruppenleiter akzeptiert die Empfindsamkeit und die manchmal auftretende Überforderung von Frau I; von daher definiert er seine Rolle als die eines Unterstützenden und Schützenden, der mögliche Überforderungssituationen von vornherein zu vermeiden versucht. Deshalb hält er es für wenig hilfreich, dass er so wenig Informationen über Frau I bekommt: »Also das ist rigoroser Datenschutz, und manchmal ärgert mich das auch ein bisschen, weil man kann viel verkehrt machen, wenn man nicht weiß, was dahintersteht.« Für ihn sind Informationen und Austausch wichtige Bedingungen gelingender Arbeit: »Da hab ich das größte Interesse dran, weil, wenn ich Leute aus dem Trainingsbereich übernehme, weil sie eben halt in der WfB bleiben, dann ist natürlich mein Bestreben, dass ich Leute bekomme, die schon mal so 'ne Ahnung haben, was hier überhaupt stattfindet, und nicht dann irgendwann feststellen: ›Das will ich nun doch nicht.‹ Von da aus bieten wir Praktika an. ... Da gibt es ja auch so Unterlagen drüber mit so Fragebögen drin, wo dann genau festgehalten wird, was die jeweiligen gemacht haben und wie sie dabei zurechtgekommen sind.«
Zur eigenen Rolle im Betrieb betont Frau I ihren akzeptierten Status: »Hier will mich ja keiner loswerden. ... Als ich das hier hatte mit der Blase, wo ich ... operiert worden bin '98, da wollten sie mich auch wiederhaben. Aber ich konnte lange nicht arbeiten, wenn, denn nur halbe Tage. Halbe Tage nachher, und dann musste ich erstmal danach zur Kur, weil ich ja lange gelegen hab - drei Monate ja.« Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, wo man hingehört - »genau«! Zur Rolle von Frau I in der Schlosserei äußert sich der Gruppenleiter nicht.
Ihre Zukunftsperspektiven sieht Frau I dort, wo sie jetzt arbeitet: »Nee, lieber nicht mehr wo anders machen.« Alternativüberlegungen weist sie zurück: »O wei, o wei, o wei. Dann würd' ich vielleicht, wenn ich an Arbeiten vielleicht nicht gedacht hätte, gar nichts machen, vielleicht. Oder erst mal sehen: Was gibt es für Möglichkeiten? Man sagt ja eigentlich, es gibt Möglichkeiten. Man könnte auch bei der Polizei arbeiten, man kann auch im Sitzen was machen. Gibt das. Aber bei mir sagt man, könnte ich nicht. Warum, weiß ich auch nicht. ... Meine Betreuerin sagt das, ja, weil ich Sozialempfängerin bin.« Ohne Arbeit »würde (es) teils bestimmt langweilig sein, denke ich mal, aber wenn man so wie ich viel - wenn ich Urlaub habe, unternehm' ich viel, fahr' alleine weg, fahr' alleine mit dem HVV (öffentlicher Nachverkehr; d. Verf.), mach' ich alleine, ehrlich.«
Der Vermutung des Gruppenleiters nach wird sich die Belastbarkeit von Frau I »auch nicht mehr ändern. Also ich bin froh, wenn sie so, wie sie jetzt ist, bleibt.« Er erwartet, dass sie auch langfristig in der Werkstatt für Behinderte bleiben wird: »Das ist wohl so. Ich mein', sie kann natürlich auch wechseln. Sie hat ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen: ›Ich möchte auch mal was anderes kennenlernen!‹ Das wird ihr keiner verbieten. Sie soll da hin, wo sie sich wohlfühlt. Und wohlfühlen könnte sie sich, meiner Meinung nach, nur in so 'ner Werkstatt. Weil es ist (anderswo) einfach zu grausam: Es wird nur nach dem Geld geguckt und nicht nach dem Menschen, und da können sie viel kaputt machen, gerade bei denen hier.« Insgesamt äußert er sich sehr skeptisch über den allgemeinen Arbeitsmarkt: »Ich komme aus dem ersten Arbeitsmarkt. Ich war früher als Geselle beschäftigt und ich weiß, wie das funktioniert, und ich weiß auch, wie mit Schwächeren umgegangen wird. Das ist unsere Gesellschaft. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Da müsste ein Umdenkprozess stattfinden, den traue ich hier im Moment niemandem zu. In der ganzen Region um Hamburg rum nicht. Ich hab da auch so meine Erfahrung: Wir haben Leute vermittelt so in die freie Wirtschaft - solange es die Fördergelder gab, war es noch einigermaßen in Ordnung, und wenn die dann weg waren, dann waren die Leute wieder hier. ... Stell' sich mal einer vor, die Leute, was die da durchmachen müssen. Was man aber nicht machen darf, dass man grundsätzlich sagt, wir machen das nicht mehr. Man muss es immer wieder versuchen. Man muss sich die Leute angucken, muss sagen: ›Bei dem könnte ich mir das vorstellen und wir versuchen es halt mal!‹ Und das Scheitern dann halt auffangen. ... Einen einzigen weiß ich, der ist erfolgreich. ... Den hab' ich damals im Arbeitstrainingsbereich gehabt, der war noch kurz (im Zweckbetrieb) unten, dann ist er vermittelt worden nach (einer Fabrik) und der ist auch immer noch da. Von den anderen: Der hat im Fassadenbau gearbeitet, sehr fit, kann zeichnen und lesen, kann alles. Krankheitsbedingt kann er aber nicht viel Leistung bringen - der ist durchgefallen, der ist wieder hier. Da gibt es einige von hier in der (Institution), die's versucht haben und ganz bös' auf die Nase gefallen sind. Es ist so. Also, es wird nur nach Kosten geguckt. Was kostet? Das kommt ja hinzu, wenn ich einen Behinderten einstelle, der hat besonderen Kündigungsschutz, für den muss ich besondere Einrichtungen schaffen, ich muss mich besonders um ihn kümmern, weil das ist nun mal so bei diesen Leuten. Das will sich keiner ans Bein binden - kein Unternehmer.« Er wägt Veränderungsmöglichkeiten ab: »Ich würde nicht ganz so weit gehen und sagen: ›Die Werkstätten sind überflüssig.‹ Aber ich würde sagen: ›Einen Teil könnte man auslagern in die Gesellschaft.‹ Nur, dann müsste die Gesellschaft das auch akzeptieren und sich damit befassen - und das machen die nicht. Das wollen die auch nicht. ... Dieses Rausgehen jetzt mit Gruppen, das ist ein Ansatz. Aber ob der angenommen wird und wie der angenommen wird, das steht für mich in den Sternen.« Denn die dominierenden Verdrängungsmechanismen »funktionieren wunderbar. Das ist traumhaft. Wir haben Abiturienten auf einem Lehrstellenplatz, wo ein Hauptschüler in Anführungsstrichen reichen würde, nur damit der eine Punkte kriegt, um mal studieren zu können. Und das finde ich ein bisschen ungerecht. Aber es ist halt so.«
Wichtige Aspekte bei Frau I
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Frau I lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Frau I blickt auf ihren Weg, der sich weitgehend innerhalb einer großen Institution bewegt, mit hoher Zufriedenheit zurück. Die Ergebnisse der ersten Befragung werden voll und ganz bestätigt.
-
Dabei weisen diverse Kommentare auf eine personale Unsicherheit und Angepasstheit hin, bei der es naheliegt, einen Bezug zur Institution zu ziehen: Offenbar ist es Frau I, wie auch der Gruppenleiter feststellt, gewohnt, dass andere ihr sagen, was richtig und was falsch ist.
-
Trotz einer stark institutionell bestimmten Sozialisation ist es ihr möglich, im Alter von 40 Jahren eine selbständige Wohnform zu realisieren.
-
Ihr Gruppenleiter sieht bei Frau I vor dem Hintergrund ihrer Geschichte und vor allem aufgrund ihrer massiven gesundheitlichen Probleme seine Rolle primär als die eines Menschen, der sie stützt und schützt, indem er ihr Wohlbefinden erhöht und Anforderungen abmildert.
Ansätze zur Interpretation
Unter der Perspektive der Stigma-Theorie kann Frau I als Diskreditierte gelten, deren Sozialisation weitgehend im Rahmen einer Institution erfolgt und die sich mit dieser totalen Institution identifiziert. Sie befindet sich dieser Theorie zufolge in einem Zufriedenheits-Paradox, das darin besteht, dass sie in einem wenig individuelle Freiheiten ermöglichenden Umfeld lebt, und trotzdem gemäß einer Logik der Anpassung zufrieden ist - die Zufriedenheit kann zu einem beträchtlichen Teil als resignative Zufriedenheit gesehen werden. Es könnte auch bezugsgruppentheoretisch angenommen werden, dass Frau I sich unter Diskreditierten wohlfühlt, da ihr die vermutete Härte der Konfrontation mit ›normaler‹ gesellschaftlicher Realität, hier der ›Welt draußen‹, erspart wird. Ihr Gruppenleiter wird von ihr als solidarische und schützende (Sach-)Autorität erlebt. Er betont ihre Sozialisation unter den Bedingungen des bereits vorhandenen physischen Stigma in einer Institution, die die soziale Identität als behindert konstruiert; so sieht er es als außerordentliche Leistung, dass Frau I im vierten Lebensjahrzehnt in eine eigene Wohnung überwechselt.
Unter dem Blickwinkel der Theorie integrativer Prozesse lässt sich sagen, dass Frau I in sehr früher Kindheit bereits die Verweigerung der Mutter, sie zu akzeptieren, hat erfahren und deren Abgrenzung ertragen müssen, was bereits eine grundsätzliche personale Unsicherheit begründet haben könnte. Ob der Grund für die Abstoßung durch die Mutter in der sichtbaren körperlichen Schädigung liegt oder in welchem Maß andere Faktoren eine Rolle spielen, muss offen bleiben. In einer damals noch anstaltsähnlichen Institution wird sie nach Mutmaßung des Gruppenleiters in einer großen Gruppe Ausgesonderter auf Anpassung an dortige Regeln sozialisiert. So kann man in den Kategorien der Theorie integrativer Prozesse konstatieren, dass Frau I in mehrfacher Hinsicht Desintegration erlebt - bis hin zur gleichzeitigen Anpassungforderung innerhalb der Aussonderung. Individuation, Emanzipation und Normalisierung dagegen spielen nur partiell - so vermutlich im Wohnumfeld seit zwei Jahren - eine Rolle. Für Frau I könnte das Integriertsein in der Schlosserei einer Werkstatt für Behinderte bereits ein hohes Maß an möglicher Normalisierung bedeuten, denn dort wird sie zumindest vom Gruppenleiter mit allen Stärken und Schwächen gesehen und akzeptiert und dort ist ihre Anwesenheit erwünscht und Begegnung, Kooperation und Gemeinsamkeit sind mit verschiedenen Personen möglich - wenngleich unter den gesellschaftlich exotisierten und institutionell ausgesonderten Bedingungen einer Werkstatt für Behinderte.
Frau J, 43 Jahre alt, ist seit 23 Jahren Mitarbeiterin einer Werkstatt für Behinderte. Dort arbeitet sie in einer Verpackungs- und Montagegruppe, füllt Tinte ab und versieht die Behälter mit Etiketten. Aus einer Juristenfamilie stammend, besucht Frau J eine Schule für Körperbehinderte. Von dort wechselt sie in das Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte, in der sie heute noch tätig ist. Ihren eigentlichen Wunsch, einen pädagogischen Beruf als Erzieherin oder Lehrerin oder einen naturwissenschaftlichen Beruf (Biologie, Chemie, Physik) zu erlernen, kann sie nicht realisieren, denn »alle haben wegen der Anfälle zur WfB geraten.« Sie betont jedoch, sie »selber hätte lieber in der freien Wirtschaft gearbeitet.« In der gleichen Gruppe arbeitet ebenfalls seit 23 Jahren ihr Mann, mit dem Frau J seit langer Zeit im gleichen Haus, seit einigen Jahren in einer Wohngruppe lebt und mit dem sie seit zwei Jahren verheiratet ist.
In der ersten Befragung äußert sich Frau J über ihre Schulzeit positiv, sie »wäre gern länger zur Schule gegangen.« Ihr Betriebspraktikum macht sie in einer Wäscherei des ersten Arbeitsmarktes. Zur Berufsberatung, sagt Frau J, »möchte ich mich nicht äußern«, jedenfalls ist das Ergebnis der Gespräche: »Meine Eltern haben sich letztlich von der Werkstatt überzeugen lassen.« Das Arbeitstraining bewertet Frau J eher positiv, obwohl sie betont, »ich hätte lieber meine Lieblingsjobs im Beruf umgesetzt.« Obwohl sie auch ihren Arbeitsplatz im Bereich Verpackung und Montage nicht gewünscht hat, akzeptiert sie ihn, denn »WfB und Eltern haben sich darauf geeinigt.« Als das Arbeitstraining zu anstrengend wird und die Anfälle zunehmen, geht Frau J zur Halbtagsarbeit über. Lange Zeit will sie sich »andere Werkstätten und Firmen anschauen«, doch das »hat nie geklappt.« Auch Fortbildungswünsche werden abgelehnt mit Sätzen wie: »Das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht.« Inzwischen hat sie all dies aufgegeben, und auch den Arbeitsbereich innerhalb der Werkstatt für Behinderte will sie nicht mehr wechseln, denn sie arbeitet mit ihrem Mann in einer Gruppe: »Ihm wäre das nicht recht,« und sie will ihn »nicht alleine lassen.« Obwohl Frau J die Tätigkeit mag, ist sie mit ihrer Beschäftigungssituation nur mäßig zufrieden. Nach wie vor hat sie eigentlich deutliche Interessen im naturwissenschaftlichen Bereich, jedoch »nimmt man mir aus Angst vor Anfällen die Chance, anderes auszuprobieren.«
Die zweite Befragung findet mit Frau J und ihrem Ehemann als ihrer Vertrauensperson in deren gemeinsamer Wohngruppe statt. Das Gespräch mit dem Gruppenleiter, früher Malermeister, selbst Vater eines behinderten Sohnes und mit Frau J seit 23 Jahren in der gleichen Gruppe, wird in der Werkstatt für Behinderte geführt.
Über ihre Stärken und Schwächen macht Frau J eine Reihe von Aussagen. Ihre Stärken sieht sie in ihren breitgefächerten Interessen, etwa für Biologie, Erdkunde und Geschichte, beispielsweise im Rahmen von Erwachsenenbildungskursen. Auch ihr Mann findet gut, dass sie »so interessiert ist, aktiv ist.« Bezogen auf die Arbeit nennt Frau J, »dass ich besonders gut verpacken kann. Darum bin ich auch in der Abteilung Verpackung und Montage. Mich interessieren aber auch durchaus andere Sachen. Nur da ist, wie gesagt, schwieriger dranzukommen.« Als Schwäche sieht Frau J zum einen ihre Feinmotorik, die es ihr erschwert, Montageaufträge »zusammenzukriegen«, zum anderen beeinträchtigen sie ihre epileptischen Anfälle und die damit verbundenen Medikamente.
Der Gruppenleiter von Frau J sieht ebenfalls diese gravierenden Beeinträchtigungen: »Vor allem aufgrund der Epilepsie, die sie hat, ist ihr Kurzzeitgedächtnis ja immens gestört. Sie muss immer wieder teilweise bei Arbeiten, die wir denn vor längerer Zeit hatten, ... neu angelernt werden, neu trainiert werden und so weiter, und das ist das, was bei (Frau J) auffällig ist. Aber wie gesagt, das haben wir von medizinischer Seite erfahren, das hängt mit diesen Epilepsieanfällen zusammen. Das Langzeitgedächtnis funktioniert also noch relativ gut.« Auch sieht er »manuelle Schwierigkeiten. Sie hat einen Spasmus in den Händen und da ist sie so verklammert (seufzend) - ach, sie zerstört viel Arbeit und ich kann (ihr) weiß Gott nicht jede Arbeit anbieten.« Jedoch bestätigt er auch die vielfältigen Interessen von Frau J und benennt zudem hohe verbale Fähigkeiten: »Sie artikuliert sehr sauber, das muss man sagen, das hat sie schon immer getan und ... (sie) war nicht nur auf einer Sonderschule, sondern hat auch ein paar Hauptschuljahre gemacht. Und aufgrund dessen hat sie ein gesundes Allgemeinwissen, ... und kann hier ganz schön mitreden. Wir klönen hier natürlich über alles Mögliche, über politische Geschehnisse vom Tag und so weiter, die Zeitung nehmen wir hier durch und da ist es denn gerade (Frau J), die denn auch Fragen stellt und sich über dies und jenes wundert.« Zu ihren Fortbildungsinteressen merkt er jedoch kritisch an: »Jaja, das stellt sie immer in den Vordergrund, und das ist aber so eine Geschichte. ... Naja, ist sie halt stolz drauf, aber da steckt nicht allzu viel hinter. Letzten Endes hat sie da wenig Interesse dran, aber sie bekundet es halt immer so, und wenn wir sie dann vor nackte Tatsachen stellen: ›Ja, Du hast jetzt die Möglichkeit hier, einen PC-Lehrgang mitzumachen oder dies und jenes und so.‹ - ›Ach nee.‹ - Dann nicht.« Zudem hat der Gruppenleiter den Eindruck, Frau J lebe »in diesem Erscheinungsbild. Sie hält sich hier auch für 'ne kleine Lehrerin, indem sie andere Leute dann maßregelt: ›Nein, das siehst du verkehrt, und bedenke doch mal!‹ ... Sie belehrt sie ... und dann gibt sie auch oft was Falsches« von sich.
Frau J reflektiert ihre Entwicklung folgendermaßen: Ihr ursprünglicher Berufswunsch im erzieherischen Bereich wurde »schon in der Schule und im Kindergarten angeregt. Ich hab zugesehen, wie andere gefüttert wurden. Dann hab ich regelrecht im Kindergarten fast gebettelt, das auch mal machen zu dürfen. Mir ist ständig geholfen worden. Ich hab' auch so Sachen erlebt, wie man anderen hilft und so weiter. Deshalb habe ich auch in der Schule einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, den würde ich gerne wiederholen.« Vor diesem Hintergrund tut sie sich mit dem Schritt in die Werkstatt für Behinderte schwer: »Also ich selber wäre nicht gern in sowas hineingeraten, nur dann haben sich meine Eltern mit der Behörde unterhalten, und die haben absolut abgeschlagen, dass ich in öffentliche Betriebe käme - aufgrund der Epilepsie. Das gab eine Diskussion mit meinen Eltern, und da haben die letztendlich eingeschlagen. Ich meine - pffff - was soll ich da jetzt machen?« Tatsächlich sind ihre epileptischen Anfälle schon damals »nicht ganz ohne, manchmal zwei oder drei den Tag, das war unterschiedlich. ... Mittlerweile, jetzt durch die Umstellung ist das etwas weniger geworden. ... Also sehr viel auch gar nicht, das ist gesunken.«
An das Arbeitstraining kann sich Frau J nur vage erinnern: Da »macht man natürlich noch andere Sachen als Verpacken, ... im Moment habe ich da echte Schwierigkeiten, das alles zusammenzukriegen.« Sie erinnert sich jedoch daran, dass sie nicht Töpfern oder Büroarbeit gemacht hätte: »Nein, sowas nicht. An sowas bin ich ja gar nicht rangekommen.« So fängt Frau J in der Verpackung und Montage an, wo sie ohne Unterbrechung bis heute arbeitet: »Also es gibt Sachen, die ich gerne mache in der Verpackung, aber es gibt auch Sachen, die ich gerne trotzdem mal versuchen würde. Und mein Gruppenleiter lässt mich auch manchmal was ausprobieren, aber wir merken das beide, dass ich Schwierigkeiten hab'. Aber gut, wo es klappt, da mach' ich sie denn auch mal.« Darüber hinaus wird ihr immer wieder vorgeschlagen, ein Praktikum in einer anderen Gruppe der Werkstatt für Behinderte zu machen, aber »das Problem ist: Also ein Praktikum mache ich eigentlich nur dann, wenn ich anschließend vorhab', wo anders zu arbeiten. Wenn mir die Chance nie gelingt, wenn da nie Angebote ankommen, sie alle abgelehnt werden, dann hat meiner Meinung nach ein Praktikum auch keinen Sinn.«
Ebenso sieht sie die Möglichkeiten der innerbetrieblichen Erwachsenenbildung: »Wir haben jetzt wieder ein kleines Heftchen gekriegt, wo Vorschläge für solche Kurse angeboten sind. Eins würde ich gern mitmachen, aber ich glaub', da würde ich wieder 'ne Absage kriegen. Wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren mich so viel für solche Sachen interessiert und ich hab' so viele Abschläge gekriegt, dass ich eigentlich gar keine Laune hab', mich mehr zu melden.« Ihren Interessen geht Frau J nun in der Freizeit nach: »Aufgrund dessen, dass mir das bis jetzt immer abgeschlagen ist, hab' ich mich natürlich gut an anderen Sachen abreagiert. Das hat eigentlich schon was gebracht. Ich hab' hier meine Hobbys ausgeweitet. Dann hab' ich die Sachen, die mir abgeschlagen sind, zum Hobby gemacht. Warum denn nicht. Dann hab' ich eben so gesehen meinen dicken Kopp durchgesetzt. Is' ja so.«
Der Gruppenleiter sieht Frau J's Entwicklung durch ihre Epilepsie dominiert: »Früher hatte sie die Blitz-Nick-Salaam-Epilepsie, dies aus heiterem Himmel (nickt): Zack! Und hatte so einen kleinen Wegtreter, aber kam dann schneller wieder zu sich. Aber jetzt: Wenn sie jetzt einen Anfall kriegt, ist die fertig, am Boden zerstört. Dann holen wir sie hier mit dem Rollbett ab und dann legen wir sie oben in den Ruheraum und das dauert dann zwei Stunden und dann hängt sie hinterher immer noch so. ... Sie hat jetzt die schweren Anfälle, das sind die Grand-Mal-Anfälle, wo das richtig mit Zuckungen und mit Erbrechen losgeht, da sterben 10.000 Gehirnzellen so, medizinisch sind wir da informiert worden.« Er sieht, dass Frau J insofern »natürlich ein bisschen abgebaut« hat, aber »das haben hier sehr viele.«
Auch der Mann von Frau J, wegen dem sie im ersten Interview nicht ihre Gruppe verlassen zu können meint, betreibt als gesundheitlichen Gründen seinen vorzeitigen Rentenbeginn: »Ich warte auf einen Brief von der Behörde, ich werde jetzt erst 48 und ich warte immer noch auf die 50 Jahre, früher in Rente zu gehen.« Frau J kommentiert dies: »Wenn er aus - was ja Thema ist - Gesundheitsgründen das macht, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt Ade sage. Also ich wäre noch zu jung dafür, würd' ich denken.«
Frau J zeichnet ein ambivalentes Bild ihrer Zufriedenheit: Wiederholt hadert sie mit der Entscheidung von Behörde und Eltern, dass sie in die Werkstatt für Behinderte gehen soll: »Ich wär' gern in das Gespräch reingefahren, das die da mit meinen Eltern geführt haben, aber naja. ... Enttäuscht bin ich natürlich gewesen.« Sie findet die Werkstatt als Institution »sehr wichtig«, besonders für »Behinderte, die schwerer behindert sind. ... Sonst hätten die Langeweile zuhause. Aber, wie gesagt, ich würde gern in einen Außenbetrieb reingehen.« Sie bekräftigt: »Wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, dann würde ich auch gern was anderes machen und auch außerhalb der Werkstatt. ... Letztlich bin ich nicht unzufrieden, aber man gibt sich ja eben doch damit letztendlich ab, weil, wenn einem die Türen alle zugehalten werden - wo will man da denn noch Anschluß kriegen? ... Sonst bin ich gerne in der Werkstatt, das ist nicht die Sache.« Unzufrieden ist Frau J mit ihrem Verdienst: »Ich würd' mich ja gerne über ein bisschen mehr Kohle freuen. ... Die wüsste ich schon zu verwenden.«
Mehrfach thematisiert Frau J Effekte ihrer Epilepsie: »Ich bin jetzt durch die Tablettenumstellung ruhiger geworden als ich bin, aber - es wäre natürlich schön, wenn es auch anders wäre, wenn ich die nicht nehmen würde. Also sowieso nicht, ohne Epilepsie, meine ich jetzt.« Vieles, was Frau J gern täte, wird mit der Begründung ihrer Epilepsie abgelehnt. So würde sie gern an einem Kurs ihrer Werkstatt für Behinderte zum Thema: ›Was muss ich über einen Außenarbeitsplatz wissen?‹ teilnehmen, vermutet jedoch resigniert, dort nicht teilnehmen zu dürfen: »Weil mir von den anderen Sachen, bei denen ich mich beworben hab', die sind mir alle abgeschlagen. Und dann verliert man natürlich auch den Mut. ... Bezieht sich alles auf die Epilepsie. Deshalb kann ich Kurse, die ich gerne machen würde, aber die mir abgeschlagen sind, nicht machen.« Andere befürchten, »so weit ich das überblicken kann, dass ich da zu unbeholfen bin oder eben auch dauernd Anfälle kriegen kann. ... So wie ich das verstanden hab', so kommt das bei mir auch immer an, dass es abgeschlagen wird, nicht weil es abgeschlagen wird, sondern eben alles auf die Behinderung bezogen.«
Auch der Gruppenleiter von Frau J sieht ihre Unzufriedenheit: »Sie möchte zu gern wie 'n gesunder Mensch leben, sie möchte auch gerne einkaufen gehen und ihre täglichen kleinen Dinge da verrichten.« Immer wieder führen Frau J und er Gespräche über das Dilemma, dass sie mehr selbständig tun möchte, sich aber sofort die Frage nach Verantwortung und Aufsicht aufdrängt, wenn sie allein unterwegs ist und einen Anfall bekommt: »Ich sag: ›Du, Anfalls-kranke ..., die so plötzlich, also blitzartig einen Anfall kriegen, dürfen nicht ohne Aufsicht sein. Das ist nun mal so.‹ Und das ist eben ihr größter Kummer und ihr größter Ärger, dass sie nicht das darf, was andere dürfen. Und da leidet das Mädchen dran - also wirklich.« Dieses Problem stellt sich für den Gruppenleiter vor allem in der Freizeit, denn in der Werkstatt für Behinderte »wird sie ja wunderbar betreut, hier ist sie sehr gut aufgehoben, hier kann sie und darf sie alles, geht alleine zum Essen und dies und jenes.« Bei der Arbeitssituation sieht er, dass Frau J durch ihre Spastik in den Händen Probleme bei mancher Fertigung hat: »Ab und zu gibt's da manchmal so einen Ruck, leider. Und das stört doch sehr. Und sie ist da auch drüber verärgert, wenn sie sieht, wie schön und gepflegt und glatt die anderen die Arbeit denn können, und sie kann das dann nicht so.«
Die Rolle des Gruppenleiters besteht unter anderem darin, in solchen Situationen mit Frau J schonend umzugehen: »Dann kriegst du von ihr so total zerknautschte Papiere - kannst' gar nicht mehr abschicken. Dann muss ich sagen: ›Ach, liebe (Frau J)‹, das tut mir denn auch im Herzen weh, sie möchte es so gerne und ich sag': ›Du, guck mal, wir können das dem Kunden nicht zumuten, dass er das so in Empfang nimmt. ‹« Darüber hinaus stellt er für Frau J immer wieder spezifische Vorrichtungen her, »dass sie da gut mit klarkommt, dass sie denn doch die eine oder andere Arbeit, die sie eigentlich nicht könnte, dass sie die denn doch erfüllen kann so weit.« Überhaupt versucht der Gruppenleiter, Frau J immer wieder aufzubauen: »Ich sag immer: ›Mensch, Du musst nach unten gucken, nicht nach oben. Es gibt Leute, Menschen auf dieser Erde, die sind weitaus schlimmer betroffen. Die habt ihr ja selber drüben da im Wohnbereich, die da im Rollstuhl hängen, die sich kaum bewegen können und nicht sprechen. ... Da bist du doch 'ne starke Person gegen. Sei doch zufrieden mit deinem Schicksal so. Das ist nun mal so und lässt sich nicht ändern. Und du hast da deinen (Mann) ... und ihr könnt zusammen...‹ Also zusammen dürfen sie ja beide los, er hakt sie dann unter, ja, ... und dann hab ich sie auch mal am (Nachmittag) getroffen, sind die beiden da einkaufen gegangen. Oder hat sie im Rollstuhl geschoben.« Gleichwohl gehört es auch zu seiner Rolle, Frau J zu bremsen, wenn sie allzu belehrend mit ihren KollegInnen in der Gruppe umgeht und beim allgemeinen Gespräch über Aktuelles falsche Dinge behauptet: »Da schalte ich mich dann sofort ein und sag: ›Nee, Moment, das stimmt so nicht, da müssen wir mal ganz sachlich bleiben.‹ Ja, das mache ich denn halt.« Als alter Vertrauter ist der Gruppenleiter auch an der Gestaltung der Hochzeit beteiligt gewesen: »Ich hab da Musik gemacht - ich mach' ja ab und zu einen auf Diskjockey. Das war eine ganz tolle Hochzeit, ... richtig mit Kirche, mit allen Schikanen.«
Der Hintergrund für die Tätigkeit des Gruppenleiters ist dabei ein spezifischer: »Da gibt es 'ne ganz klare Sache. Ja: Ich habe einen behinderten Sohn. Und ich war ein gesunder Malermeister, bin immer noch gesund, Powertyp, ne. Und da hab' ich gesagt: ›Du musst was tun. Du musst nicht nur reden und sabbeln‹ - Ich war damals im Elternrat von dieser Sonderschule denn, nicht.« In diesem Rahmen lädt er den damaligen Leiter der ersten Werkstatt für Behinderte - »noch so 'n Provisorium, so 'n Barackendings« - zu einem Elternabend ein zur Frage: »Was wird aus unseren Zöglingen nach der Schule, wo bleiben sie?« Während eines Films über diese erste Werkstatt für Behinderte »klopft er mich auf die Schulter und sagt denn: ›Wir planen ein großes Projekt, ... wir suchen dynamische Handwerksmeister, hätten Sie nicht Lust?‹ ... Und nach 'm halben Jahr war es schon so weit, da habe ich da drüber nachgedacht: ›Ach, dann bist Du beim Staat, hast immer pünktlich Feierabend.‹ ... Ich war damals ein kleiner Handwerksmeister mit ein paar Gesellen und dann bis in die Nacht, weil der Auftrag fertig sein musste, weil morgen ein anderer Auftrag ansteht und so, und das war das ganze Dilemma. Ja, aufgrund dessen bin ich in dieser Geschichte gelandet.«
Frau J weiß auch um die spezifische Vorgeschichte ihrer Gruppenleiters und hält ihn schon von daher für kompetent: »Jaha, das sind ja Gruppenleiter, die sich als Gruppenleiter angeboten haben, weil sie selber ein behindertes Kind haben, das heißt, das machen ja ganz viele Eltern, die selber ein behindertes Kind haben. Die wissen natürlich auch, wie man mit solchen Leuten umgeht. Das müssen sie ja schon durch die eigenen Kinder wissen.« Sie ist der Überzeugung, es gebe »eine Grenze zwischen den Nichtbehinderten, die einen solchen Job angenommen haben über ihre Kinder, die behindert sind, und den Nichtbehinderten, die keinen Kontakt zu Behinderten haben, ... das sind ja zwei verschiedene Stufen.« Weiter sorgt der Gruppenleiter »mit für die Arbeit, wo es Probleme gibt bei der Arbeit, und sonst bietet er uns auch mal kleinere Sachen an.« An dieser Stelle betont der Mann von Frau J, der Gruppenleiter sei »ein Mensch, ... ein Typ, der mehr Action macht. ... Ich meine, er sorgt für Arbeit, immer hübsch nebenbei Discomusik. ... Mit dem machen wir öfter Reisen. ... Ich weiß, dass er Humor hat, ... dass er immer voreilig ist, alles vordenkt, was wir machen, vordenken, nicht nachdenken, wenn wir arbeiten. ... Ich hab' ja immer mit ihm viel Spaß gehabt, auch humorvoll, er kann ja gute Witze. In meiner Beziehung ist er ein echter Kumpel.« Auch gibt es manchmal Kontroversen: »Doch, das haben wir schon, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Aber wir geben uns auch gegenseitig Recht.«
Bezüglich der eigenen Rolle im Betrieb zeichnet Frau J ein Bild nicht sehr intensiver Kontakte: »In der Gruppe selbst, ... da ist gute Stimmung.« Private Kontakte gibt es jedoch nur, »wenn einer Geburtstag hat und der wen eingeladen hat.« Für sich selbst meint sie: »Na, ich hab' noch ehemalige Klassenkameraden, die da arbeiten. Zu denen kann ich natürlich noch wieder Kontakte schließen« - und sie zählt eine Person auf. Ihr Mann hingegen meint, »wir sind eine starke Gruppe. Wenn wir unter Zeitdruck sind, hauen wir alle rein.« Einig sind sich beide darin, dass ihre Partnerschaft eher in der gemeinsamen Wohnsituation denn in der gemeinsamen Arbeitssituation entstanden ist, denn bei zweiterer sei es »gar nicht so einfach, jemanden zu finden.«
Der Gruppenleiter sieht die Rolle von Frau J als eine besondere: »Also das kann ich ja sagen, da hat sie anderen was (voraus): Sie interessiert sich für alles. ... Und ist da auch ganz schön stolz drauf. Sie bringt das immer wieder ins Spiel, um andere hier zu beeindrucken, das macht sie natürlich ganz gerne, wirft gerne auch mal so mit Fremdwörtern um sich, auch wenn die denn gerade in dem Moment nicht passend sind (lachend). Das ist so (Frau J), ja. Aber sonst unheimlich freundlich zu allen und möchte auch alles machen.« Der Gruppenleiter zitiert Frau J mit Sätzen wie: »Ja, das ist dann ja rein prinzipiell. Und: Du musst das mal realistisch sehen!« Er bezeichnet es als »ihre kleine Macke: Sie kehrt hier gerne die Lehrerin raus, da ragt sie insofern (raus), dass sie spürt, dass sie sich besser artikulieren kann, dass sie besser einige Sachen ... durchdenkt und so weiter, und das spürt sie natürlich und das lässt sie hier alle anderen voll spüren. Dann heißt es hier auch schon mal: ›Ach, diese Angeberin!‹ Und: ›Kannst Du nicht mal deutsche Wörter benutzen?‹ ... Und dann legt sie hier aber los.« Deshalb wird sie aber nicht in der Gruppe abgelehnt; lediglich mit einer Kollegin gibt es Antipathien, »das werden keine Riesenfreundinnen, ... aber akzeptieren tun sie sich schon.«
Ihre Zukunftsperspektiven macht Frau J weiter von ihrem Umfeld abhängig: »Die Werkstatt will das noch, dass ich noch ein Praktikum mache in einer anderen Gruppe.« Ihren ursprünglichen Ideen entsprechend schwebt Frau J jedoch eigentlich immer noch vor, »in der Biologie zu arbeiten oder in der Chemie.« Skeptischerweise glaubt sie jedoch: »Meinungsmäßig der Werkstatt wegen habe ich da gar keine Chance. Sonst von mir aus herzlich gerne.« Und sie sieht das große Problem, dass »Nichtbehinderte nicht wissen, wie man mit Behinderten und Epilepsiekranken und so weiter umgehen kann und soll. Außenstehende wissen das ja nicht. ... Das ist Meinung in der Gesellschaft und was soll ich denn dazu jetzt sagen?« Deswegen ist sie auch wenig motiviert zu Kursen, die auf mögliche Veränderungen der beruflichen Situation zielen: »Wenn ich jetzt so einen Kurs mache, dann bin ich natürlich auch daran interessiert, mich nicht nur an so einen Kurs anzuschließen, sondern eventuell dann auch einen Weg zu finden, ins Außenbetriebliche zu kommen, aber die Tür kann ich mir zumachen.« Selbst die Chance auf einen Außenarbeitsplatz sieht Frau J als sehr ungewiss: »Vielleicht habe ich ja damit noch Glück, weiß ich ja nicht. Zum Beispiel dass ich dann auf 'nem Außenarbeitsplatz - ich glaube nicht, dass ich über ein Praktikum - jedenfalls sind die Praktiken nicht so ausgearbeitet, dass man anschließend in die freie Wirtschaft gehen könnte. Jedenfalls hab' ich davon noch nichts gehört.« Zudem sorgt für Skepsis, »dass man in meinem Alter schon keinen Außenbetriebsanschluss mehr kriegt, dass man da schon zu alt für sein soll. Das weiß ich aber nicht. Das habe ich über andere Leute, die in anderen Gruppen arbeiten, so beiläufig mitgekriegt.« Mit einer Mischung aus Resignation und Frustration resümiert Frau J, dass ihr Umfeld ihr nach wie vor wenig Selbständigkeit zutraut: »Jedenfalls bin ich da skeptisch, dass sich da was ändern wird. ... So wie sich das bei mir zeigt, hab' ich jedenfalls den Eindruck, dass sich das bei mir auch langfristig nicht ändern wird, weil da zu viel Angst dahintersteckt aufgrund der Epilepsie. ... Ich hab' mich dran gewöhnt, aber irgendwo ärgert es mich natürlich doch. Aber: Was soll man jetzt machen?«
Der Gruppenleiter sieht die Situation von Frau J ähnlich: »Wenn ich sehe, wie viele Medikamente sie so zu sich nimmt, ich glaub', das sind so 28 Pillen am Tag, so, und wenn ich dann so 'n klein bisschen weiß - diese Nebenwirkungen! Ich seh' das auch so am Äußeren, jetzt kommt sie auch nicht mal mehr mit zum Schwimmen. .... Und wie gesagt, das Kurzzeitgedächtnis, das wird immer schlimmer, das kommt eben halt durch die Anfälle.« Früher hätte er Frau J mit einer Unterstützung wie durch Arbeitsassistenz viel zugetraut: »Sicherlich! Die hätte ... also Telefondienst und all' solche Geschichten hätte sie locker bewältigt. Locker!« Allerdings hat er Zweifel, ob reguläre Betriebe sich auf die Epilepsie von Frau J einstellen könnten: »Nein, das ist ja eben die Gefahr: Weil wir drauf geschult sind und mit diesem Personenkreis bekannt sind und wir wissen, wie wir zu reagieren haben, und wir wissen auch die Auswirkungen hinterher und so weiter. Ich glaub', wenn das - andere sind schockiert. Das erlebst' immer wieder, wenn du auf der Straße oder irgendwie auf dem Bahnsteig (bist) und da kriegt jemand mal 'n Anfall - die sind ja alle entsetzt.« Heute sieht er als Perspektive von Frau J: »Sie wird weiterhin abbauen, und die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Sie wird auch wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren in Frührente gehen. Das zeichnet sich ja ab.« Als der Antrag auf Frührente für ihren Mann gestellt wird, wird dies auch Frau J als Möglichkeit aufgezeigt: »Wir haben mit ihr gesprochen und gesagt: ›Hier, möchtest Du denn auch - oder möchtest Du weiter arbeiten?‹ - ›Nein, ich komm ja um vor Langeweile,‹ hat sie ganz klar gesagt: ›Nein, ich möchte weiter kommen.‹ ... Das ist nach wie vor so: Der Wunsch des behinderten Menschen ist uns höchster Befehl, das halten wir so und das wird auch immer so bleiben.«
Wichtige Aspekte bei Frau J
Aus den Schilderungen der Geschichte und der aktuellen Situation von Frau J lassen sich folgende zentrale Kernpunkte herauslesen:
-
Frau J gehört der Generation von Menschen mit Behinderungen an, deren Eltern um den Aufbau von förderlichen Bedingungen und Institutionen gekämpft haben. Der Gruppenleiter, selbst Vater eines behinderten Sohnes, gehört der Generation ihrer Eltern an und engagiert sich ebenfalls in dieser Weise.
-
Nachdem Frau J in der ersten Befragung zu den mittelgradig Zufriedenen gehört, wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass sie einerseits auch noch nach mehr als 20 Jahren mit der Entscheidung hadert, in die Werkstatt für Behinderte zu müssen. Andererseits hat sie sich mit der Situation dort arrangiert, hat Formen gefunden, ihren Interessen privat nachzugehen und ist nicht unzufrieden - auch bei Frau J gibt es eine Tendenz zu resignativer Zufriedenheit.
-
Vor allem aber hadert Frau J auch mit Mitte 40 noch mit den direkten und indirekten Folgen ihrer Epilepsie.
-
Frau J zeigt mit ihren Schilderungen ihre Situation als die einer Zwickmühle: Einerseits gibt sie ihre ursprünglichen maximalen Zielsetzungen und Wünsche nicht auf - Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt - und entwickelt zusätzliche relativierte kleinere Ziele - wie das eines Außenarbeitsplatzes. Andererseits kommen zwei Momente zusammen, die jegliche Realisierung von Zielen verhindern und für Stagnation sorgen: Das Umfeld signalisiert ihr, dass wegen der Anfälle vieles zu riskant und der einzig für sie mögliche Arbeitsort die Werkstatt für Behinderte sei, und Frau J vermeidet jegliche konkrete Schritte, indem sie diese sinnvoll nur bei Erfolgsgewissheit gehen zu können meint. So bleibt alles beim alten.
-
Dass Frau J aus einer Familie mit akademischem Hintergrund kommt, mag zu ihren ausgeprägten verbalen Fähigkeiten und ihren breit gefächerten Interessen beigetragen und Berufswünsche und Alltagsorientierungen nachhaltig mitgeprägt haben.
Ansätze zur Interpretation
Der Stigma-Theorie folgend kann Frau J als Diskreditierte angesehen werden, die teils die Auswirkungen ihres Stigmas leugnet, sie teils aber auch notgedrungen hinnimmt. Dies ist nur zu ertragen, indem sie die Verantwortung dafür anderen zuweist und so eine Opfer-Rolle einnimmt. Der medizinisch bedingte Kontrollverlust - sowohl durch Anfälle als auch durch massive Medikation - legt diese Rolle auch sehr nahe, zudem wird diese Tendenz durch die in dieser Generation übliche Sozialisation innerhalb von Institutionen verstärkt. Diese Haltung enthält eine spezifische Mischung von Frustration und Resignation. Vielleicht durch den akademischen Hintergrund der Herkunftsfamilie verschärft, leistet Frau J in der Werkstattgruppe Widerstand gegen dieses Stigmatisierungsgefühl, indem sie versucht, die Normalität eines ›kreditierten gesunden Menschen‹ zu inszenieren und dabei diese Rolle als ›kleine Lehrerin‹ überzeichnet. Der Gruppenleiter, der sich als Anwalt, Schützer und Moderator für Menschen mit Behinderungen definiert, betont gegenüber Frau J immer wieder relativierend zum Trost, dass es stärker Diskreditierte gebe.
Gemäß der Theorie integrativer Prozesse zeugt das Hadern von Frau J mit ihrer Epilepsie von einem inneren Uneinssein: Ihre Aufmerksamkeit scheint gebunden zu sein an Formen der Verleugnung jeglichen Andersseins und zugleich beschäftigt mit der Verfolgung der ungewollten Anteile. Bestärkt wird dies durch die Handlungen des Umfeldes, das in der Wahrnehmung von Frau J auf ihre Interessen mit Verweigerung reagiert und diese vornehmlich mit den Gefahren für Frau J durch die Epilepsie begründet. Institutionell fühlt Frau J sich spätestens durch die Zuweisung zur Werkstatt für Behinderte auf den Pol der Verschiedenheit festgelegt und ausgesondert, was ihre Sehnsucht und Wunschprojektionen um so mehr zum Gleichheitspol zu treiben scheint; die Balance aber, Prozesse der Einigung bis zur Normalisierung geraten so zunehmend aus dem Bereich des Realisierbaren. Der Gruppenleiter zeigt sich in der Identifikation mit dem Aufbau der Institution als Vater eines behinderten Sohnes aus der selben Generation voll überzeugt von der prinzipiellen wie der individuellen historischen Notwendigkeit der Institution, die die gesellschaftlich Ausgesonderten integriert und gut behandelt, da Gleichheit als unmöglich und auch Möglichkeiten der Einigungen und Balance als utopisch gesehen werden. Er beschwichtigt von daher Frau J und macht sie darauf aufmerksam, dass es anderen noch schlechter gehe.
Da die Einzelbeispiele bereits jeweils am ihrer Darstellung zusammengefasst worden und unter zwei theoretischen Perspektiven eingeschätzt worden sind, sollen an dieser Stelle zusammenfassende Bemerkungen die Ergebnisse der zehn Studien in 17 Punkten bündeln.
-
Bei den befragten MitarbeiterInnen in den Werkstätten für Behinderte ist eine langfristige Orientierung auf die dortige Arbeit durch die Sonderschule, entsprechende Praktika und Berufsberatung erkennbar. Ihre Eltern sehen die Werkstatt für Behinderte z.T. kritisch, tolerieren sie pragmatisch oder nehmen die verfügt Zuweisung hin - letzteres vor allem älteren Befragten.
-
Die MitarbeiterInnen in den Werkstätten wünschen sich nach z.T. langjähriger Zugehörigkeit zum großen Teil eine Tätigkeit ›draußen‹ und hadern mehr oder weniger stark mit ihrer Situation; selbst die eigentlich (nach der ersten Befragung sehr) zufriedenen sind nicht nur durchgängig zufrieden, sondern weisen u.U. teilweise eine resignative Zufriedenheit auf. Zudem ist ihren Aussagen nach die Peer-Group innerhalb der Werkstatt für Behinderte keineswegs eine Garantie für Akzeptanz und Freundschaft, und sie bedingt nur partiell Zufriedenheit. Somit deutet sich an, dass die MitarbeiterInnen der Werkstätten fast durchgängig ein Bewusstsein haben, das den ersten Arbeitsmarkt als das ›Eigentliche‹ und die Werkstatt für Behinderte als ›Uneigentliches‹ sieht; hier wird die gesellschaftlich subsidiäre Funktion der Werkstatt für Behinderte, also ihrer Zweitrangigkeit, widergespiegelt. Insofern finden sich hier keine Ergebnisse, die die These, »Werkstätten sind Emanzipationshilfen« (ANDERS 1996, 560) mit positiven Effekten für »Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl und Bewusstsein der eigenen Stärke bei den behinderten Beschäftigten« (ebd.) stützen würden.
-
Damit kommt der Orientierung ›raus aus der WfB‹ und ›draußen arbeiten‹, die sich in den verschiedenen Wunschformulierungen der Befragten äußert, mehr an Gewicht zu als das eines naiven Kindheitstraums mit der Qualität von Lokomotivführer, Pilot, Schönheitskönigin oder Schauspieler. Er kann auch nicht interpretiert werden als banaler, nebensächlicher Tagtraum ohne jegliche Relevanz für die Zufriedenheit und ohne jeglichen Realisierungsdruck. Vielmehr dürfte dieser Wunsch nach einer ›reellen‹ Arbeitssituation Ausdruck einer Sehnsucht nach dem Zugehörig-Sein zur ›eigentlichen Situation‹, zu der nicht künstlich geschaffenen, sondern gesellschaftliche normalen Arbeitssituation sein.
-
Bei den WerkstattmitarbeiterInnen findet sich ein hohes Maß an personaler Unsicherheit und Indifferenzen, die auf Institutionalisierungsphänomene schließen lassen. Gleichwohl ist im Vergleich mit den fünf unterstützten ArbeitnehmerInnen kein weiterer Rückschluss erlaubt, da hier Altersunterschiede bedeutsam sein können; bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen wäre hilfreich gewesen, eine ältere Person als Herrn B auszuwählen, die von der Werkstatt für Behinderte auf den ersten Arbeitsmarkt übergeht.
-
Die befragten GruppenleiterInnen nehmen in dieser Situation unterschiedliche Positionen ein: Teilweise sehen sie für einige die Perspektive des Fitmachens in der Werkstatt für Behinderte - meist unter Ausblendung der Qualifizierungschancen am realen Arbeitsort - , teilweise vertreten sie auch dezidiert das Konzept von Unterstützter Beschäftigung - ohne allerdings dafür Ressourcen zu haben. Ihre Rolle beschreiben sie jedoch insgesamt eher mit dem Zuteilen angemessener Arbeiten, Schützen, Abfedern, Trösten und Relativieren von hadernden Denkmustern bei ihren MitarbeiterInnen mit Behinderung. Sie arbeiten eher wenig mit an der Realisierung von Träumen (außer Gruppenleiter G), was ja auch im übrigen originäre Aufgabe des sozialpädagogischen Dienstes ist.
-
Es werden sehr unterschiedliche Blicke von ArbeitsassistentInnen und GruppenleiterInnen auf Stärken und Schwächen ihrer BewerberInnen bzw. MitarbeiterInnen deutlich: Erstere betonen mehr die Kompetenzen einer Person, während zweitere oft Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Stärke zu sehen und vorzugsweise Schwächen formulieren. Es bleibt die Frage offen, ob solche unterschiedlichen Sichtweisen, wie sie z.B. über Herrn E als dem einzigen, zu dem aus beiden Systemen Aussagen vorliegen, zufällig sind oder ob nicht eher eine systembedingte Logik zu vermuten ist.
-
In Verbindung damit erklärt sich ein unterschiedliches Vorgehen bei der jeweiligen Qualifizierung: GruppenleiterInnen operieren meist mit kleinschrittigem Lernen im Vorfeld gewünschter Tätigkeiten (so muss Herr E erst zuverlässig Papiere sortieren können, bevor er an Maschinen herankann oder Herr H soll erst in der Erwachsenenbildung zum PC-Kurs gehen, bevor über eine Tätigkeit am Computer nachgedacht werden kann), ArbeitsassistentInnen arbeiten ebenfalls oft kleinschrittig - aber an der gewünschten Tätigkeit selbst (bei Frau A wird so das Tischabwischen der Tische im Gästehaus trainiert). Die mehrfach auftauchenden Zwickmühlenphänomene könnten genau hier begründet sein: Eine Kleinschrittigkeit, die im Vorstadium einer erwünschten Tätigkeit steckenbleibt statt am eigentlichen Interesse zu arbeiten, wirkt offenbar demotivierend und somit kontraproduktiv (dies zeigt sich auch, wenn sie im Kontext betrieblicher Qualifizierung praktiziert wird, wie möglicherweise bei Herrn B).
-
Ohne Unterstützung durch die Hamburger Arbeitsassistenz bestünde nach Einschätzung aller Befragten der ersten fünf Studien keines der Arbeitsverhältnisse - und das mit 90 % der Finanzmittel der Werkstätten. Bei der Beschreibung der konkreten Leistungen durch die AssistentInnen werden drei Standbeine der Unterstützung in je unterschiedlicher Gewichtung als bedeutsam deutlich: Die soziale Integration und gemeinsame Reflexion, das Entwickeln von Schlüsselqualifikationen und die konkret tätigkeitsbezogene Qualifizierung.
-
Bei allen Befragten werden langfristige Orientierungen im familiären Umfeld deutlich, die in den ersten fünf Studien auf Integration in allen Lebensbereichen zielen. Gleichwohl kann man nicht von einer linearen Beziehung zwischen besuchtem Schultyp - Sonder- und Integrationsschule - und erfolgreicher beruflicher Integration sprechen, denn bei beiden besuchten Schulformen kommt es zu erfolgreicher wie zu Abbrüchen von beruflicher Integration.
-
Den geschilderten Verläufen zufolge ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher, wenn weniger Brüche in der Entwicklung vorkommen; problematisch wirken sich z.B. Folgen von wiederholten Zuständigkeitswechseln aus - so bei Herrn E vor Beginn des Integrationspraktikums. Als erfolgreich bewertete Verläufe zeigen zudem, dass Erfolg mindestens so stark vom betrieblichen Umfeld und dessen Veränderungsbereitschaft abhängt wie von der Person selbst, ob also beispielsweise akzeptierte Rollen gefunden werden. Überdies deuten die Erfahrungen darauf hin, dass wesentlich wichtiger für den Erfolg auf dem ersten Arbeitsmarkt Motivation und Interessen der unterstützt Beschäftigten sind - weitaus wichtiger als ihre kognitiven Fähigkeiten.
-
Das Ende eines unterstützten Arbeitsverhältnisses bedeutet nicht automatisch das Ende der beruflichen Integration; vielmehr sind auch bei einem Beschäftigten, dem eine geistige Behinderung zugeschrieben wird, deutliche Transfereffekte zu verzeichnen.
-
Problematisch wird es dort, wo geringe Motivation, stärker noch ein geringes Bewusstsein davon, was Arbeit bedeutet, und ein schwieriges - familiäres oder auch betriebliches - Umfeld zusammen kommen. Dies ist bei den abgebrochenen oder gefährdeten Arbeitsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt durchweg der Fall.
-
Gleichwohl bleibt es in Problemsituationen eine schwierige Gratwanderung zu entscheiden, wann ein Arbeits- oder Praktikumsverhältnis zu beenden ist - einerseits nicht zu früh aufzugeben und nutzbares Potential ungenutzt zu lassen, andererseits es zu unvertretbaren Situationen kommen zu lassen und die Beteiligten zu überfordern.
-
Der Versuch, bei massiven Schwierigkeiten in den unterstützen Formen auf die Weiterentwicklung der BewerberInnen in der Werkstatt für Behinderte zu hoffen, erscheint wenig erfolgversprechend: Die Erfahrungen zeigen, dass das Problem dort in ähnlicher Form weiter bestehen bleibt (so bei Herrn E, womit die negativen Erwartungen von Mutter B realistisch erscheinen). Dies wirft die Frage auf nach anderen Zwischenschritten, wie z.B. integrativen Zweckbetrieben, in denen ohne Zeitdruck zur Entwicklung eines Begriffes von Arbeit und einer entsprechenden Motivation beigetragen werden könnte.
-
Auf der Seite der Betriebe zeigen die Beispiele, dass ein Start mit Enthusiasmus und Euphorie leicht zu Ernüchterung und Enttäuschung führen kann (wie bei Herrn B), während ein Beginn mit gewisser Unsicherheit und Skepsis positive Überraschung, Erleichterung und Freude provozieren kann (wie bei Herrn D im zweiten Betrieb). Die Arbeitsassistenz sollte insofern besonders zu Beginn nicht nur vermitteln, welche Fähigkeiten bei einer Person mit Behinderung vorhanden und entwickelbar sind, sondern zugleich typische und vermutlich stabile Verhaltensweisen und Fähigkeiten betonen. Entscheidend ist, ob es gelingt, eine gemeinsame Optik oder zumindest sich ergänzende Blickwinkel und eine gemeinsame Konsens-Ebene zu finden (wie die Beispiele von Frau A, Frau C und Herrn D plastisch und von Herrn E drastisch veranschaulichen).
-
Die Betrachtung der verschiedenen Situationen unter Aspekten der Stigma-Theorie zeigt auf, dass es in der Werkstatt für Behinderte im wesentlichen zu einer Fortschreibung der Stigmatisierung kommt, da allein das institutionalisierte Stigma kaum relativierbar ist. Als gegenläufige Tendenz präsentieren sich die Situationen außerhalb der besonderen Institution und innerhalb eines regulären betrieblichen Rahmens: Hier gelingen Entstigmatisierungsprozesse - häufig mit Unterstützung der AssistentInnen, und dies, obwohl allein die Tatsache, dass jemand beim Stigma-Management hilft, natürlich auch gleichzeitig zeigt und unterstreicht, dass es vorhanden ist (vgl. GEHRMANN & RADATZ 1997).
-
Der Theorie integrativer Prozesse zufolge verkörpert die Werkstatt für Behinderte institutionell den Differenzpol, denn sie wurde in der Ergänzungs- und Entlastungsfunktion zur Kultur der Anpassung und des Gleichheitskults auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen. Nichts desto trotz finden sich auch in diesem behinderten Rahmen integrative Prozesse auf der interaktionellen Ebene und der der Kooperation (so etwa bei Herrn G und seinem Gruppenleiter in der intensiven Reflexion). Der Hamburger Arbeitsassistenz kommt demnach die Funktion zu, integrative Prozesse zu initiieren, mit denen es zur Veränderung des Status-Quo in Betrieben kommt und für die Beteiligten neue Qualitäten von Akzeptanz, Begegnung, Kooperation, Gemeinsamkeit und Normalisierung möglich werden. Wie weit dies gelingt, hängt von vielen Faktoren ab und vollzieht sich nicht automatisch, jedoch zeigen einige Beispiele, dass dies sehr wohl gelingen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Anliegen und Fragestellung
- 5.2 Stichprobe und methodische Überlegungen
-
5.3 Ergebnisse
- 5.3.1 Konzept und Praxis der Maßnahmen
- 5.3.2 Eigene Tätigkeit und Rolle
- 5.3.3 Personenkreis der BewerberInnen
- 5.3.4 Einbindung in Kooperationsstrukturen
- 5.3.5 Vermutete Sichtweisen von ArbeitgeberInnen und die Situation in den Betrieben
- 5.3.6 Berufsberatung durch das Arbeitsamt
- 5.3.7 Berufsschulunterricht
- 5.3.8 Perspektiven
- 5.3.9 Resümees
- 5.4 Zusammenfassung
Im Zuge der schriftlichen Befragung von ArbeitsassistentInnen und GruppenleiterInnen werden die Befragten um die »wichtigste Geschichte aus der letzten Zeit Ihrer Tätigkeit (gebeten), die zeigt, was Sie sehr erstaunt, verwirrt, erfreut, entsetzt, amüsiert, enttäuscht, begeistert oder bewegt hat« (Fragebogen, Anhang 11.4 und 11.5). Zur Einstimmung in die Thematik der Arbeitssituation der beiden Berufsgruppen und ihrer Sichtweisen geben wir zwei Beispiele wieder.
|
»Mein Bewerber, nenne ich ihn Olaf, arbeitet in einem Supermarkt in der Regalbetreuung. Olaf ist 17 Jahre jung. Zunächst machte Olaf selten, was er sollte, und sobald man ihm den Rücken kehrte, machte er, was ihm Spaß machte. Olaf ist sehr direkt, verletzend, unsensibel und redet viel - so viel, dass er alle nervt und so ausgegrenzt wird. Er hört nicht zu und arbeitet viel zu langsam. Olaf ist sehr motiviert und lebt in einer sehr schwierigen familiären Situation. Er verlangt allen viel Geduld ab. Nach ca. zwei Monaten fragte mich der Abteilungsleiter, was denn mal aus Olaf werde. Ich erklärte, dass Olaf sich im Supermarkt sehr wohl fühle, aber noch etwa neun Monate Zeit habe, sich auch anders zu orientieren und noch vieles (kennen) zu lernen. Da sagte der Abteilungsleiter zu mir, dass Olaf einem ja richtig ans Herz wachsen könne, und fragte mich, ob er nicht mal seinen Chef zur Seite nehmen und mit ihm über eine Festeinstellung Olafs reden solle. Dafür ist es noch viel zu früh, aber wir haben das Praktikum verlängert, und ich habe mich sehr über dieses Angebot gefreut. Inzwischen ist Olaf den fünften Monat in diesem Supermarkt. Seine Umgangsformen sind bedeutend besser, er arbeitet zuverlässiger und seine KollegInnen haben ihn kennen- , zu nehmen und mögen gelernt. Wenn Olaf Ende des Monats ›weiterzieht‹, wird er viel gelernt haben und seinen KollegInnen fehlen.« |
|
»Das Hauswirtschaftstraining macht sich früh morgens (8.30) auf zur Bushaltestelle, um mit dem nächsten Bus zum Supermarkt zu fahren. Wir sind insgesamt sieben Personen, jeder hat eine Einkaufstasche dabei, und ich (die Gruppenleiterin) hat den Einkaufszettel und das Geld. Bei der Ampel warten wir alle auf das grüne Zeichen und überqueren dann die Straße. Uns entgegen kommt ein älterer Herr mit Hund an der Leine. Der Hund ist an Menschen gewöhnt, wedelt mit dem Schwanz und schnuppert an der einen oder anderen Hose von uns. Eine der behinderten Mitarbeiterinnen hat aber große Angst vor Hunden, springt ein wenig unbeholfen zur Seite und schreit ein wenig. Eine andere Mitarbeiterin hingegen versucht, die verschreckte Kollegin zu beruhigen, nimmt sie in den Arm und sagt: ›Bleib ruhig, Hunde sind schließlich auch nur Menschen.‹ Ich muss, als ich dies höre, doch sehr in mich hineinschmunzeln und mache weiter keine Unruhe wegen der Situation.« |
Eine Evaluation der beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum muss unter Einbeziehung der Sichtweisen und Stellungnahmen der Personengruppe erfolgen, die in ihnen arbeitet. Insofern werden alle ArbeitsassistentInnen, die in diesen beiden Maßnahmen tätig oder tätig gewesen sind, zu ihrer Sicht der Dinge befragt - über die Aussagen der KollegInnen hinaus, die im Rahmen der Intensivbefragung bereits zu Wort gekommen sind (vgl. Kap. 4.4). Da sie die Alternative zum Arbeitstraining in der Werkstatt für Behinderte entwickeln, ausgestalten und durchführen, wird parallel auch die Situation im Arbeitstraining der Werkstätten aus Sicht der dort tätigen GruppenleiterInnen betrachtet. Die Aussagen der ArbeitsassistentInnen werden also, wo immer es möglich und sinnvoll erscheint, mit denen einer Parallelgruppe von GruppenleiterInnen im Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten für Behinderte verglichen.
Dabei ist durchaus bewusst, dass sich beide Berufsgruppen in unterschiedlichen Situationen und Kontexten bewegen und von ihrer Arbeitssituation nur begrenzt miteinander vergleichbar sind: GruppenleiterInnen sind in bestimmten Räumen kontinuierlich anleitend für Gruppen von behinderten MitarbeiterInnen im Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte tätig, während ArbeitsassistentInnen sich in die individuelle Situation einzelner unterstützter PraktikantInnen bzw. MitarbeiterInnen begeben und sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in einem komplexen Umfeld mit anderen Personen wie KollegInnen und Vorgesetzten bewegen. Dies sind von vornherein unterschiedliche Rollendefinitionen.
Im Zentrum des Vergleichs stehen unter diesen Voraussetzungen folgende Einschätzungen und Aspekte:
-
Konzept und Praxis der Maßnahmen,
-
eigene Tätigkeit und Rolle,
-
Personenkreis der BewerberInnen bzw. behinderten MitarbeiterInnen,
-
Kooperation mit anderen Beteiligten (BewerberInnen und ArbeitgeberInnen),
-
Situation in den Betrieben und anschließende Perspektiven,
-
Berufsberatung durch das Arbeitsamt,
-
Berufsschulunterricht und
-
resümierende Aussagen.
Damit kann ein Bild von wesentlichen Aspekten der Tätigkeit der AssistentInnen und ihrer Einschätzung des Ambulanten Arbeitstrainings als Alternative zum Arbeitstraining in der Werkstatt für Behinderte gezeichnet werden.
Aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen zeitlicher und kapazitärer Art (vgl. Kap. 2.1) muss die Vollbefragung der ArbeitsassistentInnen in schriftlicher Form erfolgen. Dies erscheint auch insofern gerechtfertigt, als bei ihnen eine hohe Motivation und Bereitschaft vorausgesetzt werden kann, ihre Sicht der Dinge über einen umfangreichen Fragebogen transparent zu machen. Insgesamt sind es 17 Personen, die als ArbeitsassistentInnen in den beiden Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum tätig oder tätig gewesen sind. Die angestrebte Parallelisierung mit einer analog arbeitenden Berufsgruppe in den Werkstätten bedeutet die Einbeziehung der dortigen GruppenleiterInnen. Zunächst wird erwogen, alle GruppenleiterInnen zu befragen, aus deren Gruppen TeilnehmerInnen an der Vollbefragung (vgl. Kap. 3) beteiligt waren. Dies wird jedoch nach Rücksprache mit den AnsprechpartnerInnen in den Werkstätten verworfen zugunsten des Versuchs einer Befragung aller Hamburger GruppenleiterInnen im Arbeitstrainingsbereich, denn sie sind diejenigen, die für die Ermittlung von Interessenschwerpunkten und Fähigkeitsprofilen und für eine entsprechende Einarbeitung zuständig und damit am ehesten von Schwerpunkt und Aufgaben her mit den ArbeitsassistentInnen in Beziehung zu setzen sind. Somit ergibt sich eine Parallelgruppe von 21 Personen. Diese schriftliche Befragung bezieht sich also im optimalen Fall einer hundertprozentigen Beteiligung auf 38 Personen.
Methodisch stellt sich die Herausforderung, dass einerseits im Fragebogen nicht zu viele geschlossene Fragen enthalten sein dürfen, da mit ihnen im wesentlichen nur die antizipierten Inhalte der UntersucherInnen erhoben werden können, andererseits eine Vielzahl von offen gestellten Fragen wiederum Kategorisierungen notwendig macht, so dass zwar eher die für die Befragten wichtigen Inhalte erhoben, sie jedoch unter den Gesichtspunkten der UntersucherInnen strukturiert und einer Quantifizierung zugänglich gemacht werden. Insofern wird in den beiden Fassungen der Fragebögen eine ausgewogene Mischung aus offenen Fragen, Einschätzungsskalen und einigen gemischten Fragen mit teils vorgegebenen und teils offen ergänzbaren Antwortmöglichkeiten versucht (vgl. Anhang 11.4 und 11.5). Dabei ist den AutorInnen bewusst, dass der Fragebogen einen relativ hohen Zeiteinsatz der Befragten erfordert; dies wird jedoch zugunsten der vielen wichtigen Informationen als vertretbar angesehen, auch wenn ggf. Informationslücken aufgrund einer möglicherweise nicht ganz so hohen Motivation bei den Befragten in den Werkstätten für Behinderte entstehen können, da ja in erster Linie das Ambulante Arbeitstraining evaluiert wird.
An einer Vielzahl von Stellen werden Signifikanzprüfungen durchgeführt; damit wird statistisch ermittelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Unterschiede zwischen Gruppen - hier zwischen AssistentInnen und GruppenleiterInnen - nicht mehr als zufällig erklärt werden können, sondern systematisch bedingt sind. Dies wird nach dem Chi-Quadrat-Test mit einem Wert (p) angegeben: Bei p < 0.10 liegt eine statistische Tendenz vor, bei p < 0.05 ist mit 95%iger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass ein nicht zufälliger, sondern signifikanter Unterschied vorliegt, bei p < 0.01 kann dies mit 99%iger Wahrscheinlichkeit angenommen und von einem sehr signifikanten Unterschied ausgegangen werden. Im folgenden werden nur tendenzielle und signifikante Werte angegeben, bei den vielen nicht signifikanten Werten wird darauf verzichtet.
Die Befragung findet im Dezember 2000 und Januar 2001 statt. Dazu werden die Fragebögen in entsprechender Anzahl an die AnsprechpartnerInnen bei der Arbeitsassistenz und in den vier Hamburger Werkstätten für Behinderte gesandt mit der Bitte, sie im Rückumschlag bis zum Stichtag zurückzuschicken. In einem Anschreiben wird den potentiellen Befragten Sinn und Zweck der Befragung erläutert, um Mitarbeit geworben und persönliche Anonymität zugesichert.
Insgesamt gehen 25 Fragebögen ein; somit wird eine Rücklaufquote von 82,4 % bei der Arbeitsassistenz (14 von 17 Fragebögen) und von 52,4 % bei den Werkstätten erreicht (elf von 21 Fragebögen; leider treffen drei von einer Werkstatt für Behinderte abgeschickte Fragebögen nicht bei den AutorInnen ein.) Die Tabellen für Kap. 5 befinden sich im Internet (vgl. die Adresse im Vorwort).
Die Befragten lassen sich folgendermaßen beschreiben: Zwei Drittel von ihnen sind Frauen, ein Drittel Männer, wobei es eine Gleichverteilung bei den GruppenleiterInnen gibt und der größere Frauenanteil durch die AssistentInnen zustandekommt (vgl. Tab. 5.1). Während der Schwerpunkt vom Alter her bei den AssistentInnen in den 30ern liegt, sind die GruppenleiterInnen sehr signifikant älter, mit einem Schwerpunkt in den 50ern (vgl. Tab. 5.2; chi2 = .009). Dementsprechend gibt es auch bei der Dauer der Tätigkeit und der Zahl der Personen, für die sie zuständig gewesen sind, klare Unterschiede: Während über die Hälfte der AssistentInnen bis zu fünf Jahren tätig sind, sind dies über die Hälfte der GruppenleiterInnen bis zu zehn Jahren (vgl. Tab. 5.3; chi2 = .021). Knapp die Hälfte der AssistentInnen sind bisher für bis zu 20 Personen, knapp die Hälfte der GruppenleiterInnen dagegen für über 100 Personen zuständig gewesen (vgl. Tab. 5.4; chi2 = .015). Dies dürfte mit den unterschiedlichen Berufserfahrungen und dem Alter, aber auch mit der Arbeitsstruktur zusammenhängen, denn die GruppenleiterInnen sind - wie die Bezeichnung schon sagt - für Gruppen, die AssistentInnen dagegen an verschiedenen Orten für einzelne Personen zuständig. Von daher erklärt sich auch, warum es bei der Zahl der TeampartnerInnen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen gibt, sondern bei beiden der Schwerpunkt bei bis zu zehn TeampartnerInnen liegt (vgl. Tab. 5.5).
Deutliche, wenn auch nicht signifikante Unterschiede gibt es bei dem beruflichen Weg: Bei den AssistentInnen hat die Hälfte eine pädagogische Ausbildung und ein knappes Viertel eine handwerkliche und zudem eine pädagogische Zusatzausbildung; den zweiten Weg ist hingegen die Hälfte der GruppenleiterInnen gegangen (vgl. Tab. 5.6). Gewisse Unterschiede zeigen sich auch in der Motivation zu dieser Arbeit (vgl. Tab. 5.7): Bei beiden Gruppen lassen sich bei etwas mehr als der Hälfte der Befragten die Motive als qualitative Gründe zusammenfassen, etwa wenn es um die Vielfalt der Aufgaben, die Selbständigkeit und ähnliches geht, die GruppenleiterInnen haben sich zu etwa einem Drittel aus pragmatischen Gründen (Angebot bekommen, Verdienst etc.) für diese Arbeit entschlossen, und bei einigen AssistentInnen liegen eher idealistische Gründe vor (›etwas wirklich Integratives tun‹, ›Pioniergeist und mangelnde Perspektive in der Werkstatt‹).
Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der konkreten Arbeitssituation: Während alle GruppenleiterInnen mit voller Stelle arbeiten, tun dies nur knapp drei Viertel der AssistentInnen, jedoch über ein Viertel mit einer dreiviertel Stelle (vgl. Tab. 5.8; chi2 = .095).
Beide Gruppen zeigen sich relativ gut informiert über die jeweils andere Form des Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.9): Lediglich eine AssistentIn und ein Viertel der GruppenleiterInnen kennt die andere Form nicht. Dies könnte mit den unterschiedlichen Arbeitssituationen zusammenhängen, da die GruppenleiterInnen in ihrer Institution, die AssistentInnen hingegen ambulant und auch im Anschluss an die Arbeit ihrer Klientel in der Werkstatt für Behinderte tätig sind. Sie selbst lassen eher im dunkeln, in welcher Form sie sie kennengelernt haben, lediglich zwei GruppenleiterInnen und eine AssistentIn berichten von Hospitationen und eine AssistentIn hat in einer Werkstatt für Behinderte selbst gearbeitet (vgl. Tab. 5.10).
Zunächst werden die Befragten um eine Einschätzung der beiden Formen des Arbeitstrainings gebeten, indem sie bis zu drei derer Stärken und Schwächen angeben. Diese offenen Antworten werden im nachhinein kategorisiert.
Demnach sind beim Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte Schutz und Sicherheit eine wesentliche Stärke, wenn etwa der beschützende Rahmen oder kleine Gruppen, Kontinuität, begleitende Dienste und der sichere Arbeitsplatz - von beiden Gruppen - genannt werden; die von den GruppenleiterInnen hervorgehobene Stärke der hohen Passung mit den individuellen Fähigkeiten der behinderten MitarbeiterInnen wird von den AssistentInnen dagegen nicht geteilt, die demgegenüber die soziale Einbindung als zweite Stärke sehen (vgl. Tab. 5.11). Wenige AssistentInnen sehen explizit keine Stärken beim Arbeitstraining der Werkstätten und lassen viele Möglichkeiten zu Nennungen ungenutzt. Schwächen sehen die GruppenleiterInnen fast ausschließlich bei den Rahmenbedingungen innerhalb der Werkstatt für Behinderte, bei denen sie etwa zu wenig Personal und zu geringe Ausbildung, zu große Gruppen, einen zu unflexiblen Rahmen und schlechte Kooperation mit dem Beschäftigungsbereich bzw. den nahezu zwangsläufigen Übergang in ihn kritisieren (vgl. Tab. 5.12). Demgegenüber sehen die AssistentInnen als größte Schwäche, dass in der Werkstatt für Behinderte keine Integration stattfindet und innerhalb einer Scheinwelt mit unrealistischen Selbstbildern agiert wird. Jedoch kritisieren auch sie problematische Rahmenbedingungen und Unterforderungstendenzen; auch zu wenig Förderung und geringes individuelles Eingehen mit einer starken Gruppenorientierung (in Tab. 5.12 als ›soziale Vergruppung‹ bezeichnet) sehen sie kritisch.
Beim Ambulanten Arbeitstraining differieren die Aussagen der beiden Gruppen wesentlich mehr als bei dem der Werkstatt für Behinderte. Die AssistentInnen sehen im wesentlich drei Stärken: zum ersten das Konzept mit der Arbeitsbegleitung vor Ort, zum zweiten die starke individuelle Orientierung mit der Passung zu Fähigkeiten und Interessen und zum dritten die Integration in der gesellschaftlichen Realsituation (vgl. Tab. 5.13). Demgegenüber betonen die GruppenleiterInnen wenig Stärken des Ambulanten Arbeitstrainings; fast zwei Drittel der Antwortmöglichkeiten bleiben ungenutzt. Am ehesten sehen sie positiv, dass das Ambulante Arbeitstraining in der Realsituation erfolgt, und sie empfinden seine Rahmenbedingungen als Stärke, unter denen mit einem hohen Finanzaufwand gearbeitet werde - dies sind real 90 % des Kostensatzes des Arbeitstrainings in der Werkstatt für Behinderte. Schwächen beschreiben die GruppenleiterInnen ebenso sparsam wie Stärken; am ehesten sehen sie soziale Isolation, ein geringes Spektrum möglicher Tätigkeiten und Überforderung als Schwächen des Ambulanten Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.14). Die AssistentInnen nutzen nur 60 % der Antwortmöglichkeiten und heben als größte Schwächen die Rahmenbedingungen (hier geht es um hohen Verwaltungsaufwand, geringe Platzzahlen und hohe Wartezeiten, geringe Bezahlung, zeitliche Begrenzung der Unterstützung, die Koppelung an die Werkstatt für Behinderte und ähnliches) sowie Sonstiges (etwa die Kooperation mit Berufsschulen und den Zugang nur über das Arbeitsamt) hervor. Ebenfalls spielen Tendenzen zu sozialer Isolation und ein eher geringes - hervorgehoben wird dabei: geschlechtsspezifisch typisiertes - Spektrum an Branchen eine gewisse Rolle.
Insgesamt scheint sich die Einschätzung des Arbeitstrainings in der Werkstatt für Behinderte bei den AssistentInnen bei den Schwächen auf strukturelle wie konkrete Bedingungen zu beziehen und bei den Stärken vor allem auf Sicherheit und soziale Einbindung zu richten - bei letzterer deutlich mehr, als die GruppenleiterInnen betonen. Am Ambulanten Arbeitstraining sehen die AssistentInnen vor allem dessen strukturelle Verankerung und ihre geringe Bezahlung als problematisch, die entscheidenden Stärken liegen für sie im Konzept. Beide Gruppen nehmen eher vorsichtig zur jeweils anderen Form Stellung, deren Stärken bleiben von der Hälfte der AssistentInnen und sogar von fast zwei Dritteln der GruppenleiterInnen unkommentiert; während die Schwächen des Arbeitstrainings der Werkstatt für Behinderte von je einem Drittel der Gruppen unkommentiert bleiben, geschieht dies beim Ambulanten Arbeitstraining bei 60% der GruppenleiterInnen und bei 40% der AssistentInnen - vermutlich aus unterschiedlichen Gründen. Offensichtlich sind die GruppenleiterInnen nicht so gut informiert über die alternative Form wie die AssistentInnen.
Weiterhin wird eine Reihe von Fragen zu Problemaspekten gestellt. So geben die Befragten als größte Problematik bei der Qualifizierung signifikant Unterschiedliches an (vgl. Tab. 5.15; chi2 = .089): Für die AssistentInnen ist das betriebliche Umfeld die größte Herausforderung, gefolgt von der unterstützten Person selbst, während bei den GruppenleiterInnen die eigene Institution und ihr Konzept das größte Problem darstellt, gefolgt von den Bedingungen des Umfeldes.
Auch bei den Alarmzeichen, an denen die Befragten problematische Situationen festmachen, gibt es signifikante Unterschiede (vgl. Tab. 5.16; chi2 = .065): Während zwei Drittel der GruppenleiterInnen Problemtendenzen anhand von Stimmungsschwankungen und Verhaltensänderungen bei ihren MitarbeiterInnen erkennen, spielen diese Zeichen bei den AssistentInnen eine ebenso große Rolle wie äußerliche Zeichen - Fehlzeiten, Krankmeldungen, Verspätungen - und wie Stagnationstendenzen; eine gewisse Rolle spielen bei ihnen auch Aussagen der unterstützten Personen selbst, die bei den GruppenleiterInnen dagegen nicht genannt werden. Diese deutlichen Unterschiede dürften auf die unterschiedlichen Arbeitssituationen zurückgehen, wo GruppenleiterInnen kontinuierlich in der Arbeitstrainingsgruppe, AssistentInnen dagegen zumindest nach einiger Zeit nicht mehr ständig anwesend sind.
Ebenso gibt es signifikante Unterschiede bei den Gründen für den Abbruch eines Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.17; chi2 = .033): Während die GruppenleiterInnen fast nur Gründe bei der Person selbst sehen, spielen bei den AssistentInnen auch die Situation im Betrieb und eine schlechte Vorbereitung eine Rolle - und bei einem Drittel von ihnen sind Abbrüche noch nicht vorgekommen. Auch diese Unterschiede dürften in den verschiedenen Realsituationen begründet sein.
Ergänzend werden die AssistentInnen nach genannten und realen Gründen für die Verweigerung eines Arbeitsvertrages auf dem ersten Arbeitsmarkt gefragt (vgl. Tab. 5.18 und 5.19). Genannt wird von ArbeitgeberInnen vor allem, dass kein Bedarf bestehe, jedoch werden auch (nicht ausreichende) Leistung und Arbeitstempo der unterstützten Personen ins Feld geführt. Als real nehmen die AssistentInnen vor allem Vertrauensprobleme wahr: mangelndes Vertrauen in die Person, in die Flexibilität des Betriebs, in die Arbeitsassistenz; eine fehlende Passung und betriebswirtschaftliche Gründe sind demnach nicht wichtiger als andere Aspekte.
Die GruppenleiterInnen werden alternativ zu den AssistentInnen gefragt, ob sie sich ihre behinderten Werkstatt-MitarbeiterInnen auch im Ambulanten Arbeitstraining vorstellen könnten, was von fünfen bejaht und von fünfen verneint wird. Bei der ergänzenden Frage nach Bedingungen, unter denen dies möglich sein könnte (vgl. Tab. 5.20), werden verschiedene Begleitumstände genannt: eine kontinuierliche Assistenz, eine vorher abgeschlossene Qualifizierung in der Werkstatt für Behinderte, eine entsprechende Qualität des Betriebs und eine Passung zwischen betrieblichem Bedarf und Fähigkeiten der Person.
Weitere Fragen beziehen sich auf den äußeren Rahmen des Arbeitstrainings. So schätzen die Befragten dessen Erfahrungsbreite signifikant unterschiedlich ein (vgl. Tab. 5.21; chi2 = .056): Zwei Drittel der GruppenleiterInnen halten sie für angemessen, ein Drittel für unter-schiedlich, bei den AssistentInnen ist dies umgekehrt. Einschätzungen, der Rahmen sei übertrieben oder unzureichend, kommen nicht vor. Hier mag sich wiederum die unterschiedliche Situation auswirken - in der Werkstatt für Behinderte mit stärkerem Gruppenbezug, im Betrieb mit stärkerem Individuumsbezug. Auch nach dem Zeitrahmen wird gefragt: Während des Arbeitstrainings wird er als eher groß angesehen, unabhängig von seinem Ort (vgl. Tab. 5.22), ebenso im Integrationspraktikum (vgl. Tab. 5.23). Lediglich für die Zeit danach zeigen sich - wenn auch nicht signifikante - Unterschiede (vgl. Tab. 5.24): AssistentInnen empfinden ihren zur Verfügung stehenden Zeitrahmen größer als GruppenleiterInnen im Arbeitstraining. Auch dies dürfte in der realen Situation begründet sein, denn die jeweiligen Aufträge sind unterschiedlich zugeschnitten: AssistentInnen sollen auch nachfolgende Unterstützung leisten, GruppenleiterInnen geben ihre MitarbeiterInnen an KollegInnen im Beschäftigungsbereich weiter.
Darüber hinaus werden die AssistentInnen mit der in der Intensivbefragung (vgl. Kap. 4) wahrgenommenen Problemstellung konfrontiert, dass es bei ihnen ein Spannungsverhältnis geben kann zwischen der individuellen Logik der BewerberIn in ihrer Entwicklung und der Logik des Betriebes mit seinen Bedarfen (vgl. Tab. 5.25). Dies wird im wesentlichen bestätigt, von einem Viertel der AssistentInnen jedoch mit positiv herausgefordertem Unterton als produktiver Prozess.
Einer der deutlichsten Unterschiede zwischen den Gruppen zeigt sich in der Einschätzung von Rolle und Stellenwert des Ambulanten Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.26; chi2 = .007): Während die AssistentInnen ihm hohen Stellenwert und gute Qualität bescheinigen und lediglich die geringen Platzzahlen kritisieren, weisen die GruppenleiterInnen dem Ambulanten Arbeitstraining mehrheitlich einen geringen Stellenwert zu und sehen es nur für eine spezielle Klientel als angemessen und sinnvoll an: für die Grenzfälle zwischen geistiger und Lernbehinderung bzw. die in der Werkstatt für Behinderte unter- und im Förderlehrgang überforderten Personen.
Die letzte Frage in diesem Bereich richtet sich auf die erreichte Durchlässigkeit zwischen den beiden Formen des Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.27). Hier ergibt sich fast durchgängig ein negatives Bild, entweder wird kaum Kontakt gesehen oder speziell eine fehlende Durchlässigkeit aus der Werkstatt für Behinderte in die ambulante Form wahrgenommen - ohne große Unterschiede zwischen den Gruppen.
Zwischenfazit
Insgesamt unterscheiden sich die Aussagen der AssistentInnen und GruppenleiterInnen zu Konzept und Praxis der Formen des Arbeitstrainings nicht extrem. Neben dem unterschiedlichen Informationsstand bezüglich der jeweils anderen Form sind auch qualitative Tendenzen festzustellen: Die AssistentInnen stellen als Stärken des Ambulanten Arbeitstrainings vor allem konzeptionelle Sachverhalte heraus, seine Schwächen sehen sie dagegen im wesentlichen in administrativen und Umsetzungsbedingungen; am Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte kritisieren sie jedoch beides, Konzept- und Umsetzungsmerkmale.
Weitere Unterschiede gehen im wesentlich auf die verschiedenen situativen Bedingungen der Arbeit zurück, etwa wenn für die AssistentInnen das betriebliche Umfeld die größte Herausforderung ist und sie auch bei Abbrüchen - die ein Drittel von ihnen noch nicht erlebt hat - einen wesentlichen Grund darstellt oder wenn die Einschätzungen von Erfahrungsbreite und zeitlichem Rahmen individuell unterschiedlicher wahrgenommen wird als von den GruppenleiterInnen.
Der Stellenwert des Ambulanten Arbeitstrainings wird von beiden Gruppen sehr unter-schiedlich bemessen, von den AssistentInnen hoch, von den GruppenleiterInnen niedrig, mit unterschiedlichen und unterschiedlich großen Zielgruppen im Blick. Einen Konsens gibt es dagegen darin, dass die Durchlässigkeit zwischen beiden Formen bestenfalls in Ansätzen realisiert ist. Vor allem bleibt aber festzuhalten: Bei einiger Kritik an konkreten Umsetzungsaspekten stehen die AssistentInnen voll und ganz hinter dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings.
Eine ganze Reihe von Fragen beziehen sich auf die eigene Tätigkeit und Rolle der beiden Berufsgruppen. Beginnend bei den Informationsquellen und ihrer Bedeutung, über Einschätzungsfragen zur Tätigkeit allgemein und die Betrachtung von Tätigkeitsanteilen, über Schwerpunkte und Grenzen der Arbeit, die Selbst- und vermutete Fremdeinschätzung der Rolle, typische Kooperationskonflikte, AnsprechpartnerInnen bei eigenen Sorgen, potentiellen Fortbildungsbedarf bis zu Veränderungswünschen reicht diese Palette.
Ausgangspunkt für die ersten Fragen sind die Informationsquellen bei Beginn der Arbeit. Insgesamt wird der Stellenwert von Vorinformationen als hoch bis sehr hoch angesehen, ohne große Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 5.28). Dabei haben verschiedene Informationsquellen unterschiedliche Bedeutung (vgl. Tab. 5.29): Von den beiden vorgegebenen Informationsquellen in beiden Gruppen haben die Berichte aus Schulen eine hohe Bedeutung, den Gutachten vom Arbeitsamt wird eine wesentlich geringere zugesprochen. Für die AssistentInnen ist allerdings das selbst erstellte Fähigkeitsprofil der Arbeitsassistenz am wichtigsten (vgl. Kap. 1.3.2). Darüber hinaus geben die Befragten gruppenspezifisch weitere wichtige Informationsquellen an: Sehr viele AssistentInnen halten Gespräche mit dem Umfeld, Berichte aus früheren Institutionen und auch das Gespräch mit der Person selbst für wichtige Quellen, die GruppenleiterInnen messen vor allem Berichten von Fachleuten (medizinischen und psychologischen Gutachten) und auch Gesprächen mit dem Umfeld hohen Informationsgehalt zu. Hier könnten tendenziell unterschiedliche Sichtweisen auf den Personenkreis ablesbar sein, wo einerseits das persönliche Umfeld und die Person selbst, andererseits fachliche Gut-achten höheren Stellenwert erhalten.
Eine Serie von zwölf Fragen bezieht sich auf die Einschätzung der Arbeit. So finden etwa 80 % beider Gruppen ihre Arbeitssituation insgesamt gut oder sehr gut; jeweils nur eine Person bewertet sie als eher schlecht (vgl. Tab. 5.30). Fast das gleiche Ergebnis ergibt sich auch in Bezug auf die Vielschichtigkeit der Arbeit (vgl. Tab. 5.31), das Anforderungsprofil (vgl. Tab. 5.32) und die Sinnhaftigkeit der Arbeit (vgl. Tab. 5.33). Etwas negativere Bewertungen - bei immer noch deutlicher positiver Dominanz der Einschätzungen - kommen beim Arbeitsklima (vgl. Tab. 5.34), bei der Einschätzung des Erfolges (vgl. Tab. 5.35) und bei der Sicherung des Arbeitsplatzes vor (vgl. Tab. 5.36).
Bei einigen Fragen ergibt sich ein gemischteres Bild: Knapp die Hälfte der Befragten empfindet die gesellschaftliche Anerkennung als eher oder sehr hoch, die andere Hälfte dagegen als eher oder sehr niedrig (vgl. Tab. 5.37), ebenso sieht es in Bezug auf die Vernetzung mit anderen aus (vgl. Tab. 5.38). Auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb werden gemischt bewertet, mit positiverer Tendenz bei der Arbeitsassistenz gegenüber den Werkstätten (vgl. Tab. 5.39).
Lediglich zwei signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen kommen in diesem Bereich vor: Während fast die Hälfte der GruppenleiterInnen die vorhandene Fortbildung als viel wahrnimmt, finden alle AssistentInnen, sie hätten eher oder sehr wenig Fortbildung (vgl. Tab. 5.40; chi2 = .013). Und während sich ein Viertel der GruppenleiterInnen bei der Arbeit eher wenig gestresst fühlt, sind alle AssistentInnen ausnahmslos der Meinung, sie hätten eher oder sehr viel Stress bei der Arbeit (vgl. Tab. 5.41; chi2 = .011).
Fasst man die Antworten auf die Fragen zur Einschätzung der eigenen Arbeit in einem Index (Wert zwischen 1 und 4) zusammen, so zeigt sich, dass die GruppenleiterInnen (Mittelwert: 2,1) sich etwas positiver äußern als die AssistentInnen (Mittelwert: 2,3); dabei hat die Einschätzung des Stresses eine hohe Bedeutung für diesen nicht signifikanten Unterschied.
In einem weiteren Fragenkomplex wird den Anteilen verschiedener Tätigkeiten nachgegangen (vgl. Tab. 5.42). Dabei werden verschiedene Bereiche vorgegeben (konkretes Üben, gemeinsame Reflexion, Arbeit mit dem betrieblichen Umfeld, Herstellen von Arbeitshilfen, interne Arbeit im Büro), zusätzlich werden von den Befragten die Zusammenarbeit mit dem privaten Umfeld und mit der Berufsschule benannt. Insgesamt nimmt das konkrete Üben bei beiden Gruppen den größten Raum ein (Mittelwert bei den AssistentInnen 45,4 %, bei den GruppenleiterInnen 57,1 %; insgesamt 49,7 %), gefolgt bei den AssistentInnen von der Arbeit mit dem betrieblichen Umfeld und bei den GruppenleiterInnen von der gemeinsamen Reflexion der Situation. Alle weiteren Tätigkeitsbereiche sind demgegenüber untergeordnet. Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen gibt es lediglich in einem höheren Anteil der AssistentInnen bei der Arbeit mit dem betrieblichen Umfeld (chi2 = .016), bei der Herstellung von Arbeitshilfen (chi2 = .033) und bei der internen Arbeit (chi2 = .091). Zusammenarbeit mit dem privaten Umfeld und mit der Berufsschule kommen als zusätzliche Nennungen nur bei AssistentInnen vor. Auffällig ist darüber hinaus die große Heterogenität der Anteile zwischen den einzelnen Befragten, besonders bei den Anteilen des Übens - hier zeigen sich bei den AssistentInnen Anteile in einem Bereich von unter 5% bis über 66%; ein Indiz für offenbar sehr unterschiedliche individuelle Bedarfe der unterstützten Personen.
In weiteren Fragen geht es um Schwerpunkte und Grenzen von Leistungen. Nach ihrer wichtigsten Unterstützungsleistung gefragt, geben die Befragten signifikant unterschiedliche Antworten (vgl. Tab. 5.43; chi2 = .086): Bei den AssistentInnen rangieren die Arbeitsbegleitung vor Ort und die Funktion als AgentIn zwischen allen Beteiligten an der Spitze. Demgegenüber dominiert bei den GruppenleiterInnen das Unterstützen und Helfen. Bei den Schwerpunkten der Unterstützung gibt es ebenfalls, allerdings keine signifikanten Unterschiede (vgl. Tab. 5.44): Hier hat die Persönlichkeitsentwicklung den größten Anteil bei den AssistentInnen, bei den GruppenleiterInnen hingegen das Ermöglichen von Erfahrungen. Die Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten werden dagegen eher ähnlich gesehen (vgl. Tab. 5.45): Die AssistentInnen sehen zur Hälfte vor allem bei der Abgrenzung gegenüber dem Privatbereich sowie zu kleineren Anteilen bei Rahmenbedingungen und betrieblichen Gegebenheiten Grenzen erreicht, während je ein Viertel der GruppenleiterInnen dies bei Therapiebedarf und bei der Abgrenzung gegenüber Privatem feststellt.
In einem anderen Komplex werden die Befragten um Stellungnahmen zur Selbstwahrnehmung und zur vermutlichen Fremdwahrnehmung ihrer Rolle gebeten (vgl. Tab. 5.46 und 5.47). Beides weicht zwischen beiden Gruppen nicht sonderlich ab. Ihre eigene Rollendefinition beschreiben die AssistentInnen zur Hälfte als BeraterInnen und BegleiterInnen, ein weiteres Viertel nimmt mehrere Rollen ein. Die GruppenleiterInnen sehen sich zu einem Drittel als UnterstützerInnen und BetreuerInnen, ein weiteres Viertel nimmt ebenfalls mehrere Rollen ein. Bei beiden Gruppen kommt die Rolle als Chef nicht vor. Hingegen verschieben sich die Rollen zu einem Stück mehr Dominanz in der vermuteten Fremdwahrnehmung durch die unterstützten Personen bzw. die behinderten MitarbeiterInnen: Bei den AssistentInnen werden aus den BeraterInnen und BegleiterInnen deutlich mehr TrägerInnen mehrerer Rollen und UnterstützerInnen/BetreuerInnen, bei den GruppenleiterInnen geht der Anteil der UnterstützerInnen zurück zugunsten von Chefs. Auch taucht in beiden Gruppen nun auch die LehrerInnen-Rolle auf.
Sehr deutliche Unterschiede gibt es bei den Aussagen zu typischen Kooperationskonflikten (vgl. Tab. 5.48; chi2 = .000): Bei den AssistentInnen dominieren mit über der Hälfte die 'unsolidarischen Anteile der Rolle', d.h. die Anteile, mit denen sie Kontrolle ausüben, Interessen der Vorgesetzten im Betrieb wahrnehmen und mit ihnen auch Informationen austauschen; auch ist die Abgrenzung vom privaten Bereich hier bedeutsam. Bei den GruppenleiterInnen hingegen dominieren stark Verhaltensprobleme der behinderten MitarbeiterInnen.
Wenn es mal Schwierigkeiten oder Sorgen bei der Arbeit gibt, wenden sich über die Hälfte der AssistentInnen an KollegInnen und die Leitung der Arbeitsassistenz und über die Hälfte der GruppenleiterInnen an KollegInnen (vgl. Tab. 5.49). Ein jeweils weiteres Viertel wendet sich an KollegInnen bzw. KollegInnen und Leitung. Damit scheinen alle Befragten verlässliche AnsprechpartnerInnen für schwierige Situationen zu haben.
Vorhandenen Qualifizierungsbedarf bejahen fast alle Befragten, lediglich eine GruppenleiterIn macht hierzu keine Angaben. Dabei wird von den AssistentInnen schwerpunktmäßig Supervision und Gesprächsführung sowie - ebenso von den GruppenleiterInnen - ein breites Spektrum mit Verschiedenem gewünscht (vgl. Tab. 5.50).
Abschließend sollen die Befragten ihre Veränderungswünsche an der aktuellen Situation kundtun; hierbei zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Tab. 5.51; chi2 = .023). Das drängendste Problem scheint demnach für die AssistentInnen die Arbeitszeit zu sein, die mehr planbar und weniger hektisch sein sollte; recht hoch ist bei Ihnen der Anteil nicht gegebener Antworten. Die GruppenleiterInnen wünschen sich demgegenüber vor allem eine Verbesserung der Rahmenbedingungen der Arbeit in räumlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht; zwei GruppenleiterInnen bekunden, demnächst dieses Arbeitsfeld ohnehin verlassen zu wollen.
Zwischenfazit
Insgesamt schätzen in weiten Bereichen AssistentInnen wie GruppenleiterInnen ihre Arbeit gut bis sehr gut ein; AssistentInnen empfinden in Relation zu den GruppenleiterInnen allerdings, dass sie deutlich weniger Fortbildung und deutlich mehr Stress haben.
Die Anteile der konkreten Tätigkeit differieren zwischen den Befragten - unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit - beträchtlich; den größten Anteil nimmt das konkrete Üben mit den Personen ein, gefolgt von der Arbeit mit dem betrieblichen Umfeld. Schwerpunkte der Unterstützung liegen bei den AssistentInnen eher in der Begleitung vor Ort und in der Mittlerfunktion zwischen den Beteiligten mit Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung, bei den GruppenleiterInnen Unterstützung und Hilfe im Arbeitsprozess mit Blick auf neue Erfahrungen. Grenzen ihrer Unterstützungsmöglichkeiten nehmen beide Gruppen im Grenzbereich zum Privaten wahr, die GruppenleiterInnen auch im Grenzbereich zum Therapiebedarf.
Ihre Rollen in der Kooperation mit den unterstützten Personen umschreiben die AssistentInnen vor allem als BeraterInnen und BegleiterInnen, die GruppenleiterInnen - etwas stärker führend - als UnterstützerInnen und BetreuerInnen. Eine Tendenz zu zunehmender Dominanz vermuten die Befragten in der Wahrnehmung ihrer Rolle durch die unterstützten Personen; nun tauchen auch die Rollen von Chefs und LehrerInnen auf.
Typische Kooperationskonflikte mit den unterstützten Personen hängen mit der vermittelnden Rolle der AssistentInnen zwischen den Beteiligten zusammen, die offenbar von den unterstützten Personen ein Stück weit als unsolidarisch wahrgenommen werden; die GruppenleiterInnen nennen vor allem Verhaltensprobleme ihrer MitarbeiterInnen. Entsprechend richten sich auch die formulierten Fortbildungsbedarfe bei den AssistentInnen primär auf Gesprächsführung und Supervision, während sie sekundär ebenso wie die GruppenleiterInnen verschiedene Gebiete nennen. Dringendste Veränderungsbedarfe sehen die AssistentInnen in Bezug auf ihre Arbeitszeit, während die GruppenleiterInnen ihre Rahmenbedingungen verbessert bekommen wollen - und zwei haben vor, ihren Arbeitsbereich zu verlassen.
Durch die Aussagen zur eigenen Tätigkeit und Rolle ziehen sich keine gravierenden Gegensätze, aber es werden schon unterschiedliche Facetten deutlich: AssistentInnen arbeiten stärker individuumsorientiert und in der Funktion eines Katalysators, der die Entwicklung einer Situation vorantreibt, GruppenleiterInnen sind stärker in der Gruppensituation anleitend tätig.
Ein wichtiger Fragenbereich ist, für welchen Personenkreis die Befragten das jeweilige Arbeitstraining für angemessen halten. Hierzu wird zunächst ohne Vorgaben die Bitte geäußert, den Personenkreis zu beschreiben. Dies tun die beiden Gruppen der Befragten extrem unter-schiedlich (vgl. Tab. 5.52; chi2 = .000): Zwei Drittel der AssistentInnen beschreiben konkrete Verhaltensweisen, ein Achtel nennt Behinderungskategorien, ein Fünftel tut beides. Dagegen nennen die GruppenleiterInnen ausschließlich Behinderungskategorien zur Beschreibung ihrer Klientel. Hier werden deutliche Unterschiede in der Beschreibung deutlich, die auf verschiedene Paradigmata zurückgeführt werden können (vgl. Kap. 1.2): AssistentInnen gehen viel stärker vom einzelnen Individuum aus, während das kategoriale Denken bei den GruppenleiterInnen dominiert. Sicher spiegeln sich hier auch institutionelle Strukturen wider.
Darüber hinaus werden die Antworten nach positiven, neutralen bzw. gemischten und negativen Attribuierungen ausgewertet (vgl. Tab. 5.53;chi2 = .086): Die AssistentInnen beschreiben zu insgesamt einem Drittel konkrete Verhaltensweisen und Eigenschaften mit deutlich positivem oder negativem Unterton; hierbei sind zu einem Sechstel auch rein positive Beschreibungen enthalten. Zwei Drittel von ihnen beschreiben sowohl positive als auch negative Seiten ihrer Klientel. Dies trifft auch für alle GruppenleiterInnen zu, zumindest dann, wenn man die Benennung von Behinderungskategorien als neutral einordnen will - hierüber ließe sich jedoch je nach paradigmatischer Orientierung und Begriffsdefinitionen kontrovers diskutieren.
Auf die offene Frage nach den wesentlichen Qualifizierungszielen in den Formen des Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.54) nennen ein Viertel der AssistentInnen und ein Fünftel der GruppenleiterInnen rein persönlichkeitsbezogene Ziele, ebenfalls ein Fünftel der GruppenleiterInnen nennt dagegen ausschließlich arbeitsbezogene Ziele. Es dominiert jedoch der Blick auf beide Bereiche: Fast drei Viertel der AssistentInnen und fast zwei Drittel der GruppenleiterInnen halten sowohl persönlichkeitsbezogene als auch arbeitsbezogene Ziele für wesentlich und formulieren sie auch institutionsunabhängig.
Mögliche Voraussetzungen - Fähigkeiten und Fertigkeiten - , die bei den Personen vor einem Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt gegeben sein müssen, werden wie folgt beschrieben (vgl. Tab. 5.55; chi2 = .027): Die Hälfte der AssistentInnen sieht keine - obwohl bestimmte Fähigkeiten zwar erleichternd wirken würden - , aber sie sieht es gerade als Chance, diese Fähigkeiten während des Ambulanten Arbeitstrainings gemeinsam zu entwickeln; ein Viertel bejaht sie hingegen. Demgegenüber bejahen drei Viertel der GruppenleiterInnen Voraussetzungen, vor allem mit Blick auf die Bereiche des Sozialverhaltens und der Schlüsselqualifikationen.
Deutlich mehr Einigkeit besteht bei den Befragten darüber, dass bestimmte Fähigkeiten für ein erfolgreiches Arbeitstraining gegeben sein sollten, denn dies verneint lediglich eine AssistentIn. Inhaltlich dominiert bei den AssistentInnen mit mehr als drei Viertel der Äußerungen Motivation und Interesse, gefolgt von einer förderlichen Wirkung bestimmter Fähigkeiten, etwa Lesen, Schreiben und Rechnen oder eine gewisse Reflexionsfähigkeit, die aber nicht für unabdingbar gehalten werden; auch wird ein realistisches Fähigkeitsselbstbild genannt. Die GruppenleiterInnen nennen zur Hälfte ebenfalls Motivation, darüber hinaus soziale Fähigkeiten, Werkstattfähigkeit, geringen Pflegeaufwand und Unterstützung durch das Umfeld.
Unterschiede zwischen Personen, die den Sonderschulweg, und solchen, die den integrativen Weg gegangen sind, werden recht verschieden wahrgenommen (vgl. Tab. 5.56; chi2 = .081): Von den Befragten, die hierzu Stellung nehmen, sehen alle AssistentInnen Unterschiede, jedoch nur die Hälfte der GruppenleiterInnen; die andere Hälfte von ihnen widerspricht diesem und verneint Unterschiede. Dabei sehen die AssistentInnen durchweg und die GruppenleiterInnen bis auf eine Ausnahme Vorteile bei den IntegrationsschülerInnen, denen ein ausgeprägteres Selbstbewusstsein und höhere Fähigkeiten zugeschrieben werden. Eine GruppenleiterIn sieht bei beiden Gruppen Vor- und Nachteile in jeweils unterschiedlichen Richtungen.
Den Stellenwert von Arbeit überhaupt schätzen die Befragten ähnlich ein, wobei Arbeit für die Klientel der AssistentInnen noch als ein Stück wichtiger eingeschätzt wird als bei den GruppenleiterInnen (vgl. Tab. 5.57). Die Klientel der Arbeitsassistenz stellt sich demnach ein bisschen motivierter dar als die der Werkstätten. Dabei werden von den AssistentInnen verschiedene Gründe häufiger genannt als von den GruppenleiterInnen (vgl. Tab. 5.58): Etwas häufiger ist offenbar das Soziale wichtig, deutlich häufiger werden finanzielle Aspekte genannt, signifikant häufiger spielt der Status als Arbeitender eine Rolle (chi2 = .043).
In zwei weiteren Fragen wird Kriterien für die Auswahl und die Verweildauer an einem Arbeitsplatz nachgegangen. Dabei sollen die Befragten Kriterien und eine Rangfolge angeben. Bei der Arbeitsplatzauswahl werden verschiedene Kriterien vorgegeben (vgl. Tab. 5.59): Demnach rangieren ohne Unterschiede zwischen den Gruppen im Durchschnitt durchweg die Neigungen der Person an erster Stelle, gefolgt von der sich anbietenden Tätigkeitsstruktur; an dritter Stelle liegen vorhandene Kooperationserfahrungen, an vierter die Aussicht auf einen Arbeitsvertrag. Dabei sind die individuellen Wertungen durchaus heterogen (vgl. Tab. 5.60). Etwas anders, wenngleich wiederum ohne größere Gruppenunterschiede, stellt sich die Situation dar, wenn es um die Entscheidung über die Verweildauer an einem Arbeitsplatz geht (vgl. Tab. 5.61): Im Durchschnitt ist dann das Lernpotential etwas wichtiger als der Wunsch der BewerberInnen, mit größerem Abstand folgen institutionelle Bedingungen und die soziale Situation. Doch auch hier sind die individuellen Kriterien durchaus unterschiedlich (vgl. Tab. 5.62)
Zwischenfazit
Deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen gibt es in der Sichtweise auf ihre Klientel: Die AssistentInnen beschreiben sie deutlich individueller und wesentlich weniger kategorial und etikettierend als die GruppenleiterInnen.
So beschreiben die AssistentInnen die wesentlichen Qualifizierungsziele auch stärker persönlichkeitsorientiert als die GruppenleiterInnen, die persönlichkeits- und arbeitsbezogene Ziele gleichwertig sehen. Eine stärkere Tendenz zu kategorialem Denken bei den GruppenleiterInnen wird auch in den vermuteten notwendigen Voraussetzungen vor der Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt deutlich: Sie sehen deutlich mehr Voraussetzungen, bevor in einen anderen Bereich zugewiesen werden kann, während die AssistentInnen gerade die Entwicklungschancen im Betrieb des ersten Arbeitsmarktes in den Blick nehmen, für die sicherlich bestimmte Fähigkeiten - vor allem Motivation und eine Vorstellung von Arbeit - hilfreich sind. Den Stellenwert von Arbeit schätzen die AssistentInnen bei ihren unterstützten Personen etwas höher ein als die GruppenleiterInnen bei ihren MitarbeiterInnen, beim finanziellen Aspekt und noch stärker beim Status als arbeitender Mensch zeigen sich diese Unterschiede.
Dennoch sind die bestimmenden Gründe für die Wahl eines Arbeitsplatzes bei beiden Gruppen in erster Linie die Neigungen der Person und die Tätigkeitsstruktur, die dort geboten wird. Während bei der Wahl die Neigung wichtiger ist, hat bei der Entscheidung über die Dauer des Verbleibens am Arbeitsplatz das Lernpotential Priorität.
Zur Einbindung in Kooperationsnetze wird eine Vielzahl von Fragen gestellt, die sich zum einen auf die Qualität und zum anderen auf die Intensität beziehen. Die Aussagen hierzu werden im folgenden zusammengefasst. Demnach ist die Kooperation
-
mit den BewerberInnen bzw. MitarbeiterInnen durchgängig gut und im wesentlich auch intensiv (vgl. Tab. 5.63 und 5.64).
-
mit den Eltern von der Qualität her sehr signifikant unterschiedlich zwischen den Gruppen (chi2 = .009): Fast alle AssistentInnen schätzen sie als gut ein, jedoch nur ein Drittel der GruppenleiterInnen (vgl. Tab. 5.65). Auch die Intensität wird unterschiedlich gesehen: Ein Viertel der AssistentInnen schätzt sie eher hoch ein, während fast alle GruppenleiterInnen sie für höchstens wenig intensiv halten (vgl. Tab. 5.66).
-
mit den KollegInnen von der Qualität her von wenigen Ausnahmen abgesehen gut (vgl. Tab. 5.67), jedoch bei den AssistentInnen signifikant intensiver als bei den GruppenleiterInnen (vgl. Tab. 5.68; chi2 = .069): Die meisten AssistentInnen, jedoch nur die Hälfte der GruppenleiterInnen schätzen die Kooperation mit KollegInnen als intensiv oder sehr intensiv ein.
-
mit den Vorgesetzten in den jeweiligen Betrieben durchgängig gut (vgl. Tab. 5.69); zwei Drittel der AssistentInnen, jedoch nur ein Drittel der GruppenleiterInnen bezeichnen sie auch als intensiv (vgl. Tab. 5.70).
-
mit dem Arbeitsamt lediglich für ein Drittel der GruppenleiterInnen und für ein Sechstel der AssistentInnen eher gut, dagegen für die Hälfte der AssistentInnen und für ein Fünftel der GruppenleiterInnen schlecht (vgl. Tab. 5.71), lediglich von einem Viertel der GruppenleiterInnen wird sie als intensiv bezeichnet, von fast der Hälfte von ihnen und von fast vier Fünfteln der AssistentInnen wird sie als wenig oder gar nicht intensiv angesehen (vgl. Tab. 5.72).
-
mit den BerufsschullehrerInnen qualitativ recht unterschiedlich: ein Drittel der AssistentInnen und zwei Drittel der GruppenleiterInnen schätzt sie als eher oder sehr gut ein, dagegen sieht sie mehr als die Hälfte der AssistentInnen als eher oder sehr schlecht (vgl. Tab. 5.73). Von einem Drittel der GruppenleiterInnen wird die Kooperation mit den BerufsschullehrerInnen als intensiv wahrgenommen, von allen übrigen Befragten wird wenig oder gar keine Intensität gesehen (vgl. Tab. 5.74).
-
mit den TeampartnerInnen in der Arbeitssituation fast durchgängig gut und intensiv (vgl. Tab. 5.75 und 5.76).
-
mit der Leitung der Werkstatt für Behinderte bzw. der Arbeitsassistenz fast durchgängig gut (vgl. Tab. 5.77), jedoch für mehr als die Hälfte der AssistentInnen und fast vier Fünftel der GruppenleiterInnen wenig oder gar nicht intensiv und lediglich für ein Drittel der AssistentInnen intensiv (vgl. Tab. 5.78).
-
mit der jeweils anderen Form des Arbeitstrainings qualitativ sehr gemischt, wobei die AssistentInnen sie besser einschätzen als die GruppenleiterInnen (vgl. Tab. 5.79). Einigkeit besteht über eine geringe Intensität, allerdings mit der deutlichen Tendenz, dass die AssistentInnen sie als intensiver wahrnehmen als die GruppenleiterInnen (vgl. Tab. 5.80; chi2 = .018).
Insgesamt zeigt sich eine Staffelung der Qualität und Intensität der Kooperation: Im engsten Kreis stehen bei guter Qualität mit den Befragten die BewerberInnen bzw. MitarbeiterInnen, die TeampartnerInnen, die KollegInnen und teilweise - eher bei AssistentInnen - die Eltern und die Vorgesetzten in Verbindung. Weiter entfernt ist die Leitung mit geringerer Intensität und guter Qualität der Kooperation. Einen dritten und entferntesten Kreis bilden BerufsschullehrerInnen und BerufsberaterInnen mit der geringsten Intensität und sehr unterschiedlich wahrgenommener Qualität der Kooperation.
Fasst man die Aussagen zu zwei Indizes zur Kooperation zusammen, so zeigen sich lediglich minimale Unterschiede zwischen den Gruppen: Der Index zur Kooperationsqualität liegt mit 2,16 für die AssistentInnen und mit 2,17 für die GruppenleiterInnen geringfügig unter einem ›eher gut‹, der Index zur Kooperationsintensität liegt mit 2,57 für die AssistentInnen und 2,56 für die GruppenleiterInnen in der Mitte zwischen ›intensiv‹ und ›wenig intensiv‹. Dies zu interpretieren scheint insofern schwierig, als einerseits eine intensive Einbindung in Kooperationsnetze als wichtig, auf der anderen Seite als stresserzeugend angesehen werden muss.
Im letzten Teil zur Kooperation werden die Befragten ebenso wie in Kap. 3 die TeilnehmerInnen gebeten, die Kooperation mit den TeilnehmerInnen aus ihrer eigenen und aus der Sicht der TeilnehmerInnen unter den Aspekten Freundlichkeit, Unterstützung und Erreichbarkeit einzuschätzen (vgl. Tab. 5.81 - 5.83). Insgesamt kommt keine negative Bewertung vor (wenig freundlich, wenig unterstützend, wenig erreichbar), bei dem ersten und dritten Aspekt schätzen sich die AssistentInnen mit 70% bzw. 80% positiver Voten besser ein als die GruppenleiterInnen mit 60% bzw. 55%. Dagegen sehen sie sich mit einem Sechstel signifikant weniger gut unterstützend als die GruppenleiterInnen mit über der Hälfte positiver Voten, und drei Viertel der AssistentInnen halten sich gegenüber einem Drittel der GruppenleiterInnen nur für mal mehr und mal weniger unterstützend (chi2 = .083). Aus diesem Ergebnis spricht eine gewisse Unzufriedenheit bei den AssistentInnen, die auch auf zu gering empfundene Möglichkeiten bei den Anwesenheitszeiten zurückgehen dürfte.
Aus der Perspektive der unterstützten Personen, vermuten die Befragten, werden die AssistentInnen in der Kooperation mit nur einem Drittel positiver Voten gegenüber fast der Hälfte bei den GruppenleiterInnen als ein Stück weniger freundlich und - mit lediglich einem Sechstel positiver Voten in Relation zu über der Hälfte bei den GruppenleiterInnen - auch weniger erreichbar wahrgenommen (vgl. Tab. 5.84 - 5.86). Ihre Unterstützung sehen sie von den unterstützten Personen aus kritischer als aus der eigenen Perspektive: Unter 10 % der AssistentInnen, dagegen fast drei Viertel der GruppenleiterInnen meinen, sie würden als sehr gut unterstützend wahrgenommen, dagegen sehen fünf Sechstel der AssistentInnen und etwa ein Drittel der GruppenleiterInnen sich als mal mehr und mal weniger unterstützend wahrgenommen - ein sehr signifikanter Unterschied (chi2 = .001), der mit den geringeren Anwesenheitszeiten vor Ort, aber auch mit dem extrem großen Spektrum unterschiedlichster Situationen in den Betrieben zusammenhängen könnte. Gleichwohl gibt es hier lediglich eine einzige negative Bewertung.
Fasst man die drei Aspekte jeweils zusammen und bildet Mittelwerte der Gruppen (Werte: 1 - 3). So liegt die Selbstwahrnehmung der Gruppen recht dicht zusammen (Mittelwert der AssistentInnen: 1,4, der GruppenleiterInnen: 1,36) und noch im positiven Bereich. Dagegen fallen die Einschätzungen der vermuteten Fremdwahrnehmung weiter auseinander (Mittelwert der AssistentInnen: 1,83, der GruppenleiterInnen: 1,35), so dass die AssistentInnen schon eher im mittleren, indifferenten Bereich liegen. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass die Aufgabenstellung der AssistentInnen weniger in der Rolle freundlicher Zugewandtheit und jederzeit verfügbarer Unterstützung liegt, sondern eher in der Entwicklung einer Situation, in der es stärker auf die Selbstentwicklungskräfte der BewerberInnen, auf selbstbestimmte Situationsgestaltung und Selbstregulierung ankommt als in der betreuten Situation in der Werkstatt für Behinderte - und dies deuten die AssistentInnen für die BewerberInnen als latente Unzufriedenheit.
Zwischenfazit
AssistentInnen wie GruppenleiterInnen sind in hohem Maße in kooperative Netzstrukturen eingebunden: Die Kooperation mit BewerberInnen bzw. MitarbeiterInnen, KollegInnen und TeampartnerInnen wird als intensiv und gut wahrgenommen; AssistentInnen sehen darüber hinaus mehr und bessere Kooperation mit Eltern und Chefs in den Betrieben und mit geringerer Intensität auch eine bessere Kooperation mit ihrer Leitung. Je weiter entfernt KooperationspartnerInnen jedoch sind und je seltener und weniger man mit ihnen zu tun hat, desto mehr gehen auch die Bewertungen der Qualität auseinander, mit generell eher negativer Tendenz; dies betrifft vor allem BerufsschullehrerInnen und BerufsberaterInnen. Alles in allem gibt es nur geringe Unterschiede zwischen AssistentInnen und GruppenleiterInnen.
Die Selbstwahrnehmung ihrer Kooperation mit den BewerberInnen bzw. MitarbeiterInnen und deren vermutete Fremdwahrnehmung bewegt sich fast ausschließlich im mittleren und positiven Bereich. In puncto Freundlichkeit und Erreichbarkeit sehen sich die AssistentInnen besser als die GruppenleiterInnen, bei der Unterstützung ist dies umgekehrt; in der vermuteten Wahrnehmung der BewerberInnen sehen sich die AssistentInnen nicht in dem Maße in positivem Licht ihrer Klientel wie die GruppenleiterInnen. Ob dies mit situativen Bedingungen oder mit anders akzentuierten Funktionen (Katalysator vs. Anleiter) zu tun hat, muss hier letztlich offen bleiben.
Zunächst wird nach der vermuteten Einschätzung der ArbeitgeberInnen in Bezug auf einige Gegebenheiten auf dem ersten Arbeitsmarkt und in der Rehabilitationslandschaft gefragt.
So nennen die AssistentInnen, nach ihrer wichtigsten Leistung für die ArbeitgeberInnen gefragt, zu fast einem Drittel die Entlastungsfunktion für den Betrieb und zu einem zweiten Drittel die Vermittlungsfunktion zwischen den Beteiligten; ein weiteres Viertel sieht die Qualifizierungsfunktion im Vordergrund (vgl. Tab. 5.87).
Sehr signifikant unterschiedlich fällt die Einschätzung der Sicht der ArbeitgeberInnen auf die Arbeitsassistenz und die Werkstatt für Behinderte aus (vgl. Tab. 5.88; chi2 = .004): Fast zwei Drittel der AssistentInnen sehen ihre Kompetenz als hoch oder sehr hoch wahrgenommen. Dagegen schätzt der gleiche Anteil der GruppenleiterInnen die Beurteilung eigener Kompetenz durch ArbeitgeberInnen als gering ein, doch auch die Kompetenz der Arbeitsassistenz wird nur im Ausnahmefall als eher hoch und bei einem Viertel als eher gering wahrgenommen vermutet; zwei Drittel äußern sich allerdings nicht dazu (vgl. Tab. 5.89; chi2 = .011). Auch sehen die GruppenleiterInnen die Chancen einer Beschäftigung ihrer Klientel auf dem ersten Arbeitsmarkt zu je einem Drittel als eher niedrig oder sehr niedrig ein; das dritte Drittel äußert sich nicht dazu.
Welche Bedeutung ArbeitgeberInnen wohl Kostenzuschüssen und dem erweiterten Kündigungsschutz für Schwerbehinderte sowie dem vermehrten Urlaubsanspruch zumessen, wird im folgenden erfragt. Dabei gehen die Einschätzungen ein Stück weit auseinander. Mehr als drei Viertel der AssistentInnen messen Kostenzuschüssen - einem einstellungsförderlichen Faktor - eine eher oder sehr hohe Bedeutung zu, GruppenleiterInnen nur zu etwas mehr als einem Drittel (vgl. Tab. 5.90). Umgekehrt sehen nur etwas mehr als ein Drittel der AssistentInnen, aber mehr als die Hälfte der GruppenleiterInnen eine eher oder sehr hohe Bedeutung des Kündigungsschutzes und der Urlaubsansprüche - ein einstellungshinderlicher Faktor (vgl. Tab. 5.91). Hier werden unterschiedliche Tendenzen bezüglich eher optimistischer oder eher pessimistischer Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt nochmals belegt.
Weiter wird nach den vermuteten Motiven von ArbeitgeberInnen für die Einstellung von Menschen mit Behinderungen gefragt. Die Antworten werden nach dem Vorkommen abgeleiteter Kategorien geordnet (vgl. Tab. 5.92). Demnach bejahen die AssistentInnen in der Summe wesentlich mehr Einstellungsmotive von ArbeitgeberInnen als die GruppenleiterInnen. An der Spitze der Motive stehen dabei Kostenersparnisse durch finanzielle Zuwendungen wie Lohnkostenzuschüsse, bei den AssistentInnen gefolgt von sozialem Engagement und kompetenten BewerberInnen (je zwei Drittel der Nennungen), dem unterstützten Arbeitsverhältnis (ein Drittel), guten Erfahrungen mit der Arbeitsassistenz (ein Viertel) und freien Stellen (ein Fünftel). Dagegen vermuten die GruppenleiterInnen nach den finanziellen Zuwendungen soziales Engagement und Mitleid bzw. oberflächlicher Imagepflege (je ein Drittel) und die Kompetenz der BewerberInnen (ein Sechstel). Statistisch signifikante Unterschiede gibt es bei den in Assistenzkreisen stärker vertretenen Motiven der kompetenten BewerberIn (chi2 = .069) und des unterstützten Arbeitsverhältnisses (chi2 = .068) sowie dem seltener vertretenen Motiv des Mitleids und der Imagepflege (chi2 = .034). Weiter bleibt festzustellen, dass als problematisch empfundene Motive wie Mitleid und die Ausnutzung mit einfachen Arbeiten nur eine kleine Minderheit der insgesamt vermuteten Motive bilden.
Zur Situation in den Betrieben werden den AssistentInnen mehrere Fragen gestellt. Zum einen beschreibt fast die Hälfte von ihnen die Wahrnehmung der unterstützten Personen in den Betrieben (vgl. Tab. 5.93) als ›zunehmend kompetent‹, fast ein Viertel sieht sie unter-schiedlich wahrgenommen und lediglich ein Sechstel der AssistentInnen meint, die unterstützten Personen würden vor allem defizitär gesehen. Ihre eigene Rolle wird mit zwei Fragen reflektiert: Die Hälfte der AssistentInnen beschreibt die positiven Ausprägungen ihrer Rolle (vgl. Tab. 5.94) zur Hälfte als ›GesprächspartnerInnen‹, jedoch auch manchmal als ›AnwältIn‹ oder ›Sprachrohr‹ der unterstützten Person, in problematischer Ausprägung (vgl. Tab. 5.95) sehen sie sich zu einem Drittel als ›KontrolleurInnen‹ und › (Neben-)Chefs‹ im Betrieb, zu einem knappen Viertel als ›BehindertenbetreuerInnen‹ und zu gewissen Anteilen auch als ›Entlastungsperson‹ wahrgenommen.
Zwischenfazit
In den vermuteten Sichtweisen von ArbeitgeberInnen gehen die Einschätzungen beider Gruppen teils deutlich auseinander; hier dürfte sich auch die unterschiedliche Nähe zu aktuellen Situationen auf dem ersten Arbeitsmarkt auswirken. AssistentInnen sehen die Wahrnehmung ihrer Kompetenz, die Beschäftigungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Bedeutung besonderer Regelungen und die Einstellungsmotive von ArbeitgeberInnen positiver und optimistischer als die GruppenleiterInnen, die deutlich skeptischer sind und bei denen offenbar in der größeren Distanz zum ersten Arbeitsmarkt tradierte alltagstheoretische Vermutungen einen höheren Stellenwert haben. Während die AssistentInnen ihre eigene Rolle in Betrieben durchaus in positiven und problematischen Varianten kennzeichnen - einerseits als ›kompetenter GesprächspartnerIn‹, andererseits u.a. als ›Kontrolleur‹ und als ›BehindertenbetreuerIn‹, an den Zuständigkeit delegiert wird -, stellen sie die dort unterstützten MitarbeiterInnen fast zur Hälfte als zunehmend kompetent wahrgenommene Personen dar, dagegen ist eine als defizitär wahrgenommene Rolle nur mit einem Sechstel vertreten. Demnach scheint man in Betrieben in bemerkenswertem Maße zu einer Einschätzung von Leistungen und Entwicklungen mit individueller Bezugsnorm in der Lage zu sein.
Einige Fragen beziehen sich auf die Berufsberatung des Arbeitsamtes, die die zuweisende Stelle für beide Formen des Arbeitstrainings ist. Pauschal werden die Befragten nach deren Qualität gefragt (vgl. Tab. 5.96): Unisono gibt es nur abwägende, jedoch keine extremen Bewertungen: Die AssistentInnen sehen die Qualität eher problematisch, die GruppenleiterInnen eher positiv, jedoch sollten die Aussagen wegen der hohen Anteile fehlender Angaben nicht zu hoch gewichtet werden.
Gleiches gilt auch für die Frage nach den Gründen für die wahrgenommene Qualität (vgl. Tab. 5.97). Die positive Tendenz der GruppenleiterInnen bezieht sich auf die fachliche Kompetenz, die jedoch durch bei den BerufsberaterInnen wahrgenommene unrealistische Einschätzungen relativiert wird, die problematische der AssistentInnen resultiert - bei einem recht hohen Anteil unklarer Angaben - aus verschiedenen Aspekten.
Ebenso enthalten sich über die Hälfte der Befragten einer einschätzenden Antwort zum vermuteten Informationsstand im Arbeitsamt bezüglich des Ambulanten Arbeitstrainings (vgl. Tab. 5.98): Die übrigen GruppenleiterInnen halten ihn für eher hoch, während dies lediglich für ein Drittel der Stellung beziehenden AssistentInnen gilt; die anderen beiden Drittel schätzen den Informationsstand als geringer ein.
Zwischenfazit
Insgesamt macht sich offenbar eine große Distanz zum Arbeitsamt bemerkbar, die zu vielen fehlenden Angaben führt; darüber hinaus zieht sich eine eher kritische Tendenz bei den AssistentInnen und eine eher Kompetenzen wahrnehmende Sichtweise bei den GruppenleiterInnen durch die Antworten. Auch wenn extrem negative Antworten - als scharfe Kritik am Arbeitsamt - bei den ArbeitsassistentInnen nicht vorkommen, so führen bei ihnen immer wieder auftauchende Fälle, bei denen unrealistische Einschätzungen des Arbeitsamtes von BewerberInnen wahrgenommen werden (vgl. Kap. 4.4.1), evtl. verstärkt durch die Kontingentierungsproblematik, zu einer gewissen kritischen Distanz zur Berufsberatung des Arbeitsamtes.
Einige Fragen beziehen sich auf den Berufsschulunterricht, der mit dem Arbeitstraining koordiniert sein sollte. Zunächst wird nach dessen Bedeutung gefragt (vgl. Tab. 5.99): Alle Stellung beziehenden Befragten schätzen den Berufsschulunterricht als wichtig ein. Seine Qualität wird allerdings recht unterschiedlich wahrgenommen (vgl. Tab. 5.100): Während die sich äußernden GruppenleiterInnen ihn ausnahmslos positiv einschätzen, sind die Stellungnahmen der AssistentInnen heterogen. Dabei sehen sie durchweg Unterschiede zwischen den beiden für sie zuständigen Berufsschulen auf der inhaltlichen und der Konzeptebene, die sie auch als Qualitätsunterschiede wahrnehmen, während die GruppenleiterInnen keine Unterschiede zwischen den Berufsschulen feststellen, da sie durchweg nur mit einer Berufsschule zu tun haben.
Ein mögliches Erklärungsmuster ergibt sich aus den Aussagen über die Aufgaben des Berufsschulunterrichts, die von beiden Gruppen extrem unterschiedlich definiert werden (vgl. Tab. 5.101; chi2 = .000): Eine Hälfte der AssistentInnen meint, Berufsschulunterricht müsse sich vor allem anderen auf die Reflexion der Situation im (Ambulanten) Arbeitstraining beziehen, die andere möchte darüber hinaus individuelle Förderung realisiert sehen. Demgegenüber sehen die GruppenleiterInnen seine Aufgaben vor allem in der Weiterführung kognitiven Lernens.
Die inhaltliche und konzeptionelle Verknüpfung zwischen den Formen des Arbeitstrainings und der Ausrichtung des Berufsschulunterrichts sehen die Befragten recht unterschiedlich realisiert (vgl. Tab. 5.102; chi2 = .073): Die AssistentInnen sind in ihrer Einschätzung gespalten, was möglicherweise auch auf Erfahrungen mit den beiden unterschiedlichen Berufsschulen zurückgehen kann, dagegen sehen die GruppenleiterInnen, so weit sie sich äußern wenig oder gar keine Verknüpfung.
Zwischenfazit
Insgesamt zeigt sich - abgesehen von der allgemein hoch eingeschätzten Bedeutung des Berufsschulunterrichts - ein nahezu durchgängig heterogenes Bild, was Aufgaben, Konzept und Verknüpfung zwischen Berufsschulunterricht und Arbeitstraining angeht. Ob dies auch an den deutlich unterschiedlichen Konzepten der beiden für das Ambulante Arbeitstraining zuständigen Berufsschulen liegt, könnte sich in den Gesprächen mit den BerufsschullehrerInnen zeigen (vgl. Kap. 8).
Einige Fragen richten sich auf die Zukunftsperspektiven und ihre Chancen und Gefahren nach dem Durchlaufen der beiden Formen des Arbeitstrainings. Bei den Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt es lediglich einen Unterschied in der Differenziertheit der Antworten der Befragten (vgl. Tab. 5.103): Während die GruppenleiterInnen zu zwei Dritteln die Chance der Integration benennen und mit einem knappen Drittel die Chance der Selbstverwirklichung sieht, sehen bei dem zweiten Punkt die AssistentInnen dies ebenso; sie stellen jedoch die Chance der Integration zusätzlich in verschiedenen Facetten dar, indem sie ›echte Arbeit‹ von einem ›reellen Arbeitgeber‹ erhoffen.
Bei potentiellen Gefahren auf dem ersten Arbeitsmarkt gehen die Aussagen der Gruppen dagegen signifikant auseinander (vgl. Tab. 5.104; chi2 = .074): Während die GruppenleiterInnen vor allem soziale Isolation, in gewissen Maße auch Ausbeutung befürchten, sehen die AssistentInnen vor allem Überforderungsgefahren und das mögliche Problem der dauerhaften Abhängigkeit von Assistenz, soziale Isolation und Kündigungen stehen dagegen zurück.
Die umgekehrte Tendenz von pauschalen und differenzierteren Aussagen findet sich bezüglich positiver Perspektiven in der Werkstatt für Behinderte (vgl. Tab. 5.105; chi2 = .032). Hier sehen die AssistentInnen Chancen vor allem im Hinblick auf Schutz und Absicherung sowie auf soziale Zugehörigkeit als Gleicher unter Gleichen, die GruppenleiterInnen sehen demgegenüber vor allem die Passung der Beschäftigung mit den Fähigkeiten und Neigungen ihrer Klientel, aber auch andere Aspekte wie Selbstverwirklichung und Weiterentwicklung.
Zukünftige Gefahren in der Werkstatt für Behinderte sehen in der Optik beider Gruppen ähnlich aus (vgl. Tab. 5.106): Sie lassen sich unter den Begriffen Stagnation, Unterforderung und Deprivation zusammenfassen und beziehen sich letztlich auf eine Situation des Ausgegrenzt-Seins in einer eher unflexiblen Institution.
Zwischenfazit
Insgesamt zeigt sich das Bild, dass die Befragten die längerfristigen Chancen der beruflichen Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt und die Gefahren der Werkstattsituation relativ einheitlich sehen, dagegen die Gefahren auf dem ersten Arbeitsmarkt und die Chancen in der Werkstatt für Behinderte recht unterschiedlich wahrnehmen - hier dürfte sich auch die jeweilige Distanz zu der je anderen Realität widerspiegeln.
Abschließend werden die Befragten um resümierende Aussagen anhand von Satzanfängen gebeten.
Das Beste an ihrer Arbeit (vgl. Tab. 5.107) sehen die AssistentInnen vor allem in der Unterstützung bei der Arbeit und in der Vielschichtigkeit, doch auch Sinnhaftigkeit und erfolgreiche Vermittlungen gehören zum ›Schönsten‹. Demgegenüber heben die GruppenleiterInnen vor allem die Arbeit mit Menschen und die Vielschichtigkeit hervor, gefolgt von der Selbständigkeit bei der Arbeit.
Das ›Schwierigste‹ an der Arbeit (vgl. Tab. 5.108) sehen die AssistentInnen - als zweite Seite der schönen Medaille - in der Komplexität der Tätigkeit, im notwendigen Konfliktmanagement und in der sicheren Einschätzung der Fähigkeiten der unterstützten Personen; auch die professionelle Rolle wird genannt. Die GruppenleiterInnen sehen dagegen neben der Einschätzung der Fähigkeiten der behinderten MitarbeiterInnen Aspekte des Zeitmanagements als problematisch an.
Die Werkstatt für Behinderte sehen die Befragten als geeignet an (vgl. Tab. 5.109) für Menschen, die einen geschützten Rahmen wünschen und die nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Dabei verwenden allerdings die AssistentInnen eher Formulierungen, die einen aktiven Willensprozess kennzeichnen (›entscheiden‹, ›wollen‹), während die GruppenleiterInnen durchgängig von objektiven Notwendigkeiten ohne aktive Anteile der Person sprechen (›brauchen‹, ›sollen‹).
Über den Personenkreis, für den das Ambulante Arbeitstraining geeignet ist, gehen die Meinungen auseinander (vgl. Tab. 5.110; chi2 = .018): AssistentInnen sehen es vor allem als geeignet an für Personen, die motiviert sind, etwas Neues versuchen und ihre Fähigkeiten klären wollen, dagegen sehen GruppenleiterInnen es vor allem für die Personen als angemessen, die ›Grenzfälle‹ sind oder die die Werkstatt für Behinderte ablehnen.
Auch bei der Frage nach Kriterien der Integrierbarkeit zeigen sich deutliche Unterschiede (vgl. Tab. 5.111; chi2 = 056). Während die AssistentInnen eher eigentlich jeden Menschen oder jeden, der möchte, für integrierbar halten oder die Frage als falschen Ansatz kritisieren, macht sich Integrierbarkeit bei den GruppenleiterInnen vor allem an entsprechenden Fähigkeiten der Menschen mit Behinderungen fest.
Auf die Frage nach Veränderungswünschen für die Zukunft wird ein ganzes Spektrum von Antworten gegeben (vgl. Tab. 5.112): Bei den AssistentInnen stehen freie Wahlmöglichkeiten für alle jungen Menschen mit Behinderungen, unabhängig von Quotierungen, als gesellschaftlich-politische Veränderungen ganz oben auf dem Wunschzettel; insbesondere wird von vielen eine Ausweitung der Platzzahlen bei Ambulantem Arbeitstraining und Integrationspraktikum gewünscht, und die zeitliche Befristung der finanziellen Förderung müsse aufgehoben werden. Bei den GruppenleiterInnen werden neben gesellschaftspolitischen Veränderungen - mehr ›Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft‹ und mehr ›Außenarbeitsplätze unter dem Schutz der Werkstatt‹ - auch bessere Ressourcen, d.h. mehr Zeit, Geld und Personal gewünscht.
Bei Vorgesprächen betont eine Gruppenleiterin ihr Misstrauen gegenüber integrativen Orientierungen - auch innerhalb der eigenen Werkstatt für Behinderte, da sie damit lediglich einen stärkeren Anpassungsdruck für Menschen mit Behinderung verbunden sieht. In ihrem Arbeitstrainingsbereich gelte dagegen das Motto: ›Bei uns dürfen die Behinderten noch behindert sein.‹ Hierdurch angeregt werden alle nach dem Motto gefragt, unter das sie ihre Arbeit stellen könnten. Hierzu antworten
... die AssistentInnen:
-
Es ist viel mehr möglich, als es auf den ersten Blick scheint.
-
Immer wieder neue Verläufe
-
Ich wachse an meinen Erfahrungen
-
Äußerst anstrengend, aber sinnvoll und wichtig
-
Immer mit der Ruhe
-
In der Ruhe liegt die Kraft
-
DRANBLEIBEN!
-
Weitermachen!
... die GruppenleiterInnen:
-
Lernen kann jeder
-
Individuelle berufliche Bildung für Menschen mit Leistungseinschränkungen
-
Ein Mensch muss sich wohlfühlen, erst dann kann er sich entwickeln und fühlt sich sicher
-
Probleme können gemeinsam gelöst werden
-
Den Weg für das (Berufs-)Leben ebnen
-
Ran an den Speck und nicht viel gefackelt
Zwischenfazit
Auch in den Resümees zeigen sich die AssistentInnen als entschiedene VertreterInnen konzeptioneller Vorstellungen - sie bilden ›das Beste‹, auf der zweiten Seite der Medaille auch ›das Schwierigste‹ der Arbeit. Demgegenüber sind die Aussagen der GruppenleiterInnen weniger programmatisch und konzeptionell orientiert, sondern verweisen eher auf kontextunabhängige Qualitäten und Probleme.
In den Aussagen über die Personenkreise, für die die Werkstatt für Behinderte, das Ambulante Arbeitstraining geeignet und die überhaupt integrierbar sind, werden unterschiedliche Grundorientierungen sichtbar: Bei diesen Fragen sind für die AssistentInnen letztlich subjektive Interessen und Wünsche der Menschen mit Behinderung entscheidend, in den Augen der GruppenleiterInnen dagegen deren Fähigkeiten und von ihnen als objektiv gesehene Notwendigkeiten.
Bei den Veränderungswünschen stehen gesellschaftlich-politische ganz oben; allerdings stellen die AssistentInnen gezielte Forderungen für die konzeptionelle und quantitative Weiterentwicklung des Ambulanten Arbeitstrainings, während die GruppenleiterInnen ihre Wünsche allgemeiner formulieren.
Bei der Befragung der ArbeitsassistentInnen im Ambulanten Arbeitstraining und der GruppenleiterInnen im Arbeitstraining der Werkstätten für Behinderte handelt es sich tendenziell um unterschiedliche Gruppen: Die ArbeitsassistentInnen sind deutlich jünger, demzufolge kürzer im Beruf tätig, sie haben eher eine pädagogische Ausbildung als Basis und sind mit stärker programmatischer Motivation in ihre Arbeit gegangen. Die GruppenleiterInnen sind älter, schon länger tätig, eher zunächst handwerklich und später zusätzlich sonderpädagogisch ausgebildet, ihre Motivation hat höhere Anteile pragmatischer Überlegungen. Auf dieser Folie lassen sich die weiteren Aussagen in folgenden Punkten zusammenfassen:
-
Die ArbeitsassistentInnen stehen voll und ganz hinter Konzept und Praxis des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums. Sie sehen beides als angemessen für Personen, die motiviert sind zur Arbeit und die diesen Weg wollen; bestimmte Fähigkeiten darüber hinaus sind förderlich, aber nicht notwendige oder ausschließende Voraussetzung. Die Werkstatt für Behinderte sehen sie in Konzept wie Praxis kritisch. An vielen Stellen machen die AssistentInnen stark subjekt- und individuumsorientierte Aussagen: Die einzelne Person und ihr Wille sind das Entscheidende. Demgegenüber wird bei den GruppenleiterInnen eher eine pragmatische Haltung deutlich, sie gehen zudem eher von als objektiv empfundenen Bedarfen ihrer Klientel aus. Das Ambulante Arbeitstraining sehen sie daher auch eher als angemessene Maßnahme für einen kleinen, besonders leistungsstarken Teil der MitarbeiterInnen der Werkstatt für Behinderte.
-
Kritisch sehen die AssistentInnen beim Ambulanten Arbeitstraining einige Bedingungen: Die strukturelle Verankerung mit der Anbindung an die Werkstatt für Behinderte und der zeitlichen Limitierung der Unterstützungsleistungen sowie die konkreten Bedingungen der Bezahlung und des Zeitmanagements sind hier wichtig.
-
Die Durchlässigkeit beider Formen des Arbeitstrainings sehen AssistentInnen wie GruppenleiterInnen nur in geringem Maße realisiert.
-
Die professionelle Rolle der AssistentInnen lässt sich im Unterschied zu den GruppenleiterInnen, die fördernd und betreuend agieren, mit dem Bild eines Katalysators beschreiben, der dafür sorgen soll, dass eine Situation sich entwickelt - und die unterstützte Person ist ein wichtiger, aber nur ein Teil der Situation im Betrieb. Das macht die Arbeitssituation herausfordernd und immer neu, aber auch belastend und stressig.
-
Die ArbeitsassistentInnen bewerten ihre Arbeit als gut bis sehr gut, ebenso wie die GruppenleiterInnen. Schwerpunkte von Tätigkeiten sind quantitativ vor allem die konkrete Unterstützung der Person vor Ort und die Arbeit mit dem betrieblichen Umfeld. Damit korrespondiert die qualitative Dominanz der Begleitung und der Mittlerfunktion zwischen den Beteiligten, wobei der Blick mehr auf die Persönlichkeits- als auf die Fähigkeitsentwicklung gerichtet ist. Die GruppenleiterInnen blicken demgegenüber stärker auf die Entwicklung der Fähigkeiten und sehen sich eher als betreuende Förderer.
-
Grenzen der Unterstützung sehen die AssistentInnen vor allem dort, wo es um private Kontaktwünsche und Probleme geht, typische Konflikte gibt es vor allem in Bezug auf die Anteile der professionellen Rolle, die von den BewerberInnen als ›unsolidarisch‹ wahrgenommen werden, wenn also etwa Forderungen aus der Sicht von Vorgesetzten oder KollegInnen an sie gerichtet werden. Fortbildungsbedarf sehen die AssistentInnen denn auch in erster Linie im Bereich von Gesprächsführung und Supervision. Über die Grenzen der Förderung äußern sich die GruppenleiterInnen im wesentlichen genauso wie die AssistentInnen, sie sehen Konflikte eher durch Verhaltensprobleme ihrer MitarbeiterInnen bedingt und wünschen sich Fortbildung in vielen Bereichen.
-
Die Befragten sehen sich nach Intensität und Qualität weitgehend in hohem Maße in Kooperationsstrukturen eingebunden. Dies gilt am deutlichsten für die PartnerInnen im direkten, alltäglichen Umfeld (BewerberInnen, KollegInnen, TeampartnerInnen), tendenziell auch für PartnerInnen mit etwas weniger Berührung (Eltern, Leitung). Wesentlich geringer und unterschiedlicher wird die Kooperation mit weiter entfernten PartnerInnen empfunden (BerufsberaterInnen, BerufsschullehrerInnen). Hierbei unterscheiden sich die beiden Gruppen wenig, an deutlichsten noch bei der Zusammenarbeit mit den Eltern, die von den AssistentInnen positiver wahrgenommen wird.
-
Die Selbst- und die vermutete Fremdwahrnehmung der Befragten aus der Sicht ihrer Klientel bewegt sich nur im positiven und mittleren Bereich, negative Aussagen gibt es hier nicht. Dabei sieht sich mal die eine, mal die andere Gruppe etwas positiver, in der Wahrnehmung der BewerberInnen sehen sich die AssistentInnen in einem weniger positiven Licht in Relation zu den GruppenleiterInnen.
-
Sichtweisen von ArbeitgeberInnen schätzen die AssistentInnen mit deutlich positiver Tendenz ein: Sie selbst werden vor allem als ›kompetente GesprächspartnerInnen‹ wahrgenommen, positiv bewertete Einstellungsmotive sind weitaus mehr vertreten als problematische, Einstellungshindernisse durch gesetzliche Regelungen von Kündigung und Urlaub spielen nur eine geringe Rolle. Die AssistentInnen beschreiben eigene Rollen in Betrieben durchaus als hilfreiche und weniger hilfreiche, die unterstützten MitarbeiterInnen sehen sie dort vor allem als ›zunehmend kompetent‹ und nur in geringem Maße als ›defizitär‹ wahrgenommen - anscheinend sind Betriebe in nennenswertem Maße in der Lage, Leistungen mit individueller Bezugsnorm wahrzunehmen.
-
In der Einschätzung der Berufsberatung halten sich die Befragten eher bedeckt, offenbar ist die Distanz zu groß, als dass man sich sehr deutlich festlegen möchte. So dominieren vorsichtige Aussagen, bei den AssistentInnen mit zweifelnder, bei den GruppenleiterInnen mit zustimmender Tendenz. Scharfe Kritik und extreme Einschätzungen kommen nicht vor, viele Befragte machen keine Angaben zu diesem Bereich.
-
Einig sind sich die Befragten darin, dass der Berufsschulunterricht wichtig ist; die Schwerpunkte seiner Aufgaben (im Spektrum zwischen kognitivem Lernen und/oder Schlüsselqualifikationen und der Reflexion der Situation und Rolle im Betrieb) und die realisierte Qualität sehen sie recht unterschiedlich; offenbar gibt es auch bezüglich der beiden Berufsschulen, die für das Ambulante Arbeitstraining zuständig sind, deutliche Unterschiede in den Einschätzungen.
-
Was zukünftige Perspektiven angeht, so sehen beide Gruppen die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt (Integration, Selbstverwirklichung) und die Gefahren in der Werkstatt für Behinderte (Stagnation, Unterforderung) ähnlich, Unterschiede gibt es jedoch bei den Chancen in der Werkstattsituation (Schutz und Absicherung vs. individuelle Passung) und bei den Gefahren auf dem ersten Arbeitsmarkt (Überforderung und dauerhafte Abhängigkeit von Assistenz vs. Isolation).
-
Die Beschreibung der Klientel geschieht - wie bereits angedeutet - bei den AssistentInnen sehr individuumsorientiert, überwiegend nonkategorial und mit Blick auf Entwicklungen in der betrieblichen Situation. Die GruppenleiterInnen beschreiben ihre Klientel eher gruppenorientiert, durchgängig kategorial und mit Blick auf individuelle Fähigkeiten mit der Folge möglicher Zuweisungen.
-
Schließlich zeigen sich auch in den Resümees die AssistentInnen als konzeptionell voll überzeugte ProgrammatikerInnen, die eigenständige Subjekte individuell unterstützen und klare Vorstellungen für zukünftige Veränderungen haben, während die GruppenleiterInnen sich eher pragmatisch und allgemein äußern und Personen anhand ihrer Kriterien beschreiben.
Die beschriebenen Unterschiede zwischen AssistentInnen und GruppenleiterInnen können im wesentlichen auf zwei Wurzeln zurückgeführt werden: Zum einen spielen unterschiedliche situative Bedingungen der Arbeit eine Rolle, denn es macht einen Unterschied, ob man jeweils einzelne Personen in verschiedenen Betrieben unterstützt oder ob man eine Gruppe anleitet. Zum anderen wird immer wieder der Hintergrund deutlich, dass es sich bei der Arbeitsassistenz um einen relativ jungen, kleinen und innovativen Fachdienst handelt, dessen MitarbeiterInnen an konzeptionellen Fragen massiv interessiert sind, bei den Werkstätten für Behinderte hingegen um seit Jahrzehnten etablierte Institutionen, deren MitarbeiterInnen sich weniger um konzeptionelle, sondern mehr um konkrete praxisbezogene Dinge Gedanken machen. Insofern hat es eine nachvollziehbare Logik, dass die Arbeit der Arbeitsassistenz sich stark am Integrationsparadigma orientiert, während die Werkstätten stark im rehabilitativ-sonderpädagogischen Paradigma verwurzelt sind und Übergänge zum integrationspädagogischen Paradigma erst in Ansätzen und dann eher auf der institutionellen Ebene zu finden sind (vgl. Kap. 1.2).
Inhaltsverzeichnis
- 6.1 Anliegen und Fragestellung
- 6.2 Methodische Überlegungen und Stichprobenbildung
-
6.3 Ergebnisse
- 6.3.1 Chefin A: »Ich habe in der Anfangsphase auch jeden Tag gemerkt, wie wir lernen, sensibler zu werden«
- 6.3.2 Chef B: »Ich tue es eigentlich gerne, auch wenn ich deswegen Schwierigkeiten habe«
- 6.3.3 Chefin C: »Für mich ist es ein schönes Gefühl, sie ist hier, und ich weiß, dass es auch anderen so geht - und das ist es halt«
- 6.3.4 Chef D: »Er ist ein fester Bestandteil durch das, was er kann«
- 6.3.5 Chef E: »Das sehe ich auch als wirkliche Hilfe an, nicht nur als kleine soziale Gefälligkeit, sondern als echte Hilfe für uns«
- 6.3.6 Chefin F: »Sie ist so mit im Team integriert, das macht keinen Unterschied«
- 6.3.7 Chefs G: »Der eine hat vielleicht geistig nicht so viel drauf, aber bringt tolle Arbeit, und den kann man besser integrieren als jemanden, der vielleicht viel mehr drauf hat, aber nichts leistet«
- 6.4 Zusammenfassung
Neben den unterstützten ArbeitnehmerInnen sind die Betriebe die zweite Gruppe der KundInnen, mit denen die Arbeitsassistenz zu tun hat. Insofern ist deren Einschätzung des Ansatzes der Arbeitsassistenz und der Arbeit der ArbeitsassistentInnen ein wichtiges Datum, das bei einer Gesamteinschätzung Berücksichtigung finden muss.
In der Regel besteht bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung aus Sicht von Unternehmen »eine diffuse Mischung aus Vorurteilen und realen Bedenken« (HAA 1997b, 8). Folgende Schwierigkeiten und Probleme werden befürchtet:
-
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind den flexiblen Anforderungen eines Arbeitsplatzes nicht gewachsen und können als ArbeitnehmerInnen die geforderte Leistungsnorm nicht erfüllen. Die ArbeitgeberInnen haben kein Vertrauen in die nötige Selbständigkeit der ArbeitnehmerInnen mit Behinderung.
Das betriebliche Interesse ist auf leistungsfähige und flexibel einsetzbare Arbeitskräfte ausgerichtet. Beschäftigte sollen »eine Leistungsreserve aufweisen, die Raum für Arbeitsintensivierung und flexiblen Arbeitseinsatz lässt« (SEMLINGER & SCHMID 1985, 105). Auch wenn mit betriebseigenen Schwerbehinderten gute Erfahrungen gemacht werden und ihnen eine hohe Leistungsbereitschaft und -fähigkeit attestiert wird, fällt die Beurteilung von betriebsfremden Schwerbehinderten wesentlich zurückhaltender aus. Von ihnen werden hohe Fehlzeiten, eine höhere Krankheitsanfälligkeit aufgrund der Behinderung und soziale Schwierigkeiten innerhalb des Kollegenkreises befürchtet (vgl. NIEHAUS 1997, 44). Oftmals wird irrtümlicherweise auch der Grad der Behinderung mit der zu erwartenden Leistungsfähigkeit gleichgesetzt (vgl. DALFERTH 1995, 45).
-
Den BewerberInnen mit Behinderungen fehlen Qualifikation und (Vor-)Erfahrung bei bestimmten Arbeitsplätzen.
Arbeitsplätze werden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf der Grundlage von normierten Berufsbildern vermittelt (vgl. CIOLEK 1995, 61). Menschen, die diesen Normen nicht entsprechen, werden so Möglichkeiten genommen, ihre Arbeitskraft anzubieten; unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten können sie im Prozess der Arbeitsvermittlung nicht bestehen. Die Qualifikation, die Menschen mit Behinderungen z.B. aus der Werkstatt für Behinderte mitbringen, erweist sich in vielen Fällen als unzureichend für die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes (vgl. DOOSE 1997b, 283).
-
Es werden Nachteile hinsichtlich einer langfristigen Beschäftigungspflicht befürchtet, vor allem nach dem Wegfall der Lohnkostenzuschüsse bezüglich des besonderen Kündigungsschutzes für Schwerbehinderte und des Anrechts auf Mehrurlaub.
Das unternehmerische Denken und Handeln wird von betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt. Kosten-Nutzen-Abwägungen bestimmen die Personalpolitik: Das Ganze muss sich rechnen. Viele Betriebe fürchten, dass nach Ablauf der Lohnkostenzuschüsse das Beschäftigungsverhältnis nicht kostendeckend fortgesetzt werden kann und aufgrund des bestehenden Kündigungsschutzes den ArbeitnehmerInnen mit Behinderung nicht gekündigt werden kann. Auch das Anrecht auf Mehrurlaub verursacht Angst vor erhöhten Personalkosten bzw. -aufwendungen.
-
Gravierend sind die bestehenden Vorurteile im Hinblick auf die Arten der Behinderungen, besonders das Bild von Menschen mit einer geistigen Behinderung verursacht Hemmungen und Ängste.
Der Schwerbehindertenstatus wirkt sich offensichtlich für arbeitssuchende Schwerbehinderte stark stigmatisierend aus, bei ihnen wird er »als Indiz für geringe Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit aufgefasst« (NIEHAUS 1997, 44). Dieser Stigmatisierungseffekt findet sich vor allem im Hinblick auf die Art der Behinderung: Bewerber mit sogenannten ›klassischen Behinderungen‹ (z.B. Gehörlose, Sehbehinderte oder Querschnittsgelähmte) haben dabei grundsätzlich größere Chancen als geistig Behinderte oder psychisch Behinderte. Hier zeigt sich die unterschiedliche soziale Akzeptanz gegenüber den verschiedenen Arten der Behinderungen (vgl. CLOERKES 1997, 77ff.).
Trotz dieser allgemein bestehenden Vorbehalte gegenüber der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zeigt die Erfahrung von Integrationsfachdiensten wie der Hamburger Arbeitsassistenz, dass diese Barrieren bei funktionierender Information überwindbar sind und dass die Menschen, »die bisher als ›nicht vermittelbar‹ galten, mit entsprechender Unterstützung erfolgreich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können« (DOOSE 1997a, 85; vgl. auch TROST & SCHÜLLER 1992). Offensichtlich lassen sich Argumente finden, mit denen Unternehmen zu überzeugen sind, »dass mit einer entsprechenden Unterstützung und Förderung die vermeintlichen betriebswirtschaftlichen Nachteile kompensiert werden können« (BEHN-CKE & CIOLEK 1997, 224). Einige dieser Argumente können in Anlehnung an die Hamburger Arbeitsassistenz wie folgt benannt werden (vgl. HAA 1997b, 6, auch SCHARTMANN 1999, 69f.):
-
Betriebe stellen ArbeitnehmerInnen ein, die zwar nicht die volle Leistung erbringen, aber zuverlässig und hochmotiviert sind,
-
der Integrationsfachdienst gewährleistet, dass ein geeigneter Arbeitnehmer den Arbeitsplatz besetzt,
-
durch die angebotene Arbeitsplatz(um)gestaltung erhöht sich die betriebswirtschaftliche Effektivität,
-
die Lohnkostenzuschüsse und weitere finanzielle Hilfen grenzen das finanzielle Risiko ein,
-
mit der Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung kann der Betrieb seiner gesetzlichen und sozialen Beschäftigungspflicht nachkommen,
-
die ArbeitsassistentInnen arbeiten den neuen Mitarbeiter ein, sie entlasten damit die Mitarbeiter des Unternehmens,
-
das soziale Engagement für Menschen mit Behinderung erzeugt in der Öffentlichkeit ein positives Image,
-
die geforderte Rücksichtnahme auf die sogenannten Leistungsschwächeren trägt zu einer allgemeinen Verbesserung des Betriebsklimas bei,
-
für auftretende Probleme bietet die Hamburger Arbeitsassistenz langfristig und verbindlich Unterstützung.
Vorrangiges Ziel ist dabei nicht die zahlenmäßig hohe Vermittlung von unterstützten Beschäftigungsverhältnissen als vielmehr die Tatsache, dass das Beschäftigungsverhältnis sowohl den Erwartungen des Betriebes als auch den Möglichkeiten und Bedürfnissen des Arbeitnehmers mit Behinderung gerecht wird. Dabei steht empirischen Untersuchungen zufolge für den Betrieb als Einstellungskriterium die »passgenaue Besetzung des Arbeitsplatzes« deutlich an der Spitze, gefolgt von der »guten Einarbeitung am Arbeitsplatz«, während die Erfüllung der Pflichtquote einen nachrangigen Stellenwert hat (SCHARTMANN 1999, 32). Auch für MAIR (1997, 28f.) steht nach seinen Ergebnissen die Sinnhaftigkeit Unterstützter Beschäftigung für das Unternehmen in ökonomischer wie betrieblicher Hinsicht an der Spitze der Einstellungsmotive. Erst sekundär treten pro-soziale Einstellungen, finanzielle Unterstützung und das Vorhandensein eines fachlichen Unterstützungsdienstes hinzu (vgl. auch MAIR & BARLSEN 2000).
Es stellt sich also hier die Frage, welche Realität stimmt - die alltagstheoretische Realität, dass es für einen Betrieb im Grunde genommen kontraproduktiv ist, eine Person mit Behinderung zu beschäftigen oder die Realität der Arbeitsassistenz, dass dies sehr wohl erfolgreich möglich ist.
Auch bei den Interviews mit Vorgesetzten geht es darum, dass eine Balance erreicht wird aus den Frageinteressen der Interviewer und den Schwerpunkten, Ansichten und Impulsen der Befragten. Dies ist auch hier wichtig, selbst wenn das gesellschaftliche und soziale Gefälle zwischen Interviewern und Interviewten nicht in der Weise besteht, wie dies bei den TeilnehmerInnen an den Maßnahmen der Fall ist (vgl. Kap. 4.2). Insofern werden auch hier mündliche Interviews mit der Grundlage eines Interviewleitfadens geführt (vgl. Anhang 11.6). Dabei soll es auch mit den Vorgesetzten zu einer ausgewogenen Mischung von offenen und strukturierten Impulsen geben.
Im ersten Teil des Interviews wird jeweils in offener Form nach verschiedenen Bereichen gefragt: nach den Prozessen vom Beginn der Arbeit bis zur aktuellen Situation, nach der Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz und nach der Bedeutung finanzieller und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Deutlich strukturierter wird im zweiten Teil die Einschätzung der Möglichkeit von Unterstützter Beschäftigung anhand zweier provozierender Impulse erhoben: Zum einen werden die Befragten mit einem Zitat aus einem Gespräch eines Wirtschaftsverbandssprechers mit der Arbeitsassistenz konfrontiert, in dem er um Adressen von Unternehmen gebeten wird, mit denen die Arbeitsassistenz Kontakt aufnehmen möchte: »Wissen Sie, es hat wenig Sinn, wenn ich Ihnen Adressen von Firmen weitergebe. Ich bin sicher, dass Sie bei diesen Firmen kein Glück haben werden. Der norddeutsche Markt ist hart umkämpft, da kann sich keine Firma erlauben, ihr Image durch Behinderte zu schädigen« (aus BEHNCKE 1998, 29). Zum anderen werden den Befragten mehrere Fotos vorgelegt, auf denen Unternehmen mit Personen mit deutlich sichtbarer Behinderung für ihre Produkte werben (vgl. die Abbildungen in Anhang 11.6). Zu beiden Impulsen werden sie um Kommentare gebeten. Zudem sollen die Befragten ihre Zufriedenheit mit ihrer Entscheidung der Einstellung einer Person mit Behinderung im Betrieb, mit der Praxis, mit der Assistenz, mit der Kooperation und mit den finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen in ungefähren Prozentwerten einschätzen. Den Abschluss der Interviews bilden jeweils fünf resümierende Satzanfänge, die die Befragten ergänzen sollen:
-
»Anders laufen müsste beim nächsten Mal ...«
-
»Die wichtigste Leistung der Hamburger Arbeitsassistenz war für mich ...«
-
»Gewünscht hätte ich mir von der Hamburger Arbeitsassistenz ...«
-
»Belastend ist bei beruflicher Integration für mich und meinen Betrieb ...«
-
»Bereichernd ist bei beruflicher Integration für mich und meinen Betrieb ...«
-
»Wenn ich nochmals vor der Entscheidung stünde, würde ich ...«
Die Auswahl der InterviewpartnerInnen trifft die Hamburger Arbeitsassistenz, da sie als einzige Stelle einen Überblick darüber hat, welche Unternehmen Menschen mit Behinderungen mit ihrer Unterstützung beschäftigen. Abgesprochene Kriterien dafür sind, dass schon längerfristige Erfahrungen vorliegen, dass aber auch ein möglichst großes Spektrum unterschiedlicher Merkmale der Betriebe vertreten sein sollen: Wirtschaftssektoren, Betriebsgrößen, Branchen und Tätigkeitsbereiche für die MitarbeiterInnen. Aus arbeitsökonomischen Gründen wird eine möglichst hohe Überschneidung angestrebt zwischen den Vorgesetzten, die im Rahmen der Intensivbefragung beteiligt sind (vgl. Kap. 4), und denen, die in diesem Rahmen befragt werden. So werden acht Unternehmen ausgewählt und für die Interviews angefragt:
-
Ein Gästehaus beschäftigt eine unterstützte Mitarbeiterin im Bereich von Küche und Reinigung.
-
Eine Tankstelle setzt einen unterstützten Mitarbeiter ein im Bereich von Lagerhaltung (Shop) und Reinigung, er soll jedoch mehr und mehr in Richtung Service an der Tankstelle qualifiziert werden.
-
Im Rahmen eines großen Medienkonzerns wird eine unterstützte Mitarbeiterin in einem Call-Center beschäftigt, wo sie im Telefondienst ein Projekt mit Zeitschriftenabonnements betreut.
-
Ein Konditoreibetrieb beschäftigt einen unterstützten Mitarbeiter als Bäckereigehilfen in der Backstube.
-
Eine Catering-Firma betreibt in einer Bankzentrale alle entsprechenden Service-Angebote; in diesem Rahmen wird eine unterstützte Mitarbeiterin an einem Kiosk beschäftigt.
-
In mehreren Filialen einer großen Hotelkette werden mehrere unterstützte Mitarbeiterinnen im Zimmerservice und im Restaurant eingesetzt.
-
Ein Outdoor-Ausrüster mit mehreren Filialen in verschiedenen Städten beschäftigt zwei unterstützte MitarbeiterInnen im zentralen Lager, in dem sie Bestellungen entgegennehmen und Sendungen zusammenstellen.
-
In einem Altersheim ist ein unterstützter Mitarbeiter als Hausmeistergehilfe angestellt.
Es handelt sich also um Betriebe aus den Bereichen Dienstleistung, Handel, Gastronomie und Handwerk. Alle acht Betriebe sind zu Gesprächen bereit, jedoch muss aufgrund kurzfristiger Krankheitsvertretung ein Interview entfallen, so dass die Situation im Altersheim nicht betrachtet werden kann. Alle anderen Interviews werden im August 2000, in der Regel in den Unternehmen während der Arbeitszeit der Befragten durchgeführt, sie dauern zwischen 50 und 90 Minuten.
Nach der Auswahl durch die Hamburger Arbeitsassistenz kann davon ausgegangen werden, dass die befragten Unternehmen angesichts ihrer Bereitschaft zum Interview eine positive Haltung zur Unterstützten Beschäftigung haben. Dieses als positives Ergebnis herauszustellen, wäre also ein Artefakt. Vielmehr geht es um die differenzierte Analyse von Erfahrungen, Einschätzungen und Motive. Die Auswertung der Interviews mit deren vollständiger Transkription vom Band orientiert sich an den entsprechenden Bereichen:
-
Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und die gegenwärtige Situation
-
Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz
-
Finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung
-
Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen
-
Motive zur Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung
-
Resümierende Einschätzung
Im folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Interviews jeweils für sich dargestellt, so dass die Situation im Betrieb und die Erfahrungen der Vorgesetzten anschaulich nachvollzogen werden können. Überdies entspricht die Reihenfolge der ersten vier Unternehmen der im vierten Kapitel. Dabei lässt es sich nicht vermeiden, dass es zu Überschneidungen kommt, jedoch ist der Fokus der Betrachtungen ein unterschiedlicher: Dort ging es um die Einschätzung der Entwicklung einer Person und förderliche oder behindernde Faktoren, hier zielt die Darstellung nun auf die Erfahrungen, Einschätzungen und Motive innerhalb einer Firma. Abgeschlossen wird die Darstellung mit einer zusammenfassenden Diskussion der Ergebnisse.
Bei dem Unternehmen A handelt es sich um ein Gästehaus. Interviewpartnerin ist dessen Leiterin, im folgenden Chefin A. Das Interview findet in einem Speiseraum in ruhiger Atmosphäre statt.
Die Arbeitnehmerin mit Behinderung, Frau A, befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews in einem festen Vertragsverhältnis, sie ist seit vier Monaten beschäftigt und arbeitet 30 Stunden wöchentlich. Zu ihren Aufgaben zählen das Aufräumen, die Blumenpflege, das Gestalten der Speisesäle und das Helfen in der Spülküche. Dort trocknet sie Geschirr und räumt es weg.
Zur Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und zur gegenwärtige Situation führt Chefin A aus, dass schon vor Frau A's Zeit im Gästehaus eine Arbeitnehmerin mit Behinderung beschäftigt wird, die zuvor 18 Jahre in einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet hat. Dieses Beschäftigungsverhältnis ist auf Eigeninitiative von Chefin A entstanden: »Ich würde gerne jemanden bei uns einstellen, der eine geistige Behinderung hat und bei uns seinen Arbeitsplatz finden könnte.« Durch persönlichen Kontakt zu MitgründerInnen des Stadthaus-Hotels in Hamburg kennt Chefin A die Hamburger Arbeitsassistenz und wendet sich an sie. Ein Mitarbeiter der Hamburger Arbeitsassistenz überlegt vor Ort zusammen mit Chefin A, welche Möglichkeiten zur Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung bestehen. Da sich das Gästehaus gerade im Umbau befindet und ein zusätzlicher Raum entstehen soll, »kann ich sagen und meinen Anstellungsträgern gegenüber argumentieren: ›Wir richten da etwas Neues ein. Da wird ein neuer Bedarf geweckt, und das kann ich mit dem und dem kombinieren zu einer Stelle.‹« Es wird daraufhin eine Stelle mit 30 Wochenstunden konstruiert. Die Aufgabe, diese mit einem Mitarbeiter zu besetzen, wird von der Hamburger Arbeitsassistenz geleistet: »Ich hatte erst gedacht, ich müsste jemanden auswählen und es gäbe so eine Art Bewerbungsgespräch von mehreren Interessenten, war dann ganz dankbar, dass mir diese Arbeit abgenommen wurde von der Hamburger Arbeitsassistenz ..., die sagten, sie denken, dass sie eine geeignete Bewerberin für mich aussuchen können. Darauf habe ich mich verlassen.«
Die von der Hamburger Arbeitsassistenz ausgewählte Frau X entspricht auf den ersten Blick nicht den Vorstellungen, die Chefin A sich gemacht hatte, aber: »Okay, so ist es die Frau, die für uns geeignet sein soll, und ich werde dazu beitragen, dass das so sein wird.« Dieses Beschäftigungsverhältnis geht nach zwei Jahren zu Ende, da die Mitarbeiterin chronisch erkrankt. Es entsteht »eine sehr lange Übergangsphase«, während der die Hamburger Arbeitsassistenz geholfen und »um das zu überbrücken, eine Praktikantin gestellt« hat. Diese Praktikantin ist Frau A. Es gibt dann eine Phase, in der beide im Jugendgästehaus beschäftigt sind, und in der Frau A mit starkem »sozialen Engagement ... das Nichtkönnen von der (Frau X) durch so viel Mehrarbeit kompensiert hat, dass wir nicht gemerkt haben, wie schlecht es (Frau X) geht.« Frau X muss dann zu allseitigem Bedauern aus gesundheitlichen Gründen aufhören zu arbeiten; bei einem späteren Telefonat »sagte sie, dass sie möglicherweise wieder in die Werkstatt zurückgeht, aber dass sie es draußen sehr schön fand.«
Frau A arbeitet jetzt seit vier Monaten im Jugendgästehaus. Der ›neue‹ Raum liegt in ihrer eigenen Verantwortung, dort ist sie für das Aufräumen, das Tischeindecken und die Dekoration zuständig. Darüber hinaus sorgt sie auch in anderen Räumen für die Dekoration, pflegt die Blumen und hilft in der Spülküche. Besonders die Tätigkeit in der Spülküche macht sie »mit System: Sie ist die einzige, bei der sich das Einräumen von Tellern so anhört, als wenn jemand rhythmisch Schreibmaschine schreiben kann. Ich habe ihr das mal gezeigt. Sie ist eigentlich Linkshänderin und der Arbeitsablauf ist für einen Rechtshänder eigentlich konzipiert, d.h. sie muss immer, zu ihrer Behinderung hinzukommend, noch umdenken auf einen anderen Arbeitsplatz. ... Sie benutzt beide Hände und bewegt sich immer von rechts nach links. Dieser Rhythmus, das macht ihr scheinbar Spaß. Wenn sie die Teller einräumt, das ist rhythmisch so gut, das höre ich bis ins Büro. Dann weiß ich immer schon: Aha, (Frau A) ist an der Spülmaschine, klick, klack, klick, klack. Das macht niemand sonst so, weil die anderen daran nicht denken.« Chefin A betont, dass Frau A in ihrer Arbeit großen Ehrgeiz entwickelt und auch Spaß daran hat, »(zu) dekorieren, Tisch (zu) decken, ein bisschen feinere Dinge (zu) machen.«
Probleme in diesem Beschäftigungsverhältnis gibt es laut Chefin A kaum. Frau A wird von ihren Kollegen in der Küche »sehr geschätzt, weil sie auch jemand ist, der sehr lieb ist, sie ist sehr gleichmäßig, nie launisch. Diesen Arbeitsbereich füllt sie als ganzer Mensch aus, sie ist immer sachlich und nett zu allen Kollegen.« Frau A macht bei keinerlei »Intrigenspielchen« mit, »alles solche Dinge, also solch eine Loyalität, die ist ja so viel ausgeprägter als - ja, bei vielen anderen Menschen. Das schätze ich auch sehr, das schafft auch eine Ruhe im Arbeitsbereich.«
Die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz besteht also zunächst darin, dass sie auf die Anfrage von Chefin A hin eine Mitarbeiterin auswählt und ihr damit die Arbeit abnimmt, nach einer geeigneten Bewerberin suchen zu müssen. Aber auch insgesamt spielt die Hamburger Arbeitsassistenz für Chefin A »eine sehr wichtige Rolle, ... weil sie detaillierter auf den Menschen eingehen können.« Eine »Einarbeitung in dem Umfang, wie sie wichtig ist bei jemandem, der kein räumliches Empfinden hat, das zu trainieren ..., das jemandem deutlich zu machen«, so etwas kann niemand ›nebenbei‹ leisten: »Ich denke, dass diese Einarbeitung, wie sie erfolgt durch die Arbeitsbegleitung, von uns aus nicht leistbar wäre.«
Die Art und Weise der Hamburger Arbeitsassistenz, mit Frau A zusammenzuarbeiten, hat Chefin A sehr beeindruckt: »Die waren manchmal ganz kaputt, die Arbeitsassistenten, weil, sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie irgendwann in der Lage sein wird, diesen Raum folgerichtig zu reinigen, und das kann sie jetzt. Die haben sich mit so ein paar Symbolen geholfen dabei, das erleichtert ihr die Arbeit total.« Chefin A hält diese Arbeit »für immens wichtig, dieses Trainieren, das Bestätigen. Das schafft eine Präzision in den Arbeitsabläufen, wie sie wünschenswert ist, wie sie aber kein herkömmlicher Mitarbeiter eigentlich abgeben will.« Das einzige, was Chefin A sich in der Zusammenarbeit mit der Hamburger Arbeitsassistenz noch gewünscht hätte, wäre »eine Kontinuität in der personellen Begleitung, die aber aus persönlichen Gründen nicht gewährleistet werden konnte.«
Finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung haben für Chefin A »erst einmal eine erleichternde Bedeutung, was den Wirtschaftlichkeitsrahmen angeht, eine zusätzliche Stelle zu schaffen.« Diese Art von Zuschüssen hält sie für unerlässlich, »auch als eine politische Unterstützung, um diesen Bereich am Arbeitsmarkt abzudecken. ... Das zeigt ja auch irgendwo, dass sie da auch ernst genommen werden von außen. In dem Erhalt eines Arbeitsplatzes eine wirtschaftliche Unterstützung zu erfahren, das ist wichtig für den Arbeitnehmer und das ist wichtig für den Arbeitgeber, wenn es keine vergleichenden Möglichkeiten gibt.« Allerdings müsste eine finanzielle Unterstützung flexibel verlängerbar sein, »wo eine Einarbeitung länger dauert als dieses normale Maß.« Chefin A weist darauf hin, dass in diesem Bereich ein sehr niedriges Lohnniveau besteht, und »wir knapsen eigentlich immer so rum, um wirtschaftlich zu überleben. Da passt das natürlich hervorragend rein.«
Den erweiterten Kündigungsschutz schätzt Chefin A »nicht schwieriger ein als bei anderen Mitarbeitern.« Sie empfindet das Kündigungsschutzgesetz »bei anderen Menschen genauso hinderlich« und glaubt: »Es ist heute nur ein Vorwand, wenn man sagt, dass das behinderte Menschen anders im Arbeitsleben einbindet als einen nichtbehinderten Menschen.« Dass die erste Mitarbeiterin mit Behinderung »von sich aus ging, ohne dass wir ihr gekündigt haben, hat ja eigentlich deutlich gemacht, dass das so ist wie bei allen anderen Menschen auch. In der Regel möchte ja ein Mensch seinen Arbeitsplatz ausfüllen und nicht weggehen, sondern er möchte die Arbeit gern machen. Wenn er dann aber aus irgendwelchen Gründen, die der Arbeitgeber nicht zu vertreten hat, nicht mehr in der Lage ist, diesen Arbeitsplatz auszufüllen, dann wird er immer wechseln.« Chefin A setzt sich dafür ein, dass sie innerhalb ihres Verbandes nicht mehr an der Umlage für die Ausgleichsabgabe beteiligt wird: »Wenn ich als kleine Einrichtung in meinem Betrieb drei Menschen mit Behinderung beschäftige, dann möchte ich nicht, dass ich zusätzlich an der Ausgleichsabgabenumlage beteiligt werde. Denn ich erbringe das ja letztendlich für die anderen mit und dann möchte ich, dass mir das wie ein Bonus berechnet wird.«
Die Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen von Chefin A wird deutlich, als sie auf das Zitat des Wirtschaftsverbandssprechers wütend reagiert: »Imageschädigend - was muss das für ein managermäßiges Armloch gewesen sein!? Das ist ja unglaublich! Das sind so Menschen mit mangelnder sozialer Kompetenz. So etwas halt' ich für eine Fehlbesetzung im Management, wenn man sich so äußert. Bäh!« Ihre eigenen Erfahrungen bezeichnet Chefin A als »nur positiv«. Sicherlich hat sie schon MitarbeiterInnen gehabt, die sich skeptisch gezeigt haben: »Wie soll die denn mit so einer dicken Brille jemals ihre Arbeit schaffen.« Daraufhin macht Chefin A ganz unmissverständlich ihre Meinung deutlich: »Ja, ich sag': Jeder hat irgendwo eine Schwachstelle, der eine hat eine große Klappe, bei der nächsten Frau ist das die dicke Brille. Ich toleriere das bei ihnen, solange sich das in die betrieblichen Gegebenheiten einfügen lässt, und ich toleriere das bei dem anderen Menschen, wenn dadurch die Arbeit nicht leidet. Und wir sind doch alle dazu da, miteinander ein gutes Ergebnis zu machen. Das ist ja das Schöne auch an so einem Betrieb, dass man sich nicht so abgrenzt, sondern alle sehr verzahnt miteinander arbeiten.« Die vorgestellten Werbeprospekte findet Chefin A sehr beeindruckend, sie ist der Meinung, dass solche Werbung verstärkt in die Öffentlichkeit gebracht werden muss. Sie hält unsere Gesellschaft für »überreif« für eine solche offensive Konfrontation und findet, »dass das ganz wichtig ein Stückchen Aufklärungsarbeit ist, in diese Richtung zu gehen, dass menschliches Leben auch das beinhaltet, und dass wir das nicht länger wegschließen dürfen. (Frau A) hat neulich sehr schön von ihrer Schulzeit erzählt, was das so für sie bedeutete, eine Gesamtschule zu besuchen und eine Integrationsklasse zu haben.«
Bezüglich ihrer Motive macht Chefin A deutlich, dass sie sich aus eigener Initiative an die Hamburger Arbeitsassistenz gewandt hat mit dem Gedanken an das »sinnvollen Tun für Menschen. Grundsätzlich.« Chefin A beherbergt in ihrem Gästehaus seit 19 Jahren in jedem Sommer über einige Wochen eine Gruppe des Vereins ›Leben mit Behinderung‹ und beschreibt, was sich im Laufe dieser Jahre bei ihr persönlich verändert hat: »Ich habe gemerkt mit zunehmendem Alter aber, dass ich mich mehr hineinfühlen kann in andere Menschen, in junge Menschen. Ich habe die hier gesehen als Kinder, hab' sie jugendlich, erwachsen werden sehen und immer gedacht: Wo bleiben sie denn? Und die Vorstellung, dass viele eben in Werkstätten gehen, um da stupide Tätigkeiten zu machen, empfand ich immer so wie Gefängnis. Ich habe dann immer gedacht: Wenn das mein Kind wäre, würde ich meinem Kind eine andere Umgebung wünschen.« Durch diese Sommeraufenthalte entstehen persönliche Kontakte, z.B. zu BetreuerInnen, die am Aufbau des Projektes ›Stadthaus-Hotel‹ beteiligt sind: »Und das hat mir ja ungeheuer gut gefallen und ich dachte, nur ein bisschen davon umsetzen können, ich kann ja nicht alles umstellen, aber ein Stückchen, und das möchte ich gerne. Es war den Versuch allemal wert.«
Die Tätigkeitsbereiche der Werkstätten für Behinderte, die Chefin A hauptsächlich im Verpackungs- und Montagebereich verortet sieht, empfindet sie als »so steril, ganz anders, völlig anonym, und ich denke mal, da gibt es dann nie wirkliche Anerkennung für die persönliche Leistung.« Ihrer Vorstellung nach lebt jeder Mensch von solcher persönlicher Anerkennung und »gerade dieser Dienstleistungsbereich, für Menschen tätig zu sein, der gibt ja eine ganz starke Selbstbestätigung so in der sozialen Entwicklung.« Chefin A ist der Meinung, dass besonders dieser Bereich, in dem sie arbeitet, »sehr viel menschenwürdige Arbeitsplätze zulässt. Das ist, (wie) einen großen Haushalt (zu) führen mit allem Drum und Dran, und da passt es eigentlich ganz gut, Menschen mit sehr unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen einzusetzen.«
Chefin A beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, ob man nicht ihre Zivildienststellen durch unterstützte Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung ersetzen bzw. eine Umstrukturierung vornehmen kann. Sie erfährt eine hohe »Mitarbeiterfluktuation, die ist ganz was Belastendes, speziell auch mit Zivis, weil man gerade mit zunehmendem Alter so an Substanz verliert, immer einzuarbeiten, einzuarbeiten und wenn man die Menschen so weit hat, dann gehen sie wieder weg.« Chefin A möchte erreichen, dass sich die Mitarbeiter mit ihren Arbeitsplätzen identifizieren: »Dass jemand sagt, das ist mein Job (im Gästehaus), das mach' ich.« Sie betrachtet das auf längere Sicht: »Ich engagiere mich, wenn ich einen behinderten jungen Menschen einstelle, sicherlich in gleicher Weise oder stärker in der Einarbeitungsphase. ... Aber ich erreiche möglicherweise, und das hoffe ich, eine Bindung an den Arbeitsplatz, die für mich ganz wichtig ist.«
Resümee von Chefin A
Chefin A ist durch ihre Erfahrungen mit dem Verein ›Leben mit Behinderung‹ besonders interessiert und sensibilisiert für die Thematik der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen. Ihr Interesse hat sie in persönliches Engagement umgesetzt und denkt diesbezüglich noch weiter, was die Idee mit den Zivildienststellen verdeutlicht. Dieses soziale Engagement ist ausschlaggebend für den Einstieg in die berufliche Integration, aber der Aspekt der Wirtschaftlichkeit ist ebenso wichtig. Finanzielle Unterstützung und personelle Begleitung durch die Hamburger Arbeitsassistenz ist, besonders in der Einarbeitungszeit, unverzichtbar. Es gibt diese ja auch in der Werkstatt für Behinderte oder, wie Chefin A berichtet, bei einem Hotel eines christlichen Vereins, dort in Form von »kostenlosen Mitarbeitern. Das sind Subventionen in so irrwitzigen Höhen. Wenn man das mal vergleicht, wir müssen ja hier unsere Wirtschaftlichkeit jeden Tag unter Beweis stellen, und das finde ich nicht korrekt, wenn das so merkwürdig verteilt wird.« Daher ist es um so verständlicher, dass Chefin A sich nicht mehr an der Umlage der Ausgleichsabgabe ihres Trägers beteiligen will. Sie empfindet die berufliche Integration als überhaupt nicht belastend, sondern als Bereicherung: »Ja, die Freude des Mitarbeiters an seinem Arbeitsplatz, der nach außen auf Gäste und andere Mitarbeiter abstrahlt.« Sie würde beim nächsten Mal »Zwillinge nehmen - vielleicht zwei davon« und möchte diese Erfahrung: »überhaupt nicht missen von meiner persönlichen Entwicklung her.« Chefin A hält es für unerlässlich, sich diesem Thema zuzuwenden, »zur Auseinandersetzung mit mir selbst. ... Ich bin immer begeistert, mit welcher Unbefangenheit unsere Kinder damit umgehen. Die haben ja nie was anderes kennengelernt. Für die waren das immer die tollsten Sommer damals, hier im Haus zu spielen und zu feiern und dazwischen zu sein.« Sie selbst hat in der Anfangsphase auch Tag für Tag gemerkt, »wie wir lernen, sensibler zu sein,« und den Menschen mit Behinderung in seiner Persönlichkeit wahrzunehmen, »das heißt also, ein Mensch, der eine geistige Behinderung hat, ist noch lange nicht mit dem anderen vergleichbar.« In der gemeinsamen Zeit tritt »die Behinderung, wie auch immer sie geartet ist, ja irgendwann zurück, die nimmt man gar nicht mehr wahr. Man hört die Stimme von demjenigen oder merkt eben sein angenehmes Auftreten, die Beständigkeit in der Arbeit, ja die Ruhe und die Identifizierung mit dem Arbeitsplatz. Das sind alles so Dinge, die in den Vordergrund gehen.« Am Ende des Interviews stellt Chefin A fest, »dass Menschen, die mit behinderten Menschen leben und arbeiten, einen ganz hohen Grad an Menschlichkeit verzeichnen, und das ist mir verdammt wichtig und das möchte ich einfach so beibehalten. Ich möchte das in die Öffentlichkeit bringen, weil ich das so wichtig finde.«
Beim Unternehmen B handelt es sich um eine Tankstelle des Mineralölkonzerns Esso. Die InterviewpartnerInnen - ein Ehepaar, im folgenden Chef und Chefin B genannt - sind die Pächter dieser Tankstelle. Sie beschäftigen sechs Mitarbeiter, sind also der Pflichtquote des Schwerbehindertengesetzes entsprechend nicht verpflichtet, einen Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Das Interview findet bei laufendem Betrieb im Verkaufsraum der Tankstelle statt.
Der unterstützte Arbeitnehmer Herr B ist 18 Jahre alt und befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt in einer Probebeschäftigung. Zu seinen Aufgaben zählen hauptsächlich das Auffüllen der Waren in den Regalen und bestimmte Reinigungstätigkeiten, z.B. von Toiletten und Hof. Diese Tätigkeitsbereiche sind für Herrn B klar definiert und abgesteckt. Darüber hinaus soll er in entstehenden Freiräumen kleinere Aufgaben erledigen, die über seine ›Routinetätigkeiten‹ hinausgehen.
Zur Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und zur gegenwärtigen Situation führen Chef und Chefin B aus, dass auf eine telefonische Anfrage der Hamburger Arbeitsassistenz hin und aufgrund ihres eigenen Interesses der erste persönliche Kontakt mit deren Mitarbeiter zustandekommt. Nach einer Art ›Probetag‹ wird für Herrn B eine Probezeit festgelegt. Die personellen Entscheidungen werden von den Pächtern eigenständig getroffen, bei dem Konzern Esso wird lediglich ein Gesamtkostenblock ›Personalkosten‹ eingereicht; wer an der Tankstelle beschäftigt wird, ist nicht von Interesse. In dieser Probezeit wird für Herrn B in Kooperation mit der Hamburger Arbeitsassistenz ein eigener Aufgabenbereich, herausgenommen aus anderen Tätigkeitsbereichen, entwickelt, dem er zu Beginn auch gewachsen zu sein scheint.
Wie bereits erwähnt, ist Herr B hauptsächlich mit dem Auffüllen der Warenregale im Verkaufsraum beschäftigt. Mit den Kunden der Tankstelle kommt er in Kontakt: »Jeder, der so ›esso-mäßig‹ aussieht, der wird von den Kunden auch angesprochen,« zumal den KundInnen nicht auffällt, dass Herr B behindert ist: »Nun macht er ja auch so vom Äußerlichen her nicht gerade den behinderten Eindruck.« Wenn diese Situation eintritt, hat Herr B keine Probleme damit, bei Auskünften über eine gesuchte Straße o.ä. hilft er weiter, solange er die Fragen beantworten kann. Ansonsten »sagt er dann immer gleich, ich hole mal jemanden, der ihnen weiterhelfen kann, und das kommt eigentlich sehr gut rüber.«
Im Moment haben die Chefs B mit Herrn B ein Problem, welches schon einmal aufgetreten ist. Nachdem sich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses alles sehr positiv entwickelt - Herr B zeigt Interesse und es entwickelt sich ein guter Kontakt - bezeichnet das Ehepaar die momentane Situation aus folgenden Gründen als schwierig: Herrn B's Interesse an der Arbeit hat stark nachgelassen, seine Leistungen schwanken zwischen starken Höhen und gegenwärtigen Tiefen. Das Ehepaar ist davon überzeugt, dass Herr B genau weiß, wie er sich verhalten muss, damit ihn niemand anspricht, »nach dem Motto, wenn ich mich jetzt doof anstelle, dann sprechen die mich nicht an und ich bekomme keine weitere Arbeit.« Ein Schlüsselerlebnis bildet für den Chef B der Bericht eines Mitarbeiters. Als ein Arbeitsassistent zur Qualifizierung in den Betrieb kommt, sagt Herr B »dann: ›Ich zeig dir jetzt mal was.‹ Und seine sehr gute Ausstrahlung, die er vorher hatte, positiv, lächelnd - plötzlich ließ er den Kopf hängen. Der von der Arbeitsassistenz kam, sah (Herrn B) und sagte:›Och, ich glaube, heute hat das keinen Zweck.‹ ... Da haben wir zum ersten Mal erkannt, dass er Dinge bewusst tut.«
Ein weiteres Problem stellt das Annehmen von Arbeitsanweisungen dar. Herr B nimmt lediglich Anweisungen von den InterviewpartnerInnen entgegen, nicht aber von seinen KollegInnen. Da diese aber sehr eigenverantwortlich arbeiten und nur bei größeren Schwierigkeiten Rücksprache mit den Chefs halten, stört dieser Sachverhalt die Arbeitsabläufe nachhaltig. Die Motivation, in eigener Verantwortung seine Aufgabenbereiche zu bearbeiten, findet sich nach Aussagen von Chef B bei Herrn B nicht: »Ja, nur der liebe (Herr B) versteht es nicht. Er ist schon zu lange hier, behaupte ich mal, er weiß gar nicht mehr, wie schwer es ist, etwas zu bekommen. ... Es ist unheimlich schwierig, ihn dahin zu bekommen, dass er das Verständnis bekommt, dass das nicht so einfach ist, einen Job zu bekommen und dass er was tun muss - mehr tun muss.« Chef B hat das Gefühl, dass Herr B mal mehr, mal weniger schnell arbeitet und dass er Dinge ganz bewusst tut. Er betont die Schwierigkeit, die jeweilige Situation zu unterscheiden und richtig einzuschätzen: »Heute wissen wir, wenn er den Traurigen macht, das könnte Absicht sein. Wie soll ich das unterscheiden? ... Sehen Sie, ist alles nicht ›eia-popeia‹. Wir haben eine ganze Menge mit ihm zu arbeiten, das ist aufwendig und für uns Neuland. Da haben wir festgestellt, den können wir wirklich behandeln wie jeden anderen Mitarbeiter eigentlich auch, das tun wir auch, er wird nicht bevorzugt, er kriegt genau so zwischen die Hörner wie die anderen und er muss auch seine Leistung bringen.«
Diese Situation bezeichnet Chef B als einen »ständigen Prozess,« bestimmt von großem Druck seitens des Kunden, des Umsatzes und der Gesellschaft. Der Ansatz, Herrn B's Tätigkeitsbereich zu erweitern und ihm somit auch den Arbeitsplatz zu sichern, stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt als schwierig dar, da Herrn B's Leistungen nicht den Erwartungen seines Chefs entsprechen: »Wir kämpfen darum, dass wir ihn auch halten können.« Spätestens nach Ablauf der Lohnkostenzuschüsse muss sicher sein, dass Herr B die Arbeit leistet, die für seinen Arbeitsplatz notwendig ist. In einer prozentualen Einschätzung beschreibt Chef B seine Zufriedenheit mit der Arbeit von Herrn B mit 50%.
Die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz beginnt durch ihre telefonische Kontaktaufnahme mit der Tankstelle. Chef B beschreibt deren Arbeit als eine kompetente Begleitung von Herrn B: »Die wussten dann schon. ... Das haben sie ihm dann schon beigebracht.« Die ArbeitsassistentInnen haben keinerlei Probleme damit, sich sowohl in die Arbeit von Herrn B als auch in das Tankstellenleben »reinzufuchsen«. Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz insgesamt schätzt Chef B überaus positiv ein: »Von denen bin ich sehr überzeugt, das hat mir sehr gut gefallen. ... Was die für uns gemacht haben, das ist wirklich eine ganze Menge.«
Finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung sind für Chef B wichtig. So macht er die Bedeutung der Lohnkostenzuschüsse deutlich: »Wenn das nicht wäre, wäre ich glaube ich nicht bereit, das zu probieren.« Für ihn ist von großer Bedeutung, den Arbeitsplatz von Herrn B auf lange Zeit zu sichern: »Und wenn ich eine Entscheidung treffe, solch einen guten Mann zu nehmen, dann muss ich auch sicher sein, dass ich ihn in fünf oder zehn Jahren noch beschäftigen kann.« Der ›Anreiz‹ durch die Zuschüsse ist offensichtlich, aber Chef B geht es um eine langfristige Beschäftigung und er hofft, dass »alle meine Kollegen dann auch so ehrlich sind und rechtzeitig die Notbremse ziehen, wenn sie sehen: Den kann ich gar nicht mehr in fünf Jahren bezahlen, ..., weil er nicht das bringt, was ich brauch'.« Er sieht ganz deutlich die Gefahr, dass andere Arbeitgeber ein solches Beschäftigungsverhältnis eingehen, die Lohnkostenzuschüsse ›mitnehmen‹, aber keine Zukunftsperspektive sicherstellen können. Dass der verbesserte Kündigungsschutz von Menschen mit Behinderungen von vielen Unternehmen als Einstellungshemmnis angegeben wird, kann Chef B nicht nachvollziehen. Er ist sich zwar darüber im klaren, dass sein Mitarbeiter Herr B einen erweiterten Kündigungsschutz hat, er »ihm nicht aus betrieblichen Gründen kündigen« kann, aber »wenn ich ihn abmahne in seinen Tätigkeiten, die er gemacht hat, (kann) ich ihn auch loswerden. Das weiß ich. So was gibt es nicht, dass man einen Menschen nicht mehr loswerden kann, das kann mir keiner erzählen. ... Aber ich weiß auch, dass das Versorgungsamt mich nicht pleite gehen lassen will, wenn man sagt, ich kann nicht mehr..., es geht nicht mehr.«
Ihre Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen machen die Chefs B mit ihrer entsetzten Reaktion auf das Zitat des Wirtschaftsverbandssprechers deutlich. So sagt Chef B: »Das ist ja frech! Der ist ja demotiviert, der Mensch! Das ist ja ein Pessimist!« Chefin B äußert ärgerlich: »Was soll man denn seiner Meinung nach mit den Behinderten machen, so wie früher einsperren und nicht rauskommen lassen? Oder ignorieren, dass sie überhaupt da sind und ihnen keine Chance geben?« Ausführlicher beschreibt Chef B: »Das hat sehr viel Sinn. Viele wissen überhaupt gar nicht, welche Möglichkeiten sie haben mit diesen Behinderten. ... Ich bin überzeugt, wenn die Hamburger Arbeitsassistenz diesen Adressen nachgeht und das vorstellt, (dass sie) einen großen Teil mehr Firmen dazu bekommen könnte, so etwas zu tun.« Dass er laut der Aussage des Verbandssprechers seinem Firmenimage schaden soll, findet Chef B »mehr als frech! Glaube ich überhaupt nicht!« Er ist davon überzeugt, dass die Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung in keinster Weise einen Schaden bedeutet, ganz im Gegenteil: »Wenn ich aber in der heutigen Zeit sage, Leute, ihr bekommt dieses Jahr keine Kalender mehr von mir, aber ich kann euch sagen, das Geld, was ich sonst für Kalender ausgegeben habe, das läuft bei mir auf zwei Beinen über den Hof - ich habe da mit Sicherheit keinen Image-Schaden von, sondern ich habe mit Sicherheit viele dabei, die sagen, das finde ich in Ordnung. Und das spricht sich weiter. ... Und wer dann noch von Image-Schaden spricht, der hat es nicht verstanden, der weiß nicht, was los ist.« Die Tatsache, dass vermehrt Menschen mit Behinderungen in der Werbung zu finden sind, findet Chef B ganz wichtig: »Muss man auch!« Zu einer veränderten Gesellschaft, die Menschen mit Behinderungen und jeden so akzeptiert, wie er ist, trägt nach den Aussagen von Chefin B die veränderte Schule bei, »diese Integrationsklassen, wo dann also Down-Syndrom-Kinder mit drin sind und Kinder, die also lernen können, aber eben irgendeine Beschädigung oder eine Schädigung haben, und ich denke mal, bei den jungen Leuten ist da ein Umbruch gegenüber - also ich sage mal - nicht uns, aber meinen Eltern.« Beide können nicht verstehen, wie sich im Restaurant jemand darüber beschweren kann, »weil am anderen Tisch jemand behindert war.« Schließlich könnte dies für Chef B jedem noch passieren »denn so eine Behinderung ist nicht immer von Geburt an, sondern die kann auch im Berufsleben passieren, Schädel-Hirn-Geschichten.«
Bezüglich ihrer Motive wird aus den bisher dargestellten Gesprächsinhalten deutlich, dass es den beiden InterviewpartnerInnen nicht nur um die Einstellung einer Arbeitskraft geht, die für die ersten Jahre eine besondere finanzielle Unterstützung erhält, sondern einem Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, einer regulären Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachzugehen. »Wir haben sehr, sehr viele Behinderte, die froh wären, wenn sie sich ihr Geld selber verdienen könnten, und ich wäre froh, wenn es viele machen würden. Das ist so mein Standpunkt, sonst wäre ich mit (Herrn B) schon nicht mehr zusammen.« Nach Aussagen von Chef B hatte auch eine eigene Erfahrung im Rollstuhl und an Gehhilfen über einen Zeitraum von 14 Monaten einen großen Einfluss auf die Entscheidung: »Ich selbst habe im Rollstuhl festgestellt, wie toll und rücksichtsvoll die ganzen Leute sind (ironisch), möglicherweise war das ein Anstoß, ne?«
Resümee von Chef B
Die Chefs B sind sehr interessiert und aufgeschlossen gegenüber Menschen mit Behinderungen und deren beruflicher Integration in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Chef B stellt fest: »Die Erfahrung im Umgang mit Behinderten ist für mich die persönliche Bereicherung.« Ihr Bemühen um Herrn B und seinen Arbeitsplatz tritt während des gesamten Interviews klar hervor. Es zeigen sich allerdings zwei große Probleme: Das eine ist der große Druck, auf jeden Fall so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten, hervorgerufen durch die angespannte Arbeitsmarktlage, die steigenden Ölpreise, unzufriedene Kunden und die große Konkurrenz mit anderen Tankstellen; das andere ist Herrn B's anscheinend mangelndes Interesse an seiner Arbeit, so dass sein Arbeitsplatz aus betriebswirtschaftlichen Gründen momentan stark gefährdet ist. Seine beiden ArbeitgeberInnen sind jedoch nach wie vor bemüht, das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten. Chef B antwortet auf die Frage, was beim nächsten Mal anders laufen müsste: »Ich müsste mich besser vorbereiten.« Er setzt bei der Frage nach Problemen bei seiner eigenen Person an und verdeutlicht, was für ihn stark belastend ist: »Das immer wieder von vorne beginnen. Dinge, die (Herr B) eigentlich schon kann, muss ich immer wieder erklären.« Chef B ist mit der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz sehr zufrieden und hat auf die Frage, was er sich noch von ihr gewünscht hätte »nichts hinzu(zu)fügen.«
Im Anschluss an die von den Chefs B geschilderte Situation ergeben sich zwei weiterführende Fragen: Es bleibt ungeklärt, worin das als mangelnd wahrgenommene Interesse von Herrn B besteht und was seine fehlende Arbeitsauffassung bedingt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Herr B, der mit 18 Jahren noch sehr jung ist, noch keine Vorstellung davon hat, was es heißt zu arbeiten und dafür bezahlt zu werden. Ihm ist der ›Ernst der Lage‹ vielleicht gar nicht bewusst. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wäre, dass Herr B keinen Spaß an seinen Tätigkeiten hat und engagierter arbeiten würde, wenn die Arbeit eher seinen Vorstellungen entspräche. In seinem Interview hat Herrn B geäußert, dass er gerne Kfz-Mechaniker werden würde und ihm das ›Herumschrauben‹ an seinem Mofa viel Freude bereite (vgl. Kap. 4.4.2). Vielleicht liegt hier ein Ansatz, um Herrn B's Interesse ›zu wecken‹ und somit seinen Arbeitseifer zu steigern.
Das Unternehmen C ist ein Call-Center einer großen Tele-Mediengruppe. Die Interviewpartnerin Chefin C ist die Teamleiterin des Projektes, an dem die unterstützte Arbeitnehmerin Frau C arbeitet. Frau C macht für eine Computerzeitschrift den Leserservice und hat eine Festanstellung. Das Interview wird in einem ruhigen Raum geführt.
Zur Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und zur gegenwärtigen Situation wird ausgeführt, dass auf eine Anfrage der Hamburger Arbeitsassistenz ein Kontakt zustandekommt, nachdem Frau C bereits in einem anderen Call-Center gearbeitet hat, dort aber nicht glücklich war. Nach prinzipiellem Interesse an einer Zusammenarbeit mit Frau C geht es darum, nach einem geeigneten Projekt zu suchen, das ihren Fähigkeiten entspricht, »und da muss man natürlich sehen: ›Habe ich als Call-Center überhaupt die Möglichkeit, irgendwie Menschen mit Behinderungen einzustellen; schaffen die das überhaupt?‹« Es bietet sich das Projekt einer Computerzeitschrift an, das unter der Leitung von Chefin C steht. Diese wird von ihrer Chefin gefragt, »ob ich das mache, weil ich ja letztendlich dann für (sie) zuständig bin und natürlich sehen muss: ›Will ich das oder will ich das nicht?‹ Irgendwie weil es ist ja eine Mehrarbeit, die man dadurch hat und für mich war es eine Herausforderung, sage ich ganz ehrlich.« Mit einem anderen Projekt, »das würde zum Beispiel nicht gehen, weil da wird Englisch verlangt, da muss man super flink sein in der EDV.« In einer Teamsitzung, die alle vier Wochen für die unterschiedlichen Projekte stattfindet, werden die anderen MitarbeiterInnen auf ihre neue Kollegin Frau C vorbereitet.
Zu Beginn werden erst einmal Kundengespräche simuliert und so das notwendige Verhalten trainiert: »Also wir haben eine Woche bestimmt trainiert und dann irgendwann ging es los, und die Assistenten (war) die erste Zeit ja immer hier mit ihr zusammen.« Frau C bearbeitet den Leserservice dieser Computerzeitschrift: »Jemand möchte ein Abo bestellen, jemand möchte eine Zeitung nachbestellen, jemand fragt, was stand in der Zeitung oder in der - und das macht sie halt alles.« Zu den KollegInnen ist das Verhältnis »wie für einen normalen Menschen auch, entweder mag man denjenigen oder nicht.« Der Umgang mit Frau C ist nach Aussagen der Chefin C sehr stark von den einzelnen Personen abhängig, es gibt einige, die »verstellen sich total und andere, die reden mit jedem super lustig, also es kommt ganz auf die Person drauf an.« Frau C's Anwesenheit hat »weder was negativ noch positiv verändert. Gelacht wurde hier vorher schon viel und hilfsbereit und nett waren sie alle vorher auch schon.« Frau C nimmt also keine besondere Rolle aufgrund ihrer Behinderung ein, »es wird (zwar) schon sehr viel auf sie geachtet und wenn sie überfordert ist, kommt gleich einer zu mir und sagt: ›Hallo, das musst du noch mal oder hier und da müssen wir noch mal gucken und so.‹« Chefin C empfindet das Verhältnis als »normal, würde ich sagen, es ist ein ganz normales Verhältnis.« Frau C hat auch »eine Lieblingskollegin, die hängen den ganzen Tag zusammen und mögen sich ganz gern, also sie sucht sich, wie im normalen Leben auch, einen mag man, einen mag man nicht und so ist das dann halt hier auch.«
Bei der geleisteten Arbeit von Frau C beschreibt ihre Chefin Schwankungen zwischen Höhen und Tiefen, »so Phasen, also, es gab auch schon mal hundert Prozent, aber jetzt würde ich sagen achtzig Prozent.« Als herausragende Eigenschaften hebt die Chefin Frau C's freundliche und ruhige Art hervor: »Sie würde ja nie austicken, also, das wird ihr ja nie passieren. Sie hat einfach eine bestimmte Ruhe.« Chefin C weiß ganz genau, dass sie sich darauf verlassen kann, dass Frau C nicht nur ruhig und ausgeglichen am Telefon ist, sondern sie sich auch bei Unsicherheiten sofort an KollegInnen wenden würde: »Sie würde nie eine falsche Auskunft geben.«
Es besteht lediglich ein telefonischer Kundenkontakt, daher kann man keine Auskünfte über eventuelle Reaktionen auf die Behinderung von Frau C geben, höchstens wenn es mal etwas länger dauert und Frau C ein paar Mal nachfragt, kann es schon sein, »dass der eine oder andere denkt, mein Gott, dauert das. Aber das macht sie durch ihre höfliche Art wett.«
Die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz beginnt mit ihrer Anbahnung des Kontakts und der Vorstellung von Frau C bei diesem Call-Center. Chefin C macht deutlich: »Ohne die wären wir da nicht drauf gekommen.« Die Zusammenarbeit mit ihr bewertet Chefin C mit hundert Prozent positiv, besonders die Unterstützung in der Zeit des Übens und der ersten Telefonate, »das ist auch nötig gewesen. Weil - ich hätte jetzt nicht die Zeit dafür gehabt.« Auf die Frage, was sie sich noch von der Hamburger Arbeitsassistenz gewünscht hätte, äußert sie, »dass sie halt da sind, wenn ich mit dem Finger schnippe - wenn ich den Wunsch schon mal frei habe.« Die ArbeitsassistentInnen kommen zwar noch regelmäßig zwei- oder dreimal in der Woche, aber die Arbeit im Call-Center »ist halt dann zu schnellebig«, d.h. von heute auf morgen ändert sich etwas in der Zeitschrift, »und dann würde ich halt gern, dass sie jetzt da sind und mit (Frau C) sich hinsetzen und das trainieren.« Allgemein ist Chefin C mit der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz sehr zufrieden.
Über finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung kann Chefin C keine genauen Aussagen machen, »also, ich weiß, dass wir Zuschüsse bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend war.« Dass bei diesem Beschäftigungsverhältnis die Quotenregelung aus dem Schwerbehindertengesetz eine Rolle gespielt hat, um eventuell die Ausgleichsabgabe zu sparen, kann Chefin C sich nicht vorstellen, »weil wir sind ja eine Riesenkette, ... das ist riesengroß, und ich bin mir sicher, dass (Frau C) die einzige ist, die aus einer Arbeitsassistenz hier im Call-Center ist, und denen ist das wirklich dann egal mit den Abgaben, weil sonst müssten wir wirklich ein paar mehr einstellen.« Eine besondere Kündigungsregelung spielt laut Chefin C vermutlich keine Rolle, da eigentlich die »Bezahlung bei uns ... der Leistung entsprechend ist. Das spielt dann natürlich in die Urlaubstage mit rein.«
Bezüglich ihrer Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen macht Chefin C deutlich, dass sie nicht glaubt, dass behinderte Mitarbeiter das Firmenimage schädigen: »Früher war es mit Sicherheit mal anders, aber ich denke, heutzutage nicht mehr«, ganz im Gegenteil: »Ich bin immer ganz stolz, wenn ich irgendwie sagen kann: Und übrigens...« Bei den Werbeprospekten empfindet sie, »dass das jemanden sympathisch macht, wenn man normal denkt. Ich finde, es macht sympathisch, also Hilfsbereitschaft sehe ich daraus irgendwie.« Sie ist davon überzeugt, dass das auf keinen Fall »so auf die Mitleidsschiene abzieht, ja es gibt so ein zusammenhaltendes Gefühl.«
Hier können nur die Motive dargestellt werden, die im Interview von Chefin C deutlich geworden sind; über die Motive ihrer Chefin, die die Einstellung von Frau C verantwortet hat, deutet Chefin C nur an, dass »sie wohl auch in ihrem Studium was Pädagogisches gemacht hat und das auch sehr spannend fand und auch wohl wichtig für sie.« Es ist davon auszugehen, dass soziales Engagement ausschlaggebend gewesen ist. Bei Chefin C selbst wird auch eine soziale Einstellung deutlich, sie hat als »Supervorbild« ihre große Schwester, die im therapeutischen Bereich tätig ist und mit der sie als Jugendliche an »Behindertenreisen» teilgenommen hat, »und das war halt total schön. ... Und da dachte ich mir irgendwie, das ist ja toll, dass die kleine Schwester dann auch mal ein bisschen ... - eigentlich eine ganz blöde Geschichte.« Für sie ist die Zusammenarbeit mit Frau C eine positive »Herausforderung.«
Resümee von Chefin C
Chefin C hat also im privaten Bereich bereits persönliche Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen gemacht und kann sich bei der Zusammenarbeit mit Frau C einer »Herausforderung« stellen, ihr Interesse umsetzen und neue Erfahrungen sammeln: »Ich habe nicht gesagt: O nein! Ich habe gedacht: super spannend irgendwie.« Ein sehr wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang, dass »ja nicht viel passieren kann, (Frau C) kann nicht viel passieren und mir halt auch nicht. Es war ja ein Praktikum, Betreuer sind hier... .« Es sind also Rahmenbedingungen gegeben, die für diese neue Situation allen Beteiligten gute und erleichternde Voraussetzungen ermöglicht haben. Bislang ist Frau C die einzige unterstützte Arbeitnehmerin. Chefin C empfindet bei der beruflichen Integration »nichts belastend«, sondern als »ein schönes Gefühl, dass (sie) anstatt in der Werkstatt zu sitzen hier ist, und das ist eigentlich das Schöne, da hatte sie ja tierische Angst vor. Für mich ist es ein schönes Gefühl, dass ich weiß, sie ist hier, und ich weiß, dass es auch den anderen so geht.« Abschließend stellt Chefin C fest, hätte sie selbst jemals eine solche Personalentscheidung zu treffen, »würde ich es genauso machen wie mit der (Frau C), also auf jeden Fall. Aber es kommt auch auf die Person an, sie passt supergut hier rein.« Die Tatsache, dass jemand auf einen Arbeitsplatz und in ein Team passt, ist also bei einem Arbeitnehmer mit Behinderung ebenso entscheidend »wie bei einem ›normalen‹ Mitarbeiter auch - ›normal‹, dieses Wort ist schon blöd.«
Das Unternehmen D ist ein Konditoreibetrieb mit drei Filialen. Das Interview findet in der Hauptfiliale statt, in der sich auch die Backstube befindet. Interviewpartner ist zu Beginn der Chef der Konditorei, Chef D, und später noch sein Geselle, Geselle D, der für den unterstützten Arbeitnehmer Herrn D unmittelbar zuständig ist. Herr D arbeitet in der Backstube; dort geht er verschiedenen Tätigkeiten nach und ist an der Herstellung von Backwaren beteiligt.
Zur Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und zur gegenwärtige Situation wird ausgeführt, dass durch einen persönlichen Besuch von ArbeitsassistentInnen der erste Kontakt zustandekommt. Herr D hat zuvor schon in einer Bäckerei in der gleichen Gegend gearbeitet.
Herr D befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews im Integrationspraktikum und arbeitet in der Backstube. Dort hat er verschiedene Aufgaben. So »legt er Butter auf den Butterkuchen oder Pflaumen auf den Pflaumenkuchen« oder er legt verschiedene Backwaren auf Backbleche: »Er ist überall, wo er ein bisschen helfen kann.« Direkten Kundenkontakt hat Herr D nicht, da er ausschließlich in der Backstube arbeitet. Mit dieser Arbeit ist sein Chef D hundertprozentig zufrieden: »Ja, da brauche ich kein Prozent abzuziehen.« Er bezeichnet Herrn D als zuverlässig, pünktlich, und »ein netter Mensch, das ist er.« Schwierigkeiten gab und gibt es keine, »man braucht oft nichts mehr zu sagen. Er hatte gute Vorkenntnisse gehabt. ... Da haben wir dagestanden und gestaunt.« Auch behauptet Herr D seinen Arbeitsplatz, z.B. gegenüber neuen Praktikanten : »Er lässt sich da auch nicht wegdrängen, sondern sagt dann, das ist meine Arbeit.« Und er achtet darauf, dass der Praktikant seine Arbeit ordentlich macht: »Dann sagt er: ›Hier, das musst du so machen.‹« Manchmal bringt Herr D die Arbeitsabläufe nicht vollständig zu Ende, »das hat er noch nicht ganz raus, aber das kriegt er mit der Zeit dann bestimmt auch hin.« Die anderen Mitarbeiter des Betriebes hat Chef D nicht weiter vorbereitet: »Gar nicht, nein. Die haben zwar alle geguckt.« Aber er wird voll akzeptiert: »Das ist hier wahrscheinlich mehr (der Fall) wie in einem anderen Betrieb.«
Zur Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz merkt Chef D an, dass die Arbeit der ArbeitsassistentInnen für ihn von großer Bedeutung ist. Durch sie ist das Arbeitsverhältnis entstanden, und wenn sie Herrn D bei seiner Arbeit begleiten, »ist (das) einfacher. Für den (Herrn D) auf jeden Fall, ja. Denn dann arbeitet er, ohne dass da Probleme sind.« Wenn die ArbeitsassistentInnen ihm etwas sagen, »das behält er auch. Die haben da eine ganz andere Beziehung. Wenn er dann im Moment nicht so weiß, dann sagen die, komm her, das muss so sein, und passen halt auf ihn auf.« Aber nicht nur die Begleitung empfindet Chef D als wichtig, »auch die Ideen von den ArbeitsassistentInnen.« Diese haben für das Auflegen der Backwaren auf die Bleche spezielle Gitter anfertigen lassen, in die die Brötchen, Croissants etc. nur noch hineingelegt werden müssen und dadurch gleiche Abstände haben. Je nach Größe der Backwaren haben die Gitter unterschiedliche Formate: »Das mit dem Brötchenauflegen, da wär' ich nicht drauf gekommen, da gibt es auch verschiedene Größen, da hat sich die Arbeitsassistenz echt Gedanken gemacht.« Es gibt »nichts«, was sich Chef D noch von der Hamburger Arbeitsassistenz wünschen würde.
Über finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung, etwa Lohnkostenzuschüsse, ist Chef D nicht genau orientiert, er weiß lediglich vom Arbeitsamt, dass dieses nötige Hilfsmittel für die Arbeit von Herrn D finanzieren wird. Auch über die gesetzlich geregelten Ansprüche von Menschen mit Behinderungen ist Chef D nicht genau informiert, auf den Hinweis der fünf Tage Mehrurlaub antwortet er: »Der Altgeselle in der Backstube kriegt ja auch fünf Tage mehr Urlaub.«
Seine Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen macht Chef D deutlich, indem er auf das Zitat des Wirtschaftsverbandssprechers mit Unverständnis reagiert: »Wieso sollte ich mich da geschädigt fühlen, wenn ich solche Leute beschäftige? Er hat keinen direkten Kundenkontakt. Natürlich, die erste Zeit kam er immer durch den Laden, jetzt nimmt er die andere Tür rein und raus, aber selbst da würde ich mich nicht schämen. Und bei der Arbeit hat ja keinen Kontakt mit Kunden. Er ist glücklich in der Backstube. Und das war ein Experte, der das gesagt hat?« Überdies würde keiner einem Brötchen ansehen, von wem es hergestellt wurde, Chef D sieht »da keine Probleme,« findet eine solche Aussage »sehr hart gegenüber diesen Beschädigten ... äh Behinderten, beschädigt sind sie ja gar nicht.« Bezüglich der Werbung eines Bäckers, dessen Tochter mit Down-Syndrom auf einem Plakat für sein Brot wirbt, ist Chef D der Überzeugung: »Man muss das nur richtig auslegen, kann auch mehr Umsatz bringen. Hat vielleicht noch keiner probiert, jedenfalls nicht der Wirtschaftsberater.«
Chef D hat sich auf die Frage nach seinen Motiven für die berufliche Integration bei einem Telefonat mit dem Interviewer eher locker geäußert: »Ich hab ein großes Herz!« Im Interview hebt er sehr eindeutig heraus: »Wenn ich keine Behinderten einstelle, muss ich am Ende noch bezahlen. Das ist ja unser Sozialnetz. Ja, dann kann ich auch jemanden einstellen.« Aber es wird auch klar, dass Chef D und die anderen Mitarbeiter sehr um ihren Kollegen Herrn D bemüht sind.
Resümee von Chef D
Bei Chef D ist schwer auszumachen, wie die Motive zur Einstellung von Herrn D gewichtet sind. Eine soziale Einstellung wird ebenso deutlich wie ein wirtschaftlicher Aspekt: »Er ist ja kein Krankheitsfall, den wir eingestellt haben, er ist ein Behindertenteil, der hier arbeitet. ... Wir sind ja nicht ein Auffanglager, sonst hätten wir ihn ja nicht einzustellen brauchen.«
An anderer Stelle findet auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema ›Behinderung‹ statt, wo Geselle D sagt: »Für mich war das auch der erste Fall, mongoloide Behinderung. Wo wir die Scheu überwunden hatten, und es war eine Scheu zuerst. Erst sieht man die Leute immer und sagt, bloß nichts damit zu tun haben... .« Es wird eine gewisse anfängliche Skepsis deutlich, die aber durch die erfolgreiche Arbeit mit Herrn D und mit der Hamburger Arbeitsassistenz korrigiert wird: »Und dass das so gut klappt, das hätte ich nicht gedacht.« Da Chef D wenig Wissen über die gesetzlichen Bestimmungen zeigt, kann man davon ausgehen, dass diese keine hohe Bedeutung auf die Einstellung von Herrn D haben. Wenn Chef D noch mal vor einer solchen Entscheidung stünde, würde er »das wieder so machen.«
Das Unternehmen E ist ein Catering-Service, das in Hamburg die Kantine, einen Kiosk und andere ›Catering-Aufgaben‹ für den Hauptsitz eines Geldinstitutes betreibt. Es ist laut Aussage des Interviewpartners Chef E eines der größten Unternehmen dieser Branche in Europa. Chef E ist Personalchef und der direkte Vorgesetzte der unterstützten Arbeitnehmerin Frau E. Das Interview findet in ruhiger Atmosphäre im Büro von Chef E statt. Frau E befindet sich in einem festen Arbeitsverhältnis, sie arbeitet in einem Zweier-Team am Kiosk und geht dort verschiedenen Tätigkeiten nach. Ihre Aufgaben sind klar definiert und abgegrenzt.
Zur Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und zur gegenwärtigen Situation nimmt Chef E wie folgt Stellung: Zunächst kommt auf eine Anfrage der Hamburger Arbeitsassistenz ein Praktikumsverhältnis mit Frau E zustande. In diesem ist Frau E beschäftigt, als Chef E vor eineinhalb Jahren zu der Firma stößt. Als er kurz darauf von der Hamburger Arbeitsassistenz gefragt wird, ob er sich vorstellen könnte, Frau E auch einen festen Arbeitsvertrag zu geben, meint er, er sei noch nicht lange genug in dem Unternehmen, als dass er eine solche Entscheidung treffen könnte: »Da haben wir gesagt, das stellen wir noch mal zurück, das muss ich mir erst mal angucken, weil Hintergrund war ja von Anfang an, dass die Arbeitsassistenz sich nachher Stück für Stück auch zurückzieht.« In Zusammenarbeit mit den ArbeitsassistentInnen wird Frau E's Arbeitsgebiet nochmals neu definiert: »Sie hat ein festes Aufgabengebiet, es ist also wichtig, dass sie das macht, dafür ist sie verantwortlich - und das hat sie richtig motiviert. Und ich war eigentlich dann erst richtig positiv überrascht, wie gut sie das schon macht, also wie selbständig sie in ihrem Rahmen die Aufgaben schon bewältigt.«
Frau E arbeitet mit einer Kollegin im Kiosk. Dort hat sie verschiedene Aufgaben zu bewältigen: Neben dem Getränkeregal, das sie auffüllt und ordnet, liegen die Zeitschriften in ihrem Verantwortungsbereich. »Die Aufgaben delegieren wir fest, weil diese Aufgaben nehme ich den anderen dann weg, die sich natürlich sehr freuen, dass sie das nicht auch noch machen müssen, sondern hier eine echte Hilfe haben. Das Getränkeregal z.B. ständig auf einem bestimmten Niveau zu halten, eine von vielen Arbeiten .... Eine ganz wichtige Aufgabe, die (Frau E) übernommen hat.« Sie hat dabei nicht mit Bargeld zu tun, es läuft alles über Chip-Karten, aber die Zeitschriften sind ein »Verantwortungsgebiet, wo sie sich rantraut. Da geht es sehr wohl um Geld, die Zeitschriften, die ablaufen, werden wieder zusammengestellt und zurückgeschickt. Das geht nur, wenn sie die Scheine richtig ausfüllen.« Bei dieser Aufgabe wird sie im Moment noch von den ArbeitsassistentInnen unterstützt, »und dann wird es eine Aufgabe, wo sie - und das machen wir ja schon - eingearbeitet werden kann.«
Durch ihre Arbeit am Kiosk hat Frau E viel Kundenkontakt. »Die Kunden ..., die kommen mit (ihr) eigentlich richtig gut zurecht ..., viele kennen (Frau E) aber schon, sie hat da schnell Freunde gefunden. Aber bei vielen sehe ich es halt, dass sie da noch unsicher sind. Aber ich denke, das ist auch nur natürlich.« Ob sich innerbetrieblich viel verändert hat, kann Chef E nicht genau sagen, aber was die KundInnen angeht, ist deutlich: »Die Distanz zwischen Verkaufspersonal oder Unternehmen und den Kunden ... ist hier etwas aufgeweicht, die kommen teilweise herein und sagen: ›Hey (Frau E)‹ - seitdem und mit Einverständnis der Mitarbeiterin wohl ist das so gewachsen, dass viele sie beim Vornamen nennen.«
Mit der Arbeit von Frau E ist Chef E zu 82,5 Prozent zufrieden - »82,5 Prozent, das war nur ein Spaß, aber ich sage mal, zum Großteil bin ich zufrieden aufgrund der Art und Weise, wie sie sich einbringt und wie sie auch eine Wertigkeit für mich darstellt, also einen Nutzen darstellt, na ja, und die zwanzig Prozent - das wäre übertrieben, wenn ich sage, alles hundert Prozent. Sie ist noch nicht so weit, sie muss noch viel lernen, aber das kann ich auch von keinem anderen sagen.« Chef E beschreibt seine Mitarbeiterin als »motiviert. Das würde ich mir bei jedem wünschen, dass jemand mit Spaß zur Arbeit kommt und motiviert ist - und sehr gewissenhaft, sie kümmert sich drum, sie macht das sehr genau.« Eigentlich versucht Chef E bei allen MitarbeiterInnen, »sie möglichst immer den eigenen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen, dann haben wir auch noch Spaß dabei.« Doch gerade für Frau E ist eine unterfordernde Tätigkeit, »wo sie eh nichts zu leisten hat, ihr Potential eigentlich viel weitreichender ist - für viele ist das ja in Ordnung, aber für sie halt nicht. Sie braucht noch ein bisschen mehr, aber das kann sie auch.«
Soweit Chef E weiß, sind die MitarbeiterInnen nicht besonders vorbereitet worden, »sicherlich auch, weil sie ja nicht im großen Team hier in der Küche arbeitet, sondern sie da vorne im Zweier-Team mit im Kiosk arbeitet. Aber wenn sie hier mal rüberkommt, alles kennt sie.«
Probleme gibt es kaum, »es sind ja meist nur Kleinigkeiten, wie sie da ab und zu mal vor sich hinträumt.« Wenn Chef E die Arbeit von Frau E kritisiert, dann macht er das, »um auch mal demonstrativ zu zeigen, dass ich darauf achte, dass ich die Aufgabe ernst nehme.« Er beschreibt sie als jemanden, der seine Gefühle und Sympathien stark nach außen trägt und ihn »von Anfang an sehr gerne« mochte und dann auch erst mal »zum Knuddeln« kommt: »Das ist am Anfang natürlich auch sehr ungewohnt gewesen, d.h. erstens mit einem behinderten Mitarbeiter plötzlich konfrontiert zu werden, dann jemanden zu haben, der schnell Kontakt schafft - da kommst du hier an und es wird erst mal geschmust, und auch das ist erst mal Gewöhnungssache.« Nachdem er Frau E häufiger kritisiert, »da war sie am Anfang ein bisschen stutzig und hatte auch gefragt: ›Beobachtest du mich jetzt?‹ - Aber ich glaube, sie liebt mich immer noch.«
Die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz beginnt wie meistens durch deren Anfrage, die zuerst in ein Praktikum, später in ein festes Beschäftigungsverhältnis mündet. Chef E macht deutlich, dass es ohne die Arbeit der ArbeitsassistentInnen »mit Sicherheit nicht zum Arbeitsverhältnis gekommen (wäre). Ganz bestimmt sogar nicht.« Für ihn als Arbeitgeber ist wichtig, »dass sie das entsprechend vorbereitet haben.« Auch die Impulse der ArbeitsassistentInnen, was Frau E noch tun könnte, empfindet er besonders in der Anfangszeit als wichtig. So bringen die ArbeitsassistentInnen Chef E darauf, ihr die Rücksendung abgelaufener Zeitschriften zu übertragen: »Die Remissionsgeschichte zum Beispiel, eine geldwerte Sache, die delegiere ich nicht so schnell und einfach, und ich habe mir das angeguckt, und siehe da, es klappt. Dann habe ich gesagt: ›Okay, dann behalten wir das bei.‹« Auch die Initiative der ArbeitsassistentInnen, die Arbeitsgebiete zu definieren und einen Arbeitsplan für Frau E zu erstellen, und auch die Arbeitsbegleitung vor Ort spielen für Chef E eine große Rolle: »Hätten sie mir (Frau E) jetzt am Anfang gegeben und gesagt, nun arbeite mal ganz alleine mit ihr, das wäre für den Anfang sowieso utopisch gewesen, aber jetzt alles alleine aufzubauen, Arbeitsorganisation, rauszukriegen, wo setze ich sie am besten ein und wie arbeite ich mit ihr zusammen, das hätte den Rahmen gesprengt. Das hätte ich nicht geschafft - dazu ist die Position auch zu eigenständig da drüben.« Auch die Anwesenheit von zwei weiteren Menschen im Betrieb, die nicht vom Fach sind, sieht Chef E nicht als Belastung, sondern als »Erleichterung. Die kennen (Frau E), kennen sie als Person und können sie noch lenken und führen.« Er wünscht sich von der Hamburger Arbeitsassistenz »momentan nichts weiter« und bezeichnet die beiden ArbeitsassistentInnen, die Frau E begleiten, als engagiert: »Sie machen einen Superjob.«
Was finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung angeht, macht Chef E sehr deutlich: »Auch wenn ich gerne gewillt bin, einem Menschen - auch (Frau E) - eine Chance zu geben, muss ich das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen. ... Das muss sich rechnen, (Frau E) muss sich rechnen. Das habe ich ihr auch gesagt: Sie verdient mit ihrer Arbeit ihren Arbeitsplatz mit.« Frau E hat eine Halbtagsstelle, für die nur Geld da ist, wenn der Umsatz stabil bleibt - »dadurch habe ich überhaupt das Geld über, um eine Halbtagsstelle da drüben im Budget aufzunehmen. Wäre das alles so schlecht da drüben, dass der Umsatz entsprechend sinken würde, dann hätte ich diese Position nicht mehr über.« Chef E ist der Meinung, dass ohne die Lohnkostenzuschüsse ein solches Beschäftigungsverhältnis wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre. Auch wenn sich eine solche wirtschaftliche Kalkulation vielleicht ein bisschen kalt anhört, »aber ich denke, das ist nur realistisch.« Auf die Nachfrage, ob sich das Arbeitsverhältnis im Hinblick auf das Ende der Lohnkostenzuschüsse denn nun rechnet, antwortet er bestimmt: »Das rechnet sich schon, weil sie jetzt auch Sachen übernommen hat, die kein anderer dann macht. Sie arbeitet nicht einfach nur nebenher, sondern ihre Aufgaben, die sie übernimmt, sind wichtig. Das spare ich an anderer Stelle wieder ein.«
Die gesetzlichen Regelungen wie verbesserter Kündigungsschutz und Mehrurlaub als Argument gegen eine Einstellung von Menschen mit Behinderung kann Chef E nachvollziehen, besonders für kleinere Unternehmen bezeichnet er sie als »Hemmschuhe.« Der besondere Kündigungsschutz, der MitarbeiterInnen mit Behinderungen schützen soll, »verhindert aber teilweise gerade die Einstellung.« Besonders am Anfang, »da kennt er die noch nicht, da ist auch ein kleines Risiko für ihn. Nehme ich jetzt einen Behinderten, gebe ihm die Chance, oder nehme ich, jetzt mal übertrieben gesagt, einen topfiten Menschen, was heutzutage allerdings auch schon schwierig genug ist, aber er ist dann eher geneigt, einen ›Normalen‹ zu nehmen, den kann er nach einer gewissen Zeit auch wieder rausschmeißen, wenn er sagt, das war es dann doch nicht.« Das Absenken der Ausgleichsabgabe spielt nicht allein die große Rolle für Chef E. Er macht deutlich, dass es mehrere Gesichtspunkte gibt, »sich überhaupt in eine solche Richtung zu orientieren. ... Auf der einen Seite ist es eine Portion Eigennutz, indem man sagt, hier haben wir die entsprechenden Zuschüsse, Vergünstigungen und da bitte kann man auch reinrechnen, dass wir entsprechende Einsparungen bei der Ausgleichsabgabe haben, das ist ein Pluspunkt, weshalb man sich dafür entscheidet.« Auf der anderen Seite steht für ihn »genauso der Mensch (Frau E), ich habe ja nicht irgend jemanden genommen, sondern ich habe mich ja für (sie) entschieden, die ich hier kennengelernt habe, die a) sympathisch und b) auch willens und in der Lage ist, diese Arbeit zu beherrschen.«
Seine Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen macht Chef E im Kommentar zum Zitat des Wirtschaftsverbandssprechers deutlich: Da fällt ihm »fast nichts mehr ein ...: Das ist mit Sicherheit nicht unsere Position. ... Wir sind sehr stolz darauf; das hätten wir nicht gemacht, wenn wir in irgendeiner Weise unseren Ruf geschädigt sehen. Das schockiert mich doch eher.« Sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und sein soziales Engagement zu zeigen, findet Chef E wichtig: »Das machen wir nicht anonym, wir machen es gerne und versuchen ..., das auch irgendwie als Verantwortung zu sehen, gerade als großes Unternehmen. Wir haben uns auch sehr über diese Plakataktion (der Hamburger Arbeitsassistenz, d. Verf.) gefreut mit Dagmar Berghoff und unserer (Frau E) hier. Das war ja auch eine sehr schöne Sache.« Er hält gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte für notwendig, »dass man einfach weiß, dass es nicht nur perfekte blonde, blauäugige Kinder gibt, sondern dass es da alle Schattierungen gibt. Das gehört genauso dazu.«
Bezüglich seiner Motive macht Chef E seine Meinung deutlich, dass sich besonders ein Großunternehmen wie seines »sozial engagieren« soll. Im Privatbereich hat Chef E »nur am Rande« Kontakt zu Menschen mit Behinderungen, seine »Tochter ist in einem Kindergarten, wo in ihrer Gruppe auch integrativ ein behindertes Mädchen ist.« Das soziale Engagement und damit verbunden ein vorhandener Werbeeffekt reichen laut Chef E aber nicht aus: »Wenn ich das jetzt nur mache, damit ich ab und zu mal auf ein Poster komme, dann hätte das nicht so den Sinn.« Frau E ist für ihn als Arbeitgeber eine »echte Hilfe«, so dass er sie für ihre Arbeit auch bezahlen kann. Er sieht ihre Beschäftigung »nicht nur als kleine soziale Gefälligkeit, dass wir einfach nur eine große Firma sind, die da soziale Bonbons verteilt, sondern dass sie hier auch eine richtige Aufgabe hat.«
Resümee von Chef E
Chef E macht im Gespräch mehrfach seinen wirtschaftlichen Standpunkt deutlich. Für ihn muss Frau E Arbeit leisten, die ihre Anstellung rechtfertigt. Dafür ist für ihn die Arbeit der ArbeitsassistentInnen eine grundlegende Voraussetzung: »Hätten wir jetzt erst mal ein Jahr investieren müssen, um (Frau E) dahin zu bringen, dann hätten wir das als Wirtschaftsbetrieb nicht leisten können. Das sage ich ganz ehrlich.« Ohne die Anfrage der Hamburger Arbeitsassistenz käme solch ein Beschäftigungsverhältnis ohnehin nicht zustande, denn nach Einschätzung von Chef E würde sich kaum ein Unternehmen von sich aus nach MitarbeiterInnen mit Behinderung umsehen, besonders nicht ein Großunternehmen: »Wenn Sie jemanden haben, der einen Wirtschaftsbetrieb führt, der ist meistens in Eile, hat viele Probleme an den Hacken und schafft sich nicht noch neue.« Mit seiner Entscheidung für Frau E ist ihr Chef »bis jetzt ganz zufrieden.« Als Belastung könnte er sich »höchstens erst mal das Fremde, das Neue« vorstellen, dass Menschen, die nicht richtig informiert sind, »negativ eingestellt sind gegen so jemanden am Anfang.« Bereichernd ist dagegen für ihn bei beruflicher Integration, »dass man hier auch mal andere Menschen - hört sich jetzt blöd an - , aber auch jemanden aus anderen Bereichen kennenlernt, man geht halt nicht täglich damit um, und es ist ja eine ganz andere Art und eine andere Qualität, andere Bereiche kennenzulernen und miteinander umzugehen.« Wenn er wieder vor einer solchen Entscheidung stünde, würde er »noch jemanden einstellen.« Chef E weist aber auch darauf hin, dass eine solche Entscheidung »immer typbezogen ist, es gibt sicherlich auch problematischere Fälle wie unsere (Frau E) hier. ... Mit (ihr) haben wir jemanden hier, der das voll rechtfertigt, aber ich kann mir wirklich problematischere Fälle vorstellen, - wäre auch verwunderlich - ich habe auch genug Arbeitnehmer hier, die problematisch sind, das wird es in allen Bereichen geben.«
Chef E ist davon überzeugt, dass man »aufklärerisch« tätig werden muss: »Hätten Sie mich einfach nur gefragt, ob ich einen behinderten Mitarbeiter nehmen würde, und ich kenne (Frau E) noch nicht, hätte ich vielleicht auch anders geantwortet, hätte ich vielleicht gesagt, ich habe also wirklich Probleme genug, jetzt soll ich mich noch mit Behinderten rumschlagen.« Eine Bezeichnung wie »geistig Behinderter ..., damit kann man erst mal wenig anfangen. Man muss erst mal hingehen und mit den Menschen ... zusammenarbeiten.« Viele Menschen sind laut Chef E »ungeübt mit dem Umgang und unsicher, viele wollen nur das Beste eigentlich und wissen aber eigentlich nicht so recht, wie sie sich so einem Menschen nähern sollen oder mit ihm umgehen sollen, entweder gucken sie weg oder laufen schnell weiter.«Auch für ihn gibt es am Anfang solche Momente, wobei Chef E feststellt, dass es »eine Gewohnheitssache ist - man baut sich da viel zu viele Barrieren auf.« Die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen zu forcieren, bezeichnet Chef E als »noch ein Stückchen Arbeit« Viele Menschen haben das »noch nicht kennengelernt oder halten das für Spielkram ..., das ist doch nichts für die harte Wirtschaft. Das ist was für die Hobbythek oder für eine Werkstatt und für Zivis, so für diesen sozialen Bereich. (Es gilt,) das in die Wirtschaft zu integrieren, praktisch ins normale Leben, also da, wo es dann auch ernst genommen wird und nicht am Rande mit irgendwelchen Fördermaßnahmen läuft.«
Bei dem Unternehmen F handelt es sich um ein Hotel einer großen, internationalen Firmengruppe. Die Interviewpartnerin, Chefin F, ist Personalchefin und zum Zeitpunkt des Interviews im Mutterschutz, weshalb sie während des Interviews zu detaillierteren Angaben bezüglich der Arbeit von Frau F per Telefon Informationen von einem Kollegen einholt. Die unterstützte Arbeitnehmerin Frau F arbeitet, nachdem sie ihre Schulzeit in Integrationsklassen und im BVJ-i der Berufsschule verbracht hat, im Service des Hotels - ebenso wie weitere unterstützte ArbeitnehmerInnen, die aus Sonderschulen und Integrationsklassen gekommen sind. Das Interview findet bei Chefin F zuhause statt.
Die Schilderungen von Chefin F über die Entstehung des Beschäftigungsverhältnisses und die gegenwärtige Situation beginnen damit, dass es vor dem Beschäftigungsverhältnis mit Frau F eine andere unterstützte Arbeitnehmerin gibt, Frau Y, die auch durch die Hamburger Arbeitsassistenz vermittelt und begleitet wird; dieses Beschäftigungsverhältnis muss nach kurzer Zeit beendet werden. Frau F ist die nachfolgende unterstützte Arbeitnehmerin, die im Hotel beschäftigt ist, sie steht in einem festen Arbeitsverhältnis. Ihre Hauptaufgaben bestehen im Ein- und Abdecken der Tische zu den Mahlzeiten und auch bei besonderen Anlässen. Chefin F bezeichnet die Mitarbeiterin Frau F als »total zuverlässig, immer pünktlich, interessiert, und sie macht ihre Arbeit auch sehr genau.« Der Chefin ist zudem sehr wichtig, dass Frau F gut reagieren kann, wenn Gäste sie ansprechen: »Wenn ein Gast die Person anspricht, nicht einfach umdrehen und weggehen und sagen, huch, oh Gott, da hat mich jetzt jemand angesprochen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll ..., was eine normale Reaktion ja wäre. Das hat sie aber nicht. Sie steht dann schon da ... durch Training, man hat das mit ihr trainiert.«
Schwierigkeiten in dem Beschäftigungsverhältnis gibt es laut Chefin F schon hin und wieder, vor allem wenn es viel zu tun gibt und alles sehr schnell gehen muss, »und da ist jemand, der braucht halt seine Zeit, der bremst natürlich alles.« Mit den KollegInnen gibt es »schon Reibereien, dass man mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt hat oder sonst irgendwie. Aber im großen und ganzen ist es halt sehr positiv aufgenommen worden und wäre das nicht, hätten wir auch (Frau F) keinen Arbeitsvertrag geben können, wenn das Team da nicht mitmacht.« Bei den MitarbeiterInnen kann Chefin F eine »Wandlung beobachten: Die sagten dann schon nach den ersten Monaten: Das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, mit einer behinderten Person so eng zusammenzuarbeiten, und ich achte heute in meinem Alltag auch schon ganz anders auf behinderte Menschen.« Frau F hat ständig Kontakt mit Gästen, aber ihre Chefin kann keine Aussagen über Reaktionen der Gäste machen, »sie erleben diesen Mitarbeiter ja nur eine halbe Stunde ... , und ich denke, wenn ein Hotelgast merkt, dass das im Team kein Problem ist, dass jemand mit Behinderung dort tätig ist, ich meine, wenn man sieht, das ist ein Team und das ist da kein Problem, warum sollte sich da ein Gast dran stören, wenn man doch sieht, dass die Arbeit funktioniert.«
Zur Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz merkt Chefin F an, dass sie deren Arbeit sehr wichtig findet. Den Kontakt zu einem der Akquisiteure bewertet sie mit 85 bis 90 Prozent Zufriedenheit, besonders die Hilfe »in Bezug auf Finanzierung, Formulare ausfüllen und so weiter, weil das nimmt ja doch sehr viel Zeit in Anspruch.« Die Begleitung von Frau F durch die ArbeitsassistentInnen bildet für Chefin F vor allem zu Beginn eine Grundvoraussetzung, um zu trainieren, zu üben, »und da ist diese Begleitung ganz ganz wichtig und das muss gut funktionieren.« Sie hebt hervor, dass das Hotelpersonal nicht pädagogisch ausgebildet ist; sie »können gerne fachliche Kompetenzen vermitteln und diese Möglichkeiten bieten, aber alles, was pädagogisch, psychologisch damit zu tun hat ... , da will ich also auf keinen Fall, dass wir da irgendwas mit zu tun haben. Wir sind da nicht ausgebildet und haben da auch keine Zeit für. Das geht nicht. Wir können nicht noch zusätzliche Arbeit uns aufhalsen.« Ganz wichtig findet sie, dass zwischen den ArbeitsassistentInnen und der unterstützten Arbeitnehmerin »Sympathie« ist, sonst »wird da nichts vermittelt, das ist ganz klar.«
Die Arbeit der ArbeitsassistentInnen bewertet Chefin F mit 75 bis 80%; hundert Prozent findet sie immer schwierig, denn »da ist sicherlich eine Steigerung möglich.« Als wichtigste Leistung bezeichnet sie die kompetente und gute Hilfestellung der Hamburger Arbeitsassistenz und wünscht sich von dieser »nichts« zusätzlich.
Finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung spielen für Chefin F die »größte« Rolle. Sie macht deutlich, dass sie für die Einstellung eines Mitarbeiters das Budget haben muss. »Und warum sollte ich einen behinderten Mitarbeiter einstellen, der nicht die volle Arbeitsleistung im Gegensatz zu einer Fachkraft oder einer anzulernenden Kraft bringt? Flexibilität, ... . Wo liegt da der Vorteil drin? Und der kann einfach nur dann sein, wenn ich diesen Mitarbeiter bekomme, ohne dass ich was dafür zu zahlen habe in der ersten Zeit.« Es ist ihrer Meinung nach ganz wichtig, dass die ersten Jahre mitfinanziert werden, »und wenn (Frau F) sich in der Zeit mit ihren Eigenschaften als sehr gut bewährt hat oder gut - was würde dagegen sprechen, sie nicht dann aus eigener Tasche zu finanzieren? Nur diese Zeit braucht man auch, um zu sehen, ob es hinhaut.« Die fünf Tage Mehrurlaub machen für Chefin F »auf deutsch gesagt den Kohl auch nicht fett, im Hotel hat man sowieso wenig Urlaubsanspruch.«
Den besonderen Kündigungsschutz bewertet Chefin F als durchaus schwierig: Einerseits ist sie der Meinung, dass es »schon sinnvoll ist, dass jemand, der beeinträchtigt ist, anders geschützt werden muss, denn wenn personelle Wechsel in den Unternehmen sind und da kommt jemand, der da nichts mit anfangen kann oder vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat und räumt dann auf - das kann nicht sein.« Auf der anderen Seite kann es aber auch nötig sein, einer Kündigung zuzustimmen, »wenn wirklich konkrete Sachen vorliegen. ... Und wenn sich da mal jemand querstellt in der Hauptfürsorgestelle - also ich glaub', wenn man einmal als Unternehmen diese Erfahrung gemacht hat, dann ist die Tür für alle Zeit verschlossen für sämtliche Anfragen.« Mit ihrer früheren Mitarbeiterin Frau Y musste Chefin F diese Prozedur selbst bereits durchlaufen, »und das war nicht ganz unproblematisch.« In diesem Fall ist es aber für sie und ihr Unternehmen so ausgegangen, dass die Kündigung realisiert wurde.
Zur Ausgleichsabgabe macht Chefin F keine konkreten Aussagen, da die Löhne aus der Zentrale bezahlt werden, »und da werden auch die Behindertenabgaben dann errechnet.« Sie weist ihren Direktor darauf hin, kann aber keine Angabe dazu machen, »inwiefern das letztendlich doch von den Kosten her heruntergenommen wurde.« Chefin F kann sich gut vorstellen, dass viele Unternehmen nach der Devise handeln: »Damit ich halt keinen Stress oder sonst irgendwas habe, zahle ich vielleicht lieber das Geld und habe meine Ruhe.«
Die Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen von Chefin F wird darin deutlich, dass sie die Aussage eines Wirtschaftsverbandssprechers, nach der sie durch die Beschäftigung von Frau F ihrem Unternehmensimage schaden soll, nicht nachvollziehen kann. Im Gegenteil ist sie vielmehr der Meinung, »man könnte das werbe-technisch ausschlachten.« Chefin F hat vor, ihre unterstützten MitarbeiterInnen, die zwischenzeitlich in allen drei Hamburger Häusern tätig sind, vor ein Unternehmensschild zu stellen, ein Foto zu machen und einen Bericht dazu zu schreiben, um »darüber zu informieren, was läuft hier. Warum soll ich das auch nicht kundtun? ... Ne, es heißt ja immer, tue Gutes und tue es kund. ... Und ich denke, das könnte sehr viel bewirken.« In der Öffentlichkeit zu werben hält sie für »überfällig. Es passiert immer noch viel zu wenig. Die Gesellschaft geht da zwar schon viel offener mit um... . Das sehe ich ja heute auch erst, wo ich selber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, mit einem Kinderwagen unterwegs bin, dass es Busse gibt, die Rollstuhlfahrer mitnehmen können. Das war ja vor ich weiß nicht wie langer Zeit noch nicht so möglich. Also, die Gesellschaft ist schon interessierter als vor ein paar Jahren, aber es gibt noch viel zu tun.«
Die Motive von Chefin F sind von der Überzeugung geleitet, dass es ganz wichtig ist, in der Gesellschaft »ein Feingefühl dafür zu entwickeln, dass behinderte Menschen im engeren Umfeld vorhanden sein können.« Und obwohl sie mit der Mitarbeiterin Y schlechte Erfahrungen gemacht hat, »haben wir gesagt: Okay, ein negatives Erlebnis heißt ja nun nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist.«
Resümee von Chefin F
Chefin F macht deutlich, dass der wirtschaftliche Gesichtspunkt ganz wichtig ist; ein Unternehmen muss sich fragen: »Macht das Sinn, macht das keinen Sinn, welchen Vorteil hat das Hotel daraus? Ist ja klar, als Hotel muss ich da auch Vorteile draus haben«» Daher ist ein Finanzierungszuschuss über einen längeren Zeitraum enorm wichtig, um zu sehen, ob die Zusammenarbeit mit dem unterstützten Arbeitnehmer passt, wo es Schwierigkeiten gibt: »Wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier einen behinderten Mitarbeiter, der muss aber von ihnen bezahlt werden, da kriegen sie keine Tür mit auf. Und von einem zwei- oder vierwöchigen Praktikum werde ich keine Erfahrungen sammeln mit solchen Menschen also, mit dem Menschen selber und mit dem, was da alles Drumherum damit zu tun hat.«
Bei einem Unternehmensforum hat die Hamburger Arbeitsassistenz darüber informiert, wie die Finanzierung in den Werkstätten für Behinderte aussieht, dass die Menschen mit Behinderungen dort »voll finanziert werden, so aber in den Unternehmen nicht. ... Das klafft schon ganz schön auseinander. Da haben wir von den Unternehmen schon gesagt, da muss sich mal was Schnelles tun, sonst wird sich diese ganze Geschichte gar nicht weiterentwickeln.« Chefin F ist der Meinung, dass kein Hotel selbständig auf eine Institution wie die Hamburger Arbeitsassistenz zugehen würde, »also, so würde ich das nicht machen. Also was für einen Vorteil habe ich als Unternehmen davon, auf die Institution zuzugehen. Das müsste eher dann anders rum sein.« Auch eine Begleitung während der Arbeit durch den Betrieb kann nach Chefin F nicht gewährleistet werden, dafür fehlt ihrer Meinung nach sowohl die pädagogische Ausbildung als auch die Zeit. Sie ist mit ihrer Entscheidung, ihre Mitarbeiterin Frau F eingestellt zu haben, hundertprozentig zufrieden, bezeichnet es aber als »personenabhängig«, denn schließlich hat es mit der Vorgängerin im Laufe der Zeit große Probleme gegeben.
Chefin F würde bei einer erneuten Entscheidung »das noch mal« und »gar nicht« anders machen. Als schwierig bezeichnet sie bei beruflicher Integration »die gesellschaftliche Akzeptanz, behinderte Menschen im engeren Umfeld zu haben.« Diese möchte sie durch ihre Arbeit verstärkt herstellen. Für sie persönlich sind die Veränderungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung »so prägnant, und das, finde ich eigentlich, sollte selbstverständlich sein, nur so kann man's dann auch lernen. Wenn ich diesen Umgang nie habe - woher soll ich das dann wissen? Und das fand ich schön.«
Bei dem Unternehmen G handelt es sich um einen ›Outdoor-Ausrüster‹ mit mehreren Zweigstellen in verschiedenen Städten. Das Interview findet im Verwaltungshauptsitz statt, Interviewpartner sind in der Geschäftsführung der Firma: Chef G1 ist einer von zwei Gründern und hat heute in der Public-Relations-Abteilung seinen Schwerpunkt, Chef G2 leitet die Personalabteilung. In diesem Unternehmen sind zwei ArbeitnehmerInnen beschäftigt, die im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung arbeiten. Die erste unterstützte Arbeitnehmerin, Frau G, kommt aus einer Werkstatt für Behinderte und ist schon länger in einem festen Arbeitsverhältnis beschäftigt. Der zweite Arbeitnehmer, Herr G, hat Integrationsklassen und ein BVJ-i durchlaufen, ist seit einem Jahr im Unternehmen G und hat mittlerweile auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Beide sind im Lager beschäftigt und werden beim Kommissionieren eingesetzt.
Ausgangspunkt für die Schilderung der Entstehung der Beschäftigungsverhältnisse und der gegenwärtigen Situation ist, so Chef G1, »dass ich jedes Jahr diese Zahlung machen muss für Nichtbesetzung der Pflichtplätze. Das waren, glaube ich, 200 Mark jeden Monat, und wenn ich drüber nachdenke, ich hatte selbst mal einen Unfall vor vielen Jahren, dass man auch mal zu den Gelähmten oder Behinderten gehören könnte. Das sind Leute, die geistig vollwertig sind, die wollen noch arbeiten. Nichts ist schlimmer, als wenn man zu Hause sitzt. Eigentlich jeder als normaler Mensch, der arbeiten möchte, der empfindet das als Demütigung, wenn er keine Arbeit hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein Behinderter genauso denkt, der ist ja geistig voll da und ist nicht in der Gesellschaft integriert. Das müsste man mal ändern - und dann haben wir mal angefangen mit (Frau G), das war zufällig, dass (einer der beiden Leiter) kam von der Hamburger Arbeitsassistenz.« Weiter betont er, dass das Unternehmen auch öfter Menschen vom Arbeitsamt vermittelt bekommen hat, die nicht richtig lesen und schreiben können, oder Schulen anfragen, ob sie nicht dem einen oder anderen einen Praktikumsplatz einrichten können. Im Unternehmen sind auch immer wieder Jugendliche aus »sozial schwachen Familien.«
Frau G und Herr G arbeiten im Lager. Dort werden sie beim Kommissionieren eingesetzt, Frau G sucht Waren anhand von Artikel- und Lagerfachnummern heraus, über die Tätigkeiten von Herrn G wird nichts anderes erwähnt. Frau G ist zu Beginn für eine andere Tätigkeit vorgesehen, bei dieser hat sie aber zu große Schwierigkeiten, daher hat Chef G1 in Zusammenarbeit mit den KollegInnen eine neue Tätigkeit für sie gesucht, die Arbeit im Warenlager, »und das stiefelt sie dann runter.« Mit der Arbeit dieser beiden MitarbeiterInnen ist Chef G2 zwischen achtzig und hundert Prozent zufrieden. Entscheidend ist, dass sie »Lust haben zu arbeiten.« Schwierigkeiten gibt es bei Frau G am Anfang lediglich mit den Pausenzeiten: »Sie hat immer so viel Zeitdefizite, weil sie nicht einschätzen kann, wie viel Pausen sie hat. ... Jetzt gehen wir hin und sagen: ›Hier, du hast jetzt acht, sieben Stunden, nun komm mal in die Hufe und bau die mal ab.‹ Das ist besser, das ist reeller. Ihr hilft das und uns dann auch.« Probleme mit den KollegInnen benennen die beiden Chefs nicht explizit; Chef G2 dazu: »Da ist auch keiner in der Firma, der die beiden hänselt.« Und Chef G1 fügt hinzu: »Wir sind ja eine multi-kulturelle Gesellschaft hier in der Firma und haben ohnehin uns ständig damit auseinander zusetzen, Leute zu integrieren. ... Zum Beispiel ist der Stellvertreter von (Chef G2) in der Personalabteilung ein Afghane, der hat hier bei uns im Lager angefangen, und dann nach einigen Monaten hat er eine kaufmännische Lehre begonnen, macht jetzt sein Abitur in Abendkursen nach.« Wenn es mal Reibereien gibt, dann ist nach Chef G2 dafür eher verantwortlich, dass jemand an der falschen Stelle arbeitet und nicht die Person selber, »und (Herr G) und (Frau G) sind eben pflegeleicht.«
Bezüglich der Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz hebt Chef G1 hervor, dass die Zusammenarbeit mit ihr für ihn besonders zu Beginn sehr wichtig ist, um die Tätigkeiten abzugrenzen. Auch die Vorbereitungen durch die Akquisiteure findet er gut, an der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz insgesamt »gibt es überhaupt keine Mängel.« Die wichtigste Leistung besteht für Chef G2 in der Betreuung durch die ArbeitsassistentInnen, und er wünscht sich nichts weiter: »Es ist alles so gelaufen ... - besser kann man es nicht machen.«
Was finanzielle und gesetzliche Aspekte der Beschäftigung angeht, so meint Chef G2, in dieser Firma denke man über Lohnkostenzuschüsse »nicht so richtig nach. ... Das haben wir nie gemacht, dass wir jetzt einen Vorteil haben.« Er macht deutlich, dass die Firma auf die Förderung eigentlich auch verzichten könnte, aber eine gewisse Sicherheit stellen die Zuschüsse doch dar, denn »man weiß ja nie, was man dann wirklich bekommt. Das war vielleicht ganz in Ordnung, dass man erst einmal sagt, man nimmt die Förderung dann erst mal mit und so weiter. ... Aber darüber haben wir nie nachgedacht.« Chef G2 ist der Meinung, dass die meisten Firmen »das davon abhängig machen.« Er würde sogar so weit gehen, dass man, wenn man den Arbeitnehmer nicht übernimmt, »die Förderung dann zurückzahlen sollte. ... Oder einen Teil davon, damit die nicht von vornherein erst einmal kassieren, um das nur auszunützen.« Auch über die Sonderregelungen wie besonderen Kündigungsschutz und Mehrurlaub als Einstellungshindernisse haben die Chefs G nach eigenen Angaben nie nachgedacht.
Ihrer Position zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen entsprechend sind beide Chefs eher empört über die Aussage des Wirtschaftsverbandssprechers, dass sie mit ihren unterstützten ArbeitnehmerInnen ihrem Image schaden sollen. Chef G2 bezeichnet ihn als »rückständig« und Chef G1 ergänzt: »Das ist ja in keiner Weise image-schädigend, man muss solche Leute individuell einsetzen.«
Über eine Werbekampagne mit Menschen mit Behinderungen haben beide noch nicht nachgedacht, ihre Models sollen vor allem authentisch wirken: »Claudia Schiffer mit unseren Rucksäcken, das wäre vielleicht auf der ersten Seite, würde aber nichts bewirken, weil man ihr das nicht abnimmt.« Was Chef G1 sich gut vorstellen könnte, wäre, »wenn irgendeiner tatsächlich mit einem Behinderten loszieht, meinetwegen eine Tour durch Schweden macht, dass man da eine Fotostrecke macht. So was kann ich mir sehr sehr gut vorstellen.« Menschen mit Down-Syndrom beispielsweise in der Werbung einzusetzen, hat für ihn »zwei Seiten: Auf der einen Seite ist es schick, sich damit zu schmücken unter Umständen, die können ja prächtig ›funktionieren‹, einfach weil manche Typen ja ganz witzig sind, und auf der anderen Seite könnte das auch so ein bisschen anbiedernd aussehen, wenn man das machen würde.« Was das Verhältnis zu Menschen mit Behinderungen betrifft, findet Chef G2 »unsere Gesellschaft krank. ... Und weil unsere Gesellschaft so rückständig ist, ... man verschließt sich diesen Dingen, die gehören zu uns.«
Was ihre Motive angeht, machen beide Chefs deutlich, dass sie sich um die Beschäftigung von verschiedenen Menschen bemühen. Von beiden wird auch hervorgehoben, dass man selbst einmal von Behinderung betroffen sein könnte. Chef G2 beschreibt seine eigenen Erfahrungen nach einem Unfall: »Ich war ja nicht weit davon weg. Ich habe ja auch wieder das Sprechen lernen müssen, das Laufen lernen müssen und all solche Sachen. ... Das sind solche Sachen, da hat man die Nähe dazu, als wenn du dir gar nicht vorstellen kannst, dass auch einer mal nicht so normal ist.« Er meint, dass man dann ein ganz anderes Gespür dafür entwickelt, »wenn jemand in so einer Situation ist.« Und Chef G1 fügt hinzu, dass sich jeder Gedanken machen sollte, »wie leicht es ist, dass man in eine solche Situation kommen kann, durch Verkehrsunfälle oder wenn man auf Reisen ist.« So stellt es für beide eine »soziale Verpflichtung dar, solche Leute ... auch zu integrieren.«
Resümee von den Chefs G
Während des Interviews wird deutlich, dass beide Interviewpartner ein großes soziales Engagement zeigen, sicherlich forciert durch die persönlichen Erfahrungen. Beide vertreten gleichzeitig die Meinung, dass solche Beschäftigungsverhältnisse auch an qualitative Grenzen stoßen: »Wenn ich (Chef G1) mir vorstelle, dass wir jetzt sieben, acht oder sogar neun Pflichtplätze besetzen müssten und würden das mit sieben, acht oder neun Leuten machen - weiß nicht, ob das für einen Betrieb tragbar wäre. ... Obwohl wir 300 Leute sind - das würde nachher auf niedrige Tätigkeiten rauslaufen, wie nur Kataloge kleben.«
Sie betonen auch die Prämissen ihrer Personalpolitik: In ihrer Firma bekommt jeder eine Chance zu beweisen, was er kann, ohne dass auf schulische Abschlüsse geachtet wird. Wichtig ist ihnen eine gute Zusammenarbeit der KollegInnen untereinander. Stehen Neueinstellungen auf dem Plan, dann geht derjenige in die vorgesehene Abteilung, »und letztendlich entscheidet die Abteilung, die Leute, die dort arbeiten und sagen, den können wir gebrauchen oder nicht gebrauchen.« Entscheidend sind Loyalität und Engagement der MitarbeiterInnen, es gibt auch einen Preis für den, der »am fleißigsten gearbeitet hat« Beiden ist ein guter Umgang »im menschlichen Bereich« wichtig, sie bemühen sich immer, »die Leute gut zu motivieren und dass sich alle bewusst sind, dass wir an einem Strang ziehen. Wenn es der Firma gut geht, ...«
Die beiden Chefs G haben, wenn sie an Menschen mit Behinderungen denken, zunächst vor allem Menschen im Rollstuhl vor Augen, die, wie Chef G2 meint, »geistig voll da sind. ... Wir haben auch bei uns im Laden viele Kunden, die im Rollstuhl sitzen, die einfach die Fleece-Sachen zu schätzen wissen oder Schlafsäcke, Fußsäcke kaufen oder so. Ich glaube, unsere Kollegen können auch recht gut damit umgehen.« Zudem vergibt Unternehmen G, wie Chef G1 erzählt, »einmal im Jahr den Preis ›Globetrotter des Jahres‹, den hatten wir vor fünf Jahren an (XY) vergeben. ... Er fuhr mit dem Rollstuhl und sein Bruder mit dem Fahrrad nebenher durch Syrien. Aber das ist auch so ein fantastischer Typ, er weiß, wie Gesunde darüber denken, und kann das genau einschätzen, und alle Fragen, die irgendwie im Raum stehen, die liest er denen von den Lippen ab.« Gleichwohl schätzen sie auch die Fähigkeiten ihrer beiden MitarbeiterInnen, Frau G und Herr G: »Daraus sehe ich ja, dass die Tätigkeit auch Leute machen können, die eben nicht so viel drauf haben, geistig und so weiter. Der eine hat vielleicht geistig nicht so viel drauf, aber bringt tolle Arbeit, und den kann man besser integrieren als jemanden, der vielleicht viel mehr drauf hat, aber nichts leistet.« Als belastend empfindet Chef G2 die »Einarbeitungszeit und die ganzen Formalitäten.« Bereichernd findet er dagegen, »dass man über andere Menschen auch mal nachdenkt.« Beim nächsten Mal würde er deshalb »nichts anders machen.«
Obwohl sich die sieben Unternehmen sowohl hinsichtlich ihrer Größe als auch der Branche, in der sie tätig sind, unterscheiden, ergeben sich bei der Auswertung der Interviews eine Reihe von Übereinstimmungen. Daneben lassen sich jedoch auch einige Differenzen in den Aussagen der befragten Vorgesetzten feststellen. Im folgenden werden diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede systematisch erfasst und einander gegenübergestellt. Abschließend wird ein knappes Schlussfazit gezogen.
Im Blick auf die Entstehung der unterstützten Beschäftigungsverhältnisse ist festzuhalten, dass alle Beschäftigungsverhältnisse durch die Hamburger Arbeitsassistenz zustande gekommen sind. Sechs der sieben befragten Unternehmen werden durch Akquisiteure der Hamburger Arbeitsassistenz angefragt, nur Chefin A wendet sich von sich aus an die Arbeitsassistenz. Fünf der sieben Vorgesetzten geben an, dass sie von sich aus weder auf die Idee gekommen wären, ArbeitnehmerInnen mit Behinderung gezielt zu suchen und einzustellen, noch sich an die Hamburger Arbeitsassistenz oder einen vergleichbaren Dienst gewandt hätten. Dieser Sachverhalt zeigt deutlich die zentrale Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz bei der Initiierung von unterstützten Beschäftigungsverhältnissen.
Was die gegenwärtige Situation angeht, so verfügen die unterstützten ArbeitnehmerInnen in fünf Unternehmen bereits über feste Arbeitsverträge, in einem weiteren besteht ein Vertrag mit Probezeit und in einem Unternehmen befindet sich der unterstützte Mitarbeiter nach dem Abbruch seines Arbeitsverhältnisses in einem anderen Betrieb im Integrationspraktikum; die beiden letztgenannten haben jedoch Aussichten auf eine Übernahme in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis.
Insgesamt erfolgt der Einstieg in die unterstützte Beschäftigung durch eine ausführliche Einarbeitungs- und Probephase. Dieser Zeitraum wird von allen Vorgesetzten als eminent wichtig bewertet, da nur so eine ausreichende Einschätzung der Leistungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen mit Behinderung möglich ist. Die Befragten messen dieser Anfangsphase auch deshalb eine große Bedeutung bei, da es für die meisten von ihnen (fünf von sieben) der erste engere Kontakt zu Menschen mit Behinderungen ist, sie daher kaum Erfahrungen haben, auf die sie zurückgreifen können. So ist es eine völlig neue Erfahrung für Chef E, wie ungewöhnlich herzlich sich seine Mitarbeiterin ihm gegenüber verhält - was ihn zunächst irritiert, später jedoch freut. Anfänglich bestehende Hemmnisse und Barrieren im Verhalten gegenüber und im Umgang mit Menschen mit Behinderungen lösen sich weitgehend in der praktischen Erfahrung auf. Chef B äußert, er könne mit seinem unterstützten Mitarbeiter ebenso umgehen wie mit allen anderen MitarbeiterInnen seines Betriebes auch - hier wird nach anfänglicher Unklarheit die Entdeckung von Gemeinsamkeit und Gleichheit deutlich, die jedoch später wieder in Unsicherheiten gerät.
Von den sieben Vorgesetzten sind sechs mit der Arbeit ihrer unterstützten ArbeitnehmerInnen sehr zufrieden, sehen jedoch den aktuellen Stand als noch ausbaufähig an und trauen ihre MitarbeiterInnen zu, dass sie im Hinblick auf ihre Tätigkeit lern- und entwicklungsfähig sind. Auftretende Probleme bezeichnen diese Befragten als eher gering und lösbar. Lediglich ein Vorgesetzter (Chef B) ist mit der Leistung seines Mitarbeiters nicht zufrieden, vor allem Motivationsprobleme des unterstützten Arbeitnehmers und seine dementsprechend schwankende Arbeitshaltung bilden für ihn ein Problem. Von daher ist zu diesem Zeitpunkt unsicher, ob er nach Ablauf der Probezeit einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen wird. Auch in der Identifikation mit den Eltern bemüht sich Chef B, gleichwohl ist er ebenso wie die ArbeitsassistentInnen vor Ort unsicher, wie weit sich sein Mitarbeiter in Haltung und Leistung wird stabilisieren können, so dass er dessen Arbeitsplatz auch längerfristig sichern kann.
Ganz überwiegend werden die MitarbeiterInnen jedoch als stark motiviert beschrieben, sie haben Spaß und auch den nötigen Ehrgeiz an ihrem Arbeitsplatz in hohem Maße entwickelt - bis dahin, dass Chef E berichtet, seine Mitarbeiterin brauche im Unterschied zu manchen anderen MitarbeiterInnen einen Arbeitsauftrag, der sie voll fordere. Fünf Vorgesetzte betonen darüber hinaus auch die Zuverlässigkeit ihrer MitarbeiterInnen: Sie gehen gewissenhaft und sehr genau ihren Tätigkeiten nach. Aus dem Kollegenkreis werden keine besonderen Probleme berichtet, die explizit auf die Behinderung der ArbeitnehmerInnen zurückzuführen wären - Unsicherheiten bestehen hier lediglich bei Chef B. Von den Vorgesetzten werden die üblichen menschlichen Prozesse von Zu- und Abneigung beschrieben, wie sie in jeder Gruppierung auftreten.
Einige Vorgesetzte heben eine positive Entwicklung hin zu mehr Sensibilität und Rücksichtnahme innerhalb der Belegschaft hervor - dies kann als Zeichen für eine Verbesserung des Betriebsklimas genommen werden. Entstehen aufgrund der Tätigkeiten der unterstützten ArbeitnehmerInnen Kontakte zu KundInnen, so bemerken die Vorgesetzten hierbei keine ablehnenden Haltungen. Im Gegenteil berichtet Chef E, es hätten sich im Zuge der Beschäftigung seiner unterstützten Mitarbeiterin vermehrt Kontakte entwickelt, ein Abbau von Distanz zwischen Bediensteten und KundInnen sei festzustellen, und zudem sei der Umsatz an ihrem Kiosk stabil.
Die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz wird nicht nur auf die Initiierung der unterstützen Beschäftigungsverhältnisse beschränkt gesehen, sondern erstreckt sich entsprechend dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung auch auf die Einarbeitung und Begleitung der unterstützten ArbeitnehmerInnen im Betrieb.
Alle sieben Vorgesetzten bewerten die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz als sehr professionell. Alle beschreiben die Begleitung der ArbeitnehmerInnen mit Behinderung vor Ort im Betrieb durch ArbeitsassistentInnen als unentbehrlich, da eine solche Begleitung durch die Vorgesetzten oder andere MitarbeiterInnen weder zeitlich noch fachlich zu leisten wäre.
Als Aufgaben der Hamburger Arbeitsassistenz im allgemeinen und der ArbeitsassistentInnen im besonderen werden genannt: die Vorbereitung der Zusammenarbeit durch eine Arbeitsplatzanalyse und die Auswahl eines geeigneten Arbeitnehmers sowie bürokratische Hilfestellungen. Zudem sind insbesondere die ArbeitsassistentInnen im Betrieb notwendige BegleiterInnen, die die ArbeitnehmerInnen mit Behinderung, ihre Fähigkeiten und Verhaltensweisen genau kennen, um so in Kooperation mit den Vorgesetzten und KollegInnen Tätigkeitsbereiche und Arbeitsfelder zu definieren, den ArbeitnehmerInnen jeweils eigene, begrenzt selbstverantwortete Arbeitsbereiche zuzuweisen und sie mit ihnen gemeinsam zu realisieren. Alle befragten Vorgesetzten erfahren die ArbeitsassistentInnen als kompetente und engagierte Hilfestellung, die wichtige und den Arbeitsablauf verbessernde Impulse geben. Insgesamt ist man mit der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz sehr zufrieden - was kein überraschendes Ergebnis ist angesichts der Auswahlkriterien für die GesprächspartnerInnen.
Finanzielle Aspekte spielen bei der Begründung der unterstützten Beschäftigungsverhältnisse für alle Befragten eine zentrale Rolle. Sie mindern das Risiko der Anstellung von ArbeitnehmerInnen mit Behinderung vor allem in der Anfangszeit erheblich. Alle Vorgesetzten sehen als elementare Voraussetzung, dass sich die unterstützten Arbeitsverhältnisse wirtschaftlich rechnen sollen. Etwaige Minderleistungen müssen dabei durch Zuschüsse ausgeglichen oder durch Umstrukturierungen und die Arbeit der ArbeitsassistentInnen kompensiert werden. Drei Unternehmen heben deutlich hervor, dass mit der Einstellung eines unterstützten Arbeitnehmers auch der Wegfall oder bei größeren Unternehmen zumindest eine spürbare Senkung der zu leistenden Ausgleichsabgabe verbunden ist. Einige Vorgesetzte können aufgrund der Unternehmensstruktur (Einbindung in einen Konzern) diesbezüglich keine Aussagen treffen.
Als nachteilig wird die Tatsache bewertet, dass die Lohnkostenzuschüsse und Eingliederungshilfen zeitlich befristet sind, so dass sich nach Ablauf der Bezuschussung zwangsläufig die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der unterstützten Beschäftigungsverhältnisse stellt, auch wenn alle Arbeitgeber zum jetzigen Zeitpunkt ihre Absicht betonen, die Arbeitsplätze langfristig sichern zu wollen. Ähnlich wie auch Chefin A findet es Chefin F darüber hinaus unverständlich, weshalb MitarbeiterInnen in Werkstätten für Behinderte eine lebenslange Förderung ihres Beschäftigungsverhältnisses erfahren, die für unterstützte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jedoch auf maximal drei Jahre beschränkt wird.
Gesetzliche Aspekte für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, vor allem der besondere Kündigungsschutz sowie das Anrecht auf bezahlten Mehrurlaub, werden von allen Befragten wahrgenommen, jedoch stellen sie kein Hemmnis bei der Begründung eines unterstützten Beschäftigungsverhältnisses dar. Dies widerspricht den in Kap. 6.1 benannten Vorbehalten gegenüber der Einstellung behinderter ArbeitnehmerInnen sehr deutlich. Gleichwohl hat Chefin F auch problematische Erfahrungen bei der Auflösung eines unterstützten Beschäftigungsverhältnisses gemacht; durch die Hilfestellung der Hamburger Arbeitsassistenz kann in der Auseinandersetzung mit der Hauptfürsorgestelle jedoch vermittelt und sogar ein neues unterstütztes Beschäftigungsverhältnis geschlossen werden. Eine solche Negativerfahrung mit behinderten ArbeitnehmerInnen kann, so Chefin F, im Extremfall auch zur völligen Verweigerung eines Unternehmens im Blick auf die Einrichtung unterstützter Beschäftigungsverhältnisse führen. Hinsichtlich der Situation kleinerer Unternehmen können einige Vorgesetzte eine gewisse Skepsis gegenüber dem besonderen Kündigungsschutz nachvollziehen, da sie die Gefahr eines Verlustgeschäftes sehen, sollte die Zusammenarbeit nicht den gewünschten Erfolg bringen. Demgegenüber steht die von den Vorgesetzten B und F geäußerte Überzeugung, dass es sich dabei eher um Ausflüchte handelt und bei nachvollziehbaren Gründen einer Kündigung immer zugestimmt würde.
Hinsichtlich der gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen, zu der sie mit verschiedenen Aussagen zum Image-Schaden durch bzw. zur Werbewirksamkeit von Menschen mit Behinderungen konfrontiert werden, machen die Vorgesetzten eine Fülle unterschiedlicher Angaben, die jedoch weitgehend in die gleiche Richtung weisen.
Allen gemeinsam ist die ablehnende und empörte Reaktion auf die Aussage des Wirtschaftsverbandssprechers, die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer sei imageschädigend für ein Unternehmen. Die Reaktionen auf die Aussage fallen dabei zum Teil recht emotional aus, Schimpfwörter werden bemüht. Dies geschieht möglicherweise deshalb, weil die Befragten darin auch eine indirekte Infragestellung ihrer eigenen Personalentscheidung sehen. Die Vorgesetzten erfahren nach eigenen Angaben positive Reaktionen auf die Beschäftigung eines Arbeitnehmers mit Behinderung in ihrem Betrieb und fühlen sich dadurch in ihrer Entscheidung bestätigt.
Genauso unisono reagieren alle Befragten positiv auf die ihnen präsentierten Werbematerialien. Zwei Vorgesetzte halten eine Werbekampagne mit behinderten Arbeitnehmern auch für ihr Unternehmen für möglich. Ein Unternehmen hat bereits für die Integration von Menschen mit Behinderungen geworben, eins plant solche Aktivitäten.
Sechs der Befragten betonen, sie hielten es für überfällig, die Gesellschaft mit dem Thema Behinderung vermehrt zu konfrontieren. Es reiche jedoch nicht aus, ab und zu Plakataktionen zu starten; vielmehr gehe es um eine intensive Aufklärungsarbeit: Nicht Mitleid solle das Ziel solcher Aktionen sein, sondern die öffentliche Würdigung von ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen als Persönlichkeiten mit individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten. Alle Befragten stellen fest, dass sie durch die Beschäftigung von unterstützten MitarbeiterInnen für die gesellschaftliche Situation von Menschen mit Behinderungen sensibilisiert worden sind.
Bei den Motiven zur Einstellung von unterstützten MitarbeiterInnen tauchen bei allen Vorgesetzten - in unterschiedlicher Gewichtung - wirtschaftliche und soziale Aspekte auf.
Zunächst stellen die Vorgesetzten durchweg fest, das unterstützte Beschäftigungsverhältnis müsse sich rechnen. Unterstützte Beschäftigung als Zuschussgeschäft hat keine Chance. Insbesondere wird auf zwei Aspekte eingegangen: Zum einen spielt in kleineren Betrieben die Ausgleichsabgabe eine gewisse Rolle, zum anderen wird betont, es sei entscheidend wichtig, dass das Unternehmen einen echten Nutzen durch die Wahrnehmung realer Aufgaben durch die unterstützten MitarbeiterInnen habe. Es gehe nicht um zusätzliche Beschäftigung, sondern um Entlastung für andere KollegInnen von bestimmten Aufgaben, die nun von den unterstützten MitarbeiterInnen wahrgenommen werden. Zudem sei der wirtschaftliche Aspekt im Hinblick auf eine langfristige Absicherung des Arbeitsverhältnisses wichtig.
Soziale Motive werden ebenfalls von allen Vorgesetzten genannt. Da tauchen verschiedene Facetten auf, vom eher emotionalen ›großen Herz‹ über das Bedürfnis, Menschen eine Chance zu geben, über die festgestellte Notwendigkeit, sich als großes Unternehmen sozial zu engagieren - aber nicht nur ab und zu für Zwecke der Werbung - oder das Engagement für gesellschaftliche Integration bis zu einer ausgesprochen sozial-integrativen Unternehmensphilosophie insgesamt, sei es im Hinblick auf eine sich ergänzende Vielfaltsgemeinschaft oder auf eine multikulturelle Situation mit vielen Menschen mit Schwierigkeiten, bei der die konkrete Leistung mehr zählt als schulische Abschlüsse und formale Berechtigungen. Diese Unternehmensphilosophie ist teilweise gepaart mit scharfer Kritik an gesellschaftlicher Aussonderung und den ihr entspringenden Institutionen wie der Werkstatt für Behinderte. Dies geht auch bis dahin, dass Chefin A sich verbandspolitisch für die Umwandlung von Zivildienststellen in unterstützte Beschäftigungsverhältnisse einsetzt.
Bei mehreren Vorgesetzten werden darüber hinaus auch biographische Anteile der Motivation deutlich, seien es eigene Erfahrungen nach einem Unfall, zum Teil dann im Rollstuhl, die therapeutisch arbeitende Schwester als Vorbild und die Erfahrung von schönen ›Behindertenreisen‹ oder die - eher als marginal bewertete - Zugehörigkeit der eigenen Tochter zu einem integrativen Kindergarten.
In den Resümees werden die selbst gesetzten Schwerpunkte der Aussagen der Vorgesetzten, aber auch ihre Stellungnahmen zu den Satzanfängen zusammengefasst.
Charakteristisch ist bei den selbst gesetzten Schwerpunkten, dass alle Vorgesetzte wiederum die gleiche Kombination von Leistungsaspekt und Gesellschaftsaspekt ansprechen. Bei der Leistung werden Dinge genannt wie reelle Aufgaben für eine konkrete Person statt Mildtätigkeit, die Passung mit dem Team bzw. dem Betrieb ist entscheidend, es muss ökonomisch Sinn machen, Leistung entscheidet statt erworbener Abschlüsse. Diesen Leistungsaspekt kann man als grundlegenden Basisaspekt sehen, ohne den es nicht geht. Alle Vorgesetzten sprechen jedoch von sich aus auch den Gesellschaftsaspekt an und nennen Dinge wie die Auseinandersetzung mit Integration als Chance für persönliches Wachstum, eigene biographische Erfahrungen, das Dazulernen in der Kooperation mit einem Kollegen mit Behinderung, den Auftrag zum Einreißen von Barrieren (das Thema muss in die Wirtschaft integriert und nicht Hobbythek und Zivis überlassen werden), Integration weiter anschieben - auch unter dem Aspekt der disparitätischen Förderung bei Arbeitsassistenz und Werkstatt für Behinderte. In diesen Äußerungen wird ein hohes Maß von gesellschaftlichem Engagement deutlich.
Ebenso wird dieses in den Ergänzungen der Satzanfänge deutlich. So wird bei den Belastungen durch berufliche Integration Konkretes genannt (Formalienaufwand, Einarbeitung, immer wieder von vorn beginnen u.ä.), aber auch Gesellschaftliches (erst mal das Neue und Fremde, geringe gesellschaftliche Akzeptanz) - und einige Vorgesetzte sehen nichts Belastendes. Stärker noch wird das gesellschaftsbezogene und soziale Denken bei der Frage nach bereichernden Momenten betont, die von allen bejaht werden: Hier kommen Aspekte auf der persönlichen Ebene (schönes Gefühl, Nachdenken über andere Menschen, Reflexion über Andere) und auf der gesellschaftlichen Ebene zur Sprache (mehr Selbstverständlichkeit, behinderte Menschen im Umfeld zu haben, Vielfalt menschlichen Lebens, Bewusstsein, dass nicht alle perfekt blond und blauäugig sind). Alle Vorgesetzten schließlich würden bei einem nächsten Mal wieder eine unterstützte Person einstellen, eine Vorgesetzte lieber zwei, einer würde sich selbst besser vorbereiten und zwei betonen zudem, sie würden nichts anders machen.
Abschließend können die wesentlichen Ergebnisse der Befragung von Vorgesetzten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes als Fazit zusammengefasst werden:
-
Die befragten Vorgesetzten äußern, dass die Betriebe auf offensive Akquisition von Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen durch entsprechende Fachdienste angewiesen sind. Kaum ein Betrieb wird von sich aus aktiv und sucht nach MitarbeiterInnen mit Behinderungen.
-
In der Einarbeitungszeit brauchen die Betriebe konkrete Unterstützung durch ArbeitsassistentInnen, die eine Passung zwischen den Möglichkeiten des Betriebes und den Fähigkeiten der unterstützten Person herbeizuführen helfen und dazu auch Veränderungen betrieblicher Abläufe anregen.
-
Bei ihren unterstützten MitarbeiterInnen nehmen sie vor allem deren hohe Motivation, Identifikation mit dem Arbeitsplatz und ihre Zuverlässigkeit als sehr positiv wahr.
-
Bei der Mitarbeiterschaft insgesamt sehen die befragten Vorgesetzten keine spezifischen Abgrenzungstendenzen, einige beobachten vielmehr bei ihren MitarbeiterInnen und sich selbst verstärkte Reflexion und Rücksichtnahme und konstatieren somit eine Verbesserung des Betriebsklimas.
-
Grundlage für die berufliche Integration in den Betrieben ist, dass sie sich rechnet - und das tut sie weitgehend, zunächst durch die zeitlich befristeten Zuschüsse, teilweise auch durch den Wegfall oder die Reduzierung der Ausgleichsabgabe. Kritisch und als befremdlich nehmen sie den Unterschied in der Subventionierungsdauer bei Arbeitsassistenz und Werkstatt für Behinderte wahr.
-
Verbesserter Kündigungsschutz und Mehrurlaub spielen für die Befragten im Gegensatz zur öffentlichen Meinung keine große Rolle. Bevor eine Firma Schaden erleidet, wird sie im Einvernehmen mit der Hauptfürsorgestelle einem Mitarbeiter mit Behinderung kündigen können.
-
Berufliche Integration durch unterstützte Beschäftigungsverhältnisse hat für die Befragten auch einen deutlich gesellschaftlichen Aspekt. Die Einstellung von Menschen mit Behinderungen verbinden sie nicht mit einem drohenden Imageverlust der Firma, vielmehr können sie sich gut vorstellen, offensiv in die Öffentlichkeit zu gehen - oder sie tun es bereits. Zur Verbesserung der gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Behinderungen wollen sie beitragen, indem sie ihnen durch Arbeit in ihrem Betrieb gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und zugleich für KollegInnen und KundInnen Begegnungen und Beziehungen mit den unterstützten MitarbeiterInnen initiieren. So wird gleichzeitig gesellschaftliches Bewusstsein und gesellschaftliche Realität verändert.
-
Die Motivation zur beruflichen Integration in ihren Betrieben wird denn auch durch zwei Facetten bestimmt: den Leistungs- und den Gesellschaftsaspekt. Beide werden je nach Situation der Firma unterschiedlich gewichtet. Auch werden biographische Anteile thematisiert.
-
Mit ihren Aussagen widerlegen die Vorgesetzten die in Literatur und Öffentlichkeit vertretenen Hindernisse, Schwierigkeiten und Probleme, mit denen Unterstützte Beschäftigung für dysfunktional, exotisch und unrealistisch erklärt wird. Vielmehr bestätigen sie die in der Fachliteratur vertretenen Argumente für die Realisierung unterstützter Beschäftigung auf ganzer Linie - und das für einen Personenkreis, dem deutliche kognitive Einschränkungen, d.h. Lern- und geistige Behinderungen zugeschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
Mit den BerufsberaterInnen für den Rehabilitationsbereich wird die Gruppe in die Evaluation einbezogen, die als MitarbeiterInnen des Arbeitsamtes die zuweisende und finanzierende Stelle für das Ambulante Arbeitstraining sind. Ihnen kommt insofern eine Schlüsselstellung zu, als sie über die Personen entscheiden, die in das Ambulante Arbeitstraining aufgenommen werden können, und darüber, welche Personen nicht dorthin kommen, sondern in das Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte oder andere Rehabilitationsmaßnahmen eintreten.
Insgesamt zählen zu den Aufgaben der Berufsberatung des Arbeitsamtes die Berufsorientierung, die Unterstützung bei der Berufswahl, die Vermittlung in Ausbildungsstellen und die Förderung der beruflichen Erstausbildung und der beruflichen Rehabilitation (vgl. BA 1997, 93). Dabei betreffen die Berufsorientierung und die berufliche Beratung Jugendliche und Erwachsene, die entweder vor Eintritt in Ausbildung und Beruf oder während ihres Berufslebens mit Berufswahlentscheidungen konfrontiert sind. Personell gliedert sich die Berufsberatung in:
-
BerufsberaterInnen für SchulabgängerInnen der Sekundarstufe I an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,
-
BerufsberaterInnen für Behinderte (I), die für die Berufsberatung, Berufswahl und berufliche Ersteingliederung behinderter SchulabgängerInnen aus dem Sekundarbereich I (Sonder- und allgemeinen Schulen) zuständig sind,
-
BerufsberaterInnen für AbiturientInnen und HochschülerInnen, die zum Teil auch solche mit Behinderungen betreuen (BerufsberaterInnen für Behinderte II) (vgl. ebd.).
Die Berufsberatung stellt folgende Angebote und Leistungen zur Verfügung:
-
Berufsorientierung umfasst Schulbesprechungen, Medien- und Seminarangebote, individuelle Betriebskontakte und Berufserkundungen, Eltern- und Vortragsveranstaltungen (vgl. hierzu BA 1997).
-
Individuelle Beratung und Vermittlung schließt eine umfassende persönliche Beratung der Ratsuchenden nach Vereinbarung und die Ausbildungsvermittlung ein. Hierzu finden Sprechstunden in der Schule und im Arbeitsamt statt (vgl. ebd.).
Die Reha-Berufsberatung des Arbeitsamtes ist für Behinderte, Gleichgestellte und Benachteiligte zuständig (vgl. die juristische Definition in Kap. 1.1). Für diesen genannten Personenkreis bietet die Berufsberatung in der Zuständigkeit der BerufsberaterInnen für Behinderte (I) neben den bereits erwähnten Leistungen und Angeboten der Berufsberatung zusätzlich berufsfördernde Maßnahmen an. Dieses umfasst Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB), ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), die Förderung der Berufsausbildung (im dualen System) im Rahmen der beruflichen Rehabilitation, Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrichtungen (BüE) und gewährleistet eine nachgehende Betreuung (vgl. Kap. 1.1.1 sowie BA 1997).
Am Beratungsverfahren werden ergänzend drei Fachdienstabteilungen des Arbeitsamtes beteiligt, sofern gutachterlicher Bedarf besteht: der technische, der medizinische und der psychologische Fachdienst. Sie tragen zur Klärung bei, ob die Person zur entsprechenden Gruppe gehört, wozu sie fähig ist und welche Notwendigkeiten der Unterstützung bei ihr bestehen (vgl. BA 1997). Zwar sind die Untersuchungen beim medizinischen und psychologischen Dienst freiwillig, sie bilden jedoch die Voraussetzung für die Zuweisung zu berufsfördernden Maßnahmen (vgl. BA 1997, 47 und 293).
Um diesen Personenkreis unterstützen zu können, muss also zunächst vom medizinischen und psychologischen Dienst die Zugehörigkeit der einzelnen Personen zu ihm festgestellt werden. Hier stellt sich die Frage nach dem Behinderungsbegriff, dessen ambivalenter Doppelcharakter, Menschen einerseits zu stigmatisieren und somit zu benachteiligen und sie andererseits zu bevorteilen (vgl. BLEIDICK 1999, 84), bei amtlichen Verfahren der Diagnostik deutlich wird. Gerade dort orientiert man sich nach wie vor stark am personorientierten Modell von Behinderung, das sie vor allem in der Orientierung an Defiziten als persönliche, medizinisch und/oder psychologisch begründete Kategorie versteht und soziale, gesellschaftliche und ökologische Aspekte weitgehend ausblendet (vgl. SANDER 1999).
Dementsprechend erfolgt auch die Berufsberatung für junge Menschen mit Behinderung in einem Zusammenhang, der unter einem zentralen Dilemma steht: Die Berufsberatung hat einerseits den institutionellen Auftrag, Personen mit besonderem Bedarf entsprechend vorhandenen unterschiedlichen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation zuzuweisen. Dazu bedarf es auch hier bestimmter Kategorien und Kriterien, nach denen entschieden werden kann, welche Maßnahme für die betreffende Person die richtige und angemessene ist.
Andererseits hat Beratung gemäß den ›Maximen einer Beratungstheorie‹ (vgl. ALTERHOFF 1994, 19ff.) den Auftrag, den Ratsuchenden auf der Basis der Freiwilligkeit und auf der Grundlage einer Vertrauensbeziehung orientierende und lediglich Entscheidungen vorbereitende Hinweise zu geben (vgl. MÜNDER 1991, 13) und gemeinsam Möglichkeiten zu überlegen, so dass die Ratsuchenden ohne ein massives Machtgefälle zwischen BeraterInnen und ihnen bei offen bleibendem Beratungsziel und Handlungsspielraum entscheiden können, wie ihr Weg weitergehen soll (vgl. ALTERHOFF 1994, 19). Berufsberatung - die aufgrund institutioneller Vorgaben keine Chance hat, den Maximen des Beratungsauftrags gerecht zu werden - steht im Bereich der Rehabilitation unter der Notwendigkeit, individuell für jeweils einzelne Personen abzuwägen, was für sie sinnvolle Schritte sein könnten. Dies kann nicht ohne die maßgebliche Einbeziehung von deren persönlichen Interessen und Neigungen - und denen ihres Umfeldes, in erster Linie denen der Eltern - erfolgen.
Mit diesem unauflösbaren Dilemma, einerseits institutionsbezogen und kategorial und andererseits individuumsbezogen und nonkategorial denken und handeln zu müssen, müssen die einzelnen BerufsberaterInnen umgehen und ihre jeweiligen Gewichtungen finden - und dies dürfte in individuell unterschiedlicher Art und Weise geschehen.
Diese Befragung bewegt sich also in einem komplexen und schwierigen Terrain. Hinzu kommt, dass die Berufsberatung für junge Leute mit Behinderung zumindest in einer Phase Anfang der 90er Jahre, als die Elternbewegung für Integration sich neu mit der Fortsetzung schulischer Integration im Bereich der Arbeitswelt auseinanderzusetzen hatte, Gegenstand höchst kontroverser Betrachtungen und Meinungen war. Die Schärfe der damaligen Auseinandersetzungen wird anhand einer Broschüre der LAG Eltern für Integration deutlich, die einen Text enthält mit dem Titel: »Was kommt nach der Schule?« In diesem Text, der vom Anfang der 90er Jahre stammt und wegen seiner Kompromisslosigkeit auch innerhalb der Elternbewegung Gegenstand kontroverser Diskussionen war, heißt es zur Rolle der Berufsberatung (SCHULTHEISS 1997, 101): »Viele Eltern ... klagen darüber, dass die Gespräche im Grunde auf eine Einstimmung auf die Werkstatt für Behinderte hinauslaufen. Suchten Jugendliche und ihre Eltern jedoch nach einer Perspektive außerhalb der Werkstatt, so blieben sie ohne qualifizierte berufliche Beratung. Als Eltern wurde ihnen dann erst einmal klarzumachen versucht, dass sie weder ihr Kind noch die Situation realistisch einschätzen könnten.« Weiter werden die diagnostischen Verfahren des psychologischen Dienstes, insbesondere die verwendeten Tests, scharf kritisiert: »Diese Tests sind noch weniger als die üblichen Schultests geeignet, die Fähigkeiten und Möglichkeiten eines behinderten Jugendlichen zu erfassen. Sie stellen lediglich eine Möglichkeit dar, die behinderten Schulabgänger in zwei Gruppen einzuteilen: Die ›Schlechten‹ in die WfB, die ›Guten‹ in die berufliche Rehabilitation« (ebd.). Als Konsequenz wird Eltern geraten:
-
»Gehen Sie zur Berufsberatung möglichst nur mit einem dritten Beteiligten, z.B. mit einem engagierten Lehrer/einer engagierten Lehrerin aus ihrer Schule.
-
Lehnen Sie den Test erst einmal ab und erarbeiten Sie gemeinsam alternative Möglichkeiten (s.a. nächsten Abschnitt).
-
Falls der Test unumgänglich sein sollte und ungerechterweise schlecht ausfällt, so ist er anfechtbar.
-
Bestehen Sie auf Offenlegung des Tests.
-
Ist ein Gutachten nötig, kann in manchen Fällen statt des Arbeitsamtes auch das Gesundheitsamt angefragt werden» (SCHULTHEISS 1997, 101f.).
In der Wahrnehmung engagierter Integrationseltern wird die Berufsberatung in der Anfangszeit offenbar zu einer vor allem konfrontativen Etappe, auf der unterschiedliche Meinungen, Einstellungen und Orientierungen aufeinandertreffen, die schwer miteinander vereinbar sind - dies ist auch vor dem Hintergrund des beschriebenen Dilemmas nicht verwunderlich; jedoch mögen auch die Arbeitsroutinen des Arbeitsamtes als Neuland für Eltern einerseits und die ungewohnten und manchmal ungewohnt scharf vorgetragenen Wünsche der Integrationseltern - und nicht zuletzt die geringen Möglichkeiten, diesen Wünschen zu entsprechen - bei den BerufsberaterInnen andererseits zu dieser Phase der Konfrontation beigetragen haben.
Auch von anderen im Umfeld der Integrationsbewegung wird die Praxis der Berufsberatung kritisch betrachtet: So muss sich z.B. jemand, der nach einer Vermittlung begleitende Hilfen am Arbeitsplatz in Anspruch nehmen möchte, vom Versorgungsamt als »geistig behindert« einstufen lassen (vgl. BAG UB 1999, 88). Die Art der Behinderung wird somit bestimmend für die Möglichkeiten der Lebensgestaltung und des Hilfeangebots. Gegenüber dieser kategorialen Logik sollte die Berufsberatung vielmehr individuumsbezogen und behinderungsunspezifisch erfolgen. Sie sollte zudem ihre Informationen so anbieten, dass sie für die jeweiligen Adressaten verständlich sind (vgl. BAG UB 1999, 27), und es sollten diejenigen Hilfen und Informationen sein, die sie ganz individuell benötigen, um ihr Berufsfeld zu finden (vgl. ebd., 28). Diese Hilfen und Informationen sollten sich an den Fähigkeiten und Interessen, dem Selbstkonzept und der Lebensplanung einer Person orientieren. Die Berufsberatung kann hierbei auch diagnostische Untersuchungen einschließen, die Berufseignungsdiagnostik kann jedoch nur als eine Hilfestellung bei der Abklärung verschiedener Möglichkeiten fungieren und nicht dem Ratsuchenden als Zuweisungsinstrument seine eigene Entscheidung abnehmen. Überhaupt kann die Berufsberatung den Ratsuchenden nur zu eigenen Entscheidungen hinführen (vgl. ebd.).
Diese kritische Sichtweise wird auch auf das Rehabilitationssystem insgesamt bezogen, wenn etwa SCHÖNWIESE feststellt, bei der Rehabilitation stehe nicht der Dialog im Vordergrund, »sondern reflexorientiertes Diagnostizieren und Be-Handeln« (1995, 8). Er fordert deshalb ein Umdenken in diesem Bereich: »Die in der Pädagogik/in der Rehabilitation Tätigen können den betroffenen Personen ... nur begleitend zur Verfügung stehen, in Dialog treten und Gegenvorschläge machen. Dabei kann ein gemeinsamer Prozess entstehen, in dem aber nicht manipulativ für die betroffenen Personen entschieden wird« (ebd.).
In diesem kontroversen Feld findet die Befragung der Reha-BeraterInnen des Arbeitsamtes statt. Sie widmet sich mehreren Aspekten, die in diesem Zusammenhang von Belang sind (vgl. Interviewleitfaden im Anhang 11.7):
-
Sie beleuchtet die Kooperation mit vorhergehenden Institutionen sowie mit jenen, zu denen Ratsuchende zugewiesen werden. Speziell sind Unterschiede zwischen lange bestehenden und relativ neu hinzugekommenen Institutionen, also zwischen einerseits Sonderschulen und Rehabilitationsträgern wie Berufsbildungswerke und Werkstätten für Behinderte und andererseits integrativen Schulen und der Arbeitsassistenz von Interesse.
-
Weiter betrachtet sie den Beratungsprozess vor dem Hintergrund des bereits beschriebenen zentralen Dilemmas; zu diesem Aspekt gehört auch die Frage nach möglichen Zuweisungskriterien für die verschiedenen zur Verfügung stehenden Maßnahmen.
-
Zudem eruiert sie neben der Einschätzung des Ambulanten Arbeitstrainings durch die BeraterInnen deren Verständnis von beruflicher Integration, unterstützter Beschäftigung und ähnlichen grundlegenden Begriffen.
-
Da sich in den Interviews bestätigt, dass die psychologischen Fachgutachten einen zentralen Punkt im Gesamtprozess der Beratung ausmachen, recherchiert sie auch die Sichtweisen und Verfahren, die in der Erhebung der Daten für die psychologischen Fachgutachten eine Rolle spielen.
Für diese Fragestellung ist - wie schon bei der Intensivbefragung und bei den Vorgesetzten - das qualitative Interview am angemessensten. Die Form des qualitativ-teilstandardisierten Interviews ist unter anderem methodologischen Kriterien unterworfen wie Offenheit, Flexibilität hinsichtlich der Interviewsituation und Zurückhaltung des Interviewers, was zur Folge hat, dass die Befragten als Subjekte das Gespräch qualitativ und quantitativ bestimmen (vgl. LAMNEK 1989, 64). Dabei ist das problemzentrierte Interview, an dem sich die Befragung der Reha-BeraterInnen orientiert, nach einem freien Beginn durch eine zunehmende Strukturierung gekennzeichnet (ebd., 75f.). Am Schluss sollen die Befragten auf Stimuli des Interviewers reagieren. Die Datenerfassung kann im wesentlichen mit Kurzfragebogen, Leitfaden, Tonbandgerät (einschließlich Transkription) und Transkript erfolgen (vgl. ebd., 77).
Der Interviewleitfaden ist eine geeignete Grundlage für die Datenerhebung, denn er gibt dem Interviewer ein Menü von Aspekten an die Hand, lässt ihm aber die Möglichkeit, deren Reihenfolge situativ zu variieren (vgl. ebd., 47), so dass die Befragten nach offenen Impulse auch ihre eigenen Schwerpunkte einbringen können. Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang 11.7) folgt den in Kap. 7.1 dargestellten Vorüberlegungen.
Die inhaltsanalytische Auswertung der Interviews erfolgt nach den folgenden Bereichen:
-
Qualität der Kooperation (mit Schulen, mit der Arbeitsassistenz, mit Betrieben),
-
Beratungsprozess (Beratungssituation, Zuweisungskriterien zur Hamburger Arbeitsassistenz),
-
Einschätzung der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz (deren Rolle, Erfolg und Veränderungsbedarf) und grundlegende Orientierungen (vermutete Motivation von Arbeitgebern für berufliche Integration, Verständnis von beruflicher Integration, Motivation zur Tätigkeit als Reha-Berurfsberater)
Zum dritten Bereich werden die Befragten - ähnlich wie die Vorgesetzten in Kap. 6 - um die Komplettierung folgender Satzanfänge gebeten:
-
»Die Hamburger Arbeitsassistenz ist angemessen für Leute, die ... «
-
»Die Werkstatt für Behinderte ist für Menschen, die ... «
-
»Unterstütze Beschäftigung bedeutet ... «
-
»Beruflich integrierbar ist, wer ... «
Von den neun BerufsberaterInnen für Behinderte I im Arbeitsamt Hamburg werden acht befragt, nachdem ihnen telefonisch das Anliegen der Befragung nahegebracht und ihr Einverständnis eingeholt worden ist. Die Interviews finden alle im Arbeitsamt statt und werden mit Einverständnis der Befragten auf Kassettenrecorder aufgezeichnet. Die vollständig transkribierten Gespräche werden ausgewertet, zusammengefasst und den Befragten zur kommunikativen Validierung vorgelegt, so dass als gesichert gelten kann, dass die wiedergegebenen Aussagen auch den Auffassungen der Befragten entsprechen (vgl. LAMNEK 1988, 152f., FLICK 1995, 245f.).
Da es bei der Analyse der Texte nicht in erster Linie um biographische und einzelfallspezifische Aspekte der Befragten geht, sondern um die professionelle Tätigkeit einer Berufsgruppe von ExpertInnen, werden sie im folgenden - im Unterschied zu den Interviews der Intensivbefragung und der Vorgesetzten - nach inhaltlichen Kriterien und nicht nach Befragten strukturiert dargestellt. Die Sicherstellung der Anonymität der Befragten ist angesichts der kleinen Stichprobe nicht ganz unproblematisch, die Interviews werden daher bei den einzelnen inhaltlichen Aspekten im folgenden unter Ignorierung ihrer Geschlechtszugehörigkeit - was eigentlich kaum vertretbar ist - von A bis H in der zufälligen Reihenfolge des Stattfindens dargestellt. Es lässt sich jedoch pauschal aussagen, dass die Berufsberaterinnen einen individuelleren Zugang zu ihren Ratsuchenden zu haben scheinen als ihre männlichen Kollegen.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in einer zusammenfassenden Beschreibung der Aussagen. Wie schon in früheren Kapiteln werden wörtliche Zitate kursiv gekennzeichnet. Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse erfolgt mittels eines Zwischenfazits im Anschluss an die jeweiligen Themenbereiche. Die Ergebnisse des ergänzend durchgeführten Interviews mit dem Leiter und einem Mitarbeiter des psychologischen Fachdienstes wird im Anschluss an die inhaltlichen Gesichtspunkte aus den Gesprächen mit den BerufsberaterInnen in Kap. 7.4 dargestellt, in Kap. 7.5 werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.
Berater A verweist auf die gesetzliche Kooperationsvereinbarung mit den für die Reha-BerufsberaterInnen in Betracht kommenden Schulformen. Demnach arbeitet Berater A ebenso wie die KollegInnen eng mit den ihm zugeordneten Sonderschulen zusammen: »Der Berater sucht diese Schulen auf, um künftige Schulabgänger, deren Eltern und Lehrer über die beruflichen Bildungsmöglichkeiten und Eingliederungsmöglichkeiten zu informieren.« Nach mit den Klassen und/oder den Elterngruppen stattfinden Gesprächen »verabredet der Berater mit dem Klassenlehrer der Klassen, die zur Entlassung anstehen, Beratungstermine für die sogenannte Erstberatung, die in der Regel in den Klassenräumen unter Beteiligung des Klassenlehrers und des Sozialpädagogen und der Eltern stattfinden.« Mit den allgemeinen Schulen ist die Kooperation »etwas lockerer,« denn dort kommt zunächst »der normale Berufsberater zum Zuge« und gibt später dann die Zuständigkeit an die Reha-Berufsberatung weiter. Die Zusammenarbeit mit Integrationsschulen ist zum einen aus Kapazitätsgründen zeitlich schwerer zu realisieren, da es dort immer nur um wenige SchülerInnen mit Behinderungen geht und eine feste Zuordnung dazu führen könnte, »dass der Reha-Berater zusätzlich zu Veranstaltungen, Schulbesprechungen oder Elternabenden gebeten würde, was unsere begrenzten Kapazitäten übersteigen würde.« Zum anderen gibt es in der Kooperation mit ihnen häufiger Schwierigkeiten, »weil gerade diese kämpferischen Integrationsleute doch ein bisschen andere Vorstellungen davon haben als wir nach unserer Erfahrung hier.«
Zur Kooperation mit Schulen führt Berater B detaillierter aus: »In der Regel ist es so, dass ich mindestens ein Jahr vor der Entlassung mit den Klassen Kontakt aufnehme, im Normalfall eine ... Infoveranstaltung mache zum Thema Berufswahl, bzw. was gibt es da an für Möglichkeiten nach der Schule, wo ich allgemeine Sachen anbiete und dann meistens entweder zeitnah oder unmittelbar im Anschluss dann in der Schule Einzelgespräche anbiete, meistens in Kooperation mit dem Lehrer, also das heißt der Lehrer ist dabei. Der kennt einfach die Jugendlichen natürlich viel, viel besser als wir. Und in der Regel ... laden die Schulen die Eltern dazu ein, die das eigentlich auch in großer Zahl in Anspruch nehmen. Meistens biete ich - nein, anbieten tue ich es immer, aber nicht jede Schule wünscht das - auch einen Elternabend an, um ... das gleiche mit den Eltern noch mal zu ermöglichen. ... Es setzt sich einfach immer mehr durch, dass auch Elternabende mit Schülern stattfinden.« Dabei stellt sich die Situation mit den Eltern insofern als recht komplex dar, als das Informationsgefälle sehr groß ist: »Das ist auch immer so ein Spagat, wenn man jetzt vielleicht mal vorinformierte Eltern hat, die sich schon schlau gemacht haben und andere wissen gar nichts. Das ist auch sehr anspruchsvoll, es ist echt schwer. Aber in der Regel merkt man, dass das sehr gerne angenommen wird und ... die Arbeit leichter macht. Wenn die Eltern schon mal eine grobe Idee haben, das ist gut. Und was ich immer wieder auf diesen Veranstaltungen merke, ist, dass vielen Eltern gar nicht bewusst ist, wie viel Förderungsmöglichkeiten es gibt. Also das heißt, wir kriegen ganz oft eben so ein: ›Ach, ich dachte, mein Kind kommt von der Schule, von der Förderschule, von der Schule für Geistigbehinderte - danach kommt doch sowieso nichts.‹ Insofern sind sie dann auch ermutigt, wenn man sagt, okay, dann schalten wir jetzt mal Fachdienste oder führen weitere Gespräche dann hier im Arbeitsamt.« Bei den Jugendlichen ist Berater B weniger die konkrete Information wichtig, sondern vor allem, »dass sie wissen, ach da war einer und der war ganz okay, da kann ich mal hingehen. Viel mehr bleibt meistens nicht hängen. Aber ich denke, wenn das der Fall ist, dann ist das auch schon eine ganze Menge.« Manchmal gibt es auch Kontroversen zwischen LehrerInnen und Berater B, denn »die Einschätzung von Lehrern ist nach unserem Gefühl - ich glaube, wir sind da doch etwas näher an der Arbeitswelt dran - ganz schön oft doch realitätsfern. Ja, und das führt zwangsläufig manchmal zu Konflikten. ... Das stimmt tatsächlich, dass es manchmal auch Berater gibt, die da nicht so scharf darauf sind, den Lehrer bei Gesprächen dabei zu haben - wobei das eben klar ist, das Dilemma: Der kennt den Schüler besser.«
Dennoch warnt Berater B vor pauschalen Aussagen und sieht es eher von den einzelnen LehrerInnen abhängig, wie qualifiziert und realistisch sie agieren: »Es gibt ganz tolle Lehrer, die wissen topp Bescheid. Die kümmern sich enorm. Dann gibt es echte Kämpfernaturen, die kämpfen, aber in die falsche Richtung. Also, wo man wirklich sagt, kann (man) das ... nicht erledigen, bevor wir den Leuten da einen falschen Floh ins Ohr setzen. Also das heißt meinetwegen, dass da Bildungsgänge rausgesucht werden, für die jemand nicht in Frage kommt oder die banalsten Dinge.«
Die größte Streuung von Verhaltensweisen sieht Berater B bei engagierten (Sozial-)PädagogInnen in Integrationsklassen: Einerseits gibt es »Sozialpädagogen in Integrations-klassen, (die) kommen dann zu uns und sagen: ›Ja, wir wissen ganz genau, was er machen will. Und ist schon alles geklärt. Sie müssen das nur noch hier unterschreiben.‹ Tut uns leid, aber geht leider gar nicht. Das ist dann, denke ich, für den Jugendlichen auch viel viel übler, weil er hat ja dann einen Weg gefunden. Und wenn ich ihm vorher schon sagen kann aufgrund meines Wissens, also es sind bestimmte Wege, die sind dir momentan leider verschlossen, ... dann ist das Beratungsergebnis ein anderes. ... Ja klar, das ist auch für uns ganz schön unbefriedigend, aber ich sage mal, ich weiß dann wenigstens, was ich mit ihm noch machen kann. Und da pfuscht mir dann unter Umständen wirklich häufig mal jemand dazwischen.« Andererseits gibt es auch sehr positive Beispiele, denn »I-Klassen haben den Vorteil, dass sie ja in der Regel eben einen Sozialpädagogen in der Klasse haben, der sich - im Gegensatz zu manchen anderen Lehrern - mehr aus dem Unterrichtsgeschehen rausziehen kann und eben auch Dinge erledigen kann. Und da habe ich eben beiderlei erlebt. ... Und ich habe auch wirklich sehr positive Aspekte, jetzt auch in Bezug so auf Hamburger Arbeitsassistenz, so Integration wird natürlich auch dann von den I-Schulen oft gerne gewünscht und weiter fortgesetzt.«
In Relation dazu ist »an den Schulen für Geistigbehinderte ... im Grunde genommen diese Perspektive Werkstatt für Behinderte ... für die auch an Struktur eigentlich klar vorgegeben und das kennen sie in der Regel durch Praktika. Und ja, es ist relativ selten, dass jetzt wirklich noch von ganz abgehobenen Sachen gesprochen wird, ... aber das ist die absolute Ausnahme. Also das ist sehr stark an der Realität orientiert, weil sie die auch eben so kennengelernt haben.« Anderseits scheint die Schattenseite dort neben der eingefahrenen Eingleisigkeit auch in einem geringen Zutrauen in sich selbst zu liegen, denn »sehr, sehr viele ... sagen auch, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht oder so.«
Für Berater C sind die etablierten Kooperationsstrukturen mit Sonderschulen »ein ziemlich guter Service, den wir bieten. Dass man so die Schwellenängste abbaut, indem man selber dort ist. ... Eltern und Schüler kennen hier in diesem schrecklichen Amt einen Menschen, können den benennen, und von daher hat sich das als wirklich spitzenmäßig ergeben.« Für SchülerInnen aus Integrationsklassen »finden ab und zu mal von Reha-Beratern, also dann von unserer Crew - auch mal werden Eltern zusammengefasst - Infoveranstaltungen (statt), entweder hier im Haus oder auch, dass man in die Schulen geht oder sich wo anders verabredet. Aber für diese Schulen sind wir nicht zuständig, weil das einfach auch eine Frage der Kapazität ist. Das können wir eben nicht leisten.«
In den Vorstellungen über berufliche Perspektiven gibt es »ganz eindeutig« Unterschiede zwischen Eltern aus Sonderschulen und Integrationsklassen: »Integrationseltern und -schüler sind in der Regel Elternhäuser aus der oberen Mittelschicht und höher und von daher sind das Eltern und Schüler, deren Ziele sehr, sehr hoch gesteckt sind, und meines Erachtens höher gesteckt sind als jetzt in anderen Schulen. ... Allein die Tatsache, dass Eltern sich entscheiden: ›Wir möchten unser Kind integrativ beschult wissen‹ - oder schon im Kindergarten fängt das ja schon an, heißt das im Rahmen dieser Gesellschaft, (dass) diese Eltern das Optimale wollen. Und da diese Eltern auch sehr durchsetzungsfähig sind und auch wissen, wo sie wen anbohren können, erreichen sie auch ziemlich viel, unter anderem eben auch durch Eigeninitiative. Also das Verhältnis ist nicht konfliktfrei. ... Die Vorstellungen, ... was wir jetzt so von seiten des Arbeitsamtes so nach dem SGB III machen können, sprengen da häufig den Rahmen. Und das ist dann eine Frage unserer Phantasie, inwieweit wir da irgendwas basteln können.« Bei der Kooperation mit LehrerInnen gibt es solche, »die von der Einschätzung ... eine hohe Akzeptanz hatten in Bezug auf das, was wir jetzt vielleicht vorschlagen, als auch Lehrer, die sehr massiv auch angekreidet haben überhaupt, was wir hier tun. Also, das ist beides.«
Berater D arbeitet nicht nur mit den Sonderschulen intensiv zusammen, sondern bietet für Integrationsklassen mit dem Institut für Lehrerfortbildung Termine für Eltern und LehrerInnen an, sich über Förderungsmöglichkeiten zu informieren. Es findet »keine getrennte Berufs-vorbereitung oder Berufsorientierung in den Klassen statt, ... weil das ja dann immer nur maximal vier betrifft, und das finden wir dann auch nicht gut, wenn wir die dann rausnehmen im Sinne: Das ist jetzt extra für euch. Das kann irgendwie nicht der Weg sein.«
Bezüglich der Realitätsnähe oder Realitätsferne beruflicher Vorstellungen bei Sonder- und IntegrationsschülerInnen sieht Berater D keine wesentlichen Unterschiede: »Ich würde keinen Trend nennen können. Also, es gibt Einzelfälle, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Doch die findet man da und da.« Entscheidend für Berater D ist vielmehr »das Alter und damit auch die verbundene Reife. ... Ich kann unmöglich jemanden nach dem neunten Schuljahr in eine unserer Maßnahmen stecken . ... Und wenn der fünfzehn ist, dann machen wir zwei Jahre maximal Förderung im F2 und dann soll er arbeiten - und das kann er nicht. Also das ist einfach klar, und aus dieser Erfahrung heraus muss ich auch sagen: So lang wie möglich versuchen, zur Schule zu gehen, nicht um da ›abzuparken‹, das meine ich nicht, sondern schon, ob berufsvorbereitende Schulen sinnvoller wären oder ob meinetwegen eine Geistigbehinderten-Schule weiter durchlaufen werden soll. ... Aber der Hintergrund ist einfach, wenn jemand 18 oder 19 ist, ein ganz anderer, und wenn man dann noch überlegt, dass viele ja auch in der ganzen Entwicklung einfach retardiert sind, dann ist das nur sinnvoll, länger zur Schule zu gehen.«
Bei den LehrerInnen sieht Berater D dagegen schon Unterschiede: Die aus dem Integrationsbereich »sind schon informierter, sie haben auch eine Planung. Wenn es dann nicht gehen kann, muss natürlich darüber gesprochen werden und das hat sich, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren reichlich verändert. Also, anfangs ... war das noch so: Jetzt muss aber, ansonsten machen wir Widerspruch. Und das ist also nicht mehr so. Das hat sich verändert, eigentlich mehr in Richtung Konstruktivität, ich sehe das ganz positiv. ... Nach dem, was jetzt alles auf dem Tisch liegt und ja auch nach meiner Meinung, die dann geäußert worden ist, gebe ich denen, ... was der (Schulabgänger) eigentlich will.« Tendenziell gibt es für Berater D einen Unterschied zum »Sonderschulbereich, da erlebe ich das eigentlich mehr so: ›Ach ja, der Berufsberater kommt und der empfiehlt ja dann was.‹« Dennoch sind die meisten LehrerInnen in beiden Bereichen »sehr interessiert daran, über die Arbeitswelt etwas zu erfahren.« Eher sind Altersunterschiede von Bedeutung: »Beginnern« in den Schulen steht Berater D mit Rat zur Seite und sieht sich als Ansprechpartner. Und wenn es mal Unstimmigkeiten zwischen Schule und Berufsberater gibt, dann ist das nicht ein »Gegeneinander-Arbeiten«, sondern »konstruktive Kritik. ... Es ist ein schönes Arbeiten, ich bin gern an meinen Schulen.«
Für Berater E ist die kontinuierliche Kooperation mit den Förderschulen (für Lernbehinderte) »durchaus gut«, denn »es ist ein eingelaufene Sache und man weiß gegenseitig, was man voneinander zu halten hat und wer wem was bieten kann.« Mit den Schulen, die Integrationsklassen führen, ist das sehr anders, denn »das sind verstreute Leute.« Zudem kommen die Eltern mit unterschiedlichen Haltungen auf die Reha-BeraterInnen zu: »Manche Eltern melden sich, kümmern sich rechtzeitig und sagen: ›Wir kommen zu Ihnen und möchten mit Ihnen das zusammen besprechen, dass wir das Beste und Richtige zusammen herausfinden‹ und gehen offen auf uns zu. Andere kommen notgedrungen hier her, weil sie was machen wollen, was vielleicht das Arbeitsamt bezahlen soll. Also muss man das Arbeitsamt dann ja leider mit einschalten und kommen mit allen Vorbehalten gegen uns hier her und da ist es häufig schwieriger.«
Berater E sieht zwischen den Berufswünschen von Sonder- und IntegrationsschülerInnen deutliche Unterschiede: »Integrationskinder« haben meist »unrealistische Ideen.« Das hat für Berater E auch damit zu tun, dass die LehrerInnen beim Betriebspraktikum froh sind, »wenn auch die Integrationskinder irgendwie irgendwo dann irgendwas auch machen, und prompt landen sie im Kindergarten, Mädchen jedenfalls sehr viele. Sie fühlen sich da dann auch wohl, weil die Kinder da nicht so viel von ihnen verlangen oder sie nicht anmachen. Und dann ist das ganz toll und sie wollen Erzieherin werden. Das kommt also immer wieder vor, ist aber völlig unsinnig und nützt ihnen auch nichts - also (eine) betriebliche Sache, irgendeine Planung, die da möglich wäre, ist es dann nicht.«
Berater F zufolge ist die Zusammenarbeit mit den Schulen »exzellent, ganz eng, ganz dicht, ganz nah, sehr gut. Also auch vom Einschaltungsgrad der Schulen, behaupte ich mal, 99 Prozent in diesen Schulen, weil wir in die Schulen hineingehen, im vorletzten Schuljahr oder zu Beginn des letzten Schuljahres und uns sozusagen als Begleiter anbieten. Wir machen dann Berufswahl-Unterricht. ... Und dann plant man halt die Gespräche, die wir auch überwiegend dann ... in den Schulen im Beisein der Lehrer und der Erziehungsberechtigten, wenn die Erziehungsberechtigten erlauben, dass die Lehrer dabei sind. Ich habe das noch nie erlebt, dass sie die nicht dabei haben wollten, aber man muss sie fragen. Und die Kids sitzen dann mit mindestens drei Erwachsenen da. ... Sie fühlen sich dann auch so ein bisschen im Mittelpunkt: Ich bin die Hauptperson, das sage ich auch immer.« Bei den »Integrationsleuten« ist oft das Problem, »dass sie ein wenig zu spät auf uns zukommen, weil wir haben da nicht so eine enge Bindung an die Schulen.« Hier gibt es ein Kapazitätsproblem - »die vielen Integrationsklassen, die über die ganze Stadt verteilt sind - wir müssten ja zwanzig Leute sein, um die zu betreuen. Ich würde das auch gerne tun und wir halten das auch für sinnvoll, dass da Präsenztage abgehalten werden, aber das können wir einfach nicht leisten. Da sind wir einfach zu wenig.«
Bei der Zusammenarbeit ist Berater G stark auf Informationen aus der Schule angewiesen. Aus Eltern- und Schulsicht wird in der Schule zusammen der »Ist-Stand« des Jugendlichen besprochen und gemeinsam überlegt, »was eigentlich sinnvoll, was angehbar, was machbar ist.« Fast alle SchülerInnen haben dann schon Praktika absolviert, bei den »eindeutigen Geistigbehinderten-Schülern« meist in der Werkstatt für Behinderte. Doch es gibt auch SchülerInnen, »wo man sagt, da können wir uns eigentlich vorstellen, dass da noch ein bisschen was drin ist, ... müssen wir auch bildungsmäßig noch mal gucken.« Im Unterschied zu den Sonderschulen stellt Berater G fest: »Eine Zusammenarbeit mit Integrationsschulen gibt es gar nicht, weil die Integrationsschüler ja verteilt sind im normalen, allgemeinbildenden Schulwesen. Und das ist auch schon die Schwierigkeit, sowohl für die Schule selber, sage ich jetzt mal, als auch für uns, weil wir in den Gesamtschulen ja nicht drin sind als Reha-Berater.« Berater G fällt jedoch auf, dass IntegrationsschülerInnen aufgrund des »familiären Hintergrundes ein höheres Bildungslevel« haben, »wo dann oft schon gegengesteuert wird oder zumindest schon versucht wird, realistisch zu diskutieren, was so machbar ist für das Kind.« Die Informiertheit über Berufsmöglichkeiten ist da auch höher und »was das Unrealistische angeht, ist es beides eigentlich ähnlich oder fast gleich.« Bei den LehrerInnen sieht Berater G hinsichtlich der Berufsvorstellungen zwei Extreme, und das unabhängig von Schultypen: Die einen sind »sehr oberflächlich auf Erfolg und schnelle Realisierung« aus und die anderen haben diese »weltfremde, berufsfremde, naive Haltung: Man kann alles.«
Für Berater H ist die Kooperation mit den LehrerInnen an Schulen für Geistigbehinderte ganz unterschiedlich. Da gibt es »ganz engagierte, mit denen das prima läuft, und es gibt auch so ein paar, die immer nur am Gängeln sind.« Oftmals ist es auch so, dass sich die Schulen »zu viel kümmern«, sie versuchen »viel Eigenideen einzubringen, die dann aber teilweise schon so veraltet sind und wo man dann als Spezialist immer sagen muss: ›Ja, das gab es vor drei Jahren mal, das gibt es jetzt aber nicht mehr.‹ Und wo die Eltern dann erst mal auf die falsche Bahn gesetzt werden.« So kommt es vor, dass SchülerInnen geraten wird, sich ohne Kontakt mit dem Arbeitsamt direkt bei der Werkstatt für Behinderte anzumelden. Durch solche Vorgehensweisen gibt es dann Zeitverluste, und Berater H empfindet von daher die Zusammenarbeit als »nicht so reibungslos.«
Im Sonderschulwesen allgemein stellt Berater H zunehmend Veränderungen fest, vor allem, »dass das Niveau gerade in den letzten Jahren stetig abgenommen hat. Das ist kein Problem der Schule, sondern das ist (so, dass) durch diese Integrationsmodelle und -versuche natürlich immer mehr Schüler auch an Regelschulen landen - und wer dann an den Sonderschulen aufgenommen wird, wird immer schwächer. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal eine Klasse, aus der fast alle in die Werkstatt gehen werden. Und da versuche ich natürlich auch zu differenzieren, ob da welche dabei sind, die eventuell auch für die Arbeitsassistenz in Frage kommen. ... Und das ist an allen Schulen so: An den Förderschulen treffe ich verstärkt auf Grenzfälle zu geistig Behinderten. Und an den Geistigbehinderten-Schulen sind jetzt welche, die wären früher überhaupt nicht zur Schule gegangen, sondern in Tagesförderstellen. Das macht uns zwar Probleme und Arbeit, aber eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, dass auch die Schwächeren in der Schule gefördert werden.«
Die fehlende Kooperation mit den Integrationsschulen sieht Berater H als ein Problem, da dies ja »dem Gedanken der Integration widerspricht. ... Also das falscheste wäre natürlich, wenn da zwei Berufsberater hingehen und sagen, ihr drei geht jetzt zu dem Berufsberater für Behinderte und ihr geht zu dem anderen.« Inzwischen sind die allgemeinen BerufsberaterInnen für die Integrationsklassen insgesamt zuständig und »die müssen dann schon gucken, gibt es da einen Rollstuhlfahrer oder ... sagt der Lehrer: ›Das ist ein Integrationsschüler‹. Und dann werden wir eingeschaltet und dann versuchen wir natürlich den Kontakt genauso herzustellen, ohne dass eine große Trennung stattfindet.«
Zwischen SchülerInnen aus Sonder- und Integrationsschulen besteht zunächst »der große Unterschied« in der langfristigen Orientierung. Auf dem Integrationsweg befinden sich »in der Regel Schüler, Familien, wo die Eltern schon sehr aktiv waren und immer gesagt haben, mein Kind soll möglichst integrativ beschult werden. Die haben meist schon mit dem Kindergarten angefangen in dem Bereich und wollen natürlich, dass diese Kette jetzt nicht abreißt.« Doch auch bezüglich der Berufsvorstellungen gibt es zwischen den jungen Leuten »erhebliche Unterschiede.« Für viele Jugendliche aus der Schule für Geistigbehinderte »ist das völlig klar«, dass sie in die Werkstatt für Behinderte gehen, denn »die Schule geht geschlossen« da hin. Zudem haben sie dort beim Praktikum frühere MitschülerInnen getroffen »und das finden die toll. ... Und wenn ich dann sage: ›Mensch, aber die Lehrerin hat doch gesagt, du kannst so viel, du kannst sogar rechnen und schreiben und so weiter, hättest du vielleicht Lust, da mehr draus zu machen?‹ Da habe ich mir schon öfter Absagen eingehandelt. Die mögen das gar nicht.« Auf der anderen Seite »gibt es halt welche, die genauso unrealistische und überdrehte Vorstellungen haben und meinen, sie können alles Mögliche und können sich nicht selbstkritisch einschätzen. Und dann die Leute, die ganz realistische Vorstellungen haben und sagen: ›Ich weiß was ich kann und was ich nicht kann. - Können wir nicht gemeinsam versuchen, da was zu machen?‹« Ein weiterer Unterschied ist der, dass IntegrationsschülerInnen in der Regel mit ihren Eltern und SozialpädagogInnen zur Beratung kommen, und »bei den Sozialpädagogen ist es schon so - weil das sind natürlich auch Leute, die haben sich diesen Job ausgesucht und die sind natürlich auch auf dieser Integrationsschiene. Und da gibt es natürlich schon manchmal Reibereien, weil die auch dem Arbeitsamt gegenüber oft nicht so positiv eingestellt sind, weil sie uns immer noch in diese alte Kiste packen und uns vorhalten, wir kennen immer nur diese eingefahrenen Wege und dieses ist Neuland und da kommen wir nicht mit. - Gut, meistens kommt man zueinander, aber (sie) merken schnell: ›Aha, das ist einer, mit dem kann man reden.‹ Aber es gibt natürlich auch Kollegen bei uns, die dem nicht so aufgeschlossen gegenüber stehen und da haben sie es sicherlich schwer.«
Zwischenfazit zur Kooperation mit Schulen
Zur Organisation kann zusammenfassend gesagt werden, dass die BerufsberaterInnen für Behinderte eine langfristige, zeitintensive, kontinuierliche und elaborierte Kooperation mit klarer Struktur mit den Sonderschulen praktizieren: Etwa zwei Jahre vor Schulschluss informieren sie die SchülerInnen über Fördermöglichkeiten, beginnen mit Berufswahl-Unterricht, führen mehrfach Einzelgespräche, meist gemeinsam mit Jugendlichen, Eltern und LehrerInnen und gestalten so den zweijährigen, mitunter schwierigen Prozess, den individuellen weiteren Weg für die Jugendlichen zu finden. Dabei ist jeder Berufsberater für bestimmte Sonderschulen zuständig. Gesamtschulen mit Integrationsklassen fallen hingegen in den Aufgabenbereich der allgemeinen Berufsberatung, die IntegrationsschülerInnen über die Berufsberatung für Behinderte im Arbeitsamt informiert und die dortigen Reha-Berater über diese SchülerInnen unterrichtet.
Die Berufsberatung im Rehabilitationsbereich kooperiert also innerhalb von festgelegten Strukturen nur mit den Sonderschulen. Die Zusammenarbeit mit Integrationsschulen hat demgegenüber keine so hohe Dichte und fordert von Schulen und Eltern ein Stück mehr Eigeninitiative. Erschwert wird sie quantitativ durch Kapazitätsprobleme bei der Berufsberatung im Rehabilitationsbereich und teilweise auch qualitativ durch grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen bezüglich beruflicher Möglichkeiten bei Jugendlichen mit Behinderung.
Dabei lassen sich jedoch unterschiedliche Tendenzen bezüglich der Einschätzungen der Kooperation feststellen, worin auch eine eher kritische oder eher wohlwollende Haltung gegenüber Integrationsschulen zum Ausdruck kommt:
-
Die Kooperation mit Sonderschulen gestaltet sich intensiv und konsensual, die mit Integrationsschulen hingegen eher schwierig und kontrovers. Dort kommen deutlich mehr unrealistische Berufsperspektiven vor und eher misstrauische Eltern und ideologisch engagierte PädagogInnen (A, E).
-
Die Kooperation mit beiden Schulformen gestaltet sich jeweils unterschiedlich, abhängig von der Schulkultur und/oder den jeweiligen Personen. In beiden Systemen gibt es Beispiele von größerem oder geringerem Realismus, aber auch informierte und engagierte KooperationspartnerInnen (B, C, F, G).
-
Während in Sonderschulen eher verfestigte Wege, vor allem in Richtung auf die Werkstatt für Behinderte, zu finden sind, wird in der Zusammenarbeit mit Integrationsschulen die Konsensbildung im Vordergrund gesehen; hier gibt es auch einen tendenziell besseren Informationsstand und ein größeres Engagement bei den Beteiligten (D, H).
Für Berater A gibt es »keine besonders strukturierte Zusammenarbeit mit der Hamburger Arbeitsassistenz, sondern eine nach den Erfordernissen des Einzelfalles zwanglose, meist tele-fonische Verständigung über Möglichkeiten und Vorgehensweisen.«
Laut Berater B gibt es keine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Arbeitsassistenz, und »rein technisch (ist) auch die Arbeitsassistenz ein Arbeitstraining über eine Werkstatt. So wird es ja auch abgerechnet dann, und insofern ist dann auch der Berater der (Werkstatt) ... auch irgendwo der Ansprechpartner.« Neben einem Besuch, bei dem alle BerufsberaterInnen bei der Arbeitsassistenz waren, »um sich einfach mal gegenseitig kennenzulernen«, gibt es eher eine fallbezogen-pragmatische Kooperation: »Ansonsten steht ja immer mein Name, meine Telefonnummer und alles darauf, wenn wir jetzt als Eingliederungsvorschlag sagen, wir schlagen die Arbeitsassistenz vor. ... Dann ruft man da eben an. Und genauso rufen die eben auch bei uns an. ... Aber es gibt keinen festen Termin, was weiß ich, aller viertel Jahr treffen wir uns zur Besprechung oder so was.«
Auch Berater C ist eine Zusammenarbeit in dem Sinne, »dass regelmäßig einmal pro Jahr« eine Besprechung mit der HAA stattfindet, »nicht bekannt.« Die Leiter der Arbeitsassistenz »sind irgendwann hier gewesen zu einer Dienstbesprechung und haben ihre Projekte vorgestellt.« Ansonsten kooperiert Berater C fallbezogen mit ihnen, »da rufe ich dann initiativ an.« Allerdings könnte es auch sein, »dass Berater D hier unser Kontaktmann ist für die Arbeitsassistenz. Das ist mir im Moment so organisatorisch nicht ganz klar, das müsste man ihn dann noch mal fragen.«
Für Berater D ist »da ein Stück weit Kooperation« vorhanden, weil »die Hamburger Arbeitsassistenz bei uns beim Fachausschuss in den Werkstätten beteiligt ist.« Die einzelnen Fälle werden jedoch von den jeweils beratenden KollegInnen besprochen.
Nach Berater E gibt es eine punktuelle Zusammenarbeit zwischen der Hamburger Arbeitsassistenz und der Berufsberatung und »wir kennen auch einige von den Leuten der Hamburger Arbeitsassistenz.« Manchmal ruft auch jemand im Arbeitsamt an und sagt: »Da hat sich jemand bei uns gemeldet und möchte hierher, wir haben uns auch schon mal gesehen.« Doch es bleibt meistens beim konkreten Einzelfall.
Berater F hat »mit denen überhaupt keine Schwierigkeiten, keine Probleme, auch ganz gute Kontakte.« Berater F betreut keine »Geistigbehinderten-Schule« und hat »daher weniger Kontakt mit den Arbeitsassistenten.« Die Berufsberatung sieht Berater F bezüglich der Arbeitsassistenz als »Multiplikator«, der dafür zu sorgen hat, sie »in den Schulen publik« zu machen, denn die Hamburger Arbeitsassistenz »ist ein Bestandteil des Angebotes des Arbeitsamtes.«
Berater G hat »eigentlich sehr wenig Einblick in die tägliche Arbeitsweise dieser Arbeitsassistenz. Ich weiß nur, dass die Arbeitsstellen versuchen eng zu betreuen, ... denn in dem Moment, wo die (Ratsuchenden) hier angemeldet sind, aufgenommen sind ins Arbeitstraining, ob mit oder ohne Arbeitsassistenz, gebe ich die ab.«
Berater H meint, es gebe sicherlich einmal im Jahr ein Treffen mit der Arbeitsassistenz, wenngleich nicht so systematisch. Sonst gestaltet sich die Kooperation eher »einzelfallbezogen, und das finde ich auch nicht problematisch.« Wenn Arbeitsassistenz in Frage kommt, dann »wende ich mich an die, manchmal muss man auch gar nicht groß über den Fall reden. Dann mache einen kurzen Bericht und einen Eingliederungsvorschlag, und dann erfahren wir meist nach ein paar Monaten, der ist jetzt da und da.« Auf dieser Ebene ist »die Zusammenarbeit recht gut, und das läuft problemlos.« Bedauerlich findet Berater H jedoch die fehlende Beteiligung der Arbeitsassistenz an Sitzungen der Fachausschüsse in den Werkstätten: »Das ist uns auch noch nicht gelungen - ich weiß nicht, woran das hängt -, aber das wäre mir sehr lieb, zumindest wenn solche Fälle besprochen werden, dass dann Leute von der Arbeitsassistenz dabei wären. Ich finde, die gehören da rein.«
Zwischenfazit zur Kooperation mit der Arbeitsassistenz
Nach den vorstehenden Äußerungen kann festgestellt werden, dass die Befragten durchweg keine strukturell verankerte Zusammenarbeit mit der Hamburger Arbeitsassistenz haben. Hinsichtlich ihrer Sicht von Kooperation werden jedoch drei unterschiedliche Tendenzen deutlich:
-
Ein Berufsberater zeichnet ein Bild, nachdem er fast gar nicht mit der Hamburger Arbeitsassistenz kooperiert und auch äußerst wenig Kontakte mit diesem Integrationsfachdienst hat (G).
-
Die meisten Berufsberater kooperieren nach Bedarf, aus Eigeninitiative heraus, einzelfall-bezogen und unproblematisch mit der Hamburger Arbeitsassistenz (A, B, C, E, F, H).
-
Ein Berufsberater berichtet über keine regelmäßige, aber doch ein Stück weit kontinuierliche Kooperation, auch in einem Fachausschuss einer Werkstatt für Behinderte (D).
Berater A hat keine Kontakte mit Betrieben, die mit den Maßnahmen der Arbeitsassistenz zu tun haben. »Insofern ist mir persönlich kein einziger Arbeitsplatz bekannt, auf den ein Teilnehmer vorbereitet werden soll.« Ansonsten gibt es zwar »Einzelfälle, in denen Berater mit Betrieben Einzelmaßnahmen vereinbaren, aber ... bislang nicht für geistig Behinderte.«
Für Berater B gibt es »sehr sehr wenig« direkte Kontakte mit Betrieben. Interesse für Menschen mit Behinderungen besteht seitens der Betriebe selten - wenn, dann will man »am besten ein guten Abiturienten, der eben dummerweise im Rollstuhl sitzt.« Hier begegnen Berater B »etwas blauäugige Vorstellungen so über Behinderung auf seiten mancher Arbeitgeber.« Berater B steht im Kontakt mit einem großen Industriebetrieb, der ganz gezielt Gehörlose einstellt. Insgesamt ist es aber »ein schweres Geschäft und es findet in der Regel dann doch eher so über individuelle Sachen statt. Es kommt schon eher mal vor, dass jemand eben vielleicht auch als Integrationsschüler ein Praktikum irgendwo gemacht und die Firma gesagt hat: ›Unter Umständen könnten wir uns das vorstellen, ihn auszubilden.‹«
Berater C hat lediglich zu Ausbildungsbetrieben Kontakt, nämlich »wenn man versucht, jemanden unterzubringen.« Das betrifft speziell die »Förderschüler«, Grenzfälle, »wo wir denken, das müsste eigentlich hinhauen und dass man dann auch mal in die Betriebe geht.«
Berater D sieht Kontaktpflege mit Betrieben als selbstverständliche Aufgabe: »Ja klar. Das ist unser Job, Klinken putzen zu gehen.« Zum einen basiert die Kooperation auf Eigeninitiative des Berufsberaters, »dass wir uns mehr oder weniger selbst vorschreiben, wir machen zwei bis fünf Besuche im Monat: Einfach vorstellen, sagen, wer man ist ... und mal einen Tag nehmen, wo man einfach mal so durchgeht.« Andererseits »haben wir schon viele Praktikantenplätze bekommen.« Es gibt auch Arbeitgeber, »die rufen uns an und sagen: ›Ich habe hier jemanden und den finde ich ganz prima. Gibt es da Förderung für?‹« Und es kommt auch vor, »dass die einfach zusammen kommen, vielleicht schon einen Vertrag geschlossen haben und irgendwann fällt dann auf: ›Ach ja, der ist ja ein Behinderter. Da gibt es doch Geld.‹ Und auf einmal wird so getan, als ob das Ganze in Frage gestellt ist und nur zustande kommt, wenn das Arbeitsamt dann zahlt.«
Berater E persönlich hat wenig Kontakt zu Betrieben. Es gibt jedoch manchmal interessierte Arbeitgeber, die jemanden ausbilden wollen und »dann auch nach Ausbildungszuschuss fragen und so.« Berater E stellt fest, dass es durch die in den letzten Jahrzehnten vermehrten Fördermaßnahmen immer mehr Betriebe gibt, »die dann gar nicht mehr gewöhnlich ausbilden wollen, sondern nur, wenn sie Zuschüsse kriegen. Das ist eine unangenehme Nebenwirkung.«
Berater F geht aktiv in die Kooperation mit Betrieben: »Ich mache das immer in meinem Wohnbezirk, da nerve ich die immer.« Berater F geht gern akquirieren und will »was lostreten«, aber wenn, dann lieber in kleineren Betrieben, da »kriegt man schon mal den einen oder anderen Praktikantenplatz.« Dass sich Arbeitgeber im Arbeitsamt melden, wenn sie einen Menschen mit Behinderung einstellen möchten, »das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr erlebt, früher schon.« Meistens waren das selbst betroffene Betriebsinhaber. Dazu meint Berater F, »wenn ich das höre, dass er (Arbeitgeber) ein behindertes Kind hat, dann bin ich sofort auf der Schwelle. Dann weiß ich, da kann ich was lostreten.«
Kooperation mit Betrieben besteht bei Berater G, aber »nicht so ausgefeilt.« Es gibt zwar im Reha-Bereich Betriebe, »wo wir wissen, da können wir auch Jugendliche unterbringen, auch behinderte. Aber es ist nicht übermäßig viel, sage ich mal ganz selbstkritisch.«
Zur Kooperation mit Betrieben meint Berater H, dass »wir da ... froh« sind, »dass es die Arbeitsassistenz gibt, die uns diese Arbeit abnimmt«, denn es bleibt viel zu wenig Zeit zum Akquirieren. Bezogen auf Angebote seitens der Arbeitgeber, jemanden mit Behinderung einstellen zu wollen, »passiert das immer dann - ich sage das jetzt mal so zynisch - , wenn derjenige wieder mal mit seinem Steuerberater gesprochen hat und erfahren hat, dass es da irgendwie Zuschüsse gibt. Und dann kommen diese Anrufe: ›Ich hätte gerne einen Behinderten.‹ Wo ich dann sage: ›Das ist aber nett.‹ Und wenn wir dann nachfragen: ›Was darf es denn sein?‹ Dann soll es möglichst jemand sein, der auch hundert Prozent schwerbehindert ist, Abitur, leistungsfähig, nicht im Rollstuhl sitzt, keine Sinnesbehinderung hat, und das sind dann meistens so die Diabetiker oder so. Ja das ist dann manchmal ein bisschen bitter.« Es gibt aber auch »Anrufe von Leuten, die das wirklich jetzt aus sozialem Engagement heraus machen. Ich weiß, dass es vorkommt, dass die sagen: ›Ich hatte letztes Jahr ein Mädchen.‹ ... Und sagen: ›Das würde ich gerne noch mal machen.‹ Immer wenn die Erfahrungen gut waren, dann kriegen wir schon mal solche Anrufe.«
Zwischenfazit zur Kooperation mit Betrieben
Die Zusammenarbeit mit Betrieben gestaltet sich nach voranstehenden Aussagen sehr unter-schiedlich. Auch hier lassen sich drei Tendenzen unterscheiden:
-
Mit Betrieben gibt es so gut wie keine Zusammenarbeit (A).
-
Mit Betrieben gibt es wenig Kontakt, Akquisition kommt nur gelegentlich vor (B, C, E, G), deshalb wird die Existenz der Hamburger Arbeitsassistenz entlastend wahrgenommen (H).
-
Es gibt eine intensivere Kooperation mit Betrieben und regelmäßige Akquisition (D, F).
Wie Berater A berichtet, ist es »besonders als die ersten ›Integrationsschüler‹ zur Entlassung anstanden, ... zu Spannungen gekommen. Die Eltern verlangten Integration auch weiterhin, also auch in Maßnahmen des Arbeitsamtes, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz. Maßnahmen für Behinderte, die nach Meinung der Berater dem Leistungsvermögen angemessen waren, wurden nicht akzeptiert.« Dies bringt Berater A und die KollegInnen in Schwierigkeiten, denn »andere Maßnahmen hätten die Teilnehmer aber überfordert und hätten sie nach dem gegebenen Konzept nicht in der erforderlichen Weise fördern können. Ein Berater kann aber keine Maßnahme fördern, die nicht zweckmäßig erscheint oder deren Erfolg ausgeschlossen erscheint.« Die Konflikte drehten sich immer wieder um die Zuweisung in die Werkstatt für Behinderte durch die BeraterInnen, weil ihnen »das Erreichen eines Arbeitsplatzes auf dem ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen erschien im Hinblick auf Entwicklungsstand und Leistungsvermögen.« Dieser Einschätzung, die »nicht akzeptiert« wurde, wurden »sehr unrealistische Forderungen seitens der Eltern« entgegengesetzt. Sie wiederum ignorierten, »dass ein Berater nur im Rahmen seiner gegebenen Möglichkeiten handeln kann.« So fühlten sich die BeraterInnen mit diesen Vorstellungen von Integrationseltern überfordert, denn es ist nicht ihr Auftrag, »die förderungsrechtlichen Bestimmungen zu ändern oder die Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt.«
Lediglich in einem kleinen Rahmen wird ein berufsvorbereitender Lehrgang für ehemalige IntegrationsschülerInnen geöffnet: »Dort wurden in einen Lehrgang für nicht behinderte Schulabgänger einige Schüler aus Integrationsklassen ›integriert‹. Das erfolgte in sogenannten Einzelmaßnahmeverträgen als ›Förderlehrgang 2‹«. Dessen übliches Ziel der Arbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt »war für den damals anstehenden Personenkreis aber nicht erreichbar und hätte bei Beachtung der Vorschriften nicht bewilligt werden dürfen. Die Fachkräfte wurden aber schriftlich angewiesen, dies im Rahmen eines ›Modellversuches‹ zu tun.« Diese Maßnahme war allerdings nicht nur für Berater A problematisch, sondern auch »für die Integrationsverfechter war es zum Teil kaum akzeptabel, den dafür notwendigen ›Antrag auf berufliche Rehabilitation‹ zu stellen, weil der Förderlehrgang 2 ja eine Maßnahme für Behinderte ist, die nur im Rahmen des anderen Lehrganges durchgeführt wurde.«
Doch auch in der aktuellen Zeit ist es in der Beratungssituation »häufig so, dass Eltern mit Vorstellungen und Wünschen kommen, die dem Berater überzogen vorkommen. Das wird genährt durch meines Erachtens stark beschönigende - meist fehlt ein Teil der Wahrheit - Berichte von Integrationserfolgen, was meiner Kenntnis in Hamburg begann mit dem ›Stadthaus-Hotel‹. Wenn der Berater dann versucht, sich ein Bild von den Leistungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu machen, wird er insbesondere von manchen Eltern eher desinformiert als informiert, sei es, weil die Eltern es nicht anders sehen, oder weil sie einen Zweck verfolgen, den sie damit zu erreichen hoffen.«
Die sichersten Informationen geben Berater A »die Lehrer von Schulen für geistig Behinderte, aber auch von manchem Klassenlehrer der Integrationsklassen erhält man realistische Einschätzungen. Wenn der Berater Zweifel hat oder die Meinungen auseinander klaffen, kann eine psychologische Eignungsuntersuchung helfen.« Selbst diese Untersuchungsergebnisse werden jedoch »von manchen Eltern nicht anerkannt. Merkwürdigerweise werden die einzelnen Aussagen voll akzeptiert, aber die daraus resultierenden Konsequenzen nicht. Schließlich kann der Berater nur aus den gegebenen Möglichkeiten schöpfen, und die sind für diesen Personenkreis sehr gering: Werkstatt für Behinderte für die Schwächeren, Hamburger Arbeitsassistenz für Bewerber, für die eventuell eine Tätigkeit außerhalb der Werkstatt für Behinderte möglich erscheint und zuletzt für einige Wenige der Förderlehrgang 2, der den Zugang zum ungeschützten Arbeitsmarkt eröffnen soll.«
Berater B bietet im Beratungsgespräch mögliche Fördermöglichkeiten an und versucht, den Wünschen des Jugendlichen und der Eltern im größtmöglichen Maße gerecht zu werden. Bei Unsicherheit zieht Berater B den psychologischen Dienst zu Rate. Auf einen möglichen Konflikt zwischen dem positiven Willen der Betreffenden und den negativen Ergebnissen der Fachgutachten angesprochen, meint Berater B: »Ich habe den Konflikt noch nicht gehabt. ... Aber ich glaube, ich würde ihn auch nicht bekommen, weil ich dann im Grunde genommen denke, wir haben nichts zu verlieren. Da würde ich dann auch einfach sagen, wir sind nicht die Institution, die es schaffen soll, ... dann würde ich eben auch wirklich sagen, guckt euch den jenigen an. Wir sind ja froh, es ist ja dann ein als durchaus positiv zu bewertendes Ziel, was die haben.«
Berater C erlebt den Beratungsprozess mitunter als problematisch, denn das Arbeitsamt bittet »ja alle Jugendlichen, gerade auch Integrationsschüler, aber auch alle Leute, für die wir zuständig sind, bei uns im Arbeitsamt einen Test mitzumachen, und bei Integrationsschülern ist es auch häufig so, dass wir einen Arzt mit einschalten, einfach um uns da auch abzusichern. Und die Konflikte entstehen sehr häufig in dem Moment, wo dieses psychologische Gutachten eröffnet wird. Und selbst wenn wir gelernt haben, mit Euphemismen auch zu arbeiten - zum Beispiel: Ich habe ein Gutachten, da steht was von geistiger Behinderung - dann haue ich das den Leuten nicht um die Ohren, sondern beschreibe das so, dass da Lernschwierigkeiten sind, im Verhältnis zur Altersgruppe anders gelernt wird und solche Dinge. Und dass das angezweifelt wird, dass das auf seriösen Füßen steht - da gibt es Konflikte.« Gerade psychologischen Tests gegenüber bestehen bei Eltern Vorbehalte, wenngleich sie nach Berater C nicht »wie ein Urteil« benutzt werden, sondern dass das vielmehr »ein Versuch ist, sich einem Menschen anzunähern, dass eben die Summe dessen, was wir an Infos zusammentragen, dann unseren Vorschlag ergibt.« Wenn »wir da überhaupt nicht im Moment durchblicken«, bekommt der Fachdienst genaue Fragestellungen und eine Voreinschätzung vom Berufsberater. »Ansonsten stelle ich nur offene Fragen, dass die Psychologen da ... eine gute Möglichkeit haben, frei zu antworten, dass man auch nicht jemand dann wirklich so festlegt.«
Zwar entsteht beim Lesen eines Gutachtens bei Berater C »natürlich schon eine Planung: Also optimale Lösung wäre dieses, zweitbeste Lösung wäre die, dritte wäre die.« Dennoch geht Berater C sehr individuell vor: »Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich mit einem geistig behinderten Ratsuchenden umzugehen habe oder mit einem Förderschüler oder ob das ein körperbehinderter junger Mann oder junge Frau ist, das ist sehr unterschiedlich. Und es hängt natürlich auch ganz stark von den Eltern mit ab, wie man vorgeht.« Besonders bei Integrationseltern achtet Berater C angesichts derer Entstigmatisierungsbestrebungen darauf, »meine Sprache von solchen Dingen frei zu halten und eben, wie gesagt, auch mal mit ein paar Euphemismen zu arbeiten, um einfach da auch nicht die Atmosphäre gleich zu belasten.«
Berater D geht ebenso wie die KollegInnen in der Kooperation mit Sonderschulen langfristig mit Berufswahl-Unterricht, Elternabenden und individuellen Gesprächen vor. »Das geht eigentlich immer dann so um das Thema: ›Wie komme ich da ran an die Sache, an das Geheimnis, was ich denn werden soll?‹« Ebenso wichtig wie das Herausfinden eigener Interessen ist jedoch auch, »dass wir auch sehr deutlich darüber sprechen, was gibt es da für Grenzen bezüglich des Wollens und Könnens und so weiter. Und das hat eben mit Selbstwahrnehmung zu tun.« Dabei informiert Berater G alle SchülerInnen über jegliche »Möglichkeiten vom Berufsvorbereitungsjahr bis hin zu Tagesförderstätte. ... Da ich ganz früh anfange mit der Sache (Berufsberatung), sehe ich auch nicht ein, das zu kanalisieren, sondern da sollen die erst mal wissen oder sollen selbst entscheiden, ob sie das alles wissen wollen.« Dabei ist Berater D bewusst, dass es bei diesem Prozess um grundlegende, existentielle Entscheidungen geht: »Schließlich geht es ja um etwas: ›Kann ich eine Ausbildung beginnen?‹ Ich meine, das ist ja eine Wahnsinnsentscheidung. Das ist ja auch eine Weiche, die man da stellt.«
Berater D hält es für wichtig, alle Beteiligten - Jugendliche, Eltern und LehrerInnen - »an einen Tisch zu kriegen und da auch eine gemeinsame Richtung rauszukriegen.« Gleichwohl hat auch das fachliche Gutachten eine wesentliche Bedeutung bei dieser Entscheidung, und Berater D hätte auch Schwierigkeiten zu begründen, »wenn das Gutachten sagt: ›Ausbildung geht nicht‹ und (ich) eine Ausbildung im Berufsbildungswerk mit demjenigen klar mache.« Solche Widersprüche hat Berater D jedoch »wirklich noch nicht erlebt. Ich habe zwar erlebt, dass sich Menschen beschwert haben über den Umgang beim Psychologischen Dienst. Aber wenn ich eine Gutachtenerstellung bei den Eltern vorschlage, dann habe ich noch nie erlebt, dass die Leute irgendwie so sagen: ›Nein, das will ich überhaupt nicht.‹ Ich habe noch nie erlebt, dass gesagt wurde: ›Dieses Gutachten ist Quatsch‹ oder das angezweifelt wurde.«
Berater E macht in der Förderschule »gerne einen Elternabend und da erzähle ich dann, was es alles gibt und wie der Verlauf bei uns ist. Nämlich Erstgespräch in der Schule und zweitens meistens psychologische Eignungsuntersuchung und wenn nötig, ärztliche Untersuchung. Bei der psychologischen Untersuchung mit der Erklärung dazu, dass man ja dann nicht verrückt ist und was da gemacht wird und was nicht gemacht wird und so und versuchen Ängste der Leute zu nehmen.« Mit den psychologischen Tests werden Schulkenntnisse abgefragt: »Was hat er im Moment drauf und welche Rechenregeln kennt er und welche nicht?« Das Ergebnis wird dann mit dem Altersmaßstab verglichen. Zur psychologischen Eignungsuntersuchung »geben wir Nachricht, aus was für einer Schulart jemand kommt und auch unseren Eindruck.« Das Untersuchungsergebnis ist bedeutsam für die Zuweisung zur Maßnahme, denn man kann keine Ausbildung finanzieren, »wenn mir alles sagt, das muss Werkstatt sein.« Häufig bespricht Berater E mit Ratsuchenden, dass auch vorläufige Versuche ohne Erfolgsgarantie gestartet werden sollen, »auch wenn ich vielleicht im Kopf habe, das sieht mir danach aus, dass das Werkstatt sein muss, und Förderlehrgang 2 wird wahrscheinlich nicht gut gehen. ... Dann gibt es ja auch durchaus Fälle, wo es dann deutlich ist, dass es anders sein muss und dann ist es aber auch für die Eltern und für den Jugendlichen anders nachzuvollziehen - oder ich freue mich mit, dass es doch viel besser geht, als ich das vorher gedacht habe. Das ist dann auch gut. Es geht ja nicht um Recht haben oder was, sondern es geht darum, dass was möglich ist. Manchmal muss jemand erst gekitzelt werden, dass er dann doch zeigt, was er kann. Das ist ja auch das Spannende.«
Für Berater F ist die Beratung im Integrationskontext manchmal schwierig, denn die »haben doch Ansprüche, die oft über das Vermögen hinausschießen und da muss man dann ganz sensibel mit umgehen, dass das nicht zu kontroversen Diskussionen führt mit den Eltern, mit den Betreuern und den Betroffenen selbst. Das ist oft nicht so einfach. Es ist schon häufiger so ein wenig kontrovers verlaufen, was es nicht sein müsste. ... Die eigenen Einschränkungen realistisch in Beziehung setzen zu den beruflichen Anforderungen - das ist ja das, was wir uns wünschen und was wir hoffen zu bewirken durch unsere Arbeit.« Nach dem, was dann alles so »auf dem Tisch liegt« - Unterlagen, Aussagen der LehrerInnen, Zeugnisse, Tests, ärztliches Gutachten, Wünsche der Jugendlichen selbst - »macht man sich eine Vorstellung« und einen Vorschlag. Doch Berater F findet, »man darf nichts festschreiben« und hat sich »abgewöhnt zu sagen: ›Das kannst du nie.‹ ... Das steht mir nicht zu.« Kürzlich erlebt Berater F ein Beispiel in einem Kfz-Betrieb, wo ein junger Mann auf Berater F zukommt und »ganz stolz sagte, er hat gerade den Laden übernommen und erzählt: ›Ich bin ehemaliger Förderschüler. Jetzt habe ich meinen Meister und bin Betriebsinhaber.‹ Also das gibt es.« Berater F ist als Berufsberater wichtig zu helfen, »den Sprachlosen eine Sprache zu geben und denen, die nicht laufen können, ein Bein zu leihen.«
In der Art der Beratung eines Jugendlichen richtet sich Berater G sehr stark danach, »wie die Schule ihn einschätzt, wobei natürlich auch im Gespräch so gewisse Dinge ganz einfach abgeklärt werden.« Im direkten Gespräch kann man dann feststellen, »wie weit jemand überhaupt folgen kann oder wie weit jemand jetzt nicht mehr mitkommt, wie weit auch bestimmte Kulturtechniken da sind.« Kulturtechniken werden dann wichtig, wenn weiterer Schulbesuch in Frage kommt, »wo ich den Eindruck habe, eigentlich ist das niemand für die Werkstatt, ... sondern eher Förderlehrgang« oder ähnliches.
Berater G schaltet im Zweifelsfall den psychologischen Fachdienst ein, der die »Leistungsdimension im sprachlichen, mathematischen und logischen Bereich« überprüft. Da werden dann »so bestimmte Testbatterien abgefahren« und nach einem Gespräch mit dem Diplompsychologen »stricken die ein Gutachten.« Das Gutachten ist eine »wesentliche Hilfe, wobei ich bin jetzt nicht sklavisch dran gehalten, also die Autonomie der Entscheidung habe ich. Aber es ist schon ein wesentlicher Punkt, wenn im Gutachten drin steht: ›Hier ist wirklich eine ganz massive geistige Behinderung da und ein Erreichen von regulärer Arbeitsmarktreife ist erst mal auszuschließen.‹ Und das ist schon eine Sache, wo ich nicht so einfach drüber weggehen kann.« Wenn es nach Eröffnung des Gutachtenergebnisses mit den Eltern und dem Jugendlichen zu Konflikten kommen sollte, dann gibt es »im Zweifelsfalle weitere Diagnostikmöglichkeiten« wie die Arbeitserprobung oder ein Praktikum im Förderlehrgang 2, um zu sehen, »wie er da zurecht kommt.«
Einmal hat Berater G auch gegen den Willen der Eltern zugewiesen, und zwar war das »nicht direkt eine Geistigbehinderten-Schülerin, ich würde sie als Integrationsschülerin bezeichnen, wo also Eltern seit Jahrzehnten im Grunde genommen ihre Tochter überfordern und das nicht wahrhaben wollen.« Die Eltern »hatten sich dann darauf versteift, die Tochter müsste eine Ausbildung machen, möglichst im Bürobereich, was sie absolut nicht schnallen würde. ... Die Eltern wollen nicht wahrhaben, dass sie eine behinderte, beeinträchtigte Tochter haben, die einfach mit ganz anderen Methoden angefasst werden muss.«
Berater H versucht erst mal »unheimlich viel Daten zu sammeln, Informationen zu bekommen«, wobei »die Lehrer, die Eltern und die Jugendlichen selber die allerwichtigsten Informationsquellen sind.« Mit der Integrationsbewegung »hatten wir natürlich das Problem« vor der Existenz der Arbeitsassistenz, dass die Eltern mit ihrer integrativen Grundorientierung »diese Kette nicht abreißen« lassen wollten, das Arbeitsamt jedoch »diese Kette nicht vollenden, fortsetzen konnte« und »eher reagierte. ... Und da gab es dann Schwierigkeiten, einen Übergang zu finden, aber jetzt mittlerweile gibt es ja mehr Angebote und jetzt fällt es langsam nicht mehr so schwer. Und die Eltern wissen das auch.« Diese Eltern kommen »auch mal selber und sagen: ›Ich kenne da jemanden, der hat mal in diesem Café und da mal was gemacht, und können Sie da nicht was machen?‹ ... Dadurch lerne ich auch relativ viel, weil ich dann viel Anregung kriege.« Bei vielen Eltern und Jugendlichen ist der »Hauptwunsch, nicht in die Werkstatt zu gehen.« Berater H vertritt dann, »dass man es einfach probieren soll, dass der Jugendliche seine Erfahrungen selber machen soll, an seine Grenzen stoßen soll, und das tut manchmal vielleicht auch weh, aber dann sitzt es besser, als wenn ich sage: ›Das kannst du nicht.‹ Oder der Arzt, der Psychologe und ich sagen gemeinsam: ›Und deshalb gilt das jetzt, du schaffst das nicht.‹ ... Also ich würde das nicht von vornherein ablehnen, sondern die Erfahrung selber machen lassen.« Berater H informiert »in der Regel über die Arbeit der Arbeitsassistenz, und ich habe auch immer, wenn ich in Schulen gehe, diese Merkblätter mit. ... Bei denen ich das anspreche, wo es dann letzten Endes in Frage kommt, ist es zu 90 Prozent eigentlich mein Vorschlag gewesen und bei zehn Prozent der Gedanke von den Eltern oder von den Jugendlichen, die vielleicht auch schon Kontakt hatten.«
Für manche Jugendlichen hält Berater H jedoch das »Gegenteil von Integration« für »besser, weil wenn sie an einer Geistigbehinderten-Schule praktisch groß geworden sind und unter ihresgleichen und kommen dann in einen großen Betrieb und sind womöglich der einzige mit einer schweren Behinderung und merken, dass sie anders sind, ... dann ist das für manche so quälend und bitter, dann ist dieses, was manche als ›Ghetto‹ bezeichnen, einfach viel behütender.«
Zwischenfazit zur Beratungssituation
Betrachtet man die Beratungssituation, können bei Anerkennung individueller Unterschiede folgende allgemeine Aussagen getroffen werden: Insgesamt erscheint die Beratungssituation bei SonderschülerInnen tendenziell eindeutiger und unproblematischer als bei IntegrationsschülerInnen und deren integrationsorientierten Eltern. Ursachen dafür können in subjektiv als weniger aussagefähig empfundenen Unterlagen aus Integrationsschulen liegen, aber auch in unterschiedlichen Vorstellungen über anstrebenswerte oder realistische Maßnahmen und Förderungen. Von mehreren BeraterInnen wird berichtet, dass es vor längerer Zeit - in der Anfangsphase des Übergangs von Integrationsklassen in das Arbeitsleben - massive Probleme zwischen Berufsberatung und Integrationseltern gegeben hat (vgl. Kap. 7.1); diese sind mit der Zunahme auch integrationsorientierter Maßnahmen weitestgehend überwunden. Ein weiterer, in Einzelfällen brisanter Punkt sind die Gutachten der Fachdienste aus dem Hause, denen manche Eltern mit Misstrauen gegenüberstehen; dies gilt wiederum eher für Eltern mit integrativer Orientierung, die sensibler auf Verfahren mit möglicher Etikettierungswirkung - gerade bei Diagnostik - und auf mögliche Diskriminierung, auch im sprachlichen Bereich, reagieren. Hier kann dann der Konflikt entstehen, dass Eltern solchen Verfahren mit Misstrauen begegnen, zumal wenn diese entscheidend sein können für Finanzierung und damit Zuweisung zu Maßnahmen.
Genau bei der Gewichtung von Gutachten und anderen Datenquellen in Relation zu Wünschen und Interessen von Ratsuchenden und ihrem Umfeld bestehen tendenzielle Unterschiede zwischen den BeraterInnen:
-
Gutachten im Hause und die Feststellung von Fähigkeiten durch vorhergehende Institutionen sind primär entscheidend für die Zuweisung zu einer Maßnahme, auch wenn dies zu-nächst im Gegensatz zu geäußerten Wünschen steht (A, G).
-
Sowohl das Gutachten als auch Wünsche und Interessen von Jugendlichen und Eltern spielen in der Beratungssituation eine wichtige Rolle (C, E).
-
Interessen und Wünsche von Ratsuchenden und ihren Eltern sind hoch bedeutsam im Beratungsprozess und ggf. wichtiger als andere Daten (B, D, F, H).
Nach Berater A sind »die Zuweisungskriterien ... nicht so streng, ich möchte sie als ›aufgeweicht‹ bezeichnen, weil es bei strenger Anwendung von Eignungskriterien sicher Probleme geben würde.« Eigentlich sind die angemessene Klientel für das Ambulante Arbeitstraining »Grenzfälle, wo ich meine, im Arbeitsleben werden die überfordert sein oder Jahre brauchen, bis sie das vielleicht packen und im Arbeitstraining in der Werkstatt werden sie unterfordert sein.« Jedoch wird das Ambulante Arbeitstraining auch für Personen genutzt, »die dem Leistungsvermögen nach der Werkstatt für Behinderte zuzuordnen wären, die diesen Weg aber nicht akzeptieren. Das Ziel, eine Arbeit auf dem ungeschützten Arbeitsmarkt zu erreichen, scheint (aber) nicht realistisch. Der geschützte oder unterstützte Arbeitsmarkt ist aber noch nicht etabliert und es gibt immer nur ›Einzelinitiativen‹, über die man auch selten klare Auskünfte bekommt.« Eine entsprechende Zuweisung ist gleichwohl nicht brisant und »der Berater (muss) keinen Regress befürchten bei einer Fehleinschätzung«, »da förderungstechnisch die Arbeitsassistenz an die Werkstätten für Behinderte gebunden ist, und eine Förderung auch nur zwei Jahre betragen kann und damit auch nicht höhere Kosten verursacht.«
Berater B hat bisher zwei Personen dem Ambulanten Arbeitstraining zugewiesen: »Das eine ist eine Gesamtschul-Integrationsschülerin gewesen, wo das Thema Integration immer ganz vorne anstand für die Familie, also der Wunsch der Eltern einfach ganz stark ist, ... wo von der Familie ganz klar gesagt wurde, sie lehnen die Beschäftigung in der Werkstatt ab, das würden sie nicht mitmachen.« Angesichts eigener Zweifel - »also da waren schon so ein paar Problemchen dabei« - wendet sich Berater B an »den psychologischen Dienst mit dieser Fragestellung: ›Wie sehen sie das?‹ Und wir sind eben zu dem Schluss gekommen: ›Klar, Versuch macht klug. Also verantworten können wir das allemal.‹ Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist für mich die Superkandidatin. Aber was anderes kam da nicht in Frage für die Mutter. ... Das andere war jemand, der auch im Grenzbereich lag« und einen F2-Lehrgang abbrechen musste. Dessen Behinderung »war von der Familie nicht zu akzeptieren. Also das war schon so ein Drama, überhaupt einen Reha-Antrag stellen zu müssen, um in den Förderlehrgang zu kommen. ... Der ist also dann letztenendes dort nie aufgekreuzt. Und die Werkstatt (war) für die eben auch überhaupt kein Thema.«
Die Frage nach Zuweisungskriterien zum Ambulanten Arbeitstraining stellt sich für Berater B eher als Frage danach, ob er dies bei einer konkreten Person für realistisch hält, als auf allgemeiner Ebene. In erster Linie ist für Berater B die Motivation wichtig, also »sie wollen arbeiten. ... Und das ist ja sehr sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also das reicht ja ... bis zur totalen Verweigerung jeglicher Aufgabenstellungen - die würden natürlich ganz sicher nicht in Frage kommen - bis zu welchen, die also bei der Arbeit eigentlich auch gut (sind). ... (Wo man) auch dann von Lehrern so Rückmeldungen kriegt: ›Mensch, ... (der hat) da ein Praktikum gemacht und die waren völlig perplex, was der da weggeschafft hat.‹« Dass manche jungen Menschen nicht so sehr motiviert zum Arbeiten sind, kann Berater B »jetzt gerade bei so Grenzgängern ... ein Stück weit nachvollziehen, wenn er sich nicht richtig wohlfühlt, weil vielleicht noch viele leistungsschwächer werden in der Werkstatt für Behinderte, aber dass er es natürlich auch auf dem ersten Arbeitsmarkt extrem schwer hat und sich in Sozialhilfe flüchtet oder so. Das Problem haben wir natürlich, ganz klar.« Zentral sind für Berater B beim Ambulanten Arbeitstraining darüber hinaus »Sozialkompetenzen, also eine gewisse Anpassungsfähigkeit, Wegefähigkeit ist natürlich auch eine Sache, die das enorm erleichtert. In einer Großstadt ist ja häufig schon das Hinkommen für viele sehr sehr schwierig. Also das sind so Kriterien, die das ... einfacher machen dann - aber ich muss sagen: ... Also bisher war hier noch niemand gewesen, wo ich gesagt (habe): ›Sie könnten doch auch mal daran denken.‹ Sondern eigentlich ist das immer schon bekannt.«
Bei der Zuweisung zur Hamburger Arbeitsassistenz steht für Berater C der Wunsch der einzelnen Ratsuchenden und ihrer Eltern im Vordergrund: Da »habe ich kein Problem damit, die auch anzumelden und dann sollen die sehen, ob die das können.« Berater C wird jedoch von sich aus nicht initiativ und rät gezielt zum Ambulanten Arbeitstraining, sondern es sind meistens die Ratsuchenden, »I-Eltern und auch aus den Schulen für Geistigbehinderte, wo das Anliegen auch gleich formuliert wird - es sind ja nicht nur Integrationsmenschen, die in die Arbeitsassistenz gehen.« Berater C ist für mehrere Schulen für Lernbehinderte, nicht aber für eine Schule für Geistigbehinderte zuständig; vielleicht sieht Berater C von daher das Ambulante Arbeitstraining für eine andere Klientel als große Chance, für die Berater C auch »ganz vehement« kämpft, »dass die Arbeitsassistenz sich um die kümmert und für die eine Perspektive erarbeitet.« Diese Klientel, »die Grenzgänger«, sind jedoch »nicht ganz der Personenkreis, auf den die das eigentlich absehen.« Damit meint Berater C die jungen Leute, »wo wir sagen: Wir versuchen das mit einem Förderlehrgang 2 und haben das große Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt oder erster Arbeitsmarkt. Und wo sich dann innerhalb des ersten Jahres herausstellt, wir erreichen dieses Ziel nicht. Wo ich denke, wenn die jetzt mit einer Arbeitsassistenz gefördert werden, dann sind die irgendwann wirklich soweit, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das sind also diese Grenzgänger, wo man klar am Gutachten sagt, keinesfalls Werkstatt und somit auch erst mal nicht Arbeitsassistenz.«
Da Berater D von vornherein erst mal versucht, »jedem die Chance zu geben«, ist die Zuweisung weniger von aufgestellten Kriterien abhängig nach dem Motto »Schublade auf ›Werkstatt‹ und Schublade auf ›Hamburger Arbeitsassistenz.‹« Berater D hält es für wichtiger, »dass der Jugendliche sich das ansieht und ein Gefühl entwickelt, wie sind die eigentlich. ... Da geht es darum, zu gucken, wo könnte ich mich eigentlich am wohlsten fühlen. Und dann natürlich auch die Eltern, dass die das so mittragen und sagen: ›Gut, wir haben uns - meinetwegen - für unser Kind das und das vorgestellt und nun möchten wir das auch erst mal probieren.‹« In dieser Optik sind Sachinformationen wichtig, aber die Entscheidung ist letztlich stark abhängig vom Wunsch der Ratsuchenden.
Aus Berater E's Schilderungen spricht deutliche Unzufriedenheit über die gegenwärtige Praxis. »Die formale Geschichte ist ja so, dass wir sie in einer Werkstatt mit anmelden, weil das ja an eine Werkstatt angebunden sein muss und da können wir dann das Stichwort dazu schreiben, dass man das eben im Ambulanten Arbeitstraining machen kann.« Berater E ist der Meinung, dass vielfach eigentlich die falschen Personen in das Ambulante Arbeitstraining kommen. Denn häufig gibt es im Förderlehrgang 2 gescheiterte junge Leute, »bei denen ich denke, wenn die jetzt die Hilfe der Arbeitsassistenz kriegen würden, um einen ganz gezielten Arbeitsplatz zu finden, der nun ausschließlich auf diesen Menschen passt, dann könnte das gut was werden. Und wir machen auch den Vorschlag und ich habe es aber noch nicht (erlebt), dass das mit irgendwem gelungen ist. Meine Meinung ist, dass das der richtige Personenkreis wäre, um mit der Hamburger Arbeitsassistenz gut weiterzuhelfen.« Stattdessen unterstützt die Arbeitsassistenz »oftmals sehr sehr schwache, sehr geistig behinderte Jugendliche, von denen ich denke, dass das auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt trotz Arbeitsassistenz gar nichts werden kann und dass da die gesamte Arbeitskraft verpufft - und teilweise an Kindern von Eltern, die sehr eloquent sind und überall nachbohren können und dann gleich an die höchste Stelle gehen. Jedenfalls diejenigen, die man auf den Weg bringen könnte, kommen nicht voran.« Die eigentliche Klientel sind für Berater E Menschen, die »auf der Grenze zwischen der Werkstatt und dem allgemeinen Arbeitsmarkt stehen.«
Für Berater F sind die Klientel des Ambulanten Arbeitstraining »Geistigbehinderte und Körperbehinderte, klar, weil da auch nichts anderes übrigbleibt und wir froh sind, dass wir die Arbeitsassistenz haben, sonst wäre es ausschließlich die Werkstatt.« Oftmals steht auch der Wunsch der Eltern, die ihre Kinder zum Ambulanten Arbeitstraining schicken möchten, im Vordergrund, die dann sagen: »Mein Kind geht nicht in die Werkstatt.« Wenn »nach allem, was mir hier auf dem Tisch liegt, ich mir denken könnte, der könnte auch draußen mit einer besonderen Hilfe durchaus Fuß fassen, dann sage ich das auch. ... Dann schreibe ich das der Werkstatt rein.« Allerdings sind Zuweisungskriterien für das Ambulante Arbeitstraining »ein ganz heißes Thema, ganz schwierig, da möchte ich mich auch eigentlich gar nicht festlegen. Ich denke mir, wenn wir ganz ehrlich sind, wird das oft auch so nach Gefühl und Wellenschlag (gemacht). Wir haben zwar Unterlagen, die Aussagen der Lehrer, die Zeugnisse, unseren Test, ärztliches Gutachten, den Jugendlichen selbst, wie er sich so gibt und dann macht man sich eine Vorstellung und ein Vorschlag.« Für Berater F haben die Werkstätten auch die Aufgabe zu gucken, ob jemand unterfordert ist, die »sollten dann schon mal bei der Arbeitsassistenz anläuten.« Auf die geringen Übergangszahlen von der Werkstatt für Behinderte zur Hamburger Arbeitsassistenz angesprochen, meint F: »Das kann natürlich auch mal unterlassen worden sein, die Arbeitsassistenz anzugeben.«
Nach Berater G sind die beiden Formen des Arbeitstrainings »bisher noch Angebote für unterschiedliche Personenkreise. Das muss man eindeutig sagen, das heißt, es noch nicht soweit, dass man jetzt sagt: ›Ja, denkbar wäre es ja, wir probieren das mit jedem aus, wieweit das nicht geht‹ - dass von vornherein so was versucht wird wie Ambulantes Arbeitstraining.« Dennoch wird nicht konkret klar, welche Form für wen in Frage kommt; eher scheint das Ambulante Arbeitstraining leistungsstärkeren jungen Menschen mit geistiger Behinderung zugeordnet zu werden. Bei der Frage nach dem Anteil an Vorinformationen über die Arbeitsassistenz bei den Ratsuchenden meint G, »das kann ja nur um G-Schüler gehen, ... denn ich erzähle ja keinem Förderschüler« von der Arbeitsassistenz, »für den ich ganz andere Möglichkeiten habe bis hin zur Ausbildung. Da ist ja Arbeitsassistenz kein Thema.«
Wenn Berater H nach den gesammelten Informationen den Eindruck hat, »da ist jemand an einer Geistigbehinderten-Schule, der fleißig ist, am Arbeitsplatz bleiben kann, der irgendwie solche Arbeitstugenden aufweist, ja, da könnte man über solche Sachen dann nachdenken.« Wie Berater H feststellt, besteht bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung häufig »so ein beneidenswerter Anarchismus: Die können ja machen, was sie wollen, also von ihrem Arbeitsplatz aufstehen und kommen und gehen wann sie wollen. Oder auch mal irgendwie mit der Lehrerin knutschen oder so. Die müssen natürlich lernen, dass sie das bei einer Meisterin nicht machen können oder dass sie da an ihrem Platz sein müssen. Und wer das gelernt hat, der ist schon mal ganz gut.« Wichtig wäre für Berater H auch, dass »die sich durchsetzten können und ihre Wünsche artikulieren können und die auch nicht gleich zerbrechen, wenn dann mal ein Geselle, der nun nicht dieses Feeling hat und fragt: ›Wieso begreifst du das nicht?‹ Oder (sagt): ›Gehe weg, ich mache das selber.‹«
Dabei weist Berater H unter Umständen jemanden der Werkstatt für Behinderte zu, bei dem momentan die Gefahr der Überforderung im Ambulanten Arbeitstraining besteht, längerfristig aber schon bei guter Entwicklung ein Übergang zur Arbeitsassistenz erfolgen könnte, was Berater H auch der Werkstatt für Behinderte mit auf den Weg gibt. Das kann jedoch die Folge haben: »Wenn der Jugendliche sich dann so wunderbar eingegliedert hat in der Werkstatt und toll mitarbeitet und dann auch selber nicht das Bedürfnis äußert, klar wird dann auch nicht offensiv auf ihn eingeredet. Ich frage mich auch, ob das dann gut ist. Und die jugendlichen Menschen, die dann da arbeiten, haben dann natürlich auch nicht die Fähigkeit, alle paar Wochen zu dem Sozialpädagogen zu laufen und zu sagen, ich möchte hier raus.«
Zwischenfazit zu Zuweisungskriterien zum Ambulanten Arbeitstraining
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für alle BerufsberaterInnen beide Momente, sowohl die Ergebnisse der Fachgutachten als auch die Wünsche und Interessen der Ratsuchenden, in die Entscheidungsfindung über die Zuweisung eingehen.
Dennoch lassen sich in der Gewichtung zwischen beidem und in der weiteren Beschreibung von Zuweisungskriterien tendenzielle Unterschiede feststellen:
-
Die angemessene Klientel für das Ambulante Arbeitstraining sind ›Grenzfälle‹ zwischen Lern- und geistiger Behinderung oder das oberste Leistungsspektrum bei geistiger Behinderung. Deren Fähigkeiten stellen das entscheidende Zuweisungskriterien zum Ambulanten Arbeitstraining dar (G, H) - es sei denn, Eltern oder Ratsuchende lehnen die Werkstatt für Behinderte aus ideologischen Gründen kategorisch ab (A, E).
-
Fähigkeiten und Wünsche der Ratsuchenden gehen gleichgewichtig in die Zuweisungskriterien ein (B, F).
-
Der individuelle Wunsch, das Arbeitstraining ambulant bei der Hamburger Arbeitsassistenz absolvieren zu wollen, steht im Vordergrund (D), wenngleich auch Abbrecher aus dem F2 die Chance haben sollten, dort hineinzukommen (C).
Das Ambulante Arbeitstraining wird von den Befragten unter drei Aspekten eingeschätzt: seiner Rolle innerhalb des Systems der beruflichen Rehabilitation, seinem Erfolg und seinen Veränderungsbedarfen.
Für Berater A ist das Ambulante Arbeitstraining eine »Nische« innerhalb des Systems der beruflichen Rehabilitation. Sie »ist auch nur mit einer Hilfskonstruktion hier in unsere Fördermöglichkeiten angebunden. Aber im Prinzip ist das ein Ziel, das ich nur unterstützen kann. Ich habe nur also Bedenken, dass die wirtschaftliche Realität und der Anspruch ... miteinander vereinbar ist.«
Berater B schätzt den Stellenwert der Hamburger Arbeitsassistenz »zahlenmäßig gering« ein, jedoch vom »Trend der Zeit, Zeitgeist, Interesse von seiten unserer Ratsuchenden groß, auf jeden Fall.«
Für Berater C ist das Ambulante Arbeitstraining »ein wichtiges neues Instrumentarium (im Hinblick auf die) ... Grenzgänger, was uns die Möglichkeit gibt, diesen jungen Leuten die Werkstatt zu ersparen.«
Für Berater D ist die Arbeit der Arbeitsassistenz »ein wesentlicher Teil von Initialzündung, so einfach Veränderung.« Als die Hamburger Arbeitsassistenz ihre Arbeit beginnt, »da war das Konkurrenz zur Werkstatt, und jetzt hat die Werkstatt auch einiges begriffen und sattelt um, und die Hamburger Arbeitsassistenz bekommt durch die Werkstätten Konkurrenz.« Berater D hält die Arbeit der Arbeitsassistenz »für einen Erfolg - ein absolut wichtiger Schritt.«
Berater E findet, dass die Arbeitsassistenz »durchaus keine idiotische Idee« ist, doch Berater E interpretiert den Adressatenkreis »etwas anders« als »die Hamburger Arbeitsassistenz das durchweg tut, getrieben von den Integrationseltern mit Power.« Berater E ist der Meinung, »dass den Leuten, die an der Grenze zwischen WfB und allgemeinen Arbeitsmarkt stehen, geholfen werden sollte« und nicht den »zu schwachen Leuten«, denn »dann könnte man da eine Menge machen und dann wäre das auch gut auszubauen.«
Für Berater F hat die Hamburger Arbeitsassistenz eine wichtige Rolle und ist »zumindest bei allen Leuten, die im Reha-Bereich tätig sind, bekannt.« Insgesamt läuft in dieser Stadt »unheimlich viel in Richtung Arbeitsassistenz.« Doch deren Arbeit ist »im Verhältnis zu dem sehr großen Teil des Reha-Systems kaum auffällig und der Umfang ist natürlich sehr gering zum Verhältnis der Masse. ... Ich begrüße das, dass es das gibt und finde das ganz toll.« Berater F findet dieses Angebot auch insofern wichtig, als »dass es jetzt so was wenigstens schon mal für unsere Geistigbehinderten gibt«, denn es sind Leute, deren Interessen am dringendsten auch stellvertretend von anderen wahrgenommen werden müssen.
Berater G meint, die Hamburger Arbeitsassistenz steckt noch »in den Anfängen, in den Kinderschuhen, sowohl inhaltlich-konzeptionell, fachlich als auch faktisch vom Umfang her.« Dennoch sieht Berater G eine generelle Entwicklung, innerhalb derer »die Werkstätten aber auch anfangen sich natürlich zu verändern. Ich meine, die Werkstätten werden in ihrer Form als Werkstatt, oder vielleicht werden sie sich auch anders nennen, nur überleben, wenn sie sich diesem Trend auch stellen oder dieser Entwicklung. ... Also wir müssen sie auch aus diesem Korsett rauskriegen, dass wir sagen, das ist aber nur jetzt Arbeitstraining. Da geht eben die Kohle rüber im bestimmten Umfang. Entscheidendes Ziel ist sowieso für uns die Integration in Arbeit, wie auch immer, am besten auf dem ersten Arbeitsmarkt oder wenn es eben noch nicht geht, erst mal auf dem geschützten und dann hat sich das. Dann müssen wir sehen, wie eng er dran ist, was da machbar ist.«
Für Berater H ist die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz »eine wichtige, eine tragende mittlerweile.« Sie spielt aber eine »für meinen Geschmack noch viel zu geringe Rolle im Rahmen der Rehabilitation. ... Sie hat sich in Hamburg, nach anfänglicher Skepsis, sehr gut etabliert.«
Zwischenfazit zur Rolle
Die Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz und des Ambulanten Arbeitstrainings innerhalb des Rehabilitationssystems wird von den BerufsberaterInnen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Es lassen sich drei Tendenzen feststellen:
-
Die Hamburger Arbeitsassistenz nimmt innerhalb des Rehabilitationssystems keine wesentliche, sondern eher eine marginale Rolle ein (A, G).
-
Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz fällt im Verhältnis zu dem sehr großen Teil des Rehabilitationssystems quantitativ kaum auf, liegt aber qualitativ im Trend der Zeit und wird begrüßt (B, E, F).
-
Die Hamburger Arbeitsassistenz spielt eine tragende, z.T. zukunftsweisende Rolle und bedeutet eine wichtige Veränderung innerhalb des Rehabilitationssystems (C, D, H).
Berater A hält sich »über den Eingliederungserfolg der Hamburger Arbeitsassistenz ... (für) wenig informiert, ich nehme aber an, dass von dem Personenkreis, der durch die Berufsberatung dort hin kommt, kaum einer dauerhaft in ungeschützte Arbeit gekommen ist. Sicherlich werden in der Arbeit am Menschen Erfolge erzielt hinsichtlich der Entwicklung der Persönlichkeit und von Fähigkeiten für die Arbeitswelt.« Berater A sieht jedoch auch deutliche »Grenzen in der Entwicklungsmöglichkeit der Teilnehmer, und mit immer mehr Aufwand ist schließlich kaum noch mehr zu erreichen, so dass der ungeschützte Arbeitsmarkt verschlossen bleiben wird. Gemessen an dem, was die ›Eltern für Integration‹ sich davon versprochen haben, und das war meines Erachtens Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt, sehe ich die Erfolge als gering an, ebenso an den Schilderungen und Hoffnungen, die seitens der Hamburger Arbeitsassistenz verbreitet wurden. Wenn man die Einmündung in ›Unterstützte Beschäftigung‹ mit einbezieht, sieht die Bilanz sicherlich erheblicher günstiger aus.«
Den Erfolg der Hamburger Arbeitsassistenz schätzt Berater B quantitativ und qualitativ unterschiedlich ein: »Einfach aufgrund der geringen Zahl an Rückmeldungen kann ich das nicht so positiv beurteilen.« Was die Qualität angeht, ist Berater B sich unsicher: Einerseits kann Berater B »niemanden nennen bisher. ... Es war nicht so, dass irgend jemand gesagt hätte: Ich kenne jetzt schon drei Leute, die einen tollen Arbeitsplatz haben oder so. Also, das ist auch immer so eine Sache, wo ich dann sage: Dann muss man auch manchmal die doch sehr hohen Erwartungen speziell von Eltern ein bisschen herunterfahren.« Andererseits hat Berater B »noch nie einen Rücklauf gehabt, dass mal jemand sagt, die waren da unmöglich oder die waren ganz blöd zu mir und so. Also insofern muss ich sagen, angenommen und aufgenommen sind die auf jeden Fall an Betrieben. Und da habe ich noch nie irgend etwas Negatives gehört.«
Für Berater C ist es schwierig, den Erfolg des Ambulanten Arbeitstrainings einzuschätzen: »Kann ich schwer sagen, weil ich zu wenig Erfahrung habe. Wie gesagt, wenn es um diese Grenzgänger geht, ist das Spitze. Und bei den anderen, bei den G-Jugendlichen traue ich eine Einschätzung mir nicht zu.«
Berater D hält die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz für einen »Erfolg.« Wenn die Kriterien jedoch so gesetzt werden, »dass Integration nur dann erfolgreich ist, wenn sie ohne jegliche Hilfsmittel fortbestehen kann, wenn ich diese Messlatte anlege, dann hat die Hamburger Arbeitsassistenz keinen Erfolg. Diese Messlatte würde ich nie anlegen.« Schon die Anstöße durch die Arbeitsassistenz machen ihre Arbeit erfolgreich, »diese ganze Wichtigkeit, die von dort ausgeht, diese ganze Thematik, dass die mal angerissen wird als Alternative zur Werkstatt - denn es ist ja eigentlich schnuppe, wo das Geld hinfließt: Wenn da tausende Mark hinfließen im Monat, warum soll nicht auch ein Teil oder das Gleiche als Zuschuss an den Arbeitgeber laufen, wenn jemand einen Behinderten in seinem Betrieb einstellt?« Berater D findet es wichtig, dass die Arbeitsassistenz entstanden ist und bestehen bleibt.
Für Berater E arbeitet Arbeitsassistenz »bisher nicht sehr erfolgreich«, was Berater E unter anderem auf deren falschen Adressatenkreis zurückführt. Unter Qualitätsgesichtspunkten hat Berater E »durchaus Fragezeichen dran, ob die Arbeitszeit, die die Arbeitsassistenz bezahlt bekommt, wirklich so gut angewandt wird und so effektiv gearbeitet wird, wie es die Leute können. Ich weiß es nicht. Aber so genau kann ich nicht reingucken, das ist nur so meine Vermutung.« Als quantitativen Aspekt nennt Berater E die geringe Anzahl der Plätze: »Zwölf Plätze ist ja auch so wenig, ist doch nicht viel«, zumal, wenn die Ratsuchenden, die für Berater E dort sinnvoll zugewiesen wären, keine Chance bekommen. Diesbezüglich, meint Berater E, gibt es »ganz viele Gespräche über die Arbeit der Arbeitsassistenz.«
Berater F sieht die Arbeit der Arbeitsassistenz »als sehr kompetent« und findet es gut, »dass es jetzt so was wenigstens schon mal für unsere Geistigbehinderten gibt, ... doch die Anzahl derer, die (dort) durchlaufen, ist einfach zu gering.« Aber »wenn es denn gelingt, jemand unterzubringen, dann ist das eine ganz tolle Sache. Wenn es dann sogar noch gelingt, einen nichtgeförderten Arbeitsplatz zu finden, dann ist es super.«
Über den Erfolg der Arbeitsassistenz kann Berater G sich »noch kein Urteil erlauben.« Doch nach »unserer Messlatte« ist es quantitativ »sicherlich noch minimal, also es fällt noch nicht ins Gewicht, würde ich sagen. Wir haben damals uns gewundert, als die hier waren bei der Dienstbesprechung und über die Fallzahlen berichteten, und dann haben wir gesagt: ›Oh, das muss heftig sein.›» Zu den geringen Fallzahlen in Relation zu den eigenen Beratungszahlen meint G: »Wenn ich 15 Leute hier über das Jahr hätte, also dann könnte ich mich so richtig reinhängen. Dann könnte ich noch so richtig sozialpädagogisch arbeiten und fachlich könnte ich mir die Zeit nehmen, könnte einen an die Hand nehmen und gucken und sehen, dass er auch ankommt.«
Berater H meint: »Da sie ja im Moment noch mit kleiner Flamme arbeitet, finde ich, sie arbeitet sehr erfolgreich, weil sie halt nur einen bestimmten Teil der Jugendlichen rausnehmen kann und (einen) bestimmten Teil der Betriebe hat, und das funktioniert ganz gut. Wenn man jetzt sagen würde, die Jugendlichen haben einen Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz und ich schicke denen jetzt zwanzig Leute pro Jahr, dann hätten die wahrscheinlich Schwierigkeiten.«
Zwischenfazit zum Erfolg
Der Erfolg des Ambulanten Arbeitstrainings der Hamburger Arbeitsassistenz wird von den Befragten sehr unterschiedlich bewertet und an verschiedenen Maßstäben gemessen:
-
Die Hamburger Arbeitsassistenz ist im Vergleich zum Rehabilitationssystem schon aufgrund der geringen Vermittlungszahlen nicht sehr erfolgreich. Zudem bemüht sie sich um die falsche Klientel (E) oder gibt fälschlicherweise - ebenso wie in der Werkstatt für Behinderte - subventionierte Arbeitsplätze als Integration auf dem ungeschützten, ersten Arbeitsmarkt aus (A).
-
Die Hamburger Arbeitsassistenz hat noch einen eher geringen Wirkungsgrad und ist schwer einzuschätzen (B, C, G).
-
Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz wird für den einzelnen Jugendlichen, der dadurch einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt findet, erfolgreich eingeschätzt, wenngleich sie noch kleine Platzzahlen aufweist (D, F, H).
Berater A weiß »über die Arbeit im Einzelfall zu wenig, um darüber etwas sagen zu können.
Das Dilemma ist, dass die Arbeitsassistenz sich einem Personenkreis angenommen hat, für den diese Förderung sicher gut und wichtig ist, die aber das Ziel ›ungeschützter Arbeitsmarkt‹ in der Regel nicht erreichen kann.« Gleichwohl hofft Berater A, »dass man bei der Hamburger Arbeitsassistenz inzwischen realistisch genug geworden ist, die Möglichkeiten der Teilnehmer in der Entwicklung und auf den Arbeitsmärkten, d. h. in den Betrieben richtig einzuschätzen.«
Berater B sieht vor allem quantitativen Veränderungsbedarf: »Was wir immer wieder hören von Leuten, die Kontakt aufnehmen wollen: sehr, sehr lange Wartezeiten. Also das ist mit Sicherheit - also das würde dann für eine Ausweitung des (Ambulanten Arbeitstrainings) irgendwo sprechen.«
Berater C sieht Veränderungsbedarf vor allem in der Außendarstellung der Arbeitsassistenz: »Mein Eindruck von denen ist, dass sie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit ... ihren Erfolg sehr hoch hängen und so tun, als wenn sie überhaupt nirgends mit irgendwas ein Problem haben. Das gefällt mir nicht. Also sie sind alle so von gar keinem Zweifel angenagt und machen un-heimlich viel PR. Und es ist alles überhaupt kein Problem. Das war auch das, was die uns hier auf dieser Dienstbesprechung vermittelt haben. Und das gefällt mir nicht.«
Berater D findet, »es müssten mehr Plätze sein. ... Wenn also die Werkstätten sich auch verändern und so etwas anbieten, dann habe ich es ja auch leichter als Berater. Dann sind es nämlich nicht nur die zwölf Plätze, sondern dann kann man auch sagen: ›Pass mal auf, die machen das Gleiche oder Ähnliches.‹«
Berater E hält einen anderen Adressatenkreis - der »auf der Grenze zwischen WfB und allgemeinen Arbeitsmarkt« steht - für die Hamburger Arbeitsassistenz für angebrachter, denn das wären jedenfalls diejenigen, »die man auf den Weg bringen könnte.«
Berater F meint, das Ambulante Arbeitstraining »sollte erweitert ... und ausgebaut werden und nicht so klein in irgendeiner Nischen stattfinden.« Außerdem sollte es sich auf »andere Personenkreise ausweiten, aber das wird auch schwierig. Zum Beispiel psychisch Behinderte ist ein ganz großes problematisches Feld. Das sind die schlimmsten Fälle, die man jahrelang hat und immer wieder Rückfälle.«
Berater G möchte »jetzt hier nicht Pauschalkritik machen«, doch »Transparenz ist sicherlich ein Punkt, auch gegenüber den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist wichtig. Das ist noch zu wenig - wobei wir sind nicht die Hauptkooperationspartner. Die Hauptkooperationspartner oder vielleicht demnächst auch Konkurrenten - oder jetzt schon - sind die Werkstätten. Und je eher sich Werkstätten umstrukturieren, desto härter wird der umkämpfte Markt, sage ich jetzt mal so, den es ja hier in Hamburg gibt um die Behinderten und auch um die Staatsknete.«
Berater H findet, das Angebot der Arbeitsassistenz »sollte noch weiter ausgeweitet werden, dass es diese Möglichkeit für noch mehr Leute gibt. ... Auf dem Niveau, auf dem die jetzt arbeiten, denke ich, arbeiten die sehr erfolgreich. Und wahrscheinlich muss man das langsam aufstocken, damit dann auch mehr Leute dahin können.« Berater H wünscht sich, »dass die Arbeitsassistenz auch häufiger in den Fachausschusssitzungen» dabei ist und dass »die Zusammenarbeit mit den Werkstätten enger« ist. Dabei hat Berater H im Bewusstsein: »Die Werkstätten, das ist natürlich auch ein bekanntes Problem, die werden nicht gerade ihre Leistungsträger gerne abgeben und das würde ich mir wünschen, dass also da - die Mauern sind schon weitgehend gefallen - dass das noch ein bisschen ... wird und dass es nicht einfach jetzt ein Problem darstellt, wenn da die Arbeitsassistenten einfach mal so in die Werkstatt gehen und sich tolle Leute raussuchen könnten. Das fände ich irgendwie erstrebenswert, wenn das durchlässiger wäre.«
Zwischenfazit zum Veränderungsbedarf
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die BerufsberaterInnen auch sehr unterschiedlichen Veränderungsbedarf für die Hamburger Arbeitsassistenz formulieren. Das Spektrum wird hierbei voll ausgeschöpft und reicht von recht negativen bis zu deutlich positiven Äußerungen:
-
Es wird mehr Transparenz für die KooperationspartnerInnen und mehr Realismus in der Außendarstellung wie in der Arbeit selbst gefordert (A, C, G).
-
Es wird eine Veränderung der Zielgruppe vorgeschlagen, nämlich die Personen, die für die Werkstatt für Behinderte zu leistungsstark und für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu leistungsschwach sind (E).
-
Es wird eine quantitative und qualitative Ausweitung des Ambulanten Arbeitstrainings empfohlen: Mehr Plätze sollten vorhanden sein und andere Personenkreise sollten einbezogen werden (B, D, F, H).
Für Berater A»wird nur ein Arbeitgeber mit gutgehendem Betrieb und einer toleranten, nicht zu sehr unter Leistungsdruck stehenden Belegschaft bereit sein, für leistungsgeminderte Bewerber einen Platz zur Verfügung zu stellen.« Zudem besteht Skepsis, da »eine Förderung gern ›mitgenommen‹ wird für eine Leistung, die man sonst auch ohne sie erbracht hätte. Wenn aber das Geld ausschlaggebend wird, ködert man leicht die Falschen, die sehr darauf angewiesen sind und die das Wohl der Leistungsgeminderten erst in zweiter Linie sehen.
Trotzdem erscheint es mir vernünftig, wenn man versucht, in den Betrieben Bedingungen zu schaffen, unter denen ›Unterstützte Arbeit‹ möglich ist, und das wird ohne Finanzierung nicht gehen.« Gleichwohl meint Berater A, dass ArbeitgeberInnen, die Menschen mit Behinderungen einstellen, »tatsächlich einen Beitrag leisten wollen zur Integration von Behinderten. Einen wirtschaftlichen Anreiz dafür gibt es sicherlich nicht. Selbst die Tatsache, dass man sich vielleicht damit ›rühmen‹ kann, so dass das dem Ansehen der Firma nützt, wird kaum wirtschaftlichen Nutzen haben. Vielleicht sind diese Arbeitgeber auch selbst durch Behinderungen in der eigenen Familie dafür mehr sensibilisiert.«
Für Berater B könnten »persönliche Betroffenheit« und Kontakt mit behinderten Menschen im »Verwandtenkreis« ArbeitgeberInnen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen motivieren.
Berater C nennt als Motiv spontan: »Kohle.« Andererseits »gibt es aber auch inzwischen eine Reihe von Arbeitgebern, die einfach sagen: ›Ich habe eine Verantwortung.‹«
Berater D sieht bei ArbeitgeberInnen »oftmals persönliche Motivation, also im Bekanntenkreis irgend jemand und (man hat) gute Erfahrungen gemacht oder (ist) aus eigener Familie damit schon mal in Berührung gekommen.« Es gibt aber auch Arbeitgeber, »die auch Bock haben, einfach mal so was mitzumachen und mal so eine Geschichte ausprobieren und so, dann auch übernehmen.«
Nur vermuten kann Berater E, warum ArbeitgeberInnen Menschen mit Behinderungen einstellen, denn »ich kann es nicht belegen mit direkten Aussagen. Überall gibt es ja Leute, die ein Verantwortungsgefühl für alle um sie herum haben, auch bei Arbeitgebern. Und dann gibt es Leute, die in der Verwandtschaft und Freundschaft auch jemanden kennengelernt haben, der wenig kann, und denen das dadurch konkret geworden ist, dass das solche Arbeitsplätze geben muss. Und größere Betriebe sind verpflichtet nach Schwerbehindertengesetz, Arbeitsplätze anzubieten und müssen sonst diese lächerliche Pflichtabgabe bezahlen - da werde ich ja auch jeden Tag wütend, wenn ich daran denke, was das für ein Groschen ist.«
Berater F nennt als vermutbare Motive zur Einstellung von Menschen mit Behinderung »Betroffenheit, emotionale Anrührung und Anmutung durch die Medien. An dieser Stelle sind wir doch, glaube ich, am ehesten zu kriegen. Und wenn einmal gute Erfahrungen gemacht worden sind, dann kann man das auch wiederholen und auswerten, verbreiten und multiplizieren.«
Berater G sieht unterschiedliche Motivationen, einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Zum einen kennt Berater G aus der Praxis einen Arbeitgeber, der sagt, »unser Betrieb ist hanseatisch und konservativ, aber sozial eingestellt«, und der meint, »wir wollen also diesen Jugendlichen eigentlich ganz normal wie andere behandeln in dem Moment, wo er sich einigermaßen bei uns einfügt.« Dann sieht Berater G da noch die »Schicken und Reichen«, die die »hanseatisch-soziale Masche fahren« und das mehr aus Prestigegründen tun: »Wenn es uns schon so ›saugut‹ geht hier in Hamburg, dann müssen wir aber auch sehen, denn wir sind ja auch sozial, vielleicht kommen wir ja dann auch in die Presse.« Berater G meint außerdem, man müsse die ArbeitgeberInnen »schon locken, ... weil das sind eben nicht die Leute, die man auf dem Arbeitsmarkt eigentlich haben will.«
»Geld« vermutet Berater H als eine wesentliche Motivation bei ArbeitgeberInnen, doch oft sagen ArbeitgeberInnen auch: »Ich gucke mir den mal an, wenn er okay ist, dann ist mir das egal, ob der gut hört oder schlecht sieht, wenn der hier reinpasst, dann mache ich das.« Berater H meint, »dass die meisten Betriebe natürlich ein Interesse haben, dass ihr Laden läuft, dass die Mitarbeiter zuverlässig sind und ihre Arbeit machen.« Berater H bekommt auch häufig solche Rückmeldungen von Betrieben: »Wir nehmen gerne diese Jugendlichen, weil die haben so eine gute Arbeitstugend, weil die dann häufig auch so froh sind, dass sie diesen Job haben.«
Zwischenfazit zur Motivation von ArbeitgeberInnen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen
In den vorangegangenen Vermutungen dominieren jeweils in unterschiedlicher Kombination und Bedeutung folgende Motivationen (mit Mehrfachnennungen):
-
Persönliche Kontakte zu Menschen mit Behinderung innerhalb des Familien- und Verwandtenkreises, also biographische Anteile (A, B, D, E)
-
Gute Erfahrungen (D, F, G, H)
-
Geld in Form von Förderungszuschüssen, weniger Ausgleichsabgabe etc. (A, C, E, H)
-
Soziales und gesellschaftliches Verantwortungsgefühl (A, C, E, G)
-
Oberflächliche Imagepflege (G)
Bemerkenswert erscheint, dass die beiden am häufigsten genannten Motive einen positiven Beiklang haben - der Glaube an die Möglichkeiten der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt ist nach wie vor vorhanden.
Berufliche Integration ist für Berater A in vollem Maße »eigentlich dann erfolgt, wenn ein Arbeitsplatz auf dem ungeschützten Arbeitsmarkt ohne Förderleistungen von irgendeiner Seite besessen wird. Eine Integration würde ich auch noch akzeptieren, wenn in einem Betrieb ein ›unterstütztes Arbeitsverhältnis‹ besteht. Bei Werkstattarbeitsplätzen bin ich schon geneigt, nicht mehr eine Integration anzunehmen. Aber das ist wohl mehr eine ›Empfindung‹.«
Für Berater B macht sich berufliche Integration weniger an einem bestimmten Status oder einer Institution fest, sondern am subjektiven Empfinden: »Im Grunde genommen ist für mich eigentlich wichtig, dass derjenige seinen Platz in der Gesellschaft findet, mit dem er leben kann. Und der eine braucht vielleicht einen Beamtenstuhl, um sich wohlzufühlen und der nächste kann vielleicht auch auf dem Kiez Tätowierer werden, wenn er sich dabei wohlfühlt und für sein Leben klar kommt. Und da ist einfach der Beruf das Standbein, denke ich und eben auch eine Sache, über die man sich zumindest in dieser Kultur eben (definiert). Ich denke mal, wenn das für den Menschen, (wenn) der (das) irgendwie in Deckung kriegt, dann ist (das) für mich ›integriert‹.« Auch wenn formal »jemand seine zwei Jahre Arbeitstraining gemacht hat und in den Produktionsbereich übergewechselt ist, dann gilt er für uns als integriert. Und insofern gibt es ja gar keine Notwendigkeit der beruflichen Rehabilitation. Er ist ja in unserem Sinne eingegliedert.«
Für Berater C bedeutet berufliche Integration »vor allen Dingen, alle, mit denen wir da so zu tun haben, so weit zu bringen, dass sie bis zu einem gewissen Grade diese Gesellschaft und ihre Mechanismen auch mit durchschauen, ihre Interessen vertreten können und Kenntnisse erwerben, mit denen sie auch in der Freizeit was tun können.« Berater C gibt sich nicht der »Illusion« hin, »dass das bei allen irgendwie gelingt.« Beruflich integriert sein heißt für Berater C auch, »für ihr eigenes Empfinden zu wissen: Ich habe hier was geleistet. Ich habe das und das an Abschlüssen erworben. Ich kann mich in dieser Gesellschaft besser zurecht finden.«
Berater D versteht unter beruflicher Integration, »dass jeder seinen Platz findet, den er kann.«
Für Berater E bedeutet berufliche Integration zu versuchen, »was zu finden, was diesen Menschen und seinen Fähigkeiten wirklich ganz gut entspricht, dass er nicht dauernd unterfordert ist und unglücklich ist und nicht dauernd strampeln muss und überfordert ist und zu viel von sich verlangt und krank wird. Also, dass es einigermaßen zu den Fähigkeiten passt.«
Für Berater F bedeutet berufliche Integration »dabei sein, wie alle anderen auch, mittun, nicht außen vor sein.«
Berufliche Integration heißt für Berater G, »in seinen Job zu kommen, so halbwegs so, dass man einen Kompromiss auch guten Herzens eingehen kann, ohne dabei unglücklich zu werden, auch Geld dabei zu verdienen und sich auch etwas leisten zu können und existieren zu können.«
Berufliche Integration bedeutet für Berater H, »dass jeder Mensch seinen Fähigkeiten angemessen eingesetzt werden kann und wenn das auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist, ist das gut.« Berater H findet es aber auch nicht immer schlecht, »wenn jemand in einer Werkstatt eingesetzt werden kann, weil wenn es seinen Fähigkeiten entspricht und der Mensch sich da wohlfühlt, habe ich damit auch kein Problem.« Integration heißt für Berater H nicht »zwanghaft integrieren in das, was wir als normal sehen, sondern ich finde, jemand, der 500 Mark verdient, indem er da Arzneimittel verpackt und dabei glücklich ist, ist für mich auch integriert.«
Zwischenfazit zum Verständnis von beruflicher Integration
Berufliche Integration bedeutet für die meisten BerufsberaterInnen, dass jemand seinen Platz in der Gesellschaft findet und sich nicht ausgegrenzt fühlt. Dieses Verständnis impliziert nicht unbedingt vom Status die berufliche und soziale Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Es geht mehr um das subjektive sich Integriert-Fühlen als um ein objektives Integriert-Sein eines Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. Trotz dieser Gemeinsamkeiten sind unterschiedliche Tendenzen bezüglich des Verständnisses von beruflicher Integration vorzufinden:
-
Berufliche Integration wird vor allem als institutionelle Eingliederung verstanden (A, B).
-
Beruflich integriert zu sein, bedeutet primär für den einzelnen Zufriedenheit und bedingt nur sekundär bestimmte Fähigkeiten seitens des zu Integrierenden (D, E, G, H).
-
Berufliche Integration bedeutet vor allem gesellschaftliche Partizipation (C, F).
Die Berater werden gebeten, resümierend verschiedene Satzanfänge zu vervollständigen. Sie ergänzen den Satzanfang wie folgt: ›Die Hamburger Arbeitsassistenz ist angemessen für Menschen ...‹
A: »die eine geistige Behinderung haben und die auf dem normalen Arbeitsplatz nicht einzugliedern sind.«
B: »die sich durch ihr Angebot angesprochen fühlen.«
C: »die auf keinen Fall in eine Werkstatt sollten, weil die da völlig unterfordert sind und die der erste Arbeitsmarkt zunächst einmal nicht aufnimmt.«
D: »mit geistiger Behinderung.«
E: »die auf der Grenze zwischen der Werkstatt und dem allgemeinen Arbeitsmarkt stehen.«
F: »die auf dem Arbeitsmarkt durch alle Raster fallen.«
G: »die arbeiten wollen und auch in gewissem Umfang arbeiten können auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.«
H: »die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ohne Begleitung arbeiten können.«
Aus den Statements sind folgende Tendenzen abzulesen:
-
Die Klientel der Hamburger Arbeitsassistenz wird bestimmt durch Behinderungen oder anderen Kategorien (A, D, E, G, H).
-
Die Klientel der Hamburger Arbeitsassistenz leitet sich aus bestehenden unpassenden Strukturen ab (F).
-
Die Klientel der Hamburger Arbeitsassistenz definiert sich durch ihren eigenen Willen (B, C).
›Die Werkstatt für Behinderte ist da für Menschen ...‹
A: »die auch eine Behinderung, meistens eine geistige Behinderung haben und die sich damit zufrieden geben.«
B: »die ihrer Betreuung bedürfen.«
C: »deren Behinderung als so gravierend eingestuft werden muss, dass nach unserer Einschätzung Arbeitsassistenz sie überfordern würde.«
D: »mit geistiger Behinderung.«
E: »die gewiss nicht im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, aber nach einiger Zeit. In der Werkstatt sollte man schon gucken, ob jemand vielleicht so weit gekommen ist, dass es dann gehen könnte.«
F: »die auf dem Arbeitsmarkt nicht untergebracht werden können, mit aller Mühe nicht, zu-nächst, möchte ich sagen, zunächst nicht untergebracht werden können - immer mit Option versehen: Das lernt man, das muss man.«
G: »die dauerhaft oder vorübergehend nicht unter den Härten und Gegebenheiten des allgemeinen Arbeitsmarktes zurecht kommen würden.«
H: »die nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzbar sind und sich mit den Gegebenheiten in einer Werkstatt auch arrangieren können.«
Die für die Werkstatt für Behinderte in Frage kommende Klientel wird von den Befragten ebenfalls unterschiedlich beschrieben:
-
Die Klientel der Werkstatt für Behinderte leitet sich aus Behinderungs- oder anderen Kategorien ab (A, C, D).
-
Die Klientel der Werkstatt für Behinderte wird definiert anhand von Unterstützungsbedürfnissen (B, E).
-
Die Klientel der Werkstatt für Behinderte leitet sich ab von gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen, vor allem auf dem ersten Arbeitsmarkt (F, G, H).
›Unterstütze Beschäftigung bedeutet ... ‹
A: »dass für leistungsgeminderte Arbeitnehmer Arbeitsplätze vorgehalten werden, die ohne eine geldliche Subvention nicht wirtschaftlich wären und entfallen würden.«
B: »hoffe ich, so viel Hilfe, wie derjenige für sein Arbeitsleben benötigt.«
C: »ein Versuch unserer Gesellschaft, Menschen mit Behinderung zu integrieren.«
D: »Unterstützung für das Arbeitsleben.«
E: »wirklich genau rausfinden, was der Jugendliche kann und mit ihm zusammen und der Firma die Arbeit bauen, die er wirklich machen kann, dass es auf die Person zugeschnitten ist.«
F: »Begleitung, helfen, sich an einem Arbeitsplatz zurechtfinden, um dann allein die Arbeit bewältigen zu können.«
G: »das kann viel bedeuten. Das ist nicht gekoppelt an geistig Behinderte. Das kann jeder mal gebrauchen, selbst wenn er ganz hoch im Job sitzt.«
H: »bedeutet beides: Arbeitsassistenz und Werkstatt unterstützt Menschen bei ihrer Berufsausübung, was immer das ist.«
Diese Aussagen geben Auskunft über ein insgesamt eher diffuses Bild der BerufsberaterInnen zum Begriff Unterstützte Beschäftigung (vgl. Kap. 1.3). Daraus ergeben sich drei unterschiedliche Tendenzen:
-
Die Aussagen über unterstützte Beschäftigung bleiben eher nebulös (G).
-
Die Aussagen über unterstützte Beschäftigung sind weniger konkret (A, B, H).
-
Die Aussagen über unterstützte Beschäftigung sind eher eindeutig (C, D, E, F).
›Beruflich integrierbar ist ... ‹
A: »das hängt davon ab, welche Leistungen er erbringen kann und was der Arbeitsplatz an Anforderungen stellt.«
B: »ich glaube fast jeder, der möchte.«
C: »wer über ein Mindestmaß an sozialer Kompetenz verfügt.«
D: »wer es kann und der es will.«
E: »wer ein Mindestmaß an - wie hieß es - wirtschaftlich verwertbare Arbeit machen kann. So heißt das, glaube ich, in unserem Gesetz - wer in der Werkstatt arbeiten kann.«
F: »fast alle, fast alle, fast alle.«
G: »eigentlich jeder, wenn die Gegebenheiten sich darauf einstellen. Was unten bei rauskommt, ist eine andere Frage. Also die gesellschaftlich verwertbare Arbeit ist eine Definition, die nicht qua Gott gegeben ist, sondern die von Menschen gemacht wird.«
H: »wer heute den leider sehr hohen Normen und Anforderungen in der Gesellschaft genügt. Das sollte nicht so sein und die Arbeitsassistenz hilft ein bisschen mit, das abzufedern. Aber es ist leider immer noch so, dass die Leute passförmig gemacht werden.«
Den Aussagen zufolge gibt drei unterschiedliche Auffassungen von der Klientel, die beruflich integriert werden kann:
-
Beruflich integrierbar ist, wer allgemein definierten Standards entspricht (A, E).
-
Beruflich integrierbar ist, wer den Willen und die Fähigkeiten dazu hat (C, D, F, H).
-
Beruflich integrierbar ist jeder, wer es will (B) oder wenn sich die Bedingungen entsprechend verändern (G).
Ergänzend wird ein weiteres Interview geführt zur Frage, welche Funktion der psychologische Fachdienst im Rahmen der Beratung hat und welche Verfahren dort angewandt werden. An diesem Interview nehmen mit dem Befrager zwei Personen teil, der Leiter dieses Fachdienstes (im folgenden Psychologe L) und ein langjähriger Mitarbeiter (im folgenden Psychologe M). Auch dieses Interview wird aufgenommen, transskribiert, inhaltsanalytisch ausgewertet und von den Befragten kommunikativ validiert.
Der psychologische Fachdienst ist, wie Psychologe L erläutert, eine ergänzende Abteilung im Arbeitsamt ohne direkten Publikumsverkehr: »Wir haben keinen direkten Zulauf, das heißt, die Leute können nicht direkt zu uns kommen, sie machen das zwar manchmal, aber wir sind dann gehalten, sie an die Fachabteilungen zu verweisen und wir erstellen oder leisten unsere Arbeit nur im Auftrag der Fachabteilung. ... Das Hauptgebiet und weswegen wir eines Tages mal eingerichtet worden sind, sind diese Fachdienstgutachten.« Sie werden von dem Fachdienst für den gesamten Bereich des Arbeitsamtes erstellt, d.h. die »Klientel fängt an etwa bei 14 und hört auf bei Ende 50 theoretisch. ... Und es umfasst die ganze Spanne von Leuten, die eigentlich weiter keine Erkrankungen oder Beeinträchtigungen oder psychische Auffälligkeiten haben, aber gerne etwas über ihre Eignung erfahren möchten, bis hin zu Leuten, die Beeinträchtigungen in allen möglichen Richtungen haben. Das können Beeinträchtigungen des Intellekts sein, also Geistigbehinderte, Lernbehinderte und so weiter, es können aber auch körperliche Beeinträchtigungen sein und es können insbesondere auch psychische Beeinträchtigungen sein.« Die Aufgabenstellung dreht sich in der Regel »darum, dass wir behilflich sind, bei dieser Weichenstellung mitzuwirken, d.h. also zu sagen: ›Aha, der braucht die und die Unterstützung, der braucht die und die Hilfen, da ist vom Potential her das und das möglich. Hier sollte man lieber damit warten und vorher noch das und das machen usw.‹« Wie Psychologe M präzisiert, werden auch konkretere Fragestellungen an den Fachdienst herangetragen, etwa »ob die ›Arbeitsmarktreife‹ vorliegt, oder ob die Teilnahme an einer Maßnahme einer WfB angezeigt ist.«
Je nach Voraussetzungen der Ratsuchenden müssen dann die entsprechenden Vorgehensweisen gewählt werden: »Je stärker die Beeinträchtigung ist, desto aufwendiger ist natürlich die Ansprache der Leute. Wenn sie also meinetwegen eine Schulklasse z.B. nehmen, die z.B. ein Programm zur Berufswahl macht, dann können sie im Grunde genommen die Leute alle in einen Raum setzen, können mit denen Aufgaben machen. ... Je größer die Beeinträchtigung, die Handikaps werden, desto schwieriger ist es - sie können nicht 15 Geistigbehinderte nehmen, und sie in einen Raum setzen und sagen: ›So, Jungs und Mädchen, nun geht's mal los, setzt mal schön die Kopfhörer auf und zack.‹ Sondern das gestaltet sich dann immer aufwendiger bis hin zur Einzeluntersuchung.«
Damit stellt sich - bei Menschen mit geistiger Behinderung schärfer als bei anderen - die erste diagnostische Herausforderung, wie Psychologe M darstellt, nämlich zu sehen, »welche gruppentauglich oder nicht gruppentauglich sind.« Als KandidatInnen für das Ambulante Arbeitstraining gelten dabei eher die, »die schon ein bisschen gruppentauglicher sind«, doch auch sie sind von der Schule her nur Kleingruppen bis zwölf Personen gewohnt. Sonst gibt es noch kleinere Gruppen im Reha-Bereich: »Das schwankt dann so zwischen eins und vier.« Weiter sind verschiedene Aspekte für die Wahl der Gruppengröße wichtig, etwa »wie gut die einzelnen die Kulturtechniken beherrschen« und »wie gut jemand überhaupt so ein Aufgabenverständnis« hat. Auch spielt eine Rolle, welche Verfahren angemessen sind, »dass wir dann für mehrere nicht die Sonderschulbatterien laufen lassen, sondern eine Extrabatterie für Geistigbehinderte.« Sonst könnte es passieren, dass erstere »schon so weit oben in Anführungsstrichen im Niveau ansetzen, dass die Fähigkeiten, die diese potentiell Geistigbehinderten haben, gar nicht erkannt werden. Es würde dann alles nur unterdurchschnittlich oder weit unterdurchschnittlich sein.« Daher sind »spezielle Verfahren anzuwenden, bei denen Förderschüler jedoch unterfordert und schnell gelangweilt wären.« Insofern spielen Tempo und Ausdauer eine wichtige Rolle: »Es muss schon eine Aufmerksamkeitsspanne von ein bis eineinhalb Stunden sein, dann die Pause, dann noch mal so ein Zyklus durch und vielleicht noch mal eine kurze Pause. ... Die Teilnehmer sollten auf diese Art Aufgaben mit Pausen von 8 bis 13 Uhr mitmachen können. Aber da ist auch ein großes Fragezeichen dahinter, ... bei manchen geht nämlich die Kurve schon ab elf Uhr 'runter und dann setzen die ganzen Eigenheiten im Arbeitsverhalten ein.«
Junge Leute mit Körperbehinderungen müssen ebenfalls häufig einzeln untersucht werden. »Bei nicht wenigen Rollstuhlfahrern stellt sich die Frage der Hygiene und Selbstversorgung. Was da an Schulen so alles mitgetragen wird, ist schon manchmal erstaunlich. ... Wenn wir mögliche Probleme im Vorfeld sehen oder zumindest befürchten, dann neigen wir natürlich auch erst mal zur Einzeluntersuchung. ... Und manche sind aber auch so stark motorisch beeinträchtigt, dass sie auf Fragebögen kaum richtig das Kreuz treffen, geschweige denn richtig leserlich ihren Namen schreiben - oder das dauert dann sehr lange.«
Psychologe M macht auch Grenzen deutlich: »Das Problem ist auch bei manchen, ... dass es zur Untersuchung an sich dann gar nicht kommt. ... Wir erkennen zwar, sie sind nicht so schwer behindert, dass sie sich und andere gefährden, so dass sie also gleich in entsprechende Anstalten müssen. ... Da stellt sich aber sehr schnell raus, Lesen und Schreiben geht eigentlich gar nicht, ... auch Texte und so was, und da passiert nichts und das Rechnen ist im einstelligen Fingerbereich oder so, dann ist aber auch hier Schluss. Und manche können sich auch nur ein, zwei Stunden konzentrieren und sind dann an ihre Grenzen gelangt. Also, es ist eben so, dass wir dann schon solche Grundlagen einfach sehen, dass das nicht geht bzw. auch, dass die Eigenständigkeit einfach gar nicht da ist.« Mit solchen Personen »geht das dann doch mehr so Richtung Anstalten oder Tagesförderstätten oder vergleichbar betreuungsintensive Einrichtungen.«
Psychologe M berichtet über die Untersuchungsbereiche, die größtenteils mit Tests erfasst werden: Im ersten, dem »intellektuellen Bereich« wird beobachtet, »ob er sich da einigermaßen in dem zu erwartenden Bereich bewegt, und wenn nicht, dann sieht es natürlich auch schon schlechter aus, dann ist besondere Förderung notwendig bzw. es werden Grenzen sichtbar.«
Zum zweiten geht es um »einfache Arbeitsaufgaben, Buchstaben ankreuzen, Zahlen sortieren, ordnen. ... Und dabei sehen wir uns auch an: Wo liegt er vom Tempo her - mehr bei den Lernbehinderten oder ist er eher bei den Geistigbehinderten wiederzufinden; daran sind die Sachen ja normiert worden.« Dabei wird auch die Frustrationstoleranz mit erfasst, »so dass manche dann anfangen zu sagen: ›Jetzt reicht es. Ich kann das nicht mehr.‹ Oder: ›Es ist schwer.‹ Naja, das ist die Frage, wie aufgeschlossen sie selber sind und sagen: ›Ich will es noch mal versuchen.‹ Oder ob sie dann die Flinte schon nach einer halben Minute ins Korn werfen.«
Ein dritter Bereich der Untersuchung ist die Feinmotorik, also »Hand-Fingergeschick, also ob man einigermaßen genau arbeiten kann mit einer Schere, einem Messer, einem Stück Draht oder ähnlichem. ... Hierfür haben wir unterschiedliche Aufgaben.«
Der vierte Block beschäftigt sich mit dem Rechnen: Da gibt es »gute Gruppen, da läuft das gut, da können wir auch schon im Grundrechnen ordentlich was zulegen, und da gibt's eben auch welche, da ist dann eben schon beim Grundrechnen ganz früh Schluss. ... Beziehungsweise wenn wir ihnen ganz einfache Aufgaben geben, sind sie auch sehr engagiert dabei. Aber es sind nur Aufgaben mit 3 + 4 und 9 - 7. Das sind halt schöne Sachen, da fühlen sie sich dann bestätigt, wenn sie dabei ein Erfolgserlebnis haben.« Jedoch hört es bei den Grundrechenarten »meistens schon auf. Mehr geht dann nicht, und daneben untersuchen wir noch, wie weit jemand kommt, wenn er lange Zeit hat bzw. wie schnell er unter Zeitdruck ist.«
Der fünfte Untersuchungsbereich betrifft Lesen und Schreiben: »Mittels Leseproben versuchen wir uns ein Bild zu machen von dem, was er lesen und was er nicht lesen kann. Denn es gibt im Arbeitsleben manche Aufgaben, bei denen man zumindest eine Gebrauchsanweisung bekommt, und dann soll man aber lesen können, wie diese Maschine zu bedienen ist.« Das Schreiben wird abgeprüft »mit einfachen Schreibproben bis hin zu Diktaten, je nachdem. ... In der Regel geht es um Schreibproben, ob jemand dann seinen Namen schreiben kann, damit fängt das ja erst ein mal an, mit dem Vornamen, dass er den leserlich schreiben kann, das ist ja schon für manche schwer. Dann geht es mit dem Nachnamen weiter. Danach geht es los mit Hauptsätzen, ob sie dann einfache Hauptsätze selber schreiben - oder vielleicht nur abschreiben können.«
Der sechste Bereich schließlich ist »einfach das ganze Drumherum, das Sozialverhalten, dies ist nicht weniger wichtig. ... Also ob er auch vom Sozialverhalten her aufgeschlossen ist.« Dazu gehört die körperliche Reife, aber auch das Verhalten: »Wenn sie sich gut aufführen und diese Zeit mit durcharbeiten, ist es ein wichtiges Kriterium für uns. Wenn aber einer in der Zwischenzeit den ›Hampelmann‹ macht und es nach elf Uhr so richtig runtergeht, dann ist das leider eine ungünstige Situation.«
Unter Umständen können auch mangelnde Fähigkeiten in den Kulturtechniken durch gutes soziales Verhalten kompensiert werden: »Wenn er nicht lesen kann, dann muss er eben anderweitig ganz gut sein, um das ausgleichen zu können. Wenn er meinetwegen zeigt, dass er sehr lernwillig ist und auch sonst engagiert ist und schnell arbeiten kann, dann hat er es in der Regel auch im Praktikum irgendwo schon mal gezeigt, oder aber in der Freizeit, z.B. im Schwimmverein oder an anderer Stelle.« Psychologe L fasst dies im Begriff der »Anstelligkeit« zusammen.
Über die konkreten Verfahren hinaus verdeutlicht Psychologe L die Rahmung dieses Prozesses. Die Arbeit im psychologischen Fachdienst kann nur erfolgreich sein, »wenn Sie das lernen und geschafft haben, sich sehr schnell auf Leute einzustellen und sehr schnell zu Leuten auch Kontakt zu bekommen.« Da ist es notwendig, »ein Gespür dafür zu entwickeln, wie jetzt jemand angesprochen werden will: Signale aufnehmen und immer das richtige Maß an Distanz halten, rangehen, nicht zu dicht rangehen, wieder weggehen und so weiter. Und je mehr das gelingt und je positiver es konnotiert wird, desto leichter kommt man mit den Menschen in Kontakt. Und auch wenn 'n Geistigbehinderter sich jetzt nicht so artikulieren kann, wie das ein anderer Mensch kann, ist da ja das Nichtsprachliche, was dann da auch alles mitschwingt, es wird natürlich auch alles mit aufgenommen. ... Und das zu schaffen, das ist also wirklich, möchte ich sagen, eine Basisvoraussetzung hier von dieser Tätigkeit. Das macht es auf der anderen Seite auch sehr schwer und wie ich finde sehr anspruchsvoll hier zu arbeiten.«
Psychologe L sieht ein Vorteil darin, »dass wir ja hier in einer besonderen Rollensituation sind, und wenn jemand zum Psychologen geht, geht er da sicher auch mit einer anderen Erwartung hin, als wenn er sich mit seinem Nachbarn oder mit einem Lehrer oder mit einem Kaufmann oder sonst irgendwie trifft. Da hat er sicherlich schon die Erwartung, naja, der will mich eine Menge Sachen fragen.« Zudem erleichtert es die Arbeit, »dass wir ja nicht un-bedingt mit einer bestimmten Richtung identifiziert werden, beispielsweise wie das bei einem Lehrer der Fall ist.« So können die meisten Ratsuchenden mit einer positiveren Haltung zum Fachdienst kommen, denn man bemüht sich darum, mit ihnen eine positive Interaktionssituation zu gestalten und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen: »Hier ist es so: Wir unterhalten uns mit ihnen über alles Mögliche. Wir sprechen mit ihm darüber, was ihn interessiert, was er sich vorstellt, was er werden möchte, was seine Hobbys sind, was ihn interessiert, was ihm leicht fällt, was ihm schwer fällt, und da haben Sie natürlich immer eine Menge Anknüpfungspunkte. Und Sie erhalten dann aus den verschiedenen Bereichen immer wieder weitere Hinweise, wo Sie dann auch nachfragen können, um sich ein genaueres Bild zu machen. Das heißt, Sie haben es im Grunde genommen in der Hand, auch wenn Sie sich mit dem Menschen unterhalten, mit ihm auch ein für ihn irgendwie interessantes anregendes Gespräch zu führen, wo er den Eindruck hat, er fühlt sich also verstanden. Da hab' ich mein Interesse an ihm bekundet und er hat auch dieses oder jenes so an Rückmeldung oder Signal bekommen oder auch nachher am Ende vielleicht eine Empfehlung oder auch einen Rat bekommen, der ihn weiterbringt. Und das bringt die Leute in eine Situation, in der sie nicht unbedingt verschließen, weil sie etwas sowieso nicht interessiert oder sie etwas total blöd finden.«
Dennoch gibt es auch Ratsuchende, bei denen dies schwieriger ist: »Manchmal kommen Leute vielleicht auch mit Erwartungen hierher zu uns: Ach, jetzt muss ich einen Test machen, um Gottes Willen, das ist aber etwas Furchtbares. ... Ich werd' geprüft oder ich muss dahin oder ich weiß es nicht oder das ist der Idiotentest oder irgendwie so was. ... Obwohl das schon lange nicht mehr so durchgängig ist, wie das früher vor zehn oder 15 Jahren der Fall war, als dies im Volksmund noch verbreiteter war als heute. Aber es kommt dann eben darauf an, was Sie quasi gleich am Morgen auch für eine Arbeitsvereinbarung mit demjenigen hinbekommen, weil es ist ja irgendwo ein gemeinsames Arbeiten.«
Insofern stellt sich die Herausforderung, über den Aufbau einer Beziehung mit den Ratsuchenden erst einmal die Voraussetzung für eine produktive Testsituation zu schaffen. »Und entweder Sie schaffen das oder Sie schaffen es nicht, und wenn Sie das nicht schaffen, dann sind auch Ihre Ergebnisse nur die Hälfte wert. Oder Sie kommen gar nicht so weit oder die Ergebnisse sind auch verfälscht oder Sie haben das Potential nicht erkannt, was vielleicht doch vorhanden ist. ... Man kann sich das ja auch leicht vorstellen, also, wenn man jetzt nur die Schwierigkeiten nimmt, wie schwierig das jetzt diesen Ratsuchenden fällt, bestimmte Aufgaben zu bewältigen. Und wenn Sie sich das nicht klarmachen, darauf keine Rücksicht nehmen und diese Dinge, wie das Bloßstellen vor den anderen, aber auch das Aufmuntern oder auch das Vermitteln eines Erfolgserlebnisses bei den bestimmten Dingen, die gekonnt werden - wenn Sie zum Beispiel solche Dinge nicht beherzigen, ja, dann ist es ganz klar, dass der Weg sich gabelt und da führt er dann den Berg runter, ja. Weil derjenige dann doch mehr entmutigt ist - der kann das niemals reflektieren und Ihnen jetzt mit gestochenen Worten analytisch erläutern, warum er sich nun frustriert und entmutigt fühlte, der ist dann einfach so. Und Sie merken dann und kriegen am Ende das Ergebnis und sagen: ›Oh, da war ja gar nicht viel drin.‹ Da muss man schon sehr sorgfältig und sehr feinfühlig auch sein.« Bei aller selbst-kritischen Reflexion meint Psychologe L: »Ich würde es voll unterschreiben, das ist nicht unbedingt einfach, aber wenn man sich sehr gut auf diese Situation, auf diesen Kontext auch, in dem wir unsere Arbeit machen, einstellt, dann kann man das, meine ich, auch sehr effektiv betreiben.«
Dieser sensible Umgang mit den Ratsuchenden muss sich durch den ganzen Prozess ziehen bis zum Ende, denn, so Psychologe M, »danach findet ja immer noch ein Nachgespräch statt, ... das ist mit jedem dann einzeln.« Dazu kommen dann häufig Vertrauenspersonen, »je nachdem, wie das Verhältnis zwischen dem Jugendlichen und seinen Eltern oder dem Betreuungs-personal, was da mitkommt, ist. ... In der Regel sind die Behinderten auch froh, wenn jemand mitkommt, weil sie häufig selber nicht alles so überblicken, und dann sind sie erleichtert, wenn da jemand ist, der versteht, worum es geht.« Die Maxime, ergänzt Psychologe L, »ist größtmögliche Transparenz. Also auch um die Leute mit einzubeziehen und auch das Bemühen, den jüngsten Ratsuchenden und den einfachsten Ratsuchenden so mündig wie möglich zu behandeln. ... Gleichwohl ist es natürlich so, dass man immer abwägen muss, wie groß ist die Differenzierungsmöglichkeit, was kann verstanden werden, wie kann ich jetzt etwas vermitteln.«
Neben vielen Fällen, in denen die Zusammenarbeit zwischen Eltern von behinderten Kindern und der Berufsberatung und dem Psychologischen Dienst sehr konstruktiv verläuft, gibt es leider auch Fälle, in denen die Eltern einer Untersuchung und Beratung im Psychologischen Dienst sehr skeptisch gegenüber stehen und dem Psychologischen Dienst zum Teil mit offenem Mißtrauen begegnen. Zu diesen Situationen führt Psychologe L, selbst Vater, aus: »Diese Eltern sind dann häufig in Sorge, dass ihrem Kind im Psychologischen Dienst Unrecht getan wird, es nicht gerecht behandelt wird, es zu schlecht beurteilt wird, sein Potential nicht erkannt wird und eine negative Rückmeldung dem Kind Schaden zufügen und es abstempeln könnte. Mühevolle Förderung, so die Sorge, könnte zunichte gemacht werden. Gerade wenn Eltern ein behindertes Kind haben, dann ist ja der Schritt zu einem Schuldgefühl und zu einem schlechten Gewissen wegen dieser Behinderung ein sehr kleiner. Das äußert sich dann natürlich auch in der Erziehung der Kinder und in allem weiteren Umgang, sprich, es ist ganz verständlich, dass die Eltern dann sozusagen in Anführungsstichen alles wieder gutmachen wollen. ... Von daher wollen die Eltern natürlich möglichst viel erreichen, investieren einerseits sehr viel in die Förderung, andererseits kann das soweit gehen, dass quasi augenscheinliche Einschränkungen der Kinder regelrecht ausgeblendet werden von den Eltern. Also dass das Kind eine geistige Behinderung hat, ist gar nicht mehr wichtig - es steht unmittelbar vor der mittleren Reife und wir denken über das Abitur nach, um jetzt mal zu überzeichnen.«
Hier hat die Bildungspolitik mit ihren Bestrebungen um immer mehr hohe Abschlüsse ihren Anteil, aber speziell auch Integrationsklassen haben eine problematische Wirkung, denn sie »befördern diesen Gedanken ja. Nach dem Motto, mein Kind ist doch eigentlich ebenso gut wie alle anderen auch. Es ist doch schon in der Klasse sowieso und es kommt immer darauf an, dass man die Kinder nur richtig fördert. ... Manche Eltern laufen Gefahr, dann das richtige Maß zu verlieren, ... was sind die Möglichkeiten, was sind aber auch irgendwo die Grenzen. Als wäre, wenn das Kind jetzt noch die mittlere Reife bekommt oder den Realschulabschluss, dann alles wieder in Ordnung, dann ist mein Kind eigentlich gar nicht mehr behindert - so quasi. Und dann ist das, was bei der Geburt oder sonst irgendwie in der Schwangerschaft oder durch Unfall etc. schiefgegangen ist, alles wieder kompensiert. Also wir haben uns jetzt soviel Mühe gegeben und wir haben alles wieder gutgemacht und wieder ausgeglichen. Das ist jetzt natürlich ganz bewusst drastisch formuliert.«
Vor aller Bearbeitung des eigenen Traumas nehmen diese Eltern gemäß der Beobachtung von Psychologe L gar nicht wahr, was sie ihrem Kind signalisieren: »Das Schlimme daran ist aus meiner Sicht, dass die Eltern gar nicht begreifen, was sie in solchen Fällen damit ihren Kindern antun können. Denn das Kind spürt aus meiner Sicht sehr wohl diesen ständigen Druck der Eltern und diese ständige Überforderung, die damit verbunden ist, und auch wenn es geistig behindert ist. Es kann dabei gar nicht zur Ruhe kommen, denn das spürt das auch, nimmt es auch irgendwo auf. Ich denke, es würde ... dem Kind viel besser tun, das eben auch so zu akzeptieren und ihm das Gefühl zu vermitteln: ›Du bis auch so okay, und wir suchen einen Rahmen für dich, wo man die Dinge, die du kannst, anerkennt und wo die ihren Sinn machen und wo das in Ordnung ist.‹ ... Bloß das, glaube ich, liegt den Eltern sehr fern, gerade wenn sie selbst hohe Bildungs- und Berufsabschlüsse haben, wo dann so ein Kind sicherlich dann auch als besonderer Makel erlebt werden kann.«
Diese in der Integration engagierten, aber letztlich die Behinderung ihres Kindes verleugnenden Eltern, so die Wahrnehmung von Psychologe L, sind dann auch für das Arbeitsamt problematisch: »Wenn Eltern sich davon kaum abbringen lassen, dann machen sie - ich möchte sagen, uns hier im Psychologischen Dienst noch weniger - gerade den Beratern das Leben sehr sehr schwer, und da tun mir die Berater manchmal leid, die sich dann wirklich mit diesen Leuten ärgern müssen und die dann überzeugen müssen und händeringend dann auch nach einem Fachgutachten greifen und sagen: ›Hier steht es doch auch schwarz auf weiß. Und das hat sich doch weder der Arzt noch der Psychologe jetzt aus den Fingern gesaugt, so ungefähr.‹ Ja, das kann dann auch schon mal konfliktreich zugehen, denke ich.«
Auf die Größe des Anteils in dieser Weise agierender Eltern legt sich Psychologe L nicht fest; auch Psychologe M sieht dies als schwierig an: »Es gibt einen Teil von den Eltern, die selber schwimmen, die hin- und hergerissen sind. Auf der einen Seite sehen sie das Fragezeichen mit dem Arbeitsmarkt: ›Das kann ja alles nicht hinhauen und das war schon immer mit meinem Sohn schwer, und ich weiß es eigentlich auch gar nicht, was ich machen soll.‹ ... Und ein anderer Teil meint auf der anderen Seite fürsorglich: ›Wir wollen unseren Jungen oder Mädel nicht überfordern, und die vom Arbeitsamt wissen das eigentlich am besten, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, und wenn Sie als Berufsberater uns das empfehlen‹, - dann wird das zwar nicht offiziell gesagt - ›aber dann würden wir uns schon danach richten.‹ ... So erlebe ich das, dass also ein Teil uns sehr wohlwollend gesonnen ist und ein Teil eben so selber schwankt und einen Teil - ... ist es dann wirklich so.« Bei diesem dritten Teil kommen die beschriebenen Verdrängungsmechanismen vor und es treten Konflikte auf. »Aber das ist das Ärgerliche für die Jugendlichen, dass die das dann eben durch das Leben zu spüren bekommen.«
Was Zuweisungskriterien für das Ambulante Arbeitstraining angeht, so sollten nach Psychologe M die Ratsuchenden »eine gewisse Eigenständigkeit mitbringen, d.h. dass sie irgendwie mal potentiell mit oder ohne Aufsicht acht Stunden im Erwachsenenkreis ›mitspielen‹ können, nicht nur Kinderallüren haben, sondern dass man ihnen auch Anweisungen geben kann und sie sich daran halten. Wenn man zum Beispiel sagt, man macht 'ne Pause, dass sie auch wiederkommen.« Weiter »gehen wir davon aus: Wie kann denn derjenige denn auch Einzelinstruktionen verstehen, wie setzt er das um und bemüht er sich auf Dauer? ... Und wenn er sich einigermaßen bemüht und das versteht, dann ist das schon ein gutes Zeichen.«
Insgesamt begrüßt Psychologe M das Ambulante Arbeitstraining »von dem Gedanken her, dass man erst mal die Leute sozusagen auf einen potentiellen Platz setzt und sagt, jetzt sollen sie mal zeigen, wie gut sie mitkommen, und man versucht, sie anfangs stärker zu betreuen und dann immer ein bisschen weniger, und dann gleitet das langsam aus ..., und man sozusagen den Klienten, diesen Part von Leuten hat, von denen man noch nicht weiß, geht das später mal nach oben, - heißt: können die mal auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich arbeiten oder ganz Gute vielleicht mal auf ein Helferniveau irgendwie durchrutschen - oder ist doch nur Werkstatt für Behinderte auf Dauer möglich, also geht es dann doch noch weiter runter, und um sozusagen die Spreu vom Weizen so zu trennen.«
Gleichwohl hat Psychologe M Bedenken wegen der Klientel: »Es muss eben nur in einem realistischen Kontext immer sein und es darf nicht zu viel sozialpädagogische Betreuung sein - das muss dann eben klar sein, die ebbt dann ab - oder man muss dann eben deutlich Stellung beziehen und sagen: Es geht einfach nicht, weil man doch einen zu hohen Betreuungsaufwand im Hintergrund haben muss.«
Bei den jungen Leuten mit geistiger Behinderung »sind sehr viele drunter, da wird gleich klar, da ist die ganze Selbständigkeit, die Sozialanpassung, aber auch die Verständigung so schwach, dass leider kein nennenswertes Potential vorhanden ist. Deswegen wäre es dann auch aus meiner Sicht überflüssig oder rausgeschmissenes Geld, den Leuten dann noch zu sagen, ja, man muss nur alles betreuen und sie müssen sich nur im Alltag mal bewähren und dann werden sie das schon schaffen. Es gibt einfach so viele Mitmenschen, und so habe ich den Eindruck, da kann man froh sein, dass es Werkstätten für Behinderte gibt. ... Manche rutschen ja so weit runter, dass ich noch nicht mal die Werkstatttauglichkeit sehe, sondern einfach nur sagen kann, ich bin froh, wenn der auf Dauer in den Anstalten seinen Platz außerhalb des Elternhauses findet, denn wir haben ja nicht wenige, die sind die jungen Häschen, die dann mit 28 oder 35 aus dem Hause rausmüssen, weil die Eltern schon lange berentet sind.«
Psychologe M plädiert dafür, realistisch zu bleiben, auch Betrieben gegenüber: »Da muss man einfach sagen, es gibt auch gewisse Grenzen und man kann in den Betrieben kein grenzenloses Verständnis voraussetzen. Wenn jemand sich nicht selber windeln kann ... Da sollte man die Kirche im Dorf lassen, das ist das Wichtige, denke ich bei dieser ganzen Problematik. Und wie gesagt, ein Teil von denen, die uns besuchen, kann in diese Richtung gehen, aber es sind sehr viele, bei denen man sagen muss, es geht jetzt noch nicht oder es wird nie gehen.«
Insofern, betont Psychologe L, kommt es für das Arbeitsamt »auch auf eine gute Einschätzung an, dass halt auch die richtigen Leute dann dort hinkommen. Das ist vielleicht auch manchmal nicht einfach, da immer regulierend einzugreifen, weil natürlich immer auch unterschiedliche Interessen bestehen. Die Einrichtungen selbst haben natürlich immer das Interesse, sich möglichst auszudehnen, das ist ja völlig klar. ... Aber da muss man sich irgendwann die Frage stellen: Würde es sich da auch noch lohnen oder sollen die nicht lieber doch in einen anderen Bereich gehen?« Psychologe L findet insofern auch den Grundsatz der Durchlässigkeit zwischen Arbeitsassistenz und Werkstätten für Behinderte wichtig; hierbei bekommen die Werkstätten durch neue Gesetze zusätzlichen »Druck, dass sie doch mehr und mehr die Leute auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten sollen. Es gibt natürlich von vielen Kollegen sehr große Skepsis aufgrund genau dieser Erfahrung, dass das mehr wie ein ›closed job‹ ist, wenn die Leute einmal in der Werkstatt gelandet sind. Aber davon möchte man natürlich weg.« Insofern formuliert Psychologe L ein Fazit seiner Einschätzung des Ambulanten Arbeitstrainings mit zwei widersprüchlichen Tendenzen: »Ich glaube, da ist es dann wie mit so vielen Dingen: Diese Zielstellung ist eigentlich eine gute, aber es wird dann natürlich, um sie zu transportieren, wieder übertrieben. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Leute ins ambulante Training kommen, die auch dahin gehören. Aber hier sollte kein Platz für Omnipotenzphantasien sein.«
Die Aussagen der Reha-BerufsberaterInnen für die Ersteingliederung lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:
-
Kooperation erfolgt mit den Institutionen, mit denen die BerufsberaterInnen schon länger zusammenarbeiten - Sonderschulen, Werkstätten für Behinderte, Berufsbildungswerke - , in strukturell verankerter, langfristiger, kontinuierlicher, intensiver Form mit eindeutigen personellen Zuordnungen. Bei neueren PartnerInnen - allgemeine Schulen mit Integrationsklassen und Arbeitsassistenz - geschieht sie nicht strukturell verankert, sondern fallbezogen, zudem quantitativ mit mehr Distanz und qualitativ teilweise mit mehr Kontroversen.
-
Von der Kooperation gibt es durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen bei den BeraterInnen: Bei den verschiedenen Schulformen werden Engagement, Realismus und Informationsstand in verschiedenen Richtungen unterschiedlich eingeschätzt, es dominiert jedoch dabei die Einschätzung, dass dies weniger vom Schultyp als mehr von den konkreten Personen abhängig ist. Auch mit der Arbeitsassistenz werden unterschiedliche Intensitäten der Kooperation beschrieben.
-
Die Beratungssituation gestaltet sich tendenziell bei IntegrationsschülerInnen schwieriger als bei SonderschülerInnen; sei es aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen heraus, sei es auch aufgrund unterschiedlicher grundsätzlicher Orientierungen. Einige BeraterInnen beschreiben eine Anfangsphase, in der es zu sehr scharfen Konfrontationen mit Eltern kommt, die jedoch inzwischen auch aufgrund veränderter Angebotsmöglichkeiten weitgehend überwunden sind. Ein Kristallisationspunkt bei Kontroversen in der Beratung sind die psychologischen Fachgutachten.
-
Auf dem Weg zur Zuweisung zu bestimmten Maßnahmen beziehen die BeraterInnen durchweg Gutachten und andere erhobene Daten einerseits und Wünsche und Interessen der Ratsuchenden andererseits in die Betrachtung ein. Die Gewichtung erfolgt allerdings recht unterschiedlich.
-
Die unterschiedliche Gewichtung von erhobenen Daten und Wünschen zeigt sich auch bei Aussagen über Zuweisungskriterien zum Ambulanten Arbeitstraining: Eine (geringere) Tendenz geht dahin, das Ambulante Arbeitstraining vor allem als angemessen zu sehen für Grenzfälle zwischen geistiger und Lernbehinderung und dieses für maßgeblich zu halten, eine andere (größere) Tendenz priorisiert Wünsche und Interessen bei Personen mit geistiger Behinderung oder bezieht den Wünschen folgend deren Fähigkeiten mit ein.
-
Das Ambulante Arbeitstraining wird sehr unterschiedlich eingeschätzt, was seine Rolle, seinen Erfolg und eventuelle Veränderungsbedarfe angeht: Das Spektrum reicht von der Sicht einer marginale Rolle, geringen Erfolgs und eines Bedarfs an mehr Transparenz und Realismus, über eine mittlere Position, die die Maßnahme für quantitativ unzureichend, aber qualitativ gut und erfolgreich hält und über eine Veränderung der Zielgruppe nachdenkt, bis zu einer Sicht, die die Maßnahme für zukunftsweisend hält, großen Erfolg bescheinigt und ihre Ausweitung von der Menge und von der Zielgruppe her wünscht. Hier überwiegen die positiven Einschätzungen leicht gegenüber den negativen. Der Erfolg wird stark davon abhängig gemacht, wie schnell unterstützte Personen von Hilfe unabhängig werden; dabei wird die Dauersubventionierung der Werkstätten für Behinderte nicht kritisch reflektiert, ein entsprechender Bedarf im Anschluss an das Ambulante Arbeitstraining dagegen sehr kritisch gesehen.
-
Was die Motivation von Arbeitgebern angeht, Menschen mit Behinderungen einzustellen, zeichnen die BeraterInnen ein eher positives Bild: Positiv eingeschätzte Motive wie Verantwortung und biographische Bezüge bilden zwei Drittel, problematisch empfundene wie Geld und oberflächliche Imagepflege werden zu einem Drittel genannt. Damit ist allerdings noch nichts über die Gewichtung der verschiedenen Motive gesagt.
-
Berufliche Integration assoziieren die BeraterInnen vor allem damit, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Im Vordergrund steht dabei eher das subjektive Gefühl des Integriert-Seins als ein objektives Integriert-Sein. Hier wird ein individuumszentrierter Blick deutlich. Gleichwohl gibt es auch hier unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die eher institutionelle, partizipatorische oder Aspekte der Zufriedenheit betonen.
-
In den Statements, durch die die BeraterInnen zu spontaner und schneller Antwort provoziert werden, scheinen beide alltagstheoretischen Orientierungen durch: die kategoriale wie die individuelle Logik, in jeweils unterschiedlicher Gewichtung bei den Statements.
Die Ergebnisse zur Tätigkeit und Rolle des psychologischen Fachdienstes können in den folgenden Punkten zusammengefasst werden:
-
Der psychologische Fachdienst wird in einer Vielzahl unterschiedlichster Konstellationen zur Beratung hinzugezogen; insofern ist er für eine höchst heterogene Klientel - was das Alter, aber auch was Fähigkeiten und Einschränkungen angeht - zuständig. Insofern müssen die Untersuchungen in angemessenen Gruppierungen, ggf. auch einzeln stattfinden.
-
Aus den Schilderungen wird deutlich, dass als Verfahren im wesentlich Tests in Form von Batterien genutzt werden; mit ihnen werden bei SchulabgängerInnen Bereiche wie Denken, Zahlenverständnis, Feinmotorik, Rechnen, Lesen und Schreiben und Sozialverhalten erhoben. Begleitend werden Fähigkeiten wie Frustrationstoleranz und Ausdauer vermerkt.
-
Bei der Begutachtung werden die Tests gerahmt durch eine Gesprächssituation, in der als notwendige Voraussetzung für valide Ergebnisse eine Beziehung und ein Vertrauensverhältnis zur Person aufgebaut werden muss. Dabei müssen etwa Nähe und Distanz ausbalanciert werden. Durch die Rahmung können auch zusätzliche Mosaiksteine gefunden werden, die das Bild der Person komplettieren. Dies ist eine anspruchsvolle Herausforderung, die viel von den PsychologInnen verlangt.
-
Der Fachdienst sieht sich selbst in einer spezifisch positiven Rolle, da er nicht in irgendwelche, u.U. längerfristigen Zusammenhänge eingebunden ist, sondern neutral vorhandene Fähigkeiten und Unfähigkeiten feststellen kann, um so durch klare Daten bei Entscheidungen zu helfen.
-
Wenn dennoch mitunter Eltern von Kindern mit Behinderungen den Verfahren des Fachdienstes misstrauisch gegenüberstehen, dann steht seiner Sicht nach immer wieder eine Situation unverarbeiteter Traumata bezüglich der Behinderung des Kindes im Hintergrund: Es soll Normalität demonstriert werden, aber dem Kind werde dies nicht gerecht. Nach Sicht der Psychologen wird dies bestärkt durch die Bildungspolitik und speziell durch schulische Integration, indem nun der Schein von Normalität in allgemeinen Schulen leichter aufrechterhalten werden könne - auf Kosten der Akzeptanz des Kindes, das dadurch nach Meinung der Psychologen leide. Bei akademischen Eltern sei diese Tendenz besonders stark. Die Psychologen meinen, dass ein Teil der Elternschaft insgesamt sehr unsicher über die Perspektiven des Kindes ist, ein zweiter Teil ist aufgeschlossen für Ratschläge des Arbeitsamtes und ein dritter Teil besteht aus den beschriebenen problematischen Eltern.
-
Die Zuweisung zum Ambulanten Arbeitstraining erfolgt für den psychologischen Fachdienst vor allem nach Fähigkeitskategorien wie Eigenständigkeit, acht Stunden arbeiten können und an die Erwachsenenrolle angepasstes Verhalten. Sie sehen in ihm eine gute Chance, zu diagnostizieren, wer tatsächlich in Frage kommt für eine betriebliche Arbeitssituation - so kann im Betrieb die ›Spreu vom Weizen getrennt‹ werden.
-
Die Einschätzung des Ambulanten Arbeitstrainings fällt eher kritisch aus, da dort nach Meinung der Psychologen tendenziell mit der falschen Klientel gearbeitet wird. Vielmehr sollte dort mit weniger sozialpädagogischer Betreuung und mehr Realismus der kleine Teil von Personen im Grenzbereich zwischen geistiger und Lernbehinderung unterstützt werden, für den diese Maßnahme angemessen ist. Zudem wird bei aller Anerkennung von Trägerinteressen die Gefahr von dortigen Omnipotenzphantasien gesehen - dem Arbeitsamt kommt somit die Funktion zu, dafür zu sorgen, dass dort die richtigen Personen zugewiesen werden.
-
Insgesamt wird ein stark kategoriales, auf Institutionen bezogenes Denken der Gesprächspartner deutlich: Es geht um Arbeitsmarktreife, Gruppentauglichkeit, Werkstatttauglichkeit und ähnliches. Dies ist gepaart mit einer Sichtweise, die mit ihren ständigen Negativformulierungen als extrem defizitorientiert bezeichnet werden muss. Gilt dies schon für die Beschreibungen der Testsituation, so gilt es in extremer Weise, wenn es um Unterstützung bei Hygiene in der Schule, die formulierte Notwendigkeit von Anstaltsunterbringung oder die Zuweisung in eine Tagesförderstätte geht - und das ohne jede Problematisierung.
Als zentrales Dilemma der Tätigkeit und Rolle der Berufsberatung ist in den einleitenden Überlegungen (vgl. Kap. 7.1) die Notwendigkeit beschrieben worden, zwei widersprüchliche Logiken, die institutionelle und die individuelle, in Übereinstimmung oder zumindest in eine Balance zu bringen. In diesem Dilemma spiegelt sich der Hintergrund des Paradigmenwechsels in der Behindertenhilfe wider, bei dem es genau um den Wechsel von einer institutions-orientierten und defizitfixierten zu einer individuums- und kompetenzorientierten Sichtweise geht (vgl. Kap. 1.2). Dieses Balanceproblem wird durch die Aussagen der Reha-BeraterInnen deutlich bestätigt, die damit verdeutlichen, dass sie sich ebenfalls im Spannungsfeld dieses Paradigmenwechsels bewegen.
Weiter ist vermutet worden, dass die BeraterInnen dieses Dilemma je individuell unter-schiedlich handhaben dürften. Dem soll im folgenden nachgegangen werden, indem versucht wird, die qualitativen Aussagen zu quantifizieren. In den Zwischenfazits sind meist drei Tendenzen benannt worden, die in zwei Spannungsfeldern angesiedelt sind: dem zwischen Institutions- und Individuumsorientierung und dem zwischen Sonderinstitutions- und Integrationsorientierung - da beide den Kern des Paradigmenwechsels ausmachen, erscheint es logisch, sie als paradigmatische Orientierungen hier zusammenzufassen. Insofern können die Aussagen der BeraterInnen in diesem Spektrum ausgezählt werden. Demnach werden den Tendenzen die Zahlen eins bis drei zugeordnet, der institutionsorientierten die niedrigste, der individuumsorientierten die höchste. Die vermuteten Motive bei Arbeitgebern werden hier auch aufgrund der Mehrfachnennungen außer Betracht gelassen. Das Bild in der Zusammenschau zeigt Tab. 7.1:
Tab. 7.1: Rating der Aussagen der einzelnen BeraterInnen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
Kooperation |
Mit Schulen |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
mit Arbeitsassistenz |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
|
Mit Betrieben |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
|
Beratung |
Situation |
1 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
Kriterien HAA |
1 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Rolle |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
|
|
HAA |
Erfolg |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
3 |
|
Veränderungsbedarf |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
|
|
Sicht |
Berufliche Integration |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
Statements |
HAA ... |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
WfB ... |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
UB ... |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
|
|
Berufl. Integration ... |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
|
Summe Wert |
15 1,2 |
29 2,2 |
29 2,2 |
33 2,5 |
22 1,7 |
33 2,5 |
21 1,6 |
30 2,3 |
Das Rating der Aussagen der BeraterInnen kann nun anhand der Summenwerte zu drei unter-schiedlichen Berater-Typen gruppiert werden:
-
Typ 1 agiert deutlich institutionsorientiert und denkt vorwiegend kategorial. Im Beratungsprozess haben harte Daten ein sehr hohes Gewicht, individuelle Wünsche der Ratsuchenden sind zweitrangig - es sei denn, es ist massiver Widerstand zu erwarten. Im Vordergrund steht die Zuweisung zu Institutionen nach allgemeinen Kriterien von Leistung und Verhalten, gepaart mit einer integrationskritischen Grundhaltung, die sich auch auf das Ambulante Arbeitstraining bezieht.
-
Typ 2 berücksichtigt individuelle Wünsche etwas mehr und hat eine etwas geringere Distanz zur Integration als Typ 1, agiert und denkt ansonsten aber ähnlich.
-
Typ 3 steht natürlich auch innerhalb eines institutionell verfassten Systems, das kategorial funktioniert, jedoch nehmen persönliche Wünsche und Interessen der Ratsuchenden im Beratungsprozess einen höheren Stellenwert ein als institutionelle Zuordnungen. Typ 3 weist eine deutlich größere Nähe zu integrativen Konzepten wie beim Ambulanten Arbeitstraining auf. Im Zweifelsfall plädiert Typ 3 eher dafür, etwas auszuprobieren, auch wenn der Erfolg nicht sicher ist.
Typ 1 ist bei den BeraterInnen ein mal, Typ 2 zwei mal und Typ 3 fünf mal vertreten. Somit ergibt sich, wenn man den Mittelwert 2 als Balance zwischen institutioneller und individueller Orientierung nimmt, eine personelle Gewichtung zugunsten individueller Orientierungen. Der Mittelwert der Summenwerte aller BeraterInnen ergibt fast exakt 2, d.h. es kann der Schluss gezogen werden, dass die Reha-BeraterInnen sich insgesamt genau auf einer Balance zwischen institutions- und individuumszentrierten Denken befinden. Oder bezogen auf den Paradigmenwechsel gesprochen: Sie befinden sich genau in der widersprüchlichen Situation des Umbruchs zwischen rehabilitativ-sonderpädagogischem und integrativem Paradigma (vgl. Kap. 1.2).
Damit wird aber gleichzeitig auch ein weiteres Dilemma deutlich: Je nachdem, mit welchem Berater ein Ratsuchender zu tun bekommt, wird er eher institutionell orientiert oder individuell beraten. Sicherlich kann nicht erwartet werden, dass alle BeraterInnen völlig uniform beraten - und letztlich auch denken. Ob eine solche Heterogenität unterschiedlicher Einschätzungen und Einstellungen aber akzeptabel oder förderlich ist, muss dahingestellt bleiben. Da aber die Aussage gemacht wurde, es könne auch gewechselt werden, wenn es zwischen Ratsuchendem und Berater Probleme gebe, und da die Berater auch untereinander im Gespräch sind und sich ggf. zu Rate ziehen, wäre Aufgeregtheit überzogen.
Anders stellt sich jedoch die Situation beim psychologischen Fachdienst dar. Hier wird in einem Ausmaß kategorial, institutionell und zudem defizitorientiert gedacht, dass kritische Eltern sich in ihren Vorbehalten bestätigt fühlen dürften. Dies mag aufgrund des spezifischen Auftrags und der damit verbundenen Perspektive nahe liegen, dass es jedoch in keiner Weise reflektiert wird, lässt schon sehr nachdenklich werden. Es muss offen bleiben, ob die beiden Psychologen in ihren Aussagen unterschiedliche Standpunkte vertreten - L eher mit dialogischem, individuumsorientiertem und M eher mit defektologischem, institutionellem Blickwinkel - oder ob sie beide lediglich unterschiedliche Seiten der Untersuchungssituation ergänzend beleuchten. Festzustellen bleibt, dass es im Interview keine Anzeichen dafür gibt, dass der in der Behindertenhilfe vorzufindende Paradigmenwechsel bisher bis zur Beratungspraxis des psychologischen Dienstes vorgedrungen wäre.
Das Ambulante Arbeitstraining schließlich bekommt ein Zeugnis von den BerufsberaterInnen ausgestellt, dass in schulischen Noten zwischen zwei und drei liegen würde. Die Hamburger Arbeitsassistenz hat in den BerufsberaterInnen von der Tendenz her einen recht scharfen Kritiker, zwei eher distanzierte Stellungnehmende, drei vorsichtige Sympathisanten und zwei entschiedene BefürworterInnen.
Inhaltsverzeichnis
- 8.1 Anliegen und Fragestellung
- 8.2 Methodische Überlegungen
-
8.3 Ergebnisse
- 8.3.1 Zugänge zur Tätigkeit
- 8.3.2 Konzeptmerkmale und Profile des Berufsschultages und Passung mit dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings
- 8.3.3 Kooperationsbeziehungen
- 8.3.4 Blick auf die SchülerInnen und Effekte von Unterricht und Arbeitstraining
- 8.3.5 Kritische Stellungnahmen und Würdigungen
- 8.3.6 Zusammenfassung
Alle TeilnehmerInnen des Ambulanten Arbeitstrainings haben Anspruch auf einen Berufsschultag in der Woche. Die Gruppe der BerufsschullehrerInnen hat somit mit allen Personen, die ins Ambulante Arbeitstraining involviert sind, direkt und kontinuierlich über den gesamten Zeitraum der Maßnahme Kontakt: Einmal wöchentlich arbeiten sie mit den unterstützten BewerberInnen in der Schule zusammen, kooperieren regelmäßig mit den AssistentInnen ihrer SchülerInnen, haben Kontakte zum Arbeitsumfeld in den Betrieben ihrer SchülerInnen und kommen überdies in einer Konzeptgruppe zusammen, in der u.a. Fragen des Berufsschulunterrichts und dessen konzeptioneller Koordination mit dem Ambulanten Arbeitstraining beraten und diskutiert werden. Sie sind somit quasi ein Teil der Gesamtkonstruktion der Zeit im Arbeitstraining, zugleich aber auch in der Funktion als Begleiter ihrer SchülerInnen potentielle Zeugen dafür, wie sie die Qualität dieser Maßnahme erleben. So können die beteiligten BerufsschullehrerInnen als eine zentrale Quelle der Kritik der konkreten Umsetzung des Konzepts des Ambulanten Arbeitstrainings angesehen werden, die ggf. ein originäres Interesse an konstruktiven Veränderungen haben dürften. Ihren Aussagen und Einschätzungen ist von daher großes Gewicht beizumessen. Personen im Integrationspraktikum haben dagegen keinen Anspruch auf Berufsschulunterricht, jedoch bietet eine der beiden Schulen denjenigen die Teilnahme daran an, die vorher bei ihr dem BBE-i angehört haben.
Die Aussagen der im Berufsschulunterricht für Personen im Ambulanten Arbeitstraining engagierten LehrerInnen werden in folgenden Punkten gefasst:
-
Es wird kurz gekennzeichnet, welche persönlichen Zugänge den Weg zu dieser Tätigkeit kennzeichnen.
-
Der Einblick in die Konzeptmerkmale und Profile des Berufsschultages in ihrer Schule und ihre Einschätzung der Passung mit dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings geben Aufschluss über konkrete Formen der Ausgestaltung innovativ angelegter schulischer Lernmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in der Sekundarstufe II.
-
Die Frage nach Form und Qualität der Kooperationsbeziehungen aus der Perspektive der BerufsschullehrerInnen klärt, in welcher Weise der Unterrichtstag mit den Erfahrungen der SchülerInnen als in Betrieben Unterstützte verbunden ist und wie dicht die Verzahnung empfunden wird.
-
Von zentraler Bedeutung ist die Einstellung der LehrerInnen zu ihren SchülerInnen, die mit dem Blick auf diese und auf die an ihnen beobachteten Effekte von Unterricht und Arbeitstraining transportiert wird.
-
Abschließend soll aufgezeigt werden, welche Veränderungsbedarfe und Verbesserungsmöglichkeiten die Befragten sehen und wie sie den Stellenwert des Ambulanten Arbeitstrainings gesellschaftlich einschätzen.
So sollen diese Umfeldbeteiligten und MitgestalterInnen der Situation im Ambulanten Arbeitstraining befindlicher Personen als Quelle der kritischen Würdigung des Erreichten und der Perspektivenentwicklung in die Evaluation der Maßnahme einbezogen werden.
Insgesamt werden vier BerufsschullehrerInnen befragt, die für den Berufsschulunterricht der SchülerInnen aus dem Arbeitstrainingsbereich der Hamburger Arbeitsassistenz zuständig sind oder waren. Es sind damit je zwei VertreterInnen der beiden berufsbildenden Schulen InterviewpartnerInnen, in denen die TeilnehmerInnen des Ambulanten Arbeitstrainings einen Tag in der Woche zur Schule gehen: Schule A, die einen hauswirtschaftlichen Schwerpunkt und seit ca. vier Jahren entsprechende Klassen eingerichtet hat, wird hier vertreten durch Lehrerin A1 und Lehrer A2; Schule B, die seit 1996 SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstraining unterrichtet, wird vertreten durch Lehrer B1 und Lehrer B2. Alle Interviews finden in Räumen der Schulen statt, nur das Gespräch mit Lehrer B1 wird in dessen Wohnung geführt. Auch hier werden mittels eines Interviewleitfadens Impulse gegeben (vgl. Anhang 11.8, jedoch wird den Akzentsetzungen der LehrerInnen Priorität eingeräumt, um ihre Sicht und ihre Position insbesondere zum Ambulanten Arbeitstraining der Hamburger Arbeitsassistenz transparent zu machen. Um ihrem großen Gewicht als sehr dicht an der Situation der Menschen im Ambulanten Arbeitstraining beteiligte Zeugen Rechnung zu tragen, sollen diese Berufsschullehrer ausführlich zu Wort kommen. In Zwischenfazits werden ihre Kernaussagen zusammengefasst.
Lehrerin A1 ist im therapeutischen Bereich tätig bevor sie eine Fortbildung zur Lehrerin für fachpraktischen Unterricht macht und nun seit vielen Jahren im hauswirtschaftlichen Bereich dieser Schule arbeitet. Eine Zeit lang ist sie in der Beschulung von Personen aus der Werkstatt für Behinderte tätig, seit ca. zwei Jahren arbeitet sie nun im Berufsschulunterricht für den Personenkreis im Ambulanten Arbeitstraining und parallel dazu in BVJ-TQ-Klassen (vgl. Kap. 1.5). Sie zieht ein sehr positives Fazit: »So war mein Werdegang hier reinzurutschen so nach und nach in die Lehrerschiene, weil einfach der Bedarf bestand. ... Hier an die Schule zu kommen, war schon eine tolle Entscheidung. Also ich hatte nicht gedacht, dass es sich so positiv entwickelt, ich war halt sehr mit Vorbehalt eigentlich hier erschienen, weil ich gedacht hab': Es gibt keine Ergotherapie, also in meinem Bereich kann ich eigentlich gar nicht so arbeiten, so wie ich das gelernt hab', und dass ich womöglich so als Springer eingesetzt werde. Gerade da, wo es brennt, muss ich dann hin, aber es hat sich dann doch ganz anders differenziert. Also von daher bin ich sehr zufrieden, dass es so gelaufen ist.«
Lehrer A2 ist hat ein Handwerk gelernt und dann das Lehramt an Berufsschulen studiert. Nach dem Referendariat wird er »vor die Alternative gestellt, entweder Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag ... zu unterrichten oder Geistigbehinderte. Das war für mich vollkommen neu - ich hatte mir meinen beruflichen Werdegang ganz anders vorgestellt. Ich ... hab' mich dann, nachdem ich's mir angesehen hatte, für die Geistigbehinderten entschieden.« Lehrer A2 erlebt den Aufbau der ersten Werkstatt für Behinderte mit und ist dort seit den Anfängen des Berufsschulunterrichts für Menschen im Arbeitstrainingsbereich beschäftigt. Eine Zeit lang ist er beteiligt am Berufsschulunterricht des Ambulanten Arbeitstrainings, »da habe ich vielleicht zwei Jahre unterrichtet. Nur der Fehler war an der Sache letztendlich, dass ich dann plötzlich zu wenig Schüler hatte, so dass ich aus der Maßnahme rausgenommen wurde.« Lehrer A2 erinnert als besondere Stationen seiner Tätigkeit: »Klassische Höhepunkte waren natürlich der Einzug in (die Werkstatt), nicht. Also vom Theorieunterricht doch zum Praxisunterricht ... (der) Schüler aus dem Arbeitstrainingsbereich. Dann der Umzug zu dieser Schule (A), das war auch ein Höhepunkt, denn der Ursprung war ja, dass man versucht hatte, die Beschulung vor Ort vorzunehmen, also an den WfBs. Und jetzt kam eine Werkstatt nach der anderen auf die Welt in Hamburg und dann sind wir als Schule nicht mehr nachgekommen. Das lief damit einher, dass wir hier recht ordentliche Fachräume bekommen hatten und das motiviert natürlich. ... Dann Stadthaus-Hotel, dann BVJ-TQ-Maßnahmen, hatte ich nur nebenbei so beobachtet, da war ich selbst nicht involviert, weil ich sehr stark im anderen Bereich bin: Fachschule, Physikunterricht, Sportunterricht und so weiter. Aber ich hab's beobachtet und irgendwo war das ja auch eine ganz große Sache, ne? Und sicher also der Unterricht mit Schülern der Hamburger Arbeitsassistenz, das war natürlich auch eine große Sache.«
Lehrer B1 schildert seinen Weg nach dem Studium für das Lehramt an Sonderschulen: »Ich hab' in der Sonderschule ja nur im Referendariat gearbeitet, und meine erste Stelle war in einer Integrationsklasse. ... Bevor ich also in die Berufsschule kam, hatte ich schon einige Jahre in Integrationsklassen hinter mir. Die Geschichte ist so, dass es zwischen der Gesamtschule und der Gewerbeschule eine besonders intensive Zusammenarbeit gibt, Projekte in Klasse 9 und 10, wo Berufsschullehrer rüber kamen in die Gesamtschule in ein Restaurantprojekt und ein Holzprojekt - und von daher bestand ein reger Austausch. Und als die ersten Integrationsklassen nun durchgewachsen waren bis Klasse 10, entstand die Frage: Was passiert mit den geistig behinderten Schülern aus den I-Klassen? Optimal wäre es eigentlich, wenn da Kontinuität reinkommt und jemand diese Schüler auch begleitet. Die Schüler kannten ja Berufsschullehrer schon durch die Projekte und günstig wäre es, wenn einer mitgeht. Und so ist denn als erster Sonderschullehrer in den Berufsschulbereich (Lehrer B2) gekommen. Der hat im BBE-i, damals hieß das noch F1-i, gearbeitet, der ja integrativ organisiert ist mit Schülern mit geistiger Behinderung aus I-Klassen und sogenannten benachteiligten Jugendlichen, die die Möglichkeit haben, den Hauptschulvermerk zu bekommen. Als dann 1996 der Berufsschulunterricht für Schüler aus dem Ambulanten Arbeitstraining organisiert werden musste, ergaben sich zwei Standorte, einmal (Schule A) und (Schule B). Da hatte ich dann die Möglichkeit auch rüberzurutschen in den Berufsschulbereich, wobei Stammschule immer die Gesamtschule geblieben ist.«
Seine Arbeit, die er für einen Erziehungsurlaub unterbricht, findet Lehrer B1 »ganz überwiegend zufriedenstellend!« Die Arbeit macht Lehrer B1 großen Spaß: »Ein Großteil meiner Zufriedenheit resultiert daraus, dass ich einen großen Freiraum hatte, ausprobieren konnte.« Als besonderen Aspekt betont Lehrer B1 einen »angenehmen Kontrast auch zur Gesamtschule, weil die SchülerInnen ... hoch motiviert waren und mit einer gewissen Dankbarkeit mittags nach Hause gegangen sind. Bei einigen Schülern hatte dieser Flair von Berufsschule was ganz Besonderes, und ich hab' gegenüber diesen Schülern, denen das so wichtig war, nie gesagt, dass ich Sonderschullehrer bin. Für die hatte das ein ganz hohes Prestige. Sonderschullehrer - ich hatte den Eindruck, das wäre eine Frustration gewesen, dass das nun doch kein ›richtiger‹ Berufsschullehrer ist.«
Lehrer B2 ist der angesprochene Kollege von Lehrer B1. Er ist ebenfalls nach dem Studium für das Lehramt an Sonderschulen in Integrationsklassen der erwähnten Gesamtschule tätig. »Wir haben ja schon seit 1992 konzeptionell gearbeitet und die Integrative Berufsvorbereitung entwickelt. Dann ergab es sich, dass ich ab 1994 mit einer halben Stelle aus der Gesamtschule mit meinen Schülern in die Berufsschule gewechselt bin. Seit dem arbeitete ich sowohl in der Integrativen Berufsvorbereitung als auch im Ambulanten Arbeitstraining.« Darüber hinaus arbeitet Lehrer B2 für das Beratungszentrum Integration des Instituts für Lehrerfortbildung: »Dort bin ich zuständig für die Berufsorientierung für Abgänger aus Integrationsklassen. Außerdem arbeite ich in verschiedenen anderen Projekten, zum Beispiel Regio-Net.«
Zwischenfazit
Die Nachfrage nach den Zugängen der Befragten zur Arbeit mit SchülerInnen, die im Ambulanten Arbeitstraining sind, zeigt einen grundsätzlichen Unterschied:
-
Lehrerin A1 hat als Ergotherapeutin in der Berufsschule gearbeitet und ist, weil Bedarf besteht, ›in die Lehrerschiene hineingerutscht‹, für die sie sich parallel fortbildend fach-praktisch qualifiziert; sie sieht als zentral ihren Fachschwerpunkt Hauswirtschaft und ist phasenweise in verschiedene Projekte ihrer Schule, auch in den Unterricht der SchülerInnen im Arbeitstraining in der Werkstatt für Behinderte, involviert.
-
Letzteres gilt besonders für ihren Kollegen, Lehrer A2, der seine enge Verbundenheit mit diesem Zweig seiner unterrichtlichen Tätigkeit betont. Er entscheidet sich nach der Ausbildung zum Handwerker sowie nach Studium und Referendariat für das Lehramt an Berufsschulen für den Unterricht mit einer Personengruppe, mit der er noch nie zu tun hatte und baut den Berufsschulunterricht für Menschen mit geistiger Behinderung in der Werkstatt für Behinderte mit auf. Nur vorübergehend ist er beteiligt am Unterricht mit Personen im Ambulanten Arbeitstraining.
-
Beide Lehrer der Schule B haben das Lehramt an Sonderschulen studiert und sind langjährig in Integrationsklassen einer Gesamtschule tätig. Dort sind sie bereits in der Berufsvorbereitung im Wahlpflichtfach Arbeitslehre und an der Konzeptentwicklung eines integrativen Berufsschulunterrichts an der kooperierenden Berufsschule beteiligt, zu der sie - gemeinsam mit ihren SchülerInnen - überwechseln.
Alle Beteiligten betreten also mit sehr unterschiedlichen Hintergrund Neuland, das viel Gestaltungsfreiheit bietet, aber auch Gestaltung fordert. Ob und inwieweit die eher therapeutisch, berufsschulpädagogisch grundgelegten - und im Unterricht von WerkstattmitarbeiterInnen erfahrenen - Laufbahnen auf der einen Seite und die eher sonderpädagogisch geprägten, vor allem aber integrationsklassenerfahrenen Zugänge auf der anderen Seite sich in der Praxis der Schule A und der Schule B auswirken, könnte im folgenden deutlich werden. Auswirken dürfte sich darüber hinaus zweierlei: zum einen der aus den Beschreibungen der bisherigen Wege indirekt zu erschließende Altersunterschied von etwa zehn Jahren zwischen den LehrerInnen der beiden Schulen und zum anderen ihr in Schule A eher pragmatischer, in Schule B dagegen programmatischer Zugang zum Berufsschulunterricht in dieser Form.
Lehrerin A1 kritisiert im Hinblick auf den Berufsschultag die Rahmenbedingungen: »Es ist relativ wenig Zeit, sechs Stunden sind schnell um. Ich find' es wichtig, dass man in der Schule auch an die Praxis anknüpft beziehungsweise auch einen Praxisteil hat ... Ich könnte mir nicht vorstellen, sechs Stunden Theorie zu unterrichten.« Zudem fragt sie sich, »ob es den Schülern hilfreich wäre, wenn sie nur an drei Tagen im Praktikum sind oder ob sie dann vielleicht zu sehr aus dem Praktikum herausgerissen wären und dort nicht so Fuß fassen können. Für die Schule ist es natürlich immer angenehmer: Erst mal hat man dann einen anderen Kontakt zu den Schülern, man erfährt ein bisschen mehr und hat dann auch mehr Zeit, sich mit den einzelnen Themen zu beschäftigen beziehungsweise die Praxis aus dem Unterricht heraus zu begleiten.« Lehrerin A1 nimmt bei ihren SchülerInnen aber keine echte Unzufriedenheit mit dem Berufsschultag wahr, schätzt sie allenfalls bei einigen als ambivalent ein. Zwar ist ihrer Wahrnehmung nach der Kontakt zu den MitschülerInnen wichtig, aber »es gibt viele, die sagen: ›Och, eigentlich arbeite ich lieber - was soll ich hier in der Schule?‹ Und auf der anderen Seite finden sie es natürlich toll, mal früher nach Hause gehen zu können. ... Auf der anderen Seite lernen sie aber auch gerne noch. Rechnen ist ganz groß angesagt, das mögen sie sehr gerne, aber auch Lesen und Schreiben einfach noch mal trainieren, was eben so während der Arbeit zu kurz kommt. Das ... sehen sie schon auch, dass das ein Vorteil ist und ihnen doch noch was bringt. Also sie kommen gerne, aber man hört auch immer wieder: ›Was soll ich hier?‹«
Die Heterogenität in der Klasse ist für Lehrerin A1 keine neue Herausforderung, denn »die unterschiedliche Schülerschaft kennen wir eigentlich aus allen Klassen, die mit der Beschulung der behinderten Schüler zu tun haben. ... Was hier in dieser Klasse eher noch schwierig ist, dass die Schüler zu so unterschiedlichen Zeiten kommen. Also es gibt nicht den Anfangstermin nach den Sommerferien, sondern einige kommen nach den Sommerferien, einige kommen im Herbst, einige dann im Frühjahr, und so ist eigentlich ein ständiger Wechsel der Schülerschaft. Man kann nicht sagen: ›Wir fangen alle gemeinsam an, ihr habt jetzt alle diesen Vorlauf über ein Thema.‹ Sondern es kommen eben immer mal wieder neue dazu, alte gehen und so kann es erst mal immer wieder unruhig sein. Was ich schon erstaunlich finde ist, dass wenn man so nach den Sommerferien gemeinsam beginnt, dass sie sich sehr schnell finden. Gerade jetzt habe ich das Gefühl: Die kennen sich schon ewig. Viele kennen sich natürlich auch oft schon ewig von der vorhergehenden Schulzeit.« Um dem ständigen Wechsel zu begegnen und um inhaltlich aufeinander aufbauen zu können, plant Lehrerin A1, »in Halbjahresmodulen zu arbeiten. Also dass wir einen Praxisteil haben, der halbjährlich wechselt. Jetzt zum Beispiel bereiten wir die Brötchen für den Kiosk vor. Und um diesen Praxisteil kommen zwei Stunden Theorie, die sich auf den Praxisteil bezieht, und zwei Stunden Politik. ... Und so könnte dann alles halbe Jahr jemand einsteigen, ohne dass er da nun viel verloren oder verpasst hätte. Das wechselt dann vier mal, und so hätte dann jeder diesen Durchlauf mal mitmachen können. Ich hoffe, das bewährt sich.« Ein zweiter Praxisschwerpunkt liegt bei der Nahrungszubereitung, ein dritter bei der Produktion von warmen Speisen für den Kiosk und im vierten Teil könnte der Schwerpunkt beim Arbeiten am Computer liegen. Doch auch individuellen Bedarfen soll entsprochen werden können: Bei einem Schüler, der noch nicht Lesen gelernt hat, möchte Lehrerin A1 »probieren, ob man da noch was bewegen kann, dadurch, dass wir ja in Doppelbesetzung arbeiten. Dass man vielleicht mal für eine Stunde mit ihm rausziehen kann und dann das noch mal so ein bisschen angehen kann.«
Lehrer A2 sieht die Zeit im Berufsschulunterricht mit den Schülerinnen im Ambulanten Arbeitstraining »eine große Herausforderung. Also ich hab's ja auch parallel unterrichtet, zwar an anderen Wochentagen, aber in der gleichen Zeit.« Er sieht die Notwendigkeit, hier ganz anders zu arbeiten als mit seiner anderen Schülergruppe: »Sonst bei den Behinderten aus dem Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten ist mein Fachbereich Metalltechnik. ... Das ist ganz anders aufgebaut als die Situation von Jugendlichen bei der Hamburger Arbeitsassistenz, die also aus ... vielen Betrieben kamen, und darauf musste ich ja eingehen. Das war also jetzt so, dass ich... erst mal den anderen Schülern erklären musste: In welchem Betrieb arbeitet Fritz, was ist das für ein Betrieb und die Situation also verdeutlichen. Dann musste ich auf die ganz individuellen Probleme eingehen. Beispielsweise sollte eine Schülerin mit Geld rechnen, ja, dann musste ich also Geldrechenübungen hervorzaubern auf die Schnelle, mir irgendwo Papiergeld besorgen. ... Wie gesagt, das hing damit zusammen, dass wir unter-schiedliche Fächer in einer Klasse hatten. Einfacher ging das natürlich bei meinen Kollegen, ... die aus dem hauswirtschaftlichen Bereich waren, nicht. Dann kann man das doch ganz anders zentralisieren, fachlich verbessern, fachliche Qualität bieten - zumal wir das auch als Schule sehr gut können. Und ich hatte kaufmännisch etwas reingebracht, bei den Schülern, bei denen ich das für angebracht hielt, zumal ich ja irgendwo so eine Art Ausbildung hatte. Ich hatte ja das zweite Fach Wirtschaftslehre ursprünglich mal, das kam mir da dann wieder zugute. ... Wir hatten das Thema Inventur... - eine Schülerin, die arbeitete in einem Kiosk im Altersheim - und plötzlich hieß es denn auch: ›Ja, Inventur ist notwendig. Wir müssen jetzt ganz schnell eine Inventur über's Knie brechen.‹ Also das gehört irgendwie zu diesem Berufsbereich Kiosk, die Inventur. Und so konnte ich das thematisieren. Aber das gibt da bestimmt noch wichtigere Themen.« Lehrer A2 sieht sich also gefordert, flexibel, und kreativ zu reagieren: »So sah ich meinen Auftrag. Also ich hatte keinen fest gegebenen Lehrplan, gar nichts, also im Grunde genommen ging's von mir aus.«
Seine SchülerInnen im Betrieb zu besuchen findet Lehrer A2 wichtig, »um meinen Unterricht überhaupt vernünftig gestalten zu können. Zum Beispiel war ein Schüler bei der Abfallbeseitigung bei den XY-Werken, und das Fachgebiet kenn' ich überhaupt nicht. Sicher, man kennt die Müllabfuhr ... und Duales System, aber dann ist auch Schluss. Aber diese Materialien, die da getrennt wurden, haben wir uns angesehen, so dass ich das also auch in den Unterricht einbringen konnte, dass das auch sinnvoll theoretisiert werden konnte, was dieser Schüler dort gemacht hat oder eine Schülerin (heute in Betrieb E, vgl. Kap. 6.3.5; d. Verf.), die bei den XY-Werken an der Spülmaschine gearbeitet hat.«
Lehrer A2 reflektiert seine Berufsrolle und Kompetenz: »Wenn ich an die Beschulung der Schüler aus dem AT-Bereich der Werkstätten denke, dann gab das ja auch manchmal Kritik. Dann waren einige der Meinung, das müssten Sonderpädagogen leisten, weil sie ja eben ausgebildet sind. Aber dann kam von der Gegenseite wieder: ›Nein, genau der Berufspädagoge ist wichtig, damit endlich mal irgendwo der Schnitt kommt. Hier ist Sonderschule zu Ende und jetzt kommt etwas ganz anderes, das ist für viele Jugendliche ganz wichtig und 'n ganz anderer Ansatz, 'ne ganz andre Rangehensweise!‹ ... Sicher habe ich die Situation einfach versucht, mit den Schülern aufzuarbeiten, die betriebliche Situation. Das war auch so mein Hauptanliegen.« Auch Lehrer A2 räumt ein, es fehle oft »die Zeit, die betrieblichen Probleme aufzuarbeiten. Aber das ist ja so das Problem, ... wenn man so reingeht ins Fachliche, dann muss man auch bestimmte Dinge ableisten, erkennt vieles dabei, und dann hätte man gern noch mehr Zeit, um bestimmte Situationen besser aufzuarbeiten. Aber: Was soll man alles schaffen? Also ich find's ganz toll, wenn das fachlich so qualifiziert aufgearbeitet wird.«
Lehrer B1 muss im Nachhinein schmunzeln über die Anfangsphase des Berufsschulunterrichts für SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstraining: »Ich hatte den Anspruch von selbstbestimmtem Lernen und hab dann gesagt ›Was möchtet ihr hier lernen?‹ (Eine Schülerin) sagte, sie möchte Englisch lernen und dann habe ich nach Büchern geguckt, wo das so 'n bisschen kindgerechter vermittelt wird, irgendwelche Englischbücher angeschleppt. (Ein Schüler) sagte, er hat sich schon immer für Anästhesie interessiert, ... also hatte 'ne ganz klare Vorstellung davon, was die Berufsschule ihm da vermitteln sollte und also hab' ich Biologiebücher und Ähnliches angeschleppt. Wir haben uns auch gemeinsam verständigt über die Anfangs- und Endzeiten. Wir haben mit drei Leuten angefangen und zu Spitzenzeiten waren es neun Schüler und Schülerinnen.« Zur Heterogenität seiner Schülerschaft fällt Lehrer B1 zu-nächst deren Altersspanne ein, »die Bandbreite ist von 20 bis Ende 30. Zuletzt hatte sich das verschoben, da war keiner mehr über 30. Aber das ist eigentlich kennzeichnend für den Berufsschulunterricht, diese Heterogenität. Sie kommen aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlichen Motivationen, arbeiten an unterschiedlichen Arbeitsplätzen, wohnen in der Wohngruppe, wohnen zuhause, wohnen betreut alleine, und es gibt ja in dem Sinne kein rundes Schuljahr, sondern es ist ein Kommen und Gehen. In dem Moment, wo die Maßnahme bewilligt ist, kommen die Leute, und sie verschwinden in dem Moment, wenn das Arbeitstraining abgelaufen ist, nach einem Jahr, meistens zwei Jahren, je nachdem, was sie vorher schon an Ansprüchen aufgebraucht haben an anderen Maßnahmen oder wenn sie in ein Arbeitsverhältnis gehen. Das ist natürlich für die Organisation des Unterrichts auch immer eine Herausforderung zu gucken, dass jeder bestimmte Eckpunkte oder Basiskomponenten mitgekriegt hat und dann für andere, dass sich nicht so viel doppelt. In bestimmten Bereichen ist es sinnvoll, was zu wiederholen, und es ist völlig okay, zweimal ist überhaupt kein Nachteil.«
Lehrer B1 weiß um die hohe Zufriedenheit seiner SchülerInnen mit diesem Unterrichtstag: »Da hatte ich Glück, dass die Leute, die ich da hatte, sehr offen dafür waren und auch die Rückmeldung gegeben haben, dass ihnen das was gebracht hat. Also erstaunlich schnell: Durchgespielte Situationen am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zur Arbeit, zum Beispiel in der Bahn sich nicht zu trauen, nach einem Sitzplatz zu fragen beispielsweise, die kann man natürlich schön üben, die Reaktionen von Fahrgästen spielen - das hat Spaß gemacht. Das war eine Möglichkeit, dieses zu Kopflastige, zu Wortlastige ein bisschen aufzubrechen. Es ist schnell deutlich geworden, dass, wenn es am Arbeitsplatz schief geht, es in den seltensten Fällen an mangelnden Fachkompetenzen liegt, sondern es liegt vorwiegend an Sozialkompetenzen. Von daher musste der Unterricht dem entsprechen: ›Was kann ich zu einem guten Betriebsklima beitragen?‹ Oder: ›Ist Mobbing wirklich der Trick, wenn ich jemanden anders nicht mag?‹ Dieses ›Missverständnisse Ausräumen‹ und bis hin zu ›Wenn ich den letzten Tag im Praktikum bin, was kann ich da mitbringen?‹ und ›Einen ausgeben, wenn ich Geburtstag habe‹. Der Anspruch war der, möglichst dicht dran zu sein am Arbeitsplatz mit den Problemen, die es da gibt, und die Leute in dem Bereich zu unterstützen. Es war immer meine Befürchtung, dass sich dieser Berufsschulunterricht zu sehr verselbständigt und abkoppelt.«
Lehrer B1 resümiert: »Im ersten Jahr war die Resonanz sehr positiv. Ich denke, dass wir da einen offenen Austausch hatten in der Klasse. ... Das hängt natürlich ganz stark mit den Schülern zusammen, die du grad' in der Klasse hast, das hängt auch vom Grad der Behinderung ab, wie viel da verbal laufen kann. Wir haben ... manchmal diese Morgenrunden etwas überfrachtet, das war für einige dann kaum durchzuhalten, andere hatten aber ein sehr großes Interesse viel zu erzählen.« So reicht das Maß von »sehr hoher Zufriedenheit bis: ›Na ja muss halt auch sein, muss es auch geben.‹ Aber überwiegend, denk' ich, positiv.« Lehrer B1 betont, »mit zunehmendem Schweregrad von geistiger Behinderung wird es natürlich fordernder und schwieriger. Ich hatte manchmal ein ungutes Gefühl, wenn wir zu kopflastig gearbeitet haben, viel verbal - wobei das wieder stärkeren Schülern ein Bedürfnis war - und du auf der anderen Seite merkst, bei den anderen kommt zu wenig an oder sie überfordert es. Das war schon so ein Spagat, und ich denke für die Zukunft: Gut, der Ansatz mit dem Rollenspiel, das ist ein richtiger, auch im ästhetischen, kreativen Bereich, dass man in Zukunft noch mehr Möglichkeiten nutzen könnte. Wir haben den Schwerpunkt auf den Austausch gesetzt und das verschriftlicht - unter anderem deshalb, weil es eine hohe Attraktivität für Schüler hat, am PC zu arbeiten. Aber der kreative Bereich könnte noch stärkeres Gewicht bekommen, ... unter anderem aus der Erfahrung von der Produktionsschule in Dänemark, wo wir alle zusammen hingefahren sind und gemerkt haben, der Kreativbereich ist unheimlich wichtig. Es ist eine ganz große Gefahr, dass du da zu eingleisig fährst, um die Leute in irgendwelche Betriebe reinzubringen und Persönlichkeitsentwicklung auf der Strecke bleibt.«
Lehrer B2 fasst die Arbeit an der Schule B zusammen: »Ich glaube, diese Schule ist immer sehr dicht an der aktuellen Entwicklung.«
Zwischenfazit
Als Konzeptmerkmale für den Berufsschultag an beiden Schulen werden Gemeinsamkeiten, aber auch bedeutsame Unterschiede deutlich, die sich als durchaus verschiedene Profile beschreiben lassen. So ist denn auch die Passung des jeweiligen Berufsschulunterrichts mit dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings unterschiedlich zu bewerten:
-
Außer von Lehrer B2, der hier kurz eigene Flexibilität konstatiert, wird allseits betont, dass die große Heterogenität der Lerngruppe und das ständige Kommen und Gehen der SchülerInnen Hauptmerkmale dieser Berufsschulsituation sind.
-
Zudem wird an Schule A Zeitmangel beklagt, was bei Lehrerin A1 zum Wunsch nach einem zusätzlichen Berufsschultag führt. Hier wird als Lösung eine gewisse Modularisierung in Projektepochen mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten angestrebt. Weiter werden Fachlichkeit und Praxisteile ergänzend zur Theorie als Kernanliegen der Unterrichtstätigkeit bewertet sowie die Aufgabe und Notwendigkeit, Kulturtechniken zu trainieren. Die Vielfalt der betrieblichen Situationen der Schülergruppe im Ambulanten Arbeitstraining fordert anders heraus als in der Arbeit mit SchülerInnen im Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte: Flexibilität und Improvisation sind hier nun besonders gefragt.
-
Lehrer B1 sieht den Austausch und die gemeinsame Reflexion von Erfahrungen am Praktikumsplatz (aber auch in anderen Lebensbereichen) seiner SchülerInnen als Unterrichtsschwerpunkt und beschreibt eine quasi supervisorische Qualität der Arbeit in der Lerngruppe als Kern des Lerngeschehens. Hierbei stellt das Rollenspiel eine zentrale Methode dar. Weiter betont er die Selbstbestimmung als ein Unterrichtsprinzip und die Form der gemeinsamen Absprache und Einigung auf Inhalte und Arbeitsformen. Hier kommen der Wunsch nach Englisch und der Arbeit am Computer vor - nicht aber explizit Kulturtechniken; vielmehr betont Lehrer B1 den Bedarf am kreativen Bereich, denn er möchte der Gefahr der assimilierenden Einpassung in betriebliche Strukturen vielfältige Chancen der Persönlichkeitsentwicklung entgegenhalten.
-
Während Lehrerin A1 die Zufriedenheit der SchülerInnen mit dem Berufsschultag ambivalent einschätzt, meint Lehrer B1, dass bei seinen SchülerInnen eine hohe Zufriedenheit vorhanden ist.
Es zeigt sich, dass alle Beteiligten von der Notwendigkeit situativer Entscheidungen und adaptiver Anpassung des Unterrichts ausgehen; dabei hält Schule A tendenziell eher an eigener Schwerpunktsetzung - dem Schulprofil entsprechend - im Hauswirtschaftlichen fest und setzt auf Modularisierung nach fachlichen Gesichtspunkten, während Schule B tendenziell eher auf Einigungen mit den jeweiligen SchülerInnen zu setzen scheint, wenn es darum geht, Lernstoffe und Vorgehensweisen auszuwählen. Vielleicht lässt sich daraus ein unterschiedlicher Grad der Passung von Ambulantem Arbeitstraining im Betrieb und Schule A versus Schule B ableiten, der eventuell auch durch die Einschätzung der wahrgenommenen Zufriedenheit der SchülerInnen zum Ausdruck kommt.
Lehrerin A1 besucht ihre SchülerInnen im Praktikum: »Ich nehme es mir vor, dass ich mindestens einmal im Halbjahr jeden am Praktikumsort besuche, und das hat eigentlich ganz gut geklappt in der letzten Zeit. Das finde ich auch ganz wichtig. ... Wir haben das eben so aufgebaut, dass wir uns immer 'ne halbe Stunde Zeit nehmen pro Unterrichtstag, um über die Praktikumssituation zu sprechen, aber man erfährt relativ wenig. Das sind so Routineantworten letztendlich, aber es geht nicht so ins Detail. ... Am meisten erfährt man selbst, wenn man vor Ort ist und sich vielleicht die Räumlichkeiten vorstellt, die Arbeitsabläufe besser kennt, so die einzelnen tatsächlich auch in ihrer Tätigkeit sieht.« Lehrerin A1 bewertet die Zusammenarbeit als gut und findet, »zwischen Schule und Arbeitsassistenten, da herrscht doch eine gute Kommunikation, man tauscht sich kräftig aus. ... Wir haben Gespräche mit den Arbeitsassistenten, die dann alle drei bis vier Monate zu uns in die Schule kommen, wir setzen uns dann zusammen mit dem Schüler und sprechen über das Praktikum, was sehr viel aufschlussreicher ist natürlich.«
Von der Relevanz dieser Gespräche mit den ArbeitsassistentInnen spricht auch Lehrer A2, denn aus deren Ideen ergibt sich mancher Unterrichtsinhalt: »Das ist ja gut, wenn man sich da austauscht, so dass man eventuell so kleine Defizite mal aufgreift. Und dann ist es so, ... dass ein gebildeter Mensch ja auch sein berufliches Umfeld etwas kennenlernt, und ... darin sah ich auch so meine Aufgabe, das Umfeld etwas weiter zu umreißen.« Lehrer A2 besucht seine SchülerInnen auch in Betrieben: »Zeitweilig ja. Zwar nicht wie der (Lehrer B1) in dem Maße, ganz und gar nicht, so weit hat man mich hier auch gar nicht losgelassen. Äh, dafür bin ich zu teuer, nicht (lachend). Doch, ich habe mir Schüler im Betrieb angesehen, vor allem in den XY-Werken und - doch, ich fand das war auch wichtig für mich, um meinen Unterricht überhaupt vernünftig gestalten zu können.«
Für Lehrer B1 ist im Unterricht neben der Reflexion der zweite Schwerpunkt seiner Tätigkeit die »Arbeitsbegleitung. Ich hab' also nicht nur, wie es beispielsweise in der (Schule A) ist, einmal am Praktikumsplatz reingeguckt, um mir ein Bild zu machen, sondern ich hab' die Leute kontinuierlich begleitet. Hab' also enger mit der Hamburger Arbeitsassistenz zusammengearbeitet, so dass es dann immer ein, zwei Schüler waren, wo ich teilweise einen ganzen Vormittag da war, eine ganze Schicht mitgemacht habe, so als Tandem: Gemeinsam mit einer Kollegin von der Hamburger Arbeitsassistenz - und das hat sich bewährt.« Lehrer B1 hat die Erfahrung gemacht, dass »in diesen sechs, sieben Stunden vielleicht eine Situation auftritt, die ganz prekär oder prägnant ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass du die Situation erwischst, sehr gering ist, wenn du da 'ne halbe Stunde reinschneist und dem Vorarbeiter die Hand gibst und sagst: ›Na, wie macht er sich denn?‹ und dem Schüler mal auf die Schulter klopfst ... und dann wieder gehst. Sondern wir haben dann nach Feierabend noch 'n Kaffee getrunken und den Start ins Wochenende ›zelebriert‹. Das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht auch, an Schüler so ranzukommen. Das verhält sich dialektisch: Im Grunde genommen wirst du dann ja auch in deinem Unterricht anders gesehen. Wenn du den Arbeitsplatz kennst, also mit dem Schüler zusammen gearbeitet hast, sieht er dich auch im Unterricht anders, als wenn du immer jemand aus einer anderen Welt bist.« Diese hohe Kooperationsdichte mit SchülerInnen, Betrieben und AssistentInnen macht aber Lehrer B1 für sie nicht zum Job-Coach, sondern er läuft »immer als der Berufsschullehrer.«
Bei SchülerInnen, bei denen Lehrer B1 nicht kontinuierlich Arbeitsbegleitung macht, sieht er »einen hohen Kommunikationsaufwand mit den Arbeitsassistenten, das ist teilweise schwierig gewesen. Wir haben das jetzt stärker institutionalisiert (und setzen) ... jedes Vierteljahr einen Sprechtag an, wo von jedem Schüler mindestens ein Arbeitsassistent kommt, und dann hat man eine halbe Stunde, vergleichbar einem Elternsprechtag. Dann gibt's immer diese Dreierrunde: Berufsschullehrer, Berufsschüler, Arbeitsassistent. Und so kriegst du das Ganze besser in den Griff, ... weil ich gerade bei der Arbeitsassistenz oft den Eindruck habe, dass die Leute hart am Limit sind, ziemlich wild durch Hamburg düsen, da überfordert sind, und oft bleibt der Austausch auf der Strecke. Ich habe öfter nachgehakt: ›Sag mal, (eine Schülerin) hat gesagt, ihr sucht da einen Platz für sie im Bereich ›x‹ - kann ich mir gar nicht vorstellen!‹ Und dann kam man wieder ins Gespräch, das waren eigentlich immer Fragen, die im Berufsschulunterricht aufgeworfen wurden durch Berufsschüler.« Die Notwendigkeit des Austausches besteht mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von ArbeitsassistentInnen: »Manchmal war's ja der günstige Fall, dass einer mehrere abgedeckt hat. Im ungünstigen Fall hast du bei neun Schülern dann achtzehn Arbeitsassistenten, also einen bisschen engeren Kontakt vielleicht mit vier, fünf, und insgesamt waren das aber bestimmt zehn bis fünfzehn.«
Einige Aspekte der Arbeit der Arbeitsassistenz haben die Kollegen der Schule B »durchaus kritisch begleitet. ... Ein Punkt war zum Beispiel, dass es verschiedene Schüler gab, wo wir der Meinung waren, dass wir sie gut begleitet haben, dass wir sie gut in Betriebe reingebracht haben, wo es aber nach dem Wechsel zur Arbeitsassistenz Probleme gegeben hat und die dann abbrechen mussten, sie dann doch in der WfB gelandet sind. Das ist ein paar Mal passiert - und nun die Frage: ›Woran liegt das? Wieso hat es in dem einen Bereich geklappt? Warum in dem anderen nicht?‹ Da kommt man zwangsläufig dahin zu gucken: Was machen die anders?« Im dritten Jahr des BBE-i sind »wir dreimal in der Woche für zwei Stunden im jeweiligen Betrieb, worauf diese sich einstellen und verlassen können,« was den Betrieben sehr wichtig sei. »Die Arbeitsassistenz sagt: ›Das können wir nicht leisten. Wir müssen auf Krisenfälle dynamisch reagieren und wenn mal was ist, dann müssen wir auch mal jemand abziehen und da 'nen Schwerpunkt setzen. Wir können diese Verlässlichkeit nicht bieten.‹ Unsere Meinung (ist aber), dass diese Verlässlichkeit aber eine ganz wichtige Sache ist, und auch viel Zeit reinzubuttern - auch bei Leuten, bei denen es vermeintlich läuft, weil diese Krisensituationen immer wieder auftreten. Also Namen sind in diesem Fall (u.a. Herr E aus Kap. 4.4.5; d. Verf.). Bei (einer anderen Schülerin) wäre es beinahe schiefgegangen, hat dann doch geklappt. Wir haben dann überlegt, wie wir das in Zukunft besser verzahnen können, diesen Übergang, dass also nicht nach dem dritten Jahr ein Bruch entsteht, sondern ein weicher Übergang, so dass im ersten Halbjahr des dritten Jahres zwei Leute aus (Schule B) die Begleitung machen und dann nur noch einer und sich der Arbeitsassistent der Arbeitsassistenz dann sozusagen als zweiter einschaltet und nach einem Jahr wechselt das. Dann übernimmt der die führende Rolle, der aus (Schule B) ist sozusagen dessen Assistent, so dass immer klar ist, wer da eigentlich dominant ist und wer der zweite ist, dass sich zwischen den Arbeitsassistenten aus zwei verschiedenen Häusern zwangsläufig eine Zusammenarbeit ergibt.« Hier ist zum einen zu berücksichtigen, dass die angeführten Personen zu einer Zeit zur Arbeitsassistenz übergegangen sind, als es das Integrationspraktikum noch nicht gab und ein organisatorischer Umweg über die Konstruktion eines Außenarbeitsplatzes gegangen werden musste. Zum anderen sind auch konzeptionelle Unterschiede zwischen dem BBE-i der Berufsschule und der Arbeitsassistenz zu sehen: einerseits eine regelmäßige, andererseits eine bedarfsorientierte Unterstützung.
In Hinblick auf Kooperationserfahrungen mit den Betrieben resümiert Lehrer B1, man müsse »differenzieren auch bei den Betrieben, um welche Ebene es geht. ... Oft ist das so, dass auf Leitungsebene Wohlwollen besteht, auf der direkten Kollegenebene auch. Aber wenn dann auf der Vorarbeiterebene die ganze Sache nicht mitgetragen wird,« wird es problematisch: »Die sind denn da auch nicht souverän.« Der arbeitsbegleitende Berufsschullehrer, der schwierige Situationen kommen sieht, hat »in solchen Betrieben schon deshalb wenig Möglichkeiten, weil jedes Mal, wenn du kommst, wird dir gesagt, dass alles läuft. ... Und sie sehen eigentlich nicht die Bedeutung von Arbeitsbegleitung. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ihrer eigenen schulischen Sozialisation zusammenhängt, dass man denkt: ›Ach, da kommt so 'n Typ, der sowieso keine Ahnung hat von dem ganzen Business, so 'n Klugscheißer‹ und: ›Wir kriegen das alles geregelt!‹ Aber wenn es dann schief läuft, hast du überhaupt keine Möglichkeit mehr zu intervenieren, ... weil sie dich gar nicht dicht genug rangelassen haben.«
Lehrer B2 stellt fest: »Es existieren neben ständigen informellen Kontakten zwischen den Kollegen der Hamburger Arbeitsassistenz und der Berufsschule auch institutionalisierte Schnittstellen. Zweimal jährlich werden gemeinsam Sprechtage für die Teilnehmer gemeinsam durchgeführt. Im Rahmen des Unterrichts werden Betriebsbesuche durchgeführt und ausgewertet. Einmal jährlich findet eine Seminarfahrt statt, die von Kollegen aus beiden Institutionen begleitet wird. Insgesamt wird versucht, möglichst direkt Themen und Probleme aus den Betrieben im Unterricht aufzugreifen und zu bearbeiten. Die Rückmeldung zur Hamburger Arbeitsassistenz läuft zu großen Teilen auch über die Teilnehmer.«
Gleichwohl bestätigt Lehrer B2 ergänzend kritisch empfundene Aspekte: »Die Teilnehmer im Ambulanten Arbeitstraining sind auf verschiedenen, wechselnden Praktikumsplätzen, und es ist nicht immer klar, wie es zu diesen Plätzen kommt. Auch die Teilnehmer wissen manchmal selbst nicht, wie es nach Ende eines Praktikums weitergeht. Dann heißt es: ›Du arbeitest ab übernächster Woche bei der Tankstelle xy.‹ Hintergrund ist in der Regel ein positiver Kontakt zu einem Betrieb, und dann wird versucht, dort einen passenden Teilnehmer unterzubringen. Das kann ein Problem sein, glaube ich, aber ich glaube auch, dass das kaum zu lösen ist. Es ist halt nicht so einfach, passende Arbeit beziehungsweise Praktikumsplätze zu akquirieren. Dieses Problem haben wir ja auch. Beim Wechsel von Teilnehmern aus dem BBE-i ins Integrationspraktikumsjahr gab es manchmal das Problem der Arbeitsassistenz, dass die Arbeitsassistentinnen nicht so kontinuierlich vor Ort sind. Für die Betriebe ist das, finde ich, mitunter schwierig, dass bestimmte Zeiten nicht regelmäßig eingehalten werden, die Präsenz dann unterschiedlich ist. Die Kollegen der Arbeitsassistenz begründen das in erster Linie mit ihren eigenen Strukturen und Arbeitsabläufen. Das wären die Probleme eigentlich aus meiner Sicht. Ansonsten habe ich da noch manchmal das Gefühl, dass der ganze Ansatz schon eingegrenzter gegenüber unserem dritten Jahr ist, in dem wir ja auch betrieblich arbeiten. Dort ist die Verbindung auch zu Eltern noch dichter und zum Umfeld und so weiter, die ganze Vernetzung. Die Teilnehmer sind bei uns viel dichter betreut.«
Lehrer B2 vermutet bei der Arbeitsassistenz eine andere Haltung zur Zusammenarbeit mit Eltern: »Also was ich höre, ist, dass die Hamburger Arbeitsassistenz eigentlich eher mit den Teilnehmern arbeiten - die sind ja auch erwachsen - und die Eltern bleiben eher außen vor. Wir kriegen die Teilnehmer ja jünger, die sind oft erst 16, wenn man anfängt, mit ihnen zu arbeiten, oder ich kenne ja viele schon aus der Gesamtschule. Da kenne ich ja auch die Eltern zum Teil schon sieben, acht Jahre. Das ist dann ja normal, dass man im Kontakt bleibt. Also die Kontinuitäten sind in der Integrativen Berufsvorbereitung (BBE-i; d. Verf.) sicherlich größer, glaube ich. Ob das nun hinterher richtig ist, dass man das löst?«
Als speziellen Aspekt der Arbeit beschreibt Lehrer B2 die Kooperationserfahrungen mit den Reha-BeraterInnen, von denen auch schon einige in Schule B waren: »Ich kenne die meisten persönlich. Die Berufsberater sind natürlich prinzipiell geneigt, den sicheren Weg zu gehen, das heißt Arbeitstraining und WfB. Da haben sie auch die Möglichkeiten, schnell viel Geld lockerzumachen. Und auf dem anderen Weg, da geben sie unter Umständen viel Geld aus, und dann kommen die Betroffenen zurück in die Beratung. Dieses Problem haben die Berufsberater ja auch. Dahinter stecken meines Erachtens in erster Linie finanzielle Zwänge. Vereinfacht gesprochen ist den Berufsberatern der Einzelne unter Umständen vergleichsweise in der Priorität erst mal zweitrangig, weil sie ja so viele Leute auf ihrer Problemliste haben, dass sie natürlich sagen: ›Da hab' ich noch zwei, drei andere. Da ist die Chance, dass die realistisch in den Arbeitsmarkt gehen viel höher als ausgerechnet meinetwegen bei (Frau C, vgl. Kap. 4.4.3; d. Verf.).«
Zwischenfazit
Bei der Darstellung der Kooperationsbeziehungen wird eine eminent unterschiedliche Gewichtung der Kooperation mit Betrieben und der Hamburger Arbeitsassistenz erkennbar, was - wie von den LehrerInnen beider Schulen betont wird - vor allem sehr verschiedenen Rahmenbedingungen und Stundenausstattungen geschuldet ist.
-
Von Schule A aus sind gelegentliche Besuche am Praktikumsplatz möglich, die eher dem verbesserten Einblick bei den LehrerInnen in die betriebliche Situation ihrer SchülerInnen dienen sollen als die Qualität einer Kooperation mit dem Betrieb zu erreichen. Lehrer A2 erinnert besonders den Besuch in einer Praktikumssituation von SchülerInnen in einem Großbetrieb als wichtige Grundlage für eine ›vernünftige Gestaltung‹ seines Unterrichts.
-
Auch die vierteljährlichen Gespräche mit den jeweiligen AssistentInnen sollen das Bild der Situation der SchülerInnen abrunden; auch dient der Austausch als Anregung für das Aufgreifen von Themen für den Unterricht oder das Bearbeiten von kleinen ›Defiziten‹.
-
Schule B hingegen legt großen Wert auf eine kontinuierliche Begleitung der SchülerInnen in den Betrieben, und so benennt Lehrer B1 dies als seinen zweiten Tätigkeitsschwerpunkt, wobei die Verlässlichkeit gerade auch für die betriebliche Seite betont wird. Hierdurch entsteht ein deutlich veränderter, verbindlicherer Kontakt zur betrieblichen Seite einerseits und andererseits gleichzeitig eine andere Beziehung zu den SchülerInnen.
-
Wenn eine kontinuierliche Arbeitsbegleitung nicht realisierbar ist, gibt es auch in Schule B vierteljährliche Zusammenkünfte mit den BerufsschülerInnen, mindestens einer/m ihrer AssistentInnen und dem Berufsschullehrer. Dabei gelingt es bei etwa einem Drittel der SchülerInnen, einen engeren Kontakt mit deren ArbeitsassistentInnen zu halten.
-
In der kritischen Betrachtung der Kooperation von den Lehrern der Schule B verbindet sich der Aspekt der Kooperation während des Ambulanten Arbeitstrainings mit dem Übergang vom schuleigenen BBE-i zur Arbeitsassistenz. Vor diesem Hintergrund wird bei der Arbeitsassistenz eine personelle Diskontinuität der Betreuung und generell eine mangelnde Verlässlichkeit wahrgenommen. Den Übergang vom BBE-i zur Arbeitsassistenz sehen die beiden Lehrer für einige ihrer SchülerInnen als krasse Veränderung, weshalb eine bessere Verzahnung angestrebt und bereits teilweise in Form von Tandem-Teamarbeit von Berufsschullehrer und ArbeitsassistentIn im Integrationspraktikum realisiert wird. Hierdurch wird eine sehr dichtere Form der Zusammenarbeit erhofft. Darüber hinaus wird im Vergleich mit dem BBE-i eine geringere Verbindung zu den Eltern und dem Umfeld konstatiert und problematisiert. Allerdings ist hierbei zu bedenken, dass die zwischenzeitliche Einführung des Integrationspraktikums die davor bestehenden Diskontinuitäten - organisatorisch zudem über einen Werkstatt-Außenarbeitsplatz - wesentlich vermindert hat.
Die befragten LehrerInnen der Schule A haben neben der Tätigkeit in der Klasse der SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstrainings Unterrichtsverpflichtungen in diversen anderen Klassen. Dagegen können sich die Lehrer der Schule B weitgehend auf diese Klasse und ihr Umfeld konzentrieren, so dass hier eine hohe Kooperationsdichte mit SchülerInnen im Betrieb und mit ihrem betrieblichen (und zudem teilweise ihrem privaten) Umfeld und ihren ArbeitsassistentInnen entsteht.
Für Lehrerin A1 macht es sich »teilweise schon« bemerkbar, dass einige Ihrer SchülerInnen aus Integrationsklassen stammen, »im Moment noch eher negativ. Die aus Gesamtschulen kommen, haben manchmal relativ schlechte Erfahrungen machen müssen: Dass sie immer unten waren, diejenigen, die am wenigsten können, die gesondert behandelt werden, die auch oftmals viel auszuhalten hatten. Wenn sie hierher kommen in diese Schule, ich mein', das ist ja auch ansatzweise Integration, viel Kooperation, dass sie dann erst mal aufblühen, weil sie in einer Klasse sind, in der sie nicht immer nur die schlechtesten sind, unten an der Leistungsleiter, sondern doch auch mal was können. ... Ich hab' noch ein Vorurteil - ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es ein Vorurteil: Dass vielleicht viele in den Gesamtschulen nicht so gefördert werden können, wie es in den Sonderschulen möglich ist. Beim (einen Schüler) denke ich immer wieder, der hätte doch eigentlich mehr lernen müssen, also gerade was seine Sprachbehinderung angeht, er nuschelt ja so, und dass er so gar nicht lesen, schreiben und rechnen kann, ihm's so schwerfällt. ... Gerade bei (ihm) wollt' ich gern noch mal probieren, ob man da noch was bewegen kann.«
Als ein Erfolgsbeispiel sieht Lehrerin A1 die berufliche Integration von der Schülerin, die aus Integrationsklassen einer Gesamtschule kommend nun im Betrieb E (vgl. Kap. 6.3.5) arbeitet. Bei ihr hat sie »das einfach sehr überrascht, dass sie etwas finden konnte. In der Schule hatte ich sie einfach so wahrgenommen, dass ich es mir nicht vorstellen konnte - also überhaupt nicht! Ich hätt' Stein und Bein geschworen: Das klappt nicht! Weil sie nicht in der Lage war, bei einer Sache zu bleiben oder eine Sache wirklich konsequent zu Ende zu führen, ohne sich irgendwie abzulenken oder sich zurückzuziehen oder aus der Pause nicht wiederzukommen. Das hat mich sehr überrascht, das fand ich fantastisch! Also nie hätte ich das gedacht.« Hier müssen offenbar die ArbeitsassistentInnen sehr gute Arbeit geleistet haben: »Ich kann es mir einfach nicht anders erklären. Die Schule ist einfach eine andere Situation als am Arbeitsplatz, nicht dieser Ernstcharakter. Und (sie) sagt ja auch immer - jedes Mal nach der Pause musste ich sie darauf hinweisen, pünktlich zurückzukommen, und sie hat es nie geschafft: ›Ja auf dem Arbeitsplatz ist das anders, da schaff' ich das.‹ Anfangs war es auch da ein Problem, jetzt tatsächlich nicht mehr. Also vielleicht war es für sie tatsächlich so, dass sie unterschieden hat zwischen Arbeitsplatz und Schule.«
Als ein Negativbeispiel erinnert sie hingegen eine Schülerin, »die ihren Praktikumsplatz schon nach einem Monat wieder verlassen musste, weil der Arbeitgeber sich das anders vorgestellt hatte - oder wie auch immer. Das war ziemlich traurig, das so erfahren zu müssen, weil sie das dann eben auch nicht einordnen konnten, ob sie das nun so ganz auf sich beziehen müssen oder ob das jetzt die Arbeitssituation als solche war, die das notwendig gemacht hat.« Bei einer anderen Abbruchssituation sieht Lehrerin A1 den Grund für die Beendigung des angefangenen Weges zugunsten eines Werkstatt-Außenarbeitsplatzes eher bei der Schülerin selbst. Sie hat, aus einer Sonderschule kommend, »dieses Training absolviert, also die zwei Jahre hatte sie voll ausgenutzt, aber doch feststellen müssen, sie schafft es nicht, in der freien Wirtschaft unterzukommen.« Hier besteht das Problem nicht in zu wenig Assistenz, sondern »es liegt an (ihr) selbst. Ich glaube, sie ist sehr verträumt, sie braucht einfach einen festen Rahmen, sie muss wissen, was sie zu tun hat. Ich glaub', sie ist überfordert - sie kann sehr viel, sie ist sehr leistungsstark, aber sie ist überfordert, wenn viele Einflüsse auf sie einströmen und sie sich auf eine Sache konzentrieren muss und dann womöglich sich schnell umorientieren muss, um etwas anderes anzugehen. Sie nimmt einfach zu viel wahr. Und sie kann dann nicht sortieren, was jetzt wichtig ist, und das konnte sie auch nicht lernen in den zwei Jahren. Und sie braucht einfach diesen beschützenden Rahmen.« Ein weiterer Schüler, den Lehrerin A1 bereits vor Jahren als Berufsschüler aus der Werkstatt für Behinderte hatte, gibt einen unterstützten Arbeitsplatz auf, denn er »hat es körperlich nicht geschafft, der war einfach zu sehr angestrengt, hatte immer wieder Rückenprobleme. Und bei dem hatte ich auch so das Gefühl, ... (dass er) sich dann aber in der Werkstatt so aufgehoben fühlte. Also er ging da sehr gerne hin, weil er da doch so eben seinen Bereich gefunden hatte, wo er Gutes leisten kann. Und ich weiß gar nicht, wie das dann kam, dass er dann zur Arbeitsassistenz (kam) - ja, wahrscheinlich weil er doch sehr leistungsstark war. ... Wahrscheinlich war er auch überfordert, hatte denn eben doch die positive Erfahrung von der Werkstatt vielleicht auch im Hinterkopf.«
Ihrer Wahrnehmung nach gibt es Personentypen, die für das Konzept der Arbeitsassistenz geeigneter sind als andere; bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten müsse man mitbringen - »ja, das denke ich schon. Entweder es müssen Leute sein, die gar nicht auf Kommunikation wertlegen. Also zum Beispiel (eine Schülerin), die ist sehr in sich gekehrt, sie nimmt kaum Kontakt auf zu anderen Mitschülern, beziehungsweise nur dann, wenn sie sie betreuen, betüdeln, umsorgen kann, was aber an ihrem Arbeitsplatz nicht wichtig ist, und deswegen kümmert sie sich um ihre Arbeit und ich glaub', sie kommt damit gut zurecht. Andere, die sehr kommunikativ sind, ... suchen sich ihre Kontakte auch in einem Umfeld, wo sie vielleicht nicht so ihresgleichen finden. Die find' ich auch geeignet. Und die dazwischen, die eigentlich so ein bisschen Ansprechspartner brauchen, aber nicht so kontaktfreudig sind, dass sie sich sie selber suchen können, da sehe ich Schwierigkeiten. Die ... hätten's da schwerer, wenn sie sich in einem Umfeld betätigen, wo sie nicht unbedingt auf Menschen treffen, die so in ihrem Niveau« kommunizieren, und denen drohe dann die Gefahr der Vereinsamung.
Lehrerin A1 sieht als Effekte und Prozesse der Veränderung - bei einigen mehr, bei anderen weniger deutlich -, »dass sie sehr stolz auf ihre Leistungen und Fähigkeiten sind, also gerade dann, wenn sie mal wieder so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Bei (Frau A, vgl. Kap. 4.4.1; d. Verf.) ist mir das sehr aufgefallen, die hat sehr an Selbstbewusstsein mitnehmen können für sich und bei (einer anderen Schülerin) inzwischen auch. (Diese Schülerin) hatte mal so einen Einbruch«, als deren Freundinnen, Frau A und Schülerin XY, die wie sie aus Integrationsklassen stammen, schneller einen Arbeitsplatz bekommen »nach einem halben Jahr ... und nach anderthalb Jahren ihren Arbeitsplatz hatten, und sie immer noch so das Gefühl hatte, sie tritt auf der Stelle. Aber inzwischen ist es so, dass sie doch einiges dazulernen konnte, dass sie auch gelobt wird von der Arbeitsassistenz beziehungsweise ihren Kollegen, und das beflügelt sie. Im Moment hat sie eine gute Phase, und sie spricht darüber, dass über einen Arbeitsvertrag diskutiert wird.« Auch eine andere Mitschülerin aus einer Integrationsklasse, die aus der Türkei stammt, hat jetzt einen Vertrag: »Das hat ja schon vor den Sommerferien geklappt!« Lehrerin A1 ist genau informiert darüber, welche ihrer SchülerInnen einen Arbeitsvertrag bekommen, denn »in der Regel passiert das ja innerhalb der zwei Jahre und bisher waren es eben zwei, wo es in diesen zwei Jahren nicht geklappt hat.« Alle anderen haben einen Arbeitsvertrag: »Wie viele das sind, das weiß ich gar nicht, weil das ja immer so ein stetiger Wechsel ist - ich kann eben nicht von Klasse zu Klasse rechnen.« Lehrerin A1 vermutet, dies könnten um die zehn SchülerInnen sein, »wobei ich nicht weiß, ob diese zehn ihren Arbeitsplatz noch innehaben.«
Sozialisationseffekte von Sonderschule oder Integrationsklasse sieht Lehrer A2 nicht, die Vorgeschichte seiner Schüler ist ihm auch nicht so bekannt: »Nee, nö, da hab' ich nie nachgeforscht. ... Ich geh' immer ganz neu an die Schüler ran, das ist meine Art. Ob das nun richtig ist oder falsch, weiß ich nicht, aber das habe ich immer so gemacht. Ich hab' da nie lange in Akten geguckt, sondern hab' den Schüler auf mich zukommen lassen. ... Ich lass' also den Schüler so mit meiner Art auf sich wirken und seh' da Vorteile oder Nachteile. Also er muss ja denn sowieso mit mir klarkommen.«
Auch sieht Lehrer A2 zwischen den SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstraining und denen im Arbeitstraining der Werkstätten für Behinderte keine Unterschiede: »Nee, also so deutlich kann ich es nicht sagen. Also es ist auch so, wenn man Schüler über längerer Zeit kennenlernt, dann merkt man ja im Laufe der Zeit auch erst die Schwächen. ... Ja, auch die Stärken, sicher, das ist klar, ... aber das geht ja jetzt um die Schwächeren, und ... die Defizite spürt man so im Laufe der Zeit erst auf, nicht. So im ersten Augenblick sieht das ganz oft ganz toll aus, und ich war auch oft voller Hoffnung, wenn ich denn einen jungen Mann sah, der beispielsweise im Krankenhaus XY da angefangen hatte und voller Enthusiasmus zur Arbeit ging und davon berichtete bei mir im Unterricht, und irgendwann kam der Einbruch. ... Da gibt es wohl mehrere Fälle.«
Allerdings hat Lehrer A2 bei den SchülerInnen aus der Werkstatt für Behinderte ein »bisschen das Gefühl, dass sie schwächer geworden sind. Nein, dass viele Schwächere dabei sind einfach. Ich schätze mal, das sind die Schüler, die früher in die Tagesförderstätten kamen. Die Werkstätten haben sich also doch mehr geöffnet und haben die also auch mit aufgenommen. Wobei, was heißt schon schwächer oder nicht schwächer? Das können auch mal Verhaltensweisen sein, die so sind, dass die Schüler kaum zu beschulen sind manchmal.« Dabei stellt er andererseits jedoch keine deutlichen Unterschiede zur Gruppe der SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstraining fest: »Also deutlich - deutlich nicht. Das kann ich so nicht sagen. Also wenn ich an (Herrn D) denk', dann ganz bestimmt nicht, nein.« Dass sein ehemaliger Schüler Herr D (vgl. Kap. 4.4.4) je einen Arbeitsvertrag bekäme, hätte Lehrer A2 »eigentlich nicht« für möglich gehalten: »Aber da sehe ich das auch so: Es gibt einige Sonderfälle, wie bei (Herrn D), da hat die Arbeitsassistenz einen idealen Arbeitgeber gefunden, ne, der hat ein Faible für solche behinderten Menschen, der Bäcker XY und ja, in dem Fall wird es klappen.« Nach Lehrer A2 müsse es so sein, dass »so ein Bäcker XY Idealist ist. Das geht einmal gut. Gut.« Vom Wechsel des Herrn D zu einer anderen Arbeitsstätte in einer Konditorei und dem erneuten Arbeitsvertrag erfährt Lehrer A2 in dieser Situation: »Ach so, das wusste ich nicht. Das ist ja erstaunlich.«
Nach Meinung von Lehrer A2 sind keine Typen zu beschreiben, für die die Institution Werkstatt für Behinderte oder das Konzept Unterstützter Beschäftigung geeigneter wären: »Ich hab' mich oft getäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ganz, ganz schwer. ... Ich hab' manchmal 'ne Perspektive gesehen, wo keine war, und ... ganz schwierig sehe ich immer die Fälle des unzuverlässigen Schülers. Da sehe ich immer ganz große Schwierigkeiten, und ich bin erstaunt, wie viele unzuverlässige Schüler die Arbeitsassistenz doch so aufgenommen hat. Irgendwo müsste da doch schon mal so 'ne Vorinformation sein, denn ... ich stell mir einfach mal vor, ich wär' Arbeitgeber, dann hätte ich keine Lust dazu, einen unzuverlässigen Schüler aufzunehmen und einen unpünktlichen Schüler. Ich meine jetzt nicht fünf Minuten, aber einen Schüler, der des öfteren über Stunden zu spät kommt oder tageweise überhaupt nicht da ist - beziehungsweise dann ist das ja ein Mitarbeiter für den Arbeitgeber. ... Da hätte ich dann vorher mehr aussortiert. Aber die Arbeitsassistenz ... schleppt doch einige so ganz schön über Jahre mit durch, die nicht so zuverlässig sind. Und über Erfolge oder Misserfolge kann ich ja gar nichts aussagen, denn das ist ja nicht in meinem Blickfeld. Ich seh' das - oder hab' das ja nur aus der schulischen Sicht gesehen, die Beschulung war ja irgendwann zu Ende.« Er sieht als Gründe für Abbrüche bei beruflicher Integration »das alte Lied ›Einer muss gehänselt werden‹ und gerade extrem ist das wohl in Betrieben, in denen die anderen Mitarbeiter nicht sehr viel schlauer sind als der behinderte Mitarbeiter. Da sehe ich eine Gefahr.«
Für Lehrer B1 besteht die Möglichkeit, die Wege einzelner seiner SchülerInnen langfristig zu betrachten, hierbei ist für ihn »der Zusammenhang zu I-Klassen interessant: ... Ich hatte ja sechs Jahre eine I-Klasse mit vier im Vergleich zu anderen I-Klassen stärker behinderten Schülern: Drei geistig behinderte Mädchen und (ein Junge) mit autistischen Zügen. Und im Nachhinein zu sehen, wem der Schritt ins Berufsleben gelungen ist und wem nicht, das ist natürlich interessant, dass es dem Mädchen gelungen ist, das sozial am angepasstesten ist, die aber intellektuell am schwächsten ist. (Sie) ist (den anderen) in Kulturtechniken, in vielen Bereichen unterlegen gewesen, aber sie ist angepasst gewesen. Das ist natürlich denn eine Frage: ›Was heißt das nun für den Unterricht?‹« Hingegen ist sein ehemaliger Schüler mit Autismus ein sehr unangepasster junger Mann geblieben mit sehr auffälligen Verhaltensweisen, der aber mittlerweile verantwortungsvolle Arbeiten der Demontage, Reinigung und Remontage von Teilen aus Flugzeugcockpits ausführt. Dieser Schüler »ist jemand, da gab es Probleme in dem Moment, wo er nicht genug zu arbeiten hat, aber in dem Moment, wo er was machen kann, klotzt der unheimlich ran.«
Lehrer B1 sieht denn auch innerhalb der Gruppe, die von der Arbeitsassistenz unterstützt wird, deutliche Unterschiede, die er von den AssistentInnen nicht genügend berücksichtigt findet: »Die gehen ja eigentlich klassischerweise von 'ner Gruppe von Leuten aus, die relativ weit sind in ihrer Entwicklung, auch bezüglich dessen, zu wissen, was sie wollen, die ganz selbstbewusst auftreten und sagen: ›Wir wollen nicht in die WfB, wir wollen da und da hin - und unterstützt uns dabei, wir wollen richtig arbeiten!‹ Und diese Gruppe der Schüler mit geistiger Behinderung aus I-Klassen, die ist teilweise anders drauf: Gerade die erste Generation mit der engagierten Elternschaft, wo die eigene Motivation, nicht in die WfB zu wollen, oft gar nicht so stark ist. ... Ja, von daher ist, was ich schon gesagt habe, viel ... verlässlich da sein immer zu festen Zeiten, Elternkontakte stärker halten, das sind die Eckpunkte, oder zumindest stärker den Kontakt zu den Kollegen suchen, die diese Elternkontakte haben oder die Schüler über sechs oder mehr Jahre begleitet haben. Ich denke, an solchen Punkten ist es dann gescheitert. ...
Ich denke auch, dass die Arbeitsassistenz - was die Behinderungsbilder angeht - ursprünglich vorrangig Leute begleitet hat, die weniger stark behindert waren. Und dass sie von den Erwartungen her oder wie sie an Unterstützung ran gehen, wie sie Leute begleiten, dass sie da bei stärker geistig behinderten Schülern oft was vorausgesetzt haben, was so gar nicht da war. Und dann gesagt haben: ›Ja, (Herr E, Kap. 4.4.4, d. Verf.) in der Küche - das ging doch gar nicht! Der hat ja keinen Lappen angefasst, der hat sich doch geekelt! Da war klar, der musste da raus!‹ Wo die Kollegen, die ihn davor begleitet haben, sagen: ›Klar, in dieser Situation so, wenn du da mit (Herrn E) so rangehst, dann fasst der auch keinen Lappen an!‹ ... Und wo (die) Hamburger Arbeitsassistenz klar sagt: ›Wer da und da arbeiten will, der muss das und das können, wenn da keine Bereitschaft da ist, dann geht das da nicht!‹
Dieser Personenkreis ist ja auch im Berufsschulunterricht selbst anders aufgetreten. Das beißt sich dann schon. Da hat es dann auch oft Kopfschütteln gegeben bei anderen Schülern, (wenn) jemand an der Kinderrolle festhält, sich weigert erwachsen zu werden, das auch demonstriert mit Kinderlieder-Hören. Was die anderen, die an dem Schritt sind, erwachsen zu werden oder zu sein, einfach ›nur daneben‹ finden. ... Es geht immer darum, diese Querverbindungen aufzuzeigen, wenn einer zum Beispiel gesagt hat: ›Ich vergess' manchmal, dass die Pause zu Ende ist, dann gibt es Ärger!‹ Dann wird rumgefragt: ›Wie ist das bei dir?‹ Damit jeder begreift: ›An meinem Arbeitsplatz ist das so, und diese oder jene Aspekte sind nur an meinem Arbeitsplatz so, aber dieses und jenes ist auch typisch für Arbeit allgemein.‹ Also Parallelen aufzeigen. Und dann gab's zum Beispiel die Situation: ›Die Chefin hat gesagt, es ist soviel zu tun, und hat mich gebeten, eine halbe Stunde länger zu bleiben. Hab' ich natürlich gemacht.‹ ... Wenn dein Chef sagen würde: ›Eine halbe Stunde länger, es ist soviel zu tun.‹ Und dich fragen - und alle durch die Bank haben gesagt: ›Ja klar, würd' ich machen!‹ und (zwei Schülerinnen sagen): ›Nö, ich bin doch nicht blöd, um vier gehe ich!‹ Und an solchen Punkten wird es dann deutlich. Das ist natürlich auch für die Arbeitsassistenz eine Herausforderung.« Für Lehrer B1 ist das »ein Merkmal geistiger Behinderung. Da wissen wir ja auch, dass Entwicklung nicht linear läuft, sondern dass es Phasen von Stagnation und Regression gibt.«
Lehrer B1 erlebt oft, dass das Selbstwertgefühl seiner SchülerInnen durch die Arbeit »draußen« steigt: »Wir haben ja viel Besuch gehabt in (Schule B) und haben immer gesagt, das ist sinnvoll, wenn die Schüler immer wieder in dieser Vorstellungssituation sind, sagen, wo sie arbeiten, ... und von daher haben wir uns auch nie gestört gefühlt, sondern haben das immer als eine Lernchance gesehen, sich zu präsentieren. Und da kam Stolz durch. Wir haben uns ja auch eine Wohngruppe und eine WfB angeguckt, und da war es dann auch so, dass die dann gefragt haben: ›Wo arbeitet ihr denn?‹ Und dann haben sie ganz stolz erzählt, wo sie arbeiten und haben erfahren, dass die dann gestaunt haben, die Anleiter.« Und wenn eine Schülerin türkisch-polnischer Herkunft mit Down-Syndrom der alten Integrationsklasse von Lehrer B1 von ihrem Betrieb erzählt, kommt das dadurch sehr gestiegene Selbstwertgefühl zum Tragen. Dabei ist es dort seiner Wahrnehmung nach »vom Betriebsklima nicht dolle, sehr hektisch, sehr angespannt.« So ist es »eigentlich ein Phänomen, dass jemand wie (sie) in so einem Betrieb nicht baden geht.« Vielmehr ist es sogar so: »Sie hat da was ausgelöst. Das Betriebsklima hat durch so einen Menschen, der langsam ist, aber andere Kompetenzen hat, gewonnen.«
Auf der anderen Seite hat Lehrer B1 bei einem anderen Schüler, der aus einer Werkstatt für Behinderte kommt und »der sich so lange mit der Frage auseinandergesetzt hat: ›WfB oder nicht WfB?‹ erlebt, was die WfB auch bietet. Er hatte verschiedenste Praktika gemacht im Arbeitstraining, war überall gern gesehen, überall wollten sie ihn haben - und in der Werkstatt aber auch. Da wird dann deutlich, dass so eine übergeordnete Instanz, die das ganze koordiniert oder in so ein Netzwerk einbaut, fehlt. Das sind natürlich auch die Leistungsträger in der WfB. Die in der WfB sagen dann: ›Komm ..., bleib' doch bei uns!‹ Er ist einer, der nicht nein sagen kann, zwischen den Stühlen sitzt ..., hat dann ... in so einer Luftballonfabrik gearbeitet, hat vorher bei (Unternehmen G, vgl. Kap. 6.3.7; d. Verf.) im Lager gearbeitet - überall hätte er was werden können, aber wenn du siehst, wie (er) wohnt in einer Einzimmerwohnung ... in so einem Hochhaus. ... Und er ist natürlich - egal in welchem Betrieb, wie gut das soziale Klima in so einem Betrieb auch ist - in der Hierarchie unten. Und dieses ganze Behütende von Sozialarbeitern, wenn du irgendwelche Probleme hast, das gemeinsame Essen und die Disco am Wochenende, das kann natürlich kein Betrieb bieten.« Als die Entscheidung fällt, zurück in die Werkstatt für Behinderte zu gehen, wird das »auch im Unterricht thematisiert, auch mit den anderen: ›Was spricht eigentlich für die WfB und was dagegen?‹ ... Oder einer stellte die Frage: ›Welche Vor- und Nachteile hat es eigentlich behindert zu sein?‹ Wo ich auch erstaunt war, was da so kam, wie dann (ein Schüler) da saß und dann so überlegte, ob es mehr Vor- oder Nachteile hatte.«
Die meisten ehemaligen SchülerInnen von Lehrer B1 haben bereits einen Arbeitsvertrag, »aber wie gesagt: Da muss man auch sehen, wie es nach ein paar Jahren aussieht. Ich glaube, das wird oft vergessen, dass es was anderes ist, wenn ein Mensch mit geistiger Behinderung einen Arbeitsvertrag kriegt. Ich sehe die Gefahr, dass man sich dann zurücklehnt: ›So, das haben wir jetzt geschafft, der ist drin. Der nächste!‹ Aber das ist ein lebenslanger Prozess, und ich habe die Befürchtung, dass dazu zu wenig Ressourcen reingehen, um die Leute denn auch zu stabilisieren und zu halten. ... Die spannende Frage der nächsten Jahre ist: ›Wie lange bleiben die Leute drin?‹«
Lehrer B2 meint, SchülerInnen, »die aus den Integrationsklassen sind, ... kennen diese Zusammenhänge oder erkennen die auch wieder und sind zum Teil auch belastbarer, was zum Beispiel Frust angeht. Im Vergleich zu den anderen Teilnehmern aus dem Ambulanten Arbeitstraining sind diese eher schwächer und in der Tendenz, meine ich, (sind) ... in den letzten Jahren in der Arbeitsassistenz insgesamt mehr Leute mit weniger gravierenden Behinderungen, finde ich. Ich habe das auch schon mal mit den Kollegen der Arbeitsassistenz angesprochen; die sehen das nicht so, glaube ich. Sie haben ja auch keine andere Wahl, denn sie die Teilnehmer werden ja vom Arbeitsamt gemeldet, werden ja nicht (von ihnen selbst) ausgesucht. Aber ich glaube, für die Hamburger Arbeitsassistenz ist es auch gut, dass sie solche Teilnehmer kriegen, weil das Leute sind, mit denen man gut arbeiten kann, wo es auch reale Vermittlungschancen gibt. Teilnehmer, wie wir sie zum Teil im BBE-i haben, kommen bei der Arbeitsassistenz direkt eher weniger an.«
Lehrer B2 ist über manche Entwicklung bei seinen TeilnehmerInnen erstaunt: »Im Positiven haben wir das an sich ganz häufig. ... Wir erwarten meistens nicht viel. ... Manche lernen hier noch lesen, zum Beispiel. Das ist mir dann immer ein Rätsel, warum diese Teilnehmer nicht zehn Jahre lang in der Schule schon mal irgendwo lesen gelernt hätten. So was haben wir nicht selten. Wenn man aber die Berichte liest und es heißt, der kann nicht lesen oder irgend so etwas, ja, dann erwarten wir das auch nicht - vielleicht ist das die Chance. Schließlich haben wir auch nicht so langfristige Zielsetzungen hier, sondern versuchen erreichbare konkrete Ziele zu realisieren.«
Lehrer B2 glaubt, dass im Falle seines langjährigen Schülers Herrn E (vgl. Kap. 4.4.4) »die Arbeitsassistenz sehr ratlos oder hilflos war. Nach dem dritten Jahr im BBE-i wurde er zu-nächst durch eine Mitarbeiterin einer WfB im Betrieb betreut, und es musste danach sehr schnell auf ein Arbeitsverhältnis hingearbeitet werden. In dem Betrieb konnte sich das natürlich keiner vorstellen. Zu dieser Zeit gab es das Integrationspraktikumsjahr noch nicht und die Betreuung war allein schon aus diesem Grund sehr diskontinuierlich.« Allerdings ist (Herr E) der Meinung von Lehrer B2 nach »natürlich auch eine ›spezielle‹ Person. Er hatte wenig Bezug zur Arbeit überhaupt und ist ja von seiner Mutter auch nie intensiv gefordert oder gar unter Druck gesetzt worden. Da kommt viel zusammen. Mein Eindruck ist, dass er fast vollständig entlastet wurde von seiner Mutter. Viele Wünsche sind ihm erfüllt worden, ohne dass er sich jemals selbst anstrengen musste. Also ich finde, (Herr E) ist kein gutes Beispiel für eine gescheiterte Entwicklung - der würde unter Umständen auch, wenn er nicht müsste, nicht in die Werkstatt gehen. Also ich finde, das ist auch ein ganz ungeeignetes Fallbeispiel.«
Zu dem strukturell begründeten Phänomen, dass SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstraining noch recht jung sind, meint Lehrer B2, die ArbeitsassistentInnen, »sind auch Profis und können sich natürlich auch auf 18-19jährige junge Erwachsene einstellen. Zur Klientel der Hamburger Arbeitsassistenz gehörten bisher ja eher nicht die Schulabgänger direkt aus der Geistigbehinderten-Schule. Das heißt, diese jungen Erwachsenen, die 19, 20 sind, die wie alle anderen jungen Menschen, die nicht behindert sind, ja an der Stelle auch in den Beruf gehen, benötigen auch konzeptionell ein anderes Setting als diejenigen im Fachdienst der Arbeitsassistenz, die ja eher 23, 24, 25 Jahre alt sind. Eine Konsequenz ist hier sicherlich die Einrichtung des Integrationspraktikums.«
Zwischenfazit
Bei der Beschreibung der Gruppe der SchülerInnen und die von den LehrerInnen wahrnehmbaren Effekte von Schulsozialisation, Berufsschulunterricht und Arbeitstraining werden divergierende Grundhaltungen erkennbar:
-
So ist bei den LehrerInnen der Schule A eine indifferente bis negative Einschätzung der Sozialisationseffekte bei ihren SchülerInnen aus Integrationsklassen vorhanden. Sie nehmen an, in Sonderschulen wäre eine bessere Förderung möglich und sehen für ihre SchülerInnen in Gesamtschulen insgesamt eher schlechte Erfahrungen oder messen den Vorwegen der SchülerInnen keine Bedeutung zu.
-
Den Lehrern der Schule B zufolge kommen aus Integrationsklassen eher SchülerInnen mit ausgeprägten Behinderungen, die im Vergleich mit ehemaligen SonderschülerInnen kognitiv schwächer, aber eher sozial unauffällig, belastbar und besser in der Lage sind, Frustrationen zu bewältigen. Die Arbeitsassistenz sehen sie noch nicht hinreichend auf diesen Personenkreis eingestellt, sondern eher orientiert an solchen älteren Werkstatt-MitarbeiterInnen, die genauer wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Auch bezüglich Erfolgen und Misserfolgen zeigen sich deutliche Divergenzen:
-
Die LehrerInnen der Schule A zeigen sich von erfolgreichen Verläufen, also vor allem von geschlossenen Arbeitsverträgen überrascht und lassen eher wenig Zutrauen in Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt deutlich werden; Erfolge erklären sie eher mit Sonderbedingungen wie einem außergewöhnlich idealistischen Arbeitgeber. Gleichwohl sehen eine recht hohe Erfolgsquote, die sie vor allem auch der Arbeitsassistenz zurechnen. Unterschiedliche Einschätzungen gibt es über die geeignete Klientel für das Ambulante Arbeitstraining: Lehrerin A1 meint, die Arbeitsassistenz sei ihrer Einschätzung nach eher etwas für besonders leistungsstarke, sehr in sich gekehrte oder sehr kontaktfreudige Menschen, nichts aber für solche, die auf Ansprache auf ihrem Niveau angewiesen seien, denn denen drohe die Gefahr der Vereinsamung. Lehrer A2 verneint die These von der Eignung der Konzeptionen für bestimmte Typen.
-
Erstaunen ist mitunter auch bei den Lehrern der Schule B vorhanden, jedoch zeigen sie sich vorsichtiger mit prognostischen Vermutungen. Sie sehen häufig Stolz und gestiegenes Selbstwertgefühl bei ihren SchülerInnen durch die Arbeit ›draußen‹ und meinen, dass die meisten einen Arbeitsvertrag in Aussicht oder in der Tasche haben. Allerdings äußern sie die Sorge, ob es wohl allen gelingen kann, langfristig beschäftigt zu bleiben.
Die LehrerInnen der Schule A machen mit ihren Äußerungen eine gewisse Skepsis gegenüber integrativer Erziehung, Gemeinsamem Unterricht und Formen der Unterstützen Beschäftigung auf Dauer deutlich und tendieren latent zur Sonder(schul)pädagogik und zur Institution der Werkstatt für Behinderte, obwohl oder weil sie ursprünglich nicht aus der Sonderpädagogik kommen.
Die Lehrer der Schule B machen aus der Integrations(klassen)pädagogik kommend deutlich, dass sie über die gelingende Fortsetzung integrativer Wege bei einem großen Teil ihrer SchülerInnen erfreut sind; andererseits bringen sie ihre Sorge zum Ausdruck, ob sich die Arbeitsassistenz hinreichend auf diesen jungen, noch nicht so arbeitserfahrenen Personenkreis einstellt.
Lehrerin A1 bewertet die Stimmigkeit des Konzepts Ambulanten Arbeitstrainings differenziert: »Also grundsätzlich find' ich's gut. Was ich manchmal schwierig finde, was vielleicht aber auch erst noch mal erprobt werden muss, ob man an diesem Drei-Monate-Rhythmus festhalten soll, ob es wirklich notwendig ist, dass jeder verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen muss. Ob es nicht ausreicht, wenn sich jemand schnell in einen Arbeitsbereich einfindet, dass man sagt: ›Gut, das ist jetzt einfach sein Job, seine Arbeit‹. Ob es so viel Sinn macht, unterschiedliche Sachen anzubieten, man sich dem Zwang so aussetzen muss. Ansonsten finde ich die Betreuung gut, dass immer zwei Arbeitsbetreuer für einen zuständig sind, sich verantwortlich fühlen und sich dann auch eben die Zeit nehmen, anfangs öfter begleiten zu können, sich nach und nach rauszuziehen.« Andererseits sieht sie auch Bedarf, weitere Bereiche für das Ambulante Arbeitstraining zu erkunden. Das Problem besteht für sie darin, »dass die einzelnen einfach zu wenig darum wissen, was es tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt zu tun gibt. Also was sie kennen ist Putzen, ist Küche, das kennen sie aus der Schule, das kennen sie von zu Hause, von daher orientieren sich viele dahin. Andere Arbeitsbereiche müssen wahrscheinlich erst mal erschlossen werden. Ganz langsames Vorangehen, Ausprobieren und darauf Einstimmen, dass sie sich auf so was einlassen können. ... Da muss man erst mal noch die Phantasie entwickeln, was alles möglich ist.«
Resümierend stellt Lehrerin A1 fest, »die Gesellschaft hat eine Chance, sich zu verbessern, wenn sie mehr Kontakt zu diesen Menschen hat, weil sie so viele Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, die eigentlich im normalen Leben vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Was das soziale Miteinander-Umgehen angeht oder die Freude am Leben - ich finde das fantastisch - das sollte man der Gesellschaft nicht nehmen!« Sie ist optimistisch, dass die Gesellschaft bereit ist, diese Chance wahrzunehmen, »aber ich bin von Natur aus optimistisch. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Was ich mir wünschen würde, dass man das vielleicht noch so hingehend erweitert, dass immer zwei, drei behinderte Arbeitnehmer in einem Bereich arbeiten, dass sie dort wirklich mehr Möglichkeiten zur Kommunikation kriegen.«
Was gesellschaftliche Veränderungen der Situation von Menschen mit Behinderungen angeht sieht Lehrer A2»kleine Fortschritte. ... Vielleicht sind das große Fortschritte. Das Problem ist ja auch die Gesellschaft, nicht, die Nichtbehinderten.« Vor allem aber bemerkt er, dass sich in den Werkstätten für Behinderte etwas tut: »Es kristallisiert sich vielleicht heraus, dass bestimmte Berufsbereiche besser geeignet sind einfach für diese Menschen mit Behinderung, das sehen jedenfalls viele Mitarbeiter der Werkstatt wohl auch. Deswegen ... denkt man jetzt auch mehr in Richtung Hausmeistertätigkeit. Wobei ich das nicht für ganz unproblematisch halte, ... ich seh' einfach diese Ansprüche bei dieser Hausmeistertätigkeit, diese Vielseitigkeit, die gerade da gefordert wird. ... Also (die eine Werkstatt) will ... ihren AT-Bereich in einen Großbetrieb setzen und denn da Tätigkeiten übernehmen. Und dann ist das ja die Frage: ›Macht dann die eigentliche Arbeit der Gruppenleiter oder machen es wirklich die behinderten Menschen?‹ Das ist kritisch zu sehen.« Was in entsprechender Hinsicht sonst in anderen Werkstätten für Behinderte läuft, »da bin ich jetzt nicht informiert. ...Ich weiß jetzt, dass (die eine Werkstatt) beispielsweise ...(ihren) AT-Bereich ausrichten will mit ganz neuen Konzepten. Das Konzept steht noch nicht; da sind sie noch in der Bearbeitungsphase. ... Da sind Ansätze auch bei den Werkstätten jetzt vorhanden. Ich sehe da überhaupt ein Zusammenwachsen ... (von Arbeitsassistenz) und Werkstätten. Denn letztendlich: Wenn die Werkstätten für Behinderte sich ändern, dann brauchen sie auch letztendlich den Arbeitsassistenten. Der wird da auch gebraucht, oder man bildet jetzt die Gruppenleiter um zu einer Art Arbeitsassistent.« Ob dort auch das Interesse und das entsprechende Potential besteht, »das weiß ich nicht, nein. Es geht ja darum, ... wir richten uns ja immer nach den Bedürfnissen unseres Klientels. So. Und dann wird das wahrscheinlich den Gruppenleitern nahegelegt. Aber darüber kann ich jetzt keine Aussage machen, wie sich die Gruppenleiter dabei fühlen.«
Lehrer A2 hört »hin und wieder, dass jemand im Betrieb einfach gehänselt wurde und daraufhin einfach lieber in der WfB arbeitet, nicht. Also wenn nicht richtig assistiert wird, dann ist das für mich 'ne ganz kritische Sache. Jetzt hat mir auch gerade ein Schüler ... gesagt, er kriegt jetzt eine Stelle ... und das läuft über den Sozialpädagogischen Dienst..., hat er sich allein ausgesucht und das macht er denn auch allein. Äh, ich hoffe, dass irgendwie ein Arbeitsassistent oder irgend jemand da hinkommt und die Sache begleitet, sonst sehe ich auch die Gefahr, dass er wieder der letzte ist und irgendwann frustriert in die Werkstatt zurückkommt.«
Lehrer A2 ist der Meinung, es sei für einen Arbeitsvertrag in einem regulären Betrieb nötig, »dass so ein Bäcker XY Idealist ist. Das geht einmal. Gut. ... Was überhaupt nicht geht, hab' ich so das Gefühl, das sind« große Firmen und Handelsketten, denn »da kriegen die Chefs dann von oben gesagt: ›Also hier keine langfristigen Verträge abschließen!‹ Und insofern fällt das für unsere Behinderten immer schon flach.« In Branchen und Berufsfeldern, in denen Vorgesetzte »eine sozialpädagogische Ausbildung hatten, ... sieht das natürlich wieder ganz anders aus, die haben schon ganz andere Lebensvorstellungen entwickelt. ... Aber vielleicht sieht man auch die Schwierigkeiten von seiten des Betriebes darin, den Arbeitsplatz entsprechend einzurichten, der muss ja auf diesen behinderten Menschen abgestimmt werden, kennen wir ja aus diesem (Herrn D)-Film, und da kann ich mir vorstellen, dass viele da Probleme sehen.« Auch das Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings und die Umsetzung durch die Hamburger Arbeitsassistenz bewertet Lehrer A2 insgesamt in seiner Stimmigkeit »kritisch - seh' ich's natürlich vom Ergebnis her. Also es ist ja auch immer eine Frage, wenn man jetzt eine Statistik macht, über welchen Zeitraum man beobachtet. Also wenn man jetzt über einen ganz langen Zeitraum beobachten würde, ich hab' das Gefühl, dann würde die Arbeitsassistenz so nicht gut aussehen. Ich hab' schon vorher gesagt: Irgendwo sehe ich eine Zukunft nur im Zusammenwachsen mit anderen Maßnahmen, eine Bündelung der Kräfte. So ist das so, dass jeder so 'n bisschen so für sich rumarbeitet. Es ist richtig, die Arbeitsassistenz hat ja Verbindung zur WfB, denn die Werkstätten bleiben ja auch als Arbeitgeber für den behinderten Menschen zuständig, ne, wenn ich das richtig verstanden hab', zunächst. ... Dann muss also auch 'ne ganz langfristige Begleitung stattfinden und die kostet. Wenn man diese Kosten trägt, dann wird's wieder stimmig. Ich seh' da auch 'ne Kostenfrage.« So meint Lehrer A2, die Stunde der Wahrheit komme vielleicht erst nach einigen Jahren.
Lehrer B1 bestätigt, dass »man da unheimlich vorsichtig sein muss: Da hab ich auch bei der Hamburger Arbeitsassistenz so den Eindruck, dass (man) in dem Moment, wo das gelungen ist, Leute in ein festes Arbeitsverhältnis reinzubringen, ... Gefahr läuft, sich schon zu früh zurückzulehnen. Das ist ja eine lebenslange Aufgabe eigentlich. Deshalb ja unsere Bestrebung, von diesem 80-70-60-Modell wegzukommen und eine langfristige Unterstützung, Lohnkostenförderung zu erreichen. Bei (dem Schüler mit Autismus) kann das auch wieder kippen - ich denke, bei allen diesen Schülern.« Und dann ist erneuter Unterstützungsbedarf gegeben.
Andererseits hat sich Lehrer B1 bezogen auf die Praktikumsplätze »eigentlich immer gewundert, wie stark den Bedürfnissen da doch entgegengekommen werden kann.« Demnach wird das Instrument der personenzentrierten Planung konsequent und gut angewendet, und Wünsche und Fähigkeiten sind deutlich handlungsleitend dafür, wo die Personen am Ende arbeiten: »Mir fallen da auch gleich zwei, drei Schüler ein - die zu Beginn des Arbeitstrainings wirklich recht wenig Orientierung hatten, was sie eigentlich wollen: ›Sie hat Lust auf ein Stück Kuchen, also will sie Bäckerin werden.‹ So von einer Sekunde zur anderen pendelt das. Und da wird, meine ich, viel Aufwand betrieben rauszukriegen, was das Richtige ist. ... Das ist auch so eine Gratwanderung, denn da ist ja auch immer die Zeit, die dir wegläuft. Du willst nicht irgendwie hektisch anfangen, es ist ja auch nicht der Anspruch der Arbeitsassistenz - teilweise ein Missverständnis bei Eltern, die meinen denn, gleich der erste Betrieb, in den man reinkommt, das müsste das Ziel sein, da einen Festvertrag zu bekommen. Darum geht es gar nicht, sondern erst mal darum, verschiedenste Arbeitsfelder kennenzulernen. Aber irgendwann musst du dann auch einen Schritt weiter sein und das dann festklopfen - nur ausprobieren ist das andere Extrem. Aber ich habe den Eindruck so von dem, was ich von der Arbeitsassistenz so mitbekommen habe, dass die doch einiges dafür tun, den Bereich, der es sein könnte, systematisch einzukreisen.« Als ein Schüler bei einer Betriebsbesichtigung äußert, zu einer dort beobachteten Packertätigkeit hätte er Lust und die Lehrer es an die Assistenten weitergeben, haben »die gesagt: ›Ja ganz gut und schön. Finden wir aber nicht gut, weil wir meinen, dass das von den Möglichkeiten, die (dieser Schüler) hat, langfristig eine Unterforderung ist, und dann ist es uns noch nicht gelungen, ihm zu vermitteln, wie man rückenfreundlich Dinge hebt.‹ ... Also du merktest doch schon, da ist ein Konzept, das hat Hand und Fuß. Es gibt aber auch den anderen Fall, wo wir dann mitkriegen, der macht irgendwo ein Praktikum und wir denken: ›Wie kann das sein? War das eine Verlegenheitslösung, damit er überhaupt etwas zu tun hat?‹«
Gesamtgesellschaftlich sieht Lehrer B1 für Menschen mit Behinderungen eine Reihe durchaus widersprüchlicher Tendenzen, beginnend mit der Medizintechnik zur »Früherkennung und was den pränatalen Bereich angeht. Ich habe den Eindruck, dass diese ethische Dimension von der Mehrheit der Leute noch nicht gesehen wird. Sondern ich glaube, es ist so, dass das ganz viele Leute einfach praktisch finden, als Fortschritt der Medizin feiern. Aber was Betriebe in Hamburg angeht, da ist schon eine Menge passiert, was die Bereitschaft angeht, Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten zu lassen, sie eventuell sogar zu übernehmen. ... Die Plakataktion und der Werbefilm der Hamburger Arbeitsassistenz - ich glaube schon, dass solche Aktionen was bringen, und dass in Hamburg ein relativ günstiges Klima herrscht. Aber ich werde immer so ein bisschen desillusioniert, wenn ich wo anders hinkomme, in Flächenstaaten, sobald man nach Süden kommt, spätestens dann merkt man, dass das nicht die Realität ist, sondern dass das nach wie vor Ausnahmen sind - na gut, die beweisen immerhin, dass es möglich ist.«
Lehrer B2 teilt die Skepsis seines Kollegen: »Die Zahlen, die wir hier in Hamburg haben, sind - auch bei allem guten Willen - ja verschwindend gering. Man müsste auch mal die Zahlen angucken, was passiert, wenn die Arbeitsassistenz die Teilnehmer vermittelt hat, und was dann zwei und drei Jahre später ist? Diese Zahlen wären ja die eigentlich interessanten. Solange noch in diesem einigermaßen dichten Betreuungsverhältnis gearbeitet wird und danach diese 80-70-60-Regelung greift, gut, da mag das noch immer gehen. Aber was ist dann, ein, zwei oder drei Jahre danach? Da funktioniert das Konzept nicht bei allen. Das ist meine feste Überzeugung.« Lehrer B2 betont, »das ist keine Kritik an den Kollegen persönlich oder an der Arbeit, an der Wertschätzung der Arbeit. Ich glaube, das ist eine Falle, in der das System auch ein bisschen steckt. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.« Seine grundsätzliche Kritik betrifft die Gesamtkonstruktion des Ambulanten Arbeitstrainings: »Die jetzigen Strukturen waren vielleicht auch die einzige Möglichkeit zu starten, ich weiß es nicht.«
Lehrer B2 bezeichnet es als eine »Schwachstelle des Systems, zu denken, man könnte am Anfang massiv hineingehen und sich dann, als Ziel, relativ rasch aus dem System entfernen. Das ist meines Erachtens von Anfang an ein konzeptioneller Irrtum. Dieses Konzept wird auch vertreten, weil sonst auch keine Fördermittel zur Verfügung ständen. Die ganzen Konzepte sind ja wahrscheinlich gezwungenermaßen auch auf diesem Hintergrund geschrieben worden. Deshalb wurden auch Zielsetzungen so formuliert, und nicht in erster Linie zielgruppenorientiert. Für Menschen mit hohem Betreuungsbedarf, Leute, die von ihrer Behinderung her auch eigentlich permanenten, lebenslangen Bedarf hätten, ist dies das falsche Konzept.«
Letztlich sieht Lehrer B2 die gesamte strukturelle Anbindung der Hamburger Arbeitsassistenz als problematisch an: »Ich halte das auch für politisch fatal. Letzten Endes ist die Hamburger Arbeitsassistenz ein Subunternehmer der Werkstatt. Also sind sie, wenn man so will, abhängig von den Lobbyisten der traditionellen Behindertenarbeit und hängen an dem kleinen Geldtropf, der da tröpfelt. Und dazu hängen auch die Arbeitsplätze der Kollegen in der Arbeitsassistenz davon ab, das heißt sie sind selbst existentiell davon bedroht und abhängig von der Kooperationsbereitschaft mit den WfBs und der Arbeitsverwaltung. Das ist doch ein denkbar unglückliches Konstrukt.«
Lehrer B2 sieht die Arbeitsassistenz in den Rahmen der Werkstatt für Behinderte gezwängt, denn »die Kollegen bzw. behinderten Menschen sind ja faktisch im Status eines Arbeitnehmers einer Werkstatt. Die Arbeitsassistenz könnte genauso gut im Verwaltungstrakt (einer Werkstatt) irgendwo ein Büro haben und wären als Serviceeinheit Bestandteil dieser Werkstatt. Sie würden dann auch nicht anders arbeiten, könnten ganz genau das Gleiche machen. Sie wären noch näher an ihrem Klientel: Die Interessenten aus der Werkstatt könnten in die Beratungsstunde gehen und sagen: ›Tag, wie ist es? Ich will eigentlich gar nicht mehr hier, sondern lieber außerhalb arbeiten.‹«
Lehrer B2 befürchtet: »In fünf Jahren ist die Hamburger Arbeitsassistenz unter Umständen überflüssig geworden. Das, was die macht, können theoretisch in fünf Jahren auch alle die Werkstätten als hausinterner Fachdienst selbst.« Damit ist dann allerdings nicht unbedingt verbunden, dass die MitarbeiterInnen mit Behinderungen dann - so wie jetzt - tarifentlohnte Arbeitsplätze bekämen, »aber dafür sind sie abgesichert. Dies wird das Argument von den Skeptikern einer weiteren emanzipatorischen Entwicklung sein. Das ist meine Befürchtung: fünf bis zehn Jahre, dann ist dies auch kein gesellschaftlich relevantes Thema mehr. Zudem öffnen sich die Werkstätten inhaltlich Richtung Arbeit außerhalb der WfB, zum Beispiel macht eine Werkstatt jetzt eine Altenpflegehelferausbildung. Vielfältige Wahlmöglichkeiten nehmen auch in den WfBs von Jahr zu Jahr zu, und das ist ja auch gut so.« Jedoch ändert sich der grundsätzliche Status des Menschen mit Behinderung nicht wirklich, denn »daran haben manche Leute ja auch kein Interesse, weil es ja auch um wirtschaftliche Interessen geht.« Lehrer B2 plädiert daher für eine Abkoppelung der Arbeitsassistenz von den Werkstätten: »Eigentlich müsste die Hamburger Arbeitsassistenz eine unabhängige Agentur sein, müsste die Mittel zur Verfügung haben, die bisher institutionell gebunden sind. Wir müssen zu einer personellen Bindung die Förderungsmittel kommen.«
Noch weitergehend favorisiert Lehrer B2 einen anderen Ansatz unterstützter Arbeit, der das System im Ganzen verändern würde: »Wenn man sich einen Teilnehmer vorstellt, der möglicherweise lebenslang Unterstützungsbedarf hat, den könnte man doch in ein unterstützendes System geben mit all dem Geld, was an ihm in der Werkstatt hängt. Man könnte ihn vollsubventioniert in Arbeit bringen und zusätzlich Arbeitsassistenz finanzieren, lebenslang! Aber die Arbeitsassistenz könnte es derzeit nicht. Sie müsste nämlich ihre Idee revidieren, dass sie die Teilnehmer in Arbeit bringt und sie sich dann wieder herauszieht. Ich würde das Gegenteil tun: Ich würde solch einen Teilnehmer versuchen in Arbeit zu bringen und dem Arbeitgeber garantieren, dass ich ihn zeitlebens situationsangemessen betreuen kann. Der Platz in der Werkstatt kostet doch auch knapp 3000 DM jeden Monat. Von den finanziellen Ressourcen, die die Gesellschaft aufbringt und die auch da sind, könnte man das lebenslang garantieren. Dann können Phasen mit wenig oder auch ohne Betreuung wechseln mit intensiveren Betreuungen oder Kriseninterventionen. Vorübergehende Arbeitslosigkeit, neue Arbeitsplatzsuche etc. könnten zum Serviceangebot solch einer Agentur gehören. Die Verknüpfung zum sozialen Umfeld (Wohnen, Freizeit) könnte konzeptionell mit einbezogen werden. Formen der beruflichen Erwachsenenweiterbildung auch für Menschen mit geistiger Behinderung wären denkbar.«
Lehrer B2 sieht darin, für ein solches System Arbeitsplätze und die Bereitschaft bei Arbeitgebern zu finden, »kein Problem. Bisher sind Angebot und Nachfrage noch günstig, aber natürlich sättigt sich auch so ein Markt irgendwann. Deshalb ist das eine Frage der finanziellen Rahmenbedingungen, auch für die Betriebe.« Die bisherigen Subventionsstrukturen für die Werkstätten für Behinderte wenigstens anzutasten, »das hätte man von Anfang an politisch machen müssen. Die Vernetzungen und die Verquickungen der Befürworter der alten Konzepte sind von Anfang an nicht scharf genug getrennt worden. Die Arbeitsassistenz hätte meines Erachtens deutlich machen müssen, dass sie so arbeitet, weil es politisch keinen anderen gangbaren Weg gab, aber die Idealvorstellung hätte man jahrelang immer daneben stellen müssen, in meinen Augen.«
Die Werkstätten für Behinderte sind nach der Einschätzung von Lehrer B2 nicht beunruhigt über die Entwicklungen, weil sie dadurch bedroht wären, sondern weil »sie selbst wissen, dass sie auf dem Gebiet der Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt unprofessionell gearbeitet haben. Das ist ein Stück Selbsterkenntnis, aus dem sie natürlich nur schlecht heraus können. Die Kollegen dort wissen doch auch, dass es für manchen Werkstattmitarbeiter auch andere Möglichkeiten außerhalb der WfB geben müsste. Die WfBs haben hier ja auch ihren gesetzlichen Auftrag jahrelang nicht ernsthaft wahrgenommen.« Gleichwohl sieht Lehrer B2, dass sich die KollegInnen in den Werkstätten schon aus ihrer subjektiven Lage heraus dort in die Strukturen einpassen müssen: »Natürlich kann man nicht jeden Tag zur Arbeit gehen und sagen: ›Es müsste alles anders werden. Und dass es dort viele Leute gibt, die gute Arbeit machen, das ist doch keine Frage, wenn man ins Detail schaut und sieht, wie im konkreten Einzelfall mit einem behinderten Menschen professionell gearbeitet wird. Es kann ja nicht um das Argument gehen, die Werkstätten morgen schließen zu wollen. Dennoch sollte man auch für die Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit die volle Wahlfreiheit schaffen, in einem beschützten Rahmen zu arbeiten, oder - subventioniert und betreut und genauso abgesichert wie in einer WfB - auf dem ersten Arbeitsmarkt in einem Betrieb der Wirtschaft!«
Zwischenfazit
Alle Befragten erkennen den Stellenwert des Konzepts der Arbeitsassistenz für Personen im Ambulanten Arbeitstraining an, aber sie nehmen auch engagiert und kritisch Stellung und betonen dabei - mit unterschiedlicher Vehemenz - unterschiedliche Aspekte:
-
Lehrerin A1 möchte, dass mit Behutsamkeit und Phantasie neue Orientierungen entwickelt und Arbeitsbereiche für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt weiter erschlossen werden. So bewertet sie das Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings, wie es von der Arbeitsassistenz vorgehalten wird, als grundsätzlich gut - insbesondere wegen der verantwortlichen zwei AssistentInnen und der dosierten, sich reduzierenden Unterstützung vor Ort. Andererseits stellt sie in Frage, ob nicht zum Teil einigen SchülerInnen zu viele Praktikumswechsel zugemutet werden, und sie wünscht sich die Möglichkeit, dass bis zu drei Arbeitnehmer mit Behinderung in einem Bereich beschäftigt werden, um Kontakt und Kommunikationsbedingungen zu verbessern. Gesellschaftlich sieht sie durch berufliche Integration die Chance des allseitigen Zugewinns an Lebensqualität.
-
Lehrer A2 ist insgesamt skeptisch, was die Bereitschaft der Gesellschaft zur Integration angeht, denn ›die Nichtbehinderten‹ sind für ihn dabei ein Problem, erst recht in Bezug auf die Einstellungen von Arbeitgebern. So sieht er vor allem im Rahmen der Werkstatt für Behinderte Veränderungsprozesse und favorisiert das Zusammenwachsen von Werkstatt- und Assistenzkonzept. Seine Beobachtungen und Erfahrungen beziehen sich vornehmlich auf den Werkstattbereich und überlagern immer wieder die Frage nach der Tragfähigkeit des Konzepts der Hamburger Arbeitsassistenz. Lehrer A2 bewertet das Ambulante Arbeitstraining kritisch und zweifelt - allerdings ohne sie zu kennen - statistische Erfolgszahlen von eingegangenen Arbeitsverhältnissen an. Zur Lösung der Kostenfrage sieht er wegen der häufig notwendigen langfristigen Begleitung nur eine realistische Perspektive in der Bündelung der Kräfte, also der Fusion von Werkstatt für Behinderte und Arbeitsassistenz.
-
Lehrer B1 zweifelt ebenfalls an der langfristigen Tragfähigkeit des Konzepts der Hamburger Arbeitsassistenz, insbesondere wegen der Befristung der personellen Unterstützung, kommt aber zu ganz anderen Konsequenzen: Politisch gilt es vom dreijährigen Lohnkostenzuschuss weg und hin zu einer unbefristeten Lohnkostenförderung zu kommen und Ressourcen für Phasen des Stabilisierungs- und Neuqualifizierungsbedarfs vorzuhalten. Positiv bewertet er das Vorgehen der Arbeitsassistenz, verschiedenste Arbeitsfelder zu erschließen und Form und Umfang des Aufwands für jede Person den richtigen Tätigkeitsbereich im geeigneten Betrieb zu finden. Trotz widersprüchlicher gesellschaftlicher Tendenzen bescheinigt er der Stadt Hamburg ein relativ günstiges Klima für berufliche Integration durch unterstützte Beschäftigung, was insbesondere durch Aktivitäten der Hamburger Arbeitsassistenz mitbeeinflusst ist.
-
Auch Lehrer B2 zieht aus seiner Befürchtung, dass das bisherige Konzept der abnehmenden Unterstützung nicht langfristig trägt, sondern es ein unglücklicher konzeptioneller Irrtum sei zu glauben, so könne strukturell Arbeitsbegleitung funktionieren, deutlich andere Konsequenzen als Lehrer A2. Für fatal und politisch falsch hält er die Anbindung der Arbeitsassistenz an Werkstätten für Behinderte, die sie zu einem ›integrativen‹ Subunternehmen einer Sonderinstitution mache. Verbunden mit einer radikalen Kritik an der Institution fordert er die Unabhängigkeit eines Unterstützungssystems wie der Arbeitsassistenz als eigenständige Agentur und die Mittelbindung an Personen statt an Institutionen. Eine solche Agentur müsste, will sie auch Menschen mit schwererer Behinderung gerecht werden, das Gegenteil des gegenwärtigen Konzepts anstreben, nämlich ihnen und dem Arbeitgeber ggf. eine durchgängige dichte Betreuung garantieren. Hierfür wäre eine Umverteilung in der Subventionsstruktur nötig und machbar. Geschehe dies nicht, so würden Umformungsprozesse die Arbeitsassistenz in wenigen Jahren überflüssig machen, da die Werkstätten für Behinderte ihre erheblichen Ressourcen entsprechend verändert einsetzen könnten, um sich als System selbst zu erhalten.
Einig sind sich die Befragten darin, dass es Veränderungsbedarfe gibt, obwohl das Erreichte ein erster guter Anfangsschritt in eine richtige Richtung sei. Wie jedoch weitere Entwicklungsschritte aussehen und in welche Richtung sie führen sollten, dazu bestehen höchst konträre Positionen. Darüber hinaus wird bei den Lehrern der Schule B die Tendenz deutlich, den Übergang vom BBE-i in das Integrationspraktikum möglichst lange autonom in der Hand zu haben.
Die Befragungsergebnisse bilden zwei recht unterschiedliche Profile von Berufsschulen ab und zeigen sich bei den LehrerInnen weniger in Übereinstimmungen als vielmehr in zum Teil ergänzenden und zum Teil entgegengesetzten Positionen. Hierbei bilden Lehrer A2 und Lehrer B2 sicher die gegensätzlichen Extreme, während zwischen Lehrerin A1 und Lehrer B1 größere Nähe und Berührungspunkte bestehen. Dennoch erscheinen die Gemeinsamkeiten innerhalb der beiden Schulen und der Unterschiede zwischen ihnen dominierend.
Schule A hat eine lange Tradition im Berufsschulunterricht für Personen im Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten für Behinderte, und die hier befragten BerufsschullehrerInnen drücken deutlich ihre Verbundenheit mit und teilweise Verwurzelung in dieser Institution aus. Entsprechend zurückhaltend sind sie Aspekten gegenüber, die diese - wenn auch nur latent und indirekt - in Frage stellen könnten. Konzeptionell setzt die Schule A auf die Modularisierung von inhaltlichen Bereichen und legt ihren Schwerpunkt auf fachliche Qualifizierung. Den Fachbezug ein Stück weit zu relativieren und mit größerer Flexibilität auf die unter-schiedlichen Situationen an den Praktikumsplätzen der SchülerInnen einzugehen, ist eine Herausforderung für die BerufsschullehrerInnen. Unter den Rahmenbedingungen, auch in anderen Klassen mit anderen Zielgruppen eingesetzt zu sein, ist eine im Vergleich zu Schule B geringere Kooperationsdichte mit den SchülerInnen, AssistentInnen und Betrieben und zumal mit den Eltern nicht verwunderlich.
Im Ambulanten Arbeitstraining sehen die LehrerInnen der Schule A eine lediglich ergänzende Form der Berufsvorbereitung zum Arbeitstraining in der Werkstatt für Behinderte, vergleichbar mit anderen ebenfalls in ihrer Schule beheimateten Berufsschulprojekten, die auf die Tätigkeiten in integrativen Zweckbetrieben vorbereiten sollen. Mit Behutsamkeit wird der Weg allmählicher Erweiterungen und Veränderungen ausgebaut, nicht aus voller Überzeugung vielleicht, sondern weil die Idee herangetragen wurde, man dort pragmatisch hineinrutschte oder ähnliches.
Die beiden BerufsschullehrerInnen der Schule A bringen zum Teil Auffassungen zum Ausdruck, die eher einer traditionellen Sonderpädagogik zugeordnet werden oder im Polaritätenmodell unterschiedlicher Verständnisse von Behinderung dem defektologischen Pol zuzuordnen wären (vgl. Kap. 1.2). Der Paradigmenwechsel zur dialogischen Haltung, wie er für ein Engagement innerhalb der beruflichen Integration in Form der unterstützen Beschäftigung eine wichtige Voraussetzung sein dürfte, ist noch nicht vollzogen und, wenn überhaupt bewusst angestrebt, erst am Anfang der Überlegungen. Vielmehr dominiert hier eine pragmatisch reagierende Vorgehensweise, sozusagen eine ›Realo-Strategie‹. Das Ambulante Arbeitstraining kann hier nach im wesentlichen bleiben, wie es ist, man sollte allenfalls Häufigkeit und Dauer der Praktika hinterfragen. Unterstützte Beschäftigung ist nicht für alle Menschen mit Behinderungen das Richtige, Zwischenschritte - mindestens die Kombination von unterstützten Arbeitsplätzen von zwei bis drei - und Werkstatt-Außenarbeitsplatz oder eben der Platz in einer sich verändernden Werkstatt für Behinderte sollten demnach als Wahlmöglichkeiten zu einer möglichst großen individuellen Passung vorgehalten werden. Als zukunftsträchtig wird angesehen, wenn die Werkstätten das Ambulante Arbeitstraining auf dem ersten Arbeitsmarkt als Teil ihrer Angebotspalette anbieten und damit auch die Durchlässigkeit zu anderen Angeboten absichern. Dabei werden jedoch die widersprüchlichen institutionellen Interessen der Werkstatt für Behinderte nicht mitreflektiert, wenn nämlich deren LeistungsträgerInnen einerseits auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden und andererseits im Hause zu hoher Produktivität und positiven Erlösen beitragen sollen.
Schule B hat, auch ablesbar aus den hier vorliegenden Positionen ihrer Lehrer, einen anderen Weg hinter sich. Die Tatsache, dass hier ursprüngliche Sonderpädagogen mit längerer Erfahrung im Unterricht in Integrationsklassen an Gesamtschulen Stellung beziehen, mag verschärfend hinzukommen. Beide sind ursächlich an der Konzeptentwicklung der integrativen Projekte an der Berufsschule B beteiligt. Der konzeptionelle Schwerpunkt für die Arbeit in den Klassen des Ambulanten Arbeitstrainings liegt eindeutig im selbstreflexiven Bereich, also bei der Bearbeitung von Themen wie der Rolle als ArbeitnehmerIn, übliches Verhalten im Betrieb und ähnliches. Dieser Schwerpunkt steht nicht in einem Spannungsverhältnis zu den so unterschiedlichen Praktikumsplätzen der SchülerInnen, sondern ermöglicht durch die Vielfalt ihrer Erfahrungen eine Intensivierung des Austausches. Insofern verwundert der hohe Stellenwert nicht, den die Lehrer der Schule B der Kooperation mit SchülerInnen, Betrieben, AssistentInnen und Eltern bzw. Wohnumfeld beimessen - bis hin zu kontinuierlicher Arbeitsbegleitung, der dank eines großzügigen Stundenrahmens möglich ist. Die Lehrer der Schule B identifizieren sich in hohem Maße mit den integrativen Entwicklungen, bis hin zu politischem Engagement für veränderte Rahmenbedingungen beruflicher Integration.
So einig sich die LehrerInnen beider Schulen sind, dass der Erfolg beruflicher Integration sich letztlich erst nach Jahren zeigen könne, so stark weisen die Rückschlüsse der Lehrer der Schule B in eine andere Richtung als die der KollegInnen von Schule A; vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Schule B der Gesellschaft mehr (zu)traut und auch zuzumuten bereit ist: Die Forderung nach einer veränderten finanziellen, von Institutionen unabhängigen Förderstruktur ist sicherlich eine radikale, sie ist getragen vom Paradigmenwechsel, fort vom defektologischen Behinderungsbegriff und hin zum dialogischen, weg also von einer institutionellen und hin zu einer individuellen Logik. Eine solche ›Fundi-Position‹ muss mit dem Attribut ›utopisch‹ kämpfen, was die Vehemenz ihres Vortrags an entsprechenden Stellen erklären mag.
Die grundsätzliche Richtung des Ambulanten Arbeitstrainings halten die Lehrer der Schule B - neben ihrem schuleigenen BBE-i natürlich - für eine erfolgreiche integrative Form der Berufsvorbereitung, allerdings melden sie in zweierlei Richtung Bedenken an: Zum einen halten sie die administrative und juristische Verankerung der Arbeitsassistenz insgesamt für überaus problematisch, besonders die Anbindung an die Werkstatt für Behinderte und die zeitliche Begrenzung der Unterstützungsmöglichkeiten wird kritisch gesehen. Zum anderen wollen sie die Qualität der Unterstützung insbesondere unter dem Aspekt der Verlässlichkeit und im Hinblick auf den Personenkreis der SchulabgängerInnen mit geistiger Behinderung gesichert wissen. Von daher ist auch die deutlich werdende Tendenz verständlich, den Übergang vom BBE-i in das Integrationspraktikum möglichst lange autonom in der Hand zu haben. Unter den gegenwärtigen widrigen administrativen Bedingungen wird der Arbeitsassistenz als unabhängigem Fachdienst keine große Überlebenschance gegeben, sondern als düstere Perspektive die Übernahme ihrer Funktion durch die Werkstätten prognostiziert, ohne allerdings eindeutige Aussagen darüber zu treffen, ob dies dem Anspruch und der Idee der beruflichen Integration entsprechend dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung entsprechen würde.
SchülerInnen im Ambulanten Arbeitstraining und ihre AssistentInnen haben alle Chancen, recht unterschiedliche Situationen und KooperationspartnerInnen im Kontext des Berufsschulunterrichts zu erleben, und sie haben mit recht unterschiedlichen Sichtweisen zu tun von der Maßnahme, in der sie sich befinden. Dies wirkt sich bei denen, die nur das jeweils eine kennen, nicht in besonders profilierter Zufriedenheit oder Unzufriedenheit aus. Bei denen aber, die Vergleichsmöglichkeiten haben, überwiegt die Zustimmung zu Arbeitsschwerpunkten und Arbeitsweise der Schule B (vgl. auch Kap.5.3.7). Es bleibt festzuhalten, dass Schule B in höherem Maße als Schule A eine konzeptionelle Passung mit dem Ambulanten Arbeitstraining aufweist.
Inhaltsverzeichnis
-
9.1 Wesentliche Ergebnisse
- 9.1.1 Langfristige Orientierungen der TeilnehmerInnen und ihres Umfeldes
- 9.1.2 Prozesse in Arbeitstraining und Integrationspraktikum und Effekte
- 9.1.3 Rolle und Arbeitssituation von ArbeitsassistentInnen und GruppenleiterInnen
- 9.1.4 Erfolgsfaktoren und Erfolgshemmnisse
- 9.1.5 Berufsberatung aus der Perspektive des Ambulanten Arbeitstrainings
- 9.1.6 Berufsschulunterricht aus der Perspektive des Ambulanten Arbeitstrainings
- 9.1.7 Individualorientierung versus Gruppenorientierung
- 9.1.8 Entwicklungslogik versus Zuweisungslogik
- 9.2 Positionen zum Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum
- 9.3 Diskussion unter theoretischen Perspektiven
- 9.4 Handlungsbedarfe und offene Fragen
- 9.5 Schluss
Die vorliegende Untersuchung evaluiert zwei Maßnahmen, die von der Hamburger Arbeitsassistenz getragen werden: das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikumsjahr. Die wesentliche Fragestellung richtet sich dabei auf die Funktionalität der beiden Maßnahmen - halten sie also von der Qualität her das, was sie strukturell versprechen? Die Beantwortung dieser Frage erfolgt - auch durch die Rahmenbedingungen der externen Evaluation bedingt - anhand der Wahrnehmung und Einschätzung der Maßnahmen durch die Beteiligten: der TeilnehmerInnen selbst, ihrer AssistentInnen, ihrer Eltern, ihrer Vorgesetzten, ihrer BerufsschullehrerInnen und ihrer zuweisenden BerufsberaterInnen. Mit Hilfe aller ihrer Aussagen können gewünschte Prozesse und Effekte rekonstruiert werden. Zusätzlich wird an vielen Stellen die Alternative, also das Arbeitstraining innerhalb der Werkstatt für Behinderte, vergleichend betrachtet. Im Rückblick erscheint es sinnvoll nochmals zu betrachten, dass die Evaluation nicht mit von vornherein festgelegten Erfolgskriterien und Hypothesen an die Maßnahmen herangegangen ist; vielmehr hat sie sich suchend und um das Nachvollziehen von Prozessen und Effekten bemüht ins Forschungsfeld hineinbewegt und hat versucht, Muster zu entdecken und schlüssige theoretische Erklärungen zu finden - also ein induktives Vorgehen, das sich je nach konkreter Fragestellung dem Untersuchungsgegenstand mit Hilfe qualitativer und quantitativer Verfahren hermeneutisch nähert (vgl. hierzu LAMNEK 1988, FLICK 1995). Angesichts des geringen Bestandes gesicherter Forschungsergebnisse erscheint dies als das sinnvolle und gebotene Verfahren.
Im folgenden erfolgt die Zusammenfassung und Diskussion der Evaluationsergebnisse in fünf Schritten: Zunächst werden die wesentlichen Ergebnisse über die Kapitelstrukturen hinweg zusammengestellt, im zweiten Schritt werden die subjektiven Wahrnehmungen der Beteiligten in sechs Positionen verdichtet und die zentralen Kontroversen benannt, drittens werden die Ergebnisse im Licht verschiedener theoretischer Ansätze diskutiert, im vierten Schritt wird der Blick nach vorne gerichtet, indem Handlungsbedarfe und Perspektiven aufgezeigt werden, und fünftens wird schließlich ein Fazit gezogen.
Nun wird der Versuch unternommen, die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation über die Kapitelstrukturen hinaus in acht Punkten zusammenzufassen. Hierbei werden die Ergebnisse aus den Werkstätten für Behinderte ebenfalls einbezogen.
Die TeilnehmerInnen der beiden Formen des Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums kommen in diese Maßnahmen meist aufgrund langfristiger Orientierungen von ihnen selbst und/oder ihres Umfeldes. Sie haben Schullaufbahnen in verschiedenen Schulformen hinter sich und sind von der Sonderschule aus durch Betriebspraktika in der Werkstatt für Behinderte eher auf diese orientiert bzw. von der integrativen allgemeinen Schule aus über Betriebspraktika auf dem ersten Arbeitsmarkt und entsprechende Berufsorientierung in integrativen Formen auf den ersten Arbeitsmarkt orientiert (vgl. Kap. 3.3.1.1 und 3.3.1.3).
Bestätigt werden diese Befunde aus der ersten Befragung durch die Berichte der TeilnehmerInnen und ihrer Eltern in den Einzelstudien (vgl. Studien A bis D, Kap. 4.4), der Weg von der Schule für Geistigbehinderte in die Werkstatt für Behinderte wird u.U. auch von den Eltern kritisch betrachtet (vgl. Studie F; Kap. 4.4.6). Ebenfalls weisen einige BerufsberaterInnen auf eingefahrene Wege von der Schule für Geistigbehinderte zur Werkstatt für Behinderte (vgl. Kap. 7.3.1.1) wie auf konflikthafte Situationen mit integrationsorientierten Eltern hin, die in einer früheren Phase zu scharfen Kontroversen geführt haben (vgl. Kap. 7.3.2.1).
Vor diesem Hintergrund erscheint die weitgehend übereinstimmende Feststellung der Befragten darüber logisch, dass die Durchlässigkeit zwischen beiden Formen des Arbeitstrainings nur in Ansätzen realisiert ist (vgl. Kap. 5.3.1).
Die Tätigkeitsbereiche beider Gruppen - Assistenz- und Werkstatt-Gruppe - differieren im Arbeitstraining bzw. Integrationspraktikum wie in der nachfolgenden Beschäftigung beträchtlich (vgl. Kap. 3.3.2.2 und 3.3.3.3): Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktika sowie nachfolgende Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt finden eher im Dienstleistungsbereich und (im weitesten Sinne) in der Gastronomie statt, Arbeitstraining und Beschäftigung in der Werkstatt für Behinderte vollziehen sich an handwerklichen und industriellen Tätigkeiten. Dies wird auch in den Einzelstudien bestätigt (vgl. Kap. 4) sowie durch Beispiele von Vorgesetzten, die die Tätigkeiten ihrer unterstützten MitarbeiterInnen beschreiben (vgl. Kap. 6.2). Durch den Schwerpunkt im Dienstleistungs- und Gastronomiebereich entsteht - neben den je individuellen Möglichkeiten und natürlich auch unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktsituation - mehr Präsenz in der Öffentlichkeit, mehr Begegnungen und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Menschen werden möglich, der Aspekt der Gemeinwesenorientierung wird gestärkt.
Dabei ist die Erfahrungsbreite in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und verschiedenen Betrieben im Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum nicht geringer als im Arbeitstraining der Werkstätten für Behinderte (vgl. Kap. 3.3.2.2). Für die Wahl von Arbeitsplätzen sind bei ArbeitsassistentInnen wie GruppenleiterInnen Neigungen und Interessen der TeilnehmerInnen entscheidend, für die Verweildauer an einem Arbeitsplatz ist allerdings das vorhandene Lernpotential noch wichtiger (vgl. Kap. 5.3.3).
Für die soziale Situation in beiden Formen des Arbeitstrainings und der nachfolgenden Beschäftigung ergibt sich tendenziell insgesamt eine Patt-Situation: Das Auskommen mit den KollegInnen gestaltet sich nahezu gleich (vgl. Kap. 3.3.2.3); in den Werkstätten für Behinderte kommt es einerseits häufiger zu Problemen mit KollegInnen (vgl. Kap. 3.3.2.6), andererseits werden zwar in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes seltener neue Freunde gefunden, jedoch wird auch nicht über massives Hänseln und Mobbing berichtet - weder von TeilnehmerInnen (vgl. Kap. 3.2.2.3 und 3.3.3.3), noch von Vorgesetzten (vgl. Kap. 6.4). Vielmehr stützen sich die TeilnehmerInnen dort auf ein vielfältigeres Unterstützerumfeld in der Beschäftigungssituation (vgl. Kap. 3.3.3.3), und mehrere Vorgesetzte berichten von einer Verbesserung des Betriebsklimas im Zuge der Unterstützten Beschäftigung (vgl. Kap. 6.4).
Der Assistenz-Gruppe machen das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum mehr Spaß und sie gefallen ihr besser, auch wenn es mehr Stress gibt und es anstrengender ist als das dortige Arbeitstraining für die Werkstatt-Gruppe (vgl. Kap. 3.3.2.6); gleichwohl sind Veränderungswünsche nach ›weniger Stress‹ in der Assistenz-Gruppe nur gering vertreten (vgl. Kap.3.3.2.7). Die mit dem Arbeitstraining verbundenen Hoffnungen erfüllen sich bei der Assistenz-Gruppe etwa zur Hälfte, bei der Werkstatt-Gruppe nur zu einem Drittel (vgl. Kap. 3.3.2.7), zudem melden größere Anteile der Assistenz-Gruppe beim Arbeitstraining und bei der Beschäftigung keine Veränderungswünsche an (vgl. Kap. 3.3.2.7 und 3.3.3.4).
Auch wenn die Zufriedenheit in der Beschäftigungsphase bei beiden Gruppen recht hoch ist (vgl. Kap. 3.3.3.4), wollen 41 % der Befragten in der Werkstatt-Gruppe irgendwann die Werkstatt für Behinderte verlassen und ›draußen‹ auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein (vgl. Kap. 3.3.3.5). Lediglich eine einzige Person, die über das Integrationspraktikum einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen hat, äußert, dass sie sich auch eine Rückkehr in die Werkstatt für Behinderte vorstellen könnte, da ihr dort das Weben so gut gefallen hat - dass dies auch ein schönes Hobby sein könnte, ist ihr nicht bewusst. Häufig äußern selbst solche Personen, die sich sehr zufrieden mit dem Arbeitstraining und der Beschäftigung in der Werkstatt für Behinderte zeigen, Pläne, ›draußen‹ arbeiten zu wollen, so auch Frau F (vgl. Kap. 4.4.6). Hier stellt sich die Frage, ob die hohe Zufriedenheit in der Werkstatt für Behinderte zu gewissen Anteilen eine »resignative Zufriedenheit« (vgl. ULICH, zit. in BURTSCHER 2001, 33) sein könnte; derlei Tendenzen zeigen sich jedenfalls in den Einzelstudien I und J (vgl. Kap. 4.4.9 und 4.4.10; zusammenfassend Kap. 4.5). Sollte diese Überlegung zutreffen, erschiene die in etwa gleich große Zufriedenheit beider Gruppen in einem neuen Licht, zu ungunsten der Werkstätten für Behinderte.
Bei über 50% der TeilnehmerInnen gelingt es, das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum in ein tarifentlohntes, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu überführen (vgl. Kap. 3.3.3.1). Diese hohe Vermittlungsquote führen BerufsschullehrerInnen auf die gute Arbeit der ArbeitsassistentInnen zurück (vgl. Kap. 8.3.4). Beispiele hierfür finden sich bei den Einzelstudien (vgl. Kap. 4), bei Herrn D allerdings mit einem instabilen Verlauf, denn nach längerer Zeit einer problematischen Entwicklung kommt es zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zum Eintritt in das Integrationspraktikum und innerhalb weniger Monate zu einem neuen Arbeitsvertrag (vgl. Kap. 4.4.4). Damit ist deutlich, dass das Ende eines Arbeitsverhältnisses nicht das Ende unterstützter Beschäftigung bedeutet, vielmehr sind klare Transfer-Effekte zu beobachten - und dies bei einem Menschen, dem eine geistige Behinderung zugesprochen wird.
In der anschließenden Beschäftigung arbeitet nur ein Viertel der unterstützt Beschäftigten mit voller Stelle, alle anderen mit Teilzeitverträgen (vgl. Kap, 3.3.3.2). Dennoch verdienen sie - selbst bei den geringen Löhnen im Dienstleistungs- und Gastronomiebereich - deutlich mehr als ihre KollegInnen in den Werkstätten für Behinderte (vgl. ebd.), wenngleich auch dieser Verdienst nicht dafür ausreicht, um unabhängig von Sozialleistungen zu werden.
Bei den TeilnehmerInnen am Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum und ihren Eltern findet sich durchgängig die Einschätzung, dass sie ohne die ArbeitsassistentInnen in der Werkstatt für Behinderte arbeiten würden oder zuhause säßen (vgl. Kap. 4.5). Deren Unterstützung mit den drei Standbeinen der tätigkeitsbezogenen Qualifizierung, der Entwicklung von Schlüsselqualifikationen und der Unterstützung sozialer Integration durch gemeinsame Reflexion sind die entscheidende Bedingung für die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt (vgl. Kap. 4.5), was im übrigen von den Vorgesetzten bestätigt wird (vgl. Kap. 6.4). Das Konzept und die Leistungen vom Ambulanten Arbeitstraining und vom Integrationspraktikum werden auch von den beteiligten BerufsschullehrerInnen anerkannt, auch wenn sie kritische Anmerkungen in ganz unterschiedlichen Richtungen haben (vgl. Kap. 8.3.5).
Es verwundert nicht, dass die AssistentInnen voll und ganz hinter dem Konzept und der Praxis des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums stehen, beides offensiv vertreten und die Werkstätten für Behinderte ebenso kritisch sehen (vgl. Kap. 5.3.1). Dabei rangieren für sie Qualifizierungsziele im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung vor jenen mit direktem Arbeitsbezug, wogegen GruppenleiterInnen aus dem Arbeitstraining der Werkstätten beides gleichrangig sehen (vgl. Kap. 5.3.3). Gleichwohl sehen AssistentInnen auch problematische Punkte: Als Schwächen der beiden Maßnahmen sehen sie perspektivisch für die TeilnehmerInnen eine mögliche dauerhafte Abhängigkeit von Assistenz und Überforderungstendenzen, weniger dagegen soziale Isolation und Ausbeutung, wie es die GruppenleiterInnen befürchten (vgl. Kap. 5.3.8). Von den BerufsschullehrerInnen der Schule B werden - vor allem vor dem Hintergrund des Übergangs aus dem BBE-i in das Integrationspraktikum - Bedenken benannt in Bezug auf die Verlässlichkeit der Unterstützung (vgl. Kap. 8.3.3) - dies hängt mit den unterschiedlichen Konzepten einer im BBE-i zeitlich konstanten bzw. einer bei der Arbeitsassistenz bedarfsbezogen flexiblen Unterstützung zusammen. Zudem wird vermutet, die Arbeitsassistenz stelle sich noch nicht hinreichend auf den Personenkreis ein, der mit deutlichen geistigen Behinderungen direkt aus der Schule auf sie zukomme, weil er auch kaum bei ihr auftauche; sie habe es mit älteren BewerberInnen aus der Werkstatt für Behinderte zu tun (vgl. Kap. 8.3.4). Diese Vermutung kann zumindest den Aussagen der TeilnehmerInnen nach nicht bestätigt werden, denn etwa ein Viertel von ihnen im Ambulanten Arbeitstraining kommt aus Schulen für Geistigbehinderte und ist unter 21 Jahre alt - hinzu kommen ebenso junge AbsolventInnen aus Integrationsklassen (vgl. auch Tab. 3.4 und 3.6).
Einige Problempunkte werden auch von Vorgesetzten als kritische Anmerkungen zu den Rahmenbedingungen formuliert: Die Befristung der Unterstützung durch die AssistentInnen und der Lohnkostenzuschüsse sehen sie als Gefährdungen von unterstützten Arbeitsverhältnissen, nicht dagegen gesetzliche Vergünstigungen wie Kündigungsschutz oder Mehrurlaub für Schwerbehinderte (vgl. Kap. 6.4). In die gleiche Richtung gehen auch die strukturellen Kritikpunkte der BerufsschullehrerInnen von Schule B, die von den AssistentInnen weitgehend geteilt werden: Die administrative Anbindung an die Werkstätten für Behinderte mit den geringen Platzzahlen und der Zwang zur zeitlichen Befristung der Unterstützung werden für sehr problematisch gehalten und entsprechende Veränderungswünsche formuliert (vgl. Kap. 8.3.5 sowie 5.3.1 und 5.3.9). Eine positive Tendenz hinsichtlich der Einstellungsbereitschaft von Arbeitgebern nehmen auch die BerufsberaterInnen wahr, indem sie wesentlich mehr positiv besetzte als problematisch wahrgenommene Einstellungsgründe sehen (vgl. Kap. 7.3.4.1).
Insgesamt lässt sich die Aussage machen, dass das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum von den unmittelbar Beteiligten - TeilnehmerInnen, Eltern, AssistentInnen und Vorgesetzten - weitgehend positiv bewertet und als sinnvoll angesehen werden - mit geringen graduellen Unterschieden zwischen beiden Maßnahmen (vgl. Kap. 3.3.2.8). Die mittelbar beteiligten BerufsschullehrerInnen erkennen die positiven Leistungen und das Konzept an, üben jedoch in sehr unterschiedlichen Richtungen pragmatische wie grundsätzliche Kritik (vgl. Kap. 9.2). Von nur indirekt Beteiligten - BerufsberaterInnen und GruppenleiterInnen im Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten für Behinderte - wird der Stellenwert des Ambulanten Arbeitstrainings sehr unterschiedlich eingeschätzt. Alle befragten GruppenleiterInnen schätzen ihn im Gegensatz zu den AssistentInnen niedrig ein (vgl. Kap. 5.3.1), dagegen findet sich bei den BerufsberaterInnen ein großes Spektrum unterschiedlicher Einschätzungen: Der Stellenwert wird von marginal bis zukunftsweisend, der Erfolg von gering über quantitativ gering und qualitativ hoch bis zu generell hoch eingeschätzt. Veränderungsbedarfe werden in mehr Transparenz und Realismus, in einer Veränderung der Zielgruppe hin zu ›Grenzfällen‹ und in einer massiven Ausweitung, auch zusätzlich für andere Zielgruppen, gesehen (vgl. Kap. 7.3.3). Es kann vermutet werden, dass mit zunehmender Entfernung die Einschätzungen von weniger Sicherheit und von weniger Informationen geprägt sind oder von mehr innerer Distanz - oder beides.
Festzuhalten bleibt ein sehr positives Fazit für beide Maßnahmen, sowohl was die Stellungnahmen zu den Prozessen und Situationen während ihnen angeht, als auch was die Effekte in Form anschließender Wege mit über 50% sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen angeht - ohne sie damit zum einzigen Erfolgsmaßstab zu machen.
Die Rolle der AssistentInnen in beiden Maßnahmen lässt sich als die eines (chemischen) Katalysators bezeichnen, der eine bestehende Situation weiterzuentwickeln hilft, in einem gewissen Unterschied zur Rolle der GruppenleiterInnen, die stärker leitend und betreuend in einem eigens geschaffenen Feld agieren (vgl. Kap. 5.4). Gleichwohl gibt es auch eine Reihe von Übereinstimmungen zwischen beiden Gruppen, nicht zuletzt, dass sie ihre doch recht unter-schiedliche Arbeit und Arbeitssituation weitgehend positiv einschätzen (vgl. Kap. 5.3.2). Mit den unterschiedlichen Facetten der Berufsrollen - hier Beeinflussung und Mitentwicklung einer Situation, dort Förderung von Personen - sind bei den AssistentInnen eine höhere Komplexität der Arbeit und mehr Stress verbunden. Insofern verwundert es nicht, wenn sie Fortbildungsbedarfe vor allem im Bereich Gesprächsführung und Supervision nennen und Veränderungsbedarfe vor allem bei dem Thema Arbeitszeit und beim besseren Austausch mit KollegInnen ansiedeln (vgl. ebd.). Hiervon wären indirekt auch positive Effekte für die Akquisition zu erwarten.
Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Anteile konkreter Tätigkeiten bei den AssistentInnen wie auch bei den GruppenleiterInnen stark individuell variieren (vgl. ebd.); ob dies den Bedarfen der unterstützten Personen oder eigenem Stil geschuldet ist, muss hier offen bleiben. Beide Gruppen sehen Grenzen ihrer Möglichkeiten erreicht, wenn Problemstellungen und Handlungsbedarfe in den Bereich des Privaten oder auch des Therapeutischen hineinreichen (vgl. Kap. 5.4); dies zeigt sich auch in der Studie E, in der das private Umfeld unterstützt werden müsste, womit die Assistentin jedoch von Auftrag, Ausbildung und Zeitbudget her überfordert ist (vgl. Kap. 4.4.4). Beide Gruppen sind ihren Aussagen nach auch stark in kooperative Netze eingebunden: Primär kooperieren sie mit den TeilnehmerInnen, KollegInnen und TeampartnerInnen, in zweiter Linie mit Eltern und der Leitung - was vor allem für die AssistentInnen gilt - , schließlich mit BerufsschullehrerInnen und BerufsberaterInnen. Im inneren Bereich sehen sie eine gute und intensive Kooperation, mit dem äußeren nimmt die Intensität ab und die Einschätzungen der Qualität gehen weiter auseinander (vgl. Kap. 5.3.4).
Bezüglich ihrer Kooperationssituation mit den TeilnehmerInnen gibt es in der Einschätzung der Qualität sehr ähnliche Ergebnisse bei AssistentInnen und GruppenleiterInnen: Generell liegen die Einschätzungen im positiven bis mittleren Bereich (vgl. Kap. 5.3.4). Zwar nehmen die TeilnehmerInnen mit den AssistentInnen mehr Reibung wahr, jedoch wird von ihnen seltener der Wunsch nach einem besseren Eingehen auf ihre individuellen Belange geäußert als gegenüber den GruppenleiterInnen (vgl. Kap. 3.3.2.4). Bezüglich der professionellen Rolle sehen die TeilnehmerInnen bei den AssistentInnen mehr begleitende und beratende Anteile, die GruppenleiterInnen nehmen sie eher als FreundInnen oder Chefs wahr (vgl. ebd.); die beiden Berufsgruppen wiederum sehen sich eher in beratender/begleitender (AssistentInnen) und betreuender/unterstützender Rolle (GruppenleiterInnen), aus der vermuteten Fremdsicht durch die TeilnehmerInnen tauchen auch Rollen mit stärkerer Dominanz wie Chefs und LehrerInnen auf (vgl. Kap. 5.3.2.) - hierbei fällt die vermutete Sicht durch die TeilnehmerInnen vor allem bei den AssistentInnen kritischer aus als deren reale Aussagen.
Typische Konfliktsituationen gestalten sich aufgrund der verschiedenen Grundsituationen - EntwicklerIn von Situationen oder Förderung von MitarbeiterInnen - unterschiedlich: Bei den AssistentInnen handelt es sich um eher situativ bedingte, von TeilnehmerInnen möglicherweise als ›unsolidarisch‹ empfundenen Rollenanteile, etwa Forderungen im Sinne der Vorgesetzten, bei GruppenleiterInnen geht es eher um Verhaltensprobleme ihrer MitarbeiterInnen.
In Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes sehen sich die AssistentInnen - in deutlichem Unterschied zu den GruppenleiterInnen der Werkstatt für Behinderte - als kompetent wahrgenommen, obwohl sie ihre Rollen in positiven wie in problematischen Varianten beschreiben (vgl. Kap. 5.3.5). Professionelle und kompetente Arbeit bescheinigen ihnen auch die Vorgesetzten; insbesondere bei der Einarbeitung und Begleitung sind sie unentbehrlich, denn sie analysieren den Arbeitsbereich und machen konkrete Vorschläge für den Zuschnitt und ggf. die Erweiterung eines unterstützten Arbeitsplatzes (vgl. Kap. 6.4). So kommt es dazu, dass nach Einschätzung der AssistentInnen über die Hälfte der unterstützten MitarbeiterInnen in den Betrieben als ›zunehmend kompetent‹ wahrgenommen und nur ein kleiner Teil vor allem ›defizitär‹ betrachtet wird (vgl. Kap. 5.3.5). Bei den ArbeitgeberInnen sehen die AssistentInnen zudem ein Spektrum positiver Einstellungsmotive, deutlich mehr als die GruppenleiterInnen vermuten (vgl. Kap. 5.3.5).
Schließlich wird der Übergang vom BBE-i zum Integrationspraktikum von den beteiligten BerufsschullehrerInnen als problematisch wahrgenommen, da sie bei den ArbeitsassistentInnen eine geringere Dichte und Kontinuität in der Unterstützung und weniger Kontakt mit Eltern sowie deren geringeren Stellenwert wahrnehmen - die Beispiele, an denen diese Problematik aufgezeigt wird, stammen jedoch aus der Zeit, als es das Integrationspraktikum noch nicht gab und institutionell kompliziertere Wege gegangen werden mussten (vgl. Kap. 8.3.3). Dieser Übergang wird nun durch das Integrationspraktikum selbst und durch ein Tandemsystem im Übergang von der Berufsschule zur Arbeitsassistenz besser geebnet.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Arbeitssituation der AssistentInnen mit ihrer Ausrichtung auf die Entwicklung einer Situation in einem Betrieb eine komplexe und anstrengende, eine jeweils sehr spezifische, aber auch eine bei den anderen Beteiligten, von TeilnehmerInnen wie von Vorgesetzten, weitgehend anerkannte ist; in der Kooperation mit den TeilnehmerInnen stehen sie keineswegs schlechter da als die GruppenleiterInnen in den Werkstätten für Behinderte.
In der Zusammenschau lassen sich eine Reihe von Aussagen nennen, die als Erfolgsfaktoren bzw. Erfolgshemmnisse gesehen werden können.
Zunächst ist festzustellen, dass die Vorgesetzten die Einarbeitung der unterstützten MitarbeiterInnen durch die AssistentInnen für unverzichtbar halten, um konkrete Erfahrungen mit der Person sammeln und das Zusammenpassen ermessen zu können (vgl. 6.4). Auf seiten der AssistentInnen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass sie eine klare Vorstellung davon haben, dass das jeweilige unterstützte Arbeitsverhältnis eine reale Chance auf Realisierung hat - so die Assistentin in Studie D (vgl. Kap. 4.4.4) - und dass sie für die Ausgestaltung und Erweiterung des Aufgabenbereichs der unterstützten Person konkrete Vorschläge machen, wie die Aussagen von Chef E verdeutlichen (vgl. Kap. 6.3.5). Letztlich hängt der Erfolg zentral davon ab, in welchem Maß die AssistentInnen ihre Rolle als AgentInnen zwischen allen Beteiligten und ihre Funktion als Motor und Katalysator für die Weiterentwicklung der Situation realisieren können (vgl. Kap. 5.3.2). Dabei stehen sie vor der Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen den Gegebenheiten und Notwendigkeiten im Betrieb mit einem gewissen Maß an Anpassung an sie auf der einen Seite und dem aktuellen Stand der Entwicklung der Person selbst und ihren möglichen Schritten der Weiterentwicklung auf der anderen Seite - dies sehen sowohl die AssistentInnen als auch die BerufsschullehrerInnen (vgl. Kap. 5.3.1 und 8.3.2). Dass diese Gratwanderung schwierig sein kann, zeigt Studie D (vgl. Kap. 4.4.4), dort wird jedoch auch deutlich, dass bei einem Stellenwechsel erfreuliche Transfereffekte beobachtet werden können.
Bei den TeilnehmerInnen sind nicht - wie vielfach angenommen wird - die kognitiven Fähigkeiten für einen erfolgreichen Verlauf entscheidend, sondern eine Vorstellung davon, was Arbeit bedeutet und eine Motivation zum Arbeiten. Dies wird in positiver Variante in den Studien A, C und D deutlich, Probleme in diesem Bereich zeigen die Studien B und E (vgl. Kap. 4.4). In beiden letztgenannten Situationen kommen auch belastende Momente aus dem familiären Umfeld zum Tragen, wenn Herr B immer wieder zwischen kindlicher und Erwachsenenrolle mit seiner phasenweise allein erziehenden Mutter hin- und herpendelt, und die symbiotische Beziehung zwischen Herrn E und seiner seit langem allein erziehenden Mutter dürfte auch von erschwerender Relevanz sein; mit diesen Persönlichkeitsproblemen mit familiären Anteilen ist die Arbeitsassistenz überfordert, hier sind andere Dienste und Stellen gefordert (vgl. ebd.). Studie E zeigt darüber hinaus, dass eine Kette von institutionellen Übergängen Entwicklungen erschweren können; hier hat die Einrichtung des Integrationspraktikums einige Wegstrecken geebnet (vgl. Kap. 4.4.5).
Auf seiten der Betriebe sind Bereitschaft und Offenheit des betrieblichen Umfeldes zur Veränderung von Abläufen ein wichtiges Moment, auch eine anfänglich neugierige, realistische Skepsis bei Vorgesetzten scheint eine wichtige Erfolgsbedingung zu sein, zukunftsträchtiger als eine Anfangseuphorie, die mögliche Schwierigkeiten ausblendet (vgl. Kap. 4.5). Ist dies vorhanden, haben die Vorgesetzten die Chance, sich durch hohe Motivation, Ehrgeiz und Zuverlässigkeit der unterstützten MitarbeiterInnen beeindrucken zu lassen - und dies zeigen sie in ihren Aussagen (vgl. Kap. 6.4).
Letztlich wird der erfolgreiche Verlauf in starkem Maße davon abhängen, wie weit es den AssistentInnen gelingt, mit allen Beteiligten zu einer gemeinsamen Optik, einer gemeinsamen Sicht der Dinge zu kommen. Dies gelingt in den Studien A, C und D, in der Studie B bleiben starke Unsicherheiten bestehen, bei Studie E gelingt es nicht; hier bleiben die Beteiligten mit ihren individuellen subjektiven Wahrheiten zurück, zwischen denen es gravierende Diskrepanzen gibt (vgl. Kap. 4.4).
Studie E verdeutlicht darüber hinaus, dass an der pragmatischen Hoffnung deutliche Zweifel anzumelden sind, bei Schwierigkeiten über einen vorübergehenden, zeitlich begrenzten Wechsel in eine Werkstatt für Behinderte zu einem Zuwachs an Bewusstsein über Arbeit an sich und durch vermehrte Erfahrungen zu einer Klärung der Interessen und Vorlieben zu kommen und dann später nochmals gezielter auf dem ersten Arbeitsmarkt qualifizieren zu können. Ohnehin ist fraglich, ob die Situation in der Werkstatt für Behinderte als ›reale‹ Arbeitssituation im Hinblick auf die anstehende Problematik angesehen werden kann, in diesem Fall werden die Probleme vielmehr weitergegeben und einer Lösung keinen Deut nähergebracht. So erscheinen die Befürchtungen der Mutter in Studie B durchaus realistisch, dass der Weg ihres Sohnes in der Werkstatt für Behinderte ›endet‹ (vgl. Kap. 4.4.5, 4.4.2, zusammenfassend 4.5).
Die Wahrnehmung der Berufsberatung aus der Sicht des Ambulanten Arbeitstrainings gestaltet sich deutlich heterogener als bei den Personen, die die länger etablierten Wege von den Sonderschulen in die Werkstatt für Behinderte oder andere Institutionen gehen.
Bei den TeilnehmerInnen des Ambulanten Arbeitstrainings - mit dem Integrationspraktikum hat die Berufsberatung des Arbeitsamtes direkt nichts zu tun - findet sich eine starke Polarisierung der Einschätzungen: Offenbar gibt es mehr sehr gute oder sehr schlechte Erinnerungen als im Mittelbereich der Zufriedenheit (vgl. Kap. 3.3.1.2). Dieses Phänomen findet sich auch in den Einzelstudien wieder: So berichten Frau A und ihre Mutter von einer vorzüglichen Beratung, die AssistentIn ist jedoch vom psychologischen Fachgutachten mehr als irritiert (vgl. Kap. 4.4.1), bei Frau C gibt es massive Konflikte mit dem Sozialhilfeträger (vgl. Kap. 4.4.3), bei Herrn D dagegen überhaupt keine Probleme (vgl. Kap. 4.4.4).
Diese Polarisierung findet sich in stark abgeschwächter Form bei den AssistentInnen und GruppenleiterInnen, die aufgrund der geringen Intensität der Kooperation mit den BerufsberaterInnen eher reserviert Stellung nehmen und lediglich eine Tendenz zu eher kritischen Einschätzungen bei den AssistentInnen und eher anerkennenden bei den GruppenleiterInnen zeigen (vgl. Kap. 5.3.4 und 5.3.6).
Diese Unterschiede dürften auf die große Heterogenität der Einstellungen und Einschätzungen bei den BerufsberaterInnen zurückgehen; sie tritt bei den innovativen Wegen deutlicher hervor als bei den strukturell verankerten Wegen. Es kommt offenbar darauf an, mit welcher Person in der Berufsberatung man zu tun hat oder wen man kennt, ob man eher positive oder problematische Erfahrungen macht, in welchem Maße die individuellen Wünsche und Interessen Berücksichtigung finden und welchen Stellenwert ggf. eingeholte Gutachten des psychologischen Fachdienstes bekommen (vgl. Kap. 7.5).
Der Berufsschulunterricht findet bei den TeilnehmerInnen durchgängig eine positive Einschätzung (3.3.2.5), bei AssistentInnen und GruppenleiterInnen wird die Kooperation mit den KollegInnen in den Berufsschulen bei geringer Intensität qualitativ durchaus unterschiedlich eingeschätzt (5.3.4). Dies wird auch u.a. dadurch beeinflusst, welche Aufgaben dieser Unterricht schwerpunktmäßig haben soll. Dabei lassen sich tendenziell zwei Richtungen unterscheiden: Die eine - eher bei GruppenleiterInnen - zielt vor allem auf weitere kognitive Förderung, die andere - mehr bei AssistentInnen - sieht vor allem Bedarf bei der Reflexion der Praktikumssituation, der Rolle im Betrieb und ähnlicher Aspekte mehr; von einigen AssistentInnen wird auch beides kombiniert favorisiert. Die GruppenleiterInnen sehen den Unterricht positiv, jedoch wenig bis gar nicht mit dem Arbeitstraining verknüpft, während die AssistentInnen die Qualität des Unterrichts recht unterschiedlich einschätzen und große Unterschiede zwischen den beiden Berufsschulen feststellen (vgl. Kap. 5.3.7).
Diese Einschätzungen haben starke Bezüge zu den Aussagen der BerufsschullehrerInnen (vgl. Kap. 8). Zwar ist der dortige Unterricht überall von großer Heterogenität und zeitlicher Flexibilität gekennzeichnet, setzt aber genau die genannten Schwerpunkte: Schule A legt den Schwerpunkt auf kognitive Förderung mit der Verbindung von praktischen und theoretischen Anteilen und will ihn durch inhaltliche Modularisierung weiter systematisieren, während Schule B den Schwerpunkt auf Einigungen mit den SchülerInnen über Vorhaben legt und die Reflexion der Situation und der Rolle in den Betrieben in den Mittelpunkt stellt (vgl. Kap. 8.3.2). Da zudem auch die Zeitbudgets in den Schulen für den Unterricht während des Ambulanten Arbeitstrainings unterschiedlich groß sind und sich so Kooperation mit AssistentInnen und Betrieben sehr verschieden gestalten - in Schule A gelegentliche Besuche, in Schule B in einigen Fällen regelmäßige Begleitung in Betrieben - , kommen die unterschiedlichen Einschätzungen berufsschulischer Praxis nicht überraschend zustande (vgl. Kap. 8.3.3). Damit tritt klar zutage, dass die Passung zwischen dem Ambulanten Arbeitstraining und dem Berufsschulunterricht bei Schule B wesentlich höher ist als bei Schule A, die offenbar die ambulante Form des Arbeitstrainings nur als eine praktizierte Variante neben vielen andern betrachtet und ihr Selbstverständnis als Berufsschule noch nicht hinreichend mit den konzeptionellen Notwendigkeiten des Ambulanten Arbeitstrainings in Übereinstimmung gebracht hat. Dieses korrespondiert wiederum mit eher skeptisch-pragmatischen Tendenzen in den Aussagen der LehrerInnen zum Ambulanten Arbeitstraining von Schule A und den eher radikal-integrationistischen Kritiken der Lehrer von Schule B, die sich im Rahmen des Ambulanten Arbeitstrainings eine konsequentere strukturelle Verankerung und eine noch individueller eingehende Praxis wünschen.
Es gibt eine ganze Reihe von Aussagen und Ergebnissen, die sich auf ein tendenzielles Muster zurückverfolgen lassen, das mit der Polarität Individuumsorientierung und Gruppenorientierung beschrieben werden kann. Dabei geht es darum, dass im Umfeld der Assistenz-Gruppe und ihrer Wege ein höheres Maß individueller Planung und Unterstützung vorhanden ist als bei der Werkstatt-Gruppe, deren Institution sich als weniger flexibel und standardisierter zeigt.
Dies wird bei den TeilnehmerInnen darin deutlich, dass die Arbeitsplätze bei der Assistenz-Gruppe in höherem Maße den individuellen Wünschen entsprechen (vgl. Kap. 3.3.2.2), dass dort auch weniger Wünsche nach besserem Eingehen auf die individuellen Wünsche genannt werden (vgl. 3.3.2.4.), dass in Studie G auch ein unflexibles Programm ohne die Möglichkeit individueller Schwerpunktsetzungen im Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte kritisiert wird (vgl. Kap. 4.4.8) - wobei gerade dort der Gruppenleiter im Beschäftigungsbereich durch ein hohes Maß individuumszentrierter Reflexion auffällt. Bei der Beschäftigung fallen flexiblere Arbeitszeiten der TeilnehmerInnen in der Assistenz-Gruppe auf (vgl. Kap. 3.3.3.2). Damit einher gehen in den Einzelstudien Phänomene von Institutionalisierung und personaler Verunsicherung bei den MitarbeiterInnen in den Werkstätten für Behinderte, die Sozialisierungseffekte einer weniger individuumszentrierten Institution sein können, möglicherweise aber auch mit Effekten unterschiedlichen Alters zusammenhängen könnten (vgl. Kap. 4.4.7 - 4.4.10; zusammenfassend 4.5) oder damit, dass innovativere Bereiche in Werkstätten für Behinderte nicht untersucht wurden.
Mit der aufgezeigten Polarität korrespondieren unterschiedliche Beschreibungen der Klientel bei AssistentInnen und GruppenleiterInnen: Erstere beschreiben die von ihnen unterstützten Personen sehr individuell und wenig mit Hilfe tradierter Kategorien, zweitere dagegen durchgängig kategorial und etikettierend und sehr wenig individuell (vgl. Kap. 5.3.3), auch wenn in den Studien Ausnahmen deutlich werden (vgl. Kap. 4.5). Die gleichen Tendenzen finden sich auch bei den BerufsschullehrerInnen in Schule B, die - als ausgebildete Sonderschullehrer - sich deutlich integrationspädagogisch, nonkategorial und dialogisch darstellen, und denen in Schule A, die - als nicht ausgebildete SonderschullehrerInnen - eher eine sonderpädagogische, kategoriale, teils sogar defizitorientierte Haltung zeigen (vgl. Kap. 8.3.6). Bei den BerufsberaterInnen gibt es eine Minderheit, die eher institutionell orientiert agiert, während eine Mehrheit in hohem Maße individuumsorientiert arbeitet (vgl. Kap. 7.5); von hier aus werden auch verfestigte Strukturen beim Übergang von der Schule für Geistigbehinderte zur Werkstatt für Behinderte kritisiert (vgl. 7.3.1.1).
Das Bild bei den AssistentInnen wiederum wird gestützt von Aussagen der BerufsschullehrerInnen, die die hohe Intensität und Systematik bei der Suche nach individuell passenden Tätigkeiten für die unterstützten Personen betonen (vgl. Kap. 8.3.5), und es entspricht auch der Aussage von Vorgesetzten, die Erfahrungen mit ihren konkreten unterstützten MitarbeiterInnen schildern, es aber ablehnen, allgemeine Aussagen über Menschen mit Behinderungen zu machen, und die sich zum Teil mit Entsetzen von den pauschalisierenden Äußerungen des Wirtschaftsverbandssprechers distanzieren (vgl. Kap. 6.4). Von den Vorgesetzten wird darüber hinaus neben der Betrachtung der ökonomischen Seite gesellschaftliches Engagement stark betont; dies kann als Beitrag zur Entstigmatisierung und stärkeren Beachtung des Individuums interpretiert werden.
Die erste Polarität zwischen Individuums- und Gruppenorientierung wird ergänzt durch eine zweite, die mit den Begriffen Entwicklungs- und Zuweisungslogik umschrieben werden kann. Hier werden Tendenzen zu unterschiedlichen Verständnissen der Situationsdynamik erkennbar - und letztlich hat dies stark mit den Grundsätzen im Rehabilitationssystem zu tun, in welcher Reihenfolge qualifiziert und plaziert wird: Auf der einen Seite steht der Ansatz, in einer Realsituation die Fähigkeiten einer Person zu entwickeln, auf der anderen werden Fähigkeiten im Vorwege gefördert, um die Person dann anschließend entsprechend dem erreichten Niveau zuzuweisen (vgl. Kap. 1.3.2).
So betonen die AssistentInnen sehr stark, bei den Stärken und Interessen der TeilnehmerInnen anzusetzen und im gewünschten Feld - natürlich unter Beachtung der Bedingungen des Arbeitsmarktes - gemeinsam Kompetenz zu entwickeln (vgl. Kap. 4 und 5.3.9). Diese Stärken sehen sie auch vorrangig, während GruppenleiterInnen sich stärker an Schwächen orientieren und mitunter - so mindestens in den Studien F und H - Schwierigkeiten haben, überhaupt Stärken von MitarbeiterInnen mit Behinderungen zu nennen (vgl. zusammenfassend Kap. 4.5). Sie sehen auch häufiger ihre Aufgabe darin, angemessene Arbeiten zuzuteilen und - eher wenige - MitarbeiterInnen für den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt ›fit zu machen‹ (vgl. ebd.). So stellen GruppenleiterInnen im Rückblick - etwa in den Studien F und I - ebenso wie KollegInnen der Berufsschule A auch mangelnde Eignung von MitarbeiterInnen fest und vermerken deren Rückkehr vom ersten Arbeitsmarkt in die Werkstatt für Behinderte (vgl. Kap. 4.4.6, 4.4.9, 8.3.4), während AssistentInnen gerade gemeinsam mit den TeilnehmerInnen und den PartnerInnen im betrieblichen Umfeld die konkrete Situation weiterentwickeln - und sie nicht etwa lediglich auf bestimmte Arbeiten hin trainieren, also letztlich der Situation anpassen (vgl. Kap. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 5.3.1, aber auch 6.3.5). Im ersten Fall liegt das Problem letztlich bei der Person, im zweiten im Umfeld, was unterschiedliche Folgen und Sichtweisen nach sich zieht.
Die AssistentInnen betonen demzufolge, dass zwar vor Beginn und für einen erfolgreichen Verlauf des Arbeitstrainings zwar bestimmte Fähigkeiten der TeilnehmerInnen hilfreich und erleichternd sind, sie bilden jedoch nicht - wie in der Sicht der GruppenleiterInnen vorherrschend - exklusive Voraussetzungen für den Einstieg in oder für den erfolgreichen Verlauf des Arbeitstrainings (vgl. Kap. 5.3.3). Hier sind wiederum für die AssistentInnen Interessen und Wünsche der TeilnehmerInnen maßgeblich, während GruppenleiterInnen eher von festgestellten objektiven Bedingungen, etwa der Integrationsfähigkeit, und von Eignungen für den ersten Arbeitsmarkt oder die Werkstatt für Behinderte ausgehen (vgl. Kap. 5.3.9).
Zwar wird in beiden Gruppen kleinschrittig gearbeitet, jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Während AssistentInnen mit TeilnehmerInnen gemeinsam im gewünschten Feld des ersten Arbeitsmarktes an der kleinschrittigen Realisierung von Wünschen arbeiten - etwa in Studie A, wo im Gästehaus über Wochen das professionelle Tischabwischen geübt wird - , werden mehrfach Situationen geschildert, in denen GruppenleiterInnen erst an die gewünschten Tätigkeiten herangehen, wenn die behinderten MitarbeiterInnen im Vorfeld einfachere, jedoch wenig motivierende Arbeiten zuverlässig und zufriedenstellend erledigen - etwa in Studie E, wo das Sortieren von Papier in der Werkstatt-Druckerei nicht klappt und so die Arbeit an Geräten und Maschinen unerreichbar bleibt, oder in Studie H, wo die wenig motivierenden Segel-Gummis nicht so zuverlässig montiert werden, dass die Arbeit mit Maschinen oder am Computer in Frage käme, jedoch möglicherweise auch an der Esso-Tankstelle in Studie B, wo das Regale-Einräumen und Hof-Fegen auch nicht so klappt, dass der junge Mann an Autos herangelassen wird. Hier entstehen Phänomene einer Zwickmühle, wenn das kleinschrittige Vorgehen im Vorfeld bereits stecken bleibt und so quasi zu einer ›Motivations-Qualifizierungs-Falle‹ wird (vgl. zusammenfassend Kap. 4.5).
Auch bei dieser Polarität sind BerufsberaterInnen und BerufsschullehrerInnen in beiden Richtungen zu finden: Für einige BerufsberaterInnen sind Fachgutachten und festgestellte Fähigkeiten entscheidende Zuweisungskriterien, für andere haben persönliche Interessen und Wünsche höhere Priorität, die auch bei zweifelhaften Chancen einen Versuch wagen lassen (vgl. Kap. 7.3.2.1); dementsprechend ist das Ambulante Arbeitstraining nur für eine kleine Klientel von ›Grenzfällen‹ angemessen oder aber im anderen Fall für jene, die es möchten (vgl. Kap. 7.3.2.2). Bei den Statements tauchen mehr oder minder kategoriale Aussagen auf, aber immer auch in Balance mit individuell orientierten (vgl. Kap. 7.3.4.3). Bei den Psychologen des Arbeitsamtes findet sich hingegen ein stark kategoriales und defizitorientiertes Denken, insofern schätzen sie das Ambulante Arbeitstraining als marginal bedeutsam ein und sehen in ihm eine gute Möglichkeit selektiver Diagnostik zur ›Trennung von Spreu und Weizen‹ für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bei Eltern nehmen sie teilweise eine problematische Verleugnungsstrategie unter dem Deckmantel der Integration wahr (vgl. Kap. 7.4.3). Bei den BerufsschullehrerInnen findet sich an der Schule A eher ein kategoriales und etikettierendes Denken im Sinne geeigneter Personen für Maßnahmen, an Schule B bestehen demgegenüber stark nonkategoriale und individuumsorientierte Vorstellungen (vgl. Kap. 8.3.4).
Zum Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums sowie deren nachfolgende Perspektiven lassen sich verschiedene Positionen beschreiben. Sie unterscheiden sich durch zweierlei Elemente: Zum einen gehen sie in eine eher negative oder eher positive Richtung, zum anderen beziehen sie sich auf unterschiedliche Ebenen. In Abhebung voneinander werden sie als alltagstheoretisch, pragmatisch und programmatisch bezeichnet; damit soll betont werden, dass sie sich eher auf eigene alltagstheoretische Eindrücke, auf konkrete Gestaltung von konkreter Praxis oder auf grundsätzliche konzeptionelle und strukturelle Gegebenheiten beziehen. Dabei kommen fließende Übergänge und eher uneindeutige Zuordnungen vor, die hier in der Tendenz systematisiert werden.
1. Alltagstheoretische Negativkritik: »Ich weiß zwar nichts Genaues, aber ich glaube nicht, dass es erfolgreich ist.«
Diese aus der Distanz heraus formulierte Kritik ist alltagstheoretisch begründet und von der Haltung her eher intuitiv-abwehrend. Diese Position wird deutlich, wenn
-
GruppenleiterInnen eher vermutete Schwächen des Ambulanten Arbeitstrainings in den Sinn kommen, wie ein geringeres Spektrum von Tätigkeits- und Erfahrungsmöglichkeiten in der ›teureren‹ betrieblichen Realsituation, die zu Vereinzelung und dauernder Überforderung führen würden (vgl. Kap. 5.3.1), sie skeptisch sind gegenüber Einstellungsmotiven und -bereitschaft von ArbeitgeberInnen des ersten Arbeitsmarktes (vgl. Kap. 5.3.5), deren Kooperations- und Veränderungswillen bezweifeln und - vor dem Hintergrund früherer, nicht systematisch unterstützter ›Ausschleusungsversuche‹ mit besonders leistungsstarken MitarbeiterInnen - die nach ›draußen‹ Gegangenen frustriert in die Werkstatt für Behinderte zurückkommen sehen (vgl. Kap. 4.4.6, 4.4.9, 5.3.8),
-
Berufsberater in Zweifel ziehen, ob es überhaupt schon zum Abschluss von Arbeitsverträgen gekommen sei (vgl. Kap. 7.3.3.2 ),
-
ein Berufsschullehrer den Abschluss von Arbeitsverträgen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu einer exotischen Sache mit ganz besonderen ArbeitgeberInnen erklärt (vgl. Kap. 8.3.5) und
-
die Psychologen des Arbeitsamts meinen, dass die falsche Klientel berücksichtigt würde, nämlich eine, die nicht ›ohne Aufsicht acht Stunden im Erwachsenenkreis mitspielen‹ könne, und das Konzept zum ›Trennen von Spreu und Weizen‹ tauge (vgl. Kap. 7.5) und
-
ein Wirtschaftsverbandssprecher signalisiert, die Beschäftigung von Behinderten sei unrealistisch und käme einer Image-Schädigung des einstellenden Unternehmens gleich (vgl. Kap. 6.2).
2. Pragmatische Negativkritik: »Im Prinzip mag das in Ordnung sein, aber konkret finde ich Einiges schlecht.«
Die geäußerte Kritik ist konkret und bezieht sich auf eigene Erfahrungen. Dieser Haltung entspricht es, wenn
-
TeilnehmerInnen und ihre Eltern wie in Studie E zwar am Ideal der Integration festhalten, aber konkrete Erfahrungen damit eher eigene Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche enttäuscht und doch in eine Werkstatt für Behinderte geführt haben, was vor allem dem Vorgehen der Arbeitsassistenz angelastet wird (vgl. Kap. 4.4.5),
-
BerufsberaterInnen es als ›durchaus keine idiotische Idee‹ bezeichnen, aber sie den Adressatenkreis prinzipiell anders definieren würden (vgl. Kap. 7.3.3.1) und daher die Arbeitsassistenz den falschen (zu schwachen) Personenkreis fördere, bei dem sich der hohe Aufwand nicht auszahlen könne, und zudem zu sozialpädagogisch sei (vgl. Kap. 7.3.3.2) und
-
BerufsschullehrerInnen eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen äußern: die Überlegung, je zwei Personen mit Unterstützungsbedarf zur Verbesserung ihrer Kommunikationssituation in einem Betrieb zu plazieren, die Forderung nach mehr Begleitung und höherer Verlässlichkeit und der Wunsch nach einem dauerhaften Lohnkostenzuschuss, um Beschäftigungsverhältnisse auch für leistungsschwächere Menschen langfristig sicherzustellen (vgl. Kap. 8.3.5).
3. Programmatische Negativkritik: »Mit dieser strukturellen und konzeptionellen Konstruktion ist die Arbeitsassistenz auf dem Holzweg.«
Hier handelt es sich um Fundamentalkritik, die aus zwei Richtungen kommen kann: aus einer radikal integrationistischen oder aus einer radikal abwehrenden Perspektive. Solcherlei konzeptionelle Grundsatzkritik wird genährt von fundamentaler Unzufriedenheit und ist getragen von einer Haltung großer Skepsis. Sie wird deutlich, wenn
-
GruppenleiterInnen alle Veränderungen als bedrohlich wahrnehmen und schon bei Dezentralisierungsbemühungen der eigenen Werkstattleitung, zumal unter dem Begriff Integration, verstärkten Anpassungsdruck an die Norm sehen und ihm ihr Motto entgegenhalten, bei ihnen dürfe der Mensch mit Behinderung noch behindert sein (vgl. Kap. 5.3.9),
-
BerufsberaterInnen zwar das Konzept prinzipiell gutheißen, aber den ArbeitsassistentInnen unrealistische Vorstellungen unterstellen, weltverbesserisch an Veränderungsmöglichkeiten des Arbeitsmarktes zu glauben und diesen - falschen - Personenkreis dauerhaft ›unter normalen Bedingungen‹ unterbringen zu können, zumindest aber in ihrer Außendarstellung Erfolge zu hoch zu hängen und Probleme zu verschweigen (vgl. Kap. 7.3.3.3); BerufsberaterInnen erklären dies mit dem Antreiben durch Integrationseltern mit der entsprechenden politischen und sprachlichen ›Power‹ (vgl. Kap. 7.3.3.1) und
-
einige Berufsschullehrer meinen, die Arbeitsassistenz müsse zu einem Angebot der Werkstatt für Behinderte werden und unter deren Dach und Schutz stattfinden, andere dagegen betonen, die Anbindung an die Werkstatt für Behinderte sei ein zentrales Problem und die Befristung der Unterstützung sei für bestimmte Personen eine Illusion (vgl. Kap. 8.3.5).
Diesen kritischen Haltungen, die beim Arbeitsassistenz-Konzept in erster Linie negative Aspekte betonen, stehen solche gegenüber, die dagegen eher zum Hervorheben seiner positiven Aspekte tendieren.
4. Alltagstheoretische Positivkritik: »Ich weiß nichts Genaues, aber ich glaube, es ist was ganz Gutes.«
Ebenso wie bei der ersten Position besteht auch hier eher ein Grundgefühl, das auf geringer Nähe und geringem Informationsstand basiert. Trotz einer gewissen Distanz wird ebenfalls alltagstheoretisch geleitet eine intuitiv bejahende Meinung geäußert. Dies wird deutlich, wenn
-
einige Werkstatt-MitarbeiterInnen angeben, bereits seit einiger Zeit bei der Arbeitsassistenz angemeldet zu sein oder mit dem Gedanken dazu zu spielen (vgl. Kap. 3.3.3.5) oder sie und ihre Eltern wie in Studie F darauf hinweisen, dass zumindest eine Arbeit in einem integrativen Zweckbetrieb attraktiv wäre und heute ›alles machbar‹ sei (vgl. Kap. 4.4.6),
-
GruppenleiterInnen sich ihre Klientel auch im Ambulanten Arbeitstraining unter der Voraussetzung vorstellen können, dass vorher bereits eine Qualifizierung in der Werkstatt für Behinderte stattfindet, umfassend begleitende Assistenz gewährleistet wird und eine Passung zwischen dem Bedarf und den Fähigkeiten der Person und einem qualitativ gutem Betrieb herstellbar ist (vgl. Kap. 5.3.1).
5. Pragmatische Positivkritik: »Ich finde es toll, wie sie das machen.«
Diese konkret pragmatische, würdigend anerkennende Positivkritik nimmt Vorteile des Konzepts durch dessen erlebte Umsetzung wahr. Diese von praktischen Erfahrungen her überzeugte Haltung kommt zum Ausdruck, wenn
-
TeilnehmerInnen und ihre Eltern wie in den Studien A, B und C konstatieren, dass der Einsatz der Arbeitsassistenz weiterbringe, gar nicht besser laufen könne, AssistentInnen tolle BeraterInnen mit sehr viel Verständnis und Einfühlungsvermögen auch für Eltern seien und ihre positive Grundeinstellung Vieles bewege und Unerwartetes ermögliche (vgl. Kap. 4.4.1, 4.4.2 und 4.4.3).
-
ChefInnen beeindruckt sind von dieser ›immens‹ wichtigen Arbeit und der Arbeitsassistenz eine sehr wichtige Rolle zuschreiben (vgl. Kap. 6.3.1), sehr damit zufrieden sind, wie sich AssistentInnen in die jeweiligen Arbeiten ›reinfuchsen‹ und überzeugt sind, dass ihre Arbeit eine Menge bringe (vgl. Kap. 6.3.2), zu hundert Prozent positive Bewertungen vergeben für die geleistete Unterstützung des Integrationsprozesses (vgl. 6.3.3), große Bedeutung zusprechen, da auch dank vieler Ideen der ArbeitsassistentInnen alles ohne Probleme laufe und nichts zu wünschen übrig bleibe (vgl. Kap. 6.3.4) und man es nicht besser machen könne (vgl. Kap. 6.3.6) und
-
BerufsschullehrerInnen sich erstaunt zeigen über manche Erfolge ihrer SchülerInnen, die sie aufgrund deren Verhaltens oder der gezeigten Fähigkeiten in der Schule so nicht erwartet hätten und der Arbeitsassistenz daher gute Arbeit bescheinigen (vgl. Kap. 8.3.4 und 8.3.5),
-
auch die ArbeitsassistentInnen selbst als große Stärke des Ambulanten Arbeitstrainings sehen, geleitet von den individuellen Fähigkeiten und Interessen der unterstützen Person Arbeitsbegleitung vor Ort machen zu können, also erst zu plazieren und dann zu qualifizieren, damit konkret Begegnung herbeizuführen und so die Möglichkeit integrativer Prozesse im Kontext gesellschaftlicher Realsituationen zu eröffnen (vgl. Kap 5.3.1).
6. Programmatische Positivkritik: »Das Ganze ist konzeptionell bahnbrechend und zukunftsträchtig.«
Diese ausgesprochen positive Haltung ist überzeugt von diesem konzeptionellen Ansatz und sieht ihn als richtungsweisenden Impuls für die zukünftigen Perspektiven des Rehabilitationssystems insgesamt. Solche Haltung wird deutlich, wenn
-
TeilnehmerInnen, die inzwischen einen Arbeitsvertrag haben, und ihre Eltern wie in Studie C und D betonen, dass sie mit Hilfe der Arbeitsassistenz Träume haben verwirklichen können oder gar erreichen konnten, was sie in ihren kühnsten Träumen nicht erwartet hätten (vgl. Kap. 4.4.3 und 4.4.4),
-
ArbeitsassistentInnen deutlich machen, dass sie voll und ganz hinter diesem Konzept und seiner Praxis stehen, das sie für jeden Menschen zugänglich sehen möchten, der diesen Weg gehen will (vgl. Kap. 5.4), also ohne Quotierungen die freie Wahlmöglichkeit für alle jungen Menschen mit Behinderungen, eine dementsprechende Ausweitung der Platzzahlen und die Aufhebung der zeitlichen Befristung der Unterstützung wünschen (vgl. Kap. 5.3.9),
-
ChefInnen die Arbeit der Assistenz als grundsätzlich sinnvolles und persönlich bereicherndes Tun sehen, für das sie eine Öffentlichkeit schaffen wollen (vgl. Kap. 6.3.1), davon überzeugt sind, dass sich bei besserer Information mehr Unternehmen dafür öffnen würden (vgl. Kap. 6.3.2), um sich in sinnvoller Form sozial zu engagieren, was gerade in Deutschland mit seiner Geschichte angezeigt sei (vgl. 6.3.5), darüber hinaus fordern, dass Dauersubventionen auch in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes möglich sein müssten (vgl. Kap. 6.3.6) und schließlich ArbeitgeberInnen bei Kündigungen erhaltene Lohnkostenzuschüsse zumindest anteilig zurückzahlen sollten (vgl. Kap. 6.3.7),
-
BerufsberaterInnen hier u.a. den Zeitgeist oder den Trend der Zukunft repräsentiert sehen (vgl. Kap. 7.3.3.1), Konzept und Praxis der Arbeitsassistenz als ›Erfolg‹, ›ganz tolle Sache‹ und ›super für Menschen mit geistiger Behinderung‹ bezeichnen (vgl. Kap. 7.3.3.2), quantitativen Ausbaubedarf sehen und einen Ausweitungsbedarf auf andere Personenkreise konstatieren (vgl. Kap. 7.3.3.3) und
-
BerufsschullehrerInnen, trotz vieler programmatischer Veränderungswünsche in Hinblick auf eine konsequentere Weiterentwicklung in Hamburg ein relativ günstiges Klima für berufliche Integration durch unterstützte Beschäftigung sehen und dies insbesondere auf Aktivitäten der Hamburger Arbeitsassistenz zurückführen (vgl. Kap. 8.3.5).
Die zentralen Kontroversen bei der Einschätzung der beiden Maßnahmen kreisen dabei um drei Aspekte:
-
Bezüglich der angemessenen Zielgruppe stehen sich zwei Standpunkte gegenüber: Entweder werden die Maßnahmen lediglich für eine kleine Zielgruppe im Grenzbereich zwischen geistiger und Lernbehinderung als angemessen gesehen - dies gilt für GruppenleiterInnen, einige BerufsberaterInnen und BerufsschullehrerInnen - oder es wird vertreten, dass die Maßnahmen im Prinzip für jede Person geeignet seien, die dies wolle und entsprechend motiviert sei - was von ArbeitsassistentInnen, einigen BerufsberaterInnen und Berufsschullehrern vertreten und implizit auch durch TeilnehmerInnen und ihr Umfeld verdeutlicht wird.
-
Eine zweite Kontroverse dreht sich um die Erfolgskriterien: Von verschiedenen Seiten wird erst die langfristige Beschäftigung von unterstützten ArbeitnehmerInnen als letztlicher Erfolgsmaßstab gesehen. Die Basis, auf der dies erfolgen soll, gestaltet sich jedoch höchst gegensätzlich: Während ein Berufsberater die subventionslose Beschäftigung zum Maßstab erhebt, fordern einige Berufsschullehrer, Vorgesetzte und AssistentInnen gerade die zeitlich unbegrenzte Unterstützungsmöglichkeit, da alles andere utopisch sei oder neue selektive Grenzen bezüglich des unterstützbaren Personenkreises schaffen würde.
-
Eine dritte Kontroverse kreist schließlich um die Perspektiven: Manche sehen die Zukunft betrieblicher Arbeitstrainings und Praktika unter dem Dach und dem Schutz der Werkstatt für Behinderte realisiert - so GruppenleiterInnen und ein Teil der BerufsschullehrerInnen -, andere fordern gerade die Lösung der Maßnahmen aus diesen institutionellen Bindungen und favorisieren einen Träger für betriebliche Arbeitstrainings, Praktika und Beschäftigung als unabhängiger, freier Fachdienst - dies vertreten AssistentInnen und ein anderer Teil der BerufsschullehrerInnen.
Was die Kontroverse um die Zielgruppe angeht, so lassen sich in den Ergebnissen dieser Untersuchung keine Anhaltspunkte zugunsten des Standpunktes finden, die Maßnahmen seien lediglich für die schon öfter genannten ›Grenzfälle‹ geeignet. Vielmehr machen die Studien A und D sowie die Aussagen von Chef E deutlich, dass es keineswegs nur dieser vermutete Personenkreis ist, sondern auch Personen - zumindest vorläufig - auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt beschäftigt werden, denen dieses nicht zugetraut und denen teilweise in Fachgutachten zugeschrieben wurde, sie befänden sich am unteren Leistungsende der Population in den Werkstätten für Behinderte. Gerade die Fälle mit deutlich diskrepanten Erwartungen und Erfahrungen verdeutlichen, dass prognostische Aussagen zur Eignung von Personen mit größter Vorsicht und größter Zurückhaltung zu erfolgen haben und dass in allen Zweifelsfällen - wie ein Teil der BerufsberaterInnen dies auch praktiziert - ein Versuch in diesen Maßnahmen gemacht werden sollte. Darüber hinaus spricht Studie E - was als Hinweis genommen, nicht aber verallgemeinert werden kann - gegen die These einer weiteren Gliederung von rehabilitativen Maßnahmen im Sinne einer leistungsbezogenen Abfolge vom Förderlehrgang über das Ambulante Arbeitstraining zur Werkstatt für Behinderte, denn Herr E kann seine Situation nach allen Schwierigkeiten im Integrationspraktikum keineswegs in der Werkstatt für Behinderte konsolidieren, vielmehr trachtet sie danach, dass die Schwierigkeiten im familiären Kontext oder im Rahmen einer Tagesförderung angegangen werden. Im Gegenzug wird in Studie B deutlich, dass die Problematik bei den ›Grenzfällen‹ durchaus nicht automatisch weniger brisant ist als bei Menschen mit geringeren kognitiven Fähigkeiten.
Zur Kontroverse um Erfolgskriterien geben die vorliegenden Untersuchungsergebnisse keine direkten Hinweise; jedoch zeigen beispielsweise die Veränderungen zwischen der ersten und zweiten Befragung der TeilnehmerInnen bereits, dass die Aussagen über deren aktuellen Status jeweils immer nur Momentaufnahmen sein können und dass letztlich sicherlich dem Standpunkt zuzustimmen ist, dass erst die langfristige Entwicklung zu gesicherten Aussagen über Erfolge führt - und dafür bestehen die Maßnahmen noch nicht lange genug. Andererseits machen die vorliegenden Ergebnisse jedoch wichtige Teilerfolge sichtbar, die in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden sollten, da sie offensichtlich auf neue, bisher nicht praktizierte Möglichkeiten aufmerksam machen. Insofern handelt es sich hier um erste wichtige Schritte auf einem neuen Weg, dessen langfristiger Erfolg sich noch erweisen muss.
Ob sich schließlich die weitere Perspektive der Maßnahmen unter dem Dach der Werkstatt für Behinderte oder als von ihnen losgelöste Agentur erfolgen sollte, dazu geben die vorliegenden Ergebnisse keine direkten Hinweise. Angesichts der skeptischen Haltung vieler GruppenleiterInnen in Bezug auf den ersten Arbeitsmarkt und ihrer insgesamt eher kategorialen und defizitorientierten Sichtweise des Personenkreises, den sie dort zu unterstützen hätten, ergibt sich ein erheblicher Widerspruch zwischen integrativem Auftrag und eher segregativen Einstellungen. Letztlich sollten für die Lokalisierung der Maßnahmen weniger Trägerinteressen entscheidend sein als vielmehr die vorzufindende Qualitäten: die Quantität und Qualität der Unterstützungsleistungen und die Frage des Status in der Folge betrieblicher Praktika, als sozialversicherte Arbeitsverhältnisse mit einem entsprechenden Verdienst und mit der Zugehörigkeit zum Betrieb des ersten Arbeitsmarktes.
Insgesamt ergibt sich bei den unterschiedlichen Einschätzungen ein Bild, bei dem die jeweilige Nähe und der vorzufindende Informationsstand eine wichtige Rolle spielt. Je stärker involviert die Stellungnehmenden sind, je dichter sie das Geschehen konkret verfolgen können, desto positiver sind auch ihre Stellungnahmen, je weiter entfernt von der Praxis der Maßnahmen sie agieren, desto skeptischer und kritischer fallen die Einschätzungen aus, desto mehr nimmt auch die Bedeutung grundsätzlicher Sichtweisen und alltagstheoretischer Zuschreibungen in Relation zu realen Gegebenheiten zu.
Nach der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse stellt sich die Frage, wie sie unter verschiedenen theoretischen Blickwinkeln einzuordnen sind. Hierzu werden - wie schon bei den Einzelstudien - die Stigma-Theorie und die Theorie integrativer Prozesse (vgl. Kap. 4.1) und zusätzlich die Debatte um den Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe (vgl. Kap. 1.2) herangezogen.
Unter stigmatheoretischen Gesichtspunkten ist festzustellen, dass das institutionalisierte Stigma in der Werkstatt für Behinderte kaum in Frage zu stellen oder zu relativieren ist; zudem tauchen mehrfach Phänomene personaler Unsicherheit auf, die Rückschlüsse auf die sozialisatorischen Effekte auf das Leben unter den Bedingungen einer ›totalen Institution‹ nahe legen. Die relativ hohe Zufriedenheit der MitarbeiterInnen in den Werkstätten für Behinderte kann wohl zu einem gewissen Teil als ›resignative Zufriedenheit‹ verstanden werden, wie u.a. in den Studien I und J, jeweils unterschiedlich akzentuiert, deutlich wird: Hinter der geäußerten Zufriedenheit wird immer wieder die Hinnahme des Status-Quo sichtbar.
Bei den von der Arbeitsassistenz unterstützten Personen gelingt es in vielen Fällen, innerhalb eines vorhandenen oder positiv weiterentwickelten Umfeldes ein positives Stigma-Management zu betreiben und Prozesse der Entstigmatisierung einzuleiten. So machen die Studien A, C und D deutlich, dass die offensichtlichen Stigmata im Rahmen des jeweiligen betrieblichen Umfeldes nicht die Relevanz erreichen wie von vielen alltagstheoretisch befürchtet. Andererseits zeigt Studie B, dass die Situation bei nicht offensichtlichen Stigmata - und dies bei einer Person, die ein relativ hohes Leistungsniveau aufweist, einem ›Grenzfall‹ - erheblich problematischer sein kann, denn sie selbst richtet offenbar großes Augenmerk darauf, dass ihr Stigma nicht entdeckt wird, und entwickelt so ein brüchiges, widersprüchliches Verhaltens- und Leistungsrepertoire, das zu allseitiger Verunsicherung führt, die soziale Einbindung und den Abschluss eines Arbeitsvertrages gefährdet - und zugleich in einem anderen Stigma mündet: das des unmotivierten, unzuverlässigen und unsteten Kollegen.
Bei den Prozessen von Entstigmatisierung spielen die ArbeitsassistentInnen eine zentrale Rolle als Motor, aber auch die KollegInnen wie die Vorgesetzten in den Betrieben können sie massiv im Sinne des »natural support« (SCHARTMANN 1995a) oder eines »Psychotops« (EMPT 2001, 84) unterstützen oder sie können sie ebenso stark behindern.
Der Theorie integrativer Prozesse folgend sind die Werkstätten für Behinderte institutionell am Differenzpool gefangen, denn sie verdanken ihre Entstehung als subsidiäre Institution der damalig geringen Integrationskraft und -bereitschaft des ersten Arbeitsmarktes mit den dominierenden und an Verwertungsgesichtspunkten orientierten Anpassungs- und Gleichheitsansprüchen, den sie ergänzen und entlasten. In dieser institutionellen Situation gesellschaftlich-normativer Abwehr und Ausgrenzung können sich integrative Prozesse nur in einem eingeschränkten Maße vollziehen, wie die teils langjährigen Prozesse des Haderns und des Resignierens in individuell unterschiedlichen Gewichtungen - so in Studie H und J - zeigen. Daran können auch die teilweise intensiven Bemühungen von GruppenleiterInnen um Akzeptanz, dialogische Begegnung und Kooperation strukturell nichts ändern. In ihrer teilweise übernommenen Rolle als »Zeugen« (vgl. MILLER 1979) geraten sie zudem in Loyalitätskonflikte zu ihrer Institution.
Im betrieblichen Umfeld des ersten Arbeitsmarktes stehen die Vorzeichen für integrative Prozesse unter Umständen günstiger, denn hier handelt es sich zunächst um kein gesellschaftlich ausgegrenztes, sondern ein in seiner Wichtigkeit hoch bewertetes Umfeld. Dessen Integrationskraft und -bereitschaft zu erhöhen ist die zentrale Aufgabe der Arbeitsassistenz, die auch insofern unter starkem Druck steht, als ein Scheitern integrativer Prozesse das Infragestellen der Zugehörigkeit von unterstützter Person und UnterstützerInnen sowie deren Entfernung aus diesem Umfeld bedeuten kann. Den Untersuchungsergebnissen zufolge gelingt das Anregen integrativer Prozesse auf allen Ebenen, wenngleich auch mit Schwierigkeiten und Krisenphasen: Gerade die Studien über die unterstützten MitarbeiterInnen auf dem ersten Arbeitsmarkt (vgl. Kap. 4) zeigen teilweise ein hohes Maß an Akzeptanz im Betrieb ihnen gegenüber, ohne eine Sonderrolle, wenngleich mit spezifischer Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse. Ein hohes Maß von Begegnung wird ebenso deutlich wie ein hohes Maß von Kooperation - auch dies bei Anerkennung individueller Unterschiede auf der Basis von Gleichwertigkeit. So wird innerhalb eines Rahmens von Gemeinsamkeit und Normalisierung, der die unterstützten Personen mit gleichem Status als KollegInnen anerkennt und ihre individuellen Fähigkeiten und Begrenztheiten nicht ignoriert, berufliche Integration als dynamischer Prozess möglich. Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass dies ein zunehmend statischer Zustand wird; vielmehr kann eine solche ausbalancierte Situation immer wieder durch Veränderungen von Abläufen, von personellen Konstellationen, von äußeren und auch von inneren Einflüssen aus dem Gleichgewicht geraten, wie auch die Studien B und D zeigen. Insofern besteht auch nach Ende der Maßnahmen ein vermutlich sehr viel geringerer, aber evtl. punktuell oder phasenweise auch wieder hoher Unterstützungsbedarf, dessen Realisierung gesichert werden muss. Darüber hinaus verdeutlicht dieser theoretische Blickwinkel, dass der Abschluss von Arbeitsverträgen nicht das alleinige Erfolgskriterium dieser Maßnahmen sein kann, denn in welchem Maße integrative Prozesse realisiert werden können, hängt von der Ökologie des ganzen Umfeldsystems ab und kann nicht einer beteiligten Gruppe allein - den ArbeitsassistentInnen - zugeschrieben werden. Insofern greift ein linearer Beurteilungsmaßstab anhand abgeschlossener Arbeitsverträge und langfristiger Beschäftigungsverhältnisse deutlich zu kurz.
Unter dem Gesichtspunkt der zwischenzeitlich langjährigen Diskussion um einen Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe stellt sich die Situation recht eindeutig dar: Hier muss festgestellt werden, dass das Agieren der MitarbeiterInnen etablierter und tradierter Sonderinstitutionen, hier in erster Linie der GruppenleiterInnen, weitgehend das sonderpädagogisch-rehabilitative Paradigma widerspiegelt, während die MitarbeiterInnen eines jungen, innovativen, auf individuelle Unterstützung angelegten Projekts, hier die AssistentInnen, stark im integrativen Paradigma verwurzelt sind - gerade in den Polaritäten unterschiedlicher Orientierungen zwischen Gruppe und Individuum und unterschiedlicher Logiken zwischen Zuweisung bzw. Eignung und Entwicklung wird dies deutlich (vgl. Kap. 9.1). Dass es hier klare Bezüge zwischen dem Sein und dem Bewusstsein gibt, ist unabweisbar; unterschiedlich mögen die Einschätzungen darüber ausfallen, wie groß die Spielräume für individuelles Agieren und für die Veränderung beider sind, evtl. unter veränderten Rahmenbedingungen.
Eher vielleicht überraschend erscheint es gerechtfertigt, die Vorgesetzten - hier handelt es sich um eine spezifisch ausgewählte Gruppe, was nicht vergessen werden darf - ebenfalls eher dem integrativen Paradigma zuzuordnen, denn sie lehnen es mehrfach ab, etwas über ›Behinderte‹ zu sagen, sondern nehmen zu konkreten Personen in ihren Betrieben Stellung. Andererseits können sie jedoch nicht als ›übersoziale Sonderlinge‹ abgetan werden, handelt es sich doch immerhin um Vorgesetzte in Betrieben unterschiedlicher Größen, die also teilweise nicht aus oberster Leitungsposition in betriebliche Hierarchien eingebunden sind, und in Betrieben unterschiedlicher Branchen. Es scheint kein klares Muster zu geben, in welchen Bereichen die Chancen größer sind und wo kleiner, allenfalls kann vermutet werden, dass lokale Traditionen eine geringere oder - im Fall Hamburgs - größere Offenheit bedingen. Die hanseatische Tradition ohne herrschende Landesherren mag hier eine sozio-ökologische Rolle spielen, gleichzeitig ist die maßgebliche Beeinflussung des öffentlichen lokalen Klimas in Sachen beruflicher Integration durch die Hamburger Arbeitsassistenz seit Beginn der 90er Jahre nicht von der Hand zu weisen, was wiederum die Offenheit von Betrieben fördert.
Die begleitend agierenden Berufsgruppen zeigen sich in ihren Orientierung gespalten. Sehr deutlich ist dies bei den LehrerInnen in den beiden Berufsschulen zu sehen, die geradezu klassisch beide Paradigmata holzschnittartig vertreten. Es zeigt sich in weniger scharfer Abgrenzung auch bei den BerufsberaterInnen, bei denen sich die Umbruchssituation vom einen zum anderen Paradigma in einem kontinuierlichen Spektrum unterschiedlicher und teilweise widersprüchlicher Stellungnahmen und Orientierungen widerspiegelt. Auffällig und in dieser Ausprägung erschreckend ist die stark im sonderpädagogisch-rehabilitativen Paradigma verwurzelte, defizitorientierte Sicht des psychologischen Fachdienstes im Arbeitsamt, bei dem sich noch keine Spuren einer seit Jahrzehnten geführten Paradigmendiskussion zeigen. Hier wird in einem Maß kategorial und segregativ gedacht, wie es die befragten Vorgesetzten in den Unternehmen kategorisch ablehnen. Ob dies auf die spezifische Rolle des ständigen Diagnostizierens und Empfehlens zurückzuführen und quasi als ›déformation professionelle‹ einzuschätzen ist oder welche sonstigen Erklärungen zutreffen könnten, muss offen bleiben.
Aus allen theoretischen Betrachtungswinkeln geht deutlich hervor, dass es sich bei den evaluierten Maßnahmen nicht einfach um neue Organisationsformen ohne weitere Hintergründe handelt, sondern um Ausdruck eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, der auch das System der beruflichen Rehabilitation als Ganzes berührt. Scharfe Auseinandersetzungen, wie sie in einer vergangenen Phase zwischen BerufsberaterInnen und Eltern beschrieben werden, sind unter diesem Blickwinkel nicht individuellen Personen, sondern den Prozessen im Rahmen dieses Umbruchs zuzuschreiben, und Unterschiede in Auffassungen, Einschätzungen und Orientierungen sind ebenfalls Ausdruck dieses Umbruchs.
Von der Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und ihrer theoretischen Reflexion können in unterschiedlichen Richtungen Handlungsbedarfe für eine qualitativ wie quantitativ optimierte Weiterführung der Maßnahmen abgeleitet werden, die sich nach ihrer zeitlichen Dimension unterscheiden lassen. Unter eher kurzfristigem Handlungsbedarf lässt sich folgendes subsumieren:
-
Zunächst erscheint es sinnvoll, nicht mehr vom ambulanten in Relation zum stationären, sondern vielmehr vom betrieblichen oder unterstützten Arbeitstraining zu sprechen, unter anderem deshalb, weil mit dem Schwerbehindertengesetz aus dem Jahr 2000 der Anspruch auf die Unterstützung durch Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste auf dem ersten Arbeitsmarkt einen höheren Stellenwert bekommen hat.
-
Für die sozialpolitischen Entscheidungsträger gilt es, die Platzzahlen für beide Maßnahmen bedarfsgerecht auszuweiten und für den Abbau von Wartelisten zu sorgen. Entscheidend für die Zuweisung sollten entsprechend der Orientierung an Selbstbestimmung und Integration noch stärker als bisher der Wille und die Interessen der BewerberInnen sein - und nicht nur ihre kognitiven Möglichkeiten, die sich als ein nicht entscheidendes Kriterium erwiesen haben.
-
Darüber hinaus gilt es, zusätzliche Möglichkeiten des Erfahrungensammelns für solche junge TeilnehmerInnen zu schaffen, die noch keinen klaren Begriff von Arbeit und keine hinreichende Motivation zur Arbeit haben. Hier müssen für jene Situationen, die die ArbeitsassistentInnen pragmatisch durch einen zeitlich befristeten Übergang in die Werkstatt für Behinderte zu bewältigen versucht haben - eine Strategie, deren Erfolg als zweifelhaft eingeschätzt werden muss - , andere Lösungen gefunden werden. Die Arbeitsassistenz selbst hat zwischenzeitlich durch die Gründung einer gGmbH und entsprechender Zweckbetriebe entschiedene Schritte in diese Richtung unternommen, die reellere Perspektiven bieten.
-
Für die Arbeitsassistenz gilt es weiterhin, für eine Verbesserung der Arbeitssituation der AssistentInnen in Richtung auf mehr internen Austausch und Fortbildung in Gesprächsführung und Supervision zu sorgen und das Stresspotential durch übergroße Mobilität in der gesamten Großstadt zu reduzieren. Zu überlegen wäre darüber hinaus, ob eine fallbezogene Beratung für Problemsituationen durch eine pädagogisch-psychologische Fachkraft zu organisieren wäre.
-
Aus verschiedenen Aussagen und aus öko-systemischer Perspektive insgesamt stellt sich die Herausforderung, die Kooperation mit Eltern verstärkt in den Blick zu nehmen und zu reflektieren - bei allen Schwierigkeiten, die dies hat (vgl. hierzu auch die Wiener Erfahrungen in BURTSCHER 2001, Kap. 15 sowie SCHARTMANN 2000).
-
Ebenfalls aus öko-systemischer Perspektive ist es erforderlich, den Informationsaustausch mit der Rehabilitationsabteilung des Arbeitsamtes sowie insbesondere mit dem psychologischen Fachdienst zu verbessern und zu systematisieren. Ein durchgängig guter Informationsstand bei den BerufsberaterInnen könnte manche alltagstheoretische Annahme über Erfolge und angemessene Zielgruppen und manche Kritik an als überschwänglich wahrgenommener Außendarstellung der Arbeitsassistenz relativieren. Zudem könnte das Konfliktpotential zwischen Eltern und Psychologen in Bezug auf die Fachgutachten weiter entschärft werden, wenn der psychologische Fachdienst ein realistischeres Bild vom Anforderungsprofil und den Möglichkeiten des Ambulanten Arbeitstrainings hätte.
-
Geboten erscheint ebenfalls eine Verbesserung der konzeptionellen Koordination mit dem Berufsschulunterricht zum Ambulanten Arbeitstraining, vor allem mit der Berufsschule A. Inwieweit auch eine bessere personelle Ausstattung im Hinblick auf stärkere Einbindung in betriebliche Situationen und Kooperation mit ArbeitsassistentInnen realisiert werden könnte, ggf. auf Kosten der Doppelbesetzung zur Einzelförderung, müsste gemeinsam mit der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung eruiert werden.
-
Angesichts der vorgefundenen langfristigen Orientierungen erscheint es darüber hinaus notwendig, dass die Schulen für Geistigbehinderte über verstärkte Information für Betriebspraktika und weitere Perspektiven außerhalb der Werkstatt für Behinderte sensibilisiert werden, um die bisherigen Einbahnstraßen ohne Abbiegemöglichkeiten für ihre SchülerInnen abzubauen (vgl. auch TROST 1997).
-
Für die Werkstätten für Behinderte stellt sich zum einen die allgemeine Entwicklungsaufgabe, sich stärker mit den bestehenden Möglichkeiten und ihren konkreten Rahmenbedingungen auseinander zusetzen - so stehen z.B. für das angeblich teurere Ambulante Arbeitstraining nur 90% der Mittel zur Verfügung, die im Arbeitstraining der Werkstatt für Behinderte vorhanden sind, da 10% für Verwaltungsaufwand in den Werkstätten verbleiben. Zum anderen besteht die spezielle Entwicklungsaufgabe, die Wünsche von mindestens 41% der befragten MitarbeiterInnen, die aus der Werkstatt für Behinderte heraus auf den ersten Arbeitsmarkt wollen, ernst zu nehmen und - so weit nicht schon geschehen - diesbezügliche Schritte einzuleiten. Dazu gehören u.a. auch ein - sicherlich zum Teil erst in konkreten Prozessen erfahrbares - besseres Wissen und eine realistischere Einschätzung der aktuellen Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt und selbstverständlich auch die notwendigen Ressourcen für Begleitung und Einarbeitung.
Längerfristig erscheinen die folgenden Handlungsbedarfe aus den Untersuchungsergebnissen ableitbar:
-
Unter strukturellen Gesichtspunkten sollte überlegt werden, ob das Ambulante Arbeitstraining an den Werkstätten für Behinderte sinnvoll verortet ist. Es ist eine von vornherein widersprüchliche Konstruktion, wenn eine tradierte Institution aus ihrer paradigmatischen Verwurzelung heraus nun mit anderen grundsätzlichen Orientierungen neue Unterstützungsformen praktizieren soll und dabei ihre eigenen institutionellen Interessen ignorieren muss - die LeistungsträgerInnen sorgen für die Sicherung der ökonomischen Basis, müssen also gehalten werden, sie sind in der Regel aber auch die ersten, denen der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zugetraut wird, die also abgegeben werden müssten. Aus dem Schulbereich ist bekannt, dass Sonderschulen in einer neuen Rolle als integrationsunterstützende sonderpädagogische Förderzentren sich in den seltensten Fällen paradigmatisch neu orientieren, sondern vielmehr - aus systemtheoretischer Sicht logischerweise - starke Tendenzen zur Erhaltung und Expansion der eigenen Institution aufweisen (vgl. HINZ 2000a). Insofern ist unter innovationsstrategischen wie unter qualitativen Aspekten zu diskutieren, ob nicht betriebliche Arbeitstrainings, Praktika und Beschäftigung von institutionell unabhängigen Agenturen unterstützt werden sollten (vgl. hierzu sinngemäß TROST 1994, 108). Angesichts der allgemeinen Diskussion um persönliche Budgets für den Wohnbereich und erste Versuche damit wären auch für den Arbeitsbereich persönliche Budgets mitzudiskutieren.
-
Die Koordination und Kooperation aller Anbieter für diesen Bereich sowie klare sozialpolitische Aussagen über weitere Perspektiven sind dringend notwendig; eine konzeptbezogene Reflexion der gesamten Angebotspalette in diesem Bereich muss erfolgen in dem Sinne, wie es bei HANNEMANN (2001) deutlich wird: Es muss um eine Palette von Angeboten gehen, die koordiniert als sozialpolitisches Gesamtkonzept und nicht pragmatisch-naturwüchsig auf Einzelinitiativen basierend und damit möglicherweise bestimmte Angebote und ihre Qualität verdrängend realisiert werden; angesichts der ökonomischen Situation wird dies immer schwieriger und dringender (vgl. auch Kap. 1.4.4).
-
Die Kritik von verschiedenen Seiten legt es nahe, die Aufhebung der zeitlichen Befristung von Unterstützungsleistungen ins Auge zu fassen: Es ist nicht vermittelbar, dass die gleichen Personen - also nicht nur die ›Grenzfälle‹, wie die Untersuchung deutlich zeigt - in den Werkstätten für Behinderte dauersubventioniert werden, in den betrieblichen Formen jedoch nur zeitlich befristet unterstützt werden können. Hier ergibt sich ein eklatanter Widerspruch zum allgemeinen Grundsatz des Rehabilitationssystems, dass ambulante vor stationären Leistungen rangieren; real werden bei dem Arbeitstraining ressourcenbedingt die stationären Angebote priorisiert. Mit einer dauerhaften Regelung auch für die betriebliche Form des Arbeitstrainings wäre nicht nur der z.T. beträchtliche Zeitdruck aufgehoben, sondern auch die Ausdehnung des unterstützbaren Personenkreises auf Personen mit längerfristigerem Unterstützungsbedarf möglich. Es sollte in begrenztem Rahmen erprobt werden, welcher reale Bedarf sich bei einer zeitlichen Entfristung ergeben würde und welche finanziellen Konsequenzen daraus entstehen würden.
-
Ebenfalls ist nicht vermittelbar, dass aus finanziellen Gründen für das betriebliche Arbeitstraining nur in Frage kommt, wer den Weg zum Arbeitsort selbständig bewältigen kann. Auch hier ist eine Gleichstellung zwischen den Formen des Arbeitstrainings anzustreben, denn auch hier gilt es, der Bindung von Ressourcen an die Person den Vorrang gegenüber deren Bindung an Institutionen zu geben.
-
Schließlich wäre im Falle der Ausweitung betrieblicher Angebote eine Regionalisierung des Fachdienstes - in wessen Trägerschaft bei bestehender Qualität auch immer - ins Auge zu fassen, was mehrfach positive Wirkungen haben könnte: Zum einen würden die Bezüge zum Stadtteil verbessert, Kontakte mit Betrieben könnten intensiviert werden, was positive Rückwirkungen auf die Akquisition haben dürfte, und Stress, Zeit- und Reibungsverluste durch die übergroße Mobilität der AssistentInnen könnten reduziert werden.
Die bisherigen Untersuchungen können selbstverständlich nicht alle Aspekte der beiden Maßnahmen beleuchten und schon gar nicht alle Fragen in diesem Zusammenhang klären. Offene Fragen, die weitere Beachtung erfahren sollten, sind u.a. die folgenden:
-
Eltern sollten in größerem Rahmen bezüglich ihrer Einschätzung und Zufriedenheit mit den beiden Maßnahmen befragt werden; bei den vorliegenden Untersuchungen sind sie lediglich im Rahmen der Einzelstudien zu Wort gekommen und haben sich dort bis auf eine Ausnahme sehr positiv über die ArbeitsassistentInnen geäußert. Repräsentative Aussagen, evtl. wiederum in Parallelisierung mit Eltern der Werkstätten für Behinderte, sind jedoch noch nicht erhoben worden.
-
Eine weitere offene Frage ist die der konzeptionellen Planung und Ausstattung betrieblicher Formen von Unterstützten Arbeitstrainings und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen; hierzu liegen in Hamburg keinerlei Erfahrungen vor, in Berlin haben kürzlich zwei Projekte mit Personen aus Tagesförderstätten begonnen (vgl. HOFFRICHTER & ZINN 1998). Einem der profiliertesten und erfahrensten Träger unterstützter Maßnahmen stünde ein solches Projekt gut an.
-
Weiterhin sollten neben den positiven auch Erfahrungen des Scheiterns mit Betrieben des ersten Arbeitsmarktes untersucht werden, denn von ihnen dürften präzisere Hinweise auf Problemstellen und Schwachpunkte der Maßnahmen zu erhalten sein.
-
An mehreren Stellen ist bereits von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, dass die Untersuchung längerfristiger Effekte bei Beschäftigungsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt, auch nach Ablauf der Zeit mit Lohnkostenzuschüssen, eine außerordentliche hohe Relevanz hat; überhaupt wären längerfristige Längsschnittuntersuchungen wichtig, die im bestehenden zeitlichen Rahmen nicht direkt, sondern nur retrospektiv erschließend möglich waren.
Abschließend erscheint es wichtig zu betonen, dass die Hamburger Arbeitsassistenz mit ihren beiden betrieblichen, unterstützten Maßnahmen - bei mancher Kritik im Detail - Maßstäbe gesetzt hat. Wer auch immer sich in den nächsten Jahren auf den Weg entsprechender Angebote macht, wird sich an diesen Maßstäben messen lassen müssen: Arbeitsplätze auf dem all-gemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen mit einem ortsüblichen Tariflohn und dem Status von ArbeitnehmerInnen innerhalb des jeweiligen Betriebes. Wenn sich Praxis mit dem Prädikat beruflicher Integration bezeichnen lassen möchte, dürfen diese Standards nicht unterschritten werden.
Auf theoretischer Ebene fasst das heuristische Modell (vgl. Tab. 9.1) mit den beiden paradigmatischen Orientierungen im Anschluss an Tab. 1.1 (vgl. Kap. 1.2) die widersprüchliche Entwicklung für den Bereich des beruflichen Hilfesystems für Menschen mit Behinderungen zusammen.
Tab 9.1: Paradigmata im beruflichen Hilfesystem (nach WEZEL 2001, 51)
|
Sonderpädagogisch-rehabilitatives Paradigma |
Integratives Paradigma |
|
|
Auf praxisbezogener Ebene wurden bereits wesentliche förderliche und erschwerende Faktoren für berufliche Integration benannt (vgl. Kap. 9.1.4). Es hat sich in der Evaluation der beiden Maßnahmen der Hamburger Arbeitsassistenz, des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums, gezeigt, dass nicht nur strukturell die Voraussetzungen geschaffen worden sind, sondern in hohem Maße auch prozessual berufliche Integration gelingt. Dies hängt - unter systemischem Blickwinkel nicht überraschend - neben der Person selbst mit vielen weiteren Faktoren zusammen, wie daher auch das folgende Polaritätenmodell widerspiegelt (vgl. Tab. 9.2).
Für berufliche Integration ist es ...
Tab. 9.2: Fördernde und hemmende Faktoren bei beruflicher Integration
|
... förderlich, wenn... |
... erschwerend, wenn ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALBRECHT, Friedrich, HINZ, Andreas & MOSER, Vera (Hrsg.) (2000): Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplin- und professionsbezogene Standortbestimmungen. Neuwied/Berlin: Luchterhand
ALTERHOFF, Gernot (19942): Grundlagen klientenzentrierter Beratung. Eine Einführung für Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und andere in sozialen Berufen Tätige. Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer
ANDERS, Dietrich (1996): Die Werkstatt für Behinderte - der andere Weg ins Arbeitsleben. In: ZWIERLEIN, 547-562
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN (Hrsg.) (2000): Schwerbehindertengesetz. Text und Verordnungen. Karlsruhe: Eigenverlag
ARBEITSGRUPPE AUSSENARBEITSPLÄTZE IN HESSEN (Hrsg.) (1989): Konzeptionspapier zur Schaffung und Finanzierung von Arbeits-, Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen außerhalb von Werkstätten für Behinderte. Kassel/Frankfurt/Limburg: Eigenverlag
BA (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT) (Hrsg.) (1997): Berufliche Rehabilitation junger Menschen. Handbuch für Schule, Berufsberatung und Ausbildung. Nürnberg: Eigenverlag
BAG INTEGRATIONSFIRMEN, BAG UB, SOZIALVERBAND REICHSBUND (1998): Positionen und Eckpunkte zur Weiterentwicklung von Integrationsfirmen und Integrationsfachdiensten. Impulse, H.9, 9-11
BAGS (BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES) (Hrsg.) (1999a): Lebenssituation behinderter Menschen in Hamburg. Bericht zur Entwicklung der sozialen und beruflichen Rehabilitation. Hamburg: Eigenverlag
BAGS (BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES) (Hrsg.) (1999b): Behinderte machen einen guten Job! Aktionsprogramm zur Integration von Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt. Hamburg: Eigenverlag
BAGS (BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES) (Hrsg.) (2001): Neue Jobs für Schwerbehinderte. Behinderte und Arbeitsmarkt in Hamburg - Zwischenbilanz 2001 und Perspektiven. Hamburg: Eigenverlag
BAG UB (BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR UNTERSTÜTZTE BESCHÄFTIGUNG) (1999): Materialien zur berufsbegleitenden Qualifizierung in Unterstützter Beschäftigung. Modul 1: Unterstützte Beschäftigung. Überblick und Philosophie. Hamburg: Eigenverlag
BARLSEN, Jörg & BUNGART, Jörg (1995): Innovative Entwicklung in der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung - ein Überblick. Gemeinsam Leben 3, 14-17
BARLSEN, Jörg & HOHMEIER, Jürgen (1997): »Unterstützte Beschäftigung«. Ein neues Element im System der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam Leben 5, 56-59
BECK, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main: Suhrkamp
BEHNCKE, Rolf (1998): »Natürlich kann sie nicht alle Arbeiten durchführen!« Ein besonderes Arbeitsverhältnis? - Unterstützte Beschäftigung konkret. Impulse, H.10, 29-31 (http://bidok.uibk.ac.at/library/imp10-98-konkret.html) Stand: 24.4.2007, Link aktualisiert durch bidok
BEHNCKE, Rolf & CIOLEK, Achim (1997): Arbeiten außerhalb der Werkstatt. Die Hamburger Arbeitsassistenz - ein Fachdienst zur beruflichen Integration für Menschen mit geistiger Behinderung. In: SCHULZE u.a., 221-237 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
BEHNCKE, Rolf, CIOLEK, Achim & KÖRNER, Ingrid (1993): Arbeiten außerhalb der Werkstatt: Die Hamburger Arbeitsassistenz - ein Modellprojekt zur beruflichen Integration für Menschen mit geistiger Behinderung. Geistige Behinderung 32, H.4 (Einhefter), 1-27
BENKMANN, Rainer (1994): Dekategorisierung und Heterogenität. Aktuelle Probleme schulischer Integration von Lernschwierigkeiten in den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland. Sonderpädagogik 24, 4-13
BLEIDICK, Ulrich (1999): Behinderung als pädagogische Aufgabe. Stuttgart/Berlin/¬Köln: Kohlhammer
BMA (BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG) (Hrsg.) (1998): Die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation. Vierter Bericht der Bundesregierung. Bonn: Selbstverlag
BMA (BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG) (Hrsg.) (2000): Ratgeber für behinderte Menschen. Berlin: Selbstverlag
BOBAN, Ines & HINZ, Andreas (1993): Geistige Behinderung und Integration. Überlegungen zum Begriff der ›Geistigen Behinderung‹ im Zusammenhang integrativer Erziehung. Zeitschrift für Heilpädagogik 44, 1993, 327-340 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/boban-behinderung.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
BOBAN, Ines & HINZ, Andreas (1995): Werkstadthaus Hamburg - wohnen mitten in der Stadt und arbeiten in einem rollstuhlgerechten Hotel. Zeitschrift für Heilpädagogik 46, 1995, 384-387 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/boban-hotel_hamburg.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
BOBAN, Ines & HINZ, Andreas (1999): Persönliche Zukunftskonferenzen. Unterstützung für individuelle Lebenswege. Behinderte 22, H.4-5, 13-23 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-konferenz.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
BOBAN, Ines, HINZ, Andreas, LÜTTENSEE, Jens & POKOJEWSKI, Claudia (1997): Das Stadthaus-Hotel Hamburg - ein Integrationsbetrieb. In: SCHULZE u.a., 247-261 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
BÖGER, Hella (2001): Berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen aus Arbeitgebersicht. Halle (Saale): Unveröff. Examensarbeit
BÖHRINGER, Klaus-Peter (2000): Arbeitsrehabilitation im Wandel. Stand und Perspektiven der Integration psychisch kranker und geistig behinderter Menschen. Impulse, H.17, 3-9
BOURDIEU, Pierre u.a. (1997): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz: UVK Universitätsverlag
BRONFENBRENNER, Urie (1989): Ökologie der menschlichen Entwicklung. Frankfurt am Main: Fischer
BSJB (BEHÖRDE FÜR SCHULE, JUGEND UND BERUFSBILDUNG) (Hrsg.) (1997): Wege ins Berufsleben für Jugendliche mit Behinderungen. Broschüre zur Informationsveranstaltung am 11.09.1997. Hamburg: Eigenverlag
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE (Hrsg.) (1996): Selbstbestimmung. Kongressbeiträge. Marburg: Lebenshilfe
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE (Hrsg.) (2000): Konzepte und Instrumente zur Nutzerbefragung. Dokumentation des Expertenhearings der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Marburg: Eigenverlag
BUNGART, Jörg (1997): »Unterstützte Beschäftigung« von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in der Bundesrepublik - ein Vergleich. Gemeinsam leben 5, 59-64
BURTSCHER, Reinhard (1998): Berufliche Integration ohne Emanzipation ist ein Missverständnis. Erziehung heute, H.3 / betrifft: Integration. Sondernummer 3a: Weissbuch Integration (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/burtscher-weissbuch_beruf.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
BURTSCHER, Reinhard (2001): Unterstützte Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Zur Theorie der Arbeitsassistenz in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen. Innsbruck: Unveröff. Dissertation
CHRISTE, Gerhard (1997): Soziale Betriebe: Ein arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Integration Schwerbehinderter ins Beschäftigungssystem. In: NIEHAUS & MONTADA, 86-104
CIOLEK, Achim (1995): Hamburger Arbeitsassistenz. Fachdienst zur beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung. Erfahrungen und Thesen zur Unterstützten Beschäftigung. Gemeinsam Leben 2, 60-64
CLOERKES, Günther (1997): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Heidelberg: Winter
DALFERTH, Michael (1995): Geistig behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Integrationschancen und Hemmnisse. Geistige Behinderung 34, 36-47
DEUSCH, Berthold (1998): Unterscheidung der Konzepte Unterstützter Beschäftigung nach Gesichtspunkten des Supported Employment und Integrationsdienste im Auftrag der Hauptfürsorgestellen. Impulse, H.9, 15
DOOSE, Stefan (1996): Ergebnisse einer Studie über unterstützte Beschäftigung in Deutschland. Impulse, H.1, 5-7 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-vergleich.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
DOOSE, Stefan (1997a): Stand der Entwicklung und Zukunft von »Unterstützter Beschäftigung« in Deutschland. Gemeinsam Leben 5, 84-88
DOOSE, Stefan (1997b): Unterstützte Beschäftigung. Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich. In: SCHULZE u.a., 262-291 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
DÜRR, Walter (1996): Integration von Menschen mit Behinderungen aus berufspädagogischer Sicht. In: EBERWEIN, Hans (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. Interdisziplinäre Zugangsweisen sowie Aspekte universitärer Ausbildung von Lehrern und Diplompädagogen. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 208-230
EBERWEIN, Hans (Hrsg.) (19995a): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam: Ein Handbuch. Weinheim: Beltz
EBERWEIN, Hans (1999b): Integrationspädagogik als Weiterentwicklung (sonder) pädagogischen Denkens und Handelns. In: EBERWEIN 1999a, 55-68
ECKERT, Detlef (1996): Zwischen Eingliederung und Aussonderung - Zur Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen seit dem Beginn der 80er Jahre. In: ZWIERLEIN, 492-502
ELBE-WERKSTÄTTEN (1999): Sich ändern oder untergehen. Wohin entwickeln sich unsere Werkstätten im neuen Jahrtausend? Schwindelfrei, Ausgabe 20, Winter 1999/2000, 26-35
ELLGER-RÜTTGART, Sieglind & BLUMENTHAL, Wolfgang (Hrsg.) (1997): Über die große Schwelle. Junge Menschen mit Behinderungen auf dem Weg von der Schule in Arbeit und Gesellschaft. Ulm: Universitätsverlag
EMPT, Angelika (2001): Autismustherapie und Förderung - wo sie schadet, wie sie nützt ... Behindertenpädagogik 40, 82-92
ERNST, Karl-Friedrich (1998): Integrationsfachdienste für besonders betroffene Schwerbehinderte - ein Zwischenbilanz aus der Sicht der Hauptfürsorgestellen. Impulse H.10, 6-12
FEHRE, Eva-Maria (1997): John O'Brien: Supported Employment in den USA. Impulse, H.7/8, 28
FEUSER, Georg (2000a): Zum Verhältnis von Sonder- und Integrationspädagogik - eine Paradigmendiskussion? In: ALBRECHT, HINZ & MOSER, 20-44
FEUSER, Georg (2000b): Arbeit - gemieden und gepriesen. Aspekte der Rehabilitation, Selbstbestimmung und Integration. Vortrag im Rahmen der Tagung »Arbeit ist möglich« am 26. 9. 2000 in Hamburg. Bremen: Unveröff. Skript
FLICK, Uwe (1995): Qualitative Forschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
FORSTER, Rudolf (1998): Der Weg geistig behinderter Jugendlicher und Erwachsener ins Arbeitsleben. Inclusive Education for all - Inklusive Bildung für alle, Bd. 6. Aachen: Mainz
FRICK, Bernd & SADOWSKI, Dieter (1996): Arbeitsmarktpolitik für Behinderte in Deutschland: Möglichkeiten und Grenzen. In: ZWIERLEIN, 471-479
FRIEDRICHS, Jürgen (199014): Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag
FRISKE, Andrea (1995): Als Frau geistig behindert sein. Ansätze zu frauenorientiertem heil-pädagogischen Handeln. München/Basel: Reinhardt
GEHRMANN, Manfred (1998): Unterstützte Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung in regulären Betrieben. In: HASEMANN & PODLESCH, 192-199
GEHRMANN, Manfred & RADATZ, Joachim (1997): Stigma-Management als eine Aufgabe von Integrationsfachdiensten für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Gemeinsam Leben 5, 66-72
GINNOLD, Antje (2000): Schulende - Ende der Integration? Integrative Wege von der Schule in das Arbeitsleben. Neuwied/Berlin: Luchterhand
GINNOLD, Antje & RADATZ, Joachim (2000): »SprungBRETT« ins Arbeitsleben. Gemeinsam leben 8, 19-23 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-00-sprungbrett.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
GLENZ, Volker SCHULZE, Hartmut & STURM, Hartmut (1997): Wege in die Arbeitswelt: Der integrative Förderlehrgang F1-i/BBE-i. In SCHULZE u.a., 142-166 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
GOFFMAN, Erving (1967): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp
GORZ, Andre (1989): Kritik der ökonomischen Vernunft. Sinnfragen am Ende der Arbeitsgesellschaft. Hamburg: Rotbuch
GRAUMANN, Götz (Hrsg.) (1998): Handbuch Integrationsfirmen. Daten, Fakten, Analysen. Walldorf: Integra
GRUBMÜLLER, Josef, HINZ, Andreas, LOEKEN, Hiltrud & MOSER, Vera (1999): Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik? - Theoretische Überlegungen und konzeptionelle Konsequenzen. In: SCHMETZ, Ditmar & WACHTEL, Peter (Hrsg.): Entwicklungen - Standorte - Perspektiven. Sonderpädagogischer Kongress 1998. Würzburg: Verband Deutscher Sonderschulen, 279-295
GRUND, Berthold & BEHNCKE, Rolf (1996): Das ambulante Arbeitstraining - ein Angebot der beruflichen Erstausbildung der Hamburger Arbeitsassistenz für SchulabgängerInnen der Sonderschulen und Integrationsklassen. Impulse, H.2, 19-20
HAA (HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ) (Hrsg.) (1997a): Ambulantes Arbeitstraining - Integratives Verbindungsglied zwischen Schule und unterstützter Beschäftigung. In: LAG ELTERN FÜR INTEGRATION, 114-119
HAA (HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ (Hrsg.) (1997b): Fachdienst für die berufliche Integration von Menschen mit geistiger Behinderung. Konzept und Arbeitsweise (Selbstdarstellung). Hamburg: Eigenverlag
HAA (HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ) (Hrsg.) (1997c): Analyse des finanzielle Mitteleinsatzes und der Einsparungen für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Zeitraum vom März 1992 bis März 1997. Hamburg: Eigenverlag
HAA (HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ) (Hrsg.) (1999): Konzept, Entwicklung und Perspektiven der Maßnahmen Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikum. Bericht Juni 1999. Hamburg: Unveröff. Skript
HAA (HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ) (Hrsg.) (2000): Dritter Zwischenbericht über das Projekt »Integrative berufliche Orientierung und Qualifizierung von Menschen mit Behinderung im Übergang von der Schule in den Beruf«. Bericht Juni 2000. Hamburg: Unveröff. Skript
HAA (HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ) (Hrsg.) (2001): Übergang von der Schule in den Beruf für Menschen mit Behinderung. Handbuch zum Modellprojekt des »Ambulanten Arbeitstrainings« und des »Integrationspraktikums« der Hamburger Arbeitsassistenz. Hamburg: Eigenverlag
HANNEMANN, Uwe (2001): WfB Dinosaurier - eine Konkurrenz zum Integrationsfachdienst? Impulse, H.18, 23-24
HASEMANN, Klaus & PODLESCH, Wolfgang (Hrsg.) (1998): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Baltmannsweiler: Schneider
HINZ, Andreas (1993): Heterogenität in der Schule. Integration - Interkulturelle Erziehung - Koedukation. Hamburg: Curio 1993 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
HINZ, Andreas (1996a): ›Geistige Behinderung‹ und die Gestaltung integrativer Lebensbereiche. Überlegungen zu Erfahrungen und Perspektiven. Sonderpädagogik 16, 144-153 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-lebensbereiche.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
HINZ, Andreas (1996b): Zieldifferentes Lernen in der Schule. Perspektiven für einen integrativen Umgang mit Heterogenität. Die Deutsche Schule 88, 263-279
HINZ, Andreas (1998): Hamburg. In: ROSENBERGER, Manfred (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung - Idee, Konzepte, Zukunftschancen. Neuwied: Luchterhand, 213-230
HINZ, Andreas (2000a): Sonderpädagogik im Rahmen von Pädagogik der Vielfalt und Inclusive Education. Überlegungen zu neuen paradigmatischen Orientierungen. In: ALBRECHT, HINZ & MOSER, 124-140
HINZ, Andreas (2000b): Evaluation des Modellprojekts »Berufliche Orientierung und Qualifizierung im Übergang zwischen Schule und Beruf für Menschen mit Behinderung / Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikumsjahr« der Hamburger Arbeitsassistenz. Interner Zwischenbericht zum 30. 9. 2000. Halle (Saale): Unveröff. Skript
HINZ, Andreas (2001): Ambulantes Arbeitstraining und Integrationspraktikumsjahr der Hamburger Arbeitsassistenz. Erste Ergebnisse der externen Evaluation. Impulse Nr. 18, 21-22
HINZ, Andreas & LÜTTENSEE, Jens (1997): Integrationsbetriebe - ein Weg zur beruflichen Integration für Menschen mit Behinderungen. (Unveröff. Skript zur Tagung des Arbeitsmarktservice Österreich in Salzburg, 9./10. Oktober 1997: »Behinderung Arbeitsmarkt?«). (Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-betrieb.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
HOFFRICHTER, R. & ZINN, K. (1998): Arbeit für (schwerst)körperbehinderte und mehrfachbehinderte Menschen. Ein Ziel - ein Weg! Oder: Ein Ziel und viele Wege? Impulse, H.7/8, 24-27
HOFMANN, Christiane, KUNISCH, Monika & STADLER, Bernadette (1996): »Ich spiel jetzt in Zukunft den Depp.« Geistige Behinderung und Selbstbild. Geistige Behinderung 35, 26-41
HOHMEIER, Jürgen (1975): Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozess. In: BRUSTEN, M. & HOHMEIER, Jürgen (Hrsg.): Stigmatisierung 1. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied/Darmstadt: Luchterhand, 5-25 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html ) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
HORIZON-ARBEITSGRUPPE (Hrsg.) (1995): Unterstützte Beschäftigung. Handbuch zur Arbeitsweise von Integrationsfachdiensten für Menschen mit geistiger Behinderung. Reutlingen/Berlin/Hamburg/Gelsenkirchen: Eigenverlag
IMPULSE (1999): Themenschwerpunkt: Unterstützte Beschäftigung in Europa. Impulse Nr. 13 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp13-99-schwerpunkt.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
JACOBS, Kurt (1988): Das gegenwärtige System der Berufsausbildung und Berufseingliederung von Menschen mit besonderen Lernerschwernissen, insbesondere unter dem Aspekt der Beschäftigung in den Werkstätten für Behinderte (WfB). In: ROSENBERGER, Manfred (Hrsg.): Ratgeber gegen Aussonderung. Heidelberg: Schindele, 176 - 197
JÄHNERT, Detlev (1997a): Es hat nie nur die WfB sein müssen: Schlaglichter auf eine falsche Entwicklung. Gemeinsam leben 5, 72-75
JÄHNERT, Detlev (1997b): Über den Tag hinaus - Finanzierung und Zukunft von Unterstützter Beschäftigung. Impulse, H. 5/6, 34-37
JAHODA, Marie (1984): Braucht der Mensch die Arbeit? In: NIESS, Frank (Hrsg.): Leben wir, um zu arbeiten? Die Arbeitswelt im Umbruch. Köln: Bund, 11-17
JUNKER, Axel (1997): Supported Employment Made in USA: Ein Modell für Deutschland? Impulse, H.7/8, 12-21
KAN, Peter van & DOOSE, Stefan (1999): Zukunftsweisend. Peer Counceling & Persönliche Zukunftsplanung. Kassel: bifos
KINDT, Herma & KÜHL, Karsten (1997): Berufliche Qualifizierung für Menschen mit geistiger Behinderung an der W2. In: SCHULZE u.a., 196-219 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
KMK (KULTUSMINISTERKONFERENZ) (1994): Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland. Zeitschrift für Heilpädagogik 45, 484-494
KÖBBERLING, Almut & SCHLEY, Wilfried (2000): Sozialisation und Entwicklung in Integrationsklassen. Untersuchungen zur Evaluation eines Schulversuchs in der Sekundarstufe. Weinheim/München: Juventa
KRATZER-MÜLLER, Hedi (1997): Integration von Beschäftigten aus Werkstätten für Behinderte in den allgemeinen Arbeitsmarkt: Umsetzung des Hessischen Konzeptionspapiers zur Schaffung und Finanzierung von Arbeits-, Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen außerhalb der Werkstätten für Behinderte. Gemeinsam leben 5, 80-83
KROHN, Johanna (1997): Integratives Berufsvorbereitungjahr. In: SCHULZE u.a., 190-194 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
KUHN, Theodor S. (1973): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt am Main: Suhrkamp
LAG ELTERN FÜR INTEGRATION (Hrsg.) (1997): Integration in Hamburg. Informationen, Gedanken, Erfahrungen. Hamburg: Eigenverlag
LAMNEK, Siegfried (1988): Qualitative Sozialforschung. Bd. 1: Methodologie. München/Weinheim: Psychologie Verlags Union
LAMNEK, Siegfried (1989): Qualitative Sozialforschung Bd.2: Methoden und Techniken. München/Weinheim: Psychologie Verlags Union
LEICHSENRING, Kai & STRÜMPEL, Charlotte (1997): Berufliche Integration behinderter Menschen. Innovative Projektbeispiele in Europa. Wien: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
LÜHR, Wolfgang (2000): Begrüßungs- und Eingangsrede zur Fachtagung vom 13. - 14. Juni 2000. In: LAG DER WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE HAMBURG (Hrsg.): Die Zukunft aktiv gestalten - welche Entwicklung geben wir der beruflichen Rehabilitation? Dokumentation der Referate und Arbeitsergebnisse. Hamburg: Unveröff. Skript, 2-4
MAIR, Helmut (1997): Schließungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt und Unterstützte Beschäftigung. Impulse, H.5/6, 25-32
MAIR, Helmut & BARLSEN, Jörg (2000): Entwicklungsperspektiven von Erwerbsarbeit und von Integrationsfachdiensten für Arbeitssuchende mit Behinderungen. Zeitschrift für Heilpädagogik 51, 398-403
MARKOWETZ, Reinhard (2000): Identität, soziale Integration und Entstigmatisierung. Gemeinsam Leben 8, 112-120 (auch im Internet unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-identitaet.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
MILLER, Alice (1979): Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Frankfurt: Suhrkamp
MONTADA, Leo (1997): Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt. In: NIEHAUS & MONTADA, 3-17
MOHR-HERRLITZ, Rainer & GÖRGEN, Elisabeth (1997): Berufsorientierung in Frankfurt: Ernst-Reuter-Schule II. In: Schulze u.a., 121-130 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
MÜNDER, Johannes (19912): Beratung, Betreuung, Erziehung und Recht. Handbuch für Lehre und Praxis. Münster: Votum
NIEHAUS, Mathilde (1997): Barrieren gegen die Beschäftigung langfristig arbeitsloser Behinderter. In: NIEHAUS & MONTADA, 28-53
NIEHAUS, Mathilde & MONTADA, Leo (Hrsg.) (1997): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Wege aus dem Abseits. Frankfurt/Main: Campus
OPPOLZER, Alfred (o.J.): Die Elbe-Werkstätten aus der Sicht des Personals. Ergebnisse der Personalbefragung der Elbe-Werkstätten GmbH 1999. Hamburg: Unveröff. Skript
PERABO, Christa (1993): Neue Ansätze der Integration von behinderten Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Behindertenpädagogik 32, 338-371
REISER, Helmut (1991): Wege und Irrwege zur Integration. In: SANDER, Alfred & RAIDT, Peter (Hrsg.): Integration und Sonderpädagogik. St. Ingbert: Röhrig, 13-33
RITZ, Hans-Günther (1997): Schwerbehindertenpolitik in der Freien und Hansestadt Hamburg - die Tätigkeit der Hauptfürsorgestelle. In: BAGS (BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIA-LES) (Hrsg.): Arbeitsmarkt und Arbeitsplatzgestaltung für Behinderte. Frankfurt am Main: Lang, 47-90
ROGAL, Frank (2000): Unterricht an Berufsschulen für SchülerInnen im Arbeitstraining sowie im dritten Jahr des Lehrgangs zur Verbesserung Beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE). Impulse, H.17, 23-26
ROGAL, Frank, STURM, Hartmut & VONDAY, Norbert (1997): Berufsorientierung in Hamburg: Geschwister-Scholl-Gesamtschule: Ein Kooperationsprojekt der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG) und der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt (G12). In: SCHULZE u.a., 72-85 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
SANDER, Alfred (19995): Behinderungsbegriffe und ihre Konsequenzen für die Integration. In: EBERWEIN, 99-107
SCHARTMANN, Dieter (1995a): Soziale Integration durch Mentoren: Das Konzept des »Natural Support« als Aktivierung innerbetrieblicher Unterstützungsressourcen in der beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung. In: Behinderte 18, H.4, 43-54
SCHARTMANN, Dieter (1995b): Supported Employment in den USA. Ein Literaturbericht. Behindertenpädagogik 34, 54-80
SCHARTMANN, Dieter (1999): Berufliche Integration geistig behinderter Menschen - die Sicht der Betriebe. Gemeinsam Leben 7, 69-76 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-99-betriebe.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
SCHARTMANN, Dieter (2000): Der Übergang von der Schule in das Erwerbsleben - Möglichkeiten, Chancen und Risiken. Gemeinsam leben 8, 9-14 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-00-chancen.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
SCHLEY, Wilfried (1990): Sonderpädagogen zwischen Identitätsverlust und Neuorientierung: Wege aus der Krise. Zeitschrift für Heilpädagogik 41, Beiheft 17, 246-251
SCHÖLER, Jutta (Hrsg.) (1996): »Italienische Verhältnisse« Teil II: Menschen mit Behinderungen auf dem Weg von der Schule in die Arbeitswelt. Berlin: Klaus Gruhl
SCHÖNWIESE, Volker (1995): Behinderung - Rehabilitation - Integration. Referat beim Symposium »Rehabilitation - Integration. 20 Jahre Kinderneurologie am Rosenhügel« am 5. 5. 1995 in Wien. (im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-rehabilitation.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
SCHULTHEISS, Andreas (Hrsg.) (1997): Was kommt nach der Schule? In: LAG ELTERN FÜR INTEGRATION, 99-103
SCHULZE, Hartmut u.a. (Hrsg.) (1997): Schule, Betriebe und Integration: Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt. Hamburg: Eigenverlag (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
SCHUMANN, Werner (1995): Der Berufsbegleitende Dienst in Reutlingen - eine Brücke zwischen der Lebenswelt von Personen mit Behinderungen und dem »ersten Arbeitsmarkt«. Gemeinsam Leben 2, 73-76
SCHUMANN, Werner (1998): Fachdienste zur beruflichen Eingliederung von Personen mit einer sog. geistigen Behinderung als Brücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt. In: HASE-MANN & PODLESCH, 184-191
SEMLINGER, Klaus & SCHMID, Georg (1985): Arbeitsmarktpolitik für Behinderte: betriebliche Barrieren und Ansätze zu ihrer Überwindung. Basel: Birkhäuser
SEYD, Wolfgang (1997): Zielperspektiven beruflicher Bildung vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. In: ELLGER-RÜTTGART & BLUMENTHAL, 13-27
SEYL, Karl-Hermann (1996): Die Bedeutung der Werkstätten für Behinderte. In ZWIERLEIN, 536-546
SPECK, Otto (1992): Berufliche Eingliederung für schwer vermittelbare junge Menschen. In: SPECK, Otto & KANTER, Gustav O. (Hrsg.): Schwer vermittelbar! München/Basel: Reinhardt, 11-25
SPECK, Otto (19963): System Heilpädagogik. Eine ökologisch-reflexive Grundlegung. München/Basel: Reinhardt
STORZ, Michael (1997): Schöne neue Arbeitswelt. Anmerkungen zur beruflichen (Teil-) Integration von marktbenachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in postindustrieller Zeit. Zeitschrift für Heilpädagogik, 398-405
STORZ, Michael (1999): Hauptsache Arbeit?! Integration von marktbenachteiligten jungen Menschen in die Tätigkeitsgesellschaft. Die Deutsche Schule 91, 38-51
TROST, Rainer (1994): »Unterstützte Beschäftigungsverhältnisse« für Menschen mit geistiger Behinderung. Gemeinsam leben 2, 104-110
TROST, Rainer (1997): Übergang von der Schule für Geistigbehinderte zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Impulse, H.5/6, 49-51
TROST, Rainer & SCHÜLLER, Simone (1992): Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine empirische Untersuchung zur Arbeit der Eingliederungshilfe in Donaueschingen und Pforzheim. Walldorf: Integra
WAGNER, Herbert (1993): Sonderschule - und danach? Über Probleme veränderter Arbeitsmärkte und Berufsperspektiven für Behinderte. In: Behindertenpädagogik 32, 263-276
WERKSTATT BREMEN (Hrsg.) (1999): NutzerInnen-Befragung der WfB 1999. Bremen: Unveröff. Skript
WETZEL, Gottfried & WETZEL, Petra (2001): Übergang von der Schule ins Berufsleben bei Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf - was können wir aus internationalen Erfahrungen lernen? Behinderte 24, H2. 2, 71-77 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh2-01-wetzel-uebergang.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
WEZEL, Kathleen (2001): Berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen und die Rolle der Berufsberatung. Halle (Saale): Unveröff. Examensarbeit
WIENERS, Thomas & DECKERS, Ludger (1997): Berufsorientierung in Köln: IGS Köln-Holweide. In: SCHULZE u.a., 94-120 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-integration.html) Stand: 24.04.2007, Link aktualisiert durch bidok
WOCKEN, Hans (1996): Sonderpädagogischer Förderbedarf als systemischer Begriff. Sonderpädagogik 26, 34-38
ZINK, Klaus J. & DIERY, Hartmuth (1996): Die Integration Schwerbehinderter in das Arbeitsleben. In: ZWIERLEIN, 480-491
ZWIERLEIN, Eduard (Hrsg.) (1996): Handbuch Integration und Ausgrenzung. Behinderte Mitmenschen in der Gesellschaft. Neuwied: Luchterhand
ZWIERLEIN, Eduard (1997): Leben ohne Arbeit - eine Alternative?! In: NIEHAUS & MONTADA, 18-27
11.1 Fragebogen TeilnehmerInnen (Variante Arbeitsassistenz)
11.2 Fragebogen TeilnehmerInnen (Variante Werkstatt für Behinderte)
11.3 Interviewleitfaden Intensivbefragung
11.4 Fragebogen ArbeitsassistentInnen
11.5 Fragebogen GruppenleiterInnen im Arbeitstraining der Werkstätten für Behinderte
Den Anhang können sie unter folgender Url herunterladen:
http://bidok.uibk.ac.at/download/boban-berufsvorbereitung.pdf
11.6 Interviewleitfaden Vorgesetzte in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes
1. Prozesse
-
Zustandekommen des Arbeitsverhältnisses
-
Vorstellbarkeit vor fünf Jahren
-
Beschreibung des Ablaufs
-
Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz
-
Anfängliche Schwierigkeiten
-
Eigene Erwartungen - an ArbeitnehmerIn, an Hamburger Arbeitsassistenz
-
Entscheidungsprozesse im Betrieb
-
Personalentscheidungen - in diesem Fall
-
Einbezug von KollegInnen in die Entscheidung
-
Vorbereitung der KollegInnen
-
Bedeutung der Behinderung des Arbeitnehmers dabei
2. Rolle der Hamburger Arbeitsassistenz
-
Form der Zusammenarbeit - mit Akquisition und mit ArbeitsassistentInnen
-
Zusammenarbeit der Hamburger Arbeitsassistenz mit Vorgesetztem und anderen KollegInnen
-
Kompetenz der Hamburger Arbeitsassistenz - Qualität
3. Finanzierung
-
Rolle dieses Aspektes
-
Bedeutung der Kostenzuschüsse
-
Entscheidung auch ohne Zuschüsse
-
›Rechnet sich‹ dieses Arbeitsverhältnis?
-
Bedeutung sozialpolitischer Rahmenbedingungen (Kündigungsschutz, Mehrurlaub etc.)
4. Gegenwärtige Situation
-
Tätigkeit der unterstützten Person im Betrieb
-
Kundenkontakt
-
Reaktionen von KundInnen
-
Einschätzung der Arbeitsleistung der unterstützten Person - in Prozenten
-
Innerbetriebliche Veränderungen (Rolle des Arbeitnehmers)
-
Veränderungen im Umgang der KollegInnen miteinander
-
Veränderungen bei Vorgesetzten - Verminderung oder Bestätigung von Bedenken
-
Probleme und Schwierigkeiten - Anteil der unterstützten Person, der Behinderung
5. Einschätzungen
-
Zitat des Wirtschaftsverbandssprechers (›Imageschädigung‹) und Werbeplakat mit Menschen mit Down-Syndrom
-
Reaktionen bei UnternehmerkollegInnen
-
Zufriedenheit zwischen 0 und 100 % ...
... mit der eigenen Entscheidung
... mit der Arbeit der unterstützten Person
... mit der Entwicklung der unterstützten Person
... mit der Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz insgesamt
... mit der Kooperation der AssistentInnen mit der unterstützten Person, KollegInnen, Chef
... mit der Kooperation der KollegInnen mit der unterstützten Person
... mit der finanziellen Unterstützung
... mit gesetzlichen Schutzbestimmungen (Kündigung, Urlaub etc.)
... mit Regelungen zur Ausgleichsabgabe
6. Resümee - Sätze vervollständigen
-
Anders laufen müsste beim nächsten Mal ...
-
Die wichtigste Leistung der Hamburger Arbeitsassistenz war für mich ...
-
Gewünscht hätte ich mir von der Hamburger Arbeitsassistenz ...
-
Belastend ist bei beruflicher Integration für mich und meinen Betrieb ...
-
Bereichernd ist bei beruflicher Integration für mich und meinen Betrieb ...
-
Wenn ich nochmal vor der Entscheidung stünde, würde ich ...
Werbungsbilder mit Menschen mit Behinderungen



11.7 Interviewleitfaden Reha-BeraterInnen im Arbeitsamt
1. Kooperationsstrukturen
Schule
-
Qualitative Beschreibung der Zusammenarbeit mit den Schulen
-
Unterschiede zwischen Integrationsschulen und Sonderchulformen
-
Unterschiede in den Vorstellungen der LehrerInnen (allgemeine / Sonderschulen) über berufliche Perspektiven ihrer SchülerInnen
-
Unterschiede bei den Berufswünschen
Hamburger Arbeitsassistenz
-
Unmittelbare Zusammenarbeit zwischen Reha-Beratung und der Hamburger Arbeitsassistenz
-
Vernetzung zwischen der Hamburger Arbeitsassistenz und Werkstätten für Behinderte
Betriebe
-
direkte Kontakte zu ArbeitgeberInnen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
-
Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
-
Anfragen von ArbeitgeberInnen für Menschen mit Behinderungen
2. Berufsberatung
-
Zuweisungskriterien für künftigen Weg (WfB/HAA/F2 des BBW/andere) - alle Wege bei jeder Beratung in der Diskussion?
-
Vorgehen bei Beratung des letzten Falles einer Zuweisung zur HAA und WfB
-
unterschiedliche Profile der Tätigkeitsbereiche in WfB/HAA: einerseits Handwerk, Verpackung/Montage, andererseits Dienstleistung, Gastronomie - Erklärung? Logik?
-
Veränderungen der Beratungssituation im Zusammenhang mit der Integrationsentwicklung
-
Umgang mit ›unrealistischen‹ Vorstellungen seitens behinderter Menschen und ihrer Angehörigen
-
Kontakte mit Ratsuchenden nach Beginn des Ambulanten Arbeitstrainings
3. Statements (strukturierte Fragen)
-
Wie schätzen Sie die Rolle der HAA innerhalb des Rehasystems ein? Wie erfolgreich schätzen Sie die Arbeit der HAA ein? Sehen Sie Veränderungsbedarf?
-
Wie hoch ist der Anteil an Vorinformationen über die HAA bei den Ratsuchenden?
-
Wie können Sie sich erklären, dass ein relativ hoher Prozentsatz von SchulabgängerInnen der Lernbehindertenschulen in den Werkstätten für Behinderte arbeitet?
-
Welche Motivationen vermuten Sie bei ArbeitgeberInnen, die einen Menschen mit Behinderung eingestellt haben?
-
Was bedeutet für Sie berufliche Integration?
-
Wie sind Sie zur Berufsberatung im Rehabereich gekommen?
4. Satzanfänge vervollständigen
-
Die Hamburger Arbeitsassistenz ist angemessen für Leute, die ...
-
Die Werkstatt für Behinderte ist da für Menschen, die ...
-
Unterstützte Beschäftigung bedeutet ...
-
Beruflich ›integrierbar‹ ist, wer ...
11.8 Interviewleitfaden BerufsschullehrerInnen
-
Zugangswege der BerufsschullehrerInnen (über Berufsschul- oder Sonderschulschiene)
-
Vorerfahrungen (im Vergleich mit der WfB)
-
Curriculum - Inhalte (instrumentelle Fähigkeiten, Wissenslücken, Schlüsselqualifikationen, Persönlichkeitsentwicklung - was sind Schwerpunkte?) - Funktion - Abschlüsse - Individualisierung angesichts der verschiedenen Arbeitsanforderungen
-
Ablauf eines Berufsschultages
-
Arbeitsbereiche
-
Kooperation mit AssistentInnen - Formen, Intensität, Berichte
-
Kooperation mit Betrieben
-
Vorinformationen für BerufsschullehrerInnen - Verzahnung mit integrativen Berufsschulprojekten
-
Bild der BerufsschullehrerInnen von ihren SchülerInnen
-
Prozesse und Effekte - wie kommen die SchülerInnen herein, wie gehen sie heraus?
-
Zufriedenheit mit der Arbeit, Höhepunkte und Tiefpunkte
-
Gründe für Abbrüche
-
Stimmigkeit mit dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings
-
Veränderungen gesellschaftlicher Einstellungen
Tabellen zu den Kapiteln 3 und 5
Den Anhang können sie unter folgender Url herunterladen:
http://bidok.uibk.ac.at/download/boban-berufsvorbereitung1.pdf
Quelle:
Ines Boban, Andreas Hinz: Integrative Berufsvorbereitung
erschienen in: Beltz GmbH, Julius, ISBN: 3-407-56162-8
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 24.04.2007
