Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt
Beiträge und Ergebnisse der Tagung INTEGRATION 2000 am 30./31. Mai 1996 in Hamburg, Für die BIDOK-Veröffentlichung im Internet wurden leichte Änderung vorgenommen z. B. Zwischenüberschriften eingefügt und Photographien nicht berücksichtigt. BIDOK empfiehlt das "handfeste" Exemplar zu kaufen, wer sich intensiver mit dem Gesamtwerk beschäftigen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Die Herausgeber
- Dank
- Die Herausgeber
- Vorwort
- Kapitel I: Konsens Integration - aber wie?
- Hier ist viel geschehen - mehr als anderswo!
- Gedanken aus arbeitsmarktpolitischer Sicht
- Neue Wege zur Integration geistig Behinderter
- "Geht das denn überhaupt?"
- Radikale Umsteuerung in der Zielsetzung
- Ehrliche Integration durch Differenzierung
- Arbeitgeberverbände als Katalysatoren in den Betrieben
- Betriebliche Integration
- Lücke zwischen Reden und betrieblichem Alltag
- Das Schulwesen nach dem Grundsatz der Integration gestalten
- Gemeinsam lernen und leben - für eine Schule, die sich verändert
-
Es ist normal, verschieden zu sein
- Vorbemerkung
- Erheblicher Nachholbedarf.
- Ernst, aber nicht perspektivlos
- Gewerkschaftliches Engagement hat Tradition
- Recht auf Arbeit für alle - Behinderte nicht isolieren
- Benachteiligungen bei der Berufsausbildung abbauen
- Arbeitgeberbarrieren überwinden
- Gesellschaftliches Bewußtsein schärfen
- Bündnis schaffen
- Ausblick: Licht am Ende des Tunnels
- Quellen
- Literaturangaben
- Kapitel II: Qualifikation in Schulen und Betrieben
- II A) Berufsorientierung in Gesamtschulen
- Berufsorientierung in Hamburg: Geschwister-Scholl-Gesamtschule
- Das Holzprojekt
-
Berufsorientierung in Köln: IGS Köln Holweide
- 1. Der Integrationsversuch in der Sek I der IGS Köln Holweide
- 2. Das Berufsorientierungskonzept an der IGS und seine Veränderungen im gemeinsamen Unterricht
- 3. Betriebsprojekte als ganzheitlicher lebens- und zukunftsorientierter Ansatz
- 4. Der Schulstraßen - Kiosk
- 5. Die Druckerei
- 6. Betriebsprojekte sind ein Schritt in die richtige Richtung
- Berufsorientierung in Frankfurt: Ernst-Reuter-Schule II
- Ziele des Schulversuchs
- Berufspraktika in der Gesamtschule
- II B) Berufsqualifikation in Berufsschulen
- Wege in die Arbeitswelt - Der Integrative Förderungslehrgang F1-i / BBE-i
- Interview: Praktikum Mövenpick
- Integration im F1-i - ein neuer Weg
- Praxisbericht: Erfahrungen einer Schülerin
- Integratives Berufsvorbereitungsjahr
-
Berufliche Qualifizierung für Menschen mit geistiger Behinderung an der W2
- Was kommt nach der Schule?
- Das Pilotprojekt: STADTHAUS-HOTEL - HAMBURG
- Berufsvorbereitung und Teilqualifikation
- Eine neue Schulform konkretisiert sich
- Perspektive: Arbeitsplatz
- Die SchülerInnen
- Die LehrerInnen
- Ziele der Berufsvorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahme
- Festlegung der Unterrichtsinhalte und Fächer
- Unterricht
- Lernen in der Ernstsituation des Kiosk-Projekts
- Der Projekttag
- Integration
- Kapitel III: Integration in den Betrieben
-
Arbeiten außerhalb der Werkstatt
Die Hamburger Arbeitsassistenz - ein Fachdienst zur beruflichen Integration für Menschen mit geistiger Behinderung
- Grundgedanken und Arbeitsweise der Hamburger Arbeitsassistenz
- "Ich suche Arbeit, ich brauche Eure Unterstützung!" - die Erstellung des Fähigkeitsprofils
- Arbeitsplatzakquisition - die Achillesferse beruflicher Integration
- Qualifizierung am Arbeitsplatz
- Verlauf und Dauer der Qualifikation
- Nachsorge und langfristige Betreuung
- Der Übergang von der Schule in den Beruf - das Ambulante Arbeitstraining
- Finanzierungsstrukturen der Hamburger Arbeitsassistenz
- Individuelle Arbeitsbegleitung des Rauhen Hauses
- Das Stadthaus-Hotel Hamburg - ein Integrationsbetrieb
-
Unterstützte Beschäftigung -
Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich
- Einleitung
-
Der Kampf für Integration und gegen Aussonderung als Wurzel der Unterstützten Beschäftigung
- Unterstützte Beschäftigung als Teil der Bewegung für gleichberechtigte Teilhabe und Integration von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen
- Der sich abzeichnende Paradigmawechsel in der Behindertenpolitik von wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge zu bürgerrechtlichem Schutz vor Diskriminierung
- Das amerikanische Antidiskriminierungsgesetz
- Entwicklungen auf europäischer Ebene
- Das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz
- People First - Eintreten für eigene Rechte und Selbstbestimmung
- Unterstützte Beschäftigung als neue Perspektive
- Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung
- Die internationale Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung
- Unterschiede zwischen Unterstützter Beschäftigung in den USA und Deutschland
- Ergebnisse von Unterstützter Beschäftigung
- FAZIT: Unterstützte Beschäftigung erschließt neue Perspektiven der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen
- Literatur
- Integration auf dem Weg ins Jahr 2000
Hartmut Schulze, Dipl. Handelslehrer, Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt für Auszubildende des Berufsbildungswerkes Hamburg (G 12)
Hartmut Sturm, Sonderpädagoge in einer Integrationsklasse der Gesamtschule Geschwister Scholl und im integrativen Förderungslehrgang (F1-i) der G 12
Uta Glüsing, Lehrerin in einer Integrationsklasse an der Geschwister Scholl Gesamtschule in Hamburg
Frank Rogal, Sonderpädagoge in einer Integrationsklasse der Gesamtschule Geschwister Scholl und in der Arbeit mit behinderten Menschen im ambulanten Arbeitstraining an der G 12
Monika Schlorf, Sozialpädagogin in einer Integrationsklasse an der Gesamtschule Hamburg-Bergedorf
ISBN 3-00-002804-8
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge liegt bei den Autoren.
Vertrieb des Buches über:
GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15,
20148 Hamburg
Umschlaggestaltung: Andreas Mohrmann
Druck: Druckerei-Kollektiv Zollenspieker, 21037 Hamburg
© Die Herausgeber, Hamburg 1997
Dieser Reader wurde durch die Beiträge auf der am 30./31. Mai 1996 durchgeführten Tagung "Integration 2000" ermög-licht. Auf dieser Tagung kamen im Curio-Haus in Hamburg 63 Referenten und 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammen und diskutierten zwei Tage lang über Erfahrungen und Perspektiven der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Arbeitswelt. Auf den Podien fanden erste Diskussionen und Begegnungen mit Vertretern der Wirtschaft und der Betriebe statt.
Dieser Reader ist keine Dokumentation im herkömmlichen Sinne, sondern er faßt diejenigen Beiträge und Ergebnisse der Tagung zusammen, die dazu beitrugen, eine Antwort auf die Frage nach den Formen und Möglichkeiten der betrieblichen Integration zu geben. Unter dieser Fragestellung konnten somit viele interessante, wichtige Beiträge und Diskussionen in angrenzenden Themenstellungen leider nicht aufgenommen werden. An dieser Stelle sei deshalb allen Referenten der Diskussionsveranstaltungen und der Foren herzlich gedankt. Ebenso danken wir den engagierten TeilnehmerInnen, die uns für diesen Reader durch ihre Diskussionsbeiträge viele wichtige Impulse gegeben haben.
Neben der Dokumentation von ausgewählten Tagungsbeiträgen wird im Reader dargestellt, wie in Hamburg infolge der Tagung wesentliche Hemmnisse für die Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung in den Arbeitsmarkt abgebaut wurden. Dies gelang in erster Linie durch die auf der Veranstaltung eingeleitete Kooperation von Arbeitsamt, Amt für Arbeit und Sozialordnung und Betrieben. Allen, die daran mitgewirkt haben, gilt unserer Dank. Die Herausgeber möchten an dieser Stelle auch denjenigen Personen und Institutionen danken, die für die Tagung verantwortlich zeichneten und durch deren Unterstützung dieser Reader ermöglicht wurde:
-
Teilnehmer des Kurses "Berufliche Integration" am Beratungszentrum Integration (BZI)
-
Beratungszentrum Integration (BZI) des Instituts für Lehrerfortbildung in Hamburg
-
Geschäftsstelle der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hamburg
-
Abteilung Schulgestaltung der Behörde für Schule, Jugend und Berufsausbildung (BSJB Hamburg
-
Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e.V.
Ingrid Körner, Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e. V.
Peter Pape, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, Hamburg
Hartmut Schulze, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Hamburg
Seit nunmehr 14 Jahren bestehen in Hamburg Integrationsklassen, in denen nichtbehinderte und behinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam lernen. Für den Grundschulbereich haben Integrationsklassen durch das 1997 in Kraft getretene neue Hamburger Schulgesetz nunmehr den Status eines Regelangebotes erhalten. Mit dem "Durchwachsen" dieser Integrationsklassen entstanden bis zum Jahr 1997 in Hamburg an 40 Schulen 187 Integrationsklassen - davon werden 99 Klassen an 19 Schulen der Sekundarstufe I geführt.
So ergab sich nach 10 Jahren für die Berufsschulen, die Träger der beruflichen Bildung und die Betriebe die Aufgabe, die Bemühungen um die gesellschaftliche Integration von Menschen - insbesondere mit geistiger Behinderung - fortzuführen und letztlich mit einer dauerhaften Eingliederung in das Arbeitsleben abzuschließen.
In Hamburg entstanden daraufhin für Menschen mit geistiger Behinderung vier verschiedene integrative Wege in das Arbeitsleben:
-
Integrative Berufsvorbereitungsklassen (BVK-i/BVJ-i) als zweijährige berufsschulische Vollzeitmaßnahme
-
Berufsvorbereitungsklassen teilqualifizierend (BV-TQ) als zweijährige berufsschulische Vollzeitmaßnahme für behinderte Jugendliche mit einem anschließenden Jahr Teilzeitunterricht in Kooperation mit einem betrieblichen Projekt
-
Das zweijährige ambulante Arbeitstraining der Hamburger Arbeitsassistenz in Betrieben und in Kooperation mit Berufsschulen
-
Die zweijährigen integrativen Förderungslehrgänge (Fl-i/BBE-i) als Arbeitsamtmaßnahme eines Trägers in Kooperation mit einer Berufsschule und anschließendem begleiteten Praktikumsjahr in Betrieben.
Die konzeptionelle Weiterentwicklung des integrativen Bildungsangebotes für Abgänger mit geistiger Behinderung aus Integrationsklassen der Sekundarstufe I, d. h. ihrer beruflichen Vorbereitung und Qualifizierung, wurde in Hamburg 1992 durch eine Arbeitsgruppe eingeleitet. Daran wirkten u. a. Vertreter der Handwerks- und Handelskammer, der Arbeitsverwaltung, der Ämter für Schule, Jugend und Berufsbildung sowie Vereine und Gewerkschaften mit. Von der Arbeit dieser Gruppe gingen wichtige Impulse für die in diesem Reader dargestellten Hamburger Konzepte aus. Die Arbeitsgruppe formulierte wesentliche Rahmenbedingungen und pädagogisch strukturelleAnforderungen an die berufliche Integration, so daß Maßnahmen der Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und Eingliederung verwirklicht werden konnten, die auf die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung zugeschnitten sind.
Ausgehend von den positiven Erfahrungen, die in diesen Maß-nahmen gemacht wurden, veranstalteten die GEW, die Schulbehörde Hamburg und der Verein Eltern für Integration die Tagung
"INTEGRATION 2000 - Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in Ausbildung und Beruf".
Hamburg eignete sich als Tagungsort deshalb, weil hier die Integration bundesweit am konsequentesten entwickelt wurde und heute für geistig behinderte Menschen integrative Bildungsgänge bis hin zur begleiteten beruflichen Eingliederung entstanden sind. Dieses konnte nur gelingen, weil Eltern, Politik, Schulen, Träger und die Arbeitsverwaltung in einem kontinuierlichen Diskussionsprozeß stehen und gemeinsam Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die letztlich zu ersten Beispielen gelungener Integration in das Arbeitsleben führten.
In 6 Hauptveranstaltungen und 24 Foren mit 63 Moderatoren und Referenten diskutierten 350 Teilnehmer mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Schulen und Gewerkschaften über die unterschiedlichen Konzepte, Erfahrungen und offenen Fragen - insbesondere auch über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für betriebliche Integration. Neben Hamburger Projekten wurden Erfahrungen aus der Gesamtschularbeit in Köln und Frankfurt präsentiert sowie über Modellversuche unterstützter Beschäftigung in den USA berichtet.
Die in diesem Reader dokumentierten Beiträge der Tagungsteilnehmer machen einerseits den Konsens in der Frage der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in das Arbeitsleben deutlich und zeigen andererseits:
-
Behinderte Menschen stellen spezielle Anforderungen an betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze,
-
Betriebe stellen spezielle Anforderungen an die Integration,
-
Spielräume für die Finanzierung von Leistungen für behinderte Menschen werden enger.
Dies paßt auf den ersten Blick nicht zusammen - und dennoch gibt es Beispiele dafür, daß bei konstruktiver Herangehensweise aller Beteiligten Wege gefunden werden können, um das einvernehmlich formulierte gesellschaftliche Ziel der Integration zu verwirklichen. Solche Erfahrung macht Mut, und wir hoffen, daß dieser Reader einen Beitrag dazu leistet, auch in komplizierten Zeiten die große Aufgabe der Integration weiter voranzubringen.
Die Dokumentation wichtiger Beiträge der Tagung und die Darstellung der Entwicklung nach der Tagung in Hamburg - bis August 1997 - soll nunmehr dazu beitragen,
-
erfolgreiche Hamburger Integrationsmaßnahmen zu dokumentieren und die Rahmenbedingungen zu institutionalisieren,
-
Erfahrungen landesweit zu publizieren, um Initiativen und Institutionen Anregungen und Unterstützung zu bieten,
-
Informationsmaterialien und Diskussionsanstöße zusammenzustellen, um den Dialog und die Zusammenarbeit mit Betrieben zu vertiefen.
Gert Hinnerk Behlmer, Staatsrat in der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg
Die Veranstalter haben mir in der Einladung die Rolle des Vertreters von Politik und Gesellschaft zugedacht, der Erfahrungen und Perspektiven zum Thema "Integration 2000" in dieser Eröffnungsrunde einbringen soll.
Meine ganz persönlichen Erfahrungen und mein Bezug zum Thema liegen 18 Jahre zurück. Ich habe damals im Versorgungsamt Hamburg gearbeitet und den schweren Weg miterlebt, den die sogenannten "zivilen Behinderten" zurückgelegt haben, bis sie die Anerkennung erreicht hatten, die für die sogenannten "Kriegsbeschädigten" galt.
Auf dem Weg hierher im Schnellbus habe ich gesehen, wie sich der Bus an der Straßenkante neigte, und ein Rollstuhlfahrer wie selbstverständlich, ohne jede Hilfe in diesen Bus hineinfahren und hier herkommen konnte. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen, als Menschen mit Behinderungen auch im Verkehr eben nicht integriert, sondern wie in vielen anderen Lebensbereichen durch Extratransporte ausgegrenzt wurden. Insofern kann ich mit einem gewissen Selbstbewußtsein für die Stadt sagen: Hier ist viel geschehen, mehr als anderswo.
Ganz aktuell kann ich in die Tagung eine gute und eine für Sie eher problematische Nachricht aus dem Rathaus einbringen. Die gute Nachricht werden Sie wohl schon in den Zeitungen gelesen haben. Der Senat hat vorgestern einen Entwurf eines Schulgesetzes beraten und beschlossen und der Bürgerschaft zugeleitet, in dem die Integration in der Schule ausdrücklich als Ziel festgeschrieben worden ist. Natürlich ist das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen, die Bürgerschaft hat zu entscheiden. Die Zeitungen haben auch berichtet, daß es dabei Stimmen gegeben hat, die den Leistungsgedanken im Schulgesetz stärker betonen wollen. Dies ist aber nicht als Gegensatz zur völlig unstrittigen Zielsetzung der Integration von behinderten Menschen diskutiert worden.
In derselben Senatssitzung hat der Finanzsenator vorgetragen, daß nach der neuesten Steuerschätzung im Mai dieses Jahres in Hamburg 350 Millionen DM Einnahmen fehlen und im nächsten Jahr voraussichtlich über 800 Millionen DM weniger eingenommen werden als geplant. Ich will diese schlechte Nachricht nicht ungebührlich dramatisieren, aber die Dimension dieser Korrektur gegenüber den Zahlen, die wir noch im Oktober oder Mai letzten Jahres erwartet haben, ist bedrohlich. Und darin liegt ein Kern unseres Problems:
Sehr hohen Erwartungen können sehr tiefe Enttäuschungen folgen, selbst dann, wenn objektiv die Lage durchaus noch besser wird. Im Klartext heißt das, daß trotz dieser Korrekturen auch in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich mehr Geld ausgegeben wird in Hamburg für alle Politikbereiche, mit Sicherheit auch für den Bereich der Behindertenpolitik. Aber es wird voraussichtlich weniger sein, als wir noch vor einem halben Jahr gehofft haben, ausgeben zu können. Damit müssen wir und Sie politisch bei unseren Planungen umgehen lernen, denn in den nächsten Jahren wird die Situation nicht nur in Hamburg, sondern auch im Bund, in anderen Ländern und Gemeinden von zwei Themen bestimmt sein: der Krise des Beschäftigungssystems und der Sorge um die Zukunft der Arbeit, und - damit in Ursache und Wirkung vielfältig verbunden - die Notwendigkeit zur Konsolidierung der Staatsfinanzen, verbunden mit massiven Spareingriffen in vielen Politikbereichen.
Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt kann ich mich auf wenige Worte beschränken, ich nehme an, daß Herr Koglin dazu noch nähere Ausführungen machen wird. Sie alle wissen, daß wesentlich mehr Arbeitsplätze fehlen, als die registrierte Arbeitslosigkeit ausweist. Pessimistische Schätzungen besagen, daß eher 7 - 8 als 4 -5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland fehlen. Eine wirkliche Verbesserung der Situation ist derzeit nicht zu erkennen. Mit der Verschärfung des Wettbewerbs weltweit wächst der Konkurrenzdruck, der alle Bereiche von Industrie über Dienstleistungen und auch das Handwerk erfaßt und die Betriebe ständig zu Rationalisierungen zwingt. Dabei wird auf allen Ebenen rationalisiert, schwerpunktmäßig aber genau dort, wo es in Zusammenhang mit dem heutigen Thema besonders wehtut, mit dem Abbau von Stellen für einfachere Beschäftigung und nicht so hohen Qualifikations-Anforderungen. Während 1980 noch etwa jeder vierte Beschäftigte als An- oder Ungelernter tätig war, wird es nach plausiblen Schätzungen im Jahre 2000 nur noch jeder zehnte sein. Diese Entwicklung wird, für sich genommen, die Integration von Menschen mit Behinderungen mit Sicherheit nicht erleichtern, sondern eher schwerer machen. Wir müssen diesem Problem aber ins Auge sehen und Wege finden, um das gemeinsame Ziel dennoch zu erreichen.
Auch die Dimension und Härte des zweiten Problemkomplexes, der Krise der öffentlichen Finanzen, wird diese Aufgabe nicht erleichtern. Der wohlfeile Rat, durch Umschichtung und Setzen der richtigen Prioritäten in den öffentlichen Haushalten müßten die Mittel eben freigeschaufelt werden, zieht nicht mehr. Ich will das nicht vertiefen, ich bitte Sie aber zu bedenken, was für Aufgaben von der sozialen Sicherung über die innere Sicherheit bis zum Anspruch der Menschen auf Wohnung, gesunde Umwelt und Arbeitsplatz mit den begrenzten öffentlichen Finanzen zu bewältigen sind. Die Haushaltslücke wird nach der neuen Schätzung nicht eine 3/4 sondern eher 1,5 Milliarden im nächsten Jahr sein. Dabei haben wir uns daran gewöhnt, daß wir alle Zukunftsinvestitionen schon lange nicht mehr aus unseren laufenden Einnahmen finanzieren können, sondern voll durch Kredite - auf Pump. Das führt dazu - lassen Sie mich Ihnen dies als Zahl noch zumuten - daß in Hamburg inzwischen 16 % der laufenden Einnahmen für Zinszahlungen ausgegeben werden müssen. Da ist es auch kein Trost, daß diese sogenannte Zinssteuerquote beim Bund inzwischen sogar schon 25 % beträgt. Verschärft werden unsere Probleme schließlich dadurch, daß die Krise des Beschäftigungssystems auch die entscheidende Ursache nicht nur für fehlende Einnahmen im Staatshaushalt, sondern auch für die Krise der sozialen Sicherungssysteme ist.
Mit diesen Bemerkungen möchte ich Sie zu Beginn dieser Tagung auf keinen Fall mutlos machen und den Eindruck erwecken, daß unsere Aufgaben unlösbar wären. Ich meine aber, daß wir uns alle klar machen müssen, daß nur unter diesen geschilderten Rahmenbedingungen Erfolge wirklich erreichbar sein werden. Hinsichtlich der Integration von Menschen mit Behinderungen in die Betriebe wird das nur gelingen, wenn für diese Betriebe verläßliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Behinderten, gerade auch geistig behinderten Menschen, geschaffen werden. Die dürfen weder zu kompliziert sein, so daß sie keiner versteht und sich der einfache Handwerker nicht auf sie einlassen wird, noch dürfen es unrealistische Patentrezepte sein. Unternehmen sind Wirtschaftseinheiten, bei denen nicht auf Dauer damit gerechnet werden kann, daß Wohltaten verteilt werden. Motivation für das Unternehmen muß ein betriebswirtschaftlicher Nutzen sein. Dieser Nutzen braucht nicht in Mark und Pfennig aus der Beschäftigung des einzelnen Behinderten zu erfolgen. Wenn durch das Zusammenarbeiten mit behinderten Mitarbeitern das Betriebsklima und letztlich auch die Arbeitsproduktivität aller Beschäftigten positiv beeinflußt wird, dann wird sich Integration rechnen. Unternehmenskultur wird immer mehr Teil der Unternehmensführung, bei der das Miteinander der Belegschaft wichtig ist und nicht Ellenbogen- und Konkurrenzmentalität im Betrieb als das allein selig machende Verhalten dominieren.
Wir werden in Zukunft die vorhandenen Ressourcen noch effektiver nutzen müssen. Das gilt auch für die finanziellen Ressourcen, und der Ruf nach mehr Geld wird nicht gehört werden können. Beispiele aber, die Sie auf diesem Kongreß behandeln, zeigen, wie durch Innovation in den Institutionen und durch Veränderung der Instrumente vorhandene Mittel noch besser zur Erreichung ihrer Ziele genutzt werden können. Ich weiß, daß dies im Einzelfall meist sehr schwierig ist. Ich glaube aber, daß die enorme Schubkraft, die die Pioniere der Integration in der Schule in den letzten Jahren entwickelt haben, auch bei der Integration von behinderten Menschen in der Wirtschaft helfen wird, Lösungen zu finden, die trotz der Beschäftigungs- und Finanzprobleme der nächsten Jahre Erfolg bringen. Daß sich dabei dann auch die vorhandene Landschaft der Behinderteneinrichtungen verändern wird und muß, ist für mich ein Beispiel für konstruktive Unruhe und wünschenswerte Erneuerung.
Dr. Olaf Koglin, Direktor des Arbeitsamtes Hamburg
Die Frage, wie man behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren könne und solle, galt lange Zeit als beantwortet. Betriebe wurden zur Beschäftigung von Schwerbehinderten verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe wurde eingeführt. Die Rehabilitation Behinderter wurde geregelt, speziell auf die Bedürfnisse Behinderter zugeschnittene Bildungsstätten eingerichtet. In Zeiten hoher Arbeitskräftenachfrage wurden damit auch die meisten Behinderten integriert. Für die, die dennoch nicht in der Lage waren, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, entstanden die Werkstätten für Behinderte. Aber auch diese wurden mit der Erwartung verbunden, daß durch Trainingsmaßnahmen in den Werkstätten arbeitende Behinderte befähigt werden könnten, wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Damit stand - aus damaliger Sicht und zu den Arbeitsmarktbedingungen der sechziger und siebziger Jahre - ein geschlossenes Integrationssystem zur Verfügung.
Die Realität war auch damals schon eine andere. Der Gruppe der psychisch Behinderten konnte nur sehr begrenzt Rechnung getragen werden, Übergänge aus der Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt waren selten und Abgrenzungsprobleme (z. B. was ist eine wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung?) begleiteten die Entwicklung.
Diese Systeme, auf deren Schaffung wir als Gesellschaft sehr stolz waren, geraten heute zunehmend in die Kritik. Dafür sind aus meiner Sicht in erster Linie drei Faktoren ursächlich:
Der Arbeitsmarkt ist seit Jahren nicht mehr durch Vollbeschäftigung, sondern durch hohe Arbeitslosigkeit geprägt. In der Vermittlung beeinträchtigt sind nicht nur Behinderte, sondern auch Nichtbehinderte. Nicht behinderungsbedingte, vermittlungshemmende Merkmale haben zum Teil mehr Gewicht als Behinderungen. Unterschiedliche Lösungsansätze für Behinderte und Nichtbehinderte werden nicht selten als ungerecht empfunden.
Die Aufnahme in eine Werkstatt für Behinderte verliert an Akzeptanz bei den Betroffenen. Die kleinen Übergangsraten aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt lassen diese nicht mehr als Durchgangsstation, sondern eher als Endstation erscheinen.
Die schwierige Finanzsituation der Kostenträger läßt alle Beteiligten nach neuen Wegen suchen. Will man geringeren Finanzmitteln nicht schlicht durch Kapazitätsabbau begegnen, müssen neue Wege in der Integration gesucht werden.
Bei allen Integrationsüberlegungen in der Vergangenheit war ein Grundsatz beherrschend: Der Behinderte sollte in die Lage versetzt werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Bezuschussung des Lohnes kam nur vorübergehend in Betracht, um Probleme der Einarbeitung oder des Arbeitstrainings auf dem Arbeitsplatz auszugleichen. Die Möglichkeit, einen behinderungsbedingten Nachteil im Wettbewerb um einen Arbeitsplatz dauerhaft - notfalls ein Arbeitsleben lang - durch Lohnsubvention auszugleichen, wurde nicht eingeräumt. Durch die Konstruktion von Förderketten in Einzelfällen konnten zwar Grenzfälle über einen längeren Zeitraum im allgemeinen Arbeitsmarkt gehalten werden, ohne eine wettbewerbsfähige Arbeitsleistung zu erbringen, nach dem Auslaufen der Förderketten stand dann aber erneut Arbeitslosigkeit oder die Rückkehr in eine Werkstatt für Behinderte.
Diese Fälle haben gezeigt, daß geistig behinderte Menschen in wettbewerbsorientierte Betriebe integriert werden können, wenn die Notwendigkeit zur Erwirtschaftung des Lohnes nicht oder zumindest nicht in vollem Umfang gegeben ist. Verzichtet man beim Integrationsbegriff auf die eigene Erwirtschaftung des Lohnes, eröffnen sich damit völlig neue Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben. Ohne die Beachtung notwendiger betrieblicher Rentabilitätsüberlegungen sind neue Formen der Arbeitsteilung denkbar, können einfache Tätigkeiten isoliert angeboten werden, die auch von schwerer behinderten Menschen verrichtet werden könnten.
Die Zahl der Versuche, schwerer behinderte Menschen in wirtschaftlich arbeitende Betriebe zu integrieren hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Neben den Eingangs- und Trainingsbereich der Werkstätten für Behinderte sind Förderungslehrgänge mit integrativem Charakter getreten, Integrationsklassen haben Vorarbeit geleistet. Der Wunsch der Behinderten und ihrer Angehörigen nach Fortsetzung dieser Integration im allgemeinen Arbeitsmarkt wird zunehmend stärker. Integration in diesen Maßnahmen bedeutete aber nicht Leistungsgleichheit mit den Nichtbehinderten, sondern eine sich menschlich befruchtende Leistungsungleichheit.
Die vorübergehende Integration auch schwer behinderter Menschen in Betriebe hat bewiesen, daß Betriebe in der Lage sind, Arbeitsplätze und Arbeitsinhalte zur Verfügung zu stellen, die der Leistungsfähigkeit der Behinderten Rechnung tragen. Diese Betriebe konnten auch schwerer behinderte Menschen betreuen, wenn sich die übrigen Mitarbeiter des Betriebes mit dem Problem auseinandersetzten, zur Betreuung bereit waren und Beratung durch erfahrene Kräfte in der ersten Zeit bekamen. Gleicht dann die vom Behinderten erbrachte Arbeitsleistung die Betreuungsleistung aus, bedarf es einer Erstattung der Betreuungsleistung durch die öffentliche Hand nicht. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts durch eine angemessene Entlohnung bedeutet dann gleichzeitig eine deutliche Kostenersparnis durch die fehlende Notwendigkeit zur Finanzierung der Infrastruktur eines Arbeitsplatzes.
Auf Vergütung der Betreuungsleistung sollte auch solange verzichtet werden, bis nicht eine grundsätzliche Entscheidung zur Privatisierung dieser Dienstleistung getroffen worden ist. Die Stellung dieser Frage bedeutet an sich schon das Zulassen neuer Denkstrukturen bei der beruflichen Integration von Behinderten.
Es bleibt dann die Frage im Raum, wovon der Behinderte seinen Lebensunterhalt bestreitet. Diese Frage stellt sich aber nicht neu. Auch wenn der Behinderte in einer Werkstatt für Behinderte arbeitet, kann er von dem dort erzielten Lohn nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten. Sofern er nicht mehr von seinen Familienangehörigen unterhalten wird, müssen die Kosten vom Sozialhilfeträger erbracht werden. Dessen Leistungen wiederum sind gegenüber eigenem Arbeitseinkommen subsidiär. Könnte ein System geschaffen werden, bei dem der Behinderte einen "Lohn" für seine Arbeit im Betrieb bekäme, würde dieser den Sozialhilfeaufwand mindern. Gleichzeitig würde dies aber auch die Integration in die Sozialversicherungssysteme sichern wie dies mittelbar heute auch in den Werkstätten geschieht. Die Mehrbelastung der öffentlichen Hand durch das Lohnprinzip dürfte sich in Grenzen halten. Dies gilt insbesondere, wenn man die Kosten der Werkstatt für Behinderte mitberücksichtigt. Der vom Betrieb übernommene Betreuungsaufwand wird durch die Arbeitsleistung des Behinderten selbst verdient
Werkstätten für Behinderte werden damit nicht überflüssig. Die in ihnen arbeitenden Behinderten werden allerdings nicht mehr das bisherige Leistungsbild besitzen, die Leistungsträger werden die Werkstatt verlassen. Sollte eine Integration in großer Zahl in die Betriebe durch Veränderung der Rahmenbedingungen für die Zahlung des Lebensunterhaltes möglich sein, muß der Leistungsbereich der Werkstatt für Behinderte neu beschrieben werden. Sie sind aber als Grundversorgung unverzichtbar.
Die in diesem Zusammenhang immer wieder gehörten Bedenken - subventionierte Arbeit könne den Wettbewerb verzerren - müssen meiner Ansicht nach zurücktreten. Nennenswerte wirtschaftliche Vorteile sind für einen Betrieb nicht erzielbar, wenn die Übernahme der Lohnkosten an die Aufnahmekriterien für eine Werkstatt für Behinderte gekoppelt ist. Auch ist vorstellbar, daß die Übernahme der Lohnkosten nur teilweise erfolgt, wenn nach einer angemessenen Trainingszeit die Leistungsfähigkeit und damit der wirtschaftliche Vorteil der Arbeit für den Betrieb beschrieben werden kann. Ich würde aber dringend davor warnen, zu früh zu viel Gegenleistung seitens des Betriebes zu erwarten. Dies würde den Behinderten erneut in eine Wettbewerbssituation mit Nichtbehinderten bringen und die Sache für den Betrieb unkalkulierbar machen. Bei wirtschaftlichen Veränderungen steht der behinderte Mitarbeiter sofort zur Disposition oder gerät in einen Leistungsdruck, dem er nicht gewachsen ist. Wer in dem möglichen wirtschaftlichen Vorteil für den Betrieb ein Problem sieht, mag gegenrechnen, wieviel mehr es kostet, ohne die Mitwirkung des Betriebes die Infrastruktur eines weiteren Platzes in einer Werkstatt für Behinderte vorzuenthalten.
Will man diesen Weg gehen, bleiben noch Fragen offen. In welchem Umfang gilt das Arbeitsrecht für diese Mitarbeiter? Sollte man über Formen der Arbeitnehmerüberlassung nachdenken, auch um bei Problemen in einem Betrieb die Arbeitslosigkeit des Behinderten zu vermeiden? Der Wechsel von einem Betrieb zu einem anderen könnte dadurch erleichtert werden. Ist eine Zusammenarbeit mit den Werkstätten für Behinderte denkbar, so daß in Zeiten, in denen eine Mitarbeit in einem Betrieb nicht möglich ist, der Behinderte in der Werkstatt mitarbeiten kann? Kann die öffentliche Verwaltung beteiligt werden? Planstellen werden dort mit immer engeren Haushalten auch immer größerem Produktivitätsdruck ausgesetzt. Fragen, deren konkrete Beantwortung ich erst erwarte, wenn vorher die integrationspolitische Entscheidung getroffen worden ist. Die Lösung der Detailprobleme könnte sich für die Akteure als so schwierig darstellen, daß man die grundsätzliche Entscheidung erst gar nicht sucht.
Würde man einen solchen Weg gehen, könnten mehr Behinderte in das Erwerbsleben integriert werden als heute, und das bei konstanten, wahrscheinlich eher in Zukunft weiter sinkenden Ausgaben für diesen Bereich. Gleichzeitig würden Erfahrungen gesammelt mit langfristig subventionierter Arbeit. Erfahrungen, die direkt die Frage aufwerfen, ob für leistungsgeminderte Nichtbehinderte nicht ähnliche Wege beschritten werden können. Die Integrationspolitik für Behinderte hätte dann Signalfunktion für die Arbeitsmarktpolitik generell.
Uwe Riez, Leiter des Amtes für Sozialordnung in der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales
In Hamburg sind viele Integrationsansätze im Bildungsbereich geschaffen worden; Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Das verbessert die Teilhabe der Behinderten an allgemeiner und beruflicher Bildung, ohne die Belange Nichtbehinderter zu beeinträchtigen. Wenn wir diese verbesserten Bildungsmöglichkeiten nicht nur theoretisch, sondern real in größere Chancen für die berufliche Eingliederung umsetzen wollen, dann müssen konsequent auch hier die Instrumente integrativ gestaltet bzw. fortentwickelt werden. Grundsätzlich heißt das: Weg von Sondereinrichtungen - rein in das normale Arbeitsleben.
Mit den einschlägigen Erfahrungen, die wir im Rahmen der Werkstätten für Behinderte schon länger und mit der Hamburger Arbeitsassistenz in den letzten Jahren gewonnen haben, verfügen wir über eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Das sollte uns ermutigen, diesen Beschäftigungsbereich auszubauen. Unser Mut als Behörde reicht jedenfalls so weit, daß wir bei uns hausinterne Konsequenzen gezogen haben: Wir haben uns entschlossen, innerhalb unserer Behörde alle Kompetenzen für den Bereich Beschäftigungsförderung organisatorisch zusammenzufassen und verfolgen damit das Ziel, aus der Eindimensionalität der Förderinstrumente herauszukommen.
Wir sehen, daß wir in vielen Bereichen gute Instrumente haben, die aber eindimensional organisiert sind und oft einen Eingang, aber keinen Ausgang haben. Hier wollen wir für mehr Bewegung sorgen, indem wir die grundsätzlich vorhandenen Übergangswege in den allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern. Das bedeutet, daß der gesamte Instrumentenkasten, den wir zur Beschäftigungsförderung haben, flexibilisiert wird. Die einzelnen Instrumente wollen wir miteinander verbinden und effizienter gestalten, damit sie quasi multifunktional nutzbar sind. Die allgemeinen Integrationsinstrumente sollen umfassend geöffnet werden, also auch dort, wo geistig Behinderte wegen der Eindimensionalität von Behördenorganisation und von Einrichtungen per se erstmal gar keinen Zugang hatten.
Dabei wird möglicherweise zunächst einmal an den zweiten Arbeitsmarkt gedacht, weil gegenwärtig die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik überwiegend hier angesiedelt sind. Dieser Bereich soll durchaus mit ins Auge gefaßt werden. Der Schlüssel für dauerhafte Beschäftigungschancen liegt jedoch nach wie vor im ersten Arbeitsmarkt, und hier müssen wir prüfen, wie weit wir in der Lage sind, im Rahmen unserer Ressourcen Wege zu eröffnen, die Beschäftigung - und zwar möglichst dauerhafte Beschäftigung - im ersten Arbeitsmarkt ermöglichen.
Wenn man das will, braucht man nicht nur die Bereitschaft von Betrieben des ersten Arbeitsmarktes für eine unterstützte Beschäftigung von Behinderten; die ist - wenngleich vereinzelt - durchaus vorhanden. Man muß den Betrieben auch das Know-how erschließen, ohne das solche Beschäftigungsverhältnisse zum Scheitern verurteilt sind. Da sind wir mit der Arbeitsassistenz, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg. Allerdings darf man nicht verkennen: Insgesamt ist die Arbeitsmarktlage für ein solches Unterfangen außerordentlich ungünstig. Selbst wenn die Arbeitsassistenz in unbegrenztem Umfang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte, bekäme man es nicht hin, daß ein Betrieb über einen geistig Behinderten sagen wird: "Von dem habe ich genauso viel wie von jemandem, der nicht behindert ist". Das Problem und die dahinter steckende Erwartungshaltung werden wir lösen müssen.
Wir beabsichtigen, eine Expertenkommission für das gesamte Feld der Lohnkostenförderung einzusetzen, die auch den Bereich der Behindertenbeschäftigung diskutieren wird. Wir wollen prüfen, welche Form von Förderung wir auch aus städtischen Mitteln leisten können, um zu dauerhafter Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen. Ich will nun die Erwartungshaltung nicht gleich in ungeahnte Höhen wachsen lassen. Das muß sich in den Rahmen unserer finanziellen Handlungsmöglichkeiten fügen. Aber da sind meines Erachtens durchaus mobilisierbare Ressourcen vorhanden, die wir zielgerichteter und effektiver einsetzen können, so daß ich eigentlich doch recht optimistisch bin, daß wir Schritt für Schritt die Beschäftigungsmöglichkeiten verbreitern können. Ich denke, wir brauchen viele Beispiele. Wenn wir ein überzeugendes Beispiel gelungener Beschäftigung haben im Betrieb A, dann können wir am Ende auch den Betrieb B und Betrieb C dazu bringen, sich damit anzufreunden, d. h. wir müssen versuchen, das Netz solcher Beispiele langsam, aber kontinuierlich dichter zu knüpfen. Genau diesen Weg wollen wir jetzt gehen.
Um nicht mißverstanden zu werden, betone ich, daß damit nicht die Absicht verbunden ist, alle Werkstätten für Behinderte zu schließen, weil der erste Arbeitsmarkt besser ist als der zweite. Da würden wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Aus heutiger Sicht ist es eine Illusion zu glauben, daß man ohne die Werkstätten auskäme; ganz abgesehen von der Unmöglichkeit, in überschaubarer Zeit solch ein Ergebnis zu erreichen. Aber es darf nicht verboten sein, mit der Utopie - "es ist allemal besser, Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu haben als beschützende Werkstattplätze" - im Kopf einen Prozeß zu organisieren, bei dem gezielt und systematisch Alternativen zur Werkstattbeschäftigung aufgebaut werden. Für die Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales heißt das, die Mittel aus der Ausgleichsabgabe, aus der Eingliederungsbeihilfe flexibler zu handhaben, um schrittweise mehr Arbeitsverhältnisse im geförderten Bereich des allgemeinen Arbeitsmarktes zu erreichen.
Deutlich ist: Überall, wo jetzt Erfahrungen mit dieser Form der Beschäftigung gesammelt wurden, sind es in der Regel gute Erfahrungen, und daran müssen wir anknüpfen. Die Maxime lautet daher: "Jede gute Erfahrung muß möglichst zwei weitere nach sich ziehen." Es wird vieltausendfach Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Das ist zwar ein ziemlich langer und mühsamer Weg, aber ich sehe dazu keine Alternative.
Dieter Horchler, Präses der Handwerkskammer Hamburg
Ich bin den Veranstaltern dankbar dafür, daß sie durch diese Tagung eine Plattform schaffen für die intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe: "Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in Ausbildung und Beruf."
Für viele löst dieses Thema fast automatisch die Frage aus: "Geht das denn überhaupt?" Oder: "Wieso Integration? Es gibt doch die beschützenden Werkstätten! Und nur dort können geistig behinderte Menschen ihren Möglichkeiten entsprechend betreut werden und arbeiten." Und damit hat man dann das Thema abgehakt und ist beruhigt, daß so gut für die Behinderten gesorgt wird.
Denn völlig unbefangen können die wenigsten von uns mit Behinderungen - und mit geistiger Behinderung schon gar nicht - umgehen. Daß die Versorgung in Spezialwerkstätten zugleich auch etwas mit Ausgrenzung zu tun hat, dieser Gedanke wird gern verdrängt. Wir sind es in unserer Gesellschaft mittlerweile gewohnt, Sondergruppen zu bilden, Programme für sie zu entwickeln und die Betroffenen dann meist dauerhaft in diese "Schubladen" zu stecken und zum einen beruhigt zu sein und zum anderen auch einmal verärgert, weil dieses natürlich Geld kostet und die Abgabenlast erhöht.
Mir hat vor diesem Hintergrund deshalb an der Einladung zu dieser Tagung und an der Aufmachung des Prospektes spontan gefallen, wie aus der Reihung der ganz normalen Lebensstationen eines Menschen das Wort "Integration" entsteht und wie diese Reihe sehr deutlich und zwingend die Aufgabenschritte für die Integration vom "Kindergarten" bis zur "Persönlichkeitsentwicklung"(!) beschreibt.
Und mir hat gefallen, daß das Tagungsprogramm zum Lernen einlädt, zum Erfahrungsaustausch und zur Information.
Das Motto des Gesamtprogrammes der "Initiative Bildung" hat mich zusätzlich motiviert, an dieser Tagung teilzunehmen. Ich will es ausdrücklich zitieren, weil es hervorragend beschreibt, worum es gerade bei der Integration von geistig Behinderten geht:
"Nicht fertige Antworten sollen dabei verkauft, sondern Fragen gestellt, Herausforderungen benannt, in der Auseinandersetzung mit anderen die beste Antwort gesucht werden." Dieses Leitwort beschreibt meine eigene Position zum Thema: Ich habe mehr Fragen als Antworten. Deshalb will ich auch diese Tagung zur Information nutzen.
-
Was können wir lernen?
-
Wo müssen wir umdenken?
-
Wie geht Integration in das normale Arbeitsleben praktisch?
-
Welche Erfahrungen liegen vor?
-
Sind sie auf die Struktur der Handwerksbetriebe zu übertragen?
-
Gelingt Integration in kleinen Betrieben besser?
-
Setzt Integration eine bestimmte Betriebsgröße und Arbeitsteiligkeit voraus?
-
Können Arbeitsplätze für geistig Behinderte nur bei werkstattgebundener Produktion geschaffen werden?
-
Ist ein direkter Einsatz vor Ort beim Kunden möglich?
-
Welche Barrieren gibt es? - Existieren sie in unseren Köpfen? - Oder in der jetzigen betrieblichen Situation?
-
Was können wir verändern?
-
Welche Unterstützung gibt es?
-
Wo liegen Grenzen?
Das Handwerk ist Vorbild für soziale Integration. Im Handwerk arbeiten die unterschiedlichen sozialen Gruppen, Geschlechter und Nationalitäten direkt, unkompliziert und selbstverständlich miteinander. Die persönliche Arbeitsatmosphäre ist die beste Voraussetzung für eine humane Arbeitswelt.
Das Handwerk bietet umfangreiche Möglichkeiten, den immateriellen Defiziten im Arbeitsleben, die durch starke Arbeitsteilung mit einseitiger geistiger oder körperlicher Beanspruchung entstehen und auf andere Lebensbereiche ausstrahlen, entgegenzuwirken.
Bietet das Handwerk auch einen vernünftigen Rahmen und guten Boden für die Integration von geistig Behinderten?
In der Einladung ist von "ersten Vorüberlegungen über eine Eingliederung in Betriebe" zu lesen. Diese und die aufgeführten Themen der Foren machen Mut, sich offen mit der Frage der Integration von geistig Behinderten in das Arbeitsleben zu befassen.
Ich hoffe, daß wir in diesen zwei Tagen Antworten dafür finden oder Fragen stellen, die weiterhelfen.
Inge Bornemann, Leiterin der Abteilung Berufsbildung in der Handwerkskammer Hamburg
Ich glaube, wir sind uns fast einig, was getan werden muß: Wir brauchen eine radikale Umsteuerung in der Zielsetzung, einen ganz klaren Entschluß zur Integration. Es müssen vernünftige Rahmenbedingungen gesetzt werden, und man muß dieses Ziel in kleinen Schritten gemeinsam erreichen.
Das Hamburger Handwerk plädiert seit Jahren dafür, die Politik der Ausgrenzung zu verlassen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es wieder ermöglichen, daß wir alle Personengruppen, die wir im Laufe unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu Problemgruppen gemacht haben, sie gut versorgt haben, für sie Programme entwickelt haben, daß wir sie aus diesen Schubladen rausholen und ihnen wieder ein normales Leben in normalen Bezügen ermöglichen. Und wir können uns auch vorstellen, daß das Ganze kostenneutral für die Gesellschaft ist, aber für die einzelnen Menschen ein Gewinn. Insofern ist so eine Tagung ein Signal, denn ich kann mir vorstellen, daß nicht jeder Handwerksbetrieb sofort das, was ich sage, unterschreibt und sagt: "Prima, das ist gut so, und das geht auch!"
Wir brauchen die Rahmenbedingungen, wir brauchen die guten Beispiele und müssen dann in kleinen Schritten dieses Ziel erreichen. Aber die grundsätzliche Bereitschaft, etwas zu tun, ist da, und ich finde gut, daß es eine Entwicklung gibt, den Weg der Integration konsequent weiterzugehen und nicht bei der schwierigen Aufgabe, der Integration in den Arbeitsmarkt, haltzumachen.
Man muß allerdings sehen, daß eine problemlose, normale Beschäftigung in den kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks in den wenigsten Fällen zu erreichen ist. Hier muß eine ganze Menge geleistet werden. Das fängt beim subventionierten Lohn an, das endet bei der Vorbereitung der Menschen bis hin zur Ansprache der Kunden, die einfach darauf vorbereitet sein müßten, daß ein Mensch in ihrer Wohnung erscheint, mit dem sie zunächst mal nicht gerechnet haben. Ich glaube, daß das "Stadthaus-Hotel" so sehr erfolgreich ist, weil alle Menschen wissen, wenn sie da hingehen, wer sie erwartet, wer dort arbeitet, und daß das dann auch eine bewußte Entscheidung ist.
Das Akzeptanzproblem muß auf zweifache Weise angegangen werden:
-
Wir setzen grundsätzlich auf Integration und:
-
Hier ist ein Betrieb, der dies bereits vollzogen hat.
Vor diesem Publikum muß man das zwar nicht sagen, aber denken Sie an ganz normale Kunden, die vielleicht doch nicht so völlig unbefangen, oder zumindest erst einmal hilflos reagieren, wenn sie mit einem Menschen zu tun haben, mit dem sie nicht gelernt haben zu kommunizieren.
Hubert Grimm, Leiter des Geschäftsbereichs Berufsbildung der Handelskammer Hamburg
Es ist tatsächlich so, daß wir uns im Ziel einig sind, das liegt auf der Hand, alles andere wäre verwunderlich, will doch niemand das Gegenteil behaupten. Der Weg aber, der zu diesem Ziel führt, liegt doch noch streckenweise im Dunkeln.
Wenn in meinem Statement das Wort "Differenzierung" vorkommt, dann werden viele von Ihnen denken: "Hoppla! Das widerspricht doch dem Ziel dieser beiden Tage, nämlich der Integration." Ich bin der Meinung, das widerspricht nicht der Integration. Es geht mir darum, keine unnatürlichen Strukturen zu schaffen, die ziemlich teuer und deshalb nicht lange haltbar sind. Das fängt schon in den Schulen an. Da kann es nicht darum gehen, daß man eine Orientierung nach unten startet, daß man eine Anpassung versucht, indem man die Zielsetzungen an den Möglichkeiten der Schwächsten orientiert.
Ein gutes Beispiel ist die Qualifikation zum "Qualitätsfachmann". Auf diesem Wege, in dem die Leistungspotientiale erkannt, benannt und dann auch gefördert werden, läßt sich wahre Integration verwirklichen. Es besteht allerdings die Gefahr, daß Menschen, die mit weniger Einschränkungen zu kämpfen haben, in solche Qualifikationen und Beschäftigungen drängen, die für die Beeinträchtigten entwickelt wurden. Das muß verhindert werden! Der Schutz nach oben muß gewährleistet werden. Der richtige Weg führt also über das klare Aufzeigen der Potientiale, das differenzierte Fördern und die Entwicklung von Angeboten der beruflichen Bildung in nach oben geschützten Maßnahmen.
Reinhard Wenzek, Landesvereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg e. V.
Ich kann nahtlos an das anknüpfen, was Dr. Koglin eingangs gesagt hat zum Vorgehen bei dem, was hier als Zielsetzung oder als Thema genannt worden ist. Der politische Willensbildungsprozeß ist die entscheidende Weichenstellung, um zu Ergebnissen zu kommen, die allen Behinderten - wie auch das Potential beim Einzelnen ist - eine Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht.
Dieser politische Willensbildungsprozeß ist, meine ich, auf allen politischen Ebenen auch vorhanden. Er ist von den Vorrednern ja auch bekräftigt worden. Ich kann das für die Arbeitgeberverbände bestätigen, was sich darin dokumentiert, daß wir auf verschiedenen Ebenen, z. B. mit den Kammern, mit den Gewerkschaften, der Arbeitsverwaltung und der öffentlichen Verwaltung tätig sind.
Das Problem, das sich grundsätzlich bei dieser Angelegenheit stellt, ist, daß wir verschiedene Zielgruppen ausmachen, die förderungs-würdig sind und auch integriert werden müssen, daß aber der Wettbewerb unter den Gruppen, die zu nennen wären, sehr viel größer geworden ist. Herr Grimm hat das an einigen Beispielen darzustellen versucht, daß bei der Erarbeitung von Konzepten auch die Rahmenbedingungen (er nannte das "Schutz nach oben") gewährleistet sein müssen. Dabei haben wir grundsätzlich das Problem, daß natürlich sehr viele Gruppen gefördert werden wollen und müssen, wir aber im Rahmen der knapper werdenden Ressourcen dies nicht immer gewährleisten können.
Wir verstehen uns als Arbeitgeberverbände - ähnlich wie die Kammern - hier im Wesentlichen als Katalysatoren, um auch im Rahmen der Willensbildungsprozesse die Bereitschaft in den Betrieben und Unternehmen zu schaffen, an einem Strang mitzuziehen.
Um auf das Problem der politischen Willensbildung zurück-zukommen: Die Zielsetzung von Rahmenbedingungen in der Integration, die wir zu schaffen haben, muß meines Erachtens immer sein, den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen und keine Strukturen zu schaffen, die das Problem nur für eine bestimmte Zeit verschleiern, und nach Abschluß bestimmter Maßnahmen die Betroffenen an derselben Stelle wie zu Beginn einer Maßnahme stehen.
Von daher ziehen wir meines Erachtens am selben Strang und auch am selben Ende des Strangs. Die Umsetzung im einzelnen ist sehr schwierig; Konzepte liegen in genügendem Maße vor. Was jetzt teilweise noch fehlt, sind die Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muß, z. B. auch im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes, und daß dort auch weitere Förderungsmöglichkeiten eröffnet werden!
Inhaltsverzeichnis
Ulrike Schürmann, Stellv. Direktorin des Novotel-West, Hotel in Hamburg
Können wir Menschen mit geistiger Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt integrieren?
Im Novotel Hamburg-West machen seit 1994 Menschen mit geistiger Behinderung Praktika. Nach drei vierwöchigen Berufspraktika haben wir einer Praktikantin ein Jahrespraktikum angeboten. Im folgenden sollen die wichtigsten Erfahrungen nach nunmehr zehn Monaten zusammenfassend dargestellt werden.
-
Frau G. hat sich sehr gut in unserem Team eingelebt.
-
Es ist eine Bereicherung für das alltägliche Leben, den Umgang mit behinderten Menschen zu erfahren. In der Freizeit reagiert man schon jetzt wohlwollender auf behinderte Menschen als vorher.
-
Frau G. ist immer hilfsbereit und nett, nie unfreundlich, weder zu Gästen noch zu Vorgesetzen und Kollegen.
-
Sie hat Spaß an der Arbeit.
-
Frau G. nimmt kleine Routinearbeiten ab.
-
Sie ist sehr mitteilungsbedürftig.
-
Die Behinderung ist nicht sofort erkennbar für die Menschen, somit wird sie häufig überschätzt und als "ganze Kraft" von den Kollegen eingeplant; durch diese Vorfälle kommt Frau G. an ihre Leistungsgrenzen, oder sie werden überschritten. Das Ergebnis ist dann negativ.
-
Ein flexibler Arbeitseinsatz ist schwierig. Frau G. muß Zeit haben, sich auf ihre bevorstehenden Arbeiten zu konzentrieren.
-
Eine Einarbeitung in neue Arbeitsabschnitte erfordert einen großen zeitlichen Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter.
-
Durch andere (jüngere) Schulpraktikantinnen, meistens 3 Wochen im Hotel, läßt sich Frau G. sehr leicht ablenken und wird teilweise albern. Die Unterhaltung mit den 15/16-jährigen Mädchen ist häufig interessanter als die Arbeit, die erledigt werden soll.
-
Frau G. hat viel Zeit benötigt, um ihren Platz in unserem Hotel zu finden und dann später auch damit zurechtzukommen. Seit langem jedoch schon wird sie eher als Mitarbeiterin des Hauses und nicht als Praktikantin angesehen.
-
Für Frau G. wurde von Anfang an die Hotelgarderobe zur Verfügung gestellt, damit Sie sich hier gegenüber unseren Gästen nicht von unseren anderen Mitarbeitern unterscheidet.
-
Anfangs ist Frau G. vor schwierigen Situationen davongelaufen, meldete sich kurzfristig krank. Durch viele Gespräche mit ihr, überwiegend mit ihrem Betreuer, wurden die Probleme aufgedeckt, besprochen und gemeinsam nach Lösungswegen gesucht.
-
Frau G. wurde manchmal von Ihrem Umfeld überschätzt und teilweise mit zu großen Aufgaben konfrontiert. Das Ergebnis war dann nicht positiv für Frau G. und das Hotel.
-
Sie benötigt im Betrieb auch sehr viel persönliche Zuwendung. Dafür ist häufig kaum Zeit, eine Situation, die Frau G. noch akzeptieren lernen muß.
-
Pünktliches Erscheinen war bei Frau G. noch nie ein Thema
-
Leider ist Frau G. nicht immer zuverlässig und konzentriert bei der Arbeit; sie läßt sich leicht ablenken von ihrem Umfeld.
Eine zukünftige Zusammenarbeit mit Frau G. ist für uns durchaus vorstellbar, da sie sich mit ihrem Wesen und ihrer Art sehr gut bei uns eingelebt hat und die Mitarbeiter des Hotels keine Akzeptanzschwierigkeiten haben. Auch von unseren Gästen kam nie eine negative Rückmeldung.
Bei einer weiteren Beschäftigung in unserem Haus ist besonders wichtig, daß auch weiterhin eine pädagogische Betreuung gewährleistet wird. Schwerpunkt könnte hier die Beschäftigung auch im Arbeitsalltag sein, so daß das Hotelteam eine Hilfestellung erfährt.
Darüber hinaus sind Fragen nach der Art des Beschäftigungsverhältnisses, der Arbeitszeit etc. weiterhin klärungsbedürftig.
Uwe Grund, Landesvorsitzender der DAG Hamburg
Offen gesagt: Ich glaube, daß in dieser wie in vielen anderen Fragen zwischen den Sonntagsreden und dem, was in den Betrieben abläuft, doch eine große Lücke klafft. Und ich will auch sehr selbstkritisch feststellen: Ich bin der festen Überzeugung, daß viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und viele Betriebsräte es noch nicht als einen eigenständigen Auftrag ansehen, viel für die Integration von Behinderten, geschweige denn für die Integration von geistig Behinderten in den Betrieben zu tun. Es gibt eine große Lücke, die geschlossen werden muß.
Zweite Aussage: Wenn wir da was erreichen wollen, ist es wichtig, daß sich nicht nur so eine Willensbildung ergibt, sondern daß sich der aktuelle Trend wieder grundsätzlich ändert. Gegenwärtig haben wir eine Lage, die heißt, die Betriebe müssen von "Sozial-Klim-Bim" und allem Ballast befreit werden. Das ist die wahre Lage. Der Sozialstaat, sagen die Gewerkschaften, ich unterstreiche dies, ist in Gefahr. Davor darf man nicht die Augen verschließen. Wenn dieser Dammbruch stattfinden wird, ist jetzt schon sicher, meine Damen und Herren, wird das die Behinderten am ersten treffen.
Dritter Punkt: Wenn wir anerkennen, daß es eine gesellschaftliche Verpflichtung gibt, Behinderte zu integrieren in den verschiedenen Lebensformen vom Kindergarten, über die Schule bis in den Arbeitsprozeß hinein, dann kann es meiner Ansicht nach nicht angehen, daß man am Ende sich von dieser Verpflichtung billig freikaufen kann. Es reicht nicht aus, was in diesem Zusammenhang geschieht. Die Akzeptanz in Zusammenhang mit einer deutlich höheren Abgabe wird nur dann steigen, wenn wir parallel dazu - nächste These von mir - den Unternehmen erklären - wir werden allen, die Behinderte integrieren, dabei Unterstützung zukommen lassen. Ich bin der festen Überzeugung: Ohne Lohnkostenzuschüsse, die den Teil der Minderleistung oder wie auch immer man das bezeichnen will, dauerhaft abfangen, wird es nicht möglich sein, in einem marktwirtschaftlichen System Integration in großem Umfange zu realisieren. Das ist aber ein Problem, und das muß man den Betrieben dann auch deutlich sagen, daß das geht.
Letzte These: Es ist nicht in Ordnung, finde ich, wie innovative Einrichtungen, wie z. B. die Hamburger Arbeitsassistenz, ringen müssen, welche Verdrehungen und Verquerungen notwendig sind, um am Ende ein solches Projekt überhaupt einigermaßen funktionsfähig am Leben halten zu können. Das ist für mich nicht akzeptabel, weil ich der festen Überzeugung bin, ohne solche unterstützenden Aktivitäten in den Betrieben wird es nicht möglich sein, das gewünschte Ziel zu erreichen.
Peter Daschner, Landesschulrat der Freien und Hansestadt Hamburg
Ich freue mich sehr, daß es zu dieser gemeinsamen Veranstaltung gekommen ist und daß wir drei, der Verein "Eltern für Integration", die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Schulbehörde uns einig sind - es soll ja auch hin und wieder Situationen geben, wo wir uns nicht ganz einig sind, insbesondere, wenn's um das geht, wozu mein Vater immer gesagt hat: "Das Geld, das ist bei uns das Wenigste!" -, daß wir uns aber einig sind, was den gesellschaftspolitischen und den pädagogischen Stellenwert von Integration ausmacht, die sich auch zeigt bei der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in den Bereichen Berufsorientierung, Berufsvor-bereitung und Berufsqualifizierung.
Herr Staatsrat Behlmer hat es schon angesprochen, aber ich möchte es noch mal wiederholen, weil wir schon etwas stolz darauf sind als Schulbehörde, daß wir die erste große Hürde genommen haben, was das neue Schulgesetz angeht, nämlich vor zwei Tagen im Senat. Zu beiden Kernthemen dieser Tagung, nämlich zu Integration und zu Berufsorientierung, sagt das neue Schulgesetz an prominenter Stelle etwas aus: In Paragraph 3 heißt es, bezogen auf die Grundsätze für die Verwirklichung des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags:
"Das Schulwesen ist nach dem Grundsatz der Integration so zu gestalten, daß die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen in größtmöglichem Ausmaß verwirklicht werden können. Jede Form äußerer Differenzierung soll ausschließlich der Förderung der einzelnen Schüler und Schülerinnen dienen. Unterricht und Erziehung sind auf den Ausgleich jeder Form von Benachteiligung und auf die Verwirklichung von Chancengleichheit auszurichten."
Dieses ist eine Verdeutlichung des Auftrages, der bisher auch schon im Hamburger Schulgesetz verankert war, gleichzeitig eine große Herausforderung für uns und für diejenigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die daran schon an vielen Stellen arbeiten, natürlich auch eine Unterstützung. Denn dieser Gesetzestext ist ja nicht nur geschrieben, damit er laut und feierlich vorgelesen wird, sondern er erhebt auch einen Anspruch. Darauf kann man sich auch beziehen, und deshalb bin ich sehr froh, daß dieses an dieser Stelle ins Gesetz kommen soll. In Paragraph 12 ist dann die Rede von der Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, - Sie wissen, zur Zeit sind Integrationsklassen und integrative Regelklassen Schulversuch, und da heißt es: "Mit der Einrichtung von Integrationsklassen, integrativen Regelklassen und individuellen Integrationsmaßnahmen werden die organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen für eine integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf geschaffen. Die zuständige Behörde richtet auf Antrag der Schulkonferenz einer Grundschule Integrationsklassen zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf als Regelangebot ein". Jetzt kommt allerdings noch ein Nebensatz, der das thematisiert, worauf Herr Staatsrat Behlmer schon hingewiesen hat: "...wenn dafür die örtlichen, räumlichen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen gegeben sind." Aber das weiß nun jeder, daß bestimme Voraussetzungen gegeben sein müssen, und wir sorgen uns alle darum und versuchen dazu beizutragen, daß diese Voraussetzungen geschaffen werden können. Aber nicht alles können wir aus eigenem Willen schaffen, das konnte nur Schopenhauer mit seiner Idee von der "Welt als Wille und Vorstellung".
Es kommt noch ein Zweites in das Schulgesetz, was mit der Thematik dieser Tagung zu tun hat. Ich zitiere aus dem Paragraphen 2, in dem die allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele stehen: "Auf allen Schulstufen und in allen Schulformen der allgemeinbildenden Schule ist in altersgemäßer Form in die Arbeits- und Berufswelt einzuführen und eine umfassende berufliche Orientierung zu gewährleisten". Das versuchen viele Kolleginnen und Kollegen natürlich heute auch, und zwar in allen Schulformen, aber es hat hier wiederum eine Verdeutlichung erfahren, der wir auch nachkommen werden.
Die Bildungspolitik ist derzeit von Gegensätzlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten geprägt. Vielleicht geht der Vorsitzende, Kollege Wunder, noch darauf ein. Die Sparzwänge brauche ich nur noch anzudeuten, Staatsrat Behlmer hat es ausgeführt. Arbeitszeitverdichtungen finden statt in der Wirtschaft, aber auch in der Schule, auch in der Schulbehörde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, daß es seit Jahren wieder eine Reihe von Initiativen gibt, die Aufbruch, Mobilität und Kraft signalisieren. Die GEW nennt es "Initiative Bildung". Neue Schulgesetze mit den Ansprüchen, die ich eben zitiert habe, formulieren Ähnliches. Die inzwischen berühmte Denkschrift aus Nordrhein-Westfalen enthält die Aufforderung, Schulen im Sinne von größerer Selbständigkeit und Verantwortung zu entwickeln, Schulprogramme zu erarbeiten, das eigene Profil zu schärfen. Was stattfindet, ist - neben den in der Tat schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen - eine Verknüpfung von Reformen von unten, die es immer schon gab, und Reformen von oben oder dem Willen jedenfalls, diese Reformen aufzugreifen. Das ist für manche eine unbequeme Sache, weil die alte Orientierung nicht mehr stimmt. Plötzlich wird "von oben" etwas propagiert, was man eigentlich "von unten" bisher vergeblich gefordert hat. Ich denke, das ist eher eine gute Position, um gemeinsam weiterzukommen.
Selbstverständlich steht vieles auf dem Prüfstand. Das Argument, bisher habe es doch das und das gegeben, bisher sei doch nach vier Klassenstufen Integration in der Grundschule die Integration in Gesamtschulen oder in Haupt- und Realschulen weitergegangen, dieses Argument löst keinen Automatismus mehr aus. Es ist nichts mehr wie bisher, und deshalb folgt auch nichts mehr wie bisher. Bei einem gedeckelten Budget ist jede Maßnahme einzeln zu bewerten und ggf., wenn man sie für wichtig genug hält, ist dafür zu sorgen, daß sie ermöglicht werden kann, indem man an anderer Stelle etwas nimmt und umschichtet.
Wir als Schulbehörde können nur das Geld ausgeben, was uns die Bürgerschaft gibt, und die hat das, was sie von den Bürgern kriegt bzw. was sie auf dem Kapitalmarkt aufnimmt und wofür sie Zinsen zahlt - derzeit ca. 2 Mrd. DM pro Jahr, fast soviel wie der gesamte Schulhaushalt dieser Stadt. Das muß insgesamt - ich singe natürlich kein Trübsinnslied für Sie - das muß nicht schlecht sein. Wir werden an Tugenden verwiesen, die wir in letzter Zeit nicht so im Vordergrund hatten, wie zum Beispiel der resümierende Blick auf die Ergebnisse der Dinge, für die wir uns anstrengen. Was ist eigentlich - in einer Schule etwa - aus der und der Initiative geworden? Was ist aus den Kindern geworden, die wir unter den und den Bedingungen gefördert haben? Evaluation und Qualitätssicherung sind in dem Zusammenhang Stichworte, die nicht etwas Schlechtes ausdrücken, sondern eher etwas Richtiges und Gutes.
Daß der Wandel in der Lebens- und insbesondere der Arbeitswelt hohe Anforderungen an die Schule stellt, das ist selbstverständlich. Die Realität an Schulen, was Berufsvorbereitung angeht, - nicht nur an Hamburger Schulen - , ist auf diese Anforderungen nur unzureichend bzw. erst in Ansätzen vorbereitet. Wenn man Schülerbefragungen ernst nimmt, dann findet man dort, daß am weitesten das Urteil der Jugendlichen auseinanderklafft zwischen der Bedeutung, die sie selbst der Vorbereitung auf das Berufsleben beimessen, und dem, was die Schule dazu beiträgt.
Relevante Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis: Unabhängig von der Schulform wird die als zu gering empfundene berufliche Orientierung von Schule bemängelt. Dabei ist es allemal bedeutsam, wie Jugendliche auf die wohl schwierigste Entscheidung ihres bisherigen Lebens, nämlich die Berufs- und Studienwahl, vorbereitet werden. Daß Berufsorientierung in der Schule aber alles andere sein kann als berufliche Zurichtung und sich nicht auf ein Fach oder ein Praktikum beschränken muß, zeigen viele Beispiele, die wir in Hamburg hier haben und die es auch anderswo gibt, und auch die Projekte, die Sie auf dieser Tagung kennenlernen werden. Ich wünsche sehr, daß diese Projekte Strahl- und Ansteckungskraft erhalten.
Was tun wir in Hamburg konkret? In diesem Bereich arbeiten wir an einem umfassenden Konzept von Berufsorientierung und wir versuchen unsere kostbarste Ressource, nämlich die pädagogische Arbeitskraft der Lehrerinnen und Lehrer so einzusetzen, daß z. B. Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer auch in der allgemeinbildenden Schule arbeiten, daß wir einen Berufsschultag machen, an dem die Klassen - angefangen haben wir mit Förderschulen, aber jetzt auch mit Haupt- und Realschulen - in die Berufsschule gehen und dort einen "Werkstatt-Tag" unter der Leitung eines Berufsschulkollegen absolvieren.
Zur Integration in Hamburg einige Stichworte, denn es ist darauf hinzuweisen, daß die beruflichen Integrationsmodelle in Hamburg auf einem Fundament stehen, einen Unterbau haben, und der sieht derzeit so aus: Im laufenden Schuljahr nehmen 158 Klassen an 32 Schulen am Noch-Schulversuch "Integrationsklassen" teil, davon sind bereits 79 Klassen in der Sekundarstufe I. Die Zahl der integrativen Regelklassen in der Grundschule beläuft sich inzwischen auf 304, und dies an 35 Grundschulen. Um das ein bißchen für die auswärtigen Gäste zu übersetzen oder eine Anschauung zu liefern: Man kann sagen, 13% aller Schüler und Schülerinnen in Hamburg mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Integrationsmaßnahmen beschult. 16% aller Grundschulen haben Integrationsklassen und integrative Regelklassen. Und 19%, also fast jede fünfte 1. Klasse in Hamburg ist entweder eine Integrationsklasse oder eine integrative Regelklasse. D. h., wir haben in über 10 Jahren in Hamburg, vielfach auf Initiative und Druck der Eltern, von denen viele hier sind, etwas entwickelt, was nicht nur im Gesetz einen Stellenwert hat, sondern auch in der Realität.
Da seit drei Jahren nun geistig behinderte Jugendliche aus den 10. Klassen der Integrationsklassen abgehen, denn vor drei Jahren sind wir mit der Integration in Klasse 10 angelangt, wurde in Hamburg nach neuen Möglichkeiten der beruflichen Integration für diese Gruppe gesucht, die bisher in den Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten für Behinderte und anschließend in die Werkstätten für Behinderte übergingen. Es wurde das System der "integrativen Berufsvorbereitungsklassen" entwickelt, die von der Schulbehörde finanziert werden, und das System der integrativen Förderlehrgänge, die gemeinsam vom Arbeitsamt und von der Schulbehörde finanziert werden. In diesen bundesweit einmaligen Modellprojekten bereiten sich behinderte und nicht behinderte Jugendliche gemeinsam auf die Arbeitswelt bzw. auf eine Berufsausbildung vor. Nach Abschluß der jeweils 2- oder 3jährigen Maßnahmen wird die Beschäftigung, auch der geistig behinderten Jugendlichen, auf dem ersten Arbeitsmarkt angestrebt - Herr Koglin hat ja einige gute Hinweise dafür gegeben. Auch dieses Projekt wird Ihnen im Rahmen der Präsentation der Hamburger Arbeitsassistenz morgen vorgestellt. Im Rahmen der beiden integrierten Förderlehrgänge, also Arbeitsamt plus Schulbehörde, konnten im vergangenen Jahr Ladenprojekte und der Betrieb eines Bistros, was wir ja von den Schülern schon erfahren haben, verwirklicht werden.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen, den beteiligten Schulen, dem Arbeitsamt, den Mitarbeitern der Behörde und dem Verein zur Förderung der beruflichen Bildung danken, die hier ein beispielhaftes Aktionsbündnis zu Wege gebracht haben, denn eine Institution alleine kann es nicht schaffen. Ich hoffe sehr, und wünsche, daß die erfolgreiche Arbeit in diesen Projekten fortgesetzt wird und daß es gelingt, weitere Kooperationsvorhaben dieser Art zu stiften. Die Schulbehörde wird sich bemühen, daß wir auch bei enger Haushaltslage Initiativen aus Schulen oder von Eltern in diesem Bereich Unterstützung verschaffen, und daß wir die Kooperation mit anderen Behörden zu Wege bringen, um integrative Projekte der beruflichen Orientierung und Ausbildung weiterzuentwickeln und auszubauen.
Abschließend möchte ich auf die Begrüßungsworte der GEW-Vorsitzenden, Frau Ammon, eingehen: Es mehren sich in dieser Gesellschaft Zeichen der Segregation, der Trennung, der Ausgrenzung, auch durch bestimmte Weichenstellungen in der Sozialpolitik, aber es gibt auch ermutigende Zeichen der Integration, des Zusammenführens und der Solidarität - und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Kongreß hat neben dem Kontakte Knüpfen und dem Informationserhalt auch die Funktion, denen, die das bisher betrieben haben, zu danken und ihnen ein Ansporn zu sein.
Dieter Wunder, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Die GEW tritt dafür ein, daß alle Kinder und Jugendliche gemeinsam lernen und leben können, gleich, ob es sich um Ausländer handelt oder um Menschen mit körperlichen oder geistigen Benachteiligungen. Wir möchten erreichen, daß das Bildungswesen so umgestaltet wird, daß tatsächlich alle in denselben Bildungseinrichtungen unterrichtet und erzogen werden. Dabei spielt die Integration Behinderter eine wesentliche Rolle. Die Idee zur Integration von Behinderten ist mindestens ebenso stark von den Eltern ausgegangen wie von Lehrerinnen und Lehrern. Viele Kolleginnen und Kollegen in der GEW, die anfangs etwas zögerlich, später sehr bereitwillig waren, haben sich dann als Vorkämpfer für die Integration Behinderter eingesetzt. Überall dort, wo wir in den letzten 15 Jahren deutliche Fortschritte gemacht haben, war die GEW dabei. Ich finde das erstaunlich für unsere Gewerkschaft, denn sie ist die größte Organisation von Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern. Diese Lehrergruppe ist groß geworden in dem traditionellen und oft sehr gut ausgebauten Sonderschulsystem. Dieses gute deutsche Sonderschulsystem ist wesentlich ein Ergebnis der Arbeit der GEW. Trotzdem ist es gelungen, daß die GEW sich an vielen Orten stark gemacht hat für Integration, daß wir große Fortschritte gemacht haben, ohne das Vertrauen unserer Kolleginnen und Kollegen in den Sonderschulen zu verlieren.
In der Auseinandersetzung mit denen, die Integration bekämpfen, gibt es das Argument: "Das mag ja für einen Teil von Behinderten richtig sein. Das mag ja für Blinde, Hörgeschädigte möglich sein, das mag ja für einen Teil von Körperbehinderten möglich sein, aber ist es denn für alle möglich?" Ich glaube nicht, daß man darauf eine endgültige Antwort heute geben kann, aber ich denke, als pädagogisches Prinzip sollten wir sagen: "Solange die Grenzen von Integration nicht ausprobiert worden sind, solange in vielen Fällen die Kreativität und die Phantasie von Lehrerinnen und Lehrern, von Eltern nicht zusammengebracht wurde, so lange wird man auf jeden Fall sagen können: Wir müssen weitere Versuche machen, wir müssen mehr Menschen als bisher einbeziehen".
Ein großes Problem ist die Frage der Rahmenbedingungen, abhängig von finanzpolitischen Voraussetzungen. Integration bedarf zusätzlicher Maßnahmen und ist nur dort gerechtfertigt, wo man den Besonderheiten behinderter Kinder und Jugendlicher wirklich gerecht werden kann. Für diese finanzpolitischen Rahmenbedingungen haben wir zu arbeiten. Wir können uns als Pädagoginnen und Pädagogen nicht ohne weiteres mit dem abfinden, was an finanzpolitischen Rahmenbedingungen von der Politik gerade festgesetzt wird. Es gibt einen echten Konflikt zwischen dem, was aus pädagogischen Gründen wünschenswert und notwendig ist, und den mitunter doch recht zufälligen Entwicklungen finanzpolitischer Prioritäten. Wir können und wir wollen uns diesen finanzpolitischen Bedingungen nicht ohne weiteres unterwerfen. Ich will in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, daß wir in einem der reichsten Länder dieser Erde leben und manche Länder, die weniger reich sind als wir, mehr für Behinderte tun, einen größeren Teil des Sozialproduktes für sie aufwenden als wir. Wir fordern deshalb vom Hamburger Senat wie von anderen Landesregierungen, daß sie die Integrationsbemühungen fortsetzen und daß sie auch bereit sind, dafür zusätzlich Gelder bereitzustellen.
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß Integration vor allem den außerordentlichen Bemühungen von Eltern wie auch Lehrerinnen und Lehrern zu verdanken ist. Deshalb muß man an dieser Stelle auch einmal gegenüber denjenigen, die sich kritisch und negativ über das Engagement von Lehrern äußern, sagen, daß dies alles nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht Lehrerinnen und Lehrer sehr viel mehr getan hätten, als man eigentlich von ihnen verlangen kann.
Integration von Behinderten heißt auch, daß eine Schule sich verändert. Eine Integrative Schule, eine Integrative Klasse kann nicht Pädagogik im traditionellen Sinne machen. Lehrerinnen und Lehrer müssen sich völlig umstellen und müssen eine sehr viel individualistischere, eine sehr viel mehr auf das einzelne Individuum eingehende Pädagogik entwickeln, müssen wirklich zeigen, daß sie in der Lage sind, auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Dabei entdecken Lehrerinnen und Lehrer, daß die Pädagogik der Vielfalt eigentlich die beste Pädagogik ist für alle Kinder und Jugendlichen, daß also Vielfalt als Reichtum, als Bereicherung von Pädagogik angesehen wird und nicht als Verarmung oder gar als zusätzliche Erschwernis.
Die heutige Tagung wird unterstützt und finanziell gefördert von der "Initiative Bildung" der GEW. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ausgangspunkt der "Initiative Bildung" ist die Tatsache, daß wir festgestellt haben, daß Bildung in unserer Gesellschaft einen zu geringen Stellenwert hat. Wir haben uns gefragt: Was können wir eigentlich als Gewerkschaft tun, um Bildung in dieser Gesellschaft wieder einen anderen Stellenwert zu geben? Dabei haben wir drei Wege eingeschlagen.
Der erste Weg: Wir haben Kolleginnen und Kollegen in Bildungseinrichtungen aufgefordert, Beispiele zu nennen für das, was sie dafür tun, daß sich die Praxis verändert. Viele dieser Projekte haben wir finanziell gefördert und sie auf Veranstaltungen und in Publikationen der GEW vorgestellt. Wir dürfen nicht nur Forderungen stellen, wir dürfen nicht nur reden über das, was getan wird, sondern wir müssen gute Beispiele zeigen zum Nachahmen und zum Ermutigen.
Der zweite Weg: Wir haben uns vorgenommen, den bildungspolitischen Dialog mit den unterschiedlichsten Gruppen dieser Gesellschaft zu führen.
Der dritte Weg: Wir möchten in Diskussionsveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Fragen die bildungspolitische Diskussion in der Bundesrepublik insgesamt voran bringen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr werden Veranstaltungen zum Thema Bildungsfinanzierung sein.
Diese Überlegungen der GEW stehen im Einklang mit internationalen Diskussionen und sprechen gegen die Bescheidenheit, die uns zur Zeit von vielen Politikern, insbesondere von Finanzpolitikern in der Bildungspolitik gepredigt wird. Es hat in den letzten Monaten eine Reihe von interessanten internationalen Gutachten gegeben, die alle auf dasselbe hinauslaufen: Für die Zukunft unserer Gesellschaften ist das Bildungswesen einer der wichtigsten Bereiche, wenn nicht der wichtigste Bereich, und es ist notwendig, daß Regierungen dem Bildungswesen mehr Aufmerksamkeit widmen und daß das Bildungswesen besser als bisher ausgestattet wird.
Interessant ist bei diesen Untersuchungen - ich beziehe mich z. B. auf den Bericht der Weltbank und auf den Bericht des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission Delors -, daß als ein Schwerpunkt von Bildungspolitik die Berücksichtigung von Benachteiligten besonders hervorgehoben wird. Es wird darauf hingewiesen, daß es unbedingt notwendig ist, daß sich das Bildungswesen nicht nur um diejenigen kümmert, die angeblich oder tatsächlich leistungsstark sind, die ohne Schwierigkeiten die Bildungseinrichtungen durchlaufen, sondern daß wir uns mehr um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern.
Dabei sind Fragen der Bildungspolitik nicht von Fragen der allgemeinen Gesellschaftspolitik zu trennen. Wollen wir den Weg weitergehen, der zu einer Gesellschaft der Starken und Leistungsfähigen führt, alle anderen aber auf der Strecke bleiben läßt? Oder wollen wir eine Gesellschaft, die alle Menschen der unterschiedlichsten Art zusammenfaßt und in der es eine Solidarität dieser unterschiedlichen Menschen zueinander gibt? Die Grundfrage, die sich stellt, ist: Wollen wir eine Gesellschaft, in der Solidarität ein grundlegender Wert ist? Was derzeit in der Politik passiert und wie z. B. die Bundesregierung ihre Finanzpolitik entwickelt, geht offenbar von einem Gesellschaftsbild aus, das die Schwachen in unserer Gesellschaft diskriminiert. Man muß sich nur mal ansehen, wie über Arbeitslose, wie über Sozialhilfeempfänger gesprochen wird, wie gerechtfertigt wird, warum Kürzungen dort ohne weiteres möglich sind.
Heute morgen ist in der Süddeutschen Zeitung mit sympathischen Worten ausführlich dargestellt worden, wie der BDI-Chef Henkel sich erfolgreich um die Erneuerung der Industriegesellschaft in Europa kümmert und viele kluge Überlegungen anstellt. Aber eines wird auch deutlich: seine Verlegenheit, wenn die Sprache auf die Verlierer dieser Entwicklung kommt. Solche gesellschaftliche Härte kann von uns weder aus bildungspolitisch-pädagogischer Sicht noch aus gewerkschaftlicher Sicht akzeptiert werden. Wir setzen gegen diese Politik der Ausgrenzung die Politik der Integration.
In diesem Zusammenhang will ich noch einmal auf den Bericht der Delors-Kommission zurückkommen. Eine der Hauptsorgen, die darin zum Ausdruck kommt, ist, daß die Gesellschaften innerlich zerfallen, daß es keine Verpflichtung der Menschen mehr zueinander gibt. Wenn wir nicht eine gesellschaftliche Vision entwickeln, wie die Menschen wieder zueinander finden und zueinander halten, gehen wir Entwicklungen entgegen, wie wir sie aus amerikanischen und englischen Großstädten kennen. Wir sollten die Frage der Integration von Behinderten vor dem Hintergrund solcher gesellschaftspolitischen und bildungspolitischen Überlegungen sehen. Wenn wir Behinderte integrieren, wenn wir dafür bereit sind, alles aufzubringen, dann ist das ein Zeichen dafür, wie diese Gesellschaft sich entwickelt und ein Zeichen gegen die Gesellschaft des Egoismus. Als GEW-Vorsitzender fordere ich Integration als Grundprinzip für Bildungs- und Gesellschaftspolitik.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Erheblicher Nachholbedarf.
- Ernst, aber nicht perspektivlos
- Gewerkschaftliches Engagement hat Tradition
- Recht auf Arbeit für alle - Behinderte nicht isolieren
- Benachteiligungen bei der Berufsausbildung abbauen
- Arbeitgeberbarrieren überwinden
- Gesellschaftliches Bewußtsein schärfen
- Bündnis schaffen
- Ausblick: Licht am Ende des Tunnels
- Quellen
- Literaturangaben
"Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." (Grundgesetz Art. 3, Abs. 3)
Karl-Heinz Köpke, stellv. Vorsitzender DGB Nordmark Andreas Köpke, Student der Erziehungswisssenschaften
"Jeder Mensch muß ohne Angst verschieden sein können." Diese Forderung von Theodor Adorno faßt zusammen, was Kern und Fundament unserer Demokratie ist. In besonderer Weise findet sich dieses Demokratieverständnis im Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3 des Grundgesetzes. Doch die gesellschaftliche Alltagspraxis ist (zu) weit von diesem Anspruch entfernt. Migranten, Alte, Kranke und Menschen mit Behinderungen erleben dies allzu oft. Man braucht nur ein wenig anders zu sein, und es drohen Diskriminierung, Ausgrenzung und Abwertung. Angesichts dieser Aussonderungspraxis drängen sich unbequeme Fragen auf: Was ist eigentlich normal? Warum ist es erstrebenswert, normal zu sein? Und vor allem: Wer bestimmt, was normal ist? Ist nicht vielmehr die einzigartige Singularität des einzelnen Menschen das eigentliche Kennzeichen menschlichen Lebens?
Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Kultur leben davon, daß es Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten gibt. Es ist ein eklatanter Widerspruch, einerseits zu wissen, daß die Fortentwicklung unserer Gesellschaft von der Vielfältigkeit der Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer einzelnen Mitglieder abhängt, andererseits die Norm, den Durchschnitt zum Maß aller Dinge zu machen. Damit unterdrücken wir Begabungen, die wir - weil von der Norm abweichend - als negativ ignorieren.
Es ist unbestritten, daß fehlende Fähigkeiten durch "andere" nicht ersetzt werden. Genauso gewiß ist, daß diese "anderen" aber in besonderer Weise ausgebildet sein können. Beispielsweise der Geruchssinn bei einem blinden Menschen oder sein Gehör, Tastsinn usw. Aber erkennen wir diese Fähigkeiten an? Nein. Der Blinde, dessen Wunsch es ist, aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird mit einem Schwerbehindertengrad von 100% eingestuft und damit seine Aussicht auf einen Arbeitsplatz praktisch verneint. Seine "anderen" Fähigkeiten und Fertigkeiten werden übersehen und als unbedeutsam für die Arbeitswelt eingestuft. Der Blinde wird ausgesondert und damit die Chance vertan, seinem Leben durch die Möglichkeit zur Berufstätigkeit Bedeutung und vor allem Normalität zu verleihen.
Es ist noch ein langer Weg, bis es in unserer Gesellschaft selbstverständlich sein wird, jeden einzelnen in seiner Individualität und Einzigartigkeit so anzunehmen, wie er ist. Gegenwärtig sind wir noch weit von dem Ziel entfernt, Integration als Normalität zu praktizieren und damit dem Rechnung zu tragen, was Fredi Saal in seiner Biographie "Warum sollte ich jemand anders sein wollen?" Mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht hat: "Ich jedenfalls fühle mich als Spastiker als Schöpfung Gottes."
Der Nachholbedarf in Sachen Integration zeigt sich besonders bei Menschen mit Behinderungen. Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus dem Jahre 1994 zufolge sind mit 7,5 Millionen Menschen fast 10% aller Bundesbürger behindert.
Ob im Bildungswesen oder auf dem Arbeitsmarkt, immer wieder sind Menschen mit Behinderungen besonders von Ausgrenzungen betroffen. Dies zeigt bereits ein Blick in die Arbeitslosenstatistiken. Fast 30% aller Arbeitslosen sind gesundheitlich erheblich beeinträchtigt. Gegenwärtig sind über eine Million Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen registriert, darunter gut 180.000 Schwerbehinderte. Hinzu kommt, daß die Arbeitslosigkeit für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen erheblich länger dauert, als bei Arbeitslosen ohne Beeinträchtigung. Insbesondere für ältere Arbeitslose mit Behinderungen sinken die Wiedereingliederungschancen in die Arbeitswelt rapide.
Das sind die Ergebnisse einer neoliberalen Politik, die einseitig auf die Selbstheilungskräfte des Marktes setzt, Arbeitnehmerrechte reduziert, Kranke bestraft, Menschen mit Behinderungen benachteiligt, Arbeitslose herabwürdigt und Sozialhilfeempfänger kriminalisiert. Die von der Bundesregierung betriebene Spaltung unserer Gesellschaft in Arme und Reiche, Privilegierte und Benachteilige verschärft diese Trends. Nach über einem Jahrzehnt systematischer Demontage des Sozialstaates drohen die Grundprinzipien unserer sozialen Demokratie, endgültig dem "Turbo-Kapitalismus" zum Opfer zu fallen.
Die Konsequenzen dieser ausgrenzenden Politik lassen sich in Zahlen festmachen. Beispielsweise sind nach dem Schwerbehindertengesetz Arbeitgeber verpflichtet, 6% ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Bei rund 21 Millionen Arbeitsplätzen im Oktober 1995 wären demnach 1,26 Millionen Menschen mit Schwerbehinderungen in bundesdeutschen Betrieben und Verwaltungen zu beschäftigen. Diesem gesetzlichen Pflichtsatz steht eine tatsächliche Zahl von lediglich 844.400 Beschäftigungsverhältnissen gegenüber. Das entspricht nur etwa 4% . Eine beschämende Quote, insbesondere wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese Zahl seit über 12 Jahren kontinuierlich sinkt.
Eine Trendwende ist solange nicht zu erwarten, wie sich die verantwortliche Politik weigert, die Ausgleichsabgabe bei Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgabe zu erhöhen. Diese liegt bei lediglich 200 DM monatlich pro Nichtbeschäftigung eines Menschen mit Behinderung. Angesichts dieser geringen Abgabe überrascht es nicht, daß ein Verstoß gegen die Beschäftigungspflicht allenfalls als Kavaliersdelikt betrachtet wird. Gleichzeitig bemühten sich Arbeitgeber darum, die bestehende Regelung aufzuweichen. Mit Erfolg, das Gesetz wurde geändert. Statt wie bisher die Zahl aller Arbeitnehmer als Bezugsgröße für die Ermittlung der 6%-Quote heranzuziehen, wurde diese Größe um die Zahl der Auszubildenden, Teilzeitbeschäftigten und Kurzarbeiter reduziert. Damit wird die gesetzlich festgeschriebene Quote mit weniger beschäftigten Menschen mit Behinderungen erreicht, als dies bislang möglich ist.
Die Bemühungen um eine wirksame Integration von Menschen mit Behinderungen stecken angesichts solcher Tendenzen immer noch in den Kinderschuhen. Hieran ändert auch die Feststellung von Richard von Weizsäcker in einer Rede vor der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte" am 1. Juli 1993 nichts, wenn er konstatiert: "Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Daß Behinderung nur als Verschiedenheit aufgefaßt wird, das ist das Ziel, um das es uns gehen muß." Der damalige Bundespräsident befindet sich mit diesem Anspruch zwar im Einklang mit der Menschenrechtskonvention, die in Artikel 14 feststellt, daß die Menschenrechte unteilbar für alle gelten, "ohne Unterschied... sozialer Herkunft,... der Geburt oder des sonstigen Status." Doch schöne Worte und bedrucktes Papier ändern an der alltäglichen Benachteiligung der Menschen mit Behinderungen allerdings (zu) wenig.
Gerade in einer Zeit, in der Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Benachteiligungen politikfähig wird, kommt es darauf an, einschränkungslos für die Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen einzutreten. Einen wichtigen Beitrag hierzu stellt die im Mai 1996 in Köln veröffentlichte, vom DGB initiierte und von den Wohlfahrts- und Sozialverbänden mitgetragene Sozialstaatscharta dar. Gemeinsam fordern die Unterzeichner, daß Menschen mit Behinderungen mehr Chancen in Arbeit und Beruf gewährt werden müssen. Wörtlich heißt es: "Wir können es nicht hinnehmen, wenn die sozialen Sicherungssysteme zunehmend Lücken aufweisen, so daß immer mehr Menschen, ... chronisch Kranke, behinderte Menschen und Alte, in Armut geraten. Bürgerinnen und Bürger bei Krankheit, Behinderung....ein menschenwürdiges Leben zu sichern, ist Kern unseres Sozialstaates. ... und gleiche Bildungschancen unverzichtbare Voraussetzung. Den besonderen Bedürfnissen von Alten, Behinderten und Kinderreichen ist Rechnung zu tragen."
Zweifelsohne, die Lage für Menschen mit Behinderungen ist ernst, doch sie ist keinesfalls ausweglos. Ein Beispiel dafür, daß auch Fortschritte für Menschen mit Behinderungen erzielt werden, ist die Grundgesetzänderung aus dem Jahr 1994.
Das Grundgesetz (GG) ist seit seinem Inkrafttreten häufig geändert worden. Dies geschah längst nicht immer in eine fortschrittliche Richtung, wie die Veränderungen des Asylrechts in Artikel 16a illustrieren. Daß das Grundgesetz durch Revision allerdings auch an humanem Gehalt gewinnen kann, zeigt die Änderung aus dem Jahre 1994, mit der Artikel 3 (Gleichheit vor dem Gesetz) wie folgt ergänzt wurde: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." Ein wichtiger Etappensieg für die Menschen mit Behinderungen.
Daß die Grundgesetzänderung mehr als eine Änderung der Papierzulage darstellt, sondern unmittelbar eine Besserstellung der Behinderten befördert, zeigt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30 Juli 1996 (1 BVR 1308/96). Darin wurde das Recht von Behinderten auf Integration in allgemeinbildende Schulen unter Bezug auf die zitierte Grundgesetzänderung festgeschrieben. Die Bundesrichter stellen in ihrem Urteil klar, daß Behinderte vorrangig das Recht auf Integration in einer Regelschule haben.
Die Richter gaben damit der Verfassungsbeschwerde einer körperbehinderten Schülerin statt. Die Schülerin hatte die Grundschule, ohne eine Klasse zu wiederholen, besucht. Im Anschluß wechselte sie in die fünfte Klasse einer integrierten Gesamtschule. Die zuständige Schulbehörde entschied aufgrund eines Gutachtens, welches dem Kind besonderen pädagogischen Förderbedarf attestierte, den zwangsweisen Wechsel in eine Sonderschule. Hiergegen legte das Mädchen Widerspruch ein, da ein Sonderschulabschluß ihre Berufs- und Lebenschancen nicht unerheblich einschränke und die "Berufswahlmöglichkeiten minimiert". Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht lehnte dieses Gesuch ab, wogegen die Schülerin Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegte. Der Verfassungs-beschwerde der Schülerin gab das Bundesverfassungsgericht statt. Die Richter begründeten dies damit, daß das niedersächsische Schulgesetz Behinderten, "grundsätzlich einen vorrangigen Anspruch auf gemeinsame Beschulung mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in den allgemeinbildenden Schulen gibt". "Von diesem Prinzip dürfe nur abgewichen werden, wenn die organisatorischen, personellen und sächlichen Gegebenheiten eine integrative Beschulung nicht erlauben". Die Richter fordern für diesen Ausnahmefall allerdings eine "erhöhte Begründungspflicht", da außer einem nichtssagenden Hinweis auf "organisationsbedingte Umstände" nicht ersichtlich sei, warum eine sonderpädagogische Förderung an der Gesamtschule unmöglich ist.
Aufgrund dieser Sachlage und der Tatsache, "daß das Interesse der Beschwerdeführerin, wegen ihrer Behinderung nicht benachteiligt zu werden, in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG verfassungsrechtlich geschützt ist", gaben die Rechter der Verfassungsbeschwerde statt und verwiesen die Klage an das Oberverwaltungsgericht zurück.
Auch wenn die Richter betonen, daß sich die Entscheidung nicht auf Länder ohne entsprechend der Grundgesetzänderung aktualisierte Schulgesetze übertragen ließe, stellt dieser Beschluß eine wichtige Weichenstellung dar: Schließlich kann demnach jedes Bundesland unter Bezug auf den Artikel 3 des Grundgesetzes dazu verpflichtet werden, die Beschulung Behinderter "vorrangig" anders zu regeln, als sie in Sonderschulen zu überweisen. Damit stärkt das Urteil all denen den Rücken, die sich seit Jahren für eine aktive Integration von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf einsetzen.
Das Urteil hat auch für andere Lebensbereiche, insbesondere die Berufs- und Arbeitswelt, Signalcharakter. Dokumentiert hier doch das höchste deutsche Gericht unmißverständlich, daß die Integration von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich Vorrang hat vor Aussonderung und Benachteiligung.
Diese Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen ist nicht zuletzt das Ergebnis des jahrzehntelangen Engagement zahlreicher gesellschaftlicher Kräfte. Auch der DGB und seine Gewerkschaften haben sich hieran immer wieder beteiligt. Betrachtet man deren programmatische Aussagen der vergangenen Jahrzehnte, so zeigt sich, daß der Einsatz für die Rechte der Menschen mit Behinderungen in den Gewerkschaften eine bemerkenswerte Tradition hat.
Bereits im DGB-Grundsatzprogramm von 1949 findet sich die Forderung nach einer "Wirtschaftspolitik, die unter Wahrung der Würde freier Menschen die volle Beschäftigung aller Arbeitswilligen ... sichert" (S.162). In dem Grundsatzprogramm von 1963 findet das gewerkschaftliche Bekenntnis zur Integration von Menschen mit Behinderungen seine volle Entfaltung: "Der Behinderte ist durch umfassende medizinische und berufliche Maßnahmen dazu zu befähigen, am beruflichen und gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt teilzunehmen". (S.108). Dieses Bekenntnis erneuern und präzisieren die Gewerkschaften in dem DGB-Grundsatzprogramm von 1981, welches die Gleichstellung Behinderter in allen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen fordert, wenn es u.a. heißt: "Behinderten und anderen gefährdeten Arbeitnehmergruppen ist ein besonderer Schutz zu gewähren". (S.39). Oder an anderer Stelle: "Alle behinderten Menschen müssen die Chance erhalten, in Arbeit, Beruf und Gesellschaft eingegliedert zu werden". (S.116).
Früh setzte sich in den DGB-Gewerkschaften auch die Erkenntnis durch, daß sich das Engagement um die Integration von Menschen mit Behinderungen nicht allein auf Gleichstellungsregelungen in Arbeitsrechtsgesetzen oder Tarifverträgen beschränken darf. Die Herstellung von Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen ist schließlich erst dann verwirklicht, wenn auch Bildung und Ausbildung von dem Integrationsgedanken durchdrungen sind. So hält der DGB in dem Grundsatzprogramm von 1981 fest: "Die pädagogische Förderung behinderter Kinder muß vom Ziel der Eingliederung in das allgemeine Bildungswesen bestimmt sein". Und weiter: "Diese Ziele lassen sich am besten durch die integrierte Gesamtschule verwirklichen". (S.149). Der DGB schließt sich hier unmittelbar dem Zusatzprotokoll zur Menschenrechtskonvention aus dem Jahre 1952 an, in dem es in Artikel 2 heißt: "Das Recht auf Bildung darf niemanden verwehrt werden".
Die Forderungen nach Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderungen im Bildungswesen finden in dem 1982 beschlossenen "Bildungspolitischen Grundsatzprogramm des DGB" eine ausführlichere Betrachtung. In ihrem Forderungskatalog plädieren die Gewerkschaften u.a. dafür, "behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam zu erziehen, zu unterrichten und auszubilden. ... Förderung heißt: Nicht auslesen, sondern unterschiedliche Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen und individuelle sowie schichtenspezifische Unterschiede auszugleichen. ... Behinderte sind durch zusätzliche Hilfen zu fördern" (S.10). Neben diesen grundsätzlichen Forderungen finden sich Konkretisierungen in Bezug auf die verschiedenen Bildungsstufen. Mit Blick auf den Elementar- und Primarbereich stellt der DGB fest, daß": ... viele Kindergartengruppen zu groß (sind), um eine sinnvolle Förderung zu gewährleisten. Dies benachteiligt insbesondere behinderte Kinder": (S.13). "Zur Förderung lernschwacher oder behinderter Kinder muß jeder Grundschule auch die Fachkompetenz von Sozialpädagogen und Sonderschullehrern zur Verfügung stehen, um eine Aus-sonderung dieser Kinder zu vermeiden und sie zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen" (S.15). Der DGB reflektiert in seinem "Bildungspolitischen Programm" auch die Konsequenzen, die die Forderung nach umfassender Integration von Menschen mit Behinderungen im Bildungsbereich für die Sekundarstufe 1 und die Weiterbildung nach sich ziehen": Kinder mit Behinderungen sollen soweit wie möglich in den Regelschulen unterrichtet werden. Sie sind dort durch Lehrer mit spezifischen Fachqualifikationen, durch medizinische und sozialpädagogische Fachkräfte zusätzlich zu fördern. Die Sonderschulen sind soweit wie möglich in Regelschulen zu integrieren". (S.20). Und weiter: "Bisher benachteiligte Arbeitnehmergruppen wie ... Behinderte, sind bei der beruflichen Weiterbildung besonders zu fördern". (S.30)
Daß es sich für den DGB dabei nicht nur um Lippenbekenntnisse handelt, unterstreichen eine Vielzahl von Aktivitäten, die der gewerkschaftliche Fachverband unternommen hat, um die Integration von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Beispielhaft hierfür ist sein Engagement zur Verbesserung der Situation und Perspektive von Beschäftigten in Werkstätten für Behinderte (WfB). In diesen Einrichtungen finden Menschen mit Behinderungen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als schwer bzw. nicht vermittelbar eingestuft werden, Beschäftigung. In der Bundesrepublik existieren etwa 400 solcher Werkstätten mit ungefähr noch einmal der gleichen Zahl an Zweigunternehmen und Filialen. Der DGB kritisiert diese Form der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, in einem isolierten (Sonder-) Arbeitsmarkt heftig, wenn er 1989 unter dem Titel "Recht auf Arbeit für alle - Behinderte nicht isolieren" in einem Positionspapier die Unteilbarkeit des Anspruchs auf Arbeit einfordert": Alle körperlich, geistig und seelisch Behinderten sind in das Recht auf Arbeit einbezogen. Sie haben Anspruch auf dauerhafte Eingliederung in die Arbeitswelt ebenso wie alle Nichtbehinderten. Behinderte dürfen nicht in die Isolation getrieben werden; sie haben Anspruch, vorrangig auf einem Arbeitsplatz in "normalen" Betrieben und Verwaltungen eingegliedert zu werden. Bei der bisherigen Aussonderungspraxis in Betrieben und Verwaltungen darf es nicht bleiben. Der Übergang Behinderter aus den Werkstätten für Behinderte auf Arbeitsplätze in "normalen" Betrieben und Verwaltungen des allgemeinen Arbeitsmarktes ist verstärkt zu fördern".
Im Zusammenhang mit ihrem Engagement für die Interessen der Beschäftigten in WfB setzten sich die Gewerkschaften dafür ein, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) fixierten Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte für Menschen mit Behinderungen aufzuheben. Wörtlich heißt es hierzu in dem DGB-Papier: "Der DGB ... setzt sich besonders für die Solidarität zwischen Behinderten und Nichtbehinderten ein. Er sieht eine wichtige Aufgabe darin, die immer wieder praktizierte Ausgrenzung Behinderter ... aufzuheben. Das gilt für alle körperlich, seelisch und geistig Behinderten, deren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung oft unterdrückt und deren Entwicklungsmöglichkeiten durch Aussonderung aus dem Arbeitsleben, soziale Isolation und - bei geistiger Behinderung - zusätzlich durch längst überholte, Persönlichkeitsrechte einschränkende Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches blockiert werden". (DGB 1989). Außerdem fordert der DGB, daß "alle in den Werkstätten für Behinderte beschäftigten körperlich, geistig oder seelisch Behinderten ... die Möglichkeit zur Organisation in einer DGB-Gewerkschaft haben" müssen. Auch bei dieser Forderung kann sich der DGB auf die Menschenrechtskonvention berufen. Schließlich heißt es dort in Artikel 11, Absatz 1: "Alle Menschen haben das Recht, ... zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten".
Aus dem zitierten Positionspapier ging 1990 die "Münchener Erklärung zur Situation behinderter Menschen in den Werkstätten für Behinderte" hervor. Die Gewerkschaften erneuern in dieser Erklärung ihre Kritik an dem bestehenden System der WfB und erhalten hierin breite Unterstützung durch Behinderten- und Wohlfahrtsverbände. Im Zentrum der "Münchener Erklärung" steht die Kritik an der Benachteiligung und Diskriminierung von Beschäftigten in den WfB, im Gegensatz zu Menschen mit Behinderungen, die auf dem "normalen" Arbeitsmarkt Beschäftigung gefunden haben. Beispielsweise betrug das Stundenentgelt zum damaligen Zeitpunkt für Beschäftigte in WfB lediglich DM 1,50. Folgerichtig lautet eine Forderung der "Münchener Erklärung": "Es ist eines sozialen und demokratischen Rechtsstaates unwürdig, wenn arbeitende Menschen ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrer Arbeitsleistung bestreiten können. Die Werkstätten müssen aus öffentlichen Mitteln in die Lage versetzt werden, ein angemessenes, existenzsicherndes Arbeitsentgelt zu zahlen". Außerdem kritisieren die Unterzeichner der "Münchener Erklärung" die weitgehende Rechtlosigkeit der Beschäftigten der WfB. Diese äußert sich u.a. darin, daß geistig Behinderten in der WfB, den Grundsätzen des BGB folgend, jegliche Geschäftsfähigkeit aberkannt wird. So können sie sich beispielsweise ihre Arbeitsstelle nicht selbst aussuchen oder mit der WfB einen eigenen Arbeitsvertrag schließen. Hierzu heißt es in der "Münchener Erklärung" wörtlich: "Die weitgehende Rechtlosigkeit führt zu absurden Erscheinungen: Während schwerbehinderten Arbeitnehmern in der Erwerbswirtschaft weiterreichende Schutzrechte gesetzlich zugestanden werden, gelten diese Bestimmungen für schwerbehinderte Werkstattangehörige nicht". Die Unterzeichner fordern "Behinderte Werkstattbeschäftigte dürfen bezüglich der bundesweit geltenden Schutzrechte gegenüber Arbeitnehmern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht schlechter gestellt werden".
Auch außerhalb der WfB gibt es Handlungsbedarf: Dies verdeutlicht ein Blick auf die Defizite des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG), die sich in den schon 1993 erhobenen DGB-Forderungen an eine Novellierung dieses Gesetzes zeigen. Die Gewerkschaften plädieren hier für eine "erweiterte Gleichstellungsmöglichkeit" von Menschen mit Behinderungen, die bisher nicht unter dem Schutz des Schwerbehindertengesetzes stehen. Eine Erweiterung erscheint um so dringlicher, da sich sonst mehrere Gruppen von unterschiedlich geschützten Behinderten herausbilden. Aus diesem Grund fordert der DGB "... auch für nicht gleichgestellte Behinderte mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, sowie zunehmend auch Gesundheitsbeeinträchtigte und Behinderte mit einem Grad der Behinderung von weniger als 30, den Schutz des Schwerbehindertengesetzes".
Ferner tritt er dafür ein, den Arbeitgebern verstärkte Einstellungshilfen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten zu gewähren. Schließlich plädieren die Gewerkschaften für eine Verbesserung des Kündigungsschutzes für Schwerbehinderte. Dieser "muß schon mit der Einstellung des Schwerbehinderten einsetzen". Leider haben diese Forderungen kaum Eingang in die neuen arbeitsrechtlichen Regelungen für Menschen mit schweren Behinderungen gefunden. An diesem Punkt zeigt sich einmal mehr, daß die Integration von Menschen mit Behinderungen offensichtlich keinesfalls zu den primären Politikzielen der Bundesregierung gehört.
Das behindertenfeindliche Klima in der bundesdeutschen Politik offenbart sich auch an anderen Stellen, so z. B. in der Ausbildungspraxis etlicher Unternehmen. Zeigte sich bereits die mangelnde Integrationsbereitschaft bei der Nichterfüllung der gesetzlichen Beschäftigungsquote, so verschärft sich dieser Mißstand bei einem Blick in die Ausbildungspraxis.
Nach § 48 des Berufsbildungsgesetzes und § 42b der Handwerks-ordnung haben die Unternehmen die Möglichkeit, Jugendliche mit Behinderungen außerhalb der 400 staatlich anerkannten Berufsbilder zu qualifizieren. Statt einer regulären Facharbeiterausbildung, wird den Betroffenen doch damit lediglich die Chance einer minderqualifizierten sog. Werkerausbildung eröffnet.
Die Werkerausbildung ist gegenüber der Facharbeiterausbildung mit etlichen Nachteilen verbunden. Die Ausbildung führt nur zu einer eng spezifizieren anstatt einer breiten Qualifikation. Dies impliziert eine erhebliche Einschränkung der Flexibilität derart ausgebildeter Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinaus bieten sich kaum Qualifikationsmöglichkeiten für einen späteren beruflichen Aufstieg an. Hinzu kommt, daß der so ausgebildete Werker durchschnittlich 30% weniger Entgelt erhält als der vergleichbare Facharbeiter.
Für die Unternehmen hat die derzeitige Praxis einigen Reiz, sind doch mit der Beschäftigung sog. Werker Einsparungen in den Personalkosten zu erzielen. Darüber hinaus dient die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen - auch wenn sie nur in solchen (prekären) Arbeitsverhältnissen erfolgt - der Imagepflege. Wird hier doch ein Beitrag zur Integration Behinderter in die Berufs- und Arbeitswelt erbracht. Daß das soziale Engagement der Arbeitgeber nur eine begrenzte Reichweite hat, zeigt sich an zunehmenden Vorbehalten, Menschen mit Behinderungen eine Vollausbildung zu gewähren. Beispielsweise ist die Zahl der Jugendlichen mit Behinderungen, die außerhalb einer Vollausbildung qualifiziert werden, in den letzten fünf Jahren so rapide angestiegen, daß die Zuwachsrate in den östlichen Ländern 1996 die alarmierende Marke von 20% bereits hinter sich gelassen hat.
In dies Bild paßt die Tatsache, daß sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der Regelungen für eine Berufsausbildung Behinderter von 450 auf 780 fast verdoppelt hat. Dabei läßt sich die Bedeutung dieser Entwicklung nur dann ermessen, wenn man sich vor Augen führt, daß hiermit quantitativ erfaßt ist, in welchem Umfang Möglichkeiten existieren, Jugendliche mit Behinderungen in einer (Schmalspur-) Ausbildung zu qualifizieren. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit nennt diese Entwicklung "bildungs- und geschäftspolitisch bedenklich" und fordert Ende 1996, die als Ausnahme gedachten Ausbildungsverhältnisse "auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren".
Um diesen Zustand zu überwinden, plädieren die Gewerkschaften für die uneingeschränkte Übertragung des Integrationsgedankens der Gesamtschule im allgemeinbildenden Schulwesen auf die berufliche Ausbildungspraxis. Genau wie hier nicht mit Eintritt in die fünfte Klasse die Entscheidung über den Schulabschluß fällt, soll dies auch für die Berufsausbildung gelten. Konkret bedeutet dies, daß allen Jugendlichen mit Behinderungen eine Vollausbildung gewährt wird. Ob die für einen erfolgreichen Abschluß erforderlichen Leistungen voll erfüllt werden können, soll sich im Ausbildungsprozeß zeigen, anstatt den betroffenen Jugendlichen von vornherein nur eine Schmalspurausbildung i. S. der Werkerausbildung zu bieten.
Die Gewerkschaften greifen die gegenwärtige Praxis insbesondere deshalb an, da den Jugendlichen mit Behinderungen hierdurch jede Möglichkeit genommen wird, sich für den normalen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Daß die gewerkschaftliche Kritik zunehmend Anklang findet, läßt auf eine baldige Abhilfe hoffen. Beispielsweise fordert die Bundesanstalt für Arbeit Handwerkskammern usw. auf, dafür zu sorgen, daß auch für Jugendliche mit Behinderungen das normale Vollausbildungsangebot der Regelfall sein soll. In dem Runderlaß 25/90 heißt es: "Es sind zunächst alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Ausbildung in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen zu erreichen". Damit wird jedem Menschen mit Behinderung das grundsätzliche Recht auf eine normale Ausbildung im Gegensatz zu einer (verkürzten) sog. Behindertenausbildung zugesprochen. Weiter heißt es in dem Erlaß: "Bedingen jedoch Art und Schwere der Behinderung eine individuelle Anpassung der Ausbildung, ist initiativ auf eine volle Ausschöpfung der entsprechenden gesetzlichen Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung hinzuwirken. Danach dürfen Behinderte in anerkannten Ausbildungsberufen abweichend ... ausgebildet werden". Ferner heißt es dort: "Damit möglichst viele Behinderte den Abschluß in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf erwerben können, sollte zunächst die Möglichkeit angestrebt werden, während der Ausbildung und auch bei den Prüfungen Erleichterungen und Lernhilfen zu gewähren, um behinderungsbedingte Benachteiligungen auszugleichen". Im Klartext heißt dies: Die Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf muß auch für Jugendliche mit Behinderungen Normalität werden.
Dieser Erlaß liest sich wie ein gewerkschaftliches Positionspapier, wird hierin doch den Jugendlichen mit Behinderungen uneingeschränkt das vorrangige Recht auf eine normale Ausbildung eingeräumt und sogar Erleichterungen zur Bewältigung der Anforderungen in Aussicht gestellt, um behinderungsbedingte Nachteile zu kompensieren. Die Bundesanstalt für Arbeit fordert damit Unternehmen und Kammern unmißverständlich auf, die gegenwärtige Regel wieder zum begründeten Ausnahmefall zu machen. Dieser Appell entspricht der gewerkschaftlichen Vorstellung, allen Jugendlichen mit Behinderungen die uneingeschränkte Möglichkeit für eine Vollausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf zu geben.
Auf dieser Basis läßt sich das Ziel anvisieren, Jugendliche mit Behinderungen nicht nur im Bildungs-, sondern auch im Ausbildungsbereich und in der Berufswelt umfassend zu integrieren. Die Separierung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in WfB, würde damit auf ein Minimum reduziert. Erst wenn eine solche Durchlässigkeit erreicht ist, wird den WfB der Charakter von Abschiebe- und Bewahranstalt genommen. In anderer Weise gilt dies für Berufsbildungswerke (BBW), deren Bemühungen um die volle Integration ihrer jugendlichen Teilnehmer in den normalen Arbeitsmarkt noch wesentlich stärkerer Unterstützung und Akzeptanz durch die Gesellschaft und ihre politischen Repräsentanten bedürfen. Den Berufsförderungswerken (BFW) ist dies erfreulicherweise bereits weitgehend dank intensiver Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern, Arbeitsverwaltung und der freien Wirtschaft gelungen. Allerdings kann kein Zweifel daran bestehen, daß eine größere Bereitschaft zur Integration in den Betrieben und Verwaltungen ihre Arbeit noch erfolgreicher machen würde.
Es ist damit offensichtlich, daß der größte Handlungs- und Nachholbedarf bei den WfB besteht. Dies gilt um so mehr, wenn man sich die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die in den verschiedenen Einrichtungen zur beruflichen Integration beschäftigt werden, vor Augen führt. Anfang der neunziger Jahre waren in den WfB - mit etwa 100.000 - um ein Vielfaches mehr Menschen mit Behinderungen beschäftigt, als in den BBW (ca. 10.000) oder in den BFW (ca. 12.000).
Insgesamt herrscht ein zu geringes Bewußtsein für die Notwendigkeit, Arbeitnehmer mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies hat im wesentlichen seine Ursache im vorherrschenden ökonomischen Denken vieler Unternehmen, wobei soziale Verantwortung zunehmend in den Hintergrund tritt. Die Integration von Menschen mit Behinderungen in den normalen Arbeitsmarkt ist eben keine Selbstverständlichkeit.
Diese Tatsache zeigt sich auch darin, daß die im sog. Ausgleichsfond für die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt alljährlich zur Verfügung stehenden Gelder nicht ausgeschöpft werden. Insgesamt hat dieser Fond ein jährliches Volumen von rund einer halben Milliarde DM. Dieser Fond speist sich aus den von den Unternehmen zu zahlenden Abgaben für die Unter-schreitung der Pflichtquote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Zur Verfügung stehen diese Gelder nicht nur Bildungs- und Förderungseinrichtungen für Behinderte, sondern auch unternehmerischen Initiativen, die sich um eine Integration von Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt bemühen. Von dieser Möglichkeit wird noch zu wenig Gebrauch gemacht. Es ist ein Armutszeugnis, daß unsere Gesellschaft einerseits für 180.000 Schwerbehinderte keine Beschäftigung hat und gleichzeitig die Gelder, die zur Qualifikation und Integration dieser Personengruppe vorhanden sind, nicht ausgeschöpft werden.
Um diese mangelnde Integration zu einem öffentlichen Thema zu machen, haben sich die Träger von Maßnahmen zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderungen in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) zusammengeschlossen. Dieser Vereinigung gehören die Spitzenverbände von Arbeitsverwaltung, Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und ähnliche Einrichtungen an. Die Hauptaufgabe der 1969 gegründeten BAR besteht darin, den Trägern der unterschiedlichen Integrationsmaßnahmen einerseits ein Forum für einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch und andererseits ein gemeinsames Sprachrohr zu bieten. Die BAR hat das Ziel, Defizite und Schwierigkeiten bei der Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt öffentlich zu machen, auf notwendige gesetzliche Veränderungen hinzuwirken und durch eigene Vorschläge und Maßnahmen zur Erhöhung von Wirksamkeit und Erfolg der Reha-Maßnahmen beizutragen. Beispielsweise organisierte die BAR mit Unterstützung des DGB im Jahre 1994 den inhaltlichen Schwerpunkt der Kieler Woche unter dem Thema "Einander verstehen - miteinander leben". Eine Woche lang kamen in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Experten für Behindertenfragen ebenso wie Betroffene zusammen und diskutierten Wege, wie das Leitmotiv "Ich bin behindert, na und?" zum gesellschaftlichen Selbstverständnis werden kann. Eine internationale Konferenz, die im unmittelbaren Vorfeld der Entscheidung des Bundestages über die Änderung des Artikel 3.3 durch den Zusatz "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" von nicht geringer Bedeutung war. Es ist zudem bemerkenswert, daß durch diese massive Werbung auch auf kommunalpolitischer Ebene nachhaltige Erfolge zur weitgehenden Integration von Menschen mit Behinderungen erzielt werden konnten.
Aufgrund dieser und ähnlicher Erfolge ist es notwendig, solche über-institutionellen Bündnisse fortzuentwickeln. Wichtig ist es, daß sich die Gewerkschaften gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Kräften weiterhin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Die Anträge zum 15. Ordentlichen Bundeskongreß des DGB Berlin 1994 lassen an dieser Position keinerlei Zweifel aufkommen. Die Gewerkschaften bekennen sich erneut zum Sozialstaat, denn nur "er verhindert Not und Elend für arbeitslose, ältere, kranke Menschen." (S.114). Auch die Situation Behinderter in allgemeiner und beruflicher Bildung findet ausdrücklich Beachtung, wenn es u.a. heißt: "Bildung hat die Aufgabe, zur gesellschaftlichen Integration beizutragen. Demokratische Bildungseinrichtungen sind Bildungsstätten ohne Aussonderung; ausgrenzende Bildung ist keine Bildung. Die Integration Behinderter ist eine Aufgabe aller Bildungseinrichtungen" (S. 298). Bezüglich der beruflichen Bildung stellt der DGB an anderer Stelle fest: "Darüber hinaus ist die Verpflichtung aufzunehmen, Jugendlichen, die bislang in der beruflichen Bildung prinzipiell benachteiligt waren, durch geeignete Förderungsmaßnahmen den erforderlichen Abschluß einer qualifizierenden Berufsausbildung zu ermöglichen." (S. 324)
Entsprechend eindringlich fallen auch die Ausführungen für Menschen mit Behinderungen im neuen DGB-Grundsatzprogramm von 1996 aus. Dort heißt es, "... notwendige Aufgaben der Sozialpolitik sind: die Sicherung von Erwerbschancen; die Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung; die Integration der Behinderten und ihr Schutz vor gesellschaftlicher und beruflicher Ausgrenzung." (S. 26). Auch in diesem Papier betonen die Gewerkschaften die besondere Aufgabe von Bildung und Erziehung für die Integration der Menschen mit Behinderung: "Behinderte können und sollen mit nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern gemeinsam unterrichtet werden. Die Gesamtschule wirkt sozial ungleich verteilten Chancen entgegen. Sie muß deshalb besonders gefördert werden." (S. 35)
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten zu keinem Zeitpunkt gezögert haben, sich uneingeschränkt für die Integration von Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Hier wurde und wird im positivsten Sinne des Wortes Lobbyarbeit für diejenigen geleistet, die keine Lobby haben.
Die vorgehend thematisierten Aspekte illustrieren in diesem Kontext zweierlei: Einerseits hat der Einsatz für die Rechte Benachteiligter keinesfalls an Brisanz verloren, er nimmt vielmehr permanent zu. Andererseits ist der Einsatz für die Integration von Menschen mit Behinderungen nicht nur von Rückschlägen geprägt: Im Gegenteil, in einigen Bereichen wurden beachtliche Erfolge erzielt. Erfolge, die Mut machen und Kraft geben für weitere Anstrengungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Denn eines ist gewiß: Eine Gesellschaft und ein Bildungssystem, die auf Selektion und Ausgrenzung aufbauen, die Menschen mit Behinderungen nicht als vollwertig anerkennen, sind für eine Demokratie nicht nur ein Makel, sondern schlicht eine Schande.
Das Maß der alltäglichen Integration von Menschen mit Behinderungen bleibt auch künftig ein Prüfstein dafür, inwieweit es gelungen ist, das grundgesetzlich fixierte Menschenbild der Gleichheit aller Menschen in allen Lebensbereichen zu realisieren: Im Kindergarten, in den Grund-, Sekundar-, Berufs- und Hochschulen, in der Aus- und Weiterbildung, in der Berufs- und Arbeitswelt, in der Familie, im persönlichen Umgang miteinander. Die demokratische Utopie universeller Menschenrechte muß in der gesellschaftlichen Alltagspraxis realisiert werden. Dies ist keine Frage des guten Willens oder der politischen Überzeugung, dies ist vielmehr ein durch Grundgesetz und Menschenrechtskonvention geforderter unabdingbarer Grundsatz. Die Vereinten Nationen unterstreichen den Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, wenn es in der "Konvention über die Rechte des Kindes" aus dem Jahre 1990 heißt: "Kein Kind darf aufgrund des Geschlechts, aufgrund von Behinderung, wegen seiner Staatsbürgerschaft oder seiner Abstammung benachteiligt werden." Und an anderer Stelle: "Das Recht auf eine gute Betreuung bei einer Behinderung." Der hier geforderte Anspruch bringt ein human-istisches Menschenbild zum Ausdruck, welches seinen Namen verdient. Er bleibt solange uneingelöst, bis Verschiedenheit und Abweichung von der Norm eine akzeptierte Selbstverständlichkeit sind und kein Anlaß für Ausgrenzung.
Ein langer, steiniger Weg liegt bis zum Erreichen dieses Ziels vor uns. Dies nicht zuletzt deshalb, da die gesellschaftliche Integration Behinderter jedem neoliberalen Politikverständnis zuwiderläuft. Deshalb ist eine breite Allianz nötig, welche die Grundsätze des Bildungs- und Sozialstaates gegenüber allen neoliberalen Anfeindungen entschlossen verteidigt. Die bereits erwähnte gemeinsam von Wohlfahrts-, Sozialverbänden und den Gewerkschaften mit Unterstützung der Kirchen getragene Sozialstaatscharta stellt ein solides Fundament für eine solche Allianz dar. Dies gilt es fortzuentwickeln und mit Leben zu erfüllen.
Gesetze, Konventionen, Entschließungen u.a.:
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, in der zuletzt am 3.11.1995 geänderten Fassung
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vom 30. September 1990
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950
Münchener Erklärung zur Situation behinderter Menschen in Werkstätten für Behinderte vom 10. September 1990
Sozialstaatscharta, Köln 1996
Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 20. März 1952
Adorno, Theodor: Minima Moralia. Frankfurt am Main 1976
Bundesanstalt für Arbeit: Runderlaß 25/90. Nürnberg 1990
Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 30. Juli 1996. 1 BVR 1308/96. Karlsruhe 1996
DGB: 15. Ordentlicher Bundeskongreß des DGB in Berlin vom 13. - 17. Juni 1994 Angenommene Anträge. Frankfurt am Main 1994
DGB: Bildungspolitisches Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbund. Düsseldorf 1982
DGB: Die Zukunft gestalten. Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbund 1996. Düsseldorf 1996
DGB: DGB-Grundsatzprogramm 1949. In: Pfromm, Hans-Adam: Das neue DGB Grundsatzprogramm. Einführung und Kommentar. München Wien 1981
DGB: DGB-Grundsatzprogramm 1963. In: Pfromm, Hans-Adam: Das neue DGB Grundsatzprogramm Einführung und Kommentar. München Wien 1981
DGB: DGB-Grundsatzprogramm 1981. In: Pfromm, Hans-Adam: Das neue DGB Grundsatzprogramm. Einführung und Kommentar. München Wien 1981
DGB Bundesvorstand: Recht auf Arbeit für alle - Behinderte nicht isolieren. Stellungnahme zur Situation und Rechtsstellung Behinderter in Werkstätten für Behinderte (WfB) Typoskript. Düsseldorf 18. April 1989
DGB Bundesvorstand: Forderungen zur Novellierung des Schwerbehindertengesetzes (SchwG). Typoskript. Düsseldorf 30. September 1993
Weizsäcker, Richard von: Rede vor der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte" vom 1. Juli 1993. Typoskript. Berlin 1993
Inhaltsverzeichnis
Ein Kooperationsprojekt der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG) und der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt (G12)
Frank Rogal, Hartmut Sturm, Sonderpädagogen, Geschwister-Scholl-Gesamtschule u. Staatliche Berufsschule Eidelstedt; Norbert Vonday, Gewerbelehrer Fachrichtung Holztechnik, Staatliche Berufsschule Eidelstedt
Die GSG führt seit 1988 einzügig Integrationsklassen, so daß von den etwa 800 SchülerInnen 20 SchülerInnen mit Behinderung sind (v.a. geistigbehindert, lernbehindert, verhaltensauffällig).
In den Integrationsklassen an der GSG stellte sich ab Jahrgang 8 (1991 erstmals) mit Beginn der Berufsorientierung und des 1. Betriebspraktikums die Frage, wie behinderte Jugendliche unter den Bedingungen einer Gesamtschule sinnvoll auf den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt vorbereitet werden können. Da behinderte Jugendliche viel mehr als nichtbehinderte durch konkrete Erfahrung lernen, müssen über längere Zeiträume Lernsituationen geschaffen werden, die im Sinne lebensbedeutender Orientierungshilfen auf den zukünftigen Übergang von der Schule in ein - wie auch immer geartetes - Berufsleben vorbereiten. Dazu gehört der Erwerb von Kompetenzen, die eine gewisse Berufsreife am Ende der regulären Schulzeit gewährleisten, z. B. Interesse an bestimmten beruflichen Tätigkeiten entwickeln, eine Vorstellung vom Leben und Rhythmus in der Arbeitswelt haben, elementare Kenntnisse einfacher handwerklicher Grundfertigkeiten besitzen, Wege zum Arbeitsplatz selbständig bewältigen können und auch Probleme am Arbeitsplatz erleben.
Zentrale Fragestellung für die Pädagogik in I-Klassen bleibt auch hier: Wie kann Unterricht auch in der Berufsorientierung so konzipiert werden, daß nichtbehinderte und behinderte Jugendliche weiterhin gemeinsam lernen und die Erfahrungen und Probleme ihrer Mitschüler dabei kennenlernen und erleben können?
Die Erfahrung der bisherigen Unterrichtspraxis in I-Klassen gab deutliche Hinweise darauf, daß alle handlungsorientiert und projektartig durchgeführten Unterrichtsvorhaben neben den behinderten Schülern in besonderer Weise gerade von den leistungsstärkeren Schülern mit Realschul- oder Gymnasialprognose aufgegriffen worden sind und zu neuen Lernerfolgen geführt haben. Diese Erfahrungen bedeuteten in der Praxis, daß bei projektorientierten Unterrichtsvorhaben
-
integrative Arbeit möglich ist
-
davon viele nichtbehinderte SchülerInnen in besonderer Weise profitiert haben und
-
auch inhaltlich anspruchsvolle Themen realisiert werden konnten.
Die Kooperation mit der Berufsschule Eidelstedt in den Jahrgängen 9 und 10 führte in der Tat zu Unterrichtsprojekten, die im Sinne der oben dargestellten Vorüberlegungen Lösungen ermöglichten:
In Jahrgang 9 und 10 werden in der Gesamtschule an einem Tag in der Woche berufsorientierende Unterrichtsprojekte mit Ernstcharakter durchgeführt. Ernstcharakter bedeutet, es werden Projektziele angestrebt, die außerhalb oder innerhalb der Schule eine tatsächliche Realisierung erfordern. Dabei sollen
-
sich behinderte und nichtbehinderte Jugendliche langfristig konkret beruflich orientieren und sich so mit den Fragen und Problemen des Übergangs in das Berufsleben handelnd auseinandersetzen,
-
sich behinderte Jugendliche und Jugendliche ohne Perspektive auf einen Hauptschulabschluß personell und institutionell auf den Übergang in berufsvorbereitende Maßnahmen in der Sek.II vorbereiten,
-
berufsorientierende Unterrichtsprojekte mit Ernstcharakter weiterhin einen integrativen Unterricht im Bereich "berufliche Orientierung" ermöglichen.
Im Anschluß an die berufsorientierenden Projekte können Jugendliche mit und ohne Behinderung im Rahmen berufsvorbereitender Maßnahmen (Förderungslehrgänge F1i) des Arbeitsamtes (durch-geführt von der G12 und dem "Verein zur Förderung der berufliche Bildung) weitergefördert werden.
Im folgenden werden die berufsorientierenden Projekte im Jahrgang 9 und 10 vorgestellt.
Die Idee, ein Restaurantprojekt an der Hamburger Geschwister-Scholl-Gesamtschule zu initiieren, entstand 1993: Mit der Zielsetzung, Lernen unter Ernstbedingungen zu ermöglichen, entwickelten Lehrer dieser Schule gemeinsam mit Kollegen der Berufsschule G12 ein Projekt, das behinderten und nichtbehinderten SchülerInnen die Gelegenheit bieten sollte, ein kleines Restaurant innerhalb der Schule zu betreiben. Wie die meisten Hamburger Gesamtschulen ist auch die Geschwister-Scholl-Gesamtschule eine Halbtagsschule, die ihrer Schülerschaft bis heute keinen Mittagstisch bietet.
Der Einzugsbereich dieser im Hamburger Westen gelegenen Gesamtschule kann als sozialer Brennpunkt bezeichnet werden. Viele der SchülerInnen wachsen in unvollständigen Familien auf. Die alleinerziehenden Elternteile sind häufig berufstätig, so daß eine "Versorgung" auch über den Unterricht hinaus sinnvoll ist. Diese Nachfrage, auf die bisher nicht reagiert wurde, greift die Idee, ein Restaurant als Projekt zu führen, auf.
Ganz bewußt wurde dabei von den Bedürfnissen und Möglichkeiten der SchülerInnen mit Behinderung ausgegangen: Es galt, ihnen (nach den beiden Berufspraktika in Klasse acht und neun, sowie dem Holzwerkstatt-Projekt in Klasse neun) auch in Jahrgang 10 berufsorientierende Erfahrungen zu ermöglichen und so den Übergang in die Berufsschule vorzubereiten.
Um 9.45 Uhr trifft sich die dreizehnköpfige SchülerInnengruppe mit den vier LehrerInnen. Zuerst wird der Aufgabenplan von den SchülerInnen aus der Bürogruppe, die ihn entwickelt haben, vorgestellt. Fehlt ein Schüler, muß die Gruppe nun festlegen, wer dessen Aufgaben übernimmt. Des weiteren besteht Gelegenheit, Informationen zwischen der Küchen- und der Bürogruppe auszutauschen: Was soll auf die Plakate, die in der kommenden Woche im Schulgebäude ausgehängt werden, hat die Küchengruppe schon festgelegt, was in den nächsten Wochen auf dem Speisenplan steht? Auch für Kritik ist hier Raum (z. B. an den beiden PlakatiererInnen, die Plakate zwar angehängt haben, nicht unbedingt aber an Stellen, an denen es sinnvoll gewesen wäre.
Im folgenden arbeiten die Gruppen für sich. Die Küchengruppe teilt die Aufgaben unter sich auf (Wer ist für das Salatbuffet zuständig, wer backt die Brötchen, wer hat das Gratin im Blick, und wer kümmert sich um die Zubereitung des Nachtisches?). Der genaue Zeitplan wird von Lehrerseite vorgegeben: 11.00 Uhr Brötchen in den Herd, 12.40 Uhr Spaghetti ins Wasser usw.
Bevor die Zutaten aber verarbeitet werden, gilt es, ihre Vollständigkeit zu überprüfen: Hat die Einkaufgruppe etwas vergessen, muß jetzt schnell von einem "Kurier" eingekauft werden. Leerlauf entsteht während der Zubereitung der Gerichte kaum, denn andere Aufgaben (wie z. B. das Mangeln der Tischdecken) müssen parallel dazu erfüllt werden.
In der Zwischenzeit entwirft und druckt die Bürogruppe Plakate, Speisenkarten, Abrechnungsformulare, Kellnerbons, Gutscheine, Statistiken über Einnahmen, Ausgaben sowie Verkaufszahlen der verschiedenen Produkte. Für Aufgabenbereiche, die so umfangreich sind, daß häufig Arbeiten vergessen werden, entwirft und druckt die Bürogruppe Arbeitsplatzbeschreibungen (nicht ohne sich zuvor der Zustimmung aller RestaurantbetreiberInnen versichert zu haben). Diese Arbeit am PC übt auf viele SchülerInnen einen großen Reiz aus, büßt jedoch im Laufe des Projektjahres Attraktivität ein, da sie recht isoliert abläuft. Kommunikation untereinander - in der Küche selbstverständlich - führt hier leicht zu Störungen.
SchülerInnen mit Behinderung, die sich für die Bürogruppe entschieden haben, erhalten weniger komplexe und für sie überschaubare Aufgaben: So gilt es, wöchentlich die Einkaufsbelege aufzukleben, die Beträge mit dem Taschenrechner zu addieren, um dann die ermittelte Summe dem Schüler mitzuteilen, der damit betraut ist, die Statistik über Einnahmen und Ausgaben zu führen. Auch hier wird wieder die Erfahrung gemacht, daß das eigene Tun wichtig und bedeutsam ist im Gesamtzusammenhang: Der "Statistiker" kann erst dann weiterarbeiten, wenn ich ihm die von mir errechnete Zahl nenne. Auch schafft das Wiedererkennen des sich wöchentlich wiederholenden Sicherheit, fördert das Selbstbewußtsein und unterstützt das Selbstkonzept, denn ich erlebe mich in "meinem" Bereich als kompetent.
Um 12.30 Uhr stößt die Bürogruppe wieder zur Küchengruppe. Da das Restaurant von 13 bis 14 Uhr geöffnet ist, bleibt jetzt noch ½ Stunde für Vorbereitungen:
-
Zusätzliche Tische werden aufgestellt.
-
Der Raum wird dekoriert.
-
Mit Stellwänden wird der Küchenbereich vom Restaurantbereich abgetrennt.
-
Die Musikanlage wird angeschlossen.
-
Das Salatbuffet wird aufgebaut.
-
Bestecke werden in Servietten gewickelt.
-
Die Tische werden eingedeckt, mit Milchkännchen, Salz-, Pfefferstreuern, Kerzen und Speisekarten versehen.
-
Die Kasse wird aufgebaut, das Wechselgeld überprüft.
-
Der für den Getränkeausschank zuständige Schüler richtet seinen Arbeitsplatz ein.
-
Die KellnerInnen sprechen die Zuständigkeiten für bestimmte Tische ab.
Ab 13 Uhr ordnen sich drei SchülerInnen den drei verschiedenen Gerichten zu, für deren Ausfüllung sie verantwortlich sind. Gleichzeitig nehmen sich die für "Abwasch 1" eingeteilten SchülerInnen die Töpfe und das Geschirr vor, was nicht mehr in die Geschirrspülmaschinen paßt. Sie werden ab 14 Uhr durch die Gruppe "Abwasch 2" verstärkt.
Die letzten Gäste haben gegen 14.30 Uhr das kleine Restaurant verlassen. Wer von den "MitarbeiterInnen" bis jetzt vor lauter Streß nicht zum Essen gekommen ist, hat nun dazu Gelegenheit. Der Kassierer zieht sich mit der Kasse in eine ruhige Ecke zurück, um sich besser konzentrieren zu können. Bis die Abrechnung stimmt, vergehen meist 45 Minuten.
Jetzt heißt es Durchhalten, denn einerseits ist die "Luft fast raus", und andererseits fallen nun die Aufgaben an, die kaum einem Spaß machen: Aufräumen, Abwaschen, Putzen ...
Der Arbeitstag schließt mit einer Besprechung des ganzen Teams. Hier kann noch Rückmeldung gegeben werden, falls etwas besonders gut gelaufen ist, oder besprochen werden, warum etwas heute über-haupt nicht geklappt hat. Wer von den SchülerInnen "entlassen" wird, entscheiden nicht die LehrerInnen, sondern der "Obmensch", nachdem er überprüft hat, ob alle Jobs zufriedenstellend ausgeführt worden sind.
In dieser Phase geht es darum, den SchülerInnen zu vermitteln, daß es ihr Restaurant ist, das sie selbst gestalten können. Für viele SchülerInnen ist dies eine neue Erfahrung in der Gesamtschule: Identifikation mit einem Projekt, dessen Entwicklung sie selbst steuern und durch das sie Geld verdienen können.
Um die Orientierung bei der Frage "Welche Art von Restaurant wollen wir betreiben?" zu erleichtern, besucht die Projektgruppe ein Restaurant im Stadtteil. Hier gilt es, gezielt zu beobachten, welche Speisenpalette geboten wird, ob die Zutaten frisch sind, wie Service und Kasse organisiert werden, ob lange auf die Gerichte gewartet werden muß, wie es um die Atmosphäre bestellt ist und welche Preise genommen werden.
In diesem mehrere Wochen dauernden Findungsprozeß ("Wollen wir ein anspruchsvolles Restaurant oder eher eine Imbißbude betreiben?") wird von der Gruppe erwartet, daß sie sich auch über einen Namen verständigt, sowie über Öffnungszeit, Preisniveau der Speisen, Ambiente usw. Dabei wird Wert darauf gelegt, sich soweit wie möglich an einem "normalen" Restaurant zu orientieren.
Jeder, der die anonyme Architektur der typischen Gesamtschulkomplexe aus den 70er Jahren kennt, wird nachvollziehen können, wie schwierig es ist, einen Raum in einem solchen Gebäude so zu verändern, daß er den Charme eines kleinen Restaurants ausstrahlt. Diese Herausforderung wird aber von der Projektgruppe (oder besser: einigen SpezialistInnen, die sich für diese Aufgabe entscheiden) phantasievoll angegangen: Pflanzen, Bilder, weiße Tischdecken, Kerzen, Hintergrundmusik und mehr werden besorgt.
Schließlich müssen alle MitarbeiterInnen zum Gesundheitsamt, um sich das für den Lebensmittelverkauf erforderliche Gesundheitszeugnis ausstellen zu lassen. Einigen wird hier erst bewußt, daß Restaurant nicht nur gespielt, sondern Ernst gemacht wird.
Doch fragen auch KollegInnen und SchülerInnen ungeduldig, wann endlich eröffnet wird, zunächst muß die Gruppe sich auf die Arbeitsaufteilung verständigen, geeignete Rezepte heraussuchen, Probekochen, Werbung betreiben, Preise kalkulieren und vieles mehr. Um einen guten Start zu gewährleisten, ist der Planungs- und Vorbereitungsaufwand beträchtlich. Nicht alle SchülerInnen können dies leicht aushalten. Einige halten die Sitzungen für "übertrieben" und würden am liebsten gleich loslegen, anstatt zu "labern".
Die Fragestellung, welches Maß an Spezialisierung zum Nutzen des Projekts einerseits, für die Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen andererseits, anzustreben ist, zieht sich wie ein roter Faden durch das Projektjahr. Dabei weisen die PädagogInnen die SchülerInnen auf den Maßstab hin: einem "richtigen" Restaurant auch in der Organisation der Arbeit möglichst nahe zu kommen.
Zu Beginn durchlaufen alle TeilnehmerInnen die beiden Bereiche (Küche, Bistro). Im Anschluß entscheiden sie sich für die kontinuierliche Arbeit in einem dieser Felder. Je nach Interessen und Vorerfahrungen der teilnehmenden SchülerInnen wurden in jedem Jahr andere Modelle entwickelt:
-
Die Gruppen werden nach Zeiträumen von wenigen Wochen ausgetauscht.
-
Nach einem halben Jahr erfolgt der Wechsel.
-
Es findet kein Wechsel statt.
-
Einzelne SchülerInnen wechseln die Gruppen.
Gibt es zuwenig Bewegung zwischen den Gruppen, entsteht die Gefahr, daß SchülerInnen die Arbeit ihrer "KollegInnen" aus der anderen Gruppe zu wenig wertschätzen (da sie sie kaum selbst erfahren haben).
In Abständen von mehreren Wochen ist es erforderlich, das Restaurant einmal geschlossen zu halten. Diese "Verschnaufpausen" haben sich bewährt, um
-
der Gruppe Gelegenheit zu geben, die Auswahl an Gerichten für die kommenden Restauranttage zu treffen und
-
über den Wegfall des Produktionsdrucks Raum für Reflexion und daraus evtl. resultierende Veränderungen zu schaffen.
Der letzte Öffnungstag des Restaurants ist der Ernstfall: Die SchülerInnen betreiben ihr Restaurant an diesem Tag in Eigenregie. Die PädagogInnen des Projekts halten sich aber im Schulgebäude auf, um im "Notfall" Unterstützung leisten zu können. Die SchülerInnen nehmen diesen besonderen Arbeitstag sehr ernst: Sie tragen mehr Verantwortung, müssen auch mehr Streß aushalten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, daß sich das Wagnis, sich als Pädagoge auch einmal zurückzuziehen, lohnt (auch wenn uns das nicht leicht fiel). Viele SchülerInnen arbeiten mit höherer Motivation, nehmen die Herausforderung an, im entscheidenden Moment die Leistung zu bringen und das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.
Die Gruppe beginnt sich selbst zu regulieren, übt auch Druck auf MitarbeiterInnen aus, die weniger arbeiten als andere. Dieser Druck, der sonst von LehrerInnenseite ausging, bewirkt an diesem Tag aber mehr: Michael, der sich dem Abwasch bereits entzogen hatte, setzt seine Arbeit schließlich fort! Und was wir LehrerInnen zunächst nicht wahrhaben wollten, bestätigt sich nun doch: Die SchülerInnen arbeiten besser, wenn wir nicht daneben stehen.
Um den Eltern die Gelegenheit zu geben, das von ihren Kindern geführte Restaurant zu besuchen, sich von ihnen bekochen und bedienen zu lassen, wird es an einem Abend speziell für sie geöffnet. An diesem Tag nimmt die Gruppe ihre Aufgabe besonders ernst und entwickelt großen Ehrgeiz. Schon kleine Mißgeschicke werden als peinlich empfunden, dies gilt insbesondere für den Servicebereich, da die hier beschäftigten SchülerInnen den direkten "Kunden-kontakt" haben.
Jedes der (bis heute vier) Restaurantprojekte hat eine eigene Form gefunden, den einjährigen Prozeß zu dokumentieren: Rezept-sammlung, Videofilm, Zeitung, Kochbuch mit Vorstellungen der SchülerInnen und kleinen Artikeln. Unterschiedlich war der Grad an Identifikation mit der Erstellung der Dokumentation: Machte es eine Schülerin zu ihrer Sache, einen Videofilm zu drehen und zu schneiden (mit Lehrerunterstützung), gab es im nächsten Jahr Probleme, den SchülerInnen die Dokumentation als etwas Sinnvolles zu vermitteln. Nach Überwindung der Startschwierigkeiten und schließlich mit der frisch gedruckten Broschüre in Händen wußte es die "Belegschaft" des kleinen Restaurants aber durchaus zu schätzen, eine Erinnerung an die Mitarbeit in diesem ganz besonderen Projekt auch schwarz auf weiß zu haben.
Das letzte Treffen der Projektgruppe ist der Auswertung gewidmet: Sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form wird Bilanz gezogen, Kritik geübt und werden Vorschläge gesammelt, die darauf zielen, das Restaurant zu verändern. Bewährt hat sich die Widerspiegelung von Äußerungen, die die SchülerInnen zu Beginn des Projektes abgaben ("Ich freue mich besonders auf ...", "Ich befürchte, daß ..." usw.) So wird für die ProjektteilnehmerInnen die eigene Entwicklung innerhalb dieses einen Jahres im Rückblick nachvollziehbar.
Der erwirtschaftete Gewinn kommt der Gruppe selbst zugute. Über die Verwendung wird mehrheitlich entschieden. Bedingung: Das Geld wird im Rahmen einer Gruppenaktivität ausgegeben. Bisher entschieden sich die Gruppen dafür, von dem verdienten Geld
-
eine Exkursion zur "Produktionshochschule" in Svendborg/Dänemark
-
einen Restaurantbesuch mit anschließendem Musicalbesuch
-
einen Kegelabend inkl. Restaurantessen
zu finanzieren. Auszahlungen an einzelne SchülerInnen - obwohl häufig gewünscht - werden abgelehnt.
Während die anfallenden Arbeiten an dem Tag, an dem das Restaurant geöffnet ist, von einer Gruppe aus behinderten und nichtbehinderten SchülerInnen erledigt werden, wird der Einkauf am Vortag ausschließlich von den behinderten SchülerInnen der 10. Integrationsklasse durchgeführt.
Im wesentlichen läuft der Einkauf in vier Schritten ab, für die drei bis vier Unterrichtsstunden benötigt werden:
1. Ausgehend von der Liste der zu kaufenden Zutaten kontrollieren die SchülerInnen (je nach Klasse zwei bis vier) den Lagerbestand.
2. Die nicht ausreichend vorhandenen Lebensmittel werden auf Listen festgehalten. Die Unterstützung hierbei erfolgt differenziert: Je nach erreichtem Stand im Lese-/Schreiblernprozeß werden die Begriffe
-
selbständig geschrieben,
-
nachdem der Lehrer langsam lautiert hat, geschrieben,
-
die Anfangsbuchstaben geschrieben,
-
die Lebensmittel skizzenhaft gezeichnet,
-
die Lebensmittel zeigenden Piktogramme aufgeklebt.
3. In den Geschäften kaufen die SchülerInnen mit Hilfe ihrer Listen selbständig ein. Finden sie ein bestimmtes Produkt nicht, werden sie vom Pädagogen dazu ermutigt, das Personal anzusprechen.
4. Wieder in der Schule angekommen, müssen die Lebensmittel eingeräumt werden: Die SchülerInnen müssen nun darüber entscheiden, wo sie bis zum nächsten Tag gelagert werden sollen (Schrank, Kühlschrank, Tiefkühltruhe usw).
-
Persönliche Bedürfnisse hinter die Erfordernisse des Projektes zurückstellen können Die Einkaufsliste ist verbindlich, auch wenn sie Zutaten für ein Gericht enthält, was dem einkaufenden Schüler nicht schmeckt.
-
Spezialisierung als sinnvoll begreifen Verschiedene Zuständigkeitsbereiche kristallisieren sich mit der Zeit heraus, was dazu führt, daß im Sinne des Projektes effektiver gearbeitet wird, gleichzeitig wird dem Schüler über das Erkennen von Vertrautem (jede Woche die Zutaten für das Salatbuffet einkaufen) ein Erfolgserlebnis durch Handlungskompetenz (in diesem Bereich) ermöglicht.
-
Sich und sein Tun als bedeutsam für das Projekt begreifen Ohne die eingekauften Zutaten kann die Küchengruppe am folgenden Tag nicht arbeiten. "Feierabend" kann deshalb nicht dann sein, wenn eine best. Zeit verstrichen ist (wie sonst in der Schule üblich), sondern erst dann, wenn die Arbeit erledigt ist. Vielen SchülerInnen, die sich daran gewöhnt haben, daß um 13.35 Uhr Unterrichtsschluß ist, fällt es schwer, hier "umzudenken".
-
Selbst Geschriebenes als wichtig erleben Der vom Umfang weit über den häuslichen Einkauf hinausgehende Großeinkauf wird erst durch das Hilfsmittel Einkaufsliste möglich.
-
Im Umgang mit Geld sicherer werden Bevor die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt fällt, werden Preisvergleiche angestellt.
-
Wissen, daß Lebensmittel unterschiedlich haltbar sind Das Haltbarkeitsdatum muß überprüft werden.
-
Mit Lebensmitteln angemessen umgehen Empfindliche Waren müssen auf Dosen etc. gelegt werden, nicht umgekehrt.
-
Sich orientieren können Dies bezieht sich sowohl auf die Wege zu den verschiedenen Geschäften, als auch auch auf das Zurechtfinden innerhalb der Läden.
-
Sich zu helfen wissen Für viele SchülerInnen bedeutet es eine große Überwindung, eine fremde Person des Personals um Unterstützung zu bitten.
-
Oberbegriffe bilden können Durch den Transport in unterschiedlich farbigen Kisten wird die Zuordnung zu Produktgruppen (Milchprodukte, Gemüse, Obst etc.) erleichtert.
Warnung
Dieser Absatz wurde vom Konverter eingefügt, weil LogicTran hier eine falsche Struktur erzeugt. Eine 'section' kann nicht aus einem 'title'(Überschrift) alleine bestehen. Hätten die möglicherweise nachfolgenden Elemente eine Ebene tiefer liegen sollen? Bitte bereinigen Sie die Dokumentstruktur und führen sie die Konvertierung nochmals durch!
Entsprechend der Projektidee ist bzgl. des zeitlichen Ablaufs vieles denkbar, sofern es nicht Produktion, Verwaltung, Verkauf erschwert oder behindert. Den teilnehmenden SchülerInnen eröffnen sich also Freiräume (Arbeitsrhythmus, Musik hören bei der Arbeit usw.), die sie im - dem 45-Minuten-Takt unterworfenen - Unterricht sonst nicht genießen:
-
Die Arbeitszeit wird von der Gruppe selbst festgesetzt. Der Stundenplan spielt an diesem Tag keine Rolle.
-
Entscheidet sich die Projektgruppe dafür, Gerichte über den üblichen Rahmen hinaus anzubieten, z. B. an einem Stand am Tag der offenen Tür o.ä., dann ist die Teilnahme freiwillig. Den Verdienst teilen diejenigen SchülerInnen unter sich auf, die die Arbeitsleistung erbracht haben.
-
Jedem Schüler steht ein Pausenkontingent von 45 Minuten zu. Wie und wann die Pausen genommen werden, entscheidet jeder selbst. Bedingung: Pausen müssen sinnvoll genommen werden, d.h. in Phasen hoher Arbeitsdichte verbieten sie sich von selbst. Um für alle transparent zu machen, wer wann Pause macht, werden sie von den SchülerInnen an der Tafel festgehalten.
-
Um zu verhindern, daß die ProjektteilnehmerInnen durch den zeitlichen Umfang ihrer Arbeit gegenüber ihren MitschülerInnen, die nicht an diesem Projekt teilnehmen, benachteiligt werden, wurden zwei Ausgleiche geschaffen:
1. Jeder Schüler darf einmal im Laufe des Jahres früher Feierabend machen.
2. Die Projektgruppe erhält einen "Urlaubstag".
Das, was das Restaurantprojekt von anderen Projekten in Gesamtschulen unterscheidet, ist die Anleitung durch KollegInnen zweier Schultypen: Gesamtschule und Berufsschule. Diese Zusammenarbeit hat sich als äußerst fruchtbar erwiesen und war die Voraussetzung dafür, daß dieses Projekt sich zu der Form entwickeln konnte, die wir heute kennen. GesamtschullehrerIn und BerufsschullehrerIn bringen unterschiedliche Vorerfahrungen in das Projekt ein, die unterschiedliche Herangehensweisen - sowohl an SchülerInnen, als auch an die "Sache" - zur Folge haben.
Verkürzt dargestellt, haben die Kollegen der Berufsschule (Handelslehrer, Gewerbelehrer) sich dafür eingesetzt, in das Restaurant so wenig Schule wie möglich und so viel Professionalität wie möglich einfließen zu lassen. Die KollegInnen der Gesamtschule (Sonderschullehrer, Regelschullehrerin, Sozialpädagogin) brachten ihre Kenntnis der Lerngruppe ein, besonders auch der SchülerInnen mit Behinderungen, eine Bedingung, da die Arbeit - gerade mit geistigbehinderten SchülerInnen - für die BerufsschullehrerInnen neu war.
Über die kontinuierliche Zusammenarbeit kam es zu einem Kompetenztransfers, der es beiden Berufsgruppen heute ermöglicht, auch die "andere" Perspektive einzunehmen - zu Beginn des Projekts vor vier Jahren so nicht denkbar. Trotzdem darf nicht das Mißverständnis entstehen, daß nach dieser bereichernden "gegenseitigen Fortbildung" die Mitarbeit der BerufsschullehrerInnen im Projekt verzichtbar wäre. Im Gegenteil: Erst sie gewährleisten, daß die Abbildung beruflicher Realität in der Gesamtschule auch in Zukunft auf hohem Niveau erfolgt.
Das Restaurantprojekt in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule wurde erst dadurch möglich, daß die Schulleitung es als bedeutsam für Schulentwicklung und damit unterstützenswert anerkannte. Bis es soweit war, mußte der lange Weg der Überzeugungsarbeit gegangen werden. Heute genießt das Projekt Priorität bei der Stundenplangestaltung, eine Voraussetzung dafür, daß die Abkoppelung vom komplexen Stundenplan einer Gesamtschule am Projekttag gelingt. Das Projekt wird in der ganzen Schule nicht mehr nur geduldet - wie in der Anfangsphase - sondern gewollt und aktiv unterstützt. Die Akzeptanz des Projekts im Kollegium ist hoch, u. a. daran zu erkennen, daß KollegInnen immer wieder Nachteile, die ihnen durch das Restaurant entstehen, in Kauf nehmen (z. B. evtl. höhere Schülerfrequenzen in den parallel stattfindenden Kursen).
In den Projekttag fließen die Unterrichtsfächer Arbeitslehre (2 Stunden), Wahlpflichtkurs Arbeitslehre (2 Stunden), Deutsch (1 Stunde) und Politik (1 Stunde) ein. Die teilnehmenden SchülerInnen müssen folglich in Kauf nehmen, eine Deutsch- und eine Politikstunde pro Woche zu versäumen. Es wird erwartet, daß sie sich eigenverantwortlich darum bemühen, die Unterrichtsinhalte der verpaßten Stunden nachzuholen.
Leistungsbewertung im Restaurantprojekt erfolgt durch eine Note im (obligatorischen) Fach Arbeitslehre sowie im Wahlpflichtkurs Arbeitslehre.
Abschließend soll auf einige Erfahrungen eingegangen werden, die in den vier Jahren, die das Restaurantprojekt nun läuft, gesammelt wurden:
-
Ein Projekt lebt von zu lösenden Problemen. Diese Probleme müssen "echt" sein und dürfen nicht erst künstlich durch PädagogInnen geschaffen werden. Zuviel Routine - eine Gefahr gerade nach mehrjährigem Restaurantbetrieb - mag die Qualität des Produktes steigern, der Prozeß aber leidet hierunter. Probleme im Sinne der Projektidee sind also gerade die Chance, Lernanlässe zu schaffen. Zuviel Routine und reibungsloser Ablauf sollten eher mißtrauisch stimmen.
-
Das Team aus PädagogInnen sollte nicht zu groß sein. Anstelle von vielen KollegInnen, die aber nicht den ganzen Projekttag zur Verfügung stehen, ist ein Team aus wenigen (max. vier) KollegInnen vorzuziehen, das dafür aber durchgängig präsent sein sollte.
-
Zu viele anwesende PädagogInnen an einem Arbeitsplatz (egal ob Küche oder Büro) können dazu führen, daß SchülerInnen sich zu sehr auf sie verlassen, in der Folge weniger gefordert und aktiv sind.
-
Einige leistungsstarke SchülerInnen in der Projektgruppe sind wünschenswert. Eine Gruppe, die sich aus behinderten SchülerInnen und nichtbehinderten, aber relativ schwachen SchülerInnen zusammensetzt, läuft Gefahr, sich schnell "im eigenen Saft zu drehen". Wichtige Impulse starker SchülerInnen, die das Projekt beleben, entfallen. Eine möglichst heterogen zusammengesetzte Gruppe ist also anzustreben.
Inhaltsverzeichnis
Norbert Vonday, Gewerbelehrer Fachrichtung Holztechnik
In diesem Projekt sollte anhand von ein oder zwei Produkten das fachgerechte Planen, die Materialbeschaffung, die Fertigung und die Vermarktung dieser Produkte erfahrbar gemacht werden. Ein weiterer Gesichtspunkt war die gemeinsame Grundfinanzierung bzw. Vorfinanzierung und das Erzielen von Gewinn.
Die Integrationsklasse bestand aus 10 Schülerinnen und zehn Schülern im Alter von etwa 15 Jahren. Von diesen gelten jeweils zwei Mädchen und drei Jungen als behindert (Körperbehinderung, Lernbehinderung, Verhaltensauffälligkeiten). Alle fünf können lesen und schreiben. Die Gruppe wird von einer Gesamtschullehrerin und einer Sonderpädagogin angeleitet. Von der G12 wurde ein Gewerbelehrer, Fachrichtung Holztechnik, für das Projekt abgeordnet.
Für die Gruppenteilung standen uns der Klassenraum mit Nebenraum (ein Arbeitslehreraum mit Schraubstöcken und Schultischen) und ein Werkraum mit Hobelbänken zur Verfügung. (Der Arbeitslehreraum erschien uns mit seinen Schraubstöcken für ein Holzprojekt in dem geplanten Umfang ungeeignet. So fügte es sich gut, daß in der G12 ungenutzte Hobelbänke zu finden waren und ein leerer Klassenraum in der GSG)
Die materiellen Voraussetzungen waren somit gut, was die gesamte Arbeit sehr unterstützt hat.
Während der ersten Phase sollten alle Schüler, unabhängig von ihren Neigungen und Fähigkeiten, an alle anfallenden Arbeiten herangeführt werden. Wir teilten die Klasse in zwei funktionsfähige Gruppen von jeweils 9 (Gruppe A) und 11 (Gruppe B) SchülerInnen auf. Nach einem gemeinsamen Einführungstag wurde eine Gruppe zur Produktions- und die andere zur Verwaltungsgruppe. Jeweils drei bis vier Wochen arbeiteten die SchülerInnen in jeweils einer der Gruppen. Anschließend wechselten die Gruppenmitglieder. Im gleichen Rhythmus wechselte auch die Zweitbetreuung in der Produktionsgruppe. So hatte die Produktionsgruppe A immer die Sozialpädagogin und die Produktionsgruppe B immer die Sonderschul-lehrerin als Zweitkraft. Dazu kamen noch durchgängig zwei Hospitationsstunden eines Kollegen der GSG.
Wir begannen das Projekt an einem Freitag mit der noch ungeteilten Klasse und stellten zunächst einige Überlegungen zum Berufsleben an, welches die SchülerInnen in den auf sie zukommenden 40 Berufsjahren vielleicht erleben werden. Dabei gingen wir von der These aus, daß in Zukunft die Mehrzahl der berufstätigen Menschen wahrscheinlich innerhalb ihrer Lebensarbeitszeit diverse Berufe ausführen wird, die womöglich ganz andere sein werden, als der zunächst erlernte Beruf. Die Menschen werden wahrscheinlich recht erfinderisch im Geldverdienen werden müssen. Unter diesem Eindruck wurde dann auch unser Ziel formuliert: "Wir wollen zusammen Geld verdienen". Dazu gründeten wir eine kleine Firma, die später den Namen "Wood Pecker AG" erhielt. Es wurde ein Eigenkapital von 10,-DM je beteiligter Person vereinbart. Dieses Startkapital von 240,-DM gab uns den ersten materiellen Handlungsspielraum.
Um das Anlaufen der Produktion im Vorhinein strukturieren zu können, hatte sich das Team entschlossen, ein Produkt mit überschaubarem Schwierigkeitsgrad und Materialeinsatz vorzugeben. Unser erstes Produkt sollte ein Strandstuhl sein, wie er z. B. an der Bergedorfer Gesamtschule im Arbeitslehreunterricht in Einzelfertigung hergestellt wird. Wir wählten die Produktionsform einer Kleinserie unter möglichst professionellen Bedingungen, auch mit dem Einsatz von Maschinen.
Auch wenn im Rahmen des Projektes keine grundlegende Einführung in das Technische Zeichnen erfolgen kann, so bemühten wir uns doch zunächst um die Erstellung einer weitgehend normgerechten Zeichnung des Werkstückes und die Erstellung einer Materialliste. Jede der beiden Gruppen erstellte zunächst nur eine Zeichnung der Stuhllehne bzw. der Sitzfläche. Es folgte anhand von beiden Zeichnungen eine Ermittlung der Rohmenge, die von uns beim Holzhändler erworben werden mußte, und der Holzeinkauf.
Im Anschluß an diese Vorbereitungsarbeiten erfolgte der Grobzuschnitt und das Aushobeln und Zuschneiden des Materials im Maschinenraum. Dabei waren jeweils zwei SchülerInnen zum Bearbeiten ihres Materials anwesend. Die anderen befaßten sich derweil mit der zweiten technischen Zeichnung und einer motivierenden Nebenarbeit für den privaten Gebrauch. (Es handelte sich um ein farbig gestaltetes Puzzle aus Sperrholz, welches nahezu ungeteilten Anklang fand.)
Mit Hilfe von Kleinmaschinen (Oberfräse, Bandschleifer und Ständerbohrmaschine) wurde in der dritten vierwöchigen Sequenz der Strandstuhl in seinen Einzelteilen hergestellt und die Teile noch vor dem Zusammenbau grundiert und lasiert.
Parallel zu diesen Tätigkeiten wurde von einer kleinen Untergruppe mit wechselnder Beteiligung der Bezugsstoff für die Stuhllehnen an den elektrischen Nähmaschinen in der Schneiderwerkstatt der Schule hergestellt.
Schließlich wurden die meist farbig gestalteten Teile verschraubt und mit dem Lehnenbezug versehen.
Nach vier oder fünf Gruppenwechseln war die erste Phase unserer Produktion damit vor den Hamburger Frühjahrsferien abgeschlossen. Der Großteil des Schuljahres lag hinter uns.
Die Verwaltungsgruppe hatte zunächst die Aufgabe, die Finanzen des Projektes zu regeln. Das Startkapital von 10,-DM wurde jedem Beteiligten durch eine Aktie mit entsprechendem Wert bestätigt.
Um die Materialkosten des ersten Produktes so gering wie möglich zu halten, bemühte sich diese Gruppe um Sachspenden bei verschiedenen Firmen, was auch recht erfolgreich war. So stiftete uns die Firma Auro die Grundierung und Lasuren in diversen Farbtönen. Einige Markisenhersteller überließen uns viele Meter von Markisenstoff, den wir zum Bespannen der Rückenlehnen unserer Strandstühle benötigten. Mit einem Materialpreis von etwa 9,-DM für das Holz kalkulierte die Gruppe einen Verkaufspreis von 25,-DM je Stuhl. Dieser Preis erschien uns erzielbar und enthielt auch eine angemessene Gewinnspanne.
Unabhängig vom jeweiligen Gruppenwechsel, der sich aus der Produktionsgruppe ergab, wurden in der Verwaltungsgruppe immer die gerade anfallenden Arbeiten erledigt, es erfolgte also keine Wiederholung der Tätigkeiten, was wegen deren Art auch nicht möglich gewesen wäre.
Vorbereitend für die zweite Phase, war die Entwicklung einer weiteren Produktidee notwendig. Dazu wurden Erkundungen in einschlägigen Geschäften angestellt, Produkte und Preise verglichen und auf ihre eventuelle Realisierbarkeit mit unseren beschränkten Möglichkeiten überprüft. Schließlich einigte man sich auf zwei Vorschläge: einen Dreieckstisch und einen Gartenklapptisch. Um die endgültige Auswahl zu treffen, wurde eine Befragung bei Eltern und Kollegen der Schule durchgeführt, die zu dem Ergebnis führte, den Gartenklapptisch zu einem Abgabepreis ohne Oberflächenbehandlung von 140,-DM herzustellen.
Da unser Kapital samt einem Darlehen aus dem Haushalt der G12 schon aufgezehrt war, mußte für die zweite Produktion eine andere Art der Finanzierung entwickelt werden. Die Verwaltungsgruppe warb zu diesem Zweck mit Hilfe unseres Prototyps, einem eigens dafür erstellten Werbefilm und einem lebenden Stilleben von einem sommerlichen Gartenfrühstück um Käufer. Diese mußten mit der Bestellung eines Tisches eine Vorauszahlung von 100,-DM leisten, was uns die Möglichkeit zur Materialbeschaffung gab. Da wir in diesem Fall nicht auf Spenden bauen konnten, lag unsere kalkulierte Gewinnspanne nur bei etwa 60,-DM. Bei 11 Tischbestellungen ergibt das aber auch eine recht erfreuliche Summe.
Weil die Herstellung des Strandstuhles mehr Zeit als eingeschätzt gedauert hatte, entschlossen wir uns für den zweiten Produktionsdurchgang zu einer Gruppenteilung, die über die gesamten noch verbleibenden sechs Wochen Bestand haben sollte. Die SchülerInnen konnten dazu ihre Wünsche äußern und sich für die Produktionsgruppe oder die Verwaltungsgruppe bewerben. Auf diese Weise entstand eine hoch motivierte Produktionsgruppe, die wegen der knappen Zeit auch recht konzentriert produzieren mußte, um die bestellten und vertraglich zugesagten Gartentische termingerecht herstellen zu können.
Wir verzichteten in diesem Fall auf das Erstellen einer technischen Zeichnung, sondern legten den Schwerpunkt auf das möglichst selbständige Entwickeln von Vorrichtungen, die uns eine Serienproduktion mit Hilfe von Kleinmaschinen ermöglichen sollten. Weil die damals meist von mir vorbereiteten Vorrichtungen aus der Stuhlproduktion den SchülerInnen noch eindrucksstark in Erinnerung geblieben waren, gelang es ihnen, diese Konstruktionsaufgabe auf erfreuliche Weise zu lösen. Auch die anschließende Fertigung hat bisher reibungslos geklappt.
Zur Zeit hat die Gruppe noch zwei Produktionstage zur Verfügung, und es scheint, als ob die 11 Tische termingerecht fertiggestellt würden.
Die Verwaltungsgruppe arbeitete in dieser Zeit mit unterschiedlichem Erfolg. Während die Produktionsgruppe in ihre letzte heiße Phase trat, war die Verwaltung mit der Werbung und dem Abschluß der Kaufverträge beschäftigt.
Zum Schluß hat sich die Gruppe mit der Auslieferungsorganisation der Stühle und Tische befaßt, eine Abschlußbilanz erstellt und noch eine Gesamtpräsentation für die Schulgemeinschaft vorbereitet. Diese Arbeiten wurden wieder mit Lust und Einfallsreichtum erledigt.
Während der Abschlußveranstaltung fand ein Rückblick auf den Beginn des Projektes und unsere Ausgangsfragen nach Berufstätigkeit und der Möglichkeit, sich auf verschiedenste Art und Weise sein Geld zu verdienen statt. Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Was hätte anders laufen sollen, welches waren die Höhepunkte? Aber vor allem natürlich: Wieviel Geld haben wir denn nun verdient, und was stellen wir damit an?
Das Holzprojekt sollte den behinderten SchülerInnen (2 Mädchen und 3 Jungen) nach dem 1. Berufspraktikum weitere berufsvorbereitende Erfahrungen ermöglichen. Sie sollten - zwar immer noch in einem "Schutzraum" - einen Vorgeschmack auf die Arbeitswelt bekommen.
Die behinderten Mädchen wurden der Gruppe A, die 3 Jungen der Gruppe B zugeordnet. Es fand keine spezielle Behindertenbetreuung statt, sondern es gab gezielt Hilfen von LehrerInnen und SchülerInnen der jeweiligen Gruppe.
In der ersten Phase wurden sie - unabhängig von ihren Neigungen und Fähigkeiten - an alle anfallenden Arbeiten herangeführt. Sie waren in ihre Gruppe (Verwaltung oder Produktion) integriert und arbeiteten oft in Kleinteams.
Nachdem alle SchülerInnen im Wechsel in der Verwaltung und der Produktion gearbeitet hatten, wurden sie in der Intensivphase nach ihren Fähigkeiten eingeteilt; die behinderten SchülerInnen erhielten überschaubare Aufgaben.
Für sie war es auch mit Hilfe oft sehr schwierig, planvoll und genau zu arbeiten, da keine Ausschußware produziert werden durfte.
Auch ihr Durchhaltevermögen wurde auf eine harte Probe gestellt, denn gerade in der Produktion waren die überschaubaren Aufgaben oft die wenig geliebten (wie z. B. Schleifen der Holzflächen, Lackieren etc.)
Es überwogen aber bei weitem die positiven Erfahrungen, wie z.B.:
-
Integration der Behinderten in die Verwaltungs- und Produktionsgruppe (jede Hand und jeder Kopf wurde gebraucht!)
-
Produktorientierte und kollegiale Zusammenarbeit
-
Trainieren von planvollem und genauem Arbeiten
-
Kennenlernen unterschiedlicher Arbeitsbereiche
-
Erweiterung der eigenen Handlungskompetenz durch Kennenlernen und Heranführen an neue Arbeitsbereiche
-
"Hineinschnuppern" in die Arbeitswelt
Alle diese Erfahrungen gaben den SchülerInnen mit Behinderungen das Gefühl, ein wichtiges Mitglied ihres Teams zu sein.
Gerade in den letzen Wochen (Intensivphase), wo unter Zeitdruck gearbeitet werden mußte, motivierten einige durch ihr Engagement ihre MitschülerInnen.
Ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Projekt ist die positive Zusammenarbeit mit der Gewerbeschule 12, da fast alle behinderten Schüleren nach der 10. Klasse in berufsfördernde Maßnahmen gehen werden.
Durch den kontinuierlichen Kontakt zum Gewerbeschullehrer wird den Behinderten ein Übergang zur G12 erleichtert. Und auch die G12 kann sich gegebenenfalls auf die zu erwartenden Schüler einstellen.
Rückblickend läßt sich für unser Team in jedem Fall sagen, die Sache hat sich gelohnt. Der Kraftaufwand war manches Mal erheblich, auch die Vorbereitung der Holzberge ging über das zunächst erwartete Maß hinaus. Dies war vor allem deshalb zeitaufwendig, weil der schulische Maschinenraum Mitte des Schuljahres wegen nicht ausreichender Staubabsaugung gesperrt wurde. Aber es gab viele wunderbare Momente oder sogar längere Zeiträume, in denen die Arbeitsatmosphäre voll Produktivität war, kaum ein mauliges Wort zu hören war und die SchülerInnen wie selbstverständlich bei ihrer Aufgabe waren.
Zu diesem Erfolg hat wesentlich der Einsatz der Kleinmaschinen und Vorrichtungen beigetragen. Auf diesem Gebiet sind nun allerdings noch einige Nachverhandlungen mit dem Institut für Lehrerfortbildung zu führen, weil wir an mancher Stelle über das erlaubte Maß hinausgegangen sind. Aus meiner Erfahrung in der Tischlerausbildung erschien mir dieses Vorgehen aber vertretbar. Die von uns eingesetzten Vorrichtungen garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit und Arbeitsgenauigkeit, so daß wir uns davon auch einige Überzeugungskraft für die o.g. Verhandlungen versprechen.
Für die SchülerInnen entstand durch das Projekt ein eindrucksvoller Einblick in die Produktion von Tischlerei-Erzeugnissen. Von der Pro-duktauswahl, der Kalkulation, über den ersten Strich auf dem Zeichenblatt, der Materialliste, dem Holzeinkauf bis zum fertig oberflächenbehandelten Stück und schließlich zur Vermarktung und Auslieferung an die hoffentlich zufriedenen Kunden wurde so alles erlebbar, wie es in der Tischlerei auch nicht viel anders stattgefunden hätte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Integrationsversuch in der Sek I der IGS Köln Holweide
- 2. Das Berufsorientierungskonzept an der IGS und seine Veränderungen im gemeinsamen Unterricht
- 3. Betriebsprojekte als ganzheitlicher lebens- und zukunftsorientierter Ansatz
- 4. Der Schulstraßen - Kiosk
- 5. Die Druckerei
- 6. Betriebsprojekte sind ein Schritt in die richtige Richtung
Thomas Wieners, Ludger Deckers, Sonderpädagogen in Köln
Seit dem Schuljahr 1986/87 werden an unserer Schule Kinder und Jugendliche mit Behinderung zusammen mit Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung unterrichtet. Sie kommen in der Regel von der Peter-Petersen-Grundschule in Höhenhaus, in der seit 1980 ein Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht in der Grundschule erfolgreich durchgeführt wird.
Die Schule - inzwischen zwanzig Jahre alt geworden - arbeitet von Beginn an nach dem Team-Kleingruppen-Modell (TKM). Das Team, eine Gruppe von Lehrerlnnen begleitet jeweils drei von neun Klassen eines Jahrgangs insgesamt während der gesamten Schullaufbahn in der Sekundarstufe 1. Es bildet eine eigene pädagogische und organisatorische Einheit, praktisch eine kleine autonome Schule in dem großen System der Gesamtschule, so daß sich zwischen den am pädagogischen Prozeß Beteiligten enge Bezüge entwickeln können. Der zweite Pfeiler des Modells ist die heterogene Tischgruppe, in deren Rahmen innerhalb der Klasse die Schülerinnen neben dem reinen Fachlernen auch das "Miteinander - Leben und - Lernen" erfahren sollen. Eine äußere Fachleistungsdifferenzierung findet nur in den Fächern Englisch (ab Klasse 7) und Mathematik (ab Klasse 9) und zwar in jeweils zwei Niveaus statt. Der Integrationsversuch an der Gesamtschule Holweide hat sich auf der Grundlage dieser schon vorhandenen Organisations- und Kooperationsstrukturen (Team und Kleingruppe) entwickelt.
Angefangen mit drei Integrationsklassen und sechs Schülerlnnen mit Behinderung im ersten Integrationsteam hat sich der Schulversuch in den vergangenen neun Jahren sehr schnell erweitert. Zur Zeit leben und lernen 103 Schülerinnen mit unterschiedlichen Behinderungen in 32 Klassen, betreut von 15 Teams der Schule und zwei Ober-stufenjahrgängen. Nach dem alten SAV haben wir erziehungsschwierige, lernbehinderte, körperbehinderte, geistigbehinderte sowie mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler. Es gibt an der Schule inder Sekundarstufe 1 nur noch drei Teams, in denen keine Schülerinnen und Schüler mit Behinderung unterrichtet werden. Zu jedem Team gehört ein Sonderschullehrer.
Unter den derzeitigen Bedingungen können wir maximal zwei Drittel des Unterrichts doppelt besetzen, das heißt, daß zwei Kolleginnen und Kollegen (das können auch zwei Gesamtschullehrerinnen sein) gemeinsam den Unterricht vorbereiten und durchführen.
Das Spannende am gemeinsamen Unterricht ist, daß wir uns bis heute in einem permanenten Prozeß der Entwicklung befinden. Positive wie negative Erfahrungen, Fortschritte und Rückschläge, Erfolge und Enttäuschungen fordern immer wieder zum Nachdenken, Entwickeln und Handeln heraus.
So versuchen wir auch den Bereich der Berufs- und Lebensorientierung auf Grundlage eigener Erfahrungen aber auch in Kooperation mit anderen in dem Bereich Tätigen ständig weiterzuentwickeln
Grundlage unseres Berufsorientierungkonzepts war lange Jahre das sogenannte Bielefelder Modell. Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler bereits in den Klassen 5 - 7 einen ersten Zugang zum Thema Berufsorientierung. Das Projekt "Was Vater und Mutter tagsüber tun" mit Betriebserkundungen sowie das Projekt "Traumberufe" erlauben einen kindgemäßen, handlungsorientierten und affektiven Zugang zum Thema, der sich auch im gemeinsamen Unterricht bewährt hat. Über die eher kognitiv orientierte Behandlung des Themas im Arbeitslehreunterricht, fächerübergreifende Projekte und Erkundungen konkretisiert sich die Berufsorientierung dann im Betriebspraktikum zum Ende des achten oder zu Beginn des neunten Schuljahres, um schließlich in Klasse 9 und 10 ganz gezielt auf den Übergang von der Schule in den Beruf vorzubereiten. Nur wenige Inhalte schulischen Lernens weisen einen derart engen Alltags- und damit lebenspraktischen Bezug auf, wie die Berufs- bzw. Zukunftsorientierung. Sie betrifft daher uneingeschränkt alle Schülerinnen und Schüler, die in Holweide gemeinsam unterrichtet werden. Im gemeinsamen Unterricht ergeben sich jedoch z. T. neue Aufgabenstellungen, die zu einer individualisierten Herangehensweise, und damit zu inhaltlichen wie strukturellen Erweiterungen und Veränderungen auf drei Ebenen geführt haben. Einige ausgewählte Beispiele werden im folgenden kurz dargestellt.
Beispiel 1:Vorbereitung auf das Betriebspraktikum
Das Thema: Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung wird im gemeinsamen Unterricht zum Thema aller Gruppenmitglieder. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß Jugendliche ohne Behinderung sensibler werden in der Wahrnehmung eigener Teilleistungs-Störungen und so zu einem realistischeren Selbstbild bezogen auf ihre Schul- und Ausbildungswünsche finden.
Die Suche nach einem Praktikumsplatz soll den Eltern und ihren Kindern jedoch möglichst nicht abgenommen werden, Eigeninitiative wird jedoch beratend und praktisch unterstützt. Einzelne Schülerinnen und Schüler werden in der Vorbereitungsphase, im Praktikum selbst und in der Nachbereitung von Studentinnen oder Studenten der heilpädagogischen Fakultät in Form einer Arbeitsassistenz betreut.
Bei Bedarf werden Kleingruppen eingerichtet, in denen die individuellen Lernziele bezogen auf das Praktikum allgemein oder den speziellen Arbeitsplatz Einzelner verfolgt werden: Selbständigkeitstraining, Fahrtraining, sicheres Auftreten, sich vorstellen, "wenn ich mal nicht weiter weiß", Telefontraining... .
Beispiel 2, Projekt Berufswahl und Bewerbung:
In diesem Projekt wird von der Stellensuche über Bewerbung mit Lebenslauf, Berufseignungstest bis zum Vorstellungsgespräch die Arbeitsplatzsuche möglichst realitätsnah durchgespielt. Schülerinnen und Schüler mit Behinderung verfassen hier z. B. schriftliche Kurzbewerbungen für eine Praktikumsstelle. Die erworbenen Fähigkeiten aus der Unterrichtseinheit Lebenslauf oder der Vorbereitungsphase für das Betriebspraktikum können hier erweitert oder angewandt werden. Andere Jugendliche üben in dieser Phase unterschiedliche Formen der Selbstdarstellung und/oder des Sich-Vorstellens. Das Training von Testsituationen und das Vorstellungsgespräch lassen sich individuell gestalten, wobei die möglichst große Realitätsnähe (z. B. durch das Auftreten fremder Personen), das Projekt zu einem kontrollierten Belastungstraining machen. Für uns hat dieser Baustein neben dem starken Anwendungsbezug für die Schülerinnen und Schüler einen besonders hohen diagnostischen Wert.
Beispiel 1, zusätzliche Praktika:
Seit dem ersten Integrationsjahrgang haben wir Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in den Jahrgängen 9 und 10 die Möglichkeit gegeben, sogenannte Langzeitpraktika zu machen. Das heißt, sie arbeiteten für mindestens drei Monate an einem festen Tag in der Woche in einem Betrieb ihrer Wahl oder unserer Empfehlung. In dieser Form haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich allmählich an die Anforderungen eines Arbeitsplatzes zu gewöhnen. Die regelmäßige Rückkehr in die vertraute Umgebung der Schule sowie die Möglichkeit, bei Bedarf über jeden Arbeitstag unmittelbar zu sprechen, wirken entlastend. Auf der anderen Seite haben wir die Beobachtung gemacht, daß das Bewußtsein, einmal in der Woche in der Erwachsenenwelt zu arbeiten, sich in der Regel positiv auf die Entwicklung der Persönlichkeit und das Selbstbewußtsein der Jugendlichen ausgewirkt hat. Durch die Möglichkeit, auf die Erfahrungen des ersten "Schnupper"-Praktikums zurückgreifen zu können und die intensive Begleitung z. B. auch im Rahmen des WP II-Kurses Berufskunde (s.u.) erhält dieses Praktikum eine größere Bedeutung im Bezug auf das Training berufs- und alltagsrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten wie: Selbständigkeit, Selbstbewußtsein, realistische Selbsteinschätzung, Ausdauer, Umgang mit Mißerfolgen oder Unsicherheit, Beherrschen von Arbeitsabläufen, Kommunikation...
Nicht zuletzt hat diese Form des Praktikums dazu geführt, Betriebe für eine Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu interessieren, bzw. sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. Für einzelne Schüler war das Langzeitpraktikum ein Test für ein weiteres Blockpraktikum im gleichen oder einem andern Betrieb in Klasse 10. Auch haben sich aus diesen Praktika schon Übernahmen im Rahmen eines Förderlehrganges ergeben. Die eben erwähnten zusätzlichen Blockpraktika bieten wir auch alternativ zum Langzeitpraktikum an, wenn wir der Meinung sind, daß im Einzelfall längere kontinuierlich Einarbeitungs- und Gewöhnungszeiten notwendig sind oder über die Woche zu viel vom Erlernten wieder verloren geht.
Beispiel 2: WP II -Unterricht Berufskunde
In den ersten Integrationsjahrgängen haben wir im Rahmen des zweiten Wahlpflichtfaches einen sogenannten Berufskundekurs mit wöchentlich drei Stunden eingerichtet, in den wir Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Förderbedarf empfohlen haben. Je nach Zusammensetzung hatten die Kurse ein enormes Spektrum an sehr individuell gestalteten Inhalten anzubieten. Es reichte vom Schreiben eines Lebenslaufes bis zum Erlesen von Signalwörtern, vom Erfassen des Zahlenraums bis 100 bis zu Wiederholungen aus dem Mathematikunterricht. Weitere Themen waren z. B.:
-
Schreibmaschinenkurs
-
Einführung in Grundlagen der Textverarbeitung
-
Umgang mit Geld, vom Bezahlen bis zur Kontoführung
-
Konzentrations- und Ausdauertraining
-
Übungen und Rollenspiele zur Selbst- und Fremdwahrnehmung
-
Herstellen eines Werkzeugkastens in arbeitsteiliger Werkstattarbeit, Wechsel von anspruchsvoller handwerklicher Arbeit und weniger motivierenden, sich wiederholenden Arbeitsgängen, phasenweise Übernahme von Planung und Organisation, Kontrollieren, Hilfe geben, kooperieren
-
Umgang mit Hilfe und Hilfebedarf
-
Austausch in der Gruppe über die Erfahrungen im Langzeitpraktikum
Dieser Kurs ist in den letzten beiden Jahrgängen jedoch nicht mehr eingerichtet worden, da die "Zwangszuweisung" kritisiert wurde, die dazu führte, daß Jugendliche mit Behinderung interessante Alternativen aus dem übrigen Wahlpflichtangebot nicht mehr wählen konnten. Insbesondere das relativ große Angebot an kreativen und handlungsorientierten Bereichen bietet in den Jahrgängen 9 und 10 noch einmal Chancen für einen gemeinsamen Unterricht.
An dieser Stelle wird deutlich, daß ein Berufsorientierungskonzept im gemeinsamen Unterricht nicht losgelöst von allen übrigen Bedingungsfaktoren einer Integrationsschule betrachtet werden kann. So war der nächste Entwicklungsschritt in der Berufsorientierung u. a. von Faktoren bestimmt, die nicht originär diesen Bereich betreffen: Im Laufe der Entwicklung unseres Schulversuches hat sich die Schülerschaft verändert. Die Anzahl der Jugendlichen mit schweren geistigen Behinderungen nahm zu. Auch Mehrfachbehinderungen hatten wir in den ersten Jahrgängen nicht. Wir stellten fest, daß der Anteil von Unterricht, in dem alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden, mit der Veränderung der Schülerpopulation abnahm. Es scheint mir jedoch zu kurz gegriffen, wenn wir diese Entwicklung zu mehr äußerer Leistungsdifferenzierung nur auf die Veränderung äußerer Bedingungen abwälzen. Realistischerweise müssen wir sehen, daß sich unsere Hoffnung, mit der Integration würde in der Sekundarstufe I eine Entwicklung zu mehr Handlungsorientierung, mehr fächerübergreifenden Angeboten, mehr Projektorientierung im Unterricht eingeleitet, nur in Ansätzen erfüllt hat. Klassischer, abschlußorientierter Fachunterricht in den oberen Klassen bietet aber zu wenig gemeinsame Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten.
Im Umfeld dieser "gesamtschulischen" Problematik entstand die Idee, für die Klassen 9 und 10 lebens- und zukunftsorientierte Projekte einzurichten, die parallel zum übrigen Fachunterricht laufen, ihn langfristig zum Teil ersetzen. Bevor ich auf diese Projekte näher eingehe, möchte ich kurz auf eine wichtige dritte Ebene der Veränderung eingehen.
Haben Jugendliche mit Behinderung in der Schule zehn bis elf Jahre lang gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung gelebt und gelernt, wirken die absolut unbefriedigenden Zukunftschancen, Lebens- und Beschäftigungsmöglichkeiten besonders erschreckend. So hat das Berufsorientierungskonzept die vielleicht wichtigste Erweiterung durch die Einrichtung einer SozialpädagogInnenstelle mit dem Arbeitsschwerpunkt "außer- und nachschulische Integration" erfahren. Die Schwerpunkte der Arbeit sind: Beratung von Jugendlichen und ihren Eltern in den Klassen 8 - 10 (also vom Praktikum bis zum Abschluß und z. T. darüber hinaus), Beratung von Teamlehrerinnen und Teamlehrern, Kontakte mit Betrieben, Aufbau eines Netzwerkes mit möglichst vielen für die nachschulische Integration wichtigen Stellen, Institutionen und Verbänden, Konzeptentwicklung.
In der Phase der Berufsorientierung wird noch einmal die Behinderung für Jugendliche und ihre Eltern zum beherrschenden Thema. Enttäuschungen, Trauer und vermeintliche Ausweglosigkeit führen nicht selten zu Hilflosigkeit, Selbstzweifeln ("Hab ich in den letzten Jahren alles falsch gemacht?") bis hin zu Agonie. Beratung kann helfen, Mut zu machen, Ängste und Vorurteile zu nehmen und damit, ausgehend von einer realistischen Einschätzung der Situation, wieder Perspektiven zu öffnen. Nur wer Perspekiven vor Augen hat, kann aktiv werden und Initiative ergreifen.
Eigeninitiative ist Ziel der alle schulischen Maßnahmen zur Berufsorientierung begleitenden Beratungstätigkeit. So unterstützen wir z. B. beratend und z. T. ganz konkret (Üben von Vorstellungsgesprächen) die Praktikumsplatzsuche, stellen aber möglichst keine Plätze zur Verfügung.
Wir ermutigen Eltern und Jugendliche, z. B. sich selbst ein Bild von unterschiedlichen nachschulischen Einrichtungen zu machen, um selbstbewußt mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten zu können.
Neben der individuellen Beratung werden "peer - groups" angeboten, in denen Jugendliche die Möglichkeit haben, gemeinsam mit anderen "Betroffenen" Erfahrungen auszutauschen, sich zum Beispiel mit so schwierigen Themen wie dem eigenen Hilfebedarf oder dem Umgang mit Unsicherheiten auseinanderzusetzen, aber auch positive Erfahrungen zu verarbeiten und weiterzugeben. Wichtige Partner in dieser Phase sind die Teamlehrerinnen und Teamlehrer.
Der ständige Kontakt zu örtlichen Betrieben und zu den Praktikumsbetrieben, auch nach dem Praktikum selbst, ist wichtiger Bestandteil der Netzwerkarbeit. Wir versuchen so, Arbeitgeber zu interessieren, Vorbehalte abzubauen und zu ermutigen. Auf diese Weise ist manch erfolgreiches Praktikum eingeleitet worden und mancher Arbeitsplatz im Rahmen eines Förderlehrgangs für Jugendliche mit geistiger Behinderung eingerichtet worden. Zu erwähnen ist, daß diese Erweiterung der Förderlehrgänge für Jugendliche mit geistiger Behinderung nicht ohne die gute Kooperation mit dem Reha-Berater des Arbeitsamtes und den Trägern der Förderlehrgänge möglich gewesen wäre.
Nicht erst über die Förderlehrgänge entstanden die ersten Kontakte mit Berufsschulen, um das Problem der mangelnden oder fehlenden schulischen Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung nach Abschluß der Klasse 10 an der Gesamtschule anzugehen. Mit den Jugendlichen in den Förderlehrgängen haben wir zwar "einen Fuß in der Tür", aber die Integration in den Berufsschulunterricht ist noch nicht befriedigend. In einem Fall hat die Einzelintegration einer Schülerin auch mit zum Abbruch der Maßnahme geführt. Mit zwei Berufsschulen sind wir zur Zeit im Gespräch über die Einrichtung einer Klasse oder Möglichkeiten der Einzel- oder Kleingruppenintegration in geplante vollzeitschulische Maßnahmen im Rahmen von Benachteiligtenprojekten. Wir haben in diesem Zusammenhang auch Kontakt zu einer WfB, die für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterricht anbietet.
Diese ganzheitlich orientierte Tätigkeit im Rahmen der Berufsorientierung (die für uns Lehrerinnen und Lehrer so nicht zu leisten wäre) wirkt natürlich auch wieder in die Schule zurück. So hat die Kooperation mit der "Integrationsberaterin" auch unseren Blick erweitert, verändert und gelenkt auf das hier und jetzt Notwendige und Machbare in Hinblick auf die außer- und nachschulische Integration. Diese Perspektivenerweiterung kam unserer zum Ende des vorigen Abschnitts angedeuteten Suche nach lebens- und zukunftsorientierten Projekten entgegen.
Neben den oben angedeuteten eher globalen Problemen einer inhaltlichen und organisatorischen Umstrukturierung des Unterrichts in den oberen Klassen der Sekundarstufe I hatten wir den Eindruck, daß unsere bisherigen Veränderungen und Ergänzungen des Berufsorientierungskonzeptes nicht mehr ausreichten, d. h. den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler in Hinblick auf eine Lebens- und Zukunftsorientierung nicht immer gerecht wurden. So stellten wir fest, daß auch zusätzliche Praktika z. T. in Langzeitform nicht unbedingt zu einer erhofften realistischeren Selbsteinschätzung bezogen auf die eigene berufliche Zukunft führten. Trotz unterrichtlicher Begleitung schien uns die Verbindung von Arbeit und Schule z. T. nicht ausreichend. Insbesondere für einige Jugendliche mit geistiger Behinderung hatten die Betriebspraktika zu wenig Ernstcharakter. Die SchülerInnen wurden liebevoll von Betriebsangehörigen betreut und hatten z. B. keine Verantwortung zu übernehmen. Auch die Möglichkeiten, berufs-, arbeits- oder lebenspraktisch relevante Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, erschien uns zu gering. Ohne Zweifel bleiben die Betriebspraktika ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Konzepts, können aber nur einen Teil der notwendigen Lernziele abdecken. Auf die Problematik des sogenannten Berufskundekurses im Wahlpflichtbereich habe ich oben schon hingewiesen. Aus dieser hier nur angedeutete "defizitorientierten" Betrachtung der Situation entstand, ausgehend von eigenen positiven Erfahrungen projektorientierten Arbeitens und durch Anregungen anderer Integrationsschulen die Idee, ein Betriebsprojekt einzurichten. In einer ersten Phase formulierten wir wünschenswerte Lernziele und Schwerpunkte eines derartigen Projektes, von denen wir hier eine Auswahl vorstellen:
Lernziele und -bereiche eines geplanten Betriebsprojekts
-
Umgang mit Hilfe und Hilfebedarf bezogen auf eine bestimmte Tätigkeit
-
Selbständigkeit
-
Erweiterung der sozialen Kompetenz
-
Umgang mit fremden ständig wechselnden Personen
-
Beschäftigung mit, bzw. Akzeptieren von ungeliebten Notwendigkeiten
-
Beherrschen komplexer Handlungsabläufe
-
Erwerb handwerklicher (manueller) Fähigkeiten und Fertigkeiten
-
Verbesserung der Selbst- und Fremdwahrnehmung
-
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes, insbesondere bezogen auf das nachschulische Leben
-
Finden eines angemessenen Anspruchsniveaus
-
Fähigkeit zu arbeitsteiliger Teamarbeit in einer Produktion
-
Persönlichkeitsstabilisierung
Bedingungen und Schwerpunkte (aus denen sich jeweils wieder individuelle Ziele ableiten lassen)
-
Verbindung zum schulischen Lernen (im Projekt erfahrene Lerndefizite könnten mit veränderter Motivation im Unterricht aufgearbeitet werden)
-
lebenspraktische Relevanz bezogen auf individuelle nachschulische/berufliche Perspektiven
-
vertraute Arbeitsgruppe und pädagogische, bei Bedarf psychosoziale Betreuung
-
Realitätsnähe (Handeln wird nicht von Eltern oder Schule bestimmt, sondern ergibt sich sinnhaft aus einem Gesamtzusammenhang)
-
Die eigene Arbeit hat etwas mit dem Erfolg des Projekts zu tun
-
Das Produkt der eigenen Arbeit ist erkennbar, Erfolg oder Scheitern in einem Sinnzusammenhang unmittelbar erfahrbar.
Aufbauend auf die Lernerfahrungen, die einige Jugendliche bereits seit längerem in dem Unterrichtsangebot "Lebenspraktische Übungen" sammeln konnten, stand am Anfang zunächst die Absicht, eine Cafeteria für das Lehrerkollegium aufzubauen. Parallel dazu entstand durch den Wegfall der Planstelle unseres Schuldruckers die Idee, dieses personelle Vakuum zu nutzen, um mit einer Schülergruppe an einem Tag der Woche die Druckerei als Serviceangebot für die gesamte Schule zu betreiben. So bekam dieses zweite Projekt sehr rasch klare Konturen durch die vorgegebene Struktur und Einrichtung der bereits vorhandenen Druckwerkstatt.
Um die Projekte noch im Schuljahr 95/96 einrichten zu können, mußten wir parallel zur inhaltlichen und organisatorischen Planung der Betriebe die Belegschaft zusammenstellen. Dazu wurde eine vergleichende Tätigkeitsanalyse erstellt. Unter den vier Kategorien: Arbeitsorganisation, Betriebswirtschaft, Öffentlichkeit und Produktion stellten wir ein möglichst differenziertes Profil der voraussichtlich anfallenden Tätigkeiten und Anforderungen auf. Ein interessantes Ergebnis war, daß die Summe der gemeinsamen Anforderungen viel höher war als erwartet. Das läßt vermuten, daß die Chancen für Transfermöglichkeiten aus derartigen Betriebsprojekten in eine betriebliche Realität relativ hoch sind. Die daneben aber deutlich auftretenden Unterschiede im Anforderungsprofil zwischen einem Gastronomiebetrieb und einem technischen Dienstleistungsbetrieb wie der Druckerei waren eine wichtige Grundlage für die Auswahl unserer Belegschaft.
Obwohl nach wie vor als integrative Projekte gedacht, entschieden wir uns in der ersten Phase, nur Jugendliche mit Förderbedarf in die engere Wahl zu nehmen. Dabei spielten u. a. folgende Überlegungen eine Rolle:
-
die Anzahl von Jugendlichen mit Förderbedarf war wesentlich höher, als die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze,
-
Arbeitserleichterung für uns in der Aufbauphase,
-
manche der übergreifenden Lernziele sind leichter in einer Gruppe ähnlich Betroffener zu erreichen.
Analog zur Tätigkeitsanalyse wurden Schüler/innenprofile erstellt. Alle Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs mit Förderbedarf wurden mit ihren individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken und Schwächen vorgestellt. Außerdem wurden mögliche bzw. zu erstrebende Lern- und Abschlußziele beschrieben.
Das Abgleichen der Schülerprofile mit den Tätigkeitsprofilen der Betriebe konnte jedoch noch nicht alleinige Entscheidungsgrundlage sein. Weitere Faktoren waren zu berücksichtigen:
-
Wünsche der Jugendlichen
-
Wünsche der "Betriebsleiter"
-
personelle Ausstattung
-
sächliche Bedingungen
-
das betriebliche Umfeld (Schulöffentlichkeit)
-
soziales Gefüge der Gruppe
In dem sich so ergebenden komplexen Feld, sich zum Teil gegenseitig bedingender Faktoren wurde die Schüler/innenzuweisung selbst zu einem wichtigen Bedingungsfaktor für alle Gestaltungsmomente und die weitere Entwicklung der Projekte.
Zum Ende des Schuljahres war klar, daß die Cafeteria mit sechs, die Druckerei mit fünf Jugendlichen ihre Arbeit aufnehmen würde. Die Gruppen waren dabei erstaunlich und erfreulich heterogen geworden.
Im Verlauf der zahlreichen Konzeptionsgespräche veränderte sich die Planung für die Cafeteria dahingehend, daß wir den potentiellen Kundenkreis nicht auf die Lehrer beschränken, sondern das Angebot an alle Schülerinnen und Schüler der Schule richten wollten, um damit einerseits eine größere schulinterne Öffentlichkeit der Be-triebsprojekte zu erreichen und andererseits die Verkaufssituation für alle zu nutzen im Sinne der Schaffung neuer Begegnungs- und Auseindersetzungssituationen zwischen Schülern mit und ohne Behinderung. Diese Grundidee diskutierten wir sodann in den verschiedenen unmittelbar angesprochenen Gremien, wie dem Team der Berufsorientierungsbeauftragten und der Integrationskonferenz sowie auf Jahrgangsebene mit den Kolleginnen und Kollegen der beteiligten Jahrgänge während einer ganztägigen Kollegiumstagung. Dabei wurden kreative Ideen auf ihre Realisierbarkeit überprüft, Pläne im Detail konkretisiert (Zeitrahmen, Raumfrage, Finanzmittel, personelle Betreuung usw.) sowie erste Überlegungen zu den Schülerinnen und Schülern angestellt, für die ein solches Projekt in Frage kommen könnte. Alle diese Planungsschritte fanden statt in direkter Kooperation oder zumindest ständigem Austausch zwischen den verantwortlichen Kollegen beider Betriebsprojekte. In einem Gespräch mit der Schulaufsicht wurde uns spontan Unterstützung zugesagt und insgesamt 12 Lehrerwochenstunden als Sonderzuweisung für die personelle Betreuung der Projekte zur Verfügung gestellt.
Der Einstieg in die erste Realisierungsphase geschah zunächst sehr informell, d. h. es wurden bestehende Kontakte innerhalb der Schule genutzt, um den Arbeitsraum herzurichten, über den Hausmeister und durch Spenden Einrichtungsgegenstände zu besorgen, um finanzielle Mittel vom Förderverein der Schule zu erhalten usw.
Wir mußten aber schon bald erkennen, daß wir in der ersten Begeisterung am Anfang des neuen Schuljahres einige gravierende Fehler gemacht hatten, indem wir die offiziellen Entscheidungsgremien der Schule nicht ausreichend formal an dem Planungs- und Entscheidungsprozeß beteiligt hatten. So entstand zunächst einige Verwirrung, und die Realisierung des Projektstarts schien sich auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dabei war von entscheidender Bedeutung, daß wir das Alleinverkaufsrecht des Mensapächters für Speisen und Getränke in seinem Kiosk nicht beachtet hatten. Wir suchten in einem Gespräch mit dem Mensapächter diesen Konflikt zu entschärfen und trafen bei ihm auf großes Verständnis für unsere Idee und die Ziele des Projektes.
Trotz seiner Bedenken bezüglich eventueller Umsatzeinbußen im Mensakiosk begegnete er uns mit einer unerwarteten Offenheit und der Bereitschaft, das Projekt nicht scheitern zu lassen. Deshalb konnten wir im Laufe des Gesprächs nach Wegen der direkten Kooperation mit der Mensa suchen, die er spontan aufgriff und unterstützte. So veränderte sich die Projektidee dahingehend, daß wir, bzw. die Schülergruppe, einen ambulanten Kioskverkauf in der "Schulstraße" (Eingangshalle der Schule) und vor dem Lehrerzimmer als Filiale des Mensakiosks organisieren. D. h., wir beziehen unsere Rohstoffe (Brötchen, Belag, Butter, Getränke) nach vorhergehender Bestellung von der Mensa zu einem reduzierten Einkaufspreis, bereiten die Brötchen in einem eigenen Arbeitsraum zu und bauen einen Verkaufsstand auf, an dem die Waren zum gleichen Preis wie am Mensakiosk angeboten werden.
Je nach Verkaufserfolg bleibt nach der Abrechnung mit der Mensa ein kleiner finanzieller Gewinn für die Projektkasse übrig. Das erwirtschaftete Geld investieren wir in den Kauf von Arbeitskleidung, Ausstattung des Verkaufsstandes oder gemeinsame Freizeitaktivitäten der Projektgruppe.
In diesem Prozeß der Veränderung unserer Projektidee fand durch die notwendige Zusammenarbeit mit der Mensa einerseits eine deutliche Zielreduktion statt (kein Café, sondern Kiosk), andererseits wurde das Profil der Arbeit stark geprägt in Richtung einer "Professionalisierung" durch die sozusagen vertraglichen Vereinbarungen und Verpflichtungen mit einem Großküchenbetrieb, die sich auch im Bewußtsein aller beteiligten Schülerinnen und Schüler widerspiegeln: "Herr St. (der Mensapächter) ist unser Chef!" Zugleich ergaben sich aus diesen Vereinbarungen auch erhebliche Vorteile für die praktische Durchführung des Projektes in dem begrenzten (zeitlichen) Rahmen, der uns zur Verfügung steht: Wareneinkauf (Bestellung und Abholung) findet direkt in der Schule statt, Lagerhaltung ist fast nicht notwendig, der Pächter bietet Hilfe an bei der Ausstattung des Arbeitsraumes und des Kioskstandes; es entstehen keine steuerlichen Probleme.
Die weitere Vorlaufphase bis zum Start des konkreten Kioskverkaufs wurde bestimmt durch Aufgaben, die mit der Erfüllung der Auflagen für einen regulären Küchenbetrieb in Zusammenhang standen: amtsärztliche Untersuchung im Gesundheitsamt, bauliche Veränderungen und Einrichtung des Arbeitsraumes, Beschaffung von Arbeitskleidung.
Aufgrund unserer mangelnden Erfahrung bei der Vorabplanung zog sich diese erste Phase über ca. 10 Wochen hin, in denen wir uns bereits regelmäßig wöchentlich mit der Schülergruppe trafen. Es war unser Ziel, möglichst viele vorbereitende Schritte mit den Schülern selbst zu tun: Fahrten zum Gesundheitsamt, Renovierung des Raumes, Plakatgestaltung für die Werbung, Rollenspiele zu Verkaufssituationen. Obwohl sich die meisten Schülerinnen und Schüler recht schnell mit dem Projekt identifizierten und ein starkes Wir-Gefühl in der Gruppe entwickelten, blieb es oft schwierig, die Erwartungen und die Motivation der Schülerinnen und Schüler über einen so langen Zeitraum zu strecken bis zur Eröffnung des Kiosks, die schließlich eine Erleichterung der Spannung und einen Auftrieb im Arbeitseifer brachte, der bis heute andauert.
Wir begleitenden Lehrer nutzten diese Zeit für Lobbyarbeit in den verschiedenen Schulgremien. Unser verändertes, differenzierteres Arbeitskonzept erwies seine Überzeugungskraft und öffnete uns Türen zu weiterer Unterstützung:
-
Der Essensausschuß der Schulkonferenz begrüßte unsere Initiative und führte in der Schulkonferenz einen offiziellen Beschluß zur Unterstützung des Betriebsprojektes herbei.
-
Der Förderverein signalisierte Bereitschaft zu finanzieller Hilfe in der Startphase.
-
Die Schulleitung diskutierte das Projekt und erreichte bei der Schulverwaltung die kurzfristige Genehmigung und, nach einem Ortstermin, auch die Realisierung der baulichen Veränderungen im Arbeitsraum durch die Haushandwerker (Wasser- und Stromanschluß, Einbau einer Spüle mit Boiler).
-
Das Teestuben-Team des Freizeitbereiches spendete uns Geld für den Kauf des Boilers.
So konnten wir im November 1995 mit dem Kioskverkauf beginnen.
Das zentrale Förderziel, das wir uns mit dem Unterrichtsangebot "Betriebsprojekt Schulstraßen - Kiosk" gesetzt haben, besteht in einer mehrdimensionalen Kompetenzerweiterung, die ebenso komplex wie für die einzelnen beteiligten Schülerinnen und Schüler differenziert formuliert werden muß. Die nachschulische und berufliche Integration der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung steckt dabei den Rahmen für die Konkretisierung dieser Zielperspektive ebenso ab, wie die angestrebte, möglichst umfassende Selbstversorgung in einer zukünftigen Lebenssituation.
Folgende Dimensionen der Förderung sollen berücksichtigt werden:
-
Sozial-kommunikative Kompetenz
-
Förderung der Ich-Stärke
-
Mathematisch-rechnerische Kompetenz
-
Hauswirtschaftliche Kompetenz
-
Betriebswirtschaftliche Kompetenz
Die mathematisch-rechnerische Kompetenz erweitert sich im handlungsorientierten Umgang mit Geld während der Verkaufssituationen und beim Erstellen der Tagesabrechnung. Die Gruppe setzt die Preise für die Waren in Absprache mit dem Mensakiosk fest. Sie schreiben die Preisschilder. Sie lesen die Preise in der korrekten DM-Pfennig-Aussprache und lernen dadurch die Bedeutung der Kommaschreibweise verstehen: Markbeträge stehen vor dem Komma, Pfennigbeträge stehen hinter dem Komma.
Sie üben die Benutzung des Taschenrechners beim Addieren der Preise und subtrahieren die Preise beim Berechnen des Wechselgeldes. Dabei taucht das besondere Problem der Erfassung und Addition der einzelnen Münzwerte auf, die sie nicht durch einfaches Zählen der Münzenanzahl bewältigen können. Das vor allem bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu beobachtende Abzählen der konkret-veranschaulichenden Materialien im Rechenunterricht wird aufgebrochen. Der Förderung des Begreifens der Münzenwerte durch Zusammenstellen der Preise mit unterschiedlichen Münzstücken kommt dabei eine besondere Rolle im Mathematikunterricht zu, wenn diese Schwierigkeiten beim Herausgeben des Wechselgeldes in der konkreten Verkaufssituation unterrichtlich aufgegriffen und bearbeitet werden sollen. Darum suchen wir den informellen Austausch mit den jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrern über den Lern- und Leistungsstand der SchülerInnen. Es ist festzustellen, daß sich die Motivation einzelner Schüler in Bezug auf ihre Mitarbeit im Mathematikunterricht durch die praktisch erfahrbare Relevanz der Unterrichtsinhalte für ihre Tätigkeit in dem Kioskprojekt deutlich erhöht hat.
Für die Abrechnung der Kasse und die Bezahlung der Rohmaterialien in der Mensa entwickelten wir eigene Formulare, um diesen recht umfangreichen Aufgabenbereich zu strukturieren und so zu vereinfachen, daß auch die Schülerinnen und Schüler daran maßgeblich beteiligt werden können.
Die Erweiterung der hauswirtschaftlichen Kompetenz findet in vielfältiger Weise in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen der praktischen Arbeit statt: beim Abholen und Auspacken der Rohwaren, beim Zubereiten der Verkaufsprodukte, beim Zusammenstellen und Präsentieren der Waren am Verkaufsstand, bei der Ausgabe und dem Verpacken der Waren, beim Säubern der Arbeitswerkzeuge, beim Reinigen des Arbeitsraumes und der Arbeitskleidung. Die Schülerinnen und Schüler erwerben in ihrer Arbeit nicht nur praktische Fertigkeiten in der Handhabung der hauswirtschaftlichen Arbeitsgeräte, sondern gewinnen auch Einsicht in die Bedeutung und Notwendigkeit der Einhaltung von Hygienevorschriften, die immer wieder besprochen und in der direkten Umsetzung bewußt gemacht werden: eigene Körperpflege, saubere Arbeitsgeräte und saubere Arbeitskleidung, eigene Gesundheit, vorschriftsmäßige Lagerung der Waren. Die Reinigung der Arbeitskleidung in der schuleigenen Waschmaschine sowie das Bügeln und Falten der Kittel und Schürzen gehört ebenso zur Nachbereitung des Verkaufstages wie das Händewaschen und Haarebinden vor Beginn der gemeinsamen Arbeit.
Nicht zuletzt werden in den Gruppendiskussionen über unser Warenangebot bzw. dessen Erweiterung auch grundlegende Ernährungsaspekte thematisiert.
Eine besondere Bedeutung in Hinblick auf die berufliche Integration kommt dem betriebswirtschaftlichen Aspekt der Kompetenzenerweiterung zu, da er im herkömmlichen Unterricht nicht oder nur abstrakt-theoretisch behandelt wird. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen durch ihre regelmäßigen Besuche in der Mensaküche und ihre Kontakte zu dem dort arbeitenden Personal einen Einblick in einen Großküchenbetrieb, der mittelfristig im Rahmen von Betriebs-praktika vertieft werden soll. Eine Bereitschaft des Mensapächters wurde bereits signalisiert.
Darüber hinaus spielt die Organisation der praktischen Arbeit im Vorbereitungsraum und am Verkaufsstand eine große Rolle im Rahmen der regelmäßig zu Beginn stattfindenden Arbeitsbesprechung und der am Schluß stattfindenden Reflexion des Arbeitstages. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Absprache und Einhaltung von Zeiten (Arbeitszeit, Pausen) sowie auf die Planung der Arbeitsteilung, die in einer Rotation der verschiedenen Tätigkeiten jede/n an jeder Aufgabe im Wechsel beteiligen soll. Die Schülerinnen und Schüler erfahren und erkennen die Möglichkeiten und Grenzen ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Konfrontation mit den verschiedenen Arbeitsanforderungen und in der Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen, die in unterschiedlichem Tempo und mit unterschiedlichem Geschick die einzelnen Arbeitsschritte ausführen und mit denen der anderen koordinieren müssen. (Siehe auch Abschnitt: Förderung der Ich-Stärke)
Schließlich stellt die Auseinandersetzung mit der Erfahrung von finanziellen Verlusten und Gewinnen einen nicht unerheblichen Aspekt dar. So muß bei der Bestellung der Rohwaren die Verkaufsmenge kalkuliert werden und die Frustration über nicht verkaufte Waren, die zu einem finanziellen Verlust bzw. reduzierten Gewinn für die Projektkasse führen, bewältigt werden , indem z. B. die übriggebliebenen Brötchen selbst verzehrt werden.
Einigen SchülerInnen gelingt es, die Arbeitsorganisation und den Ablauf eines Arbeitstages mit den Phasen der Planung, der Produktion, des Verkaufs, der Reinigung und der Abrechnung als Ganzes so zu begreifen, daß sie ihren eigenen Platz in dieser Struktur erfassen lernen und in zunehmenden Maße selbständig Verantwortung übernehmen und andere Mitschüler anleiten können. Die so entstehende Gruppenhierarchie soll von den anderen als Bestandteil einer realistischen Betriebsstruktur akzeptiert werden.
Die sozial-kommunikative Kompetenz wird in den verschiedenen Feldern der Interaktion gefördert: mit dem Küchenpersonal während der Bestellung und Materialabholung, mit der Küchenleitung während der Abrechnung, innerhalb der Arbeitsgruppe während der Planungsgespräche, der Zubereitungstätigkeiten und der Tagesreflexion sowie mit den Kunden während des Verkaufs.
Alle diese Kontakte finden unter begrenzten, für die beteiligten SchülerInnen überschaubaren Bedingungen statt: Sie sind regelmäßig wöchentlich wiederkehrend und nicht mehr fremd, sie sind dadurch für sie einschätzbar und deshalb schließlich weniger angsterzeugend als Situationen während eines Praktikums außerhalb der Schule. Somit schafft das Betriebsprojekt in gewisser Weise einen geschützten Raum, der dennoch realistischere Arbeitsbedingungen ermöglicht als herkömmliche Unterrichtsprojekte. Insofern ist das Betriebsprojekt eine Art Langzeit-Planspiel.
Das Zugehörigkeitsgefühl zum Küchenpersonal hat sich schnell eingestellt und die Akzeptanz des Küchenleiters als "unseren Chef" spielte von Anfang an eine große Rolle im Prozeß der Identifizierung als "Arbeitende". Die Ebene der Ansprache der Schüler und Schülerinnen auf einer von pädagogischen Formulierungen freien Ebene hilft den beteiligten Jugendlichen, andere in der Arbeitswelt übliche Kommunikationsmuster kennenzulernen und selbst auszuprobieren.
Ein wichtiges Erfahrungsfeld ist der Umgang mit Kritik als unmittelbare Rückmeldung auf ihr Handeln und Verhalten sowohl innerhalb der Arbeitsgruppe (Lob und Tadel der anderen Gruppenmitglieder) als auch von außerhalb an dem Verkaufsstand (Freude, Genuß oder Beschwerden der Kunden). Dabei vollziehen sich schwierige, zum Teil sehr komplexe Lernprozesse, die die Fremd- und Selbsteinschätzung der Jugendlichen so stark berühren, daß sie ein wichtiges Korrektiv auf dem Weg zu einer realistischeren Selbstwahrnehmung darstellen. Schließlich wird in diesen vielschichtigen Auseinandersetzungen mit sich selbst, den anderen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung die Konfrontation mit der eigenen Behinderung zu einem zentralen Thema für alle Beteiligten, d. h. für die Arbeitsgruppe selbst wie auch für die Kunden.
Damit verwirklicht sich ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Ziel dieses spezifischen Betriebsprojektes: Wir streben durch das Hinaustreten in die Öffentlichkeit eine Förderung des Selbstkonzeptes an, indem wir die Auseinandersetzung mit der eigenen Person in der Gruppe der Jugendlichen mit Behinderung und in der Konfrontation mit den Personen, die die Schulöffentlichkeit darstellen, ermöglichen. Dies geschieht für die beteiligten Schülerinnen und Schüler in völlig anderen, neuen Situationskonstellationen als die gewohnten in der Klasse oder der Tischgruppe. Die Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung treten den Jugendlichen mit Behinderung in neuen Rollen gegenüber, sprechen in veränderter Art und Weise miteinander, wollen etwas voneinander und müssen dies klar aushandeln, sehen und erleben die behinderten Mitschüler mit ihren Schwierigkeiten, ihrem Tempo, ihren Tätigkeitsformen, ihren Sprachbarrieren usw. Hier tut sich ein weites Feld für interessante psychosoziale Untersuchungen auf, die die Interaktionsprozesse und ihre Wirkungen auf Einstellungen oder Reaktionsverhalten beleuchten.
Schließlich resultiert aus den beschriebenen und bislang noch zu wenig ausgewerteten Erfahrungen der Jugendlichen eine Förderung der Ich-Stärke, die so im Klassenunterricht der höheren Jahrgänge unserer Schulform kaum noch zu ermöglichen ist.
Die Erfolgserlebnisse in der Arbeit durch die Verkaufsbilanz am Ende eines Tages schafft hohe Motivation für das gemeinsame, aber auch das Tun jedes einzelnen. Sie führen zu einer Identifikation mit dem Projekt und dem Unternehmen der Gruppe, was zu einer Stärkung des Wir-Gefühls führt, an dem jeder durch seinen individuellen Beitrag, der begrenzt, aber anerkannt ist, partizipiert.
Nach kurzen Beschreibungen der unmittelbar die Druckerei betreffenden Rahmenbedingungen soll dieses Projekt anhand der exemplarischen Sequenz eines Arbeitstages dargestellt werden. Wir wollen so einen anschaulichen Einblick geben in die Strukturen des vielschichtigen komplexen Handlungs-, Lern-, Erfahrungs-, auch Konfliktfeldes eines scheinbar einfachen Betriebsablaufes in einem solchen Projekt sowie die handelnden Personen in Ihrem Tun vorstellen.
Dem Schulverwaltungsamt, der Schulleitung, der Schulaufsicht sowie dem Kollegium wurde ein Konzept für das Druckereiprojekt vorgelegt.
In Verhandlungen mit dem Schulverwaltungsamt erreichten wir, daß wir an einem Tag in der Woche die schuleigene Druckerei betreiben durften, nachdem unser Drucker in Pension gegangen war. Einzige Bedingung war, daß wir nach dem ersten halben Jahr einen Erfahrungsbericht vorlegen und mit der Verwaltungsleiterin in Kontakt bleiben. Im Gegenzug boten wir an, die vierzehntägig erscheinende Kollegiumszeitung (Auflage 280 Exemplare, ca. 20 bis 30 Seiten) zu drucken, zusammenzulegen, zu heften und zu verteilen. Seit der "Betriebseröffnung" unterstützt das Schulverwaltungsamt unsere Arbeit sehr kooperativ.
Die Schulaufsicht stimmte dem Projekt zu. Wir erhielten sogar zusätzliche Stunden aus Rundungsgewinnen für die Entwicklung und Durchführung derartiger berufsorientierender Projekte.
Die Schulleitung stimmte dem Projekt zu, regte jedoch eine Beratung und Zustimmung der Gesamtkonferenz an. Da die Kolleginnen und Kollegen nach der Pensionierung des Druckers ihre Materialien zum größten Teil selbst gedruckt hatten und jederzeit Zugang zur Druckerei hatten, mußten sie erst von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt werden, denn am Projekttag sollte es in der Druckerei keine Selbstbedienung geben. Die LehrerInnenkonferenz stimmte zwar zu, es dauerte jedoch eine Weile und kostete manche Anstrengung, bis sich die zunächst so genannte "Druckerei Mittwoch" als Servicebetrieb etabliert hatte.
Eine wichtige Aufgabe der Vorbereitung war die vorläufige Gestaltung des Arbeitsplatzes. Die Druckerei war seit Bestehen der Schule ein Einmannbetrieb, in dem sich neben der sehr individuellen Arbeitsplatzgestaltung eine Menge Überflüssiges an Material, Apparaten und Möbeln angesammelt hatte. Mit Unterstützung der Hausverwaltung ist der Raum jetzt klar und offen gegliedert, alles Überflüssige ist entsorgt, wir haben eigene Schränke. Folgende Maschinen und Geräte stehen uns zur Verfügung: eine Siebdruckmaschine, ein Rüttler, eine Schneidemaschine, eine alte Heftmaschine, Tacker und Locher. Außerdem benutzen wir eine alte Falzmaschine, deren Wartung und Reparatur jedoch unsere Sache ist, da sie nicht mehr zum Bestand gehört. Die Verbrauchsmaterialien fürs Drucken besorgt die Verwaltung.
Aus Spendengeldern wurde eine Maschine angeschafft, mit der wir Hefte mit Kunstoffbinderücken versehen können. In Eigenbau entstanden einfache Pressen für Leimbindungen (Lumbecken), sowie Hilfsmittel mit Führungsschienen zum Lochen und Heften. Die Verbrauchsmaterialien für die Bindearbeiten und den speziellen Hefter bestellen wir selber beim Großhandel und bezahlen sie aus unseren Umsätzen.
Seit Beginn des Schuljahres 95/96 betreiben drei Mitarbeiterinnen (Helga, Tanja, Manuela) und zwei Mitarbeiter (Volker, Daniel) gemeinsam mit einem Lehrer jeden Mittwoch die Druckerei. Wir drucken Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer und drucken für die Verwaltung. Außerdem stellen wir die 14tägig erscheinende Schulzeitung her und übernehmen die Verteilung. Unterrichtsmaterialien sortieren und heften wir gegen Berechnung. Wir stellen Hefte und Broschüren mit Kunsttoffbinderücken oder im Lumbeckverfahren (Leimbindung) her und produzieren Abreißblocks. Auch diese Leistungen lassen wir uns bezahlen.
Damit wir diesen Service anbieten und aufrecht erhalten können, müssen wir die Maschinen und Geräte warten können. Wir führen Buch über alle Aufträge. Wir führen ein Konto, akzeptieren aber auch Barzahlung.
Um dem Projekt möglichst viel Realitätsnähe zu geben, war bzw. ist es nötig, daß es sich nicht nur inhaltlich, sondern auch formal vom Unterrichtsbetrieb abhebt. So sind die Anfangs-, End- und Pausenzeiten nicht identisch mit Unterrichtsanfang und -ende. Der Arbeitstag beginnt um 9.00 h und endet um 15.30 h (Unterricht 8.15 h - 16.15 h). Frühstücks- und Mittagspause sind insgesamt etwas kürzer als die der Mitschüler/innen und liegen etwas versetzt, so daß für die Drucker/innen die Uhrzeit und nicht der Gong maßgebend ist, sie trotzdem aber die Möglichkeit haben, sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu treffen. Weder vor noch nach der Arbeitszeit besuchen die Jugendlichen den Klassenunterricht.
Alle Mitarbeiter tragen einheitlich graue Arbeitskittel. Dies war einigen zunächst unangenehm bis peinlich, ist inzwischen aber selbstverständlich. In dem Maß, in dem sich die Jugendlichen mit ihrer Arbeit und dem Betrieb identifiziert haben, ist der Kittel zu einem Symbol des Andersseins geworden. "Ich bin Arbeiter, ich habe eine wichtige Funktion, ich bin erwachsen".
Eine weitere wichtige "Äußerlichkeit", die viel zur Identifikation der Mitarbeiter/innen mit ihrem Betrieb beigetragen hat, ist der Name. Die Gruppe gab ihrem Betrieb den Namen PRINT-TEAM, und wir haben ein Logo entwickelt.
Die Arbeit beginnt absolut pünktlich, schon damit unterscheiden wir uns von den meisten Unterrichtsstunden, und das ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen selbstverständlich. Mit Daniel habe ich allerdings, nachdem er mehrmals blau gemacht hatte, erst einen Arbeitsvertrag schließen müssen, in dem ihm bei Wiederholung Entlassung angedroht wird.
Wie an jedem Arbeitstag beginnen wir mit der Besprechung. Manuela stellt das aktuelle Datum auf dem großen Kalender ein. Die Schulzeitung steht diese Woche nicht an.
Volker berichtet, daß bis jetzt nur fünf Druckaufträge vorliegen. Erfahrungsgemäß kommen im Lauf des Tages aber noch etliche dazu. Im Fach "Zusammenlegen und Heften" liegt noch ein Großauftrag vom Chor, der heute erledigt werden muß. Von der ca. 100 Seiten starken Broschüre des Integrationstages in Köln sind noch etwa 80 Stück fertigzustellen (Kunstoffbinderücken). Außerdem müssen wir an unserer Selbstdarstellung weiterarbeiten, einem Plakat mit Fotos, die mit Text versehen werden müssen. Das ist uns zur Zeit wichtiger, als weitere Abreißblocks herzustellen. Manuela weiß, daß wir auch noch welche auf Lager haben. Dringend muß heute auch jemand zur Bank, um Kontoauszüge zu holen. Bei der Arbeitseinteilung müssen wir immer berücksichtigen, daß eine/r für Sofortaufträge zur Verfügung steht. Inzwischen sind wir so sicher geworden, daß wir auch diesen Service anbieten können. Bevor wir die Verteilung der Arbeiten vornehmen, lasse ich Daniel, er ist der einzige, der sicher lesen kann, einen Brief an das PRINT-TEAM vorlesen. Es handelt sich um eine Reklamation. Wir haben einen Fehler bei der Rechnungserstellung gemacht.
Damit ist der erste Job verteilt. Da Volker die Rechnung abgezeichnet hat, muß er sich zähneknirschend an die Korrektur machen. Das fällt ihm sehr schwer, da er beim Rechnen auf den Taschenrechner angewiesen ist und er den Rechengang zum Erstellen einer Rechnung noch nicht sicher beherrscht. Danach soll er an der Integrationsbroschüre weiterarbeiten, da er das Verfahren am sichersten beherrscht und wir etwas in Termindruck sind.
Da die bisher vorliegenden Druckaufträge alle einseitig zu drucken sind, wird Helga zunächst zum Drucken eingeteilt. Das macht sie übrigens am liebsten. Volker, der gleich nebenan arbeitet, ist bei Problemen für sie zuständig.
Manuela, Daniel und Tanja übernehmen den Sortier- und Heftauftrag für den Chor. Tanja ist daneben für Sofortaufträge zuständig, Daniel für die Kasse.
Nach der Frühstückspause werden wir noch einmal eine kurze Besprechung machen, um die übrigen Jobs (Selbstdarstellung, Bank, Buchführung) und das, was im Laufe des Vormittags noch an Bestellungen eintrifft, zu verteilen.
Fast während der gesamten Besprechung hat Tanja wieder zusammengekauert auf ihrem Stuhl gesessen, die Arme zwischen die Beine geklemmt. Wenn sie angesprochen wurde, hat sie lächelnd den Kopf weggedreht und sich noch mehr verkrochen. Erst gegen Ende der Besprechung wird sie wieder "warm", und bei der Arbeitsverteilung signalisiert sie schon deutlich, ob sie einverstanden ist oder nicht.
Das Sortieren findet in einem anderen Raum statt. Daniel übernimmt sofort die Führung in der Sortier- und Heftgruppe, wobei er immer noch Schwierigkeiten hat, die anderen bei der Organisation teilhaben zu lassen. Er macht das, erklären ist nicht sein Ding. Genauso schnell, wie er durchstartet und mit höchstem Tempo arbeitet, steigt er aber auch zwischendurch aus, weil er einfach nicht mehr kann. Da ist Manuela in vielem zuverlässiger, aber sehr, sehr vorsichtig und unsicher. Sie überlegt erst fünfmal, ob das, was sie macht, wohl richtig ist. Hat sie etwas verstanden, ist sie eine gute "Vorarbeiterin". Tanja arbeitet auch lieber sofort drauf los. Im Arbeitsprozeß ist sie nicht wiederzuerkennen. Konzentriert und mit viel Eifer ist sie bei der Sache, muß aber genau eingewiesen sein, weil sie sonst schnell, konzentriert und mit viel Eifer falsch vorgeht. Die drei brauchen also etwas Einstiegshilfe von mir, dann läuft die Sache alleine. Die Gruppe entscheidet selbst, wer wann mit Heften dran ist. Die Exemplare müssen dazu nämlich wieder in die Druckerei zur Heftmaschine gebracht werden. Das Zusammenlegen selbst ist nicht gerade der beliebteste Job, hat aber den Vorteil, daß er sehr kommunikativ ist. Das hat nicht nur Entlastungsfunktion und zeigt, daß gemeinsames Arbeiten auch Spaß machen kann, sondern wirkt ganz stark gruppenstabilisierend. Daniel, der sich zunächst allen in der Gruppe weit überlegen fühlte, den emotional wie intellektuell sicher Welten von Helga und Tanja trennen, konnte in dieser gleichberechtigten Arbeitssituation, die von allen als notwendig und sinnvoll angesehen wurde, u. a. durch die Vermittlung durch Manuela auch mit Tanja kommunizieren.
Helga steht inzwischen an der Druckmaschine und bearbeitet ihren ersten Auftrag. Sie hat den Auftrag mit den Druckvorlagen aus dem entsprechenden Körbchen genommem, das Formular auf einem Klemmbrett befestigt, das hinter der Druckmaschine steht, und die Vorlagen an den richtigen Platz auf der Maschine gelegt. Für Helga muß alles sehr deutlich, klar und einfach strukturiert sein. Dann ist sie in der Lage, einen Arbeitsablauf selbständig durchzuführen. Inzwischen hat sie es gelernt, um Hilfe zu rufen, wenn sie nicht weiter weiß oder etwas Unvorhergesehenes passiert. Helga legt jetzt also nacheinander die Druckvorlagen ein, gibt die Auflagenhöhe ein, entnimmt die fertigen Exemplare, legt sie in den Rüttler und legt sie so aufeinander, daß die einzelnen Seiten jeweils über Eck liegen. Zum Schluß legt sie die Vorlagen auf den Stapel und schreibt einen Lieferschein. Auf dem Lieferschein, den ich vom Layout her genauso wie das Auftragsformular gestaltet habe, muß sie den Namen des Auftraggebers und die Auflagenhöhe übertragen, das aktuelle Datum eintragen und ihn dann unterschreiben. Sie bringt den fertigen Stapel in das Auslieferungsregal und nimmt sich den nächsten Druckauftrag, nicht ohne sich am Spiegel zwischendurch zuzulachen (Anmerkung: Helga liest nicht, was sie schreibt, nur die Zahlen und das Datum).
Während des nächsten Drucks geht ihr das Papier aus. Sie erkennt diese Meldung der Maschine und legt selbständig neues Papier nach.
In der Zwischenzeit hat Volker seinen Arbeitsplatz eingerichtet und mit seiner Bindearbeit begonnen. Hier ist er absolut selbständig, arbeitet mit Übersicht und Sorgfalt. Da die Maschine nur etwa 20 Blätter auf einmal stanzen kann, muß jedes Exemplar der Broschüre in etwa fünf Abschnitten gestanzt werden. Volker hat es sich angewöhnt, etwa zehn Exemplare zu stanzen, um sie dann nacheinander zu binden. Während Helga selbständig druckt, habe ich die Möglichkeit, ihm beim Erstellen der neuen Rechnung zu helfen. Die Rechnerei ist eine Tortur für ihn. Das Schreiben der Rechnung erledigt er selbständig, wenn auch sehr, sehr langsam. Das Lesen ist so schwer. Endlich kann er weiter binden.
Helga meldet sich. Die Maschine setzt aus, und sie kann die Fehlermeldung nicht identifizieren. Volker unterbricht seine Arbeit, erkennt das Problem und wechselt die Farbpatrone aus.
Aus dem Sortierraum klingt lautes Lachen herüber. Die drei sind fertig, aber keiner hat daran gedacht, den Auftrag mit einem Lieferschein zu versehen und damit abzuschließen. Es ist ja auch schon 10.25 Uhr. Die Arbeit muß aber vor der Pause noch abgeschlossen werden. Manuela übernimmt das ungefragt, obwohl sie die schriftlichen Arbeiten nicht mit links macht. Sie ist neben Volker diejenige mit dem größten Einsatz und Verantwortungsgefühl.
Im Lauf der ersten 11/2 Stunden sind einige neue Druckaufträge eingegangen. Zum Teil Terminsachen, die bis mittags fertig sein sollen. Na, das kann ja heiter werden! Helga versichert mir beim Rausgehen wieder mehrmals, daß sie pünktlich nach der Pause kommt.
!Ach ja, sie hat bisher kein einziges mal nach ihrem Taxi gefragt!
Wenn wir den Betrieb, wie er nach ca. einem Jahr läuft, mit der ursprünglichen Planung vergleichen, so sind relativ wenig Abweichungen festzustellen. Die Arbeitsbereiche Lagerhaltung und Bestellung spielen leider nicht die geplante Rolle. Bis auf die Materialien für die Bindearbeiten wird alles über die Verwaltung besorgt. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie deren Unterstützung unserer Arbeit ist ausgezeichnet.
Stärker noch als erwartet mußten Arbeitsplatz und Materialien mitarbeitergerecht verändert werden. Dabei ist es interessant zu entdecken, daß manche Ideen, wie die Vereinfachung und Vereinheitlichung von Formularen, allen Mitarbeitern und Kunden entgegenkommen. Das gilt auch für ergonomische Veränderungen und Hilfsmittel. Ein integratives Mitarbeiterteam fordert zum Nachdenken über Strukturen am Arbeitsplatz heraus und kann Innovationen anregen, die allen zu Gute kommen und damit letztlich auch der Produktivität.
Größere Bedeutung als erwartet haben die versteckten "mit-laufenden" Lernziele erhalten. Derart positive Gruppenprozesse, die Steigerung von sozialer Kompetenz, deutlich zu beobachtende Persönlichkeitsentwicklung zu mehr Selbstbewußtsein und Selbständigkeit haben wir in der Form nicht erwartet. Gleiches gilt für die hohe Motivation, sich auf neue Aufgaben einzulassen und Schwieriges auszuprobieren bis hin zu dem Wunsch, ein Praktikum in einer Druckerei zu absolvieren.
Noch nicht optimal klappt die Kooperation mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Aufgreifen von Lernwünschen, die sich im Betrieb ergeben, kann noch verbessert werden.
Es gibt wenig andere schulische Projekte, in denen derart kontinuierlich, ganzheitlich und praxisorientiert gearbeitet und gelernt wird. Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur die vielfältigen Arbeitsbereiche und Strukturen der Betriebe kennen, erwerben sogenannte Grundfertigkeiten und Arbeitstugenden, sondern können ein hohes Maß an lebenspraktischer Kompetenz erwerben. Das geht von der zeitlichen Einteilung des Tagesablaufes, über Verhalten im Straßenverkehr, kommunikative Kompetenz im Umgang mit Fremden (Kunden, Lieferanten), Telefonieren, Durchstehen von Streßsituationen, Verantwortung übernehmen bis hin zur Kontoführung. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, daß die Mitarbeit in den Projekten zum Teil positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Schülerinnen und Schüler haben an Selbstbewußtsein gewonnen, und dies, obwohl sie zuweilen recht hart ihre Grenzen erfahren und diese auch thematisiert werden. In einer Gruppe, in der dieser Erkenntnisprozeß psychosozial aufgefangen wird, kann die/der Betroffene jedoch dazu stehen und so zu einer realistischeren Selbsteinschätzung ohne Minderwertigkeitsgefühl finden.
Eine wichtige Grundlage für alle positiven Erfahrungen des ersten Jahres ist ohne Zweifel die hohe Motivation, die von der Mitarbeit in den Projekten ausgeht. Denn die Jugendlichen erfahren hier, daß ihr Betrieb, mit dem sie sich identifizieren, auf ihre Mitarbeit und ihren Einsatz angewiesen ist, um anerkannt zu werden und erfolgreich zu sein, und das heißt nicht zuletzt auch, wirtschaftlichen Gewinn zu machen. Die von einigen Jugendlichen erkannte Zukunftsbedeutung der Arbeit wirkt zusätzlich motivierend. Diese Motivation geht zum Teil über die Arbeit im Betrieb hinaus. Der Wunsch, noch einmal ein Praktikum zu machen oder erkannte Defizite aufzuarbeiten, sind Beispiele dafür. Es muß allerdings erwähnt werden, daß die Ver-bindung zwischen Betriebsprojekten und Unterricht noch nicht optimal funktioniert.
Ein weiteres Beispiel für das "Darüberhinauswirken" ist die enge Verzahnung mit der oben erwähnten schulinternen psychosozialen Beratung zu Fragen der außer- und nachschulischen Integration, die wiederum eng mit zahlreichen nachschulischen Maßnahmen und Einrichtungen kooperiert. Hier zeigt sich eine zusätzliche diagnostische Dimension der Projekte, die einerseits für die schulinterne Beratung, andererseits für differenzierte Darstellungen von berufs- und alltagsrelevanten Fähigkeiten nach außen von Bedeutung sind.
Die Betriebsprojekte müssen immer als Teil eines ganzheitlichen Konzepts von Bildung und Berufsorientierung gesehen werden, in dem durch permanenten Informationsfluß zwischen allen beteiligten Personen Entwicklungschancen und -fortschritte im rechten Moment erkannt werden und angemessene Fördermaßnahmen eingeleitet oder von den Betroffenen selbst eingefordert werden können. Betriebsprojekte sollten in der Zukunft Teil des Gesamtkonzepts für einen Projektunterricht für alle Schüler der Klassen 9 und 10 sein. Wir haben einen Anfang gemacht.
Kontaktadresse:
Thomas M. Wieners
Ludger Deckers
Gesamtschule Köln-Holweide, Burwiesenstr. 125, 51067 Köln
Tel : 0221/693091, Fax: 0221/697847
Rainer Mohr-Herlitz, Elisabeth Görgen Gesamtschullehrer an der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt
Inhaltsverzeichnis
1. Für Schülerinnen und Schüler der Ernst-Reuter-Schule II (Schulformunabhängige Gesamtschule mit integrativen Lerngruppen) mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der Sonderschulen im Einzugsbereich (Heinrich-Steul-Schule, Schule für Körperbehinderte, und Albert Griesinger-Schule, Schule für Praktisch Bildbare) und für Schülerinnen und Schüler der Ernst-Reuter-Schule II aus Klassen mit gemeinsamem Unterricht, die keine Abschlußerwartung haben, besteht an der Ernst-Reuter-Schule II die Möglichkeit, eine Schulzeitverlängerung über das 9. bzw. 10. Schuljahr hinaus von 3 bis 4 Jahren zu beantragen. Diese Schulzeitverlängerung soll dazu dienen, die kognitiven, praktischen und sozialen Fähigkeiten der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu vertiefen und zu erweitern und sie über berufsorientierende Maßnahmen in die Arbeitswelt (erster Arbeitsmarkt) zu integrieren.
-
Ziel des Schulversuches ist es, daß die betroffenen Jugendlichen am Ende der Schulzeitverlängerung so qualifiziert sind, daß sie von ihrem Praktikumsbetrieb oder durch eine andere Beschäftigungsmaßnahme in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis übernommen werden können.
Arbeitsassistenz
3. Während der Schulzeitverlängerung organisiert ein außer-schulischer Träger eine Arbeitsassistenz. Diese stellt die Verbindung zwischen Schule und Praktikumsbetrieb her, indem sie in Kooperation mit den Lehrkräften, den betrieblichen Ausbildern und Betreuern den für die einzelnen Schülerinnen und Schüler erstellten Förderplan umsetzt, modifiziert und/oder weiterentwickelt.
-
Der außerschulische Träger hat die Aufgabe, auf dem ersten Arbeitsmarkt für die einzelnen Jugendlichen einen Praktiumsbetrieb bzw. Arbeitsplatz zu finden. Dies muß das eigentliche Ziel sein, da es Aufgabe des Projektes ist, für das Leben der behinderten Menschen möglichst viel "Normalität" herzustellen.
-
Kooperation zwischen Schulen und Arbeitsassistenz Die Zusammenarbeit zwischen den beruflichen Schulen, den bereits o. g. Einrichtungen und dem Träger einer Arbeitsassistenz ist wesentlicher Teil des Schulversuchs. Aufgabe der Schule ist es dabei, sowohl die schulorganisatorischen und pädagogischen Voraussetzungen für das Lernen und die Betreuung in der Schule zu schaffen, als auch in Verbindung mit einem außerschulischen Träger für die Arbeitsasssistenz den Übergang in die Arbeitswelt vorzubereiten und zu begleiten.
Förderpläne
-
In Abstimmung mit den Eltern und dem außerschulischen Träger für die Arbeitsassistenz werden Förderpläne für die betroffenen Schülerinnen und Schüler erstellt. Jeder Plan beschreibt individuell, in welcher Weise die berufsorientierenden Maßnahmen ergriffen werden, wann sie beginnen sollen und welchen Umfang sie perspektivisch im Verlauf der 3- bis 4jährigen Schulzeitverlängerung einnehmen sollen.
Schulorganisatorische Voraussetzungen
7. Die Gruppengröße soll nicht mehr als 10 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf umfassen.
-
Die unterrichtliche Betreuung und praktische Anleitung der Jugendlichen erfolgt durch Sonderschullehrerinnen bzw. -lehrer und Berufsschullehrerinnen und -lehrer. Im Werkstattbereich können auch Fachlehrer für Polytechnik/Arbeitslehre bzw. Honorarkräfte mit entsprechender Ausbildung zur Betreuung der Jugendlichen eingesetzt werden.
9. Für unterstützende und pflegerische Maßnahmen für die behinderten Jugendlichen ist ein/e Integrationshelfer/in erforderlich.
-
Neben den in der Schule zur Verfügung stehenden behindertengerecht eingerichteten Werkstätten muß für die Lerngruppe ein Klassenraum mit Nebenraum zur Verfügung stehen. Beide Räume sollten so eingerichtet sein, daß handlungsorientiert gearbeitet werden kann.
Fachliche Begleitung des Schulversuchs
-
Eine fachliche Begleitung durch Fachberater für Behinderte an beruflichen Schulen für den Schulversuch "Berufsorientierende Maßnahmen" für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf" ist dringend erforderlich.
Berufsorientierende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf an der Ernst-Reuter-Schule II
Das vorliegende Konzept ist ein Organisationsvorschlag für den Schulversuch "Berufsorientierende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf an der Ernst-Reuter-Schule II". Die vom Fachbereich Integration beauftragte Projektgruppe arbeitet begleitend an der Erweiterung und Konkretisierung der in diesem Konzept beschriebenen Phasen in Kooperation mit den Sonderschulen und der Berufsschule.
Die berufsorientierenden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf an der Ernst-Reuter-Schule II gliedern sich in 2 Abschnitte:
Das Fach Arbeitslehre bietet den unterrichtsorganisatorischen Rahmen, in den die berufsorientierenden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf eingebunden sind.
1.1 Handlungsorientierte Projekte in Klasse 5 - 8
In den Klassen 5 - 8 werden mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des handlungsorientierten Unterrichts Projekte in Praxisschwerpunkten wie Gartenbau, Hauswirtschaft, Büro-organisation und Gestaltung angeboten. In diesen Projekten liegt der Schwerpunkt auf der Schulung praktischer Fertigkeiten.
1.2 Praktika
Die Phase der eigentlichen Berufsorientierung beginnt im 8. Jahr-gang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Betriebspraktikums. Diesem ersten Praktikum folgen im 9. und 10. Jahrgang weitere Blockpraktika. Dabei sollen die Schüle-rinnen und Schüler verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen.
1.3 Praktischer Tag
Im 9. und 10. Schuljahr wird für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und solche, von denen aufgrund der aktuellen Abschlußhinweise davon ausgegangen werden kann, daß sie keinen Hauptschulabschluß erreichen werden, ein Praktischer Tag pro Woche eingerichtet.
Am Praktischen Tag finden berufsorientierende Maßnahmen in den Polytechnikwerkstätten der Schule und in Betrieben statt, die mit der Schule kooperieren. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler erfolgt durch Lehrer und Lehrerinnen der jeweiligen Klassenteams, damit eine Vor- und Nachbereitung des prak-tischen Unterrichts gewährleistet ist. Der Praktische Tag wird so organisiert, daß auf diesen Tag Unterrichtsfächer gelegt werden, an denen die Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förder-bedarf aufgrund ihrer Behinderung nicht teilnehmen (z. B. Fremdsprachenunterricht, Naturwissenschaften) oder die auch praktisch orientiert sind (Arbeitslehre/Polytechnik).
2.1 Ziel der Maßnahme
Nach dem 10. Schuljahr besteht für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Möglichkeit einer drei- bis vierjährigen Schulzeitverlängerung an der Ernst- Reuter-Schule II (Allgemeinbildende Schule) und der Elly-Heuß-Knapp-Schule (Berufsschule). Diese Schulzeitverlängerung soll dazu dienen, die kognitiven, praktischen und sozialen Fähigkeiten der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu vertiefen und zu erweitern und sie über berufsorientierende Maßnahmen auf die Arbeitswelt (erster Arbeitsmarkt) vorzubereiten. Je nach individuellem Entwicklungsstand des einzelnen Jugendlichen können die berufsorientierenden Maßnahmen in die Phase der Berufsausbildung bzw. die Hinführung zu einer Arbeitstätigkeit übergehen.
2.2 Förderplan
Für jeden Jugendlichen, der am Schulversuch teilnimmt, wird von der Allgemeinbildenden Schule, der Berufsschule und dem Träger der Arbeitsassistenz im Einvernehmen mit den Eltern für den Zeitraum der Schulzeitverlängerung ein individueller Förderplan erstellt, der die Inhalte, den Umfang und den Zeitplan für die einzelnen Maßnahmen festlegt.
Aufgabe der Schulen ist es dabei, sowohl die schulorganisa-torischen und pädagogischen Voraussetzungen für das Lernen und die Betreuung in der Schule zu schaffen als auch in Verbindung mit einem außerschulischen Träger für die Arbeitsassistenz die Integration in die Arbeitswelt vorzubereiten und zu begleiten.
2.3 Zeitliche Gliederung der Maßnahme
Während der Schulzeitverlängerung erhalten die Jugendlichen an einem Tag in der Woche Unterricht mit allgemeinbildendem Schwerpunkt und einen Tag Unterricht mit berufsbildendem Schwerpunkt. An 3 Tagen der Woche nehmen die Jugendlichen an Praktika in Betrieben teil, oder sie arbeiten in Werkstattpro-jekten an den am Schulversuch beteiligten Schulen mit.
Die Schulzeitverlängerung kann für den einzelnen Jugendlichen, gemessen am Fortschritt seiner Entwicklung, ein bis vier Jahre in Anspruch nehmen.
2.4 Unterrichtliche Betreuung der Jugendlichen
An dem Unterrichtstag mit allgemeinbildendem Schwerpunkt steht einer Sonderschullehrkraft, die den Unterricht federführend gestaltet, eine Berufsschullehrkraft zur Seite; am Unterrichtstag mit berufsbildendem Schwerpunkt liegt die Unterrichtsgestaltung in der Hand einer Berufsschullehrkraft, die Sonderschullehrkraft assistiert. An den 3 Praktikumstagen werden die Jugendlichen, die in Betrieben ihre Praktika durchführen, von der Arbeitsassistenz betreut bzw. von betrieblichen Betreuern bzw. Betreuerinnen. Arbeiten die Jugendlichen in schuleigenen Werkstätten, so wird die Betreuung durch Sonderschullehrkräfte und/oder Politechniklehrer und -lehrerinnen und/oder Honorarkräfte betreut, die dem Werkstattbereich zugeordnet sind.
2.5 Schwerpunkte der allgemeinen und der berufsschulischen Bildung
Die Inhalte des allgemeinbildenden und des berufsbildenden Tages je Woche sind in der Hauptsache bestimmt von den Tätigkeiten während der Praktika in den Betrieben bzw. im Rahmen der Werkstattprojekte in den Schulen. Dabei wird die Lernausgangslage der einzelnen Jugendlichen berücksichtigt.
Bildungsschwerpunkte sind dabei:
-
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler;
-
Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse im sprachlich/gesell-schaftlichen Bereich;
-
Erweiterung mathematischer Fähigkeiten unter berufsbezogenen Aspekten;
-
Vertiefung der ästhetischen Bildung;
-
Sport.
Die berufsorientierenden Maßnahmen werden in enger Kooperation mit den Berufsschulen entwickelt und durchgeführt.
2.6 Berufsfelderangebot an der Ernst-Reuter-Schule II
Einrichtungen zu folgenden Berufsfeldern sind an der Ernst-Reuter-Schule II bereits vorhanden bzw. sollen ausgebaut und noch entwickelt werden:
-
Holztechnik
-
Metalltechnik
-
Textiltechnik und Bekleidung
-
Agrartechnik / Gartenbau
-
Ernährung und Hauswirtschaft
-
Wirtschaft und Verwaltung
-
Drucktechnik
Aufbau des Schulversuchs:
Berufsorientierung für Jugendliche mit sonderpädagogischem und besonderem Förderbedarf an der Ernst-Reuter-Schule II
Schwerpunkte in der Sekundarstufe I
|
Klasse 5 - 8/1 |
Praxisschwerpunkte in verschiedenen polytechnischen Bereichen bzw. Praxisfeldern wie Garten, Küche, Gestaltung, Büro |
|
Klasse 8/2 |
1. Betriebspraktikum |
|
Klassen 9/10 |
Praktischer Tag: Projekte innerhalb und außerhalb der Schule Gartenbau, Holz, Ton, Spielplatzgestaltung, Künstlerhaus, Pausenverkauf, Weihnachtsbaumverkauf u. a. |
|
Klassen 9/10 |
Weitere Betriebspraktika |
Aufbau der Schulzeitverlängerung (maximal 3 Jahre)
Klasse 11-13
|
3 Praktikumstage in Betrieben mit Unterstützung durch die Arbeitsassistenz |
Orientierung |
Kooperation mit: Betrieben |
|
3 Praktikumstage in Werkstattprojekten der am Schulversuch beteiligten Schulen |
Orientierung |
Arbeits-verwaltung |
|
1 Unterrichtstag mit berufsbildendem Schwerpunkt |
Vorbereitung |
Kammern |
|
1 Unterrichtstag mit allgemeinbildendem Schwerpunkt |
Erprobung |
Arbeits-assistenz |
Anschließende Möglichkeiten:
1.Halbjahr
|
Schultag mit allgemeinbilden-dem Schwerpunkt |
Schultag mit berufsbildendem Schwerpunkt |
|
Sonderschullehrer/in (ERSII) |
Berufsschullehrer/in |
|
Werkstattprojekte |
Werkstattprojekte |
Werkstattprojekte |
|
Sonderschullehrer/in (ERSII) Polytechniklehrer/in und/oder Honorarkraft |
Sonderschullehrer/in (ERSII) Polytechniklehrer/in und/oder Honorarkraft |
Sonderschullehrer/in (Koop. Sonderschulen) Polytechniklehrer/in und/oder Honorarkraft |
2. Halbjahr
|
Schultag mit allgemeinbildendem Schwerpunkt |
Schultag mit berufsbildendem Schwerpunkt |
|
Sonderschullehrer/in (ERSII) Berufsschullehrer/in |
Berufsschullehrer/in Sonderschullehrer/in (ERSII) |
|
Werkstattprojekte |
Werkstattprojekte |
Werkstattprojekte |
|
Sonderschullehrer/in (ERSII) Polytechniklehrer/in und/oder Honorarkraft |
Sonderschullehrer/in (ERSII) Polytechniklehrer/in und/oder Honorarkraft |
Sonderschullehrer/in (Koop. Sonderschulen) Polytechniklehrer/in und/oder Honorarkraft |
Inhaltsverzeichnis
Monika Schlorf, Sozialpädagogin GS Hamburg-Bergedorf; Uta Glüsing, Lehrerin GS Geschwister-Scholl in Hamburg
Bei den ersten Betriebspraktika, die wir bei geistig behinderten SchülerInnen begleitet haben, haben wir selbst voller Spannung und auch Ängsten auf das Neue reagiert. In Vorgesprächen mit den Betrieben sind vor allem äußere Auflagen und Bedingungen (Kleidung, Schutz, Arbeitszeit, Verhalten) geklärt worden, von unserer Seite erfolgte eine "vorsichtige" Andeutung der Probleme unserer SchülerInnen, um niemanden zu verprellen und nicht im letzten Moment den Praktikumsplatz zu verlieren. Eigentlich waren wir immer nur froh, wenn unsere SchülerInnen überhaupt einen Platz hatten.
In der folgenden Darstellung beziehe ich mich im wesentlichen auf das erste Betriebspraktikum von B. in der 8. Klasse in einem großen Hotelbetrieb. Während des dreiwöchigen Praktikums gelang es mir nicht, über die täglichen Anforderungen hinaus eine klare Vorstellung von den Zielen dieses Praktikums zu gewinnen, zumal die Besuche bei den normalen SchülerInnen zu konkreten Gesprächen über ihre Berufswahl dienten. Bei B. hetzte ich nur den unterschiedlichen Zwängen hinterher.
Ein Teil meiner Aufmerksamkeit richtete sich darauf, daß sie möglichst nicht auffiel und daß sie den Betriebsablauf nicht störte. Wenn B. sich z. B. in der Eingangshalle des Novotels sofort in die Kinderspielecke setzte und mit Lego-Steinen spielte, war es zunächst einmal nur peinlich. Noch peinlicher waren die lauter werdenden Gespräche um den "Ernst des Praktikums". Solche Situationen wiederholten sich mehrmals täglich, da es viele "Spielanreize" (Fußabtreter, Staubsauger, Schwimmbad) gab und außerdem der Weg ebenso häufig an den Lego-Steinen vorbeiführte. Das änderte sich auch nur minimal in der kurzen Zeit.
Der andere Teil meines Engagements bestand darin, bei B. eine passable Arbeits-Produktivität zu erreichen. Unbewußt stand der Druck dahinter, dem Betrieb, der so bereit war, einem geistig behinderten Menschen ein Praktikum zu gewähren, zu beweisen, daß auch geistig behinderte Menschen zur Arbeit motiviert sind oder sogar besonders motiviert sind.
Die meisten Arbeiten haben "wir" meines Erachtens recht gut erfüllt, allerdings nur, solange sie Neuigkeitsreiz hatten. Das bedeutete für mich als Begleitperson, daß ich dann möglichst im Akkord arbeitete, Tabletts einordnete, Gläser abtrocknete, da B. schon die Lust verloren hatte.
Erst mit Abstand schält sich die wirkliche Bedeutung des Betriebs-praktikums für uns heraus. Es klingt banal und auch das nur, weil wir unsere Erfahrungsmaßstäbe anlegen. Das BP leistet ungeheuer viel, wenn es "nur" einen Einblick in die Arbeitswelt liefert. So steht es natürlich auch in den Lernzielen der allgemeinen BPs der Gesamtschulen, aber für einen geistig behinderten Menschen ist das viel weitgreifender, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn ihm fehlen noch mehr diese Einblicke in die Berufswelt als es auch schon bei normalen SchülerInnen der Fall ist.
Die eigentliche Zukunftsplanung setzt sehr viel später ein. Es geht also nicht darum, den "richtigen" Beruf möglichst schnell und sicher zu finden, sondern sich grundsätzlich auf etwas Neues einzulassen. Das Neue besteht aus einer Vielzahl von Eindrücken. Sie lernen Menschen kennen, die sich nicht berufsmäßig oder vom sozialen Engagement für behinderte Menschen interessieren und sich um sie kümmern, sondern einfach nur sachlich in einer sachlichen Umgebung funktionieren. Der Schonraum des Zuhauses, der Schule, der Behinderteneinrichtung fehlt. Sie erleben das Andersartige, nicht mehr so wichtig zu sein, niemanden zu haben, der ihnen besondere Beachtung schenkt. Die Situation, in der jemand ihnen nur schnell etwas im Vorbeigehen zuruft, das sie gar nicht so schnell verstanden haben, ist eine völlig neue. Sie sind auch nur eine Nummer unter vielen. Sie müssen lernen herauszufinden, wer ihnen etwas genauer erklären kann, wer für sie "zuständig" ist, wer nicht. Sie müssen immer wieder fragen, sich mit den neuen Bedingungen anfreunden, neue Anfangs- und Schlußzeiten lernen, sich in den Räumlichkeiten zurechtzufinden.
Diese grundsätzliche Erfahrung reicht für das erste und auch das zweite Betriebspraktikum völlig aus. Wenn sich die Gespräche darauf richten, haben sie ihren Sinn erfüllt. Es sollte uns bewußt sein, wie wenig und doch wie viel wir erwarten können!
Für die meisten SchülerInnen bedeutet auch der Fahrtweg ein wichtiger Einschnitt. Andere Buslinien, Umsteigen usw. müssen geübt werden. In dieser neuen Umgebung sicher zu werden, sich auf sie einzulassen, ist die Transferleistung, die hier im Mittelpunkt steht, nicht das Erlernen bestimmter Tätigkeiten. Es wäre viel erreicht, wenn grundsätzlich Hemmungen und Ängste vor etwas Neuem geringer werden könnten oder sogar abgebaut werden.
Im Nachhinein geht es auch bestimmt nicht darum, den "Ernst des Alltags" mitzuerleben und möglichst die volle Arbeitszeit drei Wochen lang durchzuhalten, wie es z.T. bei normalen SchülerInnen gesehen wird. Denn geistig behinderte Menschen haben weniger Möglichkeiten, solchen Frust nach Feierabend mit Freunden zu bewältigen. Hier müßte dann wieder das Elternhaus Zeit genug und viel Verständnis aufbringen.
Man muß immer bedenken, daß die Eindrücke so vielfältig, so gravierend sind, daß die Erschöpfung viel eher einsetzt. Auch die neuen Tätigkeiten reichen einerseits weit über die Angebote in der Schule hinaus, andererseits können sie auch so monoton sein, daß sie in Langeweile, Müdigkeit oder Aggressivität münden.
Eine kürzere Arbeitszeit, die in sich aber klar mit Pausen geregelt ist, gibt einen genauso guten Einblick in die Arbeitswelt als der Ganztag. Diese Frage sollte individuell mit dem Betrieb geregelt werden.
Das Allerwichtigste ist aber, die Erwartung an "konkurrenzfähige" Effektivität aufzugeben. Es geht nicht darum, eine möglichst idiotensichere Tätigkeit zu finden, die dann im Akkord, meist auch mehr durch die BegleiterIn, ausgeübt wird. Das sollte mit dem Betrieb vorher besprochen werden. Schön wäre es, wenn die PraktikantIn verschiedene Tätigkeiten beobachten kann, einfache Arbeitsgänge selber ausprobieren kann und dann, wenn es gut klappt, auch längere Zeit ausführen darf. Die positive Bestärkung sollte im Vordergrund stehen.
Wenn es gelingt, wie bei B. z. B. im Novotel, eine Zeitlang selbständig die Minibar in den Hotelzimmern zu kontrollieren und aufzufüllen, während die Begleiterin auf den entsprechenden Karten die leeren Flaschen vermerkt, und dabei B. richtig stolz ist, ist mehr erreicht. Auch wenn sie diese Tätigkeit "nur" bei zehn Zimmern "durchhält" und damit die fehlenden dreißig Zimmer nicht mehr versorgt, ist der Akzent auf das sorgfältig Erreichte zu legen. Es ist nämlich eine enorme Leistung, die leeren Flaschen herauszufinden - manchmal stehen sie auch noch irgendwo im Zimmer herum -, durch neue zu ergänzen und in der vorgeschriebenen Anordnung hinzustellen.
Ideal ist es, wenn die PraktikantIn im Kontakt mit anderen Arbeitnehmern steht, die intensiv beschäftigt sind. Hier wird es endlich deutlich, daß jeder in einem Arbeitsprozeß eingeordnet ist, daß jeder selbstverantwortlich seinen Arbeitsgang ausfüllt und daß es nicht mehr nach Lust und Laune geht. Niemand kann plötzlich alles stehen lassen. Wenn B. z. B. in der Küche Gläser nachpoliert und die Arbeitnehmer aus dem Küchenteam ab und zu zu ihr herübersehen, nicken oder ihr schnell einen Trick verraten, dann fühlt sie sich ernstgenommen, gibt sich große Mühe. Sie erlebt, daß sie gebraucht wird.
Für uns als PädagogInnen hat sich im Laufe der Zeit auch ein anderes Selbstverständnis herausgebildet. Wir erinnern die Betriebe an ihre soziale Verantwortung. Wir erscheinen nicht mehr als die Vertreter, die etwas anbieten, was niemand haben will. Wir gehen selbstverständlich davon aus, daß es fast überall auch Praktikums-plätze für geistig behinderte Menschen gibt. Gleichzeitig reden wir offen über die individuellen Möglichkeiten unserer SchülerInnen. Wir hoffen, daß die "Bettelei" um Praktikumsplätze aufhört und die Vertretermentalität ebenso bald ausstirbt.
Am wenigsten sinnvoll bezogen auf die spätere Eingliederung in das Berufsleben erscheinen uns die Betriebspraktika, die wohl eher als "Notlösung" gewählt wurden, wie z. B. Plätze in einer Schule, in einem Kindergarten oder sogar im Privathaus.
Hier herrschte der Wunsch vor, den behüteten Raum nur graduell zu verlassen, am liebsten sogar ganz weit zurück in die Kindheit zu fliehen. Um so schwerer war es, die dort anliegenden Berufsmöglichkeiten wahrzunehmen, z. B. die einer KindergärtnerIn oder LehrerIn. Das bekannte Muster, selbst SchülerIn oder Kind zu sein, überwog. Es kann individuell natürlich immer sinnvoll sein, diese Rolle an einem anderen Ort neu zu erleben und neu zu gestalten. Außerdem gibt es sehr gute Arbeitsplätze in sozialen Einrichtungen, wie z. B. die Küche, die ein vollwertiges Praktikum ermöglichen. Das hängt von den individuellen Bedingungen ab. Das müßte im Einzelfall vorher überprüft werden, da es von der Sache her schwierig ist, das Einzelhaus, den Kindergarten oder die Schule als Berufsorte zu erleben.
Die eigentliche Zukunftsplanung, welche Berufsrichtung irgendwann eingeschlagen wird, setzt später ein. Sie sollte - unserer Erfahrung nach - auch nicht mit zusätzlichen Praktika oder Besuchen in Betrieben wie Bäckerei oder Schusterei forciert werden, da die SchülerInnen damit noch weiter aus der Integrationsarbeit in der Schule herausgerissen werden.
Viel sinnvoller haben sich die arbeitsfeldorientierten Projekte in der Schule wie Cafeteria, Restaurant oder Holzprojekte bewährt, in denen die SchülerInnen neue Arbeitsrhythmen, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortlichkeit lernen können. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Vorbereitung und Durchführung der Berufspraktika für SchülerInnen mit geistiger Behinderung, die im folgenden beschrieben werden.
Die berufsorientierenden Maßnahmen für SchülerInnen mit geistiger Behinderung müssen schrittweise ausgebaut werden und in der Regel individuell angepaßt sein. Die schrittweise Integration in die Gesellschaft umfaßt die Bereiche Schule, Berufsschule, Arbeitswelt, Freizeit und Wohnen. Ziel der Schulpraktika kann nicht sein, daß Fertigkeiten für das spätere Berufsleben erworben werden. Ebenso können wir nicht davon ausgehen, daß hier möglichst bald der Berufswunsch formuliert wird, oder gar die Zukunftsplanung bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung im Sekundarbereich einsetzt bzw. initiiert werden müßte.
Es ist sinnvoll, in den Jahrgängen 9 und 10 nach weiterführenden integrativen Maßnahmen zu suchen, die den bislang erlebten Halt innerhalb einer Gruppe von Gleichaltrigen bietet und hier zielgerichtet mit dem Ausbau von Schlüsselqualifikationen beginnt, die wiederum für geistig Behinderte anders definiert werden als für SchülerInnen ohne Behinderung. Auf diese speziellen Bedürfnisse haben sich insbesondere die Schulen G13 BVJ-I in Bergedorf und G12 F1-I in Eidelstedt eingerichtet.
Der Begriff Schlüsselqualifikation muß in diesem Zusammenhang neu definiert werden, denn es kann auch in den integrativen Maßnahmen nach Jg. 10 für viele Jugendliche noch nicht der Erwerb von qualifizierenden Fertigkeiten im Vordergrund stehen, denn das Maß der Produktivität ist erfahrungsgemäß kein Ausschlußfaktor. Die SchülerInnen müssen oftmals noch hier befähigt werden, sich selbständig im sozialen Kontext aufzuhalten, sich in unterschiedlichen (Berufs-) Feldern gezielt zu verhalten oder auch erst einmal Interesse an bestimmten beruflichen Tätigkeiten entwickeln.
Die Erwartungen an die Schulpraktika im Sek.1-Bereich sollten vor Beginn, den individuellen Möglichkeiten angemessen, formuliert werden. Zu hoch gesteckte Erwartungen erzeugen bei den Betrieben Unsicherheit und bei den begleitenden LehrerInnen oder SozialpädagogInnen einen unangemessenen Leistungsdruck vor Ort, der dazu führen kann, daß man anfallende Arbeiten selbst erledigt, um den reibungslosen Ablauf nicht zu stören.
Ziel der Praktika kann sein, die Arbeitswelt kennenzulernen, was je nach Behinderung beobachtend oder aktiv passiert. Besonders aktiv waren die SchülerInnen immer dann, wenn sie von vornherein Spaß an ihrer Tätigkeit fanden.
Für die das Praktikum begleitende Person kann dieser erste Kontakt der Schüler mit der Arbeitswelt Aufschluß über die sozialen Kompetenzen geben, darüber, ob sie angemessenes Verhalten gegenüber Vorgesetzten und MitarbeiterInnen zeigen und sich aufgrund ihres Verhaltens nicht ins soziale Abseits manövrieren. Der Erwerb von Fertigkeiten steht dabei nicht im Vordergrund. Denn die spätere Integration in einen Betrieb kann nicht zum Ziel haben, jemanden einzustellen, der möglichst hohe Arbeitsleistung zeigt, da diese bei geistig Behinderten weniger normierbar sind als bei Jugendlichen ohne Behinderung. Die Integration geistig behinderter Menschen in die Berufswelt kann primär erst einmal der Isolation Betroffener ent-gegenwirken.
Im Rahmen einer Berufskundeprojektwoche im Jahrgang 8 kann die Auseinandersetzung mit vergangenen außerfamiliären Stationen des eigenen Lebens (Kindergarten, Grundschule, Gesamtschule) und den zukünftigen (Wünschen, Ängsten, Illusionen) beginnen.
Hier sollte die Arbeit beginnen, die im Jahrgang 10 mit dem Übergang in eine weiterführende Maßnahme endet. In der Regel werden diese Aufgaben von den Sonderpädagogen oder Sozialpädagogen übernommen, da sie auch im Vormittagsbereich angesiedelt sind. Die Arbeit sollte langfristig angelegt sein und regelmäßig stattfinden.
Inhaltlich kann sie die Bereiche Aufarbeitung der Befindlichkeit, die im Zusammenhang mit dem anstehenden Praktikum steht, aber auch das Training bestimmter Dinge wie z. B. Orientierung im Stadtteil, Benutzung von Bus, Bahn oder Fahrrad umfassen.
Auch kann man gemeinsam mit den SchülerInnen nach schulinternen Arbeitsfeldern (Cafeteria, Schulzoo, Hausmeisterei, Werkstatt) Ausschau halten und sie ggf. kennenlernen.
Es können Betriebe, Berufsschulen, Wohngruppen und WfB besucht werden. Die Nutzung schulinterner Arbeitsfelder hat den Vorteil, daß die SchülerInnen in ihrem sozialen Umfeld bleiben und wir sie in diesem Bereich besser einzuschätzen lernen, was für die Praktikumsplatzsuche und die Vorbereitung der Betriebe bedeutend sein kann. Ist der Praktikumsplatz bekannt, kann man in dieser festgelegten Zeit anfallende Tätigkeiten, wie z.B. Umgang mit dem Computer, vorher üben.
Die Wahlmöglichkeit für SchülerInnen mit geistiger Behinderung beschränkt sich auf die Betriebe, die bereit sind, sie zu übernehmen. Als besonders gut haben sich Betriebe im Stadtteil bewiesen, zu denen man den Weg regelmäßig einüben konnte, so daß er u. U. sogar allein bewältigt wurde.
Die Idee, SchülerInnen mit geistiger Behinderung möglichst viele Berufe kennenlernen zu lassen, d. h. möglichst viele "Eintages-Praktika" oder zusätzliche längere Praktika zu organisieren, kann nur in Ausnahmefällen empfohlen werden, um die sozialen Kontakte in der Schule nicht zu früh zu unterbrechen, aber auch, um die MitschülerInnen in ihrer sozialen Verantwortung weiterhin ernst zu nehmen.
Hinzu kommt, daß der hohe organisatorische Aufwand die fachgerechte Betreuung der anderen behinderten Kinder verhindert.
Parallel zu der Arbeit mit den Jugendlichen sollte Kontakt zu den Eltern aufgenommen werden, um Praktikumsfelder einzugrenzen, Bewährtes zu erörtern und die Eltern zu motivieren, sich an der Praktikumsplatzsuche zu beteiligen. Da die Ängste der Eltern hinsichtlich der beruflichen Entwicklung ihrer Kinder oftmals zur Verunsicherung der Schüler beiträgt, sollte die Möglichkeit der Zusammenarbeit und Unterstützung rechtzeitig signalisiert werden. In dem Zusammenhang können auch WfB, anthroposophische Einrichtungen und Wohngruppen thematisiert werden.
Der erste Kontakt zu den Betrieben sollte ohne SchülerIn und persönlich aufgenommen werden, da sich Telefonate als relativ wirkungslos erwiesen haben. Im Erstgespräch sollten die Möglichkeiten und Grenzen angesprochen und die Vorstellungen des Betriebes erörtert werden.
Es muß deutlich darauf hingewiesen werden, daß die tatsächliche Arbeitsleistung offen ist und die Jugendlichen in der neuen Situation u. U. Verhalten zeigen, das nicht immer im Einklang mit Leistung steht. Wichtig ist, daß vor Ort eine feste Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, um über flexible Arbeitszeiten und andere organisatorische und inhaltliche Fragen in der konkreten Situation zu sprechen.
Das Praktikum sollte konstant durch Dritte begleitet werden, was u. U. auch für Sondereinrichtungen gilt. Aufgrund des hohen Betreuungsaufwands kann diese Aufgabe nicht von LehrerInnen oder SozialpädagogInnen übernommen werden.
Die Eltern können bei gemeinnützigen Vereinen, in Hamburg z. B. Lebenshilfe, ausgebildete Unterstützung von SozialpädagogInnen bekommen oder beim Sozialamt Geld beantragen, um Studenten zu finanzieren.
Das sollten GesamtschullehrerInnen und SozialpädagogInnen, die das Betriebspraktikum von geistig behinderten SchülerInnen betreuen, bei ihrer Planung berücksichtigen:
-
Es ist gut, schon von der 7. Klasse an die SchülerInnen und die Eltern auf das Betriebspraktikum vorzubereiten.
-
Mit den Eltern können geeignete Praxisfelder entworfen werden. Bewährt haben sich die Bereiche Hotel, Bauernhof, öffentliche Verkehrsmittel, DB, Einzelhandel, Gärtnerei, Töpferei, Friseur, öffentliche Büchereien, kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe. Außerdem gibt es in einigen Gesamtschulen Karteien über geeignete Betriebe.
-
Die Eltern sollten rechtzeitig auf die Möglichkeit der außerschulischen Begleitung durch Fachkräfte während des Praktikums informiert werden. Diese kontinuierliche Betreuung durch SozialpädagogInnen oder StudentInnen ist eine notwendige Voraussetzung, wenn das Praktikum für die SchülerInnen erfolgreich sein soll. Es sei denn, der Betrieb wünscht eine regelmäßige Betreuung durch eigenes Personal. Finanziell kann die Begleitung durch die Eingliederungshilfe nach BShG § 49 bei der zuständigen Sozialbehörde beantragt werden.
-
Für die SchülerInnen ist es wichtig, daß sie systematisch und kontinuierlich auf das Thema Arbeit vorbereitet werden, ca. 1-2 Wochenstunden während der normalen Unterrichtszeit. Schwerpunkte sind Orientierung im Stadtteil, Kennenlernen von Gewerbeschulen und Wohngruppen.
-
Wenn es bereits schulinterne Arbeitsfelder gibt, wie u. a. Cafeteria, Schulzoo oder Garten, sollten auch sie einbezogen werden.
-
Es ist wichtig, die Betriebe rechtzeitig anzusprechen, entweder durch Eltern oder Pädagogen. Die Möglichkeiten und Grenzen im Tätigkeitsbereich müssen genau besprochen werden. Die Schwierigkeiten und Besonderheiten im Verhalten der SchülerInnen sollten klar betont und erläutert werden.
-
Wesentlich ist es auch noch, eine feste AnsprechpartnerIn im Betrieb zu haben, mit der alles auf dem Vorwege besprochen werden kann und die zuständig und verantwortlich ist.
-
Nach dieser gründlichen Vorbereitung sollte sich die SchülerIn vorstellen, evt. schon mit der BegleiterIn.
-
Auf dem Vorwege müssen dann noch die Arbeitszeiten festgelegt werden, die nicht zu lang sein sollten. Dagegen sollte aber Pünktlichkeit und Präsens in dieser Zeit erfüllt sein.
-
Auch die Ziele sollten definiert werden, eher allerdings kleinschrittartig, wie z. B., daß die SchülerIn es schafft, Personen angemessen anzusprechen oder sich Hilfe zu holen.
Nicht zuletzt ist es entscheidend, diesen Kontakt zum Betrieb nach dem Praktikum aufrechtzuerhalten und mit der AnprechpartnerIn eine gemeinsame Auswertung vorzunehmen. Aus Erfahrung läßt sich feststellen, daß ein Interesse des Betriebes an BPs von geistig behinderten SchülerInnen aufgebaut werden kann, das hoffentlich später auch zur beruflichen Integration führt.
Inhaltsverzeichnis
Volker Glenz, Berufsschullehrer an der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt in Hamburg (G12); Hartmut Schulze, Schulleiter der G12; Hartmut Sturm, Berufsschullehrer / Sonderpädagoge an der G12
Seit nunmehr 14 Jahren bestehen in Hamburg Integrationsklassen, in denen nichtbehinderte und behinderte Schüler[1] gemeinsam lernen. Für die Berufsschulen, die Träger der beruflichen Bildung und die Betriebe stellte sich ab 1993, als die ersten Schüler mit geistiger Behinderung die Gesamtschule verließen, die Aufgabe, die Bemühungen um die gesellschaftliche Integration von Menschen - insbesondere mit geistiger Behinderung - fortzuführen und letztlich mit einer dauerhaften Eingliederung in das Arbeitsleben abzuschließen. In Hamburg befaßte sich deshalb 1992 eine Arbeitsgruppe, in der u.a. Vertreter der Handwerks- und Handelskammer, der Arbeitsverwaltung, der Ämter der Behörde für Schule Jugend und Berufsbildung sowie Vereine und Gewerkschaften mitwirkten, mit dieser Thematik.
Es entstanden daraufhin für Menschen mit geistiger Behinderung verschiedene integrative Wege in das Arbeitsleben:
-
Integrative Berufsvorbereitungsklassen (BVK-i, jetzt BVJ-i) als zweijährige berufsschulische Vollzeitmaßnahme,
-
Berufsvorbereitungsklassen teilqualifizierend ((BV-TQ) als zweijährige berufsschulische Vollzeitmaßnahme für behinderte Jugendliche mit anschließendem Jahr Teilzeitunterricht,
-
Zweijährige integrative Förderungslehrgänge (F1-i, jetzt BBE-i) als Arbeitsamtsmaßnahme eines Trägers in Kooperation mit einer Berufsschule und anschließendem begleiteten Praktikumsjahr in Betrieben.
Die zweijährigen Integrativen Förderungslehrgänge wurden als Bestandteil einer Gesamtkonzeption "Die berufliche Integration von Lernschwachen und behinderten Jugendlichen - unter besonderer Berücksichtigung der geistig behinderten Schülerinnen und Schüler aus Integrations-klassen" 1992 in einer behördlichen Arbeitsgruppe entwickelt.
Die Realisierung dieses Modellvorhabens begann im Sommer 1992 in einer Integrationsklasse der "Geschwister-Scholl-Gesamtschule" ge-einsam mit der "Staatlichen Berufsschule Eidelstedt (G 12)". Das Gesamtkonzept umfaßte
-
eine pädagogische Konzeption zur Fortsetzung der in den allgemeinbildenden Schulen begonnenen Integrationsarbeit im Hinblick auf eine dauerhafte, der jeweiligen Persönlichkeit gemäße individuelle und berufliche Entwicklung,
-
Rahmenbedingungenund pädagogisch strukturelle Anforderungen, die eine auf die speziellen Bedürfnisse und Interessen behinderter Menschen hin gestaltete Berufsvorbereitung und Qualifizierung erfordert.
Die Konzeption basiert auf vier Grundüberlegungen:
-
Ausgehend von einer Phase der beruflichen Orientierung in den Klassen 9 und 10 der Gesamtschulen sollte der Übergang in den Beruf in neuen Organisationsformen stattfinden. Als Rahmen wurde für die behinderten Schüler eine Lernorganisation gewählt, die die Schule als den alleinigen Ort der Integration aufgibt, d.h. ihn durch das Lernen und Arbeiten in pädagogisch gestalteten Projekten außerhalb der Schule erweitert, so daß ein begleiteter Kontakt und Austausch mit der außerschulischen und betrieblichen Realität möglich wird. Für die Realisierung der Projekte sollte die Berufsschule mit einem Träger kooperieren, so daß pädagogisch gestaltete Berufssituationen mit Ernstcharakter außerhalb der Schule möglich wurden.
-
Die meisten Mitschüler der behinderten Jugendlichen in den Integrationsklassen streben nach der 10. Klasse höhere Bildungsabschlüsse an oder beginnen eine Berufsausbildung. Das hat zur Folge, daß der Integrationsprozeß in das Berufsleben jetzt gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern stattfinden mußte, die nach dem Ende ihrer allgemeinbildenden Schulzeit noch eine Orientierung oder besondere Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in eine Ausbildung oder in den Beruf benötigten. Dies sind Jugendliche, die berechtigt sind, an Förderungslehrgängen bzw. BBE-Lehrgängen des Arbeitsamtes teilzunehmen.
-
Der Übergang in die Berufsvorbereitung soll durch möglichst durchgängige Betreuungs- und Begleitkontinuität gesichert sein: Deshalb ist ein Drei-Phasen-Konzept entwickelt worden, das an alle Beteiligten bzgl. Abstimmung und Kooperation besondere Anforderungen stellt. Nicht nur die Berufsschule und der Träger müssen zu integrierenden Einrichtungen weiterentwickelt werden, auch die unterschiedlichen Ressorts der Schul-, Arbeits- und Rehabilitationsverwaltung müssen teilweise umdenken und die integrative Qualifizierung von Menschen mit geistiger Behinderung als übergreifende, gemeinsame Aufgabe begreifen.
-
Dievierte Grundüberlegung bezieht sich auf Elemente der pädagogischen Arbeit, die den Prozeß der Persönlichkeitsbildung und der individuellen Entwicklung von Neigungen, Fähigkeiten und Kompetenzen besonders unterstützen. Hierzu gehören neben der Förderung der sozialen Kompetenzen in der Gruppe die Einbeziehung künstlerischer Prozesse als Bestandteil einer persönlichkeitsorientierten Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt.
Ausgehend von diesen vier Grundüberlegungen ist der Integrationsprozeß in dieser Konzeption durch eine innovative Verknüpfung von vier Elementen geprägt:
-
Heterogenität der Lerngruppen, um den behinderten Jugendlichen ein möglichst anregungsreiches Lernen zu ermöglichen und die sozialen Kompetenzen der nichtbehinderten Jugendlichen zu entwickeln.
-
Duale Strukturd.h. enge Kooperation von Ausbildern, Berufsschullehrern, Sozialpädagogen und Arbeitsassistenten mit der Möglichkeit, Projektunternehmen (Bistro, Laden) zu Lernzwecken zu gründen.
-
Kontinuität der Betreuung der behinderten Jugendlichen durch enge Verzahnung der Arbeit der Mitarbeiter der beteiligten Institutionen in den drei Phasen des Konzeptes.
-
Persönlichkeitsfördernde Bestandteile in der Arbeit durch individualisiertes, selbständiges Lernen, durch Förderung von Gruppenprozessen und insbesondere auch durch die Einbeziehung künstlerischer Prozesse.
Die Konzeption sieht insgesamt drei Phasen vor, die aufeinander aufbauen und durch unterschiedliche Partner realisiert werden, wobei eine enge Verknüpfung der Phasen gewährleistet ist. Die drei Phasen gestalten den Weg der geistig behinderten Menschen
-
von der Berufsorientierungin der Gesamtschule
-
über die dual organisierteBerufsvorbereitung und berufliche Qualifizierung in derBerufsschule und bei einem Träger
-
bis hin zur beruflichen Integrationin einen Betrieb begleitetdurch Fachdienste einer WFB der Hamburger Arbeitsassistenz (siehe Abb.1).
Derzeit ist insgesamt eine 6-jährige Förderung in diesen drei verschiedenen Qualifizierungsphasen konzeptionell möglich. Seit 1.8.1997 befinden sich die ersten vier Teilnehmer erstmals in der Phase der betrieblichen Integration und werden durch eine Arbeitsassistenz der ELBE-Werkstätten begleitet.
Die geistig behinderten Schüler aus Integrationsklassen (anders als Abgänger aus Sonderschulen für geistig behinderte Menschen mit durchschnittlich 12 Schuljahren) beginnen bereits nach der 10. Klasse mit der Berufsvorbereitung und Qualifizierung. Dies ist sinnvoll, um möglichst früh mi t einer Orientierung auf die sozialen Anforderungen der Arbeitswelt zu beginnen - erfordert aber auch genügend Zeit, um die notwendigen persönlichen Reifungs- und Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.
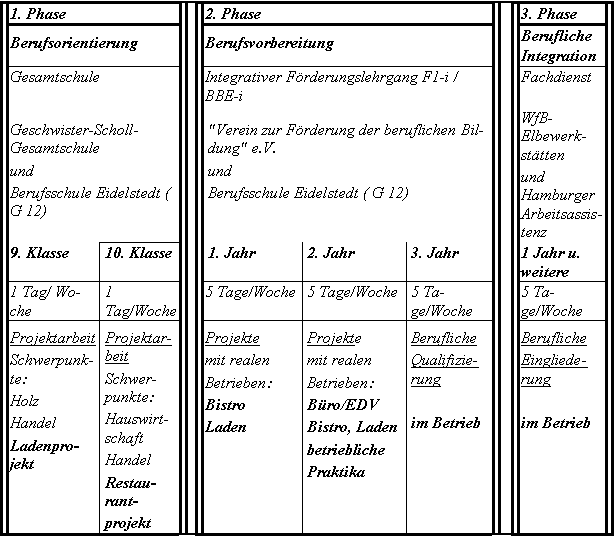
Abbildung 1: Schaubild des Gesamtkonzeptes
Das Schaubild macht deutlich, daß der integrative Weg von der Schule hin zu einer möglichen betrieblichen Integration auf drei Säulen beruht:
Berufsorientierung - Berufsvorbereitung - Berufliche Integration
In der Phase der Berufsvorbereitung und Berufsqualifizierung arbeiten der "Verein zur Förderung der beruflichen Bildung" und die G 12 drei Jahre zusammen. In den ersten beiden Jahren nehmen die behinderten Jugendlichen an 4 Projekten mit Ernstcharakter teil. Im dritten Jahr kommen die behinderten Jugendlichen an einem Tag in der Woche in die Berufsschule und arbeiten an den anderen vier Tagen in Praktikumsbetrieben. Dort werden sie am Arbeitsplatz von Arbeitsassistenten betreut.
In der dritten Phase erfolgt der Übergang zu einer dauerhaften Beschäftigung - als Einstieg auf der Basis eines Praktikantenvertrages. Durch eine Betreuung am Arbeitsplatz werden die behinderten Jugendlichen sicherer in den verschiedenen Aufgabengebieten und finden auch sozial ihren Platz im Betrieb. Am Ende dieses Eingliederungsprozesses soll die Übernahme in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitsvertrag stehen.
In enger Kooperation entwickelten die Staatliche Berufsschule Eidelstedt und der "Verein zur Förderung der beruflichen Bildung" ein Konzept für einen integrativen Förderungslehrgang (F1i), der die erfogreiche Arbeit in Phase 1, der Kooperation zwischen der Geschwister-Scholl-Gesamtschule und der G12, fortsetzt. Einer der Hauptvorteile dieser Kooperation liegt darin, daß die Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln in Förderungslehrgängen im AfG geregelt ist und dadurch betriebsähnliche Strukturen geschaffen werden können. Darüber hinaus werden die Teilnehmer finanziell nach dem AfG gefördert.
Um für die Jugendlichen den Übergang von der Sek. I zur Sek. II zu erleichtern, wird das Team im F1i durch den Klassenlehrer und den Berufsschullehrer, den sie aus der Kooperation im 9. und 10. Schuljahr kennen, gebildet. Dazu kommen die Kollegen des Vereins zur Förderung der Beruflichen Bildung, eine Hauswirtschaftsmeisterin, eine Sozialpädagogin sowie eine Arbeitsassistentin der Berufsschule.
Im Förderungslehrgang F1i werden insgesamt zwölf Teilnehmer gefördert, davon drei bis vier Jugendliche mit Behinderung aus Integrationsklassen.
Viele Vorerfahrungen aus der Gesamtschule kommen nun den Jugendlichen im ersten Förderungsjahr zugute: Die Gruppe plant und realisiert im ersten Halbjahr gemeinsam ein Ladenprojekt, in dem Spielzeuge und andere Artikel in einem Einkaufszentrum verkauft werden. Ein Unterschied zur Schule ist jedoch deutlich: Das Geschäft hat reguläre Ladenöffnungszeiten von Montag bis Samstag und eine Arbeitswoche insgesamt 38,5 Stunden, auch wenn diese nicht vollständig im Laden zu leisten sind.
Im zweiten Halbjahr wird das "Bistro zum Kölibri" als Lernort eröffnet. Auch hier profitieren die Jugendlichen von ihren Erfahrungen aus dem Schulrestaurant.
An das erste Förderungsjahr schließt sich ein zweites Förderungsjahr für die Teilnehmer mit Behinderung an. Nichtbehinderte Teilnehmer stoßen neu dazu, da für diese die Teilnahme auf ein Jahr begrenzt ist. Gleichzeitig beginnt ein zweiter Lehrgang, in dem die Schulabgänger aus der nachfolgenden Integrationsklasse der Gesamtschule aufgenommen werden. Es gibt nun zwei Lehrgänge mit zwei Teams, die das erarbeitete Konzept weiterentwickeln: Während die eine Gruppe das Bistro führt, betreibt die andere ein Ladengeschäft.
Die Jugendlichen im zweiten Förderungsjahr sind jetzt bereits in vielerlei Hinsicht routiniert. Verschiedene Langzeitpraktika werden mit gutem Erfolg absolviert. Auch im Bistro lernen die Teilnehmer zunehmend komplexere Aufgaben zu übernehmen und bleiben selbst in Belastungssituationen immer besser handlungsfähig. Im zweiten Halbjahr dieses 2. Förderungsjahres wird wieder ein Ladengeschäft geführt.
Für die Jugendlichen mit Behinderung kann ein drittes Förderungsjahr aufgrund der positiven bisherigen Entwicklung im Wege einer Einzelfallgenehmigung durch das Arbeitsamt bewilligt werden. Ziel im dritten Jahr ist eine konkrete Qualifizierung in einem Betrieb und parallel dazu weiterhin ein berufsschulisches Angebot. Konkret bedeutet dies, daß die Jugendlichen 4 Tage in der Woche im Betrieb sind und an einem Tag in der Woche die Berufsschule besuchen.
Im Rahmen der Förderungslehrgänge werden durch Betriebe reale Lernsituationen geschaffen, die pädagogische Projekte darstellen. Lehrer und Ausbilder verständigen sich mit den Teilnehmern über die Projekte, die Gesamtaufgabe wird eingegrenzt, Rahmenbedingungen werden benannt, Wünsche der Jugendlichen aufgenommen. Den Teilnehmern werden die Ernstsituationen schnell bewußt, sie erkennen den Sinn und die Bedeutung unmittelbar in den Lernsituationen, sie setzen sich mit ihren Ängsten aber auch Erfolgen in den transparenten Lern- und Arbeitsprozessen auseinander. Alle Teilnehmer finden Aufgaben unterschiedlichen Niveaus vor und können sich mit ihren Fähigkeiten und Anforderungen an sich selber einbringen. In Projekten treten immer wieder unterschiedlichste Spannungen und Konflikte auf, auch in der Zusammenarbeit von Teilnehmern mit und ohne Behinderung. Das Aufspüren und Bearbeiten dieser Spannungen und Konflikte treibt einerseits die Projekte voran, ist andererseits für das emotionale sich Wohlfühlen aller Teilnehmer unabdingbare Erfolgsbasis. Ständige Reflexionen sorgen dafür, daß es nicht beim bloßen Alltagshandeln bleibt, auch hierbei können sich alle Teilnehmer entsprechend ihren Fähigkeiten und ihrem Entwicklungsstand einbringen.
Die Projekte werden nicht nur punktuell eingesetzt, sondern sind während des gesamten Zeitraumes unverzichtbarer Bestandteil des Lernens. Allein durch den Zeitrahmen und durch die sehr enge Verzahnung des Vereins als Träger der Maßnahme mit der Berufsschule wird sichergestellt, daß keine theoretische Überfrachtung stattfindet, sondern statt dessen handlungsorientiertes Lernen im Mittelpunkt steht. Die notwendigen Fachkenntnisse werden nicht separat vermittelt, sondern prozeßbegleitend immer dann, wenn im Projekt ein Anlaß entsteht und es deshalb auch den Teilnehmern notwendig erscheint.
Wesentlich an dieser Lernform ist, daß immer wieder reale Probleme entstehen, die gelöst werden müssen, damit es nicht zu einer Störung der betrieblichen Abläufe im Projekt kommt. Die Probleme werden gemeinsam analysiert, verschiedene Lösungsmöglichkeiten diskutiert und verantwortlich gelöst. Auf der einen Seite gibt es Problemstellungen, die in allen Projekten mit realen Lernsituationen entstehen, wie die Planung von Arbeitsabläufen, Zuteilung der Arbeitsplätze, Festlegung von Arbeitszeiten. Auf der anderen Seite gibt es Problemstellungen, die für alle Beteiligten unvorhersehbar auftauchen, wie Diebstähle, Belästigungen, Kommunikationsstörungen etc. Damit diese Probleme auch gelöst oder geklärt werden können, ist die Schaffung eines institutionellen Rahmens notwendig. Dazu gehören praxisfreie Tage zur Reflexion, Planung, Problemlösung und Wochenplanung, Morgenrunden zur Erstellung von Tagesarbeitsplänen und Gesprächsrunden für beispielsweise Tagesabschlußbesprechungen.
Die Anwendung der Projektmethode in Verbindung mit der Realisierung von Ernstsituationen schafft somit einen pädagogischen Rahmen, der vielfältige Lernanlässe, Aufgaben, Probleme nach sich zieht und verschiedene Lösungsmöglichkeiten zuläßt. In diesem Rahmen kann jeder Teilnehmer die für ihn geeigneten Lernmöglichkeiten finden und erproben bzw. die Ausbilder können die Projekte nutzen, um Teilnehmern mit Behinderung, die nicht imstande sind, selbst geeignete Aufgaben zu finden, entsprechende Tätigkeiten zu übertragen oder zu erproben.
Da Jugendliche mit Behinderung viel mehr als nichtbehinderte durch konkrete Erfahrung lernen, müssen über längere Zeiträume Lernsituationen geschaffen werden, die im Sinne lebensbedeutender Orientierungshilfen auf den zukünftigen Übergang ins Berufsleben vorbereiten. Dazu gehört der Erwerb von Kompetenzen, die eine gewisse Berufsreife am Ende der Förderung gewährleisten, z.B. Interesse an bestimmten beruflichen Tätigkeiten entwickeln, eine Vorstellung vom Leben und Rhythmus in der Arbeitswelt haben, elementare Kenntnisse einfacher handwerklicher Grundfertigkeiten besitzen, Wege zum Arbeitsplatz selbständig bewältigen können und auch Probleme am Arbeitsplatz erleben. Diesen pädagogischen Anforderungen in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen wird die Projektmethode in besonderer Weise gerecht. Hier ist alles "echt" und konkret erfahrbar. Erfolge, aber auch Mißerfolge ziehen in der Regel ein direktes "Feedback" nach sich. Dieser ganzheitliche Ansatz beinhaltet viele konkrete Möglichkeiten, die Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern. Von der entspannten Lernatmosphäre profitieren die Jugendlichen mit und ohne Behinderung gleichermaßen.
Seit dem Beginn Integrativer Förderungslehrgänge wurde in jedem Jahr ein Ladengeschäft geführt. Der Schwerpunkt Gastronomie wurde mit dem "Bistro zum Kölibri" realisiert, daß seit 1994 besteht und fortgeführt wird. Die Schwerpunkte Hauswirtschaft und Verwaltung/EDV werden am Lehrgangsstandort Niekampsweg praktiziert. Im folgenden sollen die einzelnen Praxisorte näher vorgestellt werden.
Im ersten Jahr des Integrativen Förderungslehrgangs wurde von September 1994 bis Januar 1995 eine Geschenkboutique geführt. Gemeinsam mit den Teilnehmern wurde über den Namen, das Sortiment und möglichen Standort beraten. Das Sortiment stand schnell fest: In der Vorweihnachtszeit sollten Spielzeuge und andere Geschenkartikel in einem Einkaufszentrum verkauft werden. Als Standort wurde ein leerstehendes Ladengeschäft im Tiefparterre im Einkaufszentrum Niendorf-Nord gewählt. Das Geschäft bekam den Namen "Überraschungsei" und hatte reguläre Öffnungszeiten von Montag bis Samstag einschließlich der langen Samstage in der Vorweihnachtszeit.
Im Lehrgangsjahr 1995/96 wurde ein Ladenprojekt in der Alsterdorfer Straße aufgebaut. An diesem Standort wurden zwei Projekte realisiert, da inzwischen ein zweiter Förderungslehrgang eingerichtet worden war. Von September 1995 bis Januar 1996 wurde dort der "World-Shop" mit ähnlichem Sortiment wie beim "Überraschungsei" betrieben. Im zweiten Halbjahr von 2/96 bis 7/96 wurde dann vom anderen Lehrgang das Blumengeschäft "Grüner Fleck" geführt.
Im Lehrgangsjahr 1995/96 wurde ein neuer Standort für das Ladenprojekt in der Bahrenfelder Straße aufgebaut. In dem dort gegründeten Laden "Tausendwunder" werden Second-Hand Kinderbekleidung, Spielzeuge, Bücher usw. sowie eine Auswahl neuwertiger Waren verkauft.
Mit diesem neuen Ladengeschäft fiel auch die Entscheidung, mit dem Ladengeschäft fest an einem Standort zu bleiben und auch das Sortiment im wesentlichen nicht zu wechseln. Auch der Geschäftsname soll von den jeweiligen Gruppe übernommen werden. Dies erschien aus verschiedenen Gründen für die weitere Projektarbeit als vorteilhaft: Neben der hohen Anzahl an Geschäftsvorfällen erwies sich das Second-Hand-Sortiment als außerordentlich geeignet, unterschiedlichste Tätigkeiten auf verschiedenen Niveaus im Hintergrund des Geschäftsbetriebes zu organisieren. Es wurde möglich, bestimmte Waren auf Lager zu halten. Schließlich konnte auch eine Stammkundschaft gewonnen werden.
Dies hatte eine Verschiebung der Inhalte zur Folge: In den ersten beiden Jahren hatten Themen wie Standortsuche, Sortimentswahl, Namengebung, Einkauf der Waren etc. einen sehr hohen Stellenwert und waren zumindest zu Beginn des Lehrgangs die zentralen Themen für die Gruppe. Mit dem festen Standort konnte mit den neuen Gruppen sofort in die konkrete Planung des Ladenbetriebes eingestiegen werden. Geblieben ist das Prinzip, daß jede Lehrgangsgruppe in der von ihr zu verantwortenden Zeit den Laden wirtschaftlich autonom führt, d.h. das Geschäft wird von der Gruppe eröffnet, geführt und zum Ende des Halbjahres auch wieder abgewickelt.
Viele andere Themen sind geblieben: Es werden Dienstpläne entwickelt, so daß immer nichtbehinderte Teilnehmer mit behinderten Teilnehmer gemeinsam im Laden unter Anleitung eines Ausbilders oder eines Lehrers Dienst haben. Im Laden sind Arbeitsplätze wie Kasse, Bedienung, Lager usw. zu besetzen, so daß immer bis zu vier Jugendliche im Laden Dienst haben. Die Arbeitszeiten der Jugendlichen orientieren sich hier an den Ladenöffnungszeiten und müssen entsprechend in monatlichen Dienstplänen berücksichtigt werden. Die übrigen Teilnehmer arbeiten in der Verwaltungsgruppe (s. 0) am Standort Niekampsweg. Dort wird vorrangig mit Hilfe der EDV an Abrechnungen, Kassenbüchern, Korrespondenzen, Werbung etc. gearbeitet.
Im vierten Jahr wurde das Ladengeschäft "Tausendwunder" (vgl. Abb.2) von den Teilnehmern des neuen BBE-i Lehrgangs Ende August 1997 wieder neu eröffnet. Dabei wurden die vorhanden Strukturen weiter benutzt und ausgebaut.
Diese Auflistung macht die konkreten Handlungs- und Lernanlässe in einem realen Betrieb deutlich. Dabei lassen sich fast alle Tätigkeiten auf verschiedenen Anforderungsniveaus ausführen. Hier finden die ebenfalls sehr leistungsheterogen Jugendlichen ohne Behinderung Anforderungen auf ihrem Niveau wie auch die Jugendlichen mit Behinderung. Die Möglichkeiten reichen dabei von der Arbeit mit konkreter Einzelunterstützung bis hin zur selbständigen, eigenverantwortlichen Übernahme einzelner Geschäftsbereiche, wie z.B. den Kassenbetrieb, wo es nur noch am Abend eine Endkontrolle gibt. Durch die gemeinsame Arbeit von Jugendlichen mit und ohne Behinderung lernen diese die Stärken und Möglichkeiten der anderen kennen und schätzen. Die Jugendlichen mit Behinderung finden unter den nichtbehinderten Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, ohne daß sie sich in einer pädagogisch durchstrukturierten Situation befinden. Die Aufträge sind real und es wird von ihnen durch die "Kollegen" eine echte Arbeitsleistung erwartet. Andererseits lernen die Jugendlichen ohne Behinderung schnell die Stärken und auch Grenzen der Behinderten kennen und einschätzen, so daß sie diese auch immer besser an den richtigen Stellen einbinden. Hier finden viele Kommunikationsprozesse statt, die typisch für die integrative Arbeit sind und im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen mit Behinderung von enormen Wert sind.
Unter der Vielzahl in einem Ladengeschäft anfallender Tätigkeiten seien im folgenden einige aufgelistet, die sich pädagogisch bewährt haben:
Abbildung 2: Arbeiten im Laden
|
Kasse |
Verkauf |
Verwaltung / Sonstiges |
|
Kassieren |
Ware einräumen |
Warenkontrolle |
|
Geld wechseln |
Ware auszeichnen |
Geld zur Bank bringen |
|
Geld zählen |
Ware zurücklegen |
Kontoauszüge holen |
|
Zählleiste bedienen |
Ware umräumen |
Dienstpläne lesen, erkennen |
|
Kassenabrechnung: |
Verkaufsgespräch führen |
Ladenreinigung |
|
Abrechnungszettel ausfüllen |
Nachbestellungen festhalten |
Telefonate führen |
|
Einkäufe abrechnen |
Kundenwünsche festhalten |
Kerzenproduktion |
|
Werbezettel machen |
||
|
Handzettel verteilen |
||
|
Werbeschilder anbringen |
||
|
Dekoration |
||
|
Inventur, Zählzettel |
Im zweiten Halbjahr des 1. Förderungslehrgangs wurde als Praxisort für der Lehrgangsinhalt Gastronomie/Hauswirtschaft das "Bistro Kölibri" am Hein-Köllisch-Platz gegründet. Dieses Bistro wird seitdem von den Lehrgangsgruppen im halbjährlichen Wechsel mit dem Ladengeschäft betrieben. Das Bistro selbst deckt den Schwerpunkt Gastronomie und im Rahmen der Hauswirtschaft die Zubereitung kleiner Speisen ab. Dazu kommt die Zubereitung eines Stammessens in der Küche am Niekampsweg (s.3.2.3.) und die Verwaltungsarbeit (s.0), die im Rahmen des Bistrobetriebes entstehen.
In der Praxis bedeutet dies, daß die Lehrgangsgruppe, die für den Betrieb des Bistros zuständig ist, drei Tätigkeitsfelder auszufüllen hat: Bistro, Küche und Verwaltung. Auch hier entsteht realitätsnah das Problem der Dienstplangestaltung. Dienstpläne werden während der Planungssitzungen mit den Teilnehmern erarbeitet. Es entsteht Transparenz bei der Gestaltung und Einsicht in die betrieblichen Erfordernisse. Zu berücksichtigen ist auch immer wieder der Einsatz der Jugendlichen mit Behinderung, die einerseits nach ihren persönlichen Kompetenzen eingesetzt werden , andererseits aber auch alle betrieblichen Abläufe kennenlernen sollen. Wie in den Ladengeschäften lassen sich auch im Bistro fast alle Tätigkeiten auf unterschiedlichem komplexem Niveau organisieren, so daß für alle Teilnehmer adäquate Anforderungen gefunden werden können.
Ein Ausschnitt aus den möglichen Tätigkeiten im Bistro ist in Abbildung 3 zu sehen.
Abbildung 3: Arbeiten im Bistro
|
Vorleistung |
Kasse |
Service |
Essen |
Aufräumen |
|
Tische stellen |
Kassieren |
Bestellung aufnehmen |
Vorbereitung Frühstück |
Tische abräumen |
|
Tische decken, Blumen stellen |
Geld wechseln |
Servieren |
Kleine Gerichte zubereiten |
Putzen |
|
Speisekarten vorbereiten |
Einkäufe abrechnen |
Tische abräumen, neu eindecken |
Menü auffüllen |
Aufräumen |
|
Stelltafel beschriften |
Kassenabrechnung: zählen, Zählzettel ausfüllen |
Getränke ausschenken |
Nachtisch zubereiten |
Wegstellen |
|
Dekoration |
Geldzählleiste bedienen |
Kaffee/Tee nachkochen |
Portionieren |
Reste entsorgen |
|
Kasse aufstellen |
Abrechnungszettel ausfüllen |
Getränke nachfüllen |
Tische beiseite stellen |
|
|
Geld zählen |
Müll entsorgen |
|||
|
Geld einsortieren |
Abschließen |
|||
|
Geschirr-spülmaschine |
Leergut entsorgen Einkäufe |
Wie oben schon deutlich wurde, existiert für beide Betriebe auch eine Verwaltungsgruppe. Hier werden alle im Rahmen der Projekte anfallenden Verwaltungsaufgaben erledigt. Dazu werden die Teilnehmer in die Anwendung der EDV eingewiesen und erlernen wichtige Grundfertigkeiten. Im Anwendungsbereich werden Kenntnisse in der Textverarbeitung (Word) und in der Tabellenkalkulation (Excel) vermittelt.
Die wichtigsten Verwaltungsaufgaben in der Bistro-Gruppe umfassen die Kassenbuchführung, Einkauf für das Stammessen, Kalkulation der Rezepte, Werbung, Speisenkartenerstellung, Tageskarten, Korrespondenz usw.
Bei der Laden-Gruppe ist neben dem Kassenbuch in erster Linie die gesamte Warenbeschaffung zu nennen. Hier wird weitgehend mit Kommissionsware gearbeitet. Es müssen Einkaufspreise, Verkaufspreise, Umsätze, Gewinn und Verlust etc. ständig berechnet werden. Daneben gibt es Korrespondenz mit den Zulieferbetrieben und Kunden.
In beiden Gruppen kümmern sich die Teilnehmer während der Verwaltungsarbeit auch um externe Betriebspraktika. Dazu werden Lebensläufe und Bewerbungsschreiben erstellt. Zum Lehrgangsende ist die Lehrstellensuche bzw. Arbeitsplatzsuche das wichtigste Thema.
Auch die Jugendlichen mit Behinderung werden voll in die Verwaltungsarbeit integriert. Für viele ist gerade der Umgang mit dem Computer so reizvoll, daß sie sich sehr motiviert wieder mit Schriftsprache oder Rechenproblemen auseinandersetzen. Einen Überblick über Tätigkeiten im Rahmen der Verwaltungsarbeit mag die folgende Liste geben. Dabei handelt es sich in diesem Fall um spezielle Tätigkeiten für die Teilnehmer mit Behinderung, da sich im Rahmen der Verwaltungsarbeit nicht alle Aufgaben auf beliebigen Anforderungsniveaus widerspiegeln lassen.
Abbildung 4: Arbeiten in der Verwaltung / EDV
|
EDV |
Verwaltung |
|
Texte abschreiben; lesen |
Ablage in eigene Ordner |
|
Bedienung Hardware |
Kuvertieren |
|
Mausbedienung |
Kopieren |
|
Eigene Texte schreiben |
Schneidemaschine bedienen |
|
Textgestaltung |
Lochen |
|
|
Sortieren nach Zahlen, Belegnummern |
|
kleine Tabellen erstellen |
Belege aufkleben |
|
Kassenabrechnung Excel |
Telefonieren |
|
Serienbriefe |
Gespräche annehmen, weiterleiten |
|
Werbezettel ausmalen |
|
|
Dokumentation, z. B. Bilder kleben |
|
|
Ausschneiden |
Diese Aufstellung macht deutlich, daß auch in diesem Bereich ernstzunehmende Aufgabenstellungen für Menschen mit geistiger Behinderung vorhanden sind. In vielen Fällen waren die Ergebnisse sehr positiv. Auch die nichtbehinderten Teilnehmer waren oft überrascht vom Leistungsvermögen ihrer Kollegen.
Das 3. Förderungsjahr im Rahmen des F1-i / BBE-i versteht sich als Fortsetzung der integrativen Berufsvorbereitung F1-i / BBE-i für Abgänger mit geistiger Behinderung aus Hamburger Integrationsklassen.
Die positiven Entwicklungen in den ersten beiden Förderungsjahren in unseren Schwerpunkten Hauswirtschaft, Einzelhandel und Gastronomie sollten in diesem Jahr auf betrieblicher Ebene weiter ausgebaut und gefestigt werden.
Mit dem Förderungslehrgang 1996/97 haben erstmals vier geistig behinderte Menschen das dritte Förderungsjahr durchlaufen. Seit dem 1.8.1997 befinden sich erneut drei Teilnehmer im dritten Förderungsjahr, während drei der vier aus dem 1. Durchgang seit 1.8.97 in der Phase 3 "Berufliche Integration" bereits in Betrieben integriert sind.
Die positiven Erfahrungen mit Betriebspraktika in den ersten beiden Förderungsjahren bestätigten sich auch im dritten Förderungsjahr. Drei der vier Teilnehmer haben sich im Förderungsjahr 1996/97 gut in die Betriebe integriert. Dabei handelte es sich um zwei Plätze in großen Hotels und eine im hauswirtschaftlichen Bereich eines Kindergartens. Im laufenden Jahr 1997/97 haben zwei junge Frauen einen Platz in Altenheimen gefunden und ein junger Mann bei der Hamburger Hochbahn.
Die Praktikanten haben feste Aufgaben in bestimmten Bereichen gefunden und arbeiten zum Teil sehr selbständig. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist als harmonisch zu bezeichnen. Sie sind jeweils von Montag bis Freitag im Betrieb und haben montags Ihren Schultag.
In den Betrieben werden sie je nach Bedarf vor Ort am Arbeitsplatz konkret unterstützt. Parallel dazu laufen Gespräche mit den jeweiligen Geschäftsleitungen und Kollegen. Hier können Erfahrungen mit dem Praktikanten reflektiert und Probleme angesprochen werden.
Aus Sicht der Praktikanten läßt sich sagen, daß diese sich durchaus wohl an ihren Arbeitsplätzen fühlen und gerne zur Arbeit gehen. Fehl- und Krankheitszeiten sind sehr gering. Im Laufe der Zeit haben sie in ihrem Betrieb sozusagen bevorzugte Bezugspersonen gefunden, die sie selbständig bei Problemen ansprechen. Diese Selbständigkeit am Arbeitsplatz konnte sich nur auf Grund der intensiven Betreuung der Praktikanten während der gesamten Praktikumszeit seitens des Trägers und der Berufsschule entwickeln. Die Art der Betreuung hat sich dabei qualitativ verändert in Richtung Beratung und Hilfe bei immer wieder auftretenden kleineren Problemen. Hier ist es wichtig, die Betriebe dauerhaft zu entlasten, bzw. schon im Vorwege tätig zu werden. Es wurde deutlich, daß auch auf Dauer immer mit Betreuungsbedarf am Arbeitsplatz zu rechnen ist. Es ist nicht davon auszugehen und kann auch nicht das Ziel sein, diese Personengruppe ganz ohne Arbeitsassistenz dauerhaft in Betriebe zu integrieren.
Bei der vierten Praktikantin im Jahr 1996/97 erwies sich die Integration in einen Betrieb als wesentlich schwieriger als von uns erwartet. Die anfängliche Einzelbetreuung im Betrieb konnte nicht reduziert werden. Auf betrieblicher Seite konnte niemand diese Anleiterfunktion übernehmen, ohne daß es den Betriebsablauf massiv beeinträchtigt hätte. Als Konsequenz wurde das Praktikum abgebrochen. Es schloß sich ein Praktikum in einer WfB an. Hier zeigte sich, daß diese Praktikantin vorläufig nur in einer WfB einen geeigneten Arbeitsplatz findet und an eine Integration in einen Betrieb vorerst nicht zu denken ist.
Die Rückmeldungen aus den Betrieben über Erfahrungen mit Praktikanten aus dem F1i ließen erkennen, daß unter bestimmten Voraussetzungen die Integration von geistig behinderten Menschen in Betriebe denkbar und wünschenswert ist. Diese Erfahrungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
-
Grundsätzlich sind viele Betriebe bereit, geistig behinderten Menschen einen Praktikumsplatz oder ein Langzeitpraktikum (1Jahr) anzubieten.
-
Betriebe brauchen "Schnupperpraktikanten", um festzustellen, wie die Mitarbeiter auf geistig behinderte Menschen am Arbeitsplatz reagieren.
-
Entscheidend für die Aufnahme von geistig behinderten Menschen in einen Betrieb ist die Grundeinstellung der Geschäftsleitung bzw. Personalchefs. Entsprechend wichtig sind vorbereitende Gespräche auf dieser Ebene.
-
Praktikanten dürfen keine unzumutbare Mehrbelastung oder zusätzliche Kosten, die von den Betrieben zu tragen wären, verursachen.
-
Betriebe brauchen Hilfe bei der Integration auf zwei Ebenen: Konkrete Hilfe am Arbeitsplatz des Praktikanten und Gesprächs- und Reflexionsangebote für die Mitarbeiter.
-
Die Motivation der Betriebe, geistig behinderte Menschen zu beschäftigen, ist in der Regel nicht darin begründet, die Arbeitskraft dieser Menschen möglichst ökonomisch zu nutzen. Ziel ist deshalb, einen Teilbereich betrieblicher Arbeit einem Menschen mit geistiger Behinderung anzubieten und so den dafür zuständigen Mitarbeiter evtl. zu entlasten.
Neben der Arbeit in den Betrieben und in Betriebspraktika existieren weitere Elemente: Wahlpflichtbereich, kulturelle Projekte und Kulturtechniken.
Der Wahlpflichtbereich umfaßt Politik, Sport, Kultur und soziale Gruppenarbeit. Abweichend vom grundlegenden Projektansatz in Verbindung mit den Dienstleistungseinrichtungen Bistro/Laden werden die Fächer Politik und Sport an einem für alle Jugendlichen praxisfreien Tag in der Woche isoliert unterrichtet. Teilweise werden im Fach Politik kleine Projekte, die von den Schülern ein großes Maß an Eigeninitiative verlangen, realisiert. Eine Themenauswahl erfolgt im Einvernehmen mit den Jugendlichen.
Es werden Angebote in den Bereichen Theater, Video, Töpfern, Tanzen, Arbeitskreis Liebe/Freundschaft und Zeitung gemacht. Die Wahlpflichtkurse Video, Theater und Zeitung sind besonders beliebt und in einem zweiten Jahr gewählt worden. Stolz sind alle Teilnehmer auf ihre Präsentationen, sei es die Herausgabe einer Zeitung oder der Abschlußball.
Im Wahlpflichtbereich Sport werden den Teilnehmern Angebote gemacht, die der allgemeinen Fitneß dienen. Ziel ist hier vorrangig, daß die Jugendlichen Sport als Möglichkeit entdecken, einerseits die eigene Gesundheit zu pflegen und andererseits Sport als eine sinnvolle Freizeitbestätigung erfahren. Daneben bieten sich gerade im Sport vielfältige Situationen, in denen nichtbehinderte und behinderte Teilnehmer gemeinsam aktiv werden können. Auf diese Weise entsteht auch ein wichtiges soziales Lernfeld, in dem Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Akzeptanz geübt und praktiziert werden können.
Darüber hinaus sind bei vielen Teilnehmern auch Bewegungsmangelerscheinungen zu beobachten, die durch gezielte Angebote wenigstens teilweise kompensiert werden können.
Kulturelle Projekte haben seit Beginn des Förderungslehrganges Integration eine wichtige Rolle gespielt. Die besondere Bedeutung des Faches Kultur ergibt sich aus seiner Aufgabenstellung, die bisherige Kette von Mißerfolgserlebnissen und Demotivation zu durchbrechen und Mündigkeit und persönliche Autonomie zu schaffen.
Um kreative Prozesse auszulösen, bedarf es einer von der angespannten Alltagssituation abgelösten Stimmung. Wir bedienen uns dabei bestimmter Meditationstechniken und Suggestivmethoden, die eine Entspanntheit entstehen lassen und die damit erst die Voraussetzungen schaffen, um schöpferische Prozesse zu initiieren. Bildhaft wird in diesem Zusammenhang oft die Beschreibung der Aktivierung der linken Gehirnhälfte bemüht, die im Gegensatz zur rational-logischen Denkweise der rechten Hälfte den Ort kreativ-musischer Prozesse darstellen soll.
An den Entspannungsprozeß schließen sich dann unterschiedlichste Möglichkeiten schöpferischer Ausdrucksweise an. Dies können sein:
-
Kreatives Schreiben
-
Malen, Modellieren
-
Bewegen, Tanzen, Spielen
-
Video, Fotografieren nebst selbst Entwickeln
-
Musizieren, insbesondere rhythmische Arbeit
-
Szenische Umsetzungen, die auch eine Verbindung der o.g. Ausdrucksweisen mit einschließen.
Beispielhaft sei hier erwähnt:
-
Schwarzes Theater
-
Schattenspiel
-
Commedia dell`arte
-
Spiel und Bau von Masken
-
Entdecken des ´inneren`Clowns
-
Musical, Playback-Revuen
Besonders erfolgreich für Entwicklungsschritte im Wachstum der Persönlichkeit ist das Theaterspielen, weil es einerseits sehr zielgerecht auf ein Produkt (Inszenierung) hin arbeitet und andererseits alle möglichen ´Nebentätigkeiten` ermöglicht (Licht, Schminke, Kostüme, Kulissen, Musik ...). Hier ist konkret erfahrbar, was mit dem Zusammenspiel von Körper und Geist gemeint ist. Und nicht zuletzt die Aussicht auf den Erfolg kann sowohl Motivation sein als auch große Ängste überwinden helfen. Ein Erfolg kann dann wirklich als Therapeutikum betrachtet werden, das das wichtigste Ziel der Arbeit, die Stärkung des Selbstvertrauens, mit zu realisieren verhilft.
Ziel dieser Techniken ist es, Körper und Geist in seinen Interdependenzen zu erfahren, um Zugang zu längst verschütteten Empfindungen zu finden, die ein authentisches Lebensgefühl hervorzubringen vermögen, das dann geeignet ist, Lernblockaden aufzulösen und jene schöpferischen Fähigkeiten zu entwickeln, die das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken, also jene Ich-Stärke vermitteln, die die besten und notwendigen Voraussetzungen sind, um auch im Arbeitsleben bestehen zu können.
Da bei den behinderten Jugendlichen der Grad der Behinderung recht unterschiedlich ist, lassen sich nur wenig allgemeine Aussagen über die Entwicklungschancen durch die beschriebene ´Kulturarbeit` machen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Jugendlichen i.d.R. eine besondere Affinität zu kreativen Aufgaben haben. Widerstände, wie sie bei den nichtbehinderten Jugendlichen oft anzutreffen sind, begegnet man nur selten, und die Offenheit und Direktheit führt immer wieder zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, die für die Nichtbehinderten auf Welten verweisen, die dazu taugen, bei sich selbst Spuren zu verfolgen, die es ihnen ermöglichen, Facetten anderer Lebenwirklichkeiten zu entdecken. Gerade weil bei den beschriebenen kreativen Prozessen die Kluft zwischen den behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen vergleichsweise geringer ist als im kognitiven Bereich, ergibt sich für letztere eine Chance der Akzeptanz, wie sie sonst im Alltag nur selten zu erreichen ist. Insofern ist das generelle Ziel, die Stärkung des Selbstvertrauens, auch bei den behinderten Jugendlichen durch die beschriebenen Methoden realisierbar.
Im Förderungslehrgang Integration ist die herkömmliche Strukturierung in Unterrichtsstunden und Unterrichtsfächer aufgehoben. Der theoretische Unterricht erfolgt in der Regel unmittelbar im Zusammenhang mit der praktischen Projektarbeit oder im Wahlpflichtbereich.
Vierteljährlich erhalten alle Jugendlichen in einem Gespräch mit ihrem Betreuer eine Rückmeldung über die Entwicklung und sollen Wünsche über das äußern, was sie noch lernen wollen.
Die nichtbehinderten Teilnehmer haben die Möglichkeit, den Hauptschulabschluß nachzuholen und erhalten halbjährlich ein Zeugnis. Aus den im Projektunterricht erbrachten Leistungsnachweisen, ergänzt durch Politikunterricht, Sport und Kunst werden Noten in folgenden Fächern erteilt:
|
Fachpraxis |
Fachtheorie |
Allgemeinbil-dende Fächer |
Wahlfach |
|
Hauswirtschaft |
Fachrechnen |
Deutsch |
Kunst |
|
Wirtschaft und Verwaltung |
EDV |
Politik |
|
|
Sport |
Die behinderten Teilnehmer erhalten jährlich ein Berichtszeugnis, in dem ihre Entwicklung dokumentiert wird. Da die behinderten Jugendlichen alle Projekte zweimal durchlaufen, wird außerdem in einer tätigkeitsbeschreibenden Skala das Erlernen von bestimmten Fertig- oder Fähigkeiten in den realen Lernorten festgehalten. So kann der Lernfortschritt festgehalten und die Stärken der Einzelnen können abgelesen werden.
Während des Förderungslehrganges F1-i absolvieren die Jugendlichen in jedem Förderungsjahr mindestens ein Betriebspraktikum. Wenn es für die berufliche Qualifizierung wichtig erscheint, wird ein zweites oder auch drittes Praktikum ermöglicht. Zwischen den Betrieben, den Praktikanten und dem Verein werden Praktikumsverträge abgeschlossen.
Art und Umfang des Praktikums richtet sich einerseits nach den Möglichkeiten der Teilnehmer und andererseits nach den betrieblichen Gegebenheiten. In der Regel wird ein Zeitraum von drei bis vier Wochen für die Betriebspraktika veranschlagt. Die Jugendlichen werden auf das Praktikum vorbereitet und in die möglichst selbständige Suche nach einem geeigneten Platz einbezogen.
Während des Praktikums werden die Jugendlichen je nach Bedarf durch eine Arbeitsassistenz im Betrieb betreut, in besonderen Fällen ist auch Einzelbetreuung erforderlich. Dabei sind in jedem Fall die betrieblichen Belange zu beachten und in der Planung schon zu berücksichtigen. Erfahrungsgemäß sind Betriebe, die sich bereit erklären, Jugendlichen mit geistiger Behinderung ein Praktikum anzubieten, in der Regel auch sehr aufgeschlossen, wenn es um konkrete Hilfen am Arbeitsplatz oder regelmäßige, auch unangemeldete Besuche vor Ort geht.
Betriebspraktika im Rahmen des F1-i knüpfen an die ersten Erfahrungen in Betrieben in den Praktika der Gesamtschule an.
Die Schwerpunkte in diesen Praktika verlagern sich in diesen Praktika in Hinblick auf das 3. Förderungsjahr, das ganzjährig im Betrieb bei einem Berufsschultag stattfindet.
Wichtige Fragen sind:
-
Wie weit ist der Jugendliche den Belastungen eines Arbeitstages gewachsen?
-
Werden die Erwartungen im Hinblick auf die sogenannten "Arbeitstugenden" Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß etc. erfüllt?
-
Reichen die sozialen Kompetenzen aus, um die kommunikativen Anforderungen am Arbeitsplatz zu bewältigen?
-
Wird eine Arbeitsleistung erbracht, die betrieblich zu verwerten ist?
-
Kann der Praktikant Probleme am Arbeitsplatz artikulieren und versucht er, diese zunächst selbst zu regeln?
-
Wie wird mit Kritik umgegangen?
-
Ist die Behinderung eine Thema im Betrieb, zu dem der Jugendlich selbst Stellung beziehen muß?
-
Gibt es im Betrieb geeignete Tätigkeiten, die langfristig eine Perspektive eröffnen?
Diese Fragen müssen sehr individuell angegangen werden und in möglichst enger Kooperation mit dem Betrieb gelöst werden. Dabei hat es sich als nützlich erwiesen, wenn vor Beginn des Praktikums oder nach kurzer Zeit eine Art Patenschaft im Betrieb zwischen einem Mitarbeiter und dem Jugendlichen gegründet wird. Dabei entsteht zum einen persönliche Nähe zu einer Person im Betrieb und andererseits haben die Arbeitsassistenten eine festen Ansprechpartner. Darüber hinaus hat sich gezeigt, daß diese "Zusatzaufgabe" von diesen Mitarbeitern in den meisten Fällen als positives und bereicherndes Element in ihrer Arbeit erlebt wurde (siehe Kasten: Interview im Mövenpick).
Optimal ist es, wenn im Verlauf verschiedener Praktika sich herauskristallisiert, welche Bereiche für den Jugendlichen auch langfristig geeignet erscheinen und unter Umständen ein Betrieb sich bereit erklärt, das dritte, betriebliche Förderungsjahr als Partner anzubieten. Hier liegen bisher überaus gute Erfahrungen vor.
Wie wichtig Praktika nicht nur für die Qualifizierung der geistig behinderten Menschen, sondern insgesamt für den integrativen Wandel in der Gesellschaft sind, soll stellvertretend für viele Betriebe das folgende Interview dokumentieren. Das Interview führte Annelore Schmidt, Mitarbeiterin im Integrativen Förderungslehrgang, im Mövenpickrestaurant in der Mönckebergstraße
[1] In diesem Artikel wird versucht, statt sprachsperriger Konstruktionen möglichst geschlechtsneutrale Rollenbezeichnungen zu verwenden (Teilnehmer, Schüler, Ausbilder, Lehrer etc.). Daß dies nicht immer gelingen kann, ist uns bewußt. Als Autoren meinen wir, wo immer es geht, beide Geschlechter.
Inhaltsverzeichnis
Annelore Schmidt, Hauswirtschaftsmeisterin in der Funktion einer Sozialpädagogin an der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt in Hamburg
Meine erste Frage: Ist Jasmin die erste Praktikantin, die mit geistiger Behinderung bei Ihnen gewesen ist?
Also bei mir persönlich nicht. Ich habe in meinen vorherigen Betrieben auch schon geistig behinderte Praktikanten gehabt, auch hier im Haus. Ich weiß, daß auch meine Vorgänger das vor Jahren schon gemacht haben, dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen aufgegeben haben.
Und was waren Ihre Beweggründe, einen Praktikanten mit geistiger Behinderung aufzunehmen, bzw. sind die Entscheidungsstrukturen im Betrieb bzgl. Aufnahme behinderter Praktikanten?
Also, wir sind zu dieser Entscheidung gekommen, weil wir im Betrieb selber schon vier behinderte Menschen beschäftigt haben, sowohl leicht körperlich als auch geistig Behinderte, und sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, und weil wir ganz einfach denken, daß gerade behinderte Menschen eine Chance verdienen, und der Erfolg gibt uns recht. Es hat nicht nur bei den Mitarbeitern ein anderes Umgehen miteinander in dieser Zeit stattgefunden, auch die Resonanz der Kunden war ja wirklich durch die Bank positiv.
Was waren Ihre Erwartungen und haben sich diese Erwartungen erfüllt?
Also nach dem ersten Eindruck von Jasmin hatte ich nicht erwartet, daß sie so viel Leistung bringen kann, wie sie jetzt tatsächlich gebracht hat. Es liegt sicher auch daran, daß es für sie das erste Mal war und sie ja auch gar nicht wußte, was auf sie zu kam. Aber wie sie sich in diesen Wochen entwickelt hat, das war schon absolut faszinierend. Sie hat ja zum Schluß bis auf Kassieren alle Tätigkeiten selbst ausgeführt, und auch der Umgang mit den fremden Menschen, mit Personen im Restaurant war toll.
Und was waren Ihre Befürchtungen? Waren diese Befürchtungen begründet?
Befürchtungen hatte ich von unserer Seite gar keine. Ich hatte ein bißchen Befürchtungen, daß es vielleicht von der Größenordnung dieses Restaurants für Jasmin ein bißchen viel sein könnte, weil ja doch, wenn es voll ist, sich 400 Leute hier bewegen und dann noch das Personal zusätzlich. Aber es ist ja überhaupt nichts passiert.
Hatten Sie vorher mit behinderten Menschen zu tun?
Ja, ich persönlich schon. Ich habe, wie gesagt, vorher in anderen Betrieben mit Behinderten gearbeitet, habe auch im Bekanntenkreis einige Familien, die behinderte Kinder haben.
Und glauben Sie, daß diese Vorerfahrungen unabdingbar sind oder reicht es, sich auf die neue Situation einzulassen?
Also, ich denke, bei jedem einigermaßen vernünftigen Menschen reicht eine Offenheit und der Wille, sich auf etwas Neues einzulassen, aus. Grundvoraussetzung ist, daß es Menschen sind, die miteinander umgehen wollen und können. Dann spielt es auch keine Rolle, ob es ein Behinderter ist oder ein sogenannter Normaler.
Gab es eine Einstellungsveränderung in bezug auf behinderte Menschen bei Ihnen oder in der Belegschaft?
Also bei mir nicht, weil meine Einstellung da sowieso eine sicherlich etwas offenere ist, aber ich habe es bei meinen Mitarbeitern bemerkt. Die Mitarbeiter waren sehr erfreut, was für ein Zusammenarbeiten möglich ist, und waren fasziniert von der Freude, mit der dieses Mädchen an die Arbeit gegangen ist, und haben dadurch wirklich eine andere Einstellung bekommen. Sie sind auch auf mich zugekommen und haben gefragt, ob wir das wieder machen.
Und können Sie sagen, was das Normale und was das Andere ausmacht? Für den Betrieb im Umgang mit Jasmin?
Normalerweise herrscht unter den Kollegen ein etwas rauher Tonfall. Das ist speziell in Hintergrundbereichen so, und man konnte in den Wochen merken, daß einfach sehr viel mehr gemacht wurde, ich drücke es mal so aus, eine hellere Atmosphäre untereinander war, daß die Aggressionen weggenommen wurden auf einmal.
Hatte Jasmin Publikumskontakte. Und wenn ja, können Sie von Reaktionen der Kundschaft auf die etwas andere Praktikantin berichten?
Ja, ja. Erste Reaktion der Kundschaft war: Oh toll, Mövenpick macht so etwas auch. Zweite Reaktion, speziell auf Jasmin bezogen, war: So ein nettes Mädchen, daß die das mit einer solchen Behinderung hier so hinkriegt, ist ja toll. Wir haben nur positive Reaktionen gehabt. Ich habe niemanden gehabt unter den Gästen, der gesagt hat: "Na, also was soll das denn". Ja, ich habe das ja selber auch gemerkt. Ich denke, es ist rübergekommen.
Wenn ein anderer Betrieb mit dem Gedanken spielt, behinderte Praktikanten aufzunehmen, was würden Sie denen raten? Was ist zu beachten, nach den von Ihnen gesammelten Erfahrungen?
Auf jeden Fall sollte ständig die gleiche Betreuung stattfinden von und durch einen erfahrenen Mitarbeiter, der auch, das haben wir hier festgestellt, nach Möglichkeit die Betreuungskurse für neue Mitarbeiter bei Mövenpick schon gemacht hat. Das ist eine Erfahrung, die man dabei sehr gut verwerten kann.
Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage: Könnten Sie Bedingungen nennen, sowohl bzgl. Betrieb als auch Praktikanten, die erfüllt sein sollten, damit es zu einem für beide Seiten erfolgreichen Beschäftigungsverhältnis kommt, wie z. B. bei Jasmin?
Also der Betrieb müßte auf jeden Fall erfüllen können, daß Führungskräfte im Haus sind, die in der Lage sind, auf Behinderte mit ihren differenzierten Umgangsweisen einzugehen, die auch dieses Zeitpotential haben. Ich denke, man sollte beachten, daß man sie nicht unbedingt in der hektischen Mittagszeit einsetzen kann. Das würde sicherlich zu einer Überforderung führen. Von der Seite Jasmin aus sehe ich überhaupt keine Probleme, weil sie so offen ist, so in der Lage ist, auf Leute zuzugehen und auch offensichtlich Neues aufzunehmen. Da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten.
Schwieriger wird es natürlich, wenn zu der geistigen Behinderung auch noch eine starke körperliche Behinderung dazu käme, dann wäre es schwierig, weil es sich immer auch um eine körperliche Arbeit handelt. Ansonsten, das, was wir hier aus dem Betrieb von unseren anderen Behinderten sagen können, ist, daß nach 11/2 bis 2 Jahren eine solche Entwicklung zu sehen ist, daß die Leute dermaßen aus sich rauskommen, sich weiterentwickeln, wo die Betreuer vorher gesagt haben, das gibt es doch gar nicht. Auf einmal auch in der Lage sind und eine Leistung bringen, die man von ihnen nie erwartet hätte. Ganz einfach, weil sie dann auch Freude an der Arbeit haben.
Ich glaube, ich hatte Ihnen das damals schon erzählt. Wir hatten ja kurz vorher eine junge Frau mit einer starken Lernbehinderung und einer leichten geistigen Behinderung auch für die Küche eingestellt. Sie ist mittlerweile soweit, daß sie einen Bereich allein führt. Das ist absolut faszinierend. Sie hilft jetzt von sich aus im Verkauf und geht auf die Kunden zu, sie hat sich also dermaßen entwickelt, war vorher total zurückgenommen und verschüchtert. Sie kommt jetzt so aus sich raus, daß es eine Freude ist. Ich denke, das wäre ... nicht einen Bereich zu übernehmen, aber einfach für sich selber ein anderes Selbstwertgefühl zu bekommen.
Für Ausbilder und Lehrer haben sich im Arbeitsalltag des Integrativen Förderungslehrgangs ungezählte Situationen ergeben, in denen behinderte und nichtbehinderte Teilnehmer miteinander kommunizieren und kooperieren. Im Vordergrund steht dabei immer das Bestreben, für alle Teilnehmer möglichst positive Voraussetzungen für die anstehenden Aufgaben zu schaffen.
Alle Jugendlichen waren regelmäßig anwesend und zeigten eine hohe Motivation und Bereitschaft, sich auf die Projekte einzulassen. Alle Teilnehmer wurden auf ihrem Niveau in ihren Fähigkeiten gefördert und erlangten so neue Kompetenzen in den Lernfeldern. So haben beispielsweise die Jugendlichen mit Behinderung gelernt, sich in neuen Arbeitsfeldern zurechtzufinden, brauchten weniger Anleitungen für bekannte Tätigkeiten, sprachen deutlicher, hielten länger durch, konnten die anfallenden Arbeiten beschreiben und für sich bewerten.
Diese Erfahrungen werden am Beispiel der Morgenrunde deutlich: Der Tag beginnt mit einer Morgenrunde, in der alle ihre momentane Stimmung zum Ausdruck bringen können, aus der Freizeit oder von zu Hause erzählen oder auch Probleme ansprechen. Das Bedürfnis, sich mitzuteilen bzw. angehört zu werden, wird bei allen akzeptiert, ohne Unterschied ob jemand behindert ist oder nicht. In dieser Runde wird gemeinsam der Arbeitstag bzw. montags die gesamte Woche geplant, Probleme angesprochen und geklärt. Die Teilnehmer mit Behinderung werden ernst genommen, beachtet, aber auch beobachtet.
Besonders bei der Arbeitsverteilung in der Morgenrunde achten die Mitarbeiter darauf, daß "einfache" Arbeiten nicht immer wieder an Teilnehmer mit Behinderung vergeben werden, sondern alle alles mit unterschiedlicher Unterstützung tun müssen.
Die Berufsberater des Arbeitsamtes haben festgestellt, daß es einige Jugendliche ohne Behinderung ablehnen, in einen Integrativen Förderungslehrgang vermittelt zu werden. Es bestehen erhebliche Vorbehalte, Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf ein gemeinsames Lernen mit Behinderten. Auch bei fast allen Jugendlichen, die das Arbeitsamt in die Lehrgänge vermittelt hat, sind diese Befürchtungen vorhanden.
Befragungen dieser Jugendlichen haben ergeben, daß sie schon nach kurzer Zeit Kontakt mit den Jugendlichen mit Behinderung aufgenommen haben, ihre Skepsis verloren und am Ende die Zusammenarbeit als ein Stück Normalität erlebten.
In der ersten Lehrgangsgruppe hat ein Teilnehmer mit Behinderung wiederholt Besuche nach Feierabend bzw. am Wochenende von Jugendlichen ohne Behinderung erhalten, eine Teilnehmerin mit Behinderung hat bis heute so enge Kontakte zu Teilnehmerinnen ohne Behinderung, daß sie nahezu ihre gesamte Freizeit nach Feierabend mit ihnen verplant und verbringt.
Um weitere Anhaltspunkte über eine mögliche Integration der Menschen mit Behinderung in die Gruppe zu erhalten, wurde jeder Jugendliche einzeln befragt. Auf einer Fläche mit konzentrischen Kreisen sollte jeder einen Holzklotz mit dem eigenen Namen in der Mitte plazieren und weitere Holzklötze mit den Namen der Mitschüler so aufstellen, wie diese nach ihrer Ansicht um sie herum stehen. Die am nächsten plazierten Klötze sollten diejenigen sein, die er/sie gerne mag und mit der er/sie viel zu tun hat. Anschließend wurden die Plazierungen bewertet..
In der Auswertung wurde deutlich, daß die Jugendlichen mit Behinderung aus Sicht der nicht behinderten nicht dem mittleren Kern der Gruppe angehörten, sie aber auch nicht weiter davon entfernt sind als andere Teilnehmer ohne Behinderung sind.
Die Aufstellungen der Jugendlichen mit Behinderung zeigten, daß diese in ihre Nähe Jugendliche mit und ohne Behinderung stellen und ebenso weiter entfernt. Dieses deutet darauf hin, daß sie sich selbst als zur Gruppe zugehörig empfinden.
Bisher haben sieben Teilnehmer mit Behinderung die ersten beiden Förderungsjahre durchlaufen. Deren Eltern sind zu ihrer Einschätzung befragt worden und haben sich ausnahmslos positiv über die Ergebnisse der Integrativen Arbeit geäußert:
Auf die Frage, was ihrem Kind im Lehrgang gut getan hat, kamen Antworten wie: Es wurde in Projekten gelernt, die die wirkliche Arbeitswelt nahebrachten. Ebenso wurde das gemeinsame Lernen und die Integration aller Schüler in die Gemeinschaft hervorgehoben. Ferner wurde zur Frage, welche Erwartungen sich erfüllt bzw. nicht erfüllt haben, deutlich, daß sich bei den Teilnehmern im Lehrgang berufliche Wünsche und Vorstellungen entwickelt haben, die Selbständigkeit und der Umgang mit Menschen sich gesteigert bzw. verbessert haben. Berufsbezogene Entwicklungsschritte wurden von den Eltern bei ihren Kindern beispielsweise darin gesehen, daß sie den Sinn von Arbeitstugenden erfahren und verstanden haben, Handlungskompetenzen entwickelt haben, die zu einer weiteren Selbständigkeit führten. Dieses habe geholfen, komplexe Arbeits- und Handlungsabläufe zunehmend zu meistern.
Die Zusammenarbeit ihrer Kinder mit anderen nicht behinderten Teilnehmern der Gruppe wurde unterschiedlich erlebt. So beurteilten die Eltern die Zusammenarbeit als gut bis außergewöhnlich. Ferner wurde berichtet, daß erstmalig eine Freundschaft mit einem nicht behinderten Menschen geschlossen wurde, die sich allerdings nicht gefestigt hat.
Auf die Frage, ob es Entwicklungsschritte gab, die nicht erwartet worden waren, wurde geantwortet, daß die Fortschritte in diesem Maße nicht erwartet wurden, daß die Teilnehmerin sich selbständig an die Arbeitseinteilung hält, daß der Lehrgang insgesamt den persönlichen Reifungsprozeß vom Jugendlichen zum Erwachsenen unterstützt hat.
Die ersten Absolventen mit Behinderung haben nach einer dreijährigen Förderung den Integrativen Förderungslehrgang zum 31.07.97 verlassen. Eine erste Gesprächsrunde unter Beteiligung von Praktikumsbetrieben, Eltern, dem Amt für Arbeit und Sozialordnung der BAGS, der Gewerbeschule 12 und der Hamburger Arbeitsassistenz ergab folgende Ergebnisse:
-
Die Zusage der Betriebe, die Jugendlichen im Rahmen von Praktika weiter qualifizieren zu können, wenn eine Unterstützung in der Form wie im ersten Praktikumsjahr zugesichert würde. Die Ausbilderinnen der Betriebe machten übereinstimmend deutlich, daß sie den Fortschritt in der Qualifikation der behinderten Jugendlichen durchaus für vergleichbar hielten zu dem entsprechenden Status der anderen nicht behinderten Auszubildenden nach dem ersten Lehrjahr - jeder auf seinem Lernniveau. Es wurde übereinstimmend die Einschätzung zum Ausdruck gebracht, daß eine weitere Qualifizierung zumindest für ein Jahr aus ihrer Sicht sinnvoll und notwendig sei.
-
Die Absage der Betriebe, den Jugendlichen mit Behinderung bereits für den 01.08.97 ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in Aussicht zu stellen, aus oben genannten Gründen. Der Beginn eines Arbeitsverhältnisses zu einem späteren Zeitpunkt wird vom Verlauf und Erfolg der weiteren Qualifizierung abhängig gemacht.
-
Die Zusicherung für die Finanzierung der Unterstützung der Praktika durch Arbeitsbegleitung für ein weiteres Jahr seitens des Amtes für Arbeit und Sozialordnung, wobei allerdings die Grundlagen der Finanzierung noch nicht benannt werden konnten.
-
Die Bereitschaft der Eltern, eine Verlängerung der Qualifizierungszeit und damit des Praktikumzeitraumes zu akzeptieren.
Zum 01.08.97 konnte eine dauerhafte Lösung für die Finanziereung der Arbeitsbegleitung noch nicht gefunden werden. Übergangsweise (für 1 Jahr) werden die Jugendlichen als Mitarbeiter einer Werkstatt für Behinderte geführt - hier die ELBE-Werkstätten -, da alle in Frage kommenden Jugendlichen die notwendigen Anspruchsvorausetzungen für die Eingliederungshilfe erfüllen. Durch die Bewilligung einer zusätzlichen Arbeitsbegleitung wird die ELBE-Werkstatt in die Lage versetzt, die Qualifizierung in den Betrieben des ersten Arbeitsmarktes zu organisieren.
Seit 1.8.1994 wurden im Rahmen integrativer Förderungslehrgänge insgesamt 14 Jugendliche aus Integrationsklassen gefördert. Davon befinden sich die ersten drei erfolgreich auf dem Weg in die betriebliche Integration.
Bisher läßt sich feststellen, daß alle Erfahrungen darauf hinweisen, daß der eingeschlagene Weg erfolgreich ist und sich ernsthafte berufliche Perspektiven für den Personenkreis junger Erwachsener mit Behinderung aus Integrationsklassen entwickeln lassen.
Frey, K.: Die Projektmethode, Weinheim/Basel, 1993
Glenz, V.;Sturm, H.: Roy serviert jetzt im Bistro, in: hlz, Zeitschrift der GEW Hamburg 5/95
Glenz, V.; Sturm, H.: Auf dem Weg in Berufsleben, in: IMPULSE, Hamburg Nr. 2/96
Glenz, V.; Sturm, H.: Integrative Förderungslehrgänge in Hamburg, in: Interdisplinäre Schriften zur Rehabilitation Bd.6, Ellger-Rüttgardt, E: (Hrsg.), Universitätsverlag Ulm Jan. 1997
Gutjons,H.: Was ist Projektunterricht, in Bastian/Gutjons, Hrsg., Das Projektbuch, Hamburg 1986
Jansen, N.: Berufsorientierung und -vorbereitung von Jugendlichen mit Behinderungen im Rahmen eines integrativen Förderungslehrganges, Wiss. Hausarbeit, PH Heidelberg 1996
Suin de Boutemard, B.: Projektunterricht - Geschichte einer Idee, die so alt ist wie unser Jahrhundert, in: Bastian/Gutjons, Hrsg., Das Projektbuch, Hamburg 1986
Sturm, H.: Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und berufliche Integration für Jugendliche mit und ohne Behinderung, in: 25 Jahre Gesamtschule in der Bundesrepublik Deutschland -Länder- und Werkstattberichte-
Gudjons,H.; Köpke,A.(Hrsg.): erscheint bei Klinkhardt 1997
Schartmann, D; Kündigungsgründe bei unterstützten Arbeitsverhältnissen, in : IMPULSE 1/96
Annelore Schmidt, Hauswirtschaftsmeisterin in der Funktion einer Sozialpädagogin an der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt in Hamburg
Die berufliche Bildung in Deutschland war schon immer integrativen Aspekten gegenüber aufgeschlossen. Das duale System der Berufsausbildung kennt keine formalen Zulassungsbeschränkungen. Es steht Abgängern aus Sonderschulen, Hauptschülern und Abiturienten gleichermaßen offen. Es gilt nur die fachliche Schwelle, die durch die berufspraktischen und -theoretischen Anforderungen des jeweiligen Ausbildungsberufs gegeben ist.
Überwiegend anders sieht es im staatlichen Schulwesen und in der Berufsvorbereitung aus. Entsprechend dem Ansatz, Kindern und Jugendlichen eine größtmögliche Förderung zu bieten, hat sich nach dem Krieg in der Bundesrepublik ein breit ausdifferenziertes Schulsystem entwickelt.
Auch die berufsvorbereitenden Maßnahmen, die von der Bundesanstalt für Arbeit finanziert werden, haben sich in eine breite Maßnahmenpalette ausdifferenziert, die unterschiedliche Gruppierungen von Jugendlichen für unterschiedliche Zielperspektiven ansprechen.
Mit dem Förderungslehrgang Integration (Fli) wird ein neuer Weg beschritten. Es soll den integrativen Ansatz fortsetzen, der bereits für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen (Integra-tionsklassen) seit den 80er Jahren erprobt worden ist.
Mit diesem Förderungslehrgang Integration (Fli), die sich noch als modellhafte Erprobung versteht, schließt sich das letzte Handlungsfeld, so daß für behinderte SchulabgängerInnen nunmehr auch in der beruflichen Vorbereitung auf eine betriebliche Beschäftigung ein integratives Angebot zur Verfügung steht.
Ausgehend von den Postulaten Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit wird Integration sowohl als Ziel als auch als Weg verstanden.
Zentrale Elemente des integrativen Ansatzes sind:
-
Gemeinsames Lernen von behinderten und nicht-behinderten Menschen;
-
Lernen und Arbeiten außerhalb von Sondereinrichtungen;
-
Individualisierung des Lernens;
-
Binnendifferenzierung;
-
Lebenslanges Lernen;
-
Lernen und Arbeiten entsprechend den Bedingungen und Bedürfnissen behinderter Menschen.
Der integrative Ansatz geht bewußt über die Integration als Organisationsform einer gemeinsamen Berufsvorbereitung von Behinderten und Nicht-Behinderten und Jugendlichen hinaus. Von besonderer Bedeutung ist hierbei, daß die Zahl der behinderten und nicht-behinderten Lehrgangsteilnehmer in einem sinnvollen Verhältnis stehen muß, um das Integrationsziel nicht zu gefährden. Nach den bisherigen Erfahrungen sollte in einer Gruppe von 12 TeilnehmerInnen die Zahl der behinderten Jugendlichen nicht größer als 3 oder 4 sein.
Neben der Integration als Organisationsform ist die personelle und soziale Integration von besonderer Bedeutung. Durch die ganzheitliche Herangehensweise entwickelt sich das Sozialverhalten und die Kooperationsfähigkeit der Jugendlichen in einem weit höherer Maß und neue Zugänge zur Persönlichkeitsentwicklung werden geöffnet.
In Übereinstimmung mit dem bisherigen Schulversuch in Hamburg wird das Gewicht insbesondere auf folgende pädagogische Elemente gelegt:
-
Die Bildungsinhalte sollen verstärkt auf die Entwicklung der Persönlichkeit abzielen (Selbstbewußtsein, Selbstverantwortung und Identität). Angebote im musisch-künstlerischen Bereich und im Bereich des Körperbewußtseins, der Entspannung und der Selbsterfahrung sollen als Inhalte entwickelt werden.
-
Ganzheitliche Berufsvorbereitung, in der fächerübergreifend und problemorientiert in Projekten und Praktika gelernt wird, soll eine besondere Bedeutung erhalten.
Die Projekte des Förderungslehrganges sollen soweit wie möglich
-
Ernstcharakter haben, so daß die Jugendlichen, ausgehend von ihren Möglichkeiten reale Produktionsaufgaben im kaufmännischen oder gewerblich/hauswirtschaftlichen Bereich bewältigen können. Sie werden herausgefordert und können sich erproben.
-
den Jugendlichen die Möglichkeit geben, den Wert ihrer eigenen Arbeitskraft dadurch zu erfahren, daß verkäufliche Dienstleistungen oder Produkte das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit sind,
-
soziale Kompetenzen durch arbeitsteilige Problemlösung bei der Produktion und dem Angebot von Dienstleistungen entstehen lassen,
-
exemplarische berufsbedeutsame Tätigkeiten beinhalten, so daß Neigungen erkannt werden können, Berufsentscheidungen gefunden und überprüft werden können.
Der integrative Ansatz kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn er für alle Beteiligten, sowohl für die behinderten als auch für die nicht-behinderten TeilnehmerInnen, einen zusätzlichen Nutzen und Erfolg bringt. Daraus ergibt sich, daß ein ergänzendes Eingehen auf die jeweiligen Motivations- und Problemlagen sowohl der Behinderten als auch der Nicht-Behinderten Bestandteil des integrativen Ansatzes ist.
Der Förderungslehrgang Integration (Fli) entstand als gemeinsames Modellvorhaben des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung e. V. mit der Gewerbeschule 12. Eine enge Verzahnung beider Kooperationspartner war von Beginn an Voraussetzung für den Förderungslehrgang Integration. Neben der inhaltlichen Verzahnung bedeutete dies die Aufgabe eines durch Unterrichtsstunden struk-turierten Schulunterrichts und den gleichberechtigten Einsatz aller Beteiligten im Rahmen verschiedener Projektvorhaben.
Am 01.08.1994 begann der Fli mit 5 benachteiligten Jugendlichen (sogen. Fl-Teilnehmer) und 4 behinderten Abgängern aus Integrationsklassen.
Die besondere Zielsetzung ist, noch nicht ausbildungsfähige und behinderte Jugendliche gemeinsam auf unterschiedliche Ziele (Auf-nahme einer Berufsausbildung bzw. Beschäftigung auf dem freien Arbeitsmarkt vorzubereiten).
Der Förderungslehrgang enthält 3 inhaltliche Schwerpunkte:
-
Hauswirtschaft und Gastronomie
-
Kaufmännische Tätigkeiten und Einzelhandel
-
Büroorganisation und Verwaltung mit EDV
Alle 3 Schwerpunkte werden im Rahmen von 2 Projekten vermittelt:
-
ein Küchen-Bistro-Projekt, in dem Mittagstisch und kleinere Speisen und Getränke angeboten werden. Das Projekt umfaßt ebenfalls hauswirtschaftliche Elemente wie z. B. Wäsche- und Hausreinigung sowie alle mit Planung, Einkauf, Lagerung, Abrechnung und Verwaltung zusammenhängenden Tätigkeiten
-
ein Laden-Projekt, in dem Artikel verschiedener Art angeboten werden. Das Projekt umfaßt ebenfalls hauswirtschaftliche Elemente sowie alle mit Planung, Einkauf, Lagerung, Abrechnung und Verwaltung zusammenhängenden Tätigkeiten.
Die Berufsvorbereitung in allen 3 Schwerpunkten erfolgt einerseits in den dafür eingerichteten und ausgestatteten Räumen im Niekampsweg.
Für den Betrieb beider Projekte wurden außerdem sowohl ein Bistro als auch ein Laden angemietet und von den Jugendlichen betrieben, so daß unter Praxisbedingungen mit Ernstcharakter eine Vertiefung erfolgen kann.
Hierdurch erwerben die Jugendlichen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, um - je nach den individuellen Voraussetzungen - den Anforderungen einer Berufsausbildung gewachsen zu sein, eine Berufswahlentscheidung treffen zu können bzw. Einblicke in die Anforderungen der Arbeitswelt gewinnen zu können und ihnen gewachsen zu sein.
Die Inhalte, die für den von der G 12 zu vergebenden Hauptschulabschluß maßgeblich sind, ergeben sich aus folgenden Fächern:
-
Fachpraxis:
Hauswirtschaft
-
Fachtheorie:
Fachrechnen
EDV
-
Allg.:
Deutsch
Politik
Sport
Die Unterrichtsfächer werden fachübergreifend in den Projekten vermittelt.
Darüber hinaus sind kulturelle Schwerpunkte (Exkursionen, Kulturprojekte) vorgesehen, um die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Insbesondere wird der kreative Umgang mit verschiedenen Materialien, Farben und Formen geübt.
Im laufenden dritten Maßnahmejahr befinden sich mittlerweile 35 Jugendliche im Fli. Die bisherigen Erfahrungen zeigen trotz aller Anlaufschwiergkeiten, daß der Förderungslehrgang Integration sowohl für die Benachteiligten als auch die Jugendlichen mit Behinderung einen Erfolg darstellt.
Von den benachteiligten Jugendlichen konnten im Sommer 1995 80% Teilnehmer, im Sommer 1996 72% in eine Berufsausbildung vermitttelt werden.
Die 4 Jugendlichen mit Behinderung, die 1994 begannen, befinden sich jetzt in einem dritten, individuell geförderten Lehrgangsjahr. Drei von ihnen haben eine realistische Chance, einen Arbeitsplatz auf dem 1. Arbeitsmarkt zu erhalten.
Damit zeigt dieses Modellvorhaben, daß es den hohen Erwartungen gerecht werden kann und ein übertragbares Modell auch für andere Bundesländer darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Norbert Jansen, Studienreferendar für Sonderpädagogik in Köln
Die ersten SchülerInnen der Integrationsklassen haben zum jetzigen Zeitpunkt die Schwelle ins Berufsleben erreicht und einen Bildungsgang durch Grund-, Gesamt- und Berufsschulen absolviert. Hier sollen die Erfahrungen einer der ersten AbsolventInnen des integrativen Förderungslehrganges (F1i) an der Berufsschule Hamburg-Eidelstedt in diesem Modell der Berufsorientierung und -vorbereitung geschildert werden.
Frau G. ist eine hilfsbereite Persönlichkeit, die auf andere Menschen offen zugeht. Sie wirkt fröhlich, ist kontaktfreudig und hilfsbereit. Sie ist gerne bereit, gestellte Aufgaben zu erledigen. Mit KollegInnen und Fremden unterhält sie sich gerne. Sie kann die meisten Texte lesen und in moderater Geschwindigkeit schreiben, z. B. kann Frau G. schwierige Telefonnotizen für andere verständlich anfertigen.
Die Auswirkungen der schwierigen Geburt mit Sauerstoffmangel wurden später als MCD diagnostiziert, womit eine allgemeine Entwicklungsverzögerung, leichte Ablenkbarkeit, erschwerte Raum- und Zeitwahrnehmung, motorische Auffälligkeit und Probleme im Umgang mit Mengen umschrieben werden sollte.
Frau G. kam nach einer Ablehnung in einem Regelkindergarten zunächst in einen Sonderschulkindergarten, wo die Eltern Rückschritte in ihrer sprachlichen Entwicklung feststellten. Kein Wunder, denn in der Gruppe sprach noch kein anderes Kind. Daraufhin wurde sie von den Eltern in einer integrativen Gruppe einer AWO-Kinder-tagesstätte angemeldet. Die Kindergartenzeit verlief hier positiv, Frau G. hatte vielfältige Freundschaften und Entwicklungsmöglichkeiten in der heterogenen Kindergruppe. In der integrativen Grundschulklasse (dem 2. Jahrgang Integrationsklassen in Hamburg überhaupt) lernte Frau G. Lesen und Schreiben, sich bildnerisch und musikalisch auszudrücken. Besonders hervorgehoben werden schon hier ihre Fähigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Hilfsbereitschaft, wie auch ihr Gemeinschaftssinn. Lernprobleme zeigten sich aufgrund ihrer leichten Ablenkbarkeit.
Die Gesamtschulzeit war von Problemen der Pubertät und den verschiedenen Interessen und Lernbedürfnissen der Jugendlichen bestimmt. Frau G. hätte zu der Zeit noch gerne viel gespielt, während die MitschülerInnen jetzt mehr redeten. Im Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 konnte sie viele neue Kontakte knüpfen. In dieser Zeit ging die Leistungsschere in den Integrationsklassen immer weiter auseinander, was vielen LehrerInnen einen gemeinsamen Unterricht unmöglich erscheinen ließ. Die speziellen Wahlpflichtangebote für die Jugendlichen mit Behinderungen und die berufsorientierenden Projekte in den Klassen 9 und 10 wurden dann zu einer neuen Säule des gemeinsamen Unterrichts (Holzbankproduktion, Laden, Schulrestaurant) in denen sich jeder mit ihm angemessenen Aufgaben in die Gemeinschaft einbringen konnte. Wichtig in der Gesamtschulzeit waren für Frau G. auch die Gesprächsrunden mit einer Mädchengruppe, die durch die Wissenschaftliche Begleitung initiiert worden war. Durch das Verständnis und Wissen um die Situation der Klassenkameradinnen fühlte sie sich in der Klasse wieder verstanden und mit ihren Problemen beachtet. Am Ende der 10. Klasse wurden als Frau G.s größte Probleme genannt: Ihre allgemein chaotische Grundstruktur, ihre Tendenz zur Überschätzung der eigenen Kräfte, was zu Überforderung führte, der Mengenbegriff blieb für sie schwierig.
Nach Beendigung der 10. Klasse begann Frau G. einen regulären zweijährigen Lehrgang (F2) mit direkter Anbindung an einen Hotelbetrieb, d. h., zu Beginn war sie mit einer 6wöchigen Praktikumsphase konfrontiert, in der sie für ihre Bedürfnisse anscheinend nicht genügend betreut werden konnte. Sie fühlte sich überfordert und ausgenutzt, ihre Vorgesetzten im Hotelbetrieb konnten ihre Leistungsfähigkeit nicht einschätzen und übertrugen ihr für den Anfang zu viele selbständige Arbeiten. Im Rahmen dieser Maßnahme kannte Frau G. niemand vorher, und es verwundert nicht, daß in der Anfangsphase des Lehrgangs die Zeit zum Kennenlernen fehlte. Der Abbruch des Lehrgangs war für Frau G. scheinbar der einzige Ausweg aus der Überforderung. Man könnte auch sagen, dieser Lehrgang ist "an Frau G. gescheitert"; die notwendigen Bedingungen konnten hier nicht hergestellt werden.
Im 1. Jahr sicherten der Sonderpädagoge und ein Berufsschullehrer den Informationstransfer in das neue Team und gaben Frau G. als Bezugsperson Sicherheit. Der Berufsschullehrer unterrichtete Frau G. in den berufsorientierenden Projekten ab Klasse 9, der Sonderpädagoge 4 Jahre als Klassenlehrer. Dies bedeutete für Frau G., daß neue Tests und eine Kennenlernphase beim Übergang in den Lehrgang unnötig waren. Auch zwei der Jugendlichen mit Behinderungen kennt sie schon aus der Schule. Die überschaubare Struktur (12 TeilnehmerInnen, 7 AnleiterInnen, ein weiterer Lehrgang im Gebäude) kommt Frau G. sehr entgegen, so daß ihre eigene zeitweilige Strukturlosigkeit nicht noch durch die Umgebung (wie im "Großbetrieb Gesamtschule") verstärkt wird. Die Vielfalt der Bezugspersonen (4 Frauen, 3 Männer) kommt wie allen TeilnehmerInnen so auch Frau G. zugute. Sie sucht jetzt verstärkte Orientierung bei den Anleiterinnen wegen der aktuellen Themen: Beziehung, Familie und Kinderbekommen. Auch von den unterschiedlichen Ausbildungen der Bezugspersonen und deren verschiedenen Erfahrungen kann Frau G. profitieren: Der Sonderpädagoge bringt Kompetenzen zu speziellen Fördermaßnahmen und -materialien, in der Beratung (der Eltern / des PädagogInnenteams) und aus der Integrationsarbeit in der Gesamtschule, speziell auch mit den drei Jugendlichen mit Behinderungen ein, die BerufsschullehrerInnen in den Bereichen Arbeitslehre, Handel, Hauswirtschaft, Küche, im Projektunterricht und in den Projektbetrieben. Die Sozialpädagoginnen ergänzen das Team in den Bereichen der außerunterrichtlichen Angebote, der Einzelfall- und Krisenberatung und der Zusammenarbeit mit anderen Sozialinstitutionen (z. B. mit dem Sozialamt, dem Jugendamt und den WohngruppenbetreuerInnen).
In der konsequenten Projektarbeit mit Ernstcharakter lernte Frau G. in handlungs- und produktorientierten Zusammenhängen. Es wurden ein Laden-Projekt (Geschenkartikel, Spielzeug, Blumen) und ein Bistro-Projekt, neben den konstanten Lernorten Verwaltung und Küche, durchgeführt. Häufige Tätigkeiten waren: Ware einkaufen, Werbezettel und Speisekarten erstellen, Tagesgerichte kochen, Werbung, Korrespondenz abwickeln, Arbeitspläne erstellen, usw. Die vielfältigen Bildungs- und Lernangebote erstreckten sich in den einzelnen Bereichen von der Computeranwendung bis zum Bewerbungsschreiben (Verwaltung), vom Einkauf, der Verarbeitung und Lagerung bis zur Selbstversorgung (Küche), vom Verkauf, der Beratung und der Warenpflege bis zur kompletten Kassenabrechnung (Laden),vom lebenspraktischen Bereich, dem Umgang mit Geld, dem Einkaufen und Kochen bis zum Organisieren eines Bistro-Betriebes. In den stadtteilbezogenen Projekten ist das Umfeld in den Arbeits- und Tagesablauf mit einbezogen, Kontakte werden geknüpft (Analyse der Ladenumgebung, Lieferanten, Nachbarn, Kunden), Öffentlichkeitsarbeit (Flugblatt "Wer sind wir") wird betrieben. In den Betrieben wird Zusammenarbeit gefordert und somit Wert-schätzung für die Fähigkeiten und die Persönlichkeit des anderen gefördert. Frau G. wird von den TeilnehmerInnen als belastungs-fähige, kollegiale, zuverlässige Mitarbeiterin kennengelernt, eine Definition über die Defizite ist hier nicht so leicht möglich. Weiter hat sie die Möglichkeit zur erneuten Überprüfung ihres Selbstbildes.
In den persönlichkeitsfördernden Angeboten im Kulturunterricht erlebte Frau G. ergänzend alternative Beschäftigungen als Ausgleich zum anstrengenden Arbeitstag. Hier konnte sie bisher unbekannte Stärken erleben: Kreativität im Freien Schreiben entdecken, Spiel und Sport, Malen und Musik machen als Freizeitbeschäftigung erleben. Wie schon in der Gesamtschule erlebte sie Ablösungsprozesse von den Eltern, sie zog dann auch Anfang des zweiten Jahres in eine betreute Wohngemeinschaft und nahm so ihre Zukunftsplanung ein weiteres Stück in die eigene Hand.
Zum prinzipiell gleichen Ablauf wurden im 2. Jahr für Frau G. und ihre KollegInnen neue Schwerpunkte gesetzt: Verstärkte Berufsorientierung durch mehrere Betriebspraktika und gezielte Erweiterung der Kompetenzen in den Berufsfeldern. Ein sehr wichtiger Punkt war für Frau G. der Vorsprung der Jugendlichen mit Behinderungen vor den Neuen: "Wir können denen dann zeigen wie das geht, damit die das auch so lernen können wie wir. Wir wissen schon, wo alles ist!" Aus dieser Stärkung des Selbstwertgefühls erfuhr sie Sicherheit für den Umgang mit neuen KollegInnen und Kunden. Sie konnte viele neue Kontakte probieren und sich als Expertin erleben. In den zwei Jahren hatte sie die Möglichkeit sich in verschiedenen Berufsfeldern zu orientieren und ihre persönliche Eignung und Neigung in gezielten Betriebspraktika zu überprüfen. Ihr Weg führte von einer Lebensmittelfiliale, über die Küche einer Kindertagesstätte wieder in ein Hotel, wo sie vor Beginn dieses Lehrgangs so schmerzliche Erfahrungen gesammelt hatte. Doch jetzt war Frau G. so selbstsicher und belastungsfähig, daß sie ihre Aufgaben mit Anleitung und Betreuung gut erledigte und mittlerweile sogar das Langzeitpraktikum im 3. Jahr in diesem Hotel absolviert. Sie erledigte nicht nur ihre Arbeiten zufriedenstellend, sondern hatte auch im Service des Hotelrestaurants viel Spaß in der Zusammenarbeit mit den KollegInnen.
Das 3. Lehrgangsjahr wurde für Frau G. auf Antrag der Lehrer des Förderungslehrgangs durch das Arbeitsamt als Einzelfallentscheidung genehmigt. Entwicklungsperspektiven sind: Auf neue Situationen flexibel einlassen; auf neue Personen in anderer Arbeitsumgebung einstellen; Arbeiten gewissenhafter, ruhiger und zuverlässiger erledigen lernen; Hilfe und Anleitung sollen wegfallen können, die Arbeitsergebnisse sollen allen Anforderungen genügen. Die in Frage kommenden Tätigkeitsbereiche sollen näher eingegrenzt werden. Für das Ende des 3. Jahres wird angestrebt, ein Beschäftigungsverhältnis an einem konkreten Arbeitsplatz zu realisieren. Die Ausbildung findet jetzt in einem Hotelbetrieb in einem Langzeitpraktikum in den zwei Schwerpunkten Etagendienst und Restaurant statt. Hier leistet sie eine Vier-Arbeitstage-Woche, ergänzt durch einen Berufsschultag gemeinsam mit den drei Jugendlichen des 3. Jahres. Frau G. formulierte ihre Ansprüche an das 3. Jahr so: "Da kann ich noch Fortschritte machen und sicherer werden."
Im Förderungslehrgang konnte Frau G. große Fortschritte machen: Sie äußerte ihren Standpunkt und vertrat ihn gegenüber Kollegen und Vorgesetzten, sie schätzte ihre Leistungsressourcen realistischer ein, legte öfter die notwendigen Pausen ein, hat persönliche Vorlieben erkennen und von geforderten Notwendigkeiten unterscheiden gelernt. Sie hat Gestaltungsmöglichkeiten im Freizeitbereich kennengelernt. Sie hat ihre Kommunikationskompetenzen erweitert (Beziehungen eingehen, Konflikte lösen). Sie konnte ihre bisherigen Erfahrungen auf neue Situationen anwenden, ihre Leistungsfähigkeit in den verschiedensten Arbeitsfeldern kennenlernen und ausbauen. Durch die gezielte Förderung und die sinnvolle Projektarbeit hat sie sich in vielen Kompetenzbereichen weiterentwickelt. Im selbständigen Erledigen und Planen von Arbeitsaufgaben hat Frau G. sich weiter verbessert und benötigte immer weniger Hilfen.
In der Gruppe der TeilnehmerInnen ist sie ein akzeptiertes Mitglied und sie schaffte es wie niemand anders, zwischen ihren langjährigen MitschülerInnen mit Behinderungen mit ihren Eigenheiten und den Jugendlichen ohne Behinderungen mit ihren anfangs großen Ängsten und Vorbehalten zu vermitteln. Sie konnte neue Beziehungen knüpfen und sich mit anderen auseinandersetzen, wie es für alle Jugendlichen, die in diesem Alter die Schule wechseln oder eine Berufsausbildung beginnen, die Regel ist. Für Frau G. ist es im Laufe der Schulzeit normal geworden, sich über ihre Fähigkeiten, ihre Schwierigkeiten, ihre Leistungsfähigkeit, über Konflikte mit anderen und ihre Lebensplanung Gedanken zu machen, sich mit anderen auszutauschen und Lösungen, auch zusammen mit anderen, zu erarbeiten.
Das vielleicht einzige echte Manko des Förderungslehrgangs lag auch für Frau G. in der Einschränkung auf die zwei Bereiche Hauswirtschaft und Handel. So hatte sie keine echte Wahlmöglichkeit bei der Anmeldung zum Lehrgang, da Alternativangebote mit anderen Schwerpunkten (z. B. Sozialberufe, Gärtnerei) noch fehlen.
Frau G.
-
weiß, wo sie in einer Gruppe steht.
-
definiert sich in ihrem Umfeld von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen.
-
kann sich in ihren Bedürfnissen artikulieren und erkennt Überforderungen früher.
-
kennt ihre Schwächen und versucht, Lösungswege zu finden.
-
weiß, daß sie Hilfen braucht und schämt sich ihrer nicht.
-
sucht und probiert berufliche Perspektiven.
-
hat die Erfahrung gemacht, daß sie ein Problem im Gespräch mit den Betroffenen lösen kann und ist immer selbständiger geworden, holt sich kaum noch Hilfe.
-
hat ihre Belastbarkeit kontinuierlich steigern können (Von 2 Stunden konzentrierter Arbeit in der Schule bis zum 8 Stunden Arbeitstag) "Ich bin zwar ganz schön geschafft, aber ich kann eine ganze Woche richtig arbeiten." Das war für ihre Mutter noch in der 8. Klasse undenkbar.
-
kann ihre Freizeit selbständig gestalten.
-
pflegt Freundschaften zu Jugendlichen mit und ohne Behinderungen.
-
kann die meisten Arbeiten unter Anleitung zufriedenstellend erledigen.
Für Frau G.s Identitätsentwicklung in der integrativen Schullaufbahn lassen sich also rückblickend günstige Bedingungen ausmachen. Die Erfahrungen bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, beim Finden des eigenen Platzes und beim Entwickeln und Artikulieren eigener Bedürfnisse haben hier eine deutliche Entwicklung der Persönlichkeit und der Handlungskompetenzen ermöglicht. Aus der momentanen Situation kann wohl eine begründete Hoffnung abgeleitet werden, daß für Frau G. die Berufsorientierung und -vorberei-tung ihre Ziele weitgehend erreichen wird, daß die Krisen der Schul-zeit in der Identitätsentwicklung produktiv genutzt werden konnten und daß sie notwendige ("Schlüssel"-) Kompetenzen erwerben konnte. Die Aussicht auf eine berufliche Eingliederung im Rahmen der Hamburger Arbeitsassistenz in einem gesicherten Arbeitsver-hältnis erscheint realistisch.
Im privaten Bereich kann man meiner Meinung nach schon jetzt von einer gelungenen Integration sprechen, wenn man das erreichte Maß an Selbständigkeit, Frau G.s Freizeitaktivitäten und -kontakte betrachtet. Hier ist Frau G. kaum von anderen jungen Menschen ihres Alters zu unterscheiden: Sie lebt in einer Wohngemeinschaft, pflegt Kontakte verschiedenster Art, organisiert sich selbst, nimmt Hilfen bewußt in Anspruch. Sie hat in der Auseinandersetzung mit ihrem Umfeld gegen den Druck gesellschaftlicher Leistungsnormen ein lebbares Selbstkonzept entworfen. Mehr noch: Frau G. zeigt Nichtbehinderten, welche Probleme ein Mensch mit Behinderungen haben kann (als Podiumssprecherin auf Tagungen, in alltäglichen Gesprächen mit Fremden und mit FreundInnen ohne Behinderung) und ermöglicht einer Mitschülerin mit sehr auffälligem Verhalten ganz selbstverständlich Kontakte, von denen die "Integrationsprofis" nur träumen können.
Norbert Jansen
Gottesweg 16
50969 Köln
Tel.: 0221/936 20 73
Johanna Krohn, Sozialpädagogin G13
Vor inzwischen knapp 3 Jahren, im Sommer 1993, wurden die ersten Integrationsklassen aus der 10. Klasse der Bergedorfer Gesamtschule entlassen. Nach vielfältigen Kontakten mit unterschiedlichen Gewerbeschulen des angrenzenden Berufsschulzentrums fand sich schließlich im Gartenbaubereich der G13 ein Kollegenteam bereit, die behinderten SchülerInnen in ihre Berufsvorbereitungsklassen zu inte-grieren. Zum gegenseitigen besseren Kennenlernen wurden mehrwöchige Praktika für alle IntegrationsschülerInnen in Begleitung eines Kollegen/einer Kollegin der abgebenden Schule vor dem Schulwechsel vereinbart. Danach erfolgte eine Auswertung der Praktika mit dem klaren Ergebnis aller beteiligten SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, einen gemeinsamen Versuch zu wagen. Mit Hilfe der Schulleitung der G13, die von Anfang an den Schulversuch unterstützt hat, wurden Rahmenbedingungen für die integrative Berufsvorbereitungsarbeit mit der Schulbehörde erarbeitet:
-
Klassenfrequenz : 17 + 3.
-
bei gleichbleibender Lehrerstundenbesetzung eine zusätzliche Sozialpädagogenstelle für jeweils 3 behinderte SchülerInnen.
-
als "behindert" zählen zukünftig nur noch SchülerInnen mit geistiger Behinderung.
-
Zivildienstleistende je nach Bedürftigkeit der behinderten SchülerInnen.
Inzwischen sind wir im 3. Jahr der "Erprobung", wobei in jedem Schuljahr neue IntegrationsschülerInnen aufgenommen wurden und einige auch schon die Schule verlassen haben.
Zur Zeit lernen in 2 Integrationsklassen 7 behinderte Jugendliche gemeinsam mit 31 sogenannten BVK-Schülern. BVK-Schüler sind Schüler, an denen allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe I gescheitert sind. Sogenannte Schulversager, die ohne Perspektive auf einen Schulabschluß ihre Schule vorzeitig verlassen. Gelernt wird in einem Lernbetrieb, einer Gärtnerei, in 3 Produktionsgruppen:
-
eine Blumen- und Zierpflanzengruppe, die Pflanzen für den Verkauf produziert.
-
eine Laden-/Floristikgruppe. Hier werden die Pflanzen, die in der Gärtnerei produziert werden, weiterverarbeitet und verkauft.
-
eine Garten- und Landschaftsbaugruppe, die auftragsbezogen um Dienstleistungsgartenbau tätig ist. Hier werden Gärten, Spielplätze, Schulhöfe gestaltet und Pflegearbeiten durchgeführt.
An 4 Tagen in der Woche wird in den Produktionsgruppen gearbeitet. Der theoretische Unterricht findet projektbezogen statt. Es gibt also keine Schulfächer im herkömmlichen Sinn mehr, sondern es wird in den Projektgruppen fachbezogen geplant, gerechnet, kalkuliert, geschrieben, gezeichnet und gestaltet. Gearbeitet wird von 8.00 - 10.00 Uhr, dann wird gemeinsam gefrühstückt. Danach wird wieder von 10.30 - 14.00 Uhr in den Gruppen gearbeitet, unterbrochen von einer halben Stunde Mittagspause. Es folgt eine Tagesabschluß-, bzw. Vorbereitungsbesprechung für den nächsten Tag. Um 14.30 Uhr ist Schulschluß.
Am 5. Tag ist Wahltag. An diesem Tag wird nicht in den Produktionsgruppen gearbeitet. Dann können die SchülerInnen zwischen unterschiedlichen Angeboten wählen. Die Wahlangebote reichen von Projekten wie "Orientierung in Hamburg/Bergedorf" auf dem Stadtplan und praktisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrädern oder Paddelbooten; dem Besuch von Museen und anderen Einrichtungen der Stadt, über künstlerische/musische Angebote bis zu Themen wie Liebe und Sexualität, Mode, Gesundheit, Gewalt usw. Auch Themen des zukünftigen Lebens, wie "Wie und wo möchte ich mal wohnen/leben?", "Was kostet ein Auto, ein Führerschein und welche Alternativen zum Auto gibt es?" werden gemeinsam bearbeitet. Unter fachkundiger Anleitung wird "Erste Hilfe im Notfall" geübt, und gemeinsam werden Feste und Feierlichkeiten geplant und durchgeführt. So fand kürzlich, nun zum dritten Mal, eine Theateraufführung in der Schule statt, wo behinderte und nichtbehinderte SchülerInnen mit Hilfe einer Theaterpädagogin ein selbst ausgedachtes Theaterstück vorführten.
Im Team wird entschieden, ob es sinnvoll ist, ein Wahlthema an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen zu intensivieren, bzw. Wahlthemen von vornherein zu blocken. Die gesamte Projektarbeit wird mit Zustimmung der Schulleitung vollständig eigenständig und eigenverantwortlich geplant und durchgeführt. Zum "Kernteam" gehören zur Zeit 3 LehrerInnen, 1 Gärtnermeister und 2 SozialpädagogInnen, die alle in voller Stundenzahl in den Projekten arbeiten. Jede Projektgruppe ist also durchgängig doppelt besetzt. Dazu kommen KollegInnen, die uns stundenweise (möglichst ganze Tage!) im Projekt oder an Wahltagen unterstützen, sowie, je nach Förderbedarf der behinderten Schüler, Zivildienstleistende. Mindestens einmal im Jahr unternehmen wir eine 14-tägige Projektfahrt in unser Schullandheim, wo wir während dieser Zeit gemeinsam arbeiten und leben.
Die behinderten Jugendlichen sind in den Produktionsgruppen integriert. Unser Projektangebot richtet sich nach den Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen, wobei der fachliche Rahmen auf den Gartenbaubereich eingeengt ist. Nach einer Phase des Kennenlernens entscheiden sich die Jugendlichen für eine der drei Produktionsgruppen, in der sie dann in der Regel bleiben. Um allen SchülerInnen eine sinnvolle Teilnahme an der Bewältigung gemeinsamer Aufgaben zu ermöglichen, haben wir im letzten Schuljahr den Tätigkeitsbereich der Blumen- und Zierpflanzengruppe um hauswirtschaftliche Aufgaben erweitert. Nun wird für alle, die es wollen, an 2 Tagen in der Woche ein Mittagessen gekocht. Hier finden vor allem 2 Rollstuhlfahrer einen Wirkungskreis.
Um das Angebot für die SchülerInnen noch vielfältiger zu gestalten, streben wir zukünftig eine verstärkte Zusammenarbeit mit den beiden Nachbarschulen des Berufsschulzentrums an, wo in anderen Fachbereichen ähnlich projektorientiert gearbeitet wird. Bisher arbeitet K., ein geistig behinderter Jugendlicher, der unbedingt Bäcker werden will, an 2 Tagen in der Woche im Bäckerprojekt der Nachbarschule mit. Außerdem profitieren wir gegenseitig von den Arbeitsergebnissen der Projektgruppen. So beziehen wir unsere Frühstücksbrötchen von den "Bäckern", die Cafeteria der Nachbarschule erhält eine Blumendekoration unserer Floristengruppe, wir verkaufen Produkte der "Metaller" in unserem Laden usw.
Insgesamt stellen wir fest, daß sich besonders die behinderten SchülerInnen sehr mit "ihrem Betrieb" identifizieren und ihre Arbeit sehr ernst nehmen. So äußerte B., ein geistig behinderter Schüler, auf meine Frage, wie es ihm in der neuen Schule gefällt: "Gut, hier bin ich groß, und das hier ist Arbeit."
Die meisten haben sich durch den Schulwechsel merklich entwickelt, sie sind erwachsener geworden, können besser durchhalten, haben gelernt, ihre Leistungsfähigkeit besser einzuschätzen, und einzelne sind stark damit beschäftigt, an sich zu arbeiten. So "verliert" M., ein geistig behindertes Mädchen, "nicht mehr so oft ihre Zeit", wie sie sagt. Anfänglich brauchte sie täglich Zeiten des Rückzuges, des Alleinseins, wo sie die für sie bisher ungewohnten Erlebnisse und Anforderungen verarbeiten konnte. Wir waren also mehrmals täglich damit beschäftigt, M. zu suchen. Inzwischen hält sie Arbeitsphasen bis zu 2 Stunden am Stück durch, ohne wegzulaufen. Am meisten Spaß bringen ihr Tätigkeiten, die ihr inzwischen vertraut sind, die sie beherrscht und selbständig ausführen kann. Dann fühlt sie sich sicher. Zur Zeit arbeitet sie daran, eine bestimmte Arbeit in einer bestimmten Zeit zu schaffen. So haben inzwischen alle ein bestimmtes Maß an Professionalität erreicht. Das heißt jedoch nicht, daß wir Erwachsenen nicht auch immer wieder an Grenzen stoßen, wenn es darum geht, Arbeitsarrangements zu entwickeln, um alle SchülerInnen sinnvoll an der Projektarbeit zu beteiligen. Besonders unsere Rollstuhlfahrer können viele Tätigkeiten nur durch die Unterstützung von Zivildienstleistenden bewältigen. In der Regel klappt die Zusammenarbeit der Jugendlichen in den Produktionsgruppen auch bei unterschiedlichen Anforderungen durch uns Erwachsene gut. Anfängliche Unsicherheiten und Ängste sind nach unseren Erfahrungen schnell vergessen, und die unterschiedlichen Behinderungen werden im Alltag schnell zur Normalität. Das heißt jedoch nicht, daß nicht auch folgende Situation auftreten kann: An einem kalten Wintertag, an dem Schnee geräumt werden mußte, kam K. nach kurzer Zeit wieder herein und erklärte: "Weißt du, B. und ich, wir sind behindert. Und weil wir behindert sind, können wir nicht alles. Und draußen ist Schnee, und das ist uns zu kalt."
Das soziale Miteinander in der Gruppe gestaltet sich wie in jeder anderen Gruppe auch. Es gibt Sympathien und Antipathien zwischen den Jugendlichen, auch zwischen behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen, es entstehen jedoch auch Freundschaften untereinander. Was nicht eingetreten ist, sind Befürchtungen unsererseits, daß nämlich besonders benachteiligte Jugendliche ihre Aggressionen an den behinderten Jugendlichen auslassen würden. Im Gegenteil, wir staunten nicht selten über die Fürsorglichkeit und Umsichtigkeit, mit der sich nach außen besonders cool wirkende Jugendliche um ihre behinderten Kollegen kümmern.
Eins erscheint uns sicher: Auch wenn wir Erwachsenen bei unseren Überlegungen um geeignete Aufgabenstellungen für jeden einzelnen Jugendlichen und um die Gestaltung sinnvoller integrativer Arbeitsabläufe immer wieder an Grenzen stoßen, so entfaltet sich das Leben in einer integrativen Gruppe um so lebendiger, vielseitiger mit jeder Andersartigkeit der einzelnen Persönlichkeiten. Hier gilt es eben, immer wieder neu zu sehen, zu fühlen und zu lernen, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen und diese für die Gruppe befriedigend zu lösen. Das ist sicher nicht überall so und vielleicht auch nicht für jeden das Richtige. Als ich B. unlängst nach seinen Erfahrungen eines Praktikums in einer Werkstatt für Behinderte befragte, äußerte er: "...Ich weiß nicht, die Leute waren alle so anders als hier, anders als ich, und weißt du, bei der Arbeit, da kannst du alt werden."
Inhaltsverzeichnis
- Was kommt nach der Schule?
- Das Pilotprojekt: STADTHAUS-HOTEL - HAMBURG
- Berufsvorbereitung und Teilqualifikation
- Eine neue Schulform konkretisiert sich
- Perspektive: Arbeitsplatz
- Die SchülerInnen
- Die LehrerInnen
- Ziele der Berufsvorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahme
- Festlegung der Unterrichtsinhalte und Fächer
- Unterricht
- Lernen in der Ernstsituation des Kiosk-Projekts
- Der Projekttag
- Integration
Herma Kindt, Karsten Kühl, Gewerbelehrer an der Staatlichen Schule Ernährung und Haus-wirtschaft Uferstraße
Das dreijährige 'Hamburger Modell' BV-TQ (BVK 7/8) mit einer zweijährigen Berufsvorbereitung in Vollzeitform und einer anschließenden, einjährigen dualen und spezialisierenden Ausbildung in Teilzeitform : Eine gezielte berufliche Vorbereitung und Teilqualifizierung von Menschen mit geistiger Behinderung und anderer Lernbeeinträchtigung an der Staatlichen Schule Ernährung und Hauswirtschaft Uferstraße (W2).
Für Betroffene ein Beispiel, das hoffen läßt, - für viele eine Sensation : Die berufliche Karriere des Jens L. Jens ist geistig behindert. Wenn er zusammen mit seinen KollegInnen ein Frühstücksbuffet zubereitet, Kaffee einschenkt und anschließend die Betten und Zimmer herrichtet, übt er eine ganz normale Berufstätigkeit aus. Jens hat einen Arbeitsplatz in einem richtigen Hotel, dem Stadthaus-Hotel Hamburg. Ihm macht seine Arbeit sehr viel Spaß, und er ist sehr glücklich, so weit gekommen zu sein.
Die Frage, "Was kommt nach der Schule?", bewegte Jens ebenso wie alle anderen Schulabgänger sowie deren Eltern, bzw. BetreuerInnen auch - ist doch damit eine der wichtigsten zukunftsbestimmenden Lebensentscheidungen verknüpft. Eröffnen sich für nicht behinderte SchülerInnen viele verschiedene Perspektiven, so sind die Menschen mit geistiger Behinderung und ausgeprägten Lernbeeinträchtigungen bis vor einiger Zeit in der Regel auf den abzweiglosen Einbahnweg 'Werkstatt für Behinderte' (WfB) eingeschränkt worden. Sieht man einmal von den wenigen bestehenden, zumeist privat getragenen Lebens- und Produktionsgemeinschaften - häufig anthroposophischer Ausprägung - ab, so ist zu beobachten, daß sich erst in jüngster Zeit alternative Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für Schulabgänger der Sonder- und Förderschulen sowie aus Integrationsklassen entwickelten.
So helfen Einrichtungen wie die Arbeitsassistenz, bzw. das ambulante Arbeitstraining in Hamburg dem behinderten Mitmenschen, einen für ihn speziell zugeschnittenen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, einzurichten und mit Erfolg auszufüllen
Neben den arbeitsbegleitenden Maßnahmen entstehen zunehmend mehr Integrationsbetriebe, in denen behinderte und nichtbehinderte Mitarbeiter gleichberechtigt zusammenarbeiten. Das über den Hamburger Raum hinaus bekannte, von Eltern geistig behinderter SchülerInnen gegründete Pilotprojekt "Stadthaus*Hotel Hamburg" stellt einen dieser Betriebe dar. Neben 2 ½ Stellen für nicht behinderte stehen 7 halbe Stellen für behinderte Mitarbeiter zur Verfügung.
Doch bevor Jens und seine KollegInnen hier ihre Arbeit aufnehmen konnten, war von der Idee bis zur Realisierung viel Planungs- und Pionierarbeit zu leisten, denn mit diesem Projekt wurde absolutes Neuland betreten. Fünf der jungen MitarbeiterInnen, die heute im Stadthaus-Hotel arbeiten, kennen sich seit dem Kindergarten und haben zusammen die private Sonderschule, das anthroposophisch geleitete Friedrich-Robbe-Institut, besucht.
Es war der Wunsch der Eltern und der Kinder, daß die Gruppe auch nach dieser gemeinsamen Zeit zusammenbleiben sollte. Warum sie auf die verschiedenen sozialen Einrichtungen verteilen und auseinanderreißen, sie die restliche Zeit ihres Lebens im Ghetto einer annonymen Anstalt verbringen lassen - so der Vater einer schwerst mehrfach behinderten Tochter-, wenn sie als kleine Gruppe harmonisch eingebettet in der wirklichen Welt leben und arbeiten können? Auf diese Weise, so die Eltern, werde ihre Selbständigkeit und ihre Lebensfreude am besten gefördert. Von dieser Auffassung geleitet, gründeten die Eltern und befreundete Sonderschulpädagogen den Verein "Werkstadthaus Hamburg e.V.", dessen Ziel darin bestand, eine gemeinsame Wohn- und Arbeitsstätte für ihre Kinder im Hamburger Stadtbereich zu schaffen. Da ihre Kinder alle ein freundliches Naturell hätten und es gut verstünden, andere Menschen an sich zu binden, meinten die Eltern, sei eine Hotel-Pension für sie der beste Arbeitsplatz - ein Hotel mitten in Hamburg und nicht irgendwo auf dem Lande, weil sie eben alle in den Strukturen dieser Stadt aufgewachsen seien.
Zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Robbe-Institut verfügten Jens und seine langjährigen MitschülerInnen aber noch nicht über die notwendigen Fähigkeiten und erforderlichen Qualifikationen, um ihre Tätigkeit in solch einem Betrieb aufnehmen zu können. Aber auch das Gebäude, in dem die Jugendlichen leben und arbeiten sollten, war aufgrund von baulichen Problemen noch nicht fertiggestellt. Diese Notlage war jedoch ein - so erst rückblickend bewertbar - glücklicher Zufall, der die Eltern zwang, nach einer geeigneten Übergangslösung zu suchen. Bei dieser Suche traf der Verein in der Hamburger Schulbehörde und Schule auf VertreterInnen, die sich der Situation annahmen und offen waren für unkonventionelle und produktive Lösungen.
Die konstruktive Wendung, aus dieser Notsituation einen produktiven Nutzen zu ziehen, bestand in der Idee, die SchülerInnen im Bereich des berufsbildenden Schulwesen gezielt auf ihre zukünftige Hoteltätigkeit unter berufsspezifischen Gesichtspunkten vorzubereiten. Warum sollte z.B. für Schulabgänger von 'Sonderschulen für Geistigbehinderte' nicht dasselbe Recht auf Berufsvorbereitung gelten, wie es auch anderen Schülern zusteht? Schließlich hatten die SchülerInnen sogar eine konkrete, definierbare berufliche Perspektive, für die man sie qualifizieren konnte. Diese Auffassung setzte sich durch, als erstmals in der Geschichte des beruflichen Schulwesens in Deutschland an der Staatlichen Schule Ernährung und Hauswirtschaft Uferstraße (W2) die Berufsvorbereitungsklasse in Vollzeitform eingerichtet wurde, die zunächst auf ein Jahr begrenzt und dann auf insgesamt zwei Jahre erweitert wurde.
Für Jens und seine MitschülerInnen wurde aus der Notlösung 'Berufsvorbereitung' ein grundlegender Bildungs- und Qualifikationsgewinn, der sie mit den erforderlichen Kompetenzen ausstattete, die im Hotel gestellten Aufgaben fachgerecht und selbständig auszuführen. Die Dauer von 2 Jahren erwies sich bei dieser Schülergruppe als erforderlicher zeitlicher Rahmen für die Vorbereitungsphase.
Im ersten Vollzeitjahr liegt der Schwerpunkt auf der Berufsvorbereitung (BV), d. h. für den Schüler primär in der Aneignung von Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen, die ihm ermöglichen, die besonderen Anforderungen der Lern- und Arbeitssituationen sowie der Arbeitswelt zu bewältigen, und darüber hinausgehend besonders in der Entwicklung seiner individuellen Eigenschaften zu einer geschlosseneren und gefestigteren Persönlichkeit zu gelangen. Die fachliche Seite umfaßt Teilqualifikationen auf der breiteren Grundlage des Berufsfeldes.
Im zweiten Vollzeitjahr steht die fachliche (Teil-)Qualifizierung im Mittelpunkt des Lerngeschehens jedoch weiterhin unter Berücksichtigung der persönlichkeitsbildenden Aspekte und der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen.
Der sich anschließende, einjährig befristete und einmal wöchentlich stattfindende Berufsschulunterricht begleitet die Schüler unter der Zielsetzung, sie speziell für ihre arbeitsplatzspezifischen Tätigkeiten zu qualifizieren. Der Lernprozeß ist dabei auch lernortübergreifend (in Betrieb und Schule) konzipiert. Die überfachlichen sozialen, humanen und allgemeinen Handlungskompetenzen sind auch hier ein wesentliches Ziel der berufspädagogischen Bemühungen
Struktur der beruflichen Teilqualifikation/Berufsvorbereitung: BV-TQ
Für junge Menschen mit geistiger und/oder anderer Lernbehinderung
|
Struktur der beruflichen Teilqualifizierung |
Berufsfeldbreite Grundbildung Eltern-Initiative-Projekte/Integrati-onsbetriebe setzen dabei Akzente im Berufsfeld |
Fachliche Qualifizierung Orientierung an den fachlichen Anforderungen der Eltern-Initiativ-Projekte/Integrati-onsbetriebe |
Spezielle Qualifizierung Entsprechend der speziellen Anforderungen des einzelnen Arbeitsplatzes im Projekt "Spezialisierung" |
|
z. B.: Tage |
Berufsvorbereitung (BV) und Teilqualifikation (TQ) |
Teilqualifikation (TQ) und Berufsvorbereitung (BV) |
Speziell abgestimmte Teilqualifikation und Berufsvorbereitung |
|
1-Mo |
|||
|
2-Di |
|||
|
3-Mi |
1. Ausbildungsjahr |
2. Ausbildungsjahr |
|
|
4-Do |
|||
|
5-Fr |
3. Ausbildungsjahr |
|
Zeit: |
In Vollzeitform |
In Vollzeitform |
In Teilzeitform |
|
Lernort: |
5 Tage Fachpraxis und -theorie in der Schule |
5 Tage Fachpraxis und -theorie in der Schule |
1 Tag in der Berufsschule 4 Tage im Betrieb |
|
Dualität: |
5 SchülerInnen arbeiten und lernen z. Zt. wöchentl. 9 Std. "dual" im zukünft. Betrieb |
Duale Teilqualifizierung: Ausbildung in Schule und Betrieb |
|
|
Varianz der Lernorte |
Unterricht: lernortübergreifend durch Projekt- und Exkursionstag |
Unterricht: lernortübergreifend; projektorientiert: Lernort: Kiosk - Projekt: 6-9 Mon./1xWo. (Produktion und Verkauf) - |
Unterricht: lernortübergreifender Berufsschulunterricht auch am Arbeitsplatz der SchülerInnen |
|
Kooperation mit Eltern-Projekt/ Integrat. - Betrieb |
Akzentuierung der berufsfeldbreiten Grund- bildung durch spezielle Ausrichtung der Eltern-Initiativ-Projekte/ Integrationsbetrieb (z. B.: Café, Hotel oder Gästehaus) |
Inhalts- undZielabstimmung mit den Qualifikationsanforderungen der Integrationsbetriebe/ Eltern-Initiativ-Projekte (z. B.: das Fach "Konditorei" für das Projekt "Café") |
SehrengeKooperation zwischen Berufsschule und Betrieb zwecks Vermittlung arbeitsplatzbezogener Qualifikationen (z. B.: Thema "Bedienung der elektron. Kasse/Kassieren") |
|
anderer Lernort |
Praktikum (block- oder tageweise) |
Was zunächst als Notlösung angesehen wurde, erwies sich nach den Aussagen aller direkt und indirekt Beteiligten als ein sehr produktiver Zwischenschritt auf dem Weg von der Schule zur Berufstätigkeit, ohne den es nach Einschätzung des Ausbilders im Hotel zu immens großen Problemen am Arbeitsplatz gekommen wäre. Für die Schule und die beteiligten Berufspädagogen erwuchsen aus diesen Erfahrungen modellartig Perspektiven für eine neue Form der Berufsvorbereitung und zwar für Menschen mit einer geistigen Behinderung bzw. mit einer ausgeprägten Lernbeeinträchtigung.
Jens gehörte zur ersten Klasse dieser Schulform, in der seit 1991 geistig behinderte und andere lernbeeinträchtigte junge Menschen für ihre zukünftige berufliche Tätigkeit in Integrationsbetrieben, in denen behinderte und nicht behinderte Arbeitnehmer gleichberechtigt zusammen arbeiten, qualifiziert werden. Wenn Jens an seinem Arbeitsplatz im Hotel die ihm übertragenen Aufgaben fachgerecht und selbständig bewältigen kann, dann hat er - wie seine KollegInnen auch - die Ausübung seiner Tätigkeit in dieser berufsvorbereitenden und zugleich teilqualifizierenden Schulform erlernt.
Sie ist ein schulisches Pilotprojekt, das sich durch bewußte Flexibilität und Offenheit für Innovationen stetig weiterentwickelt und somit bewährt hat. Die Bezeichnung der Klassen dieser Schulform als Berufsvorbereitungsklasse 7/8 (BVK 7/8) führte häufig zu Verwechslung mit den gleichnamigen Klassen, in denen Jugendliche ohne Hauptschulabschluß durch ausschließlich berufsvorbereitende Maßnahmen die Aufnahme einer Vollausbildung ermöglicht werden sollten. Mittlerweile ist die vierte Klasse eingeschult, die erste mit der neuen Bezeichnung BV-TQ, womit auch die doppelte, d. h. die berufsvorbereitende (BV) und zugleich teilqualifizierende (TQ) Intention zum Ausdruck gebracht ist.
Wenn man die Neuanmeldungen für die nächsten Klassen einbezieht, werden in absehbarer Zeit insgesamt ca. 40-45 behinderte SchülerInnen an der W2 die fachlichen Qualifikationen für ihren Tätigkeitsbereich erworben haben und in die Arbeitswelt entlassen worden sein.
Weiterführende konzeptionelle Überlegungen und erste Planungen befassen sich mit dem Ausbau und der Aufnahme auch neuer Berufsfelder aus dem Dienstleistungsbereich, sei es - wie oben angesprochen - die Ausweitung des Berufsfeldes Gesundheit oder der Tätigkeitsbereich des Hausmeister-Helfers mit übergreifenden Elementen aus den traditionellen Berufsfeldern Metall, Holz, Farbe und den Schwerpunkten in den Arbeitsbereichen der Pflege, Wartung, Reparatur, Transport, Botentätigkeiten etc. Entsprechende fachliche, räumliche und auch personelle Ressourcen sind an der beruflichen Schule (W2) gegeben.
So unterschiedlich Vorbildung und Leistungsfähigkeit dieser SchülerInnen auch sein mögen: gemeinsam ist allen, daß sie und Ihre Eltern schon eineEntscheidung für das künftige Berufsfeld getroffen haben und für die meisten von ihnen der konkrete Arbeitsplatz schon feststeht. Denn die meisten Eltern unserer SchülerInnen haben sich zu Initiativen und Vereinen zusammengeschlossen, deren Ziel es ist, Arbeitsplätze für ihre Kinder zu schaffen.
Zur Zeit werden im zweiten Ausbildungsjahr 15 SchülerInnen, aufgeteilt in zwei Klassen, für ihre zukünftigen Tätigkeiten qualifiziert. Fünf SchülerInnen werden ab Sommer 1997 gemeinsam mit nicht behinderten MitarbeiterInnen ein Eiscafé führen. Die besondere Situation, daß das Eiscafé bereits im Sommer 1996 eröffnet wurde, ermöglicht den SchülerInnen eine duale Lernsituation, in der sie neben der schulischen Unterrichtszeit ca. 9 Stunden wöchentlich im Betrieb unter Anleitung und zunehmend auch selbständiger arbeiten. Für vier andere SchülerInnen ergibt sich ab Sommer 1997 eine Mitarbeit in einem Gästehaus mit einem Pensionsbetrieb, der neben Frühstück auch kleine Gerichte und Snacks anbieten will. Drei der SchülerInnen wollen zum selben Zeitpunkt Tätigkeiten im Bereich der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft einer anthroposophischen Einrichtung übernehmen; diese werden sich zunächst insbesondere auf den Bereich der Nahrungszubereitung und Wäschepflege konzentrieren. Eine einzelne SchülerIn hat die Zusage, in einem bereits angelaufenen, betreuten Stadtteilcafé, dessen Träger eine der Hamburger Werkstätten ist, mitarbeiten zu können. Zwei SchülerInnen haben noch keine konkreten Optionen auf einen Arbeitsplatz.
In der Unterstufe, die im Sommer 1996 eingeschult worden ist, strebt der größte Teil der SchülerInnen auf ein Projekt zu, das von den Eltern und vom Diakonischen Werk getragen wird und zukünftige Arbeitsplätze im Bereich einer Altenpflege-Einrichtung ( Nahrungszubereitung, Wäschepflege, aber auch leichte pflegerisch-betreuende Aufgaben, etc.) bereitstellen will.
Die SchülerInnen, die sich in dieser Ausbildung befinden, sind junge Menschen, die im Bereich Hauswirtschaft / Gastronomie arbeiten wollen, die aber aufgrund unterschiedlicher Beeinträchtigungen und Behinderungen gegenwärtig auf dem Arbeitsmarkt keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden. Es sind aber auch andere junge Menschen dabei, die sicherlich über einen langen Zeitraum oder auch ständig unterstützende Hilfe bei der Erledigung von Arbeitsaufträgen benötigen, jedoch in einer Werkstatt für Behinderte keine Alternative sehen.
Am Beispiel der Zusammensetzung der im August 1995 eingeschulten Schülergruppe wird deutlich, aus welchen Schulen die Jugendlichen zu uns kommen: Von der Christophorus-Schule (eine Waldorf- und Förderschule) kommen 8 unserer jetzigen SchülerInnen. 2 SchülerInnen kommen von einer staatlichen Sonderschule für geistig Behinderte. 2 SchülerInnen waren an einer anthroposophischen Sonderschule für geistig Behinderte, 2 weitere haben an Gesamtschulen Integrationsklassen bis zur 10. Klasse besucht. 1 SchülerIn war vorher an der privaten Schülerschule Schenefeld und 1 Schüler hat nach Beginn des Schuljahrs aus der Berufsvorbereitungsklasse (BVK 8) einer anderen Berufsschule zu uns gewechselt.
Die Jugendlichen sind in zwei Klassen von jeweils 8 bzw. 7 SchülerInnen aufgeteilt, wobei berücksichtigt wurde, daß jede Gruppe vergleichbar heterogen zusammengesetzt ist.
Jede Gruppe wird im wesentlichen von zwei LehrerInnen unterrichtet:
-
Dem Klassenlehrer, einem Gewerbelehrer, der über mehrere Jahre geistig behinderte Jugendliche in der Berufsschule unterrichtet hat, der aufgrund dieser Tätigkeit die Schülergruppe sehr genau kennt und durch seine Ausbildung konkrete Erfahrungen mit der Berufs- und Arbeitswelt hat.
-
Der Co-Klassenlehrerin, einer Gewerbelehrerin, die in der Berufsausbildung für HauswirtschafterInnen und Hauswirtschaftliche BetriebshelferInnen tätig war und daher Erfahrung mit der Berufsausbildung und mit betrieblichen Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen in diesem Berufsfeld hat.
Einige wenige Stunden werden von anderen KollegInnen unterrichtet, weil Klassenlehrer und Co-KlassenlehrerIn für einzelne Fächer, z. B. Musik oder Konditorei nicht ausgebildet sind. Unser Bestreben ist es, das Klassenkollegium so klein wie möglich zu halten, damit für die SchülerInnen eine kontinuierliche personelle Betreuung gegeben ist. Trotzdem muß gewährleistet sein, daß jedes Fach von kompetenten, dafür ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet wird und daß die bei der Unterrichtsplanung und Durchführung für diese Schülergruppe erforderlichen didaktischen und methodischen Kriterien berücksichtigt werden.
Das durch die Praxisfächer sich ergebende Fachraumprinzip führt zum häufigen Wechsel der Unterrichtsräume und damit zu einer Diskontinuität, die sich durch Lehrerwechsel auch noch um die personelle Dimension erweitert, ein Zustand, der einer Teambildung eher entgegenwirkt. Zur Stabilisierung der Schülergruppe, aber auch zur Einzelförderung ergibt sich die Notwendigkeit einer zusätzlichen Betreuung. Im Falle zweier schwerst mehrfach behinderter SchülerInnen wurde diese Aufgabe von den für sie zuständigen Sozialpädagoginnen mitgetragen. In anderen Klassen übernehmen Jahres-PraktikantInnen sozialpädagogischer Ausbildungsgänge die kontinuitätsstiftende Betreuung und auch die individuelle fachliche Förderung im Lernprozeß.
Sicherlich steht die Vorbereitung auf die zukünftige Tätigkeit im angestrebten Projekt an der ersten Stelle, wenn über Zielsetzungen nachgedacht wird. Aus berufspädagogisch-ganzheitlicher Sicht sind drei Dimensionen - die human-individuelle, die fachliche und die gesellschaftliche - von konstitutiver Bedeutung für berufliches Lernen. Ohne persönlichkeitsfördernde Veränderungen, ohne fachliche Kompetenzerweiterung und ohne Bezug zur Gesellschaft, nur für sich allein, bliebe solch ein Lernansatz substanzlos. Drei Zielkomplexe, die sich wechselseitig beeinflussen, sind für alle im Rahmen von Unterricht anzustrebenden Lernprozesse maßgebend:
-
Die Persönlichkeitsbildung: Sie soll den einzelnen in der Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit soweit fördern, daß er in der Lage ist, in produktiver Form mit anderen in Beziehung zu treten.( Sozialverhalten, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit etc.)
-
Die fachliche Qualifikation: Sie ermöglicht dem einzelnen die kompetente und produktive Mitarbeit in den angestrebten Integrationsbetrieben bzw. auch in ähnlich strukturierten Projekten (Fachkompetenz).
-
Die gesellschaftliche Integration: Integration als das aktive In-Beziehung-Setzen mit Gesellschaft wird durch die unmittelbare Teilhabe und konstruktive Mitgestaltung an der gesellschaftlichen Arbeit und dem gesellschaftlichen Leben bestimmt. Selbständigkeit, Sozialkompetenz und Fachkompetenz haben dabei einen entscheidenden Einfluß.
Didaktisch-methodische Entscheidungen stellen die Praxisfächer in das Zentrum dieser teilqualifizierenden Berufsvorbereitung . Drei Kriterien sind für die Auswahl der Ziele und Unterrichtsinhalte und für die Festlegung der Fächer und damit letztendlich auch für das Angebot erwerbbarer Teil- Qualifikationen mitentscheidend.
1. Die Qualifikationsanforderungen des künftigen Arbeitsplatzes
Sie werden nach eingehenden Recherchen und Absprachen mit den Projektleitungen in einem Anforderungskatalog zusammengefaßt und bilden das Kriterium für die Festlegung der Unterrichtsinhalte und Fächer.
Lag bei der Vorbereitung der SchülerInnen auf die Tätigkeit im Stadthaus*Hotel, in dem Jens nun arbeitet, die Akzentsetzung u.a. auf der Zubereitung und dem Servieren von Frühstück sowie dem Reinigen und Pflegen der Zimmer, verschiebt sich zum Beispiel der Akzent bei der jetzigen Gruppe, die in einem Eiscafé arbeiten wird, in Richtung Service und Konditorei. Bei der zweiten Gruppe mit dem Ziel 'Gästehaus' spielt die Pflege einer Gartenanlage eine bedeutende Rolle, so daß in Absprache mit den Eltern zusätzlich zu den Praxisfächern Nahrungszubereitung, Hauspflege, Wäschepflege und Service die Fächer Gartenbau und Konditorei aufgenommen wurden. Diese inhaltlichen Festlegungen bilden folglich den Rahmen, innerhalb dessen Teilqualifikationen erworben werden können.
Eine für 1997 angemeldete Gruppe plant in einem Altersheim zu arbeiten: Entsprechend wird dann Gesundheitspflege ein Praxisschwerpunkt sein.
2. Qualifikationsanforderungen nach den Lehr- und Ausbildungsplänen
Grundlage für die Ausbildung und den Erwerb von Teilqualifikationen ist im wesentlichen der Lehrplan für das 1. Jahr der HauswirtschafterInnenausbildung. Dieser Lehrplan legt alle grundlegenden Inhalte fest, die für die Tätigkeit in diesem Berufsfeld notwendig sind, wie insbesondere: Hygiene, Unfallverhütung, Arbeitsorganisation, den sachgerechten Umgang mit Geräten und Materialien unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten, sowie eine Einführung in die Praxisbereiche u.a. Haushaltskochen, Wäschepflege, Hauspflege, Konditorei. Aus diesem Lehrplan werden nur die Inhalte und Lernziele übernommen und angestrebt, die für die künftigen Tätigkeiten in den überschaubaren Bereichen der Projekte von Relevanz sind.
3. Individuelles Qualifizierungspotential und Interesse der SchülerInnen
Wie oben beschrieben, bestehen unsere Klassen aus sehr heterogenen Schülergruppen. Das Spektrum erstreckt sich von der lernbeeinträchtigten SchülerIn mit Hauptschulabschluß bis zur SchülerIn mit einer ausgeprägten geistigen Behinderung, eine Zusammensetzung wie sie sonst wohl nur in Integrationsklassen vorkommt, wobei bei uns der Anteil der geistig behinderten SchülerInnen höher ist als in I-Klassen. Das individuelle Qualifizierungspotential weicht folglich stark voneinander ab.
Diese Leistungsheterogenität bestimmt die Auswahl der Inhalte und Ziele in einem wesentlichen Maße mit. Sie macht eine Zieldifferenzierung hinsichtlich erreichbarer Teilqualifikationen erforderlich. Die SchülerInnen entwickeln aufgrund ihrer unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten und Interessen individuell ausgeprägte Qualifikationsprofile mit zum Teil inhaltlich variierenden Schwerpunkten innerhalb des gegebenen Rahmens.
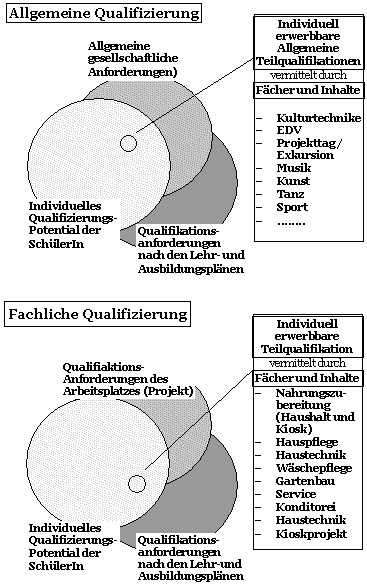
Die beiden Diagramme zur allgemeinen, bzw. fachlichen Qualifizierung zeigen, wie durch die unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen die Auswahl der Fächer und Inhalte festgelegt wird. Die durch sie vermittelte fachliche, bzw. allgemeine Qualifizierung ist in dem Maße ausgeprägt, wie das individuelle Lern- und Qualifizierungspotential des Schülers Teilqualifikationen erwerben läßt. So bestimmt jeder Schüler durch sein Vermögen den Grad seiner möglichen Teilqualifikation für den angestrebten Arbeitsplatz.
Aus dem Stundenplan wird ersichtlich, wie die Eltern-Initiativ-Projekte sich im inhaltlichen Angebot der Schulform widerspiegeln. Die Tätigkeiten im Eiscafé und Gästehaus werden hier im dritten Halbjahr durch die Praxisfächer Service, Nahrungszubereitung und Verkauf sowie durch Konditorei und Haustechnik inhaltlich abgedeckt und vorbereitet.
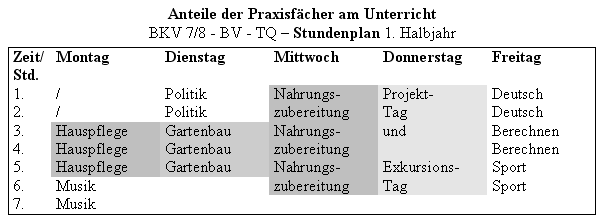
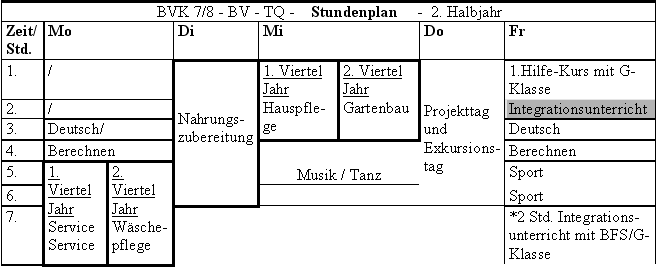
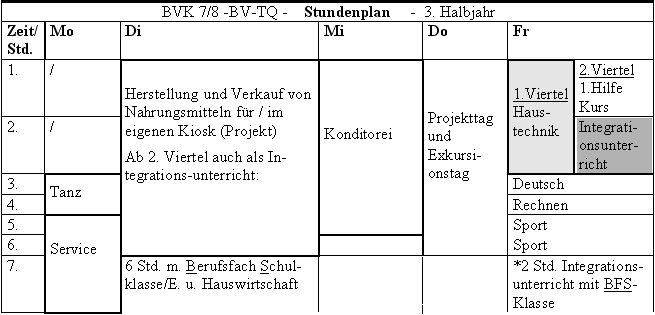

Der Unterricht hat wie oben dargelegt das Ziel, den Lernenden den Erwerb einer beruflichen, sozialen und individuellen Handlungskompetenz zu ermöglichen. Der Unterrichtsprozeß ist derart zu gestalten, daß sie zugleich mit den beruflichen Teilqualifikationen auch allgemeine, persönlichkeitsbildende Qualifikationen erwerben. Beide sollen sie befähigen, daß sie in ihrer beruflichen und außerberuflichen Lebenswelt ihnen angemessene Tätigkeiten und Aufgaben fachgerecht und selbständig, evtl. auch unter Anleitung, bewältigen.
Um diesen Anspruch umzusetzen, bilden die Praxisfächer (Nahrungszubereitung, Backen, Wäschepflege, Hauspflege, Service, Gartenbau) den didaktisch-methodischen Kern in der Gesamtkonzeption des Unterrichts. Soweit angemessen, richten sich die Inhalte der anderen Fächer (insbes. Deutsch, Politik, Berechnen) nach dem Zweck und der Notwendigkeit, die sie für die Praxis haben. Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur fächerübergreifende und handlungsorientierte Unterrichtsformen sondern auch Unterricht in Projektform. Durch den Ernstcharakter der Handlungssituation wird die Wirklichkeit der Lebenswelt in die Lernsituation zurückgeholt, und es kann auf Sekundärerfahrungen mit hohen kognitiven und abstrakten Anteilen weitgehend verzichtet werden.
Im Betrieb des schuleigenen Kiosks wird der Ernstcharakter manifest, wenn unter Zeitdruck die zu verkaufenden Waren hergestellt werden müssen und unter dem Druck nachdrängender Kunden verkauft werden müssen.
Die Einrichtung eines wöchentlichen Projekttages, an dem die Beschränkungen des Lernortes 'Schule' aufgehoben werden und Unternehmungen außerhalb der Räumlichkeiten und der inhaltlichen Vorgaben von Schule durchgeführt werden können, unterstützt eine Unterrichtsgestaltung, die auf das Erlernen von Handlungsstrategien sowie auf die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen ausgerichtet ist. Im musisch-kreativ-motorischen Bereich (Musik, Tanz, Sport) bieten die besonderen Wahrnehmungs- und Handlungsformen eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen ganzheitlicher Lernansätze.
Handlungs- und projektorientiertes Lernen - wie das Lernen in der Ernstsituation des Kiosks - ist besonders für den Erwerb von übertragbaren und in vielen Situationen verwertbaren Fähigkeiten (Schlüsselqualifikationen) relevant. Die Ausrichtung auf handlungsorientiertes Lernen läßt einen hohen Grad der Integration von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu und trägt somit entscheidend zum systematischen Erwerb von beruflichen Qualifikationen und Schlüsselqualifikationen bei.
Die Bedeutung des Kiosk-Projektes für die Schule
SchülerInnen, die am Kiosk-Projekt beteiligt sind, versorgen an einem Tag in der Woche den schuleigenen Kiosk . Da laut einer schulinternen Umfrage 50% der SchülerInnen ohne ein Frühstück in die Schule kommen, hat der Kiosk eine wichtige Versorgungsaufgabe und trägt ganz entscheidend zum Wohlbefinden der SchülerInnen in der Schule bei. Durch das Angebot von vollwertigen Speisen werden die SchülerInnen an eine gesunde Ernährung herangeführt, ihre Konzentrationsfähigkeit und Lernbereitschaft wird durch das gesunde Frühstück ganz erheblich gefördert. Obwohl am Kiosk keine Süßigkeiten verkauft werden, ist die Akzeptanz des Angebotes hoch. Das zeigt sich deutlich am Umsatz:
-
In der 1. Pause wird ein Frühstück, bestehend aus ca. 100 halben Vollkornbrötchen mit diversen Belägen (Käse, Wurst, Quark, Ei), ca. 25 Portionen Müsli sowie kalten und warmen Getränken, angeboten.
-
In der 2. Pause werden warme Snacks wie Pizza, Lasagne, Aufläufe, aber auch Salate angeboten. Da in dieser Pause die schuleigene Kantine ein vollständiges Mittagessen anbietet, reichen hier 30 Portionen im Angebot.
Durch den Schulkiosk wird nicht nur die schlechte Ernährungssituation vieler SchülerInnen aufgefangen, gleichzeitig hat er eine wichtige soziale Funktion, wenn in der Pausenhalle behinderte und nicht behinderte, deutsche und ausländische SchülerInnen gemeinsam frühstücken und auf diesem Wege ein selbstverständliches Umgehen miteinander ermöglicht wird. Die Atmosphäre in der Pausenhalle ist daher auch deutlich besser, wenn der Kiosk geöffnet ist.
Die Arbeit im Kiosk-Projekt gliedert sich in die zwei Bereiche: Produktion und Verkauf.
Die Bedeutung des Kiosk-Projektes für die in der Nahrungsmittelproduktion tätigen SchülerInnen
Nicht nur die Konsumenten profitieren vom Schulkiosk. Für die Klassen, die den Kiosk betreiben, bietet er eine angemessene Trainingsmöglichkeit für die Fächer Nahrungszubereitung, Service, Hygiene, Hauspflege, Gestalten, Deutsch und fachbezogenes Rechnen. Wenn behinderte SchülerInnen den Kiosk betreiben, kommt noch hinzu, daß sie erkennen, daß sie die gleiche Leistung erbringen wie nicht behinderte SchülerInnen. Ihr Selbstbewußtsein wird dadurch erheblich gefördert.
Die SchülerInnen der BV-TQ steigen im 2. Ausbildungsjahr in das Kiosk-Projekt ein. Zu diesem Zeitpunkt haben sie schon die grundlegenden Hygieneregeln verinnerlicht, sie kennen und beachten die notwendigen Maßnahmen zur Unfallverhütung, sie haben mit allen in der Küche vorhandenen Geräten und Maschinen gearbeitet und grundlegende Techniken der Nahrungsproduktion bei der Herstellung von im Privathaushalt üblichen Mengen kennengelernt.
Bei der Produktion der Speisen für den Kiosk geht es darum, bisher Gelerntes anzuwenden und so zu trainieren, daß Qualität und Quantität des Arbeitsergebnisses gesteigert werden. Der Ernstcharakter der Produktion und die festgelegte Pausenzeit, zu der das Frühstück von den anderen SchülerInnen abgefordert wird, strukturieren den Arbeitsablauf durch ihre zeitlichen Vorgaben.
Der Kiosk ist als Beispiel für die gewerbliche Herstellung von Nahrungsmitteln anzusehen. Das Herstellen großer Mengen erfordert eine andere Arbeitsorganisation als die Zubereitung von Speisen für den Privathaushalt: Bei der Nahrungszubereitung kleiner Mengen stellt jede SchülerIn ein Gericht allein her, bei der Verarbeitung großer Mengen ist ein arbeitsteiliges Vorgehen unbedingt notwendig. Für unsere Schülergruppe hat das den Vorteil, daß jede SchülerIn entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt werden kann und unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit ganz erheblich zum Gelingen des Gesamtergebnisses beiträgt, da ja jede Teilaufgabe für das fertiggestellte Produkt grundlegend notwendig ist.
Gleichzeitig ist die Möglichkeit zum Trainieren ganz bestimmter Fertigkeiten gegeben, z. B. gleichmäßiges Schneiden, ansprechendes Dekorieren usw. Damit keine Monotonie aufkommt, ist es wichtig, daß die SchülerInnen, die von ihnen benötigte Arbeitszeit selbst messen und daran ihre Leistungssteigerung, die durch ein wiederholendes Üben erreicht wird, erkennen können.
Außerdem soll jede SchülerIn jede Teilaufgabe, die für das Gesamtergebnis wichtig ist, ausgeführt haben. Diese Arbeitsweise ermöglicht eine Binnendifferenzierung, die für die einzelne SchülerIn optimal ist, da sie entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten eingesetzt ist und an jeder Stelle im Produktionsprozeß einen wichtigen Anteil für das Entstehen des Gesamtergebnisses hat.
Die Entwicklung, die unsere SchülerInnen in diesen 8 Wochen geleistet haben, zeigt sehr deutlich den Erfolg dieses Projekt-Lernens. So konnten die SchülerInnen innerhalb dieser 8 Wochen die benötigte Zeit für die Zubereitung der Nahrungsmittel für die erste Pausenversorgung trotz regelmäßigen Wechselns des Arbeitsplatzes von 90 auf 60 Minuten reduzieren. Durch den wachsenden Überblick über die Struktur der Produktion (Transparenz der prozessualen Zusammenhänge) und die Wiederholung von Zubereitungsaufgaben (Training und Orientierung der Motorik) nahm die Selbständigkeit bei der Arbeitsausführung in erheblichem Maße zu. Alle SchülerInnen haben aufgrund ihrer hohen Identifikationsleistung bezüglich der übernommenen Versorgungsaufgabe die Bereitschaft gezeigt, außerordentliche Anstrengungen auf sich zu nehmen - mit dem Ergebnis, daß sie alle ihre Arbeitsausdauer deutlich steigern konnten. Durch die übernommene Verantwortung für die Bewältigung dieser Ernstsituation und durch die positiven Rückmeldungen der Käufer ihrer Produkte hielt die Motivation zum konzentrierten und erfolgsorientierten Arbeiten über die ganze Zeit hin an.
Die Bedeutung des Kiosk-Projektes für die im Verkauf tätigen SchülerInnen
Beim Verkauf der Lebensmittel werden soziale und fachliche Fähigkeiten gefordert und eingeübt. Die SchülerInnen müssen sich auf ganz verschiede Menschen einstellen, unter Streß (Zeitdruck) immer freundlich bleiben und die Übersicht behalten. Die Tätigkeit im Kiosk ist ein bedeutendes Moment der Integration behinderter Schüler in die Schule. Der "normale" Umgang miteinander zeigt, daß die Integration in diesem Bereich gelungen ist. Es spielt für die Käufer keine Rolle, welche Klasse gerade den Kiosk betreibt. Dadurch, daß an unserer Schule alle Klassen, die berufsfachlichen Unterricht haben, im Rahmen ihrer Ausbildung dort zumindest für einige Wochen auch mal eingesetzt sind, wird der Kiosk auch von allen SchülerInnen angenommen und frequentiert.
Der Verkauf fordert auch erhebliche fachliche Qualifikationen, so z. B. Umgang mit Geld, wie z. B. Nachzählen, Wechseln, Herausgeben, Berechnen der Einnahmen und Ausgaben aber auch die Einsicht in die Notwendigkeit von Quittungen und Buchführung und Preisberechnung für die angebotenen Speisen. Das Erstellen von Werbeplakaten und Texten für den Kiosk oder Informationen über Fragen zur gesunden Ernährung oder zu bestimmten Lebensmitteln sind ebenso realistisch wie die Dekoration der Verkaufs- und Pausenhalle entsprechend der Jahreszeit. Auch diese Aufgaben bieten viele Möglichkeiten der Binnendifferenzierung, so daß die SchülerInnen entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten gefördert werden können.
Ausweitung des Kiosk-Projekts
Zur Zeit arbeiten im Kiosk-Projekt die beiden Parallelklassen BV-TQ zusammen. Während die eine Gruppe die Speisen herstellt, verkauft die andere Gruppe die Produkte. Im nächsten Halbjahr soll der erfolgreiche Integrationsunterricht mit einer Berufsfachschulklasse - wie er mit dem Unterricht in 1. Hilfe begonnen wurde - fortgesetzt werden. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit Berufsfachschulklassen bzw. multinationalen Klassen unserer Schule im Kiosk-Projekt. Eine Gruppe dieser Klasse wird zusammen mit einer BV-TQ-Klasse als integratives Team gemeinsam Speisen herstellen, bzw. verkaufen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht die Chance, daß Speisenangebote vielfältiger gestaltet werden können, als es mit der BV-TQ allein möglich ist. Für die behinderten und die nichtbehinderten SchülerInnen unserer Schule bedeutet diese hautnahe projektbezogene Kooperation in solch einem ausgeprägten handlungsorientierten Lern- und Produktionszusammenhang gleichzeitig auch immer ein konstruktiver Schritt zur Normalisierung des Umgangs miteinander - und das ist schön, dies so zu erleben.
Während der Praxisunterricht gezielt auf die künftigen Arbeitsplätze vorbereitet, besteht das Ziel der Projekttage in der gesellschaftlichen Integration der Jugendlichen. Hier werden auch Themen aufgegriffen, die man bewältigen muß, wenn man möglichst selbständig und eigenverantwortlich leben will, wie z. B. Umgang mit anderen Menschen, Umgang mit Geld, Kennenlernen von Beratungsstellen, Planung und Gestaltung der Freizeit oder auch Rechte und Pflichten als Bürger. Obwohl diese Themen nur bedingt mit dem künftigen Arbeitsplatz zu tun haben, werden hier Schlüsselqualifikationen vermittelt, die auch der späteren beruflichen Tätigkeit zugutekommen.
Die Themen der Projekttage können von SchülerInnen und LehrerInnen eingebracht werden. Es sind direkt geäußerte Wünsche der SchülerInnen (z. B. Theaterbesuch oder das Thema "Sexualität"), aber auch Themen, die sich aus Gesprächen und Situationen im Unterricht ergeben, wenn deutlich ist, daß bestimmte Fragen die SchülerInnen besonders beschäftigen; z. B. Umgang mit Geld, Ver-meidung von Gewalt.
Die Projekttage werden auch genutzt, um wichtige berufliche Inhalte intensiver zu erarbeiten, als es im Fachunterricht möglich wäre, z.B. Videoaufnahmen zum Thema "Hygiene beim Umgang mit Nahrungsmitteln" oder Produktion von Lebensmitteln auf einem ökologischen Bauernhof.
Beeindruckend für SchülerInnen, LehrerInnen und Gäste sind berufsspezifische Projekte (z. B. Frühstücksbüffet für 20 Personen, Herstellung und Verkauf von 120 Gläsern Apfelgelee), bei denen die SchülerInnen in einer Ernstsituation Produkte herstellen, die aufgrund des Umfangs, des Schwierigkeitsgrades und der zur Verfügung stehenden Zeit professionelles Arbeiten erfordern. Hier wenden die SchülerInnen bereits ihre erworbenen Fähigkeiten an. Jeder trägt entsprechend seiner Stärken zum meist positiven Gesamtergebnis bei.
Im ersten Ausbildungsjahr überwiegen Projekte, die sich auf die Bewältigung allgemeiner Lebenssituationen beziehen, im zweiten Ausbildungsjahr sollen stärker berufsbezogene Projekte den Vorrang haben. Die Durchführung der Projekte erfolgt in drei Schritten:
1. Planung
In dieser Phase ist zu klären, welches Interesse und welchen Bezug SchülerInnen und LehrerInnen zum eingebrachten Thema haben, welche Aspekte den SchülerInnen wichtig sind, welche Fragen sie beantwortet haben möchten, wie die Informationen zu beschaffen sind, wieviel Zeit dafür notwendig ist, welche Vorbereitungen erfolgen müssen (Material besorgen, Termine vereinbaren).
2. Durchführung
Die Durchführung einer Unternehmung erfolgt entsprechend der Planung und ist sehr abhängig vom Thema. In der Regel erfolgt zu jedem Thema eine Exkursion (Besuch von Beratungsstellen, Sparkasse, Bauernhof, HEW), z. T. werden Gäste als Referenten eingeladen, in kleinen Gruppen werden Themen bearbeitet, in Rollenspielen werden Verhaltensvariationen durchprobiert, auf Schautafeln und in Zeitungen werden Ergebnisse festgehalten. Durch Binnendifferenzierung wird sichergestellt, daß jede SchülerIn ihren Interessenschwerpunkt verfolgen kann und daß jeder sein Arbeitsergebnis als Erfolg erlebt. Das Gesamtergebnis ist das Ergebnis der Klasse, zu dem jede/r entsprechend ihrer Fähigkeiten beigetragen hat. Es gibt nur individuelle Ziele und Leistungsmaßstäbe und keinen für alle gleichen Maßstab.
3. Nachbesprechung
Bei der Nachbesprechung wird geklärt, ob die während der Planung aufgestellten Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt wurden, oder ob das Thema noch weiter behandelt werden soll, bzw. noch einmal aufzugreifen ist. Ganz besonders wichtig ist die Auswertung von Praxisprojekten mit Ernstcharakter. Hier stellen die SchülerInnen die von ihnen geleistete Arbeit der ganzen Klasse noch einmal vor und berichten, wie sie gearbeitet haben, was gut gelaufen ist, was Spaß gemacht hat und wo die Schwierigkeiten lagen. Sie berichten von ihren Ängsten, von Streßsituationen und von ihren Erfolgen und Freuden bei der Tätigkeit. In dieser Situation können die LehrerInnen sehr viel von den SchülerInnen lernen, da die Betroffenen am besten schildern können, wie sie bestimmte Situationen erfahren haben. Wichtig ist, daß die SchülerInnen erleben, daß sie von den LehrerInnen als gleichberechtigte Partner anerkannt sind und daß die Konsequenzen, die aus dem Projekt gezogen werden, auch von allen gemeinsam getragen werden.
-
Wenn das Ziel dieser Ausbildung darin besteht, fachliche und allgemeine Qualifikationen zu erwerben, um im Bereich des ersten Arbeitsmarktes in einem Integrationsbetrieb eine fachliche und bezahlte Tätigkeit auszuüben bedeutet nicht nur das Erreichte die Integration schlechthin, dann ist auch der Weg, der dahin führt, bereits ein integrativer Akt.
-
Offene, handlungsorientierte Unterrichtsformen entsprechen den Anforderungen eines integrativen didaktischen Ansatzes. Sie fördern in geschlossenen Lerngruppen durch ihre vielseitigen Möglichkeiten die Akzeptanz der Andersartigkeit und die Normalität im Umgang. Die oben beschriebene Heterogenität unserer Lerngruppen hat unsere Bemühungen um Integration innerhalb der nicht unproblematisch interagierenden Gruppenzu einem produktiven (auch Lern-) Prozeß werden lassen. Sie wachsen immer mehr zu einem Team zusammen.
-
Die Integration unserer Schüler findet darüber hinaus auch in fruchtbarer Weise innerhalb der gesamten Schüler- und Lehrerschaft der Schule statt. Sie ist ein im Fluß befindlicher Prozeß, der über Akzeptanz zur Begegnung und weiter zur Gemeinsamkeit führt und schließlich in den Zustand der Normalisierung mündet. So zum Beispiel, wenn die ruhige Sabrina sich in den Pausen immer mit den gleichen Schülern einer anderen Klasse zum Klönen trifft oder einige Tage später im Kiosk belegte Brötchen an sie verkauft.
-
Auf einer dritten Ebene wird Integration im geplanten gemeinsamen Unterricht (Integrationsunterricht) mit SchülerInnen der Berufsfachschulklassen zur gemeinsamen Aufgabe für alle Beteiligten. In einem Halbjahreskurs zur 'Ersten Hilfe' durchliefen die Beteiligten beider Klassen alle Stadien eines normalen Integrationsprozesses: von der Abgrenzung über die Annäherung zur Normalität - ganz normal!
Dieser Aufsatz ist in der Zeitschrift: Behinderte, Zft., Heft 6/1996, Graz 1996, erschienen.
Inhaltsverzeichnis
- Grundgedanken und Arbeitsweise der Hamburger Arbeitsassistenz
- "Ich suche Arbeit, ich brauche Eure Unterstützung!" - die Erstellung des Fähigkeitsprofils
- Arbeitsplatzakquisition - die Achillesferse beruflicher Integration
- Qualifizierung am Arbeitsplatz
- Verlauf und Dauer der Qualifikation
- Nachsorge und langfristige Betreuung
- Der Übergang von der Schule in den Beruf - das Ambulante Arbeitstraining
- Finanzierungsstrukturen der Hamburger Arbeitsassistenz
Rolf Behncke, Achim Ciolek, Projektleitung der Hamburger Arbeitsassistenz
Mit Recht kann für viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens Erfolg in der Integration von Menschen mit Behinderung reklamiert werden: Auf dem Weg ins Erwachsenenleben vom Kindergarten über die Vorschule bis zur Schule sind die integrativen Ansätze gemeinsamen Lebens und Lernens von Behinderten und Nicht-Behinderten in der Bundesrepublik unübersehbar.
Doch auf die lapidare wie selbstverständliche Frage: "Was kommt nach der Schule?" gibt es erst vorläufige Antworten. Mittlerweile differenziert sich allerdings zunehmend das Angebot an Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auch außerhalb der Werkstätten für Behinderte.
Die Tätigkeit der Hamburger Arbeitsassistenz zielt auf die individuelle Integration der Menschen mit Behinderung in reguläre Beschäftigungsverhältnisse des allgemeinen Arbeitsmarktes.
Im Frühjahr 1992 nahm die Hamburger Arbeitsassistenz ihre Tätigkeit auf. Die Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e.V. - Initiatoren des Modellprojektes - orientierten sich vorwiegend an Erfahrungen der Supported Employment Programme in den USA und wenigen Modellprojekten in Europa (z. B. Open Road von St. Michaels House in Dublin). Die vor Ort gewonnenen Eindrücke, der augenscheinliche Nachweis, daß berufliche Integration funktionieren kann, war letztendlich ausschlaggebend für die Initiierung eines ähnlichen Projekts in Hamburg.
Die LAG Eltern für Integration ist ein unabhängiger Interessenverband von Eltern behinderter und nicht-behinderter Kinder in Hamburg. Insbesondere hat sich der Verband erfolgreich um die Einrichtung von Integrationsklassen an den Hamburger Regelschulen verdient gemacht. Im Kreise dieser Eltern sind die ersten Vorstellungen, Konzepte und Umsetzungsstrategien entwickelt sowie die Finanzierungsbasis des Projekts geschaffen worden.
In den Jahren 1992 bis 1994 arbeitete die Hamburger Arbeitsassistenz als Modellprojekt, finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, Programm HORIZON und der Hauptfürsorgestelle Hamburg. Auf Grund der in diesen Jahren geleisteten erfolgreichen Tätigkeit befindet sich der Fachdienst seit Januar 1995 in der Regel-finanzierung und gehört in die Angebotspalette der beruflichen Rehabilitation in Hamburg.
Seit Beginn des Jahres 1996 kann der Fachdienst mit dem Ambulanten Arbeitstraining - Integrative berufliche Qualifizierung - ein weiteres Unterstützungsangebot machen, das sich vorwiegend an die SchulabgängerInnen aus den Sonderschulen und Integrationsklassen richtet.
Auch wenn bezahlte Arbeit in den westlichen Industriegesellschaften (nicht nur dort) auf Grund technologischer und arbeitsorganisatorischer Umstrukturierungen zunehmend zu einem knappen Gut wird, von einigen sogar das Ende der Arbeitsgesellschaft (damit allerdings auch gewisse Chancen der Emanzipation) eingeläutet wird, ist es unbezweifelbar, daß der Status, der mit "Lohn und Brot" verbunden ist, nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert hat. Unbezweifelbar sind auch die positiven Auswirkungen eines "anerkannten" Arbeitslebens auf das persönliche Selbstwertgefühl, auf das Erleben sozialer Eingebundenheit und auf individuelle Entwicklungschancen. Was für nichtbehinderte Menschen gilt, ist in ungleich höherem Maße für jene zutreffend, deren Biographie in weiten Teilen durch Ausgrenzung und Vorenthaltung dieser persönlichen und gesellschaftlichen Anerkennung bestimmt wird.
Auf eine kurze Formel gebracht, besteht die Aufgabe des Fachdienstes darin, zusammen mit einem/r behinderten Arbeitsuchenden einen für ihn/sie geeigneten Arbeitsplatz zu finden, bzw. einen solchen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, ihn/sie dort bei der Qualifizierung zu unterstützen und alles dazu beizutragen, daß dieser Arbeitsplatz dauerhaft gehalten werden kann. Im einzelnen sieht das so aus:
Schema des Integrationsverlaufs
-
Bewerbungsverfahren: Erarbeitung eines Fähigkeitsprofils
-
Akquisition eines geeigneten Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt
-
Vorbereitung der Arbeitsaufnahme: Modifikationen am Arbeitsplatz, Vorbereitung der betrieblichen Mitarbeiter und des/r behinderten ArbeitnehmerIn
-
Qualifizierung und Begleitung am Arbeitsplatz
-
Langfristige Nachbetreuung/Krisenintervention
Z. Zt. kommen ca. 70 % der Personen, die das Unterstützungsangebot der Hamburger Arbeitsassistenz in Anspruch nehmen wollen, aus den WfBs oder waren früher einmal MitarbeiterIn einer WfB.
Die BewerberInnen kommen überwiegend aus dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung. Sie sind sicherlich diejenigen, die die geringsten Chancen haben, auf dem regulären Arbeitsmarkt Beschäftigung zu finden.
Das Ziel des Bewerbungsverfahrens ist die Ermittlung eines individuellen Interessen- und Fähigkeitsprofils des/r Arbeitsuchenden, welches die unverzichtbare Ausgangsbasis für die Identifizierung eines geeigneten Arbeitsplatzes sowie der dann dort ansetzenden Qualifizierungsmaßnahmen darstellt. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß es sich um Personen handelt, die in der Regel über keinerlei Erfahrungen mit einer regulären Beschäftigung haben, sondern fast ausschließlich Arbeitsplätze in der Werkstatt für Behinderte kennen. Somit ist neben der Erstellung des individuellen Fähigkeitsprofils die Orientierung hinsichtlich möglicher Tätigkeiten und deren Anforderungen zentrale Aufgabe dieser Phase.
Das Fähigkeitsprofil wird überwiegend mittels Gespräche mit den BewerberInnen selbst, deren Angehörigen, den Pädagogen aus dem Betreuten Wohnen, den WfB, etc. erstellt. Daneben werden kurzzeitige Arbeitserprobungen durchgeführt.
Bemühungen um die berufliche Integration Behinderter auf dem regulären Arbeitsmarkt müssen sich zwangsläufig mit den Strukturen und Gesetzmäßigkeiten des Systems "der sozialen Marktwirtschaft" als bestimmende Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik auseinandersetzen. Der Anspruch, dem einzelnen Menschen in "seiner ganzheitlichen Individualität und Entwicklungsmöglichkeit, seiner Lernfähigkeit und Motivierbarkeit" im Rahmen eines befriedigenden Arbeitslebens Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, ist schnell mit dem Prinzip der unternehmerischen Vertragsfreiheit und vor allen Dingen mit betriebswirtschaftlichem Optimierungsdenken konfrontiert.
Die Erfahrungen der Akquisitionspraxis der Hamburger Arbeitsarbeitsassistenz bestätigen zwar die abstrakten Gesetzmäßigkeiten von Privatwirtschaft und Markt als handlungsleitende Maxime des am Markt konkurrierenden Unternehmers - und potentiellen Arbeitgebers für behinderte ArbeitnehmerInnen. Trotzdem - und auch das zeigen die Erfahrungen der Integrationsbemühungen - handelt es sich nicht um unüberwindbare Barrieren.
Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen im Umgang mit UnternehmerInnen, bzw. den entsprechenden Personalleitungen im Rahmen der Arbeitsplatzakquisition:
In Berücksichtigung der das unternehmerische Denken und Handeln bestimmenden Maximen wird die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Beschäftigung eines/r schwerbehinderten Arbeitnehmers/in herausgestellt. Es wird deutlich gemacht, daß mit einer entsprechenden Unterstützung und Förderung die vermeintlichen betriebswirtschaftlichen Nachteile kompensiert werden können:
-
das Unternehmen stellt eine zwar leistungsgeminderte, dafür aber zuverlässige und motivierte Arbeitnehmerin ein;
-
durch die Aktivitäten der Arbeitsassistenz ist weitgehend gewährleistet, daß ein Arbeitsplatz von einem/r dafür geeigneten ArbeitnehmerIn besetzt wird;
-
die angebotene Arbeitsplatz(um)gestaltung erhöht die betriebswirtschaftliche Effektivität;
-
die Einarbeitung am Arbeitsplatz wird durch die Hamburger Arbeitsassistenz übernommen und entlastet betriebliches Personal;
-
Unternehmen können auf ein vorteilhaftes öffentliches Image nicht mehr verzichten, das Engagement "für" Behinderte gehört dazu;
-
die geforderte Rücksichtnahme auf Leistungsschwächere trägt auch allgemein zur Verbesserung des betrieblichen Klimas bei;
-
es wird langfristig und verbindlich Unterstützung bei der Lösung von Problemen angeboten;
-
dem Unternehmen wird die Möglichkeit geboten, den sozialen und gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen ("Beschäftigungspflicht").
Auch UnternehmerInnen haben eine "soziale Einstellung". Das Akquisitionsbemühen zielt durch ein glaubhaftes Engagement auch auf die soziale Verpflichtung der Gesellschaft im allgemeinen wie des/r Unternehmers/in im besonderen gegenüber Menschen mit Behinderungen ab. Soziales Engagement darf allerdings nicht zu Mitleid und Fürsorge verkommen, die langfristige Perspektive von Integrationsarbeit liegt in der Veränderung industrieller Arbeitswelt, der sie beherrschenden leistungs- und gesundheitsorientierten Werte und Normen.
Die Akquisitionstätigkeit im einzelnen
Es überrascht nicht, daß gerade in den Branchen erfolgreich akquiriert wird, in denen nach wie vor ein großes Angebot an maschinell nicht so schnell zu ersetzenden einfachen Hilfstätigkeiten besteht. Darüberhinaus ist in diesen Betrieben die Personalsituation durch große Fluktuation gekennzeichnet, woraus ein gewisses Interesse des Arbeitgebers an stabilen, zuverlässigen ArbeitnehmerInnen, die u. U. auch nicht ganz so leistungsstark zu sein brauchen, erwächst. Diese Arbeitsplätze liegen im überwiegenden Teil im Dienstleistungsbereich und im Handel.
Die Akquisition von Arbeitsplätzen ist vor allen Dingen in kleineren Betrieben erfolgreich.
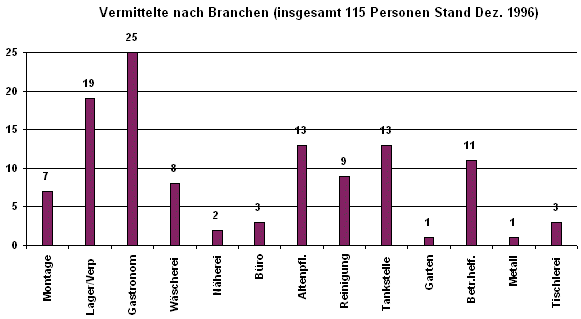
Akquisitionsbemühungen um Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger Behinderung stoßen auf eine Reihe immer wiederkehrender Vorurteile, Bedenken und Befürchtungen auf Arbeitgeberseite:
-
Geistig behinderte Menschen entsprechen nicht den Flexibilitätsanforderungen am Arbeitsplatz;
-
es fehlt die erforderliche Qualifikation/Vorerfahrung für einen bestimmten Arbeitsplatz;
-
geistig behinderte ArbeitnehmerInnen erfüllen nicht die Leistungsnorm;
-
die erforderliche Selbständigkeit wird ihnen nicht zugetraut;
-
die langfristige Beschäftigungsverpflichtung, schmerzlich vor allem nach Wegfall des dreijährigen Lohnkostenzuschusses durch das Arbeitsamt;
-
der "rauhe Umgangston" im Betrieb macht eine Integration schwer;
-
der besondere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte.
Eine diffuse Mischung aus Vorurteilen und realen Bedenken macht die mangelnde Vorerfahrung und Kenntnis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung nur allzu deutlich. Der Begriff "Behinderung" wird zunächst oft spontan assoziiert mit der Angewiesenheit auf einen Rollstuhl, der Begriff "geistige Behinderung" mit Unberechenbarkeit des Verhaltens und allgemeiner Orientierungslosigkeit. Der Zusammenhang zwischen der sozialen Isolation von Menschen mit Behinderung und Vorurteilsbildung mit daraus resultierenden subjektiven Einstellungshemmnissen in Betrieben ist offensichtlich.
An dieser Stelle setzt die Überzeugungsarbeit der MitarbeiterInnen der Hamburger Arbeitsassistenz an. Diese besteht zum einen in einer allgemeinen "Entmystifizierung" und "Entdramatisierung" hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit und "Eigenheiten" von Menschen mit geistiger Behinderung, zum zweiten darüberhinaus aber im glaubwürdigen Angebot der besonderen Unterstützungsleistungen durch das Instrumentarium der Hamburger Arbeitsassistenz.
Ein sichtlicher Erfolg praktischer Überzeugungsarbeit ist der Umstand, daß mittlerweile in mehreren Betrieben der Arbeitgeber sich dazu entschlossen hat, weitere Einstellungen von ArbeitnehmerInnen mit Behinderung vorzunehmen.
Arbeitsplatzanalyse
Besteht eine grundsätzliche Bereitschaft seitens des Unternehmens, eine Person mit Behinderung einzustellen, wird zunächst der in Frage kommende Arbeitsplatz/Arbeitsvorgang durch eine/n Arbeitsassistenten/in des Fachdienstes analysiert und in Hinblick auf bestimmte behinderte ArbeitnehmerInnen bewertet. Die Analyse des betrieblichen Arbeitsplatzes kann im Prozeß der individuellen Arbeitsvermittlung als das Gegenstück zur Erarbeitung eines individuellen Fähigkeitsprofils angesehen werden. Die Überprüfung/Ab-gleichung des Fähigkeitsprofils mit dem Arbeitsplatzprofil ist daher die Grundlage für die Vermittlungsentscheidung.
Vor allen Dingen in kleineren Betrieben kommt es häufiger vor, daß vorher nicht existente Arbeitsplätze für den/die zu beschäftigende Arbeitnehmer/in erst geschaffen werden, dadurch daß zuvor auf mehrere Arbeitnehmer verteilte einfachere Tätigkeiten zu einem vollgültigen Arbeitsplatz neu gebündelt werden.
Die Erfahrung zeigt, daß in der Regel sowohl vom Fachdienst als auch von der Firma die Fähigkeiten der behinderten Arbeitnehmer unterschätzt wurden (bzw. ungeahnte Fähigkeitspotentiale im Rahmen des Integrationsprozesses aktiviert worden sind). Meist führt diese erfreuliche Erkenntnis dazu, daß schon nach kürzester Zeit Zuständigkeitsbereich und Eigenverantwortlichkeit im Betrieb erweitert werden.
Qualifizierung am Arbeitsplatz
Die intensive und individuelle Einarbeitung und Betreuung des/der Behinderten am Arbeitsplatz durch eine/n Arbeitsassistent/in ist Kernstück in Konzept und Tätigkeit der Hamburger Arbeitsassistenz. Dauer und Intensität hängen von den individuellen Anforderungen des/r behinderten Arbeitnehmers/in, des Arbeitsplatzes und den Bedürfnissen des Arbeitgebers ab. Allerdings hat der Kostenträger Hauptfürsorgestelle Obergrenzen sowohl hinsichtlich der Dauer als auch der Stundenanzahl gesetzt. Derzeitig darf der Fachdienst höchstens zwei Jahre und höchstens 205 Stunden im Jahr ein Arbeitsverhältnis unterstützen, wobei in individuell zu begründenden Fällen diese Grenzen überschritten werden dürfen.
Das Gesamtfeld beruflicher Qualifikation am Arbeitsplatz setzt sich aus verschiedenen Einzelqualifizierungsinhalten zusammen:
-
Das selbständige Erreichen und Verlassen des Arbeitsplatzes.
-
Die räumliche Orientierung im Betrieb, d. h. das sichere Sich-Bewegen-Können in den verschiedenen räumlichen Bereichen: Arbeitsplatz, Kantine, Pausenraum, sanitäre Einrichtungen, Verwaltung, etc..
-
Die zeitliche Orientierung, d. h. pünktlicher Arbeitsantritt, Einhalten der Pausen, Arbeitsende, Verständnis von Arbeitsabläufen entwickeln.
-
Das Erlernen der konkreten Arbeitstätigkeit
-
Das Erlernen sozialer Kompetenzen: Kritik erfahren und leisten können, Interessen formulieren bzw. akzeptieren können, Fragen stellen können, sich selbst zu helfen lernen; ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz erreichen, mit den betrieblichen KollegInnen kommunizieren lernen, etc.
-
Das Erlernen von sogenannten Schlüsselqualifikationen wie Flexibilität, selbständiges Arbeiten, Problemlösungsfähigkeiten, etc.
-
Ein realitätsbezogenes Verständnis von Arbeit entwickeln, sich der eigenen Motivation versichern.
-
Letztlich auch die Vermittlung von Kommunikationsfähigkeiten bei den nicht-behinderten ArbeitskollegInnen.
Die Qualifikation in diesen Bereichen wird von Arbeitsassistenten/innen der Hamburger Arbeitsassistenz übernommen, wobei in der Regel zwei Arbeitsassistenten/innen, die sich abwechseln, im Rahmen eines "Patensystems" jeweils für ein Unterstütztes Beschäftigungsverhältnis verantwortlich sind.
Wie die Qualifizierungstätigkeit des/r Arbeitsassistenten/in im einzelnen aussieht, ist sehr individuell von der zu betreuenden Person, dem einzelnen Arbeitsplatz, von ganz individuellen Umständen abhängig:
Ist es in einem Fall notwendig, sehr intensiv auf der Basis eines zuvor erarbeiteten Qualifizierungsplans beispielsweise mit Handführung einzelne Arbeitsfertigkeiten zu vermitteln und zu üben, so mag es in einem anderen Fall genügen, in der Anfangszeit des Arbeitsverhältnisses lediglich anwesend zu sein, um dem/r behinderten ArbeitnehmerIn fürs erste etwas Sicherheit zu vermitteln.
Das Arbeitsfeld stellt hohe Anforderung an die Person und Arbeit des/der Arbeitsassistenten/in, da der gesamte Qualifizierungsprozeß unter den Bedingungen realer Arbeitswelt und eines regulären Beschäftigungsverhältnis durchgeführt wird.
In der Praxis wurde deutlich, daß die wesentlichen Anteile am Qualifizierungsprozeß weniger in der Vermittlung der reinen Tätigkeitsfertigkeiten liegen. Vielfach liegt die größere Herausforderung in der Förderung sozialer Kompetenzen und angemessenen Verhaltensweisen auf beiden Seiten: die des/der einzugliedernden ArbeitnehmerIn und - ebenso wichtig - die der betrieblichen KollegInnen und Vorgesetzten, die ebenfalls qualifiziert werden müssen.
Die ArbeitsassistentInnen beziehen ihr Unterstützungsangebot nicht auf die ArbeitnehmerInnen mit Behinderung allein, sondern müssen intensiv auch mit den ArbeitskollegInnen zusammenarbeiten, um den kollegialen Umgang mit der/m neuen ArbeitnehmerIn zu erleichtern.
Arbeitsassistenten/innen sind in ihrer Tätigkeit auch stark gefordert, in dem gesamtbetrieblichen Arbeitsprozeß mögliche "Nischen" zu erkennen, die in den bestehenden Arbeitsplatz des/der behinderten ArbeitnehmerIn miteinbezogen werden können, zumal die Erfahrung zeigt, daß im Zuge der Einarbeitung bis dahin unerkannte Fähigkeitspotentiale bei dem/der Behinderten freigesetzt werden. Die im Vorfeld der Vermittlung geleistete Anpassung zwischen Arbeitsplatz- und individuellem Fähigkeitsprofil erweist sich im weiteren Verlauf als ein dynamischer Prozeß und bedarf in der Regel insofern einer Überprüfung und partiellen Veränderung. Dazu gehört die Steuerung steigender betrieblicher Erwartungen.
Die Dauer der beruflichen Qualifizierung am Arbeitsplatz ist auf die jeweiligen Voraussetzungen des/r Arbeitnehmers/in und des Arbeitsplatzes abgestimmt. D. h. es gibt über eine grobe Einteilung von Lernphasen (Orientierung - Qualifizierung - Stabilisierung) hinaus kein standardisiertes Curriculum, keine vorpräparierten Lernmodule, die in jeder Lernsituation Anwendung finden würden - diese werden für den konkreten Einzelfall entwickelt und stehen in permanenter Praxisbeziehung.
Davon wird der Unterstützungsbedarf abhängig gemacht. In den ersten Wochen steht der/die Arbeitsassistent/in dem/r behinderten ArbeitnehmerIn während des gesamten Arbeitstages zu Seite. Im Zuge der Verselbständigung des/r Arbeitnehmers/in reduziert der/die Arbeitsassistent/in sein/ihre zeitliche Anwesenheit - kommt nur noch während des halben Arbeitstages in die Firma oder nur zwei Tage die Woche, schließlich reduziert sich die Betreuung auf gelegentliche Besuche oder Telefongespräche. Der Kontakt sowohl zum/r Arbeitnehmer/In als auch zur Firma reißt jedoch nicht ab. Insbesondere die emotionale Stützung ist auch langfristig für den/die behinderte ArbeitnehmerIn von Bedeutung. Wie bereits oben erwähnt, enden die Möglichkeiten Hamburger Arbeitsassistenz, ein Beschäftigungsverhältnis zu unterstützen auf Grund der Auflagen des Kostenträgers Hauptfürsorgestelle nach zwei Jahren (in begründeten Einzelfällen kann auch länger begleitet werden). Nach diesen zwei Jahren geht die Begleitungsaufgabe an den arbeitsbegleitenden Dienst der Hauptfürsorgestelle über, der allerdings nur auf Grund geringer Kapazitäten bestenfalls einen nur gelegentlichen Kontakt zum Betrieb aufrecht erhalten kann.
In der Regel wird jedem Beschäftigungsverhältnis ein mehrwöchiges Praktikum vorweg geschaltet, in dieser Phase bleiben die Personen Angehörige der WfB. Dem zukünftigen Arbeitgeber wird mit dieser Verfahrensweise eine zusätzliche Sicherheit geboten, im Falle der Nichteignung ohne große Schwierigkeiten wieder aussteigen zu können (eher als Überzeugungsinstrument gedacht). Auch der/die zukünftige ArbeitnehmerIn erhält somit einen Entscheidungsspielraum. Nach der Praktikumsphase wird - wenn das Praktikum zu aller Zufriedenheit verlaufen ist - ein gültiger (ortsüblich oder tariflich entlohnter) Arbeitsvertrag geschlossen, der in der Regel unbefristet ist.
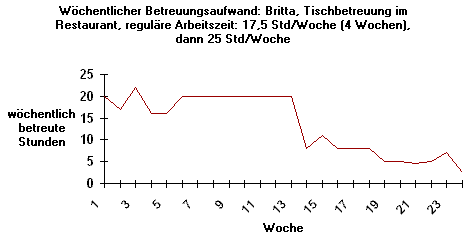
Im Zuge der Tätigkeit der Hamburger Arbeitsassistenz erweist sich die langfristige Stabilisierung der/s Arbeitnehmers/in mit Behinderung als bedeutsamer Arbeitsschwerpunkt des Fachdienstes. Nur wenige Arbeitsverhältnisse sind sogenannte Selbstläufer, bei denen nur hin und wieder ein Telefongespräch geführt wird, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. In der Mehrzahl der Betreuungsverhältnisse stehen auch über einen längeren Zeitraum mehr oder weniger intensive Interventionen seitens des/r Arbeitsassistenten/in auf der Tagesordnung. Zuvor nicht erwartete Schwierigkeiten können u.U. sogar das gesamte Arbeitsverhältnis gefährden:
-
Ist die erste Euphorie, endlich einen Arbeitsplatz "draußen" gefunden zu haben, verflogen, stellt sich häufig Ernüchterung ein: Ungewohnte Leistungsanforderungen, Streß mit KollegInnen, etc. können Anlaß geben, im Arbeitseifer nachzulassen, unpünktlich und krank zu werden, usw., was wiederum die Auseinandersetzungen im Betrieb verschärft.
-
Die "Nestwärme" der WfB mit ihren überschaubaren Strukturen, ihren größeren Freiräumen und sozialen Beziehungen gewinnt eine neue Attraktivität.
-
Es stellt sich heraus, daß das eigentliche Problem weniger im Bereich der Qualifikationsanforderungen als vielmehr in handfesten bis dato unerkannten psychischen Schwierigkeiten, u.U. durch die Arbeitssituation verschärft, liegt. Nicht selten werden diese Schwierigkeiten durch die ungewohnte Arbeitssituation auf dem ersten Arbeitsmarkt hervorgerufen.
Um diese und andere Probleme - z. B. eine Veränderung der Arbeitstätigkeit - im Sinne des Arbeitsplatzerhalts angemessen und vor allen Dingen rechtzeitig vor einer krisenhaften Zuspitzung bearbeiten zu können, stehen die MitarbeiterInnen der Hamburger Arbeitsassistenz auch nach der Phase der intensiven Begleitung im regelmäßigen Kontakt mit den am Integrationsprozeß Beteiligten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß es unerläßlich ist, diesen Kontakt aktiv zu pflegen. Es ist nicht immer davon auszugehen, daß Arbeitgeber, KollegInnen oder der/die ArbeitnehmerIn mit Behinderung jeweils selbst die Initiative in einem Problemfall ergreifen.
In der langfristigen Nachsorge erweist sich die Zusammenarbeit mit Personen des sozialen Umfeldes als besonders wichtig. Im kontinuierlichen Austausch mit den BetreuerInnen aus dem Wohnbereich und den Eltern lassen sich aufkommende Schwierigkeiten frühzeitig ausmachen und entsprechend begegnen.
Bis jetzt (Dezember 1996) sind von der Hamburger Arbeitsassistenz 166 Unterstützte Praktika eingerichtet worden. Aus den 166 Praktika sind 116 reguläre Beschäftigungsverhältnisse hervorgegangen.
Bisher gab es für SchulabgängerInnen aus den Sonderschulen und Integrationsklassen nur begrenzte Möglichkeiten, außerhalb des Arbeitstrainings in den Werkstätten für Behinderte eine berufliche Erstausbildung zu erhalten. Auch war der Weg aus dem Eingangs- und Arbeitstrainingsbereich in den Produktionsbereich der WfB in der Regel alternativlos vorgezeichnet.
Die Hamburger Arbeitsassistenz hatte in ihrem bisherigen Schwerpunkt fast ausschließlich Personen unterstützt, die bereits längere Zeit in einer WfB gearbeitet hatten. Für den Personenkreis der SchulabgängerInnen sind diese Angebote des Fachdienstes häufig nicht angemessen. Für viele junge Menschen ist das Angebot eines regulären Beschäftigungsverhältnis im unmittelbaren Anschluß an die Schule verfrüht. Sie benötigen zunächst eine Phase der beruflichen Orientierung, der praxisbezogenen Vorbereitung auf das Arbeitsleben und der Qualifizierung.
Seit Beginn des Jahres 1996 ist die Hamburger Arbeitsassistenz in der Lage, ein entsprechendes Angebot zu machen - das Ambulante Arbeitstraining:
In einer maximal zweijährigen Maßnahme wird den jugendlichen SchulabgängerInnen aus den Sonderschulen und Integrationsklassen eine berufliche Orientierung und Vorbereitung sowie eine branchenspezifische Qualifizierung vermittelt. Kernstück der Maßnahme sind fachlich strukturierte Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Wie bereits in unterstützten Beschäftigungsverhältnissen werden die PraktikantInnen am betrieblichen Arbeitsplatz nach den individuellen Erfordernissen durch Arbeitsassistenten/innen des Fachdienstes unterstützt und qualifiziert. Grundlage der Praktikumsverläufe sind individuelle Qualifizierungspläne, die sich an den Berufsbildern der entsprechenden Branchen orientieren, ohne die in den entsprechenden Ausbildungsverordnungen vorgegebenen Leistungsstandards zu übernehmen, da diese in der Regel die Möglichkeiten des beschriebenen Personenkreises weit überschreiten. Alle Praktikumsverläufe werden dokumentiert und zertifiziert, so daß einem potentiellem Arbeitgeber sehr konkret vermittelt werden kann, über welche beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen ein Bewerber mit Behinderung verfügt. Es ist davon auszugehen, daß die Eingliederungschancen durch diese betriebsnahe Maßnahme erheblich erhöht werden.
Flankiert werden diese Praktika durch Phasen der psycho-sozialen Betreuung und berufsschulischer Maßnahmen. Auch hinsichtlich der Berufsschule werden neue Wege beschritten: Anders als im herkömmlichen berufsschulischen Unterricht finden sich die Qualifizierungsbereiche der jeweiligen Praktikumsorte im Berufsschulunterricht des Ambulanten Arbeitstraining wieder; Berufsschul-lehrerInnen gehen in die Praktikumsbetriebe ebenso wie die Arbeitsassistenten/innen in die Berufsschule gehen.
Grundlage dieser Maßnahme sind Vereinbarungen zwischen der Hamburger Arbeitsassistenz und den Hamburger Werkstätten sowie der Arbeitsverwaltung:
TeilnehmerInnen an der Maßnahme "Ambulantes Arbeitstraining" werden zunächst von der Berufsberatung des Arbeitsamtes an eine der Hamburger WfB als Teilnehmer des regulären Arbeitstrainings der WfB verwiesen, allerdings mit der Maßgabe "möglicher Teilnehmer für das Ambulante Arbeitstraining". D. h. diese/r Jugendliche erhält den offiziellen Status eines WfB-AT-Mitarbeiters mit allen sozialen Absicherungen, ohne aber u. U. eine WfB je von innen gesehen haben zu müssen, weil er/sie unmittelbar in die Maßnahme Ambulantes Arbeitstraining der Hamburger Arbeitsassistenz geht. Möglich ist auch die Teilnahme am Ambulanten Arbeitstraining von Personen, die sich bereits in einem AT der WfB befinden, aber die restliche Zeit ihres ATs als Ambulantes AT durchführen möchten (max. 2 Jahre). Sollte nach Absolvierung des Ambulanten ATs sich nicht unmittelbar ein unterstütztes Beschäftigungsverhältnis anschließen, ist es durchaus möglich, in den Produktionsbereich der WfB zu gehen, wenn der Teilnehmer dieses wünscht.
Finanziert wird das Ambulante Arbeitstraining über den Tageskostensatz, den das Arbeitsamt an die zuständige WfB zahlt und von dort unter Abzug einer Verwaltungspauschale an die Hamburger Arbeitsassistenz weitergeleitet wird.
Pro Jahr werden zunächst 12 Personen an dieser Maßnahme teilnehmen. Es ist geplant, die Zahl in den folgenden Jahren auszudehnen.
In den ersten drei Jahren war der Fachdienst im Rahmen eines Modellprojektes zu 45% aus Mitteln des Europäischen Sozialfond-Programms HORIZON und zu 55% aus Mitteln der Ausgleichsabgabe der Hauptfürsorgestelle Hamburg finanziert.
Nach Beendigung der erfolgreichen Modellphase gehört die Hamburger Arbeitsassistenz seit Januar 1995 zum Regelangebot in der Hamburgischen Rehabilitationslandschaft.
Folgende Kostenträger finanzieren derzeitig die Angebote des Fachdienstes:
-
die Kosten im Übergang von der WfB bis zum Abschluß eines Arbeitsvertrages im Rahmen eines Praktikums von max. sechsmonatiger Dauer werden vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales) nach dem Bundessozialhilfegesetz als Eingliederungshilfe §39/40 erstattet. Während dieses Praktikums bleibt der/die Praktikant/in Mitarbeiter/in der WfB. Grundlage sind mit den WfB geschlossene Kooperationsverträge.
-
Die Unterstützungsleistungen des Fachdienstes nach Abschluß eines Arbeitsvertrages werden aus Mitteln der Ausgleichsabgabe auf der Grundlage des Schwerbehindertengesetzes §31 in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenver-ordnung §27 in Form von stundenbezogener Einzelfallabrechnung geleisteter Arbeitsbegleitung finanziert. Die Hauptfürsorgestelle begrenzt die Unterstützungsdauer auf zwei Jahre und 205 Stunden pro Jahr. In einzelnen Fällen können individuell begründet Unterstützungsdauer und -intensität erweitert werden.
-
Die Leistungen des Fachdienstes im Rahmen des Ambulanten Arbeitstrainings werden vom Arbeitsamt (in manchen Fällen von den Rentenversicherungsträgern) auf der Grundlage des § 54 AFG/A-Reha in Verbindung mit der Werkstättenverordnung (analog zum Arbeitstrainingsbereich in den WfB) finanziert. Grundlage sind mit den Hamburger WfB geschlossene Kooperationsverträge.
Mittlerweile hat Konzept und Arbeitsweise der Unterstützten Beschäftigung Eingang in die bundesdeutsche Rehabilitationslandschaft gefunden. Derzeitig (Dezember 1996) arbeiten ca. 100 Fachdienste der beruflichen Eingliederung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Mehrzahl davon ist in den letzten zwei Jahren vorwiegend mit Unterstützung der jeweiligen Hauptfürsorgestelle ins Leben gerufen worden.
Hamburger Arbeitsassistenz, Fuhlsbüttlerstr. 402, 22309 Hamburg
Tel.: 040-63254-94/95, Fax: 040-63254-96
Inhaltsverzeichnis
Ingrid Maulwurf, Mitarbeiterin des Rauhen Hauses, Leiterin des Bereichs Arbeit und Kultur
In der Abteilung werden z. Zt. 280 Menschen in unterschiedlichen Wohn- und Lebensformen ambulant oder stationär betreut. Mit dem Bereich der beruflichen Rehabilitation hat das Rauhe Haus 1993 Neuland betreten. Notwendig wurde dieser Schritt dadurch, daß es im Rauhen Haus stationär betreute Menschen gab, die den Besuch einer Behindertenwerkstatt verweigerten. Vor allem gab es jedoch Probleme mit einem autistischen jungen Mann, der aufgrund seiner Verhaltensweisen in allen Hamburger Werkstätten Arbeitsverbot bekam. Auf der Suche nach Alternativen stellte sich schnell heraus, daß es für diese Menschen keine gab.
Während zunehmend versucht wird, durch ein Angebot an integrierten Wohn- und Lebensformen für Menschen mit Behinderungen wieder kulturelle Zusammenhänge herzustellen, in denen sie als Subjekte kommunikativ handeln und mit den Bedingungen unserer Gesellschaft in Berührung kommen könnten, werden sie aus dem Produktionsprozeß nach wie vor verdrängt. Damit werden sie aus einem zentralen Lebensbereich ausgegrenzt, Arbeiten findet in eigens zu diesem Zwecke konstruierten Welten, z. B. in Behindertenwerkstätten statt. Durch die solchen Sonderwelten eigenen isolierenden Bedingungen wird das Anderssein der in ihnen lebenden bzw. arbeitenden Menschen festgeschrieben.
All dies findet seinen Niederschlag im professionellen Handeln. Soziale und interkulturelle Probleme wurden reduziert auf vorhandene Defizite behinderter Menschen, die es mit Hilfe optimaler Förderung zu beheben oder zumindest soweit wie möglich zu reduzieren galt. Dies alles innerhalb eines geschützten Rahmens, in dem der behinderte Mensch vermeintlich optimale Entwicklungschancen erhalten sollte. Soziale Arbeit sollte in erster Linie dem behinderten Menschen dabei helfen, weniger behindert zu werden.
In den letzten Jahren hat es jedoch zunehmend andere Strömungen innerhalb der Behindertenhilfe gegeben, die mit emanzipatorischen Ansätzen versuchten, behinderte Menschen darin zu unterstützen, zu Subjekten in lebensweltlichen Konstrukten zu werden und darüber hinaus die Möglichkeit zu erhalten, selbst in die Konstruktion von Lebenswelten einzugreifen. Dieser Zugewinn an Autonomie ist für den behinderten Menschen gleichzeitig mit einem großen Verlust an Sicherheit verbunden - im Lebens- und im Arbeitsbereich. Der Widerspruch zwischen der Sicherheit der Versorgung und dem Risiko der Emanzipation ist längst nicht aufgelöst und wird uns noch lange beschäftigen. Dafür sorgt schon die immer größer werdende Anzahl von Menschen mit Behinderungen, die ihr Recht auf autonome Lebenswelten einfordern - so wie es der eingangs beschriebene junge Mann in der WfB auf sehr unbequeme Art und Weise auch getan hat. Mit welchem Hintergrund, welchem Selbstverständnis arbeiten wir nun in der individuellen Arbeitsbegleitung?
In einem Aufsatz in der neuen Praxis Sozialarbeit definiert Burghard Müller Sozialarbeit als die "Kunst, mit Fremden zu leben und anderen behilflich zu sein". Behinderte Menschen gehören als Adressaten sozialer Arbeit zu denen, die "anders" sind, Anderssein impliziert Fremdheit.
Als Professionelle mit ihnen zu leben, bzw. zu arbeiten, ist ein Teil der Kunst im Sinne von Können und Intuition. Als Professionelle versuchen wir, sie in ihrer Autonomie zu stärken und ihren Prozeß der Emanzipation zu unterstützen. Wir unterstellen ihnen Kompetenzen und versuchen, ihre Lebenswelten auf der Grundlage der vorhandenen Bedürfnisse und Ressourcen zu beschreiben und uns mit ihrer Realität auseinanderzusetzen. Vor allem gestehen wir ihnen das Recht zu, so zu sein, wie sie sind.
Dies ist jedoch nur ein Teil unserer Professionalität. Der andere erscheint mir mindestens genau so wichtig. Anderen dabei behilflich zu sein, mit Fremden zu leben. Dies schließt den Teil unserer Professionalität ein, in dem es um die Interaktionen, Konflikte, Arrangements mit denen geht, die zu den vermeintlich nicht Behinderten gehören.
Die Kunst im beschriebene Sinne wäre es, in einem wechselseitigen Prozeß miteinander zurechtzukommen, tragbare Kompromisse auszuhandeln zwischen verschiedenen Lebenswelten und sich über Normen und Werte zu verständigen. Diese Aufgabe sozialer Arbeit nennt B. Müller die Politik der wechselseitigen Bezugnahme sozialer Gruppen.
Auf unsere Arbeit im Rauhen Haus übertragen bedeutet das, daß wir unsere Aufgaben u. a. in dem Versuch sehen, zwischen sich fremden, Prozesse der gegenseitigen Verständigung, des Aushandelns von gemeinsamen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu initiieren, zu unterstützen und zu begleiten. Konsequenterweise kann diese Wechselseitigkeit jedoch nur außerhalb von Sondereinrichtungen und Sondermaßnahmen, in lebensweltlichen Zusammenhängen stattfinden, in denen Begegnung und Auseinandersetzung möglich ist und Fremdheit dadurch - wenn auch nicht überwunden - so doch weniger beängstigend und lebensbedrohlich erlebt werden kann. Dem Bereich der Arbeit kommt dabei zentrale Bedeutung zu.
Mit dem Ansatz der individuellen Arbeitsbegleitung versuchen wir, die von mir beschriebenen Prozesse außerhalb von Sondereinrichtungen zu initiieren und zu begleiten.
Adressaten der Arbeitsbegleitung sind 40 Menschen mit geistiger und/oder seelischer Behinderung, die den Werkstattbesuch verweigern oder aufgrund ihrer Verhaltensweisen dort nicht tragbar sind. In der Regel sind dies Menschen, die durchaus in der Lage sind, produktive Arbeit zu leisten, sich jedoch dem von einer WfB vorgegebenen Rahmen häufig nicht anpassen können oder wollen.
Rechtsgrundlage sind die §§ 39, 40 BSHG, insbesondere § 40 Abs. 2, in dem Behinderte, die "wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung" für arbeits- und berufsfördernde Maßnahmen nach Absatz 1 mit dem Ziel der Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen. Diesen Menschen soll "nach Möglichkeit Gelegenheit zur Ausübung einer der Behinderung entsprechenden Beschäftigung, insbesondere in einer Werkstatt für Behinderte gegeben werden."
Die individuelle Arbeitsbegleitung ist eine über einen Tageskostensatz finanzierte teilstationäre Maßnahme. Ab 1996 sollen die Leistungen der Arbeitsbegleitung individuell und flexibel über Fachleistungsstunden abgerechnet werden.
Für den Personenkreis, für den es keine oder nur sehr begrenzte Möglichkeit gibt, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu tariflichen Bedingungen eingegliedert zu werden, versteht sich die Arbeitsbegleitung als niedrigschwellige und kostenneutrale Alternative zur WfB.
Mit der Schaffung von individuellen, überschaubaren und dezentralen Arbeitsmöglichkeiten, die in das gesellschaftliche Umfeld integriert sind, wird bewußt auf die Vorhaltung eines stark formalisierten Rahmens verzichtet. Die dadurch erzielten Einsparungen können in die Arbeitsbegleitung fließen, so daß - trotz eines Personalschlüssels von 1:4 - die Kosten für einen Werkstattplatz nicht überschritten werden müssen.
Gleichzeitig ermöglicht diese Art der Organisation ein hohes Maß an Flexibilität. Nicht der behinderte Mensch muß sich an vorhandene Strukturen anpassen, sondern diese sollten sich vielmehr seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend verändern, bzw. neu geschaffen werden.
Ziel ist es, für den o. g. Personenkreis einen der Leistung entsprechend bezahlten Arbeitsplatz in einer sozial integrierten Arbeitsumgebung zu schaffen, bzw. zu finden. Neben Einzelarbeitsplätzen können dies auch Kleingruppen von bis zu 4 Personen sein.
Unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Möglichkeiten, Interessen und Neigungen des behinderten Menschen soll unter größtmöglicher Bezogenheit auf die Normalität ein objektives Teilhaben am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Subjektiv soll der behinderte Mensch durch eine Erweiterung seiner Handlungskompetenz zu mehr Autonomie und Selbstverwirklichung gelangen können.
Dementsprechend müssen die Rahmenbedingungen der Arbeit so beschaffen sein, daß sie sozialen Austausch, Kommunikation und Weiterentwicklung ermöglichen.
Mit einem Personalschlüssel von 1:4 stehen dem behinderten Menschen pädagogisch und/oder handwerklich qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. Unter Einbeziehung des sozialen Netzwerkes und unter Berücksichtigung der schulischen und beruflichen Vorerfahrungen macht sich der Arbeitsbegleiter ein differenziertes Bild von der Persönlichkeit des Teilnehmers und gestaltet den Kontakt so, daß eine Auseinandersetzung über die Bedingungen und Strukturen des zukünftigen Arbeitsplatzes stattfinden kann. Es wird ein Profil erarbeitet, das die Bedürfnisse und Vorstellungen des Teilnehmers berücksichtigt und seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Einschränkungen entsprechend potentielle Arbeitsfelder herausarbeitet.
Im nächsten Schritt geht es um die praktischen Erfahrungen, die durch Hospitationen, Praktika oder durch gemeinschaftliches Arbeiten in Form von kleinen Produktionsgemeinschaften oder Arbeitsprojekten gesammelt werden. Die Arbeitsbegleitung sieht ihre Aufgabe auch in der Vernetzung mit Schule, Ausbildung, Maßnahmen nach dem AfG, Fachdiensten und anderen Reha-Maßnahmen.
Die im Verlauf der praktischen Arbeit gewonnenen Erfahrungen werden im Anschluß aufgearbeitet, Erwartungen und Wünsche des Teilnehmers mit der Realität abgeglichen, so daß ein realistisches Bild der Möglichkeiten und Grenzen eines zukünftigen Arbeitsplatzes entsteht. Hat sich herausgestellt, daß der Teilnehmer auf einem geschützten oder teilgeschützten Arbeitsplatz arbeiten möchte, bieten sich kleine Produktionsgemeinschaften oder Arbeitsprojekte als dauerhaft begleitete Arbeitsmöglichkeit an.
Ist dies nicht der Fall, wird die Eingliederung vorbereitet, indem ein Arbeitgeber gesucht wird, der dem Leistungsvermögen und der Persönlichkeit des Teilnehmers entsprechend, eine Beschäftigungsmöglichkeit anzubieten hat. Der Teilnehmer wird, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, analog zur WfB, über das Rauhe Haus sozialversichert, die Rahmenbedingungen der Arbeit (Bezahlung, Arbeitszeit, Strukturen, Verhalten, Anforderungen, Erwartungen etc.) werden mit dem Arbeitgeber ausgehandelt. Gemeinsam mit dem Teilnehmer werden die notwendigen Formalitäten erledigt, der Fahrtweg eingeübt, der Tagesablauf geplant, Erwartungen und Ängste besprochen und die Arbeitsaufnahme vorbereitet. Ist die Arbeit aufgenommen, bietet die Arbeitsbegleitung Hilfe bei der Einarbeitung. Sie arbeitet, falls erforderlich, auch selber mit.
Die Hilfen zur sozialen Integration reichen von einer Gestaltung der Kommunikation und dem Abbau von Vorurteilen durch Aufklärung und Information über Konfliktberatung und Krisenintervention.
Die Arbeitsbegleitung steht langfristig zur Verfügung. Ziel ist jedoch eine Anbindung an Kollegen und die weitestgehende Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Teilnehmers am Arbeitsplatz.
Im Verlauf der fast 3 Jahre, die es die Arbeitsbegleitung jetzt gibt, hat sich in der Praxis das Angebot wie folgt ausdifferenziert: Neben den begleitenden Hilfen für Teilnehmer an Einzelarbeitsplätzen gibt es ein Arbeitsprojekt und mehrere Produktionsgemeinschaften.
Im Arbeitsprojekt arbeitet ein Arbeitsbegleiter mit vier stationär betreuten Teilnehmern in einer betriebsähnlich organisierten Arbeitsgruppe. Es werden Arbeitsaufträge im Bereich Renovierung, Instandsetzung und Entrümpelung durchgeführt. Der Arbeitsbegleiter ist gleichzeitig Anleiter, die Arbeitsaufträge werden vorrangig durch die Teilnehmer erfüllt. Die Löhne müssen vom Projekt erwirtschaftet werden und liegen bei 300 DM monatlich.
In Produktionsgemeinschaften arbeiten Teilnehmer und Arbeitsbegleiter gemeinsam, die Produktivität des Arbeitsbegleiters fließt unmittelbar in das Arbeitsergebnis ein.
Beispielsweise hat ein Arbeitsbegleiter mit 2 Teilnehmern die Gartenpflege des Hamburger Autismus-Institutes übernommen. Das Einkommen der Teilnehmer liegt nach Leistung gestaffelt zwischen 200 und 350 DM im Monat. Ein Arbeitsbegleiter produziert mit einer Teilnehmerin ein Kinderbuch, in einer anderen Produktionsgemeinschaft werden verschiedene Bautätigkeiten für einen Reitverein ausgeführt.
Der überwiegende Teil der Teilnehmer arbeitet jedoch auf individuell zugeschnittenen Einzelarbeitsplätzen unter weitestgehend normalen Bedingungen. Für einen gar nicht so untypischen Verlauf einer solchen Begleitung möchte ich zum Abschluß noch einen Teilnehmer und seinen Werdegang in der individuellen Arbeitsbegleitung vorstellen:
Tobias ist 24 Jahre alt und lebt in einer Wohngruppe des Rauhen Hauses. Er ist aufgrund seiner problematischen Verhaltensweisen aus der WfB ausgegliedert worden und hat 4 Jahre an einer Tagesfördergruppe teilgenommen. Er war dort mit verschiedenen Tätigkeiten im hauswirtschaftlichen Bereich eingebunden. Tobias bewarb sich um einen Platz in der Arbeitsbegleitung. Der Arbeitsbegleiter arbeitete zunächst mit ihm zusammen in der Küche und in der Wäscherei eines dem Rauhen Haus zugehörigen Altersheimes. Es wurde deutlich, daß Tobias große Probleme im Umgang mit den dort arbeitenden Frauen hatte, die er durch langes und ausführliches Erzählen seiner Abenteuer als Batman von der Arbeit abhielt. Ebenso gestaltete er seine Pausen ganz nach seinen Bedürfnissen und trank den für alle Kollegen gekochten Kaffee in seiner ersten Pause bereits gänzlich aus.
Dies wurde als Störung empfunden und an Tobias zurückgemeldet. In gemeinsamen Gesprächen wurden diese Erfahrungen aufgearbeitet, es fanden Auseinandersetzungen darüber statt, was Arbeit überhaupt bedeutet und welches Verhalten von ihm erwartet wird. In Gesprächen mit den Kolleginnen wurde aber auch um Verständnis für Tobias' Eigenheiten geworben und es wurden Kompromisse gefunden, die das Zusammenarbeiten ermöglichen sollten. Tobias bekam seine eigene Kaffeekanne und festgelegte Zeiten zum Erzählen seiner Abenteuer. Die Arbeitszeit wurde seinen Bedürfnissen angepaßt, die Pausen konnten damit reduziert werden. Insgesamt wurde Tobias ein großer Schonraum zugestanden, in dem er erstmalig Erfahrungen mit der "wirklichen" Arbeitswelt sammeln konnte.
Nach 3 Monaten wurde ein Praktikum in der Kantine eines größeren Betriebes vereinbart. Tobias, der jahrelang mit einem Behindertenbus zur Tagesförderung fuhr, lernte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln selbständig zu seinem Praktikumsplatz zu fahren. Während des Praktikums gab es erneut Problemen im Umgang mit den dort tätigen Frauen. Es wurde deutlich, daß Tobias sich als Mann von den Tätigkeiten in einer Küche, die von Frauen gemacht wurden, abgrenzte. Er wollte Kaufhausdetektiv werden. Diese Absicht verfolgte er mit großer Energie, es kam zu einem Vorstellungsgespräch, in dem Tobias die Voraussetzungen für diese Tätigkeit deutlich gemacht wurden. Er erkannte, daß er diese Voraussetzungen nicht erfüllt, und nahm Abstand von diesem Wunsch. In der weiteren Auseinandersetzung um eine mögliche Beschäftigung äußerte er den Wunsch, Totengräber zu werden, da es eine Figur in einem Comic gibt, die so heißt und auch entsprechend furchterregend aussieht und mit der er sich nach Abschluß der Batman-Phase sehr stark identifizierte. Im Berufsinformationszentrum konnte Tobias sich über die Arbeitsmöglichkeiten auf einem Friedhof informieren.
Es wurde eine Möglichkeit der Mitarbeit bei einer Friedhofsgärtnerei gefunden, wo Tobias seit 3 Monaten mitarbeitet. Die Möglichkeit der langfristigen Beschäftigung mit 20 Wochenstunden gegen ein leistungsgerechtes Entgelt zeichnet sich ab.
Inhaltsverzeichnis
Ines Boban, Dr. Andreas Hinz, Jens Lüttensee, Claudia Pokojewski, Lehrerin, Erziehungswissenschaftler, MitarbeiterInnen des Stadthaus-Hotels
Im folgenden beleuchten wir den bundesweit vermutlich bekanntesten Integrationsbetrieb aus unterschiedlichen Perspektiven: Jens Lüttensee beschreibt zum Auftakt das Hotel als seinen Arbeitsplatz und stellt es in den Zusammenhang seiner Lebenssituation. Ines Boban und Andreas Hinz zeigen aus der Perspektive der PädagogInnen, die die Entwicklung des Konzepts und die Realisierung gemeinsam mit der Elterngruppe betrieben haben, Geschichte und Struktur des Projekts auf und geben eine erste kleine Befragung von Gästen wieder. Abgerundet wird die Darstellung des Projekts durch Claudia Pokojewskis Beschreibung ihres Arbeits- und Lebensalltags. Für sie wie auch für Jens Lüttensee waren Ines Boban und Andreas Hinz als SchreibmediatorInnen tätig. Am Schluß folgt eine Liste von Veröffentlichungen zum Projekt.
Ich heiße Jens Lüttensee aus dem Stadthaus-Hotel Hamburg-Altona. Ich bin 22 Jahre alt. Mein Traumberuf ist Musiker, Dirigent. Die in Wirklichkeit ist, ich arbeite im Hotel: Waschbecken und Klo putzen und Dusche, das Bett abziehen und im Bad feudeln, saugen auch und Wäschereipflege. In der Wäscherei muß ich Wäsche waschen, 45 Minuten zum Trockner tun, an die Mangel und bügeln, erst die Kleinteile und dann die großen Teile. Die Mangelwäsche nur zehn Minuten zum Trockner. Dann Wäsche zusammenlegen.
An der Rezeption sage ich: "Herzlich Willkommen im Stadthaus-Hotel!" Im Service mache ich Kaffeedienen, den Gästen dienen, den Frühstücksbuffet aufbauen mit Wurst und Käse, Joghurt, Milch und schön Saft, Cornflakes, Obst und Marmelade, auch Honig. In Service für die Gäste bekomme ich das Trinkgeld, für Danke für Frühstück. Das Trinkgeld kommt in die Kasse für alle.
Chef Thorsten Schönrock stellt Dienstplan auf. Morgens um 9 bis halb 2, Frühdienst ist ab 7 Uhr. Drei Tage in der Woche frei, und dann kommt Frühdienst. Im Jahr sind 35 Tage Urlaub. Fünf nehme ich im Dezember zu mein Geburtstag.
Im Dienst trage ich die Fliege, die gute Hose und das grüne Jackett. Sonst Jeans und Schlips auch gerne. Chef Herr Krim paßt auf saubere Hände auf - immer erst Hände waschen. Und die Haare sauber duschen in der Wohngruppe.
Am wichtigsten im Hotel ist Herr Thorsten Schönrock mit allen Kollegen auch, keinen nerven, das geht. Die unsere Gäste sind nett. Die Spülmaschine einräumen, Buffet und Tische aufräumen. Das war's. Danach zur Pause. Alle zusammen trinken Selter und Kaffee, im Sommer auf der Terrasse. Noch Wäscherei und Feierabend.
Am Feierabend alle gut essen, und kuschel ich mit Zivi Sascha, der alte Freund und auch Karsten mein Freund beruflich ist der Wohngruppe arbeiten natürlich. Das war schon lange, bei Mirco so klein war schon, immer gekuschelt und auch Britta Born. Annalena lieber nicht, und Dirk Becker auch ein alter Kumpel. Dann in der Tanzschule, da erst Walzer, Rumba, Chachacha und noch Discofox, Foxtrott und Hacke-Spitze-Polka. Wir tanzen die Tanzgruppe. Außerdem mein Hobby ist die Musik, nämlich Dirigent gelernt mein Kopf am Klavier. Orgel und Flöte nicht mehr so, aber schön laut Schlagzeug gut. Ich dirigiere die CD Mozart, Strauß, Jacques Offenbach, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach Flötenkonzert, Carl Orff Carmina Burana und Sieben-Schwäne-Tanz, Tschaikowski auch.
Bei Schule Uferstraße gewesen mit acht Leuten Schülergruppe. Bei Schule gelernt bei Karsten Kühl, unserm Lehrer, täglich Berufsschule. Bei ihm gelernt Rechnen, bei Frau Timbeck Wäschereipfleger, bei Frau Kindt, die machte die Kochen. Da Brötchen geschmiert, für ganze Schule verkauft in Kiosk zum Pause, die anschließend. Vorher Robbe-Institut-Schule mit zehn Leute ein Gruppe. Da Schreiben, Eurhythmie gelernt, viele Feste gefeiert: St. Michael-Fest am Herbst, der was noch Erntedankfest, St. Martins-Fest für Frühling. Immer ganz schön.
Schon lange gewesen der Bürger auch mit Andreas Hinz in Kongreß in Duisburg mit von Lebenshilfe und noch im Harz auch mit Ines, und mit Gesa und ich in Hannover Tagung und mit René Herr Horn im Hamburger Spaß-Verein in Borgweg. Auch in Österreich Innsbruck Congress, nä, mit Musik und Theater, die Kabarett ganz toll auch noch getanzt und hinterher Peter und der Wolf Prokofieff. Auch später mal Wien vielleicht ein Referent ich, und Zauberflöte in Oper oder London Konzert, alle einladen in zu wohnen in Stadthaus-Hotel gerne. Verteilt die Prospekte, vorgestellt mich und Stadthaus-Hotel mit Video, und sage ich: "Jetzt kommt Andreas, alter Kumpel, und Ines, süße Braut!"
"Woran denken wir in Hamburg? Alster, Michel, Schmidt-Theater und an ... das Stadthaus-Hotel, na klar!!"[2]
Das Stadthaus-Hotel ist Teil eines Gesamtprojekts, das vom Werkstadthaus Hamburg e.V. betrieben wird. Die Entwicklung des Projekts zeigt Abbildung 1 im Überblick.
Es begann mit einer Elterngruppe einer Klasse in einer anthroposophischen Schule für Geistigbehinderte, die über die gastweise Unterbringung des Hamburger Spastikervereins mit zwei (damals) StudentInnen der Sonderpädagogik in Kontakt kamen. Nachdem über Jahre die gleiche Gruppe z.T. mit den gleichen BetreuerInnen auf Reisen ging, wurden dort erste Ideen für ein Projekt ersponnen, das die Zusammengehörigkeit der sehr heterogenen Gruppe dieser Klasse auch nach der Schule sichern sollte. Es tauchte dabei die Idee einer Teestube auf, die aber mangels finanzieller Ertragsmöglichkeiten durch die Utopie einer Pension ersetzt wurde. Diese ersten Utopien mündeten in die Entwicklung eines Konzepts. Dessen Kernpunkte waren neben dem Erhalt der Gruppe u.a.:
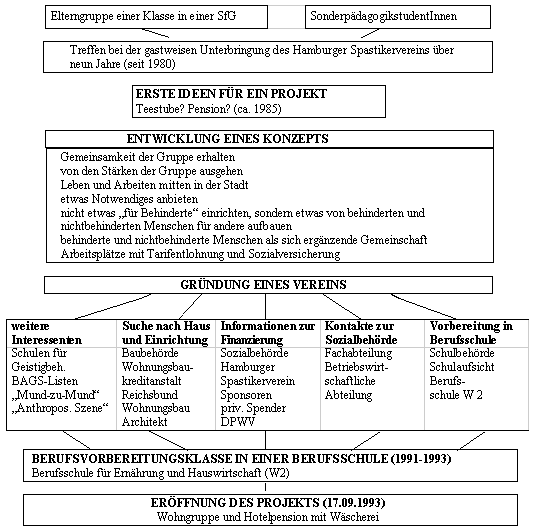
Abb. 1: Entwicklung des Projekts
-
Wir wollten von den Stärken der Gruppe ausgehen. Sie lagen nicht im Sortieren, Zählen, Montieren von Dingen, sondern im Herstellen einer annehmenden Atmosphäre und in einem großen Potential für die Rolle von GastgeberInnen.
-
Wir wollten, daß die Gruppe mitten in der Stadt mit einer Vielzahl von 'Außen'-Kontakten arbeiten und leben können sollte (von Projekten 'draußen auf dem Land' hatten wir immer wieder gehört, daß sie sehr 'im eigenen Saft schmorten').
-
Es sollte nicht ein Projekt 'für Behinderte', sondern ein Projekt von behinderten und nichtbehinderten Menschen für die Umgebung sein (und unser Produkt sollte nicht gekauft werden, weil 'unsere lieben Behinderten' es 'hergestellt' haben, sondern weil es hochwertig und einfach gut ist und einem echten Bedarf entspricht).
-
Die behinderten und nichtbehinderten MitarbeiterInnen im Hotel sollten sich in ihren Kompetenzen partnerschaftlich ergänzen - sie verdanken sich dem Konzept nach gegenseitig ihre Arbeitsplätze. Und auch in der Wohngruppe sollte es kein hierarchisches Verhältnis zwischen BewohnerInnen und ihren AssistentInnen geben.
-
Und schließlich sollten Arbeitsplätze entstehen, bei denen die ArbeitnehmerInnen sozialversichert sind und ortsüblich tariflich ent-lohnt werden.
Nachdem wir mit elf Mitgliedern einen Verein gegründet hatten (der inzwischen 14 Mitglieder umfaßt), kam nun eine Phase vielfältiger Aktivitäten:
-
Die Gruppe mußte von fünf auf acht Personen vergrößert werden, wegen der größeren Vielfältigkeit, aber auch wegen Auflagen der Sozialbehörde. Dazu mußten weitere Interessenten gefunden werden - in Schulen für Geistigbehinderte, über die Bedarfsmeldungs-listen der Sozialbehörde, durch Mund-zu-Mund-Propaganda und innerhalb der 'anthroposophischen Szene' in Hamburg.
-
Es mußte ein Haus gefunden und dessen Einrichtung geplant werden. Dazu fanden Gespräche statt mit der Wohnungsbaukreditanstalt und mit der Baubehörde, die uns in Kontakt brachte mit dem Reichsbund-Wohnungsbau, der zu der Zeit ein Projekt sozialen Wohnungsbaus in Altona plante und uns (durch den Architekten) bei den weiteren Planungen mit unseren speziellen Anliegen berücksichtigte.
-
Als fast wichtigste Aufgabe mußten wir uns um die Finanzierung kümmern und dazu Informationen von der Sozialbehörde und vom Paritätischen Wohlfahrtsverband einholen - und hierbei halfen uns die guten Kontakte zum Hamburger Spastikerverein. Außerdem sprachen wir mögliche Sponsoren und private Spender wegen finanzieller Unterstützung an.
-
Dann mußte unser Vorhaben von der Sozialbehörde überhaupt erst einmal für gut und sinnvoll befunden werden. Dies geschah in der Fachabteilung - für uns überraschenderweise - wohl vor allem deshalb, weil in Hamburg rollstuhlgerechte Hotelunterkünfte fehlen und so die Aussicht auf eine gute Auslastung der Unterkunft gegeben schien. Weiter mußte eine Rentabilitätsrechnung vorgelegt werden, mit deren Hilfe die betriebswirtschaftliche Abteilung die Kosten abschätzen konnte.
-
Schließlich ergab sich ein zusätzliches Problem: Als die Gruppe die Schule verlassen mußte, war das Hotel noch nicht fertig. So überlegten wir, ob die Berufsschulpflicht nicht auch ein Recht für die Gruppe auf den Besuch der Berufsschule bedeuten könnte. Wir nahmen Kontakt zur Schulbehörde, zur Schulaufsicht der Berufsschulen und zur in Frage kommenden Berufsschule für Ernährung und Hauswirtschaft (W 2) auf, die gleichzeitig auch für den Berufsschulunterricht derer zuständig ist, die sich im Eingangs- und Trainingsbereich der Werkstätten für Behinderte befinden.
So kamen die jungen Leute in eine eigene Berufsvorbereitungsklasse, in der sie zwei Jahre lang an fünf Tagen in der Woche auf ihre konkreten zukünftigen Aufgaben vorbereitet wurden. Die Schule stellte die LehrerInnen, der Verein die zusätzlich notwendigen sozialpädagogischen Kräfte, die von der Sozialbehörde finanziert wurden. Was zuerst als Problem einer zeitlichen Lücke erschien, erwies sich im nachhinein als sehr sinnvoller Schritt auf dem Weg von der allgemeinen Schule zur Berufstätigkeit. Während des ersten Jahres der Tätigkeit im Hotel gab es einen Tag zusätzlich noch Berufsschulunterricht; die jungen Leute waren z. T. wohl ganz froh, als sie schließlich ganz vom Status der SchülerInnen zum Status arbeitender Erwachsener übergegangen waren ...
Am 17.09.1993 war es dann schließlich so weit: Nach achtjähriger Vorbereitungszeit wurde das Stadthaus-Hotel im Rahmen einer Veranstaltung mit dem damaligen Hamburger Sozialsenator feierlich eröffnet. Was anfangs viele als unrealistische Spinnerei empfunden hatten, war nach jahrelangem Krafteinsatz von Eltern und PädagogInnen nun doch Realität geworden.
Wie das Werkstadthaus-Projekt organisiert ist, zeigt Abbildung 2. Formal besteht es aus zwei Teilen: einer Wohngruppe und dem Hotel mit angeschlossener Wäscherei.
Die Wohngruppe wird - wie andere in Hamburg auch - über einen Pflegesatz finanziert, der je nach Personenkreis nach unterschiedlichen Pauschalen berechnet wird. In der Wohngruppe befinden sich zwei 'schwer-mehrfachbehinderte' und sechs 'normalgeistigbehinderte' (?) junge Leute. Unterstützt wurde die Finanzierung durch zusätzliche Spenden.
Anders als in anderen Wohngruppen ist lediglich die Tatsache, daß für die beiden 'schwer-mehrfachbehinderten' Frauen ein Raum und eine Fachkraft zusätzlich bereitgestellt wird, da sie sonst in eine Tagesförderstätte gehen würden. Statt dessen erhalten sie im Bereich der Wohngruppe spezielle Angebote, die für sie sinn- und lustvoll sind und auch für das Hotel unterstützend wirken können (z. B. eine Quarkspeise herstellen oder Marmelade kochen). Sie 'arbeiten' also in ihrem Kreativraum; und die anderen BewohnerInnen können in der Freizeit gerne dazukommen.
Das Hotel nimmt - wie jedes andere Unternehmen in Deutschland auch - staatliche Zuschüsse in Anspruch: auf drei Jahre befristete Lohnkostenzuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit (im ersten Jahr 80 %, im zweiten 70 % und im dritten Jahr 60 % der Lohnkosten) und den Minderleistungsausgleich nach § 27 der Ausgleichsabgabenordnung nach dem Schwerbehindertengesetz. Die Hauptfürsorgestelle, die die Gelder derjenigen Betriebe verwaltet, die ihre Pflichtquote an schwerbehinderten MitarbeiterInnen nicht erfüllen, sondern pro Monat und Platz 200 DM Ausgleichsabgabe zahlen, bezuschußt hiermit die Arbeitsplätze für schwerbehinderte MitarbeiterInnen. In den Bundesländern unterschiedlich gestaffelt, wird dem Arbeitgeber ein Ersatz dafür geboten, wenn die schwerbehinderten MitarbeiterInnen nicht die 'volle Leistung' bringen können. In Hamburg gibt es für die Einrichtung von acht Arbeitsplätzen eine Stelle als Unterstützung, offiziell befristet auf zwei Jahre; wenn aber der Bedarf weiter besteht, kann man wohl von der Weiterfinanzierung ausgehen. Das Hotel hat natürlich auch eigene Einnahmen aus der Bezahlung der Unterkunft durch die Gäste, und auch hier wirken Spenden unterstützend.
Zur Zeit arbeiten sieben behinderte Mitarbeiter mit je halben Stellen im Hotel. Zu den sechs jungen Leuten ist eine weitere Mitarbeiterin hinzugekommen, die einige Häuser weiter selbständig wohnt. Die sieben behinderten MitarbeiterInnen betreiben das Hotel zusammen mit drei nicht behinderten, von denen zwei ausgebildete Hotelfachleute sind. Um die langen Öffnungszeiten des Hotels zu besetzen, gibt es noch Aushilfskräfte auf Honorarbasis. Alle hauptamtlichen MitarbeiterInnen sind sozialversichert und werden nach den Tarifen des Hotel- und Gaststättengewerbes ortsüblich bezahlt. Die behinderten Mitarbeiter-Innen, die in der Wohngruppe leben, müssen allerdings einen großen Teil ihrer Einkünfte an das Sozialamt zur Finanzierung der Wohngruppe abführen und behalten von ihrem Lohn ein monatliches Taschengeld von ca. 300 bis 400 DM zur freien Verfügung (die behinderte Mitarbeiterin, die selbständig wohnt, behält ihr ganzes Einkommen).
Das Hotel stellt elf Betten in sieben rollstuhlgerechten Zimmern bereit (zwei Doppelzimmer, ein Familienzimmer mit drei Betten und Einzelzimmer). Jedes Zimmer verfügt über genügend Platz für die Bewältigung aller Tätigkeiten mit dem Rollstuhl bzw. vom Rollstuhl aus und über die notwendigen Haltegriffe bei der Toilette und im Bad, dessen Dusche stufenlos erreichbar ist. Weiter gibt es für jedes Zimmer eine Notklingel, mit der im Notfall Hilfe geholt werden kann. In der Wäscherei wird die eigene Wäsche, aber auch Wäsche von anderen AuftraggeberInnen gewaschen und gebügelt (dies kann z. B. Wäsche von anderen Wohngruppen sein, die nicht selbst waschen können, aber auch die von jeder anderen Institution). Mit der Wäscherei verbindet sich vor allem die Hoffnung auf zusätzlich zu erwirtschaftende Gelder. Für die behinderten Gäste bietet das Hotel eine stundenweise Assistenz bei Unternehmungen oder im Hause an. Geplant ist ein Stipendium für auswärtige KünstlerInnen, das gegen Kost und Logis zu gegenseitiger Anregung in dem Kreativbereich beitragen soll.
Die privaten Einzelzimmer befinden sich im ersten und zweiten Stock, der Gemeinschaftsbereich der Wohngruppe, der Kreativbereich und die Wäscherei liegen im ersten Stock, das Hotel nimmt das Erdgeschoß des siebenstöckigen Sozialwohnungsbaues ein (ursprünglich waren im Erdgeschoß Stellplätze für Autos vorgesehen).
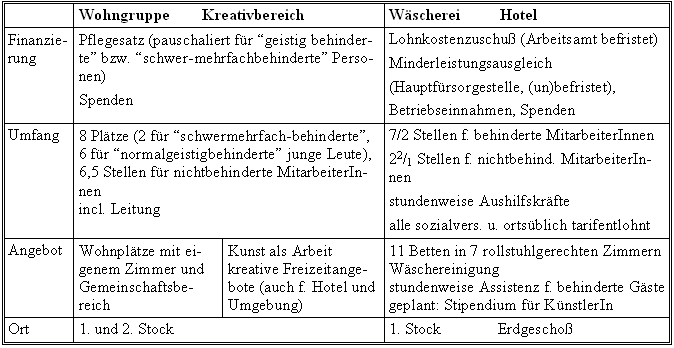
Eine kleine Befragung der Gäste von Studierenden der Interstaatlichen Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule St. Gallen (Schweiz) Ende 1995 ergab folgendes Bild:
Von den 35 Befragten sind 15% Menschen mit Behinderungen, das Altersspektrum reicht von 20 bis zu 80 Jahren. Knapp über die Hälfte von ihnen sind Geschäftsreisende, die anderen Ferienreisende.
Informationen über das Hotel haben die Befragten von Bekannten (40% !) oder über die Medien (30%) bekommen; Werbung und das Fremdenverkehrsbüro spielen nahezu keine Rolle als Informationsquelle. Bei den Gründen für die Wahl dieses Hotels gibt es ein breites Spektrum: Zwei Drittel der Befragten geben soziales Engagement an, ein Drittel die Lage (vermutlich die Nähe zum 'Phantom der Oper'), ein Fünftel ist zufällig in diesem Hotel gelandet. Das Hotel lebt also nicht nur von seinem Status als soziales Projekt, sondern hat auch 'Laufkundschaft' und überzeugt durch seinen Standort.
Detailliert wurden die Gäste zu ihrer Zufriedenheit befragt, etwa zum Empfang, zur Sauberkeit, zum Service, zum Frühstück, zum Zimmerdienst und zum Preis-Leistungs-Verhältnis.
Auf einer fünfstufigen Skala wurden insgesamt 245 Angaben gemacht (vgl. Abb. 3): Von ihnen entfielen 210 auf 'zufrieden', 14 auf 'eher zufrieden', 1 auf 'weder noch' und zwei auf 'eher unzufrieden'. Dieses Ergebnis kann positiv verbucht werden, zumal in den Bereichen Service, Frühstück, Sauberkeit, Zimmerdienst, also jenen Bereichen, in denen die Gäste auch mit den MitarbeiterInnen mit Behinderungen zu tun haben, ausschließlich positive Rückmeldungen abgegeben wurden.
Claudia ist 25 Jahre alt und in vielerlei Hinsicht eine besondere Frau, gerade weil sie in vielerlei Hinsicht keine besondere Frau ist. Ihr Arbeitsplatz ist das Stadthaus-Hotel Hamburg, aber sie wohnt nicht in der Wohngruppe, sondern in einer eigenen Wohnung. Sie ist stolz auf ihre Einbauküche und besonders auf 'die Mikrowelle'. Souverän geht sie mit ihrem Telefaxgerät um. Ihr modernes Spinnrad kommentiert sie lachend: "Ja, manchmal spinne ich auch!"
Als meine Mutter mich bekam, sagten ihr die Ärzte: "Sie haben ein Down-Syndrom-Kind". Sie wußte damals natürlich überhaupt noch nicht, was das bedeutet. Da mußte sie erstmal die Schulbank drücken, so wie ich heute, wenn ich Englisch lernen will. Na, und mein Vater genauso. Aber sie haben's geschafft - ist das nicht toll?
Ich bin nicht in eine Schule für Geistigbehinderte, ich bin in eine Förderschule gegangen. Da bin ich immer gut zurechtgekommen. Ich hatte ja ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Lehrerin. Auch meine Mitschüler waren nett, fand ich alle prima. Aber ich hatte mal 'ne fünf in Sport, bei dem einen Lehrer, der immer mit Fußballspielen ankam. Dann hatte ich mal 'ne zwei bei einem anderen, der eher Gymnastik machen wollte. Rechnen war nicht meine Stärke, aber Deutsch und Geschichte. In der Schule bin ich nie gehänselt worden oder sowas. Aber ich kenn das; aus Angst davor hab ich viel Schokolade gegessen, aber darüber will ich nix reden.
Ich arbeite im Stadthaus-Hotel zusammen mit meinen Chefs und fünf Kollegen. Zwei von ihnen haben ja auch Down-Syndrom, genau wie ich. Davor habe ich ja verschiedene Bereiche besucht und auch schon mit Behinderten gearbeitet, zum Beispiel. Im ersten Praktikum, das war in einer Bäckerei, da hab ich das Leben erst richtig kennengelernt! Das zweite Praktikum hab ich in der Küche im Altenheim gemacht. Wo ich ja auch gern mit alten Leuten arbeite. Das kann ich auch sehr gut. Mein drittes Praktikum war in einer Werkstatt für Behinderte. Aber da hat es mir gar nicht gefallen. Da mußte ich immer sitzen und mit den Händen arbeiten. Da wird man steif und das seh ich nicht ein, von der Wirbelsäule her und dem ganzen Körper! Hotel hatte ich noch nicht. Da habe ich mich entschieden, ins Hotelfach zu gehen und da acker ich mich jetzt voran! Ich mag die Atmosphäre dort und bin gern im Service. Da kann man mit den Gästen klönen und trotzdem arbeiten. Meistens arbeite ich von 7 Uhr bis 12.30 Uhr.
Ich geh einmal in der Woche zum Kochkurs, denn ich will mir selbst was kochen können. Bei Fertiggerichten weiß man ja nicht, was da genau drin ist. Ich glaub nicht, daß die so gesund sind. Abends esse ich Obst oder eine Scheibe Brot. Ich will wieder schlank werden, und nachher bleib ich auch schlank.
Ich seh gern die Autos rein- und rausfahren, geh mal ins Kino und lern was in Kursen am Abend. Außerdem kann man mal Bummeln gehen - und hinterher mach ich meine Buchführung, damit ich weiß, wo mein Geld bleibt. Das gehört ja auch zum Haushalt machen, nicht nur saubermachen, Wäsche in die Maschine und so; mach ich ja alles selbst.
Also im Fernsehen sehe ich mir manchmal Krimis an und Naturfilme, aber auch Trickserien. Die soll ich nicht gucken, sagt meine Mutter, aber ist mir egal. Ich guck sie trotzdem. Nachrichten im ersten Programm, damit ich weiß, was so in der Welt passiert, und auf RTL die Mini-Playback-Show. Man braucht ja etwas Abwechslung. Musikcassetten höre ich, wenn ich male, stricke oder schreibe, sticke oder knüpfe oder beim Beinehochlegen nach der Streßarbeit. Im Moment höre ich am liebsten die Prinzen, o wenn die nach Hamburg kommen! Da geh ich hin, genau wie Cats oder Phantom der Oper, fand ich auch so toll! Mein Kollege Mirco schwärmt so für David Copperfield. Ich schwärm eben am meisten für die Prinzen. Von denen hätte ich gern mal ein Originalfoto, ein Poster mit den Schweinen und ein echtes Autogramm und die Cassette dazu.
Zum Beispiel Englisch. Das lern ich ja jetzt für's Hotel, wegen der vielen Gäste, die nur Englisch sprechen, und das verstehe ich dann nicht so gut. Deshalb gehe ich einen Abend in der Woche in einen Kurs, Erwachsenenbildung nennt sich das. Französisch verstehe ich ja auch nicht, aber naja, erstmal lern ich nun Englisch. Von dem Bauchtanzkurs und dem Kochkurs hab ich ja schon erzählt. Aber ich lerne auch noch Keyboardspielen.
Wenn ich male und nachdenke, fällt mir einiges ein. Ich hoffe, daß sich der Hausmüll reduziert. Einssein mit der Natur, Mensch und Natur, das wäre das Schönste. Und daß Mauern zwischen den Menschen überhaupt nicht sein sollen. Daß sie gegeneinander Krieg führen, muß aufhören! Das wäre herrlich, wenn auf der ganzen Welt keine Gewalt wäre. Wenn Arme Häuser kriegten und Arbeit, das wäre schön. Und Liebe kann jeder haben, egal wie er ist, sei es behindert oder nichtbehindert, sei es normal, ob er so wie Du und ich gebaut ist. Tja, so denken behinderte junge Menschen. Immer denk ich so beim Ausmalen. Es bringt mir Spaß, immer neue Ideen zu entwickeln! Ich bin gespannt, was die großen Behörden sagen, wenn sie das lesen werden. Vielleicht sagen die dann 'Mensch, die hat Recht, da machen wir mit!' Deshalb möchte ich ja auch ein Buch schreiben, z. B. darüber, mit Behinderten zu arbeiten, damit sie mehr Mut haben für's Leben. Manche denken: 'Ach, wäre es schön zu sterben'. Aber das soll man nicht, die sollen Mut bekommen. Das Leben ist schöner. Sterben tut ja jeder einmal. Man soll die Freude am Leben behalten!
Ja, so ein Buch möchte ich mal schreiben. Und deshalb finde ich auch wichtig, wenn etwas über mein Leben in der Zeitung steht oder ich bei Mona Lisa oder Ilona Christen im Fernsehen sein kann. Da hab ich auch gesagt, was ich über die Umwelt und den Frieden denke. Vom Honorar habe ich mir einen Ring gekauft und Geld gespendet. Die Kranken und Armen liegen mir am meisten am Herzen, ich verfolg ja immer die Nachrichten deshalb. In ein Waisenhaus nach Bosnien oder Serbien, wo wirklich Not am Mann ist. Aber nun muß ich erstmal an Morgen denken. Da reisen alle Gäste ab nach dem Frühstück, das ist viel Arbeit. Da gibt's viel Trinkgeld, das geht in eine gemeinsame Kasse!
Ihre Eltern sagen, Claudia heute so leben zu sehen, ist besser als sechs Richtige im Lotto! Und daß sie ihr immer alles zugetraut haben, was sie selber tun wollte.
BARK, Christa Maria: Leben und Arbeiten mit Künstlern und Gästen. Das Werkstadthaus Hamburg. Zusammen 10, 1990, H. 8, 8-10
BOBAN, Ines & HINZ, Andreas: Traumziel: Teestube. Zusammen 7, 1987, Heft 9, 10-11
BOBAN, INES & HINZ, ANDREAS: Menschen im Hotel. Das Band 25, 1994, Heft 2, 23-25
BOBAN, INES & HINZ, ANDREAS: Ein Tag im Leben des Jens L. - oder: Was es heißt, ein Hotel zu betreiben. Gemeinsam leben 2, 1994, Heft 4, 30-33
BOBAN, INES & HINZ, ANDREAS: Werkstadthaus Hamburg - Wohnen mitten in der Stadt und Arbeiten in einem rollstuhlgerechten Hotel. Zeitschrift für Heilpädagogik 47, 1995, 384-387
BOBAN, INES & HINZ, ANDREAS: Aus der Teestube wurde ein Hotel. Zusammen 15, 1995, H.3, 38-40
BOBAN, INES & HINZ, ANDREAS (REDAKTION): Unser Arbeitsplatz: Das Stadthaus-Hotel in Hamburg. Magazin der Lebenshilfe-Zeitung, Nr. 2, Juni 1994, 8-9
BOBAN, INES, HINZ, ANDREAS & LüTTENSEE, JENS: Wir arbeiten im Hotel und sind Gastgeber. In: BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE (Hrsg.): Selbstbestimmung. Kongreßbeiträge. Marburg: Bundesvereinigung 1996, 442-448
BOBAN, INES & P., CLAUDIA: CLAUDIA P. - besser als sechs Richtige. Leben mit Down-Syndrom Nr. 23, 1996, 14-16
HINZ, ANDREAS: Einbindung von Menschen mit geistiger Behinderung. Contraste 11, 1994, Heft 120, 7
HINZ, ANDREAS: Konzeptionelle Überlegungen für die Berufsvorbereitung geistig und schwerst-mehrfachbehinderter Jugendlicher. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.): Ein Ort auch für uns! - geistig behinderte junge Erwachsene lernen in der Berufsschule. Marburg: Bundesvereinigung 1994 (im Erscheinen)
HINZ, ANDREAS (REDAKTION): Konzept des Vereins Werkstadthaus Hamburg e.V. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.): Ein Ort auch für uns! - geistig behinderte junge Erwachsene lernen in der Berufsschule. Marburg: Bundesvereinigung 1994 (im Erscheinen)
VIDEOFILM DER HAMBURGER SCHULBEHöRDE üBER DIE VORBEREITUNG IN DER BERUFSSCHULE (BEZUG GEGEN SELBSTKOSTENPREIS: Karsten Kühl, Staatliche Schule für Ernährung und Hauswirtschaft, Uferstraße 10, D-22081 Hamburg)
Adresse:
Stadthaus-Hotel Hamburg, Holstenstraße 118, D-22765 HAMBURG
Tel.: 040/38 99 20-0, Fax: 040/38 99 20-20
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
-
Der Kampf für Integration und gegen Aussonderung als Wurzel der Unterstützten Beschäftigung
- Unterstützte Beschäftigung als Teil der Bewegung für gleichberechtigte Teilhabe und Integration von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen
- Der sich abzeichnende Paradigmawechsel in der Behindertenpolitik von wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge zu bürgerrechtlichem Schutz vor Diskriminierung
- Das amerikanische Antidiskriminierungsgesetz
- Entwicklungen auf europäischer Ebene
- Das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz
- People First - Eintreten für eigene Rechte und Selbstbestimmung
- Unterstützte Beschäftigung als neue Perspektive
- Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung
- Die internationale Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung
- Unterschiede zwischen Unterstützter Beschäftigung in den USA und Deutschland
- Ergebnisse von Unterstützter Beschäftigung
- FAZIT: Unterstützte Beschäftigung erschließt neue Perspektiven der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen
- Literatur
Stefan Doose, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e. V.
Wenn niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf[3], müssen Menschen mit Behinderung auch das Recht und die Möglichkeit haben, in regulären Betrieben gemeinsam mit nichtbehinderten Kollegen zu arbeiten. Menschen mit einer geistigen Behinderung haben dagegen bisher beispielsweise in vielen Ländern nur die Möglichkeit, in einer geschützten Werkstatt für Behinderte zu arbeiten oder arbeitslos zu sein. Die unausgesprochene Grundannahme dieses Systems ist es, daß Menschen mit einer schweren Behinderung, die dauerhafte Unterstützung benötigen, wenn überhaupt, nur in entsprechend ausgestatteten Sondereinrichtungen arbeiten können. Dieser Beitrag möchte mit dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung eine andere Sichtweise einführen und der Frage nachgehen, wie integrative und individuell sinnvolle Unterstützungsmöglichkeiten zur Eingliederung in das Arbeitsleben aussehen können.
Ich möchte Ihnen als Einführung die Geschichte erzählen, wie ich 1991 zu dem Thema gekommen bin. Ich habe damals beim Rauhen Haus in Hamburg gearbeitet und dort in einer Wohngruppe einen jungen Mann betreut, der in eine Werkstatt für Behinderte ging. Der junge Mann war ein großer Elvis-Fan und Autoliebhaber und als Person mit sogenannten "autistischen Zügen" diagnostiziert. Er fing damals an, in der Werkstatt mit Werkzeug um sich zu werfen, so daß die Werkstatt entschied, daß er dort nicht mehr arbeiten solle. Er flog also aus der Werkstatt heraus. Ich habe mir gedacht, das ist ja kein Problem: Er hat es sich mit einem Arbeitgeber verdorben, gehen wir halt zum nächsten Arbeitgeber. Wir haben nämlich vier Werkstätten für Behinderte in Hamburg. Man hat mir dann allerdings schnell ziemlich unmißverständlich klar gemacht, daß, wenn man aus einer Werkstatt herausgeflogen ist, man aus allen Werkstätten herausgeflogen ist. Darauf sagte ich dem zuständigen Berufsberater, das wäre ja so etwas ähnliches wie ein Berufsverbot. Denn damals sah es noch so aus, daß die Werkstatt für Behinderte die einzige Arbeitsmöglichkeit für Menschen mit einer geistigen Behinderung war. So wollte er es nicht sehen und meinte, es gäbe ja noch die Tagesförderstätten. Tagesförderstätten sind in Hamburg Beschäftigungsangebote für Menschen mit sehr schweren Behinderungen. Wir kamen dort hin, und Andreas stellte schnell fest, daß er dort nicht arbeiten wollte. Auf der anderen Seite stand auch für ihn fest, daß er kein Brückenpenner werden wollte, wie er es sagte. Nun war die Not groß, was wir tun sollten.
Dies war die Geburt des ersten Arbeitsbegleiters, der eine ungewöhnliche Finanzierung hatte, die leider heute in Deutschland noch immer ungewöhnlich ist. Die Werkstatt bekam in Hamburg etwa 2500 DM monatlich, um den Rahmen für die Beschäftigung von Andreas sicherzustellen. Wir haben vorgeschlagen, mit demselben Betrag ambulant etwas anderes zu organisieren, das vielleicht eher seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht. Dann haben wir zunächst für 20 Stunden pro Woche einen Arbeitsbegleiter eingestellt, der sich mit ihm auf die Suche nach individuellen Arbeitsmöglichkeiten machte. Dabei konnten wir uns für ihn damals keine tariflichen Arbeitsmöglichkeiten vorstellen, aber individuelle Arrange-ments. Sie haben damals Garten- und Hausmeisterarbeiten im Autismus-Institut übernommen, dann hat er mit Begleitung einen Förderlehrgang gemacht. Die Begleitung konnte im Laufe der Zeit erheblich reduziert werden, auch ist Andreas nie mehr am Arbeitsplatz aggressiv geworden.
Jetzt, fünf Jahre später, steht zur Diskussion, daß Andreas mit einem Begleiter zusammen eine Ausbildung als Tischler in einer Firma macht und dort soviel lernt, wie er während einer normalen Ausbildungszeit lernen kann. Andreas, der damals in der Wohngruppe wohnte, wohnt heute mit einem Freund zusammen als Wohngemein-schaft in einer eigenen Wohnung und wird dort ambulant betreut.
Die positiven Veränderungen seiner Lebenssituation in allen Lebensbereichen zeigen, wie es sich auswirken kann, wenn man beginnt, individuell sinnvolle ambulante Formen der Unterstützung zu entwickeln.
Unterstützte Beschäftigung basiert auf der Überzeugung, daß Arbeit ein wesentlicher Teil unseres Lebens und unseres sozialen Status ist. Gleichwertige, gleichberechtigte Teilhabe an den zentralen Lebensbereichen setzt ein kommunikatives, zwischenmenschliches Miteinander voraus. Ausgrenzung, egal in welchem Lebensbereich, macht diese Kommunikation unmöglich. Menschen mit Behinderung dürfen daher nicht gegen ihren Willen von diesem wichtigen Lebensbereich ausgeschlossen werden. Es geht insgesamt um eine Art Wiedereinwanderungsprozeß in die eigene Gesellschaft, aus deren alltäglichen Lebensräumen Menschen mit Behinderungen ausgebürgert worden sind. Dieser Wiedereinwanderungsprozeß geht Schritt für Schritt vor sich: mit unseren Versuchen der Integration im Kindergarten, der Integration in der Schule und nun auch mit der Integration im Berufsleben. An jeder Schwelle (Grundschule/ Sekundarstufe I/ Berufsschule/ Arbeitsleben) wiederholte sich der Kampf gegen das allgemeine Vorurteil, daß behinderte Menschen am besten durch getrennte Strukturen wie Sonderschulen oder Werkstätten gefördert werden können. Die Eingliederung in die Gesellschaft, so das zugrundeliegende Paradoxon, könne am besten durch die Ausgliederung vorbereitet werden. Die Eltern für Integration sind dagegen der Überzeugung, daß alle Menschen, ob behindert oder nicht, miteinander leben, lernen und arbeiten können und sollen.[4]
Sie haben etwas getan. Sie haben Integrationsgruppen in Kindergärten, Integrationsklassen in Grundschulen und in der Sekundarstufe I, integrative Berufsvorbereitungsklassen angestoßen und die Hamburger Arbeitsassistenz gegründet. 13 Jahre später gibt es in Hamburg Integrationsgruppen in über 40 Kindergärten, 79 Integrationsklassen in 21 Grundschulen, 306 integrative Regelklassen an 35 Grundschulen und 80 Integrationsklassen an 17 Schulen in der Sekundarstufe I[5], es gibt zwei integrative Berufsvorbereitungsklassen[6], einen integrativen Förderlehrgang[7], das ambulante Arbeitstraining[8] mit 12 Plätzen und die Hamburger Arbeitsassistenz[9], die in den letzten 4 Jahren 115 Menschen mit einer geistigen Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt und dort unterstützt hat. Dennoch sind auch in Hamburg noch die größte Zahl der Menschen mit Behinderungen im Kindergarten, Schul- und Arbeitsbereich in Sondereinrichtungen, und auch in der Integration sind beileibe nicht alle Probleme gelöst.
Die Behindertenrechtsbewegung hat zu einem allmählichen Bewußtseinswandel geführt, daß der Ansatzpunkt für die Veränderung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung nicht wohlfahrtsstaatliche Fürsorge, sondern ein bürgerrechtlicher Schutz gegen Diskriminierung sein muß.
Diese Bewegung hin zu einem rechtebezogenen Ansatz der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen hat ihre Wurzeln in der amerikanischen Behindertenrechtsbewegung, hat aber mittlerweile ihren Niederschlag in einer Reihe von internationalen Dokumenten und nationalen Verfassungsgeboten zum rechtlichen Schutz gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung geführt.[10]
Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung ist unter dem Begriff "Supported Employment" in den achtziger Jahren in den USA entwickelt worden.[11] Es ist auch ein Ergebnis der Behindertenrechtsbewegung in den USA, die sich als Teil der Bürgerrechtsbewegung versteht und ähnlich wie gegen die Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe gegen die Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung kämpft.
Diese Bemühungen führten 1990 zum amerikanischen Antidiskriminierungsgesetz (ADA). Es verbietet, Menschen im öffentlichen Leben, im Bereich Telekommunikation, im öffentlichen Dienst oder in der Arbeit aufgrund ihrer Behinderung zu benachteiligen. Dies hat wirklich zu sichtbaren Veränderungen geführt.[12] So müssen zum Beispiel Restaurants und Kneipen prinzipiell auch rollstuhlgerecht zugänglich sein. Speisekarten müssen zwar nicht in Blindenschrift vorliegen, der Kellner ist aber im gegebenen Fall verpflichtet, die Karte vorzulesen.
Ein anderes eindrucksvolles Beispiel ist mir begegnet, als ein Ranger in einem der wunderschönen Nationalparks in den USA mir erklärte, wieso es notwendig sei, Esel im Grand Canyon zu haben. Es gibt dort einen Streit zwischen Eselbenutzern und Wanderern: Die Wanderer mögen die Eselbenutzer nicht, weil die Esel auf den Wegen Häufchen hinterlassen. So gab es mehrfach Petitionen, daß die Esel von den Wanderwegen verschwinden sollten. Der Ranger erklärte mir aber, daß es wichtig sei, daß es weiterhin Esel gäbe, damit auch mobilitätseingeschränkte Menschen in den Grand Canyon hinunterkommen. Dies ist ein Beispiel dafür, daß aufgrund des Antidiskriminierungsgesetzes eine Bewußtseinsveränderung begonnen hat.
Der Grundgedanke des Antidiskriminierungsgesetzes, die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als Bürgerrecht zu sehen, hat auch in anderen Rehabilitationsgesetzen Niederschlag gefunden. In den Grundsätzen des Rehabilitationsgesetzes[13] heißt es beispielsweise:
|
Präambel des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes "Behinderung ist ein natürlicher Teil der menschlichen Erfahrung und schränkt in keiner Weise das Recht jedes einzelnen ein,
|
Ich würde mir wünschen, daß ein Rehabilitationsgesetz bei uns so beginnen würde.
Die Verankerung des Verbotes der Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung im Grundgesetz ist ein erster wichtiger Schritt zur Neuorientierung des gesellschaftlichen Umganges mit Behinderung in Deutschland.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat diese internationale Entwicklung aufgegriffen und kürzlich einen Entwurf einer neuen Strategie der Europäischen Gemeinschaft zur Chancengleichheit für behinderte Menschen vorgelegt.[14]
Der Grundsatz des "Mainstreaming" soll in den nächsten Jahren Grundlage der europäischen Förderung im Bereich der Behindertenpolitik werden.
Der Grundsatz des "Mainstreaming"
Dieser Grundsatz bedeutet, daß Maßnahmen entwickelt werden, die die
-
uneingeschränkte Teilhabe und Einbeziehung behinderter Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft und andere Lebensbereiche generell erleichtern,
-
aber dabei Wahlfreiheit bieten.
-
Dieser Ansatz gilt und hat Vorteile für alle Menschen mit einer Behinderung, unabhängig von Art und Schweregrad dieser Behinderung.[15]
Die Dimension von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe als verfassungsgemäßes Bürgerrecht sollte auch bei der Diskussion von Unterstützter Beschäftigung in Deutschland stärker in den Vordergrund der Diskussion gestellt werden. Daß die Aktion Sorgenkind 1997/98 eine groß angelegte öffentliche Aktions- und Aufklärungskampagne "Aktion Grundgesetz" für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung startet, ist in diesem Zusammenhang zu begrüßen und zeigt den beginnenden Paradigmawechsel von barmherziger Fürsorge für "Sorgenkinder" zu einem rechtebezogenen Ansatz der Herstellung von Chancengleichheit.
"Niemand soll aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden". Die Verankerung des Verbotes der Benachteiligung von Menschen wegen ihrer Behinderung in Artikel 3 des Grundgesetzes im Jahre 1994 ist ein wichtiger Schritt zur Neuorientierung des gesellschaftlichen Umganges mit Behinderung. Das Gesetz beinhaltet zwar im Gegensatz zum amerikanischen Antidiskriminierungsgesetz keinen individuell einklagbaren Anspruch, es bindet aber den Gesetzgeber. Die im Grundgesetz getroffene grundsätzliche Wertentscheidung des Gesetzgebers wird daher in der Zukunft stärker daraufhin durchdekliniert werden müssen, inwieweit Gesetze und Ausführungsbestimmungen in der Behindertenhilfe nicht zu einer faktischen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen führen. Jemanden gegen seinen Willen in Einrichtungen statt im Gemeinwesen zu betreuen, dürfte in Zukunft nur in besonders zu begründenden zwingenden Ausnahmefällen rechtlich möglich sein.[16]
Eine stärkere Bedeutung für die Ausgestaltung der Hilfen müssen in Zukunft die Menschen mit Behinderung selbst haben. Menschen mit Behinderung selbst - und nicht mehr Platzzuweisungen der Kostenträger - werden in Zukunft entscheiden, wer ihnen im Rahmen ihres Rechtsanspruches hilft. Viele Einrichtungen der Behindertenhilfe sind darauf nicht vorbereitet. Sie konnten sich bisher darauf verlassen, daß der behinderte Mensch real meist keine Alternative zu der für ihn vorgesehenen Betreuung hatte, egal ob er die angebotene Hilfe als für sich wirklich hilfreich empfand oder nicht. Der neue Maßstab sollte sein, daß wir Dienste entwickeln, die von denen, die wir unterstützen wollen, auch als wirklich hilfreich erlebt werden.
Diese Dienste können nur mit den Menschen entwickelt werden, um deren Leben es geht. Es gibt in Nordamerika eine Selbstvertretungsbewegung, die sich "People First" nennt. Dies ist ein unterstützter Zusammenschluß von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Der Name "People First" weist auf ihre Forderung hin, sie zuerst als Menschen und nicht als Geistigbehinderte zu sehen. People First hat auf einem ihrer Treffen für den Bereich Arbeit einen Grundrechtekatalog verabschiedet:
Forderungen von People First
-
Wir wollen nicht in Armut leben
-
Wir wollen das Recht auf einen integrierten Arbeitsplatz in unserer Stadt
-
Wir wollen arbeiten, unabhängig von unserer Produktivität
-
Wir wollen faire Löhne
-
Wir wollen am Arbeitsplatz respektiert werden.
Die Idee von People First weitet sich mittlerweile auch auf andere Länder aus, so gibt es einen europäischen Sitz in London. Als Folge der Lebenshilfetagung "Ich weiß doch selbst, was ich will" im Herbst 1994 und der ersten entsprechenden Veröffentlichungen[17] und Seminare entstehen mittlerweile auch die ersten "People First" - Gruppen in Deutschland.
In einer gemeinsamen Aktion der Interessengemeinschaft Selbstbestimmtes Leben, von Eltern gegen Aussonderung und der Bundesvereinigung Lebenshilfe ist derzeit eine bundesweite Koordinierungsstelle zum Aufbau von People First Gruppen als Modellprojekt beantragt worden. [18]
Unterstützte Beschäftigung ist nicht einfach eine Technik der beruflichen Integration, sondern bedingt ein neues Grundverständnis der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen.
Das traditionelle Hilfesystem für Menschen mit Behinderung verlangt in der Regel, daß wir jemanden als behindert definieren und genau beschreiben, was jemand nicht kann. Wir sind professionell darin, den Blick darauf zu richten, wo die Defizite von jemandem liegen. Wenn ich mir diese professionellen Urteile ansehe, frage ich mich manchmal, wie es Ihnen wohl gehen würde, wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber ein Zeugnis bekommen würden, in dem ausschließlich das steht, was Sie nicht können. Sie würden wahrscheinlich wutentbrannt zu dem Arbeitgeber gehen und sich über diese Unverschämtheit beschweren. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Tätigkeiten und Fähigkeiten seiner Angestellten positiv zu beschreiben. Für Menschen mit Behinderungen scheint dies keine gängige Betrachtungsweise zu sein.
Menschen mit Behinderungen sind Menschen mit Fähigkeiten. Diese gilt es zu entdecken und zu stärken. Unterstützte Beschäftigung hat gezeigt, daß man individuelle Arbeitsmöglichkeiten findet, wenn man weiß, was eine Person kann, bei alledem, was sie auch nicht kann.
Die Orientierung auf die Defizite und Behinderung einer Person führte häufig zu der Annahme, daß von Menschen mit Behinde-rungen nicht allzuviel zu erwarten sei. Dies hatte dann die Reduzierung ihrer Erfahrungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen zur Folge.
Ein ausgebautes System von speziellen Schon- und Schutzräumen für Menschen mit Behinderungen in Form von Sondereinrichtungen führt zu einer zunehmenden gesellschaftlichen Isolation.
Dem traditionellen System von Sondereinrichtungen liegen gewisse Grundannahmen über Menschen mit Behinderungen zu Grunde, die sich wie folgt charakterisieren lassen[19]:
Traditionelle Auffassungen der Behindertenhilfe
-
Menschen mit Behinderungen können keine eigenen Entscheidungen treffen und müssen beschützt werden.
-
Experten wissen besser als Freunde, Eltern, Angehörige und die Person mit Behinderung selber, was für Menschen mit Behinderung gut ist.
-
Menschen mit der gleichen Art der Behinderung benötigen gleiche, auf die Behinderung abgestimmte, spezielle Hilfen und Einrichtungen.
-
Menschen mit geistiger Behinderung bleiben ihr Leben lang auf dem Stand eines Kindes.
-
Menschen mit Behinderungen sind am zufriedensten, wenn sie relativ einfache Montagearbeiten ausführen können.
-
Menschen mit Behinderung finden die besten Freunde unter ihresgleichen.
-
Unsere Gesellschaft ist nicht in der Lage, mit Menschen, die anders sind, umzugehen und sie zu respektieren.
-
Große und umfassende Einrichtungen können den Interessen von Menschen mit Behinderungen am besten gerecht werden.
Demgegenüber basiert der Ansatz von Unterstützter Beschäftigung auf anderen, neuen Vorstellungen:
Grundannahmen von Unterstützter Beschäftigung
-
Menschen wollen ihr Leben selbst bestimmen und Entscheidungen treffen. Dafür brauchen sie gute Informationen und Unterstützung.
-
Informelle Kontakte und Netzwerke sind mindestens genauso wichtig wie formelle Hilfen. Vielfältige Perspektiven sind wichtig, Experten haben nur eine unter anderen.
-
Die Motivation, Wünsche, Stärken und Fähigkeiten einer Person sind wichtige Ausgangspunkte der Hilfe und nicht die Behinderung. Menschen mit gleicher Behinderung haben nämlich sehr unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten, Wünsche und Ziele.
-
Menschen hören nie auf, zu wachsen und sich zu entwickeln. Jeder Mensch kann lebenslang lernen.
-
Menschen wollen etwas zugetraut bekommen, gefordert werden, dazulernen und sich weiter entwickeln.
-
Menschen möchten für andere etwas bedeuten. Menschen versuchen in ihrem Leben die gleichen fundamentalen Wünsche zu befriedigen (Anerkennung, Beziehungen, Sicherheit, Entwicklungsmöglichkeiten).
Individuelle, flexible, ambulante Hilfen in den alltäglichen Bezügen der Gesellschaft können am besten dazu beitragen, Menschen mit Behinderungen zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen.
Eine veränderte Sichtweise von Menschen mit Behinderungen und ihrer Möglichkeiten ist Voraussetzung für eine veränderte Form der Unterstützung im Arbeitsleben. Denn unsere Sichtweise von Menschen mit Behinderung bestimmt unser Handeln.
Das Entscheidende ist, die Fragestellung in der beruflichen Rehabilitation umzustellen. Traditioneller Weise erscheint mir, zumindest in Deutschland, die Fragestellung zu sein: Wer paßt in welche Maßnahme? Diese Maßnahmen der beruflichen Integration sind von Trägern und Kostenträgern entwickelt worden, die sich ausgedacht haben, was für Menschen mit einer speziellen Behinderung wohl sinnvoll sei. Im Einzelfall führt das dann häufig dazu, daß sich der behinderte Mensch der Maßnahme anpassen muß und nicht die Maßnahme dem behinderten Menschen. Wir müssen von den Menschen lernen und flexible Strukturen schaffen, in denen eine individuell sinnvolle Unterstützung angeboten werden kann.
Unterstützte Beschäftigung zeichnet sich durch verschiedene Kriterien aus:
-
Unterstützte Beschäftigung istbezahlte Arbeit. Der eine Schwerpunkt liegt auf bezahlt. Der andere Schwerpunkt liegt auf Arbeit, also eine sinnvolle Tätigkeit, die auch wirklich gebraucht wird und nicht Beschäftigung mit Lego-Steinen, die am Tag zu irgendwelchen Dingen zusammengesetzt, am Abend wieder zerstört und in Kisten gepackt werden.
-
Es geht um bezahlte Arbeit in integrierter Arbeitsumgebung, also dort, wo andere Menschen auch arbeiten.
-
Es ist gedacht für Menschen mit Behinderungen, die bisher als nicht vermittlungsfähig galten und die
-
langfristige Unterstützung benötigen, um erfolgreich arbeiten zu können.
Unterstützte Beschäftigung ist auch eine methodische Vorgehensweise und umfaßt z. B. eine individuelle Berufsplanung, Arbeitsplatzsuche, Arbeitsplatzanalyse, Anpassung des Arbeitsplatzes, sowie die Begleitung und Qualifizierung am Arbeitsplatz.[20]
Ziel von Unterstützter Beschäftigung ist vor allem die soziale Integration, nicht nur die Vermittlung eines Arbeitsplatzes. In Zusammenarbeit mit allen anderen engagierten Personen, Initiativen und Institutionen einer Region sollen Bedingungen für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden, die
-
gemeindenah organisiert und in die üblichen gesellschaftlichen Abläufe eingebunden sind,
-
Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung und zur Nutzung der eigenen Fähigkeiten bieten,
-
dazu beitragen, gute Beziehungen zu Freunden, Familie, Bekannten und Kollegen einzugehen und aufrechtzuerhalten,
-
Möglichkeiten der Wahl und Entscheidung bezüglich der eigenen Lebensführung erweitern und die Lebensqualität des unterstützten Menschen auch subjektiv verbessern und
-
dazu beitragen, daß Menschen mit Behinderung von anderen respektiert werden und ihre persönliche Würde bewahren können.[21]
Unterstützte Beschäftigung soll nicht eine neue Form von beschützenden Diensten sein, sondern geeignete Unterstützungsstrukturen bieten, die von Menschen mit Behinderungen gemäß ihren persönlichen Bedürfnissen genutzt werden. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, daß der Mensch mit Behinderung als Kunde Kontrolle über die Eingliederungshilfen hat und an den zu treffenden Entscheidungen partizipieren kann.
Unterstützte Beschäftigung ist aus der Integrationsbewegung heraus für Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung entwickelt worden. Die Möglichkeit, Menschen mit einer Behinderung durch individuelle Unterstützung und Begleitung auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, ist aber nicht auf eine Behinderungsart beschränkt. Die Zielgruppe von Unterstützter Beschäftigung hat sich so im Laufe der Zeit, oft von Modellprojekten begleitet, ausgeweitet. Unterstützte Beschäftigung hat sich als ein erfolgreicher Weg erwiesen für
-
Menschen mit einer Lern- oder geistigen Behinderung, einschließlich Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung,
-
Menschen mit psychischen Behinderungen,
-
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung,
-
Menschen mit Autismus,
-
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen.
Unterstützte Beschäftigung für Menschen mit schweren Behinderungen
Der Ausgangspunkt von Supported Employment war besonders die Förderung von Menschen mit einer schweren Behinderung. So vertritt Paul Wehmann, Professor an der Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia und einer der Gründer von Supported Employment, die Auffassung: Wir müssen mit den Menschen mit schweren Behinderungen anfangen und zwar eigentlich mit denen mit den schwersten Behinderungen. Wenn wir gezeigt haben, daß Unterstützte Beschäftigung mit diesen Menschen möglich ist, daß wir diese Menschen in integrativen Arbeitsverhältnissen unterstützen können, dann wird die Integration von Menschen mit leichteren Behinderungen folgen. Es ist in Modellprojekten gezeigt worden, daß dies mit erheblichem Aufwand für eine Vielzahl von Zielgruppen möglich ist. In der Praxis sind aber eher Menschen mit einer leichteren Behinderung integriert worden oder Menschen mit Lern- und leichten geistigen Behinderungen, sowie Menschen mit einer psychischen Behinderung sind die Zielgruppe, die flächendeckend bisher am meisten von Supported Employment profitiert hat. [22]
Es gibt somit eine beträchtliche Diskrepanz zwischen der momentanen breiten Praxis und dem von einigen innovativen Projekten nachgewiesenermaßen Erreichten.
Für die Integration von Menschen mit schweren Behinderungen ist eine klare Ziel- und Schwerpunktsetzung der Dienste notwendig
Es gibt eine Reihe von Projekten, die auch Menschen mit einer schweren Behinderung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes unterstützen. Sie haben gemeinsam, daß sie sich die Integration dieser Personengruppe zur ausdrücklichen Aufgabe gemacht haben. Ist dies nicht ausdrückliche Zielsetzung, geraten, unter dem Druck von Vermittlungszahlen und der Rechtfertigung dem Kostenträger gegenüber, Menschen mit schweren Behinderungen auf die Wartelisten, weil man mit ihnen keine schnellen Erfolge erzielen kann, die man oft in so einer Phase braucht.
In den USA lassen sich verschiedene Formen von Unterstützter Beschäftigung finden:
- Unterstützte Einzelarbeitsplätze. Dies sind Arbeitsplätze in regulären Betrieben, an denen jemand durch einen Arbeitsassistenten und die Kollegen je nach Bedarf unterstützt wird. Dies sind 80% der Arbeitsplätze in Supported Employment[23]. Unterstützte Einzelarbeitsplätze sind in Bezug auf die Integration im Betrieb und die Lohnhöhe, die Form von Supported Employment mit den besten Ergebnissen.[24]
- Mobile Dienstleistungsgruppen. Hier bietet eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen Dienstleistungen in der Region an. So werden z. B. Gartenarbeiten übernommen oder Glascontainer gereinigt. Diese Gruppenangebote dürfen aus maximal acht Menschen mit Behinderung bestehen, um als Form Unterstützter Beschäftigung zu gelten. Acht Personen sind jedoch auch schon eine große Gruppe mit der Folge, daß die unterstützten Arbeitnehmer eher als Behindertengruppe gesehen werden als einzelne Arbeitnehmer mit individuellen Persönlichkeiten.
- Enklaven in regulären Betrieben. Dies sind Gruppen von unterstützten Arbeitnehmern, die in regulären Betrieben arbeiten. Dies entspricht den Außenarbeitsplätzen, die einige Werkstätten für Behinderte in Deutschland in Betrieben haben. Die Idee ist, anstatt in der Werkstatt jahrelang Teile für eine Firma wie z. B. IBM zu montieren, dies in deren Betrieb zu tun. Dabei gibt es zwei Formen von Enklaven:
-
Gruppenarbeitsplätze, an denen bis zu acht Personen in einer Abteilung im selben Raum arbeiten. Die Gruppenangebote sollten in Bezug auf die tatsächliche Integration genau betrachtet werden. Getrennte Pausenzeiten, keine Teilnahme an den Betriebsfeiern sind Anzeichen einer sehr begrenzten wirklichen Integration.
-
Arbeitsplatzcluster, bei denen zwar verschiedene Menschen mit Behinderung im selben Betrieb arbeiten, jedoch in unterschiedlichen Abteilungen. Diese Organisationsform hat meiner Ansicht nach größeres Integrationspotential. So ist es leichter, eine intensive Betreuung, z. B. für Menschen, die eigentlich eine 1:1 Betreuung benötigen, zu organisieren und trotzdem Voraussetzung für die Integration der unterstützten Personen in unterschiedlichen Abteilungen zu schaffen.
- Kleine Integrationsbetriebe. Bei dieser Form gründen Menschen mit und ohne Behinderungen eine Firma und vermarkten ihre Produkte. Diese Form spielt in den USA, im Gegensatz zu Deutschland, zahlenmäßig allerdings keine Rolle.
In den Jahren 1985/86 gab es in den USA eine Gesetzesinitiative zur Einführung von Supported Employment. Diese war interessanterweise als "System Chance Grant" gedacht, als ein Modellprojekt, das das stationäre System der beruflichen Rehabilitation verändern sollte. Das System gesonderter Werkstätten sollte in ein System unterstützter Arbeitsplätze im Gemeinwesen umgestaltet werden.
In den USA gibt es 11 Jahre nach der Einführung von Supported Employment ca. 140.000 Menschen in Unterstützter Beschäftigung[25]. 1993 gab es über 3700 Anbieter von Unterstützter Beschäftigung[26]. Insgesamt wird geschätzt, daß ca. 300.000 Menschen mit Behinderung in irgendeiner integrativen Maßnahme sind[27]. Dies sind ca. 10-20% der insgesamt unterstützten Menschen mit Behinderung.
Die Association of Persons in Supported Employment (APSE) ist der amerikanische Dachverband für Supported Employment, der im Juli 1996 seine 7. Jahrestagung mit über 1200 Teilnehmern in New Orleans veranstaltete.
Die Idee von Supported Employment hat sich über die USA hinaus, vor allem in englischsprachigen Ländern, schnell ausgebreitet. So gab es recht früh Unterstützte Beschäftigung in Kanada, Großbritannien, Irland, Neuseeland und Australien. In Kanada sind in einigen Regionen beispielsweise bereits 50% der im Arbeitsleben unterstützten Personen mit Behinderung in unterstützter Beschäftigung. [28]
Mittlerweile ist Unterstützte Beschäftigung auch in Europa und einigen Ländern Asiens wie Japan oder Hongkong aufgegriffen worden. Mittlerweile ist sogar eine World Association of Supported Employment (WASE) gegründet worden.
Unterstützte Beschäftigung gibt es mittlerweile in vielen Staaten Europas, so daß man auch hier von einer richtigen Bewegung sprechen kann. Supported Employment gibt es in Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Finnland, Schweden, Zypern und Malta. Mittlerweile gibt es auch erste Projekte in Österreich. In den Niederlanden gibt es beispielsweise seit 1994 einen Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz, und in Norwegen wurden nach einem erfolgreichen Modellversuch landesweit 150 Arbeitsassistenten eingestellt. Diese Zahl soll in den nächsten zwei Jahren noch einmal verdoppelt werden.
Als Vernetzungsorganisation auf europäischer Ebene fungiert die European Union of Supported Employment (EUSE) mit Sitz in Rotterdam.
In Dublin hat im Oktober 1995 die zweite Tagung der EUSE mit über 550 Teilnehmern aus allen Ländern Europas stattgefunden, die nächste Tagung wird vom 15.-16. Mai 1997 in Oslo stattfinden.
Unterstützte Beschäftigung begann in Deutschland mit ersten Modellprojekten[29] Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre, die zum Teil von der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des HORIZON Programmes gefördert wurden.
Die internationale Fachtagung "Wo anders arbeiten?! - Alternative Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen" des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte und des Hamburger Spastikervereins versammelte im März 1994 in Hamburg zum erstenmal auf breiter Basis in Deutschland die in diesem Bereich entstandenen Projekte und Ansätze. Die über 300 Teilnehmer forderten am Ende der Tagung in der "Hamburger Erklärung" eine Neuorientierung von Ausbildung und Arbeit für behinderte Menschen.[30]
Als Folge der Tagung wurde im Oktober 1994 die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) als der bundesweite Zusammenschluß von Integrationsfachdiensten und Initiativen in der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die sozial-politische Zielsetzung der BAG UB besteht in der Verankerung und Weiterentwicklung von Unterstützter Beschäftigung als ambulante Unterstützung im Arbeitsleben im bundesdeutschen Rehabilitationssystem. Die BAG UB gibt u.a. die vierteljährliche Zeitung impulse heraus, organisiert Fortbildung und Beratung im Bereich Unterstützter Beschäftigung und führt Fachtagungen durch.
Mittlerweile gibt es in Deutschland ca. 120 Integrationsfachdienste und ca. 80 Vermittlungsdienste[31] an Werkstätten für Behinderte, die - allerdings teilweise nur sehr begrenzt - Menschen direkt am Arbeitsplatz unterstützten können. Die Hälfte der Integrations-fachdienste sind in den letzten eineinhalb Jahren entstanden, so daß man von einem richtigen Boom in der letzten Zeit reden kann. Viele dieser Projekte sind wiederum als regionale Modellprojekte entstanden. [32]
Unterstützte Beschäftigung wird in Deutschland im Gegensatz zu den USA nicht als grundlegende Veränderung, sondern als Ergänzung des Systems der beruflichen Rehabilitation diskutiert, das unbeabsichtigt entstandene Lücken zwischen Werkstätten und dem allgemeinen Arbeitsmarkt schließen soll.
In diesem Sinne plant das Bundesarbeitsministerium von 1997-2001 ein weiteres, bundesweites Modellprojekt mit Integrationsfachdiensten in allen Bundesländern.
Unterstützte Beschäftigung ist im Vergleich USA - Deutschland zur Zeit noch von erheblichen Unterschieden geprägt. Einige Beispiele sollen diese Unterschiede deutlich machen:
In Deutschland war es kürzlich eine große Zeitungsmeldung wert, daß in Bremen eine Frau mit Down-Syndrom in einem normalen Supermarkt arbeitet. In Amerika würde dies zu keiner Zeitungsmeldung reichen. Die Supported Employment Agentur, für die ich in den USA gearbeitet habe, hat z. B. auch nichtsprechende Menschen, Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung oder eine Frau, die taub-blind war, in regulären Betrieben unterstützt. Diese Menschen hatten allerdings auch eine langfristige, intensive Unterstützung.[33].
Die taub-blinde Frau arbeitete in einem Kreisgericht in der Aktenvernichtung. Sie mochte das Vibrieren der Aktenvernichtungsanlage und war in Bezug auf die erforderliche Vertraulichkeit sicherlich eine optimale Besetzung der Stelle.
Eine andere Frau, die einen Helm trug, damit sie sich nicht selbst verletzte, erledigte in der Universität die Postgänge. Sie arbeitet dort Teilzeit 20 Stunden die Woche, die 1:1 von einem Arbeitsbegleiter begleitet wurden, der sich jederzeit über Pieper von der Projekt-leitung auch Hilfe holen konnte. Die Frau verdiente dort den Mindestlohn von damals $ 4,75, was sehr viel weniger ist als die Einstiegslohngruppen in Deutschland. Man muß einfach wissen, daß in Amerika viele Menschen - und nicht nur behinderte Menschen - Löhne verdienen, von denen sie eigentlich nicht leben können. Diese Frau hatte vorher jahrelang in einem psychiatrischen Krankenhaus gelebt und war eine der Teilnehmerinnen, die durch Dezentra-lisierung wieder in das Gemeinwesen integriert wurden. Wenn man gesehen hat, was diese Frau für Fortschritte machte, wie sie sich mit diesem Arbeitsplatz identifizierte, dann ist dies ein wunderschönes Beispiel dafür, wie lebendig Unterstützte Beschäftigung sein kann. Als sie sich das erste Mal traute, alleine von Büro zu Büro zu gehen und die Blätter einzusammeln, die sie für das Recycling sortierte, war das ein unheimlich großer Schritt für sie. Dies hätte man ihr in keiner Prognose über ihre Entwicklung im Arbeitsleben zugetraut. Man hätte traditionellerweise sicherlich gesagt, diese Frau muß sich erst hier bei uns in der Sondereinrichtung bewähren, ehe sie dann die Chance bekommt, draußen zu arbeiten - und sie wäre nie an der Reihe gewesen.
In einer Studie[34] über 130 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in Deutschland, die von speziellen Vermittlungsdiensten von Werkstätten für Behinderte und Integrationsfachdiensten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden worden, ergibt sich für die von Integrationsfachdiensten unterstützten Arbeitsplätze (N=80) folgendes Bild:
Ergebnisse einer Untersuchung von 80 unterstützten Arbeitsplätzen in Deutschland
-
Die in die Untersuchung einbezogenen unterstützten Arbeitnehmer haben zu über 80% eine Lern- oder geistige Behinderung.
-
Für zwei Drittel der unterstützten Beschäftigten ist dies das erste reguläre Arbeitsverhältnis.
-
Die Hälfte der unterstützten Arbeitnehmer wird mindestens einmal wöchentlich am Arbeitsplatz direkt vom Fachdienst unterstützt. Meist ist die direkte Unterstützung am Arbeitsplatz am Anfang stärker und läßt im Laufe der Zeit nach.
-
Die Arbeitsplätze werden am häufigsten im Produktions- und Montagebereich, im Gastronomie- und Küchenbereich und im Lagerbereich gefunden.
-
Die unterstützten Arbeitsplätze werden überwiegend in kleineren Betrieben gefunden. So haben 72% der Betriebe weniger als 50 Beschäftigte und 46% sogar weniger als 15 Angestellte.
Barrieren für die berufliche Integration
Die Barrieren für eine berufliche Integration behinderter Menschen stellen sich nach einer Umfrage unter 25 Integrationsfachdiensten für Menschen mit geistiger Behinderung im Jahre 1995[35] wie folgt dar:
Barrieren für die berufliche Integration
-
Wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit
-
Mangelndes Interesse von Arbeitgebern, Menschen mit einer erheblichen Behinderung einzustellen
-
Geringe Qualifikation der Bewerber mit Behinderungen (Lücke zwischen der benötigten Qualifikation und der in der Schule und WfB erhaltenen)
-
Inflexibles Förderungsrecht
-
Keine Unterstützung von Werkstätten für Behinderte
Die wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit stellt eine äußerst schwierige Rahmensituation für die Arbeit der Integrations-fachdienste dar. Im Durchschnitt liegt die Arbeitslosigkeit in Deutschland zur Zeit bei ca. 10% und ist damit doppelt so hoch wie in den USA. Die spezifische Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen liegt mit 16% nochmals wesentlich höher. Knapp 4 Millionen Menschen sind offiziell arbeitslos gemeldet, davon fast 180.000 Menschen mit Schwerbehinderungen. Schätzungen gehen von einer real wesentlich höheren durch Arbeitsmarktmaßnahmen und Frühverrentung verdeckten Unterbeschäftigung von ca. 7 Millionen Menschen in Deutschland aus. Für Menschen mit schweren Behinderungen gab es jedoch auch in Zeiten von Hochkonjunktur geringe Beschäftigungschancen. Arbeitgeber haben teils erhebliche Bedenken gegen die Einstellung von Menschen mit einer Schwerbehinderung und wollen sich nicht mit möglichen Problemfällen im Betrieb belasten. Bei Arbeitgebern wie in großen Teilen der Bevölkerung gibt es wenig konkrete Kenntnisse über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung, die Vorurteile überwiegen und erschweren die Arbeit der Fachdienste.
150.000 Menschen mit zumeist einer geistigen Behinderung arbeiten in Deutschland mittlerweile im Sonderarbeitsmarkt der Werkstätten für Behinderte. Die Qualifikation, die die Menschen mit Behinderung für die Rehabilitation aus der Werkstatt für Behinderte mitbringen, erweist sich in vielen Fällen für die Fachdienste als unzureichend und teilweise kontraproduktiv für die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes.
Hinzukommen die Widerstände der Werkstätten, leistungsfähigere Mitarbeiter gehen zu lassen. Integrationsfachdienste wurden von einigen Werkstätten nicht als sinnvolle Ergänzung der Eingliederungsbemühungen, sondern als Bedrohung der Werkstatt und der eigenen Arbeitsplätze aufgenommen. Erschwerend kommt hinzu, daß beim Verlassen der Werkstatt durch ein inflexibles Förderrecht der verschiedenen Töpfe, der Kostenträger in der Regel wechselt und der Anspruch auf eine langfristige, intensive personelle Unterstützung oder eine besondere Rentenversicherung verlorengeht. Diese Faktoren behindern nach Einschätzung der Integrationsfachdienste die Eingliederung von Menschen mit Behinderung erheblich.
Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration
Daß die Integration behinderter Menschen trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen erfolgen konnte, ist nach Ansicht der befragten Fachdienste auf folgende Erfolgsfaktoren zurückzuführen:
Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration
-
Individuelle Unterstützung am Arbeitsplatz durch den Arbeitsbegleiter
-
Lohnkostenzuschüsse
-
Gute regionale Kontakte der Fachdienstmitarbeiter
-
Hohe Motivation der Menschen mit Behinderung
-
Positive Einstellung von Arbeitgebern
Die individuelle Unterstützung am Arbeitsplatz durch den Arbeitsbegleiter war nach Einschätzung der befragten Fachdienste der wichtigste Erfolgsfaktor für die berufliche Integration der betreuten Menschen mit zumeist geistiger Behinderung. Diese Unterstützung senkt die Hemmschwelle der Betriebe, Menschen mit schweren Behinderungen eine Chance zu geben, da sie nicht befürchten müssen, bei eventuell auftretenden Problemen alleingelassen zu werden. Die Lohnkostenzuschüsse sind ein weiterer wichtiger Faktor, der eine Einstellung fördert und die betriebswirtschaftlichen Risiken erstmal minimiert.
Um erfolgreich arbeiten zu können, brauchen die Fachdienstmitarbeiter gute formelle und informelle Kontakte zu Arbeitgebern und den Institutionen in der Region wie z. B. dem Arbeitsamt, der Hauptfürsorgestelle, der Werkstatt, den Schulen und anderen Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderungen. In der Regel dauert es 1-2 Jahre, bis die Fachdienste diese notwendigen Kontakte voll ausgebaut haben.[36]
Ein weiterer wichtiger positiver Faktor ist die unheimlich starke Motivation von vielen der unterstützten Menschen mit Behinderung, die arbeiten wollen.
Allen Schwierigkeiten mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt zum Trotz finden sich auch immer wieder Arbeitgeber mit einer positiven Einstellung, die diesen Menschen eine Chance in ihrem Betrieb geben.
Unterstützte Beschäftigung hat für die unterstützten Arbeitnehmer-Innen in der Regel zu einer erheblichen Verbesserung der Lebenssituation geführt.
Die Lohnhöhe entspricht in der Regel in etwa der untersten Lohngruppe der jeweiligen Länder, so liegt der Durchschnittslohn in Unterstützter Beschäftigung nach entsprechenden Untersuchungen in den USA bei $ 5,52 oder in Deutschland bei 13,50 DM pro Stunde[37]. Dies ist wesentlich höher als in einer entsprechenden Werkstatt für Behinderte. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit liegt in den USA bei 22 Stunden, in Deutschland bei über 33 Stunden. Die Spanne reicht dabei von der Unterstützung in regulären Betrieben von nur einigen Stunden in der Woche bis zur Vollzeitbeschäftigung. Über 75 % der Arbeitsplätze können als gut integriert gelten und zeichnen sich durch regelmäßige Kommunikation am Arbeitsplatz, positive Beziehungen zu Kollegen und große Zufriedenheit der unterstützten Arbeitnehmer aus. Langzeitstudien über Unterstützte Beschäftigung in den USA weisen eine bemerkenswerte Stabilität von Arbeitsverhältnissen nach und zeigen, daß Menschen mit Behinderungen nicht nur weit mehr verdienen als in Werkstätten für Behinderte, sondern auch umfangreichere soziale Netzwerke haben, größeres Selbstvertrauen besitzen und zufriedener sind. Dies hat die Einstellung zu dem, was für Menschen mit Behinderungen erreichbar und wünschenswert ist, sowohl bei den Betroffenen als auch bei ihren Familien und nicht zuletzt bei den Fachleuten verändert.
Ich hoffe, es ist deutlich geworden, daß Unterstützte Beschäftigung mehr ist als eine neue Rehabilitationsmaßnahme. Es ist eine veränderte Sichtweise, die zu einer veränderten Praxis führt. Gemeinsames Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen als Ziel, die Fähigkeiten und Wünschen eines Menschen als Ausgangspunkt, echte Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung und Kontrolle des Menschen mit Behinderung als Wegweiser und ambulante, individuelle, flexible Unterstützung als Methode sind die Eckpfeiler von Unterstützter Beschäftigung. Ohne eine derart veränderte Perspektive werden auch Integrationsfachdienste nur eine Fortsetzung des alten Maßnahmeparadigmas mittels einer neuen Maßnahme sein.
Unterstützte Beschäftigung hat das Potential, die berufliche Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen strukturell zu verändern.[38] Modellprojekte in vielen Ländern der Welt zeigen, daß viel mehr möglich ist, als wir bisher geglaubt haben. Wir stehen am Anfang einer Entwicklung neuer Formen der beruflichen Integration. Dies wird angesichts der hohen Arbeitslosigkeit weltweit kein einfacher Weg sein. Die unterstützten ArbeitnehmerInnen zeigen uns, daß sich die Anstrengung lohnt, und es liegen genug Erfahrungen vor, so daß wir nicht von vorne beginnen müssen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, daß auch Menschen mit einer schweren Behinderung in Zukunft mit der notwendigen Unterstützung integriert in regulären Betrieben arbeiten können.
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN HAUPTFüRSORGESTELLEN: Integrationsfachdienste im Auftrage der Deutschen Hauptfürsorgestellen. Erhebung vom 22.3.96. Karlsruhe: AG der Deutschen Hauptfürsorgestellen 1996
BARLSEN J. & BUNGART, J. : Unterstützte Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Zwischenbericht über den Stand der Forschungsarbeiten. Münster: Westfälische Wilhelms Universität 1996
BEHNCKE, R.: Das ambulante Arbeitstraining. In: Impulse - Zeitung der BAG UB, 1996a, H. 2, 19-21
BEHNCKE, R.: Unterstützte Beschäftigung - eine Zwischenbilanz. In: Das Band, Oktober 1996b
BEHNCKE, R., CIOLEK, A.: Arbeiten außerhalb der Werkstatt. Die Hamburger Arbeitsassistenz - ein Fachdienst zur beruflichen Integration für Menschen mit geistiger Behinderung. In: GEW HAMBURG (IM DRUCK)
BELLAMY, G., RHODES, L., MANK, D., ALBIN, J.: Supported Employment. A community implementation guide. Baltimore: Paul Brookes 1987
BISSONETTE, D.: Beyond traditional job development. The art of creating opportunity. Chatsworth, USA, 1994
BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG (BMA): Die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation. Dritter Bericht der Bundesregierung. Bonn 1994.
BUNDESVERBAND FüR KöRPER- UND MEHRFACHBEHINDERTE E.V.: Hamburger Erklärung zur Neuorientierung von Ausbildung und Arbeit für behinderte Menschen. Erklärung anläßlich der internationalen Tagung "Wo anders arbeiten" vom 4.-6. März 1994 in Hamburg. In: Das Band, 1994, H. 2, 20-22
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE (HRSG.): Wege zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Ein Leitfaden für die Praxis für Menschen mit geistiger Behinderung. Marburg: Lebenshilfeverlag 1995
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE (HRSG.): Wege zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Ergebnisbericht der Projektgruppe. Marburg: Lebenshilfeverlag 1996
CIOLEK, A.: Hamburger Arbeitsassistenz. Fachdienst zur beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung. Erfahrungen und Thesen zur Unterstützten Beschäftigung. In: Gemeinsam leben, 1995, H. 2, S. 60-64
DILEO, D. & LANGTON, D. (HRSG.): Facing the future. Best practices in Supported Employment. St. Augustine, Florida, USA: Training Resource Network, 1996
DALFERTH, M.: Geistig behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Integrationschancen und Hemmnisse. In: Geistige Behinderung 1995, H. 1, 36-47
DOOSE, S. : Supported employment and natural supports in Germany and the US: A survey of program and individuals in supported employment in Germany. Eugene, Oregon, USA: University of Oregon, Specialized Training Program, 1995
DOOSE, S.: Ergebnisse einer Studie über unterstützte Beschäftigung in Deutschland. Impulse-Zeitung der BAG UB, 1996 a, H. 1, S. 5-7
DOOSE, S.: Kündigungen in Unterstützter Beschäftigung. Ergebnisse aus der Befragung von Integrationsfachdiensten im Juni 1995. In: Impulse-Zeitung der BAG UB, 1996b, H. 1, S. 18
DOOSE, S.: I want my dream. Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen. In: Das Rauhe Haus (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung "Perestroika in der Behindertenhilfe. Von der zentralen Versorgungswirtschaft zur Subjektorientierung." Hamburg 1996c
DOOSE, S.: Neue Wege in der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Unterstützte Beschäftigung. Eine Untersuchung von Integrationsfachdiensten und Unterstützten Arbeitsplätzen. Bremen (in Vorbereitung)
DOOSE S. & MANK, D.: Die Zukunft von Unterstützter Beschäftigung. In: SCHüLLER, S./TROST, R. (Hrsg.). Unterstützte Beschäftigung - Ein neuer Weg zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen. (im Druck)
DUFRESNE, D. & LAUX, B.: From Facilities to supports: The changing organization. In: V. Bradley, J. Ashbaugh & B. Blaney (Hrsg.), Creating individual supports for people with developmental disabilities: A mandate for change at many levels, S. 271-280, Baltimore: Paul Brookes, 1994
ERNST,K.-H.: Betreuungs- und Beratungsdienste in der beruflichen Eingliederung Schwerbehinderter. In: Behindertenrecht 1995, H. 5, S. 101-105.
GöBEL, S.: Wir vertreten uns selbst. Kassel: BIFOS 1995
GEHRMANN, M.: Unterstützte Beschäftigungsverhältnisse für Menschen mit einer geistigen Behinderung in den USA. Berlin: ISB, 1995
HAGNER, D.: The social interactions and job supports of supported employees. In: J. Nisbet (Hrsg.), Natural supports in school, at work, and in the community for people with severe disabilities. Baltimore, USA: Paul Brookes, 1992, 217-239
HAGNER, D. & DILEO, D.: Working together. Workplace culture, supported employment, and people with disabilities, Cambridge, MA., USA: Brookline, 1993
HEIDEN, H.-G.(HRSG.): "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Grundrecht und Alltag - eine Bestandsaufnahme. Reinbek: Rowohlt, 1996
HELIOS: Supported Employment - Report of the Economic Integraton Thematic Group No. 10, 1994-96. Brüssel: HELIOS 1996.
HORIZON -ARBEITSGRUPPE (HRSG.): Unterstützte Beschäftigung. Handbuch zur Arbeitsweise von Integrationsfachdiensten für Menschen mit geistiger Behinderung. Hamburg: Hamburger Arbeitsassistenz 1995
JUNKER, A.: Supported Employment made in USA - ein Modell für Deutschland? Vortrag Seminar der BAG UB und des PBI am 20.06.96 in Gießen. Hamburg: BAG UB 1996a
JUNKER, A.: Supported Employment für Personen mit schweren Behinderungen. Beispiele von Community Work Service, Vortrag am 21.06.96 in Gießen. Hamburg: BAG UB 1996b
KOMMISSION DER EUROPäISCHEN GEMEINSCHAFTEN: Mitteilung der Kommission zur Chancengleichheit für behinderte Menschen. Eine neue Strategie der Europäischen Gemeinschaft in der Behindertenthematik. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Dokumente Katalog Nr. CB-CO-96-422-DE-C, 1996
KIERNAN, W., MCGAUGHEY, M., GILMORE, D., MCNALLY, L., KEITH, G.: Beyond the workshop: National perspective on integrated employment. Boston: Institute of Community Inclusion 1994
KLAMMER, W.: Fachdienst für die berufliche Integration (FbI). Konzept der Bundesvereinigung Lebenshilfe zum Thema: Wege zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit (geistiger) Behinderung. In: Fachdienst der Lebenshilfe 1995, H. 3
KROHN, J.: Integrative Berufsvorbereitung in der Gewerbeschule G 13 im Gartenbaubereich. In: Impulse-Zeitung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung, Hamburg 1996, H. 2, S. 16-18
LAG ELTERN FüR INTEGRATION E.V. (HRSG.): Integration in Hamburg. Gedanken, Erfahrungen, Informationen. Hamburg: Selbstverlag 1992
MANK, D.: The underachievement of supported employment. A call for reinvestment. In: Journal of Disability Policy Studies 5 (2) 1994, 1-24.
MANK, D., CIOFFI, A.; YOVANOFF, P. : Oregon Natural Supports Research Project. Descriptive Statistics. Eugene, Oregon, USA: Specialized Training Program, University of Oregon, 1996a
MANK, D., CIOFFI, A.; YOVANOFF, P.: Patterns of Support for Employees with Severe Disabilities. Eugene, Oregon, USA: Specialized Training Program, University of Oregon, 1996b
MOUNT, B.: Benefits and Limitations of personal future planning. In: Bradley, V., Ashbaugh, J. & Blaney, B. (Hrsg.): Creating individual supports for people with developmental disabilities: A mandate for change at many levels, Baltimore, USA: Paul Brookes 1994, S. 97-108
PEOPLE FIRST: Wie man eine People-First Gruppe aufbaut und unterstützt. In: Geistige Behinderung, 1995, H. 1, Praxisteil
PERABO, C. : Neue Ansätze der Integration von behinderten Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. In: Behindertenpädagogik, 1993, H. 4, S. 338-371
POWELL, T., PANCSOFAR, E., STEERE D., BUTTERWORTH, J., ITZKOWITZ, J., RAINFORT B.: Supported Employment. Providing integrated employment opportunities for persons with disabilities. New York: Longman, 1990
PROJEKT BERUFLICHE INTEGRATION FüR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN: Betrifft: Berufliche Integration. Zwei Jahre PBI. Zwischenbericht. Frankfurt: Johann Wolfgang Goethe Universität 1995
REHABILITATION ACT AMENDMENTS. Public Law 102-589. Reauthorization of the Rehabilitation Act (Public Law 93-56). Washington: Congress 1992
SALE, P.: Supported employment in den Vereinigten Staaten - ein Rückblick mit Gedanken zur Umsetzung in Europa, Vortrag auf der Tagung "Wo anders arbeiten - Alternative Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen", Hamburg 04.03.1994, in: DOOSE S. (HRSG.) Reader Alternative Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für geistig und psychisch behinderte Menschen, BAG UB, 9. Auflage, Hamburg 1996
SCHARTMAN, D.: Supported employment in den USA. Ein Literaturbericht. In: Behindertenpädagogik 1995, H. 1, S. 54-80.
SCHARTMAN, D.: Das Mentoren-Modell, In: Zusammen 1996, H. 1.
SCHöN, E.: Frauen und Männer mit (geistiger) Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in der Region Tübingen. Ergebnisse der Begleitforschung zum Modellprojekt Berufsbegleitender Dienst (BBD). Hrsg.: Bundesministerium für Arbeit und Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern 1993
SCHüLLER, S.: Praxis der beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in Kanada. In: TROST 1993
STURM, H.: GLENZ, V.:Auf dem Weg ins Berufsleben. Frau G. qualifiziert sich für eine Tätigkeit im Hotel- oder Gastronomiegewerbe oder: Berufliche Integration jugendlicher SchulabgängerInnen aus Hamburger Integrationsklassen im Rahmen von Integrativen Förderungslehrgängen (F1i). In: Impulse-Zeitung der BAG UB, 1996, H. 2, S. 13-16
SOWERS, J. & POWERS, L. (HRSG.): Vocational preparation and employment of students with physical and multiple disabilities. Baltimore: Paul Brookes 1991
TROST, R. & SCHüLLER, S.: Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine empirische Untersuchung zur Arbeit von Eingliederungsinitiativen in Donaueschingen und Pforzheim. Walldorf: Integra Verlag 1992
TROST, R. (HRSG.): Wege zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit geistiger Behinderung. Bericht einer Fachtagung der Universität Tübingen in Blaubeuren 09./10. April 1992. Karlsruhe: Landschaftsverband Baden 1993
TROST, R.: Bericht zur ersten Konferenz der Europäischen Union für Supported Employment (EUSE) 16./17. Mai 1994 in Rotterdam. Tübingen: Forschungsstelle Lebenswelten behinderter Menschen, 1994
VEREINTE NATIONEN: Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993. Rahmenbestimmung für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte. Bonn BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG (HRSG.), 1995.
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY (VCU): National Marketing Initiative Fact Sheets (Part 1-3). National supported employment data for the fiscal year 1993. Virginia: Rehabilitation Research and Training Center on Supported Employment, Virginia Commonwealth University 1995
VON LüPKE, K.: Nichts Besonderes. Zusammen-Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung. Essen: Klartext Verlag, 1994
WEHMAN, P., SALE, P., PARENT, W.: Supported Employment. Strategies for Integration of Workers with Disabilities. Stoneham, MA, USA: Butterworth-Heinemann, 1992
WERKSTATT BREMEN: Qualifizierung mit Behinderung. Neue Wege auf alten Pfaden. Bremen: Werkstatt Bremen 1996
Stefan Doose hat 1994/95 an der University of Oregon in den USA Behindertenpädagogik mit dem Schwerpunkt "Supported Employment" studiert und ist jetzt Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e. V. (BAG UB). Dies ist der bundesweite Zusammenschluß der Integrationsfachdienste, Initiativen und engagierten Personen in Deutschland.
Adresse:
Fuhlsbüttler Str. 402, D-22309 Hamburg
Tel.: +49 40 6399629 (mittwochs), FAX: +49 40 6325496
[3] Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
[4] LAG Eltern für Integration 1992
[5] Stand Schuljahr 96/97: Für das nächste Schuljahr sind 6 neue Standorte für Integrationsklassen beschlossen worden, telefonische Auskunft des Beratungszentrums Integration, Hamburg 3.2.97
[6] ausführlicher Bericht über eine integrative Berufsvorbereitungsklasse, Krohn 1996
[7] ausführlicher Bericht über den integrativen Förderlehrgang, Sturm/ Glenz 1996
[8] ausführlicher Bericht über das ambulante Arbeitstraining, Behncke 1996, Hamburger Arbeitsassistenz 1995
[9] Behncke, Ciolek (in Druck), Behncke, Ciolek, Körner 1993
[10] Vereinte Nationen 1993
[11] Grundlagenliteratur: Bellamy, Rhodes, Mank, Albin 1987, Powell u.a. 1990, Wehman/Sale/Parent 1992, Hagner & DiLeo 1993, DiLeo& Langton 1996 - es gibt mittlerweile einige deutschsprachige Artikel zur Entwicklung von Supported Employment in den USA: Sale 1994, Perabo 1993, Schartmann 1995, Gehrmann 1995, Barlsen & Bungart 1996, Junker 1996a.
[12] Heiden 1996
[13] Rehabilitation Act Amendments 1992
[14] Europäische Kommission 1996
[15] Europäische Kommission 1996, 9
[16] Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Behinderten 1995
[17] People First 1995, Göbel 1995
[18] Kontaktadresse: ISL - People First, Susanne Göbel, Jordanstr. 5, 34117 Kassel, Tel. 0561 72885-46 (Mi. 17-19 Uhr)
[19] vgl. Trost 1994, Helios 1996, S.9
[20] vgl. Powell u.a. 1990, Wehman u.A. 1992, für Deutschland: Horizon 1995, Klammer 1995
[21] vgl. Trost 1994
[22] zusammenfassend Wehman & Kregel 1994, Mank 1994
[23] VCU 1995
[24] Wehman / Sale/ Parent 1992
[25] Mank, Cioffi, Yovanoff 1996,
[26] VCU 1995
[27] Kiernan u.A. 1994
[28] Schüller 1993
[29] Trost/Schüller 1992, Schön 1993, Horizon 1995, Überblick s.a. Dalferth 1995, Behncke 1996
[30] Bundesverband für Körper und Mehrfachbehinderte 1994
[31] siehe auch Projekt Berufliche Integration 1995, Werkstatt Bremen 1996
[32] erste Ergebnisse s. Barlsen & Bungart 1996,
[33] vgl. ähnlich Fallbeispiele bei Junker 1996b
[34] Doose 1995, 1996a
[35] Doose 1995, 1996a
[36] vgl. ähnlichen Befund Arbeitsgemeinschaft der Hauptfürsorgestellen 1996, S.9
[37] Mank./Cioffi/Yovanoff 1996, Doose 1995
[38] vgl. Doose/Mank 1996
Inhaltsverzeichnis
Die Herausgeber
Die Tagung "INTEGRATION 2000" im Mai 1996 ließ die Fortschreibung der Integration in die Arbeitswelt möglich erscheinen. Was hat sich seitdem verändert? Was hat sich weiterentwickelt? Wie wird es weitergehen? Den "Großen Sprung" gab es natürlich nicht, aber viele kleine Zeichen. In Zeiten herber Einschnitte in das soziale System ist es schon ein Fortschritt, daß Integration nicht in Frage gestellt wird, sondern im Gegenteil Politiker, Betriebe, Arbeitgeber, Arbeitsverwaltung und Schulbehörde sich während der Tagung diesen Fragen in der Diskussion stellten und ernsthaft nach Lösungen suchten.
Unbestritten scheint sich auf allen gesellschaftlich relevanten Ebenen die Erkenntnis durchzusetzen, daß sich ein moderner, zukunftsorientierter Staat auch in Zeiten knapper werdender Ressourcen nicht weiter dem Thema gesellschaftliche Integration geistig behinderter Menschen entziehen kann. Ausgrenzung, Aussonderung und Verdrängung haben nach jahrzehntelangem Schweigen keinen Platz mehr in der öffentlichen Diskussion, zumal auch im europäischen Ausland gerade der Umgang mit geistig behinderten Menschen, deren Recht auf Selbstbestimmung, Arbeit und Wohnen mittlerweile selbstverständlicher ist als in Deutschland.
Heute geht es um das "WIE" in der Integration und nicht mehr um das "OB":
-
Wie kann Integration flächendeckend in Kindergärten und Schulen gewährleistet werden?
-
Wie kann Integration nach der allgemeinbildenden Schule fortgesetzt werden?
-
Wie läßt sich die Integration in die Arbeitswelt bewerkstelligen?
-
Wie muß die Wohnsituation geistig behinderter Menschen diesen Veränderungen angepaßt werden?
-
Wie teuer ist Integration?
Die GG-Änderung des Artikel 3: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" gilt seit 1994, hat aber eine besondere Bedeutung im letzten Jahr erlangt, als sich ein Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 30.07.96 darauf gestützt hat und damit einer behinderten Schülerin ihr Recht auf Integration in einer Gesamtschule zugesprochen hat Dieses Urteil ist insofern bemerkenswert, weil es exemplarisch im konkreten Fall die Benachteiligung aufhebt. Noch geht es um die allgemeine Schulbildung. Eine Übertragung auf die Berufsausbildungschancen und die gleichwertigen Chancen im Berufsleben sind zu erwarten.
Auf schulischer Ebene haben sich die Veränderungen im neuen Hamburger Schulgesetz von 1997 niedergeschlagen. Integration wird als übergeordneter Grundsatz aufgestellt: "Das Schulwesen ist so zu gestalten, daß die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen in größtmöglichem Ausmaß verwirklicht werden können. ..." (§3.1) und in §3.3 heißt es, "Unterricht und Erziehung sind auf Ausgleich von Benachteiligungen und auf die Verwirklichung von Chancengleichheit auszurichten." Im Aufbau des Schulwesens wird in §12 die Integration als gesetzlich ermöglichte Form festgeschrieben: "Mit der Einrichtung von Integrationsklassen, Integrativen Regelklassen und individuellen Integrationsmaßnahmen werden die organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen für eine integrative Erziehung ... geschaffen."
Auf gewerkschaftlicher Ebene stellt das DGB-Grundsatzprogramm von 1996 die Integration Behinderter und ihren Schutz vor beruflicher Ausgrenzung als notwendige Aufgabe der zukünftigen Sozialpolitik hin.
Auf politischer Ebene sind in Hamburg erste Weichen gestellt worden, die berufliche Integration geistig behinderter Menschen im Rahmen der "Unterstützten Beschäftigung" auszuweiten. Neben den 2500 Arbeitsplätzen in Werkstätten für Behinderte sind nun auch im Rahmen der "Unterstützten Beschäftigung" 100 dauerhaft begleitete Arbeitsplätze in Betrieben geschaffen worden.
Behinderte Menschen machen einen wichtigen Teil der Gesellschaft aus (ca. 10% schwerbehinderte Menschen leben in der BRD), so daß ihre Probleme und Bedürfnisse beständig in das öffentliche Bewußtsein gerückt werden müssen. Das GG "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" und das internationale Diskriminierungsverbot von Behinderten fordern öffentliche Einrichtungen, Schulen und Betriebe auf, ihren möglichen Anteil zur Integration beizutragen.
Durch das Engagement Betroffener, Eltern und Freunde von Betroffenen haben Kindergärten, Schulen, Behörden und einzelne Betriebe sich ihrer sozialpolitischen Aufgabe gestellt und zu einer Verbesserung der beruflichen Chancen von Menschen mit geistiger Behinderung beigetragen. Die Integration in Schulen und Betrieben hat gezeigt, daß die Akzeptanz gegenüber behinderten Menschen zunimmt und die Bereitschaft zur sozialen Integration wächst. Die Einsicht, Solidarität mit Menschen zu üben, die ein gleiches Bedürfnis nach Kommunikation und gesellschaftlicher Anerkennung haben, selbstbestimmt leben wollen, wächst mit den Kontakten vor Ort.
Die Reduzierung von Einrichtungen, in denen es zu Problemzentralisierung zwangsläufig kommt (Sonderschule, WfB) hin zur Verteilung der Probleme durch Dezentralisierung (Integrationsklassen, Unterstützte Beschäftigung) ist aus sozialem/kollegialem Interesse bedeutend und findet auch aus schul- und arbeitsmarktpolitischer Sicht ihre Legitimation. Das heißt nicht, daß man auf Sondereinrichtungen verzichten kann. Sondereinrichtungen behalten ihre wichtige Funktion, sie werden auch in naher Zukunft einem großem Anteil behinderter Menschen eine sichere Lebensperspektive bieten. Aber sie müssen sich ebenso der Forderung stellen, daß es außerhalb ihrer Einrichtungen Chancen für diejenigen gibt, die andere Arbeits- und Lebensformen wünschen. Die Angst, daß die "Starken" die Sondereinrichtungen verlassen, um in integrative Maßnahmen zu gehen, ist dabei sicherlich berechtigt, kann aber nicht dazu führen, den behinderten Menschen eine Wahlmöglichkeit vorzuenthalten.
Seit 1993 die ersten geistig behinderten Menschen die Gesamtschule verließen, sind in der Folge in Hamburg verschiedene Möglichkeiten entstanden, einen integrativen Weg in die Arbeitswelt zu gehen. Wie der Weg in die Arbeitswelt beschritten werden kann, veranschaulicht folgende Grafik:
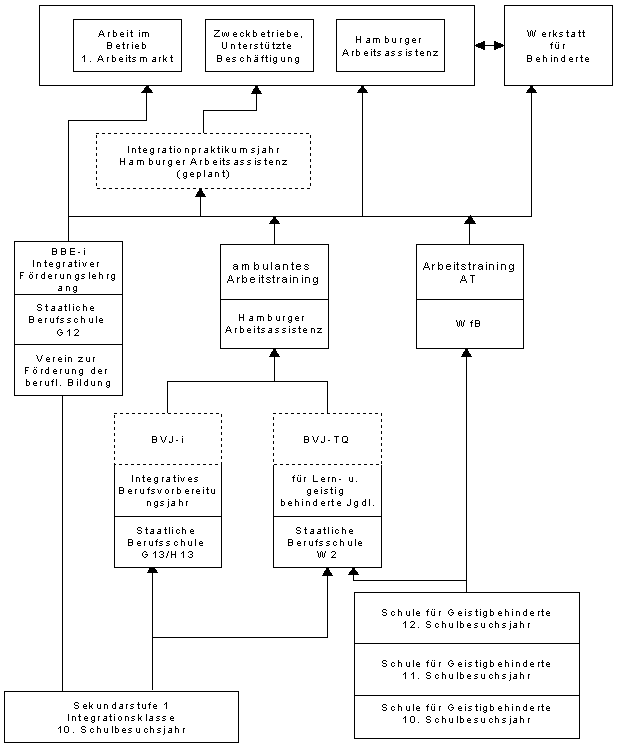
Es wird deutlich, daß die Vielfalt der integrativen Wege für sehr unterschiedliche Organisationsformen und Abläufe sorgt. So führt der direkte Weg nach der Integrationsklasse über den BBE-i schon nach drei Jahren in die Betriebe, während alle anderen Wege über das BVJ oder nach der Sonderschule vier bis fünf Jahre beanspruchen. Wie kann betriebliche Integration gelingen?
Bei Überlegungen, das Kompetenzprofil eines geistig behinderten Menschen mit dem Anforderungsprofil eines bestimmten Arbeitsplatzes zur Deckung zu bringen, wird oft Gefahr gelaufen, den Stellenwert der erforderlichen Fachkompetenzen zu über- und die Bedeutung der notwendigen Sozialkompetenzen zu unterschätzen.
Ausgehend von den Erfahrungen der Hamburger Arbeitsassistenz und dem Integrativen Förderungslehrgang hängt die Frage, ob es zur beruflichen Eingliederung eines Arbeitnehmers mit Behinderung kommt, in vielen "Fällen" davon ab, ob es gelingt, die Sozialkompetenzen zu erwerben, die bei Menschen ohne Behinderung als selbstverständlich vorausgesetzt werden:
-
Umgangsformen im Betrieb kennen
-
Distanz aushalten können (Kollegen von Freunden unterscheiden können)
-
Hierarchische Strukturen durchschauen und akzeptieren
-
Sich in die Rolle des Praktikanten finden
-
Verschiedene Wege, Konflikte zu lösen kennen und nutzen
-
Bewußtsein dafür erhalten, daß es außer den Fachkompetenzen noch anderes zu lernen gilt
-
Phasen hoher Arbeitsdichte von Phasen niedriger Arbeitsdichte unterscheiden können, entsprechend Kräfte einteilen
-
Auch unbequeme Kollegen aushalten können
-
Anweisungen befolgen, akzeptieren
-
Stimmungen im Betrieb wahrnehmen und, wenn von der eigenen abweichend, auch aushalten können; spüren, wann Zurückhaltung angemessen ist
-
Aushalten können, wenn Kollegen "anders" sind, nicht versuchen, sie zu verändern
-
Erkennen, daß es klug sein kann, auch etwas zu tun, was nicht in unmittelbarem Zusammenhang zur Arbeit steht und zu dem man keine Lust hat: z.B. Teilnahme an einem Betriebsausflug (Erwartungen spüren)
-
Beobachten, wie sich andere Kollegen im Betrieb verhalten
-
Balance finden zwischen Abschottung und Aufdringlichkeit
-
Wissen, daß die Tatsache, daß niemand schimpft nicht gleichbedeutend sein muß mit "alles bestens"
-
Akzeptieren, daß Arbeit nicht immer Spaß macht
-
Kritik annehmen und aushalten können
Herr K. arbeitet in einem Modellbaugeschäft. Die Arbeit im Lager stellt ein komplexes Tätigkeitsfeld dar, welches eine hohe Fachkompetenz erfordert. Es gelingt Herrn K., sich diese Lagerkompetenzen anzueignen:
-
Die Aufnahme von Kundenbestellungen und die Zuordnung zu den jeweiligen Artikeln
-
Die Warenweitergabe per Postversand
-
Die Warenannahme, Überprüfung der Warenmenge und Warenart anhand der Lieferscheine
-
Die Etikettierung der Ware und Einsortierung in das Warenlager
In der ersten Phase des Praktikums hat Herr K. auch Kundenkontakt. Bedingt durch seine autistischen Züge kommt es hier zu Konflikten, da die hohe Sozialkompetenz, die Voraussetzung für Kommunikation mit Kundschaft ist, von Herrn K. nicht mitgebracht wird. In der Folge arbeitet Herr K. deshalb ausschließlich im Lager, wo seine Stärke (hohe Fachkompetenz) auch für den Betrieb zum Tragen kommt.
Ungeachtet dessen gilt es - nicht zuletzt im Interesse eines guten Betriebsklimas - Herrn K. beim Erwerb und Ausbau von Sozialkompetenzen durch die Arbeitsassistenz weiterhin zu unterstützen. Parallel hierzu werden seine Mitarbeiter darin geschult, mit ihm angemessen umzugehen. Unterschiedliche Kommunikationsmuster werden aufgezeigt, damit Herr K. und seine Kollegen "sich in der Mitte treffen" können. Eine Qualifikation beider Seiten findet statt. Als ein Beispiel soll der Chef des Modellbaugeschäts dienen, dem es heute gelingt, weniger hektisch auf Herrn K. zuzugehen: Wie auch seine Angestellten hat er sich langsam verändert.
Das Beispiel zeigt, daß bei der beruflichen Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung der Aneignung sozialer Kompetenzen eine große Bedeutung zuzumessen ist. Dabei gilt es, eine Vernachlässigung der fachlichen Unterstützung zu vermeiden, da Fach- und Sozialkompetenzen nicht isoliert voneinander zu sehen sind, sondern miteinander harmonieren sollten.
Wie teuer ist Integration?
Noch immer ist in der politischen Diskussion festzustellen, daß der Aufbau bzw. der Ausbau der Integrationsfachdienste unter der Prämisse der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung betrachtet wird. Um der Frage nachzugehen, ob dem so ist, hat die Hamburger Arbeitsassistenz (im folgenden HHAA abgekürzt) untersucht, in welchem Verhältnis ihr finanzieller Mitteleinsatz zu den Kosteinsparungen steht, die durch die berufliche Integration in unterstützte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entstehen. In der Untersuchung wurde diese Fragestellung weiter ausdifferenziert:
-
Welche Kostenträger werden belastet und welche Kostenträger werden entlastet durch den Ansatz der Unterstützten Beschäftigung?
-
Wie sieht die Kostenbilanz für die Unterstützte Beschäftigung aus?
Der Untersuchung liegt die Auswertung aller im Zeitraum von 1992 bis zum März 1997 durchgeführten Praktika und Unterstützten Arbeitsverhältnisse zugrunde unter Berücksichtigung
-
des finanziellen Mitteleinsatzes der unterschiedlichen Kostenträger für jedes unterstützte Praktikums- bzw. Arbeitsverhältnis und
-
der daraus resultierenden Ersparnisse unterschiedlicher Kostenträger aufgrund der beruflichen Integration.
Die Erhebung unter dem oben genannten Kostengesichtspunkt erfolgte auf Grundlage der Auswertung von
-
durchgeführten unterstützten Praktika und
-
unterstützten Arbeitsverhältnissen.
Die Untersuchung zeigt, daß der finanzielle Mitteleinsatz für die HHAA bereits nach einem Zeitraum von ca. 4,5 Jahren durch entsprechende Mitteleinsparungen unterschiedlicher Kostenträger ausgeglichen wird. Ferner ist innerhalb des fünfjährigen Untersuchungszeitraums sukzessiv positivere Bilanz der Kosten festzustellen.
Unter Einbeziehung des finanziellen Mitteleinsatzes und der Einsparungen aller Kostenträger sind bereits nach knapp dreijähriger Tätigkeit des Fachdienstes positive Monatsbilanzen zu verzeichnen.
Die positive Kostenbilanz der HHAA ist insbesondere darauf zurückzuführen, daß für jedes unterstützte Arbeitsverhältnis in der Anfangsphase zwar ein relativ hoher finanzieller Mitteleinsatz erforderlich ist, dem jedoch in relativ kurzer Zeit bereits entsprechende Einsparungseffekte gegenüberstehen[39] .
Der immer noch vertretenen Position, den finanziellen Mitteleinsatz für die HHAA bzw. für die Integrationsfachdienste allgemein als einen zusätzlichen Mitteleinsatz zu bewerten, stehen die Untersuchungsergebnisse klar entgegen.
Das Ergebnis der Untersuchung weist nach, daß das politische Ziel, die Chancen der Menschen mit einer Behinderung bei der beruflichen Integration zu verbessern, durch den Ansatz der unterstützten Arbeitsverhältnisse nicht mit den Anforderungen zur Einsparung öffentlicher Haushaltsmittel kollidiert.
Wenn man die Arbeitsplatzsituation geistig behinderter Menschen verändern will, muß man sich gleichzeitig mit Ihrer Wohnsituation beschäftigen. Hier hat sich in vielen Wohngruppen die Betreuung längst auf individuelle Modelle eingestellt. Zum Beispiel lassen sowohl die Wohngruppen des Vereins "Leben mit Behinderung" in Hamburg als auch die Wohngruppen der "Lebenshilfe" in Schenefeld bei Hamburg unterschiedliche Arbeitszeiten ihrer Bewohner zu.
Einige Bewohner arbeiten in einer WfB, andere werden zu Tagesförderstätten gebracht, wenige arbeiten auf dem Freien Markt und manche bleiben auch den ganzen Tag über in der Wohngruppe.
Auch in der "Lebenshilfe" gibt es Bewohner, die zu unterschiedlichen Zeiten abwesend sind, z.B. auch Jugendliche in der Ausbildung. Voraussetzung für diese ist allerdings die Fähigkeit, den Arbeitsweg selbständig zu schaffen und auch ohne Hilfe rechtzeitig zur Arbeitszeit die Wohnung zu verlassen. Jede/r verfügt über einen Schlüssel und kann unabhängig gehen und kommen. Im individuellen Fall besteht eine große Bereitschaft, auf besondere Bedingungen einzugehen. Auch teilzeitarbeitende Menschen können in den Wohngruppen betreut werden.
Die "Lebenshilfe" versucht gleichzeitig, andere Wohnformen vorzubereiten, wie zunächst ambulantes Wohnen und schließlich auch selbständiges Wohnen.
Sicher sollte man offen zugeben, daß diese Flexibilität jetzt gerade noch mit dem eingestellten Personal zu leisten ist, daß aber bei erheblich mehr Arbeitenden auf dem Freien Markt, die durchaus noch nicht gänzlich ohne Betreuung leben können, die Anzahl der Betreuer sicher erhöht werden müßte. Es gibt immer Zeiten, in denen kein Personal anwesend sein muß, es sei denn in den Wohngruppen, in denen Einzelne den ganzen Tag zu Hause sind.
Zukunftsweisend sind die Überlegungen zu veränderten Wohnformen, die sowohl integrative Modelle als auch das Zusammenwohnen verschieden behinderter Menschen, die sich gegenseitig stützen können, ausprobieren. Die Wohnsituation geistig behinderter Menschen scheint sich in mancher Hinsicht schon auf die Integration in den Arbeitsmarkt verändert zu haben.
Es hängt also alles von der Bereitschaft aller Betroffenen ab, den Weg in die Arbeitswelt für geistig behinderte Menschen zu öffnen:
-
Von der grundsätzlichen Bereitschaft der Betriebe, mit Hilfe der Fachdienste individuelle Arbeitsplätze bei sich zu entdecken.
-
Von der Bereitschaft der Mitarbeiter in den Betrieben, sich auf die Zusammnearbeit mit geistig behinderten Menschen einzulassen.
-
Von Lern- und Qualifizierungsmöglichkeiten für geistig behinderte Menschen.
-
Von den zuständigen Kostenträgern, Kosten zu übernehmen oder umzuverteilen.
-
Von den verantwortlichen Politikern, die grundsätzlichen Ideen in die Realität umzusetzen.
-
Von dem Mut und Ideenreichtum aller derer, die Integration nicht nur für eine Utopie halten sondern für eine realistische Vision.
Mit dem Ziel, vielfältige Anregungen zu schaffen, haben wir diesen Sammelband herausgegeben und verknüpfen damit die Erwartung, Dialoge auf allen Ebenen in Gang zusetzen!
Quelle:
Hartmut Schulze, Hartmut Sturm, Uta Glüsing, Frank Rogal, Monika Schlorf (Hrsg.): Schule, Betriebe und Integration. Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt. Beiträge und Ergebnisse der Tagung INTEGRATION 2000 am 30./31. Mai 1996 in Hamburg
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 11.02.2005
[39] vgl.: Analyse des finanziellen Mitteleinsatzes und der Einsparungen, Studie der Hamburger Arbeitsassistenz 1997
