Dargestellt an einem Vergleich zwischen Integrationsfachdiensten in Deutschland und der Arbeitsassistenz in Österreich.
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der "Philosophie" an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, im April 2005
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- I Vorwort
- II. Relevanz des Themas
- III. Beschreibung des Forschungsvorhabens
- IV. Aufbau der Arbeit
- A. Theoretischer Teil
- 1. Unterstützte Beschäftigung
-
2. Rahmenbedingungen für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung
- 2.1.Die Sozial- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union
- 2.2. Die Sozial- und Behindertenpolitik in Österreich und Deutschland
- 2.3. Das System der beruflichen Rehabilitation und Integration in Österreich und Deutschland
- 2.4. Rechtliche Grundlagen der Arbeitsassistenz in Österreich und der Integrationsfachdienste in Deutschland
- 2.5.Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland: Daten und Fakten
- 2.6. Zusammenfassung
-
3. Typologie und Arbeitsweise der Arbeitsassistenz und der Integrationsfachdienste
- 3.1.Rollen und Aufgaben der Fachkräfte
- 3.2. Typologien und Selbstverständnisse von Fachdiensten
- 3.3. Phasen- oder Prozessverlauf der beruflichen Integration
- 3.4. Erste Phase: Klärung der Ausgangssituation, Berufsorientierung und Fähigkeitsanalyse
- 3.5. Zweite Phase: Akquisition von Betrieben mit geeigneten Arbeitsplätzen
- 3.6. Dritte Phase: Vorbereitung auf die Arbeitsaufnahme und Vermittlung sowie betriebliche Qualifizierung
- 3.7.Vierte Phase: Nachbetreuung - Arbeitsplatzbezogene und Arbeitsbegleitende Unterstützung, Krisenintervention
- 3.8. Zusammenfassung
-
4. Evaluationsstudien und Forschungsarbeiten
- 4.1.Erfolgsbestimmung in der beruflichen Integration
- 4.2. Methodische Grundlagen der Evaluation von Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation
- 4.3. Vergleich zentraler Forschungsergebnisse aus Evaluationsstudien - Forschungsstand
-
4.4. Forschungsarbeiten zum Thema Qualität und Qualitätskriterien
- 4.4.1. Fasching (2003): "Qualitätskriterien in der beruflichen Integrationsmaßnahme Arbeitsassistenz unter besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen mit Lernbehinderung"
- 4.4.2. Giedenbacher, Stadler-Vida, Strümpel (2003): QUIP - Quality in Practice: "Die Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der Beteiligten".
- 4.4.3. Bungart, Supe, Willems (2000): "Qualitätssicherung und -entwicklung in Integrationsfachdiensten".
- 4.5. Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration
- 4.6. Zusammenfassung
-
5. Die Qualitätsforschung und -diskussion in Behindertenhilfe und sozialer Arbeit
- 5.1. Ursprung und Begründungszusammenhänge der aktuellen Qualitäts-diskussion in der Behindertenhilfe
- 5.2. Der Qualitätsbegriff - unterschiedliche Sichtweisen
- 5.3 Pädagogische Dimensionen von Qualität - normative Grundlagen und Leitbildprinzipien
- 5.4. Zur Rolle der relevanten Anspruchsgruppen: NutzerInnen, Kostenträger und Leistungsanbieter
- 5.5. Qualitätssicherung und Erfolgsmessung in der Behindertenhilfe - Begründung und Methoden
- 5.6. Anforderungen an ein QM - System in sozialen Handlungsfeldern
- 5.7. Zusammenfassung
-
6. Qualitätsmangement und QM - Systeme in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen
- 6.1. Begriffliche Klärung und allgemeine Grundlagen von Organisationsentwicklung, "lernender Organisation", Qualitätsmanagement, und "Total Quality Management" (TQM) aus systemtheoretischer Sicht
- 6.2. Zur Notwendigkeit von Qualitätsmanagement sowie qualitätssichernder Maßnahmen in der beruflichen Integration
- 6.3. Vorstellung allgemeiner QM - Systeme aus dem Bereich der Wirtschaft
-
6.5. Überblick über speziell für den Bereich der beruflichen Integration entwickelter QM - Systeme und Instrumente
- 6.5.1. Das QUIP (Quality in Practice) Evaluationshandbuch
- 6.5.2.MUQ - Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste
- 6.5.3. KASSYS - Kasseler Systemhaus - Qualitätsmanagement Referenzmodell zur psychosozialen Betreuung nach dem Sozialgesetzbuch
- 6.5.4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Modelle
- 6.6. Zusammenfassung
- B. Empirischer Teil
- 7. Darstellung der Erhebungs- und Auswertungsmethode
-
8. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
- 8.1.Überschrift: Hintergrund und Erfahrungen der InterviewpartnerInnen
- 8.2. Überschrift: Einstellungen und Werthaltungen
- 8.3. Überschrift: Rahmenbedingungen
- Überschrift: Motive für die Qualitätsdiskussion
- 8.5. Überschrift: Qualitätsverständnis und Kriterien
- 8.6.Überschrift: Stärken und Schwächen
- 8.7. Überschrift: Nachhaltigkeit
- 8.8. Überschrift: Qualitätsmanagementsysteme
- 8.9. Überschrift: Benchmarking
- Überschrift: Zukunft von Unterstützter Beschäftigung
- 8.11.Zusammenfassung
- 9. Ausblick und Formulierung des weiteren Forschungsbedarfs
- 10. Literatur und Bibliographie
- C.ANHANG
-
(I).Nützliche Links
- (1).Forschungseinrichtungen mit Informationsressourcen zu den Schwerpunkten Behinderung und Berufliche Integration:
- (2).Institutionen im Bereich der beruflichen Integration (Auswahl):
- (3).Nationale und Internationale Dachverbände mit zum Teil sehr umfangreichen Informationsressourcen:
- (4).Öffentlich-rechtliche Institutionen in Österreich und Deutschland mit zahlreichen Informationsressourcen:
- (5).Informationsressourcen und Volltextzugriffe zu den Themen berufliche Ausbildung und Integration von Menschen mit Behinderung:
- (6).Informationsressourcen über die Sozial und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union:
- (7).Internetressourcen über die Gemeinschaftsinitiative EQUAL inkl. der Entwicklungspartnerschaften in Österreich und Deutschland, sowie andere EU Programme:
- (II).Lebenslauf
- (III).Inhalt des Materialbandes
- (IV).Erklärung:
- Abkürzungsverzeichnis
Ich möchte mich an dieser Stelle bei folgenden Personen, die mich bei der Fertigstellung meiner Diplomarbeit in praktischer und emotionaler Art und Weise unterstützt haben bedanken:
Univ. Ass. Dr.In Helga Fasching für die engagierte und kompetente Betreuung und Begleitung der Diplomarbeit.
Rolf Behncke, Jörg Bungart, Stefan Doose, Dr.In Angelika Fritzer, Walter Lackner, Dr.In Karin Rossi, Dr. Dieter Schartmann und Mag. Michael Stadler-Vida dafür, dass sie mir äußerst interessiert und kollegial für ein Interview zur Verfügung gestanden sind. Bei diesen Personen möchte ich mich besonders bedanken: Dr.In Karin Rossi für die Einladung zur Dachverbandstagung, Walter Lackner und Michael Stadler-Vida für die Einladung zur Tagung nach Schladming, sowie für viele interessante Gespräche im Rahmen unseres leider gescheiterten EQUAL Projektes, Dr. Dieter Schartmann für die umfangreiche Literatur die er mir zur Verfügung gestellt hat und Stefan Doose für die vielen Artikeln und die kompetente Rückmeldung auf meine Arbeit.
Regina Buchinger, Stefanie Hiller, Helga Neira, Elke Schweiger und Mag.a Christina Tsohohey für unzählige Rückmeldungen und Korrekturlesen dieser Arbeit.
Helga Neira und Helga Keil für ihr Vertrauen in meine professionellen Fähigkeiten.
Meiner Mutter Ernestine Koenig und meiner Schwester Michaela Koenig, wegen denen ich wahrscheinlich überhaupt erst dieses Studium angefangen habe.
Eva Auer, Christina Tsohohey, Thorsten Gegenwarth, Stefanie Hiller, Olivia Prinz, Dominiko Racek, Haymo Rungger und Daniela Schmidt für besonders inspirierende, herausfordernde und wertvolle Freundschaften.
Sowie allen Personen die mich ein Stück oder länger meines bisherigen Weges begleitet haben und die hier nicht namentlich erwähnt sind. Danke
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem derzeit im gesamten Sozialbereich hochaktuellen Thema, und zwar mit Qualität und Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung. Im Mittelpunkt der Betrachtung und Analyse steht der systematische Vergleich zweier für den europäischen Raum als innovativ zu betrachtenden Institutionen und den ihnen zugrunde liegenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen. Dies sind die Integrationsfachdienste in Deutschland sowie die Arbeitsassistenz in Österreich. Der Grund warum ich für einen "Blick über den Tellerrand" gerade Deutschland zum Vergleich gewählt habe, liegt darin, dass aufgrund vieler Parallelen in den Systemen dieser beiden Ländern vielfach Lern- und Transfermöglichkeiten in das jeweils andere System aufgezeigt werden können, genauso wie, dass "von den anderen" bzw. "von den besten" lernen, auch Grundlage moderner und erfolgreicher Qualitätsmanagementansätze wie beispielsweise dem Benchmarking darstellt. Um einem interessierten Leser einen umfassenden Einblick und breiten Überblick über die hier behandelte Thematik zu eröffnen, spannt diese Arbeit einen sehr weiten Bogen, ausgehend von der Beschreibung des diesen Institutionen zugrunde liegenden Konzepts der Unterstützten Beschäftigung bis hin zur Darstellung organisationstheoretischer Grundlagen des Qualitätsmanagements und der Darstellung dafür anwendbarer Systeme. Es wird ein Einblick in die Grundlagen der Evaluation von beruflichen Integrationsmaßnahmen gegeben, als auch Forschungsstudien präsentiert die sich diesem Thema angenommen haben. Nachdem sich die Qualitätsdebatte in diesen Institutionen nicht unabhängig von gesellschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen in der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit entwickelt hat, wird auch dieser Bereich auf seinen Entstehungs- und Begründungszusammenhang untersucht. Die Auswertung von acht ExpertInneninterviews in den beiden Ländern bildet schließlich einen eigenständigen Forschungsbeitrag dieser Diplomarbeit.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird auf eine sensible Sprachweise eingegangen, insofern verwende ich durchgängig (mit Ausnahme von Zitaten) die Bezeichnung "Menschen mit Behinderung" und führe an allen Stellen an denen beide Geschlechter benannt werden, diese auch explizit an.
"Die Begriffe Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sind in verblüffend kurzer Zeit hochaktuelle, um nicht zu sagen, beherrschende Begriffe um die Zukunft Sozialer Arbeit geworden." (Speck 1999a: S.15).
Speck (vgl. 1999b: S.13f) attestiert einen tief greifenden, gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der, ausgehend vom "Mythos des Endes des Sozialstaates", lange Zeit geltende Werte zunehmend in Frage stellt. So auch das Bekenntnis zum Sozialstaat und der gesellschaftlichen Solidarität. Gerade pädagogische Fachkräfte neigten in der Vergangenheit oft zu der Meinung, dass pädagogische Qualität nicht mess- oder bestimmbar sei, sowie dass Konzepte der Evaluation lediglich den Kontrollinteressen der Träger und Geldgeber dienen würden (vgl. Frühauf 2001, S.11). Der Prozess des Umdenkens setzte vielfach erst ziemlich spät ein, so formulierte Feuser anlässlich des PraktikerInnenforums zum Thema "Qualität und Integration" in Linz 2003, es sei "fünf vor zwölf", um Qualitätskonzepte von fachlicher Seite her zu bestimmen, sonst würden diese von anderer Seite aufoktroyiert (vgl. Feuser 2004, S.32ff).
Die Diskussion zum Thema Qualitätssicherung, sofern sie von fachlicher Seite aus geführt wird, birgt allerdings auch viele Chancen. Sie kann einer Qualitätssicherung vorbeugen, die lediglich aus Kostenreduzierungsgründen stattfindet. Durch transparentere Darstellung und Kommunikation von Ergebnissen besteht die Möglichkeit eine Professionalisierung der eigenen Arbeit zu verstärken. (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001b: S.183).
Auf der anderen Seite haben sich, beginnend in den neunziger Jahren, sowohl in Österreich als auch in Deutschland neue ambulante Beratungs- und Unterstützungsangebote gebildet, die ausgehend von einem "Paradigmenwechsel" in der Behindertenhilfe (vgl. Doose 1997: S.6f sowie Doose 2003: S.5) die Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt als zentrale Maßnahme in den Mittelpunkt rückten. Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei auf jene Menschen gelegt werden, denen vorher in der hier vorherrschenden kapitalistischen Leistungsgesellschaft die Werkstatt für Behinderte meist als einzige Alternative zur Verfügung stand (vgl. Jantzen 1992: S.28ff).
Integrationsfachdienste und Arbeitsassistenz setzten seit ihrer Entstehung der vorher starren Landschaft der beruflichen Rehabilitation eine Maßnahme entgegen, die vermehrt auf Individualisierung und Flexibilisierung Wert legte. Von Anfang an mussten sie sich dem strengen und prüfenden Blick der relevanten Fördergeber unterziehen. Nach langer Einarbeitungszeit und zahlreichen Evaluationen ihrer quantitativen Wirksamkeit wurden Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste gesetzlich verankert (im Behinderteneinstellungsgesetz in Österreich sowie im Schwerbehindertengesetz in Deutschland). Beide Maßnahmen, denen jeweils das Konzept der Unterstützten Beschäftigung zugrunde liegt, haben sich somit zu relevanten Elementen des jeweiligen Rehabilitationssystems sowie dem System ambulanter niedrig schwelliger Hilfen für Menschen mit Behinderung entwickelt (vgl. Bungart / Supe / Willems 2000: S.1f).
Qualität und Qualitätssicherung drängen sich bei Integrationsfachdiensten und Arbeitsassistenz ganz besonders auf, da sie wie kaum eine andere Maßnahme im Mittelpunkt öffentlich -rechtlichen Interesses stehen. So formulierte Bungart (2003: S.1.):
"Gerade angesichts einer einseitig geführten Diskussion um Kostenreduzierung ist eine fachlich begründete Diskussion (Hervorhebung durch den Verfasser O.K.) um effektive und effiziente Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie über Chancengleichheit für behinderte und benachteiligte Personen unbedingt erforderlich."
Auch von Seiten der Interessensvertretungen und übergreifenden nationalen Dachverbänden wurde und wird dem Thema viel Platz eingeräumt. So stand sowohl die letztjährige Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung (BAG-UB) im November 2003 in Bad Kissingen, sowie die heuer stattfindende Jahrestagung des Dachverbandes Arbeitsassistenz im März 2004 in Salzburg unter dem Motto Qualität und Qualitätssicherung. Auch auf der 6. Weltkonferenz der European Union of Supported Employment (EUSE) im Mai 2003 in Helsinki wurde das Thema Qualitätssicherung zu einem Arbeitsschwerpunkt der EUSE für die nächsten zwei Jahre erklärt (vgl. Schüller 2003, S.17f).
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass es sich bei dem Thema Qualität und Qualitätssicherung in Institutionen der beruflichen Integration um ein hochaktuelles und brisantes Forschungsfeld handelt. Gerade bei der Debatte um Qualität sehen sich Institutionen vielfältigen und zum Teil konkurrierenden Interessen und Interessensgruppen gegenüber (vgl. Frühauf, 2001, S.13f sowie Fink, 2001, S.36f), deren Ansprüche es in einem funktionierenden Qualitätsmanagementsystem zu integrieren gilt. So steht u.a. von Seiten der Geldgeber der optimale Einsatz der Mittel dem Interesse der Fachleute gegenüber, Art, Umfang und Qualität der Leistung zu verbessern (vgl. Fink, 2001: S.34).
Qualität als relationaler Begriff hat grundsätzlich immer zwei Ausprägungen (eine positive und eine negative), und es gilt diesen Begriff erst mit Inhalt zu füllen. Integrationsfachdienste und Arbeitsassistenz bewegen sich auf einer normativen Ebene, die dem Leitgedanken des Normalisierungs- und Integrationsprinzips folgen. Normative Grundlagen bilden somit die Basis dafür, was als gute Qualität zu verstehen ist (vgl. Metzler / Wacker 2001: S.51ff). Nicht bloß eine Orientierung an Vermittlungszahlen, sondern vor allem auch qualitative Elemente wie Zufriedenheit, Lebensqualität und gesellschaftliche Integration müssen in geeigneten Instrumentarien berücksichtigt werden. Die wissenschaftliche Forschung beteiligte sich in den letzten Jahren auf diesen normativen Grundlagen aufbauend, Qualitätsstandards bzw. Qualitätskriterien aufzustellen, die in einem kooperativen Prozess mit allen am Prozess der beruflichen Integration beteiligten Personengruppen entwickelt wurden (vgl. Bungart u.a. 2000 & 2001c, Fasching 2003 sowie Giedenbacher / Strümpel / Vida 2002 & 2003a). Diese Kriterien haben die Grundlage für fachlich fundierte Qualitätssicherungsinstrumente bzw. -systeme wie das QUIP (Quality in Practice) Evaluationshandbuch bzw. MUQ (Modulsystem unfassendes Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste) gebildet.
Im Rahmen der Diplomarbeit: "Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung. Dargestellt an einem Vergleich zwischen Integrationsfachdiensten in Deutschland und der Arbeitsassistenz in Österreich" wird im theoretischen Teil dieser Diplomarbeit die Bedeutung dieser Thematik nachgezeichnet.
Der empirische Teil der Arbeit wird, ausgehend von der Forschungsfrage:
" Welche Bedeutung haben Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagement-systeme für unterschiedliche Prozessbeteiligte im Rahmen des Prozesses der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland "
mittels ExpertInneninterviews einen eigenständigen wissenschaftlichen Beitrag zur Qualitätsforschung in Institutionen der Behindertenhilfe und Arbeitsmarktintegration liefern. Unter "unterschiedlichen Prozessbeteiligten" (Stakeholder) verstehe ich unterschiedliche Interessensgruppen, die am Prozess der beruflichen Integration beteiligt sind. So habe ich bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen (=ExpertInnen), wie aus der Tabelle auf S.165 entnommen werden kann, darauf geachtet, dass sowohl RepräsentantInnen der Hauptinteressensvertretungen, VertreterInnen relevanter öffentlich - rechtlicher Körperschaften, LeiterInnen von Integrationsfachdiensten bzw. Arbeitsassistenz-einrichtungen sowie Personen vertreten sind, die sich wissenschaftlich mit Fragen der Qualität in Institutionen der beruflichen Integration beschäftigt haben. Im Interviewleitfaden wurden Fragen zu den unterschiedlichen Qualitätsebenen berücksichtigt, wie sie von Donabedian (1982) in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität aufgeteilt wurden (vgl. u.a. Meinhold 1998, S.26f; Bungart / Supe / Willems 2001, S.26; Metzler / Wacker 2001, S.58f; Fasching 2003, S.105). Außerdem liegt ein Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration.
Inhaltsverzeichnis
Die Diplomarbeit ist grundsätzlich in einen theoretischen und einen empirischen Teil aufgeteilt.
Im ersten Kapitel der Diplomarbeit wird zunächst das Konzept "Unterstützte Beschäftigung" (Supported Employment) als das normative und theoretische Grundgerüst von sowohl Arbeitsassistenz als auch Integrationsfachdiensten vorgestellt. Dabei ist auch der historischen Darstellung der Entstehung von Arbeitsassistenz in Österreich und den Integrationsfachdiensten in Deutschland Platz gewidmet.
Gerade in Zeiten in denen einer der Hauptantriebe der Qualitätsdebatte die schon angesprochene Ressourcenknappheit öffentlicher Mittel darstellt, kommt den gesetzlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten eine erhebliche Bedeutung zu. Im zweiten Kapitel möchte ich zunächst einen kurzen Überblick über bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen sowohl für den Bereich der beruflichen Rehabilitation im Allgemeinen als auch für Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste im speziellen in den beiden Ländern geben. Die Rolle der Europäischen Union als relevanten Fördergeber wird auch thematisiert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Arbeitsweise von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten. Der Verlauf der beruflichen Integration wie er in den beiden Maßnahmen angebahnt werden soll, stellt sich idealtypisch in einem aus vier Phasen bestehenden Prozess dar. In diesem Kapitel werden diese einzelnen Phasen thematisiert und die ihnen zugrunde liegenden Konzepte, wie z.B. das Modell der "Persönlichen Zukunftsplanung" vorgestellt. Auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Arbeitsweise zwischen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienst wird näher eingegangen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Untersuchungen zur Evaluation dieser beiden Modelle sowie mit Forschungsarbeiten, in denen Qualitätskriterien für Unterstützte Beschäftigung entwickelt wurden. Es wird auf die Problematik der Erfolgsfeststellung in der beruflichen Integration sowie auf die Schwierigkeit der Darstellung qualitativer Erfolge eingegangen. Ebenso stelle ich erste Ergebnisse einer Untersuchung über die Nachhaltigkeit vom beruflichen Integrationsmaßnahmen (Doose 2004) dar.
Das fünfte Kapitel lenkt den Fokus auf die Qualitätsdiskussion in der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit, aus welcher sich die Qualitätsdebatte in dem Praxisfeld der beruflichen Integration entwickelt hat. Ein Schwerpunkt liegt hier in der Darstellung (bzw. Explizierung) des impliziten normativen Bezugspunktes, der für die Ausgestaltungen von Qualitätsstandards und Qualitätssicherungssystemen unerlässlich ist. Auf die Chancen und Risiken der aktuellen Entwicklung wird dabei ebenso eingegangen werden, wie auf einen Versuch zu bestimmen, was pädagogische Qualität im Unterschied zu wirtschaftlicher Qualität ausmacht. Den Abschluss dieses Kapitels bilden Kriterien, wie sie für ein Qualitätsmanagementsystem in sozialen und pädagogischen Handlungsfeldern erforderlich sind.
Im letzten Kapitel des theoretischen Teils behandle ich das Thema Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration. Nach der begrifflichen Klärung zentraler Termini in der Qualitätsdiskussion, wird ein kurzer Überblick über relevante Qualitätsmanagementmodelle wie DIN-ISO oder EFQM gegeben. Der Hauptteil dieses Kapitels widmet sich der Darstellung von drei Modellen, die speziell für den Einsatz in Institutionen der beruflichen Integration entwickelt wurden.
Im empirischen Teil der Arbeit wird zunächst auf die angewandte Forschungsmethodik eingegangen, dazu wird zunächst die Erhebungsmethode "ExpertInnennterview" vorgestellt, die Auswahl der InterviewpartnerInnen begründet, der Interviewleitfaden dargestellt sowie der eigene Forschungsansatz verortet. Anschließend wird die auf die Auswertungsmethode "interpretative Auswertungsstrategie für Leitfadenorientierte ExpertInneninterviews" nach Meuser und Nagel (2002) eingegangen
Das Hauptkapitel beinhaltet die Darstellung der Ergebnisse der Interviews. Im Anschluss an die Auswertung wird der weitere Forschungsbedarf thematisiert und einige kritische Anmerkungen zur aktuellen Lage von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
Im ersten Kapitel der Diplomarbeit wird zunächst das aus den USA stammende Konzept "Unterstützte Beschäftigung" (Supported Employment) als das normative und theoretische Grundgerüst sowohl von Arbeitsassistenz als auch von Integrationsfachdiensten vorgestellt, auch wenn eine absolute Gleichsetzung dieser Ansätze nicht immer vollzogen werden kann.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG - UB) definiert:
"Unterstützte Beschäftigung (UB) als einen wertegeleiteten, methodischen Ansatz im Bereich der beruflichen Rehabilitation. Diese innovative ambulante Form der beruflichen Integration umfasst alle Hilfen, die für Menschen mit Behinderung erforderlich sein können um erfolgreich in einem Betrieb des regulären Arbeitsmarktes zu arbeiten. Mit dem Konzept Unterstützte Beschäftigung erhalten viele Menschen mit Behinderungen erstmals eine legitime Wahlmöglichkeit außerhalb von Werkstätten für Behinderte (bzw. anderen Sondereinrichtungen) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten[1]".
Weiter heißt es,
"Unterstützte Beschäftigung ist ein kundenorientiertes Modell, das die unterstützte Person in den Mittelpunkt stellt. Kerninhalte von Unterstützter Beschäftigung sind die individuelle Berufsplanung, die Erarbeitung eines individuellen Fähigkeitsprofils für die Suche nach einem passenden Arbeitsplatz, die Arbeitsplatzakquisition selbst, die Arbeitsplatzanalyse, die Anpassung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsplatzanforderungen, die Qualifizierung am Arbeitsplatz und die kontinuierliche Unterstützung der ArbeitgeberIn und der unterstützten ArbeitnehmerIn bei auftretenden Fragen oder Problemen im weiteren Verlauf der Beschäftigung (ebenda)".
Sowie
"Ziel von Unterstützte Beschäftigung ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen für dauerhafte, bezahlte, reguläre Arbeitsverhältnisse für Menschen mit Behinderung - unabhängig von Art und Umfang der Behinderung - in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu schaffen und zu erhalten (ebenda)".
Aus dieser Definition lassen sich bereits sehr viele Wesensmerkmale herauslesen, die auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit im Kontext der Qualitätsdiskussion von Bedeutung sein werden, so z.B.:
-
der Ansatz ambulanter Hilfen bzw. Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
-
die Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten
-
der kundenorientierte Ansatz
-
der methodische Ablauf
-
die Bedeutung von Rahmenbedingungen für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung
Mit dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung geht auch ein Paradigmenwechsel[2] einher den Doose (Hinz 1996, zit. nach Doose 1997, S.6) als
"einen Wechsel von einer Theorie der Andersartigkeit zu einer Theorie der Gleichheit und Verschiedenheit"
beschreibt. Der zentrale Ausgangspunkt von Unterstützter Beschäftigung ist demnach
"Menschen mit Behinderungen als Menschen mit Fähigkeiten zu sehen und durch neue, ambulante Unterstützungsangebote die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, dass sie diese Fähigkeiten auch im Arbeitsleben in regulären Betrieben an der Seite von Nichtbehinderten Kollegen einbringen können." (Doose 1997, S.6)
Gerade das System der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung folgt der Annahme, dass die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt am besten durch spezielle an der Behinderung orientierte Maßnahmen und Einrichtungen erreicht werden kann, bzw. dass Menschen mit Behinderung, wenn sie dauerhafte Unterstützung benötigen, wenn überhaupt, nur in einer entsprechend ausgestatteten WfbM arbeiten können (vgl. Doose 1997, S.6ff)
Für Hohmeier (2001) ist Unterstütze Beschäftigung demnach einerseits im Kontext von Leitbildveränderungen im Bereich der Behindertenarbeit zu sehen, die mit Begriffen wie
"Normalisierung, Integration, Gleichstellung, Kundenorientierung,"
etc. umschrieben werden können, wonach dem Konzept der UB auf konzeptioneller Ebene eine ähnlich handlungsrelevante Bedeutung zukomme wie seinerzeit dem Normalisierungs- oder dem Autonom-Leben Prinzip. Andererseits hat der Mangel an geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsstellen, der rapide Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung, sowie die Verknappung finanzieller Ressourcen im sozialen Bereich auf politischer und administrativer Ebene zwangsläufig dazu geführt, dass die Effektivität des Rehabilitationssystems in Frage gestellt wird (vgl. Hohmeier 2001, S.15ff).
Nach Lynch (1997, S.21) gründet sich das Konzept der Unterstützten Beschäftigung auf fünf (Menschen-)rechten behinderten Personen:
-
"Das Recht auf Achtung der menschlichen Würde (Dignity).
-
Das Recht auf Freiheit der Wahl in allen Lebenslagen (Choices).
-
Das Recht zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und gleichberechtigt am sozialen Geschehen teilzunehmen (Relationship).
-
Das Recht eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen (Contribution).
-
Das Recht integriert in der Ortsgemeinde zu leben. (Ordinary Places)". (vgl. auch Brooke & Wehman 1997)
Unterstützte Beschäftigung definiert sich international über folgende Kernelemente:
-
Integration: Unterstützte Beschäftigung ist nicht auf die Vermittlung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt begrenzt, sondern bemüht sich drüber hinaus Integration in allen Bereichen des betrieblichen Alltags zu fördern.
-
Bezahlte, reguläre Arbeit: Das Ziel Unterstützter Beschäftigung ist die Vermittlung bezahlter, regulärer Arbeit. Nur wenn die für einen Klienten vorgesehene Tätigkeit auch für Menschen ohne Behinderungen akzeptabel ist und von ihnen nicht billiger und effektiver verrichtet werden kann, handelt es sich um reguläre Arbeit. Die Tätigkeit hat den üblichen marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien zu entsprechen, und der Klient soll grundsätzlich die Möglichkeit haben, im gleichen zeitlichen Umfang wie seine Nichtbehinderten Kollegen arbeiten zu können.
-
Erst platzieren, dann qualifizieren: Durch dieses Prinzip wird das gängige Rehabilitationssystem "erst qualifizieren dann platzieren" umgekehrt. Dieser methodische Ansatz gründet sich darauf, dass es insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten oder schweren geistigen Behinderung deutlich schwerer fällt, einmal erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu generalisieren und sie der jeweiligen entsprechenden betrieblichen Realität auch umzusetzen. Durch den Ansatz des "Training on the Job" werden einem behinderten Arbeitnehmer die konkreten Arbeitsanforderungen nach erfolgreicher Platzierung direkt an seinem späteren Arbeitsplatz vermittelt.
-
Unterstützungsangebote für alle Menschen mit Behinderung: Zielgruppe von Unterstützter Beschäftigung sind prinzipiell Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung bisher als nicht vermittlungsfähig galten und intensive individuelle Hilfen benötigen um erfolgreich eine Arbeit finden zu können. Es ist eine Grundüberzeugung des Supported Employment, dass prinzipiell kein behinderter Mensch als zu stark behindert angesehen wird, um nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können.
-
Flexible und individuelle Unterstützung: Unterstützte Beschäftigung umfasst alle Hilfen, die im Einzelfall notwendig sind um erfolgreich in einem Betrieb zu arbeiten. Vor allem die Einarbeitung am Arbeitsplatz verlangt eine radikale Individualisierung der zu leistenden Unterstützung.
-
Keine zeitliche Begrenzung der Unterstützung: In vielen Fällen ist ein Integrationsprozess mit der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und mit einem ambulanten Arbeitstraining nicht abgeschlossen. Ein erheblicher Teil der Klienten von Supported-Employment-Programmen ist zur Verrichtung ihrer Arbeit lebenslang auf weitergehende Unterstützung angewiesen.
-
Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten und Förderung von Selbstbestimmung: Unterstützte Beschäftigung soll die traditionell sehr eingeschränkten Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung hinsichtlich der Art der Arbeit / Tätigkeit sowie der Art der Unterstützung / Assistenz erweitern. (Vgl. u.a. Horizon Arbeitsgruppe 1995, S.23ff; Doose 1996, S.10ff; Doose 1997, S.28f; Adlhoch 1997, S.15ff; Brooke und Wehman 1997, S.7ff; Ginnold 2000, S.158f; Boban und Hinz 2001, S.32ff)
Für Hohmeier (2001) liegen die größten Stärken der Unterstützen Beschäftigung vor allem in
-
"der Überwindung der starren Trennung von beruflicher Qualifizierung und Platzierung
-
in der Entwicklung von methodischen Strategien insbesondere in der Akquisition von Arbeitsplätzen sowie dem "Training on the Job" und
-
in Chancen der Kooperation und Vernetzung mit den anderen Elementen des Rehasystems." (Hohmeier 2001, S.22)
Unterstützte Beschäftigung wurde in den USA in der Folge von Bürgerrechtsbewegungen für die Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Ausgehend von unterschiedlichen Entwicklungslinien, wie auch später nachgezeichnet werden wird, sowie zahlreichen Modellprojekten hat sich das Konzept der Unterstützen Beschäftigung international bei Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsformen bewährt. Die Möglichkeit Menschen mit einer Behinderung durch individuelle Unterstützung und Begleitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, hat sich als ein erfolgreicher Weg bewiesen für:
-
Menschen mit Lernschwierigkeiten[3], sowie Menschen mit einer "schweren" geistigen Behinderung
-
Menschen mit psychischen Behinderungen
-
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen
-
Menschen mit Autismus
-
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen (vgl. Doose 1997, S.29)
Auch wenn im Laufe dieser Arbeit keine umfassende Erörterung des Behinderungsbegriffs erfolgen soll, so möchte ich doch an dieser Stelle kurz auf den Wandel des Behinderungsbegriffs eingehen wie er sich auch in der "International Classification of Functioning, Disabilities and Health" (ICF), der Neufassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2001 ausdrückt. Diese überarbeitete Version der alten ICIDH lehnt sich noch stärker an eine ökosystemische Sichtweise von Behinderung an, wie sie etwa von Sander (1988) vertreten wird.
"Ein solcher Behinderungsbegriff hat den Vorteil, dass er den Blick unmittelbar auf den Prozess der Integration des betreffenden Menschen in sein konkretes Umfeld lenkt und damit pädagogische Handlungsmöglichkeiten eröffnet." (Sander 1988 zitiert nach Niehaus 2000, S.325f)
Die ICF sieht die Behinderung einer Person einerseits durch die Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen sowie andererseits durch Beeinträchtigungen der Aktivität und Partizipation (Teilhabe) bestimmt. Dadurch werden neben den personenbezogenen Faktoren vor allem die Kontextfaktoren stärker berücksichtigt. So können nach Doose (2003, S.4)
"beispielsweise positive personenbezogene Faktoren wie eine hohe Motivation des behinderten Arbeitnehmers oder Umweltfaktoren, wie eine wirkungsvolle Antidiskriminierungsgesetzgebung und das Angebot von Unterstützter Beschäftigung die Beeinträchtigung einer Person zur Teilhabe am Arbeitsleben beeinflussen und damit zwar nicht ihre Schädigung, aber insgesamt ihre Behinderung reduzieren."
Unterstützte Beschäftigung umfasst in seiner Konzeption verschiedene Organisationsformen. Die Hauptunterscheidung ist jene nach individuellen Betreuungsmodellen sowie nach unterschiedlichen Gruppenmodellen. Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf der Unterstützung von Einzelpersonen liegt, wie es auch der Organisationsform von sowohl Arbeitsassistenz als auch Integrationsfachdiensten entspricht, soll in Folge trotzdem eine kurze Auflistung existierender Gruppenmodelle erfolgen:
-
Enklaven oder Cluster Modelle: Bei dem Enklaven Modell arbeitet eine Gruppe von 3 - 8 MitarbeiterInnen mit einer zumeist "schweren Behinderung" innerhalb eines Betriebes in einem Raum unter der Anleitung einer Betreuungsperson gemeinsam. Diese Gruppe bildet in der Regel eine räumlich getrennte Abteilung und ist für leichtere Zuarbeiten im Rahmen der Gesamtproduktion zuständig. Eine direkte Zusammenarbeit mit nicht behinderten Kollegen erfolgt sehr selten, auch wenn versucht wird, die soziale Integration durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie die Zusammenlegung der Pausen zu fördern. Einen höheren Grad der Integration bietet daher das so genannte Cluster Modell, in welchem die einzelnen MitarbeiterInnen in unterschiedlichen Abteilungen des Betriebes verteilt sind.
-
Mobile Arbeitsgruppen: Auch in diesem Modell bezieht sich die Integrationsmaßnahme auf eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Der Unterschied zur Arbeitsenklave besteht darin, dass die Gruppe nicht an ein Unternehmen gebunden ist, sondern unterschiedliche und wechselnde Dienstleistungen innerhalb einer Gemeinde durchführt. Die meisten dieser Arbeiten sind Reinigungsarbeiten oder Arbeiten im Garten oder Landschaftsbau. Auch diese Gruppen werden von einer nicht behinderten Betreuungsperson begleitet.
-
Integrationsbetriebe: Dies sind Kleinunternehmen, die zumeist eigens für behinderte Menschen geschaffen wurden, aber als reguläre Betriebe mit einer teilweisen ökonomischen Ausrichtung geführt werden. Die MitarbeiterInnen sind zum Großteil Menschen mit Behinderungen. Integrationsbetriebe werden sowohl in den USA als auch in den meisten europäischen Ländern unter unterschiedlichen Bezeichnungen, z.B. Sozioökonomische Betriebe, Integrative Betriebe, etc. geführt. (vgl. Schartmann 1995[4], S.5; Doose 1996, S.15; Brooke / Wehman 1997, S.5f)
Die (sicher noch nicht abgeschlossene) Entwicklung von Systemen der Behindertenhilfe insbesondere in Österreich und Deutschland, welche sich von einer sozial- bzw. wohlfahrtsstaatlichen Tradition, hin zu einem aktiven Schutz vor Diskriminierung sowie einem rechtebezogenen Ansatz der Chancengleichheit veränderten, wurde v.a. durch internationale Reformgesetzgebungen eingeleitet. Dieser so genannte "Paradigmenwechsel" in der Behindertenpolitik hat vom angloamerikanischen Raum ausgehend über die internationale Ebene in die Behindertenpolitik der Europäischen Union in die nationalen Gesetzgebungen der Mitgliedsländer Einzug gehalten (vgl. Doose 2003, S.5f). Im Folgenden nun eine Auflistung einiger der bedeutsamsten internationalen Reformgesetze:
-
Americans with Disabilities Act (1990): Dieses durch den Einsatz der amerikanischen Behindertenrechtsbewegung erlassene Gesetz verbietet die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung in allen wesentlichen öffentlichen Bereichen und dem Arbeitsleben. Den entscheidenden Einfluss übt dieses Gesetz dadurch aus, dass es Personen die sich diskriminiert fühlen, ein individuelles Klagerecht einräumt und es alle öffentlichen und privaten Dienste verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren ihre Dienste und Einrichtungen barrierefrei[5] umzugestalten (vgl. Doose 1997, S.8f; Junker 1998, S.13; Doose 2003, S.5).
-
Resolution der Vereinten Nationen (1993): "Rahmenbestimmung über die Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte": Der Grundsatz der Gleichberechtigung impliziert, dass die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen gleich wichtig sind, und dass diese Bedürfnisse zur Grundlage der Planung der Gesellschaft gemacht und alle Ressourcen so eingesetzt werden sollen, dass für jeden Menschen die Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe gewährleistet ist. Der Ausdruck "Herstellung der Chancengleichheit" bezeichnet den Prozess, mit dessen Hilfe die Systeme der Gesellschaft allen zugänglich gemacht werden sollen, insbesondere Menschen mit Behinderung. Außerdem sind Menschen mit Behinderung Mitglieder der Gesellschaft und verfügen über das Recht in ihrer jeweiligen Ortgemeinde zu bleiben (vgl. Doose 1997, S.9; Doose 2003, S.5). Die von ihnen benötigte Unterstützung soll im Rahmen der üblichen sozialen Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungsdienstleistungen angeboten werden. Die Europäische Union griff diese Entwicklung auf und verabschiedete die
-
Strategie der Europäischen Gemeinschaften zur Chancengleichheit für behinderte Menschen 1996: Zentrales Element dieser Strategie war die Verankerung des Grundsatzes des Mainstreamings als Grundlage der europäischen Förderungen im Bereich der Behindertenpolitik. Das Thema Behinderung wurde dadurch zu einem Querschnittsthema der Europäischen Union das in allen Politikbereichen, z.B. der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, berücksichtigt werden soll (vgl. Doose 1997, S.10; Doose 2003, S.5).
Auf den europäischen und den spezifischen nationalen Gesetzeskontext und auf Entwicklungen in Österreich und Deutschland wird im nächsten Kapitel "Rahmenbedingungen" noch genauer eingegangen.
Supported Employment entwickelte sich in den USA, ähnlich wie in den meisten Ländern Europas aus der Debatte um die schulische Integration, allerdings hatte diese Forderung in den USA einen deutlich anderen Charakter. Die Integrationsbewegung knüpfte in ihrer Argumentation an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung an, wonach Aussonderung auf Diskriminierung beruhe und somit mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung nicht vereinbar sei (vgl. Junker 1998, S.12f). Supported Employment wurde in den USA nach einer Reihe von erfolgreichen Modellprojekten erstmals 1984 gesetzlich verankert. Auf die Bedeutung des 1990 erlassenen "Americans with Disabilities Act" wurde bereits hingewiesen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Supported Employment in den USA von einem anderen, sowohl rechtlichen als auch institutionellen Grundverständnis ausgeht. Anders als in Österreich und Deutschland gibt es in den USA weder gesetzliche Verpflichtungen für Arbeitnehmer behinderte MitarbeiterInnen zu beschäftigen, noch gibt es rechtlich verankerte Schutzbestimmungen für behinderte MitarbeiterInnen in Betrieben wie beispielsweise den Kündigungsschutz. Trotzdem gibt es eine größere Bereitschaft von Arbeitgebern Menschen mit Behinderung einzustellen, v.a. durch die Möglichkeit einer tariflichen Entlohnung unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne[6] . Auch Organisationen und Behindertenverbände sind in diesem Verständnis keine Fürsorgeeinrichtungen sondern Anbieter von Dienstleistungen, in diesem Fall von Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitsplatzfindung und der beruflichen Qualifikation (vgl. Junker 1998, S.12ff).
Nach Wehman, Revell und Brooke (2002) gibt es in den USA derzeit über 3700 Supported Employment Projekte, und über 150.000 Menschen in unterstützen Dienstverhältnissen, was etwa 10-20% der unterstützen Menschen mit Behinderung entspricht. Die "Association of Persons in Supported Employment" (APSE) ist der amerikanische Dachverband für alle Supported Employment Träger. Die Zielgruppe von Supported Employment hat sich im Lauf der Jahre durch zahlreiche Modellprojekte kontinuierlich erweitert. Es konnte nachgewiesen werden, dass alle Menschen mit der entsprechenden oft intensiven Unterstützung in integrativen Arbeitsverhältnissen arbeiten können. Trotzdem ist die Hauptzielgruppe in den USA überwiegend jene, der Menschen mit leichteren Behinderungen bzw. Menschen mit Lernschwierigkeiten, wodurch sich eine beträchtliche Diskrepanz zwischen dem in den Modellprojekten nachgewiesenen Erreichbaren und der momentanen Praxis zeigt (vgl. Doose 1997, S.36), eine Entwicklung, die sich wie später beschrieben werden wird, auch in Europa gezeigt hat.
In Europa gibt es Supported Employment, mit ersten Vorläufern in den achtziger Jahren, seit Anfang der neunziger Jahre, wobei ab Mitte der neunziger Jahre in vielen Ländern eine sprunghafte quantitative Entwicklung bis hin zur flächendeckenden Einführung erkennbar war. In Irland und Großbritannien waren dabei die amerikanische Entwicklung von Supported Employment auch durch die sprachliche Gemeinsamkeiten eher aufgenommen worden und bis auf einige Ausnahmen (Frankreich, Belgien, Dänemark) verlief die Ausbreitung von Supported Employment in Europa von West nach Ost. In Irland, dem Vereinigten Königreich (England & Wales, Schottland und Nordirland), den Niederlanden, Deutschland, Norwegen, Portugal, Spanien, Norditalien (mit einer eigenen Tradition) gab es früher größere Modellprojekte in Supported Employment, es folgten Österreich, Schweden, Finnland, Island ab Mitte der neunziger Jahre und mittlerweile gibt es erste Projekte in Griechenland, Zypern, Malta, Estland, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und der Tschechischen Republik (vgl. Doose 1997, S.37).
Ganz entscheidend zur Verbreitung und Vernetzung von Unterstützter Beschäftigung in Europa beigetragen haben die Förderungsmöglichkeiten und Beschäftigungspolitischen Programme und Gemeinschaftsinitiativen des Europäischen Sozial Fonds (ESF). Insbesondere die EU - Gemeinschaftsinitiativer HORIZON und HELIOS haben zur Entwicklung konkreter Maßnahmen in den einzelnen Regionen und zu einer europaweiten Fachdiskussion und einem Austausch beigetragen. So wurde Anfang der neunziger Jahre die "European Union of Supported Employment" (EUSE) als europäisches Netzwerk nationaler Organisationen gegründet. Die EUSE veranstaltet seit ihrer Gründung alle zwei Jahre Tagungen in unterschiedlichen Städten Europas (die letzte 2003 in Helsinki). Obwohl auch in Europa die Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung nicht reibungslos verlaufen ist, vor allem aufgrund von Widerständen bestehender Einrichtungen der jeweiligen Rehabilitationssysteme, wurden zahlreiche innovative Ideen von den bestehenden Systemen aufgegriffen und in gesetzliche Regelungen gebracht. Dabei wurden viele Elemente von Unterstützter Beschäftigung wie individuelle Arbeitsvermittlung oder Job Coaching auch an andere Benachteiligungsgruppen übertragen, während v.a. Menschen mit schweren Behinderungen nach wie vor oft nicht die notwendige längerfristige Unterstützung zur Verfügung gestellt wird. So zeigt sich auch in Europa das Bild, dass oft sinnvolle Weiterentwicklungen der bestehenden Systeme zu einer Zielgruppenverschiebung führen, und die eigentliche Idee der beruflichen Integration schwerbehinderter Menschen dabei verloren geht (vgl. Doose 1999, S.1ff[7]).
Leichsensring und Strümpel (1997) untersuchten Mitte der Neunziger Jahre unterschiedliche Projekte zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in verschiedenen europäischen Ländern. Aus diesen Projekten lassen sich "einzelne Bausteine" entnehmen, mit deren Hilfe innovative Projekte beschrieben werden können. Diese Auflistung soll auch eine erste Annäherung an projektübergreifende fachliche (Mindest-)Qualitätsstandards darstellen:
-
Integration und Normalisierung: Der erste übergreifende Trend der untersuchten Projekte besteht darin, Menschen mit Behinderung ein ähnliches Leben wie nicht behinderten Menschen zu ermöglichen. Es besteht die Tendenz aussondernde Arbeitsverhältnisse zugunsten von Arbeitsmöglichkeiten am offenen Arbeitsmarkt zu reduzieren bzw. einen Übergang dorthin zu ermöglichen (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.159f).
-
Förderung der Selbstbestimmung und der Individualität: Als eine Voraussetzung für Integration und "Normalisierung" wird in den Projekten die Förderung von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung (Empowerment) gesehen, außerdem sollen durch z.B. Berufsorientierung und Beratung den behinderten Menschen Informationen über ihre Wahlmöglichkeiten bereitgestellt werden um zu durchdachten und nicht beeinflussten Entscheidungen bezüglich ihrer (beruflichen) Lebensplanung zu gelangen (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.160f).
-
Abstimmung zwischen Person und Umwelt: Ein weiterer wesentlicher Baustein ist die Abstimmung zwischen Umwelt- und Arbeitsbedingungen und individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Erfordernissen. Vor allem Projekte deren Hauptaufgabe die Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist, bemühen sich um eine größtmögliche Passung der behinderten Person und der Arbeitsumwelt um die Chance zu erhöhen eine passende Arbeitsumgebung zu finden (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.161f).
-
Ganzheitliche Betrachtung der Person und des Lebenslaufes: Um die optimale Passung zwischen Person und Arbeitsplatz zu gewährleisten, müssen u.a. beim Auftreten von Schwierigkeiten auch die anderen Lebensbereiche berücksichtigt werden bzw. eine Vernetzung mit unterschiedlichen Unterstützungsangeboten (z.B. Wohnbetreuung) erfolgen (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.163f). .
-
Einbindung in die Region - Kooperation und Koordination: Projekte müssen nicht nur ihren Blick auf die Person in ihrer jeweiligen Umwelt richten, sondern auch den Gesamtkontext der Region, in die sie eingebunden sind, analysieren und in der Planung berücksichtigen. Dazu gehört v.a. die zielgerichtete Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutionen des Sozialwesens (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.164f).
-
Betriebswirtschaftliche Orientierung - Zusammenarbeit mit Betrieben: Bei allen in der beruflichen Integration realisierten Projekten kommt der Zusammenarbeit mit Betrieben, der Orientierung an der betrieblichen Praxis sowie an modernen betriebswirtschaftlichen Kriterien eine entscheidende Bedeutung zu. Diese Zusammenarbeit geht in vielen Fällen soweit, dass Betriebe auch als eigene Kundengruppe betrachtet und Angebote auf die Bedürfnisse von Betrieben ausgerichtet werden (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.165f).
-
Vereinbarung betriebswirtschaftlicher und sozialer Gesichtspunkte: Dieser Aspekt bezieht sich nicht nur auf die erforderlichen Qualifikationen der MitarbeiterInnen in den Projekten, sondern stellt vor allem eine Aufgabe für das (Qualitäts-)Management der Einrichtungen dar. Der Konzentration auf soziale Aspekte der Arbeit stehen zum Teil sich jährlich ändernde Förderungskriterien sowie eine europaweit starke Ausrichtung an Vermittlungszahlen gegenüber (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.167f).
Das Konzept der Unterstützen Beschäftigung hat maßgeblich die Entwicklung von Arbeitsassistenz in Österreich und Integrationsfachdiensten in Deutschland mit beeinflusst. Gleichzeitig stellen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste die Institutionalisierung von Unterstützer Beschäftigung in diesen beiden Ländern dar. Im Folgenden soll nun die Entstehung dieser beiden Maßnahmen nachgezeichnet werden.
Blumberger (2002) nennt in seiner Studie "Arbeitsassistenz in Österreich - Entwicklung und Perspektiven" folgende Gründe, die zur Einrichtung der ersten Arbeitsassistenz Modellprojekte geführt haben:
-
Sowohl die Zahl der "begünstigt behinderten" Personen als auch jener Personen, die aufgrund einer Behinderung vom AMS als "schwervermittelbare Arbeitslose" galten war in den Jahren seit 1990 um je gut ein Drittel angestiegen.
-
Der Anteil an Personen mit psychischen Beeinträchtigungen an allen langzeiterkrankten Versicherten stieg ebenso stark an (vgl. Blumberger 2002, S.11).
Im Jahr 1992 wurden deshalb die ersten beiden Arbeitsassistenz-Modellprojekte in Niederösterreich und Oberösterreich für die Zielgruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bewilligt[8]. Diese ersten beiden Modellprojekte waren zunächst auf zwei Jahre befristet und wurden von Anfang an evaluiert. Von den Ergebnissen der Evaluation und den zwischen den beteiligten Institutionen erarbeiteten Zielvorgaben wurde ein Weiterbestehen sowie ein flächendeckender Ausbau der Arbeitsassistenz in Österreich abhängig gemacht. Die Modellprojekte erwiesen sich als erfolgreich, sowohl hinsichtlich der Vermittlungsquote, 43 bis 50 Prozent der arbeitssuchenden Personen wurden erfolgreich betreut, als auch hinsichtlich einer Kosten - Nutzen Kalkulation, welche die fiskalischen Kosten der Arbeitsassistenz mit den denen von Arbeitslosigkeit verglich (vgl. Blumberger 2002 S.11; Fasching 2003, S.92).
Unabhängig von der Entwicklung der Arbeitsassistenz arbeitete das Institut für Sozialdienste (IFS) in Vorarlberg bereits seit Mitte der achtziger Jahre nach den Prinzipien der Unterstützen Beschäftigung vorwiegend für die Zielgruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten und schweren geistigen Behinderungen (vgl. Badelt / Österle 1992). Die ersten Arbeitsassistenz Einrichtungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung waren neben dem IFS, die Lebenshilfe Ennstal (damals Liezen) in der Steiermark und der Verein Bungis in Burgenland.
Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahr 1995 wurde das Angebot der Arbeitsassistenz schrittweise ausgebaut und auch auf andere Behinderungsarten ausgedehnt. Dieser Ausbau stand in einem engen Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Kofinanzierung durch den Europäischen Sozialfonds. 1999 erfolgte die gesetzliche Verankerung der Arbeitsassistenz im Behinderteneinstellungsgesetz. Mit der Einführung der Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung ("Behindertenmilliarde") im Jahr 2001 wurde die ursprünglich für erwachsene Menschen mit Behinderung konzipierte Arbeitsassistenz auch auf die Zielgruppe jugendlicher Menschen mit Behinderung ausgeweitet. Von der Europäischen Union wurde die Arbeitsassistenz als "Best Practice" Beispiel, d.h. als erfolgreiche und nachahmenswerte Maßnahme, ausgewählt (vgl. BMSG 2003, S.129f). Im Jahr 2001 wurde der Dachverband Arbeitsassistenz zur Vernetzung aller Arbeitsassistenz- Anbieter in Österreich gegründet. Der Dachverband Arbeitsassistenz verfolgt nach eigenen Angaben weiters folgende Zielsetzungen:
-
"Förderung des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der Träger von Arbeitsassistenz-Einrichtungen in Österreich
-
Vernetzung der Informationen und des Know-hows der Träger
-
Initiierung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur gesellschaftspolitischen Aufklärung zum Thema Behinderung bzw. Benachteiligung und Arbeit
-
Veranstaltung von Tagungen, Seminaren und Workshops
-
Sicherung und Weiterentwicklung österreichweiter Qualitätsstandards der Arbeitsassistenz" [9]
Nach Angaben des Dachverbandes Arbeitsassistenz bieten derzeit (Ende 2004) 34 Trägerorganisationen die Dienstleistung Arbeitsassistenz an 98 verschiedenen Standorten in allen österreichischen Bundesländern an.
1.3.2. Entstehung der Integrationsfachdienste in Deutschland[10]
Doose (1997) und Bungart (2002) unterscheiden zwei unterschiedliche Wurzeln, die zur Entstehung und Institutionalisierung der Integrationsfachdienste in Deutschland beigetragen haben. Auch in Deutschland kann den Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds, beim Aufbau der Integrationsfachdienste, eine entscheidende Bedeutung beigemessen werden, insbesondere im Rahmen des HORIZON Programms.
-
Die erste Entwicklungslinie ging, ähnlich wie in Österreich, von der Zielgruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen aus. Bereits Ende der siebziger Jahre wurden die Psychosozialen Dienste (PSD) im Auftrag der Hauptfürsorgestellen (heute Integrationsämter) gegründet[11]. Ihre Aufgabe bestand in der psychosozialen Betreuung von arbeitenden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die PSD erkannten sehr früh, dass eine Reihe der von ihnen betreuten Menschen arbeitslos wurde, sowie dass es viele arbeitslose und arbeitssuchende Menschen gab, die eine Begleitung bei der Arbeitsplatzsuche und bei der Arbeit benötigten um erfolgreich eingegliedert werden zu können. Die Dienste erweiterten ihren Aufgabenbereich deshalb schon sehr bald in den Bereichen der Arbeitsplatzstabilisierung sowie der Erst- und Wiedereingliederung (vgl. Doose 1997, S.37f. ; Bungart 2002, S.12f sowie Homepage der BAG-UB)
-
Die zweite Entwicklungslinie kam aus dem Bereich der abgebenden Einrichtungen in der Phase "danach", wo verstärke Aktivitäten insbesondere bei Sonderschulen, Werkstätten für Behinderte und Berufsbildungswerke zu verzeichnen waren. Es wurde erkannt, dass berufsvorbereitende und qualifizierende Maßnahmen oft nicht ausreichten, und eine nachgehende Beleitung für den Übergang bzw. die Vermittlung in den betrieblichen Alltag entwickelt werden musste. Entscheidende Impulse sowie entsprechende Konzepte gingen dabei vor allem von der engagierten Elternbewegung für Integration aus. Verschiedene Projekte stützen sich dabei auf das Konzept der Unterstützen Beschäftigung, wie die von einer Hamburger Elternbewegung für Integration im Jahr 1992 gegründete Hamburger Arbeitsassistenz. Zielgruppe dieser Dienste waren vor allem Menschen mit einer Lern- bzw. geistigen Behinderung (vgl. Doose 1997, S.37; Bungart 2002, S.13; Homepage der BAG-UB).
Die Integrationsfachdienste wurden zunächst von den Hauptfürsorgestellen als regionale Modellprojekte eingerichtet, welche in den Jahren 1998-2001 vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung als Bundesmodellprojekt wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurden. Die gesetzliche Verankerung der Integrationsfachdienste im Schwerbehinderten- bzw. Sozialgesetz (SGB IX) im Herbst 2000 bzw. 2001 erfolgte im Zuge der so genannten "50.000 Jobs für Schwerbehinderte" Kampagne. Es gibt derzeit nach Angaben der BAG-UB 181 Integrationsfachdienste, je einen pro bundesdeutschen Arbeitsamtbezirk (vgl. Kastl / Trost 2002, S.25ff; Doose 2004, S.6; Homepage der BAG-UB).
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung wurde bereits im Oktober 1994 infolge der ersten bundesweiten deutschen Tagung von Initiativen zur beruflichen Integration gegründet. Die sozialpolitische Zielsetzung der BAG-UB besteht in der Verankerung und Weiterentwicklung von Unterstützter Beschäftigung als ambulante Unterstützung im Arbeitsleben im deutschen Rehabilitationssystem. Zu den weiteren Aufgabengebieten der BAG-UB zählen u.a.:
-
"die bundesweite Interessensvertretung der Integrationsfachdienste
-
Information, Beratung & Dokumentation
-
Netzwerkbildung, Projektarbeit und Evaluation
-
Weiterbildung und Qualitätssicherung" (Homepage der BAG-UB)
In diesem ersten Kapitel der Diplomarbeit wurde das Konzept der Unterstützten Beschäftigung als ein methodischer Ansatz vorgestellt, der sich über den angloamerikanischen Raum, vermittelt über internationale Reformgesetzgebungen in die Europäische Union bis in die einzelnen Mitgliedsländer verbreitet hat. Es liegen der Unterstützten Beschäftigung international spezifische Kernelemente zugrunde, welche sie von anderen Elementen und Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung unterscheidet. Dazu zählen insbesonders der Ansatz des "Training on the Job", sowie eine radikale Individualisierung der Unterstützungsleistungen. Auf die Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung in den USA, in Europa, sowie der Institutionalisierung und Entwicklung der Arbeitsassistenz und der Integrationsfachdienste wurde genauer eingegangen. Im Zuge der weiteren Ausführungen im Kontext der Qualitätsdiskussion, Kriterien und Systeme wird besonders zu beachten sein, inwieweit die Grundsätze der Unterstützten Beschäftigung darin einfließen und Berücksichtigung finden. Das folgende Kapitel bezieht sich auf die Bedeutung von Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eingegangen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf rechtlichen Aspekten liegt.
[1] vgl. Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG - UB), im Internet unter URL: www.bag-ub.de
[2] Ein Paradigma besteht nach Kuhn (1973) in einem grundlegenden gemeinsamen Verständnis, das eine wissenschaftliche Gemeinschaft hat und das für eine Zeit nicht mehr diskutiert werden muss. Boban und Hinz (2001, S.25f) erörtern die Frage, ob wirklich von einem Paradigmenwechsel zu sprechen ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass immer noch von zwei unterschiedlich bezeichneten Paradigmen auszugehen ist, einerseits einem sonderpädagogischen und andererseits einem Integrationsparadigma. Diese beiden Ansätze werden oft als abgrenzbare Grundverständnisse beschrieben und implizieren auch unterschiedliche Verständnisse von Behinderung und Integration. Dieser Argumentation folgend ist das Konzept der Unterstützten Beschäftigung im Integrationsparadigma zu verorten.
[3] Der Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten ist die selbstgewählte Bezeichnung der "Selbstbestimmt - Leben Bewegung" (vgl. Firlinger 2003, S.29)
[4] Die Seitennummerierung bezieht sich auf die Internetversion des Artikels von Dieter Schartmann: "Soziale Integration durch Mentoren" 1995, im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schartmann-mentoren.html (Zugriff: 13.11.2004)
[5] Der Begriff "barrierefrei" wird heute zumeist statt des Begriffs behindertengerecht verwendet, da er inhaltlich weiter gefasst ist. Es bezieht sich auf Zugänglichkeit und Benutzbarkeit von Gebäuden und Informationen für alle Menschen, egal welche Form der Behinderung sie haben (vgl. Firlinger 2003, S.98)
[6] Auf die Problematik des "Working Poor", also des Abrutschens unterhalb die Armutsgrenze trotz einer oder mehrerer Beschäftigungen sei an dieser Stelle hingewiesen. Auf eine detaillierte Darstellung der sozialen Nachteile eines liberalisierten (Wirtschafts-)Systems wie jenes in den USA soll an dieser Stelle nur auf Speck 2002 "Ökonomisierung sozialer Qualität" verwiesen werden.
[7] Der Artikel von Stefan Doose: "Unterstützte Beschäftigung in Europa" ist auf der Homepage der BAG-UB im Internet unter URL: www.bag-ub.de herunterzuladen.
[8] Dies waren für den städtischen Bereich mit dem Standort Linz die Arbeitsassistenz Pro Mente Oberösterreich und für den ländlichen Bereich das Institut für berufliche Integration (IBI) der PSZ GmbH mit dem Standort in Wolkersdorf im niederösterreichischen Weinviertel.
[9] siehe Homepage des Dachverbandes Arbeitsassistenz im Internet unter URL: www.arbeitsassistenz.or.at (Zugriff: 13.11.2004)
[10] Die Artikel von Stefan Doose (2004c): "Die Phasen der Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung, Integrationsfachdiensten und Arbeitsassistenz in Deutschland. Eine Analyse des Prozesses und des Beitrags des zehnjährigen Wirkens der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung" und Dieter Schartmann (2005): "Betriebliche Integration durch Integrationsfachdienste", beschreiben ausführlich die Entwicklung und Institutionalisierung der Integrationsfachdienste in der Bundesrepublik Deutschland.
[11] der erste PSD in Köln nahm im Auftrag der dortigen Hauptfürsorgestelle bereits 1977 seine Arbeit als Modellversuch auf.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1.Die Sozial- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union
- 2.2. Die Sozial- und Behindertenpolitik in Österreich und Deutschland
- 2.3. Das System der beruflichen Rehabilitation und Integration in Österreich und Deutschland
- 2.4. Rechtliche Grundlagen der Arbeitsassistenz in Österreich und der Integrationsfachdienste in Deutschland
- 2.5.Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland: Daten und Fakten
- 2.6. Zusammenfassung
Sozial- und Behindertengesetzgebungen auf europäischer und nationaler Ebene, Förderrichtlinien, Finanzierungsstrukturen & Förderprogramme, Arbeitsmarktlage, Konjunktur & Arbeitslosigkeit, institutionelle Rahmenbedingungen im System der Behindertenhilfe und beruflichen Rehabilitation, Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung, u.v.m. stellen die strukturellen Rahmenbedingungen dar mit denen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste agieren (müssen). Auch wenn es nicht möglich sein wird auf alle diese Aspekte im Detail einzugehen, soll dieses Kapitel einen breiten Bogen über diese angeführten Themen spannen. Obwohl ein Großteil dieser Faktoren außerhalb des Einflussbereiches von Fachdiensten liegt, haben sie vor allem im Kontext von Qualitätsmanagement eine entscheidende Bedeutung.
Nach Bühler (1997, S.105) zeigt sich
"eine europäische Sozialpolitik am deutlichsten in ihrer Orientierung an der Beschäftigungspolitik, die bestimmt ist durch Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Vermeidung von Nachteilen für ArbeitnehmerInnen in den einzelnen Mitgliedsstaaten".
Dabei zielt die Europäische Sozialpolitik auf eine langfristige Angleichung der Systeme der einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Pfeiler der Europäischen Sozialpolitik finden sich in der 1989 beschlossenen Gemeinschaftscharta über die sozialen Grundrechte der ArbeitnehmerInnen (Sozialcharta). Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Europäische Sozialcharta kein subjektives Recht darstellt. Im Punkt 12 der Sozialcharta (Förderung der sozialen und beruflichen Eingliederung von Behinderten) heißt es im Abschnitt 26:
"Alle Behinderten müssen unabhängig von der Ursache und Art ihrer Behinderung konkrete ergänzende Maßnahmen, die ihre berufliche und soziale Eingliederung fördern, in Anspruch nehmen können." (Bühler 1997, S.106)
Die Europäische Gemeinschaft hat in dieser Sozialcharta Grundrechte formuliert, deren Verwirklichung eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Arbeit garantieren soll. Die Bedingungen dafür, dass diese Rechte eingelöst werden können, haben sich aber vor allem im letzten Jahrzehnt deutlich verändert. Schlagworte wie Globalisierung, Rationalisierung, Technologisierung sowie ein weitgehendes Verschwinden einfacher Tätigkeiten im produzierenden Sektor charakterisieren diesen Veränderungsprozess, der die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Behinderung erheblich verschlechterte. Die 1996 von der Europäischen Kommission erlassene "neue Strategie zur Chancengleichheit für behinderte Menschen" die einen rechtebezogenen Ansatz favorisierte, sowie der Vertrag von Amsterdam 1997 haben die Handlungsspielräume der Europäischen Union für Antidiskriminierungskonzepte und -maßnahmen deutlich erweitert. So formuliert Blumberger (2002, Kapitel 1.4, S.1):
"Während in den auf kollektive soziale Sicherung abgestellten wohlfahrtsstaatlichen Systemen die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung durch einen allerdings auf vorangehende Erwerbsarbeit beschränkten - solidarischen Versicherungsschutz des Einzelnen vor sozialen Risiken, durch soziale Hilfe, auch durch positive Diskriminierung und spezifische gesetzlich verankerte Rechte angestrebt wurde, berufen sich neuere Ideen auf die Menschenrechte, auf demokratische Verfassungen und allgemeine Bürgerrechte. Dem Staat kommt dabei weniger die Aufgabe zu, beispielsweise besondere Institutionen für die soziale Integration oder Beschäftigungsmöglichkeiten bereit zu stellen, sondern vielmehr dafür zu sorgen, dass Integration oder Beschäftigung nicht erschwert wird."
Seit dem Beschäftigungspolitischen Gipfel in Luxemburg 1997 sind behindertenspezifische Fragen ein fester Bestandteil der jährlichen Leitlinien des Rates sowie seit 1998 auch der jährlich erlassenen Nationalen Aktionspläne (NAP) der einzelnen Mitgliedsstaaten. Grundlage sind die vier Säulen der europäischen Beschäftigungspolitik, nämlich Beschäftigungsfähigkeit, Förderung des Unternehmertums, Anpassungsfähigkeit an den industriellen Wandel und Chancengleichheit für Frau und Mann (Gender Mainstreaming). Die Beschäftigungspolitik der Europäischen Union hat versucht sich auf die Veränderungen in der Arbeitswelt und den zunehmenden Kostendruck, ausgelöst durch steigende Sozialausgaben einzustellen. Es lässt sich ein europaweiter Trend ausmachen, der auf einer Verschiebung von passiven zu aktiven Maßnahmen basiert. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über klassische und neuere Beschäftigungspolitiken in der EU. Diese Maßnahmen werden in den meisten Ländern mittlerweile kombiniert und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung angeboten (vgl. Niehaus 2000, S.127ff; Blumberger 2003, S.12ff; Doose 2003, S.5ff):
Tabelle 1: Überblick über klassische und neuere Beschäftigungspolitiken für behinderte Menschen in der EU (Doose 2003, S.7)
|
Beschäftigungspolitiken in der EU Klassische Ansätze |
Beschäftigungspolitiken in der EU Neuere Ansätze |
|
- Passive Maßnahmen
|
- Aktive Maßnahmen
|
|
- Quotenreglung |
- Antidiskriminierungsgesetze |
|
- Kündigungsschutz |
- Aufklärungskampagnen |
|
- Lohnkostenzuschüsse, Steuervorteile |
- Maßgeschneiderte Angebote
|
|
- Arbeitsplatzanpassung |
|
|
- Rehabilitation, Umschulung
|
- Ausbildung und Lernen
|
|
- Werkstätten für behinderte Menschen |
- Integrationsfirmen |
|
- Sonderbereich |
- Querschnittsbereich |
Das Jahr 2003 wurde von der Europäischen Union zum "Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung" erklärt. Der Schwerpunkt der europaweit durchgeführten Maßnahmen lag dabei vor allem auf der Sensibilisierung für Diskriminierungsschutz und Gleichberechtigung behinderter Menschen, auf der Förderung von Best Practice Modellen sowie auf einer positiven Darstellung von Menschen mit Behinderung (vgl. SORA / KMU / ABIF 2004, S.18)
Zur Umsetzung der Ziele der europäischen Gemeinschaft stehen einerseits die Strukturfonds zur Verfügung, andererseits gab und gibt es spezifische Aktions- oder Förderprogramme für bestimmte Politikbereiche, so auch für die Förderungen von Menschen mit Behinderung. Beim Europäischen Sozialfonds (ESF) handelt es sich, anders als der Name vermuten lässt, nicht um ein sozialpolitisches sondern um ein arbeitsmarktpolitisches Instrument. Der ESF (ko)finanziert seit 1960 Maßnahmen und Projekte, die von den Mitgliedsländern vorgeschlagen werden im Rahmen der so genannten Ziel 3 Förderung, bei der es u.a. um die berufliche Eingliederung von Personen geht, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind (vgl. Bühler 1997, S.106ff). Sowohl die Arbeitsassistenz in Österreich als auch die Integrationsfachdienste in Deutschland sind maßgeblich durch ESF Mittel gefördert und ausgebaut worden (vgl. Doose 2003, S.9).
Eines der ersten Aktionsprogramme der Europäischen Union, das explizit Menschen mit Behinderung als Zielgruppe hatte, war die Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT mit dem Unterprogramm HORIZON von 1992-1999. In diesem Förderzeitraum sind europaweit ca. 1700 Projekte finanziert worden, die neue Problemlösungen für Menschen mit Behinderung insbesondere in den Bereichen Ausbildung und Beschäftigung entwickelten. Auch für den Auf- und Ausbau von Supported Employment Programmen war das HORIZON Programm der entscheidende Motor. So sind beispielsweise die ersten Fachdienste für die Zielgruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten und zum Teil schweren geistigen Behinderungen mit diesen Mitteln aufgebaut worden. Zu nennen wären hier insbesondere das europäische Vorreiterprojekt "Challenge" in Irland, aber auch die Hamburger Arbeitsassistenz in Deutschland oder die Arbeitsassistenz Liezen (heute Ennstal) in Österreich (vgl. Lynch 1997, S.21f; Doose 2003, S.9, Stadler Vida / Giedenbacher / Strümpel 2003, S.4ff;).
Durch das dritte HELIOS Programm zur Förderung der Chancengleichheit und Integration behinderter Menschen von 1992-1996 wurden insbesondere Austausch und Informationsmaßnahmen gefördert, dadurch konnten viele Kontakte unter aktiven Personen und Organisationen in Europa geknüpft werden. So beschäftigte sich auch innerhalb dieses Austauschprogramms eine eigene Arbeitsgruppe (Helios Arbeitsgruppe 10) mit dem Thema Supported Employment. Dies brachte nicht nur eine vermehrte thematische Auseinandersetzung, sondern förderte auch die Vernetzung von Supported Employment Programmen in Europa (vgl. Bühler 1997, S.108ff; Doose 2003, S.5ff, S.9;).
Eine beachtliche Anzahl von Projekten, die sich mit Menschen mit Behinderung befassten, wurden im Rahmen verschiedener "Mainstream" Programme wie SOKRATES, LEONARDO DA VINCI, DAPHNE, PHARE, etc. durchgeführt. Besonders zu erwähnen an dieser Stelle ist dabei das QUIP Projekt, welches im Rahmen des LEONARDO Programms Qualitätskriterien in Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht unterschiedlicher Prozessbeteiligter entwickelte. Auf das QUIP Projekt wird im Detail im Kapitel Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration eingegangen (vgl. Blumberger 2002, S.7; Doose 2003, S.9; Stadler Vida / Giedenbacher 2003).
Im Rahmen der neuen Gemeinschaftsinitiative EQUAL mit einer Laufzeit von 2000 - 2006 bzw. 2007 sind Menschen mit Behinderung wieder eine von mehreren Zielgruppen, wobei die Schwerpunktsetzung innerhalb der einzelnen Mitgliedsländer variiert. Während in Österreich Menschen mit Behinderung explizit als Zielgruppe mit einem definierten Budget festgelegt sind, können in Deutschland Projekte für Menschen mit Behinderung im Rahmen der Zielgruppe "ausgegrenzter Personen vom Arbeitsmarkt" gefördert werden. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. In Österreich gibt es ein fixes Budget für derartige Projekte. Allerdings sind die förderbaren Maßnahmen recht eng gefasst, während Deutschland eher einen Mainstream Ansatz bevorzugt. Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL läuft über zwei separate Förderperioden. In der ersten Antragsrunde wurden sowohl in Österreich als auch in Deutschland vor allem Projekte gefördert, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Übergang Schule - Beruf für Jugendliche mit Behinderung zu professionalisieren. Zu nennen wären hier z.B. die Entwicklungspartnerschaft "Keine Behinderung trotz Behinderung" in Deutschland in der auch die BAG-UB vertreten ist, bzw. die Entwicklungspartnerschaften "Intequal" oder "Styria Integra" in Österreich. Eine weitere Entwicklungspartnerschaft, die im Kontext der Qualitätsthematik zu erwähnen wäre, ist "QSI" (Quality Supported Skills for Integration"), die es sich zum Ziel gesetzt hat, einheitliche Standards für Ausbildungen im Integrationsbereich und zur Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt zu entwickeln[12] (vgl. u.a. Equartal 2003). In der zweiten Antragsrunde wird der Schwerpunkt der Projekte auf den Bereich "Beratung von Unternehmen" und "Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung" liegen, es wird sich zeigen, ob auch von dieser Förderperiode innovative Impulse für die Behindertenpolitik ausgehen werden.
"Behindertenpolitik im Allgemeinen will der Benachteiligung behinderter Menschen entgegenwirken, Arbeitsmarktpolitik für Behinderte im Speziellen misst dabei der Integration in das Beschäftigungssystem eine zentrale Bedeutung bei. Diese normativ festgelegte Zielsetzung basiert auf zwei Pfeilern, auf sozial-ethischen Ansprüchen einerseits und ökonomischem Kalkül andererseits (OECD 1992, zit. nach Mühling 2000, S.42)".
Sowohl Österreich als auch Deutschland lassen sich einem Wohlfahrtsstaatmodell zuordnen, mit vielen Parallelen gerade im Bereich der Behindertenpolitik sowie der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit Behinderung. Während die österreichische Bundesverfassung keine konkrete Zielbestimmung und Kompetenzaufteilung für den Bereich der Sozialpolitik kennt, ist in Deutschland die Verpflichtung auf einen Sozialstaat im deutschen Grundgesetz verankert, wodurch sich für viele Maßnahmen auch ein Rechtsanspruch ableiten lässt. Das Wohlfahrtssystem ist strukturell gesehen idealtypisch ein Gegenmodell zu einem liberalisierten Marktsystem wie es z.B. im angloamerikanischen Bereich vorherrscht, wobei europaweit Entwicklungstrends bestehen, die sich weg von klassischen Wohlfahrtsmodellen und hin zu Marktsystemen verändern (vgl. BMAS 1998, S.3; Badelt / Österle 2000, S.1ff; Blumberger 2002 S.5ff).
Behinderung als Zieldimension von Sozialpolitik wird in beiden Ländern, auch gemäß den Vorgaben der Europäischen Union als Querschnittsmaterie behandelt mit unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Kompetenzaufteilungen auf Bundes- und Landesebene, auf die im Detail nicht näher eingegangen wird. Es lassen sich nach Badelt & Österle (2000, S.73) grundsätzlich drei Zugänge der Behindertenpolitik unterscheiden:
-
"Die Rehabilitation mit dem Ziel der Herstellung bzw. Wiederherstellung der individuellen Befähigung,
-
die Gewährung von Geld oder Sachleistungen zum Ausgleich von Benachteiligungen,
-
und schließlich gesellschaftspolitische Maßnahmen zur Verhinderung oder Milderung jener Benachteiligungsmuster, die sich im gesellschaftlichen Kontext ergeben."
Insbesondere der Rehabilitationsbegriff ist im Zuge der Ausführungen genauer zu betrachten. Es werden darunter jene medizinischen, beruflichen, pädagogischen und sozialen Maßnahmen verstanden, die dazu dienen sollen, betroffenen Personen einen angemessenen Platz in der Gesellschaft zu sichern. Rehabilitation bezeichnet sowohl einen Prozess als auch ein Ergebnis bzw. Ziel. Im Kontext der beruflichen Rehabilitation ist die (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsleben Ziel und Ergebnis eben dieser Maßnahme (vgl. Seyfried 1990, S.31f; Badelt / Österle 2000, S.73)
Nach Mühling (2000, S.43) lassen sich folgende Unterziele einer behindertenbezogenen Arbeitsmarktpolitik eruieren:
-
Prävention
-
Berufliche Rehabilitation
-
Berufliche Eingliederung
-
Schutz der betrieblichen Beschäftigung
-
Soziale Sicherung
Zur Erreichung dieser Ziele lassen sich die behindertenpolitischen Instrumente in drei Kategorien systematisieren:
-
Maßnahmen der regulativen Steuerung nehmen in Form von Geboten, Verboten, finanziellen und immateriellen Anreizen direkt oder indirekt Einfluss auf das Verhalten der Akteure.
-
Maßnahmenausgleichender Steuerung sollen durch die Gewährung von finanziellen und sachlichen Transferleistungen an Menschen mit Behinderung und Arbeitgeber die Wettbewerbsnachteile von beiden Gruppen ausgleichen
-
Maßnahmen zur Schaffung eines Ersatzarbeitsmarktes verzichten auf eine Beeinflussung des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die angestrebte Behindertenbeschäftigung wird durch öffentliche (Sonder-)Einrichtungen erreicht (vgl. Badelt / Österle 2000, S.80f; Mühling 2000, S.46).
Die bedeutendsten Regelungen, die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung betreffend, sind in Österreich im Behinderteneinstellungsgesetz und in Deutschland im Schwerbehindertengesetz, das strukturell in das SGB (Sozialgesetzbuch) IX integriert wurde, verankert. Nachfolgend sind die wichtigsten Regelungen dieser beiden Gesetze angeführt.
Die Zuerkennung von Leistungen bzw. die Inanspruchnahme von Maßnahmen ist in beiden Ländern von der Zuerkennung eines Status abhängig, der die betreffenden Personen als Menschen mit einer Behinderung ausweist - in Österreich der Status eines "begünstigten Behinderten" sowie in Deutschland der Status eines "Schwerbehinderten". Auf die mit diesen "Etikettierungen" verbundene Stigmatisierung sei an dieser Stelle nur hingewiesen. Die Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis ist insbesondere an einen nach medizinischen Kriterien festgestellten Behinderungsgrad (bzw. Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit) von mindestens 50 % gebunden. In den jeweiligen Novellierungen dieser beiden Gesetze werden nun allerdings auch Personen mit einem Grad der Behinderung von 30 % Leistungen und Maßnahmen zuerkannt, wenn die Behinderung tatsächlich zu einem Nachteil bei der Suche nach einem Arbeitsplatz führt. Der Behinderungsgrad, dies sei noch anzumerken, sagt allerdings nichts über die Leistungsfähigkeit bzw. Leistungseinschränkung eines Menschen auf einem bestimmten Arbeitsplatz aus (vgl. Badelt / Österle 2000, S.82, Mühling 2000, S.61f; BIH 2002 S.181f).
Zu den wichtigsten Instrumenten des BEinstg und des SGB IX zählt die zu den Instrumenten der regulativen Steuerung gehörende Quotenregelung, welche die Verpflichtung von Dienstgebern zur Beschäftigung behinderter Menschen mit dem jeweiligen Behindertenstatus vorsieht. Diese Beschäftigungspflicht ist in beiden Ländern an die Betriebsgröße bzw. die Anzahl der MitarbeiterInnen der Betriebe gekoppelt. Das BEinstg sieht vor, dass jede(r) private und öffentliche DienstgeberIn auf je 25 DienstnehmerInnen einen "begünstigten Behinderten" einstellen soll. Im SGB IX ist geregelt dass jede(r) ArbeitgeberIn, der/die über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügt, wenigstens 5 % schwerbehinderte Menschen beschäftigen muss. Ausnahmeregelungen für bestimmte Branchen bzw. Wirtschaftszweige sind in beiden Gesetzen vorgesehen (vgl. Badelt / Österle 2000, S.83, Mühling 2000, S.62; BIH 2002, S.81f).
Ebenso zu den Maßnahmen der regulativen Steuerung gehört die unmittelbar mit der Quotenregelung verbundene Ausgleichstaxen- (Ö) bzw. Ausgleichsabgabenregelung (D). Diese Regelungen sehen vor, dass pro nicht besetztem Pflichtplatz eine entsprechende Geldsumme gezahlt werden muss. In Österreich ist dieser Betrag einheitlich und beläuft sich derzeit auf ca. 200€ pro nicht besetzter Stelle. Mit der Novellierung des SGB IX 2001 wurde die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem Grad der Erfüllung der Beschäftigungspflicht gestaffelt und beträgt derzeit zwischen 105 und 260€. Betriebe, die ihrer Beschäftigungspflicht gar nicht oder kaum nachkommen, zahlen dementsprechend mehr als Betriebe, die ihre Pflichtzahl nur knapp unterschreiten. Die dadurch eingenommenen Gelder werden in beiden Ländern zweckgebunden für Maßnahmen der beruflichen Integration bzw. für personen- bzw. betriebsbezogene Transferleistungen wie z.B. Lohnkostenzuschüsse, Minderleistungsausgleich oder Arbeitsplatzanpassungen verwendet. Die Verwaltung und Verteilung dieser Gelder obliegt in Österreich dem Bundessozialamt für Soziales und Behinderungswesen (BSB) und seinen Landesstellen sowie in Deutschland den jeweiligen Integrationsämtern (vgl. Badelt / Österle 2000, S.83; BIH 2002, S.54f).
Zu den sowohl von Fachdiensten als auch von Betrieben umstrittensten Regelungen gehören die in beiden Ländern existierenden Kündigungsschutzbestimmungen. Menschen mit Behinderung unterliegen zwar in keinem der beiden Länder einem absoluten Kündigungsschutz, allerdings ist im Falle einer angestrebten Kündigung ein besonderes Schlichtungs- bzw. Mediationsverfahren vor einem eigens dafür bestellten Behindertenausschuss erforderlich. Der Kündigungsschutz tritt in beiden Ländern erst ab dem 6. Monat der Beschäftigung in Kraft. Insbesondere Informationsdefizite auf der Seite der DienstgeberInnen führen dazu, dass dem Kündigungsschutz eine beschäftigungshemmende Wirkung zugesprochen wird. Hier ist auf die so genannte "Insider-Outsider Problematik" hinzuweisen, wonach der Kündigungsschutz nur für behinderte Personen, die sich bereits in einem Dienstverhältnis befinden, zu erhöhter Arbeitsplatzsicherheit führt, für nicht beschäftigte Menschen mit Behinderung allerdings eine zusätzliche Barriere darstellt (vgl. Badelt / Österle 2000, S.84; BIH 2002, S.140ff).
Zu den Maßnahmen der ausgleichenden Steuerung zählen in beiden Ländern z.B. eine Reihe von personen- oder betriebsbezogenen finanziellen oder materiellen Transferleistungen. Dazu gehören u.a. Zuschüsse für Arbeitsplatzadaptierungen oder Lohnzuschüsse zum Ausgleich von Leistungseinschränkungen behinderter ArbeitnehmerInnen. Diese Lohnkostenzuschüsse oder Minderleistungsausgleich sind in jedem Fall auf die Tätigkeit auf einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden und können, so wie alle anderen Transferleistungen nur von den zuständigen Leistungsträgern bewilligt werden. Im Gegensatz zu Förderungen am Ersatzarbeitsmarkt werden sie nur zeitlich befristet bewilligt (vgl. Badelt / Österle 2000 S.84f; Mühling 2000, S.63ff; Doose 2003, S.11). Zusätzlich werden zu den Instrumenten der ausgleichenden Steuerung auch berufsvorbereitende und qualifizierende Maßnahmen, Beratungen für Unternehmen aber auch die Dienstleistungen der Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste gezählt, auf deren Einbettung in die jeweiligen Rehabilitationssysteme und rechtliche Fördergrundlagen an späterer Stelle noch genau eingegangen wird.
Zu der dritten Kategorie den Maßnahmen zur Schaffung eines Ersatzarbeitsmarktes zählen in Österreich die Integrativen Betriebe und in Deutschland die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Beide Einrichtungen stellen einen öffentlichen Ersatzarbeitsmarkt zur Beschäftigung behinderter Menschen und zur Vorbereitung auf ein Beschäftigungsverhältnis im allgemeinen Arbeitsmarkt dar. Sowohl Integrative Betriebe als auch die Werkstätten für Behinderte sind auch in den jeweiligen Bundesgesetzen verankert. Insbesondere die zweite ihrer gesetzlich definierten Kernaufgaben, nämlich die Vorbereitung auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, nehmen die beiden Einrichtungen nur in einem unbefriedigenden Ausmaß wahr. So beträgt die jährliche Durchlässigkeit der Integrativen Betriebe in etwa 3 % (vgl. Badelt / Österle 2000, S.86; BIH 2002, S.223f).
Durch die Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung ("Behindertenmilliarde") wurden seit 2001 verstärkt Maßnahmen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben gefördert. Die Schwerpunkte lagen bei den Problembereichen Einstieg und Wiedereinstieg in den offenen Arbeitsmarkt. Besondere Impulse konnten dabei insbesondere bei der Schnittstelle Schule - Beruf für Jugendliche mit Behinderung realisiert werden, so wurde durch die Beschäftigungsoffensive die Maßnahme des Clearing und die der Jugendarbeitsassistenz geschaffen. Im Nationalen Aktionsplan zur Beschäftigung (NAP) 2003 wurden folgende Zielsetzungen für die kommenden Jahre formuliert:
-
Die Erarbeitung eines Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes unter Einbeziehung der Betroffenen[13].
-
Die Weiterführung und Evaluierung der Beschäftigungsoffensive[14].
-
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau der jüngsten gesetzlichen Regelung, welche die Integration behinderter Menschen betrifft, und zwar der Integrativen Berufsausbildung. Diese seit September 2003 in Kraft getretene Regelung ermöglicht die Absolvierung einer Teillehre für behinderte Jugendliche, bzw. eine bedarfsgerechte Verlängerung der Lehrzeit.
-
Die besondere Förderung von Frauen mit Behinderung sowie ein weiterer Ausbau der Arbeitsassistenz gehören ebenfalls zu den Zielsetzungen (vgl. NAP Österreich 2003, S.25f; SORA / KMU / ABIF 2004, S.15ff;)
In Deutschland wurde laut dem NAP 2003 in den letzten Jahren das Schwerbehindertengesetzes ("Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft") novelliert, und am 1. Oktober 2000 das "Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter" verabschiedet. Die darin u.a. verankerte Neugestaltung des Systems von Ausgleichsabgabe und Beschäftigungspflicht und der Auf -und Ausbau eines flächendeckenden Netzes von Integrationsfachdiensten und Integrationsunternehmen dienen dem Ziel, die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen nachhaltig zu senken. Das Schwerbehindertengesetz wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2001 Teil des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX), mit dem das Recht der Rehabilitation und der Teilhabe behinderter Menschen neugefasst, modifiziert und fortentwickelt worden ist. Ziel war, insbesondere die Beschäftigungssituation behinderter und dabei wiederum speziell schwerbehinderter Menschen zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer Vereinfachung des Förderrechts besonders im Bereich der Integrationsfachdienste (vgl. NAPDeutschland 2003, S.29ff)
"Berufliche Rehabilitation umfasst alle Hilfen zur Erhaltung und Erlangung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, wie die Beratung, die Vermittlung eines behindertengerechten Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, die Einleitung berufsfördernder Maßnahmen (inkl. Nachreifung und Berufsorientierung, Ergänzung der Verfasser.) sowie die Gewährung von Leistungen an Arbeitgeber oder an den Maßnahmenträger." (Vonderach 1996, S.14)
Eine im Sinne der weiteren Ausführungen sehr brauchbare Definition bezüglich "Integration von Menschen mit Behinderung" ist jene nach Horak und Schmid (2003, S.20), worin Integration als:
"Nichtaussonderung aus gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen verstanden wird. Dabei wird von einer Unteilbarkeit des Rechtes auf Integration auf Grundlage des als unteilbar verstandenen Menschenrechts auf Teilhabe an der Gesellschaft ausgegangen. Integration richtet sich daher an alle Lebenszusammenhänge (Schule, Berufsleben, Wohnen, Freizeit, Kultur- und Gesellschaftsleben, etc.) und orientiert sich sowohl auf die behinderten Personen, seine/ihre Angehörigen als auch auf jene "nicht behinderten", die gegenüber dem System "Integration" Gesellschaft abbilden (Schule, Arbeitswelt, Freizeit, Nachbarschaft, etc.)
Wie bereits erwähnt, werden die Aufgabenbereiche Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderung in beiden Ländern als Querschnittsmaterie von mehreren Institutionen getragen. Zu den wichtigsten Akteuren in Österreich zählen das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) als zentrale Koordinationsstelle, das Bundessozialamt für Soziales und Behinderungswesen (BSB) und seine Landesstellen, welche die operativen Aufgaben der regionalen Koordination wahrnehmen, das Arbeitsmarktservice (AMS), das nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auch für Menschen mit Behinderung offen steht, die Sozialversicherungsträger, die Bundesländer sowie die maßnahmenerbringenden Projektträger. Eine ähnliche Kompetenzverteilung finden wir in Deutschland mit den zentralen Akteuren Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS), den Integrationsämtern und der Bundesagentur für Arbeit (vgl. BIH 2002, S.243ff; BABE 2003, S.22ff;).
An dieser Stelle soll nun ein besonderes Augenmerk auf die institutionalisierte Angebotspalette der beruflichen Integration in Österreich und Deutschland gelegt werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen in Österreich zählen:
-
das Angebot des Clearing, dass für Jugendliche zwischen 14 und 24 an der Schnittstelle Schule- Beruf eine Klärung über den gewünschten und realisierbaren Lebensweg aufzeigt, welche in einen Entwicklungs- und Karriereplan münden soll. Die Clearing Träger nehmen auch eine Vernetzungs- und Schnittstellenfunktion im zum Teil sehr dichten Netz der unterschiedlichen Maßnahmen wahr und erleichtern den Jugendlichen mit Behinderung die Orientierung.
-
Auf die Arbeitsassistenz und Jugendarbeitsassistenz wird im Folgenden noch genau eingegangen.
-
Das Job Coaching, das ursprünglich zu den Aufgaben der Arbeitsassistenz zählte, wurde teilweise aus dem Angebot herausverlagert und zu einer eigenständigen Maßnahme. Job Coaching bedeutet individuelle Unterstützung bei der Eingliederung in die Strukturen eines Betriebes sowie an die Anforderungen eines Arbeitsplatzes.
-
Nachreifungsprojekte werden vielfach einer Qualifizierung oder Integration vorgeschaltet um behinderungs- oder persönlichkeitsbedingte Einschränkungen auszugleichen. Häufig geht es um die Vermittlung arbeitsrelevanter Großtugenden der Arbeitswelt ("Schlüsselqualifikationen").
-
Qualifizierungsprojekte werden in unterschiedlichen Bereichen angeboten und sind in ihrer Dauer meist zeitlich befristet. Ein besonderer Schwerpunkt der Qualifizierung soll in der 2003 geschaffenen
-
Integrativen Berufsausbildung liegen, welche die Möglichkeit der Teilqualifizierungslehre, also einen anerkannten Teilabschluss in einem Berufsfeld zum Ziel hat, bzw. die individuelle Verlängerung der normalen Lehre um behinderungsbedingte Einschränkungen auszugleichen.
-
Beschäftigungsprojekte sollen durch befristete Anstellungen in einer möglichst realen Arbeitssituation auf eine Anstellung am ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Eine spezifische Form dieser Beschäftigungsprojekte ist die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, welche sich am Grundprinzip privatwirtschaftlicher Leasingfirmen orientiert. Ziel ist auch hier die Übernahme in ein reguläres Dienstverhältnis.
-
Outplacement Maßnahmen sollen die Integration aus Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekten unterstützen und forcieren.
-
Seit 2004 wird die Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, die von der Wiener Assistenzgenossenschaft (WAG) in einem Modellprojekt erprobt worden ist, für Menschen mit körperlichen Behinderungen finanziert. Das Besondere an der Persönlichen Assistenz ist, dass es ausschließlich von Selbstvertretungsorganisationen angeboten und durchgeführt wird. Der/dem AssistenznehmerIn obliegen die für ein selbstbestimmtes Leben notwendigen Kompetenzen. Dies sind die Anleitungs-, Raum-, Organisations-, Personal- und Fachkompetenz. Der/die AssistentIn führt dabei Hilfstätigkeiten aus, die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Arbeit stehen, welche der/die AssistenznehmerIn nicht eigenständig durchführen kann. Die Persönliche Assistenz ist in ihrer Dauer nicht befristet, es gibt allerdings nur ein befristetes Kontingent und die Assistenz ist in ihrer Funktion anders als z.B. im schwedischen Modell nur auf die Ausübung eines Berufes beschränkt.
-
Die bereits erwähnten Integrativen Betriebe stellen eine Form des öffentlichen Ersatzarbeitsmarkts für behinderte Menschen dar.
-
Im Unterschied zu den Integrativen Betrieben steht in den von den Ländern finanzierten Beschäftigungstherapie Werkstätten, wie es der Name schon impliziert, der Leistungsaspekt im Hintergrund. Die in diesen Einrichtungen tätigen Menschen verfügen über keinen ArbeitnehmerInnenstatus und bekommen lediglich ein Taschengeld ausbezahlt. Die SORA / KMU / ABIF Studie 2004 bescheinigt, dass eine immer größer werdende Gruppe von Jugendlichen, die durchaus in berufsvorbereitenden Angeboten eine Möglichkeit zur Arbeitsintegration haben, aufgrund des Quotendrucks der Qualifizierungs- und Arbeitsassistenzeinrichtungen in Beschäftigungstherapie Einrichtungen landen. (Vgl. Badelt / Österle 2000, S.88ff; BABE 2003, S.31ff; Prischl 2004, S.193.ff; SORA / KMU / ABIF 2004, S.21ff)
Das System der beruflichen Rehabilitation sowie das Angebot an Maßnahmen in den Bereichen der Berufsorientierung, der Berufsvorbereitung, der Qualifizierung, der arbeitsbegleitenden Hilfen oder der Vermittlung, etc. sind in Deutschland noch vielfältiger als In Österreich. Ginnold (2000, S.114) spricht sogar von einer
"Geheimwissenschaft, angesichts der fast unüberschaubaren Anzahl von berufsvorbereitenden und berufsausbildenden Angeboten"
deren Abkürzungen zum Teil für noch mehr Verwirrung sorgen. Ich möchte im Folgenden einen Überblick über die wichtigsten dieser Maßnahmen geben, die im gesamten Bundesgebiet angeboten werden. Nicht berücksichtigt sind dabei zahlreiche Modelle der Berufsvorbereitung im Rahmen der letzten Schuljahre an Schulen für so genannte Geistig- und Lernbehinderte Menschen:
-
Berufsbildungswerke (BBW) sind überbetriebliche und überregionale Einrichtungen zur beruflichen Erstausbildung von Jugendlichen mit Behinderung, mit Ausnahme von Jugendlichen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Es können in den BBW sowohl Berufsausbildungen nach der regulären Ausbildungsverordnung mit einem vollwertigen Abschluss, als auch "Theoriegeminderte Berufsausbildungen" erworben werden. Neben der Ausbildung werden Unterbringung (meist in Form eines angeschlossenen Internats), Freizeitangebote und begleitende Dienste (ärztlicher, psychologischer & Sozialdienst) bereitgestellt. Insgesamt gibt es in Deutschland 47 BBWs mit rund 14.000 Ausbildungsplätzen
-
Für Erwachsene Menschen mit Behinderung, die in der Regel bereits berufstätig waren, fungieren die Berufsförderungswerke (BFW) als Einrichtungen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie der Umschulung. Es gibt derzeit in Deutschland 28 BFWs mit ca. 15.000 Ausbildungsplätzen. Sowohl die BBW als auch die BFW wurden in Deutschland überregional eingerichtet und verfügen zum Großteil über ein angeschlossenes Wohnheim. Die Ausbildungen erfolgen gemäß dem dualen System, allerdings am selben Lern- und Arbeitsort. Im neuen SGB IX wird eine verstärkte Orientierung an betrieblichen Ausbildungen angestrebt.
-
Es gibt auch in Deutschland die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung eine Berufsausbildung im dualen System zu absolvieren. Diese wird wie in Österreich an zwei Lernorten, und zwar dem Ausbildungsort und der Berufsschule durchgeführt, und dauert je nach Lehrberuf zwischen 2 und 3 Jahre. Jugendlichen mit Behinderung stehen eine Reihe von unterstützenden Angeboten zur Verfügung. Zu den wichtigsten zählt sicher die Möglichkeit so genannte Ausbildungsbegleitende Hilfen in Anspruch zu nehmen. Diese können z.B. in der Form von Stützunterricht oder Beratungsgesprächen grundsätzlich während der gesamten Ausbildungszeit in Anspruch genommen werden. Der stetige Anstieg an Anforderungen auch im Bereich der Lehrberufe macht es allerdings auch in Deutschland für Jugendliche mit Behinderung sehr schwer einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
-
Die so genannten F1 - F4Förderlehrgänge[15] sind berufsvorbereitende Angebote in überbetrieblichen Rehabilitationseinrichtungen, die sich an Jugendliche richten die (noch) "nicht ausbildungsreif" sind. Ziel dieser zwischen 12 und 36 Monate dauernden Lehrgänge ist es, eine dauerhafte Integration in eine Berufsausbildung oder Beschäftigung zu erreichen.
-
Zu den Aufgaben der Integrationsfachdienste wird an anderer Stelle Bezug genommen.
-
Die Maßnahme der Arbeitsassistenz kann mit den Modellen des Job Coaching wie mit der Persönlichen Assistenz in Österreich verglichen werden. ArbeitsassistentInnen haben dabei den Auftrag schwerbehinderten Menschen bei der Erlangung eines Arbeitsplatzes und bei der dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen. Auf diese Leistung besteht seit der Novellierung des SGB IX ein Rechtsanspruch. Die Arbeitsassistenz wird sowohl durch die betroffenen Personen selbstorganisiert als auch im Rahmen von Institutionen in einem Arbeitgebermodell durchgeführt.
-
Die Werkstatt für Behinderte Menschen (WfBM) ist gesetzlich als Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen und zur Eingliederung in das Arbeitsleben definiert und stellt die häufigste Form eines öffentlichen Ersatzarbeitsmarktes in Deutschland, vor allem Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dar, die in der Regel aus anderen Angeboten der beruflichen Rehabilitation herausfallen. Die meisten WfbMs sind in einen Eingangs-, einen Berufsbildungs- sowie einen Arbeitsbereich aufgeteilt und erfüllen dadurch ein breites Aufgabenfeld von der Berufsorientierung über Qualifizierung bis hin zur Bereitstellung von Dauerarbeitsplätzen. In den 671 WfbMs in Deutschland arbeiten mittlerweile rund 227.000 Menschen mit Behinderung, davon etwa 13.000 Personen die den Berufsbildungsbereich besuchen (Bericht der Bundesregierung 2004, Zahlen für 2002). Einige WfbMs bieten in der Form von Außenarbeitsplätzen oder einzelnen Projekten, die sich strukturell an diversen Organisationsformen von Unterstützter Beschäftigung orientieren, integrative Alternativmodelle mit dem Ziel der Integration in den ersten Arbeitsmarkt an. Die Übertrittsquoten von WfbMs in den allgemeinen Arbeitsmarkt sind trotz gesetzlicher Bestimmungen sehr gering.
-
Neben den WfbMs existieren in Deutschland so genannte Tagesförderstätten, in denen Mehrfachbehinderte Menschen betreut werden, die nicht im Arbeitsbereich der WfbMs beschäftigt werden können. Strukturell sind die Tagesförderstätten meist an eine WfbM angegliedert. (Vgl. Doose 1997, S.19ff; Ginnold 2000, S.121ff; Markowetz 2000, S.115ff; BIH 2002, S.78f & S.128f & S.223; Blesinger 2002, S.24ff; Bundesanstalt für Arbeit 2002, S.279 & S.322 & S.326 & S.457 & S.459; Bericht der Bundesregierung 2004; Doose 2004d, S.1ff)
-
Es ist sicherlich in beiden Ländern festzustellen, dass es eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen gibt, die für sich das Attribut "integrativ" in Anspruch nehmen. Sehr oft ist allerdings unklar, worin das integrative Moment bzw. der Integration fördernde Charakter von eben diesen Maßnahmen liegt. So schreibt z.B. Markowetz (2000, S.111), dass
"die Begriffe berufliche Rehabilitation und berufliche Integration oft synonym verwendet werden,...".
Als Unterscheidungsmerkmal führt er an, dass
"die berufliche Rehabilitation den Weg beschreibt, während die berufliche Integration das Ziel darstellt". Daraus folgert er, dass "insofern zwar jede Maßnahme der beruflichen Integration als eine integrative aufgefasst werden kann, auf der Grundlage eines umfassenden Integrationsverständnisses, das an sich den Anspruch der grundsätzlichen Gemeinsamkeit von Behinderten und Nicht - Behinderten im Lebensbereich Arbeit, ..., stellt, müsste man mit der Beurteilung schon wesentlich zurückhaltender sein. (ebenda)"
Aus diesem Grund wird es als zielführend angesehen Indikatoren für Integration und integrative Projekte zu bestimmen und zu entwickeln, um auf diese Weise neue Qualitätsstandards in diesem Bereich zu schaffen (vgl. SORA / KMU / ABIF 2004, S.102). Zwei weitere kritische Thesen führt Ginnold (2000, S.141) an, die grundsätzlich auch für beide Länder als zutreffend aufgefasst werden können, und zwar, dass
-
"Berufsvorbereitende Maßnahmen für Jugendliche mit Behinderung oft zur Warteschleife werden,....," und dass
-
"es wesentlich mehr Angebote für junge Männer als für junge Frauen gibt".
Im Folgenden Teil werde ich nun die unmittelbaren gesetzlichen Rahmenbedingungen der beiden Institutionen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste genauer untersuchen und darstellen, in welcher Art und Weise Qualität bzw. Qualitätssicherung bereits in den gesetzlichen Vorgaben dieser Dienste verankert ist.
Seit 01. Jänner 1999 ist die Arbeitsassistenz im BEinstg als Instrument der beruflichen Integration verankert. Demnach werden die Kosten der begleitenden Hilfen am Arbeitsplatz, insbesondere Arbeitsassistenz finanziell gefördert. Das BSB ist entsprechend seinem Kompetenzbereich für die Beauftragung der Arbeitsassistenz-Einrichtungen zuständig. Zur Durchführung dieser Aufgabe gewährt das BSB Förderungen an gemeinnützige Einrichtungen, welche die Dienstleistung erbringen. Die Finanzierung der Arbeitsassistenz erfolgt aus Mitteln des ATF, zusätzlich werden projektbezogen auch Förderungen von ESF, AMS und den Bundesländern ausbezahlt (vgl. Badelt / Österle 2000, S.90; Blumberger 2002, S.11ff). Die Arbeitsassistenz ist für arbeitssuchende "begünstigte Behinderte" im Sinne des BEinstg zugänglich. Außerdem gehören zum förderbaren Personenkreis auch Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie sozial und emotional gehandikapte Jugendliche (bis zum vollendeten 24. Lebensjahr).
Die genaue Definition des Auftrages der Arbeitsassistenz ist in den BSB "Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen am Arbeitsplatz"[16] festgehalten: Der Auftrag an die Träger der Arbeitsassistenz beinhaltet die Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderung zur Erlangung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Zur Erfüllung dieses Auftrags sind von den Arbeitsassistent/innen insbesondere auch folgende Aufgaben wahrzunehmen:
-
"Begleitung und Abklärung der beruflichen Perspektiven,
-
Beratung von Dienstgeber/innen und im betrieblichen Umfeld,
-
Zusammenarbeit mit allen Einrichtungen, Behörden und Institutionen,
-
Teilnahme an vom Bundessozialamt einberufenen Arbeitsbesprechungen,
-
Unterstützung bei Fragen der sozialen Sicherheit außerhalb des Arbeitsplatzes (z.B. in Wohnungsfragen, im familiären Bereich, im Freizeitverhalten usw.),
-
Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit." (Richtlinien zur Förderung begleitender Hilfen)
Die gesetzliche Grundlage für die Integrationsfachdienste ist das SGB IX, in welches das Schwerbehindertenrecht integriert wurde. Aufgrund der übergeordneten Zielsetzung des SGB IX sollen somit die IFD zur Förderung der "Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft"von Menschen mit Behinderungen beitragen. Die IFD können im Auftrag der Integrationsämter, der Bundesagentur für Arbeit (BA) und weiterer Rehabilitationsträger tätig werden. Die Finanzierung der IFD erfolgt durch die beauftragende Institution. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die IFD in Vermittlung und Begleitung getrennt worden sind, wodurch sich unterschiedliche Zuständigkeiten & Finanzierungsstrukturen ergeben haben. Der Vermittlungsbereich wurde im Zuge des Gesetzes zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter in die Zuständigkeit der Bundesanstalt für Arbeit gelegt, wohingegen der Bereich der begleitenden Hilfen den Integrationsämtern zugeteilt wurde. Zu der Zielgruppe des IFD gehören Schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender Betreuung sowie insbesondere Menschen aus WfbM und SchulabgängerInnen.
Die Aufgaben der IFD sind im SGB IX § 110 wie folgt formuliert:
"die Beratung, Unterstützung und Vermittlung von schwerbehinderten Menschen auf geeignete Arbeitsplätze sowie die Information und Beratung von Arbeitgebern".
Im Abschnitt (2) §110 erfolgt eine sehr genaue Definition des Aufgaben- und Methodenkatalogs der IFD. Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es demnach:
-
"die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit den schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation zu erarbeiten,
-
die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorientierung und Berufsberatung in den Schulen einschließlich der auf jeden einzelnen Jugendlichen bezogenen Dokumentation der Ergebnisse zu unterstützen,
-
die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,
-
geeignete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
-
die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
-
die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,
-
mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechende Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,
-
eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie
-
als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, über die Leistungen für die Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeitgeber diese Leistungen abzuklären,
-
in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern die für den schwerbehinderten Menschen benötigten Leistungen zu klären und bei der Beantragung zu unterstützen."
Die Erfolgskriterien der Arbeitsassistenz werden laut Horak & Schmid (2003, S.45)
"vom BMSG unter Einbindung des BSB und unter Rücksichtnahme auf Erfahrungen aus der Praxis festgelegt."
Die Rahmenkriterien, was als Erfolg bewertet wird, sind in den "Richtlinien zur Förderung begleitender Hilfen festgelegt". Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Erfolgsvorgaben derzeit ausschließlich quantitativer Natur sind, es interessiert wie viele Arbeitsplätze erlangt oder gesichert werden konnten sowie wie viel Geld dafür ausgegeben wurde (vgl. Fasching 2003, S.166f & Horak / Schmid 2003, S.13)[17]. Im Sinne der Richtlinien (2004, S.3)
"gilt ein Dienstverhältnis eines Menschen mit Behinderung als erlangt, wenn es innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Begleitung zumindest drei Monate aufrecht ist. Ein Dienstverhältnis gilt als gesichert, wenn es zumindest sechs Monate nach Beginn der Interventionen durch die Arbeitsassistenz noch aufrecht ist. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes können weitere Interventionen in eine neuerliche Begleitung münden."
Ein gefundener Arbeitsplatz gilt auch nur dann als Erfolg, wenn er zumindest eine Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden ermöglicht. Die Anzahl der zu erzielenden Erfolge pro ArbeitsassistentIn (Vollzeitäquivalent) und Jahr werden zwischen dem BSB und dem Projektträger in Förderverträgen für jeweils ein Jahr festgelegt, dabei dürfen diese 15 und bei psychisch beeinträchtigten Personen 10 nicht unterschreiten. Für die Erfolgs- bzw. Qualitätskontrolle von Arbeitsassistenz Projekten ist ebenfalls das BSB verantwortlich. Die Controllingfunktion über die quantitativen Messungen übt das BSB
- mittels bundesweit einheitlicher Computerunterstützter Dateneingabe, das so genannten "Portal Austria",
- über von den Trägern zu erstellende Halbjahres- und Jahresstatistiken,
- über die jährliche Projektabrechung
- sowie über halbjährlich stattfindende Arbeitsbesprechungen aus.
Innerhalb des BSB gibt es eine Qualitätssteuerungsgruppe welche den Trägern Standards der Strukturqualität vorgibt und diese auch überprüft. Diese Qualitätsstandards beziehen sich u.a. auf die Ausstattung, die Qualifikation des Personals sowie auf das Vorhandensein eines Qualitätssicherungs- bzw. Managementsystems. Letzteres war bis jetzt noch nicht zwingend vorgesehen, es wird jedoch angedacht für die Ausstellung von langfristigen Fördervereinbarungen von den Trägern ein Qualitätsmanagementsystem zu verlangen (vgl. Fasching 2003, S.166f; Leitfaden zur Projektbearbeitung des BMSG 2003, S.18ff sowie Richtlinien zur Förderung begleitender Hilfen 2004, S.6).
Die Erfolgskriterien für die Integrationsfachdienste in Deutschland folgen einem anderen Muster. Dies ergibt sich schon aus der strukturellen Trennung der Bereiche Vermittlung und Begleitung. Die Bundesanstalt (jetzt Bundesagentur) für Arbeit war für die Errichtung eines IFD in jedem Arbeitsamtbezirk zuständig, eine Entwicklung, die nunmehr abgeschlossen ist. Daraus ergab sich auch die Übernahme der Struktur- und Finanzverantwortung für den Bereich der Vermittlung. Die Bundesanstalt führte ein stark vermittlungsorientiertes Finanzierungssystem ein, mit einer geringen personenbezogenen Pauschale und einer hohen Vermittlungsvergütung. Die Integrationsämter, die per Gesetz für den Bereich der begleitenden Hilfen zuständig sind, übernahmen den Bereich der begleitenden Hilfen. Dazu ist noch anzumerken, dass grundsätzlich die beauftragende Institution für die Finanzierung aufkommen muss. Dies bedeutet, dass die IFD für sieben potentielle Kostenträger aktiv werden können. Auf die durch diese Entwicklung ausgelöste Zielgruppenverschiebung wird später Bezug genommen. Im Zuge einer großen Strukturreform wird ab 2005 die Strukturverantwortung für die IFD nunmehr ausschließlich in die Hände der Integrationsämter gelegt. Es wird auch ein neues Vergütungssystem eingeführt werden, das über eine 80 % Sockelfinanzierung und einen 20 % leistungsbezogenen Anteil funktionieren wird. Dadurch sollen auch einheitliche Standards für den IFD in den Bereichen Datendokumentation, Qualitätssicherung und Finanzierung erreicht werden. Zukünftig sollen die Erfolgskriterien mit jedem IFD individuell im Rahmen von Ziel- bzw. Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Dadurch können auch verstärkt die regionalen Arbeitsbedingungen der einzelnen Fachdienste in die Ausgestaltung der Leistungsvereinbarungen einbezogen werden. Ausgangspunkt für die Leistungsvereinbarungen soll jedenfalls immer eine Standortbestimmung der eigenen Arbeit sowie konkrete Ziele anhand der Parameter Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität für einen festgelegten Zeitraum sein (vgl. Schartmann 2003, S.25ff; Seel 2004, S.2ff).
Im SGB IX §20 (2) wird von Erbringern von Leistungen zur beruflichen Rehabilitation ein Qualitätsmanagementsystem verlangt, das
"durch Zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen die Qualität der Versorgung gewährleisten und kontinuierlich verbessern soll".
Für den Bereich der IFD hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter das Qualitätsmanagementsystem "KASSYS" ursprünglich nur für den Bereich der begleitenden Hilfen entwickelt, welches ebenfalls im Zuge der Strukturreform auch auf den Vermittlungsbereich ausgedehnt und den Integrationsfachdiensten als zentrales Steuerungsinstrument zu Grunde gelegt werden wird.
Es ist zunächst grundsätzlich anzumerken, dass es weder in Österreich noch in Deutschland eine allumfassende Statistik gibt, die über die Anzahl von Menschen mit Behinderung bzw. deren Lebens- und Arbeitssituation eine Gesamtaussage zulassen könnte. Nicht nur bei nationalen Daten, sondern erst recht bei einem europäischen Vergleich bestehen Definitions-, Erfassungs- und Zählprobleme, die einen Datenvergleich erschweren (vgl. Blumberger 2002). Nach Schätzungen der Europäischen Kommission (2001) und der OECD (2003) sind 8-14 % der europäischen Bevölkerung von einer wie auch immer gearteten Behinderung betroffen. Außerdem handelt es sich bei der Gruppe der Menschen mit Behinderung um eine heterogene Personengruppe, die sich aus Menschen mit angeborenen und erworbenen Behinderungen, solchen mit verschiedenen Schweregraden der Behinderung, mit physischen und psychischen sowie mit temporären und permanenten Behinderungen zusammensetzt (vgl. OECD 2003, S.22). Einem Vergleich der Arbeitsmarktlage behinderter Menschen in den beiden Ländern ist die Tatsache voranzustellen, dass sich die Aufnahme einer Beschäftigung als ein zweistufiger Prozess interpretieren lässt, in dessen erster Phase sich ein Individuum entscheidet, Arbeit anzubieten. Erst die zweite Phase bezieht sich auf Arbeitsplatzsuche und das Finden einer geeigneten Stelle. Vor diesem Hintergrund ist es sehr aufschlussreich sich die Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung und der Arbeitslosigkeit von behinderten und nicht behinderten Menschen anzusehen. Nach Daten der Europäischen Kommission (2001, S.24) sind in Europa
-
rund 52% der Behinderten, aber nur 28% der Nichtbehinderten nicht erwerbstätig, und außerdem
-
stehen nur etwa 42% der Behinderten, aber beinahe 65% der Nichtbehinderten im Berufsleben.
Während die Arbeitslosenraten von Menschen mit Behinderung nur geringfügig schlechter sind als jene von nicht behinderten Menschen ist die Partizipationsrate deutlich geringer. So betrug die Partizipationsrate von Menschen mit Behinderung in Österreich im Jahr 1996 49,9% gegenüber einer Rate von 75% bei Nichtbehinderten. In Deutschland betrug das Verhältnis im gleichen Jahr 57,6% gegenüber 78,4% (vgl. Europäische Kommission 2001, S.40f). Die OECD (2003, S.62) bezifferte die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung in einem Vergleich der Beschäftigungssysteme der einzelnen Mitgliederländer für das Jahr 1999 sogar etwas niedriger. Demnach betrug das Verhältnis in diesem Jahr für Österreich 43,4%: 71,8% und für Deutschland 46,1% : 69,0%. Betrachtet man die Zahlen noch etwas genauer wird deutlich, dass die Rate der schwerer behinderten Menschen in Beschäftigung sogar nur ca. 25% beträgt.
Weitere beschäftigungshemmende Faktoren innerhalb der Gruppe der Menschen mit Behinderung sind ein durchschnittlich höheres Alter und ein geringeres Bildungsniveau. Außerdem sind Menschen mit Behinderung vermehrt in Niedriglohnbranchen tätig, haben ein niedrigeres Grundeinkommen und v.a. arbeitlose Menschen mit Behinderung sind überproportional häufig von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen (vgl. Badelt / Österle 2001, S.91; Europäische Kommission 2001, S.39ff; BMSG 2003, S.13ff).
Da es auch in Österreich keine einheitliche Definition von Behinderung gibt, kann auch keine Aussage über die Gesamtanzahl der behinderten Menschen getroffen werden, es können nur Annäherungen über relevante Kennziffern erfolgen. Eine derartige für die Arbeitsmarktlage relevante Kennziffer ist jene der "Begünstigt Behinderten" Personen in Österreich, deren Anzahl in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist und im Jahre 2003 86.808 Personen betrug. Dieser Anstieg ist zum einen auf Grund der allgemeinen demographischen Entwicklung erklärbar, allerdings kann auch durch eine veränderten Einstellung gegenüber Arbeit von Menschen mit Behinderung die Partizipationsrate angestiegen sein. Der Anteil an Frauen unter den begünstigt Behinderten hat sich seit 1995 (35,1%) nur geringfügig verändert und betrug im Jahre 2003 38,1% (vgl. BMSG 2003, S.11ff).
Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH, 2004, S.10ff), leben in der Bundesrepublik Deutschland rund 6,7 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung. Nach Schätzungen von Bahlke (2001, S.13) wird diese Gruppe bis zum Jahr 2010 auf 7,7 Millionen Menschen angewachsen sein. Derzeit sind etwas mehr als drei Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter (zwischen 15 - 65) schwerbehindert, aber nur rund ein Drittel dieser Gruppe ist auch erwerbstätig.
Aus der folgenden Tabelle kann die Entwicklung der Gesamtbeschäftigung, der Arbeitslosenquoten, die Anzahl der Menschen mit Behinderung in Beschäftigung, der Anteil der Menschen mit Behinderung an der Gesamtbeschäftigung und der Gesamtarbeitslosigkeit, der Anzahl der arbeitslos gemeldeten Menschen mit Behinderung, sowie der Anteil dieser Personen an der Gesamtarbeitslosigkeit vom Jahr 2000 bis 2003 bzw. 2004 in Österreich und Deutschland entnommen werden.
Tabelle 2: Gesamtbeschäftigung; Arbeitslosenquote; anerkannte Menschen mit Behinderung in Beschäftigung; Anteil von Menschen mit Behinderung an der Gesamtbeschäftigung; Gesamtarbeitslosigkeit; Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung; sowie Anteil der behinderten Personen an der Gesamtarbeitslosigkeit von 2000 - 2004 in Österreich und Deutschland Die verwendeten Daten stammen von folgenden Quellen: Österreich: Sozialstatistik des BMSG im Internet abrufbar unter www.bmsg.gv.at sowie der Arbeitsmarktstatistik des AMS im Internet unter www.ams.or.at. Deutschland: Statistik der Bundesagentur für Arbeit im Internet unter http://www.pub.arbeitsamt.de-/hst/services/statistik/detail/x.html. Die mit einem * gekennzeichneten Daten beruhen auf eigenen Berechnungen der Datenquellen. Die Jahresstatistik 2004 für Deutschland wurde aus den veröffentlichten Monatsstatistiken Jänner - September 2004 als Durchschnittswert errechnet.
|
Veränderung gegenüber Vorjahr |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Änderung 2000 - 2003 bzw. 2004 |
|
Gesamtbeschäftigung (sozialversicherungspflichtige unselbständige Erwerbstätige) |
||||||
|
Österreich |
3.133.738 |
3.148.155 + 14.417* |
3.155.161 + 7.006* |
3.184.759 + 29.598* |
+ 51.021* + 1,6%* |
|
|
Deutschland |
27.319.667 |
27.825.624 + 505.957* |
27.817.114 - 8.510* |
27.571.147 - 245.967* |
+ 251.480* + 0,9%* |
|
|
Arbeitslosenquote |
||||||
|
Österreich |
5,8 % |
6,1% |
6,9% |
7,0% |
+ 1,2%* |
|
|
Deutschland |
9,6% (W:7,8 / O:17.4) |
9,4% (W:7,4 / O:17,5) |
9,8% (W:7,9 / O:18) |
10,5% (W:8,4 / O:18,5) |
+ 0,9%* (W:+0,6% / O: 1,1%) |
|
|
Anerkannte Menschen mit Behinderung in Beschäftigung (Bei Einstellungspflichtigen und nicht einstellungspflichtigen Dienstgebern) |
||||||
|
Österreich |
51.426* |
52.885* + 1.459* |
53.699* + 814* |
+ 2.273* + 4,4%* |
||
|
Deutschland |
849.660 |
861.300 + 11.640* |
837.464 - 23.836* |
- 12.196* - 1,4%* |
||
|
Anteil von Menschen mit Behinderung an der Gesamtbeschäftigung |
||||||
|
Österreich |
1,64 %* |
1,68%* |
1,70%* |
+ 0,06%* |
||
|
Deutschland |
3,11 %* |
3,10%* |
3,01%* |
- 0,10%* |
||
|
Gesamtarbeitlose |
||||||
|
Österreich |
194.314 |
203.886 + 9.572* |
232.418 + 28.532* |
240.079 + 7.661* |
243.880 + 3.801 |
+ 49.566* + 25,51 %* |
|
Deutschland |
3.888.652 |
3.851.636 - 37.016* |
4.060.317 + 208.681* |
4.376.027 + 315.710* |
4.413.217* (bis 09/04) + 37.190* |
+ 524.565* + 13.49 %* |
|
Arbeitslos gemeldete Menschen mit Behinderung |
||||||
|
Österreich |
32.148 |
29.767 - 2.381* |
31.039 + 1.272* |
30.545 - 494* |
28.860 - 1.685* |
- 3.288* - 11,39 %* |
|
Deutschland |
184.089 |
171.325 - 12.764* |
156.882 - 14.443* |
167.856 + 10.974* |
174.128* + 6.272* |
- 9.961* -5,41 %* |
|
Deutschland inklusive Personen in Maßnahmen |
- |
- |
- |
574.381* |
547.987* |
- |
|
Anteil von Menschen mit Behinderung an der Gesamtarbeitslosigkeit |
||||||
|
Österreich |
16,55 % |
14,60 % - 1.95* |
13,36 % - 1.24* |
12,72 % - 0.64* |
12 % - 0.72* |
- 4,55 %* |
|
Deutschland |
4,74 %* |
4,45 %* - 0.29* |
3,86 %* - 0.59* |
3.84 %* - 0.02* |
3,95 %* + 0.11* |
- 0,79 %* |
|
Deutschland inklusive Personen in Maßnahmen |
- |
- |
- |
13,13 %* |
12.416 %* |
- |
Wie aus dieser Tabelle zur entnehmen ist, hat sich das Erwerbspersonenpotential sowohl in Österreich als auch in Deutschland, trotz Geburtenrückganges von 2000 - 2003 erhöht. Die Gesamtarbeitslosigkeit hat sich in Österreich und Deutschland in den Jahren 2000 - 2004 kontinuierlich verschlechtert, während sich die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung sowohl absolut als auch relativ gesehen deutlich günstiger entwickelt hat. Diese Verbesserung ist zum einen sicherlich auf eine verstärkte Ausrichtung der Behindertenpolitik in diesen beiden Ländern auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik ("Behindertenmilliarde" in Österreich bzw. "50.000 Jobs für Schwerbehinderte" Kampagne in Deutschland) zurückzuführen. Allerdings sind Statistiken immer auch kritisch zu beleuchten. So werden z.B. in Österreich den Darstellungen zur Arbeitslosigkeit von Behinderten häufig verschiedene bzw. unklare Definitionen dieses Personenkreises zu Grunde gelegt. Dies wird unter anderem dann zum Problem, wenn auf der Basis unterschiedlicher Definitionen von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Arbeitslosenquoten berechnet werden, und etwa die beim Arbeitsmarktservice registrierten behinderten Arbeitslosen unvermittelt mit den "Begünstigten Behinderten" der Bundessozialämter in Verbindung gesetzt werden. Das Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)wendet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags für mehr Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Sorge zu tragen einen erweiterten Behindertenbegriff an. Wesentlich für die Definition des AMS ist, dass die Behinderung sich tatsächlich negativ auf die individuell festzustellenden Vermittlungs- und Beschäftigungschancen auswirkt. Zu den "behinderten" KlientInnen des AMS zählen sowohl Personen, die nach Bundes - und/oder Landesgesetzen "begünstigt" sind (für 2001 rund 16 % der "Behinderten"), als auch Personen mit physischen, psychischen oder geistigen Einschränkungen (unabhängig vom Grad ihrer Behinderung), die durch ein ärztliches Gutachten belegt sind oder sonst glaubhaft gemacht werden (vgl. BMSG 2003, S.12). So waren im Jahr 2002 von 87.015 "begünstigt behinderten" Personen 29.914 ohne Beschäftigung, während bei den 31.039 vom AMS als arbeitslos gemeldeten behinderten Menschen im Jahresschnitt nur 3.327 "begünstigt Behinderte" waren. Berücksichtigt man diese "Überschneidung" so ergibt sich für das Jahr 2002 eine Anzahl von 57.626 Menschen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter ohne eine Beschäftigung (Quelle: Sozialstatistik BMSG und Monatsstatistiken AMS). Außerdem sind jene Personen, die sich in Qualifizierungsmaßnahmen des AMS und/oder BSB befinden, nicht in der Statistik erfasst.
In Deutschland erstaunt insbesondere der geringe Anteil von Menschen mit Behinderung an der Gesamtarbeitslosigkeit. Bei einer genauen Durchforstung der Statistik zeigt sich, dass eine sehr große Anzahl an "Schwerbehinderten" Personen in Erwerbsunfähigkeitsrenten bzw. in berufsvorbereitenden oder qualifizierenden Maßnahmen nicht in der Arbeitslosenstatistik aufscheint. Berücksichtigt man diese Anzahl, so ergibt sich ein Verhältnis, das ungefähr jenem in Österreich entspricht.
Wie bereits erwähnt gibt es in beiden Ländern ein Quotensystem, welches ArbeitgeberInnen ab einer MitarbeiterInnenanzahl von 20 bzw. 25 vorschreibt eine bestimmte Anzahl an behinderten Menschen zu beschäftigen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der besetzten und nicht besetzten Pflichtplätze in Österreich und Deutschland. Nicht berücksichtigt sind jene behinderten Personen, die bei nicht einstellungspflichtigen Dienstgebern beschäftigt sind, im Jahr 2002 waren dies in Österreich 14,35 % aller beschäftigten "Begünstigt Behinderten", 5,95% waren selbständig erwerbstätig.
Tabelle 3: Anzahl der besetzten und nicht besetzten Pflichtplätze in Österreich und Deutschland
|
Anzahl der besetzten und nicht besetzten Pflichtplätze |
|||||
|
Jahr / Land |
Einstellungspflichtige Dienstgeber (privat / öffentlich) |
Anzahl der Pflichtplätze |
davon besetzt inkl. Doppelan-rechnungen |
davon offen |
Erfüllungsquote |
|
2000 |
|||||
|
Österreich |
14.611 |
84.869 |
54.818 |
30.051 |
64,59 %* |
|
Deutschland |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2001 |
|||||
|
Österreich |
14.840 |
86.157 |
55.219 |
30.938 |
64,09%* |
|
Deutschland |
140.779 / 10.816 |
978.532 |
768.388 |
328.340 |
78,52%* |
|
2002 |
|||||
|
Österreich |
- |
- |
- |
- |
|
|
Deutschland |
140.967 / 10.898 |
944.522 |
748.435 |
309.591 |
79,24%* |
Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, liegt die Erfüllungsquote in Deutschland etwas höher als jener in Österreich. Aufgrund unterschiedlicher Definitionen und Verfahren zur Zuerkennung des jeweiligen "Behindertenstatus" ist dadurch aber kein eindeutiger Vergleich möglich. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass öffentliche Institutionen in Österreich ihre Beschäftigungspflicht stärker erfüllen als privatwirtschaftliche Unternehmen, in Deutschland ist dieses Verhältnis ausgewogen.
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass Menschen mit Behinderung trotz positiver Entwicklungen in den letzten Jahren eine auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Gruppe darstellen. Obwohl der Anteil an begünstigt Behinderten Personen am Erwerbspersonenpotential in Österreich von 1995 - 2003 von 2% auf 2,5% gestiegen ist (in Deutschland im Jahr 2002: 2,3%), hat sich die Wahrscheinlichkeit arbeitslos zu sein oder zu werden im selben Zeitraum für diese Personengruppe von 32% auf 34% verschlechtert. Demgegenüber steht eine allgemeine Arbeitslosenquote von derzeit rund 7%. Die Notwendigkeit von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten ist also weiterhin sehr dringend, denn ohne gezielte Maßnahmen der beruflichen Integration würden sich negative Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaftslage noch ungünstiger auf die Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung auswirken.
Dieses Kapitel sollte - im Kontext mit Qualitätsbemühungen von Institutionen der beruflichen Integration - auf die Bedeutung von Rahmenbedingungen in der konkreten Integrationsarbeit hinweisen. Auch wenn Entwicklungen in diesen Bereichen sich in der Regel dem direkten Einfluss von Fachdiensten entziehen, so haben sie doch erhebliche Auswirkungen auf dessen Arbeit. Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch herausgearbeitet werden wird, gehört die gezielte Beobachtung und Berücksichtigung von relevanten Veränderungen im Umfeld eines Fachdienstes zu den zentralen Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems, vor allem im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Dienstes und somit schließlich zur dessen langfristiger Existenzsicherung. Rückblickend bleibt vor allem die herausragende Bedeutung der europäischen Sozial- und Beschäftigungspolitik - vor allem mit seinen Förderprogrammen - für die Implementierung und des Ausbau von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten als neues Element in der beruflichen Rehabilitationslandschaft festzuhalten. Weiters habe ich versucht eine Systematisierung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente für Menschen mit Behinderung vorzunehmen sowie die (mehr oder weniger integrative) institutionalisierte Maßnahmenpalette in diesem Bereich zu beschreiben. Ich bin ferner auf die unmittelbaren rechtlichen Rahmenbedingungen der Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste eingegangen, und habe dargestellt, in welchem - gesetzlichen - Rahmen Qualitätssicherung für diese Institutionen - bereits - eine Rolle spielt. Zum Abschluss dieses Kapitels habe ich einen kritischen Blick auf die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung in diesen beiden Ländern geworfen. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, habe ich den gesamten Bereich der Einstellungen und Barrieren gegenüber der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in dieser Arbeit ausgeklammert, der in einer umfassenden und differenzierten Analyse der Rahmenbedingungen einen wichtigen Stellenwert einnehmen sollte. Den Bereich der institutionellen Rahmenbedingungen habe ich an dieser Stelle ebenfalls ausgespart, da er im weiteren Verlauf der Arbeit noch an mehreren Stellen eine wichtige Rolle spielen wird. So auch gleich zu Beginn des nächsten Kapitels, in dem ich unter anderem versuche einen Überblick über Typologien und Selbstverständnisse von Fachdiensten zu geben. Außerdem beschreibe und diskutiere ich die Arbeitsweise von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten, die sich - angelehnt an die Grundsätze der Unterstützen Beschäftigung - idealtypisch als ein vierstufiger Prozess beschreiben lässt.
[12] Eine Liste von Homepages aller relevanten Entwicklungspartnerschaften findet sich im Anhang.
[13] Da die Arbeiten zum Bundesbehindertengleichstellungsgesetz sich zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit in Begutachtung befinden, verweise ich auf folgende Homepages um sich über den aktuellen Stand der Entwicklung zu informieren: www.bizeps.or.at bzw. www.gleichstellung.at
[14] Der Evaluationsbericht für die Jahre 2001 & 2002 liegt bereits vor und kann von der Homepage des BMSG im Internet unter URL: www.bmsg.gv.at heruntergeladen werden
[15] Die Bundesagentur für Arbeit hat seit Ende 2004, in Folge der seit langem in dem Bereich der Berufsvorbereitung für benachteiligte Jugendliche existierenden Probleme und der fast unüberschaubaren Anzahl an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, ihr Konzept für diesen Bereich völlig umstrukturiert und ein neues Fachkonzept veröffentlicht. Wesentliche Eckpunkte dieser Reform, die auch zur Abschaffung der so genanten F - Förderlehrgänge geführt haben, ist die Auflösung der alten Maßnahmenkategorien sowie die inhatliche Gliederung der berufsvorbereitenden Maßnahmen in vier Qualifizierungsebenen, und zwar in eine Eignungsanalyse, eine Grundstufe, eine Förderstufe sowie eine Übergangsqualifizierung. Gestärkt werden sollen vor allem auch betriebliche und wohnortnahe Qualifizierungsangebote. Die oben genannten Qualifizierungsebenen, sollen sich in der Praxis als gestufte, individuell unterschiedliche lange und durchlässige Phasen gestalten, die von einer durchgehenden Bildungsbegleitung flankiert werden. Im Rahmen von "Qualifizierungsbausteinen" sollen erreichte Qualifikationen zertifiziert werden. Ziel ist es, möglichst vielen Jugendlichen einen Übergang in Ausbildung oder Arbeit zu ermöglichen. (Vgl. Ginnold 2004; Doose 2004d)
[16] Die Richtlinien können von der Homepage des BMSG im Internet unter URL: www.bmsg.gv.at heruntergeladen werden
[17] Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Erfolgskriterien erfolgt im Kapitel 4, an dieser Stelle sollen nur die rechtlichen Vorgaben wiedergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 3.1.Rollen und Aufgaben der Fachkräfte
- 3.2. Typologien und Selbstverständnisse von Fachdiensten
- 3.3. Phasen- oder Prozessverlauf der beruflichen Integration
- 3.4. Erste Phase: Klärung der Ausgangssituation, Berufsorientierung und Fähigkeitsanalyse
- 3.5. Zweite Phase: Akquisition von Betrieben mit geeigneten Arbeitsplätzen
- 3.6. Dritte Phase: Vorbereitung auf die Arbeitsaufnahme und Vermittlung sowie betriebliche Qualifizierung
- 3.7.Vierte Phase: Nachbetreuung - Arbeitsplatzbezogene und Arbeitsbegleitende Unterstützung, Krisenintervention
- 3.8. Zusammenfassung
Das vorliegende Kapitel beinhaltet die unterschiedlichen Aufgaben und Rollen der Fachkräfte in den beiden zu untersuchenden Institutionen, schließt den Versuch einer typologischen Zuordnung der Fachdienste an und setzt sich mit sowie dem Prozess der beruflichen Integration auseinander, wie er in diesen Einrichtungen stattfindet, anhand vier idealtypisch aufeinander folgender Phasen und den dahinter liegenden methodisch didaktischen Konzepten unter Bezugnahme auf empirische Studien.
Paulik (1999, S.61ff) beschreibt die Tätigkeit einer/eines ArbeitsassistentIn als ein Mehrtypenmodell mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Aufgabenstellungen und gibt eine Auflistung unterschiedlicher Arbeitstypen, die jedoch in der Praxis des alltäglichen Handelns nur verbunden vorkommen. Im Folgenden eine Auflistung einiger der zentralen Rollen:
-
die Rolle des Beraters: Aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung werden die Fachkräfte zu Informanten, die durch ihre Informationen Entscheidungsprozesse verkürzen und effizienter gestalten können. Dabei kommen als Adressaten der Information einerseits die KlientInnen, Familienangehörige, Angehörige des sozialen Umfelds etc., andererseits Angehörige des Betriebes, ArbeitgeberInnen etc. in Frage.
-
die Rolle des Vertreters: in der VertreterInnenrolle sind die Fachkräfte ein Sprachrohr der Angelegenheiten der KlientInnen. Durch ihre Ausbildung und ihre formalen Qualifikationen besitzen sie eine gute Kenntnis des Feldes und der jeweils üblichen Spielregeln und können so auf Ebenen intervenieren, die den KlientInnen größtenteils verschlossen sind.
-
die Rolle des Koordinators: durch die Ausdifferenzierung des Leistungsangebotes im Bereich der beruflichen Rehabilitation ist auch der Bedarf an Koordination gestiegen. Im Falle der Unterstützen Beschäftigung besteht eine der Hauptkoordinationsaufgaben darin, zwischen dem administrativen System der Arbeitsmarktverwaltung und beruflichen Rehabilitation, der Welt der Unternehmen und Betriebe und dem sozialpädagogischen und psychosozialen Netz von Unterstützungsangeboten die Verbindungen herzustellen.
-
die Rolle des Übersetzers: in dieser Funktion sollen die Fachkräfte zwischen jenen Welten "Brücken" bauen, die unterschiedliche Diktionen und unterschiedliche Sichtweisen als Problematik haben, um die Voraussetzungen für Koordinierung und Kooperation zu schaffen. Insbesondere diese Rolle kann in den Auswirkungen auf die beratenden Professionisten als extrem belastend empfunden werden.
-
die Rolle des Planers oder Case Managers: befasst sich konkret mit der Planung, Kontrolle und Lenkung des Hilfeerstellungsprozesses. Dabei werden Aspekte der Koordination und des Managements angesprochen. Die Vermittlung zwischen der Klientenproblematik und dem Hilfesystem mit der Vielzahl fachlicher Einrichtungen ist in diesem Verständnis Kern der Tätigkeit. Die Leistungen des Case Managers bestehen also hauptsächlich im Arrangieren und in der Steuerung des Problembewältigungsprozesses (vgl. Paulik 1999, S.61ff).
Brooke und Wehman (1997, S.15) ergänzen die Rollen der so genannten "Employment Specialists" um zwei weitere relevante Aspekte und zwar um die
-
Rolle des "Head Hunter", welche sich vor allem mit der Durchführung von zahlreichen Marketing Aufgaben befasst, sowohl aus der Sicht des Fachdienstes selbst als auch in der Identifizierung von persönlichen Strategien für die Jobsuchenden. Ein Head Hunter beobachtet stets die Entwicklungen am globalen und am regionalen Arbeitsmarkt und bemüht sich um die Pflege von Kontakten mit der Wirtschaftswelt.
-
Die Rolle des "Technikers" verlangt ein Wissen um die zentralsten Rehabilitationstechnologien, welche Menschen mit Behinderung in ihrem Arbeitsleben unterstützen können.
Die hier angeführten (sicher nicht vollständig erfassten) Rollenbeschreibungen geben einen Eindruck von der Komplexität der Aufgabenstellung, mit der sich eine Fachkraft auseinandersetzen muss, und weisen auf die wichtige Bedeutung von Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte hin. Doose (2002) gibt in seinem Artikel: "Qualifizierung und Fortbildung von IntegrationsberaterInnen in Integrationsfachdiensten" einen sehr guten Überblick über benötigte Kompetenzen einer Fachkraft sowie einen Überblick über die "Berufsbegleitende Qualifizierung" wie sie von der BAG-UB entwickelt und angeboten wird. Ein ähnlicher modularer Lehrgang wird in Österreich vom Integrativen Bildungsverein angeboten: die "Qualifizierung zur Fachkraft in der beruflichen Integration"[18].
In einigen empirischen Untersuchungen (u.a. Doose 1997, Bungart / Supe / Willems 2000, Burtscher 2001; Kastl / Trost 2002) werden die Fachdienste hinsichtlich ihrer Typologie bzw. ihres Selbst- und/oder Grundverständnisses unterschieden. Sämtliche Zuordnungen sind im Sinne der qualitativen Sozialforschung immer als "Idealtypen" zu sehen.
Strukturelle und inhaltliche Unterschiede sieht Doose (vgl. 1997, S.39) in der Unterscheidung zwischen
-
Akquisitions- und
-
Begleitungsorientierten Fachdiensten,
welche auf einen Unterschied in der Möglichkeit der direkten Begleitung am Arbeitsplatz hinweisen. Dieser Unterschied wird zum Teil auch durch die Zielgruppe der Fachdienste bedingt. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland sind
-
- behinderungsspezifische und
-
- behinderungsübergreifende Fachdienste tätig.
Fachdienste für psychisch Beeinträchtigte sind sehr oft einem akquisitionsorientierten Typus zuordenbar. Vor allem Fachdienste für Menschen mit Lernschwierigkeiten und / oder geistiger Behinderung sehen die direkte Begleitung als einen Hauptschwerpunkt ihrer Arbeit (z.B. die Hamburger Arbeitsassistenz). Diese begleitungsorientierten Fachdienste sind eher dem Konzept der Unterstützen Beschäftigung zuzuordnen.
Burtscher (2001) unterscheidet die Projekte hinsichtlich ihrer Orientierung und ihres Selbstverständnisses ebenso idealtypisch nach einem
-
- rehabilitativen und einen
-
- integrativen Ansatz,
wobei sich in der Praxis in den letzten Jahren sicherlich eine Annäherung der beiden Modelle ergeben hat. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über diese beiden Ansätze:
Tabelle 4: Unterschiede hinsichtlich der Orientierung und dem Selbstverständnis (Burtscher 2001)
|
Modell A - rehabilitativer Ansatz |
Modell B - integrativer Ansatz |
|
Fürsorgeeinrichtung; Anlehnung an Versorgungseinrichtungen |
Anbieten von Dienstleistungen; Anlehnung an Selbstbestimmt-Leben Grundsätzen |
|
begünstigte bzw. begünstigbare Behinderte; eingegrenzte Zielgruppe |
Menschen mit besonderen Bedürfnissen; keine Einschränkung |
|
Pflicht zur Arbeit |
Recht auf Arbeit |
|
Mindestleistungspotentiale beim Behinderten |
gemeinsam 100 % Leistungsfähigkeit |
|
Beratung primär im Bereich Erwerbsarbeit |
erweitertes Beratungsverständnis |
|
Diagnostik - Vergangenheit: Was konnte bisher geleistet werden? Anpassung an vorhandene Leistungen / Erfahrungen |
Schwerpunkt Zukunft: Welche Wünsche hat der/die Betroffene? Entwicklung von neuen Perspektiven / Utopien |
|
Qualifizierung ergibt Arbeit |
erst platzieren, dann qualifizieren |
|
Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen (z. B. Geschützte Werkstätten) |
Alternative zur Geschützten Werkstätten |
|
unpolitisch |
aktiv politische Arbeit |
|
Erfolgsmessung: quantitativ |
Erfolgsmessung: qualitativ |
|
Vermittlungsdruck |
bedürfnisorientiert; Versuch eines flexiblen Zeitrahmens, auch längerfristig |
Eine weitere typologische Unterscheidung liefern Kastl & Trost 2002 (S.221ff), die unter Anwendung verschiedener statistischer Verfahren eine Typologie konstruiert haben, welche die Komplexität der Modellprojekte in Deutschland auf drei unterschiedliche Typen reduzieren lässt. Wichtigstes Kriterium zur Bildung der drei Typen ist die Art und Weise der Ausgestaltung der Beziehung der Fachdienste zu ihrem zentralen Auftraggeber, in diesem Fall dem Arbeitsamt. Damit in engem Zusammenhang stehen wesentliche inhaltliche Kriterien der Ausgestaltung des Beratungs- und Betreuungsverlaufes wie z.B. der KlientInnenzusammensetzung, der Fallzahlen, der Zugangswege der KlientInnen, des Betreuungsbedarfs der KlientInnen, der Gewichtung der einzelnen Phasen des Integrationsprozesses sowie der Anzahl der Vermittlungen etc. Die Fachdienste werden in folgende Typen gegliedert:
-
einen "arbeitsamtnahen Typus",
-
einen "arbeitsamtabhängigen Typus", und
-
einen "relativ autonomen Typus".
Die wichtigsten oben angeführten inhaltlichen Unterscheidungen sollen ebenfalls anhand einer Tabelle veranschaulicht werden.
Tabelle 5: Übersicht über die Typen der Fachdienste (Kastl & Trost 2003, S.38)
|
Arbeitsamtnaher Typus (A) |
Arbeitsamtabhängiger Typus (B) |
Relativ autonomer Typus (C) |
|
|
Kooperation |
|||
|
Beratung als obligatorische Phase der Beauftragung |
keine oder geringe Bedeutung |
keine |
hohe Bedeutung |
|
Fallzahlen pro BeraterIn |
hoch |
niedrig |
mittel |
|
Beauftragung |
Zuweisung mit informellen Spielräumen |
strikte Zuweisung |
kooperative Beauftragung |
|
Verhältnis zum Arbeitsamt |
kooperativ |
konfliktträchtig, asymmetrisch |
sehr kooperativ |
|
Verhältnis zum Integrationsamt |
geringe operative Bedeutung |
geringe operative Bedeutung |
hohe operative Bedeutung |
|
KlientInnen |
|||
|
Zugang |
Arbeitsamt (80-90%) |
Arbeitsamt (80-90%) |
andere Zugangswege möglich |
|
Merkmale |
überwiegend Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen |
überwiegend Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen UND besonderen Vermittlungshemmnissen |
überwiegend Menschen mit verschiedenen Behinderungen UND Bedarf an arbeitsbegleitender Unterstützung |
|
Betreuungsbedarf |
mittel / niedrig |
mittel / hoch |
mittel / hoch |
|
Arbeitsweise |
|||
|
Kontaktdichte zu KlientInnen und Betrieben |
niedrig |
hoch |
sehr hoch |
|
Phasen (Abklärung, Vorbereitung, Vermittlung, Nachbetreuung) |
häufig rudimentär (Abklärung, Bewerbungsvorbereitung, Vermittlung) |
bei stagnierenden Fallverläufen unvollständig |
häufiger vollständiges Phasenmuster |
|
Schwerpunkt |
Vermittlung |
Psychosoziale Betreuung |
Arbeits- und berufsbegleitende Unterstützung |
|
Anteil betreuungsintensiver Fallverläufe |
niedrig |
hoch |
hoch |
|
Vermittlungen |
|||
|
hoch (ca. 20 pro BeraterIn und Jahr) |
niedrig (ca. 5 / Jahr) |
mittel (ca. 12 / Jahr) |
All diese Differenzierungen machen deutlich, dass es DEN Fachdienst, sei es Arbeitsassistenz oder Integrationsfachdienst nicht gibt. Im Folgenden soll nun versucht werden, anhand einer Prozessbeschreibung der einzelnen Phasen grundlegende Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, bevor ich am Abschluss dieses Kapitels einen Vergleich der Arbeitsweisen dieser beiden Institutionen darstelle.
Wie bereits im Kapitel 2 ausgeführt wurde, lautet der Auftrag an Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste Menschen mit Behinderung bei dem Prozess der beruflichen Integration zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen. Angelehnt an das methodische Konzept der Unterstützen Beschäftigung verläuft die berufliche Integration, wie sie in den beiden Maßnahmen angebahnt werden soll, entlang eines idealtypisch aus vier Phasen bestehenden Prozesses, innerhalb dessen sich verschiedene Aufgaben- und Problemstellungen ergeben. Gemäß dem Leitprinzip der Individualisierung der Unterstützungsleistungen muss dieser Eingliederungsprozess für jede(n) BewerberIn auf eine individuelle Art und Weise organisiert werden. Die im Folgenden benannten vier Schritte oder Phasen, sind stets in einer mehr oder weniger ausgeprägten Form zu bewältigen, um das Ziel einer nachhaltigen Integration zu erreichen. So folgt auf eine
-
initiale Abklärungsphase mit den Schwerpunkten der Berufsorientierung und der Fähigkeitsanalyse, die
-
Phase der Arbeitsplatzakquisition, an welche sich
-
die Phase der Vorbereitung auf die Vermittlung und Arbeitsaufnahme sowie die betriebliche Qualifizierung anschließt, schlussendlich kommt
-
die Phase der arbeitsplatzbezogenen und arbeitsbegleitenden Unterstützung die vielfach Nachbetreuungsphase genannt wird (vgl. Kastl / Trost 2002, S.157 & Fasching 2003, S.121).
Diese benannten Phasen oder Beratungsfelder stehen vom zeitlichen Ablauf grundsätzlich in einer chronologischen Abfolge, werden zum Teil aber auch parallel zueinander bearbeitet bzw. durchlaufen.
Am Beginn der Zusammenarbeit zwischen einem Fachdienst und einem Klienten steht immer eine Abklärungsphase, die der Erhebung von Informationen dient, welche für die Aufnahme und Gestaltung der Betreuung wesentlich sind. Es sind zunächst folgende Punkte abzuklären:
-
wird die formale Bedingung des Vorliegens einer Behinderung erfüllt,
-
gehört der / die KlientIn zur Zielgruppe des Fachdienstes
-
entsprechen die Angebote des Fachdienstes der konkreten Problemlage des/der KlientIn.
Auf die Problematik des Aussiebens weniger leistungsstarker Menschen zu diesem Zeitpunkt, begünstigt durch einen starken Vermittlungsdruck, möchte ich an dieser Stelle nur kurz hinweisen. Jedenfalls folgt nach der Prüfung der formalen Zuständigkeit die Phase der Kontaktaufnahme. Vor allem dem Erstgespräch kommt dabei ein besonderer Status zu. Ziel dieses Gespräches ist neben dem gegenseitigen Kennenlernen die Abklärung, ob eine Zusammenarbeit auf Dauer möglich ist und die Konstitution einer vertrauensvollen und tragfähigen Basis für das weitere Miteinander gegeben ist. Bei vielen Fachdiensten wird das Erstgespräch durch die Verwendung von Interviewleitfäden oder Fragebögen strukturiert, damit zentrale Fragebereiche systematisch abgearbeitet werden können. Dies sind z.B.: Interessen und Wünsche, Erwartungshaltungen, berufliche Vorstellungen, Bedeutung der Behinderung, Gründe der Arbeitslosigkeit, finanzielle Situation etc. Die Phase der Abklärung erstreckt sich in der Regel über mehrere unterschiedlich geführte und strukturierte Beratungsgespräche, wobei die Intensität der Kontakte mit der/dem KlientIn sowie seinen Bezugspersonen stark variiert. Ein nicht zu unterschätzender Anteil der Arbeit von Fachkräften sind oftmals nur kurzfristige Beratungen, die meist nur punktuelle Hilfen im Kontext der Arbeitsplatzsuche betreffen. Ein zentraler Aspekt für die Etablierung eines Arbeitsbündnisses ist die Frage des Zugangs der KlientInnen. Es entspricht dem Verständnis eines professionellen Dienstleisters, dass die KlientInnen sich aus eigener Initiative einfinden. Solch ein "niedrigschwelliger" Zugang ist natürlich sehr stark von der Öffentlichkeitsarbeit und dem Marketing der Einrichtungen abhängig, wird aber auch durch die Zuweisungspraktiken der jeweiligen Fördergeber mitbestimmt. Vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen kommt der Berufsorientierung eine erhebliche Bedeutung zu. Ziel ist es über einen Abgleich der Erwartungen und Wünsche der KlientInnen mit der Realität zu einer realistischen beruflichen Perspektive zu gelangen, da ein Großteil der Jugendlichen nur eine begrenzte Vorstellung von der Berufswelt im Allgemeinen hat. Kastl & Trost (2002, S.168) geben an, dass nur etwas 8-10% der Menschen mit Lernbehinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen eine realistische Selbsteinschätzung haben. Die gesamte Phase der Abklärung dient außerdem der Erhebung und Erstellung einer umfassenden Fähigkeitsanalyse der KlientInnen. Zur Informationsgewinnung steht den Fachkräften eine Vielzahl von Medien und Methoden zur Verfügung. Sehr umstritten ist der Einsatz von "objektivierenden" bzw. (Teil-)standardisierten Tests, Verfahren und Assessment-instrumenten. Die Horizon Arbeitsgruppe (S.11) etwa meint:
"dass solche Kriterien Gefahr laufen, ausschließlich nur den kognitiven, emotionalen und/oder physischen Status quo zu beschreiben, ohne externe Faktoren miteinzubeziehen und auch ohne andere Informationsquellen zu nutzen".
Eines dieser umstrittenen Verfahren ist MELBA (Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit), welches die Erstellung eines Fähigkeitsprofils ermöglicht, das sich aus der Selbst- und Fremdeinschätzung der KlientInnen zusammensetzt. Nach Kastl & Trost (2002, S.170) schätzen Fachkräfte den Erkenntniseffekt von MELBA in Relation zum Aufwand als eher niedrig ein, während
"ganzheitliche und kontextbezogene Einschätzungen der Kompetenzen eines Klienten oft wesentlich entscheidender sind".
Unabhängig davon, welche Medien zur Informationsgewinnung herangezogen werden, besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine sorgfältig erstellte und methodisch kontrollierte Fähigkeitsanalyse ein zentrales Gütekriterium und eine Voraussetzung für eine sinnvolle Integrationsarbeit darstellt. Insgesamt ist es sowohl für die Fachkraft als auch für den/die KlientIn von entscheidender Bedeutung, dass die Abklärungsphase als solche im zeitlichen Verlauf sichtbar ist. Es werden hier wesentliche inhaltliche Fragen geklärt und die Grundlage für ein stabiles Vertrauensverhältnis aufgebaut (vgl. Horizon Arbeitsgruppe 1997, S.11; Paulik 1999 S.90ff; Pfaffenbichler 1999, S.32.ff; Kastl / Trost 2002, S.162ff; Fasching 2003, S.122ff).
Das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung stellt eine Alternative zur institutionellen Hilfeplanung dar, kann aber auch in den institutionellen Unterstützungsprozess integriert werden, wie es etwa die Hamburger Arbeitsassistenz oder der Verein Spagat in Vorarlberg durchführt. Grundlage des Konzepts ist individuelle Hilfeplanung, die sich von der institutionellen dahingehend grundlegend unterscheidet, dass sie den Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt rückt und sich an seinen Fähigkeiten, Stärken, aber auch Grenzen orientiert. Persönliche Zukunftsplanung bietet sich überall dort an, wo es um Veränderungen von Lebenssituationen geht. Dies kann die Bereiche Bildung, Arbeit, Freizeit und Wohnen betreffen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die grundlegenden Unterschiede, das Menschenbild und das jeweilige Selbstverständnis der beiden Systeme.
Tabelle 6: Vergleich Institutionelle und Persönliche Hilfe- bzw. Zukunftsplanung (Doose 2000, S.8)
|
|
|
Persönliche Zukunftsplanung |
|
Kernelement der Persönlichen Zukunftsplanung ist der Unterstützungskreis, dessen Grundidee es ist, ein Netz um jeden Jugendlichen aufzubauen, welches ihn nicht nur bei der Eingliederung in die Arbeitswelt unterstützt, sondern das längerfristig bereit ist, sich regelmäßig mit ihm zu treffen, ihn bei Fragen im Zusammenhang mit Lebensqualität zu unterstützen und an konstruktiven Lösungen bei auftretenden Problemen mitzuwirken. Der betroffene Mensch entscheidet dabei selbst, welche Personen in seinen Unterstützungskreis aufgenommen und welche Themen bei den Zukunftsplanungen bzw. Zukunftskonferenzen bearbeitet werden sollen, er/sie wird dabei von einem Zukunftsplaner unterstützt. Grundprinzipien der methodischen Zugänge zur Zukunftsplanung sind
-
die Beteiligung der Person selbst,
-
das Prinzip des runden Tisches mit der Überzeugung, dass jede(r) etwas zur Gestaltung der Situation beitragen kann,
-
die Konsensbildung (wie aus der Organisationsentwicklung bekannt),
-
die Verabredung nächster pragmatischer Schritte und
-
die Visualisierung als sichtbarer Ausdruck von Einigungen, an die später angeknüpft werden kann.
Als genereller Effekt ist die (Be-)Stärkung der Person allein schon durch das Zusammentreten des Kreises, wie auch aller am Prozess Beteiligten festzustellen. Der wichtigste Bestandteil einer solchen Konferenz ist schließlich der so genannte Aktionsplan, in dem die erarbeiteten Schritte und Aufgaben der einzelnen Personen im Unterstützungskreis (in überprüfbaren Einheiten) festgehalten sind. (vgl. Boban / Hinz 1999[19]; Niedermaier / Tschann 1999[20]; Doose 1997, S.30; Doose 2004[21]).
Die Akquisition von Arbeitsplätzen ist nach Behncke (2001, S.81) ein
"entscheidender Baustein in der Unterstützen Beschäftigung", welche "in das gesamtgesellschaftliche Anliegen von Fachdiensten eingebettet ist, für Menschen mit Behinderung Möglichkeiten des Zugangs zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen".
Diese Kernaufgabe der Fachdienste impliziert die Notwendigkeit sich mit den Bedingungen und Gesetzen der Unternehmenswelt auseinanderzusetzen. Privatwirtschaftliche Unternehmen, so lässt sich pauschal sagen, werden durch unternehmerisches Denken und betriebswirtschaftliches Handeln geprägt, deren Zielsetzung auf die wirtschaftliche Gewinnerzielung unter marktwirtschaftlichen Konkurrenzbedingungen ausgerichtet ist. Dem privaten Arbeitgeber dient die Arbeit eines Arbeitnehmers in der Regel dazu, einen Mehrwert zu produzieren. Für die Kalkulation des Arbeitgebers muss eine Konstellation gefunden werden, womit sich ein Arbeitsverhältnis für den Arbeitgeber zumindest einigermaßen trägt, z.B. durch die Subventionierung der Differenz von Tariflohn und Produktivität. (vgl. Doose 1997, S.13 & Behncke 2001, S.81ff). Es existieren mittlerweile auch einige innovative Managementkonzepte, die sich vermehrt den so genannten "Human Resources" eines Unternehmens, also den MitarbeiterInnen zuwenden. Zu nennen wäre hier beispielsweise der Ansatz des "Diversity Management". Derartige Trends entwickeln sich allerdings vermehrt nur in Großunternehmen, während ein überwiegender Anteil der Arbeitsplätze eher in kleinen Unternehmen akquiriert wird (vgl. z.B. Schartmann 1999[22]).
Von den meisten AutorInnen zu diesem Themenkreis wird im Kontext der Akquisitionstätigkeit die Bedeutung der Herausbildung eines strategisch geplanten Marketingkonzepts für den einzelnen Fachdienst betont. Damit im Zusammenhang steht auch die Positionierung als ein Dienstleistungsunternehmen, das neben Menschen mit Behinderung auch Betriebe und Unternehmen als ihre primären KundInnen anspricht. Die permanente Vereinigung der unterschiedlichen Ansprüche dieser beiden Kundengruppen sowie der Vorgaben der Kostenträger ist ein Balanceakt, der sicherlich zu den anspruchvollsten Anforderungen an ein Qualitätsmanagement der Fachdienste zählt. Die Entwicklung eines fachdienstspezifischen Marketings ist auf jeden Fall als ein permanenter Prozess zu sehen, der in der Etablierung eines eigenen Profils bzw. einer "Corporate Identity" münden sollte, die neben der Darstellung nach außen auch Konzept und Arbeitsweise des Dienstes insgesamt erfasst (vgl. Behncke 2001, S.83ff). Auf die Bedeutung des Marketings und entsprechende Strategien werde ich im Zusammenhang mit Qualitätsentwicklung noch genauer eingehen.
Die Akquisitionstätigkeit ist eine Aufgabe, die sowohl strategisches Denken und Planen aber auch Kreativität und Einfühlungsvermögen verlangt. Zu den ersten Aufgaben der Akquisition zählt sicherlich die Sondierung des regionalen Arbeitsmarktes, wobei sich die Fachkraft nicht nur an Stellenausschreibungen orientiert, sondern den Zugang zu potentiellen ArbeitgeberInnen über unterschiedliche Medien und Kontakte sucht. Wird bedacht, dass etwa nur 10 - 20% der Arbeitsplätze über Stellenausschreibungen besetzt werden (vgl. Behncke 2001, S.97) kommt diesen alternativen Zugangswegen eine hohe Bedeutung zu. In der Literatur werden grundsätzlich zwei Akquisitionsstrategien beschrieben, die von Fachdiensten angewendet werden, und zwar eine:
-
bewerberorientierte Strategie, und
-
eine arbeitgeberorientierte Strategie (vgl. Behncke 2001, S.91; Kastl / Trost 2002, S.188 & Fasching 2003, S.128)
Die bewerberorientierte Strategie folgt dem Ansatz der Unterstützen Beschäftigung mit der Forderung "One Person at a time", und zielt darauf ab, für eine konkrete Person solange einen Arbeitsplatz zu suchen, bis ein solch passender gefunden wird. Diese Strategie entspricht sowohl dem Grundverständnis der meisten Fachdienste nach individueller Vermittlung und erleichtert so auch das unmittelbare Gespräch im Betrieb, da von den konkreten Möglichkeiten eines einzelnen Bewerbers ausgegangen werden kann. Arbeitsplätze werden sehr oft anhand von formalen Qualifikationen beschrieben, die sich an definierten Berufsbildern orientieren. Diese Tatsache darf Fachkräfte nicht abschrecken, da ArbeitgeberInnen jenseits dieser formalen Qualifikationen Arbeitskräfte für konkret auszuführende Tätigkeiten einstellen. Ein Nachteil bei dieser Strategie ist sicherlich, dass es meist sehr vieler ArbeitgeberInnenkontakte bedarf bis ein geeigneter Arbeitsplatz gefunden werden kann. Nach Angaben von Kastl / Trost (2002, S.190) sind dies in etwa 80% der vermittelten BewerberInnen bis zu zehn Kontakte. Außerdem können Fachkräfte in die Lage geraten einem grundsätzlich einstellungsbereiten Dienstgeber keine passende Arbeitskraft anbieten zu können. Daher empfiehlt es sich parallel zu der bewerberorientierten Vorgehensweise auch die zweite Strategie anzuwenden.
Bei der arbeitgeberorientierten Strategie werden ArbeitgeberInnen kontaktiert, ohne dass über ein(e) bestimmte(r) BewerberIn gesprochen wird. Hierbei sollte das Gespräch eher den Charakter eines Dienstleistungs- oder Beratungsgesprächs annehmen, in dem die Fachkraft den Betrieb auf der Grundlage fundierter Informationen, ihr Unterstützungsangebot auf die Anforderungen des Betriebs abstimmen kann. Diese Strategie verlangt von den Fachdiensten, dass sie über eine Auswahl an möglichen BewerberInnen im Sinne eines Personalpools verfügen, wobei aufgrund des Anforderungsprofils des Arbeitsplatzes der/die geeignetste MitarbeiterIn vorgeschlagen wird. Dies hat zwei grundlegende Nachteile: zum einen ist eine vollständige Übereinstimmung bzw. "Passung" von Anforderungen und Fähigkeiten auf diese Weise nur schwer zu realisieren, wodurch vielfach Folgeprobleme z.B. durch Über- oder Unterforderung entstehen können, und zweitens ist die Gefahr sehr groß, dass schwächere BewerberInnen auf diese Weise nur sehr selten für eine Stelle vorgeschlagen werden.
Eine Gemeinsamkeit beider Ansätze und mithin ein weiteres Spezifikum erfolgreicher Akquisitionstätigkeit ist die Loslösung von der Vorstellung festgelegter Berufsbilder. Insbesonders für Menschen mit schweren Behinderungen sind passende Arbeitsplätze gerade durch die Rationalisierung und Automatisierung im produzierenden Bereich gar nicht vorhanden, sondern müssen erst geschaffen werden. Dafür müssen einerseits Wirtschafts-trend genau analysiert und andererseits im Kontakt mit den ArbeitgeberInnen in vielen Fällen potenzielle Tätigkeiten identifiziert werden, über die dort noch gar nicht nachgedacht wurde. Dabei können vor allem die Instrumente "Job Carving" oder "Job Stripping" zum Einsatz kommen. Dahinter verbirgt sich die Vervollständigung von Arbeitsplätzen mit bewältigbaren Aufgaben, beziehungsweise die Herauslösung von überfordernden Teilaufgaben aus den Arbeitsplätzen behinderter MitarbeiterInnen. Eine solchermaßen orientierte Arbeitsgestaltung und Aufgabenstrukturierung definiert nach Wetzel[23](1999)
"Arbeitsplätze nicht über exogene Berufsbilder, sondern über die endogene Bündelung von Aufgaben, orientiert am Bewältigungspotenzial eines bestimmten Bearbeiters",
eine Notwendigkeit, der Betriebe z.B. aufgrund sich rascher verändernder Auftragslagen, sowie einer tendenziell älter werdenden Belegschaft ohnehin konfrontiert sehen. Hier können Fachdienste bereits sehr früh wirtschaftlich verwertbares Know-how zur Verfügung stellen. (Vgl. Doose 1997, S.30f; Horizon - Arbeitsgruppe 1997, S.16ff; Paulik 1999 S.103ff; Pfaffenbichler 1999, S.96f; Schartmann 1999; Wetzel 1999; Behncke 2001, S.81-109, Kastl / Trost 2002, S.186ff; Fasching 2003, S.127ff)
Ein zentraler Aspekt in der Akquisitionsphase ist auch die Information der Betriebe über das Dienstleistungsangebot der Fachdienste sowie eine Beratung über die vorhandenen Fördermöglichkeiten. Des weiteren existieren für das konkrete Akquisitionsgeschäft eine Vielzahl von Strategien sowie formelle und informelle Regeln, auf die im Detail hier nicht näher eingegangen wird. Der Integrationsfachdienst Bayern hat ein "Praxishandbuch der erfolgreichen Akquisition" (2001) erstellt, das über die BAG-UB bezogen werden kann.
Nach erfolgreicher Vermittlung eines/einer KlientIn in ein Beschäftigungsverhältnis oder Praktikum beginnt eine mehr oder weniger intensive Unterstützung des Integrationsprozesses im Betrieb. Dabei richtet sich diese Unterstützung nicht nur auf den/die BewerberIn, sondern schließt auch das betriebliche und soziale Umfeld mit ein, um eine dauerhafte Integration zu gewährleisten. Das Ziel aller Vermittlungsbemühungen ist es, sowohl aus der Sicht der ArbeitnehmerInnen als auch jener der ArbeitgeberInnen auf einen entsprechenden Arbeitsplatz eine passende Arbeitskraft zu vermitteln. Dieser Auswahlprozess wird als "Matching" oder "Passung" von Bewerberprofil und Arbeitsplatzanforderungen bezeichnet. Eine absolut passgenaue Vermittlung kann aus verschiedensten Gründen (vgl. Bungart / Putzke 2001, S.111f) selten erreicht werden. Dies ist allerdings als ein Prozess zu sehen, in dem im Verlauf der betrieblichen Unterstützung und Qualifizierung sowohl die Lern- und Entwicklungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen als auch vorhandene Spielräume im Betrieb für die Gestaltung eines Arbeitsplatzes, in Einzelfällen unterstützt durch (technische) Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung, genutzt werden können um eine Passung zu erreichen.
Fasching (2003, S.138) unterteilt die betriebliche Beratungs- und Unterstützungsphase in zwei Stufen:
-
"in einer Vorbereitungsphase, in der häufig in Praktika die Fähigkeiten der BewerberInnen und die Anforderungen des Arbeitsplatzes untersucht und verglichen werden.
-
In der zweiten Phase der betrieblichen Qualifizierung werden die Jugendlichen durch ein "Training on the Job" am Arbeitsplatz eingearbeitet und erhalten Unterstützung zur sozialen Integration in den Betrieb".
Kastl & Trost (2002, S.176) nennen folgende typische Formen der Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme:
-
"Unterstützung bei der Anfertigung von Bewerbungsunterlagen, und bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche,
-
unterschiedliche Arten des Trainings kommunikativer, sozialer, berufsspezifischer und sonstiger Kompetenzen,.
-
psychosoziale Betreuung bzw. Veranlassung einer solchen,
-
Initiierung und Unterstützung eines niedrigschwelligen Einstiegs ins Arbeitsleben, insbesondere durch Praktika und Trainingsmaßnahmen,
-
sowie verschiedene Formen kurzfristiger Fortbildungsangebote".
Vor allem Praktika erweisen sich als zentrales Element der Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme. Sie bieten den BewerberInnen eine Gelegenheit einen realistischen Eindruck von bestimmten Arbeitsbereichen zu erhalten und sich zu vergewissern, ob und in welcher Weise die eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten mit den dort vorherrschenden Bedingungen in Einklang gebracht werden können. Sie bieten außerdem die Chance zur Erweiterung der eigenen Kompetenzen. Für die ArbeitgeberInnen bietet eine solche Maßnahme die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Menschen mit Behinderung auch in Stresssituationen zu überzeugen. In vielen Fällen stellt eine positive Erfahrung während eines Praktikums für beide Seiten einen ausschlaggebenden Grund für die Einstellung eines Menschen mit Behinderung dar. Kastl & Trost (2002, S.180) stellen einen Zusammenhang zwischen der Form der Behinderung und der Häufigkeit absolvierter Praktika dar. Demnach erweisen sich Praktika insbesonders für Menschen mit Lernschwierigkeiten als eine der zielführendsten Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Anstellung (vgl. auch Fasching 2003, S.149).
Als weiteres wesentliches Element in der Vorbereitungsphase wird die "Arbeitsplatzanalyse" gesehen. Sie wird sowohl vor einer Platzierung als auch besonders intensiv während der ersten Wochen nach der Platzierung durchgeführt. Dabei werden der Arbeitsplatz, der Arbeitsprozess, das betriebliche und das soziale Umfeld systematisch untersucht, um auf dieser Grundlage einen auf den Bedarf des/der BewerberIn individuell abgestimmten "Qualifizierungsplan" zu entwickeln, der sich am Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes orientiert. Die Arbeitsplatzanalyse dient so einerseits dazu, im Vorfeld zu entscheiden, ob ein Betrieb für eine(n) BewerberIn einen passenden Arbeitsplatz bieten kann, aber auch die Basis für die Qualifizierung im Betrieb zu schaffen (vgl. Doose 1997, S.31f & Fasching 2003, S.139f).
Die eigentliche Phase der Einarbeitung und betrieblichen Integration wird in den meisten Konzepten als "Training on the Job" bezeichnet. Dieser Ansatz rückt den Betrieb als Lernort in den Mittelpunkt der betrieblichen Qualifizierung und stellt gemäß dem Ansatz der Unterstützen Beschäftigung eine Abkehr von der traditionell schrittweisen Vorbereitung auf zukünftige berufliche Anforderungen im Rahmen von überbetrieblichen (Sonder)Einrichtungen. Das "Training on the Job" soll sich nicht nur in einem Training der Arbeitsfertigkeiten erschöpfen, sondern vor allem an der Entwicklung der für den Arbeitsplatz relevanten Schlüsselqualifikationen arbeiten sowie Unterstützung leisten beim Einfinden und Eingebundensein in die jeweilige Betriebskultur (vgl. Bungart / Putzke 2001, S.112ff).
Nach Kastl & Trost (2002, S.191) wird der Begriff "Nachbetreuung" als der Sammelbegriff für alle Formen arbeitsplatzbezogener und arbeitsbegleitender Unterstützung verwendet. Diese Nachbetreuung gilt
"als zentrales Moment zum fachlichen Konzept der Fachdienste und unterscheidet ihr Angebot substanziell von allen lediglich auf Vermittlung bezogenen Formen der Unterstützung und auch von allen Formen beruflicher Qualifizierung" (ebenda).
Unter "arbeitsplatzbezogener und arbeitsbegleitender Unterstützung" werden Aktivitäten des Fachdienstes verstanden die nach der Akquise einsetzen, dazu zählen:
-
Arbeitsplatzbezogene Serviceleistungen für die KlientInnen und ArbeitgeberInnen im Zusammenhang mit einer Einstellung, z.B. Arbeitsplatzanpassung, Hilfen bei der Beantragung von Fördermitteln sowie die Beratung von Kollegen und Vorgesetzten.
-
Arbeitsplatzbezogene Serviceleistungen für die KlientInnen zur Bewältigung praktischer arbeitsbezogener Anforderungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz.
-
Arbeitsbegleitende psychosoziale Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Arbeitsverhältnisses in Form von Beratungsgesprächen mit den KlientInnen. Ebenso zählen dazu Kriseninterventionen und Konfliktberatung im betrieblichen Kontext (vgl. ebenda).
Die Überschneidung der ersten beiden Punkte mit der vorherigen Phase der Vorbereitung auf die Vermittlung und der betrieblichen Qualifizierung, deuten auf die Schwierigkeit der eindeutigen zeitlichen Abgrenzung einzelner Unterstützungsleistungen im Ablauf des Integrationsprozesses hin. Zu den eigentlichen Aufgaben der Nachbetreuung zählt einerseits der (begleitete) Ablösungsprozess von "professioneller" zu "natürlicher" Unterstützung ("Natural Support"), sowie das rechtzeitige Erkennen von Problemfeldern, um durch intensivierte Beratung Krisen vorzeitig vermeiden zu können.
Wie eben erwähnt, gehört es zu den Aufgaben der Fachkraft mögliche natürliche Unterstützungsarten in einer Firma zu erkennen. Im klassischen Phasenmodell der begleitenden Unterstützung am Arbeitsplatz (intensive Anfangsphase, Berater am Arbeitsplatz, Beobachter in der letzten Phase) ist es der kritische Punkt ein Gleichgewicht zwischen professioneller und natürlicher Unterstützung zu finden. Wichtig dabei ist die Zusammenarbeit und die Beratung der KollegInnen im Betrieb. Ebenso sollen diese von Anfang an gezielt in die Anleitung und Einarbeitung des/der neuen MitarbeiterIn und bei der Lösung von auftretenden Problemen miteinbezogen werdeb. Ist die betriebliche Trainingsphase abgeschlossen, soll ein(e) MentorIn im Betrieb dieses Aufgabenfeld übernehmen. Diese(r) MentorIn sollte eine Person sein, der/die schon längere Zeit dem Betrieb angehört und dementsprechend differenzierte Kenntnisse sowohl über die einzelnen Arbeitsabläufe als auch über die unterschiedlichen MitarbeiterInnen besitzt. Die Aufgabe des Fachdienstes beschränkt sich von diesem Zeitpunkt an nur noch auf eine regelmäßige Präsenz im Betrieb, damit sich die Beteiligten an den Fachdienst erinnern und im Bedarfsfall auf ihn zurückgreifen können. Zahlreiche empirische Studien belegen die Bedeutung von Kontinuität und Verlässlichkeit in der Nachbetreuungsphase, sowohl für die ArbeitgeberInnen als auch die ArbeitnehmerInnen. (vgl. Schartmann 1995, S.6ff; Horizon Arbeitgruppe 1997, S.23ff; Fasching 2003, S.145f).
Wie ich am Anfang dieses Kapitels dargestellt habe, gibt es DEN Fachdienst der beruflichen Integration, sei es Arbeitsassistenz oder Integrationsfachdienste, nicht. Es können je nach Betrachtungsweise Unterschiede in der Struktur, der Zielgruppe, dem Selbstverständnis und der Ausrichtung der Arbeitsweise beobachtet werden. Der hier ebenfalls dargestellte Phasenverlauf orientiert sich am Konzept der Unterstützen Beschäftigung und stellt eine idealtypische Abfolge des Prozesses der beruflichen Integration dar. Die methodische Gestaltung dieses grundlegenden Konzepts variiert in Abhängigkeit von den jeweiligen Rahmenbedingungen. Für die konzeptionelle und inhaltliche Ausrichtung der Fachdienste stellen sich vor allem die unterschiedlichen Zielgruppen, welche auch je einer unterschiedlichen Form der Unterstützung bedürfen, als besonders konstitutives Merkmal dar. So wird z.B. bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die Begleitung am Arbeitsplatz oft als stigmatisierend empfunden, wohingegen sich bei der Eingliederung lernbeeinträchtigter Menschen die innerbetriebliche Hilfe als zentrales Element der Fachdienstarbeit herausgestellt hat. Im Großen und Ganzen kann auf Grundlage der Literatur die Arbeit von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten als sehr ähnlich eingeschätzt werden, die meisten Unterschiede ergeben sich eher aufgrund der unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen als im Bereich der grundlegenden Arbeitsweise, wie etwa die Aufteilung in Vermittlung und Begleitung in Deutschland,. Das folgende Kapitel wird sich nun mit Evaluationsstudien dieser beiden Institutionen sowie mit Forschungsarbeiten zu Qualität und Qualitätskriterien befassen.
[18] Die Curricula dieser beiden Lehrgänge können im Internet auf den entsprechenden Homepages der BAG-UB und des integrativen Bildungsvereins heruntergeladen werden: URL: www.bag-ub.de sowie URL: www.biv-integrativ.at
[19] Der Artikel von Boban / Hinz (1999): "Persönliche Zukunftskonferenzen -unterstützung für individuelle Lebenswege" ist auf der BIDOK Homepage im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/ herunterzuladen.
[20] Der Artikel von Niedermaier / Tschann (1999): "Ich möchte arbeiten" - Der Unterstützungskreis" ist auf der BIDOK Homepage im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/ herunterzuladen.
[21] Der Artikel von Doose (2004): "I want my dream! Persönliche Zukunftsplanung - Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung" ist im Internet unter URL: www.persoenliche.zukunftsplanung.de herunterzuladen.
[22] Der Artikel von Schartmann (1999): "Berufliche Integration geistig behinderter Menschen - die Sicht der Betriebe" ist auf der BIDOK Homepage im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/ herunterzuladen.
[23] Der Artikel von Wetzel (1999): "Behinderte Personalarbeit? Übersehene Potentiale einer Beschäftigung behinderter Mitarbeiter" ist auf der BIDOK Homepage im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/ herunterzuladen.
Inhaltsverzeichnis
- 4.1.Erfolgsbestimmung in der beruflichen Integration
- 4.2. Methodische Grundlagen der Evaluation von Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation
- 4.3. Vergleich zentraler Forschungsergebnisse aus Evaluationsstudien - Forschungsstand
-
4.4. Forschungsarbeiten zum Thema Qualität und Qualitätskriterien
- 4.4.1. Fasching (2003): "Qualitätskriterien in der beruflichen Integrationsmaßnahme Arbeitsassistenz unter besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen mit Lernbehinderung"
- 4.4.2. Giedenbacher, Stadler-Vida, Strümpel (2003): QUIP - Quality in Practice: "Die Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der Beteiligten".
- 4.4.3. Bungart, Supe, Willems (2000): "Qualitätssicherung und -entwicklung in Integrationsfachdiensten".
- 4.5. Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration
- 4.6. Zusammenfassung
Bevor ich in diesem Kapitel einige wesentliche Fakten von empirischen Forschungsergebnissen zu Evaluationen von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten darstelle und vergleiche, sowie einen Überblick über Forschungsarbeiten, die sich mit dem Thema Qualität und Unterstützte Beschäftigung gebe, möchte ich zunächst noch auf einige grundlegende Aspekte der Erfolgsbestimmung und Evaluation von Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation / Integration eingehen.
Ziel und zentrales Anliegen jeder Evaluationsstudie ist die Erfolgsermittlung von Maßnahmen und Programmen. Es sind vor allem ökonomische Gründe, die dazu geführt haben, dass die Frage nach dem Erfolg beruflicher Rehabilitations- und Integrationsmaßnahmen in den letzten Jahren immer vehementer gestellt wurde. So formuliert Barlsen (2001, S.41f):
"In Zeiten knapper finanzieller Ressourcen hat die Evaluation innovativer Maßnahmen nicht nur auf die fachliche Diskussion und theoretische Entwicklung, sondern auch auf den damit verbundenen Kostenaspekt zu rekurrieren."
Nach Blaschke und Plath (1999, S.9)
"kann ein Erfolg von Maßnahmen nur dann festgestellt werden, wenn Wirkungen signifikant nachgewiesen und eben dieser Maßnahme zugerechnet werden können".
Weiters unterscheiden die Autoren zwischen
-
Wirksamkeit, als Erreichen der Ziele,
-
Effektivität, im Sinne von Nettoeffekten, und
-
Effizienz, die sich durch einen möglichst geringen Finanzmitteleinsatz ausdrückt (vgl. ebenda).
Das zentrale Erfolgskriterium aus der Sicht der Kostenträger ist für Brand & Naust-Lühr (2000, S.144),
"dass den Aufwendungen für die Rehabilitationsmaßnahme möglichst hohe Einsparungen bei den Versicherungsleistungen gegenüber stehen",
also sehr plakativ formuliert Arbeit für "möglichst viele Menschen mit möglichst wenig Geld". Dementsprechend beschränken sich die Erfolgsmessungen weitgehend auf die leichter zugänglichen quantitativen Kriterien und Kostenaspekte. Von Seiten der PraktikerInnen wird immer wieder gefordert auch qualitative Aspekte der Leistungs- und Erfolgsbewertung sowie Prozessindikatoren stärker zu berücksichtigen. So können z.B. Wohlbefinden, erhöhte Lebensqualität oder gestärktes Selbstbewusstsein neben oder anstelle einer Vermittlung Ergebnisse einer erstellten Dienstleistung sein, auch wenn dies kaum in quantitativen Zahlen ausgedrückt werden kann (vgl. Matul & Scharitzer, 2002, S.606). Der bereits angesprochene Spannungsbereich zwischen sozial-ethischen Ansprüchen einerseits und dem ökonomischen Kalkül andererseits ist auch an diesem Punkt besonders bedeutsam. Auch von Seiten der Forschung werden die verwendeten Bewertungskriterien nur als bedingt funktionell angesehen, so formulieren Horak und Schmid im Evaluierungsbericht zur Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung (2003, S.13),
"dass die Bewertungskriterien für Erfolg in ihrer derzeitigen Form keine gesamthafte Betrachtung der Wirkung gewährleisten"
und fordern eine "ganzheitliche Betrachtung" der Erfolge, dies bedarf ihrer Ansicht nach einer "Ausweitung der Bewertungskriterien" sowie eines geeigneten Indikatorensystems (ebenda). Ebenso stellt die von SORA, KMU und ABIF (2004, S.108) durchgeführte Evaluationsstudie über Maßnahmen für Jugendliche mit Behinderung fest, dass
"Vermittlungsquoten als alleiniges Erfolgskriterium für Förderinstrumente in Frage zu stellen"
sind, und führt weiters an, dass "auch qualitative Maßstäbe wie z.B. Empowerment wesentlich erscheinen". Brand und Naust-Lühr (2000, S.145) weisen darauf hin, dass selbst der Erfolgsindikator "Vermittlung" erhebliche Operationalisierungsprobleme aufweist, und stellen die Frage, ob jede Vermittlung als gelungene Integration bezeichnet werden kann. Außerdem betonen die Autoren, dass
"Vermittlung als Ergebnis des Rehabilitationsprozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt,..." und "dieses Vorgehen weder zur Aufklärung des vorangegangenen Prozesses noch zur Verbesserung der Abläufe beitragen will, es geht ausschließlich darum festzustellen ob das Ergebnis Vermittlung vorliegt oder nicht (ebenda, S.150)".
Deshalb plädieren sie dafür, auch die "prozessuale Dimension des Erfolgs" zu berücksichtigen. Dies könne z.B. durch individuelle Zielvereinbarungen und die Markierung von Zwischenzielen mit den einzelnen RehabilitandInnen geschehen, die in einem "individuellen Förderplan" festgehalten und laufend überprüft werden können. Auch Blaschke und Plath (1999, S.13ff) haben in Untersuchungen durch das Prinzip der so genannten "Kriterienaufschaltung" nachgewiesen, dass sich der "Integrationserfolg" reduziert, wenn neben der bloßen Erwerbstätigkeit noch andere Integrationsmerkmale, wie z.B. Nachhaltigkeit der Vermittlung, Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz oder soziale Integration etc., erfüllt sein müssen. Natürlich stehen diese Merkmale in einem Wechselverhältnis und weisen auf die Wichtigkeit einer "passgenauen" Vermittlung insbesonders bei Menschen mit Behinderung hin. In Anlehnung an diese Tatsachen stellt Fasching (2003, S.174) für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten erweiterte Erfolgskriterien als "Ergebnisse einer guten Beratung" auf, durch die eine dauerhafte Integration am Arbeitsplatz erreicht werden kann, und zwar:
-
die Identifizierung mit einem Beruf
-
die Übereinstimmung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen
-
die Zunahme an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
-
eine hohe Motivation und Zufriedenheit mit der Arbeit
-
die soziale Integration in dem Betrieb, welche sich durch den Aufbau persönlicher Kontakte zu den MitarbeiterInnen ausdrückt, sowie
-
vorhandene Strategien zur Lösung von Konflikten (vgl. ebenda).
Eine ähnlich differenzierte Darstellung erfolgreicher Ergebnisse von Unterstützter Beschäftigung bezogen auf Vermittlung wurde im Rahmen des QUIP Projektes ("Quality in Practice") erstellt, auf welches ich in diesem Kapitel noch genauer eingehen werde. Demnach ist eine Vermittlung erfolgreich wenn:
-
ein Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden oder gehalten werden kann, die Entlohnung angemessen ist, und der/die ArbeitnehmerIn ein festes Dienstverhältnis hat;
-
ein Arbeitsplatz den Vorlieben, Fähigkeiten und Fertigkeiten des/der ArbeitnehmerIn entspricht, das Arbeitsklima angenehm ist, der/die ArbeitgeberIn zufrieden ist, der/die ArbeitnehmerIn sich seinen/ihren Aufgaben gewachsen fühlt und klare Aufgaben hat;
-
der/die Arbeitnehmerin als KollegIn geschätzt wird und ein volles Teammitglied ist, er/sie Unterstützung durch das Arbeitsumfeld erfährt, in das Arbeitsteam integriert ist, ein gutes Verhältnis zu den KollegInnen hat, und Möglichkeiten sich an Aktivitäten außerhalb des Arbeitsplatzes zu beteiligen;
-
der/die ArbeitnehmerIn Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung hat; und
-
jeder Person mehrere Alternativen offen stehen (vgl. Giedenbacher 2003, S.9f).
Die Evaluation und Bewertung derart differenzierter Kriterien für den Vermittlungserfolg machen es natürlich notwendig neben Verwaltungs- auch zusätzliche Befragungsdaten heranzuziehen, nur so wäre eine solche "Analysetiefe" (vgl. Blaschke und Plath 1999) zu gewährleisten.
Der Begriff "Evaluation" bezeichnet nach Markert (2003, S.48)
"Prozesse informationsgestützter und kriteriengeleiteter Beurteilungen, dabei kommt im Rahmen von Evaluationen insbesondere der systematischen und transparenten Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und schriftlichen Dokumentation zielgerichteter Datenerhebungsprozesse eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung sozialer Prozesse und Strukturen zu".
Die verwendeten Evaluationsverfahren beziehen sich in der Regel auf unterschiedliche Zieldimensionen, konzeptionelle Ausrichtungen und Durchführungsebenen. Vor diesem Hintergrund können folgende beide Grundtypen von Evaluation differenziert werden:
-
Im Rahmen summativer Evaluationen werden die Wirkungen einer Maßnahme untersucht und mit den vorher festgelegten Zielen in Verbindung gesetzt. Solche Evaluationen sind oft als "Input-Output" Vergleiche konzipiert und verzichten insofern explizit auf "projektformende" Effekte.
-
Formative Evaluationen hingegen untersuchen und bewerten bereits den Verlauf einer Maßnahme. Diese Prozessorientierung zielt darauf ab, Zwischenergebnisse zu vermitteln, um somit bereits während des Verlaufs korrigierend eingreifen zu können (vgl. Markert 2003, S.52).
Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit bezieht sich auf die Frage "von wem" bzw. "von welchem institutionellen Standort aus " Evaluationsprozesse gesteuert und/oder durchgeführt werden.
-
Bei externen bzw. Fremdevaluationen wird die Bewertung konkreter Maßnahmen von "externen Dritten" durchgeführt", die dafür einen entsprechenden Auftrag erhalten haben, wohingegen
-
interne bzw. Selbstevaluationen dadurch gekennzeichnet sind, dass eine Einrichtung selbst versucht, sich oder einzelne Teilbereiche einer Bewertung zu unterziehen. In diesem Falle evaluieren praktisch Tätige ihre spezifischen Arbeitsbedingungen und -prozesse nach Maßgabe eigener Kriterien (vgl. Markert 2003, S.52f).
Unabhängig von der jeweils durchgeführten Form der Evaluation gibt es nach Markert (2003, S.50ff) ein
"grundlegendes Struktur- und Ablaufmuster, an denen sich Evaluationsmaßnahmen orientieren".
Demnach können unterschiedliche Phasen und Arbeitsschritte benannt werden, die in der Praxis zwar hinsichtlich ihrer Reihenfolge und Gewichtung variieren, aber doch immer vorkommen:
-
eine Vorbereitungs- und Planungsphase
-
eine Phase der Methodenauswahl und Operationalisierung zu Grunde gelegter Untersuchungsfragen
-
eine Phase der Datenauswertung, sowie
-
abschließend eine Phase der Berichterstattung und des Ergebnistransfers (vgl. ebenda).
Eine Unterteilung der methodischen Zugänge in der Evaluationsforschung im Bereich der beruflichen Rehabilitation geben Mühling (2000, S.58ff) sowie Blaschke und Plath (1999, S.11ff). Demnach kann eine Unterscheidung zwischen Monitoring, Verbleibsanalysen, Wirksamkeitsanalysen und Effizienzanalysen erstellt werden.
Beim Monitoring handelt es sich um eine statistische Erfolgskontrolle, welche den summativen Evaluationsverfahren zuzurechnen ist, wo mit Hilfe aggregierter Verwaltungsdaten versucht wird, den Erfolg von Rehabilitationsmaßnahmen anhand quantitativer Datengrößen zu bestimmen. Dabei werden in der Regel die TeilnehmerInnenstruktur, die Eingliederungs- bzw. Vermittlungsquote in Arbeit, die Anzahl der AbbrecherInnen sowie die Anschlussarbeitslosigkeit erfasst. Das Monitoring wird von Seiten der FördergeberInnen und der öffentlichen Verwaltung in erster Linie als Kontroll- und Steuerungsinstrument gebraucht.
Verbleibsanalysen sind wie das Monitoring zu den summativen Verfahren zu zählen. Sie geben darüber Auskunft, was aus den TeilnehmerInnen von Maßnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Abschluss der Maßnahme geworden ist und wo sie untergekommen sind. Nach Blaschke und Plath (1999, S.13) handelt es sich bei den beiden Verfahren um "orientierende Überblicksanalysen", die keinen unmittelbaren Beitrag zum Problem der Erfolgsbewertung und Erfolgssicherung beruflicher Rehabilitation leisten.
Methodisch anspruchsvoller und aussagekräftiger sind die Wirksamkeitsanalysen, welche den tatsächlichen Effekt von Interventionen untersuchen. Dabei soll das erzielte Ergebnis verglichen werden, mit jenem Ergebnis, das auch ohne die Maßnahme zustande gekommen wäre. Wirksamkeitsanalysen messen also in erster Linie die Effektivität von Maßnahmen. Solch ein Forschungsdesign würde die Bildung einer so genannten Kontrollgruppe verlangen, was aber alleine aus ethischen Gründen zumeist nicht möglich ist. Aus diesem Grund werden in der Regel nachträglich vergleichbare Kontrollgruppen gebildet, bzw. ein "Vorher-Nachher" Vergleich bei den TeilnehmerInnen durchgeführt.
In Effizienzanalysen soll schließlich durch einen Vergleich der Kosten und der Wirkungen bzw. der Kosten und des Nutzens einer Maßnahme deren Effizienz ermittelt werden. Eine Schwierigkeit bei derartigen Untersuchungen ist vor allem die Bewertung von direkten und indirekten Aufwendungen und Erträgen der Intervention (vgl. Mühling 2000, S.58ff).
All diese beschriebenen Evaluationsverfahren berücksichtigen nach Blaschke und Plath (1997, S.246ff &1999, S.13ff) eher eine "Analysebreite" und implizieren keine direkten Auswirkungen auf den Prozessablauf bzw. die Prozessgestaltung. Im Sinne einer "Analysetiefe" empfehlen sie differenzierende Untersuchungsmethoden, wie z.B. Fallanalysen, wofür aber wie bereits erwähnt, neben statistischen Verwaltungsdaten auch systematisch erhobene Befragungsdaten erhoben und berücksichtigt werden müssen.
Einleitend möchte ich anmerken, dass das Feld der beruflichen Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderung einen seit Beginn der neunziger Jahre stark beforschten Bereich, darstellt. Es ist mir im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht möglich, auf sämtliche Studien in all ihren Aspekten einzugehen. Ich werde mich darauf beschränken einige zentrale Aspekte aus den wichtigsten Evaluationsstudien in Österreich und Deutschland wiederzugeben[24].
Über die Schwierigkeit der einheitlichen Darstellung von Forschungsergebnissen schreibt Barlsen (2001, S.41):
"Ebenso vielfältig wie die Fachdienste selbst, sind auch die (Forschungs-)Berichte und Publikationen, so dass eine vergleichende Darstellung der vorliegenden Ergebnisse bislang nur bezüglich einiger weniger zentraler Aspekte, wie zum Beispiel verschiedener quantitativer Angaben zu den Bewerbern oder zu Art und Größe akquirierter Betriebe, möglich ist".
Ebenso liefert Barlsen (ebenda) eine zeitliche und inhaltliche Unterscheidung der Studien, die - obwohl er sich primär auf deutsche Forschungsberichte bezieht - zum Teil auch auf Österreich zutrifft. Demnach,
"diskutieren vor allem die älteren Forschungsberichte die grundsätzliche Effektivität des neuen Unterstützungsangebotes, versuchen die Zielgruppe einzugrenzen und geeignete Betriebe bzw. Arbeitsplätze zu beschreiben. In anderen Publikationen liegt der Schwerpunkt eher auf den Verfahren und Arbeitsweisen der Integrationsfachdienste. Neben Strategien zur Akquisition von Arbeitsplätzen, diagnostischen Instrumenten zur Erhebung der Fähigkeiten und Einschränkungen der Bewerber werden Methoden der Begleitung am Arbeitsplatz evaluiert. Derzeit laufende Forschungsprojekte untersuchen die Organisationsstrukturen der Fachdienste in Abhängigkeit von ihrer Trägerschaft, die Kooperationsbeziehungen mit anderen Institutionen, insbesondere der Arbeitsverwaltung und entwickeln Konzepte zur Qualitätssicherung und -entwicklung".
Badelt und Österle evaluierten bereits 1992, noch vor Beginn der Einrichtung von Arbeitsassistenz-Projekten, die Arbeitsweise des Vorarlberger Modells der Unterstützen Beschäftigung durch das IFS (Institut für Sozialdienste) Reha. Das Vorarlberger Modell war als Alternative zum so genannten "Weißenberger Konzept" gedacht, welches die verstärkte Ausrichtung von Behinderten Werkstätten zum ersten Arbeitsmarkt vorsah. Die Evaluation wollte aufzeigen, welchen
"Stellenwert der Supported Employment Ansatz im arbeitsmarktpolitischen Instrumentarium für Behinderte einnehmen kann" (Badelt & Österle 1992, S.85).
Die Untersuchung orientierte sich am theoretischen Konzept der Kosten-Wirksamkeits-Analyse. Im Gegensatz zur "Kosten-Nutzen-Analyse" geht dieser Ansatz von einem Bündel an Zielen aus und berücksichtigt nicht nur monetäre Aspekte. Die Zielgruppe bei diesem Modellprojekt waren zu über 60% Menschen mit einer Lern- oder geistigen Behinderung, die zum Großteil nur eine Sonderschule abgeschlossen hatten. Fast drei Viertel der TeilnehmerInnen konnten zum Erhebungszeitpunkt höchstens 50% der Leistung erbringen, was insofern bemerkenswert ist, als dass die meisten dieser Personen in den heutigen Arbeitsassistenz-Projekten auf Grund des Ausmaßes ihrer Leistungsminderung für die Aufnahme in eine Maßnahme als nicht ausreichend qualifiziert angesehen würden. Die Finanzierung der Lohnkostenzuschüsse erfolgte in fast allen Fällen ausschließlich durch das Land Vorarlberg. Obwohl die Lohnkostenzuschüsse zum Teil über 50% betrugen, stellten die Autoren in einer Kostenanalyse relative Kostenvorteile gegenüber den Arbeitsplätzen in geschützten Werkstätten fest (vgl. Badelt & Österle 1992).
Auf die - für den Ausbau der Arbeitsassistenz schlussendlich wegbereitenden - Evaluationsstudie von Blumberger / Gsaxner / Heilbrunner (1994): "Evaluierung des Modellprojektes Arbeitsassistenz in Oberösterreich und Niederösterreich" habe ich bereits im Kontext der Entwicklung von Arbeitsassistenz aufmerksam gemacht.
Es existieren ferner einige Studien, die über regionale Aspekte der Dienstleistung Arbeitsassistenz Aufschluss geben, und deshalb an dieser Stelle nur namentlich angeführt werden
-
Weiß (1997): "Evaluation der Arbeitsassistenz Salzburg im ersten Jahr des Bestehens"
-
Hovorka / Sigot (Hrsg.) (2001): "Integration durch regionale Arbeitsassistenz in Niederösterreich"
-
IFA Steiermark (2002): "Begleitforschung der Entwicklungspartnerschaft Styria Integra"
Blumberger (2002) veröffentlichte im Auftrag des BMSG, die bislang einzige bundesweit durchgeführte Studie zum Thema Arbeitsassistenz. Nachdem das Bezugsjahr der Studie (1999) bereits einige Jahre zurück liegt, kann angenommen werden, dass einige der Ergebnisse bereits als überholt zu erachten sind. Die Aufgabe der Studie war es,
"den Stand der bisherigen Entwicklung der Arbeitsassistenz zu dokumentieren und Entscheidungsgrundlagen für die weitere Ausgestaltung und Praxis der Arbeitsassistenz zu erarbeiten" (Blumberger 2002, S.12).
Dabei wurden vor allem quantitative Daten erhoben, eine Umfrage über den Bekanntheitsgrad von Arbeitsassistenz bei Unternehmen durchgeführt und Vorschläge für die weitere Entwicklung vorgelegt. Im Folgenden möchte ich nun die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen:
-
Die Anzahl der Vollzeitäquivalente wurde von 1997 bis 1999 von 68,55 auf 154,8 mehr als verdoppelt, wobei 1998 die Anzahl der Erfolge pro Vollzeitstelle 11,25 betrug.
-
Im Jahr 1999 wurden insgesamt 6191 Beratungen und 2623 Betreuungen durchgeführt. Der Anteil an Frauen betrug 33%, wobei der Anteil bei Betreuungen mit 47% deutlich günstiger ausfiel als bei Beratungen mit nur 27%. Dies ist wahrscheinlich auch auf die "Gender-Mainstreaming" Vorgaben des ESF zurückzuführen, wonach der Geschlechteranteil möglichst gleich verteilt sein sollte.
-
Der Betreuungsschwerpunkt nach Art der Behinderung variierte in den einzelnen Bundesländern 1997 zum Teil beträchtlich, was auch auf die sozialtherapeutische Infrastruktur in den einzelnen Regionen, sowie die Schwerpunktsetzung der einzelnen Arbeitsassistenz-Einrichtungen in Bezug auf die Behinderung zurückzuführen ist. Der Schwerpunkt lag 1997 österreichweit mit 42% bei Personen mit psychischen Beeinträchtigungen, weiters waren Menschen mit Hörbehinderung zu 11%, Menschen mit Sehbehinderung zu 2%, Menschen mit geistiger Behinderung zu 16%, Menschen mit einer Köperbehinderung zu 15% und Menschen mit einer Mehrfachbehinderung zu 11% vertreten.
-
Der Versorgungsgrad und die Betreuungskapazitäten differierten 1997 und 1998 ebenso beträchtlich und standen in keiner Relation zu der Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung in den einzelnen Bundesländern. So kamen z.B. in Wien auf jede Vollzeitstelle 1097 arbeitslose Menschen mit Behinderung, während es in Salzburg nur 128 waren. Es ist anzunehmen, dass diese regionalen Disparitäten mittlerweile durch entsprechende Personalaufstockungen bereits angeglichen sind.
-
Die Erfolgsquoten an positiven Interventionen (Erlangungen & Erhaltungen) der einzelnen Arbeitsassistenz Einrichtungen lagen, bezogen auf das Bundesland zwischen 25% (in Kärnten) und 52% in Vorarlberg, wobei der österreichische Durchschnitt bei 41,6 % lag.
-
Aufgrund der relativ kleinen Anzahl an Vermittlungen war es zum Erhebungszeitpunkt nicht möglich direkt auf Arbeitsmarkteffekte rückzuschließen. Zwar war von 1995 bis 1999 die Anzahl der als schwervermittelbar registrierten Arbeitslosen, die wieder eine Beschäftigung fanden, um 4.348 gestiegen, wobei Blumberger allerdings von einem gewissen Mitnahmeeffekt ausgeht, da sich die Arbeitsmarktsituation im gleichen Zeitraum relativ günstig entwickelt hat. Er weist allerdings darauf hin, dass "sich die positiven Wirkungen der Arbeitsassistenz nicht alleine und vollständig in der Arbeitsmarktstatistik abbilden. Viele Menschen mit Behinderung lassen sich nicht als "arbeitslos" oder "arbeitssuchend" registrieren, auch wenn sie keiner Erwerbsbeschäftigung nachgehen können. Die Arbeitsassistenz unterstützt aber auch diese Gruppe, daher können Erfolge bei der beruflichen Integration statistisch nicht erfasst werden (Blumberger 2002, S.19). "
-
Bezogen auf die Arbeitsweise wurden auch Unterschiede festgestellt, diese hatten weitgehend klientInnenspezifische Gründe. Die größten Unterschiede zeigten sich demnach im Bereich der Unternehmenskontakte und der Arbeitsplatzakquise, dem Beratungskonzept und dem Angebot an weitergehender Begleitung, sowie in der durchschnittlichen Betreuungsdauer.
Des Weiteren wurden 20 Fallstudien an Unternehmen durchgeführt, diese kamen zu weiteren Ergebnissen:
-
Die Initiative zur Einstellung eines Menschen mit Behinderung geht in den untersuchten Fällen zumeist von Seiten der Arbeitsassistenz aus.
-
Gute persönliche Kontakte und das umfassende Dienstleistungsangebot der Arbeitsassistenz erleichtern die Integration eines Menschen mit Behinderung.
-
Positive Erfahrungen der Unternehmen in Bezug auf die Einstellung von Menschen mit Behinderung stellen einen wesentlichen Faktor für das Gelingen von Maßnahmen der Arbeitsassistenz dar. Darüber hinaus vergrößert sich die Bereitschaft zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.
-
Finanzielle Förderungen können beschäftigungsrelevant sein. Als beschäftigungsförderlich wirken sich finanzielle Zuschüsse eher bei kleineren Unternehmen aus, die diese bei Einstellung eines Menschen mit Behinderung erhalten können.
-
Aufgrund des besonderen Kündigungsschutzes lässt sich feststellen, dass Unternehmen behutsamer und kritischer bei der Einstellung eines Menschen mit Behinderung vorgehen.
-
Der Bereich der Aufklärungsarbeit bezüglich des Kündigungsschutzes, relevanten finanziellen Leistungen und der Abbau von Vorurteilen von Seiten der Unternehmen, erweist sich als ein weiterer bedeutsamer Faktor für das Gelingen von Maßnahmen der Arbeitsassistenz.
-
Die geringe Sichtbarkeit einer Behinderung gilt in vielen Fällen als ein besonderes Einstellungshemmnis. Psychische Behinderung erscheinen nach wie vor in unserer Gesellschaft ein Tabuthema zu sein. Es scheint, dass unterschiedliche Motive dafür verantwortlich sind (vgl. Blumberger 2002, S.24ff).
Außerdem wurde noch eine telefonische Unternehmensbefragung (N=539) zur Ermittlung des Bekanntheitsgrades der Arbeitsassistenz durchgeführt. Diese Erhebung brachte folgende Ergebnisse:
-
Für 48% der befragten österreichischen Unternehmen war die Arbeitsassistenz ein Begriff.
-
Der Bekanntheitsgrad schwankte jedoch bundesländerweit.
-
In ländlichen Gebieten war die Arbeitsassistenz den Unternehmen eher bekannt.
-
Unternehmen, die bereits näheren Kontakt mit der Arbeitsassistenz hatten, zeigten geringfügig eine größere Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
-
Eine Bereitschaft zur Kooperation mit der Arbeitsassistenz bekundeten jedoch nur drei von zehn Unternehmen.
Im letzten Teil der Studie, in welchem Vorschläge für die weitere Entwicklung vorgelegt gemacht wurden, wird die Empfehlung ausgesprochen "Marktelemente" in die öffentliche Nachfrage von Arbeitsassistenz aufzunehmen. Dabei wird aber explizit auf zwei mögliche Gefahren verwiesen, und zwar auf die eines möglichen Qualitätsverlustes und die des Eintretens eines "Creaming the Poor" Effektes[25]. Außerdem wird der Vorschlag unterbreitet, die Verwaltung zu vereinfachen, indem das BMSG für die Rahmenvorgaben für die Arbeitsassistenz sowie für das strategische Controlling zuständig ist und die operativen Aufgaben bei den regionalen Bundessozialämtern liegen sollen. Verbesserungspotentiale der Anbieter wurden insbesondere bei ihrer Wirtschaftskompetenz und einem professionellen Leitbild festgestellt. Es wurden deshalb dahingehend Empfehlungen ausgesprochen zumindest die Dokumentation der Arbeitsassistenz-Einrichtungen zu vereinheitlichen sowie Qualitätsstandards festzulegen. Außerdem sollte von den Projektträgern die Verwendung eines Qualitätsmanagementsystems nachgewiesen werden und die Qualifikation der ArbeitsassistentInnen im Sinne eines "Qualifikationsprofils" vereinbart werden (vgl. Blumberger 2002, S.31ff). Einige dieser Empfehlungen wurden vom zuständigen BMSG bereits aufgegriffen und verwirklicht.
Die Arbeitsassistenz war auch eines von mehreren Themen in zwei aktuellen Untersuchungen zum gesamten "Systemumfeld der beruflichen Rehabilitation und Integration in Österreich", die beide vom BMSG in Auftrag gegeben worden, und zwar Horak und Schmid et. al. (2003): "Evaluierung der Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung" sowie die von den Forschungsinstitutionen KMU, SORA und ABIF durchgeführte Studie: "Maßnahmen für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen - Evaluierung, Analyse, Zukunftsperspektiven".
Die von der Evaluierungsstudie zur Beschäftigungsoffensive dargelegten Empfehlungen beziehen sich nicht unmittelbar auf die Maßnahme der Arbeitsassistenz. Nachdem ihnen aber eine bedeutende Relevanz im Bereich der allgemeinen Rahmenbedingungen zukommen könnte, möchte ich trotzdem die zentralen Ergebnisse kurz zusammenfassen:
-
Um künftig die Wirksamkeit von Instrumenten und Maßnahmen eindeutig bewerten zu können, sollte nach Empfehlung der Autoren eine einheitliche Datenbasis geschaffen werden, da die Datenerfassung und Auswertung und damit die Datengrundlage vor allem im Bereich der Menschen mit Behinderung weder umfassend noch vergleichbar ist[26]. Dazu müssten einerseits einheitliche Definitionen und Kategorisierungen gebildet werden, andererseits auch eine "vernetzte Entwicklung aller entsprechenden Instrumente und Kategorien sowie aller behindertenpolitisch relevanten Akteure (BMSG, BSB, AMS, Länder, etc.)" erfolgen (Horak & Schmid et. al. 2003, S.58).
-
Für die Bewertung der arbeitsmarktpolitischen Effekte wird empfohlen, die von den AkteurInnen eingebrachten zusätzlichen Effekte wie z.B. "Soziale Integration" von Seiten der Fördergeber ebenfalls als Zielvorgaben zu formulieren, "da sie neben den quantitativ messbaren Indikatoren "Entwicklung der Arbeitslosigkeit" und "Beschäftigungsquote" wichtige positive Effekte darstellen" (Horak & Schmid 2003, S.58).
-
Bezugnehmend auf die Nachhaltigkeit von Maßnahmen wird angeraten eine über einen längeren Zeitraum laufende Auswertung der KlientInnendaten durchzuführen, da so eher Aussagen über deren Wirksamkeit ermöglicht würden.
-
Außerdem sprechen sich die Autoren für die Einführung längerer Förderperioden zur Förderung innovativer Projekte, sowie zur verstärkten Nutzung formativer Evaluation auf Maßnahmenebene aus (vgl. Horak & Schmid 2003, S.58ff).
Die zweite aktuelle Untersuchung zur Evaluierung der Maßnahmen für Jugendliche mit Behinderung (SORA / KMU / ABIF 2004, S.5f) entwickelt aufbauend auf der Analyse der Situation von Jugendlichen an der Schnittstelle Schule / Beruf ein
"Konzept für ein durchgängiges und nachhaltiges Fördersystem".
Ebenso wie bei der oben angeführten Studie, könnte den Empfehlungen arbeitsmarktpolitische Relevanz zukommen. Im Zusammenhang mit der Arbeitsassistenz wird ein weiterer Ausbau dieses Angebots ebenso wie ein Ausbau von Möglichkeiten der Unterstützung und Begleitung am Arbeitsplatz (z.B. Job Coaching) empfohlen. Außerdem sollen unter anderem mehr Förderungsmöglichkeiten für geistig behinderte Jugendliche geschaffen werden, um eine Wahlfreiheit zwischen ersten und zweitem Arbeitsmarkt sowie der Beschäftigungstherapie zu ermöglichen. Um die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zu erhöhen wird angeraten, die Förderungspolitik transparenter und kontinuierlicher zu gestalten sowie den Vermittlungsquotendruck zu senken. Ebenso wie Horak und Schmid (2003) sprechen sich die Autoren für eine langfristig angelegte Evaluierung von integrativen Projekten aus. Des weiteren sollen Sensibilisierungskampagnen, die auf die Bedürfnisse und Probleme von Jugendlichen mit Behinderung im Alltag und in der Arbeitswelt aufmerksam machen, auch nach dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung (2003) weiter forciert sowie das Behinderteneinstellungsgesetz hinsichtlich beschäftigungshemmender Faktoren wie dem Kündigungsschutz neu überarbeitet werden (vgl. SORA / KMU / ABIF 2004, S.95ff).
In Deutschland, so kann zu Beginn angemerkt werden, ist die Fülle an Forschungsarbeiten im Bereich der beruflichen Rehabilitation / Integration noch weitaus ergiebiger und differenzierter, was sich aber auch auf Grund der weitaus größeren Anzahl an beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen erklären lässt. Aufgrund der Vielfältigkeit der deutschen Forschungslandschaft zu dieser Thematik beschränke ich mich darauf, zwei Sekundärquellen zu präsentieren (Barlsen 2001 sowie Doose 2004), welche einen guten Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Deutschland geben.
Wie bereits erwähnt, befassen sich die bisher vorliegenden Untersuchungen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung mit jeweils bestimmten Fragestellungen der einzelnen Modellprojekte in Deutschland. In fast allen Untersuchungen wurden die spezifischen Voraussetzungen der TeilnehmerInnen (Alter, Geschlecht, schulische und berufliche Bildung, Art und Grad der Behinderung, etc.) erhoben, außerdem wird zumeist auf die Arbeitsweise der Modellprojekte eingegangen, sowie die Struktur der einstellenden Betriebe untersucht. In einigen Untersuchungen wurden auch monetäre Kosten-Nutzen Analysen durchgeführt. Festzuhalten ist ferner, dass sich die ersten Untersuchungen vor allem mit den von den damaligen Hauptfürsorgestellen beauftragten zielgruppenspezifischen Fachdiensten für Menschen mit Lernschwierigkeiten befassten, während neuere Untersuchungen vor allem behinderungsübergreifende Dienste analysierten, die von den Arbeitsämtern beauftragt wurden (vgl. Doose 2004, S.9f; Barlsen 2001, S.42ff). Im Folgenden nun die wichtigsten Ergebnisse:
-
Hinsichtlich der Geschlechterverteilung und des Alters ähneln sich die NutzerInnen aller untersuchten Fachdienste, demnach sind 60% der begleiteten Personen männlich und 40% weiblich. Im Schnitt wenden sich BewerberInnen zwischen 20 - 30 Jahren an den IFD.
-
Schwerer zu vergleichen sind Art und Ausmaß der Behinderung, da sich die Zielgruppen der einzelnen Fachdienste unterscheiden. Doose (2004, S.11) konstatiert, dass "sich bei der Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung in Deutschland von Modellphase zu Modellphase eine Zielgruppenverschiebung feststellen" lässt. Im Zuge der Ausweitung der Zielgruppe hat sich der Anteil von SchulabgängerInnen und MitarbeiterInnen aus WfbMs, obwohl sie im SGB IX ausdrücklich als Zielgruppe formuliert sind, auf unter 1% marginalisiert. Besonders deutlich wurde diese Zielgruppenverschiebung nach Doose (2004, S.12) auch bei jenen Menschen mit einer schweren geistigen, Körper- oder Sinnesbehinderung, "bei denen die Vermittlung eines Arbeitsplatzes alleine keine hinreichende Unterstützung darstellt, da sie den Arbeitsplatz ohne weitere Begleitung leicht wieder verlieren."
-
Barlsen (2001, S.49ff) versucht aus den Untersuchungen bewerberInnenspezifische Zusammenhänge mit dem Vermittlungserfolg darzustellen. Obwohl aufgrund unterschiedlicher Operationalisierungen und unterschiedlicher Ausgangs-voraussetzungen die Ergebnisse, insbesondere auf die Stärke der Zusammenhänge, nur bedingt vergleichbar sind, so werden doch zwei Befunde durchgängig bestätigt, und zwar, dass "die Vermittlungswahrscheinlichkeit bei vorhandenen Arbeits- Erfahrungen - insbesondere auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt - und mit dem Niveau der beruflichen Qualifikation" steigt, sowie dass "ein Zusammenhang mit dem Ausmaß der Behinderung festgestellt" werden kann (Barlsen 2001, S.49f). Vor allem der zweite Aspekt wird nach Barlsen aber insofern relativiert, als das dieser Zusammenhang, "wie die nicht unerhebliche Zahl erfolgreicher Vermittlungen (vermeintlich) schwächerer Bewerber zeigt, in Abhängigkeit von der Arbeitsmarktsituation, der betrieblichen Struktur sowie der Unterstützung durch die Fachdienst in gewissem Grad variabel und beeinflussbar" ist. (ebenda)
-
Bezogen auf die einstellenden Unternehmen stellt Barlsen (2001, S.53) fest, dass die vorliegenden Ergebnisse keinerlei Ergebnisse liefern, "die es sinnvoll erscheinen lassen, bei der Akquisition von Arbeitsplätzen bestimmten Wirtschaftssektoren oder Betriebsgrößen besondere Präferenzen einzuräumen. Vielmehr erscheint es notwendig, die Aktivitäten möglichst auf das gesamte Spektrum vorhandener Arbeitsplatzanbieter ausrichten, um zu vermeiden, dass durch branchenspezifische Rationalisierungen, Auftragseinbußen, etc. Vermittlungsengpässe entstehen". Bei Menschen mit Lernschwierigkeiten handelt es sich bei den ausgeübten Tätigkeiten überwiegend um Anlern- und Hilfsarbeiten, wobei klare geschlechtsspezifische Unterschiede in Richtung "typischer" Frauen- bzw. Männerberufe ausgemacht werden können (vgl. Doose 2004, S.15).
-
Die einstellenden Betriebe sind in den einzelnen Untersuchungen zwischen 50 und 66 % Kleinbetriebe mit unter 50 Beschäftigten, wobei ein großer Anteil davon auf Kleinbetriebe mit unter 16 ArbeitnehmerInnen fällt, die gesetzlich keine Schwerbehinderten Menschen beschäftigen müssten. Kastl und Trost (2002, S.209ff) erklären dieses Phänomen zum einen durch die überwiegende Anzahl kleinerer Betriebe und die flachen Hierarchien in diesen Unternehmen, bei denen meistens nur der Betriebsinhaber von einem Integrationsversuch überzeugt werden muss. Zum anderen haben finanzielle Förderungsmöglichkeiten für Kleinbetriebe eine größere Relevanz. In großen Unternehmen werden schwerbehinderte MitarbeiterInnen zumeist unter den bereits beschäftigten ArbeitnehmerInnen "rekrutiert" und ihnen nahe gelegt, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen (vgl. Doose 2004, S17).
-
Bei den Beschäftigungsmotiven können grundsätzliche Gemeinsamkeiten festgehalten werden, wobei die Gewichtung der einzelnen Motive je nach Untersuchung variiert. Barlsen (2001, S.54) und Doose (2004, S.19) nennen dabei vor allem folgende Motive: die Qualifikation, Motivation und Leistungsfähigkeit der BewerberInnen, wobei ArbeitgeberInnen eher bereit sind Personen einzustellen bei denen obige Aspekte bereits im Rahmen eines Praktikums erprobt wurden. Weitere Motive sind die Eignung eines/einer BewerberIn für einen bestimmten Arbeitsplatz sowie die Angebote des Fachdienstes wie personelle Unterstützung, Hilfe bei der Einarbeitung am Arbeitsplatz oder der Arbeitsplatzanpassung. Finanzielle Unterstützungen üben wie bereits erwähnt vor allem bei kleineren Betrieben eine Anreizfunktion aus, und letztlich spielen soziale Motive und Engagement sowie persönliche positive Erfahrungen der ArbeitgeberInnen eine entscheidende Rolle.
-
Nach Barlsen (2002, S.56f) lag die durchschnittliche Vermittlungsquote der untersuchten Fachdienste, die Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen begleiten, bei rund 1/3 aller in die Begleitung aufgenommenen BewerberInnen. Die Quote der IFD die überwiegend Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen betreuen, liegt mit ca. 50% etwas höher, wobei diese Vermittlungen häufiger auf Teilzeitstellen erfolgen und die Arbeitsverhältnisse auch oft schneller beendet werden. Die neuen bundesweit arbeitenden IFD vermittelten im Jahr 2002 7.555 Personen, was einer Vermittlungsquote von ca. 21,5% entspricht, was nach Doose (2004, S.21) aufgrund der allgemeinen Entwicklung am Arbeitsmarkt in Deutschland sowie der kurzen Zeit des Bestandes des Dienste bemerkenswert ist. Auch in der deutschen Fachdiskussion wird die überwiegende Fokussierung auf die Vermittlungszahlen als alleiniges Qualitätskriterium als wenig aussagekräftig betrachtet und umfangreiche Qualitätskriterien gefordert. Außerdem formulieren Kastl und Trost (2002), dass diese Orientierung umso kritischer zu sehen ist, "wenn dabei die gesetzliche Zielgruppe der Integrationsfachdienste verfehlt wird."
-
Bezüglich der sozialen Integration im Betrieb zeigen die verschiedenen Forschungsberichte, dass zwischen 80 und 90% der vermittelten Menschen mit Behinderung gut integriert sind. Auch die Arbeitszufriedenheit wird von einem Großteil der ArbeitnehmerInnen als überwiegend positiv bewertet (vgl. Doose 2004, S.25). Barlsen (2001, S.57f) gibt an, dass bislang keine Längsschnittstudien über die langfristige Stabilität der Dienstverhältnisse vorliegen, die darüber Aufschluss geben können, "ob durch IFD tatsächlich dauerhafte Arbeitsverhältnisse angebahnt werden können, oder ob sie lediglich kurzfristige Mobilitätsprozesse zwischen dem allgemeinen und dem Sonderarbeitsmarkt initiieren." Dieses Forschungsdefizit versucht Stefan Doose derzeit durch seine Dissertationsstudie auszugleichen: "Einige Jahre später - die Lebens- und Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung in Unterstützter Beschäftigung. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie zur Situation der von IFD und WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelten Menschen mit Behinderung.".
Im Folgenden möchte ich drei Forschungsvorhaben vorstellen, die sich im Besonderen mit der Thematik der Qualität von Unterstützter Beschäftigung auseinandergesetzt und in unterschiedlichen Forschungsansätzen jeweils geeignete Qualitätskriterien entwickelt haben. Diese Studien beziehen sich unmittelbar auf die Institutionen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste, wobei sich eine auf Österreich, eine auf einen europäischen Kontext und eine vornehmlich auf Deutschland konzentriert. Eine Auseinandersetzung und Berücksichtigung dieser Studien wäre auch aus sozialpolitischer Hinsicht relevant, da die im Rahmen dieser Untersuchungen erhobenen Qualitätskriterien, einen brauchbaren Ansatz liefern können, um zukünftig die Qualität von Fachdiensten nicht mehr ausschließlich an Vermittlungsquoten zu messen, sondern im Sinne des gesamten Dienstleistungsprozesses zu sehen.
Zentrales Forschungsanliegen der Dissertationsstudie von Fasching (vgl. 2003, S.11) war es, Kriterien zur Beurteilung des Beratungserfolges zu definieren, welche über eine ausschließliche Orientierung an Vermittlungsquoten hinausgehen. Zur Begründung führt Fasching an:
"Das Qualitätsverständnis der Arbeitsassistenz ist quantitativ orientiert und entspricht damit in keiner Weise einem professionellen Konzept von Qualitätsmanagement. Ein Qualitätskonzept, in dem neben dem Ergebnis- vor allem die Prozess- und die Strukturebene relevant werden, ist geeignet die verschiedenen Aufgaben und Rahmenbedingungen von Beratung in der Arbeitsassistenz adäquat abzubilden." (Fasching 2003, S.11).
Die Forschungsfrage dieser Untersuchung lautete:
"Was kennzeichnet eine `gute Beratung`, damit Jugendlichen mit Lernbehinderung eine dauerhafte berufliche Integration am allgemeinen Arbeitsmarkt gelingt?" (Fasching 2003, S.14).
Ziel war es demnach, Qualitätskriterien "guter Beratung", bezogen auf die Zielgruppe der "Jugendlichen mit Lernbehinderung", anhand der Dimensionen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen und praktischen Perspektive zu bestimmen (vgl. ebenda, S.14 & 112ff).
Ausgehend von einer Analyse des ("Ist") Beratungsprozesses und der strukturellen sowie institutionellen Rahmenbedingungen bestimmt Fasching (vgl. 2003, S.147ff) Kriterien für die Prozess- und Strukturqualität, die sich bezogen auf den Prozess an der in Kapitel 3 bereits dargelegten Phasenabfolge orientieren. Ich möchte im Folgenden, die von der Autorin dargelegten Stärken und Schwächen der Arbeitsassistenz, sowie die sich daraus ableitenden Vorschläge zur Verbesserung der Praxis präsentieren. Zu den größten Stärken dieser Dienstleistung zählen demzufolge:
-
die individuelle und kontinuierliche Beratung und Unterstützung
-
die Förderung der Selbstbestimmung
-
die Entwicklung einer Berufsperspektive entsprechend den individuellen Fähigkeiten
-
die Durchführung von Praktika
-
die Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen
-
die Förderung arbeitsbezogener und sozialer Kompetenzen
-
der Abbau von sozialen Vorurteilen in Betrieben
-
die Unterstützung bei der sozialen Integration im Betrieb
-
die Einbeziehung des sozialen Netzwerkes, sowie
-
die Kooperation mit allen relevanten Institutionen die am Integrationsprozess unmittelbar beteiligt sind. (Vgl. Fasching 2003, S.176ff).
Die angeführten Schwächen resultieren primär alle aus dem durch den hohen Vermittlungsdruck ausgelösten Mangel an Zeit und Ressourcen sowie der zu kurzen Betreuungszeit. Beides wirkt sich negativ auf den gesamten Beratungsprozess aus. Dabei kommen in der Praxis oft insbesondere die gerade im Hinblick auf Jugendliche mit Lernbehinderungen in empirischen Studien belegten wichtigen Phasen der Vorbereitung und der Nachbetreuung zu kurz. Auch indirekt klientInnenbezogene Aufgaben, wie die Schnittstellenarbeit der Fachdienste, die Kooperation mit Betrieben aber auch die Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen kann durch den Mangel an vor allem zeitlichen Ressourcen zumeist nicht intensiv genug erfolgen (vgl. Fasching 2003, S.181ff). Da diese Voraussetzungen nicht in ausreichendem Maße gegeben sind, entwirft die Autorin Verbesserungsvorschläge für die Praxis, die sich zum Großteil auf die strukturellen Rahmenbedingungen beziehen. Einige der Empfehlungen lauten:
-
Um eine einseitige Ausrichtung und Bewertung des Erfolges an ausschließlich quantitativen Kriterien, sowohl aus der Sicht der Auftraggeber und -nehmer zu vermeiden, sollten zukünftige gesetzlich vorgeschriebene Leistungsvereinbarungen sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte umfassen.
-
Es sollten für die Prozess- und Strukturqualität einheitliche Mindeststandards geschaffen werden, die garantieren, dass die Hauptkundengruppen der Arbeitsassistenz gut beraten werden können.
-
Die Dauer der Betreuungszeiten sollte grundsätzlich ausgeweitet werden um sowohl eine adäquate Vorbereitung als auch Nachbetreuung zu ermöglichen.
-
Durch eine Personalaufstockung sollte die Betreuungsrelation auf einen einheitlichen Stand gesenkt werden.
-
Für eine ausreichende Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte sollte gesorgt werden. (Vgl. Fasching 2003, S.183ff).
In dem aus Mitteln des LEONARDO Programms der Europäischen Kommission geförderten Forschungsprojekts QUIP ("Quality in Practice") arbeiteten über einen Projektzeitraum von zwei Jahren jeweils ein Forschungsinstitut und ein praktischer Partner in sechs europäischen Ländern (Österreich, Ungarn, Großbritannien, Norwegen, Spanien, Tschechische Republik) zusammen. Die österreichischen PartnerInnen, welche das Projekt gleichzeitig initiierten, waren die "Lebenshilfe Ennstal" und das "Europäische Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung". Die Ziele dieses Projektes lauteten:
-
"Eine Verbesserung der Methoden in Unterstützter Beschäftigung in den beteiligten Ländern zu unterstützen.
-
Eine Liste von Erfolgskriterien für Unterstützte Beschäftigung abseits von rein quantitativen Bewertungskriterien zu erarbeiten.
-
Instrumente für eine fortlaufende Evaluierung von Arbeitsassistenzen bereit zu stellen." (Giedenbacher, Stadler-Vida & Strümpel 2003, S.6)
Die Basis der oben angeführten Ziele sollten Qualitätskriterien für Unterstützte Beschäftigung aus der Sicht der unterschiedlichen Prozessbeteiligten bilden. Ausgangspunkt für diese Bestrebungen war die Frage:
"ob sich die Ziele der PartnerInnen im Prozess von Unterstützter Beschäftigung eigentlich vereinbaren lassen." (Giedenbacher 2003, S.6)
Das übergeordnete Ziel dieses Projektes war es vor allem die Sichtweisen der unterschiedlichen Prozessbeteiligten kennen zu lernen. Als wichtigste Prozessbeteiligte ("Stakeholder") wurden folgende Personengruppen definiert:
-
die LeiterInnen der Fachdienste,
-
die FachdienstmitarbeiterInnen,
-
die NutzerInnen,
-
die ArbeitgeberInnen sowie
-
die VertreterInnen der Fördergeber. (vgl. Giedenbacher 2003, S.6)
Methodisch wurden vor allem partizipative Erhebungsverfahren angewendet, um den jeweiligen AkteurInnen die Möglichkeit zu geben, ihre spezifischen Sichtweisen zum Thema "Qualität von Unterstützter Beschäftigung" einzubringen. Der Projektzeitraum war in 5 Phasen unterteilt, wobei jede Phase einer Gruppe von Prozessbeteiligten gewidmet war. Zum Abschluss wurden die Ergebnisse der einzelnen Erhebungen in einem Workshop zusammengetragen, und in einem Diskussionsprozess schließlich die Liste der Qualitätskriterien erarbeitet. Als zentrales Ergebnis wurde festgestellt, dass
"Jeder/Jede dieser AkteurInnen vielmehr einen Ausschnitt aus der umfassenden Vorstellung von einem qualitativ hochwertigen Dienst sieht." (Giedenbacher 2003, S.7)
Die endgültige Liste der Qualitätskriterien soll demnach eine "umfassende Vorstellung von Qualität von Unterstützter Beschäftigung" darstellen und ist ebenfalls entsprechend der internationalen Diskussion in die Parameter Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität gegliedert[27]. Ein weiteres Ergebnis dieses Projektes, das auf den Qualitätskriterien als Grundlage aufbaut, stellt das "Handbuch zur Selbstevaluation" für Fachdienste dar, auf das ich noch genau im Kontext der Qualitätssysteme und -instrumente eingehen werde (vgl. ebenda, S.7ff).
Im Rahmen, der von der Westfälischen Universität Münster im Auftrag des Ministerium für Arbeit und Soziales, der Qualifikation und Technologie in Nordrhein-Westfalen, dem Landschaftsverband Rheinland Integrationsamt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe Integrationsamt durchgeführten Untersuchung, bestand die Zielsetzung neben der Evaluation von vier behinderungsübergreifenden Fachdiensten, Kriterien für die Beurteilung der Qualität der Arbeit von Integrationsfachdiensten zu bestimmen, welche wiederum die Grundlage für die Entwicklung und Erprobung eines Qualitätsmanagementsystems für IFD darstellen sollte. An dieser Stelle möchte ich mich auf die empirische Erhebung und Bestimmung von Qualitätskriterien konzentrieren, die Darstellung des in diesem Projekt entwickelten QM - Systems "MUQ" (Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagementsystem für IFD) erfolgt ebenfalls im Kapitel 6. Unter Qualitätskriterien verstehen die Autoren:
"Aussagen, die präzisieren, welchen konkreten Erfordernissen eine fachlich qualifizierte und erfolgreiche Arbeit von Integrationsfachdiensten genügen muss. Derartige Erfordernisse können aus den an Fachdienste gerichteten Erwartungen abgeleitet werden, können Eigenschaften der erbrachten Dienstleistungen definieren, die Ausgestaltung des Prozesses der Leistungserbringung beschreiben und Maßgaben für die Effizienz der Fachdienstarbeit beinhalten." (Bungart, Supe & Willems 2000, S.178)
Die Bestimmung der Qualitätskriterien erfolgte in dieser Untersuchung nicht durch eine theoretische Ableitung aus Konzepten, sondern ähnlich wie beim QUIP Projekt, im Sinne eines "kundenbezogenen" Qualitätsansatzes im Rahmen von ExpertInneninterviews mit unterschiedlichen Prozessbeteiligten. Die leitfadengestützten Interviews wurden mit Hilfe inhaltsanalytischer Verfahren ausgewertet, wobei die einzelnen Aussagen bestimmten Kategorien zugeordnet wurden. Dabei war bemerkenswert, dass fast alle Befragten ausschließlich Kriterien für die Prozessqualität nannten. Kriterien für die Strukturqualität wurden zumeist nur auf explizite Nachfrage nach den notwendigen Rahmenbedingungen für Fachdienste genannt. Das Ergebnis des Erhebungsprozesses war ein Kriterienkatalog mit 93 Aussagen zur Arbeit von Integrationsfachdiensten. Die Gliederung dieser Kriterien orientiert sich an folgendem Muster:
-
"Grundlegende Prinzipien für die Arbeit mit Nutzern und Betrieben
-
Außenbeziehungen
-
Klärung der Aufnahme und der Ausgangssituation
-
Strategien der Arbeitsplatzsuche
-
Merkmale von Betrieben und Arbeitsplätzen
-
Vorbereitung der Arbeitsaufnahme und betriebliche Qualifizierung
-
Soziale Eingliederung
-
Nachgehende Begleitung und Krisenintervention." (Bungart, Supe & Willems 2000, S.187)
Bei dieser Aufzählung wird deutlich, dass sich die ersten beiden Kriterien auf alle Bereiche der Fachdienstarbeit beziehen, währen die anderen Kriterien spezifischen Phasen im Verlauf des Prozesses gewidmet sind. Die erarbeiteten Kriterien wurden schließlich schriftlich an eine noch größere Gruppe von ExpertInnen versandt, um zu einer Gewichtung der einzelnen Kriterien zu kommen sowie etwaige Unterschiede in der Bewertung durch einzelne Gruppen festzustellen. Bei dieser schriftlichen Befragung konnte festgestellt werden, dass es bei einem Großteil der Kriterien zu einer weitgehenden Übereinstimmung zwischen den Befragten kommt. Es wurden jedoch auch einige deutliche (wenn auch nicht immer signifikante) Unterschiede in der Bewertung der Kriterien sichtbar:
-
NutzerInnen betonen vor allem die Aspekte der Mitbestimmung oder Transparenz und fordern einen niedrigschwelligen Zugang. Sie betonen die Gefahr von Stigmatisierungen und wünschen sich von den Fachdiensten eine Vertretung in eigener Sache.
-
Betriebe erwarten in erster Linie zuverlässige Informationen über mögliche Risiken und Anforderungen einer Beschäftigung, eindeutige Vereinbarungen, eine Vermeidung von Störungen des betrieblichen Ablaufs sowie eine Gewährleistung der notwendigen Unterstützung durch die Fachdienste.
-
Für Träger sind die Frage der Auswahl von NutzerInnen mit hohen Vermittlungschancen sowie der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit besonders wichtig.
-
FachdienstmitarbeiterInnen verstehen sich im Gegensatz dazu als Anwalt der NutzerInnen und betonen den professionellen Umgang mit Betrieben und das Einbeziehen des sozialen Umfelds. (Vgl. Bungart, Supe & Willems 2000, S.208f)
Unterschiede zeigten sich auch bezogen auf die begleiteten Zielgruppen, demnach benötigen vor allem so genannte geistig behinderte Menschen eine intensivere Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz sowie beim anschließenden "Training on the job". Abschließend stellen die Autoren fest, dass
"für eine qualifizierte und erfolgreiche Integrationsarbeit es von grundlegender Bedeutung sein wird, dass die Fachdienstmitarbeiter unterschiedliche Erwartungen und Interessen der Beteiligten rechtzeitig erkennen und ausbalancieren, so dass Konflikte möglichst verhindert werden und den Integrationsprozess nicht gefährden." (Bungart, Supe & Willems 2000, S.209)
Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch auf den Artikel von Stefan Doose (2004): "Qualität auf lange Sicht - Zur Nachhaltigkeit der von Integrationsfachdiensten vermittelten Arbeitsverhältnisse" eingehen, der basierend auf Befragungen von IntegrationsberaterInnen im Rahmen eines Workshops anlässlich der BAG-UB Jahrestagung 2003, erste Thesen zur Nachhaltigkeit von unterstützten Arbeitsverhältnissen aufwirft.
Wie ich in meinen Ausführungen bereits dargelegt habe, existieren derzeit weder in Österreich noch in Deutschland Untersuchungen, die über die langfristige Wirksamkeit von Arbeitsassistenz oder Integrationsfachdiensten Aufschluss geben. Diese Tatsache wird im Rahmen zahlreicher Studien und Untersuchungen beanstandet (vgl. u.a. Barlsen 2001; Kastl & Trost 2002; Horak & Schmid 2003; SORA, KMU & ABIF 2004). Doose (2004) der aktuell im Rahmen seiner Dissertation an einer Verbleibs- und Verlaufsstudie arbeitet, fasst den Erkenntniszusammenhang, den solche Untersuchungen bedeuten würden, wie folgt zusammen:
"Es bleibt festzuhalten, dass es in den wenigsten Integrationsfachdiensten intern gesicherte und im Sinne einer Qualitätssicherung systematische Erkenntnisse gibt, was aus den vermittelten Personen geworden ist. Dabei wären Erkenntnisse über langfristige Effekte von Eingliederungsbemühungen sowohl im Hinblick auf die Wirksamkeit der Maßnahmen als auch für die Weiterentwicklung der Dienstleistung von Integrationsfachdiensten und von nachhaltigen und langfristigen Förderinstrumenten der beruflichen Integration von entscheidender Bedeutung." (Doose 2004, S.3f)
Im Rahmen des angesprochenen Workshops wurde Fachkräften die Frage gestellt: "Welche Faktoren die Nachhaltigkeit der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung positiv beeinflussen?". Doose (vgl. 2004, S.4) unterteilt die Antworten in
-
unterstützungssystembedingte,
-
betriebsbedingte und
-
arbeitnehmerbedingte
Faktoren auf.
Zu den Unterstützungssystembedingten Faktoren zählen demnach:
-
eine passgenaue Vermittlung als Grundstein für ein langfristig erfolgreiches Arbeitsverhältnis. Schnelle Vermittlungen, die wenig Rücksicht darauf nehmen, ob die Interessen und Fähigkeiten des/der ArbeitnehmerInnen mit den Anforderungen des Arbeitsplatzes weitgehend übereinstimmen, gelten zwar als erfolgreiche Vermittlung im Sinne der Statistik, sind aber längerfristig gefährdet und problematisch.
-
Der Fachdienst benötigt gerade in der Anfangsphase ein gutes und verlässliches Instrumentarium von gesetzlichen Förderleistungen wie Lohnkostenzuschüssen, Arbeitsplatzausstattung oder Job-Coaching, die einzelfallbezogen und unbürokratisch zugänglich sein sollten. Insbesondere im Kontext der Lohnkostensubventionen wäre ein für den/die ArbeitgeberIn kalkulierbarer und realer Ausgleich für den Zeitraum der Leistungsminderung erforderlich, auch für jenen Personenkreis, bei dem eine dauerhafte finanzielle und personelle Unterstützung unerlässlich ist.
-
Eine gute langfristige Begleitung durch den Fachdienst, der über die Vermittlung hinaus als zuverlässige(r) AnsprechpartnerIn und aktive(r) BegleiterIn fungiert.
-
Als für die Nachhaltigkeit von Vermittlungen zentraler Faktor wird die Bedeutung des regelmäßigen Kontakts mit den Betrieben hervorgehoben. Dabei sollten die Fachkräfte auch offene und kritische Bereiche ansprechen. Der regelmäßige und positive Kontakt ermöglicht es nicht nur bei möglichen Problemen frühzeitig vermitteln zu können, sondern hilft auch im Laufe der Zeit zusätzliche Arbeitsplätze zu erschließen.
-
Auf der Basis eines regelmäßigen Kontaktes und eines aufgebauten Vertrauensverhältnisses können im Falle auftretender Probleme durch rechtzeitige Krisenintervention Arbeitsverhältnisse oft nachhaltig stabilisiert werden. (Vgl. Doose 2004, S.4)
Zu den betriebsbedingten Faktoren gehören:
-
Eine günstige wirtschaftliche Lage und gesunde wirtschaftliche Struktur des Betriebes als wesentliche Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit von Arbeitsplätzen.
-
Ein gutes Betriebsklima ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die Integration im Betrieb und die Nachhaltigkeit von Vermittlungen.
-
Ein(e) unterstützende(r) feste(r) AnsprechpartnerIn im Betrieb im Sinne eines/einer MentorIn ist nach Einschätzung der Fachkräfte ebenfalls ein positiver Faktor, wobei im Laufe der Zeit bewusst mehrere Personen im Betrieb miteinbezogen werden sollten. (Vgl. Doose 2004, S.4f)
Schlussendlich zählen zu den arbeitnehmerbedingten Faktoren:
-
die Motivation des/der ArbeitnehmerIn, welche umso dauerhafter sein wird, wenn bei der Arbeitsvermittlung die Beweggründe zu arbeiten und die Interessen der Personen ausreichend berücksichtigt werden sowie kein Druck bzw. Zwang zur Arbeit besteht.
-
Schlüsselqualifikationen, soziale Kompetenz und persönliche Stabilität, sind weitere Faktoren für die Stabilität von Arbeitsverhältnissen. Dabei sind Schlüsselqualifikationen nicht als feste Charaktereigenschaften von Personen zu verstehen, sondern diese können durch gezieltes Coaching unterstützt werden. Die persönliche Stabilität der ArbeitnehmerInnen kann ebenfalls durch Anregungen über eine sinnvolle Freizeit- und Lebensgestaltung, sowie der Vermittlung von Hilfen bei persönlichen Krisen positiv beeinflusst werden.
-
Schließlich sollte die Qualifikation und Arbeitsleistung der ArbeitnehmerIn im Rahmen der betrieblichen Bandbreite liegen. Dabei ist weniger von einer 100%igen Leistungsfähigkeit auszugehen, sondern die Bedeutung der oben angeführten Passung wird noch stärker betont.(Vgl. Doose 2004, S.5)
Betrachtet man jene Faktoren, die nach Ansicht der Fachkräfte die Nachhaltigkeit von Vermittlungen negativ beeinflussen, so findet sich vielfach eine Umkehrung der positiven Faktoren. Auch wenn der einzelne Fachdienst nicht alle angeführten Faktoren, welche natürlich alle zusammenspielen, selbst beeinflussen kann, so hat der Fachdienst nach Doose (2004, S.5) doch:
"... bei vielen Faktoren einen Ansatzpunkt durch die Art seines Dienstleistungsangebotes die Nachhaltigkeit von Arbeitsverhältnissen zu unterstützen. Dafür müssen aber auch die entsprechenden Fördermöglichkeiten gegeben sein."
Ich bin in diesem Kapitel zunächst auf die Problematik der Erfolgsbestimmung und der einseitigen Orientierung auf quantitative Erfolgsgrößen eingegangen, und habe anschließend einige grundlegende Aspekte und Methoden zur Evaluation von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen dargestellt. Bezogen auf den Vergleich der wichtigsten Forschungsergebnisse in diesem Bereich, zeigt sich vor allem für Österreich die Notwendigkeit, erneut eine bundesweite Untersuchung über die Arbeitsassistenz durchzuführen, da aktuelle Studien zumeist nur einige regionale Aspekte darlegen, und die Ergebnisse der bislang einzigen österreichweiten Untersuchung als überholt anzusehen sind. In beiden Ländern fehlen bislang Untersuchungen, die über die langfristige Wirksamkeit dieser Maßnahmen hinreichend Auskunft geben können, wobei dieses Forschungsdefizit in Deutschland gerade durch zwei derartige Studien ausgeglichen werden soll. Im Anschluss habe ich drei Forschungsarbeiten vorgestellt, die bezogen auf die Arbeitsassistenz und die Integrationsfachdienste konkrete Qualitätskriterien erarbeitet haben, die ein umfassendes Bild über die Qualität dieser Dienstleistung geben. Abschließend habe ich basierend auf ersten Ergebnissen der Verlaufs- und Verbleibsanalyse von Stefan Doose (2004), erste Thesen zur Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration wiedergegeben. Im folgenden Kapitel werde ich nun auf wesentliche Aspekte der Qualitätsforschung und Diskussion in Behindertenhilfe und Sozialen Arbeit als Makroebene der beruflichen Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderung eingehen.
[24] Im Anhang findet sich in der zusätzlichen Bibliographie ein Großteil der relevanten Studien aus Österreich und Deutschland.
[25] Als "Creaming The Poor" Effekt wird die Wirkung einer Maßnahme für benachteiligte soziale Gruppen beschrieben, wenn damit verbunden ist, dass dadurch nur Personen erfasst werden, die wiederum innerhalb dieser Gruppe "besser" gestellt sind als andere.
[26] Ich erinnere in diesem Zusammenhang u.a. an die Problematik der uneinheitlichen Darstellung der Behindertenbeschäftigung und Behindertenarbeitslosigkeit von Seiten des BMSG und der Bundessozialämter sowie des AMS, wie ich es in Kapitel 2 bereits dargestellt habe.
[27] Eine gesamte Darstellung des QUIP Qualitätskriterien ist der Homepage des QUIP Projektes im Internet unter URL: http://www.quip.at zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1. Ursprung und Begründungszusammenhänge der aktuellen Qualitäts-diskussion in der Behindertenhilfe
- 5.2. Der Qualitätsbegriff - unterschiedliche Sichtweisen
- 5.3 Pädagogische Dimensionen von Qualität - normative Grundlagen und Leitbildprinzipien
- 5.4. Zur Rolle der relevanten Anspruchsgruppen: NutzerInnen, Kostenträger und Leistungsanbieter
- 5.5. Qualitätssicherung und Erfolgsmessung in der Behindertenhilfe - Begründung und Methoden
- 5.6. Anforderungen an ein QM - System in sozialen Handlungsfeldern
- 5.7. Zusammenfassung
Es ist in den letzten Jahren in fast allen sozialen Handlungsfeldern eine verstärkte Auseinandersetzung mit Fragen der Qualität und der Qualitätssicherung zu beobachten. Auch die wachsende Anzahl entsprechender Publikationen zu dieser Thematik in den letzten Jahren weist auf einen Bedeutungszuwachs hin (vgl. u.a. Heiner 1996; Meinhold 1998; Brunner / Bauer / Volkmar 1998; Jantzen / Lanwer-Koppelin 1999, Speck 1999a & 1999b; Kolbe 2000; Schubert / Zink 2001; Feyerer / Prammer 2004; Heiner 2004 etc.). Aspekte der Qualität sind aber deswegen nicht unbedingt als neu zu bezeichnen. Die Frage nach Standards begleitet vielmehr die Entwicklung der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit von Anfang an (vgl. Metzler / Wacker 2001, S.50), nur steht die aktuelle Qualitätsdebatte diesmal unter anderen Vorzeichen. Bevor ich mich deshalb konkret mit dem Bereich der beruflichen Integration befassen werde, halte ich es für notwendig, zuerst die Entwicklung in den Bereichen der Behindertenhilfe und der sozialen Arbeit nachzuzeichnen, sowie auf Aspekte der übergreifenden Qualitätsdiskussion im Sinne einer Makroebene genauer einzugehen.
Einleitend ist festzustellen, dass die Ursprünge und die daraus resultierenden Begründungszusammenhänge des aktuellen "Qualitätsbooms" nicht verkürzt auf einen Nenner gebracht werden können, sondern im Zusammenwirken verschiedener "mehrdimensionaler" ökonomischer und sozialer Faktoren zu sehen sind, auf welche ich im Folgenden genauer eingehen werde (vgl. Engel / Flösser / Gensink 1996, S.48ff; Volkmar 1998, S.55ff; Speck 1999a, S.13ff; Speck 1999b, S.17ff; Zink 2001, S.80ff).
Als Hauptgrund werden von den meisten Autoren im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Diskussion um die "Krise des Sozialstaates" ökonomische Sparzwänge sowie daraus resultierend gesetzliche Reformen angesehen. Angesichts knapper werdender öffentlicher Finanzmittel stehen soziale LeistungsanbieterInnen vor einem nicht unerheblichen Legitimationsdruck. Dazu schreiben etwa Schwarte & Oberste-Ufer (2001, S.62f):
"Die Verschränkung von Kostensenkungs- und Qualitätsaspekten wird mittlerweile kaum noch problematisiert. Es scheint ausgemacht, dass man die Behindertenhilfe billiger und gleichzeitig besser machen kann."
Gerade diese aktuelle Entwicklung hat zu sehr viel Verunsicherung in Institutionen der Behindertenhilfe geführt. Es geht die Befürchtung um, dass das, was unter Qualität verkauft wird, letztendlich zu einem Abbau von Qualität führen könnte. Speck attestiert, dass diese Befürchtungen nicht unbegründet seien und verortet tief greifende gesellschaftliche Veränderungsprozesse sowie eine veränderte Wertepriorisierung, die ökonomische Werte wie Wettbewerb oder Effizienz in den Vordergrund treten lassen (vgl. Speck 1999a, S.13). Speck (1999a) führt dieses ökonomisch favorisierte Qualitätsdenken geschichtlich auf den angloamerikanischen Bereich zurück, wo soziale Dienste generell auf der Basis des Nachweises ihrer Effektivität finanziert, und ständige "Erfolgsnachweise" vorgelegt werden müssen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Mittel zweckgebunden und zielgerecht verwendet werden. Speck sieht die Tradition dieses Denkansatzes stark mit den in diesen Ländern vorherrschenden Wirtschaftssystemen verbunden, in denen die Wirtschaft in einer dominierenden Funktion zum Staat steht (vgl. Speck 1999a, S.27ff).
Auch auf Gesetzesebene hat der Terminus Qualitätssicherung Einzug genommen, wobei diese Entwicklungen in Österreich etwas zeitverzögert aufgetreten sind bzw. derzeit kurz vor ihrer Implementierung stehen. Eine zentrale Veränderung der Gesetzes-Novellen ist die Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips und die Einführung einer "leistungsgerechten Vergütung" für Erbringer sozialer Dienstleistungen (vgl. Lachwitz 1999, S.49f). Die LeistungserbringerInnen verpflichten sich in Verträgen mit den FördergeberInnen:
-
"Vereinbarungen über Inhalt, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistungen zu treffen, sowie
-
Vereinbarungen zum prospektiven Entgelt und
-
Vereinbarungen über die Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit auszuhandeln" (Frühauf 200, S.12.).
Die sozialen DienstleistungserbringerInnen sind also von Seiten der Politik dazu aufgefordert, bei finanziell engeren Rahmenbedingungen die Qualität der Leistungen nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern noch zu verbessern (vgl. Lanwer-Koppelin 1999, S.151). Beck (1999) meint dazu, dass die einseitige Orientierung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Einführung von Prinzipien des freien Marktes auch in wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen den inhaltlichen Interessen eher konträr zu sein scheinen und von erheblichem Einfluss auf die Qualitätsentwicklung sind (vgl. Beck 1999, S. 42). Damit gehen auch veränderte Formen des Selbstverständnisses von öffentlicher Verwaltung sowie gesetzliche festgelegte Formen der (Ressourcen-)Steuerung von sozialen Dienstleistungen einher, welche für die qualitätsbewusste Verwendung der öffentlichen Gelder sorgen sollen (vgl. Frühauf 2001, S.13; Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.66; Zink, 2001, S.90ff). Konzepte und Schlagworte wie "Lean Bureaucracy", "Contracting Out" oder "New Public Management" charakterisieren diesen Veränderungsprozess auf Seiten der FördergeberInnen (vgl. Zutter-Baumer 2003).
In dieser durch Finanzierungskrisen und gesetzlichen Veränderungen ausgelösten Verschärfung des Wettbewerbs ist in den letzten Jahren ein konkurrierender sozialer Dienstleistungsmarkt entstanden. AnbieterInnen sozialer Dienstleistungen stehen somit vor dem Zugzwang ihre Leistungen unter den verschärften (Markt-)Bedingungen als öffentlich legitimierbare, förderungswürdige Angebote unter Beweis zu stellen. Der Qualität der Leistungen sowie der Qualitätssicherung kommt in diesem Zusammenhang auch auf strategischer Ebene eine Bedeutung zu, impliziert es doch die Möglichkeit, sich in einer relativ ähnlichen Angebotspalette durch entsprechend gute Leistungsqualität von anderen AnbieterInnen abzugrenzen und sich dementsprechend zu positionieren. Aber auch inhaltliche Interessen spielen in diesem Kontext für Einrichtungen eine zentrale Rolle. Im Rahmen kontinuierlicher Qualitäts- und Organisationsentwicklung kann erkannt werden, welche Veränderungen der eigenen Arbeit im Vergleich zu vorgegebenen Qualitätsstandards notwendig und sinnvoll erscheinen. Durch diese Definition von einheitlichen Standards für die Qualität der Arbeit wird auch der gerade von Fachkräften geäußerten Forderung nach Professionalisierung entsprochen (vgl. Engel / Flösser / Gensink 1996, S.48ff; Volkmar 1998, S.55ff; Frühauf 2001, S.14; Schwarte / Oberste - Ufer 2001, S.66; Zink 2001, S.90ff).
Schlussendlich sollte jede Qualitätsdebatte sowie die damit verbundenen Entwicklungs-prozesse stets im Sinne der NutzerInnen geführt werden bzw. von ihnen ausgehen. Die Frage nach Qualität lässt sich allgemein fassen als die Frage danach, welche Entwicklungs- und Lebensmöglichkeiten Menschen mit Behinderung zugestanden oder von ihnen reklamiert werden können sowie welche spezifischen Leistungen dafür zur Verfügung stehen müssen. Die Antworten auf diese Frage sind zu unterschiedlichen Zeiten stets anders ausgefallen, so schreiben Metzler und Wacker (2001, S.50):
"Verändert haben sich im Laufe der Zeit ebenso das Verständnis von Behinderung wie die Konzeptionen der Pädagogik und Pflege, die sozialpolitischen Grundlagen und die Rechtspositionen behinderter Menschen. Anstoß dieser Entwicklungen war jeweils die Erkenntnis, dass die Qualität von Hilfen nicht ausreichend sei, dass diese Qualität im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext mit all seinen Teilbereichen neu definiert werden müsse. Diese Bindung der Qualitätsfrage an gesellschaftliche Entwicklungen bedeutet zugleich, dass Hilfen und Dienstleistungen für behinderte Menschen einem immer weiter fortschreitenden Prozess unterliegen, dass die Frage nach Bedürfnissen und adäquaten Hilfen stets aufs Neue beantwortet werden muss."(Metzler / Wacker 2001: S.50)
Die Qualität der Dienstleistungen und Hilfsangebote ist also sowohl im Sinne eines "VerbraucherInnenschutzes" als auch im Kontext der jeweils geltenden sozial- und gesellschaftspolitischen und pädagogischen Tendenzen und Strömungen zu sehen. Von besonderer Relevanz sind dabei programmatische Leitlinien in der Behindertenhilfe, wie die Selbstbestimmung und Empowerment, die gesellschaftliche Integration oder die Normalisierung von Lebensbedingungen, denen allen die Stärkung der Position der Betroffenen gemein ist, welche als übergeordnete Ziele jeglicher Qualitätsverbesserungen zu sehen sind. Das Zusammenwirken all dieser Aspekte in ihrem Einfluss auf die Qualität der Dienstleistungen soll abschließend anhand einer Abbildung veranschaulicht werden:
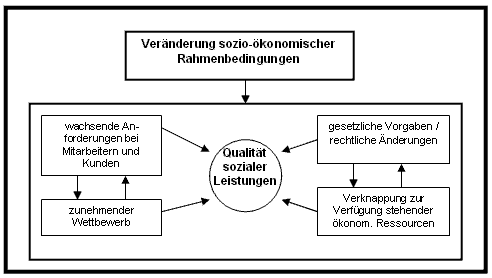
Abbildung 1: Zusammenwirken veränderter Rahmenbedingungen für die Qualität sozialer Leistungen (Volkmar 1998, S.57)
Der Begriff Qualität beinhaltet in unserem Sprachgebrauch zunächst ganz neutral die Beschaffenheit, die Güte oder den Wert eines Gegenstandes oder einer Leistung. Es wird demzufolge von guter oder schlechter Qualität gesprochen, je nachdem ob z.B. ein Gegenstand den festgelegten Kriterien entspricht oder nicht (vgl. Metzler / Wacker 2001: S.51). Grundlage für solch ein Verständnis ist die internationale Definition nach DIN EN ISO 9000:2000, die den Qualitätsbegriff wie folgt definiert:
"Vermögen einer Gesamtheit inhärenter Merkmale eines Produktes, Systems oder Prozesses, zur Erfüllung von Forderungen von Kunden und anderen interessierten Parteien." bzw. "Qualität ist die Gesamtheit der Eigenschaften und Merkmale einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter Erfordernisse bezieht." (vgl. Kaminske / Brauer 2003, S.167; Metzler / Wacker, 2001, S.51).
Wesentlich ist demnach der Bezug zwischen den Eigenschaften einer Dienstleistung und den Erwartungen (Zielen, Maßstäben), die an diese Leistung gestellt werden. Qualität ist also keine Eigenschaft, die einem Produkt oder einer Dienstleistung einfach so zukommt, sondern sie ist stets als Ausdruck der Relation zwischen realisiertem Ist- und gefordertem Soll Stand zu verstehen und zu bewerten. Voraussetzung für eine Bewertung von Qualität ist also eine möglichst exakte Definition von anzustrebenden Zielkategorien in Form von Leitlinien oder Qualitätsstandards (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001: S.64).
Bei der Anwendung obiger Definitionen ergeben sich außerdem einige wesentliche Fragen:
-
Was ist unter der Gesamtheit von Merkmalen zu verstehen? Welches sind die sind die relevanten Qualitätsdimensionen einer Leistung, welches sind die Erfordernisse?
-
Wer legt Erfordernisse fest, wer setzt etwas voraus?
-
Wie ist die Eignung zu beurteilen? Wie kann Qualität gemessen werden? (vgl. Matul / Scharitzer 2002, S.610)
Diese eben genannten Fragen beziehen sich unmittelbar auf die konkreten Probleme vor denen sich jede Form eines Qualitätsdiskurses steht. Die "Was bzw. Welche Fragen" benennen die Problematik der inhaltlichen Ausgestaltung des Qualitätsbegriffes sowie der normativen Bezugsgrößen. Die "Wer Fragen" setzen sich mit den Beteiligten Anspruchsgruppen und der Gewichtung ihrer Stimmen auseinander. Schlussendlich machen die "Wie Fragen" auf die Problematik der Operationalisierung von konkreten Qualitätsindikatoren bzw. auf deren Messung aufmerksam. Ich möchte versuchen, meine inhaltlichen Ausführungen der Beantwortung jener Fragen zu widmen.
Qualität kann je nach Konkretisierungsgrad und (wissenschaftlichem) Bezugspunkt unterschiedlich weit gefasst werden. Eine Orientierung, welche Perspektiven bei der Definition und Beurteilung von Qualität eingenommen werden können, bietet die Unterscheidung nach Garvin (1984 zit. nach Volkmar 1998: S.58ff; Schubert / Zink 2001: S.2f & Kaminske / Brauer 2003, S.169f) in transzendente-, produktbezogene, kunden-, herstellungs- und wertorientierte Ansätze, welche auch schon die Problematik der Qualitätsbestimmung in sozialen Dienstleistungen verdeutlichen.
-
Die transzendente Sichtweise fasst Qualität als absolut und universell erkennbar auf. Sie ist ein Zeichen von kompromisslos hohen Ansprüchen, ist nicht präzise zu definieren und wird nur durch Erfahrung festgestellt.
-
Die produktbezogene Sichtweise setzt bei einzelnen objektiven präzise messbaren Eigenschaften von Produkten oder Dienstleistungen an. Die Qualität eines Produktes ergibt sich aus der Übereinstimmung der Ausprägungen einzelner Teileigenschaften mit spezifischen Vorgaben. Eine Übertragung auf den sozialen Bereich ist bei diesem Ansatz insofern schwer, als soziale Dienstleistungen meist immateriellen Charakter haben und nicht in einzelne Komponenten zergliedert und präzise gemessen werden können (vgl. Volkmar 1998, S.59; Schubert / Zink 2001, S.2).
-
Der kundenorientierte Ansatz setzt Qualität mit der Erfüllung von Kundenanforderungen gleich. Die Anforderungen ergeben sich aus den Bedürfnissen oder Erwartungen der VerbraucherInnen bzw. NutzerInnen, Qualität kann also mit Bedürfnisbefriedigung gleichgesetzt werden. Die Grenzen der Übertragung dieses Ansatzes sind dann gegeben, wenn die LeistungsabnehmerInnen ihre Bedürfnisse oder Erwartungen nicht in adäquater Weise artikulieren können (vgl. Volkmar 1998, S.59; Schubert / Zink 2001, S.2f).
-
Bei der herstellungsorientierten Sichtweise steht die Fehlervermeidung bei der Erstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch die Erfüllung von detaillierten Anforderungen und Spezifikationen im Vordergrund. Die Gefahr dieses Ansatzes im Kontext sozialer Dienstleitungen besteht darin, dass ausschließlich die Leistungsanbieter die Qualität definieren und die Bedürfnisse der Abnehmer unberücksichtigt bleiben (vgl. Volkmar 1998, S.59; Schubert / Zink 2001, S.3).
-
Beim wertorientierten Ansatz wird die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung in Relation zu dem dafür gezahlten Preis gesetzt. Kosten und Preise werden bei diesem Ansatz zu den zentralen Bestimmungsgrößen für Qualität. Gerade im Kontext der vorher beschriebenen gegenwärtigen Entwicklungen zu mehr Wirtschaftlichkeit, birgt dieser Ansatz die Gefahr den humanen Aspekt sozialer Dienstleistungen zu Gunsten betriebswirtschaftlicher Sichtweisen zu vernachlässigen (vgl. Hodl 1998, S.96f; Volkmar 1998, S.59; Schubert / Zink 2001, S.3; Kaminske / Brauer 2003, S.169f).
In der Qualitätsdebatte wird in der Regel auch auf eine weitere und umso wichtigere methodische Differenzierung des Qualitätsbegriffes eingegangen, und zwar jene nach Donabedian (1982 zit. nach u.a. Heiner 1996, S.29; Metzler / Wacker 2001, S.58f; Horak / Schmid 2003, S.39; etc.) in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.
-
Strukturqualitätbezieht sich auf objektive Rahmenbedingungen, unter denen Dienstleistungen erbracht werden (wie z.B. Art und Umfang der materiellen Ausstattung, finanzielle Ressourcen, Art und Anzahl des Personals, Motivation Qualifikation von MitarbeiterInnen, etc.).
-
Prozessqualität umfasst allgemein gesprochen die Gesamtheit aller Aktivitäten, die zwischen den Leistungserbringern, z.B. den pädagogisch Tätigen und den Leistungsempfängern, d.h. den Menschen mit Behinderung, stattfinden. Eine Erhebung der Prozessqualität setzt die Definition professionell anerkannter Standards voraus.
-
Ergebnisqualität schließlich stützt sich auf beobachtbare Veränderungen beim Hilfeempfänger im Sinne von messbaren Indikatoren, d.h. je nach Zielformulierung z.B. eine Besserung des Gesundheitszustandes, der Zuwachs an Kompetenzen, oder im Kontext dieser Ausführungen insbesondere eine Eingliederung in Arbeit etc. (vgl. Heiner 1996, S.29; Metzler / Wacker 2001, S.58f; Horak / Schmid 2003, S.39).
Bereits mehrmals wurde nun schon die Bedeutung von Standards als Voraussetzung zur Bestimmung qualitativer Erfolge und zur Vergleichbarkeit sozialer Dienstleistungen genannt. Nach Hummel (1997; S.40, zit. nach Feuser 2002: S.9) sind Qualitätsstandards:
-
"allgemeingültige Normen, die die Organisation selbst fachlich und inhaltlich definiert, sie machen
-
allgemeine Aussagen über die Qualität, die Quantität und das Niveau aller Leistungen der Organisation, sie halten
-
die Organisation auf einem qualitativ hochwertigen Niveau, sie sind
-
die konkrete Ausfüllung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, sie sorgen
-
für interne und externen Transparenz und sind
-
wichtige Informations- und Planungsinstrumente." (Feuser 2002: S.9).
Der Formulierung von konsensfähigen Qualitätsstandards, sowohl einrichtungsintern als auch -übergreifend, kommt somit eine zentrale Bedeutung in der inhaltlichen Ausgestaltung des fachlichen Qualitätsverständnisses zu. So formulieren Schwarte und Oberste-Ufer (2001, S.64):
"Nur dann, wenn definierte Standards über Minimalkriterien hinausgehen und sowohl die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen als auch die Erfahrungen professioneller Arbeit (inklusive der NutzerInneninteressen) berücksichtigen und regelmäßig zur Diskussion stehen. sind sie als Leitlinien guter Praxis richtungs- und handlungsanweisend."
Im Endeffekt rekurrieren alle sozialen und pädagogischen Handlungs- und Arbeitsfelder, neben einem auf konkrete und begrenzte Ergebnisziele bezogenen Qualitätsbegriff, auf ein umfassenderes Verständnis pädagogischer Qualität. Dieses Verständnis wird von einem ethisch-normativen Bezugspunkt maßgeblich durch das jeweilige Menschenbild, der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung[28] und dem Verständnis von angemessen und qualitätsvollen Hilfen bestimmt, welche letztlich auf eine Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen abzielen. Der Alltag von Menschen mit Behinderung ist in besonderem Maße durch die Aufgabe der dauerhaften Bewältigung von zumeist umfangreichen und dauerhaften Beeinträchtigungen gekennzeichnet. Ziel jeder Pädagogik, die sich mit der Verbesserung von Lebenslagen behinderter Menschen befasst, ist es nach Beck (1999, S.36):
"das Alltagsleben, aber auch besondere Belastungen [oder Benachteiligungen - Ergänzung der Verfasser O.K.] in einer subjektiv befriedigenden und objektiv die Bedürfnisse in einer ausreichend sichernden Weise zu bewältigen. Dann kann als Ergebnis psychisches und physisches Wohlbefinden, Zufriedenheit und ein objektiv guter Lebensstandard erreicht werden. Dies meint der Begriff Individuelle Lebensqualität,..."
Um folglich den Terminus "pädagogische Qualität" zu bestimmen, ist stets ein Rückbezug auf gesellschaftliche und normative Ziel- und Leitvorstellungen durchzuführen. Erziehung und Bildung sind zwei derartige pädagogische Legitimationsbegriffe, die allen pädagogischen Handlungen zugrunde liegen. Auch in der Behindertenhilfe ist, wie bereits erwähnt, eine Auseinandersetzung mit normativen und programmatischen Leitlinien zu verzeichnen, die bei der Bestimmung von qualitativ guter Arbeit stets berücksichtigt werden müssen. Schwarte und Oberste-Ufer (2001, S.72) nennen dabei u.a. die gesellschaftliche Integration, die Normalisierung von Lebensbedingungen, die Förderung des Ansehens und der Kompetenz und die Selbstbestimmung etc. als übergeordnete Ziele für die Arbeit in Institutionen der Behindertenhilfe. Außerdem und insbesondere der eben erwähnte Begriff der "Lebensqualität" ist für die Bestimmung pädagogischer Qualität von entscheidender Bedeutung. So schreibt Beck (1999, S.35):
"(...) ob bei entsprechenden Übertragungen die Effektivität sozialer Dienste darin gesehen wird, "Sinn" für das Alltagsleben und die Alltagsbewältigung behinderter Menschen zu "produzieren", wird davon abhängen, ob in der Praxis und in der Wissenschaft die Aufgabe erkannt wird, "Effektivität" für den Bereich pädagogisch - sozialer Dienstleistungen in Termini der Lebensqualität zu definieren (Hervorhebung durch den Verfasser O.K.), Kontrollverfahren im Sinne der Nutzer zu entwickeln und die Diskussion von Fragen der Zielorientierung und des Menschenbildes im gesamten System der Hilfen als "Alltagsgeschäft" zu verankern. (...)".
Dabei ist die Unterscheidung zwischen Lebensqualität und Versorgungsstandards, auf die Metzler und Wacker (2001, S.55f) hinweisen, von besonderer Bedeutung. Denn wenn die Behindertenhilfe darauf ausgerichtet ist, die Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung an allgemein anerkannte gesellschaftliche Standards anzugleichen, ohne dieser Personengruppe einen Sonderstatus oder Sonderraum innerhalb der Gesellschaft zuzuweisen, müssen die Lebensverhältnisse einem Vergleich standhalten. Die Versorgungsstandards stellen eine derartige empirische, anhand von Indikatoren überprüfbare, Gesamtperspektive dar, die einen entsprechenden Vergleich mit der Gesamtbevölkerung ermöglichen. Lebensqualität allerdings, erschließt sich lediglich aus der subjektiven Sichtweise von Menschen mit Behinderung. Der eigentliche Prüfstein für soziale Dienstleistungen ist daher die Frage, ob sie für Menschen mit Behinderung Ressourcen darstellen, mit deren Hilfe eigene Lebensstile entwickelt, individuelle Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnisse ausgebildet sowie selbständiges und selbstbestimmtes Handeln unterstützt werden können.
Außerdemverweisen Metzler und Wacker (2001, S.57) auf zwei allgemeine Grundsätze zur Qualitätsfrage sozialer Dienste, die einerseits dazu dienen sollen dem Konzept der Lebensqualität auch im Alltag der Behindertenhilfe Relevanz zu verleihen, und andererseits auch zur inhaltlichen Ausfüllung des Begriffes pädagogische Qualität Impulse zu setzen:
-
Die Qualitätsfrage personenbezogener sozialer Dienstleistungen setzt an der Definition des Hilfebedarfs an. Eine Feststellung funktioneller Defizite (z.B. nicht alleine essen zu können) liefert zwar notwendige aber keine hinreichenden Anhaltspunkte zur Bestimmung der individuellen Lebenssituation und des Hilfebedarfs eines Menschen mit Behinderung. Deshalb ist es auch zwingend notwendig über vorhandene und fehlende Kompetenzen hinaus, individuelle Lebensperspektiven, -ziele und -wünsche zu berücksichtigen.
-
Die Qualität der Hilfen bemisst sich daran, inwieweit diese individuelle Freiräume eröffnen und Entwicklungspotenziale unterstützen. Individuelle Unterstützung meint, dass Hilfebedarf eine Anleitung zur Selbständigkeit bedeutet, auch wenn der Zeitbedarf für diese Form der Hilfestellung bedeutend größer sein wird (vgl. Metzler / Wacker 2001, S.57f).
Eine Definition für "soziale" bzw. "pädagogische" Qualität liefert Speck (1999), indem er darin einen Wertekomplex sieht,
"der sich auf das Individuum als Person, mit unverlierbarer Menschenwürde, und zugleich auf seine Zugehörigkeit (Inklusion) zu anderen in einer ihm und dem Gemeinwohl förderlichen Weise bezieht. Eine spezifische Ausprägung und Funktion erhält soziale Qualität unter dem Aspekt drohender Ausgrenzungen (Exklusion) wie sie u.a. durch vorliegende funktionelle Beeinträchtigungen (Behinderungen) entstehen kann." (vgl. Speck 1999a: S.129)
Unter diesem genannten Aspekt bezieht sich soziale Qualität v.a. auf Institutionen des Sozialen, die notwendig sind um die Menschenwürde und Zugehörigkeit derer zu wahren, denen Ausgrenzung droht, und nicht auf wirtschaftliche Effizienz. Die (Weiter-)Entwicklung sozialer Qualität stellt in diesem Verständnis eine permanente Aufgabe dar, an der alle Beteiligten in einem gemeinsamen reflexiven und evaluativen Kommunikations- und Gestaltungsprozess mitwirken.
Die Qualität der einzelnen Dienstleistungen wird nach Lanwer-Koppelin (1999, S.157) maßgeblich durch das Leitbild bzw. die Leitidee der Einrichtungen bestimmt. Dieses Leitbild beinhaltet
"die Auseinandersetzung des Trägers mit seinen Ziel- und Wertvorstellungen, d.h. die behindertenpädagogische Tätigkeit gestaltet sich aus den von Trägern formulierten Leitbildern, Zielvorstellungen und Wertsetzungen. Das bedeutet, dass die vorgegebenen Leitbilder sowie Zielsetzungen des Trägers als Grundlage zu verstehen sind, die den Bezugsrahmen für die Entwicklung, Gestaltung und Realisierung der behindertenpädagogischen Assistenz darstellen. Sie sind vor dem Hintergrund der Sicherstellung der Bedürfnisse der behinderten Menschen, o.ä. damit ausschlaggebend für die Bestimmung der fachlichen Anforderungen an eine qualifizierte, unterstützende behindertenpädagogische Assistenz."
Die Existenz und Bedeutung dieser Leitbilder ist mittlerweile in so gut wie allen Einrichtungen unumstritten und wird von einer breiten Öffentlichkeit anerkannt. Diese Leitlinien verfolgen die Absicht, so Schwarte und Oberste-Ufer (vgl. 2001, S.72) einer konsequenten Individualisierung der Hilfen, welche den einzelnen Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen ins Zentrum der Konzeption, Organisation und Durchführung von institutionell angebundenen Angeboten und Dienstleistungen stellt. Selbige Autoren verweisen allerdings auf die Tatsache, dass diese Leitbilder in den meisten Diensten sehr allgemein gehalten werden, wodurch sie fast beliebig mit eigenen Vorstellungen und Schwerpunktsetzungen gefüllt werden können. Dies führen sie auf die unterschiedlichen Entwicklungsstände in den einzelnen Einrichtungen der sozialen Rehabilitation bei grundsätzlich ähnlichen Rahmenbedingungen zurück. Es ist nach wie vor unklar, ob und in welcher Weise die Leitbilder in der Praxis zur Umsetzung gelangen bzw. nach welchen Maßstäben oder Beurteilungskriterien dies bewertet werden könne. Schwarte und Oberste-Ufer (2001, S.72) betonen in diesem Zusammenhang:
"Die fehlende Operationalisierung von Standards und - unter anderem daraus folgend - ihre mangelnde Überprüfbarkeit lässt sich somit als ein Zentralproblem der gegenwärtigen Qualitätsdiskussion in der Behindertenhilfe ausmachen."
Auch Wolfgang Mizelli (2004, S.23), Mitbegründer der Selbstbestimmt Leben Initiative Österreich, verortet eine grundlegende Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit sozialer Dienstleistungen. So schreibt er,
"Selbstbestimmung, Assistenz, Empowerment und ExpertInnenschaft in eigener Sache sind als Schlagworte in der Arbeit mit behinderten Frauen und Männern derzeit modern. Sie werden in Leitbildern gerne als Qualitätsparameter der Arbeit verwendet. Allerdings werden die Begriffe selten mit dem Inhalt übernommen, der ursprünglich gemeint war."
Von sozialen Dienstleistungen sprechen wir, wenn es sich um personenbezogene Dienstleistungen handelt, die im weitesten Sinne helfendes Handeln darstellen. Gemessen an der Anzahl der Beschäftigten stellt dieser Dienstleistungssektor bereits den viert größten Arbeitsmarkt für alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten dar (vgl. Braun 1999, S.134ff). Institutionen, die soziale Dienstleistungen für existentiell betroffene Menschen erbringen, erfüllen nach Fink (2001, S.34) schon alleine deshalb eine (gesellschafts-) politische Funktion,
"weil sie nur solange erforderlich sind, wie es einen bestimmten gesellschaftlich akzeptierten Bedarf gibt, weil Gesetze und Verordnungen Anspruchs-Berechtigte und einen großen Teil des gesamten Systems festlegen, innerhalb dessen der Bedarf und die Leistungen definiert und praktisch umgesetzt werden, und weil die Kosten der Dienstleitung in der Regel nicht der Empfänger übernimmt." (Fink 2001, S.34).
Klicpera und Klicpera-Gasteiger (1995: S.35) weisen auf drei grundlegende Unterschiede zwischen sozialen Diensten und anderen Dienstleitungsbetrieben hin:
-
Soziale Dienste haben einen Versorgungsauftrag. Das bedeutet, dass es nicht alleinige Aufgabe der sozialen Dienste sein kann, Konsumenten für die angebotenen Leistungen zu finden. Es gilt sicherzustellen, dass die Bedürftigen erreicht werden. Dieser Versorgungsauftrag impliziert einerseits, dass all jene Menschen, die dieser speziellen Hilfestellungen benötigen, sie auch in Anspruch nehmen können und andererseits jene Menschen, die nicht darauf angewiesen sind, ausgeschlossen werden.
-
Soziale Dienste wenden sich an Menschen, die weniger in der Lage sind, ihre Interessen zu artikulieren und zu schützen. Dies gilt insbesondere für jene Dienste, die Menschen mit geistiger Behinderung als Zielgruppe haben. Soziale Dienste haben den Auftrag die Rechte dieser Menschen zu vertreten und dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht eingeschränkt werden.
-
Soziale Dienste greifen in vielen Fällen stark in die Lebenswelt von Menschen ein. Um individuelle Lebenslagen zu berücksichtigen, können soziale Dienste nur begrenzt normiert werden. Es erfordert stets eine Ausgewogenheit zwischen Offenheit und Flexibilität (vgl. Klicpera / Klicpera-Gasteiger 1995, S.35).
Nach Fink (2001, S.44) orientieren sich soziale Dienstleistungen grundsätzlich an drei Kernelementen. Es besteht (1) ein gesellschaftlich akzeptierter und über Gesetze und Verordnungen geregelter (Hilfe-)Bedarf als Ausgangspunkt. (2) Die Leistung, mit der dieser Hilfebedarf befriedigt werden soll, ist definiert, und es besteht (3) ein Konsens über den Aufwand, der notwendig ist, um die Leistung zu erbringen. Die Leistung als direkte Folge des Hilfebedarfes hat folgende Zielsetzungen:
-
die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern,
-
die selbständige Lebensführung zu fördern,
-
die Ausübung eines angemessenen Berufs oder sonstigen angemessenen Tätigkeit zu unterstützen, sowie
-
die Teilnahme an der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Damit stößt man gleich auf eine weitere Problematik, nämlich auf die bereits angesprochene Erfolgsmessung sozialer Leistungen. Soziale Arbeit ist einerseits immateriell, das bedeutet dass die Qualität einer Dienstleistung nur bedingt sinnlich wahrgenommen werden kann, und sie ist andererseits transaktional bestimmt, was ausdrückt, dass die NutzerInnen von Dienstleistungen nicht nur passiv Konsumierende, sondern stets auch Co-Produzenten eben dieser Leistungen sind. Die Qualität eines Angebotes kann daher nur eine (wenn auch zentrale) Voraussetzung für den Erfolg von sozialen oder rehabilitativen Dienstleistungen sein. Außerdem stehen Intention und Wirkung von professionellem Handeln nur in einem mittelbaren Zusammenhang. Dementsprechend kann weder unmittelbar von dem Erfolg oder Misserfolg einer bestimmten Maßnahme direkt auf die Qualität der erbrachten Leistung geschlossen werden, noch kann sich pädagogisches Handeln linear aus zuvor definierten Zielbestimmungen ableiten (vgl. Braun 1999, S.134ff; Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.67; Kaminske / Brauer 2003, S.59ff). Ein weiteres Charakteristikum sozialer Dienstleistungen ist, dass Produktion und Verwertung oft zeitlich zusammen fallen, man spricht in diesem Zusammenhang vom so genannten "Uno-Actu Prinzip". Ebenso stellt sich die Beziehungsstruktur zwischen NutzerInnen und MitarbeiterInnen als ungleich vielschichtiger dar, als es durch die eher abstrakten Begriff wie Leistungsanbieter und Leistungsabnehmer ausgedrückt wird. Ergebnisqualität ist somit auch von konkreten Personen und den zwischen ihnen stattfindenden Interaktionsprozessen abhängig. Demnach bestimmen in einem hohen Maße auch subjektive Faktoren die Arbeit in diesem Bereich, so dass Ergebnis und Prozess entscheidend auch von der KundInnenbeteiligung abhängen und nur in begrenztem Maß vorhersagbar oder autonom steuerbar sind (vgl. Engel / Flösser / Gensink 1996; Volkmar 1998, S.60f; S.50ff; Fasching 2003, S.99). Anhand dieser kurz skizzierten Probleme wird es deutlich, dass die quantitative "Outputmessung" sozialer Dienstleistungen sich ungleich schwieriger darstellt als bei normierten Industrieprodukten. Schwarte und Oberste-Ufer (2001, S.68) meinen dazu:
"die Erhebungstechniken quantitativer Verfahren können soziales Handeln nur sehr unzureichend erfassen. Ihre hohe Standardisierung wird mit einer starken Reduktion und Polarisierung bei der Erhebung komplexer Zusammenhänge, wie sie soziale Beziehungen und Tätigkeiten nun einmal darstellen, erkauft. Auf diese Weise gehen zahlreiche, für das Verständnis der interaktiven Abläufe und subjektive Konnotationen sozialer Prozesse wesentliche Aspekte und Informationen verloren."
Speck (1999a: S.124f) spricht in diesem Kontext auch vom "Eigenwert des Sozialen". Nach Speck ist der helfende Akt kein Tauschakt, wodurch sich die Wertigkeiten des Ökonomischen und Sozialen schon stark voneinander unterscheiden. Im Unterschied zum Tauschakt wird der helfende Akt nicht von beidseitigen Interessen, sondern jeweils vom Anderen initiiert. Der moralische Imperativ wird im Gegensatz zum Verkaufsinteresse nicht egologisch (vom Eigennutz her) konstituiert. Es ist vielmehr so, dass ich vom Anderen, der Hilfe braucht, in die Pflicht genommen werde, bevor ich fragen kann, welchen Preis ich dafür erhalte. Der moralische und soziale Akt ist asymetrisch begründet und geht der eigenen Rationalität voraus. Dieses anthropologische Bild liegt Speck zufolge allem Helfen und sozialem Tun zugrunde (vgl. Speck 1999a, S.124f).
Qualität ist nichtsdestotrotz stets aus Sicht der unterschiedlichen KundInnengruppen zu definieren. Dies bedeutet den Qualitätsbegriff im Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen der einzelnen Anspruchsgruppen wahrzunehmen und zu konkretisieren. Auf einen derartigen "Stakeholder" Ansatz habe ich bereits im Zuge des QUIP Projektes hingewiesen, wo es darum gegangen ist, die Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der unterschiedlichen Prozessbeteiligen zu bestimmen. Insbesondere dem KundInnenbegriff ist in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist aber vorab zu klären, wer mit dem Begriff KundInnen gemeint ist, bzw. wessen Erwartungen als Grundlage für die Formulierung von Qualitätsstandards oder Kriterien eingeholt und berücksichtigt werden sollen. Nach Meinhold (1998, S.20) sind
"damit alle Personen und Institutionen bezeichnet, die sich über die Qualität der Dienstleistung ein Urteil bilden und die Akzeptanz der Dienstleistung fördern oder beeinträchtigen können."
Des Weiteren regt Meinhold (ebenda) die Unterscheidung in externe und interne Kunden an. Zu den externen KundInnen zählen u.a. die NutzerInnen und die Kostenträger, zu den internen insbesondere alle MitarbeiterInnen, die in irgendeiner mit der Erbringung der Dienstleistung zu tun haben. Die Verwendung des KundInnenbegriffs wird aber gerade im Hinblick auf die NutzerInnen von sozialen Dienstleistungen häufig kritisiert, da sie über keine Konsumsouveränität und nur über geringe Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bei der Inanspruchnahme dieser Dienste verfügen. Denn nur wer eine starke rechtliche und finanzielle Position innehat, ist in der Lage seine Interessen als Kunde/Kundin auf dem sozialen Dienstleistungsmarkt zu realisieren. Der/die NutzerIn könne zwar von einer besseren Qualität profitieren, kann darauf aber keinen Einfluss ausüben, da der Preis und die Leistung von den KostenträgerInnen festgesetzt werden, welche die Leistung auch bezahlen. Auch BefürworterInnen dieses Begriffs sehen zwar die kritischen Aspekte, betonen aber den strategischen Wert den dieser Begriff aus ihrer Sicht besitzt, demnach signalisiert die Bezeichnung Kunde,
"eine neue Qualität von Beziehungen zwischen Sozialarbeit und ihren Adressaten, die stärker als bisher von Elementen der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, der Basis von Akzeptanz und anerkannter Mündigkeit, der Anerkennung des Adressaten als Subjekt im Hilfeprozess (und nicht als Objekt) sozialarbeiterischen Handelns geprägt sind." (Merchel 1995, S.329f zit. nach Bungart / Supe / Willems 2001, S.25)
Anders als in der Wirtschaft, in der KundInnen in den meisten Fällen je nach Dienstleistung oder Produkt, sehr leicht ausgemacht und eingegrenzt werden können, verfügt der Sozialsektor über vielschichtigere KundInnenbezüge als bloß Empfänger einer Leistung zu sein. Soziale Arbeit ist "multireferentiell" organisiert, da sie mehrere Adressaten mit unterschiedlichen Ziel- und Qualitätsvorstellungen besitzt, die nicht immer konfliktfrei integriert werden können. Angebot und Leistung werden idealtypisch innerhalb des so genannten Dreiecksverhältnis KostenträgerInnen, LeistungsanbieterInnen und LeistungsadressatInnen ausgehandelt und bestimmt. In der Realität entscheidet in letzter Konsequenz allerdings zumeist der/die KostenträgerIn, welche Unterstützungen in welchem Ausmaß den NutzerInnen gewährt werden, sowie die Art und Weise, in welcher der/die LeistungsanbieterIn dem/der KostenträgerIn rechenschaftspflichtig ist. Dem/der LeistungsabnehmerIn kommt daher eigentlich nur eine nachrangige Stellung zu. Diese als "asymetrisch" zu bezeichnende Beziehungsstruktur birgt natürlich die Gefahr, dass sowohl die Ansprüche der AdressatInnen sowie pädagogische Gesichtspunkte vernachlässigt werden. Qualität ist dementsprechend als eine hoch politische Kategorie anzusehen, da sie mit der Definitionsmacht verbunden ist zu bestimmen, was und von welchem Standpunkt als gute Qualität zu verstehen ist. Deshalb wird heute vielfach eine Verlagerung der Definitionsmacht oder zumindest eine aktive Einbeziehung der AdressatInnen im Hilfeerstellungsprozess gefordert (vgl. Meinhold 1998 S.20ff; Braun 1999, S.136f; Lanwer-Koppelin 1999, S.154f; Matul / Scharitzer 2002, S.611ff; Fasching 2003, S.100ff; Mizelli 2004, S.24f; EQUAL PGI 2004).
Eine erste derartige Entwicklung kann sicherlich im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL verortet werden, in der neben dem Empowerment der Zielgruppen als zentrale Vorgabe, auch die aktive Einbeziehung der Betroffenen in die Projektvorbereitung, Durchführung und Evaluation verlangt und gefördert wird. Im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft (EP) "QSI" wurde diese Vorgabe besonders vorbildlich durch die Einführung des "Betroffenen Mainstreaming" durchgeführt. Darunter versteht die EP:
"Betroffene - im Falle von QSI behinderte Frauen und Männer sowie Eltern behinderter Kinder - müssen in alle Planungs-, Durchführungs- und Entscheidungsprozesse gleichberechtigt eingebunden sein. Es gelten die Prinzipien des Empowerment und der Selbstbestimmung. Empowerment bedeutet für uns die Verantwortung für das eigene Tun zu fördern. Unter Selbstbestimmung verstehen wir die Kontrolle über das eigene Leben zu haben und die Möglichkeit, aus akzeptablen Angeboten auszuwählen." (Brandl / Fellinger / Feuerstein 2004, S.18f.)
Auch wenn außer Zweifel steht, dass die Qualitätsdiskussion die Chance bietet zu einer längst überfälligen Verbesserung von Leistungen für Menschen mit Behinderung zu gelangen, so wird doch vor allem der allgemein propagierten Bedeutung des Marktes und des Wettbewerbs in der pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Literatur ein erhöhtes Maß an Skepsis entgegengebracht. Zu einem der schärfsten Kritiker zählt sicher Speck (vgl. 1999a), dem es nicht darum geht, den Markt tendenziell zu kritisieren, sondern vielmehr um seine Verabsolutierung in gesellschaftspolitischer Hinsicht, d.h. seine Ideologisierung. Unter Ideologie versteht Speck (1999a, S.104f):
"die Verabsolutierung von Teilsichten und Teilabsichten, die unter Ausblendung anderer Teile der Wirklichkeit einen Hoheitsanspruch fordern. Systemtheoretisch gesehen ist das Wirtschafts-System ein geschlossenes selbstreferentielles System, das auf eigenen Wachstum gerichtet ist, d.h. dass es sich gegen externe Regulierung wehrt und es auch nicht als seine Aufgabe ansieht sich an der Lösung externer Probleme zu beteiligen. Soziallasten werden nur als Nebenkosten und Kostentreiber gesehen, die das eigene Wachstum bremsen."
Trotzdem wird immer wieder auf das Argument zurückgegriffen, dass die wirtschaftliche Krise unter anderem auf erhöhte Soziallasten zurückzuführen sei. Die damit verbundene Verteuerung der Arbeit bedinge Arbeitslosigkeit, diese können aber überwunden werden, wenn man Lohnnebenkosten kürzt und gleichzeitig die sozialen Ausgaben senkt. Nach Speck sitzen derartige Begründungszusammenhänge einem ideologischen Phantom auf, da die Wirtschaft nicht auf Sozialität ausgerichtet ist (vgl. Speck 1999a: S.104f). Die Behauptung, dass mehr Markt die soziale Qualität verbessern würde, ist für Speck demzufolge eine Illusion. Zur Veranschaulichung führt er noch einige Punkte an:
-
Der in Not geratene Mensch verfügt über keine Konsumsouveränität. Er kann zwar von einer besseren Qualität profitieren, kann darauf aber keinen Einfluss ausüben, da der Kostenträger die Preise und Leistungen festsetzt.
-
Es kann zu einem ruinösen Marktwettbewerb kommen, der zu einer Etablierung von Sozialkonzernen führt, die aufgrund ihrer Vormachtsstellung Dumpingpreise anbieten könnten[29], wodurch die Gefahr der Etablierung von Minimalqualitäten gegeben wäre.
-
Schließlich würde der vermehrte Wettbewerb auch mehr Druck auf die MitarbeiterInnen ausüben, die schon bisher unter zum Teil sehr schweren und belastenden Bedingungen arbeiten mussten.
-
Außerdem könnten Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf zu reinen Kostenfaktoren werden (vgl. Speck 1999a, S.110f; Lanwer-Koppelin 1999, S.153ff).
Gerade angesichts dieser Entwicklungen hält es Feuser (vgl. 2002: S.5) für unumgänglich pädagogische Reformmodelle, wie die Integration, nach erziehungswissenschaftlichen und anderen humanwissenschaftlichen Kriterien fachlich und qualitativ zu bestimmen. Trotzdem spart Feuser auch nicht an Kritik an pädagogischen Fachkräften, so formuliert er:
"dass die Qualitätsdebatte heute aus der äußerst problematischen Allianz der leeren öffentlichen Kassen und sich anbahnender bzw. auch schon vollzogener ethischer Dammbrüche mit einem in gleicher Weise durch einen neoliberalen Zeitgeist getragenen Globalisierungsstreben und entsprechenden Deregulierungsprozessen in den nationalstaatlichen Bereichen nicht mehr heraus lösbar ist, macht sie ungleich schwerer und löst auch Unbehagen aus, aber legitimiert nicht, sie weiterhin zu verdrängen, sich nur angegriffen und verleumdet zu sehen, sich zurückzuziehen und herauszuhalten. Das holt das Versäumte nicht nach und macht das heute Drohende nicht minder gefährlich." (Feuser 2002: S.3).
Grundsätzlich ist noch einmal festzustellen, dass es im sozialen Bereich "die Qualität" schlechthin nicht gibt und nicht geben wird. Insofern stellen sich zwangsläufig die Fragen, wieso es dann überhaupt sinnvoll und notwendig ist, die Qualität und den Erfolg von sozialen Dienstleistungen zu beschreiben und zu messen. Eine mögliche Begründung geben Horak und Schmid (2003, S.39). Demnach kann eine Qualität,
"die nicht messbar gemacht wird, nicht als Gestaltungs- und Steuerungsinstrument eingesetzt werden. Deshalb ist eine operationale Formulierung der Qualitätsdimensionen und der damit verbunden Merkmalsausprägungen erforderlich. Nur durch die Entfaltung, Messung und Beurteilung des Qualitätsgrades können Schritte zur Verbesserung und Weiterentwicklung gesetzt werden."
Ebenso wichtig ist nach Ansicht der Autoren dementsprechend die Erfolgsessung. Dabei gilt der Grundsatz:
"Wer sich verbessern will, muss wissen wo er steht." (Horak / Schmid 2003, S.40)
Erfolgsmessung ist daher besonders wichtig um:
-
Ziele zu konkretisieren und zu operationalisieren,
-
Leistungen zu dokumentieren,
-
Transparenz zu schaffen,
-
den Zielerreichungsgrad verfolgen zu können,
-
für Frühwarnung und um Trends zu erkennen und
-
Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken. (vgl. Horak / Schmid 2003, S.40)
Nach Heiner (vgl. 1999, S.64) ist jede Form von Qualitätssicherung von drei Faktoren abhängig. Und zwar bedarf es (1) konsensfähiger und eindeutiger Qualitätsstandards oder -Kriterien, (2) einer verlässlichen Beachtung und Umsetzung der selbigen in alltägliches Handeln und schlussendlich (3) geeignete Verfahren, die Mängel bei der Kriterienformulierung oder/und Realisierung der damit angestrebten Dienstleistungsqualität erkennen und beheben können.
Nachdem nun eine Begründung für die Notwendigkeit für Qualitätssicherung und Erfolgsmessung gegeben wurde und Qualitätsstandards definiert worden sind, ist es an der Zeit sich Gedanken über Inhalt und Methode für ein Qualitätssicherungssystem zu machen (vgl. Frühauf 2001, S.13f). Inwiefern ein Qualitätssicherungssystem für den Einsatz in Institutionen der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit geeignet ist, ist nach Speck und Heiner abhängig von zwei fundamentalen Grundfragen, nämlich ob sie
-
dazu führen werden Qualität in Institutionen der Sozialen Arbeit und Behindertenhilfe zu fördern, indem sie gleichermaßen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung unterstützen, und
-
diese geeignet sind, fachfremde und sachunkundige Eingriffe in professionelle Arbeitszusammenhänge abzuwehren, indem sie z.B. plausible Standards erarbeiten oder auf vorhandene Standards zurückgreifen, und damit in der Lage sind sich der drohenden Ökonomisierung gegenüber zu behaupten (Heiner 1996, S.24; Speck 1999a, S.144).
Schwarte und Oberste-Ufer (2001, S.76ff) teilen die in jüngerer Zeit entwickelten Verfahren idealtypisch in drei Kategorien ein, und geben einen Überblick über ihre Anwendbarkeit in sozialen Dienstleistungen:
-
Primär formal und verfahrensorientierte Instrumente, die sich auf eine Normierung organisationeller Abläufe richten. Dazu zählen vor allem die DIN-ISO Normenreihen, bzw. das EFQM - Modell. Diese Verfahren, die in ihrer Anlage aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext entlehnt sind, haben zurzeit auch in sozialen Dienstleistungsunternehmen Hochkonjunktur. In diesen Verfahren soll durch eine hochdifferenzierte Kontrolle die Effektivität und KundInnenorientierung eines Dienstes gesteigert werden. Diese primär verfahrenszentrierten Ansätze müssen notwendigerweise die spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen sozialer Dienstleistungen verfehlen. (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.76f)
-
Verfahren der Personalbemessung arbeiten auf der Basis von erhobenen individuellen oder kategorisierten Hilfebedarfe, die in ihrer Mehrzahl auf Strukturqualität sowie objektive Faktoren von Lebensqualität (also eher Lebensstandards) ausgerichtet sind. Obwohl diese Verfahren mehrheitlich auch inhaltliche Kriterien berücksichtigen, liegt ihr Schwerpunkt vor allem darauf, für in Leistungsgruppen zusammengefasste Aufgaben Zeitwerte zu ermitteln. Weitgehend unberücksichtigt bleibt die Frage, wie durch quantifizierende Angaben Merkmale des Prozesses abgebildet werden können. (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.77).
-
Primär inhaltlich orientierte Instrumente. Dazu zählt unter anderem das Verfahren LEWO. LEWO ist ein standardisiertes, deskriptives, mehrdimensional und multiperspektivisch angelegtes Instrument zur extern begleiteten Selbstevaluation von residentiellen Diensten. Durch die inhaltliche Ausrichtung dieses Instrumentes, erlaubt es Fachkräften ihre Arbeit zuverlässig einzuschätzen, sowie über Stärken und identifizierte Schwachstellen Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung ihrer Arbeit zu finden (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.76ff).
Speck (1999a, S.161ff) trifft seine Unterteilung der vorliegenden Methoden aus einer etwas anderen Perspektive, er unterscheidet primär zwei Modelle, die von einer Extremposition ausgehend sich polar gegenüberstehen. Diese beiden Modelle repräsentieren folglich:
-
zum einen der Wert sicherzustellender ökonomischer Effizienz, und
-
zum anderen der Wert gemeinsam hervorzubringender sozialer Qualität
Den ersten Ansatz nennt Speck Kontrollansatz. Entsprechende Verfahren bedienen sich vor allem Methoden des Controllings, also externen Wertmaßstäben einschließlich hierarchischer Führungsstrukturen, von denen aus Evaluationen durchgeführt werden. Den zweiten Ansatz bezeichnet Speck als Reflexionsansatz. Diese Verfahren gehen primär von der persönlichen und fachlichen Autonomie jedes einzelnen Beteiligten aus. Über den Weg der gemeinsamen Reflexion, soll in diesen Modellen, aus eigenem Interesse und Selbstverantwortung in Übereinstimmung mit den Menschen, denen das Tun gilt, eine Verbesserung und größere Entsprechung der Qualität in der sozialen Realität angestrebt werden. Die beiden Ansätze unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der primären Wertorientierung (vgl. Speck 1999a, S.161ff).
Ad Kontrollansätze: Unter diesen Ansätzen versteht Speck - mehr oder weniger pauschal - Strategien und Methoden, die auf eine totale Inanspruchnahme aller Beteiligten abzielen. Hierzu zählt Speck v.a. Modelle eines Total Quality Managements (TQM). Solche dominant und einseitig hierarchischen Modelle gelten mittlerweile auch schon in der Wirtschaft als unproduktiv und überholt. Ein klassisches Controlling Verfahren ist die schon beschriebe ISO 9000 Strategie. Speck hält Kontrolle auch in sozialen Dienstleistungen für notwendig, er wehrt sich allerdings gegen totalisierende Kontrollsysteme. Für Speck müsse eine wirksame Qualitätskontrolle nicht nur einseitig von einer Leitungsebene aus erfolgen, sondern im Sinne einer Verantwortlichkeit aller Beteiligten (vgl. Speck 1999a, S.165ff).
Ad Reflexionsansätze: Für Speck ist Reflexion oder reflexive Evaluation die zwingende Folgerung aus der Tatsache, dass bei der Organisation und Effektivität von zwischenmenschlichen (sozialen) Arbeitsprozessen nicht einfach linear verabsolutierbare Werte oder planerisch sicherzustellende Ergebnisse existieren. Bei jeglichem menschlichen Handeln ist stets mit Unvorhersehbarem zu rechnen, und zwar sowohl auf der Seite der helfenden Person als auch bei den Betroffenen. Speck spricht von Evaluationsverfahren im Dialog. Eine auf menschlichen Werten beruhende Qualitätsentwicklung ist im Besonderen auf reflexive Evaluationsverfahren angewiesen. Sie ermöglicht eine eigene und zugleich gemeinsame Bewertung, der sich eine Gruppe von Menschen stellt, die zusammenarbeiten (wollen). Heute wird meist übereinstimmend die interne Evaluation der externen Evaluation als die adäquate Form von Qualitätssicherung und -verbesserung sozialer Praxis angesehen (vgl. Speck 1999a, S.170ff).
Angesichts der Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung beteiligungsorientierter Konzepte und Modelle in der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit, müssen, so Engel, Flösser und Gensink (1996, S.56f), aktuell diskutierte Modelle der Qualitätsbestimmung wie beispielsweise das "Total Quality Management" oder die Zertifizierung nach "DIN ISO" als zu kurz greifend betrachtet werden.
"Diese für den industriellen und gewerblichen Produktionssektor entwickelten Qualitätskonzepte zeichnen sich nämlich durch eine nicht beteiligungsorientierte Verhältnisbestimmung, insbesondere zu den LeistungsabnehmerInnen aus, und bleiben einer innerorganisatorischen Logik verhaftet." (ebenda).
Deshalb haben Schwarte und Oberste-Ufer (2001, S.85ff) angesichts der Problematik der Übertragung fachfremder Ansätze auf den Kontext der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit Gütekriterien aufgestellt, die bei der Entwicklung von neuen fachlichen Instrumenten des Qualitätsmanagements bzw. der Qualitätssicherung berücksichtigt werden sollten. Die Aufzählung und Beschreibung dieser Gütekriterien wird sogleich den Abschluss dieses Kapitels bilden:
-
Inhaltliche Fokussierung: Um den Anforderungen und Bedingungen sozialer Dienstleistungen zu genügen, dürfen sich Instrumente der Qualitätssicherung nicht auf formale und verfahrenstechnische Grundsätze beschränken. In geeigneten Instrumenten müssen inhaltliche Standards und Leitlinien für die Arbeit sozialer Einrichtungen benannt werden (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.85).
-
Explikation fachtheoretischer Grundlagen und Anwendungsbereiche: Diese inhaltlichen Leitlinien sind notwendigerweise wertgebunden, und werden aus normativen Prinzipien hergeleitet. Dies zu begründen und den Bereich der Anwendbarkeit der Instrumente zu beschreiben, ist ein Gebot wissenschaftlicher Seriosität (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.85).
-
Hinreichende Operationalisierung der Leitlinien und Standards: Die angesprochenen Leitlinien bleiben unverbindlich, wenn sie nicht hinreichend für den Einsatz in der Praxis konkret ausformuliert und durch Indikatoren überprüfbar sind (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.85).
-
Mehrdimensionalität: Qualität ist stets als mehrdimensionales Konstrukt zu verstehen. Deshalb ist es wichtig, dass geeignete Instrumente auch interaktionale Komponenten berücksichtigen. Neben inhaltlichen, fachlichen und institutionsbezogenen Kriterien müssen auch die Qualifikation der Fachkräfte sowie die sozialpolitische Ebene einbezogen werden (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.85).
-
Bipolarer Zugang - Nutzer- und Dienstperspektive: Geeignete Verfahren müssen neben der Dienstperspektive auch die Bedeutsamkeit der Hilfen für die Nutzer von Angeboten und Leistungen beschreiben, und diese Ebenen zusammenführen (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.86).
-
Multiperspektivischer Ansatz: Wie in dieser Arbeit schon erwähnt müssen Qualitätssicherungsinstrumente die Perspektiven aller beteiligten Gruppen umfassen (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.86).
-
Eignung zur Selbstevaluation: Qualität kann nicht nur durch Endprüfungen gesichert werden, sondern ist vielmehr als ein kontinuierlicher Prozess zu verstehen. Die Instrumente müssen deshalb für die Nutzung aller beteiligten MitarbeiterInnen konzipiert sein, und der Anforderung einer hinreichenden Alltagsnähe Rechnung tragen (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.86).
-
Eignung zur Qualifizierung der Fachkräfte sozialer Dienste: Da sich die Qualität vor allem im täglichen Handeln der Fachkräfte erweist, müssen Instrumente Gelegenheit zur systematischen Reflexion, Dokumentation und Auswertung des eigenen beruflichen Handelns geben. Wenn derartigen Verfahren in solch einem selbstevaluativen Weg zum Einsatz gelangen, ermöglicht dies eine aufgabenbezogene und arbeitsplatznahe Qualifizierung der Fachkräfte (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.86).
-
Qualitative methodische Ausrichtung: Entscheidend für die Qualität und Effektivität sozialen Handelns ist eine differenzierte Problem- und Ressourcenbeschreibung sowie die Analyse von Lösungsmöglichkeiten in einem kommunikativen Prozess unter den Beteiligten. Um dies zu ermöglichen sind primär qualitative Verfahren einzusetzen (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.86).
-
Kontinuität der Anwendung: Da Qualitätsentwicklung von einer kontinuierlichen Planung, Konzeptualisierung und Überprüfung von Ablauf, Wirkungsgrad und Effektivität abhängig ist, müssen Qualitätssicherungsverfahren für einen regelmäßigen und alltagsintegrierten Einsatz geeignet sein (vgl. Schwarte / Oberste-Ufer 2001, S.86).
Werden die eben beschriebenen Gütekriterien angemessen berücksichtigt, so meinen Schwarte / Oberste-Ufer (2001, S.86f), besteht eine Chance, besonders angesichts veränderter gesetzlicher und gesellschaftlicher Bedingungen, die Qualitätsentwicklung ohne Reduktion auf kontraproduktive Minimalstandards vorzubringen und durchzusetzen. Auch das im nächsten Kapitel vorgestellte "Modulsystem Umfassende Qualitätsmanagementsystem" für Integrationsfachdienste (MUQ) hat sich bei der Entwicklung auf diese Gütekriterien bezogen.
In diesem Kapitel habe ich auf Ursprünge und Begründungszusammenhänge der aktuellen Qualitätsdiskussion aufmerksam gemacht. Die aktuelle Forderung nach Qualität ist demnach im Zusammenwirken mehrdimensionaler ökonomischer und sozialer Faktoren zu sehen. Anschließend habe ich mich mit dem Qualitätsbegriff auseinandergesetzt und daraus unterschiedliche Implikationen für die Bestimmung pädagogischer Qualität abgeleitet. In der Auseinandersetzung mit den normativen Bezugsgrößen pädagogischer und sozialer Qualität haben ich versucht aufzuzeigen, dass die Bewertung dessen, was als Qualität zu verstehen ist, stets von fachlich kompetenter Seite und der Lebensqualität der Betroffenen zu erfolgen hat. Eine Bestimmung von Charakteristika sozialer im Unterschied zu wirtschaftlichen Dienstleistungen und Produkten sowie eine Darstellung der Rollen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen hat aufgezeigt, dass pädagogische Qualität prozessgebunden und deshalb ungleich schwieriger zu bestimmen und zu messen ist. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass vor allem die LeistungsabnehmerInnen stärker in den Hilfeerstellungsprozess eingebunden werden sollten. Des Weiteren habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die aktuelle Entwicklung auch mit einigen Gefahren verbunden ist, auf die sowohl von Seiten der Leistungsanbieter als auch der Kostenträger bedacht zu nehmen ist. Zum Abschluss des Kapitels habe ich noch eine Unterscheidung von Methoden zur Qualitätssicherung und Erfolgsmessung aus zwei unterschiedlichen pädagogischen Gesichtspunkten getroffen, sowie angesichts der Problematik der Übertragung fachfremder Systeme Gütekriterien dargestellt, die bei der Entwicklung von neuen fachlichen Instrumenten der Qualitätssicherung berücksichtigt werden sollten. Im letzten Kapitel des theoretischen Teils wird das Thema Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration behandelt. Nach der begrifflichen Klärung zentraler Termini in der Qualitätsdiskussion, soll ein kurzer Überblick über die relevanten Qualitätssicherungs- bzw. Qualitätsmanagement-modelle wie DIN-ISO oder EFQM gegeben werden. Der Hauptteil dieses Kapitels wird sich der Darstellung von drei Modellen widmen, die ganz speziell für den Einsatz in Institutionen der beruflichen Integration entwickelt wurden.
[28] Unter einer "Integrativen Einstellung" gegenüber Menschen mit Behinderung wird nach Tröster (1990, zit. nach Wetzel / Zettl 2004, S.73) "eine dauerhafte, über verschiedene Situationen und Zeitpunkte hinweg stabile Disposition verstanden, auf behindere Personen mit positiven Grundgefühlen zu reagieren, vorteilhafte Meinungen über sie zu vertreten und sich ihnen gegenüber in zugewandter Weise zu verhalten und einer Integration aufgeschlossen gegenüber zu stehen."
[29] vgl. die Auslagerung der Asylantenbetreuung im Flüchtlingslager Traiskirchen in Österreich an die Firma "Homecare Europe". In der zweiten EQUAL Antragsrunde wird sich die Entwicklungspartnerschaft "IMPROVE - Qualität im Wettbewerb um soziale Dienste" u.a. damit befassen Qualitätsstandards für zukünftige Ausschreibungen zu entwickeln, die über preisliche Gesichtspunkte hinausgehen.
Inhaltsverzeichnis
- 6.1. Begriffliche Klärung und allgemeine Grundlagen von Organisationsentwicklung, "lernender Organisation", Qualitätsmanagement, und "Total Quality Management" (TQM) aus systemtheoretischer Sicht
- 6.2. Zur Notwendigkeit von Qualitätsmanagement sowie qualitätssichernder Maßnahmen in der beruflichen Integration
- 6.3. Vorstellung allgemeiner QM - Systeme aus dem Bereich der Wirtschaft
-
6.5. Überblick über speziell für den Bereich der beruflichen Integration entwickelter QM - Systeme und Instrumente
- 6.5.1. Das QUIP (Quality in Practice) Evaluationshandbuch
- 6.5.2.MUQ - Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste
- 6.5.3. KASSYS - Kasseler Systemhaus - Qualitätsmanagement Referenzmodell zur psychosozialen Betreuung nach dem Sozialgesetzbuch
- 6.5.4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Modelle
- 6.6. Zusammenfassung
Dieses abschließende Kapitel des theoretischen Teils wird sich nun ausführlich mit der Bedeutung von Qualitätsmanagement und entsprechender Systeme für und in Institutionen der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung beschäftigen. Nach einer grundlegenden Einführung in die entsprechende Terminologie und Theoriezusammenhänge, werden zunächst Systeme, die aus dem Bereich der Wirtschaft und Industrie stammen, vorgestellt und nach ihrer Relevanz in sozialen Handlungsfeldern hinterfragt, und anschließend drei Systeme / Instrumente präsentiert und verglichen, die speziell für den Einsatz in Arbeitsassistenz bzw. Integrationsfachdiensten entwickelt wurden.
In Anlehnung an Bungart / Supe / Willems (2000) erachte ich es für zweckmäßig die beiden Themenkomplexe Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement zu Beginn dieses Kapitels gemeinsam zu betrachten, da beide dadurch begründet sind, dass sie sich mit Verbesserungspotentialen und -möglichkeiten von Organisationen auseinandersetzen. In diesem Sinne kann Qualitätsmanagement als Teilbereich von Organisationsentwicklung angesehen werden. Die Bedeutung dieser Ansätze für die Gestaltung und vor allem Optimierung in sozialpädagogischen Handlungsfeldern wie insbesondere der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung erschließt sich aus den Ausführungen des vorangegangenen Kapitels (vgl. Bungart / Supe / Willems 2000, S.5ff).
Unter Organisationsentwicklung soll im weiteren Verlauf folgende Definition verstanden werden:
"Organisationsentwicklung umfasst alle geplanten Schritte und Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, wesentliche Aspekte einer Organisation, nämlich Arbeitsabläufe, kommunikative Prozesse, Struktur, die Organisationskultur oder -dynamik eines Unternehmens oder ihr Gesamtgefüge unter maßgeblicher Beteiligung der Mitarbeiter in Richtung auf vorgegeben Ziele hin zu optimieren." (Engelhardt 1996, zit. nach Bungart / Supe / Willems 2000, S.6).
Der Begriff Organisationsentwicklung ist einem historischen Wandel unterworfen, der neben dem theoretischen Bezugsrahmen nach wie vor zu Uneinigkeit in der Fachliteratur über das Verständnis dieses Begriffs führt. Bungart, Supe und Willems (vgl. 2000, S.7) unterscheiden vier theoretische und konzeptionelle Zugänge, die, obwohl sie zeitlich aufeinander folgend aufgetreten sind, sich nicht immer gegenseitig abgelöst haben:
-
einen bürokratisch - administrativen Zugang
-
einen sozialpsychologisch-verhaltenswissenschaftlichen Zugang
-
einen motivations- und partizipationsorientierten Zugang
-
einen systemtheoretischen und ganzheitlichen Zugang
Im Zuge meiner weiteren Ausführungen werde ich mich vornehmlich auf den systemtheoretischen Ansatz beziehen. Organisationen können demnach als der Umwelt gegenüber "offene Systeme" verstanden werden, die sich aus Gruppen und Individuen zusammensetzen, welche meist koordiniert über eine Hierarchie von Verantwortung, in arbeitsteiliger Form, versuchen bestimmte Ziele zu erreichen (vgl. Rosenstiel 1999, S.51). In diesem Verständnis stellen Organisationen soziale Systeme dar, in denen die dort tätigen Menschen miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Eine systemische Betrachtungsweise lenkt den Blick deshalb auf die Beziehungen und die Kommunikation der einzelnen Systemteile, also insbesondere auf die Interaktionen der beteiligten MitarbeiterInnen. Damit eine Organisation und die in ihr ablaufenden Prozesse möglichst effektiv und effizient funktionieren, müssen die einzelnen Elemente gut aufeinander abgestimmt sein und die jeweiligen Akteure produktiv zusammenarbeiten. Die Organisationsstrukturen und Verhaltensweisen der MitgliederInnen sind sowohl als Ergebnis von Austauschprozessen innerhalb des Systems als auch mit der ihr eigenen Umwelt zu sehen. Diese "natürliche Eigendynamik" offener Systeme bedingt, dass Organisationen in der Lage sind, zielgerichtet und bewusst zu planen sowie ihre internen und externen Austauschbeziehungen aktiv zu steuern. Durch Organisationsentwicklungsprozesse ausgelöste Veränderungen können sowohl die Organisation als Ganzes als auch Teilbereiche betreffen, sofern einzelne Abteilungen über die dafür notwendige Autonomie verfügen. Aber auch punktuelle Veränderungen können in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess letztendlich zu einer grundlegenden Veränderung führen, da auch kleine Veränderungen stets Auswirkungen auf das Gesamtgefüge haben. Insbesondere in sozialen Einrichtungen darf sich Organisationsentwicklung nicht nur mit Strukturen befassen, da vor allem den Einstellungen, Erwartungen und Qualifikationen der MitarbeiterInnen ein hoher Stellenwert für die Erreichung der gesetzten Ziele zukommt (vgl. Bungart / Supe / Willems 2000, S.7ff). Moderne Organisationsentwicklungsprozesse beschäftigen sich deshalb mit zwei Hauptaspekten:
-
"Steigerung der Effektivität bzw. Produktivität einer Organisation durch Verbesserung der Arbeitsabläufe und -methoden auf der Basis der Förderung von Flexibilität, Innovationsbereitschaft und Lernfähigkeit des Systems.
-
Steigerung der Humanität der Arbeitsbedingungen, d.h. die Verbesserung der Arbeitssituation der Mitarbeiter durch die Gewährleistung von Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Handlungs- und Entscheidungsspielräumen, sowie durch Mitwirkung an Entscheidungs- und Beratungsprozessen, die die eigene Arbeit betreffen." (Engelhardt 1996, zit. nach Bungart / Supe / Willems 2000, S.10)
Aus derartigen Organisationsentwicklungsansätzen hat sich das Konzept der "lernenden Organisation" bzw. des "organisationalen Lernens" entwickelt. Darunter wird
"die Fähigkeit einer Institution als Ganzes verstanden, Fehler zu entdecken, diese zu korrigieren sowie die organisationale Wert- und Wissensbasis zu verändern, so dass neue Problemlösungs- und Handlungsfähigkeiten erzeugt werden.... Organisationales Lernen manifestiert sich in der Art und Weise, wie die Wissensbasis einer Organisation nutzbar gemacht, verändert und fortentwickelt wird." (Hodl 1998, S.63)
Der Ausgangspunkt dieses Konzeptes stellte die Frage dar: "Ob Organisationen überhaupt lernen können, und wenn ja, wie?". Dieser Lernbegriff, der sich ebenfalls auf soziologische Systemtheorien bezieht, wurde in Untersuchungen über das Lernen von Individuen formuliert und verfügt im Vergleich dazu über eine eher jüngere Geschichte (vgl. Hodl 1998, S.65). Für Individuen stellt das Lernen bei sich ändernden Umfeldbedingungen eine existentielle Notwendigkeit dar. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass dies auch für Organisationen in der modernen Gesellschaft gilt, welche auch vor (zum Teil von ihnen selbst ausgelösten) tief greifenden Veränderungen stehen (ausgedrückt durch Schlagworte wie Globalisierung, Technologisierung, Flexibilisierung, etc.). Angesichts immer komplexer werdender Aufgaben kann der Einzelne das gesamte relevante Wissen nicht mehr besitzen, so dass sich zunehmend auch bzw. gerade in sozialen Institutionen die Notwendigkeit ergibt, mehrere Spezialisten mit unterschiedlichen Kenntnissen, Erfahrungshintergründen und Kompetenzen zur Bewältigung einer Aufgabe zu beauftragen. Der Lernbegriff bleibt trotzdem, auch in dieser Konzeption, auf das Individuum bezogen, was bedeutet, dass Organisationen nur lernen können, wenn sowohl Management und MitarbeiterInnen lernen und in der Lage sind daraus einen Nutzen zu ziehen. Die Bedeutung von Qualifikation, Aus- und Weiterbildung sowie das vielfach propagierte "Lebenslange Lernen" rücken dadurch ins Blickfeld der Betrachtung (vgl. Rosenstiel 1999, S.51ff; Bungart / Supe / Willems 2001, S.13ff). Wie kann es nun einer Organisation gelingen zu einer "Lernenden Organisation zu werden? Rosenstiel (1999, S.48) fasst die wichtigsten Aufgaben wie folgt zusammen:
"Geht es darum eine lernende Organisation aufzubauen, so sind die zu erfüllenden Aufgaben entsprechend zu gestalten, die Personen gezielt auszuwählen und zu entwickeln, die Gruppen angemessen zu strukturieren, die Organisation in ihrem Aufbau und in ihren Abläufen auf das genannte Ziel hin auszurichten und eine Kultur zu schaffen und zu stabilisieren, in der Lernen der einzelnen und die Wissensweitergabe an das System selbstverständlich sind."
Auf dem Weg zu einer lernenden Organisation zu sein erfordert eine "Lernkultur" innerhalb einer Organisation zu etablieren, welche nach dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung eine Reflexion über die eigene Tätigkeit und einen Austausch hierüber mit Anderen sowie innovatives Denken und Handeln ermöglicht. Dabei gilt, dass Arbeitsprozesse Lernprozesse auslösen, ermöglichen und fördern sollen. Dies impliziert auch eine Haltung Fehler zuzulassen um aus ihnen lernen zu können. Dazu benötigt es Informations- und Kommunikationsstrukturen, die durch alle Ebenen einer Organisation zu installieren sind, um derartige Reflexionen produktiv und transparent machen zu können. Das daraus gesammelte Wissen ist als zentrales Kapital einer Einrichtung anzusehen, und durch gezielte Dokumentationssysteme festzuhalten. Die Lernpotentiale einer Organisation können schließlich - nach der Qualifikation der handelnden MitarbeiterInnen einerseits und dem Vorhandensein effizienter Arbeitsstrukturen andererseits - niedriger oder höher sein. (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001, S.17). In diesem Zusammenhang wird häufig auf das "Lernebenenmodell" nach Argyris / Schön und Batseon (1996, u.a. bei Bungart / Supe / Willems 2001, S.18f; Goihl 20003, S.26ff) verwiesen:
-
Beim "Single Loop Learning" werden (operative) Fehler entdeckt und korrigiert sowie das System wieder auf die (strategische) Unternehmensnorm ausgerichtet. Bei einem derartigen Anpassungslernen besteht lediglich das Ziel, die gemachten Fehler zukünftig zu vermeiden, Normen, Ziele und Verhaltensweisen werden nicht grundlegend in Frage gestellt oder verändert.
-
Beim "Double Loop Learning" werden auch die Ziele und Werte und somit die theoretische Orientierung einer Einrichtung in Frage gestellt. Ein solches Veränderungslernen wird häufig durch Wertekonflikte ausgelöst, und bietet die Möglichkeit Unternehmensziele zu modifizieren und damit seinen Handlungsspielraum zu vergrößern. Das "Double Loop Learning" kann auch als Lernen höherer Ordnung bezeichnet werden und verändert somit auch die Grundlage für Lernvorgänge niedrigerer Ordnung auf der Handlungsebene.
-
Die komplexeste Lernform bezeichnet schließlich das "Deutero Learning", dessen zentraler Bestandteil die Einsicht in die Kontexte von Problemlösungsstrategien ist, um das "Lernen zu lernen". Diese Ebene des reflektierenden Lernens zeigt den MitarbeiterInnen die Wege des Single und des Double Loop Learning auf, und ermöglicht durch das daraus ausgelöste Wissen über Lernprozesse kreative, innovative und wandlungsfähige Handlungskompetenz sowohl auf der Handlungs-, Ziel- und Sinnebene. Im Zentrum des Deutero Learning steht somit das Hinterfragen der üblichen Zielsetzungs-, Problemlösungs- und Lernprozesse in Organisationen sowie die Analyse und Neugestaltung übergeordneter Sinnbezüge. (Vgl. Bungart / Supe / Willems 2001, S.18f; Goihl 20003, S.26ff)
Mit dem Konzept der Lernenden Organisation können gerade für soziale Dienstleistungsunternehmen, deren Kernprozesse ja durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet sind, neue Möglichkeiten und Chancen bestehen. Doch stoßen derartige Veränderungsprozesse auch häufig auf strukturelle und ideologische Grenzen und Widerstände. Die Übernahme eines Qualitätsmanagementsystems, das auf der Idee der kontinuierlichen Verbesserung aufgebaut ist, kann einen ersten Schritt in Richtung Lernender Organisation bedeuten.
Der Begriff Qualitätsmanagement gilt mittlerweile als Oberbegriff für alle systematischen qualitätsbezogenen Tätigkeiten und ersetzt damit den bisherigern Oberbegriff Qualitätssicherung. In der internationalen Norm DIN EN ISO 9000:2000 wird Qualitätsmanagement definiert als:
"aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zur Leitung und Lenkung einer Organisation bezüglich Qualität. Leitung und Lenkung bezüglich Qualität umfassen üblicherweise die Festlegung der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele, die Qualitätsplanung, die Qualitätslenkung, die Qualitätssicherung und die Qualitätsverbesserung." (Kaminske / Brauer 2003, S.207.)
Qualitätsmanagement umfasst demnach vier Stufen, die zusammenfassend als fortlaufender Regelkreis beschrieben werden können:
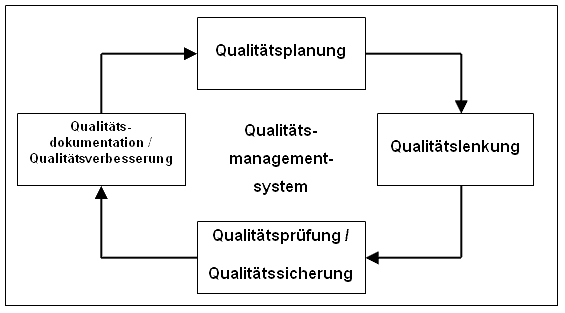
Abbildung 2: Der Qualitätsmanagementprozess (Bungart / Supe / Willems 2001, S.27; Kaminske / Brauer 2003, S.206ff.)
-
Im Rahmen der Qualitätsplanung werden zunächst die einzelnen Tätigkeiten festgelegt. Es erfolgt eine Bestimmung des IST - Zustandes, die Entwicklung von SOLL - Forderungen sowie die Ableitung von Verfahren zur Verwirklichung dieses SOLL - Zustandes
-
Die Qualitätslenkung umfasst alle vorbeugenden, überwachenden und korrigierenden Maßnahmen, die zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen beitragen. Sie befasst sich dabei vor allem mit den Bereichen der Personal- und Organisationskultur, der Aufbau- und Ablauforganisation sowie einrichtungsspezifischer Informations- und Kommunikationssysteme.
-
Die Qualitätsprüfung stellt anhand eines SOLL - IST Vergleichs fest, ob die angestrebten Qualitätsmerkmale innerhalb eines definierten Zeitraums tatsächlich erreicht wurden. In so genannten Audit Verfahren werden sämtliche qualitätsbezogenen Tätigkeiten und Elemente einer Organisation untersucht.
-
Im Rahmen der Qualitätsdokumentation werden sämtliche Maßnahmen in den drei vorherigen Bereichen schriftlich dokumentiert. Als zentraler Teil der Dokumentation entsteht nach Durchlaufen aller Phasen ein Qualitätshandbuch, welches eines Darstellung der einzelnen inhaltlichen und methodischen Schritte sowie eine Anleitung für die Gestaltung und Dokumentation der Arbeitsprozesse enthält. (Vgl. Bungart / Supe / Willems 2001, S.27f.; Kaminske / Brauer 2003, S.206ff.)
Als übergeordneter Bestandteil des Qualitätsmanagements ist die Qualitätsverbesserung zu sehen. Dazu zählen sämtliche Maßnahmen zur Steigerung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Prozesse, um daraus einen entsprechenden Nutzen, sowohl aus Sicht der Organisation als auch der MitarbeiterInnen und vor allem der KundInnen, zu erzielen (vgl. Kaminske / Brauer 2003, S.208). Ein konsequentes Qualitätsmanagement ist ferner durch eine umfassende Qualitätsphilosophie gekennzeichnet die sich nach Zink (vgl. 2001, S.84f) wie folgt zusammenfassen lässt:
-
Qualität wird als ein wesentliches Organisationsziel mit langfristigen und dauerhaften Charakter verstanden.
-
Qualität umfasst mehrere Dimensionen und beschränkt sich nicht nur auf die Qualität von Produkten bzw. Dienstleistungen. Zu integrieren sind auch die Qualität der Prozesse, der Arbeitsbedingungen sowie der Außenbeziehungen im weitesten Sinn.
-
Qualität wird als organisationsweite Aufgabe betrachtet. Alle MitarbeiterInnen sind aktiv in ein solches Konzept miteinzubeziehen.
-
Die Qualitätsbemühungen müssen vor allem präventiv gestaltet werden. Daraus leitet sich einerseits eine systematische Klärung von KundInnenanforderungen ab sowie andererseits eine Abkehr von der ergebnisorientierten Qualitätssicherung und daher eine stärkere Betrachtung von Arbeitsabläufen als notwendige Voraussetzung für frühzeitige Eingriffsmöglichkeiten. (Vgl. Zink 2001, S.84f)
In der Praxis erfolgt die Umsetzung des Qualitätsmanagements in erster Linie durch die Einführung oder den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. Auf den Aufbau und den Nutzen von unterschiedlichen Qualitätsmanagementsystemen werde ich in weiterer Folge dieses Kapitels noch genau eingehen.
Als umfassendster Qualitätsmanagementansatz kann das so genannte "Total Quality Management" (TQM) angesehen werden, dass nach DIN EN ISO 9000:2000 folgendermaßen definiert wird:
"ein auf der Mitwirkung aller ihrer Mitglieder gestützte Managementmethode einer Organisation, die Qualität in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenstellung der Kunden auf langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitglieder der Organisation und für die Gesellschaft zielt." (Kaminske / Brauer 2003, S.322)
TQM zeichnet sich gegenüber anderen Qualitätskonzepten dadurch aus, dass es außerordentlich breit angelegt ist, in der Absicht, Qualität zur wichtigsten oder zumindest zu einer der wichtigsten Erfolgsdispositionen einer Organisation zu machen. TQM ist daher nicht nur Teil des Unternehmenskonzepts sondern, nimmt darin eine dominierende Stellung ein. Es kann durch vier zentrale Elemente charakterisiert werden, und wird von zahlreichen Autoren als besonders geeignet für soziale Dienstleistungsorganisationen betrachtet (vgl. Hodl 1998, S.99ff; Bungart / Supe / Willems 2001, S.28ff; Kaminske / Brauer 2003, S.322ff).
-
Das oberste Ziel ist in diesem Konzept die KundInnenorientierung einer Organisation sowie die Erfüllung von KundInnenerwartungen, wobei dies sowohl für "externe" als auch "interne" KundInnen gilt.
-
Die MitarbeiterInnenorientierung bedeutet in diesem Konzept, dass die MitarbeiterInnen auf allen Ebenen der Organisation dauerhaft für die Qualität der Dienstleistung verantwortlich sind. Dieser Ansatz impliziert einerseits eine Stärkung der Verantwortung jedes/jeder einzelnen MitarbeiterIn aber auch die spezifische Einbeziehung seiner Kompetenzen und Ressourcen.
-
Das Prinzip der Managementorientierung sieht Qualität als oberstes Organisationsziel und bezieht sich auf die Verantwortung der Leitungsebene zur Etablierung einer Qualitätskultur.
-
Die Prozessorientierung betont schließlich die kontinuierliche und dynamische Verbesserung des bestehenden Dienstleistungsangebotes. Qualitätssicherung und -entwicklung wird als Bestandteil der täglichen Arbeit verstanden, und nicht auf punktuelle Überprüfungen zu bestimmten Zeitpunkten reduziert. (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001, S.28f.)
Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Konzept Qualitätsmanagement ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt vor allem im Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung besonders relevant. Die im vorherigen Kapitel aufgezeigten Spannungsfelder für Einrichtungen der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit betreffen sowohl Arbeitsassistenz als auch Integrationsfachdienste in besonderem Maße, bewegen sie sich doch unmittelbar an der Nahtstelle zwischen der sozialen Dienstleistungsgesellschaft und der Wirtschaftswelt, und sind damit sämtlichen sozial- und arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen und Tendenzen besonders stark ausgesetzt. Trotz der allgemeinen Wirtschaftslage und der damit verbundenen hohen Arbeitslosigkeit haben diese Einrichtungen in beiden Ländern nachweisen können, dass sie konzeptionell in der Lage sind auch gegen einen allgemeinen Trend zunehmender Arbeitslosigkeit, Menschen mit Behinderung in Arbeit zu vermitteln und Arbeitsplätze zu sichern (vgl. Bungart 2003, S.1ff). Nach den erfolgreichen Modellphasen dieser beiden Projekte, sind diese Instrumente flächendeckend ausgebaut, in die entsprechende Regelförderung des jeweiligen Landes übernommen sowie in den für die berufliche Integration und Rehabilitation bestimmenden Gesetzen verankert worden. Das deklarierte Ziel dieser beiden Einrichtungen, nämlich die dauerhafte Integration von Menschen mit Behinderung in der Arbeitsmarkt, bedingt, durch die hohe Komplexität der Aufgabenstellung und der dadurch notwendigen Verbindungen zum gesamten institutionellen Umfeld sowie zu den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, zahlreiche Lern- und Professionalisierungsnotwendigkeiten im Sinne der vorangegangenen Erörterungen über Organisationsentwicklung, Organisationales Lernen und Qualitätsmanagement (vgl. Paulik 1999, S.145 & 166ff). Auch ist es bezeichnend, dass die in den letzten Jahren (sehr intensiv geführte) Qualitätsdiskussion über und innerhalb dieser beiden Institutionen zu einem Zeitpunkt einsetzte an dem die "Pionierphase" im Auf- und Ausbau dieser Dienste weitgehend als abgeschlossen bezeichnet werden konnte, und aus einer organisationstheoretischen Perspektive die Phase der "Konsolidierung" einsetzte. Diese Qualitätsdebatte konzentrierte sich aber vornehmlich auf quantitative Aspekte der Integrationsarbeit und dabei insbesonders auf die Vermittlungsquoten, so dass von Seiten der Einrichtungen zunehmend eine stärkere Berücksichtigung fachlicher Qualitätskriterien der Arbeit gefordert wurde. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Qualität wurde in beiden Ländern sowohl hinsichtlich der Ausgestaltung der Angebote als auch der zu erreichenden Ergebnisse thematisiert. Fragen wie: "Wie können wir gleichzeitig quantitativ und qualitativ erfolgreich arbeiten?" bzw. "ab wann steht das quantitative Ziel in einem diametralen Gegensatz zu hochqualitativer und vor allem nachhaltiger Arbeit?" standen dabei im Mittelpunkt der Diskussion sowie entsprechender Forschungsprojekte (vgl. Giedenbacher 2003, S.6). Wie im gesamten Bereich der sozialen Arbeit fehlt es allerdings bislang auch im Bereich der beruflichen Integration weitgehend (mit einigen Ausnahmen auf die ich anschließend eingehen werde) an entsprechenden Konzepten und Verfahren. Paulik (1999, S144) schreibt dazu:
"Jahresstatistiken, Berichte, Gutachten und Fallschilderungen werden überwiegend unter legitimatorischen Gesichtspunkten erstellt, eine inhaltliche Erörterung, die Reflexion der Probleme in einzelnen Phasen und kritische Analysen fehlen zumeist."
Seit einigen Jahren ist aber nunmehr eine aktivere Gestaltung der Qualitätsdebatte von Seiten der Einrichtungen und vor allem der übergreifenden nationalen Dachverbände zu beobachten, deren Ziel darin liegt, die Chancen, welche dieser Prozess ermöglicht, wie z.B. die transparente Darstellung der Ergebnisse nach außen oder die weitere Professionalisierung der eigenen Arbeit voranzutreiben, gezielt zu nutzen. Qualitätsmanagement kann und darf, so wird einheitlich betont, nicht mit Kosteneinsparung gleichgesetzt werden. Unter dem Stichwort "Qualität hat ihren Preis" wird eine einseitig unter dem Aspekt der Kostenreduzierung geführte Qualitätsdiskussion zugunsten einer fachlichen Perspektive abgelehnt (vgl. Bungart 2001, S.15; Bungart / Supe / Willems 2001b, S.184). Aus einer Qualitätsmanagementperspektive, die ausgehend von einem übergeordneten Ziel, welches in diesem Fall die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt darstellt, wird die Qualität der Leistung durch das Ausmaß der Zielerreichung bestimmt. Insofern muss, und in diesen Punkt herrscht auch unter allen Prozessbeteiligten weitgehende Übereinstimmung, der Faktor Vermittlung in der Beurteilung der Dienste (hoch) bewertet werden. Trotzdem sollte die Operationalisierung der Zielsetzung(en) und damit die Bewertung der Qualität sich auch auf die Rahmenbedingungen sowie auf die Dimensionen der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität beziehen um eine exakte Erfassung und Darstellung der tatsächlich erbrachten Dienstleistungsqualität zu ermöglichen. Gerade hierbei fehlen allerdings noch zum Großteil geeignete Indikatorensysteme, um solch differenzierte Bewertungen zu ermöglichen (vgl. Bungart 2002, S.20; Horak / Schmid 2003, S.11). Aber auch normative Standpunkte werden in die Qualitätsdiskussion eingebracht, so schreibt etwa Weiß (2002, S.51):
"Die Entscheidung über die Qualität der Arbeit ist auch von der Sichtweise von Menschen mit Behinderung (=Menschenbild) abhängig. Von zentraler Bedeutung sind dabei die ganzheitliche Sichtweise des Menschen und die Forderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des Lebens und damit auch das Recht auf "wirkliche" Arbeit mit "normaler" Entlohnung und "normalen" Arbeitsbedingungen, gemäß den Grundforderungen der "Supported Employment" Bewegung."
Die besondere Notwendigkeit von qualitätssichernden Maßnahmen für Fachdienste der beruflichen Integration lässt sich direkt aus der - sich aus der Aufgaben- und Zielgruppenbeschreibung erschließenden - Bedeutung von Vernetzung und Kooperation ableiten. Die Qualität der Leistungen eines Fachdienstes hängt somit zu einem wesentlichen Teil von der Qualität der Zusammenarbeit mit den relevanten KooperationspartnerInnen an verschiedenen Schnittstellen ab. Der Aufbau effektiver und effizienter Vernetzungsstrukturen - unter anderem mit Institutionen der öffentlichen- und der Arbeitsmarktverwaltung, mit abgebenden Einrichtungen wie Schulen, Qualifizierungsprojekten oder Beratungseinrichtungen, mit medizinischen und sozialen Rehabilitationsträgern, und vor allem mit Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes - erfordert qualifiziertes Personal und professionelles Management. In diesem Zusammenhang von mindestens ebenso so großer Relevanz stellt sicherlich die Klärung des Qualitätsverständnisses und der Ansprüche der unterschiedlichen Interessensgruppen dar. Geeignete Qualitätsmanagementkonzepte müssen daher sowohl den so genannten "Schnittstellenanalysen" zwischen dem Leistungsanbieter und den unterschiedlichen Leistungsabnehmern, sowie der Klärung der verschiedenen KundInnenbedürfnisse eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, um so eine multiperspektivische Qualitätssicherung und -entwicklung zu ermöglichen (vgl. Bungart 2001, S.15f; Bungart 2002, S.20; Fasching / Niehaus 2003, S.48ff). Dazu schreibt Barlsen (2001, S.61):
"Die effektiven Organisationsstrukturen von Fachdiensten bewegen sich demnach auf einem schmalen Grad zwischen Autonomie und Vernetzung. Auch wenn die optimale Balance letztendlich nur von jedem Dienst gesondert in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Institutionen zu erarbeiten ist, erscheint es notwendig Regelungen für die Arbeitsabläufe und -beziehungen zwischen Fachdienst, ihren Trägern und Kostenträgern zu bestimmen, die die dazu notwendigen Handlungsspielräume sicherstellen."
Unter einem Qualitätssicherungs- bzw. -Managementsystem wird nach DIN EN ISO 9000:2000:
"ein System für die Festlegung der Qualitätspolitik und von Qualitätszielen sowie zum Erreichen dieser Ziele"
verstanden.
"Dies ist die Gesamtheit der aufbau- und ablauforganisatorischen Gestaltung, sowohl zur Verknüpfung der qualitätsbezogenen Aktivitäten untereinander, wie auch im Hinblick auf eine einheitliche, gezielte Planung, Umsetzung und Steuerung der Maßnahmen des Qualitätsmanagements im Unternehmen." (Kaminske / Brauer 2003, S.210)
Es gibt keine einheitlichen Qualitätsmanagementsysteme. Aufbau und Umfang eines Systems hängen von den individuellen Zielsetzungen ab, die ein Unternehmen oder eine Organisation damit verbinden. Dazu kommen noch interne und externe Einflussfaktoren, spezifische organisatorische Abläufe sowie unterschiedliche Organisationsgrößen.
Hodl (1998, S.104) beschreibt den allgemeinen Aufbau eines Qualitätssicherungssystems anhand eines Pyramidenmodells wie folgt:
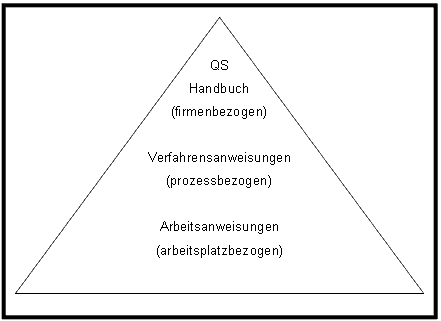
Abbildung 3: Ebenen eines Qualitätssicherungssystem (Hodl 1998, S.105)
An der Spitze der Pyramide werden die Ziele der Qualitätssicherung im Qualitätshandbuch zusammengefasst, und grundlegende Ausführungen zu Aufbau- und Ablauforganisation und den Bestandteilen des Qualitätssicherungssystems gemacht. Die mittlere Ebene der Verfahrensanweisungen soll eine detaillierte Beschreibung eines SOLL Konzepts für die Ablauforganisation liefern, sowie einen Überblick über die zu regelnden Prozesse geben. Auf der untersten Ebene werden schließlich Arbeitsanweisungen für die einzelnen Arbeitsplätze gegeben (vgl. Hodl 1998, S.104f).
Ferner liefert Hodl in Anlehnung an Porter / Parker (1993) Bedingungs- bzw. Erfolgsfaktoren die für die erfolgreiche Erarbeitung und Implementierung von Qualitätskonzepten unerlässlich sind. Zu den wichtigsten auch im Hinblick auf soziale Dienstleistungen zählen:
-
Das Verhalten des Managements bzw. der Leitung, welche ein klares (nicht delegierbares) Bekenntnis ablegen müssen, sich aktiv an Qualitätsprozessen zu beteiligen.
-
Es muss eine Strategie zur Implementierung vorhanden sein, welche die zu erreichenden Ziele und die Anforderungen an das Qualitätssystem definiert.
-
Es benötigt eine entsprechende Organisation für die Umsetzung sowie klare Zuständigkeiten, Koordination und Transparenz.
-
Die Strategie muss durch gut entwickelte Kommunikationskanäle an alle MitarbeiterInnen kommuniziert werden, sowie durch permanente Rückkoppelungsschleifen die dadurch erhaltenen Informationen gezielt einarbeiten.
-
Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen soll sowohl den aktuellen als auch durch den Qualitätsprozess zukünftig erwartbaren Weiterbildungsbedarf abdecken.
-
Für den Erfolg maßgeblich ist die aktive Einbindung aller MitarbeiterInnen entsprechend ihren individuellen Ressourcen. (Vgl. Hodl 1998, S.106f)
Vor allem der Faktor der MitarbeiterInnen Einbeziehung muss in sozialen Handlungsfeldern als besonders maßgeblich eingestuft werden. Geschieht dies nicht in ausreichendem Maße, erscheint Qualitätssicherung lediglich als "von oben" aufgesetzt, wird zu einem reinen Marketinginstrument nach außen und führt nicht zu einer tatsächlichen fachlichen Verbesserung. Nach Bungart (2003, S.3) würde dadurch:
"die Professionalität der MitarbeiterInnen nicht ernst genommen, das Konzept Qualitätsmanagement ausgehöhlt und damit die Chancen zur Professionalisierung, die in ihm liegen, nicht genutzt. Gerade in sozialen Arbeitsfeldern ist Qualitätsmanagement nicht ohne Personalentwicklung denkbar."
Zum Abschluss des vorigen Kapitels bin ich auf die Anforderungen eingegangen, die bei der Neuentwicklung bzw. dem Aufbau oder der Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems berücksichtigt werden sollten, diese gelten natürlich auch ganz besonders im Bereich der beruflichen Integration. Eine Vielzahl an vornehmlich größeren Trägern von Arbeitsassistenz oder Integrationsfachdiensten haben zum Teil als Antwort auf gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen von externen AbnehmerInnen oder schlichtweg aus strategischen Gründen bereits Qualitätsmanagementsysteme (mit oder ohne Zertifizierung) eingeführt. Da die meisten dieser angewendeten Verfahren aus dem Bereich der Wirtschaft und der Industrie stammen, werde ich nun folgend die wichtigsten dieser Systeme mit dem Fokus ihrer Anwendbarkeit und Nützlichkeit insbesondere in Einrichtungen der beruflichen Integration kurz vorstellen.
Die in den 80er Jahren von der "International Standardisation Organisation" (ISO) entwickelten DIN EN ISO Normenreihen zählen zu den eher verfahrensorientierten Ansätzen - und werden dementsprechend im Bereich der sozialen Arbeit häufig kritisiert. Trotzdem haben sich zahlreiche Institutionen dazu entschlossen dieses System anzuwenden. Als zentralen Grund für die Beschäftigung mit den ISO Normen nennt Vilain (vgl. 2003, S.24) den Willen die "begehrte Zertifizierung" zu erhalten, welche durch eine entsprechend autorisierte Gesellschaft in einem Zertifizierungsverfahren - dem so genannten Audit - erteilt wird. Es wurde und wird ISO nachgesagt ein mechanisches und technisches Verständnis von Qualität zu haben, da es sich lediglich an zuvor festgelegten Funktionserfordernissen eines Produktes oder einer Dienstleistung orientiert. Es ist in den letzten Jahren allerdings zu einer wesentlichen Veränderung der jeweiligen Normenreihen gekommen, die nun eine stärkere Ausrichtung an den Prinzipien des TQM mit den zentralen Parametern der Management-, Prozess-, KundInnen- und MitarbeiterInnenorientierung berücksichtigt (vgl. Vilain 2003, S.24ff; Kaminske / Brauer 2003, S.68ff). Des Weiteren fand eine Reduktion und Vereinfachung der Normen statt, die sich nunmehr an vier Primärstandards orientieren, welche in einem systemtheoretischen Regelkreislauf sich wechselseitig beeinflussen.
-
Die Verantwortung der Leitung umfasst die Verpflichtung das QM System aufzubauen, aufrecht zu erhalten und ständig weiterzuentwickeln. Ferner ist die Leitung zuständig für die Umsetzung einer umfassenden KundInnenorientierung und mit einer geeigneten Qualitätspolitik betraut, sowie mit der Aufstellung von mess- und überprüfbaren Qualitätszielen und Forderungen für alle Bereiche, die gegebenenfalls geändert werden können. Außerdem ernennt die oberste Leitung einen Beauftragten für Qualitätsfragen, der u.a. für den Ablauf und die interne Kommunikation zuständig ist.
-
Das Management der Mittel bezieht sich auf die Ermittlung, Festlegung und Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel, des entsprechenden Personals, der Einrichtungen und der Arbeitsumgebung.
-
Der Bereich Produktrealisierung umfasst die Planung und Einführung der notwendigen Prozesse zur konkreten Ausgestaltung der Dienstleistung. Bei kundInnenbezogenen Prozessen müssen die KundInnenanforderungen ermittelt und bewertet sowie die Kommunikation mit den KundInnen gewährleistet sein.
-
Den Abschluss eines jeweiligen Zyklus und gleichzeitig den Beginn eines neuen stellt der Bereich Messung, Analyse und Verbesserung dar. (Vgl. Vilain 2003, S.26ff)
Dieser interne Kreislauf ist wiederum in einen übergeordneten Kreislauf eingebettet, der mit der Erfassung der Forderungen bzw. Erwartungen der KundInnen beginnt, über die Realisierung der Dienstleistung führt, und der sich mit der Erfassung und Auswertung der KundInnenzufriedenheit wieder in den internen Kreislauf einspeist.
Die Zertifizierung nach der ISO Normenreihe bietet für Organisationen die Möglichkeit den Nachweis über die Existenz eines QM Systems zu erhalten. Dazu bedarf es allerdings einer sehr fantasiereichen - mit viel personellem und finanziellen Aufwand verbundenen - Übersetzung aus der Welt der großbetrieblichen Produktion, in die meist klein- oder mittelbetrieblich strukturierte soziale Dienstleistungslandschaft. Dies stellt sich trotz eines mittlerweile existierenden "Leitfadens für Dienstleistungen" meist als ein sehr schwieriger, mit pädagogischen Ansprüchen und Standards schwer vereinbarer, Prozess dar. Als meist sehr nützlich erweist sich die Erstellung eines Qualitätshandbuches, in welchem die zentralen Prozesse und Abläufe niedergeschrieben werden (vgl. Franz 1999, S.16ff). Insbesondere für NutzerInnen bleibt aber festzuhalten, dass diese Zertifizierung nur etwas über die Qualitätsfähigkeit einer Organisation aussagt, jedoch keinen Nachweis über die tatsächliche Qualität der Dienstleistung liefert. Außerdem ist nach Kolbe (vgl. 2000, S.21) zu sagen, dass ein Zertifikat auch auf der Basis von Mindeststandards ausgestellt wird.
Von zahlreichen Autoren wird das so genannte EFQM Modell als eines, für den Bereich der sozialen Dienstleistungen weitaus geeigneteren Verfahren angesehen, da es sich zentral an der Philosophie des TQM orientiert. Dieses Modell wurde 1992 von der "European Foundation for Quality Management" als Basis für die jährliche Verleihung des europäischen Qualitätspreises[30] entwickelt und zählt seitdem zu den allgemeinen Referenzmodellen für Qualitätsmanagement (vgl. u.a. Franz 1999, S.19ff; Schiersmann / Thiel / Pfizenmaier 2001, S.25ff; Schwan / Kohlhaas 2002, S.25ff; Langnickel 2003, S.38ff; Kaminske / Brauer 2003, S.180ff). Das Europäische Qualitätsmodell stützt sich auf ein Grundmodell von neun Bewertungsbereichen, welche die Schlüsselmerkmale wiederspiegeln nach denen eine hervorragende Organisation geführt wird. Zur Bewertung der Organisationen sind die Bereiche in die so genannten Befähiger- und Ergebniskriterien aufgeteilt, auf die jeweils 50% der möglichen Punkte entfallen. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Modell der Organisationsentwicklung, das konkret auf der Idee der Lernenden Organisation basiert. Aus der folgenden Abbildung sind die jeweiligen Bereiche und der ihnen zugehörige Punktewert abzusehen:
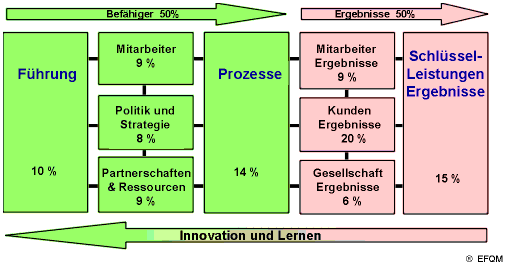
Abbildung 4: Das EFQM Modell für Exzellenz (vgl. Online Verwaltungslexikon im Internet unter URL: http://www.olev.de/ )
Durch dieses Modell soll die Vision des TQM auf den Boden der Unternehmensrealität heruntergebrochen werden. Kern des Verfahrens ist ein systematischer Selbst - Bewertungsprozess, der als der entscheidende Wert des gesamten Modells gesehen wird, da im Rahmen dieser Selbstbewertung gezielt die betroffenen Organisationen zu Beteiligten gemacht werden. Es existieren zahlreiche, unterschiedlich umfangreiche Methoden der Selbstbewertung, die Wahl einer Methode hängt von der aktuellen Ausgangssituation einer Organisation in Bezug auf die bereits erreichte Qualitätskultur, den zur Verfügung stehenden Ressourcen und den gewünschten Ergebnissen ab. Im externen Begutachtungsprozess werden die eingereichten Unterlagen von speziell ausgebildeten Assessoren begutachtet, die entscheiden, in welchen Unternehmen Audits durchgeführt werden. Die Neufassung des Europäischen Qualitätsmodells, welches nunmehr "EFQM für Exzellenz" heißt, beinhaltet auch eine neue Bewertungsmethode, die nach ihren Anfangsbuchstaben "RADAR" genannt wird. Das RADAR Konzept setzt sich aus vier Prozesselementen zusammen, mit deren Hilfe die einzelnen Bewertungsfelder (wie von einem Radarschirm) abgetastet werden:
-
Result (Ergebnisse)
-
Approach (Vorgehen)
-
Deployment (Umsetzung)
-
Assessment and Review (Bewertung und Überprüfung)
Dieses Konzept legt einer Organisation folgende Vorgehensweise nahe:
-
Sie sollte Ergebnisse definieren, die sie aufgrund ihrer Politik und Strategie erzielen möchte.
-
Sie sollte entsprechende Vorgehensweisen planen und entwickeln, um gegenwärtig und zukünftig die geforderten Ergebnisse zu erzielen.
-
Sie sollte diese Vorgehensweise systematisch umsetzen und so ihre möglichst weitreichende und umfassende Realisierung sicherstellen.
-
Sie sollte ihre konkreten Vorgehensweise und deren Umsetzung kontinuierlich bewerten und überprüfen, um daraus mögliche Verbesserungen zu identifizieren, zu priorisieren, zu planen und einzuführen. (Vgl. Langnickel 1999, S.25ff; Schwan / Kohlhaas 2002, S.31f; Kaminske / Brauer 2003, S.184f).
Aus dem Blickwinkel sozialer Dienstleitungen bleibt festzuhalten, dass das EFQM Modell geeignet erscheint, tatsächlich zu einer Qualitätsverbesserung beitragen zu können. Es basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, welcher nach der Qualität von Leistungen, Prozessen und Organisationen gleichermaßen fragt und auf deren Verbesserung ausgerichtet ist. Das Modell ist offen für eine breite Beteiligung der MitarbeiterInnen und legt deren Zufriedenheit auch als Kriterium fest. Es ist flexibel anwendbar, kann schrittweise eingeführt werden und hält die Kosten durch den Wegfall der Zertifizierungsausgaben geringer. Es existieren außerdem bereits einige - von der "FREY Akademie" entwickelte - an EFQM angelehnte Modelle, die speziell für den Sozial- und Gesundheitsbereich entwickelt wurden. Dazu zählt unter anderem das Modell "QAP" (Qualität als Prozess). Aber auch diese Vorteile dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit der Einführung eines solchen Systems ebenfalls eine Menge an personellen Ressourcen (zum Teil dauerhaft) gebunden werden, und dass die Übersetzung in die konkrete Organisationsrealität gerade für kleinere Einrichtungen in der Anfangsphase meist nicht ohne eine(n) externe(n) BeraterIn gelingt. Außerdem macht die Tatsache, dass es bislang kein Zertifikat gibt, das Modell als Marketinginstrument nach außen weniger relevant. (vgl. Franz 1999, S.18f; Langnickel 2003, S.45ff).
Die Balanced Scorecard kann als ein betriebswirtschaftliches Qualitätscontrolling Instrument aufgefasst werden. Eine einfache Definition für Controlling liefert Koch (2003, S.15):
"Controlling unterstützt alle Leitungskräfte einer Organisation durch die Aufbereitung von Informationen, die Bereitstellung von betriebswirtschaftlichem Methodenwissen und die Prozessbegleitung bei der Optimierung betrieblicher Entscheidungen."
Als weitere wichtige Unterscheidung ist die Trennung zwischen operativem und strategischem Controlling zu verstehen. Während das operative Controlling meist nur auf einen kurzfristigen Planungshorizont aufbaut und sich weitestgehend mit Kostenrechnung beschäftigt, bedeutet strategisches Controlling Beobachtung und Beeinflussung von gegenwärtigen und zukünftigen Marktbedingungen um so eine langfristige Existenzsicherung sicherzustellen. In eine derartige Analyse fließen auch nicht messbare Faktoren, wie Wertewandel oder rechtliche Rahmenbedingungen mit ein (vgl. Koch 2003, S.15f).
Bei der von Kaplan und Norton Anfang der 90er Jahre entwickelten Balanced Scorecard (BSC) handelt es sich um ein kennzahlenbasierendes strategisches Steuerungsinstrument, das neben monetären auch nicht monetäre Leistungsmessgrößen in die Ausrichtung eines Organisation einbezieht. Sie verkoppelt Ziele und Maßnahmen im Sinne von Ursache-Wirkungsbeziehungen und will damit die "Erfolgsrezepte" einer Organisation dokumentieren und überprüfbar machen. Zusammengefasst will die BSC zu einer höheren Transparenz des Leistungserstellungsprozess und somit zu einer effektiveren Steuerung beitragen (vgl. Scherer 2002, S.13). In ihrem Grundkonzept haben die Entwickler vier Perspektiven vorgeschlagen, und zwar (1) Finanzen, (2) KundInnen, (3) Prozesse sowie (4) Lernen und Entwicklung. Dabei soll es sich um einen offenen und formalen Denkrahmen handeln, dessen inhaltliche Kategorien - sowie geeignete Indikatoren für jede Kategorie - auf die konkrete Anwendungssituation einer Organisation zugeschnitten werden müssen. Die jeweiligen Maßnahmen müssen aus der Strategie und der Vision einer Einrichtung abgeleitet werden. Für NGO´s ist dies weniger die Gewinnmaximierung, sondern die Akzeptanzsicherung bei ihren wesentlichen Anspruchsgruppen. Dadurch ergibt sich auch die Relevanz für soziale Dienstleistungen (vgl. Scherer 2002, S.13ff; Kaminske / Brauer 2003, S.197f).
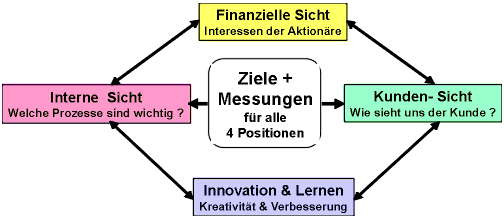
Abbildung 5: Balanced Scorecard als Rahmen zur Operationalisierung der Strategie (vgl. Online Verwaltungslexikon im Internet unter URL: http://www.olev.de/)
Das Konzept hilft dabei, eine Verbindung zwischen grundlegenden strategischen Organisationszielen und operativer Steuerung herzustellen, indem es den Blick über die Finanzen auf weitere Perspektiven lenkt. Dadurch kann eine konkrete Verständigung der Organisationsziele erfolgen und eine Bündelung der Anstrengungen in Richtung auf gemeinsam definierte Ziele. Es setzt allerdings zur Umsetzung professionelle Organisationsstrukturen, eine explizite strategische Planung und eine bewusste Auseinandersetzung mit den Organisationszielen voraus. Dabei handelt es sich allerdings durchwegs um Bereiche in denen viele soziale Einrichtungen noch erhebliche Defizite aufweisen. Die Kosten und der damit verbundene Aufwand sind also maßgeblich vom Entwicklungsstand der Organisationen abhängig. Wird es erfolgreich angewendet, kann es auch im sozialen Bereich insbesondere einer zielorientierten Verwendung von zumeist begrenzten Ressourcen dienen (vgl. Koch 2003, S.19ff).
Benchmarking bezeichnet einen Prozess des systematischen und verbesserungsorientierten Vergleichs zwischen Organisationen, Unternehmen oder auch Ländern. Durch einen solchen Vergleich sollen Unterschiede und Leistungslücken zur eigenen Organisation erkannt und Möglichkeiten zur Verbesserung aufgezeigt werden. Gegenstände des Vergleichs können Produkte, Methoden, Prozesse oder Dienstleistungen sein, die hinsichtlich der Kosten, der Qualität, des Zeitaufwand und der KundInnenzufriedenheit mit den Leistungen anderer Organisationen verglichen werden. Ziel des Benchmarking ist es durch diesen Vergleich zu lernen, die wirkungsvollsten Methoden ("Best Practice") herauszufinden, zu adaptieren und somit die eigene Position zu steigern und zu verbessern. Im Bereich der Privatwirtschaft ist Benchmarking als ein Verfahren etabliert worden, wie Unternehmen aus Geschäftsprozessen anderer Unternehmen, darunter vor allem auch Firmen fremder Branchen, für die Optimierung der eigenen Abläufe lernen können. In diesem Kontext ist Benchmarking ein Management Werkzeug, das neben anderen Instrumenten zur Stärkung der Markt- und Wettbewerbsposition eingesetzt wird. Dabei ist Benchmarking ein dynamischer Prozess, der als stetiger Lernprozess organisiert werden sollte (vgl. Patterson 1996, S.13f; Hackenberg 2001, S.13; Haubrock / Gohlke 2001, S.18f; Kaminske / Brauer 2003, S.10f).
Es werden grundsätzlich drei Arten des Benchmarking unterschieden:
-
Internes Benchmarking innerhalb einer Organisation.
-
Wettbewerbsorientiertes Benchmarking mit externen Organisationen welche die gleiche oder eine ähnliche Dienstleistung erbringen.
-
Funktionales Benchmarking in einem branchenübergreifenden Vergleich mit Unternehmen die eine Dienstleistung hervorragend beherrschen. (vgl. Kaminske / Brauer 2003, S.12f)
Unabhängig von der Art des Benchmarking lässt sich der grundsätzliche Ablauf des Benchmarking-Prozesses in fünf Phasen einteilen, die sich wiederum in Unterschritte zergliedern lassen. Ohne die einzelnen Phasen an dieser Stelle exakt zu definieren, werden sie als (1) Planungsphase, (2) Analysephase, (3) Integrationsphase, (4) Umsetzungsphase und (5) Reifephase bezeichnet (vgl. Kaminske / Brauer 14f).
Gerade im Kontext der beruflichen Integration wird das Instrument Benchmarking oft von Seiten der öffentlichen Verwaltung verwendet, um einen Vergleich unter den unterschiedlichen Anbietern herstellen zu können. Dabei beschränkt sich dieses Benchmarking analog zur Erfolgsmessung, aber zumeist auf einen Vergleich der so genannten "Hard Facts". Nach Hackenberg (2001, S.38) darf aber ein Benchmarking
"nicht alleine deshalb erfolgen, weil es der Zeitgeist angeblich erfordert (...) Beschäftigungsförderung ist in Deutschland in den letzten Jahren mit zahlreichen Neuerungen, innovativen Ansätzen, Modellen und Experimenten konfrontiert worden. Die vielfach offenkundig gewordenen Begrenztheit traditioneller Verfahren und Strukturen hat bundesweit Nachdenken, Veränderungen, Experimentieren und innovative Praxis ausgelöst, die bislang nur wenig systematisch bewertet worden ist."
In diesem Zusammenhang kann Benchmarking bei drei Zielen behilflich sein:
-
Es kann erfolgreiche Praxisansätze sichtbarer und bewertbarer machen.
-
Es kann den Lernprozess systematisieren und damit wirksamer machen.
-
Es kann den Wettbewerb um die "Best Practice" im Hinblick auf Erfolg und Qualität fördern und in strukturierte Bahnen lenken. (Vgl. Hackenberg 2001, S.38f)
Um diese Ziele zu ermöglichen muss Benchmarking aber über den Vergleich bloßer Kennzahlen und Leistungsindikatoren hinausgehen, welche zumeist nur (wenig aussagekräftige) Anhaltspunkte für die Bestimmung von Ursache-Wirkungsanalysen ermöglichen. In einer von der "Bertelsmann Stiftung" (vgl. Hackenberg 2003) durchgeführten Benchmarking Untersuchung über die Arbeitsmarktförderung in verschiedenen europäischen Staaten (darunter auch Österreich und Deutschland) wurde neben einem "quantitativen" auch ein "qualitatives Benchmarking" durchgeführt. Dazu schreibt Hackenberg (2003, S.28f):
"Ein "Lernen von den Besten" ist nur möglich, wenn die Teilnehmer in einen Austausch über qualitative Aspekte eintreten. Die Bedeutung dieses Austausches für die Initiierung von Lernprozessen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden."
Die Eckpunkte eines qualitativen Benchmarkingverfahren wurden in dieser Untersuchung in den folgenden Schritten wiedergegeben:
-
Eingrenzung des Themenfeldes für die Struktur- und Prozessanalyse
-
deskriptive Darstellung der Strukturen und Prozess durch die TeilnehmerInnen
-
Vergleichsanalyse
-
Entwicklung von Schlussfolgerungen unter Einbeziehung der Kennzahlenergebnisse für die Leistungsqualität zur Identifizierung von "Best Practice"
-
Ableitung von Schlussfolgerungen für eine optimale organisatorische Gestaltung des Leistungserstellungsprozess
-
Neuformulierung von Strategien und Überarbeitung von Konzepten. (Vgl. Hackenberg 2003, S.29)
Die aus diesen Schritten gewonnen Ergebnisse können sein:
-
Ein Stärken- und Schwächenprofil der TeilnehmerInnen.
-
Entwicklung von Qualitätskennzahlen.
-
Leitfaden für eine gute Praxis und Handlungsempfehlungen.
-
Änderung der Schwerpunktsetzung bezüglich der Zielgruppen und Instrumente. (Vgl. Hackenberg 2003, S.29f)
Ein derartig verstandenes und durchgeführtes Benchmarking Verfahren erscheint aus dem Blickwinkel sozialer Organisationen, und vor allem der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung, als besonders relevant, da es sowohl den Lern- und Verbesserungsaspekt aller beteiligten Akteure fokussiert und außerdem eine differenzierte Darstellung von Qualität und Erfolg gewährleistet.
Zum Abschluss des theoretischen Teils dieser Diplomarbeit werde ich nun drei Instrumente bzw. Systeme zum Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration vorstellen, auf deren Entstehungshintergrund ich bereits in den vorigen Kapiteln eingegangen bin.
Das QUIP Evaluationshandbuch ist neben den "Qualitätskriterien aus der Sicht der unterschiedlichen Prozessbeteiligten" das wichtigste Produkt dieses Projektes und baut auch auf ihnen auf. Es richtet sich primär an Fachdienste der beruflichen Integration, die an einer Evaluierung der eigenen Arbeit sowie einer fortlaufenden Qualitätsverbesserung interessiert sind. Das Evaluationshandbuch ist in erster Linie als ein Instrument zur Selbstevaluation von Diensten konzipiert, und liefert dafür zahlreiche Instrumente und Methoden, die aber auch von "Außenstehenden in eine systematische Evaluation integriert werden können. Die Entscheidung ob die Evaluation intern oder extern durchgeführt wird, ist letztendlich von den vorhandenen Ressourcen abhängig. Der Aufbau des Handbuches ist analog zu Projektgestaltung jeweils einer Gruppe von Prozessbeteiligten gewidmet, und beschäftigt sich mit den für diese Gruppe spezifischen Qualitätskriterien, die im Laufe des Projektes identifiziert wurden. Die ersten drei Kapitel sind den HauptkundInnen der Dienstleistung Unterstützte Beschäftigung gewidmet, und zwar den Arbeitssuchenden, den ArbeitgeberInnen sowie den politischen Entscheidungs- und FinanzgeberInnen. Mit der Rolle der dienstleistungserbringenden ArbeitsassistentInnen und LeiterInnen befassen sich die beiden nächsten Kapitel. Den Abschluss bildet das Kapitel "die PartnerInnen an einem Tisch" an dem sämtliche Ergebnisse zusammengetragen, diskutiert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden sollen. Für jede Gruppe von Prozessbeteiligten sind in den Kapiteln unterschiedliche Instrumente und Methoden (Fragebögen, Interviewleitfäden, Workshops) entwickelt worden, um den NutzerInnen des Handbuches die Möglichkeit zu geben zu überprüfen, ob die in QUIP entwickelten Qualitätskriterien in der eigenen Organisation erfüllt werden. Die Methoden werden von den Autoren als qualitativ offener Ansatz angesehen, die darauf abzielen, unterschiedliche Meinungen einzuholen und auf dieser Grundlage Qualitätsentwicklung zu ermöglichen. Ferner ist das Evaluationshandbuch so aufgebaut, dass es den Fachdiensten ermöglicht, jeweils zu entscheiden, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Einschätzung einzelner Gruppen interessiert ist, oder ob es sich gleich ein umfassendes Bild machen will. Die einzelnen Instrumente sind also derart gestaltet, dass sie flexibel und variabel einsetzbar sind (vgl. Giedenbacher / Stadler-Vida / Strümpel 2003, S.6ff).
Das "Modulsystem umfassende Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste" (MUQ) wurde im Rahmen des im Kapitel 4.4.3. bereits beschriebenen Modellprojekts "Qualitätssicherung und -entwicklung in Integrationsfachdiensten" entwickelt und stellt ein modulares in sich geschlossenes QM - System dar, auf welches ich nun genauer eingehen werde. Die Bezeichnung "Umfassendes Qualitätsmanagement" deutet an, dass dieses Modell in der Tradition einer TQM Philosophie steht, demzufolge:
"Qualitätsmanagement sich nicht nur auf die Überprüfung der Arbeitsergebnisse (Ergebnisqualität) bezieht, sondern den gesamten Fachdienst betrifft. Es werden sowohl die Arbeitsprozesse (Prozessqualität) und die dahinter stehenden Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen (Strukturqualität) mit in den Blick genommen, als auch nach Möglichkeit die Interessen aller am Integrationsprozess beteiligten Gruppen berücksichtigt." (Bungart / Supe / Willems 2001, S.187)
MUQ ist in mehrere Module gegliedert, die bestimmten Modulsystemen oder -ebenen zugeordnet sind, dies sind die so genannten (1) Basismodule, (2) Arbeitsstandardmodule, (3) Rahmenmodule sowie (4) das Modul Audit, externer Beratung und Evaluation (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.34 & 2001b, S.187).
Ad 1.) Zu den Basismodulen zählen in MUQ die einzelnen Module "Leitbild", "arbeitsleitende Prinzipien", "Kundenorientierung" sowie "Vorgaben der Leistungsträger", die allesamt grundlegende Orientierungspunkte für die Ausgestaltung der eigenen Arbeit darstellen und daher am Anfang des Qualitätsmanagementprozesses stehen.
Unter einem Leitbild wird die Darstellung von übergeordneten Werten und Zielen einer Einrichtung verstanden, das einen verbindlichen Rahmen für alle MitarbeiterInnen eines Dienstes darstellt. Im Rahmen des Qualitätsmanagements kommt dem Leitbild eine steuernde Funktion, die sich in vier Aspekten ausdrückt: es wird (1) das Profil der Einrichtung herausgearbeitet und geschärft, dient (2) zur Motivation der MitarbeiterInnen in dem es einen gemeinsamen Wertekomplex beschreibt, es spezifiziert (3) den organisatorischen Rahmen eines Dienstes und schafft (4) richtungweisende Kriterien für alle fachlichen Strukturen und Prozesse (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a; S.36f & 2001b, S.189f).
Im Modul Arbeitsleitende Prinzipien erfahren die im Leitbild formulierten Grundsätze eine Konkretisierung, indem über eine Aufstellung allgemein akzeptierter fachlicher Richtlinien eine Annäherung an die Abläufe im Arbeitsalltag hergestellt wird, ohne allerdings bereits konkrete Handlungsleitlinien zu beschreiben. Hauptfokus dieser Prinzipien bildet die "Art und Weise der Zusammenarbeit mit den zentralen Zielgruppen" (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.38f & 2001b, S.190f).
Das Modul Kundenorientierung beinhaltet keine konkrete Vorgehensweise, sondern bedeutet grundsätzlich die Strukturen und Tätigkeiten der Fachdienstarbeit an den Erwartungen und Bedürfnissen derjenigen Personen zu orientieren, welche die Angebote des Dienstes nutzen oder mit ihm kooperieren. Auf die Kundenorientierung im engeren Sinn entfallen sämtliche Tätigkeiten, welche sicherstellen, dass die Interessen und Bedürfnisse der Hauptkundengruppen, NutzerInnen und Betriebe angemessen erfüllt werden. Dabei sollen sie eine Einflussmöglichkeit sowohl auf die Gestaltung der Leistung als auch auf die Bewertung der erbrachten Leistung haben. Dies verlangt vom Fachdienst natürlich Wege zur Erschließung von Kundeninteressen zu entwickeln, sowie die systematisch erhobenen Kundenerwartungen ausreichend zu berücksichtigen (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.39f & 2001b, S.191f).
Ebenso stellt das Modul Vorgaben der Leistungsträger und Träger eher Anforderungen an die Fachdienstarbeit auf, sich mit den Vorgaben, die auf Basis der gesetzlichen Grundlagen bestimmte fachliche Rahmenbedingungen aufstellen, auseinanderzusetzen, und diese ausreichend zu berücksichtigen. Es wird die Empfehlung ausgesprochen von Anfang regelmäßige Koordinierungstreffen zu planen und durchzuführen sowie Leitlinien für die Fachdienstarbeit zu erstellen (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.42ff & 2001b, S.193f).
Ad 2.) Die Arbeitsstandardmodule gelten als zentrales Instrument im Rahmen der Qualitätssicherung. Sie orientieren sich an einem Qualitätsbegriff,
"der sich nicht auf strukturelle und formale Aspekte für die Erbringung einer Dienstleistung beschränkt (z.B. DIN ISO Norm), sondern ausdrücklich fachlich inhaltliche Kriterien des Integrationsprozesses als Ausgangspunkt aller Qualitätsbemühungen nimmt." (Bungart / Supe / Willems 2001b, S.195)
Im Mittelpunkt der Bemühungen steht hier also ausdrücklich die Bestimmung der Prozessqualität. In Anlehnung an das Phasenmodell der beruflichen Integration, werden analog vier zentrale Arbeitsfelder innerhalb der Fachdienstarbeit beschrieben.
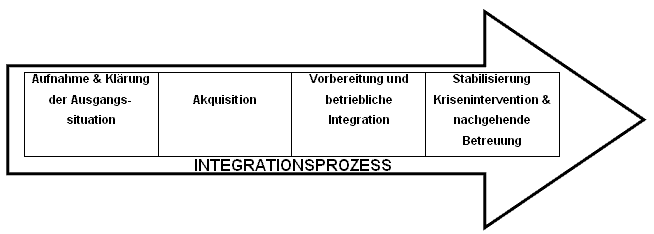
Abbildung 6: Die vier Arbeitsfelder des Integrationsprozesses (Vgl. Bungart / Supe / Willems 2001c, S.65)
Pro Arbeitsfeld sollen vier bis sechs Standards erarbeitet werden, wobei die Autoren betonen dass diese "fachdienstspezifisch" zu entwickeln sind, um auf unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Rahmenbedingungen eingehen zu können. In der in MUQ verwendeten Definition setzt sich ein "Arbeitsstandard" aus drei Hauptelementen zusammen:
-
einem "Leistungsziel" ("Was soll erreicht werden?"),
-
mehreren "Handlungsleitlinien" um dieses Ziel zu erreichen ("Wie kann das Leistungsziel effizient erreicht werden ?"), sowie
-
mehreren "Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung" ("Woran ist zu erkennen, dass das Leistungsziel erreicht wurde?"). (Vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.44f & 2001b, S.196f)
Bei den Leistungszielen handelt es sich um Zielsetzungen innerhalb des Dienstleistungsprozesses, welche konkrete zukünftige Zustände oder Ereignisse beschreiben, die durch Handeln erreicht werden sollen. Diese Ziele sind innerhalb eines Teams in gemeinsamer Reflexion auszuhandeln und in Ober- und Unterziele zu gliedern. Dadurch entstehen so genannte "Zielbäume" die letztlich zur Identifizierung des übergeordneten Leistungsziels führen. Im Rahmen des Modellprojekts hat die Evaluation der Leistungsziele ergeben, dass die intensive Auseinandersetzung mit den Zielen der eigenen Arbeit - bereits im Reflexionsprozess - zu einigen positiven Aspekten (z.B. Strukturierung der Arbeit, Begriffs- und Zielklärung innerhalb des Teams, Erkennen eigener Stärken in der Integrationsarbeit, etc.) beigetragen hat (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.47ff & 2001b, S.197ff).
Bei der Bestimmung der Handlungsleitlinien können die vorher angesprochenen Unterziele bereits gezielt genutzt werden, da sie in einer "Ziel-Mittel-Relation" als Mittel zur Erreichung des Leistungsziels angesehen werden können. In der Formulierung der Leitlinien ist darauf zu achten, dass eine Balance zwischen "Allgemeinheitsgrad" und "Spezifität" erreicht wird, damit sie zwar als relevante Strukturierungshilfe dienen, aber dennoch die notwendige Flexibilität der Ausgestaltung der Arbeitsprozesse nicht einschränken sollen (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.53ff & 2001b, S.202ff).
Den abschließenden Schritt bilden die Überlegungen, welche Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung eingesetzt werden können. Als Voraussetzung um entsprechende Verfahren zur entwickeln und effizient einsetzen zu können, müssen die Leistungsziele eindeutig formuliert und operationalisiert worden sein. Die Verfahren sollten vor allem zwei Kriterien erfüllen, nämlich sowohl "(zeit)ökonomisch einsetzbar" als auch "alltagstauglich" zu sein. Als Möglichkeiten bieten sich hierbei sowohl der Einsatz von "Checklisten", als auch das "Einholen persönlicher Rückmeldungen" an (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.56ff & 2001b, S.205ff).
Durch die Struktur der Arbeitsstandards und den darin enthaltenen fachlich inhaltlichen Kriterien, so formulieren die Autoren, wird es den FachdienstmitarbeiterInnen möglich, nicht nur quantitative Erfolge wie die Vermittlungsquote zu beschreiben, sondern auch explizit qualitative Ergebnisse darzulegen. Dadurch könnte eine einseitige Ausrichtung an quantitativen Kriterien grundsätzlich vermieden werden (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001b, S.215).
Ad 3.) Während die Basismodule grundlegende Vorgaben für die Entwicklung von Arbeitsstandards dargestellt haben, beschreiben die Rahmenmodule "Mitarbeiter-", Management-" und "Außenorientierung" Zielsetzungen bzw. Werthaltungen die für die Gestaltung des gesamten Qualitätsmanagementprozess von Bedeutung sind. Diese orientieren sich großteils an den Grundsätzen des TQM und werden von mir daher an dieser Stelle nicht mehr detailliert beschrieben (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, S.68ff & 2001b, S.217ff).
Ad 4.) Im abschließenden Modul Audit, externe Beratung und Evaluation werden Elemente vorgestellt, die sowohl den Aufbau als auch die kontinuierliche Pflege und Verbesserung des gesamten Qualitätsmanagementsystems betreffen. Ich möchte hier nur noch kurz auf den Begriff des "Audit" eingehen, wie er im Rahmen des MUQ Systems verwendet wird. Unter dem Auditbegriff wird hier folgendes verstanden:
-
Audits sind regelmäßige Überprüfungen zur Zielerreichung in den Fachdiensten (Soll-Ist Vergleich) zum Zwecke der transparenten Darstellung der Qualität der Arbeit nach innen und außen sowie der kontinuierlichen Verbesserung.
-
Innerhalb von Audits werden sowohl (ausgewählte) Ergebnisse der erbrachten Dienstleistung - unter Beachtung der KundInnenanforderungen - die Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der eingesetzten Verfahren sowie das gesamte QM System untersucht.
-
Es werden die relevanten Informationen zu den Dimensionen Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität zusammengefasst, präsentiert und reflektiert,
-
sowie notwendige Strategien der Weiterentwicklung bzw. Verbesserung vereinbart und deren Einhaltung geprüft. (Vgl. Bungart / Supe / Willems 2001a, 71ff & 2001b, S.220ff).
Das Qualitätsmanagement Referenzmodell KASSYS (Kasseler Systemhaus) wurde im Auftrag der "Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen" entwickelt. Ursprünglich war es für jenen Bereich des Integrationsprozesses bestimmt, der in der originären Trägerschaft der Integrationsämter liegt, und zwar den Bereich der Beruflichen Begleitung. Im Zuge der bereits angesprochenen Strukturreform, durch welche die Integrationsämter ab dem Beginn des Jahres 2005 die gesamte Strukturverantwortung für die Integrationsfachdienste übernehmen werden, kommt es zum jetzigen Zeitpunkt gerade zu einer Erweiterung des KASSYS Modells, in das auch der Bereich der Vermittlung - vor allem unter Bezugnahme auf das System MUQ - integriert werden wird. Ich beziehe mich in meiner Darstellung auf die zweite KASSYS Auflage aus dem Jahr 2002.
Das System KASSYS selbst ist modular aufgebaut und besteht aus weitgehend unabhängigen Elementen, die einzeln oder en bloc in andere Systeme eingefügt werden können. Der Aufbau und die Gliederung des Systems entspricht der Architektur eines (System-)Hauses, und ist in folgende Bereiche untergliedert:
-
Das Dach des Hauses behandelt das Thema Führungsqualität und dokumentiert im wesentlichen die maßgeblichen gesetzlichen nationalen und regionalen Regelungstexte und Rahmenvereinbarungen, die für den Bereich der (Zusammen-) Arbeit zwischen Integrationsfachdienst und beauftragenden Trägern von Relevanz sind. Außerdem wird ein Modell zur Erhebung von KundInnenerwartungen (NutzerInnen, ArbeitgeberInnen, FördergeberInnen und MitarbeiterInnen) und von Qualitätskennzahlen vorgelegt, welche helfen soll in Zukunft die bundesweite Statistik zu vereinheitlichen.
-
Den Hauptteil des Hauses stellen die wesentlichen Aufgabenbereiche oder Kernprozesse des Integrationsfachdienstes - in Bezug auf die berufliche Begleitung - unter Berücksichtigung ihrer Ziele, ihres prozesshaften Ablaufs, ihres Ergebnisses und der Kundenzufriedenheit, dar. Sie bilden bildhaft gesprochen die drei tragenden Säulen des Hauses. Entsprechend seiner Bedeutung nimmt der erste Kernprozess, die "berufliche Begleitungim Einzellfall" den breitesten Raum ein und stellt, unterteilt in 39 Teilprozesse die wesentlichen Tätigkeitsfelder und Maßnahmen dar. Der zweite Kernprozess "fachdienstliche Stellungnahmen" bedarf einer kurzen Erläuterung. Es werden darunter Stellungnahmen verstanden, welche MitarbeiterInnen des IFD im Auftrag eines Integrationsamtes anfertigen, um die Sachbearbeiterinnen bei der Ermessensausübung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX zu unterstützen. Im Rahmen von KASSYS werden für diese Tätigkeiten zahlreiche Arbeitshilfen vorgestellt. Den dritten Kernprozess bildet die "betriebliche Beratung", welcher sich in seiner Darstellung vor allem auf fallübergreifende Aspekte der Fachdienstarbeit bezieht und den präventiven Charakter betont. Der vierte Kernprozess wird nach Vervollständigung von KASSYS der Bereich der "Vermittlung" sein.
-
Das Fundament des Hauses bilden einige Elemente zur Strukturqualität der Fachdienste, welche derzeit noch überarbeitet und ergänzt werden, um die Bedeutung der Strukturqualität für die Arbeit der Integrationsfachdienste - im Sinne eines stabilen und tragfähigen Fundaments - nicht zu vernachlässigen. (Vgl. KASSYS 2002, Kapitel 0.1, S.1ff; Kapitel 1.4, S.2ff; Kapitel 2.2., S.1)
Ebenso im Zuge der Strukturreform wird das System KASSYS bundesweit allen Trägern von Integrationsfachdiensten als einheitliches Qualitätsmanagement Modell - im Sinne eines integralen Bestandteils zur Qualitätssicherung - vorgeschrieben werden. Dadurch sollen u.a. folgende Vorteile und Synergieeffekte erzielt werden:
-
Eine Verbesserung der Außenwirkung bei KundInnen und AuftraggeberInnen durch Herstellung größerer Klarheit und Akzeptanz der Dienstleistung.
-
Erzeugung einer höheren Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
-
Herstellung klarer Nahtstellenregelungen und Verantwortlichkeiten.
-
Eine Optimierung der Ressourcennutzung.
-
Eine Vereinheitlichung des Vorgehens.
-
Erleichterung der Weiterentwicklung durch ein geregeltes Steuerungsverfahren der Dienste.
-
Einen professionellen Input für die (bereits vorhandenen) QM - Systeme der Dienstleistungsträger. (Vgl. KASSYS 2002, Kapitel 0.4, S.3)
Wie bereits erwähnt, bildet der erste Kernprozess "die einzellfallbezogene beruflichen Begleitung" den Hauptteil der Ausführungen im KASSYS System. Berufliche Begleitung wird dabei als:
"personenbezogene Arbeit" verstanden, welche vom IFD Mitarbeiter "Sachkompetenz und die Fähigkeit sich auf Beziehungen einzulassen abverlangt". Dabei wird besonders betont, dass "Qualität im engen Zusammenhang mit Beziehungsqualität steht." (KASSYS 2002, Kapitel 2.1., S.1)
Eine Besonderheit von KASSYS stellt sicherlich die Beschreibung und Darstellung der Gesamt- und der Teilprozesse in visualisierten Prozessdarstellungen, im Sinne einer Maßnahmenmatrix dar. Die verschiedenen Tätigkeitsfelder und deren Maßnahmen werden dabei als ineinander übergehende oder parallel ablaufende Prozesse verstanden und dargestellt. Die jeweiligen Maßnahmenmatrizen sind als dynamisches Modell gedacht, welche für Veränderungen und Ergänzungen auch unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten offen stehen. Trotz ihrer auf den ersten Blick scheinbaren Komplexität und Unübersichtlichkeit, können sie die Fachkräfte doch sicherlich in der zeitlichen und inhaltlichen Strukturierung ihrer Arbeit unterstützen. Den einzelnen Tätigkeitsfeldern ist in ihrer Darstellung folgendes gemein: sie enthalten ein Prozess-Ablauf-Schema mit Hinweisen zu Führungsvorgaben, Zielen, Aktionen und zur Dokumentation. Daneben finden sich in zahlreichen Abschnitten ergänzende Arbeitshilfen wie Erläuterungen, Formulare, Checklisten, Literaturhinweise oder auch beispielhafte Lösungen im Sinne eines "Best Practice" Vergleichs. Zu den beschriebenen Tätigkeitsfeldern gehören u.a. die Teilprozesse:
-
Eingliederung in den Betrieb
-
Wiedereingliederung in den Betrieb
-
Begleitung bei bestehendem Arbeitsverhältnis
-
Umsetzung des Klienten im Betrieb
-
Gestaltung behindertengerechter Arbeitsbedingungen
-
Einzel - Kontaktpflege (Betrieb)
-
Mitwirkung bei Kündigungsverfahren
-
Begleitung bei Arbeitsplatzverlust
-
Hilfe zur Klärung und Förderung der beruflichen Perspektive
-
Maßnahmen zur sozialen Sicherung
-
Erarbeitung realisierbarer beruflicher Ziele
-
Training sozialer Kompetenzen
-
Hilfe zur psychischen Bewältigung der Behinderung, etc. (Vgl. KASSYS 2002, Kapitel 2)
Eine genaue Darstellung der einzelnen Tätigkeitsfelder würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, und ich verweise interessierte Personen deshalb auf die Möglichkeit sich das komplette KASSYS Handbuch von der Homepage der BIH herunterzuladen.
Abschließend möchte ich noch auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Instrumente und Modelle eingehen. Bei den Gemeinsamkeiten ist insbesondere herauszustreichen, dass alle drei Modelle an den spezifischen Prozessen und Inhalten der Dienstleistung ansetzen. Sie stehen daher - in einem weiteren Verständnis - alle im Rahmen einer TQM Philosophie, zumindest was die Bereiche der KundInnen-, MitarbeiterInnen und Prozessorientierung betrifft. Bezüglich ihrer inhaltlichen Ausrichtung berücksichtigen alle Modelle die Grundlagen der "Unterstützten Beschäftigung" und sind daher - aufgrund der Gemeinsamkeiten der Dienstleistungen - vice-versa auch in die jeweils anderen Länder übertragbar. Alle Systeme können sowohl einen Qualitätssicherungs- oder -entwicklungsprozess einleiten, zur Optimierung bereits bestehender Instrumente verwendet und darin integriert, aber auch untereinander angewendet werden. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der weitgehende modulare Aufbau all dieser Instrumente, so dass sie sowohl als Teil aber auch als Ganzes genutzt werden können. Alle setzen in ihrem Selbstverständnis an dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung an und gehen systematisch und strukturiert vor. Nicht zu unterschätzen ist aber auch, dass alle Systeme und/oder Instrumente für ihre Einführung, Umsetzung und laufende Anwendung sowohl Zeit, als auch personelle und finanzielle Ressourcen, sowie geeignete institutionelle Rahmenbedingungen inklusive einem klaren Commitement der Leitungsebene benötigen. Aber auch die politisch Verantwortlichen sind gefordert, ihrerseits die Forderung nach Qualität durch entsprechende Rahmenbedingungen und insbesondere dem zur Verfügung stellen finanzieller Ressourcen zu unterstützen.
Vom Selbstverständnis der einzelnen Modelle erfüllt nur das System MUQ den Anspruch als umfassendes Qualitätsmanagementsystem angewendet werden zu können. QUIP versteht sich als (Selbst-)Evaluationsinstrument mit dessen Hilfe die spezifischen Sichtweisen der unterschiedlichen Prozessbeteiligten in Bezug auf Qualität erhoben werden können. KASSYS wird in naher Zukunft als horizontale Vorgabe an alle Integrationsfachdienste in Deutschland umgesetzt. Es erfüllt daher von Seiten der FördergeberInnen im weitesten Sinne eine Regulations- und Steuerungsfunktion. Durch seine detaillierten Prozessbeschreibungen und Hilfsmittel ist es aber geeignet, wertvolle inhaltliche Inputs in die verschiedenen QM Systeme der Träger zu liefern.
In diesem abschließenden Kapitel des theoretischen Teils, habe ich zunächst die theoretischen Grundlagen von Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement aus einer systemischen Perspektive beschrieben. Anschließend bin ich auf die Struktur von Qualitätssicherungs- bzw. Qualitätsmanagementsystemen eingegangen, und habe vier unterschiedliche Modelle aus dem Bereich der Wirtschaft und Industrie vorgestellt und auf ihre Relevanz in sozialen Handlungsfeldern unter besonderer Berücksichtigung der beruflichen Integration hinterfragt. Zum Abschluss habe ich drei Systeme bzw. Instrumente, die im Rahmen von zum Teil umfassenden Forschungsprojekten speziell für ihren Einsatz in den Institutionen der Arbeitsassistenz bzw. der Integrationsfachdienste entwickelt wurden, präsentiert und sie im Hinblick auf ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin untersucht. Im nun folgenden empirischen Teil dieser Arbeit, werde ich zunächst die im Rahmen meiner Untersuchung verwendeten qualitativen Forschungsansätze das "ExpertInneninterview" und die "Interpretative Auswertungsstrategie für leitfadengestützte ExpertInneninterviews" Nach Meuser und Nagel (2002) vorstellen, anschließend die Ergebnisse darstellen und diskutieren sowie einen abschließenden Ausblick formulieren.
[30] Mit dem europäischen Qualitätspreis werden europäische Unternehmen in unterschiedlichen Kategorien, gemessen an der Betriebsgröße, ausgezeichnet. Seit 1996 wird dieser Preis auch jährlich an "Nicht Gewinnorientierte Organisationen" (NPO) verliehen (vgl. Langnickel 2003, S.38).
Inhaltsverzeichnis
Zu Beginn des empirischen Teils dieser Diplomarbeit steht die Darstellung der Erhebungsmethode "ExpertInneninterview" und der Auswertungsmethode "interpretative Auswertungsstrategie für Leitfadenorientierte ExpertInneninterviews" nach Meuser und Nagel (2002).
"Experteninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht", so lautet der Titel eines Artikels von Meuser und Nagel (2002, S.71ff), in dem die Autoren zu Beginn das Ungleichgewicht zwischen der Relevanz von ExpertInneninterviews in zahlreichen Forschungsprojekten und der weitgehenden Ausklammerung dieser Methode in Lehrbüchern zu qualitativer Sozialforschung kritisieren. Ich erachte es aus diesem Grunde zunächst für notwendig, die Methode "ExpertInneninterview" an dieser Stelle vorzustellen. Für Bogner und Menz (vgl. 2002, S.33) spielt das ExpertInneninterview als Methode der Datenproduktion auch zunehmend im Rahmen pädagogischer Fragestellungen eine prominente Rolle. Es gilt daher zuerst den Begriff des/der "ExpertIn" zu konkretisieren. Nach Deeke (1995, S.8f) können als ExpertInnen diejenigen Personen bezeichnet werden:
"die in Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als "Sachverständige" in besonderer Weise kompetent sind. Mit Kompetenz ist dabei die relativ exklusive Verfügung von Wissen zu einem bestimmten Sachverhalt gemeint. Als Experten angesehene Personen zeichnen sich als Fachleute durch "Fachwissen" aus oder verfügen als Beteiligte an einem bestimmten Prozess oder Ereignis über exklusives Ereignis- oder Fallwissen. (Hervorhebung O.K.)"
Der ExpertInnenbegriff lässt sich demnach als ein "relationaler Begriff" charakterisieren, der sowohl als soziales, als auch über die Zuschreibung dieses Status als methodisches Konstrukt verstanden werden kann. Dieses Konstrukt bezieht sich - wie in dem Zitat augenscheinlich wird - auf das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis und kann damit auf die Typen des "Theoretikers" und des "Anwenders" zugespitzt werden. Als ExpertInnen werden demnach diejenigen Personen angesprochen die:
-
in irgendeiner Weise Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung, bzw.
-
über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügen.
Ein weiteres wichtiges Wesensmerkmal dieser Methode ist der "Experte als Handlungsträger einer bestimmten Organisation". Das ExpertInnenwissen ist bei diesem Typus in einen bestimmten institutionellen Kontext eingebunden. Die Gegenstände des ExpertInneninterviews sind folglich die damit verbundenen Zuständigkeiten, Aufgaben und Tätigkeiten dieser Personen, bzw. der aus dieser (beruflichen) Position gewonnene exklusive Erfahrungs- und Wissensbestand. Das Wissen dieser ExpertInnen erhält in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen nicht deshalb seine Relevanz, weil es beispielsweise in besonders reflektierter oder systematisierter Form reproduziert wird, sondern weil es in besonders hohem Maße praxiswirksam ist (vgl. Deeke 1995, S.9ff; Bogner / Menz 2002, S.39ff; Düring / Bergmann 2004, S.1ff).
Obwohl die Methode des ExpertInneninterviews in die unterschiedlichsten Untersuchungssettings eingebettet sein kann, lässt sie sich doch aufgrund ihrer forschungspraktischen Orientierung weitgehend der qualitativen bzw. interpretativen Sozialforschung zuordnen (vgl. Bogner / Menz, S.36f). Bogner und Menz (vgl. 2002, S.37ff) stellen eine Differenzierung dieser Methode in Abhängigkeit von ihrer Erkenntnisleitenden Funktion auf, die ich an dieser Stelle wiedergeben werde:
-
Das explorative ExpertInneninterview dient zur Orientierung und Strukturierung eines thematisch neuen Forschungsfeldes und somit zur Generierung von Hypothesen. Es wird ferner eingesetzt um die Handlungsbezüge und Orientierungsmuster der jeweiligen ExpertInnen als Akteure in ihrem spezifischen institutionellen Umfeld aufzuhellen und verstehbar zu machen. Methodisch eignen sich dafür vor allem "offene Interviewformen", die in machen Fällen aber auch durch einen Interviewleitfaden unterstützt werden.
-
Das systematisierende ExpertInneninterview hingegen zielt auf eine systematische Informationsgewinnung in einem klar umrissenen Untersuchungsfeld, welches auf Vergleichbarkeit abzielt. Es möchte einen Forschungsgegenstand von verschiedener ExpertInnenseite her beleuchten. Diese Interviewform wird zumeist als "problemzentriertes Interview" mit einem vorformulierten Interviewleitfaden durchgeführt.
-
Das theoriegenerierende ExpertInneninterview schließlich ist nicht nur an der Gewinnung von Informationen interessiert, sondern möchte analytisch die "subjektive Dimension" des ExpertInnenwissens erschließen. (Vgl. Vogel 1995, S.74f; Bogner / Menz 2002, S.37f)
Dem qualitativen ExpertInneninterview kommen demnach unterschiedliche Funktionen im Forschungsprozess zu. Die Funktion der Exploration dient vor allem dem Verstehen der innerhalb des Forschungsfeldes agierenden ExpertInnen, wohingegen das systematisierende Interview vor allem auf Material- und Datengewinnung abzielt. Nach Vogel (1995, S.75) können allerdings auch beide dieser Funktionen in einem ExpertInneninterview vereint sein.
Vogel (1995, S.73ff) weist in seinem Artikel "Wenn der Eisberg zu schmelzen beginnt" auf methodische Probleme in der Durchführung von ExpertInneninterviews hin. Der Autor betont, dass
"die Befragung ein sozialer Interaktionsprozess ist und, dass das Resultat bzw. die Ergiebigkeit eines Interviews in sehr starkem Maße von den wechselseitigen Wahrnehmungsmustern und Einstellungen (Hervorhebung O.K.) der am Gespräch beteiligten Akteure abhängig ist." (Vogel 1995, S.78)
Die in qualitativen ExpertInneninterviews auftretenden (zumeist ambivalenten) Interaktionseffekte werden von Vogel (1995, S.79ff) anhand vier Beispielen verdeutlicht:
-
Der Eisbergeffekt: kann sich in zwei Extremausprägungen bemerkbar machen, und zwar einerseits in einer unterkühlten, von Misstrauen geprägten Gesprächsatmosphäre, sowie andererseits durch gezieltes Zurückhalten von Informationen bezüglich des thematisierten Sachverhalts. Im Interview wird daher nur die Spitze des Eisbergs sichtbar (vgl. Vogel 1995, S.79).
-
Der Paternalismuseffekt: drückt sich in einer demonstrativen Gutmütigkeit des Befragten aus, zumeist gepaart mit dem Versuch die Gesprächsführung und die Gesprächsinhalte zu diktieren. Ausgelöst wird dieser Effekt in der Regel durch Alters- und Statusunterschiede zwischen InterviewerIn und Befragtem (vgl. Vogel 1995. S.80).
-
Der Rückkoppelungseffekt: ist durch den hartnäckigen Versuch von Seiten des/der befragten ExpertIn gekennzeichnet, die Frage - Antwort Situation umzudrehen um den/der ihm gegenüber sitzenden WissenschaftlerIn mit ihn/ihr selbst interessierenden Fragen zu konfrontieren (vgl. Vogel 1995, S.80f).
-
Der Katharsiseffekt: ist eine häufige Erscheinungsform in qualitativen Interviews. Das Interview erfüllt in diesem Fall eine kompensatorische Funktion und dient dem Befragten als Anreiz Affekte abzureagieren (vgl. Vogel 1995, S.81f).
Die Auswahl der InterviewpartnerInnen für die ExpertInneninterviews in Österreich und Deutschland erfolgte in der vorliegenden Untersuchung gezielt und systematisch. Es wurde gemäß des oben definierten ExpertInnenverständnis darauf geachtet, dass die ausgewählten Personen Verantwortung entweder am Entwurf, der Implementierung oder der Kontrolle für Aspekte des Qualitätsmanagements in Institutionen der beruflichen Integration verfügen, sowie, bedingt durch ihre berufliche Funktion, an zentralen Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Im Sinne eines Stakeholder Ansatzes wurden als Prozessbeteiligte die
-
FördergeberInnen
-
Interessensvertretung
-
LeiterInnen von Institutionen
-
Forschung
als besonders relevante "Ebenen" unterschieden und für die Untersuchung berücksichtigt. Ohne deren Bedeutung bei der Mitwirkung an Qualitätssicherungs- bzw. -entwicklungsprozessen schmälern oder vernachlässigen zu wollen, wurden - aus zeitökonomischen Gründen - die Ebenen der NutzerInnen, MitarbeiterInnen sowie ArbeitgeberInnen nicht in diese Untersuchung einbezogen. Nachdem jeweils geeignete Personen für die unterschiedlichen Ebenen ausgewählt worden sind, wurden sie per E-Mail angeschrieben um ihre Bereitschaft für ein ExpertInneninterview zu erfragen. Alle acht der ausgewählten Personen erklärten sich sofort bereit für ein Interview zu Verfügung zu stehen, wodurch auch die Aktualität dieser Thematik besonders deutlich wird. Es wurden von Fr. Dr. Rossi und Hr. Walter Lackner auch jeweils Einladungen zu Tagungen ausgesprochen, die sich ebenfalls mit dem Thema "Qualität in der Arbeitsassistenz" beschäftigten, und zwar die Jahrestagung des Dachverbandes Arbeitsassistenz[31] im März 2004 in Salzburg sowie die Fachtagung "Qualität in der beruflichen Integration" im Mai 2005 in Schladming, auf der ich auch die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema "Dialog über Grenzen" moderieren durfte. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die interviewten ExpertInnen, ihre berufliche Funktion, die Zuteilung zu den definierten Ebenen, das Land sowie Datum und Ort des Interviews.
Tabelle 7: Überblick über Namen der interviewten ExpertInnen; berufliche Funktion; Ebene; Land; Datum und Ort des Interviews
|
Name des/der interviewten Experten/Expertin |
Berufliche Funktion |
Ebene der Prozess-beteiligten |
Land |
Wann und Wo |
|
Jörg Bungart |
Geschäftführer der Bundes-Arbeitsgemeinschaft (BAG-UB) für Unterstütze Beschäftigung |
Interessen-Vertretung |
Deutschland |
01.04.04 in Hamburg |
|
Stefan Doose |
Ehemaliger Geschäftsführer der BAG-UB. Evaluation und wissenschaftliche Begleitung beim QUIP Projekt, aktuell Dissertation (Verbleibs- und Verlaufsstudie von Personen die vor über 5 Jahren von IFD vermittelt wurden) |
Forschung |
Deutschland |
31.03.04 in Lübeck |
|
Rolf Behncke |
Stellvertretender Geschäftsführer der Hamburger Arbeitsassistenz. Ehemaliger Vorsitzender der BAG-UB |
Leiter einer Institution |
Deutschland |
02.04.04 in Hamburg |
|
Dr. Dieter Schartmann |
Vertreter des Integrationsamtes Rheinland. Leiter des Unterausschusses Integrationsbegleitung in der "Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen" (BIH) |
Fördergeber |
Deutschland |
29.03.04 in Köln |
|
Dr.in Karin Rossi |
Leiterin des "Instituts für berufliche Integration" (IBI), Vorstandsmitglied im Dachverband Arbeitsassistenz |
Interessen-Vertretung Leiterin einer Institution |
Österreich |
27.04.04 in Wien |
|
Mag. Michael Stadler-Vida |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Zentrum für Wohlfahrts- und Sozialforschung. Seit 01.01.05 Forschungsbüro "Queraum" - Büro für Kultur- und Sozialforschung |
Forschung |
Österreich |
30.04.04 in Wien |
|
Walter Lackner |
Geschäftsführer der "Lebenshilfe Ennstal" |
Leiter einer Institution |
Österreich |
13.04.04 in Neusiedl am See |
|
Dr.in Angelika Fritzer |
Vertreterin des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) |
Fördergeber |
Österreich |
20.04.04. in Wien |
Die Interviews wurden zwischen Ende März 2004 und Ende April 2004 in Deutschland und Österreich durchgeführt. Fünf der Interviews fanden in den jeweiligen Arbeitsräumen der ExpertInnen statt, zwei in den privaten Wohnungen und eines in einem Kaffeehaus. Die Gesprächsatmosphäre während den Interviews war durchwegs als entspannt und kollegial zu bezeichnen, die Dauer der Interviews betrug zwischen 70 und 180 Minuten inklusive Vor- und Nachgesprächen. Die Interviews wurden jeweils mittels eines digitalen Tonbandes aufgezeichnet, und vollständig transkribiert[32]. Im Anschluss an die Interviews wurden kurze Gedächtnisprotokolle verfasst um die Gesprächsatmosphäre und den Verlauf des Interviews zu dokumentieren. Die transkribierten und paraphrasierten Interviews wurden den interviewten ExpertInnen per E-Mail zugesandt, entsprechende Rückmeldungen per E-Mail (in fünf Fällen), telefonisch (in zwei Fällen) und persönlich (in einem Fall) eingeholt und in der anschließenden Auswertung berücksichtigt.
Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten wurden die Interviews durch einen Interviewleitfaden strukturiert. Bei der Auswahl der Fragen wurde darauf geachtet die Balance zu finden, um auf der einen Seite die zu behandelnden Themen deutlich einzugrenzen und vorzugeben, sowie andererseits die Fragen so offen zu formulieren, dass die spezifische Sichtweise der interviewten ExpertInnen zu den angesprochenen Themen deutlich wird (vgl. Meuser / Nagel 2002, S.77ff). Der an dieser Stelle präsentierte Interviewleitfaden und die darin gestellten Fragen reflektieren sowohl das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur, als auch offene Fragen, die anlässlich der Jahrestagung des Dachverbandes Arbeitsassistenz behandelt wurden:
Interviewleitfaden:
-
Kurze Beschreibung der beruflichen Funktion, sowie der persönlichen Erfahrungen die Sie mit Qualität und Qualitätssicherung in ihrer beruflichen Laufbahn gemacht haben!
-
Die Bedeutung von nationalen und EU- rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Qualität der Arbeitsassistenz bzw. Integrationsfachdienste.
-
Welche Veränderungen im Hinblick auf diese Rahmenbedingungen wären Ihrer Ansicht nach denkbar (bzw. wünschenswert) um die Qualität der Arbeitsassistenz bzw. Integrationsfachdienste zu verbessern?
-
Unter welchen Motiven wird Ihrer Ansicht nach die Qualitätsdiskussion in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung geführt? Können sie nationale bzw. fachliche Spezifika ausmachen?
-
Beschreiben Sie mir, bitte, in 3 bis 4 Punkten, was Qualität in der Arbeitsassistenz bzw. in Integrationsfachdiensten aus Ihrer Sicht ausmacht?
-
Worin liegen Ihrer Ansicht nach die Stärken und die Schwächen der Arbeitsassistenz bzw. der Integrationsfachdienste?
-
Was kann aus Ihrer Sicht neben der Vermittlungsquote als Erfolg von Maßnahmen der beruflichen Integration gewertet werden?
-
Viel diskutiert wird zurzeit die Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration, einerseits aufgrund der schlechten Arbeitsmarktlage, andererseits hat der große Erfolgsdruck zu einer Verschiebung der Zielgruppe geführt. Wie beurteilen Sie aus Ihrer Position die Nachhaltigkeit von Maßnahmen, bzw. welche Entwicklungen könnten sich Ihrer Ansicht nach abzeichnen?
-
Ein Bestandteil eines Qualitätssicherungssystems sollte die Form der Dokumentation sein, was müsste von Ihrer Position aus betrachtet, in einem geeigneten Dokumentationssystem erhoben bzw. aufgezeichnet werden?
-
Welchen Kriterien muss ein Qualitätssicherungssystem für den Bereich der beruflichen Integration genügen, um sinnvoll und effizient einsetzbar zu sein?
-
Vielerorts werden Grabenstreitigkeiten über einzelne Qualitätssicherungssysteme geführt. Mittlerweile existieren Systeme, die speziell für den Einsatz in diesem Arbeitsfeld entwickelt worden sind. Bestehen aus Ihrer Sicht dadurch Vor- oder Nachteile im Vergleich zu "herkömmlichen" Systemen wie ISO oder EFQM?
-
Benchmarking wird als ein Weg gesehen die Qualität in Institutionen der beruflichen Integration zu verbessern. Was wären aus Ihrer Position geeignete Benchmarks um einen zielführenden Vergleich unter den einzelnen Anbietern zu ermöglichen?
-
Worin sehen sie das Selbstverständnis der von Ihnen repräsentierten Organisation im Hinblick auf Arbeitsassistenz bzw. Integrationsfachdienste (bzw. berufliche Integration) im Allgemeinen bzw. bezüglich der Fragen nach Qualität und Qualitätssicherung im Besonderen?
-
Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen. In welchen Bereichen wären für Sie Zusammenarbeiten denkbar und zielführend, speziell im Hinblick auf Fragen der Qualität bzw. Qualitätssicherung?
Ich verorte die von mir gewählte Erhebungsmethode eines leitfadengestützten, themenzentrierten ExpertInneninterview gemäß der Differenzierung von Bogner und Menz (vgl. 2002, S.37ff) sowie Vogel (1995, S.75) sowohl innerhalb eines explorativen Ansatzes, mit dem Ziel der Orientierung und Strukturierung des thematischen Forschungsfelds "Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration" sowie innerhalb eines systematisierenden Ansatzes mit dem Fokus auf Vergleichbarkeit der spezifischen Sichtweisen unterschiedlicher Prozessbeteiligter (=Stakeholder) in den beiden Ländern Österreich und Deutschland.
Bezüglich der Auswertung von ExpertInneninterviews schreiben Meuser und Nagel (2002, S.80):
"Anders als bei der Einzelfallanalyse geht es hier nicht darum, den Text als individuell-besonderen Ausdruck seiner allgemeinen Struktur zu behandeln. Das Ziel ist vielmehr, im Vergleich mit den anderen ExpertInnentexten das Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen."
Ich orientiere mich bei meiner Auswertungsstrategie ebenfalls an der von Meuser und Nagel (vgl. 2002, S.80ff) vorgeschlagenen "interpretativen Auswertungsstrategie für Leitfadenorientierte ExpertInneninterviews", deren Vorgehen insbesondere durch das Prinzip des "thematischen Vergleichs" gekennzeichnet ist, mit dessen Hilfe Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt werden sollen.
Die Auswertung der ExpertInneninterviews orientiert sich in erster Linie an inhaltlich zusammengehörigen thematischen Einheiten und nicht an der Sequenzialität von Äußerungen je Interview. Ein besonderes Gewicht erhält ebenfalls der Funktionskontext der ExpertInnen, die von Anfang an im Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet werden. Die Vergleichbarkeit der Interviews wird, wie bereits erwähnt, insbesonders durch die leitfadenorientierte Interviewführung gewährleistet. Da in der vorliegenden Untersuchung die Erforschung des Kontextwissens der Prozessbeteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, bilden die thematischen Schwerpunkte des Leitfadens bei der Auswertung die ersten Beobachtungsdimensionen (vgl. Meuser / Nagel 2002, S.81ff). Dies spiegelt auch die leitende Forschungsfrage dieser Untersuchung wieder:
"Welche Bedeutung haben Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementsysteme für unterschiedliche Prozessbeteiligte im Rahmen des Prozesses der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland"
Im Zentrum der Untersuchung stehen demnach der horizontale Vergleich zwischen den beiden Ländern Österreich und Deutschland und der vertikale Vergleich innerhalb der definierten Gruppen der Prozessbeteiligten. Im Folgenden werden nun die ersten vier, der von Meuser und Nagel beschriebenen sechs methodischen Punkten angeführt, die im Rahmen der im Anschluss folgenden Auswertung und Interpretation berücksichtigt wurden:
-
Transkription: Als erster Schritt und Voraussetzung für die Auswertung des Interviews steht die Transkription der auf Tonband aufgenommenen Interviews. Da bei ExpertInneninterviews das gemeinsam geteilte Wissen der ExpertInnen im Mittelpunkt steht, kann auf aufwendige Notationssysteme verzichtet werden. Pausen, Stimmlagen sowie nonverbale und parasprachliche Elemente wie Gestik und Mimik fließen nicht in die Interpretation mit ein. Bezüglich der Vollständigkeit entspricht die gesamte Transkription der produzierten Interviews nicht dem Normalfall. Zur Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Texte, wurden in diesem Fall allerdings alle Interviews vollständig und wortgetreu transkribiert (vgl. Meuser / Nagel 2002, S.83).
-
Paraphrase: Die Autoren betonen, dass die Entscheidung, welche Teile eines Interviews paraphrasiert werden, im Hinblick auf die leitende Forschungsfrage erfolgen soll, allerdings wird auch davor gewarnt "Inhalte durch voreiliges Klassifizieren zu verzerren und Informationen durch eiliges Themenraffen zu verschenken". Die Sequenzierung des Textes nach thematischen Einheiten erfolgte in der vorliegenden Untersuchung zunächst entlang der im Leitfaden vorgegebenen Themen und Kategorien. Ähnlich wie bei der "Qualitativen Inhaltsanalyse" nach Mayring (vgl. 1997) wurden auch in diesem Fall zusätzliche Kategorien induktiv am Material entwickelt. Zur Unterstützung der Codierung und Paraphrasierung der Interviewtexte, wurde ein Programm zur Computerunterstützten Qualitativen Datenanalyse (MAX - QDA) verwendet[33] (vgl. Kuckartz 1997, S.584ff). Die Paraphrasierung ist der erste Schritt der Verdichtung des Textmaterials. In diesem Schritt geht es weniger um eine Beseitigung von Redundanzen als vielmehr um eine Reduzierung von Komplexität. Zum Abschluss der Paraphrasierung sollen erste Trennlinien zwischen Themen deutlich werden, Erfahrungsbündel und Argumentationsmuster sichtbar werden sowie erste Relevanzen und Beobachtungsdimensionen Kontur annehmen. (Vgl. Meuser / Nagel 2002, S.83ff)
-
Überschriften: Der nächste Schritt der Materialverdichtung und gleichzeitig die Vorstufe zum thematischen Vergleich besteht darin die paraphrasierten Passagen mit Überschriften zu versehen. Dabei soll textnah vorgegangen und die Terminologie der interviewten ExpertInnen aufgegriffen werden. Die Zuordnung einer Textpassage zu mehreren Überschriften ist zulässig, da nicht die Logik eines Einzelfalls Gegenstand der Auswertung ist. ExpertInneninterviews zeichnen sich häufig durch eine vielschichtige Verzahnung von Themen aus, daher ist es das Ziel dieses Arbeitsschritts Passagen zusammenzustellen, die gleiche oder ähnliche Themen behandeln (vgl. Meuser / Nagel 2002, S.85f).
-
Thematischer Vergleich: Dieser abschließende Auswertungsschritt der vorliegenden Untersuchung dient dazu, anhand der definierten Überschriften, den Äußerungen der ExpertInnen die Relevanzstrukturen abzulesen. Es gilt nach Meuser und Nagel (2002, S.86):
"typische Erfahrungen, Beobachtungen, Interpretationen und Konstruktionen, Verfahrensregeln und Normen der Entscheidungsfindung, Werthaltungen und Positionen - Handlungsmaximen und Konzepte im Rahmen der Funktionsausübung"
herauszuarbeiten und in der Auswertung darzustellen. Diese Aussagen werden in der Auswertung durch typische Textpassagen aus den Interviews verdeutlicht und illustriert[34]
[31] Eine ausführliche Zusammenfassung der Jahrestagung des Dachverbandes Arbeitsassistenz vom 2.-3. März 2004 im Kolpinghaus in Salzburg findet sich im Materialband zur Diplomarbeit.
[32] Die Transkripte zu den durchgeführten Interviews finden sich im Materialband zur Diplomarbeit
[33] Es wurde die Demonstrationsversion des Programms MAX-QDA verwendet. Diese kann von der Homepage des Anbieter im Internet unter URL: http://www.max-qda.de heruntergeladen werden, und ist ab dem Zeitpunkt des Downloads für 30 Tage aktiv.
[34] Die letzten beiden von Meuser und Nagel (vgl. 2002, S.88ff) vorgeschlagenen Auswertungsschritte "Soziologische Konzeptualisierung" und "Theoretische Generalisierung" werden in der vorliegenden Untersuchung aus zeitökonomischen Gründen ausgespart.
Inhaltsverzeichnis
- 8.1.Überschrift: Hintergrund und Erfahrungen der InterviewpartnerInnen
- 8.2. Überschrift: Einstellungen und Werthaltungen
- 8.3. Überschrift: Rahmenbedingungen
- Überschrift: Motive für die Qualitätsdiskussion
- 8.5. Überschrift: Qualitätsverständnis und Kriterien
- 8.6.Überschrift: Stärken und Schwächen
- 8.7. Überschrift: Nachhaltigkeit
- 8.8. Überschrift: Qualitätsmanagementsysteme
- 8.9. Überschrift: Benchmarking
- Überschrift: Zukunft von Unterstützter Beschäftigung
- 8.11.Zusammenfassung
Zu Beginn der Auswertung gilt es nach Mayring (2000, S.47) darzulegen,
"von wem und unter welchen Bedingungen das Material produziert wurde",
also die Vorannahmen und die Vorerfahrung der interviewten ExpertInnen darzustellen. Diese erste Überschrift bezieht sich folglich auf die Frage, über welche Erfahrungen und Kenntnisse die ExpertInnen in Bezug auf die leitende Thematik "Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration" verfügen. Diese erste Überschrift gliedert sich in die vier Bereiche Ausbildung, beruflicher Werdegang, Aufgaben und Tätigkeiten der Institution sowie persönliche und institutionelle Erfahrungen mit Qualitätsmanagement.
Sechs von acht der interviewten ExpertInnen haben ein Hochschulstudium absolviert:
-
Drei ExpertInnen haben ein Doktoratstudium (Diplompädagogik, Psychologie, Rechtswissenschaften) absolviert.
-
Drei ExpertInnen haben ein Diplomstudium bzw. Magisterstudium (Diplompädagogik, Sozialpädagogik, Soziologie) absolviert.
Ein Großteil der ExpertInnen kann zu PionierInnen im Aufbau der Dienstleistungen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste in Österreich und Deutschland gezählt werden. Im Folgenden werden die wichtigsten (von den ExpertInnen in den Interviews angegebenen) beruflichen Daten angeführt:
Rolf Behncke ist einer von zwei Geschäftsführern der Hamburger Arbeitsassistenz und gleichzeitig ein Gründungsmitglied des Vereins. Er bezeichnet sich selbst als Quereinsteiger:
"Komm ursprünglich nicht aus diesem Bereich. Habe lange Zeit vorher Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe gemacht. Dort in dem Bereich Erwachsenenbildung aber auch unmittelbar in Projekten in der so genannten Dritten Welt mitgearbeitet und bin in den Bereich Integration von Menschen mit Behinderung eher zufällig gekommen. Also ist da so keine klare Lebenslinie zu sehen, wenn man davon absieht, dass da so ein Engagement ist, für Menschen die in irgendeiner Form Unterstützung brauchen - kann man das so als roten Faden sehen."
Jörg Bungart ist Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG-UB). Nach dem Studium der Erwachsenenbildung mit den Schwerpunkten Körper- und Geistigbehindertenpädagogik, sowie einer Ausbildung in systemischer Beratung (NLP-Master-Practitioner), war er seit Ende der 80er Jahre in verschiedenen Modell- und Forschungsprojekten zur beruflichen und sozialen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen tätig, insbesondere in den Bereichen Integrationsfachdienst, Qualitätsmanagement, Übergang Schule-Beruf, unterstützte Kommunikation und Tagesförderstätte. Neben seiner Funktion als Geschäftsführer ist er in die Fortbildung der BAG-UB in den Bereichen Qualitätsmanagement und Lernende Organisation eingebunden.
Stefan Doose ist von seiner Ausbildung Sozialpädagoge und Diakon. Nach dem Studium der Sozialpädagogik absolvierte er einen Aufbaustudiengang an der Universität Bremen mit den Schwerpunkten Berufliche Bildung und Sozialwissenschaften, und war gleichzeitig doppelt immatrikuliert in Behindertenpädagogik. Von 1994-1995 studierte er an der University of Oregon "Rehabilitation and Special Education" mit dem Schwerpunkt Supported Employment und schrieb in den USA seine Abschlussarbeit, in der er 120 Arbeitsplätze in Supported Employment untersuchte (Doose 1995). Er war federführend am Aufbau der BAG-UB beteiligt und von 1996-2001 erster Geschäftsführer. Danach legte er aus persönlichen Gründen einen Wechsel ein, und absolvierte sein Referendariat
"Damals das war Pionierarbeit - und ich bin dann zu dem Eindruck gekommen, es gibt Leute, die sind gut für Pionierphasen und es gibt Leute, die sind gut für die Konsolidierung - so wie eine Organisation auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Leute braucht."
Derzeit ist er an einer Fachschule für Soziapädagogik in der Ausbildung von ErzieherInnen tätig. Außerdem war er am "QUIP" Projekt als externer Evaluator beteiligt, und hält zahlreiche Vorträge zu seinem zweiten inhaltlichen Schwerpunkt der "Persönlichen Zukunftsplanung". Über seine laufende Dissertation ist im Kapitel 4.5. bereits berichtet worden.
Dr. Dieter Schartmann ist Sachgebietsleiter im Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rheinland und in seiner Funktion zuständig für die Arbeit der Integrationsfachdienste. Außerdem ist er Vorsitzender des Unterausschusses Integrationsbegleitung im Rahmen der Bundesarbeitgemeinschaft der Integrationsämter. Nach seinem Studium war er an der Entwicklung des MELBA Verfahrens an der Universität Siegen beteiligt, und arbeitete danach 2,5 Jahre als Integrationsbegleiter in einem IFD. Seit 1998 arbeitet er in seiner Funktion am Integrationsamt.
Mag. Michael Stadler-Vida hat nach seinem Studium der Soziologie an der Universität Wien siebe Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung gearbeitet. In dieser Funktion war er an einigen europäischen Forschungsprojekten beteiligt, in denen die Qualität von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung Thema war. Dazu zählte auch das QUIP Projekt, das im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative LEONARDO federführend vom Europäischen Zentrum in Kooperation mit der Lebenshilfe Ennstal und der Salva Vita Foundation (Ungarn) eingereicht wurde. Seit 01.01.2005 betreibt er gemeinsam mit seiner Kollegin Fr. Mag. Yvonne Giedenbacher das Forschungsbüro "Queraum" für Kultur- und Sozialforschung, und ist derzeit an zwei Entwicklungspartnerschaften der Gemeinschaftsinitiative EQUAL für die wissenschaftliche Begleitung und transnationale Koordination zuständig.
Fr. Dr. Karin Rossi ist Leiterin des Instituts für berufliche Integration (IBI) in Wien welches Arbeitsassistenz für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen anbietet. Gleichzeitig ist sie Vorstandsmitglied im Dachverband Arbeitsassistenz (Kassier). Nach dem Studium der Psychologie absolvierte sie eine Ausbildung zur Gesprächstherapeutin. Sie war lange Zeit in der beruflichen Integration tätig, zunächst im BBRZ als Berufsorientierungstrainerin, anschließend auf freiberuflicher Ebene für das BFI. Seit 1995 arbeitet sie im IBI, zunächst als Arbeitsassistentin in NÖ, anschließend als Teamleiterin in Wien und seit 2001 hat sie die Projektleitung für die beiden Standorte in Wien. Ansonsten ist sie freiberuflich als Therapeutin in den Bereichen Zeit- und Konfliktmanagement tätig und macht Weiterbildungen für klinische Psychologen im Bereich berufliche Rehabilitation.
Walter Lackner kommt ursprünglich aus der Hotellerie und hat lange Zeit als Betriebsrat und Empfangschef in einem Hotel in Wien gearbeitet. Seit seinem 45sten Lebensjahr ist er Geschäftsführer der Lebenshilfe Ennstal (damals Liezen). Er ist bereits sehr früh in engen Kontakt mit europäischen Pionieren getreten, so dass er bereits 1995, ebenfalls über ein LEONARDO Projekt, die erste Arbeitsassistenz für Menschen anbieten konnte, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren.
"Zufälligerweise hab ich dann im 94er Jahr, da war ich in St. Andrews, anlässlich einer Tagung, und ich hab zufälligerweise da was bekommen und bin dort hingefahren. Da habe ich den Christy Lynch kennen gelernt - ich weiß nicht, ob du den kennst - der hat beim St. Michaels College - ist dir ein Begriff - das "Open Road Project" - gibt es noch immer in Dublin, das hat er damals vorgestellt auf dieser Tagung. Das war genau das, was wir brauchten. Wir hatten Beschäftigungstherapie, die hatten Beschäftigungstherapie - die haben die Hälfte raus gebracht, wir werden auch welche rausbringen - da werden wir etwas machen. Das war jetzt unser Konzept für unsere Form der - ich habe es einmal Arbeitsassistenz genannt. Und dann habe ich noch etwas von diesem - Badelt, Österle, diese Studie da - und noch andere - Pete Richie "SHS" - Scotish Human Services - "Enable" und so und das hat das ganze irgendwie abgerundet,."
Von 2001 - 2003 war Walter Lackner zentral an der Realisierung und Durchführung des QUIP Projektes beteiligt.
Fr. Dr. Angelika Fritzer arbeitet in der Sektion IV des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG), in der Abteilung die sich konkret mit Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Integration beschäftigt. Sie befasst sich vornehmlich mit der Erstellung von Richtlinien, ist also in der Vorstufe vor der Umsetzung der Maßnahmen tätig. An dem Thema Arbeitsassistenz arbeitet sie bereits seit einigen Jahren:
"Die Arbeitsassistenz ist für mich bereits seit einigen Jahren ein Thema. Es hat sich auch zufällig so ergeben, wie ich angefangen habe in diesem Bereich zu arbeiten, war die Arbeitsassistenz ein Problemfall sozusagen, eine Maßnahme, wo man einfach Handlungsbedarf gesehen hat, und zwar nicht deshalb, weil es problematisch war - die Notwendigkeit der Arbeitsassistenz war allen klar - und es ist von der Maßnahme her nie angezweifelt worden, dass es nicht beibehalten wird, aber es war einfach die Arbeitsassistenz die älteste Maßnahme im Sinne eines Projektes. Es ist auch sehr gut gelaufen, auch von der EU zu einem "Best Practice" Projekt gekürt worden und man hat ja dann gesehen, es ist ein gewisser Stillstand eingetreten zu dem Zeitpunkt, als ich dazu gestoßen bin, und hab mich dann recht intensiv damit beschäftigt. Ja das ist soweit mein Verhältnis zur Arbeitsassistenz."
Im Sinne der Verortung der ExpertInnen in ihrem institutionellen Handlungskontext ist es zunächst bedeutsam, eine Differenzierung der Institutionen nach den oben definierten Ebenen vorzunehmen.
Ebene der Fördergeber:
Auf dieser Ebene sind in Österreich das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) und in Deutschland das Integrationsamt Rheinland vertreten. Dabei sind zwei Unterscheidungen vorzunehmen. Das BMSG repräsentiert die strategische Ebene, während das Integrationsamt die operative Ebene einnimmt. Die zweite Unterscheidung betrifft den Entscheidungsradius. Das BMSG ist als Bundesministerium für das gesamte Bundesgebiet Österreich zuständig, während das Integrationsamt, aufgrund der föderalen Struktur[35] für die Region Rheinland[36] zuständig ist. Dieter Schartmann ist auch Vorsitzender des Unterausschusses Integrationsbegleitung im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter, was seinen persönlichen Wirkungsradius ebenfalls auf das gesamte Bundesgebiet Deutschland ausdehnt.
Angelika Fritzer beschreibt das Aufgaben- und Verantwortungsgebiet des BMSG und ihrer speziellen Abteilung wie folgt:
"wir sind hier die Sektion IV, die Sektion, die unter anderem zuständig ist für das Behindertenwesen. Die Abteilung in der ich arbeite beschäftigt sich konkret mit Fördermaßnamen zur Förderung der beruflichen Integration. Wir haben diese Fördermaßnahmen bis vor wenigen Jahren hauptsächlich über den ATF finanziert, den Ausgleichstaxfonds, sowie mit ESF - Mitteln. Jetzt haben wir auch die Behindertenmilliarde und somit mehr Möglichkeiten Maßnahmen umzusetzen. Ich persönlich beschäftige mich vorwiegend mit Richtlinien und mit wesentlichen Projekten auch. Wir sind eigentlich in der Vorstufe vor der Umsetzung der Maßnahme tätig. Wenn diese Maßnahmen dann einmal in den Grundsätzen geregelt und in Richtlinien gegossen sind, werden sie vom Bundessozialamt und von seinen Landesstellen verwaltet."
Die Aufgaben des Integrationsamtes werden von Dieter Schartmann auf diese Weise definiert:
"Unsere Aufgabe hier ist die Steuerung der IFD und die fachliche Verantwortung für die Arbeit der IFDs. Das geht so weit, dass wir auch die Einzelfallkontrolle haben. Das heißt, dass jede Maßnahme, die ein Mitarbeiter im IFD mit einem schwerbehinderten Menschen durchführt, muss hier beantragt, auf Sinnhaftigkeit überprüft und genehmigt werden - nun das ist gesetzlich so verankert." sowie an anderer Stelle: "Also wir haben einen technischen Fachdienst, in dem Ingenieure arbeiten, wir haben die finanziellen Möglichkeiten in der Sachbearbeitung, die für die Finanzausstattungen zuständig sind."
Ebene der Interessensvertretung:
Die Ebene der Interessensvertretung wird in Deutschland von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG-UB), und in Österreich vom Dachverband Arbeitsassistenz eingenommen. Die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen beiden Institutionen bestehen einerseits in ihrer institutionellen Anbindung an die Träger dieser Dienstleistung sowie andererseits, wie es die Namen schon implizieren, in der Breite ihrer institutionellen Öffnung gegenüber anderen Dienstleistungen der beruflichen Integration. Zu den Aufgaben dieser Institutionen gehören u.a. natürlich die Vertretung der Interessen der MitgliederInnen insbesonders gegenüber den Fördergebern, die Mitwirkung und Mitgestaltung bei Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Dienstleistung, die Organisation und Durchführung von Fortbildungen und Tagungen, der Austausch von Best Practice Beispielen sowie die Sensibilisierung gegenüber ArbeitgeberInnen und einer bereiten Öffentlichkeit. Jörg Bungart formuliert diesen Auftrag folgendermaßen:
"Das sehen wir natürlich auch als unseren Auftrag, was an sich auch ganz typisch ist für eine Bundesarbeitsgemeinschaft. Und da setzen wir auch verschiedene Mittel ein. Dadurch, dass wir auch in unterschiedlichen Gremien vertreten sind, wir stehen ja auch Gott sei Dank im Gesetz, in dem wir aber auch durch unsere ganz praktische Arbeit wie Fortbildung versuchen diese Aufklärung auf ganz vielen Ebenen auch anzusetzen: auf der Ebene der Praxis - der professionellen Praxis - auf der Ebene der Gesetzgebung, durch unsere Gremienarbeit, aber auch durch viele Gespräche z.B. auch mit Leistungskostenträgern. Und da suchen wir, so sage ich einmal, natürlich auch die Kooperationspartner, die eine gewisse Öffnung haben, die dann auch in ihrer Organisation - dort gibt's ja wieder keine einheitliche Meinung - dann gewisse diese integrative Gedanken auch weitertragen können. Das ist für uns eine sehr wichtige Strategie."
Ebene der LeiterInnen von Institutionen:
In dieser Ebene sind wegen der Doppelfunktion von Fr. Dr. Rossi drei LeiterInnen von Institutionen vertreten, in Österreich das Institut für berufliche Integration (IBI), die Lebenshilfe Ennstal sowie in Deutschland die Hamburger Arbeitsassistenz. Zwei der Fachdienste arbeiten im städtischen (Wien und Hamburg) einer im regionalen Raum (Bezirk Ennstal, Steiermark). Bezüglich der Zielgruppen werden von den drei Fachdiensten Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (IBI), überwiegend Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. mit einer geistigen Behinderung (Hamburger Arbeitsassistenz) sowie aufgrund des regionalen Zugangs Menschen mit allen Arten von Behinderung (Lebenshilfe Ennstal) erfasst. Unterschiede bestehen auch im Hinblick auf die Anbindung der Dienstleistung in die institutionelle Angebotspalette der Trägerinstitutionen. Das Institut für berufliche Integration ist an die Psycho-Soziale-Zentren (PSZ) GmbH angebunden, bietet als solches allerdings ausschließlich die Dienstleistung der Arbeitsassistenz an. Die Lebenshilfe Ennstal ist Mitglied der Lebenshilfe Steiermark bzw. Lebenshilfe Österreich, und bietet neben der Arbeitsassistenz, Berufliche Qualifizierung, Clearing, Job Coaching, Job Allianz (Marketing für Firmen) und Beschäftigungstherapie an. Die Hamburger Arbeitsassistenz ist ausschließlich ein Fachdienst zur beruflichen Integration, jedoch strukturell an einen Verbund von Trägern angebunden, welche im Raum Hamburg den lokalen Integrationsfachdienst bilden.
Ebene der Forschung:
Diese Ebene ist durch eine Forschungseinrichtung und eine Privatperson vertreten. Das Europäische Zentrum für Wohlfahrtsforschung und Sozialpolitik ist strukturell an die Vereinten Nationen (UNO) angegliedert, trägt sich jedoch zum Großteil über Drittmittelforschung zumeist im Rahmen von EU - oder Nationalstaatlichen Finanzierungen. Stefan Doose führt bereits seit einigen Jahren Untersuchungen über Unterstützte Beschäftigung durch, und hat zahlreiche Artikel zu diesem Thema verfasst. Derzeit arbeitet er im Rahmen seiner Promotion an der Universität Bremen an einer Verlaufs- und Verbleibsstudie, welche in einem Forschungsverbund mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Universität Münster (Prof. Dr. Hohmeier) durchgeführt wird.
Im Folgenden wird der Erfahrungshintergrund der ExpertInnen in Bezug auf Qualitätsmanagement näher betrachtet. Im Sinne des angeführten ExpertInnen-verständnisses wird an dieser Stelle zwischen Erfahrungen
-
beim Entwurf, der Entwicklung oder der Konzeption; bzw.
-
der Auswahl, der Anwendung, der Implementierung;
von Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementsystemen unterschieden. Unterscheidungen in Bezug auf die Länder bzw. die unterschiedlichen Ebenen erscheinen in diesem Punkt nicht zielführend, da daraus keine generalisierenden Schlussfolgerungen gezogen werden können. Ebenso werden die Erfahrungen der ExpertInnen keiner Wertung unterzogen.
Erfahrungen beim Entwurf, der Entwicklung bzw. der Konzeption:
Fünf der ExpertInnen (bzw. die von Ihnen vertretenen Institutionen) waren im weiteren Sinn an der Entwicklung von Qualitätssystemen, -konzepten, -standards, -kriterien oder -tools beteiligt.
Dieter Schartmann war an der Entwicklung mehrerer Systeme beteiligt, er schildert seine Erfahrungen wie folgt:
"Ja, Erfahrungen selber mit Qualitätsmangement in IFD sind sehr vielschichtig. Ich habe Anfang der 90er Jahre an der Uni Siegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Projekt MELBA mitgearbeitet, und war an der Entwicklung dieses Verfahrens beteiligt, das ja auch qualitätssichernd für die Arbeit der IFDs eingesetzt werden kann. Ich habe dann selber 2,5 Jahre in einem IFD gearbeitet und dort fachliche Integrationsbegleitung gemacht. Seit 1998 bin ich hier im Integrationsamt beschäftigt und bin im Rahmen dieser Tätigkeit hier im Integrationsamt auf vielfältige Prozesse die QM betreffen gestoßen. Da wäre einmal das System MUQ, das hier unter anderem im Auftrag von unserem Integrationsamt gemacht und entwickelt worden ist. Dann das nordrheinwestfälische QM - Papier, das wir anlässlich der Novellierung des Schwerbehindertengesetzes im Jahre 2001 gemacht haben, und die Weiterentwicklung von KASSYS, die jetzt abgeschlossen ist, die ist auch hier in Köln mitgemacht worden."
Auf weitreichende Erfahrungen kann auch Jörg Bungart zurückblicken:
"Dann war die nächste Station - das lief so über 4 ½ Jahre - war dann eine Begleitforschung im Rahmen der Modellprojektforschung der IFD, wie es bei uns heißt, in Westfalen-Lippe. Ich habe da im Kern auch sehr viel Evaluation und Fortbildung gemacht und das ist, glaube ich, heute noch immer sehr wichtig, weil wir darin auch Kriterien herausgearbeitet haben, die sich heute in anderen empirischen Untersuchungen immer wieder bestätigen, und die, wenn man so will, auch in der QM Begrifflichkeit als Qualitätskriterien bezeichnen werden können. Der nächste Schritt war da so im Kern auch ein Forschungsmodellprojekt in Nordrhein Westfalen über QM in IFD, wo dann auch dieses Handbuch entstanden ist. Wir haben das mit insgesamt 11 Fachdiensten gemacht, aber da brauche ich nicht so viel erzählen, weil das steht ja alles in dem Handbuch drin. Und da haben wir dann auch Sachen gemacht, die dann auch explizit unter dem Begriff QM zu fassen sind, und haben uns eben auch konzeptionell sehr stark an entsprechender Literatur und an entsprechenden Konzepten orientiert, und im Kern auch an dieser Idee des Total Quality Management."
Stefan Doose war aufgrund seiner Funktion als erster Geschäftsführer der BAG-UB sehr früh in den Qualitätsentwicklungsprozess der Integrationsfachdienste eingebunden. Im Zuge des HORIZON Projektes "Unterstützte Beschäftigung 2000" war er an der Entwicklung einer Berufsbegleitenden Qualifizierung beteiligt, aus der sich bereits sehr viele Qualitätsstandards für die Arbeit der Fachdienste ableiten lassen konnten. Außerdem fungierte er als externer Evaluator beim QUIP Projekt:
"Ich habe neben meinem Referendariat als externer Evaluator mitgearbeitet beim QUIP Projekt. Ich war daran auch beteiligt und hab versucht meine Erfahrungen da in den Prozess mit einzubringen und rückzumelden, und ich hab mich dort auch mehr als Prozessevaluation und qualitatives Feedback gesehen."
In unterschiedlichen Funktionen waren auch Walter Lackner und Michael Stadler-Vida am QUIP Projekt beteiligt. Letzterer hat im Rahmen seiner Forschungstätigkeit am Europäischen Zentrum auch an anderen Projekten mitgewirkt, bei denen die Qualität von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung Thema war.
"Ich beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Qualität, also ursprünglich mit dem Thema Qualität von sozialen Dienstleistungen allgemein, und in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung. Ja, was haben wir für Projekte dazu gemacht. Das erste Projekt bei dem ich am Zentrum mitgearbeitet habe, war ein Projekt für die European Foundation in Dublin, wo es sehr allgemein um das Thema Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung ging in drei unterschiedlichen Bereichen, nämlich damals auf der einen Seite für Dienstleistungen für arbeitslose Jugendliche, langzeitarbeitslose Jugendliche, dann in der Altenpflege und dann aber auch für Menschen mit Behinderung,.." sowie an anderer Stelle "...und das Thema ist weiterhin für uns relevant, weil wir ja jetzt mit einem tschechischen Partner ein Projekt haben, wo es wieder um Qualitätsindikatoren geht im Bereich Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, aber weiter gefasst als beim QUIP Projekt. Im Gegensatz zum Projekt Unterstützte Beschäftigung - Arbeitsassistenz geht es bei dem Projekt um unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Angebote,..."
Erfahrungen bei der Auswahl, der Anwendung, bzw. der Implementierung:
Über grundsätzliche Überlegungen und Anfragen von Seiten des BMSG bezüglich der Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems berichtet Angelika Fritzer[37]:
"zum Thema Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung: ich habe zwei Seminare (...) zu diesem Thema belegt und mich in der Folge intensiv damit beschäftigt. Ich habe auch Gespräche (...) geführt inwieweit man in Österreich diesbezüglich bei der Maßnahme Arbeitsassistenz ein System entwickeln könnte, und wie man die bestehenden anerkannten QM-Systeme anwendbar machen kann für ein gemeinsames QM-System. Es ist ein sehr interessantes Thema, und es wird auch Thema hier in dieser Abteilung sein. Wir haben bei den vorhergehenden Dachverbandssitzungen in den Jahren 2003 und 2004 dieses Thema angeschnitten, bei der zweiten war es ja - sie waren ja auch dabei -das Thema der Tagung. Wir lassen das jetzt auch nicht auf sich ruhen, sondern wir wollen das aufgreifen und mit entsprechender professioneller Unterstützung dann auch implementieren."
Karin Rossi machte in zwei unterschiedlichen Institutionen Erfahrungen bei der Implementierung und Anwendung von zwei Qualitätsmanagementsystemen:
"... ich habe zwei Mal mit Qualitätssicherungssystemen Erfahrung gemacht. Und zwar das erste Mal im BBRZ: damals hat das BBRZ eine ISO Zertifizierung angestrebt, keine Ahnung nach welchem ISO System das genau gewesen ist - daran kann ich mich nicht mehr erinnern, es war damals, es ist mir eigentlich in sehr schlechter Erinnerung geblieben,..." "...im Jahre 2001 ist von unserem Träger der PSZ GmbH QAP eingeführt worden, also ursprünglich nur, dass wir geschult worden sind, dann hat es so einen Probebetrieb gegeben, wo aufgrund dieses Probebetriebs irgendwie die Richtlinien dafür so erarbeitet worden sind, wie QAP da stattfinden soll, und dieses Jahr sind wir erstmalig im Regelbetrieb drinnen."
Über keine unmittelbaren Erfahrungen im Sinne der Anwendung von Systemen verfügt Rolf Behncke:
"Mit Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement so im Sinne der Begrifflichkeit wie sie so heute verwendet wird, habe ich unmittelbar oder haben wir auch im Fachdienst bislang wenig zu tun. Also wir haben kein etabliertes System des Qualitätsmanagements. Sehr wohl allerdings haben wir - aber das wird ja später wohl noch zur Sprache kommen - eine sehr aktiv und engagiert geführte Qualitätsdiskussion. woraus sich gewissermaßen auch gewisse Standards ableiten."
Diese Überschrift stellt vor allem normative Aspekte in der Bewertung von Qualität und Qualitätsmanagement in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die leitende Forschungsfrage lautet: welche Einstellungen und Werthaltungen werden von den befragten ExpertInnen und den von ihnen repräsentierten Institutionen vertreten, und wie wirken sich diese auf die Bewertung von Qualität aus?
Diese Kategorie wurde in der Codierung der Interviews nachträglich hinzugefügt, da sie in den Aussagen einiger ExpertInnen einen sehr breiten Raum einnimmt. Es ist wiederum nicht das Ziel Wertungen bezüglich der vertretenen Einstellungen vorzunehmen.
Dieser Überschrift ist voranzustellen, dass Unterschiede weniger länderspezifisch, als vielmehr innerhalb der Prozessebenen ausgemacht werden können, wobei die Gewichtung dieses Punktes in Abhängigkeit von subjektiven Prioritäten auf der Seite der ExpertInnen variiert.
Einen wesentlichen Aspekt, v.a. in der Argumentation von LeiterInnen von Institutionen und von Seiten der Interessensvertretung macht die Verortung der Dienstleistung innerhalb des Wertekomplex der Unterstützten Beschäftigung sowie die sich daraus ergebenden Zielsetzungen aus, die zum Teil natürlich in einem Widerspruch zu einem eher nutzengeleiteten Interesse der FördergeberInnen stehen. Dies drückt sich insbesonders in der Frage aus, für wen und unter welchen Voraussetzungen die Dienstleistung zugänglich ist bzw. sein sollte. Vor allem in Österreich ist der offene Zugang für alle Menschen mit Behinderung aus der Sicht von LeiterInnen ein wesentliches Kriterium. So argumentiert beispielsweise Walter Lackner:
"Und wir haben gesagt, wir wollen es in einem gewissen Zeitraum fertig bringen, dass jeder, der Arbeit sucht und eine Behinderung hat und sagen kann: "Ich will arbeiten", also sich in irgendeiner Form ausdrücken kann, auch Arbeit bekommt."
Darin sieht Karin Rossi auch gleichzeitig die Vision und den gesellschaftlichen Auftrag von Arbeitsassistenz:
"aber der grundsätzliche Anspruch zu sagen, wird sind eine Gesellschaft und wir können uns das leisten auch behinderte Menschen zu integrieren, die nicht 100 % Leistung bringen, sondern nur 80% oder nur 50% oder so. Ja, und denen die Chance zu geben, nicht nur Körbe zu flechten, sondern Friseur zu werden oder LKW Fahrer oder was auch immer. Das heißt, ihnen eigentlich ihre persönlichen Vorstellungen und Wünsche freizugeben, also da steckt für mich irrsinnig viel drinnen, also das ist die Vision der Arbeitsassistenz"
Ein dazu nicht absolut konträrer, aber doch eingeschränkterer Standpunkt wird von Seiten der Fördergeber vertreten, wonach Aufwand und Nutzen sowohl für den behinderten Menschen als auch für den Fördergeber in einem stimmigen Verhältnis stehen sollen:
"Also es ist sicher eine ganz große Aufgabe von uns, eine Aufgabe die uns auch sehr wichtig ist. Man muss aber schon bei dem Thema versuchen klar zu sehen und auch abzugrenzen wo eine Integration möglich und auch sinnvoll für die betroffene Person ist, wo zieht er einen Gewinn daraus, und wo ist es ihm nicht dienlich..." sowie "Arbeitsassistenz ist schon so definiert, dass wir Menschen die schwer zu vermitteln sind, begleiten - es ist aber nicht so definiert, dass jemand drei Jahre an der Hand genommen wird und dann vielleicht mit weiterer Unterstützung in den Arbeitsmarkt kommt. In einem solchen Fall müsste man sich schon überlegen, ob es vorbereitende Maßnahmen gibt die sinnvoller sind,..." (Fritzer)
Dieses nutzengeleitete Interesse wird nach Michael Stadler-Vida auch in den Vorgaben der Fördergeber ersichtlich:
"... andererseits ist die Frage bei der öffentlichen Hand auch immer - wofür verwendet man das Geld und welchen Nutzen hat man auch daraus, und ich denke, wenn man sich die Vorgaben vom Sozialministerium anschaut, die sind schon sehr stark nutzengleleitet. Da ist immer die Frage, was hole ich mit welchem Mitteleinsatz da heraus,..."
Ein weiterer Schwerpunkt kann in der Gewichtung des leitenden Menschenbildes ausgemacht werden. So führt etwa Rolf Behncke in Abgrenzung zu einem behavioristischen Menschenbild aus:
"Was die Qualifizierung angeht, ist es schon so, dass das so genannte Menschenbild eine vergleichsweise große Rolle spielt. Es ist vielleicht auch eine pädagogische Fragestellung die vielleicht auch bei allen Mitarbeitern ständig im Kopf ist, inwieweit wir nun Menschen mit Behinderung als lernfähiges Subjekt ansehen, der über die Möglichkeit, vernünftig Dinge zu reflektieren auch Lernfortschritte machen kann. Also wo Lernfortschritte und Bewusstsein, dass irgendwas gemacht wird im Einklang miteinander stehen, also beispielsweise wo früher und auch heute noch bestimmte theoretische Ansätze existieren, wo ein Mensch als Blackbox angesehen wird und durch äußeres Training bestimmte Verhaltensweisen antrainiert werden können, obwohl die Person eigentlich gar nicht weiß, was sie tut. Also dieses Menschenbild spielt schon eine große Rolle und schlägt sich dann auch nieder insofern in der konkreten pädagogischen Arbeit vor Ort."
Wie sich dieses Menschenbild auf die konkrete Arbeit auswirkt, versucht Stefan Doose nachzuzeichnen:
"Weil, wenn ich als Integrationsberater nicht davon überzeugt bin, dass die Person, die ich unterstütze, auch arbeiten kann und ein guter Arbeitnehmer ist, der, wenn er richtig eingesetzt wird, auch sein Potential hat, wie soll ich dann einen Arbeitgeber überzeugen. Dann verkaufe ich minderwertige Ware - das ist ein anderes Bild, das Leute im Kopf haben."
Auf die Bedeutung einer integrativen Grundhaltung als zentrale Voraussetzung für alle Fachkräfte weist Walter Lackner hin:
",... ich glaube, dass berufliche Integration sehr viel mit Haltung zu tun hat, und das wollen wir auch herausbringen - Haltung im Sinne von "Attitude". Das wollen wir auch herausbringen bei unserer Tagung, also das QUIP, was wir unter QUIP nennen, dass es auch eine Haltung impliziert und, dass das nicht jeder machen kann."
Die Akzeptanz und das Bestehen der Dienstleistung sind schlussendlich auch von einer derartigen Grundhaltung auf der Seite der Fördergeber abhängig, wie Jörg Bungart ausführt:
"Und die Umsetzung ist nicht zuletzt davon abhängig auch wie aufgeklärt die Entscheidungspersonen sind, d.h. wie stark das Thema Integration da auch in den Köpfen verankert ist, und das ist natürlich wieder eine andere Aufgabe, die der Aufklärung und Information usw."
Eine solche Grundhaltung wird insbesondere von Institutionen vertreten, die sich selbst im Rahmen der Integrationsbewegung verorten, dies trifft in besonderem Maße auf die Hamburger Arbeitsassistenz zu:
"Der Impuls stammt nach wie vor ursprünglich von den Wurzeln unserer Arbeit, da wir eben ursprünglich aus einer Integrationsbewegung kommen. In diesem Zusammenhang wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Leute die wir unterstützen ein hohes Maß an Eigenständigkeit haben und bestimmen können, was sich hier abspielt. Es orientiert sich da sehr viel an den individuellen Erfordernissen der einzelnen Personen, und ich sage mal so einen gewissen Fundamentalismus, gibt es hier nach wie vor,..." (Behncke)
Auch der Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik, von einem rehabilitativen zu einem integrativen Paradigma, ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung:
"Also das aller wichtigste ist für mich sich den Ausgangspunkt deutlich zu machen. Unterstützte Beschäftigung ist für mich eine Möglichkeit Teilhabe für Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft in einem Kernbereich - in diesem Fall dem Arbeitsleben - zu erreichen. Nur in diesem Kontext ist Unterstützte Beschäftigung bzw. sind IFD innovativ bzw. machen sie etwas Neues. Bezogen auf den Paradigmenwechsel - eine andere Form des Umgangs miteinander, also dass auch ein anderer Geist in diesen Diensten ist und nicht der alte Geist in einer neuen Maßnahme. Das ist für mich ein wesentliches Qualitätskriterium und ich finde, es muss sich immer an der Frage messen lassen, tragen diese Dienste etwas dazu bei, dass sich die Lebensqualität der unterstützten Personen auch verbessert." (Doose)
Von diesem Menschenbild und dieser Haltung ausgehend, ergeben sich aus Sicht der ExpertInnen einige handlunsgleitende Prinzipien in der Arbeit mit den NutzerInnen:
"Sehr wohl ist diese Vision, dieses Ziel, das ein Mensch mit Behinderung als sein Lebensziel oder als sein berufliches Ziel ansieht, durchaus der Maßstab oder die Leitlinie an der sich dann auch unser Handeln orientieren muss. Und es ist wichtig, dass man dann versucht, sozusagen die Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und das, was jemand möchte aneinander anzugleichen." (Behncke)
Die Ziele der NutzerInnen sind demnach Maßstab und Leitlinie für professionelles Handeln. Dass allerdings auch Kompromissbildung notwendig ist, um das Ziel der beruflichen Integration nicht zu verlieren, führt Rolf Behncke so aus:
".... obwohl man da eigentlich wieder an dem Punkt ist das der Arbeitsmarkt nicht nach Belieben formbar ist, sondern irgendwann muss man dann auch das nehmen, was es gibt. Sonst kann man sich von dem Ziel der Integration sozusagen verabschieden, also da gibt es immer ein Stück weit Kompromissbildung. Wie gesagt nicht jeder Traum ist umsetzbar, nicht jeder Mensch mit Behinderung kann Pilot oder Ärztin oder Kindergärtnerin werden, sondern bleibt bei der Küchengehilfin im Kindergarten oder was weiß ich. Also da gibt es wahrscheinlich immer eine Anforderung Kompromisse zu bilden, wobei natürlich jeder die Freiheit hat zu sagen, das mach ich nicht mit."
Rolf Behncke weist auch auf ein weiteres wesentliches Spannungsmoment im Kontext von Unterstützungsleistungen hin, in dem Anspruch und Realität oft auseinander klaffen. Die Grauzone zwischen Förderung und Unterstützung der Selbstbestimmung bzw. des Selbstbestimmungsrechts der NutzerInnen einerseits, und ihrer "Bevormundung", im Sinne des Überstülpens oder Vorformulierens von Entscheidungen andererseits:
"...also es handelt sich in den meisten Fällen ja um Menschen mit Lernschwierigkeiten die ein hohes Maß an Unterstützung brauchen, um Perspektiven zu entwickeln und um Entscheidungen zu fällen. Und da gerät man selbst schnell in eine Diskussion, ob nicht beispielsweise wieder dieser Personenkreis in eine Position kommt, wo ihnen etwas übergestülpt, Perspektiven vorformuliert, bzw. Entscheidungen für sie getroffen werden, nicht zuletzt aufgrund der intellektuellen Schwierigkeiten, die manche Leute haben, die wir unterstützen. Also an der Stelle gibt es durchaus noch Punkte, die uns bewusst sind, wo wir aufpassen müssen, ob wir unseren eigenen Ansprüchen genügen. Also da kann es durchaus sein, das muss ich auch zugestehen, dass es da ein Auseinanderklaffen gibt zwischen eigentlich präsentem Anspruch, wie z.B. das Selbstbestimmungsrecht zu akzeptieren, aber andererseits um schnell mal im Alltag zu Ergebnissen zu kommen, was ohne den Menschen gemacht wird, oder aber auch über den Kopf der Person hinaus eine Entscheidung z.B. sehr stark beeinflusst wird. Ich glaube, da sind wir einfach in so einer Grauzone in der sich jeder Unterstützer bewegt, und ich glaube, da muss man auch mal länger darüber diskutieren im Bereich Unterstützer, wo es um Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen geht. Wo hört Unterstützung auf und wo fängt Bevormundung an. Das ist denke ich so eine Grauzone, aber den Mindestanspruch den wir an uns stellen ist, dass wir uns dessen auch durchaus bewusst sind, das wir uns da in so einer Grauzone bewegen."
Die Forderungen nach Kritik- und Reflexionsfähigkeit werden auch von Walter Lackner als zentrale Prinzipien in seinem Qualitätsverständnis angesehen:
"... ich sehe Qualität also nicht im Qualitätshandbuch, sondern dass gewisse Prinzipien da sind, und dass das nicht leere Worte sind, sondern dass man sich daran hält, dass man eine gewisse Haltung und eine Kritikfähigkeit hat, Reflexion zu machen. Mach ich das wirklich so, wie ich es sage, ja? Und es ist nicht wichtig, ob ich jetzt eine Krawatte trage und nach außen hin irrsinnig klass wirke und eine schön geschliffene Rhetorik hab, sondern es ist wichtig, dass ich die Ärmel aufgekrempel."
Die folgende Überschrift wird die Frage behandeln, inwieweit nationale bzw. EU - rechtliche Rahmenbedingungen bzw. Förderprogramme Einfluss auf die konkrete Arbeit und das Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration haben. Ferner geht es um die Einschätzung der ExpertInnen, welche Rahmenbedingungen auf nationalem und auf europäischem Niveau sich als der Qualität förderlich bzw. hemmend darstellen, sowie welche Veränderungen aus ihrer Sicht wünschenswert, zielführend und umsetzbar wären. Aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene wird dieser Aspekt für beide Länder separat analysiert. Zusätzlich werden auch mögliche wechselseitige Implikationen betrachtet. Da die europäische Dimension in vielerlei Hinsicht eine Rahmen- bzw. Brückenfunktion darstellt, bezieht sich die Auswertung zuerst darauf.
Es besteht unter den ExpertInnen weitgehend Konsens darüber, dass die europäischen Rahmenbedingungen, insbesondere der Europäische Sozialfonds (ESF) mit seinen Förderprogrammen und Gemeinschaftsinitiativen, mit der Zielsetzung eine fortschrittliche Entwicklung in den EU Ländern voranzutreiben, maßgeblich für die Entwicklung und den Ausbau der Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste verantwortlich war. Die Behandlung und Thematisierung des europäischen Kontextes nimmt interessanterweise auf Seite der FördergeberInnen in beiden Ländern einen kleineren Raum ein. So attestiert Dieter Schartmann lediglich, dass von Seiten der EU viele inhaltliche und qualitative Anregungen kommen. Angelika Fritzer weist auf die Bedeutung der ESF-Mittel hin:
"EU-rechtliche Rahmenbedingungen, solange hier künftig Mittel in dem Ausmaß wie bisher zur Verfügung stehen werden - was ja auch in Anbetracht der neuen Beitrittsländer nicht so klar ist - aber derzeit sind sie zufrieden stellend ...."
Unter den anderen InterviewpartnerInnen besteht ein eindeutiger Konsens, dass erst durch die EU v.a. die finanziellen Voraussetzungen geschaffen wurden, um diese Dienstleistungen aufzubauen. Sowohl die Hamburger Arbeitsassistenz als auch die Arbeitsassistenz der Lebenshilfe Ennstal sind zunächst als EU Projekte in den Förderprogrammen HORIZON bzw. LEONARDO entstanden. Dazu einige Zitate:
"...also diese Rahmenprogramme oder Finanzierungsmöglichkeiten schaffen oftmals überhaupt die Voraussetzung, dass es diese Entwicklung dieser Dienstleistungen gab. Die Arbeitsassistenz ist ja ein gutes Beispiel dafür, die ja ursprünglich nur Projektbasis hatte, auch schon mit europäischen Geldern finanziert oder zumindest mitfinanziert, und jetzt in den letzten Jahren mit den ESF Geldern zumindest stützend aufgebaut worden ist. Das heißt die EU schafft oft die Voraussetzungen, dass so etwas überhaupt finanziert wird." (Stadler-Vida)
"Die andere Sache, die man auch ganz klar sagen kann, es gäbe Unterstütze Beschäftigung in Österreich und Deutschland nicht ohne die Förderprogramme der EU. Der Durchbruch, in Österreich kann man das par excellence sehen, dass der Boom kam, als die Förderprogramme da waren, wo man ja traditionelle Maßnahmen nicht so einfach fördern konnte. Auch die ersten Modellprojekte in Deutschland sind damals alle durch den ESF auch gefördert worden." (Doose)
"Gehen wir zuerst in den europäischen Kontext, weil ich glaube, das ist der Sympathischere, weil in Europa und in der europäischen Gesetzgebung und in dem europäischen Selbstverständnis gibt es diesen Artikel 12 von der EU - Charta, in dem es um das Recht auf Arbeit geht. Hätten wir nicht die EU, habe ich immer gesagt, hätten wir nicht die Arbeitsassistenz, schon allein von den Finanzen. Wir hätten die ESF Gelder nicht, vor allem die Beamten, die sind ja geil darauf, da gibt es jetzt Geld und da machen wir etwas. Was ist egal, aber Hauptsache wir machen etwas. Und ich denke, da spielt auch die Qualität der Konzeption eine große Rolle, also man sollte zuerst Konzepte haben und dann erst umsetzen." (Lackner)
"Also die EU - Förderprogramme sind extrem wichtig dafür, dass so ein Projekt überhaupt auf die Beine gestellt wird. Auch mit der Zielsetzung, die damit verbunden ist, das ist ja auch im Sinne einer fortschrittlichen Entwicklung innerhalb der Länder der EU Staaten selbst. Und ohne diese EU - Programme, die wir hier so im Laufe der letzten 10-12 Jahre mitgekriegt haben, sind die ganz wichtig um überhaupt so etwas in Gang zu stoßen..." (Behncke)
Im Kontext der Qualitätsentwicklung wurde neben konkreten durch die EU kofinanzierten Projekten, wie beispielsweise dem QUIP Projekt, auch auf die Bedeutung des europaweiten thematischen Austausches, insbesondere im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT hingewiesen, die unter anderem auch zur Gründung der "European Union of Supported Employment" (EUSE) beigetragen haben. Dazu Stefan Doose:
"Insofern waren sie auch bedeutsam für die Qualitätsentwicklung und auch die Möglichkeit, dass Leute z.B. im Rahmen von HELIOS - das war ein Unterprogramm im Rahmen von EMPLOYMENT - Leute auch innerhalb von Europa reisen konnten, sich andere Projekte angucken konnten was andere Leute machen. Es ist ganz wichtig gewesen dort auch zu diskutieren, was meinen wir eigentlich, wenn wir Unterstützte Beschäftigung sagen, was meinen wir eigentlich was ist gute Arbeitsplatzentwicklung, was ist gute Qualität, und was ist auf einer europäischen Perspektive wichtig."
Der Einfluss auf die nationale Gesetzgebung wurde von den deutschen ExpertInnen insgesamt stärker hervorgehoben. In diesem Zusammenhang wird vor allem auf die im neuen deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IX) umgesetzten EU - Richtlinien hingewiesen:
"Also ich denke, dass die EU - Richtlinien zunehmend Einfluss sicherlich gewinnen werden, es werden ja mittlerweile bestimmte Standards festgelegt, die in den einzelnen Ländern dann umgesetzt werden müssen. Da ist mein Eindruck - der Stefan Doose hat bei uns ja auch mal einen Artikel dazu geschrieben - dass das auch viel voran bringt. Ich hoffe also durchaus, dass es dazu beiträgt bei den Standards zu einer Angleichung auf einem europäischen Level zu kommen, und, dass es auch nicht zuletzt durch ESF geförderte Modellprojekte zu einem guten Austausch unter den europäischen Ländern führt. Das sehe ich als sehr positiv. Auch unser Sozialgesetzbuch 9, was ja in Deutschland ausschlaggebend ist, ist ja nicht zuletzt aufgrund der EU Vorgaben so entwickelt worden..." (Bungart)
Insgesamt wurde vor allem von den LeiterInnen von Institutionen in beiden Ländern, insbesondere im Kontext des EU - Vergabegesetzes und möglicher Ausschreibungen, auch vor der Gefahr einer drohenden Qualitätsverschlechterung gewarnt, sofern ausschließlich preisliche Gesichtspunkte in den Ausschreibungen berücksichtigt werden. Dabei wurde auch auf erste Erfahrungen in verwandten Dienstleistungsbranchen hingewiesen.
"... ja, und was sicher eine Auswirkung hat - ich weiß nicht ob es zukünftig ist - weil wir das jetzt schon spüren - also was momentan sicherlich die größte Erschütterung ist, ist einfach dieses EU Vergabegesetz, das dann in Österreich in das Bundesvergabegesetz herunter gebrochen wird. Wenn ich sage zukünftig, dann hat das einfach damit zu tun, dass zur Zeit noch nicht ausgeschrieben wird, der Arbeitsassistenz aber so als Damoklesschwert im Rücken steht. Es gibt auch vom AMS einige Projekte bei denen schon ausgeschrieben wird, und wir hören in der Zwischenzeit auch einige Schreie aus dieser Richtung. Das ist sicher so das Massivste von der EU Ebene was wir so spüren, also wenn das so herunter gebrochen ist auf Bundesebene." (Rossi)
".... andererseits finde ich, was insgesamt im Zuge der Vergemeinschaftlichung geplant ist, so freier Verkehr von Waren und Dienstleistungen, Arbeitskräften und Kapital führt das zu einer eindeutigen Qualitätsverschlechterung hier. Also es sind z.B. - ich weiß nicht, ob ihnen das so vertraut ist - es sind viele Maßnahmen der beruflichen Vorbereitung, wo ein Stück weit auch Menschen mit Behinderung betroffen sind, aber in einem erheblich höherem Maß benachteiligte Jugendliche gehen hinsichtlich der Qualität baden. Da wird EU weit - also noch nicht EU weit - aber deutschlandweit ausgeschrieben. Irgendwann wird EU weit ausgeschrieben werden, also ein Anbieter aus Sizilien kann dann ein Projekt hier in Hamburg machen und umgekehrt, wo, so wie es sich zumindest in der Tendenz andeutet, null Augenmerk auf Qualitätsstandrads gelegt wird, sondern wo es ausschließlich nach preislichen Gesichtspunkten geht." (Behncke)
Dieser drohenden Qualitätsverschlechterung kann, so die Ansicht von Rolf Behncke, vor allem durch die Berücksichtigung qualitativer Kriterien, wie etwa einer regionalen Verbundenheit und Einbindung der Anbieter in das institutionelle Netzwerk der beruflichen Integration, in Ausschreibungen begegnet werden. Einen, durch den hohen administrativen Aufwand nicht immer förderlichen Einfluss üben nach Ansicht Karin Rossis die Gender - Mainstreaming Maßnahmen und Richtlinien der EU aus. Es besteht dabei die Gefahr, dass grundsätzlich notwendige und positive Maßnahmen keinerlei Einfluss auf die konkrete Arbeit ausüben.
Bei der Darstellung des Einflusses der nationalen Rahmenbedingungen wird zunächst auf die Spezifika der einzelnen Länder eingegangen, um anschließend gleiche oder ähnliche Einflussfaktoren aufzuzeigen.
Es besteht bei den ExpertInnen in Deutschland große Einigkeit bei der Bewertung der nationalen Rahmenbedingungen und der sich daraus ergebenden Konsequenzen. Kein Konsens wird dahingehend erzielt, inwieweit gesetzliche Rahmenbedingungen, mit Ausnahme der Ressourcenverteilung und -ausstattung sowie der gesetzlichen Vorgabe, gewisse Qualitätsstandards einzuhalten, einen unmittelbaren Einfluss auf die Qualitätsentwicklung in den Diensten ausüben. Klarheit besteht darin, dass die Gesetze, dabei vor allem das Sozialgesetzbuch (SGB IX), die rechtliche und finanzielle Legitimation bilden, damit die Dienste eingerichtet und finanziert werden können. Erstaunlicherweise wird mit Ausnahme des Fördergebers in der Thematisierung der ExpertInnen die Qualität des Gesetzes besonders hervorgehoben und zum Teil sehr breit ausgeführt.
"... die national rechtlichen Rahmenbedingungen, tja, die sind für uns ganz wichtig. Dadurch, dass in Deutschland durch das SGB IX zunehmend - tja, wir haben in Deutschland ein sehr stark differenziertes Rehasystem, und das kann das SGB IX auch nicht vollständig aufheben, denn dann müsste man ja alles umgestalten. Aber dadurch, dass schon Zuständigkeitsfragen schneller geregelt werden sollen, dass zu Fragen wie zusammengearbeitet wird Regelungen da sind, die Vernetzung und die Zusammenarbeit, das sind wichtige Standards und Voraussetzungen des Gesetzes. Es ist ein lernendes Gesetz. Es erfüllt, wenn man so will selber gewisse Qualitätsstandards. Da sehe ich schon sehr große Vorteile, und für mich sind auch die genannten Zielkriterien wie Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeit die obersten Standards überhaupt im Rahmen der bundesdeutschen Sozialgesetzgebung, und die müssen runter gebrochen werden auf die ganz konkrete Ebene in allen Bereichen." (Bungart)
Es wird dabei besonders hervorgehoben, dass die im Gesetz festgelegten Zielgruppen- und Aufgabenbeschreibungen auf empirischen Untersuchungen Ende der 90er Jahre basieren. Diese spiegeln zum Großteil den Methodenkatalog der Unterstützten Beschäftigung wieder. Außerdem wird die Zuständigkeit der IFD für den Übergang Schule - Beruf im Gesetz explizit betont. Dabei wird von allen ExpertInnen ein großer Widerspruch zwischen den Ansprüchen des Gesetzes und dem tatsächlich Realisierten ausgemacht. An dieser Stelle werden die wesentlichen Aspekte zusammengefasst, die von den ExpertInnen aus Deutschland dargestellt werden:
Nach Auslaufen der erfolgreichen Modellprojektphasen und der gesetzlichen Verankerung der IFD wurde das "Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter" sowie die Kampagne "50.000 Jobs für Schwerbehinderte" verabschiedet. In dessen Zuge bekam die Arbeitsmarktverwaltung (AVW) (heute Bundesagentur für Arbeit) die Verantwortung für den Vermittlungsbereich der IFD zugesprochen. Die Arbeitsmarktverwaltung führte daraufhin ein neues Finanzierungs- und Vergütungssystem ein, das auf einer niedrigen Betreuungspauschale und einer Vermittlungsvergütung basierte. Durch diesen Finanzierungsdruck war es den IFD einerseits nicht möglich, den im Gesetz festgelegten Aufgabenkatalog zu erfüllen. Andererseits führte es zum Wegbrechen besonders benachteiligter Gruppen ("Creaming Effekt"), den WerkstättenmitarbeiterInnen und SchulabgängerInnen, welche im Gesetz explizit als Zielgruppe angeführt werden. Die Arbeitsmarktverwaltung beauftragte zahlreiche neue Träger, zumeist Bildungsträger, die über keinen entsprechenden Hintergrund in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung verfügten. Von Seiten der Integrationsämter wurde versucht über eine Qualitätsdiskussion mit der AVW ins Gespräch zu kommen. Dabei zeigte sich, dass die AVW über ein sehr einseitiges Qualitätsverständnis verfügt, wonach die Anzahl der Vermittlungen der einzig ausschlaggebende Indikator für Qualität ist.
Weitere hemmende Faktoren sollen anhand von Zitaten der ExpertInnen veranschaulicht werden. Bezugnehmend auf die "50.000 Jobs Kampagne" führt Jörg Bungart aus:
"... da müssen wir aufpassen, wenn dann in Deutschland so "50 000 Jobs für Behinderte" Kampagnen kommen, dann ist die spezifische Stärke der Fachdienste gefährdet, weil dann gehe ich auf Masse, und das ist bei der Zielgruppe natürlich völliger Unsinn (...). Ich muss individuelle Wege beschreiten, nur dann kann der IFD auch seine Stärke entfalten, mit der Methodik, die er auch hat, wenn er sie da entsprechend einsetzt..."
Dieter Schartmann spricht die Problematik der unterschiedlichen Kostenträger an:
"Ja, im Moment ist es ja so geregelt, dass die IFDs für mehrere Kostenträger gleichzeitig tätig werden können, d.h. für schwerbehinderte Menschen einmal für die Arbeitsmarktverwaltung (AVW) im vermittelnden Bereich, auf der anderen Seite für das Integrationsamt (IA) im Rahmen der begleitenden Hilfen. Zusätzlich können sie noch für die Rehaträger zuständig werden, wenn behinderte Menschen Unterstützung benötigen. Das ist eine sehr komplexe, teilweise unübersichtliche Gemengelage von unterschiedlichen Kostenträgern und unterschiedlichen Qualitätsdokumentations-anforderungen."
Stefan Doose berichtet über das Wegbrechen einzelner Zielgruppen als Folge der Übernahme der Verantwortung durch die Arbeitsmarktverwaltung:
"Das, was entscheidend ist, dass ganz bestimmte Personengruppen nicht mehr zum IFD zugewiesen wurden. Menschen aus WfbM sind von der Arbeitsmarktverwaltung, was man aus der Statistik nachweisen kann, nicht zugewiesen worden. Im Jahre 2002 - Moment - dass ich nicht lüge [schaut in seinen Unterlagen nach] kamen beispielsweise 69 Personen von 35.191 Personen aus WfbMs. 69 von 35.191 zeigt so deutlich, das liegt ja sogar über dem Zufallsfaktor - das ist eine ganz klare Einflussnahme durch die Arbeitsmarktverwaltung. Die haben die IFD ja auch nie gewollt, die wollten ihre Schwerbehindertenvermittlung ausbauen, (...)"
Den Widerspruch zwischen den im Gesetz beschriebenen Anforderungen und der tatsächlichen Umsetzung, macht Rolf Behncke vor allem am Übergang Schule - Beruf fest:
"Ich denke einmal der IFD, so wie er jetzt bundesweit arbeitet, kann diese Arbeit mal nicht so einfach übernehmen. Weil ich sag mal Schule und Schülerinnen ein fremdes Wesen für die IFD sind. Das System Schule ist unbekannt und Schülerinnen kennt der IFD zur Zeit gar nicht. Also ich denke einmal der IFD und die Mitarbeiter des IFD müssen sich erstmal vertraut machen mit dem, was da so auf sie zukommt. Und da gibt es einfach auch Ungereimtheiten und noch keine klaren Zuständigkeiten, wie weit der IFD sich abgrenzt gegen Aufgaben der Schule einerseits und gegen Aufgaben der Arbeitsmarktverwaltung oder der Berufsberatung des Arbeitsamtes - das ist offen."
Auf Österreich bezogen zeigen sich einerseits strukturelle Unterschiede, andererseits ist die Diskrepanz in der Bewertung der Rahmenbedingungen zwischen der Position der Fördergeber und jener der anderen Prozessebenen stärker ausgeprägt als in Deutschland. Zunächst zu den strukturellen Unterschieden auf der Ebene der gesetzlichen Rahmenbedingungen. In Österreich ist die Arbeitsassistenz auf gesetzlicher Ebene offener geregelt. Im Rahmen des bundesweiten Behinderteneinstellungsgesetzes wird darauf verwiesen, dass begleitende Hilfen im Arbeitsleben, zu denen insbesondere die Arbeitsassistenz zählt, förderbar sind. Die Ausgestaltung der Begleitenden Hilfen ist in Form von Richtlinien organisiert, die in der Zuständigkeit des BMSG herausgegeben werden. Details (wie die Kapitel 8.5.3. betrachteten Erfolgskriterien) sind in dem "Leitfaden zur Projektbearbeitung" festgehalten, welcher den für die operative Steuerung und Kontrolle zuständigen Bundessozialämtern als Arbeitsgrundlage dient. Der Vorteil in dieser Vorgehensweise wird von Seiten der Fördergeber in der Flexibilität gesehen, auf z.B. arbeitsmarktpolitische Veränderungen rascher reagieren zu können. Allerdings kritisieren vor allem die LeiterInnen von Institutionen die oft mangelnde bzw. nicht transparente Kommunikation. Den größten Einfluss auf die konkrete Arbeit und die Qualitätsentwicklung üben nach Ansicht der LeiterInnen die "Richtlinien zur Förderung der begleitenden Hilfen", sowie bestimmte Aspekte im Behinderteneinstellungsgesetz wie etwa der Kündigungsschutz, aus. Sehr emotional diskutiert werden in Österreich vor allem die Erfolgsvorgaben bzw. -quoten, und den dadurch ausgelösten Erfolgsdruck auf die Träger dieser Dienstleistung.
Von Seiten der Institutionen werden als hemmende Faktoren die Notwendigkeit des Erwerbs des so genannten "Feststellungsbescheids" und die damit in Verbindung stehenden längerfristigen Förderungsmöglichkeiten sowie der Kündigungsschutz angeführt. Dazu Fr. Dr. Rossi:
"Wir raten wirklich nur sehr wenigen Menschen sich den Feststellungsbescheid zu suchen. Aber es ist natürlich eine individuelle Geschichte und man muss immer individuell schauen, weil damit ja auch sehr viele Förderungen verknüpft sind. Ja und gerade die Dauerförderungen und die längerfristigen Förderungen sind sehr oft einfach mit diesem Feststellungsbescheid verknüpft, weil die AMS Förderungen kurzfristiger sind, aber man kann das nicht so pauschal sagen..." sowie "Aber für ganz viele Klienten, die keine Arbeit haben, muss ich ganz ehrlich sagen, raten wir ihnen nicht unbedingt dazu, weil das zunehmend eine massive Barriere wird."
Auf die Problematik der Erfolgsvorgaben gehen Mag. Stadler-Vida und Walter Lackner ein:
"Zumindest in Österreich ein Punkt, wo ich sehr skeptisch bin, sind die veränderten Möglichkeiten in den letzten Jahren. Der Dr. Schuster vom Bundessozialamt Wien hat das meiner Meinung bei der Dachverbandstagung sehr gut auf den Punkt gebracht, und zwar, dass man die spezifische Qualität von Arbeitsassistenz durch übertriebene Vorgaben auch zerstören und im Endeffekt auch den Unterschied zu der Dienstleistung des AMS dadurch vernichten kann und dadurch auch die ganze Idee der Arbeitsassistenz damit zerstört. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt." (Stadler-Vida)
"Also ich habe mir aufgeschrieben: Richtlinien der Arbeitsassistenz. Ich meine das sagt alles, wo es jahrelang nur um Quoten geht. Zuerst 1:10 und jetzt 1:15, die sind also 50% mit ihrer "sozusagen" Leistungsforderung hinaufgegangen. Bitte, wo gibt es das sonst, das man sagt, wir verlangen nicht mehr 100% wir verlangen jetzt 150%, in welchem Betrieb verlangt man das von Mitarbeitern. Ich hab also prinzipiell immer versucht - auch wenn wir am Anfang, wo wir unsere Pionierzeit hatten sehr hohe Erfolgszahlen hatten - habe ich immer gesagt, ich bin dagegen, dass man nur an den Erfolgszahlen misst. Aber der Kostenträger, das BSB aber auch das Ministerium haben nur diese eine Zahl gesehen, das ist die ganze Qualität, 10 Plätze. Daneben gilt auch noch wie viel das kostet, die Verweildauer im Betrieb und so..." (Lackner)
Als weiteren, die Qualität hemmenden Faktor, wird von allen ExpertInnen in Österreich, mit Ausnahme der Fördergeber, die Zersplitterung des Angebots der Arbeitsassistenz in zahlreiche Maßnahmen genannt. Es gibt dadurch Unklarheiten bezüglich der Abgrenzung der einzelnen Dienstleistungen voneinander, und es besteht dabei selbst für Fachkräfte wenig Transparenz. Den Fördergebern wird vorgeworfen, zu schnell neue Systeme einzuführen, die mit jenen der Träger zumeist nicht kompatibel sind. Dabei wird unter anderem auf die neue Teilqualifizierungslehre und die Berufsausbildungsassistenz verwiesen:
"...wir bei der Arbeitsassistenz, wir sind noch wenig davon betroffen, z.B. Jugendarbeitsassistenz und Berufsausbildungsassistenz, die haben ganz unklare Abgrenzungen zueinander, und Aufgabengebiete, die klassischerweise die Arbeitsassistenz gemacht hat. Die Lehrberufe macht jetzt die BAS, und ab wann setzt die Arbeitsassistenz ein, und wie tun sie da, und da kennt sich keiner aus, ja und das finde ich nicht sehr förderlich, also insofern meine persönliche Meinung." (Rossi)
"Da gab es In der Steiermark diese Aktion, wir hatten z.B. eine Arbeitsassistenz für Jugendliche, und das BSB hat dann diese Aktion Clearing gestartet, das hat "Startklar" in der Steiermark geheißen. Plötzlich haben wir nicht gewusst, wie wir unser Konzept weiterführen sollen. Weil wir haben das in der Arbeitsassistenz für Jugendlich gemacht und sie haben ein Konzept gehabt, wo sie eben nur die Schnittstelle betreut haben: Schule - Einstieg in den Arbeitsmarkt. Jetzt haben wir diese Problematik wieder mit der Berufsausbildungsassistenz - BAS heißt das. Ja, das ist in keinem Konzept früher drinnen gewesen, wir haben unser Konzept früher mit Job-Coaching gehabt, und jetzt - ich weiß nicht ob du das so genau kennst, dieses BAS - aber da ist jemand, der an und für sich keine pädagogischen Aufgaben hat, sondern organisatorische Aufgaben, und diese Person muss mit 20 Leuten den Prozess der TQL managen. Ja, wie weiß ich nicht, wenigstens mit unseren Zielgruppen" (Lackner)
"etwas was über kurz oder lang in Österreich sicher ein Thema sein wird, ist die Integration der ganzen unterschiedlichen Maßnahmen. Ich bin da derzeit sehr skeptisch, es gibt ja momentan einen florierenden Markt an neuen Dienstleistungen, wie die nicht alle heißen. Mittlerweile in dem letzten Bericht, den ich in der Hand gehabt habe von dem KMU Institut, zum Thema Integrationsmaßnahmen für Jugendliche, da habe ich so ein höchst komplexes Diagramm gesehen wie die ganzen Maßnahmen ineinander wirken sollen..." (Stadler-Vida)
Auf konkrete Veränderungsvorschläge im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wird durch die ExpertInnen in Deutschland konkreter und ausführlicher eingegangen als in Österreich.
Von Seiten des Fördergebers Integrationsamt, wird dabei vor allem auf die (seit 01.01.2005 mittlerweile durchgeführte) Überführung der Strukturverantwortung für beide Bereiche der IFD (Vermittlung und Begleitung) in den Verantwortungsbereich der Integrationsämter eingegangen. Dieser Strukturverantwortliche soll stellvertretend für alle Kostenträger die Arbeit mit den Integrationsfachdiensten koordinieren, und für beide Bereiche die Finanzverantwortung tragen. Für den IFD besteht darin eine wichtige Voraussetzung effektiv und effizient zu funktionieren, da er sich nicht mehr mit unterschiedlichen Anforderungen und Finanzierungssystemen beschäftigen muss. Außerdem wird das Qualitätsmanagementsystem KASSYS auch für den Vermittlungsbereich konzeptionell weiterentwickelt, und allen Diensten als zentrales Steuerungsinstrument vorgesetzt. Es ist nach Dr. Schartmann insgesamt ein struktureller Umbau dahingehend zu verzeichnen, die Dienste wieder so zu organisieren, wie sie vor der Übernahme durch die Arbeitsmarktverwaltung gewesen sind.
Von Seite der LeiterInnen, Interessensvertretung und Forschung werden für Deutschland noch zahlreiche weiterführende Verbesserungsvorschläge angeführt. Von allen drei ExpertInnen wird der Gesetzgeber aufgefordert, die Forderungen des SGB IX schrittweise zu realisieren, in dem Sinn, dass alle im Gesetz definierten Leistungen auch finanziert werden. Ebenso wird eine Änderung der Finanzierungsstruktur gefordert, die sich nicht ausschließlich am Vermittlungserfolg orientiert. Jeweils zwei Nennungen erhalten folgende Forderungen:
-
Eine Zusammenführung der Bereiche Vermittlung und Begleitung. (Doose und Bungart)
-
Die Einführung von Quoten in den Fachdiensten zur Vermittlung von WerkstättenmitarbeiterInnen und SchulabgängerInnen (Behncke und Bungart).
-
Mehr Angebote von betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen zur Unterstützung des Integrationsprozesses (Doose und Bungart).
-
Eine Umlenkung der Finanzflüsse weg von Institutionen hin zur Ermöglichung von individuellen Lösungen (Persönliches Budget) (Doose und Behncke).
-
Jeweils eine Nennung erhalten folgende Forderungen:
-
Eine auch über den Gesetzgeber veranlasste konzeptionelle Weiterentwicklung der WfbMs in Richtung verstärkter Ausrichtung auf integrative Angebote (Bungart).
-
Die Festschreibung von Qualitätskriterien in der Verwaltungsebene, um Trägern einforderbare Rechte zu garantieren (Doose).
-
Verlässlichere und unbürokratische Unterstützungsstrukturen, die es individuell möglich machen Unterstützung je nach Anforderung zu intensivieren (Doose).
-
Die Einführung einer verbindlichen Qualifizierungsstruktur für FachdienstmitarbeiterInnen in Anlehnung an das Konzept der "Berufsbegleitenden Qualifizierung" der BAG-UB (Doose).
-
Die Einführung eines einheitlichen Qualitätsmanagementsystems, welches sowohl von den Kostenträgern als auch von der BAG-UB anerkannt wird (Doose).
-
Einführung eines Rechtsanspruches der Person auf die Dienstleistung (Doose).
In Österreich sieht das BMSG derzeit keinen Bedarf für eine Änderung der Gesetzeslage. Auf veränderte Rahmenbedingungen kann flexibel im Rahmen interner Erlasse oder durch eine Veränderung des Leitfadens zur Projektbearbeitung eingegangen werden. Die Erfolgsvorgaben an einzelne Projektträger können bei nicht Erreichen auch herabgesetzt werden. Wesentlich ist es in diesem Fall allerdings die Begründungen und Einschätzungen der zuständigen Landesstelle des Bundessozialamtes einzuholen. Bezüglich eines möglichen Rechtsanspruches auf Arbeitsassistenz konnten zum Zeitpunkt des Interviews keine konkreten Aussagen gemacht werden, da sich das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz noch in der Entwurfsphase befand, und das BMSG aufgrund der nicht vorhersehbaren langfristigen Finanzierungssituation (ESF Mittel und Behindertenmilliarde) grundsätzlich vor Herausforderungen gestellt ist, die gelöst sein müssen um einen Rechtsanspruch auf die Dienstleistung zu ermöglichen. Es wird allerdings auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bezüglich der Qualitätskriterien und der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems soll es eine wissenschaftliche Begleitung geben, deren Ergebnisse dann mit dem BMSG rückgekoppelt und auf Vereinbarkeit mit den Vorgaben überprüft werden müssen. Bezüglich der Erfolgsvorgaben zeigt sich das BMSG grundsätzlich offen und gesprächsbereit. Die Basis für die derzeitigen Quoten scheint allerdings abgesichert. Sobald ein Veränderungsbedarf nachvollziehbar und über ein Qualitätsmanagementsystem haltbar begründet werden kann, werden auch andere Kriterien wesentlichen Einfluss auf die Erfolgsvorgaben haben.
Von den ExpertInnen der anderen Prozessebenen werden folgende Verbesserungsvorschläge bzw. -forderungen gestellt:
-
Eine Einbindung von Qualität und Qualitätskriterien inklusive qualitativer Indikatoren in die Erfolgsvorgaben und Bewertung der Dienstleistung (Lackner, Rossi, Stadler-Vida).
-
Eine stärkere Berücksichtigung von Entwicklungen in anderen europäischen Ländern (Lackner, Stadler-Vida).
-
Die Erweiterung des Dachverbandes Arbeitsassistenz im Sinne eines Dachverbandes für berufliche Integration, unter Einbeziehung aller wesentlichen Maßnahmen (Lackner).
-
Die Überarbeitung des Behinderteneinstellungsgesetzes, insbesondere im Hinblick auf den Kündigungsschutz und die Verknüpfung von langfristigen Förderungen mit dem Feststellungsbescheid. (Rossi)
-
Mehr Kontinuität und Verlässlichkeit bei Förderungen des Bundessozialamtes. Die Arbeitsassistenz braucht nicht die Kompetenz um über Vergabe und Höhe von Förderungen zu bestimmen. Ähnlich den AMS - Förderungen, wäre eine Information im Vorfeld sowie ein etwaiger Entscheidungsspielraum wünschenswert (Rossi).
Diese Überschrift untersucht die Frage, welche Motive und Beweggründe aus Sicht der ExpertInnen für eine verstärkte Auslösung der Qualitätsdiskussion im Bereich der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung verantwortlich sind. Zunächst werden die Hintergründe und Entwicklungslinien in den beiden Ländern betrachtet. Anschließend werden die Hauptmotive der ExpertInnen und der von ihnen vertretenen Institutionen dargestellt, wobei eine Differenzierung zwischen politisch / ökonomischen und fachlichen Motiven erfolgt.
Zunächst zur Darstellung der Hintergründe in Deutschland. Die Qualitätsdiskussion im Bereich der beruflichen Integration hat eine verhältnismäßig kurze Geschichte. Vorreiter waren die WfbMs die, hauptsächlich ausgelöst durch Druck von Zulieferern, ihre Produktionsbereiche nach ISO zertifizieren ließen. Ein Hintergrund und eine Grundlage für die Qualitätsdiskussion in der Institution Integrationsfachdienste waren die zahlreichen Modellprojekte, die von den damaligen Hauptfürsorgestellen eingerichtet und mit zumeist wissenschaftlicher Begleitung evaluiert wurden. Das Forschungsprojekt "Qualitätssicherung in Integrationsfachdiensten", in dessen Rahmen auch das System MUQ entwickelt worden ist, brachte eine erste explizite Auseinandersetzung mit der Thematik im Sinne der heute verwendeten Terminologien. Die bundesweit flächendeckende Einrichtung der Integrationsfachdienste, und die Übernahme der Struktur- und Finanzverantwortung für den Vermittlungsbereich der IFD durch die Arbeitsmarktverwaltung führten sehr bald zu einem sehr einseitigen Qualitätsverständnis. Dazu Dieter Schartmann:
"Insofern war die Einrichtung des IFD, was so der Bereich der Arbeitsvermittlung an betrifft, flächendeckend im Bundesgebiet unter sehr schlechten Startbedingungen gestartet, wenn man es unter qualitativen Gesichtspunkten aus betrachtet. Die Aufforderung so viele Leute zu vermitteln hat natürlich sehr schnell dahin geführt, dass als Spiegel auf der Qualitätsseite die Anzahl der Vermittlungen nicht als ein Indiz für die Qualität, sondern zum ausschließlichen Indikator für die Qualität der Dienste geworden ist."
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter (BIH) versuchte daraufhin mehrmals mit der Arbeitsmarktverwaltung ins Gespräch zu kommen, um auch andere Qualitätsdimensionen in die Bewertung der Dienste mit einzuführen.
In Österreich besteht Einigkeit darüber, dass die Qualitätsdiskussion in der Arbeitsassistenz in der Debatte um die Erfolgszahlen ihren Ausgang nahm. Aus der Sicht von Angelika Fritzer stellt es sich wie folgt dar[38]:
"Ursachen für die verstärkten Diskussionen sind sicherlich zum Teil die unterschiedlichen Ergebnisse in den Einrichtungen der Arbeitsassistenz gewesen. Die Diskussionen, die seit einigen Jahren geführt werden, waren auch bedingt durch die vorgegebenen Erfolgsquoten. Seitens der Arbeitsassistenz kam die Forderung, Qualität zu messen. Dagegen spricht von unserer Seite nichts, im Gegenteil, wir sehen das sehr positiv"
Die Forderung auch vermehrt qualitative Aspekte in die Beurteilung der Dienste einzuführen, wurde von den Trägern der Dienstleistung an die Fördergeber herangetragen. Wenig Konsens wurde anfangs in der Frage erzielt, worin die spezifische Qualität von Arbeitsassistenz besteht. Dies hat nach Ansicht von Karin Rossi mit einer grundsätzlichen Skepsis im Sozialbereich gegenüber Formen der Qualitätsmessung zu tun:
"... gerade der Sozialbereich hat ja was gegen messen und gegen festschreiben, und es gibt überhaupt einen ganz misstrauischen Zugang. Gerade der Sozialbereich - natürlich, es gibt auch andere Bereiche - aber im Sozialbereich ist es schon ein Stück Tradition, das sehr viel von Qualität und von qualitätsvoller Arbeit geredet wird: "und man darf doch Qualität nicht nur nach Vermittlungszahlen messen sondern man muss doch auch Qualität in die Arbeit bringen". Aber wenn man dann genauer nachfragt, dann gibt es 25 verschieden Versionen von Qualität, und keiner weiß so wirklich, was Qualität ist."
Die Motive werden anhand der unterschiedlichen Prozessebenen in den beiden Ländern analysiert. Dabei werden, wie einleitend angeführt, politisch / ökonomische und fachliche Motive unterschieden. Es zeigen sich große Ähnlichkeiten in der Argumentation und Begründung:
Der Fördergeber Integrationsamt versuchte über eine Qualitätsdiskussion mit der Arbeitsmarktverwaltung ins Gespräch zu kommen. Ausschlaggebende Gründe dafür waren eine durch das neue Vergütungssystem ausgelöste Zielgruppenverschiebung sowie mangelnde Nachhaltigkeit in den Vermittlungen. Das Integrationsamt Rheinland, das über eine lange Tradition an Integrationsfachdiensten und über empirisch gesichertes Datenmaterial verfügt, konnte diese Verschiebung auch empirisch belegen. Die Motive des Integrationsamtes werden politischen / ökonomischen Motiven zugerechnet. Auch fachliche Grundsatzentscheidungen bezüglich der Ausrichtung der Dienstleistung für besonders benachteiligte Personengruppen spielen dabei eine Rolle.
Von Seiten des Fördergebers BMSG werden unterschiedliche Motive explizit genannt. Dies ist zum einen ein internationaler und länderübergreifender Trend, wonach die Qualitätsfrage allgemein im Sozialbereich Einzug hält. Die Motivebene der Fördergeber liegt zum anderen auf begrenzten Ressourcen und auf einem Ende des so genannten "Gießkannenprinzips". Dabei wird diese Diskussion auch in Bereichen geführt, die schwerer behinderte Menschen betreffen. Dementsprechend hat sie insbesondere im Bereich der beruflichen Integration, welcher die Schnittstelle zur Wirtschaft darstellt, einen hohen Stellenwert. Die Arbeitsassistenz im speziellen wird als "Pilotprojekt" dienen, um die in einem solchen Qualitätsentwicklungsprozess gewonnenen Erfahrungen auf alle anderen vom BMSG geförderten Maßnahmen auszuweiten. Es ist geplant über das Bundesvergabegesetz eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben, um Qualitätskriterien für diesen Bereich zu definieren und die Frage nach möglichen Indikatoren zur Erfassung von Qualität zu beantworten. Dabei möchte das BMSG vor allem Erfahrungen der Institutionen einholen und in diese Studie einfließen lassen. Ebenso sollen bereits entwickelte Systeme dahingehend berücksichtigt und überprüft werden, inwieweit sie auf die Arbeitsassistenz übertragbar sind, bzw. es Bedarf zur Entwicklung eines eigenständigen Systems gibt.
Aus Sicht der BAG-UB wird den Fördergebern ein weiteres politisch / ökonomisches Motiv zugewiesen. Demnach geraten Kostenträger zunehmend stärker unter Druck nachzuweisen, wofür finanzielle Mittel eingesetzt und welche Erfolge damit erzielt werden. Dahinter stecken zumeist keine fachlich fundierten Entscheidungen. Dies führt oft dazu, schnell große Systeme aufzubauen, anstatt Entwicklungen kontinuierlich und systematisch voranzutreiben. Dies, sowie die Position der BAG-UB, bringt Jörg Bungart in dem folgenden Zitat zum Ausdruck:
"Es gibt jetzt eine aktuelle Studie, herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung - ist wohl ein gemeinsames Projekt gewesen, Österreich, Schweiz und Deutschland waren da wohl beteiligt - und die Schweiz hat gesagt: "also wir haben wohl zwischen 1995 und 1999 ganz Viele vermittelt", dann hat man aber festgestellt, dass die da jetzt alle wieder raus sind, weil die Leute viel zu schnell auf nicht passende Arbeitsplätze vermittelt wurden. Das ist genau unsere Argumentation auch in unserer Diskussion IFD und QM. Und an dieser Studie war jetzt auch die Bundesanstalt für Arbeit beteiligt, aber bis das mal runtersickert. Weil es gibt auch eine Diskussion welche langfristigen Wirkungen erzielt werden und nicht nur diese kurzfristigen Effekte und Effekthascherei, die zum Teil wirklich auch betrieben wird. Da habe ich jetzt wirklich auch eine Hoffung, dass wir da jetzt auch eine Weiterentwicklung hinkriegen."
Für den Dachverband Arbeitsassistenz birgt die Qualitätsdiskussion zahlreiche Möglichkeiten, da sich der Dachverband neben seiner Funktion als Interessensvertretung als Vertreter von Inhalten positioniert.
"... weil der Dachverband doch irgendwie - wie soll ich sagen - nicht nur Vertreter der Anbieter sondern auch Vertreter der Inhalte ist, nach dem Motto: "Wo Arbeitsassistenz draufsteht, soll es auch drinnen sein". Ja, und es ist mir auch ein Anliegen, dass Arbeitsassistenz auch Arbeitsassistenz bleibt, und das beinhaltet eben bestimmte inhaltliche Schwerpunkte, wie z.B. Weiterbetreuung, wenn jemand schon vermittelt ist, was man natürlich ganz leicht unter Kostendruck wegrationalisieren kann" (Rossi)
Der Dachverband sieht als weiteres Motiv des BMSG, über Qualitätsmanagement Instrumente zur Verfügung zu haben, die es ermöglichen, einen betriebswirtschaftlichen und fachlichen Vergleich unter den Anbietern durchzuführen. Dies ist, nach Karin Rossi ein "nachvollziehbares Motiv". Das Hauptmotiv des Dachverbandes ist der zunehmende Druck unter den Sozialprojekte geraten. Es wird gefordert, neben betriebswirtschaftlichen Messgrößen auch andere Messgrößen in die Bewertung der Dienste heranzuziehen. Als Hauptargument führt der Dachverband an, dass der zunehmende Kostendruck andernfalls zu einem Verlust an Qualität und Inhalten in der Arbeitsassistenz führen wird.
In der Argumentation der LeiterInnen von Institutionen überwiegen fachlich motivierte Gesichtspunkte, aber auch Kritik an der Haltung der Fördergeber. Rolf Behncke merkt dazu an, dass mittlerweile in allen Leistungsbereichen von unterschiedlichen Kostenträgern bestimmte Qualitätsstandards eingefordert werden, die allerdings zumeist sehr oberflächlich sind. Es ist derzeit auch in Diskussion ein standardisiertes Qualitätsmanagement Verfahren einzuführen. Dies könnte für manche Anbieter Probleme darstellen. Als fachliche Motive werden von den LeiterInnen genannt:
-
Ein Motiv Qualitätsmanagement einzuführen besteht darin, dass neue MitarbeiterInnen oftmals keinen Pioniergeist mehr mitbringen. Qualitätshandbücher können bei der MitarbeiterInneneinschulung als eine Art Curriculum bzw. roter Faden fungieren. (Lackner)
-
Als Motiv für eine fachliche Qualitätsdiskussion wird die Herausarbeitung spezifischer Prozessqualitätsmerkmale gesehen. Diese können Grundlage für eine fachlich geführte Qualitätsdiskussion, im Sinne einer spezifischen Haltung und Einstellung sein, um damit eine Abkehr von einer rein quantitativ geführten Diskussion einzuleiten. (Lackner)
-
Als Basis für eine Qualitätsdiskussion ist es ein fachliches Qualitätsmotiv, den Prozesseigner (den behinderten Menschen) miteinzubeziehen. Ansonsten werden elementare Bestandteile missachtet, und keine Basis für eine Qualitätsdiskussion gelegt. (Lackner)
-
Im Sinne einer KundInnenorientierung und als Gegengewicht zu Quotendruck und Schablonen muss als leitendes Motiv "Arbeit für Alle" fungieren. (Lackner)
-
Ein Hauptmotiv ist, eine permanent selbstreflexive Arbeitsweise und Haltung sicherzustellen, aus der sich grundlegende Prinzipien ableiten lassen. Dies sind unter anderem die Eigenständigkeit der unterstützten Personen und die Orientierung an den individuellen Erfordernissen. Dies leitet sich im Fall der Hamburger Arbeitsassistenz von den Wurzeln der eigenen Arbeit als Integrationsbewegung ab. (Behncke)
-
Als eigene Motivation bezeichnet Karin Rossi, Qualität zu definieren und bis zu einem gewissen Grad mess- und objektivierbar zu machen. Dabei stellt sie sich gegen eine, ihrer Ansicht nach, sehr einseitige Sichtweise von Qualität im Sozialbereich. Dies ist jene des eigenen Zuganges sowie, eventuell jene der KlientInnen. Ein weiteres Motiv ist dabei auch der Aspekt der Weiterentwicklung. (Rossi)
-
Es besteht die Gefahr unter zunehmendem Kostendruck die spezifische Qualität der Dienstleistung zu verlieren, indem LeiterInnen dazu neigen bestimmte qualitätsbildende Leistungen zu streichen (z.B. Weiterbildung für MitarbeiterInnen). (Rossi)
-
Ein wesentliches Motiv ist die Gewährleistung eines niedrigschwelligen Zuganges für alle Menschen die arbeiten wollen. Unter Vermittlungsdruck neigen Institutionen zur Vorselektion. (Rossi)
Die Forschung kann die Motive der unmittelbar beteiligten Akteure aus der Distanz bilanzieren. So betonen beide ExpertInnen, dass viele Institutionen die aus inhaltlichem Interesse über Qualität nachdenken wollen, nicht über genügend Ressourcen verfügen um geeignete Instrumentarien (Z.B. NutzerInnenbefragungen) zu entwickeln oder anzuwenden. Stefan Doose stellt der Beschäftigung mit Qualität einen Soll - Anspruch voraus:
"Ich hoffe, dass die Motive auch sind die Dienstleistung besser zu machen, das wäre für mich das Motiv und die Verbindung. Und das wäre im Grunde genommen auch das Kriterium, es macht nur dann Sinn, wenn eine verbesserte Dienstleistungsqualität dann auch dazu beiträgt das Leben der unterstützen Menschen zu verbessern."
Als weitere politisch / ökonomisch motivierte Argumente werden angeführt:
-
Stefan Doose betont, dass eine inhaltlich geführte Qualitätsdiskussion einer aus Kosteneinsparungsgründen geführten Diskussion entgegengesetzt werden kann. Dort wo Kosten-Einsparung möglich ist, weil Dienststrukturen ineffizient sind, ist dies aber durchaus legitim und sinnvoll, wenn es im Umkehrschluss dazu führt, dass Leistungen, die kostenintensiver sind, auch bezahlt werden können.
-
Qualität in sozialen Dienstleistungen ist zu einem Modethema geworden. Die Motive der einzelnen Institutionen sind dabei sehr unterschiedlich. Sie reichen von ernsthaften inhaltlichen Absichten bis zu dem Motiv durch die Zertifizierung anerkannt zu sein ("den Schein zu wahren"). (Doose).
-
Die Motive des BMSG werden von Michael Stadler-Vida als stark nutzengleleitet bezeichnet. Es interessiert derzeit vor allem, wofür das Geld verwendet, und welcher Erfolg mit welchem Mitteleinsatz zu erzielen ist. Dies schlägt sich auch in den bestehenden quantitativen und leicht messbaren Indikatoren nieder. Das BMSG ist an dieser Stelle gefordert diese auch in Abgrenzung zu anderen Dienstleistungen weiterzuentwickeln.
Auf einer fachlich institutionellen Ebene werden weitere Motive identifiziert:
-
Die Beschäftigung mit Qualitätskriterien auf fachlicher Seite ist auch immer mit der Frage der Legitimation der eigenen Arbeit(-sweise) verbunden. (Stadler-Vida)
-
Die Arbeitsassistenz hat sich in den letzten Jahren vom Projektstatus hin zu einem (Dienstleistungs-)Angebot entwickelt. Diese Institutionalisierung hat sich auch am Aufbau des Dachverbandes gezeigt. Dadurch sollte es, im Sinne der Etablierung der Trademark Arbeitsassistenz ein fachliches Motiv sein, zu erheben, welche Kriterien, Grundwerte und Strukturen vorhanden sein müssen, um von Arbeitsassistenz sprechen zu können. (Stadler-Vida)
An dieser Stelle wird dokumentiert, was Qualität in Institutionen der beruflichen Integration für die interviewten ExpertInnen darstellt. Zusätzlich werden exemplarisch zentrale Qualitätskriterien, die sich aus Sicht der ExpertInnen als wesentlich erweisen, nach den Parametern der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität definiert. Die Gegenüberstellung des Qualitätsverständnisses und der Qualitätskriterien erfolgt entlang der Prozessebenen, da grundsätzlich von einer Übereinstimmung der Kriterien für beide Länder ausgegangen wird.
Es lassen sich in der Analyse der Interviews keine verallgemeinernden Aussagen über ein spezifisches Qualitätsverständnis aus Sicht der Fördergeber ableiten, sehr wohl jedoch klare und umfangreiche Ausführungen über wichtige Qualitätskriterien. Diese werden in den Kapiteln 8.5.1., 8.5.2. sowie 8.5.3. dargestellt.
Jörg Bungarts persönliches Qualitätsverständnis korreliert stark mit der Zielgruppen- und Aufgabenbeschreibung, die im Gesetzestext des SGB IX mit den obersten Leitzielen der Selbstbestimmung und Wahlfreiheit formuliert werden. Ein übergeordnetes Qualitätskriterium stellt für ihn Flexibilität dar. Um in diesem komplexen Aufgabenfeld optimal tätig werden zu können, benötigt es ein hohes Maß an flexiblem Handeln. Zusätzlich braucht es auch einen gewissen Rahmen - der über Qualitätsmanagement sichergestellt werden kann - um in der Komplexität die Orientierung zu behalten. Die Qualität der Integrationsfachdienste wird auch durch externe Faktoren, wie vor allem die Arbeitsmarktlage, mitbestimmt. Integrationsfachdienste waren bislang in der Lage gegen den Trend der Arbeitslosigkeit gute Vermittlungszahlen für einen Personenkreis zu erreichen, der ohne diese spezielle Form der Unterstützung vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen wäre. Um dies weiterhin zu erreichen müssen externe Faktoren in der Weiterentwicklung der Dienstleistung stets berücksichtigt werden.
Für Karin Rossi ist es oberstes Kriterium, dass jede Qualitätsentwicklung nicht nur den Status Quo festschreibt, sondern vor allem Weiterentwicklung bringt. Die spezifische Sicht von Qualität ist für sie vor allem durch die Vision der Arbeitsassistenz geprägt, die Vermittlung von behinderten Menschen in den ersten Arbeitsmarkt im Sinne von Chancengleichheit. Diese Vision impliziert auch das Offensein für alle, und wendet sich gegen eine Ausgliederung von Menschen mit Behinderung als grundsätzlicher Anspruch der Gesellschaft.
Einen großen Raum nimmt das Qualitätsverständnis in der Darstellung der LeiterInnen ein. Für Walter Lackner stellt Qualität dar über die Grenzen des eigenen Handels die berufliche Integration eines behinderten Menschen als Prozess zu sehen, indem unterschiedliche Maßnahmen zusammenwirken müssen. Dies drückt er in dem folgenden Zitat aus:
"Ja, ich finde es gehört Systematik, es gehört systematisch - nicht dass ich sage, ich habe da ein Ding, und wir schauen, wie mach ich das. Sondern dass ich eine klare Struktur von beruflicher Integration habe, die ich auf den jeweiligen Klienten abstimme, wo ich ihm eben dann Module anbiete, kennst du das - Road to Supported Employment (von John O´Brien) - wo man verschiedene Abzweigungen usw. hat, und man muss halt immer diesen Weg des Erfolges finden. Wichtig ist der Erfolg, es geht nicht um Ideologie, dass man die richtige berufliche Integration macht, aber die erfolgreiche - eine systematische, die sehr viel anbietet, aber es hängt eben dann vom Geschick des Moderators des Prozesses ab, ..."
Qualität drückt sich im Vorhandensein von zentralen Prinzipien wie Pioniergeist, Kritik- und Reflexionsfähigkeit aus. Außerdem, so argumentiert Walter Lackner, braucht es Menschen, die auch nach vielen Jahren Erfahrung die Bereitschaft haben, das etablierte System ständig aufs Neue herauszufordern, um den Blick auf den Prozess des behinderten Menschen zu lenken. Sehr ähnlich begründet auch Rolf Behncke sein Qualitätsverständnis, indem er betont, dass sich die Qualität des Angebots und die Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsschritte an den Bedürfnissen der KundInnen der Dienstleistung zu orientieren haben. Es ist demnach wichtig Kompromisse zwischen den Bedingungen des Arbeitsmarktes und den individuellen Wünschen der NutzerInnen zu erzielen.
Von Seiten der Forschung hebt Michael Stadler-Vida hervor, dass als Grundkriterium oder Minimumstandard, um von Arbeitsassistenz sprechen zu können, der Hauptfokus der Dienstleistung auf den Übergang in den bezahlten Arbeitsmarkt gerichtet sein muss. Die spezifische Qualität, welche die Arbeitsassistenz von anderen Angeboten abgrenzt, ist die individuelle Betreuung und die Abstimmung auf die Person. Als weitere übergeordnete Kriterien werden das Einbeziehen der wichtigsten Akteure der öffentlichen Hand und die Auseinandersetzung mit der Unternehmenswelt genannt.
Für Stefan Doose charakterisieren die Begriffe "Know-how" und "Leidenschaft" die spezifische Qualität der Dienstleistung. Know-how über Instrumente und deren Nutzung impliziert einen Bedarf an ständiger Weiterentwicklung und Weiterbildung. Leidenschaft drückt sich dadurch aus, ein ernsthaftes Interesse zu haben Menschen mit Behinderung bei dem Prozess der beruflichen Integration zu begleiten sowie durch einen respektvollen und unterstützenden Umgang für bessere Lebensqualität zu sorgen und Freude an der Arbeit mit Betrieben zu haben. Qualität verlangt von den beteiligten Akteuren ein Denken in Qualitätsdimensionen, sowie den ständigen Anreiz besser zu werden. Um neue Ansätze auszuprobieren, die durch die Regelförderung nicht abgedeckt werden, sind weiterhin Förderprogramme notwendig
Es besteht unter den InterviewpartnerInnen ein breiter Konsens, dass es weiterhin notwendig ist auf nationaler sowie auf europäischer und internationaler Ebene über Qualität und Qualitätskriterien zu diskutieren. Einige der Aussagen weisen insbesondere auf die "Qualitätskriterien aus der Sicht der unterschiedlichen Prozessbeteiligten" des QUIP Projektes, sowie die von einer Arbeitsgruppe des Dachverbandes erstellte Sammlung von Kriterien, hin.
In der Darstellung der Fördergeber nehmen vor allem Kriterien zur Struktur- und Ergebnisqualität den größeren Raum ein. Dieter Schartmann geht auch auf Kriterien zur Prozessqualität ein. Aus Sicht des Integrationsamtes werden die folgenden Kriterien der Strukturqualität definiert:
-
Ein wichtiges Kriterium ist die Niederschwelligkeit der Dienste. Dadurch ist der IFD nicht abhängig vom Zuweisungsträger, sondern kann selbst aktiv werden, dazu ist aber eine Rückkoppelung mit den Fördergebern erforderlich.
-
Es ist von Bedeutung, dass qualitativ gute Träger die Dienstleistung erbringen. Diese sollen sowohl Kompetenzen in behinderungsspezifischen Aspekten als auch Wissen über das Funktionieren des allgemeinen Arbeitsmarktes mitbringen. Der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte kommt daher eine zentrale Bedeutung zu.
-
Ein weiteres Kriterium ist eine gemeinsame Vorgehensweise im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört exemplarisch, dass der Fachdienst auch als solcher zu erkennen sowie die telephonische Erreichbarkeit zu vereinbarten Zeiten gewährleistet sein muss. Ein erstes Beratungsgespräch soll nach der ersten Kontaktaufnahme innerhalb eines gewissen Zeitraumes (z.B. 2 Wochen) stattfinden können.
Angelika Fritzer betont, dass es ihr wichtig ist, dass kein Mensch, der eine Arbeitsassistenz aufsucht, zurückgewiesen wird. Dies hängt natürlich mit der internen Organisation und dem Qualitätsmanagement der Einrichtungen zusammen.
Auf der Ebene der Strukturqualität sind aus Sicht der BAG-UB und des Dachverbandes Arbeitsassistenz zur Einhaltung der fachlichen Standards folgende Kriterien relevant:
-
Zur optimalen Gewährleistung von Qualität und zur Erreichung der im Gesetz definierten Zielgruppen braucht es eine adäquate Ausstattung mit finanziellen Ressourcen sowie vor allem auf Deutschland bezogen ein anderes Vergütungssystem. (Bungart)
-
Träger sind aufgefordert ihre Einrichtungen optimal zu organisieren. Dadurch kann viel an Synergie- und Einsparungseffekten erzielt werden. (Bungart)
-
Wesentliche Faktoren für Qualität sind eine gute Personalentwicklung und Personalmanagement sowie Kompetenzen im Bereich der Organisationsentwicklung. Da als wesentliche Qualitätskriterien das Arbeiten mit konstantem Personal und eine geringe Fluktuation der MitarbeiterInnen angesehen werden, zählt zu den Aufgaben der LeiterInnen insbesondere die Personalführung (Bungart und Rossi).
-
Von großer Bedeutung sind die Qualifikation und Weiterbildung der Fachkräfte. Diese müssen - von sozialpädagogischen bis zu wirtschaftlichen Kompetenzen - eine große Palette an Qualifikationen abdecken, was nur in Ausnahmefällen erwartet werden kann. (Bungart und Rossi)
-
Qualität auf der Strukturebene ist stark von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Unterstützung durch die Träger abhängig. (Bungart)
-
Ein weiteres Qualitätskriterium im Bereich der Strukturqualität ist die Etablierung und Verankerung in der Region als Produkt der langjährigen Erfahrung der Anbieter. Dieses Netzwerk ist erforderlich um hoch professionelles Arbeiten zu ermöglichen. (Rossi)
LeiterInnen von Institutionen nennen folgende Kriterien der Strukturqualität:
-
Die regionale Verbundenheit der Anbieter sowie die Einbindung in das regionale Netzwerk. (Behncke)
-
Die Ermöglichung eines niederschwelligen und unbürokratischen Zuganges für die NutzerInnen der Dienstleistung, im Sinne eines "One-Stop-Service". Walter Lackner betont dabei, dass der integrative Ansatz bereits in der Organisation und der Erreichbarkeit der Dienste sicherzustellen ist. Auch wenn der Kostenträger den differenzierten Weg unterschiedlicher Maßnahmen geht, kann den NutzerInnen die Orientierung erleichtert werden, indem einzelne Maßnahmen nicht an verschiedenen Standorten verstreut sondern zentral angeboten werden.
-
Eine wichtige Bedeutung hat die Konzeptqualität. Projekte sollen von ihrem Selbstverständnis her so angelegt sein, dass eine Implementierung in die Regelförderung (Mainstreaming) wahrscheinlich ist. (Lackner)
-
Ein Aspekt der Strukturqualität ist über ein Qualitätsmanagementsystem zu verfügen, welches derart gestaltet ist, dass "gwöhnliche" Menschen damit arbeiten können. (Lackner)
Zahlreiche weiterführende Kriterien zur Strukturqualität werden von der Ebene der Forschung beigesteuert:
-
Die zentralen Komponenten der Strukturqualität sind die Träger-, Finanzierungs- und Zuweisungsstrukturen. Qualität wird auf der Strukturebene stark durch die Verwaltungsebene bestimmt, und dabei vor allem durch die Ausstattung mit Finanzen. (Doose)
-
Zur Strukturqualität gehört ganz wesentlich die Ausbildung und Weiterbildung der Fachkräfte. Dafür sind gezielte Personalauswahl und Personalentwicklung sowie die notwendigen Rahmenbedingungen (z.B. Finanzierung von Fortbildung, Bezahlung der Fachkräfte, langfristige Dienstverträge, etc.) erforderlich, damit Fachkräfte ihren Job behalten können. Eine hohe Fluktuation ist für die Dienstleistung katastrophal, da die Einarbeitung meist eine lange Zeit in Anspruch nimmt. (Doose und Stadler-Vida)
-
Fachdienste benötigen flexiblere Formen der inneren Differenzierung, dies bedeutet vor allem für Deutschland eine Aufhebung der starren Trennung in Vermittlung und Begleitung. (Doose)
-
Es braucht verlässliche Stützstrukturen, die es bei Notwendigkeit erlauben, Unterstützung hoch- oder runterzufahren, sowie langfristig zur Verfügung stehende kompetente AnsprechpartnerInnen für die KundInnen der Dienstleistung. (Doose)
-
Ein weiteres Kriterium ist eine verbindliche, modular aufgebaute Qualifizierungsstruktur für Fachkräfte, mit der Möglichkeit der Anrechnung individueller Einzelqualifikationen. (Doose und Stadler-Vida)
-
Die Organisation der Fachdienste sollte über eine eigenständige Leitungsperson mit einem gewissen Entscheidungsspielraum verfügen. Dies wird, insbesondere im Kontext der Veränderung der Dienstleistung von einem Projektstatus in Richtung zu einer integrierten Maßnahme, als wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Angebots gesehen. (Stadler-Vida)
Angelika Fritzer verweist in Bezug auf die Kriterien zur Prozessqualität auf die Vorgaben in den entsprechenden Richtlinien. Sie verweist darauf, dass der fachliche Input durch die Einrichtungen der Arbeitsassistenz eingebracht werden soll. Auf die Prozessqualität Bezug nehmend erklärt Dieter Schartmann, dass für alle Phasen der Prozesskette bestimmte Anforderungen zu definieren sind. Dies beinhaltet unter anderem die Fähigkeitsabklärung, das Anforderungsprofil eines Arbeitsplatzes, sowie die Motivationsabklärung. Ein entscheidendes Qualitätskriterium stellen die so genannten "Vorbereitenden Maßnahmen" dar, die vor einer Platzierung ausreichend durchgeführt werden müssen. Zahlreiche empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass, je besser diese Vorbereitungsphase genützt wird, desto höher ist die Nachhaltigkeit der daraus resultierenden Vermittlungen. Kurzatmige Vermittlungen sieht er weder für die ArbeitgeberInnen noch für die ArbeitnehmerInnen als zielführend an.
Von Seiten der Interessensvertretungen betont Jörg Bungart, dass im Sinne einer effektiven und effizienten Organisation sowie eines optimalen Ressourceneinsatzes es als Minimalanforderung notwendig ist, die Prozessqualität in Form von Leistungsbeschreibungen zu bestimmen. Diese Beschreibungen können als Leitlinien für die Einschulung von NeueinsteigerInnen Anwendung finden. Weitere von den Interessensvertretungen genannte Kriterien für die Prozessqualität sind:
-
Die Vernetzung als entscheidendes Kriterium. Fachdienste sind die ersten Institutionen, die gegen das differenzierte Rehabilitationssystem arbeiten müssen. Es ist ihre Aufgabenstellung mit allen relevanten Institutionen zu kooperieren. Fachdienste stellen im Vergleich zu Schulen oder Werkstätten ein offenes System dar. Dabei muss der IFD bewusst darauf achten, was von ihm selbst aktiv gesteuert werden kann. Um energie- und ressourcenbewusst zu arbeiten, impliziert dies als Qualitätsanforderung eine gezielte Auswahl an KooperationspartnerInnen zu treffen. Unter Kosteneinsparungs-Aspekten wird Vernetzung zukünftig im gesamten sozialen Bereich zunehmend als Anforderung gestellt werden. Durch ihre Erfahrung können Fachdienste in Zukunft sicher Vorteile nutzen. (Bungart)
-
Zu den wichtigsten Kriterien der Prozessqualität zählt, nach Karin Rossi, insbesondere die Weiterbetreuung am Arbeitsplatz, sowie der erweiterte KundInnenkreis. (Rossi)
Von den LeiterInnen werden folgende Kriterien der Prozessqualität in den Interviews angeführt:
-
Ein zentrales Kriterium ist die qualifizierende Begleitung am Arbeitsplatz. Dabei sollen berufliche Perspektiven und eine optimale Passung zwischen den Wünschen und Fähigkeiten der NutzerInnen und den Anforderungen des Arbeitsplatzes praxisnah durch Begleitung in Betrieben erreicht werden. (Behncke)
-
Wichtig sind eine ständig reflektierende Arbeitsweise sowie eine permanente Orientierung an den Bedürfnissen der unterschiedlichen KundInnen. (Behncke)
-
Auch die Kostenträger sollten sich aktiv in den "Prozess der beruflichen Integration eines Menschen mit Behinderung" einklinken, um Entwicklungen wie beispielsweise im Spitalwesen zu vermeiden. (Lackner)
-
Auch von Seite der LeiterInnen werden Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Einrichtungen als wesentliche Elemente von Prozessqualität gesehen. Trotz Reglementierung und Aufteilung besteht noch oft ein Wettbewerbsdenken. Es benötigt ein kooperatives Verständnis zwischen den einzelnen Einrichtungen, dass die einzelnen Projekte keine Gegner sondern Partner sind. (Lackner)
-
Empowerment der Zielgruppen sowie die Einführung von Unterstützungskreisen sind weitere Kriterien. (Lackner)
Die ExpertInnen der Forschungsebene ergänzen die Aufzählung um folgende Kriterien und Aspekte der Prozessqualität:
-
Stefan Doose sieht im Rahmen der Prozessqualität vor allem die Art der Begleitung und Unterstützung der NutzerInnen durch den Prozess als wichtigen Faktor. Entscheidende Aspekte des Paradigmenwechsels spiegeln sich dabei im Prozess wieder. Dies macht sich unter anderem darin bemerkbar, ob das Angebot vom Selbstverständnis als wirkliches Dienstleistungsangebot strukturiert ist, oder ob es noch alte Betreuungsstrukturen aufweist, in dem Sinn, dass die Vermittlungsfähigkeit immer als Charakteristikum der Person und nie als Charakteristikum der Dienstleistung aufgefasst wird.
-
Weitere relevante Aspekte sind, wie NutzerInnen der Dienstleistung informiert und in Entscheidungen eingebunden werden, sowie auf welche Art und Weise (respektvoll vs. abwertend) ihre Stärken und Schwächen erhoben werden. (Doose)
-
Ein Qualitätskriterium ist, ob der Dienst zeitnah und zügig agiert, so dass die NutzerInnen den subjektiven Eindruck haben, dass etwas geschieht, und sie nicht nur auf einer Warteliste stehen. (Doose)
-
Eine weitere Ebene der Prozessqualität ist die Qualität der einzelnen methodischen Schritte. Dazu zählen unter anderem ein professionelles Marketing, die Arbeitsakquisition, das Auftreten, die Qualifizierung am Arbeitsplatz, die Arbeitsplatzanalyse sowie vorhandene und durchdachte Konzepte für die Nachbetreuung und das Coaching. (Doose)
-
Ganz entscheidend ist die Abklärungsphase, in der es möglich sein sollte, genau zu analysieren, welche Unterstützung eine individuelle Person benötigt um einen Arbeitsplatz zu erlangen. (Stadler-Vida)
-
Ein wesentliches Element der Prozessqualität ist die Beziehung zwischen ArbeitsassistentIn und den Job-Suchenden im Sinne des Eingehens auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der konkreten Person. (Stadler-Vida)
Es besteht bei den ExpertInnen Einigkeit darüber, dass die Anzahl der Vermittlungen ein entscheidendes Kriterium für die Bewertung der Dienste darstellt, darüber hinaus aber auch ein Bedarf an der Entwicklung weiterführender Indikatoren zur Berücksichtigung qualitativer Aspekte besteht. Von den Fördergebern werden neben der Vermittlungsquote folgende weiterführende Kriterien für die Ergebnisqualität genannt:
-
Die KundInnen- und NutzerInnenzufriedenheit soll über Fragebögen erhoben und einer neutralen Instanz zur Auswertung überlassen werden. (Schartmann)
-
Ein wichtiges Kriterium ist die Verankerung in der Region, sowohl im Sinne der Einbindung in das Netzwerk der Behindertenhilfe als auch die Bekanntheit bei Unternehmen. Dies kann Teil eines Qualitätsmanagementsystems sein und in der Bewertung der Dienste berücksichtigt werden. (Schartmann)
-
Von Seiten des BMSG werden als miteinander korrelierende Qualitätskriterien die Nachhaltigkeit und die Art des Arbeitsplatzes genannt. Ausschlaggebend für letzteres ist die individuelle Stimmigkeit für die konkrete Person. (Fritzer)
-
Als eine wesentliche Herausforderung für die Zukunft wird gesehen neben der Vermittlungsquote andere Indikatoren zu finden, an denen Qualität gemessen werden kann. (Fritzer)
-
In den Indikatoren soll auch eine Differenzierung in den Vermittlungen erfolgen. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dass ein Arbeitsplatz der für einen schwerer behinderten Menschen geschaffen wird, mehr zählt, als ein Arbeitsplatz für eine Person mit einer leichteren Beeinträchtigung, die in der Arbeitswelt keine unmittelbaren Auswirkungen hat, bzw. dass ein Arbeitsplatz, der drei Jahre erhalten wird, mehr Wert hat, als einer der drei Monate besteht. (Fritzer)
Jörg Bungart stellt voraus, dass weiterhin ein Bedarf an einer bundesweiten Diskussion über Ergebnisqualität gegeben ist. In die Bewertung der Dienste sollen die verschiedenen Schritte einfließen, die zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses hinführen. Als brauchbare Erfolgsmaßstäbe können die Qualitätskriterien des QUIP Projektes sowie die Leistungsziele des Systems MUQ herangezogen werden, sofern diese nach Prozessstrukturen und Ergebnisqualität aufgeschlüsselt werden. Karin Rossi führt folgende Aspekte der Ergebnisqualität an:
-
Die Anzahl der Clearings.
-
Die Differenzierung des Erfolgs, nach erstem oder zweitem Arbeitsmarkt, bzw. Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigungen.
-
Die Dauer der Dienstverhältnisse. Die Nachhaltigkeit als Erfolgskriterium ist allerdings bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu relativieren, da neben der Passung und der Qualität des Arbeitsplatzes auch psychische Faktoren eine Rolle spielen, die nicht beeinflussbar sind.
-
Die Kosten einer Vermittlung.
Auch von den LeiterInnen wird gefordert Qualitätskriterien zu definieren, die über eine reine Vermittlung hinausgehen. Berücksichtigung in der Bewertung sollen dabei vor allem die vermittelten Zielgruppen, sowie soziodemographische Daten der Region wie Arbeitsmarktsituation, Arbeitslosigkeit oder Bevölkerungsdichte finden. (Behncke und Lackner). Von Rolf Behncke werden zusätzlich die folgenden Kriterien vorgebracht:
-
Die Verweildauer im Betrieb.
-
Die Erhebung der Zufriedenheit der wichtigsten KundInnen.
-
Erfolg kann bei Nicht-Vermittlung auch die berufliche Klärung sein, in dem Sinn, dass ein Mensch aufgrund der Möglichkeit Erfahrungen zu machen sich beispielsweise dafür entschieden hat den Weg in den Arbeitsmarkt nicht zu beschreiten.
Bezüglich der Ergebnisqualität spricht sich Stefan Doose dafür aus, Fachdienste nicht zu reinen Clearingstellen zu machen, weil "Sortierung" dem Grundgedanken von Unterstützter Beschäftigung widerspricht. Als Kriterien sind für ihn insbesondere vorstellbar: die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze, die Zeit, die dafür aufgebracht wurde, die Qualität und längerfristig Stabilität der Arbeitsplätze sowie, ob Unterstützung auch länger- oder langfristig zu Verfügung gestellt werden kann. Beide ExpertInnen nennen die Bedeutung der Erhebung der NutzerInnenzufriedenheit. Michael Stadler-Vida ergänzt die folgenden Kriterien der Ergebnisqualität:
-
Ein messbarer Indikator kann die Fluktuation bzw. die Verweildauer der Fachkräfte sein.
-
Die Vermittlungszahlen sollen gewichtet werden, indem der Hintergrund, vor dem Leistungen erbracht werden (Arbeitsmarktlage, Zielgruppen, etc.) berücksichtigt wird. Dazu können beispielsweise die EU - Klassifikationen der einzelnen Regionen als Grundlage herangezogen werden. Dadurch kann eine Basis geschaffen werden die Zahlen vergleichbar zu machen.
-
Ein Basiscurriculum für die Qualifizierung der Fachkräfte bietet die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Fachkräfte den Vorgaben entsprechend ausgebildet sind.
-
Zur Messung der Zufriedenheit der wichtigsten Akteure kann der Fördergeber den Trägern finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, damit die Dienste standardisierte Modelle verwenden. Indem die Ergebnisse anschließend an eine neutrale Instanz zur Auswertung gegeben werden, kann der Fördergeber dadurch im Gegenzug zu vergleichbaren Ergebnissen kommen.
Ziel dieser Überschrift ist es, die Frage zu beantworten, worin die interviewten ExpertInnen die spezifischen Stärken und Schwächen dieser Dienstleistung sehen. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die Abgrenzung der Dienstleistung von anderen Angeboten sowie die Wahrnehmung und Beurteilung von persönlichen und institutionellen Grenzen. Die Auswertung erfolgt entlang der definierten Ebenen der Prozessbeteiligten. Mögliche Überschneidungen zu der Überschrift Qualitätskriterien werden berücksichtigt.
Die Thematisierung der besonderen Stärken und Charakteristika der Dienstleistung nimmt in der Darstellung einiger ExpertInnen einen großen Stellenwert ein. Eine Abgrenzung zu anderen Angeboten nimmt Dieter Schartmann vor, indem er sagt:
"Ja, ich denke Stärken werden immer da deutlich, wo der IFD seine Kompetenzen auch einbringen kann, wie sie häufig in der Berufsbiographie des IFD dann auch erworben sind, weniger kompliziert ausgedrückt, da, wo er soziale Arbeit auch leisten kann. Das, denke ich, ist eine der Stärken der IFDs - sozialarbeiterisch tätig werden zu können und zu dürfen. Dadurch werden gleichzeitig auch bestimmte Aussagen gemacht z.B. zur Betreuungsrelation eines IFD zu Behinderten bzw. Schwerbehinderten Menschen, d.h. wenn eine Fachkraft 80 Leute zu betreuen hat, dann kann er nicht mehr diese intensive Einzelfallarbeit auch leisten, die aber sowohl für den IFD als auch für den behinderten Menschen notwendig ist. Ich denke der IFD ist immer da stark, wo er besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen eine personelle Unterstützungsdienstleistung anbieten kann, die diese auch benötigen."
Einen großen Stellenwert misst er auch der Unterscheidung der Zielgruppen bei. Die Stärken des Integrationsfachdienstes kommen demnach vor allem dann zum Tragen, wenn er jene Zielgruppen erreicht, bei denen eine "besondere Betroffenheit", das heißt ein Bedarf an (zeit)intensiver personeller Unterstützung besteht. Eine weitere Stärke und ein Charakteristikum verortet er in der Möglichkeit des "schnittstellenübergreifenden" Arbeitens. Das System der beruflichen Rehabilitation ist in Deutschland stark segmentiert und selbst für Fachkräfte schwer zu durchschauen. Der IFD stellt die einzige Dienstleistung dar, welche die Möglichkeit bietet, an den NutzerInnen "dran zu bleiben" und sie durch den ganzen Prozess der beruflichen Integration zu begleiten.
Aus der Sicht des BMSG liegt die große Stärke der Arbeitsassistenz, darin, dass sie in einer Gesamtbetrachtung gut funktioniert. Dabei verweist Angelika Fritzer auch auf die Ernennung der Arbeitsassistenz zu einem europäischen "Best-Practice" Beispiel durch die EU - Kommission. Weitere Stärken liegen in der hohen Motivation und Professionalität der MitarbeiterInnen. Das hat sich auch in den Bestrebungen zur Gründung des Dachverbandes ausgedrückt. Hervorgehoben werden außerdem die langjährige Erfahrung sowie das "Erwachen eines Verständnisses" für Veränderungen. Bis vor wenigen Jahren hat es, nach der Beurteilung von Angelika Fritzer, noch weniger Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit dem Ministerium gegeben, insbesondere beim Offenlegen und Vergleichen von Zahlen. Diese Schwäche hat sich zunehmend in eine Stärke verwandelt, da auch im Rahmen der Dachverbandstagung 2004 in Salzburg der Wunsch nach einem Benchmarking Prozess ausgedrückt wurde, was aus ihrer Sicht vor allem für kleinere Anbieter zu Synergieeffekten beitragen kann[39]. Vor allem zum Dachverband Arbeitsassistenz besteht nach Angelika Fritzer eine zunehmend gute Kooperationsbasis.
Überscheidungen zu den Qualitätskriterien bestehen in der Darstellung der Stärken durch die anderen Prozessebenen, und werden deshalb an dieser Stelle nur kurz angeschnitten. Für Jörg Bungart liegt die größte Stärke des IFD in der Flexibilität. Zahlreiche Erfahrungen mit der Zielgruppe haben gezeigt, dass es trotz einer gewissen Standardisierung, die über ein Qualitätsmanagement sichergestellt werden kann, möglich sein muss, individuelle Wege zu beschreiten. Außerdem zählt die Vernetzung zu einer der größten Stärken der Fachdienste. Karin Rossi, Walter Lackner und Rolf Behncke heben als Abgrenzung zu anderen Maßnahmen die individuelle Orientierung, die Qualifizierung und Weiterbetreuung am Arbeitsplatz sowie den erweiterten KundInnenkreis als besondere Stärken hervor. Für Rolf Behncke stellt die Existenz der BAG-UB eine besondere Stärke dar, da sie besondere Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung bietet. Mag. Stadler-Vida betont die Bedeutung des psychosozialen Aspekts in der Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und NutzerInnen. Dieser darf allerdings nicht Selbstzweck sein, sondern stellt die Grundlage für ein erfolgreiches Agieren dar. Stefan Doose sieht als zunehmende Stärke die fortschreitende Professionalisierung in den Bereichen Arbeitsplatzakquisition und Marketing, sowie ein besseres Einschätzen betrieblicher Strukturen. Die größte Stärke liegt seiner Ansicht nach in der Betriebsnähe der Fachdienste. Durch dieses "ernsthafte Annehmen" der Interessen und Bedürfnisse der Betriebe werden "Brücken zwischen den beiden Welten gebaut".
In der Darstellung der Schwächen und Grenzen der Dienstleistung zeichnen sich zwei Schwerpunkte ab. Zum einen werden Schwächen angeführt, die mit fachlichen Aspekten der Dienste zusammenhängen, und demzufolge durchaus Verbesserungspotential besteht. Zum anderen werden auch viele Bereiche angeschnitten, die mit übergeordneten Rahmenbedingungen, gesetzlicher Natur oder der Arbeitsmarktlage in Verbindung stehen, und für die Fachdienste oftmals Grenzen ihrer eigenen Beeinflussbarkeit darstellen. An dieser Stelle sind vor allem die Gesetz- und Fördergeber gefordert ihren eigenen Handlungsspielraum zur Verbesserung der Dienstleistung optimal auszunützen.
Für den Fördergeber Integrationsamt ist in der Beauftragung der Dienste der persönliche Status der "besonderen Betroffenheit" ausschlaggebend. An jenen Stellen, wo Personen nur einen Arbeitsplatz brauchen, aber keine intensive personelle Unterstützung notwendig ist, bedeutet der Einsatz der Integrationsfachdienste eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Dieter Schartmann sieht eine Schwäche des Integrationsfachdienstes darin, dass er sich in manchen Fällen als autonomes System versteht, welches frei in der Region agieren kann. Die Einzellfallverantwortung obliegt den zuständigen Kostenträgern, und der IFD bleibt an dessen Mandat gebunden. Diese Schwäche wird auch dann deutlich, wenn der IFD, welcher über keine eigenen Finanzmittel verfügt, seinen Handlungsspielraum übersteigt und in Betrieben bereits finanzielle Zusagen tätigt. Im Bereich der Begleitenden Hilfen bestehen, von Minderleistungsausgleich bis zu technischen Arbeitshilfen, zahlreiche Möglichkeiten Unterstützungen zu finanzieren. Dem/der NutzerIn und den Betrieben bietet sich nur dann ein umfassendes Dienstleistungsangebot, wenn sich der IFD als Teil eines umfassenden Leistungsspektrums versteht und alle notwendigen Schritte auch mit den Fördergebern rückkoppelt. Eine weitere Schwäche sieht Dieter Schartmann im Fehlen eines niedrigschwelligen Zugangs im Vermittlungsbereich des IFD. Es dürfen dort nur Personen betreut werden, die direkt über das Arbeitsamt zugewiesen werden.
Vom BMSG wird in der Frage der Grenzziehung ein Problem verortet für welche Personen mit welchen Beeinträchtigungen die Arbeitsassistenz das geeignete Unterstützungsinstrumentarium ist. Die Arbeitsassistenz ist für Angelika Fritzer als eine Maßnahme definiert, die für Personen zuständig ist, die sich "an der Grenze befinden". Bezüglich des Zugangs von Menschen mit einer schweren Behinderung argumentiert sie[40]:
"Es stellt sich natürlich die Frage inwieweit für Schwerstbehinderte, Arbeitsassistenz die richtige Maßnahme ist. Arbeitsassistenz ist schon so definiert, dass wir Menschen die schwer zu vermitteln sind begleiten- es ist aber nicht so definiert, dass jemand drei Jahre an der Hand genommen wird und dann vielleicht mit zusätzlicher Unterstützung in den Arbeitsmarkt kommt. Man sich in einem solchen Fall überlegen ob es vorbereitende Maßnahmen gibt die sinnvoll sind, etwa ob ein Mensch vielleicht noch qualifiziert wird oder eine gewisse Nachreifung erfährt, und dann einfach als "Jobready" auch mit der schwierigen Bedingung einer Behinderung dann zur Arbeitsassistenz kommt. Also das ist für mich auch wichtig, das best mögliche für den jeweiligen behinderten Menschen zu erreichen"
Die Interessensvertretungen in beiden Ländern sehen als eine Schwäche auf der fachlichen Ebene vor allem die Betriebsarbeit der Fachdienste an. Jörg Bungart führt dies darauf zurück, dass noch nicht alle Dienste bestimmte Standards adäquat umgesetzt haben. So verfügen nur wenige Fachdienste über eine Betriebsdatenbank, in der die wichtigsten Daten und Fakten über Betriebe, Ansprechpersonen sowie die bisherigen Ergebnisse dokumentiert werden. Karin Rossi führt diese Schwäche auf eine nicht ausreichende Öffentlichkeitsarbeit zurück. Bekanntheit erlangen die Fachdienste zumeist über direkte Kontakte. Vor allem im Bereich der Arbeitsplatzsicherung, ein Angebot das sie für Firmen als sehr wirkungsvoll einschätzt, besteht zu wenig Bekanntheit. Diese Schwäche kann auch mit der Verortung vieler Fachkräfte im Sozialbereich in Verbindung gebracht werden:
"... aber es ist immer wieder für ganz viele im Sozialbereich eine Schwierigkeit die Sprache der Firmen zu sprechen und die Sprache der Firmen zu verstehen, zu akzeptieren und nicht so zu polarisieren zwischen böser Firma und armer Klient. Ich denke mir, dass dies eine irre Schwierigkeit ist, die aber auch eine Stärke sein kann, ist aber sicher bei einigen eine Schwäche. Ja, es hat etwas mit unserer Profession zu tun, dass wir nicht aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich kommen. An diesem Punkt holen wir für mein Gefühl sehr stark auf. Wir haben auch gemerkt, dass unsere Folder, das ist alles so Klienetenlastig gewesen, auch von der Formulierung, nicht was eine Firma so eigentlich interessiert. Und da würde ich eigentlich die größte Schwäche von der Arbeitsassistenz sehen."
Jörg Bungart sieht fachlich bestimmte Schwächen in der schlechten Abstimmung zwischen den Bereichen Vermittlung und begleitende Hilfen. Zudem identifizieren sich viele neue Träger, die über die Arbeitsmarktverwaltung ins Geschäft gekommen sind, nicht mit dem dahinter stehenden Konzept der Unterstützten Beschäftigung. Karin Rossi beurteilt die mangelnde Einbeziehung der wichtigsten Akteure in die Maßnahmengestaltung und -auswertung als ein weiteres fachliches Manko.
Politische und durch andere Rahmenbedingungen bedingte Schwächen verortet Jörg Bungart zum einen im existierenden Vergütungssystem, durch das SchulabgängerInnen und WerkstättenmitarbeiterInnen kaum erfasst würden, und zum anderen in politisch motivierten Kampagnen wie der "50.000 Jobs für Schwerbehinderte" Kampagne.
Für Österreich kritisiert Karin Rossi die zunehmende Aufsplitterung des Dienstleistungsangebots Arbeitsassistenz in zahlreiche Maßnahmen, deren Abgrenzung zueinander oft nicht einmal für Fachkräfte vollständig nachvollziehbar ist.
In seiner Darstellung der fachlich bedingten Schwächen schließt sich Walter Lackner weitestgehend der Argumentation von Karin Rossi an, demnach werden die eigentlichen "Prozesseigner" zu wenig in den Gestaltungsprozess miteinbezogen. Darin und in der Forderung der Kostenträger nach "Empowerment" verortet er einen Widerspruch:
"... also Empowerment ist für mich sehr wichtig, und wir wollen ein Projekt machen, das finde ich spannend, weil da sind wir noch viel zu schwach. Weil, sagt einmal der Dr. Haller: "mir ist wichtig bei einem Projekt Empowerment". Was versteht ein Kostenträgervertreter von Empowerment? Die Behördenvertreter sehen die Menschen der Zielgruppe als Objekt. Ein Objekt kann doch nicht, wie soll man sagen, mehr Entscheidungsmöglichkeiten oder mehr Wertigkeit oder so bekommen, das ist doch irgendwie physikalisch nicht tragbar. Und da möchte ich schauen, das wir den Beamten noch ein bisschen was zeigen, in provokanter Art die Augen öffnen."
Für Rolf Behncke werden die fachlichen Grenzen immer an jenen Stellen deutlich, an denen die Wünsche der NutzerInnen und die Anforderungen der Arbeitswelt nicht miteinander in Einklang gebracht werden können:
"Ja, na ja die Grenzen der Arbeit sind, wie es vielleicht ja schon rüber gedrungen ist, überall da wo es eine zu große Kluft gibt, also da, wo es nur um Vermittlungen und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen geht. Die Kluft zwischen dem, was zunehmend auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwartet wird, die Verengerung und Steigung von Anforderungen einerseits und den Möglichkeiten, die einige Leute, die wir unterstützen haben, andererseits. Also das ist vielleicht eine Schwäche, also wir sagen immer, wenn es einmal nicht klappt, dann waren wir zwar nicht gut genug, haben nicht ausreichend Fantasie entwickelt, aber wir sind auch in einem gewissen Sinne entschuldbar. Denn wenn wir sagen, wir haben es nicht geschafft, dann hätten andere Leute schon viel früher das Handtuch geworfen ..."
Als Schwächen auf der politischen Ebene sieht Walter Lackner einerseits die Aufsplitterung der Dienstleistung, sowie andererseits die bislang fehlende Verankerung von Qualitätskriterien und die übertriebene Quotenorientierung. Rolf Behnckes Einschätzung zufolge, können aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen die im Gesetz stehenden Leistungen nicht ausreichend durchgeführt werden. Dabei verweist er insbesondere auf die Begleitung und Qualifizierung am Arbeitsplatz. Grenzen der Arbeit würden auch immer dort augenscheinlich, wo es zuerst Systemveränderungen bedürfte um Lösungen erreichen zu können:
"Also an der Stelle kommt man dann tatsächlich in Bereiche, wo es letztlich um Systemveränderungen geht. Also wo man so sehr ins Umfeld eingreifen müsste, damit Strukturen entstehen, damit Menschen mit Behinderung - also jeder Mensch mit Behinderung - egal in welchem Maße er behindert ist so arbeiten kann, wie sie möchte oder wie er möchte. Aber da sind wir tatsächlich an Grenzen gekommen, oder da sind wir an Grenzen gestoßen, wo ein Wechsel oder eine Veränderung ansteht, wo wir zwar ein bisschen dran arbeiten können, aber wir die Entwicklung nicht in der Hand haben."
Auch von der Forschung werden ähnliche Argumente vorgebracht. Fachliche Schwächen sieht Michael Stadler-Vida vor allem in Praktiken mancher EU-Länder, wo sehr viel Wert auf das Wohlbefinden der NutzerInnen gelegt wird, aber der Fokus auf den bezahlten Arbeitsmarkt nicht ausreichend verfolgt wird. Auf politischer Ebene wird durch übertriebene Vorgaben der Unterschied zur Dienstleistung des AMS und damit auch die Intention der Arbeitsassistenz zerstört. Probleme sieht Stefan Doose in den durch die Zuweisung der Arbeitsämter neu hinzugekommenen Zielgruppen der Integrationsfachdienste. Der IFD hat es dabei erstmals mit Personen zu tun, die zum Teil eigentlich nicht arbeiten wollen. Weitere Schwächen sind die heterogene und qualitativ sehr unterschiedliche Landschaft der Fachdienste, was er auch auf das Fehlen eines einheitlichen Qualitätsmanagement zurückführt, sowie ein Fehlen von ausreichenden betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen.
Die Auswertung der Überschrift Nachhaltigkeit gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst wird die Frage behandelt, welche Entwicklungen sich aus Sicht der interviewten ExpertInnen in den beiden Ländern in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Vermittlungen ergeben haben. Im Zweiten Abschnitt werden Kriterien definiert, die für eine Nachhaltigkeit von Bedeutung sind. Der dritte und letzte Punkt befasst sich mit Veränderungsvorschlägen, die aus Sicht der ExpertInnen für eine verbesserte Nachhaltigkeit relevant sind. Die Auswertung des ersten und letzten Unterpunktes erfolgt getrennt nach den beiden Ländern, die Darstellung der Kriterien erfolgt entlang der Prozessebenen.
Die Darstellung der Entwicklungen in den letzten Jahren in Deutschland erfolgt von allen InterviewpartnerInnen einheitlich. Das Integrationsamt Rheinland hat die Entwicklungen seit der Übernahme der IFD durch die Arbeitsmarktverwaltung evaluiert und dabei festgestellt, dass die Zielgruppen der SonderschulabgängerInnen und WerkstättenmitarbeiterInnen von je 30 % in den Modellprojekten auf 0,4 bzw. 0.6 % weggebrochen sind. Dieter Schartmann unterstellt der Arbeitsmarktverwaltung den IFD für seine Zwecke instrumentalisiert zu haben:
"... und es wurde das große Heer von arbeitslosen Schwerbehinderten in das IFD geschickt, teilweise muss man auch sagen: durch den IFD gejagt. Der IFD, und das ist hier so vereinbart gewesen, hat mit der Arbeitsmarktverwaltung - und umgekehrt - eine bestimmte Platzkapazität abgesprochen, das waren z.B. für den IFD Aachen 240 Plätze, die der IFD dann belegt, und die Arbeitsmarktverwaltung ist dann zuständig dafür, dass diese 240 Plätze dann auch permanent belegt sind. Das hat dazu geführt, dass das Arbeitsamt natürlich guckt, dass diese 240 Plätze immer belegt sind, weil sie natürlich auch ein eigenes finanzielles Interesse daran haben. Und man hat im Grunde genommen die gesamte Kartei des Arbeitsamtes dann durch den IFD geschickt, wobei nicht primär - offiziell schon, inoffiziell aber nicht - primär das Ziel der Vermittlung in Frage stand, sondern auch die Abklärung, beispielsweise was passiert mit den arbeitslosen Schwerbehinderten überhaupt. Es sind z.B. viel mehr in Rente geschickt bzw. längerfristig krank geschrieben worden als im Endeffekt ins Arbeitsleben vermittelt worden sind. Der IFD wurde im Grunde instrumentalisiert, für die Zwecke der Arbeitsmarktverwaltung eine Klärung innerhalb der Zielgruppe durchzuführen."
Diese Zielgruppenverschiebung wird nach Dieter Schartmann auch dadurch belegt, dass 70 % der vermittelten Personen in den letzten Jahren das Angebot der begleitenden Hilfen nicht mehr in Anspruch nehmen, was impliziert, dass es den Personen lediglich um den Erhalt eines Arbeitsplatzes ging. Von allen ExpertInnen wird die negative Wirkung der "50.000 Jobs Kampagne" auf die Nachhaltigkeit der Vermittlungen thematisiert. Nach Jörg Bungart hat keine eigentliche Zielgruppenverschiebung stattgefunden, da die Dienste, welche schon vorher überwiegend Menschen mit Lernschwierigkeiten als Zielgruppe hatten, diese auch weiterbetreut haben. Die neu hinzugekommen Dienste jedoch haben, vor allem aufgrund des restriktiven Vergütungssystems der Arbeitsmarktverwaltung diese Zielgruppen nicht mehr erreicht. Dies belegt auch die Argumentation von Rolf Behncke, der im Falle der Hamburger Arbeitsassistenz aufgrund der Zuweisungen durch das Arbeitsamt von einer Erweiterung der Zielgruppe spricht. Auswirkungen in der Fachdienstarbeit sind allerdings auch dort spürbar:
"Wenn wir Arbeitsplätze besetzen können, dann ist es manchmal so, dass wir nicht nur eine Peson vorschlagen können, die zur ursprünglichen Zielgruppe gehört, also Menschen mit geistiger Behinderung aus der Werkstatt. Sondern wir haben möglicherweise auch jemanden den das Arbeitsamt zugewiesen hat, der nicht so eine schwere geistige Behinderung hatte, vielleicht sogar einmal eine Berufsausbildung angefangen hatte. Da ist es sozusagen unsere Disziplin zu sagen, wir müssen an unseren Qualitätsgesichtspunkten festhalten, dass wir den schwächeren Menschen nehmen, also unter Anführungszeichen schwächeren Menschen als den etwas besser qualifizierten Menschen. Also steht Qualität da durchaus an der Stelle in Frage oder wird gefordert. Auf der anderen Seite haben wir den Zwang, wir müssen ja irgendwie auch Leute vermitteln und bevor wir ganz auf die Nase fallen und einen ganz Schwachen für diese Stelle nehmen - wissen eigentlich im vornherein, das wird nichts - nehmen doch lieber den etwas Fitteren und schlagen ihn für die Stelle vor, so dass wir da ein wenig auch an einer Nahtstelle sind, wo wir uns vor Verschiebung hüten müssen. Also aufpassen, dass wird nicht durch diesen Vermittlungszwang und diese Vermittlungsdynamik uns verleitet sehen die Zielgruppe sozusagen in Richtung "mehr fit" zu verschieben. Also da müssen wir aufpassen."
Stefan Doose berichtet über erste Ergebnisse aus seinem Forschungsprojekt. Demnach zeigt sich eine sehr gute Nachhaltigkeit für die ersten Modellprojekte, welche überwiegend Menschen mit Lernschwierigkeiten als Zielgruppe hatten. Zwei Drittel der damals (vor mehr als fünf Jahren) vermittelten Personen sind dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Eine überwiegende Anzahl dieser Personen befindet sich noch auf dem gleichen Arbeitsplatz auf den er/sie ursprünglich vermittelt wurde. Dies ist einerseits positiv zu werten, andererseits auch problematisch im Hinblick darauf, dass jene Personen kaum Möglichkeiten haben sich beruflich fortzuentwickeln. Bezüglich der aktuellen Zielgruppenverschiebung schließt sich Stefan Doose weitgehend der Argumentation der anderen ExpertInnen an.
In Österreich, liegen zum Thema Nachhaltigkeit derzeit noch keine empirisch gesicherten Ergebnisse vor. Demzufolge basiert die Argumentation großteils auf Beobachtungen und Mutmaßungen der unterschiedlichen Akteure. In der Beurteilung zeigen sich jedoch erhebliche Differenzen in der Wahrnehmung der Fördergeber und der übrigen ExpertInnen. So geht Angelika Fritzer vom BMSG davon aus, dass der so genannte "Creaming" Effekt in Österreich nicht eingetreten ist[41]:
"Wir finanzieren Sach- und Personalkosten, es ist bis jetzt keine Arbeitsassistenzeinrichtung wegen Nichterfüllung dieser Quote sanktioniert worden. Wesentlich bei einer Abweichung sind nachvollziehbare Begründungen. Wir haben das Jahr 2003 ja auch als eine Art Probejahr bezeichnet, das Jahr 2003 ist abgelaufen, jetzt wäre der Umgang mit der Quote im Jahr 2004 zu klären."
Ihre Begründung führt Angelika Fritzer auch auf Aussagen von ArbeitsassistentInnen zurück, wonach diese betonen nicht nur Menschen mit "leichter Behinderung" vermitteln zu wollen. Diese sind außerdem auch nicht Zielgruppe der Arbeitsassistenz sondern des AMS. Demgegenüber stehen die Wahrnehmungen der Interessensvertretung und der LeiterInnen, die sehr wohl von einer schrittweisen Verschiebung der Zielgruppe sprechen, auch wenn diese Entwicklung bislang nicht so dramatisch ausfällt wie in Deutschland. Dazu Karin Rossi:
"Was wir feststellen, wenn ich mich jetzt an dem anhalte, was de facto momentan passiert, fällt mir auf, dass wir stärker selektieren. Ich kann ihnen jetzt keine Untersuchungen dazu sagen, sondern es sind eher nur so Wahrnehmungen, die ich habe: mehr Erstgespräche aus denen weniger Betreuungen werden. Es wird auch sehr viel mehr darauf geschaut, dass es erfolgsversprechende Klienten sind. Ja, Creaming the Poor das ist so das Schlagwort. Wenn man versucht jetzt die Besseren von den Schlechteren herauszunehmen, das ist eine Tendenz, die wir spüren, gegen die sich die Arbeitsassistenten auch sehr wehren. Von meiner Seite kommt auch ein gewisser Druck in die Richtung, dass wir auch verstärkt Werbung machen die so genannten Besseren zu kriegen. Das heißt so eine Verschiebung hat sicher stattgefunden. Ich glaube, wenn man es zahlenmäßig belegt, tut sich noch nicht so wahnsinnig viel in der Richtung. Allerdings glaube ich, dass das eher längerfristig ein Problem wird, und dass Leute die weniger Chance auf eine Integration oder auf eine schnelle Integration haben - würde ich sagen - die also mehr Schritte für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt brauchen, oder diejenigen, die so auf der Mitte vom Weg stehen bleiben, weil sie maximal einen SÖB schaffen, über kurz oder lang durch den Rost fallen werden. Und da habe ich wirklich große Ängste in diese Richtung, Befürchtungen, dass Menschen irgendwie verkommen in irgendwelchen Beschäftigungstherapien. Das klingt immer so negativ gegen Beschäftigungstherapien, aber für manche ist es wirklich ein Verkümmern, für manche ist es gut und für manche ist es ein Verkümmern, für die die einfach mehr Potential haben."
Eine weitere von Karin Rossi beobachtete Tendenz ist, dass die Vermittlungen schneller werden, weil weniger im Vorfeld gearbeitet wird. Dies ist für einige NutzerInnen sicher kein Nachteil, aber es besteht doch die Befürchtung, dass es zu reinen Vermittlungen kommt, und nicht mehr ausreichend auf die Passung geschaut wird. Aufgrund des Vermittlungsdrucks verloren gegangen ist auch das Angebot der "Klärung des weiteres Lebensweges", bei Personen die nicht vermittelt werden konnten. Walter Lackner thematisiert die Gruppe der so genannten "Systemerhalter", also jener Personen, die zwar ihren Arbeitsplatz länger als die drei monatige Behaltepflicht behalten, anschließend aber ihren Arbeitsplatz wieder verlieren, und ständig aufs neue in das System zurück gespeist werden:
"... 40 Prozent der betreuten Personen sind nach drei Monaten noch auf dem Arbeitsplatz auf den sie vermittelt wurden. Nach sechs Monaten sind es nur mehr 30 Prozent. Das heißt, dass zehn Prozent der betreuten Personen zwischen Arbeitsplatz, Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit immerfort herumkreisen. Die Integrationsfachkraft ist daher immer wieder in zyklischen Abständen mit den gleichen sich steigenden Klientenproblematiken konfrontiert."
Auch Michael Stadler-Vida spricht von einer Verschiebung der Zielgruppe, auf die allerdings lediglich aufgrund der Rückmeldungen der Anbieter gemutmaßt werden kann, da das BMSG bislang die Statistikdaten nicht zur Auswertung frei gegeben hat:
"Na ja, derzeit können wir ja nur mutmaßen, weil diese Daten in der Datenbank, die wurden bis jetzt ja nicht dahingehend veröffentlicht, dass man sie auswerten könnte. Das heißt, wir können nur mutmaßen aufgrund der Rückmeldungen der Anbieter. Ich weiß nicht, ob es diese dramatische Entwicklung wie in Deutschland gibt - das kann ich schwer abschätzen - aber ich würde einmal annehmen, und ich glaube das ist auch keine Fiktion, dass wenn man dauernd an dieser einen Schraube zieht, dass man sagt Vermittlungsquoten werden immer weiter hinaufgesetzt, dass das notwendigerweise einfach zu einer Verschiebung führt. Auch wenn die Anbieter sagen, sie wollen das nicht machen, und die öffentliche Hand sagt, es wird alles nicht so heiß gegessen, es führt zu einer Verschiebung. Weil wenn es nicht so heiß gegessen wird, und wenn es eh keine Konsequenzen hätte - so würde ich das einmal sagen - dann bräuchte man das ja nicht."
Die FördergeberInnen müssen sich demnach entscheiden, ob die Vermittlungsquoten die ausschlaggebende Grundlage für die Bewertung der Dienste darstellen. Tun sie das, wird zwangsläufig eine Zielgruppenverschiebung ausgelöst, da die AnbieterInnen ökonomischen Zwängen unterworfen sind und so agieren müssen, dass sie auch langfristig finanziert werden.
Bei der Darstellung der Kriterien werden gemäß der im Kapitel 4.5. durchgeführten Differenzierung nach Doose (2004) unterstützungssystembedingte Faktoren, unter die sowohl politische Rahmenbedingungen sowie Aspekte der Fachdienstarbeit subsumiert werden, und persönlichkeitsbedingte Faktoren unterschieden. Betriebsbedingte Kriterien wurden nicht erwähnt, da diese sich nicht im Einflussspektrum der interviewten ExpertInnen befinden.
Von Seiten der FördergeberInnen werden folgende Unterstützungssystembedingte Kriterien genannt:
-
Es bedarf einer genauen Abklärung, ob die Dienstleistung für die betreffende Person das geeignete Unterstützungsinstrumentarium ist. (Fritzer)
-
Es muss eine kontinuierliche Begleitung im Sinne eines "Integrationspfades" ermöglicht werden, durch die der/die NutzerIn relativ selbständig den Weg bis zur Erlangung eines Arbeitsplatzes gehen kann. Dabei sind die Fachdienste gefordert, genau abzuklären, welches für eine bestimmte Person die beste Maßnahme ist, anstatt einfach in den nächst besten Job zu vermitteln. (Fritzer)
-
Fachdienste müssen sich als Teil eines umfassenden Dienstleistungsspektrums sehen, und mit den entsprechenden Institutionen optimal kooperieren. (Schartmann)
Von Angelika Fritzer wird ein personenbezogenes Kriterium angesprochen:
-
Behinderungs- und persönlichkeitsbedingte Probleme sollten vor einer Vermittlung zum Großteil gelöst sein, da der Druck am Arbeitsmarkt ungleich höher ist, weil neben den beruflichen Problemen auch die Eingliederung in das soziale Gefüge gelingen muss.
Die Interessensvertretungen führen folgende, ausschließlich unterstützungssystembedingte, Kriterien an:
-
Auf der praktischen Ebene ist die Passgenauigkeit ein wesentliches Kriterium. Dies bedeutet einem/einer NutzerIn in manchen Fällen auch von einem bestimmten Arbeitsplatz abzuraten und weiter zu suchen. (Bungart und Rossi)
-
Ein wichtiges Kriterium in der Arbeit mit Firmen ist insbesondere in ländlichen Regionen die Ehrlichkeit gegenüber den ArbeitgeberInnen in Bezug auf Leistungsmöglichkeiten der NutzerInnen. (Rossi)
-
Die Qualität des Arbeitsplatzes, vor allem im Sinne der arbeitsrechtlichen Absicherung, ist ein weiteres Kriterium. Die Gefahr des "Working Poor" muss beachtet werden. (Rossi)
-
Das Aufzeigen eines perspektivischen Weges auch beim Scheitern einer Vermittlung und die vertrauensvolle Begleitung des Übergangs in eine andere Institution, können unter Umständen dazu führen, dass NutzerInnen einige Zeit später eine Vermittlung schaffen. (Rossi)
-
Ein Kriterium für Nachhaltigkeit ist die optimale Organisation und Abstimmung der Einrichtungen. Es bedarf auch der vollen Unterstützung für die Fachdienste durch die Leitungs- und Trägerebene. (Bungart)
-
Um bestimmte Zielgruppen ausreichend zu erfassen, ist eine interne Differenzierung im Sinne des Reservierens von Stellenanteilen (insbesonders für WerkstättenmitarbeiterInnen und SonderschulabgängerInnen) erforderlich. (Bungart)
-
Es benötigt ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Vergütungssystem für Fachdienste, das statt Vermittlungsquoten eher Wirkungsfaktoren berücksichtigt. (Bungart)
-
Es bedarf auf Seite der Gesetzgeber eine langfristige und strategische Planung, nur dadurch können Kontinuität für die Arbeit der Fachdienste aber auch für die Betriebe erzielt werden. (Bungart)
Die LeiterInnen führen die folgenden unterstützungssystembedingten Kriterien an:
-
Nachhaltigkeit bedeute nicht nur Effektivität in dem Sinn, dass möglichst viele Personen in den Arbeitsmarkt vermitteln werden, sondern vor allem auch Menschen mit einer schweren Behinderung, die arbeiten wollen. (Lackner)
-
Ein Kriterium ist die Einbeziehung der wichtigsten Akteure in die Angebotsgestaltung und die Erhebung ihrer Zufriedenheit mit der Dienstleistung. (Behncke und Lackner)
-
Es ist erforderlich, die Anforderungen des Fördergebers ausreichend zu berücksichtigen und sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu bewegen. (Behncke und Lackner)
-
Es benötigt ein Paket an aufeinander abgestimmten Maßnahmen, um einer Person individuell abgestimmt das richtige Mittel mit entsprechender Struktur und Personal anbieten zu können. (Lackner)
-
Die im Gesetz vorgegebenen Leistungen, insbesondere die Begleitung am Arbeitsplatz, müssen in einem höheren Maße verbindlich und finanzierbar sein. (Behncke)
-
KundInnen müssen auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Probleme auftreten, auf das Angebot der Fachdienste unbürokratisch zugreifen können.(Behncke)
-
Die Möglichkeit langfristige bzw. dauerhafte personelle und/oder finanzielle Unterstützungsleistungen (z.B. dauerhaften Lohnkostenzuschuss) in Anspruch zu nehmen, muss möglich sein. (Behncke)
Die Aufzählung wird von Seite der Forschung um die folgenden Kriterien ergänzt:
-
Es muss gewährleistet sein, dass die KundInnen über den gesamten Prozess von einer konstanten Ansprechperson begleitet werden. (Stadler-Vida)
-
Die Vermittlungszahlen dürfen nicht dazu führen, dass die Idee der Dienstleistung torpediert wird. (Stadler-Vida)
-
Es bedarf weiterhin einer bundesweiten und internationalen Diskussion über Qualität und Qualitätskriterien. (Doose)
-
Ein wesentliches Kriterium ist die KundInnenzufriedenheit und KundInnenpflege. -(Doose)
-
Die Einstellung der IntegrationsbegleiterInnen ist ein weiterer wichtiger Faktor. (Doose)
-
Es benötigt ein höheres Maß an betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen. (Doose)
Zentrale personenbedingte Voraussetzungen sind nach Stefan Doose auch die Schlüsselqualifikationen der Person, ihre Persönlichkeit und das soziale Netzwerk.
Aus der Sicht von Dieter Schartmann muss das System der Integrationsfachdienste wieder so umgebaut werden, wie es vor der Übernahme der Arbeitsmarktverwaltung ausgesehen hat. Als wichtige Veränderungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sieht er die Einführung eines neuen Finanzierungssystems für die Fachdienste. Eine zentrale Rolle wird zukünftig dem Integrationsamt zukommen, welchem (nunmehr seit Anfang 2005) die Strukturverantwortung für den gesamten IFD übertragen wird. Zum Zeitpunkt des Interviews befanden sich dazu, nach Auskunft von Dieter Schartmann, einige zentrale Prozesse in Vorbereitung. Dazu zählt vor allem die Einführung von KASSYS als einheitlichem Qualitätsmanagementsystem, sowie die Weiterentwicklung dieses Systems vor allem um Struktur- und Prozessmerkmale für den Vermittlungsbereich, die dann auch dementsprechend umgesetzt werden sollen. Die BAG-UB fordert vom Gesetzgeber auch vermehrt Öffnungsversuche in bislang für den Integrationsfachdienst unzugänglichen Institutionen einzuleiten. Diesen Standpunkt nimmt auch Stefan Doose ein, indem er sagt:
"... momentan ist ja auch ein gesetzlicher Auftrag da, wunderschön formuliert im SGB IX und auch in der Werkstattverordnung. Aber natürlich ist es in der Werkstätten so, auch wenn es um QM geht, dass sie nur ein bedingtes Interesse haben ihre besten betrieblichen Mitarbeiter gehen zu lassen. Es sei denn, es gibt einen sehr reflektierten Konsens darüber, dass die Existenzberichtigung dieser Einrichtungen nur darin besteht, dass sie Rehabilitationseinrichtungen sind und einen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten. Das erfordert aber eine ziemliche Klarheit zu welcher der Kostenträger sicherlich etwas beitragen können."
Außerdem fordert Stefan Doose, dass die Zuweisungspraxis der Dienste im Sinne eines freien Zugangs geändert wird, sowie eventuell auch die Einführung eines Rechtsanspruches auf die Dienstleistung. Die Dienste sollen sich zudem verpflichten stärkere Übergangsquoten aus Schulen und Werkstätten zu erreichen. Dies könnten die Fördergeber dadurch unterstützen, indem sie finanzielle Anreizsysteme im Förderungsrecht schaffen. Neben den Zuweisungsstrukturen und der finanziellen Ausstattung müssen, wie in den Kriterien angeführt, Unterstützungsstrukturen existieren, die es ermöglichen, dass einer Person auch die Unterstützung zukommen kann, die sie benötigt.
Angelika Fritzer ist der Überzeugung, dass die Nachhaltigkeit leicht in das bestehende System implementiert werden kann. Dazu reicht eine Entscheidung darüber, wie viel Wert ein Arbeitsplatz hat, der nicht nur wie nach den derzeitigen Kriterien drei Monate, sondern beispielsweise ein Jahr oder länger beibehalten wird. Zu diesem und zu anderen Kriterien wie der Art des Arbeitsplatzes müssen aber zunächst Indikatoren gefunden werden. Es soll zukünftig grundsätzlich eine Differenzierung und Gewichtung innerhalb der Vermittlungszahlen erfolgen. Auch Walter Lackner meint, dass die Behaltepflicht im Sinne der Erfolgsdefinition ausgeweitet werden müsse. Zusätzlich besteht in vielen Regionen ein vermehrter Bedarf an zusätzlichen Qualifizierungsangeboten nicht nur in traditionellen Betätigungsfeldern. Michael Stadler-Vida ist der Überzeugung, dass bereits jetzt mit den Monitoringdaten mehr angefangen werden kann:
"... da gibt es ja dieses Eingabe- und Monitoringsystem. Also meiner Meinung nach könnte man jetzt schon mit diesen Monitoringdaten bereits mehr anfangen als das, was derzeit geprüft wird. Man könnte wirklich verfolgen, was passiert mit den vermittelten Personen nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach neun Monaten, nach zwölf Monaten. Es können vielleicht einfach einmal exemplarisch Einzelbeispiele heraus gezogen werden, um zu schauen, wie es mit der Nachhaltigkeit wirklich ausschaut. Sind das wirkliche Erfolge, oder sind das so Karrieren, die sich immer im Kreis drehen. Menschen die vielleicht über diese drei oder sechs Monate Behaltepflicht beschäftigt sind, aber dann wieder zur Arbeitsassistenz kommen und das Ganze wieder von vorne losgeht. Also das würde zumindest einen Aufschluss darüber geben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Damit könnte man dann als Anbieter aber auch als öffentliche Hand darauf reagieren."
Diese Überschrift gliedert sich in vier Bereiche. Zunächst wird die Einschätzung der ExpertInnen in Bezug auf Qualitätssicherungs- bzw. Qualitätsmanagementsysteme behandelt. Es geht um die Frage ob es aus Sicht der ExpertInnen notwendig erscheint, für Fachdienste der beruflichen Integration speziell für diesen Arbeitsbereich entwickelte Systeme anzuwenden, sowie welche Vorteile sich dadurch im Vergleich zur Anwendung herkömmlicher Systeme bieten. Außerdem wird betrachtet, wie die ExpertInnen einzelne Systeme in Bezug auf ihre Anwendbarkeit in Fachdiensten einschätzen. Der zweite Unterschwerpunkt erhebt, welche Probleme sich bei der Anwendung von Systemen in Fachdiensten ergeben. Der dritte Bereich behandelt die Frage, welche Kriterien aus Sicht der ExpertInnen in der Entwicklung, Auswahl und Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems zu beachten sind, damit sie möglichst effizient in die Praxis umgesetzt werden können. Zum Abschluss stellen die ExpertInnen dar, welche (Weiter)Entwicklungen von Systemen bzw. übergeordneten Rahmenbedingungen notwendig sind.
Für Österreich stellt Angelika Fritzer vom BMSG fest, dass derzeit Überlegungen bestehen allen Arbeitsassistenz-Einrichtungen die Verwendung eines anerkannten Qualitätssicherungssystems vorzuschreiben. Bezüglich der Entwicklung eines allgemein verbindlichen Systems stellt sie fest[42]:
"Unser Ansatzpunkt ist derzeit ein anderer. Es wäre natürlich schon eine interessanter Prozess, ein für alle Arbeitsassistenzeinrichtungen verbindliches Qualitätssicherungssystem zu schaffen, - das hätte gewisse Vorteile, insbesondere hinsichtlich der Vergleichbarkeit und des Benchmarkings. Es ist auf der anderen Seite sehr schwierig und vielleicht auch nicht sinnvoll sämtlichen Trägern solche Qualitätssicherungssysteme aufzudrängen, vor allem aus dem Grund, dass viele Träger bereits sehr gute Qualitätssicherungssysteme anwenden..."
Von Seiten des BMSG wird keine Spezifizierung vorgenommen, welche Systeme dabei geeigneter erscheinen. Es soll eine Frage der Freiwilligkeit sein, welche Systeme verwendet werden. Dies erklärt sie insbesondere dadurch, dass bereits etliche Träger ein eigenes Qualitätsmanagementsystem besitzen, und es daher sowohl aus Sicht der Fördergeber als auch der Träger ineffizient wäre, ihnen ein spezielles System vorzuschreiben.
Für Dieter Schartmann vom Integrationsamt braucht es für die spezielle Dienstleistung eines Fachdienstes auch ein spezielles Qualitätsmanagementsystem:
"Wir haben hier für die IFD Spezielle Systeme entwickelt, wegen der speziellen Arbeitsweise und den unterschiedlichen Sichtweisen. Es benötigt in diesem Arbeitsfeld einerseits einen engen notwendigen Kontakt zum Kostenträger, das ist in anderen Bereichen der sozialen Arbeit nicht so, in denen auch andere gesetzliche Grundlagen bestehen. Andererseits erfordern auch die unterschiedlichen Zielgruppen, vor allem die Arbeitgeber auf der einen Seite auch ein eigenes QM System. Also ich denke, um es noch einmal zusammenzufassen, QM im Bereich der sozialen Arbeit: denn soziale Arbeit bedeutet immer, dass das, was im Prozess erarbeitet, im Grunde genommen auch gleich wieder konsumiert wird - und darin unterscheidet er sich auch vom industriellen Bereich. Deswegen ist es gerade im QM Bereich für den IFD erforderlich, viel stärker auf den Prozess als auf das Ergebnis zu achten und deswegen meine ich, erfordert es auch ein eigenes QM System."
Aus Sicht von Jörg Bungart können Qualitätsmanagementsysteme auch als "Etikettenschwindel" missbraucht werden, wenn der leitende Anspruch hinter der Einführung eines Systems nicht jener der kontinuierlichen Verbesserung der Dienstleistung ist. Denn, so argumentiert er, die Einführung eines solchen Systems hat per se noch wenig mit dem eigentlichen Sinn von Qualitätsmanagement zu tun, und zwar der Verbesserung des Angebots sowie eine transparente Darstellung der Ergebnisse nach außen. Primär geht es den Institutionen zunächst darum sich einen Marktvorteil zu verschaffen:
"Und dann ist so ein System immer in der Gefahr, egal wie ich es nenne, einfach nur ein wenig angedockt oder angehängt zu werden, aber es wird eigentlich nicht wirklich gelebt. Also QM Systeme haben für mich nur dann eine Rechtfertigung, auch durch den Aufwand, der damit betrieben wird, wenn sie tatsächlich auch gelebt werden und d.h. auch in allen Ebenen einbezogen werden."
Nach Jörg Bungart ist der Vergleich einzelner Systeme grundsätzlich schwierig, da sie unter anderen Zielsetzungen und Zusammenhängen entwickelt wurden. Der Trend in Qualitätsmanagement und Systementwicklung geht seiner Ansicht nach verstärkt zu den Bereichen KundInnen und MitarbeiterInnenorientierung.
Übereinstimmung dahingehend, dass Qualitätsmanagementsysteme auf die Spezifika dieses Arbeitsbereiches eingehen müssen, gibt es bei Walter Lackner, Rolf Behncke und Michael Stadler-Vida
"Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Qualität etwas mit der Arbeit zu tun haben muss, also Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement müssen etwas mit der Arbeit zu tun haben, und zwar auf die Spezifika dieser Arbeit eingehen. Wir haben einen Prozess und, dieser Prozess wird vom Arbeitsassistenten moderiert - und auf diese spezielle Situation muss Qualitätsmanagement eingehen, damit wir zu einem Erfolg kommen." (Lackner)
"Aber ein Teil der Instrumente müssen auf die Besonderheit dieses Arbeitsbereiches eingehen. Das muss man dann wirklich auch mit den Arbeitsassistenzprojekten oder Einrichtungen abstimmen, und dafür muss man sich die Zeit nehmen, und das kostet dann einfach auch Geld..." (Stadler-Vida)
Die Vorteile eines abgestimmten Konzepts liegen nach Michael Stadler-Vida darin begründet, dass sich die handelnden Akteure in den Besonderheiten ihrer Arbeit ernst genommen fühlen. Dadurch gehen vor allem bei der Umsetzung weniger Energie und Ressourcen verloren. Für Stefan Doose beschränkt sich der Nutzen von Qualitätsmanagementsystemen nach DIN-ISO im Beschreiben der Prozessabläufe sowie in der Einschulung neuer MitarbeiterInnen:
"Aber ich denke, Prozesse zu beschreiben und gerade Menschen, die neu in diesem Beruf sind, zur Verfügung zu stellen, macht sicherlich einen Sinn, danach verfliegt der Nutzen aber. Der Nutzen von solchen Sachen liegt bei der Erarbeitung, dem deutlich machen und dem Beschreiben von Prozessabläufen. In dieser Phase kann man sich überlegen wie man gewisse Prozesse eigentlich macht, und ob man sie wirklich so macht wie man es sich vorstellt. Das ist vor allem bei der Weitergabe dieser Dinge an neue Mitarbeiter, z.B. in Form eines Qualitätshandbuches, von Bedeutung. Danach ist es aber kein bedeutendes Qualitätskriterium mehr."
Einen großen Raum in der Darstellung der ExpertInnen nimmt die Einschätzung und Beurteilung einzelner Qualitätsmanagementsysteme ein, insbesondere die Unterscheidung zwischen DIN-ISO und EFQM. Dabei wird von einem Großteil der ExpertInnen die Übertragbarkeit von ISO auf diesen Arbeitsbereich als schwierig eingeschätzt:
"Also ich bin immer sehr skeptisch wenn ich höre - und das machen auch viele hier im Norden - dass im Bereich der sozialen Arbeit zertifiziert werden soll. Die ISO Normen sind nicht für den Bereich der sozialen Arbeit gemacht worden, sondern die sind für andere Sachen belegt. Wenn spätere Entwicklungen in Richtung sozialer Arbeit stattgefunden haben, dann wurde das immer wieder nur aufgepfropft. Man baut dann eigentlich auf falschen Grundlagen auf und das kann so auch nichts werden. Also ich denke für den Bereich der sozialen Arbeit gibt es eine Menge an QM Systemen die auch alle gut sind." (Schartmann)
"...damals hat das BBRZ eine ISO Zertifizierung angestrebt, keine Ahnung nach welchem ISO System das genau gewesen ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist mir eigentlich in sehr schlechter Erinnerung geblieben. Also wir haben damals versucht das ISO System, dass ja ursprünglich für produzierende Betriebe entwickelt worden ist, und wir haben versucht, das auf den Sozialbereich umzuformulieren. Das war ziemlich schwierig, möchte ich sagen. Es hat in mir auch nicht den Eindruck hinterlassen, dass es der Qualität wirklich dienlich ist. Dazu muss ich noch sagen um nicht ISO total schlecht hinzustellen, es hatte sicher etwas mit der schlechten Einführung zu tun gehabt, ..." (Rossi)
"Ich würde da noch einmal unterscheiden, also die ISO ist für mich wirklich ein formales Verfahren. Das bekommen wir bei unseren Fortbildungen auch immer wieder mit. Ich sagte bereits, dass viele Werkstätten ISO eingeführt haben, die sind zum Teil gar nicht unzufrieden mit dem System. Aber auch dort ist es auf den sozialen Bereich angepasst worden, auf die Werkstatt z.B. oder auch bei Bildungsträgern. Die Rückmeldung ist aber immer noch, dass es ein aufgepfropftes technisches System ist. Und diese Rückmeldung habe ich nicht nur aus dem sozialen Bereich, sondern ich war in Münster auch einmal bei der Handwerkskammer bei einem QM Zirkel, und die selbe Kritik kam genauso von den kleinen Handwerksbetrieben. Es ist offenbar nicht nur im sozialen Bereich nicht gut adaptiert, sondern auch sag ich mal im gewerblichen Bereich - im handwerklichen Bereich zumindest - und auch in der Wirtschaft insgesamt." (Bungart)
Ein positiver Effekt von DIN-ISO wird von einigen ExpertInnen in der Beschreibung der Prozesse gesehen:
"Tja, im Falle der ISO Normierung, glaube ich, dass sie sicherlich am Anfang einen gewissen Effekt bringt, wenn man Prozesse beschreibt. Aber die Qualität hängt auch sehr davon ab, wie gut man diese Prozesse am Anfang beschreibt. Wenn man schlechte Prozesse beschreibt, dann hat man zwar, wenn man sie gut dokumentiert, seine ISO Pflicht und Schuldigkeit getan, hat aber noch immer keine brillante Arbeitsplatzakquisition geschaffen, oder hat von der Grundeinstellung noch immer einen Prozess, der die Leute als Betreute behandelt beispielsweise." (Doose)
Durchwegs positiver beurteilt wird das EFQM System, vor allem aufgrund seiner offeneren Struktur und der Orientierung an den wichtigen TQM Prinzipien der KundInnen- und MitarbeiterInnenorientierung:
"Also QM Systeme haben für mich nur dann eine Rechtfertigung, auch durch den Aufwand der damit betrieben wird, wenn sie tatsächlich auch gelebt wird und d.h. auch in alle Ebenen einbezogen werden. Und ich glaube da ist EFQM schon einen Schritt weiter, es basiert ja auch auf den Prinzipien von Total Quality Management. Aber auch dieses System kann natürlich missbraucht werden, das ist mit allen Systemen so. Aber es ist von der Grundidee, wenn man sich schon mal anguckt, welche Bewertungsbereiche da mit einbezogen sind, die sind da sicher schon mal weiter und weiterentwickelt worden. Da haben wir so etwas drin wie Mitarbeiterorientierung, da haben wir Kundenorientierung drin. Es ist also ein System das zumindest grundsätzlich - so muss man es vielleicht sagen - auch geeigneter ist im Leben vernetzt zu werden auch innerhalb einer Organisation." (Bungart)
Einige der ExpertInnen thematisierten die Besonderheiten der speziell für diesen Arbeitsbereich entwickelten Systeme KASSYS, MUQ und QUIP. Dabei gehen vor allem Dieter Schartmann und Jörg Bungart auf die Unterschiede zwischen KASSYS und MUQ ein. Von den formalen Kriterien wurde KASSYS ursprünglich für den Bereich der begleitenden Hilfen und MUQ für den Vermittlungsbereich der IFD entwickelt. KASSYS hat dabei aber einen anderen Verbindlichkeitscharakter, da es von Seiten der Fördergeber als Instrument zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit mit den Diensten eingesetzt wird. MUQ hingegen ist als offizielles Verfahren nie zum Einsatz gekommen. In der geplanten Erweiterung von KASSYS werden vor allem die Parameter der Struktur- und Prozessqualität stärker berücksichtigt. Das Verfahren wird auch auf den Vermittlungsbereich ausgedehnt. Die Besonderheiten von MUQ liegen nach Dieter Schartmann im hohen selbstevaluativen Anteil dieses Systems, diese sollen in der Erweiterung von KASSYS berücksichtigt werden. Jörg Bungart sieht für das System KASSYS noch Entwicklungsbedarf. Seiner Ansicht nach, gibt es noch zu wenige Anleitungen wie das System von den Fachdiensten genützt werden kann, darüber hinaus muss noch ein Auditsystem entwickelt werden. Über die Besonderheiten von MUQ führt er aus:
"... a ja das MUQ, man kann ja MUQ auch als EFQM System verstehen. Wir haben da zwar nicht diese Bewertungsskala angewendet, aber von den Ideen kann man es so verstehen. Von daher ist es von den Grundideen und den Grundkonzepten aber hiermit weitgehend identisch, außer dass man diese Bewertung noch einführt, und die Frage klärt, wie man jetzt an diese Punktezahlen kommt, das haben wir ja nicht gemacht. Und das besondere an dem MUQ System ist eben, dass die Arbeitsstandards von vornherein so angelegt sind - darauf haben wir immer Wert gelegt - dass sie für jeden Dienst speziell entwickelt werden müssen, weil es einfach auch immer andere regionale Bedingungen gibt. Z.B. wenn es um Vernetzung geht, oder wie abhängig ich von den Zielgruppen bin, die ich in meinem Dienst habe. Daher ist erforderlich, gewisse Standards auch einrichtungsspezifisch zu entwickeln. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei KASSYS so auch nicht drinnen ist."
Das QUIP Modell wird von einem Großteil der ExpertInnen positiv bewertet. Darauf Bezug nehmend hält Michael Stadler-Vida zunächst die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Qualitätssicherungs- und Selbstevaluationsinstrumenten, als zwei unterschiedliche Zugänge die sehr wohl nebeneinander existieren und sich gegenseitig bereichern können, für wichtig. QUIP ist dabei in erster Linie als Selbstevaluationsinstrument zu verstehen. Institutionen können mit beiden Instrumenten etwas anfangen, solange sie einen Sinn darin sehen:
"... Selbstevaluation als auch diese Instrumente und Methoden, die wir verwenden, sind gut, wenn ich diese Messung als Grundlage sehe mein Konzept zu verändern. Aber als Kontrollinstrument von außen sind sie natürlich denkbar unbrauchbar. Also das ist auch, warum ich einen Unterschied zwischen einem Evaluationshandbuch oder einem Selbstevaluationshandbuch ziehe oder einem Qualitätssicherungs- oder -Entwicklungsinstrument, was ja noch weiter geht."
Auf die Besonderheiten von QUIP gehen auch Stefan Doose und Walter Lackner ein, die beide ebenfalls an der Entwicklung dieses Instruments beteiligt waren:
"Also ich finde die Qualitätskriterien aus dem QUIP Projekt sind aus meiner Sicht das Beste was auf dem Markt ist. Was ich an den Qualitätskriterien mag ist, dass sie aus den unterschiedlichen Perspektiven formuliert sind, die unterschiedlichen Ebenen betrachten und gleichzeitig so formuliert sind, dass sie etwas Herausforderndes haben. Die wenigsten Dienste können heute sagen: wir klatschen einmal in die Hände, das haben wir alles, sondern für die meisten Dienste liegt in den Qualitätskriterien da auch ein Stachel drinnen." (Doose)
"Ich finde QUIP ist mehr als ein Tool. Die Haltung, die Prozesskette und die nötige Dokumentation dazu - und das ist nicht so viel, das hat man bald. Mittlerweile hat das ja eh jeder Träger, also man muss sich nur anschauen was da für Etappen sind. Man tut so, als ob das irgend so etwas Transzendentes wäre das Qualitätsmanagement, das ist was ganz einfaches. Ich denke am Anfang haben ein paar herum getan, und dann haben sie sich zusammengesetzt und gesagt: so was brauchen wir da um Schritt für Schritt nach vorne zu gehen, und jetzt schreiben wir das endlich einmal auf, und sie haben das aufgeschrieben und fertig - aber es soll nicht die Bibel sein." (Lackner)
Die Umsetzungsproblematik stellt sich für das BMSG vor allem dahingehend, die gesamten hierarchischen Stufen auf eine Ebene zu bringen, sowie für alle beteiligten Seiten geeignete Kriterien für qualitätsvolle Arbeit zu definieren[43].
Auf Seite der Institutionen ist die Anwendung und Umsetzung von Systemen immer eine Frage der begrenzten vorhandenen zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen. Ein weiteres Problem wird, von Karin Rossi darin gesehen, dass für Tools zur Erhebung der KundInnenzufriedenheit keine adäquaten Auswertungsinstrumente existieren, um einen aussagekräftigen Vergleich und eine Gewichtung der Aussagen durchführen zu können. Vor allem in Betrieben stellen sich Befragungen als sehr schwierig dar, da zumeist wenige Rückmeldungen gegeben oder Erhebungen von vorn herein abgelehnt werden. In vielen Institutionen fehlt es am Wissen über geeignete Instrumente und deren Einsatzmöglichkeiten. Karin Rossi berichtet von einem Beispiel, in dem das Institut zur beruflichen Integration versucht hat, Prozesskriterien und Leistungsbeschreibungen für die vier Stadien zu definieren. Es stand die Idee dahinter, den Prozessverlauf genau zu beschreiben sowie zeitliche und inhaltliche Definitionen zu geben. In der täglichen Praxis und Anwendung zeigten sich jedoch große Probleme, da die Zuordnung zu den einzelnen Stadien sich in der Dokumentation und Auswertung als sehr kompliziert herausstellte. An dieser Stelle kann die Praxis von wissenschaftlichen Begleituntersuchungen sehr profitieren.
Auch Walter Lackner berichtet von Problemen bei der Einführung und Anwendung des QUIP Evaluationshandbuches:
"Es gibt vielleicht ein oder zwei Personen, die mit dem Handbuch arbeiten. Die anderen sind dazu jetzt gezwungen worden, dass sie das Handbuch im Laufe von Besprechungen durcharbeiten. Also man kann ja zwingen, und ich mach das auch. Die Mitarbeiter haben alle gesagt, also die Leute sind ja zum Teil nicht mehr da, aber sie waren alle in dem Prozess drinnen und haben groß dahergeredet, aber wenn es darauf ankommt, ist man zu faul ein wichtiges Unterstützungsmaterial zu nützen. Also wo kommen wir da hin. Ich meine: das existiert ja jetzt schon ein Jahr im Internet, und wir haben ja auch schon den Abdruck bekommen. Ich würde sagen, seit November beginnen wir das Schritt für Schritt Kapitel für Kapitel durchzugehen."
Aus Sicht des Fördergebers Integrationsamt ist es ein wesentliches Kriterium ein Instrument in der Hand zu haben, das ermöglicht mit den Diensten ins Gespräch zu kommen, wobei diese Gespräche natürlich immer Bewertungscharakter haben.
Von Seiten der BAG-UB werden als wichtige Kriterien für ein Qualitätsmanagementsystem vorgebracht:
-
Vor der Vereinheitlichung eines Qualitätsmanagementsystems sollen sich Auftraggeber und Leistungsträger zunächst über gewisse Vorgaben einig werden.
-
Es sollen jene Daten zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erhoben werden, die es erlauben, einen Dienst optimal zu steuern. Dabei benötigt es vor allem bei den Prozessdaten noch Experimentierbedarf um herauszufinden, welche Daten benötigt werden um über Rückmeldungen wirklich zu einer Verbesserung der Dienstleistung zu gelangen.
-
Es sollen nicht von Anfang an große Systeme eingeführt werden, sondern es sollte allen Beteiligten möglich sein Entwicklungen schrittweise und systematisch zu durchlaufen.
-
Ein Qualitätsmanagementsystem sollte zumindest einmal pro Jahr ein Audit vorsehen. In diesem Audit sollen Leitung, Team und Kostenträger eine Rückschau auf die zu den Qualitätsparametern erhobenen Daten, sowie eine Prozessreflexion durchführen um daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
-
Die Auswahl und Entwicklung von Systemen ist noch oft von einem statischen Verständnis geprägt. Angesichts rasanter Entwicklungen in diesem Bereich müssen sich Qualitätsmanagementsysteme ständig weiterentwickeln können.
-
Ein zentraler Aspekt ist jener der Kosten-Nutzen Relation. Dabei sollen nur jene Informationen erhoben werden, die tatsächlich zu einer Weiterentwicklung beitragen. Dafür müssen die erhobenen Daten in einem Kreislauf- bzw. Spiralprozess ständig in den Prozess zurückgeführt werden.
-
Im Sinne der Anwendbarkeit soll ein System ausreichend Anleitungen beinhalten wie es tatsächlich genutzt werden kann.
Aus Sicht des Dachverbandes Arbeitsassistenz werden folgende Kriterien formuliert:
-
Es soll eine wissenschaftlich fundierte Branchenversion entwickelt werden, die einen Vergleich unter den einzelnen Anbietern ermöglicht, sowie die Konkurrenz unter den einzelnen Systemen verringert. Dieses System soll nicht nur den Status Quo festschreiben, sondern vor allem Weiterentwicklung ermöglichen.
-
Um objektiv festzustellen, welches Systems geeignet ist, und einen Teil des Wettbewerbs auszuschalten, soll eine Ausschreibung stattfinden.
-
Trotz unterschiedlicher Prioritätensetzungen ist die Grundvoraussetzung bei Einführung eines Systems die Abstimmung zwischen Fördergebern und Arbeitsassistenz-Einrichtungen.
Die LeiterInnen von Institutionen geben die folgenden Kriterien an:
-
Ein von allen LeiterInnen vorgebrachtes Kriterium ist jenes des Zeitaufwandes, der in einem realistischen Verhältnis zu den vorhandenen Ressourcen der Fachdienste stehen muss. (Behncke, Rossi und Lackner)
-
Das System soll praxisnah und prozessorientiert sein, sowie auf die Spezifika der Arbeit eingehen (Rossi und Lackner)
-
Das System sollte auf die Verbesserung der Prozesse angelegt sein, anstatt Prozesse nur statisch festzuschreiben. (Lackner)
-
Die Handhabbarkeit ist ein weiteres Kriterium. Dabei sind modulare Systeme von Vorteil, da einzelne bereits vorhandene Bausteine übernommen werden können. (Behncke)
-
Das System soll in Anlehnung an die Prozesskette der beruflichen Integration eine Leitlinie vorgeben. Außerdem sollen für bestimmte Situationen Hilfsschritte und Handlungsanleitungen gegeben werden. (Behncke und Lackner)
Von den Vertretern der Forschung werden die Kriterien um die folgenden Aspekte ergänzt:
-
Ausschlaggebend für eine Institution ist zunächst die Feststellung, ob ein System oder Instrument zu der Einrichtung passt, und ob ein Sinn darin gesehen wird, das System anzuwenden. (Stadler-Vida)
-
Der Zeitaufwand muss den Realitäten der Organisation entsprechen. Bei der Entwicklung von Systemen sollen daher vor allem kleinere Anbieter einbezogen werden. (Stadler-Vida)
-
Durch ein Qualitätsmanagementsystem soll in Fachdiensten ein kontinuierlicher Prozess eingeleitet werden, die internen Abläufe regelmäßig zu überprüfen und nach Verbesserungspotentialen zu suchen. (Doose)
-
In regelmäßigen Audits soll überprüft werden, ob die Ziele bzw. die Zielgruppen erreicht wurden. (Doose)
Aus Sicht des BMSG soll das Thema Qualitätssicherung bzw. Qualitätsmanagement im Rahmen der einzelnen Projekte und Maßnahmen behandelt werden. Dabei wird es den Anbietern überlassen bleiben, welche Systeme sie anwenden. Es können durchaus auch in Deutschland entwickelte und angewendete Systeme zum Einsatz kommen. Die Anforderungen des BMSG an die Träger werden sein, ein anerkanntes Qualitätsmanagement System zu verwenden und die Erfolgsvorgaben zu erfüllen. Bezüglich der zukünftigen Definition der Erfolgsvorgaben stellt Fr. Dr. Fritzer fest[44]:
"...wobei die Erfolgsquoten in Zukunft dann von diversen anderen Kriterien beeinflusst werden, das heißt unsere Anforderungen werden dann nicht sein, dass pro ArbeitsassistentIn eine gewisse Anzahl von Personen vermittelt werden. Man wird verschiedene erfolgsbeeinflussende Faktoren zu berücksichtigen haben, einerseits sicherzustellen dass der Träger nach einer der anerkannten Systeme qualitätsvoll arbeitet, andererseits jene Informationen einzuholen, die es uns möglich machen Qualität aus unserer Sicht zu beurteilen."
Auch Michael Stadler-Vida ist der Überzeugung, dass es nicht unbedingt eines eigenen Instruments für Österreich bedarf. Dafür soll aber ein Konsens über eine Mindestanzahl an zu erbringenden Qualitätskriterien im Sinne einer Minimalanforderung erzielt werden. Bezüglich der Kosten für die Implementierung eines derartigen Systems fordert er von den Fördergebern:
"und von Seiten der öffentlichen Hand muss das Commitement gegeben werden, dass diese Kosten bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Summe auch abgedeckt werden. Nicht nur die Kosten des Instruments selbst, sondern das sind vor allem auch die Kosten der Arbeitszeit. Vor allem am Anfang bei der Implementierung, bzw. dann regelmäßig während des Verwendens bedarf es hoher personeller Ressourcen. Über die Kosten wurde bis jetzt - zumindest was ich mit bekommen habe - in diesem großen Rahmen nie gesprochen. Es wurde zwar gesagt, wir wollen ein System haben, und wir wollen etwas Großes haben und etwas Einheitliches haben, aber man muss sich wirklich im Klaren sein, was das schlussendlich für die Anbieter bedeutet."
Grundvoraussetzungen für die Umsetzung sind ferner, dass Gruppen von Anbietern, die aufgrund der Rahmenbedingungen (Region, Zielgruppe, Größe) zusammenpassen, sich diesem Prozess für eine gewisse Zeit gemeinsam widmen. Außerdem sollen vor allem die Befürchtungen kleinerer Anbieter ernst genommen und in die Entwicklung ausreichend miteinbezogen werden.
Bezüglich methodischer Weiterentwicklungen gibt Jörg Bungart einige Denkanstöße:
"Und jetzt die speziellen Systeme, die im Bereich IFD in Deutschland entwickelt worden sind. Man muss sehen, wie die auch alle zum Einsatz kommen, also auch MUQ ist ja danach nie mehr eingesetzt worden. Das ist ja auch richtig so, weil es keine klare Vorgabe gab. Also da gibt es jetzt einen gewissen methodischen Grundstock, den man da hat, der mehr oder weniger meist geführt wird. Den müsste man dann auch weiterentwickeln, aber ganz klar unter diesen Prinzipien Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung - auch an das EFQM angelehnt. Und da kommt dann auch wieder dieser Gedanke, den ich eingangs schon einmal gesagt habe, wer bestimmt letztendlich was gute Qualität in der Praxis ist. Also ich als Dienst kann das für mich ja besser beurteilen als extern. Der Auftraggeber aber auf jeden Fall, und bestimmt der das alleine, er muss es ja natürlich, denn er gibt das Geld her. Aber er kann das nicht alleine machen, und das ist im MUQ ja auch nicht weiter ausgeführt worden. Und ich glaube, wir brauchen da wirklich eine externe Bewertungsstelle, weil der Auftraggeber ja natürlich Teil des Systems ist, der auch wiederum als ein Akteur die Qualität mitbestimmt. Solange er nur alleine die Qualität letztendlich beurteilt, ist das natürlich völlig unausgeglichen und aus QM Sicht natürlich völlig unsinnig und eben einseitig. Also in dem Bereich müssten die Systeme, die jetzt existieren, oder auch die Praxis, die jetzt existiert, absolut weiterentwickelt werden."
Der bereits existierende methodische Grundstock, dabei insbesondere die drei angesprochenen Systeme KASSYS, MUQ und QUIP, sollen zu einem gemeinsamen Kriterienkatalog zusammengeführt werden. Dieser Kriterienkatalog wäre ein brauchbarer Erfolgsmaßstab, der auch in die Bewertung der Dienste mit einfließen kann. Zusätzlich wäre eine erstmalige praktisch Arbeitsbasis geschaffen, von der ausgehend nach einer gewissen Zeit betrachtet werden kann, in welchen Bereichen Weiterentwicklungen notwendig und sinnvoll sind.
Hier werden die Fragen behandelt, wie die interviewten ExpertInnen Benchmarking als Instrument zur Qualitätsverbesserung in Institutionen der beruflichen Integration einschätzen, was aus ihrer Sicht geeignete Benchmarks sind, die für einen zielführenden Vergleich unter den anderen Anbietern herangezogen werden können, welche Probleme in der Anwendung dieses Verfahrens zu berücksichtigen sind und wie ein idealtypischer Benchmarking Prozess aussehen kann. Zur Beantwortung dieser Fragen orientiert sich die Auswertung entlang der Prozessebenen.
Von einem Großteil der ExpertInnen wird Benchmarking explizit als ein geeignetes Verfahren bezeichnet, um über einen Qualitätsvergleich tatsächlich zu einer Qualitätsverbesserung der Fachdienste beitragen zu können. In Österreich können Unterschiede zwischen Fördergeber und den anderen Prozessebenen bei der Einschätzung dieses Verfahrens in Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten und Durchführungsbedingungen ausgemacht werden. Von Seiten des BMSG werden bislang nur quantitative Benchmarking Verfahren eingesetzt. Diese konzentrierten sich bislang auf einen Vergleich der Erfolgsquoten, der Kosten und der einzelnen Behinderungsarten. Benchmarking wurde vom BMSG bisher deshalb eingesetzt, so Angelika Fritzer, weil nicht nachvollziehbare Unterschiede in den Kosten und den Erfolgsquoten einzelner Anbieter bestehen. Positiv beurteilt das BMSG, dass im Zuge der Dachverbandstagung der Wunsch nach einem Benchmarking von Seiten der Träger ausgesprochen wurde[45]:
Karin Rossi sieht Unterschiede in den grundsätzlichen Ansprüchen an ein Benchmarking Verfahren zwischen Trägern und Fördergeber, die aber im wesentlichen nachvollzieh- und miteinander vereinbar sind:
"...der Vergleich wird mir ein bisschen aufgezwungen, ein Vergleich im Sinne eines Benchmarkings, dass ich mich z.B. mit der Caritas hinsetze und sage: wie tut ihr, und wie tun wir, im Sinne von mich verbessern - ja - aber der Rest im Grunde ist mir aufgezwungen worden, ist schon okay, aber so ist es. Ich habe nie darüber nachgedacht mich mit der Caritas zu vergleichen, und zu schauen: ist jetzt die Caritas besser oder wir, das ist eine Fragestellung, die hat das Bundesministerium aber nicht ich. Meine Fragestellung ist, wenn die Caritas besser ist wie ich, wie kann ich gleich gut werden wie die Caritas - ja - wie kann ich mich entwickeln, und wenn die Caritas besser ist als ich, dann hat die Caritas vielleicht trotzdem die Fragestellung, wie kann ich noch besser werden,..."
Als Voraussetzung für ein Benchmarking nennen einige ExpertInnen die vorherige Klärung unter allen Beteiligten, was unter welchen Umständen und unter welchen Interessen untersucht und evaluiert werden soll. Ein Benchmarking kann nur funktionieren, so Jörg Bungart, wenn - im Vorfeld exakt definierte - vergleichbare Kriterien oder Bereiche existieren, an denen die Dienste gemessen werden können. Als Grundbedingung sollen für alle an einem Benchmarking teilnehmenden Institutionen keine Sanktionen verbunden sein. Dies widerspricht der Grundintention dieses Verfahrens, dem gegenseitigen Lernen, wie es auch in der Wirtschaft eingesetzt wird. Dieter Schartmann spricht das Problem an, dass nur wenige Indikatoren wie beispielsweise die Vermittlungsquote als "harte Fakten" gewertet werden können. Selbst bei diesen können äußere Faktoren mitspielen, die in einem Benchmarking zunächst nicht aufscheinen. Bei den hauptsächlich "weichen Faktoren" stellt sich das bereits bekannte Operationalisierungsproblem. Es bedarf auch einer Verständigung darüber, wie breit dieses Verfahren angelegt werden soll. Werden nur Eckwerte herangezogen um eine Verteilung über das ganze Bundesgebiet zu erhalten, haben die Zahlen wenig Aussagekraft und der Lerneffekt bleibt gering. Karin Rossi sieht dahingehend ein großes Problem, dass bislang keine einheitlichen und klaren Definitionen von Erfolg existieren. Dadurch wird, und darin schließt sich auch Michael Stadler-Vida an, nur die Grundlage für Missverständnisse bzw. zum gegeneinander Ausspielen von Anbietern geschaffen. Angelika Fritzer, Rolf Behncke und Michael Stadler-Vida gehen auf die Problematik der regionalen Besonderheiten ein, wonach der Vergleich von städtischen und ländlichen Regionen zum Teil wenige Rückschlüsse bringt.
Antworten auf die Frage welche Benchmarks geeignet sind, fallen in ihrer Ergiebigkeit unterschiedlich aus. Für Dieter Schartmann sind denkbare Bewertungskriterien beispielsweise die Verankerung eines Dienstes in der Region, die NutzerInnenzufriedenheit, sowie relevante Prozessdaten die darüber Aufschluss geben, was mit Menschen passiert, die in die Dienste kommen. Von Seiten des Dachverbandes wird sich eine Arbeitsgruppe mit dieser Frage beschäftigen. Zum Zeitpunkt des Interviews konnte Karin Rossi darüber noch keine Aussagen treffen. Als Grundlage scheinen ihr die im Rahmen der Dachverbandstagung in einem Workshop erstellten Benchmarks nützlich. Dies sind unter anderem die Form der Kooperationen und Betriebskontakte, die MitarbeiterInnen, die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit, die Rahmenbedingungen sowie die Erfolge. Walter Lackner vertritt den Standpunkt, dass Benchmarks vor allem Eigenheiten der Regionen berücksichtigen müssen. Aus Sicht von Rolf Behncke soll sich ein Benchmarking auf die Kernaufgaben der Fachdienste konzentrieren. Für die Bestimmung der Benchmarks können die Kriterien des SGB IX als Leitlinie dienen. Daran kann auch aufgezeigt werden, inwieweit einzelne Dienste die im Gesetz vorgegeben Leistungen auch tatsächlich umsetzen können. Einen passenden Vergleich liefert Stefan Doose, der die zu erhebenden Daten mit den für die Steuerung eines Fahrzeugs notwendigen Instrumenten auf einem Armaturenbrett vergleicht:
"Und das eine, was ich noch ganz wichtig finde, es werden ganz viele Daten gesammelt für unterschiedliche Kostenträger und meine These ist: die meisten Daten dienen nicht dazu um Entscheidungen zu treffen. Ob etwas qualitativ gut ist oder nicht gut ist, sondern es werden ganz viele Daten gesammelt, die manchmal auch Datenmüll sind, die niemand benötigt und die sich auch niemand mehr anguckt und nach denen niemand auch irgendwelche Entscheidungen trifft. Und es ist eine ganz wichtige Frage - so ähnlich wie man ein Armaturenbrett hat - welche Anzeigen müssen auf meinem Armaturenbrett als IFD sein, damit ich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich glaube die Diskussion darüber, welche Instrumente brauche ich auf meinem Armaturenbrett um zu sehen, ob ich noch richtig liege, das ist eine ganz wichtige. Ich habe schon gesagt, Vermittlungsquote alleine reicht nicht aus, aber es ist sicher ein Instrument, das ich mit draufhaben muss. Wie lange ich welche Prozesse unterstütze und welche Instrumente ich verwende, kann eine andere Sache sein. Es kann sein, z.B. wie lange es braucht, bis man bei uns einen ersten Besuchskontakt oder so was kriegt, kann da auch draufkommen, es kann aber auch sein Nutzerzufriedenheit. Solche Dinge, dass man einfach eine Diskussionsrunde unter den Mitarbeitern und unter den Beteiligten hat, welche Instrumente müssen eigentlich auf unsere Tafel rauf, um wirklich das Ding gut fliegen zu können, und einige Werte kann man dabei vernachlässigen, und bei einigen Dingen ist es halt wichtig, die mit drauf zu haben."
Als wesentlichen Faktor müssen Benchmarks vor allem Strukturmerkmale erfassen. Dies ist vor allem aufgrund heterogener Rahmenbedingungen in den einzelnen Regionen von Bedeutung. Diese Tatsache scheint grundsätzlich auch auf Österreich übertragbar. Dazu kann Benchmarking Überblick und Transparenz über Rahmenbedingungen und Förderungspolitik in den einzelnen Regionen schaffen.
Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass in einem idealtypischen Benchmarking Prozess in einer ersten Phase die Erhebung quantitativer Zahlen eine Grundvoraussetzung darstellt, diese aber nur Hinweise über die tatsächliche Qualität der Dienste bzw. den Entwicklungsbedarf ausdrücken können. In einer zweiten, für den Anspruch des voneinander Lernens schlussendlich ausschlaggebenden Phase, müssen die erhobenen Daten im Rahmen eines qualitativen Benchmarking interpretiert und in einem gemeinsamen Diskussionsprozess diskutiert und analysiert werden. Für die erste Phase ist es zunächst notwendig eine Klärung unter allen Beteiligten zu erwirken, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden sollen. Weiters müssen die Bewertungsbereiche genau definiert und operationalisiert werden. Dies kann beispielsweise auch die unterschiedliche Gewichtung von Vermittlungszahlen beinhalten. Um Konkurrenzdenken zu minimieren ist es von Vorteil an ein solches Benchmarking keine Sanktionen zu verknüpfen, dazu Michael Stadler-Vida:
"Wobei immer die Frage ist, was man mit diesen Ergebnissen bezwecken möchte. Ich meine Ergebnisse sind, wenn sie dann auch Grundlage für finanzielle Entscheidungen sind, auch manipulierbar oder in die richtige Ecke zu trimmen. Ich meine in erster Linie sollten solche Ergebnisse immer die Grundlage für eine Selbstevaluation sein und für die Verbesserung der eigenen Arbeit, und nicht als Kontrollinstrument von außen dienen."
Für die Datenauswertung sind schließlich eine gute methodische Vorgangsweise sowie Transparenz von Bedeutung. Zur Erhebung der Zufriedenheit der wichtigsten NutzerInnen können die Fördergeber den Trägern Ressourcen zur Verfügung stellen, um standardisierte Verfahren einzusetzen. Dadurch würden vergleichbare Ergebnisse erzielt. In der zweiten Phase bilden die empirisch erhobenen Daten und Ergebnisse schließlich die Grundlage für einen, im Idealfall, moderierten Diskussionsprozess, in dem alle Beteiligten Ursachen und Hintergründe der Ergebnisse analysieren und Konsequenzen festlegen. Michael Stadler-Vida veranschaulicht dies in dem folgenden Zitat:
"... und meiner Meinung nach macht Benchmarking sehr viel Sinn, wenn man sich dann hinsetzt, wenn man unterschiedliche Ergebnisse hat, und das ist ja auch das, was in der Industrie passiert und überlegt, was sind die Gründe für die unterschiedlichen Ergebnisse. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein, das kann sein, dass die Betreuungsintensität anders ausschaut. Dann kann ich mir als Anbieter die Frage stellen, na ja, wo möchte ich was ändern, ist das für mich eine Option etwas zu verändern, oder hat es möglicherweise zu tun mit dem schwächeren Kontakt mit der Unternehmenswelt. Also ich denke mir, wenn man einmal Zahlen hat, wo man zumindest annehmen kann, dass sie halbwegs vergleichbar sind, dann lösen sie einen Vergleichsprozess aus. Dann schaffen sie auch die Möglichkeit, dass sich die Projekte und die Anbieter, vielleicht zuerst intern aber dann auch mit der öffentlichen Hand hinsetzen und dann einmal schauen, in welche Richtung kann es gehen. Aber das ist erst die Grundlage, weil wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, warum soll man da darüber nachdenken."
Einige ExpertInnen sehen es außerdem als aufschlussreich an, Benchmarking auch mit anderen europäischen Ländern durchzuführen, beispielsweise durch die Übernahme von bereits definierten und bewährten Benchmarks. Ziel eines idealtypischen Benchmarking Prozesses kann aus Sicht der ExpertInnen nicht im Erreichen einer größtmöglichen Objektivität gesehen werden, sondern in einer Selbstevaluation, die über eine Selbstreflexion zur einer Verbesserung der Praxis beiträgt.
Die abschließende Überschrift befasst sich mit der Frage, welche Erwartungen und Hoffnungen die interviewten ExpertInnen an die Zukunft von Unterstützter Beschäftigung haben, und welchen Beitrag die Qualitätsdiskussion dazu leisten kann.
Die Dienstleistung der Arbeitsassistenz wird vom BMSG grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Es gibt nach Angelika Fritzer aber sehr wohl Verbesserungsbedarf und Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen. Diese sieht sie unter anderem in der Steigerung der Qualität des Angebots und der Zufriedenheit der Fachkräfte. Eine weitere wichtige Aufgabe für die Zukunft wird der Transfer der Erfahrungen, die im Qualitätsentwicklungsprozess in der Arbeitsassistenz gemacht werden, auf andere Angebote und Maßnahmen sein, die sich derzeit teilweise noch in einer Erprobungsphase befinden. Hier sollen von vornherein Strukturen geschaffen werden, damit Qualität nachvollziehbar und Kriterien zur Beurteilung qualitätsvoller Arbeit vorhanden sind. Für diesen Transfer sieht Angelika Fritzer die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft als wichtige Voraussetzung an. Den Auftrag an die Arbeitsassistenz formuliert sie in ihrem Abschlusssatz[46]:
"Arbeitsassistenz ist eine sehr bewährte, essentielle und gut funktionierende Maßnahme. Es gibt allerdings auch noch Verbesserungspotential. Es geht uns jetzt darum, eine Weiterentwicklung in jenem Bereich zu ermöglichen, der bisher zu wenig Beachtung gefunden hat, nämlich in der Qualität der Dienstleistung. Das ist für mich kurz zusammengefasst, der Auftrag für die Maßnahme Arbeitsassistenz seitens des Fördergebers."
Auch Dieter Schartmann betont zum Abschluss die Wichtigkeit und die Bedeutung der Integrationsfachdienste. Für ihn ist, in Abgrenzung zur Auffassung der Arbeitsmarktverwaltung, ein wichtiger Auftrag an die Zukunft eine "Kultur der Kooperation" zwischen Fördergeber und Trägern zu erreichen, die zu einem konstruktiven Diskussionsprozess beiträgt. Auch an dieser Stelle wird das Abschlusszitat von Dieter Schartmann wiedergeben:
"Also die IFD sind für das Integrationsamt ein integraler Bestanteil unseres Leistungsangebotes, das wir für schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber haben. Wir sind sehr überzeugt von der Arbeit der IFD, deswegen haben wir im Rheinland auch das größte System bundesweit aufgebaut. Wenn man es von den Kosten, betrachtet ist es das umfangreichste, was wir haben und es ist auch das älteste. Das zeigt auch, dass wir mit der Handlungsweise der IFD sehr zufrieden sind. Und das Thema Qualität ist für uns zentral dabei, denn man kann Dienste auch beauftragen und im Grunde genommen laufen lassen. Ich bin sogar sicher, dass manche Dienste froh wären, wenn sie uns nicht sehen würden, sondern nur das Geld bekommen würden. Ich denke aber, das kann es nicht sein, weil ein Dienst kann nur so gut arbeiten wie, er auch eigene Bewertungsmaßstäbe hat. Und das wird meines Erachtens über ein QM System auch sichergestellt. Deswegen ist für uns QM im Grunde genommen das zentrale Steuerungs- und Arbeitsinstrument für die Zusammenarbeit mit den Diensten."
Aus Sicht des Dachverbandes ist eine Aufgabe für die Zukunft die Erweiterung des Dachverbandes und die Zusammenführung mit anderen Maßnahmen der beruflichen Integration. Von Seiten des BMSG ist dazu ein klarer Auftrag formuliert worden. Dazu versucht der Dachverband derzeit einen Diskussions- und Meinungsbildungsprozess unter den Mitgliedern anzuregen, wie eine solche Erweiterung von statten gehen kann und die Interessen der Arbeitsassistenz trotzdem gewahrt bleiben können. Probleme können sich dann in der Namensgebung ergeben, auch deshalb, weil eine der Hauptaufgaben des Dachverbandes derzeit die Positionierung und Bekanntmachung der "Trademark Arbeitsassistenz" ist. Persönlich spricht sich Karin Rossi im Sinne der "Trademark" für eine breitere und für alle Beteiligten übersichtlichere Angebotspalette der Dienstleistung Arbeitsassistenz aus.
Für Jörg Bungart existiert noch eine große Kluft zwischen dem Konzept der Unterstützen Beschäftigung und dem Angebot der Integrationsfachdienste in dem Sinn, dass es nicht völlig offen für alle Menschen unabhängig von Art und Schwere der Behinderung ist. Dabei handelt es sich um einen Personenkreis, der auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz nur schwer zu integrieren ist. Um die Zieldimensionen der Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeit für alle Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, bedarf es neuer Wege und Konzepte einer Gemeinwesenintegration, die nur über eine Öffnung von Werkstätten und Tagesförderstätten erreicht werden könnten. Dies drückt Jörg Bungart auch in dem folgenden Zitat aus:
"Eine gute Qualität ist dann zu erzielen, wenn wir mehr Wahlmöglichkeiten bekommen, eine Öffnung und auch mehr Selbstbestimmung hinkriegen. Das ist dann aber nicht durch den IFD zu erreichen, so wie wir ihn heute haben, und wie er auch im Gesetz steht. Das kann aber auch nicht das Ziel sein. Denn dann hätten wir wieder einen Dienst - der IFD ist ja eh schon gewissermaßen ein Randienst, und das würde dann noch extremer und da glaube ich brauchen wir auch nach wie vor eine gewisse Differenzierung. Sonst hätten wir ja auch gar keine Wahlfreiheit, dass ich zwischen unterschiedlichen Settings auch wählen kann, in denen ich arbeiten kann, und in denen ich leben kann, und die mich dann auch unterstützen. Da wollen wir als BAG-UB natürlich noch eine Weiterentwicklung haben in Richtung Inklusion von Gesellschaft - und das ist sicher noch ein längerer Weg."
Für die Zukunft der Integrationsfachdienste sieht er eine hohe Qualität dann als erreicht an, wenn die Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung, welche zum Großteil mit den Zielgruppen- und Aufgabenbeschreibungen, die im Gesetz formuliert sind, korrelieren, auch dementsprechend umgesetzt werden können. Job Coaching und andere Unterstützungsleistungen am Arbeitsplatz sollen überall dort zur Verfügung stehen, wo sie erforderlich sind. Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten sind für ihn die obersten Qualitätsziele sozialpolitischer Arbeit, aus denen sich alle weiteren Ziele und Kriterien ableiten sollten.
Walter Lackner bringt seinen persönlichen Standpunkt kurz und prägnant zum Ausdruck. Als grundlegende Voraussetzungen um qualitätsvoll arbeiten zu können, braucht es einen auf die Zieldimension der beruflichen Integration ausgerichteten selbstkritischen Ansatz. Qualität solle immer von jenen Menschen beurteilt werden, für welche die Dienstleistung geschaffen wurde.
Rolf Behncke sieht in der Qualitätsdiskussion eine Möglichkeit und ein breites Forum, um gerade unter dem zunehmendem Kostendruck und der Zielgruppendiskussion, die ursprünglichen Anliegen stärker zu vertreten, für deren Umsetzung auch entsprechende Qualitätskriterien erforderlich sind. Sein Standpunkt wird anschaulich in dem folgenden Zitat ausgedrückt:
"Und von daher wäre eine unmittelbare Konsequenz daraus - wenn man bestimmte Unterstützungsleistungen erbringen will, dass ein bestimmtes qualitatives Niveau von Angeboten auch erforderlich ist. Das heißt Menschen mit schweren Behinderungen benötigen ein höheres Maß und ein qualitativ anderes Maß an Unterstützung als andere nicht so stark eingeschränkte Menschen. Also wenn man will, dass es einem großen Kreis oder allen Menschen möglich ist an der Gesellschaft und vor allem am Bereich Arbeit teilzuhaben, dann ist es eben wichtig, dass diese qualitativen Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Wenn man so will, ist die Qualitätsdiskussion im Grunde genommen im ganz großen Maßstab ein Beitrag, dass ein hohes Maß an Teilhabemöglichkeit und Selbstbestimmungsmöglichkeit gewährleistet werden kann. Wenn es nur mehr darum geht nach rein quantitativen Gesichtspunkten irgendwelche kurzfristigen Erfolge zu erzielen, führt das automatisch dazu, dass ein bestimmter Personenkreis ausgegliedert oder ausgeschlossen wird und schränkt deren Möglichkeiten ein. Von daher ist es wichtig auch auf diese anderen Aspekte immer wieder hinzuweisen."
Mögliche Aufgaben für die Zukunft sind für Michael Stadler-Vida, zum einen die Integration der florierenden "Maßnahmenlandschaft" in Österreich. Es existiert derzeit ein höchst komplexes System an unterschiedlichen Maßnahmen, die in ihrer momentanen Form nur schwer zusammenwirken können. Aufschlussreich können dabei Erfahrungen aus anderen Ländern sein, die nicht einen derart spezialisierten Weg gehen. Zum anderen soll möglichst rasch die Frage geklärt werden, was geschieht, wenn die ESF Gelder nicht mehr in dem Ausmaß wie bisher zur Verfügung stehen. Für eine seriöse Planung sowohl von Seiten der Fördergeber als auch der Anbieter ist es von Vorteil, nicht so viel Ressourcen in den Aufbau von Strukturen zu stecken, die nach einigen Jahren vielleicht wieder zusammenschrumpfen müssen. Von Seiten der öffentlichen Hand soll daher die Behindertenmilliarde als Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen langfristig zur Verfügung stehen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Qualität ist für ihn aus legitimatorischen Gründen notwendig. In einer Gesellschaft, die sehr stark auf Arbeit als Wert aufbaut, stellt die Arbeitsassistenz eine zentrale Voraussetzung dar, dass allen Gruppen ein Anteil an der Arbeitswelt zumindest als Option offen steht. Die Beschäftigung mit der Qualität von sozialen Dienstleistungen sollte nicht gemacht werden, weil es gerade ein Modethema darstellt. Dies macht nur Sinn, wenn es etwas mit der konkreten Arbeit und der konkreten Dienstleistung zu tun hat.
Mehrere Visionen und Erwartungen für die Zukunft der Fachdienste und Unterstützter Beschäftigung steuert Stefan Doose bei. Angebote der beruflichen Integration sollen sich langfristig in Richtung Unterstützung in betrieblichen Settings entwickeln. Auch Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke sind durch das SGB IX aufgefordert, ihr Angebot vermehrt in Betriebe auszulagern. Diese Tendenz bezeichnet er als richtig, da vor allem die so genannte "zweite Schwelle" zum Übertritt in den Arbeitsmarkt zunehmend höher wird. Ein wichtiges Anliegen ist ihm Modellprojekte durchzuführen, die aufzeigen unter welchen Bedingungen auch Menschen mit einer schweren Behinderung in der Lage sind in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes zu arbeiten. Dafür wird es arbeitsrechtliche Zwischenlösungen und einen neuen Status von geschützten Arbeitsplätzen wie z.B. dauerhaft ausgelagerte Werkstättenplätze geben müssen. Die derzeitigen Anforderungen an die Produktivität schließen eine große Personengruppe von Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben gänzlich aus. Stefan Doose zeigt kein Verständnis dafür, warum es ohne finanzielle Anreize für die betreffenden Personen dauerhaft möglich ist, Werkstättenplätze zu subventionieren, aber nicht möglich, dieselben Unterstützungsleistungen diesen Personen auch außerhalb von Werkstätten zukommen zu lassen. Es benötigt daher längerfristige Lohnkostensubventionierungen und Unterstützungsleistungen, um es Menschen unabhängig von ihrer Produktivität zu ermöglichen in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes arbeiten zu können. Dazu das folgende Zitat:
"Da sind wir jetzt noch viel weiter weg als wir es am Anfang der Diskussion waren. Natürlich, ist es aber auch weiter möglich. Wir haben bessere gesetzliche Grundlagen als wir sie je hatten. Da stehen die Sachen drin mit einer anderen Zuweisung, mit einer anderen finanziellen Ausstattung, mit anderen Modellprojekten, mit anderen Förderungen. Dass man sagt, das wollen wir politisch - ist das machbar, und ich denke, da gibt man sich in den nächsten Jahren Mühe, wenn man z.B. über Community-Care nachdenkt, wenn man über gemeindenahe Dienstleistungen nachdenkt zur Ermöglichung von Integration über ambulante Assistenzdienste. Dann wird das über kurz oder lang die Tendenz sein solche Unterstützungen in dieser Weise auch zu positionieren. Wenn man das nicht macht, dann wird man halt einen immer wachsenden Werkstattbereich haben der unheimliche Ressourcen bindet, weil Personen auch immer älter werden, und wo man fragt: ist das, was wir als Teilhabeergebnis haben eigentlich das, wofür wir das ganze Geld bezahlen, oder können wir nicht mit dem selben Geld andere Unterstützungssysteme schaffen wo das größere Maß von Integration rauskommt."
Weiteren Entwicklungsbedarf sieht Stefan Doose auch darin, Unterstützungsangebote auch außerhalb von Arbeitsplätzen anzubieten. Gerade Angebote im Freizeitbereich sind in Deutschland häufig an die WfbM angebunden. Menschen, die aus dem einem System rausfallen, fallen daher auch aus dem anderen System heraus, was wiederum zu Einbußen in der Lebensqualität der betroffenen Personen führen kann. Es besteht daher ein großer Bedarf neue Entwicklungen in Anlehnung an die Unterstützte Beschäftigung auch im Freizeitbereich, beispielsweise Freizeit- und Bildungsassistenz, zu realisieren.
Wie die ersten Ergebnisse seiner aktuellen Untersuchung belegen, befindet sich ein Grossteil der von Integrationsfachdiensten vermittelten Personen auf Positionen in denen sie kaum Chancen auf berufliche Weiterentwicklung sehen. Ein Auftrag an die Zukunft der Integrationsfachdienste kann es deshalb sein, nicht nur für Erstvermittlung zur Verfügung zu stehen, sondern sich auch um Weiterbildung und Weitervermittlung der unterstützten ArbeitnehmerInnen in höhere Position zu bemühen. Ziel aller Anstrengungen muss es sein, gute ambulante und betriebsnahe Dienstleistungen zu entwickeln, die sowohl von ArbeitgeberInnen als auch NutzerInnen als hilfreich erlebt werden. Zu diesem Zweck braucht es daher nicht nur Qualitätssicherung sondern auch Qualitätsentwicklung.
Die mit Hilfe der "interpretativen Auswertungsstrategie für leitfadengestützte ExpertInneninterviews" nach Meuser und Nagel (2002) durchgeführte Auswertung der Interviews hatte zum Ziel, den Themenkomplex Qualität und Qualitätsmanagement in Fachdiensten der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung zu reflektieren, sowie die spezifische Sichtweise von unterschiedlichen Prozessbeteiligten im Rahmen der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland darzustellen und zu vergleichen.
In der ersten Überschrift wurde der berufliche Hintergrund und die Erfahrungen der interviewten ExpertInnen mit der leitenden Forschungsthematik dargestellt.
Qualität bleibt eine inhaltslose Kategorie wird sie nicht mit spezifischen normativen Wertvorstellungen verbunden. Dementsprechend befasste sich die zweite Überschrift mit den Einstellungen und Werthaltungen der interviewten ExpertInnen und deren Auswirkung auf die Qualität der Dienstleistung. Die Gewichtung dieses Themenkomplexes weist kaum länderspezifische Unterschiede auf, sie wird aber erwartungsgemäß von den Ebenen der LeiterInnen und der Interessensvertretung in beiden Ländern besonders hervorgehoben. Einen großen Stellenwert spielt dabei die Verortung der Dienstleistung innerhalb des Wertekomplexes der Unterstützten Beschäftigung, aus der sich spezifische Zielsetzungen ergeben, wie vor allem die Zugänglichkeit zu der Dienstleistung für alle arbeitssuchenden und arbeitswilligen Menschen unabhängig von Art und Schwere ihrer Behinderung. Darin werden auch die Vision und der gesellschaftliche Auftrag an die Fachdienste gesehen. Einen dazu nicht gänzlich widersprüchlichen aber doch nutzengeleiteteren Standpunkt, wird von Seiten der FördergeberInnen vertreten, wonach die Dienstleistung grundsätzlich nur für jene Menschen in Frage kommt, bei denen eine rasche Integration in den ersten Arbeitsmarkt möglich erscheint. Die Zielgruppendebatte bleibt ein stark diskutiertes Thema und zieht sich durch fast alle ausgewerteten Überschriften. Auf der normativen Ebene wird dem leitenden Menschenbild - der Mensch als lern- und arbeitsfähiges Subjekt - sowie einer entsprechenden integrativen Grundhaltung gegenüber Menschen mit Behinderung eine große Bedeutung eingeräumt. Von diesem Menschenbild und dieser Grundhaltung leiten sich direkt handlunsgleitende Prinzipien ab, wonach die individuellen Ziele der NutzerInnen Maßstab und Leitlinie für professionelles Handeln darstellen. Von den ExpertInnen wird auch darauf hingewiesen, dass es sehr oft einer Kompromissbildung zwischen Erwartungen und Vorstellungen der NutzerInnen sowie den Ansprüchen und Anforderungen des Arbeitsmarktes bedarf, um dem Ziel der erfolgreichen Integration nachzukommen. Das sich daraus ergebende Spannungsfeld zwischen Unterstützung des Selbstbestimmungsrechtes und der Bevormundung der NutzerInnen sollte von Fachkräften stets im Auge behalten und reflektiert werden.
Die dritte Überschrift befasste sich mit der Bedeutung und dem Einfluss von europäischen und nationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Qualität der Dienstleistung. Aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Vorgaben und Bestimmungen, zeigen sich vor allem in der Bewertung der nationalen Rahmenbedingungen strukturell bedingte Unterschiede. Ein länderübergreifender Konsens besteht dahingehend, dass die Europäische Union mit dem Europäischen Sozial Fonds und seinen Förderprogrammen die zentrale Voraussetzung für die Entstehung und den Ausbau der Dienstleistungen in den beiden Ländern dargestellt hat. Einfluss auf die Qualitätsentwicklung wurde von Seiten der EU vor allem durch die Möglichkeit des europaweiten thematischen Austausches, der auch zur Gründung der EUSE beigetragen hat, sowie durch konkrete Projekte wie etwa dem QUIP Projekt ausgeübt. Insgesamt stärker wahrgenommen, wird in Deutschland der Einfluss der europäischen Rahmenbedingungen und Vorgaben auf die nationale Gesetzgebung. Gewarnt wurde in beiden Ländern von Seiten der LeiterInnen vor einer drohenden Qualitätsverschlechterung im Zuge von Ausschreibungen durch EU bzw. nationale Vergabegesetze, sofern in diesen ausschließlich preisliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Weiters kritisiert wird der hohe administrative Aufwand von grundsätzlich positiven Richtlinien und Vorgaben, wie beispielsweise dem Gender Mainstreaming. In Deutschland besteht Einigkeit, dass das SGB IX die rechtliche und finanzielle Legitimation für die Einrichtung der Dienste darstellt. Das im Jahr 2004 novellierte SGB IX wird grundsätzlich als progressives Gesetz aufgefasst. Es besteht allerdings ein großer Widerspruch zwischen den im Gesetz formulierten Ansprüchen und dem in Fachdiensten, vor allem aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen, tatsächlich Realisierten. Probleme werden vor allem in der Übernahme der Strukturverantwortung für den Vermittlungsbereich der IFD durch die Arbeitsmarktverwaltung gesehen, durch die es zu einer dramatischen Zielgruppenverschiebung gekommen ist. Im Qualitätsverständnis der Arbeitsmarktverwaltung war die Anzahl der Vermittlungen das einzige Indiz für die Qualität der Dienste. In Österreich üben vor allem das Behinderteneinstellungsgesetz sowie die "Richtlinien zur Förderung begleitender Hilfen" einen Einfluss auf die Qualität der Dienste aus. Sehr emotional wird in Österreich die Debatte um die Erhöhung der Vermittlungszahlen geführt. Außerdem wird von Seiten der LeiterInnen die zum Teil mangelnde und oft nicht transparente Kommunikation mit den Fördergebern kritisiert. Negativen Einfluss üben vor allem die Notwendigkeit des Erwerbs eines Feststellungsbescheids, sowie der damit verbundene Kündigungsschutz, die Zersplitterung des Angebots der Arbeitsassistenz in zahlreiche eigenständige Maßnahmen und die sich daraus ergebende unklare Abgrenzung der einzelnen Maßnahmen zueinander aus. Bereits im Zuge einer Strukturreform seit 01.01.2005 realisierte Veränderungen in Deutschland sind, die Übergabe der Strukturverantwortung für beide Bereich des IFD in die Trägerschaft der Integrationsämter, die Einführung einer neuen Finanzierungsstruktur sowie die Vorschreibung von KASSYS als zentrales Instrument zur Qualitätssicherung für die Zusammenarbeit mit den Diensten. Weitere offene Forderungen betreffen insbesondere die Zusammenführung der Bereiche Vermittlung und Begleitung, eine stärkere Umsetzung und Finanzierung der Forderungen im SGB IX sowie eine verstärkte integrative Ausrichtung der WfbMs. Für Österreich sieht das BMSG keinen Bedarf an einer Änderung der Gesetzeslage. Ein zu lösendes Problem ist vor allem die unklare langfristige Finanzierungssituation. Geplant ist eine wissenschaftliche Begleituntersuchung um erweiterte Qualitätskriterien für die Arbeitsassistenz zu erstellen, die auch Einfluss auf die Erfolgsvorgaben haben könnten. Weitere Forderungen betreffen die Erweiterung des Dachverbandes Arbeitsassistenz um den Einschluss aller relevanten Maßnahmen der beruflichen Integration, die Überarbeitung des Behinderteneinstellungsgesetzes vor allem bezüglich des Kündigungsschutzes sowie mehr Kontinuität und Verlässlichkeit bei Förderungen durch das Bundessozialamt.
Die vierte Überschrift behandelte die Frage welche Hintergründe und Motive für die verstärkte Qualitätsdiskussion in dem Bereich der beruflichen Integration verantwortlich waren bzw. sind. Auf der Motivebene wurde zwischen politisch-ökonomischen und fachlichen Motiven unterschieden, wobei sich länderübergreifend ähnliche Argumentationsmuster zeigen. Eine erstmalige explizite Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgte in Deutschland anlässlich des MUQ Projektes. Für die aktuelle Diskussion ausschlaggebend waren allerdings, die durch das einseitige Qualitätsverständnis der Arbeitsmarktverwaltung ausgelöste Zielgruppenverschiebung sowie die mangelnde Nachhaltigkeit in den Vermittlungen. In Österreich nahm die Qualitätsdiskussion in der Debatte um die Erhöhung der Vermittlungszahlen ihren Ausgang, wodurch vor allem die Anbieter die Forderung stellten, auch qualitative Aspekte in der Bewertung der Dienste zu berücksichtigen. Poltisch-ökonomische Motive konnten vor allem auf der Seite der Fördergeber identifiziert werden, dazu zählt insbesondere die Verknappung finanzieller Ressourcen und dadurch ausgelöst eine gezielte Steuerung sowie ein Legitimationsbedarf der effizienten Verteilung öffentlicher Mittel. Von Seite der LeiterInnen und den Interessensvertretungen dient die Qualitätsdiskussion in erster Linie dazu, über die Beschreibung fachlicher Qualitätsmerkmale einer einseitig ökonomisch geführten Debatte vorzubeugen, und über die Positionierung der Inhalte die eigene Arbeitsweise weiterzuentwickeln und zu legitimieren. Ein weiteres fachliches Motiv ist die durch die Institutionalisierung des Angebots bedingte Notwendigkeit, die Dienstleistung inhaltlich qualitativ zu definieren und von anderen Maßnahmen abzugrenzen. Als Soll Forderung für jedwede Qualitätsdiskussion wurde aufgestellt, dass sie nur dann Sinn macht, wenn eine verbessere Dienstleistungsqualität auch dazu führt, das Leben der unterstützten Personen zu verbessern.
Die fünfte Überschrift befasste sich mit dem spezifischen Qualitätsverständnis der ExpertInnen, und stellte exemplarische Qualitätskriterien entlang der Qualitätsparameter der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität auf. Insbesondere das Qualitätsverständnis korreliert in den meisten Punkten mit den in der zweiten Überschrift behandelten Einstellungen und Werthaltungen. Zentrale Termini im Qualitätsverständnis der ExpertInnen sind vor allem Selbstbestimmung und Wahlfreiheit, KundInnenorientierung sowie Know-how und Leidenschaft. Ohne konkrete Qualitätskriterien an dieser Stelle zu wiederholen, kann in der Auswertung folgende zusammenfassende Schlussfolgerungen bezüglich der Qualitätskriterien gezogen werden: Die Strukturqualität eines Fachdienstes, so kann subsumiert werden, wird maßgeblich durch die Träger-, die Finanzierungs- und die Zuweisungsstrukturen bestimmt. Für die Prozessqualität ist es als Minimalanforderung notwendig für alle Phasen des Integrationsprozesses Leistungsanforderungen und -beschreibungen zu formulieren. Bei der Ergebnisqualität gilt der Konsens, dass Bedarf an der Entwicklung weiterführender Indikatoren besteht, um qualitative Aspekte in der Fachdienstarbeit zu berücksichtigen.
Ziel der sechsten Überschrift war es die Frage zu beantworten worin die ExpertInnen spezifische Stärken und Schwächen der Dienstleistung sehen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Abgrenzung der Dienstleistung gegenüber anderen Maßnahmen sowie auf die Wahrnehmung von fachlichen und strukturellen Grenzen der Fachdienstarbeit gelegt. Als besondere Stärken werden länderübergreifend insbesondere die individuelle Orientierung und die Flexibilität, das Schnittstellenübergreifende Arbeiten und die Vernetzung sowie die Betriebsnähe und das Annehmen um die Bedürfnisse der Betriebe identifiziert. Bei den Schwächen werden einerseits fachliche Aspekte ausgemacht, andererseits auch Grenzen in den übergeordneten Rahmenbedingungen verortet, die sich der Beeinflussbarkeit von Fachdiensten weitgehend entziehen und eine Stelle aufzeigen, an der vor allem Gesetz- und Fördergeber verstärkt aufgerufen sind, die Rahmenbedingungen optimal auszugestalten. Zu den Schwächen auf fachlicher Ebene wird durchgehend die Betriebsarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Ermangelung entsprechender Ressourcen, die oft nicht ausreichende Einbeziehung der wichtigsten Akteure (vor allem NutzerInnen und Betriebe) sowie die, insbesondere bei neuen Fachdiensten, fehlende Identifikation mit dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung genannt. Auf politischer Ebene liegen die Schwächen, bezogen auf Deutschland, vor allem im stark vermittlungsorientierten Vergütungssystem, und länderübergreifend in einer fehlenden Verankerung von Qualitätskriterien, in mangelnden finanziellen Ressourcen, im Fehlen ausreichender betrieblicher Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote sowie in einer durch "überbetriebene" Vorgaben bedingten Aushöhlung der Intention der Dienstleistung.
Die siebte Überschrift behandelte den Themenkomplex der Nachhaltigkeit und untersuchte die Fragen, welche Entwicklungen sich in den letzten Jahren in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Vermittlungen in den beiden Ländern ergeben haben, welche Kriterien für eine Nachhaltigkeit von Bedeutung sind sowie welche Veränderungen aus Sicht der ExpertInnen notwendig und sinnvoll erscheinen. Die Situation in Deutschland, so lässt sich zusammenfassen, stellt sich in Bezug auf die Zielgruppenverschiebung dramatischer dar als in Österreich. Bedingt durch das restriktive Vergütungssystem der Arbeitsmarktverwaltung und der negativen Wirkung der "50.000 Jobs Kampagne", können vor allem die neu hinzugekommenen Dienste die Zielgruppen der WerkstättenmitarbeiterInnen und SonderschulabgängerInnen nicht mehr erreichen. Für Österreich liegen derzeit noch keine empirisch gesicherten Ergebnisse vor, was auch darin liegt, dass die Monitoringdaten des Bundesrechenzentrums bislang nicht zur Auswertung freigegeben sind. In den folglich auf Beobachtungen und Mutmaßungen basierenden Meinungen der ExpertInnen, kann ein Widerspruch zwischen der Position des Fördergebers und der übrigen ExpertInnen ausgemacht werden. Während das BMSG nicht davon ausgeht, dass ein "Creaming Effekt" in Österreich eingetreten ist, sprechen die anderen Ebenen von einer schrittweisen Verschiebung der Zielgruppe bedingt durch den Vermittlungsdruck. Außerdem wird die Gruppe der so genannten "Systemerhalter" thematisiert, also jener Personen die ihren Arbeitsplatz länger als die drei monatige Behaltepflicht halten, anschließend aber ständig aufs Neue in das System zurück geworfen werden. Bei den einzelnen Kriterien, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden, wird gemäß der Differenzierung von Doose (2004a) zwischen Unterstützungssystembedingten und Persönlichkeitsbedingten Faktoren unterschieden. Die vornehmlich genannten Unterstützungssystembedingten Kriterien, beinhalten sowohl Aspekte der Fachdienstarbeit als auch übergeordnete gesetzliche Rahmenbedingungen. Neben den durch die Strukturreform bereits eingeleiteten Veränderungen in Deutschland, fordern die ExpertInnen von den Gesetzgebern Übertrittsquoten für bestimmte Zielgruppen im Förderungsrecht zu definieren sowie dafür finanzielle Anreize zu schaffen, die Zuweisungspraxis der Dienste im Sinne eines Rechtsanspruches der Person zu reformieren sowie politisch initiierte Öffnungsversuche in für die Fachdienste bislang kaum zugänglichen Institutionen (z.B. WfbM) einzuleiten. In Österreich soll es zu einer Erweiterung der als Erfolg definierten Behaltepflicht kommen. Des Weiteren müssen Indikatoren gefunden werden, um eine Gewichtung und Differenzierung der Vermittlungszahlen durchführen zu können.
Die Einschätzung und Bewertung einzelner Qualitätsmanagementsysteme war Thema der achten Überschrift. Dabei wurden die Fragen behandelt, ob es aus Sicht der ExpertInnen in Fachdiensten von Vorteil ist, speziell für diesen Arbeitsbereich entwickelte Systeme zu verwenden, wie die einzelnen Systeme auf ihre Anwendbarkeit in Fachdiensten eingeschätzt werden, welche Probleme sich bei der Anwendung von QM-Systemen ergeben können, welche Kriterien für Systeme erforderlich sind um erfolgreich implementiert zu werden sowie welche Veränderungen in Bezug auf die einzelnen Systeme sowie übergeordneter Rahmenbedingungen notwendig erscheinen. Die Notwendigkeit speziell für diesen Arbeitsbereich entwickelte Systeme zu verwenden wird grundsätzlich von den deutschen ExpertInnen stärker hervorgehoben. Einigkeit besteht dahingehend, dass jedes QM-System zumindest auf die Spezifika dieses Arbeitsbereiches eingehen muss. Dabei erscheinen vor allem jene Systeme geeignet, die einen starken Fokus auf die Bereiche KundInnen- und MitarbeiterInnenorientierung legen. Insbesondere die Übertragbarkeit der DIN-ISO Normen wurde durchwegs als schwierig beschrieben. Nutzen dieses Systems wird vor allem in der Beschreibung der Prozessabläufe sowie in der Weitergabe und Einschulung neuer MitarbeiterInnen gesehen. Grundsätzlich positiver wird wegen seiner Orientierung an der TQM Philosophie das EFQM Modell bewertet. Einen breiten Raum in der Auswertung dieser Überschrift nimmt die Unterscheidung und Bewertung der im Rahmen dieser Diplomarbeit ausführlich beschriebenen QM-Systeme und Instrumente MUQ, KASSYS und QUIP ein. Probleme bei der Umsetzung und Anwendung liegen insbesondere in begrenzten zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen, zudem benötigen Fachdienste professionelle Begleitung bei der Implementierung. In der umfangreichen Kriterienliste erhalten der für die Implementierung und Anwendung notwendige Zeitaufwand sowie die Abstimmung der Systeme auf die Spezifika der Arbeit die meisten Nennungen. In Österreich wird den Anbietern von Seiten des BMSG zukünftig die Verwendung eines anerkannten QM-Systems vorgeschrieben. Es wird aber eine Frage der Freiwilligkeit bleiben, welche Systeme die einzelnen Träger verwenden. Bezüglich methodischer Weiterentwicklungen sollten die bereits entwickelten als methodischer Grundstock zusammengeführt werden. Dadurch wäre eine brauchbare Arbeitsgrundlage geschaffen, von der ausgehend nach ausreichender Anwendungszeit geprüft werden könnte, in welchen Bereichen Weiterentwicklung notwendig ist.
Die neunte Überschrift behandelte die Fragen wie die ExpertInnen Benchmarking als Instrument zur Qualitätsverbesserung in Fachdiensten der beruflichen Integration einschätzen, und wie ein idealtypischer Benchmarkingprozess aussehen könnte. Es kann festgehalten werden, dass trotz unterschiedlicher Erwartungen und Ansprüche an ein Benchmarking Verfahren von Seiten der Fördergeber und der anderen ExpertInnenebenen, grundsätzlich Konsens besteht, dass bei klaren Ausgangsbedingungen und Zielvorstellungen, Benchmarking als ein brauchbares Verfahren angesehen werden kann um zu einer Qualitätsverbesserung in Fachdiensten beitragen zu können. Ein idealtypisches Verfahren müsse sich als mehrstufiger Prozess erweisen, in dem nach Abschluss der quantitativen Datenerhebung ein qualitativer Diskussionsprozess eingeleitet wird.
Die zehnte und letzte Überschrift fragte nach den persönlichen Erwartungen und Hoffnungen der ExpertInnen für die Zukunft von Unterstützter Beschäftigung sowie nach dem Beitrag den die Qualitätsdiskussion dazu leisten kann.
[35] Das Pendant in Österreich wäre in diesem Fall das Bundessozialamt mit seinen föderal agierenden Landesstellen.
[36] Die Region Rheinland verfügt über das am dichtesten ausgebaute Netz an Integrationsfachdiensten im deutschen Bundesgebiet.
[37] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
[38] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
[39] An dieser Stelle wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer ein Zitat nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
[40] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
[41] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
[42] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
[43] An dieser Stelle wurde ein Zitat von Fr. Dr. Angelika Fritzer nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
[44] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
[45] An dieser Stelle wurde ein Zitat von Fr. Dr. Angelika Fritzer nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
[46] Das folgende Zitat wurde von Fr. Dr. Angelika Fritzer überarbeitet.
Die vorliegende Diplomarbeit hatte zur Absicht, das Thema Qualität und Qualitätsmanagement in Fachdiensten der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung in seiner Vielfalt und inhaltlichen Breite einem interessierten Publikum darzustellen. An dieser Stelle werden nun abschließend Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsvorhaben definiert, und einige kritische Anmerkungen zur aktuellen Lage von Menschen mit einer so genannten geistigen bzw. Mehrfachbehinderung aufgezeigt.
Bevor ich allerdings auf konkrete Vorschläge für zukünftige Forschungsvorhaben eingehe, möchte ich eine aus meiner Sicht für die Zukunft zentrale Fragestellung voranstellen, und zwar, wie und in welchen Bereichen eine zielführende Kooperation und ein optimaler Transfer der Ergebnisse zwischen Praxis und Forschung erreicht werden kann und welche Rahmenbedingungen dafür erforderlich sind. Die Praxis kann nicht ohne die Theorie, sowie die Theorie nicht ohne die Praxis existieren. In vielen Fällen herrscht allerdings auf beiden Seiten noch viel Ablehnung und Skepsis, was all zu häufig die Vergeudung wertvoller Ressourcen zur Folge hat. Auch im Rahmen der Interviews stellte ich den ExpertInnen zum Abschluss sowohl diese Frage, als auch die Frage nach Bereichen für weiterführende Forschung. Das Verhältnis Praxis - Forschung wird dabei von den ExpertInnen in folgender Weise thematisiert. Praktisch arbeitende Institutionen verfügen, demnach oft nicht über die fachlichen und personellen Ressourcen um interessierende Fragestellungen wissenschaftlich betrachten und analysieren zu können, dabei kann die Forschung sowohl im Sinne der Nachhaltigkeit, der Fundierung, der Legitimation, der strategisch-taktischen Ausrichtung sowie insbesondere der Weiterentwicklung professioneller Arbeit Unterstützung leisten. Von der Forschung wird allerdings auch verlangt, sich mit Respekt und Sensibilität in die Praxis zu begeben, Situationen wahrzunehmen und zu berücksichtigen, dass es in einem derart komplexen Arbeitsfeld nicht immer möglich ist, allgemeingültige Schlüsse zu ziehen. Die Praxis kann in vielen Fällen eine Art Korrektivfunktion für wissenschaftliche Produktionen übernehmen, indem es sie im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit und Praxisnähe überprüft. Gerade im Hinblick auf eine ressourcenschonende Arbeitsweise wird von beiden Seiten die Bedeutung des "Lernens" und des "Transfers" als besonders zentral gesehen. An dieser Stelle müsste ein Umdenken und ein Einleiten von Reformen vor allem im Rahmen der Struktur der Projektförderungs- sowie der Forschungslandschaft selbst erfolgen. Auch wenn mittlerweile Kriterien wie Nachhaltigkeit, oder Verbreitung und Vernetzung zu Ausschreibungsvoraussetzungen gerade von Projekten innerhalb der EU Gemeinschaftsinitiativen (z.B. EQUAL oder LEONARDO) zählen, so sind Forschungsprojekte immer noch so konzipiert, dass nach der Projektlaufzeit keine Ressourcen für Verbreitungsaktivitäten mehr zur Verfügung stehen. Es existiert mittlerweile ein unglaubliches Potential und Reservoir an durchdachten und erfolgreichen Konzepten, Methoden und Materialien die zum Großteil in Onlinedatenbanken und -archiven ungenutzt dahinvegetieren. Ohne die Bedeutung und die Notwendigkeit an weiterer Forschung und an der Entwicklung neuer Methoden, Konzepte und Materialien an dieser Stelle zu schmälern, so ist es doch unverständlich, dass immer wieder Energie und Ressourcen in neue Projekte fließen, und sich nicht der Aufgabe angenommen wird, bestehende Modelle zu sichten und neue Methoden des Transfers dieser Ergebnisse zu erproben. An dieser Stelle, so argumentiert Michael Stadler-Vida benötigt es wahrscheinlich einem eigenen Berufsbild, aber auch der Möglichkeit von EU - Ausschreibungen, die Personen ermöglichen die vorhandenen Methoden und Produkte zu sichten und beispielsweise im Rahmen von Workshops oder Kongressen strukturiert für eine Implementierung in den Mainstream und zur Unterstützung der Praxis vorzubereiten und zu begleiten. Der auf diesem Wege gewonnene Effekt stünde, meiner Auffassung nach, in einem äußerst effizienten Verhältnis zu den dafür benötigten Ressourcen.
Auf obige Argumentation bedacht nehmend und zum Teil anknüpfend, wird ein weiterer Forschungsbedarf exemplarisch in folgenden Bereichen verortet:
-
Wie im Rahmen meiner Ausführungen an anderer Stelle bereits ausgeführt, arbeiten vor allem größere Träger und Anbieter der Dienstleistung Arbeitsassistenz bzw. Integrationsfachdienst bereits mit anerkannten Qualitätsmanagementkonzepten und -systemen. Gerade kleinere Anbieter sind mit der Aufgabe der Einführung eines derartigen Systems, oft sogar schon mit der Anwendung von einzelnen Instrumenten wie etwa dem QUIP Evaluationshandbuch, aus Gründen finanzieller und personeller Engpässe, überfordert. Eine vor allem für Diplomarbeiten spannende und beidseitig lohnende Aufgabe wäre es, beispielsweise einen Fachdienst bei der Anwendung und Implementierung eines, der im Rahmen dieser Diplomarbeit beschriebenen Konzepte oder Methoden, zu unterstützen sowie diesen Prozess systematisch zu evaluieren. Eventuell wäre bei einem solchen Vorhaben auch eine Kooperation mit StudentInnen der Wirtschaftswissenschaften zielführend.
-
Im Hinblick auf methodische Weiterentwicklungen bestehender Qualitätsmanagementsysteme und Qualitätskriterien, wird weniger Bedarf in der Entwicklung neuer Ansätze ausgemacht, als vielmehr in der gezielten Sichtung und Zusammenführung dieser Modelle zur Schaffung einer tragfähigen Arbeitsgrundlage für Fachdienste der beruflichen Integration. Methodische Weiterentwicklungen benötigt es allerdings in Bereichen der Profilerhebung, Diagnostik und Assessment. Die hier derzeit existierenden Systeme werden als zu umfangreich aufgefasst. In der dahinter stehenden Grundhaltung, möglichst viel von einem Menschen erfassen zu wollen, verortet Jörg Bungart ein verstecktes Helfersyndrom. Seiner Ansicht nach müssten diese Systeme unter dem Aspekt der Reduzierung weiterentwickelt werden. Weiterer Forschungsbedarf wird von Rolf Behncke auch in der Weiterentwicklung methodisch didaktischer Instrumente im Bereich des Trainings von Schlüsselqualifikationen gesehen.
-
Auf Deutschland bezogen halten es die ExpertInnen auch im Sinne eines professionellen Ergebnistransfers für notwendig, die Implementierung und Einführung von KASSYS im Rahmen einer Langzeituntersuchung zu begleiten und zu evaluieren. Weiters wird auch eine bundesweite Evaluation der unterschiedlichen Vorgehens- und Arbeitsweisen der Integrationsfachdienste im Sinne eines Best-Practice Vergleichs zum jetzigen Zeitpunkt als zweckmäßig erachtet. Eine solche Untersuchung sollte vor allem auch gezielt auf die NutzerInnenzufriedenheit eingehen sowie die Qualität des Netzwerkssystems untersuchen, um Hinweise für einen möglicherweise notwendigen strukturellen Reformbedarf sichtbar zu machen.
-
In Österreich kann ebenso ein Bedarf an einer großflächig durchgeführten bundesweiten quantitativen und qualitativen Untersuchung und Evaluation der Dienstleistung Arbeitsassistenz ausgemacht werden. Die bislang einzige österreichweite Untersuchung (Blumberger 1999) datiert sechs Jahre zurück, ein Großteil der in dieser Studie erhobenen Daten sogar schon über acht Jahre. Angesichts des rasanten und flächendeckenden Ausbaus der Arbeitsassistenz, vor allem seit Beginn der Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung ("Behindertenmilliarde") und der Einführung der Arbeitsassistenz für Jugendliche im Jahre 2001 müssen sämtliche Daten und Schlussfolgerungen dieser Studie als bereits überholt angesehen werden. Um umfassende Hinweise über Stärken und Schwächen des derzeitigen Unterstützungssystems zu erhalten sollte auch die Kooperation und Vernetzung mit anderen bestehenden Maßnahmen und Angeboten der beruflichen Integration in solch eine Untersuchung einbezogen werden. Darüber hinaus wäre es sinnvoll Lösungsansätze zu finden, wie die derzeitigen Unterstützungsressourcen angesichts sich abzeichnender finanzieller Engpässe (Wegfall der ESF Mittel ab dem Jahr 2006), möglichst ohne Einbußen für den zu unterstützenden Personenkreis, effizienter genutzt werden könnten.
-
Sowohl von ExpertInnen aus Österreich als auch Deutschland wird die Durchführung eines breit angelegten Benchmarking als aufschlussreiches Forschungsvorhaben angesehen, welches zu einer Qualitätsverbesserung in Fachdiensten einen Beitrag leisten könnte. Ein solches Vorhaben dürfte sich allerdings nicht auf den Vergleich statistischer Eckdaten beschränken, sondern müsste nach dem Vorbild der Untersuchung der Bertelsmann Stiftung (vgl. Hackenberg 2003) über ein strukturiertes qualitatives Benchmarking erfolgreiche Praxisansätze identifizieren und - über die Vermittlungsquote hinausgehende - Best-Practice Kriterien aufstellen. Solcherart gewonnene Kriterien könnten in einem weiteren Schritt dermaßen aufbereitet und vor allem operationalisiert werden, dass sie als Indikatoren für eine umfassendere Bewertung der Qualität der Dienste herangezogen werden könnten.
-
Es existieren europaweit nur wenige Forschungen und Erkenntnisse über die längerfristige Entwicklung der von Fachdiensten angebahnten Integrationsprozesse. Eine Ausnahme stellt hier die mehrfach angeführte Dissertationsstudie von Doose (2004b) dar. Vor allem in Österreich gibt es keine empirisch abgesicherten Studien die über die Nachhaltigkeit der von der Arbeitsassistenz vermittelten Personen Aufschluss geben würde. Eine solche Untersuchung könnte nicht nur objektiv feststellen, ob in Österreich ein "Creaming" Effekt bereits eingetreten ist bzw. sich abzeichnet, sondern darüber hinaus auch Kriterien für die (Um-)Strukturierung des Unterstützungssystems zu benennen, die für eine nachhaltige Vermittlung von Vorteil sind.
Zum Abschluss möchte ich noch einige kritische persönliche Anmerkungen zur Lage von Menschen mit einer so genannten geistigen bzw. Mehrfachbehinderungen machen. Ich schließe mich an dieser Stelle der Aussage von Stefan Doose an, der meint, dass wir in Bezug auf Teilhabemöglichkeiten für diesen Personenkreis weiter entfernt sind als wir es am Anfang der Diskussion waren! Besonders im Zuge einer Debatte um die Qualität von Unterstützungsangeboten für Menschen mit einer Behinderung fehlt es all zu oft an der notwendigen Transparenz und Ehrlichkeit. Wird über Qualität in der Unterstützten Beschäftigung gesprochen wird, so sollte man sich darüber im klaren sein, dass genauso wie Qualität, schon von ihrer Definition her, nie als wertfreie Kategorie gesehen werden kann, auch das Konzept der Unterstützten Beschäftigung ein Wertemodell vorgibt. Ich beabsichtige an dieser Stelle nicht irgendwelche Dogmen oder Ideologien zu vertreten, ich halte persönlich sehr wenig von "IntegrationsfundamentalistInnen", nur gilt es sich wieder bewusst zu werden, aus welchem Grund und für welche Zielgruppe derartige Unterstützungsangebote eigentlich geschaffen wurden. Und zwar um Personen, die einen hohen Bedarf an arbeitsbegleitender Unterstützung bzw. Assistenz benötigen, Teilhabe an der in unserer Gesellschaft sehr bedeutsamen Arbeitswelt zu ermöglichen. Zwar wird vielerorts beteuert, dass niemand und vor allem nicht Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung von den neu geschaffenen Unterstützungsangeboten ausgeschlossen werden, aber gleichzeitig stehen eben jene Personen, bei denen eine "rasche Integration" auf den ersten Blick nicht wahrscheinlich erscheint sehr oft vor verschlossenen Türen. Anstatt Personen das Ausmaß an arbeitsbegleitender Unterstützung bzw. Assistenz zur Verfügung zu stellen, dass sie für eine erfolgreiche berufliche und soziale Integration benötigen, durchlaufen viele Jugendliche und junge Erwachsene zu oft so genannte "Maßnahmenkarrieren", die zum Teil weit mehr finanzielle Ressourcen aufbrauchen als individualisierte Lösungen, bis sie sich in zumeist Lebzeit subventionierten beschäftigungstherapeutischen Einrichtungen bzw. Werkstätten für behinderte Menschen wieder finden. Erfolgreiche und innovative Modelle der beruflichen und sozialen Integration in eben jenen Einrichtungen können wohl in beiden Ländern an wenigen Händen abgezählt werden. Die vom Prinzip her sinnvolle Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Arbeitsmarktservice (bzw. Bundesagentur für Arbeit) führt in vielen Fällen zu einer fälschlichen "Verobjektivierung" von individuellen Problemlagen. Menschen werden dabei lediglich als Posten in begrenzten Budgets gesehen und von einem Kompetenzbereich in den anderen geschoben. Der Volkswirtschaftliche Nutzen für den/die SteuerzahlerIn bleibt dagegen verschwindend gering bis nicht vorhanden. Nun droht, wie weiter oben angeführt angesichts sich abzeichnender finanzieller Einbußen, der Druck und der Konkurrenzkampf auf Anbieter der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung noch stärker zu werden. Wird dies zu einer noch stärkeren Quotenorientierung führen, erwartet uns in Österreich wohl eine ähnlich dramatische Entwicklung wie in Deutschland, wo eben jener Personenkreis, mit wenigen Ausnahmen, gänzlich als Zielgruppe von Fachdiensten weggebrochen ist. In Deutschland wurde dies zumindest erkannt und man hat versucht durch die seit 01.01.2005 eingetretene Strukturreform die begangenen Fehler rückgängig zu machen und zukünftig zu vermeiden. Um wieder auf das vielfach angesprochene "Lernen" zurückzukommen, sollten wir in Österreich unsere "Lehren" daraus ziehen. Was wir, meines Erachtens brauchen, ist eine ehrliche, offene und transparente Diskussion über die eigentliche Ausgangsfrage unter Einbeziehung und Einbindung der Betroffenen Personen selbst: Wollen wir Teilhabe für Menschen mit einer so genannten geistigen bzw. Mehrfachbehinderung, unter welchen Bedingungen, mit welchen Unterstützungsinstrumentarien und vor allem mit welchen finanziellen Mitteln. Das dieses Anliegen nicht nur von Fachdiensten der beruflichen Integration alleine gelöst werden kann, liegt auf der Hand, sondern es benötigt einen, von den individuellen Zielen und Wünschen der NutzerInnen ausgehende Umstrukturierung der gesamten Unterstützungslandschaft in Bundes- und Länderkompetenz, insbesonders neuer Ansätze und Konzepte in beschäftigungstherapeutischen Einrichtungen und Werkstätten für behinderte Menschen. Wird diese Diskussion nicht geführt, so ist nach Stefan Doose davon auszugehen, dass wir gerade angesichts der demographischen Entwicklung mittel- bis langfristig einen immer wachsenden Bereich des Ersatzarbeitsmarktes für eben jenen Personenkreis haben werden, der unheimliche Ressourcen bindet, und wobei man sich fragt, ob das Teilhabeergebnis das auf diesem Weg erreicht wurde nicht weitaus größer sein könnte, wenn das selbe Geld in andere Unterstützungssysteme fließt bei dem das größere Maß an Integration und persönlicher Zufriedenheit herauskommt. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass wenn über Qualitätsmanagement angedachte Reformen wie KundInnenorientierung nicht nur leere Hülsen bleiben sollen, die Qualitätsdiskussion aktiv dazu genützt werden muss, um eben jene Anliegen wieder stärker zu vertreten.
Das hier vorliegende Literaturverzeichnis ist sowohl als Literaturverzeichnis als auch als Bibliographie zu sehen. Alle im Rahmen dieser Diplomarbeit zitierten Quellen sind mit einem "*" markiert:
ABIF; KMU - Forschung; SORA (2004): Maßnahmen für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen - Evaluierung, Analyse, Zukunftsperspektiven. Wien, herausgegeben vom BMSG*
Adelfinger, Theresia (2003): "Aktion Berufsplan" - Persönliche Zukunftsplanung und Integrationsbegeleitung im Übergang Schule-Beruf. In Impulse Nr. 28. 12/2003. S.17-19*
Afflerbach, Thorsten (1998): Berufsbezogene Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen - Aktivitäten des Europarates. In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag, S.323-336*
Albrecht, Martin (1998): Effizienz in der beruflichen Rehabilitation - Ergebnisse einer ILO Vergleichsstudie. In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag, S.359-363
Argyris, Chris; Schön, Donald (2002): Die Lernende Organisation: Grundlagen, Methoden, Praxis. Stuttgart, Klett - Cotta Verlag, *
Badelt, Christoph (Hrsg.) (2002): Handbuch der Nonprofit Organisationen - Strukturen und Management, 3. Auflage. Stuttgart, Schäffer-Pöschel Verlag, *
Badelt, Christoph; Österle, August (2001): Grundzüge der Sozialpolitik, Spezieller Teil - Sozialpolitik in Österreich. Wien, Manz Verlag*
Badelt, Christoph (Hrsg.) (1992): Geschütze Arbeit: Alternative Beschäftigungsformen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Menschen. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag; *
Badelt, Christoph; Österle, August (1992): "Supported Employment" - Erfahrungen mit einem österreichischen Modell zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Menschen. In Badelt, Christoph (Hrsg.): Geschütze Arbeit: Alternative Beschäftigungsformen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Menschen. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag, S. 81-150*
Bahlke, Susanne (2001): Behinderung im Erwerbsleben. Idstein, Schulz - Kircher Verlag*
Barloschky, Katja (2000): Die Zukunft der Arbeit. In Impulse Nr.15/2000. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp15-00-zukunft.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Bartz, Elke (1999): Der Stellenwert von Arbeitsassistenz für Menschen mit Behinderungen. In Impulse Nr.11/1999. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp11-99-stellenwert.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Barlsen, Jörg (2001a) : Unterstützte Beschäftigung und Integrationsfachdienste im Spiegel empirischer Forschung. In Barlsen, Jörg; Hohmeier; Jürgen (Hrsg.): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S.39-63*
Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001b): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben *
Barlsen, Jörg; Bungart, Jörg; Hohmeier, Jürgen (1999): Integrationsbegleitung in Arbeit und Beruf von Menschen mit Lern- oder geistiger Behinderung. In Impulse Nr.12/1999. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp12-99-untersuchung.html*(Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (2003): Bericht der Bundesregierung zur Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen 2003. Im Internet unter URL:http://www.sgb-ix umsetzen.de/index.php/nav/tpc/nid/1/aid/354
Beck, Iris (1999): Der "Kunde", die Qualität und der "Wettbewerb": Zum Begriffschaos in der Qualitätsdebatte. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold, S.35-S.47*
Behncke, Rolf; Lilienthal, Ilja (2004): Qualifizierung am Arbeitsplatz. In Impulse Nr.30 08/2004, S.3-7, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de
Behncke, Rolf (2003): Selbstbestimmung und Teilhabe am Arbeitsleben - Aktueller Stand, Zukunftsperspektiven, Innovative Modelle. In Impulse Nr.25 03/2003, S.3-5, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de
Behncke, Rolf (2001): Die Akquisition von Arbeitsplätzen im Rahmen der Unterstützen Beschäftigung. In Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 81-110*
Bensch, Camilla; Klicpera, Christian (2000): Dialogische Entwicklungsplanung - Ein Modell für die Arbeit von BehindertenpädagogInnen mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Heidelberg, Edition S
Bergmann, Stefan; Düring, Pamela von (2004): Das Experteninterview. Im Internet unter URL: http://www.geographie.uni-osnabrueck.de/mitarbeiter/rolfes*
Bericht der Bundesregierung (2003) nach § 160 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) über die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen. Berlin Im Internet unter URL: http://www.bmgs.bund.de/downloads/BerichtParagr160SGBIX.pdf *
BIH (Hrsg.) (2004): Jahresbericht 2003/2004. Hilfen für Schwerbehinderte Menschen im Beruf. Karlsruhe. Im Internet unter URL: http://www.admin.integrationsaemter.de/ uploads/534/Jahresbericht_03_04.pdf/ *
Blandow, Jürgen (1999): Diskurse zur Qualität in der Jugendhilfe. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold, S.75-85
Blascke, Dieter (1997a): Problemhintergrund der Verbleibs- und Wirkungsforschung bei Behinderten und bei anderen Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik. In Niehaus, Mathilde; Montada, Leo (Hrsg.): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt, Frankfurt, Campus Verlag, S.131-143*
Blaschke, Dieter; Plath, Hans (1997b): Zu einigen Problemen der Forschung über Behinderte - eine Einführung. In Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 30. Jg. / 1997, S.241-254*
Blesinger, Berit (2003): Themenschwerpunkt Arbeitsassistenz auf der Jahrestagung der BAG-UB 2002. In Impulse Nr. 25 03/2003. S.24-28, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Blesinger, Berit (2004): Arbeitsassistenz - für wen? In Impulse Nr.30 08/2004, S.7-10, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Blumberger, Walter (1996): Berufsverläufe und Lebensbedingungen von begünstigten behinderten Frauen und Männern. Kurzfassung des Projektberichtes. Im Internet unter: www.ibe.co.at
Blumberger, Walter (2001): Evaluierung der Geschützen Werkstätten nach § 11 Behinderteneinstellungsgesetz. Kurzfassung des Projektberichtes. Im Internet unter: www.ibe.co.at
Blumberger, Walter (2002a): Grundlagen beruflicher Rehabilitation und Prävention. Unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript. WS 2002/2003. Universität Wien. Institut für Sonder- und Heilpädagogik.*
Blumberger, Walter (2002b): Arbeitsassistenz in Österreich- Entwicklung und Perspektiven. Wien, herausgegeben von BMSG*
Blumberger, Walter (2003): Wissenschaftliche Grundlagen der beruflichen Rehabilitation. Vortragsmanuskript. Im Internet untern URL: http://www.ibe.at
BMAS (1992): Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung. Wien, herausgegeben von BMAS
Boban, Ines; Hinz, Andreas (1999): Geistige Behinderung und die Gestaltung integrativer Lebensbereiche. Sonderpädagogik 26, 1996, H.3, 145-153
Boeßenecker, Karl-Heinz (Hrsg.) (2003): Qualitätskonzepte in der sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis. Weinheim - Basel, Beltz Votum Verlag *
Bogner, Alexander (Hrsg.) (2002): Das Experteninterview - Theorie, Methode und Anwendung. Opladen, Leske / Budrich Verlag*
Bogner, Alexander; Menz, Wolfgang (2002): Das theoriegenerierende Experteninterview - Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In Bogner, Alexander (Hrsg.): Das Experteninterview - Theorie, Methode und Anwendung. Opladen, Leske / Budrich Verlag, S.33-70*
Brand, Willi; Naust-Lühr, Andrea (2000): Dimensionen des Erfolgs beruflicher Rehabilitation und die Schwierigkeit sie methodisch zu erfassen. In Kipp, Martin; Stach, Meinhard (Hrsg.): Innovative Berufliche Rehabilitation. Bielefeld, Bertelsmann Verlag, S.144-161*
Brandl, Maria; Feuerstein, Bernadette (2004): Allen Fortschritt verdanken wir den Unzufriedenen. In QSI: Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit. Erkenntnisse und Empfehlungen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft QSI. Wien, herausgegeben von Integration Österreich, S.17-23*
Braun, Hans (1999): Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung in sozialen Diensten. In Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München - Basel, Reinhardt Verlag, S.134-145*
Brinkmann, Christian; Deeke, Andreas; Völkel, D. (Hrsg.) (1995): Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung - Diskussionsbeiträge zu methodischen Fragen und praktische Erfahrungen. Nürnberg, BeitrAB 191*
Brooke, Valerie; Wehman, Paul (1997): Supported Employment: A Customer Driven Approach. Im Internet unter URL: http://www.worksupport.com/Main/semanual.asp
Brunner, Ewald; Bauer, Petra; Volkmar, Susanne (Hrsg.) (1998): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag *
Brunner, Ewald Johannes (1998): Soziale Einrichtungen im Härtetest - Vom Nutzen und Nachteil von Evaluation und Qualitätssicherung für soziale Organisationen. In Brunner, Ewald; Bauer, Petra; Volkmar, Susanne (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag S.8-15*
Bühler, Angelika (1997): Initiativen der EU zur Beschäftigung behinderter Menschen. In Niehaus, Mathilde; Montada, Leo (Hrsg.) (1997): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt, Frankfurt, Campus Verlag, S.105-120*
Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.) (2002): Teilhabe durch berufliche Rehabilitation - Handbuch für Beratung, Förderung, Aus- und Weiterbildung. Herausgegeben von der Bundesanstalt für Arbeit.*
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (2002a): Kassys - Kasseler Systemhaus - Qualitätsmanagement - Referenzmodell zur psychosozialen Betreuung nach dem Sozialgesetzbuch. Karlsruhe, herausgegeben von Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen*
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (2002b): ABC - Behinderung und Beruf - Handbuch für die betriebliche Praxis. Wiesbaden; Universum Verlanganstalt*
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (2003): Gemeinsame Empfehlungen Qualitätssicherung nach § 20 Abs. 1 SGB IX vom 27. März 2003. Im Internet unter URL: www.bar-frankfurt.de
Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung (2003): Zur Situation der Integrationsfachdienste. Stellungnahme der BAG-UB. Im Internet unter URL: www.bag-ub.de*
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (1998): Bericht zur Lage behinderter Menschen in Deutschland. Bonn, herausgegeben von BMS*
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (1999): Einblick 2 - Arbeit - Orientierungshilfen zum Thema Behinderung. Wien, herausgegeben von BMGS
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (2001): Peer Review: "Arbeitsassistenz" - Support for the Integration of disabled persons into the labour market in Austria. Wien, herausgegeben vom BMSG
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (2003a): Bericht über die Lage der behinderten Menschen in Österreich. Wien, herausgegeben vom BMSG*
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (2003b): Clearing Jahresbericht 2003. Wien, herausgegeben vom BMSG
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (2003c): Bundesweites arbeitsmarktpolitisches Behindertenprogramm 2003-2004. Wien, herausgegeben vom BMSG*
Bungart et. al. (1999): Arbeitsstandards als zentrales Instrument eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems". In Impulse Nr.14/1999. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp14-99-instrument.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Bungart, Jörg; Supe, Volker; Willems, Peter (2000): Qualitätssicherung und Entwicklung in Integrationsfachdiensten. Ergebnisse eines Modellprojektes zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in Fachdiensten zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen (Abschlussbericht) Münster, Universität Münster*
Bungart, Jörg, Putzke, Susanne (2001a): Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozess der betrieblichen Integration. In Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S.111-160*
Bungart, Jörg; Supe, Volker; Willems, Peter (2001b): Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste. In Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 183-228*
Bungart, Jörg; Suppe, Volker; Wilems, Peter (2001c): Handbuch zum Qualitätsmanagement in Integrationsfachdiensten - Ergebnisse eines Modellprojektes zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in Fachdiensten zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Nordrhein Westfalen, herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales *
Bungart, Jörg (2001d): Qualitätsmanagement in sozialen Handlungsfeldern. In Impulse Nr.19 06/2001, S.14-20, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Bungart, Jörg (2002): Integrationsfachdienste im Netzwerk zur Teilhabe am Arbeitsleben. In Impulse Nr.22 05/2002, S.12-21, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Burtscher, Reinhard (1998): Berufliche Integration ohne Emanzipation ist ein Missverständnis. In: Erziehung heute, Sonderheft: Weissbuch Integration, Heft 3, 1998 / betrift:integration, Sondernr. 3a 1998, S. 47-51 Hrsg: Tiroler Bildungspolitische Arbeitsgemeinschaft, Studien Verlag Innsbruck 19. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/burtscher-weissbuch_beruf.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Burtscher, Reinhard (2001): Unterstütze Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Dissertation zur Erlangung eines akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Im Internet unter URL:http://bidok.uibk.ac.at/library/burtscher-beschaeftigung.html*
(Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Demmin, Michael (1999): Entwicklung von Qualitätsgrundsätzen für den Bereich der beruflichen Rehabilitation. In Niehaus, Mathilde (Hrsg.) (1999): Erfolg von Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.29-41
Diettrich, Andreas (1998): Qualitätsmanagement in der beruflichen Weiterbildung - Aktuelle Entwicklungen und Probleme. In Brunner / Bauer / Volkmar (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.87-106
Dobbe, Bernhard (1998): Qualitäts- und Prozessmanagement innerhalb der psychosozialen Betreuung. In Impulse Nr.10/1998. Im Internet unter URL:http://bidok.uibk.ac.at/library/imp10-98-management.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Doose, Stefan (1996): Supported Employment für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in den USA. Hamburg, herausgegeben von der BAG-UB*
Doose, Stefan (1997a): Stand der Entwicklung und Zukunft von Unterstützer Beschäftigung in Deutschland. In Impulse Nr.5/6 09/1997. S.39-44*
Doose, Stefan (1997b): Unterstützte Beschäftigung - ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich. In Schulze, H. (Hrsg): Schule, Betriebe und Integration - Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt. Hamburg, Beiträge und Ergebnisse der Tagung Integration 2000.*
Doose, Stefan (1998): Unterstütze Beschäftigung - Neue Wege in der beruflichen Integration für Menschen mit Lernschwierigkeiten: Eine Untersuchung von Integrationsfachdiensten und unterstützten Arbeitsplätzen in Deutschland. Hamburg, herausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung. Im Internet unter URL: www.bag-ub.de*
Doose, Stefan (2001): Qualifizierung und Fortbildung von IntegrationsberaterInnen in Integrationsfachdiensten. In Barlsen, Jörg; Hohmeier; Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Verlag Selbstbestimmtes Leben; Düsseldorf; S.229-253*
Doose, Stefan (2003a): Unterstütze Beschäftigung im Kontext von internationalen, europäischen und deutschen Entwicklungen in der Behindertenpolitik. In Impulse Nr. 27 09/2003; S.3-13, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Doose, Stefan (2003b): "I want my dream" - Persönliche Zukunftsplanung - Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen. 6 überarbeitete und erweiterte Neuauflage; Hamburg, herausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung*
Doose, Stefan (2004a): Qualität auf lange Sicht - Zur Nachhaltigkeit der von Integrationsfachdiensten vermittelten Arbeitsverhältnisse. In Impulse Nr.29 05/2004, S.3-8*
Doose, Stefan (2004b): Einige Jahre später - die Lebens- und Arbeitssituation von Menschen in Unterstützter Beschäftigung. Verbleibs- und Verlaufsstudie zur Situation der Integrationsfachdiensten und Werkstätten für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelten Menschen mit Behinderung. Aktualisiertes Expose der Dissertation*
Doose, Stefan (2004c): Die Phasen der Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung, Integrationsfachdiensten und Arbeitsassistenz in Deutschland. Eine Analyse des Prozesses und des Beitrags des zehnjährigen Wirkens der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB). In: Impulse Nr.32, S.3-14.*
Doose, Stefan (2005): Unterstütze Beschäftigung im Übergang Schule-Beruf. In Vds Landesverband Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Mitteilungen H.1, S.5-19. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-uebergang.html *
Dreisbach, Dieter (1998): Veränderte Formen der gesellschaftlichen Solidarität und die Stellung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft. In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8; Universitätsverlag Ulm S.49-55
Engel, Matthias et. Al. (1996): Qualitätsentwicklung in der Dienstleistungs-gesellschaft - Perspektiven für die soziale Arbeit. In Heiner, Maja (Hrsg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.48-67*
Engelhardt, Hans Dietrich (1999): Wozu nützt Sozialmangement. In Gemeinsam leben; 1/1999. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-99-wozu.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
ESF (2000): Ziel 3 Österreich 2000-2006 - einheitliches Programmplanungsdokument, Wien, herausgegeben vom ESF*
Europäische Kommission (2001): The employment situation of people with disabilities in the European Union. A Study prepared by EIM Business and Policy Research. Brüssel, herausgegeben von der Europäischen Kommission Generaldirektion Beschäftigung und Soziales*
Europäische Kommission (2002): Definition des Begriffs "Behinderung" in Europa: eine vergleichende Analyse. Brüssel, herausgegeben von der Europäischen Kommission Generaldirektion Beschäftigung und Soziales*
Fasching, Helga (2000): Verein "Autark". In Impulse Nr.15/2000. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp15-00-autark.html
Fasching, Helga (2003): Qualitätskriterien in der beruflichen Integrationsmaßnahme Arbeitsassistenz unter besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen mit Lernbehinderung. Unveröff. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Fakultät für Human und Sozialwissenschaften an der Universität Wien.*
Fasching, Helga / Niehaus, Mathilde (2003): Qualitätsdiskussion in der beruflichen Integration. In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 4/5/2003; S.46-54*
Feuser, Georg (2004): Qualitätskriterien inklusiver Bildung. In Feyerer, Ewald; Prammer, Wilfried (Hrsg.): Qualität und Integration. Beiträge zum 8. PraktikerInnenforum. Linz, herausgegeben von der Pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich, S.30-50*
Feyerer, Ewald; Prammer, Wilfried (Hrsg.) (2004): Qualität und Integration. Beiträge zum 8. PraktikerInnenforum. Linz, herausgegeben von der Pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich*
Fink, Franz (2001): Aufgaben der Qualitätssicherung und -förderung in Einrichtungen der Behindertenhilfe - Qualitätsmanagement mit einem Blick über die Institution hinaus. In Zink, Klaus (Hrsg.) (2001): Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen. 2. Auflage. Neuwied, Luchterhand Verlag, S.34-49*
Firlinger, Beate (2003): Buch der Begriffe. Sprache, Behinderung, Integration. Wien, herausgegeben von Integration Österreich*
Franz, Hans-Werner: Integriertes Qualitätsmanagement in der Weiterbildung. EFQM und DIN ISO 9001. Bielefeld, Bertelsmann Verlag *
Friebertshäuser, Barbara (Hrsg.) (1997): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim - Basel, Juventa Verlag*
Frühauf, Theo (1999): Qualität sozialer Qualität weiterentwickeln - Instrumente und Systeme der Qualitätssicherung. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (1999): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold, S.109-127*
Frühauf, Theo (2001): Chancen und Risiken neuerer gesetzlicher Entwicklungen für die Qualität der Dienstleistung in Einrichtungen der Behindertenhilfe. In Zink, Klaus (Hrsg.) (2001): Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen. 2. Auflage. Neuwied. Luchterhand Verlag, S.11-33*
Garz, Klaus (Hrsg.) (1991): Qualitativ - empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden und Analysen. Opladen, Leske / Budrich Verlag
Gerdes, Sabine (2004): Der Verbleib nach der Vermittlung durch Integrationsfachdienste in den allgemeinen Arbeitsmarkt. In Impulse Nr.31 10/2004, S.17-24
Gerull, Peter (1999): Qualitäsmanagement in sozialen Handlungsfeldern - Überblick und aktueller Diskussionsstand. In Gemeinsam leben; 1/1999. Im Internet unter URL:http://bidok.uibk.ac.at/library/gl1-99-handlungsfelder.html
Giedenbacher, Yvonne; Stadler-Vida, Michael; Strümpel, Charlotte (2002): Die Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der Beteiligten am Fallbeispiel der Arbeitsassistenz Liezen. Wien, herausgegeben vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Im Internet unter URL: http://www.quip.at*
Giedenbacher, Yvonne; Stadler-Vida, Michael; Strümpel, Charlotte (2003a): Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der Beteiligten - Ein Evaluationshandbuch. Wien, herausgegeben vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Im Internet unter URL: www.quip.at*
Giedenbacher, Yvonne (2003b): "Stell Dir vor es geht um Qualität und alle reden mit" Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der Prozessbeteiligten. In Impulse Nr. 26 06/2003; S.3-13, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Ginnold, Antje (2000): Schulende - Ende der Integration? Integrative Wege von der Schule in das Arbeitsleben. Neuwied - Berlin, Luchterhand Verlag*
Ginnold, Antje (2005): Der undurchsichtige Qualifizierungsdschungel beim Übergang Schule - Beruf. Informationen zu den aktuellen Veränderungen für Jugendliche mit Behinderung in Wien. In Berliner Behindertenzeitung, Ausgabe Februar 2005. Im Internet unter URL: http//www.berliner-behindertenzeitung.de/bbz/05-02/050214.htm/
Gläser, Jochen, Laudel, Gritt (2004): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Wiesbaden, UTB Uni Verlag für Sozialwissenschaften*
Gusel, Doris (2004): Teilqualifizierungslehre - Integrative Berufsausbildung. In Verzetnisch, Fritz; Schlögl, Peter; Prischl, Alexander (Hrsg.): Jugendliche zwischen Karriere und Misere. Die Lehrausbildung in Österreich - Innovationen und Herausforderungen. Wien, ÖGB Verlag, S.205-213
Hackenberg, Helga (2001): Benchmarking in der lokalen Beschäftigungsförderung. Recherche und Assessment bestehender Benchmarking Ansätze. Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung*
Hackenberg, Helga (2003): Benchmarking in der kommunalen Beschäftigungsförderung. Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung*
Hagen, Jutta (1999): Die Methoden der BWL - alles andere als eine Chance für die soziale Arbeit. In Gemeinsam leben; 1/1999. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/ library/gl1-99-bwl.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Halfar, Bern (2003): Benchmarking für stationäre Wohneinrichtungen in der Behindertenhilfe. In Verbansdienst der Lebenshilfe Nr. 3 / 2003, S.135-140
Hansen, Eckhard (1999): Nationale Qualitätskulturen in der Wohlfahrtspflege. Ein Vergleich am Beispiel personenbezogener sozialer Dienstleistungen für Erwachsene in England und Deutschland. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold, S.21-S.34
Haubrock, Manfred; Gohlke, Susanne (2000): Benchmarking in der Pflege. Bern, Verlag Hans Huber, *
Heiner, Maja (Hrsg.) (1996a): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Lambertus Verlag; Freiburg im Breisgau*
Heiner, Maria (1996b): Evaluation zwischen Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. In Heiner, Maja (Hrsg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Lambertus Verlag; Freiburg im Breisgau S.20-47*
Heiner, Maja (2004): Professionalität in der sozialen Arbeit. München, Kohlhammer Verlag,
Heiner, Maja (2005): Soziale Arbeit als Beruf. München, Kohlhammer Verlag,
Helios Report (2000): Unterstütze Beschäftigung in Europa. Im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Hinz, Andreas; Boban, Ines (2001): Integrative Berufsvorbereitung - Unterstütztes Arbeitstraining für Menschen mit Behinderung. Erschienen in der Reihe "Beiträge zur Integration". Berlin, Luchterhand Verlag *
Hitzler, Ronald (Hrsg.) (1994): Expertenwissen - Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen, Leske / Budrich Verlag*
Hodel, Markus (1998): Organisationales Lernen und Qualitätsmanagemt. Frankfurt am Main, Europäischer Verlag der Wissenschaften *
Hohmeier, Jürgen (2001): Unterstützte Beschäftigung - ein neues Element im System der beruflichen Rehabilitation. In Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S.15-24*
Horak, Christian (2002): Neuordnung der Integrativen Betriebe. Wien. Herausgegeben von BMSG
Horak, Christian; Schmid, Tom (2003): Evaluierung der Beschäftigungsoffensiver der Bundesregierung - Gemeinsamer Jahresbericht 2001-2002. Wien, herausgegeben vom BMSG*
Integrationsfachdienst Bayern e.V. (2001): Praxishandbuch der erfolgreichen Akquisition - Handlungsorientierung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. Abensberg, herausgegeben von IFD Bayern e.V. *
Jähnert, Detlev (1999): Entwicklung und Visionen von Unterstützer Beschäftigung. In Impulse Nr. 14. 12/1999. S.3-6, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Jantzen, Wolfgang (1992): Allgemeine Behindertenpädagogik - Band 1 - Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. 2. Auflage, Weinheim und Basel, Beltz Verlag.*
Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.) (1999a): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold*
Jantzen, Wolfgang (1999b): Geistige Behinderung ist ein sozialer Tatbestand. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold S.197-215
Johnson, Helmut (1999): Qualitätsmanagement in der Betreuung behinderter Menschen. In Gemeinsam leben; 2/1999. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-99-management.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Junker, Axel (1998): Supported Employment Made in USA - ein Modell für Deutschland? In Impulse Nr.7/8 03/1998. S.12-21, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Kaminske, Gerd; Brauer, Jörg (2003): Qualitätsmanagement von A-Z. Erläuterungen moderner Begriffes des Qualitätsmanagements. 4. aktualisierte und ergänzte Auflage. München - Wien, Carl Hanser Verlag*
Kastl, Jörg Michael; Trost, Rainer (2003): Die Wiederkehr des Verdrängten. In Impulse Nr.26 06/2003, S.31-43, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Kipp, Martin; Stach, Meinhard (2000): Innovative Berufliche Rehabilitation. Bielefeld, Bertelsmann Verlag*
Koch, Christian (2003): Balanced Scorecard. In Boeßenecker, Karl-Heinz (Hrsg.): Qualitätskonzepte in der sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis. Weinheim - Basel, Beltz Votum Verlag, S.7-15*
Klicpera, Christian; Klicpera-Gasteiger, Barbara (1995): Die Bedeutung von Standards und anderer Qualitätssichernder Maßnahmen. In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr.4 / 1995, S.33-42*
Kohlenberg, Hildegard (2000): Qualität von Humandienstleistungen. Opladen, Leske und Budrich Verlag*
Kolbe, Hermann (2000): Pädagogische Qualität. Mit QM nach ISO zur umfassenden Qualität im Behindertenheim. Dortmund, Verlag modernes Lernen*
Kraus, Rudolf (1998): Berufliche Rehabilitation und Integration als Zukunftschance für behinderte Menschen. In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag S.9-13
Krönes, Gerhard (1998): Qualitätsmanagement sozialer Dienstleistungen. In Brunner, Ewald; Bauer, Petra; Volkmar, Susanne (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.69-86
Kuckartz, Udo (1997): Qualitative Daten computergestützt auswerten: Methoden, Techniken, Software. In Friebertshäuser, Barbara (Hrsg.): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim - Basel S.585-598*
Lachwitz, Klaus (1999): Vom Pflegesatz zur Leistungsgerechten Vergütung - ein Abenteuer mit ungewissen Ausgang. 1. Januar 1999; Stichtag für neue Finanzierungsstrukturen in der Behindertenhilfe. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold S.49-S.73*
Lamnek, Siegfried (1995): Qualitative Sozialforschung - Band 2 - Methoden und Techniken. Weinheim - Basel, Beltz Verlag
Landschaftsverband Rheinland (2002): Dokumentation des Workshop: Qualitätsmanagement in den Integrationsfachdiensten im Rheinland. Köln, herausgegeben vom Landschaftsverband Rheinland
Langnickel, Hans (2003): Das EFQM-Modell für Excellence - Der europäische Qualitätspreis. In Boeßenecker, Karl-Heinz (Hrsg.) (2003): Qualitätskonzepte in der sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis. Weinheim - Basel, Beltz Votum Verlag, S.38-47*
Lanwer-Koppelin, Willehad (1999): Aus weniger wird mehr? In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold S.151-171*
Leichsenring, Kai; Strümpel, Charlotte (1997): Berufliche Integration behinderter Menschen- Innovative Projektbeispiele aus Europa. Wien, Schriftenreihe "Soziales Europa" herausgegeben von BMAS*
Lynch, Christy (1997): Supported Employment - more than a job. In Impulse Nr.5/6 1997, S.7-11*
Mair, Helmut (2001): Unterstützte Beschäftigung vor dem Hintergrund veränderter Arbeitsmärkte. In Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 25-38*
Markert, Andreas (2003): Evaluation. In Boeßenecker, Karl-Heinz (Hrsg.): Qualitätskonzepte in der sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis. Weinheim - Basel, Beltz Votum Verlag, S.48-59*
Markowetz, Reinhard (1998): Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben für Menschen mit schwersten geistigen Behinderungen und gravierenden Verhaltensproblemen - (k)ein Thema für unseren Sozialstaat?! In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag S.198-211
Markowetz, Reinhard (2000): Die Werkstätten für Behinderte Neu denken und neu machen. In Kipp, Martin; Stach, Meinhard (Hrsg.): Innovative Berufliche Rehabilitation. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, S.111.143*
Matul, Christian; Scharitzer, Dieter (2002): Qualität der Leistungen in NPOs. In Badelt, Christoph (Hrsg.): Handbuch der Nonprofit Organisationen - Strukturen und Management. 3. Auflage, Stuttgart, Schäffer-Pöschel Verlag, S.605-632*
Mayring, Philip (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung, 5 Auflage. Weinheim - Basel, Beltz Verlag*
Meinhold, Marianne (1998): Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag*
Meinhold, Marianne (2002): Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit. Vortagsmanuskript zum ISMOS Lehrgang WU - Wien
Metzler, Heidrun (2001): Zum Qualitätsbegriff in der Behindertenhilfe. In Zink, Klaus (Hrsg.) (2001): Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen. 2. Auflage. Neuwied, Luchterhand Verlag, S. 50-61*
Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (1991): Experteninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht - Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In Garz, Detlef (Hrsg.): Qualitativ -empirische Sozialforschung - Konzepte, Methoden und Analysen. Opladen, Leske / Budrich, Verlag; S.441-471*
Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (1994): Expertenwissen und Experteninterviews. In Hitzler, Ronald (Hrsg.): Expertenwissen. Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen, Leske / Budich Verlag. S. 180-192*
Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (1997): Das Experteninterview - Wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung. In Friebertshäuser, Barbara (Hrsg.): Handbuch qualitative Sozialforschung in der Erziehungswissenschaft. Weinheim - Basel, Beltz Verlag, S.481-491 *
Mizelli, Wolfgang (2004): Qualitätsparameter in der Arbeit mit und für behinderte Frauen und Männer. In QSI: Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit. Erkenntnisse und Empfehlungen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft QSI. Wien, herausgegeben von Integration Österreich, S.23-28*
Momm, Willi (1997): Internationale Forschungskooperation - Ein Beitrag zur Entwicklung rationaler Beschäftigungspolitik für Behinderte. In Niehaus, Mathilde; Montada, Leo (Hrsg.) (1997): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Frankfurt, Campus Verlag, S.122-129
Mosen, Günther (2001): Wege zur Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sozialer Arbeit. In Verbandsdienste der Lebenshilfe Nr. 1 / 2001, S. 7-15
Motsch, Harald (1999): Berufliche Integration durch Jugend am Werk. In Impulse Nr.13 09/1999. S.25-27, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de
Mrozynski, Peter (2003): Europarechtliche Einflüsse auf die berufliche Eingliederung behinderter Menschen. In Impulse Nr. 27 09/2003; S.19-20, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de
Mühling, Tanja (2000): Die berufliche Integration von Schwerbehinderten. Würzburg, Deutscher Wissenschaftsverlag *
Nationaler Beschäftigungspolitischer Aktionsplan für Deutschland 2004. Im Internet unter URL: http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/nap_2004/-nap2004de_de.pdf
Nationaler Beschäftigungspolitischer Aktionsplan für Österreich 2004. Im Internet unter URL: http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/nap_2004/nap2004au_de.pdf
Niehaus, Mathilde (Hrsg.) (1999): Erfolg von Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag *
Niehaus, Mathilde (2000): Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen in Europa. In Rehabilitation 39/2000, S.127-133*
Oberndorfer, Barbara (2004): Integrative Berufsausbildung - Meilenstein oder schlechter Kompromiss. In Verzetnisch, Fritz; Schlögl, Peter; Prischl, Alexander (Hrsg.): Jugendliche zwischen Karriere und Misere. Die Lehrausbildung in Österreich - Innovationen und Herausforderungen. Wien, ÖGB Verlag, S.199-204
OECD (2003): Behindertenpolitik zwischen Beschäftigung und Versorgung - Ein internationaler Vergleich. Frankfurt / New York, Campus Verlag*
Österle, August (1992): Behinderte und Arbeitsmarkt - Eine Analyse der arbeitsmarktpolitischen Instrumente zugunsten behinderter Menschen. In Badelt, Christoph (Hrsg.): Geschütze Arbeit: Alternative Beschäftigungsformen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Menschen. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag, S.17-79
Patterson, James (1996): Grundlagen des Benchmarking. Wien, Überreuther Verlag *
Paulik, Richard (1999): Arbeitsassistenz und berufliche Integration in Bayern und Oberösterreich: Theorien - Konzepte - Strategien. Linz, Edition Pro - Mente*
Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.) (1999): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München - Basel, Reinhardt Verlag*
Pfaffenbichler, Maria (1999): Lebensqualität durch Arbeitsassistenz. Innsbruck - Wien, Studien Verlag*
Plath, Hans Eberhard.; Blascke, Dieter (1999): Probleme der Erfolgsfeststellung in der beruflichen Rehabilitation. In Niehaus, Mathilde (Hrsg.) (1999): Erfolg von Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S. 9-28*
Prischl, Alexander (2004): Integrative Berufsausbildung - gleiche Rechte neue Chancen. In Verzetnisch, Fritz; Schlögl, Peter; Prischl, Alexander (Hrsg.): Jugendliche zwischen Karriere und Misere. Die Lehrausbildung in Österreich - Innovationen und Herausforderungen. Wien, ÖGB Verlag, S.193-198*
QSI (2004): Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit. Erkenntnisse und Empfehlungen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft QSI. Wien, herausgegeben von Integration Österreich*
Reinhard, Volker (2000): QM + LQ - eine Vernunftehe? In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft; 2/2000. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh2-00-vernunftsehe.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Rosenstiel, Lutz von (1999): Die lernende Organisation als Ausgangspunkt für Qualitätsentwicklung. In Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München - Basel, Reinhardt Verlag; *
Saner, Irmgard (2004): Gleichzeitig Kosten senken und Qualität sichern? In Impulse Nr.29 05/2004, S.35-38
Schabmann, Alfred; Klicpera, Christian (1998): Erleben von Berufstätigkeit. In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft; 4/5/1998. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-98-erleben.html (Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Schartmann, Dieter (1995): Soziale Integration durch Mentoren. In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr.4 / 1995*
Schartmann, Dieter (1999): Berufliche Integration geistig behinderter Menschen - die Sicht der Betriebe. In Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 2-99. Im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-99-betriebe.html*(Stand: 19.04.2006, Link aktualisiert durch bidok)
Schartmann, Dieter (2000): Übergänge von der Sonderschule / WfbM in das Erwerbsleben - Ergebnisbericht. Köln, herausgegeben vom Landschaftsverband Rheinland
Schartmann, Dieter (2001): Berufliche Integration als Zone der nächsten Entwicklung. In Behindertenpädagogik, 40. Jg. Heft 1/2001, S.35-66
Schartmann, Dieter; Seel, Helga (2003): Der Qualitätsentwicklungsprozess für IFD in Nordrhein Westfalen. In Impulse Nr. 26 06/2003; S.25-30, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Schartmann, Dieter (2005): Betriebliche Integration durch Integrationsfachdienste. Unveröffentlichter Artikel *
Scherrer, Wennemar (1996): Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. In Heiner, Maja (Hrsg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.9-19
Scherer, Andreas; Alt, Michael (Hrsg.) (2002): Die Balanced Scorecard in Verwaltung und Non-Profit Organisationen. Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag*
Schiepek, Günther (1998): Produktion und Beurteilung von Qualität in psychosozialen Einrichtungen. In Brunner, Ewald; Bauer, Petra;, Susanne Volkmar (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.16-53*
Schiersmann, Christiane; Thiel, Heinz; Pfizenmaier, Eva (2001): Organisationsbezogenes Qualitätsmanagement. Opladen, Leske / Budrich Verlag, *
Schneider, Michael (2001): Arbeitsassistenz, Arbeitsplatzassistenz, persönliche Assistenz am Arbeitsplatz für Schwerbehinderte - Begriffsklärungen und Kostenszenarien. In Barlsen, Jörg; Hohmeier, Jürgen (Hrsg.) (2001): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderungen - Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf, Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 67-80
Schüller, Simone (2003): 6. Konferenz der Europäischen Union für Unterstütze Beschäftigung in Finnland. In Impulse Nr. 27 09/2003; S.17-18, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Schwarte, Norbert (1996): Selbstevaluation und fachliche Standards in der sozialen Rehabilitation Behinderter. In Heiner, Maja (Hrsg.) (1996): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.197-214*
Schwarte, Norbert; Oberste-Ufer, Ralf (2001a): Qualitätssicherung und -entwicklung in der sozialen Rehabilitation Behinderter: Anforderungen an Prüfverfahren und Instrumente. In Zink, Klaus (Hrsg.) (2001): Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen. 2. Auflage. Neuwied, Luchterhand Verlag, S.62-88*
Schwarte, Norbert; Rohrmann, Albrecht; McGovern, Karsten; Schädler, Johannes (Hrsg.) (2001b): AQUA-NetOH: Arbeitshilfen zur Qualifizierung von örtlichen Netzwerken Offener Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Siegen, Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste an der Universität Siegen
Schwan, Renate; Kohlhaas, Günther (2000): Qualitätsmanagement in Beratungsstellen. Selbstbewertung nach dem EFQM Modell für Excellence. Weinheim - Basel, Beltz Verlag*
Seel, Helga (2002): QM-System der Integrationsfachdienste in Nordrhein Westfalen, herausgegeben durch den Landschaftsverband Rheinland*
Seifert, Monika (1999): Qualität und Verantwortung. In Jantzen, Wolfgang; Lanwer-Koppelin, Willehad (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin, Edition Marhold S. 217-231
Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.) (1998a): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag
Seyd, Wolfgang (1998b): Das System beruflicher Rehabilitation - Kritik und Anstöße. In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.) (1998): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag S.35-45
Speck, Otto (1999a): Die Ökonomisierung sozialer Qualität - Zur Qualitätsdiskussion in Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit. München - Basel, Reinhardt Verlag *
Speck, Otto (1999b): Marktgesteuerte Qualität - eine neue Sozialphilosophie? In Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.) (1999): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München - Basel, Reinhardt Verlag, S.15-30*
Stadler-Vida, Michael (2003): Perspektiven der Qualität von Unterstützter Beschäftigung. In Impulse 26/2003, S.9-13, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de
Stein, Ina (1998): Anspruch und Wirklichkeit bei der beruflichen Rehabilitation und Integration. In Seyd, Wolfgang et. Al. (Hrsg.) (1998): Zukunft der beruflichen Rehabilitation und Integration in das Arbeitsleben. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation Band 8. Ulm, Universitätsverlag, S.27-34
Trost, Rainer; Kastl, Jörg Michael (2002): Integrationsfachdienste zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung in Deutschland - Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zur Arbeit der Modellprojekte des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Im Internet unter URL: http://www.bmgs.bund.de/download/broschueren/-F295Gesamt.pdf*
Verzetnisch, Fritz; Schlögl, Peter; Prischl, Alexander (Hrsg.) (2004): Jugendliche zwischen Karriere und Misere. Die Lehrausbildung in Österreich - Innovationen und Herausforderungen. Wien, ÖGB Verlag *
Vieweg, Barbara (2003): Selbstbestimmt Leben und berufliche Teilhabe. In Impulse Nr. 25 03/2003; S.5-9, im Internet unter URL: http://www.bag-ub.de*
Vilain, Michael (2003): DIN EN ISO 9000ff:2000. In Boeßenecker, Karl-Heinz (Hrsg.): Qualitätskonzepte in der sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis. Weinheim - Basel, Beltz Votum Verlag, S.15-23*
Vogel, Berthold (1995): "Wenn der Eisberg zu schmelzen beginnt" - Einige Reflexionen über den Stellenwert und die Probleme des Experteninterviews in der Praxis der empirischen Sozialforschung. In Brinkmann, C.; Deeke, A.; Völkel, B. (Hrsg.) (1995): Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung. Nürnberg, BeitrAB 191; S. 73-84*
Volkmar, Susanne (1998): Qualität sozialer Einrichtungen. In Brunner, Ewald; Bauer, Petras; Volkmar, Susanne (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.54-68*
Vonderach, Gerd (1996): Lebensgeschichte und berufliche Rehabilitation. Münster, Lit Verlag*
Wehman, Paul; Revell, Grant;Brooke, Valerie (2002): Competitive Employment: Has it become "first choice" yet? In: Kregel, John, Dean, David, Wehman, Paul (Hrsg.): Achievements and Challenges in Employment Services for People with Disabilities: The Longitudinal Impact of Workplace Supports, Richmond: Virginia Commonwealth University, S. 42-62
Weiß, Susanne (1999). Unterstützte Beschäftigung durch Arbeitsassistenz - Indikatoren für die Qualitätseinschätzung. In Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 1 (3), S.45-56.*
Wetzel, Ralf (1999): Behinderte Personalarbeit? Übersehene Potentiale einer Beschäftigung behinderter Mitarbeiter. In Personalwirtschaft 10/99, Hermann Luchterhand Verlag*
Wetzel, Gottfried (2004): Einführung in die Thematik der Qualitätssicherung. In QSI (2004): Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit. Erkenntnisse und Empfehlungen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft QSI. Wien, herausgegeben von Integration Österreich, S.10-17
Wetzel, Ralf (1999): Fachdienste als (Fach-)Berater von Individuum, Personal und Organisation. In: Betriebswirtschaftliches Denken und Arbeitsplatzanalyse. Modul 5 Berufsbegleitende Qualifizierung in Unterstützter Beschäftigung. Hamburg, herausgegeben von der BAG-UB*
Wetzler, Rainer (1996): Internationale Evaluationsansätze zur Qualitätssicherung sozialer Dienstleistungen. In Heiner, Maja (Hrsg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.108-120
Wienand, Manfred (1999): Qualitätssicherung bei der Leistungserbringung im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes. In Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München - Basel, Reinhardt Verlag, S.31-40
Zwingmann, Elke (1998): Qualitätsmanagement im Sozialbereich - Gefesselte Kreativität? In Brunner / Bauer / Volkmar (Hrsg.): Soziale Einrichtungen bewerten - Theorie und Praxis der Qualitätssicherung. Freiburg im Breisgau, Lambertus Verlag, S.239-257
Zink, Klaus (Hrsg.) (2001): Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen. 2. Auflage. Neuwied, Luchterhand Verlag*
Zutter-Baumer, Barbara (2003): Heilpädagogik und New Public Management. Ein Plädoyer für reflektierte Leistungsvereinbarungen. Luzern, Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik*
Inhaltsverzeichnis
- (1).Forschungseinrichtungen mit Informationsressourcen zu den Schwerpunkten Behinderung und Berufliche Integration:
- (2).Institutionen im Bereich der beruflichen Integration (Auswahl):
- (3).Nationale und Internationale Dachverbände mit zum Teil sehr umfangreichen Informationsressourcen:
- (4).Öffentlich-rechtliche Institutionen in Österreich und Deutschland mit zahlreichen Informationsressourcen:
- (5).Informationsressourcen und Volltextzugriffe zu den Themen berufliche Ausbildung und Integration von Menschen mit Behinderung:
- (6).Informationsressourcen über die Sozial und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union:
- (7).Internetressourcen über die Gemeinschaftsinitiative EQUAL inkl. der Entwicklungspartnerschaften in Österreich und Deutschland, sowie andere EU Programme:
http://www.sora.at/index.html - Österreichisches Forschungsinstitut in Wien mit zahlreichen Forschungsarbeiten und Evaluationsstudien zum Thema der beruflichen Integration mit (zum Teil) Volltextzugriff
http://www.kmuforschung.ac.at/ - Österreichisches Forschungsinstitut in Wien mit zahlreichen Evaluationsstudien zum Thema der beruflichen Integration mit (zum Teil) Volltextzugriff auf Evaluationsstudien
http://www.ibe.co.at/web/index.htm - Institut für Berufs- und Erwachsenenbildung in Linz - Österreichisches Forschungsinstitut mit zahlreichen Evaluationsstudien zum Thema der beruflichen Integration mit (zum Teil) Volltextzugriff
http://www.euro.centre.org/ - Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung - Internationales Forschungsinstitut mit Sitz in Wien mit zahlreichen Evaluationsstudien zum Thema der beruflichen Integration mit (zum Teil) Volltextzugriff
http://www.cedefop.eu.int/ - European Centre for Development of Vocational Training - Europäisches Forschungsinstitut mit Forschungsarbeiten und Evaluationsstudien zum Bereich der Beruflichen Bildung, (zum Teil) mit Volltextzugriff
http://iab.de/iab/default.htm - Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung - Deutsches Forschungsinstitut mit Forschungsarbeiten und Evaluationsstudien zum Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit Schwerpunkt auf Deutschland, (zum Teil) mit Volltextzugriff
http://www.inbas.com/ - Institut für berufliche Bildung. Dieses Institut bietet wissenschaftliche Dienste im Bereich Berufsausbildung, aktive Arbeitsmarktprogramme und Wohlfahrtssysteme. Volltextzugriff auf der Homepage.
http://www.bfb.at/ - Verein zur beruflichen Förderung und Bildung. Der BFB ist ein Verein zur beruflichen Förderung und Bildung, der Projekte zum erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit körperlichen und intellektuellen Behinderungen entwickelt.
http://www.ifa-steiermark.at/ - Institut für Arbeitsmarktbetreuung und -forschung mit Standort in Graz. Evaluation der EQUAL Entwicklungspartnerschaft Styria Integra. Teilweise Volltextzugriff auf der Homepage.
http://www.sfs-research.at/ - Sozialökonomische Forschungsstelle mit Sitz in Wien. Forschungsschwerpunkte u.a. Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Evaluationsstudien und wissenschaftliche Begleitung für zahlreiche Entwicklungspartnerschaften der EQUAL Gemeinschaftsinitiative.
http://www.psz.co.at/ibi/ - Das Institut zur beruflichen Integration (IBI) mit Sitz in Wien, bietet Arbeitsassistenz für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an.
http://www.lebenshilfe-ennstal.at/ - Die Lebenshilfe Ennstal mit Standorten im Bezirk Liezen, bietet neben der Dienstleistung der Arbeitsassistenz, Clearing, berufliche Qualifizierung und Beschäftigungstherapie für Menschen mit allen Arten von Beeinträchtigungen an.
http://www.ifs.at/ - Das Institut für Sozialdienste in Vorarlberg war einer der Vorreiter der Unterstützten Beschäftigung für Menschen mit Behinderung in Österreich.
http://www.win.or.at/ - Das Wiener Integrationsnetzwerk (WIN) bietet Clearing und Arbeitsassistenz für Menschen mit allen Arten von Beeinträchtigungen an.
http://www.alphanova.at/index_pc.php - Die Alpha Nova Betriebs GmbH bietet eine Vielzahl an sozialen Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen an. In der Rubrik "Forschung und Entwicklung" finden sich zahlreiche Informationsressourcen zu bereits abgeschlossenen Projekten (u.a. JOBWÄRTS - Module zum Training von Schlüsselkompetenzen für Menschen mit Lernschwierigkeiten)
http://www.bungis.at/ - auf der Homepage des Vereins BUNGIS mit Sitz in Markt Allhau (Burgenland) findet sich u.a. ein Volltextzugriff auf die Vereinzeitschrift: "Gemeinsam Leben"
http://www.wag.or.at/ - Die Wiener Assistenzgenossenschaft (WAG) bietet die Dienstleistung der Persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz für Menschen mit Körperbehinderung an. Auf der Homepage finden sich zahlreiche Informationsressourcen zur Persönlichen Assistenz.
http://www.zfk.at/ - Die Selbstvertretungsstelle Zentrum für Kompetenzen bietet regelmäßig Fortbildungen für Menschen mit Behinderung und Fachkräfte an (z.B. Persönliche Zukunftsplanung) - Informationen finden sich auf der Homepage.
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.html - Die sehr informative Homepage der Hamburger Arbeitsassistenz bietet neben Informationsmaterialien, auch zahlreiche Informationsressourcen über Projektbeispiele der Unterstützten Beschäftigung.
http://www.bag-ub.de/ - Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützt Beschäftigung. Umfangreiche Informationsressourcen zu dem Thema Unterstützte Beschäftigung in Deutschland, Europa und den USA, Curriculum der Berufsbegleitenden Qualifizierung für Integrationsfachkräfte, (zum Teil) Volltextzugriff auf die Zeitschrift IMPULSE die von der BAG vier Mal jährlich herausgegeben wird.
http://www.arbeitsassistenz.or.at/ - Dachverband Arbeitsassistenz Österreich, mit Links zu allen Arbeitsassistenz Anbietern in Österreich
http://www.e-u-s-e.de/ - European Union for Supported Employment - zum Zeitpunkt des Zugriffs Konstruktionsarbeiten auf der Website
http://www.wase.net/ - World Organisation for Supported Employment, mit zahlreichen Links zu nationalen Dachverbänden weltweit
http://www.apse.org/ - Association of Persons in Supported Employmet, umfangreiche Informationsressourcen über Supported Employment in den USA
http://www.afse.org.uk/ - Association for Supported Employment - Britischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung
http://www.ilo.org/ - International Labour Organisation
http://www.who.int/en/ - World Health Organisation
http://www.bagwfbm.de/ - Die Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte Menschen bietet zahlreiche Informationsressourcen.
http://www.oear.or.at/ - Auf der Homepage der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation finden sich zahlreiche Informationsressourcen und Links zu relevanten Gesetzestexten und Sozialprojekten in Österreich
http://www.bar-frankfurt.de/ - Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in Deutschland bietet einen umfassenden Downloadbereich über Forschungsberichte und Modellprojekte in der Rehabilitation für Menschen mit Behinderung
http://www.easpd.org/ - The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD fördert die Chancengleichheit von Menschen mit einer Behinderung durch effektive und hochwertige Dienstleistungssysteme in Europa. EASPD vertritt mehr als 6000 Dienstleistungsanbieterorganisationen in 22 europäischen Ländern. Zahlreiche Informations- und Downloadressourcen mit Volltextzugriff auf der englischen Homepage.
http://www.workability-international.org/indexeurope.html - Workability Europe ist ein regionales Mitglied von Workability International dem größten Organ, das Anbieter von Arbeits- und Beschäftigungsdiensten für Menschen mit einer Behinderung vertritt. Die Homepage ist auf Englisch und beinhaltet zahlreiche Positionspapiere und Informationsressourcen.
http://www.edf-feph.org/ - European Disability Federation - EDF ist ein europäischer Dachverband, der mehr als 37 Millionen behinderte Menschen in Europa vertritt. Seine Aufgabe besteht darin, den behinderten Bürgern den vollen Zugang zu den Grund- und Menschenrechten über ihre aktive Beteiligung an der Entwicklung der Politiken und der Einführung in die Europäische Union zu gewährleisten. Die Website ist auf Englisch oder Französisch und beinhaltet zahlreiche Informations- und Downloadressourcen.
http://www.inclusion-europe.org/ - Inclusion Europe ist eine Organisation ohne Erwerbszwecke, die sich für die Rechte und Interessen von Menschen mit geistigen Behinderungen und ihren Familien in ganz Europa einsetzt. Die Website besteht in 22 Sprachen (u.a. auch Deutsch) und beinhaltet zahlreiche Positionspapiere und Informationsressourcen mit Volltextzugriff
http://www.bmgs.bund.de/ - Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (Deutschland). Sämtliche Gesetzestexte und zahlreiche vom BMGS in Auftrag gegebene Forschungsarbeiten und Evaluationsstudien zur Bestellung oder Download.
http://www.behindertenbeauftragter.de/ - Behindertenbeauftragter der Bundesregierung (Deutschland). Auf der Website finden sich zahlreiche Begriffserklärungen zum Thema Behindertenpolitik.
http://www.bmsg.gv.at/ - Bundesministerium für Gesundheit, soziale Sicherung und Konsumentenschutz (Österreich). Sämtliche Gesetzestexte und Richtlinien sowie zahlreiche vom BMSG in Auftrag gegebene Forschungsarbeiten und Evaluationsstudien zum Download.
http://www.integrationsaemter.de/ - Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter (Deutschland). Die Website bietet eine umfangreiche "Infothek", u.a. mit der Internetversion des Fachlexikons "Behinderung und Beruf".
http://www.basb.bmsg.gv.at/ - Bundessozialamt für soziales und Behindertenwesen (Österreich). Informationen rund um das Serviceangebot des Bundessozialamtes und seinen Landesstellen für Menschen mit Behinderung und Betriebe.
https://www.arbeitsagentur.de/ - Bundesagentur für Arbeit (Deutschland). Zugriff auf die umfangreiche Statistik zu relevanten Daten des Arbeitsmarktes (z.B. Arbeitslosigkeit, Beschäftig von Menschen mit Behinderung, etc.)
http://www.ams.or.at/neu/ - Arbeitsmartservice Österreich. Zugriff auf die umfangreiche Statistik zu relevanten Daten des Arbeitsmarktes (z.B. Arbeitslosigkeit, Beschäftig von Menschen mit Behinderung, etc.)
http://www.start-labor.org/ - Europäisches Knowledge Center zur beruflichen Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Lernbehinderung. Umfangreicher Downloadbereich mit Volltextzugriff zu Artikeln, Dokumenten und Konzepten zu den Themenbereichen Ausbildung und Beschäftigung für Menschen mit Lernbehinderung.
http://www.worksupport.com/ - Informationswebsite der University of Virginia über SE. Informationen über Supported Employment Anbieter in den USA. Umfangreicher Downloadbereich mit Volltextzugriff auf Forschungsarbeiten und Evaluationsstudien über Supported Employment in den USA.
http://www.adecco-stiftung.de/ - Volltextzugriff auf Literatur zur beruflichen Integration
http://www.good-practice.de/ - Good Practice Center zur Förderung von Benachteiligten in der Berufsbildung. Volltextzugriff auf Konzepte der der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Informationen über das neue Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit.
http://www.bibb.de/de/ - Bundesinstitut für berufliche Bildung. Zahlreiche Publikationen zu innovativen Konzepten der beruflichen Bildung zum Download.
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/ - Informationsportal zur Sozialpolitik in Deutschland
http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/inst05/abs/ - Forschungsarbeitsgemeinschaft "Arbeit, Bildung und Spiel als Bedingungen geistiger Entwicklung" mit Diplomarbeiten, Dissertationen und Positionspapieren zum Download.
http://www.bpb.de/ - Bundeszentrale für politische Bildung. Website beinhaltet u.a. ein Internetlexikon mit zahlreichen Informationen zu Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.
http://www.arbeitundbehinderung.at/ - Informationsportal der österreichischen Sozialpartner um Informationsdefizite auf der Seite von Unternehmen zu verringern und die Bereitschaft zur Einstellung von Menschen mit Behinderung zu erhöhen. Einige Studien im Downloadbereich verfügbar.
http://bidok.uibk.ac.at/ - Behindertenintegration und Dokumentation - Volltextarchiv der Universität Innsbruck mit zahlreichen Publikationen, Diplomarbeiten, Dissertationen und Artikel zu allen relevanten Themen welche die Integration von Menschen mit Behinderung betreffen (u.a. Arbeitswelt).
http://www.senist.net/vl/ - Europäisches Volltextarchiv mit Artikeln zu den Themen berufliche Ausbildung und Integration von Menschen mit Behinderung mit dem Schwerpunkt auf den Übergang Schule-Beruf (Transition) in verschiedenen Sprachen zum Download.
http://www.biv-integrativ.at/index2.html - Integrativer Bildungsverein. Curriculum des Lehrgangs für die "Qualifizierung zur Fachkraft in der beruflichen Integration".
http://www.persoenliche-zukunftsplanung.de/ - Zahlreiche Informationen und Materialien zum Thema Persönliche Zukunftsplanung zum Download.
http://europa.eu.int/ - Homepage der Europäischen Kommission
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_de.html - EU Informationswebsite zu den Themen Beschäftigung, soziale Angelegenheiten & Chancengleichheit
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/index_de.htm - Informationswebsite über die europäische Beschäftigungsstrategie
http://www.employment-disability.net - Employment Disablity Forum. Europäisches ExpertInnenforum zur Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung.
http://www.peerreview-employment.org/ - Peer Review of active labour market policies. Volltextzugriff auf die Peer Review Untersuchung der Arbeitsassistenz Österreich.
http://www.pakte.at/ - Territoriale Beschäftigungspakte Österreich (TEP)
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat - Eurostat - Zugriff auf zahlreiche Europäischen Statistiken (u.a. Eurobarometer 2004)
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf/en/index.htm - Homepage und Informationswebsite über den Europäischen Sozialfonds (ESF)
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_de.cfm - Homepage der Gemeinschaftsinitiative EQUAL mit zahlreichen Programminformationen und Zugriff auf Informationen über sämtliche Entwicklungspartnerschaften in Europa.
http://www.equal-de.de/ - Nationale Vertretungsstruktur EQUAL Deutschland. Informationen über die Programmausgestaltung in Deutschland.
http://www.equal-esf.at/new/de/index.html - Nationale Vertretungsstruktur EQUAL Österreich. Informationen über die Programmausgestaltung in Österreich.
http://www.equal-jobstart.de/ - Homepage der EQUAL Entwicklungspartnerschaft: "Keine Behinderung trotz Behinderung" in Deutschland.
http://www.intequal.at/ - Homepage der Equal Entwicklungspartnerschaft "Intequal" in Österreich (NÖ)
http://www.equal-aeiou.at/ - Homepage der EQUAL Entwicklungspartnerschaft: "Arbeitsfähigkeit erhalten für Individuen, Organisationen und Unternehmen" in Österreich
http://www.sensitec.info/ - Homepage der EQUAL Entwicklungspartnerschaft "Sensitec" in Österreich
http://www.mim.tsn.at/ - Homepage der EQUAL Entwicklungspartnerschaft: "Mensch im Mittelpunkt" in Österreich (Tirol)
http://www.styria-integra.at/ - Homepage der EQUAL Entwicklungspartnerschaft: "Styria Integra" in Österreich (Stmk.)
http://www.qsi.at/cgi-bin/TCgi.cgi - Homepage der EQUAL Entwicklungspartnerschaft "Quality Supported Skills for Integration" in Österreich
http://www.tsw-equal.info/ - Europäisches Netzwerk im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL mit der Schwerpunkt: "Transition from School to work"
http://www.sokrates-leonardo.de/- Homepage der EU Bildungsprogramme SOKRATES und LEONARDO mit Programminformationen.
http://www.leonardodavinci.at/ - LEONARDO Nationalagentur Österreich
http://www.quip.at/ - Homepage des LEONARDO Projektes « Quality in Practice »
|
Geburtsdatum und Ort: |
13.01.1980 in Wien |
|
Schulen und Ausbildung: |
1986 - 1989 deutsche Volksschule Algier, Algerien 1989 - 1990 Volksschule, 1080 Wien, Pfeilgasse 1990 - 1994 Gymnasium, 1150 Wien, auf der Schmelz 1994 - 1995 Gymnasium, 1170 Wien, Geblergasse 1995 - 1996 Bloomingdale High School, Brandon, Florida, USA 1996 - 1999 Gymnasium, 1170 Wien, Geblergasse Reifeprüfung: 1999 mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. 2000 - 2005 Studium der Pädagogik mit der empfohlenen Fächerkombination Sonder und Heilpädagogik. |
|
Berufliche Daten: |
1999 - 2000 Zivildienst am Therapieinstitut Keil 2000 - 2001 geringfügige Beschäftigung im Verein Komit (Ersatzdienst) 2002: Gründungsmitglied des Vereins "Mnemopol" (Schriftführer) für Wissenschaftliche Kommunikation und Mitarbeit am Aufbau eines Internetportals (Online Archiv) zum Austausch von studentischen Seminararbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen 2001 - 2003 Wohnbetreuung in ambulanten und Vollbetreuten Wohnformen des Verein Komit. Psychosoziale Einzelbetreuung von verhaltensauffälligen Jugendlichen. Mitarbeit an Sport- und Skibobkursen für Jugendliche mit Behinderung. Organisation und Leitung von Freizeit- und Urlaubsangeboten 2004 Mitglied des Projektkoordinationsteams im Therapieinstitut Keil für die Einreichphase zu einem Projekt der EU Gemeinschaftsinitiative EQUAL für die Entwicklungspartnerschaft: "Alternativen und Wahlmöglichkeiten für Menschen in der Beschäftigungstherapie" Aufgabengebiete: Wissenschaftliche Grundlagenforschung und Konzeptentwicklung. Vernetzung mit nationalen Projektpartnern. Organisation und Moderation von Projekttreffen. Verfassen der Antragsunterlagen 2004 Moderation der Podiumsdiskussion "Dialog über Grenzen" am Symposium Qualität in der beruflichen Integration der Lebenshilfe Ennstal seit 2004 Anstellung in den Ausbildungsgruppen desTherapieinstitut Keil als sozialwissenschaftlicher Berater.Aufgabengebiete: Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung.Netzwerkarbeit und Kontakt mit regionalen Institutionen, ArbeitgeberInnen und Vertretern der Fördergeber.Akquisition von Praktikums- und Arbeitsstellen für dieTeilnehmerInnen der Ausbildungsgruppen. Organisation und Koordination betrieblicher Praktika. Verantwortlich für die Einreicharbeiten zu einem Forschungsprojekt zur Finanzierung durch die Österreichische Nationalbank |
-
Transkription des Interviews mit Dr.In Angelika Fritzer (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz)
-
Transkription des Interviews mit Dr.In Karin Rossi (Dachverband Arbeitsassistenz Österreich, Institut für berufliche Integration)
-
Transkription des Interviews mit Walter Lackner (Lebenshilfe Ennstal)
-
Transkription des Interviews mit Mag. Michael Stadler-Vida (Europäisches Zentrum für Wohlfahrtsforschung und Sozialpolitik, Forschungsbüro Queraum für Kultur- und Sozialforschung)
-
Transkription des Interviews mit Dr. Dieter Schartmann (Integrationsamt Rheinland)
-
Transkription des Interviews mit Jörg Bungart (Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung)
-
Transkription des Interviews mit Rolf Behncke (Hamburger Arbeitsassistenz)
-
Transkription des Interviews mit Stefan Doose
-
Bericht über die Jahrestagung des Dachverbandes Arbeitsassistenz 2004
Hiermit erkläre ich, Oliver Koenig, dass die vorliegende Diplomarbeit mit dem Titel: "Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung" von mir selbst verfasst wurde, ausschließlich die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen herangezogen wurden sowie diese Arbeit oder Teile dieser Arbeit nicht zum Erwerb von Zeugnisse in anderen Lehrveranstaltungen verwendet wurde.
|
AAS |
Arbeitsassistenz |
|
ABIF |
Forschungseinrichtung |
|
ADA |
Americans with Disabilities Act |
|
AMS |
Arbeitsmarktservice (Österreich) |
|
APSE |
Association of Persons in Supported Employment |
|
ATF |
Ausgleichstaxfonds |
|
AVW |
Arbeitsmarktverwaltung (Deutschland) |
|
BA |
Bundesagentur für Arbeit (Deutschland) |
|
BAG-UB |
Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung(Deutschland) |
|
BAS |
Berufsausbildungsassistenz |
|
BBRZ |
Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum |
|
BBW |
Berufsbildungswerk |
|
BEHeinstg |
Behinderteneinstellungsgesetz |
|
BFI |
Berufsförderungsinstitut |
|
BFW |
Berufsförderungswerk |
|
BIDOK |
Behinderten Integration Dokumentation - Internet Text Archiv |
|
BIH |
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (Deutschland) |
|
BMAS |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Deutschland) |
|
BMGS |
Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (Deutschland) |
|
BMSG |
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Österreich) |
|
BMWA |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Österreich) |
|
BSB |
Bundessozialamt für Soziales und Behinderungswesen (Österreich) |
|
BSC |
Balanced Scorecard |
|
BTH |
Beschäftigungstherapie |
|
CI |
Corporate Identity |
|
DAPHNE |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
DA-VINCI |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
DIN-ISO |
Deutsche Industrie Norm - International Standardisation Organisation |
|
EFQM |
European Foundation for Quality Management - Europ. Qualitätspreis |
|
EMPLOYMENT |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
EP |
Entwicklungspartnerschaft |
|
ESF |
Europäischer Sozial Fonds |
|
EU |
Europäische Union |
|
EUSE |
European Union of Supported Employment |
|
EQUAL |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
GM |
Gender Mainstreaming |
|
HELIOS |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
HORIZON |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
IA |
Integrationsamt (Deutschland) |
|
IBI |
Institut für berufliche Integration |
|
ICF |
International Classification of Functioning, Health and Disability |
|
ICDH |
International Classification of Diseases and Health |
|
IFD |
Integrationsfachdienst |
|
IFS |
Institut für Sozialdienste |
|
ILO |
International Labor Organisation |
|
IMBA |
Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt - ist ein Profilvergleichs- und Dokumentationsverfahren für die Prävention und Rehabilitation |
|
INTEQUAL |
Entwicklungspartnerschaft der Gemeinschaftsinitiative EQUAL |
|
KASSYS |
Kasseler Systemhaus - Qualitätsmanagement Referenzmodell für Integrationsfachdienste |
|
KMU |
Forschungseinrichtung |
|
LEONARDO |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
LEWO |
Lebensqualität in Wohnstätten |
|
MELBA |
Psychologische Merkmalprofile zur Eingliederung Behinderter in Arbeit |
|
MUQ |
Modulssystem umfassendes Qualitätsmanagement für IFD |
|
NAP |
Nationaler Beschäftigungspolitischer Aktionsplan |
|
NGO |
Non Governmental Organisations |
|
NPM |
New Public Management |
|
NPO |
Non Profit Organisations |
|
NRW |
Nordrhein Westfalen |
|
OECD |
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa |
|
PCP |
Person Centered Planning |
|
PHARE |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
PSD |
Psycho- Soziale Dienste |
|
PSZ GmbH |
Psycho- Soziale Zentren |
|
QAP |
Qualität als Prozess - Qualitätsmanagementsystem |
|
QM |
Qualitätsmanagement |
|
QSI |
« Quality Supported Skills for Integration » |
|
QUIP |
« Quality in Practice » - Projekt der Gemeinschaftsinitiative |
|
RADAR |
Kernstück des E.F.Q.M. - Modells für Excellence: Results |
|
SE |
Supported Employment |
|
SGB IX |
Sozialgesetzbuch (Deutschland) |
|
SÖB |
Sozioökonomischer Betrieb |
|
SOKRATES |
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union |
|
SORA |
Forschungseinrichtung |
|
TAFÖ |
Tagesförderstätte |
|
TQL |
Teilqualifizierungslehre |
|
TQM |
Total Quality Management |
|
UB |
Unterstützte Beschäftigung |
|
UNO |
Vereinte Nationen |
|
WAG |
Wiener Assistenz Genossenschaft |
|
WfbM |
Werkstatt für behinderte Menschen |
|
WHO |
Word Health Organisation |
Quelle:
Oliver Koenig: "Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung"- dargestellt an einem Vergleich zwischen Integrationsfachdiensten in Deutschland und der Arbeitsassistenz in Österreich.
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der "Philosophie" an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, im April 2005
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 17.05.2010
