Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie bei Ao. Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese, Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Danksagung
- 1. Einleitung
- 2. Menschen mit Lernschwierigkeiten
- 3. Was ist eine Institution?
- 4. Der Ausblick und das Verstehen
- 5. Qualitative Forschung
- Schlussfolgerungen
- Literaturverzeichnis
- Eidesstattliche Erklärung
- Lebenslauf
Abbildung 1: Die Lehrerin stellt sich ihre Idealklasse vor 9
Abbildung 2: Die Lehrerin vor der wirklichen (realen) Klasse 10
Abbildung 3: Die Lehrerin vor dem behinderten Kind 10
Abbildung 4: Die Institution Geistigbehindertsein 12
Abbildung 5: Das Beziehungssystem der praktischen Assistenz 19
Abbildung 6: Das Beziehungssystem der persönlichen Assistenz 19
Abbildung 7: Das institutionelle Beziehungssystem 20
Abbildung 8: allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell 39
Abbildung 9: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse 40
Abbildung 10: Interpretationsregeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 41
Abbildung 11: Das Kategoriensystem in ihrem Zusammenhang 56
Ich danke Volker Schönwiese für die Betreuung meiner Diplomarbeit und die konstruktiven inhaltlichen Anmerkungen.
Ich danke auch der Leiterin der Werkstätte für ihre Offenheit bezüglich der teilnehmenden Beobachtung.
Danke Marian für die tatkräftige Unterstützung in der intensiven Zeit des Diplomarbeit-Schreibens. Vor allem deine Expertise in den Bereichen Grammatik und Rechtschreibung waren eine große Hilfe.
Institutionen spielen im Leben von Menschen mit Behinderungen eine große Rolle. Durch den häufig unhinterfragten, institutionalisierten Umgang mit Menschen mit Behinderungen scheint es für unsere Gesellschaft "normal" zu sein, Menschen mit Behinderungen in Institutionen unterzubringen. Durch meine Arbeit als Unterstützerin in einem Selbstvertretungsprojekt verbringe ich viel Zeit mit Betroffenen, die ihr Leben nicht in Institutionen verbringen, sondern weitgehend selbstbestimmt in eigenen Wohnungen leben und einer Arbeit im Sinne des ArbeitnehmerInnengesetzes nachgehen. Viele von ihnen mussten dafür kämpfen, um so leben zu dürfen, wie sie das wollen. Mein Zugang zum Thema Behinderung ist geprägt durch die Selbstbestimmt Leben Bewegung. Das heißt, für mich ist es nicht "normal", Menschen mit Behinderungen ohne deren Zustimmung in Institutionen unterzubringen, für mich ist es "normal", Menschen mit Behinderungen über ihre Rechte aufzuklären und sie in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen.
Die Abhängigkeit von Menschen mit Behinderungen von Institutionen ist häufig so groß, dass sie den gesamten Alltag der Betroffenen bestimmt. Geht es zum Beispiel darum, sich mit anderen Menschen zu treffen, dann ist man - mit dem Argument der Verantwortung der BetreuerInnen - auf das Entgegenkommen dieser angewiesen. In Beratungsgesprächen, in denen es darum geht, das Leben umgestalten bzw. verändern zu wollen, wird immer deutlich, wie schwierig es allen Beteiligten erscheint, dem Menschen mit Behinderung die Entscheidungsmacht über sein / ihr Leben (zurück zu) geben und somit seiner / ihrer Selbstbestimmung Raum zu geben. Aussagen von Betroffenen wie: "Ich muss mich behindert stellen" oder "ich muss behindert tun" machten mir deutlich, wie wenig Chancen die Betroffenen haben, sich ihrem Umfeld so zu präsentieren, wie sie wirklich sind. Es scheint als hätten die Nicht-Behinderten die Macht an sich gerissen und würden jede Form der Kommunikation mit ihren Vorstellungen vom Behindert-Sein dominieren.
Wie kann es sein, dass die Gesellschaft eine ganz bestimmte Gruppe erwachsener Menschen marginalisiert, infantilisiert und somit in den gesellschaftlich erzeugten Grundbedürfnissen Wohnen, Arbeit und Freizeit fremdbestimmt? Niedecken könnte mit dem Konzept der Institution Geistigbehindertsein - mit welchem ich im ersten Kapitel der Frage des Konstruktionsprozesses von Lernschwierigkeit nachgehe - eine mögliche Antwort darauf geben. Ausgehend von der Kategorie Behinderung als einer sozialen Kategorie geht es nicht um die Frage nach dem organischen Defekt, der einer Lernschwierigkeit zugrunde liegt, es geht um die "(...) organische Realität in ihrer komplizierten Verwobenheit mit der gesellschaftlichen überhaupt." (Niedecken 1989, S. 22)
Im zweiten Kapitel geht es um die Institution der Behindertenhilfe und deren Auswirkungen sowohl auf das Leben der Menschen mit Behinderungen selbst als auch auf den Gesellschaftsbereich und somit den Umgang mit Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen. Niedecken meint, Institutionen "(...) haben unter ihrer offensichtlichen Fürsorge-Aufgabe die Funktion, das Geistigbehindertsein als Institution im Sinne des Phantasmas zu organisieren und abzusichern." (ebd., S. 114) Mit den Begriffen Umhospitalisierung und Deinstitutionalisierung beschreibe ich am Ende des zweiten Kapitels die Interdependenz der Institutionen mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen.
Ausgehend von der sozialen Perspektive von Behinderung werden die organischen Ursachen auf keinen Fall negiert, spielen in Bezug auf die Fragestellung jedoch eine nachgeordnete Rolle, denn
"Behinderung als Produkt verstehen, heißt nicht, Realitäten leugnen, vielmehr die organische Realität in ihrer komplizierten Verwobenheit mit der gesellschaftlichen überhaupt erst sehen, anstatt sie zum unhinterfragbaren Schicksal zu erklären." (ebd., S.22)
Irrational erscheinendes Verhalten als "festgefahrenes Verhalten", als "Resultat erfahrener Gewalt" und somit als Überlebensstrategie oder auch als "primäre Kompensation der Auswirkung von Gewaltverhältnissen" zu verstehen bedeutet, dieses als Kompetenz der betreffenden Person zu verstehen. (vgl. Heijkoop 2009, Jantzen 1998 und 2003, Goffman 1973) Das Umfeld und der institutionelle Charakter im Umgang mit Menschen mit Behinderungen werden zu einer möglichen Ursache der Lernschwierigkeit erklärt, und diesen Prozess ein Stück weit zu verstehen ist Ziel dieser Arbeit, denn:
"kein Kind (...), sei es noch so unzweifelbar schwer organisch geschädigt, wird geistig behindert geboren. (...) Das (...) zur Welt gekommene Kind muß sich erst noch geistig entwickeln, eben unter erschwerten Bedingungen." (Niedecken 1989, S. 34)
Im empirischen Teil meiner Arbeit gehe ich der Frage nach, wie Institutionen der Behindertenhilfe mit der Kategorie Lernschwierigkeit beziehungsweise Behinderung umgehen und inwieweit diese am Konstruktionsprozess von Behinderung beteiligt sind. In Anlehnung an Niedecken stelle ich mir die Frage, wie die Institution als Organisator der Institution Geistigbehindertsein funktioniert? Mit Hilfe einer Beobachtung in einer so genannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auch Beschäftigungstherapie genannt, werde ich diesen Fragen näher kommen und die Erkenntnisse der Theorie anhand der empirisch gewonnenen Daten diskutieren.
Ich verwende in dieser Arbeit nicht, wie in der Literatur häufig zu lesen, den Begriff geistige Behinderung. Stattdessen werde ich den, von den Betroffenen selbst geforderten Begriff der Lernschwierigkeit[1] verwenden. Lernschwierigkeit ist sinngemäß mit dem Wort "geistige Behinderung" gleichzusetzen.
Ich spreche in dieser Arbeit dann von Menschen mit Behinderungen, beziehungsweise verwende ich dann den Begriff Behinderung, wenn es sich entweder um die Bezeichnung einer Kategorie (eben die Kategorie Behinderung), um ein Zitat oder eine allgemein gehaltene Aussage handelt, welche sowohl für Menschen mit körperlicher Behinderung als auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten zutrifft.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel geht es um die Frage, inwieweit Lernschwierigkeiten aus sozialer Perspektive verstanden werden können und wie der Umgang mit Lernschwierigkeiten organisiert ist.
Zahlreiche unterschiedliche Definitionen von Lernschwierigkeiten und Theorien darüber, welche Ursachen ihr zugrunde liegen könnten, existieren. Theunissen hält fest, dass es
"(...) bis heute keine einheitliche Beschreibung oder Kennzeichnung des als geistig behindert definierten Personenkreises (gibt). Im Gegenteil: es ist festzustellen, dass sich Auffassungen über geistige Behinderung zum Teil erheblich unterscheiden und dass es ein breites Spektrum verschiedener Definitionen, Theorien und Ansätze gibt (...)." (Theunissen 2005, S. 11)
Niedecken beschreibt diesen Irrweg aus wissenschaftlichen Beschreibungen als "Verwirrspiel der Theorien" und macht dies im folgenden Zitat deutlich:
"(...) eine organisch verursachte Wahrnehmungs- Verarbeitungs- Störung also. Oder der kleine Saboteur: zwei einander entgegengesetzte Konzepte, die in den Phantasien der Mutter so unvermittelt nebeneinander bestehen, wie sie zwischen den Theoretikern zur unüberbrückten Kluft geführt haben. Ist das Kind von Natur aus unfähig- oder leistet es Widerstand? Überall kehrt diese Spaltung wieder: im Streit darüber, ob autistische Menschen geistig behindert seien oder nicht, in der Behauptung eines umrissenen, allen gemeinsamen Defekts, der bis heute unnachweisbar ist, im Verhalten der autistischen Menschen, die neben oft schwerer Retardierung nicht selten einzelne herausragende Leistungen zeigen können (...)." (Niedecken 1989, S. 156)
Neben dem diffusen und unklaren Begriff der Lernschwierigkeit wird die Situation der Diagnostizierung noch unsicherer, wenn wir davon ausgehen, dass Diagnosen "(...) lediglich als Hinweis (...) auf einen vermuteten und medizinisch nachzuweisenden oder auf einen offensichtlichen organischen "Defekt" genommen werden." (ebd., S. 32) Niedecken geht noch weiter und spricht von "Verlegenheitsdiagnosen", wenn es um die
"(...) am häufigsten gestellte Diagnose (...): "Geistige Retardierung leichteren, mittleren, schweren Grades, vermutlich infolge frühkindlicher Hirnschädigung unklarer Genese (geht)." Als Ursache der oft nur vermuteten Hirnschädigung wird in solchen Fällen dann nachträglich- nachdem das Kind als geistig behindert aufgefallen ist- ein angenommener Sauerstoffmangel bei der Geburt, eine unerkannt gebliebene Enzephalitis oder ähnlich Unbestimmtes verantwortlich gemacht: eine völlig unsichere, eine Verlegenheitsdiagnose also." (ebd., S. 33)
Diese medizinisch orientierten Verlegenheitsdiagnosen gehen davon aus, dass das Kind von Geburt an eine Lernschwierigkeit hat. "Kein Kind aber, sei es noch so unzweifelbar schwer organisch geschädigt, wird geistig behindert geboren. (...) Das (...) zur Welt gekommene Kind muß sich erst noch geistig entwickeln, eben unter erschwerten Bedingungen." (ebd., S. 34)
Ein Mensch mit Lernschwierigkeiten ist jemand, der sich bei manchen Sachen schwerer tut und für manche Sachen länger braucht als andere.[2] Auch wenn ich mit dieser Definition Gefahr laufe auf Widerstand zu stoßen, bin ich davon überzeugt, dass eine Lernschwierigkeit nicht mehr, aber auch nicht weniger ist. Einwände gegen diese Definition wird es nicht zuletzt aufgrund des häufig zu beobachtenden, irrationalen und autoaggressiven Verhaltens von Menschen mit Lernschwierigkeiten geben. Tauschen wir jedoch den eher medizinisch orientierten Begriff des irrationalen Verhaltens gegen den von Heijkoop vorgeschlagenen Begriff des "festgefahrenen Verhaltens" ein, dann wechseln wir die Perspektive und die Situation bekommt eine neue Qualität. (Heijkoop 2009)
Heijkoop unterscheidet zwischen "(...) der Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung, die ein ebenso akzeptiertes Leben führen wie die meisten anderen Menschen (...)" und jener Gruppe, die Probleme haben und als Menschen mit festgefahrenem Verhalten bezeichnet werden können. (ebd., S. 15) "Sie haben nicht einfach mal ein Problem, weil manchmal etwas nicht klappt, sondern ständige, unaufhörliche Probleme. Die Art und Weise, in der diese Probleme auftreten, ist für uns "Normale" nicht immer gleich erkennbar." (ebd., S. 15)
Diese Bezeichnung verweist darauf, dass das Verhalten immer in einem Kontext stattfindet der mitgedacht werden muss wenn wir das Verhalten verstehen wollen und beinhaltet somit die soziale Perspektive von Behinderung.
Festgefahrenes Verhalten ist keine Andersartigkeit, nichts, was der Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten eigen wäre. "Auch Menschen mit normaler Entwicklung können sich festfahren, können in eine Sackgasse geraten und das Gefühl haben, keinen Weg hinaus zu finden." (ebd., S. 16)
Die Unterscheidung zwischen der Lernschwierigkeit einer Person und dem festgefahrenem Verhalten könnte hilfreich sein, weil wir aufgefordert werden, genauer und anders hinzuschauen als bisher: es ist nicht mehr sofort klar, was die Lernschwierigkeit ist. Aussagen wie, "der / die ist eben behindert" oder "der / die schlägt sich immer selber; das hat was mit seiner / ihrer Behinderung zu tun" verlieren ihre Gültigkeit.
Es geht also nicht um die Frage nach dem organischen Defekt, der einer Lernschwierigkeit zugrunde liegt, es geht um die "(...) organische Realität
in ihrer komplizierten Verwobenheit mit der gesellschaftlichen überhaupt." (Niedecken 1989, S. 22)
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in unserer Gesellschaft eine "konstruierte Randerscheinung", wenn wir von der Lernschwierigkeit als einer konstruierten Kategorie ausgehen, deren "Mitglieder" abgeschoben an den Rand und isoliert in (Sonder)Institutionen untergebracht und versorgt werden. Auf der Straße begegnen sie starrenden Blicken - es ist (noch) keineswegs "normal", verschieden zu sein. Der diskriminierende und ausschließende Umgang mit Menschen mit Lernschwierigkeiten ist ein Beweis dafür, dass "diese" Menschen unserer Gesellschaft kaum etwas wert sind und wir sie lieber gar nicht haben würden.
Beispiele dafür finden sich genug: 1999 bekamen Eltern eines behinderten Kindes "Schadenersatz" zugesprochen, weil diese das ungeborene Kind abgetrieben hätten, wären sie über die Behinderung rechtzeitig informiert worden. (vgl. Kommenda 2008, Infobox) Dass dies keinen Einzelfall darstellt, zeigt ein ähnlicher Fall im Jahre 2007.
Die Eltern eines behinderten Kindes machten für die ersten viereinhalb Jahre 204.578,52 Euro Schadenersatz geltend. (vgl. Schmid 2008, Abs. 1)
Laut Niedecken ist es der gesellschaftliche Mordauftrag, der "(...) unterschwellig, kaum greifbar, mit Fürsorge überdeckt - in den Phantasmen, die unser Denken und Fühlen über das "Geistigbehindertsein" beherrschen", unbewusst existiert und in diesen Beispielen zur Realität wird. (Niedecken 1989, S. 14)
Die Abneigung und Angst gegenüber Menschen mit Behinderungen lässt sich im Alltag immer wieder beobachten. Eine Erfahrung aus meinem Alltag: Ich stehe mit einer Frau, die im Rollstuhl sitzt und Spastikerin ist, im Fahrstuhl: "Davor habe ich am meisten Angst", meinte der neben uns stehende Mann ganz ungeniert zu seinem Freund, mit Blick auf die Rollstuhlfahrerin.
Menschen mit Behinderungen lösen Angst aus. "Zunächst und offensichtlich geht es wohl um die Angst, selbst zum / zur VersagerIn zu werden, wenn wir uns mit den "Versagern" in dieser Gesellschaft auseinandersetzen." (Niedecken 1989, S. 16) (Körperliche) Unversehrtheit, Fitness, Makellosigkeit, Gesundheit sowie Unabhängigkeit sind einige der vielen Grundvoraussetzungen für eine Partizipation an unserer Gesellschaft (vgl. Rödler 1996, S. 54) "Wir, die Normalen, kommen selbstständig im Leben zurecht, sind effektiv in unserem Tun, welches uns das Überleben in der Gesellschaft sichert. (...) Sie sind sichtbar Abhängige, also gelten sie uns als Unmündige." (Niedecken 1989, S. 16) "Unser Verhältnis zu ihnen ist bestimmt vom Anderssein oder vielmehr: von unserer Betonung dieses Andersseins. Das Anders-Sein muß um jeden Preis verteidigt werden" (ebd., S. 16f)
Dieses Anders-Sein um jeden Preis, die Angstabwehr und ständige Aufrechterhaltung der zwei Gruppen (behindert / nicht behindert) wird auch im Pflege- und Betreuungsbereich beobachtet. (vgl. Goffman 1973, S. 19f; Koch-Straube 1997, S. 251, S. 260ff) Ein Beispiel dafür ist "das Nebeneinander von zwei Kommunikationssträngen, die nicht miteinander vermittelt werden (...). Die MitarbeiterInnen reden mit den BewohnerInnen und im gleichen Atemzug mit den KollegInnen, die vorangegangenen Äußerungen kommentierend oder korrigierend." (Koch-Straube 1997, S.251)
In Anbetracht dieser Umstände könnte man - wie Rödler - zu der Überzeugung gelangen, dass die "(...) Lebensrealität von Menschen mit schwerer Beeinträchtigung eine Ent-Täuschung für die in diesem Jahrhundert in unserem Land wesentlich bedeutsamen Menschenbilder (ist), entkleidet diese ihrer halluzinatorischen Überzeugungskraft." (Rödler 1996, S. 53)
Ganz im Gegensatz zu den Alltagserfahrungen ist es in den letzten Jahren zum common sense geworden, Behinderung auch als soziale Kategorie zu definieren. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits im Jahre 1980 die gesellschaftliche Benachteiligung neben zwei weiteren Aspekten (Individuelle Schädigung und Beeinträchtigung) in ihre Definition von Behinderung aufnahm, erweiterte sie diese im Jahre 2000 zur "International Classification of Functional Disability" (ICF). "Neu an der ICF ist die Einbeziehung von Umweltfaktoren wie Assistenz- oder Heilmittelbedarf. Auch personelle Faktoren wie die Geschlechtszugehörigkeit, Alter, Ethnie sollen hinzugezogen werden." (Puschke 2005, S. 1)
Theunissen meint, dass es "(...) der Vergangenheit an (gehört), Behinderung und spezifische Störungen zu individualisieren. Stattdessen wird von einem reziproken, prozesshaften Zusammenwirken individueller (...) und sozialer (...) Faktoren ausgegangen (...)." (Theunissen 2005, S, 32)
""Geistigbehindertsein" ist das Produkt eines Prozesses, einer Auseinandersetzung (...)", schreibt auch Niedecken in ihrem Buch "Namenlos". (Niedecken 1989, S. 61) Mit psychoanalytischen Überlegungen beschreibt sie eine Theorie, die als Erklärungsansatz für den Prozess rund um die Konstruktion Lernschwierigkeit verwendet werden kann. Niedecken stellt den gesellschaftlichen Mordauftrag, die Tötungsphantasien, die damit verbundenen Schuldgefühle und das Phantasma ins Zentrum ihrer Theorie. Die gesellschaftlichen Strukturen werden als Einflussgrößen mitgedacht und die individuelle Schicksalshaftigkeit dadurch in Frage gestellt. So zum Beispiel beschreibt sie in Anlehnung an Erdheim Phantasmen[3] als "(...) Instrumente der Unbewußtmachung von gesellschaftlichen Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen." (Niedecken 1989, S. 40)
2.3. "Institution Geistigbehindertsein"[4]
Tötungsphantasien und die Angst, die Menschen mit Behinderungen bei anderen auslösen, spielen in der Analyse Niedeckens eine große Rolle. Niedecken geht, der psychoanalytischen Theorie folgend, von Abwehrmechanismen aus, die wir gebrauchen, um mit unseren Ängsten umgehen zu können. Die Folge der Abwehrmechanismen ist die konstruierte Institution Geistigbehindertsein, denn "unbewusste Abwehr führt zu impliziten Annahmen, die einen greifbaren Kulturaspekt bilden. Obwohl diese unbewusst sind, sind sie dennoch sehr mächtig und bleiben vor allem deshalb einflussreich, weil sie nicht bewusst erkannt und begründet werden." (Hinshelwood / Skogstad 2006, S. 33)
"In solchen phantasmatischen Konstrukten sind kollektiv gültige Abwehren archaischer Ängste - Ängste vorm vollkommenen Ausgeliefertsein, Ängste vor überwältigender Triebhaftigkeit, Ängste vor Bloßstellung und Demütigung, Ängste schließlich vor Vernichtung - präformiert, sie bieten sich in der Not der totalen Verunsicherung an wie Strohhalme, an die die Eltern sich klammern, um die von Untergang bedrohte Eltern-Kind-Beziehung zu retten. Die Abwehrmechanismen geben Sicherheit, zugleich aber engen sie die Wahrnehmung der Eltern von ihrem Kind, und damit auch die des Kindes von sich selbst, in einer Weise ein, die die Entfaltung von dessen Neugierde und geistigen Aktivität noch weiter einzuschränken geeignet ist." (Niedecken 1997, S. 4)
Die zur Realität gewordenen Tötungsphantasien äußern sich heute nicht mehr wie vor 70 Jahren. Das was heute stattfindet, wird im Gegensatz zum früheren Töten (im Wortsinn) von Niedecken sehr passend als "Seelenmord" bezeichnet - eine andere, nicht so offensichtliche Qualität des Tötens. (Niedecken 1989, S. 15)
In Bezug auf Menschen mit Down Syndrom beschreibt sie sehr deutlich, was unter Seelenmord zu verstehen ist:
(...) alle fürchten, sich mit "diesem Menschen" zu identifizieren- schließlich will niemand die Eigenschaften an sich wahrnehmen, die wir kollektiv auf "die Mongoloiden" projizieren: dumm- angepaßt, wehr- und hilflos, aber "süß". Mit diesem Verächtlichen können wir uns nicht identifizieren, dies können wir nur weit von uns weisen; und so kann das "mongoloide" Kind an sich nichts finden, das ihm einen Grund geben könnte, mit Stolz zu fühlen und zu sagen: Das bin ich. (ebd., S. 130)
"(...) Geistige Behinderung (wird) zu einer Institution (...), die die Tötungsimpulse, welche sich auf die Behinderten richten, unbewußt macht." (Erdheim 1989, S. 1) Die Institution ist also das, was die (negativen) Gefühle hinsichtlich Behinderungen und somit den Umgang mit den Betroffenen regelt. Sie sind
" (...) zu festen Regelsystemen verdinglichte hierarchische Interaktionsstrukturen, die nicht mehr in ihrer interaktiven Bedeutung gesehen werden, sich vielmehr naturhaft- unabänderlich darstellen. So aber sieht für uns das "Geistigbehindertsein" aus." (Niedecken 1989, S.13)
So ist es Teil der Institution Geistigbehindertsein, Diagnosen als naturhaft anzuerkennen und nicht daran zu zweifeln, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten betreut und therapiert werden müssen (von Professionellen und / oder der Familie) - eine naturhaft-unabänderliche Darstellung.
Als Organisatoren der Institution Geistigbehindertsein nennt Niedecken die Diagnose, das Phantasma und die institutionalisierten Techniken (Therapie). Den Bereich der Diagnose werde ich aus zweierlei Gründen ausblenden. Erstens: " Wenn sie (die Experten) Störungen finden, ist das gemeinsame Denken und Suchen beendet. Das ist wohlgemerkt nur das Ende für die Experten, denn für die Eltern und für die Betreuer beginnt an dieser Stelle oft ein langer (...) Weg." (Heijkoop 2009, S. 18) Und zweitens: "Die Frage nach dem "Warum" ist oft der Schrei der Verzweiflung der direkt Betroffenen, die hoffen, es gäbe irgendwo einen Knopf, den man drehen könnte und dann wäre mit einem Mal alles "vorbei"." (Hejkoop 2009, S. 18) Dennoch eine kurze Anmerkung, die es im Hinterkopf zu behalten gilt: Eine Diagnose bedeutet für Eltern neben dem Schock über das Unausweichliche immer auch eine Erleichterung, denn dem langen Weg der Unsicherheit und Verzweiflung wird schließlich ein Ende gesetzt. Wenn die Angehörigen von ihrer Schuld befreit und eine Diagnose die erhoffte Klarheit bringt, so ist dies nur auf den ersten Blick so.
"Es wird der Mutter angeboten, sie freizusprechen von der Schuld, die die Gesellschaft, anstatt sie kollektiv anzuerkennen, ihr als einzelner Betroffener aufgeladen hat; damit aber wird ja gerade, (...) anerkannt, daß es eine Individualschuld gibt, von der freizusprechen sei." (Niedecken 1989, S. 56)
Phantasmen sind gefestigte Bilder, Vorurteile und Phantasien, die wir gegenüber Menschen mit Behinderungen haben. Das Phantasma ist immer und überall präsent. Es
" (...) schreibt die Inszenierung vor wie ein Drehbuch: Ohnmacht und Allmacht werden personifiziert zu dumm- angepaßten, bis zur äußersten Selbsterniedrigung abhängigen Behinderten, die von uns- allmächtig- gefördert werden müssen einerseits; verhaltensgestörten, bis ins Extrem entfremdeten, als leibhaftige Triebe bedrohlich- faszinierenden Behinderten, deren Allmacht mittels Verhaltenstherapie "gelöscht" werden muß, andererseits." (ebd., S. 116)
Das Phantasma drängt sich in seiner allgegenwärtigen Existenz zwischen jede Art der Kommunikation. Am Beispiel der Mutter - Kind Beziehung kann davon gesprochen werden, dass durch das Phantasma "(...) die lebendigen, liebevollen Phantasien (...) (der ) Mutter zerstört wurden, und der Ort, an welchem sie gemeinsam Spielraum herstellen könnten, von der Angst der Mutter usurpiert ist." (ebd., S. 93)
Folgende Abbildungen machen die Angst vor dem Unbekannten am Beispiel der Schule deutlich:
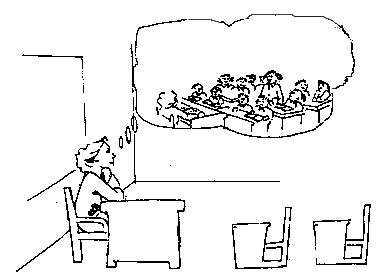
Abbildung 1: Die Lehrerin stellt sich ihre Idealklasse vor Abbildung entnommen aus: Gidoni/ Landi 1989
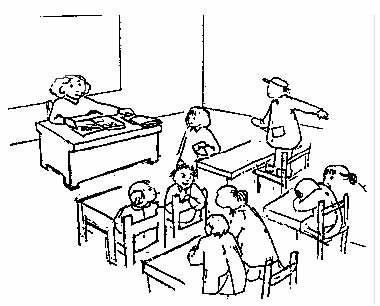
Abbildung 2: Die Lehrerin vor der wirklichen (realen) Klasse Abbildung entnommen aus: Gidoni/ Landi 1989
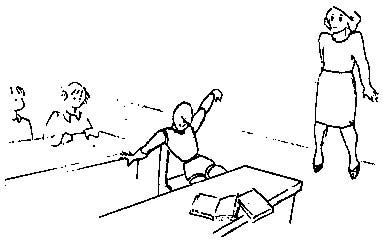
Abbildung 3: Die Lehrerin vor dem behinderten Kind Abbildung entnommen aus: Gidoni/ Landi 1989
Wenn die schreckliche Phantasie - das behinderte Kind - zur Realität wird, dominieren die beängstigenden Gefühle und der gesellschaftliche Mordauftrag wird spür- und sichtbar. Die Folge könnte als "phantasmatisch entgleiste Interaktion" formuliert werden. (Niedecken 1989, S. 108) Von nun an sind die Eltern / BetreuerInnen / LehrerInnen / die Gesellschaft der Wahrnehmung beraubt, das Phantasma ist das einzige an dem sie sich festhalten können.
"Das Gesehene, Erlebte wird zur Kenntnis genommen (...), aber die Dimension des Sinnes ist ausgeschlossen, unbewußt, verdrängt aus Angst vor den Tötungsphantasien. Mit dem Phantasma sieht alles so aus, als müsse es so sein, selbstverständlich, ohne Bedeutung, reine Natur, Schicksal, unabänderlich und unhinterfragbar. Wenn die Mutter in Panik nach dem phantasmatischen "so ist es eben mit meinem Kind" greift, dann wird dieses "so ist es" zur Verhinderung ihrer Einfühlung. Das Phantasma suggeriert ihr ja, was sie verstehen soll, und ersetzt ihr eigenes Fühlen und Wahrnehmen." (ebd., S.111)
Zugespitzt formuliert könnte es in der Abbildung so weiter gehen: Das Lehrerkollegium ist davon überzeugt, dass dieses behinderte Kind eine spezielle Förderung benötigt und versucht, dies den Eltern zu kommunizieren. Die bereits verunsicherten Eltern spüren die Abneigung gegenüber ihrem behinderten Kind und somit auch gegenüber ihnen, wollen jedoch für ihr Kind nur das Beste. Das Kind könnte in eine Sonderschule kommen. Die Eltern glauben daran, dass es so sein muss, denn "das Kind ist eben behindert". Irrationales Verhalten könnte mit derselben Annahme unhinterfragt und als bedeutungslos wahrgenommen werden. Das Phantasma drängt sich zwischen jede Form der Kommunikation und des Einfühlens.
Niedecken beschreibt diesen Vorgang sehr eindrucksvoll als Nachäff-Spiel, das von Kindern gerne gespielt wird. Äußerungen werden dabei "(...) nachgeäfft, ohne Rücksicht auf irgendeine Bedeutung." (ebd., S. 108) Das angegriffene Kind ist der Situation ohnmächtig ausgeliefert. "Durch Flucht sich aus der Affäre ziehen geht kaum, weil es nun erst recht gehört werden will. (...) Den Angriff verbal abzuwehren ist schon gar nicht möglich, weil die Regeln verbaler Auseinandersetzung mit diesem Spiel außer Kraft gesetzt sind." (ebd., S. 108) Das nachäffende Kind hört zu, ohne die Bedeutung zu hinterfragen. Wie dem / der verhaltensauffälligen BewohnerIn (nicht) zugehört wird, wenn er / sie immer wieder dieselbe, scheinbar sinnlose Floskel von sich gibt. Oder "die Anfälle, das Verstimmtsein feststellen, ohne die Frage nach dem Sinn zuzulassen (...)." (ebd., S.115)
So wird "alles Wahrgenommene (...) im Bann des Phantasmas zum Zeichen, Zeichen für irgendetwas, das nur noch als außerhalb der Beziehung gesehen wird - Zeichen für einen Organschaden; für den Irrtum des Arztes; für Schuld oder Unschuld der Mutter." (ebd., S.113)
Niedecken beschreibt die Institution "Geistigbehindertsein" als einen Teufelskreis, der immer und überall (re)-produziert wird. Diesen Teufelskreis, der die komplizierte Verwobenheit der organischen Realität mit der gesellschaftlichen repräsentiert, versuche ich mit Hilfe der folgenden, selbst gestalteten Abbildung darzustellen:
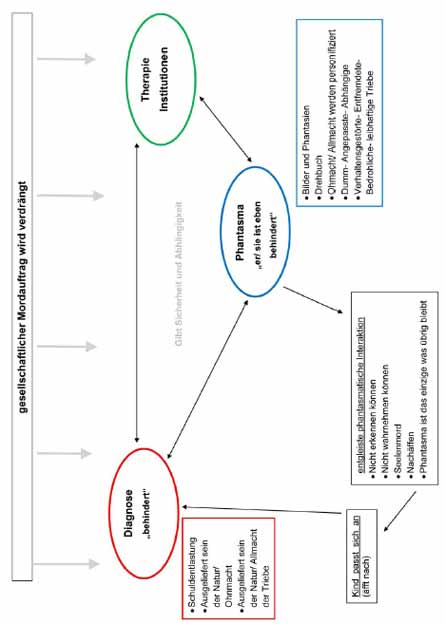
Abbildung 4: Die Institution Geistigbehindertsein
Die Therapie und im größeren Umfang die Institutionen sind Teil dieses Teufelskreises. Sie sind nach Niedecken der dritte Organisator neben der Diagnose und dem Phantasma. Man könnte sage, Institutionen tragen zur Aufrechterhaltung der Konstruktion Behinderung bei, sie sind "dazu da (...), phantasmatisch entgleiste Beziehungen zu verfestigen. Diese haben unter ihrer offensichtlichen Fürsorge-Aufgabe die Funktion, das Geistigbehindertsein als Institution im Sinne des Phantasmas zu organisieren und abzusichern." (ebd., S. 114) Man könnte auch allgemeiner formulieren: "Durch die bloße Tatsache ihres Vorhandenseins halten Institutionen menschliches Verhalten unter Kontrolle. Sie stellen Verhaltensmuster auf, welche es in eine Richtung lenken (...)." (Berger / Luckmann 1980, S. 58)
Daraus ergibt sich eine zentrale Frage: Inwieweit produzieren oder konstituieren Institutionen der Behindertenhilfe das Behindert- Sein mit, indem sie - so wie Berger und Luckmann es postulieren - Verhaltensmuster aufstellen?
Diese Frage setzt die definitorische Klärung des Begriffes "Institution" genauso wie die Herausarbeitung zentraler Merkmale und Mechanismen von Institutionen voraus.
Inhaltsverzeichnis
Der Begriff Institution beschreibt unterschiedliche Dinge und wird auch in vielfältiger Weise verwendet. Soziologisch betrachtet versteht man darunter beispielsweise einen "Komplex relativ festgefügter Handlungs- und Beziehungsmuster (...)", wodurch ein sehr breiter Institutionsbegriff deutlich wird. (Koch-Straube 1997, S.434) In diese Beschreibung würde die Institution Familie genauso fallen wie die Institution Kirche oder die Institution Geistigbehindertsein.
In diesem Kapitel geht es um Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe. Das heißt, der Begriff Institution umfasst Tages-, Wochen- oder Langzeitheime für Menschen mit Behinderungen genauso wie Werkstätten (Beschäftigungstherapie). Aselmeier fasst zusammen,
"(...) dass bei der dauerhaften Unterbringung und Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung außerhalb ihrer Herkunftsfamilie in eigens dafür konzipierten Settings in der Regel von institutioneller Betreuung gesprochen wird. Der Ort, an dem diese Betreuung geleistet wird, wird vor allem in englischsprachigen Quellentexten gemeinhin als Institution bezeichnet." (Aselmeier 2008, S. 42)
In der Praxis der Behindertenhilfe existieren dafür auch noch andere Begrifflichkeiten, wie beispielsweise Organisation, Verein oder Einrichtung.
Institutionen sind aber noch mehr als Orte der Betreuung und Unterbringung. Nach Aselmeier scheint sich der Begriff der Institution einerseits auf ein "soziales und materielles Gebilde zu beziehen, andererseits beinhaltet er (...) eine phänomenologische Dimension, die (...) auf die Wirkung von Institutionen auf ihre Insassen abzielt." (ebd., S. 42) Nicht zuletzt sind mit dem institutionellen Setting auch spezifische Strukturen sowie Denk-,Handlungs- und Beziehungssysteme verbunden. (siehe u.a. Bradl weiter unten) Dies hat beispielsweise zur Folge, dass es zu einer sogenannten Deinstitutionalisierung mehr bedarf als nur der (materiellen) Auflösung. (vgl. ebd., S. 43f)
"Erforderlich ist eine tiefere Betrachtung dessen, was unter dem Begriff Institution zu verstehen ist, wie eine mit diesem Begriff verknüpfte Umgangsweise mit Menschen mit geistiger Behinderung verändert (...) werden muss, um den Zielen der gesellschaftlichen Teilhaben, Selbstbestimmung, Bürgerrechte und Chancengleichheit näher zu kommen." (ebd., S. 44)
Aselmeier betont - wie auch Berger und Luckmann - den Zusammenhang zwischen Institutionen und den Umgang mit Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft. Auch Koch-Straube schreibt, dass die gesellschaftlichen Anforderungen in Institutionen wirksam werden und verweist somit auf deren Zusammenhang. (vgl. Koch-Straube 1997, S. 340) Wie kann die Beziehung zwischen Institution und Gesellschaft erklärt werden?
Nach Berger und Luckmann kann von Institutionalisierung gesprochen werden, "(...) sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. (...) Für ihr Zustandekommen wichtig sind die Reziprozität der Typisierung und die Typik nicht nur der Akte, sondern auch der Akteure." (Berger / Luckmann 1980, S. 58) Das heißt, Institutionalisierungen sind grundsätzlich wiederkehrende Handlungen, die zur Gewohnheit wurden und somit auch erwartet werden. Mit der Institutionalisierung sind immer auch Verhaltensregeln und Rollen verbunden. Die "(...) Handlungen des Typus X (müssen) von Handelnden des Typus X ausgeführt werden." (ebd., S. 58) Die Institution Behinderung schreibt zum Beispiel vor wie, wann, wo und von wem ein Mensch diagnostiziert wird und welche weiteren Schritte im Zuge einer bestimmten Diagnose eingeleitet werden.
"Wenn habitualisierte Handlungen Institutionen begründen, so sind die entsprechenden Typisierungen Allgemeingut. Sie sind für alle Mitglieder der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe erreichbar. Die Institution ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und individuellen Akten Typen." (ebd., S. 58)
Es entstehen Bezeichnungen oder Typisierungen wie Behinderung, Betreuung, BetreuerIn oder Zu-Betreuende. Auch die Typisierungen Mann und Frau sind beispielsweise als Produktionsleistung der Institution Geschlecht zu definieren.
"Die gesellschaftlichen Vorgänge (...) produzieren das Selbst in seiner besonderen und kulturrelevanten Eigenart. (...) Einerseits ist der Mensch sein Körper (...). Andererseits hat er einen Körper." (ebd., S. 53) So werden wir zu Mann oder Frau, Behinderte, Nicht-Behinderte, Homosexuelle, usw. Man könnte sagen, Institutionen sind "(...) ein Produkt des Menschen (...), oder genauer: eine ständige menschliche Produktion." (ebd., S. 55)
Wenn Institutionen vom Menschen produzierte Gebilde sind, so könnten wir sie doch beliebig verändern. Diese beliebige Veränderbarkeit trifft jedoch nur dann zu, wenn es sich um institutionalisierte Interaktionen einer kleinen Gruppe handelt.
"(...) der Routinehintergrund für die Aktivität von A und B bleibt für ihre eigene Intervention auf Grund von Überlegung leicht erreichbar. Obgleich die einmal etablierten Routinen als solche die Tendenz zu Dauer und Bestand haben, gibt es doch für das Bewußtsein noch die Möglichkeit, sie zu verändern oder gar abzuschaffen." (ebd., S. 62)
A und B "(...) verstehen, was sie geschaffen haben. Das ändert sich jedoch mit der Weitergabe an eine neue Generation. (...) Den Kindern ist die von den Eltern überkommene Welt nicht mehr ganz durchschaubar. (...)." (ebd., S. 63) Aus einem "so könnten wir das machen" wird ein "(...) "So [sic] macht man das"". (ebd., S. 63) "So steht sie (die Welt) ihnen (den Kindern) nun als gegebene Wirklichkeit gegenüber - wie die Natur und wie diese vielerorts undurchschaubar."(ebd., S. 63)
Folgen wir dieser Argumentation, so könnten wir annehmen, der Mensch als Produzent der Wirklichkeit / Institution und die Wirklichkeit / Institution als Produkt stehen in einer dialektischen Beziehung, das heißt Wechselwirkung zueinander. (vgl. ebd., S. 64f)
Institutionen und damit die Versorgung, Unterbringung, Verwahrung (Pflege und Schutz) und Ausgrenzung anscheinend hilfsbedürftiger Menschen in großen Anstalten, haben eine lange Tradition. Historisch betrachtet entwickelte sich der Diskurs vom Prinzip der Verwahrung über die Förderung und Rehabilitation bis hin zur Selbstbestimmung und Chancengleichheit. (vgl. Schönwiese Sommersemester 2003) Das 19. Jahrhundert ist der Beginn einer systematischen Institutionalisierung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, welche aus Gründen der Rationalisierung sowie zum Schutz der Bevölkerung, aber auch zum Schutz ihrer eigenen Person, verfolgt wurden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt es zu Bemühungen, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern - von Seiten der Professionellen, Angehörigen, aber vor allem von den Betroffenen selbst. Die Betroffenen schließen sich vermehrt in Selbsthilfegruppen (independent living, people first) zusammen, um gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Auch theoretische Konzepte, wie beispielsweise das Normalisierungsprinzip, Selbstbestimmung, Integration / Inklusion und Assistenz versuchen, einen Paradigmenwechsel hervorzurufen. Dörner gibt jedoch zu bedenken,
"während wir seit Jahrzehnten begeistert die gerade erwähnten Reformkonzepte preisen und uns permanent darin fortbilden, sinkt nicht etwa die Zahl der Heimplätze, sondern steigt viemehr kontinuierlich an (...). Die Institutionalisierungsquote der Bevölkerung beträgt jetzt schon fast ein Prozent." (Dörner 2006, S. 97f)
Ich fasse zusammen: trotz gegenläufiger Tendenzen gewinnen Institutionen im Leben von Menschen mit Behinderungen an Bedeutung.
In den 50er und 60er Jahren wurde die theoretische / wissenschaftliche Perspektive um die soziologische Dimension erweitert. Galt die Verwahrung von Andersartigkeit bis dahin als etwas Naturgegebenes und Notwendiges, so wurde diese Sichtweise durch die Soziologie erweitert. Ab diesem Zeitpunkt wurde immer deutlicher, dass "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" verstanden werden kann. (Jantzen 1998, S. 47) Die soziale Dimension von Behinderung gewinnt an Bedeutung und rückt in das Zentrum der Analyse, wodurch es zu einer Kritik an der traditionellen, das heißt auch institutionellen Betreuung von Menschen mit Behinderungen kommt. ( vgl. u.a. Schönwiese Sommersemester 2003, S. 5; Jantzen 2003, S.101; Aselmeier 2008, S. 41)
Als Hauptwerk der soziologisch ausgerichteten Wissenschaft kann das Buch von Erving Goffman (1973), "Asyle" erwähnt werden. Als teilnehmender Beobachter verbrachte Goffman viel Zeit (insgesamt 1 Jahr) in einer psychiatrischen Anstalt mit ungefähr 7000 Insassen und entwickelte die Theorie der totalen Institution. Das zentrale Thema seiner ethnographischen Studie ist, neben der Definition der totalen Institution, deren Auswirkung auf die Insassen.
Goffman zeigt sehr deutlich, dass die Insassen durch den Institutionsalltag gezwungen sind, unterschiedliche Überlebensstrategien, wie beispielsweise Anpassungsformen, zu entwickeln, und versteht Behinderung somit auch als Resultat sozialer Verhältnisse. Und es sind genau diese logisch entwickelten Strategien, die wir so oft als irrational und als die Behinderung wahrnehmen.
"Damals wie heute glaube ich, daß jede Gruppe von Menschen- Gefangene, Primitive, Piloten oder Patienten- ein eigenes Leben entwickeln, welches sinnvoll, vernünftig und normal erscheint, sobald man es aus der Nähe betrachtet (...)." (Goffman 1973, S.7)
Richten wir den Blick weg von den Professionellen hin zu den InsassInnen und versuchen wir zu verstehen, dann erscheinen uns irrationale Handlungen plötzlich als logische Konsequenzen der erlebten Erfahrungen und als großes Potential der InsassInnen. Koch-Straube schreibt, "solche Phänomene sind entschlüsselbar, wenn wir unsere üblichen Maßstäbe (...) aufgeben". (Koch-Straube 1997, S. 109) Die Behinderung kann demnach "(...) als primäre Kompensation der Auswirkung von Gewaltverhältnissen" definiert werden (Jantzen 2003, S. 102). Wenn wir dieser Argumentation folgen, dann kommen wir zu einem Schluss: "Geistigbehinderte gibt es nicht!" (Feuser 1996).
Wolfgang Jantzen (1998, S. 43- 62) beschreibt im Rahmen einer rehistorisierenden Diagnostik drei Beispiele, in denen er
"(...) aufzeigt, was es (...) bedeutet: 1) einen nahezu völlig auf Natur reduzierten Prozeß menschlicher Entwicklung dialektisch zu entschlüsseln, 2) verdinglichende Diagnosen des psychiatrischen Modells zu überwinden und 3) geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt zu begreifen." (Jantzen 1998, S. 47)
Eines dieser Beispiele handelt von einem 40 jährigen Mann namens Marius. Marius wird auch als autoaggressiv bezeichnet. Sein autoaggressives Verhalten äußert sich unter anderem durch Schläge gegen den Kopf. Während der Beratung, an der auch Marius beteiligt war, sprach ihn ein Mitarbeiter - aus Angst, er könnte es nach dem Kaffeegenuss nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffen - an und fragte, ob er nicht auf die Toilette müsse. Daraufhin "(...) passierte das, wovor alle am meisten Angst hatten: Marius schlug sich gegen den Kopf und mit dem Kopf hart gegen die Wand. Der Mitarbeiter versuchte einzugreifen, aber es nutzte nichts." (ebd., S. 52) Jantzen versuchte die Autoaggression als "(...) sinnvollen Ausdruck individueller Verzweiflung von Marius (...)" zu verstehen, und teilte ihm unmissverständlich mit, dass ihn niemand wegschicken wolle, im Gegenteil: alle möchten, dass er bei der Beratung dabei ist und auch bleibe. (ebd., S.53) "Marius wurde schlagartig ruhig, setzte sich wieder und trank weiter Kaffee. Wir lösten dann später die Situation so auf, daß wir eine Pause machten, damit er zur Toilette gehen konnte." (ebd., S.52)
Zusammengefasst kann man sagen, der Weg, "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" begreifen und verstehen zu können, führt unabdingbar über das Verstehen der sozialen Verhältnisse - hier im speziellen über die institutionelle Struktur der traditionellen Behindertenhilfe. (ebd., S.47) Denn diese "(...) bilden einen fruchtbaren Boden für Hospitalisierungssymptome, wenngleich sie Einfluß auf die Entwicklung des Einzelnen nehmen und auch von ihm beeinflußt werden". (Theunissen 1998, S. 78) Um das Verstehen der Verhältnisse soll es nun gehen.
Um dem komplexen System Institution näherzukommen, sind unter anderem die Ausführungen von Bradl und Goffman hilfreich. Bradl deshalb, weil er eine Metaebene institutioneller Systeme beschreibt und dadurch eine grundsätzliche Orientierung möglich macht. Im Gegensatz dazu liefert Goffman eine ausführliche und differenzierte Analyse der Situation der Betroffenen, die als solche einen großen Beitrag zur Diskussion der institutionalisierten Behindertenhilfe geleistet hat und aus dieser auch nicht mehr wegzudenken wäre. Mit Koch-Straube werde ich den Begriff des "Hidden Curriculum" einführen, welcher auf die inoffiziellen Regeln einer Institution hinweist. Abhängigkeit, Macht und Gewalt spielen in Institutionen eine zentrale Rolle und werden unter anderem mit dem strukturellen Gewaltbegriff von Galtung diskutiert.
Bradl (1996) teilt das institutionelle System in vier Subsysteme auf und verweist dabei auf die Grenzen der Selbstbestimmung als ein systemimmanentes Merkmal. (Bradl 1996, S.184- 202)
Die "(...) strukturellen Grenzen der Selbstbestimmung im Heim liegen im "institutionellen System" selbst, d.h.
-
in der institutionellen Struktur, d. h. in institutionellen Abläufen und Strukturen,
-
in institutionellen Denksystemen, d.h. in institutionsgeprägten Interessen, Haltungen und Einstellungen,
-
in institutionellen Handlungssystemen, d.h. im alltäglichen und professionellen Handeln,
-
in institutionellen Beziehungssystemen, d.h. in institutionstypischen Beziehungsmuster und Rollen." (ebd., S.184f)
Um eine konkrete Vorstellung davon zu bekommen, was Bradl mit dieser Differenzierung meint, werde ich die vier Untersysteme und zentrale Aspekte daraus genauer beschreiben.
Fremdbestimmung durch die institutionelle Struktur (vgl. ebd., S. 185 - 190)
Die Fremdbestimmung bezüglich der institutionellen Struktur und dem Ablauf äußert sich schon ganz grundsätzlich durch die fehlenden Wahlmöglichkeiten (vor allem für Menschen mit "schweren Mehrfachbehinderungen"), durch die den Betroffenen und ihren Angehörigen nichts anderes übrig bleibt, als beispielsweise das eine Angebot / die eine Institution zu wählen, die es in ihrer Umgebung gibt. Im Tagesablauf der Institution haben die Betroffenen kaum Einfluss auf Aufnahmeabläufe, Betreuungspersonen sowie die Organisation der Betreuung (Arbeitsabläufe).
Fremdbestimmung durch das institutionelle Denksystem (vgl. ebd., S.190 - 194)
Neben institutions-definierten Interessen (Optimierung von Förderung und Therapie) ist das institutionelle Denksystem geprägt durch die Träger-Philosophien, wobei
"als Träger von Behinderteneinrichtungen (...) Lebenshilfe, Diakonie und Caritas mittels ihrer Unterorganisationen eine zentrale Rolle (spielen). (...) In einer bestimmten geschichtlichen Epoche prägte sich ein damals sicherlich überlebensnotwendiges Bild vom Behinderten als das einer "leidenden Kreatur", die nur als "Objekt christlicher Nächstenliebe" ihren Platz in unserer ansonsten behindertenfeindlichen Gesellschaft finden konnte." (ebd., S. 190f)
Auch wenn Träger bemüht sind, dem Selbstbestimmungsaspekt nachzukommen, stehen schon allein die institutionellen Strukturen diesen Bemühungen im Weg. Kuppe bezeichnet die institutionsbezogene Sichtweise als eine historisch gewachsene, durch die der Mensch mit Behinderung droht, "wieder nach hinten zu rutschen. Beispiele dafür sind Versuche, den Auszug von Bewohnerinnen und Bewohnern aus einer großen Einrichtung zu verhindern, weil dadurch die Auslastung der Großküche nicht mehr gewährleistet sei (...)." (Kuppe 1998, S. 25)
Neben der Träger-Philosophie nennt Bradl die gesellschaftlichen Entwertungen, die das institutionelle Denksystem stark beeinflussen. Die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte BürgerInnen wird durch extreme Entwertungen und Abneigungen von Seiten der Gesellschaft gegenüber diesen sowie gegenüber der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen stark beschränkt. "Diese brisanten Tendenzen (...) prägen neue soziale Abwehrhaltungen und reaktivieren paradoxerweise das Schutzangebot großer Einrichtungen." (Bradl 1996, S.191f) Wenn die gesellschaftliche Entwertung von Behinderung neue Schutzangebote und in der Folge auch Exklusion hervorruft, dann wird die gesellschaftliche Tendenz dadurch verstärkt, beziehungsweise legitimiert. Gleichzeitig wird kontraproduktiv, vor allem hinsichtlich des Ziels der Selbstbestimmung und Normalisierung im Sinne des Normalisierungsprinzips (siehe unter anderem Thimm 1994), gearbeitet.
Eine Alternative zu diesem Vorgehen beschreibt neben Galtung (1975) auch Freire (1973). Galtung nennt für Konflikte zwischen "topdogs" (Menschen ohne Behinderungen) und "underdogs" (Menschen mit Behinderungen) eine Zwei-Phasen-Strategie: "(...) zunächst eine dissoziative Phase, die die Beteiligten (underdogs) bis zu einem gewissen Punkt Selbsterhaltung, Selbstachtung und Autarkie erwerben läßt, bis der Konflikt gleichgewichtig geworden ist (...)." (Galtung 1975, S.67) Nach der dissoziativen Phase, das heißt eine Phase der Trennung, kann der gleichgewichtige Konflikt - also ein Konflikt zwischen gleichgewichtig gewordenen Parteien - unmittelbar ausgetragen werden (assoziative Phase). (vgl. ebd., S.61ff)
Freire (1973) spricht von problemformulierender Bildungsarbeit und in diesem Zusammenhang vom Prozess des Bewusstwerdens der eigenen Situation, deren Ingangsetzung die Aufgabe der UnterstützerInnen (in Freires Worten des Lehrer-Schülers) ist. "Die Rolle des Revolutionärs besteht darin, zu befreien und zusammen mit dem Volk befreit zu werden, nicht aber es zu "gewinnen"." (Freire 1973, S.78) Es soll also nicht darum gehen, die Benachteiligten zu schützen und damit von der Gesellschaft ein Stück weit auszusperren, sondern um eine Unterstützung und Assistenz, die die Stärkung der Menschen mit Behinderung und eine Veränderung der Verhältnisse zum Ziel hat. Denn, "(...) das Objekt der Aktion der Akteure ist die Wirklichkeit, die es um der Befreiung der Menschen willen zu verändern gilt." (ebd., S. 154)
Mitarbeiterdominierte Entscheidungsabläufe sind aufgrund der Organisation großer Gruppen durch wenige Personen zwar notwendig, können jedoch mit einer bedürfnisorientierten und individuellen Unterstützung nicht vereinbart werden. ""Keine Extrawurst"- dies scheint oft ein wichtiges pädagogisches Denkmodell im Gruppenalltag zu sein. Was für den einen gilt, gilt für alle: muss für einen die Küche oder die Außentüre abgeschlossen bleiben, bleibt sie für alle zu." (Bradl 1996, S. 193f)
Fremdbestimmung durch das institutionelle Handlungssystem (vgl. ebd., S. 194 - 198)
Grundsätzlich kommt es durch die Realisierung des Selbstbestimmt-Leben Konzeptes in der Praxis zu einer schwierigen Herausforderung: "Je größer und umfassender die individuelle Hilfebedürftigkeit ist, um so größer ist auch die reale Abhängigkeit von anderen Menschen oder Hilfesystemen, um so größer damit auch die Gefahr der Fremdbestimmung." (ebd., S. 194)
Die damit verbundene Abhängigkeit von Handlungsmustern der MitarbeiterInnen wird umso größer sein, je weniger deutlich sie der / die Betroffene zum Ausdruck bringen kann. Welche nonverbalen Äußerungen wahrgenommen werden und wie diese gedeutet werden, welche Grenzen wann gesetzt werden, wann die BetreuerInnen einschreiten und wann nicht - das alles sind Fragen, deren Antworten sehr stark von der Persönlichkeit und dem theoretischen Zugang der BetreuerInnen abhängig sind.
"(...) Die institutionelle Betreuung (verschärft) die soziale Abhängigkeit des einzelnen Heimbewohners noch einmal in besonderer Weise- im Extremfall bis hin zum rechtlosen Ausgeliefertsein an die jeweiligen Betreuungspersonen." (ebd., S. 197)
Fremdbestimmung durch das institutionelle Beziehungssystem (vgl. ebd., S. 198f)
Das institutionelle Beziehungssystem unterscheidet sich ganz grundsätzlich vom Assistenzkonzept im Sinne der Selbstbestimmt-leben-Bewegung, zu der vor allem Menschen mit körperlicher Behinderung zählen. Das Assistenzkonzept im Sinn der Selbstbestimmt-leben-Bewegung geht von einer Dienstleistungsbeziehung aus, wobei der Auftraggeber / die Auftraggeberin - der Mensch mit körperlicher Behinderung - dem / der AssistentIn Anweisungen gibt. Die AssistentInnen übernehmen also (meist praktische) Tätigkeiten, damit den Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben möglich wird (vgl. Steiner 1999). Selbstbestimmt Leben Innsbruck (SLI) vergleicht die Tätigkeit persönlicher AssistentInnen mit jener Assistenz, die alle Menschen im Laufe ihres täglichen Lebens benötigen. Manche Menschen wechseln ihre Autoreifen selbst, andere geben diese Arbeit mittels eines Auftrages weiter (sei es aus Zeit- oder Kompetenzgründen). (vgl. Homepage von SLI) Die Beziehung zwischen AssistenzgeberIn und AssistenznehmerIn ist eine direkte, wobei die AssistentInnen unabhängig vom sozialen Beziehungssystem des / der AuftraggeberIn existieren. Diese Art der Assistenz bezeichnet Bradl als praktische Assistenz. Diese wird durch die Abbildung 5 veranschaulicht:
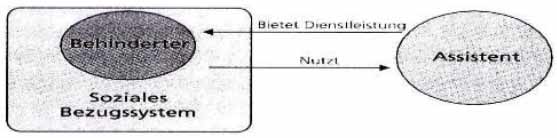
Abbildung 5: Das Beziehungssystem der praktischen Assistenz Abbildung entnommen aus: Bradl 1996, S. 198
Für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten ist die praktische Assistenz kein Konzept, das ihren Bedürfnissen gerecht werden könnte. "Die Assistenzrolle (...) ist nicht lediglich die eines praktischen Helfers, sondern ebenfalls einer wichtigen Bezugsperon, auch für die persönliche Lebensplanung und die Kommunikation." (Bradl 1996, S.198) Informationen geben und Vorschläge machen können wichtige Aufgaben der AssistentInnen sein, um dem Menschen mit Lernschwierigkeiten selbstverantwortliche Entscheidungen und somit Selbstbestimmung zu ermöglichen. Bradl nennt diese Tätigkeit persönliche Assistenz. Abbildung 6 macht deutlich, inwieweit sich das Beziehungssystem durch die persönliche Assistenz ändert.
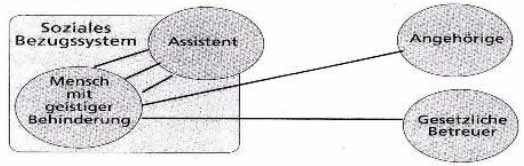
Abbildung 6: Das Beziehungssystem der persönlichen Assistenz Abbildung entnommen aus: Bradl 1996, S. 199
Im Gegensatz dazu existiert im institutionellen Betreuungsmodell "(...) ein komplexes Geflecht von Beziehungen zwischen Systemen wie Träger, Institution, Wohngruppe, begleitende Dienste, Team, einzelne Mitarbeiter und dem Bewohner. " (ebd., S. 199) Abbildung 7 soll dieses komplexe Beziehungsgeflecht illustrieren.
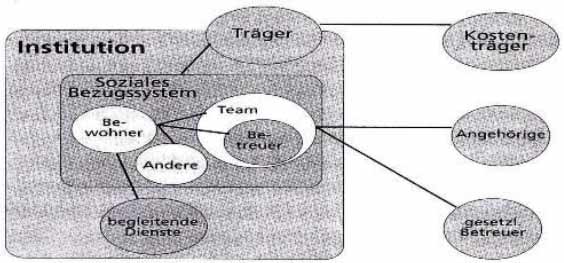
Abbildung 7: Das institutionelle Beziehungssystem Abbildung entnommen aus: Bradl 1996, S. 199
Wie man bereits bei einem ersten Blick auf die obige Grafik klar erkennen kann, ergibt sich für den / die Betroffenen durch das vielschichtige Beziehungsnetz, in welches er / sie im institutionellen Kontext eingebettet ist, automatisch ein hohes Maß an Fremdbestimmung. Interessenskonflikte auf Seiten der MitarbeiterInnen, für den betroffenen Menschen unbeeinflussbare institutionelle Abläufe, die von den Eigeninteressen der Institutionen herrühren, Vernachlässigung von Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen sowie unüberwindbare Abhängigkeiten sind oft die Folge dieser komplexen Konstruktion. Schließlich haben Institutionen nicht nur persönliche Verantwortung sondern vor allem auch bürokratische.
"Bürokratische Verantwortung bedeutet: "Der Laden muss irgendwie laufen", die Gelder müssen hereinkommen, es muss doch alles so normal wie möglich aussehen, dass wir auch von außen anerkannt werden... Persönliche Verantwortung heißt manchmal genau das Gegenteil: Wir müssen auch mal ein Chaos wagen, wir müssen ein Risiko eingehen, damit es mit einer Person weitergeht (...)." (Jantzen 2003, S. 45)
Wir haben nun gesehen, dass institutionelle Strukturen immer Elemente der Fremdbestimmung beinhalten. Institutionelle Zielvorstellungen dominieren weitestgehend den Alltag aller Beteiligten. Zu Recht betont Jantzen deshalb die Bedeutung der "ideologischen Entschlüsselung" auf dem Weg des Verstehens. (Jantzen 2003, S. 65f) "EntInstitutionalisierung ist deshalb der konsequenteste Weg", um allen Menschen ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. (ebd., S. 200)
Im Gegensatz zu Bradl, der eine Analyse der Strukturen vornimmt, konzentrierte sich Goffman auch auf die Insassen einer Institution.
Erving Goffman entwickelte in den 70er Jahren eine ausführliche Theorie der totalen Institution. Neben psychiatrischen Einrichtungen beziehen sich seine Analysen auch auf Klöster, Gefängnisse, Konzentrationslager und vieles mehr. Die Ausführungen Goffmans, zu finden in dem Buch Asyle (1973), sind deshalb so besonders, weil die Betroffenenperspektive die dominierende Perspektive ist. Es handelt sich dabei um eine gründliche und differenzierte ethnographische Studie, die eine verfeinerte Darstellung der Situation der Betroffenen ist und viele Erklärungen für Verhaltensauffälligkeiten im Sinne des Verstehens der Betroffenen liefert.
"Obwohl von ihm keine Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Menschen untersucht wurden, kann als einhellige Fachmeinung gelten, dass die beschriebenen Effekte auch in den entsprechenden Großeinrichtungen in unserem Bereich auftreten. (...) Entgegen einer oberflächlichen Rezeption hat Goffman (1972) den Begriff der totalen Institution nie auf Großeinrichtungen beschränkt gedacht." (Jantzen 2003, S. 287)
Goffmans Theorie kann als Perspektivenerweiterung genutzt werden, in der versucht wird, die Welt ein Stück weit mit den Augen der Betroffenen zu betrachten.
Die Herangehensweise Goffmans ist sowohl eine ethnographische als auch eine soziologische. Dadurch sind die Merkmale totaler Institutionen unabdingbar mit den Auswirkungen auf die Betroffenen verbunden. Die Theorie der totalen Institution zeigt, "(...) dass vieles, dass bisher der Natur zugeschrieben wurde, der menschenunwürdigen Verwaltung von Personen geschuldet war. Eine Reihe von Reaktionen (...) waren nunmehr als Konstruktionen der Einrichtung selber aufgedeckt." (ebd., S. 101)
Zentrale Merkmale totaler Institutionen sind laut Goffman, dass die Trennung der drei Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit nicht existiert und der Tagesablauf, welcher einem einzigen, allumfassenden Plan untergeordnet ist, mit einer Gruppe von SchicksalsgenossInnen geteilt wird. Das führt dazu, dass "(...) alle Angelegenheiten des Lebens (...) an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt (finden)". (Goffman 1973, S. 17) Die Trennung der Lebensbereiche Arbeit Wohnen - Freizeit hat unter anderem zu Folge, dass "(...) das Verhalten eines Insassen auf einem Schauplatz seines Handelns (...) vom Personal in Form von Kritik und Überprüfung seines Verhaltens in einem anderen Kontext vorgeworfen werden kann." (ebd., S. 44) Mit anderen Worten, "(...) die umhüllende Allgegenwart der Institution (...)" zeigt sich aufgrund der fehlenden Differenzierung der Lebensbereiche. (Koch- Straube 1997, S. 343)
Ein weiteres Merkmal bezeichnet Goffman als Diskulturation. Diskulturation, "(...) besteht (darin), daß jemand gewisse, im weiteren Bereich der Gesellschaft erforderliche Gewohnheiten verliert oder sie nicht erwerben kann." (Goffman 1973, S. 76) Sozusagen "(...) ein Verlern-Prozeß, der den Betreffenden zeitweilig unfähig macht, mit bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt fertig zu werden, wenn und falls er hinausgelangt." (ebd., S. 24) Dieser Verlern-Prozess, gekoppelt mit Stigmatisierungen, führt bei den Betroffenen zu einer Entfremdung von der Gesellschaft. Diese äußert sich beispielsweise dadurch, dass der Betroffene gar keine Bestrebungen erkennen lässt, die Institution verlassen zu wollen. Als Beispiel dafür kann die Situation in Gefängnissen herangezogen werden, in welcher der Häftling kurz vor seiner Entlassung erneut eine strafbare Handlung ausführt, mit dem Ziel einer weiteren Inhaftierung. (vgl. ebd., S. 338)
Die starke Tendenz der Betroffenen, die Institution nicht verlassen zu wollen, ist laut Goffman nicht nur Ausdruck der Entfremdung, sondern auch eine mögliche Folge der so genannten Kolonisierung. (eine Anpassungsform; siehe dazu weiter unten)
Beschränkungen und Demütigungen des Selbst sind Kennzeichen der Diskulturation, "(...) die durch vielfältige Eingriffe in die Grundlage des Selbst, in die Verfügbarkeit über die eigenen Lebensbedingungen bewirkt werden." (Jantzen 2003, S. 287) "Die Zugehörigkeit zu totalen Institutionen (...) unterbricht automatisch die Rollenplanung (...)", denn Zuschreibungen wie der Insasse, die Insassin oder der hilfsbedürftige Mensch mit Behinderung verweisen auf die einzige Rolle, die Betroffene in totalen Institutionen einnehmen und dadurch Beschränkungen hinsichtlich ihres Selbst erfahren. (ebd., S. 25)
Schwanninger drückt diese zugewiesene Rolle sehr pointiert aus:
"Das Heim hat die Aufgabe übernommen, uns Behinderte auf die Rolle vorzubereiten, die wir in der Gesellschaft zugewiesen bekommen haben:
|
arm, |
rührende Spendenaktionen, |
|
hilflos, |
Hilflosengeld, |
|
kann für seinen Lebensunterhalt, |
Beschäftigungswerkstatt, |
|
nicht aufkommen, |
Sonderförderung, |
|
lieb, |
Sonder(Sonnen)zug, |
|
nicht in der Norm, |
psychiatrische Anstalt, |
|
Geschlechtslos, |
bei normaler Sexualität, |
|
Prüfstein Gottes. |
Medikamentöse Sexualdämpfung" (Schwanninger 1982, S. 11) |
Demütigungen finden beispielsweise hinsichtlich der Sprache und des Handelns statt - durch besondere Anreden, verbale Auf- und Abwertungen oder das Fehlen von Privatsphäre. Hygiene, Verantwortung für das Leben oder Sicherheit könnten als Gründe - von Seiten der Organisation - für dieses Handeln genannt werden. Sehr oft geht es um die Effizienz und Ökonomie, wie etwa der Sachzwang, dass große Gruppen mit geringem Aufwand betreut werde müssen. (Goffman 1973, S. 32-160)
Nach der institutionsbedingten Erschütterung des Selbst "(...) bietet hauptsächlich das Privilegiensystem einen Rahmen für die persönliche Reorganisation." (ebd., S.54) Unter Privilegien sind Vergünstigungen oder Belohnungen zu verstehen, die Draußen ein grundsätzliches Recht waren.
"Da sie dem Insassen als mögliche Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, haben diese wenigen Wiedererwerbungen anscheinend einen reintegrierenden Effekt; sie stellen die Verbindung mit der ganzen verlorenen Welt wieder her (...)." (ebd,. S.55)
Unter diesen Bedingungen werden den Betroffenen Entwicklungschancen vorenthalten, beziehungsweise werden diese verhindert und die Betroffenen müssen sich an die Organisationsform (Privilegiensystem, Demütigungsprozesse,....) anpassen, und dafür entwickeln sie unterschiedliche Strategien, von denen Goffman folgende fünf nennt (vgl. ebd., S.65ff):
Rückzug aus der Situation bedeutet keinerlei Beteiligung an Interaktionsprozessen. Dieser Prozess ist auch bekannt als "Regression", "Knastpsychose" oder "Stumpfsinn".
Kompromissloser Standpunkt meint die Verweigerung jeder Art der Zusammenarbeit mit dem Personal.
Kolonisierung:
"Der Insasse nimmt den Ausschnitt der Außenwelt, den die Anstalt anbietet, für die ganze, und aus den maximalen Befriedigungen, die in der Anstalt erreichbar sind, wird eine stabile, relativ zufriedene Existenz aufgebaut." (ebd., S. 66) Der Betroffene versucht, "(...) die Rolle des perfekten Insassen zu spielen." (Jantzen 2003, S. 66) Er / sie äfft nach, wie Niedecken diese Art der Anpassung auch nennen würde. Folge dessen ist das zur Realität gewordene Bild des immer zufriedenen, dankbaren und fröhlichen Menschen mit Behinderung. (vgl. Schönwiese 2001)
Konversion:
"Offenbar macht der Insasse sich das amtliche Urteil über seine Person zu eigen und versucht die Rolle des perfekten Insassen zu spielen. Während der kolonisierte Insasse sich, so gut es geht, unter Einsatz der beschränkten Möglichkeiten ein freies Gemeinschaftsleben aufzubauen sucht, ist die Haltung des Konvertiten eher diszipliniert, moralisch und monochrom, wobei er sich als einen Menschen darzustellen sucht, mit dessen Begeisterung für die Anstalt das Personal allezeit rechnen kann." (Goffman 1973, S. 67)
Ruhig Blut bewahren ist eine Möglichkeit der Anpassung, die eine Kombination aus den bisher beschriebenen Typen und einer Reihe von sekundären Anpassungen ist- keine Anpassungsstrategie im konkreten Sinne wird radikal verfolgt.
Sekundäre Anpassung meint im Gegensatz zur primären Anpassung
"(...) ein Verhalten, bei welchem das Mitglied einer Organisation unerlaubte Mittel anwendet oder unerlaubte Ziele verfolgt, oder beides tut, um auf diese Weise die Erwartungen der Organisation hinsichtlich dessen, was er tun sollte und folglich was er sein sollte, zu umgehen." (ebd., S.185)
Es ist eine Möglichkeit, "(...) wie das Individuum sich der Rolle und dem Selbst entziehen kann, welche die Institution für es für verbindlich hält." (ebd., S. 185) Dem Insassen wird dadurch deutlich, dass er noch Kontrolle über sein Leben ausüben kann. Beispiel für eine sekundäre Anpassung ist jene Situation, in der sich der Gefangene Bücher ausleiht - nicht des Lesens wegen, sondern um Kontakt mit dem Bücherei-Personal zu haben; oder wenn ein in der Küche arbeitender Insasse für andere Insassen Essen aus der Küche schmuggelt.
Mit Looping oder Rückkoppelung im Regelkreis meint Goffman einen spezifischen Prozess, der kennzeichnend ist für totale Institutionen. (vgl. ebd., S. 43ff) Dabei wird die Beziehung zwischen dem handelnden Individuum und der Handlung zerstört. "Jemand ruft beim Insassen eine Abwehrreaktion hervor und richtet dann seinen nächsten Angriff gerade gegen diese Reaktion." (ebd., S.43)
Wenn eine Frau in einer Großeinrichtung deswegen autoaggressiv wird, weil die Beziehungen in ihrer Gruppe zerfallen und sie dafür bestraft wird, dann kann von einem Looping-Effekt gesprochen werden. (vgl. Jantzen 2003, S. 287) Konkret hat dieser Prozess folgende Auswirkungen für die Betroffenen: "Die Schutzreaktion des Individuums gegenüber einem Angriff auf sein Selbst bricht zusammen angesichts der Tatsache, daß es sich nicht, wie gewohnt, dadurch zur Wehr setzen kann, daß es sich aus der demütigenden Situation entfernt." (Goffman 1973, S. 43)
Erschütterungen des Selbst, Anpassungsstrategien sowie jede andere Art der Anpassung können als mögliche Erklärungsansätze für "irrationales Verhalten" herangezogen werden. Wenn wir uns mit Goffmans Ausführungen bewusst machen, welchen Bedingungen die Betroffenen ausgesetzt sind und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, dann sind wir dem Verstehen ein Stück weit näher gekommen.
Wie bereits in Goffmans Ausführungen kurz erwähnt, wirken sich jene Vorstellungen, die die Beteiligten einer Institution von Menschen mit Behinderung haben, auf die institutionellen Handlungen und Interaktionen aus und beinhalten somit auch die von mir eben beschriebenen Konsequenzen für die Betroffenen. Koch-Straube meint, dass diese Vorstellungen nicht gänzlich Teil der offiziellen Haltung - nachzulesen in diversen Leitbildern - sind, denn neben den offiziellen Regeln und Gesetzen gibt es auch noch etwas, das als das hidden curriculum bezeichnet werden kann.
Beim hidden curriculum[5] handelt es sich um unausgesprochene Regeln, die sich in bestimmten Handlungsweisen und Erwartungen äußern, die für AkteurInnen einer Institution selbstverständlich geworden sind. Mit Bradls Worten könnte man sagen, unausgesprochene Regeln werden häufig im Denk-, Handlungs- und Beziehungssystem einer Institution sichtbar. Diese - oft unbewussten - Regeln gründen auf einer Reihe von ontologischen und normativen Vorstellungen vom Menschen.
BetreuerInnen entscheiden beispielsweise für die Betroffenen, und die Betroffenen nehmen dieses Vorgehen in der Regel hin und akzeptieren es.
"Dann machen Sie es halt, wie Sie es meinen", "es muß eben sein", sagen die BewohnerInnen und so scheinen sich die Rollen von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen, die Entscheidungsfindung betreffend, in der Regel zu ergänzen." (Koch- Straube 1997, S.285)
Eine häufig zu beobachtende Situation kann diesen Gedanken der (unbewussten, selbstverständlich erscheinenden) Entscheidungsübernahme veranschaulichen: BetreuerInnen klopfen an die Zimmertür der BewohnerInnen, erwarten sich jedoch keine Reaktion und warten diese in der Folge auch nicht ab. (vgl. ebd., S.285)
Folgt man der Argumentation des offiziellen und inoffiziellen curriculums, so erscheint folgendes Zitat als logisch und konsequent:
"Die Organisation schreibt auch vor, was als offiziell anerkannter Maßstab des Wohlergehens, als gemeinsame Werte, als Anreiz oder als Strafe zu gelten hat. (...) Indem sie ihm sagt, was es tun soll und warum es dies tun soll, schreibt die Organisation dem Mitglied sein gesamtes Sein vor." (Goffman 1973, S.177)
Institutionen legen also nicht nur fest, was erlaubt ist und was nicht, sondern haben immer auch eine bestimmte Vorstellung von jenen Menschen, welche die Existenzberechtigung der Institution darstellen. Mit anderen Worten, Handlungen und AkteurInnen werden typisiert. (vgl. Berger / Luckmann 1980, S. 58)
Institutionen, die sich die Betreuung von Menschen mit Behinderungen zum Ziel gemacht haben, gehen beispielsweise von der Rolle des Menschen mit Behinderung als ZuBetreuenden und oft auch hilfsbedürftigen Menschen aus, für den auch Verantwortung übernommen werden muss. Im Gegensatz dazu verfolgen People First Projekte das Bild des / der ExpertIn in eigener Sache.
Nicht nur die Institution und ihre MitarbeiterInnen auf der einen Seite, sondern auch die Betroffenen auf der anderen entwickeln eine Vorstellung des Seins. Koch- Straube nennt als Beispiel die Floskel, "(...) es muß eben sein", und zitiert dabei die Antwort der BewohnerInnen des Pflegeheims auf die machtentziehende Praxis der Institution, sichtbar bei der Arbeit der BetreuerInnen. (vgl. Koch-Straube 1997, S. 195ff)
"Es geht vielmehr um die Tatsache, daß die in Organisationen gehegte Handlungserwartung eine Vorstellung vom Handelnden impliziert und daß eine Organisation daher als ein Ort angesehen werden kann, an dem Annahmen über die Identität der Beteiligten gehegt werden. Indem es die Schwelle der Anstalt überschreitet, übernimmt das Individuum die Pflicht, sich an der Situation zu beteiligen und sich in ihr entsprechend zu orientieren und anzupassen. Indem er an einer Aktivität in der Anstalt teilnimmt, übernimmt der einzelne die Verpflichtung, sich in diesem Augenblick für diese Aktivität zu engagieren. Durch diese Orientierung und durch diesen Aufwand an Aufmerksamkeit und Mühe paßt er seine Haltung sichtbar der Anstalt und der von dieser gehegten Vorstellung von ihm selbst an. Die Beteiligung an einer bestimmten Aktivität und in einem bestimmten Geist bedeutet, daß der Betreffende akzeptiert ein Mensch zu sein, der in einem bestimmten Milieu zu Hause ist. Wenn daher jede soziale Institution als ein Ort angesehen werden kann, wo systematisch Konsequenzen für das Selbst eintreten, dann können wir sie folglich auch als einen Ort ansehen, an dem der Teilnehmer sich systematisch mit diesen Konsequenzen auseinandersetzt. Vorgeschriebene Aktivitäten unterlassen oder sie in unvorschriftsmäßiger Weise oder zu unvorschriftsmäßigen Zwecken ausführen heißt, das offizielle Selbst und die ihm offiziell verfügbare Welt ablehnen. Eine Handlung vorschreiben heißt, eine Welt vorschreiben; sich vor einer Vorschrift drücken heißt, sich vor einer Identität drücken. (Goffman 1973, S.182f)
Dieses Zitat beschreibt nicht nur die impliziten Vorstellungen aller Beteiligten einer Institution, der Autor bringt auch die Abhängigkeit der Betroffenen zur Sprache. Der Satz, "(...) sich vor einer Vorschrift drücken heißt, sich vor einer Identität zu drücken" zeigt, dass keine Alternativen für die Betroffenen bleiben. (ebd., S. 182f)
Wie auch in Abbildung 7 deutlich wurde, ist die Abhängigkeit ein bedeutendes Thema für alle Beteiligten eines Institutionsalltages. (vgl. Goffman 1973, Koch- Straube 1997, Bradl 1996) So genannte ExpertInnen / Professionelle der Behindertenhilfe übernehmen die Verantwortung für das Leben der Menschen mit Behinderungen, sind zuständig für sie und haben somit das Recht und die Pflicht, über sie und ihr Leben (mit) zu entscheiden. (vgl. Illich 1979, S.15- 17)
"Viele Interaktionen zwischen Pflegenden und Gepflegten (...) erscheinen mir als Riten, die nicht nur Spielregeln im wechselseitigen Verhalten regeln (Rituale), sondern auch das Verhältnis von Abhängigkeit versus Macht festschreiben." (Koch-Straube 1997, S.296)
Das festgeschriebene Macht- und Abhängigkeitsverhältnis der traditionellen Behindertenhilfe wurde unter anderem durch die Selbstbestimmt- Leben Bewegung und das damit verbundene Assistenz-Modell in Frage gestellt. Menschen mit Behinderungen fungieren hier als ExpertInnen in eigener Sache, als RegisseurInnen ihres Lebens und erhalten dadurch Subjektstatus.
"Assistenz macht das Opfer des alten Systems (weniger mächtige Behinderte) zur mächtigeren ArbeitgeberIn und die HelferInnen zu machtlosen GehilfInnen ihrer anordnungsberechtigten ArbeitgeberInnen. Es werden die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, um den Betroffenen Selbstbestimmung zu ermöglichen." (Steiner 1999, S.6)
Die Verantwortung / Zuständigkeit liegt somit nicht mehr bei den Professionellen, sondern bei den Betroffenen selbst. Steiner definiert den Kompetenz-Begriff als Zuständigkeit für das eigene Leben, nicht zu verwechseln mit dem Begriff der "Fähigkeit". Der Kompetenzbegriff in diesem Sinne ist ein hilfreicher, denn die Kontrolle über das eigene Leben zu haben ist somit nicht mehr eine Frage des Schweregrades der Behinderung, sondern eine Frage der Unterstützung. "Niemand kann sagen: Jemand kann nicht zuständig sein für das eigen Lebens - sie / er ist zu schwer behindert!" (ebd., S.6)
"Die Zuständigkeit für das eigene Leben ist quasi ein Bestandteil der Autonomie- sprich Selbstbestimmung- eines jeden Individuums. Jeder Mensch ist autonom, hat die Zuständigkeit für sich und sein Leben, hat also alle Kompetenzen seiner eigenen Person in Händen." (ebd., S. 6)
Der Einwand, Selbstbestimmung würde der Realität vieler Menschen mit Behinderung nicht entsprechen und zu Überforderungen führen, muss ernst genommen werden. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen mit Behinderung lange Jahre in institutionalisierten Verhältnissen verbracht haben und dadurch ein Verhalten entwickelt haben, dass häufig mit erlernter Bedürfnis- und Hilflosigkeit oder auch autoaggressivem Verhalten beschrieben wird. (vgl. Theunissen 1998, S. 85f) Hier setzt die komplexe Aufgabe der Unterstützungspersonen an, die herausgefordert sind,
"(...) die Zusammenhänge zwischen hospitalisierenden Lebensbedingungen und individueller Entwicklung sowie den impliziten Sinn von Äußerungen, Handlungen und Artefakten zu erschließen und zu begreifen (...). (Dazu) bedarf es einer verstehenden Sichtweise als konstitutives Moment einer Diagnostik und assistierenden Hilfe." (ebd., S. 78)
Abhängigkeit und das einseitige Machtverhältnis würde ich als zentrale Aspekte eines unsichtbaren Gewaltverhältnisses beschreiben. Aus zahlreichen Protokollen, Beobachtungen und Gutachten wissen wir, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Situationen direkter Gewalt gekommen ist. (Zwangsmaßnahmen wie Fixierungen oder Einsperren). Auch wenn es immer noch Gewalt im Umgang mit Menschen mit Behinderungen gibt, sind die Erziehungsmethoden, mit Koch-Straubes Worten gesagt, "sanfter" geworden und der manipulative Charakter der Institution somit nicht mehr so offensichtlich. (vgl. Koch-Straube 1997, S.192f) Der manipulative Charakter ist nicht mehr so offensichtlich, er ist aber immer noch da.
Woraus besteht aber nun das von mir postulierte Gewaltverhältnis, wenn nicht mehr (nur) aus der direkten Gewalt? Johann Galtung (1975) gibt dafür eine mögliche Antwort: die strukturelle Gewalt.
Der Begriff der strukturellen Gewalt ist im Zusammenhang mit Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe und den damit verbundenen Verhältnissen ein sehr hilfreicher. Hilfreich deswegen, weil er die von mir beschriebenen Merkmale (Abhängigkeit, einseitiges Machtverhältnis, Fremdbestimmung,...) in einen Zusammenhang bringt und eine mögliche Erklärung dafür bietet. Wie bereits erwähnt, weist die strukturelle Gewalt auf das hin, was nicht mehr so deutlich erkennbar ist.
"Er (der medizinische Bereich) ist nicht deshalb das Schlachtfeld, weil es sichtbare Drohungen und Unterdrücker gibt, sondern deshalb, weil sie fast unsichtbar sind, und auch nicht deshalb, weil die Perspektive, die Werkzeuge und die Praktiker in der Medizin und in anderen helfenden Berufen von Grund auf böse sind, sondern gerade weil sie es nicht sind." (Illich 1979, S. 77f)
Die Erziehungsmethoden sind "sanfter" geworden und dadurch der manipulative Charakter der Institution nicht mehr so offensichtlich, schreibt Koch-Straube in Hinblick auf die Institution Pflegeheim. (vgl. Koch-Straube 1997, S.192f)
"Ein in der Regel freundlicher Umgangston und eine fachgerechte Behandlungsweise einerseits und eine ansprechend gestaltete Umgebung andererseits (...) verschleiern jedoch die realen Machtverhältnisse und verhindern nicht das Gefühl von Ohnmacht bei den alten Menschen." (ebd., S.192f)
Galtung selbst verschärft diese Aussagen noch, indem er festhält: "Die Opfer der direkten Gewalt gehen in die Nachrichten ein, die Opfer der strukturellen Gewalt dagegen in die Statistiken." (Galtung 1975, S. 46)
Grundsätzlich versteht Galtung unter dem Begriff Gewalt folgendes: Galtung spricht dann von Gewalt, wenn die aktuelle Verwirklichung (somatische und geistige) geringer ist als die potentielle. Gewalt ist also "(...) die Ursache für den Unterschied zwischen dem Potentiellen und Aktuellen, zwischen dem, was hätte sein können, und dem, was ist." (ebd., S.9) Ein Beispiel soll diesen Gedanken verdeutlichen. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, eine Unterstützung zu erhalten, welche es ihnen wiederum ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Viele Menschen mit Lernschwierigkeiten leben jedoch in einem institutionalisierten Umfeld, welches - wie Bradl und andere zeigen - ein selbstbestimmtes Leben unmöglich macht. Das heißt, das Potentielle ist in diesem Fall größer als das Aktuelle, somit kann in diesem Fall von Gewalt gesprochen werden.
Die strukturelle Gewalt unterscheidet Galtung von der personalen Gewalt. Erstere ist systemimmanent - Gewalt ohne unmittelbare AkteurInnen. Sie drückt sich durch ungleiche Machtverhältnisse und Lebenschancen sowie durch eine ungleiche Verteilung der Ressourcen und Entscheidungsgewalt über diese aus. (Galtung 1975, S. 9-15) Wie bereits erwähnt wird durch diesen Begriff gerade das angesprochen, was so oft übersehen wird.
"Das Objekt der personalen Gewalt nimmt die Gewalt normalerweise wahr und kann sich dagegen wehren- das Objekt der strukturellen Gewalt kann dazu überredet werden, überhaupt nichts wahrzunehmen. (...) Strukturelle Gewalt ist geräuschlos, sie zeigt sich nicht (...)." (ebd., S. 16)
Die Wahrnehmung der strukturellen Gewalt ist demnach sehr viel schwieriger und verlangt nach einer weitreichenden Analyse der Verhältnisse. Denn, "aus all dem folgt, daß der negativ als Abwesenheit von Gewalt definierte "Frieden" uns nicht nur zur Abwesenheit von direkter Gewalt, so wie sie sich im Töten ausdrückt, führt, sondern auch zu Fragen der Gleichheit und - im weitesten Sinne - der Selbstverwirklichung." (ebd., S. 47)
Institutionen können somit als Agenten struktureller Gewalt verstanden werden. Dadurch schließt sich der Kreis zu jenem Gedanken, den ich zu Beginn dieses Kapitels erwähnt habe: "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" verstehen. (Jantzen 1998, S.47)
Wie stark das institutionelle System und der damit verbundene, fremdbestimmte Umgang mit Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft verankert ist, zeigt nicht nur die historische Entwicklung und der damit verbundene zahlenmäßige Anstieg institutionalisierter Personen, (vgl. Dörner 2006, S. 98) sondern auch die zahlreichen gescheiterten Versuche einer Deinstitutionalisierung.
Deinstitutionalisierung und Enthospitalisierung werden trotz ihrer unterschiedlichen Bedeutung in der Literatur häufig als Synonyme verwendet. Wenngleich ich mit dem Begriff der Deinstitutionalisierung eine radikalere Forderung verbinde, werde ich mich an den gängigen Begrifflichkeiten orientieren.
Unter Enthospitalisierung versteht Hoffmann einen Prozess, dessen Ziel es ist, die Lebensverhältnisse von hospitalisierten Menschen dem Normalisierungsprinzip folgend zu verbessern. (vgl. Hoffmann 1998, S. 110) Dabei geht es nicht nur um eine Veränderung bezüglich der räumlichen Verhältnisse, "(...)Enthospitalisierung umfaßt ein breites Spektrum von politischen, strukturverändernden und pädagogischen Maßnahmen (...)." (Hoffmann 1998, S. 110)
Die Orientierung an den Bedürfnissen der Betroffenen muss ein zentrales Kriterium sein, wenngleich diese allzu oft im Zuge des komplexen Prozesses der Enthospitalisierung und unter
"(...) der Annahme, daß eine Ausgliederung für alle geistig behinderten Menschen wünschenswert erscheinen und zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt (...), (zu kurz kommen). Es wird von den fehlplazierten geistig behinderten Menschen ausgegangen, anstatt die Lebenssituation des Einzelnen zu berücksichtigen." (ebd., S. 118)
Kuppe spricht von der Enthospitalisierung als einem Prozess, der "(...) im Spannungsfeld der dialektischen Beziehung von Individuum und Gesellschaft, von Historie und Zukunft" steht. (Kuppe 1998, S.17). Mit Galtungs Worten könnte man sagen, Enthospitalisierung muss zu Verhältnissen führen, die personale und strukturelle Gewalt überwinden. "Wenn wir Deinstitutionalisierung wollen, so müssen wir anerkennen, dass die institutionalisierten und hospitalisierten Menschen Opfer von Gewalt sind." (Jantzen 2003, S.68) Deshalb spricht Jantzen auch nicht von schwerstbehinderten, sondern von schwerhospitalisierten Menschen. Die Verhältnisse, in denen diese Prozesse stattfinden, nennt er "Krieg als Gesellschaftszustand".
Jantzen (2003) spricht in Anlehnung an Jan Philipp Reemtsma vom "Krieg als Gesellschaftszustand" und spricht somit jene Verhältnisse an, die Galtung als strukturelle Gewaltverhältnisse bezeichnet. Was versteht Jantzen darunter?
"Krieg kommt (...) nicht aus heiterem Himmel, er wird systematisch materiell und ideologisch vorbereitet und existiert folglich als Gesellschaftszustand (...)." (Jantzen 2003, S. 56) Genauso wenig ist das Kriegsende "(...) mit der Beendigung von Krieg als Gesellschaftszustand gleichzusetzen."(ebd., S.56) Als Beispiel nennt Jantzen die Lebenshilfe für geistig Behinderte, welche sich erst lange Zeit nach Beendigung des Krieges von ihrer faschistischen Vergangenheit (Gründungsväter Villinger und Stutte) distanziert hat. Den Krieg beenden würde demnach bedeuten, friedliche Verhältnisse zu schaffen. (ebd., S. 55ff) Die Frage, die man sich im Rahmen der Deinstitutionalisierung stellen muss, lautet folglich: "Wie kann Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung stattfinden als Beendigung von Krieg als Gesellschaftszustand und zugleich als Aufbau friedlicher Verhältnisse." (ebd., S. 57) Theoretisch wurde und wird immer wieder versucht, diese Frage mit Konzepten wie Selbstbestimmung, Assistenz oder Integration zu beantworten. Praktisch scheint es jedoch so zu sein, als ob wir die Grenze der (Ab)Normalität nicht überwinden könnten. Der institutionelle Charakter bleibt trotz entgegengesetzter Bestrebungen aufrecht.
Die Folge dessen könnte das sein, was häufig als Etikettenschwindel bezeichnet wird. In Bezug auf Enthospitalisierung oder Deinstitutionalisierung könnte demnach - wenn es bei dem oberflächlichen Prozess bleibt - lediglich von Umhospitalisierung gesprochen werden.
Claudia Hoffmann definiert Umhospitalisierung als einen Begriff, "(...) der dann benutzt wird, wenn es sich nur scheinbar um Enthospitalisierung handelt, d.h. wenn hospitalisierende Bedingungen in irgendeiner Art beibehalten werden." (Hoffmann 1998, S. 109) Konkret bedeutet Umhospitalisierung, "(...) behinderte Menschen, die bislang in Einrichtungen wie Psychiatrien, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen fehlplatziert lebten, (werden) zwar ausgegliedert, aber erneut in zu großen Wohneinrichtungen mit institutionellem Charakter untergebracht (...)." (ebd., S. 115) Das Fortbestehen des institutionellen Charakters kann zusammenfassend als das Merkmal der Umhospitalisierung bezeichnet werden.
Weil Enthospitalisierung inhaltlich häufig nicht Deinstitutionalisierung meint(e) "(...) kam es in einigen Fällen zu Umhospitalisierungen von einer "Totalen Institution" (GOFFMAN) in die andere. Motor für diese "Verlegungen" war dabei weniger der einzelne Mensch als das Interesse am Erhalt oder der Erweiterung der sie übernehmenden Einrichtung." (Kuppe 1998, S. 24)
Hoffmanns Differenzierung in formale und inhaltliche Ent- und Umhospitalisierung macht noch einmal deutlicher, wie komplex dieser Vorgang ist. Formale Enthospitalisierung zielt auf Veränderungen bezüglich der Struktur ab (räumliche Integration, Dezentralisierung oder demokratisch- partnerschaftliche Organisationsstruktur), inhaltliche Enthospitalisierung vorwiegend auf das, was den unmittelbaren Alltag und das Denk-, Handlungs- und Beziehungssystem betrifft (Normalisierung des Tagesablaufes, Ermöglichung von Beziehung zwischen den Geschlechtern, Mit- und Selbstbestimmung). Beide Formen sollten möglichst gleichzeitig stattfinden, denn die Verwirklichung der formalen Enthospitalisierung ist kein Garant für gelungene inhaltliche Enthospitalisierung. (vgl. Hoffmann 1998, S. 111-116)
"Insofern sind der inhaltlichen Enthospitalisierung Grenzen gesetzt, wenn nicht gleichzeitig auch formale Enthospitalisierung stattfindet." (ebd., S. 149)
Der inflationäre Gebrauch des Begriffes Assistenz ist ein Beispiel dafür, dass die inhaltliche Ent- oder Umhospitalisierung der formalen voraus ist. Offiziell spricht man von Assistenz, praktisch handelt es sich aber weiterhin um Betreuung.
Eine ernst gemeinte Abhandlung der Frage nach den Alternativen zu Institutionen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Auf den Gedanken von Schirmer, deinstitutionalisierte Institutionen anzustreben, möchte ich dennoch kurz eingehen:
"Eine individuelle Betreuung ohne dahinterliegenden Rahmen (Institution) läuft Gefahr, bei irgendeiner gravierenden Störung, z.B. Wegfall der Bezugsperson, nicht fortgesetzt zu werden. Die Kontinuität bei bleibender Fachlichkeit wird durch die Institution gesichert. Individuelle Ausprägungen ohne verbindliche Struktur sind nicht von hoher Gestalt und somit häufig von kurzer Dauer. Aus der Sichtweise der Gestaltheorie [sic] zeigt eine Institution mit weitgehender Deinstitutionalisierung eine ausgeprägte Gestalthöhe und ist damit in hohem Maß überlebensfähig." (Schirmer 1998, S. 234)
Der Begriff der deinstitutionalisierten Institution dürfte auf den Typus einer Institution verweisen, welche ihres Institutionscharakters beraubt ist.
Der institutionelle Charakter äußert sich im Gebäude, in der Hausordnung, in den Regeln und Gesetzen genauso wie im Verhalten der Professionellen und der Gesellschaft im Umgang mit ZuBetreuenden. Dennoch ist der institutionelle Charakter mehr als die Summe dieser Bestandteile. Als institutionellen Charakter würde ich all das bezeichnen, was dem Prozess der Institution Geistigbehindertsein dienlich ist, an deren Produktion beteiligt ist und somit der Auflösung selbiger im Weg steht. Wenn wir davon ausgehen, dass es die Institution Geistigbehindertsein ist, die uns von grundlegenden Veränderungen abhält, so ist es der institutionelle Charakter, den es im Kern zu verändern gilt. Alle anderen Bestrebungen würden oberflächliche bleiben und schlussendlich als Etikettenschwindel oder Umhospitalisierungen existieren, so wie ich es bereits mit Hoffmanns Worten beschriebt: beim Prozess der Umhospitalisierung werden "(...) behinderte Menschen, die bislang in Einrichtungen wie Psychiatrien, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen fehlplatziert lebten, zwar ausgegliedert, aber erneut in zu großen Wohneinrichtungen mit institutionellem Charakter untergebracht (...)." (Hoffmann 1998, S. 115)
So scheint es auch mit der Frage nach dem Aufbau von friedlichen Verhältnissen, das heißt faire Verhältnisse in Bezug auf Gleichheit und Selbstverwirklichung, zu sein (vgl. Galtung 1975, S.14). Theoretisch scheint es zumindest, als ob wir Konzepte dafür hätten (Selbstbestimmung, Assistenz, Integration, Inklusion). Praktisch scheitern wir aber immer wieder an grundsätzlichen Überlegungen, an der konsequenten Verfolgung des Paradigmenwechsels. So kann es beispielsweise sein, dass von Selbstbestimmung oder Assistenz gesprochen wird, die dafür notwendige Machtumkehr jedoch nicht stattfindet und somit alle Anstrengungen oberflächlich bleiben. Das heißt, der institutionelle Charakter bleibt trotz entgegengesetzter Bestrebungen aufrecht.
Wenn wir also von Menschen mit festgefahrenem Verhalten, so wie Heijkoop (2009) sie bezeichnet oder mit Jantzens (2003) Worten von schwerhospitalisierten Menschen ausgehen, dann bedarf diese Sichtweise einer verstehenden. Denn, "um die Zusammenhänge zwischen hospitalisierenden Lebensbedingungen und individueller Entwicklung sowie den impliziten Sinn von Äußerungen, Handlungen und Artefakten zu erschließen und zu begreifen, bedarf es einer verstehenden Sichtweise als konstitutives Moment (...)." (Theunissen 1998, S. 78)
"Wer einmal erkannt hat, dass Menschen mit festgefahrenen Verhaltensweisen auch selbst nach Auswegen suchen, der hat den Schlüssel zur Lösung der Verhaltensprobleme entdeckt." (Heijkoop 2009, S.19)
"Mit anderen Worten: Verhaltensweisen, die für uns als normabweichend oder gar "pathologisch" gelten, können für einen Betroffenen sehr wohl zweckmäßig und sinnvoll sein sowie ein Stück Selbstbestimmung zum Ausdruck bringen. In der Hinsicht sollten wir uns vor negativen Etikettierungen und entwertenden Personenbeschreibungen hüten und der Empowerment- Philosophie folgend stets ein "positives", d.h. kompetenzorientiertes und "ganzheitliches" Menschenbild als Vehikel zum Verstehen des Anderen zugrunde legen." (Theunissen 1998, S. 75)
[5] Hidden Curriculum meint "das nicht allgemein zugängliche, also versteckte Konzept." (Koch- Straube 1997, S. 298f)
Behinderung als soziale Kategorie zu definieren würde primär bedeuten, scheinbar irrationales Verhalten als sinnvollen Ausdruck verstehen zu wollen, um in einem weiteren Schritt dem Ziel der DeInstitutionalisierung, beziehungsweise der Rückgabe der Kontrolle über das eigene Leben, näher zu kommen.
Verstehen meint einen Prozess, der
"(...) reziproke (innere) Zusammenhänge zwischen Individuum und Lebenswelt, Figur und Hintergrund, Reaktionen/ Handlungen und Lebensereignissen zu erschließen versucht, um zu hypothetischen Aussagen über Institutionalisierungseffekten und einem subjektiv bedeutsamen Sinn von Verhaltens- und Erlebensweisen eines als hospitalisiert geltenden Menschen zu gelangen." (Theunissen 1998, S. 78)
Die verstehende Sichtweise, so wie sie von Theunissen beschrieben wird, geht von einem subjektiven Sinn der Verhaltensweisen aus. Das heißt, augenscheinlich irrationales Verhalten bekommt einen Sinn, beispielsweise "(...) als primäre Kompensation der Auswirkung von Gewaltverhältnissen" (Jantzen 2003, S. 102). Jantzen spricht in diesem Zusammenhang auch von "ideologischer Entschlüsselung" und meint die Interpretation des Verhaltens als sinnvolles und nicht ideologisch als Folge eines Defektes. (ebd., S. 65)
Bezüglich der bereits geschilderten Beratungssituation mit Marius schreibt Jantzen folgendes:
"Entscheidend für mein Verstehen war es (...), die rational verstandene Reaktion der Autoaggression als sinnvollen Ausdruck individueller Verzweiflung von Marius auch in einer für mich höchst kritischen Situation aufrechterhalten zu können. Entscheidend war es aus diesem Verständnis heraus zu versuchen, einen Dialog zu führen, in dem der andere das spürte, dessen Verlust er mit der Autoaggression ausdrückte: Verständnis." (Jantzen 1998, S. 53)
Die Vorstellung, Verstehen in kritischen Situationen wie beispielsweise bei autoaggressivem Verhalten zu zeigen, löst Unbehagen aus. Die Institution Geistigbehindertsein könnte eine mögliche Erklärung dafür bieten. "Die Identifikation mit den geistig Behinderten, die nötig ist, wenn wir sie verstehen und uns mit ihnen verbünden wollen, löst und wirbelt all die Ängste auf, die durch die Institution "Geistigbehindertsein" gebunden waren." (Niedecken 1989, S. 25) Verstehen von scheinbar irrationalem Verhalten setzt die Identifikation mit den Menschen mit Behinderung voraus. Angesichts des gesellschaftlichen Mordauftrages, der gegenüber Menschen mit Behinderung existiert, erscheint dies die Schwierigste aller Aufgaben zu sein. (vgl. Niedecken 1989)
Jantzen nennt auch noch einen anderen möglichen Grund für die Ängste, die auf dem Weg zum Verstehen entstehen können: das Fehlen von Handlungsalternativen. (vgl. Jantzen 2003, S. 64)
Nicht-verstehen-wollen bedeutet die Aufrechterhaltung gegenwärtiger, fremdbestimmter Strukturen und Umgangsformen- die Aufrechterhaltung der Institution Geistigbehindertsein. "Solange sie (die Therapeutin) nicht versteht, wird die Therapeutin unter Übernahme der zugewiesenen Rolle (...) in der Inszenierung des Patienten mitspielen, somit seine frühen traumatischen Erfahrungen wiederholen." (Niedecken 1989, S. 20) Niedecken erzählt von einem Jungen namens Andy, der nichts anderes essen kann als weiße Nudeln und Schokolade. Vor anderem Essen ekelt ihn. Ständige Versuche des Personals, ihm diese Essgewohnheiten auszutreiben ("schließlich mussten auch wir essen was auf den Tisch kommt"), schlugen fehl. Der Schlüssel zum Verstehen ist nicht weit weg, wenn man die Erfahrungen, die Andy in seinem Leben mit seinem Vater- der konnte Chaos und Schmutz nicht ertragen- gemacht hat, anerkennt (vgl. Niedecken 1989):
"Als Andy einmal am Mittagstisch sitzt mit Händen, die vom Spielen noch geringfügige Schmutzspuren aufweisen, erbricht der Vater sich aus Ekel. Ist es da ein Wunder, daß das Kind verzweifelt durch magische Praktiken (...) sich müht, ebenso rein zu werden; durch seine Bevorzugung von Schokolade, die ihm offenbar eine Art väterlich gebilligtes Schmutz- und Fäkalienäquivalent ist, für seine dem Vater so unerträgliche kindliche Lust am "Schmutz"." (ebd., S. 20)
Dieses Beispiel macht deutlich, dass es beim Verstehen immer auch um die "(...) Rekonstruktion individueller Lebensgeschichten und deren Bedeutung für das betreffende Individuum (...)" geht. (Theunissen 1998, S. 78) Jantzen spricht in diesem Zusammenhang von Rehistorisierung oder rehistorisierender Diagnostik. Diese Art des Verstehens geht ebenfalls von einer sozialen Kategorie von Behinderung aus und versteht diese als Resultat gewalttätiger Erfahrungen- sowohl direkter als auch indirekter Gewalt.
"Rehistorisierende Diagnostik bedeutet (...), durch die Sphäre des Ausschlusses und der Gewalt, die ein Leben geprägt haben, durch die ideologischen Verdinglichungen der sozialen Konstruktion eines "harten Kerns" bis zur dialektischen Entschlüsselung von Situationen zu gelangen, welche durch die klassische Diagnostik als Ausdruck von Passivität und Unveränderbarkeit bestimmt werden." (Jantzen 1998, S. 47)
Und an einer anderen Stelle schreibt Jantzen über die rehistorisierende Methode:
"(...) wenn man die rehistorisierende Methode verwendet und versucht, über Verstehen die innere Standpunktlogik von Personen einzunehmen, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich fragt: "Wie hätte ich denn unter den Umständen gelebt?" Und meistens bleibt die Frage offen, ob man es besser gemacht hätte oder überhaupt so gut gemacht hätte." (Jantzen 2003, S. 104)
Unter anderem Goffman hat uns gezeigt, welch dramatische Auswirkungen Institutionserfahrungen auf die Betroffenen haben können. Deshalb muss es darum gehen, über den Weg des Verstehens den institutionellen Charakter in der Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu beseitigen. Denn:
"damals wie heute glaube ich, daß jede Gruppe von Menschen- Gefangene, Primitive, Piloten oder Patienten- ein eigenes Leben entwickeln, welches sinnvoll, vernünftig und normal erscheint, sobald man es aus der Nähe betrachtet (...)." (Goffman 1973, S.7)
Inhaltsverzeichnis
Das Ziel qualitativer Forschung ist das Verstehen und Rekonstruieren sozialer Wirklichkeiten, welche durch Interpretationsleistungen der Beteiligten ihre Bedeutung gewinnen. (vgl. Bennewitz 2010, S. 45, Atteslander 2006, S. 71)
"Die soziale Welt wird als eine durch interaktives Handeln konstituierte Welt verstanden (...). Das heißt nicht, dass die soziale Wirklichkeit jederzeit beliebig zur Disposition steht und ständig neu zu konstruieren ist. Vielmehr haben sich bestimmte Elemente zu Traditionen, Institutionen, Strukturen verdichtet, die den Einzelnen wie auch sozialen Gruppen ‚starr' entgegentreten, obwohl sie sozial erzeugt und prinzipiell änderbar sind." (Bennewitz 2010, S. 45.)
Als Merkmale qualitativer Forschung nennt Lamnek Offenheit, Kommunikativität, Interpretativität und Neutralistizität. (Lamnek 2005, S. 507ff) Was ist unter diesen Merkmalen zu verstehen?
Die Offenheit bezieht sich sowohl auf das Erhebungsinstrument, die teilnehmende Beobachtung, als auch auf die Auswertungsmethode - die qualitative Inhaltsanalyse. Offenheit im Zuge der teilnehmenden Beobachtung bedeutet, ohne konkretes Beobachtungsschema ins Feld zu gehen, um flexibel und gegenstandsbezogen agieren zu können. Obwohl Offenheit eine Grundvoraussetzung für die Beobachtung darstellt, müssen die komplexen Beobachtungssituationen dennoch bewusst gefiltert werden. (vgl. Kelle 2010, S. 111f) Atteslander nennt das Merkmal Offenheit auch Gegenstandsorientierung wobei sich in der Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse die Gegenstandsorientierung vor allem durch die induktive Kategorienbildung ausdrückt. (vgl. Atteslander 2006, S.71f, S.82)
Durch das Merkmal Kommunikativität wird die soziale Wirklichkeit aus Sicht des qualitativen Paradigmas definiert. "Im qualitativen Paradigma wird postuliert, dass soziale Wirklichkeit durch Interaktion oder Kommunikation entsteht." (Lamnek 2005, S, 508)
Soziale Wirklichkeit, Interaktion und Kommunikation zu verstehen ist das zentrale Ziel qualitativer Forschung und verlangt somit das "(...) methodologische Prinzip der Interpretativität (...). Bei der Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Form wissenschaftlich kontrollierten Fremdverstehens." (ebd., S. 510)
Mit dem Merkmal der Neutralistizität wird im qualitativen Paradigma nach der natürlichen Welt als Untersuchungsgegenstand verlangt. (vgl. ebd., S. 509) Durch diese Forderung nach Neutralistizität wird somit die Laborsituation explizit als Quelle des Erkenntnisgewinns ausgeschlossen.
Ausgehend davon, dass Behinderung auch eine soziale Kategorie ist, geht es in dieser Arbeit um das Verstehen und die Rekonstruktion der Institution Geistigbehindertsein. Wie im Theorieteil meiner Arbeit bereits deutlich wurde, kann das institutionalisierte Umfeld als eine ausschlaggebende Variable in diesem Prozess betrachtet werden. Niedecken schreibt, "kein Kind (...), sei es noch so unzweifelbar schwer organisch geschädigt, wird geistig behindert geboren. (...) Das (...) zur Welt gekommene Kind muß sich erst noch geistig entwickeln, eben unter erschwerten Bedingungen." (Niedecken 1989, S. 34) Anders formuliert diesen Gedanken Jantzen, indem er postuliert, "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" verstehen zu können. (Jantzen 1998, S. 47)
Das zugrundeliegende Forschungsinteresse fragt nach dem Umgang der Institutionen der Behindertenhilfe mit der Kategorie Lernschwierigkeit. Aus diesem Interesse resultieren folgende Forschungsfragen:
-
Wie gehen Institutionen der Behindertenhilfe mit der Kategorie Lernschwierigkeit um?
-
Wie funktionieren Institutionen als Organisator der Institution Geistigbehindertsein? (in Anlehnung an Niedecken)
-
Inwiefern sind Institutionen am Konstruktionsprozess von Behinderung beteiligt?
Die geeignete Methode für die Beantwortung dieser Fragen ist die teilnehmende Beobachtung, denn "die teilnehmende Beobachtung wird (...) bevorzugt dort eingesetzt, wo es unter spezifischen theoretischen Perspektiven um die Erfassung der sozialen Konstituierung von Wirklichkeit und um Prozesse des Aushandelns von Situationsdefinitionen (...) geht." (Lamnek 2005, S. 548) Als Auswertungsmethode gelangt die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zur Anwendung.
"(...) Das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung (ist) die Beschreibung bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer leitenden Forschungsfrage." (Atteslander 2006, S. 67) Zur Beantwortung der Fragen nach dem Konstruktionsprozess der "Institution Geistigbehindertsein" sowie den Umgang von Institutionen der Behindertenhilfe mit Menschen mit Lernschwierigkeiten ist die teilnehmende Beobachtung die geeignetste Methode. Ein Defizit der häufig verwendeten Interview-Methode ist es, dass, würde man die Betroffenen zu Wort kommen lassen, damit keine Aussagen über den tatsächlichen Umgang und über die alltäglich konstruierte Struktur der Institution in ihrer Gesamtheit getroffen werden könnten. Girtler rechtfertigt den Einsatz der teilnehmenden Beobachtung, indem er schreibt:
"(...) wenn ich wissen will, welche Strategien der Mensch bei seinem Handeln einsetzt, wie er diese plant, welche "Wirklichkeiten" hinter seinem Handeln stehen, welche Bedeutungen in den Symbolen und Ritualen des Alltagshandelns stecken u.ä., so komme ich mit den quantifizierenden Verfahren nicht weiter. Hier haben die qualitativen Verfahren und vor allem die Teilnehmende Beobachtung einzusetzen (...)." (Girtler 1989, S. 103)
Um aus den vorhandenen Ressourcen möglichst aussagekräftiges Material gewinnen zu können, führte ich eine teilweise (un)strukturierte, teilnehmende Beobachtung durch. Ich hatte zwei Wochen für die tatsächliche Beobachtung zur Verfügung, wobei ich jeweils eine Beobachtungswoche, unterbrochen von einer zweiwöchigen Pause, durchführte. Um dem Feld möglichst offen begegnen zu können, beobachtete ich in der ersten Woche überwiegend ohne vorstrukturiertem Beobachtungsschema. "Im Gegensatz zur strukturierten liegen der unstrukturierten Beobachtung keinerlei inhaltliche Beobachtungsschemata zugrunde, sondern lediglich die Leitfragen der Forschung. Dies sichert die Flexibilität und die Offenheit der Beobachtung für die Eigenarten des Feldes." (Atteslander 2006, S.82) Das leitende Forschungsinteresse und die zentralen Forschungsfragen sind dabei als grundsätzliche Orientierung und Filterung zu verwenden. Wie bereits angeführt, ist eine bewusste Filterung der komplexen Situation dabei eine Grundvoraussetzung, um überhaupt etwas Spezifisches beobachten zu können. (vgl. Kelle 2010, S. 111f) Nach dem einwöchigen, offenen Zugang im Feld unterzog ich das gesammelte Material einer ersten Analyse. Dabei entstand ein Kategoriensystem, welches als Grundlage für die zweite Beobachtungswoche diente. Durch diese Vorgehensweise konnten die bereits bestehenden Kategorien in ihrer Aussagekraft vertieft oder auch in Frage gestellt und das Kategoriensystem als Ganzes somit differenziert werden. Lamnek bestätigt die Gültigkeit dieses Verfahrens wie folgt:
"Während (...) bei der strukturierten Beobachtung der Forscher seine Beobachtungen nach einem relativ differenzierten System vorab festgelegter Kategorien macht und aufzeichnet, sind bei der unstrukturierten Beobachtung nur mehr oder weniger allgemeine Richtlinien, d.h. bestenfalls grobe Hauptkategorien als Rahmen der Beobachtungen vorhanden. Innerhalb dieses Rahmens hat der Forscher für seine Beobachtung freien Spielraum. (...) Die unstrukturierte Beobachtung (...) kann damit zu einer Voraussetzung für die strukturierte Beobachtung werden." (Lamnek 2005, S. 560)
Als potentielle Beobachtungsorte kamen die Beschäftigungstherapie (Werkstatt) oder ein Heim für Menschen mit Behinderungen in Frage. Die Entscheidung fiel letztlich, die Beobachtung in einer Beschäftigungstherapie für Menschen mit Behinderungen durchzuführen. Den Ausschlag für die Beschäftigungstherapie gaben geeignetere organisatorische und feldspezifische Voraussetzungen, wie etwa das in der Beschäftigungstherapie für Beobachtungszwecke relevante Maß an Offenheit.
Trotz dieser Offenheit, welche sich in der häufigen Anwesenheit von PraktikantInnen manifestiert, bleibt der Alltag in der Beschäftigungstherapie von Außenkontakten weitestgehend unberührt, das heißt, dass externe Personen den Arbeitsprozess im Alltag kaum beeinflussen. Laut Lamnek ist es für die Praxis der Beobachtung "(...) leichter, solche Beobachtungsfelder zu suchen, die relativ geschlossen sind, weil sie wenige Außenkontakte haben, die an sich die Beobachtung komplizieren." (Lamnek 2005, S. 587)
Dieses von der Methode geforderte Maß an Offenheit ist daher von Bedeutung, weil ein in sich geschlossenes System, wie es etwa ein Gefängnis darstellt, eine Beobachtung durch eine außenstehende Person a priori verkompliziert, wenn nicht sogar unmöglich macht.
Ein weiterer Grund, welcher meine Wahl des Beobachtungsfeldes beeinflusst hat, ist die Tatsache, dass es zur Situation in Wohnheimen bereits einige Studien gibt. (vgl. Koch-Straube 1997, Weinwurm-Krause 1997, Jantzen 2003, Reuther-Dommer / Dommer 1997)
Um den Erstkontakt zum Forschungsfeld herzustellen, kontaktierte ich mehrere WerkstattleiterInnen per E-Mail, um sie von meinem Vorhaben in Kenntnis zu setzen. Die Rückmeldungen waren unterschiedlich. Das Feedback reichte von keinerlei Reaktion über den Verweis an die nächsthöhere Stelle in der Institutionshierarchie bis hin zur sofortigen Zusage und der "Bitte um telefonische Vereinbarung zwecks des Termins eines ersten Kennenlernens und des Austausches der Vorstellungen, Möglichkeiten und des gewünschten Zeitraumes."[6]
Beim zuvor telefonisch fixierten persönlichen Erstkontakt wurde mir berichtet, dass eine Feldbeobachtung ob der häufigen Anwesenheit verschiedener PraktikantInnen problemlos möglich sei. Die Leiterin informierte mich des Weiteren über ihren Werdegang, die Organisationsstruktur der Werkstatt sowie über die Eigenschaften der KlientInnen. Der eigentliche Zweck meiner Anwesenheit wurde bei diesem Gespräch nur am Rande angesprochen:
"Irgendwann fragt sie (die Leiterin) mich, was ich beobachten möchte. Ich sage ihr, dass es darum geht, wie die Leute hier arbeiten, um den Tagesablauf, darum was hier passiert und wie ich als Beobachterin auf das Feld reagiere." [7]
Wir einigten uns auf einen Zeitraum, in welchem die zwei Beobachtungswochen stattfinden sollten. Im Anschluss an das Gespräch mit der Leiterin der Institution führte mich eine Klientin durch die Räumlichkeiten. Die zu vor erhaltene Information über die häufige Anwesenheit von PraktikantInnen fand ich durch das Verhalten der KlientInnen sofort bestätigt:
"Die Klientin(c) zeigt mir die Werkstatt und wir begegnen dabei anderen KlientInnen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich eine neue Praktikantin sei - Klientin(c) antwortet für mich sofort mit ja. Die KlientInnen kommen teilweise zu mir und geben mir die Hand, teilweise sagen sie einfach nur "Hallo". Ich habe das Gefühl, dass es hier normal ist, dass fremde Leute ein und aus gehen. Einige KlientInnen wollen auch wissen, wie lange ich da bleibe." [8]
In der ersten Woche wurde von Montag bis Freitag, jeweils von 8:00 bis 15:00 Uhr, beobachtet. Nach zweiwöchiger Pause beobachtete ich erneut von Dienstag bis Freitag, von 8:00 bis 15:00 Uhr.[9] Woche eins verbrachte ich durchgehend in der Gruppe (h), in Woche zwei wechselte ich zwischen den Gruppen. Zwischendurch zog ich mich zur Aufzeichnung handschriftlicher Feldnotizen immer wieder in ein Büro zurück. Noch am selben Tag fertigte ich mit Hilfe dieser Notizen die Beobachtungsprotokolle per Computer an und verfasste ein Forschungstagebuch. Die Beobachtungsprotokolle beinhalten die von mir beobachteten Situationen, Interaktionen und Gespräche, vor allem in Bezugnahme auf die Forschungsfragen. Um der Offenheit der qualitativen Forschung auch in den Protokollen gerecht zu werden, wurden diese in chronologischer Reihenfolge verfasst. (vgl. Lamnek 2005, S. 620f)
Im Forschungstagebuch hielt ich
"(...) ganz persönliche Gedanken (...) zur Untersuchung (...) (fest). Dies ist freilich noch kein Protokoll im engeren Sinne, zumal weder systematisch vorgegangen wird noch sich der Inhalt auf das Beobachtete unmittelbar beziehen muss. Der Nutzen solch persönlicher Aufzeichnungen ist eher in Kontrolle und Ergänzung zu sehen: als Gedächtnisstütze und Verständnishilfe." (Lamnek 2005, S. 616)
Aus dieser Beobachtungs- und Aufzeichnungsphase resultierte schließlich Datenmaterial im Umfang von etwa fünfzig DIN-A4 Seiten.
Lamnek unterscheidet bezüglich der Rolle des Beobachtenden zwischen vollständiger Teilnahme, der Teilnahme als BeobachterIn, BeobachterIn als TeilnehmerIn und der vollständigen Beobachterin / dem vollständigen Beobachter. (vgl. Lamnek 2005, S. 575ff) Eine vollständige Teilnahme konnte ich in meinem Fall ebenso ausschließen wie die Rolle der vollständigen Beobachterin, denn ich agierte weder als reale Mitarbeiterin (vollständige Teilnahme) noch als reine Beobachterin (vollständige Beobachterin). Das heißt, die für mich in Frage kommenden Rollen waren die Teilnehmerin als Beobachterin und die Beobachterin als Teilnehmerin.
Nachdem ich anfangs nicht sicher war, ob alle Beteiligten über mein Vorhaben Bescheid wussten und diese Annahme durch Situationen, in denen ich als Praktikantin wahrgenommen wurde, verstärkt wurde, agierte ich offiziell in der ersten Woche mehr als Teilnehmerin denn als Beobachterin. Vor allem durch Gespräche mit den Beteiligten und die örtlichen Umstände wurde ich in der zweiten Beobachtungswoche immer häufiger als Beobachterin wahrgenommen. Die Gründe dafür waren vielfältig. Einerseits erfuhr meine Beobachterrolle in der zweiten Beobachtungswoche verstärkte Betonung seitens der Leiterin gegenüber ihren MitarbeiterInnen. Den Grund dafür sehe ich darin, dass in der zweiten Beobachtungswoche abgesehen von meiner Person und einem Zivildiener noch ein weiterer Praktikant sowie ein zusätzlicher Zivildiener zur Unterstützung in der Werkstatt arbeiteten. Darüber hinaus vertrat die Leiterin die Auffassung, dass sich die MitarbeiterInnen zur Unterstützung hauptsächlich der Zivildiener und PraktikantInnen bedienen sollten, da ich schließlich wegen einer Untersuchung für die Universität da sei.[10]
Ein weiterer Faktor war, dass durch meine zweiwöchige Abwesenheit zwischen den Beobachtungswochen der Unterschied zwischen mir und den bisherigen PraktikantInnen deutlicher zu Tage trat, denn PraktikantInnen verbringen in der Regel ihre Praktikumszeit ohne zeitliche Unterbrechung in der Werkstatt. Das Verschwimmen der beiden Rollen - Beobachterin einerseits, Praktikantin andererseits - erleichterte mir den Umgang mit dem Dilemma der Nähe und Distanz. Von einem Dilemma der Nähe und Distanz kann deshalb gesprochen werden, weil "(...) Identifikation (...) das Element der Teilnahme und des Verstehens, während Distanz das Element der Beobachtung und der Prüfbarkeit ist." (Lamnek 2005, S. 634) Die Rolle der Praktikantin brachte mir die zum Verstehen notwendige Nähe zum und Identifikation mit dem Beobachtungsfeld. Als Beobachterin hingegen konnte ich jene Distanz wahren, die als Voraussetzung zum Protokollieren und Interpretieren notwendig ist. (vgl. Merkens 1989, S. 15)
Um die Nachvollziehbarkeit des gewonnenen Kategoriensystems zu erhöhen und dem / der LeserIn einen besseren Einblick in das zu beobachtende Feld zu geben, werde ich nun die Struktur des Feldes in der gebotenen Ausführlichkeit erläutern. Nicht nur Mayring (2008) misst der Darstellung der Entstehungssituation eine besondere Bedeutung bei, indem er die Analyse der Entstehungssituation als einen eigenen Schritt bei der Inhaltsanalyse definiert, auch Lamnek stimmt hier zu: "Das Beobachtungs feld liefert mit seinen Strukturen wichtige Interpretationshilfen für das in ihm ablaufende Geschehen, weshalb seine möglichst detaillierte Beschreibung im Forschungsbericht unverzichtbar ist." (Lamnek 2005, S. 587)
Die Werkstatt, in der ich meine Beobachtung durchführte[11], ist Teil einer überregionalen Organisation. "Sie bietet 25 (+1) Menschen mit Behinderung einen individuellen Platz zum Arbeiten und der [sic] Möglichkeit zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung."[12] Das Team der WS(b) besteht aus der Leiterin, vier MitarbeiterInnen - die jeweils für eine Arbeitsgruppe zuständig sind -, drei MitarbeiterInnen - die jeweils für eine Person zuständig sind - und einem Zivildiener. Zusätzlich kommen zweimal in der Woche ein Trainer / eine Trainerin zur Psychomotorik sowie ein Physiotherapeut / eine Physiotherapeutin. Das oberste Ziel der WS(b) ist
"(...) allen, die hier zusammenarbeiten, einen individuellen Platz zu bieten und ein möglichst angenehmes Miteinander zu pflegen. Wir wollen den Klienten die Möglichkeit bieten, lebensnah ihre fachliche, psychische, soziale und lebenspraktische Kompetenz weiter zu entwickeln und zu üben." [13]
Die Gesamtfläche beträgt 470 m², aufgeteilt auf Erdgeschoss und 1. Stock, dazu kommen 200 m² Gartenfläche. Im Parterre befinden sich ein WC sowie zwei Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen. Im 1. Stock befinden sich gleichfalls Sanitäranlagen, ein weiterer Arbeitsgruppenraum, ein Turnsaal, eine Küche mit offenem Essbereich, ein Besprechungsraum, ein Balkon mit Stiege zum Garten sowie das Büro.
Die einzelnen Arbeitsgruppen bieten unterschiedliche Angebote für die KlientInnen. In der Arbeitsgruppe(t) wird hauptsächlich der Werkstoff Ton verarbeitet, Arbeitsgruppe(h) verwendet Holz als Ausgangsmaterial, in Arbeitsgruppe(m) werden zum einen kleine Präsente aus verschiedenen Materialien angefertigt, zum anderen wird dort auch die Wäsche gewaschen, gebügelt und wieder an die jeweiligen Arbeitsgruppen ausgegeben.
In einer Art von Evaluation beurteilen die KlientInnen einmal jährlich die Werkstatt und können dabei entscheiden, ob sie in dieser Werkstatt bleiben möchten, und falls ja, in welcher Arbeitsgruppe. Daraus resultiert die Gruppenzugehörigkeit für das kommende Jahr. BezugsmitarbeiterIn ist dann die / der MitarbeiterIn, die / der für die gewählte Gruppe zuständig ist. Diese BezugsmitarbeiterInnen tragen die Hauptverantwortung für die jeweiligen KlientInnen.
Als zusätzliches Angebot gibt es an zwei Nachmittagen Psychomotorik. An zwei weiteren Nachmittagen können die KlientInnen an einer Arbeitsgruppe nach Wunsch teilnehmen.
Lamnek schreibt, "teilnehmende Beobachtung von Kommunikation wird erst sinnvoll, wenn die gemachten Aussagen und Verhaltensweisen so interpretiert werden, dass sie versteh- und nachvollziehbar sind." (Lamnek 2005, S. 575)
"Die qualitative Inhaltsanalyse stellt (...) einen Ansatz empirischer, methodisch kontrollierter Auswertung auch größerer Textcorpora dar, wobei das Material, in seinen Kommunikationszusammenhang eingebettet, nach inhaltsanalytischen Regeln auswertet wird, ohne dabei in vorschnelle Quantifizierungen zu verfallen." (Mayring 2000, Abs. 5)
Die qualitative Inhaltsanalyse bietet durch das systematische Vorgehen die notwendige Systematik, um wissenschaftliche, qualitative Auswertung nachvollziehbar zu machen. "Diese Regelgeleitetheit ermöglicht es, daß auch andere die Analyse verstehen, Nachvollziehen und überprüfen können. Erst dadurch kann Inhaltsanalyse sozialwissenschaftlichen Methodenstandards (intersubjektive Nachprüfbarkeit) genügen." (Mayring 2008, S. 12) Darüber hinaus ist die induktive Kategorienbildung eine geeignete Methode, aus dem Gegenstand heraus neue, bis dato im Verborgenen gebliebene Erklärungen zu finden und somit dem Verstehen (der sozialen Wirklichkeit des Geistigbehindertseins) näher zu kommen.
Das Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring sieht wie folgt aus:
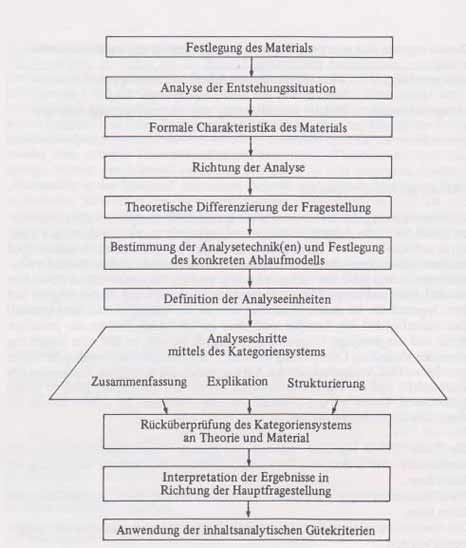
Abbildung 8: allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell Abbildung entnommen aus: Mayring 2008, S. 54
In den ersten drei Schritten des Ablaufmodells geht es um die Bestimmung des Ausgangsmaterials, welches in den vorhergegangenen Kapiteln beschrieben wurde. (vgl. Mayring 2008, S. 46f)
Die Richtung der Analyse sowie die theoretische Differenzierung der Fragestellung lassen sich dem Forschungsdesign entnehmen.
Mit der Entscheidung für eine der drei Analysetechniken (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung) - wobei auch alle drei Techniken, je nach Bedarf, zur Anwendung kommen können - ist ein konkretes Ablaufmodell verbunden. "Im Zentrum steht dabei immer die Entwicklung eines Kategoriensystems." (Mayring 2008, S. 53)
Die Technik der Strukturierung würde vorher festgelegte Ordnungskriterien verlangen, um dem Ziel, das Material auf bestimmte Aspekte hin zu untersuchen, näherzukommen. Ziel der Explikation ist das bessere Verstehen unklarer Textstellen durch das Heranziehen zusätzlichen Materials. (vgl. Mayring 2008, S. 58)
Die Analysetechnik "Zusammenfassung"
Aufgrund des Forschungsinteresses, der Fragestellung und der Größe der zu analysierenden Materialmenge orientierte ich mich nach dem Ablaufmodell der Zusammenfassung und produzierte dadurch ein größtenteils induktives Kategoriensystem. Ziel der Zusammenfassung ist es nämlich, "(...) das Material so zu reduzieren, daß die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, (in der Folge) durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist." (ebd., S. 58)
Das Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse sieht wie folgt aus:
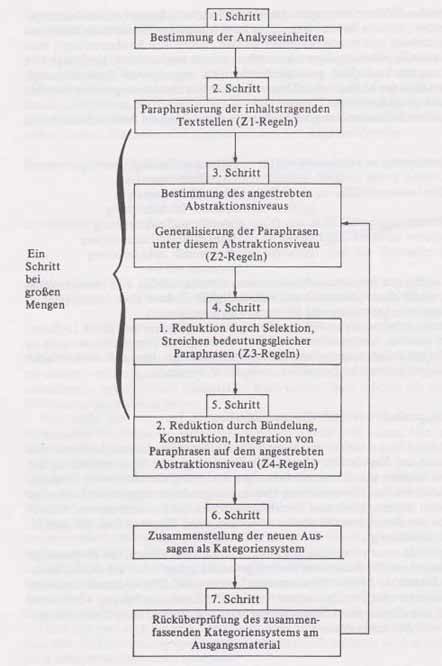
Abbildung 9: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse Abbildung entnommen aus: Mayring 2008, S. 60
Wie aus Abbildung 9 ersichtlich, stellt das Paraphrasieren der Textstellen den zweiten Schritt der zusammenfassenden Inhaltsanalyse dar. Bei diesem Schritt lehnte ich mich an folgende Interpretationsregeln an:

Abbildung 10: Interpretationsregeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse Abbildung entnommen aus: Mayring 2008, S. 62
Nach Anwendung der Interpretationsregeln werden die neu gewonnenen Aussagen zu einem Kategoriensystem zusammengefasst, welches wiederum am Ausgangsmaterial rückgeprüft werden muss.
Nun folgt ein Beispiel, an dem exemplarisch der Vorgang der Kategorienbildung nachgezeichnet wird:
Kategorie 1: Bild von Behinderung
|
Protokoll |
Paraphrase |
Generalisierung |
Kate-gorie |
|
10. März |
Die Leiterin glaubt, dass die KlientInnen den MitarbeiterInnen einen Spiegel vorhalten und ihnen zeigen, wo sie ihre Behinderungen haben. |
KlientInnen halten den MitarbeiterInnen einen Spiegel vor und zeigen ihnen, wo sie ihre Behinderungen haben. |
K1 |
|
10. März |
Weil den KlientInnen zu Hause alles abgenommen wird, werden sie dadurch behindert. |
Durch das elterliche Verhalten werden die KlientInnen in ihrer Eigenmacht behindert. |
K1 |
|
29. März |
Das Verhalten der strukturierten Eltern hindert die KlientInnen an ihrer Selbstständigkeit. |
Durch das elterliche Verhalten werden die KlientInnen in ihrer Eigenmacht behindert. |
K1 |
|
29. März |
Weil die Leiterin ihr Versprechen nicht halten kann, hat die Mitarbeiterin jetzt ein "trotziges Kind" |
KlientInnen werden als "trotzige Kinder" wahrgenommen |
K1, K3 |
|
30. März |
KlientInnen sollen brav sein, wenn der neue Mitarbeiter kommt. |
KlientInnen sollen brav sein. |
K1 |
|
30. März |
MitarbeiterInnen erklären mir, dass ich dem Klienten eine Grenze setzen muss. |
KlientInnen brauchen Grenzen. |
K1 |
|
30. März |
KlientInnen sind ein Vorbild für die Leiterin |
KlientInnen werden als Vorbild wahrgenommen. |
K1 |
Als Ergebnis der Materialbearbeitung unter Zuhilfenahme der Interpretationsregeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse kann zunächst das Kategoriensystem präsentiert werden. Im Anschluss daran werden die einzelnen Kategorien mit den theoretischen Vorannahmen in Verbindung gesetzt und diskutiert, um so einen Bogen zwischen Theorie und Empirie zu spannen.
Die Kategorien weisen keine bewusst gewählte Reihenfolge auf, sondern diese hat sich aus der chronologischen Vorgangsweise bei der Ausarbeitung des Ausgangsmaterials ergeben. Das entwickelte Kategoriensystem besteht aus zehn Kategorien und deren Unterkategorien.
Kategorie 1: Bild von Behinderung
Unterkategorie: Behinderung als soziale Konstruktion
-
Die KlientInnen werden durch das elterliche Verhalten behindert
-
Die KlientInnen werden von der Gesellschaft nicht verstanden
-
Das Verhalten der KlientInnen ist verstehbar
Unterkategorie: Der Umgang mit KlientInnen braucht eine Strategie
-
Infantilisierung
-
Objektivierung
-
KlientInnen als Vorbilder
Unterkategorie: Medizinisches Bild von Behinderung
Unterkategorie: Ohnmacht versus Allmacht
-
KlientInnen müssen gefördert werden
-
Annahme von minimalen Erfolgsaussichten seitens der MitarbeiterInnen
Unterkategorie: Behinderung als Schuldfrage
Kategorie 2: Einflüsse auf die Arbeit in der Institution
Unterkategorie: Die Bezugspersonen der KlientInnen nehmen Einfluss auf die Arbeit in der Institution
-
Erziehungsberechtigte nehmen Einfluss
-
MitarbeiterInnen vom Wohnhaus nehmen Einfluss
Unterkategorie: Die Stimmung der KlientInnen wirkt sich auf die Arbeit in der Institution aus
Unterkategorie: Die Organisation beeinflusst die Arbeit in der Institution
-
Rahmenbedingungen beeinflussen die Arbeit in der Institution
-
Führungsebenen beeinflussen die Arbeit in der Institution
Kategorie 3: Asymmetrie zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen
Kategorie 4: Abhängigkeit und Fremdbestimmung
Unterkategorie: Abhängigkeit und Fremdbestimmung von und durch das institutionelle Handlungssystem
-
Abhängigkeit von den MitarbeiterInnen und den LeiterInnen
-
Abhängigkeit von der Organisation
-
Fremdbestimmung aus organisatorischen Gründen
-
Fremdbestimmung zum Schutz vor Selbstgefährdung
Unterkategorie: Fremdbestimmung durch und Abhängigkeit von den Eltern
Kategorie 5: Verantwortungsbereiche der Werkstatt
Unterkategorie: Verantwortung der MitarbeiterInnen für die KlientInnen
-
Die MitarbeiterInnen müssen Informationen über die KlientInnen sammeln
-
Die MitarbeiterInnen sind während der Arbeitszeit für die KlientInnen verantwortlich
-
Die MitarbeiterInnen fühlen sich auch für die Freizeit der KlientInnen mitverantwortlich
-
Die MitarbeiterInnen fühlen sich auch für die Wohnsituation der KlientInnen mitverantwortlich
Unterkategorie: Das Bild von Behinderung in der Gesellschaft verändern
Unterkategorie: Elternarbeit
Unterkategorie: Teilhabe in allen Lebensbereichen zulassen
Kategorie 6: Gesundheit und Krankheit
Unterkategorie: Gesundheit als Parameter für Zufriedenheit und Glück
Unterkategorie: Krankheit als immer wiederkehrendes Thema
-
Diagnosen
-
Medikamente
Kategorie 7: Selbstbestimmung und Selbstständigkeit innerhalb des organisatorischen Rahmens
Unterkategorie: KlientInnen treffen eigene Entscheidungen
Unterkategorie: Selbstständigkeit wird gefördert
Kategorie 8: Die Werkstatt als Familienersatz und Ort des Schutzes für die KlientInnen
Unterkategorie: Die Werkstatt schützt vor der diskriminierenden Gesellschaft
Unterkategorie: Die Werkstatt als Familienersatz
-
Arbeit der MitarbeiterInnen ist Beziehungsarbeit
-
Trennung der Bereiche Freizeit / Wohnen / Arbeit verschwimmt
-
Leben in der Gemeinschaft
-
Rituale
Kategorie 9: Die Arbeit in der Werkstatt als Arbeit zwischen den Fronten
Unterkategorie: Die Ansichten der Eltern versus die Ansichten der KlientInnen
Unterkategorie: Die Ansichten der Geschäftsführung versus die Ansichten der MitarbeiterInnen und der LeiterInnen
Unterkategorie: Schutz der KlientInnen versus Förderung der KlientInnen 83
Unterkategorie: Die Ansichten der Eltern und MitarbeiterInnen im Wohnhaus versus die Ansichten der MitarbeiterInnen in der Werkstatt
Unterkategorie: Die Ansichten der LeiterInnen versus die Ansichten der MitarbeiterInnen
Kategorie 10: Die Arbeit der KlientInnen
Die einzelnen Kategorien werden nun im Detail dargestellt, diskutiert und interpretiert. Durch die Verbindung der empirisch gewonnenen Daten mit den Erkenntnissen aus der Theorie verknüpfe ich die empirischen Erkenntnisse mit den theoretischen Annahmen, woraus ein Erkenntnisgewinn folgt.
Kategorie 1: Bild von Behinderung
In den Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe existieren unterschiedlichste Bilder von Behinderung.
Die MitarbeiterInnen gehen etwa davon aus, dass die KlientInnen häufig durch das Verhalten der Eltern behindert werden und vertreten daher auch ein soziales Bild von Behinderung. Die Existenz dieses sozialen Bildes von Behinderung wird dadurch bestätigt, dass die MitarbeiterInnen davon ausgehen, dass das Verhalten der KlientInnen prinzipiell verstehbar ist.
Demgegenüber geht Niedecken davon aus, dass Phantasmen unser Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen bestimmen. Durch die Existenz der Phantasmen wird das Verhalten von Menschen mit Behinderungen zur unhinterfragbaren, reinen Natur erklärt.
"Das Gesehene, Erlebte wird zur Kenntnis genommen (...), aber die Dimension des Sinnes ist ausgeschlossen, unbewußt, verdrängt aus Angst vor den Tötungsphantasien. Mit dem Phantasma sieht alles so aus, als müsse es so sein, selbstverständlich, ohne Bedeutung, reine Natur, Schicksal, unabänderlich und unhinterfragbar. (Niedecken 1989, S.111)
Diese von Niedecken formulierte Grundannahme steht in einem Spannungsverhältnis zu den von mir eben beschriebenen Beobachtungen hinsichtlich der MitarbeiterInnen, die das Verhalten ihrer KlientInnen unter anderem als prinzipiell verstehbar betrachten können. Allerdings gibt es in der Institution kein konsistentes Bild von Behinderung.
Die MitarbeiterInnen scheinen in Bezug auf das soziale Bild von Behinderung konsequent zu sein, wenn sie sagen, dass Menschen mit Behinderungen von der Gesellschaft nicht verstanden werden und in Folge durch das Unverständnis der Gesellschaft als "behindert" definiert werden. Die Konsequenzen, die in Bezug auf diese Entwertungen und Aversionen von Seiten der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderungen gezogen werden, sind jedoch für die Frage der Selbstbestimmung und Inklusion kontraproduktiv. "Diese brisanten Tendenzen (...) reaktivieren (nämlich) paradoxerweise das Schutzangebot großer Einrichtungen." (Bradl 1996, S.191f) Wenn die gesellschaftliche Entwertung von Behinderung neue Schutzangebote und eine daraus resultierende Exklusion hervorruft, dann werden gesellschaftliche Tendenzen (Entwertung, Aversion, Exklusion) dadurch verstärkt und legitimiert. Diese Entwicklung könnte man als eine Art von Teufelskreis begreifen, da verstärkte Exklusion und die Ausweitung des Schutzangebotes einander bedingen.
Trotz einzelner Bemühungen der MitarbeiterInnen, Behinderung auch als soziale Kategorie zu verstehen, sind im Rahmen von alltäglichen pädagogischen Strategien dennoch Infantilisierung und Objektivierung im Umgang mit Menschen mit Behinderungen zu beobachten, in die keine Formen des Verstehens eingebunden sind. MitarbeiterInnen gehen davon aus, dass Menschen mit Behinderungen sowohl klare Grenzen als auch Belohnungen für ihr Verhalten brauchen. "Er soll merken, dass es so nicht geht."[14] "Beim Klienten(x) musst du klare Grenzen setzen."[15] "Ich verteile Gutzi (Süßigkeiten), wenn alles passt und es funktioniert hat mit unseren Herrschaften."[16] Die Objektivierung der Menschen mit Behinderungen in Institutionen lässt sich durch den, von einem Mitarbeiter gemachten Vergleich des "Behinderten" / der "Behinderten" mit einer Maschine, bestens illustrieren: "Da hat jeder eine eigene Gebrauchsanleitung."[17]
Die von Niedecken beschriebene Allmacht bei gleichzeitiger Ohnmacht könnte sich durch stereotyp wiederholende Therapien, die den KlientInnen angeboten werden, sowie der Zuschreibung von nur minimalen Lernaussichten äußern: "Das üben wir jetzt zwanzig Jahre und irgendwann vielleicht im nächsten Leben oder so...."[18]
In Routinen organisierte Strukturangebote lassen Fragen nach dem Sinn von ausgeführten Tätigkeiten und Bemühungen nach biografischem Verstehen in den Hintergrund treten. Dass Behinderung dabei mit Aspekten von projektiver Schuld und Angstabwehr in Verbindung gebracht werden kann, zeigt folgendes Beispiel: Wenn die gewünschten Ziele der Eltern bezüglich ihrer behinderten Kinder von der Werkstatt nicht erfüllt werden, dann sind in den Augen der Eltern die MitarbeiterInnen daran schuld.[19]
Kategorie 2: Einflüsse auf die Arbeit in der Institution
Die Einflüsse, die auf die Arbeit der Institutionen einwirken, sind vielfältiger Natur. Es scheint keineswegs so zu sein, dass die Institution als eigenständige Einheit im Rahmen der Gesamtorganisation unabhängig agieren kann. Im Rahmen einer erkennbaren, tiefen Abhängigkeit der Menschen mit Behinderungen von anderen Personen sind es meistens die Eltern oder andere Familienangehörige, welche durch ihre Vorstellungen vom "Behindert-sein" das Leben der Betroffenen und somit auch den Institutionsalltag stark beeinflussen. Dazu ein Beispiel: Als eine Mutter davon erfuhr, dass ihr erwachsenes Kind in der Werkstatt eine Liebesbeziehung unterhält, durfte dieses nicht am gemeinsamen Werkstatt-Urlaub teilnehmen und musste stattdessen zu Hause bleiben.[20] Die elterlichen Ansichten müssen aus Sicht der MitarbeiterInnen akzeptiert werden, denn diese vertreten die Meinung, "wir können uns nicht über die Eltern stellen."[21] Neben der Angst der Eltern, ihr erwachsenes Kind könnte eine Liebesbeziehung eingehen, zeigt dieses Beispiel auch, wie wenig Rücksicht auf eine weitestgehend eigenmächtige Lebensführung der Menschen mit Behinderung genommen wird. Die Verantwortung liegt entweder bei den Eltern oder bei den professionellen MitarbeiterInnen. Für Steiner ist die Zuständigkeit für das eigene Leben ein elementarer Bestandteil der Autonomie und Selbstbestimmung. (vgl. Steiner 1999, S.6) Wie dieses Beispiel zeigt, wird den Menschen im institutionellen Alltag die Verantwortung für ihr eigenes Leben entzogen und dadurch zugleich die Autonomie und Selbstbestimmung dieser Menschen verletzt.
Wenn die KlientInnen in einem Wohnhaus untergebracht sind, so haben auch die dort agierenden MitarbeiterInnen durch ihr Verhalten Einfluss auf die Arbeit in der Werkstatt. Als Beispiel kann hier folgende Beobachtung dienen: Die Verabreichung von Medikamenten liegt im Aufgaben- und Verantwortungsbereich der MitarbeiterInnen des Wohnhauses. Ein Klient bekam vom Arzt sehr starke, sedierende Medikamente verschrieben, wodurch er in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigt war. "Er braucht(e) Hilfe beim Initiieren, beim Ausführen und beim Beenden einer Handlung."[22] Die Leiterin der Werkstatt fand die Entscheidung der MitarbeiterInnen des Wohnhauses nicht richtig, dem Klienten diese Sedativa verschreiben zu lassen. Sie meinte jedoch resignierend, die MitarbeiterInnen ihrer Werkstatt müssten sich mit dieser unbefriedigenden Situation abfinden und lernen damit umzugehen.
Auch die jeweils aktuelle oder grundsätzliche Stimmung der KlientInnen beeinflusst die Arbeit in der Institution. Die MitarbeiterInnen gehen davon aus, dass sie in Bezug auf den Arbeitswillen ihrer KlientInnen flexibel sein müssen. Wenn etwa ein / eine KlientIn keine Lust verspürt, zu arbeiten, dann können sie diese Tatsache ihrer Meinung nach nicht ändern. Die Frage nach dem Sinn von Tätigkeiten wird gar nicht erst gestellt, ebenso wenig jene nach der Motivation, die einer lediglich mit Taschengeld abgegoltenen Arbeit wohl nicht zwangsläufig innewohnt.
Die Institutionen müssen sich an die Rahmenbedingungen ihrer Trägerorganisationen halten, die ihre Arbeit beeinflussen und strukturieren.
Kategorie 3: Asymmetrie zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen
Niedecken beschreibt das Verhältnis zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen als ein von der Betonung des Andersseins bestimmtes. (vgl. Niedecken 1989, S. 16f)
Die beobachtete Asymmetrie zwischen den MitarbeiterInnen und KlientInnen, welche unter anderem durch die Exklusivität einiger Räumlichkeiten (Büro) für MitarbeiterInnen sichtbar wird, könnte als ein Ausdruck dieser Betonung des Andersseins interpretiert werden. Ein weiterer Ausdruck, der auf eine asymmetrische Beziehung schließen lässt, ist das Besprechen der Lebensumstände und Verhaltensweisen der KlientInnen mit dritten Personen, manchmal sogar in Gegenwart der KlientInnen. Ferner anzuführen als Symptome der Asymmetrie sind die Ratschläge, welche die MitarbeiterInnen den KlientInnen erteilen, die Überprüfung der KlientInnen-Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt und fallweise das Ignorieren derselben, die Kontrolle, die über die KlientInnen ausgeübt wird sowie Einschätzungen, Kommentare und Reflexionen zum Verhalten der KlientInnen.
Diese Asymmetrie in der Beziehung zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen ist vergleichbar mit jener zwischen Erwachsenen und Kindern, wobei gegenseitige Bezüge auf der Grundlage von Konzepten des Verstehens institutionellen Gegebenheiten untergeordnet sind.
Koch-Straube nennt ein ähnliches Beispiel, welches noch einmal die Betonung des Andersseins hervorhebt: "Das Nebeneinander von zwei Kommunikationssträngen, die nicht miteinander vermittelt werden (...). Die MitarbeiterInnen reden mit den BewohnerInnen und im gleichen Atemzug mit den KollegInnen, die vorangegangenen Äußerungen kommentierend oder korrigierend." (Koch-Straube 1997, S.251)
Kategorie 4: Abhängigkeit und Fremdbestimmung
Bradl schreibt zu diesem Thema: "Je größer und umfassender die individuelle Hilfebedürftigkeit ist, um so größer ist auch die reale Abhängigkeit von anderen Menschen oder Hilfesystemen, um so größer damit auch die Gefahr der Fremdbestimmung." (Bradl 1996, S. 194)
Die Abhängigkeit der KlientInnen, sowohl von den Eltern als auch von der Institution, blieb mir während meiner Beobachtungen nicht verborgen. Diese Abhängigkeit von der Institution ist grundsätzlich durch die benötigte Unterstützung durch die MitarbeiterInnen gegeben. Auch hinsichtlich des Wahrnehmens weiterer Angebote sind die KlientInnen auf die Institution angewiesen. Ob die KlientInnen beispielsweise eine spezielle Therapie bekommen oder nicht, hängt von der Entscheidung der Leiterin oder des Leiters ab und davon, ob es einen freien Therapieplatz gibt.[23]
Fremdbestimmung bezüglich der institutionellen Struktur und des Ablaufs äußert sich schon ganz grundsätzlich durch fehlende Wahlmöglichkeiten. In der WS(b) gibt es KlientInnen, die sich gezwungen sahen, das Bundesland zu wechseln, weil es in ihrem Heimatort kein passendes Angebot für sie gab.[24] Ein anderer Klient war zum Schnuppern in der WS(b), aufgrund von Platzmangel wurde er jedoch gegen seinen Willen an eine andere Institution verwiesen.[25] Im Tagesablauf der Institution haben die Betroffenen kaum Einfluss auf Aufnahmeabläufe, Betreuungspersonen sowie die Organisation der Betreuung (Arbeitsabläufe). (vgl. Bradl 1996, S. 185 - 190)
Dass aufgrund der Organisationsprozesse, die eine größere Gruppe nun einmal nach sich zieht, einzelne KlientInnen kaum Einfluss auf Arbeitsabläufe haben, scheint auf der Hand zu liegen und wird durch folgendes Beispiel bestätigt: Klient: "Ich will essen. Ich hab Hunger." Mitarbeiter: "Wir müssen warten bis der Klient(x) kommt und uns einlädt. Das weißt du ja, ich kann nicht wegen dir die Regeln verändern."[26] Auch hier werden die Bedürfnisse der KlientInnen den institutionellen Gegebenheiten untergeordnet. Diesen Beispielen folgend könnte man zu dem Schluss kommen, dass Fremdbestimmung und Abhängigkeit den institutionellen Alltag von Menschen mit Behinderungen bestimmen.
Die fehlende Möglichkeit der Einflussnahme könnte dazu führen, dass die Betroffenen gezwungen werden, sich aus dem Alltag zurückzuziehen, die Flucht nach innen anzutreten und auf diese Weise ein Stück weit zu verstummen, was einem Bedeutungsverlust der Realität gleichkommt. (vgl. Koch-Straube 1997, S. 71, S. 332ff)
"Die Gegenwart, die man (...) aufgrund subjektiv erlebter und objektiv gegebener Schwäche und Behinderung (...) und vorgegebener institutioneller Bedingungen nicht mehr kontrollieren kann, auf die man bewußt gestaltend kaum einen Einfluß mehr hat, verliert an Bedeutung." (Koch-Straube 1997, S. 107)
Ein immer wieder vorgebrachtes Argument der MitarbeiterInnen, um Fremdbestimmung zu rechtfertigen, ist die Sicherheit der KlientInnen. In der WS(b) werden beispielsweise die Gruppenräume aus Sicherheitsgründen in der Mittagspause zugesperrt.[27] Bei genauer Betrachtung erweist sich das Sicherheitsargument als Totschlagargument, welches jede Diskussion schon im Keim zu ersticken vermag.
Die Abhängigkeit von und vor allem die Fremdbestimmung durch die Eltern scheint für viele KlientInnen fixer Bestandteil ihrer Lebenswirklichkeit zu sein. Beispiele dafür gibt es zu Hauf: Selbst beobachten konnte ich die Bestimmung des Essensplanes durch die Eltern. In Gesprächen mit der Leiterin und den MitarbeiterInnen habe ich ferner Dinge erfahren, die rechtlich auf tönernen Füßen stehen und auch moralisch äußerst bedenklich sind. Die Eltern untersagen ihren erwachsenen Kindern eine Liebesbeziehung, sie bestimmen unter Mithilfe des Arztes über die Medikation und verbieten die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel. Selbst das normalerweise tabuisierte Thema (Zwangs)Sterilisation war Gegenstand dieser Gespräche. Ich musste erfahren, dass eine Klientin mit dem Einverständnis der Eltern sterilisiert wurde. Genauere Informationen, ob diese Sterilisation ohne die Zustimmung oder vorherige Aufklärung der Klientin über den Eingriff stattgefunden hat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Generell legt dieses Gespräch über die Zwangs(Sterilisation) von Frauen mit Behinderungen einen Schluss nahe, zu dem auch der Unabhängige Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen kommt:
"Immer wieder ist der Wunsch nach Sterilisation auch mit einer repressiven Haltung gegenüber gelebter Sexualität von behinderten Personen verbunden. (...)Es ist völlig unbekannt, wie viele (vor allem) behinderte Frauen in den letzten Jahrzehnten sterilisiert worden sind - es ist zu vermuten, dass die Sterilisationsrate sehr hoch war - und wie hoch die Sterilisationsrate heute ist." (Diskussionspapier zum Thema Gewalt und Missbrauch des unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Oktober 2010, S. 5)
Kategorie 5: Verantwortungsbereiche der Werkstatt
Während der Arbeitszeit tragen die Institution und deren MitarbeiterInnen die Verantwortung für die KlientInnen. Insbesondere geht es darum, den Anforderungen in den Bereichen Sicherheit, Förderung der KlientInnen und deren Bedürfnisbefriedigung gerecht zu werden. Darüber hinaus kommt es im Alltag, aus organisatorischen Gründen, immer wieder zu einer Überlappung der Zuständigkeiten zwischen dem Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich. Daher kann man durchaus von einer "umhüllenden Allgegenwart der Institution" sprechen. (Koch-Straube 1997, S.343) Folgendes Beispiel aus den Beobachtungsprotokollen soll diesen Sachverhalt verdeutlichen:
Um richtig planen zu können, ist es für die MitarbeiterInnen in der Werkstatt von großer Bedeutung, auch über die Wohnsituation der KlientInnen umfassend Bescheid zu wissen. Immer wieder sind sie mit der Situation konfrontiert, dass die Eltern der KlientInnen älter werden und daher in absehbarer Zeit nicht mehr für ihre erwachsenen Kinder Sorge tragen können. Um im Bedarfsfall einen Wohnplatz für die betreffenden KlientInnen freizuhalten, sind Informationen über das gesundheitliche Befinden der Eltern für die Institutionen von großer Wichtigkeit.[28]
Wie bereits von Goffman beobachtet, ist die fehlende Trennung der Lebensbereiche Arbeit, Freizeit und Wohnen ein zentrales Merkmal totaler Institutionen. (vgl. Goffman 1973, S.17) Aus organisatorischen Gründen scheint es für die Beteiligten jedoch zweckmäßiger zu sein, diese drei Bereiche zentral von einer Stelle aus zu steuern, wodurch wiederum die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen hinter organisationsökonomische Erfordernisse zurücktreten.
Um dieser großen, von institutioneller Seite konstruierten Verantwortung gegenüber den Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden, sind die MitarbeiterInnen dazu angehalten, alle relevanten Informationen über ihre KlientInnen in einer Dokumentationsmappe festzuhalten.
Als weiteren Verantwortungsbereich der Institution betrachtet die Leiterin der WS(b) die Herbeiführung einer Veränderung der Wahrnehmung der Arbeit von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit. Im Vorwort eines, von einem Klienten der WS(b) verfassten und von der Werkstatt publizierten Buches, kann man folgendes nachlesen: "Es ist eines jener Produkte, in denen wir versuchen, Arbeiten der uns anvertrauten mental behinderten Erwachsenen ins rechte Licht zu rücken." Angesichts der von der Institution verfolgten Taschengeldpolitik erscheint es beinahe zynisch, sich für eine Änderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und des Bildes der Arbeit von Menschen mit Behinderungen einsetzen zu wollen und sich dies auf die Fahnen zu schreiben.
Kategorie 6: Gesundheit und Krankheit
Gesundheit und Krankheit konnte ich als immer wiederkehrende Themen in der Institution beobachten. Die Frage, die von einem / einer MitarbeiterIn in der Morgenbesprechung jedem / jeder KlientIn gestellt wird lautet: "Gesund und munter?"[29] Es scheint von großer Bedeutung zu sein, dass die KlientInnen gesund sind. Als mir ein Mitarbeiter von den schwierigen, häuslichen Verhältnissen des Klienten(x) berichtet, meint dieser im selben Atemzug: "Der Klient(x) ist aber in den letzten zwanzig Jahren vielleicht drei Mal krank gewesen." Dass der Gesundheitszustand der KlientInnen als Parameter für ihre Zufriedenheit herangezogen wird, zeigt die Präsenz des medizinischen Modells von Behinderung in der Institution. Wie weiter unten noch näher auszuführen ist, zeigt sich die Relevanz des Gesundheitszustandes der KlientInnen besonders in ihrer geronnenen Form, nämlich jener der medizinischen Diagnose.
Eine Klientin sagt immer wieder dieselben Worte: "Ich bin krank, lass mich, ich will nicht."[30] Für die MitarbeiterInnen sind diese Floskeln ein Ausdruck der privaten Lebenssituation der Klientin, die immer wieder mit ihrer kranken Mutter konfrontiert ist. Meine Reaktion auf die gebetsmühlenartig wiederholten Worte der Klientin könnte bestenfalls als Zeichen stiller Kenntnisnahme, wenn nicht gar bewusster Ignoranz bezeichnet werden. Auch im Fall der MitarbeiterInnen scheint es so zu sein, als ob weder Zeit noch Muße für eine angemessene Reaktion darauf vorhanden sei und man sich mit der repetitiven Situation bereits abgefunden habe.[31]
Diese Beobachtung könnte im Hinblick auf die Theorie des Phantasmas so interpretiert werden, dass sich das Phantasma zwischen die Kommunikation drängt, wodurch "das Gesehene, Erlebte (...) zur Kenntnis genommen (wird) (...), aber die Dimension des Sinnes ist ausgeschlossen (...)." (Niedecken 1989, S. 111) So wird "alles Wahrgenommene (...) im Bann des Phantasmas zum Zeichen, Zeichen für irgendetwas, das nur noch als außerhalb der Beziehung gesehen wird - Zeichen für einen Organschaden; für den Irrtum des Arztes; für Schuld oder Unschuld der Mutter." (ebd., S. 113)
Medizinische Diagnosen sind für die MitarbeiterInnen auch ein Stück weit gleichzusetzen mit Sicherheit. Der medizinische Status der KlientInnen sowie deren Medikation dienen dazu, das Verhalten der KlientInnen verstehbarer zu machen.[32] Hejikoop betrachtet die Frage nach einer Diagnose als einen Schrei der Verzweiflung, wenn er schreibt: "Die Frage nach dem "Warum" ist oft der Schrei der Verzweiflung der direkt Betroffenen, die hoffen, es gäbe irgendwo einen Knopf, den man drehen könnte und dann wäre mit einem Mal alles "vorbei"." (Hejkoop 2009, S. 18)
Kategorie 7: Selbstbestimmung und Selbstständigkeit innerhalb des organisatorischen Rahmens
Die Selbstständigkeit zu fördern ist eines der selbsterklärten Ziele der WS(b).[33] Niedecken beschreibt die Selbstständigkeit als eine wichtige Voraussetzung für das Überleben in unserer Gesellschaft. "Wir, die Normalen, kommen selbstständig im Leben zurecht, sind effektiv in unserem Tun, welches uns das Überleben in der Gesellschaft sichert. (...) Sie sind sichtbar Abhängige, also gelten sie uns als Unmündige." (Niedecken 1989, S. 16) Die Wichtigkeit, das Wort Selbstständigkeit von dem Begriff der Selbstbestimmung zu trennen, wird spätestens dann deutlich, wenn es darum geht, dass Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, ein selbstbestimmtes Leben führen wollen.
Selbstbestimmung in dem Sinne, eigene Entscheidungen treffen zu können und die Kontrolle über das eigene Leben zu haben, ist für Menschen mit Behinderungen, die in Institutionen leben, lediglich innerhalb des engen organisatorischen Rahmens möglich. Wie bereits erwähnt, entscheiden die KlientInnen beispielsweise ein Mal im Jahr darüber, ob sie weiterhin in der WS(b) bleiben möchten und falls ja, in welcher Gruppe. Angesichts der oft fehlenden Alternativen und der Tatsache, dass Selbstbestimmung auch etwas mit Wahlmöglichkeiten zu tun hat, gilt es die Frage nach dem Grad der Selbstbestimmung, der innerhalb einer Institution überhaupt möglich ist, kritisch zu betrachten.
Kategorie 8: Die Institution als Familienersatz und Ort des Schutzes für die KlientInnen
Es gibt KlientInnen, denen die Möglichkeit geboten wurde, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, die dieses Angebot jedoch abgelehnt haben, weil es ihnen in der Werkstatt besser gefällt.[34] Ein Klient kam vom ersten Arbeitsmarkt in die Werkstatt, weil er dort systematisch gemobbt wurde und die Verhältnisse dadurch für ihn unerträglich waren.[35] Diese und andere Beobachtungen lassen darauf schließen, dass die Institution von manchen KlientInnen auch als Ort des Schutzes empfunden wird.
Nicht nur die KlientInnen, auch die Leiterin geht davon aus, dass die Werkstatt den KlientInnen Privilegien bietet, die es am ersten Arbeitsmarkt in dieser Form nicht gibt. Dazu zählt etwa die Tatsache, dass die KlientInnen nicht arbeiten müssen, wenn sie das nicht wollen, und sich stattdessen auf der Couch ausruhen können. Auch in der Mittagspause ist es den KlientInnen gestattet, gemeinsam mit ihrem / ihrer FreundIn auf der Couch zu kuscheln.[36]
Diese Privilegien, welche ihnen in der Werkstatt zuteilwerden, dürften ein Grund dafür sein, warum KlientInnen sich in Werkstätten wohl zu fühlen glauben. Eines dieser Privilegien ist etwa die Führung einer Liebesbeziehung, die sich zwar nur oberflächlich im Austausch von Zärtlichkeit beim Kuscheln äußert, ihnen andernorts aber schlichtweg versagt bleibt. Bei näherer Betrachtung entpuppen sich diese Privilegien jedoch als Chimären. Was in der Institution als Privileg sich präsentiert, gehört eigentlich zu den ureigensten Bedürfnissen des Menschen, auf das er auch ein Anrecht besitzt.
Goffman identifiziert am Beispiel Gefängnis ein Privilegiensystem als Teil der Organisationsform, welches dem Insassen dabei hilft, sein erschüttertes Selbst wiederaufzubauen. (vgl. Goffman 1973, S. 65 - 76, S. 178) Durch das Annehmen der einzelnen Privilegien
"akzeptiert er (der Insasse), zumindest teilweise, die Vorstellung der Gefängnisbehörde von seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und bringt sich dadurch in eine Lage, in der er eine gewisse Dankbarkeit und Kooperationsbereitschaft (wenn auch nur, indem er das Gegebene annimmt) zeigen und damit das Recht der Gefängnisbehörde anerkennen muß, Annahmen über ihn zu hegen." (Goffman 1973, S. 178)
Koch-Straube identifiziert in Bezug auf Pflegeheime, ähnlich wie Goffman, einen, wie sie es nennt, "institutionellen Doppelcharakter", der sich darin manifestiert, dass die Institutionen "(...) Schutz und Sicherheit (bieten), (...) gleichzeitig Unterordnung unter die Regelungen des Heimalltags (fordern), (...) individuelle Entfaltungsmöglichkeiten ein(schränken) (...) (und) eine starke soziale Kontrolle aus(üben)." (Koch-Straube 1997, S. 340)
Die Institution kann nicht nur als Ort des Schutzes für die KlientInnen verstanden werden, die MitarbeiterInnen bezeichnen sie darüber hinaus als Familie(nersatz),[37] wobei es auf der Hand liegt, dass die Rolle der Kinder von den Menschen mit Behinderungen und die Rolle der Eltern von den MitarbeiterInnen eingenommen wird. Dieser Gedanke wird dadurch bestätigt, dass die Arbeit der MitarbeiterInnen von ihnen selbst als Beziehungsarbeit bezeichnet wird, denn einige KlientInnen werden bereits über zwanzig Jahre von denselben MitarbeiterInnen begleitet. Eine Mitarbeiterin beschreibt diesen Umstand so: "Die Arbeit mit den KlientInnen ist Beziehungsarbeit. Manche Leute sind da seit ich da bin (seit zwanzig Jahren), und in der Zeit bekommt man ein ganzes Leben mit."[38] Sich täglich wiederholende und gemeinschaftlich vollzogene Handlungen, wie etwa der gemeinsame Beginn und die Beendigung des Mittagessens, die durch fixe Formeln ("Wir wünschen uns allen eine angenehme Mittagspause") und Gesten (einander die Hände reichen) Ritualcharakter gewinnen, lassen die KlientInnen und MitarbeiterInnen der WS(b) als Familie erscheinen. Diese Beobachtungen vermögen zu verdeutlichen, wie weitreichend das infantilisierte Bild von Menschen mit Behinderungen in Institutionen ist.
Kategorie 9: Die Arbeit in der Werkstatt als Arbeit zwischen Fronten
Die Arbeit in den Institutionen kann als Arbeit zwischen den Fronten oder, um das Zitat eines Mitarbeiters zu wählen, als "Spagat" bezeichnet werden.[39] Interessenskonflikte der handelnden Personen verlangen nach Kompromissen, die man sehr wohl als "Spagat", treffenderweise aber auch als "Quadratur des Kreises" bezeichnen könnte, da sich die konfligierenden Interessen nicht selten diametral gegenüberstehen. Im Zuge meiner Beobachtungen konnte ich Interessenskonflikten zwischen folgenden AkteurInnen feststellen:
-
Die Meinung der Eltern versus die Meinung der KlientInnen
-
Die Meinung der Geschäftsführung versus die Meinung der MitarbeiterInnen und der LeiterInnen
-
Die Meinung der Eltern / der MitarbeiterInnen im Wohnhaus versus die Meinung der MitarbeiterInnen in der Werkstatt
-
Die Meinung der LeiterInnen versus die Meinung der MitarbeiterInnen
Ein weiterer Punkt, der einen Interessenskonflikt birgt, ist das Spannungsfeld zwischen dem Schutz der KlientInnen und deren Förderung. Dieses Spannungsverhältnis formuliert ein / eine MitarbeiterIn der WS(b) in Bezug auf die Klientin(x), welche allem Anschein nach eine komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter unterhält: "Wie bei der Klientin(x). Wenn wir uns fragen, ob sie mit ihrer Mutter Kontakt aufnehmen soll oder nicht, (stellt sich für uns die Frage:) Wo sollen wir sie schützen und wo sollen wir sie fördern?"[40]
Auch die Leiterin der WS(b) illustriert ihren emotionalen Zustand hinsichtlich der Schwierigkeit der Interessenskonflikte innerhalb des institutionellen Rahmens in beredten Bildern: "Ich fühle mich wie ein Knirschpapier, das gepresst wird."[41] Angesichts der vielschichtigen Interessenslagen scheint es innerhalb eines institutionellen Rahmens unmöglich zu sein, dem Dienstleistungsgedanken Rechnung zu tragen und von KundInnenorientierung zu sprechen.
Kategorie 10: Die Arbeit der KlientInnen
Es scheint nicht klar zu sein, ob es sich bei der Arbeit der KlientInnen um Arbeit im eigentlichen Sinne oder um Beschäftigungstherapie handelt. Die Bezeichnung der Entlohnung als Taschengeld, die geringe Höhe derselben sowie die fehlende Sozialversicherung sind allesamt Indizien, die für die Bezeichnung Beschäftigungstherapie sprechen. Andererseits scheint es die Philosophie der Werkstätte zu sein, sich sehr wohl am leistungsorientierten Arbeitsmarkt anzulehnen. Die Tatsache, dass mehr Leistung mit einem höheren Taschengeld belohnt wird, lässt diesen Gedanken zu.[42] Auch die Produkte, die durch die Arbeit der KlientInnen erzeugt werden, sind Eigentum der Institution.[43] Daher scheint es auch in der Institution so zu sein, dass die Menschen dort, wie am ersten Arbeitsmarkt, ihre Arbeitskraft verkaufen. Allerdings sind Ausflüge, Ausruhen und Therapien während der Arbeitszeit erlaubt, wodurch sich wiederum die Bezeichnung Beschäftigungstherapie aufdrängt.
Ich würde von einem Hybridmodell der Beschäftigungsarbeit sprechen, welches Elemente sowohl aus der klassischen Beschäftigungstherapie als auch Aspekte des leistungsorientierten Arbeitsmarktes beinhaltet.
Diese Begriffsdiffusion bringt der Institution zweierlei Vorteile. Eine klare Positionierung in Richtung Arbeitsmarkt würde rechtliche Konsequenzen mit sich bringen, wodurch Mindestanforderungen, wie etwa die Sozialversicherungspflicht, eingehalten werden müssten. Durch diese erwünschte Unklarheit kann man sich in der Institution ein Hintertürchen offen halten, um argumentativ flexibel zu sein.
Ein Beispiel aus dem Beobachtungsprotokoll verdeutlicht die praktischen Auswirkungen dieses Hybridmodells der Beschäftigungsarbeit: Die KlientInnen und MitarbeiterInnen führen im Auftrag der Organisation der WS(b) eine Dienstleistung für eine andere Firma durch. Die Organisation selbst bekommt für diesen separaten Auftrag von der externen Firma Geld. Die KlientInnen, die diese Dienstleistung verrichten, bekommen ein extra Taschengeld, beziehungsweise einen "Hungerlohn" von ungefähr acht Euro pro Tag. Die MitarbeiterInnen finden es nicht in Ordnung, dass die KlientInnen dafür so wenig Geld bekommen und sagen: "Die Firma betreibt damit Preisdumping."[44]
Bereits im Artikel 23 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das Recht auf Arbeit festgeschrieben. Arbeit kann als sinnvolle und bezahlte Tätigkeit definiert werden, wobei es nicht eindeutig zu sein scheint, was unter sinnvoller Tätigkeit verstanden werden kann. Des Weiteren verweist der Artikel 23 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf das Recht jedes und jeder Einzelnen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erhalten. Angesichts dieser Tatsache ist es schlichtweg nicht argumentierbar, dass Menschen mit Behinderungen beispielsweise für das Kochen oder Arbeiten in der Tischlerei im Rahmen der Beschäftigungstherapie keinen Lohn, sondern lediglich ein Taschengeld erhalten. Der unabhängige Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat im März 2010 zu diesem Thema eine Stellungnahme abgegeben.
Die derzeitige Situation in der sogenannten Beschäftigungstherapie sieht für die Menschen mit Behinderungen keinen Lohn vor. Das bedeutet in der Folge, dass die Menschen mit Behinderungen durch die Arbeit in der Beschäftigungstherapie weder sozial- noch pensionsversichert sind.
Der Monitoringausschuss verlangt deshalb folgende Änderungen:
"Personen mit Behinderungen in Tagesstrukturen, insbesondere in so genannten Beschäftigungstherapien, Werkstätten oder "Fähigkeitsorientierten Aktivitäten" müssen für ihre Arbeit ein kollektivvertragliches Entgelt erhalten und damit eigenständig Ansprüche aus der gesetzlichen Sozialversicherung erwerben können. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Schlechterstellung erfolgt, da bisher das Taschengeld nicht auf die Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt anzurechnen ist, wohl aber ein Entgelt." (Stellungnahme des unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen März 2010, S. 3)
Der Ausschuss bezieht sich bei diesen Forderungen unter anderem auf den Artikel 27 (das Recht auf Arbeit), den Artikel 28 (das Recht auf angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz) und den Artikel 25 (das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit) der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welche im Jahr 2008 von Österreich ratifiziert wurde.
"Das Konzept, das Artikel 27 zugrunde liegt, geht davon aus, dass Menschen mit Behinderungen grundsätzlich in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld beschäftigt werden, und ihnen die Möglichkeit geboten wird, einen angemessenen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen." (ebd., S. 2)
Die Höhe des sogenannten Taschengeldes verunmöglicht es den beschäftigten Menschen mit Behinderungen, einen angemessenen Lebensunterhalt zu bestreiten.
"Für die Adaptierung der derzeit herrschenden Regelungen und Praxis ist auch Artikel 25 maßgeblich, der das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheitsversorgung verbrieft und die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversicherung verbietet. Ebenso maßgeblich sind die Regelungen in (...) Artikel 28 - Recht auf angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz -, der bestimmt, dass für Menschen mit Behinderungen der Zugang zu Leistungen der Altersversorgung zu sichern ist." (ebd., S. 3)
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die rechtliche Situation nach einer Änderung der Organisation der Beschäftigungstherapie, und in weiterer Folge nach einer Adaption des von mir beschriebenen Hybridmodells der Beschäftigungsarbeit sowie einer Konkretisierung der, mit diesem Modell einhergehenden Begriffsdiffusion verlangt.
[6] Zitat aus dem E-Mail Verkehr mit der Werkstattleiterin
[7] Beobachtungsprotokoll vom 10. März 2010, S.1
[8] Beobachtungsprotokoll vom 10. März 2010, S. 4
[9] Aus privaten Gründen war es mir in der zweiten Woche nicht möglich, am Montag zu beobachten.
[10] Vgl. Beobachtungsprotokoll vom 22. April, S.3
[11] Im folgenden WS(b)
[12] Entnommen aus der Informationsmappe der WS (b)
[13] Entnommen aus der Informationsmappe über die WS (b)
[14] Beobachtungsprotokoll vom 2. April, S. 3
[15] Beobachtungsprotokoll vom 31. März, S. 1
[16] Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 1
[17] Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 7
[18] Beobachtungsprotokoll vom 21. April, S. 2
[19] Beobachtungsprotokoll vom 21. April, S. 2
[20] Beobachtungsprotokoll vom 10. März, S. 3
[21] Beobachtungsprotokoll vom 10. März, S. 3
[22] Beobachtungsprotokoll vom 21. April, S. 1
[23] Beobachtungsprotokoll vom 21. April, S. 3
[24] Beobachtungsprotokoll vom 20. April, S. 1
[25] Beobachtungsprotokoll vom 22. April, S. 2
[26] Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 5
[27] Beobachtungsprotokoll vom 29. März, S. 6
[28] Beobachtungsprotokoll vom 29. März, S. 3
[29] Beobachtungsprotokoll vom 29. März, S. 3
[30] Beobachtungsprotokoll vom 30. März, S. 4
[31] Vgl. Beobachtungsprotokoll vom 30. März, S. 4
[32] Vgl. Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 2 und 22. April, S. 4
[33] Vgl. Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 3
[34] Beobachtungsprotokoll vom 23. April, S. 1 und 23. April, S. 1
[35] Beobachtungsprotokoll vom 31. März, S. 5
[36] Beobachtungsprotokoll vom 30. März, S. 5 und 20. April, S. 4
[37] Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 8 und 20. April, S. 4
[38] Beobachtungsprotokoll vom 23. April, S. 1
[39] Beobachtungsprotokoll vom 29. März, S. 2
[40] Beobachtungsprotokoll vom 2. April, S. 2
[41] Beobachtungsprotokoll vom 1. April, S. 8
[42] Beobachtungsprotokoll vom 31. März, S. 6
[43] Beobachtungsprotokoll vom 22. April, S. 1
[44] Beobachtungsprotokoll vom 22. April, S. 1
Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe erscheinen mir als komplexes System, welches Menschen mit Behinderungen in sich "gefangen hält".
Mit Abbildung 11 möchte ich den institutionalisierten Umgang mit Menschen mit Behinderungen in seiner Komplexität noch einmal sichtbar machen. Alle entstandenen Kategorien können in Zusammenhang gebracht werden, wobei das Bild von Behinderung als Ausgangspunkt für den (gegenwärtigen) Umgang mit Menschen mit Behinderungen betrachtet werden kann.
Zwei Gedanken möchte ich dabei noch hervorheben: Die Abbildung 11 zeigt, dass der Prozess der Institutionalisierung undurchschaubar ist. Das könnte den fatalen Schluss nach sich ziehen, dass das institutionalisierte Leben von Menschen mit Behinderungen als die einzige mögliche, logische und unhinterfragbare Realität erscheint. So wie Berger und Luckmann es bereits formuliert haben: A und B
"(...) verstehen, was sie geschaffen haben. Das ändert sich jedoch mit der Weitergabe an eine neue Generation. (...) Den Kindern ist die von den Eltern überkommene Welt nicht mehr ganz durchschaubar. (...). (Aus einem), "so könnten wir das machen" wird ein "(...) "So macht man das"". So steht sie (die Welt) ihnen (den Kindern) nun als gegebene Wirklichkeit gegenüber." (Berger / Luckmann 1980, S. 63)
Folgen wir diesem Gedanken, könnte man sagen, der für das Handeln aller Beteiligten (vgl. Niedecken 1989), welches - wie bereits im empirischen Teil dieser Arbeit gezeigt - sich an den Gegebenheiten der Institution orientiert und den Sachzwängen der institutionellen Organisation untergeordnet ist.
Der zweite Gedanken ist jener, dass Menschen mit Behinderungen in institutionalisierten Settings als Akteure ihres eigenen Lebens kaum vorkommen. Das heißt, die Zuständigkeit für das eigene Leben als Bestandteil der Autonomie wird den Betroffenen vollkommen entrissen. (vgl. Steiner 1999, S.6)
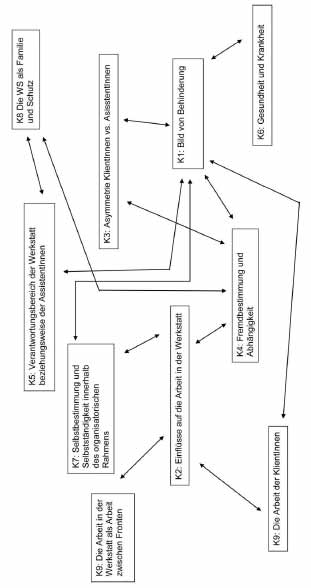
Abbildung 11: Das Kategoriensystem in ihrem Zusammenhang
Zusammenfassend könnten Schlussfolgerungen in zwei Richtungen gezogen werden. Einerseits wird der institutionalisierte Umgang mit Menschen mit Behinderungen erst durch die Existenz der Institutionen legitimiert und dadurch das Bild von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Hilfsbedürftigen, zu Betreuenden und abhängigen Menschen reproduziert. Illich schreibt darüber folgendes: "Die neuen Spezialisten, die nichts anderes tun, als solche menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, die ihre Zunft erst erfunden und definiert hat, kommen gern im Namen der Liebe daher und bieten irgendeine Form der Fürsorge an." (Illich 1979, S.14) Die Institution leitet ihre Existenzberechtigung aus diesem Sachverhalt ab und verkommt dadurch zum Selbstzweck, sie genügt sich sozusagen selbst
Auf individueller Ebene schimmern bei MitarbeiterInnen gelegentlich Ansichten durch, welche ein Verständnis von Behinderung auch als soziale Kategorie beinhalten. Allerdings lässt sich diese individuell anzutreffende Annahme nicht auf die Institution als Ganzes übertragen, da ihr kein im institutionellen Rahmen verankertes, verallgemeinerbares Verstehenskonzept zugrunde liegt.
Abschließend soll die Gretchenfrage nach dem Umgang von Institutionen mit Menschen mit Behinderungen wie folgt beantwortete werden: Einerseits agieren Institutionen innerhalb der Institution Geistigbehindertsein, indem sie den Umgang mit Behinderung determinieren, sie sind also Teil dieses Prozesses, andererseits nehmen sie für sich in Anspruch, das Bild von Behinderung in unserer Gesellschaft positiv verändern zu wollen - allein scheinen die vorhandenen Strukturen diese Bemühungen zum Scheitern zu verurteilen.
Wenn ich davon ausgehe, dass die Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe den Ansprüchen einer individuellen Begleitung von Menschen mit Behinderungen und somit dem Gedanken der Inklusion nicht gerecht werden können, so drängt sich die Frage nach der Alternative zu Institutionen oder nach alternativen Institutionen auf. Mit dem Beitrag von Schirmer, Institutionen als deinstitutionalisiert zu denken ist zwar noch kein endgültiger Lösungsansatz vorhanden, er zeigt jedoch, in welche Richtung es gehen muss, wollen wir dem Gedanken der Inklusion gerecht werden. (vgl. Schirmer 1989, S. 234)
Um den Voraussetzungen, welche die Deinstitutionalisierung verlangt, in der Praxis gerecht werden zu können, bedarf es vor allem einer Änderung in Bezug auf die Verteilung der Macht. Die Kontrolle über das eigene Leben zurückgeben zu wollen, wie es beispielsweise die Methode der persönlichen Zukunftsplanung verfolgt, ist ein in diesem Zusammenhang erwähnenswerter Ansatz.
Wird der Ansatz der Machtumkehr konsequent zu Ende gedacht, hat er weitgehende Konsequenzen für die Organisation, die Formen der Unterstützung und (professioneller) Beziehungen sowie das Verhältnis zwischen Menschen mit Behinderungen und ihren UnterstützerInnen, AssistentInnen oder BegleiterInnen im Sinne der Wahrung von Selbstbestimmung.
Aselmeier, Laurenz (2008): Community Care und Menschen mit geistiger Behinderung. Gemeinwesenorientierte Unterstützung in England, Schweden und Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden
Aster, Reiner; Merkens, Hans; Michael, Repp (Hg.) (1989): Teilnehmende Beobachtung. Werkstattberichte und methodologische Reflexionen. Frankfurt, New York: Campus.
Atteslander, Peter (2006): Methoden der empirischen Sozialforschung. 11., neu bearbeitete und erweiterte Auflage unter Mitarbeit von Jürgen Cromm. Berlin: Schmidt.
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas; Plessner, Helmuth; Plessner, Monika (1980): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.
Bennewitz, Hedda (2010): Entwicklungslinien und Situation des qualitativen Forschungsansatzes in der Erziehungswissenschaft. In: Friebertshäuser, Barbara; Langer, Antje; Prengel, Annedore (Hg.) (2010): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage (Neuausgabe). Unter Mitarbeit von Heike Boller und Sophia Richter. Weinheim: Juventa-Verl. S. 43-61
Bradl, Christian; Steinhart, Ingmar (Hg.) (1996): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verl.
Buber, Martin (1984): Das dialogische Prinzip. Original-Ausgabe. Heidelberg: Schneider.
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Red. Bearb.: Frühauf Theo (Hg.) (1997): Selbstbestimmung. Kongreßbeiträge ; Dokumentation des Kongresses "Ich weiß doch selbst, was ich will!" ; Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung vom 27. September bis zum 1. Oktober 1994 in Duisburg. 2., durchges. Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
Cook, Joanne Valiant (Hg.) (2001): Qualitative research in occupational therapy. Strategies and experiences. Albany: Delmar/Thomson Learning.
Diskussionspapier zum Thema Gewalt und Missbrauch des unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Oktober 2010, online verfügbar unter http://www.monitoringausschuss.at/cms/monitoringausschuss/attachments/8/5/2/CH0909/CMS1286260436744/gewalt_-_diskussionspunkte_fuer_stellungnahme.pdf, zuletzt geprüft am 30. Oktober 2010
Dörner, Klaus (2006): Leben in der "Normalität"- ein Risiko?. In: Theunissen, Georg; Schirbort, Kerstin (Hg.) (2006): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen, soziale Netze, Unterstützungsangebote. Stuttgart: Kohlhammer.
Erdheim, Mario (1989): Vorwort. In: Niedecken, Dietmut (1989): Namenlos. Geistig Behinderte verstehen; ein Buch für Psychologen und Eltern. [1. - 4. Tsd.]. München, Zürich: Piper.
Fengler, Christa; Fengler, Thomas (1994): Alltag in der Anstalt. Wenn Sozialpsychiatrie praktisch wird. Reprint der Erstausgabe von 1980. Bonn: Psychiatrie-Verl.
Feuser, Georg (1996): "Geistigbehinderte gibt es nicht!". Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration. Veranstaltung vom 6. - 8. Juni 1996, aus der Reihe "11. Österreichischen Symposium für die Integration behinderter Menschen "Es ist normal, verschieden zu sein"". Innsbruck. Online verfügbar unter http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-geistigbehinderte.html , zuletzt geprüft am 2. Dezember 2009.
Forster, Rudolf; Schönwiese, Volker (1982): Behindertenalltag: wie man behindert wird. Wien: Jugend und Volk (Gesellschaftswissenschaftliche Studien, 11).
Freire, Paulo (1973): Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. 1. - 20. Tsd. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
Friebertshäuser, Barbara; Langer, Antje; Prengel, Annedore (Hg.) (2010): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage (Neuausgage). Unter Mitarbeit von Heike Boller und Sophia Richter. Weinheim: Juventa-Verl.
Galtung, Johan (1975): Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Erstausgabe. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
Gidoni, Anna; Landi, Nerina (1989): Therapie und Pädagogik ohne Aussonderung. Italienische Erfahrungen. In: TAFIE (Hg.): Pädagogik und Therapie ohne Aussonderung. 5. Gesamtösterreichisches Symposium 1989, Jg. 1989, S. 77-94. Online verfügbar unter http://bidok.uibk.ac.at/library/gidoni-italien.html , zuletzt geprüft am 20. Feber 2010.
Girtler, Robert (1989): Die "teilnehmende unstrukturierte Beobachtung" - ihr Vorteil bei der Erforschung des sozialen Handelns und des in ihm enthaltenen Sinns. In: Aster, Reiner; Merkens, Hans; Michael, Repp (Hg.) (1989): Teilnehmende Beobachtung. Werkstattberichte und methodologische Reflexionen. Frankfurt/ New, York: Campus. S. 103-114
Goffman, Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. 1. Auflage, [Nachdruck]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hähner, Ulrich (2005): Kompetent begleiten Selbstbestimmung ermöglichen, Ausgrenzungen verhindern! Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit Geistiger Behinderung. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
Hähner, Ulrich; Theunissen, Georg (2006): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 5. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
Heijkoop, Jacques; Pressler, Mirjam; Mühl, Heinz (2009): Herausforderndes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung. Neue Wege der Begleitung und Förderung. 4. Auflage. Weinheim: Juventa-Verl.
Hinshelwood, Robert D. Skogstad Wilhelm (Hg.) (2006): Organisationsbeobachtung. Psychodynamische Aspekte der Organisationskultur im Gesundheitswesen. Herausgeber der deutschen Ausgabe: Burkard Sievers. Dt. Erstveröffentlichung. Gießen: Psychosozial-Verl.
Hoffmann, Claudia (1998): Enthospitalisierung oder Umhospitalisierung? Am Beispiel der neuen Länder. In: Theunissen, Georg (Hg.) (1998): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Neue Studien, Erkenntnisse und Perspektiven der Behindertenhilfe. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 109-154
Huainigg, Franz-Joseph (2010): Die Geburt eines behinderten Kindes kann kein Schaden sein. Herausgegeben von Bizeps- Info online. Online verfügbar unter: http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=11025&suchhigh=Huainigg, zuletzt geprüft am 20. Feber 2010
Illich, Ivan u. a. (1979): Entmündigung durch Experten. Zur Kritik d. Dienstleistungsberufe. Dt. Erstausgabe Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Jantzen, Wolfgang (1998): Enthospitalisierung und verstehende Diagnostik. In: Theunissen, Georg (Hg.) (1998): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Neue Studien, Erkenntnisse und Perspektiven der Behindertenhilfe. Bad Heilbrunn: Kinkhardt. (S. 43-62)
Jantzen, Wolfgang (Hg.) (1999): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Ed. Marhold.
Jantzen, Wolfgang (18.11.2002): Gewalt ist der verborgene Kern von geistiger Behinderung. Vortrag auf der Tagung "Institution= Struktur= Gewalt". Veranstaltung vom 18.11.2002. Olten (Schweiz). Online verfügbar unter: http://www.basaglia.de/Artikel/Olten%202002.htm, zuletzt geprüft am 1. November 2009.
Jantzen, Wolfgang (2003): "... die da dürstet nach Gerechtigkeit". Deinstitutionalisierung in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Berlin: Marhold Wissenschaftsverl. Spiess.
Kelle, Helga (2010): Die Komplexität der Wirklichkeit als Problem qualitativer Forschung. In: Friebertshäuser, Barbara; Langer, Antje; Prengel, Annedore (Hg.) (2010): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage (Neuausgabe). Unter Mitarbeit von Heike Boller und Sophia Richter. Weinheim: Juventa-Verl. S. 101-119
Koch-Straube, Ursula (1997): Fremde Welt Pflegeheim. Eine ethnologische Studie. Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Reihe Pflegewissenschaft. 1. Auflage. Bern: Huber.
Kommenda, Benedikt (2008): Behindert: Schadenersatz für Unterhalt. Die Presse, Print- Ausgabe. Online verfügbar unter http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/367150/index.do, zuletzt geprüft am 20. Feber 2010.
Kuppe, Gerlinde (1998): Enthospitalisierung aus sozialpolitischer Sicht. Am Beispiel des Landeskrankenhauses Gütersloh. In: Theunissen, Georg (Hg.) (1998): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Neue Studien, Erkenntnisse und Perspektiven der Behindertenhilfe. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 15-31
Lamnek, Siegfried (2005): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. 4., vollständig überarbeitete Auflage, [Nachdruck]. Weinheim: Beltz PVU.
Lüpke, Hans von; Voß, Reinhard (Hg.) (1997): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. 2. Aufl. Pfaffenweiler: Centaurus-Verl.
Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. 3. Auflage. Bern, München, Wien: Scherz.
Mayring, Phillip (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. (1 (2), Art. 20). Online verfügbar unter http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2384, zuletzt aktualisiert am 2/2009, zuletzt geprüft am 27. März 2010.
Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. 5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage. Weinheim: Beltz (Beltz Studium).
Mayring, Philipp (2008): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 10., neu ausgestattete Auflage, Druck nach Typoskript. Weinheim: Beltz.
Merkens, Hans (1989): Einleitung. In: Aster, Reiner; Merkens, Hans; Michael, Repp (Hg.) (1989): Teilnehmende Beobachtung. Werkstattberichte und methodologische Reflexionen. Frankfurt/ New, York: Campus. S. 9-19
Miller, Eric John; Gwynne, Geraldine V. (1979): A life apart. A pilot study of residential institutions for the physically handicapped and the young chronic sick. Reprinted. London: Tavistock.
Niedecken, Dietmut (1989): Namenlos. Geistig Behinderte verstehen; ein Buch für Psychologen und Eltern. [1. - 4. Tsd.]. München, Zürich: Piper.
Niedecken, Dietmut (1997): Namenlos. Eine Zusammenfassung der Inhalte meines Buches. In: Geistige Behinderung, Jg. 1997, Ausgabe 4/97, S. 375-380. Online verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/niedecken-namenlos.html , zuletzt geprüft am 6. Feber 2010.
Puschke, Martina (April 2005): Die Internationale Klassifikation von Behinderung der Weltgesundheitsorganisation. In: WeiberZEIT, Zeitung des Projektes "Politische Interessenvertretung behinderter Frauen" des Weibernetz e.V., H. 07, S. 4-5, zuerst veröffentlicht: http://bidok.uibk.ac.at/library/wzs-7-05-puschke-klassifikation.html , zuletzt geprüft am 7. Feber 2010.
Reuther-Dommer, Christa; Dommer, Eckhard (1997): "Ich will dir erzählen ...". Geistig behinderte Menschen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Gießen: Psychosozial-Verl.
Richter, Horst Eberhard (1978): Engagierte Analysen. Über den Umgang des Menschen mit dem Menschen; Reden, Aufsätze, Essays. 26. - 33. Tsd. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Rödler, Peter (1996): Von der Chance echter Begegnung. In: Bradl, Christian; Steinhart, Ingmar (Hg.) (1996): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verl. S. 53-67
Schirmer, Volker: Trägerbedingungen zur Integration von schwerst- und mehrfachbehinderten Menschen in die Gemeinde. Dargestellt an den Dr. Low´schen Einrichtungen. In: Theunissen, Georg (Hg.) (1998): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Neue Studien, Erkenntnisse und Perspektiven der Behindertenhilfe. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 206-240
Schmid, Bernhard (2008): Schadenersatz für behindertes Kind. Herausgegeben von Die Lebenshilfe Wien. Online verfügbar unter http://www.dielebenshilfe.at/Schadenersatz-fuer-behindertes.615.0.html?&type=98, zuletzt geprüft am 20. Feber 2010.
Schönwiese, Volker (2001): Das behinderte Lächeln und Theoriebezüge integrativer Pädagogik. In: Gemeinsam leben- Zeitschrift für integrative Erziehung, Jg. 2001, Ausgabe Nr. 2-01, S. 56-60 (In einer gekürzten Versionen erschienen). Online verfügbar unter http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-laecheln.html , zuletzt geprüft am 31. Jänner 2010.
Schönwiese, Volker (Sommersemester 2003): Grundlagen integrativer Pädagogik. Skriptum zur Lehrveranstaltung. Innsbruck: Studia Universitätsbuchhandlung und Kopierzentrum.
Schönwiese, Volker (28. Jänner 2009): Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe: Von der Rehabilitation zu Selbstbestimmung und Chancengleichheit. Einleitungsreferat zur Veranstaltung "Auf dem Weg zu einem Tiroler Chancengleichheitsgesetz für Menschen mit Behinderung", Landhaus Innsbruck 28. Jänner 2009. Veranstaltung vom 28. Jänner 2009. Innsbruck. Online verfügbar unter http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-paradigmenwechsel.html , zuletzt geprüft am 2. Jänner 2010.
Schumann, Monika (2001): Verschieden und gleich! Als Leitprinzip für die Theorie und Praxis sozialer Arbeit mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, H. 5 Thema: Bewegung statt Fitness Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, zuerst veröffentlicht: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh5-01-schumann-verschieden.html , zuletzt geprüft am 1. November 2009.
Schwanninger, Ernst (1982): Alle Macht der Betreuung? In: Forster, Rudolf; Schönwiese, Volker (Hg.) (1982): Behindertenalltag: wie man behindert wird. Wien: Jugend und Volk (Gesellschaftswissenschaftliche Studien, 11). S. 9-12
Steiner, Gusti (1999): Selbstbestimmung und Assistenz. In: Gemeinsam leben- Zeitschrift für integrative Erziehung, Jg. 1999, Ausgabe 3-99. Online verfügbar unter http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-99-selbstbestimmung.html , zuletzt geprüft am 9. Jänner 2010.
Stellungnahme des unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, März 2010, online verfügbar unter http://www.monitoringausschuss.at/cms/monitoringausschuss/attachments/2/8/6/CH0914/CMS1276526308845/ma_sn_beschaeftigungstherapie_final.pdf, zuletzt geprüft am 13. September 2010.
Theunissen, Georg (Hg.) (1998): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Neue Studien, Erkenntnisse und Perspektiven der Behindertenhilfe. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Theunissen, Georg (2005): Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Kompendium für die Praxis. 4., neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Theunissen, Georg; Lingg, Albert (Hg.) (1999): Wohnen und Leben nach der Enthospitalisierung. Perspektiven für ehemals hospitalisierte und alte Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.
Theunissen, Georg; Schirbort, Kerstin (Hg.) (2006): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen, soziale Netze, Unterstützungsangebote. Stuttgart: Kohlhammer.
Thimm, Walter (1994): Das Normalisierungsprinzip. Eine Einführung. 5. Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
UN Konvention über die Reche von Menschen mit Behinderung (23. Oktober 2008), Online verfügbar unter: http://www.monitoringausschuss.at/sym/monitoringausschuss/Konventionstext, zuletzt geprüft am 2. Oktober 2010
Weinwurm-Krause, Eva-Maria (1999): Autonomie im Heim. Auswirkungen des Heimalltags auf die Selbstverwirklichung von Menschen mit Behinderung. Heidelberg: Programm Ed. Schindele im Univ.-Verl. Winter.
Winnicott, Donald W. (1984): Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. Studien zur Theorie der emotionalen Entwicklung. Mit einem Vorwort von Masud M., Khan R. Ungekürzte Ausgabe, 7. - 8. Tsd. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.
Ziemen, Kerstin (13./14. Juni 2003): Anerkennung - Selbstbestimmung - Gleichstellung. Auf dem Weg zu Integration/ Inklusion. Der Aufsatz entspricht dem auf der Fachtagung "Gleich Stellung beziehen in Tirol!" (13./14. Juni 2003) in Innsbruck gehaltenen Vortrag. Veranstaltung vom 13./14. Juni 2003. Innsbruck. Online verfügbar unter http://bidok.uibk.ac.at/library/ziemen-gleichstellung.html , zuletzt geprüft am 1. November 2009.
Internetseiten
Selbstbestimmt Leben Innsbruck (SLI): http://www.selbstbestimmt-leben.net/index.php?content=Assistenz, zuletzt geprüft am 23. September 2010
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
Innsbruck, November 2010
Lisa Wimmler
Angaben zur Person Name Lisa, Wimmler Adresse Mariahilfstrasse 42, 6020 Innsbruck Geburtsdatum 31.03.1986
Arbeitserfahrungen Sommer 2006 Kindergärtnerin im Kindergarten für Alle (Integrationskindergarten) in Lienz 10. Juli 2007 - 19. August 2007 Betreuerin im SOS Kinderdorf (Caldonazzo/ Italien) 14. Juli 2008 - 30. September 2008 Praktikantin im Rehabilitationszentrum Lutzenberg (Schweiz) Seit April 2009 Unterstützerin beim Projekt Wibs
Schule- und Berufsausbildung 1992-1996: Volksschule in Lienz 1996-2000: Gymnasium in Lienz 2000-2005: Bundes-Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP) in Klagenfurt Seit 2005: Studium der Erziehungswissenschaft in Innsbruck mit dem Schwerpunkt Integrative Pädagogik/ Psychosoziale Arbeit Seit 2006: Absolvierung des psychotherapeutischen Propädeutikums in Innsbruck
Quelle:
Lisa Wimmler: Die Institution Geistigbehindertsein verstehen
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie bei Ao. Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 13.01.2011
