Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen. Eingereicht beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachen-Anhalt, Landesprüfungsamt für Lehrämter am: 19.08.2011 von: Diana Appelt Erstgutachter: Zweitgutachterin: Prof. Dr. Andreas Hinz Ines Boban. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 3 Diskurs der gegenwärtigen schulischen Struktur
- 4 Die Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg
- 5 Empirische Untersuchung
- 6 Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Interviewverzeichnis
- Anhang
- Eidesstattliche Erklärung
"Wir sind alle verschieden, aber dennoch gleich."
(Kira[1])
Eine Schülerin mit Down-Syndrom lernt von einem langen Gedicht "eine Strophe auswendig und trägt sie der Klasse vor. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern hat sich entschieden, dieses Gedicht als selbst vertonten Rap-Song vorzutragen, während die beiden Jungen mit Down-Syndrom und das Mädchen mit der eingeschränkten verbalen Ausdrucksmöglichkeit durch Wort- oder Bildkarten ergänzen und so zeigen, dass sie den Sinn des Gedichtes verstanden haben. Das wiederum hat die beiden Jungen mit Down-Syndrom so motiviert, dass sie ihre ersten Englisch-Vokabeln auch mit einem Rap-Song vortragen wollen." (Schöler 2011, 15).
Solch ein Unterricht erscheint sicherlich auf dem ersten Blick ungewöhnlich, doch Jutta Schöler beschreibt damit ein Beispiel aus der Realität des Gemeinsamen Unterrichts in der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg. Anna, Celina, Martin und Stefan[2] sind vier SchülerInnen mit einer so genannten 'geistigen Behinderung', die nicht wie gewöhnlich eine Sonderschule besuchen, sondern das Privileg besitzen, GymnasialschülerInnen zu sein. Ihre Eltern nehmen einige Anstrengungen auf sich, um ihren Kindern ein weitgehend unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Der Besuch eines Gymnasiums war ursprünglich nicht ihre Absicht. Doch am Ende einer langen, hindernisreichen Suche nach einer integrationsbereiten weiterführenden Schule hatte sich lediglich das Werner-von- Siemens-Gymnasium für die Bildung einer Integrationsklasse bereit erklärt.
Gerade im Hinblick auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist eine nähere Betrachtung der Qualität schulischer Integration von Bedeutung. Das Thema 'Integration am Gymnasium' wurde bislang in der Fachliteratur nur in kürzeren Artikeln aufgegriffen. Es war jedoch noch nicht Gegenstand einer ausführlichen, wissenschaftlichen Arbeit. Aus diesem Grund entschied ich mich, dieses Thema in meiner wissenschaftlichen Hausarbeit aufzugreifen. Der Fokus liegt dabei auf dem Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg als konkretes Beispiel aus der Praxis.
Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die grundlegenden Begriffe theoretisch dargelegt. Neben der schulischen Integration nimmt die 'Theorie integrativer Prozesse' nach Helmut Reiser u.a. eine zentrale Rolle in der vorliegenden Arbeit ein. Anschließend wird kurz auf die'Zwei-Gruppen-Theorie' als Indikator für Integration eingegangen.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der gegenwärtigen schulischen Struktur in der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Beschreibung des mehrgliedrigen Schulsystems wird die 'exklusive' Position des Lernorts 'Gymnasium' herausgearbeitet. Auf der schulpolitischen Ebene ist die UN-Behindertenkonvention von großer Bedeutung. die Auseinandersetzung mit ihr ist für diese Arbeit wichtig, da die gemeinsame Beschulung von SchülerInnen mit und ohne Behinderung nun gesetzlich verankert ist.
Im vierten Kapitel wird näher auf die Integrationsklasse am Werner-von-Siemens- Gymnasium Bad Harzburg eingegangen. Das beinhaltet zum einen die Vorstellung der Elterninitiative ERIK Goslar, die für ihre Kinder den integrativen Weg vom Kindergarten über die Grundschule zum Gymnasium ebneten. Auch die konkrete Entstehungsgeschichte der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg wird hier geschildert.
Das fünfte Kapitel umfasst die empirische Untersuchung. Mittels eines Leitfadeninterviews wurden von sechs SchülerInnen ohne Behinderung der Integrationsklasse qualitative Daten erhoben, um der Frage ' Bewirkt Integration auf der institutionellen Ebene auch Integration auf den restlichen Ebenen? nachzugehen. Dafür werden vor der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse das Anliegen und die Fragestellung sowie der Forschungsrahmen dargestellt. In der Zusammenfassung werden dann die wichtigsten Ergebnisse dargelegt und mögliche Handlungsalternativen vorgestellt.
Der Ausblick enthält neben einem Rückblick auf die Arbeit ein persönliches Resümee. Im Folgenden verwende ich den Begriff 'SchülerInnen mit Behinderung' im Singular. Denn Behinderung ist "kein Merkmal von Personen, sondern eine Konstruktion des Umfeldes (...); jemand wird durch Umstände wie den Ausschluß aus dem allgemeinen Kindergarten oder der allgemeinen Schule, durch Zuschreibungen behindert, ist es aber nicht schon von sich aus" (Hinz 1998). Es ist demnach unrelevant, welche Anzahl von Behinderung vorliegt.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel wird das theoretische Fundament der Arbeit dargelegt. Vor der Erläuterung der 'Theorie integrativer Prozesse' wird auf den Begriff 'Integration' näher eingegangen, da dieser im Mittelpunkt der Theorie steht. Nach einer Begriffsdefinition wird ein Einblick in die Geschichte schulische Integration gegeben. Die Beschränkung erfolgt hier auf dem schulischen Bereich, weil dieser in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig behandelt wird. Die Zwei-Gruppen-Theorie, die als Indikator für Integration gesehen wird, bildet dann den Abschluss.
Mit der Einführung der Schulpflicht im 18. Jahrhundert in Preußen (vgl. Hamann 1986, 66) wurde der Weg für eine Schulbildung für alle eingeschlagen. Von diesem Zeitpunkt an war Bildung nicht mehr nur den Privilegierten, dem Adel, vorbehalten, sondern jeder Bürger erhielt ein Anrecht auf Bildung. Bereits August Hermann Francke hat sich Ende des 17. Jahrhunderts mit der Gründung einer Armenschule (vgl. ebd., 48) gegen die Benachteiligung von sozialen Gruppen eingesetzt. Seitdem hat "das deutsche Schulsystem (...) Gleichheit und Verschiedenheit in mancherlei Hinsicht (...) zusammengeführt (z. B. die verschiedenen Konfessionen und Geschlechter)" (Schnell 2003, 11). Damit erhielt die Gleichberechtigung der Verschiedenen einen Bedeutungszuwachs. Allerdings konnte bis heute die Trennung von SchülerInnen mit und ohne Behinderung nur ansatzweise überwunden werden, obwohl "die Trennung (...) die an sie gerichtete Hoffnung, die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft vorzubereiten, nicht im erwünschten Maße erfüllt" (ebd.) hat. Aus diesem Grund haben viele Länder Europas bereits seit langem die Sonderbeschulung für SchülerInnenmit Behinderung aufgegeben oder eingeschränkt. Nach ca. 40 Jahren Bestreben nach schulischer Integration hat Deutschland jedoch so einen Schritt noch nicht gewagt.
"In vielen Ländern der Welt hat es sich eingebürgert, die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen als Integration zu bezeichnen" (Myschker/Ortmann 1999, 4). Hingegen lassen sich in Lexika unterschiedliche Begriffsbedeutungen, je nach Themengebiet, auffinden: z.B. in der Mathematik, Wirtschaft, Soziologie, Psychologie, etc.. Das Wort 'Integration' kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet dort: "die Herstellung bzw. Wiederherstellung eines Ganzen bzw. auch Vervollständigung" (ebd.). Heutzutage ist der Begriff mit folgenden drei Bedeutungen belegt:
-
(Wieder-) Herstellung einer Einheit aus Differenziertem, Vervollständigung
-
Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes
-
Zustand, in dem sich etwas befindet, nachdem es integriert worden ist" (Grossenbacher 1996, 13).
Der zweite Punkt entspricht im Allgemeinen der heutigen gesellschaftlichen Vorstellung von Integration. Die Definition von 'schulischer Integration' spiegelt dies wieder: Mit der Integration von Kindern mit Behinderung wird "eine organisatorische Maßnahme angesprochen, nämlich die gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder in einer Gruppe, z.B. im Kindergarten, in der Schule, im Freizeitbereich" (Reiser u.a. 1986a, 116). Demnach wird von einem Zustand auf der Verwaltungsebene ausgegangen (vgl. ebd.).
Schulische Integration wird in der Praxis auf verschiedene Weisen umgesetzt. In der vorliegenden Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf dem 'Gemeinsamen Unterricht': Hier besuchen SchülerInnen mit Behinderung "zusammen mit nicht behinderten Kindern eine Allgemeine Schule. Dabei werden sie durch sonderpädagogische Fachkräfte unterstützt. Im GU [Gemeinsamen Unterricht; D.A.] lernen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen in Regelklassen an der Allgemeinen Schule"[3] (Evers-Meyer 2009, 9). Davon können zwei andere Formen abgegrenzt werden:
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird 'Integration' überwiegend für 'schulische Integration' und 'Gemeinsamen Unterricht' verwendet.
Die Umsetzung der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung wird als Ziel verfolgt (vgl. ebd.). "Schulische Integration wird dabei als Mittel zu einem übergeordnetem Zweck (...) betrachtet" (ebd., 23). Denn "Integration ... [ist; D.A.] ein Grundwert, der zum Aufbau einer menschengerechten Gesellschaft unentbehrlich scheint" (Mittelmann 1984 zit. nach Reiser u.a. 1986, 116). Nach Jakob Muth stehen Demokratie und Integration in einer Wechselbeziehung: "Demokratisierung [ist; D.A.] letztlich ein andauernder Integrationsprozess, und Integration ist umgekehrt ein andauernder Demokratisierungs-prozess" (1996, 55). Die Verfassungen und gesetzlichen Beschlüsse aller demokratischen Länder streben immer nach einem "humane[n] Miteinander der Menschen" (ebd.). Es ist also die Aufgabe jeder demokratischen Gesellschaft, "den Abbau von Vorrechten einzelner sozialer Gruppen oder Schichten, aber auch die Respektierung der Menschenwürde jedes Einzelnen" sowie die Herstellung der "gleichen Rechte für alle Bürger" (ebd.) umzusetzen.
In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) basiert die Integration von SchülerInnen mit Behinderung in die allgemeine Schule auf unterschiedlichen Entwicklungen und historischen Wurzeln. Im nachfolgenden wird ein kurzer Überblick gegeben. Auf die Deutsche Demokratische Republik (DDR) wird nicht eingegangen, da in den neuen Bundesländern erst seit der deutschen Wiedervereinigung mit der integrationspädagogischen Praxis nach Modellen der BRD begonnen wurde (vgl. Krimmer 2006, 3). "Vor 1989 war eine schulische Integration von behinderten Schülern nicht vorgesehen und durch die politische Führung des Zentralkomitees (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei (SED) nicht erwünscht" (ebd.)
|
Nach 1945 |
In der BRD wurde, entgegen den Richtlinien der Alliierten, nach dem zweiten Weltkrieg das dreigliedrige Schulsystem aus der Weimarer Zeit wieder aufgenommen (vgl. Schnell 2003, 21f). Die Zeit wurde nicht wie in anderen europäischen Ländern "zu einer grundlegenden Erneuerung der Gesellschaft genutzt" (Deppe-Wolfinger 1990, 11). Zudem wurde den Bundesländern die Verantwortung über die Bildungspolitik zugesprochen, wie sie bereits vor 1934 existier hatte. Für die Beschulung von SchülerInnen mit Behinderung wurde das nationalsozialistische Reichsschulpflichtgesetz von 1938 bis in die 60er Jahre beibehalten (vgl. Schnell 2003, 22). "Das bedeutete, dass nach 1945 für behinderte Kinder Schulpflicht festgelegt wurde, das bedeutete aber auch, dass der Begriff der Bildungsunfähigkeit für Kinder mit geistiger Behinderung nach 1945 beibehalten wurde" (ebd., 28). |
|
1950er Jahre |
1953 wurde zur Beratung der Bundesländer, die die Bildungspolitik eigenständig bestimmten, der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (1953-1965) gebildet (vgl. Schnell 2003, 23). |
|
1960er Jahre |
Der Ausbau des Sonderschulwesens erfolgte vor allem in den 60er Jahren, begann aber schon nach dem zweiten Weltkrieg. Bis zur Mitte der 70er Jahre waren ausschließlich die Sonderschulen für die Beschulung von Kindern mit Behinderung zuständig (vgl. Hinz 1993). Der Deutscher Bildungsrat wurde 1965 als Nachfolgeausschuss gegründet. Die Forderung nach einer Bildungsreform wurde zum zentralen Thema in der Öffentlichkeit (vgl. Schnell 2003, 22f), "mit dem Ziel von Chancengleichheit, Emanzipation und Mündigkeit" (Deppe-Wolfinger 1990, 12). Als Resultat setzte die erste "Welle von Gesamtschulgründungen" (Hinz 1993) ein. Damit "wurden erstmals Schüler/innen von Sonderschulen als mögliche Schüler/innen von allgemeinen Schulen betrachtet, allerdings vor allem bezogen auf sozial benachteiligte Schüler/innen, solche mit der Diagnose Lernbehinderung oder mit auffälligem Verhalten" (Schnell 2003, 29). SchülerInnen, die mit den Ansprüchen der Lehr- und Lernzielgleichheit sowie des gleichschrittigen Lernens überfordert waren, blieben ausgeschlossen (vgl. Deppe-Wolfinger 1990, 15). Mit der Bildungsreformphase Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre, in deren Zentrum die Gesamtschulgründung stand, begann nach Helga Deppe-Wolfinger die erste Phase der Integrationsdebatte (vgl. 1990, 15). |
|
1970er Jahre |
Die zweite Phase schloss sich direkt mit der Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" von 1973 an (vgl. ebd., 16). Muth bezeichnet diese Empfehlung als "die erste geschlossene Konzeption für die Integration behinderter Kinder in das allgemeine Schulwesen" (1986 zit. nach Jacobs 2004, 15). Außerdem bewirkte sie die Verschiebung der Integrationsdiskussion von der Gesamtschule auf die Grundschule "und von der Integration der sozialen Schichten (...) zu der von unterschiedlichen Begabungen" (Hinz 1993). 1970 wurde die erste integrativ arbeitende Schule in der BRD, die Montessori-Gundschule in München, ins Leben gerufen. Erstmals wurden auch Kinder mit einer geistigen Behinderung aufgenommen. Ihr folgten weitere Schulen in freier Trägerschaft (vgl. Deppe-Wolfinger 1990, 16). Eine Elterninitiative erreichte 1976, dass die erste Integrationsklasse an einer staatlichen Grundschule, der Fläming-Gundschule in Berlin, entstand (vgl. ebd., 11). In der praktischen Umsetzung fand eine Weiterentwicklung von der ausschließlich zielgleichen zur möglichen zieldifferenten Integration statt (vgl. Jacobs 2004, 16), d.h. SchülerInnen mit Behinderung mussten nun nicht mehr unbedingt den Lernanforderungen der allgemeine Schule entsprechen, sondern konnten nach den Richtlinien der entsprechenden Sonderschule lernen. Damit verbunden war eine Veränderung im Leitspruch der Integrationsbewegung: "Das Postulat 'so viel Integration wie möglich und so wenig Segregation wie nötig', ausgegeben vom DEUTSCHEN BILDUNGSRAT, wurde vom Postulat 'Integration ist unteilbar' abgelöst" (Jacobs 2004, 16; Hervorhebung i.O.). Jedoch hat sich die Empfehlung des Bildungsrats erst wesentlich später auf einige Konzepte ausgewirkt (vgl. Schnell 2003, 23). |
|
1980er Jahre |
Der Beginn der 80er Jahre ist durch starke, ideologisch gelenkte Diskussionen gekennzeichnet. Innerhalb dieser Debatten werden Sonderschulen als "Institutionen der Gewalt" (Jantzen 1981 zit. nach Hinz 1993) bezeichnet und ihre Abschaffung gefordert. In den folgenden Jahren rücken Auseinandersetzungen auf praktischer und theoretischer Ebene in den Vordergrund (vgl. ebd.). Seit 1980 war eine Zunahme von integrativen Schulversuchen zu verzeichnen - diese Entwicklung wird als dritte Phase bezeichnet. Bis 1985 sind 19 Schulen[a] entstanden, in denen Gemeinsamer Unterricht durchgeführt wird. Die meisten davon beruhen auf Interessengemeinschaften von Eltern (siehe dazu Kapitel 4.1.1) (vgl. Jacobs 2004, 16). Zudem wurde die gesetzliche Schulpflicht für Kinder mit geistiger Behinderung bis in die 80er Jahre in allen Ländern durchgesetzt (vgl. Schnell 2003, 29). Auf dem Grundschulkongress 1989 ließen sich mit dem Grundschulmanifest auch Veränderungen in der allgemeinen Pädagogik verzeichnen. "Es geht nicht mehr um die Frage der Machbarkeit von Integration oder um das Erfahrungen-Sammeln in Modell- und Schulversuchen, sondern um eine Verankerung der Integrationsaufgabe als substantiellem Teil grundschulpädagogischer Arbeit" (Hinz 1993). Ab 1986 stieg die Einrichtung von Integrationsklassen im Grundschulbereich rasant an, so dass die Überschaubarkeit nur noch schwer möglich war (vgl. ebd.). |
|
1990er Jahre |
Alle Bundesländer verankerten in den 1990er Jahren Integration in ihre Schulgesetze. Als Grundlage dienten die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) zur sonderpädagogischen Förderung (1994) und die Ergänzung des Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes (1994) (vgl. Jacobs 2004, 29). Die KMK hat empfohlen, "gemeinsames Lernen als zukünftig verstärkt zu realisierende Unterrichtung von Schüler/innen mit Behinderung" (Schnell 2003, 16) einzusetzen. Das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz wurde 1994 mit dem Satz erweitert: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" (GG, Artikel 3 Absatz 3, Satz 2). Dies bezüglich hat das Bundesverfassungsgericht 1997 eine Grundsatzentscheidung gefällt (vgl. Schnell 2003, 16). Die Möglichkeit einer integrativen Beschulung erhielt damit den gleichen Stellenwert wie der Besuch einer Sonderschule (vgl. Evers-Meyer 2009, 11). Auf internationaler Ebene wurde sich offensiver für ein integratives Schulsystem ausgesprochen. Zum einen durch die Salamanca-Erklärung (1994) der UNESCO (vgl. Schnell 2003, 16). "Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen" (UNESCO 1994; Hervorhebungen i.O.). Auch Deutschland hat die Salamanca-Erklärung anerkannt. 1992 ist zudem die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten, die bereits 1989 verabschiedet wurde (vgl. Hausmanns 2010, 143). Im Artikel 23 werden speziell die Rechte von Kindern mit Behinderung formuliert (vgl. ebd., 148). |
|
Ab 2000 |
Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) stellt ein weiteres wichtiges internationales Dokument dar. Seit März 2009 gehört auch Deutschland zu den Staaten, die die BRK ratifiziert haben (vgl. Evers-Meyer 2009, 5). Die Vertragsstaaten willigten mit dem Artikel 24 ein, ein 'inclusive education system' - gemäß der englischen Originalfassung - sicherzustellen. |
|
Heute |
Im Bestreben um eine integrative Beschulung ist die BRK derzeit das bedeutendste rechtskräftige Dokument. Dennoch steigen laut Nationalem Bildungsbericht 2010 in Deutschland die Anzahl der SchülerInnen an Sonderschulen an. Zugleich hat Deutschland im internationalen Vergleich einen der niedrigsten Anteile an integrativ beschulten SchülerInnen mit Behinderung (vgl. Deutscher Bundestag 2010, 69f). Die Bundesrepublik kann also immer noch eindeutig in die Kategorie "integrationspädagogisches Entwicklungsland" (Schnell 2003, 17) eingeordnet werden. Der Vorsitzende der Elterninitiative ERIK Goslar berichtete im persönlichem Gespräch, dass die grundlegenden Widerstände in den Schulen selber lägen (vgl. Frank Hehlgans). Dabei hängt "die Zukunft gemeinsamer Erziehung (...) von der Bereitschaft von Schulen und jeweils der einzelnen Lehrkraft ab, sich für integrative Arbeit zu öffnen bzw. zu entscheiden - aber auch von den Rahmenbedingungen, die nur Politik und Verwaltung schaffen können" (Schnell 2003, 13). Ein Umdenken der PädagogInnen ist dringend erforderlich. Zudem darf in der öffentlichen Diskussion um schulische Integration der ökonomische Aspekt keinen zu hohen Stellenwert erhalten. "Das Argument, Integration sei viel zu teuer ist spätestens seit der Studie von PREUSS-LAUSITZ (1996) nicht mehr pauschal haltbar, zumal es aus ethischer Perspektive unverantwortbar ist" (Jacobs 2004, 20). |
|
[a] Eine Auflistung der Schulen befindet sich in Hüwe/Roebke (2006). |
|
Die Integrationsentwicklung in der BRD wurde angeregt von Erfahrungen aus dem Ausland (vgl. Deppe-Wolfinger 1990, 18). Deppe-Wolfinger spricht von einem wahren "Integrationstourismus" (ebd.), der in den 70er Jahren einsetzte[6].
Aus heutiger Perspektive sind verschiedene Entwicklungslinien erkennbar. Andreas Hinz hat diese mit ihren wesentlichen Merkmalen und Problemen zusammengefasst:
|
Versuche |
Schwerpunkte, Ziel |
"Gefahren", Probleme |
|
Versuche mit einer Behinderungsart |
Zugang zu höheren Schulabschlüssen; mehr soziale Kontakte; Spezialisierung auf Probleme einer Behinderungsart |
Gefahr der Anpassung; nur eingeschränkte Kontakte; Entfernung aus dem sozialen Umfeld |
|
Versuche mit einer "differenzierten Grundschule" |
Eingehen auf die Heterogenität der Lerngruppe, bes. am Schulanfang; Veränderung des Unterrichts (Öffnung, Individualisierung) |
eingeschränkte Schülerschaft (Aussonderung vor Einschulung); gleiche Anforderungen für alle (wenn auch mit Modifikationen) |
|
Präventionsversuche |
Vermeidung von Aussonderung; zusätzliche Hilfen für Kinder, Eltern und PädagogInnen |
wenig Notwendigkeit zur Veränderung des Unterrichts, geringes Innovationspotential; keine Aufgabe der gleichen Anforderungen für alle; eingeschränkte Schülerschaft, institutionelle Begrenzungen |
|
Integrationsklassen |
"eine Schule für alle" mit unausgelesener Schülerschaft; Aufgeben gleicher Anforderungsniveaus für alle (zieldifferentes Lernen); stärkere Entwicklungsanreize in bewußt heterogener Lerngruppe |
Auslese bei Aufnahme; schiefe Repräsentanz der Anteile von Kindern mit Behinderung und Behinderungsarten; soziale Selektivität (bes. bei Elterninitiativen); Zweiteilung von Schule und Kollegium (integrative und normale Klassen); enge Kooperation d. PädagogInnen |
|
Integrationsschulen |
s. Integrationsklassen; angemessene Berücksichtigung der Behinderungsarten und der Schichten; Wohnortnähe für alle; keine Zweiteilung der Schule |
Probleme der Heranziehung spezifischer Hilfen; enge Kooperation der PädagogInnen; Verteilung von SonderpädagogInnen auf den ganzen Jahrgang |
|
Einzelintegration |
soziale Bezüge im Umfeld, Wohnortnähe, Normalität des Stadtteils bzw. ländl. Umfelds; stärkere Entwicklungsanreize außerhalb der Sonderschule; Integrationsmöglichkeit außerhalb elitärer Schulversuche |
Gefahr der Anpassung an unveränderten Unterricht, Tendenz von der Integration zur Addition; Gefahr der Vereinzelung von Kindern mit Behinderung; Gefahr der Selektivität mit einer "integrierbaren" Schülerschaft |
|
Dezentralisierte Sonderpädagogik |
Prinzip: SpezialistInnen zu Kindern, nicht umgekehrt; Unterstützung wohnortnaher Integration durch apparative, didaktische und therapeutische Hilfen |
Gefahr der Anpassung an unveränderten Unterricht; Gefahr der Vereinzelung von Kindern mit Behinderung |
"Es muß deutlich gesehen werden, daß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Form integrativer Erziehung gibt, die alle Vorteile in sich vereinigen würde und keinerlei Gefahren aufsitzen könnte", was es jedoch "zu konstatieren gilt, ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Formen und Ansätze auf dem Weg zu mehr Gemeinsamkeit von unterschiedlichen Kindern" (Hinz 1993). Eine Vergleichbarkeit ist wegen der Verschiedenheit der Konzepte nicht möglich "und somit eine Effizienz- und Tragfähigkeitsdebatte nur schwerlich zu führen" (Jacobs 2004, 22).
Die Konzepte verdeutlichen, dass in der Integrationsdiskussion überwiegend das Anpassungsmodell als Standpunkt gewählt wird, das "über eine besondere Förderung ihr Ziel zu erreichen sucht" (Hinz 1992, 64). Durch den "Einsatz zusätzlicher sonderpädagogischer Kompetenzen (...) in der allgemeinen Schule" (ebd.) soll Aussonderung umgangen werden: "Die allgemein verbindlichen Lernziele der Schule sollen so auch von diesen Kindern erreicht werden können" (ebd.). Demnach werden die Leistungsmaßstäbe der allgemeinen Schule verfolgt - entsprechend der zielgleichen Integration. Jedoch stellt das Ergänzungsmodell die wirkliche "integrative Position" (ebd., 65) dar. "Ihre VertreterInnen streben die Verwirklichung der 'Schule für alle' an, die die volle Brandbreite von Kindern zulässt, und seien es in kognitiver Hinsicht die Spanne vom 'schwerstmehrfachbehinderten' bis zum 'schwerstmehrfachbegabten' Kind" (ebd.). Sie ermöglicht folglich eine lernzieldifferente Integration.
Die didaktische Auseinandersetzung integrativen Unterrichts führt innerhalb der Integrationspädagogik vielmehr ein "stiefmütterliches Dasein" (Wocken 1998, 37). Hans Wocken führt das auf zwei Ursachen zurück: Zum einen erforderte der Kampf um Rechtfertigung und Durchsetzung auf politischer Ebene erhöhte Aufmerksamkeit. Andererseits wurde in der wissenschaftlichen Diskussion "integrativer Unterricht (...) schlichtweg gleichgesetzt mit gutem Unterricht" (ebd.): "Es handelt nicht um eine neue, andere Pädagogik, sondern um eine gute, allgemeine Pädagogik" (Hinz 1993). Eine genauere Beschreibung liefert Deppe-Wolfinger in Anlehnung an Muth 1986: "Unterricht in integrativen Klassen bedeutet möglichst geringe äußere Differenzierung und möglichst große innere Differenzierung, um jedes Kind auf seinem jeweiligem Entwicklungsniveau zu fördern, ohne freilich die soziale Einheit der Klasse und die Gemeinsamkeit des Unterrichts zu zerstören" (1990, 17f). Georg Feuser hat mit seiner 'Theorie des gemeinsamen Gegenstandes' (1982) ein erstes konkretes Konzept geboten. Wocken legt mit Bezug darauf seine Theorie gemeinsamer Lernsituationen dar (vgl. Wocken 1998, 40-50).
Auf der theoretischen Ebene der Integrationspädagogik wurden mehrere Ansätze entwickelt. Die drei wichtigsten Theorien stammen von Georg Feuser, Alfred Sander und Helmut Reiser. 'Die Theorie des gemeinsamen Gegenstandes' von Feuser[7] bezieht sich auf die konkrete Handlungsebene des Unterrichts. Der ökosystemische Ansatz von Sander "geht demgegenüber von der übergeordneten Ebene der Entwicklung von (Schul-)Systemen aus und betrachtet so die Wechselwirkungen auf unterschiedlichen Systemebenen"[8] (Hinz 1993). Jedoch vernachlässigt er die Unterrichtsebene. Im Folgenden wird auf die 'Theorie integrativer Prozesse' nach Reiser u.a. näher eingegangen. Hinz führt diese als "umfassendste und ertragreichste Theorie im Bereich der Integrationspädagogik" (1993) an, denn sie beziehe unter anderem die anderen beiden Theorien mit ein (vgl. ebd.).
Begründer der 'Theorie integrativer Prozesse' ist die Frankfurter Arbeitsgruppe um Helmut Reiser (vgl. Jacobs 2004, 23). Der humanistische Ansatz der 'Themenzentrierten Interaktion' bildet die Kerntheorie (vgl. Jakobs 2004, 23). Darauf aufbauend erfolgt nun die detaillierte Beschreibung der Theorie integrativer Prozesse. Dabei bilden die Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit sowie die fünf Ebenen nach Hinz (1993) die Schwerpunkte meiner Ausführung.
Der Begriff 'Prozess' stammt vom lateinischen 'processus', das mit 'Fortgang, Fortschreiten' übersetzt werden kann (vgl. Kluge 1989, 567). Heutzutage werden ihm zwei Bedeutungen zugeordnet. Einerseits im juristischen Sinn das Gerichtsverfahren und andererseits kann es als von Ablauf, Vorgang oder Entwicklung verstanden werden. Der zweite Aspekt spielt in der Theorie integrativer Prozesse eine Rolle. Die Prozesshaftigkeit der Theorie wird bewusst hervorgehoben, "um die Dynamik des Geschehens zu betonen" (Klein u.a. 1987). Die Dynamik begründet sich auf die Dialektik[9] von Gleichheit und Verschiedenheit, die nach Reiser "der Motor integrativer Prozesse" (1992, 14) ist. Dialektik meint hier die dynamische Balance zwischen den zwei Tendenzen Gleichheit - was Gleichartigkeit, Annäherung an Andere und gemeinsames Miteinander einschließt - und Verschiedenheit - was Distanzierung zu Anderen und Selbstbestimmung beinhaltet (vgl. ebd.). Reiser hebt hervor, dass diese Tendenzen keine Pole sind, die sich gegenseitig ausschließen oder abschwächen, sondern sie befinden sich in einem Spannungsverhältnis, das gemäß der Dialektik nach Aufhebung strebt (vgl. ebd.). "Nach Ruth Cohn bin ich umso autonomer, je mehr ich mir meiner Verbundenheit bewußt bin, ich bin umso verbundener, je besser ich mich als einzelne/einzelner abgrenzen kann" (ebd.).
Diese dynamische Balance findet sich auf der gesellschaftlichen Ebene wieder. Gesellschaftliche Integration ist erst erreichbar, "wenn die grundsätzliche Gleichheit aller, aber auch ihre Verschiedenheit akzeptiert wird" (Hinz 1993).
Im schulischen Kontext betrachtet, muss also eine "Balance von gemeinsamen und individuellen Momenten" (Hinz 1993) gefunden werden. Unser aktuelles Schulsystem reduziert die Komplexität, die durch die vielfältigen Bedürfnisse und Fähigkeiten der heterogenen Schülerschaft hervorgerufen wird, mit Hilfe der homogenisierten Jahrgangsklassen und der Einrichtung von verschiedenen Schultypen auf Basis von Leistungsdifferenzierung (vgl. ebd.). Die Aufgabe, eine Balance in unserer von Heterogenität geprägten Gesellschaft herzustellen, wird damit nicht angegangen. Die Schwierigkeit der Integration besteht nun darin, dass die normativen Ansprüche von Schule nicht mit dem Integrationskonzept vereinbar sind. Folglich muss die Struktur und Funktion vom System Schule überdacht werden. Die Grundbedingung für gleichschrittiges Lernen nach einheitlichen Lehrplänen ist eine homogene Lerngruppe (vgl. Reiser u.a. 1986b, 154). Integration wird missverstanden, wenn angenommen wird, dass die normativen Bedingungen beibehalten und zunehmend Gleichheit trotz Heterogenität erreicht werden könnte (vgl. Reiser 1992, 154). Denn dann führt gemeinsamer Unterricht zur Homogenisierung der heterogen zusammengesetzten Lerngruppe und nicht zur beabsichtigten Integration (vgl. ebd.). Reiser sieht darin auch den Grund für das frühzeitige Scheitern von einigen integrativen Ansätzen (vgl. ebd., 155).
Reiser und seine Arbeitsgruppe betonen, dass die Theorie integrativer Prozesse sich nicht ausschließlich auf die Integration von Menschen mit Behinderung bezieht. Sie "versteht (...) sich also nicht als sonder-, sondern als eine allgemeinpädagogische Theorie" (Hinz 1993).
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, kommt die Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit in der Dynamik integrativer Prozesse konkret zum Ausdruck. Zwischen den beiden sich gegenseitig bedingenden Polen Annäherung und Abgrenzung versuchen die Prozesse, durch Synthese eine Einigung herzustellen. Dies bezüglich bezeichnet 'integrativ' "Prozesse, bei denen 'Einigungen' zwischen widersprüchlichen innerpsychischen Anteilen, gegensätzlichen Sichtweisen, interagierenden Personen und Personengruppen zustande kommen" (Klein u.a. 1987). Einigungen gehen von der Bereitschaft aus, andere Standpunkte anzuerkennen und dabei weder diesen noch seinen eigenen Standpunkt als Gegensatz zu verstehen. Verschiedenheit ist erwünscht und soll dazu anregen, das gemeinsam Mögliche aufzuspüren. Einigungen sind zum einen Voraussetzung für gemeinsames Handeln und zusätzlich auch Produkt von Handlungsversuchen (vgl. ebd.).
Das folgende Beispiel soll die dialektische Verschränktheit von Annäherung und Abgrenzung verdeutlichen: Mehrere SchülerInnen wechseln gemeinsam von der Grundschulklasse in eine neue Klasse der Sekundarstufe I. Um das neue Umfeld entdecken zu können, müssen die freundschaftlichen Verbindungen zunächst gelockert werden. Es muss eine Abgrenzung der einzelnen Personen erfolgen, um eine Annäherung an neue Personen zu ermöglichen. Nach einer Erkundungsphase und der Kontaktaufnahme zu den neuen MitschülerInnen werden die alten Freundschaften nochmals hinterfragt und neu ausgerichtet. Die individuellen Bedürfnisse nach Nähe und Distanz jeder einzelnen Person tragen den Einigungsprozess. Eventuell werden andere Formen des gemeinsamen Umgangs entwickelt oder Situationen der Nähe und der Distanzierung wechseln sich über einen längeren Zeitraum ab.
Natürlich können die Einigungsversuche auch misslingen. Es kann zu Fehlentwicklungen kommen, die sich auf der einen Seite in statische Zustände der 'Verschmelzung' einerseits oder der Auseinanderentwicklung andererseits äußern können. Nur durch Abwehrverhalten können diese gegensätzlichen Fehlentwicklungen beibehalten werden (vgl. Klein u.a. 1987).
Reiser u.a. haben eine Einteilung integrativer Prozesse auf vier Ebenen vorgenommen (vgl. 1986a, 121). Ich beziehe mich im Folgenden auf das modifizierte Modell von Hinz (1993). Demnach finden integrative Prozesse auf fünf Ebenen statt (Abbildung 2). Jede Ebene stellt eigene Ansprüche, jedoch steht sie auch in einem beweglichen Wechselverhältnis zu den anderen vier Ebenen.
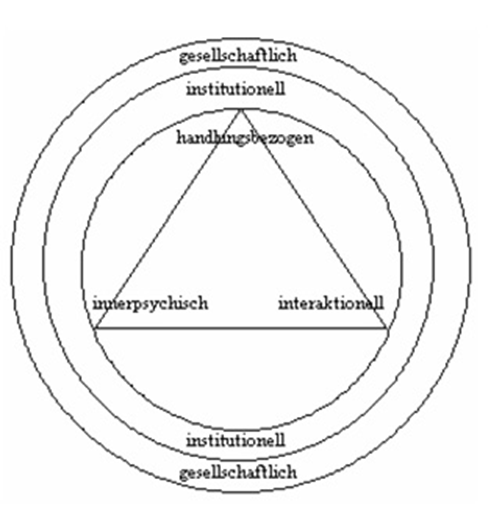
Abbildung 2: Modell integrativer Prozesse (Hinz 1993)
Den Ausgangspunkt bildet die innerpsychische Ebene. Denn "ohne sie [können; D.A.] auf allen anderen Ebenen keine Einigungen gelingen" (Klein u.a. 1987). Feuser (1985) hat das mit der Überschrift seines Zeitschriftartikels "Integration muß in den Köpfen beginnen" zum Ausdruck gebracht (vgl. Jacobs 2004, 25).
Einigung auf der innerpsychischen Ebene bedeutet für jeden Menschen die Akzeptanz der eigenen ungeliebten, versteckten Eigenschaften (vgl. Hinz 1993) - die so genannten 'Schattenseiten'. "Akzeptanz wird dann möglich, wenn die Person ihre widersprüchlichen Empfindungen und Impulse zueinander in Beziehung bringt, ohne eigene Anteile verdrängen oder verleugnen zu müssen" (Klein u.a., 1987).
Jeder Mensch besitzt Seiten, die er selber nicht begrüßt, und trotzdem wird versucht, diese Wesenszüge mittels Verfolgung oder Verleugnung abzuwehren (vgl. Hinz 1993). Verleugnung erfasst das Vertuschen, Ausschließen und Aussondern der unvereinbaren, ablehnenden Seiten der eigenen Person (vgl. Wocken 1988). Hingegen ist Verfolgung das Abschieben dieser Anteile (vgl. Hinz 1993). "Wir (...) bekämpfen sie als Projektion stellvertretend, vielleicht besonders scharf, bei anderen" (ebd.). Das Bestehen von Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung lässt sich damit erklären. Denn durch die Zuweisung einzelner Personen z.B. auf eine Sonderschule, kann im Umfeld dieser umgangen werden, sich mit seinen 'Schattenseiten' auseinanderzusetzen. Innerhalb der Sonderschule ist das Abwehrverhalten durch den 'Therapiewahn' erkennbar, womit alles zu stark 'Unnormale' ausgebessert werden soll (vgl. Jacobs 2004, 26).
Allgemein gesehen täuscht sich die Gesellschaft Perfektionismus durch Idealbilder vor. Die gesellschaftliche Idealvorstellung eines/einer 'guten' Schülers/Schülerin sieht aus meiner Sicht wie folgt aus: Er/Sie hört aufmerksam zu; bereitet sich gewissenhaft auf Klausuren vor; erledigt immer seine Hausaufgaben; widerspricht nicht; ist über eine lange Zeitspanne aufnahmefähig; geht respektvoll mit seinen Mitmenschen um; ist ehrgeizig etc.. Da eine Person selten alle Merkmale aufweist, glaubt jeder/jede Einzelne, dass er/sie 'fehlerbehaftet' sei. Dabei machen gerade diese 'Makel' die Einzigartigkeit eines jeden Menschen aus. Die Idealbilder könnten also Ansporn bieten, die Widersprüche in Bezug auf die Realität aufzudecken und seine Einmaligkeit anzuerkennen: "Die persönliche Integration jedes einzelnen von uns setzt die selbstbewußte Einsicht voraus, daß wir nicht nur gute, sondern auch dunkle Seiten haben" (Wocken 1988). Somit wird jedem Menschen auch "das Recht auf Unterschiedlichkeit" (Wocken 1987, 76) zugestanden und Behinderungen als menschlich angesehen.
Die ganzheitliche Sichtweise kann auf die interaktionelle Ebene übertragen werden. Erst durch zwischenmenschliche Beziehungen werden integrative Prozesse in Gang gesetzt und dementsprechend wirken sie als Auslöser für Prozesse auf der innerpsychischen Ebene (vgl. Klein u.a. 1987). "Eine ganzheitliche Beziehung heißt, wir selbst begegnen den anderen als ganze Person, so wie wir sind, und nehmen dabei auch unser Gegenüber als ganze Person wahr" (Wocken 1988). Die Reduzierung auf einzelne Merkmale verfälscht das Bild der eigenen Person und der Mitmenschen. Eine Einigung auf der interaktionellen Ebene zielt auf Begegnung ab. Fehlentwicklungen äußern sich in Verschmelzung oder Ablehnung (vgl. Jacobs 2004, 27). Das Imitieren eines Idols lässt seine eigenen Schwächen schnell im Hintergrund verschwinden. Denn es erfolgt lediglich eine Identifikation mit den positiven, erwünschten Charakterzügen. Andererseits kann ein Mensch mit Behinderung natürlich nur als hilfebedürftig und 'Therapieobjekt' angesehen werden. Die Herausforderung liegt darin, "die Dialektik von Gleichheit und Ungleichheit, von Einmaligkeit und Gemeinsamkeit, von Sich-Abgrenzen und Sich-Annähern stets aufs neue auszuhandeln und zu leben", denn "der Preis von Integration kann weder die einseitige Anpassung Behinderter an die Normalität Nichtbehinderter sein, noch eine einseitige Aufgabe von Entfaltungsbedürfnissen Nichtbehinderter aus Rücksichtnahme auf die Behinderten" (Wocken 1988).
Als dritte Ebene folgt die handlungsbezogene Ebene. Die Modifizierung der Theorie von Reiser 1990 führte zur Hinzunahme und Betonung des Handlungsaspekts (vgl. Reiser. 1990, 32). Hier "wirken solche Prozesse integrativ, in denen Personen gemeinsam an einem Gegenstand/ Vorhaben arbeiten mit dem Ziel, Realität zu bewältigen. Dies erfordert vielfältige und individuell gestaltbare Kooperationsmöglichkeiten" (ebd., 33). Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse finden zwischen den dialektisch verbundenen Polen Verweigerung und Vereinnahmung statt. Da Eltern von Kindern mit Behinderung oft auf ablehnendes Verhalten auf Seite des LehrerInnenkollegiums stoßen, werden Integrationsforderungen abgewiesen. Eine Klage beim Gericht ist erforderlich, um die rechtlichen Ansprüche auf integrative Beschulung durchzusetzen. In der Vergangenheit hat Ablehnung automatisch zur Aussonderung geführt. Das Anstreben von Kooperation folgt zur Einigung zwischen den widersprüchlichen Tendenzen Verweigerung und Vereinnahmung (vgl. Jacobs 2004, 28).
"Auf der institutionell bestimmten Ebene geht es um den in Erziehungskonzepten gefaßten und durch Einrichtungen repräsentierten Sachauftrag der Erziehung" (Klein u.a. 1987). Sieumfasst also die verwaltungsmäßige Grundlage der Integration (vgl. ebd.). Somit stellt sich nun die Frage, wie der kleinste gemeinsame Nenner von konzeptionellen und gesetzlichen Bestimmungen definiert ist. Kann ein Spielraum geschaffen werden, in dem gemeinsamer Unterricht mit einer heterogenen Lerngruppe möglich ist? Denn die institutionelle Separation versucht, "die Dialektik von Gleichheit und Ungleichheit durch starre Einteilungen von Individuen zum Stillstand zu bringen" (Klein u.a. 1987). Anpassung als Gegenpol zur Aussonderung möchte SchülerInnen an das System angleichen (vgl. Jacobs 2004, 28) - der erwähnte 'Therapiewahn' ist damit eine Form von Anpassung. "Eine integrative Schule, in der Gemeinsamkeit zwischen unterschiedlichen Kindern möglich ist, nimmt die Kinder an, wie sie sind, und versucht, ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu entsprechen" (Hinz 1993).
"Die normativen Grundlagen integrativer Prozesse" (Klein u.a. 1987) sind auf der gesellschaftlichen Ebene verankert. Es ist schwer, einheitlich zu definieren, was gesellschaftlich unter 'normal'[10] verstanden wird. Denn es gibt ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Auffassungen von 'Normalität'. Der Widerspruch zwischen Maßstäben eines jeden Individuums und die gesellschaftlichen Normen und Werte andererseits stehen im Mittelpunkt dieser Ebene (vgl. Hinz 1993). "Dem einen Pol entsprechend hält eine Gesellschaft schnell alles, was nur ein bisschen anders (...) ist, für falsch, schädlich, schlimm etc." (ebd.). Zum Ausdruck kommt das Abgrenzungsverhalten durch Exotisierung. Demgegenüber steht die "normative Kolonialisierung" (ebd.). Demnach wird jedes Mitglied der Gesellschaft unter Druck gesetzt, seine individuellen Einstellungen den gesellschaftlichen Vorschriften anzupassen (vgl. ebd.). "Die Berücksichtigung dieser Grundlagen verringert die Gefahr der Selbstüberforderung der Pädagogen, wenn sie sich zur Aufgabe setzen, einen Lern- und Lebensraum herzustellen, in dem der Widerspruch zwischen ungleichen Voraussetzungen und gleichen Bedürfnissen und Rechten - bei Kindern wie bei Erwachsenen - aufgehoben ist" (Klein u.a. 1987). Allerdings stellt dies eine überfordernde Aufgabe für Pädagogen dar, weil "die gesellschaftlich vorgegebenen Wertungen individueller Leistungsunterschiede in den Selbstdefinitionen der Individuen, auch im Selbsterleben der Kinder, unauflöslich verwoben wird" (ebd.). Integrative Pädagogik legt 'normale' Lebenswege statt aussondernde Effekte nahe. Diese Haltung benötigt eine Akzeptanz von der Unterschiedlichkeit individueller Maßstäbe, Voraussetzungen und Einstellungen (vgl. Hinz 1993).
Die dialektische Verknüpfung auf allen Ebenen stellt Hinz (1993) knapp mit dem folgenden
Schema dar:
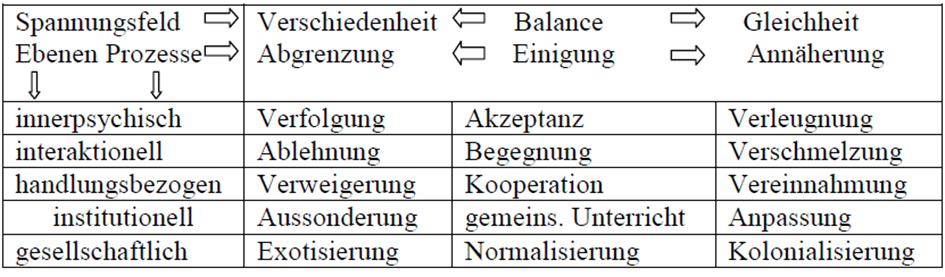
Abbildung 3: Ebenen integrativer Prozesse (Hinz 1993)
"Die Grundstruktur besteht aus Abgrenzungs- und Annäherungsprozessen zwischen den beiden Polen Gleichheit und Verschiedenheit. Sie werden auf unterschiedlichen Ebenen als widersprüchliche Tendenzen und ihre dialektische Aufhebung in Einigungen deutlich" (Hinz 1993). Integrative Prozesse dürfen nicht nur auf einer Ebene stattfinden, da durch das dynamische Wechselspiel aller Ebenen "der dialektische Prozeß von Annäherung und Abgrenzung von jeder Ebene her störanfällig ist. Andererseits können integrative Prozesse von jeder Ebene her angestoßen werden" (Klein u.a. 1987). Allgemein kann festgehalten werden, dass "Integration
(...) das Resultat eines schwierigen psychischen und sozialen Reifungsprozesses" (Reiser u.a. 1986b, 156) ist.
Aus der vorangegangenen Erklärung der einzelnen Ebenen und Abbildung 3 ist es möglich, Reisers Verständnis von Integration nachzuvollziehen. Er sieht Integration als unaufhörlichen Prozess der Einigung an, quasi als "die immerwährende Lust, eine dynamische Balance herzustellen" (Reiser 1992, 14). Es wird nie ein 'fester Endzustand' erreicht werden können. Denn es treten immer wieder Veränderungen in den verschiedenen Ebenen auf. Beispielsweise regt ein Wohnortswechsel neue Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse an. Innerhalb der neuen Schule oder des neuen Arbeitsplatzes müssen neue Interaktions- und Handlungsformen ausgearbeitet werden. Integration muss "an jedem Tag neu realisiert werden" (Muth 1996, 59). In einem unbegrenzten Zeitraum werden also immer wieder Prozesse in Gang gesetzt und Einigungen hervorgerufen.
Zudem meint Integration im Sinne der Theorie integrativer Prozesse mehr als "ein bloßes Hinzufügen von Kindern, die vorher ausgeschlossen waren, zu einem unverändertem Ganzen, sondern um einen Ansatz, der alle Kinder, alle mit Schule befaßten Personen und die Gesellschaft als ganzes betrifft und insgesamt zur Entwicklung von etwas Neuem führt" (Hinz 1993; Hervorhebung i.O.). Die Einrichtung einer Integrationsklasse ist erst einmal lediglich eine schulorganisatorische Maßnahme, die den Startpunkt integrativer Erziehung angibt. Die Entwicklung darf dort aber nicht stehen bleiben. Denn die institutionellen Bedingungen bilden die Voraussetzung, um "integrative Qualität" (Boban/Hinz 1996) zu entwickeln: Integration ist "ein zu gestaltender Prozess zwischen Menschen (...), der wesentlich aus der Intensität des Sich-Einlassens aufeinander lebt" (Köbberling/Schley 2004, 171). Die pädagogische Fachkraft bekommt von Reiser eine wichtige Rolle in der Auslösung und Gestaltung integrativer Prozesse zugeteilt: Sie versucht
-
"förderliche Bedingungen zu schaffen.
-
... wahrzunehmen, welche integrativen Prozesse dadurch in Gang kommen.
-
... zu analysieren, auf welchen Ebenen welche Prozesse in Gang kommen. (...)
-
... die Bedingungen weiter zu verbessern, weitere Ebenen einzubeziehen, die integrative Prozesse fördern" (Reiser 1992, 16).
Damit wird vorausgesetzt, dass bei der Lehrkraft bereits integrative Prozesse auf ihrer innerpsychischen Ebene ausgelöst wurden. Sollte dies nicht geschehen sein, könnten leicht Missverständnisse nach dem Motto "Montag, Mittwoch und Donnerstag gehe ich in der 4. und 5. Stunde integrieren" (zit. nach Reiser 1992, 16) auftreten. Widersprüche zwischen der Theorie integrativer Prozesse und der integrativen Praxis werden von der Wissenschaft häufig wahrgenommen. Eine problematische Praxisumsetzung ist zu verzeichnen, da das Integrationskonzept mehr und mehr zur Verflachung neigt (vgl. Jacobs 2004, 30). Denn Integration kann bei nicht durchdachter, konzeptioneller Umsetzung "Entfremdung fördern, wenn das Erleben des Andersartigen vertieft und keine gegenseitige Akzeptanz erzielt wird" (Reiser u.a. 1986b, 156). Eine andere Form der desintegrativen Entwicklung tritt auf, "wenn es zu dauerhaften Prozessen symbiotischer Verschmelzung ohne Momente der Abgrenzung" (Hinz 1993) kommt. Ein "per se harmonisches Miteinander" (Hinz 1993) ist auf keinen Fall Ziel der Theorie integrativer Prozesse. "Im Gegenteil ist es eine wichtige Aufgabe für die PädagogInnen in der gemeinsamen Situation mit den Kindern, Konflikte als Chance der Weiterentwicklung für die Gruppe wie für die Individuen wahrzunehmen und in konstruktiver Weise mit ihnen umzugehen, anstatt sie mit großem Energieaufwand zu tabuisieren" (ebd.).
In Integrationsklassen - sowie im restlichen integrativen Praxisfeld - ist eine Trennung der Gemeinschaft in 'die Behinderten' und 'die Nichtbehinderten' offensichtlich erkennbar. Entgegen den ursprünglichen konzeptionellen Überlegungen bildet die Zwei-Gruppen-Theorie ein eindeutiges Kennzeichen von Integration. Zwar wird begonnen sich von dem Homogenitätsgedanken einer Schulklasse zu entfernen, dennoch existieren die 'Unnormalen', die 'Anderen' (vgl. Hinz 1998). Damit werden andere Methoden, Inhalte und Lernwege für legitim gehalten (vgl. Boban/Hinz 2003). Das führt wiederum zu der Frage: Wo liegt dann noch das Gemeinsame im Gemeinsamen Unterricht? Die von der Natur vorgegebene Heterogenität wird noch nicht vollständig akzeptiert. Daher schlussfolgert Hinz drei Probleme: "Zum ersten erfolgt eine implizite Abwertung der 'anderen' Kinder und Jugendlichen. (...) Zum zweiten ergibt sich die Tendenz zu exklusiver oder zumindest besonderer Zuständigkeit von 'anderen' Experten für diese 'anderen' Kinder. (...) Zum dritten schließlich besteht die Tendenz zu explosionsartiger Vermehrung von sonderpädagogischem Förderbedarf" (ebd.).
Der Amerikaner Mayer Shevin bringt dieses Phänomen sehr anschaulich zum Ausdruck (1992; Übersetzung Ines Boban und Andreas Hinz)
:
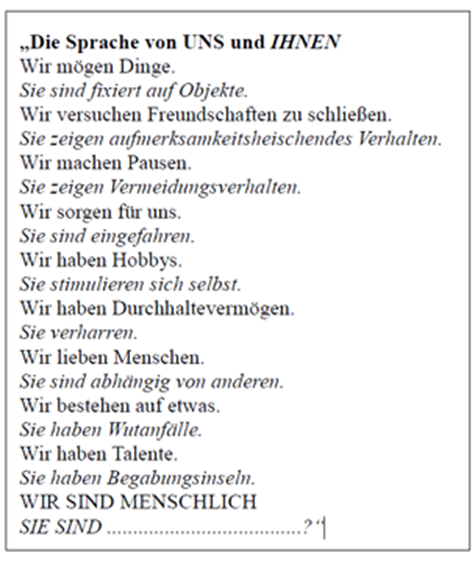
[3] Diese Definition kennzeichnet auch eine Integrationsklasse.
[4] Die Definition der Begriffe allgemeine Schule, allgemeinbildende Schule und Regelschule folgt im Kap. 3.1.
[5] In den meisten Bundesländern wurde eine Umbenennung von Sonderschulen zu Förderschulen vorgenommen. Daran gebunden waren allerdings keine Veränderungen in der Praxis dieser Schulform. Die Aussonderung von SchülerInnen mit Behinderung findet immer noch statt. Gerade unter diesem Aspekt verwende ich weiterhin die Bezeichnung 'Sonderschule'.
[6] Detailliert sind die Einflüsse aus dem Ausland in Deppe-Wolfinger (1990) beschrieben.
[7] Weiterführende Literatur: Feuser, Georg (1982): Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand/ Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. Behindertenpädagogik 21, 86-105
[8] Weiterführende Literatur: Hildeschmidt, Anne/ Sander, Alfred (1988): Der ökosystemische Ansatz als Grundlage für Einzelintegration. In: Eberwein, Hans (Hrsg.) (1988): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim: Beltz, 220-227
[9] "Fortschreiten des Denkens in gegensätzlichen Begriffen. Nach G.W.F. Hegel erzeugt jeder Begriff als Thesis einen entgegengesetzten, die Antithesis. Aus beiden Begriffen geht die Synthese hervor, als höhere Form, in der die Widersprüche ‚aufgehoben' sind" (Der Brockhaus in einem Band 2002, 195).
[10] "Die sogenannte Glocken-Kurve benannt nach Gauss ist ein wichtiges Instrument der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Sie beschreibt einen Graphen mit einer Normalverteilung, da er auf einen zentralen Grenzwertsatz beruht. Eine Summe von n unabhängig, identisch verteilten Zufallsvariablen mit dem Grenzwert Unendlich (∞) normalverteilt (vgl. Frank, Schulz, Tietz & Warmuth 1998, 349 ff). In der Statistik werden die Grenzen (-1; 1) als normal angerechnet, darüber hinaus aus der Norm. Welche Merkmale dabei untersucht werden ist unabhängig. Fakt ist egal welches Merkmal berechnet wird, beispielsweise Tippgeschwindigkeit auf der Tastatur es wird eine gaußsche Normalverteilung das Ergebnis sein. D.h. es gibt Menschen mit einer normalen, einer verlangsamten und einer besonders schnellen Tippgeschwindigkeit" (Friess 2011, 9).
Inhaltsverzeichnis
Dieses Kapitel beinhaltet einen kurzen Abriss des mehrgliedrigen Schulsystems der Bundesrepublik Deutschland. Anschließend wird die Schulform 'Gymnasium' auf ihre 'exklusive' Stellung untersucht. Zukünftig wird jedoch das Gymnasium seine Rolle überdenken müssen. Denn durch die UN-Behindertenrechtskonvention wird dieser Lernort aufgefordert, die Realisierung der gemeinsamen Beschulung von SchülerInnen mit und ohne Behinderung zu unterstützen.
Die anschließende schematische Abbildung zeigt das Schulsystem in der BRD und dient dem besseren Verständnis der kommenden Ausführung.
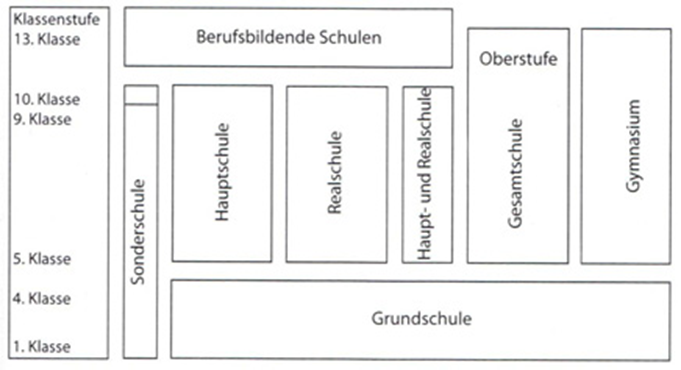
Abbildung 4: Schulstruktur in der Bundesrepublik Deutschland ab 1969 (van Ackeren/Klemm 2011, 43)
Die Schulstruktur in Deutschland unterliegt der Aufteilung in einen Primar- und Sekundarbereich. Der Primarbereich umfasst die Grundschule. Der Sekundarbereich ist untergliedert in vier Schulformen: Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule (vgl. KMK 2009, 38). In einigen Bundesländern gibt es außerdem eine Mischform von Haupt- und Realschule. Im Allgemeinen wird jedoch von einer Viergliedrigkeit im Sekundarbereich gesprochen (vgl. van Ackeren/Klemm 2011, S.49f). SchülerInnen mit Behinderung werden in der Regel an einer Sonderform - "Förderschule/ Schule für Behinderte/ Sonderschule/ Förderzentrum" (KMK 2009, 39) - unterrichtet (vgl. ebd., 38). Seit einigen Jahren werden SchülerInnen mit Behinderung zunehmend zusammen mit denjenigen ohne Behinderung beschult (vgl. van Ackeren/ Klemm 2011, 49). "Die Verteilung der Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 8 für das Jahr 2008 stellt sich im Bundesdurchschnitt wie folgt dar: Hauptschule 19,3 %, Realschule 26,4 %, Gymnasium 34,2 %, integrierte Gesamtschule 8,7 %, Schularten mit mehreren Bildungsgängen 6,1 %, Förderschulen 4,5 %" (KMK 2009., 39).
Alle Schulformen des Primar- und Sekundarschulbereichs sowie die Sonderschule werden im Begriff 'Allgemeinbildende Schule' zusammengefasst. Die 'Regelschule' beinhaltet zusätzlich den Berufsbildungsbereich. Die Bezeichnung 'allgemeine Schule' bezieht sich auf die Schulformen Gymnasium, Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschule, ohne die Sonderschule.
In Deutschland beginnt die Schulpflicht mit Vollendung des sechsten Lebensjahrs. Die Kinder besuchen zuerst die Grundschule, die in den meisten Bundesländern vier Jahre dauert - in Brandenburg und Berlin sechs Jahre. Danach gibt es in der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) und II (Klasse 11 bis 12/13) - je nach Bundesland - die Wahl zwischen den bereits aufgeführten fünf verschiedenen Schulformen. Die Entscheidung basiert oft auf eine Empfehlung der Grundschule (vgl. van Ackeren/Klemm 2011, 49ff)
"Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine GRUNDLEGENDE ALLGEMEINE BILDUNG. Sie umfasst in der Normalform die Jahrgangsstufen 5-9. In Ländern mit sechsjähriger Grundschule beginnt sie mit Jahrgangsstufe 7. Bei zehnjähriger Vollzeitschulpflicht schließt die Hauptschule die Jahrgangsstufe 10 mit ein" (KMK 2009, 108; Hervorhebung i.O.). Es kann der Hauptschulabschluss als erster allgemeinbildender Schulabschluss erreicht werden (vgl. van Ackeren/Klaemm 2011, 50).
Die Realschule erstreckt sich über die 5. bzw. 7. bis 10. Klasse (vgl. ebd.). "Sie bietet ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung und führt mit dem mittlerem Schulabschluss zur Fachoberschulreife" (ebd.).
Das Gymnasium beginnt wie die Haupt- und Realschule mit der 5. oder 7. Klasse und endet mit dem Erhalt der allgemeinen Hochschulreife in der 12. oder 13. Klassenstufe. Momentan wird in fast allen Ländern die Schulzeit auf 12 Jahre verkürzt (vgl. KMK 2009, 109f).
"Die Gesamtschule in KOOPERATIVER FORM fasst die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium pädagogisch und organisatorisch zusammen. Der Unterricht wird in Klassen erteilt, die auf die unterschiedlichen Abschlüsse bezogen sind (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe)" (KMK 2009, 110; Hervorhebung i.O.). In der gymnasialen Oberstufe gelten die gleichen Bedingungen wie in der Sekundarstufe II des Gymnasiums. Hier kann ebenso die allgemeinen Hochschulreife erreicht werden (vgl. van Ackeren/Klemm 2011, 51).
Die KMK gewährleistet "die Sicherung einer Durchlässigkeit, die nach einer Phase der Orientierung auch Möglichkeiten für einen Wechsel des Bildungsgangs eröffnet" (KMK 2009, 105). Für alle SchülerInnen beträgt die Vollzeitschulpflicht neun Jahre, teilweise auch zehn Jahre, unabhängig von der Schulform (vgl. KMK 2009, 39).
Beim Betrachten des Titels dieser Arbeit kommt unweigerlich die Frage auf, wie der Lernort Gymnasium und die Beschulung von SchülerInnen mit Behinderung zusammenpassen. Die Vorstellung der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg in der Einleitung und im Kapitel 4 zeigt darüber hinaus, dass die dort integrativ beschulten SchülerInnen eine so genannte 'geistige Behinderung' haben. Damit stellt sich die Frage, warum diese SchülerInnen ein Gymnasium besuchen. Beabsichtigen ihre Eltern, dass sie das Abitur erreichen? In diesem Abschnitt soll der Lernort Gymnasium näher betrachtet werden, um ein Lösungsansatz für die aufgeworfenen Fragen zu geben.
Seit jeher nimmt das Gymnasium eine 'exklusive' Position ein. Dabei besitzt das Wort 'exklusiv' hier zwei Bedeutungen:
-
'von einem besonders hohen Wert sein'
-
'nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sein'
Ein Blick in die Geschichte und Gegenwart liefert den Beleg für beide Bedeutungen.
Das Gymnasium als Schulform des 'höheren' Schulwesens entstand aus dem Humanismus des 16. Jahrhunderts (vgl. Hamann 1986, 32). Die Wurzeln des heutigen Gymnasiums liegen im preußischen Schulsystem. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden Neuerungen vorgenommen, die bis heute gültig sind. Mit dem 1. Abiturreglement von 1788 wurde "das Abitur zum Nachweis der Studierfähigkeit als Prüfung am Ende der 'Höheren Schulen' eingeführt" (Van Ackeren/Klemm 2011, 16). Die Reifeprüfungsordnung legte 1812 die offizielle Bezeichnung 'Gymnasium' für alle zum Abitur führenden Schulen fest (vgl. Hamann 1986, 91). Aber erst das 3. Abiturreglement (1834) teilte dem Abitur seine Funktion als Voraussetzung für alle universitären Studiengänge zu. Der Neuhumanismus mit seinem prominentesten Vertreter Wilhelm von Humboldt prägte die inhaltliche Umstrukturierung. Mitte des 19. Jahrhunderts lag ein höheres Schulwesen vor, das durch drei Aspekte gekennzeichnet war:
-
Das 'Berechtigungssystem' gewährleistete den SchülerInnen eine staatliche kontrollierte Endprüfung mit Zugangserlaubnis zur Universität.
-
Durch den 'Leistungsgedanken' wurde die Abiturprüfung außerdem an das Erbringen von Schulleistungen gebunden.
-
Im 'Bildungskonzept' wurden die inhaltlichen Richtlinien festgehalten. Es betonte die Allgemeinbildung und grenzte sich von jeglicher berufsbezogener 'Spezialausbildung' ab (vgl. Van Ackeren/Klemm 2011, 15ff).
Diese Hauptmerkmale lassen sich auch heute noch auf das bestehende Gymnasium übertragen. Obwohl die neuhumanistischen Reformen unter der Devise "jedem einzelnen die Bedingungen menschenwürdiger Existenz zu sichern, aus Untertanen freie, gleichberechtigte und mitverantwortliche Staatsbürger zumachen" (Hamann 1986, 87) erfolgten, hielten die Vertreter des Neuhumanismus Real-, Bürger- und Fachschulen für überflüssig, schlossen die Beschulung des niederen Volks (vgl. ebd., 88ff) und von Kindern mit Behinderung sogar aus. Erst die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründeten privaten Internate bewiesen die Bildungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit 'geistiger Behinderung'. Trotzdem wurde der größte Teil in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht oder verblieb im Elternhaus. Die Zeit des Nationalsozialismus ermöglichte keine Weiterentwicklung (vgl. Mühl 1999, 156). Nach 1945 wurde die Schulpflicht für Kinder mit Behinderung festgelegt. Außen vor wurden für Kinder mit 'geistiger Behinderung' gehalten - bei ihnen wurde an der 'Bildungsunfähigkeit' festgehalten. Die aus einer Elterninitiative hervorgegangene Bundesvereinigung 'Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.' setzte sich für das Recht auf Bildung für den bisher ausgeschlossen Personenkreis ein. Für die Lebenshilfe gab es nur die Möglichkeit, gesellschaftliche Integration mittels Sondereinrichtungen umzusetzen. Eine im Jahr 1960 formulierte Denkschrift führte zur gesetzlichen Verankerung in den kommenden Jahren. Hessen startete mit der Veränderungen seines Schulpflichtgesetzes und die restlichen Bundesländer der BRD folgten. Mit der 'Empfehlung für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte (Sonderschule)' 1980 wurde ein bundeseinheitlicher Lehrplan von der KMK geschaffen und somit dem Sonderschulwesen eine weitere Form zugefügt (vgl. Schnell 2003, 29ff; Mühl 1999, 157f).
Europaweit verfügt Deutschland über eines der am stärksten separierenden Bildungssysteme (vgl. Jacobs 2004, 20). Die generelle, deutschlandweite Funktion der Institution Schule ist die Selektion. In Abbildung 5 sind die vier bestehenden Selektionsstufen markiert.
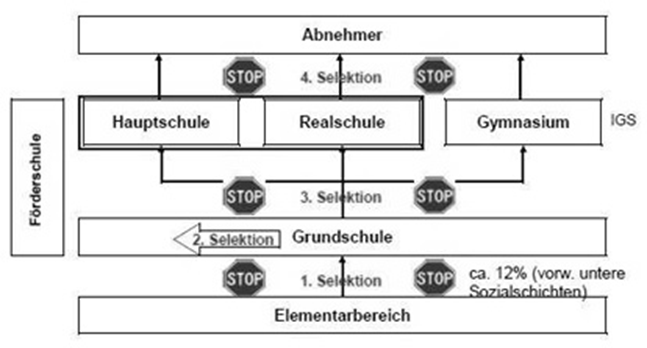
Abbildung 5: Selektionsstufen des deutschen Schulsystems (Von Saldern o.J., 4)
Empirische Analysen bestätigen, dass das gesamte deutsche Schulsystem noch stark von sozialer Auslese geprägt ist - wie im Neuhumanismus. Zwar beruht der Unterricht an den weiterführenden Schulen auf verschiedenen Anforderungsniveaus, jedoch erfolgt die Zuweisung der SchülerInnen nicht - wie vermutet werden könnte - mehrheitlich auf Basis der Schulleistungen. Die IGLU-Studien[11] machen auf die Ungerechtigkeit beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule aufmerksam. Sie zeigen, "dass Kinder aus sozial schwächeren Familien für den Erhalt einer Gymnasialempfehlung deutlich bessere Leistungen erbringen müssen als Kinder aus sozial starken, 'bildungsnahen' Elternhäusern" (vgl. Van Ackeren/ Klemm 2011, 55; Hervorhebung i. O.). Die Überlappungen sind eindeutig: "Schüler und Schülerinnen mit vergleichbarer Lesekompetenz erhielten Empfehlungen zur Hauptschule, zur Realschule und zum Gymnasium" (ebd., 54). Die TIMS-Mittelstufenstudie[12] belegt, dass bis zum Ende der Sekundarstufe I die Verfehlungen in der Schulformzuweisung erkennbar sind: "Gut 40% der Realschüler erreichen den Kernbereich gymnasialer Mathematikleistungen und 25% liegen sogar in der oberen Leistungshälfte der Gymnasien" (ebd., 55). Die PISA-Studien der Jahre 2000, 2003 und 2006 liefern vergleichbare Erkenntnisse. Aber auch die 'Durchlässigkeit' des Schulsystems als "Korrekturmöglichkeit einer im Verlauf des Bildungswegs als unangemessen wahrgenommen Entscheidung" (ebd., 56) kann die Probleme nicht aufheben. Diese Option wird umfangreich genutzt, jedoch überwiegend zum Wechsel in die Schulform mit geringerer Anforderung. "Deutschlandweit wechselten im Schuljahr 2006/2007 etwas mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun zwischen Gymnasium, Realschulen und Hauptschulen: Knapp 20% wechselten aus einem anspruchsärmeren in einen anspruchsreicheren Bildungsgang, gut 80% gingen den umgekehrten Weg" (ebd.). Die Aufstiegsdurchlässigkeit wird zu einem großen Teil von den differenziellen Lernmilieus beschränkt. So verliert ein/e HauptschülerIn, der/die die Leistungsanforderungen für das Gymnasium erfüllt, mit der Zeit den Anschluss an die GymnasialschülerInnen seines Alters, da jeder zusätzliche Tag in dem "Potenzialentfaltung ausbremsenden Lernmilieu" (ebd., 61; Hervorhebung i.O.) den Rückstand zur Regelschul- bzw. Gymnasialklasse ausbaut. Die Entkopplung von sozialer Herkunft und schulischem Erfolg ist immer noch nicht gelungen (vgl. ebd., 54ff). "Die historisch verwurzelten und über die Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter gegebenen charakteristischen Unterschiede zwischen 'niederer' und 'höherer' Bildung" (ebd., 61) bleiben in der stark gegliederten Sekundarstufe I bestehen. Somit darf Integration nicht nur die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung bezwecken, es muss jegliche Selektion muss gemäß dem Diskriminierungsverbot (GG, Artikel 3 Absatz 3) verschwinden. Ein "leistungsstarkes und gerechtes Bildungssystem" (Von Saldern o.J., 8) ist nur durch längeres gemeinsames Lernen realisierbar. Momentan liegt der Selektionszeitpunkt zu früh. Zudem ist die sinnvolle Nutzung der erworbenen "Freiheitsgrade" (Von Saldern o.J., 8) wichtig. In anderen EU-Ländern haben sich schon längst integrative Strukturen durchgesetzt, "d.h. alle Schüler haben grundsätzlich ein gemeinsames Curriculum für die allgemeine Bildung, das je nach Bedarf verändert und an bestehende Voraussetzungen angepasst wird" (Hausotter 2000 zit. nach Jacobs 2004, 20). Somit ist der Gemeinsame Unterricht von 'gymnasialen' und 'geistig behinderten' SchülerInnen, wie am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg, ein Fortschritt. Natürlich ist es eine hervorzuhebende Besonderheit, wenn der anforderungsreichste Lernort - das Gymnasium - die Aufhebung von Selektion unterstützt. Dennoch ist es "falsch, die Gymnasien von dieser gesellschaftlichen Aufgabe des gemeinsamen Unterrichts frei zu stellen" (Schöler 2010; Hervorhebung i.O.). Jedoch stellen Veränderungen - wie beispielsweise G8[13] -, die aus ökonomischer Sicht unter dem Motto 'so viel Wissen wie möglich in so wenig Zeit wie nötig' getroffen werden, ein Hindernis für die Durchsetzung von Integration und längerem gemeinsamen Lernen dar. Anstatt die Kinder unter Stress zu setzen und damit verbundene Krankheiten wie Depressionen oder Burnout zu riskieren, könnten die von der Wirtschaft geforderten 'soft skills' gefördert werden. Integration bringt also Vorteile für alle Beteiligten, neben dem sozialen Lernen wird gleichzeitig die gesellschaftliche Teilhabe ALLER bestärkt. "Diese Logik fordert Gymnasien (wie alle anderen Sonderschulen) heraus, zu fühlen, zu denken und zu handeln - das überholte Prinzip der Penne, in der Konkurrenz, Anpassung und Bulimie-Lernen dominieren, entsprang und entsprach der hierarchischen Zwangsschulidee der Industrialisierung" (Boban 2011, 14). Wenn Lernen sich wieder dem Naturinstinkt der Neugierde annähert - und keine Krankheiten verursacht -, kann dem Bedürfnis nach einer Entschleunigung des Schullebens zugunsten eines gemeinschaftlichen Miteinanders der Vielfalt entsprochen werden. Denn letztendlich "kommt nicht mehr Saft aus einer Zitrone, wenn man mehr presst" (Gruschka o.J. zit. nach Sußebach 2011 2011, 8). Leistungserhebungen können genauso einen umgekehrten Effekt erzielen. Anstelle die schwächsten SchülerInnen 'auszusieben', können die Stärken jeder Person hervorgehoben werden. Mit dieser Absicht hat GU schon viele strukturelle Erneuerungen - vor allem im Grundschulbereich - mit sich gebracht, wie beispielsweise Jahrgangsmischung, Aufhebung von 'Sitzenbleiben', Leistungsbewertung mit Portfolio, Wochenplanarbeit. Jetzt bedarf es der Verbreitung auf alle anderen Schultypen. "Unsere Gesellschaft ist dringend auf jedes einzelne Kind angewiesen - aber es wird so getan, als ginge es immer nur um die Stärksten und Schlausten. Als könnten wir auf alle anderen Kinder verzichten" (ebd., 10).
Sander sieht die schulische Integration als "ein aktuelles Ergebnis eines längeren historischen Prozesses" (2008, 27). Anhand des geschichtlichen Überblicks von Alois Bürli[14] hat Sander die Entwicklung des Bildungswesens in fünf Phasen eingeteilt:
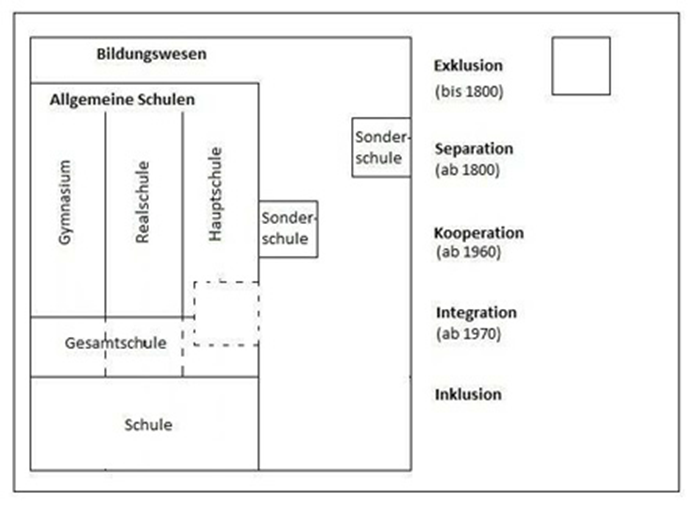
Abbildung 6: Historische Entwicklung des Schulbesuchs von Kindern mit Behinderung (in Anlehnung an Sander 2008, 38)
Die geschichtliche Entwicklung kann Fortschritte im Hinblick auf die Gemeinsamkeit von SchülerInnen mit und ohne Behinderung verzeichnen. In der Abbildung wird nicht deutlich, dass die Phasen in der Realität parallel auftraten bzw. auftreten. "Die Stadien der Separation, der Kooperation und der Integration bestehen gegenwärtig in Deutschland nebeneinander, sie überlappen einander" (ebd., 33). Dennoch ist das Stadium der Exklusion nicht abgeschlossen. Einige Bundesländer behalten sich den Ausschluss von Kindern mit 'schweren' und 'schwersten mehrfachen Behinderungen' vor (vgl. ebd. 27ff). Die historische Weiterentwicklung steht aber auch noch nicht still, denn "die menschliche Gesellschaft und ihre Einrichtungen entwickeln sich immerzu" (ebd., 38). Abzusehen ist, dass sich die einzelnen Schulformen irgendwann nicht mehr aussuchen werden können, ob sie Gemeinsamen Unterricht verwirklichen möchten. Aus der Aufteilung der allgemeinen Schulen in Abbildung 6 wird ersichtlich, dass sich in der Sekundarstufe I bisher überwiegend Haupt- und Gesamtschulen und teilweise auch Realschulen auf das gemeinsame Lernen von SchülerInnen mit und ohne Behinderung einlassen. Die Gymnasien sehen sich in der Regel nicht dafür verantwortlich und gehen einer Konfrontation mit dem Thema aus dem Weg. Die Vereinten Nationen setzen sich mit der Behindertenrechtskonvention für die Weiterentwicklung zur Phase der Inklusion (siehe Kapitel 3.3.1) ein, in der Kinder mit Behinderung "in die prinzipiell untrennbare Vielfalt aller Kinder einbezogen" (ebd., 37) werden. Damit verbunden ist die fehlende Unterteilung der allgemeinen Schulen in der Abbildung. Die schlichte Bezeichnung 'Schule' ruft die Frage hervor, ob eine Unterteilung des Schulsystems auf dieser Entwicklungsstufe überhaupt notwendig ist. Umso bedeutungsvoller ist die Entscheidung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Bad Harzburg und des Städtischen Gymnasiums Bad Segeberg - dort wurde die erste gymnasiale Integrationsklasse eingerichtet (vgl. Boban 2011, 13). Durch die Aufnahme von SchülerInnen mit einer 'geistigen Behinderung' haben sie die Herausforderung der lernzieldifferenten Beschulung angenommen. Somit sind sie noch viel exklusiver geworden - im Sinne der ersten Bedeutung des Worts (siehe oben).
Den Weg zur Integration, den viele Eltern - auch in Goslar (siehe Kapitel 4.2) - gehen mussten, war geprägt von großen Hindernissen. Der Grund dafür besteht unter anderem darin, dass kein Gesetzt zu ihrer rechtlichen Unterstützung vorlag. Doch bereits vor ungefähr 20 Jahren begann die Diskussion um eine spezielle Menschrechtskonvention für Menschen mit Behinderung, angestoßen von internationalen Behindertenorganisationen. Allerdings scheiterten mehrere Vorschläge. Im Dezember 2006 wurde der Generalversammlung ein Entwurf präsentiert. Nun musste der Vertrag noch ratifiziert werden, um rechtskräftig zu werden. Mit der Zustimmung Ecuadors trat die 'UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung'[15] am 3. Mai 2008 in Kraft. Deutschland gehört zu den Erstunterzeichnern, die am 30. März 2007 einwilligten. Endgültig wurde die Konvention in Deutschland durch das 'Gesetz zur Ratifikation des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen' am 26. März 2009 wirksam (vgl. behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011). Damit liegt den Eltern endlich eine rechtliche Absicherung für die integrative Beschulung ihrer Kinder mit Behinderung vor.
In der deutschen Fassung der BRK wurde der englische Begriff 'inclusion' durchgängig mit 'Integration' übersetzt. Diese bedeutungsvolle Abstufung bestärkte die Forderung nach einer Abgrenzung zwischen 'Inklusion' und 'Integration'. Somit zog die deutsche Übersetzung schnell Kritik auf sich, "weil daran die Tendenz erkannt werden kann, das kritische Veränderungspotential der Konvention zu verwässern" (Aichele 2010, 15). Das Deutsche Institut für Menschenrechte wies darauf hin, dass die deutsche Begriffsverwendung ein Hindernis in der internationalen Diskussion darstellt (vgl. ebd.). In Folge dessen hat das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. eine Schattenübersetzung herausgegeben. Denn "Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz haben fast ohne Beteiligung behinderter Menschen und ihrer Verbände eine deutsche Übersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen abgestimmt" (Hüppe 2010, 4). Dabei leistet eine korrekte Übersetzung einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung. Letztendlich sind jedoch ausschließlich die Versionen der BRK in den sechs UN-Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch) rechtsgültig (vgl. ebd., 3ff).
Nach der Feststellung, dass die deutsche BRK-Version eine andere Übersetzung für 'inclusion' enthält, soll nun die Frage geklärt werden, was 'Inklusion' konkret heißt. Hinz formuliert folgende Eckpunkte, die sich auf die englischsprachige Literatur beziehen und damit die internationale Sichtweise, die Inklusion als "optimierte und erweiterte Integration" (Sander 2008, 35) versteht, widerspiegeln:
-
"Inklusion wendet sich der Heterogenität von Gruppierungen und der Vielfalt von Personen positiv zu (...).
-
Inklusion bemüht sich, alle Aspekte von Heterogenität gemeinsam zu betrachten. Hier kann es um unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte,
-
(...), körperliche Bedingungen oder anderes mehr gehen. Dabei wendet sich Inklusion gegen Konstruktionen jeweils zweier Kategorien: Deutsche und Ausländer, Männer und Frauen, Behinderte und Nichtbehinderte (...). Diese Kategorisierungen sind als alltägliche 'Zwei-Gruppen-Theorien' weit verbreitet (...). Inklusion bemüht sich daher darum, jede Person in ihrer Einmaligkeit anzuerkennen und die Gruppe als pädagogisch unteilbares Spektrum von Individuen zu begreifen (...).
-
Inklusion orientiert sich an der Bürgerrechtsbewegung und wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen an den Rand zu drängen. (...)
-
Inklusion vertritt die Perspektive des Abbaus von Diskriminierung und Marginalisierung und damit die Version einer inklusiven Gesellschaft" (Hinz 2010, 64f; Hervorhebung i.O.).
Um die Unterschiede von Integration und Inklusion für die Institution Schule zu verdeutlichen, hat Hinz die Praxis beider Ansätze gegenübergestellt.
|
Praxis der Integration |
Praxis der Inklusion |
|
|
Hubert Hüppe fasst den zentralen Unterschied prägnant zusammen: "Das bedeutet: Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um 'dabei' sein zu können [Integration; D.A.], sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öffnen. Niemand darf ausgegrenzt werden" (Hüppe 2010, 3). Mit der Forderung nach Inklusion in der UN-Konvention wollen Menschen mit Behinderung gegen ihre soziale Ausgrenzung ankämpfen.
Artikel 1 bringt den Zweck des Abkommens zum Ausdruck: "Zweck (...) ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern"[16] (Artikel 1; Hüppe 2010, 12). Schlussfolgernd werden dem Vertragsstaat drei Pflichten zugeteilt: die Pflicht zur Achtung der Rechte, zur Schutzgewährleistung und zur Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung (vgl. behindertebauftragter. de, Stand: 09.06.2011).
In der BRK wird kein Anwendungsbereich ausgelassen. Die komplette Breite bürgerlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Lebensbereiche finden darin Beachtung -wie beispielsweise politische Teilhabe, Bildung oder Wohnen (vgl. Aichele 2010, 14). Hervorgehoben wird außerdem, dass mit der UN-Konvention keine 'Sonder-' oder 'Spezialrechte' geschaffen wurden, sondern es darum geht, die bestehenden Menschenrechtsverträge[17] an die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anzugleichen (vgl. behindertenbauftragter. de, Stand: 09.06.2011). Vorhandene Formulierungen wurden lediglich aufgenommen und inhaltlich konkretisiert (vgl. Aichele 2010, 12). Dabei bilden die in Artikel 3 aufgelisteten Grundsätze die Basis des Übereinkommens: die Achtung der Menschenwürde, der individuellen Autonomie und Selbstbestimmung; die Nichtdiskriminierung, die Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; die Achtung der Unterschiedlichkeit und die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung als Teil der menschlichen Vielfalt; die Chancengleichheit; die Barrierefreiheit; die Gleichberechtigung von Mann und Frau; die Achtung von Kindern mit Behinderung (Artikel 3; vgl. Hüppe 2010, 14f).
Die BRK fordert wichtige Veränderungen in verschiedenen Bereichen.
In der Gesellschaft liegt überwiegend eine defizitorientierte Sichtweise von Behinderung, welche
sich von dem medizinischen Modell ableitet, vor. Die UN-Konvention soll einen Beitrag dazu leisten, dass Verständnis von Behinderung zu verändern. Denn nach dem bio-psychosozialem Modell unterliegt Behinderung auch einer gesellschaftlichen Komponente. Menschen mit Behinderung werden ebenfalls "durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie physische Barrieren und durch das mangelnde Bewusstsein von Menschen für die Perspektive von Menschen mit Behinderung" (behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011) behindert. Daher wird in der BRK Rücksicht auf die Weiterentwicklung des Verständnisses von Behinderung genommen (siehe Präambel) und Behinderung im Artikel 2 (Begriffsbestimmungen) nicht definiert. In Artikel 1 wird nur eine Mindestdefinition vorgenommen: "Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft behindern können" (ebd.). Die Vertragsstaaten legen ihre eigene Definition von Behinderung selber fest. So enthält § 2 Absatz 1 SGB IX die deutsche, rechtsgültige Bestimmung (vgl. ebd).
Die Behindertenpolitik muss sich demzufolge vom Fürsorgedanken loslösen und "die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen" (ebd.) gewährleisten. Mit der BRD haben sich auch die einzelnen Bundesländer verpflichtet, die Inhalte der Konvention anzuerkennen und die Umsetzung zu unterstützen. Die Gerichte können jetzt die Einhaltung dieser Menschenrechte von der BRD bzw. den Bundesländern einfordern (vgl. ebd.).
Durch die Ratifikation hat die BRK den Wert eines Bundesgesetzes zugesprochen bekommen. Für diese Arbeit spielt die Umsetzung für den Lebensbereich Schule eine besondere Rolle. Im 'Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte' (1999) wurde das Menschenrecht auf Bildung verankert. Dieses wurde in der BRK erneut aufgegriffen (siehe Artikel 24 Absatz 1 Satz 1) (vgl. Aichele 2010, 16). Die Herstellung eines "inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen" (Artikel 24 Absatz 1 Satz 1; Hüppe 2010, 35) werden unter anderem mit dem Ziel verfolgt, "Menschen mit Behinderung zur wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen" (Artikel 24 Absatz 1 Satz 1c; ebd.). Mit dem Artikel 24 Absatz 2a wurde eine Rechtsgrundlage geschaffen, die den Zugang zum allgemeinen Bildungssystem für Menschen mit Behinderung in ganz Deutschland einheitlich festschreibt. Grundschulen und weiterführende Schulen werden dazu verpflichtet, SchülerInnen mit Behinderung aufzunehmen (vgl. ebd., 36). Dafür sollen "individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet" (Artikel 24 Absatz 2d; ebd.) zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehört die Förderung des Erlernens von individuell möglichen Kommunikationsformen (Brailleschrift, Gebärdensprache etc.) sowie die Bereitstellung notwendiger Mittel (Artikel 14 Absatz 3). Absatz 4 räumt des Weiteren dem Personal Rechte ein. Die Schulung von MitarbeiterInnen auf allen Ebenen des Bildungswesens und die "Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind" (Artikel 24 Absatz 4; ebd.) ist notwendig, um ein inklusives Bildungssystem zu ermöglichen.
Die UN-Konvention hat kein Verbot von Sonderschulen ausgesprochen (vgl. Schöler u.a. 2010, 9). "Aber aus der Norm, dass jedes Kind einen Anspruch auf gemeinsames Lernen mit nicht behinderten Kindern hat, ergibt sich als Schlussfolgerung, dass kein Kind in eine Institution überwiesen werden darf, in der es nur Kinder mit ähnlichen Defiziten trifft" (ebd.). In einem inklusiven Schulwesen soll nicht mehr die Aufgabe der Förderung einem Schultyp -wie zurzeit der Sonderschule - zugeteilt werden. Vielmehr wird die Regelschule Förderort für alle SchülerInnen. Sonderpädagogische Fachkräfte werden also weiterhin benötigt. Allerdings müssen Sonderschulen nicht unbedingt geschlossen werden. Sie können sich genauso nach außen öffnen und einen Wandel zur attraktiven Schule für alle Kinder vollziehen. Solange noch kein inklusives Bildungswesen existiert, muss Integration nach Artikel 24 Absatz 2a bewilligt werden (vgl. Aichele 2010, 17ff). Somit wird integrative Beschulung derzeit unterstützt. Für eine zukünftige inklusive Schulstruktur ist eine Schulentwicklungsplanung unverzichtbar (vgl. Schöler u.a. 2010, 12). Zunächst muss das Recht von SchülerInnen mit Behinderung auf Zugang zum allgemeinen Bildungssystem in den Schulgesetzen aufgenommen werden. Damit verbunden ist auch die Gewährleistung von individuellen Unterstützungsmaßnahmen. Des Weiteren wird die Entwicklung allgemeiner Standards, die "die menschenrechtlichen Anforderungen wie Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Angemessenheit und Anpassungsfähigkeit von Bildung beachten" (Aichele 2010, 20), empfohlen (vgl. ebd.). Nicht zuletzt sollten allen pädagogischen Fachkräften Fortbildungen offen stehen, "damit langfristig Kompetenzen und Qualifikationen zur Erfüllung des Rechts auf Partizipation aufgebaut werden" (Schöler u.a. 2010, 8). Nach dem 'Bildungsbarometer Inklusion' des Sozialverbandes Deutschland (2009) beginnt die Umsetzung der BRK in den Bundesländern sehr schleppend. Lediglich fünf Bundesländer wagen sich an die Ausführung der Konvention, bei vier weiteren entsteht langsam eine Diskussion und die restlichen sieben fallen durch Widerstand auf (vgl. Hinz 2010, 63f). Carmen Dorrance hat berechnet, dass 2008 15,7% aller SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf eine allgemeine Schule besuchten (vgl. Dorrance 2010, 168). 90% fordern die Vereinten Nationen (vgl. Evers-Meyer 2009, 5) - es ist daher noch ein weiter Weg für Deutschland.
Neben den Forderungen für die einzelnen Lebensbereiche enthält die BRK eine Festlegung für die innerstaatliche Durchführung und Überwachung (Artikel 33). Dementsprechend müssen von Seite des Staates staatliche Anlaufstellen für die Umsetzung des Übereinkommens eingerichtet (Focal Points) werden. In Deutschland wurde das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) dafür bestimmt. Zudem wird die Installierung ein oder mehrerer Überwachungsmechanismen von nichtstaatlicher Seite verlangt - die 'Monitoringstelle(n)' (vgl. behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011). "Unter 'Monitoring' versteht die Konvention einen notwendigen wie selbstverständlichen Prozess, in dessen Zuge die Umsetzung der Konvention - mit Hilfe einer unabhängigen Stelle - gemeinschaftlich gesteuert wird" (Aichele 2010, 22). Das Deutsche Institut für Menschenrechte übernimmt die nichtstaatliche Kontrolle auf der Bundesebene der BRD (vgl. ebd.). Artikel 33 Absatz 3 hebt zusätzlich den besonderen Bedarf einiger Beteiligter hervor: "Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und hat in vollem Umfang daran teil" (Artikel 33 Absatz 3; Hüppe 2010, 51).
Außerdem haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Konvention - d.h. für Deutschland im März 2011 - "einen umfassenden Bericht über die Maßnahmen (...) und über die dabei erzielten Fortschritte" (Artikel 35 Absatz 1; ebd., 35) dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (siehe Artikel 34) vorzulegen. Anschließend genügt eine Berichterstattung im Vier-Jahres-Rhythmus (vgl. ebd.). Dabei ist zu beachten, dass in den Berichten nur Weiterentwicklungen erkennbar sein dürfen, Rückschritte auf eine längst erreichte Umsetzung sind zu vermeiden (vgl. behindertenbauftragter. de, Stand: 09.06.2011).
Am 15.06.2011 hat die Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen den nationalen Aktionsplan[18] der BRD vorgestellt (vgl. kobinet-nachrichten.org, Stand: 15.06.2011). In den 12 Handlungsfeldern[19] werden die Querschnittsthemen Gender Mainstreaming, Migration, Vielfalt der Behinderung, Barrierefreiheit, selbstbestimmt Leben, Assistenzbedarf und Gleichstellung berücksichtigt. Das BMAS nimmt sich vor, bis 2020 seinen Aktionsplan umzusetzen und weiterzuentwickeln (vgl. behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011).
Der Staatenbericht von Deutschland wurde trotz Fristablauf noch nicht an den UN-Ausschuss übergeben. Auf der Homepage des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung ist die Information zu finden, dass das BMAS derzeit einen Entwurf mit den beteiligten Akteuren erstellt (vgl. ebd.). Gleichzeitig fertigen Nichtregierungsorganisationen so genannte 'Schattenberichte' an, die sie ebenfalls dem UN-Ausschuss vorlegen dürfen. (vgl. institut-fuer-menschenrechte. de, Stand: 16.06.2011). Denn erst durch eine Betrachtung der getroffenen Maßnahmen von mehreren Seiten kann der UN-Ausschuss ein wirkliches Bild des Umsetzungstands erlangen. Darauf aufbauend kann er seine Empfehlungen aussprechen.
In diesem Abschnitt wird der Entwicklungsstand bezüglich der schulischen Integration in Niedersachsen betrachtet. Die aufgeführten Bestimmungen und Schulgesetze bilden die Arbeitsgrundlage von ERIK Goslar (siehe Kapitel 4.1.1) und den Ausgangspunkt für die Einrichtung der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (siehe Kapitel 4.2).
In Niedersachsen sind zum einen Formen des Gemeinsamen Unterrichts, bei denen Schüler-Innen mit Behinderung StammschülerIn der allgemeinen Schule sind, durchführbar:
-
Einzelintegration
-
Integrationsklassen
-
Sonderpädagogische Grundversorgung (siehe unten)
und zum anderen Formen, bei denen SchülerInnen mit Behinderung StammschülerIn der Sonderschule sind:
-
Kooperationsklassen (vgl. Evers-Meyer 2009, 129).
Seit der Novellierung[20] des Niedersächsischen Schulgesetzes (NschG) 1993 ist Gemeinsamer Unterricht wie folgt in Niedersachsen rechtlich geregelt (vgl. dohrmann-schule.de, Stand: 22.06.2011):
"§ 4
Integration
Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen (§ 14 Abs. 1 Satz 1), sollen an allen Schulen gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern erzogen und unterrichtet werden, wenn auf diese Weise dem individuellen Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler entsprochen werden kann und soweit es die organisatorischen, personellen und sächlichen Gegebenheiten erlauben.
(...)
§ 14
Sonderschulen
(1) 1In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet und erzogen, die in ihren Entwicklungs-, Lern- und Bildungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie sonderpädagogische Förderung benötigen und diese nicht (gemäß § 4) in einer Schule einer anderen Schulform erhalten können. 2Sonderpädagogischer Förderbedarf kann in folgenden Bereichen festgestellt werden: Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, geistige Entwicklung, motorische und körperliche Entwicklung, Sehen und Hören. 3An der Förderschule können Abschlüsse der allgemein bildenden Schulen erworben werden.
(...)
(4) Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die andere Schulen besuchen. Das Sonderpädagogische Förderzentrum unterstützt die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf.
(...)
§23
Besondere Organisation allgemeinbildender Schulen
(...)
(3) Im 1. bis 10. Schuljahrgang der allgemeinbildenden Schulen können Integrationsklassen eingerichtet werden, in denen Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen (§ 14 Abs. 1 Satz 1), gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden und in denen die Leistungsanforderungen der unterschiedlichen Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler entsprechen.
(4) 1Eine besondere Organisation nach den Absätzen 1 bis 3 bedarf der Genehmigung der Schulbehörde. 2Die Genehmigung wird auf Antrag des Schulträgers oder der Schule oder des Schulelternrats erteilt, wenn ein geeignetes pädagogisches Konzept vorliegt und die organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen geschaffen sind. 3Ein Antrag der Schule kann nur im Einvernehmen mit dem Schulträger gestellt werden.
(...)
§ 68
Schulpflicht bei sonderpädagogischem Förderbedarf
(1) 1Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf (§ 14 Abs. 1 Satz 1) sind zum Besuch der für sie geeigneten Förderschule verpflichtet. 2Eine Verpflichtung zum Besuch der Förderschule besteht nicht, wenn die notwendige Förderung in einer Schule einer anderen Schulform gewährleistet ist.
(2) 1Die Schulbehörde entscheidet, ob die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht und welche Schule zu besuchen ist. 2Die Schulbehörde kann mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten auch entscheiden, dass Schülerinnen und Schüler mit geistigen Behinderungen eine anerkannte Tagesbildungsstätte zu besuchen haben, wenn der Träger der Tagesbildungsstätte zugestimmt hat" (schure.de, Stand: 21.06.2011).
Aus § 4 und § 23 Absatz 3 kann geschlossen werden, dass Gemeinsamer Unterricht in Niedersachsen grundsätzlich an allen Schulformen möglich ist und als Ziel gesehen wird. Jedoch müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden - obwohl Integration unteilbar ist (vgl. Muth). Integrationsklassen können von Schulen, Schulelternräten und Schulträgern beantragt werden (vgl. § 23 Absatz 4). Dort ist neben der zielgleichen auch die zieldifferente Beschulung durchführbar (vgl. § 23 Absatz 3). Für die sonderpädagogische Förderung werden Sonderschullehrerstunden eingesetzt (vgl. § 14 Absatz 4).
Die Genehmigung einer Integrationsklasse liegt in der vollen Entscheidungsmacht der Schulbehörden und Schulvorstände[21] (vgl. § 23 Absatz 4). Den Eltern wird kein Wahlrecht eingeräumt. Erst mit der UN-Konvention können sich Eltern die schulische Integration ihres Kindes mit großer Sicherheit einklagen. Fast 40 Jahre waren Eltern ganz allein von den Entscheidungen der staatlichen Institutionen abhängig.
Mit den 'Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland' der Kultusministerkonferenz vom 06.05.1994 hat die bildungspolitische Diskussion um mehr Gemeinsamen Unterricht eine neue Ausrichtung erhalten. Laut diesem Papier geht es nicht mehr darum, eine 'Sonderschulbedürftigkeit' festzustellen, sondern eine personenbezogene Perspektive ('Sonderpädagogischer Förderbedarf') einzunehmen[22] (vgl. dohrmann-schule.de, Stand: 22.06.2011). In Zuge dessen hat der niedersächsische Landtag am 04.09.1996 einen Erlass zur 'Fortführung der Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf' herausgegeben. Das Kultusministerium erarbeitete dazu eine Rahmenplanung, in der 'Regionale Integrationskonzepte' (RIKs) erstmals vorgestellt worden:
"Die Fortführung der Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird im Rahmen von Regionalen Integrationskonzepten geplant und abgesichert. In Regionalen Integrationskonzepten wird ausgewiesen, wie und in welcher Form Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in verschiedenen Schwerpunkten in einer Region (Einzugsbereich einer Sonderschule, einer Gemeinde oder eines Landkreises oder teilen [sic] davon) in Umsetzung des § 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes im Gemeinsamen Unterricht und in Sonderschulen gefördert werden können. Die Sonderschule als Förderzentrum erhält dadurch eine besondere Aufgabe" (Niedersächsisches Kultusministerium 1998 zit. nach dohrmannschule.de, Stand: 22.06.2011).
Die RIKs haben das Ziel, die Sonderpädagogik in die allgemeine Schule zu verlagern, um Kinder mit Behinderungen aller Art wohnortnah zu unterrichten. Eingeleitet und erarbeitet wird ein RIK von Beteiligten vor Ort (Eltern, Lehrkräfte, Schulträger). Die regionale Schulbehörde nimmt eine Unterstützerrolle bei der Entstehung und Umsetzung des Konzepts ein (vgl. Wachtel o.J.). Ein RIK verbindet vier Organisationsformen sonderpädagogischer Hilfen (vgl. ebd.):
-
Sonderpädagogische Grundversorgung in der Grundschule Sie ist das Kernelement eines RIKs. Jede Grundschulklasse, die SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung aufnimmt, bekommt zwei Sonderschullehrerstunden zugewiesen (vgl. dohrmannschule. de, Stand: 22.06.2011).
-
Integrationsklasse (siehe Kapitle 2.1.3)
-
Mobiler Dienst SchülerInnen, die zielgleich integriert werden, bekommen nach Möglichkeit SonderschullehrerInnen zugeteilt. Ihre Funktion liegt in der Förderung der integrativ beschulten SchülerInnen und der Beratung Lehrkräfte der allgemeinen Schule (vgl. ebd.).
-
Kooperationsklasse Eine Klasse der Sonderschule kann in das Gebäude einer Grundschule aufgenommen werden. Nach Absprache treffen sich eine Grundschulklasse und die ausgelagerte Sonderschulklasse zum Gemeinsamen Unterricht oder arbeiten in Projekten, Arbeitsgemeinschaften etc. zusammen (vgl. ebd.).
Eine Sonderschule fungiert als regionales Förderzentrum, welches das RIK koordiniert (vgl. Wachtel o.J.). Die regionalen Bedingungen und die Förderschwerpunkte der SchülerInnen bestimmen letztendlich die genaue Aufgabenverteilung der einzelnen Organisationsformen (vgl. ebd.).
Die KMK veröffentlicht regelmäßig die Dokumentation 'Sonderpädagogische Förderung in Schulen', um die Entwicklung in der Beschulung von SchülerInnen mit Behinderung innerhalb Deutschlands zu zeigen. Jedoch erfordert der Umgang mit den quantitativen Daten einen sehr behutsamen Umgang (vgl. Jacobs 2004, 22). Durch die Kulturhoheit der Bundesländer verwenden diese unterschiedliche Begriffsdefinitionen von Integration und Gemeinsamen Unterricht, was wiederum den Gegensatz von Theorie und Praxis widerspiegelt. Wenn von verschiedenen Voraussetzungen ausgegangen wird, ist ein bundesweiter Vergleich theoretisch nicht möglich. "Allgemeine Aussagen über den gemeinsamen Unterricht in Deutschland machen zu wollen, gleicht nahezu der Quadratur eines Kreises ; ist doch die Kulturhoheit der Länder ein zentrales Merkmal der föderalistischen Struktur, die dazu führt, dass jedes der 16 Bundesländer seine eigene Schulpolitik und damit auch seinen eigenen Weg in Bezug auf den gemeinsamen Unterricht formuliert und praktiziert" (Hinz 2000 zit. nach ebd.). Die Bundesländer verfolgen grundsätzlich das Ziel, ihre Integrationsquoten so hoch wie möglich zu deklarieren, damit sie im Konkurrenzkampf untereinander auffallen können und sich der deutsche Gesamtdurchschnitt an die europaweiten Ergebnisse annähern kann. Für eine gemeingültigere Aussage hat Dorrance (2010) die Separationsquote[23] aller schulpflichtigen Kinder in den Bundesländern des Jahres 2006 berechnet. Demnach gibt es fünf Kategorien:
-
3,1 - 4,0% Schleswig-Holstein (3,5%), Rheinland-Pfalz (3,8%), Bremen (4,0%), Saarland (4,0%)
-
4,1 - 5,0% Bayern (4.3%), Hessen (4,3%), Niedersachsen (4,3%), Baden-Württemberg (4,6%), Berlin (4,5%), Hamburg (4,8%)
-
5,1 - 6,0% Brandenburg (6,0%), Nordrhein-Westfalen (5,1%)
-
6,1 - 7,0% Sachsen (6,9%)
-
>7,0% Thüringen (8,0%), Sachsen-Anhalt (8,5%), Mecklenburg-Vorpommern (8,7%)
Im Bundesdurchschnitt liegt die Sonderschulbesuchsquote bei 4,8% - eine Erhöhung um 0,5% im Vergleich zu 2003. Lediglich in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein sind die Quoten seit 1994 ständig rückläufig. Niedersachsen lag Mitte der 90er Jahre bereits knapp unter 4,0%. Trotz des Anstiegs befindet es sich mit 4,3% im ersten Drittel der Rangfolge.
Abbildung 8 zeigt ergänzend die SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, welche eine allgemeine Schule besuchen, und verdeutlicht damit die Integrationsbereitschaft der Bundesländer.
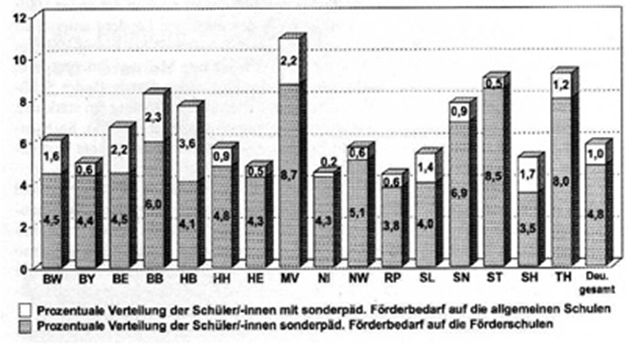
Abbildung 8: Prozentuale Verteilung der Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Förderschulenund allgemeinen Schulen (Dorrance 2010, 144)
Alle Bundesländer haben die Gemeinsamkeit, dass sie mehr SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf separieren als integrieren. Die vergleichende Gegenüberstellung belegt allerdings die großen Differenzen in der Separations- und Integrationsbereitschaft. "Hinsichtlich der Integrationsrate zeigt sich Bremen als das integrationsfreudigste Bundesland. Als am wenigsten integrationsfreudig erweist sich hingegen Niedersachsen. Dort werden 4,5% der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf anteilsmäßig zu 4,3% in Förderschulen separiert und nur 0,2% integriert beschult" (Dorrance 2010, 145). Bei der näheren Betrachtung von Mecklenburg-Vorpommern werden die Diskrepanzen deutlich. Zwar findet in Mecklenburg-Vorpommern mehr sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Schulen (2,2%) als im Bundesdurchschnitt (1,0%) statt, eine Relativierung erfolgt aber durch die hohe Zahl an separierten SchülerInnen.
Die Frage, wie die sonderpädagogische Förderung in den einzelnen Bundesländern definiert wird, bestimmt jede Statistik zu dem Thema Integration und Separation. Die großen Unterschiede sind letzten Endes auf die verschiedenen Interpretationen zurückzuführen (vgl. Dorrance 2010, 139ff). Jede Integrationsstatistik ist also mit Vorsicht zu betrachten.
[11] Eine Untersuchung des Zusammenhangs "zwischen der durch Tests gemessenen Lesekompetenz mit den Übergangsempfehlungen der abgebenden Grundschule" (Van Ackeren/Klemm 2011, 54)
[12] Ein internationaler Leistungsvergleich in Mathematik und Naturwissenschaften der Achtklässler (vgl. ebd.)
[13] Verkürzung der Schulzeit von GymnasiastInnen von 13 auf 12 Jahre
[14] Weiterführende Literatur: Bürli, Alois (1997): Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik. Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf dem europäischen Raum. Fernuniversität Hagen
[15] Im Folgenden die "UN-Behindertenrechtskonvention" (BRK) oder "(UN-)Konvention"
[16] Zitate und inhaltliche Angaben stammen aus der Schattenübersetzung, weil diese mehr der englischen Originalfassung entspricht.
[17] 'Allgemeine Erklärung der Menschenrechte' von 1948; 'UN-Pakt überbürgerliche und politische Rechte' von 1966; 'UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte' von 1966
[18] BMAS (2011): Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung. Referentenentwurf nach Ressortabstimmung (Stand: 27.04.2011) URL:http://www.53grad-nord.com/fileadmin/dokumente/Materialien/Aktionsplan_Umsetzung_UNKonvention.pdf (Zugriff: Mai 2011)
[19] Lebenslanges Lernen (Bildung)/ Arbeit/ Gesundheit, Prävention, Rehabilitation, Pflege/ Wohnen und Bauen/ Freiheit, Schutz, Sicherheit/ Kindheit/ Freizeit und Kultur/ Frauen/ Ehe, Familie und Partnerschaft/ Gesellschaftliche und politische Teilhabe/ Mobilität/ Alter (behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011)
[20] Änderung/Ergänzung eines Gesetzes
[21] "Im Schulvorstand wirken der Schulleiter oder die Schulleiterin mit Vertreterinnen oder Vertretern der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler zusammen, um die Arbeit der Schule mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten" (§ 38a Absatz 1;schure.de., Stand: 21.06.2011).
[22] Ob damit die Stigmatisierung gemindert oder gar aufgehoben werden kann, ist fraglich.
[23] Datengrundlage: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2005): Sonderpädagogische Förderung in Schulen 1994 bis 2003. Dokumentation Nr. 177. URL: http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/Dokumentation177.pdf Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2008): Sonderpädagogische Förderung in Schulen 1994 bis 2003. Dokumentation Nr. 185. URL: http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/Dok185.pdf
Inhaltsverzeichnis
Die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Ute Erdsiek-Rave, begrüßte in ihrer Amtszeit das erste integrativ arbeitende Gymnasium Deutschlands in Bad Segeberg: Es ist ein "'bewundernswertes Projekt (...) von unschätzbarem Gewinn', den vor allem diejenigen gut gebrauchen könnten, 'die als zukünftige Eliten unserer Gesellschaft heranwachsen'. Der Gewinn, das ist das Erlernen von 'Toleranz im Umgang mit Menschen, die anders sind'" (Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. o.J.). Ca. zehn Jahre nach der Etablierung einer Integrationsklasse in Bad Segeberg wagte sich auch das Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg den Schritt der integrativen Beschulung. Trotz der großen Zeitspanne zählt diese Schule ebenfalls zu den ersten integrativ arbeitenden Gymnasien in der BRD.
Die Elterninitiative 'ERIK Goslar' hat dank ihrer Hartnäckigkeit den Wunsch nach der Weiterführung der Integration erfüllen können. Anna, Celina, Stefan und Martin[24] - vier SchülerInnen mit einer so genannten 'geistigen Behinderung' - lernen seit dem Schuljahr 2006/2007 gemeinsam mit 22 'Gymnasiasten' - davon sechs aus der gemeinsamen Grundschulklasse (vgl. Schöler 2011, 14).
"Die eigentlichen Erfinder von Integrationsklassen sind die Eltern" (Wocken 1987, 66).
Seit den 70er Jahren setzen sich in der BRD Eltern von Kindern mit Behinderung für die soziale Integration ihrer Familie und Kinder im Wohnumfeld ein. Sie waren also "die wichtigsten Kräfte für die Entstehung gemeinsamen Spielens, Lebens und Lernens" (Schnell 2003, 35). Die durchweg positiven Erfahrungen des gemeinsamen Besuchs des wohnortnahen Kindergartens lösten den Wunsch nach der Weiterführung in der Schule aus. Jedoch ist eine integrative Beschulung an erhöhte Anstrengungen der Eltern verknüpft. Da der Kampf um schulische Integration nicht alleine zu bewältigen schien, bündelten sich die Kräfte in Elterninitiativen. Dabei erhielten sie Unterstützung von Eltern mit Kindern ohne Behinderung (vgl. Schnell 2003, 35 ff). Alle Eltern verfolgten ein Hauptziel: "Sie wollten für ihre Kinder keine Aussonderung und Entfremdung aus den normalen Lebensbezügen. Sie konnten nicht akzeptieren, dass ihre Kinder in den wichtigen Sozialisationseinrichtungen der institutionalisierten Bildung und Erziehung nicht auch die Vielfalt aller Gleichaltrigen kennen lernen sollten" (Hüwe/ Roebke 2006). Außerdem erhofften sie sich mehr Selbstständigkeit und soziale Kontakte. Die Eltern von Kindern mit Behinderung waren überzeugt, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz, zum Abbau von Vorurteilen und Umgangsängste zu leisten. So entstanden bis Mitte der 80er Jahre 19 Integrationsschulen, die bis auf zwei Ausnahmen auf die Intervention von Elterngruppen beruhen. Als Orientierung diente die Fläming-Grundschule in Berlin und die Montessori-Grundschule der Aktion Sonnenschein in München. Die Etablierung von Integration in die allgemein Schule ging und geht - auch nach 40 Jahren Gemeinsamen Unterrichts - nur in kleinen Schritten voran. "Häufig war es nur dem durch (laut)starke Öffentlichkeitsarbeit erzeugten Druck zu verdanken, dass das gemeinsame Lernen und Leben von Kindern mit und ohne Behinderungen nicht nach der Kindergartenzeit endete" (ebd.). Um das Thema noch weiter in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, vernetzten sich die Elternverbände untereinander. 1984 trafen sich dann einige Elternbewegungen zum ersten Mal auf Bundesebene. Auf dem zweiten Bundeselterntreffen in Bonn (1985) gründeten Mitglieder von rund 100 Elternvereinigungen aus der ganzen BRD die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 'Gemeinsam leben - gemeinsam lernen. Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder'. Kurz danach entstanden in rascher Folge die einzelnen Landesarbeitsgemeinschaften. Dem "'Paradiesgärtlein' Sondereinrichtung" (Hüwe/Roebke 2006) sollte großkundig der Widerstand geleistet werden (vgl. ebd.). Die BAG entwickelte sich zu einer "Bürgerbewegung, die hartnäckig für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eintrat und konsequent für eine nicht teilbare Integration kämpfte." (Rempt/Rempt 2000, 31 zit. nach Schnell 2003, 37). Jedoch nimmt die Zahl der aktiv mitgestaltenden Eltern beständig ab. Das begründet Irmtraud Schnell zum einen mit dem "Trend zur Individualisierung" (2003, 68; Hervorhebung i.O.). Die Eltern sind teilweise schwer für eine Mitarbeit in einer Gruppe zu motivieren, da sie die Angst vor einer zu großen Vereinnahmung abschreckt. Die Bereitschaft zur Vernetzung und das gemeinsame Auftreten hat allerdings den zahlenmäßig gleich großen Elternanteil in den 70er und 80er Jahren ausreichend politischen Einfluss geliefert. Zudem erkennt Schnell eine neue Entwicklung: "Eltern konsumieren Integration" (ebd., 69; Hervorhebung i.O.). Durch die Änderung der Schulgesetze und die Einführung von Gesamtschulen ist in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel im Saarland, Integration selbstverständlich geworden (vgl. ebd., 68f). Dennoch ist Integration nicht an jeder Schule problemlos möglich. Der Erhalt eines Integrationsplatzes für ihr Kind sollte Eltern nicht von der Mitarbeit in einer Initiative abhalten (vgl. Hüwe/Roebke 2006). "Zwar war unser Ziel, uns [die Elterninitiativen; D.A.] so bald wie möglich überflüssig zu machen, dann nämlich, wenn der Staat für eine nicht aussondernde Förderung sorgen würde, zumindest für alle, die dies wünschen, noch besser für alle - ohne Einschränkung" (Rosenberger 2000, 326 zit. nach Hüwe/Roebke 2006). Aber ist der Zeitpunkt zum Rückzug schon eingetroffen?
"Auch (...) wenn heute noch immer Elterninitiativen erfolglos um die Einrichtung von Integrationsklassen besonders im Sekundarbereich kämpfen, zeigt doch ein Blick zurück in die Anfänge, dass die Idee der Schulklasse ohne Aussonderung in den vergangenen 30 Jahren einen erfolgreichen Weg beschritten hat" (Hüwe/Roebke 2006). Als Beispiel für solche Erfolgserlebnisse soll nun der Blick auf eine Elternvereinigung in Niedersachsen - ERIK Goslar - gerichtet werden. Sie hat sich unter anderem für die Integration von vier SchülerInnen mit der Diagnose 'geistige Behinderung' am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg eingesetzt.
Aufbauend auf die Anweisungen zur Erarbeitung von RIKs (siehe Kapitel 3.4) haben sich in Niedersachsen vier ERIKs gegründet - in Peine, Göttingen, Hameln und Goslar. Da die Interessenvertreter aus Goslar und Umgebung die gleichen Ziele verfolgten wie die bereits bestehenden ERIKs, haben sie ihre Selbsthilfegruppe ERIK Goslar genannt. Die politischen Vorgaben sollten nicht nur auf dem Papier bestehen. Deshalb bemühten sich alle ERIKs, die Umsetzung in der Praxis einzufordern und voranzutreiben. Das RIK bildete also den ersten Ansatzpunkt. Unabhängig davon haben sich heute die Ziele weiterentwickelt. So wird heute Integration als "gute Notlösung" (I7[25]) aufgefasst und Inklusion angestrebt - mit der UNBehindertenrechtskonvention als Ausgangspunkt. Von Anfang an beratschlagen sich die Ortsgruppen von ERIK untereinander.
ERIK Goslar besteht gegenwärtig seit ca. zwölf Jahren. Die ersten Eltern dieser Selbsthilfegruppe haben sich über einen Streit um den einzigen integrativen Kindergartenplatz im Landkreis Goslar zusammengefunden. Aus dieser Bekanntschaft ist die erste integrative Kindergartengruppe entstanden - gleichzeitig der Beginn ihrer Elterninitiative. Zunächst organisierten die Eltern eine Informationsveranstaltung im Landkreis mit dem allgemeinen Thema 'Integration', an der überraschenderweise über 250 Personen aus verschiedenen Bereichen teilnahmen. Das große Interesse bewegte sie zur Gründung einer Selbsthilfegruppe, "mit dem Ziel die Informationen, die wir sammeln auf dem Weg zur Integration, letztendlich an die nächste Generation weiterzugeben" (I7). Die Aufgabenbereiche haben sich über die Jahre durch die unterschiedlichen Fragen, die an ERIK Goslar gerichtet wurden, weiterentwickelt - beispielsweise in der integrativen Freizeitgestaltung. Das Organisieren von Freizeitgestaltungen hat dazu geführt, dass ERIK Goslar zu einem so genannten 'nicht-eingetragenen Verein' wurde. Damit konnte eine rechtliche Absicherung und die Versicherung der Kinder sichergestellt werden. Zudem können seit dem Spendengelder entgegengenommen werden.
Derzeit bietet die Elterngruppe ein monatliches Treffen an, auf dem die Mitglieder andere Eltern, Lehrer, Verwaltungsangestellte etc. beraten oder sich einfach untereinander austauschen. Ihre Funktion sieht die Initiative:
-
als Interessensvertreter
-
in der Beratung überwiegend von Eltern im Landkreis Goslar
-
in der Einmischung in die regionale Politik bei der Erstellung von Schulen oder Konzepten
-
und nachrangig in der Einmischung in die Landespolitik, wenn Fragen dazu gestellt werden.
Die Lebensbereiche, in denen sie momentan aktiv sind, umfassen:
-
Kinderkrippe und -garten
-
Schule (Primar- und Sekundarbereich)
-
Freizeit (zeitweise acht bis neun Angebote), mit dem Ziel der Übergabe an reguläre Vereine/Organisationen
-
Arbeitswelt (Organisation von Praktika, Berufsausbildung etc.)
-
und Wohnen.
Die Aufgaben verändern sich mit der dem Älterwerden der Kinder der ERIK-Vertreter.
Im Landkreis Goslar konnte ERIK Goslar schon einige Veränderungen bewirken. Im Kindergarten-Bereich ist Integration problemlos möglich. Einzel- und Gruppenintegration werden von den regionalen Kindergärten bei Bedarf umgesetzt. Drei Kindergärten bieten überdies seit einem Jahr Integration in der Krippe an.
Der Grundschul-Bereich hat sich ebenfalls für Integration geöffnet. Ungefähr dreiviertel der Grundschulen nehmen an der sonderpädagogischen Grundversorgung (siehe Kapitel 3.4) teil. Auf Grund der Gesetzeslage (Schulgesetz und BRK) wissen die Grundschulen, dass in absehbarer Zeit auch die Integration von SchülerInnen mit einer geistigen Behinderung annehmen müssen. Die Integration von SchülerInnen mit Behinderung außerhalb der sonderpädagogischen Grundversorgung läuft immer noch als Schulmodell ab. Das bedeutet, dass die Einwilligung der Schulvorstände notwendig ist. Eine Ablehnung ist seit 2009 durch die BRK rechtswidrig geworden. Dennoch möchte die Schulbehörde ihren Erlass nicht ändern. Insgesamt werden nur noch wenige Anfragen bezüglich Integration an der Grundschule an ERIK Goslar gerichtet. Alle Eltern, die Integration für ihr Kind beantragen, bekommen sie genehmigt. Die Schulbehörde setzt sich dabei oft über das Gutachten der Sonderschullehrkräfte hinweg und richtet sich nach den Wünschen der Eltern. Denn diese treffen noch zu häufig die Diagnose 'Kind ist nicht integrationsfähig'.
Der Sekundarschul-Bereich ist noch stark in den alten Strukturen festgefahren. Die Schulbehörden drängen die Eltern zum Überdenken ihres Antrags auf Integration. Infolgedessen wird häufig eine erneute sonderpädagogische Überprüfung eingeleitet. Die endgültige Entscheidung liegt bei den Schulvorständen der allgemeinen Schulen. In vielen Fällen lehnen diese Integration ab. Ab dem kommenden Schuljahr wird es in Goslar eine neue Möglichkeit geben: Eine Integrative Gesamtschule wird eröffnet, die SchülerInnen mit Behinderung aufnehmen wird.
Von der Politik wird Integration bevorzugt. Dadurch hat ERIK Goslar im Schulträger einen neuen Bündnispartner gefunden. Er sieht Integration als Sparmaßnahme, um Förderschulen zu schließen.
Bereits zu Beginn der dritten Klasse - rechtzeitig vor dem Übergang in eine weiterführende Schule - haben die Eltern von Anna, Celina, Stefan und Martin einen Antrag auf Verlängerung der Integration für die Sekundarstufe I bei der Schulbehörde gestellt und das obwohl die zuständige Sonderschullehrerin davon abriet. Die Schulbehörde zeigte aber zunächst keine Reaktion. Daraufhin haben die Eltern selber alle infrage kommenden, weiterführenden Schulen - ohne Ausschluss von Schulformen, also Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien - in der Umgebung kontaktiert. Dabei wurden sie mit verschiedenen Haltungen konfrontiert. Neben totaler Ablehnung wurden sie aber auch zu Gesprächen bei SchulleiterInnen und in die Gesamtkonferenz sowie in den Schulelternrat eingeladen. Sehr oft lehnten sie die Aufnahme mit der Begründung ab: "Ja, das ist alles schön und gut, aber die Schulen hätten so viele andere Baustellen, dass sie sich (...) mit dieser Sache auch nicht noch beschäftigen konnten." (I7). Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schulen Integration als Wahlmöglichkeit ansahen - und teilweise auch heute noch so sehen. Die Eltern konfrontierten die Schulen dann wiederum gleich mit der Drohung, den Gerichtsweg einzuschlagen. Sie konnten nicht darauf warten, bis die Baustellen verschwunden sind oder sich im schlimmsten Fall wohlmöglich vermehrt haben. Sie brauchten sofort eine Lösung. Später wurde den Eltern bewusst, dass die Schulen den eigentlichen Grund ihnen vorenthalten haben: die Ängste vor dem Umgang und der tatsächlichen Umsetzung. Sie haben aber gleichzeitig nicht gemerkt, dass einige LehrerInnen Integration gegenüber positiv gestimmt waren, aber sich nicht trauten, sich zu äußern. Anderthalb Jahre später - einige Wochen vor Ende der vierten Klasse - hatte sich immer noch keine Schule bereit erklärt und auch die Schulbehörde hatte trotz mehrfacher Anschreiben nicht geantwortet. Dadurch blieb den Eltern keine Wahl, als erneut auf Schulsuche zu gehen. In dieser Phase haben sie das Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg aufgesucht. Zum ersten Mal fühlten sie sich akzeptiert. Die Eltern wurden durch die Schule geführt und durften ihre Vorstellungen äußern. Der Schulleiter lud sie darüber hinaus für eine Schulführung mit ihren Kindern am nächsten Tag ein. Die SchülerInnen und der Schulleiter verstanden sich von Anfang an sehr gut. Mit einem guten Gefühl gingen die Eltern und Kinder nach Hause und hegten den Wunsch, dass dieses Gymnasium ihnen zusagen würde. Auch das Werner-von-Siemens-Gymnasium konnte sich die Gründung einer Integrationsklasse vorstellen. Doch auch sie erteilten den Eltern keine Zusage. Der Grund für dieses Handeln lag in der kurzen Zeit, die noch bis zum neuen Schuljahr blieb. Schließlich lud die Schulbehörde die Schulleitung des Werner-von-Siemens-Gymnasium, eines weiteren Gymnasiums in der Region sowie einer Real- und Hauptschule zu einem Gespräch am runden Tisch ein. Letztendlich stellte die Schulbehörde - unter Druck des Kultusministeriums - alle Beteiligten vor die Tatsache, dass eine der anwesenden Schulen eine Integrationsklasse einrichten muss. Da sich keiner der Anwesenden bereit erklärte, schlug die Behörde einen Kompromiss vor: Die Eltern sollten sich noch das andere Gymnasium anschauen und danach die endgültige Entscheidung treffen. Das andere Gymnasium ließ den Eltern ihre Ablehnung gegenüber der Integration von Anna, Celina, Stefan und Martin am Tag des Schulrundgangs deutlich spüren. So wurde beispielsweise der Fahrstuhl anfangs verborgen gehalten. Nach einer kurzen Bedenkzeit entschieden sich die Eltern und das Werner-von-Siemens-Gymnasium parallel für die Integration in Bad Harzburg. Die Schulleiter dieser Schule "hatten das 'menschliche' Einsehen: 'Wir können jetzt die Eltern nicht im Regen stehen lassen'" (I7). In ihrer Begeisterung machte die Schulbehörde große Zusagen (Fortbildungen, finanzielle Mittel etc.), die später bei der Realisierung der Integrationsklasse jedoch nicht eingehalten wurden. Zwischenzeitlich hatten sich die Eltern beim Schulelternrat vorgestellt, der ihnen seine uneingeschränkte Zustimmung für das Vorhaben erteilte. Außerdem hat der stellvertretende Schulleiter, Wilfried Eberts, für die Integrationsklasse auf der Lehrerkonferenz geworben. In der abschließenden Abstimmung dieser Sitzung sprach sich schließlich die Mehrzahl der LehrerInnen dafür aus. Im Anschluss fragte er einzelne Lehrer direkt an, ob sie in der Klasse unterrichten würden. Es meldeten sich ausreichend Personen. Um die Ängste der Schule zu verringern, entschieden sich die Eltern für einen taktischen Kompromiss: "Der Kompromiss war damals noch, dass sie/wir für ein Jahr zugestimmt hat/haben" (I7). Die LehrerInnen sollten das Gefühl erhalten, dass sie nach diesem Jahr ihre Entscheidung ändern können. Einige Schulen aus dem Landkreis versuchten nach Bekanntwerden des Vorhabens mittels Telefonanrufe die Schulleitung vom Werner-von-Siemens-Gymnasium zu verunsichern und zum 'Nachdenken' zu bewegen: "Das wär ja Selbstmord" (I7). Die Lehrerabstimmung ein Jahr später bestärkte jedoch die getroffene Entscheidung. Dieses Mal unterstützen noch mehr LehrerInnen mit ihrer Stimme die Integrationsklasse. Den Eltern, der neu eingeschulten SchülerInnen, mussten auch die Ängste genommen werden. Am 'Tag der Schulvorstellung' nahmen deshalb viele Eltern die Sprechstunde von Herrn Eberts wahr. Trotzdem fragte der stellvertretende Schulleiter sie gleich, ob ihre Kinder ein Platz in der Integrationsklasse zugeteilt werden solle oder nicht. Letztendlich gingen mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze ein. Bei der Aufklärung sowie dem Abbau der Ängste haben die Eltern der Kinder ohne Behinderung aus der Grundschulklasse unterstützt gewirkt.
Rückblickend würde Frank Hehlgans keinen Eltern noch einmal solch einen beschwerlichen Weg wünschen. Dieser Weg hat viel Kraft beansprucht und ein 'dickes Fell' vorausgesetzt bzw. erzeugt. "Sich immer anzuhören, dass das Kind nicht gewünscht ist und diese Frage: Warum wollt ihr das dann überhaupt? Dieses immer wieder Begründen müssen. Das zerrt schon ganz schön an den Nerven" (I7). Aus diesen Aussagen kann die Forderung nach einer zügigen Änderung der Gesetzeslage in Deutschland abgeleitet werden, die bereits durch die UN-Konvention bekräftigt wird (siehe Kapitel 3.3)[26].
Das Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg kann bereits auf viereinhalb Jahre Integration zurückblicken. Alle Beteiligten (LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen u.a.) haben in der Zeit zahlreiche Erfahrungen gesammelt, auf die sich die Aussagen der befragten SchülerInnen in Kapitel 5 beziehen. Daher ist eine Beschreibung der aktuellen Umsetzung der Integration am Werner-von-Siemens-Gymnasium angebracht. Die Angaben dazu stammen aus unterschiedlichen Quellen: Schöler (2010, 2011), Frank Hehlgans (I7), Hospitationsbeobachtungen (Januar und Mai 2011).
Die Klasse 9b, in der SchülerInnen integrativ beschult werden, besitzt neben ihrem Klassenraum einen kleineren Nebenraum mit einer Küchenzeile, Lernmaterialien, einem Computer uvm. Dieses Zimmer wird hauptsächlich von Anna, Celina, Stefan und Martin genutzt, wenn sie nicht am allgemeinen Unterricht teilnehmen. Die SchülerInnen mit Behinderung werden nicht das Abitur erreichen, sie werden zieldifferent beschult. In knapp der Hälfte der Unterrichtsstunden werden die SchülerInnen gemeinsam unterrichtet. Obwohl die GymnasiallehrerInnen an keiner Aus- bzw. Weiterbildung teilgenommen haben, bemühen sie sich oft Gemeinsamen Unterricht durchzuführen. Das Lehrpersonal wird nach dem Prinzip der Freiwilligkeit eingesetzt - niemand wurde bzw. wird gezwungen, Unterricht in dieser Klasse zu geben. In Kunst, Musik, Deutsch und Sport bleibt die Klasse immer zusammen. Englisch, Biologie, Geschichte, Geografie, Mathematik, Physik und Chemie werden teilweise gemeinsam umgesetzt. Der Unterricht der zweiten Fremdsprache (Französisch, Latein) wird nicht integrativ realisiert. Freitags sind Anna, Celina, Stefan und Martin nicht am Gymnasium anzutreffen. In dieser Zeit gehen sie zur nahe gelegenen Berufsschule und durchlaufen die verschiedenen Ausbildungsklassen. Der Gemeinsame Unterricht hebt sich durch vielfältige Methoden vom Frontalunterricht ab. Die LehrerInnen praktizieren beispielsweise Tutorenarbeit oder Stationenlernen.
Im Schulalltag erhält die Klasse Unterstützung von zwei IntegrationshelferInnen und 20 Stunden in der Woche von einer eine Sonderschullehrerin.
In den letzten Jahren stellten die Sonderschullehrkräfte eher ein Hindernis dar. Bis zum März 2011 kamen abwechselnd immer zwei SonderschullehrerInnen in die Klasse. Dies erwies sich als ungünstig, da die Eltern und die Schulleitung keinen Einfluss auf die Wahl der SonderpädagogInnen nehmen konnten und dadurch oft LehrerInnen eingesetzt wurden, die nicht den Integrationsgedanken vertraten und daher kontraproduktiv für ein gemeinsames Arbeiten waren. So kam es auch vor, dass eine Gymnasiallehrkraft eine Stunde Gemeinsamen Unterricht vorbereitete, aber die Sonderschullehrkraft den Sonderunterricht im Nebenraum vorzog. Die derzeitige Sonderschullehrerin haben die Beteiligten ihres Engagements zu verdanken. Die Behörde hoffte, dass die Eltern und Schulleitung wegen dem Lehrermangel keine Person finden würden, die sich für die Übernahme dieser Aufgabe bereit erklären würde. Als sie anschließend doch eine Interessentin präsentierten, kam es zu einem neuen Problem: Die Lehrerin konnte nicht am Gymnasium angestellt werden. Somit musste man sich mit der Abordnung von einer Sonderschule zufrieden geben.
Von Anfang an begleitete und beriet Jutta Schöler alle Beteiligten von wissenschaftlicher Seite. "Bisher fanden drei mehrtägige Treffen statt - immer mit Auswertungsgesprächen mit Eltern von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie mit den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern und der Schulleitung" (Schöler 2011, 14).
"Das alles verlangt Zeit, Vorbereitung, Engagement. Es ist nicht der leichteste Weg - aber genau den wollten die Bad Harzburger nicht mehr weitergehen" (taz.de, Stand: 29.06.2011).
Inhaltsverzeichnis
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass Integration ein wichtiges Thema im Bereich Bildung ist. Nachdem mit den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen dargelegt wurden, nimmt die empirische Untersuchung die Qualität der Praxisumsetzung in den Fokus. Da es in der Forschung bisher nur eine unzureichende Auseinandersetzung mit Integration am Lernort Gymnasium sowie mit der Analyse von Aussagen aus einer Befragung mit SchülerInnen ohne Behinderung einer Integrationsklasse gibt, möchte ich mit dieser Studie einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungsgebiets leisten. Dabei stütze ich mich nur auf die Erfahrungen der SchülerInnen ohne Behinderung, denn "Eltern sind Experten für das Leben als Eltern, Lehrer sind die Experten für die Situation von Lehrern. Nur Schüler wissen, was es heißt, in dieser Zeit, an dieser Schule, in diesem Unterricht und mit diesem Klassenkameraden Schüler zu sein" (O'Brien zit. nach Boban 2003).
Auf Grundlage der Theorie integrativer Prozesse (siehe Kapitel 2.2) und der Einrichtung der Integrationsklasse durch die Schulleitung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums wird in dieser Untersuchung folgender Fragestellung nachgegangen: Bewirkt Integration auf der institutionellen Ebene auch Integration auf den restlichen Ebenen? Die mit Hilfe eines Leitfadeninterviews aufgenommenen Aussagen von sechs SchülerInnen werden dazu vergleichend dargestellt und interpretiert.
Im Rahmen eines Vortrags und Workshops zum Thema 'Persönliche Zukunftsplanung' - organisiert von ERIK Goslar - habe ich mit zwei weiteren AssistentInnen meine Dozentin Ines Boban im Januar 2011 nach Goslar begleitet. Der Vorsitzende Frank Hehlgans hat uns im Zuge dessen einen Hospitationstag in der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens- Gymnasium Bad Harzburg angeboten und vorbereitet. In den zwei Tagen Aufenthalt in Goslar konnten wir durch vielfältige Beobachtungen und Gespräche einen tieferen Einblick in die Realisierung der Integration an dieser Schule gewinnen.
Für die Untersuchung eignet sich eine qualitative Forschungsmethode, weil der Gegenstand "gerade nicht über das Messen, also über den methodischen Zugang der standardisierten Forschung, erfasst werden" (Helfferich 2005, 19; Hervorhebung i.O.) kann. Hier ist die Rekonstruktion von subjektiven Sichtweisen relevant (vgl. ebd.). Durch das Prinzip der Offenheit werden im Vorhinein keine zu prüfende Hypothesen bestimmt und "bei der Datenerhebung soll darauf geachtet werden, dass die Erzeugung der Daten möglichst wenig durch die Forscher beeinlusst [sic] wird, und auch bei der Datenauswertung sollen möglichst lange möglichst viele Hypothesen offengehalten und geprüft werden" (ILMES, Stand: 13.07.2011). Dieses Prinzip wird auch von Interviews - eines der beliebtesten Erhebungsverfahren in der qualitativen Sozialforschung - getragen, da sie der befragten Person im Allgemeinen keine standardisierten Fragen und Antwortmöglichkeiten vorgeben. Die Kommunikation unterliegt durch "die Interaktion zwischen Forschenden und Erforschten" (Nohl 2006, 19) trotzdem einer Strukturierung. Im Leitfaden- bzw. teilstandardisierte Interview gibt der Forschende mittels seines Untersuchungsinteresses eine thematische Orientierung vor. Voraussetzung für das Ausschöpfen des gesamten Erfahrungspotentials sind die erzählgenerierenden Fragen des Interview- Leitfadens. Damit wird die befragte Person zum ausführlichen Erzählen angeregt. Zudem trägt ergänzendes Nachfragen und das Aufgreifen von weiteren Gesichtspunkten zur Vervollständigung des Erfahrungsbilds der befragten Person bei (vgl. ebd.). Generell stellt der Leitfaden ein flexibel zu handhabendes Instrument dar. Er soll während des Interviews nicht streng nach Reihenfolge abgearbeitet werden verfolgt werden, "vielmehr geht es (auch) im L. darum, offen zu sein für die Perspektive der befragten Person, für Neues, Ungereimtheiten, usw." (ILMES, Stand: 13.07.2011). Die Entscheidung für die qualitative Methode Leitfadeninterview basiert auf dem Vorteil, dass auch eine kleine Stichprobe erforscht werden kann (vgl. Atteslander 2006, 132). Außerdem erleichtert der Leitfaden die Auswertung, da "die Interviews insofern vergleichbar [sind; D.A.], als sich alle befragten Personen zu denselben Themen äußern mussten" (Nohl 2006, 21).
Die Grundstruktur des Interview-Leitfadens stützt sich auf die Theorie integrativer Prozesse (siehe Kapitel 2.2). Die fünf Ebenen der Theorie habe ich wie folgt auf die Schule übertragen:
· innerpsychische Ebene = Ebene jeder einzelnen Person, die zur Schule gehört (SchülerInnen,
-
innerpsychische Ebene = Ebene jeder einzelnen Person, die zur Schule gehört (SchülerInnen,LehrerInnen, IntegrationshelferInnen etc.)
-
interaktionelle Ebene = Beziehungsebene (SchülerIn-SchülerIn, SchülerIn-LehrerIn)
-
handlungsbezogene Ebene = Unterrichtsebene
-
institutionelle Ebene = Schulleitungsebene
-
gesellschaftliche Ebene = Ebene der Außenwahrnehmung (restliche Klassen, Familie, Freunde, Einwohner der Stadt, Hospitationsgäste etc.)
Des Weiteren greift der Leitfaden die Zwei-Gruppen-Theorie (siehe Kapitel 2.3) auf. Die Auflistung der allgemeinen Frageregeln von Cornelia Helfferich (2005, 95) dient als Hilfestellung bei der Formulierung der Fragen.
Jede Ebene wird mittels einer Schlüsselfrage (im Interview kursiv hervorgehoben) eingeleitet. Die restlichen aufgelisteten Fragen dienen als Gedankenstütze und werden gemäß des Prinzips der Offenheit (siehe Kapitel 5.2.1) situationsabhängig gestellt. Zudem können sich die Fragen nach den einzelnen Ebenen während des Gesprächs vermischen, da die Ebenen ineinander verschränkt sind. Weiterhin kann die Reihenfolge der Ebenen verändert werden. Die Gliederung des Leitfadens dient letzten Endes als Hilfe für die Darstellung und Interpretation der Interviews.
Interview-Leitfaden
Kurze Vorstellung
Wie lange besuchst du schon die Integrationsklasse?
Innerpsychische Ebene
Was bedeutet es für dich, SchülerIn in einer Integrationsklasse zu sein?
Was ist Behinderung für dich?
Anna kann sich ja nur wenig eindeutig äußern. Kannst du Mutmaßungen angeben ...
Findest du auch, dass sich Anna, Celina, Martin und Stefan in die Klassengemeinschaft integriert fühlen?
→ Fühlen sich Anna, Celina, Martin und Stefan sicher, geborgen in eurer Klasse?
Wie gehen Anna, Celina, Martin und Stefan mit ihrer Behinderung um? Wie meistern sie Schwierigkeiten?
Hat sich durch den GU deine Sicht auf die Welt verändert?
Was hast du von Anna, Celina, Martin und Stefan allgemein gelernt?
→ Was hast du vom GU allgemein gelernt?
Wenn du eure Klasse mit den Parallelklassen vergleichst (mit SchülerInnen eures Alters), findest du, dass ihr unterschiedlich seid? an MigrationsschülerIn: Der Begriff Integration bezieht sich auf Menschen mit Behinderung aber auch auf Menschen mit Migrationshintergrund. Welche Bedeutung hat Integration in diesem Hinblick für dich?
Interaktionelle Ebene
Was glaubst du, wie hat sich die Arbeit in eurer Integrationsklasse auf euch SchülerInnen ausgewirkt?
→ an Grundschul-MitschülerIn: Welche Veränderungen gibt es gegenüber eurer Grundschulzeit?
→ Wie war euer Umgang früher und wie ist er jetzt?
→ Welche Freundschaften haben sich gehalten?
Was glaubst du, wie hat sich die Arbeit in eurer Integrationsklasse auf die Lehrer ausgewirkt?
Gibt bzw. gab es Überforderung auf Seiten der SchülerInnen bzw. LehrerInnen?
Welche Rolle spielt Gleichberechtigung/Gleichbehandlung für dich?
Welche Regeln würdest du gerne verändern, damit alle SchülerInnen eurer Klasse gleich behandelt werden?
→ Welche Ausnahmeregeln gibt es?
An welche Situationen kannst du dich erinnern
→ ... in denen das Zusammenleben erschwert war
→ ... bzw. richtig gut klappte?
In welchen Situationen/Phasen haben sich Anna, Celina, Martin und Stefan ausgeschlossen, abgelehnt, angegriffen gefühlt?
Zu welchen gemeinsamen Aktivitäten trefft ihr euch in der Schule und in der Freizeit?
→ Zusatz: ... die nicht von Lehrern bestimmt/vorbereitet werden!
Mit wem sind Anna, Celina, Martin und Stefan aus eurer Klasse befreundet?
Welche Freundschaften gibt es zwischen Anna, Celina, Martin und Stefan und dem Rest der Klasse?
Es gibt eine Theorie, die besagt, dass unter anderem in einer Integrationsklasse zwischen der Gruppe der SchülerInnen mit Behinderung und der Gruppe der SchülerInnen ohne Behinderung unterschieden wird. Wie sieht das in eurer Klasse aus?
Handlungsbezogene Ebene
Wenn du Lehrer wärst, was würdest du am Unterricht in eurer Klasse verändern?
Welche Lernformen kennzeichnen den Gemeinsamen Unterricht?
→ Kannst du eine Beispielstunde für Gemeinsamen Unterricht beschreiben?
In welchen Fächern findet Gemeinsamer Unterricht statt?
→ In welchen Fächern sollte deiner Meinung nach Gemeinsamer Unterricht stattfinden und in welchen nicht?
Wie gelingt die Verbindung von individueller Förderung mit gemeinsamen Lernprozessen?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit in Gruppenarbeitsphasen?
Wie werden Konflikte miteinander gelöst? Gemeinsam?
→ ... zwischen Anna, Celina, Martin und Stefan und dem Rest der Klasse
→ ... in alltägliche Situationen, da Barrierefreiheit etc. nicht vorhanden (Ausflüge, Klassenfahrten,
Freizeit etc.)
Institutionelle Ebene
Wenn du Schulleiter wärst, was würdest du verändern an eurem Integrationskonzept?
Wünschst du dir noch mehr Integrationsklassen an der Schule?
Für alle SchülerInnen gelten ja bestimmte schulische Bestimmungen, z.B. für die Notengebung. Weißt du welche Bestimmungen für Anna, Celina, Martin und Stefan gelten?
→ Werden die immer versetzt?
→ Wird ihre Leistung bewertet? Bekommen sie Noten?
Wenn du eure Klasse mit den Parallelklassen vergleichst, was läuft anders?
Welche SchülerInnen mit welcher Form von Behinderung sollten nicht integriert werden?
Gesellschaftliche Ebene
Wie wird eure Klasse von außen wahrgenommen?
°Wie wird eure Klasse von der gesamten Schule wahrgenommen?
→ Gefühl einer 'Sonderklasse' an der Schule?
°Wie ist das Verhältnis zu euren Parallelklassen?
→ Wie konntet ihr das Denken der anderen beeinflussen/verändern?
°Ihr seid ja schon eine Besonderheit. Wie wird das von deiner Familie und Freunden wahrgenommen?
°Was denkst du, nehmen sich Hospitationsgäste aus eurer Klasse mit?
°Wie wurde der Schulpreis, den ihr gewonnen habt, in der Stadt wahrgenommen?
°Nervt dich es, wenn ihr dauernd als 'Besonderheit' hervorgehoben werdet?
Da ich eure Klasse und die gesamte Schule nicht so genau kenne, kann es natürlich sein, dass
wir einen Bereich nicht angesprochen haben. Möchtest du zum Schluss noch was hinzufügen?
Die Auswahl der sechs SchülerInnen nahm der stellvertretende Schulleiter und nach folgenden von mir vorgegebenen Gesichtspunkten vor:
-
gleiche Geschlechterverteilung (drei männliche, drei weibliche SchülerInnen)
-
SchülerInnen mit unterschiedlich langer Erfahrung im Gemeinsamen Unterricht
-
SchülerInnen ohne und mit Migrationshintergrund
Herr Eberts berichtete am Telefon, dass mehr als sechs SchülerInnen an meiner Befragung freiwillig teilnehmen würden.
In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Informationen über die befragten SchülerInnen[27] aufgeführt.
|
Leon |
Jakob |
Sabrina |
Samuel |
Saskia |
Kira |
|
|
Interviewcodierung [a] |
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
I5 |
I6 |
|
Geschlecht |
männlich |
männlich |
weiblich |
männlich |
weiblich |
weiblich |
|
Beginn des Gemeinsamen Unterrichts |
5. Klasse |
8. Klasse |
1. Klasse |
5. Klasse |
1. Klasse |
8. Klasse |
|
Migrationshintergrund |
nein |
nein |
ja |
nein |
nein |
ja |
|
[a] Die Interviews sind ebenfalls im Interviewverzeichnis aufgeschlüsselt. |
||||||
Die Interviews wurden vom 25.05. bis 27.05.2011 durchgeführt. Im Vorfeld hatte ich die Einverständniserklärung der Eltern aller SchülerInnen der Integrationsklasse eingeholt. Zudem hat Herr Eberts die Fachlehrer über mein Anliegen informiert und die sechs SchülerInnen für die Interviewaufnahme vom Unterricht freigestellt. Die SchülerInnen wählten in Absprache mit mir die Stunden aus. Fünf Interviews fanden im Nebenraum des Klassenraums statt. Lediglich für ein Interview musste auf eine ruhige Ecke des Flurs ausgewichen werden, da beide Räume belegt waren. Die beigefügte CD-Rom enthält die Transkriptionen der mit Hilfe eines Diktiergeräts aufgenommenen Interviews[28].
Zu Beginn jedes Interviews habe ich mich vorgestellt und das Thema meiner wissenschaftlichen Arbeit kurz erläutert. Außerdem habe ich betont, dass ich die SchülerInnen als 'Integrationsexperten' betrachte und keine Meinung eines Erwachsenen einholen werde. Die Hervorhebung der Anonymisierung der Namen sollte die SchülerInnen zu kritischen und wahrheitsgetreuen Aussagen anregen. Der weitere Ablauf der Befragung wurde durch den Leitfaden strukturiert (siehe Kapitel 5.2.2).
Da sich die Grundstruktur des Interview-Leitfadens auf die fünf Ebenen der Theorie integrativer Prozesse stützt, erfolgt die Interpretation der sechs Interviews nach dem gleichen Schema. Je Ebene werden zuerst die wichtigsten Aussagen zusammenfassend dargestellt und anschließend interpretiert. Durch die gegenseitige Abhängigkeit der Ebenen ist eine eindeutige Zuordnung der Äußerungen teilweise nicht möglich. Daher können Überschneidungen in der Darstellung und Interpretation auftreten.
Neben den im Vorfeld genannten Auswahlkriterien der SchülerInnen (siehe Kapitel 5.2.3) sind im Gespräch weitere Voraussetzungen erwähnt worden, die die teilweise unterschiedlichen Sichtweisen der SchülerInnen beeinflussten. So hat sich Jakob freiwillig für den Wechsel in die Integrationsklasse entschieden. Nach der Auflösung seiner Klasse am Ende der Siebten hat er sich bewusst diese Klasse ausgesucht, weil er hier schon ein paar Freunde hatte (vgl. I2). Kira, die wegen einer Klassenwiederholung ebenso in der Achten hinzukam, wurde zufällig der Integrationsklasse zugeteilt. Zudem besucht sie erst seit drei Jahren das Wernervon-Siemens-Gymnasium, sie hat schon einige Schulwechsel hinter sich (vgl. I6). Sabrinas und Saskias Eltern hatten bereits in der Grundschule ihre Kinder für die Integrationsklasse angemeldet (vgl. I3, I5). "Es war so, dass meine Mutter gesagt hat, dass man den Umgang mit Menschen besser lernt, auch den Umgang mit behinderten Mensch oder Menschen, die halt nicht so sind wie wir" (I5), berichtete Saskia. Aus diesem Grund fiel die Klassenwahl am Gymnasium auf die Weiterführung der Integration. Samuel und sein Zwillingsbruder wurden von ihrer Mutter für die Integrationsklasse angemeldet. Aber nur Samuel wurde in die Klasse aufgenommen, weil nicht ausreichend Plätze vorhanden waren. Sein Bruder besucht deshalb eine Parallelklasse (vgl. I4).
Darstellung
Für alle SchülerInnen ist es etwas Besonderes und eine wertvolle Erfahrung, Teil dieser Klasse zu sein (vgl. I1, I4, I6). Menschen mit Behinderung sollen genauso "eine Chance haben, einen Job zu kriegen" (I2) und auf "eine angemessene Schulbildung" (I4). Zudem haben sie durch den Gemeinsamen Unterricht Kenntnisse im Umgang mit SchülerInnen mit Behinderung gewonnen und vorhandene Hemmnisse wurden abgebaut. "Das finde ich sehr wichtig, auch fürs weitere Leben. Wenn ich z.B. im Bus Leute sehe mit einem Rollstuhl, und die vielleicht nicht aus- und einsteigen können, dann würde ich immer helfen. Andere Leute trauen sich das nicht so." (I3), erzählt Sabrina. Kira mag es, wenn andere Menschen interessiert nachfragen und sie von der Integrationsklasse berichten kann (vgl. I6). Aber letztendlich wird die gemeinsame Beschulung auch als 'normal' empfunden: "Es ist halt anders als die anderen Klassen. Aber auch nach einer Zeit ganz normal" (I1). Samuel betont die "Zukunftsbedeutung"( I3) von Integration, er wünscht sich eine deutschlandweite Ausdehnung.
Behinderung wird von den jugendlichen Befragten als 'Krankheit' aufgefasst (vgl. I1, I6), wobei in zwei Arten unterschieden wird: "Also die haben halt einen Gehirnschaden bzw. körperliche Schäden" (I6). Bemerkbar macht sich die 'Krankheit' durch eine Beeinträchtigung im Lernen (vgl. I1, I2, I6). Sabrina hatte am Anfang Angst vor der neuen Situation. Aber nach dem ersten Schultag stellte sie fest, "dass wir nur eine Behinderte in der Klasse haben. Damit meinte ich Anna, weil sie im Rollstuhl sitzt. Die anderen konnten ja sprechen und so. Das habe ich nicht als Behinderung gesehen. Außer bei Anna, weil sie nicht gehen kann" (I3). Aus ihrer heutigen Sicht sind Anna, Celina, Stefan und Martin "normale Menschen, so wie wir" (ebd.). Das bestätigt auch Leon (vgl. I1). Es werden nur positive Charakterzüge aufgezählt, die sie von Anna, Celina, Stefan und Martin gelernt haben: "diese offene Art" (I2), der liebevolle Umgang (vgl. I3, I5), Gefühle zu zeigen (vgl. I5), Freude und Ehrlichkeit (vgl. I6). "Die sind irgendwie immer für etwas Lustiges gut, und die veräppeln mich sogar, obwohl das normalerweise andersherum ist. Das ist so ein Moment, da denk ich einfach 'Wow, die haben es drauf'. Die sind total glücklich und immerzu ehrlich und total niedlich und so. Man kann sich echt bei solchen Eigenschaften eine Scheibe abschneiden. Wirklich faszinierend" (ebd.). "Und was mir auch richtig stark aufgefallen ist, niemand aus dieser Klasse benutzt das Wort 'Behindert' als Beleidigung" (ebd.).
Während Leon, Jakob und Sabrina Integration nur auf Menschen mit Behinderung beziehen (vgl. I1, I2, I3), definiert Samuel Integration wie folgt: "Menschen, die anders sind, ins ganz normale Leben anzupassen. Ob das Ausländer oder Menschen mit Behinderung sind" (I4). Sabrina und Saskia sehen ihren Migrationshintergrund nicht als Problem an (vgl. I3, I5): "Für mich war das ganz leicht von Anfang an, weil ich in Deutschland geboren wurde und auch die deutsche Sprache spreche" (I5).
Interpretation
Anna, Celina, Stefan und Martin werden von allen sechs SchülerInnen akzeptiert. Jeder dieser jungen Menschen ohne Behinderung hebt die gemeinsame Beschulung als etwas Besonderes hervor. Niemand würde die Klassenwahl rückgängig machen. Dennoch sind Tendenzen der 'Verfolgung' erkennbar. Die Sichtweise auf Behinderung richtet sich stark nach der gesellschaftlichen Defizitorientierung. Des Weiteren vermittelt die oft verwendete Formulierung '(I- )Kinder' den Eindruck, dass die SchülerInnen ohne Behinderung Anna, Celina, Stefan und Martin nicht als Gleichaltrige wahrnehmen, sondern auf Grund der auffallenden - vor allem kognitiven - Entwicklungsrückstände eben als 'Kinder'. Diese Vermutung der Infantilisierung wird zudem getragen von dem Ansprechen der Hilfebedürftigkeit von Anna, Celina, Stefan und Martin. Zudem benutzt Kira den Begriff 'niedlich' als Merkmal von Anna, Celina, Stefan und Martin. Andererseits wird die Annahme einmal durch die Benennung positiver Charakterzüge abgeschwächt. Außerdem prägt das 'Normalitätsdenken' die Grundhaltung der interviewten SchülerInnen. Der gemeinsame Umgang ist im Laufe der Zeit zur Selbstverständlichkeit geworden (vgl. hierzu auch Köbberling/Schley 2000, 145).
Darstellung
Durch den Gemeinsamen Unterricht wurde laut Kira "der Teamgeist und das Arbeitsverhalten (...) gestärkt" (I6). Weiterhin haben die SchülerInnen die Kompetenz erlernt, Sachverhalte in leichter Sprache zu erklären (vgl. I2). Daneben müssen sie "mehr Verantwortung übernehmen als die anderen. Gerade für die I-Kinder" (I4). Positiv wird noch von Saskia erwähnt, dass sie "manche Menschen schneller akzeptieren, ohne sie richtig zu kennen" (I5).
Alle SchülerInnen vermuten, dass sich Anna, Celina, Stefan und Martin in ihrer Klasse wohl fühlen, da sie sich schon relativ lange kennen. "Die sind auch überhaupt nicht scheu, die gehen auf uns zu und fühlen sich total normal" (I6). "Wir fragen auch jeden Tag, wie es denen geht" (I3). Trotzdem können die SchülerInnen auch Situationen angeben, die das Gefühl von Ausgrenzung bewirkt haben könnten. Als Beispiele werden das Thema 'Bewerbung schreiben' im Deutschunterricht (vgl. I2) oder die einfache körperliche Anwesenheit von Anna, Celina, Stefan und Martin genannt, "es ist ja oft so, dass sie einfach nur hinten in der Klasse sitzen und zuhören" (I5) nach der Aussage von Saskia. Celina hätte auch schon ein Mal beklagt, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, wenn ihre MitschülerInnen "normal miteinander reden. (...) Wir standen im Kreis und haben miteinander geredet und dann hat sie gesagt, dass sie auch gern mitreden würde. Dann haben wir sie natürlich auch sprechen lassen und zugehört" (I3). Aber generell sind "die Situationen, in denen die sich ausgeschlossen fühlen könnten" (I6) selten. Im Vergleich zur Grundschulzeit empfindet Sabrina aber schon, dass sie weniger Kontakt zu Anna, Celina, Stefan und Martin hat, "weil deren Unterrichtsstoff und unser Unterrichtsstoff verschieden ist" (I3). "In der Grundschule haben wir alles zusammen gemacht" (vgl. ebd.). Auch Kira merkt an: "In der Siebten war die Integration besser, hab ich das Gefühl, also in der Achten". Mit der Zeit nehmen jedoch immer mehr LehrerInnen die Herausforderung des Gemeinsamen Unterrichts an (vgl. I4, I6) und so treten Veränderungen auf der LehrerInnenseite auf: "Zum Beispiel Herr E., unser stellvertretender Klassenlehrer, der ist früher, manchmal ein bisschen laut geworden und z.B. Anna, die hat dann immer sofort angefangen zu weinen. Und da hat er sich dann auch geändert, hat aufgepasst, dass er nicht mehr so laut wird. Und, da haben die Lehrer auch was gelernt" (I2).
Alle schätzen den besseren Zusammenhalt zwischen den SchülerInnen ihrer Klasse im Vergleich zu den Parallelklassen. Vor allem außerhalb der regulären Lernsituationen funktioniert das Zusammenleben gut, wie beispielsweise auf Klassenfahrten (vgl. I1) oder im Sportunterricht: "Dass wir es immer hinkriegen, dass sie mit uns in einem Team sind, dass wir ihnen z.B. auch die ganzen Spielregeln und alles erklären, (...) dass sie auch sagen 'ich möchte auch lernen, wie das geht'" (I2). Es ist selbstverständlich, sich zu helfen. "Wir fördern uns gegenseitig" (I5). Zudem "ist niemand irgendwie Außenseiter und wird irgendwie richtig gemobbt oder so" (I6). Kira kommt aus ihrer Erfahrung zu dem Schluss: "Das ist die sozialste Klasse in der ich je war und ich glaube, das kommt wirklich durch diese Kinder. Weil man einfach so einen Umgang mit Menschen lernt, vor allem mit besonderen Menschen" (ebd.). In diesem Zusammenhang sind auch keinem Jugendlichen große Konflikte aus der letzten Zeit in Erinnerung. Ein Grund dafür gibt Kira an: "Weil wir ja auch gar nicht auf dem gleichen Level sind" (I6). Kleine Probleme versuchen sie, "untereinander zu klären" (I3), ansonsten werden die Lehrer oder IntegrationshelferInnen hinzugezogen (vgl. ebd., I2). Saskia bringt Konflikte mit anderen Klassen an, wie beispielsweise Beleidigungen (vgl. I5). Diese werden dann "meistens durch die Lehrer gelöst oder wir machen es halt so, dass zwei oder drei von uns in die Klasse gehen und dann versuchen wir das halt zu klären. Und meistens verstehen die das dann auch" (ebd.).
Gleichbehandlung bzw. Gleichberechtigung wird eine große Rolle zugeteilt (vgl. I2, I4, I6). Zudem sind die SchülerInnen sich einig: "Wir werden alle gleichbehandelt" (I1). Ebenso herrscht untereinander ein respektvoller (vgl. I6), gleichberechtigter Umgang (vgl. I2). Anna, Celina, Stefan und Martin erhalten "auch eine Chance (...), etwas vor der Klasse vorzutragen, ihre Ergebnisse zu präsentieren" (ebd.).
Aus Sicht der Schülerinnen haben die Jungs viel weniger Kontakt zu Anna, Celina, Stefan und Martin als sie (vgl. I3, I6). "Ich finde, das ist wichtig, dass jeder immer auf die zugeht, mit denen redet, aber das machen leider nicht alle". "Die Mädchen, die sind mit denen irgendwie vertrauter" (I6). Deshalb wurde für die Pausen ein 'Anna-Dienst' vereinbart: "Wir haben das jetzt so gemacht, dass Anna in den Pausen nicht nur von den Mädchen gefahren wird. Das wurde jetzt eingeteilt, das auch mal die Jungs dran sind, die das sonst freiwillig nicht gemacht hätten" (I3). Eine Begründung dafür liefert Kira: "Vielleicht liegt das an unserer Art, dass uns dieses Hilflose irgendwie berührt oder bewegt. Dass die uns Leid tun. Aber wir geben ihnen halt das Gefühl, dass sie normal sind, dazu gehören, darum bemühen wir uns wirklich" (I6). Lediglich Sabrina und Saskia treffen sich in ihrer Freizeit mit Celina oder Anna, aber auch eher selten (vgl. I1, I3, I5). Enge Freundschaften bestehen auch nur zwischen Jakob und Stefan (vgl. I2), Sabrina und Celina (vgl. I3) sowie Saskia und Celina (vgl. I5). Samuel bezeichnet seine Beziehung zu Anna, Celina, Stefan und Martin als "gute Bekanntschaft" (I4).
Die Zwei-Gruppen-Theorie (siehe Kapitel 2.3) wird von der Mehrheit der SchülerInnen als zutreffend empfunden (vgl. I1, I2, I3, I5, I6). In einigen Unterrichtsstunden, wie Geschichte, ist es weniger auffallend, weil dort "so viel wie möglich" (I1) zusammen gearbeitet wird (vgl. ebd.). "Aber mittlerweile ist es so, dass die viel da hinten in ihrem Raum sind, und wir machen hier unsere Sachen, und das war es auch schon" (I6). Sabrina weist darauf hin, dass Anna, Celina, Stefan und Martin nicht absichtlich von den SchülerInnen ausgegrenzt werden (vgl. I3). "Dadurch, dass die hinten sitzen, fühlt man immer, dass die eine Klasse wären, obwohl wir das gleiche machen wie die" (ebd.; vgl. I6) - also ein Art 'Zwei-Klassen-Gefühl'. Die Ursache liegt laut Kira am schulischen Druck, der durch die Schulzeitverkürzung auf zwölf Jahre ausgelöst wird. Dadurch wiederum bleibt weniger Zeit für Gemeinsamen Unterricht und der 'Stoff' wird immer schwerer (vgl. I6).
Interpretation
Die Betonung des Zusammenhalts und des respektvollen, gleichberechtigten Umgangs verdeutlicht im Allgemeinen die zwischenmenschlichen Einigungen in Form von Begegnungen. Diese sind allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Eine ganzheitliche Sichtweise kann durch verschiedene Aussagen infrage gestellt werden. Sieht Kira doch zu sehr die Behinderung im Vordergrund, wenn sie begründet, dass richtige Konflikte nicht entstehen können, da nicht alle SchülerInnen "auf dem gleichen Level" (I6) sind? Diese Vermutung wird durch die Äußerung "Dass uns dieses Hilflose irgendwie berührt oder bewegt. Dass die uns Leid tun" (ebd.) bestärkt. Es existieren auch nur wenige enge Freundschaften zwischen Anna, Celina, Stefan, Marvin und ihre MitschülerInnen ohne Behinderung. Generell findet ein Aufeinandertreffen in der Freizeit nur selten oder zufällig statt. Folgende Erkenntnis von Wilfried Schley und Almut Köbberling kann geschlussfolgert werden: "Beziehungen der nichtbehinderten SchülerInnen zu behinderten verlaufen eher auf einer Ebene geschwisterlichfreundschaftlicher Hilfsbereitschaft als auf der einer gleichwertigen Partnerschaft, und diese Kontakte haben ihren Raum eher im Kontext von Unterricht als außerhalb, wo Möglichkeiten zur freien, interessengeleiteten Gesellung gesucht werden" (1994, 208). Einige Beziehungen können somit als
'Schulfreundschaften' deklariert werden. Des Weiteren wirken sich die Entwicklungsprozesse in der Pubertät auf die Beziehungen zwischen den SchülerInnen mit und ohne Behinderungen aus. In dieser Phase entwickeln sich vermehrt die Interessen der zwei Gruppen auseinander: "Zunehmend schwindet unter den Jugendlichen die Motivation zu spielen. Gespräche einerseits, modisches Aussehen, Musik und Sport andererseits treten in den Vordergrund der Kontakte - Medien, in denen besonders Mädchen mit geistiger Behinderung meist wenig Möglichkeiten haben" (Köbberling/Schley 2000, 139). In diesem spannungsgeladenen Entwicklungszeitraum sind für die SchülerInnen ohne Behinderung meist andere Probleme bedeutungsvoller als die Beziehung zu ihren MitschülerInnen mit Behinderung (vgl. ebd., 140). Anna, Celina, Stefan und Martin fehlen "Partner mit ähnlichen Interessen (...); die Beziehungen zu den wenigen anderen Jugendlichen mit Behinderung in der eigenen (...) Klasse(n) mögen mitunter eher eine Qualität der 'Notgemeinschaft' haben" (Schley/Köbberling 1994, 208). Die Lage wird sich durch den schulischen Druck und der damit folgenden Abnahme von gemeinsamen Unterrichtssituationen nicht verbessern. Die SchülerInnen bemerken das Spannungsverhältnis zwischen zunehmende Leistungsanforderungen einerseits und der Umsetzung von Integration auf der anderen Seite. Der Leistungsdruck darf nicht das Gemeinschaftsgefühl bedrohen. Dabei hat sich bereits ein großer Teil des Lehrerkollegiums auf den Unterricht in der Integrationsklasse eingelassen. Sie nehmen genauso am sozialen Lernprozess teil, wie die Veränderung des Verhaltens bei Herrn E. zeigt (siehe auch Kapitel 5.3.3).
Die Zwei-Gruppen-Theorie trifft eindeutig auf diese Klasse zu. Unpersönliche Formulierungen, wie beispielsweise "die", "denen" oder "die (I-)Kinder", sind in jedem Interview oft vorgekommen. Damit "erfolgt eine implizite Abwertung der 'anderen' Kinder und Jugendlichen" (Hinz 1998). Der Begriff 'Integrationskind' ist "ein Versuch, die Kategorie des 'Anderen' positiv besetzt zu definieren, der doch schlußendlich nichts anderes als eine beschönigende Form des sonderpädagogischen Förderbedarfs und eine modernisierte Form von Behinderung bezeichnet" (ebd.). Zusätzlich wird die Theorie durch die einengenden institutionellen Vorschriften (Lehrplan, Schulzeitverkürzung, etc.) begünstigt. Die Schulzeit wurde verkürzt, die Unterrichtsinhalte jedoch nicht. Also soll in kürzerer Zeit die gleiche Menge an Wissen vermittelt werden. Dafür eignet sich die Methode des Frontalunterrichts wohl am Besten. Folglich könnte Gemeinsamer Unterricht - der einen höheren Aufwand in der methodischen Vorbereitung bedarf - eher als Hindernis betrachtet werden.
Darstellung
Die LehrerInnen geben sich große Mühe, den Unterricht an die Bedingungen der Integrationsklasse anzupassen (vgl. I3, I5, I6). Kira stellt fest: "Die werden immer kreativer, hab ich das Gefühl. Vor allem Frau S. und Herr E. denken sich immer wieder was Neues aus, was zum Thema passt, was sie mit uns kombinieren können und so" (I6). Sabrina gibt Chemie und Physik als Beispiel an: "Da machen wir mehr Experimente oder Gruppenarbeit, wenn sie dabei sind" (I3). Saskia hebt zudem die Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung hervor: "Es kann halt immer mal sein, dass irgendwas ist. Und man auch nicht genau den Lehrplan so durchziehen kann, wie sie es möchten. Sie müssen sich auch den Umständen anpassen (...). Eventuell müssen halt die Aufgaben etwas einfacher gemacht werden, damit sie die auch lösen können" (I5).
Als häufigste Lernformen für den Gemeinsamen Unterricht werden Partner- und Gruppenarbeit genannt (vgl. I1, I2, I3, I4, I5). Sabrina beschreibt ersteres wie folgt: "Also es ist so, z. B. im Deutschunterricht ist es wenn die mal arbeiten, dann ist das nicht wie ein Zusammenunterricht. Die Anderen arbeiten und vier meist leistungsstarke Schüler melden sich, weil wir ja vier I-Kinder haben. Die vier arbeiten denn mit den I-Kindern zusammen und tragen das dann später auch mit den I-Kindern vor. Sodass nicht jeder mit den I-Kindern zusammenarbeitet, sondern nur einzelne Personen" (I3). Für die Gruppenarbeit liefert Samuel eine kurze Darstellung des Ablaufs von Gruppenarbeit: "Es ist so, dass wir zusammen Aufgaben bekommen. Wir bekommen eine und die I-Kinder bekommen sie in einer einfacheren Variante. Dann behandeln wir erst die der I-Kinder und dann unsere. Meistens kommt es dann immer auf das gleiche heraus" (I4). Die konkrete Aufgabenerarbeitung legt Kira dar: "Wir gucken halt, wie wir das aufteilen können. (...). Dann, wenn wir z. B. ein Plakat machen oder so, erklären wir kurz, was das ist, und dann lassen wir die zum Beispiel die Schrift ausmalen, oder Sachen da zu, und das macht ihnen auch total Spaß. Und Anna lassen wir ausschneiden, die soll das ja lernen mit dieser Grobmotorik. Aber so richtig vom Thema kriegen die natürlich nicht so viel mit, aber das ist ja klar Wir versuchen das schon denen nahe zu bringen, aber denen geht es dann hauptsächlich ums Ausmalen und so, das ist ja auch verständlich" (I6). Bei der Präsentation der Ergebnisse ist es üblich, dass Anna, Celina, Martin und Stefan ihren erarbeiteten Teil vorstellen (vgl. I2). Die tatsächliche Zusammenarbeit sieht also eher so aus, dass die SchülerInnen ohne Behinderung die Funktion von Tutoren einnehmen (vgl. I6). "Wir kontrollieren die oder geben denen z.B. in Mathe Tipps beim Rechnen und arbeiten dann halt mit denen zusammen." (I1), beschreibt Leon die Gegebenheiten. Dabei versuchen die LehrerInnen auch Lernsituationen zu initiieren, in denen die SchülerInnen ohne Behinderung von Anna, Celina, Martin und Stefan lernen. So erfolgt beispielsweise die Überleitung in ein neues Themengebiet indem die vier Jugendlichen mit Behinderung Experimente vorstellen und kurz erklären (vgl. I6). Ein anderes Beispiel führt Jakob an: "Anna, die macht ja mehr so eine Art Rückenschule. Da hat ein Lehrer mit uns auch mal das gemacht, was sie gemacht hat, wo sie auch ohne Rollstuhl Sport machen konnte. Irgendwelche Übungen und so. Da haben wir auch mitgemacht. Da hat sie uns das gezeigt, wie das geht" (I2).
Die Meinungen zur Veränderung der Unterrichtsgestaltung variieren unter den Befragten. Sabrina und Samuel sind mit der derzeitigen Unterrichtssituation zufrieden; sie würden keine Veränderungen vornehmen (vgl. I3, I4). Ihrer Meinung nach sind nicht alle Fächer für den Gemeinsamen Unterricht geeignet (vgl. ebd.). Die anderen SchülerInnen wünschen sich noch mehr Zusammenarbeit (vgl. I1, I2, I5, I6): "Ich würde sie so weit wie möglich mit einbeziehen" (I5). Saskia und Kira äußern diesbezüglich den gleichen Änderungsvorschlag: "Ich würde es auch besser finden, wenn sie in den Sitzreihen mit uns sitzen würden. Also zwischen uns und nicht hinten." (I5) "Und sich immer zwei um die kümmern können. (...) Dass die dann halt, während die anderen Aufgaben machen, auch vereinfachte Aufgaben machen, und dass, wenn die I-Kinder dann Fragen haben, sie sich nach links und nach rechts wenden können" (I6). Die Notwendigkeit der Integrationshelfer ist für Kira teilweise fraglich: "Die sind die ganze Zeit bei denen. Ich glaube, wir selber können das auch. Diese Aufgaben, die verstehen wir ja, und wir wissen auch, wie man mit denen umgehen soll, also können wir denen das ja auch erklären. (...) Vielleicht wäre es ja gerade gut, die mal ein bisschen selbstständig zu machen. Also ich glaub schon, dass das manchmal ein bisschen zu viel ist" (I6). Das würde auch nach Kira ein leiseres, angenehmeres Arbeitsklima bewirken (vgl. ebd.). Dennoch kommen auch Zweifel auf, "ob das so leicht möglich ist" (I1). "Manche Themen sind echt zu schwer. Und, wenn wir dann nur auf sie Rücksicht nehmen, dann kommen wir mit unserem Stoff nicht hinterher" (I2). Schließlich stehen die LehrerInnen und SchülerInnen wegen des Lehrplans unter Druck.
Aus Sichtweise von drei Jugendlichen werden 25 % aller Unterrichtsstunden pro Woche in Form des Gemeinsamem Unterrichts gestaltet (vgl. I1, I2, I3). Samuel liegt mit seiner Schätzung von einem Drittel leicht darüber (vgl. I4). Nur Saskia bemisst den Anteil sogar mit 40 bis 55 Prozent (I5). Demgegenüber steht Kira mit der niedrigsten Bewertung von höchstens 10 Prozent (vgl. I6). Aus ihrer Sicht findet Gemeinsamer Unterricht "echt selten" (vgl. ebd.) statt, weil bestimmte Arbeitsformen nicht in ihrer Definition von Gemeinsamem Unterricht enthalten sind: "Das ist meistens so, dass Martin und Stefan da hinten sitzen, und die bekommen halt einen Zettel. Und während wir Unterricht machen, machen die halt ihre Aufgaben, und die Sonderpädagogen helfen denen dann dabei. (...) Das ist für mich das Schlimmste. Weil uns das stört, beim Lernen, beim Aufpassen, wenn da hinten nur Gemurmel ist. Und das ist auch keine Integration, weil wir uns nicht mit denen beschäftigen. Die sitzen da hinten, machen ihre Aufgaben, während wir unsere Aufgaben machen. Da können die auch gleich drüben bleiben, ist für mich so die Frage. Anstelle uns gegenseitig zu stören" (ebd.). Diese kritische Sichtweise auf Gemeinsamen Unterricht teilen mit ihr Leon, Sabrina und Saskia. "Es ist ja oft so, dass sie einfach nur hinten in der Klasse sitzen und zuhören" (I5) oder sie sitzen "in der Ecke" (I1), führen ihren eigenen Unterricht und am Ende der Stunde präsentieren sie ihre Ergebnisse (vgl. ebd., I2). "Aber ich finde nicht, dass das Gemeinsamer Unterricht ist, wenn sie nur hinten sitzen und irgendwas vorbereiten, was sie uns dann beibringen" (I1).
Interpretation
Der Gemeinsame Unterricht hat nach Aussagen der sechs SchülerInnen auch Lernprozesse bei den LehrerInnen angeregt. Der Zuwachs von Kreativität und Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung wird positiv angemerkt. Die LehreInnen versuchen auch Lernsituationen herzustellen, in denen Anna, Celina, Martin und Stefan die Wissensvermittler für ihre MitschülerInnen sind. Tendenzen der Verweigerung auf der Seite der LehrerInnen erwähnen die Jugendlichen nicht. Somit lassen sich die LehrerInnen auf die Abgrenzungs- und Annäherungsprozesse in Richtung Kooperation als Einigungsform ein. Jedoch ist nicht klar, inwiefern Anna, Celina, Martin und Stefan etwas über die Thematik der Gruppenarbeit lernen. Es ist fraglich, ob Ausmalen und Ausschneiden das Erlernen neuen Wissens unterstützen.
Trotzdem legen alle SchülerInnen einen hohen Wert auf eine Zunahme von gemeinsamen Lernsituationen. Ob die Zusammenarbeit der SchülerInnen mit und ohne Behinderung als Kooperation bezeichnet werden kann, ist hingegen fraglich. Die Beschreibungen der Partner und Gruppenarbeit machen deutlich, dass die Hilfeleistungen einseitig erfolgen. Die SchülerInnen ohne Behinderung übernehmen die Rolle von 'Hilfslehrern' in gemeinschaftlichen Lernsituationen. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen sowie ein Voneinanderlernen würde mehr einem kooperativen Verhalten entsprechen. Aufgrund dieser 'Hilfslehrer'-Position der SchülerInnen ohne Behinderung wird das Infantilisierungsdenken in Bezug auf Anna, Celina, Martin und Stefan (siehe Kapitel 5.3.1) gefördert. Natürlich kann die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen von Gleichaltrigen auch positive Folgen haben. Schließlich kann dadurch die Selbstständigkeit von Anna, Celina, Martin und Stefan zunehmen und die Abhängigkeit von den Erwachsenen verringert werden. Aus diesem Grund ist die Idee von Saskia und Kira eine wichtige Anregung. Eine Umgestaltung der Sitzordnung, so dass Anna, Celina, Martin und Stefan in den Bankreihen integriert sind, würde in einigen Situationen die IntegrationshelferInnen und die SonderschullehrerInnen überflüssig machen. Dass ein oder mehrere Erwachsene einen großen Teil der Zeit des Schulalltags die SchülerInnen mit Behinderung begleiten, kann ein Hindernis in der Kontaktaufnahme mit anderen Klassenmitgliedern sein. "Wenn ein Kind lernt, wegen seiner Behinderung ständig (oder überwiegend) auf Erwachsene angewiesen zu sein, sich damit auch oft auf diese Hilfe der (hierfür bezahlten) Erwachsenen zu verlassen, dann kann diese Form des gemeinsamen Unterrichts zu einem hohen Maß von Unselbständigkeit und Desintegration in der Gruppe der Gleichaltrigen führen" (Schöler, 2002). Dies hängt von dem Aufgabenverständnis der pädagogischen Hilfskraft ab (vgl. ebd.). Nach Schöler sollte das Ziel der Tätigkeiten von IntegrationshelferInnen sein, "die SchülerInnen zu befähigen, nach ihrer Schulzeit weitgehend unabhängig von bezahlter Handreichung durch Erwachsene zu leben, dass sie die notwendigen Hilfen autonom organisieren können und in der sozialen Gemeinschaft ihre Fähigkeiten einbringen" (ebd.). In der Integrationsklasse am Werner- von Siemens-Gymnasium wird mit dem 'Anna-Dienst' (siehe Kapitel 5.3.2) in den Hofpausen und teilweise in der Partner- bzw. Gruppenarbeit versucht, die MitschülerInnen in der Gestaltung notwendiger Hilfeleistungen anzuleiten. Trotzdem sehen Saskia und Kira mehr Potential, die Selbstständigkeit von Anna, Celina, Martin und Stefan zu erhöhen.
Dabei ist die Vermittlung des Grundsatzes "Keine ungefragten Hilfeleistungen!" (ebd.) wichtig. "Erst das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und die Sicherheit der Nähe zu anderen Menschen erlauben eine autonome Lebensführung und die Gestaltung der eigenen Vorstellungen von einem erfüllten und sinnvollen Leben" (ebd.).
Der kritische Blick einiger SchülerInnen auf die Umsetzung von Gemeinsamen Unterricht ist bemerkenswert. Sie sind mit dem aktuellen Zustand, dem oft getrennt durchgeführten Unterricht im selben Raum, nicht zufrieden. Solch eine Unterrichtsform fördert die Gemeinschaft nicht. In dem Sinne liegt bei einigen LehrerInnen noch ein gering ausgeprägtes Verständnis von Gemeinsamem Unterricht vor: "Neben gutem Gemeinsamen Unterricht gibt es aber immer noch kümmerliche Integrationsformen, zum Beispiel die bloß additive Beigesellung eines behinderten Kindes ohne weitere Veränderung des Klassenunterrichts. Solche mangelhaften Formen entsprechen nicht dem eigentlichen Integrationskonzept" (Sander 2008, 35). Die Jugendlichen spüren die Spannung zwischen dem steigenden Druck durch die Leistungsanforderungen einerseits und dem Gemeinsamen Unterricht andererseits (siehe auch Kapitel 5.3.2). Jedoch können sie nicht die institutionellen Rahmenbedingungen ändern. Das Kultusministerium fordert die Einhaltung des Lehrplans. Folglich nimmt die Rücksichtnahme auf gemeinsame Aktivitäten im Unterricht ab und Anna, Celina, Martin und Stefan werden teilweise als Hindernis im zielgleichen Lernprozess wahrgenommen. Dieser Zustand beruht auf den Widerspruch, der durch die gleichzeitige Beschulung von SchülerInnen einer Klasse nach den Prinzipien der Lernzielgleichheit und der Lernzieldifferenz entsteht: ein großer Teil der Klasse verfolgt dasselbe Lernziel, während ein kleinerer Rest ein anderes Ziel anvisiert. Die Zwei-Gruppen-Theorie findet also auch auf der Unterrichtsebene statt "(...) und hier insbesondere auf den Umfang an Maßnahmen der äußeren Differenzierung speziell für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Bei einem zu großen Umfang derartiger Maßnahmen kann nur noch schwerlich von Gemeinsamen Unterricht gesprochen werden, wenn die Teilnahme an diesen Maßnahmen formal oder auch faktisch an die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gebunden ist" (Schwager o.J., 21). Somit wird die Zwei-Gruppen-Theorie in Form eines 'Zwei-Klassen-Gefühls' (siehe Kapitel 5.3.2) in der Klassengemeinschaft auf der interaktionellen Ebene aufrechterhalten und bestärkt. Hier besteht wiederum die Gefahr, dass SchülerInnen mit Behinderung "den objektiven Vorzug schulischer Integration keineswegs als annehmlich, bereichernde und förderliche Wohltat wahrnehmen [könnten; D.A.], sondern sich unglücklich und unzufrieden zeigen, Mißbehagen, Vereinsamung und Ungeborgenheit erleben. Sie sind unzufriedene Priviligierte" (Wocken 1987, 208). Wocken bezeichnet diese Gegebenheit als "Unzufriedenheitsdilemma" (ebd., 207).
Darstellung
Wenn die Jugendlichen einmal die Position des Schulleiters einnehmen dürften, würden sie drei Punkte am Integrationskonzept verändern. Leon und Samuel bemängeln die Barrierefrei- heit der Schule (vgl. I1, I4). Daher schlägt Samuel vor: "Mit dem Rollstuhl kommt man eigentlich überall hin. Aber dass man das auf dem Gelände besser hinbekommt. Man muss schon teilweise Umwege fahren, um überall hinzukommen. Vielleicht mit Rampen oder etwas umbauen" (I4). Ein weiterer Punkt, der von Jakob, Sabrina und Kira angesprochen wird, ist die Verbesserung der Informationsverbreitung in der gesamten Schule: "Ich würde erst mal auch die ganzen anderen Kinder informieren. Also ich weiß noch nicht genau wie, aber die halbe Schule weiß überhaupt nicht, dass wir eine Integrationsklasse haben, bzw. wie viele und was für welche wir hier drin haben. Und weil das so selten ist, finde ich, sollte man das auch ausnutzen" (I6). "Manchmal, werden wir so ausgelacht wie 'iii, ihr seid die I-Klasse' und das klappt halt noch nicht so gut. Dass sie eigentlich gar nicht wissen, was bei uns abgeht und, dass sie einfach so über uns urteilen." (I2). Zur Verbesserung empfiehlt Sabrina, die integrativ beschulten Jugendlichen mit ihren speziellen Eigenheiten allen SchülerInnen des Gymnasiums vorzustellen (vgl. I3). Zudem hat Kira die Idee, dass sich interessierte SchülerInnen eine Stunde mit in die Integrationsklasse setzen (vgl. I6). Saskias Gedanke zur Veränderung schließt am vorherigen Punkt an. Sie möchte ebenfalls, dass die anderen SchülerInnen mit Anna, Celina, Martin und Stefan "mehr Kontakt knüpfen" (I5) und schlägt deshalb vor, Arbeitsgemeinschaften mit ihnen anzubieten: "So Rollstuhlbasketball, dass halt auch Schüler ohne Behinderung so etwas ausprobieren können. Wir haben das mal im Sportunterricht gemacht. Und das war ganz schön" (ebd.). Die Mehrheit der SchülerInnen wünscht sich auch noch mehr Integrationsklassen an ihrem Gymnasium (vgl. I2, I3, I4, I6), wobei Samuel eine Einschränkung vornimmt: "Naja, man kann ja nicht in jedem Jahrgang eine machen, sondern nur so alle zwei bis drei Jahre. Aber ich wäre schon für mehr Integrationsklassen" (I4). Für Leon und Saskia ist eine Integrationsklasse an ihrer Schule ausreichend (vgl. I1, I5): "Es wäre schon ganz schön anstrengend, wenn man jetzt noch eine Klasse fördern würde. Es gibt ja auch nicht so viele Lehrer, die das mitmachen. Ich denke mal, wenn die bei uns weg sind, also nach der zehnten Klasse raus sind, dass man dann eventuell wieder eine neue Integrationsklasse bildet. Aber sonst würde ich sagen, dass eine Integrationsklasse pro Schule reicht" (I5). Über die gesetzlich geregelten institutionellen Vorschriften wissen die SchülerInnen unterschiedlich viel. Die meisten Jugendlichen sind sich aber eher unsicher, ob ihr Wissensstand korrekt ist. Samuels folgende Aussage enthält alle Punkte, zu denen die SchülerInnen Informationen angeben können - Notengebung, Zeugnis und Versetzen: "Die I-Kinder haben keine Benotung an sich. Sie bekommen eine Beurteilung in Textform, ob sie sich in den Fächern verbessert haben oder ähnliches. Benotung gibt es nicht, nur was sie neu gelernt haben. Für die I-Kinder gibt es keine Regeln bezüglich des Sitzenbleibens. Ich glaube, es wäre auch schlimm wenn die vier nicht mehr in einer Klasse sind" (I4). Saskia schlussfolgert die Regelung über das Versetzen von Anna, Celina, Martin und Stefan wie folgt: "Ich glaube nicht, dass die sitzenbleiben können. Sie sollten auch immer in unserer Klasse bleiben, weil sie uns auch kennen. Für die ist es auch nicht ganz einfach, sich dann wieder an neue Menschen und so zu gewöhnen. Sonst hätte das ja alles gar nichts gebracht." (I5).
Interpretation
Die aufgeführten Ideen für Veränderungen von der Seite der SchülerInnen an die Schulleitung sind bedeutsame Anregungen, die zeitnah umgesetzt werden könnten. Ein Ausbau der Barrierefreiheit würde zur Steigerung der Selbstständigkeit von Anna beitragen. Ein Fahrstuhl ist zwar im Haus vorhanden, jedoch ist der Schulhof von dort nur über Umwege erreichbar.
Auch am Städtischen Gymnasium Bad Segeberg - dem ersten integrativ arbeitendem Gymnasium (vgl. Boban 2011, 13) - hat ein Großteil der Schülerschaft wenig Kenntnisse über die Integrationsklasse (vgl. Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. o.J.). Aus diesem Grund schrieb eine SchülerIn über die Integrationsklasse in die Abi-Zeitung folgende Worte: "Zunächst fällt in dieser Klasse kein Unterricht aus, so wissen die Schüler nicht, wie es ist, sich ein bis zwei Stunden lang in der Pausenhalle zu langweilen. Außerdem haben sie eine 'Kuschelecke'. Klar wird dann gerne integriert, spätestens ab der siebten, achten Klasse, wenn das andere Geschlecht interessant wird. (...) [Mir geht es; D.A.] partout nicht in den Kopf..., geistig behinderte Kinder in ein System zu integrieren, in dem sie wissentlich gar nicht bestehen können. (...) Diese Art von Integration hat an einem Gymnasium nichts zu suchen" (ebd.). Um solche Äußerungen, die auf Unwissenheit beruhen, zu vermeiden, sollte am Werner-von-Siemens-Gymnasium allen SchülerInnen eine Kontaktaufnahme mit Anna, Celina, Martin und Stefan ermöglicht werden. Saskias Einfall, Arbeitsgemeinschaften in der Freizeit anzubieten, wäre eine Möglichkeit dazu. So könnten auch die vier SchülerInnen mit Behinderung neue Menschen kennen lernen, die vielleicht ähnliche Interessen haben. Die Tatsache, dass die interviewten Jugendlichen wenig Wert auf die institutionellen Regelungen legen, spricht für einen hohen Grad an Akzeptanz von Anna, Celina, Martin und Stefan in der Klasse.
Der in der Interpretation von Kapitel 5.3.3 erwähnte Widerstand zwischen den Prinzipien der Lernzielgleichheit und der Lernzieldifferenz sowie das damit verbundene Spannungsverhältnis zwischen den zunehmenden Leistungsanforderungen einerseits und der Durchführung von Gemeinsamen Unterricht andererseits (siehe dazu auch Kapitel 5.3.2) liegt im Verantwortungsbereich der institutionellen Ebene. Die SchülerInnen spüren den spannungsgeladenen Zustand, aber äußern dies nicht konkret. Eine Veränderung der Situation liegt letztendlich im Aufgabenbereich des Kultusministeriums. Dieses liefert die strukturellen und inhaltlichen Vorgaben für die Realisierung von Unterricht.
Darstellung
Die Außenwahrnehmung der Klasse ist sehr unterschiedlich. Kira vermutet, dass einige SchülerInnen innerhalb des Gymnasiums nicht von der Existenz der Integrationsklasse wissen (vgl. I6, I3, I5) (siehe dazu Kapitel 5.3.4). Dementsprechend wurde der im Jahr 2007 gewonnene Integrationspreis auch nur von einem kleinen Teil der Schülerschaft zur Kenntnis genommen: "In unserem Jahrgang wurde das richtig wahrgenommen, in Anderen glaube ich nicht so. (...) Es hieß nur in der Presse, dass das Gymnasium einen Preis für Integration bekommen hat. Aber sonst wurde das nicht richtig wahrgenommen" (I4). Hingegen merken fast alle befragten SchülerInnen an, dass die Parallelklassen sie mit dem Vorurteil konfrontieren, bevorzugt zu werden (vgl. I1, I2, I3, I4, I5): "Es sagen ja manche aus der Parallelklasse halt, (...) dass wir immer die besten Lehrer, obwohl es gibt ja keine besten Lehrer - das ist ja Ansichtssache - bekommen. Und irgendwie alles bei uns leichter ist" (I1). Samuel rechtfertigt das jedoch: "Aber das stimmt ja alles gar nicht, weil wir müssen ja den gleichen Stoff behandeln. Wir müssen auch zu Potte kommen. Nur dass wir noch die I-Kinder mit dazu haben. Das ist halt eher eine Schwierigkeit keine Vereinfachung" (I3, vgl. I1). Nur Kira ist der Meinung, dass es keine Probleme mit den Parallelklassen gibt.
In den Familien der Jugendlichen ist der Besuch der Integrationsklasse "mittlerweile zum Alltag geworden" (I5, vgl. I1). Wenn "lustige Sachen" (I6) passiert sind oder "wenn Martin und Stefan gerade einen guten Fortschritt gemacht haben" (ebd.), berichtet Kira es ihren Eltern. Sabrinas Mutter und Celinas Mutter sind auch schon länger miteinander befreundet (vgl. I3). Leon hat zu Beginn alles erklärt "und nachdem kam auch nichts mehr" (I1). Da Jakob den Besuch dieser Klasse selber entschieden hat, waren seine Eltern und Geschwister zunächst sehr kritisch, wie er berichtet (vgl. I2). "Aber ich hab das halt alles erklärt. Und bei dem Tag der offenen Tür haben sie sie auch schon kennen gelernt" (ebd.). Einige Verwandte von Kira haben erst einmal gefragt "Bist du behindert?" (I6). Aber sie informiert diese Personen dann über die Situation in der Klasse (vgl. ebd.).
Samuel, Saskia und Kira fühlen sich von dem besonderen Interesse der Presse genervt (vgl. I4, I5, I6). "Die Presse sieht das halt immer als was Besonderes an, das wir uns so engagieren" (I4). "Ich finde es übertrieben, dass man da jetzt immer so einen Aufstand drüber macht, nur weil wir mit denen in einer Klasse sind" (I5). Kira denkt, dass in der Presse einige Fakten verfälscht werden: "Also, ich hab mir so einen Artikel noch nicht durchgelesen, aber ich glaub, das wird alles so schön geschmückt. (...) Von außen hin denken dann alle, das ist so eine tolle Schule" (I6). Zudem wird nach ihrer Aussage für Journalisten und andere Hospitationsgäste speziell 'guter' Gemeinsamer Unterricht vorbereitet und durchgeführt (vgl. ebd.): "Da wird dann alles gemacht. Das finde ich richtig frech. Also, wenn Besucher kommen, dann kommen die schön hier hin, dann müssen wir auch lachen und die im Arm halten und umarmen, und das sind dann so gestellte Bilder, das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Manche haben überhaupt nichts mit den I-Kindern zu tun. (...) Aber dieses Oberflächliche, wenn die Presse da ist, stimmt einfach nicht. Und das wird auch nach außen getragen, dass wir hier jeden Tag schön alles zusammen machen. Integration, das ist einfach nicht mehr so, das muss man sagen. (...) Jetzt verschlechtert sich der Zustand, und wenn die Presse kommt ist plötzlich alles wieder gut." (I6).
Interpretation
Im Allgemeinen legen die interviewten SchülerInnen wenig Wert auf die gesellschaftliche Perspektive. Ihr Fokus liegt mehr auf die reale Umsetzung von schulischer Integration am Werner-von-Siemens-Gymnasium (siehe Kapitel 5.3.2 und 5.3.3).
Im Gegensatz zur Familie nehmen die Presse und die Parallelklassen die Integrationsklasse als 'exotisch' wahr. Die Zuteilung der besonderen Stellung verstehen die SchülerInnen nicht und empfinden es als überflüssig. Nach dem innerem Wertesystem der Integrationsklasse würden die Jugendlichen sich und ihre MitschülerInnen als "ganz normale Menschen" (I3) einordnen: "Wir sind doch eine ganz normale Klasse. Für uns ist das alles normal" (I5). Folglich stimmen sie nicht der Behauptung der Bevorzugung zu. Hier prallen also individuelle Maßstäbe und gesellschaftliche Normen und Werte aufeinander. Zwar mag der Unterricht in der Integrationsklasse anders ablaufen, aber dafür würde der Gemeinsame Unterricht die GymnasialschülerInnen in ihrem Lerntempo verlangsamen. Dennoch kritisieren die Jugendlichen das nach außen getragene Bild ihrer Klasse. Innerhalb des letzten Jahrs haben gemeinsame Unterrichtssituationen abgenommen. In den Medien wird also laut Kira ein falsches Bild wiedergegeben. Dabei wünscht sich die Mehrheit der SchülerInnen mehr gemeinsame Lernsituationen.
Die Einrichtung der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium wurde von der Schulleitung - also der institutionellen Ebene - beschlossen. Ausgehend von dieser administrativen Entscheidung sollten Einigungsprozesse auf den anderen Ebenen in Gang gesetzt werden. Die Theorie integrativer Prozesse sieht jedoch die innerpsychische Ebene als Ausgangspunkt vor, da nur so Einigungsprozesse auf den übrigen vier Ebenen angestoßen werden können (vgl. Kapitel 2.2.2). In der folgenden Zusammenfassung der empirischen Untersuchung steht die Beantwortung der folgenden Fragestellung im Mittelpunkt: Bewirkt Integration auf der institutionellen Ebene auch Integration auf den restlichen Ebenen? - im Mittelpunkt. Daraus resultierend werden wiederum Handlungsalternativen aufgezeigt.
Für die innerpsychische Ebene geht aus den sechs Interviews hervor, dass Anna, Celina, Stefan und Martin von ihren MitschülerInnen akzeptiert werden. Durch den Abbau von Hemmnissen hat sich ein 'Normalitätsdenken' herausgebildet, keiner betrachtet die gesamte Klasse und auch nicht die vier SchülerInnen mit Behinderung als Besonderheit. Dennoch besteht eine defizitorientierte Sichtweise auf 'Behinderung'. Zudem werden Anna, Celina, Stefan und Martin nicht als gleichaltrige Jugendliche, sondern als 'Kinder' wahrgenommen. Denn die Hilfebedürftigkeit wird als ein prägendes Merkmal der vier integrativ beschulten Jugendlichen angesehen.
Auf der interaktionellen Ebene sind ebenso Einigungsprozesse zu beobachten. In welchem Ausmaß Begegnungen stattfinden, hängt allerdings von den einzelnen Beteiligten ab. Alle interviewten SchülerInnen geben an, dass Anna, Celina, Martin und Stefan sich in der Klasse angenommen fühlen würden. Der Zusammenhalt der Klassengemeinschaft sowie der respektvolle, gleichberechtigte Umgang wird von allen SchülerInnen wertgeschätzt. Dennoch berichten die Schülerinnen, dass sie gern mehr Kontakt zu Anna, Celina, Martin und Stefan hätten. Insgesamt ist die Beziehung zwischen den SchülerInnen ohne und mit Behinderung eher als Bekanntschaft oder 'Schulfreundschaft' zu deklarieren. Feste Freundschaften und Treffen in der Freizeit gibt es nur wenige. Damit verbunden ist die Bestätigung der Annahme der Zwei-Gruppen-Theorie. Es existieren real die Gruppen der 'I-Kinder' und die der GymnasialschülerInnen.
Kooperation auf der handlungsbezogenen Ebene setzt ein gegenseitiges Geben und Nehmen sowie ein Voneinanderlernen voraus. In der Integrationsklasse des Werner-von-Siemens- Gymnasiums leisten die SchülerInnen ohne Behinderung einen größeren Teil an Hilfestellung. In Partner- und Gruppenarbeit nehmen sie die Rolle eines 'Hilfslehrers' oder Tutors ein. Jedoch bieten die LehrerInnen in der neunten Klasse - entgegen dem Wunsch der SchülerInnen nach mehr Gemeinsamen Unterricht - weniger gemeinsame Aktivitäten an. Mit dem Anstieg der Leistungsanforderungen nimmt die Zusammenarbeit mehr und mehr ab. Das wiederum senkt die Interaktionsmöglichkeiten der SchülerInnen. Sabrina erinnert sich, dass in der Grundschule alle SchülerInnen alles zusammen gemacht haben. Dabei erkennen die sechs Befragten das Bemühen der LehrerInnen, den Unterricht flexibler und kreativer zu gestalten, an. Aber, dass Anna, Celina, Martin und Stefan teilweise nur in der letzten Bankreihe sitzen und ihre eigenen Aufgaben lösen oder nur zuhören, wird von der Mehrheit der sechs Jugendlichen ohne Behinderung nicht als eine Form des Gemeinsamen Unterrichts angesehen - eher als ein Zeichen für ein gering ausgeprägtes Verständnis von Gemeinsamen Unterricht. Für eine Steigerung der Selbstständigkeit von Anna, Celina, Martin und Stefan könnten die IntegrationshelferInnen in einigen Situationen mehr in den Hintergrund treten.
Die Instanzen der institutionellen Ebene (Schulleitung, Schulbehörden, Kultusministerium etc.) erschweren durch ihre einengenden Vorschriften mit zunehmender Klassenstufe die Verwirklichung von Gemeinsamen Unterricht und folglich auch das Finden von Einigungsprozessen auf den übrigen Ebenen. Die gleichzeitige Beschulung nach den Prinzipien der Lernzielgleichheit und der Lernzieldifferenz führt zu einem Widerstand, der sich in dem Spannungsverhältnis zwischen dem steigenden Druck durch die Leistungsanforderungen einerseits und der Umsetzung von Gemeinsamen Unterricht andererseits äußert. Somit wird die Zwei-Gruppen-Theorie auch auf der Handlungsbezogenen Ebene erzeugt: "Die 'Zwei- Gruppen-Theorie' stellt in ihren miteinander verwobenen Dimensionen ein Hindernis für die Entwicklung des Gemeinsamen im Gemeinsamen Unterricht (...) dar" (Schwager, o.J.).
Einigungen auf der gesellschaftlichen Ebene sind in den Familien der interviewten Jugendlichen ersichtlich. Der Besuch der Integrationsklasse stellt keine Besonderheit mehr dar - er gehört zum 'normalen', alltäglichen Leben. Indessen weist die Presse und die Parallelklasse der Integrationsklasse eine 'exotische' Rolle zu. Das Bild, das die Journalisten vermitteln, würde allerdings nur teilweise der Realität entsprechen. Gemeinsamer Unterricht entspricht in der Realität immer seltener dem, was nach außen vermittelt wird. Demnach wird dem Vorwurf der Bevorzugung nicht zugestimmt.
Insgesamt gesehen müssen demnach noch auf allen Ebenen Einigungsprozesse - mehr oder weniger stark - angeregt werden, bzw. dürfen bestehende Einigungen nicht in Gefahr gebracht werden. Dazu können zum einen Veränderungen innerhalb der Schule vorgenommen werden. In der folgenden Tabelle werden Handlungsalternativen mit den gewünschten Zielen aufgezeigt. Potential zur Weiterentwicklung ist eindeutig vorhanden. Einige der Ideen stammen aus den Interviews mit den sechs SchülerInnen.
|
Handlungsalternativen |
Ziele |
|
Handlungsbezogene Klassenprojekte |
|
|
Nachmittagangebote, wie handlungsbezogene Arbeitsgemeinschaften (Bsp.: Rollstuhlbasketball) |
|
|
"Attraktive und gut erreichbare Treffpunkte" für die Pause (Schley/Köbberling1994, 209) |
|
|
Integration von Anna, Celina, Martin und Stefan in die Sitzordnung der GymnasialschülerInnen |
|
|
Änderung des Aufgabenverständnisses der IntegrationshelferInnen (siehe hierzu Schöler 2002) |
|
|
Voneinanderlernen anregen |
|
|
Lehrerfortbildungen |
|
|
konzeptionelle Weiterentwicklung des Gemeinsamen Unterrichts
|
|
|
Etablierung mehrerer Integrationsklassen an der Schule |
Schaffung von Gelegenheiten für SchülerInnen mit Behinderung sich leichter in natürlichen Interessensgemeinschaften zusammenzufinden |
Eine Anregung an das Kultusministerium wäre, den Sinn der Prinzipien der Lernzielgleichheit und der Lernzieldifferenz zu überdenken. In den höheren Klassen wird schulische Integration immer weiter erschwert. Der Lehrplan produziert bei den zielgleich unterrichteten GymnasiastInnen einen zu hohen Leistungsdruck und verringert die Bereitschaft der LehrerInnen für Gemeinsamen Unterricht, wodurch die in den letzten Jahren hergestellte Gemeinschaft bedroht wird, verloren zu gehen.
Die interviewten Jugendlichen sind sich unsicher, wie ihr Kontakt zu Anna, Celina, Martin und Stefan nach der gemeinsamen Schulzeit aussehen wird (vgl. I2, I3). Im Nachhinein würde Saskia die Entscheidung ihrer Eltern, seit der ersten Klasse eine Integrationsklasse zu besuchen, nicht rückgängig machen: "Wenn ich die anderen Klassen sehe, wie die miteinander umgehen, dann denke ich schon, dass wir besser zusammengewachsen sind und auch zusammengehören" (I5).
Das Leitfadeninterview hat sich als geeignete Methode für die Untersuchung meiner Fragestellung herausgestellt. Die sechs SchülerInnen haben sich während des Gesprächs kritisch mit der Lage der schulischen Integration an ihrem Gymnasium auseinandergesetzt. Die unterschiedlichen Voraussetzungen der Jugendlichen (siehe Kapitel 5.3) haben eine Vielfalt von Äußerungen aus verschiedenen Blickwinkeln erzeugt.
Die Untersuchungssituation war für mich am Anfang ungewohnt. Nach den ersten zwei Interviews konnte ich mich langsam mit meiner Rolle als Interviewende identifizieren, meine Haltung entspannte sich somit auch. Während ich mich zunächst stark an den Fragen des Interview-Leitfadens hielt, entwickelten sich nach einiger Zeit neue Fragen im Gespräch. Dennoch hatte ich teilweise ausführlichere Antworten auf die Schlüsselfragen erwartet. Allen SchülerInnen habe ich deshalb viele der zusätzlich notierten Fragen gestellt, die eigentlich nur als Gedankenstütze dienen sollten. Die stärkere Lenkung des Interviews meinerseits könnte mit dem höheren Frage- als Sprechanliegen begründet werden.
Zu Bedenken ist auch, dass die Äußerungen der SchülerInnen durch die gesellschaftliche Sozialisation geprägt sind. Dieses spiegelt sich in der defizitorientierten Sichtweise von 'Behinderung' und dem Erfüllen der Leistungsanforderungen wieder.
Die sechs Jugendlichen haben sich bemüht, neben ihrer eigenen, auch die Sichtweise der anderen Beteiligten zu mutmaßen. Um die Fragestellung jedoch noch konkreter zu beantworten, wäre ein Vergleich von Aussagen aller Beteiligten-Gruppen (SchülerInnen mit Behinderung, LehrerInnen, Eltern, IntegrationshelferInnen etc.) sinnvoll. Auf diese Weise würden die unterschiedlichen Ansprüche an die schulische Integration von jeder Gruppe, als auch von jedem Individuum, sichtbar werden.
In den letzten 40 Jahren gab es zahlreiche Eltern, die sich für die schulische Integration ihrer Kinder eingesetzt haben. Ihr Erfolg war immer abhängig von den Entscheidungen der staatlichen Institutionen. Die Vereinten Nationen haben sich diesem Problem angenommen. Nachdem Ende 2006 ein Entwurf für die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) entstand, trat sie am 3. Mai 2008 in Kraft. Deutschland, als einer der ersten Unterzeichner dieses Vertrags hat sich verpflichtet, ein inklusives Schulsystem einzurichten. Somit sind nun alle allgemeinen Schulen verbindlich aufgefordert, sich für den Gemeinsamen Unterricht von SchülerInnen mit und ohne Behinderung in einem inklusiven Bildungssystem zu öffnen. Bis ein inklusives Bildungswesen aufgebaut ist, wird integrative Beschulung unterstützt (vgl. Kapitel 3.3.3). Das Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg ist diesen ersten Schritt - vielleicht nicht ganz geplant - schon im Schuljahr 2006/2007 gegangen. Damit tragen sie dazu bei, die Aufhebung von Selektion voranzutreiben (vgl. Kapitel 3.2). Die Eltern von Anna, Celina, Martin und Stefan konnten durch die Arbeit in der Elternvereinigung 'ERIK Goslar' bereits andere weiterführende Schulen von der schulischen Integration überzeugen (vgl. Kapitel 4).
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit nimmt die derzeitige Lage der schulischen Integration am Gymnasium am Beispiel des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in den Blick. Die Theorie integrativer Prozesse macht deutlich, wie vielfältig Integration in der Realität sein kann. Ein 'fester Endzustand' wird nie erreicht werden können. Denn Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen regen immer wieder neue Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse an (vgl. Kapitel 2.2). Die empirische Untersuchung spiegelt diese Komplexität wieder. Die alleinige Einrichtung der Integrationsklasse auf institutioneller Ebene hat nicht zwangsläufig Einigungen auf allen anderen Ebenen zur Folge. Die angegebenen Handlungsalternativen zeigen das Entwicklungspotential des Gymnasiums. Es müssten zum einen mehr Begegnungsmöglichkeiten zwischen den SchülerInnen geschaffen werden. Weiterhin stößt die Kritik an der Unterrichtsgestaltung eine Überarbeitung des Verständnisses von Gemeinsamen Unterricht an (vgl. Kapitel 5). Allerdings sollten die SchülerInne in den Entwicklungsprozess eingebunden werden. Ihre Vorschläge und Wünsche sind möglicherweise für eine Verbesserung der Situation der schulischen Integration bedeutungsvoller als der Rat von Fachleuten. Auch wenn die Journalisten nicht immer die Realität wiedergeben, so kann das Werner-von-Siemens-Gymnasium doch eine Vorbildwirkung für weitere Schulen einnehmen. Das Bewusstsein für Gemeinsamen Unterricht muss in der Öffentlichkeit verändert werden. "Am stärksten wirken Beispiele. Deshalb ist jede einzelne integrative Einrichtung, die neu entsteht, zugleich die Bedingung für die Ermöglichung weiterer" (Muth zit. nach Schöler 2011, 15). Doch es bedarf auch noch weitreichendere Veränderungen. Das Kultusministerium sollte über ein gemeinsames Curriculum für alle SchülerInnen nachdenken, das an die individuellen Voraussetzungen angepasst werden kann. Nur so können sich die Prinzipien der Lernzielgleichheit und der Lernzieldifferenz nicht gegenseitig negativ beeinflussen und eine Chancengleichheit für alle SchülerInnen gewährleistet werden (vgl. Kapitel 5). Eine Reduzierung des Leistungsdrucks und die Abwendung vom gleichschrittigen Lernen könnte den SchülerInnen einen stressärmeren Unterricht bieten (vgl. Sander 2008, 37).
Die Zukunftsperspektive sollte jedoch, wie von der BRK gefordert, die Inklusion (siehe Kapitel 3.3.1) sein. Denn auch, wenn die Sonderschulen abgeschafft und SchülerInnen integrativ beschult werden, wird das Zwei-Gruppen-Denken bestehen bleiben. "Im Konzept der Inklusion ist nicht mehr die Integration der Minorität in die Majorität das Ziel, sondern eine Schule für alle. In einer Pädagogik der Vielfalt (Prengel 1993) werden alle Kinder als individuell verschieden und als prinzipiell zuwendungs- und förderbedürftig gesehen" (Feyerer 2009). Die Kompetenz der SonderpädagoInnen ist auch im inklusiven Schulsystem erforderlich. Ihre Aufgabe wird es sein, das gesamte System zu unterstützen und nicht nur die einzelnen SchülerInnen mit Behinderung (vgl. ebd.). Die Allgemeine Pädagogik kann dasselbe sein wie die Inklusive Pädagogik, unter der Bedingung, dass sie die Heterogenität aller Kinder und Jugendlichen anerkennt (vgl. Sander 2008, 35).
"Das Abitur werden die beiden Mädchen nie erreichen - [Celina; D.A.] kann zwar lesen und schreiben sowie bis 1000 rechnen, [Anna; D.A.] übt gerade, ihren Namen zu schreiben und bis zehn zu rechnen - trotzdem sind beide vollwertige und wertvolle Teile der Klasse" (focus.de, Stand: 02.08.2011).
Aichele, Valentin (2010): Das Recht auf inklusive Bildung gemäß Artikel 24 der UNBehindertenrechtskonvention: Inhalt und Wirkung. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 11-25
Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. (o.J.): Das Abendland geht nicht mehr dreimal täglich unter. URL: http://www.down-syndrom.org/pre/518.shtml (Zugriff: Juni 2011)
Atteslander, Peter (2006): Methoden der empirischen Sozialforschung. 11. Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag
behindertenbeauftragter.de (o.J.): Die UN-Konvention. URL: http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKo nvention_node.html (Zugriff: Juni 2011)
Boban, Ines/Hinz, Andreas (1996): Integrative Prozesse auf der innerpsychischen Ebene. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/boban-innerpsychisch.html (Zugriff: Mai 2011)
Boban, Ines/Hinz, Andreas (2003): Qualitätsentwicklung des Gemeinsamen Unterrichts durch den "Index für Inklusion". URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/boban-qualitaetsentwicklung.html (Zugriff: Juni 2011)
Boban, Ines (2003): Circles of Support and Person Centered Planning. Unterstützerkreise und Persönliche Zukunftsplanung. In: Feuser, Georg (Hrsg.) Integration heute - Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main: Peter Lang, 287-297
Boban, Ines (2011): Stressfrei durchs G8. Von Ideen, die jetzt geboren werden: Aqui tambien - Here too - Hier auch! In: Leben mit Down-Syndrom Nr. 66
Degener, Theresia (2003): Eine UN-Menschenrechtskonvention für Behinderte als Beitrag zur ethischen Globalisierung. URL: www.bpb.de/files/Q72JKM.pdf (Zugriff: Juni 2011)
Der Brockhaus in einem Band (2002), 9. Auflage, Leipzig: F.A. Brockhaus
Deutsches Institut für Menschenrechte (o.J.): Monitoring-Stelle. URL: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html (Zugriff: Juni 2011)
Deppe-Wolfinger, Helga (1990): Zur Geschichte integrativer Klassen und Schulen. In: Deppe-Wolfinger, Helga/Prengel, Annedore/Reiser, Helmut (Hrsg.): Integrative Pädagogik in der Grundschule: Bilanz und Perspektiven der Integration behinderter Kinder in der Bundesrepublik Deutschland 1976-1988. München: Deutsches Jugendinstitut, 11-26
Deutscher Bundestag (2010): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Nationaler Billdungsbericht 2010 - Bildung in Deutschland und Stellungnahme der Bundesregierung. URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703400.pdf (Zugriff: Mai 2011)
dohrmannschule.de (o.J.): Regionales Integrationskonzept Bad Bevensen. URL: http://www.dohrmann-schule.de/rik.htm (Zugriff: Juni 2011)
Dorrance, Carmen (2010): Barrierefrei vom Kindergarten in die Schule? Eine Untersuchung zur Kontinuität von Integration aus der Sicht betroffener Eltern. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
Evers-Meyer, Karin (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen) (Hrsg.) (2009): Wegweiser für Eltern zum Gemeinsamen Unterricht. Berlin
Feyerer, Ewald (2009): Ist Integration "normal" geworden? URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/inkl-02-09-feyerer-integration.html (Zugriff: August 2011)
focus.de (2009): Bad Harzburg: Mit Down-Syndrom aufs Gymnasium. URL:http://www.focus.de/schule/lernen/tid-15568/recht-auf-bildung-bad-harzburg-mit-downsyndrom-aufs-gymnasium_aid_436969.html (Zugriff: August 2011)
Friess, Sabrina (2011): Persönliche Zukunftsplanung als Schlüsselstrategie auf einem inklusiven Weg. Wissenschaftliche Hausarbeit: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit unveröffentlicht)
Grossenbacher, Silvia (1996): Aspekte zur integrativen Schulung. In: Schär, Adelheid/ Parmentier, Ursular (Hrsg.): Integration - Keine Frage! Behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam schulen. Zürich: SZH/SPC, 13-19
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) vom 23. Mai 1949 (BGBI. S.1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 2006 (BGBI. I S. 2034)
Hamann, Bruno (1986): Geschichte des Schulwesens. Werden und Wandel der Schule im ideen- und sozialgeschichtlichen Zusammenhang. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt
Hausmanns, Sibylle (2010): Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen als Grundlage und Messlatte von Bildungs- und Behindertenpolitik. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/ Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 143-152
Helfferich, Cornelia (2005): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag
Hinz, Andreas (1992): (Wieder-)Entdeckung der Heterogenität in der Schule? In: Schley, Wilfried/Boban, Ines/Hinz, Andreas (Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Gesamtschulen. Hamburg: Curio Verlag Erziehung und Wissenschaft, 49-74
Hinz, Andreas (1993): Heterogenität in der Schule. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html (Zugriff: April 2011)
Hinz, Andreas (1998): Niemand darf in seiner Entwicklung behindert werden. Von der integrativen zur inklusiven Pädagogik? URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-inclusion.html#id3186960 (Zugriff: Juni 2011)
Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion- terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-inklusion.html (Zugriff: Juni 2011)
Hinz, Andreas (2010): Schlüsselelemente einer inklusiven Pädagogik und einer Schule für Alle. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 63-73
Huber, Christian (2006): Soziale Integration in der Schule?! Marburg: Tectum Verlag
Hüppe, Hubert (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen) (Hrsg.) (2010): alle inklusive! Die neue UN-Konvention. URL:http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UN Konvention_KK.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff: Juni 2011)
Hüwe, Birgit/Roebke, Christa (2006): Elternbewegung gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen: Motive, Weg und Ergebnisse. Eine Bilanz nach 30 Jahren Gemeinsamen Unterrichts in der BRD. URL: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/12/12 (Zugriff: Juni 2011)
ILMES (Internet-Lexikon der Methoden der empirischen Sozialforschung) URL: http://www.lrz.de/~wlm/ein_voll.htm (Zugriff: Juli 2011)
Jacobs, Sven (2004): Integrative Prozesse bei der Teamarbeit im Gemeinsamen Unterricht. Qualitative Studie aus der Innenperspektive eines Teams an einer integrierten Gesamtschule. Hamburg: Verlag Dr. Kovač
Klein, Gabriele/Kreie, Gisela/Kron, Maria (1987): Integrative Prozesse in Kindergartengruppen. Über die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/klein-prozesse.html (Zugriff: Mai 2011)
Kluge, Friedrich (1989): Etymologisches Wörterbuch. 22. Auflage. Berlin; New York: Walter de Guyter
Köbberling, Almut/Schley, Wilfried (2000): Sozialisation und Entwicklung in Integrationsklassen. Untersuchungen zur Evaluation eines Schulversuchs in der Sekundarschule. Weinheim, München: Juventa
kobinet-nachrichten.org (o.J.): Deutscher Aktionsplan zur Behindertenrechtskonvention. URL:http://www.kobinetnachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,26933/ti cket,g_a_s_t vom 15.06.2011 (Zugriff: Juni 2011)
Krimmer, Sophie (2006): Entwicklung und aktueller Stand der gemeinsamen Erziehung und Bildung von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen im Bundesland Thüringen. URL:http://www.bpaed-ewi.tu-berlin.de/fileadmin/fg243/Dokumente/Demmer- Dieckmann/pdf-Dateien/Th_ringen.pdf (Zugriff: Juli 2011)
Mühl, Heinz (1999): Integrative Pädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In: Myschker, Norbert/Ortmann, Monika (Hrsg.): Integrative Schulpädagogik. Grundlagen, Theorie und Praxis. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 150-181
Muth, Jakob (1996): 10 Thesen zur Integration von behinderten Kindern. In: Schär, Adelheid/ Parmentier, Ursular (Hrsg.): Integration - Keine Frage! Behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam schulen. Zürich: SZH/SPC, 55-60
Myschker, Norbert/Ortmann, Monika (1999): Gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung - Ein Überblick. In: Myschker, Norbert/Ortmann, Monika (Hrsg.): Integrative Schulpädagogik. Grundlagen, Theorie und Praxis. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 3-25
Nohl, Arnd-Michael (2006): Interview und dokumentarische Methode. Anleitungen für die Forschungspraxis. Wiesbaden: VS Verlag
UNESCO (1994): Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html (Zugriff: Mai 2011)
Reiser, Helmut/Klein, Gabriele/Kreie, Gisela/Kron, Maria (1986a): Integration als Prozeß. In: Sonderpädagogik, Heft 3/16 Jahrgang, 115-122
Reiser, Helmut/Klein, Gabriele/Kreie, Gisela/Kron, Maria (1986b): Integration als Prozeß (Fortsetzung aus Heft 3). In: Sonderpädagogik, Heft 4/16 Jahrgang, 154-160
Reiser, Helmut (1990): Entwicklung der Fragestellung und Untersuchungsplan. In: Deppe- Wolfinger, Helga/Prengel, Annedore/Reiser, Helmut (Hrsg.): Integrative Pädagogik in der Grundschule: Bilanz und Perspektiven der Integration behinderter Kinder in der Bundesrepublik Deutschland 1976-1988. München: Deutsches Jugendinstitut, 26-34
Reiser, Helmut (1992): Wege und Irrwege zur Integration. In: Sander, Alfred/Raidt, Peter (Hrsg.): Integration und Sonderpädagogik. Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik. Band 6. 2. Auflage. St. Ingbert: Röhrig, 13-33
Sander, Alfred (2008): Etappen auf dem Weg zu integrativer Erziehung und Bildung. In Eberwein/ Mand (Hrsg.): Integration konkret. Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 27-39
Schnell, Irmtraud (2003): Geschichte schulischer Integration. Gemeinsames Lernen von SchülerInnen mit und ohne Behinderung in der BRD seit 1970. Weinheim; München: Juventa
Schley, Wilfried/Köbberling, Almut (1994): Integration in der Sekundarstufe. Hamburg:
Curio Verlag Erziehung und Wissenschaft
Schöler, Jutta (2002): "Neben ihr sitzt immer ein Erwachsener" - die Tätigkeiten von pädagogischen Hilfskräften im gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl4-02-erwachsener.html (Zugriff: August 2011)
Schöler, Jutta (2010): Grenzenlos gemeinsam. Auch - Gerade! - warum nicht? am Gymnasium. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-grenzenlos.html (Zugriff: Juni 2011)
Schöler, Jutta (2011): "Geistig Behinderte" am Gymnasium. In: Leben mit Down-Syndrom Nr.66, 14-15
Schöler, Jutta /Merz-Atalik, Kerstin/Dorrance, Carmen (2010): Auf dem Weg zur Schule für alle? Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bildungsbereich: Vergleich ausgewählter europäischer Länder und Empfehlungen für inklusive Bildung in Bayern. URL: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/bayern/07824.pdf (Zugriff: Juni 2011)
schure.de (o.J.): Niedersächsisches Schulgesetz. URL: http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg.htm (Zugriff: Juni 2011)
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2009): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2009. URL:http://www.kmk.org/fileadmin/doc/Dokumentation/Bildungswesen_pdfs/dossier_dt_ebo ok.pdf (Zugriff: Juni 2011)
Shevin, Mayer (1992): Barney's Harmonica & die Sprache von UNS und IHNEN. URL: http://www.inklusionspaedagogik.de/content/blogcategory/49/90/lang,de (Zugriff: Juni 2011)
Sußebach, Henning (2011): Liebe Marie, Warum müssen Fünftklässler sonntags büffeln statt Freunde zu treffen? Weshalb dieser Unsinn? Henning Sußebach versucht, es seiner Tochter in einem Brief zu erklären. URL: http://pdf.zeit.de/2011/22/DOS-G8.pdf (Zugriff: Mai 2011)
taz.de (2009): Aussortiert und abgesondert. URL: http://www.taz.de/1/zukunft/wissen/artikel/1/aussortiert-und-abgesondert (Zugriff: Juni 2011)
Van Ackeren, Isabell/Klemm, Klaus (2011): Entstehung, Struktur und Steuerung des deutschen Schulsystems. Eine Einführung. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag
Von Saldern, Matthias (o.J.): Länger gemeinsam lernen! Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg: Empirische Befunde und Handlungsmöglichkeiten. URL:http://www.ruhrunibochum.de/imperia/md/content/zfl/pdfs/symposium/prof._von_saldern.pdf (Zugriff: Juni 2011)
Wachtel, Peter (o.J.): Regionale Integrationskonzepte. URL: http://nibis.ni.schule.de/~infosos/integrationsk-3.htm (Zugriff: Juni 2011)
Wocken, Hans (1987): Integrationsklassen in Hamburg. In: Wocken, Hans/Antor, Georg (Hrsg.): Erfahrungen - Untersuchungen - Anregungen. Fulda: Jarick Oberbiel, 65-89
Wocken, Hans (1988): Integrative Prozesse. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-prozesse.html (Zugriff: Mai 2011)
Wocken, Hans (1998): Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen Unterrichts. In: Hildeschmidt, Anne/Schnell, Irmtraud (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim; München: Juventa, 37-52
|
Abbildung 1: |
Schwerpunkte und Gefahren konzeptioneller Entwicklungen (Hinz 1993) |
13 |
|
Abbildung 2: |
Modell integrativer Prozesse (Hinz 1993) |
18 |
|
Abbildung 3: |
Ebenen integrativer Prozesse (Hinz 1993) |
21 |
|
Abbildung 4: |
Schulstruktur in der Bundesrepublik Deutschland ab 1969 (van Ackeren/Klemm 2011, 43) |
25 |
|
Abbildung 5: |
Selektionsstufen des deutschen Schulsystems (Von Saldern o.J., 4) |
29 |
|
Abbildung 6: |
Historische Entwicklung des Schulbesuchs von Kindern mit Behinderung (in Anlehnung an Sander 2008, 38) |
31 |
|
Abbildung 7: |
Praxis der Integration und der Inklusion (Hinz 2002) |
35 |
|
Abbildung 8: |
Prozentuale Verteilung der Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Förderschulen und allgemeinen Schulen (Dorrance 2010, 144) |
44 |
|
Abbildung 9: |
Darstellung der ausgewählten SchülerInnen |
60 |
I1 Leon, Schüler der Integrationsklass am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (25.05.2011)
I2 Jakob, Schüler der Integrationsklass am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (25.05.2011)
I3 Sabrina, Schülerin der Integrationsklass am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (26.05.2011)
I4 Samuel, Schüler der Integrationsklass am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (26.05.2011)
I5 Saskia, Schülerin der Integrationsklass am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (26.05.2011)
I6 Kira, Schülerin der Integrationsklass am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg (27.05.2011)
I7 Frank Hehlgans, erster Vorsitzender von ERIK Goslar, Vater von Anna (25.05.2011)
Hiermit bestätige ich, Diana Appelt, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit mit dem Titel: "Integrative Prozesse in einer Integrationsklasse am Gymnasium" selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.
__________________________________
Datum, Unterschrift
Quelle:
Diana Appelt: Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen: Thema: Integrative Prozesse in einer Integrationsklasse am Gymnasium.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 02.02.2012
