eingereicht als Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck eingereicht bei Univ. Prof. Dr. Ilsedore Wieser am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck im März 1994
Inhaltsverzeichnis
- Kommentar zur Internetveröffentlichung
- Dank
- Vorbemerkung und Hinweise auf einzelne Kapitel der Arbeit
- I. Kindheit und Jugend in der heutigen Gesellschaft
- 1. Kinder in einer sich verändernden Lebenswelt
- 2. Kinder im sozialen Veränderungsprozeß
- 3. Worauf die Schule vorbereiten muß
- II. Forderung nach einer humanen Schule
- 1. Schule der Gegenwart und Zukunft Versuch einer Struktur einer humanen und damit "guten" Schule
- 2. Die einzelne Schule (Klasse) als Prüfstand für Schulreform
- III. Zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern
- 1. Integration - allgemeine Grundgedanken
-
2. Planung und Einrichtung einer Integrationsklasse
- 2.1 Zur Vorgeschichte
- 2.2 Konkreter Anlaß
- 2.3 Schulrechtliche Bestimmungen
- 2.4 Ein Blick in die Geschichte der Integration von behinderten Kindern in Österreich
- 2.5 Schulorganisatorische Bedingungen des Integrationsversuches an der Volksschule Reutte
- 2.6 Die Integrationsklasse - konkrete Einrichtung - Projektantrag
- 3. Integration erfordert Abkehr vom uniformen Unterricht
-
3.1 Menschliche Entwicklung - Strukturen menschlichen Lernens
- 3.2 Schulische Integration und ihre entwicklungslogische Didaktik
- 3.3 Der Klassenraum als Lernfaktor
- 3.4 Freie Arbeit und ihre Modelle
- 3.5 Zur konkreten Organisation und Praxis der Freiarbeit im Verlauf der 4 Schuljahre
- 3.6 Beispiele aus dem Unterricht
- 3.7 Projektorientierte Unterrichtsformen
- 3.8 Zur konkreten Organisation und Praxis der Arbeit in Projekten im Verlauf der 4 Schuljahre
- 3.9 Beispiele aus dem Unterricht
- 3.10 Resümee zum Offenen Unterricht
- 4. Die Kinder·mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter der speziellen Berücksichtigung von SABINE, einem gehörlosen Mädchen
-
5. Soziale Beziehungen in der Schule und im Wohnumfeld
- 5.1 Soziale Zusammensetzung
- 5.2 Die methodischen Verfahren
- 5.3. Einschätzung der Sozialkontakte durch die beiden in der Klasse unterrichtenden Lehrer Roland Astl und Hans P.
- 5.4 Die sozialen Beziehungen in der Klasse
- 5.5 Freizeitbeziehungen außerhalb der Schule - Nachmittagskontakte
- 5.6 Zusammenfassung und Interpretation
- 6. Zur Kooperation der Lehrer - aus der Sicht ihrer Erfahrungen
- 7. Die Eltern - aus der Sicht ihrer Erfahrungen
- 8. Der Schulversuch im Rahmen des Schulganzen: "Integration der Integration" - Die Rolle des Kollegiums beim Schulversuch
- IV. Zusammenfassung und Schußfolgerungen
- 1. Perspektiven der Lehreraus- und -fortbildung
- Literaturverzeichnis
Die Namen von LehrerInnen, SchülerInnen und weiteren beteiligten Personen wurden, bis auf wenige Ausnahmen, anonymisiert.
Mein besonderer Dank gilt Frau Univ. Prof. Dr. Ilsedore Wieser für die umfassende Betreuung meiner Dissertation und bei Herrn Univ. Doz. Dr. Volker Schönwiese für die umfangreiche Begutachtung. Von beiden Lehrenden erhielt ich während meines Studiums richtungsweisende Anregungen und Impulse, und sie waren über weite Strecken dieser Arbeit in helfendem und kooperativem Sinn beteiligt.
Weiters bedanke ich mich bei den beiden Lehrern Roland Astl und Hans P. für die stets freundschaftliche und hilfsbereite Unterstützung während der vielen Jahre des gemeinsamen Arbeitens und bei allen Eltern für ihre Gesprächsbereitschaft und ihr Vertrauen.
''Die Lebensprobleme der heute heranwachsenden Kinder sind soviel größer als ihre Lernprobleme, sie schieben sich so gebieterisch vor diese oder fallen ihnen in den Rücken, daß die Schule, wenn sie überhaupt belehren will es mit den Lebensproblemen aufnehmen muß: sie muß zu ihrem Teil Leben ermöglichen." (In: HENTIG, 1981, S. 15).
Schulen rücken heute mehr denn je wieder in das Blickfeld öffentlichen Interesses, und die Ursachen dafür sind vielfältig.
Auf der einen Seite sind es Gründe problematischen Ursprungs: die Finanzknappheit bei den Schulträgern, Sparpolitik bei Bund, Land und Gemeinden, Existenzkrise der Hauptschulen vor allem im großstädtischen Bereich oder die Identitätskrise der Gymnasien. Aber auch die Überforderung vieler Lehrer[1], und damit verbunden die immer größeren Probleme mit sogenannten "verhaltensauffälligen" oder "unbequemen" Schülern lassen Lehrer und Eltern oftmals vor einem fast unüberwindbaren Problem schier verzweifeln.
Auf der anderen Seite wächst aber auch das "positive" Interesse: Schule wird gegenwärtig zu einer immer wichtigeren gesellschaftlichen Integrationsinstanz, wobei von Vertretern der Wirtschaft nicht nur gesteigerte, sondern wie auch von den Reformpädagogen gefordert, veränderte Qualifikationen, größere Selbständigkeit, erweitertes Analyse- und Planungswissen verlangt, sondern vor allem eine vertiefte und wohl in dieser Art neu zu entdeckende soziale Kompetenz angestrebt wird.
Dies erfordert aber auf den Grundlagen der heutigen Erkenntnisse menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens eine Reform unserer Schule, die "im wahrsten Sinne des Wortes eine radikale ist, eine, die bis an die Wurzeln unseres Erziehungs- und Bildungssystems reicht", um damit eine nichtaussondernde, humane Pädagogik und damit eine demokratische Schule zu schaffen (FEUSER, 1989, S. 5).
Die Reaktionen der Beteiligten und Betroffenen auf diese grundsätzlichen Veränderungen von Schule und damit Unterricht sind sehr unterschiedlich und z.T. ambivalent. "So herrscht einerseits Resignation, »also innere Kündigung« und - berechtigt Protest, andererseits ebenfalls Protest, aber mit dem Begreifen, daß diese Schulkrise auch eine Chance zur Veränderung darstellt" (ROLFF, 1993, S. 9), zum Aufbruch auf einen Weg, um "eine für die Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder angemessene und zuträgliche Schule zu schaffen" (FEUSER. 1989, S. 5).
Ich denke, daß die Chancen für Veränderungen der Schule vorhanden sind, einerseits durch den Druck der Öffentlichkeit, aber vor allem dadurch, daß Eltern heute den Mut haben, gegenüber der Schule "die Sprache als die einzige unüberwindliche Waffe der Freiheit" (FREIRE, 1973, S. 12) einzusetzen.
Stichworte dazu sind: Soziale Integration, Schulautonomie, Projektunterricht, offenes Lernen, verbale Leistungsbeurteilung ...
Daß dies ein sehr langwieriger Prozeß ist, darauf hat Richard GROSS von der Stanford Universität mit seinem Ausspruch "Schools change slower than churches" (HAENISCH, in: Zeitschrift Pädagogik, 1991 Heft 5, S. 27) hingewiesen.
Diese Reformen der Schule "können in einem so klassisch hierarchischen Land wie Österreich nicht von oben verordnet werden. Der Wunsch danach muß von den Schulen kommen." Die Voraussetzung dafür sei "die Zusammenarbeit gut aus- und fortgebildeter Lehrer" (Karl-Heinz GRUBER. zit. n. Zeitschrift Profil Nr. 20 vom 13. Mai 1991, S. 102).
Sozial integrative Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehindeter Kinder sind aber nur sehr vereinzelt aus dem Wunsch nach Reformen aus den Schulen selbst gekommen, sondern vorwiegend aus dem unbeugsamen Durchhaltevermögen betroffener Eltern.
HAENISCH stellt in seinem Aufsatz »Die einzelne Schule ist der Prüfstand für Schulreform« (in: Pädagogik, Nr. 5, 1991) für die Bundesrepublik Deutschland - in diesem Fall durchaus mit Österreich vergleichbar - fest, daß z.B. die soziale Öffnung der weiterführenden Bildung, die Modernisierung der Curricula und die Steigerung des Anteils höherer Abschlüsse wichtige Erfolge bisheriger Schulreformen darstellten, aber "je weiter man auf die Ebene der Schule und des Unterrichts komme, desto dürftiger die Veränderungen ausfielen".
Nach wie vor dominiert mit knapp 80% der Klassenunterricht, bei dem die Lehrenden das Unterrichtsgeschehen steuern, und gar 90% aller angestrebten Ziele sind kognitive Ziele. Auch wird die Lehrer - Schüler - Beziehung meist nur über Inhalte des Unterrichts hergestellt, und es gibt sehr wenig personenbezogene Kommunikation. Nach Haenisch sind in den letzten 15 Jahren die Probleme der Lehrer auch nicht geringer geworden. Im Gegenteil, zu den bestehenden Problemen, wie Individualisierung erreichen, mit verhaltensauffälligen Schülern umgehen, mit Kollegen kooperieren, sind neue Probleme hinzugekommen, wie z.B. die Verwirklichung von Handlungs- und Erfahrungsorientierung, Umgang mit schwer motivierbaren Schülern und Gespräche mit Eltern. Dabei muß angenommen werden, daß die Schulen in starkem Maße selbst an der Produktion von Schülerproblemen mitbeteiligt sind (vgl. ebd.).
Da, verkürzt dargestellt, die bisherigen Reformstrategien, zum einen sind dies solche, die sich auf das Schulsystem als Ganzes oder auf Teile davon (z.B. Schulform) beziehen (wie Gesetzgebung, Erlässe...), zum anderen, die sich auf die Lehrer direkt beziehen, also Maßnahmen, die die Veränderung von Schule durch die Veränderung von Personen zum Ziel haben (Lehreraus und -fortbildung), nicht grundlegend dazu beitrugen, die "Schlüsselprobleme" (s. Kap. II/2, S. 33 ff.) unserer heutigen Schulmisere zu lösen, hat sich in den letzten Jahren der Interessensschwerpunkt schulischer Reformen auf die Ebene der einzelnen Schulen verlagert.
"Das wesentliche Merkmal dieses neuen Ansatzes (der natürlich nicht neu ist, sondern neuerdings nur besondere Beachtung findet) ist die Konzentration auf die Ebene der einzelnen Schule als Analyseeinheit." (SPECHT, 1991).
Hierbei steht "die Schu1e als Handlungseinheit", als Mikrokosmos des Bildungswesens, in dem die vielfältigen sozialen, intellektuellen und emotionalen Rahmenbedingungen des Bildungswesens ihre konkrete Ausformung erfahren, im Zentrum schulischer Forschungstätigkeit (vgl. ebd.).
"Die Frage nach dem "Funktionieren" dieser Systemeinheit und nach den Bedingungen dieses Funktionierens ist es, von dem sich heute Bildungsforscher Aufschluß für die weitere Gestaltung und Verbesserung des Schulwesens erhoffen." (Ebd).
In welch großes Spannungsfeld aber Schulen geraten, wenn weder Schulleiter noch Lehrer bereit sind, und dazu auch die Schulbehörde nicht beratend oder unterstützend tätig ist, den konkreten, ortsspezifischen Problemstellungen und einem durch die Eltern immer stärker artikulierten "gesellschaftlichen" Auftrag gerecht werdend, nachzukommen, habe ich in meiner Arbeit ebenso versucht darzustellen, wie anband einzelner Unterrichtbeispiele, konkret ein am einzelnen Kind orientierter Unterricht aussieht.
Diese Integrationsklasse sah ich einerseits auch unter dem Aspekt, durch einen Schulversuch das Bewußtsein für die Notwendigkeit schulischer Veränderungen zu wecken und damit das Angebot sinnvoller reformpädagogischer Erkenntnisse und Erneuerungen verbreiten zu helfen, andererseits als konkret gelebte und praktizierte "Schule", die dem Leser und vor allem dem Praktiker Wege zeigen soll, wie sie entsteht und sich entwickelt hat.
"Hier können Schulversuche wichtige Aufschlüsse liefern, wenn sie als Quasi - Feldexperimente angelegt und begleitend evaluiert werden." (SPECHT, 1991).
Ich hoffe, daß ich mit dieser Arbeit dazu beitragen kann, "ein Defizit, das die Forschungsliteratur zum Thema insgesamt ein stückweit kennzeichnet" (ebd.), zu verringern.
''Die theoretische Begrifflichkeit und das methodische Instrumentarium lassen den Leser und den Praktiker, der etwas besser machen möchte, oft in dem frustrierten Wunsch zurück, ein wenig genauer, lebendiger und "hautnaher" zu erfahren. wie denn nun konkret eine gute Schu1e von innen aussieht, was ihr Schulleben auszeichnet und wie man sich Beispiele gelungenen "Schulehaltens" im Gegensatz zu problematischen Sozialverhältnissen vorzustellen hat" (SPECHT, 1991).
Die gegenseitige Ergänzung und Beleuchtung von quantitativer Survey - Forschung und qualitativer Schulforschung im Handlungsfeld der einzelnen Klasse und Schule gehören zu den wichtigsten Aufgaben gegenwärtiger und zukünftiger Forschung und Entwicklung im Problemfeld der Schulqualität, wenn sie denn letztlich positive Auswirkungen auf die Praxis zeitigen sollten (vgl. ebd.).
Ich knüpfe an diesen Ansatz die Hoffnung, daß die gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung einer humanen und demokratischen Unterrichtspraxis führen, zu Lernprozessen in diesem Fall nicht auf seiten der Schüler, sondern auf seiten der Lehrer, der Schulleitung, der Schulbehörde, letztlich der Schule als Einheit der Organisation des Lernens.
Die positiven Bedingungen und Erfahrungen aus dieser Untersuchung sollen also dazu beitragen, menschlichere Formen der Schulorganisation, damit meine ich u. a kein selektierendes und segregierendes Schulsystem, aber auch des menschlicheren Miteinanders, damit verbinde ich eine Aussage Martin BUBERS (1975, S. 26): "... und man darf eine Gesellschaft in dem Maße eine menschliche nennen, als ihre Mitglieder einander bestätigen", zu erlangen, die sich auf die Schüler, für die die Schule letztlich gemacht wird, auswirken.
Im ersten Teil meiner Arbeit versuche ich, die heute für unsere Kinder und Jugendlichen immer rascher sich verändernde Lebenswelt, "ein Leben aus zweiter Hand" (s. Kap. I, S. 9 ff.) zu skizzieren, und die damit verbundenen "Schlüsselprobleme unserer Gesellschaft" (BOHNSACK. 1987, S. 106, siehe auch Kap. II, S. 22) aufzuzeigen.
Das Aufwachsen der Kinder ist heute gekennzeichnet durch eine Herauslösung aus gefestigten Bindungen, wobei ihre Sozialisationsbedingungen zwar offener und chancenreicher geworden sind, aber sicherlich auch krisenanfälliger (s. Kap. I, S. 9).
''Die Jugend liebt heute den Luxus, sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und plaudert, wo sie arbeiten sollte. Sie verschlingt bei Tisch die Speise, legt die Beine übereinander und tyrannisiert die Eltern" Sokrates, 470 -399 v. Ch.
Den Glauben an eine Bewältigung der Zukunft gilt es heute mehr denn je bei den jungen Menschen rückzuerobern. HESSE (1988, S. 45) nennt dies "die Rückeroberung der Zukunft", um die Bedrohung der Vernichtung der Gattung Mensch auf dieser Erde abzubauen.
Die Schule wird dazu zwar nur einen geringeren Anteil leisten können. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, Kinder und Jugendliche mit dem für die Zukunft nötigen Wissen auszustatten, das sie nicht nur befähigt, die ökologischen und damit auch wirtschaftlichen Probleme zu meistern, sondern auch eine humanere Gesellschaft zu bilden (s. Kap. 1/3.4, S. 21).
"Unsere heutige Schule ist in vielen Bereichen ihres inneren Wirkens unseren Kindern und Jugendlichen nicht nur nicht mehr zumutbar, sie zerstört ihre Sozialfähigkeit und Persönlichkeit bis in die Kerne menschlicher Persönlichkeit hinein." (FEUSER. 1989, S. 5; siehe auch Kap. II, S. 22).
Der Schwerpunkt im zweiten Teil meiner Arbeit ist daher die Forderung nach einer humanen und damit der Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder angemessenen und zuträglichen Schule.
Auch hierbei kann es nur ein Ansatz sein, daß ich versuche, der herkömmlichen Schule der Gegenwart vielfältige und differenzierte Strukturen einer humanen und damit "guten" Schule gegenüberzustellen, Strukturgegensätze u. a. wie: Systemzwang oder Selbstbestimmung, Interesse oder Leistung, Selektion oder Integration ... (s. Kap. II/I, S. 23 ff.).
Angesichts der bisher eher fragwürdigen Wirksamkeit globaler und von "oben verordneten" Schulreformstrategien, ist es heute die Einzelschule bzw. in unserer Situation die Einzelklasse, die als "Prüfstand für eine Schulreform" (HAENISCH, 1991) gilt (s. Kap. n/2, S. 33 ff.).
Schlagworte wie: Schulentwicklung zwischen "LSD und Beta - Blocker" oder zwischen "Rattenfängern und Saboteuren" kennzeichnen das z.T. stark spannungsgeladene Feld der Entwicklung von Schule.
Wer oder was auf der einen Seite die Auslöser sind, wer auf der anderen Seite die Entwicklungen hemmt oder gar entgegensteuert, welche Qualifikationen für einen Schulentwicklungsprozeß vorhanden sind und v.a.m., auf diese offenen Fragen möchte ich im dritten Teil meiner Arbeit eingehen und im Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen, darauf die aus dem Schulversuch sich herauskristallisierten Antworten und Lösungsvorschläge zu beschreiben.
''Integration steht im Spannungsfeld gesellschaftshistorischer Entwicklungen und Traditionen. Innerhalb dieses Spannungsfeldes ist sie wiederum im Zusammenhang der historischen Entwicklungen und Traditionen in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft zu verorten. Integration, unter der wir im Bereich der Pädagogik die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher verstehen, ist im Rahmen unserer Arbeiten weder hinsichtlich ihrer Ziele noch bezüglich der Wege, mittels derer die Ziele erreicht werden sollen, beliebig. Integration ist für uns eine Antwort auf die historische Gewordenheit unserer gegenwärtigen Gesellschaft und Fachwissenschaft. Hätten wir die für alle Kinder dringend erforderliche Erziehungs- und Bildungsreform, der auch wir als ihre Lehrer und ihre Eltern für unser zukünftiges Überleben dringend bedürfen, so bräuchten wir von Integration nicht zu reden; sie wäre dann selbstverständlich. Solange wir von Integration reden müssen, ist unser Erziehungs- und Bildungssystem eben an den ''Wurzeln'' faul. Die erforderlichen Veränderungen sind aber weder durch Etikettenschwindel und opportunistischer Anpassung noch durch Gleichmacherei oder eine neue Fassade zu erreichen. Integration durch Segregation gibt es nicht; Integration ist unteilbar." (FEUSER, 1989, S. 6 f.).
Ich habe ein Stück österreichische Integrationsgeschichte begleitet und denke, daß die Planung dieser Integrationsklasse, ihr konkreter Anlaß - die Situation eines gehörlosen Kindes - und ihre gelebte und von den Kindern, den Eltern und Lehrern erfahrene Unterrichtspraxis nicht nur im allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit, sondern vor allem im Interesse der Schulbehörde und Schulforschung standen. Im Zusammenhang mit einer möglichen Übernahme des Schulversuchs "Soziale Integration" in das Regelschulwesen waren die Ergebnisse und Erfahrungen auch aus dieser Klasse bedeutsam.
Zentrale Bedeutung in diesem Abschnitt sehe ich u.a im Aufzeigen einer entwicklungslogischen Didaktik, die in jeder Phase der Realisierung begründbar, wissenschaftlich bestimmbar bleibt und damit zu einer humanen Pädagogik führt.
Auf den Grundlagen heutiger Erkenntnisse über die menschliche Entwicklung und damit dem menschlichen Lernen, ist einerseits eine Abkehr vom uniformen Unterricht notwendig, andererseits ist damit aber auch eine andere Sichtweise bezüglich der Behinderung eines Menschen verbunden.
''Behinderung entsteht aus ungenügender Integration in das individuelle Ökosystem,[2] oder anders ausgedrückt Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch aufgrund einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges Mensch - Umfeld - System integriert ist." (Sander, 1988, S. 81, siehe auch Kap. III/3, S. 126 ff. u Kap. IV, S. 365).
Auch wenn der Begriff "Behinderung" dadurch eine doch andere Bedeutung erlangt, habe ich ihn in meiner Arbeit aus Gründen der besseren allgemeinen Verständlichkeit belassen und nicht von Kindern mit "besonderen Bedürfnissen" oder "Gutachtenkindern" gesprochen.
Die Vorschriften des Datenschutzes und der damit verbundenen Problematik der Anonymität habe ich in dem Maße versucht zu wahren, als ich z.B. in den Kapiteln "Soziale Beziehungen in der Schule und im Wohnumfeld" Codebezeichnungen verwendet habe.
Im Kapitel "Gutachten zur Aufnahme der Kinder mit Behinderungen" habe ich aus Gründen der Dienstverschwiegenheit gänzlich auf die vom Gesetz vorgesehenen Beschreibungs-und Gutachtenbögen H 1b, H Ic[3] und auf die schulpsychologischen Stellungnahmen verzichtet.
Da aber sehr viele Erfahrungsberichte u.ä. über diesen Schulversuch im Verlauf der vier Schuljahre schon veröffentlicht wurden, habe ich mit dem Einverständnis aller Eltern die Vornamen der Kinder z.B. bei Bildbeschreibungen, Unterrichtbeobachtungen u. dgl. belassen.
Vor allem hat mir SABINES Mutter die Erlaubnis erteilt, ihren und den Namen ihres Kindes in der gesamten Arbeit zu nennen und auch alle persönlichen Unterlagen des Mädchens (z.B. medizinische Gutachten u.ä.) zu veröffentlichen.
Selbstverständlich habe ich auch das Einverständnis von Frau Prof. Jutta SCHÖLER und Prof. Dr. Klaus-B. GÜNTHER, ihre Arbeits-, Erfahrungs- und Beratungsberichte in meine Arbeit zu übernehmen.
So beschreibt Frau Prof. J. SCHÖLER in ihrem Bericht "Klassenkonferenz" einerseits die heute so wichtige Zusammenarbeit von Lehrern, Eltern, Fachleuten (z.B. Medizinern) im Sinne des Kompetenztransfers und andererseits die immer bedeutsamere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern (s. Kap. III/4.2, S. 224 ff.).
Die Planungs- und Sprachentwicklungskonzepte Prof. Dr. Klaus-B. GÜNTHERS waren für eine integrative Erziehung im Fall des gehörlosen Mädchens SABINE die wichtigsten fachspezifischen "Hilfen" für die beiden Lehrer (s. Kap. III/4.2, S. 231 ff.).
Die Kooperation der Lehrer stellt den Brennpunkt in der schulischen Integration dar. Welche Erfahrungen die beiden Lehrer in diesen vier gemeinsamen Schuljahren gemacht haben, welche Fragen sich aufgetan und wie sie Probleme gelöst haben, versuche ich in Kapitel III/6 zu beschreiben (s. Kap. III/6, S. 265 ff.).
Zentrale und mehrfache Bedeutung aber für die Evaluation integrativer Schulversuche haben die in Kapitel III/7, S. 93 ff. beschriebenen Stellungnahmen und Aussagen der Eltern.
Die Eltern waren es, die den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder forderten und auch seine Realisierung erreichten.
"Immer mehr Eltern von Kindern mit und ohne Behinderungen wollen ihre Kinder gemeinsam unterrichtet und erzogen wissen, und dieses entschiedene Eintreten der Eltern für schulische Integration hat vielfältige Gründe. Als wichtigste Beweggründe können pädagogische, politische und emanzipatorische Motive genannt werden." (WOCKEN, 1987, S. 129).
Welche Beweggründe und welche Meinungen die Eltern in unserem Schulversuch hatten, versuchte ich durch drei persönliche Befragungen in Erfahrung zu bringen.
Ist der Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder ein fester und anerkannter Bestandteil der gesamten Schule oder führt er eher ein "Inseldasein", das vom übrigen Kollegium der Schule unbeachtet oder gar feindselig betrachtet wird? Diese Frage stellt SPECHT (1993, S. 63) in seiner Studie zur Evaluation der integrativen Schulversuche.
Dieser sehr wichtigen Frage, da "die Kollegenschaft an der Schule für die meisten Lehrer die wichtigste soziale Bezugsgruppe darstellt" (ebd.), bin ich im Kapitel III/8, S. 349 ff. nachgegangen.
"Jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, was aus ihm gemacht wurde. Alles, was wir dazu brauchen, ist Energie zur Veränderung. - Wer diese Erkenntnis im Alltag wirken läßt, wird sich selbst ebenso selbstverständlich wandeln, wie die Natur sich stetig erneuert." Jean-Paul Sartre
[1] Die männliche Bezeichnung (Schüler, Lehrer, Kollege, usw.) ist hier und im Folgenden nicht geschlechtsbezeichnend gebraucht, sondern steht aus Gründen der sprachlichen Kürze stellvertretend für beide Geschlechtsformen.
[2] Die von Alfred Sander entwickelte Kind-Umfeld-Diagnose eröffnet eine neue Sichtweise des Aufgabenfeldes schulischer Integration, indem nicht die Defizite behinderter Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern die gesellschaftlichen Umfeldgegebenheiten. Dem komplexen, ko-evolutiven Kind-Umfeld-System soll ein Diagnose-System begegnen, das in hohem Maße anschlußfähig ist
[3] ) H Ib: Beilage zum Antrag auf Aufnahme des Kindes ... in eine Sonderschule. Bericht des Leiters der Volksschule und des Klassenlehrers.H lc: Bericht des Leiters der Sonderschule (Sonderschullehrers) über die Sonderschulbedürftigkeit des Kindes ...
Vergleiche ich die Kindheit meiner beiden Töchter, K. 26 Jahre und S. 17 Jahre alt, mit der Kindheit meiner Generation, dann wird mir sehr deutlich bewußt, wie immer rascher sich für Kinder ihre Lebenswelt und deren Bedingungen verändert.
So machen Kinder und Jugendliche heute Erfahrungen, die ich u.a. noch gar nicht kannte. Sie sehen fern, das Telefon ist ein selbstverständliches und oftmals sehr ausgiebiges Kommunikationsmittel, sei es um Verabredungen zu treffen oder einfach nur um zu plaudern. Von ferngesteuerten Dinosauriern bis zu hochtechnischen Elektronikspielen stellt heute eine ungeheuer große Industrie alle nur erdenklichen Arten von Spielwaren her.
Durch eine Industrie, die eigene Kindersendungen im Radio und im Fernsehen erzeugt, die von Kinderschokolde über Kinder-und Jugendmagazine u.v.a.m. Kindern und Jugendlichen praktisch alles anbietet, wird das Aufwachsen von Kindern heute einerseits vom Konsum und andererseits durch eine Welt technischer Bilder und Informationsmöglichkeiten bestimmt.
ROLFF (1993, S. 15) stellt die Frage, ob diese veränderte Kindheit heute "ein Leben aus zweiter Hand" darstellt und ob dieses Aufwachsen der Kinder gar ein Schaden für sie sein könnte.
Ich denke, daß wir als Erwachsene nicht beurteilen können, wie Kinder selber das Leben in einer sich ständig verändernden Wirklichkeit wahrnehmen. Sicher ist nur, daß die Kinder heute mehr konsumieren und immer stärker in eine völlig neuartige elektronische Medienwelt eingebunden werden.
Wir erleben aber auch, daß die Kinder heute in einem epochalen Wandel sozialer Beziehungen aufwachsen und die Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen zwar einerseits offener und chancenreicher, aber andererseits auch krisenanfälliger geworden sind.
Als Beispiele möchte ich nur anführen: nichteheliche Lebensgemeinschaften, Ein-Eltern-Familien, Ein-Kind-Familien usw.
Außerdem wird aber auch zunehmend das innere Beziehungsgeflecht der Familie bestimmt durch veränderte Beziehungen der Ehepartner zueinander, insbesondere durch die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen und durch veränderte Erziehungsstile.
Inhaltsverzeichnis
Zunächst haben wir uns zu fragen: In welcher Lebenswelt, in welcher Gesellschaft wachsen Kinder heute auf? Aber schon bei dieser ersten Frage müssen wir erkennen, daß es darauf keine eindeutige Antwort gibt.
Wurde die Gesellschaft der Gegenwart bisher lange Zeit als eine "Industriegesellschaft" bezeichnet, so gibt es heute nicht mehr nur für die Gegenwart, sondern auch für die künftigen Generationen, schon unzählige neue Bezeichnungen.
Ich denke, daß allein darin schon ein Beweis liegt für eine immer rascher sich verändernde Gesellschaft und damit Lebenswelt für unsere Kinder. So sprechen wir u.a. von einer postindustriellen Gesellschaft ebenso, wie von einer Konsum-, Risiko- oder Erlebnisgesellschaft. Andere Bezeichnungen, wie Informationsgesellschaft, Fernsehgesellschaft, Wissenschaftsgesellschaft oder Kongreßgesellschaft sind meiner Ansicht nach alles nur Schlagwörter, nicht aber analytische sozialwissenschaftliche Begriffe, die uns helfen könnten, die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung besser zu erklären und damit angemessener zu verstehen.
Da letztlich alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens und deren Veränderungen auf die Entwicklung und LebensweIt unserer Kinder Einfluß nehmen, und damit wiederum wir Aufgaben und Ziele von Schule neu zu definieren haben, möchte ich im Folgenden eine Annäherung in der Art aufzeigen, indem ich in Ansätzen diese veränderte Lebenswelt, in der Kinder heute aufwachsen, zu beschreiben versuche.
Auch Kinder sind heute zu Konsumenten geworden. Sie sind es in einem viel größeren Ausmaß als in irgendeiner Generation zuvor. Sie sind heute aber auch zu Zuschauern geworden, wofür in erster Linie das Fernsehen verantwortlich ist. Nicht nur, daß die Kinder fast aller sozialer Schichten in einem Überangebot an Spielsachen leben, sie leben auch in einer Kinderwelt, die sich völlig neuartig entwickelt und verändert hat.
Kinder sind heute wichtige und potentielle Käufer. Wurde das Taschengeld früher sorgsam in eine Sparbüchse geworfen, bekommen es die Kinder heute zum Ausgeben.
Vieles, was Kinder heute zu erhalten wünschen, muß bezahlt werden. Es sind nicht nur die Waren, sondern auch Dienstleistungen, wie z.B. die Betreuung auf einem Sportplatz oder in einer Turnhalle. Diese Dienstleistungen haben sich inzwischen weit in den Bereich öffentlicher Dienste erstreckt. Das Kind konsumiert wie der Erwachsene, sei es z. B. in der Nachmittagsspielgruppe oder auf dem Erlebnisspielplatz.
Die Hauptkonsumartikel, einschließlich der Spielzeuge, sind die Waren, die in fast allen Geschäften in Kinderaugenhöhe nahe der Kasse, und damit demonstrativ zum Greifen und zur Kaufsucht verführend, ausgebreitet werden.
"Spielzeug", das heutzutage Kinder oftmals nur mehr anleitet, einen Hebel oder einen Knopf an einem Schalter zu betätigen. "Spielzeug", das hochtechnisiert, einmal in Gang gesetzt, automatisch sein vorprogrammiertes Spiel - Repertoire selbständig abspult. "Spielzeug" das erst, wenn es kaputt geworden ist, für Kinder interessant wird, und endlich das Zerlegen oder Reparieren zum eigentlichen "Spiel" wird.
Spielzeug wird heute gekauft und kaum mehr selbst hergestellt. Immer mehr verliert sich dadurch die traditionsstiftende Weitergabe von Spielerfahrungen. Das Kind ist also in unserer heutigen Gesellschaft zu einem wichtigen Kunden geworden.
''Es ist auf dem Weg zu lernen, daß ein gutes Leben darin besteht, die richtigen Waren und Dienstleistungen zu konsumieren oder - wie FROMM es ausdrücken würde - das Sein über das Haben zu definieren." (ROLFF, 1993, S. 20).
Worin liegt nun das Problem des Massenkonsums von Kindern?
Zunächst wohl darin, daß die Kinder in ihrer Eigenständigkeit, und damit in der Planung und Herstellung eines "Produktes" bzw. Gegenstandes, aber auch in der ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der sie umgebenden Objekt-und Ideenwelt, einen immer stärkeren Verlust erleben. Immer weniger Kinder können sich in ihren eigenen Handlungen wiedererkennen, da sie selbst kaum mehr Produzierende sind oder Produktionsabläufe "hautnah" erleben (s. Kap. II/3.1, S. 127 ff.). Sie erkennen sich zwar in den Waren, die sie kaufen und konsumieren können. Diese Dinge bleiben dem Kind aber letztlich fremd, da sie aus einer "äußeren Welt" kommen. Sie sind austauschbar und haben sich ohne eigentätige Aneignung im Kind in keinster Weise verinnerlicht und bleiben somit auch nicht erhalten.
In der eigentätigen Handlung, im eigenen Herstellen eines Gegenstandes objektivieren sich nicht nur Selbstbild und Selbstsicherheit, Kompetenz und Urteilsvermögen eines Kindes, sondern sie bleiben im hergestellten Produkt erhalten und werden verinnerlicht.
"Als lebendiges System gewinnt der Mensch im Rahmen seiner Austauschprozesse - wir können sie als Lernen bezeichnen -, ein inneres Abbild der äußeren Welt mittels seiner diesem vorausgehenden Tätigkeit im Sinne seiner eigenaktiven Aneignung derselben." (FEUSER, 1990).
Das Selbstbild eines Kindes ist gefestigter, weniger von Urteilen und Erwartungen anderer abhängig, wenn es auf eigenem Tun und auf eigener Erfahrung beruht.
Letztlich aber kommt dem eigenen Tun des Kindes und seinem Herstellen eines Produktes eine besondere Bedeutung zu, eine Erfahrung, die ihm als Konsument völlig verlorengeht.
»Die Eigentätigkeit als materielle Grundlage der Erkenntnistätigkeit«
''Das Kind lernt durch die eigene Herstellung eines Gegenstandes noch am ehesten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten, ja sogar dessen Wesen kennen: Man kann etwas besser verstehen, wenn man es entstehen sieht. Dies gilt nicht nur für die schöpferischen Leistungen, sondern ebenso für den Nachvollzug oder die Wiederholung derselben." (ROLFF, 1993, S. 20 ff.).
Unsere Kinder leben heute in einer Welt voll technischer Bilder. Diese Bilder, die durch komplizierte elektronische Geräte erzeugt werden, lassen Kinder nur mehr zu Zuschauern werden.
Heute gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen und Forschungsberichten zum Thema "Kind und Fernsehen" (Himmelweit, 1958; Gardner, 1980; Schnoor, 1992; Rolff, 1993 u.v.am.).
Das Fernsehen ist zum dominanten Medium im Alltag unserer Kinder geworden, und immer mehr Zeit verbringen die Kinder heute vor dem Bildschirm. Der Fernsehkonsum ist in den letzten Jahren gerade auch bei jenen Kindern angestiegen, in deren Haushalte zusätzlich Kabel- und Satellitenprogramme empfangen werden können.
Laut Untersuchungen und nach Messungen der "Gesellschaft für Konsum-, Markt-und Absatzforschung" in der Bundesrepublik: Deutschland, aber auch nach Untersuchungen des "Instituts für Schulentwicklungsforschung" der Universität Dortmund (ROLFF, 1993, S. 31) sitzen Grundschulkinder täglich rund zweieinhalb Stunden vor dem Fernsehgerät. Ist in einem Haushalt zusätzlich ein Videorecorder vorhanden, kommt noch eine halbe bis eine Stunde dazu.
Ich denke, daß diese Ergebnisse auch auf die Kinder in Österreich übertragbar sind, und ungeachtet dessen, wie oft und wie lange Kinder fernsehen, in unserer Welt aber werden sie sehr stark vom Fernsehen beeinflußt. Zusammenfassende Kernpunkte einer Untersuchung des "Instituts für Schulentwicklungsforschung" der Universität Dortmund zum Thema »Kinder - Leben mit dem Fernsehen« (ROLFF, 1993, S. 34) u.a. sind:
-
"Gewöhnen sich Kinder schon im frühen Lebensalter an die Aneignung der Weh durch Bilderkultur, könnte das - vor allem bei "Dauersehern" - die Entwicklung der Phantasie hemmen.
-
Die problematische Seite des Fernsehens liegt offenbar im Kern darin. daß es die verbal-analytische Aneignung von symbolischer Kultur zurückdrängt und die ikonische dominieren läßt. Anders ausgedrückt: Die Bilderkultur verdrängt die Wortkultur und erzeugt Ikonomanie.
-
Von dieser Verdrängung sind aber nicht nur die traditionellen Kulturtechniken Lesen und Schreiben betroffen. Fernsehen als Alternative zur linearen und dialektischen Logik des gedruckten Wortes beeinträchtigt mehr und mehr auch die Wahrnehmung nicht-medialer Wirklichkeit.
-
Fernsehen ist für heutige Kinder ein ständig vorhandener Bezugspunkt, der ihnen zur Weltdeutung dient. Es bleibt ihnen aber verborgen, daß es eine künstliche Weltproduktion ist, Leben aus zweiter Hand."
Wir könnten dem entgegenhalten, daß die Kinder durch das Fernsehen ihren Erfahrungsraum doch auch erweitern können, indem sie sogar sich selbst bedienend und selbst entscheidend Informationen, Bilder und Nachrichten in vielfältiger und sogar farbiger Form per Bildschirm abrufen können.
Es bleibt aber auch hierbei eine problematische Seite des Fernsehens bestehen. Nicht nur, daß z.T. sehr viel Zeit der Kinder gebunden wird, auch die veränderte Aneignungsweise von symbolischer Kultur in Form von technischen Bildern geben Grund zur Besorgnis.
''Das stellt selbst das ehrwürdige pädagogische Prinzip der Anschaulichkeit in Frage, macht es zumindest revisionsbedürftig. Denn die technischen Bilder des Fernsehens sind perfekte Bilder, professionell gemacht, unterhaltsam und gewiß auch anschaulich. Aber die Anschaulichkeit des Fernsehens will nicht unterrichten, sondern unterhalten und zwar derart, daß jeder ohne Mühe folgen kann. Das führt zu einer konsumistischen Anschauung, d.h. zu einer Art Verwöhnung durch Anschaulichkeit:
Nur keine Vorausetzungen machen und keine Anstrengungen des Begriffs verlangen. scheint das Motto der Fernsehproduktionen zu sein, denn wer dem nicht folgt, verliert die Zuschauer, auch die kleinen. Das führt in eine Falle, nämlich zu einer Pseudo-Anschaulichkeit, zu einer übertriebenen Anschaulichkeit, die mehr verdeckt als aufdeckt" (Ebd., S. 36).
Dabei ist das Unterrichtsprinzip der Anschaulichkeit aktueller denn je. Die Schule kann und soll deshalb sicher nicht auf Bilder und die Anschaulichkeit des Fernsehens verzichten, ganz im Gegenteil. Der Schule kommt aber heute u.a. die Aufgabe zu. diese neuen Bilder lesen zu lehren und damit Anschaulichkeit neu zu bedenken.
Der Computer ist heute nicht nur das neueste, sondern auch die multimedialste Möglichkeit, technische Bilder von höchster Qualität zu erzeugen. Immer mehr dringt heute schon der Computer in die Lebenswelt der Kinder ein.
Da ich persönlich nur Erfahrungen mit Computern im sonderpädagogischen Bereich aus der Arbeit in meiner Klasse mitbringe, möchte ich mich auf die Ergebnisse einer Untersuchung des "Instituts für Schulentwicklung" an der Universität Dortmund stützen, die an über 900 Grundschülern der 3. und 4. Klassen Volksschule im Jahr 1987 durchgeführt wurde.
Demnach hatte schon jeder 7. Haushalt einen Computer, und 26 % aller befragten Kinder gaben an, ein- bis zweimal in der Woche mit dem Computer zu spielen. Ich denke, daß wir diese Prozentzahlen heute schon wesentlich höher annehmen können, daß also bedeutend mehr Eltern und damit auch Kinder zu Hause einen Computer besitzen.
Bei einer Schulerprobung des Computers über einen Zeitraum von zwei Schuljahren an Dortmunder Grundschulen (vgl. LANGENBUCH u.a., 1989), bei der vor allem Programme zur Textverarbeitung, zum Rechtschreibtraining und zum Übungsrechnen eingesetzt wurden, konnte festgestellt werden, daß alle Kinder ohne Ausnahme gerne mit dem Computer arbeiteten. Sie waren motiviert, interessiert, z.T. sogar begeistert.
Diese Aussagen bestätigten sich auch in unserem Schulversuch, als die beiden Lehrer zu Ende des dritten bzw. im vierten Schuljahr in der Integrationsklasse die Kinder in die Arbeitsweise mit einem Computer einführten, und die Schüler vor allem in der Freien Arbeitsphase damit Texte eigenständig schreiben oder auch einfache Rechenspiele lösen konnten.
Inhaltsverzeichnis
Die Situation der Menschen in unserer bürgerlichen Gesellschaft zum Ende dieses Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch die Herauslösung aus gewachsenen Bindungen, Glaubenssystemen und Verhaltensweisen. Immer mehr verlieren familiäre Bindungen, Heimatzugehörigkeit, schicht- oder klassenspezifisches Milieu oder auch Stand, Religion und Geschlechtszugehörigkeit an Bedeutung.
Statt dessen finden eine Pluralisierung der Lebensformen und eine Individualisierung der Lebenslagen statt. Auch gehen immer mehr bisher gefestigte Sicherheiten im Hinblick auf Handlungsweisen und leitende Normen verloren.
2.1 Normenwandel und Individualisierung
In vieler Hinsicht läßt sich die Jugend als "Seismograph" für gesellschaftliche Veränderungen fassen. Die Auflösung traditioneller Normen, etwa die anscheinend unaufhaltsamen Auflösungstendenzen der Kernfamilie - Soziologen bezeichnen damit eine Lebensgemeinschaft, die aus einem verheirateten Elternpaar mit Kindern besteht (s. NAVE-HERZ/MARKEFKA, 1989) -, führen in der Jugendphase zu einer "Endstrukturierung" und "Individualisierung" (vgl. BOHNSACK, 1991). Ulrich BECK (1986) hat das treffend ausgedrückt:
''In der individualisierten Gesellschaft muß der einzelne entsprechend bei Strafe seiner permanenten Benachteiligung lernen, sich selbst als Handlungszentrum. als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten. Orientierungen. Partnerschaften usw. zu begreifen." (S. 217).
Das bedeutet, daß in dem Maße, wie Normalitätsstandards ihre allgemeinbildende Kraft verlieren, sich die Menschen, und besonders Jugendliche und Kinder, in der Gestaltung ihres Lebens auf sich selbst gestellt sehen.
Heute entwickeln die Jugendlichen eine Fülle unterschiedlicher Lebensstile und suchen in vielfältiger Art und Weise, ihre ganz persönliche Identität zu finden. Die Chancen für eine Individualisierung der Persönlichkeit, denke ich, haben sich zwar verbessert, aber Befreiung und Gefährdung liegen sehr dicht beieinander.
Vor allem in den letzten 20 Jahren hat sich eine Liberalisierung der Erziehungswerte besonders innerhalb der Familien vollzogen: von größter Strenge zu heute oftmals sehr weitreichender Freiheit.
Sehen wir diesen Wandel positiv, so kann man ihn als eine Abnahme von "traditionellen, autoritären" Beziehungen und als eine Zunahme von "partnerschaftlichem Umgang" bezeichnen (vgl. BOHNSACK, 1991).
Die Kehrseite dieser neuen Erziehungsstile ist aber oftmals sehr vielfältig. Mitunter ist nicht die falsche Erziehung das Problem, sondern daß überhaupt keine Erziehung stattfindet. Immer öfter erleben wir das Problem, daß durch die physische und emotionale Abwesenheit der Eltern zwar die individuellen Entscheidungsspielräume für die Kinder erhöht werden, aber sie dann letztlich mit all den Konsequenzen ihres Handelns im Alltag allein bleiben. Die Folge davon sind vielfach Kinder in unseren Schulklassen, über deren Verhalten sich die Lehrer so beklagen.
Wie widersprüchlich heute Kinder mitunter erzogen werden, und in welch großem Spannungsfeld Eltern und damit die Kinder stehen, belegen auch unsere Ergebnisse des Schulversuchs (s. Kap. III/7, S. 293 ff.). ROLFF (1993, S. 65) schreibt:
"Zudem geraten die Schülerinnen und Schüler unter zunehmenden Leistungsdruck. Denn fortgeschrittene Industriegesellschaften. in denen theoretisches Wissen mehr zählt als alles andere Wissen, sind Leistungsgesellschaften, in denen Leistung durch Examina und Zertifikate ausgedrückt wird. Ohne diese Zertifikate ist die Sicherung des Sozialstatus kaum möglich, geschweige denn sozialer Aufstieg. Das Ziel von Kindererziehung ist unter diesen Bedingungen weniger das wohlgeratene oder zufriedene Kind, sondern das leistungsfähige Kind. Deshalb steht die Familie unter einem Erziehungsdruck, der historisch ohne Vorbild ist Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Familie immer mehr zerfällt und eine Alternative zur Familienerziehung sich noch nicht etabliert hat Übererziehung und völlige Vernachlässigung von Erziehung sind die widersprüchlichen Folgen. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind die Kinder und Jugendlichen, also die Schüler."
In dem Maße, wie sich Jugendliche heute von ihren Eltern oder älteren Mitmenschen distanzieren, verstärkt sich ihre Zuwendung zu etwa gleichaltrigen Freundschaftsgruppen. Aus einer Untersuchung von ALLERBECK/HOAG (1985, S. 38) geht hervor, daß z.B. in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1962 16% der Jugendlichen Mitglieder einer informellen Jugendgruppe bzw. Clique waren, aber im Jahre 1983 immerhin schon fast 57%.
Bedeutsam dabei ist, daß viele Jugendliche diese Freundschaftsgruppen wichtiger nehmen, vielfach als Vorbilder wählen und außerdem meinen, im Kreis der Gleichaltrigen eher Verständnis für ihre Probleme zu finden (vgL ZINNECKER/MOLNAR, 1988, S. 189).
Die Folge wiederum ist, daß die Autorität der Erwachsenen eher zurückgeht und damit sich gleichzeitig die Bedeutsamkeit der Familie oder der Schule verringert. Zudem wollen die Jugendlichen sich ihre Gemeinschaft selbst suchen und weder von den Erwachsenen geleitet noch kontrolliert werden. Jugendliche distanzieren sich heute immer mehr von den Erwachsenen.
ROSENMAYR (1988, S. 27 ff.) nennt u.a. Aspekte dieser Distanzierung: Vor dem Hintergrund einer "Entwertung, auf jeden Fall einer Infragestellung des Status des Erwachsenen" müssen wir heute Jugendliche verstehen, die sich aufgrund der ''Vielfalt des Kultur-Versagens, der mangelnden Fähigkeit zum Widerstand gegen die Selbstbedrohung der Menschheit und der Gefährdung der natürlichen Umwelten und Ressourchen durch Raubbau und Verwüstung" immer mehr distanzieren. "Die Jungen sehen die Eltern und Ältere als Exponenten der durch Unglaubwürdigkeit gezeichneten Systeme" (ebd.), dann sind wir als Lehrer damit wohl ebenso betroffen.
Diese Jugendgruppen sind eine Konkurrenz zu den Schulen und zu den Familien, "können aber durchaus auch positive Funktionen haben" (FERCHHOFF/OLK, 1988, S. 24 f.), - auch in der Schule - "indem sie sich nicht um den Wissensaspekt organisieren, sondern um den Lebensweltaspekt sowie um soziale und emotionale Bedürfnisse" (BAACKE, 1987).
"Zumindest in den Städten werden Kinder zunehmend von Experten betreut: Am Montag nachmittag vom »Medienpädagogen«, am Dienstag vom »Fußballtrainer«, am Mittwoch vom »Biologen« beim umweltbezogenen Mikroskopierkurs, am Donnerstag vom »Gymnastiklehrer« und am Freitag vom »Therapeuten«. Die Mütter entwickeln sich in dieser Zeit m Taxifahrerinnen, die Kinder werden abhängig von Experten." (ROLFF, 1993, S. 64).
Am Beispiel des Kinderspiels läßt sich sehr deutlich belegen, in welch veränderter Lebenswelt Kinder heute, im Vergleich zu Kindern vor erst 20 oder 30 Jahren, aufwachsen und erzogen werden.
Konnte ich persönlich z.B. noch recht "frei" von elterlicher Kontrolle, fast täglich am Nachmittag mit anderen Kindern des Dorfes auf dem Hof, im Stall, in der Scheune oder auf dem Feld spielen und Erfahrungen sammeln, so werden die Kinder heute zusehends, sicherlich auf behutsame und sanfte Art, durch professionelle Einrichtungen nicht nur gelenkt und erzogen, sondern auch kontrolliert: durch Kinderkrippen, Kindergärten, pädagogisch geleitete Spielgruppen u.v.a.m.. Also Einrichtungen, die letztlich in irgendeiner Weise nicht nur auf "Expertenwissen" beruhen, sondern auch von "Experten" geleitet werden.
So kann die Erziehung der Kinder heute durchaus als "instrumentelle Kontrolle durch Experten" beschrieben und als "Pädagogisierung" benannt werden (vgl. PHILIPP, 1992, S. 20).
"Mit dieser »Expertisierung« gelangte ein Typus von Fachwissen in die Pädagogik, der Teil der technologischen Kultur des Rationalismus ist und der die »volkstümliche Bildung« verdrängte, ohne an deren Stelle etwas Neues zu setzen. Dieser Wissenstypus bewirkt eine Auftei1ung der Welt in Experten und Laien, eine Trennung, die auch Erzieher und Lehrer betrifft und sie nicht nur m Experten werden läßt, sondern paradoxerweise gleichzeitig auch dequalifiziert. Denn genauso wie in der Warenproduktion wurde Planungswissen von der Praxis abgezogen, in Bürokratien und Instituten zentralisiert und in m Expertenwissen verwandelter Form gestückelt an die Pädagogen zurückgegeben. Nicht nur Lehrer, sondern erst recht Eltern wurden dadurch in ihrer Erziehungsfähigkeit geschwächt. Verunsichert suchen sie Rat bei anderen. Wie nie zuvor lesen sie populärwissenschaftliche pädagogische Untersuchungen, lesen dort, daß viele Fehlentwicklungen in der frühen Kindheit angelegt sind und fürchten nun ständig, etwas falsch m machen. Allzu schnell werden didaktische Einheiten, Erziehungsstrategien, kompensatorische oder emanzipatorische Programme entwickelt. Das führt nicht nur zur Erweiterung des Alltagswissens, was ja begrüßenswert wäre, sondern mit einer gewissen Notwendigkeit auch zur Instrumentalisierung des Wissens, die in der Pädagogik weniger angebracht ist als in irgendeinem anderen Lebensbereich." (PHILIPP, 1992, S. 20).
Inhaltsverzeichnis
Von den aufgezeigten gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungstendenzen hängt es letztlich ab, worauf die Schule die Kinder und Jugendlichen vorzubereiten hat.
Durch eine ständig "wachsende Komplexität" aller Bereiche unseres Lebens aber werden "künftige Erfordernisse zunehmend widersprüchlicher und schwerer vorhersagbar". Ebenso fragwürdig ist es geworden, zu glauben, man könne einen Wissenskanon definieren, um damit künftige Anforderungen sicherzustellen (vgl. POSCH, 1992, in: SCHULE und LEBEN, S. 12).
Die zentrale Herausforderung, vor die die Schule heute gestellt ist, hat POSCH (ebd.) in zwei Fragen zusammengefaßt:
-''Wie werden die Schüler auf die Bewältigung von Unsicherheit, Widersprüchlichkeit und Komplexität vorbereitet?
-Wie werden die Schüler darauf vorbereitet, selbst initiativ zu werden. selbst Einfluß auf gesellschaftliche Prozesse zu nehmen. lokales Wissen zu produzieren und auf verantwortbare Weise umzusetzen?"
Auf diese Herausforderung ist unsere heutige Schule nur ungenügend vorbereitet, denn die "Strukturen des Lehrens und Lernens sind weitgehend auf eine statistische Gesellschaft abgestimmt, in der das erforderliche Wissen vorweg definiert und in Lehrbüchern gespeichert werden kann und in der von der Schule erwartet wird, Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten, auf zufriedenstellende Weise jene Aufgaben zu erfüllen, die andere für sie festlegten" (POSCH, ebd.).
Ebenfalls auf dem zuvor skizzierten gesellschaftlichen Hintergrund benennt ROLFF (1993, S. 48) vier Aufgabenbereiche, worauf die Schule sich vorbereiten muß.
-
"Gestaltung der Arbeitswelt,
-
selbstbewußter Umgang mit Computern,
-
Entschlüsselung mediatisierter Erfahrung und
-
Rückeroberung der Zukunft."
Kindern und Jugendlichen sollte ein grundlegendes Verständnis für die neuen Technologien vermittelt werden, zudem wird es erforderlich sein, daß die Menschen in der künftigen Arbeitswelt befähigt werden, sich rasch und flexibel auf technische Veränderungen und damit veränderte Arbeitsanforderungen anzupassen. Außerdem werden zukünftig Fähigkeiten und Kompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Belastbarkeit, Teamgeist und ähnliche noch mehr erforderlich sein, um eigene Arbeit selbständig planen, durchführen und kontrollieren zu können (vgl. ROLFF, 1993, S. 49).
Einen weiteren Beitrag der Schule zur Zukunftsgestaltung sieht ROLFF (ebd., S. 50) in der Befähigung der Schüler zum selbstbewußten Umgang mit Computern.
Wobei nicht gemeint ist, daß die Schüler möglichst rasch eine Art "Computerführerschein" erhalten und mit den entsprechenden Grundkenntnissen im Programmieren ausgestattet werden. Aber eine sozialverträgliche Gestaltung einer zukünftigen Arbeitswelt erfordert die sich ständig ausweitende, kompetente und selbstbewußte Nutzung von Computern im Alltag von nahezu jedermann (vgl. ebd.).
Als "Mediatisierung der Kindheit" werden die Erfahrungen bezeichnet, die Kinder heute mit den neuen Medien in immer größerem und vielfältigerem Ausmaß machen. Zentrales Medium ist heute nach wie vor das Fernsehen (s. Kap. 1/1.2.1, S. 12 tI.), doch auch immer mehr beschäftigen sich die Kinder mit Videospielen oder dem Computer in ihrer Freizeit.
Wobei nicht die Seh- oder Spieldauer der so entscheidende Punkt ist, sondern die Art und Weise der Aneignung von der Welt durch die Kinder, und damit in der Folge die Qualität ihrer Erfahrungen.
So liefert das Fernsehen "technische Bilder, in von den Kindern nicht beeinflußbarem Tempo, Ausschnitt und Rahmen". Es sind "symbolische Repräsentationen von Landschaften oder Menschen". Die technischen Bilder produzieren dabei "einen Schein von Unmittelbarkeit, der trügt - nicht einmal Anfassen kann man diese Sendboten von Erfahrung" (ebd., S. 63). Sie repräsentieren fast ausschließlich eine Welt der Unterhaltung, oftmals in nichtssagender Form. Das pädagogische Prinzip der Anschaulichkeit wird dabei auf den Kopf gestellt, denn die Bilder der Unterhaltungsindustrie helfen Kindern immer weniger, ihre Lebenswelt zu verstehen bzw. zu erklären.
''Da auch die Erfahrungen, die man mit dem Computer macht, im spezifischen Sinn stets eingeschränkt sind, bedürfen sie einer besonders aufwendigen Entschlüsselung: Es müssen immer unvollständige Daten interpretiert werden. Computer - Modelle wollen immer ein Stück Wirklichkeit repräsentieren." (Ebd., S. 52).
So wird eine der schwierigsten Aufgaben zukünftiger Schule darin liegen, "die Schlüssel zur Entschlüsselung von mediatisierter Wirklichkeit zu liefern" (ROLFF, 1993, S. 52 ff.).
''Ein Drama der heutigen Kindheit und Jugend, zumindest in Mitteleuropa, besteht darin, daß kaum ein Kind oder Jugendlicher an eine bessere Zukunft glaubt. Vielmehr geht Zukunftspessimismus um, bei der jungen Generation viel stärker als bei den Älteren. Kaum ein Jugendlicher glaubt, daß wir einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, daß es gelingt, die Umweltprobleme zu lösen, daß die Atomwaffen auf beiden Seiten abgeschafft werden oder daß es einen angemessenen Arbeitsplatz für alle geben wird und die Arbeitslosigkeit verschwindet. Die meisten befürchten, daß Technik und Chemie die Umwelt zerstören, daß sich die wirtschaftliche Krise verschärft und immer mehr Menschen arbeitslos werden." (HESSE et. al. 1988, S. 45, zit. n. ROLFF, 1993, S. 53).
Auch wenn die Schule das nur zu einem sehr geringen Anteil wird leisten können, wird es ihre Aufgabe trotzdem sein, in Verbindung mit allen gesellschaftlichen Gruppen nach Möglichkeiten zu suchen, die Bedrohung der Vernichtung der Gattung Mensch auf dieser Erde abzubauen und damit gleichzeitig den Glauben an eine Bewältigung der Zukunft rück zu erobern.
Hauptaufgabe der Schule wird es sein, Kinder und Jugendliche mit dem für die Zukunft nötigen Wissen auszustatten, das sie nicht nur befähigt, die ökologischen und damit auch wirtschaftlichen Probleme zu meistern, sondern auch eine humanere Gesellschaft zu bilden (vgl. ebd.).
Da sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ständig ändern, müssen auch Schulen ihr Bildungskonzept immer wieder daraufhin überprüfen, ob es der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung und speziell der Lebenssituation der lernenden Kinder und Jugendlichen gerecht wird.
In seinem Aufsatz »Pädagogische Strukturen einer "guten" Schule heute« zog sowohl BOHNSACK (1987, S. 105) als auch FEUSER (1989, S. 5) in seinem Aufsatz »Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik« eine für das Bildungswesen bzw. für die Schule allgemein, doch recht negative Bilanz.
''Unsere heutige Schule ist in vielen Bereichen ihres inneren Wirkens, aber auch in ihren unterschiedlichen äußeren Strukturen nicht nur nicht zeitgemäß, weil sie die Eierschalen des 19. Jahrhunderts bzw. des Kaiserreiches noch nicht ganz abgeworfen hat" (BOHNSACK, 1987, S. 106), sondern "nicht mehr zumutbar, da sie die Sozialfähigkeit und Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen bis in die Kerne menschlicher Persönlichkeit hinein zerstört." (FEUSER, 1989, S. 5). "Zu wenig orientieren sich Schulen im Alltag an den demokratischen Idealen von »Mündigkeit, Selbstbestimmung, Humanität und Solidarität«." (BOHNSACK, 1987, S. 106).
So gebe die Schule den Lernenden meistens keine Antwort auf die "Schlüsselprobleme" unserer Gegenwart, wie beispielsweise auf die historisch neue Gefahr, daß die Menschheit sich heute durch Atomkraft oder Umweltzerstörung selbst auslöschen kann (vgl. ebd.).
BOHNSACK fordert eine völlig neue Denkweise, welche den Umgang mit Macht, den Umgang des Menschen mit sich selbst und dem anderen, aber auch den Umgang mit der Natur gänzlich verändert.
Inhaltsverzeichnis
In welch großem Spannungsfeld heute die tradierte und in allen industrialisierten Gesellschaften bestehende Institutionalisierung von Lernprozessen zur Schule steht, verdeutlichen u.a. Schulkritiker wie ILLICH (1972), der mit dem Argument, daß "Schule nicht nur Ungleichheit und Herrschaft stabilisiere, sondern die subjektive Lebendigkeit und Identität ihrer Klientel zerstöre", die Abschaffung der Schule in dieser bestehenden Form verlangt.
BAUMERT (1980) versucht, zwischen den hierarchischen Strukturen von Dienstweg, Erlaßwesen, Lehrplänen, Schulaufsichts- und Amtswesen und der notwendigen "pädagogischen Freiheit" des Lehrers zu vermitteln, und FÜRSTENAU (1969) hat schon Ende der sechziger Jahre der traditionellen Schulverwaltung sein "Human-Relations-Modell" gegenübergestellt.
Diese Institutionalisierungsproblematik findet sich zugespitzt im Unterricht, an "dessen Schwelle Schüler wie Lehrer ihre Personalität zurücklassen und sich einer verordneten, viele Seiten ihrer Menschlichkeit ausklammernden Rolle unterwerfen" (BOHNSACK. 1987, S. 109).
Auf diese "Zwangsverwandlung" reagieren viele Jugendliche heute aufgrund veränderter Wertvorstellungen mit innerer Abwehr, z.T. Aggression und Schulverdrossenheit (ebd.).
''Die Schulpraktiker und -theoretiker beschreiben heute das Lernen in der Schule als lebensfern, handlungsarm, entsinnlicht, einseitig rationalistisch, öd und abstrakt; sie erleben die Schule als fremdbestimmte, bürokratisch durchorganisierte und ritualisierte staatliche Anstalt, sie geißeln das Elend der Zensurengebung und etikettieren die Schule als Lernknast, als Sortiermaschine oder auch als totale Institution." (KLEMM, 1985, S. 11).
Wie im Zuge einer zunehmenden Institutionalisierung ganzheitliche und lebenspraktische Inhalte und Probleme aufgeteilt, einzelnen Fächern "zusortiert" und dazu nach Jahrgängen und Lernschritten "zerteilt" und eingestuft werden, hat RUMPF (1985, S. 54) aufgezeigt.
"Unsere heutige Schule begünstigt kognitive Informationen, das Bescheidwissen und Training »subjekt-neutraler« Fertigkeiten und hält die selbstentdeckende, offene und als solche riskante Begegnung kurz, ja präsentiert sich durch ihre »Abdichtung« gegenüber Emotionalität, Körperlichkeit und Subjektivität als eine »grandiose Abwehrmaßnahme«." (Vgl. ebd.).
Viele Jugendliche reagieren heute darauf mit Abstandhalten und "innerem Fortbleiben", Entmotivierung, Sinnverlust und Entfremdung (vgl. BOHNSACK, 1987, S. 109).
Zu den 45 oder 50 Minuten-Takten in unserem Schulalltag hat WESEMANN (1984, 1985; in: BOHNSACK, 1987, S. 109) erhoben, daß dieser industrielle Zeittakt nicht nur Lehrer wie Schüler technologisch-mechanistisch durch den Vormittag "transportiert" und lehrerdominante Unterrichts- und Interaktionsformen begünstigt, sondern vielfach von Schülern als "Sinnleere des üblichen Unterrichtsbetriebes" und als "Enteignung ihrer Lebenszeit" empfunden wird. Dies wird oftmals im Vergleich zu manch außerschulischem Engagement derselben, angeblich nicht konzentrationsfähigen und uninteressierten Jugendlichen deutlich.
Kerngedanke HENTIGS in seinem 1968 publizierten Buch »Systemzwang und Selbstbestimmung« war:
''Das Ideal unserer Kultur - die Freiheit des einzelnen in einer aufgeklärten und gerechten Gesellschaft - ist durch den Systemcharakter der heutigen Zivilisation gründlich in Frage gestellt Wenn wir uns gegen die unheilvollen ökonomischen, sozialen, technischen Determinierungen behaupten und uns zu Herren der Entwicklung machen wollen, dann müssen wir uns geistig, seelisch und körperlich anders ausrüsten." (1987, S. 11).
Die 13 allgemeinen Lernziele, die das Buch behandelt, sollten den Auftrag von Schule und Bildung neu bewußtmachen, nämlich:
"»Selbstbestimmung« des Menschen ermöglichen, bevor er den »Systemzwängen« erliegt." (Ebd.).
Das war eine ganz eindeutige und offene Parteinahme HENTIGS für den Menschen gegen die Systeme.
"Parteinahme für den Menschen - das ist Humanisierung!" (Ebd. 1987, S. 13).
BOHNSACK (1987, S. 110) zieht folgendes Fazit:
"Gefragt ist nicht die bloße Rücknahme der Institutionalisierung, sondern deren Qualitätswandel: Die weithin zentralverwalteten, bürokratisierten, ökonomisch und juristisch bestimmten Formen der Institutionalisierung müssen aufgelöst und ersetzt werden durch eine neue, am Bildungszweck der Schule, an der lebendigen pädagogischen Interaktion orientierte Lehr-/Lernorganisation, wie sie in und außerhalb der Regelschule bereits vielfältig erprobt wurde. Die vorgelegte Selbständigkeit der Jugendlichen wurde bislang von der Schule kaum genutzt zur Humanisierung ihrer eigenen Institutionalisierungsformen, statt dessen werden Halberwachsene immer noch weithin der unterrichtlichen Kleinkindgängelung unterworfen."
Das Schlagwort, das in diesem Zusammenhang heute verwendet wird, lautet "Autonomie der Schule". Gemeint ist damit eine Art der lokalen Entscheidungsfindung von Schulleitung, Lehrern und Schülern über Lehr- und Lernprozesse. Autonomie hat ebenso wie Öffnung mehrere Dimensionen, von denen POSCH (1992, S. 14) einige herausgehoben hat:
-"Eigenständige Auseinandersetzung von Lehrern mit Entwicklungstendenzen im Umfeld der Schule und eine gemeinsame Entscheidungsfindung über Entwicklungsprioritäten (in den einzelnen Fächern, aber auch fachübergreifend),
-Übernahme der primären Verantwortung für Innovation im Bereich des Lehrens und Lernens und
-systematische Reflexion über die eigenen Stärken und Schwächen, sowie Entwicklung einer "Fortbildungspolitik" an der einzelnen Schule, die auf die Entwicklungsprioritäten abgestimmt ist."
Es geht nicht darum, in der Schule Interesse gegen Leistung zu stellen oder umgekehrt, sondern es geht um deren ''Verbindung in Projekten und Lernprozessen, welche dem Lernenden in ihrem Sinn für sich selbst verstanden und bejaht und mitbeschlossen werden". Eine solche Integration hat DEWEY bereits in seiner Versuchsschule um die Jahrhundertwende praktiziert und in seiner Schrift »Interest and Effort in Education« von 1913 (in: BOHNSACK, 1987, S. ‚III) theoretisch begründet. Damit entschärft sich zugleich die Disziplinproblematik:
"Disziplin wäre nicht fremdbestimmte Unterdrückung eigener Bedürfnisse, sondern selbstgewählte Konzentration der eigenen Kräfte auf ein selbstbegehrtes und mitverantwortlich angestrebtes Ziel" (Ebd.). ''Versuchen wir unter der Fragestellung »Interesse oder Leistung« alternative Einseitigkeiten zu transzendieren, dann verliert einerseits "das Interesse" die Bedeutung der momentanen Laune des Schülers und andererseits verliert "die Leistung" die Bedeutung bloßer Erfüllung letztlich selektions- und das heißt fremdbestimmter Lern- und Prüfungsanforderungen, welche die Lerninhalte selbst zu Mitteln des Zensurenerwerbs verkommen lassen und wirkliche Bildungsprozesse verhindern." (Ebd.).
Obwohl man heute weiß, daß die Ziffernnoten zur Leistungsbeurteilung eines Kindes bzw. eines Menschen sich ganz allgemein als völlig widersinnig und untauglich erwiesen haben, wird in unserem Schulsystem an diesem menschenunwürdigen "pädagogischen" Instrumentarium fast unverändert festgehalten.
Die negativen Auswirkungen der gängigen Leistungsbeurteilungen an den heutigen Regelschulen sind uns allen hinlänglich bekannt:
"Zeugnisse sind im bestehenden Schulsystem in der Regel mit der Frage der Versetzung und dadurch mit dem Auf- und Abstieg eines Schülers im Schulsystem, also mit den Prinzipien von Aussonderung nach unten und Selektion nach oben verknüpft. Durch ihren "kategorischen Wert" erweisen sie sich für Schüler, Lehrer, Eltern, zukünftige Arbeitgeber und Dienstherren als in einer Weise norm- und wert- "besetzt", daß es ungeachtet bzw. über das Zeugnis hinaus keine Möglichkeit der Aktion oder Annäherung gibt. Demgemäß entscheiden sie gewissermaßen über den Lebensweg eines Schülers." (FEUSER, 1981, S. 209).
Das Zeugnis bewertet den Schüler auf der Basis von Noten in Relation zu anderen Schülern. Der Schüler wird damit zwangsläufig zu seinen (Mit-?) Schülern in Konkurrenz gesetzt. Es werden damit Leistungsegoismen gefördert, Kooperation und Solidarität verhindert.
''Diese Ziffern vermögen "Mit-" Menschen zu "Gegen-" Menschen zu machen und trainieren die Schüler von den ersten Schuljahren an auf den Einsatz der Ellbogen und einer Lerntechnik, die dadurch wirkt, daß man selbst relativ mehr weiß, je weniger der weiß und kann, zu dem man in Beziehung gesetzt und mit dem man verglichen wird." (Ebd.).
Die Dominanz meßbarer, von Schulverwaltung und Gericht nachprüfbarer Notengebung bevorzugt die Gedächtnisleistung und benachteiligt Kreativität und kritische Selbständigkeit (vgl. BOHNSACK, 1981, S. 110). Der Zeitdruck bis zur nächsten Klausur oder Schularbeit fördert die Aushändigung und Reproduktion fertiger Ergebnisse und läßt wenig Raum für den Nachvollzug von Erkenntnisprozessen, für das Verweilen bei offenen Problemen oder für ein geduldiges Überprüfen (vgl. ebd.).
Nach Untersuchungen von SCHWARZER, 1919 ( zit. n. BOHNSACK, 1981) nimmt auch die Differenz in der Selbsteinschätzung (Selbstvertrauen, Stabilität) zwischen erfolgreichen und erfolglosen Schülern vom 1. bis 8. Schuljahr empirisch stark zu, und so ist es nicht verwunderlich, daß nach Meinung von Ärzten, Schulpsychologen u.a. Schule heute in vielen Fällen körperlich und psychisch "krankmacht" (vgl. WANDEL, 1919; LEMPP u. SCHIEFELE, 1981).
"Bezogen auf die Grundtatsache der Subjektivität des Menschen ist die Akrobatik. die wir in Bezug auf Beurteilung und Noten treiben, geradezu grotesk und lächerlich. Was ein Schüler unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen gelernt hat, wie er damit umgehen kann und was er mit welchen Mitteln und unter welchen Bedingungen in nächster Zukunft um seiner Entwicklung willen zu lernen hätte, sagen sie nicht aus. Antworten auf diese Fragen sind pädagogisch aber unverzichtbar, geht es um die Persönlichkeitsentwicklung und das Lernen eines Schülers und nicht um das "Hereinziehen von Stoff", wie die Schüler es selbst beurteilen, um eine Arbeit zu schreiben und zu bestehen und um das alles hinterher unmittelbar wieder zu vergessen. Über und durch Noten, deren gesellschaftlichen Stellenwert und Funktion wird die Subjektivität des einzelnen Schülers letztlich gänzlich negiert, obwohl wir wissen. daß es Menschsein nur als Subjekt-Sein gibt und daß, dem unerschütterlichen Homogenitätsglauben zum Trotz, jedes Subjekt seine individuelle Biographie, seine individuellen Lebens-und Lernbedingungen hat Waren zwei Schüler eineiige Zwillinge, hätten sie schon im Mutterleib durch das einfache physikalische Gesetz, daß da, wo ein Körper ist, kein zweiter sein kann, und den dadurch bedingten unterschiedlichen Sitz der sie nährenden Plazenta im Mutterleib zu keiner Minute ihrer Existenz gleiche Bedingungen gehabt. Mit Noten aber, von denen wir glauben, daß die Bewertung der Leistung des einzelnen Schülers dadurch objektiver würde, daß man sie am Klassendurchschnitt mißt, tun wir so, als käme das, was ein Lehrer im Unterricht tut, bei jedem gleich an und als läge es nur am Schüler, wenn dieses nicht der Fall ist. Wir müssen erkennen, wollen wir nur einen Millimeter auf dem Weg zu einer humanen Pädagogik vorankommen. daß Noten. Zeugnisse und die daran gekoppelte Versetzung keine pädagogischen Instrumentarien sind, sondern Machtmittel, derer sich Pädagogen im Auftrag dieser Gesellschaft bedienen müssen oder wollen. Dies, weil sie als Lehrer oder die Sache, die im Unterricht auf eine bestimmte Art behandelt wird, Schüler nicht zu motivieren vermögen. Mit der Drohung durch Noten und Sitzenbleiben, mit ''blauen Briefen" und mit Ausschluß aus einer Schullaufbahn stellen wir scheinbar pädagogisch her, was aus dem Miteinander und der Sache kommen müßte. In unserer Verblendung erkennen wir nicht einmal, daß die Schüler nur um der Vermeidung der negativen Konsequenzen willen noch zur Schule kommen und lernen." (FEUSER, 1987, S. 210).
Aufgabe einer kindgemäßen und humanen Schule ist es, die Forderung nach Leistung und das Interesse (ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung) der Schüler in Einklang zu bringen.
OLECHOWSKI (1990, S. 57) hat den Auftrag und die Ziele einer kindgemäßen und humanen Grundschule zusammenfassend nach folgenden drei Gesichtspunkten formuliert:
-"Die Grundschule hat dem Kind eine "gestaltete" Umwelt bereitzustellen, eine Umwelt, die entsprechende Impulse für eine altersgemäße psychische Entwicklung gibt.
-Die Grundschule hat die elementaren formalen und inhaltlichen Voraussetzungen zur Lebensbewältigung zu bieten; im einzelnen sind dies die grundlegenden Voraussetzungen zur Auseinandersetzung mit den Fragen der eigenen Existenz, die grundlegenden Voraussetzungen zum Zurechtfinden und zur Auseinandersetzung mit den kulturellen, den gesellschaftlichen und den sozialen Bedingungen.
-Auftrag und Ziele der Grundschule sind ferner, eine für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung zu vermitteln. Allgemein formuliert Auftrag und Ziele der Grundschule sind, elementare Voraussetzungen für die gesellschaftliche Reproduktion sowie Disposition auch zur gesellschaftlichen Gegensteuerung zu vermitteln."
Die Konsequenz für eine humane Schule ist die Entwicklung eines alternativen Leistungsbegriffs, und das würde in Anlehnung an die Zusammenfassung von OLECHOWSKI über »Auftrag und Ziele einer kindgemäßen und humanen Grundschule« in Verbindung mit dem Humanisierungsbegriff nach HENTIG (1987) folgenden skizzenhaften Strukturraster für unsere Schule bedeuten.
Wollen wir eine humane Pädagogik schaffen und damit eine Schule ohne Aussonderung, dann bedeutet dies eine bis an die Wurzeln reichende Neugestaltung unseres gesamten Erziehungs- und Bildungswesens (vgl. FEUSER, 1989, S. 5).
"Sie muß eine für alle Kinder dieses Alters »gemeinsame Schu1e« - ohne Auslese sein." (OLECHOWSKI, 1990, S. 58).
Will die Schule "der Individualität des einzelnen Schülers gerecht werden, ohne ihn aus seiner Klasse auszusondern", dann muß sie ein Ort der Inneren Differenzierung und uneingeschränkten Integration sein. Gleichzeitig aber auch ein Ort der maximalen Individualisierung, an dem ''jedes einzelne Kind an seine Entwicklungs- und Lerngeschichte anknüpfen kann" und an dem "die Einmaligkeit des Schülers akzeptiert wird" (vgl. Muth, 1986, S. 60 ff.). Es dürfte demzufolge auch keine Selektion zu Beginn der Schulzeit geben (und damit keine Durchführung von "Schulreifetests"!) und auch keine Selektion während oder am Ende der Grundschulzeit für die weiterführenden Schulen (vgl. OLECHOWSKI, 1990, S. 58).
"Das Kind ist ein Forscher; es stellt sich Probleme und löst sie, es ist fähig, selbst zu lernen."
"Der Lehrer ist nur ein Mitarbeiter, ein Reisegefährte; mit seinen Angeboten vermittelt er zwischen dem Kind und seiner Umgebung. Aber einer Umgebung, die auf Kinder eingeht" Antonella Romeo [4]
''Die Kontinuität der Spiel- und Lernaktivitäten vom Kleinkindalter ins Schulkindalter hinein bis zum Erreichen der "reifen Kindheit" (di etwa bis zum 10. Lebensjahr) ist zu gewährleisten.
Dieses Prinzip kann zum Beispiel durch die verschiedenen Formen eines offenen Unterrichts verwirklicht werden." (OLECHOWSKI, 1990, S. 57 f.).
Damit die Schule ein Ort ist, "an dem sich die Lust an der Sache einstellen kann" (HENTIG, 1987, S. 31), ist es notwendig, den Unterricht mit "einem Lebens- oder Erfahrungsraum" der Kinder zu verbinden und "Leben und Lernen, Belehrung und Erfahrung aufeinander zu beziehen". Damit Kinder nicht "der größten Plage in der Schule unterliegen, nämlich der Langeweile", wird es notwendig sein, als Lehrer eine "Didaktik zu lernen", die bedeutet:
"Sich ein Arsenal von Gegenständen anlegen, die man so gegliedert, befragbar, zeigbar, übbar gemacht hat, wie man sie im Unterricht braucht - und nicht für die Abfassung eines Brockhaus-Artikels oder für die Fortsetzung der Forschung. Die Didaktik, die wir in einer kindgerechten Schule brauchen, ist demnach eine Sache der Fachausbildung auf die Kinder hin." (HENTIG, 1987, S. 33).
''Ein weiteres Prinzip einer kindgemäßen Grundschule besteht darin, daß alle Lernprozesse in reale Lebens- und Handlungsbezüge der Kinder eingebettet zu sein haben. Diesem Prinzip kann zum Beispiel durch die Verwirklichung eines Gesamtunterrichts oder eines Projektunterrichts nachgekommen werden." (OLECHOWSKI, 1987, S. 58).
Jeder Lehrer weiß: Zum erfolgreichen Lernen, zum Zuwachs an Kenntnissen, Fähigkeiten, Einsichten, gehört es, daß das, was neu aufgenommen, neu erfahren wurde, nur in das integriert werden kann, was zuvor gelernt wurde. Dies geschieht aber nur im Handlungsvollzug, und auch nur dann, wenn das Gelernte in komplexen "Ernstsituationen" angewendet wird.
''Es ist einfach falsch, zu meinen, Lernen sei etwas, das der Lehrer dem Schüler gibt. Ins Lernen begibt sich jeder Schüler mit Hilfe des Lehrers selbst" (SILBERMANN, zit n. HEYER 1983).
Die Schule verhindert geradezu das Lernen, solange sie sich weitgehend auf Unterweisung beschränkt, solange Unterricht fast ausschließlich als offener oder verdeckter Frontalunterricht vom Lehrer gesteuert bleibt und den Kindern kaum echte Handlungsmöglichkeiten gegeben werden. Fazit:
"Die Grundschule muß sich so verändern, daß die Kinder in ihr tatsächlich ans Lernen herangelassen werden, nicht nur passiv-rezeptiv, sondern konkret aktiv-handelnd." (HEYER, 1983).
Das bedeutet aber auch, daß sich vor allem drei Dinge verändern werden müssen:
-
Die Lehrerrolle muß sich ändern
Wir Lehrer müssen lernen und uns immer wieder bewußtmachen, daß wir die Kinder bei ihrem Lernen verantwortungsvoll zu begleiten haben. Das bedeutet, daß wir Respekt vor ihren Rechten haben, Tolerenz gegenüber ihren Gefühlen und ihnen bei der Verarbeitung und Erweiterung ihrer Erfahrungen helfen.
Es bedeutet nicht, daß wir ihnen bewußt oder unbewußt unsere eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse überstülpen dürfen und das, was wir selbst in unserer eigenen Erziehung erfahren und zum Großteil verdrängt haben, weitervermitteln.
Wir Lehrer sollten lernen, den Kindern zuzuhören, ihnen zuzusehen, um von ihnen zu lernen und nicht glauben, alles vorher und besser wissen zu müssen. Wenn wir die Erfahrungen der Kinder und ihre spontanen Interessen zum tragenden Element des Unterrichts machen wollen und nicht als unbequeme, das Lernen behindernde Störung abtun, dann müssen wir diesen Anspruch endlich ernst nehmen. Wie sollen die Kinder sonst lernen, allmählich für ihre eigenen Lernprozesse selbst verantwortlich zu werden? (vgl. HEYER, 1983).
-
Der Schulraum muß sich ändern
''Das Gebäude, die Räume, der Pausenhof müssen so aufgeteilt, organisiert und ausgestattet werden, daß die Kinder mit ihren Lehrern in ihnen handelnd lernen können." (HEYER. 1983).
Im Verlauf einer Studienreise im Jänner 1993 nach Oslo/Norwegen konnte ich mich davon überzeugen, daß gerade auch ältere Schulgebäude mit Initiative, mit Improvisationsbereitschaft und Phantasie seitens der Schulleitung, der Lehrer und Eltern den Lernbedürfnissen der Kinder entsprechend umgeformt bzw. umgebaut werden können, wenn die Bürokratie nicht behindernd, sondern unterstützend eingreift. Für einen Unterricht, in dem Kinder wirklich aktiv handeln können, nicht nur zuhören, lesen, schreiben, muß das Klassenzimmer eine Werkstattfunktion erhalten und zum Raum werden, in dem sich die Kinder auch bewegen können, der Anreize bietet. Es müssen zum Beispiel auch die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß unterschiedliche Schüleraktivitäten zur gleichen Zeit möglich sind (Lärmschutz, Materialangebot).
Damit das Lernen in unterschiedlichen Gruppierungen erleichtert wird, muß das Mobiliar beweglich und für verschiedene Funktionen geeignet sein.
Letztlich sollten die einzelnen Räume in der Art offen sein, daß das Kommunikationsfeld erweitert wird (vgl. NUBER, 1977, S. 108).
"Wichtig ist, daß endlich begriffen wird und die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen werden, daß Schulgebände sich auf die Aktivitätsbedürfnisse der Kinder zu beziehen haben, nicht auf Vorstellungen der Erwachsenen, seien sie nun ästhetisch begründet oder die Folge von deren eigener Passivität." (BEYER, 1983).
-
Lernen - Ein Bezug zum realen Leben der Kinder
"Das Lernen der Kinder muß einen direkten Bezug zu ihrem Leben haben; ihre Erfahrungen müssen ernstgenommen werden. Die Schule muß sich ihrer Umwelt öffnen, die Lernprozesse dürfen nicht auf den Schulraum eingegrenzt bleiben." (Ebd.).
So wichtig es ist, daß das, was die Kinder in der Schule erleben, zugelassen und aufgearbeitet wird und daß dafür genügend Zeit vorhanden ist, so wichtig wird es zunehmend, daß der Unterricht auch nach draußen verlagert wird.
"Das Ghetto Schule muß aufgebrochen werden, das Draußen muß reingeholt, die Kinder müssen rausgelassen werden." (Ebd.).
Es bedeutet, daß die Umwelt konkreter als über Lesebuchtexte, Arbeitsbögen, Abbildungen u.ä. in die Schule einbezogen werden muß. Daß viele Kinder, Lehrer, Eltern das schulische Lernen als sinnarm erleben, kann nur dadurch verändert werden, daß die Kinder im Vorgang des Lernens zugleich erfahren, wie unser Leben gestaltbar ist. Dies läßt sich nur bewerkstelligen, wenn die Schule nicht derart abgeschirmt bleibt von den tatsächlichen Lebensverhältnissen. Die Umwelt der Schule mit ihren Einrichtungen, Menschen und Entwicklungen muß sich als Lernraum öffnen, und die Schüler müssen mit ihren Lehrern die Umwelt konkret in Erfahrung bringen können (vgl. ebd).
''Die Grundschule hat im kognitiven, im affektiven (bzw. emotionalen und sozialen) und im psychomotorischen Lernbereich Grundkompetenzen zu vermitteln. Es ist sehr wichtig, daß zum Beispiel auch hinsichtlich der (Lern)Motivation des Kindes Lernprozesse angeregt werden. Für den Grad der "Lernfreude", der ''Lernbegierde'', des ''Wissensdurstes'' usw. sind nur teilweise endogen angelegte Dispositionen verantwortlich. Entscheidend für deren Aktualisierung sind exogen angeregte Lernprozesse." (OLECHOWSKI, 1990, S. 58).
Vielfach suchen wir nach Motivationen, da wir glauben, daß diese beim Kind den Wunsch erzeugen, zu lernen, und daß sie das Lernen insgesamt erleichtern, aber sehr oft sind die Motivationen gar nicht vorhanden.
''Deshalb erweist es sich als grundlegend, Erfolgsbedingungen zu schaffen, denn der Erfolg ist es, aus dem die Motivation erwächst, und nach Erfolgsmöglichkeiten wird im Umfeld der "Heterochronie"[5] in jenen Bereichen gesucht, in denen das Kind "etwas kann". Die Grundlage für die "Geburt" der Motivation und des Lernwunsches besteht gerade darin, das, sei es auch nur minimale "Können" zu erkunden." (NICOLA CUOMO, 1993, S. 48 f.).
"Die Grundschule sollte ein Ort sein, wo nicht Schulmißerfolg oder Schulangst "mitgelernt" werden. Die Grundschule sollte ein Ort sein, der im Bewußtsein des Schülers mit Lernerfolg, mit Erfolgserlebnissen fest assoziiert ist" (OLECHOWSKI, 1990, S. 58). ''Eine "humane Schule" ist in erster Linie eine Schule, die die in ihr lebenden und lernenden Menschen achtet" (HENTIG, 1987, S. 74).
Die Aufgabe, die die Pädagogik zu erfüllen hat, liegt "im Bemühen, Kindern zu helfen, in der jeweiligen Gesellschaft erwachsen zu werden und in diesem Vorgang sich selbst zu bewahren, und nicht sie auf die mangelhaften Zustände und die machtvollen Forderungen gesellschaftlicher Gruppen abzurichten" (ebd.).
HENTIG führt in seinem Buch »Humanisierung - eine verschämte Rückkehr zur Pädagogik?« (1987) acht Gesichtspunkte an, von deren Lernbedingungen, denke ich, sich eine Schule zu versichern hat, will sie die Lebens- und damit Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen erweitern, und nicht durch die von außen gesetzten Lernziele einschränken und oftmals brechen.
-
"Ein Ort, an dem sich die Lust an der Sache einstellen kann";
-
"ein Ort, an dem Konzentration möglich ist und Durchhaltekraft belohnt wird";
-
"ein Ort, an dem Martin Wagenschein würde lehren wollen";
-
"ein Ort, an dem man gemeinsame Grunderlebnisse hat und sich bewußtmacht";
-
"ein Ort, an dem Gemeinsinn herrscht und wohltut";
-
"ein Ort, an dem man mit einem Stück Natur leben kann";
-
"ein Ort, an dem man erfahren kann, wie man Frieden macht";
-
"ein Ort, an dem die Frage nach dem Sinn gestellt werden kann und gestellt wird."
[4] ) Antonella Romeo: Woher kommt der Regen? (Die Vorschulen im italienischen Reggio Emilia kommen ohne "Erziehung" aus - die Kinder erklären sich selbst die Welt In: DIE ZEIT, Nr. 39, vom 18.9.1992, S. 98.
[5] ) R Zazzi. definiert damit das Vorhandensein verschiedener Intelligenzen in ein und demselben Kind. Die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Situationen wird erkennbar.
Inhaltsverzeichnis
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels möchte ich zunächst einigen allgemeinen Aspekten zur "Qualität von Schule" (vgl STEFFENS/BARGEL, 1993) nachgehen.
Den Schwerpunkt dabei bilden zwei Themenbereiche:
-
"Allgemeine pädagogische Leitideen und schulische Innovationen" und daraus folgend, die
-
"Konsquenz für die Gestaltung des Schullebens und der Schulgemeinschaft" (vgl. STEFFENS/BARGEL, 1993, S. 11).
Im zweiten Abschnitt versuche ich, einem modifizierten und unserem Schulversuch angepaßten Leitfaden von Fragenstellungen, der anläßlich eines OECD/CERI-Regionalseminars vom 27.09. - 01.10.1993 in Einsiedeln/CH den Teilnehmern zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt wurde, folgend, die »eigenen Erfahrungen eines Gelingens- oder Mißlingens von schulischer Innovation am Beispiel unserer Schulversuchsklasse« (Entwicklungsprozesse der Schule - im Spannungsfeld) aufzuzeigen.
Einerseits sind es die dargestellten »Schlüsselprobleme« der Gegenwart, die -wie auch immer vermittelt - die Schule tangieren, andererseits sind es auch die Veränderungen innerhalb der Schulen selbst (s. Kap. II/2.1.3, S. 39 ff.), die Konsequenzen für unsere Schule heute haben:
für die Bestimmung ihrer Aufgaben, ihre Leitbilder von Unterricht und Erziehung wie für ihre Gestaltung.
Derartige Wandlungsprozesse in der Situation der Kinder und Jugendlichen im weiten Bereich des Arbeitsalltags, in den sozialen Beziehungen innerhalb der Familien und in den kulturellen Standards und Werten verlangen eine überaus bewußte Aufnahme durch die Schulen, aber nicht im Sinne einer "Anpassung", sondern einer "Bearbeitung" und "Berücksichtigung" (STEFFENS/BARGEL, 1993, S. 11).
Von derartigem gesellschaftlichen Wandel und damit verbundenen Gefahren, Risiken und Problemen gehen nicht nur Impulse auf die einzelnen Schulen und die darin arbeitenden Lehrer aus, sondern auch ein Druck, der eine "Umorientierung auf die qualitative Schulentwicklung" verlangt.
Damit sind weniger neue Bestimmungen der zu lernenden Wissensbestände gemeint, als vielmehr die "Konstituierung pädagogischer Leitideen" für die Schulen und die "Konsequenzen für die Gestaltung des Schullebens und der Schulgemeinschaft" (vgl. ebd.).
So haben STEFFENS und BARGEL (1993, S. 49 ff.) sechs generelle Leitideen hinsichtlich der Aufgabenfelder der Schule herausgearbeitet, an denen sich die Qualität einer Schule mißt.
Fachliche Qualifizierung:
"Schule soll fachlich qualifizieren (Kenntnisse vermitteln). Sie darf sich bei der Wissenvermittlung aber nicht allein auf ihren Fächerkanon konzentrieren. Sie muß darüber hinaus den Lernenden Möglichkeiten bieten, spezielle individuelle Fertigkeiten weiterzuentwickeln und eigenständig Wissen anzueignen."
Ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung:
''Die Schule hat nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln. Sie muß vielmehr für die allseitige Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen Sorge tragen. Neben der fachlichen Qualifizierung ist es gleichermaßen notwendig, die soziale und psychische Entwicklung der Lernenden zu fördern. Deshalb darf Schule nicht nur Kenntnisse vermitteln, sie muß auch "erziehen". Weil der Entwicklungsstand der Schüler unterschiedlich ist, müssen Schulen individuell fördern."
Sozialkompetenz vermitteln:
''Weil Schule zum Leben in der Gesellschaft befähigen soll muß sie bei ihren Schülern soziale Einstellungen und Verhaltensweisen fördern. Zum Leben in der Gesellschaft zu befähigen beinhaltet auch, mit demokratischen Umgangsformen vertraut zu machen und zum mündigen Bürger zu erziehen. Es genügt nicht, wenn die Schulen nur Wissen zur Demokratie vermitteln. Den Schülern muß auch innerschulisch Gelegenheit geboten werden, demokratische Verhaltensweisen einzuüben. So hat das allgemeine Bildungswesen die moralische Urteilsfähigkeit des einzelnen ebenso zu fördern, wie den Sinn für Gerechtigkeit und soziale Mitverantwortung zu stärken. Die Schüler sollen lernen, Konflikte diskursiv auszutragen und in vernünftiger Auseinandersetzung mit den Betroffenen zu lösen. Um Formen des Zusammenlebens in der Demokratie praktisch einzuüben, müssen für die Lernenden Möglichkeiten geschaffen werden, bei Entscheidungen, die das Schulleben betreffen, mitzuwirken und bei der Durchführung persönliche Verantwortung zu übernehmen."
Umweltoffenheit:
"Wenn Schule auf das Leben in der Gesellschaft vorbereiten soll kann sie kein gegenüber der sozialen Umweh abgeschlossenes System sein. Sie muß auf gesellschaftliche Fragen Bezug nehmen und den Lernenden zu gesellschaftlichen "Schlüsselproblemen" Antworten anbieten können. Sie sollte sich ferner in ihrem Bildungskonzept auf die Anforderungen und Erwartungen der sozialen Umwelt (z.B. Eltern, Gemeinde, Arbeitswelt) beziehen. Um auf die Erwachsenenwelt vorzubereiten. sollten in der Unterrichtspraxis Bezüge zur außerschulischen Lebenswelt hergestellt und Möglichkeiten geboten werden, in schulexternen Bereichen Primärerfahrungen zu sammeln."
Bildungsangebot für alle und soziale Integration:
"Schule sollte allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen und nationalen Herkunft optimale Lernmöglichkeiten bieten. Sie darf Kindern bestimmter Sozialgruppen (z.B. Randgruppen), leistungsschwächere und "verhaltensauffällige" Schüler nicht von ihrem Bildungsangebot ausschließen."
Startchancen für alle und soziale Gerechtigkeit:
"Schule soll den Übergang in die Erwachsenenwelt erleichtern und günstige Ausgangsbedingungen für individuelle Lebensqualität schaffen. Ziel sind gute (soziale) Startchancen für alle (Chancengleichheit /Chancengerechtigkeit). Von daher leitet sich die Aufgabe ab, herkunftsbedingte Sozialisationsdefizite abzubauen und sozial Benachteiligte besonders zu fördern."
STEFFENS/BARGEL (vgl 1993, S. 50) berichten, daß im Arbeitskreis darüber Übereinstimmung besteht, daß eine "gute" Schule nicht nur jedem Kind günstige Lernmöglichkeiten bieten sollte, sondern als allgemeine Bildungseinrichtung bereit und in der Lage sein muß, auch Kinder aus sozialen Randgruppen und "schwierige" Schüler zu integrieren. Schule hat eine Sozialisationsinstanz für alle zu sein. Sie hat nicht die Aufgabe, die leistungsmäßig besseren Schüler auszulesen, sondern muß zur Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit beitragen. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Ziele von fachlicher Qualifizierung und sozialer Gerechtigkeit warnen STEFFENS/BARGEL (ebd.) vor zwei möglichen Mißverständnissen:
''Es wäre ein Mißverständnis von gutem Unterricht, wenn man unterstellen würde, je geringer die Streuung der Schulleistungen nach einer gewissen Zeit ist, desto gerechter ist das gewesen. was in der Schule passiert ist. Sondern mein Konzept wäre: Man müßte sehen, daß ein Unterricht stattfindet, bei dem jeder Schüler das Optimum seiner Lernmöglichkeiten ausnutzen kann." (Ebd).
Wir können daher wohl nicht von einer Verbesserung von Schulqualität sprechen, wenn eine Nivellierung von Schulleistungen durch einen Verzicht von individueller Förderung erkauft wird, oder wenn "Homogenität" in einer Klasse dadurch zu erreichen versucht wird, indem die weniger guten oder die Kinder mit Problemen und Beeinträchtigungen ausselektiert werden.
''Wenn die Qualität einer Schule vor allem darin besteht, daß sie keine Störer und schwierigen Schüler hat, dann kann an der Bestimmung der Qualität von Schule etwas nicht stimmen. Ich gehe davon aus, daß Schule in dieser Gesellschaft es allen Heranwachsenden ermöglichen muß, einen Grad von Bildung zu erreichen, der sie zur gesellschaftlichen Teilhabe führen soll - was ein Anspruch ist, der unteilbar ist und für alle, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, gelten muß. Diese Überlegung ist sicherlich eine normative. Ich glaube, daß man sie begründen kann. Ich glaube, daß Überlegungen aus diesem Strang einfließen müssen in die Definitionsmerkmale "Qualität von Schule"... Es gibt offensichtlich eine Diskrepanz zwischen einem normativ begründeten, aber - wie ich finde - prinzipiell berechtigten Anspruch an Schule und einer Selektionsrealität von Schule, die man vielleicht generell auf folgenden Begriff bringen kann:
Je weniger schulkonforme, nicht so lernfähige und lernbereite Schüler ausgegliedert werden, desto größer sind die Chancen, daß eine Schule eine gute Schule wird. Wenn das eine Diskrepanz ist, dann - meine ich - muß man sich auch in der Folge der Definition von Merkmalen und der Bewertung vorfindlicher Realität mit dieser Diskrepanz auseinandersetzen." (Ebd.).
Die aufgezeigten Aufgaben der Schule und die damit verbundenen Bildungsziele sind oftmals nur sehr schwer miteinander in Einklang zu bringen und werden in der Schulpraxis auch recht unterschiedlich realisiert (vgl STEFFENS/BARGEL, 1993, S. 51). Die Bildungsziele, fachliche Qualifikation und allseitige Persönlichkeitsförderung werden in der Praxis sehr unterschiedlich gewichtet, und die meisten Schulen orientieren sich meiner Ansicht nach im allgemeinen mehr am Leistungsprinzip und am traditionellen Fächerkanon, als an einer allseitigen Persönlichkeitsförderung. So haben im herkömmlichen Unterricht die Schüler nur außerhalb des Fächerkanons persönliche Stärken, Fähigkeiten und Kenntnisse zu zeigen und einzubringen.
"Außerdem scheinen weniger Fähigkeiten vermittelt zu werden, die aber im Alltag notwendig sind. Zum Beispiel die Fähigkeit, sich eigenständig Wissen anzueignen und mit anderen Menschen umgehen zu können, oder Aufgeschlossenheit gegenüber den Problemen und Lebensbedingungen in der sozialen Umwelt" (Ebd.).
Wie stark gerade in den letzten Jahren die Auseinandersetzung um die schulischen Zielsetzungen zwischen Leistungsorientierung und Persönlichkeitsbildung geworden ist, zeigen u. a. die aus der Broschüre "Erziehung 2000 - eine ganzheitliche Perspektive"[6]entnommenen 10 wichtigsten Grundsätze:
1. Grundsatz: Erziehung zugunsten der menschlichen Entwicklung
"Der wichtigste und grundlegendste Sinn der Erziehung besteht darin, die innewohnenden Möglichkeiten der menschlichen Entwicklung zu nähren. Wir fordern eine erneuerte Anerkennung der menschlichen Werte, die in unserer modernen Kultur verblaßt sind, nämlich: Harmonie, Friede, Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Mitgefühl, Verständnis und Liebe."
2. Grundsatz: Die Anerkennung der Schüler als Individuen
''Wir wollen, daß jeder Lernende - jung oder alt - als einzigartig und wertvoll anerkannt wird. Wir fordern ein gründliches Umdenken in Bezug auf Benoten, Bewerten und standardisierte Prüfungen. Wir fordern eine erweiterte Anwendung des gewaltigen Wissens, das wir über pädagogische Richtungen, vielfältige Intelligenz und die psychologische Basis des Lernens bereits besitzen. Wir stellen den Wert folgender Erziehungskategorien in Frage: ''begabt'', "lernbehindert", "gefährdet".".
3. Grundsatz: Die zentrale Rolle der Erfahrung
''Wir bestätigen, wofür die meisten scharfsinnigen Erzieher seit Jahrhunderten eintreten: Erziehung ist eine Sache der Erfahrung. Wir glauben, daß Erziehung den Lernenden mit den Wundern der natürlichen Welt in Verbindung bringen soll, allerdings durch einen experimentierenden Zugang, der den Schüler in das Leben und die Natur einweiht (eintaucht)."
4. Grundsatz: Ganzheitliche Erziehung
''Wir fordern Ganzheit im Erziehungsprozeß und eine Veränderung in Erziehungssituationen und -systemen, um dieses Ziel zu erreichen."
5. Grundsatz: Die neue Rolle der Erzieher
'
'Wir fordern ein neues Verständnis der Rolle des Lehrers. Wir verlangen neue Modelle der Lehrerausbildung, die die Pflege des inneren Wachstums und kreativen Erwachens des Lehrers miteinschließen. Wir fordern eine Entbürokratisierung des Schulsystems, sodaß Schulen (ebenso wie das Zuhause, Parks. die Natur, Arbeitsplatz und alle Stätten des Lernens) Orte der aufrichtigen, menschlichen Begegnung werden."
6. Grundsatz: Die Freiheit der Wahl
''Wir fordern sinnvolle Möglichkeiten zur wirklichen Wahl auf jeder Stufe des Lernprozesses."
7. Grundsatz: Erziehung zur teilnehmenden Demokratie
''Wir fordern ein wirklich demokratisches Erziehungsmodell, das allen Bürgern ermöglicht, auf sinnvolle Weise am Leben der Gemeinschaft und des Planeten teilzunehmen."
8. Grundsatz: Erziehung zur globalen Bürgerschaft
Wir glauben, daß jeder von uns - ob er es weiß oder nicht - ein globaler Bürger ist."
9. Grundsatz: Erziehung zur "Erdenbildung"
"Wir glauben, daß Erziehung einer tiefen Verehrung für das Leben in all seinen Formen entspringen soll. Wir wollen eine Erziehung, die "Erdenbildung" fördert: die ein Bewußtsein der planetarischen Zusammenhänge miteinschließt, die Zusammengehörigkeit persönlichen und globalen Wohlbefindens, die individuelle Rolle und den Bereich der Verantwortung."
10. Grundsatz: Spiritualität und Erziehung
"Wir glauben, daß alle Menschen spirituelle Wesen sind, die ihre Individualität durch Talente, Fähigkeiten, Intuition und Intelligenz ausdrücken. Wir glauben, Erziehung soll das gesunde Wachstum des spirituellen Lebens fördern und ihm nicht durch ständige Bewertung und Konkurrenzdenken Gewalt antun."
STEFFENS/BARGEL (1993, S. 51 f) sind der Ansicht, daß es für die Bewertung von Schulqualität wichtig sei, sich darüber klarzuwerden, welchen Stellenwert die zuvor genannten Leitvorstellungen besitzen sollen. Ihrer Ansicht nach besteht die Möglichkeit, alle Zielsetzungen als gleichrangig zu betrachten nur theoretisch, da in der Schulwirklichkeit eine "Zielhierarchie" existiert. Bestimmte Ziele sind wichtiger als andere und werden deshalb am Bildungskonzept und im Alltag der einzelnen Schulen bevorzugt behandelt.
Auch wenn STEFFENS/BARGEL (ebd.) ohne Wertbestimmung den Spannungsbogen zwischen den beiden Zielkonflikten, nämlich einerseits der Leistungsorientierung und andererseits der umfassenden Persönlichkeitsbildung beschreiben, bin ich der Ansicht, daß wir heute aus Sorge um die Zukunft der Menschheit und allen Lebens auf dieser Erde nicht umhinkönnen, uns stärker denn je an den zuvor genannten 10 Grundsätzen zu orientieren.
"Wir müssen die Schule "einbetten" in ganzheitliche Bezüge zur Welt und zu den Menschen, in den umgreifenden Hintergrund von Natur und Mensch als Schöpfung: sonst geht unsere Welt ihrem Ende entgegen." (BOHNSACK, 1987, S. 114).
In der Weise, wie sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, müssen auch Schulen ihr Bildungskonzept immer wieder daraufhin überprüfen, ob es der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung und speziell der Lebenssituation der Lernenden gerecht wird. BOHNSACK (1987, S. 105 ff.) machte in diesem Zusammenhang besonders auf den Wertewandel aufmerksam, der sich in Richtung mehr Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Individualität bewegt.
Daß es heute nicht mehr ausreicht, Schule als Unterrichtsanstalt zu konzipieren, die allein auf die Wissensvermittlung im konventionellen Fächerkanon ausgerichtet ist, darin sind sich wohl heute alle Reformpädagogen einig. Schulentwicklung ist nicht mehr über die Vorgaben der Lehrpläne und über didaktische Verbesserungen des Unterrichtsgeschehens allein zu leisten.
"Um den Veränderungen gerecht zu werden, sollte das Schulleben als Ganzes gefördert werden und neben dem Fachunterricht praktisches, ganzheitliches Lernen treten können." (STEFFENS/BARGEL, 1993, S. 53).
Möglichkeiten dazu sind verstärkte offene, soziale und kulturelle Angebote an die Schüler am Nachmittag, eine weitgehende "Öffnung der Schule" im Projektlernen bis hin zu Möglichkeiten der verstärkten Partizipation und Mitgestaltung durch die Schüler selbst (vgl. ebd).
STEFFENS/BARGEL (1993, S. 53 ff.) weisen auf fünf mögliche Kriterien der Erweiterung bzw. Umgestaltung von Schule hin:
-
Soziale Integration
Schulen sind bei ihrer Arbeit auf die Akzeptanz, Unterstützung und auf die Rückmeldungen von außen angewiesen. Schulen haben daher zu beachten, daß sie in ihre soziale Umwelt "eingebettet" sind, denn davon hängen wiederum Entwicklungschancen und die Realisierung der Bildungsaufgaben ab.
Gute Kontakte zur Schulverwaltung und Schulaufsicht, aber auch zu den kommunalen Entscheidungsträgern, Eltern u.a erweisen sich als überaus wichtig. Wir müssen uns allerdings die Frage stellen, wieweit soll und "darf' sich eine Schule an die externen Bedingungen anpassen?
''Die Orientierung an der schulexternen Nachfrage kann zur Aufgabe zentraler Bildungsziele (z.B. des Prinzips der individuellen Förderung) führen. Von daher ist es zweifelhaft, ob Schule ihren gesellschaftlichen Funktionen gerecht wird, wenn sie sich alleine nach dem "Marktmechanismus" von Nachfrage und Angebot in ihrem Umfeld richtet'' (Ebd).
-
Öffnung nach außen
Wenn Lehrer in ihrem Unterricht an den Ausgangsbedingungen bei ihren Schülern anknüpfen wollen, dann müssen sie Kenntnisse über das soziale Umfeld ihrer Schüler haben. Dazu gehören Informationen über Lebensverhältnisse ebenso, wie über die familiären Hintergründe der Kinder.
Hinsichtlich einer allseitigen Persönlichkeitsentwicklung der Schüler ist es auch unerläßlich, Kontakte und Beziehungen zur schulexternen Umwelt herzustellen. Kindern und Jugendlichen sollte durch vielseitige außerschulische Angebote die Möglichkeit geboten werden, die außerschulische Alltagswelt real kennenzulernen, um damit das Wissen über den schulischen Fächerkanon hinaus, in Eigenerfahrung und durch Eigentätigkeit zu ergänzen und zu erweitern (vgl. ebd.).
-
Gemeinwesenorientierung - Stadtteilschule
Kontakte zwischen der Schule und ihrem sozialen Umfeld (Gemeinde, Stadtteil) lassen sich z.B. durch Spielfeste, Feiern mit den Familien ausländischer Mitschüler, Projekte im sozialen und kulturellen Bereich u.a.m. vielseitig herstellen und intensivieren.
Nach STEFFENS/BARGEL aber müsse jede Schule den Stellenwert ihrer Gemeinwesenorientierung selbst festlegen, bestehe doch die Gefahr, daß durch eine zu starke Betonung der Orientierung in diese Richtung eventuell "zu viele weltanschauliche Festlegungen getroffen würden" (ebd.).
-
Außerunterrichtliche Angebote und Zusammenarbeit
Eine soziale Integration der Schule sehen STEFFENS/BARGEL auch in der Möglichkeit, daß die Schulleitung oder einzelne Lehrer Kontakte zu kommunalen Entscheidungsträgern und zu Betrieben und Institutionen vor Ort pflegen.
Durch diese externen Beziehungen könnte einerseits eine Isolation der Schule verhindert werden, und andererseits Einblick in die Alltagswelten, Lebenssituationen und Probleme der Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld gewonnen werden (vgl. ebd).
-
Bezüge zur Lebenspraxis
''Wenn die Schule zur allseitigen Persönlichkeitsentwicklung der Schüler beitragen soll, dann müsse sie Bezüge zur Lebenspraxis herstellen." (Ebd.).
Möglichkeiten dazu sind u. a, daß die Kinder und Jugendlichen im Rahmen von Projekten die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Erwachsenen in ihrer Gemeinde oder ihrem Umfeld kennenlernen.
Als besonders wichtig erweist sich, daß die Schüler für lokale Probleme sensibilisiert werden und im schulischen Kontext eigene Erfahrungen machen können, die zum ganzheitlichen Lernen gehören (vgl ebd.).
Vor allem im angelsächsischen Raum (DALIN, 1973; FULLAN, 1991 u.a.) wurden Implementationsstudien durchgeführt, die ausnahmslos zu dem Ergebnis kamen, daß sich die Umsetzung und damit auch der Erfolg von schulischen Innovationen nicht auf der staatlichen Ebene, sondern auf der Ebene von Einzelschulen entscheidet (vgl. ROLFF, 1993, S. 106).
FEND (1986) war im deutschen Sprachraum einer der ersten, der anband empirischer Untersuchungen feststellte, daß sich einzelne Schulen derselben Schulform stärker untereinander unterscheiden als von anderen Schulformen. Er zog den Schluß, daß nicht das Gesamtsystem Schule, sondern die "einzelne Schule als pädagogische Handlungseinheit" anzusehen sei.
Diese Wende schulischer Reformbemühungen von Fragen der Gesamtstrukturen hin zur Einzelschule haben STEFFENS/BARGEL schon 1987 in dem Ansatz »Qualität von Schule« zum Fokus von Schulentwicklung gemacht.
SPECHT (1991) schreibt im Diskussionspapier »Schulqualität« unter dem Aspekt »erhöhter Reformdruck auf das Bildungswesen infolge aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen«:
"Daß der einzelnen Schule als pädagogischer Handlungseinheit im Rahmen bildungspolitischer Reformstrategien wieder größere Beachtung geschenkt wird, dafür sorgen derzeit eine Reihe von gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Bildungswesen insgesamt unter Reformdruck setzen, deren Bewältigung aber vorwiegend erhöhter Anstrengungen auf regionaler Ebene und auf der Ebene der Einzelstandorte bedarf."
SPECHT nennt dazu stichwortartig einige Bereiche:
-''Der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen,
-Zuwanderungen aus dem fremdsprachigen Ausland (Erhöhung des Anteils von Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache),
-Auszehrung und Bedeutungsverlust der Hauptschule, v. a. in den Städten,
-Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in das Regelschulwesen"
''Von diesen Strukturproblemen und neuen Herausforderungen sind einzelne Regionen und Schulstandorte in teilweise sehr unterschiedlicher Weise betroffen: Der Rückgang der Schülerzahlen stellt vor allem kleine Landschulen vor Existenzprobleme; von der Ausländerproblematik und existenzbedrohenden Abwanderungstendenzen zur höheren Schule sind in besonderem Maße städtische Hauptschulen betroffen.
Der Trend zur Integration behinderter Kinder ins allgemeine Schulwesen betrifft einerseits nur einen kleinen Teil der Schulstandorte, muß mittelfristig aber zwangsläufig auf regionaler Ebene zu einer Reorganisation des sonderpädagogischen Angebots führen.
In jedem Falle müssen als Antworten auf diese Herausforderungen Problemlösungen gefunden werden, die in hohem Maße für die spezifischen Bedürfnisse von Regionen oder Einzelstandorten "maßgeschneidert" sind."
SPECHT (1991) im Diskussionspapier zur "Schulqualität":
''Wir wissen heute viel darüber, wie eine "gute" Schule "von innen" aussieht, aber recht wenig, wie sie entsteht und wie sie sich entwickelt Die zentrale Frage ist ja, wie es dazu kommt, daß etwa in der einen Schule pädagogische Fragen im Mittelpunkt der Gespräche im Kollegium stehen, in einer anderen aber vor allem organisatorische oder standespolitische. Nur wenn man mehr darüber weiß, ergeben sich Ansatzpunkte für Veränderungsmöglichkeiten. Hier könnten Schulversuche wie etwa jener zum "Sozialen Lernen"[7] in Wien wichtige Aufschlüsse liefern, wenn sie als Quasi - Feldexperimente angelegt und begleitend evaluiert werden."
In der konkreten Situation unseres Schulversuchs ist es die Situation der Integrationsklasse, anband der ich die Verbindung zwischen theoretischer Begrifflichkeit, methodischen Instrumentarien und einer lebendigen, "hautnahen" Praxis aufzuzeigen versuche.
Nur stichwortartig möchte ich hier zu den aufgeworfenen Fragestellungen die mir wichtigsten Aspekte anführen, bilden sie doch im weiteren Teil der Arbeit die zentralen Punkte meiner Ausführungen. Bewußt habe ich die im Original z.T. sehr "markanten" Überschriften des Fragebogens zum. OECD/CERI-Seminar übernommen, drücken sie meiner Ansicht nach doch sehr treffend gerade durch diese Formulierung die oftmals selbst erlebten aggressiven und spannungsgeladenen Gegensätze schulischer Entwicklung aus.
-
Was löst in den einzelnen Schulen Entwicklungsprozesse aus, und wieweit sind es "zündende Ideen", Visionen, reformpädagogische Leitideen?
Die Einrichtung des Schulversuchs war weder eine zündende Idee, noch eine Vision, als die der gemeinsame Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern vielfach heute angesehen wird (vgl. FEUSER, 1989, S. 9). Es ist eine reformpädagogische Notwendigkeit, damit die Menschheit auf dieser Erde eine Chance zum Überleben hat (s. Kap. III/1.2, S. 51 ff).
-
Wieweit sind Entwicklungsprojekte "aus der Krise geboren" und Antworten auf Leidensdruck - oder weniger dramatisch - im Schulbetrieb eben anstehende "normale" Probleme?
In unserem Bezirk gab es u.a. keine therapeutische Versorgung. Die Eltern behinderter Kinder gründeten daraufhin einen eigenen Elternverein und mußten zur Betreuung und Hilfe für ihre Kinder sowohl Physiotherapeuten, Logopäden als auch Personen zur ambulanten Frühförderung suchen und anstellen.
Dies war sicher mit ein Grund, der schließlich den Hilferuf vieler Eltern zum "Aufschrei" und zum Protest werden ließ, um sich gegen derartige Benachteiligungen zu wehren (s. Kap. III/2.4.1, S. 69).
"So sind die pädagogischen Integrationsbemühungen in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang mit Demokratisierungsbestrebungen und im Bemühen um eine praktizierte Solidarität in verschiedenen Gesellschaftsbereichen auch vor dem Hintergrund bürgerrechtlicher Basisbewegungen (Elternvereine, wie z.B. Vereinigung der Eltern behinderter Kinder u.a.) zu sehen." (KOBL in: Eberwein, 1988, S. 56).
-
Wieweit kommen die Anstöße ausschließlich aus der Schule selbst oder von außerhalb der einzelnen Schule?
Aus meiner Sicht war in keiner Phase der Entstehung ein Ansatz zu erkennen, daß die Schule und die darin arbeitenden Lehrer (mit Ausnahme von 2 Lehrern) von sich aus bereit waren mitzuhelfen, eine Möglichkeit zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder zu schaffen, und die damit verbundenen Probleme - sie wurden und werden wohl auch nicht gesehen - zu lösen (s. Kap. III/2.5, S. 70 ff.).
-
Welche spezifischen Rollen sind bei der Ingangsetzung und Einrichtung eines Schulentwicklungsprojekts zu beobachten?
Hier haben wir uns zunächst zu fragen, welches Berufsverständnis Lehrer vielfach besitzen. Sind sie nur "Befehlsempfänger", die vorgeschriebene Lehrpläne, Erlässe und Amtsblattvorschriften einhalten, oder sollten sie nicht auch Verantwortung dafür übernehmen, auf der Grundlage heutiger Erkenntnisse, Kinder und Jugendliche in einem humanen und demokratischen Unterricht auf ein Leben nach der Schule vorzubereiten? (S. Kap. III, S. 22 ff.).
In unserer konkreten Situation gingen weder die Schulbehörde noch die Schulleitung auf die Anliegen der Eltern ein.
Es war einerseits dem unbeugsamen Durchhaltevermögen der Eltern, für ihre Kinder diesen gemeinsamen Unterricht zu erreichen, und andererseits die Bereitschaft und Solidarität zweier Lehrer mit den Eltern, trotz aller Angriffe und persönlicher Schwierigkeiten, diese Klasse zu übernehmen, zu verdanken (s. Kap. III/2.6, S. 79 ff.).
-
Wer sind die treibenden Kräfte, die "Anführer", die Bremser oder gar die Saboteure, die Katalysatoren, Vermittler (z.B. gegenüber Behörden, Eltern) oder ...?
Kraft und Hilfe gaben sich die Eltern gegenseitig. Es waren aber vor allem die vielfach gleichen Sorgen, Nöte und Ängste, die die Eltern solidarisierten und sie schließlich eine "gemeinsame Sprache" finden ließen. ''Nicht mehr sprachlos" zu sein bedeutete aber auch, gegenüber den Behörden, Politikern, Beamten u.a. nicht mehr "mit dem Rücken an der Wand zu stehen", sich "artikulieren" zu können (vgl. dazu nachfolgenden Text). Heinz FORCHER, Vater eines "mehrfachbehinderten" Kindes in seinem Referat im Rahmen des 9. Österreichischen Symposiums für die Integration behinderter Menschen vom 29. - 31.10.1993 in Feldkirch, Vorarlberg:
''Viele Eltern behinderter Kinder stehen so stark unter dem Eindruck ihrer Situation, daß sie kaum in der Lage sind, eigenständig zu handeln und ihren Weg zu gehen. In dieser Situation müssen wir lernen, uns gegenseitig zu unterstützen und die Vertretung unserer Anliegen nicht Experten zu überlassen. Dies gilt auch für die Eltern nichtbehinderter Kinder. Unser Kampf gegen Nichtaussonderung ist ein Kampf zur Verbesserung der Schule insgesamt und betrifft uns alle.
Aus vielen Gesprächen mit Müttern und anderen Vätern von behinderten Kindern, sowie auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, daß es in der Regel einer Zeit der Verarbeitung bei allen Familienmitgliedern bedarf, bis sie in der Lage sind, sich auf diese neue Lebenssituation - mit einem Kind, das besondere Bedürfnisse hat - einzustellen und beginnen zu können, die weitere Lebensphase aktiv zu gestalten.
Wenn ich heute zurückdenke, war dies eine der schwierigsten Lebenssituationen überhaupt. Einerseits war ich entschlossen, etwas zu verändern, andererseits war das Gefühl, mit dem Rücken an der Wand zu stehen in solchen Augenblicken fast unerträglich.
Dazu kam, daß ich Angst hatte, mich gegenüber Behördenvertretern zu artikulieren, wobei dieses Gefühl meine Unsicherheit noch verstärkte, nämlich durch meine inhaltliche Unkenntnis.
Mir fehlte ganz einfach die Fähigkeit, die Dinge, die ich für mein Kind intuitiv als richtig erkannte, in einem größeren Zusammenhang zu argumentieren.
Dazu ein Zitat von Paulo Freire:
»Sie konnten sich nicht wehren, denn ihnen fehlte die Sprache und mit der Sprache die einzige unüberwindliche Waffe der Freiheit.«; Persönlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt das Glück, bereits Personen zu kennen, mit denen ich meine ständigen Sorgen und Ängste bereden und in gewisser Weise auch bei ihnen abladen konnte. Durch diese zum Teil engen menschlichen Kontakte war ich in den damals für mich schwierigen Gesprächssituationen nicht mehr allein, ich war also nicht mehr sprachlos."
-
Wie geschlossen oder vernetzt agiert die Gruppe, welche das "Schulentwicklungsprojekt" betreibt?
Es bestand zwar ein. starker "Verbund" zwischen Eltern, Lehrern und Kindern innerhalb der Klasse, in den ich persönlich über alle vier Schuljahre überaus stark eingebunden war, aber im Schulhaus selbst und innerhalb des Kollegiums waren die beiden Lehrer und ich mit diesem Schulversuchsprojekt völlig isoliert.
Als eine Art ''Vernetzung" aber können die im ersten Schuljahr regelmäßigen Kontakte mit andern Integrationslehrern aus dem Bezirk angesehen werden. Diese regelmäßig selbstorganisierten Treffen wurden für alle Beteiligten gerade in der Anfangsphase sehr wichtig, konnten doch dabei Erfahrungen und Informationen ausgetauscht oder einfach nur Ärger und "Frust" abgeladen werden.
Hinzukamen über den Bezirk hinausreichende Kontakte vor allem zu Eltern, die sich über den gemeinsamen Unterricht Informationen, aber auch Hilfe bei der Beantragung bzw. Einrichtung eines Schulversuchs zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder erhofften.
-
Welche Prozesse sind zu beobachten, wenn eine ungleiche Involvierung verschiedener Partner besteht (z.B. wo nur eine Subgruppe innerhalb einer großen Schule das Projekt betreibt)?
Hier sind es vor allem die in Kapitel III/8, S. 349 ff. beschriebenen und auch vom Kollegium der Schule geäußerten vielfältigen Erfahrungen, deren Bandbreite von mehrheitlich völliger Ablehnung, Unverständnis, Mißgunst, Unkolligialität u.v.a.m. bis zur Anerkennung und vorsichtigen Befürwortung reichten.
Aus meiner Erfahrung erlangt in einer derartigen Situation vorrangig der Schulleiter und in zweiter Linie die Schulaufsicht, der der Leiter einer Schule unmittelbar unterstellt ist, eine zentrale Bedeutung, sind es doch deren "positive" oder "negativen" Signale, denen die meisten Lehrer einer Schule "gehorchen". Schulleiter haben nach STEFFENS/BARGEL (1993, S. 89) eine "Schlüsselgröße" für innerschulische Entwicklungen inne. Aus meiner Sicht erweist es sich für innovativ engagierte Lehrer als besonders erschwerend, innerhalb einer Schule zu arbeiten, wenn die Schulleitung nicht ebenso bemüht ist, trotz der Alltagsbelastungen und trotz der widersprüchlichen Erwartungen, die sie zu erfüllen haben, sich von pädagogischen Leitvorstellungen leiten zu lassen, die geprägt sind von der "Vision" einer aktiven Schulgestaltung (vgl. ebd., S. 99 ff.). In unserem Schulhaus führten diese Spannungen zu einem bis heute währenden "Konflikt" innerhalb des Kollegiums.
-
Wie werden Probleme der Informationsweitergabe, des Außenseiterstatus, des Offenlassens von Türen für "Späteinsteiger", von Neid und Mißgunst oder von Hochstimmung wie im ''Wallfahrtsort'' gelöst?
Obwohl der Status eines Außenseiters nicht angenehm ist, wurde er zumindest von den beiden Lehrern nicht als ein Problem empfunden, denn einerseits übertrugen sich diese "Angelegenheit der Integrationsklasse" (s. Kap. III/2.6, S. 78) und die damit verbundenen Auseinandersetzungen, also letztlich die Schuld für die "Störung des pädagogischen Dornröschenschlafes" auf meine Person und auf die Person des Obmannes des Elternvereins, und andererseits wurde über die Klasse, z.B. über pädagogische Belange, die gesamten vier Jahre in keiner einzigen Konferenz[8] gesprochen. Hierin lag auch das Problem der Informationsweitergabe. Nur eine Kollegin besuchte bzw. hospitierte innerhalb der vier Schuljahre in der Klasse. Die Anregung beider Lehrer innerhalb einer Konferenz1, über ihre Arbeit zu berichten, stieß auf "kein Interesse" und wurde von der Schulleitung auch nicht unterstützt.
Mehrmalige Versuche seitens der Schulpsychologin und mir beim Bezirksschulinspektor, aber auch beim Schulleiter der Volksschule, doch eine Informationskonferenz über das Thema der Integration für die Lehrer zu genehmigen oder auch von ihrer Seite aus anzuregen, wurden über all die Jahre strikt abgelehnt.
-
Welche Qualifikationen für den Schulentwicklungsprozeß sind vorhanden, werden im Projekt erworben oder fehlen?
-
Sind Support - Strukturen und Qualifikationen von außen abrufbar?
Beide Lehrer sahen sich durch ihre bisherige Tätigkeit und durch die Mithilfe von Fachleuten (Prof. Jutta Schöler, Dr. Klaus-B. Günther) und der Unterstützung durch Mitarbeiter der Landesgehörlosenschule Mils in der Lage, diesen Schulversuch gemeinsam durchzuführen (s. Kap. III/2.6.1, S. 83 ff.).
Diese Unterstützung von außen war aber nicht einfach bloß abrufbar. Sie mußte ohne jegliche Hilfe der Schulbehörde durch die Eltern und unter der Mithilfe der Lehrer selbst organisiert und finanziert werden (s. Kap. III/2.6.3, S. 88 ff.).
-
Welche Unterstützung erfährt die Klasse (Schule) durch die Behörden?
Schulverwaltung und Schulaufsicht, aber auch die Institutionen der Lehrerfortbildung, zeigten sich weder als aktive Vermittler zwischen Eltern und Schule, noch als anteilnehmende Unterstützer bei Problemen für die Lehrer. Aus meiner Erfahrung bewegten sich ihre Strategien zwischen "Abwarten, um zu sehen, wie sich die gesamte Integrationsbewegung letztlich totläuft" und ganz gezielten Gegenstrategien, um diese Entwicklung einzubremsen (s. Kap. III/2.6.5, S. 123 ff.).
-
Wie erlebt die Klasse (Schule) die Reaktionen der Umgebung auf ihren Entwicklungsprozeß: Wird ihr applaudiert, wird sie unterstützt oder hat sie "gegen den Strom" zu schwimmen oder sich gegen hinderliche Rahmenbedingungen "durchzumogeln"?
Hier haben wir zu unterscheiden: Auf der einen Seite erlebte die Klasse fast durchwegs positive Reaktionen von seiten der Eltern oder Personen, die die Gelegenheit erhielten, in der Klasse den Unterricht zu beobachten und mit den Kindern und Lehrern zu sprechen.
Auf der anderen Seite schwamm die Klasse im wahrsten Sinn des Wortes "gegen den Strom" und hatte über die gesamten 4 Jahre nur mit größtem Einsatz und in gemeinsamer Anstrengung die unterschiedlichsten Schwierigkeiten und einschränkenden Rahmenbedingungen, vor allem durch die Schulbehörde und Schulverwaltung, zu meistern.
-
Welche Elemente des umgebenden Schulsystems ermuntern und unterstützen die Klasse (Schule), welche hemmen und entmutigen sie?
Aus dem Schulsystem selbst gab es in unserer konkreten Situation des Schulversuchs aus meiner Sicht kaum einen Hinweis bzw. Punkt, der unterstützend oder gar ermunternd sich ausgewirkt hätte (s. Kap. III/2.6.4, S. 101 ff.).
-
Sind Freiräume explizit gewährleistet und bekannt, oder (er)leben die Klassen (Schulen) eine Diskrepanz zwischen juristisch möglichen und faktisch wahrgenommenen Freiräumen?
Im Rahmen eines Schulversuchs wären sicherlich größere Freiräume vorhanden, die aber aus den unterschiedlichsten Gründen, vor allem weil "diese Integration" nicht gewollt war, weder von der Schulleitung noch der Schulaufsicht oder Schulverwaltung eingeräumt, angeregt oder genehmigt worden waren.
-
Ist das Projekt eher als "Strohfeuer", als punktuelle Aktivität einzuschätzen, oder bestehen Hinweise darauf, daß ein anhaltender Entwicklungsprozeß, eine dauerhafte Kultur der Schulentwicklung eingerichtet ist bzw. wachsen kann?
Auch wenn diese Integrationsklasse, so wie die gesamten schulischen Integrationsbestrebungen, zum Zeitpunkt ihrer Einrichtung und ihres Entstehens nur als "Strohfeuer" angesehen wurden, beginnen diese einzelnen "Feuer" hoffentlich mit dem am 8. Juli 1993 vom Parlament beschlossenen Integrationsgesetz bald flächendeckend Wärme der Menschlichkeit in alle unsere Schulen und Klassen auszustrahlen.
[6] Die Broschüre stammt von "GATE", Global Alliance for Transforming Education, 4202 Ashwoody Trail - Atlanta, Georgia 30319 - USA Es ist eine weltweite Vereinigung zur Umgestaltung von Erziehung. Ihre Mitglieder sind Erzieher, Eltern, Menschen aus verschiedenen Erziehungsbewegungen, denen die Sorge um die Zukunft der Menschheit und allen Lebens auf der Erde gemeinsam ist. Entnommen aus der Zeitschrift "Lernwerkstatt" des Vereins ''Mit Kindern wachsen", Jg. 4, Nr. 4. Herzogenburg, 1993.
[7] vgl. MITSCHKA, R.: Ein Jahr Schu1(vor)versuch "Soziales Lernen". Erfahrungen - Ergebnisse. Erziehung und Unterricht, 1987, Heft 2, S. 79 - 86.
[8] Ein von den beiden Lehrern und mir hergestellter Videofilm "Eine Offene Lernphase im zweiten Schuljahr einer Integrationsklasse" wurde vielerorts bei Konferenzen, Lehrertagungen, Elternabenden und dgl außerhalb der Schule gezeigt. Es tauchte aber immer wieder der Vorwurf auf: "So viel Wirbel um diese Klasse, in der weniger Kinder sind, noch dazu 2 Lehrer und richtig behindert sind die Kinder ja auch nicht!"
Inhaltsverzeichnis
''Hoffentlich wird es bald zur Selbstverständlichkeit, daß alle Kinder so akzeptiert werden, wie sie zur Welt kommen, daß ihre Mitmenschen lernen, neben ihren Schwächen auch ihre Stärken zu sehen." Manfred Rosenberger[9]
Der Begriff "Integration" ist nicht nur damit verknüpft, daß durch einen gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern Lernprozesse in emotionalen, sozialen und kognitiven Bereichen stattfinden. Integration bedeutet wesentlich mehr. Es handelt sich hierbei um Prozesse auf unterschiedlichsten Ebenen:
-
" auf der intrapsychischen Ebene durch den Austausch mit anderen Menschen und/oder der Umwelt;
-
auf der interpersonellen Ebene durch einen Dialog gegenseitiger Annäherung und Abgrenzung, wobei als Dialog die Akzeptanz der Andersartigkeit und Gleichheit einer Person verstanden wird;
-
auf der Handlungsebene, auf der alle Kinder an einem gemeinsamen Gegenstand handeln und arbeiten mit dem Ziel, Realität zu bewältigen; - auf der situativ - ökologischen Ebene, auf der zwischen Menschen innerhalb einer kooperierenden Gruppe ein lebhafter Austausch stattfindet;
-
auf der institutionellen Ebene, auf der Institution (wie Schule) in Kooperation mit anderen Einrichtungen ihre Leitvorstellungen bzw. Beauftragungen neu definieren;
-
auf der Ebene gesellschaftlicher Strukturen, auf denen Benachteiligungen und Stigmatisierungen sukzessive abgebaut werden, Verfassungsgrundsätze, wie der der Gleichberechtigung und der sozialen Gerechtigkeit schrittweise verwirklicht werden;
-
auf der transzendierenden Ebene, auf der es um die Auseinandersetzung von Unvollkommenheit und Sterblichkeit geht und letztlich um die "Sinnfrage" im allgemeinen" (vgl. "Endbericht über das Projekt schulische Integration in Tirol" der Universität Innsbruck, 1991).
Für mich bedeutet "Integration" aber auch einen Begriff, der ein "Ziel" beschreibt. Allerdings nicht ein Ziel im Sinne eines Zielpunktes einer physikalischen Wegstrecke, sondern das "Ziel" besteht darin, eine "dynamische Balance" zwischen zwei Tendenzen herzustellen:
einerseits die Tendenz zur Gleichheit mit anderen Menschen, zur Verbundenheit, zur Annäherung an andere, andererseits die Tendenz zur Abgrenzung, zur Differenz, zur Autonomie meiner Person.
Beide Tendenzen sieht REISER als dialektisch aufeinander angewiesen, ineinander verschränkt.
"Sie stehen sich aber nicht als Pole gegenüber, von denen der eine den anderen ausschließt oder mindert, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Ich bin umso autonomer, je mehr ich mir meiner Verbundenheit bewußt bin, ich bin umso verbundener, je besser ich mich als einzelner abgrenzen kann.
Ohne Entwicklung einer persönlichen Identität wird die soziale Identität zur Anpassung, zur Reduktion des selbstbestimmten Lebens, ohne Entwicklung einer sozialen Identität wird die persönliche Durchsetzung zum inhumanen Egoismus." (REISER. 1992, S. 14).
In dieser Dialektik der Tendenz zur Gleichheit und der Tendenz zur Differenz sieht REISER den Motor integrativer Prozesse. Es sind Prozesse, bei denen "zwischen Personen, zwischen Personengruppen, zwischen inneren Persönlichkeitsanteilen Annäherung und Abgrenzung stattfinden, die eine jeweils für diese Situation passende und jeweils spezifische dynamische Balance von Gleichheit und Differenz herstellen" (ebd.).
"Demokratisierung ist immer ein Integrationsprozeß, und deshalb kann Integration nicht als ein Problem verstanden werden, dessen Für und Wider diskutiert werden sollte, sondern sie ist eine Aufgabe, die den Menschen in einer demokratischen Gesellschaft aufgegeben ist" (MUTH, 1986, S. 14 u. 1988, S. 16).
Muth schreibt weiter: Integration ist ein "politisches Phänomen", das sich "auf das Zusammenleben der Menschen, auf den einzelnen Menschen in seiner Gemeinsamkeit mit anderen" (ebd., S. 16) richtet, und so sind das Zusammenleben der Menschen und die Gemeinsamkeit aller humane Selbstverständlichkeiten.
Wo diese nicht gegeben sind, oder wo sie Störungen unterliegen und deshalb hergestellt bzw. wieder hergestellt werden sollen, da wird politisch gehandelt. Aus diesen Überlegungen ist erkennbar, daß das Bemühen um die Integration in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen ein politischer Prozeß ist, ebenso wie die Praxis der Aussonderung von Behinderten. Auch in unserer Gesellschaft wird vor allem in den letzten Jahren immer verstärkter nicht nur das Oben und Unten von Menschen problematisiert und in Frage gestellt, sondern ebenso das Ausgeschlossen sein und Ausgeschlossenwerden.
''Die Gemeinsamkeit aller und die Gemeinsamkeit des Einzelnen mit den Anderen ist ein Grundrecht demokratischer Lebensauffassung, es ist ein Grundrecht des Menschseins." (Muth, 1988, S. 11).
In dieser Feststellung laufen letztlich alle Überlegungen zur politischen Dimension der Integration zusammen. Behinderten Menschen stehen diese Grundrechte ebenso zu wie allen anderen Menschen.
''Dennoch werden derzeit behinderte Kinder, Jugendliche und ihre Familien als gesellschaftliche Minderheiten vom sozialen Ausschluß bedroht, ausgesondert, diskriminiert, in ihrer Entwicklung eingeschränkt und behindert.
Durch gesellschaftliche Aussonderung - wie sie behinderte Menschen in Österreich erfahren - werden die grundsätzlichsten Menschenrechte, nämlich die Gleichheit der Rechte von Menschen ohne Berücksichtigung der Verschiedenheit von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Rasse, Religion, Alter und Behinderung verletzt.
Die geforderte Integration (Nichtaussonderung) stellt die Einlösung von deklarierten Grundrechten dar."
(Aus dem "Begleittext einer "Resolution zur Wahrung der Menschenrechte von Familien mit behinderten Kindern", 1992)[10].
Was bedeuten diese Grundrechte?
Sie bedeuten die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens und die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen bei auch extremster individueller Andersartigkeit bzw. Verschiedenheit und damit verbunden die unverlierbare Würde jedes einzelnen Menschen (vgl. Haeberlin, 1990).
"Deshalb sind z.B. alle Schulversuche, die der Frage nachgehen, ob Integration möglich ist, oder ob sie nicht möglich ist, eigentlich problematisch. In solchen Schulversuchen wird so getan, als müßte die Einlösung eines Menschenrechtes empirisch belegt und begründet werden. Wo aber die Auffassung vertreten wird, es sei unumgänglich, die Gemeinsamkeit von Behinderten und Nichtbehinderten zu begründen, da hat sich ein Bewußtsein breitgemacht, das keine Kritik an der Schule, so wie sie heute ist, üben möchte." (MUTH, 1988, S. 17).
Die Konsequenz dieser Überlegungen zur politischen Dimension der Gemeinsamkeit von Behinderten und Nichtbehinderten ist, daß Integration unteilbar ist (s. FEUSER, Vorbem., S. 6 u. SCHÖLER, Kap. 2.6.3, S. 97).
''Ein Kind mit einer Behinderung auf dem langen Weg der Menschwerdung durch Erziehung zurückzulassen als "nicht integrierbar" bedeutet, diesem Kind das Menschsein abzusprechen. Die Gefahr ist groß, von dieser möglichen Entscheidung der Pädagogen zu Beginn der Schulzeit die Rechtfertigung für Mediziner oder Philosophen abzuleiten, einem Menschen bereits am Beginn seines Lebens das Recht auf Leben abzusprechen." (MÜRNER/SIERCK, 1990).
Eine humane Schule wäre im Rahmen dieser zuvor genannten Wertentscheidung eine integrationsfähige Schule. Wir haben daher nicht zu fragen, ob dieses oder jenes Kind integrationsfähig ist, sondern ausschließlich nach der Integrationsfähigkeit und -unfähigkeit der Schule und der Gesellschaft.
"In einer integrationsfähigen Schule gäbe es keine Geringschätzung wegen unterdurchschnittlicher Schulleistungsfähigkeit, wegen Abweichungen von der Durchschnittsintelligenz und wegen anderer Auffäl1igkeiten. Die visionäre humane Schule wäre getragen vom Wunsch nach dialogischer Begegnung zwischen den Schülern, zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Eltern, Lehrern und Schülern, zwischen allen in und außerhalb der Schule in Beziehung stehenden Menschen." (Ebd., S. 94).
Ich möchte es noch einmal klar und deutlich herausstreichen:
Die primäre Frage richtet sich also nicht nach der Integrationsfähigkeit des Kindes, sondern nach der Integrationsfähigkeit der Schule!
Wenn wir also nach der Integrationsfähigkeit der Schule fragen, so haben wir uns aber damit gleichzeitig nach der Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft zu erkundigen. HAEBERLIN spricht von der ''Vision einer integrationsfähigen Gesellschaft und Schule" (1992, S. 93).
''Visionen von Integration meinen in der Regel nicht nur den pädagogischen Fortschritt in einer Schulklasse, sondern auch die Utopie einer progressiven Entwicklung der Gesellschaft mittels einer integrativen Pädagogik, wie steinig auch immer der Weg dorthin gedacht werden mag." (ANTOR, 1992, S. 30).
Persönlich habe ich diese Vision und den Glauben an eine integrationsfähige und damit humane Schule, an die Gleichwertigkeit jedes Menschen als Person und als Partner fast verloren, erlebe ich doch täglich die Situation von Aussonderung, Diskriminierung und das Abschieben von Menschen. Die Integrationserfahrungen in der Schule wären für HAEBERLIN die Voraussetzungen, um Erfahrungen für eine integrationsfähige Gesellschaft zu erlangen (vgl. 1992, S. 93). Er ergreift deshalb Partei für eine Schule, die integrationsfähig für alle ist.
''Die Trennung zwischen Regelschule und Sonderschule ermöglichte bisher zwar die Schaffung von Inseln der Menschlichkeit; sie ist aber auch als Zeichen unserer Resignation über erfahrene Unmenschlichkeit interpretierbar. Beim Nachdenken über Integration erfahre ich die Spannung zwischen Vision und Wirklichkeit Es fällt mir schwer, meine Hoffnung auf das wünschbar Bessere mit Gelassenheit in der Erfahrung des machbar Schlechteren zu verbinden." (Ebd.).
Denn dieser Vision einer integrationsfähigen und damit humanen Schule steht die erfahrene Wirklichkeit einer bürokratisch verwalteten Schule gegenüber, und damit gleichzeitig das Erfahrungswissen, daß marktwirtschaftliche Gesellschaften auf dem Bewerten nach Leistungsfähigkeit aufgebaut sind. Es stellt sich somit immer wieder die Frage:
Wie weit wird der staatlich-öffentlichen Schule politische Integrationsfähigkeit erlaubt, damit ihr Konflikt mit den Anforderungen der marktwirtschaftlichen Leistungsgesellschaft von dieser kontrollierbar bleibt?
Neben diesen marktwirtschaftlichen Anforderungen, in die die Schule einbezogen ist, wird sie aber auch als ein gesellschaftliches Teilsystem nicht nur bürokratisch verwaltet, sondern auch einheitlich reglementiert, strukturiert und vor allem kontrolliert. Sogar Schulklassen, die gerade aus den Gründen des ''Versuchens und des Suchens" nach neuen Erkenntnissen und Erfahrungen als sogenannte "Schulversuche" beantragt und eingerichtet werden (integrative Schulversuche), werden vielfach in ihrem "Freiraum" pädagogischer Innovationsarbeit reglementiert, eingeschränkt und durch Erlässe und Vorschriften (z.B. Stundenpläne, Klassenziele- und Lehrpläne, Notengebung, Lehrverpflichtung, Unterrichtszeiten u.v.m.) zum Scheitern gebracht.
Die Befürchtung, die Haeberlin (1992, S. 95) dazu äußert, sehe ich in der derzeitigen Phase der Gesetzesauslegung und -anwendung leider als eine in unserem Bundesland real gewordene Wirklichkeit.
"Humanität als im öffentlichen Bewußtsein verankerte Integrationsfähigkeit der Schule läßt sich kaum bürokratisch organisieren und kaum durch einen Verwaltungsakt anordnen, solange die gleiche Verwaltung auch für das Funktionieren der marktwirtschaftlichen Produktions- und Konsumationsgesellschaft verantwortlich ist. Unsere Schulverwaltungen werden auftragsgemäß auch die "Integration" reglementieren und "vervorschriften", sobald "Integration" anerkanntes Prinzip des öffentlichen Schulwesens werden könnte. Es ist zu befürchten, daß sich auch die Reglementierung der "Integration" an den tradierten und gesellschaftlich nicht aufgehobenen Regeln orientiert. Es ist dann auch zu befürchten, daß künftig im Rahmen der unser öffentliches Leben weiterhin beherrschenden Wertehierarchie unter dem schulorganisatorischen Etikett "Integration" ein »zielgleiches« Leistungsfördersystem für schwache Schüler in Regelklassen unter Voraussetzung der Kostenneutralität administriert werden könnte."
Ich teile die Angst mit HAEBERLIN (ebd.), die er damit verknüpft, daß bürokratisch organisierte Integration im öffentlichen Schulwesen dazu mißbraucht werden könnte, "Integrationsfähigkeit" einseitig auf das Kind zu beziehen und mit "Schulleistungsförderbarkeit" - bezogen auf Klassenziele - gleichzusetzen und bestenfalls für die bezüglich des Klassenziels ''Nicht - Förderbaren" den Sonderstatus von "lernzieldifferent Förderbaren" einzuführen.
''Eine Verbindung von Integration mit der Unterteilung in "lernzieIgleiche" und "lernzieldifferente" Schulleistungsförderbarkeit würde die mit dem separierenden Schulsystem verbundene Vorstellung von "integrationsfähigen" und "integrationsunfähigen" Kindern nicht überwinden können. Die ''lernzielgleich förderbaren" würden vermutlich weiterhin als die "integrationsfähigen" und die "nicht lernzielgleich förderbaren" als die "integrationsunfähigen" Kinder gesehen. Die Verknüpfung von "Integrationsfähigkeit" mit "Leistungsfähigkeit" bezogen auf Klassenziele könnte den Fortschritt zur Humanität zunichte machen, weil dadurch die Restgruppe der ''Nicht - Förderbaren" nicht nur bürokratisch, sondern auch noch wissenschaftlich legitimiert als ''Integrationsunfähige" und damit leicht auch als Unnütze, als gesellschaftliche Last ausgesondert wird"
Wie oft aber muß ich heute hören:
»Aber für einen Rest von Kindern muß die Sonderschule doch bestehen bleiben. Alle Kinder kann man doch nicht integrieren. «
Wenn heute auch bei uns wieder offen und uneingeschränkt darüber diskutiert werden kann, ob es ethisch gerechtfertigt ist, schwer behinderte Menschen oder später verunfallte, alte, kranke, sieche, invalide u.a. zu töten, hoffe ich nur, daß zukünftig diesen Menschen überhaupt noch ein Raum zum Leben und Überleben bleibt.
Diese, mit der neuen Euthanasie umschriebene Diskussion ist heute ebenso Realität, wie die Frage, ob wir uns nicht endlich dazu entschließen wollen, für eine menschliche Gemeinschaft auch mit schwerstbehinderten Menschen zu leben, es vor Ort zu tun, es permanent zu demonstrieren, auch um uns zur Wehr zu setzen gegen sozialen Ausschluß, gegen Rassismus und gegen einen Utilitarismus Singerscher Prägung.
[9] In: Die Grundschulzeitschrift, Heft 58, Oktober 1992
[10] In einer österreichweiten Aktion konnte 1992 die Forderung von Eltern behinderter Kinder nach einem gesetzlich verankerten Recht für ihre Kinder, ohne Aussonderung in die allgemeinen Kindergärten, in die Regelschule und in die berufbildenden Schulen aufgenommen zu werden, durch eine Unterschrift unterstützt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1 Zur Vorgeschichte
- 2.2 Konkreter Anlaß
- 2.3 Schulrechtliche Bestimmungen
- 2.4 Ein Blick in die Geschichte der Integration von behinderten Kindern in Österreich
- 2.5 Schulorganisatorische Bedingungen des Integrationsversuches an der Volksschule Reutte
- 2.6 Die Integrationsklasse - konkrete Einrichtung - Projektantrag
SABINE, ein aufgewecktes und hübsches siebenjähriges Mädchen, kommt ins schulfähige Alter. SABINE möchte selbst gern mit den anderen Kindern ihres Dorfes und ihrer Nachbarschaft in die Schule gehen.
SABINE wird im Kindergarten ihres Heimatdorfes nicht aufgenommen.
Die Mutter möchte SABINE in der Schule des Dorfes anmelden. Die Tür der Schule bleibt verschlossen. Warum?
SABINE kann nicht hören! SABINE kann nicht sprechen! SABINE kann auch keine Gebärdensprache!
Für die Schulbehörde ist klar:
-
Es gibt die über 100 km entfernte Landessonderschule für gehörlose Kinder. Dort soll Sabine in die Schule gehen.
-
Wenn SABINE diese Schule nicht besuchen will, dann hat sie eben in die nahe und zum Schulsprengel gehörige Allgemeine Sonderschule in Reutte zu gehen.
-
Es gibt auch eine Einweisung in die Sonderschule "von Amts wegen"!
Im Herbst 1987 höre ich erstmals von SABINE, einem gehörlosen Mädchen, das mit seiner Mutter und Großmutter in Lechaschau, einem Dorf nahe Reutte, lebt.
In mehreren Gesprächen mit der Mutter und weiteren Eltern geht es darum abzuklären, inwieweit ich - als pädagogischer Leiter im Vorstand der Lebenshilfe - den Eltern behilflich sein kann, für ihre behinderten Kinder einen Kindergartenplatz im Normalkindergarten zu finden.
Die Mutter von SABINE schildert die äußerst schwierige Situation um ihr Kind.
Im Oktober 1983 wurde bei SABINE, am 04.08.1982 in Ehenbichl bei Reutte geboren, »ein beidseitig hochgradiger sensoneuraler Hörschaden (an Taubheit grenzend) diagnostiziert« und eine Hörgeräteversorgung durch die Universitätsklinik für Hör-, Stimm-und Sprachstörungen in Innsbruck vorgenommen.
Verschiedene Umstände, u.a die große räumliche Entfernung zwischen Reutte und Innsbruck, und daß es im Bezirk Reutte keine Möglichkeit der hörpädagogischen Förderung gab, mögen die Hauptgründe dafür gewesen sein, daß bei SABINE der Einsatz einer Sprachaufbauförderung unterblieb, welcher bei dem geistig sehr aufgeweckten Kind sehr wohl möglich gewesen wäre.
SABINE fuhr nur sehr unregelmäßig mit ihrer Mutter in den Jahren 1984 bis 1987 zu Hörgerätekontrollen und Nachuntersuchungen in die Universitätsklinik nach Innsbruck (27. Februar 1984, 2. April 1984, 22. Oktober 1984, 19. September 1985, 19. Mai 1987 und 12. August 1987). Ab dem Jahr 1987 wurde Sabine erstmals logopädisch betreut. Die Logopädin sah sich aber nach wenigen Wochen überfordert und lehnte die weitere Verantwortung für die Betreuung ab, da bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Sprachanbahnung vorgenommen worden war.
Es war auch dem Vorstand der Lebenshilfe und mir persönlich nicht möglich, innerhalb weniger Wochen eine dem gehörlosen Kind entsprechende Fachkraft zu finden, die mit SABINE eine Sprachaufbauförderung begleitend im Kindergarten durchführen konnte.
Aus diesen Gründen und auf Anraten der Universitätsklinik Innsbruck entschloß sich die Mutter, SABINE in den Kindergarten der »Landessonderschule für Hör- und Sprachgestörte Kinder« in Mils bei Innsbruck zu schicken. Dort sollte sie die entsprechende Sprachaufbauförderung erhalten.
Um die emotionale und psychische Entwicklung des Kindes nicht zu gefährden, um auch die enge Mutter-Kind-Beziehung zu erhalten, übersiedelte sie mit ihrer Tochter nach Innsbruck.
Vom 26. November 1987 an besuchte SABINE den Kindergarten in Mils.
Schon im März 1988 kehrte die Mutter mit SABINE wieder in ihren ursprünglichen Heimatort zurück. Die Mutter berichtet:
"SABINE und ich, wir waren sehr unglücklich. Wir haben uns in der fremden Umgebung und in der fremden Stadt überhaupt nicht eingewöhnen können. Sabine ist immer öfter krank geworden und sie wollte auch nicht mehr in den Kindergarten gehen.[11] Sie wollte wieder nach Hause zur Großmutter."
In den 3 1/2 Monaten bis Ende März 1988 war SABINE nur 45 Tage im Kindergarten (November 3 Tage, Dezember 10 Tage, Jänner 14 Tage, Februar 13 Tage und März 5 Tage. - BERICHT über SABINE aus dem Kindergarten).
Ende Mai 1988 wandte sich Sabines Mutter nochmals an den Vorstand des »E1temvereins für Behinderte der Lebenshilfe Außerfern«, diesmal mit der Bitte um Hilfe, ob SABINE ab Herbst 1988 zu Hause in die Schule gehen könne.
Nochmals bei der Leitung der Volksschule ihres Heimatdorfes Lechaschau vorzusprechen, das versuchte die Mutter nicht mehr, da schon bei der Schuleinschreibung sich Schulleitung und Lehrer als nicht zuständig erklärten.
Um für SABINES schulische Situation eine Lösung zu finden, führte ich innerhalb der nächsten Tage sehr viele Gespräche sowohl mit verschiedenen Personen des Vorstandes des Elternvereins, als auch vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen meiner Schule. Eingebunden in all die Kontaktgespräche waren der Obmann des »Elternvereins für Behinderte« Heinz Forcher und auch der Volksschullehrer Roland Astl.
Für die Planung und Einrichtung eines Schulversuchs galten die Bestimmungen aus dem Bundesgesetz vom 9. Juni 1988, BGB1.Nr. 327, mit dem das Schulorganisationsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz geändert wurden (11. Schulorganisationsgesetz - Novelle).
"Schulversuche:
§ 7.
-
Soweit dem Bund die Vollziehung auf dem Gebiet des Schulwesens zukommt, kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport oder mit dessen Zustimmung der Landesschulrat (Kollegium) zur Erprobung besonderer pädagogischer oder schulorganisatorischer Maßnahmen, abweichend von den Bestimmungen des II. Hauptstückes, Schulversuche an öffentlichen Schulen durchführen. Hierzu zählen auch Schulversuche zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte sowie zur Verbesserung didaktischer und methodischer Arbeitsformen (insbesondere sozialer Arbeitsformen) an einzelnen Schularten.
-
Als Grundlage für Schulversuche sind Schulversuchspläne aufzustellen. die das Ziel der einzelnen Schulversuche, die Einzelheiten ihrer Durchführung und ihre Dauer festlegen. Die Schulversuchspläne sind in den Schulen, an denen sie durchgeführt werden, durch Anschlag während eines Monats kundzumachen und anschließend bei den betreffenden Schulleitungen zu hinterlegen; auf Verlangen ist Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren.
-
Soweit bei der Durchführung von Schulversuchen an öffentlichen Pflichtschulen deren äußere Organisation berührt wird, bedarf es einer vorherigen Vereinbarung zwischen dem Bund und dem betreffenden Bundesland
-
An Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht bedarf ein vom Schulerhalter beabsichtigter Schulversuch der Bewilligung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport, um die im Wege des Landesschulrates anzusuchen ist Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt werden, ein Schulversuchsplan gemäß Abs. 2 vorliegt und der im Abs. 7 angeführte Hundertsatz nicht überschritten wird Die Bewilligung umfaßt auch die Genehmigung des Schulversuchsplanes.
-
Vor der Einführung eines Schulversuches an einer Schule ist das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß zu hören.
-
Die Schulversuche sind von der Schulbehörde erster Instanz, bei allgemeinbildenden Pflichtschulen von der Schulbehörde zweiter Instanz, zu betreuen, zu kontrollieren und auszuwerten, wobei Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbildung herangezogen werden können. Hierbei kommt gemäß § 9 des Artikels II der 4. Schulorganisationsgesetz - Novelle, BGBL Nr. 234/1971, für den betreffenden Bereich geschaffenen Einrichtungen zur Schulentwicklung beratende Tätigkeit zu.
-
Die Anzahl der Klassen an öffentlichen Schulen, an denen Schulversuche durchgeführt werden, darf 5 vH der Anzahl der Klassen an öffentlichen Schulen im Bundesgebiet, soweit es sich aber um Pflichtschulklassen handelt, 5 vH der Anzahl der Klassen an öffentlichen Pflichtschulen im jeweiligen Bundesland nicht übersteigen. Gleiches gilt sinngemäß für Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht."
"Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder:
§ 131 a.
-
Für die Erprobung von Maßnahmen zur Ermöglichung des gemeinsamen Unterrichtes behinderter Kinder und nichtbehinderter Kinder in Schulklassen können bis einschließlich zur 8. Schulstufe sowie im Polytechnischen Lehrgang Schulversuche durchgeführt werden.
-
Innerhalb der Versuchsklassen können Lehrpläne verschiedener Schularten oder Schulstufen Anwendung finden. wobei der für das Kind gewählte Lehrplan insoweit in der Schulnachricht (§ 19 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBL Nr. 472/1986, in seiner jeweils geltenden Fassung) sowie im Jahreszeugnis und im Jahres- und Abschlußzeugnis und in der Schulbesuchsbestätigung (§ 22 des Schulunterrichtsgesetzes) zu vermerken ist:, als dieser vom Lehrplan jener Schule an der der Schulversuch geführt wird, abweicht.
-
Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen sind Unterrichtsformen und Differenzierungsmaßnahmen zu erproben. die ein größtmögliches Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen ermöglichen. Hierbei ist bei Bedarf ein zusätzlicher, sonderpädagogisch qualifizierter Lehrer heranzuziehen.
-
(Grundsatzbestimmung) Für Pflichtschulen gilt der letzte Satz des Abs. 3 als Grundsatzbestimmung.
-
Schulversuche im Sinne des Abs. 1 dürfen in nicht mehr Klassen durchgeführt werden, als 10% der Sonderschulklassen des betreffenden Bundeslandes entspricht
-
Schulversuche im Sinne des Abs. 1 können in den Schuljahren 1988/89 bis 1992/93 begonnen werden. Sie sind je nach der Zahl der in Betracht kommenden Schulstufen auslaufend abzuschließen.
-
Für Schulversuche im Sinne des Abs. 1 ist § 7 Abs. 1 bis 6 anzuwenden."
Auszug aus dem Grundsatzerlaß: Körperbehinderte oder sinnesbehinderte Kinder im Schulwesen Österreichs
(Erlaß des BMUKS Z 36 153/20-1/1 c/86 vom 29. April 1986)
''Das österreichische Schulwesen baut auf der Zielsetzung auf, jedes Kind seiner Altersstufe und Bildungsfähigkeit entsprechend bestmöglich zu fördern.
Von einer gemeinsamen Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder sind erfahrungsgemäß positive Auswirkungen hinsichtlich der Entwicklung gegenseitigen Verständnisses und anderer wichtiger Qualitäten des Zusammenlebens zu erwarten. Entsprechend den allgemeinen Zielsetzungen des österreichischen Schulwesens und mit Bezug auf den didaktischen Grundsatz, die Eigenart des Schülers und seine Entwicklungsstufe zu berücksichtigen. muß es daher ein wichtiges Anliegen sein, benachteiligte oder beeinträchtigte Kinder besonders zu unterstützen. Dies verlangt auch einen besonderen Einsatz des Lehrers und der Schulgemeinschaft und stellt die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit des allgemeinen Schulwesens unter Beweis.
-
Bildungs-und Schullaufbahnberatung für körper- oder sinnesbehinderte Kinder Bei körper- oder sinnesbehinderten Kindern sind Bildungswegentscheidungen häufig mit Unsicherheiten besetzt und schwierig zu treffen. Besonders relevant ist dabei die Frage, ob bei entsprechender Förderung der Besuch einer allgemeinen Schule möglich ist oder ob eine Aufnahme oder ein Verbleib in einer Sonderschule den günstigeren Bildungsweg für ein Kind darstellt Sowohl die Eltern oder Erziehungsberechtigten als auch der Schulleiter und die Lehrer einer allgemeinen Schule benötigen bei diesen Entscheidungen von großer Tragweite eine umfassende Information und Beratung.
-
Zur Beurteilung der Sonderschulbedürftigkeit Aus der Formulierung des Schulpflichtgesetzes und aus sonderpädagogischen Erkenntnissen ergibt sich, daß eine Behinderung erst dann pädagogisch relevant wird, wenn die Bildungsfähigkeit eines Kindes betroffen ist. Eine Sinnes- oder Körperbehinderung für sich allein begründet daher nicht zwingend oder automatisch Sonderschulbedürftigkeit. Vielmehr besuchen viele nach Art und Umfang unterschiedlich behinderte Kinder schon derzeit allgemeine Schulen, weil sie nach der oben zitierten Bestimmung des Schulpflichtgesetzes dem Unterricht zu folgen vermögen. Bei der Beurteilung der Bildungsmöglichkeiten eines sinnes- oder körperbehinderten Kindes ist in jedem Fall die Möglichkeit zu prüfen, ob auch eine allgemeine Schule besucht werden kann. Auf die Bestimmungen über die probeweise Aufnahme gemäß § 8 des Schulpflichtgesetzes und die Durchführung von Kursen zur Überprüfung der Sonderschulbedürftigkeit gemäß § 25 Bbs. 6 des Schulorganisationsgesetzes wird besonders hingewiesen. Gemäß § 8a des Schulpflichtgesetzes kann diese Prüfung auch erforderlich sein, wenn nach einer erfolgreichen Förderung in der Sonderschule die Voraussetzungen für den Sonderschulbesuch wegfallen. Vor einer Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes sind alle Möglichkeiten für organisatorische, pädagogische und therapeutische Hilfeleistungen zu prüfen, welche die Leistungsfähigkeit einer allgemeinen Schule so erweitern können, daß auch ein sinnes- oder körperbehindertes Kind das Lehrziel der Schulart erreichen bzw. langfristig und erfolgreich gebildet werden kann. Für Kinder mit Beeinträchtigungen, die dem Unterricht einer allgemeinen Schule nicht zu folgen vermögen (§ 8 des Schulpflichtgesetzes), stehen im allgemeinbildenden Schulwesen verschiedene Arten von Sonderschulen (§ 25 des Schulorganisationsgesetzes) zur Verfügung. Wird eine Sonderschulbedürftigkeit erkannt, sollten die erforderlichen Maßnahmen für eine Aufnahme möglichst umgehend erfolgen, um einen angemessenen Bildungserwerb zu sichern.
-
Allgemeine Feststellungen zur Aufnahme eines körper- oder sinnesbehinderten Kindes Voraussetzung der Aufnahme eines körper- oder sinnesbehinderten Kindes in eine allgemeine Schule ist, daß der Schwer grundsätzlich dem Unterricht zu folgen vermag und auch die Unterrichtsziele erreichen kann. Für spezielle Fragen (z.B. den Einsatz behinderungsspezifischer Hilfsmittel während des Unterrichts) ist es notwendig, daß eine Fachberatung in Anspruch genommen werden kann.
-
Hörbehinderte Kinder Hörbehinderte Kinder sind im allgemeinen Unterricht vor allem von Aufnahme- und Verständnisschwierigkeiten betroffen. Häufig resultieren aus der Behinderung auch Sprachentwicklungsstörungen, die fachpädagogisch betreut werden sollten. Die bestmögliche Hörgeräteversorgung muß bei hörbehinderten Kindern sichergestellt sein. Bei der Unterrichtsgestaltung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß der Hörtest des hörbehinderten Kindes optimal genützt werden kann (Nähe zur Schallquelle, Ausschaltung von Störgeräuschen, zusätzliche Ablesemöglichkeit usw.) und zusätzliche technische Medien bzw. visuelle Hilfen geboten werden (Texte, Veranschaulichungen usw.). Bei hochgradig hörbehinderten Kindern ist im Einzelfall zu überprüfen, inwieweit ihr zusätzlicher Förderbedarf und ihre sprachliche Entwicklung es angeraten erscheinen lassen, den Unterricht einer Volks- oder Hauptschule für schwerhörige Kinder zu besuchen.
-
Einschränkende Bemerkungen Trotz der grundsätzlichen Befürwortung eines gemeinsamen Unterrichtes von behinderten und nichtbehinderten Kindern können gewichtige Gründe auch gegen eine solche Maßnahme sprechen. Die besonderen Lernvoraussetzungen einzelner behinderter Kinder können manchmal einen Unterrichtsaufbau und eine Unterrichtsführung erfordern, wie sie an einer allgemeinen Schule nicht geboten werden können. Bei der Unterrichtsgestaltung darf nicht im Sinne einer falsch verstandenen Integration und zu Lasten einer grundlegenden Ausbildung des behinderten Kindes auf notwendige Leistungsanforderungen und Fertigkeiten völlig verzichtet werden. Durch die erhöhten Anforderungen und Belastungen, denen das behinderte Kind unterliegt, um die Folgen seiner Beeinträchtigung auszugleichen, kann auch die Gesamtentwicklung ungünstig beeinflußt werden. In diesem Fall oder wenn wesentliche medizinische Gründe dies erfordern, ist zu prüfen, ob nicht eine Aufnahme in eine Sonderschule der Bildungssituation des Kindes besser gerecht werden kann. Beim vollständigen Ausfall des Seh- oder Hörvermögens (praktischer oder vollständiger Blindheit oder Gehörlosigkeit) ist derzeit im allgemeinen die Aufnahme in eine Sonderschule erforderlich, weil dort die erforderlichen kompensatorischen Techniken ausgebildet werden können."
Zum besseren Verständnis der Ausgangssituation bzw. dem Diskussionsstand zum Zeitpunkt der Projektausarbeitung und deren Einreichung erscheint es mir notwendig, stichwortartig auf die geschichtliche Entwicklung der schulischen Integration in Österreich und im speziellen im Bezirk Reutte näher einzugehen.
Damit verflochten ist bis zum heutigen Tag auch meine persönliche Erweiterung an Erkenntnissen und Erfahrungen zum gemeinsamen Leben und Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der Schule.
Während in Italien im Jahr 1911 durch ein Gesetz die schulische Integration als verbindliche Grundlage in Kraft trat, begannen sich in Österreich Elterninitativen verstärkt erst mit dem "Internationalen Jahr behinderter Personen 1981" mit dem Thema "Leben ohne Aussonderung" als ein fundamentales Menschenrecht auseinanderzusetzen und damit auch den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder zu fordern.
Zwar gab es in Österreich mit dem Schulversuch "Integrierte Grundschule"[12] bereits im Schuljahr 1914/15 erste Versuche eines gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Kinder, aber diese nicht von der Basis der Eltern getragenen Bestrebungen liefen mit der 1. Novelle zum Schulorganisationsgesetz wieder aus.
Eine Club 2 - Diskussion und eine erste Unterschriftenaktion (''Unterschriftenaktion zur Abschaffung von Sonderkindergärten und Sonderschulen in Österreich") zur Abschaffung von Sonderkindergärten und Sonderschulen in ganz Österreich lösten einerseits heftige Diskussionen innerhalb der Sonderschullehrerschaft Österreichs aus, andererseits konnten durch ein beigelegtes Informationsblatt erste Informationen über die schulische Integration im Ausland an einen kleinen Kreis von Eltern, Fachleuten und Lehrern herangetragen werden.
Eine 1981 von Rudolf Forster veröffentlichte Studie: »Normalisierung und Ausschließung - über die Berufsfindung und das Lebensschicksal von Sonderschulabgängern« führte zu verstärkten Auseinandersetzungen und Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern der neuen Integrationsbewegung.
U.a warnt Univ.-Prof. Dr. Andreas Rett, Vorstand des Neurologischen Krankenhauses der Stadt Wien-Rosenhügel, im offiziellen Organ des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, "Mitteilungen der Österr. Sanitätsverwaltung" Heft 6 (1981) davor, daß durch "jene Integrationsfanatiker die geistig schwer Behinderten zu "Sozial-Maskottchen" gemacht werden".
Die ersten Versuche schulischer Integration
Die ersten Schulversuche zum gemeinsamen Lernen wurden (und werden immer noch) durch die Initiative einiger regionaler Gruppen von betroffenen Eltern unter Mithilfe von Lehrern, Therapeuten und anderen Fachleuten eingerichtet.
Motiviert durch erfolgreiche Versuche z.T. in privaten Kindergärten, gelang es 1984 einer Elterninitiative im Burgenland, die erste integrative Volksschulklasse einzurichten.
1985 folgten dann die ersten Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Steiermark und in Tirol.
Zum Stand der Integration im Jahr 1988 in Österreich
Dr. Karl Köppel in "Betrifft: Integration" Nr.2/Mai 1988
''Wo wir stehen:
Es gibt mehrere kleine, aber sehr effektive Gruppen von Eltern und Lehrern in verschiedenen Bundesländern, die imstande sind, politischen Druck zu machen. Es existieren Modellversuche im Burgenland, in der Steiermark. in Tirol Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Es ist bewiesen, daß Integration, wie wir sie verstehen, möglich ist; man braucht nicht mehr auf ausländische Beispiele und Erfahrungen hinzuweisen, spricht man für Integration.
Mehr und mehr wird Integration auch ein Thema in der Öffentlichkeit - die Basis verbreitert sich. Eine gesetzliche Grundlage verbreitert sich. Eine gesetzliche Grundlage der Modelle scheint in Form der nächsten Novelle des Schulunterrichtsgesetzes bevorzustehen. Eine Ver-(Partei-)politisierung konnte bisher zum Glück vermieden werden: Die Fronten ziehen sich quer durch die beiden großen Parteien.
Auf der Ebene der Didaktik haben wir zu einem großen Sprung angesetzt (siehe unten).
Wohin wir wollen:
Gesellschaftspolitisch geht es um die Abschaffung der Integration: Ohne Aussonderung gibt es auch keine Integration mehr.
Administrativ ist Dezentralisierung gefordert Eltern und Lehrer bestimmen in erster Linie die praktische Umsetzung der Ziele. Verschiedene individuelle, regionale und soziale Bedingungen müssen zu verschiedenen Modellen führen, wenn sie "passen" sollen.
Didaktisch geht es um
-
Verwirklichung eines zieldifferenzierten Lernens. Die Schüler lernen nach ihrem individuellen Entwicklungsniveau. Das gilt für jeden Schüler, also auch für behinderte und für hochbegabte.
-
Zweilehrersystem
-
Verbale Beurteilung
-
Therapien in der Klasse
-
"Offenes Lernen" und Projektarbeit.
Individuell und sozial geht es um das verbesserte Fruchtbarmachen des persönlichen Potentials im Dienste eines befriedigenden Zusammenlebens.
Woran wir scheitern können:
An der Emotionalisierung einzelner Fragen, wie der verbalen Beurteilung und der Schu1e der 10- bis l4jährigen. Am Abschieben der Modelle als Schu1versuche oder Vorzeigeschu1en in ''Reservate'' - Integration kann nur gesamtgesellschaftlich realisiert werden. An der Ökonomie, zumindest an der falschen Verteilung von Mitteln.
Am unversöhnlichen Auseinanderklaffen gesellschaftlicher Entwicklungen: Hier Föderalismus, Individualismus, Demokratisierung - dort Zentralismus, Institutionalisierung und Überwachung. In Österreich wird diese Polarisierung deutlich, wenn man das sogenannte Kärntner "Pädagogen" - Modell zum zweisprachigen Unterricht mit den hier genannten Zielen vergleicht.
Zusammenfassend möchte ich davor warnen, Integration als pädagogische Mode abzutun. Die Integrationsbewegung ist einer der zahlreichen Akte der Gegenwehr gegen die rücksichtslose und totale Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Natur entspricht demselben Geist der Desintegration wie die Aussonderung der Behinderten. Genausowenig. wie wir die Natur zerstören können, ohne uns selbst zu zerstören, können wir Behinderte aussondern, ohne uns selbst zu behindern."
In Tirol gab es bis zum Schuljahr 1985/86 noch keinen Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder. Da ich nicht nur im Vorfeld der Vorbereitung zum ersten integrativen Schulversuch in Weißenbach/Lech intensiv beteiligt war, sondern letztlich auch das Projekt in Zusammenarbeit mit der Schulpsychologin des Bezirkes Reutte ausarbeitete, erscheint es mir wichtig, diese ersten Erfahrungen festzuhalten.
Denn gerade dieser Schulversuch hat in den folgenden Jahren im Bezirk Reutte vor allem durch seine Dynamik, aber auch durch die große Emotionalität innerhalb und außerhalb der Schulen zu zahlreichen Diskussionen und Auseinandersetzungen geführt. Er beeinflußte aus meiner Sicht ganz besonders die Entstehungsgeschichte des von mir in dieser Arbeit dokumentierten Schulversuchs an der Volksschule in Reutte im Schuljahr 1988/89 (s. Kap. III/2.5.1, S. 70 ff.), und trägt wesentlich zum Verständnis bei der Entwicklung des Integrationsdenkens im Bezirk Reutte bei.
Erste persönliche Erfahrungen:
In der konkreten Vorbereitungsphase des Schulversuchs in Weißenbach besuchte ich im Rahmen einer Exkursion eine Volksschulklasse in Brixen / Südtirol, um dort eine Integrationsklasse kennenzulernen und um einen Einblick in die Unterrichtspraxis des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern zu gewinnen.
Diese Exkursion verlief für mich aber sehr enttäuschend, denn von einem gemeinsamen Unterricht aller Kinder war sehr wenig zu beobachten. Im Gegenteil, es war sogar noch der Schulhof unterteilt, wobei im schattigen Teil die italienischen Kinder und im sonnigen Teil die deutschsprachigen Kinder ihre große Pause verbrachten. In einer eigenen Klasse wurden fünf schwerstbehinderte Kinder von vier Lehrerinnen unterrichtet. Zumindest zu diesem Zeitpunkt war an dieser Schule der vom Gesetz vorgesehene gemeinsame Unterricht aller Kinder noch nicht realisiert worden.
Trotzdem gab es für mich bei diesem Schulbesuch wichtige und vor allem interessante Gespräche mit einigen Lehrerinnen und Lehrern der Schule, die einerseits den gemeinsamen Unterricht für alle Kinder als wünschenswert und richtig ansahen, andererseits aber in den einfachsten Bestrebungen hin zur Realisierung so große Probleme hatten. Aus ihrer Sicht lagen u.a. die größten Schwierigkeiten an der Schwerfälligkeit der Schuladministration, der mangelnden Unterrichts- und Praxisbegleitung, aber vor allem, daß sie auf diese neuen Aufgaben, z.B. der Unterrichtsdidaktik, in keiner Weise vorbereitet waren.
Diese aus den unterschiedlichsten Gründen und Motiven mangelnde konstruktive Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts traf auch auf unseren ersten Schulversuch im Bezirk Reutte zu.
Im folgenden Abschnitt möchte ich einerseits in Stichworten die wesentlichsten Gründe dafür aufzeigen, warum dieser erste integrative Schulversuch in Weißenbach nach dem ersten Schuljahr zu scheitern drohte. Andererseits waren es wichtige Erfahrungen, die wir bei unserem Projekt an der Volkschule Reutte entsprechend berücksichtigen und beachten konnten. Ein weiterer Grund besteht darin, daß gerade dieser Schulversuch, der nicht nur im Dorf Weißenbach, sondern im ganzen Bezirk Reutte zu einem sehr emotional geführten Thema anwuchs, besonders die Lehrerschaft zu einer so massiv ablehnenden Haltung beeinflußte. Aus heutiger Sicht ist damit u.a. auch die große mehrheitliche Ablehnung der Integration durch die Lehrer und Lehrerinnen und die damit verbundenen, und heute noch bestehenden Schwierigkeiten an der Volksschule Reutte zu erklären. Daß der Schulversuch ab dem zweiten Schuljahr mit zwei anderen Lehrerinnen dann ganz hervorragend verlief, hatte über Jahre hinweg besonders in der Lehrerschaft nur mehr sehr wenig Beachtung gefunden.
-
Bis zum ersten Schultag des beginnenden Schuljahres 1985/86 gibt es keine definitive Zusage des Ministeriums oder des Landesschulrates von Tirol, daß dieser Schulversuch genehmigt und damit durchgeführt werden kann. Damit ist eine große Verunsicherung der kommenden Arbeitssituation der beiden Lehrerinnen verbunden.
-
Die Volksschul- und die Sonderschullehrerin wollen den Schulversuch durchführen, haben sich aber über ihre gemeinsame Arbeit während der ganzen Phase der Erstellung des Schulversuchsantrages nicht wenigstens einmal vor dem ersten Schultag zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch getroffen.
-
Die Sonderschullehrerin hat den schwerst mehrfachbehinderten Buben Ernst vor dem ersten Schultag noch nie gesehen. Da ihr Motiv, in einer Integrationsklasse zu unterrichten, darin besteht, "normal" und ohne schwerstbehinderte Kinder arbeiten zu können, ist die Situation für sie besonders frustrierend.
-
Während der meisten Unterrichtsstunden gehen die beiden Lehrerinnen nach dem Motto vor: Meine Kinder - deine Kinder. Beide Lehrerinnen halten an ihren Vorstellungen von Unterricht fest, und so kommt es bei diesem "Nur -Nebeneinander" zu immer größeren Konflikten.
-
Auch unter Mithilfe der Schulpsychologin gibt es keine gemeinsame Unterrichtsplanung oder Kooperation zwischen den beiden Lehrerinnen. Die Volksschullehrerin und gleichzeitig Direktorin der Schule verweist auf ihre mehr als 30jährige Erfahrung und Unterrichtspraxis, die junge Sonderschullehrerin wiederum verweist auf ihre sonderpädagogische Spezialausbildung.
-
Es kommt zu einer überhöhten Erwartungshaltung in Bezug auf die Arbeitsleistungen der behinderten Kinder. Ernst z.B. muß über mehrere Wochen nur "Kreise" zeichnen; und zwar deshalb, weil er nicht "begreifen" will, daß ein Kreis rund und geschlossen ist und "keine offenen Stellen" hat.
Schulübergreifende Reaktionen:
Zum Ende des ersten Schuljahres informieren die Lehrerinnen im Rahmen eines Elternabends die Eltern über ihre Erfahrungen, ihre Arbeit und ihre Erkenntnisse aus dem Schulversuch.
Sie erklären offen, daß der schwerstbehinderte Ernst in der Klasse "stört", und dadurch die "Leistungen" der übrigen Kinder stark beeinträchtigt werden. Aufgrund dieser Aussagen werden einerseits die engagierten und dem Schulversuch positiv gegenüberstehenden Eltern verunsichert, zum anderen werden die Eltern, die schon von Beginn an diesem Versuch skeptisch gegenüberstanden, in ihrer eher ablehnenden Haltung bestärkt und bestätigt.
"Schule" wird erstmals zu einem öffentlichen Thema. Über "Schule und Unterricht" wird plötzlich nicht mehr nur am Elternsprechtag, an einem Elternabend einmal im Jahr oder innerhalb der Familie gesprochen. Über das Thema "Schule" wird im Dorf, auf der Straße, im Gasthaus und am Arbeitsplatz diskutiert.
Viele Lehrer und Lehrerinnen erachten das Engagement der Eltern behinderter Kinder in Angelegenheiten der Schule als nicht zu duldende Einmischung.
Besonders die auch offen ausgetragenen persönlichen und pädagogischen Schwierigkeiten der beiden Lehrerinnen miteinander, ihre negativen Stellungnahmen zum Unterricht verbreiten eine äußerst ablehnende Haltung nicht nur in der Lehrerschaft, sondern auch in Teilbereichen der Öffentlichkeit.
Dazu kommt, daß beide Lehrerinnen am Ende des ersten Schuljahres erklären, daß sie am Beispiel von "Ernst" sehen, ja sogar selbst im Klassenzimmer die Erfahrung gemacht haben, wo die Grenzen der Integration liegen. Im zweiten Schuljahr führen sie den Schulversuch nicht weiter.
Der Vater von Ernst
Nicht nur in der Besonderheit des Schulversuches von Weißenbach, in dem sein Kind eines der drei Gutachtenkinder ist, sondern in der gesamten Integrationsbewegung Österreichs nimmt der Vater von Ernst eine ganz außergewöhnliche Position ein.
Seine Persönlichkeit, sein unbeirrbares soziales Engagement und die damit verbundene Stellung in der Öffentlichkeit sind bis zum heutigen Tag im Bezirk Reutte noch immer mit überaus großen Emotionen verbunden.
Seinem unermüdlichen Einsatz aber ist es vor allem zu danken, daß in etwa zwei Monaten in Österreich es voraussichtlich gesetzlich verankert sein wird, daß behinderte Kinder gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in einer Schule, in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden.
Ernsts Vater berichtet:
''Nach gründlicher Überlegung, vorheriger Besichtigung und ausführlichen Gesprächen mit den dort arbeitenden und verantwortlichen Personen waren meine Frau und ich gezwungen, Ernst im Jänner 1984 in das 100 Kilometer entfernte Elisabetbinum in Axams zu geben. Die ''Notwendigkeit'' ergab sich aufgrund der nicht vorhandenen therapeutischen Möglichkeiten im Heimatbezirk. Vielleicht kann man sich vorstellen, in welcher Verfassung wir waren, als wir uns genötigt sahen, Ernst, unser Kind, wegzugeben und fremden Menschen anzuvertrauen. Beim ersten Auseinandergehen hat Ernst es uns relativ leicht gemacht, weil er beeindruckt und begeistert war von der neuen Umgebung, den netten Menschen, von den neuen Spielsachen und dem bunten Kugelbad. Er hat uns gehen lassen, weil zu diesem Zeitpunkt für ihn das Neue faszinierend wirkte. Er konnte natürlich nicht wissen, daß das der Beginn einer langen und sich immer wiederholenden Trennung von seiner gewohnten Umgebung und seiner Familie war und daß nicht nur ein "Spieltag", sondern eine ganze Woche Therapie auf ihn wartete. Für uns kam eine endlos scheinende erste Woche, die wir durch mehrmalige Telefonate mit unserem Kind zu verkürzen versuchten. Dabei bemerkten wir sofort an seinem Verhalten, wie sehr auch ihn die Trennung belastete und traf.
Natürlich ist auch diese erste Woche vorbeigegangen, und ich habe Ernst am Freitag mittag nach Hause geholt Auf die überschwengliche Freude, mit seinem Papa wieder nach Hause fahren zu können, folgte aber unausweichlich der Montag, an dem ich Ernst wieder ins Heim bringen mußte. Schon während der Fahrt nach Axams spürte er, daß es eine neuerliche Trennung geben werde, und er gab mir mehrmals zu verstehen, daß er gerne wieder zu seiner Mama möchte. Die folgende Abschiedsszene war sicher eines jener Erlebnisse, durch welches ich in meinem Innersten zutiefst getroffen und für mein weiteres Leben bestimmt wurde. Noch heute habe ich dieses Bild vor Augen, wie Ernst voll ohnmächtiger Verzweiflung seine ganze Not herausbrüllte, ja, wie es geradezu aus ihm herausbrach. Es war ganz, ganz furchtbar. Wie ein Brandmal prägte sich diese Szene in mir ein. Jedenfalls war für mich der Punkt erreicht, an dem ich etwas unternehmen mußte, an dem ich nicht mehr bereit war, jene Umstände zu akzeptieren, die für seine ohnmächtige Verzweiflung und meinen Zorn verantwortlich waren. Ich habe das Gefühl, daß in diesem Moment die Energie freigesetzt wurde, von der ich bis heute getrieben werde, die mich dazu bringt zu versuchen, die Situation für mein Kind und für die behinderten Menschen generell zu verbessern. Ich bin zutiefst überzeugt Nur wenn die Lebenssituation für alle behinderten Menschen in Österreich verbessert wird, kann mein Sohn Ernst in einem Klima leben, das dauerhaft seinen Bedürfnissen gerecht wird. Meiner Überzeugung nach ist eine Verbesserung der Lebensumstände für behinderte Menschen gleichzeitig die Voraussetzung für eine Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen. Ich bedaure es sehr, daß mir diese grundsätzliche Einstellung immer wieder als parteipolitisches Interesse (ich bin aktives SPÖ -Mitglied) ausgelegt wird."
(Forcher, 1989, S. 84 - 85).
Das Gebäude der Volksschule Reutte, in dem auch die Allgemeine Sonderschule und der Polytechnische Lehrgang untergebracht sind, steht im Zentrum der Marktgemeinde Reutte.
Im Schuljahr 1988/89 besuchen beinahe 500 Schülerinnen und Schüler diese drei Schulen, wobei in der Volksschule ca. 330 und in der Sonderschule 45 Kinder sind. Diese 330 Kinder werden in 12 Klassen von ca. 25 Lehrern und Lehrerinnen, einschließlich der Arbeitslehrerinnen und Religionslehrer, unterrichtet. Bis zum Schuljahr 1986/87 ist die Schule auf zwei Schulleitungen aufgeteilt, und ab dem Schuljahr 1987/88 wird sie als eine Volksschule mit einem vom Unterricht freigestellten Leiter geführt.
Trotz mehrmaliger Versuche meinerseits, auch unter der Mithilfe der für den Bezirk Reutte zuständigen Schulpsychologin und der Bitte um Unterstützung beim Bezirksschulinspektor [13] ist es nicht möglich, nach Einrichtung des ersten integrativen Schulversuchs in Weißenbach in einer pädagogischen Konferenz die Kollegenschaft der Volksschule Reutte über den Schulversuch in Weißenbach zu informieren.
Auch die Sonderschule Reutte ist wie das gesamte Sonderschulwesen deshalb entstanden, weil die allgemeine Schule nicht bereit und nicht fähig war, auch Kinder, "die infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volksschule nicht zu folgen vermögen, aber dennoch bildungsfähig sind" (Lehrplan der Sonderschule, 1962, S. 21), aufzunehmen und zu unterrichten.
Das historische Verdienst der Sonderschulen und damit ihrer Betreiber lag allgemein in dem Bemühen, sich gerade der Kinder anzunehmen, die die allgemeine Schule oder eben die "Schule des Volkes" entweder erst gar nicht in ihre Klassen hereinließ oder dann letztlich auf die hinterste Schulbank verbannte und damit meist vergaß.
H. Wocken über die Lehre aus der Geschichte der Sonderschule beim 5. Gesamtösterreichischen Symposium "Schule ohne Aussonderung - Leben ohne Aussonderung" 1989 in Reutte:
"Sonderschulen gab es deshalb, weil die allgemeine Schule unvollkommen war. Weil die allgemeine Schule nicht fähig oder nicht bereit war, auch behinderte Kinder zu unterrichten, entstanden Sonderschulen. Sonderschulen, wie auch andere sonderpädagogische Einrichtungen, waren und sind auch deshalb nichts anderes als Ersatzlösungen, die ersatzweise jene pädagogischen Hilfen anbieten, die es in allgemeinen Schulen nicht gibt. Bildlich gesprochen: Sonderschulen sind gleichsam Notaufnahmelager, die behinderte Kinder und Jugendliche deshalb aufnehmen, weil sie andernorts keine Herberge und kein Zuhause gefunden haben.
Notaufnahmelager sind keine Lebensstätten für immer und ewig. Ein Notaufnahmelager ist ein Provisorium, das lediglich für eine vorübergehende Inanspruchnahme gedacht ist. Sonderschulen waren historisch notwendig, eine immerwährende Bestandsgarantie kann indes für Übergangs- und Hilfslösungen nicht gewährt werden.
Heute ist es an der Zeit, die Sonderschulen und die Sonderpädagogik vor einem historischen Sündenfall eindringlich zu warnen. Auf das historische Verdienst der Sonderschulen fällt mehr und mehr ein Schatten. Die langandauernde Praxis der Aussonderung und Sonderbeschulung hat in den Sonderschulen das Bewußtsein aufkommen lassen, als ginge es gar nicht anders, ja als seien Sonderschulen auch der einzig mögliche Lernort für behinderte Kinder. Der Sündenfall der Sonderschulen beginnt da, wo sie das pädagogische Monopol für behinderte Kinder beanspruchen und wo sie schulische Aussonderung als einzige Möglichkeit, als das Beste für behinderte Kinder oder gar als das Ideal schlechthin bezeichnen."
Im Schuljahr 1954/55 wurde durch den Einsatz und die besondere Sorge um Kinder, die vor allem schulische Lernprobleme hatten, und unter dem Verzicht einer Direktionsstelle an der Volksschule Reutte vom damaligen Volksschullehrer E. S. die·erste Sonderschulklasse mit "lernschwachen" Kindern eingerichtet und an die Volksschule Reutte angeschlossen.
Im Schuljahr 1957/58 wurde die Schule zweiklassig, ab 1969/70 dreiklassig und damit auch als selbständige "Allgemeine Sonderschule" geführt. Mit meinem Eintritt in die Schule im Jahr 1971/72 kam noch eine weitere Klasse hinzu. und ab dem Schuljahr 1983/84 wurde mir die Leitung der Schule übertragen.
Vom ersten Tag des Bestehens der Schule an befanden sich alle Sonderschulklassen mit der Volksschule gemeinsam in einem Gebäude. Heute, im Schuljahr 1993/94 beherbergt die Sonderschule nur mehr eine Klasse.
Waren es bei der Gründung der Schule nur "lernschwache" Kinder, so sind es jetzt nur noch sechs "schwerst mehrfachbehinderte Kinder". (Diese Kinder wären noch vor wenigen Jahren als nicht schulfähig erklärt worden).
Durch die Stillegung der Allgemeinen Sonderschule, wurde die Schule im Schuljahr 1992/93 in "Sonderschule für schwerst mehrfachbehinderte Kinder" umbenannt. Diese sechs Kinder, die heute noch die Sonderschule besuchen, sind aber "nicht der harte Kern", Kinder, "die nicht integrierbar" sind, sondern es sind die Kinder, für die auch mir persönlich die Kraft und Energie gefehlt hat, gemeinsam mit den Eltern gegen an die Widerstände von seiten der zuständigen Schulen und damit ihrer LehrerInnen oder auch der Schulbehörde den gemeinsamen Unterricht mit den übrigen Kindern ihres Dorfes oder ihres Sprengels zu erreichen.
Gerade für Kinder mit schweren Behinderungen aber gilt:
"Je schwerer die Behinderung ist, desto notwendiger braucht das Kind die vielfältigen Anregungen der nichtbehinderten Kinder,
-
deren Bewegungen es mit den Augen verfolgen kann,
-
deren Geräusche es mit den Ohren wahrnimmt,
-
deren Gerüche es mit der Nase unterscheiden lernt,
-
deren Hände es am eigenen Körper spürt.
Je schwerer das Kind behindert ist, desto notwendiger braucht dessen Familie die Entlastung und die Unterstützung durch die Gesellschaft, damit die Familie das Kind annehmen und behalten kann. Zu schnell sind wir oft bereit, die Lernmöglichkeiten eines Kindes zu begrenzen, wo es richtiger wäre, die Fähigkeiten und die Veränderungsbereitschaft von Erwachsenen stärker zu fördern." (Schöler, 1990, S. 9 - 10).
10 Jahre Schulleiter der Allgemeinen Sonderschule Reutte
Schon kurz nach Übernahme der Leitung wurde ich sehr energisch, sowohl von den beiden Direktoren der Volksschule als auch von den Vertretern der Gemeinde Reutte aufgefordert, doch zuzustimmen, daß sämtliche Klassen der Sonderschule in das ehemalige alte Schulhaus neben der jetzigen Volksschule

verlegt werden.
Folgende Begründungen wurden hierfür angeführt:
-
Das Volksschulgebäude ist an erster Stelle das Schulhaus für die Volksschüler und erst in zweiter Linie ein Schulhaus für Sonderschüler!
-
Die Kinder der Schwerstbehinderten-Klasse seien "keine Schüler", daher könnten sie besser im Gebäude der Lebenshilfeeinrichtung "unterrichtet" werden.
-
Meinem Anliegen nach Gemeinsamkeit aller Kinder wäre doch durch den gemeinsamen Pausenhof Rechnung getragen und entsprochen.
Im Schuljahr 1986/87 konnte durch die unverrückbare Haltung der gesamten Kollegenschaft eine Verlegung der Sonderschule endgültig abgewendet werden.
Dieses Beharren auf einer "für uns" selbstverständlichen pädagogischen Grundmaxime "ein Schulhaus für alle Kinder" wurde und wird auch heute noch von einer großen Zahl der Lehrer der Volksschule als "stur" und besonders unkollegial ausgelegt.
Die schulische Integration und die Diskussion um das gemeinsame Schulhaus für alle Kinder haben aber zusätzlich in der Kollegenschaft der Sonderschule zu vertiefter und nachhaltiger persönlicher Neuorientierung geführt.
Diese Neuorientierung und veränderte Einstellung der Lehrer zum Unterricht von behinderten Kindern in einer Sonderschule bzw. Sonderinstitution bedingte, ein bisher gewohntes und bekanntes pädagogisches Handeln aufzugeben und sich auf ein ungewisses und zudem von vielen Seiten angefeindetes pädagogisches Neuland zu begeben.
Für die Institution Sonderschule aber bedeutet diese Schulreformaktivität ihrer Lehrer eine "folgenschwere" Veränderung, die bis zur Stillegung oder Auflösung führt.
Einige Aspekte veränderter pädagogischer Haltung:
Rückführung von Kindern in die Regelschule
Beginnend mit dem ersten Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder im Schuljahr 1985/86 konnten wir fast jährlich Kinder aus der Sonderschule in die Regelschule ihrer Heimatgemeinde oder ihres Schulsprengels "zurückführen".
|
Schuljahr 1985/86 |
VS Weißenbach |
1 Kind |
|
Schuljahr 1986/87 |
VS Reutte |
2 Kinder |
|
Schuljahr 1987/88 |
Haushaltungsschule |
1 Kind |
|
Schuljahr 1989/90 |
VS Elmen HS Untermarkt |
1 Kind 4 Kinder |
|
Schuljahr 1990/91 |
HS Elbigenalp |
1 Kind |
|
Schuljahr 1991/92 |
VS Tannheim |
1 Kind |
|
Schuljahr 1992/93 |
VS Nesselwängle |
1 Kind |
|
Schuljahr 1993/94 |
HS Untermarkt Polytechnischer Lehrgang |
1 Kind 1 Kind |
Aufnahmerückgang an der Sonderschule
Mit den Bemühungen, Kinder aus der Sonderschule in die Regelschule "zurückzuführen", wurde gleichzeitig versucht, Kinder mit besonderen Bedürfnissen durch eine entsprechende Frühförderung zu begleiten und dann in den Regelkindergarten ihrer Heimatgemeinde zu integrieren. Als Folge dieser Bemühungen wurde der Sonderkindergarten des Bezirkes Reutte aufgelöst.
In weiterer Konsequenz war es dann für Eltern mit einem behinderten Kind "leichter", ein Schulversuchsprojekt zum gemeinsamen Unterricht aller Kinder im Heimatort zu erwirken.
Damit erübrigte sich eine Einschreibung und eine Schullaufbahn an der Sonderschule.
Stützlehrertätigkeit der Sonderschullehrer
Die Lehrer der Sonderschule sind neben ihrer Tätigkeit an der Schule zusätzlich als Stützlehrer an verschiedenen Volksschulen des Bezirkes tätig, u.a. in Elmen, Heiterwang und Steeg. Durch diese Arbeit in einer Volksschulklasse konnten wichtige Erfahrungen in der Praxis des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Kinder gewonnen werden.
Diese Tätigkeit hatte aber weitere positive Auswirkungen auf die Lehrer des Bezirkes Reutte.
Impulse für die Lehrer des Bezirkes
Durch die selbstverständliche und selbstinitiierte zusätzliche Tätigkeit der Sonderschullehrer als zweite Lehrer in einer Integrationsklasse oder als Stützlehrer wurde vielen Lehrerkollegen des Bezirkes diese Neuorientierung im Bereich der Sonderpädagogik nicht nur theoretisch, sondern auch im Feld der Praxis als durchführbar bewiesen.
Diese von der gesamten Kollegenschaft der Sonderschule getragene berufliche Veränderungsabsicht, nämlich mit dem bisher erworbenen sonderpädagogischen Wissen zum Kind in seine Heimatschule zu kommen, könnte von den Lehrern des Bezirkes dahingehend verstanden worden sein, auch selbst das eigene pädagogische Handeln kritischer zu hinterfragen.
Eindeutig ist aber zu belegen, daß mit dem ersten integrativen Schulversuch im Bezirk kein Kind mehr mit der Diagnose einer Lernbehinderung an der Sonderschule angemeldet wurde.
Es darf aber auch nicht außer acht gelassen werden, daß eine Reihe von Lehrern Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf deshalb der Schulbehörde nicht meldeten, da sie fürchteten, dann mit dem "Problem der Integration" konfrontiert zu werden. Dies wiederum führte dann zur sogenannten "grauen Integration"[14].
Als Ende Mai 1988 der Obmann der "Lebenshilfe Außerfern - Elternverein für Behinderte", Herr Heinz Forcher, im Rahmen eines Arbeitsgespräches neuerlich die äußerst schwierige Situation um Sabine und ihrer Mutter schilderte, war dies für mich der letztentscheidende Anlaß, an den folgenden Tagen einen Projektentwurf zur Einrichtung einer Integrationsklasse an der Volksschule Reutte auszuarbeiten.
Dieser erste Projektentwurf wurde dann gemeinsam mit drei Sonderschullehrerinnen, einem Sonderschullehrer, einem Volksschullehrer (er konnte sich zu diesem Zeitpunkt durchaus schon vorstellen, in der Schulversuchsklasse zu unterrichten) und der Schulpsychologin noch einmal überarbeitet.
In der ersten Juniwoche überbrachte ich persönlich den Projektantrag dem zuständigen Bezirksschulinspektor.
Nachdem er mir seine volle Unterstützung und sein Einverständnis zusicherte, bat ich ihn, mit mir gemeinsam diesen Entwurf des Schulversuchsprojekts mit dem Volksschuldirektor und dem Lehrerkollegium der Volksschule zu besprechen. Natürlich sollten bei diesem "Planungsgespräch" auch die Lehrer der Sonderschule mitbeteiligt sein.
Der Bezirksschulinspektor war nicht nur von diesem Projektentwurf sehr begeistert, sondern auch von der Ausgangslage, einer gemeinsamen Besprechung aller beteiligten Personen.
Er meinte u.a.:
''Das ist eine Möglichkeit, die ich mir sehr gut vorstellen kann! Das wäre eine Lösung all der Probleme um Sabine!"
Noch am selben Vormittag sprachen wir gemeinsam beim Leiter der Volksschule in seiner Kanzlei vor. Der Volksschuldirektor lehnte aber ganz kategorisch jegliches Gespräch und jede Diskussion zu diesen Schulversuchsprojekt ab. Auch die Bitte seines Bruders, des Bezirksschulinspektors, es doch wenigstens mit einer Klasse zu versuchen, wurde vom Schulleiter mit Argumenten abgelehnt:
"Derartige Dinge brauchen wir nicht, wozu gibt es denn eine Sonderschule. Das kennen wir schon, wenn so etwas erst in einer Klasse begonnen wird, dann müssen es plötzlich alle Lehrer machen...."
Meine Bitte, die Kollegenschaft der Volksschule persönlich über den geplanten Schulversuch im Rahmen einer Konferenz bzw. Dienstbesprechung informieren zu dürfen, wurde insofern abgelehnt, als er persönlich "seine Lehrer und Lehrerinnen" davon unterrichten werde.
An der Volksschule wurde dann am folgenden Tag in der großen Pause darüber abgestimmt, "ob diese Integrationsidee überhaupt von Interesse sei"! Trotz des Versuchs, durch den Volksschullehrer Roland Astl der Kollegenschaft zu erklären, daß zu diesem Schulversuch kein Lehrer gezwungen werden kann, lehnten bis auf eine Lehrerin alle diesen Schulversuch ab.
Unabhängig von dieser Abstimmung an der Schule habe ich am Nachmittag desselben Tages das Schulversuchsprojekt dem Landesschulinspektor für Sonderschulen des Landes Tirol in Innsbruck vorgestellt.
Aussage des Landesschulinspektors:
''Ich persönlich habe keine Einwände gegen diesen Schulversuch, aber ob der Schulversuch vom Ministerium genehmigt wird, das bezweifle ich, da nur 5% aller Sonderschulklassen für Schulversuche zugelassen sind, und diese 5% sind in Tirol schon ausgeschöpft."
Ermutigt, da aus offizieller Sicht des Landesschulinspektors nur das Argument der 5%-Klausel ein Hindernis darstellte, lud ich zusammen mit den Kolleginnen der Sonderschule und gemeinsam mit der Schulpsychologin in einem persönlichen Schreiben alle Lehrer und Lehrerinnen, den Direktor und den Bezirksschulinspektor zu einem Informationsabend in meine Klasse ein. Der Bezirksschulinspektor, Direktor und alle Lehrer und Lehrerinnen folgten dieser Einladung.
Gemeinsam versuchten wir, das Schulversuchsprojekt zu erklären und vor allem nochmals ganz deutlich darzulegen, daß kein einziger Lehrer der Schule zu diesem Schulversuch gezwungen wird oder ihn durchführen muß, da beide Lehrer für diese Klasse bereits vorhanden sind. (Zwischenzeitlich hatte auch der Sonderschullehrer und Logopäde von unserer Sonderschule, Hans P., sich dazu entschlossen, in dieser Klasse zu unterrichten, falls sie zustande kommen sollte).
Leider war dieser Abend aber nur gekennzeichnet von vielen unsachlichen und sehr emotionalen Äußerungen und Zwischenrufen, sodaß eine Diskussion oder ein konstruktives Gespräch nicht möglich war.
Besonders heftig gestaltete sich die Auseinandersetzung innerhalb der Volksschulkollegenschaft selbst, als eine Volksschullehrerin sich sehr für den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder einsetzte und ihre Kollegen aufforderte, einmal über ihr so christliches Weltbild nachzudenken.
Die für mich doch überraschende Gegenargumentation einer Sonderschulkollegin verursachte zusätzlich heftige Diskussionen und vor allem die Ablehnung unseres Anliegens.
Sie meinte u.a.:
"Ein Unterricht für behinderte Kinder an der Volksschule ist deshalb nicht möglich, da die Kinder an der Sonderschule viel mehr Stunden aus Werken oder Handarbeiten hätten. und gerade diese manuellen Tätigkeiten seien aber für die behinderten Kinder so wichtig."
Der Bezirksschulinspektor erklärte unvermittelt, ohne auf weitere Argumente einzugehen, daß er seine positive Befürwortung des Schulversuchs zurücknehmen müsse, und forderte mich entsprechend deutlich auf, "in dieser Angelegenheit nichts mehr zu unternehmen".
Aussage des Bezirksschulinspektors:
"Für mich, für die Volksschule und auch die Schulbehörde ist diese Angelegenheit damit beendet."
Über den Ausgang dieser Gespräche informierte ich daraufhin den Obmann des Elternvereins für Behinderte im Außerfern.
Mit Datum vom 28. Juni 1988 lud die Sektion Lebenshilfe - Elternverein für Behinderte im Bezirk Außerfern alle Eltern, deren Kinder für das Schuljahr 1888/89 an den beiden Volksschulen in Reutte, an der Volksschule Lechaschau und an der Allgemeinen Sonderschule Reutte eingeschrieben waren, zu einem gemeinsamen Elterninformationsabend ins Haus der Lebenshilfe ein. Gleichzeitig mit der Einladung an die Eltern richtete der Obmann des Elternvereines ein Schreiben an die Marktgemeinde Reutte und an weitere öffentliche Stellen bzw. an die Schulbehörde mit der Bitte um Unterstützung zur Einrichtung dieses Schulversuchs.
Am Abend des 1. Juli 1988 wurde im Rahmen einer Podiumsdiskussion etwa 50 anwesenden Eltern, Lehrern, dem Bezirksschulinspektor, Ärzten, Gemeindepolitikern und anderen interessierten Personen die Möglichkeit eines gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern vorgestellt.
Durch die eindeutige Stellungnahme der Eltern zum gemeinsamen Unterricht aller Kinder "bat" mich noch an diesem Abend der Bezirksschulinspektor, die integrative Schulversuchsklasse unter meiner Leitung an der Allgemeinen Sonderschule Reutte zu beantragen und zu führen.
Für die Eltern stellte der Standort der Klasse an der Sonderschule kein weiteres Problem dar, nachdem wesentliche Dinge z.B. bezüglich Zeugnis, Stempel, Lehrplänen u.dgl. besprochen und geklärt werden konnten.
Bereits am 4. Juli 1988 habe ich dann das Ansuchen zum Schulversuch bzw. die Projektbeschreibung über den Dienstweg an die Schulbehörde eingereicht und auf Wunsch des Landesschulinspektors persönlich ein Exemplar nach Innsbruck gebracht.
Für den 7. Juli 1988 wurden nochmals alle interessierten Eltern zu einem Informationsabend eingeladen. Über 30 Eltern, zumeist Elternpaare, folgten dieser Einladung, bei der sich die beiden Lehrer, Volksschullehrer R. Astl und Sonderschullehrer Hans P. vorstellten, und wir gemeinsam den Eltern Organisation, Unterricht und weitere Rahmenbedingungen des Schulversuchs darlegten.
Nach diesem zweiten Elternabend hatten über 40 Eltern ihr Kind für die Integrationsklasse gemeldet.
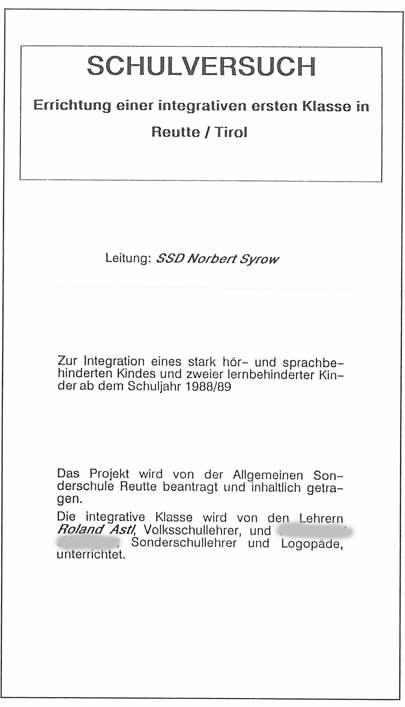
Vorbemerkungen
Anlaß für die Einrichtung einer integrativen Klasse ist die Tatsache, daß die Mutter der Schülerin Sabine sich entschieden hat, ihr Kind nicht In der Landessonderschule für r schwerhörige und taubstumme Kinder in Mils beschulen zu lassen.
Der einjährige Aufenthalt im Sonderkindergarten Mils und die damit verbundene Trennung des Kindes von der gewohnten Umgebung, von der Großmutter, die das Kind überwiegend betreut, von der Mutter und den anderen Kindern der Nachbarschalt, hatte bei dem Kind und bei der Mutter zu emotionalen Störungen und häufigen Erkrankungen des Kindes geführt.
Diese Not für Mutter und Kind waren für die Lehrer, die sich bis dahin überwiegend theoretisch mit dem Thema der Integration beschäftigt hatten, eine Aufforderung, sich jetzt auch praktisch dieser Aufgabe zu stellen.
Zu den Kindern
Sabine:
Auf Grund der Tatsache, daß in Reutte eine ambulante Betreuung hörbehinderter Kinder nicht möglich war, hat das Kind bisher keine systematische Schulung zur Anbahnung eines Sprachvermögens erhalten.
Sabine spricht jedoch einzelne Wörter und kann sowohl situationsabhängige sowie auch außerhalb konkreter Situationen mit Erwachsenen und Kindern kommunizieren.
Die Lehrer, die die Klasse übernehmen, haben Sabine als ein fröhliches, selbstbewußtes Kind erlebt, ein Kind, das ohne Scheu seine eigenen Interessen umsetzen kann, das geschickt und wendig ist und zu Menschen schnell Vertrauen gewinnt.
Sabine kopiert Zeichnungen sehr schnell und genau (siehe Zeichnungen in Anlage) und hat eine hohe Motivation, schreiben zu lernen. Dies zeigt sich in langen "Briefen", die sie ohne Aufforderung anfertigt, um Kontakt aufzunehmen ("Briefe" in der Anlage).
Im Rahmen des Unterrichts dieser integrativen Klasse ist vorgesehen, daß der beteiligte Sonderpädagoge die vielfältigen Kommunikationsformen, die Sabine entwickelt hat. genau beobachtet und für eine systematische Förderung nutzbar macht.
In Übereinstimmung mit neuester einschlägiger Literatur (vgl. Klaus-B: Günther: Schriftsprache bei hör- und sprachgeschädigten Kindern. Julius Groos Verlag Heidelberg, 1985) wird zu Beginn des ersten Schuljahres der Schriftspracherwerb besondere Bedeutung erlangen.
Von der Einrichtung der integrativen Klasse werden vor allem auch zwei lernbehinderte Kinder profitieren, die derzeit die Allgemeine Sonderschule besuchen: Stefan und Alois.
Zu den Lehrpersonen
In der Klasse unterrichten die Lehrer Roland Astl und Hans P.. Beide Lehrer haben sich schon an der Ausarbeitung des Projektes beteiligt. Sie kennen sich und sind bereit, in der integrierten Klasse zu kooperieren. Der Volksschullehrer hat Erfahrung in der Praxis "kindorientierter Lernformen" (Projekt des Pädagogischen Institutes des Landes Tirol), der beteiligte Sonderschullehrer ist ausgebildeter Logopäde und Sprachheillehrer und unterrichtet die entsprechenden Inhalte an den pädagogischen Akademien Innsbruck und Zams.
Begleitende Unterstützungen
Folgende Personen und Institutionen haben begleitende Unterstützung für den Schulversuch zugesagt:
-
Im Rahmen der Arbeitsgruppe Integration des Pädagogischen Instituts des Landes Tirol übernimmt die regionale Arbeitsgruppe die laufende praktische Beratung und Begleitung. Der Arbeitsgruppe gehören an: Bezirksschulinspektor, Sonderschuldirektor, Schulpsychologien, Volks-, Sonder- und Hauptschullehrer, Elternvertreter.
-
Die wissenschaftliche Dokumentation übernimmt eine Arbeitsgruppe am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck unter Leitung von Univ.Prof. Dr.Ilsedore Wieser und Univ.Ass.Dr.Volker Schönwiese
-
Zur Unterstützung der Therapie für das schwer hörgeschädigte Kind wird mit der Landessonderschule für gehörgeschädigte und taubstumme Kinder in Mils zusammengearbeitet. Weiters haben die Universitätsklinik Innsbruck (Dr. Herka) und die Kinderabteilung des Bezirkskrankenhauses Reutte (Prim. Dr. Müller) Ihre Unterstützung zugesagt.
-
Es ist auch gelungen. Prof. Jutta Schöler vom Pädagogischen Institut der Technischen Universität Berlin und den Spezialisten Klaus-B. Günther zur begleitenden Unterstützung zu gewinnen.
Pädagogische Prinzipien
In der integrativ geführten Klasse werden die behinderten und nichtbehinderten Kinder gemeinsam unterrichtet. Dabei erhält insbesonders das schwer gehörgeschädigte Kind zusätzliche Lehr- und Lernangebote.
Für die behinderten Kinder wird ein individueller Lern- und Erziehungsplan erstellt. Durch flexible Unterrichtsgestaltung (Klassen-, Gruppen-, Einzelunterricht) wird auf das verminderte Lerntempo der Kinder Rücksicht genommen.
Die behinderten Kinder sollen mit den anderen Kindern ganzheitlich und handelnd ihre Umwelt begreifen bzw. die Zusammenhänge verstehen lernen. Es werden dabei für die behinderten Kinder individuelle Programme (Leistungsanforderungen) erstellt.
Statt der Beurteilung durch Ziffernnoten werden die behinderten Kinder verbal beurteilt. Dies führt von einer Leistungsbewertung zu einer Entwicklungsbeschreibung. Die übrigen Schüler werden mit Ziffernnoten beurteilt.
Den Eltern wird grundsätzlich die Möglichkeit geboten, am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mitzuarbeiten.
Organisationsform
Die Integrationsklasse wird im Rahmen der Sonderschule Reutte geführt, die sich im selben Gebäude mit der Volksschule Reutte befindet.
Der Schulversuch beginnt im Schuljahr 1988/89 und erstreckt steh über 4 Schuljahre.
Neben den drei behinderten Kindern werden ca. 15 nichtbehinderte Kinder die Klasse besuchen.
Die Klasse wird in Teamarbeit von einem Volksschullehrer und einem Sonderpädagogen unterrichtet. Die beiden lernbehinderten Kinder werden nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule unterrichtet, das schwerhörgeschädigte Kind nach dem Volksschullehrplan. Den Kindern, die nach dem Volksschullehrplan unterrichtet weiden, werden
Volksschulzeugnisse ausgestellt.
Die Stundenzahl orientiert sich am Lehrplan. Die Unterrichtszeiten entsprechen jenen der allgemeinen Schule.
Es steht - falls erforderlich - ein Raum für zeitweilige Einzelbetreuung zur Verfügung.
Anhang:
1. Zeichnungen von Sabine
2. Brief von Sabine
-
Wie fanden sich die beiden Lehrer?
-
Welche berufliche Qualifikation und Erfahrung hatten sie?
In allen uns bisher bekannten Schulversuchen zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder wurde mit wenigstens zwei Pädagogen eine integrative Schülergruppe unterrichtet (Integrierte Klasse Oberwart/Burgenland; Integrationsklasse - Weißenbach/Tirol; Fläming - Grundschule/Berlin; Uckermark - Grundschule/Berlin u.a.).
In der Planung des Schulversuchs war es daher selbstverständlich, uns an diesen bisherigen in- und ausländischen Schulversuchserfahrungen zu orientieren.
''Heutigentags gehört »das Prinzip der multiprofessionellen Betreuung« zu den unstrittigen Voraussetzungen und allgemein anerkannten Grundsätzen einer integrativen Pädagogik. Die Zusammenarbeit von Pädagogen - das scheint die Lösung des Problems zu sein, wie den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und -möglichkeiten einer integrativen Schülergruppe entsprochen werden kann. Was indes als Problemlösung gedacht war, entwickelte sich sehr bald »zum zentralen Problem«." (Wocken, 1988; s. Kap. III/2.4.l, S. 65 ff.).
"Die Zusammenarbeit von Erziehern, Lehrern und Sonderpädagogen erweist sich als ein Brennpunkt des Geschehens." (Reiser in Kreie, 1985, S. 9).
In unserem Integrationsprojekt war und wurde die Zusammenarbeit der beiden Lehrer weder zum zentralen Problem, noch erwies sie sich als Brennpunkt des Schulversuchs.
Im Gegenteil (s. Kap. III/6, S. 265 ff),
die Persönlichkeit beider Lehrer, ihre hohe berufliche Qualifikation und damit ihr bisheriges pädagogisches Arbeiten hatten den größten Anteil am Zustandekommen der Integrationsklasse.
Wie fanden sich die beiden Lehrer?
Es war ein Zufall, daß die Klassenräume von Volksschullehrer Roland Astl, von Sonderschullehrer Hans P. und auch meine Klasse in einem Seitentrakt des Schulhauses nebeneinander lagen. So war es möglich, daß wir öfters am Tag - auch während unserer Gangaufsicht in der großen Pause - miteinander diskutieren und über aktuelle Probleme sprechen konnten.
So wurde der "Fall SABINE" und damit die Integration zu einem zentralen Thema.
Über viele Fragen wurde diskutiert, u.a.:
-
Wie sieht eine kindgerechte und humane Schule aus?
-
Wie muß eine demokratische Schule sein?
-
Wie muß der Unterricht in einer derart heterogenen Klasse gestaltet werden?
-
Was passiert mit der Sonderinstitution Sonderschule?
-
Welches Weltbild hat jeder von uns? U.v.m.
Aus all diesen Gesprächen erkannten die beiden Lehrer, daß es ihnen möglich sein müßte, in einer Klasse gemeinsam zu unterrichten.
Volksschullehrer Roland Astl
Roland Astl unterrichtet seit 6 Jahren an der Volksschule und hat in den vergangenen 4 Jahren nach dem Schulversuch "Kindorientierte Schule" unterrichtet. Er ist Mitarbeiter im Arbeitskreis "Kindorientierte Lernformen" des Pädagogischen Instituts des Landes Tirol.
Roland Astl zu den Eltern am 7. Juli 1988:
"Wenn ich in meinem Unterricht das Konzept eines kindgerechten Unterrichts verwirklichen möchte, dann hat in diesem Unterricht jedes Kind, ob mit einer Beeinträchtigung oder nicht, seinen Platz. Jede Mutter, jeder Vater hat ein besonderes Kind. In der Schule lebe ich mit einer Gruppe von Kindern zusammen. von denen jedes ein ganz besonderer Mensch ist. Es ist ganz »normal«, daß Kinder verschieden sind Voraussetzung, daß diese Verschiedenheiten akzeptiert werden können, ist das gegenseitige Kennenlernen durch gemeinsame Erlebnisse und Begegnungen."
Sonderschullehrer Hans P.
Hans P. ist Volksschullehrer und Sonderschullehrer für lernbehinderte und schwerstbehinderte Kinder. Seit über 10 Jahren unterrichtet er an der Sonderschule und ist innerhalb der Schule zusätzlich als Sprachheillehrer tätig sowie freiberuflich als Logopäde.
Dazu kommt seine Referententätigkeit in der Sprachheillehrerausbildung des Landes Tirol, in der er auch Mitglied der Prüfungskommission ist.
Hans P. zu den Eltern am 7. Juli 1988:
"Wenn es der Wunsch der Eltern und vor allem der Wunsch von SABINES Mutter ist, übernehme ich die schwierige Aufgabe als »Nur - Sonderschulleher« in der Integrationsklasse, aber ich möchte ganz deutlich zur Situation um SABINE sagen, daß ich kein Gehörlosenlehrer bin. Ich werde mich auf diesem Gebiet erst einarbeiten müssen, möchte und kann daher nur mein Bestes geben, aber kann sicher nicht allein verantwortlich für SABINE sein. Ich denke, daß in dieser besonderen, auch für mich völlig neuen Situation die Mutter von SABINE die Letztverantwortung trägt"
Gemeinsam gleich verantwortlich
Ein Grundprinzip unseres Schulversuchs war die im Projektentwurf festgehaltene »gemeinsame Verantwortung für alle ihnen anvertrauten Schüler«. Das heißt, daß auch Volksschullehrer R. Astl dieselbe Verantwortung für die behinderten Kinder übernimmt, wie umgekehrt Hans P. als Sonderschullehrer für die nichtbehinderten Kinder.
Vertrauen bei den Eltern
Der wohl entscheidende Aspekt beim Zustandekommen des Schulversuchs erwuchs aus dem großen und z.T. uneingeschränkten Vertrauen der Eltern in die beiden Lehrer. So, wie die reformpädagogischen Bemühungen des kindorientierten Lernens von Volksschullehrer R. Astl viele Eltern über eine für ihr Kind humanere Schule nicht nur nachdenken ließ, sondern diese sich auch für ihr Kind wünschten, so war neben der Unterrichtsarbeit die qualifizierte logopädische Betreuung von Kindern und erwachsenen Menschen durch Sonderschullehrer Hans P. bei vielen Eltern anerkannt.
Es war für diesen Schulversuch ein besonderes Merkmal, daß alle Eltern freiwillig ihr Kind für die Integrationsklasse anmelden konnten. Da es zu Beginn des Schuljahres 1988/89 drei erste Klassen gab, hatten sie die freie und uneingeschränkte Wahlmöglichkeit.
Durch die große Zahl von Anmeldungen wurde es schließlich notwendig, noch einen dritten Elternabend zu veranstalten, um gemeinsam mit den Eltern die Zusammensetzung der Kinder in der Klasse zu besprechen.
Am 25. Juli 1988 wurde dieser Elternabend im Pfarrsaal der Nachbargemeinde Breitenwang durchgeführt.
Dieser Elternabend am 25.7.1988 war wohl für alle beteiligten Personen, nämlich für die Eltern und die Lehrer, von ganz besonderer Bedeutung und ist auch heute noch nach 5 Jahren in äußerst positiver Erinnerung.
An diesem Abend haben über 40 Eltern in Eigenverantwortung darüber entschieden, welche ihrer Kinder diese Klasse besuchen sollten.
Die Eltern der nichtbehinderten Kinder wußten zwar, daß das gehörlose Mädchen SABINE in diese Klasse geht, aber es gab kaum eine Information über die beiden anderen behinderten Kinder. Ihre Information bestand lediglich aus der Kenntnis, daß der Sonderschullehrer Hans P. aus seiner bisherigen Sonderschulklasse 2 Knaben in die Integrationsklasse "mitbringt".
Durch uns Lehrer wurden die Eltern gebeten, auf folgende Überlegungen und Vorgaben zu achten:
-
Es können nicht mehr als 20 Kinder aufgenommen werden (17 nichtbehinderte und 3 Kinder mit besonderen Bedürfnissen).
-
Von den 17 Kindern sind 2 Kinder mit fremder Muttersprache zu berücksichtigen.
-
Die Zahl der Knaben und Mädchen sollte möglichst ausgewogen sein.
-
Der Forderung nach »Integration in der Wohnortschule« (vgl. Sander, 1993) sollte zumindest bei den nichtbehinderten Kindern beachtet werden, doch dieses Ziel konnte in unserer Situation des Schulversuchs bei den behinderten Kindern nicht erreicht werden (s. Kap. III/5.6, S. 263).
Innerhalb von zwei Stunden haben an diesem Abend die Eltern eigenständig, in demokratischer Abstimmung, ohne eine Einmischung durch uns Lehrer entschieden, welche Kinder ab dem Schuljahr 1988/89 die Integrationsklasse besuchen werden.
Einschließlich der drei Kinder mit Beeinträchtigungen und der beiden Kinder mit fremder Muttersprache waren es dann 10 Mädchen und 10 Buben. Bis auf ein Kind kamen alle nichtbehinderten Kinder aus einem Wohngebiet[15]. Mit Schreiben vom 1. August 1988 teilte ich den Eltern die Aufnahme bzw. die Nichtaufnahme ihres Kindes mit.
Wohnort der 3 Kinder mit Behinderungen
Der Schüler C.M. wohnt im Bereich des Schulsprengels der übrigen Kinder. Da sein Schulweg aber weiter ist als der der übrigen Kinder, fährt er mit dem Schulbus zur Schule. C.M. wurde 1 Jahr an der Sonderschule von Sonderschullehrer Hans P. unterrichtet.
Der Schüler M.M. wohnt in einer 2 km entfernten Nachbargemeinde. Er fährt ebenfalls täglich mit dem Schulbus zur Schule. M.M. wurde ebenso wie C.M. 1 Jahr an der Sonderschule von Sonderschullehrer Hans P. unterrichtet.
SABINE (s. Kap. III/2.1, S. 56 f) kommt aus Lechaschau, und ihr Weg zur Schule ist nicht weiter als der der übrigen Kinder aus dem Wohngebiet aus Reutte. SABINE wurde täglich morgens mit dem Schulbus zur Schule und mittags wieder nach Hause gebracht (s. Kap. III/5.5, S. 258 ff.).
In den Rahmenkonzepten des BMUKS, 1989, S. 19-21 zur Aufnahme behinderter Kinder in die Schulversuche:
"Zur Beurteilung, welche Kinder in einen integrativen Schulversuch aufgenommen werden und zur Feststellung von Art und Umfang eines zusätzlichen Förderbedarfs ist vor einer Antragstellung eine Beratung der am Schulversuch beteiligten Fachleute abzuhalten, für die die Bestimmungen des Erlasses BMUKS Z1 36.153/20-I/lc/86 vom 29. April 1986 "Körperbehinderte oder sinnesbehinderte Kinder im Schulwesen Österreichs; Grundsatzerlaß" in den Punkten 1 und 2 (Bildungs- und Schullaufbahnberatung) sinngemäß anzuwenden sind. In Abweichung von den Bestimmungen dieses Erlasses können im Rahmen der Schulversuche auch Kinder in allgemeinen Schulen aufgenommen werden, bei denen eine Erreichung des Lehrzieles der allgemeinen Schule nicht zu erwarten ist. Von diesem Beratungsteam wird auch ein Vorschlag erarbeitet, ob und in welchem Umfang Bedarf für den Einsatz eines zusätzlichen, sonderpädagogisch qualifizierten Lehrers besteht.
Für diese Entscheidung und vor allem für die Festlegung der Art und des Ausmaßes von Fördermaßnahmen (zusätzliche sonderpädagogische Betreuung) müssen jedoch so ausreichende Grundlagen vorliegen, daß eine spezielle Förder- und Hilfsbedürftigkeit festgestellt werden kann, die nach den Bestimmungen des Schulpflichtgesetzes vorerst als Sonderschulbedürftigkeit beurteilt werden würde. Dies gilt auch in jenen Fällen, in denen nur in einzelnen Pflichtgegenständen nach einem Lehrplan der Sonderschule unterrichtet werden soll.
Nur auf der Basis pädagogischer, medizinischer und psychologischer Feststellungen und Beurteilungen kann eine qualifizierte Beratung und Entscheidung erfolgen, wobei auch die Erfahrungen und Vorstellungen der Eltern zu. berücksichtigen sind bzw. die Eltern entsprechende Anträge stellen können.
Letztendlich hat dieses Verfahren auch eine Schutzfunktion für das Kind, sodaß es nicht ohne gewissenhafte Überprüfungen innerhalb einer integrativen Klasse als behindert bezeichnet oder nach einem Sonderschullehrplan unterrichtet wird.
Darüber hinaus wären folgende Bedingungen zu beachten:
-
Im Rahmen der Beratungen über die Aufnahme eines behinderten Kindes muß die Annahme gerechtfertigt erscheinen. daß es möglich sein wird, die Teilnahme eines Kindes an gemeinsamen Lernsituationen innerhalb eines binnendifferenzierenden Unterrichts zu gewährleisten. Dadurch soll auch sichergestellt sein. daß die individuellen Lernbedürfnisse und Lernprogramme eines behinderten Kindes innerhalb einer Gruppe befriedigt werden können.
-
Für behinderte Kinder, die innerhalb der Schule bestimmte Therapien oder Spezialförderungen benötigen. sollten diese Maßnahmen in vergleichbarer Form organisiert werden oder durch andere Angebote ausgeglichen werden können. Therapeuten sind keine schulfremden Personen. wenn sie in der Schule Therapien für einzelne Kinder durchführen.
-
Durch die Aufnahme eines behinderten Kindes dürfen andere Kinder nicht in ihren Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt sein. Lernen in der Gruppe muß langfristig ohne Gefährdungen oder Benachteiligungen möglich sein."
Folgende Gutachten wurden zwingend eingeholt:
-
Sonderpädagogisches Gutachten
-
Schulpsychologisches Gutachten
Diese Gutachten wurden ergänzt durch medizinische Berichte, und durch Gespräche mit Eltern und Kindergärtnerinnen.
Verbunden mit dem Bestreben, diese integrative Klasse einzurichten, lagen unsere vordringlichsten Bemühungen darin, möglichst vielfältige und vor allem fachkompetente Praxiserfahrungen aus sozialintegrativ geführten Klassen allgemein, bzw. mit dem spezifischen Schwerpunkt der Integration eines gehörlosen Kindes, zu erhalten.
So bemühten wir uns zunächst um Kontakte zum Landesinstitut für Gehörlose in Mils/Tirol. Von den Mitarbeitern dieser Landesinstitution wurde uns mit dem Argument abgeraten, daß es verantwortungslos sei, ein Kind in Reutte in die Volksschule zu integrieren, da dem Sonderschullehrer und Logopäden die fachliche Qualifikation fehle. Außerdem würden die speziellen Unterrichtsmittel um den Entwicklungsbedürfnissen eines gehörlosen Kindes entsprechend gerecht zu werden, nicht zur Verfügung stehen.
Am 17./18. Juni 1988 kam es im Rahmen einer Lehrerfortbildungsveranstaltung des Pädagogischen Instituts des Landes Tiro1 am Grillhof bei Innsbruck zum Thema "Integration körper- und sinnesbehinderter Kinder in allgemeinen Schulen" zu einer Aussprache bzw. Diskussion zwischen dem Leiter und den Lehrern der Gehörlosenschule Mi1s und den beiden Lehrern der Integrationsklasse, mir und weiteren Teilnehmern.
Im Tagungsbericht [16] zu dieser Veranstaltung, bei der in einer Arbeitsgruppe immer der "Fall SABINE" angesprochen wurde, schreibt Dr. Volker Schönwiese u.a.:
''Die Teilnehmer überlegen sich, was für sie persönlich Integration bedeutet.
Lehrer aus Mils erklären, daß Integration von Gehörgeschädigten bzw. Gehörlosen nur schwer vorstellbar sei.
Dies wird vor allem dadurch bewiesen, daß Südtiroler Kinder nach Mils kommen, da die Integration in ihrem Heimatland "Blödsinn" sei.
Jedes Kind soll nach seinen Möglichkeiten am besten geschult werden. Dies wird bei der Integration stark angezweifelt. Als wesentliche Voraussetzungen werden Integration in der Familie, Frühförderung, Entwicklungsbeobachtung, Beratung und Betreuung der Eltern genannt.
Im Fall SABINE im Bezirk Reutte fehlen all diese Voraussetzungen.
Es wird auch befürchtet, daß Integration für den Behinderten schädigend wirken könne, da gesunde Kinder (und Lehrer) leicht ungeduldig werden könnten.
Der Behinderte zieht sich zurück.
Daß die Gehörgeschädigten sich untereinander "wunderbar" unterhalten, sei sicher positiv, aber im wirklichen Leben sei die Situation anders. - Wird hier das Problem der Integration nicht nur hinausgeschoben? Ein großes Problem der Schule in Mils sei sicher der Internatsaufenthalt.
Immer wieder wird der Fall SABINE als konkretes Beispiel besprochen. Es gilt zu überlegen, ob es nicht möglich wäre, die Pädagogik zum Kind zu bringen!
Es muß durch die Entwicklung eines neuen Systems durchaus möglich sein!
Gesunde Kinder einer Integrationsklasse könnten ''Therapieverstärker'' sein, können aber einem Gehörlosen nicht das Sprechen beibringen. Sprache (und Rechnen) seien unbedingt nötig!"
In einem zweiten Arbeitsgespräch am Abend dieses Tages berichtete Frau Jutta Schäler, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Techn. Universität Berlin, über die Integration von gehörlosen Kindern.
Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration nannte sie folgende Rahmenbedingungen, die Dr. Volker Schönwiese im Tagungsprotokoll vom - 17. Juni 1988 festgehalten hat.
''Folgende Rahmenbedingungen sind erforderlich:
-
Frühförderung,
-
Mitarbeit der Eltern,
-
Sprechen von Ein-Wort-Sätzen und
-
Ablesen.
Der Fall SABINE wird konkret besprochen. Die Rahmenbedingungen sind nicht
vorhanden!
Es werden 2 Lösungsmöglichkeiten besprochen:
-
Zwei-Lehrer-Modell oder
-
ein arbeitsloser Lehrer wird I Jahr (mit Sabine) in Mils eingeschult und ist danach in Reutte einsetzbar."
Sehr verunsichert durch die großen Bedenken, weniger durch die Lehrer der Gehörlosenschule Mils, sondern vor allem durch die von Frau Prof. Schöler geäußerten Vorgaben und Kriterien einer verantwortungsvoll getragenen Integration des gehörlosen Mädchens SABINE, versuchten wir in den nächsten Tagen und Wochen, - zwar ohne großen Erfolg - weitere Informationen über ähnliche Schulversuche innerhalb Österreichs in Erfahrung zu bringen. Trotz aller geäußerten Bedenken und Einwände waren wir aber weiterhin der Ansicht, daß SABINE nicht mehr nach Mils kommen darf und wir nach unseren besten Kräften und Erfahrungen versuchen müssen, diesen Schulversuch einzurichten.
Mit der Einladung von Frau Prof. Schöler als Referentin zur Informationsveranstaltung über die schulische Integration am 1. Juli 1988 im Haus der Lebenshilfe bekamen wir aber unverhofft gerade durch Frau Schöler eine ganz eindeutige und uneingeschränkte Unterstützung und Befürwortung zur Einrichtung dieser Integrationsklasse.
Ihre erste Begegnung und damit verbunden ihr Schlüsselerlebnis mit SABINE in einem Restaurant waren ausschlaggebend, daß die noch vor wenigen Tagen schier unverrückbar notwendigen und nicht vorhandenen Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen integrativen Schulbesuch von SABINE plötzlich aus dem Blickwinkel von SABINES vielfachen Fähigkeiten als durchaus positiv und damit aus dieser Sicht als mögliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration angesehen werden konnten.
So berichtet Frau Prof. Schöler in ihrem Aufsatz »HERAUSFORDERUNG: KLEINE BUNTE WEDEL« (TAFIE, 1990, S. 9 ff.) über ihr Schlüsselerlebnis mit SABINE und damit verbunden über die Entstehungsgeschichte dieses Schulversuchs aus ihrer Sicht.
Herausforderung: KLEINE BUNTE WEDEL
Integration bedeutet die Fähigkeit aller Kinder zu fördern und die Normalität der behinderten Kinder zu entdecken. Am Beispiel zweier konkreter Kinder belegt die Autorin, Pädagogikprofessorin an der Freien Universität Berlin, ihre These.
Sabine und Stefanie werden im allgemeinen als schwer behindert bezeichnet. Sabine: Ein Mädchen, das taub ist. aufgrund verschiedenster unglücklicher Umstände keine angemessene Frühförderung erhielt und deshalb nicht sprechen kann.
Agnes: Ein Mädchen mit einer schweren, spastisch bedingten Bewegungseinschränkung. Sie kann deshalb nicht laufen und ihre Hände wenig benutzen. Auch sie kann nicht sprechen und wurde bis zu ihrem zehnten Lebensjahr als geistig behindert eingeschätzt.
Beide Kinder besuchen derzeit eine Integrationsklasse mit besonderen unterstützenden Maßnahmen für die beteiligten Lehrerund Lehrerinnen.
Grenzen der Integration?
Bevor ich grundsätzliche Überlegungen anhand der Lebenssituation der beiden Mädchen verdeutliche, möchte ich meine Antwort auf die immer wieder gestellte Frage nach den Grenzen der Integration voranstellen.
Wenn es Grenzen gibt. dann sind dies unsere Grenzen. Es sind die Grenzen der Erwachsenen, der gesellschaftlichen Bedingungen - aber die Grenzen liegen nicht im einzelnen Kind. Es sind unsere Grenzen, wenn wir es nicht schaffen, uns das gemeinsame Leben und Lernen mit einem schwer behinderten Kind vorzustellen, wenn wir die notwendigen organisatorischen Bedingungen nicht herstellen können, um ein schwer behindertes Kind täglich in die Schule zu transportieren, zu windeln, zu füttern. Wir müssen bereit sein, mit dem Kind zu lernen.
Für das Kind mit Behinderungen gilt. Je schwerer die Behinderung ist desto notwendiger braucht das Kind die vielfältigen Anregungen der nichtbehinderten Kinder,
-
deren Bewegungen es mit den Augen verfolgen kann,
-
deren Geräusche es mit den Ohren wahrnimmt.
-
deren Gerüche es mit der Nase unterscheiden lernt.
-
deren Hände es am eigenen Körper spürt.
Je schwerer das Kind behindert ist. desto notwendiger braucht dessen Familie die Entlastung und die Unterstützung durch die Gesellschaft, damit die Familie das Kind annehmen und behalten kann.
Zu schnell sind wir oft bereit. die Lernmöglichkeiten eines Kindes zu begrenzen, wo es richtiger wäre, die Fähigkeiten und die Veränderungsbereitschaft von Erwachsenen stärker zu fördern.
Vorgeschichte einer Integrationsklasse
In Bezug auf Sabine habe ich am Anfang einen entscheidenden Fehler gemacht Von Sabine wurde mir vor etwa einem Jahr zum ersten Mal berichtet. als ich auf Einladung der Universität Innsbruck zu einem Gastvortrag in Österreich war. Eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleiter Norbert Syrow und Volker Schönwiese, Assistent am Innsbrucker Pädagogikinstitut, sprachen mich an und schilderten mir die Situation von Sabine:
-
Ein taubes Kind, das nicht sprechen und nicht von den Lippen ablesen kann.
-
Eine Mutter, die nach den Aussagen der Sonderpädagogen in Mils nicht kooperationsfähig oder - bereit sei.
-
Eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen, die zwar für einen Integrationsversuch prinzipiell aufgeschlossen sei, bisher aber keine Erfahrungen habe und nicht mit der Unterstützung der Schulbehörde rechnen könne.
Ich war sehr skeptisch und konnte den Lehrern und Lehrerinnen keinen Mut machen. Alle schwerhörigen Kinder, die ich bisher in Integrationsversuchen kennengelernt hatte, haben zuvor Frühförderzentren besucht und konnten bereits bei Beginn ihrer Schulzeit von den Lippen ablesen und sprechen. Beides - so wurde mir berichtet - konnte Sabine nicht.
Die Kinder, die ich kannte, wurden ganz massiv von ihren Müttern unterstützt, die im wesentlichen die Rolle von Stützlehrerinnen übernommen hatten. In der einschlägigen Fachliteratur wird die viele Zeit, die die Mutter dem Kind widmen kann, um die besonderen Bedürfnisse des hörgeschädigten Kindes zu befriedigen, zu den notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgverheißenden Regelschulbesuch angesehen.
Warum müssen es immer die Mütter sein? Auch Sabine konnte von ihrem Vater keine Unterstützung erwarten. Von den Lehrern der Heim-Sonderschule, die Sabine ein Jahr lang vor ihrer Schulpflicht besucht hatte, wurde berichtet, daß Sabines Mutter nicht kooperationsbereit sei, obwohl diese mit großen finanziellen und persönlichen Opfern es möglich gemacht hatte, daß sie während der Vorklassenzeit in der von ihrem Wohnort mehr als 100 km entfernten Stadt Innsbruck wohnen konnte, um ihrem Kind einen Internatsaufenthalt zu sparen. Mutter und Tochter wurden während dieses Jahres immer wieder krank.
Die Lehrerinnen und Lehrer aus Reutte, die es sich prinzipiell vorstellen konnten, mit Sabine gemeinsame Erfahrungen in einer Integrationsklasse zu sammeln, waren selbst unsicher: Würden sie sich überfordern? Ohne das Kind zu kennen, ohne die Mutter gesprochen zu haben, konnte ich ihnen keinen Mut machen. Auch in der einschlägigen Literatur war für Sabine nur Entmutigendes zu lesen. So schreibt etwa Theodor Hellbrügge, "auch hörbehinderte Kinder haben nachweislich in der Normalschule ein besseres Sprachangebot, weshalb selbst taube Kinder erfolgreich die Normalschule besuchen können, wenn sie in den ersten Lebensjahren in ihrer Sprachentwicklung systematisch gefördert wurden". Wenn - Sabine war aber nicht systematisch gefördert worden.
Ich fuhr nach Berlin zurück. Einige Tage später rief mich Heinz Forcher vom Elternverein für Behinderte im Außerfern an. Sabines Mutter wollte nicht locker lassen: Ihre Tochter sollte nicht fort von ihr. Als Vertreter des Elternvereins wollte Forcher Sabines Mutter unterstützen. Er hatte als Vater eines behinderten Sohnes vor einigen Jahren für sein Kind den gemeinsamen Unterricht in einer Integrationsklasse erkämpft und verstand die Ängste der Mutter. 1985 hatte mich Forcher bei einem Vortrag in Bad Tatzmannsdorf (dem ersten österreichischen Integrationssymposium) gehört und bat mich nun, noch einmal nach Tirol zu kommen, um Sabine selbst kennenzulernen.
Es schien ihm undenkbar, daß ich bei meiner zögernden Aussage bleiben könnte, wenn ich Sabine erst einmal kennengelernt hätte. Wörtlich am Telefon: "Sie fragen doch sonst immer danach, was ein Kind kann. Was hat man Ihnen denn über die Fähigkeiten von Sabine erzählt?"
Ich mußte betroffen schweigen. Tatsächlich hatte man mir nur Negatives über Sabine und ihre Vorgeschichte erzählt. Die Defizite - Taubheit und fehlende Frühförderung - erschienen so eindeutig, daß daneben die Frage nach den Fähigkeiten unterblieben war. Kurzfristig konnte ich es einrichten, für vier Tage nach Weißenbach in Tirol zu fahren. Allerdings nur, wenn ich meine (damals neunjährige) Tochter mitnehmen konnte. Ich bat Herrn Forcher, mich am Flughafen in München gemeinsam mit Sabine abzuholen, damit ich sie auf dem Weg bereits kennenlernen könne.
Ein Schlüsselerlebnis mit Sabine
Während eines kurzen Aufenthaltes in einem Restaurant hatte ich mein Schlüsselerlebnis mit Sabine. Wir Erwachsenen: Heinz Forcher, Sabines Großmutter und ich sitzen an einem Kaffeehaustisch und unterhalten uns. Dazwischen Sabine und meine Tochter Judith. Nach kurzer Zeit fängt Sabine an, ihre Großmutter nörgelnd und an deren Ärmel zupfend, immer wieder auf eine Eisportion aufmerksam zu machen, die eine Frau am Nebentisch löffelt. Nein! - Die Großmutter will einmal konsequent sein. Das Kind dürfe nicht immer verwöhnt werden, außerdem habe Sabine in der letzten Zeit so viel gehustet.
Sabine läßt nicht locker. Nadine hat eine Idee: Vielleicht ist es gar nicht das Eis, das Sabine so sehr lockt? Auf den Eiskugeln stehen glitzernde, bunte Staniolpapierwedel. Will Sabine die vielleicht haben? Judith nimmt Sabine an der Hand, zieht sie zum Nebentisch, bleibt vor der erstaunten Frau stehen und klärt schnell, daß Sabine diese Papierwedel mag. Beide rennen zur Serviererin, erbetteln sich gemeinsam einen ganzen Vorrat bunter Wedel und Papierschirmchen und kommen glücklich und zufrieden an unseren Tisch zurück. Sabine will kein Eis mehr. Meine Tochter guckt mich triumphierend an: Siehst Du, ich habe herausgekriegt, was Sabine will Und: Sie hat sich getraut, danach zu fragen. Das ist, in fremder Umgebung, sonst nicht ihre Art Wenn sie für sich alleine einen Wunsch hätte erfüllen wollen, dann hätte sie wohl an meinem Ärmel gezerrt und von mir erwartet, daß ich zur Serviererin gehe und für sie frage.
Diese kleinen bunten Wedel sind für mich zum Symbol geworden. Ein Symbol für andere Formen der Kommunikation, die wir Erwachsenen erst lernen müssen. In nahzu allen Berichten über Integrationsklassen ist zu finden, wie leicht und selbstverständlich die Kinder Verständigungsprobleme überwinden.
Das schließt Konflikte nicht aus: Wenn Sabine sich von Nadine besonders gut verstanden fühlt und deshalb in den folgenden Tagen nahezu ununterbrochen mit ihr zusammen sein wollte, dann wehrte sich Nadine gegenüber diesem Verhalten. Für mich ist das ein Anzeichen für normalen Umgang zwischen den behinderten und den nichtbehinderten Kindern. Jedes Kind braucht den Freiraum, sich zurückziehen zu können. Es darf bei integrativer Pädagogik nicht erwartet werden, daß jeder Mensch und zu jeder Zeit mit allen anderen etwas gemeinsam machen muß.
Andererseits: Die alltäglichen Begegnungen zwischen den Kindern dürfen nicht institutionell verhindert oder erschwert werden. Kein Sonderpädagoge kann durch seine speziellen Förderangebote dem Kind mit Behinderungen die Anregungen und Verständigungsmöglichkeiten der nichtbehinderten Kinder ersetzen. Wenn sonderpädagogische Förderung notwendig ist, dann müssen die besonderen pädagogischen Maßnahmen zum Kind kommen, um Sonderschulen unnötig zu machen.
Innerhalb von zwei Tagen habe ich Sabine mit all ihren positiven Fähigkeiten kennenge1ernt Ich habe mich auch viel mit Sabines Mutter unterhalten. Ein Auszug aus den Gesprächsnotizen:
"Was die Experten mir immer erzählt haben, was sie alles von mir wollten, das habe ich nicht verstanden. Das ging zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Die haben mir es aber auch so erklärt, daß ich es gar nicht verstehen konnte. Ich kam mir immer ganz dumm vor. Aber dann habe ich mir gesagt: Wenn ich denen erklären täte, wie man eine Dauerwelle macht, dann könnten die das auch nicht und niemand erklärt sie deshalb für dumm. Ich täte ja gerne alles für das Kind machen. Ich will ja auch, daß es viel lernt Aber richtig erklären muß man es mir. Ich würde auch gerne vieles darüber lesen, aber das ist meist so geschrieben, daß ich es nicht verstehe."
Und weiter die Mutter von Sabine:
''Die Experten in Mils wollen nur, daß ich das Kind dort abliefere. Die erzählen mir immer, es würde dem Kind bald besser gehen, wenn ich mich nicht dauernd melde. Aber wie es mir dabei geht, danach fragen sie nicht. Das Kind kann dann auch niemand im Dorfkennenlernen. Die anderen Eltern sagen immer, sie wollen nicht, daß ihre Kinder eine Gruppe wechseln müssen. Sie wollen nicht, daß die Kinder am Vormittag mit der einen Kindergruppe zusammen sind und am Nachmittag mit einer ganz anderen. Aber wie es meiner Sabine geht, wenn sie ständig zwischen dem Heim und ihrem Dorf wechselt, danach hat niemand gefragt. Und dann kommt bei ihr doch noch die Behinderung dazu."
Soweit die Mutter, die mir einige Wochen später nach der positiven Entscheidung für die Integrationsklasse sagte, es käme ihr so vor, als wäre ihr das eigene Kind erst jetzt richtig zugehörig. Seit der Diagnose der Behinderung Taubheit hätte sie immer die Angst gehabt, ihr Kind weggeben zu müssen. Und genau das wolle sie nicht.
Den Eltern der übrigen Erstkläßler in Reutte stellte ich Sabine am 1. Juli 1988 in meinem Vortrag als ein fröhliches, selbstbewußtes Kind vor, das ohne Scheu seine eigenen Interessen umsetzen kann. das geschickt und wendig ist, schnell Vertrauen zu neuen Menschen gewinnt, schnell und genau malt und zu schreiben beginnt Dieses Kinder braucht wegen aller seiner Anteile an Normalität einen abwechslungsreichen, anregenden Unterricht und vor allem: all die Lebendigkeit der anderen Kinder.
Eine Integrationsklasse wird eingerichtet
Zwei Lehrer - ein Volksschullehrer und ein Sonderschullehrer aus Reutte - trauten es sich zu, gemeinsam die Arbeit in einer Integrationsklasse aufzunehmen. Zwei Schüler der allgemeinen Sonderschule sollten in die Integrationsklasse übernommen werden. Ein allgemeines Konzept für die Einrichtung einer Integrationsklasse lag bereits vor. Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleiter und die Schulpsychologin hatten sich schon länger mit Fragen der Integration beschäftigt, allerdings bisher nur theoretisch.
Andererseits: Wenn diese Vorarbeiten und das Bewußtsein von den notwendigen Veränderung des Unterrichts nicht vorgelegen hätten, dann hätte dieser Schulversuch auch nicht so schnell und so erfolgreich gestartet werden können. In einem Vorgespräch mit dem Landesschulinspektor, Wilhelm Margreiter [von der bidok-Redaktion anonymisiert], war geklärt worden, daß er einen Antrag auf Einrichtung einer Integrationklasse dann befürworten würde, wenn mindestens 14 andere Kinder für die Klasse angemeldet würden.
Kurz vor den Sommerferien, am 1. Juli 1988, fand dann im Haus der Lebenshilfe die entscheidende Informations- und Diskussionsveranstaltung mit großer Beteiligung statt Die größte Überraschung bestand für mich darin, daß innerhalb weniger Tage nach dieser Veranstaltung insgesamt 45 Eltern ihre Kinder für die Integrationsklasse schriftlich angemeldet hatten. Die Lehrer, die befürchtet hatten, daß nicht genügend Kinder für eine Klasse zusammenkämen, standen vor derselben Schwierigkeit wie ähnliche Schulversuche in der Bundesrepublik Deutschland: Die Zahl der angemeldeten Kinder ist in der Regel zwei- bis dreimal so hoch wie die Zahl der aufgenommenen Kinder.
Sabine und ihre Mutter, die Schulpsychologin, die beiden Lehrer, der Schulleiter und einige andere Lehrerinnen derselben Schule fuhren im Herbst 88 für eine Woche nach Berlin, um sich im Gespräch mit Lehrern und Lehrerinnen aus Integrationsklassen und durch Hospitationen auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Ich konnte einen Kollegen, Klaus Günther aus Heidelberg, zur Mitarbeit gewinnen, der sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung des Schriftspracherwerbs bei nichtsprechenden Kinder beschäftigt hat. Klaus Günther steht seither in regelmäßigem schriftlichen, telefonischen und persönlichen Kontakt sowohl mit den Lehrern in Reutte als auch mit mir. Außerdem, so wurde mir berichtet, unterstützen der für Sabine zuständige Sonderpädagoge aus Mils und ein Psychologe von der Universitätsklinik in Innsbruck die integrative Förderung von Sabine durch ihre Beratungen.
Erste Erfahrungen aus der Klasse Die beiden gleichberechtigt in der Klasse arbeitenden Pädagogen, der Volksschullehrer Roland Astl und der Sonderschullehrer und Logopäde Hans P., unterrichten gemeinsam die elf Jungen und elf Mädchen einer ersten Klasse in Reutte, zu denen auch Sabine und zwei Jungen gehören, die sonst eine allgemeine Sonderschulklasse besuchen hätten müssen. Drei Kinder in der Klasse sind türkischer Staatsbürgerschaft.
Etwas Grundsätzliches: Die Kooperationsbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer, sowie deren Bereitschaft, sich auf die neuen Aufgaben einzulassen, die sich aus den besonderen Kommunikationsformen von Kindern mit Behinderungen ergeben - dies sind die entscheidenden Voraussetzungen für das Gelingen eines Integrationsprozesses.
Wenn sich Lehrer und Lehrerinnen darauf nicht einlassen wollen, müssen die Kinder darunter leiden. Wir dürfen diese Tatsache aber nicht wie ein Naturgesetz hinstellen und sagen: Wenn die Lehrerinnen und Lehrer nicht wollen, dann ist nichts zu machen, dann müssen die Kinder mit den besonderen Problemen auf eine Sonderschule gehen. Nein: Von allen Lehrern und Lehrerinnen muß gefordert werden, daß sie sich auf diese Aufgabe einlassen. In keinem anderen Beruf kann man es sich heute leisten, 20 Jahre lang nicht dazugelernt zu haben und nicht mit anderen Menschen im unmittelbaren Arbeitsprozeß zu kooperieren. Man stelle sich nur einen Arzt oder einen Automechaniker vor, der sagen würde: Ich mache meine Arbeit alleine und so, wie ich es zehn oder 20 Jahre lang gemacht habe. Pädagogen können sich das noch leisten, obwohl sie die Kinder für eine ständig sich ändernde Welt vorbereiten sollen. Eltern sollten sich diese Haltung nicht mehr gefallen lassen; und die Schulaufsicht ist gefordert Gelegenheit für wirklich qualifizierte Fortbildung zu geben. Daran teilzunehmen, sich selbst weiterbilden, dies muß allerdings auch von Lehrern und Lehrerinnen gefordert werden.
Konkret Roland Astl und Hans P. haben diesen Veränderungsprozeß für sich selbst gewollt Sie selbst und eine Gruppe von 22 Kindern haben davon profitiert.
Am meisten gewonnen haben, neben Sabine und den beiden Kindern mit erheblichen Lernschwierigkeiten, die fünf Kinder der Klasse, deren Fähigkeiten als überdurchschnittlich einzuschätzen sind. Gute Schüler und Schülerinnen, die teilweise schon zu Beginn der ersten Klasse lesen konnten, ziehen. Vorteile aus den offenen Lernformen. Sie werden nicht auf einer Lernstufe festgehalten und sie langweilen sich nicht, woraus sich in frontal geführten Klassen im Ein-Lehrer-System oft Verhaltensstörungen entwickeln. Sondern: diese Kinder bekommen den Lernstoff, der ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.
Bei zwei weiteren Kindern stellte sich im Laufe des ersten Halbjahres heraus, daß auch sie eine besondere Beachtung, eventuell sonderpädagogische Förderung benötigen. Im engen Kontakt mit der Schulpsychologin kann auch für diese Kinder das individuelle Angebot gemacht werden. In einer normalen Klasse wären sie wohl diejenigen, die immer hinterherhinken und dann oft das Gefühl haben, es doch nie richtig zu schaffen. Während ein einzelner Lehrer in der Klasse sich meist irgendwie auf die mittleren Schüler und Schülerinnen einläßt und die besonders guten und die Kinder mit besonderen Problemen mehr oder weniger vernachlässigen muß, von Kindern wie Sabine total überfordert wäre, und im Laufe der ersten beiden Schuljahre ein bis zwei Kinder in die Sonderschule wechseln müssen, können hier zwei miteinander in der Klasse arbeitende Lehrer die Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigen. Die Schule macht Lehrern und Kindern mehr Spaß.
Über Sabine schrieb mir Klaus Günther nach einem seiner Unterrichtsbesuche: ''Es ist für mich phänomenal, wie Sabine - vermutlich zusätzlich gestützt auf vibrative Eindrücke - bei rhythmisch begleitenden Spielliedern problemlos aktiv mitmacht, sodaß ein nichteingeweihter Besucher Schwierigkeiten hätte, herauszufinden, welches unter den Kindern das gehörlose ist".
Der Klassenlehrer berichtet: "Sabine hat die wichtigsten Regeln in der Klasse erfaßt und gehört zur Gruppe der Aktiven. Durch Gesten und Lautmalerei wird immer wieder ihr großer Wunsch nach Kommunikation deutlich. Für die Erwachsenen ist erstaunlich, wie viel die Kinder von ihr wissen. Die anderen Kinder berichten gelegentlich den Lehrern, was Sabine ihnen in Pausensituationen oder am Nachmittag erzählt hat. Der Bus war weggefahren, oder: Was haben sie im Schwimmkurs erlebt?"
Hierbei wird das Prinzip deutlich, welches in der einschlägigen Literatur belegt ist. Das Verhalten der behinderten Kinder ist in besonderem Maße davon bestimmt, wie sie sich verstanden fühlen. Am meisten verstanden fühlen sie sich von anderen Kindern, mit denen sie ihre Alltagssituationen teilen. Sabine kann in der Schule am meisten erzählen, wenn ein anderes Kind ihrer Klasse auch beim Schwimmkurs dabei war. Verständigungslücken, die sie mit ihrer Mimik und Gestik nicht ausgleichen kann, überbrückt dann das andere Kind. Sabine fühlt sich verstanden, verfolgt sehr aufmerksam, was andere Kinder berichten, kann mit großer Sicherheit aus der nichtverbalen Kommunikation ablesen, ob das, was berichtet wird, auch ihrem Willen und ihren Absichten entspricht. Wenn nicht, dann kann sie heftig widersprechen, greift ein und übernimmt selbst den Bericht mit ihren Mitteln. Andererseits bekommen auch alle anderen Kinder wichtige Aufgaben: Sie beobachten und berichten genauer, als sie es für sich alleine täten. Die anderen Kinder entwickeln oft eine erstaunliche Sensibilität. Sabines Banknachbarinnen, so berichtet Klaus Günther, scheinen auch ohne Lehreranleitungen in der Lage, ihr, der Sabine, Informationen und Hinweise zu vermitteln, die sie alleine aufgrund von Beobachtungen nicht erfassen kann. So erläuterte beispielsweise ein Mädchen in einem kleinen selbsterstellten Lesebüchlein pantomimisch-gestisch die Bedeutung des zentralen Verbs.
Sabine ist für die Lehrer und Lehrerinnen oft anstrengend. Das hat aber mit ihrem drängenden, oft auch ungeduldigen Charakter zu tun. Sie möchte schöne Ergebnisse ihrer Arbeit sehen. Wenn ihr etwas unwichtig ist oder zu schwierig wird, dann gibt sie schnell auf: ermüdet, wird lustlos. Bei Freiarbeiten wechselt sie häufig die Aufgaben. Besser geht es dann, wenn sie in einer kleinen Gruppe oder in Partnerarbeit eingebunden ist. Die anderen Kinder halten sie eher bei einer kontinuierlichen Arbeit als es manchmal den Erwachsenen möglich ist.
Aber kennen wir dieses Verhalten nicht von allen Kindern?
Sabine begibt sich auch in Konflikte mit den anderen Kindern. Das ist manchmal ein stürmisches Umarmen, ein anderes Mal eine heftige Rauferei. Sie hat Humor und treibt mit den Lehren ihre kleinen Scherze. Beim Schreiben lernen hat sie eindeutig die Prinzipien der Schriftsprache erfaßt und wird sie wohl bald als wichtiges Kommunikationsmittel einsetzen können. Beim Rechnen braucht sie viel Anschauung, was allen anderen Kindern auch zugute kommt. Malen, Musik und Sport machen ihr viel Spaß. Sabine ist ein fröhliches, selbstbewußtes, auf den ersten Blick "ganz normales" Mädchen.
Sie ist taub. Sie kann nicht sprechen.
Diese eindeutigen Defizite müssen akzeptiert werden. Was sie und ihre Mitschüler und -innen in dem knappen Jahr miteinander gelernt haben, kann allen Kindern keine Sondereinrichtung bieten, in der die Kinder wegen ihrer Defizite zusammengefaßt und aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen sind.
Die Erfolge und die Berechtigung derartiger Sondereinrichtungen werden oft am defizit-orientierten, für alle Beteiligten zermürbenden Sprachaufbau gemessen. Die Kinder können dann vielleicht nach einigen Monaten oder Jahren Wörter lautieren - aber mit wem sollen sie spielen und sprechen? Da ist kein Kind, mit dem sie am Nachmittag zuvor beim Schwimmkurs waren und das sie am darauffolgenden Tag darin unterstützt, den 20 anderen Kindern der Klasse von dem ersten gelungenen Kopfsprung zu erzählen. Da wartet mittags keine Mutter und keine Großmutter, denen ein Kind wie Sabine von der Rangelei auf dem Schulhof erzählen kann, und die Mutter kann keinen Lehrer anrufen. wenn sie an einer bestimmten Stelle der Erzählung Sabine nicht verstanden hat und etwas genauer wissen will.
Die Lehrer und Lehrerinnen von Sabine sind davon überzeugt: Sie will sprechen lernen. Und weil sie das will, wird sie es auch lernen. Dafür gibt es zwar keine Garantie, aber die emotionale Sicherheit der Lehrer und Lehrerinnen. Sie soll sprechen lernen, sie wird dabei von allen Beteiligten - auch dem Ambulanzlehrer der Sonderschule - unterstützt und gefördert. Aber sie wird nicht einem defizitorientierten, zermürbenden Sprachaufbau um jeden Preis ausgesetzt.
Spezialpädagogischer Beistand, keine Sonderschule
Ich möchte noch einmal zurückblicken: Vor einem Jahr erschien es nach dem Stand der Literatur und nach meiner eigenen Einschätzung als äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, ein Kind wie Sabine mit nichtbehinderten Kindern gemeinsam die Schule besuchen zu lassen. Wenn man sie wie ein nichtbehindertes Kind behandelt hätte, wenn man Sabine zu einer einzelnen. unvorbereiteten Lehrerin in die Klasse geschickt hätte, dann wäre Sabine nach kurzer Zeit abgeschoben worden und einige Gegner von Integration hätten vielleicht laut oder zumindest leise gesagt "Jetzt muß die Mutter endlich einsehen, daß das Kind in eine Sondereinrichtung gehört!"
Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen brauchen den spezialpädagogischen Beistand in einer normalen Klasse, sie brauchen aber keine Sonderschulen. Die Entwicklung der Integrationsklasse in Reutte ist ein gelungenes Beispiel für dieses Prinzip.
Viele konnten mir vielleicht bis hierher problemlos folgen. Ja - Aber!
Ja: Sinnesbehinderte und Körperbehinderte, die können wir integrieren. Ein Kind, das geistig normal ist, das am Unterricht teilnehmen und dieselben Ziele erreichen kann wie andere Kinder auch, das ist kein Problem.
Aber: Lernbehinderte Kinder? Nein! Wer die Ziele der Grund- und Hauptschule nicht erreicht, gehört in die allgemeine Sonderschule!
Nächste Abwehrstufe: Geistig behinderte Kinder? Nein! Zahlreiche Kinder mit Down Syndrom werden in der BRD in den Schulversuchen erfolgreich gefördert; in Kanada, in den USA, in Spanien und in Italien gibt es erstaunliche Forschungen über den Entwicklungsstand, den diese Kinder bei richtiger integrativer Förderung erreichen können.
Letzte Abwehrstufe: Schwerst mehrfach behinderte und schwerst geistig behinderte Kinder. Im Frühjahr 1989 ist in eine Hauptschule in Reutte über die "Integrationsfähigkeit" von Kinder abgestimmt worden. Ich zitiere aus einem Leserbrief der "Außerferner Nachrichten" vom 12. März 1989:
"Bei dieser Abstimmung (siehe unten abgedrucktes Faksimile des Stimmzettels) ging es nicht, wie von Obmann Heinz Forcher wissentlich und falsch dargestellt wurde, um die Integration Behinderter, sondern einzig und allein um die Frage der Integration geistig schwerst Behinderter an der Hauptschule. Und nur gegen eine solche Integration hat sich der Lehrkörper ausgesprochen. weil er der Meinung war, daß eine Integration Behinderter nur dann "sinnvoll" ist, wenn die Behinderten auch "integrationsfähig" sind und damit ein gemeinsamer und gedeihlicher Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten möglicht ist."
Ich vermute, daß der Informationsstand dieser Lehrer und Lehrerinnen nicht ausreichte. Meine Fragen zu diesem Vorgang:
-
Gab es eine konkrete Anfrage für ein Kind?
-
Hätten die Lehrerinnen und Lehrer informiert werden müssen über die Fähigkeiten und die positiven Entwicklungen dieses Kindes und die Wünsche der Eltern?
-
Kannten die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeiten eines Zweipädagogenprinzips?
Am wichtigsten erscheint mir die Frage:
Wer hat diese Abstimmung veranlaßt?
Den Lehrerinnen und Lehrern ist vorzuwerfen, daß sie überhaupt abgestimmt haben. Sie haben jeweils einzeln abgestimmt über das Schicksal von Menschen. Sie haben sich selbst zu Schreibtischtätern gemacht Wenn sie ehrlich gewesen wären, dann hätten sie sagen müssen: Über eine solche Frage kann ich nicht abstimmen! Diejenigen, die die politische Verantwortung für derartige Entwicklungen tragen, können sich jetzt hinter der Abstimmung der Lehrer und Lehrerinnen verstecken.
Integration ist unteilbar
Wenn mit der Integration der leichter behinderten Kinder begonnen wird, dann dürfen die schwerer behinderten Kinder nicht ausgeschlossen werden. Integration darf auch nicht aufgrund schulorganisatorischer Bedingungen irgendwann beendet werden.
Kein Mensch kann am Anfang eines menschlichen Entwicklungsprozesses sagen, wie weit diese Entwicklung führen kann. Wenn wir jedoch einen Menschen als nicht lernfähig einschätzen, dann wird dieser Mensch auch nichts oder nur sehr wenig lernen können. Einem Menschen seine Lernfähigkeit absprechen, heißt, ihm das Mensch-Sein absprechen. Und die Besonderheit des menschlichen Lernens (wie auch vieler hochentwickelter Säugetiere) ist das soziale Lernen.
Jeder von uns hat so vieles im Leben nur gelernt, weil er oder sie es mit anderen Menschen oder wegen anderer Menschen gelernt hat. Wir alle brauchen das Vorbild von anderen Menschen, deren Beispiel, um vom Vor-Machen zum Mit-Machen, zum Selbst-Tun-Wollen und dann Alleine-Tun-Können zu gelangen. Auch den als geistig behindert oder schwerst mehrfach behindert bezeichneten Menschen darf dieses wichtige, wenn nicht sogar das wichtigste Prinzip menschlichen Lernens nicht abgesprochen werden.
...
Es ist falsch, nach der Integrationsfähigkeit eines einzelnen Kindes zu fragen. Gefragt werden muß nach der Integrationsfähigkeit oder der Bereitschaft zur Aussonderung in der Gesellschaft. Wie integrationsfähig ist diese Gesellschaft? Wie viel Bereitschaft zur Aussonderung zeigt eine Gesellschaft, die auch heute noch alte und kranke Menschen aussondert und Einrichtungen duldet, in denen diese Menschen dem sozialen Tod oder gar dem von Menschen absichtlich herbeigeführten physischen Tod ausgesetzte sind?
Helga Deppe-Wolfinger hat für einen bisher nicht veröffentlichten Vortrag formuliert: "Erst neuere soziale und politische Bewegungen - wie die Frauenbewegung und grün-alternative Bewegungen - schufen ein Bewußtsein in der Öffentlichkeit, daß Gleichheit nur dann durchgesetzt werden kann, wenn sie mit der Akzeptanz der Verschiedenheit der Menschen einhergeht. Die Vielfalt kindlicher Lebensäußerungen, auch das Anderssein, das Eigenwillige nicht als Bedrohung zu erleben, sondern als Bereicherung, ist eine Erfahrung, die besonders Eltern behinderter Kinder gemacht haben."
Gesellschaften verändern sich. Und es ist unsere Aufgabe mitzuentscheiden, mitzuhandeln, wie schnell und in welche Richtung die konkrete historische Situation verändert wird, in der wir leben. Folgendes möchte ich in Erinnerung rufen: Noch vor 100 Jahren galt es als undenkbar, daß eine Frau ein naturwissenschaftliches Studium beginnt. Maria Montessori mußte, als sie 1892 in Rom als erste Frau ein Medizinstudium begann, nicht nur auf dem Weg zur Universität und wieder nach Hause begleitet werden, sie durfte auch den Vorlesungssaal erst betreten, nachdem die Studenten ihre Plätze eingenommen hatten.
Maria Montessori entwickelte ihre Pädagogik für schwerst mehrfach behinderte, für geistig behinderte Kinder. Sie schrieb 1914: ''Hüten wir Frauen uns, die Kinder so zu behandeln, wie wir den Männern vorwerfen, uns behandelt zu haben, nämlich als wohlwollende, aber die Herrschaft aufrechterhaltende Beschützer."
Der Mensch, eine historische Idee
Ich schließe mit einem leicht veränderten Zitat von Simone de Beauvoir aus ihrem 1949 erstmals veröffentlichten Buch "Das andere Geschlecht":
''Die Definition des Menschen ergibt, daß er nicht ein gegebenes Wesen ist, sondern eines, das sich zu dem macht, was es ist."
"Der Mensch ist nicht eine natürliche Art, sondern eine historische Idee. Die Frau (und ich ergänze: Die geistig behinderte Frau) ist nicht eine starre Realität, sondern ein Werden; in ihrem Werden müßte man sie dem Manne gegenüberstellen, das heißt, man müßte ihre Möglichkeiten definieren.
Was so viele Diskussionen verfälscht, ist, daß man sie auf das beschränken will, was sie war und was sie heute ist; anstatt daß man die Frage nach ihren Fähigkeiten stellt. Tatsache ist, daß Fähigkeiten sich erst überzeugend manifestieren (das heißt sichtbar werden), wenn sie verwirklicht worden sind; Tatsache ist aber auch, daß, wenn man ein Wesen betrachtet, das Transzendenz (das heißt das jenseits des Gegenständlichen liegende) und Überwindung ist, man niemals eine Grenze ziehen kann."
Es gibt keine objektiven Kriterien, nach denen wir Grenzen menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten ziehen können. Wir dürfen keine Grenzen ziehen, hinter denen Menschen als "nicht integrierbar" zurückbleiben. Aus: Betrifft: Integration 1/1989.
Um weitere Informationen zu erhalten und um sich die kommenden Aufgaben vorzubereiten, fuhren SABINE mit ihrer Mutter, die Schulpsychologin, der künftige Klassenlehrer, einige Lehrerinnen der Sonderschule und ich als Schulleiter auf Einladung von Frau Schöler vom 15.8. bis 20.8.1988 eine Woche nach Berlin. In Gesprächen mit Lehrern und Lehrerinnen in verschiedenen Integrationsklassen, bei zusätzlichen Hospitationen und Aussprachen im gesamten Lehrerkollegium der verschiedenen Schulen konnten wir vor allem wichtige Praxiserfahrungen mit nach Hause nehmen.
An der Beratungsstelle für Hörbehinderte, Pastor-Behrens-Str.81, wurde SABINE nochmals untersucht.
Diagnose:
''Praktische Taubheit beiderseits mit geringsten Hörresten bis 500Hz - Audiogener Sprachentwicklungsrückstand. Ein Sprachverständnis ist mit einem Hörgerät nicht zu erreichen."
Im Rahmen dieser Studienreise lernten wir auch Prof. Dr. Klaus Günther von der Universität Heidelberg kennen, der sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung des Schriftspracherwerbs bei nichtsprechenden Kindern beschäftigt hat.
Klaus Günther, selbst schwer hörbehindert, begleitet seither als wissenschaftlicher Fachmann die schulische Integration von SABINE (s. Kap. III/4.2, S. 231 ff.).
Neben dieser wissenschaftlichen Begleitung durch Klaus Günther wurde uns dann auch eine regelmäßige Beratungshilfe durch das Landesgehörloseninstitut in Mils zugesichert, sowie die psychologische und medizinische Beratung der Universitätsklinik Innsbruck. Einen sehr großen Anteil am Entstehen und weiteren Gelingen des Schulversuchs aber kam Frau Prof. J. Schöler zu.
War es letztlich auch ihrem Engagement zu verdanken, daß der Schulversuch eingerichtet werden konnte, so waren in den folgenden Jahren ihre regelmäßigen Besuche und Fachgespräche mit den Lehrern, den Ärzten der Klinik in Innsbruck oder die unterstützenden und freundschaftlichen Gespräche mit der Mutter von SABINE ganz wesentliche Marksteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen schulischen Integration und Förderung nicht nur von SABINE, sondern aller Kinder dieser Klasse.
Schulversuche dürfen in Österreich nur genehmigt und durchgeführt werden, wenn eine vom Gesetz vorgeschriebene wissenschaftliche Begleitung (WIB) gegeben ist.
Im Arbeitsbericht der Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht haben GRUBER u. PETRI 1989 ein Konzept für die Erprobung und wissenschaftliche Betreuung der integrativen Schulversuche vorgelegt, das auch neuere Ansätze (EBERWEIN, 1988) in der Schulforschung berücksichtigt. In der konkreten Situation unseres Schulversuchs aber gab es durch die zuständige Landesschulbehörde, die laut Gesetz dafür verantwortlich ist, keine wissenschaftliche Begleitung oder Evaluation. Es gab sie weder im Sinne einer Bearbeitung eines eigenständigen Projekts zur erfahrungsgestützten Weiterentwicklung unserer Schulversuchsarbeit noch im Sinne einer Betreuung und Beratung.
H. WOCKEN (unveröfI MS., 1990) hat in seinem Aufsatz: ''Vom Engagement zur Reflektion - Wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs »Integrationsklasse«" - die Geschichte der wissenschaftlichen Begleitung in 5 Phasen unterteilt, wobei sich alle 5 Phasen zum einen deutlich darin unterscheiden, mit welchen Personen die wissenschaftliche Begleitung es vornehmlich zu tun hatte, an welchen Orten bzw. Institutionen sie agierte und welche Tätigkeiten, Aufgaben und Funktionen sie wahrnahm.
Die Entwicklung der wissenschaftlichen Begleitung an Hamburger Grundschulen läßt sich meiner Ansicht nach zumindest in den von WOCKEN beschriebenen 1. und 2. Phasen recht gut auch auf unseren Schulversuch übertragen, da durch das Fehlen jeglicher fachorientierter, wissenschaftlicher Begleitung von seiten der Schulbehörde ich mich zunächst auch um das Zustandekommen dieses Schulversuchs bemühte und mich im weiteren für eine unterstützende bzw. anteilnehmende Begleitung aller am Schulversuch beteiligten Personen engagierte.
Im Rahmen meines Studiums habe ich mich aber schließlich auf das eigentliche Metier wissenschaftlicher Begleitung konzentriert, nämlich die Forschung, die WOCKEN als die 3. Phase bezeichnet.
Im Zusammenhang mit der 4. und 5. Phase, nämlich der "politischen Beratung" und der "theoretischen Reflektion", war, denke ich, auch dieser Schulversuch in Verbindung mit meiner Tätigkeit ein kleines Mosaiksteinchen in der Gesamtzusammenschau der österreichischen Integrationsbewegung.
Erste Phase: Solidarisches Engagement
''Eine typische Szene aus dieser Phase: Eine Elterninitiative - eine Gruppe von Eltern mit einschulungspflichtigen behinderten und nichtbehinderten Kindern - versammelt sich in einem ausgeräumten Partykeller. Die Gespräche drehen sich um die eigenen Kinder und um die Schule, wie sie ist und wie sie für die eigenen Kinder eigentlich sein sollte.
Und immer wieder steht auf der Tageordnung die Planung von öffentlichen Aktionen. Das Schul- und Bildungswesen ist bis dahin ja noch nach der Separierungsdoktrin organisiert, derzufolge behinderte Kinder in Sonderschulen gehören; eine Regel, die keinerlei Ausnahme duldete. Im Jahr der Behinderten 1981 war die Losung "Gemeinsamkeit" ausgegeben worden, die die Eltern nun beim Wort nehmen. Die Eltern werben und agitieren, sie gehen auf die Straße und in die Rathäuser.
Die Wissenschaftliche Begleitung ist auf der Seite der Eltern mit dabei. Die "Gegner" in dieser Phase sind zahlreich: die konservativen Behörden, die irritierten Politiker, die skeptische Fachwelt und die aufgebrachten Sonderschulen. Zu den wenigen Verbündeten zählen eine aufgeschlossene Presse (NUR, Spiegel) und vereinzelte Grund- und Sonderschullehrer.
Wissenschaft, wie man sie gemeinhin versteht, ist in dieser Phase nicht gefragt. Gefordert ist parteiliches, solidarisches Engagement mit pädagogischen Laien, die für eine neue Schule für alle Kinder eintreten. Integration ist noch nicht wissenschaftlich zu erforschen, sondern erst einmal mit Unterstützung von Wissenschaftlern durchzusetzen."
(WOCKEN, unveröff. MS., 1990).
In den Kapiteln III/2.1 bis III/2.6.3 habe ich versucht aufzuzeigen, daß die einzelnen Schulversuche nur deshalb genehmigt und eingerichtet wurden, weil einige engagierte Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder, einzelne Lehrer und Lehrerinnen und weitere Personen (Schulpsychologen, Ärzte u.a) sich im solidarischen Miteinander gegenseitig sehr stark unterstützten und halfen.
Es fand sich keine wissenschaftliche Begleitung in dem Sinne, daß es Ansprechpartner gab, die zumindest um Rat und um Unterstützung gefragt werden konnten, damit behinderte und nichtbehinderte Kinder individuell und doch "am gemeinsamen Gegenstand lernend" (FEUSER, 1987) bestmöglich gefördert und unterrichtet werden können.
Es war auch für mich mitunter schwer, selbst noch verunsichert, selbst noch auf der Suche nach Lösungen und richtigen Wegen, gegen all die zum Teil sehr heftigen und unsachlichen Argumente und Äußerungen zahlreicher "Gegner", vor allem Schulpolitiker und Schulbeamte, aber auch Lehrer und Direktoren richtig, überlegt und ruhig zu reagieren, zu argumentieren und dabei nicht aufzugeben.
Letztlich entscheidend war aber, daß die Integrationsklasse genehmigt und damit eingerichtet werden konnte.
Zweite Phase: Anteilnehmende Begleitung
"Szenenwechsel Die Integrationsklassen sind erkämpft worden, jetzt sind sie da. Nun gehen die behinderten und nichtbehinderten Kinder in die gleiche Schule und müssen gemeinsam unterrichtet werden. Der Ort der wissenschaftlichen Begleitung ist die Schulklasse, die Subjekte sind die Kinder und die Lehrer der Integrationsklassen. Das gemeinsame Problem ist die neue pädagogische Frage, wie ein heterogenes Team von Pädagogen (Grundschullehrer, Sonderschullehrer, Erzieher) mit einer heterogenen Gruppe von Kindern in der Schule zusammen leben und zusammen lernen kann. Die alten Rezepte versagen, die tradierten Lehrbücher der Pädagogik wissen keinen Rat, ja sie kennen nicht einmal das Problem. Eine neue Pädagogik muß Tag für Tag von den Pädagogen vor Ort geschaffen werden.
Wissenschaftliche Begleitung vollzieht sich im Dabeisein:
An den Aufnahmeverfahren mitwirken, im Unterricht hospitieren, an den Pädagogischen Konferenzen teilnehmen, bei Eltern- und Informationsabenden dabei sein. Was integrative Schule und integrativer Unterricht ist, muß von der Wissenschaftlichen Begleitung erst selbst angeeignet werden. Wissenschaft geht in die Schule. Sie nimmt an der pädagogischen Innovation teil, nicht bevormundend, nicht besserwissend und nicht beurteilend, sondern selbst lernend und kooperativ unterstützend. Der Satz von der Dignität der pädagogischen Praxis hat uneingeschränkte Gültigkeit. Die parzipatorische, nondirektive Tätigkeit der wissenschaftlichen Begleitung kann am treffendsten mit dem Begriff "anteilnehmende Begleitung" umschrieben werden. Ein Begriff freilich, der in wissenschaftstheoretischen Traktaten nicht vorzufinden ist."
(WOCKEN, unveröff. MS., 1990).
"Wissenschaftliche Begleitung vollzieht sich im Dabeisein." (Ebd.).
Nach der Einrichtung der Integrationsklasse ergaben sich für mich vor allem zwei Schwerpunkte. So lag einerseits mein Bemühen darin, die beiden Lehrer in den verschiedensten Belangen zu unterstützen und zu begleiten, und andererseits um zu hospitieren, den Unterricht zu beobachten, um selbst wiederum zu lernen und in der Folge mit den Lehrern gemeinsam darüber reflektieren zu können.
Diese zweite Phase der "anteilnehmenden Begleitung" war durch sehr viele Merkmale gekennzeichnet. Immer deutlicher zeigte sich aber von diesem Zeitpunkt an auch, daß sich die Handlungsfelder und Handlungsaktivitäten innerhalb der fünf Phasenbereiche wissenschaftlicher Begleitung nicht scharf voneinander trennen lassen, sondern sehr stark ineinander verschränkt sind, fließende Übergänge bilden und sich oftmals völlig neuen Anforderungen zu stellen haben. In Verbindung mit neuen Versuchsstandorten, und damit auch anderen im Versuch involvierten Personen, veränderten, erweiterten und vertieften sich einerseits auch meine Handlungsaktivitäten, andererseits schärfte es aber auch meinen Blick für das Wesentliche und Bedeutsame.
Zum besseren Verständnis all der Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich "anteilnehmender Begleitung", die ich versuchte wahrzunehmen, um zum Gelingen des Schulversuchs beizutragen, möchte ich diese im Folgenden in Stichworten festhalten.
-
Eltern von behinderten und nichtbehinderten Kindern informieren und ansprechen, sich einlassen auf diese "neue", kindgerechte und humane Schule ...
-
Ansprechen von Lehrern, die bereit sind, in einer sozial - integrativen Klasse zu unterrichten ...
-
Informationen einholen und weitergeben über integrativen Unterricht und damit verbundenen didaktisch notwendigen Änderungen (Schulbesuche, Hospitationen, Fachgespräche, Literatur u.a.m.)...
-
Informationen einholen über spezielle Fachdidaktiken und spezielle Kenntnisse (in unserer Situation Gehörlosigkeit und damit verbunden spezifisch notwendige didaktische Maßnahmen)...
-
Projektantrag ausarbeiten, einreichen und die notwendigen räumlichen bzw. administrativen Bedingungen an der Schule schaffen ...
-
Mithilfe bei der Organisation und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln ... Kontaktaufnahme zu verschiedenen Fachleuten, die die Lehrer unterstützen, aber auch mitunter für Eltern, Politiker, Schulbeamte, Schulleitungen wichtige beratende und begleitende Funktionen erfüllen können. In unserem Schulversuch waren und sind es heute noch Frau Prof. Jutta Schöler (s. Kap. III/2.6.3, S. 91 ff. "Kleine bunte Wedel", Kap. III/3.9.2, 192 ff. ''Wird Sabine je sprechen können?" ...) und Prof. Dr. Klaus Günther (s. Kap. III/4.2, S. 217 ff. "Spezielle Situation von Sabine"). Im ersten Schuljahr fand eine fachliche Beratung durch Sonderschuloberlehrer A.S. von der Lande-Sonderschule für Hörgeschädigte in Mils statt. Diese Beratung wurde dann ab dem zweiten Schuljahr von Sonderschullehrerin Sieglinde Schönauer, ebenfalls aus Mils, übernommen.
-
Klärung finanzieller Fragen wie Reisekosten und Honorare der Fachpädagogen.
-
Leitung und Organisation gemeinsamer pädagogischer Konferenzen mit diesen Fachpädagogen, Lehrern und Eltern ...
-
Ein besonderes Merkmal: Durch die Herausforderung, und von der Richtigkeit des gemeinsamen Unterrichts aller Kinder überzeugt, zudem bereit, meine Möglichkeiten zum Gelingen des Schulversuchs auszuschöpfen, aber zu verunsichert und unwissend in vielen Bereichen integrativer Pädagogik, begann ich mein Studium der Pädagogik am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Bezeichnend für diese Anfangsphase der Integrationsbemühungen war wohl u.a. auch, daß ich nach Errichtung der Schulversuchsklasse und nach kurzfristiger Verlegung an die Volksschule (s. Kap. III/2.6.5, S. 123) als "schulfremde" Person in der Klasse nicht hospitieren durfte. Um u.a. Aufgaben eines Forschungsprojekts zu "Schulversuchen zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder" der Universität Innsbruck im Rahmen meines Studiums in der Klasse durchführen zu können, mußte ich ein Ansuchen an den Landesschulrat von Tirol stellen. Mit Schreiben vom 18. Jänner 1989 wurde durch den Landesschulrat die Genehmigung erteilt. "Der Landesschulrat erteilt die Genehmigung zur Durchführung dieser Unterrichtsbeobachtungen mit der Auflage, daß die Termine dafür mit der Schulleitung der Volksschule Reutte bzw. mit den versuchsführenden Lehrern vereinbart werden."
-
Wöchentliche Hospitationen in der Klasse, um selbst zu beobachten, integrativen Unterricht zu erfahren, zu erleben und vor allem selbst zu lernen. Aus diesen Erkenntnissen und Beobachtungen wiederum konnte ich unterstützend mit den Lehrern reflektieren und kooperieren.
-
Am Anfang fanden fast täglich nach Unterrichtsende oder am Nachmittag Gespräche mit den Lehrern statt (Einzelgespräche, gemeinsame Aussprachen ...).
-
Da es an der Schule selbst keine pädagogischen Konferenzen gab, versuchte ich, 14tägige pädagogische Besprechungskonferenzen einzurichten, bei denen die Lehrer der inzwischen eingerichteten Integrationsklassen ihre Erfahrungen austauschen und auch öfters ihre Probleme und Schwierigkeiten "abladen" konnten.
-
Kontakt- und Informationsgespräche mit Eltern über den laufenden Unterricht ...
-
Informationsgespräche mit Lehrern anderer Schulen, aber auch mit schulfremden Personen (Interessierte, Politiker, Presse u.a.) ...
Dritte Phase: Wissenschaftliche Forschung
''Die Integrationsklassen sind etabliert, die Anfangsschwierigkeiten überwunden, für Standardprobleme Routinelösungen erarbeitet.
Zwischen Schulpraxis, Behörde und wissenschaftlicher Begleitung ist längst ein vertrauensvoller Arbeitszusammenhang gewachsen.
Es ist nun an der Zeit, die Reform zu beschreiben und zu analysieren. Die Öffentlichkeit wartet ungeduldig auf "Ergebnisse" der wissenschaftlichen Begleitung. Wissenschaftliche Begleitung tut nun das, was als ihr eigentliches Metier gilt Forschung.
Der Unterricht wird mit Video aufgezeichnet, der Alltag in szenischen Beschreibungen eingefangen, die kognitive und soziale Entwicklung der Kinder in Fallanalysen festgehalten und mit erfahrungswissenschaftlichen Methoden untersucht, die Erfahrungen der beteiligten Eltern und Pädagogen in größeren empirischen Studien ermittelt Wissenschaftliche Begleitung ist jetzt Wissenschaft im engeren Sinne. Der Modellversuch wird evaluiert.
Vom Computer im Rechenzentrum geht es in die Bibliothek, von dort an den Schreibtisch. 1987 kann ein ersten Zwischenbericht ''Integrationsklassen in Hamburg" (WOCKEN & ANTOR. 1987) vorgelegt werden.
Der Modellversuch ist beendet und wird als Schulversuch weitergeführt Das ''Beratungszentrum Integration" wird eingerichtet und übernimmt Aufgaben, die bislang von der wissenschaftlichen Begleitung wahrgenommen wurden." (WOCKEN, unveröff. MS., 1990).
Mit meinen Möglichkeiten und Kenntnissen begann ich, nun auch den Unterricht in der Klasse zu beschreiben, zu analysieren und, entsprechend der Zunahme an Wissen um wissenschaftliche Forschungsarbeit, den Unterricht zu evaluieren.
Ich begann mich auf die Rolle des Forschers einzulassen. Um aber Schritt für Schritt die ständig wechselnden Forschungsprobleme besser bewältigen zu können, mußte ich zunächst im Rahmen meines Studiums die zur Verfügung stehenden Forschungsmethoden kennenlernen, um dann in der Folge je nach Erfordernis und unter hoher Flexibilität die meiner Ansicht nach richtige Methode im Feld meiner Forschungstätigkeit einbringen.
Einige der bedeutendsten Methoden zur Datenerhebung waren:
-
Interviews
-
Fragebögen
-
Aussagen, Beurteilungen durch Experten und außenstehende Personen
-
Tests über Einstellungen, Vorstellungen, (Soziogramme) u.a.
-
Unterrichtsaufzeichnungen
-
Klinische bzw. ärztliche Gutachten und Befunde
-
Gesetzesvorlagen
-
Dokumente und Aufzeichnungen unterschiedlichster Art (Protokolle, Presseberichte, Konferenzberichte, Aktenvermerke u.v.m.) u.a.m.
Wichtig wurde für mich die Tatsache, daß es keinen Grund gab, bestimmte Methoden (quantitative oder qualitative, standardisierte oder nichtstandardisierte oder nach welchen Gesichtspunkten auch sonst noch kategorisierte) von vornherein auszuschließen. Evaluationsforschung, also Forschung im Bereich so komplexer und tiefgreifender sozialer Realitäten, wie es der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder darstellt, erfordert ein hohes Maß an Methodenvielfalt. "Die einzigen Grenzen sind die Erfindungsgabe und die Vorstellungskraft des Forschers." (WEISS, 1974, S. 79).
Auch wurde mir sehr bald klar, daß eine Evaluation eines sozialintegrativen Schulversuchs im Sinne der experimentellen Grundlagenforschung, in der der Forscher (Evaluator) nicht an der Planung und Durchführung des Versuchs beteiligt sein sollte, und daher Evaluation "von außen" stattfindet, für die Evaluation unseres Schulversuchs unrealistisch und nicht möglich war.
Die Evaluation eines sozialintegrativen Schulversuchs ist ein Prozeß der sozialen Interaktion, in der der Forscher einerseits durch seine Tätigkeit, durch sein Verhalten die beteiligten Personen beeinflußt, so wie diese andererseits wiederum ihn beeinflussen. Gerade durch meine Bemühungen um das Zustandekommen des Schulversuchs war eine Evaluation "von außen" nur schwer möglich, und ich brauchte mich daher als Forscher nicht erst "nach innen" zu bewegen, sondern identifizierte mich von Beginn an damit.
"Dieser Prozeß der sozialen Interaktion führt dazu, daß es eine eindeutige Evaluation ''von außen" bei einem laufenden Schulversuch nicht geben kann. Die Evaluation geschieht immer mehr oder weniger ''von innen". Die Evaluation ''von innen" ist sogar unter mindestens zwei Gesichtspunkten vorteilhaft:
-
(l) Sie nützt dem Schulversuch: Ein Schulversuch gelingt umso eher, je mehr kompetente Ressourcen zur Verfügung stehen. Es ist nicht einzusehen, warum ein Evaluator seine Fähigkeiten nicht auch in den Schulversuch einbringen sollte, so wie es andere kompetente Personen auch tun (können). Solange im Evaluationsbericht alle Hilfestellungen intersubjektiv überprüfbar beschrieben werden, ist jede Hilfestellung, auch die des Evaluators, eben eine Bedingung des Schulversuchs.
-
Sie nützt der Evaluation: Durch die aktive Mitarbeit erhält der Evaluator eine intime Kenntnis des Schulversuchs. Dadurch ist er leichter oder überhaupt erst in der Lage, mögliche Ursachen für Erfolg oder Scheitern des Versuchs zu identifizieren. Erst diese Kenntnis erlaubt eine Abwägung, ob oder inwieweit ein einzelner Versuch auf andere schulische Verhältnisse übertragbar ist" (LANGFELDT in Eberwein. 1988, S. 287).
Ziel meiner Forschungsfragen:
Natürlich stand aus meiner Sicht zunächst das Bemühen, daß dieser Schulversuch gelingt, an erster Stelle, und aus dieser Sicht stellte sich mir zunächst die Frage:
Welche Bedingungen brauchen wir, damit die behinderten Kinder in der Regelschule gleich gut gefördert und unterrichtet werden können, wie in einer Sonderschule bzw. Sonderinstitution?
Aber schon durch die Aussage des Klassenlehrers Roland Astl der meinte:
"Wenn ich in meinem Unterricht das Konzept eines kindgerechten Unterrichts verwirklichen möchte, dann hat in diesem Unterricht jedes Kind, ob mit einer Beeinträchtigung oder nicht in meiner Klasse seinen Platz..." (s. Kap. III/2.6.1, S. 84),
mußte ich meine Fragestellung insofern ändern, daß ich nun zu fragen hatte:
Welche Bedingungen und Veränderungen pädagogischer, organisatorischer und personeller Art sind in der Regelschule notwendig, damit Kinder mit Behinderungen nicht ausgesondert werden?
Für mich galt es ab dieser Fragestellung nachzuweisen, daß unter diesen oder jenen Bedingungen, die wir eben bereit sein müssen zu schaffen, es möglich ist, daß alle Kinder in eine gemeinsame Schule gehen und in einer Klasse an einem Gegenstand nach je individuellen Möglichkeiten gemeinsam spielen, lernen und arbeiten.
Methodologische Grundlagen qualitativer Forschung:
Es zeigte sich, daß mit den Methoden und Verfahren der klassischen empirisch-experimentellen Sozialforschung diese komplexen pädagogischen Problemsituationen, wie sie z.B. eine sozialintegrative Klasse im Gegensatz zu qualitativ-interpretativen Verfahren darstellen, nur bedingt in der Lage sind, geeignete methodische Wege zur Rekonstruktion subjektiver Sinn-und Relevanzstrukturen aufzuzeigen.
Diese differenzierte Sichtweise führte natürlich auch zu unterschiedlichen methodologischen Konsequenzen.
"So hat - für Vertreter des interpretativen Paradigmas - sozialwissenschaftliche Beschreibung und Analyse in Bezug auf den Kontext einer Handlung und sprachlichen Äußerungen zu erfolgen und muß dem Umstand Rechnung tragen. daß der Kontext, in dem der Forscher sich bewegt, nicht automatisch dem seiner Forschungssubjekte entspricht" (EBERWEIN, 1988, S. 293 f.).
''Da die Handlungen des einzelnen Akteurs aus seinen Wahrnehmungen, Deutungen und Urteilsbildungen heraus entstehen, muß die sich aufbauende Handlungssituation quasi mit seinen Augen erfaßt werden. Die Objekte müssen so ermittelt werden, wie sie sich dem Handelnden darstellen. Das heißt daher, daß der Forscher die Welt vom Standpunkt des Forschungsobjektes aus sehen muß." (WILSON, 1973, zit.n. EBERWEIN, 1988, S. 294).
Somit hat eine Datenerhebung im sozialwissenschaftlichen Forschungsprozeß als Exploration der sozialen Wirklichkeit zwei Zielen zu dienen:
"Zum einen muß sie dem Forscher Kenntnisse über den durch die Forschungsfrage anvisierten Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit vermitteln, zum anderen soll diese gleichsam ''von innen" durchgeführte Erkundung der sozialen Welt sicherstellen, daß die Begrifflichkeit und die theoretischen Vorannahmen des Forschers in der empirischen Welt begründet sind." (EBERWEIN, 1988, S. 294).
Zum Verstehen von Handlungen des Kindes und seiner spezifischen Lebenswelt schreibt EBERWEIN (1988, S. 295) in seinem Aufsatz zur »Ethnographie als Zugang zum Verstehen von Handlungen des Subjekts sowie spezifischer Lebenswelten«:
"Durch diese Erweiterung der Methodik eröffnen sich der Integrationspädagogik über allgemeine entwicklungspsychologische und sozialisationstheoretische Erkenntnisse hinaus Forschungsmöglichkeiten, die es erlauben, Kinder und Jugendliche in ihrem Denken und Verhalten sowie in ihren lebensweltlichen Bezügen besser zu verstehen. Auf diese Weise kann es gelingen, Generalisierungen und Klassifizierungen, die in Begriffen und Zuschreibungen wie ''behindert", "verhaltensgestört", "aggressiv' usw. zum Ausdruck kommen, zu überwinden und den Blick gezielter auf die soziale Wirklichkeit sowie auf die spezifischen Lebensprobleme des einzelnen zu richten und so das Subjekt als ganze Person zu verstehen, statt nur bestimmte Symptome zu sehen. Dadurch erhöht sich auch die Chance zur Überwindung von Ausgrenzungen und Etikettierungen."
In der eigenen Forschungssituation in der Integrationsklasse, oder auch als Stützlehrer in einer 3klassigen kleinen Dorfvolksschule bzw. als Sonderschullehrer in meiner eigenen Klasse, erkannte ich zunehmend die entscheidende Bedeutung dieses forschungsmethodischen Ansatzes, einer kommunikativen und situativen Erschließung der Selbst- und Weitsicht anderer, der möglichst ganzheitlichen Erfassung und unverfälschten Beschreibung von Alltagswelten sowie der in diesen verschiedenen Welten enthaltenen subjektiven Erfahrungen. Ich habe zunehmend gelernt, mich immer mehr ein Stück weiter auf das Alltagsleben anderer einzulassen, um Menschen in ihrer Alltagssituation besser erleben, und damit ihre Handlungen besser zu verstehen und begreifen zu können. Vielleicht war gerade die Lebens- und Erfahrungsphase als pädagogischer Leiter über einige Jahre in der Einrichtung der Lebenshilfe Reutte, ohne jeden forschungspraktischen Hintergrund, für mich so prägsam, lehrreich und bedeutsam.
Im Bereich der pädagogischen Forschung aber erfordert das Paradigma des Fremdverstehens einen grundlegenden Wandel von der Labor- zur Feldforschung.
In meiner wissenschaftlichen Forschungsarbeit versuchte ich zunehmend, auch wenn ich Fragebögen oder z.T. standardisierte Interviews u.ä. als Forschungsmethoden miteinsetzte, im Sinne der Feldforschung natürliches Verhalten in der natürlichen Umwelt als komplexes Geschehen zu beobachten und zu erklären.
''Nur wenn wir in die Alltags-und Sinnwelt anderer "eindringen" und ihr Leben mit ihren Augen sehen lernen, haben wir die Chance, sie auch zu verstehen. Ein Verstehensprozeß dieser Qualität setzt ganz bestimmte hermeneutisch - interpretative Verfahren voraus." (EBERWEIN, 1988, S. 296).
Gegenstand interpretativer Unterrichtsforschung ist das "sinnhafte" individuelle Handeln in der alltäglichen Lebenssituation. Wir haben uns z.B. zu fragen: Warum schlägt sich ein Kind selbst blutig? Warum schreit ein Kind und verkriecht sich angsterfüllt in einer Ecke des Klassenraumes? Warum zeigt es Verhaltensweisen, die wir als autistisch bezeichnen?
Das ganzheitliche Verstehen von menschlichem Handeln und von der Lebenswelt als wissenschaftlicher Auftrag wird damit zur zentralen Zielsetzung der Integrationsforschung.
Unter diesen vorgenannten Aspekten werden wir Kinder in der Schule nicht mehr nur durch Noten, durch IQ und sozialen Status charakterisieren, sondern als emotionale und soziale Wesen, die alle bereits eine persönliche Geschichte aufweisen, bestimmte Sozialisationserfahrungen gesammelt haben, über Wissen verfügen u.a.m.
Vierte Phase: Politische Beratung
''Modellversuche sind ihrer Intention nach auf Übertragung angelegt Das Reformprojekt Integrationsklassen gehört zu den wenigen Schulversuchen, denen eine weitreichende Wirkung auf das übrige Schulwesen beschieden war. Schon bald nach dem Abschluß der Modellversuche wurde in der Schulbehörde eine Kommission eingesetzt, der neben Fachvertretern aus der Behörde auch die Wissenschaftliche Begleitung angehört. Es wird der Referentenentwurf »Die Integration behinderter Kinder in der Grundschule. Überlegungen zur Fortentwicklung und Ausweitung bestehender Ansätze« vorgelegt. Der Referentenentwurf ist Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen in Schulen. Parteien. Verbänden und Organisationen. Die Kämpfe der ersten Phase flackern wieder auf, die Fronten haben sich allerdings verschoben: Die Eltern stehen nicht mehr allein da, sondern finden breite Unterstützung bei Politikern, Behörden, Pädagogen und Wissenschaftlern. Wichtigste Zielsetzung ist der Aufbau von integrativen Grundschulen ab dem Schuljahr 1991/92.
Wissenschaftliche Begleitung ereignet sich jetzt wieder, wie schon in der ersten Phase, im Raume der Öffentlichkeit Ihre Orte sind nun die Amtsstuben der Schulbehörde und die Tagungsräume bildungspolitischer Interessengruppen. Die Gesprächspartner sind nicht die Kinder, Eltern und Pädagogen der Integrationsklassen, sondern Behörden und Mitglieder gesellschaftlicher Organisationen. Ziel wissenschaftlichen Handelns ist nicht die Erarbeitung, sondern die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in bildungspolitische Programmatik; in den öffentlichen Erörterungen geht es nicht um die Gewinnung von Erkenntnissen über Integration, sondern um die Gewinnung von Menschen für Integration."
(WOCKEN, unveröff., MS., 1990).
Ich denke, daß u.a die Vorlage des "Endberichts" über das Projekt »Schulische Integration in Tirol« (Handlungsorientierte Wissenschaftliche Begleitung durch das Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck, 1991) einen wichtigen Beitrag darstellte und damit einen bildungspolitischen Umdenkprozeß verstärkte, sodaß ab dem Schuljahr 1993/94 im Rahmen der 15. SCHOG - Novelle die Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Kinder gesetzlich verankert wurde.
In diesem Endbericht wurden aus unserem Schulversuch in Reutte folgende Beiträge aufgenommen:
-
Syrow, N.: SABINE möchte in die Schule. Ein Schulversuch entsteht. (Eine mehrperspektivische Entwicklungsbeschreibung)
-
ders.: Zwei Lehrer berichten über ihre Erfahrungen in Bzug auf die Kooperation innerhalb einer Integrationsklasse.
-
ders.: Soziale Beziehungen eines Schulversuches in Tirol: "Ein Schulversuch soll entstehen. Rückblickende Beschreibung".
-
ders.: Freie Arbeitszeit - eine Bilddokumentation.
-
ders.: Befragung von Eltern nichtbehinderter Kinder durch Fragebogen.
-
ders.: Freie Lernphase - eine Unterrichtsgestaltung (Videofilm).
-
ders.: Konzept einer Lernwerkstatt in Reutte.
Dem letzten Absatz von WOCKEN folgend. daß wissenschaftliche Begleitung sich an Behörden und an Mitglieder gesellschaftlicher Organisationen wendet mit der Intention, Menschen für Integration zu gewinnen, möchte ich mein Referat anläßlich einer Informationsveranstaltung der niederösterreichischen Elterninitiative, am 15.1. 993 in St. Pölten mit dem Titel:
»Integration muß in unseren Köpfen beginnen« (F. Basaglia)
an dieser Stelle einfügen. Dieses Referat, veröffentlicht in der Zeitschrift: "Betrifft: Integration" Nr.1/93,wurde außerdem an alle Abgeordnete des Parlaments als zusätzliche Unterlage und Information zu dem am 17. März d. J. bevorstehenden parlamentarischen "Hearing" übergeben.
Referat zur Informationsveranstaltung, am 15. Jänner 1993 in St. Pölten
Integration muß in unseren Köpfen beginnen! (F. Basaglia)
Als ich vor ca. 4 Wochen die Einladung erhielt, heute hier vor Ihnen zu sprechen, war mir zunächst nicht klar, aus welcher Perspektive ich den Brennpunkt unserer heutigen inneren Schulreform, nämlich die
"Soziale Integration behinderter Kinder im Regelschulwesen"
betrachten sollte, denn der Begriff "Integration", als gesellschaftliche Forderung, im Sinn von »Wiederherstellung einer Einheit«, um das Ausstoßen aus der Gemeinschaft, das Absondern von Außenseitern, das Diskriminieren von unwillkommenen Menschen zu verhindern, ist heute wirklich zu einem inflationär mißbrauchten Begriff geworden; der - je nach seiner Verwendung - alles bezeichnet, was mit Behinderten oder psychisch kranken Menschen erdacht wird.
Für das Leben in der Gemeinschaft - darauf bezieht sich letztlich die Forderung nach Integration - gelten zwei Prinzipien nach Doz. Dr. Peter Handler von der Universität Wien:
Das Prinzip der Solidarität: Der einzelne Mensch ist auf die Gesellschaft angewiesen. um sich selbst in seiner Persönlichkeit voll entfalten zu können, wobei die Gesellschaft sich nicht als Selbstzweck versteht, sondern eine Voraussetzung darstellt für die Verwirklichung der Person, der Würde zukommt, weil sie einmalig ist!
Auch die Menschenrechte beziehen sich auf die gleichen Möglichkeiten jedes einzelnen Menschen, sei er nun behindert oder nicht.
Gerade der behinderte Mensch zeigt der Gesellschaft, daß die Würde der Person nicht abhängig ist vom Aussehen, von der Intelligenz oder bestimmten Möglichkeiten, sondern vom Selbstvollzug des Lebens und der Gestaltung der eigenen Existenz. Eine Gemeinschaft, die diese Würde des Menschen nicht garantiert, die nicht vom Behinderten lernt, sondern ihn sogar als minderwertig betrachtet, ist wohl abzulehnen.
Daraus ergibt sich das Prinzip der Subsidiarität:
Diese Hilfestellung der Gesellschaft bedeutet, daß wir hier und jetzt zu handeln haben und nicht irgendwann in der Zukunft, wenn eventuell eine "bessere" Gesellschaft existiert.
Integration muß "hier und jetzt" stattfinden! Niemand, auch Lehrer dürfen nicht warten, bis jemand ein besseres Schulsystem eingeführt hat. Gesellschaftliche Änderungen - das lehrt uns die Geschichte - haben an sich soziale Werte nie verbessert, dagegen kann aber nicht bestritten werden, daß verbesserte gesellschaftliche Werte Änderungen im Gesellschaftssystem bewirken.
(p. Handler in: Päd. Fachbl., 1989)
Ich komme zum pädagogischen Feld der Integration:
Im pädagogischen Feld ist der Begriff "Integration" in den letzten Jahren ganz besonders zu einem Schlagwort verkommen, unter dessen schützender, weil fortschrittlich klingender Decke sich eine Unzahl von Praktiken verbergen, behinderte Kinder in den regulären Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zu fördern.
Im Folgenden möchte ich versuchen, Ihnen mittels einiger Gedankengänge aus eigener Berufserfahrung als Volks- und Sonderschullehrer, als Stützlehrer, als wissenschaftlicher Begleiter verschiedener Schulversuche und der eigenen Praxiserfahrung der Integration eines schwerstbehinderten autistischen Buben zu verdeutlichen, daß das, was heute als Integration sichtbar wird, nicht nur eine Zeiterscheinung oder Mode ist, als die sie oft angesehen und "gemacht" wird.
In den letzten 8 Jahren hat in Österreich eine immer größer werdende Zahl von integrativen Schulversuchen uns bewiesen, - auch wenn es in sehr vielen Bereichen noch viel zu verbessern gilt - , daß der gemeinsame Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der Kontinuität der Entwicklung einer humanen und demokratischen Pädagogik steht, die im Laufe ihrer Geschichte aber immer wieder zurückgedrängt, negiert, diffamiert, ja sogar als "Spinnerei" deklassiert wurde.
Aus den unterschiedlichsten Gründen waren besonders in den letzten Wochen verstärkt, z.T. wohl aus Unkenntnis über die Integration, sicher aber auch aus Angst und Sorge vor Veränderung und aus einem beschämenden Maß an Ignoranz reißerische Schlagworte in den verschiedensten Presseaussendungen vorzufinden.
So konnte man z.B. lesen:
-
Proteste der Lehrer gegen "Zwangs - Integration" Behinderter ...
-
Pädagogische Geisterfahrt - Bankrotterklärung ...
-
Schwere Benachteiligung behinderter Kinder ...
-
Jugend wird politischer Effekthascherei geopfert ...
-
Größter Etikettenschwindel der Schulpolitik ...
-
Verantwortungslose Vernachlässigung dieser besonders pädagogisch bedürftigen Kinder ...
u.v.m.
Manche Lehrer befürchten die "verantwortungslose Vernachlässigung dieser besonders pädagogisch bedürftigen Kinder" ...
Wenn ich aus eigener Erfahrung der Schulpraxis meiner beiden Töchter oder den unzähligen Schulbesuchen heute vielfach in unsere Schulen blicke, dann sehe ich oftmals nicht, daß wir als Lehrer/innen, als Erzieher/innen als Kindergärtner/innen besonders verantwortungsbewußt mit den uns anvertrauten Kindern umgehen. In jüngster Zeit beweisen uns vermehrt Studien, daß unsere Schulen selbst nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen kaum mehr zumutbar sind, ja z.T. ihre Sozialfähigkeit und Persönlichkeit bis in die Keime menschlicher Persönlichkeit hinein zerstören.
Eine Schulreform ist also mehr als überfällig!
Wir entziehen uns der Kenntnis dieser Notwendigkeiten meist nur dadurch, daß wir diese Mißstände als "normal", zu unserem Alltag gehörig, betrachten.
Die Integration ist ein Ansatz zu dieser Reform, weil der Ausschluß behinderter Kinder und Jugendlicher aus regulären Erziehungssituationen und Schulen sinnfällig macht, was jedem Kind und Jugendlichen passiert, nämlich x-mal ausgelesen zu werden.
Um Integration, also das gemeinsame Leben und Lernen aller Kinder zu verstehen, müssen wir zunächst unser Augenmerk auf ein allgemeines Verständnis von Lernen und Entwicklung richten.
Der italienische Kinderneurologe Prof. Milani Comparetti geht von folgendem Grundsatz aus:
Ich verkürze:
"Jeder Mensch bringt im Wechselspiel zwischen Umwelt und eigener Persönlichkeit eine Entwicklung ins Rollen, in der durch den eigenen Lebenswillen Lösungen angeboten werden, die nur dort wirksam sein können, wo sie sich mit der Realität der Umwelt messen."
(M. Comparetti in: BHP 26/1987)
Oder anders ausgedrückt
"Die Entwicklungspotenz des einzelnen Kindes kommt erst in den Möglichkeiten und Spielräumen seiner Umgebung zur Entfaltung. Also in der Komplexität der Lernfelder, in der Differenziertheit der Begegnungen, in der Vielfalt der Sozialstrukturen, in denen ein Mensch lebt. Sie definieren seine Lernpotenz, nicht das, was wir Behinderung oder Beeinträchtigung nennen."
(Feuser in: BHP 1989)
Damit zeigt sich zunächst ganz klar, was die Integration pädagogisch bedeutet:
Integration bedeutet die Ablösung des in unserem Schulsystem bestehenden Homogenitäts-Dogmas, - also eine Ablösung der immer wieder selektierten homogenen Lerngruppen.
Die Integration fordert ein Heterogenitäts-Gebot, d.h., daß eine Lerngruppe so vielfältig wie möglich sein sollte.
Das bedeutet bewußt kein Heterogenitäts-Dogma, denn es geht in der Integration nicht um dogmatische Setzungen, sondern um die Zulassung neuer Möglichkeiten, die sich in dem großen Begriff »Heterogenität«, also der Vielfalt an unterschiedlichen Geschichten, Möglichkeiten, Eigenschaften von Dingen, Menschen usw. finden.
In der täglichen Arbeit in unserer Klasse mit 8 sogenannten schwerst-mehrfachbehinderten Kindern und bei dem Versuch, uns gerade diesen Kindern aufzuschließen und für diese Kinder neue Möglichkeiten zu erobern, haben wir erkannt, was Prof. G. Feuser, Sonderschullehrer, Erziehungswissenschaftler an der Universität Bremen und Praktiker im Feld der Integration, wie folgt, ausdrückt:
"Je schwerer ein Mensch durch bestimmte Beeinträchtigungen, die auf ihn gewirkt haben, in seiner Geschichte, im Lernen beeinträchtigt ist, ein desto offeneres, größeres und desto normaleres Lernfeld braucht er." (Feuser in: BHP 1989)
Ich habe von unserer Klasse gesprochen - dazu an dieser Stelle:
Einige Anmerkungen zu meiner derzeitigen beruflichen Tätigkeit.
Mit einer Kollegin zusammen unterrichte ich 8 sogenannte schwerst-mehrfachbehinderte Kinder. Es sind 8 Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Z.T. müssen sie geflittert, stündlich sauber gemacht und gewickelt werden, wobei von allen 8 Kindern nur eines mit Schwierigkeiten sprechen kann.
Die Arten der Behinderung reichen vom schwerst autistischen und fast 90 kg schweren Buben über das 12jährige Mädchen mit Down-Syndrom bis zum 11jährigen Buben mit 15 kg im Rollstuhl bzw. auf seiner Matte liegend.
Ich möchte jetzt nicht näher auf die Kinder eingehen, aber täglich spüren und wissen wir deutlicher, wie viel wir diesen Kindern vorenthalten, indem wir ihnen nicht gewähren, dort in ihrem Dorf zu leben, dort in ihrem Ort zu lernen, sich auch da zu entwickeln, wo also ihre soziale Gruppe ist, in dem Umfeld, wo das Kind hineingeboren wurde, in dem es lebt, die Straße, in der die Familie wohnt, die Spielgefährten, die dort auch in dieser Straße wohnen. Dies klingt für viele von Ihnen vielleicht sehr hart, aber es ist so!
Die Sonderschule Reutte, vor einigen Jahren noch 4k1assig mit über 60 Kindern, deren Leitung ich vor 10 Jahren übernahm, besteht heute noch aus diesen 8 Kindern.
Für mich sind es 8 Kinder zu viel!
Sie fragen sich vielleicht, warum ich noch dort arbeite.
Die Antwort ist einfach:
Ich denke, solange diese Kinder noch an meiner Schule sind, habe ich die Verpflichtung. für sie da zu sein. Sie haben das Recht - auch unter diesen Bedingungen - auf die bestmögliche Förderung, die wir ihnen zu geben vermögen.
Kehren wir bitte zurück:
Ich habe gesagt:
"Je schwerer ein Mensch durch bestimmte Beeinträchtigungen, die auf ihn gewirkt haben, in seiner Geschichte, im Lernen beeinträchtigt ist, ein desto offeneres, größeres und desto normaleres Lernfeld braucht er."
Wollen wir Integration, müssen wir in unserer derzeitigen Pädagogik Mut zum Umdenken und zur Korrektur haben.
Was nämlich unter dem Homogenitäts-Dogma als Status Diagnostik, sozusagen als eine Unmöglichkeit erscheint - ein Defekt, ein Mangel, eine Behinderung -, dies ist auch bis heute noch der Ansatz der Heil- und Sonderpädagogik, das erscheint im Heterogenitäts-Gebot als eine normale menschliche Möglichkeit, als eine Erweiterung des menschlichen Möglichkeitsrahmens.
Wenn wir diese Dinge also richtig analysieren, und nicht von falschen Voraussetzungen ausgehen, dann sehen wir, daß im gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern jeder von jedem profitiert, und es beim gemeinsamen Lernen um einen paritätischen, gleichwertigen und gleichbedeutenden Prozeß geht - ohne auf Kosten von etwas oder jemandem, indem alle kreativ, eigenständig handelnd neue Erkenntnisse zu gewinnen suchen.
Damit bin ich bei einem ganz wesentlichen Punkt:
Wenn wir Integration in die Pädagogik umsetzen wollen, schaffen wir eine Bündelung von Erkenntnissen! Wir brauchen damit einen erkenntnisorientierten Unterricht.
Was verstehen wir nun darunter:
In pädagogischen Prozessen geht es um Einsichten von Zusammenhängen. Es geht um Sachverhalte von Dingen, die man quantifizieren und damit mathematisch berechnen kann. Es geht um bestimmte materielle Eigenschaften, die man physikalisch erfassen kann. Es geht um bestimmte Eigenschaften, die miteinander reagieren und daher chemisch sind. Es geht um bestimmte Eigenschaften, sich selbst zu erhalten; und damit sind sie biologisch, usw.
Erkenntnisse haben natürlich das Wissen zur Grundlage, denn was ich erkenne, geht als Wissen in meinen Besitz über. Mit diesem Wissen ist wieder Kapital vorhanden, neue Erkenntnisse zu gewinnen.
In unserer derzeitigen Schule lassen wir unseren Kindern wohl kaum Zeit, Erkenntnisse zu gewinnen, noch Zeit für individuelles forschendes Lernen, nach dem Motto:
Was einmal erfolgreich war, das kann man wiederholen; was zum zweitenmal Erfolg hatte, das scheint zu funktionieren; was zum drittenmal erfolgreich ist und funktioniert, das scheint eine Lösung zu sein; wenn es aber zum vierten- und fünftenmal funktioniert, dann erkenne ich darin eine Gesetzmäßigkeit. So wird nämlich geforscht, so experimentiert, so gelernt.
Was bedeutet dies für unseren Unterricht?
Das hat zur Folge, daß ich in einer Schule, in der kenntnisorientiert gearbeitet wird, einen anderen Unterricht brauche.
Ich brauche im Gegensatz zum Frontalunterricht den offenen Unterricht, die Freie Arbeit, den projektorientierten Unterricht.
Kinder gewinnen Erkenntnisse über Sachen, an denen sie merken, daß diese Dinge untereinander in Beziehung stehen, daß diese Beziehungen wieder Beziehung zu ihrem Menschsein haben, daß also Dinge, die wir heute auf der Erde vorfinden, von Menschen hergestellte Gegenstände sind - z.B. Werkzeuge, in denen die Erfahrung der Menschheit über teils Jahrtausende vergegenständlicht angesammelt ist.
Da alle Kinder verschieden, einmalig und aus ihrer Geschichte heraus einzigartig sind, muß ich jedem Kind die individuelle Möglichkeit eröffnen, seine Erkenntnis von den Dingen dieser es umgebenden Welt von allen Seiten zu betrachten und zu erforschen.
Nach diesem Schema gehen nicht nur Kinder an das Lernen heran, - das ist ganz einfach menschliches Lernen. Ich denke, gerade wir Lehrer müßten hier ganz rasch damit beginnen, auch als Erwachsene wieder die Gesetzmäßigkeiten menschlichen Lernens an uns selbst zu erfahren.
Die meisten von uns haben es spätestens zu Beginn der eigenen Schulzeit zu verlernen begonnen, - daher sollten wir nicht dieselben Fehler bei den uns anvertrauten Kindern machen.
Was können wir daraus folgern?
Aus der Erkenntnis bzw. aus dem Wissen über menschliche Entwicklung und menschliches Lernen können wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen:
"Jedes Kind, ob behindert oder hochintelligent, hat somit das Recht, über den Unterricht an den höchsten und bedeutendsten Kulturgütern, die der Menschheit zur Verfügung stehen, teilzuhaben, und so hat auch das schwerstbehinderte Kind ein Recht auf Wissen, das die Menschheit besitzt, seine Erkenntnisse zu gewinnen."
Diese Erkenntnisse bedeuten für die Integration aber noch ein weiteres wesentliches und wichtiges pädagogisches Grundprinzip.
Wenn Sie den Gedanken noch einmal aufnehmen, daß alle Kinder miteinander ihre individuellen Erkenntnisse gewinnen, dann ist es für mich nicht Integration, wie es vielfach in Integrationsklassen praktiziert wird, - auch wenn es an der Oberfläche so aussieht, - wenn der Volksschüler nach dem Lehrplan der Volksschule, der Lernbehinderte nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule, der geistig Behinderte nach dem Lehrplan der Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder usw. unterrichtet wird. Das hat nichts mit Integration zu tun. Das sind dann Sonderschulen in einer einzigen Klasse. Die nächste Folge ist sofort, daß dann die Gruppen für den Unterricht auch wieder getrennt werden.
Diese veränderte Herangehensweise bedingt - und hierin liegt ein ganz wesentlicher Moment in der integrativen Pädagogik,
-
daß alle Kinder an einem Gegenstand arbeiten, einen gemeinsamen Lehrplan haben.
Das bedeutet aber von der Arbeitsseite her,
-
daß nicht jedes Kind zur selben Zeit oder gar den gleichen Erkenntnisgewinn haben muß.
Jedem Kind wird seine individuelle Erkenntnis aus diesem Unterricht und Lernprozeß zugestanden.
Wenn wir diese Überlegungen über das menschliche Lernen in das Feld der Integration übertragen, dann merken wir sehr schnell, daß Schulversuchsmodelle, wie sie derzeit in Österreich laufen - nämlich
Kooperative Klasse,
Klein-/ Förderklasse,
Schule unter einem Dach, usw....
nichts mit Integration zu tun haben. Es sind aber genau die Modelle, die von vielen Leuten (Lehrern, Schulbeamten, Politikern ...) als Integration betrachtet werden.
Gerade die Kooperationsklasse, ein Modell, das vielfach bei uns so sehr favorisiert wird, bei dem Sonderklassen an Regelschulen mit der Möglichkeit der Begegnung erhalten bleiben, und wo nach Lust und Wollen auch einmal gemeinsame Sachen gemacht werden; diese Kooperationsmodelle halte ich für das größte Blendwerk, das man sich im Zusammenhang mit der Integration hat einfallen lassen.
Diese Kooperationsklassen sind mit Sicherheit der Garant, daß bei auftretenden Schwierigkeiten dann der Rückzug, also Scheinargumente für den Rückzug in die Stammklasse, Regelklasse oder Sonderklasse, stattfindet.
Ich gestehe einigen dieser Leute, die diese Modelle für Integration halten, durchaus zu, daß sie das isolierende und segregierende Erziehungs- und Bildungswesen durchaus verbessern wollen, da sie sehen und erkennen, daß der Ausschluß behinderter Kinder und Jugendlicher aus ihren regulären Lebens- und Lernzusammenhängen nicht zu rechtfertigen ist, und daß sich diese Praktiken bis heute nicht gerechtfertigt haben; auch nicht in und durch eine nun mehr als einhundertfünfzigjährige Epoche der Heil- und Sonderpädagogik, aber im Grunde wollen sie keine Veränderungen des Erziehungs- und Bildungswesens, zu der eine ernstgenommene Integration gesellschaftlich wie fachlich führt, nämlich zu einem Kindergarten und zu einer Schule für alle.
Daß es nicht sinnvoll ist - und ich sehe auch keine Chance -, Integration als revolutionären Akt durchsetzen zu wollen, das ist uns allen klar. Die bisherige Erfahrung in fast allen Bereichen schulischer Integration hat aber gezeigt, daß die Realisierung einfacher und schlüssiger wird, je mutiger die Veränderung erfolgt.
Integration heißt also Gegen-Gebote gegen das Homogenitäts-Dogma zu setzen.
Ich fasse 3 Kernpunkte zusammen:
-
Integration bedeutet die uneingeschränkte Teilnahme am sozialen Umgang,
-
die uneingeschränkte Teilnahme an den gesellschaftlichen Gütern und
-
die uneingeschränkte Rückgabe oder Akzeptanz der eigenen Geschichte, d.h. dort zu leben, dort zu lernen, sich zu entwickeln, wo die eigene soziale Gruppe sich befindet ... .
Für unsere Konzeption hat dies u.a. folgende Konsequenz:
Es erfordert das Prinzip der Regionalisierung:
Was bedeutet dies?
-
Es darf keine zentralisierten Integrationseinrichtungen geben, - also daß z.B. Kinder aus einer Region in eine "Integrationsschule" gebracht werden. - Das würde nämlich wieder eine Sondereinrichtung Integration bedeuten.
-
Ganz besonders schlimm wäre es wohl, würden wir damit beginnen, Kinder auszuwählen; bestimmte Kinder als integrationswürdig zu k1assifizieren und andere Kinder als nicht integrationsfähig.
Ich gehe an dieser Stelle einen Schritt in die Zukunft ...
es wäre die logische Konsequenz aus dem bisher Gesagten:
Wenn wir über das Normalisierungsprinzip nicht nur reden wollen, sondern danach auch handeln, dann darf es in Zukunft auch keine "Sonderschulüberprüfung" für die behinderten Kinder geben, um den Bedarf für die Integration festzustellen. Ich denke, es gehört zur Professionalität eines Lehrers, es ist u.a. sein Beruf, auch in den Kindergarten zu gehen, sich dort das Kind anzusehen, mit Fachleuten sich abzusprechen, um sich das entsprechende Wissen anzueignen, damit nach den Sommerferien ein nahtloser Übergang in die erste Klasse gegeben ist.
Es braucht keine Überprüfung, keinen Förderausschuß, kein Komitee, - es braucht keine Akte, - es braucht ganz einfach das normale pädagogische Engagement aller um das Kind beteiligten Personen und Institutionen. Ich meine auch, daß man von uns Lehrern verlangen kann, daß wir uns auf neue pädagogische Entwicklungen einstellen.
Ich kenne das Argument von zahlreichen Volks-, Hauptschullehrern und Lehrern an Polytechnischen Lehrgängen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, daß sie ihre Berufsentscheidung aufgrund eines Berufsbildes getroffen haben, welches sonderpädagogische Elemente nicht enthalten hätte.
Ich empfinde die ständig geforderte Freiwilligkeit der Lehrer - in Zusammenhang mit der schulischen Integration - nicht nur beschämend, sondern mehr als unwürdig.
... Was heißt Freiwilligkeit?
Wie ist eine Haltung zu benennen, aus der heraus ein Lehrer entscheidet: Dieses Kind will ich nicht in meiner Klasse haben!? Allerspätestens zu diesem Zeitpunkt sollten Berufsbild, Berufsfeld und Verantwortungsbewußtsein des Lehrers neu überdacht werden. Hier geht es nicht um Freiwilligkeit, sondern um eine Selbstverständlichkeit. Und an das Selbstverständliche erinnern zu müssen, ist ein bedenklicher - und beschämender - Hinweis auf den Zustand der Schule, der Gesellschaft überhaupt!
Wenn wir heute keinen Lehrer überzeugen können, Integration zu machen, oder wenn sich ein Lehrer weigert, in neuer Weise zu arbeiten, zu denken und sich mit diesem Problem zu beschäftigen, der soll doch dann bitte wenigstens an einen Arbeitsplatz gehen, wo das nicht gefragt ist und dort arbeiten, und nicht Lehrerinnen und Lehrern, die dazu bereit sind, den Platz wegnehmen.
Es braucht sicher niemand dadurch seinen Arbeitsplatz verlieren - das wäre auch nicht gerecht -, aber die Konsequenz wäre die Möglichkeit einer Umbesetzung der Dienststelle, also Lehrer, die schon pädagogisch nicht flexibel sind, die sollten dann doch wenigstens räumliche und örtliche Flexibilität beweisen.
Um es zu verdeutlichen:
Ist es gerechtfertigt, darf es wirklich sein, daß ein Lehrer einen 8jährigen Buben mit Down-Syndrom nicht in seine Klasse aufnimmt, obwohl über ein Jahr vorher die Eltern bei ihm als Schulleiter vorgesprochen haben. Daß dieser Lehrer es ablehnt, mit den Argumenten, er habe keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, da er jetzt sein Haus baue.
Ich frage Sie - ist es gerechtfertigt, daß ein Mädchen auch mit Down-Syndrom in einer Nachbargemeinde alle 9 Wochen in eine andere Klasse versetzt wird, mit dem Argument, daß alle Lehrer davon betroffen sein sollen. Die ersten 9 Wochen verbrachte das Mädchen in der 4. Klasse, dann 9 Wochen in der 3. Klasse und dann in der 2. Klasse. Diese Reihenfolge wurde deshalb so festgelegt, damit das Mädchen in der 2. Klasse nur Erstkommunion mitgehen kann. Der Ortspfarrer hatte es trotz Anmeldung der Eltern im Jahr zuvor vergessen. Die letzten 9 Wochen war das Mädchen dann in der 1. Klasse.
Obwohl diese Dinge allen Schulaufsichtsbeamten bis ins Ministerium bekannt waren, wurde nichts unternommen, nichts verändert, im Gegenteil ...
Da muß man wirklich öfters hinhören, und man stellt fest, daß die einfachsten pädagogischen Grundsätze ignoriert werden, denn selbst einem nichtbehinderten Kind wäre dies wohl nicht zumutbar.
Es gibt ein Argument - ein Schlagwort
Möglichkeiten und Grenzen der Integration.
Dieses müssen wir hinterfragen, um zu erkennen, welche Strategien hier betrieben werden, denn sie suggerieren eine große liberale Aufgeklärtheit - so eine Art Handreichung. Ja, das ist alles möglich, aber bedenken Sie doch ...
"Ja, selbstverständlich sind wir für Integration, aber das hat ja auch seine Grenzen, das müssen Sie doch verstehen ..."
Schließlich hat ja fast niemand etwas gegen Behinderte, aber bei der Integration hat es doch seine Grenzen.
Wenn man also in dieser Integrationspraxis arbeitet, so wie ich jetzt seit über 8 Jahren, gemeinsam mit Eltern und einer Reihe von Lehrern/innen, wer diese Praxis vertritt, wer sie mit entwickelt hat, z.T. selbst gemacht hat, wer die Fülle der Widerstände erlebt hat, nur um einmal die Tore für die Integration aufzustoßen, jedes Schuljahr erneut fast jeden Schulversuch wieder neu durchzufechten, wer die z.T. offenen und die verdeckten Widerstände sieht, die gegen die Integration letztlich wirksam werden, die die Entwicklung blockieren, die, wenn die Entwicklung da ist, diese hemmen, sie erschweren, der erkennt, daß diese Widerstände nicht zufällig sind.
Es sind meines Erachtens ganz gezielte Manöver, politisch klare Strategien, diesem Prozeß des veränderten Denkens und einer die Gesellschaft verändernden Praxis entgegenzuwirken.
Das hat dann die fatale Folge, daß sowohl Eltern als auch Lehrerinnen und Lehrer sehr schnell in diesem mühsamen Prozeß zermürbt werden.
Und wenn dann keine zusätzliche Beratung, keine Begleitung eingesetzt wird, oder daß dann Leute eingesetzt werden, die von Integration nicht überzeugt sind, - z.B. auch Sonderschuldirektoren, die Eltern über Integration beraten sollten, aber gleichzeitig ihre Institution erhalten wollen -, oder ein Landesschulinspektor für Sonderschulen, der als einzige Instanz eines Bundeslandes Anträge und Projekte von integrativen Schulversuchen genehmigen oder ablehnen kann, gleichzeitig allein die gesetzlich vorgeschriebene wissenschaftliche Begleitung von nahezu 40 Schulversuchen ausübt, - und es somit in der Praxis einfach keine wissenschaftliche Begleitung gibt ...,
dann sehe ich auch darin wiederum ein gehöriges Stück Unverantwortbarkeit, aber auch ein hohes Maß an Negierung von längst schon gemachten Erkenntnissen und doch wohl auch ein gehöriges Stück Taktik, um die Integration schon im Keim zu ersticken.
Franco Basaglia prägte das Wort
"Integration muß in unseren Köpfen beginnen!"
(F. Basaglia, 1975)
Das darf aber nicht bedeuten, daß wir mit der gemeinsamen Erziehung bzw. dem gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher warten, - wie ich schon einleitend gesagt habe - bis die entsprechenden individuellen wie gesellschaftlichen kollektiven Bewußtseinsveränderungen stattgefunden haben.
Wie unser Denken und Bewußtsein unsere Handhabungen bestimmt, bestimmen unsere Handlungen unser Denken und unser Bewußtsein: d.h., Integration ist in jeder Beziehung (nicht nur in der pädagogischen) Ziel und Weg zugleich.
Daher an dieser Stelle auch ein Appell an die Vertreter der Gewerkschaften:
Machen Sie bitte nicht den Fehler, die Integration unter dem Deckmantel von Idealforderungen verhindern zu wollen, die nicht von heute auf morgen realisierbar sind!
Ich frage:
Wo sind im pädagogischen Bereich der Sonderschule all diese Forderungen erfüllt, die jetzt plötzlich im Zusammenhang mit der Integration erhoben werden?
Warum darf an den Sonderschulen ein so hoher Prozentsatz von ungeprüften Lehrern arbeiten?
Wo gibt es an den Sonderschulen die geforderte Supervision?
Wo findet sich die qualifizierte und umfassende therapeutische Betreuung und Raumausstattung (Betreuungssituation in Klassen mit schwerstbehinderten Kindern)?
Wo zeigt sich die notwendige Weiterbildung?
Wo sind die ausgebildeten Psychologen, Logopäden, usw. ...?
Also dürfen wir doch nicht so tun, als ob an den Sonderschulen alles vorhanden wäre und diese Forderungen als unabdingbare Voraussetzungen für die Integration propagieren.
Viele Lehrer sind der Ansicht:
Um geistig behinderte Kinder zu unterrichten, brauche man Spezialkenntnisse und auch spezielle Lehr- und Lernmittel. Beides würden nur die Sonderschulen und ihre Lehrer anbieten.
Ich gebe diesen Lehrern recht - wir brauchen Spezialkenntnisse. Die braucht aber jeder Lehrer für jedes ihm anvertraute Kind.
Ich möchte versuchen, es Ihnen anders zu verdeutlichen.
Als ich vor ca. 4 Jahren mit diesem schwerst autistischen und damals schon über 70 kg schweren Buben erstmals arbeitete, hatte ich über seine Behinderung - nämlich den Frühkindlichen Autismus - sehr wenig Kenntnis.
Sonderschullehrer, die mit mir vor über 20 Jahren noch in Wien die 6 -wöchige Sonderschulausbildung absolviert haben, werden sich vielleicht erinnern, daß alles, was wir über Autismus gelernt hatten, ein Absatz von knappen 10 Zeilen im Skriptum von "Holzinger" war.
Ich möchte damit sagen:
Ich mußte mir meine Spezialkenntnis erst aneignen, indem ich mich in die Literatur einlas, indem ich mit Fachleuten sprach, die in diesem Feld arbeiten, indem ich hospitierte, indem ich meine eigene Erfahrung immer wieder kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren versuchte ...
Integration bedeutet eben auch, daß wir als Lehrer, als Therapeut und Erzieher unser Wissen und unsere Fachkenntnis im Sinne des Kompetenz-Transfers also unter den wechselseitigen und fachlich verschiedenen Qualifikationen aller beteiligten Personen, die sich mit dem Kind befassen -, zum Kind bringen. Genau hierin sehe ich meine veränderte Aufgabe heute als Sonderschullehrer bzw. Sonderschulleiter, indem ich versuche, im Sinne des Kompetenz - Transfers in der Lehrerfort- und -weiterbildung zu arbeiten. U.a. führte dies zur Einrichtung einer Lernwerkstatt.
Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Prinzip des Team - Teachings.
Daß sich in ganz Österreich in der Lehreraus- und -weiterbildung bis hin zu den Universitäten sehr viel wird verändern müssen. steht außer Frage.
Im Wissen aber auch - um es durch ein Wort von Richard Gross von der Universität Stanford auszudrücken, der sagt:
"Schools change slower thau churches" (H. Haenisch in: Pädagogik 5/1991), sind dauerhafte Veränderungen von Schule nur durch einen wohlbedachten Verbund verschiedener Maßnahmen möglich, und die schulische Integration ist ein Prozeß mit der Bedeutung des "Höchstmaßes" als Ziel. Es ist immer eine Annäherung an ein Ideal, aber diese Annäherung muß immer wieder erfolgen, auch wenn es manchmal Überwindung bedeutet und andere Lösungen Tradition haben oder einfach bequemer sind.
Noch ein Wort zur Institution Sonderschule:
Bei allen Verdiensten, die diese Institution in den vergangenen ca. 120 Jahren sich erworben hat, ist es eben eine Tatsache, daß die Sonderschulen einzig und allein zur Entlastung der Regelschulen entstanden sind. Die Heil- und Sonderpädagogik entstammt nicht etwa aus einer besonderen Pädagogik - das konnte und kann sie bis heute nicht -, sondern aus der Psychiatrie bzw. Medizin. Dorthin bringen wir Kinder, um sie zu heilen - die wenigsten Kinder werden geheilt und kommen wieder zurück. Daraus, denke ich, entstammt die irreführende Ansicht, Kinder an einer Sonderschule erst integrationsfähig zu machen!
Daß Kinder mit besonderen Bedürfnissen an der Sonderschule die bessere Förderung hätten, hat sich doch wohl schon längst in vielfachen praxisbegleitenden empirischen Untersuchungen als Mythos erwiesen. (vgl A. Kniet, 1979).
Ein weiteres Schlagwort
Behindertenförderung auf Kosten der Begabtenförderung?
Was ist das also für ein Fortschritt, der nur durch die Aussonderung der Schwachen erzieh werden kann, die ihn gefährden könnten?
Wem nützt dieser Fortschritt und auf wessen Kosten geht er?
Die Antwort scheint doch derzeit eindeutig und klar zu sein:
"Es scheint, daß nicht unsere Leistungsgesellschaft den Preis zahlen will, daß vielmehr ihre Opfer zahlen müssen, jene Kinder..., die in den allgemeinen Sonderschulklassen über 80% aus den unteren Gesellschaftsschichten bzw. heute durch Kinder aufgefüllt werden, deren Eltern nicht österreichische Staatsbürger sind Es sind überwiegend jene Kinder..., die zu den 20% Schulabgängern gehören, die keinen Arbeitsplatz geschweige Lehrstelle bekommen, die ... am ehesten ihren Arbeitsplatz verlieren."
(Jegge, 1989)
Beginnen wir mit der Integration hier und jetzt!
Denn die Bedingungen, unter denen eine integrative Erziehung und Unterrichtspraxis realisiert werden kann, lassen sich heute eindeutig benennen.
Daher ist Integration D A S Gebot der Stunde!
Unser Blick muß weiter gerichtet sein - in die Realität, in die Zukunft. Eines muß uns klar sein, wer heute Schwache oder Behinderte aussondert, tut das gleiche mit Ausländern, früher oder später mit Kranken und Alten; mit allen, die durch ihr Anderssein den Gesellschafts- und deren Leistungsnormen nicht entsprechen. Niemand darf mehr behaupten, daß es derlei Tendenzen nicht gäbe, denn nicht von ungefähr feiert die Euthanasiedebatte in diesem Umfeld "traurige Urständ". Ein ''Flensburger Urteil", haßerfüllte Übergriffe und Ausschreitungen auf zuvor genannte Randgruppen gäbe es heute kaum, hätten die Kinder der 60er und 70er Jahre den Umgang mit ihnen durch Integration als Selbstverständlichkeit in der Schule, im Ort gelernt und gelebt Tatsache ist, daß die Schule und damit wir Lehrer nicht nur die Verantwortung und Aufgabe haben, Wissens -, sondern vor allem humanitäre und ethische Bewußtseinsbildung zu vermitteln.
In einer großen deutschen Zeitung war in diesem Zusammenhang kürzlich die Frage zu lesen:
" ... hat die Schule verschlafen, was hat sie versäum!?"
Die Integration als humanitäre Selbstverständlichkeit!!!
Fünfte Phase: Theoretische Reflektion
''Der Referentenentwurf hat die bildungspolitische Öffentlichkeit aufgeweckt und in Bewegung gebracht Integration war bis jetzt eine Angelegenheit der Freiwilligen und Engagierten, sie wird nun m einem Thema, das viele angeht und existentiell betrifft:: Grundschulen, Sonderschulen, Lehreraus- und -fortbildung. Das Thema Integration kommt nun auch in der Universität zur verstärkten Geltung. Der Fachbereich Erziehungswissenschaft richtet die »Arbeitsstelle Integration« ein. Ihr gehören Wissenschaftler der Allgemeinen Pädagogik und der Behindertenpädagogik an. Mit Kollegen wird diskursiv erörtert, theoretisch reflektiert, was es mit der Integration pädagogisch auf sich hat Wissenschaftliche Texte werden wieder wichtig, Begriffe werden kritisch hinterfragt, ein gemeinsames Selbstverständnis wird erarbeitet.
Die wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs Integrationsklassen entwickelte sich vom solidarischen Engagement über anteilnehmende Begleitung, wissenschaftliche Forschung, politische Beratung bis hin zur theoretischen Reflexion. Selbstredend waren diese Phasen des Begleitungsprozesses nicht streng voneinander geschieden. Das solidarische Engagement war nie theorielos, die anteilnehmende Begleitung beinhaltete auch wissenschaftliche Distanz, neben wissenschaftlicher Forschungstätigkeit war immer auch Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, und die politische Beratung und theoretische Reflexion blieben stets auf die Nähe zu praktischen Erfahrungen angewiesen. Jede Phase vollzog sich in einem charakteristischen Szenarium von Personen und Orten. Und: Jede Phase hatte die jeweils vorhergehende zur unabdingbaren Voraussetzung und als anregende Grundlage. Das solidarische Engagement bereitete die kollegiale Partnerschaft mit Pädagogen und Schulen vor; die anteilnehmende Begleitung war die Lehrmeisterin der wissenschaftlichen Forschungsarbeit, die wissenschaftliche Forschung legitimierte die Mitwirkung als Sachverständiger in politischen Beratungsprozessen.
Ein Drehbuch allerdings, ein vorlaufendes Konzept für wissenschaftliche Begleitung, hat es nicht gegeben und konnte es nicht geben. Das pädagogische Neuland, das mit Integrationsklassen betreten wurde, erforderte Offenheit, die rasche Entwicklung des Schulversuchs erforderte Flexibilität.
Die wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs Integrationsklassen war in mancher Hinsicht ein aufregendes Forschungsabenteuer, ein Abenteuer mit unerwarteten Schwierigkeiten und Problemen, mit Unwägbarkeiten und Überraschungen. mit kräftezehrenden Anstrengungen und mit befriedigenden Entdeckungen. Ein Abenteuer also, wie es nur erlebt, aber nicht en detail am Schreibtisch entworfen werden kann; und ein Abenteuer, das in klugen wissenschaftstheoretischen Lehrbüchern nicht nachzulesen ist." (WOCKEN, unveröff. MS., 1990).
Während in anderen Bundesländern Österreichs (Steiermark. Oberösterreich, Wien, Burgenland ...) längst sogenannte "Arbeitsstellen für Integration", wenn auch unter verschiedenen Namen, z.B. ZIB (Zentrum für integrative Beratung) aber mit gleicher Zielsetzung eingerichtet wurden, wurde meiner Ansicht nach in Tirol alles unternommen, um gerade diese wissenschaftlichen Begleiteinrichtungen zu verhindern.
Nachdem das zuvor genannte Forschungsprojekt »Schulische Integration in Tirol« an der Universität Innsbruck nicht mehr verlängert wurde, gab es zumindest in unserem Bezirk Reutte, über den ich einen doch guten Überblick habe, keine wie immer geartete, aber vom Gesetz geforderte, wissenschaftliche Begleitung.
Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß von seiten der Schulaufsicht bzw. der Schulbehörde an diesem Schulversuch nicht nur bei der Einrichtung kein Interesse oder keine Unterstützung gegeben war, sondern sich diese Einstellung über alle vier Schuljahre nicht änderte. Bei der Einrichtung des Schulversuchs wurden durch kurzfristige, und ohne Rücksprache mit den beteiligten Personen (Lehrern, Eltern, Vertretern der Eltern u.a.) Entscheidungen getroffen, die die von vornherein nicht leichte Versuchssituation noch zusätzlich erschwerten.
-
Nachdem die Klasse, durch die strikte Ablehnung der Schulleitung der Volksschule und der fast gesamten Lehrerschaft, mit Zustimmung der Eltern an die Allgemeine Sonderschule angegliedert hätte werden sollen, wurden am ersten Schultag des beginnenden Schuljahres vor allem die beiden Lehrer, aber auch alle Eltern vor die neue und momentan nicht leichte Situation gestellt, daß die Klasse doch an die Volksschule kommt. Ich denke, daß es grundsätzlich richtig ist, eine Integrationsklasse an der Regelschule einzurichten, aber in einem gänzlich ablehnenden Umfeld einer Schule durch Schulleiter, fast alle Lehrpersonen und auch in unserer Situation durch den Bezirksschulinspektor ist so eine Arbeitssituation den Lehrern kaum mehr zumutbar. Es war aber auch klar, daß damit mein Plan, die Sonderschule im Verlauf der kommenden Schuljahre in eine "Integrationsvolksschule" umzustrukturieren, verhindert werden sollte. In einem Bericht in der Zeitschrift BETRIFFT: INTEGRATION (Nr. 3/1988) schrieb Helmut Spudich unter dem Titel: Sonderschulauflösung? - Nein, Danke!
Wenig Gegenliebe fand auch der Plan der Sonderschule in Reutte, Tirol sich zugunsten einer integrativen Volksschule selbst aufzulösen und alles sonderpädagogische Know-How stattdessen in eine gemeinsame Erziehung einzubringen.
Die Geschichte: Direktor Norbert Syrow und seine Lehrer an der Sonderschule hatten beschlossen, ihre Schule in eine Volksschule umzuwandeln und behinderte Kinder integrativ zu beschulen. Die äußeren Voraussetzungen dazu waren gegeben. da die Sonderschule in einem Gebäude mit der Volksschule untergebracht ist Aufgrund des Widerstandes des Bezirksschulinspektors und der Volkschule zog die Sonderschule ihren Plan zurück und beantragte daraufhin die Einrichtung einer einzelnen Integrationsklasse, was schließlich mit Druck der Eltern durchgesetzt wurde.
Auslöser für die Integrationsklasse war ein taubes Kind, dessen Eltern den weiten Weg an das Gehörloseninstitut in Innsbruck und die Trennung von der Familie nicht hinnehmen wollten. Nach anfänglichem Zögern meldeten sich schließlich weitaus mehr Eltern nichtbehinderter Kinder für die Klasse, als möglich war.
Die Schulversuchsklasse wurde nunmehr nicht an der antragstellenden Sonderschule eingerichtet, sondern an der benachbarten Volksschule. Diese Entscheidung des Unterrichtsministeriums - wahrscheinlich geprägt von den Erfahrungen aus Tulln, wo der Standort Sonderschule auf heftigen Widerstand der Eltern stieß - erscheint zwar grundsätzlich richtig, nimmt aber keine Rücksicht auf die örtlichen Begebenheiten. "Tragisch ist, daß der Versuch der Sonderschule zur Weiterentwicklung abgelehnt wurde und die Sonderschule in den Versuch jetzt nicht einbezogen wird," kommentiert Volker Schönwiese, Universitätsassistent am Innsbrucker Institut für Erziehungswissenschaft.
Die pädagogische Aufgabe an der Schulversuchsklasse ist herausfordernd. Das taube Kind kann derzeit weder Lippenlesen noch eine Zeichensprache verstehen. Jutta Schöler von der Technischen Universität Berlin, seit vielen Jahren eine der erfahrensten deutschsprachigen Pädagoginnen in Fragen schulischer Integration, machte den Lehrern und Eltern Mut zur Integration und eröffnete einen Förderweg durch den Kontakt zu einem gleichfalls gehörlosen Fachmann.
-
Kurzfristig mußten in der ersten Schulwoche 2 Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache zusätzlich in die Klasse aufgenommen werden. Auch wenn vom Landesschulinspektor argumentiert wurde, daß die Parallelklassen mehr Schüler hätten, und es ja nicht Absicht sein könne, daß in einer Integrationsklasse eine Ausnahmeregelung besteht, d.h. weniger Kinder sind, stellte es für die beiden Lehrer eine erhebliche Mehrbelastung dar. Für mich wurde bei dieser Entscheidung wieder einmal deutlich, daß bei derartigen Weisungen pädagogische Überlegungen kaum eine Rolle spielen. Zumal wenn man bedenkt, daß gerade die Integration eines gehörlosen Kindes eine der schwierigsten pädagogischen Aufgaben darstellt.
-
Letztlich waren der Mißmut und die Äußerung des Landesschulinspektors, der zu unserer Studienreise nach Berlin (s. Kap. III/2.6.3, S. 100), die wir zudem selbst finanzierten, meinte:
''Es ist nicht erwünscht, daß Lehrer sich solche Informationen aus dem Ausland holen, da es diese auch bei uns gibt" -
nicht gerade ermutigend und motivierend.
[11] Aus ärztlicher Sicht und Bestätigung sind SABINES Krankheiten vorwiegend psychisch entstanden.
[12] Im Artikel 3 der 5. Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl Nr. 323/1975 heißt es: "In der Grundschule ist der teilweise gemeinsame Unterricht von schulreifen und sonderschulbedürftigen Kindern zu erproben (Integrierte Grundschule)."
[13] Der Bezirksschulinspektor und der Leiter der Volksschule sind Brüder
[14] Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden ohne Meldung und ohne entsprechende fachliche Fördermaßnahmen an einer Regelschule "unterrichtet".
[15] Dieses Kind wurde von den Eltern schon am ersten Elternabend definitiv für die Klasse angemeldet, sollte der Schulversuch zustande kommen. Da die Eltern zum Zeitpunkt des Elternabends auf Urlaub waren, wurde dieses Kind bei der Zusammensetzung der Kinder berücksichtigt Dieses Kind kam nicht aus dem unmittelbaren Wohngebiet der übrigen Kinder.
[16] Nachlese zur Tagung "Integration Konkret" des Pädagogischen Instituts des Landes Tirol vom 17. und 18. Juni 1988 am Grillhof in Igls bei Innsbruck
Mit integrativem Unterricht sind Organisationsstrukturen und damit Lehr- und Lernprozesse verbunden, in denen behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam lernen.
So gelten für den integrativen Unterricht grundsätzlich dieselben didaktischen und methodischen Lehr- und Lernvoraussetzungen, wie sie heute für den Unterricht in der Regelschule gefordert werden.
Die ehemalige Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Sport, Dr. Hilde Hawlicek in ihrer Eröffnungsrede (in: OLECHOWSKI, 1990, S. 20) zur österreichischen Grundschulenquete 1989:
"Die Kindgemäßheit unserer Schule drückt sich aus:
-
In der Abkehr von einem uniformen Unterricht hin zu einem individualisierenden und differenzierenden Unterricht;
-
in einem Unterricht, der das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit erfaßt und sich nicht auf bloß kognitive Inhalte beschränkt Das heißt, in einem Unterricht, der sich auch die Förderung im körperlichen und sozialen Bereich zum Ziel setzt.
-
Ziel des Unterrichts ist die Förderung des einzelnen Individuums, unter dem Motto:
»Fördern statt Auslesen«."
In einem lehrerzentrierten Unterricht ist es nur schwer möglich, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen aller Kinder zu berücksichtigen. Schule, und damit Unterricht, müssen »ein Ort der maximalen Individualisierung sein« (OLECHOWSKI, 1989).
Um diesem Ziel der Förderung der Individualität des einzelnen Kindes gerecht zu werden, ohne es aus seiner Klasse auszusondern, müssen Unterrichtsmethoden verwendet werden, die das Kind in seiner Entwicklung in den Mittelpunkt stellen: z.B. Binnendifferenzierung; offene, nicht direktive Unterrichtsformen, wie Projekte, Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Erkundungen u.a.m. Der Zielsetzung integrativen Unterrrichts, nämlich
»daß alle Kinder
-
in Kooperation miteinander
-
auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau
-
an und mit einem gemeinsamen Unterrichtsgegenstand lernen«
(FEUSER, 1981, S. 12),
konnten sich die Lehrer in der konkreten Unterrichtsarbeit innerhalb des Schulversuchs im Verlauf der vier Schuljahre in dem Maße nähern, als ihre persönliche Erfahrung und damit ihre Professionalität sich festigten.
Dies erforderte zunächst, daß sich beide Lehrer sehr intensiv mit den Grundprinzipien menschlicher Aneignungsprozesse und damit dem Prozeß des Lernens ganz allgemein auseinandersetzten, wobei die theoretischen Gesetzmäßigkeiten menschlicher Lern-und Unterrichtsprozesse Grundlage für didaktische Neuorientierungen in der Praxis zu einem integrativen Lernen und Unterricht darstellten.
Wissenschaftliche Theorien, die sich auf den Menschen, auf sein Handeln und sein "So-Sein" im Kontext seiner Umwelt beziehen, aber auch nach Ursachen seiner Entwicklung fragen, sind gleichzeitig Verbindung und Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und realer Unterrichtspraxis.
Inhaltsverzeichnis
- 3.2 Schulische Integration und ihre entwicklungslogische Didaktik
- 3.3 Der Klassenraum als Lernfaktor
- 3.4 Freie Arbeit und ihre Modelle
- 3.5 Zur konkreten Organisation und Praxis der Freiarbeit im Verlauf der 4 Schuljahre
- 3.6 Beispiele aus dem Unterricht
- 3.7 Projektorientierte Unterrichtsformen
- 3.8 Zur konkreten Organisation und Praxis der Arbeit in Projekten im Verlauf der 4 Schuljahre
- 3.9 Beispiele aus dem Unterricht
- 3.10 Resümee zum Offenen Unterricht
Wollen wir das menschliche Lernen begreifen und damit wiederum das Wesen der Schule, dann müssen wir die Strukturen der menschlichen Aneignungsprozesse näher betrachten und zu begreifen versuchen.
Daß ein menschliches Leben und damit verbunden natürlich ein Lernen ohne soziale menschliche Beziehung nicht möglich ist, belegt der »Wildjunge von Aveyron« (MALSON u.a., 1976).
Nach ALEXEJ LEONTJEW und seiner Theorie ist die menschliche Entwicklung durch drei Arten von Erfahrungen gekennzeichnet:
-
die erblich fixierten Erfahrungen,
-
die individuellen Erfahrungen als Anpassungsprozeß an die Umwelt,
-
die angeeigneten gesellschaftlichen Erfahrungen.
LEONTJEW geht davon aus, daß nur dem Menschen solche gesellschaftlichen Erfahrungen möglich sind. JANTZEN bezeichnet dieses Spezifikum menschlicher Existenz gegenüber dem Tier als "soziale Vererbung" (1980, S. 96).
''Mit sozialer Vererbung ist gemeint, daß das Wesen des menschlichen Lernprozesses weder durch die genetische Weitergabe von Informationen noch durch die Ausbildung individueller Anpassungsprozesse durch mehr oder minder hoch organisierte Reflexsysteme hinreichend gekennzeichnet werden kann. Der spezifische Inhalt des menschlichen Lernprozesses ist vielmehr die Übernahme eines nichtbiologischen, sozialen Erbes, ein Prozeß, in dem die beiden anderen Ebenen reduziert, relativ bedeutungslos werden." (Ebd, S. 96/97).
Diese gesellschaftlichen Erfahrungen entstehen durch "die Haupttätigkeit des Menschen - die Arbeit" (zit. n. PREUSS-LAUSITZ, 1981, S. 139), ein Prozeß, den MARX (1970, Kap. 5) in seiner Analyse des Arbeitsbegriffes als Bedingung menschlicher Existenz und als bedeutendste Triebkraft der individuellen Aneignung des gesellschaftlichen Erbes ansieht.
LEONTJEW folgert daraus, daß es der Hauptinhalt der kindlichen Entwicklung sei, sich die Erfahrungen anzueignen, die die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte gesammelt hat. Das Wesen dieses Aneignungsprozesses des Menschen liegt aber nicht in der Anpassung an die Umwelt, sondern darin, daß sich der Mensch seine Umwelt aktiv handelnd zu eigen macht. LEONTJEW ist der Auffassung, daß der Mensch kein "passives Ding" ist, sondern daß es das Wesen des Menschen ist, "Subjekt des Lebensprozesses" zu sein (vgl. MESSMANN/RÜCKRIEM, 1978, S. 114 f.). Die von LEONTJEW beschriebenen und von JANTZEN (1986/87) weiterentwickelten Prozesse der Tätigkeit und Handlung kennzeichnen den menschlichen Aneignungs- und damit Lernprozeß im Sinne von Entwicklung dadurch, daß immer neue, höher organisierte und differenzierte, innere Abbilder von der Welt - und damit Tätigkeitsniveaus - entstehen.
''Es gibt keine menschliche Tätigkeit und damit auch kein menschliches Lernen, das außerhalb der Struktur von Arbeit gedacht werden kann, und wenn alles menschliche Lernen, alle Tätigkeit die Struktur von Arbeit hat, dann ist alle menschliche Tätigkeit nur in einem Netz von Handlungsplänen und Perspektiven zu begreifen, von kurzgreifenden Handlungsplänen bis zu langgreifenden, von kurzen Perspektiven bis zu Lebensperspektiven."
(JANTZEN, 1980, S. 100).
Im Prozeß der Tätigkeit oder der Arbeit selbst wird ein Gegenstand mit bestimmten Mitteln - gedanklichen Operationen oder Werkzeugen - bearbeitet, bis das Produkt erstellt ist. Am Ende des Prozesses hat sich der Gegenstand in das Produkt verändert und der arbeitende Mensch von einem, der dieses Produkt erstellen wollte, in einen, der es erstellt hat. Er hat sich die zu seiner Erstellung notwendigen Fähigkeiten angeeignet und in diesem Prozeß der Bearbeitung und Aneignung sich selbst verändert.
Wenn das Kind spielt, versucht es Bereiche, in denen es schon bewußte Handlungspläne hat, aber in denen die Mikrostruktur des Handels noch längst nicht zugänglich ist, grob zu strukturieren und zu entfalten.
''Indem das Kind dieses Spiel in gegenständlicher Tätigkeit unter Anwendung von gegenständlichen und sprachlichen Mitteln vollzieht, ist es am Schluß des Spiels ein anderes, hat es andere Fähigkeiten erworben." (Ebd).
Dieser Aneignungsprozeß und damit das Lernen ist nur denkbar und organisierbar im "Zusammenhang kooperativer Tätigkeit" (MARX, 1970, Kap. 11), denn kein Kind kann sich heute alleine das gesellschaftliche Wissen aneignen; vielmehr muß es systematisch mit den Vergegenständlichungen in Sprache und den Produkten und dem nichtsprachlichen Ausdruck konfrontiert werden, und zwar immer so, daß es lernfähig ist, "daß die Konfrontation der lernrelevanten Vergegenständlichung einerseits seinen Bedürfnissen und andererseits seinen Fähigkeiten entspricht, also in der Zone seiner nächsten Entwicklung liegt" (JANTZEN, 1980, S. 97/98).
"In Bezug auf schwerstbehinderte Menschen müssen wir oft feststellen, daß ihnen über Jahre gemachte Angebote zu keinem pädagogischen bzw. therapeutischen Erfolg führen. Dies lasten wir fälschlicherweise ihrem reduzierten oder mangelnden Lernvermögen an und übersehen, daß die Ursache in den durch die Art und Weise des Angebotes - bezogen auf das jeweilige Entwicklungsniveau - nicht zustande gekommenen subjektiven Sinnbildungsprozessen zu suchen ist, ohne deren Zustandekommen für das betroffene Kind nicht der geringste Anlaß besteht, diese Angebote wahrzunehmen, sie abzuspeichern und in seine Entwicklungsprozesse zu integrieren."
(FEUSER, 1989, S. 26/27).
Kennzeichnen bei LEONTJEW die weiterentwickelten Prozesse der "dominierenden Tätigkeit" den menschlichen Aneignungsprozeß und damit das Lernen, so sind es bei PIAGET (zit. n. FEUSER, 1989, S. 26) "die durch ihn beschriebenen Prozesse der »Adaption« und »Organisation«. Auf der Basis der »Sensibilität« gegenüber der Umwelt nimmt der Mensch über die »Brücke der Wahrnehmung« Informationen aus der Außenwelt auf. Er speichert und integriert sie bzw. schafft durch Rekombination des Erfahrenen selbst neue Information im System. Nach dieser Erfahrung handelt er und zwar auf jedem Entwicklungsniveau mit den jeweils intern organisierten Mitteln zentralnervöser und psychischer Funktionen" (ebd.).
Für die Unterrichtspraxis in der Schule ist es bedeutsam, in welcher Weise bei den Kindern in Auseinandersetzung mit ihrer gesellschaftlichen Umwelt »Motive entstehen«, die sie zu Tätigkeiten und in der Folge zu Handlungen bewegen. Daß die Tätigkeit, ist sie motivgebunden, und auch ein Gegenstand mit Emotionen und Gefühlen besetzt sind, ist für LEONTJEW eine weitere bedeutsame Kategorie des psychischen Erlebens.
''Wir können daraus den Schluß ziehen, daß auch die Gegenstände des schulischen Lernens von den Kindern durch ihre Motive mit Emotionen besetzt sind. Darin drückt sich das subjektive Verhältnis des Individuums zum Gegenstand seiner Tätigkeit aus." (PREUSS - LAUSITZ, 1981, S. 142).
Wenn der menschliche Lernprozeß als Aneignungs- und Tätigkeitsprozeß die Struktur von Arbeit besitzt, bleibt die Frage, inwieweit der individuelle Mensch doch schöpferisch und Gestalter seiner eigenen Geschichte ist.
JANTZEN (1981) folgert daraus:
''Mit der Realität wird jeder Mensch in einer einzigartigen Konfrontation wieder konfrontiert In dieser einzigartigen Konfrontation ist er gezwungen, die bisher erworbenen Gesetzmäßigkeiten, die seine Fähigkeiten sind, zugleich immer auf Vertrautes und Neues anzuwenden. Insofern konstituiert sich in diesem Prozeß individuell schöpferisch die Welt neu für das Individuum, allerdings nicht beliebig, sondern entsprechend den in der objektiven Realität vorhandenen gesellschaftlichen und natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten angeeignet und als Fähigkeiten über das Handeln vermittelt, über die Tätigkeit wieder nach außen gewendet, rekonstruiert der Mensch reproduktiv schöpferisch »Dinge für uns« zu »Dingen für sich«."
Für LEONTJEW findet Lernen - als Entwicklung der Persönlichkeit - nur dann statt, wenn folgende Dimensionen gleichzeitig beachtet werden:
-
"-Lernen in Abhängigkeit von der motivgeleiteten Tätigkeit des Individuums,
-
-Lernen in der Kommunikation mit anderen Menschen,
-
-Lernen in der Verknüpfung von objektiver Bedeutung und subjektivem Sinn und
-
-Lernen in der Bearbeitung des Widerspruchs zwischen objektiver Bedeutung als herrschender Ideologie und eigener Lebenspraxis" (zit. nach PREUSS -LAUSITZ, 1981, S. 148).
Bedeutsam sind die von FEUSER (1989, S. 26/27) in 5 Grundgedanken zusammengefaßten Aspekte menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens, lassen sich doch unter Berücksichtigung der Arbeiten von LEONTJEW (1973), PIAGET (1969), SPITZ (1963), JANTZEN (1980), um nur einige zu nennen, eine entwicklungslogische Diagnostik und unter Aspekten des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Kinder eine entwicklungslogische Didaktik aufbauen.
"Als lebendiges System gewinnt der Mensch im Rahmen der Prozesse, die wir Lernen nennen, ein inneres Abbild von der äußeren Welt.
-
-Das innere Abbild ermöglicht die vorgreifende Widerspiegelung in Bezug auf die umgebende Welt, d.h. es ermöglicht die Antizipation des Kommenden und damit eine stabile Orientierung des Individuums auf und in seiner Lebenswelt.
-
-Die Regulation der Austauschprozesse des Menschen mit seiner Welt orientiert sich am nützlichen Endeffekt, den sie für die Absicherung des Systems haben, d.h. nach Maßgabe der Einlösung der seine Tätigkeit antreibenden Bedürfnisse, Motive und Erwartungen. Gelernt wird folglich nur, was in und durch diese Prozesse subjektive Bedeutung gewinnt.
-
-Entwicklung können wir auf diesem Hintergrund als eine auf der Basis von Lernprozessen stattfindende, im Laufe des Lebens durch akkumulierte Erfahrung bedingte, immer komplexere und differenziertere Organisation der Psyche verstehen.
-
Die Organisationsstruktur des Psychischen umfaßt zu jedem Zeitpunkt und auf jedem Niveau der Entwicklung alle psychischen Funktionen und Parameter der Handlung, die wir als typisch menschliche erkennen. Das heißt, Entwicklung ist nicht das additive Hinzukommen einer psychischen Eigenschaft zur nächsten und' deren Anhäufung, sondern das Gesamt aller dem Menschen möglichen psychischen Eigenschaften, das auf jeder Stufe, auf jedem qualitativen Niveau, das wir ausgliedern können (das ist eine Frage der Feinheit unserer diagnostischen Raster) in Form integrierter psychischer Funktionen präsent ist (In dieser Position ist die Gegenkraft gegen das Prinzip der Atomisierung Behinderter zu sehen)" (FEUSER, 1989, S. 26 f.).
"Sehen wir Lernen und Entwicklung des Menschen als Produkte wie Organisatoren selbstorganisierter und selbstregulierter Aneignungsprozesse, so ist auch ein Mensch mit schwerster Behinderung; ein sich unter seinen individuellen Lebensbedingungen »vollwertig selbstorganisierendes lebendiges System, dem keine menschliche Eigenschaft abgeht«. Er ist ein Mensch, der sich an subjektiver und persönlicher Tätigkeits- und Sinnerfahrung orientiert. Ein denkender, wahrnehmender und handelnder Mensch, der nicht ständig mit neuen Informationen konfrontiert und gefüttert werden muß, sondern dem geholfen werden muß, daß die von ihm zumeist nur rezeptorisch aufgenommenen Eindrücke zur Information werden, und er darauf bezogen adäquat handeln kann. »Information muß stets neu organisiert und kann nicht einfach übertragen werden! Information ist nicht, was wir als Pädagogen und Therapeuten lehren oder am Schwerstbehinderten tun, sondern was im Lernenden Informationspotential erzeugt«. (Ebd.).
Vielleicht ist es zu vermessen, die beiden Lehrer auch als "Revolutionäre der Pädagogik" zu bezeichnen, als der u.a. Paulo Freire, (zit. n. PREUSS-LAUSITZ, 1981, S. 155) durch seine Alphabetisierungskampagnen in Brasilien und Chile und später in einigen westafrikanischen Ländern bezeichnet wird. Aber ist nicht jeder Lehrer heute ein Revolutionär, der in unserer so verhärteten, inhumanen Schulstruktur in seiner Klasse einen Unterricht zu praktizieren versucht, in dem jedes Kind ohne Ausnahme "im Prozeß seiner Selbstorganisation (Erziehung und Bildung) seine Persönlichkeit optimal und ungebrochen entfalten kann" (FEUSER, 1989, S. 40)?
Schon aus dem Grund, daß viele Parallelen zwischen unserer Intention der Integration und den pädagogischen Theorien Freires bestehen, haben sich beide Lehrer damit eingehend auseinandergesetzt. Denn eine Pädagogik, die Erziehung als "ein Instrument umgestaltenden Handelns" betrachtet, "als politische Praxis im Dienst der permanenten menschlichen Befreiung (FREIRE, 1974, S. 170), muß das »Verhältnis von Schülern zu Lehrern« und die Auswahl der Lerninhalte neu gestalten." (Ebd).
Nach Freire hat der Lehrer nicht die Aufgabe, nur fertiges Wissen an die Schüler weiterzureichen, einen Inhalt vorzutragen, zu übergeben, als ob es sich um etwas Fertiges, Ausgefeiltes, Vollendetes oder um etwas Abgeschlossenes handelte, sondern er soll ihnen die »Probleme klarmachen«, die im Gegenstand enthalten sind, der Schüler und Lehrer miteinander in Beziehung setzt. Lehren ist bei Freire demnach nicht Programmieren, sondern Problematisieren, nicht das Abkündigen von Antworten, sondern das Aufwerfen von Fragen und die Provokation des Schülers zur Selbstbestimmung. Dazu fordert Freire eine völlige Änderung der unterrichtlichen Didaktik, als auch z.B. der Lernumgebung einer Schulklasse.
Für Freire ist der »Lernstoff« die Lebenssituation eines Kindes, seine Erfahrung von der Situation, sein Bewußtsein mit allen darin enthaltenen Widersprüchen. Indem der Lehrer eben dieses Bewußtsein des Schülers zum Problem macht, wird er seinerseits zum Schüler des Schülers, so wie der Schüler in gewisser Weise zum Lehrer des Lehrers wird. Dies ist wiederum für Freire aber nur im Dialog[17] möglich.
''Dialog heißt, den Schwer als Subjekt anzusehen. sich selbst in Beziehung zum Schüler und dem erkennenden Objekt zu setzen. die Worte mit der »Aktion« in Verbindung zu setzen und damit Veränderungen zu bewirken." (FREIRE, 1913, S. 11).
Der Dialog aber ist auch nur dann im pädagogischen Prozeß sinnvoll, wenn er mit Lerninhalten - Freire nennt diese Inhalte »generative Themen« verbunden ist, die im Bewußtsein des Schülers zentrale lebensgeschichtliche Bedeutung haben.
In seiner Alphabetisierungskampagne ging es Freire vor allem darum, die schweigende Mehrheit der Bevölkerung aus ihrer Unterdrückung zu befreien.
Freires Entdeckung der »Kultur des Schweigens« ist zwar nicht neu, aber sie führt uns zum Grundsatz seiner pädagogischen Theorie. In ihr versucht er, die Menschen zum eigenen und selbständigen Handeln zu veranlassen, und geht dabei von ähnlichen Grundprinzipien aus wie Leontjew.
"Sie lassen sich auf die sozialen und psychischen Bedingungen des Sonderschülers übertragen, sind aber auch für die Erziehung aller Schüler von grundlegender Bedeutung. Seine Beschreibung der Einstellung der unterdrückten Lateinamerikaner liest sich wie eine Kennzeichnung eines typischen proletarischen Hilfsschülers: aggressiv gegen Seinesgleichen. machtorientierte Imitation der Stärkeren (der Unterdrücker), bestimmt von Selbsterniedrigung (der Glaube daran, daß er selbst krank, faul und unproduktiv sei), mit magischem Glauben an die Unverwundbarkeit der Unterdrücker, an die Unveränderlichkeit"
(PREUSS -LAUSITZ, 1981, S. 155).
Die bisher aufgezeigten Theorien von Leontjew, Feuser, Jantzen, Freire u.a. über die Vorgänge menschlicher Entwicklung und deren Aneignungsprozesse machen deutlich, daß ein grundlegendes Umdenken zum Lernen notwendig ist.
In Kenntnis und Beachtung dieser Theorien zur menschlichen Entwicklung, die für alle Kinder gelten, gleich welcher Art oder welcher Schweregrad einer Behinderung vorliegt, sollte es in Zukunft verstärkt möglich sein, daß nicht nur die Vorurteile und Ängste zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder weiter abgebaut werden, sondern daß integrativer Unterricht zur Selbstverständlichkeit wird.
Ein Lernen, das auf den unterschiedlichen Motiven der Kinder, auf ihren verschiedenen Handlungen, sozialen Beziehungen und Interaktionen aufbaut, kann im herkömmlichen "Fütterungsunterricht" in unseren Schulen nicht verwirklicht werden. Dies gilt in einem noch verstärkteren Maß, wenn Kinder mit Behinderungen in die Regelschule integriert werden sollen.
Es sind pädagogische und didaktische Maßnahmen zu treffen, die allen Kindern auf ihrem jeweiligen Entwicklungsstand gerecht werden.
So war es naheliegend, daß die beiden Lehrer in ihrer Unterrichtsplanung und Gestaltung u.a auf die Erkenntnisse und Erfahrungen der Reformpädagogin Maria Montessori und Celestin Freinet (s. Kap. III/3A.3, S. 150 ff.) zurückgriffen.
So hatte Maria Montessori schon zu Beginn dieses Jahrhunderts als Ärztin und vor allem als Pädagogin bei ihrer Arbeit mit geistig behinderten Kindern Fördermaterial entwickelt, das auch diese Kinder zu schöpferischer und z.T. eigenständiger Tätigkeit anregte.
Als sie im Auftrag einer römischen Wohnungsbaugesellschaft eine Betreuungsstätte für Kinder im Vorschulalter einrichtete, bot sie diesen "normalen" Kindern viele bereits bei den behinderten Kindern entwickelte Arbeitsmittel an.
Grundlagen ihrer Pädagogik entwickelte sie daraufhin aus den Beobachtungen der Kinder, sowie deren Entwicklung und Veränderung.
Die kindliche Entwicklung ist bei Montessori durch mehrere Phasen unterschiedlicher Veränderung beeinflußt. So ist das Kind von Geburt an ein mit einem aktiven Geist ausgestattetes Wesen, dessen Entwicklungsmöglichkeit durch einen "immanenten Bauplan" so angelegt ist, daß es durch Einflüsse seiner ihn umgebenden Umwelt, insbesondere der erzieherischen, gehemmt oder gefördert wird.
Maria Montessori folgert daraus, daß nicht der Erzieher oder der Lehrer das Kind "bildet" und "formt", sondern daß der entscheidende Bildungsakt durch das Kind selbst geschieht. "Hilf mir, es selbst zu tun" (ebd.). Dieser Ausspruch eines ihrer Kinder macht nicht nur das Verhältnis von Erzieher und Kind deutlich, sondern ist eine ihrer wichtigsten pädagogischen Forderungen.
Als "sensible Phasen" bezeichnet Montessori Abschnitte in der Entwicklung eines Kindes, in denen sich das Lernen am nachhaltigsten vollzieht. Diese Phasen, wiederum in unterschiedliche "sensible Perioden" unterteilt, sind bedeutsame und wichtige Zeitspannen in der Aufnahmebereitschaft entsprechender Förderangebote z.B. durch den Erzieher und Lehrer.
Wird die sensible Periode nicht berücksichtigt, so können Lernprozesse später oftmals nur unter sehr großen Anstrengungen und Mühen nachgeholt werden. So beschreibt Maria Montessori eine derartige sensible Periode am Beispiel der Aneignung der Sprache. Ein Kind erlernt in einer sehr kurzen Zeitspanne ohne große Mühe seine Muttersprache. Fehlt aber gerade in dieser sensiblen Phase die Ansprache durch einen anderen Menschen, so wird dieses Kind eine gestörte oder mangelnde Sprache entwickeln.
Aufgrund dieser genauen Beobachtungen der Kinder erstellt Montessori spezielle didaktische Angebote. So weist sie u.a. darauf hin, daß Kinder im Alter von 4 Jahren am günstigsten das Schreiben lernen u.v.m.
Diese Beobachtungen und Erfahrungen waren möglich, da den Kindern entsprechende Anregungen durch eine "vorbereitete Umgebung" (MONTESSORI 1976, S. 135-144) geboten wurden.
"Die Umgebung soll von einfacher Struktur sein, sodaß das Kind sich leicht orientieren kann. Sie sollte ein reichhaltiges und angemessenes Angebot an Aktivitätsmomenten enthalten. Das Kind darf sich in ihr frei bewegen. Die Arbeit und deren zeitliche Spanne darf das Kind frei wählen. Der Raum sollte folgende Anforderungen erfüllen:
-
Er sollte so weit sein, daß die Kinder ihrem Bewegungsbedürfnis nachkommen können.
-
Er muß die Möglichkeit bieten, daß das Kind sich auch einmal absondert und isoliert.
-
Er soll ästhetisch ansprechend sein und zum Arbeiten auffordern; Pflanzen und Tiere sollen darin Platz haben.
-
Er soll den Körpermaßen des Kindes proportional angepaßt sein.
Die Gestaltungselemente der vorbereiteten Umgebung müssen so beschaffen sein, daß sie die aufeinanderfolgenden Neigungen des Heranwachsenden, seinem jeweiligen Entwicklungsstand gemäß, ansprechen, herausfordern und einen weiteren Lernprozeß bewirken. Der Lehrer ist Pfleger des Materials, Beobachter und Berater des Kindes." (BIEWER, 1992, S. 21).
Daß das Kind mit seinen eigenen natürlichen Kräften, mit seinen Bewegungen in die Umwelt einzudringen vermag, ist für M. Montessori nur möglich, wenn es an ein Material gebundene Tätigkeiten ausführt.
Diese Tätigkeit eines Kindes unter dem Begriff "Arbeit" unterscheidet sie ganz wesentlich von dem Begriff Arbeit eines erwachsenen Menschen.
''Die Arbeit des Kindes gehört einer anderen Ordnung an und hat eine andere Mächtigkeit als die Arbeit des Erwachsenen, ja ist dieser geradezu entgegengesetzt es ist eine unbewußte Arbeit, verwirklicht durch eine in der Entwicklung befindliche geistige Energie, eine Schöpfungsarbeit, die an jene biblische Darstellung erinnert, in der es vom Menschen nur heißt, er wurde geschaffen."
(MONTESSORI, 1985b, S. 265).
Das Kind vervollkommnet also sein eigenes Sein, indem es aktiv handelnd seine es umgebende Umwelt in sich aufnimmt.
Eine Schlüsselstellung in Montessoris pädagogischem Ansatz haben die »freie Arbeit« und die »didaktischen Materialien«. In dieser "Freiarbeit", die den ganzen Unterrichtstag bestimmt, kann das Kind in freier Arbeitswahl seine Tätigkeit selbst bestimmen. Die bereitgestellten Materialien sind Gegenstände für Übungen des praktischen Lebens, Sinnes-, Mathematik- und Sprachmaterialien, sowie Materialien für den Bereich der "kosmischen Erziehung".
Auf folgende Merkmale ist bei den Materialien zu achten:
-
"Isolation der Schwierigkeit Eine Eigenschaft wird besonders hervorgehoben, die übrigen werden so weit wie möglich zurückgedrängt Wenn z.B. ein Material der Unterscheidung "groß - klein" dient, so unterscheiden sich die Teile nur in diesem einen Merkmal, niemals in anderen (z.B. der Farbe). Die Aufmerksamkeit des Kindes konzentriert sich somit auf den wesentlichen Aspekt.
-
Begrenzung des Materials: Die Montessori-Materialien verstehen sich als "Schlüssel zur Welt". Die Anzahl der Materialien ist begrenzt Einfache Strukturen bewirken, daß es für das Kind überschaubar bleibt.
-
-Kleine Lernschritte: Oft sind die Materialien Bestandteil von Materialreihen, bei denen komplexe Lerninhalte sukzessiv aufgebaut werden.
-
-Ästhetik: Die Materialien sollen dem ästhetischen Empfinden der Kinder entsprechen (glänzend, leuchtend, geordnet und sauber) und damit anziehend wirken.
-
-Aktivität: Das Material soll so beschaffen sein. daß es Aufforderungscharakter für das Kind hat.
-
-Fehlerkontrolle: Sie soll im Material liegen. sodaß das Kind unabhängig vom Erwachsenen feststellen kann. ob es die Aufgabe richtig gelöst hat.
-
-Wiederholung: Das Kind muß die Übung beliebig oft wiederholen können. bis es sich die im Material liegenden Lernelemente angeeignet hat." (zit. n. BIEWER. 1992, S. 23 f.).
Indem alle Kinder, ob sie nun behindert sind oder nicht, an und mit denselben Materialien arbeiten, hat M. Montessori schon zu Beginn dieses Jahrhunderts in der schulischen Praxis in ihren Kinderhäusern aufgezeigt, daß sich individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder kontinuierlich entwickeln können, wenn nach dem Grundsatz unterrichtet wird: "Das Kind muß dort abgeholt werden, wo es gerade steht."
(zit. n. BEWS, 1992, S. 73).
Die didaktische Realisierung dieser von mir nur exemplarisch aufgezeigten Theorien und Modelle menschlicher Entwicklung und des Lernens und die damit geforderte Lern- und Unterrichtsplanung stellen die heute "auf dem Kopf stehende Didaktik auf die Beine" (FEUSER, 1989, S. 28) und schaffen damit erst eine kindzentrierte und humane Schule.
Zum Thema einer entwicklungslogischen Didaktik in einem Unterricht für alle Kinder mit oder ohne einer Beeinträchtigung, möchte ich aus mehreren Gründen die Arbeiten Georg FEUSERS aufgreifen und versuchen, in skizzierter Form die wesentlichsten Aspekte seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse darzulegen.
Nicht nur durch persönlichen Kontakt, sondern durch seine wissenschaftlichen Theorien und Arbeiten, begründet und belegt in der eigenen Praxis als Sonderschullehrer, aber vor allem als wissenschaftlicher Begleiter diverser integrativer Erziehungseinrichtungen in Kindergarten und Schule der Stadt Bremen/BRD wurde Georg FEUSER für mich persönlich als auch für die beiden Lehrer einer der wichtigsten Orientierungshelfer schulischer Didaktik.
Sein umfassendes Verständnis für Integration und deren Realisierung in mehreren integrativen Erziehungseinrichtungen, damit verbunden der Weg zu einer Bildungs- und Schulreform im Sinne der Schaffung einer humanen Schule ohne Aussonderung, wurde zur zentralen Drehscheibe einer basalen, kindorientierten allgemeinen Pädagogik für uns.
Dabei gerieten die beiden Lehrer durch diese Kenntnisse sehr stark in das Spannungsfeld theoretischer Grundprinzipien und Forderungen, die eine humane Schule erst realisiert und den von der Gesellschaft und Schulbehörde nicht gewollten Veränderungen.
In seinem Aufsatz »Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik« schreibt FEUSER einleitend zum Abschnitt der »Didaktischen Verifikation«:
"Auf didaktischer Ebene verlangt eine kindzentrierte, basale allgemeine Pädagogik: die Fundierung des Lernens und Unterrichtens auf der Basis einer menschlichen Entwicklung und menschlichem Lernen gerecht werdenden Persönlichkeitstheorie und Entwicklungspsychologie. Vom Beginn wissenschaftlicher Pädagogik an bis heute dominiert in den Theorien und Modellen der Didaktik das Sachstrukturelle, also eine einseitig auf den Stoff und die zu vermittelnden Inhalte bezogene Lern- und Unterrichtsplanung. Nur mit diesem Instrumentarium operierend konnte den unterschiedlichen Lernmöglichkeiten, wie sie die Schüler in ihrer Biographie unter ihren jeweils spezifischen Lebensbedingungen herausgebildet haben, nur mittels hierarchisch aufgebauter Schulformen und durch den Auf- und Abstieg der Schüler (Durchfallen. Sitzenbleiben, Schulversagen. Sonderschulüberweisung) im vertikal gegliederten System (äußere Differenzierung) begegnet werden." (FEUSER. 1989, S. 4 ff).
Die tradierte Pädagogik, so FEUSER, hat einen
"Begriff der Chancengleichheit herausgearbeitet, der nicht auf ein gemeinsames Lernen eines jeden Schülers mittels seiner Möglichkeiten an den für unser heutiges kulturelles Niveau bedeutenden Inhalten. den »gesellschaftlichen Schlüsselproblemen« (KLAFKI, 1985) bezogen ist, sondern auf das Vermitteln von (Kultur-) Techniken anband von sich nach Maßgabe des absteigenden Schulsystems verengenden und reduzierten Inhalten" (ebd.).
So findet keine Integration statt, wenn in einer Klasse die Kinder nach unterschiedlichen Lehrplänen unterrichtet werden. Also die Volksschüler nach dem Lehrplan der Grundschule, das lernbehinderte Kind nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule und das geistig schwerstbehinderte Kind nach dem Lehrplan der Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder, usw.. Daß die Kinder in ein gemeinsames Schulhaus gehen und innerhalb dieser Schule in einer Klasse zusammensind, ist zunächst der äußere notwendige Rahmen, damit »Integration« pädagogisch überhaupt realisierbar ist.[18]
Ist der Unterricht derart angelegt, daß die Entwicklung von Fertigkeiten und Qua1ifikationen in der Wahrnehmung, Beantwortung und Gestaltung sozialer Interaktions-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse auf eine differenzierte Ich-Entwicklung und stabile Identitätsentwicklung abzielt, dann ist die Vorgabe eines gemeinsamen Lehrplanes prinzipiell richtig. Denn nur so ist die Gewähr gegeben, daß nicht z.B. behinderte Kinder schon durch vorurteilsmäßige Vorenthaltungen von Lernangeboten auf der Lehrplanebene vom gemeinsamen Lernen aller Schüler ausgeschlossen werden, und damit letztlich die Zielsetzung der Integration unterlaufen wird. Es besteht außerdem die Gefahr, daß im Laufe der Schu1zeit die Kinder mehr und mehr an verschiedenen Gegenständen und Themen lernen und damit wiederum immer weniger miteinander und vor allem füreinander zu tun haben (vgl. FEUSER, 1987, S. 22).
In der konkreten Situation unseres Schulversuchs konnte diese Forderung nicht erfüllt werden, da ansonsten durch die Schulbehörde dem Projektantrag nicht stattgegeben worden wäre. So mußte im Antrag des Schulversuchs ausdrücklich festgehaIten werden, daß die behinderten Kinder nach dem Lehrplan der für sie entsprechenden Sonderschule unterrichtet werden.
Ein Unterricht in unserer Intension ist nach FEUSER (1987, S. 22 f.) auf der didaktischen Ebene so angelegt, daß er
-
"von allen Kindern zugänglichen, möglichst gemeinsam gemachten Erfahrungen im unmittelbaren Lebensumfeld ausgeht,
-
den Schülern die Zusammenhänge, in denen die Dinge und Menschen erscheinen und die Beziehungen und Verhältnisse, die zwischen ihnen herrschen, im Sinne ihrer Verwobenheit und wechselseitigen Abhängigkeit erschließt, auch wenn dies jeweils einzeln zu bearbeitende Aspekte sind.
-
sie unter medialen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der auf einzelnen Entwicklungsniveaus dominierenden Wahrnehmungsqualitäten in die handelnde Verfügung der Schwer bringt und
-
sie befähigt, die damit verbundenen Erfahrungen zu fixieren und schrittweise im Sinne zu entwickelnder Denkformen (-geistige Operationen) in symbolischer (abstrakter und verkürzter) Weise mit ihnen umzugehen (Kulturtechniken i.e.S.)."
Dies ist nach Feuser wiederum nur in einem Unterricht möglich, der
-
"sich schrittweise·von einer sachkundlichen Orientierung ausgehend zu einem. vorhabenzentrierten und projektorientierten Unterricht (im Sinne der Überwindung des traditionellen Fächerunterrichts) entwickelt,
-
alle Kinder an einem gemeinsamen (Teil-) Inhalt/Gegenstand arbeiten läßt, ohne daß von allen zu gleicher Zeit und in der gleichen Zeit dasselbe zu tun verlangt wird (offener Unterricht),
-
den unterschiedlichen Entwicklungsniveaus (Interaktions-, Kommunikations- und Handlungskompetenzen) durch Maßnahmen der »Individualisierung« des Curriculums und »Innerer Differenzierung« entsprochen wird und dadurch
-
die Kooperation der Schüler miteinander für jeden in kompetenter Weise erfolgen kann, sodaß die Arbeit eines jeden Schülers bezogen auf die individuelle Zielsetzung und für das Gelingen des gesamten Vorhabens bedeutend ist"
Wenn wir die Grundprinzipien einer entwicklungslogischen Didaktik in unserer schulischen Arbeit als Lehrer oder Erzieher beachten, dann erkennen wir, daß die »Innere Differenzierung« auf der Basis der» Individualisierung« einerseits eine unverzichtbare Voraussetzung integrativen Unterrichts ist, und andererseits insgesamt eine "Humanisierung und Demokratisierung schulischen Lernens bedeutet" (FEUSER, 1989, S. 39).
Im Projektantrag des Schulversuchs wurden folgende pädagogischen Prinzipien festgelegt:
»In der integrativ geführten Klasse werden die behinderten und nichtbehinderten Kinder gemeinsam unterrichtet. Dabei erhält insbesonders das gehörlose Mädchen zusätzliche spezifische Lehr- und Lernangebote.
Für die behinderten Kinder wird ein individueller Lern- und Erziehungsplan erstellt. Durch flexible Unterrichtsgestaltung (Klassen-, Gruppen-, Einzelunterricht) wird auf das verminderte Lerntempo der Kinder Rücksicht genommen.
Die behinderten Kinder sollen mit den anderen Kindern ganzheitlich und handelnd ihre Umwelt begreifen und die Zusammenhänge verstehen lernen. Es werden dabei für die behinderten Kinder individuelle Programme (Leistungsanforderungen) erstellt.«
Die beiden Lehrer haben sich auf den Grundlagen der bisher genannten reformpädagogischen Erfahrungen und Erkenntnissen in den vier Jahren ihrer Arbeit in kritischer Auseinandersetzung mit der eigenen pädagogischen Arbeit in diesem Schulversuch u.a. an die folgenden, von HEYER (1990, S. 67) zusammengefaßten und für jegliche Unterrichtsgestaltung wichtigen Leitsätze gehalten:
-
"Jedes Kind hat »ein Recht auf eigene Lernentwicklung«. Es soll dabei unterstützt werden, seinen eigenen Lernweg zu gehen und beim Lernen zunehmend selbständiger werden.
-
Die Lernentwicklung eines jeden Kindes kann nur auf der Basis seines »augenblicklichen Lernstandes« und unter Berücksichtigung seiner eigenen »Lerninteressen« unterstützt werden. Die konkreten Erfahrungen eines Kindes müssen auch in der Schule Ausgangspunkt seines Lernens werden. Gemeinsamer Unterricht muß sich auf gemeinsame Erfahrungen und gemeinsame Interessen gründen.
-
Für die schulischen Lerninhalte ist und bleibt der/die »LehrerIn« verantwortlich - so wichtig die Berücksichtigung individueller Bedingungen und Interessen auch sein mag.
-
Kinder regen sich in ihrem Wissen und Können gegenseitig an; sie brauchen »gute Beziehungen zu Gleichaltrigen«, mit denen sie bereden und erproben können, was sie erfahren haben, um es sich so sicher anzueignen. Die Schule muß auch deshalb das soziale Leben der Kinder fördern."
In den, im wesentlichen auf einen Klassenraum sich beschränkenden Unterrichtsmöglichkeiten des Schulversuchs haben die Lehrer zunächst versucht, die äußeren Rahmenbedingungen so zu verändern und vorzubereiten, daß in der Folge offene und freie Unterrichtsformen in ihrem Unterricht Anwendung finden konnten.
Wenn Kinder in die Schule kommen, bringen sie ihre individuellen Erlebnisweisen von Räumen mit. Das Kind, vor allem das jüngere, erlebt den Raum vital, indem es sich in ihm bewegt, ihn durchläuft, Dinge erreicht oder Grenzen des Erreichbaren im Greifen, Gehen oder Steigen ernährt. Für das Kind gibt es das Unbestimmte und immer wieder neu zu Entdeckende bzw. zu Bestimmende.
M. J. LANGEVELD (1963) hat aus der Sicht der pädagogischen Anthropologie aufgezeigt, welchen Weg ein Kind zurücklegen muß, wenn es von seiner offenen und vieldeutigen und noch nicht durch eindeutig festgelegte Bestimmungen vorgegebenen Welt aus die quasi-endgültige und programmierte Welt der Erwachsenen erreichen soll. Die Lebenswelt des Kindes wird zunehmend durch Normen begrenzt und eingeengt. "Die anderen erinnern uns daran, daß ein Löffel nur als Löffel verfügbar ist. Er ist kein Schiff" (Ebd).
Wenn also Kinder mitunter in ihrer Welt versinken, wenn es Orte und Zeiten gibt, in denen unbestimmte und "geheime" Stellen gerade jene sind, in denen ein Kind ganz bei sich selbst sein kann, in denen es sich auch einmal "verlieren" darf, um dann wieder aufnahmebereit und entspannt zu sein und befreit "aufzutauchen", dann müssen Schule und damit die LehrerInnen ebenfalls ein fundamentales Verständnis für diese Stellen haben und die Welt des Kindes nicht völlig durch eine normierte Schulwelt ersetzen.
"Zurücknahme von Schulbestimmtheit bewahrt Initiative, persönlichen Ausdruck. ermöglicht eine eigene Welt So muß Schule auch auf der Ebene des Raumes als einer grundlegenden Vor-Ordnung des schulischen Lern- und Lebensprozesses ihren Anspruch auf totale Vermessung des Lerngeländes und die Verwaltung von festgelegten Funktionen und Bedeutungen aufgeben. wenn sie wichtige Quellen des Lernens nicht einfach versiegen lassen will" (KASPER, 1979, S. 22).
Im Folgenden möchte ich fünf Thesen zur Gestaltung von Lern- bzw. Klassenräumen für Grundschüler anführen, die von REINARTZ/SANDER 1977 als "Maßnahmen zur Verminderung von Schulschwäche in der Grundschule" formuliert wurden. Diese Thesen stellten für die beiden Lehrer wichtige Orientierungshilfen dar und fanden nach Maßgabe der vorgegebenen Möglichkeiten in der Gestaltung der Klasseneinrichtung Berücksichtigung.
These 1)"Grundschulen müssen von ihrer baulichen Anlage und Ausstattung her für Grundschüler eine anregungsreiche Lernumwelt darstellen. Ziel ist nicht das "perfekt" ausgestattete Schulhaus und Klassenzimmer, sondern eine schulische Lernumgebung, die Aktivitäten anregt und unterstützt und auf grundlegende Bedürfnisse von Kindern eingeht."
Der Klassenraum im ersten Stockwerk der Schule ist mit ca. 70 m recht groß und durch fünf große Fenster ein heller und freundlicher Raum. Diesen Klassenraum haben die beiden Lehrer nach ihren persönlichen Vorstellungen eingerichtet, wobei auch die Kinder ab dem ersten Schuljahr aktiv an der Ausgestaltung mitwirkten.
These 2)"Für jüngere, insbesondere für schulschwache Kinder ist es wichtig, daß eine Brücke zwischen häuslichem Wohnmilieu und schulischer Lernumwelt hergestellt wird. Die Anlage und Ausstattung der Räume sollte dem Rechnung tragen. Dabei sollten die Kinder so weit wie möglich an der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes mitwirken und situationsentsprechende Lösungen suchen können."
Für die Einrichtung der Klasse verwendeten die Lehrer nicht nur das ihnen von der Schule zur Verfügung stehende Mobiliar, sondern fertigten selbst verschiedenste Einrichtungsgegenstände (Sitzpolster, Regale, Pinnwände u.a.m.) an. Betrat man die Klasse, so hatte man das Gefühl der Weite, aber gleichzeitig auch der Behaglichkeit und Wärme, das ein Empfinden der Geborgenheit und Sicherheit vermittelte.

"In einem toten Klassenzimmer ist ein lebendiger Unterricht unmöglich."aus: M. Spielhagen: Von der Lernschulklasse zur freitätigen Arbeitsgemeinschaft, 1928
These 3)"Das Klassenzimmer sollte in verschiedene Zonen aufgegliedert sein. Die allgemeine Unterrichtszone ist anzureichern mit funktionsdifferenzierten Zonen: Leseecke, Informationsecke, Ruhezone, Zone für gestalterische oder experimentelle Betätigung, im günstigen Fall mit Naßnische. Es sollte rasch eine Freifläche für motorische Aktivitäten, Spiele und Gesprächskreise erstellbar sein."
Der Klassenraum wurde nach den gegebenen Möglichkeiten in sinnvolle »Raum-Zonen« gegliedert und differenziert. So konnte sich ein Kind auch einmal in die Leseecke zurückziehen, während andere Kinder in der Druckereiecke an einem Text arbeiteten. Aber besonders die Anordnung der Tische, der Stühle oder eine seitlich zusätzlich angebrachte Wandtafel und die Lehrertische am seitlichen Rand des Klassenraumes ließen auch außen stehende Personen sehr schnell erkennen, daß in dieser Klasse kein Unterricht stattfinden kann, bei dem der Lehrer durch Regieanweisung die Lernsteuerung für alle zur gleichen Zeit und eventuell noch in gleicher Art von vorne vornimmt. Einrichtung und Anordnung ließen sichtbar eine Unterrichtskonzeption einer reformpädagogischen Unterrichtspraxis (differenzierender Unterricht, Freiarbeit, Projektunterricht) erkennen.
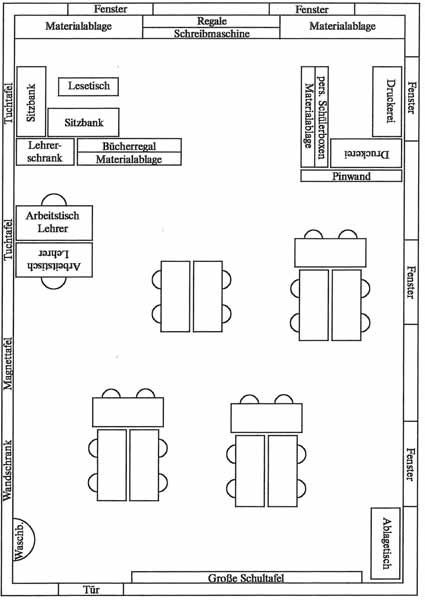
Plan der Klasse
These 4)"Die Lern- und Klassenräume sollten vielfältige Spiel- und Lernmaterialien offen präsentieren, die zum selbständigen Handeln in Einzel- und Gruppensituationen auffordern. Ein Übermaß an Stimulation sowie eine rasch sich abnützende Gleichförmigkeit sollten vermieden werden."
Die Gestaltung des Klassenraumes erfolgte unter dem Gesichtspunkt, eine für die Kinder vorbereitete und gut strukturierte Lernumgebung zu schaffen, in der den Kindern die Lernangebote und Arbeitsmittel
-
gut sichtbar und greifbar,
-
übersichtlich, und z,B. nach Sachgebieten und geordnet
-
damit frei zugänglich, unter Berücksichtigung entsprechender Handlungs- und Bewegungsfreiräume, angeboten werden.
Einsatz und Auswahl der Materialien (Sammelbegriff für Arbeitsmittel, Bücher, Bilder, Karten, Karteien, Lernspiele, Requisiten für Rollenspiele, Baukästen, Werkzeuge, Werkmaterialien und anderes) waren abhängig von der didaktischen Planung der Lehrer, den Interessen der Kinder sowie deren Fähigkeit zur selbständigen Benützung.
Wichtig wurde die ständig kritische Prüfung, in welcher Situation, in welchem Ausmaß und natürlich auch bei welchen Kindern das Materialangebot zu einer Überforderung oder gar zum Störfaktor wurde, denn gerade eine Dauerpräsentation kann sich sehr rasch abnützen. Durch gezielte Abwechslungen im Materialangebot konnten die Kinder meist wieder zu neuer Aktivität und gesteigertem Interesse angeregt werden.
These 5)"Das Klassenzimmer sollte sich als räumlich erweiterungsbedürftige Basis verstehen. Die Einbeziehung von Fluren, Schulhof und Freiflächen sollten ebenfalls als Lernräume gestaltet und genutzt werden. Gruppenräume, die Schulbibliothek können wichtige Erweiterungen der Lernmöglichkeiten darstellen. Die Grundschule darf nicht als in sich abgegrenzter Lernort verstanden werden. Das Lernen vor Ort in aufgesuchten Realsituationen kann entscheidende Motivationen auslösen, die eine isolierte Schulsituation nicht bietet."
Daß in der konkreten Situation in der Klasse und im Schulhaus keine Möglichkeit bestand, außerhalb des eigenen Unterrichtsraumes eine zusätzliche Lernumgebung für die Kinder bereitzustellen, war für die Lehrer eine doch recht große Einschränkung in der Anlage ihres gesamten Unterrichtskonzeptes.
Wissen wir doch heute, daß z.B. eine Kombination aus offenen und mehr geschlossenen Bauelementen nicht nur offenen Lehrplanelementen entsprechen und gerade Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zugute kommen. Eine Lernumgebung kann dadurch erlebnisreicher und interessanter gestaltet werden und damit mehr Herausforderungen für die Kinder bieten. Nachdem die Schule keine eigene Bibliothek besitzt, wurde in der Leseecke der Klasse für die Kinder entsprechend ihren Interessen nicht nur eine Auswahl von Büchern und Zeitschriften durch die Lehrer bereitgestellt, sondern die Kinder konnten auch ihre eigenen Bücher den Mitschülern zur Verfügung stellen. Nachdem weder ein Schu1garten noch ein Schulhof entsprechend genützt werden konnten, war es für die Lehrer aber wichtig, im Rahmen von Lehrausgängen oder Projekttagen die künstliche Welt des Schulhauses samt ihrem Inventar durch konkrete Erfahrungen aus der Realwelt (s. Kap. III/3.9A, S. 207 ff.) mit dem schulischen Lernen in Verbindung zu bringen.


''Bei der Organisation von aktiven. zielgerichteten Lernformen mit Kopf: Herz und Hand lernen wir, die Eigentätigkeit des Kindes wirklich ernst zu nehmen. Freie Arbeit, Tages- und Wochenplan ermöglichen Selbständigkeit und Selbstverantwortung. Die Klasse verändert sich und läßt den Kindern Raum und Zeit für die eigenen Interessen, für Nachdenklichkeit, für gemeinsames Überlegen und Gespräche. In der neuen Lernwelt ergeben sich täglich Ausgangspunkte für die Tätigkeiten der Kinder. Wir erleben die Faszination einer handelnden Auseinandersetzung mit den Dingen selbst: Steine werden gesammelt und geordnet, Spinnen beobachtet und mit Hilfe von Karteien Erfahrungen vertieft"
(Richard Meier/Hanne Mayer-Behrens in ''Die Grundschulzeitschrift" - Sonderheft 1989).
Achill WENZEL (1983) hat in seinen Studientexten zur »Freiarbeit in der Grundschule» Modelle und ihre Vertreter dargestellt.
Sein Buch »Freier Gesamtunterricht in der Dorfschule« (1925) weist schon im Titel auf die diesem Unterricht zugrundeliegende Konzeption hin. Der täglich am Beginn des Unterrichts stehende Gesprächskreis wird von Kretschmann zum Ausgangspunkt jeglichen Unterrichts gemacht.
''Vom Gespräch erhalten das spielende wie übende Lernen der Fertigkeiten, das Schreiben und Lesen im Training ebenso den Anstoß wie das Vorhaben, in dem es um das Erstellen von konkreten Werken geht."
(KRETSCHMANN, 1948, S. 8).[19]
Die Konzeption Kretschmanns könnte man als eine Freiarbeit im Großen sehen. Im Gespräch artikulieren die Kinder ihre Interessen. Diese Interessen gewinnen im Vorhaben ihren greifbaren Niederschlag. Kinder wählen sich ihre Aufgaben selbst. Sie bestimmen, auf welche Weise sie diese lösen wollen, wobei schriftliche, zeichnerische oder auch gebastelte Werke von ihrem Tätigkeitssinn zeugen.
Wo liegt nun das Moment der Freiheit im »Freien Gesamtunterricht« Kretschmanns?
Die Kinder bestimmen und lernen ohne direkte Abhängigkeit von der Lehrperson. Der Lehrer hat sowohl Facheinteilung als auch direktes Lehren zugunsten der Unabhängigkeit der Kinder aufgegeben. Einschränkend aber muß doch darauf verwiesen werden, daß diese Freiheit durch die Zeitgebundenheit der Themen eingeengt wurde und auch eine Persönlichkeit wie Johannes Kretschmann die Kinder auch ohne direkte Maßnahme beeinflußt haben wird.
Bei Kretschmann steht die Gesamtheit der fragenden Schüler - ähnlich der Gesamtheit einer Familie - der Gesamtheit der Umwelt mit ihren Ereignissen, ihrer Kultur, den Menschen und deren Denken gegenüber. "Die Gesamtheit der denkenden Schüler fragt sich in die Umwelt hinein." (Ebd., S. 13).
Nach WENZEL (1983) zeigt aber der »Freie Gesamtunterricht« Kretschmanns noch eine weitere Seite der Freiheit:
"In diesem Unterricht stellen Kinder Fragen und suchen Antwort durch eigenes Nachdenken, durch Nachschlagen in Büchern, durch die Hilfe von älteren Schülern, Lehrern, Eltern, Fachleuten. Ähnlich erfährt das Kind in der Freiarbeit, als deren Vorform Kretschmanns Konzeption gewertet werden kann, daß sich alle Beteiligten, freilich unter verschiedenen Aspekten, um dieselbe Wirklichkeit bemühen. So gesehen ist Vertrauen in den Gesprächspartner die Voraussetzung für die Freiheit des Fragenkönnens. Freiheit bedeutet hier, selbstbestimmend eigenes Nicht-Können anzuerkennen, um so Lernen möglich zu machen."
Welche Momente können für die heutige Freiarbeit aus dem Konzept des »Freien Gesamtunterrichts« Kretschmanns herausgehoben werden?
Worin liegen die Bindungen, welche erst Freiheit ermöglichen?
Freiarbeit kann nicht bedeuten, daß nach Lust und Einfall irgendeine Tätigkeit aufgenommen, fallengelassen oder überhaupt vermieden wird. Das wäre Willkür, und bei den dann auftretenden Störungen könnte wohl kaum ein Kind arbeiten.
Freiarbeit in der Grundschule hat etwas zu tun mit der Persönlichkeitswerdung, die die Entwicklung aller Fertigkeiten und Fähigkeiten einschließt. Nach einer Zeit der Identifikation mit Vater und Mutter sucht das Grundschulkind nach Möglichkeiten der eigenen Stellungnahme zur Wirklichkeit, wobei es dann in der gedanklichen und praktischen Auseinandersetzung mit der Umwelt Normen entdeckt.
Unter Freiheit wird hier verstanden, daß das Kind sich selbst aus Einsicht auf ein wertbezogenes und sinnvolles Ziel beansprucht und damit erfährt, in welchem Verhältnis es zur Wirklichkeit steht. Denn diese stellt Anspruche an sein Einsichtsvermögen, deren Sinn dem Kind oft fremd ist, sodaß es diese im eigenen Tun zu ergründen sucht. Unter Freiheit wird auch verstanden, daß der Mitschüler als Mitlernender mit seinen eigenen Erwartungen angenommen und in das eigene Handeln einbezogen wird (vgl. KERSTIENS, 1980, S. 178 ff.).
Während Kretschmann die schulische Freiarbeit unter dem Hauptaspekt der »Freiheit« ansah, hat Petersen in seiner Reformpädagogik bzw. in seiner Schulkonzeption die Aspekte von Freiheit und Arbeit miteinander verbunden. Außerdem hat Petersen die Gruppe der Schülergemeinschaft als wichtiges soziales Gefüge im Alltag der Schule zusätzlich in den Vordergrund gestellt.
Den Begriff »Freiarbeit« hat Peter Petersen geprägt. In dem großen Bericht über die Tätigkeit seiner Versuchsschule, der sogenannten »Jenaplan - Schule«, nennt er diese Arbeitsform auch »Freies Arbeiten«. (PETERSEN, 1930, S. 32 ff.).
Die große Bedeutung P. Petersens und seinen Einfluß auf die heutige Reformpädagogik. besonders auf den Bereich der »Freiarbeit«, versuche ich im folgenden Überblick darzustellen.
Zur Praxis der »Freien Arbeit« in der Jenaplan-Schule (vgl. ''Der große Jena-Plan" 1930, S. 32 ff.)
-
Als erste Voraussetzung für diese Unterrichtsform steht für Petersen die Ausgestaltung des Unterrichtsraumes zu einer »Schulwohnstube«. Im Arbeitsraum Schule (Klasse) finden sich bei Petersen Lexika, Lehrbücher, Werkzeuge, Lernspiele u.a.m. Mit deren Hilfe können Kinder darangehen, ihre - wie Petersen es nennt - »Probleme« zu lösen. Unter »Problemen« versteht Petersen Fragen der Kinder, welche diese außerhalb der Schule finden und welche sie stark bewegen. Kretschmann hat ja solche Fragen in den Mittelpunkt seines Unterrichts gestellt (s. Kap. III/3.3, S. 140 ff.).
-
Bei Petersen bildet die Spontaneität des Kindes den Ausgangspunkt seiner Tätigkeit. Die sich daraus ergebende Eigenleistung des Kindes und die daraus folgende Selbstgestaltung stellen das Erziehungsziel der Arbeit dar, wobei die Kinder »miteinander arbeiten«.
-
Wer miteinander arbeitet, muß auch miteinander sprechen. Bei Petersen sitzen die Kinder im Kreis, eine Sozialform, bei der im Dialog Arbeitsplanungen und Berichte über Ergebnisse ausgetauscht werden, und die nur fruchtbar sind, wenn jeder Teilnehmer den anderen sehen kann. In diesem Sinn wird heute z.B. der morgendliche »Sesselkreis« eingesetzt (vgl. WENZEL, 1983, S. 12 ff.).
Petersens Ansatz läßt die Schlußfolgerung zu:
"Freiarbeit ist ohne die Gruppe schon wegen der Möglichkeit der gegenseitigen Anregungen nicht vorstellbar." (MACHWIRTH, 1976, S. 86 f.).
Das Kind wird eben auch in seiner Einzelarbeit durch die Umgebung beeinflußt; und das für das Gelingen von Freiarbeit notwendige soziale Verhalten findet seine Bewährung im gemeinsamen sozialen Lernen innerhalb der Gruppe. Einerseits lebt die Freiarbeit erst von der Initiative und dem Interesse des einzelnen Kindes, andererseits erlebt aber ein Kind vielleicht besonders in der Freiarbeit Gemeinsamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz (vgl. WENZEL, 1983, S. 15 f.).
Wenn das Kind in der Freiarbeit selbständig sein will, dann genügen nicht nur Interessen und Arbeitsmethoden. Erforderlich sind auch Arbeitsmittel, die den Weg zur Lösung von Aufgaben weisen.
Der französische Pädagoge Freinet hat ein System von Materialien für das freie Arbeiten geschaffen, dazu gehören u.a. Setzkasten und Schuldruckerei.
Ausgehend von der Kritik an der alten Schule, welche das Kind vom Leben trennt, fordert Freinet die moderne Schule dadurch aufzubauen, daß Arbeitsmittel eingeführt und Arbeitsmethoden vermittelt werden (vgl. FREINET, 1981, S. 13 f.). Diese beiden Maßnahmen dienen dann nicht nur der Erschließung von Wirklichkeit, sondern haben auch Bedeutung in Hinsicht auf die »Verlängerung des Lebens, der Familie, des Dorfes, der Umgebung« (vgl. ebd., 1981, S. 42).
Freinet-Schulen sind heute noch gekennzeichnet durch ihre besondere Ausstattung. Dazu gehören u.a. Schuldruckerei, Handbibliothek, Arbeitskarten, Spiel- und Arbeitsecken u.a.m.
Für die Freiarbeit in unserer heutigen Regelschule können wir aus den Vorgaben Freinets ableiten:
''Die Qualität der Freiarbeit hängt ab von der Auswahl und dem Einsatz der Materialien. Auch muß der Umgang damit gelernt werden. Die Arbeitsmittel müssen »für die Kinder angemessen« sein. Da nach Freinet alle Wirklichkeitsbereiche zugänglich seien, »soll freies Arbeiten vom Beginn der Schule an möglich sein«." (WENZEL, 1983, S. 21).
Daß Freiarbeit schon im Kindergarten bzw. ab der ersten Stufe der Grundschule möglich ist, belegt auch das Modell des »Integrated Day«, verwirklicht an einigen englischen Primarschulen (vgl. Plowden-Report, 1967, S. 187 f.).

"Gerade unsere Zeit verlangt Menschen, die selbständig sind im Denken und Handeln ... Der Schüler soll aktiv und produktiv tätig sein. Das geschieht nur durch Selbsttätigkeit"
Aus: Schulze/Karnich -Frohes Schaffen und Lernen. 1958

"Der Unterrichtsgrundsatz der Selbsttätigkeit geht von der Einsicht aus: Lernen durch eigenes Tun ist wirksamer, als wenn der Schüler passiv aufnehmen muß. Selbsttätig-Sein regt ihn an. weiter zu überlegen, nachzudenken, selbständig ein Problem zu lösen. Es macht ihn problemorientierter, selbstkritischer und selbstbewußter."
Aus: K. Singer - Maßstäbe für eine humane Schule, 1981

"Zum Selbstunterricht gehört die Möglichkeit der Selbstkontrolle. Sie gibt dem Schüler Sicherheit und befreit ihn von dem Druck des dauernden Überwachtseins und der Abhängigkeit von der Entscheidung eines anderen. Besonders schüchterne Kinder, die sich nicht gern der 'Gefahr' einer falschen Antwort aussetzen, gewinnen Selbstvertrauen und Beruhigung." Aus: K. Odenbach - Selbstbildung im Schulunterricht, 1965

"Sich-gegenseitig-Helfen als Unterrichtsgrundsatz besagt, daß die Schüler und Schülerinnen in allen Unterrichtssituationen dazu ermuntert werden, einander beizustehen."
Aus: K. Singer -Maßstäbe für eine humane Schule, 1981
130

''Das Wichtigste für den Lehrer ist, Ruhe und Gelassenheit gegenüber der Tatsache zu gewinnen. daß Lernen anderen Intentionen und Wegen folgt, als er es für richtig hält.
Das Sich-zurücknehmen-Können. das Abwarten. die Geduld und das Vertrauen in sich langsam entwickelnden Aktivitäten sind die wichtigsten Tugenden. die für die Freie Arbeit entwickelt werden müssen."
Aus: M. Bönsch -Zur Didaktik: des freien Arbeitens, 1978

"Wir müssen lernen. Vertrauen zu haben zur Fähigkeit des Kindes, seinen Lernprozeß zunehmend selbst aufzubauen und zu steuern."
Aus: Kayser/Schäkel - Kinder und Lehrer lernen: Freie Arbeit, 1983

''Das Kind ermüdet nicht bei der Arbeit; es wächst an der Arbeit, und die Arbeit erhöht seine Energie. Das Kind wünscht nie, daß man es von seiner Mühe erlöse, es will vielmehr seine Aufgabe vollkommen und selbständig ausführen... Läßt man dem Kind nur ein kleinwenig Spielraum. so wird es den Willen zur Selbstbehauptung sogleich mit einem Ausruf kundgeben, wie:
»Hilf mir, es selbst zu tun«!"
(Maria Montessori in: »Kinder sind anders«)


''Neben der Methode des Lehrens ist eine Methode des Lernens zu entwickeln, die das Kind in zunehmendem Maß zur Eigentätigkeit führt und damit zur Selbstfindung befähigt."
Aus: F. Kade -Schule im Werden, 1956

"Der Lehrer hat während des freien Arbeitens Gelegenheit, einzelne Schüler genau zu beobachten, um deren besondere Lernbedürfnisse kennenzulernen. Er steht mit seiner Hilfe zur Verfügung, drängt sich jedoch nicht auf."

"Arbeitsmittel für selbstgesteuertes Lernen sollten auch der Interessenslage der Kinder entsprechend bereitgestellt werden. Sie sind nach Möglichkeit so zu strukturieren, daß Kinder jeden einzelnen Lernschritt nachvollziehen können." Aus: Kayser/Schäkel - Kinder und Lehrer lernen: Freie Arbeit, 1983
"Arbeitsmittel müssen zum Hantieren auffordern."
''Das äußere Erscheinungsbild der Arbeitsmittel muß Kinder ansprechen."
''Das Material sollte ermöglichen, daß Kinder ihre Arbeitsergebnisse selbst kontrollieren können."


''Das Arbeitsmaterial dient dazu, daß sich das Kind vom Lehrer weg und hin zur Sache wendet"
Pausen - Gedanken
Seien wir ehrlich:
''Wenn man es den Pädagogen überlassen würde, den Kindern das Radfahren beizubringen. gäbe es nicht viele Radfahrer."
Celestin Freinet

Im konkreten Schulversuch haben die beiden Lehrer versucht, die verschiedenen Tendenzen und Schwerpunkte freier Arbeit auf die spezielle Situation in der Klasse, gegeben durch die Zusammensetzung der Kinder, durch die begrenzten äußeren Rahmenbedingungen[20], aber auch durch ihre persönlich völlig neue Arbeitssituation, abzustimmen.
So, wie sich die beiden Lehrer durch ihre Unterrichtspraxis selbst in einem fortwährenden Prozeß der Weiterentwicklung und damit Veränderung befanden, so wurden auch die offenen und geschlossenen Unterrichtsformen prozeßhaft ihren Erfahrungen gemäß neu überdacht und in die Praxis umgesetzt. So war die Freie Arbeit in der ersten Schulstufe zunächst noch ein Herantasten, ein Suchen nach gangbaren und lerneffektiven Wegen und Zeitausmaßen. Während der Einstiegsphase waren es mitunter 20 bis 40 Minuten. Im zweiten Schuljahr wurde die Zeit der Freien Arbeit öfters auch bis zu zwei Stunden ausgedehnt.
Die Phase der Freien Arbeit gleich am Morgen zu Beginn des täglichen Unterrichts, oder vielleicht doch erst nach der großen Pause, also ab der dritten Unterrichtsstunde?
Vieles wurde zunächst einmal ausprobiert und im Laufe der Wochen und Monate, aufgrund der Reaktionen und Rückmeldungen der Kinder, aber auch aus den persönlichen Erfahrungen der beiden Lehrer abgeändert bzw. wenn es sich bewährt hatte, beibelassen.
War in den beiden ersten Schuljahren das Arbeits- und Lernmaterial noch vor allem durch die Lehrer strukturiert und vorgegeben, - durch die spezielle Situation des gehörlosen Mädchens Sabine war auch ein besonders vielfältiges und ausgewähltes Arbeitsmaterial für den Schriftspracherwerb vorhanden - so erfolgte ab dem 3. Schuljahr besonders in diesem Bereich eine doch ganz wesentliche Veränderung.
Einerseits genügte das in der Klasse vorhandene Arbeitsmaterial oftmals den Kindern nicht mehr, und andererseits brachten sie selbst sehr viel aus ihrem persönlichen Interessensbereich in den Schulalltag ein.
Aber auch innerhalb des Klassenraumes wurde den Schülern die freie Arbeitsphase zusehends "zu eng". Ihre Interessen verlagerten sich verstärkt auf Ereignisse, aktuelle Anlässe und Begebenheiten außerhalb der Klasse und der Schule.
Dies wiederum hatte zur Folge, daß vermehrt Unterrichtsstunden zu Projektarbeiten zusammengefaßt wurden, die sich dann auch über einen längeren Zeitraum erstrecken konnten.
Beide Lehrer bemühten sich auch, ihren Unterricht so zu gestalten, daß die zuvor genannten Funktionen der Differenzierung in ihrem Unterricht zum Tragen kamen. Ihr ständiges Bemühen lag auch darin, die Balance zu finden zwischen einer stärker am Stoff orientierten "Lernschule" und dem mehr kindorientierten "Offenen Unterricht".
Es war ein Einbringen beider Formen in ihren Unterricht, wobei er mit fortwährender Dauer der Schuljahre verstärkt die Handschrift der Kinder trug, die an der Planung und Durchführung des Unterrichts zunehmend beteiligt waren.
Das Gespräch
Ob das Gespräch nun am Morgen zu Beginn des Unterrichts stattfand oder in der Pause, für die Lehrer war das Prinzip des Dialogs mit den Kindern eine pädagogische Grundmaxime. Beim morgendlichen Kreisgespräch z.B. konnten die Kinder ihnen wichtige Dinge der Klassengemeinschaft mitteilen und so gerade zaghaften, eher zurückhaltenden Kindern ein Gefühl der Sicherheit und der Gemeinsamkeit vermitteln.
Einübungsphase
Sollen Kinder in einer Gruppe lernen, frei zu arbeiten, so brauchen sie einen gewissen Ordnungsrahmen. In der Schuleinstiegsphase haben die Kinder gelernt, sich an anregelmäßig wiederkehrende Arbeitsweisen zu gewöhnen und daran zu orientieren. Dies gibt ihnen nicht nur Sicherheit, sondern es ermöglicht ihnen auch ein vielfältiges, selbständiges und soziales Lernen. Sehr rasch wurden von den Kindern u.a. folgende Ordnungsprinzipien eingehalten:
-
ruhiges Gehen, z.B. zu den Materialtischen,
-
die Klassentür und Schranktür leise schließen,
-
den Mitschüler fragen, wenn man etwas von ihm braucht,
-
den Stuhl leise tragen und abstellen,
-
niemanden bei der Arbeit stören,
-
leise sprechen und einander zuhören,
-
fragen, wenn man Hilfe benötigt; erst den Mitschüler, dann erst den Lehrer,
-
nach der Arbeit die Materialien ordentlich wegräumen
-
u.v.a.m.
Vorbereitete Lernumgebung - Präsentation des Materials
Um eine für die Kinder angenehme und zum Lernen anregende Situation zu schaffen, haben die beiden Lehrer versucht, die Arbeitsmaterialien nicht nur gut sichtbar aufzulegen, sondern auch darauf geachtet, daß sie den Interessenlagen der Kinder als auch den Lehrplänen entsprachen.
Außerdem versuchten sie, sich noch an folgenden Richtlinien zu orientieren:
Die Arbeitsmittel sollten
-
so strukturiert sein, daß die Schüler jeden einzelnen Lernschritt nachvollziehen konnten,
-
es ermöglichen, daß die Kinder ihre Arbeitsergebnisse selbst kontrollieren konnten,
-
Erkenntnisse in konkreter Form präsentieren,
-
zum Hantieren auffordern und
-
ein Lernen auf unterschiedlichen Stufen anregen.
Beobachten - anregen - helfen - stärken
Eine der wichtigsten pädagogischen Handlungen der Lehrer in der Phase der freien Arbeit bestand im Beobachten und Helfen der Kinder. Waren Aktivitäten bei den Kindern erst in Gang gesetzt, so konnten z.B. Unlust, Hemmungen, Schwierigkeiten u.ä. bei den einzelnen Kindern wesentlich besser beobachtet und damit berücksichtigt werden, als es evtl. in einem gebundenen Unterricht möglich ist. Weitere Aufgaben sahen die Lehrer darin, den Kindern Hilfen in Form von Rat zu geben, zu fragen bzw. die Kinder zu Fragen anzuregen und natürlich ihre Arbeit anzuerkennen. Selbstverständlich beteiligten sich die Lehrer aber auch an einer Arbeit oder an einem Spiel mit einem Kind oder einer Gruppe.
Die Lehrer achteten stets darauf, vor den Kindern nicht die ständigen "Besserwisser" oder ''Verbesserer'' zu sein, sondern versuchten, den Kindern Gelegenheit zu geben, das ihnen persönlich und ganz individuell Mögliche zu erreichen und zu leisten.
Gemäßigte Ausweitung der Öffnung
Die Freie Arbeit in der Klasse wurde in den vier folgenden Schuljahren in dem Maße erweitert und differenziert, als einerseits die Lehrer ihre gesteuerten und normierten Lehr- und Lernverfahren zurücknehmen konnten, und als andererseits die Kinder sicherer wurden, die Arbeitsverfahren zu kennen und die Aufgaben zu schaffen. Wurden die Kinder zu Beginn ihrer Schulzeit noch besonders durch Materialien (Kartons, Klebstoff, Schere ...), Bilderbücher oder Konstruktionsmaterial (Bausteine ...) angeregt, so waren es im Laufe der weiteren Schuljahre zunehmend Bereiche des Lesens, Schreibens und Rechnens, aber auch Bereiche, in denen geforscht und entdeckt werden konnte. So gewann das Arbeiten in Projekten bei allen Kindern immer mehr an Bedeutung.
Zeitliche Vorgaben der Freiarbeit
Waren es im ersten Schuljahr zumindest täglich 20 bis 50 Minuten, die die Lehrer als Freiarbeit einplanten, so lernten die Kinder ab dem dritten Schuljahr mitunter 1 - 2 Stunden in dieser offenen Art des Unterrichts. Unberücksichtigt sind dabei noch die Unterrichtseinheiten, die als Projekte eingebaut wurden.
Individuelle Lernkontrollen
Auch wenn es ein Ideal darstellte, aber es war das Ziel, daß letztlich der Schüler oder die Schü1erin durch das Endprodukt der geleisteten Arbeit selbst die Kontrolle ausübte.
An den folgenden beiden Unterrichtsbeispielen,
-
einer Bilddokumentation freier Arbeitsphasen im ersten und zweiten Schuljahr
-
und einer Unterrichtsbeobachtung aus Deutsch - Rechtschreibstunde
möchte ich versuchen darzustellen, daß die Lehrer eine Ausgewogenheit zwischen einer konsequenten Wissensvermittlung und dem sich auf die Erfahrungen und individuellen Interessen der Kinder beziehenden funktionalen Gebrauch des Gelernten und des zu Lernenden zu finden versuchten.

Am Beginn der freien Arbeit erfolgt ein kurzes Gespräch mit den Lehrern. Die Kinder werden auf gegenseitige Rücksichtnahme aufmerksam gemacht, und es erfolgt mitunter eine gemeinsame Aussprache, sollten mehrere Kinder dasselbe Lernspiel oder Arbeitsmittel verwenden wollen. Danach gehen die Kinder zu ihren angestrebten Zielen.

Leseübungen mit der Setzleiste

Stefanie und Romana bereiten die Aufgabe durch das Einsetzen der Bildkarten vor.

Gemeinsam wird kontrolliert, ob die Aufgabe richtig gelöst wurde.


Bernadette schreibt auf der Schreibmaschine einen Text. Diesen Text möchte sie demnächst in der Druckerei setzen und vervielfältigen. Im Sesselkreis am Ende der Freiarbeit liest sie ihren Text den Mitschülern vor.
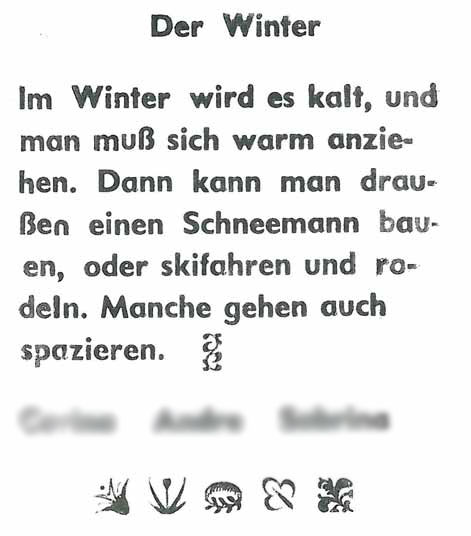

Stefan, Gregor und Alexander arbeiten mit einem "Rechenmosaik". Auf dem Aufgabenblatt sind jeweils 16 Rechensätzchen, die bei richtiger Lösung ein Gesamtbild ergeben.


Kerstin übt mit dem "Leseturm" das Lesen. Wörter sind in einzelne Silben geteilt. Als Selbstkontrolle erscheint nach den Silbenteilen eine Abbildung.

Monika und Judith setzen einzelne Wörter mit Hilfe der "Stempel" zusammen.

Julian, Elke, Katharina und Hannes bündeln verschiedene Holzstäbchen zu Mengen von 7 Teilen.

Florian interessiert sich: für Größenrelationen. Er reiht verschieden große Holzzylinder (aus dem Montessorimaterial) aneinander.

Julia und Maximilian arbeiten mit dem Lernmaterial "Sabefix". Hierbei paßt bei richtiger Lösung die Verzahnung der Plättchen ineinander.

Herold und Ulrike tasten in Partnerarbeit verschiedene Buchstabenformen auf dem Sandpapier nach.

Tanja setzt einzelne Buchstaben zu Wörtern zusammen.

Wilma und Maria suchen sich in der Regenbogenkiste kleine Lesehefte aus. Diese Hefte sind farblich nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden geordnet.

Eva versucht mit der "Rechenlochkarte" verschiedene Aufgaben zu lösen.Auf der Rückseite kann sie ihre Ergebnisse selbst kontrollieren.

Otto deckt den Anlaut des Wortes mit einem "Schieber" ab.

Franziska und Elisabeth beraten sich über ihre nächste Tätigkeit.

Am Ende der freien Arbeit müssen die Materialien wieder aufgeräumt werden.
Zeit: 12. Oktober 1990 von 9.55 - 10.45 Uhr
Vorbemerkung:
Diese Deutschstunde ist eine der vielen Möglichkeiten einer nur teilweise offenen Unterrichtseinheit innerhalb einer Rechtschreibstunde.
Die Lehrer:
"Jetzt in der dritten Schulstufe haben wir doch verstärkter angefangen, auch Ansagen mit den Kindern zusätzlich zu üben.
Es war dies vor allem eine Forderung von einigen Eltern, die Sorge hatten, daß ihre Kinder eventuell noch zu wenig fehlerfrei auswendig zu schreiben gelernt hätten. Diese Eltern brauchten bzw. wollten eben eine zusätzliche Bestätigung durch entsprechende Kontrolldiktate im Heft ihrer Kinder. Wir haben uns daher entschlossen, auch öfters eine eher geschlossene Unterrichtseinheit als Rechtschreibübung in den Deutschunterricht einzubauen.
Wenn wir eine Rechtschreibstunde planen, teilen wir die Schüler zumeist auf drei Gruppen auf.
Die guten Rechtschreiber können sich entscheiden, ob sie eventuell eigenständig ein "Dosendiktat" machen wollen, oder in der Gruppe eine Ansage mitschreiben wollen."
Zum Diktat:
''Es hat sich gezeigt, daß die sehr guten Rechtschreiber besonders gerne bei einem Diktat mitmachen. - Es ist dann ja auch immer einer von uns Lehrern dabei Ein Text wird zunächst gemeinsam gelesen. Diesen Text kann dann jedes Kind noch einmal durcharbeiten. Wir versuchen, die Kinder auf besondere Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, weisen auf die mögliche Grundform eines Wortes hin und unterstützen die Kinder mit Hinweisen, worauf sie eventuell achten sollten.
Danach unterstreichen oder umrahmen die Kinder das für sie persönlich empfundene Rechtschreibschwierige.
Dann erfolgt die Ansage durch uns Lehrer.
Am Ende der Ansage liest jedes Kind seinen geschriebenen Text nochmals durch und versucht, mögliche Fehler zu entdecken.
Nach der Korrektur des Diktats erfolgt natürlich eine Verbesserung, zumeist in individueller Aussprache mit dem Kind über seine Fehler.
Schüler, die mit der Rechtschreibung noch größere Schwierigkeiten haben, arbeiten zumeist mit einem von uns zusammen in einer Gruppe. Dabei wird ein Text an der Tafel vorbereitet bzw. erarbeitet, wobei gerade diese Erarbeitung immer wieder sehr unterschiedlich erfolgen kann. Es kann sein, daß zunächst nur einzelne Wörter erarbeitet werden, danach kleine Sätze, ein Lückentext oder durch uns eine kleine Geschichte an der Tafel vorgeschrieben wird.
Danach werden diese Texte und Sätze gemeinsam gelesen und besprochen, so besteht für die Kinder die Möglichkeit, sich die Wörter und darin versteckte
Schwierigkeiten einzuprägen. Erst dann, nach dem Zuklappen der Tafe1hälfte, werden die Texte, die auch zumeist nur aus dem Wochenthema kommen, auswendig geschrieben."
Zur konkreten Unterrichtsbeobachtung

Lehrer R. Astl sitzt mit Claudia, Udo, Arnulf, Kerstin und Olaf an einem Gruppentisch vor der großen Tafel.
Aus dem Wochenthema schreibt er einen kleinen Satz an die Tafel:
»Wir sitzen am Tisch«.
Während die Kinder den Satz still lesen und versuchen, sich den Text und die Wortbilder einzuprägen, suchen sich am großen Gruppentisch daneben Konrad, Julia, Carina, Lukas und Georg aus einer Schachtel jeweils ein Thema für ihr persönliches Dosendiktat.
Lehrer Hans P. teilt am dritten Gruppentisch einen Text aus der Rechtschreibkartei aus:
»Der Igel«.
Gemeinsam wird der Text leise gelesen, und die Kinder werden durch den Lehrer auf besondere Rechtschreibschwierigkeiten aufmerksam gemacht. Anschließend kann jedes Kind für sich mit einem Farbstift das Rechtschreibschwierige entweder unterstreichen oder einrahmen.

Inzwischen hat der Lehrer R Astl den Satz »Wir sitzen am Tisch« an der Tafel gelöscht, und die Kinder schreiben diesen Satz auswendig in ihr Heft.
Sabine spricht die einzelnen Wörter nochmals laut vor, wobei Seniha genau zuhört und auch erst dann den Satz in ihr Heft schreibt.
Inzwischen haben die Kinder um Lehrer Hans P. ihren Text durchgelesen und das Schwierige gekennzeichnet.
Die Ansage kann nun beginnen!
Am dritten Gruppentisch arbeiten die Kinder in recht unterschiedlichem Tempo an ihren Dosendiktaten (s. S. 177).
Während sich Anneli einen Text über die Maus ausgewählt hat, wollte Carina über eine Fliege schreiben. Sabrina interessiert wiederum ein gänzlich anderer Text: »Die Wunde«.
Gerhard schreibt über die Raupe und Stefan über das Reh.
Die Schülergruppe um Sabine ist inzwischen schon beim vierten Satz.
»Bernhard wäscht sich im Bad«.
Als Michaela nicht mehr so genau weiß, wie der Name "Manuel" geschrieben wird, steht sie auf und geht zu der an der Tür befestigten Namensliste. Dort liest sie nochmals das Wort, nickt ihrem Lehrer wissend und erfreut zu, geht an ihren Platz und schreibt den Satz in ihr Heft.

In der Zwischenzeit konnte der Lehrer für Steffi und Anton das letzte Wort "Bad" nochmals wiederholen, da sie es vergessen hatten.
Fast alle Schüler hatten inzwischen ihr erstes Dosendiktat beendet und sich fast unbemerkt einen zweiten Text ausgewählt bzw. geholt. Texte über einen Geburtstag, den Schnee, eine Eule waren dann zweite Themen für ein Dosendiktat.
Während die sehr guten Rechtschreiber ihre Ansage nun beendet hatten, und wie Herbert es ausdrückte, nun auf eine Fehlerentdeckungsreise gingen, schreibt Lehrer R Astl den letzten Satz an die Tafel:
»Das Baby schläft im Bett«.
Lehrer Hans P. macht Hansi und seine Mitschüler aufmerksam, ihren Text nochmals genau durchzulesen, sich an die Grundform der Worte zu erinnern, aber auch auf eine richtige Aussprache zu achten.
Während die letzten Dosendiktate von den Kindern beendet und die Hefte mit der Ansage abgesammelt werden, zeichnet Lehrer R Astl ein Baby an die Tafel.
Die Augen von Franz und Sieglinde beginnen zu leuchten. Sie wissen nun wie das Wort "Baby" zu schreiben ist.
Da heute keine Zeit mehr bleibt, um die einzelnen Ansagen noch zu besprechen, werden die Hefte eingesammelt und vereinbart, daß dies morgen nachgeholt wird.

Kopiervorlage aus der Zeitschrift: »Praxis Grundschule« 1/1987, S. 29
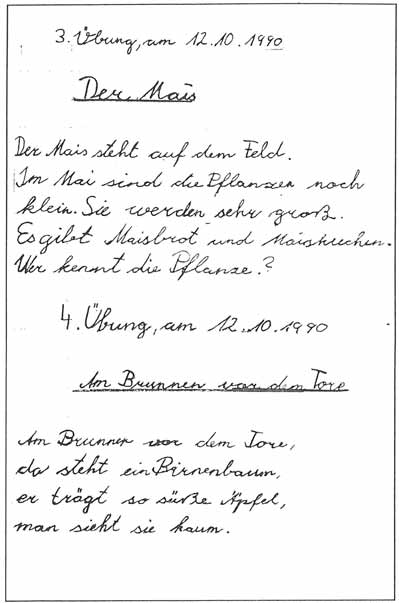
Zwei Dosendiktate

Die Kinder umrahmen oder unterstreichen das für sie persönlich empfundene Rechtschreibschwierige.
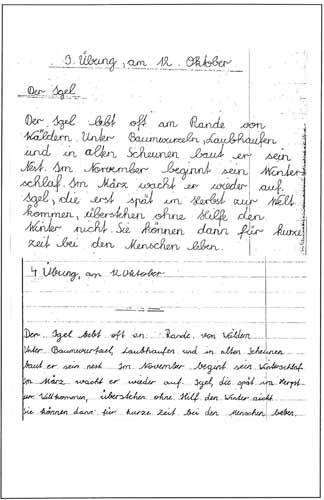
Zwei Diktate
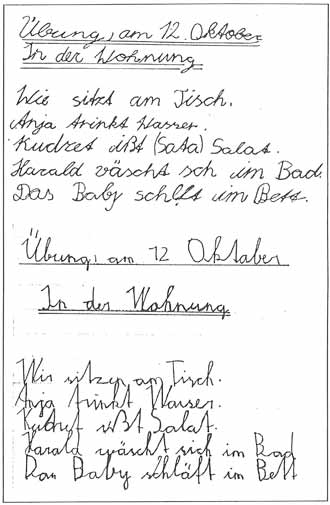
Texte, die zuvor an der Tafel vorbereitet und bearbeitet wurden.
Projektorientiertes Arbeiten ist eine weitere didaktisch-methodische Möglichkeit, nicht nur den Frontalunterricht weiter aufzubrechen und den Unterricht zu öffnen, sondern auch den Interessen der Kinder mehr Raum zu geben, ihre Neigungen und Begabungen, ihre Kreativität und Phantasie zu fördern.
Auch im österreichischen Lehrplan der Volksschulen (1987, S. 28) ist das projektorientierte und entdeckende Lernen als "neue" didaktisch-methodische Unterrichtsform vorgesehen, Erlaß des Landesschulrates für Tirol: "Projektunterricht an den allgemeinbildenden Pflichtschulen" vom 24. Februar 1987.
W. Einsiedler in seinem Aufsatz »Die neuen Lern- und Lehrformen des Grundschullehrplanes« (1989):
''Das projektorientierte Lernen stammt aus der amerikanischen Reformpädagogik zu Anfang unseres Jahrhunderts. Man wollte damit vor allem das Lernen in engen Fächergrenzen überwinden und eine Verzahnung des schulischen Lernens mit der Lebenspraxis herbeiführen. Durch dieses Merkmal der Öffnung gegenüber dem außerschulischen Leben und durch das Merkmal des kooperativen Lernens hat Projektunterricht auch eine gewisse Nähe zum Offenen Unterricht Das akzentuierende Bestimmungsstück, das projektorientiertes Lernen von anderen Unterrichtsformen abgrenzt, ist die Ausrichtung des Lernens und Arbeitens an einem Handlungsergebnis. In der Grundschule kann so ein Handlungsziel z.B. die Herstellung einer Meisenglocke, die Produktion einer Klassenzeitung oder die Einrichtung eines Schulgartens sein. Der Vorteil des Arbeitens auf ein Produkt hin gegenüber der Befassung mit kleinen Lehrplan- ''Häppchen'' ist der mögliche Aufbau von Langzeitmotivation und Sachinteresse. Die speziellen Formen ''Veränderungsprojekt'' (z.B. einen Spielplatz umplanen und den Umbau beantragen) und "Orientierungsprojekt" (z.B. Pro und Kontra zu einer Umgehungsstraße sammeln) werden in der Grundschu1e nur ansatzweise verwirklicht werden können. Entscheidend ist, daß die Kinder beim projektorientierten Lernen die Erfahrung machen, wie man schrittweise auf ein Handlungsziel hinarbeitet und wie Gemeinsamkeit und Arbeitsteilung die Zielerreichung erleichtern."
Die Arbeit in Projekten innerhalb des Schulversuchs zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder spielte besonders ab dem dritten Schuljahr eine wichtige Rolle. So konnten die beiden Lehrer in eigener Unterrichtserfahrung sehr rasch feststellen, daß diese Arbeitsform in einer derart heterogenen Lerngruppe besonders stark von positiven sozialen und kommunikativen Komponenten geprägt ist.
Durch das behutsam vertiefte Heranführen der Kinder an diese Arbeitsform konnte jedes einzelne Kind mit dem, was es an Erfahrung und Wissen einbrachte, wichtig werden für das Ergebnis der gesamten Gruppe, wobei sich individuelles und kooperatives Arbeiten zumeist die Waage hielten.
Meist hatten auch alle Kinder dieselbe Arbeitszeit zur Verfügung. Wie intensiv allerdings jedes einzelne Kind seine Zeit genutzt hatte, lag erstens in seiner eigenen Verantwortung und wurde zweitens meist nur von der Gruppe - eher unbewußt - kontrolliert.
Ein Teilziel war es aber, daß die Kinder selbst entscheiden lernen sollten, ob ihr Gruppenergebnis vereinbar und wichtig war für das Ergebnis der Gesamtklasse oder nicht.
Als ein besonders positiver Aspekt der Arbeit in Projektform wurde das Einbringen von außerschulischen Informationsquellen (Eltern, Geschwister, Bekannte u.v.m.) angesehen.
Noch eine weitere wichtige Erfahrung machten die Lehrer noch in der Zusammenarbeit mit den Kindern während verschiedener Projekte:
Lehrer R. Astl:
''Neben der Hilfestellung, den Kindern Wege und Möglichkeiten zu zeigen, ihre Erfahrungen bzw. ihre Erkenntnisse zu vertiefen und zu erweitern, kamen wir auch immer wieder in die Situation, den Kindern zur Seite zu stehen, um Gruppenkonflikte zu lösen oder um Entscheidungsprozesse zur Strukturierung einer Lernsituation bzw. zur Analyse eines Arbeitsmaterials zu erleichtern. Immer öfter waren wir aber auch nur stille Zuhörer oder Beobachter bei Gruppengesprächen oder Gruppentätigkeiten.
Manchmal hatten wir aber auch das Gefühl, eine Art "Manager" zwischen den einzelnen Gruppen von Kindern zu sein, wobei wir immer wieder darauf achten mußten, von den Kindern nicht als eine Art "Wissenscomputer" benützt zu werden."
Hätten die beiden Lehrer ihre Vorstellungen von Schule frei und ohne Einschränkung verwirklichen können, Schule und damit ihr Unterricht wären ein einziges Großprojekt geworden.
Da beiden Lehrern aber bewußt war, daß diese Art von Unterricht in seiner Struktur, seinen Anforderungen, seinen Arbeitsmöglichkeiten und damit seinen Auswirkungen so sehr dem herkömmlichen Grundschulunterricht widerspricht, haben sie versucht, ihn in dem Maße anzulegen, daß er weder für die Eltern und den Schuldirektor noch für die Schulaufsicht eine Gefahr für das schulische Fortkommen der Kinder darstellte.
"Sagt man in der Schule, man mache Projektunterricht, stellt man sich häufig nicht nur gegen sämtliche eingeführte Lernmaterialien und den Großteil der Kollegen, die ihre Lernziele "einfach durchziehen", sondern man hat notfalls Schulverwaltung und Eltern gegen sich. Alles, was nicht handfest (schriftlich!) Schulstunde um Schulstunde nachweisbar ist, wurde nicht gelernt. Arbeitstechniken auszuprobieren, gehört nicht zum Pensum eines normalen Grundschülers." (SCHEEL, 1978, S. 97).
Auch bei dieser Arbeitsform versuchten die Lehrer, sich an Richtlinien zu orientieren, die sie sich selbst vorgegeben hatten.
-
Das gewählte Thema hatte sich primär an den Interessen der Kinder zu orientieren und diese bei der Planung auch schon mit einzubinden.
-
Jedes "Projekt" sollte aus aktuellen Anlässen oder aus der vorhergehenden Unterrichtsarbeit erwachsen und in diese wieder einmünden.
-
Die Kinder sollten nach Möglichkeit selbständig handeln und arbeiten, wobei die beiden Lehrer eine handlungsbegleitende Funktion hatten.
-
Beide Lehrer waren so oft wie möglich - auch arbeitsteilig -in das Projektgeschehen mit eingebunden.
-
Nach Möglichkeit und nach gemeinsamer Vorausplanung waren auch die Eltern in die Projektarbeit eingebunden.
-
Der Auswertung der Arbeitsergebnisse und ihrer Darstellung wurde besondere Beachtung geschenkt.
-
Es wurden nach Möglichkeit alle Bereiche und Fächer des Lehrplanes eingebunden und fanden entsprechende Berücksichtigung.

-
Wird Ulrike je sprechen können? ( Die bunte Tierwelt -Eine Mathematikstunde -Deutsch I Sprachlehre ) eine Unterrichtsbeobachtung von Frau Prof. Jutta Schöler
-
Das Drucken freier Texte
-
Bilddokumentation zur Projektarbeit: Auf dem Bauernhof Stefan als Krankenpfleger
Anlaß zu diesem Thema war nicht nur der Welttierschutztag Anfang Oktober, sondern das Gastspiel eines kleinen Zirkus im Nachbarort von Reutte.
Die Kinder bringen ihre Tierbücher, Lexika und Fachbücher in die Schule mit. Aber auch die persönlichen "Lieblinge" werden in einem Käfig, Karton, an einer Leine oder in einem Aquarium voll Stolz und Freude in die Schule gebracht, um sie den Lehrern und vor allem den Mitschülern zu zeigen.
Über 14 Tage stehen Tiere im Mittelpunkt des gesamten Unterrichts. Sie werden zum zentralen Thema in sämtlichen Unterrichtsfächern.
Der Besuch und die Mitarbeit auf einem Bauernhof waren für alle Kinder nicht nur ein tolles gemeinsames Erlebnis, sondern vermittelten ihnen auch die wichtige Erfahrung, daß die vielfältige und z.T. schwere Arbeit in der Landwirtschaft nur bewältigt werden kann, wenn alle "zupacken" und mithelfen. Natürlich gehörte das Fahren auf einem Traktor ebenso dazu, wie eine stärkende Jause.
In der Schule wurde zum Thema ''Tiere'' nicht nur gezeichnet, gebastelt, gesungen und gespielt, sondern auch gerechnet und geschrieben. So hat eine Gruppe von Kindern Texte zu diesem Thema in der Druckerei hergestellt.
Eine andere Gruppe von neun Buben und Mädchen hat ein kleines »Tierbüchlein« angefertigt, das dann an die Eltern und Mitschüler verteilt wurde.
Auszüge aus dem Tierbüchlein:


Der Marder
Der Marder wohnt in hohen Gräsern. Er ist grau weiß grau.
Der Marder ist ein nettes Tier. Leider sehen Traktorfahrer den Marder manchmal nicht und überfahren ihn. Es werden nicht nur Marder, sondern auch junge Rehe überfahren.
Ich kenne einen Bauern, der ein Reh angefahren und dann mit nach Hause genommen hat.

Das Lama
Das Lama lebt in Südamerika.
Es kann im Gegensatz zu uns sehr weit spucken.

Die Kuh
Die Kuh lebt auf der Weide.
Die Kuh gibt viel Milch, die an die Molkerei verkauft wird.
Es wird aber nicht nur Milch verkauft, sondern auch Topfen und Käse und Butter.
Den Mist streut der Bauer aufs Feld.
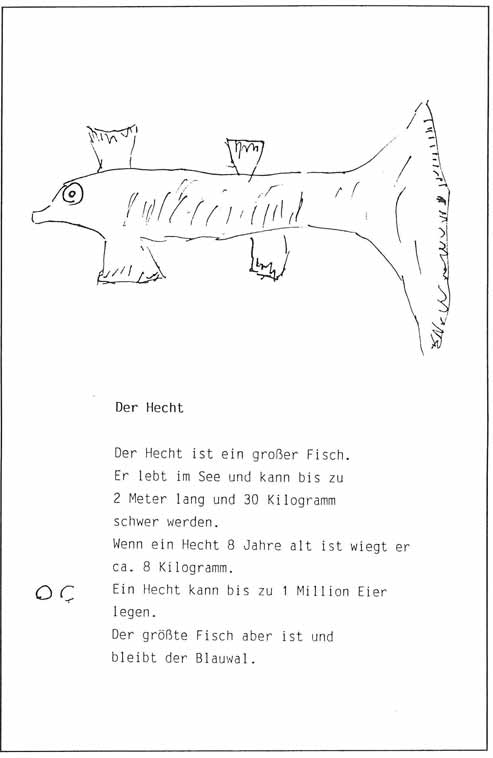
Der Hecht
Der Hecht ist ein großer Fisch.
Er lebt im See und kann bis zu 2 Meter lang und 30 Kilogramm schwer werden.
Wenn ein Hecht 8 Jahre alt ist wiegt er 8 Kilogramm.
Ein Hecht kann bis zu 1 Million Eier legen.
Der größte Fisch aber ist und bleibt der Blauwal.

Tricks der Tiere
Es gibt eine Raupe, die kann sich in eine Schlange verwandeln. Der Feind meint, diese Raupe sei eine giftige Schlange und traut sich nicht hin.
Ein Fisch brütet seine Jungen im Maul aus, und die kleinen Fische sind in Sicherheit.
Ein anderer Fisch geht angeln. Dieser Fisch hat eine Angel oberhalb des Maules. Er läßt die Angel aus. Ein kleiner Fisch meint, daß das sein Fressen sei und beißt zu. Der große Fisch reißt sein Maul auf, und der kleine Fisch ist gefangen.
Diese Unterrichtsbeobachtung von Frau Prof. Jutta Schöler bei einem ihrer Schulbesuche - am 22. Oktober 1990 über einen ganzen Schultag - möchte ich aus mehreren Gründen in ungekürzter Fassung wiedergeben:
-
Am Beispiel eines durchaus "gewöhnlichen" Unterrichtstages wird die besonders positive Schu1- und Unterrichtsatmosphäre deutlich, in der die Kinder miteinander leben und lernen.
-
Diese Unterrichtsbeispiele zeigen, daß sich Offener Unterricht, freie Arbeit und geschlossene Lernformen nicht gegenseitig ausschließen, sondern sinnvoll ergänzen.
-
Sie beschreibt einen Unterricht, bei dem die gemeinsame Förderung eines Kindes mit einer eindeutigen Behinderung möglich wird, ja fast eine Selbstverständlichkeit ist.
-
Es zeigt sich deutlich, daß die Thematik um Sabines Gehörlosigkeit in den gesamten Unterrichtsverlauf "eingebunden" ist, aber keines der Kinder in seinem Lernfortschritt dadurch beeinträchtigt wird.
-
Alle Kinder profitieren durch die für Sabine immer wieder unabdingbar notwendige Veranschaulichung des Unterrichts und zusätzlich auch durch die vielfältigen Möglichkeiten kooperativen Arbeitens.
Prof. Jutta Schöler, 22. Oktober 1992
Wird Selena je sprechen können?
Das gemeinsame Spielen und Lernen von allen Kindern gemeinsam mit dem von Geburt an tauben Mädchen Sabine ist auch dann richtig, wenn Sabine nicht spricht, sondern für sich andere Formen der Kommunikation mit den nicht behinderten Menschen zu finden.
Sabine wird für sich entscheiden, ob sie die systematische Förderung nutzt, um auch verbale Sprache zu entwickeln. Sabine wird für sich entscheiden. wie sie ihre natürliche Gebärdensprache weiter ausbaut Gemeinsam mit den 21 anderen gleichaltrigen Kindern hat sie vor zwei Jahren begonnen, die Schriftsprache zu erlernen. Ihre Fähigkeiten im richtigen Schreiben - vor allem im Zuordnen von Bildern zu den richtigen Begriffen und ihre mathematischen Fähigkeiten entsprechen etwa dem "Mittelfeld" ihrer Klasse. Es gibt einige SchülerInnen, die sind schneller und vor allem im Umgang mit den Worten gewandter als sie, und es gibt andere Kinder, die haben mit dem Unterrichtsstoff mehr Mühe. Diese Aussage gilt vor allem für Anton und Oleg, die beiden türkischen Jungen und für Seniha, das türkische Mädchen ihrer Klasse (zur Entwicklung der Sprachfähigkeiten von Sabine vergleiche Klaus-B. GÜNTHER, 1990).
Vor etwas mehr als zwei Jahren habe ich durch meine Beratung mit dazu beigetragen. daß Sabine nicht ein Internat besuchen muß. Dadurch konnte vermieden werden, daß sie von ihrer Mutter und ihrer Großmutter getrennt wird. Sie besucht eine Integrationsklasse in der Nähe ihres Wohnortes. Sie kann täglich mit nicht behinderten Kindern gemeinsam spielen. Diese anderen Kinder könnte ihr keine Sonderpädagogik ersetzen. Andererseits kann man sie auch nicht so behandeln wie jedes "normale" Kind. Besondere pädagogische Überlegungen sind notwendig! (Über die Vorgeschichte der Einrichtung dieser Integrationsklasse vgl. Schöler, 1990)
Wie sieht der Unterricht mit einem tauben Mädchen in der Klasse aus?
Wer die 3. Klasse in der Volksschule Reutte in Tirol besucht und Sabine nicht kennt, wird einige Zeit vergeblich nach ihr suchen. Sie beobachtet aufmerksam im Mathematikunterricht, turnt mit aller Selbstverständlichkeit gemeinsam mit allen anderen, schreibt, lacht, zeichnet - sie fällt überhaupt nicht auf. Deshalb will ich auch zunächst nicht beschreiben, wie ihre besonderen Lernbedürfnisse, die sich aus ihrer Behinderung ergeben, berücksichtigt werden, sondern: Ich will beschreiben, wie ein Unterricht aussehen kann, bei dem die gemeinsame Förderung eines Kindes mit einer eindeutigen Behinderung möglich wird, ja fast eine Selbstverständlichkeit ist.
Der Unterricht beginnt!
Die Schülerinnen und Schüler liegen schon mit dem Bauch auf ihren Gruppentischen, stecken die Köpfe zusammen, blättern in mitgebrachten Tierbüchern und Tierlexika. Thema dieser Woche: Tiere, ihr Lebensraum und ihre Nahrung.
Die Kinder sind sehr beschäftigt und haben viele Fragen: Was fressen Fledermäuse? Wo leben Nashörner? Warum kommen die Marder in die Stadt und fressen Autoschläuche?
Sie zeigen sich gegenseitig in den Büchern die Bilder, die sie besonders interessieren. Sie erzählen sich Erlebnisse mit Tieren. Die beiden Lehrer gehen von Tischgruppe zu Tischgruppe und beantworten die Fragen der Kinder.
Nach etwa 20 Minuten bittet der eine Lehrer die ganze Klasse um Aufmerksamkeit. Er erklärt, wie die Kinder Tischgruppe für Tischgruppe ihr eigenes kleines Büchlein über Tiere zusammenstellen sollen. Die beiden Lehrer haben kleine Formulare vorbereitet, in die die Kinder eintragen:
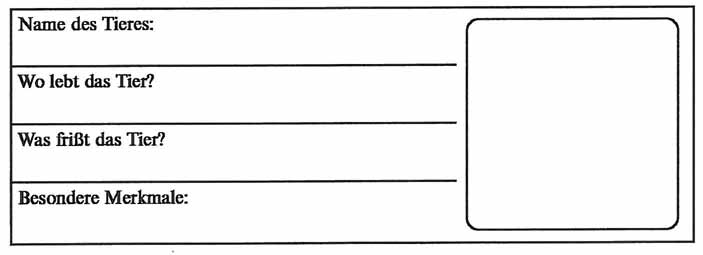
Daneben ist ein kleiner Bilderrahmen vorgegeben, in den jedes Kind "sein" Tier zeichnen kann. Die Kinder sollen sich am Tisch einigen, wer welches Tier "bearbeitet", damit am Ende jede Tischgruppe nach dem Alphabet geordnet ein vielfältiges kleines Tierbüchlein zusammenstellen kann. Alle Kinder beginnen eifrig mit der Arbeit Die beiden Lehrer gehen von Tisch zu Tisch, sie unterstützen die Kinder dabei, möglichst selbständig die notwendigen Informationen aus den vorhandenen Büchern zu suchen. Es herrscht eine angenehme Arbeitsatmosphäre, voller Eifer, angefüllt mit Gesprächen, die nicht zu laut werden. Alle Kinder arbeiten am selben Thema und doch arbeitet jedes Mädchen und jeder Junge an ihrer oder seiner speziellen Aufgabe:
Stefan hat sich vorgenommen, eine Sammlung ganz spezieller Tiere zusammenzustellen. Er sucht Informationen über:
-
den Blauwal,
-
die Klapperschlange,
-
die Fledermaus und
-
das Kamel
Er muß in mehreren Büchern nachschlagen und lange Texte lesen, um die Informationen herauszufinden, die er auf ein Blatt für das Tierbüchlein seiner Tischgruppe übertragen kann.
Stefanie ist eine Pferdeliebhaberin. Sie muß in einem speziellen Pferdebuch nachsehen und will genau erklären, welches der Unterschied zwischen einem Esel einem Pony, einem Wildpferd und einem Reitpferd ist.
Ulrike will etwas über einen Hund schreiben. Sie hat große Mühe mit der deutschen Sprache. Ihr Eifer ist ihrem Gesicht abzulesen. Es wird eine wichtige Aufgabe der Lehrer sein, sie nicht zu entmutigen und ihr immer wieder die richtigen Hilfen zu geben. Ein Lehrer geht zu ihr: Ulrike: ''Wie schreibt man Hund?" Er buchstabiert das Wort für sie. ''Wo lebt der Hund?" Ihre Deutschkenntnisse reichen nicht aus, um allein die Bedeutung der Frage zu erschließen. Der Lehrer fragt sie: "Hast du zu Hause einen Hund?" -"Nein!" - "Wohnt ein Hund in dem Haus, in dem du auch wohnst, vielleicht bei einer anderen Familie?" - ''Nein!'' - Es wird klar. Woher soll Ulrike wissen, wie und wo ein Hund wohnt? Ein Tierbilderbuch wird gesucht, durchgeblättert und tatsächlich auch eine Abbildung gefunden, auf der ein Hund vor seiner Hundehütte sitzt. Der Lehrer erklärt ihr. ''Das ist eine Hundehütte. Dieser Hund schläft in der Hundehütte." Jetzt kann Ulrike auch dieses Wort auf ihren kleinen Antwortbogen schreiben. Der Lehrer diktiert ihr.
Nun zur nächsten Frage: ''Was frißt der Hund?" Der Lehrer sagt es ihr, sie weiß es nicht: "Der Hund frißt Fleisch.
" Und welche besondere Merkmale hat ein Hund? Was kann ein Hund, was eine Katze oder ein Pferd nicht können?
Ulrike Augen strahlen. Das weiß sie: "Der Hund kann bellen!" - "Prima!" Ulrike schreibt spontan und schnell:
Derhundkanbellen
Sie ist sehr stolz auf diese Antwort Sie schaut den Lehrer mit ihren großen strahlenden Augen an. Er hat sich entschlossen, diese Antwort so stehen zu lassen und Ulrike nicht zu verbessern.
Wie wäre es wohl Ulrike in einer solchen Stunde ergangen in einer Klasse, in der nur ein Lehrer mit 20 oder mehr SchülerInnen arbeiten muß?
Sabine sucht in der Zwischenzeit etwas über Katzen aus den mitgebrachten Büchern. Die richtigen Antworten, in der richtigen Schreibweise einzutragen, das macht ihr keine Mühe.
Viel Mühe haben aber Mustafa und Hans. Die Probleme mit der deutschen Sprache sind in dieser Klasse offensichtlich mit allen SchülerInnen besprochen worden. Vor dem Beginn der schriftlichen Arbeitsphase setzen sich die SchülerInnen an einem Gruppentisch um, ohne daß die Lehrer überhaupt etwas sagen müssen. Mustafa und Hans sitzen meist nebeneinander und reden auch miteinander oft türkisch. Jetzt sitzt jeder von beiden neben einem deutschsprechenden Mädchen. Diesen Mädchen ist es offensichtlich selbstverständlich, auch immer wieder ein Auge auf den Text ihrer Nachbarn zu werfen und zu helfen, zu korrigieren, auf Fragen zu antworten. Genauso selbstverständlich ist es für diese beiden Jungen, ihre Nachbarinnen zu fragen, Hilfe anzunehmen und sich korrigieren zu lassen.
Diese beiden türkischen Jungen und diese beiden österreichischen Mädchen lernen in ihrer Art und Weise miteinander, wie es allein notwendig ist, um die gegenseitigen Vorurteile abzubauen. Sie helfen und akzeptieren sich. In einem solchen Arbeitsklima hat auch der Schüler keine Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, der sonst oft wegen seiner Ungeduld und wegen seines zeitweiligen aggressiven Verhaltens auffällt.
Etwa zehn Minuten vor dem Ende der ersten Unterrichtsstunde holt der eine Lehrer seine Gitarre und beginnt, sie zu stimmen. Es wird einen Moment ruhiger in der Klasse. In diese Ruhe hinein kann der andere Lehrer darauf hinweisen, daß alle jetzt langsam ihre Arbeiten beenden sollen, denn für die nächste Stunde hat sich ein Polizist angekündigt, der Verkehrserziehung machen wird.
Die SchülerInnen beenden ihre Arbeiten, sortieren die ausgefüllten Arbeiten nach dem Alphabet, gehen quer durch den Raum, legen alle Arbeitsmaterialien an den richtigen Ort zurück. Jeder der beiden Lehrer gibt mal hier mal dort einen kleinen Hinweis.
Als außen stehender Beobachter habe ich den Eindruck: Das ist ein gut eingespieltes Team! Die" vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer und der selbstverständliche Arbeitseifer der SchülerInnen beeindrucken mich sehr. So macht Schule Spaß: Für LehrerInnen und SchülerInnen.
Bevor es zur Pause klingelt, sitzen alle auf ihren Plätzen, einigen sich auf ein Lied, das noch gesungen werden soll und vergleichen kurz, über welche Tiere sie geschrieben haben.
Während von jedem Gruppentisch ein Schüler/eine Schülerin die Tiernamen nocheinmallaut vorliest, blättert der Lehrer, der gerade neben Sabine sitzt, das Büchlein ihrer Tischgruppe noch einmal vor ihren Augen durch und fordert sie auf, diese Namen zu artikulieren. Ich sitze genau diagonal zu ihrem Gruppentisch aufd er anderen Seite der Klasse. An ihren Lippen kann ich ablesen, wie sie stimmlos artikuliert: Hund, Katze, Maus ... und plötzlich, ganz laut, sodaß alle Kinder in der Klasse es verstehen können:
PFERD
Sabine kann sprechen! Die Lehrer hatten es mir schon zuvor gesagt Sie kann einzelne Wörter sprechen. Das Problem sei zur Zeit nur, daß sie in der Klasse meist nicht will. Aber am Nachmittag mit ihrer Logopädin spricht sie. Dort liest sie sogar schon kleine Texte vor. Oder sie schlägt ihrer Mutter Spiele vor: Sabine spricht ein Wort, während die Mutter die Augen zumachen soll - dann soll die Mutter das Wort wiederholen. Aber im Unterricht gab es bisher wohl noch nicht genügend Herausforderungen zum Sprechen für Sabine.
Ich bin mir sehr sicher: Wenn in einer ähnlichen Situation die Gruppenarbeit so vorbereitet wird, daß Uschi die Ergebnisse ihrer Tischgruppe vortragen soll, dann wird sie auch die Wörter: Hund, Katze, Maus laut sprechen und nicht nur so artikulieren, daß die anderen es ihr vom Mund ablesen können. Es wird eine der wichtigen Aufgaben der Lehrer und der Logopädin für die nächste Zeit sein, sich solche -Sabine zum Sprechen motivierenden Unterrichtssituationen auszudenken. Um herauszufinden, was Sabine besonders interessiert und wovon sie wohl am liebsten berichten will, ist es wichtig, sich auch regelmäßig mit der Mutter zu unterhalten und auch die Sonderpädagogin einzubeziehen, die zweimal in der Woche zu Hause Sabine bei den Hausaufgaben hilft.
Das Ende dieser 1. Stunde meines Besuches in Reutte zu Beginn eines 3. Schuljahres hat deutlich gemacht: Sabine will sprechen lernen. Sabine kann sprechen! Auch wenn es jetzt nur einzelne Wörter sind. Es ist die Aufgabe der begleitenden Erwachsenen, sich die richtigen Unterrichtssituationen auszudenken, durch die Sabine zum Sprechen motiviert wird. Sabine selbst ist mit ihrer jetzigen Situation in der Klasse ganz offensichtlich zufrieden. Sie hat ihre nichtverbalen Kommunikationsmöglichkeiten so großartig entwickelt, daß sie sich bisher ausgezeichnet verständigen konnte. Ihre Fähigkeiten müssen die Erwachsenen weiter ausbauen, d.h. für sie auch. daß sie und die MitschülerInnen die Gebärdensprache, die sie schon jetzt spontan immer wieder benutzen, systematisch zu erlernen. Sabine selbst kann dann entscheiden, wann sie Gebärden- und wann sie die Lautsprache benutzt
Aber jetzt ist erst einmal Pause.
Sabine rennt mit den Mädchen und Jungen auf den Flur vor der Klasse, um wie alle auf dem glatten Linoleumfußboden einen Schlitterbewerb zu machen: Wer kommt am weitesten? Mit den Patschen (den Hausschuhen), die die Kinder im Schulgebäude tragen, geht das fast so gut wie auf einer Eisbahn im Winter. Für mich ist es immer wieder faszinierend, auf welche lustigen Ideen die Kinder kommen. Wenn ich diese lärmende Fröhlichkeit in dem Schulgebäude einer "normalen" Schule höre und um mich herum erlebe, dann frage ich mich:
Sind sich die VertreterInnen der Institution Sonderschule bewußt, was sie den Kindern nehmen, wenn sie versuchen, diese Lebendigkeit durch Sonderpädagogik zu ersetzen?
Die Pause ist zu Ende.
Alle gehen wieder in die Klasse zurück. Jetzt ist der Polizist in der Klasse. Anhand von Overhead-Folien bespricht er mit den SchülerInnen in einer frontalen Diskussion, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten.
Sabine kann davon nichts verstehen. Neben ihr sitzt in dieser Stunde einer der beiden Lehrer und erklärt die Aufgaben, die der Polizist mit allen bespricht, anband eines Verkehrsspieles. Sabine sitzt an ihrem Tisch und kann sich offensichtlich gut konzentrieren. Alle anderen Kinder lassen sich durch die lautlosen Gespräche zwischen Sabine und dem Lehrer nicht ablenken.
Für mich ist es interessant zu beobachten, daß Sabine mit einem Teil ihrer Aufmerksamkeit auch bei den anderen Kindern ist: In dem Moment, als der Polizist eine Mitschülerin zu sich nach vorne ruft und mit ihr die Situation am Straßenrand spielend nachstellt, guckt Sabine aufmerksam nach vorne. Sie unterbricht für einen Moment ihre Einzelarbeit mit dem Lehrer, beobachtet das kleine Verkehrsspiel und vergewissert sich anschließend mit Rückfragen an den Lehrer, ob sie den Sinn des Spieles richtig verstanden hat.
Große Pause!
Alle Kinder gehen auf den Hof. Ich begleite den Lehrer bei seiner Hofaufsicht, unterhalte mich ein wenig mit ihm und suche Sabine. Es ist schwer, sie zu finden. In einer Ecke des Hofes entsteht ein Kinderknäuel - dort wird sie wohl sein. Der Lehrer sagt zu mir. "Sabine ist immer da, wo was los ist."
In der 3. Stunde ist Mathematik.
Während die Kinder ihre Rechenbücher und Rechenspiele auf den Tisch legen, sprechen sich die Lehrer kurz ab:
-Wer macht die Wiederholung mit allen am Anfang der Stunde? Hans P., in der Zeit kann Roland Astl noch ein paar Arbeitsmaterialien vorbereiten.
-Welche Gruppen sollen heute gebildet werden? ''Mittlere Gruppe" und "Gute und Schwache" gemischt.
-
Wer übernimmt welche Gruppe?
-
Wer bleibt im Klassenraum und wer geht in den Arbeitsraum, der auf dem Dachboden der Schule zur Verfügung steht?
Schnell ist alles klar, und der Unterricht kann beginnen. Die SchülerInnen setzen sich im Halbkreis vor die Mathematiktafel, die an der Seitenwand der Klasse angebracht ist.
Thema heute ist Wiederholung des lx1 mit der 3. Der Lehrer teilt Magnetstreifen aus mit je drei etwa 10xl0cm großen Karos. Fünf Kinder haben rote Karos und fünf Kinder haben blaue Karos. Jetzt kann es losgehen: Wieviel ist 1x3, 2x3, 3x3?
Nacheinander werden die SchülerInnen aufgerufen, gehen nach vorne, heften ihren Magnetstreifen an die Tafel und drehen anschließend auf ihrer Würfeltafel die Würfel der Dreierschritte um. So entsteht das Bild:
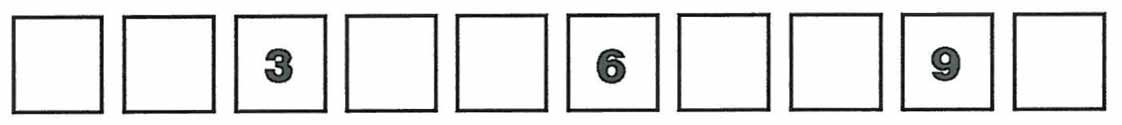
Diese Veranschaulichungen sind absolut notwendig wegen Sabine. Würde der Mathematikunterricht nur verbal ablaufen, dann ginge diese Einführungsphase völlig an ihr vorbei. Die Anschauung ist aber auch sehr sinnvoll für alle anderen Kinder. Die meisten SchülerInnen, die ich kenne, haben Schwierigkeiten im Mathematikunterricht, weil ihnen die konkreten Vorstellungen fehlen.
Es geht weiter: der vierte Schüler geht nach vorne. Was soll er mit seiner Dreier-Karte machen? Sie muß getauscht werden gegen eine Einer-Karte und eine Zweier-Karte, um den Zehnerübergang vollziehen zu können. So kann auch an der Zahlenleiste der Zehnübergang sichtbar gemacht werden.
Nacheinander gehen die Jungen und Mädchen zur Tafel und erarbeiten sich das lx1 mit der 3. Nach dieser Einführungsphase sagen die Lehrer kurz an, wer mit Hans P. im Klassenraum bleibt und wer mit Roland Astl in den "Dachraum" geht, was alles zum Arbeiten mitgenommen werden soll bzw. auf den Tischen liegen sollte. Dieses Vorgehen ist offensichtlich für alle Kinder ganz selbstverständlich. Das eine Grüppchen verläßt fröhlich schwatzend die Klasse. Das andere Grüppchen verteilt sich zum Arbeiten neu an den Gruppentischen.
Mir geht durch den Kopf: Hier ist das Verlassen des Klassenraumes und das Wechseln der Arbeitsgruppen eine Selbstverständlichkeit für alle Kinder. Genau so muß die besondere Förderung sowohl der schwachen SchülerInnen wie auch der besonders Befähigten in den Unterricht eingebaut sein! In den meisten Fällen, in denen Kinder in den "normalen" Schulen "Förderunterricht" erhalten, wird dies von den betroffenen Kindern nicht als eine Hilfe begrüßt, sondern als Bestrafung empfunden, u.a. deshalb, weil sie die einzigen sind, die den Klassenraum gelegentlich verlassen müssen oder gar, weil sie länger als die anderen in der Schule bleiben müssen.
Urs Haeberlin verweist in seiner Studie: "Die Integration von Lernbehinderten" auf dieses Problem.
In den von ihm untersuchten Klassen ist nicht integrativer Unterricht mit integrativ geplanter Didaktik praktiziert worden, sondern: Ein "Förderlehrer" kam für einige Stunden in der Woche, holte die "schwachen" SchülerInnen aus dem Unterricht und erarbeitete mit ihnen den Unterrichtsstoff. Die betroffenen SchülerInnen wurden anschließend nach ihrer Meinung gefragt.[21]
Haeberlin schreibt als Ergebnis seiner Befragung: "Wenn Schüler die Klasse verlassen, so kann bei schlechter Koordination zwischen Klassenlehrer und Förderlehrer neben dem Gefühl der schulischen Unterstützung auch das Gefühl entstehen, etwas zu verpassen. Sobald der Förderlehrer im Förderunterricht nicht schulfachbezogenen Stützunterricht erteilt, sondern pädagogisch-therapeutisch oder diagnostisch arbeitet - ohne direkten Bezug zum Regelklassenunterricht -, kann beim Schüler leicht das Gefühl des Verpassens aufkommen. Die Befürchtung, etwas zu verpassen, wird aus den Begründungen der Antworten zur Frage, ob der Schwer lieber in der Klasse bleiben würde, noch deutlicher. Von 22 Schülern wurde diese Frage ganz oder teilweise bejaht Die Begründungen waren: Weil man etwas Schönes oder Wichtiges verpassen könnte (10); kommt drauf an, was sie in der Klasse machen (9); weil dann die anderen frei haben (3)." (siehe Häberlin, Seite 53)
Während des restlichen Teils der Mathematikstunde arbeiten alle Kinder an den verschiedenartigsten Aufgaben des lx1 mit der 3. Jedes Kind löst so viele Aufgaben, wie es einem je individuellen Arbeitstempo entspricht Jedes Kind erhält die Hilfen, die es braucht In der einen Gruppe geht Hans P. von einem Tisch zum anderen. In der anderen Gruppe hilft Roland Astl den Schwächsten, während die anderen in Partnerarbeit sich gegenseitig helfen.
Für diese Arbeitsphase ist es sehr günstig, daß inzwischen von den verschiedenen Verlagen vielfältiges Übungsmaterial angeboten wird, daß also die Lehrer sich diese Materialien nicht immer wieder neu erarbeiten müssen. Andererseits scheint es für manche Kinder auch motivierender zu sein, ganz spezielles Material zu erhalten, das vom Lehrer selbst erstellt wird; z.B.: Mustafa kommt am Ende der Stunde zu Roland Astl und fragt ihn, ob er wieder lxl - Übungskärtchen bekommen könne. Der Lehrer holt kleine Karteikarten von einem Tisch, beschriftet diese jeweils auf der einen Seite mit der Aufgabenstellung, z.B. 5x3 und auf der anderen Seite mit der Lösung: 15. Stolz streckt Mustafa diese Kärtchen in die Hosentasche und verkündet: "Jetzt kann ich heute lernen! -Mit den Karten vom Herrn Lehrer!"
In der letzten Stunde wird Sprachlehre geübt. Die SchülerInnen sollen anband von Wortlisten die Tiernamen in drei Spalten einordnen:
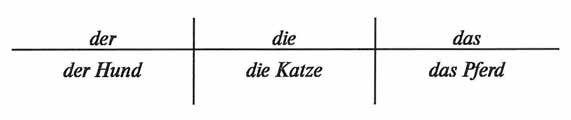
Den meisten Kindern fällt das nicht schwer, für die beiden türkischen Jungen und das türkische Mädchen ist dies jedoch eine schwierige Übung. Ein Lehrer arbeitet während der ganzen Stunde in aller Ruhe mit diesen Dreien. Der andere Lehrer erklärt Janina, wie sie anband von Umrißbildern zugleich mit den Artikeln mit Sabine auch die Artikulation der Wörter üben kann. Ich gehe zu den beiden an den Tisch, um sie bei ihrer Arbeit zu beobachten. Janina hält ein Tierbild nach dem anderen hoch und läßt Sabine das Wort aussprechen. Sabine formt die Wörter mit ihren Lippen eindeutig, nicht immer sind die Laute dazu zu hören. "Maus" und "Pferd" kann sie am besten sprechen. Dann hebt Julia ein Bild hoch: Sabine artikuliert klar und deutlich: "Der Hund". Janina schüttelt den Kopf. Sabine guckt mich erstaunt an. Ich gucke genauso erstaunt zurück. In diesem Bild habe ich einen Hund erkannt Ehe ich Janina fragen kann, was da nicht richtig sein solle, greift Sabine zu dem Bild, dreht es um und liest vor: "Der Wolf'. Etwas später gibt es dasselbe Problem mit dem Bild eines Esels, den Sabine und ich als Pferd erkennen.
Den restlichen Teil der Stunde nutzen einige Kinder, um Bastelarbeiten zu Ende zu bringen. Dafür setzen sich alle SchülerInnen wieder neu um. Jetzt arbeiten Stefanie und Sabine zusammen. Janina setzt sich an einen anderen Gruppentisch.
Zu Beginn dieses Arbeitsabschnittes erzählt Stefanie mit ausholenden Gesten und eindrucksvoller Mimik, wie sie sich vor kurzem mit einer Schere in den Finger geschnitten hat. Sabine beobachtet sie sehr aufmerksam und versteht, so wie ich, den Sinn dieser Geschichte, obwohl Sabine und ich die türkische Sprache nicht verstehen, in die Stefanie im Eifer des Erzählens immer wieder einmal wechselt Stefanie Gebärdensprache ist eindeutig.
Etwa 10 Minuten vor dem Ende der Stunde ermahnen die Lehrer, nun nichts Neues mehr zu beginnen. In aller Ruhe räumen die SchülerInnen ihre Arbeitsmaterialien wieder an den richtigen Platz.
Dem Selbstverständnis der beiden Lehrer entsprach es, eine für alle Kinder grundlegende Bildung zu sichern. Da dies nur im Rahmen von binnendifferenzierendem Unterricht erreicht werden konnte, war es erforderlich, in der speziellen Situation dieser Integrationsklasse, - u.a. durch SABINE, das gehörlose Mädchen - einen Schwerpunkt auf den Bereich Schrift und Sprache und deren Erwerb zu legen.
Aus einer über mehrere Jahre erfolgten Praxiserfahrung des Lehrers Roland Astl mit dem Schriftspracherwerb und der damit verbundenen Erkenntnis, daß Fibeln, die man. den Kindern im Erstlese- und Schreibunterricht in die Hand gibt, meist nur Texte enthalten, zu denen die Kinder keine persönlichen Beziehungen haben und außerdem nicht dem wirklich ganzheitlichen Lesen- und Schreiben lernen eines Kindes entsprechen, haben sich die Lehrer konsequenterweise entschlossen, daß die SchülerInnen das Lesen und Schreiben mit selbstgeschriebenen bzw. - hergestellten Texten lernen.
Wenn wir bedenken, daß jeder Schulanfänger gänzlich unterschiedliche Vorerfahrungen mit der Schriftsprache mitbringt, zusätzlich aber viele Kinder Schwierigkeiten mit einer vorgegebenen logischen Reihung der Lernschritte haben, so ist es nicht verwunderlich, daß viele Kinder schon nach kurzer Zeit die Freude verlieren und einige auch das Ziel nicht erreichen.
Vor allem aber Kinder, die durch eine Beeinträchtigung von vornherein diesen Lernschritten nicht folgen können, sind vom ersten Tag ihres Schuleintritts an ausgeschlossen und ohne Erfolgserlebnis.
Sicher vereinfacht ein klarer, systematischer Aufbau und die Festschreibung eines einzigen leicht nachvollziehbaren Lernweges dem Lehrer den Überblick -dazu erleichtern fertige Bild- und Übungsmaterialien die Arbeit -, aber wir wissen heute, daß gerade die Systematik eines Schreibleselehrgangs, die vom fixierten Nullpunkt ausgeht, den Schulanfängern überhaupt nicht entgegen kommt.
Wer selbst Kinder hat oder je mit Kindern im Vorschu1alter gearbeitet hat, der weiß, daß viele Kinder schon vor dem Eintritt in die Schule eine ganze Anzahl von Namen für Dinge aus ihrer Umwelt lesen können. Es sind meist Namen in Druckschrift auf Lebensmitteln, Zeitschriften, Automarken u.ä.. Wörter in Schreibschrift findet das Kind so gut wie keine.
Die meisten Kinder versuchen, bereits im Vorschu1alter die Druckbuchstaben nachzuahmen, die Wörter der Erwachsenen "nachzumalen". Sie bezeichnen es als Schreiben. Somit ist der erste Schritt zum Erlernen der beiden wichtigsten Kulturtechniken des Lesens und Schreibens getan.
Nach der Theorie des Begründers der Schuldruckerei, des französischen Pädagogen Celestin Freinet, erlernt ein Kind das Lesen und Schreiben nach der Methode des »Tatonnement experimental« (ein sich durch ständiges Versuchen Herantasten an eine Sache). Jedes Kind möchte sich seiner Umwelt mitteilen. Es möchte auf sich aufmerksam machen und seine Erlebnisse berichten. Ohne ausgeübten Zwang von Erwachsenen gelangt ein Kind aus eigenem Antrieb vom Lallen zum Sprechen, vom Sprechen zum malenden Darstellen und über das Kritzeln zum Schreiben. Das Lesen ist bei diesem Prozeß gleichzeitig das Deuten des Gemalten, Gekritzelten und des Geschriebenen.
FREINET bezeichnet diese Vorgehensweise als die "natürliche Methode".
So schreibt FREINET:
"Wenn du eine Mutter fragst - selbst wenn sie Professorin für Grammatik und Phonetik wäre -, nach welcher Methode sie ihrem Kind das Sprechen beigebracht habe, wird sie dich erstaunt ansehen. Als ob es unterschiedliche Methoden gäbe, sein Kind das Sprechen zu lehren! Es gibt für das Kind nur eine Art, das Sprechen zu lernen, nämlich die des natürlichen und allgemeinen Prozesses des tastenden Versuchens."
(Zit. n. BERGK/MEIERS, 1985, S. 12).
''Die Druckerei in der Schule ersetzt nunmehr, verbunden mit der Praxis des freien Textes, den herkömmlichen Lesebuchunterricht und verhilft den wirklichen Interessen und Erfahrungen der Kinder in der Schule zum Durchbruch. Lesen und Schreiben sind für die Kinder keine sinnentleerten Übungen mehr, sondern bekommen für sie eine reale Bedeutung."
(Zit. n. BECK/BOEHCKE 1976, S. 257).
Die Praxis des freien Textes und der Druckerei hatte eine Schlüsselfunktion als Anregung zur Entfaltung des kindlichen Selbstausdruckes. Es entstand bei den Kindern auch eine besondere Motivation vor allem dadurch, daß sie ihre eigenen Worte verwenden durften. Damit wurden Texte - auch wenn mitunter die Sprache der Kinder nicht immer den Erwartungen und den schulischen Normen entsprach - von den anderen Kindern ernst genommen und gelesen.
So bekamen ihre Texte mehrfachen Gebrauchswert:
Vervielfältigt (von den Eltern und Freunden gelesen oder als klasseneigener Lesestoff in der Leseecke eingeordnet) konnten sie als Grundlage weiterer Sprach- und Grammatikübungen dienen oder andere Kinder wiederum zu neuen Phantasien und zum Schreiben neuer Geschichten anregen.
Es erfolgte eine Differenzierung, die es ermöglichte, daß alle Kinder der Klasse trotz unterschiedlichster Voraussetzungen für einen bestimmten Lerninhalt ihr individuelles Lernziel erreichten, ohne zur gleichen Zeit das Gleiche zu tun.
Um es Sabine zu erleichtern, sich möglichst rasch den anderen Kindern, den Lehrern und anderen Personen aus ihren Umfeld mitteilen zu können, wurden dazu von den Lehrern ausgewählte und spezielle Arbeitsmittel aus den Bereichen Sprache und Schrift bereitgestellt. Im Rahmen ihrer Unterrichtsplanung kauften sich die beiden Lehrer aus eigenen Mitteln eine "Freinet-Druckerei".
Diese Druckerei wurde bei fast allen Kindern über die gesamten 4 Schuljahre sehr beliebt, nicht zuletzt wohl deshalb, weil bei dieser Tätigkeit einerseits für jedes Kind ein ganzheitlicher und eigenständiger Aneignungsprozeß ermöglicht wurde und weil es andererseits zu einem kooperativen Arbeiten von zumeist 2 bis 3 Kindern beim Setzen und Drucken der Texte kam.
So stellte u.a. das Auswählen und Setzen der Buchstaben für Sechsjährige eine durchaus schwierige feinmotorische Aufgabe dar und das Drucken selbst eine große körperliche Kraftanstrengung.
Die kognitive Aktivität der Kinder wurde wiederum einerseits durch das Lesen der Buchstaben auf dem Blatt gefördert, auf dem der freie Text notiert war, und andererseits durch das korrekte Einsetzen der Lettern in den Setzrahmen. Außerdem mußte nach dem ersten Probedruck auch noch eine Korrektur erfolgen.
Die Kinder schrieben keine Aufsätze mehr zu vorgegebenen Themen, sondern sie verfaßten Texte, in denen sie ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und Gedanken auszudrücken versuchten. Diese freien Texte konnten, ganz im Sinne Freinets, sehr unterschiedlicher Art sein: z.B. erlebte Geschichten, Träume, Sprachspiele, Themen über Tiere oder aktuelle Begebenheiten u.a.m.
Bei der Entwicklung ihrer eigenen Texte wurde nicht nur die Phantasie der Kinder sehr stark angeregt. Es entwickelten sich auch stark affektiv-kognitive Prozesse bei ihrem Bemühen, einen eigenen Text zu erarbeiten.
Wie beliebt bei den Kindern gerade die Druckerei war, konnte auch daran festgestellt werden, daß an kaum einem Tag alle, die es wollten, drucken konnten.
Von großem Vorteil aber war es, daß sich die Druckerei in der Klasse befand. Dadurch konnten sicherlich mehr Kinder öfters einen Text herstellen.
Nach dem Prinzip:
»Ein binnendifferenzierender Unterricht muß es ermöglichen, daß ein bis drei Kinder schreiben und einen Text drucken, während die übrigen an anderen Dingen arbeiten.«
Nachdem die Kinder allein oder in der Gruppe einen Text mit Schreibmaschine, Bleistift, Kugelschreiber usw. angefertigt und der Klasse oder einigen Kindern vorgelesen haben, kann er nochmals an der Tafel für alle zur Begutachtung und zur Verbesserung angeschrieben werden, wobei auch Änderungsvorschläge eingebracht werden können. Die Lehrer werden meist nur zu Hilfe geholt, wenn auch die guten Schreiber verunsichert sind.

In der Druckereiecke der Klasse wird der Text gesetzt. Auf dem Tisch sind die beiden Setzkästen mit den Bleibuchstaben.

Die Farbe wird auf eine Walze aufgetragen. Zu den weiteren Materialien gehören eine Druckwalze, Farben, eine Klapppresse und ein Farbblech. Außerdem sind Ablagemöglichkeiten zum Trocknen der frischen Abzüge vorbereitet. Zum späteren Saubermachen sind ein paar Lappen und einige alte Zahnbürsten vorhanden. Im Druckkasten werden die Buchstaben eingefärbt.


Vorsichtig wird ein Blatt Papier in den Druckkasten gelegt.Viele verschiedene Arbeitsschritte sind notwendig, bis der erste Probeabzug angefertigt werden kann (Buchstaben suchen; Buchstaben in die Setzrähmchen stellen; in Spiegelschrift setzen u.v.m.).Der erste Abzug entsteht!

Zum Handwerk des Druckers gehört auch das Saubermachen der gesamten Druckereiausrüstung (Thema - Umweltschutz - eigene Hygiene).
Nach dem Reinigen müssen die Buchstaben sorgfältig in die richtigen Fächer des Setzkastens "abgelegt" und die übrigen Gegenstände aufgeräumt werden.
Dagmar MAHLSTEDT (in BERGKJMEIERS, 1985, S. 91 f.) zum Lern- und Erziehungswert der Schuldruckerei:
''Wer einmal bei der Gestaltung eines freien Textes und beim Setzen und Drucken desselben teilgenommen hat, für den gibt es keinen Zweifel mehr über den pädagogischen Wert der Schuldruckerei Mit welch großer Sorgfalt und mit welchem Respekt vor dem Wort wählen die Schüler ihre Formulierungen. Wenn sie die einzelnen Buchstaben anheben und den Text setzen, so ist dies eine objektivere Art, die Orthographie zu erlernen, als wenn man sein Schulheft seitenweise und oft lustlos füllt. Das gleiche gilt für den freien Aufsatz, bei dem die Schwer oft Themen behandeln, die der Lehrer sich scheuen würde aufzugeben, die aber ganz natürlicher Ausdruck des kindlichen Erlebens und Denkens sind Seine Gedanken in Metall gießen, hat für die Kinder - und nicht nur für sie - die schmeichelhafte Aussicht auf Beständigkeit. Das Drucken in der Schule strahlt eine gewisse Erhabenheit aus, deren Bedeutung die Kinder zutiefst empfinden. Es wäre von größtem Wert, die Schuldruckerei in Schulen verstärkt zu erproben und sie für eine kindgemäße, natürlichere Gestaltung unseres Sprachunterrichts fruchtbar werden zu lassen."
Das Schreiben und Drucken von Texten durch die Schüler war sicherlich nicht nur für das einzelne Kind ein Gewinn, sondern auch für das gesamte Klassenklima, denn durch ihre für sie bedeutsamen -an Mitschüler oder Eltern verteilten -richtig geschrieben und sauber gedruckten Texte blieben die Kinder nicht nur motiviert, sondern lernten zudem im Sinnzusammenhang lesen. Für einige Zeit wurde für das Kind die Beschäftigung mit Texten wichtiger, als der heute so große passive Konsum von Bildern (TV).
Für die Lehrer wiederum aufschlußreich waren dabei nicht nur die individuellen Beobachtungen der Kinder und ihre Art der Kooperation beim Setzen und Drucken der Texte oder die Inhalte der Geschichten selbst, sondern vor allem auch das große Interesse dieser Kinder, die entweder im Bereich Sprache - Lesen von Beginn an Probleme hatten, und der Buben und Mädchen, für die diese Integrationsklasse eingerichtet worden war.
Einige Schüler und Schülerinnen der Klasse kommentierten eine Karikatur. Veröffentlicht in: »PÄDAGOGIK UND THERAPIE OHNE AUSSONDERUNG« (1989, S. 175 -177), herausgegeben vom Tiro1er Arbeitskreis für integrative Erziehung anläßlich des 5. Gesamtösterreichischen Symposiums "Schule ohne Aussonderung - Leben ohne Aussonderung" Reutte/Tirol, Mai 1989.
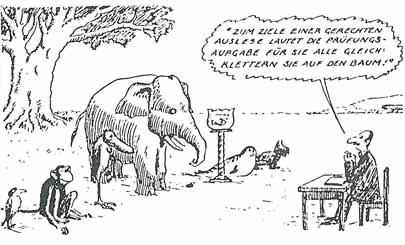
Kommentare von:
Silvia, Otto, Elsbeth, Angela, Horst, Martin, David und Roman
Klasse 1c, Volksschule Reutte
Der Elefant kommt nicht auf den Baum.
Der Vogel ist stolz, weil er rauffliegen kann.
Udo
Der Elefant kommt niemals auf den Baum.
Der Affe kann auf den Baumklettern.
Er lebt ja auf Bäumen.
Der Vogel kann rauffliegen.
Bernhard
Der Affe kommt hinauf.
Der Elefant kommt nicht leicht hinauf.
Der Vogel kommt am leichtsten hinauf.
Der Fisch kommt überhaupt nicht hinauf.
Der Hund kommt fast nicht hinauf.
Konrad
Für den Affen ist das Klettern leicht.
Der Elefant ist viel zu schwer. Da bricht der Baum nur zusammen.
Vogel: Ich fliege gleich hinauf
Robbe: Ich kann überhaupt nicht auf den Baum.
Hund: Wie soll ich da hinaufkommen?
Lehrer: Wollt ihr nicht alle das Klettern lernen?
Elefant: Aber wie soll denn ich da hinaufkommen? Ich bin so schwer.
''Dann machen wir etwas anderes'', sagt der Lehrer.
Judith
Der Mann stellt ihnen eine blöde Aufgabe.
Die Robbe kann sowieso nicht hinauf; sonst reißt sie sich die Flossen auf.
Beim Elefanten fällt der Baum um.
Der Vogel braucht gar nicht klettern. Er kann fliegen.
Der Fisch kann nicht aus dem Wasser, sonst wird er tot.
Sonst weiß ich eigentlich nichts mehr.
Markus
Der Fisch kann nicht klettern.
Der Elefant kann auch nicht klettern.
Der Lehrer weiß, daß manche Tiere nicht auf den Baum klettern können.
Er ist nur zu dem Affen nett.
Der Vogel kann ja fliegen.
Thomas
Der Fisch sagt: ''Ich kann nicht hinaufklettern. Ich brauche Wasser."
Der Elefant sagt: ''Ich kann es auch nicht. Wenn ich klettere, fällt der Baum um."
Der Affe sagt: ''Was geht leicht."
Der Seehund sagt: ''Ich rutsche dauernd ab."
Der Lehrer sagt: ''Dann gebe ich euch eine andere Aufgabe."
Veronika
Binnendifferenzierender offener Unterricht in seinen vielfältigen Formen ist eine unabdingbare Notwendigkeit, möchten wir Kinder mit so unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsam in einer Klasse unterrichten.
Dieser Unterricht muß dafür Platz haben, daß ein, zwei oder auch mehrere Kinder z.B. schreiben und drucken, während andere an anderen Dingen arbeiten.
Daß dieses »Konzept durchführbar ist, und im heute immer noch so starken Maß und traditionellen Sinn von Schule mit all ihren Leistungsanforderungen bestehen kann«, haben diese vier Jahre Schulversuch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es ist ein Konzept, das aus der Kritik der bestehenden Grundschule entstanden ist und versucht, neue wissenschaftliche Theorien von Unterricht, Lehrerverhalten, Sozialverhalten u.a.m. in eine für alle Schüler vorteilhafte Praxis umzusetzen.
Freie Arbeit und vor allem der Projektunterricht bieten schon Kindern in der Grundschule die Möglichkeit, ihre persönlichen Grenzen zu erfahren. In den verschiedensten kooperativen Arbeitsformen können sie ausprobieren, wie es ist, »allein Ziel und Prozeß bestimmen zu können, um einmal einschätzen zu lernen, was man alles ohne Lehrer - aber auch ohne Eltern und andere Erwachsene - in Erfahrung bringen kann« (SCHEEL, 1978, S. 98).
Schule in diesem Sinn zu verändern, bedeutete für die beiden Lehrer, nicht nur sehr viele Kompromisse einzugehen, sondern auch zahlreiche Zwänge, Normen und Forderungen sowohl der Schulhierarchie als auch einiger Eltern zu überwinden.
So waren für die beiden Lehrer zur Durchsetzung ihres Konzeptes gesicherte Kenntnisse der Rechtslage oder das Ausschöpfen pädagogischer Freiheit und die Auslegung des Lehrplanes wichtige Strategien, um vor allem unsachlichen Äußerungen von sogenannten "Fachkollegen" zu begegnen und damit eine Verunsicherung aller am Schulversuch Interessierten zu vermeiden.
Nachdem durch diese Unterrichtspraxis, besonders ab dem 3. Schuljahr, einige Eltern vor allem durch zwei Mütter verunsichert wurden, die die Forderung nach dem täglichen Diktat, der täglich vorgeschriebenen Hausübung, also nach abfragbarem Wissen erhoben, wurde von den Lehrern nicht nur große Diplomatie verlangt, sondern es wurden auch vermehrt inhaltliche Aussprachen und Diskussionen zum Unterricht erforderlich.
Daß immer mehr Eltern nichtbehinderter Kinder sich eine Schule und einen Unterricht nach dem Modell und der Unterrichtspraxis dieser Integrationsklasse wünschen, belegen jährlich steigende Zahlen von Elternanfragen bei der Schulleitung!
[17] Milani - Comparetti fordert vom Erwachsenen, daß er das Kind in all seinen Handlungen und Äußerungen genau zu beobachten, zu respektieren und ernst zu nehmen habe. "Es ist nicht der Erwachsene, der die Vorschläge macht, und das Kind hat irgendwie zu reagieren, sondern: Der Erwachsene muß auf die Vorschläge des Kindes reagieren und mit ihm. in einen Dialog treten. Dazu gehört, daß immer gegenseitige Mitteilungen ermöglicht werden müssen." (SCHÖLER, 1987, S. 337).
[18] So besteht u.a. eine große Diskrepanz zwischen einer entwicklungslogischen integrativen Pädagogik und den Bestimmungen zum Schulpflichtgesetz 1993, wo es in § 8 Abs. 1 heißt: "Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind die Bildungsaufgaben der der Behinderung entsprechenden Sonderschulart zu berücksichtigen", und im Schulorganisationsgesetz § 10 Abs. 4 ... "im übrigen findet der der Behinderung entsprechende Lehrplan der Sonderschule Anwendung".
[19] Kretschmanns Buch ist 1948 von Otto Haase neu unter dem Titel ''Natürlicher Unterricht" herausgegeben worden.
[20] Außerhalb der Klasse bestanden sowohl für die Kinder als auch für die Lehrer wenig Freiräume. So war es z.B. nicht möglich. Kinder allein und selbständig zum Kopieren zu schicken oder andere Räume der Schule für den Unterricht zu nützen. Auch die Vorgabe der stündlichen Schulglocke konnte nur innerhalb der Klasse verändert werden u.a.m.
[21] Haeberlin spricht in seinem Buch durchgängig nur von Schülern. Es ist zu vermuten, daß bei ihm, wie bei allen ähnlichen Untersuchungen über "Lernbehinderte" auch zu zwei Dritteln Schüler und zu einem Drittel Schülerinnen von "Schulschwächen" betroffen waren.
Inhaltsverzeichnis
Aus Gründen der Anonymität habe ich die in Kap. III/2.6.2.1, S. 88 angeführten Gutachten (schulpsychologische Stellungnahmen, Gutachten des Volks- und Sonderschullehrers, ärztliches Gutachten, meine persönlichen Beobachtungen, ...) im Folgenden zusammengefaßt.
Der Schüler M1 besuchte das erste Schuljahr 1987/88 die Allgemeine Sonderschule. Das größte Problem stellten zunächst seine überaus starken Konzentrationsstörungen dar. So wurde M1 von der Schulpsychologin anhand des Hamburg-Wechsler-Intelligenztests für Kinder (HAWIK) überprüft, und er erzielte sowohl im Untertest "Aufmerksamkeit" (Merkfähigkeit) als auch im ''Verständnis von praktischen Situationen" sowie im Bereich "rechnerisches Denken" (konzentrierte Tätigkeit und geistige Wendigkeit) extrem schwache Ergebnisse.
Beim Erfassen von Zusammenhängen im Bereich der visuellen Sensorik traten häufig Schwierigkeiten auf. Diese äußerten sich im Erkennen von Beziehungen im Raum (oben - unten, vorne - hinten ...) sowie im Erfassen gedrehter oder spiegelbildlicher Objekte. Diese Raumlagelabilität beeinträchtigte auch seine Leistungen im Lernprozeß des Lesens und Schreibens.
Zudem lagen vor allem auch auf dem Sektor der Sozialisation und des Verhaltens sehr große Schwierigkeiten vor. M1 suchte zwar den Kontakt zu seinen Mitschülern, wurde aber durch seine ständig auftretenden Verhaltensstörungen von seinen Mitschülern abgelehnt oder kaum akzeptiert. M1 fiel es besonders schwer, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, ohne dabei zu stören und die damit verbundenen Kontakte wieder abzubrechen. M1 versuchte häufig, allgemein anerkannte Gebote und Verbote zu umgehen. Auf damit verbundene Konfrontationen mit Lehrern und Mitschülern reagierte er mit Weinen, Schreien und Trotz.
Nach Aussage der Pflegemutter, bei der M1 nun schon seit über 4 Jahren lebt, seien alle Probleme aus den schwierigen familiären Verhältnissen im Kleinkindalter entstanden.
In der erzieherischen Tätigkeit kommt dem Abbau der Verhaltensstörung durch positive Verstärkung des erwünschten Verhaltens besondere Bedeutung zu. Zudem ist anzunehmen, daß durch die angestrebte soziale Integration auch die Konzentration deblockiert wird und sich somit die schulischen Leistungen verbessern werden.
Der Schüler M2, ein Kind türkischer Eltern, wurde ebenfalls im Schuljahr 1987/88 aufgrund allgemeiner Entwicklungsverzögerungen (im Alter von 5 Jahren noch keine Lautsprache) in die Allgemeine Sonderschule eingeschult.
M1 und M2 besuchten dieselbe Klasse in der Sonderschule. M2 wies bei der Aufnahme in die Integrationsklasse einen noch überaus großen, allgemeinen Entwicklungsrückstand gegenüber dem Durchschnitt der Klasse auf. So waren u.a. seine Ausdauer sowie seine Konzentration nur von sehr kurzer Dauer. Nach Aussage der Schulpsychologin können seine schulischen Schwierigkeiten aber sicher nur zum Teil mit mangelnden Sprachkenntnissen begründet werden, lagen doch seine Probleme nicht nur im schriftsprachlichen und im mathematischen Bereich, sondern vor allem in seinem sozialen Verhalten.
Da M2 um zwei Jahre älter als die meisten seiner Mitschüler war und er zudem körperlich fast alle übertraf, kam es auch dadurch immer wieder zu Auseinandersetzungen und zu Ablehnung.
Diese beiden zuvor beschriebenen Kinder M1 und M2 und SABINE hatten zum Zeitpunkt des Schulbeginns den Status der "offiziellen Behinderung". Für diese drei Kinder lagen die in Kap. III/2.6.2.1, S. 88 angegebenen Gutachten vor.
Kurz nach Schulbeginn des ersten Schuljahres aber stellte sich heraus, daß in der Klasse zwei weitere Kinder waren, die aufgrund ihrer sehr verlangsamten Entwicklung und einer MCD bzw. Teilleistungsschwäche ebenfalls einer gezielten individuellen "sonderpädagogischen" Förderung bedurften.
Diese zwei Kinder wurden in der Klasse aber als "offiziell nicht behindert" geführt und unterrichtet.
Zusätzlich waren in der Klasse noch zwei weitere Kinder, deren Eltern türkische Staatsbürger sind, und die doch auch aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse zunächst Verständigungsprobleme mit ihren Mitschülern und Lehrern zeigten.
Im Kapitel 2: "Planung und Einrichtung einer Integrationsklasse", habe ich versucht, den konkreten Anlaß und die schulorganisatorischen Bedingungen aufzuzeigen, die schließlich zur Einrichtung dieser Integrationsklasse führten.
In diesem Abschnitt meiner Arbeit möchte ich einerseits didaktisch-methodische Hinweise der Gehörlosenpädagogik aufzeigen, nach denen SABINE unterrichtet und schulisch gefördert wurde, und andererseits damit gleichzeitig versuchen zu erklären, wie ungeheuer wichtig die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern, Fachleuten u.a. ist, um eine derartig komplexe und schwierige Unterrichts- und Schulsituation für ein Kind auch verantwortungsvoll übernehmen zu können.
Andrea KINTRUP[22] schreibt in ihrer Einleitung im Rahmen einer Diplomarbeit zur 1. Staatsprüfung im Prüfungsfach "Gehörlosenpädagogik" an der Universität Hamburg mit dem Thema:
"Integration von gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Regelschulen mit Hilfe von lautsprachunterstützenden Gebärden, dargestellt am Beispiel eines gehörlosen Mädchens in Reutte"
''Der "Methodenstreit" der Integration gehörloser Schüler hat sich bis heute nicht geändert. Die meisten Gehörlosenpädagogen halten gehörlose Kinder für nicht integrierbar und die Beschulung in der Gehörlosenschule für unverzichtbar (vgl. Bund Deutscher Taubstummenlehrer (BDT), Positionspapier zur gemeinsamen Erziehung und Bildung hörbehinderter und nichtbehinderter Kinder in der Schule, 1990). Integration für gehörlose Schüler kann nur in Ausnahmefällen befürwortet werden, wenn das gehörlose Kind schon zum Zeitpunkt der Einschulung über genügend lautsprachliche und kommunikative Mittel verfügt, sodaß es problemlos dem Unterrichtsgeschehen folgen und mit den hörenden Mitschülern kommunizieren kann. I.d.R. verfügt ein gehörloser Schüler aber erst nach Abschluß der segregierten Beschulung über genügend sprachliche Fähigkeiten, um mit der hörenden Welt in Kontakt zu treten. Das bedeutet Integriert werden kann nur derjenige, der bereits zum Zeitpunkt der Einschulung die Voraussetzungen erfüllen kann, die unter »den Bedingungen der segregativen Erziehung als Ziel gehörlosenpädagogischer Förderung angesehen werden«. Selbst Befürworter der Integration gehen davon aus, daß für gehörlose Kinder eine Sonderbeschulung von Vorteil sei.
Demgegenüber stellt LÖWE (1991, S. 226 ff), einer der profiliertesten Gehörlosenpädagogen im deutschsprachigen Raum. fest, daß etwa 10% aller audiometrisch als gehörlos angesehenen Kinder in Regelschulen unterrichtet werden. Die integrierte Beschulung dieser Schüler stellt sich in der Praxis in drei unterschiedlichen Formen dar.
-
"Die teilweise Integrationsform, bei der Klassen gehörloser Kinder als sogenannte "Außenklassen" an Regelschulen untergebracht sind,
-
die volle Integrationsform, bei der gehörlose Schüler zeitweise oder ganz in Regelklassen integriert sind und
-
die präventive Integrationsform, bei der gleich starke Gruppen hörender und hörbehinderter Kinder gemeinsam an einer Sonderschule beschult werden."
Formen der teilweisen bzw. vollen Integration nach einem Stufenmodell von LÖWE (1974, S. 145):
Volle Integration
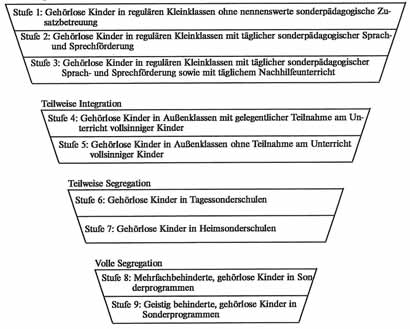
Am Ende ihrer Diplomarbeit schreibt Frau KINTRUP im Kapitel 10.6 »Stellungnahme zu meinem Einsatz«, Seite 93:
"Abschließend möchte ich meinen Einsatz in Reutte beurteilen.
Trotz anfänglicher Skepsis war ich sehr überrascht, wie positiv die Integration SABINEs bisher verlaufen ist. Dies konnte ich mir aufgrund meiner Vorabinformationen wirklich nicht vorstellen. Für mich war es beeindruckend zu sehen, wie SABINE und ihre Mitschüler miteinander umgehen, wie wohl sich SABINE in der Klasse fühlt und wie sie in der Klasse anerkannt und aufgenommen wird. SABINE hat aufgrund des Zusammenseins mit den nichtbehinderten Kindern die Möglichkeit, sich normal zu entwickeln. In Gehörlosenschulen ist mir sehr häufig aufgefallen, daß viele gehörlose Kinder aufgrund der dort vorhandenen Strukturen und Unterrichtsmethoden ein mir typisch erscheinendes Sozialverhalten entwickeln. Als Beispiel möchte ich hier nur die fehlende Kooperationsbereitschaft und übertriebene Ich-Bezogenheit nennen, die bei vielen gehörlosen Kindern sehr auffällig sind.
Solche behinderungsspezifischen Eigenschaften sind bei SABINE nicht zu erkennen.
Im Reuttener Integrationsversuch ist der ''Methodenstreit'' über die Erziehung gehörloser Kinder, der leider immer noch mit großer Heftigkeit und Ausschließlichkeit geführt wird, nicht aufgetreten. In diesem Versuch stehen SABINE und die Frage, wie sie am besten gefördert werden kann, im Mittelpunkt. Es zeigt sich, daß Integration auch auf einem anderen Weg als den über die Lautsprache möglich ist.
All dies wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn die Lehrer und die Eltern sich nicht so begeistert und mit so viel persönlichem Engagement für die Integrationsidee einsetzen würden. Ohne sie wäre die Idee wahrscheinlich aufgrund der schulorganisatorischen Probleme gescheitert."
Diese Aussagen von A. KINTRUP habe ich aus mehreren Gründen vorangestellt:
Es zeigt, in welch großem Spannungsfeld diese "volle" Integration von SABINE einerseits zwischen den Fachexperten und den Gehörlosenpädagogen stand und noch immer steht, und andererseits, unter welch großem Verantwortungsdruck sich dadurch neben der Mutter auch die beiden Lehrer befanden.
Es bestätigen sich aber auch die Anforderungen, die FEUSER (1987, S. 174 ff.) an die Lehrer stellt, die in integrativen Klassen arbeiten:
''Integrativer Unterricht verlangt letztlich im Sinne des Kompetenztransfers, ständig selbst neu zu lernen, seine Einstellungen und Haltungen zu revidieren, lieb und stabilisierend gewordene Rollen abzulegen und neue zu übernehmen und selbst die bisher Sicherheit und Stabilität, vor allem aber auch Anerkennung vermittelnde Praxis zugunsten einer neuen aufzugeben."
Damit Lehrer heute diese hohen Anforderungen, die an sie gestellt werden, aber auch erfüllen können, erfordert es ein hohes Maß an "Professionalität". Dies nicht nur bezogen auf ihr persönliches Wissen, sondern auch auf die unterschiedlichsten Ebenen pädagogischen Handelns. Damit verbunden ist eine Revision der Ausbildung und gleichzeitig der Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen zwingend erforderlich.
Anhand eines Auszugs einiger weniger Presseaussendungen und Leserbriefe möchte ich diesen, auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen "Methodenstreit" aufzeigen.
"Integration von Gehörlosen
MILS (ih). Zur vieldiskutierten Integration behinderter Kinder in Regelschulen nahmen gestern Vertreter der Landessonderschüler für gehörlose, schwerhörige und sprachgestörte Kinder in Mils Stellung.
Namens der Schule betonte Direktor W.S., daß eine Integration hochgradig schwerhöriger und gehörloser Kinder in eine allgemeine Schule in den meisten Fällen nicht sinnvoll sei, da die angestrebte spätere Integration in die hörende Umwelt nur erreicht werden könne, wenn die hörgeschädigten Kinder wissensmäßig nicht zu kurz kommen. Dr. A.S., der als Betreuungslehrer mit hörgeschädigten Kindern und deren Eltern und Lehrern in ganz Tirol arbeitet, meint dazu: "Es genügt eben nicht, wenn sich ein hörgeschädigtes Kind nur wohl fühlt in einer Regelschule. Die soziale Integration darf nicht auf Kosten der Aneignung des nötigen Wissens gehen, und es ist nun einmal eine Tatsache, daß die Wissensvermittlung bei Hörgeschädigten anders funktioniert als bei Gesunden."
Hörgeschädigte Kinder können sich Wissen nur durch das Lesen aneignen, und Lesen zu lernen ist nur durch eine entsprechende Frühförderung möglich. Die Vertreter der Milser Schule sind überzeugt davon, daß die Kinder ihrer Anstalt optimal auf einen Einstieg ins Berufsleben vorbereitet werden.
Derzeit werden in Mils 47 Kinder im Internat und 88 nur tagsüber betreut Mindestens alle 14 Tage fahren die Internatsschüler, die aus ganz Tirol, Vorarlberg und Südtirol kommen, über das Wochenende heim.
Für hörgeschädigte und sprachgestörte Kinder werden in Mils Kindergartengruppen, Volks- und Hauptschule, ein Polytechnischer Lehrgang und eine Klasse für mehrfachbehinderte Kinder geführt."
Tiroler Tageszeitung vom 29. Juni 1989
"Behinderte integrieren? - Die Antwort kann nicht nur "ja" heißen
Im Anschluß an die Jahrestagung des Katholischen Tiroler Lehrervereins am 13.11.1990 war in der Tagespresse zu lesen, daß sich die Lehrerschaft eingehend über das Für und Wider von Integration Behinderter an Volksschulen und Hauptschulen informieren kann.
Ich kann dem nicht beipflichten, denn von einem ''Wider'' habe ich während der ganzen Tagung nur andeutungsweise bei einem Arbeitskreis im Haus der Begegnung gehört. Da äußerte sich ein Integrationsteam (Klassenlehrerin und Stützlehrerin) beabsichtigt oder unbeabsichtigt einmal ganz offen und ehrlich: ''Wir haben ein Kind in der Klasse, mit dem wir nicht fertig werden. Wir wissen bald nicht mehr, was wir tun sollen!" Daraus wäre der Schluß zu ziehen, daß dieses Kind am falschen Platz ist - daß ihm die Integration nichts bringt. Es protestiert auf seine Weise dagegen. Ich habe den Eindruck, daß es diese zwei Kolleginnen aus Angst vor einer persönlichen Niederlage noch nicht gewagt haben, diesen Protest wahrzunehmen. Der Leidensweg des Kindes wird also noch auf unbestimmte Zeit weitergehen, bis es dann doch in eine Sonderschule kommt. Die Lehrer dort haben dann große Mühe, diesen deprimierten Schüler psychisch wieder aufzurichten und soweit zu bringen, daß er den Lehrstoff bewältigen kann. Den Fachleuten in der Sonderschule ist so etwas schon oft gelungen, sodaß ich für die Zukunft dieses Kindes doch optimistisch bin.
Was kann man daraus schließen? Man muß es kurz, aber eindringlich sagen: ''Behinderter ist nicht gleich Behinderter". Es folgt, daß man nicht alle Behinderten gleich behandeln und betreuen kann. Ich denke da an Kinder mit Wahrnehmungsschwächen. Sie haben meistens an einem im frühkindlichen Alter oder gar im Mutterleib erlittenen leichten Gehirnschäden zu leiden. Dieser wirkt sich so aus, daß alles, was über Sinne aufgenommen wird, nicht sofort in eine folgerichtige Reaktion umgesetzt werden kann. Dieses normal intelligente Kind erleidet in der Volksschule einen Mißerfolg um den anderen, es beginnt sich durch auffallendes Verhalten zu wehren und setzt sich dadurch einer Bestrafung aus, die es natürlich als ungerecht empfindet Die Spirale von Ursache und Wirkung dreht sich immer weiter nach unten, und für das an sich leicht behinderte Kind gibt es keine Rettung vor weiteren Erniedrigungen durch Lehrer, Mitschüler und Eltern. Die Volksschule ist hier total überfordert, denn durch den von ehrgeizigen Eltern hervorgerufenen Leistungsdruck kann der Lehrer einem Schüler mit Wahrnehmungsschwächen nie die Zeit geben. die er braucht, um seine Defizite aufzuholen.
Ein hochgradig schwerhöriges oder gehörloses Kind ist auch ein Behinderter. Welcher Außenstehende denkt schon daran, daß er hoch intelligent sein kann. Es ist also sicher der falsche Weg, wenn man so ein Kind in die Volksschule integriert, womöglich mit zwei geistig behinderten Schülern, nur um die nötige Zahl für einen Schulversuch zusammenzubringen. Das Ziel für einen Gehörlosen ist die Befähigung zum Erlernen eines Berufes, um sich voll in die Welt der Hörenden integrieren zu können. Er muß auch den Führerschein erwerben, eine Familie gründen und für sie eine Wohnung beschaffen können.
Dies alles gelingt ihm sicher nicht, wenn er in einer Integrationsklasse mit geistig Behinderten gleichgeschaltet wird.
Eltern von hochgradig hörgeschädigten Kindern haben eine bestimmt nicht leichte Entscheidung zu treffen. Sie können ihr Kind bei sich behalten und in den heimischen Kindergarten oder in die Volksschule integrieren, oder sie können es in die Spezialschule schicken. deren Lehrer sich durch ständige Fortbildung im ganzen deutschsprachigen Raum intensiv bemühen, die modernsten Methoden der Gehörlosenbildung kennen und anwenden zu lernen. Ein Psychologe, eine Ergotherapeutin, eine Physikotherapeutin und Logopädin arbeiten eng mit den Fachpädagogen zusammen.
Eines ist noch zu bedenken: Wenn ein gehörloses Kind ohne Kontakt zu anderen Gehörlosen aufwächst, dann wird es später fast sicher in eine völlige Vereinsamung gedrängt Die ständige Kommunikation mit Hörenden erfordert ununterbrochen höchste Konzentration, die dem Betroffenen nicht zuzumuten ist Er wird sich daher zurückziehen. Im Kreis der Gehörlosen findet er auch keinen Anschluß, denn er hat nie die Gelegenheit bekommen, die Gebärdensprache zu erlernen. Er kann sich also nie richtig aussprechen. Ich brauche wohl nicht näher zu erläutern, was das für einen intelligenten Menschen bedeutet.
Die Behauptung, daß alle Behinderten in die allgemeinen Pflichtschulen integriert werden können, bedeutet für einige Betroffene das Hineinführen in eine persönliche Katastrophe. Wir Sonderschullehrer arbeiten intensiv daran, um möglichst vielen dieses traurige Schicksal zu ersparen.
Es gibt immer noch Kinder, die aus verschiedenen Gründen in das Integrationsschema nicht hineinpassen. Für sie müssen weiterhin die Sonderschulen bestehen. Vielleicht hilft es den betroffenen Eltern, wenn der Begriff "Spezialschule" in die Diskussion gebracht wird."
W.S.
(Direktor der Landessonderschule Mils für gehörlose, schwerhörige und sprachgestörte Kinder)
Außerferner Nachrichten vom 9. Jänner 1991
"Integration gehörloser und hochgradig hörgeschädigter Kinder? -
Die Antwort kann nicht nur "nein" heißen
Entgegnung zu einem Beitrag von Direktor W.S. (Mi1s)
Kürzlich meldete sich Direktor W.S. (Direktor der Landessonderschule Mils für gehörlose, schwerhörige und sprachgestörte Kinder) in dieser Zeitung zur Frage der Integration Behinderter zu Wort und ging dabei ausführlich auf gehörlose und hochgradig schwerhörige Kinder ein.
Obwohl in dem Artikel keine Namen genannt werden, wird der Leser der Außerferner Nachrichten die Angaben auf Sabine R. beziehen, die seit drei Jahren eine Integrationsklasse der Reuttener Volksschule besucht. Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei zunächst darauf hingewiesen, daß Integrationsklassen üblicherweise 2 - 3 verschiedenartig behinderte Kinder aufnehmen, in Reutte sind es neben der gehörlosen Sabine zwei lern- und verhaltensauffällige Kinder. Wenn W.S. von einer sich für die Entwicklung des gehörlosen Kindes negativ auswirkenden Gleichschaltung mit geistig Behinderten (!) spricht, so suggeriert er nicht nur eine falsche Information, sonder offenbart zugleich absolute Unkenntnis über das Integrationskonzept, das eben nicht die behinderten Kinder zu einer Sondergruppe zusammenfaßt, sondern sie mit den 20 nichtbehinderten Kinder in wechselnden Lerngruppen und Lehrsituationen ihren Förderbedürfnissen, aber auch ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend variierend betreut. Wer unvorbereitet in die Klasse kommt, wird Schwierigkeiten haben, selbst das gehörlose Mädchen zu entdecken.
Als für die Ausbildung von Gehörlosenlehrern in ganz Norddeutschland zuständiger Hochsschullehrer stimme ich mit Herrn W.S. darin überein, daß gerade bei der Bildung und Erziehung gehörloser Kinder eine spezifische Fachkompetenz der am pädagogischen Prozeß Beteiligten von besonderer Bedeutung ist. Im Falle des Reuttener Integrationsprojektes wurde großer Wert darauf gelegt, daß neben übergreifenden Integrationspädagogischen Aspekten - bes. durch Frau Prof. J. Schöler (TU Berlin) - eben solche spezifisch gehörlosenpädagogischen Gesichtspunkte fester Bestandteil der pädagogischen und didaktischen Planung des Integrationsversuches waren. Von Beginn an wurde das Reuttener Integrationsprojekt von mir gehörlosenpädagogisch betreut, und ich war in diesem Zusammenhang jedes Schuljahr mehrere Male in Reutte, um den erreichten Entwicklungsstand bei Sabine zu überprüfen, offenbar werdende Probleme zu analysieren und das weitere pädagogisch-didaktische Vorgehen mit den Lehrern zu besprechen. Darüber wurde und wird weiter ausführlich in der führenden deutschsprachigen Fachzeitschrift berichtet. Trotz Schwierigkeiten wurden also im hohen und keineswegs üblichen Maße eine spezielle gehörlosenpädagogische Begleitung realisiert.
Was den derzeitigen Stand der Integrationsbemühungen um das gehörlose Mädchen anbetrifft. so können wir grundsätzlich mit dem erreichten Stand zufrieden sein, ohne Probleme etwa bezüglich der weiteren Sprachentfaltung zu ignorieren. Letzteres war kürzlich Gegenstand einer intensiven pädagogischen Konferenz mit den Lehrern und das Integrationsprojekt unterstützenden bzw. begleitenden Wissenschaftlern, bei der u.a. der Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden angeregt wurde.
Das Reuttener Integrationsprojekt kann in seinen Besonderheiten gewiß nicht das Modell für die Integration von gehörlosen Kindern schlechthin sein, ebenso gewiß aber zeigt sich, daß die Frage der Integration gehörloser Kinder nicht nur mit "nein" beantwortet werden kann. Wer daran zweifelt, möge doch zunächst einmal in der Reuttener Integrationsklasse hospitieren und nicht allein vom Schreibtisch aus argumentieren."
Prof. Dr. Klaus-B. Günther, Universität Hamburg
Außerferner Nachrichten vom 16. Jänner 1991
''Reaktionen auf meinen Leserbrief über die Integration von Behinderten in Normalschulen:
Noch einmal "Integration von Behinderten an Volks- und Hauptschulen"
Durch Zufall habe ich erfahren, daß mein Beitrag zur Integration Behinderter eine Reihe von Antwortschreiben in den "Außerferner Nachrichten" zur Folge hatte.
Nun glaube ich, daß ich mich noch einmal zu Wort melden sollte: Mit dem Beitrag der Volksschullehrerin Christine H. möchte ich mich nicht näher befassen, denn eine Auseinandersetzung auf derart aggressive und unsachliche Art kann den uns anvertrauten Schülern auf keinen Fall nützen.
Zu den Vorwürfen in den anderen Leserbriefen kann ich berichten, daß sich der Inhalt meines Artikels keineswegs speziell auf Sabine K bezieht. Ich meine alle hochgradig schwerhörigen oder gehörlosen Kinder, um die sich nicht Universitätsprofessoren bis hinauf nach Hamburg und Berlin kümmern können. Das ganze Geschehen um die kleine Sabine ist ein Versuch und als solcher eine Ausnahmesituation. Mir geht es vor allem um die Information von betroffenen Eltern, daß an unserer Schule immer noch Hörgeschädigte mit großem Erfolg gefördert werden.
Durch unsere intensive Arbeit fehlt uns leider die Zeit, ständig an die Öffentlichkeit zu treten. Natürlich gilt meine Befürchtung über eine spätere Vereinsamung Hörgeschädigter, die ohne Kontakt mit ''Leidensgenossen'' aufwachsen, auch für die Sabine. Ich habe mir diesen Umstand nicht selber ausgedacht Meine Kollegen und ich haben davon in zahlreichen Fachtagungen im ganzen deutschsprachigen Raum (auch von Eltern) gehört. Übrigens haben wir dort nie jemanden aus Reutte oder vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck gesehen. Mit der Fachliteratur ist es auch so eine Sache; es kommt darauf an, was ich mir zum Lesen aussuche. In unserer Lehrerbibliothek stehen Reihen von Büchern, aus denen wir die Kenntnisse für unsere Art der Förderung von Gehörlosen erworben haben.
Der Vorwurf: daß ich noch nie den Reuttener Integrationsversuch gesehen hätte, ist berechtigt. Zu meiner Entschuldigung muß ich ausführen, daß ich gegen Ende des letzten Schuljahres einer Einladung folgen wollte, aber kurz vor dem Termin wieder ausgeladen wurde. Umgekehrt habe ich die Kollegen aus Reutte umsonst nach Mils eingeladen. Bei uns hätten sie Gelegenheit für einen interessanten Vergleich: Wir glauben, daß die Kinder, die zur gleichen Zeit wie Sabine eingeschult sind, ganz ausgezeichnete Fortschritte gemacht haben. Sie werden in der für uns modernsten Methode der Sprachausbildung unterrichtet Alle Besucher staunen über die Kenntnisse und das Sprachvermögen der Kinder und über deren Art des Umganges miteinander und mit Außenstehenden.
Im übrigen haben wir in Mils immer schon gewußt, daß Kinder sehr unterschiedlich in ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen für das ''Lernen'' sind Der differenzierte Unterricht ist bei uns selbstverständlich, kein Kind wird zum ''Versager'' gestempelt Jeder einzelne Mitarbeiter ist mit einem Höchstmaß an Einfühlungsvermögen in die Welt des behinderten Kindes und in die Gedankengänge der besorgten Eltern ausgestattet. Anders könnte er seiner verantwortungsvollen Aufgabe nicht nachkommen.
Noch eine Richtigstellung scheint mir wichtig zu sein: Ich habe den Inhalt der Jahrestagung des Katholischen Lehrervereins überhaupt nicht kritisiert Die Veranstaltung war auch für mich sehr informativ, ich habe sie mit Interesse verfolgt Angekreidet habe ich die einseitige und irreführende Berichterstattung danach. Natürlich ist es für meine Kollegen und mich frustrierend, immer wieder als Sündenböcke für "Aussonderung" und ''Diskriminierung'' abgestempelt zu werden. Die Erfolge unserer ehemaligen Schüler im Berufsleben und die Reaktionen der zufriedenen Eltern sind nämlich ganz andere Rückmeldungen auf unsere Arbeit Eine objektive und weniger aggressive Ausdrucksweise uns Lehrer an Sonderschulen gegenüber wäre für alle wünschenswert. Dazu gehört auch die Behauptung von Frau Prof. Jutta Schöler, die Mitarbeiter der Spezialschulen würden sich in einem Schonraum bewegen. Es kann doch niemand ernsthaft glauben, daß die Arbeit in einer Klasse mit Gehörlosen oder mit Schwerstbehinderten (Schülerhöchstzahl 8) weniger Mühe macht wie die Tätigkeit eines Stützlehrers in einer integrativen Klasse. Hier müßte schon ein gewaltiger Informationsmangel vorhanden sein.
Zum Schluß möchte ich die Wichtigkeit der Integration von Kindern mit Behinderungen in Normalschulklassen besonders hervorheben. Ich bleibe aber bei meiner Behauptung, daß die Integration ihre Grenzen hat und daher auch Sonderschulen weiter bestehen müssen. Ich bitte mit Nachdruck um objektive Beratung der Eltern, denn sie tragen oft schwer an den übergroßen Sorgen um ihre Kinder.
Noch eine Anmerkung: Einer unserer vielen Beiträge zur Integration ist, daß momentan eine Kollegin aus unserer Schule wöchentlich nach Reutte fährt, um die Lehrer der Sabine K. zu beraten."
W.S. (Direktor der Landes-Sonderschule für gehörlose, schwerhörige und sprachgestörte Kinder in Mils)
Außerferner Nachrichten vom 27. Februar 1991
In einer derartig komplexen und vielschichtigen "Problematik einer echten Integration" ist die vertrauens-, aber auch verantwortungsvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Fachleuten bzw. anderen Personen eine unabdingbare Voraussetzung für ein positives Gelingen des Integrationsprozesses.
DIE KLASSENKONFERENZ, ein Artikel, den Frau Prof. J. SCHÖLER, (unveröff. MS., 1990) im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit um SABINE verfaßte, verdeutlicht das wichtige Prinzip des KOMPETENZ-TRANSFERS (die verschiedenen fachlichen Qualifikationen aller Mitarbeiter müssen untereinander ausgetauscht und wechselseitig angeeignet als solche weiterentwickelt werden).
"Die Klassenkonferenz:
Alle in einer Klasse unterrichtenden Lehrerinnen treffen sich mit der Mutter eines Kindes und holen auch "Experten" von außerhalb der Schule für dieses Gespräch hinzu. Aus welchem Grund wird in Schulen ein solcher besonderer Termin normalerweise angesetzt?
-
Welche besonderen Probleme gibt es?
-
Was hat das Kind angestellt?
-
Soll es sitzenbleiben?
Bestrafungen, oft Aussonderungen aus der gewohnten Gruppe der anderen Kinder werden meistens verhandelt bei solchen Konferenzen. Sabine ist ein Kind, dem es in dieser Beziehung besser geht als den meisten SchülerInnen. Ihretwegen wird eine Klassenkonferenz von ca. zwei Stunden durchgeführt, um gemeinsam mit allen Beteiligten zu besprechen, was noch getan und bedacht werden müßte, um ihre Integration in die Gemeinschaft der ''Normalen'' zu verbessern und um zugleich die Akzeptanz ihres Andersseins nicht zu gefährden. Die Erwachsenen tauschen ihre Erfahrungen mit Sabine aus. Es ist erstaunlich, wie sehr die anderen Kinder mit ihren natürlichen, die Lautsprache begleitenden Gebärden, Sabine immer wieder in jedes Gespräch einbeziehen. Demnächst soll versucht werden, diese Gebärdensprache allen ein wenig mehr bewußtzumachen. Klaus Günther wird deshalb ein Videoband zur Verfügung stellen, mit dem die LehrerInnen die wichtigsten Grundformen erlernen können.
Die ganze Klasse könnte sich mit dem "Maulwurf Grabowski" beschäftigen.
Dieses beliebte Kinderbuch gibt es als Videofilm mit Gebärdensprache.
Ein weiterer Punkt der Besprechung in der Klassenkonferenz ist die Frage, wie es Sabine ermöglicht werden kann, auch am Nachmittag mit anderen Kindern zu spielen. Es erweist sich immer wieder als großer Nachteil daß sie nicht im selben Dorf wohnt wie die anderen Kinder ihrer Klasse. Wenn sie den gemeinsamen Schulweg mit ihren MitschülerInnen hätte und nicht erst mit dem Schulbus fahren müßte, wäre alles viel einfacher. Außerdem ist sie am Nachmittag oft mit Einzeltherapien oder Einzelunterricht zeitlich festgelegt. Die Kinder ihrer Nachbarschaft haben nicht so gut wie die Kinder ihrer Klasse gelernt, sie zu verstehen. Und: Sabines Mutter hat kein Auto und wegen ihrer Berufstätigkeit auch wenig Zeit, um ihre Tochter zu den anderen Kindern zu bringen. Sie ist auch zu bescheiden, um es von anderen Müttern anzunehmen, daß sie Sabine hin- und herfahren.
Was ist also zu tun? Die Runde der "Experten" ist ziemlich mutlos bei diesem Problem, das der Mutter derzeit als das schwierigste erscheint: Jeden Nachmittag, jedes Wochenende drängelt Sabine. Ihre Mutter sagt "Kinder - Kinder! Sie will immer nur zu den anderen Kindern. Sie wird ganz aggressiv mit mir, wenn sie nicht zu den anderen Kindern kann. Aber ich habe einfach nicht die Zeit Von der Oma kann ich das auch nicht erwarten. Sie ist schon zu alt. Und von den anderen Leuten kann ich es nicht annehmen. Die haben doch auch ihre Arbeit und ihre Sorgen - und ich könnte mich dann mit nichts bedanken. Es sind sowieso schon alle immer so freundlich zu mir."
Im gemeinsamen Nachdenken werden dann doch zwei Lösungsmöglichkeiten gefunden:
-
Im Dorf, in dem Sabine wohnt, wird einmal pro Woche eine Turngruppe für "Mutter und Kind" angeboten. Dorthin wird Sabines Mutter mit ihrer Tochter gehen und im Gespräch mit den anderen Müttern nach Möglichkeiten suchen, wie die Kinder auch alleine Kontakte miteinander knüpfen können.
-
B.D., die Sonderschullehrerin, die zweimal pro Woche mit Sabine nachmittags arbeitet, hat zum Schluß noch eine Idee, die alle Beteiligten begeistert. Ihr fällt ein: "Die Ulli, eine Kollegin aus unserer Schule, hat gerade ihre Prüfung als Reitlehrerin bestanden. Sie beabsichtigt, eine Kindergruppe zu gründen. Ich werde mal mit ihr sprechen, ob sie das nicht hier im Dorf machen kann." Sabines Mutter weiß, auf welchem Bauernhof in der Nähe mehrere Ponies stehen, mit denen das sicherlich möglich ist. Sie wird mit dem Besitzer, einem entfernten Verwandten, sprechen. Drei Wochen später ist die Reitgruppe eingerichtet.
Nicht immer wird eine solche Klassenkonferenz so gute und schnelle Lösungen finden können, aber ohne diese Konferenz wären für Sabine zwei wichtige Entwicklungschancen auch nicht gefunden worden.
Wer jetzt in Gedanken durchrechnet, wie viel Arbeitszeit von LehrerInnen notwendig wäre, wenn für alle Kinder einer Klasse regelmäßig solche Konferenzen durchgeführt würden, wird resignierend abwinken: "Das ist viel zu aufwendig!"
Wer sich überlegt, mit welcher großen inneren Zufriedenheit die beteiligten Erwachsenen aus dieser einen Besprechung wegen Sabine herausgehen konnten, wird verstehen, daß diese Zeit nicht als verlorene Zeit verstanden wird. Andererseits: Wieviele LehrerInnen leiden darunter, daß sie wissen. ihre Zeit geht verloren. wenn sie in "Krisenkonferenzen" ein Kind letztlich nur bestrafen können. Der Faktor "Zeit" hat in der Pädagogik mit Sicherheit eine ganz andere Bedeutung als in der Wirtschaft. Bevorzugt sind die Pädagoglnnen, die ihre Zeit so verwenden können, daß sie tatsächlich mit Kindern und Eltern zusammenarbeiten und nach Lösungen suchen können. Diese LehrerInnen erhalten dadurch ihre berufliche Befriedigung, daß alle Beteiligten sich auf die Begegnungen und ein neues Zusammensein freuen können.
Kinder mit Behinderungen zwischen Medizin und Pädagogik
Die ersten Experten. mit denen eine werdende Mutter und ein werdender Vater über ihr Kind reden, sind Ärzte und Ärztinnen. Die zahlreichen Termine während der Schwangerschaft, die eine verantwortungsbewußte Mutter wahrnimmt, gelten weniger ihrer eigenen Gesundheit als der bangen Frage: ''Ist das Kind gesund?" Die Medizin hat in den vergangenen Jahren viel getan, um Beeinträchtigungen während der Schwangerschaft frühzeitig zu erkennen. In ihren positiven Anteilen kann sie durch vorbeugende Maßnahmen erreichen, daß das Kind gesund zur Welt kommt. Höchst problematisch wird der Beitrag der Medizin bei der Begleitung der Eltern auf ein erwartetes neues Leben, wenn das Ergebnis einer Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung die einzelne Mutter und den einzelnen Vater vor die Entscheidung stellt ''Trauen wir es uns zu, ein Leben mit einem behinderten Kind zu führen?", "Muten wir in dieser Gesellschaft einem Kind mit einer Behinderung das Leben zu?", "Muten wir dem noch ungeborenen Kind zu, in einer Gesellschaft zu leben. die so viel Geld ausgibt, um das einzelne behinderte Leben zu vermeiden und die so wenig Geld ausgibt, um ein Leben mit Menschen, die behindert sind, lebenswert und für alle akzeptabel zu gestalten?" Die meisten Eltern. die eine solche Untersuchung während der Schwangerschaft haben durchführen lassen, erwarten das neue Leben mit der beruhigenden Gewißheit ''Wir haben alles Notwendige getan; unser Kind wird gesund sein."
Sabine war ein gesundes, rosiges Kind. Als ihre Mutter sie aus der Klinik mit nach Hause nahm, fehlte ihr offensichtlich nichts. Nur der Mutter fehlte die Unterstützung eines Partners. In den ersten Wochen und Monaten entwickelte sich dieses Kind genauso wie die meisten anderen Kinder. Als Sabine etwa sechs Monate alt war, begann ihre Mutter unruhig zu werden. Ihr war an einem Tag aufgefallen, daß sich das Baby überhaupt nicht bewegte, als hinter ihm eine Tür zuknallte. Die Mutter beobachtete genauer, verglich Sabine mit anderen Kindern, sprach mit ihrer Freundin über ihre Beobachtungen und ging schließlich zum Kinderarzt. Der beruhigte sie zunächst: Bei so kleinen Kindern könne man eine Schwerhörigkeit noch nicht eindeutig feststellen. Sie solle in zwei bis drei Monaten noch einmal kommen. Bei der nächsten Untersuchung machte der Arzt ein bedenkliches Gesicht Es wäre wohl doch besser, zur eindeutigen Abklärung in die Klinik nach Innsbruck zu fahren. Eine Fahrt von ihrem Wohnort nach Innsbruck, das bedeutete mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine ganze Tagestour und wäre nur dann zu bewältigen, wenn sich die Ärzte mit dem Untersuchungstermin nach den Fahrplänen der Bahn richten würden. Sabines Mutter mußte jemanden bitten. sie mit dem Auto nach Innsbruck zu fahren. Sabines Mutter fährt nicht gerne Auto; hinzu kommt, daß sie nicht immer wieder andere Menschen um etwas bitten möchte, wofür sie sich dann zu Dank verpflichtet fühlt.
Warum hat ein so großes Krankenhaus wie das in Innsbruck in einem mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erschlossenen großen Einzugsgebiet keine Abteilung, in der Mütter mit ihren Kindern für zwei bis drei Tage wohnen können, wenn wichtige Untersuchungen notwendig sind?
Als Sabine etwa zwölf Monate alt war, wurde es ihrer Mutter in Innsbruck gesagt "Ihr Kind ist taub!"
Alle Untersuchungen hatten dies eindeutig ergeben: Aus medizinischer Sicht ist Sabine ein Kind, das nichts hört!
Keine Operation, keine Medizin wird da helfen können. "Sie müssen sich damit anbinden: Ihr Kind ist taub!" "Aber irgend etwas muß man doch tun? Sie können mich mit dem Kind doch nicht ohne jegliche Hilfe lassen! - Wird das Kind sprechen lernen?"
"Sie müßten regelmäßig, mindestens dreimal pro Woche, nach Innsbruck kommen. Hier arbeiten wir mit LogopädInnen zusammen, die bei sehr guter Beteiligung von Mutter und Kind schon Erstaunliches erreicht haben!"
Die Mutter hat nicht die Möglichkeit, dreimal pro Woche nach Innsbruck zu fahren. Sie konnte ihre Arbeit nicht aufgeben. Wovon hätten sie und ihr Kind leben sollen? Niemand hat sich dafür engagiert, daß eine Logopädin zum Kind kam. So blieb Sabine ohne logopädische Betreuung und lernte nicht sprechen.
Jahre später machten die Mediziner und die SonderpädagogInnen der Mutter den Vorwurf, sie hätte nicht genug getan, um ihrem Kind die notwendige Frühförderung zu ermöglichen.
Sabine sollte dann in die Vorschulklasse der Sonderschule. Ihre Mutter gab den Beruf auf, verschuldete sich, suchte eine kleine Wohnung in Innsbruck, arbeitete als Putzfrau. Das alles nur, um dem fünfjährigen Kind das Internat zu ersparen und weil sie als Mutter ihr Kind nicht hergeben wollte.
Auch das wurde ihr von den Spezialisten in der Klinik: und in der Sonderschule zum Vorwurf gemacht. Die Mutter eines behinderten Kindes müßte jederzeit bereit sein, ihr Kind abzugeben - an die Mediziner, an eine Institution, die sie nicht durchschaut; an einen Terminplan, nach dem sich ihr ganzes Leben richten soll. Was das alles für das alltägliche Leben einer Mutter, einer Familie bedeutet, interessiert die Mediziner häufig nicht, oder sie sind selbst ohnmächtig gegenüber den Zwängen einer großen Institution.
Mit großen Mühen und vielen Umwegen gelang es dann ein Jahr später, eine Integrationsklasse für Sabine in der Nähe ihres Wohnortes einzurichten (vgl. Schöler, 1990).
Zwei Jahre lang entwickelte sich Sabine in dieser Klasse sehr gut. Jetzt war es auch gelungen, über die örtliche "Lebenshilfe" eine Logopädin fest anzustellen, die Sabine und andere Kinder mit Sprachschwierigkeiten begleitet.
Die soziale und leistungsmäßige Entwicklung von Sabine erfreute alle Beteiligten - ganz besonders die beiden Lehrer und die Mutter.
Im Sommer 1990, kurz vor dem Ende der 2. Klasse, wurde Sabines Mutter von der Klinik: in Innsbruck darüber informiert, mit Sabine zu einer Untersuchung zu kommen. Es gäbe eine ganz neue Operation. Es soll festgestellt werden, ob für Sabine ein "Cochlear"-Implantat in Frage käme. Es könne sein, daß Sabine nach dieser Operation hören kann.
Zum erstenmal erfahren Sabines Mutter und danach auch die beteiligten Lehrer von der Möglichkeit eines "Cochlear"-Implantates. Es wird von den Medizinern erklärt:
-
"Die Cochlea ist die Schnecke, der innerste Teil des Ohres. In ihr liegen die Haarzellen (Sinneszellen) und die reizaufnehmenden und reizweiterleitenden Endungen der Hörnerven. Ein Cochlea-Implantat kann elektrische Reize zu den Hörnerven führen und so ein Hören ermöglichen." ...
Wie ergeht es einer Mutter, einem Vater, einem nahen Angehörigen oder Freund einer Familie, in der ein Mensch mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit lebt, wenn eine Information über eine neue medizinische Behandlungsmethode veröffentlich wird?
Es ist sehr menschlich, daß die große Hoffnung auf Heilung - auf die Umkehr der Diagnose: Behinderung - jedesmal wieder neu auflebt Wie viele Betroffene haben an sich selbst neue Medikamente erprobt, sich den oft jahrelangen Prozeduren verschiedener Therapien ausgesetzt oder sind von einem Fachmann zum anderen - oft in andere Länder - gereist, mit dem Ziel, endlich ein "normaler" Mensch zu werden, als Eltern mit einem "normalen" Kind zu leben!
Als Außenstehende sind die Spezialisten nicht berechtigt, darüber zu urteilen, welche Balance von ''Normalität'' eine betroffene Familie leben kann.
Wir können nur raten, begleiten, informieren - müssen aber die Entscheidung der Betroffenen respektieren. Für eine Familie, die ihre Balance darin gefunden hat, mit einem Familienmitglied zu leben, das behindert ist, kann es die Umkehr aller Normalität bedeuten, wenn das Kind mit der Behinderung hinausgeht in ein "normales" Leben. Andererseits kann die ständige Suche nach einer Operation, einer Therapie, einer Medizin auch bedeuten, den Menschen mit der Behinderung letztlich in seinem So-Sein nicht zu respektieren, ihm ständig zu vermitteln: ''Wir müssen dich erst reparieren, therapieren, medikamentös behandeln, damit Du anders wirst."
Sabine ist ein gesundes, fröhliches Kind. Sie hat gelernt, mit den ihr vertrauten Menschen so zu kommunizieren, daß sie verstanden wird und daß sie versteht. Ihre Taubheit ist ihre Normalität.
Anders müßten wir nachdenken, wenn sie aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalles ertaubt wäre. Andere Sorgen haben die Eltern, die über Therapien und Medikamente·nachdenken müssen, um dem Kind Schmerzen zu lindern oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu vermeiden.
Sabine ist von Geburt an taub. Und trotzdem ist sie berechtigt, auf eine Veränderung zu hoffen, die es ihr ermöglicht, die Welt auch über dieses wichtige Sinnesorgan zu erfassen: Das Gehör!
Mit der Nachricht über diese neue Operationsmethode brachen für Sabines Mutter alle Unsicherheiten wieder auf; sie hatte viele konkrete Fragen:
-
Wie groß sind die Chancen, daß Sabine tatsächlich hören kann?
-
Wie lange muß sie im Krankenhaus bleiben?
-
Wie oft muß sie vorher und nachher nach Innsbruck fahren?
-
Wird sie als Mutter während des Krankenhausaufenthaltes bei ihrer Tochter bleiben dürfen und wenn ja:
-
Wie soll sie das finanzieren?
-
Reicht dafür ihr Jahresurlaub oder riskiert sie ihren Arbeitsplatz?
-
Kann die Operation eventuell Nebenwirkungen haben?
-
Was verändert sich für die Schule, wird sie den versäumten Unterrichtsstoff nachholen können?
-
Was verändert sich für die Therapie; muß sie dann noch öfter als bisher Logopädietermine wahrnehmen?
-
Kann es sein, daß Sabine über die ungewohnten Geräusche erschrickt und sich das Gerät aus dem Ohr reißen will - so wie sie auch die Hörgeräte nie tragen wollte?
-
Welche Erfahrungen gibt es bei anderen Kindern?
-
Wenn das alles nichts nützt mit der Operation, welche Vorwürfe wird Sabine ihrer Mutter einmal machen?
-
Wenn sie die Operation jetzt nicht machen läßt, welche Vorwürfe wird Sabine ihrer Mutter dann machen?
Im Telefongespräch, das ich im Sommer 1990 mit Sabines Mutter führte, wurden alle Sorgen und Unsicherheiten deutlich, die viele Eltern haben, wenn sie für ihre Kind eine Entscheidung fällen müssen, die medizinische Kenntnisse erfordert. Ich bot Sabines Mutter an, bei meinem nächsten vorgesehenen Besuch in Reutte mit ihr in die Klinik zu fahren und mit ihr gemeinsam das Gespräch mit den Psychologen und wenn möglich den Medizinern der Klinik zu führen.
Außerdem bat ich meinen Kollegen Klaus-B. Günther, mir die neueste Fachliteratur zum Cochlea-Implantat zur Verfügung zu stellen. (Vgl. Bertram/Battner, Lehnhardt und die Broschüre des Deutschen Schwerhörigenbundes) Zur Vorbereitung meines Besuches in Tirol nahm ich außerdem Kontakt auf mit der Mutter eines ca. 16jährigen Mädchens aus Kärnten. Ich wußte, daß dieses ebenfalls seit der Geburt taube Mädchen mit großem Erfolg integrativ beschult worden war - allerdings (im Gegensatz zur Situation von Sabine) hatte dieses Mädchen bis zum Beginn der Schulzeit Sprechen gelernt. Vor zwei Jahren war bei diesem (damals) 14jährigen Mädchen die Cochlea-Operation durchgeführt worden. Das Telefongespräch ergab eine niederschmetternde Information. Aufgrund eines Operationsfehlers war ein Gesichtsnerv zerstört worden. Das Mädchen ist auf einer Gesichtshälfte seitdem gelähmt. Außerdem: "Das Mädchen hatte zwei Jahre lang alle notwendigen Übungen mit großer Ausdauer und Energie durchgeführt. Ihre Fähigkeiten, zu sprechen und zu hören, hätten sich jedoch nur ganz geringfügig verbessert. Der geringe Erfolg hat den riesigen Aufwand nicht gerechtfertigt." So lautete die Aussage einer Familienangehörigen.
Für das Gespräch wegen Sabine hatte sich der Psychologe der zuständigen Klinikabteilung viel Zeit genommen, um auf die Fragen von Sabines Mutter, von Sabines Lehrer, von dem Sonderpädagogen Klaus-B. Günther und auf meine Fragen zu antworten. Es war offentsichtlich, daß die Mediziner der Klinik es dem Psychologen überlassen hatten, diese Vorbereitungsgespräche zu führen.
In dem Gespräch wurde mir schnell deutlich: für die Mediziner ist Sabine "ein interessanter Fall". "Für den Erfolg einer solchen Operation ist wegen der anschließenden langwierigen Therapie ein hochmotiviertes und intelligentes Kind notwendig." Alle Voruntersuchungen haben ergeben, daß Sabine tatsächlich über keine Hörreste verfügt, aber: Über alle anderen Kanäle bekommt sie ungeheuer viel mit!
Bisher gibt es in Innsbruck keine Erfahrungen mit Kindern, die von Geburt an taub sind. Klaus-B. Günther verweist darauf, daß an anderen Universitäten, so
z.B. in Hannover, solche Operationen prinzipiell nur bei ertaubten Menschen durchgeführt werden.
Und die Antworten zu den konkreten Fragen?
-
Als Klinikaufenthalt kann man mit einem Zeitraum zwischen 4 und 20 Tagen rechnen.
-
Die anschließenden therapeutischen Übungen sollten möglichst täglich für mindestens eine Stunde durchgeführt werden. Es ist allerdings noch nicht geklärt, ob die Krankenkasse diese Nachsorge voll finanziert und vor allem, ob dafür dann in Südtirol tatsächlich eine Fachkraft zur Verfügung steht. Es bleibt im Raum stehen, ob nach einer gewissen Zeit wieder der Druck entsteht, sich für einen Aufenthalt in Innsbruck entscheiden zu müssen oder den Erfolg der Operation deshalb in Frage stellen zu müssen, weil die Therapien nicht regelmäßig durchgeführt werden können.
-
Eine entscheidende Frage für mich war es, warum gerade jetzt ein solcher Zeitdruck gemacht wird. Für Sabine ist derzeit nichts anderes wichtiger als der regelmäßige Kontakt zu den anderen Kindern. Hat eine solche Operation nicht Zeit bis sie 14 oder 16 Jahre alt ist, wenn sie sich selbst an der Entscheidung mehr beteiligen kann und wenn sie auch z.T. alleine nach Innsbruck fahren könnte?
-
Kann man für diese Operationstechnik in den nächsten Jahren nicht auch Erleichterungen und Verbesserungen erwarten? Der Psychologe antwortet mir auf diese Frage: "Das Gehirn ist für die neuen Reize jetzt noch eher aktivierbar. In welchem Maße das allerdings für ein achtjähriges Kind gilt, dafür haben wir keine Beweise. Außerdem: Wenn sich die Technik weiter entwickelt, dann kann diese jederzeit neu angepaßt werden, und: Jetzt ist sicher, daß die Krankenkasse die unmittelbaren Kosten bezahlt, ob dies in einigen Jahren noch der Fall ist, wissen wir nicht!"
-
Auf die Frage, ob Sabines Mutter während der Zeit des Krankenhausaufenthaltes auch in der Klinik bleiben kann oder ob über das Forschungsprojekt, das zwei Professoren in diesem Bereich durchführen, eventuell die Finanzierung eines Aufenthaltes in einer Pension in Innsbruck geregelt werden könne, reagiert der Psychologe sehr abwehrend: Er lasse es sich nicht einreden, daß ein Kind in diesem Alter durch wenige Tage Krankenhausaufenthalt hospitalisiert werde. So viel Vertrauen müsse eine Mutter schon haben und ihr Kind dem Klinikpersonal überlassen. Auf meinen Einwand, daß schon ein normal hörender Erwachsener erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten habe, sich der anonymen Institution Krankenhaus zu überlassen und daß es doch unweigerlich immer wieder Wartezeiten gäbe, die überbrückt werden müssen, in denen für ein Kind die Anwesenheit eines vertrauten Menschen notwendig sei, reagiert er wiederum mit Abwehr. In diesem Augenblick wird mir klar: Hier steht die Institution eines großen Krankenhauses gegen die möglichen Ängste eines einzelnen Kindes und gegen die Ängste einer Mutter. Von diesem Augenblick an wird mir deutlich, daß ich nicht mehr sachlich argumentieren kann und anfange, mich als Mutter zu wehren. Mein eigenes Kind würde ich nicht in diesen Apparat gehen lassen. Und ich erinnere mich, wie wichtig es für mich und meine Tochter war, als ich nach einer kleinen Handoperation bei ihr sein konnte, als sie aus der Narkose erwachte.
-
Sabines Klassenlehrer fragte noch einmal nach: "Wieviel Zeit verliert Sabine durch die Operation und die Therapien, und welcher Gewinn ist ihr sicher?"
-
Und die Antwort
-
"Sie verliert einige Tage und danach über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren etwa eine Stunde pro Tag. Aber was bedeutet diese Zeit gegenüber einem möglichen Gewinn für ein ganzes Leben? Außer den äußerst unwahrscheinlichen Folgen aus dem sehr geringen Operationsrisiko hat Sabine nichts zu verlieren. Wir können allerdings nicht sagen, was sie konkret gewinnen wird. Sie wird z.B. nach den bisherigen Erfahrungen nicht telefonieren können. Aber sie wird Geräusche hören, z.B. das Klingeln eines Telefons oder das Zuschlagen einer Tür."
Nach einem anstrengenden, insgesamt dreistündigen Gespräch verließen wir - Sabines Klassenlehrer, Klaus-B. Günther, Sabines Mutter und ich die Medizinische Hochschule Innsbruck. Wir Experten hatten Sabines Mutter nur begleitet; durch unsere Fragen erreicht, daß Antworten so klar und so ausführlich gegeben wurden, daß auch Sabines Mutter sie verstehen konnte. Die Entscheidung kann nur sie allein fällen: Soll die Operation durchgeführt werden? Auf der langen Autofahrt von Innsbruck zurück nach Reutte schweigen wir alle - lange. Erst eine Stunde später beim gemeinsamen Abendessen spricht Sabines Mutter über ihre Entscheidung: "Ich laß die Sabine so leben, wie sie ist. Es geht jetzt alles so gut, mit der Schule und so. Sabine ist glücklich, daß sie jeden Tag zu den anderen Kindern gehen kann. Ich denke, noch dieses eine Jahr soll man uns mal in Ruhe leben lassen, dann fangen schon wieder die Sorgen an. wie es mit der Oberschule weitergeht. Ich müßte wieder Schulden machen, um mir in Innsbruck ein Zimmer zu nehmen. Ich würde meinen Arbeitsplatz verlieren. Ich habe mich jetzt entschieden. Und ich bin richtig erleichtert, daß ich diese Entscheidung getroffen habe: Ich laß die Sabine so leben, wie sie ist" "
Da die Gehörlosenpädagogik ein überaus weites und fachspezifisches Thema darstellt, möchte ich im folgenden Teil dieses Kapitels zunächst einige von GÜNTHER zusammenfassende wissenschaftliche Begleituntersuchungen, Ergebnisse und Erfahrungen aus dem gemeinsamen Unterricht mit SABINE, als einzigem nichthörenden Mädchen in einer Regelschulklasse, darlegen.
Es erscheint mir dies auch deshalb sinnvoll, da es darum geht, die Entwicklung von SABINE nach 4 Jahren integrativer Beschulung aus der Sicht des begleitenden Gehörlosenpädagogen darzustellen.
In der Zeitschrift »HÖRGESCHÄDIGTENPÄDAGOGIK« 2/1990, S. 105 - 115, wurde folgender Artikel von K-B. GÜNTHER veröffentlicht:
"Erläuterungen zum Sprachentwicklungskonzept für ein nichtsprechendes gehörloses Mädchen und seine Realisierung im ersten Schuljahr an einer Volksschule
Vorbemerkungen:
Im Folgenden wird über Bemühungen berichtet, unter integrativen Bedingungen ein nichtsprechendes. gehörloses Mädchen über die schriftliche Modalität zur Verbalsprache zu führen. Anlaß für die integrative Beschulung war, daß ein etwa einjähriger Aufenthalt am weitentfernten Sonderschulkindergarten der Landessonderschule für schwerhörige und taubstumme Kinder in MILS/TIROL und die damit verbundene Trennung von der gewohnten Umgebung zu erheblichen emotionalen Störungen und häufigen Erkrankungen des Kindes geführt hatten.
Die Integrationsfrage soll in diesem Beitrag nicht diskutiert werden. Dennoch ist vor der Darstellung des Sprachentwicklungskonzeptes und seiner Realisierung zu betonen, daß die soziale Integration in die Klasse als sehr zufriedensteIlend zu bezeichnen ist (...). Wer als uneingeweihter Besucher in die Klasse kommt, wird, wenn nicht gerade speziell mit dem Mädchen gearbeitet wird, Mühe haben, die gehörlose Schülerin herauszufinden (...). Verblüffend ist für mich die wiederholte Beobachtung der z.T. gezielten Verwendung von natürlichen Gebärden durch hörende Kinder. (...) Diese gelungene soziale und kommunikative Integration war und ist eine unabdingbare Voraussetzung für das schwierige sprachtherapeutische Vorgehen.
Der Autor wurde wenige Wochen vor Beginn des ersten Schuljahres um Rat gebeten, in welcher Weise unter den integrativen Rahmenbedingungen ein Sprachaufbau bei dem gehörlosen Kind realisiert werden kann. Relevante Eckdaten für die Planung des Sprachentwicklungskonzeptes waren:
-
der audiologische Befund = Gehörlosigkeit,
-
die gänzlich fehlende Artikulation von Wörtern und Sätzen,
-
die, gemessen an den (auf Nichtbehinderte bezogenen!) Normen, überdurchschnittlichen Leistungen bei den nicht lautsprachabhängigen visuellmotorischen Subtests des PSYCHOLINGUISTISCHEN ENTWICKLUNGSTESTS (PEET), beim RAVEN/CPM (IQ = 108) und bei dem von GÜNTHER (1989) entwickelten symbolisch-schriftbezogenen graphomotorischen Wahrnehmungs- und Produktionstest (VSWP) sowie ihre beobachtbare gestisch-gebärdliche Kommunikations- und visuelle Kognitionsfähigkeit.
Auf diesem Hintergrund wurde vorgeschlagen, das anfänglich sehr niedrige Sprachniveau des beginnenden Lese- und Schreiblehrganges der ersten Klasse für Sabine als initialen Einstieg in die Verbalsprache zu nutzen, auf deren Fundament sich nachfolgend auch das Sprechen entfalten sollte. Es wurde also ein direkter Zugang zur Sprache über die Schrift versucht, der in der Geschichte der Gehörlosenpädagogik eine bis in ihre Anlange zurückverfolgbare Tradition hat und in den letzten 100 Jahren durch eine Reihe von Einzelfällen gut dokumentiert und in seiner Machbarkeit zweifelsfrei belegt ist (vgl. zu den Grundlagen und seinen didaktischen Konsequentzen GÜNTHER, 1989; 1986a).
Der lautsprachunabhängige schriftbestimmte Sprachbeginn erfolgt logischerweise mittels einer visuellen am Wort orientierten Wahrnehmungsstrategie, die wir in dem gemeinsam mit FIRTH (1986; GÜNTHER, 1986) entwickelten Stufenmodell des Schriftspracherwerbs als logographemisch bezeichnen. Der logographemische Zugang zur Schriftsprache ist keineswegs ein behindertenspezifischer, es handelt sich vielmehr um die generell auch von nicht lautsprachlich behinderten Kindern verwandte initiale Strategie zur Aneignung der Schriftsprache, die sich nach unseren Analysen empirischer Daten unter den Bedingungen des schulischen Anfangsunterrichts geradezu gegen die methodischen Intentionen der Leselehrgänge durchsetzt (GÜNTHER, 1986, S. 46 ff.). Dieser Tatbestand begründet das Konzept, den normalen Leselernprozeß der nichtbehinderten Kinder als Einstieg in der Verbalsprache bei SABINE zu nutzen, lern- und entwicklungspsychologisch.
Bei der logographemischen Strategie werden Wörter an hervorragenden bzw. charakteristischen Details und Kombinationen innerhalb ihrer Buchstabenkonfigurationen erkannt (experimentelle Belege und Diskussion bei: GÜNTHER, 1986, S. 361; SCHEERER-NEUMANN, 1986; 1987), also gerade nicht, wie die Ganzheitstheorie KERNscher Prägung meinte, mittels ganzheitlicher Wortbilder. Nur so ist es zu erklären, daß gehörlose Vorschulkinder nach NOSKOWA (1985, S. 216) aufgrund mehrjähriger systematischer Übungen beim Übergang in die Schule (im Alter von ca. 7 bis 8 Jahren in der Udssr) einen logographemischen Lesewortschatz von 2000 bis 2500 (!) Wörtern erreichen können.
Im Gegensatz zu ehernen wahrnehmungstheoretischen Vorstellungen konnten wir in einer breit angelegten Untersuchung zeigen (GÜNTHER, 1989), daß die Buchstabenformen unserer Alphabetschrift nur sehr geringe Perzeptionsleistungen erfordern und daß darüberhinaus die Aneignung der schriftlichen Zeichenformen durch ihre Materialisierung, Dauerhaftigkeit und unbeschränkt wiederholbare Abrutbarkeit im Vergleich zur Lautsprache gerade für gehörlose Kinder sehr viel einfacher ist Letztgenannter Punkt ist ganz wesentlich für das Konzept, die Verbalsprache über die Schrift initial aufzubauen und auf dieser Basis das Sprechen zu entwickeln.
Auch wenn in der Anfangsphase der initiale Aufbau der Verbalsprache in der schriftlichen Modalität im Vordergrund stand, war und ist eine angemessene Entwicklung des Sprechens ein unabdingbares Ziel des Integrationsvorhabens. Neben den natürlich auch durchgeführten Artikulationsübungen erwarteten wir einen intrinsischen Motivationsschub zum Sprechen aus konzeptuellen wie auch aus psychosozialen Gründen:
Die mit relativ groben, mit auffälligen Details und Kombinationen operierende logographemische Vorgehensweise ist primär eine Lesestrategie, mit deren Hilfe, wie schon erwähnt, auch ein umfangreicherer Wortschatz gedächtnismäßig gespeichert werden kann. Beim Schreiben führt sie jedoch schnell zu Problemen, was die richtige Auswahl, Reihenfolge und Vollständigkeit der Buchstaben betrifft. Die doppelte Kodierung und die davon abgeleiteten Graphem-Phonem-Korrespondenzen sind konstitutiv für alphabetische Schriftsysteme und erleichtern das richtige Schreiben erheblich. Entsprechend den Erfahrungen bei nichtbehinderten Kindern wurde auch für SABINE davon ausgegangen, daß die Unzulänglichkeiten der logographemischen Strategie beim Schreiben eine stärkere Nutzung von verfügbaren artikulatorischen Informationen evozieren (vgl. GÜNTHER, 1989a, S. 245 ff.).
Die interaktive Eingebundenheit und die allmählichen Erfahrungen der Grenzen von gebärdlich-gestischen Kommunikationsmitteln in der Integrationssituation sollten in direkter, aber wirkungsvoller Weise eine innere Motivation zum Erwerb des Sprechens bei SABINE erzeugen.
Die grundlegende Möglichkeit eines lautsprachunabhängigen initialen Sprachbeginns über die Schrift ist nach den vorliegenden empirischen Daten und Fallbeschreibungen unbestreitbar, für den konkreten Fall, der den normalen Lese-/Schreiblernprozeß nichtbehinderter Schulanfänger als Ausganspunkt nimmt, gab es jedoch keine theoretischen, methodischen oder didaktischen Vorbilder. In Anlehnung an Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung sowie der Struktur des normalen Lese-/Schreiblernprozesses setzten wir uns bezüglich des verbalsprachlichen Entwicklungsprozesses im ersten Schuljahr nachfolgend aufgeführte Ziele. Entsprechend dem Stufenmodell der schriftsprachlichen Entwicklung (GÜNTHER, 1986; 1986a) wurde für die Anfangsphase von einem Primat des rezeptiven Lesens ausgegangen, das allmählich verstärkend mit Schreibanforderungen verknüpft werden sollte.
Phase I:Aufbau der indikativ-symbolischen Funktion des Wortes (STACHOWIAK, 1987; STERN, 1971, S. 132ff.; s.a. WYGOTSKI, 1987, S. 163ff..), in den Worten von STERN die Entdeckung, daß jedes Ding einen Namen habe. Expliziter noch als in der frühkindlichen Lautsprachentwicklung wird die indikativ-symbolische Funktion im Rahmen des schriftsprachlichen Erwerbsprozesses über die Wortart der Nomen erarbeitet.
Phase II:So grundlegend die symbolische Funktion für den Spracherwerb auch ist, die systematischen Möglichkeiten von Sprache werden erst mit der Aneignung der Prädikationsfunktion, mittels derer die einzelnen Bezeichnungen zueinander in syntagmatische und semantische Beziehungen gesetzt werden, voll nutzbar. Wichtigstes Mittel dafür ist die Wortart der Verben, deren Bedeutung für die sprachsystematische Entwicklung sich schlagwortartig kennzeichnen läßt: Das Verb regiert den Satz (vgl. ausf. GÜNTHER, 1989b/c). Anders als die Nomen sollten die Verben von vornherein in flektierter Form im Kontext von kurzen Sätzen eingeführt werden. Parallel dazu sollten auch erste Adjektive in ihrer Determinations-und Spezifikationsfunktion eingeführt werden.
Phase III(Anfang 2. Schuljahr): Im Rahmen der verstärkten Arbeit mit Sätzen und kleinen Texten werden die operativen Funktionswörter thematisiert, vor allem die Präpositionen und Konjunktionen, die zur Herstellung von differentiell-relationalen semantisch-syntaktischen Bezügen zwischen Wörtern, Phrasen und Sätzen dienen. Präpositionen und Konjunktionen tauchen bei ungestörter Lautsprachentwicklung als letzte Wortarten auf und erweisen sich bei Dysphasien und Aphasien als besonders störanfällig, sind jedoch für einen entwickelten Sprachgebrauch unerläßlich. Die Aneignungsschwierigkeiten der operativen Funktionswörter lassen sich damit erklären, daß ihnen im Gegensatz zu den Inhaltsarten (Nomen, Verben, Adjektive) keine direkte referentielle Bedeutung zukommt, daß sie vielmehr als Anzeiger für zwischensprachliche Makroeinheiten (Wörtern, Sätzen) zu realisierenden Beziehungen fungieren (vgl. ausf. GÜNTHER, 1987).
Überprüfung des Sprachentwicklungsstandes von Sabine am Ende des ersten Schuljahres
Am Ende des ersten Schuljahres wurde versucht, zu erfassen, inwieweit das zuvor erläuterte Sprachaufbaukonzept erfolgreich war. Für den speziellen Zweck der Überprüfung des Sprachentwicklungsstandes von SABINE konnte auf kein verfügbares Diagnoseinstrument zurückgegriffen werden. Die Zusammenstellung der Wortprüflisten sollte sich an den Rangfolgen im Wortschatz von Grundschulkindern (PREGEL & RICKHEIT, 1987) als dem gegenwärtig verläßlichsten Korpus zum kindlichen Sprachgebrauch orientieren (vgl. a. GÜNTHER, 1989d). Da gegenüber den ursprünglichen Planungen die initiale Einführung der Verben aus Krankheitsgründen erst gegen Ende des ersten Schuljahres erfolgte und ebenso bei den Adjektiven nur Farbbezeichnungen sowie groß/klein eingeführt waren, ließ sich dieses Auswahlkriterium nur für die Nomen realisieren. Bei den Verben wurden sämtliche in den Wochen zuvor eingeführten Lexeme in Bild-/Satzkontexten abgefragt, bei den Adjektiven elf Farbbezeichnungen und groß/klein.
Die Nomen wurden nach Sacheinheiten gruppiert angeboten. Dabei wurden gegenüber den Häufigkeitsrangfolgen im Korpus von PREGEL & RICKHEIT (1987) in sachlogischer Ergänzung auch seltenere Normen berücksichtigt (s. z.B. die Abb. Körperteile).
Die Lesefähigkeit wurde anhand von 114 lexikalischen Items überprüft. Für die am folgenden Tag durchgeführte Überprüfung der Schreibleistung wurden von dieser Itemliste 75 erneut verwandt. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Lösungen bei den Lese- und Schreibaufgaben. Bei den Leseaufgaben wurde für die Nomen nach Sachgebieten geordnet Wortlisten vergeben und die Zuordnung zu einer entsprechenden Abbildung gefordert. In gleicher Weise waren die Farbadjektive einer Farbtafel zuzuordnen. Die Verben in kurzen Sätzen waren bezüglich einer entsprechenden Abbildungsauswahl, das Adjektivpaar groß/klein in einem antinomymen Kontext richtig zu bestimmen. Beim Schreiben dienten die Abbildungen als Vorlagen. Zusätzliche Schreibhilfen gab es nicht.
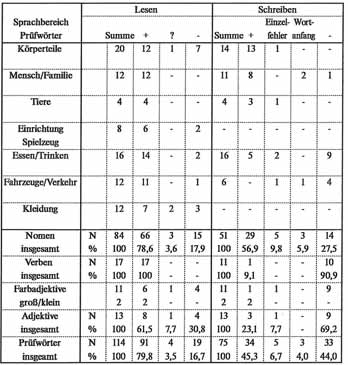
Übersicht Überprüfung des Schriftwortschatzes im Lesen und Schreiben bei Sabine am Ende des ersten Schuljahres (Juni 1989)
Die Ergebnisse bestätigen, was bereits eine informelle Überprüfung vier Monate zuvor ergeben hatte: Das Ziel der Phase I, das Erfassen der indikativ-symbolischen Funktion des Wortes, wurde zweifelsfrei erreicht:
Von den 114 lexikalischen Prüfitems erliest SABINE 80% sicher und schreibt knapp die Hälfte der 75 geforderten Wörter richtig. Bei den Nomen werden deutlich mehr als die Hälfte richtig geschrieben, und nimmt man die Wörter mit ein bis zwei falschen bzw. ausgelassenen Buchstaben hinzu, wird auch hier bereits die 2/3-Marke erreicht. Ihre Leistungsfähigkeit im Bereich der Schreibung von Nomen läßt sich sehr gut an dem nachfolgend abgebildeten Prüfungsblatt demonstrieren. Lediglich ein Wort (Mand) bleibt falsch stehen, ein weiteres wird nach Fehlerhinweis selbständig korrigiert (Baust für Bauch). Vier in der Vorlage nicht verlangte Körperteile werden von SABINE selbständig hinzugefügt.
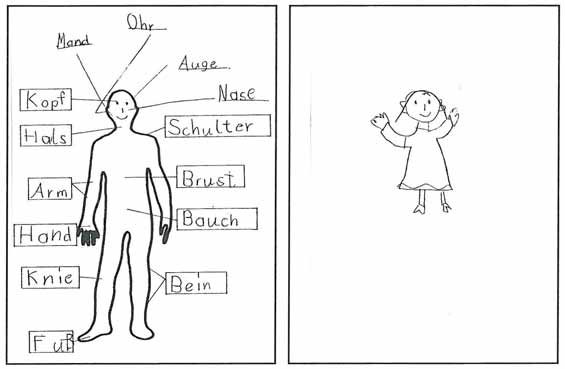
Schreibprüfblatt: Körperteile / Selbstzeichnung Sabine
Gemessen an dem ursprünglichen Planungskonzept weniger zufriedenstellend sind die für die Phase II, die Prädikationsfunktion, erreichten Ergebnisse. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß aus Krankheitsgründen die gezielte Einführung von Verben im Satzkontext erst kurz vor Schuljahresende möglich war. Auf diesem Hintergrund ist es dann doch bemerkenswert, daß Sabine in geänderten Bildkontexten alle 17 eingeführten Verben in S-V-Sätzen sicher erlesen konnte. Die Schreibanforderung war offensichtlich neu für SABINE. Interessant ist jedoch, daß das einzige richtig geschriebene Verb liest war. Die Adjektive in ihrer spezifizierenden und determinierenden Funktion wurden bislang eher beiläufig behandelt. Die rezeptive und produktive Verfügbarkeit von klein/groß als den am häufigsten verwendeten Dimensionsadjektiven von Grundschulkindern (PREGEL & RICKHEIT, 1987) verweist aber auf bislang noch nicht genutzte sprachtherapeutische Möglichkeiten. Auf diesem Hintergrund läßt sich der interpretative Schluß ziehen, daß sich trotz Verzögerungen bei der Realisierung der II. Phase das Sprachentwicklungskonzept bislang als sprachtherapeutisch realisierbar erwiesen hat. Die schriftsprachliche Aufbauarbeit im 2. Schuljahr konzentrierte sich auf die Phasen II und III des Konzepts, also auf die Entwicklung und Entfaltung der Sprache in paradigmatischen und syntagmatischen Satz- und Textzusammenhängen. Mehr noch als in der lexikalisch-symbolischen Anfangsphase wird dabei neben dem Lesen die Schriftproduktion in ihren verschiedenen medialen Realisierungsformen als eigentlicher Motor der Sprachaneignung bei SABINE zu entwickeln sein. Wie zu Anfang des Schuljahres wurden neben der zuvor diskutierten Wortschatzprüfung auch der RAVEN-CPM, der MANN-ZEICHEN-TEST (MZT) und die symbolisch-semantischen visuell-visomotorischen Subtests des PET zur Überprüfung kognitiver, gestalterisch-konzeptueller und symbolisch-semantischer Fähigkeiten eingesetzt SABINE erreichte erneut in allen (Sub-) Tests Normprozentränge zwischen 54 und 66.
Geradezu phänomenal jedoch war ihr Abschneiden im PET-Subtest Bilder Deuten (BD), der die Fähigkeit zur Oberbegriffsbildung bzw. Zuordnung zu begrifflichen Gemeinsamkeiten fordert. Sabine erreichte am Ende des ersten Schuljahres im PET-Subtest BD Normprozentrang 90 und verbesserte sich damit gegenüber der Testung im Spätherbst 1988 um 32 Prozentränge! Sie bewältigte dabei selbst hoch abstrakte Aufgabenstellungen (...), und scheiterte erst bei Anforderungen, die sie altersgemäß gar nicht verstehen kann (z.B. statistische Graphiken - vgl. zur Bewertung und Kritik des PET-BD UDEHOLM. 1989, S. 56 ff.).
Auch wenn wir uns im ersten Schuljahr primär auf den Sprachanfang in der schriftlichen Modalität konzentrierten, war es das erklärte Ziel des Integrationsvorhabens insgesamt, SABINE zum Sprechen zu bringen. Als Ausgangssituation war dabei zu konstatieren:
SABINE artikulierte zu Beginn des Integrationsprojektes keine Wörter, aber - und dies ist ganz wesentlich - sie zeigte in den geschilderten diagnostischen Überprüfungen wie auch bei ungesteuerten Beobachtungen im Laufe des Unterrichts - etwa bei rhythmisch-musikalischen Veranstaltungen - keinerlei dyspraktische Verhaltensmerkmale, die nach v. UDEN (1983) als kritische Indikatoren für lautsprachliche Aneignungsschwierigkeiten angesehen werden. Im Gegenteil schon frühzeitig fiel uns bspw. die saubere spontane Vokalisierung auf. Insgesamt muß man sie eher als eupraktisch bezeichnen.
Dies bestätigte sich auch im Ergebnis der therapeutischen Bemühungen um die Artikulationsanbahnung Ende des ersten Schuljahrs. Anfang des zweiten Schuljahres überprüften wir die Ablesefähigkeit mit dem Wortset Körperteile (...). SABINE las dabei nicht nur gut ab, sondern setzte, ohne das verfügbare Schriftbild zu nutzen, die Ableseinformation direkt in eine sonst kaum beobachtbare saubere Artikulation der betreffenden Wörter um.
Es erscheint müßig, darüber zu spekulieren, warum es dennoch solche Schwierigkeiten mit der Artikulationsanbahnung bei SABINE gab. Sicher erscheint jedoch, daß das Problem kaum mit verstärkten Artikulationsübungen klassischer Provenienz zu lösen war. Obwohl die außerschulische logopädische Betreuung und die Kooperation mit der Schule nicht optimal geregelt werden konnten, beherrscht SABINE nach Angaben des Sonderschullehrers Ende des ersten Schuljahres, unterstützt durch das PHONEMBESTIMMTE MANUALSYSTEM, sämtliche Laute analytisch in einer auffällig guten Klangqualität, während sich die synthetisierende Koartikulation trotz der bevorzugten Auswahl von Einsilbern mit Innenvokal bei dem Übungswortmaterial nur langsam entwickelt. Unerwartet war deshalb die Beobachtung, daß sie bei der Überprüfung der Schreibfähigkeit z.T. explizit beobachtbar ihre eigene Artikulation als Kontrollmittel einsetzte.
Ganz offensichtlich erscheint dies bei Schreibfehlern, wie Aoto, blao, aber auch Baust statt Bauch, die visuell kaum zureichend erklärt werden können. Auf diesem Hintergrund sind wir optimistisch, daß im Laufe des zweiten Schuljahres bei verbesserter außerschulischer logopädischer Betreuung ein endgültiger Durchbruch auch beim Sprechen erfolgt. Dabei setzen wir neben den expliziten Artikulationsübungen auf intrinsische Motivationsschübe durch die interaktive Integrationssituation und die Schreibanforderungen. Für die Erwartung, daß SABINE eine innere Motivation zum Sprechen entwickelt, spricht auch eine Mitteilung der Mutter gegen Ende des Schuljahres. Danach hat SABINE zu Hause folgendes Spiel selbst vorgeschlagen, das sie seitdem häufiger mit der Mutter spielt: Die Mutter muß die Augen schließen, SABINE wählt für sich aus einer Gruppe von abgebildeten oder realen Objekten eines heraus und spricht das betreffende Wort. Darauffolgend darf die Mutter die Augen öffnen und muß versuchen, aufgrund des gesprochenen Wortes das gemeinte Objekt zu identifizieren. Auch wenn aus der Sicht eines Erwachsenen das Augenschließen nicht logisch notwendig erscheint, so deutet dieses Spielchen doch auf eine wachsende Motivation des Kindes zum Sprechen hin und auf eine sicherlich gute Basis für weitere gezielte sprachtherapeutische Arbeit.
Resümee:
Auch wenn sich nicht in jeder Hinsicht die mit dem Sprachaufbaukonzept formulierten Erwartungen nach einem Jahr haben realisieren lassen, so sprechen die hier dargelegten Ergebnisse doch eindeutig für die Richtigkeit dieses Ansatzes, denn es gibt keinen Befund, der die Annahmen des Konzeptes tangiert Immerhin wurde mit dem Konzept pädagogisches und didaktisches Neuland betreten, für das es keine Vorbilder gab. Letztendlich sind aber die bislang erreichten Ergebnisse zurückzubeziehen auf die gelungene psycho-soziale Integration in den Klassenverband mit allen beteiligten Kindern, Eltern und Lehrern." Dr. K.- B. Günther, PH Heidelberg
Literatur
BRÜGELMANN, H. (Hg. - 1986): ABC und Schriftsprache. Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher. Konstanz: Faude.
DEUTSCHE GES. f. SPRACHHEILPÄDAGOGIK (dgs) - Landesgruppe Rheinland (Hg. - 1987): Spracherwerb und Spracherwerbsstörungen. Tagungsbericht der XVII. Arbeits- und Fortbildungstagung der dgs in Düsseldorf 1986. Hamburg: Wartgenberg.
FRITH, U. (1986): Psychologische Aspekte orthographischen Wissens. In: AUGST, G. (ed) New trends in graphemics und orthography. Berlin/New York: De Groyter, S. 218 - 233.
GÜNTHER. K.-B. (1985): Schriftsprache bei hör- und sprachgeschädigten Kindern. Bedeutung und Funktion für Sprachaufbau und Entwicklung, dargestellt am Beispiel gehörloser Kinder. Beiheft Hörgeschädigtenpädagogik 9, Heidelberg: Groos (2. verbesserte Auflage).
GÜNTHER. K.-B. (1986): Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In: BRÜGELMANN, S. 32 - 54.
GÜNTHER. K.-B. (1986a): Zur Notwendigkeit besonderer konzeptioneller Überlegungen und didaktischer Konsequenzen für den Schriftspracherwerb bei gehörlosen Kindern. In: Hörgeschädigtenpädagogik 40, 150 - 178.
GÜNTHER. K.-B. (1987): Zur Bedeutung von sprach- und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen bei dysgrammatisch sprechenden Kindern. In: Deutsche Ges. für Sprachheilpädagogik (Hg.). S. 165 - 200.
GÜNTHER. K.-B. (1989): Vergleich der symbolisch visuellen Wahrnehmungs- und visomotorischen Produktionsfähigkeit von sprachentwicklungsgestörten, gehörlosen und nichtbehinderten Kindern. Dossenheim: Habilitationsarbeit (Berichtsfassung für die DFG).
GÜNTHER. K.-B. (1989a): Schrift und Schreiben in der frühen Phase des Schriftspracherwerbs. In: Ders. in Zs. mit der DGLS (Hg). Ontogenese, Entwicklungsprozeß und Störungen beim Schriftspracherwerb. Heidelberg: Edition Schindele - HVA, S. 206 - 288.
GÜNTHER. K-B. (1989b): Notizen I. zum Integrationsvorhaben SABINE R. Arbeitspapier zum Reuttener integrationsversuch.
GÜNTHER. K-B. (1989c): Hinweise für die Erstellung einer Verb-Grundwortschatzkartei mit piktographisch-symbolischen Bedeutungsabbildungen. Arbeitspapier für das Reuttener Integrationsprojekt.
GÜNTHER. K-B. (1990): Probleme der Diagnostik semantischer Störungen. Erscheint in: GROHNFELDTÖ, M. (Hg). Handbuch der Sprachtherapie 3. Störungen der Semantik. Berlin: Marhold.
NOSKOWA, L. P. (1985): Lesen im Vorschulteil der Grundschule. In: Die Sonderschule 30, S. 212 - 217.
PREGEL, D. & RICKHEIT, G (1987): Der Wortschatz im Grundschulalter. Häufigkeitswörterbuch zum verbalen, substantivischen und adjektivischen Wortgebrauch. Hildesheim/Zürich/New York: Olms
SCHEERER-NEUMANN, G. (1986): Wortspezifisch: Ja - Wortbild: Nein. In: BRÜGELMANN, H. (Hg.), S. 171 - 185.
SCHEERER-NEUMANN, G. (1987): Wortspezifisch: Ja - Wortbild: Nein. Teil II: lesen. In: BALHORN, H. & BRÜGELMANN, H (Hg.), Welten der Schrift in der Erfahrung der Kinder. Konstanz: Faude, S. 219 - 241
STACHOWIAK, FJ. (1987): Spracherwerb, Semantik und menschlicher Kortex - vom lautbegabten zum sprachbegabten Wesen. In: DEUTSCHE GES. f. SPRACHHEILPÄDAGOGIK. (Hg.), S. 391 - 411.
STERM, W. (1971): Psychologie der frühen Kindheit. Heidelberg: Quelle & Meyer (10. unveränderte Auflage).
STERN, W. & STERN, C. (1975): Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Nachdruck der 4. neubearbeiteten Auflage 1928).
UDEN, A v. (1983): Diagnostic testing of deaf children. The syndrome of dyspraxia. Lisse: Swets & Zeitlinger.
WYGOTSKI, L.S. (1987): Ausgewählte Schriften Bd. 2: Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit. Berlin (DDR): Volk u. Wissen.
Nach 4 Jahren integrativer Beschulung an der Volksschule wurde die Entwicklung von Sabine durch Prof. Dr. Klaus-B. GÜNTHER zusammengefaßt und entsprechende Folgerungen für eine Fortsetzung des Integrationsprojekts an der Hauptschule in Reutte festgelegt (unveröff. MS., 1992):
"Die Entwicklung der gehörlosen Sabine R. nach 4 Jahren integrativer Beschulung an der Volksschule und Folgerungen für eine Fortsetzung des Integrationsprojektes in der Hauptschule.
Bereits zu Beginn der integrativen Beschulung von SABINE waren im Gegensatz zu ihren minimalen lautsprachlichen Fertigkeiten überdurchschnittliche Leistungen u.a in der Intelligenz - gemessen mit dem Coloured Progressive Matrices (CPM) - und in dem lautsprachfreien symbolisch-semantischen Subtest des Psycholinguistischen Entwicklungstest (PET) - Bilder Deuten (RD), Bilder Zuordnen und Gegenstände Handhaben (GH) -festgestellt worden (vgl. GÜNTHER. 1990; grundsätzlich zur Analyse und Bedeutung dieser Testverfahren GÜNTHER i.V.). Der Intelligenztest und die Bedeutungsprüfungen des PET wurden am Ende des 4. Schuljahres erneut eingesetzt, um festzustellen, ob und inwieweit sich bei SABINE unter den Bedingungen der integrativen Beschulung Fortschritte bezüglich der allgemeinen Intelligenz, der semantisch-begrifflichen (BD, BZ) und der symbolischen (GH) Fähigkeiten verzeichnen lassen. Für unsere Zwecke sind die eingesetzten Verfahren insofern besonders geeignet, als für die hohen Altersstufen nach unseren Erfahrungen speziell bei hör- und sprachbehinderten Kindern sich quantitativ häufig nicht einmal nennenswerte quantitative Verbesserungen in den Rohwerten, vor allem aber keine qualitativen beobachten lassen, was sich über die von uns vorgenommene Analyse der Anforderungsstrukturen der Verfahren erklären läßt Die nachfolgende Übersicht zeigt die Leistungen in den genannten Verfahren zum Schulanfang 1988 (lA), am Ende der ersten Klasse 1989 (1E) und am Ende der 4. Klasse 1992 (4E). Zusätzlich wurde in der Abschlußunteruchung 1992 noch der Heidelberger Intelligenztest HIT 3-4 - sprachfreier Intelligenztest für die Primarstufe von KRATZMEIER (1982) eingesetzt, weil es sich um ein ausdrücklich schulleistungsbezogen konzipiertes Intelligenzmeßverfahren handelt (vgl. Test-Beiheft, 4) und seine nonverbale visuell-visomotorische Aufgabenstruktur SABINES visuell-kognitiven Fähigkeiten entgegenkommt.
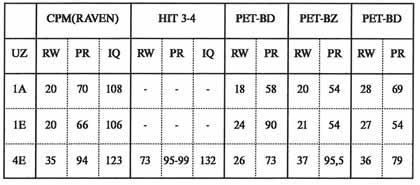
SABINES Intelligenzniveau und symbolisch-semantische Fähigkeiten zum Schulanfang 1989 (lA), Ende der 1. Klasse (1E) und Ende der 4. Klasse (4E) mittels des COLOURED PROGRESSIVE MATRICES (CPM), der HEIDELBERGER INTELLIGENZIESTS (HIT 3 - 4) und der Subtests BILDER DEUTEN (BD), BILDER ZUORDNEN (BZ) und GEGENSTÄNDE HANDHABEN (GH) des PSYCHOLINGUISTISCHEN ENTWICKLUNGSTESTS (PET).
Der Vergleich der Leistungen am Ende der Volksschulzeit mit den Werten zu Beginn und Ende der ersten Klasse zeigt für die Intelligenz und den begriffliches Relations- und Analogiedenken erfassenden PET-Subtest Bilder Zuordnen in diesem Ausmaß unerwartete Leistungsverbesserungen. Im CPM, bei dem sie 1988/89 noch deutliche Schwierigkeiten mit Symmetrieaufgaben und der Mehrmalserfassung/Differenzierung in zwei Dimensionen hatte, verfehlt sie mit 35 richtigen Antworten die maximale Punktezahl um lediglich einen Punkt. Die Ergebnisse des HIT 3-4 - IQ 132, Prozentrangintervall 95-99 - bestätigen die CPM-Werte voll. Noch ausgeprägter sind die Verbesserungen im PET-Subtest BZ, in dem SABINE, die 1988/89 das Analogiebildungsprinzip im 2. Testteil - wie die meisten Kinder in dieser Altersstufe - überhaupt nicht begriffen hatte, ihr Leistungsniveau gegenüber 1988/89 fast verdoppelt und den Test ohne Abbruchkriterium voll bewältigt. Auch beim PET-Subtest Gegenstände Handhaben, den wir als Indikator für allgemeine Symbolbildungsfähigkeit verstehen und der erfahrungsgemäß wegen seiner pantomimischen Anforderungen von gehörlosen Kindern eher überdurchschnittlich bewältigt wird, liegt SABINE am Ende der Volksschulzeit mit Prozentrang 79 um 10 Plätze höher als zum Schulanfang. Lediglich im PET-Subtest Bilder Deuten stagnieren die quantitativen Leistungen bei einem Zuwachs von lediglich 2 Punkten beinahe und gehen auf der qualitativen Ebene sogar zurück, allerdings auf sehr hohem Niveau (Prozentrang 73) am Ende der 4. Klasse, was belegt, daß sie die testmäßig geforderte Oberbegriffsbildung als allgemeines Prinzip des Tests voll verstanden hat. Die Nonnwerte sind hier jedoch wenig aussagekräftig, weil SABINE in diesem Test bereits Ende der 1. Klasse ihre potentielle Leistungsgrenze praktisch erreicht hat und die restlichen Items nach unserer Analyse keine allgemein- und entwicklungslogischen Schwierigkeitsstufen enthalten, so daß die Ergebnisse als intrumentales Artefakt zu werten sind.
Die Leistungszuwächse und das -niveau insgesamt gegenüber der Schulanfangsphase sind bezüglich der mit den eingesetzten Instrumenten erfaßten Intelligenz und den symbolisch-semantischen Fähigkeiten durchgängig so hoch, daß Meßzufälligkeiten ausgeschlossen werden können. Wir sehen in den bemerkenswerten kognitiv-semantischen und symbolischen Leistungszuwächsen ein starkes Argument für eine allgemein implizite aus der Integrationssituation resultierenden Entwicklungsförderung. Daß die Leistungszuwächse auf zusätzlicher häuslicher Förderung beruhen, kann ebenso ausgeschlossen werden, wie eine entwicklungsgenetische Erklärung, da für letztere die Zuwächse zu hoch sind, um als Entwicklungssprunge verstanden werden zu können. Das hohe kognitive und nichtverbalsprachliche symbolisch-semantische Fähigkeitsniveau ist sicher eine Erklärung dafür, warum trotz der massiven Probleme im lautsprachlichen Bereich über den Aspekt der formalen und sozialen Integration hinaus Entwicklungsfortschritte in den schulischen Leistungsbereichen, insbesondere beim Aufbau der Schriftsprache, zu verzeichnen waren, die jedoch nicht isoliert von dem, was gehörlose Kinder in der Regel in diesem Feld bspw. auch unter den Bedingungen einer sonderschulischen Betreuung erreichen können, bewertet werden sollten.
Natürlich konnte im Rahmen unserer zeitlichen und materiellen Möglichkeiten keine umfassenden Überprüfungen des erreichten Niveaus in den wichtigsten schulischen Leistungsbereichen vorgenommen werden, zumal die empirische Forschungsliteratur diesbezüglich keine ökonomisch handhabbaren Vergleiche, auf empirischer Basis ermöglichende Verfahren, anbietet. Wir beschränken uns vielmehr auf einige exemplarisch-stichpunktartige Kontrollen vornehmlich im Bereich der Schriftsprache (Deutsch Lesen/Schreiben) sowie punktuell der Mathematik. Sie finden ihre notwendige Ergänzung in den verbalen Jahreszeugnisbewertungen und in detaillierten Angaben der Arbeit von KINTRUP (1992 - s.a.w.u.).
Die Ergebnisse im mathematischen Bereich sollen hier nur kurz erwähnt werden, weil sie im wesentlichen die Angaben in den Jahreszeugnissen und Schu1nachrichten bestätigen. Danach beherrscht SABINE Technik und Funktion der Grundrechenarten. Nach unserer Überprüfung bewältigt sie diese fehlerfrei auch in einfachen Textaufgaben vom Typ: Markus hat S 5682,- bekommen. Er möchte das Geld auf drei Kinder aufteilen. Wieviel bekommt jedes Kind? Ähnliches läßt sich auch für einfache geometrische Aufgaben, wie z.B. die Unterteilung eines Kreises in 1/2, 1/4, 1/8 sagen. Insgesamt kann man sagen, daß im mathematischen Bereich grundlegende Leistungsziele erreicht wurden. Die relativen Schwierigkeiten, die sich bei SABINE im Laufe der Volksschulzeit zeigten, sind nicht notwendig ein Hinweis auf grundsätzliche Probleme, sondern vermutlich eher durch eine Vernachlässigung spezifischer didaktischer Überlegungen für diesen nur scheinbar weniger sprachlich mediatisierten Leistungsbereich bei der Arbeit mit SABINE bedingt (vgl. a. KINTRUP, S. 74). Das ist allerdings kein Spezifikum des Integrationsversuches, sondern ein Problem, das sich immer wieder auch an den Gehörlosenschu1en zeigt. Bei stärkerer Einbeziehung solcher gehörlosenspezifischen Vermittlungsweisen und Einbeziehung elektronischer Hilfsmittel (Taschenrechner) bildet die Beherrschung der Grundrechenarten eine gute Grundlage, SABINES mathematische Fähigkeiten in der Hauptschule lehrplangemäß weiterzuentwickeln.
Um Hinweise für das Wortschatzniveau von SABINE zu erhalten, arbeiteten wir mit dem Peadbody Picture Vocabulary Test (PPV1) in der Version der Testbatterie für entwicklungsrückständige Schulanfänger (TES), weil er bei aller Problematik (vgl. GÜNTHER, 1991) der international am häufigsten eingesetzte Wortschatztest ist. Der PPYT ist ein passiver Wortschatztest, der mittels 53 Vierfeld-Bildtafeln (TES-Version), auf denen die Kinder das jeweilige vorgesprochene (oder bspw. bei gehörlosen Kindern auch vorgeschriebene) Wort anzeigen sollen, arbeitet. SABINE nahm 42 (= ca. 80%) richtige Zuordnungen vor, davon 8 erst nach Vorlage des Schriftbildes. Das Ergebnis entspricht in den TES-Normen Prozentrang 51 bei hörenden, entwicklungsrückständigen Kindern. Ein prozentualer Vergleich mit AXER u.a. (1990, S. 41), die mit einer 142 Items umfassenden modifizierten Version arbeiteten, zeigt, daß SABINES Leistungen denen der nicht teilleistungsgestörten, hörgeschädigten Schüler an der Würzburger Hörgeschädigtenschule entsprechen.
Ein guter Indikator für die Erfassung der Sprachfähigkeit sind operative Funktionswörter, die selbst keine referentielle Bedeutung besitzen, sondern als Indikator für eine semantische Beziehung zwischen Wörtern fungieren (vgl. GÜNTHER, 1987). Für Kinder in der Primarstufe sind besonders Präpositionen relevant. Mit bildunterstützten Lückentexten wurde die Verfügbarkeit von Präpositionen in Sätzen vom Typ: Das Pferd springt (über) den Bach, 10 örtlich/direktionale Präpositionen - auf, durch, hinter, in, neben, über, um, unter, vor, zwischen -, die auf einem Extrablatt vorgegeben waren, geprüft. SABINE löste 8 der 10 Aufgaben richtig, in zwei Fällen setzte sie fä1schlich hinter statt vor bzw. durch ein, wobei auch die Fehler durchaus Verständnis der semantischen Funktionen von Präpositionen zeigen. Im Falle von hinter/vor liegt eine Verwechslung der Dimensionspole vor, bei hinter/durch schließt die Abbildung eine örtliche Bestimmung hinter nicht ganz aus.
Daraus läßt sich schließen, daß SABINE im Bereich der Schriftsprache über grundlegende Kenntnisse von Wortarten und Hauptsatzstrukturen verfügt. Dies wird durch KINTRUPS (1992, S. 84ff.) sowie eigene informelle Beobachtungen bestätigt. Daß sie diese Strukturen auch selbständig anwenden kann, zeigt sich bei der Beschreibung von kleinen Geschichten, von denen wir eine zur Überprüfung einsetzten, die unter Zeitdruck zwar nicht vollständig durchgeführt werden konnte, jedoch Ergänzung und Bestätigung findet in den Angaben der Lehrer und von KINTRUP. Während die spontane schriftliche Bearbeitung zwar semantisch verständlich, aber sehr fehlerhaft ist, gelingt die Beschreibung nach einer gemeinsamen Bearbeitung zufriedenstellend. Auch wenn SABINE nicht das Klassenniveau erreicht, läßt sich für den Bereich der Schriftsprache feststellen, daß hier die Entwicklungsziele des Integrationsversuches angemessen erreicht wurden und daß ihre schriftsprachlichen Fähigkeiten eine wichtige Grundlage für die gelungene Integration bilden. Im letzten Schuljahr hat SABINE auch häufiger am Computer kleine Texte bearbeitet Die technische Handhabung bereitet keine Schwierigkeiten, die Arbeit mit dem Computer macht ihr offensichtlich Spaß. Im Einsatz des Computers als Schreibwerkzeug liegen wichtige Potenzen, bei SABINE in der Hauptschule das Schreiben zur selbständigen und selbstbestimmten Schreibtätigkeit weiter zu entwickeln.
SABINE relativ gute Schreibfähigkeiten sind ein wichtiges Faktum auch für die Fortführung des Integrationsprojektes in der Hauptschule. Jedoch darf nicht übersehen werden, daß die Schriftsprache eine recht unkommunikative, weil zu langsam und unflexibel arbeitende Modalität ist. Das Ausbleiben des erwarteten sich allmählich aufgrund der Integrationssituation entfaltenden Lautsprachgebrauchs führte nach einem grundlegenden Planungsgespräch Anfang der dritten Klasse dazu, SABINES kommunikativ-sprachliche Entwicklung durch den Einsatz von Lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) zu fördern. Eine Umsetzung dieser Entscheidung war jedoch nur sehr langsam und eingeschränkt möglich, weil keiner der beiden Pädagogen Gebärden beherrschte. Deshalb arbeitete Anfang dieses Jahres eine Studentin aus Hamburg - Andrea KINTRUP - 4 Wochen in der Klasse mit dem speziellen Ziel den Gebrauch von Lautsprachunterstützenden Gebärden bei SABINE zu fundieren und intensivieren, zugleich (interessierte) Mitschüler elementar in die Möglichkeiten einzuführen, sich mit Gebärden (vor allem natürlich mit SABINE) verständigen zu können. Frau KINTRUP hat ihre Tätigkeit, Beobachtungen und Erfahrungen sehr detailliert in ihrer Examensarbeit beschrieben (S. 61 ff.). Die Ergebnisse der Arbeit belegen, daß die Entscheidung, zur Forcierung von SABINES kommunikativ-sprachlicher Entwicklung Lautsprachunterstützende Gebärden einzusetzen, richtig war, aber auch, daß die Umsetzung bis dato aufgrund der genannten Bedingungen vor Ort nur unzureichend möglich war. Das Ergebnis, daß SABINE nach nur wenigen Wochen gezielter LUG-Erfahrung deutliche Ansätze zeigt, die ihr zuvor nicht bekannte Form der Lautsprachunterstützenden Gebärden in ihrem systematischen Aspekt zu begreifen und als vorteilhaft für den kommunikativen und informativen Austausch einzusetzen.
Zur Absicherung des LUG-Einsatzes in der Integrationssituation sind Interesse an und elementare Fertigkeiten in dieser Kommunikationsform zumindest bei einem Teil der hörenden Mitschüler von Bedeutung. Tatsächlich zeigte eine Reihe von ihnen ein mehr oder weniger ausgeprägtes Interesse am LUG-Lernen (Geheimsprache). SchülerInnen, die sehr viel mit SABINE kommunizierten, hatten nach den vier Wochen schon eine Reihe von Gebärden in ihrem Kommunikationsrepertoir.
Insgesamt wurden als Ergebnis des vierwöchigen systematisierten LUG-Einsatzes Erfahrungen aus anderen Integrationsversuchen bestätigt (bspw. mit der gehörlosen ARIANE J. in BONN-BEUL). Das machte zugleich klar, daß der jetzt fundierte LUG-Einsatz für die Fortführung des Integrationsprojektes in der Hauptschulzeit ein unverzichtbares Element darstellt Sollte es Schwierigkeiten geben, sofort eine gebärdenkompetente Lehrkraft zu finden, so müßte der/die SonderschullehrerIn in dem Lehrerteam der Integrationsklasse sich verpflichten, möglichst schnell über Gebärden-Lern-Video-Cassetten und möglichst einem Intensivkurs sich die entsprechenden Kenntnisse anzueineignen, um sie dann unterrichtlich konsequent in der durch Frau KINTRUP beispielhaft erprobten Weise einzusetzen.
Wir haben bereits in unserer Stellungnahme zur Fortführung des Integrationsprojektes vom März 1992 betont, daß aufgrund der sozialen und emotionalen Integration wie auch der Einbeziehung in regelschulspezifische Erfahrungs-, Lern- und Entwicklungsprozesse in den vergangenen vier Jahren ein Abbruch der integrativen Beschulung zum gegenwärtigen Zeitpunkt pädagogisch, psychologisch und sozial unverantwortlich wäre. Es ist zu befürchten, daß ein jetziger Wechsel an die Hörgeschädigtenschule in Mils zu einer noch schwereren emotionalen Krise als vor fünf Jahren führen würde, weil die Situation von SABINE jetzt viel bewußter erlebt und verarbeitet werden würde. Die Argumentation, eine Gehörlosenschule könnte Gebärden eben so gut oder besser in den Erziehungsprozeß einbeziehen, ist deshalb und nach Erfahrungen mit dem LUG-Einsatz in Integrationsprojekten kein stichhaltiges Gegenargument.
Aus diesem Grund setzen wir uns nachdrücklich für die Fortsetzung des Integrationsversuches in der Hauptschule ein.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir auch weiterhin bereit, unsere Fachkompetenz beratend zur Verfügung zu stellen, wenn die betroffenen schulischen Stellen und Instanzen daran interessiert sind. Dies gilt auch für eine Beratungskooperation mit der Landessonderschule für Gehörlose, Schwerhörige und Sprachbehinderte in Mils insbesondere auch, was die weitere Zukunft von SABINE in der Berufsausbildungsphase angeht."
Hamburg, den 13. August 1992
Literatur.
ANGERMAIER, M. (1972): Psycholinguistischer Entwicklungstest (PET). Weinheim: Beltz.-Test
AXER, U. u.a (1990): Erfassung neurogener Lernstörungen bei Hörgeschädigten und ihre Rehabilitation. Forschungsbericht Gesundheitsforschung, S. 193. Bonn: Der Bundesmin. f. Arbeit/Sozia1ordnung.
GÜNTHER, K-B. (1987): Zur Bedeutung von sprach- und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen bei dysgrammatisch sprechenden Kindern. In: DT. GES. F. SPRACHHEILPÄDAGOGIK (Hg.): Spracherwerb und Sprachwerbsstörungen. Hamburg: WartenbeIg.
GÜNTHER, K-B. (1990): Erläuterungen zum Sprachentwicklungskonzept für ein nichtsprechendes, gehörloses Mädchen und seine Realisierung im ersten Schuljahr an einer Volksschule. In: Hörgeschädigtenpädagogik 44.
GÜNTHER, K-B. (1991): Probleme der Diagnostik lexikalisch-semantischer Störungen. In: Grohnfeldt, M. (HG.): Handbuch der Sprachtherapie 3: Störungen der Samantik. Ber1in: Edition Marhold.
GÜNTHER, K-B. (i.V.): Vergleich der symbolisch visuellen Wahrnehmungs- und visomotorischen Produktionsfähigkeit von sprachentwicklungsgestörten, gehörlosen und nichtbehinderten Kindern (VIS). Eine empirische Grundlagenuntersuchung zu den wahrnehmungsmäßigen und feinmotorisch-koordinativen Voraussetzungen für den Schrjftspracherwerb. Frankfurt/Bern/New York: Lang.
KINTRUP, A (1992): Integration von gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Regelschulen mit Hilfe von Lautsprachunterstützenden Gebärden, dargestellt am Beispiel eines gehörlosen Mädchens in Reutte. Hamburg: unveröff. wiss. Diplomarbeit.
KORNMANN, R (1977): Testbatterie für entwicklungsrückständige Schulanfänger (TES). Weinheim: Beltz-Test
KRATZMEIER, H. (1982): Heidelberger Intelligenztest HIT 3-4. Ein sprachfreier Test für den Primarbereich. Weinheim: Beltz-Test.
SCHMIDTKE, A/SCHALLER, S. & BECKER, P. (Dt. Bearbeitung - 1980): Raven-Matrizen-Test -Coloured Progressive Matrices (CPM). Weinheim: Beltz-Test.
In der zusammenfassenden Beurteilung der Integration von Sabine schreibt KINTRUP auf Seite 90 in ihrer Diplomarbeit:
"Bisher ist der Integrationsversuch sehr positiv verlaufen. SABINE ist wirklich integriert."
Sie warnt aber gleichzeitig davor, aufgrund des gelungenen Schulversuchs in Reutte alle gehörlosen Kinder auf diese Art und Weise beschulen zu wollen, denn in Reutte orientierte man sich ihrer Ansicht nach vorwiegend an der allgemeinen Integrationsdebatte. D.h., es wurde auf unverzichtbare Prinzipien, wie das der offenen Aufnahmetoleranz, ebenso geachtet, wie das des zieldifferenten Lernens und der multiprofessionellen Versorgung.
In der Darstellung über die Kommunikation und ihrer Bedeutung bei der Sprach- und Identitätsentwicklung zeigt sie auf, daß in der Erziehung und Bildung gehörloser Kinder auf den Einsatz der Gebärden nicht verzichtet werden kann und ein Kontakt zu gehörlosen Erwachsenen wenn möglich auch gefördert werden sollte.
Sie zieht den Schluß:
"Ohne Zweifel kann die Antwort auf die Frage der Integration beantwortet werden:
Ja, SABINE ist sozial und formal voll integriert." (Ebd., S. 89).
[22] Frau Andrea Kintrup, eine Studentin der Universität Hamburg, hat im Rahmen ihres Studiums vom 17.02. bis 13.03.1992 die Integrationsklasse besucht und in diesem Rahmen nicht nur den Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden mit den Schülern der Klasse, sondern auch mit den Lehrern und einigen Eltern, eingeübt.
Das Ziel ihres Einsatzes lag in der Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten durch den Einsatz von Gebärden.
Während dieser Zeit arbeitete sie zusammen mit den beiden Lehrern gleichzeitig in der Klasse und übernahm Teile des differenzierten Unterrichtes. Der Einsatz von Gebärdensequenzen erstreckte sich auf alle Teile des Unterrichtes, d.h. auf Übungssequenzen mit der Gesamtgruppe, auf die Arbeit in Kleingruppen in Phasen der Differenzierung, auf Freiarbeitsphasen und auf intensives Üben mit SABINE in Einzelfördersituationen in der Schule und zu Hause.
Im Zusammenhang mit diesem Studienaufenthalt entstand ihre Diplomarbeit zu dem obengenannten Thema.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Soziale Zusammensetzung
- 5.2 Die methodischen Verfahren
- 5.3. Einschätzung der Sozialkontakte durch die beiden in der Klasse unterrichtenden Lehrer Roland Astl und Hans P.
- 5.4 Die sozialen Beziehungen in der Klasse
- 5.5 Freizeitbeziehungen außerhalb der Schule - Nachmittagskontakte
- 5.6 Zusammenfassung und Interpretation
Im Zentrum integrativer pädagogischer Zielsetzungen steht die "Soziale Integration", der gemeinsame Unterricht und die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder, wobei das "soziale Lernen Weg und Ziel integrativer Erziehung zugleich ist" (WOCKEN, 1992, S. 86).
Mit dem Begriff des sozialen Lernens verbinden wir heute ein sehr breites Spektrum an Bedeutungen und Vorstellungen und wir meinen damit z.B. Abbau von Vorurteilen, Toleranz, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Dialogbereitschaft, Unbefangenheit im Umgang miteinander, emotionale Zuwendung, mitmenschliche Solidarität, humane Akzeptanz, Verständigungsbereitschaft und Verständigungstechniken, hilfreiches und prosoziales Verhalten und anderes mehr.
Soziale Integration bezieht sich dabei auf die gegenwärtige wie auf die künftige ''Teilhabe am gesellschaftlichen Prozeß" (PREUSS-LAUSITZ, 1990, S. 95), und ihr kommt eine herausragende Bedeutung zu.
So hat der Präsident des Landesschulrates des Bundeslandes Steiermark Dr. Bernd Schilcher in seiner Eröffnungsrede zum 7. Österr. Integrationssymposium 1991 in Graz u.a. gemeint:
''Immer mehr gewinnt die Einsicht an Boden. Man muß miteinander können. Diese Fähigkeit ist in den letzten Jahren zur dominierenden "Schlüsselqualifikation" angewachsen." (Zit. n. WOCKEN, 1992, S. 88).
Wir alle, und damit vor allem auch unsere Kinder, werden lernen müssen, in einer multikulturellen Gesellschaft zu leben, in der es Menschen mit unterschiedlichen Religionen, Hautfarben, anderen Muttersprachen, Herkunft und Kultur gibt. Dieses Zusammenleben von Menschen mit so unterschiedlichen Religionen, Sprachen und Kulturkreisen erfordert ein hohes Maß an Akzeptanz, an wechselseitiger Respektierung und Wertschätzung, aber vor allem auch ein Annehmen eines jeden Menschen in seinem So-Sein als gleichwertiger Mitmensch.
WOCKEN (1993, S. 88) hat in seinem Aufsatz »Bewältigung von Andersartigkeit - Untersuchungen zur Sozialen Distanz in verschiedenen Schulen« u.a. geschrieben:
"Adorno hat als das erste und höchste Ziel der Erziehung bezeichnet, "daß Ausschwitz sich nicht wiederholt". Mit anderen Worten: Das höchste Ziel der Erziehung ist, daß der eine den anderen wegen seiner Andersartigkeit nicht umbringt, sondern trotz seiner Verschiedenheit als gleichwertig akzeptiert Integration, also die gemeinsame Erziehung verschiedener Kinder in einer Gruppe, ist das pädagogische Bemühen darum, den Umgang mit Andersartigk.eit zu lernen und einzuüben. Die gelebte Gemeinsamkeit ungleicher Kinder bietet unersetzbare Chancen, das "Miteinander der Verschiedenen" (Buber) einzuüben und zu lernen. Das Ziel integrativer Erziehung ist die "Bewältigung der Andersheit in der gelebten Einheit" (Buber). In diesem Sinne ist integrative Erziehung Friedenserziehung par excellence. In plakativer Form könnte die Lösung lauten:
»Frieden schaffen durch gemischte Klassen«!"
In Zusammenhang mit meiner Untersuchung bedeutet "Soziale Integration", daß diejenigen Kinder, die von der Gefahr einer sozialen Randständigkeit, von Schulversagen bedroht sind oder die durch irgendeine Art der Behinderung in ihren sozialen Aktivitäten beeinträchtigt sein könnten, in die Interaktionen der Klasse, aber auch in die Freundschafts- und Spielbeziehungen außerhalb der Schule einbezogen sind.
Andererseits wollte ich natürlich auch durch zusätzliche "harte" Forschungsdaten versuchen, die bisher zumeist nur positiven qualitativen Aussagen von beteiligten Eltern, Lehrern und Wissenschaftlern über die sozialen Beziehungen zu belegen.
Zudem wären beim Gelingen der emotional befriedigenden und sozial akzeptablen Beziehungen der behinderten Kinder auch die großen Zweifel von vielen Beamten der Schulbehörde, Politikern, Lehrern und Wissenschaftlern auf ihre Berechtigung hin untersucht und damit bestätigt oder ausgeräumt.
In neueren kinder- und jugendsoziologischen Studien wird generell auf die wachsende Bedeutung der Schule für die sozialen Beziehungen der heutigen Kinder und Jugendlichen hingewiesen (vgl. Allerbeck/Hoag, 1985). Begründet wird dieser Bedeutungsgewinn der Schule durch die verringerten Kontaktmöglichkeiten im alltäglichen, außerhäuslichen Lebensraum der Kinder und Jugendlichen und durch die gesunkene Geschwisterzahl.
"Für immer mehr Kinder sind Vorschule und Schule in den entscheidenden Jahren der Sozialentwicklung der einzige Ort, an dem andere Kinder gesucht und gefunden, intensiv beobachtet, geprüft und bewertet werden können, wobei der schützende Rahmen einer formellen Institution jederzeit Rückzugsmöglichkeiten und Sicherheit bietet." (PREUSS-LAUSITZ, 1988, S. 96).
"So ist es für Kinder unter 10 Jahren auch kaum möglich, in der Schule entstandene Freundschaften in der Freizeit fortzusetzen, wenn die anderen Kinder außerhalb des engeren Wohnumfeldes wohnen. Allenfalls wenige, deren Mütter sowohl Hausfrauen sind, als auch über Auto und Zeit verfügen, können erwarten, gelegentlich zu Kindergeburtstagen und besonderen Ereignissen gefahren zu werden; kaum jedoch alltäglich und nach eigener Planung mit Freunden."
(Ebd.).
Warum es mir persönlich sehr wichtig war, schon im Verlauf des zweiten Schuljahres und damit möglichst rechtzeitig auf Kinder in der Klasse zu achten, die sowohl in der Klassengemeinschaft als auch außerhalb der Schule eine soziale Randposition einnehmen, hat einen für mich persönlich sehr tiefen Hintergrund.
Immer wieder - und ich erlebe es auch heute noch - mußte ich in meiner Tätigkeit als Lehrer von Sonderschülern erfahren, mit welch ungeheurer menschlichen Tragik sich für diese "Sonder-Kinder" das Stigma "Sonderschüler" mit ihrem weiteren Leben verbindet.
Diese Kinder wurden und werden größtenteils auch heute noch z.T. mit ihren Familien aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen.
Kommen diese Kinder dann auch noch aus einer sogenannten "milieugeschädigten" Familie, dann ist ihre Chance auf eine Integration in unsere Gesellschaft auf ein Minimum gesunken.[23]
Für unseren Schulversuch war es daher doch bedeutsam, daß wohl bei der Zusammensetzung und Auswahl der nichtbehinderten Kinder die u.a äußerst wichtige Komponente des Wohnumfeldes berücksichtigt werden konnte, aber alle drei behinderten Kinder nicht aus dem Wohnumfeld der übrigen Kinder kamen, sondern zusätzlich erschwerend aus verschieden angrenzenden Nachbargemeinden.
Schwerpunkt meines Forschungskonzeptes war es, zunächst die sozialen Beziehungen innerhalb des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern m untersuchen und zusätzlich die Freundschaftsbildungen und tatsächlichen Sozialkontakte im Wohnumfeld außerhalb der Schule aufzuzeigen. Da mir mm Zeitpunkt meiner Untersuchung aus Österreich derartige Forschungsdaten über soziale Beziehungen aus Integrationsklassen nicht vorlagen, stützte ich mich auf ähnliche Untersuchungen von WOCKEN 1987 in Hamburger Integrationsklassen und von HEYER/PREUSS-LAUSITZ/ZIELKE 1988 in der Uckermark-Grundschule in Berlin, deren unveröffentlichter wissenschaftlicher Zwischenbericht mir vorlag. Die empirischen Untersuchungen in der Uckermark-Schule haben sich auf über 10 Fragestellungen bezogen, aus denen ich 5 modifizierte, für unsere Untersuchung relevante Fragen erstellt habe.
-
Wie sind die derzeitigen sozialen Beziehungen in der Klasse zur Mitte des zweiten Schuljahres und auf die gesamten Kinder der Klasse ausgerichtet?
-
Welche realen Nachmittagsbeziehungen und welche "unabhängigen" Einflußfaktoren erhalten hierbei eine besondere Bedeutung?
-
Wie gestalten sich insbesonders die sozialen Beziehungen der behinderten Kinder, ihre informelle Stellung in der Klasse, ihre tatsächlichen Nachmittagskontakte?
-
Fühlen sich die behinderten Kinder in der Klasse wohl oder leiden sie unter den teilweise vorhandenen Leistungsunterschieden?
-
Wie werden die sozialen Beziehungen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern von den Lehrern eingeschätzt?
Nach Auswertung der Untersuchung habe ich die Ergebnisse, dazu die Freizeitbeziehungen einschließlich einer Interpretation der Soziogramme den beiden Lehrern vorgelegt und mit ihnen besprochen.
Außerdem wurde an einem der folgenden Elternabende über diese Untersuchung mit den Eltern diskutiert.
Die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft versuchte ich, über die Schulbildung und die Berufe der Eltern zu dokumentieren.
Meine Informationen über die Berufe der Eltern und ihre Schulbildung stammen größtenteils aus einer Befragung der Eltern, dazu aus den Anmeldungsunterlagen an der Schule.
Stellung im Beruf der Erziehungsberechtigten
|
Bereich |
Berufssparten |
|
|
Arbeiter |
Metallarbeiter |
4 |
|
Angestellte |
Industriekaufmann Mechaniker Koch Techn. Angestellte Schlosser Kraftfahrer |
4 1 1 3 2 1 |
|
Beamte |
AHS-Lehrer Lehrer Dipl.Ing. |
2 1 3 |
|
Selbständige |
Kaufmann |
1 |
|
Sonst./ohne Angabe |
0 |
|
|
19 Mütter sind nicht berufstätig - Hausfrauen 2 Mütter sind halbtags berufstätig Von 4 /Arbeitern sind 3 Gastarbeiter |
Besuchte Schularten der Väter
Besuchte Schularten der Mütter
VS/HS = Besuch der Volksschule und Hauptschule
TS = Besuch einer türkischen Grundschule bzw. Hauptschule
AHS/BHS = Al1gemeinbildende/Berufsbildende höhere Schule
UNI = Studium an einer Universität
o.A. = ohne Angabe
Allgemein bieten sich für die Untersuchung der informellen Klassenstrukturen soziometrische Verfahren an. Ich habe das an der Uckermark-Grundschule in Berlin herangezogene Verfahren verwendet.
Dieses Untersuchungsverfahren wurde auf der Grundlage soziometrischer Verfahren nach PETILLON (1980) für die spezielle Situation der Untersuchung sozialer Beziehungen in einer Integrationsklasse entwickelt.
Da es mir in meiner Untersuchung nicht um Vergleiche mit anderen derartigen Studien ging, konnte ich auf eine nachträgliche Auswertung nach dem Verfahren von PETILLON verzichten.
Im angewandten Verfahren werden Ablehnungsstatus und Wahlstatus in einem integrierten Sympathiestatus zusammengefaßt. Somit kann die informelle Gesamtposition eines Schülers leichter überblickt und im folgenden Vergleich untersucht werden.
Die soziometrischen Fragen bezogen sich auf die Kinder aus der Klasse,
-
mit denen man besonders gern im Unterricht zusammenarbeitet,
-
mit denen man besonders gern nachmittags zusammen sein würde (auch wenn dies aus räumlichen oder anderen Gründen nicht ginge),
-
mit denen man auf keinen Fall nachmittags zusammen sein möchte (und warum nicht).
Es konnten jeweils beliebig viele andere Schüler genannt werden.
Der integrierte Sympathiestatus errechnete sich dann wie folgt:
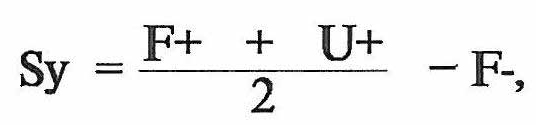
Wobei
F+ = Anzahl der erhaltenen Wahlen im Freizeitbereich,
F-= Anzahl der erhaltenen Ablehnungen im Freizeitbereich,
U+ = Anzahl der erhaltenen Wahlen im Unterrichtsbereich
Ulf Preuss-Lausitz interpretiert Schüler, die einen Sympathiestatus von + 2 und mehr erhielten als "besonders beliebte Schüler". Schüler, die einen Status von - 1,5 und weniger erreichten, als "weniger beliebt".
Diese können jedoch nicht insgesamt als Außenseiter interpretiert werden (ein Wert von - 1,5 ergibt sich schon dann, wenn ein Kind zwei Ablehnungen und eine Wahl erhält).
Als Außenseiter sind Kinder vielmehr erst dann anzusehen, wenn sie von einer erheblichen Gruppe der gesamten Klasse abgelehnt werden (von einem Drittel, in unserer Klasse also etwa von 7 Kindern oder mehr).
Die Strukturen der individuellen Sympathien und Abneigungen in der Klasse wurden von mir grafisch dargestellt.
Dazu ein Rangsoziogramm:
Erhebung nach der begrenzten, geordneten Wahlmethode. Die Auswertung und Darstellung erfolgte in Form eines Rangsoziogramms und eines konzentrischen Kreissoziogramms.
Die Ergebnisse wurden gewonnen:
-
durch Einzelgespräche mit den Schülern, um dadurch vor allem die tatsächlichen häufigeren Freizeit- und Schulkontakte zu erfassen,
-
durch Dokumentation und Beobachtung während des Unterrichts besonders in der Freien Arbeit und
-
durch Rückmeldungen der beiden Lehrer, wie sie die sozialen Beziehungen zwischen den behinderten und nichtbehinderten Kindern einschätzen.
Neben den sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse haben mich auch die tatsächlichen Sozialkontakte außerhalb der Schule interessiert. Ich habe dabei nach den Namen jener Kinder gefragt, mit denen die Schüler entweder in der Wohnung oder außerhalb derer häufiger zusammen sind.
Bei der Fragestellung verwendete ich die Methode von PREUSS-LAUSITZ und HITZLER "Soziale Beziehungen und Freizeitaktivitäten von Grundschülern" (unveröffentlichte Dokumentation der wissenschaftlichen Begleitung an der Uckermark-Grundschule in Berlin, 1988).
Hierbei wurde der Begriff Freundin bzw. Freund vermieden, da wie aus informellen Vorbefragungen festgestellt, dieser Ausdruck bei Kindern sehr unterschiedlich definiert wird. Es wurde nach jenen Kindern gefragt, mit denen sie öfter nachmittags zusammen sind, sich häufiger verabreden oder miteinander spielen, wobei durch die Nennung des Namens alle Kinder ausgeschlossen werden, die ein Kind zwar zuweilen - etwa auf einem Spielplatz - trifft, die aber außerhalb des engeren Interesses bleiben.
Eine weitere Frage war, ob diese Spielpartner aus der eigenen oder aus anderen Klassen der Schule stammen, ob sie noch vom Kindergarten her bekannt sind, ob es Geschwister oder andere Verwandte sind, oder ob sie aus Vereinen und anderen Institutionen bekannt wurden.
Eine zentrale These ist, daß der Sozialkontakt über die eigene Klasse für Schüler heute eine große Bedeutung hat. Diese Bedeutung wird verstärkt, wenn diese Kinder zugleich im engeren oder weiteren Wohnumfeld wohnen.
Zu überprüfen ist daher auch, ob die Spielpartner in der ''Nachbarschaft'' wohnen, wobei "Nachbarschaft" kein scharfumrissener Begriff ist.
Die Frage an die Kinder lautete: Wohnt dein Spielpartner "in der Nähe"? ("In der Nähe" bedeutet kurzer Weg, ohne Fahrzeug leicht zu erreichen).
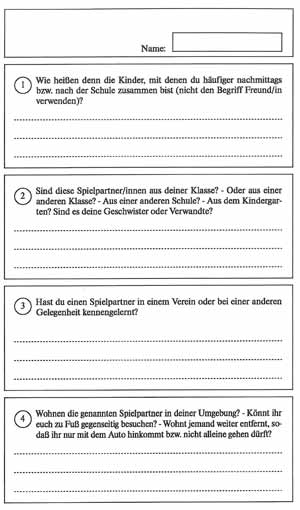
Volksschullehrer Roland Astl über Sabine:
"Sabine ist ein sehr kontaktfreudiges Mädchen. Sie zeigt keinerlei Scheu im Umgang mit anderen Kindern. Durch natürliche Gebärden tritt sie mit vielen Kindern (nicht mit allen) in Kommunikation. Sie versteht es, ihre Interessen beim spielerischen Umgang mit den anderen Kindern wahrzunehmen, auch wenn sie dabei kleinere Konflikte in Kauf nehmen muß. Sie steht in besonderem Kontakt zu einer Gruppe von Mädchen (J., E., M., C.), von denen sie sich vermutlich am besten verstanden fühlt.
Zu Buben hat sie eher weniger Kontakt. Das scheint mit den doch etwas verschiedenen Interessen zusammenzuhängen. Häufiger Kontakt besteht zu A. Auch von den Kindern der Klasse aus gesehen gibt es keine besonderen Auffälligkeiten. Die hörenden Kinder wissen, wie sie mit Sabine kommunizieren können. Ihr Defizit, "Gehörlosigkeit", wird respektiert und die Schwierigkeiten in der Kommunikation mit viel Phantasie durch natürliche Gebärden überwunden.
Durch die Sitzordnung (freie Wahl) und verschiedene Arbeitsformen (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit) ergeben sich mit fast allen Kindern Kontakte, die mehr oder weniger intensiv verlaufen.
Manche Kinder haben intensiveren Kontakt zu Sabine, manche wenig bis gar keinen.
Über die Kontakte außerhalb der Schule bin ich nicht ganz genau informiert. Aus den Erzählungen der Kinder weiß ich aber, daß sie durch die Entfernung nicht regelmäßig sind, aber doch bei verschiedenen Anlässen (Geburtstagsfeier, Schwimmkurs) stattfinden."
Sonderschullehrer Hans P. über Sabine:
"Sabine wird in der Klasse von allen Kindern akzeptiert. Sie war vor allem am Beginn des Schulversuchs Mittelpunkt, besonders für die anderen Mädchen. Auch zu privaten Feiern wird Sabine regelmäßig eingeladen."
Roland Astl über das Kind M1:
"M1 hat zu fast allen Kindern Kontakt. Eine emotional positive Beziehung beobachte ich zu K. und vereinzelt zu L. Einige Kinder verhalten sich ihm gegenüber neutral, mit vielen gibt es aber Konflikte. In vielen Fällen scheint das mit dem allgemein schwierigen Kontakt zu ausländischen Kindern zusammenzuhängen. M1 ist durch den Altersunterschied in Konflikten, die mit physischer Gewalt ausgetragen werden, meist der kräftigste. Das hat mitunter zur Folge, daß sich andere Kinder zusammenschließen, um gegen ihn besser auftreten zu können. Auch im Unterricht ergeben sich öfters Probleme. Da er Arbeitsanweisungen oft nicht vollständig oder gar nicht versteht, tritt er durch die Wiederholung von uns Lehrern oder der Kinder oft in den Vordergrund. Positiver Kontakt zu anderen Kindern bahnt sich nun im Turnunterricht an. Bei Spielen (Völkerball Staffelläufe, ....) bei denen sportliche, körperliche Leistung verlangt ist, spielt er eine wichtige Rolle."
Hans P. über das Kind M1:
''M1 sucht den Kontakt zu den Mitschülern oft vergeblich, da er durch seine geringen Deutschkenntnisse Probleme damit hat. Da M1 zwei Jahre älter ist als die anderen Kinder, ist er ihnen körperlich überlegen und baut Konflikte oft durch Raufereien ab. Er wird von ihnen daher eher gemieden."
Roland Astl über das Kind M2:
''Für M2 hat sich in der Klasse schon viel verbessert Es gelingt ihm öfters, nicht nur seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern auch auf die Wünsche der anderen Kinder einzugehen. Dennoch kommt es noch oft zu Konflikten. M2 ist vermutlich noch auf einem Entwicklungsstand, der ihn noch sehr in seiner Welt leben läßt. Am Beginn der Schulzeit hatte er intensivere Kontakte zu H. Er bezeichnete H. als seinen Freund, und sie waren viel zusammen. Durch die Stimmungsschwankungen von M2 und seine Unnachgiebigkeit z.B. bei Partnerarbeiten sind diese Kontakte wieder abgeflaut Derzeit sind für M2 nur unregelmäßige positive Kontakte mit kürzerer Dauer möglich. M2 ist sehr von positiver Verstärkung abhängig. Gelingt ihm ein Verhalten, das dies ermöglicht, ist er für bestimmte Aufgaben sehr zu begeistern."
Hans P. über das Kind M2:
''M2 hat große Probleme im Umgang mit den Mitschülern. Durch seine teilweise unberechenbaren Reaktionen (aggressiv, beleidigt, zornig, trotzig) wird er von den anderen Kindern in der Klasse eher abgelehnt Teilweise angebahnte Freundschaften werden durch oben beschriebenes Verhalten sehr schnell zerstört."
Aus der Tabelle des Rangsoziogramms ist zunächst zu erkennen,
-
daß im allgemeinen die Mädchen von Mädchen und die Buben von Buben gewählt oder abgelehnt wurden,
-
daß ein Bub in der Klasse besonders beliebt ist und etwa gleich viel positive Wahlen von seinen Mitschülern (7) wie von seinen Mitschülerinnen (8) erhalten hat,
-
daß neben zwei Knaben (Ml/M2) auch ein Mädchen mehr als zwei negative Wahlen erhalten hat.
Sabine ist besonders gut in die Klasse eingebunden. Es werden sowohl die Aussagen der Lehrer als auch meine Beobachtungen bestätigt, daß Sabine durch ihre aufgeweckte, natürliche und freundliche Art in der Klasse beliebt ist.
M1 und M2 haben je fünf negative Wahlen erhalten. Aus meiner Beobachtung während des Unterrichts und insbesonders der "Freien Arbeit" habe ich den Eindruck gewonnen, daß beide Buben recht gut im Klassenverband eingebunden sind. Hier sind es zumeist - nach Beobachtungen beider Lehrer - eher kleine Begebenheiten·in der Pause, auf dem Gang und dergleichen, wo es mit den Mitschülern zu kleinen "Auseinandersetzungen" kommt.
Nachdem 17 Mitschüler in der Klasse weder eine positive noch eine negative Aussage getroffen haben, sind beide Kinder für ihre Mitschüler sicherlich keine Belastung, was auch alle Unterrichtsbeobachtungen bestätigen.
Soziogramm
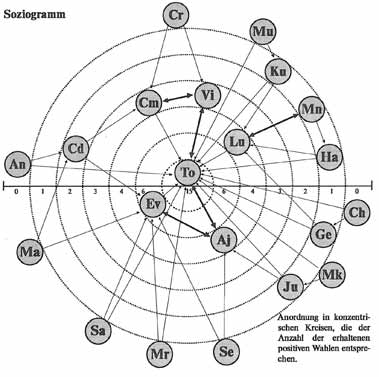
Anordnung in konzentrischen Kreisen, die der Anzahl der erhaltenen positiven Wahlen entsprechen
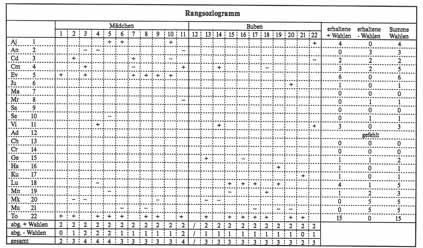
5 Kinder erhielten Sympathiewerte von +2 und mehr - sie sind wohl besonders beliebt. Unter diesen fünf Kindern befindet sich auch Sabine.
13 Kinder liegen im mittleren Bereich von +1,5 bis -1. Unter diesen 13 Kindern sind auch K und S., zwei Kinder von türkischen Gastarbeiterfamilien.
4 Kinder liegen im Bereich von -1,5 bis -5. Unter diesen vier Kindern sind M1 und M2. Diese 4 SchülerInnen, die eventuell als "weniger beliebt" angesehen werden können, sind aber sicher nicht als Außenseiter anzusehen, sie müßten von noch mehr Kindern der Klasse abgelehnt werden.
Außerdem wurden zwei Kinder (davon auch M1) von einem Kind der Klasse (aus dem obersten Bereich der Sympathiewerte) als ständige Freizeitpartner angegeben.
T., mit einem Sympathiewert von + 7,5 und 15 positiven Wahlen hat z.B. nach eigenen Angaben kennen Freizeitpartner aus der eigenen Klasse.
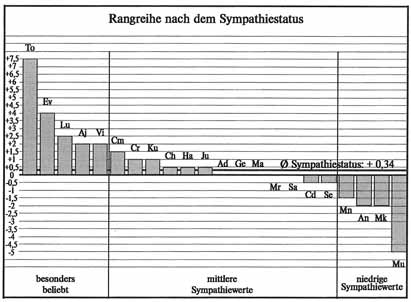
Gerade unter dem Aspekt des Aufbaues von über die Schule hinaus wirkenden, auch länger anhaltenden sozialen Beziehungen scheinen mir die Untersuchungen der nachmittäglichen Beziehungen von großem Gewicht.
Ich habe die Kinder der Klasse über ihre regelmäßigen Freizeitpartner befragt. Dabei habe ich festgehalten, wie diese Partner heißen und vor allem, ob sie aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aus der eigenen Klasse, den übrigen Klassen der Schule, aus dem Kindergarten oder einem Verein bekannt sind, oder ob es sich um Verwandte bzw. Geschwister oder um andere Kinder (etwa um Kinder von Freunden der Eltern) handelt.
Ich habe ausdrücklich nicht nach "Freunden" gefragt, da dieser Begriff von den Kindern eventuell falsch oder sehr unterschiedlich definiert wird, sondern nach jenen Kindern, mit denen sie öfter nachmittags zusammen sind, sich häufiger verabreden oder miteinander spielen.
Auf dieser Ebene konnten die Kinder doch recht präzise Angaben machen. Die Angaben der Kinder habe ich dann - ebenso wie die Soziogramme - grafisch dargestellt und mit den Lehrern besprochen. Besonders wurde über jene Kinder gesprochen, bei denen eine eventuell eingeschränkte nachmittägliche Isolation festgestellt wurde.
Im Durchschnitt hat jedes Kind der Klasse regelmäßige Freizeitpartner am Nachmittag (einschließlich der Geschwister, mit denen sie häufig etwas zusammen unternehmen).
Drei der Schüler müssen eventuell als eingeschränkt isoliert angesehen werden. Diese 3 Kinder konnten nur einen Bruder, eine Schwester bzw. ein verwandtes Kind als Freizeitpartner benennen. Eine völlige soziale Isolation am Nachmittag konnte aber bei keinem Kind festgestellt werden. Jedes Kind der Klasse hat zumindest einen (ausgenommen Sabine) regelmäßigen Freizeitpartner. Festzustellen ist, daß für Kinder in diesem Alter die Geschwister noch eine wichtige Rolle als Spielpartner in der nachmittäglichen Freizeit darstellen. Recht ausgeglichen ist auch die Anzahl der Freizeitpartner. Die Knaben haben etwa gleich viele Spielpartner wie die Mädchen.
15 Kinder haben Kontakte zu Kindern aus der Nachbarschaft bzw. aus ihrem Wohnumfeld. Etwa die Hälfte der Kinder (10) hat zudem häufigere Beziehungen zu Spielpartnern aus der eigenen Klasse. Daraus könnte man ableiten, daß die eigene Klasse nur zu 50% der Ort ist, an dem Freizeitbeziehungen gebildet worden sind. Diese 50% entsprechen aber genau der Zahl jener Kinder, die im gemeinsamen Wohnumfeld wohnen und sich gegenseitig und allein besuchen können.
Dies bestätigt, daß die Nachbarschaft der Kinder ein zentrales Vermittlungsfeld festerer sozialer Beziehungen darstellt. Es bestätigt sich auch, daß die eigene Klasse ein wichtiger Ausgangspunkt für soziale Beziehungen ist. Alle Kinder des Wohnumfeldes sind durch soziale Kontakte eingebunden. Dies verstärkt meine Ansicht, daß Kinder eines Wohnumfeldes gemeinsam eine Klasse besuchen sollten und erhärtet auch die Problematik, wenn behinderte Kinder aus ihrem Wohnumfeld gerissen werden und somit auch die Kontakte zu den Nachbarkindern verloren gehen.

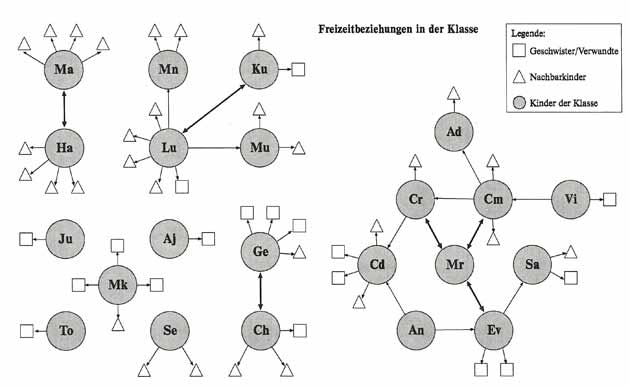
Wohnskizze - Lageplan der Schule
Anmerkung von bidok:
Aus Datenschutzgründen wurde die Wohnskizze entfernt
Zu Sabine:
So intensiv und gut Sabine während des Unterrichts innerhalb der Klasse eingebunden ist, so schwierig und wenig sind ihre derzeitigen außerschulischen sozialen Beziehungen und Partnerschaften. Nur gelegentlich ergibt sich die Möglichkeit zum gemeinsamen Spiel mit ihrer, in der Nachbarschaft wohnenden Cousine Pr.
Dadurch, daß Sabine derzeit für alle Kinder der Klasse noch nicht alleine (zu Fuß) zu erreichen ist[24] - und umgekehrt -, haben sich gegenseitige Einladungen (durch Absprachen der Mütter) bisher nur zu privaten Feiern (Geburtstage) der Kinder - diese aber regelmäßig - ergeben.
Außerdem erhält Sabine nach der Schule zur Unterstützung fast täglich logopädische Therapie und Hauslernhilfe und könnte daher nur am Wochenende ohne Einschränkung oder Zeitdruck andere Kinder besuchen bzw. zu sich einladen.
Nach Aussage der Mutter wäre Sabine auch zumeist zu müde, um noch zu anderen Kindern gebracht zu werden bzw. Kinder zu sich einzuladen. Meiner Ansicht nach ist die Müdigkeit am Nachmittag dadurch zu erklären, daß Sabine am Vormittag während des Unterrichts nach meinen Beobachtungen sehr aufmerksam ist, es für ein gehörloses Kind wahrscheinlich eine viel größere Anstrengung bedeutet, durch seine Behinderung dem Unterricht zu folgen und aktiv daran teilzunehmen.
Außerdem wird Sabine nicht nur durch die Lehrer immer wieder zu großer Aufmerksamkeit gefordert, sondern auch dadurch, daß sie von sich aus versucht, alle Aktivitäten, alle Gespräche ihrer Mitschüler zu verfolgen, zu verstehen und nachzuvollziehen.
Ich glaube, daß wir bisweilen zu wenig beachten, welch große Anstrengung der gesamte Schulalltag für ein achtjähriges gehörloses Kind bedeutet. In Absprache mit den Lehrern und der Mutter von Sabine muß im kommenden Halbjahr bzw. in den kommenden Jahren gezielt versucht werden, für das Mädchen nachmittägliche Kontakte mit anderen Kindern verstärkt herzustellen.
Von Bedeutung ist aber, daß Sabine einmal wöchentlich am späten Nachmittag ca. 2 Stunden in der Jugend- bzw. Kindergruppe des Turnvereines turnt und dort nach Aussage der Übungsleiterin mit viel Spaß und Einsatz mitmacht, auch überaus guten Kontakt zu den anderen Kindern hat und sich auch mit allen Kindern "lebhaft unterhält".
Zum Schüler M1:
Als Gastarbeiterkind, das auch zwei Jahre älter ist als die übrigen Mitschüler, hat M1 recht gute Kontakte zu anderen Kindern am Nachmittag. Dadurch, daß M1 auch außerhalb von Reutte im sogenannten "Bad Kreckelmoos"[25] wohnt, sind seine Freizeitpartner größtenteils Kinder von benachbarten Familien des Hauses. M1 ist aber groß genug, daß er allein nach Reutte gehen kann, sich auch gelegentlich mit Klassenkameraden trifft, aber auch im Sommer zu den benachbarten Sportplätzen von Reutte und Breitenwang geht bzw. im Winter zu den Eislaufplätzen. M1 beteiligt sich dabei auch aktiv am Sport. Vor allem im Sommer beim Fußballspiel, da mehrere Buben aus seinem Wohnhaus im Sportverein Reutte aktiv Fußball spielen. Eine zusätzliche Steuerung und Verstärkung von Kontakten am Nachmittag scheint bei M1 nicht erforderlich zu sein.
Zum Schüler M2:
Auch M2 wohnt, wie Sabine, nicht im Wohnumfeld der übrigen Kinder der Klasse.[26] Da M2 noch weiter entfernt von den übrigen Kindern der Klasse wohnt, haben sich bisher sehr selten nachmittägliche Kontakte zwischen ihm und seinen Mitschülern ergeben. M2 lebt bei Pflegeeltern, hat einen Bruder, den er nicht kennt, auch seine Mutter und seinen Vater sieht er kaum. Nach Aussage der Pflegemutter leidet M2 doch sehr darunter. Für M2 sind die weiteren drei Kinder der Pflegefamilie "seine Geschwister". Hier ist M2 doch recht gut in eine außerschulische Spielgemeinschaft eingebunden. Außerdem hat sich in den letzten Monaten eine Freundschaft mit einem benachbarten Buben angebahnt, dessen Eltern vor ca. einem Jahr dorthin gezogen sind. Das öfters noch "eigenwillige" Verhalten von M2 wird von den Eltern des befreundeten Buben - nach Rücksprache mit der Pflegemutter von M2 - akzeptiert und auch berücksichtigt. Außerschulisch lernt M2 jetzt in einer kleinen Jugendgruppe Flöte spielen. Außerdem musiziert er in der Kirche mit anderen Kindern des Dorfes.
Auch für M2 wäre es gut, wenn er zudem noch verstärkt Kontakte mit Mitschülern aus seiner Klasse hätte.
Zusammenfassend muß festgehalten werden, daß es für alle drei behinderten Kinder ein Nachteil ist, daß sie nicht im Wohnumfeld der übrigen Kinder leben.
Zudem hat Sabine auch keine Geschwister und lebt mit ihrer Mutter und Großmutter allein. Bei M2 -als Pflegekind - muß doch von einer stärker "familienzentrierten" Akzentuierung der Kontakte ausgegangen werden. Auch M1 wohnt nicht im unmittelbaren Wohnbereich der übrigen Kinder, er muß etwa 3 km zu Fuß nach Reutte gehen. Gerade M2 und Sabine zeigen aber deutlich, daß es von Vorteil und wichtig wäre, würden behinderte Kinder aus dem Wohnumfeld der übrigen Kinder kommen. Gerade für sie wäre der Aufbau sozialer Beziehungen in der außerschulischen Freizeit über die eigene Klasse besonders wichtig.
Für M2 sind wohl seine "Geschwister" größtenteils der Ersatz für fehlende Spielpartner. Sabine ist sehr viel allein mit ihrer Großmutter, da die Mutter berufstätig ist. Gerade aus den Erkenntnissen dieser beiden Kinder müßte man die Forderung erheben, daß jedes behinderte Kind in "seine Schule" gehen kann. Das heißt, Sabine in Lechaschau - das Schulhaus wäre für Sabine in nur 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Auch für M2 würde dies in seinem Heimatdorf Pflach zutreffen.
Für alle drei Kinder aber gilt, daß sie innerhalb der Klasse ein offenes, herzliches soziales Klima vorfinden. Sie haben innerhalb der Klasse Freunde und Freundinnen, können ihre Sympathien gegenüber ihren Mitschülern umsetzen, was nach meinen Unterrichtsbeobachtungen durchaus auf Gegenseitigkeit beruht.
Es wäre besonders für M2 und Sabine wünschenswert, wenn durch das gemeinsame Erfahrungsfeldder Klasse sich in Zukunft die Möglichkeit ergäbe, die Kontakte innerhalb der Klasse in außerschulische Freundschaften umzusetzen.
[23] So haben sich zwei meiner ehemaligen Sonderschüler im Alter von etwa 20 Jahren des Leben genommen.
[24] Sabine wohnt in der Nachbargemeinde Lechaschau und wird mit dem Schulbus zur Schule gebracht und wieder abgeholt.
[25] Kreckelmoos" - ehemaliges Krankenhaus vom Bezirk Reutte. Heute wohnen dort nur Gastarbeiterfamilien, aber teilweise unter sehr schlechten Verhältnissen.
[26] ) M2 wohnt in der Nachbargemeinde Pflach und wird mit dem Schulbus zur Schule gebracht und wieder abgeholt.
Inhaltsverzeichnis
Im damaligen Schulversuchsantrag an das BMUKS hatten wir u.a. schriftlich vermerkt:
"Die integrative Klasse wird von den Lehrern Roland Astl, Volksschullehrer, und Hans P., Sonderschullehrer und Logopäde, unterrichtet. Beide Lehrer haben sich schon an der Ausarbeitung des Projekts beteiligt Sie kennen sich und sind bereit, in der integrativen Klasse zu kooperieren. Die Klasse wird in Teamarbeit unterrichtet"
Ohne es zusätzlich schriftlich festgehalten zu haben, sind wir davon ausgegangen, daß beide Lehrer alle Kinder der Klasse gleichverantwortlich unterrichten und es damit weder finanzielle noch betreffend zu unterrichtende Stunden u.ä, Unterschiede gibt.
Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern bricht radikal mit dem Bestreben, in den Klassen möglichst homogene Lerngruppen zu bilden.
"Eine Integrationsklasse ist bejahte und gewollte Heterogenität" (WOCKEN, 1991).
Wir haben daher zunächst zu fragen: Kann ein einzelner Lehrer so viele verschiedene Kinder mit so unterschiedlichen Begabungen und Interessen, also mit so unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, gemeinsam unterrichten?
Kann ein einzelner Lehrer eine stetige Individualisierung, die eine so heterogene Gruppe von Schülern erforderlich macht, in seinem Unterricht leisten? Wenn wir eine ehrliche Antwort geben, kann sie nur lauten: Ein einzelner Lehrer kann dies nicht leisten!
Denn gerade die große Verschiedenartigkeit der Förderbedarfe behinderter und nichtbehinderter Kinder innerhalb eines gemeinsamen Unterrichts erfordert eine Vielzahl an pädagogischen Kompetenzen, die einem Lehrer allein nicht abverlangt werden können. Der Unterricht einer heterogenen Schülergruppe, wie sie eine Integrationsklasse darstellt, bedarf eines pädagogischen Teams.
WOCKEN schreibt (Pädagogische Impulse, Nr. 1, 1991) in seinem Aufsatz »Pädagogen arbeiten im Team«:
''Eine wissenschaftliche Begründung für das Team-System liefert die Systemtheorie. Das Zauberwort heißt "Komplexitätsreduktion". Eine heterogene Schülergruppe stellt ein solches Problempotential dar, das ohne Komplexitätsreduktion nicht bewältigt werden kann. Weil Integration eine Komplexitätsreduktion auf der Schülerseite durch Bildung homogener Gruppen nicht zuläßt, muß kompensatorisch die Komplexität auf der Lehrerseite erhöht werden. Der Komplexität einer heterogenen Schülergruppe muß die Komplexität des Pädagogen-Teams entsprechen, dann ist das Verhältnis wieder im Lot"
Die Zusammenarbeit von Lehrern zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder scheint aus den zuvor genannten Schlußfolgerungen zunächst die Lösung des Problems zu sein, wie den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und Lernmöglichkeiten einer integrativen Schü1ergruppe entsprochen werden kann. Zu den allgemein anerkannten Grundsätzen einer integrativen Pädagogik (vgl. Muth, 1986; Feuser, 1987) gehört heute das Prinzip der "multiprofessionellen Betreuung" (WOCKEN, 1988, S. 201). Aber gerade diese gedachte Problemlösung, ist das "zentrale Problem" (REISER, 1984, S. 309) geworden.
Warum ist die Kooperation für Lehrer so schwierig? Warum gelingt diese Kooperation oftmals schlecht oder überhaupt nicht?
Eine Fülle neuer Fragen und Probleme haben sich aufgetan, gerade im Zusammenhang mit der Problematik einer integrativen Schülergruppe, also Kindern mit so unterschiedlichen Lernvoraussetzungen.
Wir haben uns zu fragen:
-
Welche Lehrer mit welcher pädagogischen Profession sollten günstigenfalls in einer Integrationsklasse zusammenarbeiten?
-
Ist es der Regelschullehrer mit dem Sonderschullehrer, oder können auch zwei Regelschullehrer in einer Integrationsklasse unterrichten, wenn sie sich das nötige sonderpädagogische Fachwissen aneignen? Welche Ausbildung braucht der Sonderschullehrer?
-
Wie und in welchem Ausmaß sind die Eltern, sind die Therapeuten oder auch andere Personen eingebunden? Genügt eventuell eine Unterrichtshilfe (z.B. Zivildiener)?
-
Wie sind qualitativ die Unterrichtsaufgaben auf die unterrichtenden Lehrer verteilt? Wie wird die Kooperation organisiert?
-
Unterrichten die Lehrer alle gleich viel und dieselben Unterrichtsstunden gemeinsam?
-
Sollte der Sonderschullehrer ständig in der Klasse anwesend sein, oder genügt z.B. eine ambulante Beratung?
-
Brauchen Lehrer, die in Integrationsklassen unterrichten, eine spezielle Vorbereitung und Ausbildung? Ist eine begleitende Supervision erforderlich, u.a.m.?
Als wir den Schulversuch begannen, standen wir, d.h. natürlich insbesonders die beiden in der Integrationsklasse unterrichtenden Lehrer, vor sehr vielen dieser noch offenen Fragen. In Österreich gab es zu diesem Zeitpunkt noch kaum wissenschaftlich belegte Berichte, die die Erfahrungen eines Lehrerteams über mehrere Schuljahre hindurch dokumentieren. So konnten wir uns nur auf einige wenige Erfahrungsberichte aus der Bundesrepublik Deutschland stützen (FEUSER 1987; WOCKEN, 1988; ZIELKE, 1988).
Für die beiden Lehrer und auch für mich bedeutete dies: »Es ist ein Schulversuch, und wir werden versuchen, aus eigenen Erfahrungen unsere Erkenntnisse zu gewinnen.«
Aus meinen persönlichen Erfahrungen als Lehrer, aber auch schon aus den ersten Erfahrungen des integrativen Schulversuchs in Weißenbach (s. Kap. III/2.4.1, S. 65 ff.), bestätigte sich die Aussage:
"Die Zusammenarbeit von Lehrern, Erziehern und Sonderpädagogen erweist sich als Brennpunkt des Geschehens." (KREIE, 1985, S. 9).
Die Kooperation der Lehrer bildet den "Brennpunkt" der Integrationspädagogik (vgI. WOCKEN, 1988, S. 202).
Kooperationsprobleme werden oftmals mit fehlenden Kooperationserfahrungen der Lehrer in Verbindung gebracht. Sind für einen Lehrer Formen der Kooperation in einem gemeinsam durchgeführten Unterricht nicht etwas Außergewöhnliches?
Von Beginn seiner Tätigkeit an war und ist er - außer in besonderen Ausnahmefällen - in seiner Tätigkeit auf sich selbst gestellt. Ausnahmen bilden zumeist nur Hospitationen oder der Besuch einer Schulaufsichtsperson, die ja zumeist nicht am Unterricht teilnimmt. Wann erfährt ein Lehrer in seiner Tätigkeit eine Bestätigung oder aber auch eine Kritik? Lehrer sind "von Anfang an darauf orientiert und spezialisiert, nicht zu kooperieren" (FEUSER. 1987, S. 170)!
Vielfach erlebe ich in persönlichen Gesprächen mit Lehrern die von KREIE diagnostizierte "Angst des Lehrers vor der Zweisamkeit" (zit. n. KREIE, 1985, S. 41 in: WOCKEN, 1988, S. 203). In seiner Klasse ist der Lehrer völlig auf sich allein gestellt. Er muß mit allen Schwierigkeiten und Problemen, die der Unterrichtsalltag mit sich bringt, allein fertig werden. Hätte ein Lehrer irgendwelche Schwierigkeiten in seiner Klasse, müßte er doch sehr rasch um seinen guten Ruf, um sein Ansehen, ein "guter" Lehrer zu sein, fürchten.
Wer keine Probleme hat, ist ein guter Lehrer!
Gerade diese Angst, diese Unsicherheit, die den Lehrer seine Sicherheit hinter einer verschlossenen Klassentür suchen läßt, hat so gravierende negative Folgen für eine Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Kollegen. So beschränken sich Kontakte zumeist nur auf außerunterrichtliche Bereiche und nur sehr selten auf eigentliche Kernbereiche des Lehrerberufes.
Natürlich sind die in Integrationsklassen unterrichtenden Lehrer ebenso in das seit kurzem bestehende Schulsystem eingebunden, und doch bestehen ganz erhebliche Unterschiede zu den in ihren Klassen allein unterrichtenden Lehrern. Das wichtigste Merkmal eines Lehrerteam-Systems sehe ich darin, daß die Verantwortung für den gesamten Unterricht gemeinsam von mehreren Lehrern (evtl. auch ergänzend durch weitere Personen) für eine Klasse getragen wird.
WOCKEN (1988, 1991) unterscheidet in loser Anlehnung an das Modell der themenzentrierten Interaktion von COHN (1975) bei der Strukturanalyse kooperativer Arbeit nach 4 Komplexbereichen.
Diese 4 Themenbereiche sind:
-
Die Persönlichkeit der Pädagogen,
-
das pädagogische Konzept,
-
die Beziehungskultur des Teams und
-
die Rahmenbedingungen der Teamarbeit.
Es versteht sich, daß alle 4 Bedingungskomplexe selbstverständlich miteinander verschränkt und verwoben sind und sich auch wechselseitig bedingen.
In der Literatur finden sich immer mehr Vorstellungen über "diese Lehrer", die bereit und dazu fähig sind, kooperativ in einem Team zu unterrichten. So stellt FEUSER (1987, S. 174) folgenden Anspruch an Lehrer im integrativen Unterricht:
"Integrativer Unterricht verlangt letztlich im Sinne des Kompetenztransfers, ständig selbst neu zu lernen. seine Einstellungen und Haltungen zu revidieren. lieb und stabilisierend gewordene Rollen abzulegen und neue zu übernehmen und selbst die bisher Sicherheit und Stabilität, vor allem aber auch Anerkennung vermittelnde Praxis zugunsten einer neuen aufzugeben."
Es sind hohe Anspruche, die FEUSER an diese Lehrer stellt, und es erwächst daraus die Frage: Können und wollen sich Menschen so völlig verändern?
Es ist zunächst wichtig, daß gemeinsam unterrichtende Lehrer sich dessen bewußt sind, daß Teamarbeit u.a. eben auch heißen kann: Verlust an Privatheit!
Es bedeutet, daß der Schutzmechanismus des eigenen Klassenzimmers, das bislang die persönliche und berufliche Identität schützend einhüllte, nicht mehr funktioniert. Wer ich als Person bin und was ich als Lehrer leiste und kann, ist nicht mehr zu verbergen, sondern wird im Team öffentlich.
Das nun wesentlich Neue in der Arbeitssituation eines im Team arbeitenden Lehrers ist, daß praktisch in jeder Situation ein anderer Erwachsener ihn begleitet. Es bleibt nun keine Handlung, kein emotionaler Bezug und praktisch kein Wort zu den Kindern weiterhin unbeobachtet oder ungehört. Sein pädagogisches Handeln wird transparent und der Öffentlichkeit, die gerade in diesem Bereich sehr empfindsam reagiert, zugänglich.
Arbeiten Lehrer im Team in einer Klasse, ist das pädagogische Handeln mit Öffnung verbunden. Damit werden aber auch die eigenen Fähigkeiten preisgegeben und natürlich meist voll gefordert. Die eigene Selbstbewertung, die zuvor im isolierten Klassenzimmer stattfand, ist nun dem kritischen Urteil des oder der Teammitarbeiter ausgesetzt. Natürlich kann durch die Arbeit in einem Team eine berufliche Qualifikation auch eine Bestätigung erfahren. Andererseits aber können persönliche Begrenzungen und Mängel auch oftmals schonungslos offengelegt werden.
Künstliche Hüllen fallen zumindest recht rasch, und es zeigt sich die nackte Wahrheit darüber, was der einzelne als Lehrer kann und was er nicht kann.
Die Offenheit und Enthüllung, die eine tägliche Kooperation im Team herbeiführt, beschränken sich sicherlich nicht nur auf die berufliche Lehrerrolle, sondern reichen vielfach in ganz intime, persönliche Bereiche. Es verfließen die Grenzen zwischen beruflicher und privater Sphäre. So werden z.B. die persönliche Arbeitszeit und der Aufwand für eine Vorbereitung vor dem Partner ebenso offen dargelegt, wie auch die Qualität dieser Vorbereitung.
Vielfach werden persönliche Stimmungen, die individuelle Tagesverfassung und Probleme in das Team hineingetragen. Es zeigt sich, daß der Lehrer desto transparenter für den Partner oder für das gesamte Team wird, je intensiver die Kooperation ist bzw. je intensiver auch die Kommunikation zwischen den Partnern verläuft. Vielfach bringt die ungewohnte Teamsituation Verunsicherung und vor allem Angst mit sich. Angst, daß man durchschaut wird, der andere die Grenzen erfährt und man dadurch negativ beurteilt wird. Je geringer das berufliche Selbstwertgefühl ist, desto größer ist wohl die Angst vor einer kooperativen Zusammenarbeit im Team. Lehrer, die im Team arbeiten, können dadurch evtl. ihre bisherige persönliche wie berufliche Identität bedroht sehen.
"Auf der Persönlichkeitsebene bedeutet Teamfähigkeit daher die angstfreie Bewältigung von Offenheit." (WOCKEN, 1991).
Wie und wo kann die Bewältigung von Offenheit gelernt werden?
''Die bestmögliche Einübung der Bewältigung von Offenheit ist daher, wenn Pädagogen wirklich leben und am wirklichen Leben teilhaben. Es kommt darauf an. die Kommunikation mit Kindern zu ergänzen und durch eine Kommunikation mit Erwachsenen und die Vereinsamung im Klassenzimmer aufzubrechen durch eine tätige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben." (WOCKEN, 1988, S. 213 - 214).
Arbeiten Lehrer im Team, so bedeutet dies allemal einen Verlust an Autonomie und eine Beschränkung von Möglichkeiten, die der einzelne Lehrer bisher in seiner Klasse besaß. Konnte der allein in der Klasse agierende Lehrer seinen Unterricht nach seinen ganz persönlichen Vorstellungen und Zielsetzungen planen und gestalten, ohne andere zu fragen und ohne sich mit anderen abstimmen zu müssen, so wird der Unterricht in einer Integrationsklasse zur Aufgabe mehrerer Lehrer und noch weiterer Personen.
So wirft nicht nur die Heterogenität einer integrativen Schülergruppe eine Vielzahl von Sachproblemen auf, sondern auch die Heterogenität der Lehrer. "Sachprob1eme, die eine schier unerschöpfliche Quelle für Kooperationsprobleme darstellen" (WOCKEN, 1988, S. 215).
Die Konfliktebene der Heterogenität der Lehrer, die in kooperativer Arbeit den Unterricht in einer Integrationsklasse vorbereiten und gestalten, hat FEUSER wie folgt herausgearbeitet.
"Die Zusammenarbeit der Lehrer setzt für einen angestrebten Verlauf des Unterrichtsgeschehens voraus, sich in gemeinsamer Planung abzustimmen, curriculare und didaktische Fragen bezüglich der Unterrichtsformen zu diskutieren und zu klären, sich wechselseitig ausreichend zu informieren, möglichst widerspruchsfrei und reibungslos in einem gemeinsamen Unterrichtsfeld zu agieren und die Arbeitskraft unter lehr- und lernökonomischen Gesichtspunkten in den realen Unterrichtssituationen klug einzusetzen." (1987, S. 169).
Um die gemeinsamen Ziele und Aufgaben eines integrativen Unterrichts bewältigen zu können, erfordert es zunächst einen grundlegenden Konsens zumindest in den wichtigen pädagogischen und unterrichtlichen Fragen. Das erforderliche Konzept einer integrativen Pädagogik hat WOCKEN (1991) in 4 Kernbereichen zusammengefaßt:
"Ziele und Aufgaben integrativer Erziehung: Verhältnis verbindlicher Lehrplanziele und individueller Anforderungsprofile; Verhältnis von fachlichem und sozialem Lernen; Verhältnis von Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsentwicklung.
Pädagogische Grundhaltungen und Erziehungsstile: Lehrer-Schüler-Verhältnis; pädagogische Wertorientierungen: Menschenbild und Verständnis von Behinderungen; Verhältnis von Führen und Wachsenlassen.
Unterrichtsorganisation: Verhältnis von individuellen und gemeinsamen Lernsituationen: Freie Arbeit, Projekte und Lehrgänge; Methoden der Bestätigung; Ermutigung und Bestrafung.
Regeln und Rituale der Gruppe: Ordnungen und Spielregeln des Zusammenlebens in der Gruppe; Rituale geselligen Lebens; Formen der Selbstverwaltung und Mitbestimmung; Formen der Konfliktregelung."
Ein zentraler Punkt aber ist für WOCKEN, daß das pädagogische Konzept eines in Kooperation arbeitenden Teams sich erst aus der Arbeit entwickelt und letztlich niemals gänzlich abgeschlossen ist. Auch ist die ungeschriebene pädagogische Verfassung eines Teams der Spiegel seines pädagogischen Selbstverständnisses und eine unentbehrliche Orientierungsgrundlage, die eben das alltagspraktische Handeln leitet und außerdem erst ein übereinstimmendes pädagogisches Handeln aller am Unterricht beteiligten Personen ermöglicht (vgl. ebd.).
WOCKEN schreibt, daß die Beziehungskultur eines Teams wahrlich - im mehrdeutigen Sinne des Wortes - ein Brennpunkt ist und daß dazu zweierlei gehört:
''Erstens die Aufgaben- und Rollendifferenzierung im Team (Beziehungsstrukturen) und zweitens die kommunikativen und kooperativen Prozesse im Team (Beziehungsprozesse)" (ebd.).
Hier stellt sich zunächst die Frage: Wer macht was? Wie sind die Aufgaben und Rollen im Team verteilt?
Es geht also u.a. um die arbeitsteilige Bewältigung einer sehr komplexen pädagogischen Aufgabe durch Lehrer mit unterschiedlicher Ausbildung und Qualifikation (Volksschullehrer - Sonderschullehrer). Da jeder Lehrer ein unterschiedliches Selbstverständnis in die gemeinsame Arbeit einbringt, sind Aufgaben und Zuständigkeiten im Team neu zu klären und aufeinander abzustimmen. Eine zentrale Bedingung integrativen Unterrichts formuliert FEUSER (1987, S. 205) so:
''Eine wesentliche Bedingung für die Realisierung der Kooperation in der Praxis ist, daß Grund- und Sonderschullehrer gleichwertige Partner im integrativen Unterricht sind, die beide den Unterricht führen und/oder begleiten und damit wechselweise unterrichtsinitiierende und unterrichtsstützende Funktionen übernehmen."
In unserem konkreten Schulversuch war dies die Maxime, an der sich die beiden Lehrer in ihrem Unterricht über die gesamten 4 Schuljahre nicht nur orientierten, sondern nahezu "ideal" umzusetzen vermochten.
Die prozessuale Seite betrifft die kommunikativen Haltungen und das kooperative Verhalten der Lehrer innerhalb ihrer Arbeit im Team. "Können wir miteinander" ist zunächst die Frage, was letztlich bedeutet:
Wie geht man miteinander um, und wie wird miteinander gearbeitet? Wie und wann werden z.B. gemeinsame Unterrichtsplanungen gemacht, oder wann ist die Zeit für Aussprachen, Reflexionen u.ä.. Es bedeutet aber auch, wie und in welcher Form werden Krisen und Konflikte bewältigt?
"Jedes Team entwickelt im Laufe der Zeit einen eigenen Arbeitsstil und eine unverwechselbare Kultur der kommunikativen Beziehungen." (WOCKEN, 1991).
Unterrichten Lehrer in einer staatlich-öffentlichen Schule, dann sind sie eingebunden in ein gesellschaftliches System, das sowohl den Rahmen der äußeren Bedingungen als auch durch gesetzliche Vorgaben in den Prozeß einer Teamarbeit fördernd oder hemmend, unterstützend oder erschwerend eingreift. Wesentliche Bedingungen sind u.a.:
-
Regelung der Arbeitszeiten,
-
Regelung der Gehaltsfragen,
-
Regelung der unterstützenden Einrichtungen ( ambulante Hilfen, Fachberatung, Fortbildung, Supervision u.a.m.),
-
Regelung der materiellen Ausstattung (z.B. auch Räumlichkeiten) und
-
Regelung der administrativen Unterstützung durch Schulaufsicht, Schulverwaltung und Schulleitung.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Schulversuche gemäß § l3la SchOG in Kooperation mit den wissenschaftlichen Betreuern in den Bundesländern erstellt (Erlaß des BMUK. GZ.: 39.407/185 - I/14/90), wurde den Lehrern der Schulversuchsklasse durch das Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung, Abt. II ein Fragebogen über ihre Situation in der Versuchsklasse zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder zugesandt.
Sonderschullehrer Hans P. zur Frage Nr. 4:
"Müssen Sie aufgrund Ihrer derzeitigen Tätigkeit im Schulversuch Nachteile oder Probleme besoldungs- oder dienstrechtlicher Natur in Kauf nehmen? Wenn ja, bitte nähere Angaben":
''Vor meiner Tätigkeit in der Integrationsklasse war ich klassenführender Lehrer an einer Allgemeinen Sonderschule. Trotz des zeitlichen Mehraufwandes ergeben sich für mich besoldungs- und dienstrechtlich nur Nachteile."
Als Lehrer an der Allgemeinen Als Lehrer in der Integrationsklasse
Sonderschule
Anrechnung einer Wochenstunde als klassenführender Lehrer
Entfall dieses Verdienstes trotz zeitlichen Mehraufwandes: Entwicklungs-beschreibungen, Projekterläuterungen, gemeinsame Vorbereitung des Unterrichts, Fortbildungsseminare u.a.m.
Unterrichtszulage für den Abteilungsunterricht
Entfall dieser Zulage, obwohl gerade der Unterricht in einer integrativen Klasse weit mehr Binnendifferenzierung verlangt.
Lehrverpflichtung 23 Wochenstunden
Derzeit stuft mich das Land Tirol mit einer Lehrverpflichtung von 24 Wochenstunden ein, da ich in einer Volksschule unterrichte. Daß jedoch für meine Arbeit in der Integrationsklasse die Lehramtsprüfung für Sonderschulen Voraussetzung ist, wird dabei trotz mehrmaliger Anfrage einfach nicht beachtet.
Zwangsläufig ergibt sich für mich folgender Schluß:
Die Arbeit eines Sonderschullehrers in einer integrativen Klasse ist weniger wert als die Arbeit eines Sonderschullehrers in einer Sonderschulklasse. Wenn den verantwortlichen Stellen an der Integration wirklich etwas liegt, sollten diese Ungerechtigkeiten endlich beseitigt werden."
Für den Sonderschullehrer ergaben sich aber noch einige weitere Benachteiligungen: Überstundenregelung; Unterricht von Englisch an der Volksschule als Sonderschullehrer ....
Da allgemein immer wieder die Frage auftaucht, wann und wie die Lehrer ihre Unterrichtsplanung gestalten, und da dies damit ein echtes Beziehungsproblem für ein kooperativ arbeitendes Unterrichtsteam darstellen kann, habe ich den Teilaspekt »Vorbereitung und Planung des Unterrichts« mit beiden Lehrern besprochen.
In einem gemeinsamen Gespräch habe ich versucht zu erfahren, wie sie das Problem der Unterrichtsplanung und der Evaluation ihres Unterrichts in der konkreten Situation im 3. Schuljahr des gemeinsamen Arbeitens in der Klasse gelöst haben bzw. lösen.
Die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsevaluation erfordern nicht nur ein hohes Maß an intensiver Kommunikation des Lehrerteams, sondern auch einen erheblichen Zeitaufwand. Eine der bedeutendsten Erfahrungen für kooperierende Lehrer stellt der Faktor Arbeitszeit außerhalb des Unterrichts dar. Auch in einem routinierten Unterrichtsteam reichen Kontakte "zwischen Tür und Angel" oder Pausengespräche keineswegs aus.
Der in seiner Klasse allein unterrichtende und damit isolierte Lehrer kann sehr wohl ohne Rücksicht und vor allem ohne Schaden für die Qualität des Unterrichts die Vor- und Nachbereitung in seine häusliche Zeit verlegen. Mit Unterrichtsschluß kann dieser Lehrer zumeist auch das Schulhaus verlassen.
Lehrer, die im Team arbeiten, aber können das nicht. Sie müssen eigene Zeiten für gemeinsame Planungs- und Auswertungsarbeit anberaumen. Für die Lehrer bedeutet dies, Abschied zu nehmen von der angenehmen Gewohnheit, pünktlich mit Unterrichtsschluß auch die Schule verlassen zu können.
Stundenplan:
Der Stundenplan wurde von beiden Lehrern unter Berücksichtigung der vorgegebenen Möglichkeiten (5-Tagewoche, Turnsaalbenützung, Religionsstunden, Werkstunden für Mädchen u.a.) gemeinsam erstellt.
Jahresplanung: (Die beiden Lehrer berichten).
"Zu Beginn des Schuljahres wird eine doch recht ausführliche und differenzierte Jahresplanung erstellt bzw. ausgearbeitet. Dabei teilen wir den Lehrstoff aller Fächer in große Raster bzw. Unterrichtsabschnitte. Diese Unterrichtsabschnitte ermöglichen dann auch schon in der Jahresplanung eine weitere Differenzierung in Blockabschnitte für die einzelnen Kinder. Auf der Grundlage der Jahresplanung wird dann die Wochenplanung und in der Folge die Tagesplanung von uns gemeinsam erstellt."
Konkret:
''Wir sind jeden Tag bis ca. 13.30 Uhr in der Schule. In diesem Schuljahr haben wir dreimal in der Woche bis 11.35 Uhr (Montag, Mittwoch, Freitag) und zweimal bis 12.30 Uhr (Dienstag, Donnerstag) Unterricht" (Ebd.).
Wochenplanung:
"Als Grundlage, aber auch als Kontrolle für die Wochenplanung wird von uns die Jahresplanung verwendet." (Ebd.).
Konkret:
''Die Wochenplanung besprechen wir in groben Zügen bzw. Notizen jeweils am Freitag." (Ebd.).
Die detaillierte Wochenvorbereitung wird dann vom Volksschullehrer allein am Wochenende ausgearbeitet, während der Sonderschullehrer in der Zeit dafür die Eintragungen im Klassenbuch erledigt. Am Montag wird dann der vorliegende Wochenplan durch Randnotizen und Anmerkungen des Sonderschullehrers noch ergänzt. Beide Lehrer finden diese Arbeitsteilung - Wochenplan und Klassenbuch - als gute und gerechte Lösung.
Tagesplan:
''Unsere tägliche Vorbereitung für den kommenden Tag machen wir jeweils mittags nach dem Unterricht. Es gibt jeden Tag eine schriftliche Vorbereitung, die wir auch sehr konsequent einhalten, wobei wir schriftlich nur das festhalten, das wir wirklich als wichtig für uns erachten. Es muß für uns bedeutsam sein, daß wir meinen, es schriftlich festhalten zu müssen. Wer letztlich von uns die Feder in die Hand nimmt und schreibt, ist nicht so wichtig; wir wechseln uns damit einfach ab. Eine Reflexion aus dem Unterricht des Vormittages ist dann jeweils die Ausgangslage für die Vorbereitung auf den kommenden Tag. Wir überlegen täglich, von den einzelnen Kindern ausgehend, die nächsten inhaltlichen Lern- und Arbeitsschritte, die wir am kommenden Tag weiterführen. Wer von uns aber dann was konkret macht, das legen wir am Vortag noch nicht fest.
Sehr viel an Überlegungen fließt in die tägliche Vorbereitung mit ein. Für Sabine - das gehörlose Mädchen - wird in kürzeren Zeiträumen ein Lernprogramm festgelegt. In Absprache mit Prof. Dr. Klaus Günther von der UNI Hamburg und dem Gehörlosenlehrer A.S. von der Landessonderschule Mils werden Überlegungen und vorgesehene Lernschritte in die tägliche Vorbereitung mit einbezogen.
In diese Überlegungen wird täglich auch die Sonderschul- und Sprachheillehrerin Christine Specht von der Allgemeinen Sonderschule Reutte mit eingebunden. Sie versucht, durch eine Stunde am Nachmittag zu Hause (3 x wöchentlich) nicht nur als ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Schule und der Mutter von Sabine zu wirken, sondern auch für Sabine wichtige Lernschritte in abwechselnder Absprache mit uns zu festigen oder zu verstärken.
Natürlich gelten diese Überlegungen für alle Kinder der Klasse. In Abständen der Unterrichtseinheiten überdenken wir bei jedem Kind seinen momentanen Entwicklungs- bzw. Wissensstand. Für einige Kinder werden eventuell nochmals Lernschritte festgelegt, die das bisher Gelernte festigen helfen, für andere Kinder besteht die Möglichkeit einer Vertiefung oder größeren Herausforderung durch die Bewältigung erweiterter Aufgaben.
Bestimmte Sachen für die tägliche Vorbereitung machen wir in Absprache dann auch getrennt und eigenständig am Nachmittag." (Ebd).
Beide Lehrer sind fast täglich am Nachmittag in der Schule. Hier zeigt sich bisweilen, daß je nach Neigung und Interesse des Lehrers unterschiedliche Materialien und Unterlagen für den kommenden Tag oder die Woche vorbereitet werden, wobei beide Lehrer jetzt im dritten Schuljahr einfach "eingespielt" sind und beide wissen, was für den kommenden Tag gebraucht wird. War es im ersten Schuljahr doch noch notwendig, sehr genau gegenseitig abzusprechen, was jeder Lehrer am Nachmittag eigenständig und selbst vorbereitet, genügt nun - im dritten Schuljahr - eine kurze Information für den Partner zu Mittag, während des Unterrichts am Vormittag oder bei der Tagesplanung. Die Zeiten am Nachmittag in der Schule teilen sich beide Lehrer zumeist individuell getrennt für sich ein.
''Wer dann konkret welche Aufgabe in der Klasse übernimmt, das legen wir in unserer Vorbereitung nicht fest. Da wir beide zumeist schon um 7.30 Uhr, also etwa eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn, im Schulhaus sind, klären wir dies erst kurz vor dem Anfang des Unterrichtes ab. Da es schon seit dem ersten Schuljahr keine schwerpunktmäßige Aufteilung von Unterrichtsfächern zwischen uns gab und sich diese Gemeinsamkeit für alle Gegenstände im Verlaufe der Schuljahre noch verstärkt hat, stellt sich für uns dieses Problem nicht" (Ebd).
Es gefällt beiden Lehrern, daß keiner nur für bestimmte Kinder oder für ein bestimmtes Fach sich zuständig fühlt. Beide Lehrer sind gänzlich gleich verantwortlich für alle Kinder und den gesamten Unterricht. Z.B. arbeitet auch der Volksschullehrer mit den Kindern, die ein erhöhtes Maß an Unterstützung oder spezielle Hilfe brauchen.
"Diese Gleichberechtigung und auch Gleichverantwortlichkeit gefällt uns besonders gut. Hier sehen wir auch eine der bedeutendsten Chancen für das Bestehen unserer Teamarbeit und damit auch für die positive Entwicklung in der Zusammenarbeit bzw. im Zusammenleben mit unseren Kindern.
Natürlich ist während des gesamten Unterrichtes, aber auch bei der gesamten Planung, eine ständige Flexibilität zwischen uns erforderlich. Wir haben uns inzwischen recht gut darauf eingestellt, und es bereitet uns eigentlich keine Probleme.
Beide beobachten wir ja die Kinder und treffen - heute schon oftmals auch ohne Worte - entsprechende übereinstimmende Entscheidungen.
Natürlich gibt es auch die Situation, daß einem von uns auffällt, daß es heute nicht so läuft, und wir machen uns gegenseitig darauf aufmerksam und wechseln eventuell die Gruppe. Wer von uns mit welcher Gruppe arbeitet, ist zumeist eine unausgesprochene und unvorhergeplante "Laune".
Hier sehen wir für uns und für die Kinder die positive Möglichkeit, aus einer eventuellen Art von "Sackgasse" wieder herauszukommen. Natürlich äußern wir auch gegenseitig unseren Wunsch, ein bestimmtes Thema schwerpunktmäßig selbst zu übernehmen; dabei kann dies aber am nächsten Tag auch umgekehrt sein.
Was zumeist nicht in einer Vorbereitung von uns festgehalten ist, sind individuelle Aussprachen, Übungen und Rücksprachen mit den Eltern der Kinder." (Ebd).
Ein konkretes Beispiel:
''In einer Rechtschreibstunde ist das Umgehen mit Fehlern, das Verbessern und das Festigen·besonders wichtig. Wenn wir mit dem Kind über seine Schwierigkeiten sprechen, wir es auf seine Probleme aufmerksam machen, dann entwickeln wir für das Kind zumeist ein zusätzliches Übungsprogramm. In einer kleinen Notiz an die Eltern teilen wir diesen mit, wo und wie sie eventuell mit dem Kind ein Problem abbauen könnten. Dem Kind gefällt dies zumeist besonders gut, da wir uns ganz persönlich ihm zuwenden und mit ihm über seine Schwierigkeiten sprechen.
In einer Nachbereitung sollte dies wohl schriftlich festgehalten sein, aber hier scheitert es zumeist an der nötigen Konsequenz unsererseits." (Ebd.).
Resümee:
''In dieser Art ist für uns das Problem der Planung bzw. Vorbereitung auf den Unterricht praktikabel und durchaus realisierbar. Wir möchten nicht beweisen, daß Integration von einem Lehrerteam nur machbar ist, wenn zwei "Wahnsinnsbeißer" täglich diese Aufgabe erfüllen.
Wir glauben, daß dieses Problem der Vorbereitung mit einem bestimmten Arbeitsstil und einer notwendigen Konsequenz zu erfüllen ist und keine Besonderheit darstellt.
Natürlich hängt die Vorbereitung auf einen Unterricht auch damit zusammen, welche Kinder mit welcher Behinderung u.a. in der Klasse sind.
Unsere Vorbereitung und Planung in dieser vorgenannten Art ist eventuell nur in unserer ganz speziellen Situation in unserer Klasse und zwischen uns Lehrern nicht nur so entstanden, sondern nur so durchführbar.
Es hat für uns noch keinen Schultag gegeben, an dem wir nicht eine gewissenhafte schriftliche Vorbereitung hatten. Sie einmal nicht zu haben, wäre für den einzelnen Tag vielleicht nicht einmal so entscheidend, aber langfristig macht es sich bezahlt." (Ebd).
Bei allen theoretischen Überlegungen zur kooperativen Arbeit von Lehrern können viele Fragen erst konkret beantwortet werden, wenn Lehrer selbst über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse berichten. Auch wenn diese Ergebnisse und Aussagen letztlich nur dieses Lehrerteam in seiner ganz individuellen Situation und Zusammensetzung betreffen, so denke ich, lassen sich auch daraus allgemeingültige Grundelemente kooperativer Arbeit ableiten.
Vor sehr vielen offenen Fragen standen auch die beiden Lehrer zu Beginn ihrer gemeinsamen Unterrichtsarbeit:
Warum ist die Kooperation für Lehrer so schwierig?
Warum gelingt diese Kooperation oftmals schlecht oder überhaupt nicht?
Wie sind die Unterrichtsaufgaben auf die Lehrer verteilt? U.v.a.m.
Für mich war bedeutsam zu erfahren, wie die beiden Lehrer ihre nun doch völlig veränderte Arbeitssituation erlebt haben und derzeit noch erleben. Was sind nun ihre täglichen Sorgen und Probleme, oder gibt es gar keine?
Durch persönliche Einzelgespräche mit beiden Lehrern am Ende des ersten und zu Beginn des 4. Schuljahres habe ich versucht zu erfahren, wie sie in der täglichen Unterrichtspraxis, mit den ihnen immer wieder neu gestellten Aufgaben zurechtkamen und -kommen.
Zur Methode:
Da mir einige Problembereiche kooperativer Arbeit, und damit aber auch die Aussagen dazu, besonders wichtig erschienen, habe ich als Untersuchungsmethode, ähnlich der Untersuchung bei den Eltern (s. Kap. III/7.5.1, S. 332), das strukturierte Interview verwendet.
Am Ende des ersten Schuljahres habe ich mit beiden Lehrern getrennt das erste Gespräch geführt und mit ihrem Einverständnis auf Tonband aufgezeichnet.
Auch wenn ich nach dem ersten Jahr den Eindruck hatte, daß sich beide Lehrer gut verstehen und selbst recht gut mit ihren "kleinen Problemen" umzugehen und sie zu lösen vermögen, war es doch von Interesse zu erfahren, wie sie mit der Umstellung zurechtkamen, plötzlich nicht mehr allein in einer Klasse zu unterrichten, sondern ständig vor einem Partner transparent zu sein. Da aber keine gravierenden oder speziellen Schwierigkeiten in den fast täglichen Pausen oder bei den nachmittägigen Treffen in der Kanzlei meiner Schule zur Sprache kamen, habe ich mich bei der ersten Befragung auf allgemein gehaltene Fragen beschränkt. Ich wollte damit erreichen, daß beide Lehrer möglichst uneingeschränkt und offen über ihre Situation und vor allem auch über ihr persönliches Befinden sprechen können.
-
Würdest Du nach einem Jahr nochmals den Schulversuch beginnen? Wie siehst Du dieses Jahr jetzt?
-
Glaubst Du, daß man das gemeinsame Unterrichten lernen kann?
-
Wo und wie glaubst Du, kann man diese Fähigkeiten der Kooperation lernen?
-
Habt Ihr jetzt nach einem Jahr "Euren gemeinsamen Weg" gefunden?
-
Wie siehst Du dich selbst und Deinen Kollegen in der Klasse - z.B.: im Umgang mit den Kindern?
-
Du mußt Deinen Erfolg teilen, aber Du kannst auch deinen Mißerfolg teilen, - hast Du dabei Probleme?
-
Ist es für dich ein Problem, daß Du vor Deinem Kollegen während des Unterrichts so transparent bist? Fehlt die letzte Natürlichkeit, wenn man nicht alleine in der Klasse ist?
Da es mir wichtig erschien, einerseits zu erfahren, welchen Entwicklungsprozeß die beiden Lehrer nach über 3 Jahren kooperativen Unterrichts persönlich erlebt hatten, und andererseits wie sie die reale Praxis eines gemeinsamen Lernens und Lehrens von behinderten und nichtbehinderten Kindern nun einschätzten, führte ich mit ihnen zu Beginn des 4. Schuljahres nochmals ein Gespräch.
Die Kernaussagen der ersten Befragung habe ich als Ausgangsbasis der Fragestellungen für das zweite Gespräch verwendet, um vor allem den persönlichen Entwicklungsprozeß beider Lehrer besser in Erfahrung bringen und somit dokumentieren zu können. Ich denke, daß der evaluierende Prozeß, in dem beide Lehrer nun schon über 3 Jahre standen, von größtem Interesse ist und durch einen Schulversuch letztlich auch dokumentiert werden soll.
Frage (1989):
-
Würdest Du nach einem Jahr nochmals den Schulversuch beginnen? Wie siehst Du dieses eine Jahr jetzt?
"Ja, ich würde nochmals mit dem Schulversuch anfangen. Die intensive Auseinandersetzung mit den Fragen der schulischen Integration hat mich beruflich weitergebracht und auch persönlich verändert. Das spielt bis in meine eigene Familie hinein. Die Umsetzung der schulischen Integration ist ein zentraler Teil meines gesellschaftspolitischen Engagements geworden. Die Menschen, die ich dabei kennenlernte, sind für mich sehr wichtig geworden. Es sind Menschen, die mit sehr hohem persönlichen Einsatz für die Verwirklichung dieses Rechtes eintreten.
Ich denke, es muß eine Selbstverständlichkeit werden, daß behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam die Schule besuchen können.
Unser erstes gemeinsames Jahr sehe ich unter dem Strich sehr positiv.
Ich bin froh, daß ich schon vor Beginn dieser Klasse Erfahrungen mit den Möglichkeiten eines Offenen Unterrichts machen konnte. Integration bedingt eine Veränderung des Unterrichts in Richtung mehr Offenheit, mehr Kindorientiertheit und umgekehrt, Lehrerinnen und Lehrer, die für sich in Anspruch nehmen, "Offenen Unterricht" zu machen, müssen auch offen für die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnisse sein, offen für Integration sein.
Neu war für mich die Arbeit in einem Lehrerteam. Darin setzte ich von Anfang an große Erwartungen. Ich habe den Eindruck, daß wir die Anfangsschwierigkeiten gut gemeistert haben. Ich fühle mich sehr wohl mit Hans P. im Team. Wir arbeiten gut zusammen.
Ich denke, daß wir beide unsere unterschiedlichen Fähigkeiten gut in den Unterricht einbringen können und uns dabei gut ergänzen.
Was den Unterricht betrifft, können Hans P. und ich gut miteinander reden. Etwas schwieriger ist es bei grundsätzlicheren Fragen der schulischen Integration. Ich denke, mein Engagement für Integration über unsere eigene Klasse hinaus hat mich radikalisiert Da vertrete ich Positionen, die von Hans P. nicht immer geteilt werden. Ein Punkt ist die "Freiwilligkeitsdiskussion".
Ich denke, daß es in Zukunft zum Berufsbild des Lehrers gehören muß, im Team "alle" Kinder des entsprechenden Schulsprengels zu unterrichten. Das Recht der Kinder auf gemeinsamen Unterricht geht vor dem Recht der Lehrer auf einen bestimmten Dienstposten. Es darf also nicht sein, daß ein behindertes Kind deshalb abgewiesen wird. weil ein Lehrer es sich nicht vorstellen kann, das Kind zu unterrichten oder zu zweit im Team zu arbeiten. Ich denke aber, daß es hier Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Speziell gefordert ist natürlich die Aus- und Weiterbildung der Lehrer. Dann ist es sicher auch noch eine Frage der klugen. transparenten und demokratischen Personalentscheidungen.
Ein weiterer Punkt wäre auch das öffentliche Engagement. Mir ist klar, daß die Integrationsfrage eine sehr wichtige schul- und gesellschaftspolitische Frage ist. Daher muß unsere Arbeit auch eine offene und öffentliche sein, auch wenn das bisweilen für uns etwas unangenehm ist. Ich denke, daß für Hans P. das unangenehmer ist als für mich.
In der Klasse selbst hingegen ergänzen und unterstützen wir uns gegenseitig sehr gut. Auch im Umgang mit den Kindern hat es Auswirkungen, wenn zwei Erwachsene in der Klasse sind. Das ist für mich eine tolle Erfahrung."
Frage (1991):
-
Du sagtest, daß Du Dich durch die Beschäftigung mit der Integration beruflich und persönlich verändert hast. Die Menschen, die Du dabei kennengelernt hast, sind Dir wichtig geworden. Hat sich etwas verändert?
''Meine Sicht über den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder hat sich nicht verändert Ich bin nach wie vor überzeugt davon, daß wir einen richtigen Weg gehen.
Persönlich haben sich für mich einige "Bekanntschaften" zu "Freundschaften" entwickelt, die auch über das unmittelbar Berufliche hinausgehen. Das gemeinsame Engagement und auch die Belastungen und der Druck, die von seiten der Behörden oder von "Integrationsgegnern" kommen. haben uns verbunden.
Allgemein beobachte ich, daß die Zahl derer, die uns unterstützen und verstehen, wächst. Es gibt aber noch viel zu tun.
Das sehe ich auch an den Eltern der Kinder aus unserer Klasse. Elternarbeit ist mir inzwischen sehr wichtig geworden. Wenn wir in der Schule Veränderungen vorantreiben oder gewisse Freiräume schaffen wollen. brauchen wir die Unterstützung und Mitarbeit der Eltern.
Wir wurden von Eltern zum Teil sehr kritisch hinterfragt, ob ihre Kinder auch genügend Leistung erbringen, ob sie wohl gleichviel lernen als in den Parallelklassen, ob sie für die weiterführenden Schulen gerüstet seien. usw.
Es gab auch eindeutige Kritik. Das ist für uns als Lehrer eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen."
Frage (1991):
-
Für Dich war und ist der gemeinsame Unterricht eine Selbstverständlichkeit. Bist Du noch immer von der Richtigkeit überzeugt? Gibt es doch Grenzen?
"Ich halte den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder für ein Grundrecht, das verwirklicht werden muß. Ich bin der Überzeugung, daß behinderte Kinder in integrativen Situationen besser gefördert werden können als in aussondernden. Ganz allgemein muß unsere Schule offener, demokratischer, kindgerechter und humaner werden. Dabei muß für alle Kinder Platz sein. Niemand soll sagen können: Dieses Kind darf aufgrund seiner Behinderung, und sei sie noch so schwer, nicht mit nichtbehinderten Kindern in die Schule."
Frage (1991):
-
Ist die Teamarbeit für Dich immer noch so bedeutsam? Hat sich die Zusammenarbeit mit Hans P. weiter entwickelt?
''Die Teamarbeit mit Hans P. ist eine tolle Erfahrung für mich. Wir sind ein gut eingespieltes Team. Ich fühle mich an unserem gemeinsamen Arbeitsplatz "Schule" wohl. Mit Hans P. hat sich ein freundschaftliches Verhältnis ergeben, mit großer Offenheit und einem konfliktfreien Alltag, aber auch einer gesunden Distanz. Wir halten eine gewisse Trennung von Beruflichem und Privatem ein. Wenn es sich ergibt und wir dazu Lust haben, treffen wir uns dann auch einmal zu einer Bergtour oder auf ein Bier.
Unsere Zusammenarbeit hat sich gut entwickelt. Wir haben uns aufeinander eingestellt, ohne daß wir faule Kompromisse machen mußten. Es geht uns beiden darum, in der Klasse gute Arbeit zu machen. Wir mußten lernen, flexibel zu sein und durch Aussprachen Lösungen zu finden."
Frage (1991):
-
Wie siehst Du heute nach 3 Jahren das Problem der Offenheit und Öffentlichkeit? Hat sich in Eurem gegenseitigen Verhalten etwas verändert (positiv/negativ)?
"Für mich ist es kein Problem, mich in der Öffentlichkeit klar und eindeutig für Integration auszusprechen. Inzwischen wurde ich auch schon zu den verschiedensten öffentlichen Veranstaltungen, auch in der Lehrerfortbildung, eingeladen, über unsere Erfahrungen zu sprechen. Das war für mich auch ein Anlaß, mich im Theoriebereich intensiver mit Fragen der Integration und der Didaktik eines Offenen Unterrichts auseinanderzusetzen. Ich fühle mich da recht gefestigt und sicher in der Argumentation.
Was Hans P. anbetrifft, empfinde ich, daß er überzeugter ist als zu Beginn unserer Arbeit. Damals hatte ich im didaktischen Bereich vielleicht einen ''Theorievorsprung'', der aber inzwischen ausgeglichen ist. Wir reden von der gleichen Sache und verstehen einander gut. Ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl unbedingt immer der Impulsgeber sein zu müssen."
Frage (1989):
-
Glaubst Du. daß man das gemeinsame Unterrichten lernen kann?
"Abgesehen von einer offenen und selbstverständlichen Grundhaltung dem Teamteaching gegenüber glaube ich auch, daß bestimmte Arbeitsweisen gelernt werden können bzw. jedes Team für sich entwickeln muß. Dazu gehört eine Reflexion der eigenen Arbeit, die Möglichkeit, mit Kollegen Erfahrungen auszutauschen, Konfliktbewältigung, Rollenverteilung im Team.
Da hatte ich zum Beispiel eine falsche Erwartungshaltung gegenüber der Rolle der Sonderpädagogik. Ich war früher der Meinung, daß die Sonderpädagogik für Kinder mit Schwierigkeiten bestimmte funktionierende Strategien und Konzepte (fast Rezepte) entwickelt hat, um ihnen gerecht zu werden. Das halte ich heute für einen Irrtum meinerseits. In dieser Hinsicht muß einfach sehr auf die einzelnen Kinder, auf die spezielle Situation in der Klasse eingegangen werden. Bei uns war es zunächst so, daß Hans P. sich für Sabine und die beiden anderen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf verantwortlich gesehen hat, auch von außen in diese Verantwortung vielleicht gedrängt wurde. Es war für uns ein Prozeß, zu erkennen, daß wir als gleichberechtigtes Team zuständig für alle Kinder arbeiten müssen. Wir mußten auch die pädagogischen Konzepte gemeinsam mit Unterstützung der Fachleute für unsere Situation entwickeln.
Es ist sicher nicht so, daß Teamteaching einmal gelernt wird, und dann kann es jeder. Es muß dynamischer gesehen werden. Wir sind jeden Tag dabei. es zu lernen. weiterzuentwickeln. neu zu lernen. Dabei bin ich froh, in einem Umfeld eingebettet zu sein. von dem ich viel profitiere.
Darüber hinaus ergeben sich natürlich Aufgaben an die Lehreraus- und Weiterbildung. Lehrer werden derzeit zu Einzelkämpfern ausgebildet und bleiben es dann oft ihr ganzes langes Berufsleben."
Frage (1991):
-
Wie ist Deine heutige Sichtweise zur Rollenverteilung im Team? Welchen Stellenwert hat die Sonderpädagogik?
''Im Unterricht sind wir beide für alle Kinder da und gleich verantwortlich, wobei meist Hans P. derjenige ist, der in unseren Besprechungen darauf achtet, daß wir für Sabine entsprechende Situationen schaffen.
Heute bin ich eigentlich noch mehr davon überzeugt, daß die Sonderpädagogik als eigenständige, losgelöste Pädagogik unsinnig ist. Provokant formuliert Behinderte Kinder brauchen keine Sonderpädagogik - oder: Alle Kinder brauchen eine besondere Pädagogik!
Ich versuche, den Blick auf das einzelne Kind zu richten und individuelle Lernwege zu suchen. Ich muß den Kindern vor allem Zeit geben. Zeit dazu, begonnene Lernschritte zu gehen und abzuschließen. Es bedarf also auch einer Integration der Methoden, einer Integrationspädagogik."
Frage (1989):
-
Wo und wie, glaubst Du, kann man diese Fähigkeiten zur Kooperation lernen?
''Die Zusammenarbeit läßt sich bis zu einem gewissen Grad lernen. Wenn Lehrer sagen, ich kann nicht zusammenarbeiten, dann liegt das vermutlich auf einer persönlichen Ebene dieser Personen. Grundsätzlich möchte ich noch einmal sagen: Das Recht der Kinder geht vor dem Dienstpostenplan der Schulverwaltung. Andererseits halte ich die Zusammensetzung von Lehrerteams auch nicht für eine Frage, die vom Schreibtisch aus entschieden werden dar (sondern unter Mitwirkung der Betroffenen vor sich gehen soll.
Dann kommt es auch auf die Einstellung der Lehrer an. Wichtig für gute Zusammenarbeit sind:
-
die Teamarbeit als einen sich verändernden Prozeß sehen, entwicklungsbereit sein.
-
sich selbst nicht allzu ernst und wichtig nehmen und doch sich selbst auch nicht zu kurz kommen lassen
-
sehen, daß der andere auf seine Art auch gute Ideen einbringt, ihn anerkennen und ermutigen, aber auch Kritik äußern können.
Das gemeinsame Zusammenleben in der Schule wird mir immer wichtiger. Zunächst ''leben'' wir zwei Lehrer mit den 22 Kindern in der Klasse den ganzen Vormittag zusammen. Dann wollen wir gemeinsam lesen, schreiben, rechen lernen, aber wir wollen auch mit einander leben lernen. Wir wollen uns von unserer schöpferischen Seite her kennenlernen. Wir wollen spielen, lachen, singen. Wir wollen lernen, Konflikte auszutragen. Wir wollen uns durchsetzen, aber dabei auch solidarisch sein. Für alle diese Dinge wollen wir die 25 Wochenstunden gut nützen."
Frage (1989):
-
Wie siehst Du dich selbst und Deinen Kollegen in der Klasse - z.B: im Umgang mit den Kindern?
''Wir haben einen etwas unterschiedlichen Umgang mit den Kindern. Ich will das aber nicht bewerten. Unsere Belastbarkeit hat natürlich Grenzen, wie bei allen, denke ich. Ich beobachte nun, daß dies in verschiedenen Situationen unterschiedlich ist. Einmal hält Hans P. die "gewisse Unruhe" länger aus, einmal bin ich es. Manchmal sind es auch bestimmte Verhaltensweisen von Kindern, die wir unterschiedlich beurteilen. Einer findet es im Augenblick kreativ, der andere störend."
Frage (1989):
-
Du mußt Deinen Erfolg teilen, aber du kannst auch Deinen Mißerfolg teilen - dazu ist Deine Autonomie geteilt -, hast Du dabei Probleme?
''Ich sehe es als unsere gemeinsame Arbeit Erfolg teilen bedeutet ja nicht halber Erfolg, und Verantwortung teilen ist nicht halbe Verantwortung. Oder anders: ''Wir teilen uns die Arbeit", bedeutet in unserem Fall nicht, daß wir die halbe Arbeit machen.
Was ich beobachte ist, daß ich zeitlich, gedanklich und mit dem Herzen mehr bei der Sache bin als vorher. Es ist also auf der einen Seite belastender, auf der anderen Seite fallen Belastungen, die Lehrer zu tragen haben, die allein arbeiten, weg. Salopp ausgedrückt Mein Nervenkostüm bleibt geschonter. Viele Situationen, in die Lehrer im Unterricht verstrickt werden, wenn sie allein in der Klasse sind, kommen bei der Teamarbeit nicht so zum Tragen oder können leichter aufgefangen werden."
Frage (1989):
-
Ist es für Dich ein Problem, daß Du vor Deinem Kollegen während des Unterrichts so transparent bist? Fehlt die letzte Natürlichkeit, wenn man nicht alleine in der Klasse ist?
"Am Anfang wollte jeder von uns einen Idealtyp verkörpern; Gelassenheit ausstrahlen, drüber stehen. Wir spielten uns gegenseitig einen Typ vor, der wir eigentlich nicht wirklich waren. Dieses Spiel haben wir aber sehr bald durchschaut. Darüber konnten wir gut miteinander reden. Wir haben viel über organisatorische Abläufe gesprochen und den Unterricht reflektiert. Oder von der Schülerseite her die unterschiedlichen Wirkungen der Kinder auf uns besprochen. Das hat mir sehr geholfen. Besonders die Art von Hans P., sein Unbehagen auch wirklich direkt auszusprechen. Manchmal ist es auch vorgekommen, daß wir einen Konflikt während des Unterrichts verdeckt ausgetragen haben. Auch das ist uns bald aufgefallen. Durch das Bewußtmachen dieser Schwierigkeiten konnten wir sie auch lösen. Momentan sehe ich uns auf einem guten Weg der Zusammenarbeit.
Ich fühle mich durch Hans P. in der Klasse nicht kontrolliert oder gehemmt im negativen Sinn, wohl aber beobachtet Ich finde dieses sich gegenseitig Beobachten gar nicht schlecht Es belastet mich auch nicht.
Aus dieser gegenseitigen Beobachtung ergab sich bei mir auch eine Verhaltensänderung gegenüber den Kindern, ich denke in Richtung mehr Achtung, mehr Höflichkeit gegenüber den Kindern. Auch die Kinder beobachten mehr oder weniger bewußt unseren Umgang miteinander. Dieser Verantwortung müssen wir uns auch bewußt sein."
Frage (1991):
-
Könnt Ihr jetzt offener miteinander arbeiten? Haben sich die Anfangsschwierigkeiten gelegt?
"Wir haben einander gut kennengelernt und respektieren die jeweiligen Eigenarten. Eigentlich ist das keine bewußte Rücksichtnahme. Es ist eher so, daß ich einen Menschen. den ich mag, nicht ärgere, indem ich etwas mache, wovon ich inzwischen weiß, daß es ihn ärgert Manchmal kommen so vielleicht Dinge nicht zustande, die zustande kommen würden, wenn wir allein in der Klasse wären. Das ist aber eher die Ausnahme. Insgesamt haben wir zusammen viel mehr Möglichkeiten.
Was mir besonders auffällt. Wir können heute über viele Dinge lachen, die uns vor 2 Jahren noch recht nahegegangen sind Es ist viel lockerer geworden als zu Beginn. Am Anfang waren wir noch recht viel mit uns selbst beschäftigt. Heute ist das nicht mehr so notwendig bzw. macht nicht mehr einen großen Teil der Besprechungszeit aus. Das haben wir im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit gut in den Griff bekommen.
Jetzt liegt unser Hauptaugenmerk auf der Situation in der Klasse. Wir beobachten uns kaum mehr gegenseitig, sondern schauen. wie wir die Kinder bestmöglich unterstützen können. Die Organisationsformen und viele Abläufe sind gut abgesprochen und klar. Oftmals genügt ein kurzer Blickkontakt oder eine kurze Aussprache, um eine Situation im Unterricht zu verändern, einzugreifen oder laufen zu lassen. Das gegenseitige Vertrauen ist sehr groß. Wir wissen von einander, daß wir es richtig machen.
Ich spüre auch, daß sich diese Atmosphäre auf die Kinder überträgt Ich denke, daß sie da einiges mitbekommen."
Frage (1989):
-
Würdest Du nach einem Jahr nochmals den Schulversuch beginnen? Wie siehst Du dieses Jahr jetzt?
"Die Arbeit im ersten Schuljahr hat für mich viele neue Aspekte gebracht Diese neuen Aspekte beziehen sich sowohl auf den gesellschaftspolitischen als auch auf den Bereich Schule und Unterricht Bevor unsere Integrationsklasse zustande kommen konnte, mußten sehr viele Hürden genommen werden. Es gab viele öffentliche Diskussionen und Auseinandersetzungen, die ich als sehr zermürbend empfand. Erst in dieser Zeit wurde mir bewußt, wie politisch brisant das Thema "Integration" ist Zu diesem Umstand kam meine Unsicherheit, ob ich für die besondere Erziehungssituation - Integration eines gehörIosen Kindes - auch fachlich genügend kompetent wäre. Gab es doch von vielen Seiten Aussagen, daß so ein Versuch von vornherein zum Scheitern verurteilt sei.
Nach dem Ende dieses Schuljahres hat sich diese Unsicherheit weitgehend gelegt Ich fühle mich als Sonderschullehrer nicht mehr allein für die oben beschriebene Erziehungssituation zuständig, wenngleich die logopädische Arbeit immer noch vor allem in meiner Verantwortung liegt. Die guten Fortschritte der Kinder mit Behinderungen und der freundschaftliche Kontakt zu Roland zerstreuen anfängliche Bedenken immer mehr.
Damit bin ich schon bei der Beschreibung meiner Situation, im 2-Lehrer-system zu arbeiten. Ich glaube, es war für uns beide eine ungewohnte Situation, in Anwesenheit eines Kollegen zu unterrichten. Anfänglich waren von beiden Seiten gewisse Hemmungen da. Wir waren uns auch nicht im klaren, wie im Unterricht die Rollenverteilung stattfinden sollte. Ich wollte keinesfalls "nur' der Lehrer für die zu integrierenden Kinder sein und hatte gewisse Bedenken, auf diese Art eine Zweitlehrerrolle zugeteilt zu bekommen. Deshalb war es mir sehr wichtig, in vielen Unterrichtseinheiten mit allen Kindern Kontakt zu haben. Nach meiner Vorstellung sollten die Kinder unserer Klasse gar nicht registrieren, wer von uns beiden für welche Schüler zuständig ist Um diese Gleichberechtigung mußte ich öfter "kämpfen".
Auch die Tatsache, daß Kinder einer Klasse zwei erwachsene Bezugspersonen zur Verfügung haben, machte mich anfangs etwas unsicher.
Es wäre für mich keinesfalls akzeptabel gewesen, in der Funktion eines Stützlehrers nur zu einigen wenigen Kindern einen intensiveren Kontakt herstellen zu können.
Da sowohl Roland als auch ich viele Jahre alleine in einer Klasse unterrichteten, war für uns beide der Unterricht im Zweilehrersystem ungewohnt und neu. In diesem einen Jahr hat sich zwischen uns ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Dies vor allem deswegen, weil wir alle Fragen und Probleme des gemeinsamen Unterrichts offen und ehrlich ausdiskutierten.
Zusammenfassend hat mir dieses Jahr persönlich und fachlich viel gebracht und ich würde mich heute gleich entscheiden wie vor einem Jahr."
Frage (1991):
-
Du sagtest, daß das erste Jahr für Dich vor allem in der Unterrichtsgestaltung neue Aspekte gebracht hat. Hat es für Dich da eine Weiterentwicklung oder zusätzlich neue Aspekte gebracht?
''Ein neuer Aspekt war zunächst das deutlich bewußtgewordene positive Erlebnis, behinderte und nichtbehinderte Kinder in einer Klasse zu unterrichten. Durch die Anwendung offener Lernformen konnten wir bisher gute Erfolge erzielen. Ich empfinde diese Lernformen deswegen so "erfrischend", weil ich sie im bisherigen Unterricht in der Sonderschule nur sehr eingeschränkt einsetzen konnte.
Es ist für mich immer wieder ein Erlebnis, wie behinderte und nichtbehinderte Kinder gegenseitig voneinander profitieren können.
Im speziellen Fall Sabine - ein gehörloses Mädchen - haben wir, so glaube ich, gute Fortschritte erzielt.
Ich gebe jedoch zu, daß ich sehr viel über diese Integrationssituation nachdenke und mir häufig über die Fortsetzung dieses Schulversuches nach der Volksschulzeit kritische Gedanken mache."
Frage (1991):
-
Du mußtest um Deine Gleichberechtigung in Eurem Team "sehen"! Wie ist das jetzt? Wie hat es sich geändert? Ist es noch eine Belastung?
"Es hat sich sehr viel geändert Die "Gleichberechtigung" ist kein Problem mehr für mich. Dies liegt wohl daran, daß wir im Laufe der Zeit einen Modus gefunden haben, wie der Unterrichtstag "gerecht" aufgeteilt werden kann. Wir fixieren bereits in der Vorbereitung, wer von uns beiden für welche Unterrichtseinheiten zuständig ist. Soweit ich es beurteilen kann, arbeitet Roland auch sehr gern mit den "integrierten" Kindern. Man kann sagen, daß sich die Art der Arbeitsaufteilung sehr gut eingespielt hat.
Ich könnte mir gut vorstellen, mit Roland weitere vier Jahre im Zweilehrersystem zu unterrichten."
Frage (1991):
-
Das Zweilehrersystem wurde für Dich nach einem Jahr wohl selbstverständlicher - es wurde aber nicht zur Selbstverständlichkeit. Wie siehst Du das heute? Gibt es noch Zeiten, wo Du über dieses Zweilehrersystem doch "unglücklich" bist?
''In der momentanen Situation überwiegen für mich die Vorteile:
-
-Fühlte ich mich anfangs im Zweilehrersystem kontrolliert, sehe ich es heute von der positiven Seite. Vielleicht ist die Anwesenheit eines Kollegen auch manchmal Ausgangspunkt für bewußteres pädagogisches Handeln.
-
-Die Präsenz eines zweiten Lehrers kann auch entlastend sein. Vor allem dann. wenn man sich selbst in einer Phase des "Formtiefs" befindet.
-
-Ein Kollege, mit dem man sich gut versteht, kann an einem langen Schultag auch als Gesprächspartner sehr angenehm sein. Man kann gemeinsam besser über Erfolge oder Mißerfolge im Schulalltag reflektieren.
-
-Gemeinsame Vorbereitungen haben zwar den Nachteil einer fixen Zeiteinteilung. Im gemeinsamen Gespräch kommt man jedoch eher auf neue Ideen, die den Unterrichtsalltag beleben.
Diese Vorteile des gemeinsamen Unterrichtens habe ich mit Roland erfahren und schätzen gelernt. Er ist ein Kollege, mit dem ich mich gut verstehe. Ein spannungsfreier, freundschaftlicher Kontakt untereinander ist die Grundlage für eine gedeihliche Zusammenarbeit und ein positives pädagogisches Klima im Klassenzimmer."
Frage (1989):
-
Glaubst Du, daß man dieses gemeinsame Unterrichten lernen kann?
''Ich glaube behaupten zu können, daß uns dies weitgehend gelungen ist. Allerdings muß erwähnt werden, daß wir beide eine positive Grundhaltung zum Teamteaching mitbrachten. In unserem speziellen Fall hatten wir bis zum Zustandekommen dieser Klasse einige gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, und wir zogen von der ersten Stunde an am selben Strick. Es war ja ''unsere Klasse", und wir standen gemeinsam unter einem gewissen Leistungsdruck. Wir waren uns der gemeinsamen Verantwortung bewußt und brachten somit eine positive Voraussetzung für das Unterrichten im Team mit.
Wesentliche Faktoren begünstigten unsere gemeinsame Arbeit:
-Ähnliche Auffassungen über Fragen der Erziehung und des Unterrichtens,
-ähnliche Weltanschauungen und
-eine ähnliche Grundeinstellung über den Umgang und die Arbeit mit Kindern.
Kinder zu unterrichten bedeutet gerade im Grundschulbereich, sie zu erziehen und ihnen Werte zu vermitteln. Große Anschauungsunterschiede bei den oben genannten Faktoren bergen Konflikte in sich, die das Erlernen des gemeinsamen Unterrichtens wesentlich erschweren, meines Erachtens sogar unmöglich machen können."
Frage (1991):
-
Wenn jetzt zwei Kollegen eine integrative Klasse führen wollten, was wären für Dich wichtige Forderungen?
"Die Frage beinhaltet das Wort "wollen".
Ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben und dieses mit einer positiven Einstellung erreichen zu wollen, ist sicherlich die wesentlichste Voraussetzung.
Meine Forderungen an die Lehrer wären:
-
-Wille zur Arbeit in einem gleichberechtigten Team,
-
-die Fähigkeit, über alle Fragen von Erziehung und Unterricht offen zu sprechen,
-
-die Fähigkeit, manchmal seine eigene Arbeit in Frage stellen zu können - Offenheit gegenüber berechtigter Kritik und
Forderungen an den Dienstgeber:
-
-Klärung der längst fälligen Fragen bezüglich besoldungsrechtlicher Probleme,
-
-dienst- und besoldungsrechtliche Gleichstellung der im Team unterrichtenden Lehrer."
Frage (1989):
-
Du hattest also Deine Probleme? Hatte Roland dadurch, daß er schon über vier Jahre an der Volksschule unterrichtete, aus Deiner Sicht eine gewisse Vorgabe?
''Roland hatte in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, als Volksschullehrer neue Lernformen einzuführen und sie zu erproben. In meiner Arbeit als Sonderschullehrer hatte ich diesbezüglich weniger Erfahrung. Aus diesem Grund überließ ich Roland den methodischen Ansatz zum Elementarunterricht im Bereich Deutsch / Lesen."
Frage (1991):
-
Wo sahst Du Deine Schwerpunkte bei der gemeinsamen Unterrichtsarbeit?
"Gerade zu Beginn unserer Arbeit sah ich es vor allem als meine Aufgabe, mich der gehörlosen Sabine zu widmen und meine Kenntnisse als Logopäde einzubringen. Besonders während der Zeit des Erwerbs von Lese- und Rechtschreibfertigkeiten bedurfte Sabine einer besonderen Therapie. Sie konnte zu dieser Zeit nahezu keinen Laut bilden und hatte bis zum Schuleintritt fast keine Frühförderung bekommen.
Oft war es notwendig, Sprach- und Artikulationsübungen in Einzeltherapie durchzuführen, Rückstände aufzuholen und somit eine gute Grundlage für den weiteren gemeinsamen Unterricht zu schaffen.
Durch diese zusätzliche sprachtherapeutische Arbeit war es mir nur bedingt möglich, mich mit Rolands methodisch-didaktischen Ansätzen im Deutschunterricht intensiv auseinanderzusetzen.
Wir einigten uns daher, daß ich mich beim Unterricht in der Klasse mehr dem Gegenstand Mathematik widme und er den Bereich Deutsch / Lesen abdeckt."
Frage (1991):
-
Hat sich der Anteil am Unterricht im Vergleich zum ersten Schuljahr verlagert? Bist Du zufrieden, wie es jetzt läuft?
''Im Laufe der Zeit hat sich das gemeinsame Unterrichten gut eingespielt. Wir decken beide alle Unterrichtsfächer ab, es ist für uns abwechslungsreicher. Durch die offenen Lernformen und das Helfersystem verstehen wir uns bei den Kindern oft als Impulsgeber, als Helfende, wo man uns gerade braucht. Wir wissen selbst oft nicht genau, was wir im Vergleich zum ersten Schuljahr anders machen, aber es läuft einfach besser."
Frage (1989):
-
Könnt Ihr jetzt offener, freier und transparenter arbeiten und unterrichten? Hat sich etwas verändert?
"Selbst dann, wenn einer von uns eine besondere Lerneinheit übernommen hat und diese unterrichtet, kann der andere jederzeit seine Gedanken einbringen und dazwischenreden. Diese Entwicklung hätte ich mir im ersten Jahr unserer gemeinsamen Tätigkeit nicht erwartet Die Angst, dem Kollegen "ins Handwerk zu pfuschen", ist nicht mehr gegeben. Ich glaube, dies ist ein wesentliches Indiz für eine gute und zwanglose Zusammenarbeit"
Frage (1989):
-
Ist es für Dich ein Problem, daß Du vor Deinem Kollegen während des Unterrichts so transparent bist? Fehlt die letzte Natürlichkeit, wenn man nicht alleine in der Klasse unterrichtet?
''Es gibt auch heute noch Phasen, in denen ich mich alleine in der Klasse wohler fühle. Diese treten jedoch immer seltener auf. Die Verunsicherung, von einem Kollegen beobachtet zu werden, macht langsam der Gewöhnung Platz"
Frage (1991):
-
Ist die "Kontrolle" durch den zweiten Lehrer immer noch positiv?
"Am Anfang des gemeinsamen Unterrichtens stellten wir beide fest, daß wir manchmal das Gefühl hatten, einen Lehrauftritt zu absolvieren. Dieses Gefühl legte sich aber mit der Zeit; man hatte sich an die neue Situation gewöhnt und kehrte zu seiner Natürlichkeit zurück. Rolands Anwesenheit empfinde ich seitdem als Beobachtung im positiven Sinn und vielleicht auch manchmal als Instanz, die meine Arbeit kritisch betrachtet. Andererseits ist es ganz natürlich, daß auch ich mich manchmal kritisch äußere.
Solche Situationen sind vielfach Ausgangspunkt für konstruktive Gespräche."
Frage (1989):
-
Habt Ihr jetzt nach einem Jahr schon "Euren gemeinsamen Weg" gefunden?
"Ja!
Es kommt natürlich auch vor, daß man Kompromisse schließen muß. Diese muß man sich manchmal in längeren Gesprächen erarbeiten."
Frage (1991):
-
Müßt Ihr noch viele Kompromisse schließen und wie sehen diese aus?
''Wenn zwei Personen an der Erziehung von Kindern beteiligt sind, ist man nicht immer gleicher Meinung. Es ist daher manchmal notwendig, von der eigenen Auffassung etwas abzurücken, um dem Kollegen die Möglichkeit zu geben, auch seine Ideen einzubringen.
Solche Kompromisse muß man in der Unterrichtsplanung, in der erzieherischen Arbeit und in vielen anderen Bereichen eingehen.
Da es sich jedoch in den seltensten Fällen um tiefgreifende Auffassungsunterschiede handelt, wird darüber gesprochen und dann entschieden. Bis jetzt haben wir alles ausdiskutiert, einen "faulen Kompromiß" haben wie meines Erachtens noch nie geschlossen."
Frage (1989):
-
Wo glaubst Du, kann man als Lehrer diese Fähigkeit der Kooperation lernen?
"Die Basis für Kooperation lernt man sicherlich in frühester Kindheit. Von diesem Zeitpunkt an muß man, glaube ich, ständig an sich arbeiten, kooperationsbereit zu sein. Man muß bemüht sein, den Weg des Gesprächs zu suchen, durch Argumente überzeugen zu können, aber auch Toleranz zu üben.
Der Erziehung in der Schule kommt hierbei sicher eine ganz wesentliche Bedeutung zu."
Frage (1991):
-
Wie müßte für Dich die Ausbildung der Lehrer in Zukunft aussehen, besonders im Hinblick auf die Integration?
"Die Ausbildung der Volksschullehrer müßte mehr in Richtung Sonderpädagogik orientiert sein. Fast in jeder Volksschulklasse sind Kinder, die eine besondere Förderung bräuchten. Momentan ist es jedoch für den Volksschullehrer so gut wie unmöglich, auf diesen erhöhten Förderbedarf einzugehen. Die Gefahr, daß solche Kinder in Klassen mit bis zu 30 Schülern untergehen, ist relativ groß.
Die bisher angebotenen Förderstunden stellen für Kinder mit Lernstörungen keine echte Hilfe dar. Ich glaube, daß aus diesem Grund in Zukunft immer mehr Klassen im Zweilehrersystem unterrichtet werden sollten. Auf eine intensive Ausbildung im Bereich Teamteaching wird daher besonders zu achten sein. Im Bereich der Lehrerbildung sollte der Vermittlung von Kenntnissen betreffend Integrationspädagogik mehr Platz eingeräumt werden."
Frage (1989):
-
Du mußt Deinen Erfolg teilen, Du kannst aber Deinen Mißerfolg auch teilen, wie ergeht es Dir dabei?
''In den Anlangen unserer Arbeit hatte ich das sichere Gefühl, daß die geteilte Autonomie für uns ein Problem darstellte. Auch heute empfinde ich es manchmal noch ungewohnt und "behindernd", sehr viele Probleme ausdiskutieren zu müssen. Ich bin dadurch in meiner Spontanität etwas gebremst. Ich glaube, diesbezüglich sind wir beide noch in einer Lernphase. Ansonsten zählt für mich auch in diesem Lebensbereich:
Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude."
Frage (1991):
-
Du hast gesagt, daß beide Lehrer am meisten lernen müssen, ihre Autonomie zu teilen. Ihr seid am Lernen, wie ist es heute damit?
"Autonomie im Sinne von Freiheit pädagogischen Handelns in der Klasse?
Diese Freiheit haben wir uns erarbeitet.
Natürlich müssen wir noch immer viele Sachen gemeinsam besprechen. Diese Gespräche verlaufen jedoch kürzer und reibungsloser als zu Beginn unserer Arbeit. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl mich ungenügend einbringen zu können."
Frage (1991):
-
Du hast gesagt, daß viele Aspekte der Zusammenarbeit im emotionalen Bereich liegen. Wie gehst Du damit um?
''Natürlich haben sich unsere Kontakte in den vergangenen drei Jahren vertieft, und man kann durchaus sagen, daß sich aus der immer vorhandenen Kollegialität eine Freundschaft entwickelt hat.
Diese freundschaftliche Beziehung erleichtert es uns sicher auch, viele Aspekte der gemeinsamen Aufgaben ungezwungen zu überdenken und letztlich auch durchzuführen."
Inhaltsverzeichnis
Auch wenn der Anstoß zur Einrichtung dieser Integrationsklasse durch die Lehrer kam, war es letztlich der überaus starken und unnachgiebigen Haltung bzw. Zustimmung der Eltern zu verdanken, daß dieser Schulversuch zustande kam. Sie waren und sind die politische Kraft, die den gemeinsamen Unterricht ihrer behinderten und nichtbehinderten Kinder forderte und deren Umsetzung erreichte.
Eine Schulreform, die von den Eltern gefordert und getragen wird, hat wohl eine weit größere schulpolitische Tragweite und Bedeutung, als eine Reform, die "von oben" verordnet wird.
Daß so viele Eltern ihr Kind in diese Integrationsklasse schicken wollten, war einerseits erstaunlich, wurde doch gerade im Bezirk Reutte - besonders durch die Lehrerschaft - sehr viel Negatives über den ersten Schulversuch in Weißenbach verbreitet.
Andererseits zeigte es sich deutlich, daß wohl viele Eltern mit der "herkömmlichen Schule" ihre Probleme hatten und in der Integrationsklasse, aus sicher unterschiedlichen Gründen, eine positive Chance für ihr Kind sahen.
Ich denke, daß auch die starke Persönlichkeit der beiden Lehrer und ihr besonders "guter Ruf' als Lehrer für mehrere Eltern ausschlaggebend waren, ihr Kind für diese Schulversuchsklasse anzumelden (s. Kap. III/2.6.1, S. 83).
Für die allgemeine Entwicklung der schulischen Integration sowie für die Weiterentwicklung einer allgemeinen reformpädagogischen Unterrichtspraxis waren und sind die Eltern von grundsätzlicher Bedeutung.
Eine enge Kooperation voraussetzend, galt es für die Lehrer der Klasse, die Erfahrungen und Beurteilungen der Eltern zum gemeinsamen Unterricht ihrer behinderten und nichtbehinderten Kinder in ihr gesamtes pädagogisches Handeln zu integrieren.
Schon aus diesem Grund war es wichtig, die Eltern als die kompetenten Experten für ihr Kind in das gesamte Schulgeschehen als »evaluatives Feedback« (vgl. Wocken, 1987) einzubinden und ihre Meinungen und Einstellungen zu erfahren.
WOCKEN (1987, S. 129 ff.) stellt die Frage nach der Bedeutung integrativer Schulen für die Eltern und umgekehrt: Welche Bedeutung haben die Eltern für integrative Schulen?
In einer Zusammenfassung schreibt WOCKEN:
"Die Bedeutung integrativer Schulen für Eltern besteht pädagogisch in einer kindergerechten, vielfältigen, allgemeinbildenden Schule für alle Kinder mit und ohne Behinderungen; politisch in der Verwirklichung und Einübung einer mitmenschlichen Gesellschaft, die der gleichen, unveräußerlichen Würde aller Menschen wegen sich zur unverbrüchlichen Solidarität mit Behinderten und Benachteiligten bekennt und keinen sozialen Ausschluß duldet; schließlich persönlich in den emanzipatorischen Chancen, die integrative Eltern-Selbsthilfegruppen eröffnen.
Die Bedeutung der Eltern für integrative Schulen besteht politisch in ihrer Lobbyistenfunktion und pädagogisch in der komplementären Teilhaberschaft an der gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsaufgabe."
Um die Einschätzung der Eltern zum gemeinsamen Unterricht zu erfahren, habe ich im Verlauf der 4 Schuljahre insgesamt drei Elternbefragungen durchgeführt:
-
-am Ende des ersten Schuljahres und
-
-zur Mitte des dritten Schuljahres
jeweils in Form eines geschlossenen Fragebogens.
Ein mit allen Eltern ausführliches persönliches Gespräch, in Form eines eher strukturierten Interviews, bildete den Abschluß am Ende des vierten Schuljahres.
Zum Zeitpunkt der ersten Elternbefragung, am Ende des ersten Unterrichtsjahres (1988/89), lagen in Österreich noch kaum Untersuchungsergebnisse über Elternmeinungen aus Integrationsklassen vor.
Aus der Bundesrepublik Deutschland gab es erste wissenschaftliche Untersuchungen, die über Einschätzungen, Meinungen, Erwartungen und Interessen von Eltern mit Integrationserfahrung von durchwegs hoher Zustimmung berichten (MUNDER 1983; FEUSER 1987; WOCKEN, 1987).
Auch wenn die zuvor erwähnten Integrationsklassen aus der Bundesrepublik Deutschland größtenteils auf Initiative von Eltern zustande gekommen waren, können sie schwerlich mit unserem Schulversuchsmodell (vgl. Entstehungsgeschichte Kap. III/2) verglichen werden, zumal sowohl in Berlin MUNDER (Fläming - Schule in Berlin Schöneberg) und HEYER 1990 (Uckermark - Grundschule/Berlin)[27], als auch WOCKEN in Hamburg (Untersuchungen an Hamburger Grundschulen) von Schulen berichten, in denen zumindest die Schulleitung und die meisten der in diesen Schulen arbeitenden Lehrer entweder diesen Schulversuchen positiv und offen gegenüberstanden, oder sogar die ganze Schule als Integrationsschule eingerichtet war.
Auslösend war, daß es für die beiden Lehrer schon nach dem ersten Schuljahr bedeutsam wurde, die Einstellungen und Erfahrungen der Eltern kennenzulernen, nachdem durch verschiedene Presseaussendungen und Medienberichte die Gefahr bestand, daß die Eltern allgemein bezüglich des gemeinsamen Unterrichts ihrer behinderten und nichtbehinderten Kinder verunsichert wurden, und in unserer speziellen Schulversuchssituation, die Arbeit durch den Leiter der Landesgehörlosenschule Mils im Rahmen eines Radio Tirol-Journals als "nicht geglückt" bezeichnet wurde.
Außerdem gab es weder von der Schulleitung noch von der Kollegenschaft innerhalb der eigenen Schule Andeutungen der Unterstützung oder des Interesses.
Die Schulaufsicht des Bezirkes und des Landes zeigte weder Interesse am Schulversuch, noch war eine durch das Gesetz geforderte wissenschaftliche Begleitung durch das Land entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gegeben.
Auszüge eines Tonbandprotokolles:
Tirol-Journal vom 19. Mai 1989 zum Thema »INTEGRATION«
Moderator: "Herr Astl, Sie unterrichten in einer ersten Klasse. In dieser Klasse sitzt auch ein behindertes Kind, die Sabine, von der Sie mir erzählt haben, und die Sabine ist taub. Es ist vielleicht für viele Menschen sehr schwer vorstellbar, ein taubes Kind gemeinsam mit anderen Kindern, mit hörenden Kindern zu unterrichten. Wie schaut das aus? Können Sie und das ein bißchen vermitteln."
Lehrer Roland Astl:
"Wir sind zwei Lehrer und unterrichten im Zweilehrersystem. Der Kollege von mir ist Sonderschullehrer und gleichzeitig Logopäde. Ich bin Volksschullehrer. Sabine hat durch ihre Taubheit besondere Bedürfnisse, denen wir versuchen gerecht zu werden durch Maßnahmen, die der Logopäde und ich uns absprechen." Moderator: "Ja, Sie wollen also das Defizit ausgleichen durch diesen Sonderpädagogen, den es auch in der Klasse gibt." Lehrer R. Astl: ''Man muß da ein bißchen mehr zu Sabine sagen: Sabine hat ein Defizit, und das ist das, daß sie nicht hören kann. Sabine kann aber viele andere Sachen. Sie kann sehr gut sehen, sie ist ein freundliches, aufgeschlossenes Mädchen. Sie kann über natürliche Gebärden ausgezeichnet mit anderen Kindern kommunizieren. Und wir versuchen jetzt, diese Fähigkeiten, die Sabine hat, zu fördern und auszunützen und sie so in der Gemeinschaft an Sprache heranzubringen. Also unser Weg ist der, daß wir nicht versuchen, uns an ihrem Defizit, eben ihrer Gehörlosigkeit, zu orientieren, sondern an ihren Fähigkeiten, und sie bei ihren Fähigkeiten abzuholen und sie so in der Klasse zu fördern."
Moderator:
''Darf ich noch ein wenig konkreter werden? Ich meine, die Sabine sitzt da, und Sie erklären etwas in der Klasse. Sabine hört es nicht. Wie kann man diese Schwierigkeit überwinden? Können Sie es ein bißchen beispielhaft vielleicht machen?"
Lehrer R Astl:
''Im ersten Jahr war es unser Ziel, bei Sabine den Schriftspracherwerb zu gewährleisten. Sie kann Bilder den Wörtern zuordnen. Sie hat verstanden, daß man mit Schrift Sprache ausdrücken kann. Sie hat auch verstanden, daß andere Kinder um sie herum sprechen, und sie versucht, dies auch nachahmend zu tun, wobei die logopädische Betreuung für uns eine ständige Herausforderung bedeutet. Das ist unser Alltag, der für uns auch schwierig ist, und wir auf Hilfe z.B. von Sonderinstitutionen, von Gehörlosenschulen angewiesen sind.
Ein Weg ist u.a., mit Sabine einen schriftlichen Dialog zu führen.
Es gibt einen Anlaß, ein konkretes Erlebnis, so z.B. kürzlich: Eine Spinne läßt sich an einem Faden von der Decke herab. So ein Erlebnis versuchen wir sofort auszunützen. Es wird eine Spinne gezeichnet und das Wort "Spinne" oder ein Satz dazu geschrieben. Wir versuchen so, ganz konkrete Alltagssituationen in Sprache umzuwandeln."
Anruf von Herrn W.S.:
''Ich bin Leiter der Gehörlosenschule in Mils und hätte auch einiges dazu beizutragen. Ich bin der Meinung, und auch meine Kollegen, die an unserer Schule tätig sind, wir sind der Meinung, daß es verschiedene Arten von Behinderung gibt und daß man ein geistig behindertes Kind, ein hörgeschädigtes Kind nicht unbedingt von der gleichen Warte aus betrachten kann.
Ich kann mir gut vorstellen, daß eine Integration eines geistig behinderten Kindes sehr gut funktioniert, auch eines körperbehinderten Kindes. Diese Integration funktioniert auch. Aber: Wir sind der Meinung. daß man bei der Integration eines gehörlosen Kindes, ich möchte noch einmal sagen "gehörlos", den Ausdruck "taub" gibt es eigentlich nicht mehr, man müßte sagen ein gehörloses Kind, daß man bei gehörlosen Kindern da sehr vorsichtig sein muß und zwar, weil die Gehörlosigkeit als Behinderung und auch jeder Hörschaden in verschiedenen Abstufungen meistens von der Umwelt sehr unterschätzt wird in seiner Auswirkung auf die Psyche, auf die ganze Persönlichkeit so eines geschädigten Menschen. und wir kennen die Sabine. Sie war bei uns einige Zeit im Kindergarten. Ich glaube ungefähr drei Monate. Die Sabine war ein Kind, das von der Zeit vor der Schule her, also praktisch total unvorbereitet zu uns ins Haus gekommen ist, und dann hat man versucht, oder hat man die Sabine in Reutte draußen in den Integrationsversuch aufgenommen. Unserer Meinung nach und meiner Information nach, glaube ich, ist der Versuch in Reutte draußen nicht so als geglückt zu betrachten, wenn ich Kinder unserer ersten Klasse vergleiche. Und wenn ich sehe, oder höre auch, wie unsere Kinder im Unterricht reagieren, wie unsere Kinder in der ersten Klasse schon sprechen können. Und jetzt höre ich vom Kollegen Astl, daß Sie im ersten Jahr versucht haben, nur über die Schriftsprache an das gehörlose Kind heranzukommen.
Ich glaube, ich würde den Kollegen Astl einmal ganz gerne einladen, zu uns in die Schule zu kommen und sich an unseren Kindern und unseren Lehrern, an den Fachleuten. die die Ausbildung für Sonderschule für Gehörlose und Schwerhörige haben. zu orientieren, wieweit man mit so einem Kind gehen kann, was man von einem gehörlosen Kind in diesem Alter verlangen kann. Ich glaube, das wäre eine gute Lösung, und wir von der Schule sind auch durch unseren Betreuungslehrer immer mit der Schule in Reutte in Verbindung und helfen natürlich auch in gewisser Weise mit, daß dieser Integrationsversuch in Reutte gelingen kann."
Moderator:
"Sie sind im Prinzip eher dagegen, würde ich heraushören!"
Dir. W.S.:
"Ja!"
Lehrer R Astl:
''Mir sind jetzt einige Dinge ein wenig neu. Woher ist der Herr Direktor jetzt so informiert über die Sabine? Er war nie bei uns in der Klasse. Es gibt nur den Herrn A.S. als Beratungslehrer. Er ist für uns eine wichtige Ansprechperson. und seine Haltung am Beginn unseres Versuchs war immer die: Er hat uns bestärkt. Er hat uns Ratschläge gegeben, die wir versucht haben umzusetzen.
Kurz vor dem Symposium war Herr A.S. nach längerer Zeit wieder einmal bei uns in Reutte, und er wollte plötzlich wissen: Was geht mit Sabine schief? Was geht schlecht?"
Medienberichte
"Berichtigung und Klarstellung
In ihrer Ausgabe Nr. 13 vom 30. März 1989 wurde im Kulturteil unter dem Titel ''Erfolgreiche Premiere für einen guten Zweck" berichtet, daß der Obmann der Lebenshilfe Außerfern. Heinz Forcher, in seiner Ansprache bei einer zugunsten der Lebenshilfe Außerfern veranstalteten Theaterpremiere in Ehrwald die Abstimmungsergebnisse von drei Außerferner Hauptschulen über die Integration Behinderter an Hauptschulen dem versammelten Publikum mitteilte und, daß der Lehrkörper der Hauptschule Am Königsweg zu 100% (!) gegen eine Integration Behinderter stimmte.
Dazu stellen die Lehrer der Hauptschule Am Königsweg folgendes klar und berichtigen: Bei dieser Abstimmung ging es nicht, wie von Obmann Heinz Forcher wissentlich und absichtlich falsch dargestellt wurde, um die Integration Behinderter, sondern einzig und allein um die Frage der Integration geistig schwerst Behinderter an der Hauptschule (siehe unten abgedruckter Stimmzettel!). Und nur gegen eine solche Integration hat sich der Lehrkörper ausgesprochen, weil er der Meinung war, daß eine Integration Behinderter nur dann "sinnvoll" ist, wenn die Behinderten auch "integrationsfähig" sind und damit ein gemeinsamer und gedeihlicher Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten möglich ist. Außerdem sei hier noch erwähnt, daß es für die Lehrer der Hauptschule Am Königsweg eine Selbstverständlichkeit war und ist, Kinder mit schwerer Körperbehinderung zu unterrichten, ohne sich damit in der Öffentlichkeit hervorzutun. Wenn also der Obmann der Lebenshilfe Außerfern schon Abstimmungsergebnisse der Öffentlichkeit bekanntgibt, dann soll er auch bei der vollen Wahrheit bleiben!"
Der Lehrkörper der Hauptschule Am Königsweg Reutte
(Außerferner Nachrichten vom 12. April 1989)
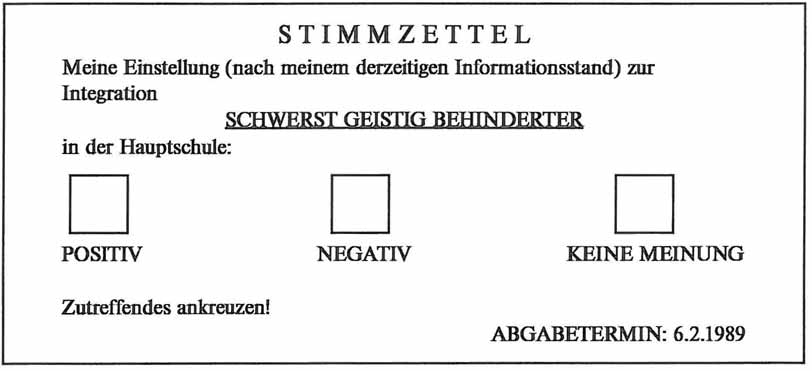
"Wir haben beschlossen: Ihr bleibt draußen!
Sehr geehrte Lehrpersonen der Hauptschule am Königsweg!
In Ihrem Leserbrief vom 12.4.1989 in den Außerferner Nachrichten ("Berichtigung und Klarstellung") behaupten Sie, daß ich Ihre Abstimmung zu Integration von ("schwer geistig") behinderten Kindern falsch wiedergegeben habe. Um es deutlicher zu formulieren: Sie bezichtigen mich der Lüge!
Sie haben also abgestimmt nach Ihrem "derzeitigen (?) Informationsstand", und zwar zu 100% negativ. Darf ich fragen, wie lange Sie noch brauchen, um sich einigermaßen zu informieren über die Möglichkeiten und vor allem über die Vorteile eines gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern?
Seit 1985 gibt es einen Schulversuch zur sozialen Integration in Weißenbach. Sie mußten doch damit rechnen, daß diese Kinder nach vier Jahren an die Hauptschultür anklopfen werden ... Was haben Sie also gemacht in den vergangenen Jahren, um sich über den aktuellen Stand der schulischen Integration Informationen zu beschaffen? Wie viele Lehrpersonen haben das Angebot wahrgenommen, an der Volksschule Weißenbach schulische Integration persönlich zu erleben? Seit 1988 gibt es die gesetzlichen Voraussetzungen für einen gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Welche Vorbereitungen gibt es dafür an Ihrer Schule? Haben Sie diesbezüglich einmal mit der örtlichen Sonderschule Kontakt aufgenommen? Das Angebot dazu war vorhanden. Wo war die Mehrzahl von Ihnen, als Univ.-Prof. Dr. Rupert Vierlinger an Ihrer Schule über innere Differenzierung (= notwendige Voraussetzung für eine Integration an der Hauptschule) referierte? Vom 4.-7.5.89 findet (teilweise in den Räumlichkeiten Ihrer Schule) das 5. Gesamtösterreichische Symposium "Schule ohne Aussonderung" in Reutte statt - eine weitere Möglichkeit, Ihren Informationsstand zu heben.
Sie tun also einerseits so, als wären Sie nicht gegen Integration. Andererseits geben Sie zu, daß Sie momentan noch zu wenig informiert sind. Warum stimmen Sie dann über etwas ab, worüber Sie - wie Sie selbst zugeben - offensichtlich zu wenig Bescheid wissen? Und wenn Sie schon abstimmen, warum stehen Sie dann nicht mehr dazu und versuchen jene, die dies an die Öffentlichkeit weiterleiten, als Lügner hinzustellen? Muß man daraus vielleicht schließen, daß Ihre innere Einstellung (siehe Ihr Stimmzettel) gegenüber Behinderten nicht so ganz unbelastet ist?
Mit freundlichen Grüßen: Heinz Forcher
PS: Zum einen hat mich als Vater eines behinderten Kindes Ihre abwertende Formulierung "schwerst geistig behindert" sehr getroffen. Können Sie diese "Definition" betroffenen Eltern erklären? Ist Ihnen bewußt, daß Sie mit Ihrer Formulierung einen Teil der Kinder schwer diskriminieren, in unsinniger Art und Weise schubladisieren und von gemeinsamen Erfahrungen und einem gemeinsamen Leben mit anderen ausschließen? Und zum anderen dürfen sie es getrost den Eltern überlassen zu entscheiden, was für ihre Kinder "sinnvoll" ist."
(Außerferner Nachrichten vom 19. Apri11989)
"Leserbrief zum Artikel "Berichtigung und Klarstellung" des Lehrkörpers der HS am Königsweg
Mit großer Befremdung haben wir Ihren Artikel vom 12.4.1989 in den "Außerferner Nachrichten" gelesen.
Wir fragen Sie: Woher nehmen Sie das Recht darüber abzustimmen, welches Kind "integrationsfähig" ist und welches nicht? Es würde uns besonders interessieren, wo Sie die Grenzen ziehen und einen für Sie vermeintlich "harten Kern" - sprich geistig Schwerstbehinderte - ab- bzw. auszugrenzen beginnen. Unserer Ansicht nach stellen Sie die Gemeinschaft aller und die Gemeinschaft des Einzelnen mit den anderen - wohl ein Grundrecht demokratischer Lebensauffassung - sehr in Frage.
Ist für Sie das Zusammenleben aller Menschen nicht eine humane Selbstverständlichkeit? Leider verfallen Sie in ein Denken, dem es darum geht, festzustellen, was ein Kind nicht kann.
Sie stellen Defizite von Kindern in den Vordergrund, statt daß Sie umgekehrt von dem ausgehen, was ein Kind kann, um es von da aus zu fördern und von da aus mit ihm auf den Weg des Lernens zu gehen.
Was verstehen sie unter "sinnvoller Integration"? Pädagogisch sinnvoll wäre es zu fragen, wie die Verhältnisse in Ihrer Schule arrangiert werden können, daß das behinderte - auch das schwerst geistig behinderte - Kind auf den Weg des Lernens kommt und Geborgenheit in der Schule erfährt. Die primäre Frage sollten Sie also nicht auf die Integrationsfähigkeit eines behinderten Kindes richten, sondern auf die Integrationsfähigkeit Ihrer Schule!
Dazu gehört auch, daß nicht alle Schüler einer Klasse auf die gleichen Lernziele festgelegt werden. Das Lernen in den Schulklassen muß dem didaktischen Prinzip der Individualisierung der Lernprozesse folgen. Dies bedeutet, daß jedem Kind die Möglichkeit eröffnet wird, seinem individuellen Lernvermögen gemäß an den Prozessen des Lehrens und Lernens teilzunehmen.
Integration kann daher unserer Ansicht nach nicht als ein Problem verstanden werden, dessen Für und Wider diskutiert werden sollte, sondern ist eine Aufgabe, die den Menschen in einer demokratischen Gesellschaft aufgegeben ist.
Notiz zum Stimmzettel Wenn wir auf Ihren "derzeitigen Informationsstand" schauen, hoffen wir auf eine positive Entwicklung in der Zukunft ..."
Studenten der Pädagogik der Universität Innsbruck
(Außerferner Nachrichten vom 3. Mai 1989)
"Leserbrief zum Leserbrief "Studenten der Pädagogik der Universität Innsbruck"
Sie fragten in Ihrem Artikel vom 3.5.1989 in den "Außerferner Nachrichten", woher die Lehrpersonen der HS am Königsweg das Recht nehmen, abzustimmen, welches Kind "integrationsfähig" ist und welches nicht. Die Abstimmung galt ja nur den geistig schwerstbehinderten Kindern. Sie glauben doch selber nicht, daß eine Lehrperson nicht weiß, wie weit ein Kind in seinem Alter geistig reif sein sollte! Müssen sich nicht alle Jahre die einschulenden Volksschüler einer Reifeprüfung unterziehen? Sollte ein Kind geistig noch nicht so weit sein, so wird empfohlen, das Kind noch ein Jahr zu Hause zu lassen, damit es im nächsten Jahr leichter mitkommt. Dies geschieht nur im Interesse des Kindes! Wie steht es da mit dem Recht!
Die ''Integration'', daß geistig zurückgebliebene Kinder mit anderen in der gleichen Klasse waren, gab es schon vor 50 Jahren; nur mit dem Erfolg, daß die Behinderten in die letzte Bank gesetzt wurden und leichtere Aufgaben erhielten. Leider konnte sich der Lehrer nicht viel mit diesen Kindern abgeben, da er mit den anderen den Lehrplan durchbringen mußte. Gott sei Dank hat sich das verbessert! Es sind Sonderschulen entstanden, die sich dem Lernfortschritt der geistig Behinderten anpaßten.
Als die oberen Stufen der Volksschulklassen aufgehoben wurden und die Schüler in die Hauptschulen kamen, mußten auch hier zwei Klassenzüge eingeführt werden. Jetzt wurden sogar drei Leistungsgruppen eingeführt. Es ist daher wohl sicher anzunehmen, daß bei dem großen Angebot der ausschulenden Kinder - je nach Berufswahl - diejenigen des 1. Klassenzuges bzw. der 1. und 2. Leistungsgruppe leichter einen Posten bekommen werden, als die anderen.
Bei der derzeitigen ''Integration'', bei der für zwei oder drei geistig behinderte Kinder eine Lehrperson beigestellt wird, die dann gemeinsam mit der Klassenlehrperson den Unterricht durchführt, ist nur zu sagen: Es gibt fast in jeder Gemeinde geistig behinderte Kinder. Wenn das also jede Volksschule durchführen will, so könnte man es schlecht der einen bewilligen und der anderen verweigern. Was das die sowieso stark verschuldete Republik kosten würde, habt Ihr natürlich nicht bedacht Das ist bei den Studenten auch nicht verwunderlich, haben doch die meisten noch keinen Groschen verdient und hängen an ihres Vaters Geldtasche!
Die Lehrpersonen der HS am Königsweg haben pflichtbewußt und vollkommen richtig gehandelt, indem sie die anderen Kinder im Auge gehabt haben. Wenn auch die "Integration" während der ganzen Schulzeit durchgeführt wird, so hat sie spätestens am Arbeitsmarkt ein Ende. Dann werden die geistig schwer Behinderten ein Sozialfall bleiben und die anderen werden sie mit ihren Sozialabgaben unterstützen.
Dies ist die Meinung eines Vaters, dessen Kind eine "integrierte Klasse" besucht"
R. Z., Weißenbach
(Außerferner Nachrichten vom 10. Mai 1989)
Aushang an der Hauptschule am Königsweg
''Neurologisches Krankenhaus der Stadt Wien
Rosenhügel
Abteilung für entwicklungsgestörte Kinder
Univ. Prof. Dr. Andreas Rett
Wien, 14.6.1989
An Herrn
HL K.D.
Hauptschule am Königsweg
Gymnasiumstraße 1
6600 Reutte
Sehr geehrter Herr Direktor!
Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 30.5.1989 und darf Ihnen mitteilen, daß Sie und Ihr Lehrkörper völlig richtig gehandelt haben. Daß Sie von den sogen. Integrationsfanatikern angegriffen werden, auch von den pädagogisch völlig unerfahrenen Studenten, war zu erwarten. Schwerstbehinderte zu integrieren, sollten sie intellektuell nicht in der Lage sein, dem Unterricht zu folgen, zumindest teilweise zu folgen, ist ein Unsinn und kann nur zu Depressionen bzw. zu Aggressionen der Behinderten führen. Daß der Großversuch in Italien total gescheitert ist, hat sich noch nicht herumgesprochen, aber "Sozialmaskottchen" in die Klasse zu setzen, ist nun einmal sinnlos. Integrationsfähigkeit kann auch nie von den Eltern sozusagen auf Wunsch bestimmt werden. Die Anforderungen einer heutigen Hauptschule sind auch nicht durch einen Stützlehrer zu beheben. Stufenweise Integration in einfachen Fächern wie Musik, Zeichnen, Religion ist möglich, aber die Integration in eine Hauptschule halte ich für absolut überfordernd und daher schlecht. Zu behaupten, daß verschiedene didaktische Ziele in einer Klasse existieren sollen ist ebenso unsinnig, da die Hauptschule nun einmalganz konkrete Ziele haben muß.
Lassen Sie sich von überehrgeizigen Eltern nicht in eine hoffnungslose Aufgabe treiben. Nach meiner Erfahrung sind vernünftige Eltern sich stets darüber im Klaren, daß ihre schwerstbehinderten Kinder eben eine besondere pädagogische Situation brauchen und selbst dann. wenn man sie durch eine Hauptschule ohne Erfolg treibt, den Übergang in ein Berufsleben nicht bewältigen.
Daß körper- bzw. sinnesbehinderte, intellektuell gesunde Kinder in die Volks- und Hauptschule zu integrieren sind, ist völlig klar. Auch schwach befähigte Kinder, die mit entsprechender Unterstützung integriert werden können, ist unbedingt richtig. Die Stütze, die sie brauchen, muß gegeben sein, wobei die Benotung durchaus individuell sein kann. Viel zu viele schwach befähigte Kinder sind bisher nur aufgrund eines verminderten IQ in die ASO abgeschoben worden. So wird vor allem in solchen Fällen die Leistung in Mathematik gesondert beurteilt werden müssen. Solche Kinder haben ja durchaus die Chance, in den anderen Fächern zu reüssieren. Hier ist ein Integrationsversuch sicher angezeigt.
Schwerstbehinderte reagieren ja oft auf Integration dramatisch und als soziales Erziehungsmittel für die gesunden Klassenmitglieder sind sie nicht geeignet Die sogen. Integrationshysterie wird von Leuten gefördert, die ihr Kind mit Gewalt in die Normalschule setzen wollen und nicht bedenken, welche seelische Belastung sie damit erzeugen. Der Schwerstbehinderte braucht ja auch seine Erfolgserlebnisse und die kann er in dem unerbittlichen Konkurrenzkampf nie erwerben.
Lassen sie sich nicht in Ihrer Haltung irremachen. Wer genügend Erfahrung mit geistig behinderten Kindern hat, weiß, daß hier ein Irrweg beschritten wird, der an manchen Orten und Ländern schon wieder revidiert wurde, weil die politische Absicht der Schulbehörden klar zu erkennen war und ist. Daß sich die Lebenshilfe so sehr dieses Themas annimmt, ist ein eindeutig behindertenpolitisches Agieren, das nur allzu durchsichtig ist Die Lebenshilfe liegt nur ebenso falsch, wie in ihrer Befürwortung der sexuellen Beziehungen Schwerstbehinderter untereinander.
Ich bin mit besten Grüßen
Ihr
Univ. Prof. Dr. A Rett
PS: Selbstverständlich ist dieser Brief zur Veröffentlichung geeignet"
In Absprache mit den beiden Lehrern habe ich mich für die ersten beiden Befragungen zur Fragebogenmethode entschieden, da eine mündliche Befragung durch ein Interview einen zu langen Zeitraum in Anspruch genommen hätte und die Aktualität der Thematik eine rasche Meinungsfindung erforderlich machte.
Außerdem sollte in beiden Befragungen durch die Möglichkeit der Anonymität den Eltern eine freie und offene Meinungsäußerung ermöglicht werden.
Die erste Befragung war auch aus Gründen des allgemeinen Verständnisses bei allen Eltern auf einige wenige, aber grundlegende Fragenkonzentriert.
Mit Datum vom 9.6.1989 erhielten 21 Elternpaare per Post ein Anschreiben, einen Fragebogen und ein Rückantwortkuvert.
(Da ein Zwillingspaar die Klasse besuchte, erhielten diese Eltern nur einen Fragebogen).
Um Mißverständnissen durch die Anschrift der Sonderschule vorzubeugen, wurde in Absprache mit der Schulpsychologin die Rücksendung an die Anschrift des schulpsychologischen Dienstes gewählt.
Die Fragen habe ich mit der Schulpsychologin, Frau Dr. D.O., den Lehrern und den Elternvertretern der Klasse auf ihre inhaltliche Akzeptanz und Verständlichkeit durchgesprochen und danach überarbeitet.
Den Eltern der drei türkisch sprechenden Kinder der Klasse habe ich telefonisch mit Hilfe einer sehr gut deutsch sprechenden türkischen Frau mitteilen lassen, daß diese Frau gerne bereit wäre, ihnen bei der Beantwortung der Fragen zu helfen, wenn sie es wünschen sollten.
Hypothetisch wurde von mir aus mehreren Gründen ein doch positives Ergebnis erwartet:
-
Die Eltern hatten alle freiwillig im Herbst des Vorjahres ihr Kind für diese Klasse angemeldet und
-
konnten in eigener Entscheidung die Zusammensetzung der Klasse unter Vorgabe der 3 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bestimmen.
-
Die Eltern wußten, welche Lehrer in der Klasse unterrichten werden
-
und sie waren durch die anfängliche Ablehnung durch die Volksschule Reutte sogar mit einer Eingliederung der Klasse in die Allgemeine Sonderschule einverstanden.
Da einige Eltern aber doch eher geringen Einblick in die Unterrichtspraxis hatten, erwartete ich vermehrt Anmerkungen unter der Rubrik "ohne Angabe" und zu den drei offengehaltenen Antwortmöglichkeiten: Was finden Sie besonders gut oder weniger gut? Was hätten Sie gerne geändert?
Von den 21 zugeschickten Fragebögen wurden 14 schriftlich zurückgesandt, und sechs persönlich bei mir in der Schule abgegeben. Insgesamt haben 16 Elternpaare ihren Fragebogen namentlich unterzeichnet.
Bei den drei türkischen Eltern kamen jeweils die Väter in die Schule und erklärten unter dem Beisein der Dolmetscherin, daß sie persönlich, aber vor allem durch die Aussagen ihrer Kinder, überzeugt sind, daß die Schule für ihr Kind sehr gut sei und sie sehr großes Vertrauen in die beiden Lehrer hätten.
Ihre durchwegs positiven Aussagen wurden von mir im Fragebogen entsprechend berücksichtigt.
Die Eltern der drei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gaben in der Schule persönlich ihren Fragebogen ab und brachten zusätzlich mündlich ihre große Zufriedenheit und auch ihr großes Vertrauen gegenüber den beiden Lehrern und dem begleitenden Team zum Ausdruck.
Den Angaben folgend sind fast alle Eltern auch nach einem Jahr von der Richtigkeit ihrer Entscheidung, ihr Kind in diese Integrationsklasse geschickt zu haben, überzeugt.
So beurteilen 17 Elternpaare die gemeinsame Erziehung auch nach einem Schuljahr noch als "sehr gut" und die übrigen drei als "gut".
Bezüglich des "uneingeschränkten Vertrauens" zu den beiden Lehrern sind alle Eltern davon überzeugt, daß sich die Lehrer "sehr große Mühe" geben, die Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten zu fördern.
Erfreulich war besonders, daß alle 20 Elternpaare ihr Kind wieder in eine integrative Klasse schicken würden und alle Kinder gerne in die Schule gehen.
Für die beiden Lehrer bedeutete das große Vertrauen der Eltern in ihre Arbeit und auch die Aussage, daß die Kinder gerne in die Schule gehen, nicht nur Sicherheit, sondern auch Motivation und Rückhalt.
Daß es für die Eltern schwer und z.T. überfordernd war, den Unterricht in der Klasse zu beurteilen, war mir bewußt. Trotzdem war es wichtig, auch geringfügige Verunsicherungen der Eltern zu beachten, so merkten z.B. 7 Elternpaare bei der Frage nach genügend Ordnung und Disziplin "stimmt teilweise" an.
Ich konnte also vermuten, daß einige Eltern evtl. Probleme mit den Erzählungen über eine freie Arbeitsphase ihrer Kinder hatten.
Die Ergebnisse des Fragebogens wurden daher am nächstfolgenden Elternabend durch die Lehrer den Eltern vorgestellt und bildeten die Grundlage für weitere vertiefende Diskussionen zur Unterrichtspraxis in der Klasse.
Ein weiteres zentrales Thema wurde auch die Frage:
»Lernt mein Kind genügend? Wird genügend Leistung verlangt?
Wird in der Freiarbeit überhaupt gelernt, oder ist es nur eine Spielstunde?
U.ä«
In den Rubriken zu den individuellen Stellungnahmen machten die Eltern u.a. folgende von mir zusammengefaßte Anmerkungen:
Was finden Sie besonders gut?
Für einige Eltern war die "Unauffälligkeit" des Schulversuchs besonders auffällig, so äußerten sie u.a.:
-
"Die erste auffällige Erkenntnis besteht darin. daß diese "Integration" ohne besondere Auffälligkeit stattfindet und von unserem Kind als selbstverständliche Gegebenheit erlebt wird."
-
''Meine Frau und ich können nur feststellen, daß das Zusammensein mit behinderten Kindern von unserem Sohn als nichts Ungewöhnliches angesehen wird."
-
''Die Einbeziehung behinderter Kinder ist für unsere Tochter kein Problem. Der beste Beweis dafür ist, daß sie fast nie über diese Kinder spricht und die Situation, so scheint es mir, einfach als "normal" empfindet Wenn von unserer Seite das Gespräch darauf kommt, so bin ich oft selbst überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit und Unbefangenheit sie das Wort "behindert" in den Mund nimmt"
Zum gemeinsamen Unterricht durch zwei Lehrer:
-
''Die "Abnormität" von zwei Lehrern in der Klasse konnte von unserer Tochter nie als solche erkannt werden."
-
"Das sogenannte ''Teamteaching'' scheint dem Kind zu gefallen. Beide Lehrer werden akzeptiert. Noch nie konnte ich irgendwelche Äußerungen vernehmen, aus denen man negative Schlüsse ziehen könnte in Bezug auf die Organisation der Unterrichtsstunde."
-
''Überraschenderweise ausschließlich positive Berichte über ''Doppellehrer'', ebenso überraschend bevorzugt das Kind kaum einen der beiden Lehrer. Laut Kind bemühen sich auch beide Lehrer im gleichen Umfang."
-
"Eine weitere Erkenntnis ergibt sich aus der Teamarbeit der beiden Lehrpersonen, die unserem Kind die Sicherheit geben, jederzeit für eine Frage oder ein Problem ansprechbar zu sein."
-
"Der Unterricht durch zwei Lehrer führt zur Flexibilität bei den Kindern."
Zum sozialen Miteinander behinderter und nichtbehinderter Kinder:
-
"Wir sind von den positiven Auswirkungen auf das soziale Lernen durch die Integration Behinderter überzeugt, und unser Sohn L. beweist uns das, indem er über das behinderte Kind nicht mehr spricht als über andere Mitschüler. Die Aktionen Sabines in der Klasse werden von ihm genauso aufgenommen wie die anderer Mitschüler. Das heißt: Für ihn ist Behinderung kein Problem."
-
"Unser Sohn fühlt sich nach seiner eigenen Aussage in Gemeinschaft aller sehr wohl, und wir haben nicht den Eindruck, daß das Zusammenleben mit Behinderten auf ihn irgendwie einen negativen Einfluß ausübt"
-
''Von unserer Tochter wird immer wieder jeder Fortschritt (im besonderen beim gehörlosen Kind) wahrgenommen und mit viel Freude weitererzählt Tiefe Eindrücke hinterlassen bei ihr dabei die von ihm getätigten Hilfeleistungen."
-
"Die integrierte Klasse hat auch noch eine weit wichtigere, weil gesellschaftspolitische Funktion. Es geht um das Erlernen des Zusammenlebens des Nichtbehinderten mit dem Behinderten. Durch diese Erfahrung sind Kinder vielleicht in der Lage, Eltern positiver bezüglich Behinderten zu beeinflussen. Auf alle Fälle ist sicher, daß die Kinder dieser Klasse als spätere Erwachsene kein gestörtes Verhältnis zu den Behinderten haben."
-
"Für unsere Tochter gibt es in der Klasse eigentlich niemanden, der als behindert bezeichnet werden hätte können. Für sie gilt z.B. K.H. als behindert Ihn kennt sie von privaten Besuchen. In der Klasse scheint Sabine für sie nur etwas interessanter oder etwas außergewöhnlicher zu sein."
-
"Sie macht wahrscheinlich eine Erfahrung mehr als Kinder von Parallelklassen, denn wer hat schon oft Gelegenheit, einem taubstummen Mädchen etwas erklären zu dürfen?"
Zum Unterricht in der Klasse und zu den Lernerfolgen ihrer Kinder machten einige Eltern folgende Anmerkungen:
-
"Bis jetzt wurden unsere Erwartungen sogar zum Teil übertroffen (Beilage zur Schulnachricht). Die in dieser Klasse praktizierte Unterrichtsform - scheinbar ohne Schulstreß - ermöglicht es den Kindern, den Unterricht in gewisser Weise selbst zu gestalten (Freie Arbeit)."
-
"Die praktizierten Unterrichtsformen (kindorientierte Lernformen, das Miteinander-Reden, Miteinander-Arbeiten, das gegenseitige Sich-Helfen-Dürfen, die Freie Arbeit ...), wirken offensichtlich sehr unterstützend und bringen Begeisterung und Freude mit sich."
-
''Trotz sehr starker Beziehung zur Mutter stellen wir eine begeisterte Teilnahme am Klassengeschehen und am Unterricht fest. Wir freuen uns einfach über die großen Lernerfolge."
-
''Wir empfinden, daß unser Bub große Lernfortschritte macht, und das wird zum größten Teil in der Schule, und nicht, wie oft üblich, durch übermäßige Hausübungen erreicht"
-
"Er geht sehr gerne in die Schule und fühlt sich in der Klasse wohl. Vor allem ist er vom vielfältigen Angebot von Lernmaterialien begeistert. Er erlebt den Unterricht dadurch lebendig und abwechslungsreich."
-
"Der Lernerfolg ist meines Erachtens sehr zufriedenstellend, was sicher darauf zurückzuführen ist, daß das Kind gerne und ohne jeglichen Zwang in die Schule geht. Die abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung wird in dieser Hinsicht natürlich auch eine große Rolle spielen."
Zusammenfassend gefiel fast allen Eltern das besonders behutsame Umgehen mit den Kindern und das große Einfühlungsvermögen durch die beiden Lehrer. Dazu das gute Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern und natürlich die völlig angstfreie und kindgerechte Schulatmosphäre.
Das gesamte Klassenklima und der große Gemeinschaftsgeist, eben das helfende und unterstützende Miteinander der Kinder, war für sehr viele Eltern etwas besonders Positives, aber auch Neues, das ihre Kinder in der Schule erleben.
Was finden Sie weniger gut?
Dazu gab es insgesamt nur drei kurze Anmerkungen, wobei der freie Samstag von 6 Elternpaaren gefordert wurde. Daß es kaum eine durch die Lehrer verordnete Lesehausübung gab und auch keine Diktate mit Noten, wurde von einem Elternteil der Klasse als weniger gut bezeichnet.
-
"Den Unterricht am Samstag",
-
"als Hausaufgabe kaum lesen",
-
"keine Diktate mit Benotung bzw. Gesichtern".
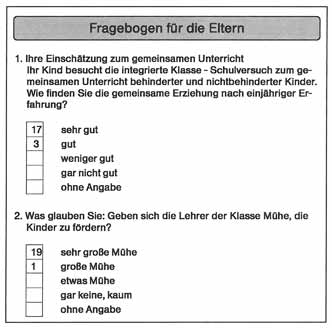
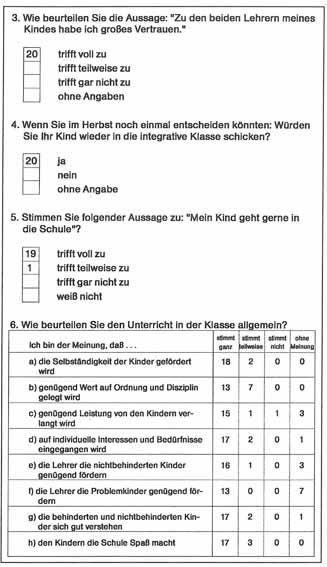
In dieser Befragung ging es vor allem um eine Bewertung (Evaluation) des Unterrichts in der Integrationsklasse durch die Eltern.
Mir war bewußt, daß die Eltern nicht die einzigen Bewertungsinstanzen für den Erfolg oder Mißerfolg einer integrativen Beschulung sind, aber die gedeihliche Entwicklung unseres Schulversuches stützte sich auch auf die Erfahrungen und Einschätzungen der Eltern.
Die Rückmeldungen und die Beurteilungen der Eltern über die bisher geleistete Unterrichtsarbeit waren für die Lehrer deshalb von Bedeutung, stellten sie doch zusätzlich wichtige Kriterien zur Gestaltung der weiteren Unterrichtstätigkeit dar.
Unmittelbarer Anlaß für diese zweite Fragebogenerhebung bei den Eltern zum Ende des ersten Halbjahres des dritten Schuljahres 1990/91 waren aktuelle Diskussionen an Elternabenden und persönliche Eltern-Lehrer-Gespräche insbesonders zu Leistungsanforderungen und dem Ausmaß der Hausübungen.
Da besonders eine Mutter am Elternabend große Bedenken zum Unterricht der beiden Lehrer äußerte, kam es zu einer recht lebhaften Diskussion zwischen den Eltern.
Die Mutter äußerte folgende Kritikpunkte:
-
"Die freie Arbeitsphase sei nur vertrödelte und verspielte Zeit ...
-
Es fehle das tägliche Diktat ...
-
Durch die Gruppenarbeit seien die Kinder viel allein, es fehle die Motivation zur Leistungssteigerung ...
-
Durch das Fehlen der Leistungskontrollen und Tests gäbe es für die Eltern sehr wenig Kontrolle ...
-
Es werde zu wenig Hausübung aufgegeben ...
-
Gute und durchschnittliche Schwer werden nicht genügend gefördert ...
-
Notenzeugnisse sind für weitere Schulen notwendig ..."
Die meisten Eltern widersprachen diesen Argumenten und wollten, daß der Unterricht in unveränderter Form durch die Lehrer weiter fortgesetzt werde. Sie waren überzeugt, daß sowohl die Qualität des Unterrichts als auch die Förderung ihrer Kinder dem entspricht, was gerade sie sich für ihre Kinder gewünscht und auch erwartet hatten, als sie ihr Kind für diese Klasse angemeldet hatten.
Da es, wenn auch nur sehr wenige, Eltern gab, die sich an derartigen Gesprächen sehr zurückhaltend oder überhaupt nicht beteiligten, erschien es den Lehrern notwendig, allen Eltern die Gelegenheit zu geben, sich zu äußern und ihre Einschätzung und Beurteilung zum Unterricht in der Klasse kundzutun.
Zur Methode:
"Da schriftliche Befragungen ein hohes Maß an Verständlichkeit und Klarheit erforderlich machen, und offene Frageformulierungen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zu schriftsprachlichen Äußerungen voraussetzen" (WOKKEN, 1987, S. 148), habe ich in dieser zweiten Befragung zum einen geschlossene Fragen mit Antwortvorgaben "zum Ankreuzen", ähnlich dem ersten Fragebogen, verwendet, zum anderen aber den Eltern auch die Möglichkeit gegeben, zu jeder Frage in offener Form Stellung zu nehmen.
Außerdem konnte ich erwarten, da fast alle Eltern sehr engagiert am Schulgeschehen ihrer Kinder teilnahmen, daß sie ihre Meinung entsprechend zusätzlich schriftlich kundtun werden, wenn sie es als erforderlich erachten.
Ich denke auch, daß diese Fragebogenmethode, bei der Eltern einzeln und anonym befragt werden, als Alternative und Ergänzung zu Elternabenden angesehen werden kann.
Aus der positiven Erfahrung meiner ersten Elternbefragung zum Ende des ersten Schuljahres, vor ca. 1 1/2 Jahren, als die Rücklaufquote nahezu 100% betrug, schloß ich, daß die Eltern sehr wohl erkannten, daß auch diese Befragung nur deshalb durchgeführt wurde, um die Schule und damit den Unterricht weiter zu verbessern.
Zur Durchführung: Bei einem vorangehenden Elternabend wurde den Eltern durch die beiden Lehrer der Fragebogen vorgestellt und die Beurteilungskriterien an einem Beispiel erklärt. Unter ausdrücklicher Zusicherung der Anonymität wurden alle Eltern um ihre Mitarbeit gebeten.
Zusätzlich hatte ich die wichtigsten Informationen zum Fragebogen auf einem Instruktionsblatt zusammengefaßt und als Deckblatt beigefügt.
Natürlich erhielten die Eltern auch die Zusage, daß sie möglichst rasch an einem der nächsten Elternabende über die Ergebnisse informiert werden würden.
21 Elternpaare erhielten persönlich bzw. per Post wiederum ein Anschreiben, den Fragebogen und ein entsprechendes Rückantwortkuvert.
Ich bat die Eltern, die Fragebögen binnen ca. zwei Wochen an die Anschrift des schulpsychologischen Dienstes zurückzusenden.
Insgesamt erhoffte ich mir durch diese zweite Befragung positive Bestätigungen und Rückmeldungen der bisher geleisteten Unterrichtsarbeit der beiden Lehrer durch die Eltern.
Zudem erwartete ich auch, daß sich die Eltern in den vergangenen drei Schuljahren nun einen vertiefteren Einblick erworben und damit aber auch ein größeres Verständnis und Wissen für die Unterrichtspraxis in dieser Klasse angeeignet hatten.
Dadurch konnte ich aber annehmen, daß die Eltern sich durchaus auch kritisch über die schulischen Leistungen ihrer Kinder äußern würden.
Einige Eltern hatten in den vergangenen 2 1/2 Schuljahren schon die Gelegenheit genützt, in der Klasse beim Unterricht ihrer Kinder zu hospitieren. Ein Großteil der Eltern wiederum half gelegentlich bei der Vorbereitung von Unterrichtsvorhaben, wobei verschiedene Lehrmittel durch die Eltern selbst hergestellt wurden, mit.
Aus solchen Aktivitäten, aus den Gesprächen mit den Lehrern und andern Eltern und nicht zuletzt aus der interessierten Anteilnahme an all dem, was die eigenen Kinder aus der Schulle mitbrachten und für die Schule zu arbeiten hatten, gewannen die Eltern eine mehr oder weniger differenzierte Meinung über den Unterricht, der ihren Kindern zuteil wurde.
In Anlehnung an eine Elternbefragung durch H. Wocken 1987 an Hamburger Integrationsklassen (vgl. WOCKEN, 1987, S. 125 ff.) erstellte ich vier Beurteilungsdimensionen.
Diese vier Faktoren spiegeln das Urteil der Eltern darüber wider:
-
-welche integrative Qualität der Unterricht besitzt,
-
-wie gut die behinderten Kinder gefördert werden,
-
-wie gut die nichtbehinderten Kinder gefördert werden,
-
-wie gut das selbständige und disziplinierte Arbeiten gefördert wird.
Unter der Berücksichtigung, daß alle drei Elternpaare der türkischen Kinder ihren Fragebogen nicht zurückschickten, sondern bei mir persönlich in der Schule vorsprachen und sich höchst lobend und in allen Punkten sehr zufrieden über den Unterricht und die Entwicklung ihres Kindes äußerten, konnte festgehalten werden, daß die Eltern besonders der Dimension "Integrative Qualität des Unterrichts" die allerbesten Noten ausstellten.
Eine äußerst positive Meinung hatten die Eltern auch darüber, daß besonders das gegenseitige Verständnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern gefördert wird.
Zur Förderung der behinderten Kinder:
Hier hatte nur etwa· die Hälfte der Eltern eine Stellungnahme angekreuzt. Auch die individuellen schriftlichen Stellungnahmen bestätigten, daß die Eltern der nichtbehinderten Kinder dazu nichts äußern konnten, da ihnen die dafür notwendigen Einblicke und Beurteilungskriterien fehlten.
Zur Förderung der nichtbehinderten Kinder:
Ab dieser Frage wurde deutlich, daß einige Eltern zumindest verunsichert waren, ob ihr Kind genügend gefördert würde.
Etwa ein Drittel der Eltern konnte sich vorstellen, daß von ihren Kindern mehr Leistung durch die Lehrer verlangt werden sollte.
Dies bestätigte auch das Verlangen von acht Elternpaaren nach mehr Hausübung für ihre Kinder.
Ein Elternteil war der Meinung, daß durch die Freiarbeit zuviel Zeit vertrödelt und verspielt werde (dieses Elternpaar wollte ab diesem Zeitpunkt sein Kind nicht mehr in diese Klasse schicken und beurteilte den gesamten Unterricht sehr negativ).
Förderung von Selbständigkeit und Arbeitsdisziplin:
Bei dieser Unterrichtsdimension beurteilten die Eltern die Selbständigkeit ihrer Kinder durchwegs positiv.
Probleme aber hatten einige Eltern bei der Frage nach Ordnung und Disziplin bzw. bei der Fragestellung: "Ist es in der Klasse zu laut?"
Ich denke, daß der binnendifferenzierte Unterricht (u.a. Freie Arbeitsphase), wie er täglich in unterschiedlichen Phasen in der Klasse praktiziert wurde, in den Augen einiger Eltern dem äußeren Eindruck nach unstrukturierter, unübersichtlicher und mitunter auch unruhiger, lebhafter und geräuschvoller war, als ein straffgeführter Frontalunterricht.
Auch entsprach natürlich das äußere Erscheinungsbild eines binnendifferenzierten Unterrichts nicht den traditionellen Vorstellungen von einer "ordentlichen" Schule.
Aber es war aus der eher zurückhaltenden Anerkennung für die Unterrichtsdisziplin wohl keine große Besorgnis der Eltern zu erkennen.
Zusammenfassend ging aus den zwar nicht sehr zahlreich abgegebenen individuellen schriftlichen Stellungnahmen und den angekreuzten Meinungen hervor, daß etwa 30% der Eltern der nichtbehinderten Kinder das disziplinierte Lernen mehr beachtet wissen wollten. Auch war dieser Anteil von Eltern der Ansicht, daß ihre Kinder durchaus mehr gefordert werden sollten und daher mehr leisten würden.
Bemerkenswert war, daß kein Elternteil der Ansicht war, daß sein Kind durch den Unterricht der beiden Lehrer überfordert wurde.
Spezifische oder unterschiedliche Bewertungstendenzen von den Eltern der behinderten und nichtbehinderten Kinder gingen aus dieser Befragung nicht hervor.
Aus den persönlichen Gesprächen mit den Eltern der behinderten Kinder wurde deutlich, daß sie in allen Bereichen der Schule und des Unterrichts überaus zufrieden waren.
Dieser Teil des Fragebogens wurde von mir in einen allgemeinen und einen speziellen Teil gegliedert.
Allgemeine Fragen zur Entwicklung des Kindes:
In diesem Abschnitt habe ich versucht zu erfahren, welche Eindrücke die Eltern gesammelt hatten und wie sich ihr Kind entwickelt hat, seitdem es die Integrationsklasse besucht.
Wiederum in Anlehnung an die Hamburger Untersuchungen durch H. WOCKEN (1987) habe ich dabei fünf Faktoren unterschieden.
-
Der erste Faktor beinhaltete Fragen zur Lernfreude, zur Schulmotivation und zu den Lehrern. Ich habe ihn mit dem Begriff "Einstellung zur Schule" überschrieben.
-
Der zweite Faktor bezog sich auf Fragen, die sich nach den sozialen Beziehungen der Kinder untereinander erkundigten: das "Verhältnis zur Klasse".
-
Der dritte Faktor wurde durch Fragen konstituiert, die die "Zufriedenheit mit den Leistungen" zum Ausdruck brachten.
-
Das ''Verhältnis zu den behinderten Kindern" wurde durch nur eine Frage erfaßt.
-
Der fünfte Faktor "Anpassung der Anforderungen" sollte ermitteln, ob das eigene Kind sich nach dem Eindruck der Eltern angemessen herausgefordert fühlt oder sich eher langweilt.
Alle Eltern hatten das Gefühl, daß ihr Kind Vertrauen zu den Lehrern hat. Es gab keine Schwierigkeiten für die Kinder mit den Lehrern, und sie gingen durchwegs gerne in die Schule.
Dem Eindruck aller Eltern nach fühlten sich die Kinder in der Klasse sehr wohl und hatten auch untereinander guten Kontakt. Zwischen einzelnen Kindern gab es durchaus auch verschiedene Auseinandersetzungen. Diese wurden aber von den Eltern als natürliche Entwicklungsphasen angesehen.
Nur das völlig negativ eingestellte Elternpaar äußerte die Ansicht, daß durch die lernbehinderten und verhaltensgestörten Kinder Unruhe in die Klasse käme und die Folge davon vermehrte Raufereinen und Lärm seien.
Für die Lehrer besonders wichtig erschien mir aber ein Hinweis von 10 Elternpaaren, die meinten, daß ihre Kinder durchaus mehr leisten könnten.
Interessant war in diesem Zusammenhang, daß bei dem Punkt "Mein Kind fühlt sich im Unterricht eher unterfordert", kein Elternteil unter "stimmt völlig" eine Anmerkung machte, und nur drei Elternpaare die Rubrik "stimmt teilweise" ankreuzten.
Die große Mehrheit der Eltern hatte einen günstigen Eindruck von der Entwicklung ihres Kindes. Schwierigkeiten hatten einige Eltern bei der Leistungsmessung ihres Kindes, da der Vergleich durch Noten, Tests oder Diktate fehlte.
Spezielle Fragen zu den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht
Da Eltern die unterschiedlichsten Vorstellungen von den Leistungsanforderungen ihrer Kinder in den einzelnen Unterrichtsfächern haben, hatte ich versucht, aus folgenden Gegenständen ihre spezielle Meinung zu erfahren.
Deutsch - Lesen
-
Lesefertigkeit
-
Rechtschreibfähigkeit
-
Sprachlehre
-
Geschichtenverfassen
Mathematik
Sachunterricht
Andere Unterrichtsfächer
Zu den konkreten Unterrichtsfächern hatten die Eltern nur sehr wenige individuelle Stellungnahmen abgegeben.
Folgende Gründe könnten dafür vermutet werden:
-
-Die Eltern hatten zuwenig Kenntnisse über die Lehrplananforderungen, und daher war für sie eine Stellungnahme nicht möglich.
-
-Die Eltern hatten das Vertrauen in die Lehrer, daß ihre Kinder die jeweiligen Ziele der Klasse erreichen bzw. am Ende der vierten Schulstufe das Wissen und Können haben werden, um eine weiterführende Schule zu besuchen.
''Für integrative Schulen wird gemeinhin die Abschaffung von Zensuren und Ziffernzeugnissen gefordert Numerale Beurteilungen sind mit den Zielen gemeinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder nicht vereinbar.
Noten messen die Leistungen einzelner Kinder am sozialen Vergleich mit Leistungen einer Lerngruppe. Bessere Noten werden errungen, indem die Schüler miteinander in Wettbewerb treten und sich mit anderen messen.
Der Wettbewerb um gute Noten verhindert gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit in der Gruppe. Hilfsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit, zentrale Zielsetzungen integrativer Erziehung werden durch Notenkonkurrenz nicht gefördert, sondern behindert und desavouiert Ferner können die Umstände der Leistungserbringung, das Maß der Anstrengung und die Größe individueller Lernfortschritte bei der Notengebung keine Berücksichtigung finden. Der Aspektreichtum einer Leistung wird undifferenziert zu einer globalen Ziffer zusammengefaßt.
Demgegenüber vermögen verbale Schülerbeurteilungen die Intention integrativer Schulerziehung besser aufzunehmen und zu unterstützen. Verbale Beurteilungen ermöglichen, den einzelnen Schüler in den Blick zu nehmen und personenbezogen zu würdigen. Die maßgebende Norm verbaler Beurteilungen ist nicht mehr das fragwürdige Postulat "Gleiche Aufgaben für alle", sondern der einzelne Schüler selbst Es gilt zu beurteilen. ob der Schüler seine ihm ureigenen Möglichkeiten genutzt hat und jene Entwicklungsfortschritte gemacht hat die ihm möglich sind." (WOCKEN, 1987, S. 175).
Offiziell wurde in der Klasse ein Ziffernzeugnis an die Kinder ausgegeben, da aber die Lehrer jeweils eine zusätzliche inoffizielle verbale Beurteilung mitgaben, hatten die Eltern Gelegenheit, beide Beurteilungsarten zu vergleichen.
In der Abstimmung wurde deutlich erkennbar, daß den Eltern die verbale Beschreibung der Leistung ihrer Kinder gut gefiel und sie diese Art der Beschreibung weiterhin wünschen würden. Die Hälfte der Eltern meinte aber auch, daß ein Ziffernzeugnis und Noten solange erforderlich sein werden, als weiterführende Schulen diese Art der Beurteilung einsetzen.
''Die höhere pädagogische Qualität von Integrationsklassen ist für viele Eltern ein wichtiges Motiv ihrer Entscheidung für eine integrative schulische Förderung. Wahrend die Eltern behinderter Kinder mit einer besseren Grundschule insbesondere sozialerzieherische Vorstellungen verbinden. ist für Eltern nichtbehinderter Kinder auch Leistungsförderung ein unverzichtbares Element der neuen Grundschule. Gelegentlich finden sich gar Eltern. die sich von Integrationsklassen vor allem noch bessere Noten. noch bessere Zeugnisse und eine noch sicherere gymnasiale Empfehlung versprechen. Übersteigerte Leistungs- und Karriereerwartungen können aber eine integrative schulische Förderung empfindlich stören. Aus diesem Grund sind die Vorstellungen der Eltern zum erwarteten Schulabschluß ihres Kindes von Interesse." (WOCKEN, 1987, S. 177).
Zur Mitte des dritten Schuljahres erschien es doch verfrüht zu sein, den Eltern eine derartige Frage zu stellen, denn die Hälfte der Eltern hatte noch keine genaue Vorstellung über den Schulabschluß ihres eigenen Kindes.
Ich denke aber, daß Bildungshoffnungen und Schulerwartungen von fast allen Eltern wohl vom ersten Schultag an still erwogen, aber kaum offen ausgesprochen wurden.
Die direkte Frage nach schulischen Ambitionen stieß scheinbar auf ein Tabu und wurde von den Eltern ungern beantwortet.
Für die Lehrer, aber auch für die wissenschaftliche Begleitung wäre gerade dieser Aspekt der Schullaufbahn zu diesem Zeitpunkt wichtig gewesen, da schon jetzt konkrete Überlegungen und Planungen stattfinden hätten sollen, wie und wo der Schulversuch in der Sekundarstufe fortgesetzt wird.
Erfreulich war, daß praktisch alle Eltern weiterhin die Zusammensetzung der Klasse als gut ansahen, zumal die Eltern ja selbst diese Zusammensetzung zu Beginn der ersten Klasse vereinbart und ohne Schul- oder Lehrereinfluß sich zu dieser Gemeinschaft für ihre Kinder entschlossen hatten.
17 Elternpaare antworteten auf die Frage nach der "Allgemeinen Zufriedenheit mit dem Schulversuch", daß sie sehr zufrieden sind.
Ein Elternteil äußerte sich "zufrieden" und ein Elternpaar hatte doch erhebliche Probleme ("Mit dem Versuch sind wir einverstanden -mit dem Ergebnis eher unzufrieden.").
17 Elternpaare würden ihr Kind wieder in diese Klasse schicken. Ein Elternpaar müßte es sich noch einmal überlegen, und eine Mutter würde ihr Kind unter gar keinen Umständen mehr in diese Klasse geben.
Ich denke, daß die Ergebnisse dieser Elternbefragung als durchwegs positiv angesehen werden konnten.
Auch vermittelte das Ergebnis der Befragung dem gesamten Team -aber vor allem den beiden Lehrern - eine Bestätigung ihres Weges zu dem Ziel einer gemeinsamen, kindgerechten, humanen und demokratischen Schule für alle Kinder.
Nach über zwei Jahren wird der Schulversuch doch zum überwiegenden Teil von der Zustimmung und dem Vertrauen der Eltern getragen, die dem Schulversuch zustimmten und ihn wollten, indem sie ihr Kind in diese Klasse schickten.
Neben den positiven Aussagen waren aber besonders die kritischen Stimmen vor allem eines Elternteiles sehr ernst zu nehmen, u.a. auch deshalb, da gerade die Eltern als Evaluatoren dem Schulversuch ihren Stempel aufdrückten.
In aller Klarheit und Nüchternheit war auch auf die zum Teil vorsichtigen Stimmen von Eltern zu hören und darauf zu reagieren, die meinten, daß ihre Kinder durchaus mehr gefordert hätten werden können, die auch Probleme hatten, die Leistungen ihrer Kinder durch veränderte Beurteilungskriterien mit anderen Kindern zu vergleichen.
Faßt man die Ergebnisse der Untersuchung bzw. Befragung durch allgemeine und generalisierende Merkmale zusammen, so ergaben sie folgendes Bild:
Die Eltern der Integrationsklasse waren in einem sehr hohen Maße mit der Praxis der schulischen Integration zufrieden. Sie hatten auch fast durchwegs einen positiven Eindruck von der Entwicklung ihres Kindes und dazu eine hohe Meinung von der pädagogischen Qualität des Unterrichts. Die Art des Unterrichts und die der pädagogischen Praxis konnte aus der Sicht der Eltern im großen und ganzen so bleiben wie sie war, auch wenn innerhalb der Elternschaft zu erkennen war, daß sehr wohl die meisten Eltern sich durch den integrativen Unterricht eine optimale Förderung der schulischen Leistungen erwarteten.
Eine Gruppe von Eltern sah aber durch eine zu starke Leistungs- und Wettbewerbsorientierung die sozialintegrativen Zielsetzungen gefährdet.
Die Eltern waren auch fast ausnahmslos bereit, ihr Kind wieder in eine Integrationsklasse zu geben.
Das hohe Maß an Zufriedenheit war sicherlich einerseits durch die freiwillige Teilnahme der Eltern am Schulversuch zu erklären, zum anderen bestand wohl weiterhin ein großes Vertrauen, ja eher ein freundschaftliches Verhältnis zwischen der Mehrzahl der Eltern und den beiden Lehrern.
Doch deutlich sichtbar wurde in der Befragung, daß Leistung und soziales Lernen -den Eltern zufolge - in einem spannungsreichen Verhältnis stehen.
Das Begriffspaar Leistung und Integration bezeichnet anscheinend doch einen pädagogischen Grundkonflikt.
Für die beiden Lehrer der Klasse bedeutete die Bearbeitung dieses Grundkonfliktes zwischen pädagogischer Theorie und pädagogischer Praxis eine große Herausforderung, und es bedurfte gründlicher Überlegungen und nachhaltiger Anstrengungen, die beiden Ziele - Leistung und Integration - gleichzeitig und ausgewogen zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund wurde eine verstärkte Information und Einbindung der Eltern in den Unterricht und in alle schulischen Aktivitäten immer wichtiger und bedeutsamer.
Als Eltern hat man zwar einen begrenzten Einblick in den Unterricht, aber trotzdem bildet man sich natürlich aus Begegnungen mit den Lehrern, aus Gesprächen mit anderen Eltern und aus Erzählungen des eigenen Kindes eine Meinung über den Unterricht in der Integrationsklasse. Wir haben eine Reihe von allgemeinen und speziellen Meinungen über den Unterricht zusammengestellt. Kreuzen Sie bitte an, ob Sie mit der angeführten Meinung völlig, teilweise oder gar nicht übereinstimmen.
Integrative Qualität des Unterrichtes:
Ich bin der Meinung, daß auf individuelle Interessen und Probleme der Kinder eingegangen wird.
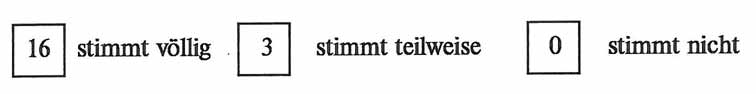
Ich bin der Meinung, daß Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft der Kinder zueinander gefördert wird.
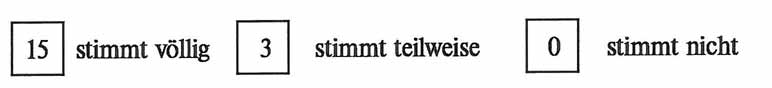
Ich bin der Meinung, daß das gegenseitige Verständnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern genügend gefördert wird.
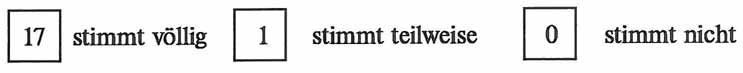
Individuelle Stellungnahme:
-
"Das Problem vom gegenseitigen Verständnis haben nur die Erwachsenen, die Kinder verstehen sich gut"
-
"Das Verhältnis der Kinder zueinander ist genauso gut oder schlecht wie in einer "normalen" Klasse."
-
''Die beiden Lehrer bemühen sich sehr, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Ihre Unterrichtsarbeit ist sehr erfolgreich, sie haben unsere volle Unterstützung!"
Förderung der behinderten Kinder:
Ich bin der Meinung, daß die Lehrer die behinderten Kinder genügend fördern.
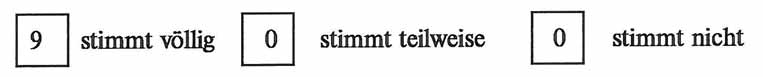
Ich bin der Meinung, daß die behinderten Kinder im Unterricht zu kurz kommen.
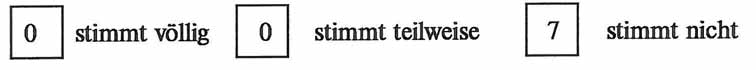
Individuelle Stellungnahme:
-
"Kann ich nicht beurteilen!"
-
"Können wir als Eltern eines nichtbehinderten Kindes nicht beurteilen."
-
"Dieser Punkt entzieht sich meiner Kenntnis."
-
"Können wir nicht wissen; notwendiger Einblick in das Unterrichtsgeschehen ist für die Beantwortung zu dürftig."
Förderung der nichtbehinderten Kinder:
Ich bin der Meinung, daß genügend Leistung von den Kindern verlangt wird.
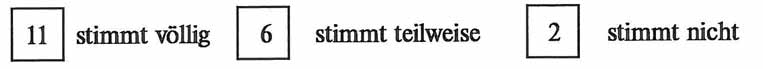
Ich bin der Meinung, daß die Lehrer die nichtbehinderten Kinder ausreichend fördern.
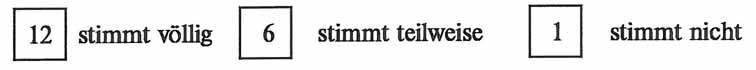
Ich bin der Meinung, daß genügend Hausaufgaben aufgegeben werden.
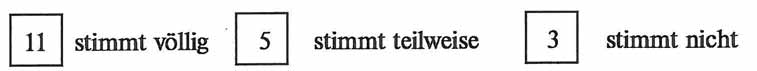
Ich bin der Meinung, daß im Unterricht zuviel Zeit vertrödelt und verspielt wird.
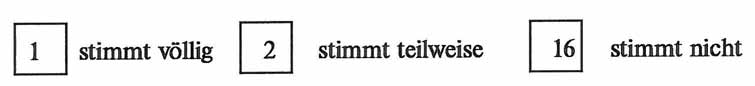
Individuelle Stellungnahme:
-
"Ein bißchen mehr Druck könnten alle Kinder meiner Meinung nach ruhig vertragen."
-
"Aufgaben sollten regelmäßiger gegeben werden."
-
"Die letzten beiden Fragen kann ich nicht beantworten."
-
''Von Vertrödeln kann keine Rede sein, wenn die Kinder die Möglichkeit zur freien Entfaltung von Kreativität und Phantasie haben!"
-
"(Meine Meinung hat nichts mit der integrativen Klasse zu tun) Ich glaube, mein Kind kann, ohne überfordert zu werden, mehr leisten; Hausübungen festigen das am Vormittag Gelernte; zu Hause kann das Kind den Stoff nochmal in Ruhe durcharbeiten. Ich glaube manchmal, mein Kind kann das Gelernte nicht, weil die Übung teilweise fehlt; ich bin aber nicht dafür, daß Kinder am Nachmittag stundenlang bei der Hausübung sitzen; ich weiß, 4 - 5 Stunden am Vormittag sind sehr anstrengend, sie brauchen den Nachmittag auch zum Spielen u.a"
-
''Von den guten und durchschnittlichen Schülern wird zuwenig gefordert. Statt der Freien Arbeit könnte das erworbene Wissen vertieft werden (Übungen etc.)."
Förderung von Selbständigkeit und Arbeitsdisziplin:
Ich bin der Meinung, daß die Selbständigkeit der Kinder ausreichend gefördert wird.
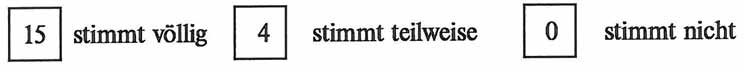
Ich bin der Meinung, daß genügend Wert auf Ordnung und Disziplin gelegt wird.
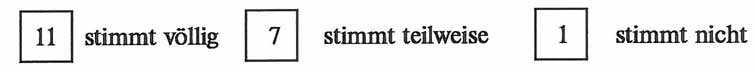
Ich bin der Meinung, daß die Kinder eine gute Arbeitshaltung erworben haben.
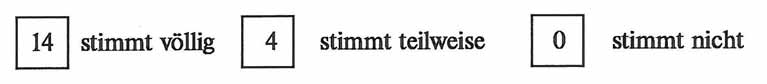
Ich bin der Meinung, daß es in der Klasse zu laut ist.
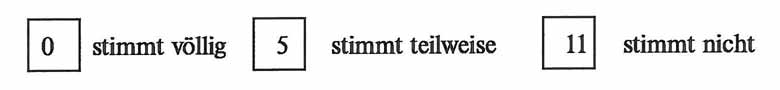
Individuelle Stellungnahme:
-
"Arbeitsdisziplin fehlt meiner Tochter total Ordnung läßt sehr zu wünschen übrig. Über Lautstärke in der Klasse klagt sie des öfteren."
-
"Gutes Training der Konzentrationsfähigkeit für die Zukunft."
-
"Ich bin begeistert von der "Freien Arbeit", ich finde, sie trägt, um selbständig zu werden, viel bei; Ordnung: Die Hefte sollen immer wieder angeschaut werden. Ich sagte z.B. zu meinem Kind: "Mache bitte die falschen Rechenaufgaben noch einmal" - Antwort: ''Nein, der Lehrer schaut sowieso nicht nach." Arbeitshaltung: Beziehe ich auf Hausübungen."
Sie haben sicherlich viele Eindrücke gesammelt, wie sich Ihr Kind entwickelt hat, seitdem es in einer Integrationsklasse ist. Wir haben hier eine Reihe von möglichen Eindrücken zusammengestellt. Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit dem angegebenen Eindruck völlig, teilweise oder gar nicht übereinstimmen.
Einstellung zur Schule:
Mein Kind hat Vertrauen zu den Lehrern.
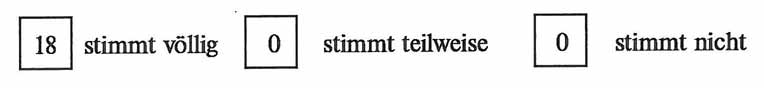
Mein Kind geht nicht so gerne in die Schule.
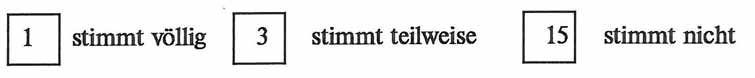
Mein Kind hat häufiger Schwierigkeiten mit den Lehrern.
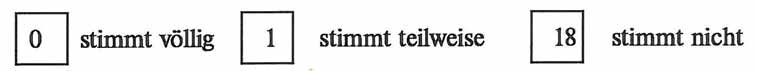
Mein Kind schimpft beim Mittagessen über die blöde Schule.
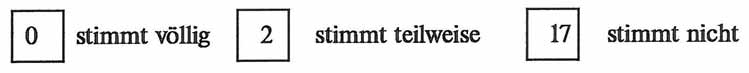
Mein Kind macht gerne seine Hausaufgaben.
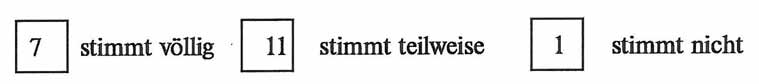
Individuelle Stellungnahme:
-
"Meine Tochter sagt immer wieder, es sei ihr sehr1angwei1ig."
-
"Mein Kind macht seine Hausübungen nicht gerne, weil es nicht gewohnt ist, zu Hause zu arbeiten; mein Kind sagt schnell: ''Viel zu viel, blöde Hausübung u.v.a."
-
"In einer normalen Klasse wäre das genauso."
Verhältnis zur Klasse:
Mein Kind fühlt sich in der Klasse sehr wohl.
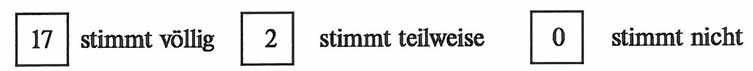
Mein Kind hat guten Kontakt zu den anderen Kindern.
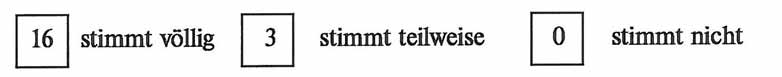
Mein Kind hat häufig Streit mit den anderen Kindern.
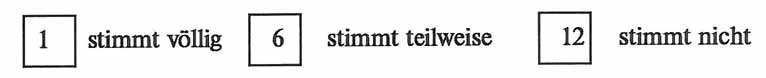
Mein Kind beklagt sich häufiger über die Mitschüler.
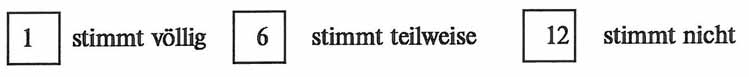
Individuelle Stellungnahme:
-
"Sie hat immer wieder Anpassungsschwierigkeiten."
-
"Die lernbehinderten und verhaltensgestörten Kinder bringen eine gewisse Unruhe in die Klasse - vermehrte Raufereien und Lärm sind die Folge. Wahrscheinlich gibt es aber auch in jeder normalen Klasse mehr oder weniger "laute und unruhige" Kinder."
Zufriedenheit mit den Leistungen:
Mein Kind leistet weniger als es leisten könnte.
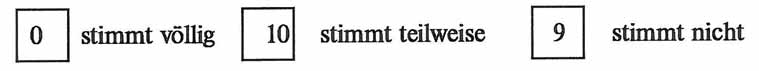
Mein Kind erbringt recht gute Leistungen im Rahmen seiner Möglichkeiten.
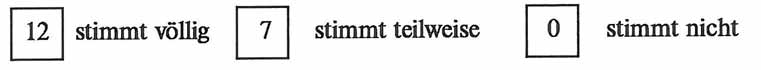
Individuelle Stellungnahme:
-
''Wie kann ich den Ehrgeiz fördern? Mehr Lob und Belohnung -auch seitens der Lehrpersonen!?"
-
"Im Vergleich zu den Geschwistern in diesem Alter ist das Kind leistungsmäßig zurück."
-
"Ich beziehe "stimmt teilweise" wiederum auf die Hausübungen. Was die Kinder in der Schule machen und wie, finde ich sehr gut. Für mich ist wichtig, daß die Kinder auch können, was sie lernen. Selbständige Übungen zu Hause finde ich sehr wichtig."
-
"Die Eltern sind zuwenig über die Leistungen informiert, da es kaum Leistungskontrollen (Tests, Ansagen) gibt."
Verhältnis zu den behinderten Kindern:
Mein Kind hat guten Kontakt zu den behinderten Kindern.
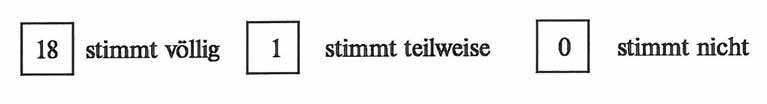
Individuelle Stellungnahme:
-
"Behinderte sollen unbedingt integriert werden - im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz -, nur so kommt ein gutes Verhältnis zu allen Menschen zustande."
Anpassung der Anforderungen:
Mein Kind fühlt sich im Unterricht eher unterfordert.
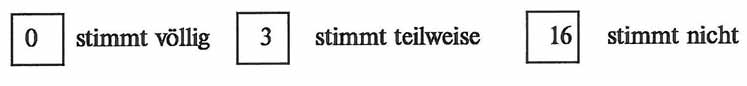
Mein Kind findet den Unterricht ziemlich langweilig.
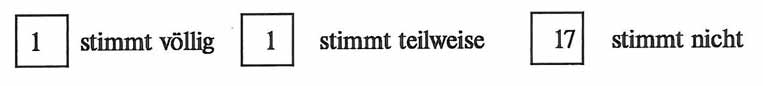
Individuelle Stellungnahme:
-
"Eventuell spricht der Lehrer mit meiner Tochter, was sie unter langweilig versteht!"
-
"Ein Kind mit 8 oder 9 Jahren kann leider noch nicht entscheiden, ob es über- oder unterfordert ist. Durch die Gruppenarbeit ist auch eine objektive Beurteilung in Bezug auf die ganze Klasse nicht gut möglich."
Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen der Eltern über die Leistungsanforderungen an ihre Kinder, besonders in den Fächern Mathematik, Deutsch und im Sachunterricht. Wir haben versucht, durch eine Reihe von Fragen Ihre spezielle Meinung zu erfahren. Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie der Meinung sind, daß Ihr Kind zu wenig, ausgewogen oder zu viel gefordert wird.
Deutsch - Lesen:
Ich bin der Meinung, daß mein Kind in der Lesefertigkeit

gefordert wird.
Ich bin der Meinung, daß mein Kind in der Rechtschreibfähigkeit

gefordert wird.
Ich bin der Meinung, daß mein Kind in der Sprachlehre

gefordert wird.
Ich bin der Meinung, daß mein Kind im Geschichtenverfassen

gefordert wird.
Individuelle Stellungnahme:
-
"Mein Kind mag nicht gerne lesen, vielleicht können die Lehrer Kinder motivieren, daß sie auch zu Hause ab und zu lesen - Hefte von der Schule mitgeben u.a. Die Kinder schreiben in der Schule viele Geschichten, dürfen dazu zeichnen - das gefällt mir sehr gut, finde ich besser als Diktate oder Texte abschreiben."
-
"Durch die wenigen Hausaufgaben fehlt die Vertiefung in der Rechtschreibung. Die Kinder werden in der Schule zuwenig zu freiwilligen oder zusätzlichen Übungen zu Hause motiviert."
Mathematik
Ich bin der Meinung, daß mein Kind in Mathematik

gefordert wird.
Individuelle Stellungnahme:
-
"Meiner Meinung nach muß man Rechnen üben, damit es schneller und leichter geht - seit mein Kind mehr Hausübungen in Rechnen hat, kann es besser rechnen und gleichzeitig macht ihm Rechnen jetzt mehr Spaß, weil es nicht mehr so mühsam ist."
Sachunterricht:
Ich bin der Meinung, daß mein Kind im Sachunterricht
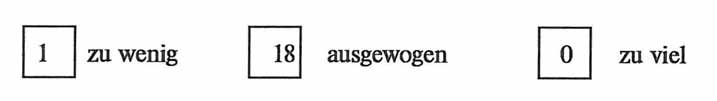
gefordert wird.
Individuelle Stellungnahme:
-
"Kann mangels Information nicht beantwortet werden!"
Anderere Unterrichtsfächer:
Ich bin der Meinung, daß mein Kind in einem anderen Unterrichtsfach (Musik, Bildnerische Erziehung, Leibesübungen u.a)
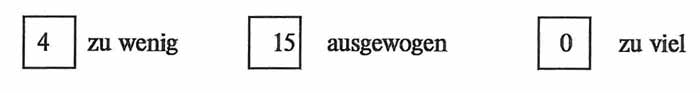
gefordert wird.
Individuelle Stellungnahme:
-
"Mein Kind singt gerne und würde es gerne öfter tun."
-
"Unser Sohn möchte mehr Instrumente spielen."
-
"Mir gefallen die Arbeiten, die in Bildnerischer Erziehung entstehen, sehr gut oder die Arbeiten in Werken. Mir gefällt, daß die Kinder alles selber machen dürfen und eigene Ideen verwirklichen können."
Für integrative Schulen und Klassen wird die Abschaffung von Zensuren und Ziffernzeugnissen gefordert. Numerale Beurteilungen sind mit den Zielen gemeinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder nicht vereinbar. Bitte kreuzen Sie an, welche Meinung Sie dazu vertreten.
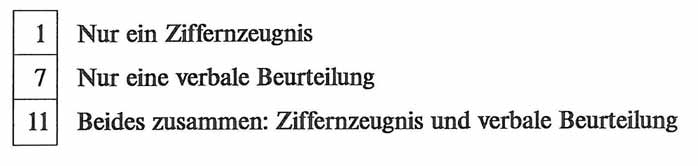
Individuelle Stellungnahme:
-
"Ist ein Aufstieg ohne Ziffernzeugnis in die nächsthöhere Schu1e überhaupt möglich?"
-
''Verbal o.k., wenn alle weiteren Schulstufen auch."
-
"Noten sind immer ungerecht, mit Worten kann man genauso sagen, du mußt fleißiger sein oder mit dir bin ich sehr zufrieden, usw."
-
"Eine nur verbale Beurteilung ist ein Nachteil für den weiteren Schulbesuch, da es hier ja nur Noten gibt. Außerdem sollen die Kinder von Anfang an lernen, auch schlechte Noten zu akzeptieren. Das kann oft auch ein Ansporn zur Verbesserung sein."
-
"Frage: Warum schließen sich numerale Beurteilung und integrativer Unterricht aus? Ich bin für die Integration Behinderter, glaube aber nicht, daß man deswegen überhaupt alles in Frage stellen muß! Grundsätzliche bildungspolitische Reformgedanken muß man doch nicht unbedingt über den Weg der "Integration" ins Spiel bringen. Es gibt in unserem "veralteten" Schulsystem sicher auch einiges, was man beibehalten kann. Ist Integration wirklich nur möglich, wenn alles Traditionelle entfernt ist? Erziehungswissenschaftler sind sicherlich dieser Meinung - ich nicht. Man sollte sich verändern, muß aber nicht alles "verdammen". Die Ziffembeurtei1ung ist für mich wirklich nicht so wichtig, aber anscheinend der "Aufhänger" für schulische Erneuerung. Dabei kann die verbale Beurteilung - ich spreche hier mehr von der Hauptschu1e - genauso nichtssagend sein! Man sucht nach Floskeln - weil einem nichts mehr einfällt -, die nichtssagende Allgemeingültigkeit besitzen ("gute Mitarbeit", "ist recht interessiert" etc.). Kein Wunder, wenn man in Gegenständen wie ME, BE etc. als "normaler" Lehrer nur 1 und 2 geben würde. Besteht hier wirklich ein so großer Unterschied zwischen Ziffernbeurteilung und verbaler Beurteilung? Wie gesagt, ich sehe dies mehr aus der Sicht der Hauptschule her. In der VS kann ich mir sowieso viele Dinge anders vorstellen. Alles in allem: Integration gefällt mir, Integration ist möglich und kein Problem, wenn Lehrer fähig sind, miteinander zu arbeiten! Um integrativ zu arbeiten. muß man sicherlich ab und zu neue Wege und Mittel finden, man muß aber nicht alles in Frage stellen! Diese Ausführungen beziehen sich nicht auf die Arbeit in der sozialintegrativen Klasse in der VS Reutte. Die Lehrpersonen, die dort tätig sind, haben meine volle Unterstützung. Es handelt sich um meine generelle Ansicht zu diesem Thema, allerdings in aller Eile zusammengestellt."
Welchen Schulabschluß sollte Ihr Kind nach Ihren Vorstellungen einmal erreichen? Bitte kreuzen Sie an:
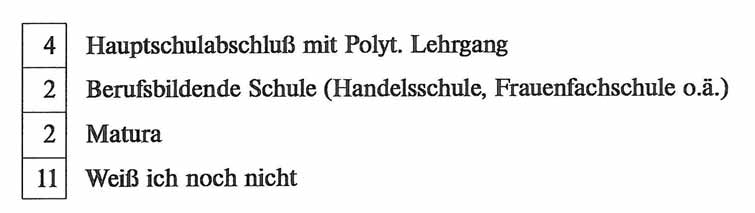
Individuelle Stellungnahme:
-
''Nach Wunsch und Möglichkeiten meines Kindes."
Sind Sie mit der Zusammensetzung der Kindergruppe Ihrer Integrationsklasse zufrieden? Bitte kreuzen Sie an:
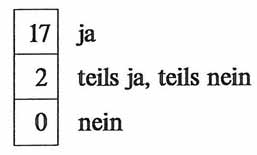
Individuelle Stellungnahme:
-
"Man kann sich auch sonst seine Klassenkameraden nicht aussuchen. Die Kinder müssen lernen, mit allen zurechtzukommen."
Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der Integration behinderter und nichtbehinderter Kinder? Bitte kreuzen Sie an:
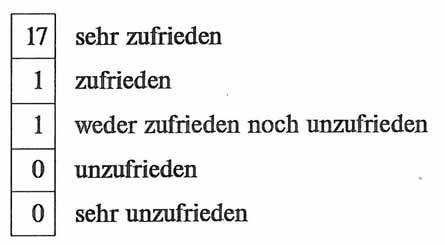
Individuelle Stellungnahme:
-
"Ein großes Lob den beiden Lehrern, sie können ausgesprochen gut mit Kindern umgehen."
-
"Was soll schlecht daran sein, wenn behinderte Mitmenschen nicht als Außenseiter, sondern als gleichberechtigte Partner (Mitbürger) akzeptiert werden! Die Integration gehört in jeder weiterbildenden und berufsbildenden Schule eingeführt."
-
"Behinderte Kinder sollen wie nichtbehinderte Kinder in ihrem Wohnort zur Schule gehen, am Nachmittag mit Nachbarkindern spielen dürfen, nicht abgeschoben im Heim leben - traurig bei jedem Abschied von den Eltern und Geschwistern u.a. Das Arbeiten in der integrativen Klasse kostet sicher mehr Zeit und Einsatz, aber mit der Zeit, wenn mehrere Klassen behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichten, können Lehrer Erfahrungen austauschen - ich denke, mit jedem Jahr wird die Arbeit leichter."
-
"Mit dem Versuch sind wir einverstanden - mit dem Ergebnis eher unzufrieden. Für schwächere Schüler ist die Klasse ein Vorteil. Gute und durchschnittliche Schüler werden weniger gefördert"
Wenn Sie von Freunden, Bekannten, Kollegen, Nachbarn usw. gefragt würden, ob Sie Ihr Kind wieder in eine Klasse mit behinderten und nichtbehinderten Kindern schicken würden, was wäre dann Ihre Antwort? Bitte kreuzen Sie an:
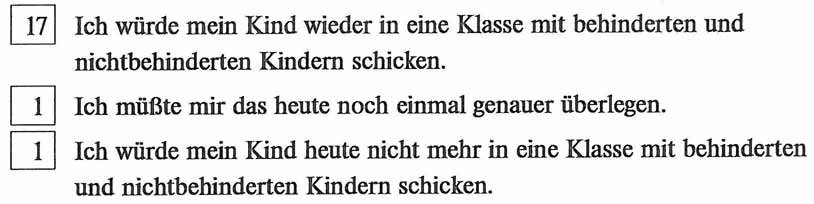
Individuelle Stellungnahme:
-
"Das Duzen der Lehrpersonen ist das Einzige, was mir wirklich gar nicht gefällt. Vielleicht bin ich zu altmodisch."
-
"Ich würde es jedem empfehlen."
-
"Der integrative Schulversuch läuft auch im nunmehr dritten Jahr mit einer unauffälligen Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit (wobei uns als Eltern eines "nichtbehinderten" Kindes keine Beurteilung über die Förderung "behinderter" Kinder zusteht). Aus Kontakten mit Eltern anderer Klassenkameraden unseres Kindes (Elternabende, Gespräche) kann aber leider abgeleitet werden, daß einige Elternpaare Zweifel an der gewählten Unterrichtsmethode (individuelle Förderung, Freie Arbeit, Motivation ohne Leistungsdruck und Wettbewerb), nicht jedoch am gemeinsamen Unterricht, haben. Offensichtlich und leider werden dabei nicht die enormen Vorteile für Erziehung und Entwicklung der Kinder berücksichtigt, sondern Vergleiche mit herkömmlichen Unterrichtsmethoden gesucht. Selbstverständlich kann man als Eltern immer höhere und weitere Lernziele für sein Kind anstreben, doch auch hier können wir aufgrund unserer Erfahrungen berichten, daß durch das ausgezeichnete Gesprächsklima und die Gesprächsbereitschaft der beiden Lehrer eine Feinabstimmung Schule - Eltern jederzeit möglich ist."
-
''Wir können keinen Grund nennen, der gegen die integrative Klasse spricht. Wir möchten, wenn es irgendwie geht, daß alle behinderten Kinder gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern unterrichtet werden."
-
"Durch die lockere Unterrichtsform haben die Kinder in der HS oder im Gymnasium bestimmt mehr Probleme bei der Umstellung. Prüfungen, Noten und Kritik sind für diese dann mehr oder weniger Neuland. Gegen behinderte Kinder in einer Klasse ist aber nichts einzuwenden."
Nach 4 Jahren integrativen Unterrichts stellte sich für mich die Frage:
Wie beurteilen die Eltern aus ihrer Sicht und Erfahrung den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder?
Eltern, die unter dem Druck unserer so sehr leistungsorientierten Gesellschaft - einer drohenden Arbeitslosigkeit - und durch die hochqualifizierten Leistungsanforderungen im Beruf rasche und kontrollierbare und damit vergleichbare Leistungen erwarteten.
Eltern, die gleichzeitig aber erkannten, daß die kognitiven Lernleistungen ihrer Kinder ohne die Entwicklung des sozialen und emotionalen Umfeldes labil und einseitig bleiben, ja evtl. im Berufsleben und in weiteren Phasen ihrer lebensgeschichtlichen Entwicklung sich als nicht mehr korrigierbar oder "reparabel" herausstellen.
In den bisherigen Befragungen und Gesprächen mit den Eltern kam ich zu ähnlichen Schlußfolgerungen, die auch FEUSER (1987, S. 204) als Resümee seiner Elternbefragung zieht:
"Insgesamt kann ich auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen feststellen, daß das Interesse von Eltern bei der Diskussion um Fragen der Integration, primär um die Sorge ausreichender leistungsmäßiger Förderung und um hinreichende Leistungssteigerungen im Unterricht zentriert ist. Dieses kann unsererseits nicht ohne Sorge zur Kenntnis genommen werden, wenngleich festzustellen ist, daß gerade diese Sorge der Eltern die bestehende gesellschaftliche Realität, die Norm- und Bewertungsmaßstäbe und die Chancen ihrer Kinder bis hin zur beruflichen Etablierung exakt widerspiegeln.
Solange die Verhältnisse und ihre impliziten Normen so sind und durch ein auf Auslese und relativ ausschließliche Leistungsoptimierung ausgerichtetes Schulsystem abgesichert werden, sind die Sorgen der Eltern erst einmal berechtigt und nicht nur als ein Versuch des Erhaltens der Aussonderungspraxis gegenüber behinderten Kindern und Jugendlichen zu bewerten.. Die Veränderungen von Einstellungen, Bewertungs- und Beurteilungskriterien sind lang andauernde und nur in Solidarität miteinander bewältigbare Lernprozesse.
Hier haben sicherlich in der Integrationspraxis erfahrene Fachleute, aber auch die integrationserfahrenen Eltern noch eine weitreichende Aufgabe vor sich, die nur gemeinsam und von vielen Seiten her bewältigt werden kann."
Zur Methode:
Als Untersuchungsmethode habe ich für diese dritte Befragung das strukturierte Interview gewählt. "Zur Ermittlung verbalisierbarer subjektiver Tatbestände ist sie auch das angemessene Verfahren." (MAYNTZ/HOLM/HÜBNER, 1978, S. 103). Das betrifft vor allem sogenannte Meinungsfragen. "Hierzu gehören Fragen nach Meinungen und Werturteilen über objektive Tatbestände, nach Einstellungen, Wünschen, Gefühlen, Motiven und Normen des individuellen Verhaltens." (Ebd.).
Die Befragung habe ich als 21 Einzelinterviews durchgeführt, wobei die Fragen und die Stellungnahmen der Befragten - nach deren Einverständnis - mittels eines Kassettenrecorders auf Tonband aufgezeichnet wurden.
Etwa bei der Hälfte aller Interviews waren beide Elternteile anwesend, ansonsten jeweils nur die Mütter.
Bei der Erstellung des Fragebogens versuchte ich, in Abstimmung mit den beiden Lehrern von einerseits allgemein gehaltenen und andererseits zentralen integrationspädagogischen Fragen auszugehen.
Als Leitfaden für die Gespräche habe ich folgenden Fragenkatalog angelegt:
-
Würden Sie Ihr Kind wieder in eine Integrationsklasse schicken? Was war für Sie besonders positiv / negativ?
-
Wurde Ihrer Ansicht nach von Ihrem Kind genügend Leistung verlangt? Wurde Ihr Kind aus Ihrer Sicht bestmöglich individuell, also seinen Fähigkeiten entsprechend, gefördert?
-
Ist Ihr Kind gerne in die Schule gegangen?
-
Wie beurteilen Sie den Unterricht in der Klasse z.B. die Freiarbeit, den Projektunterricht u.a.?
-
Wurde die Selbständigkeit Ihres Kindes genügend gefördert? Hat es gelernt, eigenständig zu handeln und Aufgaben zu lösen?
-
Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden Lehrern? Zwei Lehrer in der Klasse - ein Problem?
-
Waren Sie Ihrer Meinung nach als Eltern genügend in Schulfragen und damit verbundenen Entscheidungen eingebunden?
-
Gab es aus Ihrer Sicht Probleme zwischen den Kindern? Waren die Kinder mit Behinderungen ein Problem?
-
Waren aus Ihrer Sicht alle 4 Jahre gleich?
-
Welche Art der Beurteilung hätten Sie für Ihr Kind am liebsten gehabt?
-
War die Thematik der Hausübungen für Sie ein Problem?
Nachdem alle Eltern zu einem Interview bereit waren und sich außerdem dazu bereit erklärten, ihre Aussagen auf ein Tonband aufzeichnen zu lassen, konnte ich zunächst ·davon ausgehen, daß dieser Schulversuch allen Eltern, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven, auch nach 4 Jahren ein noch wichtiges Anliegen war.
Da von den 21 Elternpaaren 19 ihr Kind wieder in diese Klasse geschickt hätten (einschließlich der 3 Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und der Kinder mit fremder Muttersprache), aber 2 Elternpaare einen nochmaligen Besuch ihres Kindes in einer Integrationsklasse ablehnten, habe ich in der Folge die Stellungnahmen und Kernaussagen dieser 19 Elternpaare, die ihr Kind wieder in eine Integrationsklasse schicken würden, unter den vorgegebenen 11 Fragenkomplexen zusammengefaßt.
Daß zwei Elternpaare ihr Kind nicht mehr in eine Integrationsklasse schicken wollten, war mir aus den persönlichen Gesprächen der beiden Mütter mit den Lehrern bekannt.
Gerade ihre Argumente aber sind sehr ernst zu nehmen und für eine weitere integrative Unterrichtsarbeit zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund und zum besseren Verständnis stelle ich die beiden ablehnenden Stellungnahmen ungekürzt und in ihrem Orginalwortlaut den positiven Aussagen gegenüber.
-
Würden Sie Ihr Kind wieder in eine Integrationsklasse schicken? Was war für Sie besonders positiv / negativ?
Mit der ersten Frage sollte zunächst nur die grundsätzliche Haltung der Eltern in Erfahrung gebracht werden, da sich daraus der weitere Fragenablauf entsprechend aufbaute.
Daß 19 Elternpaare oder Mütter nach Ablauf der vier Schuljahre ihr Kind wieder in eine Integrationsklasse schicken würden, konnte doch als überaus positiv, nicht nur für die Integration allgemein, sondern vor allem für die persönliche Unterrichtsarbeit der beiden Lehrer angesehen werden.
Von diesen 19 Elternpaaren waren 18 ganz begeistert und ohne Einschränkung von der Richtigkeit ihrer Entscheidung überzeugt.
Besonders bemerkenswert war die Situation für ein Elternpaar, dessen Kind nach Aussage und Gutachten der Schulpsychologin eine Sonderschule hätte besuchen müssen, aber als ein Schüler ohne sonderpädagogischem Status die Volksschulzeit erfolgreich beendete.
Elternaussagen:
"Ich würde so eine Klasse allen Eltern empfehlen."
"Diese Klasse und der Unterricht der beiden Lehrer waren noch besser, als ich es mir vorher vorgestellt hatte."
"Ja, aber ich würde doch wieder darauf achten, welche Lehrer mein Kind hat
und welches Unterrichtsprogramm sie machen. Aber es muß zur Selbstverständlichkeit werden, daß behinderte und nichtbehinderte Kinder zusammen zur Schule gehen und in einer Klasse sind."
"Ich habe es bisher allen Eltern empfohlen."
"Ja, es haben mich viele Eltern angesprochen, die mit ihrem Kind Probleme hatten."
''Ich hatte mich zuvor sehr genau um die Integration zu informieren versucht, es wurde aber weit übertroffen."
''Im Kindergarten hatte man mich schon darauf aufmerksam gemacht, daß unser Kind so verschlossen sei - so verträumt. Kaum in der Schule, begann sie zu erzählen. Sie wurde immer aufgeschlossener, aber auch einfühlsamer anderen gegenüber."
''Mir hat die gesamte Idee - das Konzept gefallen. Ich würde es immer wieder, immer wieder machen."
''Ich wollte meinem Kind die Möglichkeit eröffnen, es erleben zu dürfen, auch einem schwächeren Kind zu helfen."
''Ist es nicht wunderbar, einem Kind 4 schöne Jahre geben zu können, und die hatten sie, wo die Welt heute schon so hart ist?"
''In einer Klasse, in die die Kinder gerne gehen, in der sie es einfach besser haben, können sie eben auch besser und mehrlernen."
"Schon aus Menschlichkeit würde ich es allen Eltern für ihre Kinder empfehlen."
"Ja, denn behinderte und nichtbehinderte Kinder in einer Klasse ist und muß eine Selbstverständlichkeit sein. Es war für mich besonders positiv, daß die Kinder gelernt haben, daß alle Menschen in irgendeiner Form Probleme haben. Sie haben dies in der Schule selbst nun erfahren dürfen."
''Es gibt nichts Negatives. Ja, sofort wieder."
"Ja, selbstverständlich! Es gab für uns und das Kind über all die vier Jahre nie ein Problem. Sie haben viele Dinge nebenbei gelernt, die es in einer "normalen" Klasse nicht gibt"
"Ja, ich würde auf alle Fälle dazu raten. Für mich war besonders positiv, daß die Kinder angstfrei und fast spielerisch Schule erlebt haben."
''Für mich waren in der 4. Klasse die Schularbeiten und Diktate negativ."
''Es war eigentlich alles positiv. Sofort wieder in diese Klasse."
''Man müßte für jedes einzelne Kind unterscheiden, ob es überhaupt möglich ist, es zu integrieren. Soziale Integration selbstverständlich, aber ich denke, daß es im schulischen Bereich doch schwieriger wird."
"Grundsätzlich ja, für unser Kind war diese Klasse gut, auch wenn ich glaube, daß unser Bub noch mehr gefordert hätte werden können."
"Also die Integrationsklasse war sehr gut, sofort wieder. Es war wichtig, ihn aus der Sonderschule zu holen, damit er mit anderen Kindern zusammenkommt. Er hat große Fortschritte gemacht."
''Ich habe zu jedem gesagt "Schicke dein Kind in eine Integrationsklasse!" Es waren nur positive Erfahrungen, z.B. das Lernsystem, die Gemeinschaft, alles so frei, offen und ohne Angst. Ich war einmal einfach so in der Klasse, und da hat kein Lehrer gesagt "Ruhe" oder "auf den Platz", und doch war es in der Klasse nicht laut Super war die Gemeinschaft. Es gibt nichts Negatives!"
''Ich bin und war voll zufrieden. Ich fand es ganz toll - ohne Bedenken würde ich mein Kind wieder in diese Klasse geben."
''Wenn es die Klasse nicht gegeben hätte, wäre unser Sohn auf der Strecke geblieben. Ich glaube, er hatte ganz, ganz großes Glück, daß es gerade für ihn diese Klasse gab. Mein Mann war zwar immer der Meinung, daß er nur mehr Druck und Strenge gebraucht hätte, aber ich weiß, daß es nicht so ist"
''Was uns so erstaunt hat, war, daß unsere Tochter andere tröstet und hilft, wo
wir immer geglaubt haben. daß sie Hilfe und Trost braucht. Also das war für uns Eltern schon eine tolle und wertvolle Erfahrung über unser Kind. Sie sorgt sich um andere Kinder - das war einfach so schön."
"Zusammenfassend nur gut - ich schicke sie wieder in diese Klasse."
"Ja, sofort wieder in diese Klasse. Ich habe die Integrationsklasse auch bei allen Leuten verteidigt, die über all die Jahre immer wieder gesagt haben, daß dies eine "Todesklasse" sei mit behinderten Kindern. Diese Leute haben keine Ahnung und wollten nur etwas Negatives sehen."
-
Wurde Ihrer Ansicht nach von Ihrem Kind genügend Leistung verlangt? Wurde Ihr Kind aus Ihrer Sicht bestmöglich individuell also seinen Fähigkeiten entsprechend, gefördert?
Durch diese Frage wurde bei den meisten Eltern ihre größte Sorge angesprochen. Ich denke, daß die Mehrheit der Eltern ihr Kind ja unter den Vorstellungen in die Integrationsklasse geschickt hatte, daß es gerade unter geringerem Leistungsdruck mehr leisten kann.
Also mit der Forderung nach einer qualitativ besseren Schule ist auch der Wunsch nach einer optimalen Förderung schulischer Leistungen ihrer Kinder untrennbar verbunden.
''Insbesondere Eltern behinderter Kinder, aber auch integrationsüberzeugte Eltern betrachten die Vorstellung "mehr leisten bei weniger Leistungsdruck" eher mit Sorge und Skepsis. Integration und Leistung sind pädagogische Zielvorstellungen. die sich nach Auffassung überzeugter Integrationseltern nicht mühelos miteinander vereinbaren lassen, ja sich zum Teil widersprechen. Für den größten Teil der Eltern ist eine Schule ohne Leistung nicht die bessere, attraktivere Grundschule, für den kleineren Teil kann eine leistungsorientierte Grundschule keine integrative sein. " (WOCKEN, 1987, S. 156 - 157).
Elternaussagen:
"Ganz sicher wurde von den Kindern genügend Leistung verlangt. Das allgemeine Niveau der Klasse war wesentlich höher als in normalen Vergleichsklassen. "
"Ja, die Kinder wurden wirklich ganz individuell optimal gefördert. Das war einfach toll"
''Die Kinder wurden in jeder Hinsicht motiviert. "
''Das individuelle Eingehen auf jedes einzelne Kind war sehr gut. "
''Ich denke, daß die Lehrer auf unsere doch etwas schwierige Tochter ganz besonders rücksichtsvoll und gut eingegangen sind. Ja, sogar besonders gut! Sie hat, denke ich. alles gelernt, was in der Volksschule verlangt wird."
"Unsere Tochter ist ganz sicher super gefördert worden. Es wurde auch genügend Leistung verlangt. Ihre Entwicklung war einfach super. Sie hat viel und dazu sogar alles gerne gelernt, was will man mehr?"
''Es wurde ganz sicher genügend auf Leistung geachtet, aber ich hatte auch das Gefühl, daß die Lehrer ganz spezifisch und individuell auf meine Tochter eingegangen sind."
''Wie weit die Kinder individuell gefördert wurden. konnte ich nicht feststellen. das war für uns einfach nicht so erkennbar. Ich weiß nicht, ob es so zum Tragen gekommen ist."
''Man hätte eventuell schon mehr Leistung verlangen und fordern können, aber wegen des sozialen Miteinanders war es vieleicht nicht so möglich."
''Ich war erstaunt, daß er so das Lesen gelernt hat, ohne daß wir täglich üben mußten. Am erstauntesten waren wir aber jetzt, daß er im Gymnasium in der ersten Deutschschularbeit einen so tollen Aufsatz mit einer 1 geschrieben hat. Das erstaunt uns immer noch."
"Die Individualisierung kann ich schwer beurteilen, aber wenn ich jetzt die tollen Leistungen und super Noten in der Hauptschule sehe, dann muß es doch wirklich gelungen sein."
"Für mich noch immer ein Rätsel, daß die Kinder ohne Abfragen zu Hause den Stoff in der Schule doch gelernt haben. Wie konnte das gehen? Das war super, aber für uns ungewohnt und so schwer zu verstehen. daß wir Eltern nicht ständig dahinter sein müssen."
-
Ist Ihr Kind gerne in die Schule gegangen?
Alle Eltern haben ohne Ausnahme bestätigt, daß ihr Kind gerne und größtenteils mit Freude alle vier Jahre in die Schule gegangen sei.
Elternaussagen:
''Mein Kind ist sehr gern in diese Klasse gegangen und hat sogar gerne gelernt"
"Sie ist gerne in die Schule gegangen und hat in allen vier Jahren höchstens 10 Tage gefehlt"
''Doch eigentlich schon, soweit man eben gerne jeden Tag in die Schule geht Es war für unsere Tochter sicher eine sehr schöne Schulzeit aber auch Lebenszeit, in der sie viel gelernt hat"
"Sie ist sehr gerne in die Schule gegangen, was wollen Sie mehr?"
"Ja, sehr gerne. Er besucht die beiden Lehrer heute noch und redet mit ihnen Englisch."
-
Wie beurteilen Sie den Unterricht in der Klasse z.B. die Freiarbeit, den Projektunterricht u.a.?
Auch wenn einige Eltern mit den verschiedenen Formen des offenen Unterrichts ihre Probleme hatten, da sie selbst diese Art des Unterrichts während ihrer Schulzeit nicht erlebt hatten, gefiel ihnen mehrheitlich im Verlauf der vier Schuljahre diese Unterrichtsmethode. Auch wenn dieser Unterricht gelegentlich dem äußeren Eindruck nach unstrukturierter, unübersichtlicher oder auch lebhafter ist als der herkömmliche Frontalunterricht, waren fast alle Eltern überzeugt, daß er die Kinder in den Mittelpunkt stellt und für jedes einzelne Kind eine individuelle Förderung ermöglicht.
Elternaussagen:
"Sachbereiche wurden gründlichst und fächerübergreifend behandelt und zwar fundiert"
''Es wurde sicherlich nicht so viel Stoff durchgenommen, aber der Stoff wurde von allen nur erdenklichen Seiten beleuchtet."
''Die Freie Arbeit war für unser Kind sehr wichtig. Dort lernte es, seine Vorlieben und Stärken auszubauen und überhaupt erst kennen. So hat es ganze Geschichten, ja sogar Büchlein z.B. geschrieben."
''Rückblickend denke ich, haben wir Eltern uns zu wenig um die Unterrichtsmethode Gedanken gemacht Wir haben z.T. immer wieder nur geglaubt, daß der zweite Lehrer nur für die behinderten Kinder da ist Wir haben zu wenig erkannt, wie gut dieser Unterricht für alle unsere Kinder war. Dann hätten vielleicht überhaupt keine Eltern Kritik geübt."
''Ich denke, die Kinder haben einen Unterricht und eine Schule erlebt, wie es sonst in keiner anderen Schule zu finden ist. Es wurden z.B. Bücher selbst gemacht, es wurde mit dem Computer gearbeitet, Texte gedruckt u.v.m.. Das war eine Schule, wie ich mir Schule vorstelle. Das war doch viel besser, als das tägliche Diktat oder das 1x1."
''Die Kinder haben doch täglich freie Texte geschrieben, sie haben auch gelernt, fehlerfrei zu schreiben. In welcher Klasse wird das so gemacht? Schlimm ist, daß sich dann die beiden Lehrer von zwei Eltern sagen lassen müssen: "Ich wünsche jeden Freitag ein Diktat und darunter eine Eins!" "
''Heute wissen wir alle, daß die Kinder das Rechtschreiben auch so gelernt haben und können. Ich brauche mir nur einen Brief meiner Tochter ansehen. Da braucht es doch nicht ständig eine Note."
''Die Freie Arbeit fanden wir sehr gut, da unsere Tochter oftmals Arbeiten zu Hause weitergemacht hat"
''Die Freiarbeit war eine wichtige und sehr gute Unterrichtsmethode."
''Diese Unterrichtsmethode war schon ganz besonders begeisternd. Das war so positiv. Teamarbeit wird heute auch in der Arbeitswelt verlangt"
''Das hat uns von Beginn an gefallen, besonders die Arbeitsmittel"
''Die Freie Arbeit war ganz super. Das Teamwork wurde gefördert. Die Kinder haben gelernt, daß sie nicht allein im Mittelpunkt stehen, sondern etwas gemeinsam geschafft haben. Schwache Schüler waren eingebunden und begabte konnten sich ausleben. Da profitierten alle Kinder voneinander."
''Die Lehrer haben den Kindern sehr viel an Erfahrung mitgegeben."
-
Wurde die Selbständigkeit Ihres Kindes genügend gefördert? Hat es gelernt, eigenständig zu handeln und Aufgaben zu lösen?
Auch wenn es viele positive Anmerkungen gab, die den Eindruck vermitteln, daß die Eltern durchwegs der Ansicht waren, daß die Selbständigkeit und das eigenständige Handeln ihrer Kinder besonders gefördert wurde, ist doch deutlich in den Aussagen zu erkennen, daß die meisten Eltern diese Frage nur vage oder gar nicht beantworten konnten. Für einige Eltern war wohl entscheidend, daß ihr Kind kaum eine Hilfe bei der Hausübung oder anderen Schulaufgaben brauchte. Zudem hatten die Eltern jetzt nach etwa zwei Monaten, in denen ihr Kind nun in der Hauptschule oder im Gymnasium war, die Bestätigung, daß ihr Kind genügend, ja mitunter sogar mehr gelernt hatte.
Elternaussagen:
''Durch die Fragen und Aufgabenstellungen haben die Kinder gelernt, den Stoff größtenteils eigenständig zu erarbeiten. Dinge, die in der Schule nur gestreift wurden, haben sie selbst erarbeitet, daher haben die Kinder heute schon ein so umfassendes Wissen."
"Sie wurden auch durch das gegenseitige Helfen so selbständig.""Ja, im Vergleich zu unseren anderen beiden Kindern ist unsere Tochter viel, viel selbständiger. Sie hat alle 4 Schuljahre ohne unsere Hilfe alle ihre Aufgaben gemacht."
"Sicherheit haben die Kinder für alle ihre Arbeiten gewonnen. Sie haben auch gelernt, zu dem zu stehen, was sie gemacht haben."
''Die Kinder haben gelernt, ihre Meinung zu "verteidigen". Also ich glaube, daß unsere Kinder viel weniger schnell den Kopf einziehen oder sich nicht mehr trauen."
''Unser Sohn hat sein Selbstbewußtsein und seine Selbständigkeit enorm entwickelt. Es war auch ein Grund, warum ich diese Klasse wollte."
''Die Kinder haben gelernt, auch einmal Nein zu sagen. Sie haben sich sogar den Lehrern gegenüber mitunter kritisch geäußert. Wenn Hans P. z.B. ein Lied zu hoch angestimmt hatte, dann haben die Kinder von sich aus sich gemeldet und Kritik geübt. Sie haben erfahren, daß auch gute Schüler Fehler machen, daß etwas daneben gehen kann. Ich denke, auch diese Erkenntnis ist für das spätere Leben der Kinder wichtig."
"Sie hat sich sicher ein hohes Maß an Selbständigkeit angeeignet, und ihr gesamtes Selbstbewußtsein wurde gestärkt."
"Die Selbständigkeit wurde durch die Freiarbeit sehr gefördert."
''Doch, die Eigenständigkeit wurde gefördert, so denke ich, aber es ist schwer, dies irgendwie festzustellen oder festzulegen."
''Manchmal habe ich das Gefühl, daß unser Sohn zu selbstbewußt wurde. Er ist überaus kreativ und schöpferisch geworden."
-
Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden Lehrern? Zwei Lehrer in der Klasse - ein Problem?
"Integrationsprojekte leben von der intensiven Zusammenarbeit der Eltern und Pädagogen, untereinander und miteinander. In der Anfangsphase eines Schulversuchs dürfte ein dichter Kontakt zwischen den Pädagogen und den Eltern eine wichtige, kaum verzichtbare Stütze sein." (WOCKEN, 1987, S. 165).
Die beiden Lehrer erfreuten sich einer sehr hohen Wertschätzung, sowohl was ihre Persönlichkeit als auch ihre berufliche Kompetenz betraf, bei praktisch allen Eltern. Nur ein Elternpaar war der Ansicht, daß beiden Lehrern die Erfahrung "nach dem alten System" gefehlt habe. Für die Eltern war es von Beginn an klar, daß beide Lehrer in gleichem Maß verantwortlich für alle Kinder der Klasse waren. Einhellig lobten die Eltern die positive Zusammenarbeit, die offene und freundschaftliche Art der beiden Lehrer. Viele Eltern sahen im Teamwork der beiden Lehrer innerhalb des Unterrichts eine Art Vorbildsituation des gemeinsamen Handelns für ihre Kinder, und so war die Zwei - Pädagogen - Situation in der Klasse für die Eltern sehr positiv.
Elternaussagen:
"Also die beiden Lehrer haben wohl alle Kinder gern gehabt."
''Mit den beiden Lehrern konnte ich es mir von Beginn an sehr gut vorstellen, und ich wußte, daß es da alle Kinder gut haben werden."
''Es war sicher gut, daß die beiden Lehrer so in ihrer Art unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Jeder auf seine Art wurde von den Kindern nicht nur akzeptiert und angenommen, sondern auch gemocht."
''War Roland einerseits zu lange geduldig und konnte er mitunter vielleicht zu lange zuwarten, so waren andererseits die klaren Entscheidungen von Hans P. sehr wichtig."
''Unseren Sohn hat immer wieder beeindruckt, wenn Hans P. das schöne Tafelbild von Roland ganz laut vor der ganzen Klasse bewunderte, indem er "super" und "toll" ausrief. Ich denke, daß es z.B. durch das Vorbild der Lehrer die Kinder gelernt haben, den anderen zu schätzen und anzuerkennen. Noch dazu, daß man das auch laut sagen darf. So haben sie sich über Erfolge ihrer Mitschüler gefreut. In anderen Klassen hört man das nicht."
"Also die beiden Lehrer sind schon sehr, sehr gut."
''Die beiden Lehrer waren super, da muß man einfach "Sie" sagen."
''Die Lehrer haben sich super auf die Kinder eingestellt. Da hatten unsere Kinder schon ein ganz besonderes Glück. Zwei Lehrer in der Klasse, das war wirklich kein Problem."
''Die Lehrer waren ein wirkliches Vorbild für die Kinder. Ich denke, die Kinder konnten viel davon lernen, wie die Lehrer miteinander umgingen."
"Mit den Lehrern war ich sehr zufrieden."
''Es waren zwei gute Lehrer und das war ein Vorteil."
-
Waren Sie Ihrer Meinung nach als Eltern genügend in Schulfragen und damit verbundenen Entscheidungen eingebunden?
Von allen Eltern wurde bestätigt, daß sie jede nur erdenkliche Möglichkeit hatten, sich persönlich über den Unterricht in der Klasse zu informieren oder selbst in der einen oder anderen Stunde zu hospitieren.
So fanden neben den regelmäßigen Elternabenden, an denen meist beide Elternteile anwesend waren, auch Elternnachmittage statt, an denen von einigen Müttern gemeinsam mit den Lehrern unterschiedliche Lehrmittel hergestellt wurden.
Kritisch ist aber festzustellen, daß trotz dieser von den Lehrern immer wieder angebotenen Kontaktaufnahme auch zwischen den Eltern selbst es sehr unterschiedliche Aktivitäten einzelner Elterngruppen gab.
So wurden Eltern, die einen wöchentlichen Kontakt mit den Lehrern suchten, von ein, zwei Eltern als "Wichtigtuer" bezeichnet. Andere Eltern wiederum waren der Ansicht, daß die beiden Elternsprechtage im Schuljahr genügen, da sie einerseits ein großes Vertrauen in die beiden Lehrer hatten und andererseits der Meinung waren, daß die Schule Angelegenheit der Lehrer sei.
Elternaussagen:
''Ich persönlich hätte mir gewünscht, noch mehr in das Unterrichtsgeschehen eingebunden zu sein. Mehr und öfters erleben zu können. was wird wie gelernt. Aber ich muß sagen, ich hätte auch jederzeit die Möglichkeit dazu gehabt."
''Die Lehrer hätten auf die Eltern Druck machen sollen. Sie hätten bestimmen müssen, wer von uns Eltern wann in den Unterricht zu kommen hat."
''Die Lehrer haben oft genug angeboten. in den Unterricht zu kommen, aber wir Eltern haben dieses Angebot zu wenig oft oder überhaupt nicht angenommen. bzw. wir haben wohl die Wichtigkeit nicht begriffen. Erst im 4. Schuljahr wurde es mir klar, aber da war es schon sehr spät."
''Ich habe mir gedacht ''Die Lehrer, die machen das schon richtig." Ich hatte immer größtes Vertrauen und ich wußte, daß ich jederzeit hingehen konnte bzw. auch in die Klasse kommen konnte."
''Ich denke, wir alle hätten mehr dazu beitragen können. daß nicht durch zwei Mütter so viel Negatives verbreitet wurde. Wenn eine Mutter kommt und verlangt, daß jede Woche ein Diktat und täglich ein Text frei zu schreiben ist, der dann zu benoten sei, dann hätten wir besser und nachdrücklicher dagegen argumentieren müssen."
"Ich denke, man hätte vom ersten Schuljahr an noch viel viel deutlicher das pädagogische Konzept den Eltern klarmachen müssen."
''Eltern müssen offener werden und nicht immer nur warten. bis sie von den Lehrern angesprochen werden."
''Die beiden Eltern mit ihren Problemen hätten auch wir offen ansprechen müssen."
''Es wäre schön gewesen. hätte sich ein Kreis von Eltern gefunden. der ständig aktiv in der Schule mitgearbeitet hätte. Wir hätten den Lehrern so vielleicht mehr nützliche Rückmeldungen geben können."
''Die Eltern hätten z.B. bei Projektarbeiten mehr eingebunden werden können."
''Vollkommen zufrieden, und zwar in jeder Form und auf jede Art. Ich habe und konnte mich wirklich voll und ganz auf die beiden Lehrer verlassen."
''Die Elternabende waren einfach super, da konnte man diskutieren und alles miteinander bereden."
''Es war ein Superverhältnis mit den beiden Lehrern."
"Ja, ganz sicher waren wir mehr als genügend eingebunden und informiert, aber ein. zwei Eltern haben über all die Jahre so viel Unsinn gesagt und verbreitet."
''Wir sind der Meinung, daß die Lehrer die Verantwortung in der Schule für die Kinder haben, und das haben sie voll und ganz erfüllt. Die Lehrer ließen die Kinder noch Kinder sein. Sie durften Kinder bleiben - es ändert sich schnell genug."
-
Gab es aus Ihrer Sicht Probleme zwischen den Kindern? Waren die Kinder mit Behinderungen ein Problem?
Alle Eltern waren sich einig, daß es weder zwischen den Kindern noch mit den Kindern mit Behinderungen Probleme gab.
Elternaussagen:
''Die Kinder haben in dieser Klasse gelernt, anderen Kindern etwas zu erklären. Sie haben gelernt, daß sie anderen helfen können. selbst aber auch Hilfe brauchen. aber vor allem, daß sie anderen helfen durften."
"Mir war wichtig, daß die Kinder auch unaufgefordert aufstehen und helfen durften. Sie lernten Rücksichtnahme und wurden sensibel für Probleme ihrer Mitschüler."
''Nein, es gab keine Probleme, im Gegenteil. Welche Freude hatte er zu Hause, wenn er etwas erklären konnte, helfen konnte, und es ist den Kindern dann gemeinsam gelungen. Ich glaube, unser Sohn ist da oftmals über sich hinausgewachsen."
''Ich habe erlebt, daß ihn das ganz stark gemacht hat, wenn er seine Fähigkeiten anderen anbieten durfte, aber auch selbst so viel für sich selbst empfing."
''Ich glaube, daß unser Kind später viel besser mit behinderten Menschen umgehen kann."
"So, wie die Klasse war, so war sie richtig. Auch die Zusammensetzung war einfach so gegeben."
''Mir war wichtig, daß es in der Klasse nicht so eine Art Konkurrenzkampf zwischen den Kindern gab. Also z.B. so: "Oh, du hast aber "gestrebert"!" u.ä."
"Es war einfach toll wie Sabine angenommen und eingebunden war, wie sich alle gegenseitig geholfen haben."
''Für uns war der Zusammenhalt der Kinder innerhalb der Klasse so außergewöhnlich, also so besonders gut. Ganz anders, als in anderen Klassen. Ich kann es gut vergleichen. da ich mehrere Kinder in der Volksschule hatte."
''Dieses Miteinander der Kinder war schon ganz besonders super. Wie z.B. alle Kinder gelernt hatten, mit Sabine zu sprechen - so ganz ohne Probleme."
''Wie die Kinder mit Sabine umgegangen sind, da habe ich Tränen bekommen, so super in ihrer Art des Sprechens oder der Zeichensprache. Es gehören alle Kinder zusammen. Dies zu beobachten. war eines meiner größten Erlebnisse."
"Super finde ich, mit welcher Selbstverständlichkeit unser Sohn über behinderte Menschen spricht und damit umgeht."
''Manchmal war es für ihn schon ein Problem, daß er das nicht so gut konnte wie die anderen, aber dann ist er wieder einmal nach Hause gekommen und hat gesagt "Der H. und der T., die können das auch noch nicht so gut." "
"Sie hat sich plötzlich um die Kinder Gedanken gemacht, die sich schwerer getan haben. Sie hat sich gefreut, wenn schwächere Kinder Erfolg hatten. Also es gibt keine Grenzen der Aufnahme von behinderten Kindern."
"Dieses Miteinander war super. Unser Sohn hat es oft besser verstanden. wenn es ihm ein Mitschüler oder eine Mitschülerin erklärt hat."
''Der soziale Bereich war absolut ganz toll und gut. Ja, er war hervorragend Es gab nie eine Aussage: "Der kann das nicht" - Ganz im Gegenteil"
''Dieses Miteinander, dieser Teamgeist war weit besser als in einer herkömmlichen Klasse."
-
Waren aus Ihrer Sicht alle 4 Jahre gleich?
Für einige Eltern unterschied sich das 4. Schuljahr doch erheblich von den ersten drei. Waren es einerseits die Schularbeiten und Tests, die für manche Eltern nun ein Zeichen darstellten, daß es mit der Schule endlich ernst wird, so bedeuteten gerade diese Schularbeiten für die Mehrzahl der Eltern zwar kein
Problem, aber sie hätten es lieber gesehen, wäre der bisherige Unterricht ohne Noten und Leistungsvergleiche beibehalten worden.
Einige Eltern waren auch der Ansicht, daß sich die beiden Lehrer dem Druck zweier Eltern gebeugt hätten, aber auch eventuell durch den bevorstehenden Schulwechsel der Kinder in ihrem Unterrichtskonzept verunsichert wurden.
Elternaussagen:
"Das vierte Schuljahr war nur durch die Schularbeiten anders."
"Im vierten Schuljahr gab es eindeutig mehr Hausübung."
"Für mich war das vierte Schuljahr doch wesentlich anders. Waren die ersten 3 Jahre "gemütlich", so war das vierte Schuljahr doch wesentlich härter."
"Es waren alle 4 Schuljahre gleich schön. Schade, daß es jetzt vorbei ist."
"Also ich empfand das 4. Schuljahr schon fast wie einen Schock. Plötzlich so viele Aufgaben, wo ich selbst erst einmal ''lernen'' mußte."
"Ich habe mit einer solchen Veränderung im 4. Schuljahr nicht gerechnet. Plötzlich gab es kaum mehr Freie Arbeit"
"Die große Aufregung vor den Schularbeiten ..."
''Mit der Benotung im 4. Schuljahr hatten wohl doch viele Eltern Probleme."
''Das plötzliche Beantworten von Fragen wurde in der 4. Klasse schon ein Problem."
"In der 4. Klasse war von den Prinzipien der Differenzierung nicht mehr viel da. Die ersten drei Jahre waren super."
''Die Schularbeiten waren von den Lehrern gut vorbereitet. Es gab zuvor Übungszettel, auf denen die Kinder genügend lang üben und sich vorbereiten konnten."
"Für mich war die Vorbereitung auf eine Schularbeit ein Streß."
''Weder in Mathematik noch in Deutsch waren die Schularbeiten ein Problem. Die Kinder konnten sich ohne jeden Druck darauf vorbereiten."
"Zur Schularbeit kam wirklich nur der Stoff und die Rechnungen, die die Kinder durchgenommen und gelernt hatten."
"Für unsere Tochter war das 4. Schuljahr kein Problem. Es war vielleicht eine Spur strenger, wenn man damit die Schularbeiten meint, aber sonst war es wirklich kein Problem."
"Nein, das 4. Schuljahr war nicht strenger. Man hat aber eventuell klarer festgestellt, wer in welche Schule nach der 4. Klasse geht."
"Alle vier Jahre waren gleich gut und schön."
''Ein Problem war, daß er in der 4. Klasse keine Schularbeiten mitschreiben durfte, das verstehe ich nicht Das war für ihn schon ein ganz großes Problem."
"Ich denke, im 4. Schuljahr haben die Lehrer plötzlich Druck durch die folgenden Schulen gehabt und damit mit diesen Schularbeiten und Diktaten angefangen. Das war schlecht."
''Durch die Schularbeiten und Tests war plötzlich so ein Druck da."
-
Welche Art der Beurteilung hätten Sie für Ihr Kind am liebsten gehabt?
Auch wenn fast allen Eltern die verbale Beurteilung in Form eines Berichtszeugnisses gefallen hatte, wollten nur sehr wenige zur Gänze auf das traditionelle Ziffernzeugnis verzichten. So gaben die Eltern die unterschiedlichsten Begründungen dafür an, auch wenn in der letzten Konsequenz ein verbaler Bericht über den Lernfortschritt der Kinder besser und damit kindgerechter wäre, warum es für sie bedeutsam sei, zumindest in Kombination auch ein Ziffernzeugnis für das Kind zu erhalten.
Elternaussagen:
''Unsere Kinder hörte man nie sagen: ''Welche Note hast du? Welchen Test hast du morgen?" Unsere Kinder haben erzählt, was sie gemacht haben, was sie interessierte, da haben sie ihr Wissen vertiefen dürfen - und danach haben sie die anderen Kinder gefragt - aber nicht nach Noten."
''Für unseren Sohn war viel wichtiger, wenn ein Mitschüler oder eine Mitschülerin gesagt hat: "Das hast du gut gemacht." Diese Bestätigung war ihm viel wichtiger als ein Lob der Lehrer."
''Von den Kindern hörte man nie, der hat die oder die Note. Die Kinder meldeten oder freuten sich an den eigenen Lernfortschritten, aber meistens mehr bei anderen Kindern. Z.B. ''Du, der G. kann jetzt schon bei der Gruppe mit den schwierigen Texten mitmachen!" "
''Die Noten in der 4. Klasse waren schon plötzlich eine Besonderheit."
''Mir hat die Kombination von verbaler Beurteilung und Ziffernzeugnis besonders gut gefallen."
''Ich habe mir bei einer 1, 2 oder 3 besser vorstellen können, wo mein Kind steht"
''Ich frage, kann sich heute ein Lehrherr unter einem Zeugnis ohne Noten etwas vorstellen?"
''Bei einer Gesamtbeurteilung wäre eine Note sicher besser, oder?"
"Die verbale Beurteilung war schon super. Es hätte so bleiben sollen, eventuell auch in einer Kombination."
''Für mich beide Beurteilungsarten in Kombination."
''Eventuell die Kombination zwischen verbaler Beurteilung und Ziffernnoten. Für Kinder, die von zu Hause aus so einen Notendruck durch die Eltern haben, hilft die verbale Beurteilung. Wenn Eltern vernünftig sind und ihre Kinder auch erziehen können, dann sind auch Noten in Ziffern kein Problem."
''Ich halte die verbale Beurteilung für besser."
''In der letzten Konsequenz wäre die verbale Beurteilung besser."
''Unserem Kind hat die verbale Beurteilung besser gefallen."
''Bei Noten weiß man genau, wo das Kind steht Ohne Noten ist das Kind wie ein Fisch im Aquarium. Es schwimmt irgendwo, und ich weiß nicht, wo es ist, wo es wirklich steht und wohin es schwimmt."
''Ein großes Lob den Lehrern, die solche verbale Beurteilungen formulieren und schreiben können. Das war wirklich super. Aber wir sind eben die Ziffernnoten gewöhnt und hatten so wenig Vergleichsmöglichkeiten."
-
War die Thematik der Hausübungen für Sie ein Problem?
Über alle vier Schuljahre ist erkennbar, daß einige Eltern durch die äußerst geringe und meist nicht "Muß - Hausübung" dahingehend verunsichert waren, ob ihr Kind wohl auch genügend übt, wiederholt und damit lernt. Das größte Problem hatten diese Eltern wohl damit, daß sie nicht selbst "als Lehrer" das Wissen und den Lernerfolg ihrer Kinder durch die von den Lehrern aufgegeben Aufgaben überprüfen und abfragen mußten.
Elternaussagen:
"Persönlich hatte ich mit dem Thema "Hausübung" keine Probleme. Die Kinder hatten weniger Hausübung auf, dafür aber regelmäßig."
''Durch die Freiarbeit haben einige Eltern wohl den Sinn einer Hausübung nicht erfaßt."
"Die Lehrer haben durchaus auch individuelle bzw. unterschiedliche Hausübungen den einzelnen Kindern aufgegeben."
''Es war sicherlich eine Art Minimalhausübung, aber das war super. So war auch ich nicht damit eingespannt. Ein Dank an die beiden Lehrer."
"Auch wenn andere Eltern immer wieder mehr Hausübung forderten, so habe ich immer gesagt "Gönnt den Kindern doch diese Zeit und diese Möglichkeit in ihrem Leben. Es kommt noch früh genug, daß sie viel lernen müssen." Heute stelle ich fest, daß sie sich in der Hauptschule auch nicht schwerer tut als die anderen Kinder."
''Da haben Eltern (es waren ja nur die gleichen ein oder zwei) gejammert, daß die Kinder zu wenig Hausübung aufhätten. Aber die Kinder haben den Lehrstoff gelernt, und ich habe den Eindruck sogar noch vielmehr."
''Im Vergleich zu meinen anderen Kindern hat sie sehr wenig Hausübung aufgehabt. Aber die Mehrhausübung jetzt in der Hauptschule ist auch kein Problem."
''Mehr Hausübung hätte gut getan. Sie haben zu wenig auswendig gelernt. Unsere Tochter hätte das "Muß" der Lehrer gebraucht."
''War kein Problem, denn jedes Kind konnte freiwillig noch sehr viel tun."
Die Interviews der beiden Eltern, die ihr Kind nicht mehr in eine Integrationsklasse schicken würden:
Interview 1:
Er hat immer gesagt: "Das kann ich ..."
"Also mein zweites Kind geht garantiert nicht mehr in eine Integrationsklasse.
Aber ich möchte vorweg sagen, daß daran nicht die behinderten Kinder schuld sind, sondern das Unterrichtssystem.
Ich glaube, daß es für ein "schwaches" Kind oder ein krankes Kind in der ersten und zweiten Klasse unter Umständen noch ein Vorteil sein kann, aber ganz sicher nicht für ein normalbegabtes Kind.
Die Anforderungen an die gesunden Kinder sind einfach zu nieder. Die Förderung ist speziell nur für die "schlechten" Kinder. Die behinderten Kinder werden sicherlich auch gefördert. Ja, sie sollen auch gefördert werden, das will ich ihnen durchaus zugestehen, aber man darf es nicht auf Kosten der gesunden Kinder machen.
Es wurde ganz sicher zu wenig an Leistung erbracht. Es hat einfach die Vertiefung gefehlt. Ich glaube schon, daß der Lehrplan erfüllt wurde, das hat man ja am Buch gesehen, aber die Vertiefung und die Hausübung haben gefehlt. Wenn man sich vorstellt, daß man in der vierten Klasse im Durchschnitt nur zweimal in der Woche eine Hausübung aufhat, dann ist das einfach zu wenig.
In der Schule (Gymnasium) geht es ihm jetzt zwar gut. In der Rechenschularbeit hatte er eine Eins, in Englisch eine Zwei.
Es geht ihm gut, er ist sicher beim guten Durchschnitt.
Sicher haben die Lehrer gesagt, das und jenes könnt und sollt ihr üben, aber ich finde es einfacher und leichter, wenn jeden Tag ein bestimmtes Pensum an Hausübung auf ist.
Ich sehe es jetzt im Gymnasium, da haben sie jeden Tag eine Hausübung auf. Das wäre auch für die schwachen Schüler zu schaffen gewesen, wenn man das von Beginn an durchgezogen hätte.
Ich habe das Gefühl, daß die schwachen Kinder im Verhältnis mehr gefordert wurden als die guten. Aber die durchschnittlichen Schüler sind auf der Strecke geblieben. Generell ist für mich kein Kind übriggeblieben, das richtig gefördert wurde.
Die begabten Kinder sind von Haus aus gescheit und brauchen keine Übung, die durchschnittlichen Schüler wurden zu wenig beachtet.
- Außer Sabine, für sie wurde diese Klasse ja gemacht!
Individuell wurde meiner Ansicht nach kein einziges Kind gefördert, das ist total gescheitert, - außer eben Sabine.
Ich habe das Gefühl daß außer der Sabine kein Kind in dieser Klasse etwas profitiert hat.
- Wieweit Sabine etwas profitiert hat, kann ich nicht beurteilen, wenn sie in Mils in die Schule gegangen wäre.
Ich glaube auch, wenn statt der Freien Arbeit mehr Heimatkunde gemacht worden wäre, dann hätten alle Kinder mehr davon profitiert.
Man hat mich aber inzwischen aufgeklärt, daß man in der Freien Arbeit die Kinder nicht mit etwas traktiert, was sie sowieso nicht können.
Aber ich habe das Gefühl daß da die Kinder nicht geleitet wurden. Statt daß man den Kindern da gesagt hätte: "Schau, da hast du Probleme, z.B. im Rechtschreiben, schreib das jetzt in der Freien Arbeit ab!", haben die Kinder wirklich das machen dürfen, was sie gerne wollten. Diese Zeit ist dann natürlich wieder abgegangen.
Ich habe meinem Kind gesagt "Dann lies in der Freien Arbeit!"
Ich muß sagen, er hat bis zu diesem Sommer zu Hause kaum etwas gelesen. Er hatte ja auch nie direkt eine Lesehausübung auf. Außer Fachbücher über Sterne, Saurier usw., die hat er viel gelesen, hat er keine Bücher gelesen, - Fachbücher hat er viele gelesen. Er kann aber gut lesen.
Aber eine Hausübung in all den vier Schuljahren hatte er im Lesen nie auf.
Ich habe einmal mit dem Lehrer F. darüber gesprochen. Er hat mir gesagt ''Richtiges Lesen, das ist eigentlich das Lesen unter der Bettdecke!"
So ist sein Deutsch jetzt ganz nüchtern - so wie die Fachbücher.
Ja, gerne ist er immer zur Schule gegangen.
Also da hat man von drei behinderten Kindern gesprochen. Die Kinder in dieser Klasse waren für mich nicht behindert, so wie ich eine klassische Behinderung verstehe.
So, was man heute auch unter Integration versteht, in Filmen oder aus dem Fernsehen. Integration ist, wenn ein Kind im Rollstuhl ist, oder geistig behindert ist, oder körperbehindert ist.
Ab und zu hat mein Kind auch gesagt, daß ihn die zwei Lehrer stören. Wenn er arbeiten wollte, dann hat der eine oder der andere Lehrer geredet. Das hat ihn schon manchmal gestört.
Zwei Lehrer sind für mich nicht sinnvoll. Lieber sollte man kleinere Gruppen machen und die Kinder trennen, das wäre auch in dieser Klasse sinnvoller gewesen.
Die Selbständigkeit der Kinder wurde sicher auch nicht gefördert oder gestärkt.
Im ersten Schuljahr dachte ich noch, daß alles super ist, aber ab dem zweiten Jahr merkte ich, daß die Kinder zu wenig gefördert werden.
Fleißig waren nur die Kinder, wo die Mutter dahinter war. Die Mütter sind jeden Tag zur Schule "gesprungen" und haben zu den Lehrern gesagt "Mei, kannst mir nicht etwas zum Üben geben." So ist das gelaufen.
Unserer war ein "Schlamperer" und hat viele Wörter ohne Ü - Striche oder I - Punkte geschrieben. Die Lehrer haben dann diese Striche und Punkte meist selbst gemacht - dazu noch in schwarzer oder gar blauer Tinte, das ist ...
Die Lehrer sollten die Kinder doch auf die "Schlamperei" aufmerksam machen.
Ich habe es erreicht, daß er sorgsamer wurde. Ja, und die Abschreibfehler, die haben mich fertiggemacht In den Ferien habe ich jeden Tag mit ihm geübt und gelernt Ich habe ihn bis zu 6x einen Text abschreiben lassen.
Am Elternabend haben dann die anderen Eltern alle gesagt: "Mei, bist du brutal!"
Aber es beruhigt mich, daß jetzt verschiedene Eltern sagen: "Ja, in Deutsch können sie nicht rechtschreiben ..."
Wenn ich außerschulisch nicht so viel getan hätte, wäre das Kind auf der Strecke geblieben, das ist ganz sicher. Ich glaube, die Eltern haben sich alle selbst betrogen. Da haben alle Eltern mit den Kindern selbst gearbeitet und gesagt, daß es funktioniert. Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, daß das bei allen Eltern so war, deren Kinder jetzt in die Hauptschule oder das Gymnasium gehen.
Mir ist es ganz einfach darum gegangen, daß das Kind eine Arbeitsauffassung und Arbeitshaltung bekommt. Das hat er in der Schule absolut nicht gelernt, und daran "beißen" wir jetzt noch immer sehr stark.
Nein, es bleibt nichts übrig, was positiv in dieser Klasse war. Ich würde mein Kind nicht mehr in eine integrierte Klasse geben.
Ich glaube auch, daß die "alten" Lehrer und Lehrerinnen, wie z.B. Frau K. oder P. den Durchschnitt der Kinder besser gefördert hätten. Sie haben mehr Erfahrung als junge Lehrer.
Also ich hätte einfach erwartet, daß man für die Kinder, die in die Hauptschule oder ins Gymnasium kommen, etwas mehr macht.
Die verbale Beurteilung war für die kleinen Kinder recht nett. Am liebsten wäre mir eine Kombination, aber wenn man mich fragt, dann sind mir die Ziffern am liebsten.
Es hat mich auch gestört, daß es keine Tests gab. Die Kinder haben nie das Lernen gelernt.
Also eigenständig hat er nicht gelernt zu lernen.
Er lernt und merkt sich zwar viel und leicht, gerade im Sachunterricht, er liest auch im Reutte - Buch, das interessiert ihn sehr, daher hat er auch in Heimatkunde so viel gewußt.
Er hat immer zu mir gesagt "Das kann ich ..."
Da hat es dann geheißen, daß die Integrationsklasse nach der Volksschule doch nicht am Gymnasium ist Dann sind so viele Eltern abgesprungen und haben ihr Kind ins Gymnasium geschickt.
Ich kann doch nicht sagen - Integration ist so super, und gebe mein Kind dann ins Gymnasium. Also wenn ich so überzeugt bin, dann gebe ich mein Kind doch dorthin, wo die behinderten Kinder sind.
Das habe ich von den Leuten so falsch gefunden.
Ich glaube, daß die Lehrer dazu überfordert waren. Da fehlte ihnen die Erfahrung nach dem alten, herkömmlichen System. Man hätte aus den Kindern einfach mehr herausholen können.
Jetzt ist es gut, daß unser Kind sich nicht alles so zu Herzen nimmt. Er hat immer gesagt ''Das geht schon, das schaffe ich schon, das reicht schon." Er nimmt alles locker.
Ich war froh, daß er jetzt im Gymnasium in Mathematik in der ersten Schularbeit eine Eins geschrieben hat."
Interview 2:
"Es waren wunderschöne Jahre, wenn man sie fragt ..."
''Ich würde mein Kind nicht mehr in eine Integrationsklasse geben. Sicher, die Sabine war wichtig, und wir haben unser Kind deshalb in die Klasse gegeben, damit sie ein bißchen mit Behinderten zusammenkommt. Wir wollten auch nicht hartherzig sein.
Wobei ich ehrlich sagen muß, wenn man das Kind oder die anderen Kinder fragt, dann sagen sie alle, daß es wunderschöne 4 Schuljahre waren.
Das erste und zweite Schuljahr war ja auch ganz toll, aber dann wurden die "guten" Kinder zu wenig gefördert. Die "schwachen" Kinder wurden sicher gut gefördert, aber wenn solche Kinder in einer Klasse sind, dann kann man die guten Kinder nicht mehr fördern.
Wobei die Freie Arbeit mich nicht gestört hat, aber sie war ein Risiko.
Integration in der Schule ist schon recht, aber dann sollte man zu Hause doch ernsthaft entsprechend lernen. Daß die Förderung der "guten" Kinder weniger war, liegt sicher nicht an der Integration, sondern an der Einstellung der beiden Lehrer.
Im 4. Schuljahr hatte man zu Anfang den Eindruck, daß die Lehrerjetzt "anziehen", aber das war nur bis Weihnachten.
Mit den Schularbeiten hatte unser Kind keine Probleme.
Sie ist auch jeden Tag mit Freude und gerne in die Schule gegangen.
Positives und Negatives war etwa 50 zu 50.
Die verbale Beurteilung war sicher besonders gut. Ich weiß, wie schwer so etwas ist.
Die Zusammenarbeit mit den Lehrern war ausreichend und sehr gut. Die Lehrer waren von der menschlichen Seite sehr, sehr wertvoll.
Die Elternabende waren schon etwas anderes als in normalen Klassen.
Die soziale Integration ist sicherlich gut gelungen, aber die Kinder hatten einfach zu wenig Hausübung auf.
Andere Mütter haben auch zu mir gesagt ''Dann kannst du ihr doch etwas zum übergeben."
Aber es ist doch etwas anderes, wenn eine Mutter das sagt oder der Lehrer.
Das Klassenklima war sicher super. Sie haben doch größtenteils ganz andere Sachengemacht als in normalen Klassen.
Also unserem Kind hat es super gefallen. Es waren wunderschöne Jahre, wenn man sie fragt.
Aber wenn man die Vorstellung hat, daß das Kind ins Gymnasium gehen soll, dann war die Hausübung zu wenig. Sie hat zu wenig auswendig gelernt.
Im Gymnasium geht es ohne Probleme sehr gut!"
[27] Fußnote: An der Uckermark-Grundschule in Berlin äußerten sich erstmals im Jänner 1988 die Eltern schriftlich und zusammenfassend über ihre bisherigen Erfahrungen. Diese Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von HEYER, PREUSS-LAUSITZ und ZILKE (1990 veröffentlicht) standen mir schon vorher intern zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
GRUBER/PETRI (1989, S. 73 ff.) haben die Aufgaben der Evaluation eines Entwicklungsprojekts unter verschiedenen Gesichtspunkten in eine systematische Ordnung gebracht:
''Im gegebenen Fall ist das Evaluationsobjekt - die schulische Integration behinderter Kinder - derart umfangreich und komplex, daß es zur Gewinnung eines Überblicks über den sachlichen Gesamtzusammenhang zweckmäßig erscheint, die Evaluationsaufgaben zunächst einmal nach "Bezugsbereichen" zu ordnen.
-das »konkrete integrative Unterrichtsgeschehen« in den einzelnen Klassen,
-die »längerfristigen Effekte« integrativen Unterrichts in ihrem Zusammenhang mit verschiedenen Merkmalen der Unterrichtsgestaltung innerhalb der einzelnen Versuchsmodelle,
-das »soziale Umfeld der Schulversuche«: Lehrer, Eltern, Direktoren, Schulaufsicht, Lehrerbildner und -fortbildner, Schüler außerhalb des Schulversuchs,
-die »Übertragung von Entwicklungsergebnissen« des Versuchs in die allgemeinere Schulpraxis und
-die Beziehungen zwischen integrativer Beschulung und den »Bedürfnissen« behinderter Menschen »im späteren Leben«."
Zur Evaluation des integrativen Unterrichtsgeschehens gehören Untersuchungen im sozialen Umfeld; dabei sind "verschiedene Personenkreise mittels Interviews oder Fragebogen zu den Zielen, Methoden und organisatorischen Formen der integrativen Beschulung behinderter Kinder zu befragen" (ebd.).
In diesem Teil meiner Arbeit sollten durch eine Befragung des Kollegiums der Schule folgende allgemeine Kriterien untersucht werden:
-
Welche Argumente und Begründungen werden zur Befürwortung oder Ablehnung der integrativen Beschulung behinderter Kinder geäußert?
-
Welchen Informationsstand haben die befragten Lehrerkollegen, und wo lassen sich die großen Mißverständnisse antreffen?
-
Welche Gesichtspunkte blieben in unserem Schulversuch aus ihrer Sicht unberücksichtigt: Gibt es konstruktive Ideen, Wünsche, Hinweise auf Schwierigkeiten und Nachteiliges u.a.m.?
-
Existiert nun doch eine Akzeptanz des Schulversuchs im Kollegium, beteiligen sich zunehmend weitere Lehrer oder zeigen sie zumindest Interesse?
-
Lassen sich Auswirkungen auf die Arbeit in anderen Klassen und Veränderungen in Bezug auf die pädagogische Arbeit in der Schule beobachten (vgl. ebd.)?
Eine zentrale Frage aber stellte SPECHT (1993, S. 63) in seinem Ergebnisbericht »Evaluation der Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder«, einer bundesweiten Befragung von Lehrern im Schulversuch:
"Ist der Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder ein fester und anerkannter Bestandteil der gesamten Schule oder führt er eher ein "Insel da sein", das von der übrigen Schulöffentlichkeit unbeachtet bleibt oder gar feindselig betrachtet wird?"
Diese Frage ist nicht nur theoretisch interessant, sondern für die Zukunft der Integration von übergreifender Bedeutung:
"Die Kollegenschaft an der Schule stellt für die meisten Lehrer die wichtigste soziale Bezugsgruppe dar. Wenn sich Lehrer allzu sehr im Gegensatz oder in Opposition zur Mehrheit ihrer Kollegen befinden, stellt sich oft Verunsicherung, Motivationsverlust und Resignation ein."
Nicht von ungefähr nimmt in der theoretischen und empirischen Literatur zur Frage der Qualität von Schulen (SPECHT, 1991; STEFFENS/BARGEL, 1993) das Thema "Grundkonsens im Kollegium" als Bedingung einer "guten Schule" einen so relativ großen Raum ein. Daß dieses Thema zudem eine aktuelle Bedeutung ausweist, begründet SPECHT (ebd.) durch die auch in jüngster Zeit noch bekannt gewordenen Fälle, in denen sich Lehrerkollegien einzelner Schulen über die Presse gegen die Einrichtung von Schulversuchen oder gegen den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder zur Wehr setzen (vgl. Abstimmung an der Hauptschule Königsweg/Reutte, s. Kap. III/7.2.1, S. 298).[28] In diesem Zusammenhang stellt SPECHT weiters die Frage, "ob das Einspruchsrecht von Lehrern, die an einem derartigen Schulversuch gar nicht direkt beteiligt sind, überhaupt legitim sei". Die grundsätzliche Frage in diesem Zusammenhang, die sich anläßlich derartiger Vorkommnisse stellt, ist aber die: "In welchem Maße stellt die ablehnende Haltung der Kollegenschaft einem Innovationsmodell gegenüber eine Gefährdung für den Erfolg desselben dar?" (Vgl. ebd.).
Da wir nach dem Modell »Integrative Klasse« den Schulversuch eingerichtet hatten, war im Zusammenhang mit unserer Klasse ein Ergebnis aus der Untersuchung von SPECHT besonders bezeichnend und von großem Interesse.
"Es ist dies jene. Modellvariante, die - mit ihren oft extrem heterogenen Klassen und durch die enge Kooperation von zwei unterschiedlich ausgebildeten Lehrern - die weitestgehenden Veränderungen der herkömmlichen Form von Schule und Unterricht mit sich bringt, und die daher von vielen Lehrern am stärksten als Bedrohung etablierter Gewohnheiten und Rollenbilder gesehen werden dürfte."
Für die übrigen Versuchsmodelle zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder (Kleinklasse, Klasse mit Stützlehrer, Kooperative Klasse) vermutet SPECHT, dürfte dies aus folgenden Gründen weniger zutreffen:
''Im »Kleinklassenmodell« etwa könnte erwartet werden, daß sich die Lehrer der Regelklassen durch den Schulversuch eher entlastet fühlen, da sie die für sie schwierigsten Schüler an die Versuchsklassen abgeben können. »Klassen mit Stützlehrern« werden in der Regel im Rahmen der Schulgemeinschaft weit weniger auffällig und spektakulär wirken als Integrative Klassen, da die innere Veränderung des Unterrichts durch die nur stundenweise Anwesenheit eines zweiten Lehrers weit weniger zum Tragen kommt. Auch »Kooperative Klassen« stellen in der Regel keine so weitgehenden Innovationen dar, als daß ernsthafte Akzeptanzprobleme in der Schulgemeinschaft zu erwarten wären."
Zusammenfassend stellt SPECHT fest, daß die "Integration der Integration" in die Einzelschule dort am problematischsten ist, wo sie mit den weitreichendsten Veränderungen einhergeht. Hingegen haben die eher "unauffälligen" Versuchsklassen nach dem Stützlehrermodell deutlich geringere Probleme der Anerkennung und Akzeptanz (vgl. ebd.). Differenziert wird dieses globale Bild in seiner Untersuchung durch folgende Einzeltendenzen:
-
"In Klassen der Versuchsvariante »Integrationsklasse« nehmen die Probleme mit der Bereitschaft, in der Versuchsklasse zu supplieren, zu.
-
Extrem negative Einstellungen der Kollegen in der Schule derart, daß diese sich "Mißerfolge erhoffen", kommen in der Sicht der befragten Lehrer in nennenswertem Ausmaß in Integrativen Klassen mit 22% vor.
-
Lehrer im Integrationsklassen-Modell kämpfen mitunter mit dem Problem, daß ihre Kollegen sie im Rahmen der Schule für unangemessen privilegiert halten." (Ebd.).
Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Integrativen Klassen dürften Akzeptanzprobleme, die in manchen Schulen auftreten, insbesonders mit drei Faktoren zusammenhängen:
"-Zum einen dürften dem in etlichen Fällen »grundsätzliche Einstellungsdiskrepanzen« bezüglich der Sinnhaftigkeit der Integration behinderter Kinder in das Regelschulwesen zugrunde liegen. Darauf deutet unter anderem hin, daß Diskussionen über die Legitimation und die Ziele des Schulversuchs mit Kollegen und in der Öffentlichkeit bei IK-Lehrern besonders häufig vorkommen: 83% der IK-Lehrer, aber nur zwischen 54 und 61 Prozent der Lehrer in den anderen Modellvarianten engagieren sich in der Überzeugungsarbeit für die Integration behinderter Menschen. Dies hängt natürlich nicht nur mit dem organisatorischen Modell des Schulversuchs, sondern vor allem auch mit der Einstellungsstruktur seiner Repräsentanten zusammen: Lehrer im IK-Modell treten häufiger als ihre Kollegen in anderen Modellvarianten für die schulische Integration behinderter Kinder ohne »Wenn und Aber« ein. Vermutlich ist es auch diese Kompromißlosigkeit der Werte und Einstellungen, die in der Kollegenschaft hin und wieder Widerstand erzeugt.
-Ein zweiter Faktor ist das »Supplierungsproblem« in Fällen von Krankheit oder Fortbildungsaktivitäten. In Schulen mit IK-Versuch bestehen offenbar größere Schwierigkeiten als bei anderen Modellvarianten, in solchen Fällen Kollegen zu finden, die "einspringen". Dieses Problem steht im größeren Rahmen der Frage, ob Freiwilligkeit der Tätigkeit in der Integration ein sinnvolles und wünschenswertes Prinzip ist.
-Schließlich kommt es im Zusammenhang mit dem IK-Modell offenbar relativ häufig zu Meinungsverschiedenheiten in den Kollegien, was die dienst- und besoldungsrechtliche Situation der Versuchslehrer anbelangt. Während sich hier viele Versuchslehrer über Benachteiligungen beklagen, nehmen offenbar manche ihrer Kollegen vor allem die vorteilhaften Aspekte der Tätigkeit (Zwei-Lehrer-System, kleine Klassenschülerzahlen) wahr und sehen hier gewisse Privilegierungen." (SPECHT, 1993, S. 66).
Zwei Gründe waren es vor allem, die mich veranlaßten, zur Mitte des dritten Schuljahres mit den Kollegen der Volksschule ein persönliches Gespräch über den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder allgemein zu führen und die ganz spezielle Situation der Schulversuchsklasse an ihrer Schule mit jenen Kollegen zu besprechen, die bei der Einrichtung vor 3 Jahren darüber abgestimmt hatten.
Damit wollte ich, nach meinem Engagement und der damit verbundenen Einrichtung dieser Integrationsklasse, zunächst die Gelegenheit nutzen, durch ein persönliches Gespräch die doch sehr "frostige" und größtenteils nach außen hin distanzierte Haltung der meisten Kollegen mir gegenüber aufzubrechen und wieder einen "Draht" für freundschaftliche und kollegiale Gespräche und Kontakte zu finden.
Obwohl ich wußte, daß einige der Lehrer eigentlich von sich aus an einem guten Kontakt durchaus interessiert waren, da es von dritten unbeobachtete Gespräche immer wieder gab, fehlte anscheinend der Mut, im "kollegialen" Verband mit mir zu sprechen oder sich bei einem Gespräch sehen zu lassen. Hatte und habe ich doch auch heute noch durch meinen Einsatz um die Integration behinderter Kinder den Ruf, im Kontakt mit sehr engagierten Eltern nur parteipolitisch tätig zu sein, ohne Rücksicht nur meine Interessen durchsetzen zu wollen, letztlich um mir dadurch auch meine eigene Arbeit in der Schule zu erleichtern u.v.a.m.
Zum anderen wollte ich damit erreichen, daß innerhalb des Lehrerkollegiums über die Integration und damit verbunden über allgemeine Fragen zur Schule, dem Unterricht, der Lehreraus- und -fortbildung und über Elternkontakte u.a.m. miteinander diskutiert und gesprochen wird. Ich wußte, daß bis zu diesem Zeitpunkt, also nach fast drei Jahren, in denen die Integrationsklasse an der Schule existierte, das Thema der Integration noch in keiner gemeinsamen Konferenz besprochen worden war, oder die beiden Lehrer Gelegenheit hatten, über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen den Kollegen der eigenen Schule zu berichten.
Mein Interesse lag natürlich auch darin, zu erfahren, welche persönlichen Gründe die einzelnen Lehrer für ihre fast durchwegs negative Einstellung gegenüber dem gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern hatten. Da mir bewußt war, daß eine große Voreingenommenheit mir gegenüber bestand, hoffte ich, daß die Lehrer die Argumente der Rechtfertigung ihrer Haltung und Einstellung deutlich artikulieren und aussprechen würden.
Zur Methode und Durchführung
Als Untersuchungsmethode habe ich ähnlich der Befragung bei den Eltern und den Klassenlehrern das strukturierte Interview gewählt (s. Kap. III/7.5.l, S. 332). Mit fortlaufender Dauer der Gespräche gewann ich den Eindruck, daß fast alle Lehrer gelöst und offen ihre Meinung äußerten.
Insgesamt habe ich 10 Lehrer (9 Frauen, 1 Mann) befragt, die alle an der Volksschule unterrichten, einschließlich dem Schulleiter.
Um aber gerade in dieser eher angespannten Situation eine völlige Anonymität zu wahren, habe ich die Aussagen aller Lehrer zusammengefaßt. Obwohl mir bewußt ist, daß gerade in der Unterschiedlichkeit von Dienstalter, Position (Schulleiter) u.a. für den komplexen Bereich von Schulentwicklung wichtige Details enthalten wären, habe ich aus den zuvor genannten Gründen und in der Hoffnung, dadurch wieder ein besseres Schulklima schaffen zu können, auch darauf verzichtet.
Die Befragung habe ich als 10 Einzelinterviews durchwegs in der Schule durchgeführt, wobei ich die Fragen und Stellungnahmen der Befragten - nach deren Einverständnis - mittels eines Kassettenrecorders auf Tonband aufgezeichnet habe. Die einzelnen Interviews habe ich anschließend transkribiert, und da einige sehr ausführlich (z.T. über 25 Seiten) ausfielen, in den wichtigsten Kernaussagen zusammengefaßt.
Der Fragenkatalog umfaßte 11 Fragen, die ich aus unserer zuvor beschriebenen spezifischen Situation zusammengestellt hatte.
-
Wie siehst Du heute, nach drei Jahren, die damalige Situation, als wir versuchten, Euch über den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder und über die Einrichtung einer Integrationsklasse an der Schule zu informieren?
Mehrheitlich fühlten sich die Kollegen "überrumpelt" und gaben an, keine Information gehabt zu haben und auch nicht informiert worden zu sein.
Nur ein Kollege war auch heute noch entsetzt über das damalige Verhalten und die Einstellung seiner Kollegen.
"Ich bin immer noch entsetzt über diese Haltung. Für mich ist es die einzig menschliche Möglichkeit des Zusammenlebens, und ich glaube, daß das größte Problem in der Angst liegt Viele Menschen haben noch nie etwas mit Behinderten zu tun gehabt Ich denke, daß es deshalb so schwer ist, diese Schwelle zu überschreiten. Mitmenschen so zu akzeptieren, wie sie sind und sie in das normale Leben einzubeziehen, darin sehe ich unsere Hauptaufgabe."
Folgende Kernaussagen wurden zum Teil mehrfach wiederholt geäußert:
''Ich war nicht informiert, und da das Projekt von der Sonderschule ausging, hat es uns nicht interessiert"
"Wir wußten, daß es so etwas in Weißenbach schon seit über zwei Jahren gibt, aber wir dachten, daß das niemals bis zu uns nach Reutte kommen wird."
"Ja, es ist richtig, Du hast öfters angeregt, uns darüber etwas zu erzählen, aber es kam dann so schnell."
"Wir glaubten, ''überfahren'' zu werden, und so haben wir uns gewehrt, da wir auch dachten, jetzt wollt Ihr die ganze Schule ummodeln."
"Also ich wußte überhaupt nicht, was das soll, und ich hatte auch keine Zeit, mich dafür zu interessieren."
''Ihr hattet schon so fertige Vorstellungen, das wurde mir dann einfach zu viel"
''Daß Roland in einer Konferenz darüber schon früher berichtet hatte, das ist mir entgangen."
"Schade, Du hast damit in der Schule die Kameradschaft platzen lassen."
''Das habe ich in der Schule nie gehört, daß der Roland von unserer Schule über eine Woche an der Europaenquote 1989 "Die kindgemäße Grundschule" in Wien als Referent teilgenommen hat."
-
Wie stehst Du heute zur Idee einer sozial-integrativen Klasse?
Auch nach drei Jahren blieb es bei der mehrheitlichen Aussage, daß die Kollegen an der Schule noch immer keine Information über "diese Integration" haben, aber "da man wenig von der Klasse hört und die ja wohl zufrieden sind, die es unbedingt wollten, ist es wohl in Ordnung".
Zwei der Kollegen aber sehen die Entwicklung nach diesen drei Jahren nun sehr positiv und freuen sich, daß es jetzt so gut läuft.
"Also ich freue mich, daß es so gut läuft. Ich kann dazu nur Euch allen gratulieren. Je mehr Menschen ausgegrenzt werden, desto höher wird das Potential an Versagern und Aussteigern."
''Man muß so früh wie möglich anfangen, daß Kinder auf ganz normale Art und Weise miteinander leben, denn die Kinder verstehen das Miteinander wesentlich besser als die Erwachsenen. Viele Erwachsene haben es überhaupt nie gelernt."
Neben ganz eindeutig ablehnenden Aussagen gab es nun aber doch zumindest einige Überlegungen und Gedanken, die eine gewisse Offenheit erkennen ließen.
''Ich würde das heute ebenso wenig machen, wie vor drei Jahren. Ich habe die Klasse daneben, aber wir sprechen nicht darüber. Die Lehrer werden das schon richtig machen. Mir gefällt aber mein Unterricht besser."
''Ich gehe nicht fragen. Von sich aus sagt niemand etwas, und so weiß ich nicht, wie es funktioniert."
''Ich denke, solange die Kameradschaft im Haus nicht noch mehr leidet, ist es in Ordnung. Integration hin oder her, das Klima im Haus ist wichtig."
''Es stört mich, daß man körperlich und geistig Behinderte in einen Topf wirft. Auch einen Türken zu integrieren, das sehe ich als echt absurd. Ich weiß, daß M1 so gerne in die Sonderschule gegangen ist, und dann muß er in diese Integrationsklasse. Das war schon schockierend für mich."
''Heute sehe ich darin eigentlich keine Probleme mehr, da es um die Klasse ganz normal geworden ist" "Anscheinend machen es die beiden Lehrer ganz gut."
''Ich denke, daß diese Klasse heute zunächst einmal ein Muster ist. Wir könnten uns damit eingewöhnen, aber jeder Lehrer kann das nicht machen."
''Ich sehe schon, daß es sich vom Direktor und auch einigen Kollegen zum Positiven gewendet hat."
"Im Prinzip hat sich nichts geändert, denn jetzt ist es im Schulhaus wieder ruhig."
"Also ich sehe es nicht positiv. Manche Kinder kann man vielleicht integrieren, aber ..."
''Man kann ganz sicher nicht jedes Kind integrieren, denn die stören eben auch."
''Ich habe den Aufbau der Sonderschule erlebt, und ich glaube, daß die Kinder dort einfach besser behütet sind. Dort kann man auf ein Kind sicher besser eingehen, als in einer Integrationsklasse. Ich habe Stimmen von Eltern gehört, die haben gesagt, daß sie ihr Kind niemals in eine Integrationsklasse schicken würden."
"Bei körperlich behinderten Kindern kann ich es mir noch vorstellen, aber nicht bei geistig behinderten Kindern."
"Eventuell ist es in der Volksschule noch möglich. aber weiter hinauf wird der Abstand immer größer."
''Für die behinderten Kinder ist die Integration ein großer Rückschritt. Ab der Hauptschule wird wieder Leistung verlangt, dann ist es nicht mehr möglich."
"Also ich als Mutter würde z.B. die Sabine in eine Spezialschule schicken, denn nur dort können diese Kinder gefördert werden. Sabine, ja - beim Turnen und im Zeichnen, da hätte ich kein Problem. Ich als Mutter hätte in diese beiden Lehrer nicht das Vertrauen, besonders als ich den Leiter von der Gehörlosenschule in Mils im Radio gehört habe und er dort gesagt hat, daß sie in Mils mehr Erfolg haben."
"Für mich ist es so, daß die Mehrheit siegt. Die Klasse ist wichtiger als das einzelne Kind. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Es kann z.B. nicht sein, daß ein Lehrer wegen einem behinderten Kind seinen Dienstposten wechseln muß."
-
Hast Du Dich schon einmal oder öfter mit den in der Integrationsklasse unterrichtenden Lehrern über ihren Unterricht unterhalten? Hast Du Informationen, welche Erfahrungen die beiden Lehrer in diesen drei Jahren gemacht haben? Wird im Lehrkörper darüber gesprochen?
Ich denke, daß ein Kollege mit dem Ausspruch: "Es sind noch immer so viele Emotionen da, so daß sich jeder überlegt, mit wem er spricht und was er darüber sagt", die gesamte Situation innerhalb der Kollegenschaft am deutlichsten beschreibt. So wurde weder in einer Konferenz darüber gesprochen, da das Thema "zu heiß ist", noch "öffentlich" innerhalb der Kollegenschaft.
"Ab und zu habe ich gefragt, aber ich finde es nicht allzu gut, wenn Lehrer zu oft fragen. Jeder Lehrer hat selbst genügend Probleme. Daher halte ich mich zurück. Informationen hätte ich sehr gern, aber ich weiß nicht, ob ich den Lehrern mit meinen Fragen dabei nicht auf die Nerven gehen würde. Die wollen sicher ihre Ruhe haben. Bei einer Konferenz wurde darüber nie gesprochen, denn es ist ein zu heißes Thema Die Emotionen sind immer noch so groß, da ist jeder vorsichtig, mit wem er spricht und was er darüber sagt."
''Nein, ich habe mich nie mit den Lehrern darüber unterhalten, sehe es aber auch nicht als ein Minus für mich, da ich keine Zeit dazu habe."
"Anfänglich wurde darüber noch gesprochen, aber jetzt ist es ruhig. Die Pause nach einer Unterrichtsstunde braucht man notwendig zur Erholung."
"Jetzt ist das kein Thema mehr."
"Ab und zu habe ich gefragt. Man müßte in einer Konferenz darüber sprechen, aber es gab nie die Möglichkeit. Das Thema wird bewußt bei Konferenzen nie angeschnitten. Also im zweiten Stock wird darüber überhaupt nicht gesprochen. Es ist auch nicht aktuell. Es gäbe halt die Möglichkeit nach einer Konferenz, als Allfälliges vielleicht einmal Also mir ist nicht bewußt, daß darüber einmal gesprochen worden wäre."
"So ist die Stimmung jetzt gut. Es macht denen keine Probleme und uns auch nicht. Wenn ich die Kinder im Gang oder auf dem Pausenhof beobachte, dann sehe ich, daß sie ganz normal mit den Lehrern sprechen oder auf sie zugehen. Es sieht so aus, als ob die Stimmung in der Klasse gut ist"
"Eigentlich gar nicht Es wäre mein Wunsch, daß bei einer Konferenz darüber gesprochen würde."
''Eigentlich ganz wenig, eigentlich gar nicht"
"In der Pause hat man frei, da redet man über andere Dinge. Privat habe ich mit den beiden Lehrern nichts zu tun, und so kommen wir nie zusammen. Ich hoffe, daß es nie kommen wird, daß man das einmal machen muß. In unserem Lehrkörper sind nur wenige, die sich das vorstellen können."
"Ich habe es einmal versucht, aber der Roland ist so verschlossen. Zuerst hat er mir alles erklärt, als er aber merkte, daß ich dazu kritisch bin, dann war es aus. Seitdem höre und sehe ich nichts mehr."
"Also in der Konferenz wird öfters einmal über die Gastarbeiterkinder gesprochen. Das ist ja auch so ein Fall für die Integration, und das betrifft doch fast jeden. Also speziell weiß ich nur, daß anscheinend die Sabine sonderschulfähig ist"
-
Hattest Du Gelegenheit, in der Integrationsklasse zu hospitieren oder während des Unterrichts in die Klasse zu gehen? Würde es Dich interessieren?
Ein Kollege meinte: "Ich wurde in die Klasse eingeladen, da ich es aber unter keinen Umständen einmal machen werde, ist mein Interesse nicht groß. Von den Eltern meiner Kinder in der Klasse merke ich, daß sie mit meinem System zufrieden sind, und über das andere höre ich nichts."
Jeder der Lehrer an der Schule hätte zu jeder Zeit in der Integrationsklasse hospitieren und am Unterricht teilnehmen können, aber ich denke, daß ein Kollege selbst das Problem ausgesprochen hat. Er antwortete auf die oben gestellte Frage:
"Ich hätte sehr großes Interesse. Wenn ich zum Schulleiter gehe und ihn bitte, dann würde er bestimmt nicht nein sagen. Aber für diese Sache traut sich keiner, sich stark zu machen. Es müßte ein Lehrer anfangen."[29]
"Ja, es würde mich schon sehr interessieren, da ich überhaupt keine Ahnung habe."
''Nein, ich hatte keine Gelegenheit, aber es würde mich schon interessieren."
"Ja, ich war kurz in der Klasse, über den Unterricht habe ich mich aber nicht informiert."
''Ich hatte keine Gelegenheit, aber das Problem wird irgendwie doch einmal auf uns zukommen. Aber wie es in der Klasse läuft, keine Ahnung."
"Würde mich schon sehr interessieren."
-
Wie denkst Du über das teilweise so große Engagement von Eltern, ihr Kind gemeinsam mit allen übrigen Kindern in eine Klasse zu schicken?
Die Antwort eines Kollegen möchte ich voranstellen:
''Erstens wird es in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, Radio, Presse usw. immer selbstverständlicher, daß auch Behinderte immer wieder zu Wort kommen, die von ihren Problemen erzählen, wie sie abgeschoben werden oder in irgendwelchen Wohnblocks und Heimen isoliert werden. Auf der anderen Seite glaube ich, daß immer mehr Menschen persönlich mit dem Problem einer Behinderung in Kontakt kommen. Es gibt ja doch, ich kenne zwar die Statistiken nicht, immer mehr Familien, die im näheren oder weiteren Umfeld mit Behinderten zu tun haben und dadurch ein anderes Verständnis dazu haben. Aber auch die Betreuer der Behinderten bekommen ein anderes Selbstverständnis, sodaß sie sich für ihre Forderungen formieren und damit stark machen."
Einige Lehrer sind der Ansicht, daß die Eltern behinderter Kinder zu wenig die Behinderung ihres Kindes akzeptieren können und damit wohl auch eine falsche Vorstellung über die Möglichkeiten einer schulischen Förderung haben. Es ist aber fast allen einsichtig, daß die Eltern ihr behindertes Kind in die "Normalschule schicken möchten", da Eltern "nie eingesehen hätten, wenn ein Kind in die Sonderschule muß". Die Eltern würden eben gut daran tun, dem Rat der vieler Ärzte und Experten zu folgen und nicht versuchen, "stur - heil" das einfach durchbringen zu wollen.
''Ich habe schon das Gefühl, daß das von den Eltern ausgeht, die es so wie der F. mit Gewalt wollen. Sicher gibt es dann einige Lehrer, die bereit sind, das zu tun, aber ich kenne nur sehr wenige, die das von vornherein für gut finden. Wenn jemand heute ein schwerstbehindertes Kind hat, dann sollte man doch das tun, was die Ärzte und andere raten. Ich habe das Gefühl, daß die Eltern jetzt "stur - heil" das einfach durchbringen wollen."
"Warum die Eltern das jetzt wollen, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht."
"Ja, es wird sicher Fälle geben, wo es mit leichten Behinderungen möglich ist. Aber so wie in Weißenbach, da ist es direkt schade, wenn man ein Kind in der Hinsicht fördern oder in die Schule geben will."
"Ich sehe schon ein, daß Eltern ihr behindertes Kind in eine ''Normalschule'' schicken möchten und solche Integrationsklassen ins Leben rufen."
''Die Eltern kennen nur ihr Kind und ihr Problem, aber sie wissen nicht, was die Schule zu der ganzen Integration leisten muß. Die Eltern können die Belastung, die auf die Lehrer und die anderen Kinder zukommt, nicht abschätzen. Mitunter können sie ihr eigenes Kind nicht richtig einschätzen. Die Eltern haben nie eingesehen, wenn ein Kind in die Sonderschule muß. nie."
''Weil sich das soziale Denken einfach doch geändert hat."
''Ich weiß es nicht. Wenn ich mir nun vorstelle, daß ich ein Kind mit einer großen Behinderung hätte, ich glaube, daß ich das Kind in der Reuttener Sonderschule schon sicher hätte. Ich glaube, daß es ihm gutginge und daß es eine nette Umgebung hätte."
"Ich glaube, wenn Eltern von behinderten Kindern sich damit abfinden, dann sind sie nicht so darauf bedacht. Es sind nicht alle Eltern dafür."
-
Wäre ein gemeinsamer Unterricht mit einem zweiten Lehrer für Dich vorstellbar? Welche Erwartungen hättest Du? - Warum nicht?
Sehr viele Argumente werden von den Lehrern angegeben, warum sie sich eine Zusammenarbeit mit einem Partner nicht oder kaum vorstellen können. Die Aussagen sind ebenso vielfältig und unterschiedlich wie die Menschen selbst. So reichen die Aussagen von mehr Unruhe in der Klasse bis zum Argument: "Und dann möchte ich in der Klasse eben 15 bis 20 Minuten meine Ruhe haben."
Es sind meiner Ansicht nach genau die vorgeschobenen Argumente, um in Wahrheit einerseits die "Angst vor dem Verlust an Privatheit" (s. Kap. III/6.2.l, S. 269) zu verbergen, und andererseits damit zu verhindern, daß das eigene pädagogische Handeln transparent und damit aber auch die eigene berufliche Qualifikation offenkundig wird (s. ebd., S. 270).
"Ich könnte mir momentan in dem Haus also keinen Lehrer vorstellen, mit dem ich jetzt miteinander unterrichten könnte. Momentan kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. weil mein Unterricht nicht nach einem Schema abläuft. Wenn ich z.B. das Gefühl habe, daß die Kinder müde sind, dann Flöten raus... Wenn ich merke, daß das Rechnen heute nicht funktioniert, dann weg mit den Sachen, vielleicht morgen oder übermorgen. Was mache ich da mit dem zweiten Lehrer? Wenn ich müde bin, dann gebe ich eben eine Stillarbeit und setz mich hin und lasse die Kinder schreiben - und ich möchte meine Ruhe. Ich bin nicht der Pädagoge, der immer nur das Beste herausholt und immer alles bestens macht und machen will. Ich mache es mir eben auch einmal eine Viertelstunde bequem und da könnte ich mir vorstellen, daß dies nicht gerade mit jedem möglich ist."
''Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde, es entsteht mehr Unruhe. Ich stelle es mir schwieriger vor, muß aber ehrlich sein, daß ich es noch nie probiert habe."
''Ich kann es mir mit einem zweiten Lehrer schwer vorstellen. Vielleicht ist man als "alter" Lehrer auch nicht mehr so wendig. Ich mache eine Vorbereitung und dann aber am nächsten Tag doch etwas anderes. Ich finde, das ist dann schwierig. Aber wenn es sein müßte, dann würde man sich wahrscheinlich umstellen müssen."
''Es gibt so viele Punkte, wo ich mir vorstellen könnte, daß das nicht geht. Z.B. die Eifersucht, weil die Kinder lieber zu dem gehen oder lieber den fragen. Da ist jeder Lehrer so anders. Es gäbe sicher Streit, Mißtrauen usw... Ich wäre dazu sicher nicht geeignet."
''Ich habe schon oft nachgedacht, - wenn ich mit einem Lehrer zusammenarbeiten könnte, dann wäre es der Roland. Ich habe so meine Vorstellungen, z.B. von Musik. Wenn der andere auch so denkt, ja dann vielleicht. Die Lehrer müssen zusammenpassen."
''Nicht gut vorstellbar, da es mir ganz fremd wäre. Es wäre sicher eine große Umstellung."
''Für mich kommt es nicht in Frage. Ich finde es in der Volksschule auch nicht notwendig. Die Kinder brauchen da nur eine Bezugsperson."
''Ich weiß, daß ich ein eigenartiger Mensch bin und deshalb kann ich es mir absolut und nie vorstellen. Es sind Kleinigkeiten, und die "fressen" mich dann und dann explodiere ich."
"Ja, selbstverständlich! Ich würde mich zunächst mit dem zweiten Lehrer intensiv zusammensetzen müssen, um gemeinsam ein Konzept zu finden bzw. zu erstellen. Auch müßte ich mich mit jemandem beraten - wie z.B. dem Roland."
"Ja, theoretisch schon. Nur momentan ist kein zweiter Lehrer in Sicht Er dürfte nicht zu pedantisch sein, müßte ein gewisses Maß an Fleiß haben und zumindest etwas verläßlich sein."
-
Arbeitest Du in irgendeiner Form mit einem oder mehreren Lehrern des Kollegiums an der Schule zusammen?
Eine Zusammenarbeit im Sinne von Teamarbeit gibt es in der Schule nicht. Die Zusammenarbeit beschränkt sich auf das Austauschen von Arbeitsblättern und Testbögen. Ein Kollege meinte, daß dies in der Volksschule auch nicht notwendig oder gefordert sei.
"Ja, wir arbeiten schon zusammen. Der H. schickt mir einen Rechenzettel; und ich schicke ihm auch einen Rechenzettel. Oder man fragt eben: Brauchst Du etwas? Wir kommen auch ab und zu am Nachmittag zusammen und trinken Kaffee. Das kommt so 4 - 5 mal im Jahr vor."
"Sicher arbeiten wir zusammen. Wir tauschen z.B. gegenseitig Arbeitsblätter oder Rechentests aus. Im Turnen machen wir manchmal Wettspiele."
"Ja, mit den Parallelklassen, da spricht man schon zusammen, oder man fragt z.B.: Wo bist Du? Oder man sagt, daß man einen Übungszettel hat."
"Eigentlich nicht."
"Am ehesten mit dem Pfarrer mit den Kinderliedern, Kindermesse ... aber sonst eigentlich ..."
''Nein, eigentlich nicht Manchmal die Frage: Wie weit bist Du, oder gemeinsame Tests."
''Nein, es gibt keine Zusammenarbeit Sie ist nicht notwendig und nicht gefordert. Im Organisatorischen ist es wichtig, daß man sich abspricht."
''Es ist immer fein, wenn man sieht, was der andere macht Man bekommt Ideen und kann dem anderen auch eine Idee beibringen."
''Leider ist eine Zusammenarbeit in dem Sinn, wie Du sie meinst, nie möglich gewesen."
''Nein!''
-
Hast Du in irgendeiner Form mit Kindern mit Behinderung zu tun?
8 Lehrer gaben an, daß sie noch nie näher etwas mit behinderten Kindern oder Menschen zu tun gehabt hätten.
''Ich habe einen Bekannten, dessen Kind ist schwerst hirngeschädigt Als ich das Kind mit ca. 4 Jahren sah, konnte ich mir nicht vorstellen, daß es überhaupt bildungsfähig ist. Ich habe das Kind dann einige Jahre später wiedergesehen und war so erschüttert, daß man so viel erreichen kann, wenn man es richtig macht. Es war nur in einer Behindertenklinik. Da weiß ich nun nicht, wie allein so etwas organisatorisch möglich ist, daß ein Kind so in einer Integrationsklasse gefördert wird. Aber mit zwei Lehrern, ja, das wäre notwendig und sicher dann auch möglich. Ich glaube aber, daß das nicht jeder Mensch kann. Man braucht dazu ein Gespür ...; ich möchte es fast mit einem Künstler vergleichen."
''Nein, nur mit Schwachbegabten."
-
Wie stehst Du zu der Meinung, daß Kinder mit schweren Behinderungen ebenfalls in die Regelschule integriert werden sollten?
Fast einheitlich kam die Aussage: "Ich kann es mir einfach nicht vorstellen", und daß "diese Kinder sich doch in einer gemeinsamen Klasse an der Sonderschule sicher wohler fühlen würden".
"Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wirklich nicht, beim besten Willen nicht. Aber ich würde mich belehren lassen."
"Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, daß sie besser in der Sonderschule in einer Klasse zusammen betreut und aufgehoben sind."
''Nein, das ist sicher nur negativ für die Kinder."
''Das kann ich mir nicht vorstellen. In der Sonderschule fühlen sie sich sicher wohler."
"Also, Deine Vorstellung z.B. den C. aus Deiner Klasse, nein, da ist bei mir absolut aus. Also wenn Du solche Vorstellungen hast, dann ...."
''Da bin ich im Zweifel Aber wenn die Eltern es wünschen, dann ist es für uns Lehrer Pflicht. Die Kinder sind uns anvertraut, und es haben immer noch die Eltern zu bestimmen, was sie möchten."
"Also in normalen Schulklassen, finde ich, ist das nicht mehr in Ordnung. Ja, wenn einer nur bewegungsbehindert ist oder so, dann ...."
''Wenn die Voraussetzungen da sind, dann ja."
''Nehmen wir an, daß die Klasse im zweiten Stock ist und das Kind ist gehbehindert. Was ist dann? Wenn es ein friedliches Kind ist, das die anderen nicht tangiert, dann ist es überhaupt kein Problem. Ich hatte ein Kind, das war nicht geistig behindert, aber kaum habe ich mich umgedreht, hat es den Sessel umgestoßen. So etwas geht nicht. Sicher, wenn es auf seinem Sessel sitzt, auch dort bleibt, daß es keinen Lärm macht, aber wenn es dauernd pfeift, so etwas würde ich als unpraktisch empfinden."
-
Welche Ziele und Aufgaben sollten in der (Regel-) Schule nach Deiner Meinung in erster Linie verfolgt werden?
''Daß die Kinder Gemeinschaft lernen, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, daß sie etwas lernen. Aber zuerst wäre mir die Gemeinschaft wichtig."
"Alles miteinander ...."
"Zuerst verlangt man von der Schule Wissensvermittlung. Eine gewisse Menschlichkeitsbildung und das Musische sollen auch nicht zu kurz kommen. Also überhaupt Erziehung."
''Viele. Wichtig ist halt bei uns in der Volksschule das Lesen, Schreiben und Rechnen. Meine Ansicht ist, daß man da eben das Höchstmögliche erreichen sollte, um die Kinder eben auf die nächsthöhere Schule bestmöglich vorzubereiten."
"Heutzutage finde ich das Soziale besonders wichtig. Dazu die Wissensvermittlung, das ist immer dasselbe."
"Das Gesamtziel der Schule sollte sein, daß man später einmal ein ordentlicher Mensch wird. Daß man nicht irgendwo untergeht, sondern daß man sich zu helfen weiß im Leben, lesen und schreiben kann und halbwegs vernünftig denkt."
"Daß das Lernziel mit ein bißchen Freude erreicht wird und nicht nur durch Druck und Notengebung. Aber Leistung muß da sein, das ist ganz klar."
''Ich finde, daß der Mensch lebenstüchtig werden soll und auch selbst denken soll"
Sehr viele der im Kapitel III/6.l S. 265 ff. »Kooperation als Problemlösung und als Problem« aufgezeigten allgemeinen Überlegungen werden durch die Aussagen der Lehrer überwiegend bestätigt und durch ihre persönlichen Meinungen untermauert.
Mehrheitlich wurde die von uns an die Schulleitung und an die Kollegen herangetragene Bitte um zumindest Akzeptierung bzw. Unterstützung, daß zwei an der Schule schon tätige Lehrer den Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder durchführen möchten, als "Überrumpelung" aller Kollegen angesehen.
Obwohl schon über Jahre versucht wurde, im Rahmen einer Schulkonferenz die Kollegen über den gemeinsamen Unterricht aller Kinder zu informieren, wurde es wohl auch aus dem Grund abgelehnt, "daß dies dann doch vielleicht nach Reutte kommen könnte" (s. Kap. III/8.2, S. 355).
Ich denke, daß ein Hauptgrund dafür, daß die Lehrerkollegen sich dann auch in den drei Schuljahren, an denen der Schulversuch schon an der Schule lief, "überhaupt nicht interessieren wollten", wohl der war, daß ihre vor 3 Jahren mehrheitlich ablehnende Abstimmung des Schulversuchs, durch eine kleine Gruppe von Lehrern und Eltern, übergangen und ihnen der Schulversuch letztlich "aufgezwungen" wurde.
Dies war sicherlich mit ein Grund, warum weder mit den Lehrern über ihren Unterricht gesprochen oder in der Klasse hospitiert wurde, noch durch den Schulleiter das Thema »Integration« wenigstens einmal in den 4 Schuljahren auf die Tagesordnung einer Konferenz gesetzt wurde.
Zusätzlich kam aus meiner Sicht hinzu, daß wohl ein großer Teil der Lehrerkollegen auch heute noch der Ansicht ist, daß "diese Integration" nur eine parteipolitische Angelegenheit sei.
Da auch zum Zeitpunkt der Beantragung des Schulversuchs in unserem Bezirk weder von den Kirchen noch von der Lehrergewerkschaft, noch vom mehrheitlichen Lehrerverein kaum positive Signale oder Aussagen zur Integration kamen, wurde es für die Kollegen im Schulhaus anscheinend noch schwieriger, offen darüber zu sprechen oder sich öffentlich mit Befürwortern zu zeigen.
Die im Kapitel III/6.2.1, S. 269 angesprochene »Persönlichkeit des Lehrers« und die damit verbundene Problematik wurden durch sehr viele Aussagen der Lehrerkollegen in der Weise untermauert, daß sich kaum ein Lehrer vorstellen konnte, mit einer zweiten Person in der Klasse gemeinsam zu unterrichten. "Ich könnte mir momentan in dem Haus also keinen Lehrer vorstellen, mit dem ich jetzt miteinander unterrichten könnte."
Die größten Sorgen und "Ängste", z.T. sicherlich unbewußt, sind darin zu sehen, daß sehr viele der Kollegen durch eine zweite Person in der Klasse den Schutzmechanismus des eigenen Klassenzimmers, der bislang die persönliche und berufliche Identität schützend einhüllte, in Gefahr wähnen (s. Kap. III/6.2.1, S. 269).
Kein Kollege der Schule hatte bisher die Möglichkeit, in einem Team zu arbeiten, um somit evtl. als Muliplikator zu wirken, indem er seine Erfahrungen hätte einbringen können.
Da auch die Lehrerkollegen bisher noch kaum mit behinderten Menschen in näheren Kontakt traten, ist wohl auch ihre Verunsicherung und Distanz und damit die völlige Ablehnung einer Integration geistig behinderter Kinder oder von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung in der Schule zu erklären.
[28] Im Frühjahr 1989 ist an der Hauptschule / Königsweg in Reutte über die Aufnahme und "Integrationsfähigkeit" von Kindern abgestimmt worden. Zitat aus den "Außerferner Nachrichten" vom 12. März 1989: "Bei dieser Abstimmung ging es nicht, wie von Obmann Heinz Forcher wissentlich und falsch dargestellt wurde, um die Integration Behinderter, sondern einzig und allein um die Frage der Integration geistig schwerst Behinderter an der Hauptschule. Und nur gegen eine solche Integration hat sich der Lehrkörper ausgesprochen, weil er der Meinung war, daß eine Integration Behinderter nur dann sinnvoll ist, »wenn die Behinderten auch integrationsfähig sind« und damit ein gemeinsamer und gedeihlicher Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten möglich ist" (vgl. a. SCHÖLER: Herausforderung: Kleine bunte Wedel. In: TAFIE (Hg). Pädagogik und Therapie ohne Aussonderung. Innsbruck, 1990.)
[29] Dieser Kollege hat im folgenden Schuljahr als einziger innerhalb der 4 Schuljahre in der Klasse hospitiert.
''Möglicherweise ist die Zeit nicht mehr fern, da die Pädagogik es als peinlich empfinden wird, von einem defektiven Kind zu sprechen, weil das ein Hinweis darauf sein könnte, es handle sich um einen unüberwindbaren Mangel seiner Natur. In unseren Händen liegt es, so zu handeln, daß das gehörlose, das blinde und das schwachsinnige Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden. das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt." (WY-GOTSKI, 1975, S.72).
Nach nun fast genau 10 Jahren sehr eingehender Auseinandersetzung sowohl im Theorie- als auch Praxisbereich in der eigenen Klasse und als Stützlehrer in einer Volksschulklasse mit dem gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder, möchte ich in meinen zusammenfassenden Schlußgedanken auf einige grundlegende Prinzipien und damit für mich unabdingbare reformpädagogische Forderungen hinweisen. Wir sollten zudem die sich derzeit bietende gemeinsame Chance nutzen und die Vision zu einer demokratischen und humanen Schule verwirklichen.
Auch wenn ich, gerade in der derzeitigen Phase der Umsetzung des Schulintegrationsgesetzes auf Landesebene, in meinem Innersten eher zweifle, ob es uns gelingt, durch die reformpädagogischen Veränderungen, die ein gemeinsamer Unterricht aller Kinder mit sich bringt, ein kleines Stück der Verwirklichung dieser Vision einer humaneren Schule näher zu kommen, möchte ich mir zumindest die Hoffnung bewahren.
Eine Hoffnung, die ich für alle Kinder hege, die heute noch immer - trotz aller Erkenntnisse über die menschlichen Entwicklungsprozesse und damit über das menschliche Lernen - durch ein "inhumanes" Schulsystem und integrationsunwillige Lehrer ausgegrenzt und abgesondert werden.
"Sonderinstitutionen sind Ausdruck von Angst und Pessimismus, integration ist Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden Welt." (Roser, in: Schöler, 1987, S. 80).
Eine zentrale Voraussetzung für die Verwirklichung der Vision einer humanen Schule sieht HAEBERLIN (1992, S. 102) darin,
"daß sich die Mehrheit der an Integrationsentwicklungen beteiligten Lehrpersonen als engagierte Pädagogen und Pädagoginnen mit einem inneren Feuer für Visionen und nicht als Staatsfunktionäre verstehen können und daß sie bereit sind, zugunsten der Visionen neue Formen der Zusammenarbeit in Vorschule und Schule zu wollen, zu üben und zu praktizieren." (Ebd).
Integration und Zusammenarbeit ist somit einerseits eine untrennbare Einheit, andererseits beruht diese Zusammenarbeit auf den für die Integration grundlegenden Prinzipien des Teamteachings, der Kooperation und des Kompetenztransfers.
Voraussetzung aber für eine Realisierung dieser Prinzipien ist ein auf den heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen basierendes grundlegendes Verständnis für die Begriffe Entwicklung, Behinderung und Integration (vgl. BERGER, 1990).
Aus diesem Verständnis heraus muß sich ein Unterricht, will er einer menschlichen Entwicklung und einem menschlichen Lernen gerecht werden, an der "Entwicklung jedes einzelnen Kindes orientieren" (FEUSER, 1989, S. 28), und diese Forderung nach einer Orientierung an der Entwicklung des einzelnen Kindes impliziert, daß Schüler nicht schulgerecht sein müssen, sondern es wird verstärkt die Anforderung an die Schule gestellt, kindgerecht zu sein (vgl. DAXBACHER, 1992).
Verstehen wir den Ausdruck »Behinderung« als Produkt der sozialen Beantwortung einer Beeinträchtigung eines Menschen in Form von Selektion, Segregation und Parzellierung (Vgl. FEUSER, 1989, S. 20), also einer ungenügenden Integration eines Menschen in sein "vielschichtiges Mensch-Umfeld-System" (SANDER, 1988, S. 81), ist Behinderung somit ein Ausdruck einer sozialen Isolation der Betroffenen und entsteht Behinderung erst durch gesellschaftliche Bedingungen (vgl. JANTZEN, 1980).
Aus diesen Überlegungen eröffnen sich nicht nur der allgemeinen pädagogischen Praxis neue Perspektiven, sondern es ist damit ein für alle Schulen auch neuer Handlungsauftrag gegeben.
Vor allem die Sonderpädagogik wird ihr bisheriges Selbstverständnis über weite Bereiche ihres bisherigen Handelns aufgeben müssen, will sie zukünftig das aus ihrer Geschichte angestrebte Ziel der gesellschaftlichen Integration Behinderter jemals erreichen.
Die Auffassung, soziale Integration durch schulische Seperation bewirken zu können, wurde, denke ich, empirisch hinlänglich widerlegt (vgl. EBERWEIN, 1988, S. 45), und daß eine Eingliederung nicht durch eine Ausgliederung erreicht werden kann, habe ich u.a. auch durch den hier beschriebenen Schulversuch an der Volksschule Reutte aufgezeigt.
Aus meiner nun über 25jährigen Praxis als Sonderschullehrer und der damit verbundenen Erfahrung, daß es einerseits keine Theorie der Sonderschule gibt, und andererseits seit vielen Jahren empirische Untersuchungen zur Ineffizienz der Sonderbeschulung vorliegen, verliert schon aus diesen Gründen nicht nur die "besondere" Pädagogik ihre Legitimität, sondern es erhebt sich damit gleichzeitig die Frage, wodurch das Festhalten an der Institution "Sonderschule" noch gerechtfertigt ist (vgl. Eberwein, 1988, S. 46).
Persönlich habe ich daraus die Konsequenz gezogen, durch mein Engagement beizutragen, daß möglichst viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf integriert werden.
So wurde vor zwei Jahren die Allgemeine Sonderschule in Reutte stillgelegt, und die Anzahl der sogenannten "schwerstbehinderten Kinder" beträgt derzeit nur noch sechs (s. Kap. III/2.5.2, S. 70 ff.).
Integration gründet in diesem Verständnis auf der Bewußtmachung von Benachteiligungen mit der Zielsetzung der Aufhebung sozialer Stigmatisierung, Deklassierung und Diskreditierung Behinderter. Integration leitet den Prozeß einer umfassenden Erziehungs-, Bildungs- und Schulreform ein, in Richtung einer Schule, in der alle Schüler ohne sozialen Ausschluß miteinander lernen können. Integration kann somit als Demokratisierung unserer Gesellschaft verstanden werden, wobei "Aktivitäten zur Umsetzung von Integration nicht von einer Berufsgruppe allein (z.B. Lehrerinnen und Lehrer), sondern von allen (auch politisch) Verantwortlichen zu fordern sind. Die Realisierung von Integration wird somit als Prozeß betrachtet und nicht als eine plötzlich zu erfüllende Maßnahme." (DAXBACHER, 1992).
Will die Schule die Aufgaben, die sich durch die gesellschaftliche Entwicklung herauskristallisieren, wahrnehmen und auch zu bewältigen versuchen, so hat sie innerhalb ihres Systems vielleicht nicht alles neu zu gestalten, aber in vielen Fällen ihre Verpflichtungen wesentlich ernster als bisher zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
Die Aufgabe der Schulbehörde wäre es, die gesellschaftlichen Herausforderungen an die Schulen unmißverständlich heranzubringen, aber nicht indem sie einfach von oben zugewiesen werden, sondern indem den Lehrern die erforderlichen Spielräume und Ressourcen gegeben werden, damit sie diesen Anforderungen angemessen und kreativ begegnen können (vgl. POSCH, 1992, S. 14).
In der Lehrerausbildung wird meiner Ansicht nach verstärkt darauf zu achten sein, daß Lehrer grundsätzlich dazu bereit sein müssen, sich für Integration und damit für die Zusammenarbeit zu engagieren, wollen wir den Weg zum Ziel (Vision) einer humaneren Schule beschreiten. Wobei eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht nur ein neues Rollen- und Aufgabenverständnis aller beteiligten Lehrpersonen erfordert, sondern vor allem Offenheit, Kreativität, Flexibilität, Kritikfähigkeit und Toleranz.
Dieses neue Rollen- und Aufgabenverständnis hat sich in der Ausbildung und im Aufgabenkatalog ebenso niederzuschlagen wie im Anforderungsprofil von Kindergärtnerinnen, Regelschullehrern und Sonderschullehrern. So hat sich einerseits das traditionelle sonderpädagogische Denken durch eine veränderte Ausbildung vom historisch überlieferten "Schonraumdenken" ebenso zu lösen, wie das "Homogenitätsdenken" der Regelschullehrer, daß es in einem Klassenzimmer kein Kind geben darf, das "stört", das sich nicht erwartungsgemäß entwickelt.
Regelschullehrer werden verstärkt zur Einsicht kommen müssen, daß es keine "Normalität" gibt, sondern daß Eigenart, Individualität und Abweichung die Norm sind (vgl. HAEBERLIN, 1992, S. 103).
Zudem stelle ich die Forderung, daß heute jeder Lehrer sich ein gewisses Maß an sonderpädagogischem Wissen in der Ausbildung anzueignen hat, so daß wir zumindest im Grundschulbereich nicht mehr zwischen Regelschullehrern und Sonderschullehrern unterscheiden. Diese umfassende allgemeine Ausbildung ist für mich eine der zukünftigen Selbstverständlichkeiten innerhalb der Lehreraus- und -fortbildung, wollen wir es nicht bei einer nur "kaschierten" Integration bewenden lassen.
Ein weiteres Anforderungsprofil an den professionellen Lehrer stellt zukünftig verstärkt, nicht nur auf die Arbeit in Integrationsklassen bezogen, die Fähigkeit dar, mit den verschiedensten Fachleuten im Sinne des Kompetenztransfers teilweise sehr intensiv zusammenzuarbeiten. Es bedeutet, verstärkt ständig selbst neu zu lernen, persönliche Einstellungen und Haltungen zu revidieren. Die Fähigkeit des Zusammenarbeitens beinhaltet aber auch das Vermögen, Kritik zu äußern und anzunehmen sowie gelegentliches Versagen - eigenes Versagen ebenso wie dasjenige des Kollegen - ausdrücken zu können.
Der individualisierte Unterricht, den ich in dieser Arbeit u.a. versucht habe, auch unter einigen Aspekten der Durchführung zu beschreiben, verlangt einerseits von den Lehrern eine verstärkte Bereitschaft, den Kindern einen weit größeren Handlungsspielraum. als üblich zu gewähren, andererseits auch die Bereitschaft von Schulaufsichtsbehörden, den Lehrern diesen Handlungsspielraum einzuräumen, indem u.a. Zeit für gemeinsame Vorbereitung und absprachen ebenso eingeplant werden. Es erfordert aber auch ein Umdenken bezüglich der Stundenpläne, der Unterrichtszeiten und der Unterrichtskontrolle u.a.m..
Einige zusätzliche und z.T. qualitativ neue Aufgaben, die der Lehrerfort- und -weiterbildung zukommen, zeichnen sich nach Ansicht von POSCH (1992, S. 14 ff.) bereits ab:
So wird das "eingespielte Schema zentral oder regional organisierter und vordefinierter Veranstaltungen in Zukunft durch Formen der Lehrerfortbildung ergänzt werden müssen, bei denen die Lehrer nicht die "Empfänger", sondern selbst "Gestalter" ihrer Fortbildung sind" (ebd.). Die bisherige Praxis schulexterner Fortbildung muß also ergänzt werden durch schulinterne Fortbildung, ''bei der die Auseinandersetzung mit und die Erprobung von Innovationen im institutionellen Kontext der Arbeitsstätte des Lehrers erfolgt" (ebd.).
Hat sich die Lehrerfortbildung bisher am einzelnen Lehrer orientiert, so "sollte sie nun durch eine Orientierung an Lehrergruppen oder am ganzen Lehrkörper einer Schule ergänzt werden" (ebd.). Dem Schulleiter kommt hierbei nicht mehr nur die übliche »Fortbildung zulassende« Rolle zu, sondern eine aktive Fortbildungspolitik (vgl. ebd.).
"Auch inhaltlich ist eine Verschiebung von Balancen bei der Lehrerfortbildung erforderlich: Die traditionelle Orientierung am Erwerb fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Wissens sollte durch Angebote ergänzt werden, die Lehrer(gruppen) anregen, dazu qualifizieren und dabei unterstützen, ihre Situation an der Schule selbst zu untersuchen, Probleme zu definieren, Innovationen selbst durchzuführen, sie zu prüfen und institutionell zu stabilisieren. Eine der wichtigsten Formen von Lehrerfortbildung findet vor Ort statt, durch Reflexion und Weiterentwicklung eigenen Unterrichts und durch Schulentwicklungsarbeit." (POSCH, 1992, S.15).
Ein Modell zur Verwirklichung dieser Lehrerfort- und -weiterbildung erkannte ich, im Rahmen unserer Studienreise nach Berlin (s. Kap. III/2.6.3, S. 100 ff.), in der Einrichtung einer »Lernwerkstatt« an der dortigen Technischen Universität.
Eine weitere Möglichkeit zur Unterstützung und Hilfestellung für Lehrer bei der Integration von behinderten Kindern wäre durch die Einrichtung von sogenannten »Sonderpädagogischen Zentren« gegeben, deren Aufgabenfelder in den Bereichen Betreuung, Beratung und Koordination (Vernetzung) liegen.
Auszug aus meinem Planungsprotokoll zur Einrichtung einer Lernwerkstatt an der Sonderschule Reutte:
''Lernwerkstätten sind vor allem aus dem Bedürfnis von Lehrern entstanden, ein neues Lernverhältnis entgegen dem referentenorientierten Lernen zu entwickeln. Wenn die Schule versuchen will neue Wege zu gehen, und damit mehr auf die individuellen Lernmöglichkeiten des einzelnen Kindes einzugehen, seine Selbständigkeit, Kreativität und Eigeninteressen nicht nur zu fördern, sondern wenigstens zu erhalten, müssen wir Lehrer zunächst selbst wieder erfahren, wie diese selbstgesteuerten Prozesse ablaufen.
Es geht somit vor allem darum, als Lehrer immer wieder selbst zu erfahren: Warum will ich etwas machen? Was fördert oder behindert mein Bemühen? Was erlebe ich als wirkliche Lernhilfe? Wie lange dauert mein Engagement? Arbeite ich lieber allein oder in der Gruppe? Was passiert mit mir, wenn ich scheinbar nichts tue? U.a.m..
Durch diese Erfahrungen werden wir aufmerksam auf und sensibilisiert für die Lernwege, den Forschungs- und Bewegungsdrang, die kreative Beharrlichkeit, aber auch die Ängste und Nöte von Kindern in Vorschulgruppen und Schulklassen.
Eine Lernwerkstatt kann ebensogut ein Raum sein, in dem man sich einfach nur umsehen darf und in dem eine Fülle von Materialien zusammengetragen wird, die Kollegen helfen soll ihre Klassen für offenere Unterrichtsformen auszustatten, u.v.a.m.."
Als ich im Herbst 1990 diesen Projektentwurf zur Einrichtung einer Lernwerkstatt, in den durch den Rückgang der Schülerzahlen freigewordenen und von der Marktgemeinde Reutte weiterhin zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, diesen den zuständigen Stellen der Schulaufsicht des Bezirkes sowie der Lehrerfort- und -weiterbildung des Landes Tirol vorstellte, wurde dieses Projekt zur Einrichtung einer Lernwerkstatt vor allem deshalb "skeptisch" aufgenommen, da ich mir ohne Rücksprache und ohne Genehmigung selbständig Gedanken einer möglichen Form der Lehrerfort- und -weiterbildung in unserem Bezirk gemacht und zudem mich noch auf Erfahrungen aus Berlin gestützt hatte.
Zentraler Diskussionspunkt aber, der in den folgenden Jahren nicht nur dazu führte, daß die »Lernwerkstatt Reutte« noch nicht offiziell eröffnet wurde, sondern mich auch bewog, neben Kollegen Roland Astl meine Funktion als "Koordinator" dieser Einrichtung im Rahmen einer Anstellung am Pädagogischen Institut des Landes Tirol zurückzulegen, war die Gefahr einer wiederum "von oben" vorgesehenen Institutionalisierung dieser Einrichtung.
Auf diese Befürchtungen machte eine Gruppe von Lehrern in einem Diskussionspapier schriftlich aufmerksam.
Auszug einer schriftlichen Gesprächsunterlage für die Arbeitsgruppe "Lernwerkstatt" beim Pädagogischen Institut des Landes Tirol - Treffen am 29. 4. 1992:
"Lernwerkstätten haben Erfolg, wenn sie von denen ausgestaltet und getragen werden, die in den einzelnen Regionen unmittelbar betroffen sind. Ist dies nicht der Fall, werden die Anstrengungen, die mit der praktischen "Erfindung" von Lernwerkstätten verbunden sind, kontraproduktiv, die Projektansätze verlaufen im Sande, und eine gute Idee ist zum Scheitern verurteilt.
Lernwerkstätten werden nicht nur einmal "erfunden", sondern täglich neu. Sie zu "erfinden" ist anstrengend und kostet Zeit. Bei jeder Errichtung einer Lernwerkstatt wiederholt sich aufs neue, was die Pädagogik einer Lernwerkstatt prägt. Man versteht sie, indem man sie erfindet. Das bedeutet, daß Lernwerkstätten nicht denkbar sind ohne ihr pädagogisches und bildungspolitisches Umfeld und ohne die Personen, die Lernwerkstätten entwickeln und damit pädagogische Vorstellungen verwirklichen wollen.
Werden Lernwerkstätten Teil von Institutionen der Fortbildung, kann ihr Einfluß auf die Veränderung von Schule sehr unmittelbar sein. Gleichzeitig ist aber zu befürchten, daß die prägende Kraft der Schule als Institution (vermitteIs der Lehrerfortbildung) dem Experimentieren enge Grenzen setzt Eine Lernwerkstatt verdankt ihre Wirksamkeit in der Schulreform eher den persönlichen Fähigkeiten und dem Engagement der beteiligten Personen.
Nur wenn Lernwerkstätten gegen den Druck zur Institutionalisierung lebendig sein können, haben sie Zukunft."
Als besonders positiv sehe ich heute die Tatsache, daß in den letzten Monaten eine Gruppe von Lehrern aus allen Teilen des Bezirkes Reutte in Eigeninitiative den Gedanken zur Einrichtung einer Lernwerkstatt im zuvor genannten Sinn aufgegriffen hat und demnächst in den weiterhin an der Sonderschule zur Verfügung stehenden Räumen mit der konkreten Arbeit beginnen möchte. Damit wären die Lehrer, wie es POSCH (1992, S. 15) fordert, nicht nur "Gestalter ihrer eigenen Fortbildung, sondern übernehmen wirklich selbst die Initiative bei der Entscheidung über die Ziele und inhaltliche Gestaltung von Fortbildungsaktivitäten, denn in vielen Bereichen wissen sie am besten, welche Qualifikationsanforderungen jeweils bestehen". ( Ebd.).
Die gesetzliche Regelung von schulischer Integration führt zu einer wesentlichen Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung in Österreich.
So sieht die 15. SchOG - Novelle (1) die Einrichtung Sonderpädagogischer Zentren als Verfassungsbestimmung vor und stützt sich dabei auf mehrere existierende oder in Planung befindliche Modellversuche in einigen Bundesländern.
''Nach § 27 wird eingefügt:
c) Verfassungsbestimmungen
Sonderpädagogische Zentren
§ 27 a
-
Sonderpädagogische Zentren sind Sonderschulen, die die Aufgabe haben, durch Bereitstellung und Koordination sonderpädagogischer Maßnahmen in anderen Schularten dazu beizutragen, daß Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in bestmöglicher Weise auch in allgemeinen Schulen unterrichtet werden können.
-
Der Landesschulrat (Kollegium) hat auf Antrag des Bezirksschulrates bestimmte Sonderschulen als Sonderpädagogische Zentren festzulegen. Sollte in einer Region keine Sonderschule bestehen, kann auch eine andere Schule mit angeschlossener Sonderschulklasse als Sonderpädagogisches Zentrum festgelegt werden. Vor der Festlegung ist das Einvernehmen mit dem Schulerhalter herzustellen.
-
Landeslehrer, die an Volksschulen gemäß §13 Abs. 1 zweiter Satz für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich eingesetzt werden, sind durch Sonderpädagogische Zentren zu betreuen."
In den Erläuterungen zum SchOG wird die Aufgabenstellung eines Sonderpädagogischen Zentrums in allgemeiner Weise dargelegt.
"Gerade in der Übergangszeit von der ausschließlichen Betreuung behinderter Kinder durch die Sonderschulen zu einem Angebotssystem der Integration in der allgemeinen Schule erscheint eine regionale Koordination der sonderpädagogischen Maßnahmen von besonderer Bedeutung. Die zusätzliche Aufgabe soll bestimmten Sonderschulen übertragen werden, da dort die fachlichen Kompetenzen und auch materielle und personelle Möglichkeiten für mit der Integration verbundene sonderpädagogische Maßnahmen gegeben sind.
Die Hauptaufgaben bestehen in einem sonderpädagogischen Kompetenztransfer und in einer Sicherstellung sonderpädagogischer Betreuungsqualität, einer Beratung und Unterstützung von Lehrern und Eltern sowie in der Bereitstellung materieller und personeller Ressourcen zur Unterstützung der Volksschulen bei der Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf." (Ebd.).
Sonderpädagogische Zentren werden sich zudem in Zukunft nicht nur auf die Eingliederung von behinderten Kindern in die Schule beschränken dürfen, denn ohne Einbeziehung aller anderen Lebensbereiche der behinderten Kinder und Jugendlichen wird eine schulische Integration kaum gelingen. HOVORKA (1993, S. 30) schreibt in einem Aufsatz zum Thema "Schulpädagogische Zentren im Gemeinwesen (SPZ)":
"Ohne die anderen Lebensbereiche der behinderten Kinder und Jugendlichen zu beachten, wird schulische Integration kaum gelingen; dies bedeutet, daß sich die Schule an der Lebenswelt zu orientieren hat und andererseits das örtliche Umfeld als Ressource für die schulische Integration dienen kann. Sozusagen "vor Ort", im Wohnumfeld, können die Bedürfnisse der Betroffenen ermittelt und die Leistungen der kommunalen Einrichtungen aufeinander bezogen werden. Um eine gute regionale Versorgung von neben- und außerunterrichtlichen Hilfen zu gewährleisten, bedarf es
-
der Erfassung der jeweiligen örtlichen/regionalen Gegebenheiten mit ihrer sozialen Infrastruktur,
-
der Vernetzung und Kooperation mit regionalen Dienstleistungseinrichtungen und
-
einer individuellen Bereitstellung der benötigten Hilfen (subjektive Förderstrategie).
Schulische Integration im engeren Sinn stellt ein Segment in der Arbeit des Ressourcenzentrums dar. Hierbei geht es vor allem um die Organisation und Vernetzung von Begleithilfen (wie z.B. soziale und therapeutische Begleitmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Möblierung, technische Hilfsmittel bauliche Gestaltung in der Schule, Schulwegsicherung etc.) und Unterstützung der Pädagoglnnen. Weitere Aufgaben könnten z.B. im Wahrnehmen des Familien-, Wohn-, Freizeit-, Verkehrs- und baulichen Bereich liegen.
Um all diese und weitere Aspekte als Aufgabe und Ermöglichungsraum wahrzunehmen, bedarf es der Einrichtung von "Sonderpädagogischen Zentren", die sich als regionenbezogene Beratungs- und Koordinationseinrichtung verstehen und das soziale Umfeld mit seinen institutionellen, personellen und materiellen Ressourcenvielfalt in der jeweiligen örtlichen Besonderheit einbeziehen. Die "Sonderpädagogischen Zentren" agieren als Drehscheibe: Der Bezirk oder die Region werden als lebendige Dialog- und Ressourcenplattform für die schulische Integration verstanden."
Ein Sonderpädagogisches Zentrum nur an einer gesichert weiterhin bestehenden Sonderschule?
Diese Frage stellt sich mir seit dem 22.11.1993, als der Landesschulinspektor für Sonderschulen anläßlich einer Sonderschuldirektorenkonferenz für alle Bezirke Tirols den einzelnen Schulleitern namentlich schon ganz konkret die aus seiner Sicht voraussichtlichen Standorte Sonderpädagogischer Zentren nannte und dabei den Standort an der derzeit noch bestehenden Sonderschule Reutte ausklammerte.
Auf meine Anfrage hin, warum an der Sonderschule in Reutte, einem Bezirk, in dem sich derzeit die meisten Integrationsstandorte befinden und in dem genau nach den Richtlinien und dem gesetzlichen Auftrag eines "Sonderpädagogischen Zentrums" folgend, aber eben schon Jahre früher mit der Unterstützung zur Eingliederung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Regelschulen begonnen wurde, die Einrichtung dieses Zentrums ein so großes Problem darstellt, lautete die Antwort:
Telefonnotiz vom 23.11.1993:
"Da Sie immer wieder davon sprechen, daß sich Ihre Schule auflöst, kann dort kaum ein "Sonderpädagogisches Zentrum" eingerichtet werden."
Heute nach 10 Jahren im Spannungsfeld der Auseinandersetzung um die schulische Integration kann ich diese Argumentation und Auslegung, die im Widerspruch zum gesetzlichen Auftrag des § 27 a (1) des Schulorganisationsgesetzes steht, nur mehr vor dem Hintergrund sehen, daß "Sonderpädagogische Zentren" lediglich der Existenzsicherung bisheriger Sonderschulen dienen.
Denn wenn wir die Integration ernst nehmen und die in den Zentren arbeitenden Menschen die Integration auch wirklich wollen, dann reduzieren sich zunächst in diesem Prozeß der Integration die Schülerzahlen an den Sonderschulen ebenso, wie sich schließlich die Institution "Sonderschule" nur mehr als zentraler Dienstsitz der in Regelschulen arbeitenden Sonderschullehrer darstellt.
In dieser Arbeit habe ich versucht, am Beispiel einer Integrationsklasse aufzuzeigen, wie "neue" wissenschaftliche Theorien von Unterricht, Lehrerverhalten, Motivation, Sozialverhalten u.a. in eine für Schüler vorteilhafte Praxis umgesetzt werden können. Es war der Versuch nachzuweisen, daß die These vieler Schulpraktiker, die wissenschaftlichen Theorien seien grau und für die Praxis vielfach unbrauchbar, falsch ist.
Ich konnte, denke ich, auch mit dieser Arbeit den Nachweis erbringen, daß eine Schulreform im Alltag des Unterrichts stattfinden kann, indem auf dem Hintergrund von konsequent verändertem Lehrerverhalten die Schule mithelfen kann, selbständige und motivierte Schüler zu erziehen.
So kann der Lehrer oder ein Team von Lehrern, auch auf dem Hintergrund der "neuen" Forschungen und gestützt von ihnen, Schule verändern.
Die Frage, die sich uns heute allerdings stellt, ist, ob dies überhaupt erwünscht ist.
Auch wenn mehrheitlich den wissenschaftlichen Theorien zugestimmt wird, die zu einem veränderten Unterricht führen müssen, blockieren meiner Erfahrung nach vor allem Vertreter der Schulverwaltung nachhaltig nicht nur die Erprobung, sondern auch die Übertragung dieser Theorien in die Praxis. Heraufbeschworen wird damit eine immer größer werdende Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.
Mitunter habe ich auch den Eindruck, daß einige Lehrer, Direktoren und Schulbeamte diese Schulreformen, die z.T. ihre Identifikation mit der bisherigen Rolle ihrer Tätigkeiten in Frage stellen könnten, mit der Bequemlichkeit eines Patriarchen, der sich die Schuhe von den Seinen putzen und anziehen läßt, beobachten in der Befürchtung, es einmal selbst tun zu müssen.
Wenn ich heute als Schulleiter meine volle Lehrverpflichtung selbst in der Klasse unterrichte, und nicht nach einer Erhöhung von Schülerzahlen und damit Klassen trachte, mag dies mit ein Grund sein, weshalb ich heute mehr denn je als unbequemer ''Veränderungssüchtiger'' im Kollegenkreis abgestempelt bin.
Es ist mehr als anstrengend, und für viele Menschen in unserer Gesellschaft wohl auch unbequem, sich dafür einzusetzen, daß Menschen von den sie beengenden "Mauern" einer Sonderinstitution oder von der Bedrohung einer Aussonderung befreit werden. Dies macht mir heute meine Arbeit mitunter nicht nur sehr schwer, sondern dabei erlebe ich selbst "hautnah", was es bedeutet, unter z.T. inhumanen Bedingungen zu arbeiten.
Dabei möchte ich meine Arbeit aber nur in dem Sinn verstanden wissen, daß wir alle dazu beitragen sollten, das Schweigen in unseren Köpfen zu brechen und unsere Erfahrungen als neue Anfänge in Richtung von mehr Humanität zu wagen. Damit sollten wir aber hier und jetzt beginnen, wollen wir uns als Lehrer eines Tages nicht selbst den Vorwurf machen müssen:
Hat die Schule verschlafen, was hat sie versäumt?
Die Integration als humanitäre Selbstverständlichkeit!
Allerbeck, K./Hoag, W: Jugend ohne Zukunft? München, Zürich, 1985.
Antor, G.: Pluralität der schulischen Normen - Uniformität des Lernortes? In: Lersch/Vernooij (Hg.): Behinderte Kinder und Jugendliche in der Schule. Bad Heilbrunn/Obb., 1992; S. 30 - 52.
Baacke, D.: Jugend und Jugendkulturen. Weinheim, München, 1987.
Beck, J./Boehcke, H.(Hg.): Jahrbuch für Lehrer - Hilfen für die Unterrichtsarbeit. Reinbek, 1976.
Beck, U.: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main, 1986.
Berger, E.: Schüler mit besonderen Bedürfnissen - Neue Wege der Integration. Die Voraussetzungen vom Standpunkt des Kinderneuropsychiaters. In: Olechowski, R/Wolf, W. (Hg.): Die kindgemäße Grundschule, Wien, 1990; S. 187 - 222.
Bergk, M./Meiers, K.: Schulanfang ohne Fibeltrott. Bad Heilbrunn/ObB., 1985
Bews, S.: Integrativer Unterricht in der Praxis. Innsbruck, 1992.
Biewer, G.: Montessori - Pädagogik mit geistig behinderten Schülern. Bad Heilbrunn/ObB., 1992.
Bohnsack, E: Pädagogische Strukturen einer "guten" Schule heute. In: Hessisches Institut f. Bildungsplanung u. Schulentwicklung, Heft 1. Wiesbaden - Konstanz, 1987; S. 105 - 118.
Bohnsack, E: Schule der 90er Jahre: Herausforderungen bewältigen - die Schule gestalten. In: Schule der 90er Jahre - Dokumentation zur 20 Jahr - Feier. Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung, BMUK. Graz, 1991; S. 19 - 30.
Buber, M.: Urdistanz und Beziehung. Heidelberg, 1975.
Cuomo, N.: L' emozione di conoscere. In: Forschungsprofile der Integration von Behinderten. Bochumer Symposium 1992. Essen, 1992; S. 34 - 53.
Daxbacher, R: Schulische Integration behinderter Kinder in Wien - zur Bedeutung der Prinzipien des Team - Teaching, der Kooperation und des Kompetenztransfers für Grundschulen ohne Aussonderung. Kurzfassung einer Diplomarbeit an der Universität Wien. Wien, 1992.
Dewey, J.: Interest and Eflort in Education. Boston u.a, 1913.
Eberwein, H. (Hg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Weinheim und Basel, 1988.
Einsiedler, W.: Neue Lern- und Lehrformen in der Grundschule aus empirischer Sicht. In: Olechowski, R: Die kindgemäße Grundschule. Wien, 1990; S. 234.
Fechler, H.: Sonderpädagogik in der Grundschule. Sonderschule in Niedersachsen. 1987; S. 50 - 64.
Fend, H.: Gute Schulen - schlechte Schulen. Die einzelne Schule als pädagogische Handlungseinheit. In: Die Deutsche Schule 82 (1986) Heft 3; S. 175 - 293.
Ferchhoff, W./Olk, Tb. (Hg.): Jugend im internationalen Vergleich. Weinheim, München, 1988.
Feuser, G./Meyer, H.: Integrativer Unterricht in der Grundschule: ein Zwischenbericht. Solms - Oberbiel, 1987.
Feuser, G.: Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik:. In: Behindertenpädagogik, 28Jg., Heft 1, Solms - Oberbiel, 1989; S. 4 - 48.
(URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-didaktik.html ,14.02.2012)
Forcher, H.: Veränderungen. In: Birgit Meister-Steiner u.a. (Hg.): Blinder Fleck und rosarote Brille. Innsbruck, 1989; S. 84 - 85.
(URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/wieser-fleck.html , 20.02.2012)
Forster, R: Normalisierung oder Ausschließung - über die Berufsfindung und das Lebensschicksal von Sonderschulabgängern. Endbericht. Institut für Höhere Studien. Wien, 1981.
Freinet, E.: Erziehung ohne Zwang. Der Weg Celestin Freinets. Stuttgart, 1981.
Freire, P.: Pädagogik der Unterdrückten. Hamburg, 1973.
Gruber, H./Petri, G.: Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder. Arbeitsberichte Reihe II, Nr. 21. BMUKS - Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung (Hg.). Graz,1989.
Günther, K-B.: Erläuterungen zum Sprachentwicklungskonzept für ein nichtsprechendes gehörloses Mädchen und seine Realisierung im ersten Schuljahr an einer Volksschule. In: Hörgeschädigtenpädagogik, 1990b; S. 105 - 115.
Günther, K-B.: Die Entwicklung der gehörlosen SABINE R. nach 4 Jahren integrativer Beschulung an der Volksschule und Folgerungen für eine Fortsetzung des Integrationsprojekts .in der Hauptschule. Unveröff. MS., Reutte, 1992.
Haeberlin, U.: Das Menschenbild für die Heilpädagogik. Bern und Stuttgart, 1990.
Haeberlin, U.: Ängste und Hoffnungen bezüglich der Integrationsentwicklung. In: Lersch/Vernooij (Hg.): Behinderte Kinder und Jugendliche in der Schule. Bad Heilbrunn/Obb., 1992; S. 93 - 105.
Haenisch, H.: Die einzelne Schule ist der Prüfstand für Schulreform. In: Zeitschrift Pädagogik Nr. 5, 1991; S. 27 - 31.
Hawlicek, H.: Eröffnungsrede zur Grundschulenquete 1989. In: Die kindgemäße Grundschule. Wien, 1990; S. 20.
Hentig, H.: "Humanisierung" - eine verschämte Rückkehr zur Pädagogik? Andere Wege zur Veränderung der Schule. Stuttgart, 1987.
Hesse, JJ./Rolff, H.-G./Zöpel, Ch. (Hg.): Zukunftswissen und Bildungsperspektiven. Baden-Baden, 1988.
Heyer, P.: Lernen durch Handeln und Erleben. In: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hg.): Im Brennpunkt - Meinungen - Modelle - Materialien. Frankfurt, 1983; S. 9.
Heyer, P./Preuss-Lausitz, U./Zielke, G.: Wohnortnahe Integration. Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung an der Uckermarkschule in Berlin, 1982 -1988.
Hovorka, H.: Das Forschungsprojekt: "Schulpädagogische Zentren im Gemeinwesen (SPZ)". In: Tagungsdokumentation - Sonderpädagogische Zentren als Kooperationsbeispiele netzwerkorientierter Gemeinwesenarbeit. Wien, 1993; S. 30.
Illich, J.: Entschulung der Gesellschaft. München, 1972.
Jantzen, W.: Menschliche Entwicklung, allgemeine Therapie und allgemeine Pädagogik. Solms -Oberbiel, 1980.
Kasper, H.: Vom Klassenzimmer zur Lernumgebung. Ulm, 1979.
Kerstiens, L.: Erziehungsziele und Schulwirklichkeit. Prinzipien, Rückblick, Perspektiven. Freiburg, 1980.
Kintrup, A.: Integration von gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Regelschulen mit Hilfe von lautsprachunterstützenden Gebärden, dargestellt am Beispiel eines gehörlosen Mädchens in Reutte Hamburg: Unveröff. Diplomarbeit. Hamburg, 1992.
Klemm, K/Rolff, H.-G./Tillmann, K-J.: Bildung für das Jahr 2000. Bilanz der Reform, Zukunft der Schule. Max-Träger-Stiftung (Hg.). Reinbek bei Hamburg, 1985.
Kobi, E.: Veränderte Begriffsbildung und Begründung eines integrationspädagogischen Verständnisses. In: Eberwein (Hg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Weinheim und Basel, 1988; S. 56.
Köppel, K: Lagebericht zur Integration. In: Betrifft Integration - Rundbrief der Elterninitiativen "Schule ohne Aussonderung" Nr. 2. 1988; S. 1 - 2.
Kreie, G.: Integrative Kooperation. Weinheim, 1985. Kretschmann, J./Haase, O.: Natürlicher Unterricht. Wolfenbüttel, 1948 (1. Auflage: Freier Gesamtunterricht in der Dorfschule. Berlin, 1925).
Langenbuch, G./Bauer, K-O./Rolff, H.-G./Runte, P.: Computer in der Grundschule? Werkheft 31 des Instituts für Schulentwicklungsforschung. Dortmund, 1989.
Langeveld, M.: Die Schule als Weg des Kindes. Braunschweig, 1963.
Langfeldt, H.P.: Wissenschaftliche Begleitung von Integrationsversuchen als Forschungsproblem. In: Eberwein (Hg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. 1988; S. 282 ff.
Lempp, R./Schiefele, H. (Hg.): Ärzte sehen die Schule. Weinheim u.a., 1987.
Leontjew, A.N.: Probleme der Entwicklung des Psychischen. Frankfurt/Main, 1973.
Löwe, A.: Gehörlose, ihre Bildung und Rehabilitation. In: deutscher Bildungsrat Gutachten und Studien der Bildungskommission, Band 30: Sonderpädagogik 2. Stuttgart, 1974.
Löwe, A.: Möglichkeiten und Grenzen einer Beschulung gehörloser und schwerhöriger Kinder in Regelschulen. Erfahrungen aus fünfundzwanzigjähriger Praxis. In: Hörgeschädigtenpädagogik, 1991; S. 226 - 233.
Machwirth, E.: Die Gruppe als pädagogisches Feld. Düsseldorf, 1976.
Malson, L. u.a.: Die wilden Kinder. Frankfurt/Main, 1976.
Marx, K: Das Kapital. Bd. I. Berlin/DDR, 1970.
Mayntz, R/Holm, K/Hübner, P.: Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie. Opladen, 1978.
Messmann, A./Rückriem, G.: Zum Verständnis der menschlichen Natur in der Auffassung des Psychischen bei A.N. Leontjew. In: Rückriem, G./Tomberg, F./Volpert, W.(Hg.): Historischer Materialismus und menschliche Natur. Köln, 1978.
Montessori, M.: Die Entdeckung des Kindes. Freiburg, 1969.
Montessori, M.: Schule des Kindes. Montessori - Erziehung in der Grundschule. Freiburg, 1976.
Montessori, M.: Kinder sind anders. Stuttgart, 1985.
Mürner, C./Sierck, U.: Lebensbedrohende Pädagogik - Zur verhängnisvollen Vermittlung von Ethik und "Euthanasie". In: Behindertenpädagogik, 29, Heft 3. 1990, S. 323 - 331.
Muth, J.: Integration von Behinderten. Über die Gemeinsamkeiten im Bildungswesen. Essen (Neue Deutsche Schule), 1986.
Muth, J.: Zur bildungspolitischen Dimension der Integration. In: Eberwein (Hg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim, 1988; S. 11 - 18.
Nave-Herz, R./Markefka, M. (Hg.): Handbuch der Familien- und Jugendforschung. 2 Bände. Neuwied, Frankfurt/Main, 1989.
Nuber, F.: Informeller Unterricht - Modell für die Grundschule. München/Wien/Baltimore, 1977.
Olechowski, R.: Auftrag und Ziele der Grundschule. In: Die kindgemäße Grundschule. Wien, 1990; S. 55.
Pettilon, H.: Soziale Beziehungen in Schulklassen. Weinheim, 1980.
Philipp, E.: Gute Schulen verwirklichen: ein Arbeitsbuch mit Methoden, Übungen und Beispielen der Organisationsentwicklung. Weinheim, Basel, 1992.
Piaget, J.: Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart, 1969.
Plowden-Report: Children and their Primary SchooIs. London, 1967.
Poseh, P.: Tendenzen der Schulentwicklung und Konsequenzen für die Lehrerfortbildung. In: Pädagogisches Institut des Landes Tirol (Hg.): Schule und Leben - Sondernummer 1992. Innsbruck, 1992; S. 10 - 16.
Preuss-Lausitz, U.: Fördern ohne Sonderschule. Weinheim und Basel, 1981.
Preuss-Lausitz, U./Hitzler, S.: Soziale Beziehungen und Freizeitaktivitäten von Grundschülern. (Unveröffentl. Dokumentation der wissenschaftl. Begleitung an der Uckermark - Grundschule in Berlin, 1988).
Preuss-Lausitz, U./Heyer, P./Zielke, G.: Wohnortnahe Integration - Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Uckermark - Grundschule in Berlin. Weinheim und München, 1990.
Reiser, H./Gutberlet, M./Klein, G./Kreie, G./Kron, M.: Sonderschullehrer in Grundschulen. Weinheim, 1984.
Reiser, H.: Wege und Irrwege zur Integration. In: Sander u. Raidt (Hg.): Integration und Sonderpädagogik. Saarbrücken, 1990; S. 13 - 33.
Reinartz, A./Sander, A.: Schulschwache Kinder in der Grundschule. Bd. 1. Frankfurt, 1977.
Rett, A.: Die schulische Integration geistig behinderter Kinder; ein ärztliches - schulärztliches - Problem. In: Mitteilungen der österreichischen Sanitätsverwaltung. Sonderdruck Heft 6. 1987; S. 1 - 4.
Rolff, H.-G.: Wandel durch Selbstorganisation. Theoretische Grundlagen und praktische Hinweise für eine bessere Schule. Weinheim und München, 1993.
Rosenmayr, L.: Jugend als Spiegel der Gesellschaft? Zur Deutung neuer österreichischer Forschungen. In: Janig, H. u.a. (Hg.): Schöner Vogel Jugend. Analysen zur Lebenssituation Jugendlicher. Linz, 1988; S. 4 - 35.
Roser, L.O.: Gegen die Logik der Sondereinrichtung. In: Schöler (Hg.): "Italienische Verhältnisse" insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin, 1987; S. 72 - 80.
Rumpf, H.: Über zivilisationskonforme Instruktion und ihre Grenzen - erörtert an einem Beispiel von Schulentwicklungsplanung. In: H. Rauschenberger (Hg.): Unterricht als Zivilisationsform. Königstein u.a., 1985; S. 51 - 67.
Sander, A.: Behinderungsbegriffe und ihre Konsequenzen für die Integration. In: Eberwein (Hg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim, 1988; S. 75 - 82.
Sander, A.: Wohnortnahe Integration - Grundzüge, Probleme, Erfahrungen. In: Heyer, P./ Korfnacher, E./ Podlesch, W. u.a. (Hg.): Zehn Jahre wohnortnahe Integration - Beiträge zur Reform der Grundschule. Beltz, 1993; S. 10 - 14.
Scheel, B.: Offener Grundschulunterricht. Weinheim und Basel, 1978.
Schöler, J.(Hg.): Die Arbeit von Milani Comparetti und ihre Bedeutung für die Nicht-Aussonderung behinderter Kinder in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland. In: "Italienische Verhältnisse" insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin, 1987.
Schöler, J.: Herausforderung: Kleine bunte Wedel. In: TAFlE (Tiroler Arbeitskreis für integrative Erziehung) (Hg.): Pädagogik und Therapie ohne Aussonderung. Innsbruck, 1990; S. 9 - 10.
(URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-wedel.html , 20.02.12)
Schöler, J.: Klassenkonferenz - Kinder mit Behinderungen zwischen Medizin und Pädagogik. Unveröff. MS., Reutte, 1992.
Schwarzer, R: Schulangst und Schulunlust in Gesamt- und Regelschulen (Manuskript). Aachen, 1979.
Specht, W.: "Schulqualität" - Die internationale Diskussion um ein neues Konzept und einige Folgerungen für die Schulentwicklung in Österreich. (Diskussionspapier), BMUK. (Hg.). Graz, 1991.
Specht, W.: Evaluation der Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Lehrerinnen und Lehrern im Schulversuch. BMUK - Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung, Abtl. TI (Hg.). Graz, 1993.
(URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/specht-evaluation-index.html ,20.12.12)
Spitz, R: Vom Säugling zum Kleinkind Stuttgart, 1963.
Steffens, U./Bargel, T. (Hg.): Qualität von Schule. Heft 1 - 8. Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung. Wiesbaden, 1987 ff.
Steffens, U./Bargel, T.: Erkundungen zur Qualität von Schule. (Praxishilfen Schule). Neuwied, 1993.
Wandel, E: Macht die Schule krank? Heidelberg, 1979.
Weiss, C.H.: Evaluationsforschung - Methoden zur Einschätzung von sozialen Reformprogrammen. Opladen, 1974.
Wenzel, A.: Freiarbeit in der Grundschule. Bad Heilbrunn/ObB., 1983.
Wesemann, M.: Arbeitsplatzstrukturen und unterrichtliche Tätigkeit des Lehrers. In: E Bohnsack u.a.: Schüleraktiver Unterricht. Weinheim u.a., 1984; S. 40 - 120.
Wesemann, M.: Strukturen des Lehrerarbeitsplatzes. Habilitationsschrift. Essen, 1985.
Wilson, T.P.: Theorien der Interaktion und Modelle soziologischer Erklärungen. In: Eberwein (Hg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. 1988; S. 294.
Wocken, H./Antor, G.: Integrationsklassen in Hamburg. Solms - Oberbiel, 1987.
Wocken, H./Antor, G./Hinz, A.: Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Hamburg, 1988.
(URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-integrationsklassen.html ,20.02.12)
Wocken, H.: Integration wohin - eine neue Schule für alle? In: TAFIE (Hg.): Pädagogik und Therapie ohne Aussonderung. Innsbruck, 1990; S. 55 - 56.
(URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-wohin.html ,20.02.12)
Wocken, H.: Vom Engagement zur Reflexion - Wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs "Integrationsklasse". Unveröffentl MS., 1990.
Wocken, H.: Pädagogen arbeiten im Team: Bedingungen und Prozesse kooerativer Arbeit. Unveröffentl. MS., 1991.
Wocken, H.: Bewältigung von Andersartigkeit. Untersuchungen zur sozialen Distanz in verschiedenen Schulen. In: Forschungsprofile der Integration von Behinderten. Bochumer Symposium 1992. Essen, 1993; S. 86 - 106.
Wygotski, L.S.: Zur Psychologie und Pädagogik der kindlichen Defektivität. In: Sonderschule, Heft 20. 1975; S. 65 - 72.
Zinnecker, J./Molnar, P.: Lebensphase Jugend im historisch-interkulturellen Vergleich: Ungarn 1954 - Westdeutschland 1984. In: Ferchoff, W./Olk, Tb. (Hg.), aa.O.. Weinheim, München, 1988; S. 181 - 206.
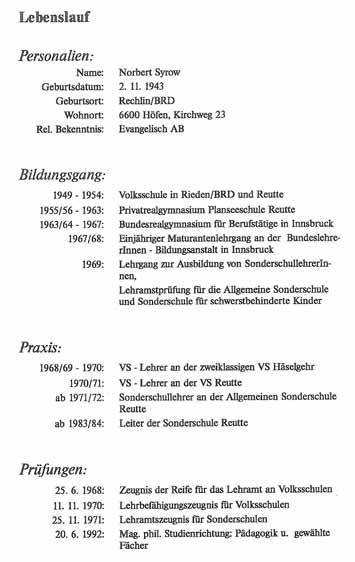
Quelle:
Norbert Syrow: Schulentwicklung im Spannungsfeld einer Integrationsklasse
Disseration zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck eingereicht bei Univ. Prof. Dr. Ilsedore Wieser am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck im März 1994
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 05.06.2012










