Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen: Eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf
Schriftliche Hausarbeit zur Prüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik, Beurteilende Hochschullehrerin Dr. Bettina Lindmeier; Zweitgutachterin Katrin Uhrlau
Inhaltsverzeichnis
- Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen: Eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf
- 1. Einleitung
- 2. Wer sind Menschen mit Unterstützungsbedarf - Zielgruppe persönlicher Zukunftsplanung
- 3. Anmerkungen zum Thema "Selbstbestimmung"
- 4. Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen - Theoretische Grundlagen
- 5. Vorstellung der Untersuchung
- 6. Persönliche Zukunftsplanung: Erste Versuche in Deutschland - Ergebnisse der Datenerhebung
-
7. Wie läuft ein Planungsprozess ab? - Auswertung der Literatur und der Interviews
- 7.1 Wann ist eine persönliche Zukunftsplanung angebracht?
- 7.2 Initiative für eine Zukunftsplanung und Anzahl der Treffen
- 7.3 Der Unterstützerkreis
- 7.4 Ablauf der Treffen und das weitere Vorgehen
- 7.5 Methoden für den Planungsprozess
- 7.6 Soziales Netz
- 7.7 Safeguards for MAPS and PATH
- 7.8 Hindernisse für erfolgreiche Zukunftsplanung und deren Umsetzung sowie Lösungsmöglichkeiten
- 7.9 Voraussetzungen für erfolgreiche Planung und Umsetzung
- 8. Praxisbeispiele
- 9. Perspektiven in Deutschland
- 10. Zusammenfassung und Fazit
- 11. Literatur

"Erkenn, wo du stehst, wo du hinwillst. Mach deinen Plan. Und dann geh!"
So lautet ein Spruch von Ken Cadigan auf einer Postkarte der Grafik Werkstatt Bielefeld.
Im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung, dem Thema dieser Arbeit, wird ähnlich vorgegangen: Man macht sich Gedanken über die jetzige Situation, entwirft einen Zukunftsplan und setzt diesen anschließend um. Bei einem so organisierten Prozess bleiben Personen, die ihre Zukunft planen, nicht auf sich allein gestellt, sondern erfahren Unterstützung von Freunden, Verwandten und anderen Bezugspersonen.
Auf dieses Konzept bin ich im Laufe meines Studiums eher zufällig gestoßen. Neu und beeindruckend fand ich, dass auch schwer behinderte Menschen dabei mit sehr viel Respekt behandelt werden, dass ihnen relevante Entscheidungen in Bezug auf ihr eigenes Leben zugebilligt werden und dass auch nach Lösungsmöglichkeiten außerhalb des traditionellen Hilfesystems gesucht wird. Trotzdem bleiben die Menschen mit Behinderungen dabei nicht auf sich allein gestellt, und ihr Unterstützungsbedarf wird nicht außer Acht gelassen. Bezugspersonen und Professionelle der planenden Person bilden einen "Unterstützerkreis" und spielen damit eine tragende Rolle bei Entwurf und Umsetzung des Zukunftsplans. Dieses war mir bisher in anderen Konzepten und in meiner eigenen Praxiserfahrung so nicht begegnet.
In der vorliegenden Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen Menschen mit Unterstützungsbedarf die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben bietet.
-
Dabei erscheint es zunächst notwendig zu klären, wer Menschen mit Unterstützungsbedarf sind (zweites Kapitel).
-
Anschließend werden im dritten Kapitel die Begriffe der Selbstbestimmung und des Empowerments erläutert, bevor
-
im vierten Kapitel die theoretischen Grundlagen und die Entstehung des Konzepts der persönlichen Zukunftsplanung dargestellt werden.
Dieses Konzept ist im amerikanischen Raum entstanden und in Deutschland noch relativ unbekannt. Da aber die Situation in diesem Land für meine spätere Tätigkeit relevant ist, soll der Schwerpunkt der Arbeit auf persönliche Zukunftsplanung in Deutschland gelegt werden. Deshalb habe ich eigene Untersuchungen über die Verbreitung des Konzepts der "persönlichen Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen" und seiner praktischen Umsetzung in Deutschland angestellt und in dieser Arbeit dokumentiert.
-
Allgemeine Angaben zum Vorgehen bei der Untersuchung finden sich im fünften Kapitel.
-
Im sechsten, siebten und achten Kapitel geht es um die Darstellung der Ergebnisse, unterstützt durch weitere Literatur zum Thema.
-
Abschließend werden im neunten Kapitel Empfehlungen für die Perspektive von persönlicher Zukunftsplanung in Deutschland angesprochen, bevor im zehnten Kapitel ein Fazit dieser Arbeit gezogen wird.
Aufgrund der Entstehungsgeschichte der persönlichen Zukunftsplanung in den USA und der wenigen deutschen Literatur zum Thema wird in der Arbeit häufig aus englischsprachiger Literatur zitiert. Diese Zitate wurden wegen der besseren Lesbarkeit des Textes von mir ins Deutsche übersetzt. In einer Fußnote findet sich jeweils die englische Originalversion des Zitates mit einer Angabe der Übersetzerin. Im Text enthaltene englischsprachige Begriffe sind kursiv gedruckt.
An dieser Stelle soll noch allen gedankt werden, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. Großer Dank gilt meinen Hospitations- und Interviewpartner(inne)n, DORIS HAAKE und allen, die anonym bleiben wollen. Ohne ihre Bereitschaft wäre diese Arbeit nicht in der vorliegenden Form entstanden. Besonders erwähnt seien CAROLIN EMRICH und STEFAN DOOSE, die mir außerdem Kontakte vermittelten und schwer zugängliche Literatur zur Verfügung stellten. Danken möchte ich ebenfalls meinen Korrekturleserinnen und -lesern und allen, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Dieses Kapitel dient der Begriffsklärung und könnte zunächst auf zahlreiche vorhandene Definitionen von (geistiger) Behinderung zurückgreifen (z. B. SPECK 1999; BLEIDICK 2001; MüHL 2000). Da aber das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung den traditionellen Zuschreibungen und Definitionen nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen lässt, setzt das Kapitel einen anderen Schwerpunkt. Der Begriff des "Menschen mit Unterstützungsbedarf" wird umfassender definiert und nicht so eng auf Personen mit Behinderungen beschränkt, wie es in üblichen sonderpädagogischen Zusammenhängen geschieht.
"Menschen mit Unterstützungsbedarf" sind vielmehr diejenigen, die sich in Krisenzeiten befinden, mit ihrem Leben unzufrieden sind und bei der Veränderung dieses Zustandes auf andere angewiesen sind. Dies gilt zu bestimmten Zeiten für jeden von uns, denn ein wesentliches Merkmal menschlicher Existenz ist das Leben in Beziehungen und die Unvollkommenheit des Einzelnen. Wir alle sind also im Laufe unseres Lebens zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Situationen auf Unterstützung durch andere angewiesen. "Die Idee der persönlichen Zukunftsplanung kann [deshalb] von allen genutzt werden, egal wie alt man ist oder in welcher Lebenssituation man sich befindet" (WELLS 2000, 143). Dieses betonen auch andere Artikel und Arbeiten zu diesem Thema (vgl. PEARPOINT & FOREST 1998, 25, 102; EMRICH 1999, 75; O'BRIEN & O'BRIEN 1998, 8).
Nun gilt die Unterstützungsbedürftigkeit des Menschen "in besonderer Weise auch für Menschen mit Behinderungen, die häufig existentiell in bestimmten Lebensbereichen auf Fachleute, bezahlte HelferInnen, Familie und FreundInnen angewiesen sind" (DOOSE 2000, 73).
Nach dem neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX), sind Menschen dann behindert, "wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist" (SGB IX Kapitel 1, §2 Absatz 1). Die WHO unterscheidet in der ICF von 2002 drei Dimensionen von Behinderung: einmal die der Schädigung (impairment), die der Aktivität (activity, bzw. activity limitation) und als drittes die Dimension der Teilhabe (participation bzw. participation restriction). Alle drei Dimensionen werden beeinflusst von Kontextfaktoren, wie Alter, Geschlecht oder Arbeitsplatz der betreffenden Person (vgl. DIMDI 2002, 14ff). Diese Einteilung berücksichtigt wie auch schon die ICIDH-1 von 1980 die soziale Komponente von Behinderung, löst aber die "defektologische Orientierung ... zugunsten einer sozialaktiven Einstellung" ab (Bleidick 2001, 59)[1].
Der Begriff "Behinderung" ist zwar unzulänglich (vgl. SPECK 1998, 20), da er pädagogisch recht unspezifisch gebraucht wird, ist allerdings in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und somit auch im Rahmen dieser Arbeit angemessen.
Jedoch zeigt ein Zitat von GEORG FEUSER, dass es im täglichen Leben keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Personen mit und ohne Behinderung gibt. "Für den Menschen ist es so ‚normal' ‚behindert' zu sein, wie es ‚normal' ist, nicht ‚behindert' zu sein. Nicht ‚behindert' zu sein ist kein Kennzeichen oder Prädikat von ‚Normalität' (FEUSER 1996, 24). Statt dessen ist es wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse eines Menschen zu schauen, unabhängig davon ob er behindert ist oder nicht.
Dies wird an dem Beispiel von MARSHA FOREST und JUDITH SNOW deutlich, das BOBAN & HINZ in ihrem Artikel beschreiben. Hier lädt JUDITH, eine Frau mit Muskeldystrophie, alle Freunde und Freundinnen von MARSHA ein, als diese von ihrer Krebsdiagnose erfährt. Es soll geplant werden, wie das Leben für MARSHA weitergehen kann. Vorher waren die Rollen noch anders verteilt: für JUDITH war auf MARSHAS Initiative hin eine Zukunftsplanung veranstaltet worden (vgl. BOBAN & HINZ 1999, 1).
"Menschen mit Behinderung sind oft unter einer Vielzahl von Etiketten und Floskeln begraben worden, die verdecken, wer sie eigentlich sind" (O'BRIEN & O'BRIEN 1995, 102)[2].
Es lässt sich also feststellen, dass persönliche Zukunftsplanung in bestimmten Lebenssituationen von allen Menschen genutzt werden kann und sollte. PEARPOINT & FOREST (1998, 99) empfehlen sogar, dass alle, die Zukunftsplanungstreffen für behinderte Personen moderieren wollen, vorher eine eigene Zukunftsplanung für sich machen sollten, um die Situation besser einschätzen zu können (vgl. Kap. 7.7).
Die Methode ist aber besonders für Menschen mit einer geistigen Behinderung, einer Lernbehinderung oder für Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht[3]. Gerade für sie ist es bis heute nämlich nicht selbstverständlich, ihr eigenes Leben auch nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Allzu oft sind die Wege vom Sonderkindergarten über die Sonderschule zur Werkstatt und zum Wohnen in einem Wohnheim vorgegeben, und um diese zu verlassen ist besondere Unterstützung nötig, welche die persönliche Zukunftsplanung bieten möchte.
[1] Bleidick bezieht sich noch auf die ICIDH-2 von 1997, die jedoch nahezu die gleiche Terminologie verwendet wie die ICF.
[2] "People with disabilities have often been buried under tons of labels and phrases that mask who they are" (Übersetzung DM).
[3] Der Ausdruck "Menschen mit Lernschwierigkeiten" wird von der Selbsthilfevereinigung People First bevorzugt, da er als weniger diskriminierend empfunden wird, als die Bezeichnung "Menschen mit geistiger Behinderung" (vgl. FREUDENSTEIN et al. 1999, 11).
Inhaltsverzeichnis
Da es in dieser Arbeit um die Frage nach einem selbstbestimmten Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf geht, sollen im folgenden Kapitel Fragen der Selbstbestimmung erörtert werden. Dabei wird zuerst auf den Begriff selbst und auf die Diskussion in Deutschland eingegangen. Anschließend wird dargestellt, wie dieses Thema in den USA diskutiert wird, bevor im abschließenden Teil das Konzept der Selbstbestimmung im Rahmen des Empowerment-Konzeptes betrachtet wird. Die Themen "Selbstbestimmung" und "Empowerment" sind insgesamt sehr komplex und könnten allein schon Inhalt einer eigenen Examenarbeit sein. Deshalb ist ihre Darstellung an dieser Stelle verständlicherweise stark verkürzt.
Für die Sonderpädagogik sind seit längerer Zeit die Begriffe "Integration" und "Normalisierung" handlungsleitend. Seit einigen Jahren ist noch der Begriff der "Selbstbestimmung" für Menschen mit Behinderungen hinzugekommen (vgl. NIEHOFF 1993, 287). Dies wird beispielsweise an dem richtungsweisenden Kongress der Lebenshilfe "Ich weiß doch selbst was ich will! - Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung" deutlich, der 1994 in Duisburg stattfand (vgl. BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1996). "Das Prinzip der Selbstbestimmung geht auf die Independent-Living-Bewegung körperbehinderter Menschen in den USA zurück, die in den 60er Jahren gegen die entmündigenden und bevormundenden Lebensbedingungen in den Großanstalten protestierten und mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten forderten" (FORNEFELD 2002, 148). Diese Forderung wurde dann auch in der Geistigbehindertenpädagogik aufgegriffen. Zur genaueren Beschreibung der independent living-Bewegung und deren Weiterentwicklung in der Geistigbehindertenpädagogik siehe Kap. 4.2.5.
MARTIN HAHN (1994, 81ff) begründet den Stellenwert der Selbstbestimmung in der Sonderpädagogik damit, dass sie an sich zum Menschsein dazugehört. Dies führt er in vier verschiedenen Überlegungen aus, die an dieser Stelle wiedergegeben werden sollen:
-
Menschliche Entwicklung vom Säugling bis zum Erwachsenen "ist auf Zuwachs an Autonomie angelegt, auch die Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung" (HAHN 1994, 81).
-
In allen menschlichen Gesellschaften wird die Beschneidung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten als Strafe eingesetzt, beispielsweise durch Freiheitsentzug. Menschen reagieren auf diese Einschnitte mit Unwohlsein, was selbstverständlich auch für Personen mit Behinderungen gilt. Diese haben sich allerdings oft damit arrangiert, dass sie nie die volle Entfaltung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten erleben konnten. Die Folgen davon können Rückzug, Hilflosigkeit und Apathie sein.
-
HAHNS dritte Überlegung begründet sich auf die Staatsform der Demokratie. Hier wird den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern im Vergleich zu anderen Staatsformen das höchste Maß an Selbstbestimmungsmöglichkeiten zugebilligt. "Aus den weltweiten politischen Bestrebungen zur Gründung und Verbesserung demokratischer Staatsformen dürfen wir herauslesen, dass die Realisierung von Selbstbestimmung ein Bedürfnis aller Menschen ist, das im Zusammenleben sozialer Regelungen und Absicherungen bedarf" (HAHN 1994, 82).
-
In den letzten Jahrzehnten legen Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen zunehmend mehr Wert auf Selbstbestimmungsmöglichkeiten. HAHN schließt aus dieser Forderung, dass Personen mit verschiedensten Behinderungen die Bedeutung der Selbstbestimmung für ihr Leben entdeckt haben, dass sie es aber offenbar im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen schwerer haben, diese zu verwirklichen (vgl. ebd.).
Selbstbestimmung für behinderte Menschen kann im Kleinen beginnen, sollte sich aber auch auf relevante Lebensentscheidungen beziehen. Sie schließt auch Personen nicht aus, die aufgrund ihrer schweren Behinderung nicht leicht verstanden werden können (NIEHOFF-DITTMANN 1996, 57). Auch diese können Speisen und Kleidung auswählen; der eigene Wohnraum sollte nach eigenen Wünschen gestaltet werden, der Privatbereich sollte gesichert sein (das kann beispielsweise bedeuten, dass jede(r) Bewohner(in) einen eigenen Zimmerschlüssel erhält), jeder sollte Mitspracherecht bei der Regelung von Arbeits- oder Wohnbedingungen haben, und auch kritische Meinungsäußerungen sollten akzeptiert werden (FORNEFELD 2002, 151).
Die zu betreuenden Personen werden als Kunden und Kundinnen gesehen, die ihre benötigte Unterstützung einkaufen. Professionelle Helferinnen und Helfer assistieren dabei, die Bedürfnisse des Einzelnen zu erfüllen (vgl. NIEHOFF 1999). Diese Ideen werden näher in Kapitel 4.5.2 erläutert.
"Die Aufgabenstellung der Selbstbestimmung ernst zu nehmen bedeutet, stetig und engagiert nach Möglichkeiten zu suchen, wie geistig behinderte Menschen aus einer ihnen oftmals auch zugeschrieben Unselbstständigkeit heraustreten und mehr und mehr als autonome Subjekte agieren können" (NIEHOFF-DITTMANN 1996, 55).
Da das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung aus den USA stammt, soll an dieser Stelle kurz auf die amerikanische Selbstbestimmungsdiskussion verwiesen werden.
Selbstbestimmung für Menschen mit Unterstützungsbedarf wird dort unter fünf Gesichtspunkten diskutiert, von denen in Deutschland allerdings noch nicht alle rezipiert worden sind (LINDMEIER & LINDMEIER 2003, 119). Diese sind:
-
"Selbstbestimmung als Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. Komponenten, die gelernt werden können - und gelehrt werden müssen;
-
Selbstbestimmung als innerer Antrieb zu autonomem, selbst gesteuerten und selbstbewusstem Verhalten (in dem Sinne, sich seiner selbst bewusst zu sein);
-
Selbstbestimmung als Form menschlicher Selbstgestaltung, die sich nur im Rahmen kommunikativer und sozialer Beziehungen vollzieht;
-
Selbstbestimmung als ein politisches Recht, als Bürgerrecht, das jedem Menschen unabhängig vom Grad seiner Behinderung zusteht;
-
Selbstbestimmung als Aufforderung zur Veränderung des Systems der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung" (LINDMEIER & LINDMEIER 2003, 119).
In Deutschland steht der Aspekt der Selbstbestimmung als "innerer Antrieb" im Vordergrund, der aus dem zweitem Gesichtspunkt hervorgeht. Dies wird auch aus dem ersten Teil dieses Kapitels, in dem lediglich deutsche Literatur verwendet wurde deutlich. Die Idee der Selbstvertretung von Menschen mit geistiger Behinderung (Punkte 4 und 5) hat allerdings ebenfalls Eingang in die deutsche Diskussion gefunden (LINDMEIER & LINDMEIER 2003, 120).
Der erste Aspekt der Selbstbestimmung (als ein Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erlernt werden müssen) spielt im Kontext von persönlicher Zukunftsplanung jedoch eine wichtige Rolle. Immer wieder wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auch echte Wahlmöglichkeiten kennen müssen, um selbst entscheiden zu können. Beispielsweise müssen sie verschiedene Wohnformen zunächst kennen lernen, um dann für sich eine Auswahl treffen zu können. Dieser Aspekt wird in der deutschen Literatur kaum diskutiert, dennoch nennen LINDMEIER & LINDMEIER (2002, 65) erste Beispiele, wie etwa das Buch von SUSANNE GöBEL "So möchte ich wohnen" (1998).
Auch der dritte Aspekt, der die Selbstbestimmung im Rahmen von sozialen Beziehungen betrachtet, nimmt einen hohen Stellenwert ein, was an vielen Punkten dieser Arbeit deutlich werden wird. Hierzu bemerken LINDMEIER & LINDMEIER: "Die soziale Komponente der Selbstbestimmung richtet das Augenmerk auf die Beziehungen der betroffenen Person: Sowohl der Aufbau von Vertrauen und partnerschaftlicher Kommunikation im Verhältnis zu professionellen Helfern als auch die Schaffung von Gelegenheiten zum Aufbau weiterer sozialer Beziehungen wird zur Aufgabe Professioneller, die die Realisierung von Selbstbestimmung unterstützen wollen" (2002, 65; Hervorh. im Original). Eine stärkere Betonung dieses Aspektes in Deutschland würde auch kritischen Anmerkungen zur Selbstbestimmungsdiskussion entsprechen, die THIMM 1997 äußerte: "Wem es ernst ist, geistig behinderten Menschen Räume zur Selbstentfaltung und Selbstbestimmung zu schaffen, der müsste sich auch (wenn nicht aktuell sogar vorrangig) für Erweiterungen des sozialen Netzwerkes behinderter Erwachsener in den Herkunftsfamilien einsetzen. Und es sollte dabei auch abgewogen werden, dass Familien sehr wohl wichtige soziale Bezüge, Bindungen (Ligaturen) sichern für Lebensperspektiven" (THIMM 1997, 231).
Im Konzept des supported living wird Selbstbestimmung nun als politisches Recht oder als Bürgerrecht gesehen. Hier werden Personen mit Behinderungen als Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde gesehen, denen angesichts der Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft selbstverständlich wie anderen auch ein Recht auf Selbstbestimmung zugestanden wird (vgl. Kap. 4.2.1). Auch THIMM (1997, 224) weist darauf hin, dass Selbstbestimmung im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Umbruchssituation, in der wir uns derzeit befinden, diskutiert werden muss. In Deutschland findet dieser Gedanke beispielsweise durch den Aufbau von People First-Gruppen langsam Verbreitung (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2002, 65).
HANS WEIß hebt in seinem Artikel zu Selbstbestimmung und Empowerment hervor, dass der Selbstbestimmungsdiskurs in der heilpädagogischen Diskussion einseitig verläuft. Dies ist seiner Ansicht nach vor allem dann der Fall, wenn Selbstbestimmung als völlig neues Paradigma bezeichnet wird, denn "kennzeichnend für die Existenz eines jeden Menschen ist es, dass er sein ganzes Leben lang in unterschiedlicher Gewichtung in einem spannungsvollen Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit, von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung steht" (WEIß 2000b, 246).
Wenn aber Selbstbestimmung aus diesem Spannungsverhältnis herausgelöst und - im Trend der momentanen gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen - als ausschließlich individuelle Kategorie aufgefasst wird, so hat dieses negative Auswirkungen auf die Qualität des Diskurses (WEIß 2000b, 248). "Eine undialektische Fassung des Problems Selbstbestimmung - Fremdbestimmung läuft Gefahr, ‚überzogen' zu wirken und immer wieder ein Umschlagen in die jeweils andere Position zu bewirken" (LINDMEIER 1998, 45 zit. n. WEIß 2000b, 248).
RAPPAPORT erläutert hierzu, dass soziale Probleme (und damit auch das in der Selbstbestimmungsdebatte diskutierte Problem von langer unnötiger Fremdbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung) ihrem Wesen nach divergent und paradox sind. So lassen sie sich auch nicht konvergent lösen, sondern erfordern divergente Sichtweisen (vgl. RAPPAPORT 1985, 157f). Konvergente Scheinlösungen dagegen erreichen oft das Gegenteil von dem, was sie anstrebten (vgl. WEIß 2000b, 253). So kann nicht einseitig auf Selbstbestimmung Wert gelegt werden, sondern es muss auch unter bestimmten Umständen das erforderliche Maß von Fremdbestimmung in Kauf genommen werden. Dies erwähnen zwar einige Vertreter der Selbstbestimmungsbewegung (z. B. HAHN 1994, 85; NIEHOFF-DITTMANN 1996, 56), trotzdem erscheint für dieses Problem das Empowerment-Konzept geeigneter, da es das Spannungsverhältnis von Selbst- und Fremdbestimmung ausdrücklich umfasst (RAPPAPORT 1985, 257).
"Zwar beinhaltet Empowerment auch den Leitgedanken der Selbstbestimmung oder Autonomie an zentraler Stelle. Es ist aber ein umfassenderes Konzept vor allem mit einer dialektischen Grundorientierung: Zum Ausgangspunkt seiner Philosophie macht es die oben genannten Widersprüchlichkeiten, Antinomien oder Paradoxien der Existenz des Menschen und seines Handelns in der sozialen Welt" (WEIß 2000b, 251).
THEUNISSEN erklärt beispielsweise, dass selbstbestimmte Handlungen auch an das soziale Umfeld angepasst sein müssen und dort keine destruktiven Wirkungen erzeugen dürfen. In diesem Sinne sei bisweilen Fremdbestimmung gegenüber behinderten Menschen erforderlich, nämlich dann, wenn die Betroffenen sich selbst oder andere gefährden (1995, 171).
Das Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdbestimmung ist auch im Konzept der persönlichen Zukunftsplanung zentral, da die planende Person einerseits mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, andererseits aber auch in ihrem sozialen Umfeld betrachtet wird.
Das Empowerment-Konzept entstand in den 60er und 70er Jahren in den USA und ist dort innerhalb der Bürgerrechtsbewegung Farbiger entstanden. "Es geht dabei um die Idee, dass einzelne Menschen wie auch Gruppen in benachteiligten und schwierigen Situationen mit Hilfe ihrer eigenen Stärken und auf der Grundlage gleicher Rechte - wie alle Mitglieder in der Gesellschaft - ihr Leben sozusagen ‚in die eigene Hand nehmen' können" (WEIß 2000b, 251). Im Empowerment-Konzept werden die Gefahren einer einseitigen Ausrichtung an den Defiziten und Hilfsbedürftigkeiten des Menschen aufgezeigt. So entwickelte sich ein kritisches Bewusstsein gegenüber dieser Perspektive, die Rechte, Kompetenzen und Selbstgestaltungsmöglichkeiten leicht übersieht (vgl. WEIß 2000b, 252). "Die Fähigkeit, in eigener Sache zu entscheiden und zu handeln oder eigene Angelegenheiten selbst regeln zu können, also die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, wird im Empowerment-Konzept bei jedem Menschen vorausgesetzt" (THEUNISSEN 1995, 167). Um sein Leben in die Hand nehmen zu können, müssen allerdings auch notwendige Ressourcen und Fähigkeiten vorhanden sein. "Wenn es Menschen daran mangelt, so hat dies mit gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen zu tun" (WEIß 2000a, 93). Es kann gefährliche Folgen haben, wenn man in dem Versuch, alte Fehler auszugleichen nun ausschließlich die Fähigkeiten-Perspektive betrachtet und die Bedürftigkeiten vernachlässigt. Dies wäre wiederum eine undialektische Lösung eines Problems. Außerdem könnte so rigide Einsparpolitik im sozialen Bereich gerechtfertigt werden (WEIß 2000b, 252). RAPPAPORT drückt dies sehr eindrücklich aus: "Rechte ohne Ressourcen zu besitzen ist ein grausamer Scherz" (RAPPAPORT 1985, 268).
Folglich ist es "verhängnisvoll, wenn in der deutschsprachigen Empowerment- [und Selbstbestimmungs- DM] Diskussion gegenüber der Rechte-Perspektive (im Sinne autonomer, selbstbestimmter Lebensgestaltung) die Bedürfnis- bzw. Ressourcenperspektive, also die Tatsache, dass Menschen auch Ressourcen brauchen, hintenangestellt werden würde" (WEIß 2000b, 252f).
Das Empowerment-Konzept soll hier nicht als neues Schlagwort, das vielleicht später Hoffnungen enttäuschen könnte, verkauft werden. Stattdessen soll es Denkanstöße für die Arbeit mit behinderten Menschen und ihren Familien bieten (WEIß 2000a, 101). So kann es auch als Basis für die Nutzung von persönlicher Zukunftsplanung hilfreich sein.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel geht es um die theoretischen Grundlagen von persönlicher Zukunftsplanung. Dabei wird diese in das Konzept des supported living eingeordnet. Zuerst werden weitere wichtige Begriffe definiert, bevor auf die Entstehungsgeschichte und die zentralen Inhalte des supported living eingegangen wird.
Die Idee des person centered planning, stammt aus den USA und ist dort Teil eines übergeordneten Konzepts, das als supported living bezeichnet wird. In Deutschland wurde dieses bislang erst in Ansätzen rezipiert.
Zu supported living gibt es lediglich vier Artikel: LINDMEIER & LINDMEIER (2000a, 2000b, 2001) & KRüGER (2000). Zur persönlichen Zukunftsplanung existieren dagegen einige Veröffentlichungen (DOOSE (2000), BOBAN & HINZ (1999), BROS-SPäHN (o. J.), LüNEBURGER ASSISTENZ GGMBH (2002) u. a.), die aber kaum das supported living einbeziehen.
Es wird dem umfassenden Konzept jedoch nicht gerecht, wenn es lediglich auf das Instrument der persönlichen Zukunftsplanung reduziert wird. Aus diesem Grund wird hier ebenfalls auf supported living näher eingegangen.
Supported living, welches im folgenden auch als "unterstütztes Leben" bezeichnet wird wurde Ende der 80er Jahre entwickelt (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 47) und "stellt sich in den angloamerikanischen Ländern als eine sehr vielschichtige Bewegung dar, die zwar auch von Fachleuten an den Universitäten vertreten und unterstützt wird, aber in erster Linie aus der Praxis heraus entwickelt wird" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 155).
Diese Tatsache macht eine einheitliche Definition schwierig, da das Konzept von jedem seiner Vertreter etwas anders verstanden wird. Zentral sind jedoch in allen Definitionen die Trennung von Wohnraum und Betreuung sowie die individuelle Planung für jeden einzelnen Menschen (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000b, 313).
Dieses wir auch in den zwei Definitionen von JOHN O'BRIEN, "einem der führenden, amerikanischen Vertreter des Ansatzes" (LINDMEIER & LINDMEIER, 2000b, 313) deutlich: "Supported living heißt, Menschen mit Behinderungen die individualisierte Hilfe anzubieten, die sie brauchen, um erfolgreich in einem Zuhause ihrer Wahl zu leben" (O'BRIEN & O'BRIEN 1991, 1)[4].
Die zweite Definition ist detaillierter und betont das Vertragsverhältnis zwischen Organisation und Mensch mit Beeinträchtigung sowie die Wichtigkeit von Würde und Sicherheit der Person: "Ein Mensch, der auf langfristige, durch öffentliche Mittel finanzierte, organisierte Unterstützung angewiesen ist, schließt einen Vertrag (eine Allianz) mit einer Organisation; deren Aufgabe ist die Bereitstellung jeglicher Unterstützung, die notwendig ist, um dem betreffenden Menschen ein Leben in Würde und Sicherheit in seinem eigenen Haus oder seiner eigenen Wohnung zu ermöglichen" (O'BRIEN 1993, 1)[5].
Die dritte Definition von WERTHEIMER, die aus dem britischen Raum stammt, schließt zusätzlich noch die Kontrolle der Person über ihr eigenes Leben ein, die aber auch O'BRIEN unterstützen würde, auch wenn sie nicht in seinen Definitionen zum Ausdruck kommt (vgl. z. B. O'BRIEN & LOVET 1992, 5). "Der gegenwärtige Schwerpunkt auf der Nutzerwahlmöglichkeit, nämlich Menschen zu ermöglichen, in ihrem eigenen Zuhause zu wohnen, egal welche Unterstützung auch immer gebraucht wird und ihnen damit mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben zu geben, ist völlig vereinbar mit den Zielsetzungen von unterstütztem Leben" (WERTHEIMER 1997, 5)[6].
Ein weiterer wichtiger Punkt, der in den genannten Definitionen noch nicht erwähnt wurde, ist die gesellschaftliche Teilhabe jeder Person mit Behinderung (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000b, 313) und die dazu ebenfalls notwendige Gemeindeentwicklung: "Wenn die individuelle Unterstützung auch die Teilhabe am Leben in der Gemeinde einschließen soll, müssen sich die Strukturen der Gemeinde verändern" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000b, 314). Diese beiden letzten Punkte, werden auch in den Prinzipien von unterstütztem Leben des schottischen Your Move-Projekt[7] deutlich, die zum Abschluss wiedergegeben werden sollen, da in ihnen auch die Wichtigkeit sozialer Beziehungen und informeller Unterstützung deutlich wird, die ebenfalls elementar im "unterstützt Leben"-Konzept sind.
-
"Menschen leben in ihrem eigenen Zuhause, nicht in Hilfearrangements.
-
Menschen wählen, wo sie leben wollen, die werden nicht platziert.
-
Alle heißt alle: Niemand wird aufgrund der Höhe oder der Art der benötigten Unterstützung vom Gemeindeleben ausgeschlossen.
-
Menschen nehmen anerkannte soziale Rollen als Mieter und Gemeindemitglied ein oder behalten diese und nicht die Rolle als Klient oder Bewohner.
-
Wohnen und persönliche Assistenz werden getrennt angeboten, um es zu ermöglichen, dass das eine ohne das andere ausgetauscht werden kann.
-
Die Unterstützung wird um die Person herum organisiert und verändert sich auch mit der Person, nicht umgekehrt.
-
Menschen mit Behinderungen sowie ihre Familien und die professionellen Helfer, die involviert sind, gehen mehr Risiken ein.
-
Es gibt eine Veränderung in der Art, in der das Personal arbeitet. Das Personal betrachtet sich selbst und wird wahrgenommen als Menschen, die neben denen stehen, welche die Hilfe nutzen und nicht als diejenigen, die über ihnen stehen.
-
Persönliche Beziehungen, Freunde, Familie und anderen informelle Möglichkeiten Menschen zu unterstützen werden geschätzt und begrüßt. Care involves caring about.
-
Es gibt eine Veränderung bezüglich der Beziehung zwischen Personal und der Gemeinde; Das Personal arbeitet außerhalb, baut Beziehungen auf und erhält sie aufrecht. - Sie sehen ihre Rolle weniger darin, die Person festzulegen, sondern eher darin, Wege zu finden, den Menschen mit Behinderungen dabei zu helfen, Teil der Gemeinde zu sein und in sie einbezogen zu werden" (SMITH & WILSON 1997, 10)[8].
Einen genaueren Eindruck über das supported living-Konzept vermittelt die im Folgenden dargestellte Abbildung von O'BRIEN (1993, 5) in der er deutlich macht, was unterstütztes Leben gerade nicht bedeutet. So reicht es nicht aus, kleinere Reformen durchzuführen, ohne das Menschenbild und die eigene Rolle zu ändern. Wahlfreiheit und Selbstbestimmung bedeuten auch nicht, eine Person, die umfassende Unterstützung benötigt, einfach allein zu lassen und echten Gefahren auszusetzen. Außerdem lässt sich durch supported living nicht der Unterstützungsbedarf einzelner Menschen oder dessen Kosten im Vergleich zu anderen Hilfeformen verringern. Das kann zwar in vielen Fällen so sein, in anderen aber wiederum nicht. Das Konzept darf auch nicht auf bestimmte Behinderungsgruppen beschränkt sein und beispielsweise Personen mit schweren Behinderungen ausschließen. Auch sie haben das Recht auf Wahlfreiheit und Selbstbestimmung, wie in einem Fallbeispiel von O'BRIEN & MOUNT deutlich wird: Erzählt wird die Geschichte von Mr. Davis, der nach klassischer sonderpädagogischer Terminologie eine schwere geistige Behinderung mit Verhaltensausfälligkeiten hat. Hier wird gezeigt, dass auch Menschen mit schweren Behinderungen von ihrer Umgebung so unterstützt werden können, dass sie ein selbstbestimmtes Leben zu ihrer eigenen Zufriedenheit führen können. Ein solches Leben ist natürlich nicht immer in kurzer Zeit ohne Hindernisse zu erreichen, was ebenfalls in dem genannten Beispiel ersichtlich ist. Mr. Davis hat nämlich auch nach einiger Zeit noch immer keinen tagesausfüllenden Arbeitsplatz gefunden, sondern erledigt lediglich einige sehr kleine Jobs. Trotzdem kann immer weiter daran gearbeitet werden, ein zufriedenstellendes Leben zu erreichen, und man kann sich immer weiter dem zugrunde liegenden Ideal annähern (vgl. O'BRIEN & MOUNT 1989).
Leben in einem "unterstützt Leben"-Arrangement kann ebenfalls nicht "verordnet" und als Allheilmittel gesehen werden, weil das dem Grundsatz der Individualität entgegenstehen würde. "Es geht nicht darum, daß plötzlich alle Jugendlichen mit Behinderungen Themenblätter ausfüllen oder Kärtchen legen, sondern darum, mit dem Jugendlichen in einer für ihn zugänglichen Art und Weise über die konkrete Gestaltung seines Lebens nachzudenken und Wahlmöglichkeiten zu erschließen" (DOOSE 2000, 105).
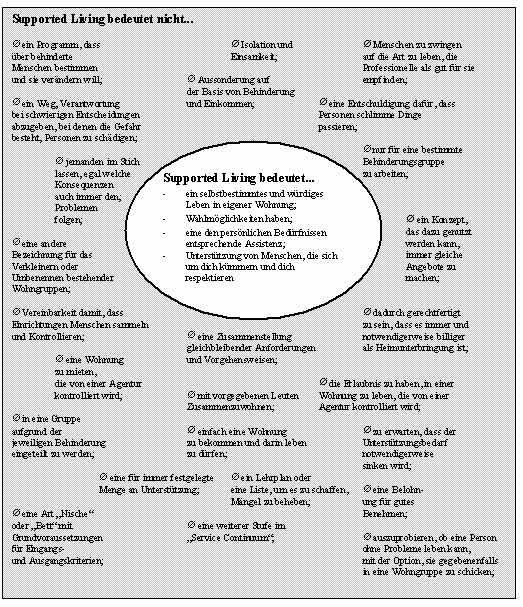
Abb. 2: Unterstützes Leben negativ definiert (O'BRIEN 1993, 5) Supported Living is not: A program to fix or chance people; Isolation & Loneliness; Segregation by disability or income; forcing people to live the way we think is good for them; A way to avoid responsibility for careful decisions about threats to people's vulnerabilities; An excuse for letting bad things happen to people; (benign) abandonment to whatever consequences follows problems; Targeted at a particular (dis)ability group; Another name for 'downsizing' existing facilities into smaller units or otherwise renaming existing services; Compatible with services that congregate and control people; A funding stream for use to do more of the same kinds of services; Justified, because it is always or necessarily cheaper than group living; A set of uniform requirements & procedures; Signing a lease on a place that staff control; Having the permission to live in an agency controlled apartment; Being assigned roommate(s); Being grouped on the basis of disability; Just getting an apartment to live in; Expecting that the amount of assistance necessary will always decrease; A fixed amount of assistance forever; A curriculum or a list of skills to master to remediate deficiencies; An incentive or reward for good behaviour; A kind of 'slot' or 'bed' with prerequisite entry and exit criteria; Another stop on the service continuum; A test to see if you can live with no problems & if not, you get sent back to group living. Supported Lining is: A safe & decent home of your own; Choice; Personalized assistance; Support from others who care about & respect you" (Übers. DM in Anlehnung an EMMERICH, 2000).:
Um die Ziele des supported living zu erreichen, wird mit jedem Menschen ein person centered planning durchgeführt. Als deutsche Übersetzung des Begriffs "person centered planning" soll in dieser Arbeit der Ausdruck "persönliche Zukunftsplanung" verwendet werden. Dieser wurde von STEFAN DOOSE und SUSANNE GöBEL geprägt, als sie begannen, die amerikanischen Konzepte zu diesem Thema in Deutschland zu verbreiten. Als weitere mögliche Übersetzungen könnten alternativ "personenbezogenen Planung" (vgl. LINDMEIER 2002b) oder "Individuelle Zukunftsplanung" benutzt werden.
Bei einer solchen persönlichen Zukunftsplanung steht im Mittelpunkt "die Frage, wie eine Person leben möchte und welche Unterstützung sie zur Verwirklichung ihrer Ziele und Lebensentwürfe benötigt" (EMRICH 1999, 74). Die persönliche Zukunftsplanung erfolgt in einem oder mehreren Zukunftsplanungstreffen, bei denen die planende Person selbstverständlich zugegen ist. Bei den Treffen sind außerdem Freunde, Familie und Fachleute, also der sogenannte "Unterstützerkreis" (vgl. Kapitel 7.3) anwesend. Diese Vielfalt an Planenden erlaubt es, verschiedene Perspektiven zu nutzen, um ein Bild von der Person zu bekommen (vgl. DOOSE 2000, 89) und informelle Unterstützung (natural support) einzubeziehen. Dies ist ein strukturelles Merkmal des "unterstützt Leben"-Konzeptes (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 158).
Um den Planungsprozess durchzuführen, gibt es verschiedene methodische Ansätze (MAP, PATH, Essential Lifestyle Planning, vgl. Kapitel 7.5). Sie dienen dazu, Dinge zu veranschaulichen, Zugänge zu erleichtern und durch visuelle Darstellungsweisen einen Überblick zu behalten. "Grundprinzipien dieser methodischen Zugänge zur Zukunftsplanung sind die Beteiligung der Person selbst, das Prinzip des runden Tisches mit der Überzeugung, dass jede(r) etwas zur Gestaltung der Situation beitragen kann, die Konsensbildung (wie aus der Organisationsentwicklung bekannt), die Verabredung nächster pragmatischer Schritte und die Visualisierung als sichtbarer Ausdruck von Einigungen, an die später angeknüpft werden kann" (BOBAN & HINZ 1999, 3).
Persönliche Zukunftsplanung ist ein Sammelbegriff oder, wie es das Your Move- Projekt ausdrückt, ein umbrella term für verschiedene Ansätze, um die Lebensbedingungen einer Person zu verbessern. Sie stellt die planende Person in den Mittelpunkt und schaut auf die ganze Person, nicht nur auf medizinische Bedürfnisse. Wichtig dabei ist ein positiver Blickwinkel auf die Person und alle anderen Anwesenden (vgl. SMITH & WILSON 1997, 24).
Selbstverständlich kann persönliche Zukunftsplanung auch in anderen Zusammenhängen als für die Planung der Wohnmöglichkeiten wie beim supported living genutzt werden. So ist sie beispielsweise ebenfalls eine gängige Methode beim supported employment (unterstützte Beschäftigung) und wird in Deutschland in diesem Zusammenhang vor allem in Hamburg und von der Lüneburger Arbeitsassistenz praktiziert (vgl. Kap.6). DOOSE nennt vier Bereiche persönlicher Zukunftsplanung: Bildung/Schule, Arbeit, Freizeit und Wohnen (vgl. 2000, 83). Auch können mehrere dieser Bereiche gleichzeitig Gegenstand eines Zukunftsplanungstreffens sein.
Wenn persönliche Zukunftsplanung jedoch isoliert betrachtet und nicht im Zusammenhang mit der Entstehung und dem Menschenbild von supported living gesehen wird, erscheint sie lediglich als eine Methode von vielen, die praktiziert werden kann, ohne einen grundlegenden Einstellungswechsel zu vollziehen (vgl. Kap. 4.2.2 & 4.2.3). Dies wird an einem Zitat von O'BRIEN & LOVET deutlich, die persönliche Zukunftsplanung dort in Zusammenhang mit Veränderung der Bedingungen für behinderten Menschen sowie für ihre Freunde und Familien in Gemeinden bringen: "Der Ausdruck persönliche Zukunftsplanung bezieht sich auf eine Gruppe miteinander verwandter Ansätze, die dazu dienen, Veränderungen in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen und ihren Familien und Freunden zu organisieren und zu lenken" (1992, 5) [9].
TAYLOR, RACINO & WALKER beschreiben in ihrem Aufsatz Inclusive Community Living (1992), der für ein Standardwerk der amerikanischen Inklusionsdiskussion geschrieben wurde (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 40), drei Phasen der Gemeindeintegration. Diese sollen hier näher beschrieben werden, da so der Ansatz des "unterstützen Lebens", d. h. Menschen mit Lernschwierigkeiten als Bürger(innen) der Gemeinde zu verstehen, ihnen einen individuellen Lebensstil zuzugestehen und auf Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens hinzuarbeiten, besser verstanden werden kann.
Nach Auffassung der Autor(innen) lassen sich diese Aspekte zu drei Kernaussagen zusammenfassen:
-
From institutions to community living - Von den Institutionen zum gemeindenahen Leben und Wohnen
-
Being in the community - Leben in der Gemeinde
-
Being part of the community - Teil der Gemeinde sein (TAYLOR, RACINO & WALKER, 1992, 299)[10].
In dieser Phase spielten verschiedene Einflüsse eine Rolle, die im folgenden, angelehnt an TAYLOR et al. (1992, 300ff), dargestellt werden sollen.
Unangekündigte Besuche von Robert Kennedy in Einrichtungen für Behinderte, über die auch in den Zeitungen berichtet wurde, sowie Veröffentlichungen wie Christmas in Purgatory[11] (BLATT & KAPLAN 1974) legten in den USA die Zustände in den Einrichtungen offen. Diese waren geprägt von einem defizitorientierten Menschenbild, das die Hauptaufgabe der Betreuung in Pflege und Verwahrung sah, da es eine Weiterentwicklung der Betroffenen nicht für möglich hielt. "Kennzeichen dieser Phase [der Betreuung von Menschen mit Behinderungen in der Nachkriegszeit DM] waren große Schlaf- und Wachsäle und das weitgehende Fehlen tagesstrukturierender Maßnahmen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 40).
Auch Elternvereinigungen in den 1950er Jahren, die bessere Schul- und Dienstleistungsbedingungen forderten, sowie die Selbstvertretungsbewegung People First, die sich in den 1970er Jahren gründete, leisteten einen Beitrag zur Verbesserung der Situation der Betroffenen.
Von den 1960er bis zu den 1980er Jahren waren Gerichtsentscheidungen und Gesetze ein wichtiges Instrument, um die Praktiken der Institutionen zu verändern. "Eine Serie von Sammelklagen gegen Bedingungen in Institutionen rüttelten alle Institutionen in diesem Land [USA DM] auf und veränderten das Gesicht der institutionellen Angebote für Menschen mit Behinderungen" (TAYLOR et al. 1992, 301)[12].
"Auch auf wissenschaftlicher Ebene wurde und wird eine Debatte über die Qualität der Betreuung in Institutionen und gemeindenahen Settings geführt" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41). Dabei geht es vor allem um Auswirkungen der Deinstitutionalisierung auf das Verhalten der Bewohner(innen), um deren Kontakt zur Familie, um Frequenz und Verschiedenartigkeit der Beziehungen und um persönliche Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. ebd. und TAYLOR et al. 1992, 303).
Bei der Umsetzung des gemeindenahen Wohnens wurden nach TAYLOR, RACINO & WALKER mehrere Prinzipien wirksam (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41). Einmal das "Normalisierungsprinzip", dass 1969 von BENGT NIRJE entwickelt wurde und sich folgendermaßen zusammenfassen lässt: "Das Normalisierungsprinzip beinhaltet, allen Menschen mit geistiger Behinderung Lebensmuster und Alltagsbedingungen zugänglich zu machen, die den üblichen Bedingungen und Lebensarten der Gesellschaft soweit als möglich entsprechen" (NIRJE 1994, 177). Es wurde schnell zu einem der leitenden Prinzipien in der Behindertenhilfe und hat einen großen Wandel in deren Einrichtungen bewirkt. WOLF WOLFENSBERGER (vgl. z. B. 1998) griff dieses Prinzip in den USA auf und entwickelte es weiter, indem er großes Gewicht auf die Aufwertung der sozialen Rolle behinderter Menschen legte. Dieses kann dadurch geschehen, dass Menschen mit geistiger Behinderung an denselben Orten zur Schule gehen, wohnen oder arbeiten, wie andere auch oder dass Personen mit Behinderungen zu sozial anerkannten Menschen Kontakte haben, anstatt lediglich in Kontakt zu ebenfalls behinderten Menschen zu stehen. Auch das äußere Erscheinungsbild, wie z. B. Modernität und Qualität der Kleidung, Haarschnitt oder Gesundheitszustand bieten für WOLFENSBERGER Möglichkeiten, die Rolle von beeinträchtigten Personen aufzuwerten (vgl. 1998, 268ff).
"Weil das Konzept der Normalisierung jedoch Gegenstand von vielen Interpretationen geworden ist, ist es nicht mehr länger so kraftvoll, wie es einst war, als ein Leitfaden für eine Veränderung der Art, wie Gesellschaft Menschen mit Behinderungen behandelt" (TAYLOR et al. 1992, 305)[13].
Ein weiterer Grund dafür, dass das Normalisierungsprinzip von anderen Leitideen abgelöst werden muss, liegt im gesellschaftlichen Wandel, der "mehr Gestaltungsfreiheit hinsichtlich des Lebensstils und eine höhere Bewertung der Individualität, der Wahlfreiheit und der Unabhängigkeit" (LINDMEIER 2002a, 12) mit sich bringt. "Ein normales Leben kann nicht mehr generell beschrieben werden durch Formeln wie ‚normaler Tagesablauf', sondern verlangt die individuelle Planung mit jedem einzelnen Menschen mit Unterstützungsbedarf" (ebd.).
Das zweite Leitprinzip ist das der Deinstitutionalisierung, welches die "Schließung von Großeinrichtungen und Umzug der Bewohner in gemeindenahe Settings" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41) forderte und herbeiführte.
Schließlich wird noch das in den 1960er Jahren entstandene Least restrictive Environment Principle angeführt, das so wenig einschränkende Umgebung wie nötig fordert. "Dieses Prinzip ... war äußerst fortschrittlich für seine Zeit. Es entstand in einer Phase, in der Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien entweder Segregation oder gar nichts angeboten wurde" (TAYLOR 1988, 50)[14]. Das Prinzip wird als eine geordnete Sequenz von Unterstützungsformen definiert, die schrittweise weniger einschränkend werden. Das Wohnkontinuum reicht beispielsweise von Institutionen als der restriktivsten Form der Unterbringung bis hin zu selbstbestimmtem Leben (vgl. Kap. 4.2.5) als der am wenigsten einschränkenden Umgebung. Im schulischen Bereich reicht dieses Kontinuum von Sonderschulen oder Sonderinternaten bis hin zur Beschulung an Regelschulen in normalen Klassen.
Die umfassende Kritik von TAYLOR et al. (1992) und TAYLOR (1988) an dem Prinzip der am wenigsten einschränkenden Umgebung "bildet eine der Grundlagen für die Entwicklung des Ansatzes der ‚Unterstützen Lebens'" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41).
Die Kritik erscheint vielleicht zunächst unverständlich. Auch in den deutsprachigen Ländern gibt es dieses Angebotskontinuum, das als fortschrittlich gilt und welches die großen Institutionen ablöste. Die deutsche Diskussion um schulische Integration, die schließlich in den Satz "Integration ist unteilbar" mündete (vgl. SPECK 1998, 422) ist jedoch durch ähnliche Überlegungen begründet (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 42).
Der Titel Caught in the continuum - gefangen im Kontinuum (TAYLOR 1988), macht bereits den zentralen Punkt der Kritik deutlich. Eine behinderte Person muss sozusagen eine Folge von Einrichtungen und Dienstleistungen durchlaufen und darin Leistungen erbringen, ehe er oder sie in einer ambulanten Wohnform wohnen oder sogar eine eigene Wohnung besitzen darf. Dem Prinzip liegt die "Annahme zugrunde, dass Menschen mit Behinderung sich qualifizieren bzw. vorbereitet werden müssen für integrative Wohn- und Lebenssituationen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41). Dabei ist jedoch fraglich, ob segregierte Formen der Dienstleistungen auf integrative Formen vorbereiten. DOOSE drückt dieses folgendermaßen aus: "Die Eingliederung in die Gesellschaft, so das zugrundeliegende Paradoxon, könne am besten durch die Ausgliederung vorbereitet werden" (1997, 3). Es liegt an der Art und Schwere der Behinderung, wie integriert jemand wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen darf. Schwerere Behinderungen setzen restriktivere Formen der Unterbringung voraus. Also wird deutlich, dass gerade für Personen mit schweren Behinderungen dieses Prinzip "voll von Fallstricken"[15] ist (TAYLOR 1988, 45). Schon aus dem Namen des Prinzips geht hervor, dass restriktive Formen der Unterbringung unter Umständen notwendig sind. Die Entscheidung darüber liegt bei den Professionellen. Das Prinzip hinterfragt nicht die Einschränkung persönlicher Rechte, sondern entscheidet lediglich über deren Art und Umfang. "Das Prinzip richtet die Aufmerksamkeit auf die physische Umgebung und weniger auf die Unterstützung, die Menschen für ihr Leben in der Gemeinde benötigen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 42).
Wenn Menschen mit Behinderungen in einer Gemeinde leben, sind sie damit nicht gleichzeitig schon Teil dieser Gemeinde. Es besteht die Gefahr der Isolation, und es ist nicht garantiert, dass kleinere, gemeindenahe Anbieter auch gleichzeitig qualitativ bessere Leistungen bereithalten. So sehen TAYLOR et al. (vgl. 1992) die Phase des Being in the community als Übergangsphase und entwickeln eine dritte Phase, die Being Part of the community (Teil der Gemeinde sein) genannt wird (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 42).
"Heute drehen sich die größten Herausforderungen um die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien am Leben in der Gemeinde, um größere persönliche Autonomie und Entscheidungsfreiheit und um die Entwicklung eines sinnvollen Gemeindelebens für alle von uns" (TAYLOR et al. 1992, 306)[16]. Es soll also ein Gemeindeleben entstehen, an dem jeder teilhaben kann. Diese Veränderung würde sich nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern auch für andere traditionell benachteilige Gruppen positiv auswirken, wie beispielsweise Schwarze, Ausländer oder Frauen. Größere persönliche Autonomie und Entscheidungsfreiheit könnte für Menschen mit Beeinträchtigungen beispielsweise bedeuten, über die Schulform entscheiden zu können oder auch darüber, wie sie wohnen möchten, ohne daran gebunden zu sein, welche Angebote ein Träger in einer Region bereithält. Sie könnten sich entscheiden, ob sie in einer Wohngemeinschaft mit selbst gewählten Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen leben wollen oder lieber alleine in einer eigenen Wohnung. Bei ihren benötigten Unterstützungsleistungen könnten sie natürlich auch selbst festlegen, wer diese wie lange leisten soll. Es müssen jeweils individuelle Lösungen für jeden einzelnen Menschen gefunden werden. Diese Forderung gilt natürlich auch für diejenigen mit schwereren Behinderungen, die Teil der Gemeinde sein können, falls es Menschen gibt, die bereit sind ihnen zu helfen, wenn sie gefragt werden. Beispiele zeigen, dass es solche Personen gibt und dass sich diese Bereitschaft positiv auf das Gemeindeklima auswirkt (vgl. PETERSON 1996, 59). Genauso, wie ein Klima gegenseitiger Akzeptanz und gegenseitiger Unterstützung positive Konsequenzen hat, wirken sich Ausschluss und Segregation sowohl für behinderte als auch für alte und kranke Menschen oder andere benachteiligte Gruppen negativ aus. In einem Klima von gegenseitiger Akzeptanz und Hilfsbereitschaft dagegen kann es dem Einzelnen, ob behindert oder nicht, weniger schwer fallen, die eigene Unzulänglichkeit und das Angewiesensein auf andere zu akzeptieren. So könnten vielleicht das Alter oder das Drohen einer Behinderung ihren Schrecken verlieren, wenn klar ist, dass es im Umfeld Menschen gibt, die auf Anfrage Unterstützung leisten würden. Also lässt sich abschließend feststellen, dass viele der Bemühungen um Integration von Menschen mit Behinderungen dieselben sind, die auch zu einer gerechteren und menschlicheren Gesellschaft für alle anderen zur Folge haben. (vgl. TAYLOR et al. 1992, 309).
Nach LINDMEIER & LINDMEIER lassen sich ähnliche Überlegungen in der Inklusionsdiskussion und damit auch in der Salamancaerklärung wiederfinden. Ebenso gibt es Konzepte zu Stadt- und Gemeindeentwicklung sowie die Feststellung, dass viele Initiativen zur Verbesserung der Situation benachteiligter Bevölkerungsgruppen auf dem gleichen Grundgedanken beruhen und die Aktivitäten deshalb besser vernetzt werden müssten (vgl. 2001, 43). Die ausführliche Darstellung solcher Konzepte würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Die Entwicklung dieser drei Phasen der Gemeindeintegration wird von verschiedenen Autoren mit geringen Abwandlungen in einer Tabelle zusammengefasst (DOOSE 2000, 159; KRüGER 2000, 113; TAYLOR 1988, 51). Die hier dargestellte Tabelle stammt aus dem Artikel von LINDMEIER & LINDMEIER (2001, 45). Hier wurde sie übersetzt aus dem Amerikanischen nach BRADLEY (1994), die die verschiedenen Phasen allerdings nicht in einer Tabelle dargestellt, sondern nacheinander beschrieben hat.

Das Umdenken weg von der Annahme, dass Menschen mit Behinderungen am besten in Sondereinrichtungen leben und arbeiten können (vgl. DOOSE 1997, 2) hin zu einem Leben in der Gemeinde wird in der Literatur als ein Paradigmawechsel bezeichnet. Paradigma ist "ein von T. S. KUHN (1962) eingeführter Begriff der Wissenschaftsgeschichte, -theorie und -soziologie. Er bezeichnet eine klassische wissenschaftliche Leistung ..., die von den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Disziplin als vorbildlich akzeptiert und durch eine wissenschaftliche Tradition begründet wurde" (FUCHS-HEINRITZ et al. 1994, 485). Alle Probleme, die in dieser wissenschaftlichen Disziplin auftreten, werden mit den Grundannahmen des herrschenden Paradigmas gelöst. Solange ein Paradigma Anerkennung findet, gelten die Grundprobleme einer Wissenschaftsdisziplin als gelöst. Wenn also in unserem Fall das Paradigma besagt, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung idealerweise in besonderen Institutionen gefördert und betreut werden sollten, wird die Sonderpädagogik daran arbeiten, diese Institutionen zu verbessern, nicht aber ihre Existenz grundsätzlich hinterfragen und nach anderen geeigneten Orten für Menschen mit Beeinträchtigungen suchen. Wenn dann allerdings gravierende Probleme auftauchen, die nicht in Sonderinstitutionen gelöst werden können, entsteht irgendwann der Gedanke, dass solche Institutionen nicht in allen Fällen geeignete Plätze für behinderte Personen sind. Damit ist der Wechsel der Grundvoraussetzungen, also des Paradigmas, vollzogen. "Im Zusammenhang mit einer Umbildung des allgemeinen Wirklichkeitsverständnisses werden sie [Paradigmen DM] abgelöst und durch neue beispielhafte Grundkonzeptionen ersetzt" (FACHHOCHSCHULE NORDOSTNIEDERSACHSEN 1999).
Nach DE JONG findet allerdings ein Paradigmawechsel nur dann statt, wenn es tatsächlich "ein neues Paradigma gibt, das an die Stelle des alten treten kann" (1982, 151). Das ist beim Umgang mit behinderten Menschen gegeben, wie aus der Abbildung 3 und der folgenden Erläuterung deutlich wird.
Behinderte Personen werden nicht mehr notwendigerweise in aussondernden Institutionen untergebracht. Das neue "Paradigma" stellt stattdessen das Unterstützungsbedürfnis des Einzelnen in das Zentrum der Überlegungen. Was braucht die Person, um erfolgreich in der Gemeinde leben zu können, und wie wird diese Unterstützung erbracht? Eine Behinderung allein ist noch kein Grund für ein bestimmtes Hilfebedürfnis. Zwei Menschen mit Down-Syndrom beispielsweise können völlig unterschiedliche Anforderungen an das Hilfesystem stellen und müssen nicht wie bisher in derselben Einrichtung wohnen und arbeiten. Einer kann sich wünschen alleine zu wohnen, ein anderer bevorzugt die Gesellschaft von vielen anderen. Einer kann vielleicht sein Geld selbst verwalten, ein anderer braucht dabei Hilfe. Es wird kein prinzipieller Unterschied mehr zwischen Personen mit und ohne Behinderung gemacht. Menschen brauchen alle ein bestimmtes Maß an Unterstützung, manche ihr Leben lang und manche nur in bestimmten Lebensabschnitten, beispielsweise als Kind oder im Alter.
Diese Veränderungen sind "nicht nur einfach eine Umstrukturierung oder die Reorganisation einer sozialen Dienstleistung. Es geht um die Neubewertung von Werten und Kultur. Dieser ‚Paradigmawechsel' schafft Positives in den Menschen selbst, in Organisationen, in Gemeinwesen und in der Lebenswirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung (KRüGER 2000, 115). O'BRIEN & O'BRIEN bezeichnen diesen Paradigmawechsel als eine "fundamentale Diskontinuität in der Art, wie Menschen Situationen verstehen und auf sie reagieren" (1991, 36)[17].
Selbst wenn in der deutschen behindertenpädagogischen Literatur von einem Paradigmawechsel gesprochen wird (z. B. HäHNER et al. 1999), gibt es in der Praxis Paradigmenmischungen und "keine radikale Abkehr von ‚alten' zu ‚neuen' Betrachtungsweisen" (EMRICH 1999, 9). Der behauptete Wechsel scheint also vorwiegend theoretischen Charakter zu besitzen und in der Praxis noch nicht stattgefunden zu haben (vgl. ebd.). Allerdings ist es fraglich, ob es in den Sozialwissenschaften überhaupt ein Paradigma geben kann, auf das alle Wissenschaftler(innen) Bezug nehmen (vgl. THIMM 1997, 223). Vielmehr gibt es wohl immer mehrere, nebeneinanderbestehende Denkschemata.
Die Einschätzung, dass der eben beschriebene Paradigmawechsel (noch) nicht stattgefunden hat, bestätigt auch das Your Move-Projekt: "Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts werden Menschen immer noch misshandelt, vernachlässigt und verbringen ihr ganzes Leben in Institutionen; hinter Mauern, über die normale Mitglieder der Gemeinschaft selten, wenn überhaupt, hinüberblicken" (SMITH & WILSON 1997, 14)[18]. LINDMEIER (2002,16) schreibt dazu: "Auch heute noch machen junge, im Elternhaus aufgewachsene Menschen die Erfahrung, dass das ‚normale Erwachsenwerden' - ausziehen, wirtschaftliche Selbstständigkeit, zusammenziehen und/oder heiraten, Kinder bekommen - für sie nur mit Einschränkungen ‚vorgesehen' ist." Diese beiden Zitate bestätigen die obige Einschätzung. Trotzdem sollte weiter eine Veränderung der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen angestrebt werden. Das Hilfesystem sollte sich an seine Nutzer(innen) anpassen und nicht wie in der Vergangenheit von ihnen verlangen, sich danach zu richten, was das Hilfesystem anbietet (vgl. O'BRIEN & LOVET 1992, 9). Deshalb wird im folgenden ausführlicher das veränderte Menschenbild und das Konzept des supported living dargestellt, das diesem Anspruch Rechnung tragen kann.
Veröffentlichungen zum unterstützen Leben und auch zur persönlichen Zukunftsplanung betonen an verschiedenen Stellen immer wieder, dass diese Ansätze eine neue Art zu denken und somit den oben beschriebenen Paradigmawechsel nötig machen (z. B. KRüGER 2000, 117; O'BRIEN 1993, 1; PEARPOINT & FOREST 1998, 95; DOOSE 2000, 121).
Diese andere Art zu denken macht sich besonders im Menschenbild deutlich, das die tägliche Arbeit bestimmt und auch den Anstoß für Neues geben kann. Die neue Denkart erfordert von Anbietern der Behindertenhilfe beispielsweise, dass sie mit den Menschen mit Behinderungen kooperieren, anstatt sie zu kontrollieren und sich selbst als Experte oder Expertin zu sehen. "Wenn du über Leuten stehst in dem Glauben, dass du es besser weißt und dass es Menschen mit Behinderungen besser geht, wenn sie tun, was du sagst, hast du das Wesentliche am unterstützen Leben nicht begriffen. ... Nur wenn du neben Menschen mit geistiger Behinderung stehst, ihre allgemeine Menschlichkeit erkennst, ihr Bemühen zu würdigen weißt, ihr Leben selbst zu regeln und dich gemeinsam mit ihnen mühst, neue Möglichkeiten zu schaffen, beginnst du, unterstütztes Leben zu verstehen" (O'BRIEN 1993, 3)[19]. Professionelle müssen sich also um symmetrische Beziehungen bemühen und dürfen nicht der Annahme verfallen, es bestünde ein qualitativer Unterschied zwischen ihnen und Menschen mit Behinderungen - diese haben zunächst einmal die gleichen Bedürfnisse wie man selbst. Hier soll dennoch keiner Gleichmacherei das Wort geredet werden. Selbstverständlich hat jeder andere Bedürfnisse und es gibt Menschen, die auf mehr Hilfe und Unterstützung angewiesen sind als andere (vgl. Kap. 2). Trotzdem können diese Unterschiede zwischen Menschen nicht lediglich an der Behinderung oder auch an einer besonderen Ausbildung festgemacht werden.
Jeder hat das Recht und die Kompetenz, für sich selbst zu bestimmten, wie er oder sie leben möchte und wird als handelndes Subjekt begriffen.
Diese Kompetenz und das Recht für sich selbst zu sprechen wird Menschen mit Behinderungen jedoch häufig abgesprochen. Im Zusammenhang von persönlicher Zukunftsplanung und unterstütztem Leben sollte dies aber im Mittelpunkt stehen. Jede Person ist Experte oder Expertin in eigener Sache und muss gefragt werden, wenn es um die eigenen Zukunft geht. DOOSE drückt dies folgendermaßen aus: "Selbst wenn ich nicht weiß, was ich will - und dies geht vielen von uns hin und wieder so - möchte ich keine Bevormundung, sondern Information, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren und einen ehrlichen Gedankenaustausch mit anderen" (2000, 73).
Es ist ohnehin sehr wichtig, so oft es geht den Dialog mit behinderten Menschen zu suchen, denn über sie wird in verschiedenen Zusammenhängen schon mehr als genug geredet. Sie selbst können, für manche überraschend, oft sehr gut selbst einschätzen was sie wollen und wissen, wo sie Hilfe benötigen und wo nicht (vgl. SCHULZE 1999, 10).
Die folgende Abbildung ist aus einer größeren Tabelle von BOBAN & HINZ entnommen und fasst noch einmal die nötigen Veränderungen im Menschenbild zusammen:
Abb. 4: Veränderung des Menschenbildes (nach BOBAN & HINZ 1999, 2f)
|
"Traditionelles" Verständnis von Behinderung |
"Integratives" Verständnis von Behinderung |
|
Anderswertigkeit |
Gleichwertigkeit |
|
Primat von Defizit + Passivität |
Primat von Kompetenz + Aktivität |
|
"behindert" sein (und bleiben) |
(in der Entwicklung) "behindert" werden |
|
(Hirnorganischer) Defekt, Schaden, ("IQ"-) Mangel, (Entwicklungs-) Defizit |
auf sich wechselseitig beeinflussenden inneren und äußeren Bedingungen basierende Entwicklung |
|
Ganz andere Bedürfnisse |
Gleiche und verschiedene Bedürfnisse |
|
Fürsorge, Stellvertretung, Abhängigkeit |
Selbstbestimmung und Abhängigkeit (bei allen) |
|
Bedarf an Behindertenarbeit |
Bedarf an Gemeinwesenarbeit |
In den USA wird die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen parallel zur Ausgrenzung anderer benachteiligter Gruppen, wie zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe, gesehen. So versteht sich die Behindertenrechtsbewegung als ein Teil der Bürgerrechtsbewegung, die in den USA auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Die Bemühungen dieser Bewegung "führten 1990 zum amerikanischen Antidiskriminierungsgesetz (ADA). Es verbietet, Menschen im öffentlichen Leben, im Bereich Telekommunikation, im öffentlichen Dienst oder in der Arbeit aufgrund ihrer Behinderung zu benachteiligen" (DOOSE 1997, 3).
Dies hat zur Folge, dass Busse, Restaurants und andere öffentliche Gebäude rollstuhlzugänglich sein müssen, dass der Kellner bei Bedarf die Speisekarte vorliest, dass Telefongesellschaften einen Dolmetscherservice für Gehörlose anbieten und ähnliches mehr. Solche Rechte können bei Bedarf vom Einzelnen eingeklagt werden (vgl. DOOSE 2000, 76).
"Der Grundgedanke des Antidiskriminierungsgesetzes [ist es], die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als Bürgerrecht zu sehen" (DOOSE 1997, 4).
In den USA gab es auch schon vor dem ADA Gesetzesänderungen, welche die Situation von Menschen mit Behinderungen verbesserten. DE JONG beschreibt beispielsweise das Jahr 1973 als ein Jahr, "das die Grenze zwischen zwei Epochen der Behindertenpolitik (in den USA) markiert" (1982, 132). In diesem Jahr wurde ein neues Rehabilitationsgesetz verabschiedet, das einige Initiativen zur Folge hatte, die behinderte Bürgerinnen und Bürger des Landes betrafen.
In der hier vorliegenden Literatur zu den gesetzlichen Grundlagen wird das SGB IX nicht erwähnt. Das mag daran liegen, dass es neuer ist als diese Literatur. Wegen seiner Aktualität und Wichtigkeit soll es jedoch an dieser Stelle kurz Erwähnung finden.
Im SGB IX wurde das "einschlägige Recht" (BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002b, 3) weiterentwickelt und als weiteres Buch im Sozialgesetzbuch zusammengefasst. Es trat am 1. Juli 2001 in Kraft und brachte Neuerungen in der Behindertenhilfe mit sich, die allerdings vermutlich noch einige Zeit zur Umsetzung benötigen werden. Das neue Gesetz hat an die Stelle der Fürsorge die Idee der Teilhabe gesetzt, was schon an dem Namen des SGB IX "Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen" deutlich wird. Teilhabe bedeutet: "Durch die notwendigen Sozialleistungen sollen behinderte Menschen die Hilfe erhalten, die sie benötigen, um am Leben der Gesellschaft und insbesondere am Arbeitsleben teilzunehmen" (BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002a, 1).
Einige der Neuerungen sollen hier kurz aufgezählt werden, um deutlich zu machen, dass mit diesem Sozialgesetzbuch wichtige rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die nötig sind, um in Deutschland die Ideen des unterstützen Lebens und der persönlichen Zukunftsplanung zu verbreiten.
Im Gesetz wird beispielweise gefordert, dass Leistungen zur Teilhabe nach Möglichkeit so gestaltet werden sollen, dass Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und dass sie gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern betreut werden sollen:
"Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können" (SGB IX, Teil 1, Kapitel 1, §4 Absatz 3).
Dies ist eine wichtige Vorrausetzung, damit Personen mit Behinderungen ein "Teil der Gemeinde" werden können (vgl. Kap. 4.2.1).
Außerdem werden Integrationsfachdienste eingeführt, welche die Aufgabe haben, Menschen mit Behinderungen zu helfen und sie bei der Arbeitssuche oder beim Übergang aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen:
"Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter bei der Durchführung der Maßnahmen zu Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden" (SGB IX, Teil 2, Kapitel 7, §109).
"Die Integrationsfachdienste können ... beteiligt werden, indem sie
-
die Schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,
-
die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten" (SGB IX, Teil 2, Kapitel 7, §110).
Im weiteren werden noch detailliertere Aufgaben beschrieben.
Gleichzeitig hat jede(r) Schwerbehinderte einen Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz, was ebenfalls eine wichtige Neuerung des SGB IX darstellt. Arbeitsassistenz bedeutet direkte persönliche Hilfe am Arbeitsplatz (vgl. BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002a, 35). Dieses wird als Aufgabe der Integrationsfachdienste definiert. Dort heißt es:
"Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es ...
-
die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten ..." (SGB IX, Teil 2, Kapitel 7, §110).
Mit diesen Neuerungen soll erreicht werden, dass Personen mit Behinderungen vermehrt auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind und nicht mehr in Sondereinrichtungen, wie der Werkstatt für behinderte Menschen, arbeiten müssen.
Eine weitere wichtige Neuerung des SGB IX ist, dass Leistungen nicht nur als Sachleistungen, sondern auch als Geldleistungen (SGB IX Teil1 Kapitel 1 §9 Absatz 2), dem sogenannten "persönlichen Budget" erbracht werden können.
"Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistung erbracht werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können ..." (SGB IX, Teil 1, Kapitel 1, §9).
Mit diesem Geld können sich die Betroffenen dann ihre Leistungen selbstbestimmt "einkaufen" und so ein Leben unabhängig von Leistungsträgern und nach eigenen Vorstellungen leben. "In Modellprojekten prüfen die Rehabilitationsträger, welche Leistungen sich dafür eignen und wie die Budgets konkret bemessen sein können" (vgl. BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002a, 25). Die Prüfung erscheint notwendig, da in Deutschland bisher wenig Erfahrungen auf diesem Gebiet vorliegen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Möglichkeit für ein selbstbestimmtes Leben nicht nur auf Menschen mit Körperbehinderungen oder mit lediglich leichten geistigen Behinderungen beschränkt bleibt und "aus dem Status einer Lösung für durchsetzungsfähige, gut informierte Einzelpersonen zu einer ‚Lösung für alle'" wird (LINDMEIER 2002a, 13).
Der Ansatz des supported living kann als eine Weiterentwicklung des independent living gesehen werden, was in diesem Kapitel näher erläutert werden soll. Dazu wird zunächst der Ansatz des independent living erklärt.
Der Begriff ist inzwischen zu einem Schlüsselbegriff in der US-amerikanischen Behindertenarbeit und -politik geworden. Auch in Deutschland spielt er eine wichtige Rolle und wird dort mit "selbstbestimmtes Leben" übersetzt.
Nach DE JONG ist es schwer, den genauern Entstehungszeitpunkt und Ort der Idee des selbstbestimmten Lebens festzustellen. Diese ist ungefähr in den 60er bis 70er Jahren in den USA entstanden, weil sich dort einerseits Menschen mit Behinderungen um ein erfüllteres Leben in der Welt von Nichtbehinderten bemühten und andererseits, weil sich professionelle Rehabilitationsfachleute um eine Berufstätigkeit für ihre Klienten bemühten, für die dies bis vor kurzem undenkbar gewesen wäre (vgl. DE JONG 1982, 137). Die independent living Bewegung tritt dafür ein, dass behinderte Menschen ein gleichberechtigtes Leben als Bürger(innen) in den USA leben können, ohne wegen ihrer Behinderung benachteiligt zu werden.
Als erstes Projekt, das es Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen ermöglichte in der Gemeinschaft zu leben, wird das von vier schwerbehinderten Studenten an der Universität von Illinois in Champaign-Urbana genannt. Sie erkämpften es sich, in einem Wohnhaus nahe der Universität zu wohnen, das an ihre Bedürfnisse angepasst war. Vorher hatten sie in einem Pflegeheim weitab des Universitätsgeländes gelebt. Dieses Projekt behinderter Studenten wurde zu einer bedeutenden Selbsthilfeeinrichtung, deren Verdienst es ist, dass die Universität von Illinois eine der für behinderte Menschen am besten zugänglichen Einrichtungen dieser Art wurde (vgl. DE JONG 1982, 137).
Durch das 1973 erneuerte Rehabilitationsgesetz, dessen "augenfälligstes Merkmal" ein Satz ist, "der jede Diskriminierung Behinderter im Sinne einer Einschränkung ihrer allgemeinen bürgerlichen Rechte in allen Programmen oder Aktivitäten verbietet, die aus Bundesmitteln gefördert werden" (DE JONG 1982, 132f), wird der Beginn der independent living Bewegung in den USA markiert. Stärkende Impulse erhielt sie außerdem durch eine Reihe anderer zeitgenössischer Bewegungen, wie durch die Bürgerrechtsbewegung, die Verbraucherbewegung, die Selbsthilfebewegung, die Bewegung zur Entmedizinisierung und der Abkehr von der Institutionalisierung behinderter Menschen (DE JONG 1982, 133). Diese Bewegungen beruhen auf ähnlichen Wertvorstellungen und Grundsätzen wie das independent living. Die Bürgerrechtsbewegung beispielsweise "machte anderen benachteiligten Gruppen bewußt, welche Rechte sie haben und wie man sie ihnen verweigerte" (DE JONG 1982, 141). In ähnlicher Weise leisteten auch die anderen Bewegungen ihren Beitrag, was hier aber nicht näher erläutert werden soll.
In den USA gibt es an verschiedenen Orten centers for independent living (Zentren für selbstbestimmtes Leben) "Jedes Center hat ein unterschiedliches Angebot von Beratung und Dienstleistungen; gemeinsam gaben die verschiedenen Centers der Bewegung sowohl einen organisatorischen Brennpunkt, wie auch die Basis für die Verwirklichung einiger der bedeutenderen Zielsetzungen der Bewegung" (DE JONG 1982, 137).
Eines der ersten Zentren, das der Bewegung mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung brachte, wurde in den frühen 70er Jahren in Berkeley (Kalifornien) gegründet. DE JONG leitet aus der independent living Bewegung sogar das independent living Paradigma ab, das für ihn das Rehabilitationsparadigma ablöst (1982, 153). Als Problem von behinderten Menschen wird im independent living Paradigma die Abhängigkeit von Fachleuten, Angehörigen und anderen Menschen gesehen, die im Rehabilitationsprozess oder in der Umwelt zu Schwierigkeiten führt. Diese Probleme sollen durch Beratung durch ebenfalls Betroffene (peer counseling s. u.), durch Rechtsbeistand, Selbsthilfe, Kontrolle der Dienstleistungen durch andere Menschen mit Behinderungen und durch den Abbau architektonischer Hindernisse gelöst werden. Menschen mit Beeinträchtigungen sehen sich nach diesem Paradigma als Konsumenten, die kritisch die benötigten Dienstleistungen einkaufen, beurteilen und auch austauschen können. Die Kontrolle und Beratung bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten übernehmen gleich Betroffene. Es geht der independent living Bewegung auch darum, Risiken eingehen zu dürfen und auch das Recht auf Scheitern zu haben, was im üblichen Behindertenhilfesystem eigentlich nicht vorgesehen ist. Ohne diese Möglichkeiten fehlt - so die Befürworter des Konzepts - Personen mit Behinderungen eine echte Autonomie (DE JONG 1982, 150).
Auch in der deutschen Literatur ist die Idee des selbstbestimmten Lebens aufgenommen worden, auf die im folgenden Bezug genommen wird. Es werden ausführlicher die Merkmale und Ziele des selbstbestimmten Lebens erläutert, die jedoch größtenteils identisch mit denen in den USA sind.
Der Schlüssel zu selbstbestimmtem Leben liegt in der "persönlichen Assistenz". "Darunter wird jede Form der persönlichen Hilfe verstanden, die einen ‚Assistenznehmer' in die Lage versetzt, sein Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten" (NIEHOFF 1999, 53). Sie kann pflegerische Tätigkeiten umfassen, Haushaltshilfe aber auch kommunikative Hilfen, wie Gebärdendolmetschen oder ein Vorlesedienst für blinde Menschen. Zeit, Ort und Ablauf für diese Assistenzleistungen werden von den Assistenznehmern und -nehmerinnen bestimmt. Wer die Assistenz leisten soll, liegt ebenfalls in der Hand des Assistenznehmers. Damit nimmt der behinderte Mensch eine Rolle als Arbeitgeber(in) seiner Assistenten ein. Die Person mit Behinderung als Arbeitgeber(in) zu sehen, verändert die sonst in der Behindertenhilfe üblichen Machtverhältnisse und soll die helfende Beziehung von einer einseitigen Abhängigkeit befreien. Der behinderte Mensch als Kunde erhält mehr Einflussmöglichkeiten und kann seinem Arbeitnehmer Anweisungen geben oder ihn aus seinem Arbeitsverhältnis entlassen (vgl. NIEHOFF 1999, 53f).
Die "selbstbestimmt Leben"-Bewegung fordert für Menschen mit Behinderungen "Regiekompetenzen" ein, um ihr Leben selbst zu kontrollieren. Solche Kompetenzen hatten sie bisher in einem von Experten dominierten Hilfesystem nicht.
Regiekompetenzen sind:
-
Die Finanzkompetenz (Auszahlung der finanziellen Hilfen an die betroffenen selbst)
-
"Personalkompetenz (Arbeitgeberfunktion)
-
die Ableitungskompetenz (Artikulieren von Bedürfnissen; Fähigkeit, Helfern gezielt die benötigten Informationen geben zu können)
-
die Raumkompetenz (Wie, mit wem leben wollen)
-
die Sozialkompetenz (Möglichkeiten und Fähigkeiten, seine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gestalten)" (NIEHOFF 1999, 58).
Die Ziele des selbstbestimmten Lebens sollten durch peer support erreicht werden. Peer support lässt sich in diesem Zusammenhang am ehesten mit "Unterstützung durch Ebenbürtige oder Gleiche" übersetzen. Ein anderer Begriff für die Beratung von Behinderten durch Behinderte ist peer counseling, das in der deutschen Diskussion wörtlich so aus dem Amerikanischen übernommen wurde (vgl. MILES-PAUL 1992, 20). Grundannahme dieser Beratung durch Gleiche ist, dass jede(r) in der Regel selbst in der Lage sind, persönliche Probleme zu lösen und gesteckte Ziele zu erreichen. Die gemeinsame Lebenserfahrung ermöglicht eine entspannte Situation, die in einer üblichen Beratungssituation aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen oft nicht gegeben ist. Beim peer counseling dagegen sind Beratende und Ratsuchende gleichberechtigt, obwohl sie in einer Sitzung unterschiedliche Rollen einnehmen, die aber in einer anderen Sitzung wieder vertauscht sein können (vgl. VAN KAN 2000, 24f). "Hinter der Erfahrung der BeraterIn und der Ratsuchenden steht der gesammelte Erfahrungswert behinderter Menschen in der ganzen Welt. Manches scheinbar persönliche Problem kann durch die Beratung in einem allgemeineren, politischen, sozialen oder kulturellen Kontext gesehen werden" (ebd.).
Die independent living-Bewegung mit ihren Zielen und Methoden hat sich allerdings auf "verhältnismäßig wenige größere Behinderungsarten konzentriert: Querschnittsgelähmte, Muskeldystrophiker, Spastiker, MS-Kranke und durch Kinderlähmung Behinderte" (DE JONG 1982, 134). Der Ansatz ist auch nur für diese Gruppe realistisch und umsetzbar. "Für Menschen mit geistigen oder psychischen Behinderungen sowie für mehrfach behinderte Menschen bedarf es hingegen in der Regel wesentlicher Modifikationen und Ergänzungen des Konzepts, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen zu können" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 144).
In der deutschen Behindertenpädagogik, besonders der Geistigbehindertenpädagogik, beginnt man inzwischen nach einer Phase der kritiklosen Übernahme des independent living-Ansatzes über mögliche Modifizierungen dieser Art nachzudenken (ebd.).
Dass es nötig ist, Menschen mit Lernschwierigkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, soll an dieser Stelle nicht angezweifelt werden. Personen mit geistiger Behinderung erleben noch stärker als Menschen mit Körperbehinderungen eine Bevormundung in allen Lebensbereichen. Diese liegt nicht in der Behinderung begründet, sondern wird durch "kulturell bestimmte, typische Reaktionsweisen auf die Behinderung (beispielsweise Besuch einer Sonderschule, WfBM) hervorgerufen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 148). Fremdbestimmung und Zwang wurden zwar vielerorts problematisiert und es wurde Menschen mit geistiger Behinderung gelegentlich auch ermöglicht wichtige Entscheidungen, beispielsweise bei der Partner(innen)wahl, der Wohnform oder der Berufswahlentscheidung, zu treffen. Trotzdem veränderten sich nicht die Machtstrukturen in der Behindertenhilfe, so dass die Bemühungen um Selbstbestimmung oft auf eine "zweifelhafte Wahlfreiheit in einer ansonsten fremdbestimmten Umgebung" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 149) beschränkt blieb.
Zudem benötigen geistig behinderte Menschen nicht nur - wie beim selbstbestimmten Leben vorgesehen - einen praktischen Helfer als Assistenten, der auf Anweisungen Dinge erledigt, die man selbst (meist körperlich) nicht leisten kann, sondern darüber hinaus "eine Bezugsperson für die persönliche Lebensplanung und die Kommunikation" (ebd.).
Somit muss der Assistenzbegriff für Menschen mit geistiger Behinderung ausgeweitet werden. "Sie haben oft Schwierigkeiten, Anleitungsfunktionen auszuüben und einzuschätzen, wie viel und welche Hilfe sie benötigen. Das aufrichtige Bemühen um ihre größtmögliche Autonomie kann auch dazu führen, dass an geistig behinderte Menschen unerfüllbare Forderungen gerichtet werden. Das Assistenzkonzept muß daher bei ihnen um Inhalte der Begleitung ausgeweitet werden" (NIEHOFF 1999, 54).
Leider bezieht das independent living Konzept diese Problematik nicht mit ein, denn es beruht auf dem "Idealbild des unabhängigen, kompetenten, gebildeten Individuum und vernachlässigt die Bedeutung von naturwüchsigen sozialen Bindungen für das menschliche Leben" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 159). Allerdings ist es der independent living-Bewegung zu verdanken, dass sie Machtverhältnisse und Entscheidungskompetenzen in aller Deutlichkeit herausgestellt hat, so dass das supported living Konzept überhaupt erst entstehen konnte. Dennoch bleibt festzustellen, dass der independent living-Ansatz, wenn auch unabsichtlich, nur denjenigen helfen konnte, die an der Spitze der Hierarchie der behinderten Menschen stehen, also denen, deren Geist trotz allem noch funktioniert.
Die Bemühungen um ein selbstbestimmtes Leben für Personen mit geistiger Behinderung müssen also weitergehen. Im Dialog mit den Betroffenen muss in symmetrischen und herrschaftsfreien Beziehungen immer wieder darum gekämpft werden, jedem und jeder Einzelnen die nötige Unterstützung zu geben, damit er oder sie ein selbstbestimmtes Leben nach eigenen Vorstellungen leben kann. Diese Möglichkeit kann das supported living Konzept mit seinen Zielen, Kernforderungen und dem Element der persönlichen Zukunftsplanung bieten. "Das Konzept des supported living behält einige der zentralen Errungenschaften des independent living-Ansatzes bei: Als hervorstechendste nennen wir nur die Trennung von Wohnraum und Hilfeleistung, die Analyse der Macht- und Kontrollstrukturen oder das Ziel, behinderten Menschen ein Leben zu ermöglichen, das nicht durch die Schablonen institutioneller Betreuung bestimmt wird. Im Unterschied zum independent living rückt es aber die sozialen Netzwerke und die lebensweltlichen Bezüge des behinderten Menschen viel stärker in den Mittelpunkt" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 160).
JOHN O'BRIEN, eine der Schlüsselfiguren der supported living-Bewegung (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 153) formulierte "five closely linked service accomplishments"[20] (1989, 19), die den Mitarbeitern in Unterstützungs-Arrangements einen Leitfaden für ihre tägliche Arbeit liefern sollen. Diese werden im folgenden dargestellt, um einen ersten Eindruck der Merkmale des supported living zu vermitteln.
O'BRIEN sieht in ihnen den Vorteil, dass "klar definierte Leistungen ... die tägliche Arbeit in zielgerichteten und an langfristigen Perspektive orientierten Bahnen leiten" (1989, 18)[21].
Diese Leitvorstellungen sind (vgl. O'BRIEN 1989, 19):
-
Growing in relationships - Wachsen in (oder Entwicklung von) sozialen Beziehungen
-
Contributing - einen Eigenbeitrag leisten
-
Making choices - Treffen von Entscheidungen bei vorhandenen Wahlmöglichkeiten
-
Having the dignity of valued social roles - Würde aufgrund gesellschaftlich anerkannter Rollen besitzen
-
Sharing ordinary places and activities - Teilhabe am allgemeinen und öffentlichen Leben[22].
Diese Leitvorstellung beinhaltet die Annahme, dass Menschen auf sinnstiftende und symmetrische soziale Beziehungen angewiesen sind, um ein erfülltes Leben zu führen. Bei der Unterstützung von behinderten Personen sollte dieses daher angemessen Berücksichtigung finden. Es kann bedeuten, den Kontakt zu Familienmitgliedern zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten oder Kontakte zu Nachbarn und Nachbarinnen zu schaffen. Um mit nichtbehinderten Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht das Interesse an einem Hobby teilen, kann man sich in einem Verein oder für einen Volkshochschulkurs anmelden. Auch Kontakte zu anderen Menschen mit Behinderung gehören in diesen Bereich (vgl. O'BRIEN 1989, 19ff).
Gerade behinderte Personen haben oft nur wenige soziale Beziehungen. Wenn sie beispielsweise lange in Institutionen gelebt haben, wurde oft lediglich der Kontakt zu Professionellen und anderen Menschen mit Behinderung erfahren. Selbst in offeneren Wohnformen sind Bindungen zur Familie oftmals abgebrochen und auf Seiten der Familie vielleicht sogar unerwünscht. In solchen Situationen gestaltet sich die Arbeit des Personals in diesem Bereich als schwierig und herausfordernd (vgl. Kapitel 7.8).
Personen mit Behinderungen sollten darin unterstützt werden, ihre Fähigkeiten und Talente zu erfahren. "Welche Fähigkeiten werden von anderen geschätzt? Was gibt die Person anderen zurück" (WELLS 2000, 146)? Sie kann sich beispielsweise als beliebte Kollegin, Mitschüler oder Kumpel erfahren und ihre Fähigkeiten bezüglich der Mobilität und der Kommunikation verbessern (vgl. O'BRIEN 1989, 20).
Bei diesem Punkt ist besonders wichtig, dass für die Person überhaupt reale Wahlmöglichkeiten vorhanden sind, die eine Kontrolle über das eigene Leben und selbstbestimmtes Handeln ermöglichen. Diese Wahlmöglichkeiten können im Kleinen beginnen, sie reichen aber auch hin zu größeren Entscheidungen, z. B. bezüglich der Wohnform oder des Arbeitsplatzes (vgl. Kap. 3). "Menschen sollten die notwendige Unterstützung bekommen, die eigene Umwelt zu deuten, die Erwartungen anderer und die Bedingungen für Zusammenarbeit zu verstehen, auf eine zufriedenstellende Art seine/ihre Ziele zu erreichen, effektiv zu kommunizieren, Konflikte auszutragen, Risiken zu begrenzen und mit positiven und negativen Konsequenzen ihrer Entscheidungen umzugehen" (O'BRIEN 1989, 21)[23].
"Welche gesellschaftlich akzeptierten Rollen hat die Person inne" (WELLS 2000, 146)? Ist sie beispielsweise eine gute Nachbarin oder kann sie es werden? Ist sie eine Freundin, ein Hausbesitzer, eine politisch engagierte Bürgerin?
"Menschen sollten die notwendige Unterstützung bekommen, anerkannte soziale
Rollen in der Gemeinde zu finden und einzunehmen, die üblichen Erwartungen von anderen Menschen in bestimmten Bereichen zu erfüllen oder zu verändern, mit vorurteilsbelasteten oder typischen Reaktionen anderer effektiv umzugehen und sich selbst positiv zu präsentieren" (O'BRIEN 1989, 21)[24].
Menschen mit Behinderungen sollten Einrichtungen, Plätze und Möglichkeiten in der Gemeinde nutzen und zwar zur selben Zeit und auf dieselbe Art wie Personen ohne Behinderung. Dazu benötigen sie die erforderliche Hilfe und Unterstützung (vgl. O'BRIEN 1989, 22). Diese Forderung klingt zunächst trivial, dennoch ist es für behinderte Menschen manchmal nicht selbstverständlich, in die Eisdiele oder zum Schwimmen zu gehen, wann sie es wünschen.
Die zentrale Frage, um die es beim supported living geht ist: "Wie können wir unsere Ressourcen nutzen, um die Menschen, die sich auf uns verlassen dabei zu unterstützen, ein besseres Leben zu führen" (O'BRIEN 1988, 5)[25]? LINDMEIER & LINDMEIER (2000a, 153f.; 2001, 46f) fassen in ihrem Artikel Ziele von unterstütztem Leben zusammen, die hier in enger Anlehnung daran und ergänzt durch andere Literatur dargestellt werden:
Dies ist ein Merkmal, das auch schon beim independent living üblich ist. Es ist aber für Menschen mit geistiger Behinderung bisher sehr ungewöhnlich. Die Trennung ermöglicht dem/der Nutzer(in) eine stärkere Kontrolle über das eigene Leben. Das Betreuungspersonal kann gewechselt werden, ohne den Wohnort ändern zu müssen, wie das normalerweise in Einrichtungen der Behindertenhilfe nötig wäre. Betroffene haben einen gesicherten Status als Mieter(in) oder Eigentümer(in) und können auch als solcher angesehen werden, obwohl Betreuungspersonal im Haus ist. So können sie eine anerkannte soziale Rolle einnehmen, wie O'BRIEN es in einer seiner Kernforderungen verlangt (vgl. Kap. 4.3.1).
Beim supported living wird nicht in Behinderungsformen oder anderen Gruppeneinteilungen gedacht, sondern individuell: "Jede Person wird ihre eigene, wechselnde Zusammenstellung von persönlicher Assistenz haben, die auf den Vorlieben und Bedürfnissen basiert, so wie die Vorlieben und Bedürfnisse in den Beziehungen auftreten" (O'BRIEN & O'BRIEN 1991, 15)[26].
Die Erkenntnis, wie die beste Unterstützungsleistung aussehen kann, liegt in jeder Person selbst und ist nicht allgemeingültig (vgl. CURTIS & DEZELSKY 1994a, 58).
Es geht nicht darum, eine möglichst passende Hilfeform für einen Menschen zu finden, die möglicherweise weit entfernt liegt, sondern darum, die Umgebung entsprechend anzupassen und die benötigte Unterstützung dort bereitzustellen (vgl. LINDMEIER 2002a, 18f).
Um die beste Unterstützungsleistung herauszufinden und alles individuell zu planen, wird mit jeder Person eine persönliche Zukunftsplanung durchgeführt, die näher in Kapitel 7 erläutert wird.
"Ein weiteres strukturelles Merkmal des supported living besteht sicherlich darin, dass bei der Realisierung der Zukunftspläne individuelle Lösungen unter Einbeziehung der vorhandenen informellen Unterstützungsmöglichkeiten (natural support) gesucht werden" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 158). Dieser natural support bezieht sich auf die in der Umgebung der unterstützen Person vorhandenen Ressourcen. Wer kann Unterstützung leisten? Eltern, Geschwister, Nachbarn, Freunde, Jugendgruppen in der Gemeinde u. a. Die wesentlichste Aufgabe professioneller Hilfe beim supported living besteht dann darin, das bereits vorhandene soziale Netz auszubauen oder falls es, beispielsweise durch lange Institutionalisierung, nicht (mehr) vorhanden ist, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Dieses ist das zentralste Merkmal des Konzeptes. Es will in jedem Fall verhindern, dass Menschen aus ihren gewohnten Lebensbezügen herausgerissen werden und ihre vorhandenen Beziehungen und Aktivitäten nicht weitergeführt werden können (vgl. dazu Kap. 7.3).
"Um Selbstbestimmung realisieren zu können, müssen den Menschen echte Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen" (EMRICH 1999, 78). So müssen behinderte Menschen Zugang haben zu verschiedenen Bildungs-, Beschäftigungs-, Wohn- und Freizeitangeboten in der Gemeinde. Nur auf des Basis von Vorhandenem und Bekanntem können echte Entscheidungen getroffen werden. Es muss auch die Möglichkeit geben, neue Dinge ausprobieren und Entscheidungen auch wieder revidieren zu können. Zu solchen Wahlmöglichkeiten gehört auch, Unterstützungsleistende und eventuelle Mitbewohner(innen) selbst auswählen zu können. Dies ist in fast keiner derzeitigen Wohnform im Behindertenhilfesystem so vorgesehen.
Die meisten Wünsche der Nutzer(innen) sind allerdings gar nicht so ungewöhnlich und betreffen eigentlich selbstverständliche Dinge. "Sie wollen, was die meisten von uns wollen: einen Platz zum Leben, der warm, sicher und bequem ist, einen Arbeitsplatz, der ihnen gefällt und die Chance bietet, Menschen zu treffen und Geld zu verdienen sowie Freunde für gegenseitige Unterstützung und ein Gemeinschaftsleben" (WERTHEIMER 1997, 58)[27].
Kontrolle über das eigene Leben ist ein entscheidendes Ziel. Dabei benötigen manche Personen zwar Unterstützung, aber nur im Hintergrund und nicht so, dass sie die Kontrolle abnimmt. "Die unterstützetn Personen sind selbst Mieter und Eigentümer, verwalten ihre Finanzen und organisieren ihre Lebensführung" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 154).
Dieser Punkt wurde auch schon weiter oben bei der Definition des supported living erläutert, woran seine Wichtigkeit deutlich wird. Bisher ist es im Behindertenhilfesystem allerdings so, dass mit der Schwere der Behinderung auch die Wahrscheinlichkeit geringerer Wahlmöglichkeiten bezüglich der persönlichen Unterstützung wächst. Deshalb wäre das Konzept gerade für Personen mit schwereren Behinderungen ein Gewinn. Die Umgebung müsste angepasst und mehr individuelle Unterstützung bereitgestellt werden, denn "selbst wenn ich auf intensive Unterstützung angewiesen bin, habe ich das Recht, trotzdem selbst die in meinem Leben wichtigen Dinge zu entscheiden" (DOOSE 2000, 89). Eine schwere Behinderung darf kein Grund sein, nicht in der Gemeinde leben zu können.
[4] "Supported Living means providing people with disabilities the individualized help they need to live successfully in a home of their choice" (Übersetzung DM).
[5] "A person with a disability who requires long term, publicly funded, organized assistance allies with an agency whose role is to arrange or provide whatever assistance is necessary for the person to live in a decent and secure home of the person's own" (Übersetzung nach LINDMEIER & LINDMEIER 2000b).
[6] "The current focus in user choice, on enabling people to live in their own home with whatever support is needed, and on giving people more control over their own
lives is wholly consistent with the objectives of supported living" (Übersetzung DM).
[7] Your move ist ein schottisches Projekt zur Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihrer Familien. Es arbeitet nach dem supported living Konzept (vgl. SMITH & WILSON 1997).
[8] "People live in their own homes, not in service settings. People choose where to live: they are not placed. All means all; no-one is excludes from community living because of the level or type of support they need. People take up and maintain valued social roles as tenant and community member, rather than client or resident. Housing and personal assistance are offered and arranged separately allowing one to be changed without the other. The support is organized around the person, and moves with the person, rather than vice versa. People, their families and the professionals involved take more risks. There is a shift in the way staff work; staff people see themselves and are seen as standing beside people who use services, not as standing over them. Personal relationship, friends, family and other informal ways of supporting people are highly valued. Care involves caring about. There is a change in the relationship between staff and the community; staff are working 'out there', building maintaining connections - seeing their role less about fixing the person and more about finding ways to help them, be part of and included in community" (Übersetzung DM).
[9] "The term, person centred planning, refers to a family of approaches to organizing and guiding community change in alliance with people with disabilities and their families and friends" (Übersetzung DM).
[10] Übersetzung LINDMEIER & LINDMEIER 2001,40.
[11] "Weihnachten im Fegefeuer" (Übersetzung DM).
[12] "A series of class-action lawsuits directed at institutional conditions sent shock-waves throughout institutions in this country and transformed the face of services for people with developmental disabilities" (Übersetzung DM).
[13] "Because the Concept of normalization has become subject to so many interpretations, it no longer is as powerful as it once was as a guiding force for a change in society's treatment of people with disabilities" (Übersetzung DM).
[14] "The principle...was extremely forward-looking for its time. It emerged in an era in which persons with developmental disabilities and their families were offered segregation or nothing at all" (Übersetzung DM).
[15] "Full of pitfalls" (Übersetzung DM).
[16] "Today the major challenges revolve around the full Participation of people with disabilities and their families in community life, increased personal autonomy and choice, and the development of meaningful community life for all of us" (Übersetzung DM).
[17] "This means a fundamental discontinuity in the way people understand and respond to situation" (Übersetzung DM).
[18] "At the end of the twentieth century people are still being abused, neglected and living their whole life in institutions; behind walls that ordinary members of the community rarely, if ever, see over" (Übersetzung DM).
[19] "If you stand over people, assuming that you know best and that people with disabilities will be better off if they do what you say, you will miss the point of supported living. ... Only when you stand with people with developmental disabilities, recognizing their common humanity, honouring their desires to make a life for themselves, and struggling with them to create new opportunities, can you begin to understand supported living" (Übersetzung DM).
[20] "Fünf eng verbundene Dienstleistungs-Fähigkeiten" (Übersetzung DM).
[21] "Clearly defined accomplishments guide daily work in terms of purpose an vision" (Übersetzung DM).
[22] Übersetzung DM in Anlehnung an LINDMEIER & LINDMEIER 2000.
[23] "People will get necessary assistance to interpret their environment, to understand other people's expectations and conditions for cooperation, to figure out satisfying ways to pursue what they want, to communicate effectively, to negotiate conflicts, to limit risks, and to manage the good and bad consequences of their decisions" (Übersetzung DM).
[24] "People will get necessary assistance to locate and fill valued social roles in community settings, meet or change the ordinary expectations of other people in the settings, deal effectively with prejudiced or stereotyped responses from others, and present themselves positively" (Übersetzung DM).
[25] "How can we use our resources to assist the people who rely on us to live better lives" (Übersetzung DM.
[26] "Each person will have a unique and changing mix of personal assistance based on the person's preferences and needs as the person's preferences and needs emerge in the relationships" (Übersetzung DM).
[27] "...they want what most of us want: a place to live which is warm, safe and comfortable; a job which they enjoy and the chance meet people an earn money; and friends for mutual support and a social life" (Übersetzung DM).
Inhaltsverzeichnis
Bis hierher wurden in dieser Arbeit die Geschichte und die Entstehung des Konzepts der persönlichen Zukunftsplanung dargestellt. Im weiteren Verlauf soll es nun um die Praxis und Weiterentwicklung dieses Ansatzes speziell in Deutschland gehen.
Dabei ist zuerst einmal wichtig, die Verbreitung des Konzepts zu klären, was allein aufgrund der spärlichen Literaturlage nicht ohne weiteres möglich erscheint. Deshalb sind eigene Nachforschungen zu diesem Bereich notwendig. Weiterhin soll so in Erfahrung gebracht werden, wie der Ansatz in der Praxis genutzt wird und welche Zukunftsperspektiven es hierfür in Deutschland gibt.
Die Untersuchung hat also das Ziel:
-
Erkenntnisse über die räumliche Verbreitung zu gewinnen
-
lebensnahe, detaillierte Informationen über die Praxis von persönlicher Zukunftsplanung in diesem Land zu erhalten sowie
-
Anregungen für deren Weiterentwicklung zu bekommen.
Um Erkenntnisse über die Verbreitung und die Art der Nutzung von persönlicher Zukunftsplanung zu erhalten ist zunächst ein exploratives Vorgehen notwendig. Gemeint ist damit die "zielgerichtete Suche nach der Erkenntnis eines Objektes" (FRIEDRICHS 1980, 121). Eine umfangreichere Exploration in Form einer Pilotstudie (pilot study) ist besonders dann angezeigt, wenn, wie in diesem Fall, das Forschungsproblem noch nicht hinreichend bekannt ist, weil es beispielsweise wenig Literatur oder wenige Vorerhebungen gibt (FRIEDRICHS 1980, 121ff).
Bei einer Pilotstudie ist ein unsystematisches Vorgehen nötig, bei dem allen sich bietenden Anhaltspunkten nachgegangen wird, die Hinweise auf die Fragestellung geben könnten. So erhält man nach und nach einen Überblick und kann durch das offene Vorgehen immer wieder neue Ansatzpunkte für weitere Forschungsfragen erschließen.
Für den anschließenden Gewinn von praxisnahen, detaillierteren Informationen über die Umsetzung des Ansatzes der persönlichen Zukunftsplanung, soll durch die Ergebnisse dieser Studie Kontakt zu Personen entstehen, die Auskunft dazu geben können.
Hier ist einerseits die offene unsystematische Beobachtung eine angebrachte Forschungsmethode, die einen allgemeinen Eindruck der Situation, beispielsweise in einem Unterstützerkreistreffen ermöglicht (vgl. FLICK 2000, 152ff). Andererseits ist das qualitative Interview wichtig, um Personen über ihr Wissen zu befragen. Hier bietet sich besonders das Leitfadeninterview an, da es im Gegensatz zu standardisierten Interviews durch seine Offenheit den Interviewpartner(inne)n genügend Raum gibt, um eigene, der Forscherin eventuell noch unbekannte, Aspekte in das Gespräch einzubringen (vgl. FLICK 2000, 94). Andererseits bietet es aber durch den sogenannten Leitfaden - einem Fragenkatalog, an dem sich die Forscherin während des Interviews orientiert - mehr Struktur als narrative Interviews. So wird die Vergleichbarkeit zwischen den Interviews erhöht und das Gespräch auf ein bestimmtes Thema gelenkt (vgl. MAYRING 1993, 49).
Als eine Form des Leitfadeninterviews ist hier das sogenannte Experteninterview (MEUSER & NAGEL 1991) angezeigt, da alle interviewten Personen über exklusives Wissen verfügen, dass nicht jedem ohne weiteres zugänglich ist.
Bei diesem Interviewtyp interessiert der/die Befragte nicht in seiner ganzen Person, sondern "als Experte in einem bestimmten Handlungsfeld" (FLICK 2000, 109). Dem Leitfaden kommt dabei eine steuernde Funktion zu, da er unergiebige Themen ausschließen soll und das Gespräch auf die Themen lenkt, für die der Interviewpartner als Experte gilt (vgl. ebd.).
Der Leitfaden ist nach Ansicht von MEUSER & NAGEL auch notwendig, damit der/die Interviewer(in) sich als kompetente(r) Gesprächspartner(in) auf dem entsprechenden Sachgebiet präsentiert und zeigt, dass er/sie sich vorab mit dem Thema des Interviews auseinandergesetzt hat (1997, 286). Der Leitfaden sollte offen gehandhabt werden, um auf spontan auftretende zusätzliche Themenaspekte reagieren zu können und Nachfragen zu ermöglichen, wenn der Gesprächspartner einen an anderer Stelle des Interviews vorgesehenen Themenaspekt anschneidet. "Entscheidend für das Gelingen des ExpertInneninterviews ist unserer Ansicht nach eine flexible, unbürokratische Handhabung des Leitfadens im Sinne eines Themenkomplexes und nicht im Sinne eines standardisierten Ablaufschemas" (MEUSER & NAGEL 1997, 487).
Zum "Experten" wird jemand, bei dem die Forscherin Gründe zu der Annahme hat, dass ihm/ihr Sonderwissen über einen bestimmten Bereich zur Verfügung steht, welches nicht jeder beliebigen Person zugänglich ist. Dieses Wissen kann dem "Experten" einerseits klar und deutlich präsent sein, muss jedoch nicht unbedingt reflexiv verfügbar sein, sondern kann sich auch im Entscheidungsverhalten zeigen (vgl. MEUSER & NAGEL 1997, 485). Jemand kann Sonderwissen in seinem Arbeitsfeld, seinem Hobby, seinem Forschungsfeld oder in einem anderen Erfahrungsbereich haben. Ebenso kann aber auch jeder durch den Forscher zum Experten gemacht werden, indem er von ihm befragt wird. Der Expert(innen)begriff hat also im Rahmen von Experteninterviews eine doppelte Bedeutung "Der ExpertInnenstatus bestimmt sich zum einen in Abhängigkeit vom jeweiligen Forschungsinteresse. Eine rein methodologische Fassung reicht freilich nicht aus, sie bietet letztlich keine Hilfe bei der Frage, wo die für das Forschungsinteresse relevanten ExpertInnen zu suchen sind. M. a. W. die von der Forscherin vorgenommene Etikettierung einer Person als Experte bezieht sich notwendig auf einen im jeweiligen Feld vorab erfolgte und institutionell-organisatorisch zumeist abgesicherte Zuschreibung" (MEUSER & NAGEL 1997, 486).
Zur Auswertung der Interviews schlagen MEUSER & NAGEL sechs Schritte vor, die im folgenden verkürzt dargestellt werden sollen (vgl. 1991, 455ff):
Die Interviews werden auf Tonträger aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Nach MEUSER & NAGEL (1991, 455) ist eine vollständige Transkription nicht der Normalfall.
Unergiebige Textpassagen werden nicht wörtlich, sondern paraphrasiert wiedergegeben. Aufwendige Notationssysteme wie bei narrativen Interviews sind für diesen Interviewtyp nicht nötig, da Pausen, Stimmlagen u. ä. nicht Gegenstand der Interpretation sind (vgl. ebd.).
Der nächste Auswertungsschritt ist die Paraphrase, ein erster Schritt zur Verdichtung des Textmaterials. Hier werden die thematischen Einheiten des Interviews der Reihe nach zusammengefasst. Ob die Paraphrase einer Textpassage lang oder kurz ist, richtet sich nach der Relevanz für das Forschungsinteresse, nicht nach der Zeit, die der Interviewte verwendet. Eine Paraphrase lässt keinen angesprochenen Themenaspekt aus und orientiert sich protokollarisch am Ablauf des Interviews, so dass kein wichtiger Inhalt verloren geht.
Im nächsten Schritt werden die einzelnen Textpassagen mit Überschriften in der Terminologie der Interviewten versehen. Hier kann in den Prozessgehalt des Textes eingegriffen werden, das heißt, die Reihenfolge des Gesagten muss nicht erhalten bleiben. Mehrere Passagen können der gleichen Überschrift zugeordnet werden. Dieses ist möglich, da es sich um eine "bereichsspezifische Analyse handelt, die Analyse eines bestimmten Teils des Wissens des Experten, nicht aber des Lebenszusammenhangs der Person" (MEUSER & NAGEL 1991, 458).
Anschließend wird im nächsten Auswertungsschritt die einzelne Texteinheit verlassen, um zwischen den Interviews nach thematisch vergleichbaren Passagen zu suchen. Die entsprechenden Überschriften werden vereinheitlicht. Dieses ist eine weitere Verdichtung des Textmaterials, bei der Redundanzen getilgt werden können. Da aber bei einer Verdichtung immer die Gefahr besteht, dass einzelne Aspekte des Materials verloren gehen, ist eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Revision dieses Auswertungsschritts nötig (vgl. MEUSER & NAGEL 1991, 461).
In diesem Auswertungsschritt erfolgt nach MEUSER & NAGEL zum ersten Mal die Lösung von der Terminologie der Befragten. Die Themenpassagen werden in fachliche Kategorien eingeteilt, also gewählte Überschriften in die Fachsprache übersetzt.
In diesem Schritt werden nun die Ergebnisse dargestellt und interpretiert. Es werden Empirie und Theorie miteinander verbunden. Hier kann geprüft werden, ob gängige theoretische Erklärungen inadäquat sind, ob sie falsifiziert werden oder ob sie passen (vgl. MEUSER & NAGEL 1991, 465).
Im Vorfeld dieser Arbeit wurden eigene Nachforschungen angestellt, um einen besseren Überblick über die Verbreitung von persönlicher Zukunftsplanung in Deutschland zu bekommen. Aus der Literatur und aus Gesprächen war bekannt, dass einige Pädagoginnen und Pädagogen zu diesem Thema arbeiten. Inwieweit sich ihre Arbeit über das gesamte Bundesgebiet erstreckt, ließ sich nicht ermitteln. Da persönliche Zukunftsplanung beispielsweise für integrative Beschulung und beim Übergang von der Schule in den Beruf genutzt werden kann, wurden alle Landesverbände des Elternverbandes "GEMEINSAM LEBEN, GEMEINSAM LERNEN e.V." angeschrieben, der sich für gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern einsetzt. Außerdem stand eine Adressenliste aus einem Workshop "Persönliche Zukunftsplanung für Fortgeschrittene" zur Verfügung, die im Jahr 2000 mit JOHN O'BRIEN in Hamburg stattfand. Die Mitglieder dieses Workshops wurden nach ihrer weiteren Arbeit im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung gefragt.
Ebenfalls bekannt war, dass die Lebenshilfe als traditioneller Träger der Behindertenhilfe das Konzept im Rahmen ihrer Angebote nutzt. Deshalb wurden auch alle Landesverbände der Lebenshilfe angeschrieben.
Weiterhin wurden noch einzelne Personen oder Einrichtungen angefragt, mit denen bei einer allgemeinen Suche im Internet Kontakt ausgenommen werden konnte, wie beispielsweise die Hamburger Arbeitsassistenz, das Projekt "Wir vertreten uns selbst" von People First, die "Interessenvertretung selbstbestimmtes Leben" (IsL) in Kassel und die Lüneburger Arbeitsassistenz. Eine ausführliche Liste mit allen Adressen und Kontakten findet sich im Anhang dieser Arbeit.
Es wurde solange nach weiteren möglichen Auskunftsquellen gesucht, bis immer wieder ähnliche Antworten und Verweise auf die gleichen Personen zurückgesendet wurden. Dies wurde als Hinweis darauf genommen, dass mit den zur Verfügung stehenden Mitteln keine breitere Auskunftsbasis mehr zu erzielen war.
Die Recherche konnte wie erhofft dazu genutzt werden, um Interviewpartner(innen) zu gewinnen, die Auskunft über die Praxis von persönlicher Zukunftsplanung in Deutschland geben konnten.
Insgesamt wurden im Laufe der Untersuchung sechs Interviews geführt und ein Zukunftsplanungstreffen besucht. Außerdem stehen Unterlagen von einer persönlichen Zukunftsplanung und ein Film zur Verfügung.
In drei der Interviews wurden Pädagoginnen und Pädagogen befragt, die sich theoretisch mit persönlicher Zukunftsplanung beschäftigen oder die über Einblick in das Behindertenhilfesystem verfügen, also eine theoretische, praxisgesättigte Außensicht auf das Konzept haben. Die weiteren Interviews und das übrige Material stammt von Menschen mit Behinderungen, die über ihre Lebens- und Zukunftsplanungsgeschichten sowie ihre Vorstellungen von der Weiterentwicklung des Konzepts befragt wurden. Sie sind Expert(inn)en in eigener Sache und können von ihren Erfahrungen, Erlebnissen und Vorstellungen berichten.
Insofern ist die Auswertungsmethode aller Interviews gleich, die Ergebnisdarstellung erfolgt jedoch aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung in verschiedenen Kapiteln.
Nach einem ersten, meist schriftlichen Kontakt zu den Interviewpartnerinnen und -partnern wurden in mehreren Telefongesprächen konkrete Interviewtermine in der Wohnung oder am Arbeitsplatz der Befragten vereinbart. Der Ort des Interviews lag in der Wahl der Befragten. Es wurden die Ziele des Interviews vorab geklärt und ein Ausblick auf die Fragen gegeben.
Die Interviewtermine begannen mit einer Aufwärmphase, in der allgemeine Gespräche geführt wurden, der Weg zum Ort des Interviews gemeinsam zurückgelegt wurde, die Interviewten Fragen stellten und ihr Einverständnis für die Aufzeichnung und die anschließende Verwendung des Interviews gaben. Es lag in ihrem Ermessen, ob sie anonym bleiben wollen oder nicht. Aus Gründen der Vereinheitlichung wird jedoch jeder/jedem Interviewparter(in) in dieser Arbeit ein Name gegeben. Bei der ersten Verwendung und in der Transkription im Anhang findet sich ein Vermerk, ob der Name geändert wurde oder nicht.
Der verwendete Leitfaden enthielt verschiedene Fragen zu den Kategorien:
-
Kontakt/bisherige Tätigkeiten im Bereich persönliche Zukunftsplanung
-
Durchführung von Planungsprozessen
-
Probleme/Hindernisse/Notwendigkeiten bei Planungsprozessen und
-
Ausblick für die Situation in Deutschland.
Der Leitfaden wurde für jedes Interview etwas modifiziert, da in vorhergehenden Interviews neue Aspekte deutlich geworden waren und die Interviewpartner(innen) oft unterschiedliche Erfahrungen im Bereich der persönlichen Zukunftsplanung hatten.
Leider bestand hier aufgrund der wenigen Interviewpartner(innen) nicht die Möglichkeit eines Probeinterviews zur Überprüfung des Leitfadens, wie es in der Literatur empfohlen wird (z. B. MAYRING 1993, 48).
Anschließend wurden die Interviews transkribiert und nach den oben beschriebenen Schritten ausgewertet.
Es wurden folgende Transkriptionsregeln verwendet:
-
I: Interviewerin
-
Anderer Großbuchstabe: Interviewpartner(in)
-
Fettgedrucktes Fragen der Interviewerin
-
(Kursivgedrucktes in Klammern): Anmerkungen
-
... Sprung im Satz oder Pause
-
??? Unverständliches
Die vollständige Transkription ist bei Expert(inn)eninterviews nicht der Normalfall. Bei den in dieser Untersuchung geführten Interviews erschien sie jedoch notwendig, da kaum thematisch irrelevante Passagen auftraten.
Für die weitere Auswertung der Interviews ergaben sich folgende Kategorien:
-
Erstkontakt mit persönlicher Zukunftsplanung
-
Situation für persönliche Zukunftsplanung in Deutschland
-
Voraussetzungen für erfolgreiche Planung
-
Hindernisse für erfolgreiche Planung
-
Optimismus in der Literatur zu persönlicher Zukunftsplanung
-
Planungsgeschichten konkreter Personen
-
Initiative für Planung
-
Rolle von Professionellen in der persönlichen Zukunftsplanung
-
Soziales Netz
-
Entwicklungsperspektive in Deutschland
-
Persönliches Budget und
-
Einstellungsänderung in Bezug auf behinderte Menschen.
Die jeweiligen Kategorien entstanden teilweise aus dem Leitfaden und waren nicht alle in jedem Interview vorhanden, was sich mit den individuell unterschiedlichen Situationen der einzelnen Interviewpartner(innen) erklären lässt.
Der Schritt der "soziologischen Konzeptualisierung" entfällt bei einigen Interviews nahezu völlig, da Forscherin und Interviewpartner(innen) aus demselben Fachgebiet, nämlich der Sonderpädagogik stammen und so die einschlägige Fachsprache sprechen.
Die Ergebnisse der Interviews werden im 6., 7. und 8. Kapitel beschrieben, die Darstellung wird durch Literatur zum Thema ergänzt. Die Kategorien finden sich meistens in den Überschriften der Teilkapitel wieder, sind allerdings manchmal auch dort einbezogen, ohne explizit im Titel benannt zu werden. Eine solche Art der Ergebnisdarstellung entspricht nicht exakt der Vorgehensbeschreibung von MEUSER & NAGEL, erscheint aber aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit als sinnvoll. Die Beschäftigung mit der zitierten Literatur ging natürlich den Interviews und ihrer Auswertung voraus, da sie die Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens bildete.
Vor der Ergebnisbeschreibung werden allerdings noch einige Erfahrungen aus der Interviewdurchführung und -auswertung dargestellt, die eine Hilfe für weiterführende Untersuchungen sein können:
Es zeigte sich, dass vor Beginn der eigentlichen Interviews genügend Zeit für die "Aufwärmphase" (s. o.) eingeplant werden sollte. Nach dem Interview hatten die Interviewpartner(innen) meiner Erfahrung nach häufig noch das Bedürfnis für ein Nachgespräch. Es ist in einer solchen Situation also ungünstig, auf einen bestimmten Bus oder Zug angewiesen zu sein.
Gerade bei Interviewpartnern und -partnerinnen mit Behinderungen erscheint der erste Aspekt besonders wichtig. Dieses mag daran liegen, dass sie nicht so viele Erfahrungen darin haben, über ihre Ansichten und ihr Leben zu berichten und deshalb für sie Ruhe und Zeit für eine gute Gesprächsatmosphäre wichtiger sind, als bei Menschen, die darin geübt sind, quasi "auf Kommando" ihre Sichtweisen und Erfahrungen darzulegen. Andererseits befinden sich Menschen mit (insbesondere sogenannter geistiger) Behinderung und Nichtbehinderte selten in der Situation, ein symmetrisches Gespräch miteinander zu führen. Dies kann zu Unsicherheiten auf beiden Seiten führen, die vielleicht durch Aufbau einer persönlicheren Beziehungsebene sowie durch mehr Erfahrung mit dieser Gesprächsform abgebaut werden können.
Wenn die Interviewpartner(innen) nicht sofort auf eine Frage antworten, sondern diese nicht verstehen und nachdenken müssen, ist die Gefahr groß, dass die Forscherin die Ruhe verliert und der Interviewpartnerin Aussagen "in den Mund" legt. Dies ist in der vorliegenden Untersuchung beispielsweise in dem Interview mit DORIS HAAKE geschehen (z. B. Z. 176ff) und muss natürlich bei der Auswertung berücksichtigt werden: eine so entstandene Passage kann nicht dazu benutzt werden, eine wichtige These zu belegen. Mit zunehmender Übung und Ruhe der Forscherin wird die Bedeutung dieses Faktors jedoch geringer. Es entwickeln sich bestimmte Techniken, wie z. B. die Frage umzuformulieren oder mehrere Beispiele zu nennen, aus denen der Interviewpartner dann auswählen kann. Beispiele können auf Karten mit Wörtern oder Bildern sichtbar gemacht oder während des Interview auf Zettel geschrieben werden. Ganz lässt sich der Aspekt der Beeinflussung durch die Interviewerin jedoch nicht ausschalten. Andererseits liegt es natürlich auch in der Hand der Interviewpartner(innen), welche Information in welcher Auswahl und mit welcher Akzentuierung sie der Forscherin zukommen lassen, was ebenfalls - soweit möglich - in der Auswertung berücksichtigt werden muss. Dies wird zum Beispiel an dem Interview mit STEFAN DOOSE deutlich, der negative Informationen im Interview abschwächt. Als er beispielsweise von einer missglückten Zukunftsplanungsgeschichte berichtet, endet er mit dem Satz: "Aber immerhin, wir haben dann wieder angeknüpft und ich hab' den Eindruck, dass dann doch Sachen passiert sind" (Interview DOOSE Z. 267). Dies kann natürlich tatsächlich so sein, andererseits ist es aber ebenso gut möglich, dass dieser Satz eine reflexhafte Abschwächung des "Misserfolgs" darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Dieses Kapitel stellt nun die Ergebnisse der Pilotstudie dar. Im ersten Teil werden allgemeine Aussagen zur Verbreitung des Konzepts der persönlichen Zukunftsplanung in Deutschland erläutert, bevor im zweiten und dritten Teil zwei konkrete Beispiele vorgestellt werden, die bemerkenswert erscheinen.
(Ergänzung zur Datenerhebung im 2005 von Dorothee Meyer: An dieser Stelle sollte man bedenken, dass diese Untersuchung ein paar Jahre alt ist. Durch das People First Projekt zur persönlichen Zukunftsplanung hat sich der Ansatz weiter verbreitet.
Außerdem ist die Datenerhebung ist nicht als vollständig anzusehen, da nur ein Teil der Persnen, die persönliche Zukunftsplanung nutzen so vernetzt ist, dass er von der Recherche erfasst wurde. Daher ist auch für die Bundesländer, aus denen negative Rückmeldung kam, anzunehmen, dass persönliche Zukunftsplanung dort an einzelnen Orten bekannt ist und praktiziert wird.
Die persönliche Assistenzplanung von HamburgStadt, einem Bereich der Stiftung Alsterdorf, einem großen Anbieter in Hamburg, orientiert sich an der persönlichen Zukunftsplanung und wurde in dieser Arbeit kaum berücksichtigt (vgl. EVANGELISCHE STIFTUNG ALSTERDORF, HAMBURGSTADT 1997.))
Als Erstes werden in der folgenden Tabelle die Rückläufe der oben beschrieben schriftlichen Nachforschungen zusammengefasst. Es wird dargestellt, aus welchen Bundesländern und von welchen Lebenshilfeverbänden positive Rückmeldungen (d. h. Konzept "persönliche Zukunftsplanung" ist bekannt oder wird genutzt), negative Rückmeldungen (Konzept unbekannt) oder keine Antworten (leeres Feld) kamen.
Abb. 1: Antworten nach Bundesländern
|
Bundesland |
Sonstige Auskünfte |
Lebenshilfe |
|
Baden-Württemberg |
||
|
Bayern |
Positive Rückmeldung |
Positive Rückmeldung |
|
Berlin |
Negative Rückmeldung |
|
|
Brandenburg |
Negative Rückmeldung |
Negative Rückmeldung |
|
Bremen |
Positive Rückmeldung |
|
|
Hamburg |
Positive Rückmeldung von mehreren Seiten |
Positive Rückmeldung |
|
Hessen |
Positive Rückmeldung |
|
|
Mecklenburg-Vorpommern |
||
|
Niedersachsen |
Positive Rückmeldung, allerdings nur Lüneburger Arbeitsassistenz. Andere Rückmeldungen waren negativ |
|
|
Nordrhein-Westfalen |
||
|
Rheinland-Pfalz |
Positive Rückmeldung |
|
|
Saarland |
Negative Rückmeldung |
|
|
Sachsen |
Negative Rückmeldung |
|
|
Sachsen-Anhalt |
||
|
Schleswig-Holstein |
Positive Rückmeldung |
Negative Rückmeldung |
|
Thüringen |
Negative Rückmeldung |
Das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung ist also in Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bekannt. Hier kann allerdings auch nicht von einer umfassenden Verbreitung gesprochen werden, da lediglich Einzelpersonen geantwortet haben. In Niedersachsen beispielsweise habe ich außer von der Lüneburger Arbeitsassistenz, die nach eigenen Angaben das Konzept praktiziert, noch drei negative Rückmeldungen bekommen. Dieses könnte in den anderen Bundesländern ähnlich sein, wenn hier Rückmeldung von mehreren Seiten gekommen wäre.
Eine Sonderstellung nimmt Hamburg ein. Hier habe ich von mehreren Seiten die Auskunft bekommen, dass im Umkreis der Hamburger Arbeitsassistenz, der Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstütze Beschäftigung und der Lebenshilfe persönliche Zukunftsplanung eine relativ häufig praktizierte Methode ist.
Aus den Bundesländern mit negativer oder keiner Rückmeldung ist davon auszugehen, dass persönliche Zukunftsplanung hier zumindest nicht umfassend verbreitet ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Methode dort im Einzelfall bekannt ist und auch praktiziert wird. Diese Vermutung wird durch eine telefonische Auskunft von SUSANNE GöBEL unterstützt, wonach zu diesem Thema angebotene Seminare relativ gleichmäßig auf das ganze Bundesgebiet verteilt sind.
Insgesamt wurde bei den Antworten immer wieder an die gleichen Personen verwiesen. Es existiert offenbar eine kleine Gruppe von Pädagogen und Pädagoginnen, die sich für die weitere Verbreitung dieses Konzepts einsetzen, indem sie Seminare und Vorträge bei verschiedenen Trägern dazu anbieten (siehe beispielsweise die Seminarausschreibung im Internet: IsL E-Mail News Service, 2002) sowie vereinzelt Veröffentlichungen herausgeben, was auch aus der von mir verwendeten Literatur deutlich wird. Dieses sind zum einen STEFAN DOOSE, CAROLIN EMRICH und SUSANNE GöBEL, die zusammen Tagungen leiten und recht genau über die Arbeit der anderen informiert sind. Zum anderen arbeitet INES BOBAN, mit Unterstützung durch ANDREAS HINZ zu diesem Thema, indem sie Unterstützerkreistreffen moderieren, Tagungen leiten und einen Artikel veröffentlicht haben (BOBAN & HINZ 2000). Teilweise wurden auch mehrere meiner Anfragen an eine dieser Personen weitergeleitet. Schon bei meinen ersten Recherchen bin ich auf diese Namen gestoßen, so dass man bei Interesse am Thema "persönliche Zukunftsplanung" relativ schnell die Chance hat, auch kompetente Ansprechpartner(innen) zu finden. Diese haben alle untereinander regelmäßigen Kontakt und wissen gegenseitig von ihrer Arbeit, so dass sich in Deutschland ein kleines Netzwerk gebildet hat, das sich aber meines Wissens nach in den letzten zwei Jahren nicht vergrößert hat.
Im Moment scheint es also in Deutschland erste Versuche mit persönlicher Zukunftsplanung zu geben, es kann aber kaum von einer fortschreitenden Verbreitung des Konzepts ausgegangen werden. Solche ersten Versuche finden in den oben erwähnten Seminaren und in vielen vereinzelten, teilweise von den jeweils gleichen Personen ehrenamtlich moderierten Zukunftsplanungen statt. Dieses geht aus den beschriebenen Fallbeispielen in BOBAN & HINZ (1999) und BROS-SPäHN (o. J.) hervor.
Um genauere Auskünfte über die Praxis persönlicher Zukunftsplanung in Deutschland zu bekommen, als es aufgrund der spärlichen Literaturlage möglich ist, wurde die Recherche bezüglich der Bekanntheit des Konzepts auch als Möglichkeit genutzt, Interviewpartner(innen) zu finden. Immer wenn eine positive Rückmeldung oder ein Hinweise auf eine Person kam, wurde nach Interviewbereitschaft gefragt. Alle oben genannten Personen reagierten darauf positiv. Aufgrund meines Wohnortes und des begrenzten Umfanges meiner Arbeit entschied ich mich für zwei Interviewpartner(innen) aus diesem Kreis, und zwar für STEFAN DOOSE aus Lübeck und CAROLIN EMRICH aus Bremen, die beide noch weitere Kontakte zu drei Personen vermittelten, die für sich eine Zukunftsplanung gemacht haben, in dieser Arbeit aber anonym bleiben wollen. Ihre Geschichten werden mit veränderten Namen im 8. Kapitel erzählt.
STEFAN DOOSE hat früher in Hamburg bei der BAG UB[28] gearbeitet und lernte das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung im Rahmen von unterstützter Beschäftigung bei einem Studienaufenthalt in den USA kennen. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland versuchte er, diese neu kennen gelernten Methoden, Einstellungen und Arbeitsweisen hier weiter zu verbreiten. Dies geschah einmal im Rahmen der BAG UB, daneben durch Seminare und Tagungen zum Thema persönliche Zukunftsplanung in Deutschland und Österreich (vgl. Interview DOOSE, Z. 1ff).
CAROLIN EMRICH lernte das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung im Rahmen ihres Pädagogikstudiums an der Universität Bremen kennen und schrieb auch ihre Diplomarbeit zu diesem Thema. Sie absolvierte ein Praktikum bei der BAG UB und begann darüber ebenfalls Seminar- und Tagungstätigkeit zum Thema persönliche Zukunftsplanung (vgl. Interview EMRICH, Z. 1ff). Beide beschäftigen sich auch jetzt noch nebenberuflich mit diesem Themenkomplex.
Über die Hamburger Arbeitsassistenz wurde der Kontakt zu DORIS HAAKE hergestellt, der Vorsitzenden von People First-Hamburg und People First-Deutschland, die sich ebenfalls dazu bereit erklärte, von ihrer Zukunftsplanung und den Perspektiven in Deutschland zu erzählen. Um noch von einer Person außerhalb der eben beschriebenen Gruppe Auskünfte bezüglich ihrer Einschätzung des Konzepts der persönlichen Zukunftsplanung zu erhalten, das ihr bis zum Interviewzeitpunkt nicht bekannt war, wurde FRAUKE SANDER (Name geändert) befragt, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet und dort Mitarbeiter(innen) in Praktikumsplätze und Arbeitsverhältnisse auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Der Kontakt zu ihr entstand über ein Seminar an der Universität Oldenburg.
Von der Lebenshilfe kam positive Rückmeldung aus Bayern und Hamburg. In Hamburg wird persönliche Zukunftsplanung im Rahmen des Programms "pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum" genutzt. In Bayern ist über die dortige Verwendung des Konzepts nichts bekannt. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe bietet in regelmäßigen Abständen Seminare mit den oben genannten Referent(innen) zum Thema persönliche Zukunftsplanung an (siehe beispielsweise die Seminarausschreibung in Internet: INFORM 2002).
Zwei Umsetzungen in der Praxis, auf die ich bei meiner Suche im Internet gestoßen bin, sollen an dieser Stelle näher erwähnt werden.
Der "Fachdienst Lüneburger Arbeitsassistenz" hat die Aufgabe Menschen mit geistiger Behinderung oder mit einer Lernbehinderung auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dazu wird zunächst ein Bewerber(innen)profil mit den Stärken, Ressourcen und Einschränkungen der einzelnen Personen erstellt. Anschließend wird nach geeigneten Arbeits- und Praktikumplätzen gesucht.
Diese Planung ist genereller Bestandsteil der Arbeit im Rahmen der Arbeitsassistenz.
Seit Anfang dieses Jahres (vgl. GäBLER 2002, 3) wird diese Arbeit jedoch von einem für jede(n) Bewerber(in) ins Leben gerufenen Unterstützerkreis begleitet. Dieser Kreis besteht aus Personen, die dem einzelnen Bewerber nahe stehen. Er dient der persönlichen, insbesondere der beruflichen Zukunftsplanung dieser Personen (vgl. LüNEBURGER ASSISTENZ 2002, 1). Es handelt sich hier also nicht um eine persönliche Zukunftsplanung im umfassenden Sinne, die alle Lebensbereiche betrifft, sondern es wird lediglich über die berufliche Zukunft nachgedacht. Trotzdem sind hier aber zwei wesentliche Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung von persönlicher Zukunftsplanung gegeben: es wird ein Unterstützerkreis gebildet, der das soziale Umfeld mit einbezieht, und es gibt einen neutralen Moderator, der unabhängig von den Institutionen ist, die Hilfemöglichkeit für die Jugendlichen bieten können.
Bei den Planungstreffen der Lüneburger Assistenz werden sechs Planungsschritte durchlaufen, die im folgenden kurz dargestellt werden:
-
"Lebensqualität (Was macht für dich Lebensqualität aus (Freizeit, Freunde, Wohnen, Arbeit)? Was ist wichtig? Was ist gut? Was fehlt noch? Was willst du nicht?)
-
Ziele (Ziele für dieses Jahr; Ziele in drei Jahren; Ziele in fünf Jahren)
-
Stärken, Fähigkeiten und Interessen (Was kannst du gut? Was interessiert dich? Was kannst du nicht so gut? Beispiele geben)
-
Berufliche Zielvorstellungen (Welche Vorerfahrungen, Praktika und Jobs sind vorhanden? Welche Wünsche bestehen? Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden?)
-
Ableitung (Mögliche Praktikumsstellen/Arbeitsstellen? Welche Unterstützung brauchst du von wem?)
-
Aktionsplan: (Planung der einzelnen Schritte. Absprachen treffen. Folgetreffen)" (GäBLER 2002, 2f.).
Die Unterstützerkreise treffen sich bei Bedarf in (un)regelmäßigen Abständen wieder und begleiten die weitere Berufsfindungs- und Berufseinführungsphase.
Das Pilotprojekts SPAGAT bezieht sich zwar auf Österreich, trotzdem soll es hier kurz erwähnt werden, da es die Idee der persönlichen Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen sehr konsequent umgesetzt hat. Auf eine ausführliche Beschreibung soll an dieser Stelle allerdings verzichtet werden. Das Modellprojekt war auf zehn Jugendliche begrenzt und startete im Herbst 1997 mit einer dreijährigen Laufzeit (vgl. Emrich 1999, 134). Sein Ziel war, die berufliche Eingliederung von Schulabgänger(inne)n mit schweren Behinderungen zu erproben. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Landes Vorarlberg und des Europäischen Sozialfonds. Bei der Umsetzung und Entwicklung arbeiteten das Institut für Sozialdienste, die Schulbehörde, "Integration Vorarlberg", das Land Vorarlberg sowie die Lehrerinnen und Eltern der Jugendlichen mit Behinderung eng zusammen. Ziel des Projekts war es, "auch für jene Jugendlichen, die nach dem Schwerstbehinderten-Lehrplan unterrichtet wurden, eine Arbeit bzw. eine sinnvolle Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden um ihnen zu ermöglichen, gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung in ihrem regionalen Umfeld zu arbeiten und zu leben" (NIEDERMAIR, 1998, 1).
Um diese Ziele zu erreichen wurde bereits vor Ende der Schulzeit in der sogenannten Eingliederungsphase ein Unterstützerkreis für jeden der acht am Projekt teilnehmenden Jungendlichen ins Leben gerufen, der mit den Methoden der persönlichen Zukunftsplanung die nächsten Schritte zum Übergang von der Schule in den Beruf plante und über längere Zeit begleitete. Anschließend wurden Praktikumplätze und mögliche spätere Arbeitsplätze gesucht. Zur weiteren Beschreibung und zu konkreten Umsetzungsbeispielen vergleiche NIEDERMAIR & TSCHANN (1999a und 1999b). Inzwischen ist das Projekt abgeschlossen und SPAGAT ist nach Auskünften von CLAUDIA NIEDERMAIR und ELISABETH TSCHANN zu einem normalen Angebot der Behindertenhilfe in Vorarlberg geworden. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 30 unterstützte Arbeitsplätze, und ca. 20 Jugendliche befinden sich zur Zeit in der Eingliederungsphase.
[28] Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung. Für weitere Informationen siehe www.bag-ub.de.
Inhaltsverzeichnis
- 7.1 Wann ist eine persönliche Zukunftsplanung angebracht?
- 7.2 Initiative für eine Zukunftsplanung und Anzahl der Treffen
- 7.3 Der Unterstützerkreis
- 7.4 Ablauf der Treffen und das weitere Vorgehen
- 7.5 Methoden für den Planungsprozess
- 7.6 Soziales Netz
- 7.7 Safeguards for MAPS and PATH
- 7.8 Hindernisse für erfolgreiche Zukunftsplanung und deren Umsetzung sowie Lösungsmöglichkeiten
- 7.9 Voraussetzungen für erfolgreiche Planung und Umsetzung
Im folgenden Kapitel wird der Ablauf von persönlichen Zukunftsplanungsprozessen dargestellt. Die Aussagen der Literatur werden durch Zitate aus den Interviews mit STEFAN DOOSE, CAROLIN EMRICH und FRAUKE SANDER illustriert. Die Interviews bieten wichtige Anhaltspunkte für Praxis und Merkmale persönlicher Zukunftsplanung, weshalb häufig aus ihnen zitiert wird. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sind Zitate aus den Interviews sind im Gegensatz zu Literaturzitaten eingerückt.
Persönliche Zukunftsplanung ist ein Methodenkomplex, der Ende der 80er Jahre in den USA entstanden ist und sich dazu eignet, mit anderen gemeinsam über die eigene Zukunft nachzudenken, Ziele zu beschreiben und diese zu realisieren (vgl. DOOSE 2000, 74). Wie schon oben erwähnt, kann persönliche Zukunftsplanung beispielsweise in den Bereichen Bildung und Schule, Arbeit, Freizeit oder Wohnen stattfinden (vgl. DOOSE 2000, 83).
Die dabei entwickelte Unterstützung überwindet die Beschränkung auf "die übliche lebensabschnittsbezogene Versorgung und Förderung und wird zu einer lebensbegleitenden Unterstützung" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 158).
Sie ist besonders dann angebracht, wenn eine Person in einem oder mehreren der genannten Bereiche mit ihrem Leben unzufrieden ist und sich eine Veränderung wünscht. Ein weiterer Grund für persönliche Zukunftsplanung ist eine unklare Zukunftsperspektive. Dies ist besonders dann der Fall, wenn eine Person mit Behinderung vor dem Übergang von einer Lebensphase in eine andere steht - beispielsweise aus der Familie in den Kindergarten, von der Schule in den Beruf, vom Wohnen in der Familie zum Wohnen in einer eigenen Wohnung - und dabei nicht auf die traditionellen Möglichkeiten zurückgreifen will, die das gestufte Behindertenhilfesystem bietet. Gerade wenn "der Wunsch da ist, die klassische ‚Behindertenkarriere', das lückenlose, oftmals vorausbestimmte Durchlaufen der Sondereinrichtungen zu durchbrechen, [muss] die Zukunft sehr viel flexibler gedacht, geplant und gestaltet werden" (GEMEINSAM LEBEN - GEMEINSAM LERNEN 2002, 1).
Übergänge dieser Art "tragen stets das Potential krisenhafter Entwicklungen in sich, zumal für Menschen mit Behinderungen im Kontext integrativer Orientierung, da hier die traditionellen Wege wenig gefragt und Alternativen noch nicht etabliert sind. Hier ist der Bedarf an sich gegenseitig stützenden problemlösenden Kreisen groß" (BOBAN & HINZ 1999, 2).
So sind Unterstützerkreise nicht nur für die Personen mit Behinderungen eine Hilfe, sondern gerade, wenn es sich noch um Kinder oder Jugendliche handelt, auch für deren Eltern, die nicht für die Integration ihrer behinderten "Kinder gekämpft [haben], damit sie danach eine Tagesförderstätte oder beschützende Werkstatt besuchen" (BROS-SPäHN o. J., 1) (vgl. Kap. 8.1 Geschichte von MAIK).
In Schulen kann das Konzept auch zur Berufsorientierung benutzt werden, was VON DANIELS in ihrem Artikel folgendermaßen bewertet: "Theoretisch erscheint das Verfahren geradezu ‚idealtypisch' für Prozesse der Berufsorientierung zu sein, und tatsächlich erweist sich in der Praxis der Einsatz der klassischen Zukunfts-Planungs-Konferenz - sowie entsprechender Verfahren - als klare Orientierungs- und Diagnosehilfe im Sinn von Fähigkeitsanalyse für alle Beteiligten" (VON DANIELS 1998, 2).
Obwohl es bei persönlicher Zukunftsplanung um die planende Person geht und diese den Ablauf selbst bestimmen sollte, ist es in der Realität oft so, dass die Initiative für einen Planungsprozess von jemand anderen ausgeht, beispielsweise von den Eltern, einem/einer Bezugsbetreuer(in) oder anderen Menschen aus dem Umfeld. Dies liegt vermutlich daran, dass die Methode mit ihren Möglichkeiten in Deutschland so unbekannt ist. DOOSE bestätigt dies im Interview:
"Ja, die Person selbst muss ja erst mal davon wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also es ist schon ... meistens irgendjemand [da], der davon erzählt" (Interview DOOSE, Z. 345f).
Wenn die Methode im Umfeld eines Menschen mit Behinderung aber erst einmal bekannt sei, dann gehe die Initiative auch häufig von der Person selbst aus:
"Wenn es zum Beispiel innerhalb einer Einrichtung üblich wird, ... [sagen Personen oft]: ‚Das will ich auch gerne. ... Wann bin ich denn endlich mal dran?'" (Interview DOOSE, Z. 349f).
Nach Ansicht von CAROLIN EMRICH ist es schwer, die Zielgruppe der Seminare zu erreichen. Ausschreibungen dazu werden oft an die Einrichtung geschickt, die diese dann erst weitergeben muss, was oft aus verschiedenen Gründen unterbleibt (Interview EMRICH, Z. 107ff).
Menschen mit Behinderungen sind also auf Personen in ihrem Umfeld angewiesen, welche die Methoden der persönlichen Zukunftsplanung kennen und dem Konzept wohlgesonnen gegenüber stehen. Das können Professionelle sein - wie im Beispiel von MAIK, THORSTEN (Namen geändert) und DORIS HAAKE - oder Selbsthilfegruppen von Betroffenen, wie es bei JANA & ANSGAR (Namen geändert) der Fall war. Sie hörten zum ersten Mal in der People First-Gruppe ihrer Stadt von den Methoden persönlicher Zukunftsplanung. MAIK Vater ist Mitglied einer Elterngruppe für schulische Integration und versucht dort, das Konzept mit seinen Vorteilen bekannter zu machen (vgl. Kap. 8.1).
Die Anzahl der Treffen zur Zukunftsplanung ist individuell verschieden. Verständlicherweise sind bei Menschen mit schwereren Behinderungen meistens mehr Treffen nötig, als bei denjenigen, denen ihre Wünsche und Bedürfnisse deutlich vor Augen stehen und die diese auch klar äußern können.
Allerdings sind meiner Meinung nach recht regelmäßige Treffen wichtig, da nur so der Prozess der Umsetzung angemessen begleitet und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden kann, wenn Probleme auftreten oder man nicht mehr weiter weiß.
In den von meinen Interviewpartnern geleiteten Seminaren gibt es meines Wissen nach lediglich ein Planungstreffen. Die Umsetzung wird dann von der planenden Person und einer weiteren Unterstützungsperson übernommen. In dem von THORSTEN (vgl. Kap. 8.4) besuchten Seminar findet nach einem Jahr ein Folgeseminar statt, bei dem die Ergebnisse überprüft werden.
Damit ein Mensch seine Zukunft nicht alleine auf sich gestellt gestalten muss, ist im Konzept der persönlichen Zukunftsplanung "der Gedanke sogenannter Unterstützerkreise verankert" (EMRICH 1999, 82).
Unterstützerkreise nehmen bei der Planung und Realisierung von persönlichen Lebensvorstellungen und -zielen eine zentrale Rolle ein (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 157). In diesen Kreisen treffen sich Verwandte, Freunde und Professionelle, die eine besondere Bindung an die planende Person haben und denken gemeinsam mit ihr über eine wünschenswerte Zukunft nach. So entsteht eine Vielfalt von Perspektiven anstatt eines einseitigen Blickwinkels auf den Planenden. Es kann zum Beispiel sein, dass Schulkameraden Dinge über ihre(n) Mitschüler(in) wissen, die den Eltern völlig unbekannt sind. Diese informellen Kontakte zu Schulkameraden, Nachbarn und Freunden haben im Konzept der persönlichen Zukunftsplanung deshalb sowohl bei der Planung als auch bei der späteren Umsetzung einen hohen Stellenwert (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 46). Menschen aus dem persönlichen Umfeld der Betroffenen können nämlich auch einen Teil der notwendigen Unterstützung erbringen. Sie können sich zum Beispiel nach Praktikumsplätzen erkundigen, bei der Wohnungssuche helfen, Unterstützung bei Freizeitgestaltung oder im Haushalt erbringen, sich zum Zusammenwohnen in einer Wohnung gegen Mietfreiheit und ein geringes Entgelt entschließen und ähnliches mehr. Es wird davon ausgegangen, dass für solche natürlichen Unterstützungsmöglichkeiten (natural support) kein pädagogisch qualifiziertes Fachpersonal notwendig ist, sondern dass es sich um Nachbarschaftshilfe oder Freundschaftsdienste handelt, die jeder Mensch in seinem Leben benötigt (vgl. O'BRIEN & O'BRIEN 1991, 40).
"Bezahlte Hilfe wird nur dann genutzt, wenn natürliche und informelle Unterstützungsmöglichkeiten nicht verfügbar sind" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 155). Das heißt natürlich nicht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Familien keine professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen sollen oder dass fachlich qualifiziertes Personal überflüssig wird (vgl. KRüGER 2000, 122 & EMRICH 1999, 123). Es muss auch professionell weiter an der Entlastung der Familien gearbeitet werden, und sie dürfen natürlich nicht mit ihren Problemen allein gelassen werden. "Allerdings müssen Angehörige stärker einbezogen werden und Verantwortung übernehmen dürfen. Die Verantwortung für die Betreuung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen liegt entweder ausschließlich bei den Familien oder ausschließlich bei der Institution, in der der betreffende Mensch lebt" (LINDMEIER 2002a, 14, Hervorh. im Original). Persönliche Zukunftsplanung kann für die Angehörigen einen Weg bieten, den Einfluss zu haben, den sie sich wünschen (vgl. O'BRIEN & LOVET 1992, 10).
Die benötigte Unterstützung wird meistens durch eine Kombination von professioneller und informeller Unterstützung erbracht (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 158). Professionelle Unterstützung sollte sich dabei aber eher im Hindergrund abspielen. Vor allem im Planungsprozess sollten sich professionelle Mitglieder des Unterstützerkreises zurücknehmen und nicht die Richtung der Planung bestimmen. "Die Person im Zentrum der Planung und diejenigen, die diese Person lieben, sind die höchsten Autoritäten was die Richtung der Lebensplanung angeht" (O'BRIEN & LOVET 1992, 5)[29].
Im Zusammenhang mit Formen der informellen Unterstützung wird oft kritisch gefragt, ob überhaupt jemand bereit sei, sich in so einem Kreis zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und verbindlich bestimmte Formen der Unterstützung zu erbringen. PETERSON schreibt dazu, dass Menschen dazu oft bereit sind, "... wenn es klar ist, dass sie nicht die ganze Verantwortung für einen Menschen tragen, sondern dass diese in der Gruppe aufgeteilt wird" (1996, 59f)[30].
Auch in Bezug auf das Engagement eines Professionellen in einem Unterstützerkreis stellt sich die Frage nach der Bereitschaft. Die Planungstreffen liegen häufig außerhalb der Arbeitszeit und sind somit eine unbezahlte und zusätzliche zeitliche Belastung. Dies hat natürlich zur Folge, dass niemand aufgrund seines Arbeitsvertrags zum Engagement in einem Unterstützerkreis gezwungen werden kann. Das hat den Vorteil, dass sich nur Professionelle zur Mitarbeit bereit erklären, die der Methode aufgeschlossen gegenüberstehen und ein wirkliches Interesse an der planenden Person haben.
STEFAN DOOSE hat die Erfahrung gemacht, dass
"sich immer wieder engagierte Leute finden lassen, die so was spannend finden ... [und] sich darauf einlassen können, ... [die] das zwar schon als eine zeitlichen Belastung erleben, aber auch als eine ungeheure Bereicherung, wenn sie merken, dass sie etwas bewirken können" (Interview DOOSE, Z. 431ff).
Auch FRAUKE SANDER würde sich in einem Unterstützerkreis engagieren. Sie antwortet auf die Frage nach ihrer Bereitschaft:
"Ich würde auf jeden Fall ja sagen, weil, [ich] an so was ... auf jeden Fall ein Interesse [habe] und mir ... meine Arbeit hier auch sehr am Herzen [liegt]. Bloß, [ich würde mich] immer als professionelle Kraft ... sehen. ... In der Freizeit [kann man aber] mal noch wieder andere Brücken schlagen" (Interview SANDER, Z. 306ff).
Informelle Gruppen mit Menschen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen sind keinen institutionellen Denkvorschriften unterworfen. Sie können deshalb oft kreativer sein und Lösungen erfinden, die dem professionellen Personal, welches in Kategorien institutioneller Hilfesysteme denkt, oft nicht mehr einfallen (vgl. EMRICH 1999, 88).
"[Die Personen, die informelle Unterstützung leisten, sind DM] ... offener und kreativer. Vielleicht auch dadurch, dass sie einfach dieses System ... in der Behindertenhilfe nicht kennen. Die wissen nicht, wo man sich da vielleicht noch hinwenden kann. [Das] müssen sie erst mal erforschen, aber darin liegt ja auch eine Chance" (Interview EMRICH, Z. 202ff).
Deshalb ist es auch gerade für Menschen, die lange institutionalisiert waren, wichtig, nach Mitgliedern für den Unterstützerkreis zu suchen, die nicht im Hilfesystem verankert sind, auch wenn der Kontakt zu den Betroffenen zunächst nicht sehr eng ist. "Wenn der Kreis sich nicht natürlich geformt hat, müssen wir einen Weg finden, dies möglich zu machen" (SMITH &WILSON 1997, 27)[31]. Sind im Umfeld keine Personen dieser Art vorhanden, können eventuell solche dem Unterstützerkreis beitreten, die sich freiwillig für jemanden engagieren wollen, auch wenn sie diese vielleicht (noch) nicht kennen. Hierzu könnten Sammelstellen für die Adressen von Freiwilligen geschaffen werden, an die sich ein lediglich aus Professionellen bestehender Unterstützerkreis dann wendet.
Persönliche Zukunftsplanung kann aber auch ohne Unterstützerkreis stattfinden, wenn die planende Person dies wünscht. Gründe dafür können zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern sein, die sonst häufig Mitglieder eines solchen Kreises sind, oder die Angst, dass sehr intime Probleme nach außen getragen werden. Dies war zum Beispiel bei der Planung von JANA & ANSGAR der Fall (vgl. Kap. 8.2). Ein anderer Grund für die Nichteinbeziehung des Umfeldes kann darin liegen, dass dieses der Methode der persönlichen Zukunftsplanung ablehnend gegenübersteht und eine Planung durch Äußerungen wie: "Das kannst du sowieso alles nicht" behindert wird (vgl. Interview EMRICH, Z. 188ff). In solchen Fällen ist es natürlich wichtig, auf die individuelle Situation der jeweiligen Personen Rücksicht zu nehmen und eine Planung anders zu ermöglichen.
"Aber wenn die [das Umfeld DM] nicht da sind oder wenn sie bewusst von Personen ausgeblendet werden, dann glaube ich trotzdem, dass es [persönliche Zukunftsplanung DM] funktionieren kann. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es irgendwo Anlaufstellen gibt, wo Leute sich hinwenden können, wenn sie eine Zukunftsplanung ganz bewusst mit Leuten planen und umsetzen wollen, die sie mal nicht kennen" (Interview EMRICH, Z. 185ff).
Es muss aber gewährleistet sein, dass es zumindest eine(n) Ansprechpartner(in) im Umfeld gibt, die sich - neben der unterstützen Person - für die Umsetzung des Plans verantwortlich fühlt. Das ist meistens die Moderatorin des Planungstreffens (vgl. Kap. 7.4) oder eine besonders nahstehender Mensch, wie der Vater oder die Mutter, wie im Beispiel von MAIK (vgl. Kap. 8.1).
Generell kann aber die Wichtigkeit eines Unterstützerkreises nicht überschätzt werden. Diese Kreise mit der starken Betonung auf der Unterstützung aus dem Umfeld und ihrer Personenbezogenheit sind meiner Meinung nach das, was persönliche Zukunftsplanung fundamental von anderen Formen der Hilfeplanung unterscheidet.
In Deutschland wird persönliche Zukunftsplanung entweder vereinzelt oder in Seminaren praktiziert. In Seminaren wird nach Auskunft von CAROLIN EMRICH ohne Unterstützerkreise, im Normalfall mit lediglich einer Unterstützungsperson gearbeitet. Diese sind meistens Bezugsbetreuer, Freunde oder Angehörige, in Ausnahmefällen auch andere. CAROLIN EMRICH nennt als Beispiel eine Haushaltshilfe, die ein Seminarteilnehmer für seine individuelle Unterstützung eingestellt hat. Diese Person war für ihn so wichtig, dass er sie auch für seine Zukunftsplanung einbezogen hat (vgl. Interview EMRICH, Z. 80ff).
Planungen in Seminaren werden von Leitern und Leiterinnen moderiert, die später nicht mehr zur Verfügung stehen. Also liegt die Verantwortung für Planung und Umsetzung lediglich bei zwei Personen, nämlich der planenden Person und einer Unterstützung.
CAROLIN EMRICH weist darauf hin, dass häufiger sogar die alleinige Unterstützungsperson nicht frei gewählt wird oder dass eine einzige Unterstützungsperson für zwei Planungen und deren Umsetzung verantwortlich ist:
"[Wir] haben ihnen immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass sie das selbst bestimmen, wer da mitkommt und mitunter ist ihnen das nicht geglückt. ... Da gab es die irresten Argumente, wo wir dann auch zum Teil noch mal hinterhertelefoniert haben, wenn ... das eigentlich nicht die Person war, die jemand dabeihaben wollte. ... Zwei oder drei TeilnehmerInnen kamen aus dem gleichen Ort und dann wurde nur eine Person mitgeschickt, [aus] kostenersparenden Gründen" (Interview EMRICH, Z. 87ff).
In einem solchen Fall ist das oben beschriebene Risiko des Scheiterns natürlich noch deutlich höher.
Die Bedeutung des Unterstützerkreises bei persönlicher Zukunftsplanung steigt mit der Schwere der Behinderung der planenden Person. "Je weniger Sprachvermögen und Lebenserfahrungen (beispielsweise aufgrund langjähriger Institutionalisierung) bei dem Unterstützten vorhanden ist, desto wichtiger wird die Rolle des Unterstützungskreises. Er übernimmt somit die Entwicklung von Zukunftsvisionen, wie sie ein körperbehinderter Mensch allein mit Hilfe von ‚peer counseling' oder durch Beratung im Freundeskreis entwickelt" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 157).
"Bei Personen, die sich verbal nicht äußern können, bleibt das Dilemma stellvertretender Voten und Entscheidungen bestehen" (BOBAN & HINZ 1999, 3). Es wird allerdings durch die Vielfalt der Perspektiven im Unterstützerkreis gemildert. Bei sehr schwer behinderten Menschen sind dann häufigere Treffen notwendig, in denen gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Diese werden dann ausprobiert und in nachfolgenden Treffen reflektiert.
DOOSE sagt zu diesem Thema:
"Bis zu einem gewissen Grad ist es dann vielleicht auch eine Sache, mit der man leben muss und es ist vielleicht besser, wenn mehrere Menschen sich Gedanken machen, als wenn das ein Betreuer entscheidet oder wenn verschiedene Leute auch noch unterschiedlich entscheiden" (Interview DOOSE, Z. 296).
Auf keinen Fall darf jemand allerdings von den Treffen des Unterstützerkreises ausgeschlossen werden. Grundsatz ist, dass in dieser Gemeinschaft jeder etwas zur Klärung der Situation beitragen kann und sei es lediglich durch die eigene Präsenz (vgl. BOBAN & HINZ 1999, 3). Im Übrigen gilt, "dass es ethisch nicht gerechtfertigt ist, für eine Person zu planen, wenn diese Person ausgeschlossen ist" (PEARPOINT & FOREST 1998, 96)[32].
Gerade in Unterstützerkreisen für schwer behinderte Menschen ist das Ausprobieren und Wagen von neuen Ideen wichtig.
"Wir [haben dann] eben auch so etwas wie eine beste Schätzung des Unterstützerkreises, ... was für die Person vielleicht gut wäre. Und die Person [kann] das dann ausprobieren ... [und] man [kann] sich hinterher treffen..., dann [fragt man sich:] ‚Scheint das was gewesen zu sein, was der Person gefällt oder haben wir danebengelegen?'" (Interview DOOSE, Z. 336ff).
Dabei besteht natürlich ein gewisses Risiko, Fehler zu machen. Diese Irrtümer sind allerdings oft nötig, um herauszufinden, was eine Person wirklich will. "Wörter wie ‚Fehler' oder ‚Irrtum' haben normalerweise einen negativen Unterton, obwohl sie oft die besten Chancen bieten, zu lernen wie man Dinge besser machen kann" (WERTHEIMER 1997, 2)[33]. Natürlich darf der Person kein Schaden zugefügt werden, allerdings kann es manchmal nötig sein, gewisse Risiken einzugehen.
Persönliche Zukunftsplanung sollte immer ein sogenanntes Planungstreffen einschließen, an dem gemeinsam über eine wünschenswerte Zukunft nachgedacht wird. Der Ablauf dieser Treffen soll deshalb an dieser Stelle näher beschrieben werden.
An einer Planungskonferenz nehmen die planende Person, ihr Unterstützerkreis und ein(e) neutrale(r) Moderator(in) teil.
Ort und Rahmen sollten von der Hauptperson selbst bestimmt werden. Diese lädt zum Treffen ein und bestimmt so auch die Mitglieder ihres Unterstützerkreises. DOOSE weist darauf hin, dass es wichtig ist, den äußeren Rahmen des Planungsprozesses einladend zu gestalten (z. B. 2000, 99). Dazu kann zum Beispiel der Raum schön gestaltet und es kann Kaffee, Saft, Gebäck o.ä. gereicht werden.
Dieser Gedanke wird nach meiner Erfahrung zwar berücksichtigt, jedoch wird bei der Raumwahl dennoch eher auf Erreichbarkeit und Zweckmäßigkeit Wert gelegt. Das Planungstreffen von MAIK fand beispielsweise in den Räumen des Integrationsfachdienstes statt, und DORIS HAAKE weist zu Recht darauf hin, dass der Raum zwar wichtig sei, aber dass man Kaffee doch auch in den Räumen der Hamburger Arbeitsassistenz kochen könne (vgl. Interview HAAKE, Z. 270). Letztendlich kann also persönliche Zukunftsplanung "überall dort stattfinden, wo sich der Mensch mit Behinderung befindet und es Menschen gibt, die ein ernsthaftes Interesse an ihm und seiner Zukunft haben" (DOOSE 2000, 102).
Es ist von großer Bedeutung, für ein Planungstreffen genügend Zeit vorzusehen, damit in Ruhe Ideen gesammelt werden können. Eventuell sind auch für den ersten Plan mehrere Treffen nötig, denn das Entwickeln von Plänen und Ideen benötigt viel Zeit.
"[Es ist wichtig,] ... sich ruhig Zeit zu nehmen, um das genau zu entwickeln, was eine Person möchte und das nicht zu schnell aufzuschreiben und auch festzuschreiben" (Interview DOOSE, Z. 316ff).
Im Laufe des Planungstreffens ist es wichtig, der planenden Person zuzuhören und versuchen zu verstehen, was diese sich für ihr Leben erträumt. Für O'BRIEN & O'BRIEN ist "Zuhören viel mehr als das Weitergeben von Wortbändern aus dem Mund an das Ohr. Zuhören bedeutet Mitschwingen in Körper, Phantasie und Geist" (1995, 15)[34].
Die Forderung, der planenden Person zuzuhören, ist allerdings leichter erhoben, als sie umgesetzt werden kann. "In der Lage zu sein, zu sagen wie wichtig es ist zuzuhören ist nicht dasselbe wie aktiv und loyal den Menschen zuzuhören, die gerade erst ihre Stimme finden" (O'BRIEN & O'BRIEN 1995, 15). Erschwerend wirkt weiterhin, wenn die Person nicht sprechen kann. Hier kommt es auf die Kreativität und den Ideenreichtum des Unterstützerkreises an, Mittel und Wege zum Verstehen zu finden. Wie kommuniziert die Person? Wie drückt sie ihr Wohlbefinden oder Unbehagen aus? "Der Prozeß muß stets von dem ernsthaften und bestmöglichen Streben geleitet sein, jegliche Mitteilungsform der planenden Person zu entschlüsseln, um so auch traditionell als Problemverhalten gedeutete Verhaltensweisen als Botschaften und Ausdruck von eigenen Bedürfnissen und persönlichem Willen dechiffrieren zu können" (EMRICH 1999, 119).
Oft ist es nötig, Dinge zuerst auszuprobieren und dann zu entscheiden, ob sie gut sind oder nicht. Dies ist einerseits bei Personen angebracht, die sich selbst nicht äußern können, andererseits aber auch bei Menschen, die im Laufe ihres Lebens nicht genügend Erfahrungen sammeln konnten, um nun plötzlich klar zu sagen, wie sie leben möchten (vgl. Kap. 7.3). Hier wird die Prozesshaftigkeit dieser Art von Planungen deutlich, die sich über viele Zukunftsplanungstreffen hinziehen können (vgl. WERTHEIMER 1997,2). "Eines der häufigsten Missverständnisse von persönlicher Zukunftsplanung ist, dass es eine kurze Reihe von Treffen ist, mit dem Zweck einen statischen Plan zu produzieren" (O'BRIEN & LOVET 1992, 9)[35].
"Also das ... auch als einen Prozess zu sehen, wo es nicht so ist: Ich mache einen Plan und bin die nächsten 20 Jahre dran gebunden, dass ich ja nicht von meinem Lebensplan abweiche, sondern dass eher als so eine These ... [zu verstehen], wo man sagt: ‚Gut, die werde ich weiterverfolgen, bis mir einen bessere These einfällt'" (Interview DOOSE, Z. 307ff).
Daraus geht hervor, dass bei einem Zukunftsplanungstreffen keine perfekte Lösung erreicht werden muss (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 45). Es geht vielmehr darum, dass alle Beteiligten sich Gedanken machen, Dinge ausprobieren und ihr Bestes tun. "Planung ist ein andauernder Teil des Lebens - eher als ein getrenntes, jährliches Ereignis" (CURTIS & DEZELSKY 1994a, 18)[36].
Um den eigenen Wünschen für eine ideale Zukunft auf die Spur zu kommen wird bei persönlichen Zukunftsplanungstreffen im ersten Schritt meistens eine "traumhafte" Zukunft geträumt. In dieser Phase der Planung muss nicht auf vorhandene Rahmenbedingungen geachtet werden, und es kann den eigenen Ideen freier Lauf gelassen werden. Natürlich kann nicht jeder dieser Träume umgesetzt werden. Statt dessen kann dann aber in der weiteren Planung ihr Kern erkundet oder der Traum in gangbare Schritte umgewandelt werden (vgl. DOOSE 2000, 96ff). Dieses ist zunächst gerade für behinderte Menschen ungewöhnlich, da diese nach traditioneller Meinung nicht so viel von ihrem Leben erwarten können (vgl. DOOSE 2000, 96). Träume sind an dieser Stelle allerdings wichtig, um die gewohnten Bahnen des Hilfesystems zu verlassen und Raum für Ideen zu schaffen, die vielleicht in den Köpfen schon vorhanden sind, aber nicht ausgesprochen wurden. Dies ist ein Prozess, der vielen Beteiligten oft schwer fällt, da vorher oft Abstriche in allen Bereichen gemacht werden mussten.
Der Prozess des Träumens kann erleichtert werden, wenn man sich auf Positives konzentriert, also ressourcenorientiert arbeitet. Dabei werden die Stärken einer Person benannt, anstatt ausschließlich die Schwächen. So kann es plötzlich möglich werden, nicht nur den hilfebedürftigen, unzureichenden Menschen mit Behinderung zu sehen, woraus sich neue Möglichkeiten erschließen. Dies kennt jeder von uns aus seinem Alltag. Wenn man sich schon morgens vor dem Spiegel einredet, dass ein schlechter Tag seinen Anfang nimmt, ist die Chance dafür tatsächlich relativ groß. Wenn man sich statt dessen über die Sonne freut, die draußen scheint und an den abendlichen Besuch eines Freundes denkt, kann auch ein kleiner Rückschlag nicht den ganzen Tag verderben. Ein Zukunftsplanungstreffen, das auf Positives ausgerichtet ist, zielt "auf gemeinsame kooperative Reflexion seiner Erfahrungen, Stärken, Bedürfnisse, Vorlieben, Begabungen etc. und die Möglichkeiten, Chancen und Erfordernisse, die in (s)einer Situation enthalten und nutzbar sind" (BOBAN & HINZ 1999, 8) und kann damit verschüttete Energien freisetzen.
Eine positive Einstellung zu sich und seinem Leben zu entwickeln ist allerdings nicht immer leicht, wie auch jeder aus eigener Erfahrung kennt. "Eigene Fähigkeiten und Stärken zu erkennen und sie zu benennen ist ein Prozeß, der für viele Menschen Zeit braucht und nicht immer einfach ist" (EMRICH 1999, 84). Hier ist der Moderator eines Zukunftsplanungstreffens wichtig.
"[Er kann klären, dass es DM] um positive Dinge gehen soll, dass es um Möglichkeiten gehen soll. Auch noch mal solche Effekte zu erklären, wie man sich in der Sprache der Unmöglichkeit bewegt, was dann passiert und im Gegensatz dazu Sprache der Möglichkeiten. Also sozusagen Metakommunikation zu betreiben und Gruppenregeln festzulegen und sich vorher klarzumachen, was ... das Ziel von so einem Unterstützerkreis ist, nämlich neue Möglichkeiten für Menschen zu erschließen" (Interview DOOSE Z. 446ff).
Der Moderator hat weiterhin die Aufgabe, das Gespräch zu leiten, darauf zu achten, dass alle Beteiligten gleichermaßen zu Wort kommen und die einzelnen Planungsschritte schriftlich festzuhalten. Dieses geschieht am besten in Wort und Bild, damit auch die Personen ihren Plan verstehen, die keine Schrift lesen können.
"... was natürlich auf jeden Fall hilft ist, wenn man Sachen möglichst lebendig auch festhält, also graphisch auch untermalt, auf jeden Fall aber schriftlich festhält" (Interview DOOSE, Z. 330f).
Außerdem achtet der Moderator darauf, dass der positive Blickwinkel auf die Person erhalten bleibt, er schlichtet Konflikte in den Kreisen (vgl. Kap. 7.8) und übernimmt ebenfalls Verantwortung dafür, dass der Plan auch in die Realität umgesetzt wird, falls diese Aufgabe kein anderes Mitglied des Unterstützerkreises übernimmt.
Insgesamt ist es wichtig darauf zu achten, dass das Vertrauen, das die planende Person ihrem Umfeld auf einem Planungstreffen schenkt, nicht missbraucht wird. CURTIS & DEZELSKY sprechen in diesem Sinne eine Mahnung an alle Beteiligten aus "Denkt daran, dass Menschen viele Informationen mit euch teilen werden. Respektiert die Privatsphäre jeder Person" (1994a, 45)[37]. Diese Forderung kann dazu führen, dass wenn die Person dies wünscht, bestimmte Personen nicht zu einem Planungstreffen eingeladen werden, obwohl sie von außen betrachtet dazugehören sollten.
Nachdem auf dem beschriebenen Weg ein Plan erstellt wurde, der die Hoffnung auf eine besserer Zukunft impliziert und bei vielen Beteiligten eine euphorische Stimmung auslösen kann, ist es wichtig, nicht in diesem Stadium zu verharren. "Persönliche Zukunftsplanung ist mehr als das Schmieden guter Pläne. Sie impliziert immer auch deren Realisierung und darf daher weder im Sammeln von Ideen und Träumen noch im Planen stecken bleiben" (EMRICH 1999, 99).
Die Umsetzung des Plans in die Realität ist natürlich der entscheidende Schritt bei persönlicher Zukunftsplanung (vgl. WELLS 2000, 149). Hier müssen sich die Mitglieder des Unterstützerkreises über die Planungsphase hinaus verantwortlich fühlen, damit die planende Person weiter auf dem Weg zu einer erstrebenswerten Zukunft gehen kann. Hilfreich ist es, wenn sich eine Person speziell bereit erklärt, die weitere Umsetzung des Plans zu verfolgen. Dies kann die planende Person selbst oder jemand aus dem Unterstützerkreis sein. Weitere Treffen sind nötig, um die Ergebnisse der bisherigen Bemühungen zu überprüfen. Meiner Ansicht nach ist es nicht vertretbar, die planende Person nach dem Planungstreffen allein zu lassen und sie selbst für die Umsetzung verantwortlich zu machen. Es werden so nämlich unrealistische Hoffnungen geweckt, die jemand allein und ohne Unterstützung seines Umfeldes oft nicht umsetzen kann.
Wenn im Rahmen von solchen Zukunftsplanungstreffen Unterstützungsmöglichkeiten geplant werden, die anschließend als Kombination von professioneller und informeller Unterstützung umgesetzt werden, so ist es gut möglich, dass dies kostengünstiger ist als traditionelle Hilfeleistungen beispielsweise in Form eines Heimplatzes (vgl. KRüGER 2000, 120f). So kann oftmals bessere Unterstützung zu einem geringeren Preis geleistet werden. Allerdings kann diese individuell geplante Unterstützung im Einzelfall auch teurer sein als die traditionell vorgesehene Hilfe (vgl. SMITH & WILSON 1997, 20). Trotzdem sollte sie aus Respekt vor der Würde des Einzelnen und den im 4. Kapitel beschriebenen Gründen dann auch in dieser Form geleistet werden. Persönliche Zukunftsplanung und unterstütztes Leben dürfen nicht einfach als eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Unterstützungsformen gesehen werden (vgl. KRüGER 2000, 121), obwohl sie das als Nebeneffekt mit sich bringen können.
O'BRIEN (1998, 18) stellt in einer Abbildung dar, wie ein Planungsprozess im allgemeinen abläuft. Dieses Schaubild soll zur nochmaligen Verdeutlichung am Schluss dieses Kapitels stehen. In den nachfolgend beschriebenen Methoden für Zukunftsplanungstreffen lassen sich diese Schritte größtenteils wiederfinden.
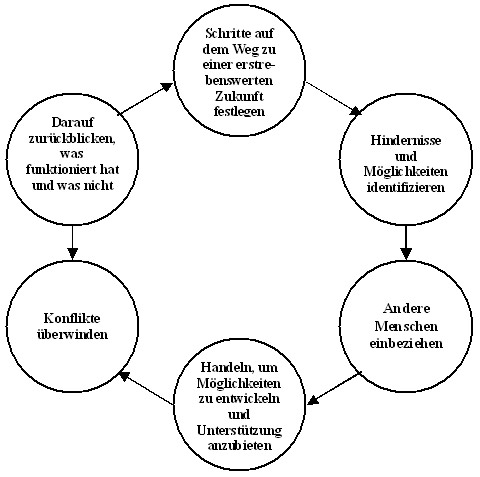
Abb. 1: Ablauf eines Planungsprozesses (O'BRIEN 1989, 18) "Define steps toward a desirable future; identify obstacles and opportunities; Involve others; Act to create opportunities and provide support; Negotiate conflicts; Review what worked and what didn't work" (Übersetzung DM).:
Für die Gestaltung der Zukunftsplanungstreffen gibt es verschiedene Methoden, die in unterschiedlichen Zusammenhängen zu unterschiedlicher Zeit entstanden sind. Sie unterscheiden sich oft nur geringfügig und haben alle das schrittweise Vorgehen und die Einbeziehung von Unterstützungspersonen in den Planungsprozess gemeinsam. Alle Methoden beginnen damit, herauszufinden, wer die Person ist und führen im Ergebnis zu konkreten Handlungsplänen für die Zukunft. Unterschiede liegen zum Einen darin, wie viel Zeit darauf verwendet wird, die Person, für die geplant wird, und ihre Geschichte kennen zu lernen. Zum Zweiten unterscheiden sich die Vorgehensweisen in der Frage, ob es um die Planung eines idealen Zukunftstraums geht, dem sich schrittweise angenähert wird oder ob ausschließlich die Verbesserung der Gegenwart Gegenstand der Planung ist (vgl. SANDERSON et al. 1997, 88ff).
Die in Deutschland gebräuchlichsten und auch schon in der hiesigen Literatur beschriebenen Verfahren sind MAP und PATH, die in den Abschnitten 7.5.1 und 7.5.2 näher erläutert werden. In 7.5.3 wird noch Essential Lifesyle Planning (grundlegende Lebensstilplanung) erläutert, eine in Deutschland weniger gebräuchliche Planungsmethode, die jedoch erwähnenswert erscheint.
Weitere Methoden, auf die aber in dieser Arbeit aus Gründen des Umfangs nicht näher eingegangen werden soll, sind: Individual service design (individueller Unterstützungsentwurf), Personal Future Planning (persönliche Zukunftsplanung)[38] und andere (vgl. SANDERSON et al. 1997, 88ff).
Unabhängig davon, mit welchen Methoden der persönlichen Zukunftsplanung man im Detail arbeitet, ist das oben beschriebene Menschenbild fundamental wichtig. Werden diese Methoden ohne die entsprechende Einstellung benutzt, stellen sie keine Neuerung gegenüber anderen Formen der Hilfeplanung dar. "Für uns sind MAPS und PATH nicht nur eine andere Art der Hilfeplanung, sie repräsentieren eine andere Art des Denkens" (PEARPOINT & FOREST 1998, 95)[39]. Auch die Gefahren für den Missbrauch dieser Methoden liegen nicht in den Methoden selbst, sondern in der Einstellung, mit der sie angewendet werden (vgl. PEARPOINT & FOREST 1998, 96).
Für den gesamten Planungsprozess gilt natürlich, dass es keine Garantie für einen gelingenden Zukunftsplan ist, wenn lediglich eine passende Planungsmethode gefunden wird. Die Arbeit des Moderators oder der Moderatorin hat Einfluss, es ist entscheidend, wie der Unterstützerkreis arbeitet und am wichtigsten ist, mit wie viel Konsequenz und Engagement der Plan später auch in die Realität umgesetzt wird. Die unterschiedlichen Planungsverfahren "sind eine wichtige Strategie, die Lebensqualität von Menschen zu reflektieren und im Sinne von Inclusion zu verbessern..." (BOBAN & HINZ 1999, 8).
PATH ist eine Abkürzung für planning alternative tomorrows with hope (vgl. HINZ & BOBAN 1999, 5) oder planning action to help (vgl. DOOSE & GöBEL 2000, 188) und wurde ab 1991 von JACK PEARPOINT, MARSHA FOREST und JOHN O'BRIEN entwickelt (vgl. SANDERSON et al. 1997, 121). Es ist nach meinem Kenntnisstand die in Deutschland am häufigsten angewandte Methode der Zukunftsplanung und wird, angelehnt an das englische Wort path (der Pfad), als "der Weg", bezeichnet. Diese Planungsmethode kann für Einzelpersonen, aber auch zur Organisations- und Projektplanung genutzt werden. Beim PATH-Prozess wird für ein Jahr geplant, eng an einen idealen Zukunftstraum, den sogenannten "Nordstern", angelehnt. Beim Planungstreffen nach dieser Methode sind im Idealfall zwei Moderatoren nötig: Einer für die beim PATH-Prozess recht aufwendige Visualisierung und ein weiterer für die Gesprächsmoderation. Ebenfalls wichtig ist ein Unterstützerkreis aus mehreren Personen zur Ideensammlung, der die planende Person schon genauer kennen sollte. Der Planungsprozess gliedert sich in acht Teilschritte, die alle in dem unten dargestellten Pfeildiagramm stichwortartig in Wort und Bild festgehalten werden. Nachfolgend werden nun die acht Planungsschritte, in erster Linie angelehnt an SANDERSON et al. (1997, 119ff), ergänzt durch HINZ & BOBAN (1999, 5f) und DOOSE & GöBEL (2000, 190ff). In verschiedenen Darstellungen unterscheiden sich die acht Schritte geringfügig, so beispielsweise in dem Zeitraum für den geplant wird oder in den Zeitpunkten, für die Zwischenziele formuliert werden.
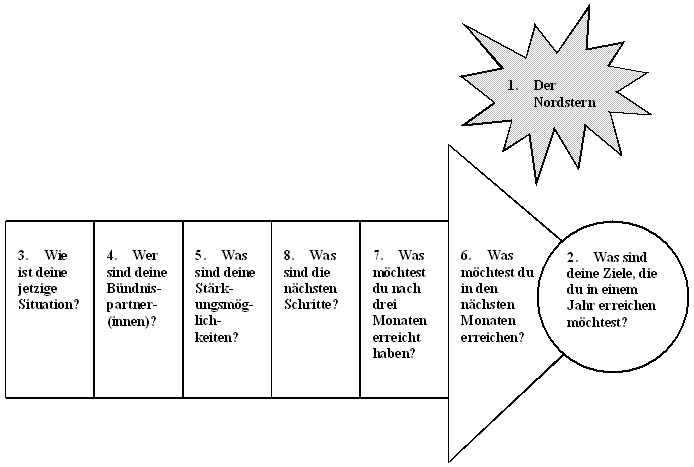
Abb. 2: Der PATH-Prozess (in Anlehnung an DOOSE & GöBEL 2000, 190)
Im ersten Schritt beschreibt die Person, mit der geplant wird, ihre persönliche ideale Zukunftsvorstellung. Diese kann eher generalisiert sein oder auch ins Detail gehen. Es kann um verschiedene Lebensbereiche wie Wohnen oder Arbeit gehen, aber auch um Generelles. Eine Person kann sich also beispielsweise neben einer eigenen Wohnung und einem eigenen Auto auch wünschen, dass eine Gesellschaft entsteht, in der niemand ausgeschlossen wird oder dass der Kontakt zu den Eltern sehr gut ist. Auch Personen aus dem Unterstützerkreis können ihre Ideen für eine ideale Zukunft anbringen. Bevor diese jedoch aufgeschrieben werden, muss die planende Person dem zustimmen. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. deren Umfeld ist dieser Schritt häufig der Schwierigste. Allzu oft wird doch immer nur auf das im Hilfesystem machbare und das in der Umgebung Vorhandene geschaut. Manchmal wird es auch für Menschen mit Behinderungen als nicht wünschenswert angesehen, überhaupt zu träumen, da dieser Prozess angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten in der Konsequenz als zu schmerzhaft erlebt werden könnte (vgl. DOOSE 2000, 96). Hier sollen die Träume aber als Orientierungspunkt dienen und dazu anregen, nicht in den üblichen Denkstrukturen zu verharren, sondern sich zu trauen, Neues zu erfinden. Beim weiteren Planungsprozess wird dann der Kern des Traumes freigelegt und in kleinere Schritte zerlegt, um so eine Annäherung in der Realität möglich zu machen. Nicht jeder Traum muss in Erfüllung gehen, bietet aber auf jeden Fall viele Ansatzpunkte für die weitere Planung.
In diesem Schritt reist die Planungsgruppe in Gedanken ein Jahr in die Zukunft. Sie kann dort auf ein außerordentlich erfolgreich verlaufenes Jahr zurückblicken und aufschreiben, was in diesem Jahr alles an Positivem passiert ist. Bei diesem Schritt geht es um optimistische und mutige, aber wiederum realistische Planung. Was ist in diesem Jahr passiert, das uns dem Idealbild näher brachte?
Im Kontrast zum vorherigen Schritt wird nun die heutige Situation beschrieben und der Unterschied zu dem Planungsziel in einem Jahr herausgestellt. So wird abgesteckt, von wo nach wo man sich bewegen will.
Wenn der angestrebte Weg einmal abgesteckt ist, geht es darum, Bündnispartner und -partnerinnen zu suchen, die für das Erreichen der Ziele wichtig sind. Dies können Mitglieder des Unterstützerkreises sein, aber auch andere Bekannte oder Professionelle, die ergänzend bei bestimmten Schritten oder Fragen weiterhelfen können. Bei der PATH-Methode wird davon ausgegangen, das niemand seine Ziele ausschließlich allein erreichen kann, sondern auf Unterstützung von anderen angewiesen ist.
Welche Dinge können uns auf der persönlichen Ebene und auf der professionellen Ebene stärken? Das ist die Frage, der beim fünften Schritt nachgegangen wird. Auf der persönlichen Ebene können Stärkungsmöglichkeiten in Hobbies oder Freundschaften liegen. Aber auch regelmäßige Treffen des Unterstützerkreises oder gemeinsame Feste zur Feier erster Erfolge gehören in diese Kategorie. Bei der Frage nach Stärkungsmöglichkeiten wird ebenfalls festgehalten, welches Wissen noch benötigt wird oder welche Fähigkeiten eine Person haben muss, um ihr Ziel zu erreichen.
Entsprechend dem vorherigen Schritt werden hier Zwischenziele für ein imaginäres Datum sechs Monate später formuliert.
Hier fordert der Moderator die Gruppe auf, für ein ungefähr drei Monate vom Zeitpunkt des Treffens entfernt liegendes Datum, Zwischenziele zu formulieren, die bis zu diesem Zeitpunkt erreicht sein sollen.
Dieser Schritt ist wohl der entscheidendste im ganzen Planungsprozess. Hier geht es jetzt von der Planung zur konkreten Umsetzung. Es wird festgelegt, welche ersten Schritte gemacht werden sollen. Dafür werden konkrete Daten und Personen festgelegt, die sich verantwortlich fühlen. Abschließend wird ein Termin für das nächste Treffen vereinbart. Wann dieses stattfindet liegt an den Bedürfnissen der planenden Person.
Dies waren die Schritte des PATH-Prozesses, die bei einem Planungstreffen durchlaufen werden.
Das Planungsverfahren MAP (Making Action Plans) wurde VON JUDITH SNOW, JACK PEARPOINT und MARSHA FOREST entwickelt. Anfangs wurde es als eine Planungsmethode für die Integration von Kindern mit Behinderungen in allgemeine Schulen genutzt, hat sich inzwischen aber als eine Methode der persönlichen Zukunftsplanung für Kinder und Erwachsene etabliert (vgl. SANDERSON et al. 1997, 113). DOOSE & GöBEL (2000, 187) bezeichnen die bei diesem Verfahren erstellte graphische Darstellung im Deutschen als "individuelle Landkarte", entsprechend dem englischen Wort map (Landkarte). Das Verfahren gliedert sich ebenfalls in acht Teilschritte, die entweder alle bei einem Treffen von zwei bis drei Stunden durchlaufen werden oder auf mehrere Treffen verteilt werden können. Im Gegensatz zum PATH-Prozess wird mehr Zeit darauf verwendet, die Personen mit ihrer Geschichte, ihren Träumen, Alpträumen, Stärken und Bedürfnissen kennen zu lernen. Deshalb ist MAP eventuell eine geeignete Methode für Kinder oder sehr schwer behinderte Personen, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht ohne weiteres äußern können. Dieses erklärt sich aus dem Entstehungszusammenhang dieser Methode im Umfeld schulischer Integrationsbemühungen. Die acht Schritte dieser Methode sind teilweise ähnlich denen im PATH-Prozess, werden in der folgenden Abbildung erläutert und hier nicht weiter ausführlich beschrieben.
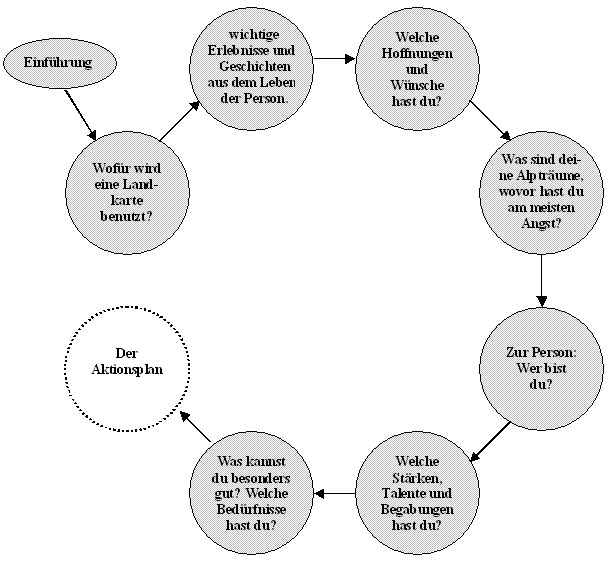
Abb. 3: Das Planungsverfahren MAP (in Anlehnung an DOOSE & GöBEL 2000, 187)
Nun soll noch die grundlegende Lebensstilplanung (Essential Lifestyle Planning) erläutert werden, eine Planungsmethode, deren Beschreibung bislang noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Die Darlegung ist eng angelehnt an SANDERSON et al. (1997, 88ff).
Essential Lifestyle Planning ist im Gegensatz zu PATH und MAP eine sehr pragmatische Methode, die auf die unmittelbare Verbesserung des jetzigen Lebenszustandes abzielt. Sie ist also mehr auf die Gegenwart als auf die Zukunft ausgerichtet und besonders dann geeignet, wenn verschiedene Helferinnen und Helfer auf gleiche Art eine Person unterstützen wollen (beispielsweise beim Wechsel des Betreuungspersonals oder der Einrichtung aber auch für die tägliche Arbeit in einer größeren Institution). Grundlegende Lebensstilplanung ist eine sehr gute Planungsmethode, um jemanden genauer kennen zu lernen oder um mit persönlicher Zukunftsplanung zu beginnen, besonders dann, wenn die Person selbst und deren Familie keine detaillierte Auskunft über die gewünschte Art und Richtung der Unterstützung geben können.
Grundlegende Lebensstilplanung wurde von MICHAEL SMULL und SUSAN BURKE-HARRISON im Kontext ihrer Arbeit mit langzeitinstitutionalisierten Personen entwickelt, die umziehen mussten, weil ihre bisherigen Heimat-Institutionen geschlossen wurden.
Das Vorgehen bei dieser Planungsmethode gliedert sich in drei Schritte:
Zu Beginn überlegt der Moderator des Planungsprozesses zusammen mit der planenden Person, wer an der Zukunftsplanung beteiligt werden soll und wichtige Informationen liefern könnte. Anschließend spricht der/die Moderator(in) mit allen Beteiligten. Die planende Person wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten in diesen Prozess einbezogen, auch wenn sie nicht mit Sprache kommunizieren kann. Dabei ist es wichtig, zuzuhören und Geschichten über die Hauptperson in Erfahrung zu bringen. Dies geschieht nicht durch ja/nein-Fragen, sondern durch offenere Formulierungen wie beispielsweise: "Was ist das erste, was du morgens machst? Was passiert, wenn das einmal nicht so ist? Was machst du dann?" Oder auch: "Hatte Jim in der letzen Zeit einen richtig guten Vormittag? Erzähl davon!" Diese Fragen können mit den Beteiligten einzeln erörtert werden oder auch auf einem Treffen, an dem alle teilnehmen.
Nach der ersten Phase werden die gesammelten Informationen in einem Plan zusammengestellt. Dieser Plan enthält verschiedene Rubriken, die jeweils unterschiedliche, vorgegebene Überschriften tragen. Es werden lediglich die Dinge aufgenommen, die für die Hauptperson wichtig sind und nicht die, die vielleicht einige Bezugspersonen wichtig finden.
Grundlegend
Unter diesem Punkt werden die Dinge gesammelt, die eine Person für ihr Wohlbefinden unbedingt haben muss oder nicht haben darf. Wenn diese Dinge nicht erfüllt sind, wird die Person unzufrieden und kann sich selbst oder anderen Schaden zufügen. Manchmal erscheinen diese Dinge bedeutungslos, sind für die Person aber von höchster Wichtigkeit.
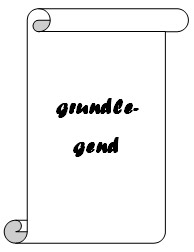
Wichtig
Diese Dinge zwar sehr wichtig für die Person, aber nicht elementar. Wenn Dinge auf dieser Liste nicht erfüllt werden können, dann ist das Leben für die Person zumindest für eine Weile noch erträglich.

Mag/bevorzugt
Hier stehen Dinge, die eine Person mag und bevorzugt oder aber auch nicht gern hat (z. B. das Lieblingsessen oder die regelmäßig besuchte Gaststätte).

Was andere über die Person sagen
An dieser Stelle werden alle positiven Eigenschaften der Person aufgelistet. Hier werden Beschreibungen in der Alltagssprache benutzt, wie z. B. "warmherzig und humorvoll". Fachjargon wie "kann seinen Ärger angemessen ausdrücken" ist hier nicht angebracht.

Was andere wissen müssen, um die Person gut zu unterstützen
Dieser Teil des Plans beschreibt die tägliche Routine der Person und welche Unterstützung sie dabei benötigt. Hier werden nicht die Dinge aufgezählt, welche die Person selbst erledigen kann.

Ungelöste Angelegenheiten
Hier werden Dinge dargestellt, bei denen die beteiligten Personen unterschiedlicher Ansicht sind oder über die es nicht genügend Informationen gibt. Diese werden "ungelöst" genannt, weil sie auf dem nachfolgenden Treffen diskutiert und damit auch gelöst werden sollen.

Weitere mögliche Überschriften, die sich je nach Person noch anbieten könnten, sind:

Jeder Plan kann anders aussehen und mit Bildern, Fotos und anderem ausgeschmückt werden.
Hat der/die Moderator(in) den Plan erstellt, wird er mit der planenden Person diskutiert, die ihn dann billigt und entscheidet, ob er in dieser Form mit den anderen Beteiligten besprochen werden darf.
Abschließend finden ein Treffen statt, bei dem alle in den Planungsprozess involvierten Personen über den Plan sprechen, ihn verbessern und ergänzen können. Dieses Treffen gliedert sich im allgemeinen in fünf Schritte:
-
Den Plan diskutieren und billigen
-
Jeden Teil des Plans durchgehen und darüber sprechen, ob in der täglichen Arbeit derzeit danach gehandelt wird
-
Sich über die Dinge freuen, die funktionieren und Anregungen sammeln, was sich ändern müsste, damit noch mehr Teile des Plans erfüllt werden können
-
Diese Anregungen aufgreifen und festlegen, wer sich bis wann um was kümmert
-
Vereinbaren, wie alle Beteiligten davon erfahren, wenn der Plan nicht mehr aktuell ist und geändert werden muss.
Der erstellte Plan sollte flexibel gehandhabt werden und nicht für immer festgelegt sein. Dazu wird er von der planenden Person oder einer nahestehenden Bezugsperson immer wieder überprüft. Von Zeit zu Zeit treffen sich alle Beteiligten und überarbeiten größere Teile der Planung, wenn sich Lebensumstände oder der Lebensstil der planenden Person ändert.
Der Begriff "soziales Netz" bezeichnet die vielfältigen Beziehungen einer Person zu den Mitmenschen seiner Umgebung, sei es zur eigenen Familie, zur Verwandtschaft, Nachbarschaft oder zu Kollegen und Freundinnen.
Dieses Beziehungsnetz spielt im Kontext von persönlicher Zukunftsplanung eine zentrale Rolle. Wie oben beschrieben wird professionelle Unterstützung nur dann genutzt, wenn informelle Ressourcen nicht verfügbar sind, wie sie aus dem Familien oder Freundeskreis kommen können. Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse haben jedoch "die Zahl und die Intensität traditioneller Bindungen abnehmen lassen" (LINDMEIER 2002a, 15). So sind informelle Ressourcen nicht (mehr) so leicht verfügbar. Daraus folgert LINDMEIER, dass bestehende Bindungen sorgsam gepflegt werden und die Möglichkeit zum Knüpfen neuer Beziehungen systematisch geschaffen werden müssen. Dies ist eine Hauptaufgabe professioneller Unterstützung (vgl. LINDMEIER 2002a, 15). "Ziel ist es also, einem Menschen dabei zu helfen, seine Umfeldsituation zu verbessern und einen Freundeskreis aufzubauen, einen Kreis von Menschen, der als freundschaftlich empfunden werden kann, da er um die Situation der Person weiß und gemeinsam seine Möglichkeiten für sie einsetzt ... Freundschaft ist [allerdings] kein Ereignis, das vom Himmel fällt. Es kommt der Verschwendung wertvollster Ressourcen gleich abzuwarten, zu hoffen und zu bangen, ob es dazu kommt, anstatt zu lernen, etwas dafür zu tun, dass sich unterstützende, freundschaftliche Beziehungen aufbauen und entfalten können" (BOBAN & HINZ, 1999, 2).
Im supportedliving-Konzept und damit auch im Kontext von persönlicher Zukunftsplanung, wird dieses Aufbauen von sozialen Beziehungen als eine Hauptaufgabe der Professionellen gesehen, die allerdings nicht unbedingt einfach ist. "Eine der herausforderndsten Aspekte von supported living ist, Menschen dabei zu helfen, informelle Unterstützung und Gemeinderessourcen zu nutzen, wo immer dies möglich ist" (WERTHEIMER 1997, 10)[40]. Bei O'BRIEN & O'BRIEN heißt es an anderer Stelle: "Zusammenarbeit zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Unterstützungspersonal um Isolation zu überwinden ist eine der spannendsten und verwirrendsten Aufgaben im Rahmen der Arbeit mit supported living" (1991, 19)[41].
Diese Herausforderung und Problematik schildern auch meine Interviewpartner(innen). Für CAROLIN EMRICH erscheint es bemerkenswert, dass
"Menschen mit Behinderungen eben interessanterweise einfach so selten richtige soziale Netze finden und aufbauen können" (Interview EMRICH, Z. 267ff). So ein großes soziales Netz ist ihrer Ansicht nach die "tragfähigere Basis" für eine erfolgreiche Zukunftsplanung, "vorausgesetzt, dass die Freunde oder Familie oder wer auch immer das ... wirklich gut unterstützen" (Interview EMRICH, Z. 183ff).
Allerdings sei es sehr schwierig ein solches soziales Netz aufzubauen, falls keines vorhanden ist. Da sei es schon eher möglich, ein professionelles Netzwerk aufzubauen oder das alte auszutauschen, wenn es den eigenen Wünschen und Vorstellungen nicht entspricht (vgl. Interview EMRICH, Z. 260ff).
FRAUKE SANDER sieht vor allem die Problematik der Vermischung von Dienstleistungen und Freundschaftsdiensten. Nach ihrer Erfahrung sehen viele ihrer Klienten Dienstleistungen, auf die sie einen rechtlichen Anspruch haben, als Freundschaftsdienste an (vgl. Interview SANDER, Z. 316ff.) und zählen auch das Personal in ihrem Umfeld zu ihren Freunden, was ihrer Ansicht nach teilweise an deren Verhalten liegen könnte:
"Und diese falsch verstandene Freundschaft, die kritisiere ich an einigen anderen Professionellen, die finde ich nicht gut. ... Ich habe auch oft in meinen Interviews erlebt, dass man dann fragt: ‚Wen würdest du als deinen Freund bezeichnen?' Und dann wird aufgezählt: ‚Integrationsfachkraft, Gruppenleiter, Wohnheimleiterin und eigentlich der Leiter von der Werkstatt auch noch. Und der Zivi.' ... Das ist die abschließende Aufzählung und da muss ich sagen, ... da wird den Leuten auch irgendwann was falsches vorgegaukelt" (Interview SANDER, Z. 294ff).
Sie bedauert, dass Personen, die in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden, nur selten tragfähige Beziehungen zu Nichtbehinderten entwickeln können. Der Kontakt in das soziale Umfeld beschränkt sich häufig auf Angehörige und andere Menschen mit Behinderungen und entstehen in Freizeitclubs o. ä.
"[An ihren Arbeitsplätzen sind sie oft DM] der letzte in der Hierarchie, ..., dem alle Anweisungen geben und wenn jedes Jahr ein neuer Azubi kommt, dann gibt der dem auch noch Anweisungen." (Interview SANDER, Z. 221ff).
STEFAN DOOSE beschreibt ein Phänomen, welches bestätigt, dass eine Person in unserem Hilfesystem entweder nur von ihren Angehörigen oder nur von einer Institution unterstützt werden kann.
"Wenn man jetzt Leute hat, die in Einrichtungen leben, dann stellt man ja oft fest, dass systematisch das, was sie an letzten Resten von Netzwerken hatten spätestens durch den Umzug in die Wohngruppe kaputtgegangen ist oder [dass die Einstellung da ist, dass] die Person ja jetzt versorgt ist " (Interview DOOSE, Z. 271ff).
In allen drei Interviews werden also verschiedenen Aspekte der Problematik des fehlenden sozialen Netzes besprochen, was die Brisanz dieses Themas deutlich macht.
Wie ein kaum vorhandenes soziales Netz aufgebaut werden kann, bleibt allerdings sowohl in der Literatur, als auch in den Interviews unklar. CAROLIN EMMRICH betont lediglich, dass sie diese Aufgabe als sehr schwierig empfindet (vgl. Interview EMRICH, Z. 260). Für FRAUKE SANDER erscheint es nicht möglich Freundschaften zu initiieren. Dieses liegt ihrer Ansicht nach außerhalb der Reichweite eines Professionellen, da es nicht "befohlen" werden kann. Trotzdem beschreibt sie einen Ansatz, der vielleicht Anhaltspunkte in diese Richtung für Professionelle geben könnte.
"Das einzige, was ich machen kann sind, ist so zumindest so Grundkommunikationen zwischen Kollegen manchmal herzustellen. Indem ich einfach mal da bin und versuche ein Gespräch aufzubauen oder einfach mal dabei bin und die behinderte Person versuche stärker einzubeziehen. Das geht schon bei solchen Sachen los, dass die behinderte Person nicht alleine am Tisch sitzt, oder das man guckt: ‚Menschenskind, wenn jemand aus der gleichen Ortschaft kommt und zum gleichen Arbeitsplatz muss, dann kann der doch mitfahren, als Fahrgemeinschaft und wenn er Benzingeld bezahlt!' Solche Sachen, die kommen oft nicht von alleine zustande, Aber da würde ich wirklich mich jetzt als Integrationsfachkraft als Kommunikationshelfer sehen. Aber Freundschaften zu initiieren, das muss ich sagen, das liegt außerhalb meiner Reichweite. Also ich weiß nicht, ob man so was irgendwie befehlen kann, oder das ist schwierig. Ja, wie gesagt, ich würde mich eher als Kommunikationshelfer bezeichnen" (Interview SANDER, Z. 248ff).
Insgesamt besteht offenbar noch ein großer Bedarf nach Ansätzen, die professionellen Mitarbeitern ermöglicht, die sozialen Netze ihrer Klienten aufzubauen. Dieses wird in der Literatur bislang lediglich als Aufgabe und Ziel beschrieben.
PEARPOINT & FOREST beschreiben in ihrem Artikel "the ethics of person centred planning" (1998) vier Sicherheitsklauseln (safeguards), die sich nicht nur auf die Methoden MAP und PATH beziehen dürften, sondern in der gesamten persönlichen Zukunftsplanung von Bedeutung sind. Sie sind dazu da, drohende Gefahren zu erkennen und zu umgehen und einen Missbrauch der planenden Person zu verhindern.
Das erste ist das Einheitlichkeitsprinzip(integrity principle) welches besagt, dass jeder, der persönliche Zukunftsplanungen für Menschen moderiert, wie schon in Kapitel 2 angedeutet, vorher eine eigene Planung gemacht haben sollte. Selbstverständlich sollte man dabei von der eigenen Familie und seinem Freundeskreis unterstützt und begleitet werden. Nur so kann jemandem nach Ansicht von PEARPOINT & FOREST die Verwundbarkeit der planenden Person deutlich werden, der sie ausgesetzt ist, wenn sie ihre Hoffnungen und Ängste preisgibt (vgl. PEARPOINT & FOREST 1998, 99). Mir bot sich im Rahmen eines Seminars an der Universität Oldenburg die Möglichkeit, selbst eine persönliche Zukunftsplanung durchzuführen. Dabei wurde mir klar wie anstrengend dieser Prozess ist und wie wichtig es ist, dass Personen im Unterstützerkreis sind, denen ich vertrauen kann. Bei Zukunftsplanungen geht es immer um persönliche Dinge, die nicht ohne weiteres beliebigen Personen zugänglich gemacht werden können. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass man die Mitglieder des Kreises selbst wählen kann und nicht, wie in Kapitel 7.3 beschrieben, eine Unterstützungsperson zugewiesen bekommt.
Eine weiteres Prinzip ist das Zusammenarbeits-Prinzip(collaboratrion principle), das verbietet, eine Zukunftsplanung allein zu begleiten "Mach es niemals alleine! Unterstütze diesen Prozess nicht alleine, weil es den gefährlichen Schluss entstehen lässt, dass wir das Leben alleine meistern können. Es liegt Sicherheit in der Zusammenarbeit" (PEARPOINT & FOREST 1998, 99)[42]. Dies ist ebenfalls eine Forderung, die in Deutschland stärker beachtet werden sollte (vgl. Kap. 7.3). Wenn eine Person allein eine Zukunftsplanung unterstützt, besteht immer die Gefahr, dass diese nicht weitergeführt wird, weil die Unterstützungsperson an ihre Grenzen stößt und dann niemand da ist, der ihr Dinge abnimmt oder sie an ihr Versprechen erinnert, falls der betreffende Menschen mit Behinderung dazu nicht in der Lage ist oder nicht den Mut dazu aufbringt.
Das dritte Prinzip ist das Sicherheitsprinzip (safety principle), das mit dem Satz "do no harm" (füge keinen Schaden zu) zusammengefasst werden kann (PEARPOINT & FOREST 1999, 100). "Es ist besser bescheiden zu sein und an seinen Fähigkeiten zu zweifeln, als in unbekannte Gewässer zu springen und irreparable Schäden zuzufügen" (ebd.)[43]. Dies bedeutet zum Beispiel, sich realistische Ziele zu stecken, die auch erreicht werden können, keine Versprechen zu brechen und dafür zu sorgen, dass das Zukunftsplanungstreffen für die Hauptperson kein einmaliges Happening ohne Konsequenzen bleibt. Andererseits kann es genauso schädlich sein, Träume und idealistische Ziele nicht zuzulassen (vgl. Kap. 7.4). Die Herausforderung liegt hier wie so oft darin, einen Mittelweg zu finden (vgl. PEARPOINT & FOREST 1998, 98). Schäden können nicht nur seelischer, sondern auch körperlicher Art sein. Hier gilt: "Toleranz gegenüber Lebensentwürfen anderer Personen endet da, wo Gefahren abzuwenden sind" (EMRICH 1999, 121). In diesem Fall geht es dann darum, dass die Versorgung, das körperliche Wohlbefinden u. ä. einer Person gesichert sein müssen.
Das Prinzip der Selbstreflexion und des Zurückblickens(self reflection and review) ist das vierte und letzte Prinzip. PEARPOINT & FOREST fordern: "Wir müssen regelmäßig reflektieren und darauf zurückblicken, was wir mit diesen Methoden machen und wie wir es tun" (1998, 100)[44]. So kann der Nutzen dieses Ansatzes verbessert und einer Verschlechterung kann vorgebeugt werden. "Niemand arbeitet in diesem Bereich ohne Verwirrungen Probleme und Irrtümer, aber Menschen, die bereit sind diese Arbeit zu machen, lernen aus ihren Erfahrungen" (O'BRIEN & O'BRIEN 1991, 33)[45].
Allerdings gilt trotz dieser Prinzipien und aller Bemühungen von beteiligten Personen: "Es gibt keine Garantie auf ein gutes Leben. Es gibt keinen magischen Gürtel. MAP und PATH sind lediglich Methoden, die jemandem helfen können sein eigenes Leben zu entwickeln und zu planen" (PEARPOINT & FOREST 1998, 96)[46].
In den vorhergehenden Kapiteln wurden zahlreiche Aspekte erläutert, die wichtig für erfolgreiche Planung sind. In diesem Kapitel sollen nun die Interviewergebnisse über diejenigen Dinge dargestellt werden, die sich in der Praxis als problematisch erweisen.
Die deutsche Literatur liefert hierzu keine Aussagen (z. B. DOOSE 2000, BOBAN & HINZ 1999 u. a.). Sie ist häufig von einem großen Optimismus geprägt und erweckt den Eindruck, dass persönliche Zukunftsplanung immer mit einem Gewinn für die planende Person verbunden ist und es eigentlich kein Scheitern gibt. Das lässt sich dadurch erklären und rechtfertigen, dass das Konzept in diesem Land noch so unbekannt ist, dass es zunächst einmal mit seinen Vorteilen verbreitet werden muss, bevor es kritisiert und weiterentwickelt werden kann.
Vor diesem Hintergrund wurden die Interviewpartner(innen) sowohl zu diesem Optimismus, als auch zu den auftretenden Hindernissen gezielt befragt.
Für CAROLIN EMRICH geht von der optimistischen Literatur viel Kraft aus (vgl. Interview EMRICH, Z. 121ff). Dies könnte den Leser(innen) Mut machen, das Konzept in der Praxis auszuprobieren, auch wenn es in Deutschland noch recht unbekannt ist. Nach ihren Aussagen ist dieser Optimismus dann in der Praxis allerdings nicht mehr immer zu spüren.
"[Die Umsetzung der Planung bedeutet DM] ein hartes Stück Arbeit für die Personen ... [und ist] oft auch mit Tiefschlägen und mit viel Frustration verbunden" (Interview EMRICH, Z. 123ff).
Diese Frustration kann ihrer Ansicht nach vor allem in der Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und Geschichte eintreten, wenn die planende Person sich Gedanken über ihre begrenzten Fähigkeiten macht. Ein anderer Frustrationsgrund sind oft auch die Rahmenbedingungen der Umwelt und des Hilfesystems, die eine Umsetzung behindern oder unmöglich machen, obwohl man sich gemeinsam einen guten Plan überlegt hat.
PEARPOINT & FOREST (1998, 98) weisen ebenfalls auf die von CAROLIN EMRICH beschriebenen Enttäuschungen und Frustrationen hin, die ihrer Meinung nach überwunden werden können, indem man gemeinsam die vorgesehenen Schritte der Planungsmethoden weitergeht, die Frustration überwindet und sich so den Zielen und Wünschen weiter annähern kann.
Für STEFAN DOOSE hat dieser Optimismus etwas mit einer persönlichen Grundhaltung zu tun, die davon ausgeht, das man viele Dinge ändern kann und sie nicht so hinnehmen muss, wie sie gerade sind. Gleichzeitig sollte man mit seiner eigenen Begrenztheit leben und wo Dinge nicht umsetzbar sind nach anderen Lösungsmöglichkeiten suchen, die das gleiche Ziel erreichen (vgl. Interview DOOSE, Z. 386ff).
O'BRIEN beschreibt 1991 und 1993 verschiedene Probleme, die im Kontext von supported living auftreten können. Dies lässt sich meiner Ansicht nach zum Teil auch auf persönliche Zukunftsplanung und auf Deutschland übertragen, weshalb hier, angelehnt an seine Überlegungen und unterstützt durch Aussagen der Interviewpartner(innen), einige Hindernisse beschrieben werden, die auftreten können.
Probleme können auftreten:
-
bei der Finanzierung der Unterstützung
-
bei der Zusammenarbeit der unterschiedlichen beteiligten Personen
-
in Bezug auf die sozialen Beziehungen und der Integration der planenden Person
-
bei der Notwendigkeit, die alten Grundannahmen, Lösungsmöglichkeiten und Arbeitsweisen zu überdenken und
-
in Bezug auf die Rolle und die Arbeitsweisen des Personals.
Hilfeleistungen für behinderte Menschen werden in der Regel als Sachleistungen nach dem BSHG (Bundessozialhilfegesetz) erbracht. Das kann zum Beispiel ein Wohnheimplatz oder ein Platz in der Werkstatt für behinderte Menschen sein. Diese einerseits sichere und verlässliche Form der Unterstützung hat aber andererseits zur Folge, dass der Einzelne wenig Mitsprachrecht bei ihrer individuellen Ausgestaltung hat. Er verfügt über wenig Bargeld und hat nur geringe Wahlmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang kann es oft schwierig sein, im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung individuell entwickelte Unterstützungsleistungen umzusetzen und finanziert zu bekommen.
CAROLIN EMRICH nennt ein Beispiel für einen geplanten Umzug:
"Jemand will aus einer Heimstruktur ... in eine andere Wohnform [umziehen] und irgendein Kostenträger spielt nicht mit. Dann können die Unterstützungsleute noch so gut ... alles vorbereiten, [aber alles ist dann hinfällig] wenn der Kostenträger plötzlich sagt: ‚Ist nicht, deinen Umzug finanzieren wir nicht'" (Interview EMRICH, Z. 139ff).
Eine Möglichkeit um individuelle Planung zu finanzieren, böte das persönliche Budget, wobei allerdings abzuwarten bleibt, ob sich dieses Modell so in der Praxis durchsetzen wird, dass es leistet, was es zu versprechen scheint. Für STEFAN DOOSE sind dazu das Potenzial und die gesetzlichen Möglichkeiten vorhanden. Das Budget-Modell könne somit eine Möglichkeit sein, das zu finanzieren, was jemand benötigt, um die eigenen Pläne umsetzen zu können (vgl. Interview DOOSE, Z. 558ff).
Die Einführung des persönlichen Budgets könnte andererseits auch bewirken, dass die Methode der persönlichen Zukunftsplanung stärker als bisher genutzt wird, weil ein Unterstützerkreis Hilfe bei der Geldverwaltung bieten könnte, wo eine Person ihr Budget nicht selbst verwalten kann.
CAROLIN EMRICH steht dieser Vermutung allerdings eher skeptisch gegenüber. Sie habe schon mit einer weiteren Verbreitung von persönlicher Zukunftsplanung gerechnet, als die individuelle Hilfeplanung im Gesetz verankert wurde[47]. Diese ist ihrer Ansicht nach nun zu einem "systemimmanenten Produkt" geworden, eine "Gefahr, die auch bei persönlichen Budget drohen" könnte (Interview EMRICH, Z. 371ff).
Ein weiteres Feld, in dem Probleme im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung auftreten können, ist die Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Personen.
LUEG beschreibt diesen Konflikt in ihrem Beitrag über Elternmitarbeit in der Schule. Lehrern und Eltern fehlt das gegenseitige Verständnis füreinander, wenn ihnen die jeweiligen Lebenswelten fremd sind (LUEG, 1996, 25). So können beide Gruppen oft nicht erkennen, dass sie jeweils auf ihre Art um das Wohl des Kindes bemüht sind. Dies ist auch in anderen Arbeitsfeldern der Sonderpädagogik, z. B. in der Schule, in der Frühförderung und anderen Bereichen ein häufiges Problem. Experten und Eltern arbeiten manchmal gegeneinander statt miteinander und verschwenden so wertvolle Energien und Ideen, die durch Gespräche und Ausräumung der gegenseitigen Missverständnisse in konstruktive Lösungsmöglichkeiten umgewandelt werden könnten.
Für die Hauptpersonen stellt mangelhafte Zusammenarbeit oft ein Problem dar, das FRAUKE SANDER folgendermaßen beschreibt:
"Es kommt dann einfach zu einem Zwiespalt, und wenn es ganz schlimm kommt, kann es soweit kommen, dass die eine Seite so redet und die andere so, und dazwischen zerreibt sich irgendwie die Person und weiß einfach nicht mehr: ‚Auf wen soll ich jetzt hören, wer ist jetzt richtig?'" (Interview SANDER, Z. 53ff).
Ähnliche Konflikte können natürlich auch in Unterstützerkreisen auftreten, wenn dort Professionelle und Eltern zusammenarbeiten und Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Eltern können beispielsweise Dinge für gefährlich und überfordernd halten, die Professionelle als wichtig für das Kind einschätzen. Hier ist auf Seiten der Professionellen ein Verständnis für die Eltern angezeigt, die oft schon viele Ratschläge für ihr Kind bekommen haben, die sich dann als wenig hilfreich herausstellten.
STEFAN DOOSE äußert sich zu diesem Thema folgendermaßen:
"Natürlich gibt es in Unterstützerkreisen auch manchmal Konflikte, zum Beispiel in der Form, dass Eltern nicht loslassen können oder Betreuer in einer Wohngruppe jemandem nichts zutrauen. ... Wenn man [Eltern] erst mal abnimmt, dass sie das Beste für ihr Kind wollen, ... dass Loslösung ein schwerer Prozess ist, ... [und] man ihnen anbietet mit ihnen gemeinsam nach einer guten Lösung zu suchen, indem man auch ihre Sache zum Thema macht. Manchmal kann das auch sein: ‚Was brauchen die Eltern für Unterstützung, damit sie zustimmen können, dass der junge Mann mit geistiger Behinderung alleine mit dem Bus fährt? Ist es, dass er Telefongeld mitkriegt? Ist es, dass er ein Handy hat wo eine Nummer einprogrammiert ist? Oder ist es, dass am Anfang jemand mit ihm geht und diesen Weg trainiert?' Also auch die Frage: ‚Was brauchen die Eltern an Unterstützung um den nächsten Schritt zu wagen?'
Und meine Erfahrung ist, dass, wenn Eltern in dieser Weise ernst genommen werden, sie sich oft leichter öffnen können für Dinge, die ihnen vorher Angst gemacht haben. [Man sollte] die Eltern nicht als die Leute, die nicht loslassen können brandmarken. Und ich glaube, ein ganz großes Manko ist, dass Profis keine gute Form von Elternarbeit lernen. Als ich in den USA studiert habe, ... gab es so Kurse, wo wir gemeinsam mit Eltern diskutiert haben: ‚Was macht gute Elternarbeit aus?' So was habe ich in Deutschland noch nie erlebt, dass man sich mit Eltern gemeinsam hinsetzt um die Frage zu klären: ‚Was ist gute Unterstützung für Eltern? ... Ist das wirklich hilfreich was ich mache? Wie kann für euch Unterstützung wirklich aussehen?' ... Ich glaube, ganz wichtig ist eine Grundhaltung, um in den Dialog mit den Leuten, die wir unterstützen wollen, reinzugehen und zu gucken, was ist für euch wirklich hilfreich? Und dann Vorschläge zu machen, wäre das hilfreich oder das hilfreich? Und auch ab und zu auszuwerten im Sinne von Qualitätssicherung. ... Und da haben wir eine ganz schlechte Tradition, das fängt in der Universitätsausbildung an" (Interview DOOSE 442ff).
Wie schwer es für Eltern ist, ihr behindertes Kind nach der Geburt zuerst anzunehmen, seine Willens- und Bedürfnisäußerungen zu verstehen, immer wieder für Fördermöglichkeiten und Akzeptanz des Kindes zu kämpfen, sozial unerwünschtes Benehmen zu verteidigen und anschließend das Kind wieder "abzugeben", um ihm mehr Eigenständigkeit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu verschaffen, beschreibt eindrücklich RENATE BöRNER in ihrem Beitrag zum Duisburger Kongress (vgl. BöRNER 1996).
Es geht also darum, die Perspektive der Eltern zu verstehen und ihnen Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten, die sie sich wünschen. "Jede Familie hat ihre eigenen Geschichte und ein einzigartiges Beziehungsnetzwerk und das Personal muss in ihrem Kontakt mit den Familien sensibel damit umgehen" (WERTHEIMER 1997, 8)[48].
Ein Fehler wäre es, Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind oder auch für einen erwachsenen Menschen zu planen, dadurch aber seine Beziehung zu den Eltern oder anderen Personen zu gefährden. Es würden dann der Hauptperson wichtige informelle Bezugspersonen verloren gehen, was nicht im Interesse von persönlicher Zukunftsplanung sein kann. Dieses entspricht dem dialektischem Vorgehen des Empowerment-Konzptes. So hemmt eine einseitige "Aufklärung" der Eltern durch Fachleute, die ihren Klienten ein autonomeres Leben mit mehr Selbstbestimmung verschaffen wollen die gute Beziehung zu Eltern. Das hat zur Folge, dass ein gemeinsames Suchen nach Lösungen und Perspektiven unmöglich gemacht wird (THEUNISSEN 1995, 174).
Für Fachleute ist außerdem zu beachten, dass Hindernisse oder Probleme von unmittelbar Betroffenen viel schwerer zu ertragen sind, als von anderen Helfern. Eltern müssen beispielsweise mit den Problemen ihrer Kinder täglich leben und können diese nicht von einer distanzierten Außensicht betrachten, wie dieses Professionellen möglich ist (vgl. Interview DOOSE 407ff).
Es geht also im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung darum, Lösungsmöglichkeiten und Perspektiven zu entwickeln, mit denen alle einverstanden sein müssen, die täglich mit den Ergebnissen leben und arbeiten werden. Das kann mehr Zeit und Umwege erfordern, ist aber dafür zufriedenstellender für alle Beteiligten.
Es stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, wie persönliche Zukunftsplanung funktionieren kann, wenn die Hauptperson über keine informellen Kontakte verfügt und damit kein soziales Netz hat, das die "informelle Unterstützung" leisten kann.
Tatsächlich ist dies ein großes Hindernis für persönliche Zukunftsplanung, was auch schon in Kapitel 7.6 deutlich wurde und von allen Interviewpartnern bestätigt wird. FRAUKE SANDER beschreibt beispielsweise, wie sehr ihre Arbeit erschwert wird, wenn diese keine Unterstützung, sondern vielleicht sogar Behinderung aus dem Familienkreis erfährt (vgl. Interview SANDER 57ff.). Das lässt sich auch auf persönliche Zukunftsplanung übertragen, wie STEFAN DOOSE bestätigt:
"Es ist natürlich umso schwieriger, umso kleiner das Netzwerk der Person ist. Also, wenn man jetzt Leute hat, die in Einrichtungen leben, ... dann ist es oft schwierig, weil es vielleicht gar kein informelles Netzwerk gibt, weil sozusagen um die Person rum ganz viele bezahlte Helfer sind. Vielleicht auch Kollegen aus der Wohngruppe oder so, wo vielleicht auch die Beziehung unterschiedlich gute Qualität haben kann" (Interview DOOSE Z. 271ff).
CAROLIN EMRICH nennt zwei Bereiche in denen Hindernisse auftreten können: Einmal bei den "Rahmenbedingungen", womit das starre Hilfesystem und die oben beschrieben Finanzierungsproblematik gemeint sein könnten, sowie außerdem das Verhalten von Menschen im Umfeld der planenden Personen.
"Ganz vehement ist es dann, wenn Leute Personen in ihrem Umfeld haben, die sagen: ‚Das kann nicht klappen.' Oder ... dass jemand nicht kreativ genug war um zu gucken: ‚Wenn das nicht klappt, was könnte denn dann klappen' Vielleicht 'ne abgespecktere Version eines Wunsches ..." (Interview EMRICH, Z. 67ff).
Hier wird deutlich, dass nicht nur fehlende Bezugspersonen, sondern auch deren behinderndes Verhalten eine großes Problem darstellen können.
FRAUKE SANDER berichtet, dass es ihrer Erfahrung nach sehr selten ist, dass Menschen von anderen Personen als ihrer Familie oder Professionellen unterstützt werden. Die im Rahmen der persönlichen Zukunftsplanung geforderte Unterstützung durch Freunde oder Nachbarn ist ihrer Erfahrung nach sehr selten.
"Zum Beispiel [Unterstützung] aus einem Wohnheim, das ist dann wieder diese professionelle Seite. Oder von Seiten der flexiblen Hilfen. ... Ich arbeite im Moment mit einem Wohnheim von uns sehr gut zusammen, die die Leute super gut unterstützen, auffangen, die ganz viel Arbeit da leisten. Wo ich dann wirklich sagen muss: Das entlastet mich total, dafür habe ich wieder Zeit für zwei andere Personen. ... [Das sind] wirklich dann vorwiegend Professionelle. Dass mal jemand so viel Unterstützung kriegt zum Beispiel vom Nachbarn oder so was: Es gibt so Einzelfälle, das sind so gewachsene Strukturen, aber in aller Regel sind es in erster Linie entweder Angehörige oder Professionelle" (Interview SANDER, Z. 131ff).
Über die Gründe für die Schwierigkeiten kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht werden. Es kann nur noch einmal bekräftigt werden, dass bei allen Unterstützungsplanungen jede Form von "informeller Unterstützung", und sei sie noch so gering, einbezogen werden muss. Nur dadurch kann die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich daraus tragfähigere Beziehungen entwickeln können. Dieses ist besonders nötig angesichts einer Tatsache, die FRAUKE SANDER beschreibt:
"Aber so ansonsten an Freundschaften ist da eigentlich wenig. Wenn Partnerschaften, sind die meistens schon in der Werkstatt geschlossen worden, dass heißt auch wieder mit einem ehemaligen Kollegen, oder einer Kollegin ... Dass aber Beziehungen geschlossen werden von Personen, die mittlerweile draußen arbeiten mit ... nicht behinderten Personen...: Es mag Einzelfälle geben, ich kenn sie nicht" (Interview SANDER 161ff).
Gerade weil es offenbar so schwer ist, Kontakte zu nicht Behinderten aufzubauen, ist es für Personen, die ihr Leben außerhalb der traditionellen Behinderteneinrichtungen leben auch wichtig, dass die Möglichkeit für Kontakte zu anderen Personen mit Behinderungen besteht. Diese sind nötig, um nicht in soziale Isolation zu geraten und außerdem nicht das Gefühl zu haben, mit seiner Behinderung "allein dazustehen".
Eine persönliche Zukunftsplanung kann scheitern, wenn die Unterstützungspersonen die planende Person nicht ernst nehmen und keine respektvolle Grundhaltung ihr gegenüber haben (Kap. 4.2). Sie müssen also der planenden Person zutrauen, ihre Wünsche, Träume und Ziele am besten selbst zu äußern und umzusetzen, auch wenn diese nicht vollständig mit denen der Unterstützungspersonen übereinstimmen.
"Ganz wichtig ist, die Grundhaltung mit der diese Planung betrieben wird. Also man kann auch persönliche Zukunftsplanung machen, indem man über die Köpfe von Leuten redet, indem man sie nicht ernst nimmt, indem man sie nicht direkt anspricht, indem man nicht versucht zu ergründen, was sie eigentlich wollen und das ist manchmal auch gar nicht so einfach" (Interview DOOSE, Z. 291ff).
Es muss im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung behinderten Menschen zugestanden werden, in eigener Entscheidung zentrale Bereiche ihres Lebens zu planen und zu verändern. Persönliche Zukunftsplanung nützt einer Person nichts, wenn nur vordergründig ihre Methoden angewendet werden, dabei aber sofort darauf geachtet wird, dass die Ziele innerhalb von kürzester Zeit ohne Aufwand und ohne Veränderung des Systems oder des Trägers zu erreichen sind, wie STEFAN DOOSE anschaulich formuliert:
" ... dass man ... schon frühzeitig die Schere im Kopf hat und die Planung dann sozusagen nur auf den nächsten Bowlingnachmittag oder ... [darauf] sich mal wieder ein neues Hemd einzukaufen ... reduziert [wird]" (Interview DOOSE, Z. 317ff).
Weiterhin besteht eine Gefahr darin, dass die Planungen nicht ernst genommen werden und die Personen nach einem vielversprechenden Seminar anschließend mit ihrer Planung allein gelassen werden und diese nicht in die Realität umgesetzt werden können.
"... Ich hab' in Österreich ... Fortbildung gehabt,... und ich bin da [nach einem Jahr] wieder eingeladen worden ... Bei einem jungen Mann ... hat die Planung stattgefunden und wir haben auch denke ich ganz gut Punkte aufgelistet, die sich damals ändern sollten, aber die Planung ist nicht weiter verfolgt worden. Und ich glaube, dass ist ein recht häufiger Knackpunkt, sozusagen auch das Durchhalten zu fördern, ... dass so was auch weiterverfolgt wird, auch wenn bei der Person selber vielleicht die ersten Ermüdungserscheinungen auftreten und Probleme auftreten. ... Nach einem Jahr ... mussten [wir noch mal von vorne] gucken, was ist jetzt, und wie kann es jetzt weitergehen. ... Und ich glaub' der größte Haken ist, dranzubleiben. ... Dass es ... jemanden gibt, möglichst die Person selber, vielleicht mit Unterstützung von anderen Personen, die diesen Prozess weitertreibt und weiterverfolgt" (Interview Doose, Z. 238ff.).
Dieses scheint in abgeschwächter Form auch im Beispiel von THORSTEN (Kap. 8.4) zuzutreffen und damit ein häufigeres Problem in Deutschland zu sein. Dabei soll niemandem böse Absicht unterstellt werden. Die Leiter(innen) der Seminare wollen das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung verbreiten und wählen dazu Formen, die ihnen angemessen erscheinen. Die planenden Personen und deren Unterstützer(innen) sind bestimmt guten Willens, alle Pläne möglichst auch umzusetzen. Allerdings ist die Situation auf einem eventuell mehrtägigen Seminar so, dass sich eine recht euphorische und kraftvolle Stimmung entwickeln kann, in der es möglich scheint, vieles im eigenen Leben zu verändern. Diese Stimmung hält dann aber nicht an, wenn man mit all seinen guten Absichten in sein altes Leben zurückkehrt und dort auf dieselben Hindernisse stößt wie zuvor. Hier fehlt dann aber die Stützung durch die Seminargruppe, um gemeinsam weiter nach Lösungen zu suchen, und die Planung gerät nach und nach in Vergessenheit. Wie an verschiedenen Stellen schon angesprochen, ist hier ein Unterstützerkreis hilfreich, der sich regelmäßig trifft, um auftretende Problemen zu überwinden und der Planung einen verpflichtenderen Stellenwert zu geben.
Professionelle arbeiten im Kontext von supported living und persönlicher Zukunftsplanung anders, als sie es im traditionellen Hilfesystem gewöhnt sind. Es gibt keine Lösungsmöglichkeiten mehr für alle, sondern die Zusammenstellung der Unterstützung ist für jede Person immer wieder neu. Es gibt also keine Stellenbeschreibungen und keine allgemein gültigen Anleitungen für die tägliche Arbeit (vgl. WERTHEIMER 1997, 59). Diese Situation erfordert ausführliche Reflexionen und Beratung durch Kollegen und Kolleginnen (vgl. WERTHEIMER 1997, 6f). Das gemeinsame Gespräch ist dabei von zentraler Bedeutung, da das "Unterstützungspersonal zwar viele positive Veränderungen feststellen wird und diese auch feiern kann, es aber auch schwierig finden kann, wenn jemand eine schlechte Phase durchmacht" (WERTHEIMER 1997, 3)[49]. Es ändert sich also die Rolle der Fachleute: sie werden zur Koordinatorin, zum Unterstützer oder zur Moderatorin (vgl. DOOSE 2000, 121). Dies stellt einerseits eine große Herausforderung dar, hat andererseits aber auch sehr positive Seiten:
"Und wenn sie ... merken, dass plötzlich ihre Arbeit eine ganz andere Qualität kriegt, weil sie es nicht mehr alleine machen müssen. Weil sie es plötzlich von anderen Leuten erfahren, weil auch sie in ihrer Arbeit unterstützt werden. ... Es geht so ein bisschen auch dazu, die Profis zu einer anderen Art von Arbeit zu verführen" (Interview DOOSE, Z 433ff).
Andererseits kann die Arbeit auch eine vermehrte zeitliche Belastung darstellen, die aber angesichts der Vorteile in Kauf genommen wird (vgl. Interview DOOSE, Z. 432).
Jedoch nehmen professionelle Personen im Konzept der persönlichen Zukunftsplanung eher eine untergeordnete Rolle ein. Wie schon beschrieben, werden sie nur herangezogen, wenn es keine informellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
"[Professionelle] sind ja eigentlich so in diesem ganz ursprünglichen Konzept auch eher so ein bisschen außen vor, sind ja eher so: ‚Na ja, wenn da nichts anderes mehr greift, dann die.' Das sehe ich ja nicht unbedingt so. ... Die können auch ganz wichtige Funktionen haben, nämlich gerade dann, wenn zum Beispiel Familie oder Freundeskreis immer nur sagt: ‚Nee, das kannst du alles nicht.' Dann würde ich mir wünschen es gäbe professionelle Strukturen, die einfach auch jemandem eine Möglichkeit geben können, das er plant und das umsetzt" (Interview EMRICH, Z. 171ff).
Professionelle können also auch dann eine wichtige Rolle im Rahmen der persönlichen Zukunftsplanung einnehmen, wenn ein soziales Umfeld zwar vorhanden ist, aber die planende Person nicht kooperativ unterstützt wird. Dies ist im Beispiel von JANA & ANSGAR (Kap. 8.2) der Fall. Dabei ist es aber wichtig, dass die planende Person selbst eben auch die mangelnde Unterstützung als solche empfinden und äußern muss. Sie muss aus eigener Initiative den Anstoß dazu geben, das Umfeld (was sonst bei Planungen einen zentralen Stellewert einnimmt) nicht mit einzubeziehen. Diese Entscheidung sollte nicht leichtfertig aus einer distanzierten professionellen Sicht erfolgen, sondern ist vielmehr von der individuellen, subjektiven Sichtweise der planenden Person abhängig, die oft nicht von außen beurteilt werden kann.
Ein Problem in der Zusammenarbeit mit Professionellen, das auch in den Interviews beschrieben wurde, ist die Schwierigkeit der "Profis", sich auf die oben beschrieben neuen Denkweisen und Arbeitsfelder einzulassen:
"Gerade bei den Profis kommt es relativ häufig vor, dass die immer wieder irgendwelche Bedenken haben und das die in ihren Strukturen denken und ganz unflexibel sind, einfach mal andere Ideen zu entwickeln. Also die sind so festgelegt auf das wie es halt im Wohnheim abläuft oder was ihr Träger an Angeboten macht. Dass man vielleicht auch mal den Träger wechseln könnte, ... das ist so fernab des gedanklichen Horizonts" (Interview EMRICH Z. 192ff).
Diese bestätigt auch DOOSE, (Z. 275) im Interview. Seiner Ansicht nach kann dieses Problem folgendermaßen abgemildert werden:
"Bei ... [einem] Unterstützungskreis [ist es] hilfreich, dass der Unterstützer nicht aus einer beteiligten Institution kommt, sondern unabhängig ist. Das wird nicht immer so machbar sein" (Interview DOOSE, Z. 426ff).
Ingesamt gilt, dass "die Zukunft von persönlicher Zukunftsplanung von dem Willen und der Fähigkeit [des Personals] abhängt, ihre Praxis durch kritische Reflexion der Auswirkungen ihrer Arbeit im Leben der behinderten Personen und ihrer Familien zu verbessern" (O'BRIEN & LOVET 1992, 20)[50].
Dieser Teil bildet den Abschluss des siebten Kapitels. In den vorhergehenden Unterpunkten wurden viele Faktoren erläutert, die wichtig für eine erfolgreiche Zukunftsplanung sind. Diese werden nun noch einmal kurz zusammenfassend aufgeführt, bevor abschließend die Interviewergebnisse zu diesem Thema dargestellt werden. Dabei beziehe ich mich auf eine Liste von JANE WELLS (2000,150ff), die zum größten Teil Punkte enthält, die aufgrund ihrer Wichtigkeit bereits weiter oben genauer beschrieben wurden.
Der Wunsch nach Veränderungen
Der Wunsch nach Veränderungen ist selbstverständlich eine Grundvoraussetzung für persönliche Zukunftsplanung. Wenn kein Veränderungswunsch besteht, ist auch keine Planung erforderlich. Dieses wurde näher in Kapitel 7.1 beschrieben.
Diesen Punkt erläutert WELLS aber noch weiter an anderer Stelle: "Die Idee der persönlichen Zukunftsplanung hat kaum eine Chance erfolgreich zu sein, wenn die Treffen verordnet werden und die Gruppenteilnehmerinnen keinen persönlichen Anteil und kein Interesse am Ergebnis haben" (2000, 142). Ein persönliches Interesse am Ergebnis und eine klare Bereitschaft sich zu engagieren sind also bei allen beteiligten Personen unerlässlich.
Eine positive Sicht auf persönliche Fähigkeiten
Gerade wenn die Ausgangssituation schwierig ist, ist es wichtig, nicht den Optimismus und die positive Sicht auf die Dinge und die beteiligten Personen zu verlieren. Der Effekt, den einerseits positive und andererseits negative Sichtweisen auf Prozesse haben können, ist ausführlicher in Kapitel 5.4 erläutert.
Der persönliche Glaube an ein bereicherndes Zusammenleben in der Gemeinschaft
Je mehr die Verbesserungswünsche einer Person mit dem Wunsch nach Verbesserung von sozialen Dienstleistungen und Veränderungen im Gemeinwesen zu tun haben, desto höher ist die Chance auf tatsächliche Veränderungen (vgl. WELLS 2000, 150f). Welche Grundannahmen für ein gemeinsames Leben in der Gemeinde wichtig sind, ist in Kapitel 3.2.1 näher erklärt.
Der Kreis der Unterstützer(innen)
Es ist wichtig, dass die Hauptperson sich nicht alleingelassen fühlt, sondern auf Unterstützung von anderen zählen kann. Die Rolle und der Stellenwert von Unterstützerkreisen wurde in Kapitel 7.3 detaillierter ausgeführt. "Je unterschiedlicher die Teilnehmerinnen sind, desto mehr Stärke besitzt die Gruppe" (WELLS 2000, 151). Ein guter und tragfähiger Unterstützerkreis bietet die Chance, dass sich in ihm die nachfolgend geforderten Personen befinden, die für eine erfolgreiche persönliche Zukunftsplanung wichtig sind.
Eine ausgebildete Moderator(in)
Die Rolle des Moderators wurde in Kapitel 5.4 erläutert. Seine Aufgabe besteht darin, die unterschiedlichen Ideen und Positionen zu vereinen, darauf zu achten, dass alle Beteiligten eines Planungstreffens ihre Ansichten äußern können, für weitere Treffen zu sorgen und sicherzustellen, dass auch tatsächlich an der Verwirklichung der geplanten Ziele gearbeitet wird. "Entscheidend für den Erfolg von persönlicher Zukunftsplanung ist, dass es mindestens eine Person gibt, die den Plan im Auge hat und dafür sorgt, dass die geplanten Dinge auch angegangen und durchgeführt werden" (DOOSE 2000, 100). Wenn im Unterstützerkreis keine Person ist, die diese Aufgabe erfüllt oder die planende Person nicht selber dafür sorgt, sollte der/die Moderator(in) diese übernehmen.
Ein(e) engagierte(r) und mit der Hauptperson eng verbundene(r) Mitstreiter(in)
Diese Person ist jemand, der sich über lange Sicht mit der Hauptperson verbunden fühlt und für sie da ist. Das kann im Normalfall niemand sein, der die Person lediglich aus sozialem Gewissen oder Berufsgründen heraus unterstützt (vgl. WELLS 2000, 151). Dies spricht wieder für die Notwendigkeit eines Unterstützerkreises, der aus möglichst vielen, nicht im System verankerten Personen besteht. Hier können solche Mitstreiter(innen) gefunden werden, seien es Eltern, Geschwister oder Freunde und Freundinnen (vgl. Kap. 7.3).
Die folgenden vier Punkte, die WELLS nennt, wurden noch nicht eigens erläutert, sprechen aber für sich selbst. Da sie sich alle auf ähnliche Sachverhalte beziehen, werden sie auch gemeinsam, nach dem vierten Punkt, erläutert.
Eine mit der Region eng verbundene Person
Eine Verbindung zum weiteren Umfeld
Eine Einrichtung, die sich für Veränderungen engagiert und dafür offen ist
Der Einfluss auf Verantwortliche
Ideen für Veränderungen und eine erfolgreiche Zukunft können noch so gut sein, haben aber wenig Chancen zur Verwirklichung, wenn es in der Umgebung der planenden Person niemanden mit guten Verbindungen nach außen gibt. Dies sind Personen, die über Hilfsangebote in der näheren und weiteren Umgebung genau Bescheid wissen, die viele Bekannte haben und über relevante Kontakte verfügen. Solche Menschen können Professionelle sein z. B. Integrationsfachdienstmitarbeiter(innen), aber auch Bürger(innen), die Einfluss in Institutionen der Gemeinde haben oder die einfach nur bekannt und beliebt sind.
Flexible Ressourcen für die persönliche Unterstützung
Dieser Punkt besagt, dass Zeit und Geld zur Verfügung stehen müssen, um phantasiereiche Ideen zur Unterstützung verwirklichen zu können. Dies können oft ambulante Hilfedienste bieten oder auch Unterstützungsmöglichkeiten, die aus dem persönlichen Budget bezahlt werden.
Viele dieser Punkte sind mit hoher Wahrscheinlichkeit dann erfüllt, wenn die planende Person über ein stabiles, offenes und wohlwollendes soziales Netz verfügt. Die Wichtigkeit dieses Netzes wurde ausführlich in Kapitel 7.6 erläutert.
CAROLIN EMRICH nennt drei Voraussetzungen, die ihrer Erfahrung nach wichtig für erfolgreiche Zukunftsplanung sind.
"Also die [erste] Grundvoraussetzung, glaube ich, ist wirklich, dass Leute das selbst wollen. ... Irgendein Willen entweder zur Veränderung oder irgendwie zum Traum erfüllen, der muss da sein und der muss auch relativ hartnäckig da sein, ... gerade bei Leuten, die in Institutionen leben. Die haben einfach bestimmte Hürden zu überwinden. ... Das ist so eine wesentliche Grundvoraussetzung und dass die auch relativ mutig sind und sich nicht von Leuten, die vielleicht in ihrem Umfeld sagen: ‚Na, weiß ich ja nicht, ob das so gut ist.' Das die sich nicht so schnell abbringen lassen. Sondern, dass sie da sagen: ‚Ich versuch' das zumindest mal'" (Interview EMRICH, Z. 43ff).
Dies ist ein Punkt, der zwar in der Literatur beschrieben wird (vgl. WELLS 2000,150), dort aber meines Wissens nach den Aspekt des erforderlichen Mutes außer Acht lässt, der allerdings nicht zu unterschätzen ist, wie jeder von uns nachvollziehen kann, wenn wir an entscheidende Veränderungen im Leben denken.
"Das [zweite] ist, dass Leute ... Phantasien entwickeln müssen so und das kann auch nicht jeder also ... wie schwer das vielen fällt so Ideen zu entwickeln Träume zu haben. Das auch legitim zu finden, dass man irgendwelche Wünsche hat. Ja, da braucht es also auch so ein bisschen Phantasie für die eigenen Person. Das ist die zweite Grundvoraussetzung" (Interview EMRICH, Z. 53ff).
Das Problem liegt wohl darin, dass Menschen mit Behinderungen selten über ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen befragt werden und sie von ihrem Umfeld eher davon abgehalten werden zu träumen, da viele Dinge für sie unerreichbar scheinen (vgl. Kap. 7.4).
CURTIS & DEZELSKY weisen darauf hin, dass man Materialien, wie z. B. die Traumkarten benutzen kann, um die Hauptpersonen darin zu unterstützen, Ideen für Träume und Wünsche zu entwickeln, wenn sie damit Schwierigkeiten haben (1994a, 75). Vor einem Zukunftsplanungstreffen kann man sich also mit Hilfe verschiedener Materialien über seine Stärken Gedanken machen, überlegen, wobei man Hilfe braucht und anfangen, erste Wunschvorstellungen zu formulieren. Diese könnte helfen, langsam das Träumen zu lernen (z. B. CURTIS & DEZELSKY (1991, 1994b), DOOSE & GöBEL (2000) und BAG UB (o. J.)).
STEFAN DOOSE drückt dies ähnlich aus. Für ihn ist es wichtig, dass eine Zukunftsplanung kein einmaliges Ereignis bleibt, sondern dass sie in einen längeren Prozess eingebettet sein sollte.
"Und ich glaube, es ist sinnvoll vorher auch schon Dinge getan zu haben, um auf Ideen zu kommen, sei es, dass man ins Gespräch kommt über die Dream Cards oder Lebensstilkarten oder überhaupt über verschiedene Übungen. Dass das vorher Thema ist, dass das also ein Prozess ist und nicht so ein Treffen, wo man mal die Wunderkerzen abbrennt und wo weder vorher was passiert ist, noch irgendwie hinterher was" (Interview DOOSE, Z. 324ff).
CAROLIN EMRICH nennt die dritte Voraussetzung für erfolgreiche Planung:
"Und eine dritte, glaube ich, die ganz, ganz wichtig ist, einfach dass es Leute im Umfeld gibt, die sagen: ‚Ich mach das mit dir. Ich setz das mit dir um. Wir probieren das aus.' Und die sich das dann aber auch wirklich ernsthaft vornehmen. Und da wirklich auch am Ball bleiben mit der Person. Das sind, so glaube ich, die wichtigsten Kriterien, die ich da finde" (Interview EMRICH, Z. 60ff).
DOOSE bestätigt diese Einschätzung, dass ein gemeinsames Vorgehen bei persönlicher Zukunftsplanung hilfreich ist.
"Das gemeinsame Durchstehen von Dingen, die vielleicht schwer zu tragen sind, von schwierigen Erfahrungen, das [ist gut], weil man das nicht alleine machen muss" (Interview DOOSE, Z. 401ff).
Auch in der Literatur wird die Notwendigkeit von sozialer Unterstützung vielfach beschrieben und hat deshalb auch in dieser Arbeit schon viel Raum eingenommen. Daraus lässt sich schließen, dass dieser Faktor ein wichtiger aber gleichzeitig einer ist, der am schwierigsten beeinflusst werden kann. FRAUKE SANDER drückt den großen Vorteil vorhandener sozialer Unterstützung folgendermaßen aus:
"[Wenn] eine positive Bindung wirklich da ist ..., dann, ganz ehrlich, dann brauch ich nicht viel zu machen, dann läuft das ganz von alleine, weil dann ganz viel von der Familie selber aufgefangen wird" (Interview SANDER, Z. 82ff).
Diese Äußerung lässt sich ohne weiteres vom Arbeitsfeld der beruflichen Integration auf den Kontext von persönlicher Zukunftsplanung übertragen. Wenn eine große Unterstützung aus dem sozialen Umfeld vorhanden ist, dann ist nur noch im geringen Maße professionelle Hilfe nötig. Eine Garantie für das Gelingen bietet gute soziale Unterstützung jedoch nicht.
"Wichtig ist ..., dass die Leute im Umfeld irgendwie versuchen alles möglich zu machen mit der planenden Person, aber manchmal gibt es, ... gerade für Leute die auf Hilfe angewiesen sind, richtig bescheuerte Bedingungen." (Interview EMRICH, Z. 146ff).
STEFAN DOOSE nennt noch weitere günstige Faktoren. Diese sind:
-
herauszuhören, was die Person eigentlich will,
-
der planenden Person die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren, die sie noch nicht kennt und
-
die Planung nicht als statisches Gebilde zu sehen, von dem nicht abgewichen werden darf, sondern die Prozesshaftigkeit der Planung und deren Umsetzung zu begreifen (vgl. Interview DOOSE, Z. 304ff).
Er hebt außerdem hervor, dass der Ansatz der persönlichen Zukunftsplanung nicht als Patentlösung für alle behinderten Menschen angesehen werden darf, sondern für die jeweilige Person passen muss. Dieses hat er bereits in seinem Buch herausgestellt (2000, 105).
Für Personen in Planungsprozessen ist es wichtig, einen Traum zu haben und eine Utopie davon, wie die Wirklichkeit eigentlich sein sollte. Dabei darf nicht aus den Augen verloren werden, dass eine Utopie jedoch nicht 1:1 umzusetzen ist, sondern dass die Möglichkeiten des Menschen begrenzt sind (vgl. DOOSE Interview, Z. 395ff).
Zusammen mit den in der Literatur genannten Faktoren geben diese Ergebnisse einen umfassenden Einblick in die für erfolgreiche Planung und Umsetzung erforderlichen Faktoren. Sie zeigen einen eindeutigen Schwerpunkt bei der Wichtigkeit von sozialer Unterstützung und begründen damit, dass dieser Faktor als der wichtigste angesehen werden muss.
[29] "The person at the focus of planning, and those who love the person, are the primary authorities an the person's life direction" (Übersetzung DM).
[30] "... when it is clear that they do not have the total responsibility for an individual but that it will be shared among the group" (Übersetzung DM).
[31] "If the circle hasn't formed naturally we have to find a way to make it happen" (Übersetzung DM).
[32] "We believe it is not ethical to plan for a person if the person is excluded" (Übersetzung DM).
[33] "Words like 'mistake' or 'error' generally have negative connotations despite the fact that they frequently offer some of the best opportunities for learning how to do things better" (Übersetzung DM).
[34] "...listening is much more than passing strings of words from mouth to ear. Listening is resonating in body, in imagination, and in spirit" (Übersetzung DM).
[35] "One of the most common misunderstandings of person centred planning is that it is a short series of meetings whose purpose is to produce a static plan" (Übersetzung DM).
[36] "Planning is an ongoing part of life - rather than a separate, yearly event" (Übersetzung DM).
[37] "Remember that individuals are going to share a lot of information with you. Respect each person's privacy" (Übersetzung DM).
[38] Übersetzung DM.
[39] "For us MAPS and PATH are not just another way of doing service plans, they represent a different way of thinking" (Übersetzung DM).
[40] "One of the most challenging aspects of supported living is helping people use informal support and community resources wherever possible." (Übersetzung DM)
[41] "Collaboration between people with disabilities an their support workers to overcome isolation and loneliness is one of the most exciting and confusing areas of work in supported living" (Übersetzung DM).
[42] "Never do it alone. Do not facilitate these processes alone because it models the dangerous assumption that we can manage life alone. There is safety in partnership" (Übersetzung DM).
[43] "Better to be humble and nervous about your capacities than to leap into unknown waters and do irreparable damage" (Übersetzung DM).
[44] "We must constantly reflect and review what and how we are doing with these tools" (Übersetzung DM).
[45] "No one does the job without confusion, problems, and errors, but people who are capable of doing the job learn from their experiences" (Übersetzung DM).
[46] "There is no guarantee of the good life. There is no magic bullet. MAPS and PATH are simply tools to help someone create and plan their own life" (Übersetzung DM).
[47] Am 01.01.1999 trat eine Neuregelung der §§ 93ff des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) in Kraft, wodurch individuelle Hilfeplanung und die Bildung von Hilfebedarfsgruppen in der Behindertenpädagogik zu einem aktuellen Thema wurden (vgl. EMRICH 1999, 30ff)
[48] "Each family has its own history and unique network of relationships and staff need to be sensitive to these in their contact with families" (Übersetzung DM).
[49] "Support Workers may notice and celebrate many positive changes, bat can find it hard when the person is going through a bad path" (Übersetzung DM).
[50] "The future of person centred planning depends on their willingness and ability to improve their practice through critical reflection on the effects of their work in the lives of people with disabilities and their families" (Übersetzung DM, angepasst an den Satzbau.).
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel werden Geschichten von Menschen erzählt, die persönliche Zukunftsplanung als eine Methode empfinden, mit der sie ihre jetzige Lebenssituation verbessern können. Die Beispiele sind aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit stark verkürzt und es werden nur wenige Zitate verwendet. Um einen lebendigeren Eindruck von der Lebenssituation der Betroffenen zu bekommen, wird auf die Transkription der Interviews im Anhang verwiesen. Am Ende des Kapitels stehen Anmerkungen zu den dargestellten Beispielen, die weitere Besonderheiten, Chancen und Probleme im Kontext von persönlicher Zukunftsplanung aufzeigen.
Für MAIK (Name nicht geändert) wurde Anfang März 2002 ein Unterstützerkreis ins Leben gerufen, der sich zusammen mit ihm und seiner Familie Gedanken um die weitere Zukunft machen sollte. MAIK besuchte damals im neunten Schuljahr die Integrationsklasse einer Gesamtschule. Es war unklar, ob er auch das 10. Schuljahr besuchen dürfte und wo er nach der Schule arbeiten könnte. Vor ihm wurde in seiner Heimatstadt noch kein Schüler mit Behinderung bis zum Ende seiner Schulzeit integrativ beschult, so dass es auch keine Beispiele gab, an denen sich die Familie hätte orientieren können. Angesichts dieser unklaren Situation erschien eine persönliche Zukunftsplanung mit einem Unterstützerkreis angebracht. Das zehnte und für MAIK letzte Schuljahr an einer allgemeinbildenden Regelschule sollte so gestaltet werden, dass es einen guten Übergang in das spätere Berufsleben ermöglichte.
Idee der Eltern war und ist außerdem, dass MAIK ein Modell dafür sein könnte, welche Perspektive Integrationsschüler und -schülerinnen im letzten Schuljahr und nach der Schule haben. Insofern wäre ein gutes Konzept für ein 10. Schuljahr auch für andere Integrationsschüler und -schülerinnen hilfreich. Dass MAIK sozusagen Modell für andere Jugendliche sein kann, könnte dazu genutzt werden, um an Kooperationspartner zu appellieren, ihre Unterstützung zuzusichern.
Beim ersten Treffen wurde mit der Methode PATH das folgende Jahr geplant (siehe Abbildung in diesem Abschnitt). Ich konnte beim dritten Treffen des Unterstützerkreises hospitieren, bei dem überprüft werden sollte, ob die Ziele vom 12.09.2002 erreicht wurden und was die nähere Zukunftsperspektive ist.
Bei diesem Treffen waren anwesend: MAIK, seine Mutter, sein Vater, ein Mitarbeiter vom Integrationsfachdienst, ein Mitarbeiter von einem anderen Bildungsträger (für Praktikumsmöglichkeiten), ein AVJ-Lehrer (Ausbildungsvorbereitungsjahr) einer Schule der Stadt, seine derzeitige Lehrerin, sein Praktikumsanleiter, STEFAN DOOSE als Moderator und der Zivildienstleistende, der MAIK momentan in der Schule und an seiner Praktikumstelle unterstützt. Dieser war über Bekannte der Familie empfohlen worden.
Zu Beginn wurden der aktuelle Stand erarbeitet und verglichen, welche der bisherigen Ziele erreicht wurden. MAIK macht momentan von montags bis mittwochs bis zum Ende des Monats ein Praktikum bei der Stadtverwaltung (vgl. Beobachtungsmitschrift, Z. 7ff).
Er öffnet dort eingehende Post, verteilt hausinterne Post, heftet Rechnungen ab und stempelt sie mit dem Posteingangsstempel, sucht am Computer Akten heraus, erfasst diese und tippt Karteikarten (vgl. Beobachtungsmitschrift, Z. 62ff).
Donnerstags und freitags besucht MAIK das 10. Schuljahr an seiner Schule. Dort erhält er donnerstags Einzelunterricht und nimmt an einem Bistro-Projekt teil. Freitags bearbeitet er mit seinem Zivi Aufgaben vom Vortag. Am Unterricht seiner alten Klasse kann MAIK nicht teilnehmen, da diese sich nach Aussagen der Lehrerin auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten muss. Das Konzept für das 10. Schuljahr ist noch nicht ausgereift, da die Situation in der Schule nicht zufriedenstellend ist und die Verbindung zwischen Schule und Praktikum verbessert werden muss.
Im Laufe von MAIK Zukunftsplanung sollte bei "Aktion Mensch" ein Projekt zum Thema "Übergang von der Schule in den Beruf" bewilligt werden, um in seiner Situation Hilfe leisten zu können. Dies ist bisher noch nicht geschehen, aber "auf gutem Wege".
Eigentlich sollte MAIK weiter an einem PC-Kurs in der Schule teilnehmen, was jetzt aber nicht möglich ist, da dieser Kurs zur Praktikumszeit stattfindet (vgl. Beobachtungsmitschrift, Z. 17ff).

Zum Abschluss des Treffens wurde ein gemeinsamer Aktionsplan erarbeitet, auf dem in drei Spalten schriftlich festgehalten wurde, wer was bis zu welchen Zeitpunkt erledigen wird. Der erste Punkt auf diesem Plan war die Notwendigkeit, am Konzept für das 10. Schuljahr weiterzuarbeiten. Dazu machen sich seine Lehrerin sowie MAIK, sein Vater und der Zivi weitere Gedanken. Besonders soll an der Vernetzung zum Praktikumsarbeitsplatz gearbeitet werden. MAIK könnte beispielsweise den Aufbau einer Stadtverwaltung kennen lernen, um Arbeitsabläufe in seinem Praktikum besser zu verstehen.
Weiterhin sollen am Arbeitsplatz der Praktikumstelle einige Verbesserungen stattfinden, die MAIK die Arbeit erleichtern. Er benötigt zum Beispiel wegen seiner Sehbehinderung Hilfsmittel, um die Schrift auf der Post besser lesen zu können. Nachdem MAIK seine Zustimmung geäußert hat, wird entschieden, das laufende Praktikum nach Möglichkeit zu verlängern. So soll ermöglicht werden, für MAIK einen gut eingerichteten Arbeitsplatz zu schaffen, der dann beispielhaft für seine späteren Arbeitsplätze sein kann. Weitere Erfahrungen in anderen Arbeitsfeldern erscheinen nicht so wichtig, da MAIK bereits mehrere Praktika absolviert hat.
Für das AVJ-I (integratives Ausbildungsvorbereitungsjahr) im kaufmännischen Bereich, dass MAIK eventuell besuchen könnte, wird weiterhin versucht, Kooperationspartner(innen) zu gewinnen (vgl. Beobachtungsmitschrift, Z. 54ff).
Nach dem Treffen betonte der Vater von MAIK, wie wichtig für ihn dieser Unterstützerkreis sei, um nicht den Mut zu verlieren. Gerade wenn Tiefpunkte zu überwinden seien, leiste er gute Hilfe. Im Sommer dieses Jahres war beispielsweise noch nicht klar, ob MAIK nach den Ferien überhaupt zur Schule gehen darf. MAIK Vater würde das Konzept gerne weiter verbreiten, damit auch andere Familien in ähnlicher Situation von den Vorteilen persönlicher Zukunftsplanung profitieren können. Er berichtete aber auch, dass die Eltern im Integrationsarbeitskreis ihrer Stadt dieser Methode eher skeptisch gegenüber stehen und trotz der Erfolge, die MAIK bereits verbuchen kann, nicht sehr leicht dafür zu begeistern sind (vgl. Beobachtungsmitschrift, Z. 103ff).
JANA & ANSGAR (Namen geändert) lernten die Methode der persönlichen Zukunftsplanung auf einem Treffen ihrer People First-Gruppe kennen. Dort stellte CAROLIN EMRICH den Methodenkomplex vor. Anschließend fragte ANSGAR sie, ob sie bereit sei, eine Zukunftsplanung für ihn und seine Freundin zu moderieren (vgl. Interview JANA & ANSGAR, Z. 15ff).
Es fanden zwei Zukunftsplanungstreffen statt, bei denen mit der Methode PATH die nächsten Jahre geplant wurden. Wesentliche Inhalte dieser Planung waren das Zusammenziehen in eine gemeinsame Wohnung, die Heirat und ein möglicher Kinderwunsch der beiden. Außerdem wollte JANA einen neuen Arbeitsplatz finden, und verschiedene persönliche Probleme, die beide miteinander oder für sich allein hatten, sollten bearbeitet und gelöst werden. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Kontakt zu den Eltern, da dieser sich sehr kompliziert gestaltet. Die Eltern waren gegen die Beziehung und die Zukunftspläne der beiden, so dass JANA & ANSGAR auf sich allein gestellt blieben und sich sogar gegen die Eltern durchsetzen mussten. Hierin lag auch die Besonderheit dieser Zukunftsplanungsgeschichte. Sie fand ohne einen Unterstützerkreis aus dem persönlichen Umfeld statt, da die Eltern eher die Zukunftsplanung behindert hätten und auch Freunde nicht einbezogen werden sollten, damit intime Probleme der beiden nicht nach außen getragen würden.
Inzwischen sind JANA & ANSGAR zusammengezogen und haben einen Hochzeitstermin in den nächsten Monaten geplant. JANA hat eine Maßnahme des Arbeitsamtes begonnen, um ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen. Der Kinderwunsch ist zunächst aufgeschoben. Was sich allerdings nicht verwirklichen ließ, war die Verbesserung der Beziehung zu den Eltern. Hier haben die beiden inzwischen auch ihre Bemühungen aufgegeben (vgl. Interview JANA & ANSGAR).
Für beide war die Zukunftsplanung ein Anlass, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und auch gegen ihr soziales Umfeld die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. An die Zeitvorgaben des Plans haben sie sich dabei aber kaum gehalten und auch das PATH Plakat spielt nur eine untergeordnete Rolle.
JANA drückt dies folgendermaßen aus:
"Aber, das ist halt so ein Plan, der muss irgendwie ständig neu gemacht werden, ständig verändert [werden] und so ist halt das Leben. ... Eigentlich ... [ist] das eine Richtlinie für mich, so ein Anhaltspunkt. ... Neulich habe ich das noch mal so rausgesucht und das noch mal durchgelesen, aber, sonst steht das Teil so mehr oder weniger nur in der Ecke, also, so richtig nach leben tue ich da eigentlich nicht" (Interview JANA & ANSGAR, Z. 312ff).
Gerade da sich beide gegen ihr Umfeld durchsetzen mussten war für sie die Unterstützung durch die Moderatorin besonders wichtig. CAROLIN EMRICH berichtete:
"Also, es gab dann zwischendrin verzweifelte Anrufe hier, weil irgendeine Mutter gerade wieder gesagt hat: ‚Nein, was tut ihr bloß?' Wie sie dann gefragt haben, ob das trotzdem ok ist. Also sie brauchten dann immer so ein Stück weit Rückversicherung" (Interview EMRICH, Z. 249ff).
Ohne die Möglichkeit der ständigen Rückversicherung wäre ein Scheitern des Plans wahrscheinlich gewesen. Da beide aber immer wieder auf Unterstützung zählen konnten, ist es hier zwei Menschen gelungen, einen Teil ihrer Träume zu verwirklichen.
DORIS HAAKE hörte 1996 zum ersten Mal vom Konzept der persönlichen Zukunftsplanung. Sie gehörte damals dem Vorbereitungsteam der Tagung "Perestroika in der Behindertenhilfe" an, die in Hamburg im Zusammenarbeit mit dem Rauhen Haus stattfand, einem regionalen Träger der Behindertenhilfe (vgl. Interview HAAKE, Z. 5ff).
Zu dieser Zeit war DORIS HAAKE arbeitslos, mit ihrer Wohnsituation unzufrieden und träumte von einer Arbeitsstelle, bei der sie Büroarbeiten erledigen konnte. Vorher hatte sie mehrere missglückte Arbeitsversuche hinter sich (vgl. Interview DOOSE, Z. 141ff).
Im Rahmen der Vorbereitungsgruppe machte DORIS HAAKE dann ihre erste Zukunftsplanung.
"Ja und dann haben wir eben rausgeguckt, was Doris gerne mag und dann kam das auch mit Organisieren raus. Sie wollte gerne mal in andere Länder fahren und sie wollte einen Freund haben, sie wollte eine eigene Wohnung haben, sie wollte vor allen Dingen Arbeit haben. Und dann haben wir eben angefangen, nachzudenken was dabei herauskommen konnte" (Interview DOOSE, 146ff).
Anschließend übernahm sie dann bei der BAG UB Aushilfsbürotätigkeiten und arbeitet seit 1998 in der Hamburger Arbeitsassistenz, wo sie auch heute noch beschäftigt ist. Sie erledigt dort Büroarbeiten, Einkäufe und übernimmt die Raumpflege (vgl. Mitschrift "Aus anderer Sicht" 1999, Z. 26f).
Im Rahmen ihrer Arbeit bei der BAG UB leitete sie auch Fortbildungen zum Thema "persönliche Zukunftsplanung" und stellte dort ihre eigene Planung vor.
Neben der bezahlten Arbeit hat sie einen weiteren wichtigen, ehrenamtlichen Schwerpunkt:
"Die bezahlte Arbeit ist mir sehr wichtig, aber wichtig ist mir auch die ehrenamtliche Arbeit für die Selbstbestimmungsgruppe People First" (vgl. Mitschrift "Aus anderer Sicht" 1999, Z. 29).
Dort ist die Sprecherin von People First Hamburg und Deutschland. Sie war auf dem 4. People First Weltkongress in Alaska, worüber sie auch in der Zeitschrift "Impulse" berichtetete (HAAKE 1999). Diese Arbeit ist ihr sehr wichtig. Sie träumt davon, sie einmal hauptamtlich machen zu können. Das Ziel von People First beschreibt sie folgendermaßen:
"Menschen mit ... Lernschwierigkeiten, wollen selber bestimmen über ihr Leben, nicht dass andere sie bevormunden" (Interview HAAKE, Z. 63f).
Sie setzt sich im Rahmen ihrer Arbeit für People First dafür ein, dass alle Dinge, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten relevant sind, auch in einfacher Sprache verfasst werden und hat auch einen Artikel zu diesem Thema geschrieben (HAAKE 2000).
Im Jahre 2000 machte sie eine zweite Zukunftsplanung, und auch im privaten Bereich hat sich ihre Situation sehr geändert. Anfangs wohnte sie in einer betreuten Wohngruppe, zog dann in eine eigene Wohnung mit PBW (pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum). Inzwischen wohnt sie mit ihrem Mann zusammen, ist mehrfach umgezogen, zuletzt im September dieses Jahres, und auch die PBW wurde abgebaut (vgl. Interview HAAKE, Z. 83ff).
Sehr wichtig für DORIS HAAKE ist ihre seinerzeitige Bezugsbetreuerin, zu der sie auch jetzt noch Kontakt hat (vgl. Mitschrift "Aus anderer Sicht" 1999, Z. 7).
Zu ihrer Familie hat DORIS HAAKE kaum Verbindungen und erfährt damit von dort auch keine Unterstützung. Lediglich ihr Onkel ist wichtig für sie, der hilft ihr beispielsweise bei Computerproblemen oder ähnlichem (vgl. Interview HAAKE Z. 135ff).
Für DORIS HAAKE sind die im Laufe der Zukunftsplanungen erstellten Pläne sehr wichtig. Sie aktualisiert sie immer wieder und nutzt sie als Richtlinie für ihr Leben.
An ihrer Geschichte wird deutlich, wie viel DORIS HAAKE in ihrem Leben mit Hilfe von persönlicher Zukunftsplanung und im Rahmen ihrer Arbeit erreicht hat. Eigentlich ist dies ein Lebenslauf, den man vielleicht als "unrealistisch" bezeichnen würde, wenn man davon hört und nicht wüsste, dass alles real ist (vgl. Interview DOOSE). Sie hat nach Ansicht ihrer Bezugsbetreuerin Stärke, Kraft und Ausdauer bewiesen und ein viel größeres Selbstbewusstsein bekommen (vgl. Mitschrift "Aus anderer Sicht" 1999, Z. 48). Dies ist ein Eindruck, dem ich mich gerne anschließen möchte.
Den Kontakt zu THORSTEN WENZEL (Name geändert) erhielt ich über CAROLIN EMRICH, die THORSTEN im Rahmen eines längeren Lebenshilfe-Seminars zur persönlichen Zukunftsplanung kennen lernte. THORSTEN ist 39 Jahre alt, arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen der Lebenshilfe und wohnt in einer offenen Wohneinrichtung der Werkstatt. Er ist mir als ein Mann begegnet, dem seine Ziele im Leben wichtig sind und der auch immer voller Ideen steckt, was er noch alles machen will. Dies kann zum Beispiel eine Ballonfahrt sein, ein Besuch bei einer Freundin am Bodensee, Fahrrad fahren und anderes. Viele dieser Ziele überlegt er sich allein und bei manchen wünscht er sich Rat von anderen (vgl. Interview WENZEL).
"Man kann nicht nur jeden Tag da vor'm Fernseher herumhocken so wie die anderen. Die anderen haben bestimmt keine Ziele im Leben. Die lassen das alles auf sich zukommen. Und wenn man keine Ziele macht im Leben, dann kommt man zu gar nichts" (Interview WENZEL, Z. 539ff).
Auf den von ihm besuchten Lebenshilfe-Seminaren standen in Kleingruppen verschiedene Dinge zur Persönlichkeitsbildung auf dem Programm (vgl. Interview WENZEL, Z. 25ff). Zusätzlich konnte jeder, der wollte, auf diesem Seminar eine persönliche Zukunftsplanung durchführen und sollte dazu eine Unterstützungsperson mitbringen. Diese Zukunftsplanungen wurde bei einem einzigen Treffen erstellt, und es gab auch keine Unterstützerkreise aus mehreren Personen. THORSTEN entschied sich für seine Bezugsbetreuerin Renate (Name geändert), die ihm ihre Hilfe anbot. Nach seinen Aussagen kümmert sich Renate nicht direkt um die Umsetzung des Plans, sondern steht zur Verfügung, wenn THORSTEN ihre Hilfe benötigt (vgl. Interview WENZEL, Z. 96ff).
Bei seiner Zukunftsplanung auf dem Seminar hat THORSTEN sich einen Parisurlaub vorgenommen und sich überlegt, wie er es erreichen könnte seine Lieblingssängerin Gabi Albrecht zu treffen. Außerdem will er an einem Kurs teilnehmen, der die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr zum Ziel hat. Er hat immer wieder den Traum einer eigenen Wohnung, was er auf dem Seminar allerdings recht unverbindlich formulierte.
"Das mit der Wohnung, das war als letztes, weil ich nicht ganz genau weiß, ob das irgendwas mal wird, denn... du siehst ja, was ich mir alles hier aufgebaut habe" (Interview WENZEL, Z. 198f).
Von dieser Wohnung berichtet er im Laufe des Interviews dann aber relativ häufig. Einerseits möchte er sie gern haben, da er die Vorteile bei anderen Leuten sieht.
"Wenn ich so andere Leute sehe und so, dann stell' ich mir das halt eben vor: ‚Ach Mensch, das könntest du da so hinstellen und das so hinstellen'" (Interview Wenzel, Z. 500f).
Andererseits ist er aber auch eher skeptisch, weil er nicht weiß, ob er allein zurechtkommen würde (vgl. Interview WENZEL, Z. 508f). Ein Grund für diese Skepsis liegt sicherlich darin, dass seine Tante, seine Betreuerin Renate und seine frühere Gruppenleiterin aus der Werkstatt ihm dringend davon abraten, seine jetzige Wohnung zu verlassen. Dies soll das folgende Zitat zeigen, was allerdings das drastischste ist, das THORSTEN zu diesem Thema berichtet.
"‚Mensch Thorsten,' sagt sie, ‚du hast so eine schöne Wohnung, zieh nicht aus da. ... Denk daran, du hast es mit deinen Hüften. Denk daran, du wirst mal älter. Denk daran, wenn du alleine wohnst, dass die,... Du bist ja nachher später mal auch nicht mehr in der Werkstatt und denn ist die Werkstatt nicht mehr für dich zuständig. Und wir haben ja auch ein Wohnheim, wo halt eben Leute sind, die halt eben ja nicht so fit sind wie wir und denn sagt sie: ‚Ja, du musst auch immer daran denken, wenn du später mal alleine in deiner eigenen Wohnung bist, die schicken sie in ein Heim rein, wo du gar nicht reinwillst. Du liegst da mit vier Leuten auf einem Zimmer, du bist hier... Sozialempfänger dann, ne? Ich meine, du kriegst eine gute Rente nachher später, aber deine Rente ist nachher weg'" (Interview WENZEL, Z. 448ff).
THORSTENS Wohnung ist sehr liebevoll eingerichtet, bedeutet ihm sehr viel, und er zeigt sie gern anderen Leuten. Er dekoriert sie passend zu jeder Jahreszeit und achtet sehr auf ihr gutes Aussehen. Hier wird ein großes Talent von THORSTEN deutlich, das Dekorieren. Dies begründet auch seinen früheren Berufswunsch.
"Ich mag unwahrscheinlich gerne dekorieren. Ich wollte ja früher Dekorateur werden. Also das war ja auch ein Ziel von mir. Aber aus Dekorateur wurde gar nichts" (Interview WENZEL, Z. 579f).
Die Zukunftsplanung des Seminars hat für THORSTEN kaum noch Bedeutung. Sie liegt auf dem Dachboden und wird nicht mehr genutzt.
THORSTEN kann allerdings viele seiner Pläne selbst verwirklichen, er arbeitet zum Beispiel daran, wie es Gabi Albrecht treffen kann, hat für eine Erneuerung der Decke in seiner Wohnung gesorgt und war im Sommer im Urlaub am Bodensee. Bei größeren Veränderungen, wie die seiner Wohnsituation oder seiner Arbeitssituation, bräuchte er allerdings unterstützende Hilfe von anderen Menschen.
Gerade das Beispiel von MAIK zeigt, dass persönliche Zukunftsplanungen in Deutschland fast nur für sehr engagierte Menschen zugänglich ist. MAIK Vater hat die Integrationsbewegung in seiner Heimatstadt maßgeblich vorangebracht und ist immer über alle Neuerungen gut informiert. Auch DORIS HAAKE hörte nur deshalb von persönlicher Zukunftsplanung, weil sie sich im Vorbereitungsteam einer Tagung engagierte. JANA & ANSGAR sind ebenfalls in der Selbsthilfegruppe People First engagiert. Man kann also in bestimmten Kreisen von persönlicher Zukunftsplanung erfahren, ansonsten hängt der Kontakt eher vom Zufall ab, wie beispielsweise bei THORSTEN, der vom Werkstattpersonal auf ein Seminar hingewiesen wurde. Von daher ist das Bemühen von MAIK Vater, dass Konzept weiter zu verbreiten und zugänglicher zu machen als sehr positiv zu bewerten.
Andererseits scheint in Deutschland aber auch eine sehr große Skepsis gegenüber persönlicher Zukunftsplanung zu herrschen. Davon berichtete der Vater von MAIK, und auch ich bin im Laufe meiner Arbeit immer wieder auf diese Skepsis gestoßen. Es wird als unrealistisch eingeschätzt, dass Menschen dauerhaft dazu bereit sind, sich in einem Unterstützerkreis zu engagieren und verlässliche Unterstützung zu leisten. Auch wird die Idee als nicht durchführbar angesehen, die Betroffenen selbst nach ihren Wünschen zu fragen und dann eventuell bei deren Umsetzung etwas zu tun, was man selbst nicht als die beste Lösung empfindet.
Wie wichtig ein Unterstützerkreis auch für die Eltern sein kann, wird am Beispiel von MAIK deutlich. Vielleicht ist der Kreis für diese sogar noch wichtiger als für ihr Kind. Mit der Hilfe von anderen kann es ihnen gelingen, auch nach vielen Jahren noch die Kraft zu haben, weiter für die Integration ihrer Kinder zu kämpfen und nicht zu resignieren, indem sie dann doch auf die klassischen Hilfeformen zurückgreifen.
Das Beispiel von JANA & ANSGAR zeigt, wie wichtig eine Begleitung der Planung - auch über die eigentliche Planungsphase hinaus - ist. Dies sollte bei jeder Zukunftsplanung gewährleistet sein, und die Verantwortung dafür sollte, wie schon mehrfach erwähnt, nach Möglichkeit nicht in den Händen einer einzigen Person liegen. Allerdings ist es auch wichtig, wie in diesem Fall, auf die individuellen Bedürfnisse der planenden Personen Rücksicht zu nehmen.
Wie wichtig es ist, jemandem überhaupt zuzutrauen, sein Leben in die Hand zu nehmen und entscheidende Dinge zu verändern, zeigt eindrucksvoll das Beispiel von DORIS HAAKE. Sie hat mit Hilfe von persönlicher Zukunftsplanung ihr ganzes Leben verändert, wohnt eigenständig, macht Urlaub im Ausland, ist verheiratet, hat einen erfüllenden Arbeitsplatz und ein vielleicht noch erfüllenderes Hobby durch ihre Arbeit bei People First. Diese Erfahrung im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung beschreibt auch CAROLIN EMRICH:
"Vor allem die Bestätigung, dass Menschen durchaus was auf die Reihe kriegen können, wenn man es ihnen zutraut und wenn sie die entsprechende Unterstützung erfahren. Und das es überhaupt nicht notwendig ist, an bestimmten festen Strukturen ... zu verhaften, sondern dass unglaublich viel denkbar ist, wenn Leute es einfach nur tun. Und das dann auch enorme Entwicklungsprozesse stattfinden können. ... Es ist mir klargeworden, dass Zukunftsplanung einfach dazu beiträgt, dass Leute auch wirklich selbstbestimmt und ja so nach eigenen Wünschen leben können" (Interview EMRICH, 407ff).
Das Beispiel von THORSTEN zeigt, wie jemand alle sich bietenden Möglichkeiten nutzt, um sein Leben gut zu gestalten und wie wichtig es ihm ist, Ziele, Unterstützung und Anhaltspunkte im Leben zu haben. Dieses Beispiel zeigt jedoch auch, wie persönliche Zukunftsplanung in Deutschland häufig praktiziert wird: auf einzelnen Seminaren ohne Unterstützerkreis.
Außerdem sollte persönliche Zukunftsplanung möglichst trägerunabhängig geschehen. Jemand sollte nicht in einer Lebenshilfe-Werkstatt arbeiten und in einer Lebenshilfe-Wohneinrichtung wohnen und gleichzeitig seine individuelle Zukunftsplanung auf einem Lebenshilfe-Seminar machen, wobei seine einzige Unterstützungsperson eine Pädagogin ist, die für die Lebenshilfe arbeitet. Dieses ist natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber unter solchen Umständen ist es verständlicherweise schwer, Lösungsmöglichkeiten außerhalb von Angeboten der Lebenshilfe zu suchen.
Es allerdings begrüßenswert, dass sich überhaupt ein großer Träger der Behindertenhilfe für die Verbreitung dieses Konzeptes einsetzt und Seminare dazu anbietet. Leider lassen diese Seminare aber die Idee der Unterstützerkreise außer Acht. Hier wird lediglich mit einer Unterstützungsperson gearbeitet, die häufig eine professionelle Kraft ist (vgl. Interview WENZEL, Z. 47ff & Interview EMRICH, Z. 55ff). Damit wird die kreative, informelle Unterstützungsseite, die einen Schwerpunkt des Konzeptes bildet und viele Chancen in sich birgt, kaum berücksichtigt.
Insgesamt bieten die von beschriebenen Beispiele einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Arten von persönlicher Zukunftsplanung, die es geben kann:
-
als Unterstützung für die Eltern eines behinderten Kindes
-
als Unterstützung für ein eigenes Leben nach eigenen Vorstellungen außerhalb der klassischen Unterstützungsmöglichkeiten des Behindertenhilfesystems und
-
als Methode, die sich auf Seminaren zu Persönlichkeitsbildung anbietet.
Das Konzept des supported living und der persönlichen Zukunftsplanung ist vor allem in den USA und in Großbritannien gebräuchlich. Dies geht aus der von mir verwendeten Literatur hervor. Die Situation dort kann nicht ohne Weiteres auf das deutsche System übertragen werden. Einerseits liegt das an den unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die auch meine Interviewpartner(innen) erwähnen:
"Ich glaube auch so was wie diese ganzen Freundeskreise, Circles of Friends so was, die dort immer beschrieben werden, das ist uns so fremd. ... also das wirkt so selbstverständlich, dass ich die Nachbarin einlade, also wenn ich mir meine eigenen Nachbarn angucke oder meine Verhältnisse zu meinen Nachbarn, dann ist das nicht so, dass ich die zu 'ner Zukunftsplanung einladen würde. Das scheint dort irgendwie zumindest aus der Literatur so, als wäre es viel, viel selbstverständlicher, als würde man da auch eher so im Gemeindesinne denken. ... Das erlebe ich hier nicht so" (Interview EMRICH, Z. 354ff).
Andererseits liegt es aber auch an der Unterschiedlichkeit der Hilfesysteme und der Finanzierungsmöglichkeiten. Jedoch bleibt festzuhalten, "dass man die bestehende bundesdeutsche Sozialgesetzgebung [durchaus] nutzen kann, um vermehrt individualisierte, flexible und informelle Dienstleitungen für Menschen mit geistiger Behinderungen anzubieten" (KRüGER 2000, 123). Vor allem durch das SGB IX sind die Möglichkeiten gegeben, die persönliche Zukunftsplanung und das persönliche Budget stärker als bisher zu nutzen.
Trotz dieser vorhandenen Möglichkeiten herrscht in Deutschland jedoch eine große Skepsis gegenüber diesem Konzept. Das wurde schon im Beispiel von MAIK erwähnt:
"Auf der anderen Seite ist eine große Scheu da, das hat ja Maik Vater eben auch gesagt.... ‚Oh? Und andere Leute da mit einbeziehen ... und um Hilfe fragen und die Leute fragen, ob sie denn Zeit haben und so was.' Da gibt es eine Hemmschwelle. Auch so, dass Leute immer denken, man muss unheimlich professionell sein, um so was machen zu können. Das kann man eigentlich erst nach einem Unistudium, und ich finde, das ist nicht so" (Interview DOOSE, Z. 527ff).
Dies bestätigt auch CAROLIN EMRICH:
"Ansonsten glaube ich, hängt das auch so ein bisschen daran, dass wir halt in Deutschland leben und nicht in USA und die Grundgedanken schon sehr amerikanisch geprägt sind. Das hat was Tolles, weil wir treffen hier auf eine ganz andere Gesellschaftsstruktur und wir sind sowieso so skeptisch und super vorsichtig und haben immer ein Gegenargument für alles. Und das ist das, was ich auch sonst erlebe wenn ich also an Seminare denke, dann sind es in der Regel die Profis, die mir sagen: ‚Ach, das funktioniert sowieso alles nicht.' Vieles würde funktionieren, wenn in den Köpfen das anders laufen würde, zumindest nach meiner Einschätzung. ... Und solange Leute halt das immer wieder behaupten, wird es sich auch nicht so wahnsinnig weit verbreiten" (Interview EMRICH, Z. 322ff).
Diese Skepsis kann dadurch begründet sein, dass es im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung keine vorgefertigten Lösungsmöglichkeiten und keine Garantien für das Gelingen gibt (vgl. WERTHEIMER 1997, 1; PEARPOINT & FOREST 1998, 98).
So ist es häufig einfacher, sich auf die schon erreichten Verbesserungen in der Behindertenhilfe zu berufen, als sich auf unsichere, neue Lösungsmöglichkeiten einzulassen (vgl. O'BRIEN & LOVET 1992, 9). Dieses kann jedoch auch zu Problemen führen: "Praktiker können sich selbst lähmen, indem sie sich im Laufe des Prozesses auf die Probleme und Hindernisse konzentrieren anstatt auf die kleinen positiven Schritte zu schauen (O'BRIEN & LOVET 1992, 15)[51]. Dieses kann ebenfalls kulturell bedingt sein. WERTHEIMER stellt auf diese Forderung hin fest: "‚Wir Briten sind im Feiern nicht besonders gut!' ... Wir sind viel besser darin, uns selbst zu kritisieren" (1997, 7)[52]. Diese Feststellung lässt sich ohne Einschränkung auch auf Deutschland übertragen, was ebenfalls eine Begründung für die herrschende Skepsis sein könnte.
O'BRIEN & O'BRIEN weisen darauf hin, dass alle im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung Engagierten stolz auf das sein sollten, was sei erreicht haben (1991, 32). Diese Forderung zeigt wieder die von meinen Interviewpartner(innen) beschrieben Einstellung in den USA, sie kann jedoch auch eine Anregung für in Deutschland arbeitende Praktiker(innen) sein.
Dadurch, dass das Konzept in Deutschland noch so unbekannt ist, bleibt es, wie schon erwähnt oft eine Lösung für sehr engagierte Familien. Dieses beschreiben auch O'BRIEN & LOVET für die amerikanischen Verhältnisse: "Manche Hilfesysteme sind so unflexibel oder ..., dass persönliche Zukunftsplanung nur für die Menschen zu guten Ergebnisse führt, die sehr engagierte Familien und Freunde haben" (1992, 10)[53]. Also ist es nötig, das Konzept stärker als bisher zu verbreiten. Dazu könnten Servicestellen eingerichtet werden, die Beratung und Unterstützung zur persönlichen Zukunftsplanung geben könnten (vgl. ZENTRUM FüR SELBSTBESTIMMTES LEBEN - MAINZ 2002). Diese Servicestellen müssten aus den schon erwähnten Gründen institutionenunabhängig arbeiten und könnten beispielsweise an den Zentren für selbstbestimmtes Leben (ZsL) angegliedert sein und dort das Konzept des peer counseling ergänzen. Diese Servicestellen könnten persönliche Zukunftsplanung selbst anbieten, oder aber Kontakte vermitteln zu Menschen, die sich mit diesem Konzept auskennen (vgl. EMRICH 1999, 130).
Weitere Verbreitungsmöglichkeiten beschreibt CAROLIN EMRICH:
"'Ne Grundüberlegung ... war, ein Projekt dazu zu initiieren. Das scheitert letztendlich genau an den gleichen Sachen, nämlich dass wir alle das nur so nebenbei machen können. ... Ein Modellprojekt mit einer Laufzeit von zwei, drei Jahren oder so was zu initiieren, was flächendeckend arbeiten kann, für den deutschsprachigen Raum, was irgendwo ganz zentral sitzt, was an ein bis zwei Träger angebunden ist, wovon einer schon auch irgendein gestandener Träger zumindest sein sollte, so was wie People 1st in Hamburg könnte wirklich nur so ein Mitträger sein" (Interview EMRICH, Z. 278ff).
"In so einem Projekt wäre halt möglich, Multiplikatoren zu schulen, wäre es möglich neue Materialien zu entwickeln oder englischsprachige Sachen nochmal gut zu übersetzen" (Interview EMRICH, Z. 309ff).
STEFAN DOOSE bestätigt dies in Z. 513ff, DORIS HAAKE sieht dieses Projekt ebenfalls als eine gute Verbreitungsmöglichkeit an:
"Wir in Hamburg hier ... von People First Hamburg ... planen ein Projekt zu Selbstbestimmung und persönlicher Zukunftsplanung und da haben wir auch jemanden an der Hand, der sich aktiv dafür einsetzt, dass das Projekt zum Laufen kommt" (Interview HAAKE, Z. 179ff).
Andere Verbreitungsmöglichkeiten wären ähnliche Versuche in Form von Seminaren wie bisher.
"Ansonsten ... ist es eben eine Möglichkeit über Seminararbeit das weiter zu verbreiten. Aber das ist eben auch relativ begrenzt und es gibt schlicht und ergreifend zu wenig Literatur dazu" (Interview EMRICH, Z. 311ff).
Hier ist es allerdings, wie schon beschrieben, wichtig, dass persönliche Zukunftsplanung nicht systemimmanent stattfinden sollte (vgl. EMRICH 1999, 128ff). Dann bestünde die Gefahr, dass persönliche Zukunftsplanung eine verankerte Methode wird, die "ohne das Herz" genutzt wird. "Dienstleister können einfacher die Begriffe und einige der Techniken von persönlicher Zukunftsplanung übernehmen, als die harte Arbeit auf sich zu nehmen, neue Wege zu erlernen, Menschen zu unterstützen" (O'BRIEN & LOVET 1992, 14)[54].
"Ich bin davon überzeugt, dass es eine sehr effektive Möglichkeit sein kann, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verändern. Ich habe Angst davor, wenn es zu einem offiziellen Instrumentarium wird, dass es bürokratisiert wird, dass es zu einer leeren Hülse wird, was Leute machen" (Interview DOOSE, Z. 484ff) (vgl. auch Kapitel 10).
LINDMEIER & LINDMEIER (2001, 48) nennen in ihrem Artikel einige Vorarbeiten, die in Deutschland geleistet sein müssen, um das "unterstützt Leben"-Konzept und damit auch die persönliche Zukunftsplanung hier weiter umsetzen zu können.
Dies sind finanzielle Fragen (z. B. zum persönlichen Budget), rechtliche Fragen (wie z. B. wann kann ein geistig behinderter Mensch einen Status als Mieter(in) oder Eigentümer(in) haben), Fragen zu Qualitätssicherung und dazu, wie die Sicherheit einer Person gewährleistet sein kann. "Angesichts der immer weiter gehenden Individualisierung der Lebensstile in unserer Gesellschaft ist es aber unabdingbar, dass wir Unterstützungsformen finden, die auch Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit des privaten Wohnens, die Realisierung individueller Lebensentwürfe und ein Leben in selbst gewählten sozialen Bezügen ermöglichen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 48).
[51] "Practitioners can paralyse themselves by agonizing over the problems and ambiguities surfaced in the process instead of looking for small positive steps" (Übersetzung DM).
[52] "'We British really aren't very good at celebrating!' [...] We are much better at self-criticism and dwelling on our shortcomings" (Übersetzung DM).
[53] "Some service systems are so incoherent or inert that person centred planning contributes to good results only for people with very energetic family and friends"(Übersetzung DM).
[54] "Rather than take on the hard work of learning new ways to assist people, service providers can more easily adopt the vocabulary and some of the techniques of person centred planning" (Übersetzung DM).
In dieser Arbeit wurde das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen ausführlich beschrieben und in seine Entstehungsgeschichte eingeordnet. Dabei wurde die Idee des Empowerment-Konzepts erläutert, um so festzustellen, ob persönliche Zukunftsplanung Menschen mit Unterstützungsbedarf die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben bieten kann. Selbstbestimmung wird hier nicht einseitig, sondern in dem in Kapitel 3 beschriebenen dialektischen Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdbestimmung gesehen.
Um die gestellten Fragen zu klären waren eigene Nachforschungen nötig, deren Ergebnisse zusammen mit der Literatur zum Thema dargestellt wurden.
Diese haben gezeigt, dass persönliche Zukunftsplanung, wenn sie richtig umgesetzt und begleitet wird, für Menschen mit Unterstützungsbedarf eine effektive Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben bietet.
-
Sie können ein Leben nach eigenen Vorstellungen führen und ihnen wird nicht lediglich aufgrund ihrer Behinderung eine festgelegte Unterstützungsleistung zugewiesen. Somit wir das Recht auf Selbstbestimmung jedes Einzelnen anerkannt und die individuelle Planung kann eine Veränderung des Systems der Hilfen zur Folge haben (vgl. zweiter, vierter und fünfter Aspekt der Selbstbestimmung in LINDMEIER & LINDMEIER 2003: Selbstbestimmung als innerer Antrieb, politisches Recht und als Aufforderung zur Veränderung des Hilfesystems).
-
Persönliche Zukunftsplanung berücksichtigt allerdings auch die Tatsache, dass Menschen die Fähigkeit selbst zu bestimmen erlernen müssen, wenn ihnen verschiedene Handlungsalternativen nicht bekannt sind (vgl. erster Aspekt: Selbstbestimmung als Bündel von Fähigkeiten, die gelernt werden können und müssen).
-
Weiterhin wird das soziale Umfeld der Person berücksichtigt und aktiv an der Planung und Umsetzung beteiligt (vgl. dritter Aspekt: Selbstbestimmung als Form menschlicher Selbstgestaltung).
Diese Einbeziehung der Eltern bzw. anderer Bezugspersonen bedeutet auch, dass auf die Bedürfnisse dieser Gruppe Rücksicht genommen wird. So kann eventuell, wenn es den Eltern hilft, ein Ablöseprozess eines behinderten Jugendlichen langsamer passieren, als es das institutionelle Hilfesystem vorsieht. Bei einem solchen Vorgehen können Konflikte minimiert werden, die traditionellerweise zwischen Professionellen und Bezugspersonen bestehen.
Die ersten Anfänge der Verbreitung von persönlicher Zukunftsplanung in Deutschland sind gegeben. Allerdings besteht weiterer Handlungsbedarf in Bezug auf breitere Streuung und Bekanntmachung des Konzeptes. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass nicht die zentralen, leider auch am schwierigsten zu realisierenden Inhalte verloren gehen. Diese zentralen Inhalte sind die Einbeziehung von informeller Unterstützung und die Idee des Unterstützerkreises (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 157). Dass diese Gefahr in Deutschland besteht, wurde an verschiedenen Stellen erwähnt. Wenn also lediglich Teilbereiche von persönlicher Zukunftsplanung, wie beispielsweise die Planungsmethoden, genutzt werden, kann dies zwar durchaus positive Effekte haben, es ist allerdings wichtig, dass das Ergebnis dann nicht als "persönliche Zukunftsplanung" deklariert wird. Das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung beinhaltet nämlich nicht nur Methoden, sondern auch eine bestimmte Einstellung und ein bestimmtes Menschenbild, was in dieser Arbeit ausführlich beschrieben wurde. Werden die Methoden der persönlichen Zukunftsplanung isoliert angewendet, sind sie nichts weiter als ein neues Hilfeplanungsinstrument innerhalb alter Grundannahmen. Durch eine Methode allein kann aber nichts Grundlegendes verändert werden.
Weiterhin ist persönliche Zukunftsplanung kein Allheilmittel und nicht unbedingt für jede behinderte Person das passende Instrument. Darauf wurde ebenfalls schon hingewiesen.
Außerdem kann es immer Bedingungen geben, die es erschweren, ein Leben zu führen, dass den eigenen Vorstellungen entspricht. Vielleicht kann nicht herausgefunden werden, was eine Person will oder sie kann aufgrund ihrer schweren Behinderung nicht an dem Ort leben, den sie sich wünscht. Vielleicht ist auch die Familie so überlastet, dass sie kurzfristige, schnelle Entlastung braucht. Sie kann sich dann nicht an einer Planung beteiligen, die sich auch noch über lange Zeit hinziehen müsste, weil sich die betreffende Person vielleicht nicht selbst äußern kann. Hier kann es dann nötig sein, Zwischenlösungen zu finden, die vielleicht noch unbefriedigend sind. Anschließend kann dann ein Unterstützerkreis unter Anwesenheit der planenden Person bessere Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, die ausprobiert und anschließend reflektiert werden können. Der Unterstützerkreis erarbeitet dann, wie schon beschrieben, Lösungsmöglichkeiten, die der planenden Person angenehm sein könnten.
Diese Bedingungen herrschen jedoch sicher nicht für den Großteil aller Menschen mit Behinderungen, weshalb sie nicht als Argument gegen die Praxis von persönlicher Zukunftsplanung genutzt werden können.
Außerdem bleibt darauf hinzuweisen, dass sich durch persönliche Zukunftsplanung nicht qualifiziertes Personal ersetzten lässt. Es muss weiterhin Menschen geben, die über Spezialwissen hinsichtlich Behinderungsarten, Hilfsmittel sowie Hilfe- und Förderungsmöglichkeiten verfügen. Das ist etwas, das informelle Unterstützung nur in begrenztem Maße leisten kann.
Insgesamt wird allerdings in dieser Arbeit deutlich, dass persönliche Zukunftsplanung ein Instrument ist, das in Deutschland bekannter werden sollte. Es kann vielen Menschen mit Behinderungen eine Möglichkeit bieten, ihr Leben zu verändern und nach ihren Vorstellungen zu verbessern. Wenn das Konzept bekannter würde und es mehr Umsetzungsbeispiele gäbe, könnte auch die so oft angebrachte Behauptung: "Das klappt doch sowieso nicht!" entkräftet werden.
Für alle, die sich um persönliche Zukunftsplanung bemühen, gilt bis dahin eine Aussage von FRAUKE SANDER, mit der ich schließen möchte:
"Denn wenn wir diese idealen Vorstellungen nicht mehr haben oder diese Ziele nicht mehr vor Augen haben, ja, dann ganz ehrlich, dann können wir uns auch begraben lassen" (Interview SANDER, 316f).
BLATT, B.; KAPLAN, F. (1974): Christmas in Purgatory. A photographic Essay on Mental Retardation. Syracuse, New York.
BLEIDICK, U. (2001): Behinderung. In: Antor, G.:, Bleidick, U.: Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln, 59-60.
BOBAN, I.; HINZ, A. (1999): Persönliche Zukunftskonferenzen. Unterstützung für individuelle Lebenswege. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 25 4/5, 13-23. Online Version: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-konferenz.html Download aus dem Internet: 11.11.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
BöRNER, R. (1996): Selbstbestimmt leben für mein Kind - wie soll das gehen? In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.: Selbstbestimmung. Kongreßbeiträge. Lebenshilfe-Verlag Marburg 1996, 70-74.
BRADLEY, V. J. (1994): Evolution of a new service Paradigm. In: Bradley, V. J.; Ashbaugh, J. W.; Blaney, B. C. (Ed.): Creating Individual Supports For People with Developmental Disabilities: A Mandate For Chance At Many Levels. Baltimore, London, Toronto, Sydney, 11-32.
BROS-SPäHN, B. (O. J.): Und was ist nach der Schule? Online: http://www.gemeinsamleben-rheinlandpfalz.de/und_was_ist_nach_des_schule.htm Download aus dem Internet: 30.06.02.
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT FüR UNTERSTüTZE BESCHäFTIGUNG (BAG UB) (Hrsg.) (o. J.): Traumkarten. o. O., o. V.
BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG (2002a): SGB IX. Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Berlin.
BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG (2002b): Ratgeber für behinderte Menschen. Bonn.
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FüR GEISTIG BEHINDERTE E. V. (1996): Selbstbestimmung. Kongreßbeiträge. Lebenshilfe-Verlag Marburg.
CURTIS, E.; DEZELSKY, M. (1991): My life Planner. Salt Lake City.
CURTIS, E.; DEZELSKY, M. (1994a): It's my life. Preference-based planning for self-directed goal meetings. Facilitators guide. Salt Lake City.
CURTIS, E.; DEZELSKY, M. (1994b): It's my life. Preference-based planning for self-directed goal meetings. Salt Lake City.
DANIELS, S. VON (1998): Aspekte zur Rolle von LehrerInnen im Prozeß der Übergangsphase. Online: http://bidok.uibk.ac.at/library/daniels-uebergangsphase.html Download aus dem Internet: 11.11.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
DE JONG, GERBEN PH. D. (1982): Independent Living: Eine soziale Bewegung verändert das Bewußtsein. In: Vereinigung Integrationsförderung e. V. (VIF) München (Hrsg.): Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten: Neue Wege gemeindenaher Hilfe zum selbstständigen Leben: Kongressbericht der Internationalen Tagung: "Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemeinschaft" München 24.26. März 1982. München: Selbstverlag, 132-160.
DIMDI (DEUTSCHES INSTITUT FüR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION) (2002): Entwurf zu Korrekturzwecken. ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Online: http://www.dimdi.de/de/klassi/ICF/ Stand: 24. September 2002. Download aus dem Internet 25.11.2002
DOOSE, S.(1997): Unterstütze Beschäftigung - Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich. In: Schulze, H. Sturm, H. Glüsing, U.; Rogal, F.; Schlorf, M. (Hrsg.) Schule, Betriebe und Integration. - Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt; Hamburg 1997 - Beiträge und Ergebnisse der Tagung INTEGRATION 2000 am 30./31. Mai 1996 in Hamburg. Online-Version: http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-vergleich.html Download aus dem Internet: 11.11.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
DOOSE, S. (2000): "I want my dream" Persönliche Zukunftsplanung - Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen. In: Kan, P. v.; Doose, S. (2000) Zukunftsweisend. Peer Counseling & persönliche Zukunftsplanung. Kassel, 69-134.
DOOSE, S.; GöBEL, S. (2000): Materialien zur Persönlichen Zukunftsplanung. Weitere Texte und Arbeitsblätter. In: Kan, P. v.; Doose, S. (2000) Zukunftsweisend. Peer Counseling & persönliche Zukunftsplanung. Kassel, 135-219.
EMMERICH, M. (2000): Der angloamerikanische Ansatz des "Supported Living" - Ein neues Konzept gemeinwesenintegrierten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung. Universität Koblenz-Landau, unveröffentl. Diplomarbeit.
EMRICH, C. (1999): Persönliche Zukunftsplanung - Überlegungen zur Verankerung eines Konzepts zur eigenen Lebens(stil)planung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Universität Bremen, unveröffentl. Diplomarbeit.
EVANGELISCHE STIFTUNG ALSTERDORF, HAMBURGSTADT (1997): Handbuch zur Assistenzplanung. Erschienen im Eigendruck.
FACHHOCHSCHULE NORDOSTNIEDERSACHSEN (1999): Sociolexicon. Online: http://www.socioweb.de/ Download aus dem Internet: 21.10.2002.
FEUSER, G. (1996): "Geistigbehinderte gibt es nicht!" Projektionen und Artefakte in der Geistigbehindertenpädagogik. In: Geistige Behinderung, 35, 18-25.
FLICK, U. (2000): Qualitative Forschung. Theorien, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Rowohlt-Verlag, Reinbek.
FORNEFELD, B. (2002): Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik. Ernst Reinhardt Verlag, München.
FREUDENSTEIN, W.; HAAKE, D.; SORGE, K.-P.; WEHRUM, P. (1999): People First Deutschland - Wir stellen uns vor. In: die randschau Nr 1/99, 11f.
FRIEDRICHS, J. (1980): Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen, Westdeutscher Verlag.
FUCHS-HEINRITZ, W.; LAUTMANN, R.; RAMMSTEDT, O.; WIENOLD, H. (Hrsg.) (1994): Lexikon zur Soziologie. Westdeutscher Verlag, Opladen.
GäBLER, U. (2002): Zukunftsplanung im Rahmen des Unterstützerkreises. o. O., o.V. Im eigenen Besitz.
GEMEINSAM LEBEN - GEMEINSAM LERNEN. VEREIN ZUR INTEGRATION BEHINDERTER MENSCHEN - NBG. LAND E.V.. (2002): Persönliche Zukunftskonferenzen Vortrag von Ines Boban und Andreas Hinz "Persönliche Zukunftsplanung für Menschen mit Behinderung" Online: http://www.lau-net.de/GLGL.Ruppert/Aktuelles/zukunftskonferenzen.htm Download aus dem Internet: 18.10.2002.
GöBEL, S. (1998): So möchte ich wohnen! Wie ich selbst bestimmen kann, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden wohlfühle. Lebenshilfe Verlag, Marburg.
HAAKE, D. (1999): Bericht über den "People First Weltkongress 1998." In: Impulse Nr. 11, Jan. 1999. Online-Version: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp11-99-first.html Download aus dem Internet: 11.11.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
HAAKE, D. (2000): Informationen zur Änderung des Schwerbehindertengesetzes in einfacher Sprache. In: Impulse Nr. 15, April 2000. Online-Version: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp15-00-einfach.html Download aus dem Internet: 11.11.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
HAHN, M. TH. (1994): Selbstbestimmung im Leben, auch für Menschen mit geistiger Behinderung. In: Geistige Behinderung 33,81-94.
HäHNER, U.; NIEHOFF, U.; SACK, R.; WALTHER, H. (1999): Vom Betreuer zum Begleiter. Lebenshilfe Verlag, Marburg.
INFORM (2002): Seminar Persönliche Zukunftsplanung Einführung und Umsetzung im Alltag. Online: http://www.lebenshilfe.de/institut/Veranstaltungen/Einzelveran/02462.htm Download aus dem Internet: 30.06.2002.
ISL E-MAIL NEWS SERVICE (2002): Persönliche Zukunftsplanung Seminar: persönliche Zukunftsplanung mit Menschen mit Behinderungen vom 28.-30. November 1997 in der Europaakademie Werra-Meißner. Online: http://selbsthilfe-online.de/bv/isl970918_3.htm Download aus dem Internet: 30.06.2002.
KAN, P. V. (2000): Das Peer-Counseling. Ein Arbeitshandbuch. In: Kan, P. v.; Doose, S. (2000) Zukunftsweisend. Peer Counseling & persönliche Zukunftsplanung. Kassel, 13-67.
KRüGER, C. (2000): Supported Living: "Ich bin über 40 Jahre alt. Dies ist mein eigener Schlüssel. Zum allerersten Mal habe ich einen eigenen Schlüssel." In: Geistige Behinderung 39, 112-124.
LINDMEIER, B. (2002a): Stellungnahme zur "Enquête der Heime" unter Berücksichtigung der Situation von Menschen mit Behinderung. In: Röttger-Liepmann, B.; Hopfmüller, E.: Initiative zur Einrichtung einer "Enquête der Heime". Dokumentation einer Tagung am 21.03.2002. Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) Bielefeld, 9-22
LINDMEIER, B. (2002b): Personenbezogene Planung. Kompaktveranstaltungen im WS 2002/2003 und im SS 2003. Oldenburg, o. V. (Veranstaltungsskript).
LINDMEIER, B.; LINDMEIER, CH. (2000a): Vom independent living zum supported living - Neue Perspektiven für ein selbstbestimmteres Leben von Menschen mit (geistiger) Behinderung? In: Färber, H.-P.; Lipps, W.; Seyfarth, Th. Für die Körperbehindertenförderung Neckar-Alb (Hrsg.): Wege zum selbstbestimmten Leben trotz Behinderung. Tübingen, 144-163.
LINDMEIER, B.; LINDMEIER, CH. (2000b): Wohnen oder Unterbringung? Integrative Wohnkonzepte in Großbritannien. In: Hans, M.; Ginnold, A. (Hrsg.): Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa. Neuwied, Berlin, 299-326.
LINDMEIER, B.; LINDMEIER, CH. (2001): Supported Living. Ein neues Konzept des Wohnens und Lebens in der Gemeinde für Menschen mit (geistiger) Behinderung. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr.3/4/2001, 39-50.
LINDMEIER, B.; LINDMEIER, CH. (2002): Professionelles Handeln in der Arbeit mit geistig behinderten Erwachsenen unter der Leitidee des Selbstbestimmung. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 4/5/2002, 63-73.
LINDMEIER, B.; LINDMEIER, CH. (2003): Selbstbestimmung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Zur Rezeption der us-amerikanischen Diskussion. In: Geistige Behinderung 2/2003, 119-138.
LUEG, C. (1996): Elternmitarbeit im Unterricht. Hohengehren, Schneider.
LüNEBURGER ASSISTENZ GGMBH (2002): Fachdienst Lüneburger Arbeitsassistenz. Online: http://www.lueneburger-assistenz.de/assistenz-text.html Download aus dem Internet: 18.10.2002.
MAYRING, P. (1993): Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken. Beltz Verlag, Weinheim.
MEUSER, M.; NAGEL, U. (1991): Das ExpertInneninterview - vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Garz, D.; Kraimer, K. (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung, Opladen 1991, 441-471.
MEUSER, M.; NAGEL, U. (1997): Das ExpertInneninterview - Wissenssoziologische Vorraussetzungen und methodische Durchführung. In: Friebertshäuser, B.; Prengel, A. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim, München, Juventa Verlag, 481-291.
MILES-PAUL, O. (1992): Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Behinderte auf dem Weg zur Selbstbestimmung. Beratung von Behinderten durch Behinderte. Peer support: Vergleich zwischen den USA und der BRD. AG SPAK Bücher, München.
MüHL, H. (2000): Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik. Kohlhammer Verlag, Stuttgart
NIEDERMAIR, C. (1998): "Ich möchte arbeiten" - Zur Gestaltung integrativer Übergänge zwischen Schule und Berufswelt für Jugendliche mit schweren Behinderungen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 4/5/1998. Online-Version: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-98-arbeiten.html Download aus dem Internet: 18.10.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
NIEDERMAIR, C.; TSCHANN, E. (1999a): "Ich möchte arbeiten" Der Unterstützungskreis. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 4/5/1999. Online-Version: http://bidok.uibk.ac.at/library//beh4-99-arbeiten.html Download aus dem Internet: 18.10.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
NIEDERMAIR, C.; TSCHANN, E. (1999b): "Ich möchte arbeiten" Portraits von sechs Jugendlichen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 4/5/1999. Online-Version: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-portraits.html Download aus dem Internet: 18.10.2002. (Link aktualisiert von bidok, 10. März 2010)
NIEHOFF, U. (1993): Selbstbestimmt leben für behinderte Menschen - Ein neues Paradigma zur Diskussion gestellt. In: Behindertenpädagogik 32, 287-298.
NIEHOFF-DITTMANN, U. (1996): Selbstbestimmung im Leben geistig behinderter Menschen. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.: Selbstbestimmung. Kongreßbeiträge. Lebenshilfe-Verlag Marburg 1996, 55-65.
NIEHOFF, U. (1999): Grundbegriffe selbstbestimmten Lebens. In: Hähner, U.; Niehoff, U.; Sack, R.; Walther, H.: Vom Betreuer zum Begleiter. Lebenshilfe Verlag, Marburg 1999, 53-64.
NIRJE, B. (1994): Das Normalisierungsprinzip, IN: Fischer u. a. (Hrsg.): WISTA Experten-Hearing 1993, Reutlingen, 175-202.
O'BRIEN, J. (1989): What's Worth Working for? Leadership for better quality human services. Responsive System Associates. Online-Version: http://soeweb.syr.edu/thechp/whatsw.pdf Download aus dem Internet: 05.08.2002.
O'BRIEN, J. (1993): Supported Living: What's the Difference? Online-Version: http://soeweb.syr.edu/thechp/!slwhatd.pdf Download aus dem Internet: 02.05.2002.
O'BRIEN, J.; LOVET, H. (1992): Finding a Way towards Everyday Lives. The contribution of person centered planning. Pennsylvania Office of mental Retardation Harrisburg, Pennsylvania. Online-Version: http://soeweb.syr.edu/thechp/everyday.pdf Download aus dem Internet: 02.05.2002.
O'BRIEN, J.; MOUNT, B. (1989): Telling new Stories. The Search for Capacity. In: O'Brien, J.; O'Brien, C.L.: A little book about Person Centered Planning. Toronto, 1998, 107-111.
O'BRIEN, J.; O'BRIEN, C.L. (1991): More than just a new Adress. Images of organizations for Supported Living Agencies. Responsive System Associates.
O'BRIEN, J.; O'BRIEN, C.L. (1995): Learning to Listen. In: O'Brien, J.; O'Brien, C.L.: A little book about Person Centered Planning. Toronto, 1998.
O'BRIEN, J.; O'BRIEN, C.L. (1998): A little book about Person Centered Planning. Toronto, 5-10.
PEARPOINT, J.; FOREST, M. (1998): The Ethics of MAPS and PATH. In: O'Brien, J.; O'Brien, C.L.: A little book about Person Centered Planning. Toronto, 1998, 93-103.
PETERSON, M. (1996): Circles of support. In: Etzioni, A. (Ed.): The responsive Community, Washington.
RAPPAPORT, J. (1985): Ein Plädoyer für die Widersprüchlichkeit: Ein sozialpolitisches Konzept des "empowerment" anstelle präventiver Ansätze. In: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis 2, 257-278.
SANDERSON, H.; KENNEDY, J.; RITCHIE, P.; GOODWIN, G. (1997): People, plans & possibilities. Edinburgh, SHS.
SCHULZE, M. (1999): Ich möchte mutig sein wie Papi. Eltern und Kinder gemeinsam im Seminar über persönliche Lebensplanung. Lebenshilfe-Zeitung 20, 1999, Nr.1, 10.
SMITH, A.; WILSON, H. (1997): Your Move. Stories from the your move project. Edinburgh, o. V.
SNOW, J. (1996): The Power In Vulnerability. In: O'Brien, J.; O'Brien, C.L.: A little book about Person Centered Planning. Toronto, 1998, 11-13.
SPECK, O. (1998): System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. Ernst Reinhardt Verlag, München Basel.
SPECK, O. (1999): Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung. Ein heilpädagogisches Lehrbuch. Ernst Reinhardt Verlag, München Basel.
TAYLOR, S. J. (1988): Caught in the Continuum: A Critical Analysis of the Principle of the least Restrictive Environment. In: Journal of The Association for Persons with Severe Handicaps 13, 1, 41-53.
TAYLOR, S. J.; RACINO, J. A.; WALKER, P. A. (1992): Inclusive Community Living. In: Stainback, W.; Stainback, S. (Ed.): Controversal issues confronting special education: divergent perspectives. Needham Heights, Massachusetts, 299-312
THEUNISSEN, G. (1995): Selbstbestimmt-Leben - Annäherungen an ein Empowerment-Konzept für Menschen mit geistiger Behinderung. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 64, 166-181.
THIMM, W. (1997): Kritische Anmerkungen zur Selbstbestimmungsdiskussion in der Behindertenhilfe. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 6/97, 222-232.
WEIß, H. (2000a): Empowerment in der Heilpädagogik und speziell in der Frühförderung - ein neues Schlagwort oder eine handlungsleitende Idee? In: Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter e.V. (DVfR); Rische, H.; Blumenthal, W.: Selbstbestimmung in der Rehabilitation; Chancen und Grenzen (vom 13.-15.Oktober 1999 in Berlin). Universitäts-Verlag, Ulm.
WEIß, H. (2000b): Selbstbestimmung und Empowerment - Kritische Anmerkungen zu ihrer oftmaligen Gleichsetzung im Sonderpädagogischen Diskurs. In: Behindertenpädagogik 3/2000, 245-260.
WELLS, J. (2000) ÜBERSETZUNG GöBEL, S.: Persönliche Zukunftsplanung. In: Kan, P. v.; Doose, S. (2000) Zukunftsweisend. Peer Counseling & persönliche Zukunftsplanung. Kassel, 141-155.
WERTHEIMER, A. (1997): Great Expectations. Experiences of Supported Living. Manchester.
WOLFENSBERGER, W. (1998): Die Lebenswirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung und die Theorie von der Valorisation sozialer Rollen. In: Hahn, M. Th. (Hrsg.): Das Normalisierungsprinzip - vier Jahrzehnte danach. Reutlingen, 247-296.
ZENTRUM FüR SELBSTBESTIMMTES LEBEN - MAINZ: Stellungnahme zum Modellprojekt "Selbst bestimmen - Hilfen nach Maß für Behinderte." Online: http://home.rhein-zeitung.de/~zsl/SbHnMfB.html Download aus dem Internet 30.06.2002.
Quelle:
Dorothee Meyer: Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen: Eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf
Schriftliche Hausarbeit zur Prüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik, Beurteilende Hochschullehrerin Dr. Bettina Lindmeier; Zweitgutachterin Katrin Uhrlau
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 22.03.2010
