Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
-
Teil A: Soziale Reaktion auf Behinderung
- 1. Begriffsbestimmungen
- 2. Ergebnisse der Einstellungsforschung
- 3. Erklärungsansätze zu Fremdwahrnehmung, Erleben und Verarbeitung von Behinderung
- 4. Individuelle und institutionelle Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderung und deren Hintergründe
- 5. Kindliche Sozialreaktion auf Menschen mit Behinderung
-
Teil B: Menschen mit Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur
- 6. Begriffsbestimmung
- 7. Historischer Abriss der literalen Darstellung von Behinderung
-
8. Das Thema "Behinderung" in der Kinder- und Jugendliteratur
- 8.1 Verteilungshäufigkeit von Behinderungsformen: Kinder- und Jugendliteratur vs. Realität
- 8.2 Das Behinderten-Bild: Visualisierung von Behinderung
- 8.3 Prinzipien der Darstellung einiger Behinderungsformen
- 8.4 Darstellung der behinderten Person: Strukturelle "Strickmuster"
- 8.5 Literarische Umgangsformen mit "Behinderung"
- 8.6 Darstellung von gesellschaftlichen Reaktionen auf behinderte Personen
- 9. Ergebnisse der medienbezogenen Wirkungsforschung
- 10. Schlussbetrachtung
- Literatur
- Anhang
Dass Menschen mit Behinderung in aller Regel eher ablehnende Haltungen entgegengebracht werden, ist allgemein bekannt. Dass sich diese Einstellungen, die sich in den Haltungen ausdrücken, im Laufe eines jeden Menschen erst entwickeln, erscheint ebenso als eine triviale Tatsache. Die Entwicklung solch ablehnender Einstellungen bei weitgehend fehlender Konfrontation mit behinderten Menschen macht bereits das Wirken kultureller Tradierungsmechanismen deutlich.
Welches Bild von behinderten Menschen in Kinder- und Jugendbüchern gezeichnet wird, wie die Darstellungen in diesem Medium auf die Einstellung der Leser/innen einwirken können und inwieweit kulturelle Tradierungsmechanismen in Kinder- und Jugendbüchern existent sind, ist weitgehend unbekannt.
Die vorliegende Arbeit untersucht Kinder- und Jugendliteratur dahingehend, wie behinderte Menschen in den entsprechenden Werken dargestellt werden. Um die mögliche Wirkungsweise dieser Darstellungen herauszuarbeiten, ist es notwendig, die gesellschaftlichen Einstellungstrukturen in differenzierter Weise zu beschreiben. Dazu werden in einem ersten Teil die Ergebnisse der vorliegenden sozialpsychologischen Untersuchungen angeführt (Kap. 2), die jedoch, um nicht auf dieser phänomenologischen Ebene haften zu bleiben, durch entsprechende Theorien ergänzt werden, die die Ursachen und Hintergründe für die ermittelten Ergebnisse zu beschreiben versuchen (Kap. 3-4). Die Ergebnisse zum kindlichen Einstellungserwerb einschließlich den bisher bekannten unterscheiden in bezug auf Geschlechtsspezifität sowie unterschiedliche Schulmodelle ("Integration") (Kap. 5) bilden den Übergang zum zweiten Teil der Arbeit.
In diesem geht es um Tendenzen gesellschaftlicher Einstellungsstrukturen, die in Kinder- und Jugendliteratur wirksam werden. Dabei wird - nicht zuletzt aus Gründen des begrenzten Umfangs der Arbeit - sowohl auf eine literarische Bewertung der vorliegenden Werke wie auch auf eine umfangreiche sozialwissenschaftlich orientierte Inhaltsanalyse einzelner Werke verzichtet (wenngleich sich die Untersuchung an einer solchen Vorgehensweise orientiert). Vielmehr soll versucht werden, ggf. auftretende, immer wiederkehrende, d.h. stereotype Muster und deren Hintergründe und Funktionen aufzuzeigen.
Nach der Darstellung allgemein relevanter Teilbereiche wie historischer Entwicklung (Kap. 7), Visualisierung (Kap. 8.3) und den bis heute bekannten Strickmustern (Kap. 8.4 - 8.5) wird in Kap. 8.6 ein Modell aufgezeigt, das in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur als ein typisches Muster zur literarischen Verarbeitung von (geistiger) Behinderung gelten kann.
Den Abschluss der Arbeiten bilden Ergebnisse der medienbezogenen Wirkungsforschung (Kap. 9) sowie Überlegungen zum Einsatz literarischer Werke im schulischen Unterricht (Kap.10).
In Bezug auf Personen-, Rollen- oder Berufsbezeichnungen verwende ich in meinen Ausführungen die inzwischen weit verbreitete und meiner Ansicht nach dadurch gesellschaftlich akzeptierte Schreibweise der zusätzlich anhängenden, weiblichen Form (Bsp. Leser/innen) wenn ich die Ausrichtung auf beide Geschlechter deutlich machen möchte. Auf eine (orthografisch korrektere) Auflistung sowohl des maskulinen wie des femininen Begriffs werde ich aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit weitestgehend verzichten.
In Bezug auf Menschen, die allgemein als behindert bezeichnet werden, verwende ich in dieser Arbeit in der Regel die Bezeichnung "Menschen mit Behinderung" und ergänze sie ggf. aus semantischen bzw. syntaktischen Gründen durch die Verwendung des Begriffs "behinderte Menschen" oder "beeinträchtigte Menschen".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsbestimmungen
- 2. Ergebnisse der Einstellungsforschung
- 3. Erklärungsansätze zu Fremdwahrnehmung, Erleben und Verarbeitung von Behinderung
- 4. Individuelle und institutionelle Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderung und deren Hintergründe
- 5. Kindliche Sozialreaktion auf Menschen mit Behinderung
"Alle eindeutig psychologischen Besonderheiten des defektiven Kindes sind ihrer Grundlage nach nicht biologischer, sondern sozialer Natur. [...]
Möglicherweise ist die Zeit nicht mehr fern, da die Pädagogik es als peinlich empfinden wird, von einem defektiven Kind zu sprechen, weil das ein Hinweis darauf sein könnte, es handele sich um einen unüberwindbaren Mangel seiner Natur. [...] In unseren Händen liegt es, so zu handeln, daß das gehörlose, das blinde und das schwachsinnige Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt".
Lew Semjonowitsch Wygotski
Der Begriff "Behinderung" wird von pädagogischer wie von medizinischer, psychologischer, soziologischer, ökonomischer, juristischer oder sozialpolitischer Seite mit jeweils fachspezifischen Akzentuierungen definiert. Entscheidend für die Definition sind die Zielsetzungen, die mit einer Definition verbunden sind.
Ein international weitgehend anerkanntes Klassifikationssystem zur Beschreibung von Behinderung ist die Definition der WHO (World Health Organisation). Sie unterscheidet drei Komponenten der Behinderung:
-
Impairment[1] (Schädigung): Impairment bezeichnet eine dauernde oder vorübergehende anatomische, physiologische oder psychologische Einbuße und/oder Anomalie des Organismus oder eines Organsystems, die an äußerlichen Symptomen, an einer fehlerhaften Funktion oder an dem Verlust einer Funktion objektivierbar ist.
-
Disability (Beeinträchtigung, Leistungsminderung): Aus einem Impairment folgen Funktions- und Aktivitätseinschränkungen (Disability), die bei der Bewältigung von Aufgaben und Anforderungen im Alltag auffällig werden.
-
Handicap (Benachteiligung, Behinderung): Hiermit wird die aus Impairment und Disability hervorgehende Schwierigkeit, Tätigkeiten, die im allgemeinen als wesentliche Grundkomponenten der täglichen Lebensführung gelten, auszuüben. Diese Schwierigkeiten führen zu einer Benachteiligung in familiärer, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht.
Diese von der WHO vorgelegte Definition bezieht die soziale Benachteiligung mit ein und hebt damit die Reduktion anderer offizieller Definitionen (wie z.B. BSHG, SchwBG u.a.) auf. Dennoch legt auch diese Definition den Ausgangspunkt der Behinderung im Individuum, in seinen biologischen Konstitutionen fest. Die drei Bestimmungsstücke folgen in der Regel konsekutiv aufeinander.
Im Bereich der Pädagogik ist die Definition BLEIDICKs vermutlich die verbreiteste. Er unterscheidet im Prinzip vier konkurrierende Paradigmen von Behinderung (BLEIDICK / HAGEMEISTER 1977), wobei nur eine multifaktorielle Betrachtungsweise das Phänomen des Behindertseins erklären könne:
-
Behinderung nach dem individual-theoretischen oder personenorientierten Begriff, eingebettet in ein medizinisches Modell von Heilpädagogik,
-
Behinderung nach dem interaktions-theoretischen (interaktionistischen) Modell, nach dem Behinderung ein Etikett infolge schulischer Leistungsabweichung und Zuschreibung sozialer Erwartungshaltungen ist,
-
Behinderung als Systemfolge in einem systemtheoretischen (systemsoziologischen) Modell, das besagt, dass Institutionen als Systeme Behinderung hervorbringen und produzieren
-
Behinderung nach dem gesellschaftstheoretischen Modell.
BLEIDICK konstatiert, dass individuelle Schuldzuweisungen inzwischen hinter eine Sichtweise von Behindert-Sein zurückgetreten sind, die dessen gesellschaftliche Vermittlung betonen und hält auch zehn Jahre später fest: "Die Tatbestände Behindertsein und Behinderung sind sozial vermittelt [...]. Darum sind alle Aussagen darüber, wer gestört, behindert, beeinträchtigt, geschädigt usw. ist, relativ, von gesellschaftlichen Einstellungen und diagnostischen Zuschreibungen abhängig" (BLEIDICK 1995, 4). Dennoch scheint er an einer medizinisch-defektologischen Definition von Behinderung festzuhalten. Trotz der o.g. Aussagen besteht der Ausgangs- und Kernpunkt einer Behinderung für BLEIDICK im erstgenannten Modell, das die Ursache und den Defekt in der betroffenen Person sucht. So formuliert er, dass Behinderung "als ein persönliches, weitgehend unabänderliches Schicksal hingenommen [wird]. Der Defekt ist kausal-ätiologisch in der Person lokalisiert" (1985, 254). "Behinderung", so BLEIDICK (1995, 3), "ist fast immer die Folge einer Schädigung, eines Mangels oder eines Defektes." BLEIDICKs Theorie reduziert meiner Ansicht nach das Phänomen Behinderung zu einseitig auf die subjektorientierte Seite, während gesellschaftliche Zusammenhänge keine adäquate Beachtung finden. Behinderung wird dadurch zu einem statischen Zustand, der keine Veränderung zulässt.
Auch in der Empfehlung "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" des Deutschen Bildungsrats nimmt Behinderung von der biologischen Schädigung aus ihren Ausgang und führt von da aus zu Beeinträchtigungen des Sozialen:
"Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. [...]
Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der Sprache, der Stütz- und Bewegungsfunktionen, der Intelligenz, der Emotionalität, des äußeren Erscheinungsbilds sowie von bestimmten chronischen Krankheiten. [...]"
Wie JANTZEN (1992) formuliert, ist der Benennung der Ebenen (biologische, psychologische, soziale) durch die Definition der WHO durchaus zuzustimmen, wobei jedoch die Wechselwirkungen der einzelnen Ebenen, die Behinderung als einen Prozess erscheinen lassen, zu berücksichtigen bleiben. Die "bio-psycho-soziale Einheit Mensch" wird nicht allein durch eine Schädigung in ihrem innersten Kern (der biologischen Ebene) behindert. Die lineare und kausalattribuierte Annahme, dass Schädigungen unmittelbar und zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der gesellschaftliche Teilhabe führe (ohne dabei die gesellschaftliche Verhältnisse zu reflektieren), trifft meines Erachtens nicht zu. Soziale bzw. gesellschaftliche Prozesse und Verhältnisse wirken auf die Entwicklung menschlicher Individuen zurück. Der gesellschaftliche Kontext ist immer entscheidend, wie, also auf welche Weise und in welchem Ausmaß, Behinderung - unabhängig von der Art und Schwere einer ggf. existierenden Schädigung - im Bewusstsein der einzelnen Gesellschaftsmitglieder existent wird! GOFFMAN (1975) versteht Behinderung als ein Stigma, d.h. ein Individuum ist in unerwünschter Weise anders, als es von den Gesellschaftsmitgliedern antizipiert wurde. JANTZEN (1992) sieht den Kern einer gesellschaftlichen Definition von Behinderung in der Abweichung des Individuum von den geltenden Leistungsnormen, welche sich vorwiegend am Verwertungsmaßstab einer Leistungsgesellschaft unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen herleiten lassen. So betrachtet er Behinderung als eine Möglichkeit menschlichen Lebens, die es zu bekämpfen gilt: jedoch ausschließlich als Ausdruck historisch entstandener Lebensumstände, die es zu verändern gilt und nicht am einzelnen Menschen als Störpotential, das sich unserem Willen und unseren Normvorstellungen entgegenstellt.
Da Behinderung nur aus gesellschaftlichen Verhältnissen heraus begreifbar ist, kann "Isolation" als zentralste Kategorie zur begrifflichen Fassung des Wesens von Behinderung angesehen werden. Isolation ist dabei Ausdruck jener Bedingungen, die ein Individuum im adäquaten Austausch mit seiner Umwelt beeinträchtigen. Die Isolation vom außerindividuellen, kulturellen Erbe kann sowohl durch innere (z.B. veränderte Wahrnehmungsstrukturen) als auch durch äußere (z.B. Vorenthaltung von Erfahrung und Wissen) isolierende Bedingungen begründet sein.
Insbesondere die Theorie der Selbstorganisation lebendiger Systeme sowie die Übertragung postrelativistischer Erkenntnisse auf die Humanwissenschaft, wie sie vor allem in den jüngeren Veröffentlichungen von FEUSER (1994, 1995) dargestellt werden, ermöglichen ein Menschenbild, in dem "Behinderung" als eine von vielen möglichen Formen menschlicher Entwicklung sowie eine für dieses Individuum höchst sinnvolle und "entwicklungslogische" Integration von div. Bedingungen menschlichen Lebens verstanden werden kann. "Wie werden nicht umhinkommen, ´Behinderung`, ´Entwicklungsstörungen` und ´psychische Krankheit` als Konfliktlösungsstrategien zu begreifen" (FEUSER 1995, 123).
"Erst wenn organische Beeinträchtigungen zu solchen sozialer Ächtung und Ausgrenzung führen, findet Behinderung der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen statt, die zur ´Behinderung` des betroffenen Menschen gemacht wird." (FEUSER 1995, 51)
"Behinderung verstehen wir als Ausdruck jener gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf einen Menschen hin zur Wirkung kommen, der durch soziale und/oder biologisch-organische Beeinträchtigungen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen und Erwartungen hinsichtlich seiner individuellen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit in Produktions- und Konsumtionsprozessen nicht entspricht.
Sie definiert folglich einen sozialen Prozeß und ist in diesem selbst wiederum eine wesentliche Variable. Davon unterscheiden wir humanbiologisch-organisch, neurophysiologisch und neuropsychologisch erklärbare Beeinträchtigungen eines Menschen, die als Bedingungen den Prozess der ´Be`-Hinderung seiner Persönlichkeitsentwicklung im o.a. gesellschaftlichen Kontext auslösen und modifizieren. Die Grundstrukturen menschlicher Aneignungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse bleiben davon unberührt.
Behinderung ist letztlich das Produkt der sozialen Beantwortung einer Beeinträchtigung eines Menschen. D.h. wir unterscheiden Beeinträchtigungen in der Entwicklung eines Menschen von seiner Behinderung als soziale Kategorie. Ferner verstehen wir, was im sozialen Kontext eines Menschen als Folge von Beeinträchtigungen resultiert und sich sichtbar dokumentiert (physisch, psychisch, sozial), als ein logisches Produkt seiner Entwicklung unter den für ihn gegebenen Bedingungen, die wir mit dem Begriff der Isolation beschreiben" (Feuser 1989, 20).
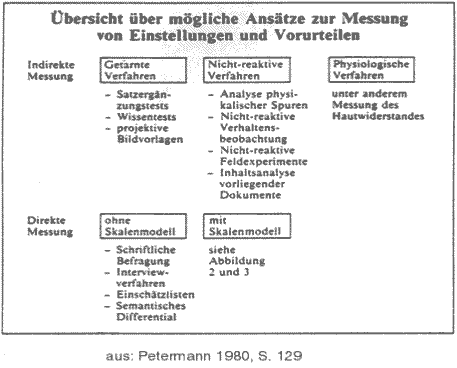
Abb.1: Übersicht über mögliche Ansätze zur Messung von Einstellungen und Vorurteilen (aus: Petermann 1980, S.129)
Die Soziale Reaktion lässt sich in zwei Komponenten unterteilen: die verbal geäußerte Reaktion im Sinne von innerer Einstellung auf der Basis des sozialpsychologischen Einstellungskonzepts sowie die reale, tatsächliche Reaktion im Sinne von Verhalten auf der theoretischen Grundlage des Stigmakonzepts (vgl. CLOERKES 1984). Die meisten Forschungen bezüglich der Sozialen Reaktion gegenüber Menschen mit Behinderung beschränken sich auf die (meist verbale) Erhebung der Einstellungen.
Die Konzeptionen, die Einstellung in Modellen zu beschreiben suchen, unterscheiden sich prinzipiell in mehrdimensionale und eindimensionale Ansätze. Unter den mehrdimensionalen Ansätzen ist die Drei-Komponenten-Theorie die verbreiteste. Sie unterteilt eine Einstellung in eine kognitive, eine affektive sowie eine konative (handlungsbestimmende) Dimension. Das Modell geht von der Annahme einer grundlegenden Konsistenz (bei durchaus möglichen Diskrepanzen) zwischen den verschiedenen Dimensionen sowie von einer prinzipiellen Konsistenz der gesamten Einstellung und dem offenen Verhalten aus. Diese Annahmen sind nicht unumstritten. Für PIAGET (vgl. SCHMITT 1979) beispielsweise ist die Handlungskomponente in der Affektivität enthalten, folglich unterscheidet er nur die zwei fundamentalen Aspekte Affektivität und Kognitivität. Andere Autoren ziehen es vor, Einstellungen eindimensional zu betrachten und nur auf die affektive Komponente zu beziehen, da vieles darauf hindeutet, dass die affektive Komponente in höchstem Maße die Einstellung bestimmt.
Mit Hilfe des Einstellungskonzepts sucht die Sozialpsychologie in der Regel soziale und gesellschaftliche Probleme auf der individuellen Ebene zu erklären, d.h. Einstellungskonzepte erfassen lediglich den persönlichkeitspsychologischen Aspekt. Die Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen wie Analysen gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse bleiben weitestgehend unberücksichtigt. Menschliches Verhalten kann jedoch nie ahistorisch und von der Gesellschaft losgelöst betrachtet werden. RUBINSTEIN (vgl. SCHWARZ 1978) trifft daher eine Unterscheidung zwischen einem dynamischen und einem qualitativ-inhaltlichen Aspekt der Einstellung. Der dynamische Aspekt bezeichnet dabei eine gewisse Handlungs- und Reaktionsbereitschaft des Individuums, während der qualitativ-inhaltliche Aspekt auf den Objektbereich verweist, dem gegenüber die Handlungs- oder Reaktionsbereitschaft besteht. Einstellungen, die neurophysiologisch als funktionelle Systeme zu betrachten sind, entwickeln sich immer in Abhängigkeit vom realen, gesellschaftlichen Sein.
Die materialistische Sozialpsychologie (ebd.) unterscheidet zwischen der aktuellen Einstellung, die sich in einer aktuellen Handlung realisiert, und der fixierten Einstellung, die eine habituelle Reaktionsbereitschaft ermöglicht. Fixierte Einstellungen sind Verhaltensdispositionen, die man als Ergebnisse von Lernvorgängen beschreiben kann, bei denen Erlebnisinhalte, die aus Verhalten, das mit aktueller Einstellung gesteuert wurde, vom Individuum kognitiv und wertend verarbeitet wurden. Die fixierte Einstellung ist in jeder Handlung beteiligt, jedoch nur als eine Variable. Es gibt somit keine direkte Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten. Die erfasste Einstellung eines Menschen kann ein tatsächliches Verhalten nicht voraussagen, sie vermag jedoch einen Teil des beobachtbaren Verhaltens zu erklären. Dies bedeutet, dass aus dem beobachteten Verhalten eine mögliche, dahinterstehende Einstellung bestimmt werden kann. Fixierte Einstellungen sind allerdings nicht ausschließlich Voraussetzung des Handelns, sondern gleichzeitig auch dessen Produkt. In kommender Tätigkeit, also in kommendem Verhalten geht die aus aktuellen Einstellungen abstrahierte und gewonnene fixierte Einstellung wieder als eine Variable in die Erscheinungsform des Verhaltens ein und wird ihrerseits im Verlauf der Handlung modifiziert. Damit wird die Thematik der Entstehung von Einstellungen berührt (vgl. 5.4).
Die Funktion der Einstellung besteht im wesentlichen aus zwei Merkmalen: Zum einen stellt sie eine Orientierungserleichterung im Verhältnis eines Individuums zu seiner Umwelt dar, zum anderen gilt sie als Statusmerkmal einer Gruppenzugehörigkeit. Diese Bezeichnung verdeutlicht, dass durch den gleichen Standort in einer Gesellschaft und die gleichen Beziehungen zu ihr auch mehrere Menschen oder Gruppen die gleiche Einstellung besitzen können. Die gruppenbedingte inhaltliche Bestimmung der Einstellung wird durch den Begriff des Einstellungsstereotyps wiedergegeben. Nach VORWERG (1966, zit. n. SCHWARZ 1978, 244) ist das Einstellungsstereotyp ein "unter gewöhnlichen Bedingungen nicht bewusst werdendes sozialpsychologisches Phänomen mit relativ konstantem Charakter gegenüber Veränderungen der ihn betreffenden Wirklichkeit. Er stellt auf diese Weise eine existentielle Voraussetzung des Gruppengeschehens dar, sichert (sich projizierend) die für jede Gruppenaktion notwendige Informationsgleichheit der Mitglieder und hält so [...] die Gruppenstruktur relativ konstant. Auf diese Weise dient er der Persönlichkeit zur Entscheidungserleichterung im sozialen Akt und erfüllt so eine ökonomische Funktion."
Ich heiße Martin. Ich bin behindert. Ich habe gute Gefühle. Ich fühle mich glücklich, weil ich Mitmenschen habe. Aber manchmal fühle ich mich auch unglücklich, wenn mir keiner hilft. Manche Leute sagen: "Wenn man behindert ist, ist das Leben aus!" Das stimmt aber nicht! Ich lebe noch!
Martin, 8 Jahre
(aus: FRANZ-JOSEPH HUAINIGG:
"Was hat`n der? Kinder über Behinderte."
Klagenfurt 1993.S.110 & Rückcover)
Die Kategorie "Art der Behinderung" umfasst die Determinanten, in denen, gemäß den sozialpsychologischen Untersuchungen, wesentliche Variablen der Sozialen Reaktion in der behinderten Person gesucht werden.
Eine "Rangordnung" impliziert eine Klassifikation in Kategorien von Behinderungen, die zwar recht gängig, jedoch fachwissenschaftlich zumindest problematisch sein dürfte. Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass Menschen mit einer sog. geistigen Behinderung die weitaus größte Ablehnung erfahren, während die Einstellungen zu Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Sinnesbeeinträchtigungen vergleichsweise positiv ausfallen. Die gesellschaftliche Vorstellung beruht mithin auf einem Bild, nach dem "Beeinträchtigungen des Kopfes" weit beunruhigender sind als "Beeinträchtigungen des übrigen Körpers" (CLOERKES 1984, 167ff). Je weniger eine Behinderung verstanden wird, desto geringer scheint die soziale Akzeptanz zu sein.
Mit den Worten von SCHöNBERGER (zit. n. CLOERKES 1984, 174) "rangiert in unserem Kulturkreis Intelligenz vor Sprachfähigkeit, diese vor Sinnestüchtigkeit, diese vor Handlungsgeschick und diese schließlich vor Fortbewegungsfähigkeit. "Je ´tiefer` die Behinderung [in dieser Aufzählung; SN] liegt, desto leichter wird der Behinderte als Mensch und Mitmensch toleriert."
Während die Schwere einer Behinderung den höchsten Stellenwert für die Betroffenheit der Nichtbehinderten zu haben scheint, gilt ebenso, dass schwerer beeinträchtigten Menschen signifikant positivere Einstellungen entgegengebracht werden als Menschen mit einer leichteren Behinderung (CLOERKES 1984). Menschen mit einer schwereren Behinderung scheinen eindeutiger dem gesellschaftlichen Bild des "Behinderten" zu entsprechen, was wiederum die Einordnung des Betroffenen in diese vermeintliche Gruppe mit entsprechenden, normativ großenteils vorgegeben Reaktionsschemata (z.B. Mitleid) erleichtert. Der Umgang mit leichter beeinträchtigte Menschen hingegen erschwert die Stereotypisierung, was zu einer verstärkten Verhaltensunsicherheit seitens der nicht-behinderten Gesellschaftsmitglieder führt.
Dieses recht eindeutig ermittelte Untersuchungsergebnis gilt jedoch nicht für Personen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Diesen Menschen wird eine negativere Einstellung entgegengebracht, je schwerer ihr Zustand beschrieben wird (ebd., 174). Geistige Behinderung wie Blindheit gelten als besonders schwere Beeinträchtigungen, aber blinde Menschen erfahren weitaus größere soziale Akzeptierung als Menschen, die als geistig Behinderte klassifiziert werden. "Die Schwere einer Beeinträchtigung scheint demnach kein wesentlicher Faktor für die Einstellungen gegenüber Behinderten zu sein" (ebd., 179).
Nach TRöSTER (1990) ergibt sich aus einer funktionalen Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten eine Belastung der Kommunikation, wobei die Art und das Ausmaß der Kommunikationsstörung von der Art der Behinderung abhängig ist und es bei bestimmten Behinderungen wiederum nicht oder nur in sehr geringem Maße möglich ist, die Funktionsbeeinträchtigungen des behinderten Interaktionspartners auszugleichen oder deren Auswirkungen in der Interaktion zu kompensieren. CLOERKES (1984, 176) führt Vorarbeiten anderer Autoren an und spricht davon, dass "funktionale Behinderungen, die zu einem Verlust [Heraushebung SN] der Kommunikationsfähigkeit führen (sprechen, hören, sehen), [...] außerordentlich negative Konsequenzen für alle Arten von sozialen Beziehungen [haben]."
Eine weitere Determinante der Sozialen Reaktion ist die zugeschriebene Verantwortlichkeit. Die gesellschaftlichen Vorstellungen über die Ursachen einer Behinderung prägen die Soziale Reaktion. Ob und in welchem Ausmaß ein Mensch als eigenverantwortlich für seine Behinderung (bzw. für das von der Norm abweichende Verhalten) angesehen wird, gilt laut TRöSTER (1990) als ein entscheidender Aspekt in der Frage der Sozialen Reaktion. Da sowohl die Einstellungsobjekte eine große Variabilität aufweisen, als sich auch die Subjekte der Einstellungen individuell unterscheiden, sind keine verlässlichen Aussagen möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass Personen, denen eine größere Eigenverantwortlichkeit unterstellt wird, ablehnender begegnet wird. Dies sind insbesondere Menschen, deren Verhaltensweisen von der sozialen Norm abweichen.
Ergänzt wird dieses Moment durch die Determinante der "Heilungschancen". Ist die (Wieder-) Anpassung an die Norm unwahrscheinlich, dürfte die Soziale Reaktion negativer, d.h. ablehnender und isolierender ausfallen, als bei einem Menschen, bei dem es sich nur um eine "temporäre" Beeinträchtigung handelt, die "Heilungschancen" mithin als gut beurteilt werden.
Die Sichtbarkeit einer Behinderung wird von allen Autor/innen als bedeutendste Determinante der Sozialen Reaktion angesehen. Dies gilt auch für Untersuchungen, die die Einstellungen von Kindern zu erfassen versuchten.
TRöSTER (1990) weist darauf hin, dass Sichtbarkeit nicht mit Auffälligkeit gleichgesetzt werden sollte. Auffällig könne eine Behinderung für einen nichtbehinderten Interaktionspartner sowohl durch die Sichtbarkeit als auch durch die veränderte Kommunikationsstruktur werden. Seiner Meinung nach ermöglicht die Sichtbarkeit einer Behinderung dem Interaktionspartner, sich auf die Behinderung einzustellen, während z.B. eine Beeinträchtigung der verbalen Kommunikation erst nach Kontaktaufnahme auffällig wird. Unmittelbar auffällige Behinderungen hemmen eine Kontaktaufnahme, während erst mittelbar auffällige (d.h. erst während längerfristigen sozialen Beziehungen auffällig werdende) Behinderungen die Fortführung des erfolgten Kontakts erschweren. Für physische Beeinträchtigungen hält SEYWALD (1976) fest, dass die Auffälligkeit bzw. die Abweichung von der Norm als dominante Eigenschaft betrachtet und auf andere Eigenschaften einer Person verallgemeinert wird.
Eng verbunden mit den unmittelbar auffälligen Behinderungen ist auch die sog. "ästhetische Beeinträchtigung", nach der die physische Attraktivität eines Menschen erheblichen Einfluss auf Einstellungen und Verhalten anderer habe. Wenngleich ungeklärt scheint, welche Merkmale einen Menschen attraktiv erscheinen lassen, finden sich in Untersuchungen hohe Übereinstimmungskoeffizienten bei der Bewertung der Attraktivität einer Person. TRöSTER (1990, 36) berichtet, dass "im allgemeinen [...] körperlich unattraktiven Menschen eher sozial unerwünschte Attribute zugeordnet werden". Besonders Entstellungen im Bereich des Gesichts haben die weitreichendsten Konsequenzen in bezug auf eine negative Einstellung. Bei Kontakten mit Menschen, die "extreme ästhetische Beeinträchtigungen" aufweisen, überwiegen affektiv-aversive Spontanreaktionen, die JANSEN (1984) "originäre Reaktionen" nennt. In den Gegensatz dazu stellt JANSEN "kulturell überformte Reaktionen", welche Resultate kognitiver Verarbeitungsprozesse sind und ein "sachliches Zusammenleben" mit den behinderten Menschen erst ermöglichen. Von einigen Autor/innen wird die sog. ästhetischen Beeinträchtigung als Inbegriff der Sichtbarkeit einer Behinderung gar als eine der wichtigsten Ursachen für die Ablehnung und Vermeidung von als behindert klassifizierten Menschen angesehen. Einer von TRöSTER (1990) angeführten Untersuchung zufolge scheinen "ästhetische Menschen" tatsächlich ein höheres Maß an Selbstvertrauen und damit einhergehend ein positiveres Selbstkonzept zu besitzen. Dies lässt sich meiner Ansicht nach durch die gesellschaftliche Widerspiegelung auf das Primat der Ästhetik, d.h. mit der negativen Reaktion auf als unästhetisch empfundene Menschen und dessen intersubjektive Verarbeitung dieser Reaktionen erklären.
Im Folgenden handelt es sich um Determinanten, die Bestimmungsgrößen auf Seite der Subjekte der Sozialen Reaktion zu bestimmen versuchen.
Untersucht wurden Variablen wie Schichtzugehörigkeit, Bildungsgrad, Beruf, Alter, Geschlecht u.a.m.
Eine eindeutige Beziehung konnte nur bei der Variable Geschlecht nachgewiesen werden. Frauen akzeptieren Menschen, die als behindert bezeichnet werden, in stärkerem Maße als Männer dies tun. Als Erklärungsversuche werden in der sozialpsychologischen Literatur ausnahmslos Annahmen angeführt, nach denen Frauen dazu tendieren, in sozial erwünschter Weise zu reagieren und nicht bereit sind, Aversionen auch offen zu artikulieren. Physiologische Verfahren oder freie Verhaltensbeobachtungen, die die Annahme der Ergebnisverfälschungen durch "Social Desirability" (die Verfälschung der Ergebnisse durch ein bewusstes Antworten im gesellschaftlich erwünschten Sinne) bestätigen oder widerlegen könnten, scheinen nicht durchgeführt worden zu sein. Generell erfährt die Annahme, Frauen verhalten sich verstärkt in sozial erwünschter Weise, keine weitere Reflexion, Hintergründe für dieses Verhalten (z.B. gesellschaftliche Rollenerwartung) werden nicht aufgeführt.
Ein weiterer Zusammenhang ist zwischen der Variable Bildung und den Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung zu erkennen. Dies in der Form, "dass mit steigendem Bildungsgrad die Bereitschaft, behinderte Personen zu akzeptieren, zunimmt" (CLOERKES 1984, 191). CLOERKES führt jedoch massive Einwände in Form von methodologischen Unkorrektheiten der Erhebung sowie die bestehende Möglichkeit des "Social Desirability" an und warnt davor, das o.g. Ergebnis zu überinterpretieren.
Die Kritik des "Social Desirability" wird ebenfalls oft angebracht, wenn es um einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Einstellung geht. Generell liegen in dieser Frage widersprüchliche Ergebnisse vor, so dass es unzulässig wäre, von einem klaren Zusammenhang zwischen Einstellung und Schichtzugehörigkeit zu sprechen.
Zwischen dem Lebensalter der Respondenten und der Einstellung konnte ein schwacher Zusammenhang gefunden werden. Demnach sei die Einstellung von älteren Menschen in der Tendenz eher ablehnend orientiert als die von jüngeren Menschen (CLOERKES 1984).
Keinerlei oder zumindest keine eindeutigen Zusammenhänge konnten indes für die meisten anderen untersuchten Variablen (Beruf [ohne Professionals], ethnische Herkunft, Konfessionszugehörigkeit, Wohnort [Stadt-Land] und Familienstand) ausgewiesen werden.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt, der sich auf Bestimmungsgrößen der Einstellung auf Seiten der Subjekte richtet, ist der Zusammenhang von Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen. Diese basieren auf psychoanalytischen Erklärungskategorien und begründen sich in der Regel mit Hilfe von Arbeiten von ADORNO. ADORNO et al. hatten postuliert, dass negative und abwertende Einstellungen bei Personen mit autoritärer Persönlichkeitsstruktur besonders ausgeprägt sind.
Die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale in bezug zur Vorurteilsforschung sind Autoritarismus, Ethnozentrismus und Dogmatismus, kognitive Einfachheit, Ambiguitätstoleranz, Ich-Schwäche und Angst.
Die Zusammenfassung verschiedener Untersuchungen bei CLOERKES (1984) zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Einstellungen und den eng miteinander verbundenen Persönlichkeitsvariablen Autoritarismus, Dogmatismus und Ethnozentrismus als Kern einer vorurteilsvollen Persönlichkeit. CLOERKES warnt jedoch völlig zu Recht vor einer Überbewertung dieser individualistischen Betrachtungsweise. Persönlichkeiten wie Persönlichkeitsmerkmale sind Produkte von Sozialisationsprozessen. Mithin spiegeln sich gesellschaftliche Intentionen, Werte und Normen in Persönlichkeitsstrukturen wider, dies jedoch auf unterschiedlichste Weise. Autorität u.a. Persönlichkeitsstrukturen müssen somit als Produkte menschlicher Entwicklung in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext verstanden werden.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass je klarer ausgeprägt jemand die Merkmale einer autoritären Persönlichkeit zeigt, desto wahrscheinlicher er dazu neigen wird, negative Einstellungsmomente stärker zum Ausdruck zu bringen (vgl. z.B. BäCHTHOLD 1984). Unter dem Gesichtspunkt des Einstellungserwerbs ist es wichtig, zu betonen, dass eine autoritäre Erziehung die Bildung von undifferenzierten Betrachtungsweisen und Vorurteilen fördert.
Nachdem bisher Untersuchungen dargestellt wurden, die die Bedingungen für Einstellungen auf der einen oder auf der anderen Seite, also im Objekt oder im Subjekt gesucht haben, folgt nun die Darstellung empirischer Untersuchungen, die sich mit den Beziehungen zwischen ihnen befassen. Vielfach ist die Bedeutung der Erfahrung von direkten Kontakten zu Menschen mit Behinderung als bedeutendste Determinante überhaupt für die Herausbildung von positiven Einstellungen ihnen gegenüber apostrophiert worden. Dies ist der Grundtendenz nach sicher richtig. Dennoch erscheint es notwendig, etwas vertiefender auf diesen Bereich einzugehen.
Differenziert betrachtet korrespondiert nicht jeder, sondern in verstärktem Maße freiwilliger Kontakt mit positiveren Einstellungen. Es zeigte sich, dass den Kontakten eine affektive, gefühlsmäßige Bindung zugrunde liegen muss, damit sie zu positiven Einstellungen, also zur Erfüllung der erwähnten Annahme, führt (CLOERKES 1984, SEIFERT 1984). Vorhandene negative Einstellungen können durch eine Bestätigung des negativen Bildes im direkten Kontakt durchaus zur Verstärkung von ablehnenden Tendenzen führen. Der auf Negativmerkmale fokussierte Blickwinkel und die damit verbundene Bestätigung der Erwartungshaltung lässt ein Anders-Sein als in der Erwartungshaltung nicht mehr zu. CLOERKES (1984, 219) hebt als Zusammenfassung zu der Bedeutung des Kontakts zu behinderten Menschen heraus:
"Nicht die Häufigkeit des Kontakts ist entscheidend, sondern seine Intensität. Nicht jeder intensive und enge Kontakt ist aber der Entwicklung positiver Einstellungen förderlich; wichtige Nebenbedingungen sind seine emotionale Fundierung und seine Freiwilligkeit"
Innerhalb der empirischen Untersuchungen zur Variable Kontakt finden die Kontakte von Professionals (in den medizinischen, pädagogischen und sozialen Berufsbereichen), von Familienangehörigen (Eltern und Geschwistern) sowie von Gleichaltrigen (Peers) zu Menschen mit Behinderung weitere Beachtung. Die Ergebnisse sind im wesentlichen gekennzeichnet von starken Einstellungsunterschieden, die mit bereits erwähnten Randbedingungen des Einstellungserwerbs begründet werden.
Wegen der Bedeutung für diese Arbeit sollen die Einstellungen von Lehrkräften zu behinderten Kindern und Jugendlichen expliziter dargestellt werden. Viele Untersuchungen, darunter VON BRACKENs (1976), stellten bei Sonderpädagog/inn/en positivere Einstellungen zu behinderten Kindern fest als bei Regelpädagog/inn/en. Deren Meinungsbild sei eher noch vorurteilsbelasteter als das der Bevölkerung im Durchschnitt. Demgegenüber muss aber auch festgestellt werden, dass auch Sonderpädagog/inn/en nicht frei von Vorurteilen sind. Laut CLOERKES (1984) kommt eine Studie sogar zu dem Schluss, dass Sonderschullehrkräfte zu autoritärem Erziehungsstil und zu Isolierung von lernbehinderten Schüler/innen neigen, wobei diese Tendenzen mit steigendem Fachwissen zunehmen! Die Kenntnisse bzw. das Wissen um Behinderungen allein scheinen somit kein Garant für positivere Einstellungen zu sein. BöTTCHER / GIPSER/ LAGA (1995) weisen ferner nach, dass die Stärke von Vorurteilen bei Lehrkräften der Tendenz nach korreliere mit dem zunehmenden Alter der Lehrpersonen wie auch mit der zunehmenden Dauer der Lehrtätigkeit.
Die bisher aufgeführten Untersuchungen entstammen zum überwiegendem Teil der Zeit vor etwa ein bis zwei Jahrzehnten, als die Einstellungsforschung ihren Höhepunkt hatte.
Seitdem besteht angesichts der Arbeit der Betroffenengruppen ("Krüppelbewegung", "Selbstbestimmt leben") bzw. deren Stellvertreter ("Lebenshilfe") sowie der in den letzten Jahren verstärkt praktizierten gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nicht-behinderter Kinder und Jugendlicher die Möglichkeit, dass diese Veränderungen bereits zu gesamtgesellschaftlichen Einstellungsveränderungen geführt haben.
In den vergangenen Jahren sind nur kleinere Untersuchungen durchgeführt worden. Sie zeigen auf, dass Alltagskontakte zu Menschen mit Behinderung heute häufiger sind als früher. Dadurch sind die Erscheinungsbilder behinderter Menschen eher präsent. KURTH u.a. (1994) sprechen von einer "integrativen Bereitschaft", die auch die Ergebnisse der Bremer Studie von HEUSMANN / LAUE (1983) erkennen lassen. LENZEN betont, dass die populären Vorstellungen über Ursache und Wesen dieser Menschen aufgrund der vermehrten Bekanntheit die Einstellungen zwar hat positiver werden lassen, die Vorstellungen über Entwicklungs- und Bildungsvoraussetzungen jedoch nicht zu verändern vermochte. "Ironisch kann anlässlich dieser Feststellung nicht verschwiegen werden, dass auch übliche ´medizinische`, ´psychologische` und ´pädagogische` Auffassungen nicht so weit vom ´Image` in der Mehrheit der Gesellschaft entfernt sind" (LENZEN 1985, 71). Nach HIEBSCH (1973, 128) brauchen "auch sachlich als falsch nachweisbare Einstellungen ihre Wirkung nicht zu verlieren (...), da deren ausdrückliche Anerkennung in bestimmten Gruppen Ansehen und soziale Anerkennung einbringen kann."
KLAUß (1996) beschreibt als Hypothesen, dass Toleranz und das Wissen über die Ursachen von geistiger Behinderung zugenommen, Verhaltensweisen und Eigenschaftszuschreibungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung sich jedoch kaum verändert haben. Weiterhin kommt er zu der Annahme, dass sich das Ansehen der betroffenen Familien trotz gestiegener Toleranz und erweiterten Wissens deutlich verschlechtert habe! Zu ähnlichen Ergebnissen kommen BREITENBACH / EBERT (1997), die bei Kindern ein deutlich gestiegenes Wissen, einhergehend mit einem grundsätzlich positiverem Bild von Kindern mit geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft (z.B. weniger Vorurteile) ermitteln konnten, dabei jedoch betonen, dass ein allgemeines Anwachsen der sozialen Distanz zu beobachten wäre. Bei Eltern von Regelschulkindern (1998) stellen sie jedoch eine abnehmende soziale Distanz fest.
Der Untersuchung von BöTTCHER / GIPSER / LAGA (1995) zufolge, die explizit die Einstellungen von Lehrkräften erhob, scheint eine Abnahme der Vorurteilsbereitschaft sich vorwiegend auf Einstellungen gegenüber Menschen mit geistigen Behinderungen, also auf die Gruppe, der den sozialpsychologischen Erhebungen zufolge die negativsten Einstellungen entgegengebracht werden, zu beziehen. Diese Tendenz sei bei den Einstellungswerten gegenüber lernbehinderten oder verhaltensauffälligen Schüler/innen weniger stark ausgeprägt bzw. z.T. nicht beobachtbar.
Die sozialpsychologische Einstellungsforschung hat trotz einer großen Anzahl von durchgeführten Untersuchungen nur wenige eindeutige Ergebnisse erbracht. Zu ihnen gehören, dass die Einstellung zu behinderten Personen abhängt a) von der Art der Behinderung, b) vom Ausmaß des intensiven und emotional positiv erlebten Kontakts zu behinderten Personen und c) von der Ausprägung autoritären Verhaltens. Hinzuzufügen ist weiterhin, dass d) weibliche Personen günstigere Einstellungen aufweisen und dass e) die Einstellung nicht - wie so oft vermutet - von der sozialen Schicht abhängt. Diese Ergebnisse verbleiben auf einem beschreibenden Niveau. Sie müssen für eine Interpretation in einen gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Beispielsweise die Prozesse, die hinter dem Phänomen stehen, dass die Eigenwahrnehmung der betroffenen Menschen von deren Fremdwahrnehmung durch die Gesellschaft abweicht, werden in den erwähnten Untersuchungen nicht hinterfragt. Auftretende Diskrepanzen werden allenfalls dem fehlenden Einschätzungsvermögen der behinderten Person zugeschrieben (z.B. STEINHAUSEN 1980). CLOERKES (1984, 254) kommt zu dem Schluss:
"Insgesamt weist das Ergebnis unserer bisherigen Betrachtungen auf eine bemerkenswerte Unabhängigkeit der sozialen Reaktion auf Behinderte von einem möglichen Einfluss der untersuchten Variablen hin."
Die Ursachen der überwiegend negativ ausgerichteten Einstellung sind augenscheinlich in anderen Zusammenhängen als in den aufgeführten zu suchen. Die Sozialpsychologie verbleibt auf der Ebene eines kausalattribuierten Denkschemas und gelangt nicht zu einer dialektischen Betrachtungsweise. Autoritäre Verhaltensweisen und erlebte Kontakte allein sagen nichts über die wirklichen Zusammenhänge aus. Auch sie entwickeln sich - ebenso wie Einstellungen - im Laufe der Sozialisation und sind zur Erklärung von negativen Einstellungen, sofern die Ausbildung z.B. eines autoritären Verhaltens nicht reflektiert wird, nur bedingt geeignet. Die im Rahmen der bio-psycho-sozialen Einheit Mensch auf der biologischen Ebene grundgelegten psychischen Regelungen (Einstellungen, Vorurteile autoritäre Neigungen etc.) werden stets von der höheren sozialen Ebene entwickelt und reguliert. Es erscheint daher notwendig, die historisch vermittelten Mechanismen auf gesellschaftlich-sozialer Ebene aufzudecken.
Eine der möglichen Erklärungsansätze für die Soziale Distanz gegenüber Menschen mit Behinderung bietet JANTZEN (1974). Das Menschenbild von behinderten Menschen wird im Sozialisationsprozess im Sinne eines für Vorurteile notwendigen "falschen Bewusstseins" geprägt. Nach JANTZEN ist die Ablehnung von behinderten Menschen eng verbunden mit der geringeren Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft vornehmlich in kapitalistischen Wirtschaftsformen. "Derjenige, der seine (wenn auch reduzierte) Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verkaufen kann, hat einen (wenn auch reduzierten) Wert; derjenige, dessen Arbeitskraft nichts wert ist, ist auch selbst nichts wert, er wird als ´lebensunwertes Leben`, als ´nicht lebenswert` betrachtet" (ebd.,159). In das sog. falsche Bewusstsein dringen nach JANTZEN durch die aktive Aneignung eines historisch kumulierten gesellschaftlichen Erbes traditionsgebundene und magische wie auch ideologische Vorstellungen ein.
Neben dem Gebrauchswert aller Waren (hier: der Ware Arbeitskraft) sei jedoch die Erscheinung des Gebrauchswertes entscheidend. Die verhängnisvolle Überbetonung von Werten wie Schönheit und Jugend fasst JANTZEN unter Heranziehung von Vorarbeiten anderer Autoren als "Warenästhetik" zusammen, der beeinträchtigte Menschen in aller Regel nicht genügen können. Damit verstoßen sie - wie ROHR (1995) schreibt - gegen die in Jahrtausenden verinnerlichten ästhetischen Normen. In diese Normen, welche in dem Wechselspiel von gesellschaftlichen und biografischen Bedingungen eines jeden Menschen in seinem Sozialisations- und Erziehungsprozess erworben werden, gingen stets die Wesensmerkmale eines Gesellschaftssystems mit ein. Das, was von marktbeherrschenden gesellschaftlichen Gruppen als schön und ästhetisch definiert wird, orientiert sich an Wesensmerkmalen marktwirtschaftlicher Systeme, nämlich an gesellschaftlicher Brauchbarkeit und Zweckerfüllung. Über die zur Verfügung stehenden Beeinflussungskanäle der suggestiv arbeitenden Werbung, die ein reines Nützlichkeitsdenken ästhetifiziert wiedergibt, werden Werte wie Leistung, Erfolg, Karriere gekoppelt mit Erscheinungen, die als schön, gesund oder ordentlich definiert werden (vgl. BONFRANCHI 1994). Menschen mit Behinderung, die diesen gesetzten Attributen in der Regel nicht entsprechen, erfahren in der Folge die Kehrseite dieses ästhetischen Stereotyps: Wer eben nicht schön, gesund, ordentlich etc. erscheint, dem wird auch keine entsprechende Leistung zugetraut.
Ein anderer soziologischer Erklärungsansatz richtet sich auf das abweichende Verhalten (Devianz) behinderter Menschen. Abweichung wird dabei verstanden als eine Verletzung gesellschaftlicher Erwartungen, wobei diese Erwartungen auf bestimmten Wert- und Normvorstellungen fußen. Während die strukturelle Ausformung dieses Ansatzes davon ausgeht, dass eine Norm wie entsprechend auch eine Verletzung der Norm objektiv fassbar ist, geht die prozessuale Ausformung davon aus, dass ein abweichendes Verhalten dann vorliege, wenn eine Verhaltensweise negativ sanktioniert wird. Der Schwerpunkt liegt bei dieser Ausformumg, die auch als "Symbolischer Interaktionismus" bezeichnet wird, nicht auf dem eigentlichen Verhalten, sondern auf der gesellschaftlichen Interpretation eines Verhaltens ("labeling").
Die Stigmatisierungstheorie grenzt sich von der Theorie des abweichenden Verhaltens ab. Die Vertreter der Stigmatheorie argumentieren damit, dass sie nur von einem abweichenden Verhalten sprechen, wenn sich Personen absichtlich so (d.h. abweichend von der Norm) verhalten. Beispielsweise Menschen mit Behinderung jedoch verhalten sich nicht absichtlich von der Norm abweichend, sondern verletzen mit ihrem So-Sein bestimmte "ungeschriebene" Normen. Nach GOFFMAN (1975) ist eine Eigenschaft einer Person zunächst weder kreditierend noch diskreditierend. Erst in Relationen, in sozialen Bezügen, könne ein Merkmal diskreditiert werden, also mit einem Stigma belegt werden. Andere Autoren weisen darauf hin, dass nicht allein dem Merkmal, dem Stigma Beachtung geschenkt werden sollte, sondern in erster Linie dem Definitionsprozess, der dieser Zuschreibung zugrunde liegt sowie dessen Folgen für die durch diesen Prozess Stigmatisierten.
Entscheidend ist in der Stigmatheorie, dass nicht nur das auslösende Merkmal, für das GOFFMAN im Übrigen dessen Visibilität für entscheidend hält, negativ definiert wird, sondern dass eine Generalisierung dieser Bewertung auf die ganze Person erfolgt. Für GOFFMAN ist die Beschädigung der normalen Identität die wichtigste Konsequenz der Stigmatisierung. Als Folge der gestörten Identität sei das Unvermögen zu normaler Interaktion besonders fatal. Die eigene, bedrohte Identität aufrechtzuerhalten sei folglich ein Ziel der nicht-stigmatisierten Personen, das sie durch die Abgrenzung von stigmatisierten Personen zu realisieren versuchen. Stigmatisierung habe auf der mikrosozialen Seite die Funktion einer Entlastung und der Stabilisierung der eigenen Identität.
Auf der gesellschaftlichen Ebene besitzt die Stigmatisierung nicht zuletzt die Funktion, die Normtreue bzw. Normkonformität zu belohnen und letztlich das gesellschaftliche System zu stabilisieren (HOHMEIER angef. n.: CLOERKES 1984 & HENSLE 1979).
Sozialpsychologische Ansätze beziehen sich in der Regel auf eine Benachteiligung von Minderheiten. Der klassische Minoritätenansatz sieht beeinträchtigte Personen als eine Minorität in der Gesellschaft an. Der Ansatz der "Disadvantaged Group" (benachteiligte Gruppe) geht hingegen davon aus, dass Menschen mit Behinderung sich in wesentlichen Punkten von anderen Minoritäten unterscheiden. Beispielsweise haben beeinträchtigte Menschen keine eigene Tradition, keine eigene Kultur, keinen eigenen Glauben.
Auch wenn eine direkte Übertragung von Minoritäten auf Menschen mit Behinderung schwierig scheint, so erscheint es mir im Hinblick auf die Soziale Reaktion behinderten Menschen gegenüber durchaus sinnvoll, eine Minderheit (als behindert klassifizierte Personen) von einer Mehrheit (sich selbst als "normal" bezeichnende Personen) abzugrenzen. Entscheidend ist die Soziale Reaktion der Umwelt, die Definition als "von Normen abweichend" (in bezug auf äußere Erscheinung, Glauben oder Verhalten) und die gesellschaftliche Sichtweise der beeinträchtigten Menschen als Minorität.
Die Gemeinsamkeit der Minoritäten liegt darin, dass ihnen besondere Plätze ("Inseln") innerhalb einer Gesellschaft eingeräumt werden, ihre Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe jedoch begrenzt werden. Minoritäten sind oftmals Opfer von starren Vorurteilen und Diskriminierungen.
Psychologische Ansätze messen physischen Angstreaktionen zur Erklärung der Ablehnung von Menschen mit Behinderung besondere Bedeutung zu. Die psychoanalytische Lehre geht dabei von einer natürlichen, triebhaften Ablehnung von beeinträchtigten Menschen aus, die gesellschaftlich stark sanktioniert wird, was zu einer Schuldangst vor dem verinnerlichten Über-Ich führt. Dabei wirke die Schuldangst so stark, dass der triebhafte Impuls selbst gar nicht ins Bewusstsein dringt, sondern verdrängt wird. Neben dieser Verdrängung bewirke die Schuldangst weitere Abwehrmechanismen, wie Projektion und Rationalisierung, die die Basis für die Ablehnung von beeinträchtigten Menschen bilden.
Auf einem psychoanalytischen Hintergrund erklärt Niedecken (1993) ihre Kategorie "Phantasmen". Die Bilder, die wir von behinderten Menschen haben, also die Erscheinungen, die wir beobachten, verschmelzen häufig mit einem unterstellten Anders-Sein. Das Bild wird zur Realität. Bei Phantasmen handelt es sich um "jene psychischen Konfigurationen, in denen Gesellschaften ihre Herrschaftsstrukturen in den Individuen gesellschaftlich unbewusst absichern, sie wie unabänderlich und naturgegeben erscheinen lassen" (ebd., 113). Sie sind das Konglomerat gesellschaftlicher Einstellungen, die die menschliche Persönlichkeitsentwicklung mitbestimmen. Kein Mensch, so NIEDECKEN, wird geistig behindert geboren. Die geistige Entwicklung konstituiert sich in der Auseinandersetzung zwischen dem Säugling und seiner Bezugsperson. Dabei geht die Haltung der sie umgebenden Umwelt in die Auseinandersetzung mit ein. Diese Haltung scheint geprägt zu sein von Prozessen der Angstabwehr, seien es Abgrenzung von diesem scheinbaren Anders-Sein, Anpassungsversuche des Anders-Sein an die Normalität oder die Übertragung tabuisierter kollektiver Tötungswünsche.
Auch in anderen psychologischen Ansätzen spielt die Kategorie "Angst" eine große Rolle. Das Bild, das der einzelne Mensch von sich selbst hat ("self-image", "Selbst") beinhaltet auch die Vorstellung, die der einzelne Mensch von seinem Körper hat. Dieses wird als "body-concept" oder "body-image" bezeichnet. "Angesichts der außerordentlich positiven gesellschaftlichen Bewertung von Schönheit und körperlicher Integrität ist eine Abweichung von diesen Standards von großer Bedeutung für das body-image des Einzelnen" (CLOERKES 1984, 27). Einige Autoren gehen davon aus, dass zwischen der Wertigkeit des eigenen body-image und den Einstellungen zu von diesen Idealen abweichenden Personen ein großer Zusammenhang bestehe. Der hohe Wert, den Gesundheit und physische Integrität in unserer Gesellschaft einnehmen, führe zu einer Angst vor dem Verlust dieses Besitzstandes, die beim Anblick von Behinderungen anderer aktualisiert wird. Als Reaktion auf die Gefährdung physischer Integrität infolge eines Mangels an anderen, zur Verfügung stehenden Verhaltensweisen, setzen die einem Individuum zur Verfügung stehenden Abwehrmechanismen Vermeidung und Rationalisierung ein. Die beschriebene Angst ist jedoch nicht allein auf gesellschaftliche Werte wie Schönheit, Gesundheit etc. zurückzuführen. Historisch gesehen resultiert diese Angst nicht zuletzt aus einer magischen Furcht vor Ansteckung, also aus einer mangelnden Informiertheit.
Den kognitiven Konsistenztheorien liegt die Annahme zugrunde, dass Angstreaktionen nicht angeboren und instinktiv seien, sondern auf "kognitive Dissonanzen" zwischen bekannten und fremdartigen Wahrnehmungen gründen. Dabei wird eine prinzipielle Konsistenz zwischen Meinungen, Gefühlen, Verhaltensabsichten und offenem Verhalten postuliert.
Nach HERDERs Gleichgewichtstheorie reagiert der Mensch auf alles Fremdartige negativ, da dieses einen angestrebten Gleichgewichtszustand stört. Der psychologische Gleichgewichtszustand wird durch die Konfrontation mit beeinträchtigten Menschen gestört, die Folge ist eine Verunsicherung insbesondere für unsichere Personen.
Die Grundannahme von FESTINGERs Theorie der kognitiven Dissonanz ist, dass die kognitiven Elemente eines Individuums (Informationen, Kenntnisse, Meinungen) bzw. die Erkenntnisse über die Welt und über sich selbst entweder in irrelevanten, konsonanten oder dissonanten Beziehungen zueinander stehen können. Zwei kognitive Elemente stehen in einer dissonanten Beziehung und damit in einer psychischen Spannung, wenn ein Element das Gegenteil des anderen impliziert. Rufen zwei sich widersprechende Einsichten Dissonanz hervor, können diese abgebaut und Konsonanz hergestellt werden, indem ein Element verändert wird. Auf die vorliegende Problematik bezogen bedeutet dies, dass ein Mensch z.B. bei der Bitte um Hilfe Abneigung empfindet, er jedoch der Ansicht ist, diese Bitte sozialen Normen folgend nicht ablehnen zu können. Die Widersprüchlichkeit erzeugt eine kognitive Dissonanz. Das Individuum wird versuchen, diese Dissonanz zu verringern, und zwar indem es diejenige Kognition verändert, deren Änderung den relativ geringsten psychischen Aufwand erfordert. Durch diese Theorie werden vor allem die ausweichenden Verhaltensweisen erklärt, wie z.B. unpersönliche Hilfe (Geld spenden) oder das Verweisen auf die größere Kompetenz anderer.
Die Kategorie, die nahezu alle Erklärungsansätze anführen, ist "Angst". Die Angst vor Behinderung äußert sich in vielfältiger Weise. Da ist z.B. die Angst, selbst behindert zu werden (durch Unfall etc.) und in der Folge von gesellschaftlichen und/oder ästhetischen Normen abzuweichen, von seiner Umwelt stigmatisiert, diskriminiert und ausgegrenzt zu werden, seine Arbeitskraft nicht mehr optimal verkaufen zu können etc. Daneben gibt es die Angst, ein behindertes Kind zu bekommen, ergänzt durch die Angst vor einer narzistischen Kränkung.
Angst an sich ist eine Emotion auf der Basis des biologischen und des individuellen Sinns. Doch Angst vor Behinderung wird erst auf der Basis des persönlichen Sinns, d.h. in einem gesellschaftlichen und sozialen Kontext wirksam. Die biologische Ebene ist die Basis der bio-psycho-sozialen Einheit Mensch, die den Aufbau der höheren Ebenen ermöglicht. Dabei reguliert die nächst höhere Ebene jeweils die darunter liegende(n). Der biologisch erklärbare Prozess des Angstempfindens wird durch die soziale Ebene gesteuert. So wie Angst auch kontrollierbar ist, so kann sie auch geschürt werden. Angst wird in der Regel dann empfunden, wenn "in einer gedanklich vorweggenommenen oder realen, als bedrohlich empfundenen Situation kein Handlungskonzept oder Verhaltensmuster zur Verfügung steht" (KöBSELL 1993). Steigt die Neuigkeit einer Handlung zu stark an, richtet sich die Tätigkeit auf die Vermeidung von negativen Emotionen, z.B. durch Flucht oder Aggression. Der hohe Grad von Neuigkeit infolge eines plötzlichen und unerwarteten Kontakts erzeugt negative Emotionen und die entstandene Handlungsungewissheit führt zum Gerichtetsein auf Vermeidung. "Da behinderte Menschen nicht zum bundesdeutschen Alltag gehören, (...) stehen den Menschen, die nie mit Behinderten konfrontiert werden, auch keinerlei Handlungs- und Umgehensweisen zur Verfügung. Sie haben lediglich ein Zerrbild im Kopf, das sie für absolut halten und das von den Medien ständig bestätigt wird" (ebd., 182). "So sind die Vorurteile gegenüber Behinderung zwar historisch gewachsen, werden jedoch sowohl durch die Medien als auch durch die, durch Vorurteile bereits auf Negativmerkmale reduzierte, Wahrnehmung ständig reproduziert" (ebd. 180).
Es wird deutlich, dass die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Kontakt zu Menschen mit Behinderung erschweren, die Grundlagen für diese Prozesse darstellen. Streng marktorientierte Wettbewerbsformen, Separierung von als behindert klassifizierten Menschen u.v.m. forcieren Ängste innerhalb einer Gesellschaft, welche durch vorherrschende Ideologien und Vor-Urteile bestätigende Mechanismen manifestiert werden. Im folgenden sollen nun konkrete individuelle und institutionelle Verhaltensmuster beschrieben werden, deren Analysen die Hintergründe der Sozialen Reaktion konkretisieren werden.
Verhaltensmuster können auch als Ausformungen der Sozialen Reaktion bezeichnet werden. Dabei können Verhaltensweisen, die gesellschaftlich negativ bewertet werden, unterschieden werden von solchen, die gesellschaftlich akzeptiert sind und gemeinhin als positiv bewertet werden. Diese allgemeine gesellschaftliche Bewertung sagt indes nichts über die wirkliche Funktion der mit den Verhaltensweisen verbundenen Prozesse aus.
Das visuelle Fixieren, also das geradezu ungläubige Anstarren, sowie diskriminierende Äußerungen, taktloses Fragen, Schuldzuweisungen, Witze oder Verspotten sorgen für einen Stigmaeffekt sowohl bei den Betroffenen als auch bei deren Angehörigen. Viele Fallbeispiele zeigen, dass diese Verunsicherung und Verletzung dazu führen kann, dass Eltern sich nicht mehr trauen, mit ihrem behinderten Kind auf die Straße zu gehen. Sie entziehen sich den negativen Reaktionen der Gesellschaft und geraten immer stärker in die Isolation. Die Gründe für die gesellschaftlichen Reaktionen sind in einem mangelnden differenzierten Wissen und in einer Unerfahrenheit im Umgang mit behinderten Menschen zu suchen. Durch mangelnde Erfahrung prägt sich (aufgrund der gleichzeitig gegebenen, Akzeptanz implizierenden sozialen Normen) eine Handlungsunsicherheit aus. Die während der Sozialisation tradierten negativen Emotionen gegenüber Menschen mit Behinderung bei gleichzeitigem Fehlen gesellschaftlicher Rechtfertigungen für dieses Empfinden bewirken Interaktionsspannungen (SEYWALD 1976, TRöSTER 1988).
Maßgeblich die in den letzten Jahren vollzogene Emanzipation der Behindertenbewegung, unterstützt durch Interessenvertretungen (z.B. Elternvereinigungen), haben das gesellschaftliche Bild von Behinderung verändert. Bestrebungen der gemeinsamen Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen, der erlassene Zusatz im §3 GG, das neue Betreuungsgesetz u.a.m. können Zeichen einer sich (langsam) verändernden Einstellungsstruktur sein. Es stellt sich jedoch die Frage, wie stabil diese Einstellungen bei Eintritt anderer Randbedingungen, etwa in ökonomischen Krisensituationen, sein werden.
Trotz aller Veränderungen ist bei der Bevölkerung die weit verbreitete Annahme vorhanden, dass man bei der zufälligen Begegnung das oben beschriebene Anstarren vermeiden und - sozusagen in Umkehrung des Prozesses - die beeinträchtigten Personen lieber "übersehen" solle. BäCHTHOLD (1984) zufolge glauben etwa 50% der Befragten, dass es am besten sei, den Kontakt zu beeinträchtigten Menschen zu meiden. Dabei wird auf die größere Kompetenz anderer (Fachkräfte) und die eigene Angst, etwas falsch zu machen, verwiesen. Ebenso wird die eigene soziale Distanzierung mit der Annahme und Zuschreibung von Isolationsbedürfnissen von beeinträchtigten Menschen gerechtfertigt. GOFFMAN (1976) formuliert als Erklärung für dieses Vermeidungsverhalten die Irrelevanzregel, nach der die Schädigung bzw. ein auffälliges, gesellschaftlich negativ besetztes Verhalten nicht wahrgenommen wird[2], was eine Scheinnormalität zur Folge hat. Diese Scheinnormaltät behindert die Ausbildung einer wirklichen Akzeptanz.
Die scheinbare Anteilnahme an beeinträchtigten Menschen wird überwiegend durch Mitleid ausgedrückt. Wie isolierend und ausgrenzend Mitleid in Wirklichkeit ist, wird deutlich, wenn man einzelne Ergebnisse der Einstellungsforschung betrachtet. Nach VON BRACKEN (1976) empfinden 98,6%, also fast alle Respondenten, mehr oder weniger Mitleid gegenüber einem Kind mit einer geistigen Behinderung. Da es sich fast um die gesamte Gruppe der Respondenten handelt, lässt sich festhalten, dass ein großer Teil eben dieser Gruppe auch Ablehnung, Entsetzen und Abscheu (jeweils 42-44%) oder sogar Angst und Ekel (jeweils um 35%) gegenüber diesen Kindern empfindet. Etwa 70% waren der Ansicht, dass es eher gut wäre, wenn ein Kind mit einer geistigen Behinderung früh sterben würde und fast 60% waren der Meinung, dass die Tötung eines behinderten Kindes durch die eigene Mutter nicht mit Mord bestraft werden dürfe! Lediglich 3% würden bei einer eventuellen Adoption eines Kindes auch ein Kind mit einer geistigen Behinderung adoptieren.
Mitleid hat offensichtlich nur sehr wenig mit wirklicher Akzeptanz zu tun[3], was sich auch im konkreten, sog. "diffusen" Hilfeverhalten ausdrückt. So sprechen sich laut JANSEN (1972) 65% der Befragten eindeutig für materielle, unpersönliche Hilfe (Spenden, Produkte aus beschützten Werkstätten kaufen, Geld sammeln...) und gegen direkte, persönliche Hilfe aus. Dennoch gilt das Mitleid in unserer Gesellschaft als gemeinhin positiv bewertete Ausdrucksform sozialen Verantwortungsbewusstseins. Aus der subjektiven Sicht der Betroffenen sind dies jedoch extrem segregierende und isolierende Randbedingungen. So stellte die Einstellungsforschung folgerichtig fest, dass nicht nur eine an materiellem und sozialem Prestige orientierte Wertehaltung zu eher negativeren Einstellungen führt, sondern dass auch bei altruistischer Wertorientierung ein schwach positiver Zusammenhang zu negativen, ablehnenden Einstellungen bestehen kann (SEIFERT 1984).
Hintergrund all dieser Auffassungen ist u.a., dass in der Regel von der Annahme ausgegangen wird, dass das Leben eines beeinträchtigten Menschen mit Leid gleichzusetzen sei. Anstelle der wirklichen und konkreten Lebensverhältnisse werden eigene Emotionen ("so wie der da möchte ich nicht sein") zum Gegenstand der Wahrnehmung gemacht[4]. Obwohl laut VON BRACKEN (1976) 78,2% der Respondenten der Meinung sind, dass ein Kind mit einer Behinderung darunter leidet, wenn ihm die Umwelt abweisend gegenübersteht, scheint es nicht ins gesellschaftliche Bewusstsein zu gelangen, dass das potentiell mögliche Leid dieser Menschen nicht durch deren psycho-biologische Konstitution gegeben ist, sondern allenfalls aus unserem Verhalten ihnen gegenüber entstehen kann. Diese Negation wiederum erscheint nach herrschender Auffassung erwünscht und ist entsprechend gesellschaftlich vermittelt. Als Beispiel für eine auf institutioneller Basis organisierten und auf Mitleid basierenden Verhaltensform sei nur die "Aktion Sorgenkind" genannt, dessen "Werbung" für ihre Zwecke ein Mitleid erregendes Behindertenbild schafft, auf dem schließlich wiederum jene ausgrenzenden und isolierenden Verhaltensweisen wiederaufbauen können. Die vermeintliche Teilhabe ("mit-") an diesem vermeintlichen Leid ("mit-leiden") entpuppt sich letztendlich als strukturelle, aber mit dem Tuch der "sozialen Hilfsbereitschaft" vertuschte Form von Ausgrenzung, die FEUSER (1995, 50) als deren "elitärste Form" bezeichnet und die eine wirkliche Annäherung und Auseinandersetzung mit behinderten Menschen eher verhindert und für eine Ausbildung von positiven Einstellungen eher kontraindiziert ist.
Bei der Betrachtung der institutionellen Verhaltensweisen kommt - neben den dezentralen Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und den "beschützenden" Werkstätten - dem bundesdeutschen Schulsystem eine besondere Rolle zu. Unter dem Deckmantel von verbesserten Förderungsmöglichkeiten und angeblich größerer Chancengleichheit wird am vertikal-hierarchisch aufgebauten und auf Segregation ausgerichteten Schulsystems festgehalten. Dieses hierarchisch gegliederte Schulsystem kann als Struktur gewordener Ausdruck der Bewertung von Kindern und Jugendlichen nach dem Nützlichkeitsprinzip aufgefasst werden (FEUSER 1995). Hier finden Gewalt und Ausschluss ihre gesellschaftliche Legitimation in der erzieherischen Zielsetzung, die in den von BASAGLIA (1973, 124) so benannten "Institutionen der Gewalt" praktiziert wird. Nach BASAGLIA habe die sog. Wohlstands- und Überflussgesellschaft erkannt, dass sie ihr wahres Gesicht nicht zeigen dürfe und aus diesem Grunde die Macht an Techniker delegiert, welche mittels der neuen Form der technisierten Gewalt die Gewalt mystifizieren. Dadurch würden sich die Opfer der Gewalt ihrer Situation nicht mehr bewusst werden. Ohne die im Zusammenhang der Arbeit sicher interessanten Aussagen der "demokratischen Psychiatriebewegung" Italiens weiter verfolgen zu können, muss spätestens an dieser Stelle deutlich werden, dass ablehnende Einstellungen beeinträchtigten Menschen gegenüber nicht als individuelle Erscheinungen betrachtet werden können, sondern vielmehr als gesellschaftlich determinierte, im historischen Kontext und auf institionellem Wege vermittelte ideologische Ausprägungen einer Ideologie verstanden werden müssen.
Menschen mit Behinderung waren schon immer Gegenstand von Ausgrenzung und Isolierung (vgl. REICHMANN 1986, REICHMANN-ROHR in: EBERWEIN 1994, ZIELKE 1992, CLOERKES 1984, 309f, HöHN 1982, BLEIDICK 1984). Zu nennen wären da die Praxen des Versteckens oder des Tötens, z.B. in antiken Kulturen oder im Mittelalter. Auf mystische und dämonische Vorstellungen, auch im christlichen Glauben (vgl. z.B. LUTHERs "Wechselbälge", vom Teufel untergeschobene Kreaturen) folgten medizinische Modelle und alsbald am Nützlichkeitsprinzip angelehnte ökonomische wie philosophische Orientierungen. Die Historie zeigt, dass dies bis hin zu einer beispiellos strukturierten Vernichtung von als minderwertig und lebensunwert bewerteten Lebens reichte.
Offene Gewalt gegen Menschen mit Behinderung hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Dies kann laut FRüHAUF / NIEHOFF (1994) auf einen allgemeinen Werteverlust und auf eine nachweislich gesunkene Hemmschwelle bei Gewaltanwendung zurückgeführt werden. Die Gründe dafür sind in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu suchen. So führt nach FRüHAUF / NIEHOFF der Wegfall von alten Orientierungen (Glaube, Autorität) bei Nicht-Vorhandensein neuer Orientierungen zu motivgeleiteten Handlungen, in deren Folge negative Zuwendung immer noch positiver empfunden werden als Nichtbeachtung. Offene Gewalt gegen Menschen mit Behinderung sind in einen Kontext einer übergeordneten Randgruppenfeindlichkeit zu stellen. Diese ist eine Folge der wirtschaftlichen Situation und sozial ungleichmäßig vorgetragener Sparbemühungen, die die Diskussion der Kosten-Nutzen-Spirale[5] wieder aufleben lassen. Sozialpolitisch unterpriviligierte Bevölkerungsgruppen sind in Grenzsituationen, in denen sie ihren sozialen Status bedroht sehen, geneigt, sich gegen andere marginalisierte Gruppen z.T. massiv und aggressiv abzugrenzen.
Diese als "Neue Behindertenfeindlichkeit" bezeichnete Ablehnung basiert andererseits auf alten ungebrochenen Einstellungen, die derzeit wieder massiv hervorbrechen (vgl. NIEHOFF 1990, FEUSER 1995). Genauso wie das eugenische Denken nicht erst mit dem 1933 erlassenen "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" begann (vgl. GERAEDTS / ZUPER 1990), hörte es nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches nicht abrupt auf. Vielmehr weisen viele Ansätze, die sich mit dem Zusammenhang von Eugenik und "Euthanasie" befassen, auf unveränderte Kontinuitäten im Denken auch nach dem Euthanasie-Programm des nationalsozialistischen Regimes hin (vgl. BRILL 1994). "SINGER und seine Thesen können deshalb ohne weiteres in einen historischen und interkulturellen Gesamtzusammenhang gestellt werden" (BONFRANCHI 1992, 43).
Nun ist BONFRANCHI (1992a) zufolge die Offenbarung und Praktizierung innerer Tötungs- und Vernichtungswünsche nicht zu vereinbaren mit einer christlich-abendländischen Kultur. Folglich fänden heutzutage offene Aktionen keine große gesellschaftliche Akzeptanz. Vielmehr müssten sie durch noch zu benennende Mechanismen legitimiert und verschleiert werden. Diese Legitimierungsmechanismen funktionieren seit Menschengedenken und seien heute lediglich in technologisierter Form optimiert.
Die Mechanismen, die da wären, um die Vernichtung von behindertem Leben zu legitimieren, möchte ich bezeichnen als
a.) die Befreiung von angeblichem Leid,
b.) die Aufstellung von (utilitaristisch fundierten) ökonomischen Kosten-Nutzen-Analysen und
c.) den sozialdarwinistisch orientierten, rassenhygienischen Traum eines "vollkommenen, hochwertigen Menschen".
Die Praxen, die diese Mechanismen vertechnisieren, bezeichnet FEUSER (1995) als "Mythen der Moderne". Sie reichen von der Sterbehilfe über das Verwahren von schwerst beeinträchtigten Menschen (z.B. im Koma oder mit einem apallischen Syndrom), dem sog. "Liegenlassen" von schwerbeeinträchtigten Säuglingen gleich nach der Geburt bis hin zur "Prävention von Behinderung" durch humangenetische Beratung (pränatale Diagnostik), Invitro-Fertilisation, Sterilisation von beeinträchtigten Frauen, prädiktiver Medizin und Gentechnologie.
Die Praxis der auf der Position einer negativen Eugenik[6] basierenden Humangenetik erscheint als lediglich unblutiger und unsichtbarer gewordenes Wechselspiel zwischen den eugenischen Kategorien Ausmerze und Auslese. Dabei wird nicht mehr mit der Ausrottung Minderwertiger, sondern unter dem Deckmantel des Humanität und angeblicher gesellschaftlicher Verantwortung mit der Verminderung schweren Leidens argumentiert.
Wie bereits beschrieben wurde, basiert die Ablehnung von Menschen mit Behinderung in der Regel auf Angst ihnen gegenüber. "Angst erzeugt geradezu den Wunsch nach Kontrolle" (KöBSELL in: DEGENER / KöBSELL 1992, 33). Das Gegenteil von Angst ist Sicherheit und es wird nichts unversucht gelassen, ein größtmögliches Maß eben dieser zu erreichen. Seien es die Patiententestamente der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben oder pränatale Diagnostik und humangenetische Beratung: sie alle dienen dazu, eine Sicherheit vor Behinderung zu suggerieren, die es objektiv nicht geben kann.
Die Gentechnolog/inn/en setzen dabei in der Tradition des biologisch-medizinischen und z.T. sozialdarwinistisch orientierten Denkmodells noch immer (in Negation der bis hierhin beschriebenen Prozesse) auf die Annahme, dass sich das individualisierte und ontologisierte Phänomen Behinderung schlicht und einfach abschaffen ließe[7]. Behinderung wird mit Leid gleichgesetzt und es erscheint als eine humane Aufgabe, Leid zu verhindern. Behinderung als ein soziales Konstrukt kann indes auch nur auf sozialer Ebene verhindert werden. Sie biologisch zu verhindern ist unmöglich. Verhindert werden kann nur Leben, welches durch gesellschaftliche Prozesse der Ausgrenzung und Isolation als behindert klassifiziert wird. Dieses Leben zu verhindern, heißt mithin, zu töten (vgl. FEUSER 1995). In konkreter Weise wird dies heute bereits im sog. "Liegenlassen" von schwerbehinderten Säuglingen praktiziert und propagiert[8]. Auch hier bedeutet das Vorenthalten apparativer Unterstützung zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung der selbstorganisierten Lebensprozesse nichts anderes, als dieses Leben zu töten. "Der Allmachtsanspruch der Medizin fordert dort den Tod, wo die Grenzen ihrer Kompetenz erreicht sind" (FEUSER 1995, 55).
Den Prozess der Entmenschung[9] über die Klassifizierung als leidvoll und lebensunwert bis zur Tötung dieser Existenzen als ethisch gebotenem Akt bezeichnet WOLFENSBERGER als die "Logik des Totmachens".
Eng verbunden mit solchen Vernichtungstendenzen sind die immer wieder angeführten Kosten-Nutzen-Analysen. Menschen mit Behinderung, deren Verwertbarkeit in am Kapital orientierten Wirtschaftsformen eingeschränkt erscheint, werden - um es mit einem nationalsozialistischen Begriff zu beschreiben - als "Ballastexistenzen", als "unnütze Esser" dargestellt. Ungebrochen scheint heute (frei nach malthusischem Denken[10]) der Mythos der endlichen Ressourcen und den damit verbundenen Verteilungsproblemen innerhalb der Gesellschaft. Welche Wertigkeiten bei diesen Verteilungskämpfen zum Ausdruck kommen, wird deutlich, wenn man betrachtet, dass z.B. 1981 der Gesundheitsökonomiepreis des Bundesministers für Arbeits- und Sozialordnung für eine Arbeit verliehen wurde, die die volkswirtschaftlichen Einsparungen durch die Vermeidung von behinderten Säuglingen durch humangenetische Beratung errechnete (vgl. z.B. GERAEDTS / ZUPER 1990, 31). Es wird deutlich, dass es sich bei der Vernichtung bzw. Vermeidung von beeinträchtigtem Leben in erster Linie nicht um rassistische Ideologien, sondern vielmehr um ökonomische Zusammenhänge handelt, die laut FEUSER in den nationalökonomischen Ausprägungen des Liberalismus des 18. und 19. Jahrhunderts fußen. So kann die faschistische Herrschaftstruktur auch als pragmatisch durchführende Staatsgewalt einer zuvor von medizinisch-psychologischen, philosophischen und ökonomischen Fachwissenschaften vorbereiteten Vernichtung gelten. Was die gegenwärtige Situation FEUSERs Ansicht nach heute von der nationalsozialistischen Herrschaftszeit noch unterscheide, seien lediglich die Herrschafts- und Gewaltstrukturen, die die Tötung realisieren - was wiederum seiner Überzeugung nach in Zukunft nach sog. liberalen Prinzipen der Selbstbestimmung vollzogen werden wird (FEUSER 1995, 60ff).
Die Angebote der humangenetischen Beratung oder pränatalen Diagnostik z.B., die eine selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen die Geburt eines Säuglings suggerieren, entpuppen sich bei systemischer Betrachtung als verschleierte Fremdbestimmung in volksökonomischem Interesse. Aufgrund der fehlenden Gewalt- und Herrschaftsstrukturen entwickelt das System der Ausgrenzung, unterstützt durch neue techologische Möglichkeiten, eine veränderte Strategie, die ich das Psychologisieren auf der Basis struktureller Gewalt nennen möchte. Diese Strategien wiederum erscheinen gesellschaftlich akzeptierter als die offenen Vernichtungen der Vergangenheit und wirken systemstabilisierend. Die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse vermitteln auf psychologisierter Ebene eine moralische bzw. ethische Handlungsnorm, nach der es Frauen (bzw. Paaren) im Falle von vorhandener oder geplanter Schwangerschaft immer schwerer haben werden, sich der "gesellschaftlichen Pflicht zur Prävention von Behinderung" zu entziehen und das Angebot der humangenetischen Beratung (sozusagen selbstbestimmt) eben nicht wahrzunehmen. Die Mechanismen, die ich damit meine, sind gesellschaftliche Bemühungen, das Leben mit einem beeinträchtigten Kind zu erschweren.
Die Voraussetzungen für eine solche Entwicklung scheinen angesichts der Diskussion um die "Neue Euthanasie", die KöBSELL (1993) als die intellektuelle Form der im Überbau verankerten Aggression gegen Menschen mit Behinderung bezeichnet, bereits vorhanden. Als philosophisch-wissenschaftliche Fundierung dient vor allem der Utilitarismus[11], zumeist in der Form des präferenz-utilitaristisch argumentierenden Moralphilosophen SINGER (1984). Seinen Auffassungen, deren Ähnlichkeit mit der Aussagen von BINDING und HOCHE (1922) augenscheinlich ist[12], wurde von diversen Autor/innen und aus unterschiedlichen theoretischen Auffassungen heraus widersprochen (JANTZEN 1991, 1991a, FEUSER 1993a, 1994, 1995, BONFRANCHI 1992a, 1993, THEUNISSEN 1990, BLEIDICK 1990). BONFRANCHI (1992) hält m.E. völlig zu recht fest, dass davon auszugehen sei, dass vermutlich viele Menschen in unserer Gesellschaft die SINGERschen Gedanken nicht falsch finden. Vermutlich würden sie ihnen - erst leise und dann immer lauter - zustimmen, wenn sie auf breiterer Basis bekannt wären. Die Grundlage sieht er in den weit verbreiteten Auffassungen der Leid-Zuschreibung in Verbindung mit unbewussten Todeswünschen. Die Gründe dürften allerdings ebenso in den oben skizzierten ökonomischen Zusammenhängen wie in der vermutlich stark verbreiteten Denkweise des Nützlichkeitsprinzips liegen.
BONFRANCHI (1992a, 1993) ist ferner einer der Autoren, die in der Ausprägung eines segregierenden Schulsystems eine Mitschuld der klassischen Heil- und Sonderpädagogik (bzw. der Erziehungswissenschaft allgemein) am Erscheinen der so titulierten "Neuen Euthanasie" sehen. Hätte in den letzen Jahrzehnten eine umfassende schulische und mithin auch gesellschaftliche Integration stattgefunden, wäre diese Diskussion seiner Ansicht nach gar nicht denkbar gewesen. Die Sonderpädagogik sei während ihrer Entwicklung derart mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass sie nicht in der Lage war, gesellschaftliche Tendenzen wahrzunehmen. Die Hochzeit der Ausweitung von sonderpädagogischen Einrichtungen sei in Wirklichkeit ein vom Staat instruierter Akt zum Zwecke der gesellschaftlichen Entlastung von Behinderung gewesen. Angesichts zugestandener Mittel und erreichten Einflusses habe sich die Sonderpädagogik korrumpieren lassen. Andere Vertreter der Heil- und Sonderpädagogik (z.B. BLEIDICK) haben diesen Aussagen widersprochen. Ich halte den von BONFRANCHI beschriebenen Prozess, für den der "Dienstbarkeit der Intellektuellen", welchen BASAGLIA mit dem Begriff "Befriedungsverbrechen" umschrieb. Nach der anfänglich sicherlich notwendigen Einrichtungen von Sonderschulen scheint keine wirkliche Analyse der Bedingungen vorgenommen worden zu sein, die es erlaubt hätte, eine Integration im Sinne von Demokratisierung und Humanisierung sowie im Interesse der Betroffenen einzuleiten. Vielmehr scheint es um eine Ausweitung der seit über 100 Jahren praktizierten Segregation gegangen zu sein, mit dem Ziel, die sich entwickelnde Eigenständigkeit als Wissenschaft zu festigen. Die politischen Absichten verkennend, ermöglichte dies eine "Instrumentalisierung der Wissenschaft zu einem Mittel der Herrschaft" (BASAGLIA).
Die meisten Untersuchungen im Bereich der Einstellungsforschung beziehen lediglich Jugendliche oder Kinder im Schulalter mit ein. Bei ihnen scheinen keine prinzipiellen Unterschiede zu Einstellungen von Erwachsenen beobachtbar zu sein (vgl. CLOERKES 1984). Sie scheinen das gesellschaftliche Normen- und Wertesystem bereits so sehr internalisiert zu haben, dass ihre Einstellungswerte sich denen der Gesamtgesellschaft weitgehend annähern. Dieser Installationsprozess der gesellschaftlich bedingten Normvorstellungen in subjektive Wertesysteme beginnt bereits in der frühen Kindheit, wobei die entscheidenden Prozesse der Einstellungsbildung bzw. der innerpsychischen Verarbeitung von Behinderungen im Kindergarten- bzw. im jüngeren Schulalter stattzufinden scheinen.
Zu Einstellungen von jüngeren Kindern liegen nur wenige Untersuchungen vor. Generell kann davon ausgegangen werden, dass die grundlegenden kulturellen Normen einer Gesellschaft im wesentlichen bereits im ersten Lebensjahr internalisiert werden.
Dreijährige zeigten in den Untersuchungen keine spezifischen Reaktionen auf beeinträchtigte Personen. Dieses Alter, also ungefähr die Periode zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr, die LEONTJEV als "Erste Geburt der Persönlichkeit" bezeichnet und in der die individuelle Ich-Bedeutung gewonnen wird, gilt als Beginn des entscheidenden Sozialisationsalters, was die Bildung von individuellen Werten und Einstellungen betrifft. Vier- bis Sechsjährige äußerten sich hingegen mit zunehmendem Alter tendenziell negativer. Ab ca. dem achten Lebensjahr kann von einer recht stabilen Einstellung ausgegangen werden. Generell stimmen die sozialpsychologischen Untersuchungen darin überein, dass auch bei Kindern die Visibilität einer Behinderung bei der Einstellungsbildung von größter Bedeutung ist (vgl. KRON 1994, Becker-Gebhard 1990a, MüNZING 1972).
WOCKEN (angeführt nach: PODLESCH / PREUSS-LAUSITZ 1993) ergänzt dies in seiner 1992 durchgeführten Untersuchung, in der er die Soziale Distanz von 1055 Schüler/innen unterschiedlichen Alters und verschiedenen Schulformen angehörend erfasste. Die größte soziale Distanz wurde dabei gegenüber Kindern mit Verhaltensstörungen ermittelt, gefolgt von Kindern mit geistigen Behinderungen, Kindern nicht-deutscher Herkunft, Kindern mit körperlichen- und schließlich Kindern mit Lernbehinderungen. Möglicherweise machten die in die Untersuchung involvierten Kinder ihren Wunsch nach Abgrenzung und Distanz nicht einzig an der Visibilität oder an der Schwere einer Behinderung fest, sondern an den Schwierigkeiten, die in der Interaktion und Kooperation mit einem anderen Kind entstehen könnten.
Häufig ist in Berichten über integrative Erziehung im Elementar- oder Primarbereich davon die Rede, dass Kinder "mit Behinderten anders umgehen", sie "keine Scheu zeigen", "Behinderungen gar nicht wahrnehmen" oder "so etwas wie Behinderung gar nicht kennen". Diese sehr oberflächlichen Beschreibungen erlauben es jedoch nicht, in einem wissenschaftlichen Sinn davon zu sprechen, dass eine gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen zu einer (generell) vorurteilsfreien, positiv ausgerichteten und Akzeptanz schaffenden Einstellung gegenüber beeinträchtigten Menschen führe.
Arbeiten, die sich gezielt mit Veränderungen von Einstellungen gegenüber behinderten Menschen infolge der zunehmenden gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder befassen, lagen bis vor wenigen Jahren laut BECKER-GEBHARD (1990a) nicht vor. BREITENBACH / EBERT (1997) sind dieser Frage in einer recht neuen Untersuchung nachgegangen. Wenn auch später wieder etwas einschränkend, so kommen beide zu der klaren Aussage, dass eine intensive schulische Kooperation zu einer deutlich geringeren sozialen Distanz, realistischeren Einschätzungen und weniger Vorurteilen gegenüber Kinder mit geistiger Behinderung führt. "Häufiger und bewußt gestalteter Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne geistige Behinderung verändert die Einstellungen der nichtbehinderten Kinder gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung positiv und wirkt der zu beobachtenden wachsenden sozialen Distanz entgegen. Nimmt die Quantität und die Qualität dieser Kontakte zu, verstärkt sich der beobachtbare Trend" (1997, 66).
Weitere Untersuchungen, die im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Begleitungen von Integrationsprojekten durchgeführt wurden, zeigen, dass Kinder, die im Rahmen der gemeinsamen Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen heranwachsen, behinderte Kinder nicht anhand der Beeinträchtigung, sondern in erster Linie an den Besonderheiten ihrer je einmaligen Persönlichkeit charakterisieren. Die räumliche und vor allem die zumeist entstandene emotionale Nähe zu ihnen erlaubt es Kindern, die Einmaligkeit eines jeden Kindes, ob mit einer Behinderung oder nicht, zu erfassen, ohne damit auf die äußerlich beobachtbare Behinderung als Definitions- und Zuschreibungsmerkmal angewiesen zu sein. WOCKEN hat in der differenzierten Auswertung seiner o.a. Untersuchung festgestellt, dass eine deutliche Reihenfolge der Distanzwerte hinsichtlich der Zugehörigkeit unterschiedlicher Schulformen existiert: Sonderschüler/innen zeigten die distanziertesten Einstellungen, Kinder aus Integrationsklassen hingegen die integrativsten!
Die deutschsprachige Integrationsliteratur bietet ferner einige soziometrische Untersuchungen an, dessen Ergebnisse hinsichtlich der kindlichen Einstellungsbildung von Interesse sein könnten[13]. Untersuchungsergebnisse belegen, dass Kinder bereits im Vorschulalter in der Lage sind, das Entwicklungsniveau ihres Spielpartners zu berücksichtigen, was sich z.B. in der Schaffung von unterschiedlichen linguistischen Umgebungen für unterschiedliche Spielpartner/innen ausdrückt. Bei der freien Wahl ihres Spielpartners / ihrer Spielpartnerin wählten nichtbehinderte Kinder jedoch überwiegend Kinder gleichen Entwicklungsniveaus. In den Fällen, in denen sich nichtbehinderte Kinder für behinderte Kinder als Spielpartner entschieden hatten, wurde die kooperative Spielform annähernd so häufig gewählt wie bei Spielpartner/innen gleichen / ähnlichen Entwicklungsniveaus (BECKER-GEBHARD 1990).
Kontakte innerhalb eines integrativen Unterrichts seien in hohem Maße geprägt durch ausgeglichene Austauschbeziehungen, die sich im Laufe der Schulzeit, also mit zunehmender Dauer des emotional positiv erlebten Kontaktes, stabilisieren und teilweise weiter positiv entwickeln (PODLESCH / PREUSS-LAUSITZ 1993, MAIKOWSKI / PODLESCH 1988, FEUSER / MEYER 1987).
Hinsichtlich der Zuordnung zu den soziometrischen Typen (in Anlehnung an die weit verbreitete Typisierung PETILLONs) seien laut DUMKE / SCHäFER etwa 50% der behinderten Schüler/innen dem Typ "unauffällig" zuzuordnen. Überdies finden sich behinderte Schüler/innen in allen weiteren Typen. Verglichen mit den nichtbehinderten Schüler/innen finden sich allerdings wesentlich mehr behinderte Schüler/innen in den negativen und weniger behinderte Schüler/innen in den positiven Typisierungen wieder.
Schüler/innen mit Behinderung schneiden hinsichtlich ihres Wahl- und Ablehnungsstatus ungünstiger ab als Schüler/innen ohne Behinderungen. Insbesondere schulleistungsschwache und "verhaltensauffällige" Kinder erhielten in der Untersuchung von DUMKE / SCHäFER in der Regel niedrigere Statuswerte als Kinder mit körperlichen- oder Sinnesbeeinträchtigungen. Für Schüler/innen mit geistigen Behinderungen seien die Werte derart uneinheitlich, dass eine klare Aussage nicht möglich scheint.
HAEBERLIN et. al. (1990) führen an, dass der soziometrische Status von schulleistungsschwachen ("lernbehinderten") Schüler/innen in integrativen Klassen durchweg geringer sei als der Durchschnitt. Dies wird auch von BLESS (1995) bei der Durchsicht verschiedener Arbeiten bestätigt. FEUSER / MEYER (1987) hingegen kommen in ihrer Untersuchung zu der Aussage, dass in der Gruppe der Schüler/innen mit erhöhtem Förderbedarf dieselben Verteilungen und Häufigkeiten ihrer Kommunikation zu beobachten seien wie in der Gesamtgruppe. Die Unterschiede zwischen den Untersuchungen sind vermutlich auf die bereits anskizzierte Problematik der unterschiedlichen Konzeptionen zurückzuführen13. Generell kann festgehalten werden, dass die soziale Integration von Kindern mit Erschwernissen des Lernens und des Verhaltens größere pädagogische Probleme aufwirft als die soziale Integration von Kindern z.B. mit geistiger Behinderung oder einer Sinnesbeeinträchtigung. Vermutlich unterliegt die Einstellung der nichtbehinderten Kinder oben ausgeführten Prozessen, nach der z.B. nicht-verstehbares Verhalten Angst macht und zur vermehrten Ablehnung führt.
Die soziale Einbindung behinderter Schüler/innen ist indes in starkem Maße von Variablen abhängig, die über die (integrative) Unterrichtsgestaltung hinausgehen. So schreibt KRON (1994), dass ermittelte Einstellungen bei (freiwilligen) Spielkontakten weniger ungünstig waren als bei schulischen Kontakten. SCHNITTKA / SOMMER (1994) halten fest, dass es empirisch belegte Tatsache sei, dass diejenigen als behindert etikettierten Kinder am stärksten sozial integriert und akzeptiert seien, bei denen sich Schulkasse und unmittelbare Nachbarschaft überschneiden, deren freundschaftliche Kontakte somit nicht auf eine Institution beschränkt bleiben, sondern darüber hinaus durch die Nachbarschaft im außerschulischen Rahmen weitergeführt und weiter gefestigt werden. Dies zeigt deutlich auf, in welchem Maße gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die über die unmittelbare Unterrichtgestaltung hinausgehen, für die soziale Integration und damit auch für die Soziale Reaktion verantwortlich sind.
Mädchen mit Behinderung sind sowohl in Sonderschulen als auch in Integrationsgruppen unterrepräsentiert. Der Anteil von Mädchen mit Behinderung innerhalb von Integrationsklassen liegt nach den Angaben von PRENGEL (nach Hinz 1993) zwischen 0% und 34% und ist somit immer noch niedriger als der Anteil der Mädchen an Sonderschulen (durchschnittlich 40%).
Demgegenüber lag in den ersten zehn Jahren integrativer Beschulung der Anteil von Mädchen ohne Behinderungen im Durchschnitt bei 57%, womit Mädchen in Integrationsklassen im Vergleich zu Regelklassen der allgemeinen Grundschule, in denen der Mädchenanteil durchschnittlich 49% betrug, überrepräsentiert sind. Allein diese Zahlenverhältnisse belegen bereits, dass Mädchen in Integrationsgruppen eine besondere Rolle einnehmen.
Kinder, die als beeinträchtigt klassifiziert werden, kommen in überwiegendem Maße aus Familien, die der Unterschicht zugerechnet werden. Soziokulturell benachteiligte Kinder haben im Verlauf ihrer familiären Sozialisation Sprach-, Einstellungs- und Orientierungsmuster erworben, die für die Bewältigung schulischer Anforderungen oftmals nicht funktional sind und die eine reibungslose Anpassung an die real existierende Schulkultur erschweren. Ihre Problemlösungsversuche werden in der Regel als unangepasstes, auffälliges und störendes Verhalten wahrgenommen und beurteilt, was den Beginn der schulischen Ausgrenzung markiert. Die Tendenz von Erwachsenen, bei Jungen und Mädchen von Geburt an unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Einstellungen zu bilden, ist empirisch inzwischen gut belegt. Die geringere Quote von Mädchen an Sonderschulen kann also in der Art und Weise interpretiert werden, dass bei Mädchen innerhalb ihrer familiären Sozialisation diejenigen Eigenschaften gefördert werden, die im schulischen Zusammenleben gefordert werden und die für die Bewältigung des schulischen Alltags funktional sind.
Die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen sind heute weitgehend bekannt. Jungen verhalten sich gemäß "typisch männlicher" Verhaltensrollen eher laut, stark, mutig etc., während Mädchen im Laufe ihrer Sozialisation eher die ihnen zugeschriebenen, "weiblichen" Rollen erlernen, die mit Attributen wie leise, zurückhaltend, kooperativ, vorsichtig oder gar ängstlich und schwach beschrieben werden. Auf die gesellschaftlichen Hintergründe dieser Verhaltensweisen kann an dieser Stelle nicht ausgiebig eingegangen werden. Für die hier vorliegende Fragestellung erscheint es wichtig, dass es vornehmlich Mädchen sind, die in größerem Maße bereit sind, sich anderen Kindern, speziell den Kindern mit Behinderung, anzunähern. Sie sind es, die den "Löwenanteil der Integrationsarbeit" (PRENGEL) leisten. Dabei tendieren Lehrer/innen dazu, Verständnis und Hilfestellungen in besonderem Maße von Mädchen einzufordern, womit sie tradierte Rollenspezifika weiter unterstützen (SCHöLER 1993).
Kinder im Grundschulalter neigen dazu, fast ausschließlich geschlechtshomogene Gruppen zu bilden und sich somit vornehmlich an Angehörigen des eigenen Geschlechts zu orientieren (Hinz 1993, 391). Während der durchschnittliche soziometrische Status von Kindern mit Behinderung gemäß mehreren Untersuchungen in der jeweils gegenschlechtlichen Gruppe keine gravierenden Unterschiede zum normalen Durchschnittswert aller Kinder aufweist, ist der Status behinderter Kinder innerhalb des eigenen Geschlechts niedriger als der nichtbehinderter Kinder! Kinder mit Behinderung erfahren von den Mitschüler/innen des eigenen Geschlechts mithin weniger Zuneigung und mehr Abneigung (DUMKE / SCHäFER 1990, PODLESCH / PREUSS-LAUSITZ 1993, WOCKEN 1987, HAEBERLIN 1990).
Da Mädchen, wie oben beschrieben, Annäherung in stärkerem Maße suchen als Jungen, passt es ins Bild, dass Jungen mit Behinderung gemäß mehrerer Untersuchungen tendenziell günstigere Statuswerte erzielen als Mädchen mit Behinderung. Die einzige mir bekannte Erklärungshypothese dazu bieten PODLESCH / PREUSS-LAUSITZ (1993) an. Sie vermuten, dass sich Mädchen wie Jungen in der Phase ihrer Identitätsfindung und der Entwicklung ihres Selbstkonzepts auf gesellschaftlich determinierte Idealbilder des eigenen Geschlechts beziehen. Die beginnende Übernahme von Geschlechtsrollen ist laut SCHEU (1977) bereits bei Kindern im Alter von 3;6 Jahren zu beobachten, wobei die Zuschreibung ab 5;6 Jahren stereotyp und relativ gefestigt erscheint. Diese Normvorstellungen, an denen sich Kinder orientieren, schließen, so PODLESCH / PREUSS-LAUSITZ, etwaige Beeinträchtigungen physischer oder psychischer Ausprägung nicht ohne weiteres ein. Von Mitschüler/innen eigenen Geschlechts scheinen Kinder mit Behinderung mithin weniger anerkannt zu werden, weil sie weniger der gesellschaftlichen Norm der geschlechtlichen Rollenerwartung entsprechen.
Das würde bestätigt durch Beobachtungen, wie sie z.B. MENTZENDORFF-MITLEHNER (1992, 1994) machte. Sie berichtet u.a. von einem Jungen mit Trisomie 21, der von eindeutigem rollenspezifischen Verhalten abweicht, indem er neben den als männlich geltenden Verhaltensweisen, die er für sich beansprucht, auch das der weiblichen Rolle zugeschriebene Verhalten zeigt. Gesellschaftliche Normen in bezug auf geschlechtliche Orientierung am Männlichen scheinen für ihn kein Maßstab zu sein, weil er diesen Normen entsprechend - aufgrund seiner Behinderung - nicht als männlich gelte. Für das Verhalten von Jungen mit Behinderung bedeute dies, dass sie sich nicht gezwungen bzw. verpflichtet fühlen, sich einer eindeutigen Rolle zuzuordnen. Mädchen mit Behinderung hingegen verhielten sich laut ihren Beobachtungen eindeutig ihrer geschlechtsspezifisch tradierten Rolle entsprechend.[14]
Wie beschrieben zeigen jüngere Kinder in stärkerem Maße originäre Verhaltensweisen, während ältere Kinder normative und moralische Erwartungen zu erfüllen suchen. Die allmähliche Anpassung an die gesellschaftlichen Standards führe nach CLOERKES (1984) zu einem permanenten Ambivalenzkonflikt zwischen originärer und "sozial erlaubter" Haltung beeinträchtigten Menschen gegenüber, der sich schließlich in Verhaltensunsicherheit ausdrücke. Diese Unsicherheit wird meiner Ansicht nach wesentlich dadurch verstärkt, dass Kindern auf der einen Seite negative, ablehnende Einstellungen im Rahmen ihrer Sozialisation vorgelebt werden, andererseits diesen ablehnenden Tendenzen durch soziale und gesellschaftliche Normen widersprochen wird.
Bei dem Versuch, das kindliche Erleben von Behinderung zu erklären, muss berücksichtigt werden, dass Kinder im Kindergartenalter über keinen exakten Begriff "Behinderung" verfügen. "Behinderung" wird von Kindern individuell nach Maßgabe ihres derzeitigen Entwicklungsniveaus unter Berücksichtigung der psychosozialen Vorerfahrungen unterschiedlich aufgefasst. Ohne die Zusammenhänge an dieser Stelle weiter ausführen zu können, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Aneignung des Begriffs "Behinderung" und dessen gesellschaftlich determinierte Bedeutung eng verbunden ist mit der individuellen Entwicklung des abstrakten und begrifflichen Denkens.
Für das Verständnis des kindlichen Erlebens von Beeinträchtigungen können die bereits beschriebenen Erklärungsansätze, insbesondere die soziologisch und sozialpsychologisch ausgerichteten, nur eingeschränkten Erklärungswert beanspruchen. Sie führen Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung vorwiegend auf gesellschaftliche Normen und Werte zurück und unterstellen dabei, dass ein individuelles Wertesystem bereits ausgebildet sei. Angesichts der sich gerade entwickelnden Normvorstellungen von Kindergartenkindern können diese Konzeptionen keinesfalls als alleinige Erklärungsgrundlage, sondern allenfalls als Bedingung der Ausbildung individueller Normensysteme im Spannungsfeld der sie umgebenden familiären, institutionellen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen gelten. Die kindlichen Erfahrung von Behinderung hängt neben dem erlebten Kontakt stark vom individuellen Entwicklungsniveau ab.
Auf der Basis psychologischer und psychoanalytischer Erklärungsansätze versucht KRON (1994) in ihrer Untersuchung, die kindlichen innerpsychischen Vorgänge, die in der Auseinandersetzung mit behinderten Kindern entstehen, zu beschreiben.
Die kindliche Wahrnehmung richtet sich nicht auf den gesamten Umfang einer Beeinträchtigung, sondern auf einzelne Aspekte davon. Dabei werden Aspekte, die in stärkerem Maße evident sind (vor allem motorische) eher und häufiger wahrgenommen als andere. Ihre Wahrnehmung ist dabei jedoch nicht auf die Sichtbarkeit der Einschränkungen zurückzuführen, sondern vielmehr auf die wachsende Diskrepanz zu ihrer eigenen Entwicklung. Ihre sich ständig erweiternden Fähigkeiten vor allem im motorischen und sprachlichen Bereich sind demnach stark an ihre Wahrnehmung von behinderten Kindern geknüpft. Damit sind auch die unterschiedlichen Äußerungen und Verhaltensweisen im Laufe der Kindergartenzeit erklärbar. Was sich innerhalb dieser Zeitspanne ändert, sind primär nicht die Erscheinungsformen, d.h. die Visibilität der Behinderungen, sondern die sich verändernden Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der nicht-behinderten Kinder. Auf diese muss das veränderte Erleben zurückgeführt werden.
Generell unterscheidet KRON zwischen zwei Modi der Auseinandersetzung mit den Besonderheiten behinderter Kinder: Während eine Kategorie Situationen erfasst, deren Ausgangspunkt der Auseinandersetzung die Behinderung eines Kindes selbst ist, begreift die zweite Kategorie die Art und Weise des Umgangs mit dem Kind als Auslöser der Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Kind eigene, frühere psychische Erfahrungen reaktiviert.
Die kindliche Erfahrung von Behinderung steht in einem Spannungsverhältnis zwischen alten und neuen Erfahrungen. Jüngere Kinder verarbeiten Behinderung als Variation vertrauter Ereignisse, indem sie die objektiv neue Erfahrung nach vertrauten Situationsmustern interpretieren. So würden sie den beeinträchtigten Kindern häufig Absicht unterstellen und ihnen Verantwortung für ihr Verhalten zuschreiben. Wo hingegen nicht von einer absichtlichen Handlung ausgegangen wird, bietet sich vielfach die Deutung als eine vorübergehende Beeinträchtigung als Erklärung an, was die Kinder oft aus eigenen Erfahrungen kennen (z.B. Krankheit, Unfallverletzungen etc.). Das bisher Unbekannte wird von Kindern in diesem Stadium mithin zwar wahrgenommen, jedoch nicht als fremd empfunden. Diese Phase, in denen Kinder ihre Erklärungsmuster für Behinderung unmittelbar ihrer bisherigen Erfahrungswelt entnehmen, fällt zusammen mit der Entwicklung des Zeitbegriffs. Ihre Wahrnehmung von Welt ist noch stark egozentrisch geprägt (PIAGET). Eine Zeitperspektive, die sich in Begriffen wie "immer" oder "nie" ausdrücken würde, fehlt noch.
Mit zunehmendem Zeitbewusstsein stellt sich gleichzeitig auch die größer werdende Selbstständigkeit infolge der motorischen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung ein. Die auftretende Diskrepanz der eigenen Entwicklung zu der Entwicklung der behinderten Kinder könne nun nicht mehr mit vertrauten Erklärungsmustern zureichend verarbeitet werden. Zwischen absichtsvollem Handeln und einem Handeln, das wesentlich durch gegebene Voraussetzungen bestimmt werde, lernen Kinder zu differenzieren. Die Art und Weise der Verarbeitung ihrer Erfahrungen, die im Widerspruch stehen zu ihrer bisherigen Erfahrungswelt, sind dabei höchst unterschiedlich, wobei sie von einem beginnenden Verständnis von individueller Verschiedenheit geprägt zu sein scheinen.
Bei dieser Auseinandersetzung kommt es laut KRON zudem zu einer Repräsentation eigener psychischer Anteile. Dabei könnten Kinder mit Behinderung anderen Kindern bei der Stabilisierung während der Ablösephase von primären Bezugspersonen oder bei der Gewährung von emotionaler Zuwendung behilflich sein. Die eigenen psychischen Anteile können für andere Kinder, insbesonders für Kinder, die unter starkem Leistungs- und sozial-normativen Konformitätsdruck heranwachsen, jedoch auch Anlass sein, gemäß sozial-normativer Setzungen zu handeln oder die eigenen, verdrängten Anteile von Schwäche zu entdecken.
Bei einigen dieser Prozesse könnten Wut und Aggressionen entstehen, beispielsweise wenn ein Kind die Enttäuschung über die individuell erlebte mangelnde Zuwendung auf ein (behindertes) Kind projiziere, bei dem es all die Zuwendung beobachten könne, die es für sich selbst wünscht. Bei der auftretenden Diskrepanz zwischen dem subjektiv Erlebten (das Empfinden, mangelnde emotionale Zuwendung zu erfahren) und dem idealen Selbstbild (z.B. geliebt und angenommen zu sein) könnten sich aggressive Wünsche gegen den Auslöser dieser subjektiven Erfahrung richten.
Emotionen wie Wut könnten aber auch entstehen, wenn kindliches Verhalten in starkem Maße von sozialen Normen und Konformitätsdruck geprägt sei und eigene Bedürfnisse in der Beziehung zu einem behinderten Kind keinen Platz hätten. Die Zurückstellung eigener Bedürfnisse in einer solchen Beziehung entspricht auf diesem Entwicklungsniveau einer klaren Überforderung. So könnten auch hier Aggressionen auf andere (behinderte) Kinder entstehen, die das Ausleben eigener Bedürfnisse dem subjektiven Erleben nach verwehren würden.
Generell muss, so KRON weiter, die Abgrenzung von behinderten Kindern als ein notwendiger Prozess der Bewältigung eigener Ängste verstanden werden, wobei diese Abgrenzung nicht als eine endgültige Definition der Beziehung, sondern vielmehr als ein zu diesem Zeitpunkt für die Entwicklung eines Individuums unabdingbare Notwendigkeit aufgefasst werden muss. Der Gefahr, dass dabei ein grundlegender Aussonderungsprozess angestoßen werde, könne explizit in integrativen Zusammenhängen entgegengewirkt werden, indem Kinder durch die täglich wiederkehrende Auseinandersetzung die für die Abgrenzung notwendigen Emotionen wie Angst verarbeiten können. "Angst machen also nicht die behinderten Kinder, sondern die eigenen Anteile, die im Zusammensein mit ihnen angesprochen werden (...)" (KRON 1994, 121).
In welchem Maße sie verarbeitet werden können, ist stark vom Umfeld des Kindes abhängig. Gemeint sind damit Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem Kind bedeutungsvolle Personen (Eltern, Pädagog/inn/en, andere Kinder) offenbaren, d.h. die Art und Weise, wie diese Personen sich auf Menschen mit Behinderung beziehen. Damit soll abschließend noch einmal betont werden, dass sich in der kindlichen, innerpsychischen Erfahrung und Verarbeitung von Behinderung immer auch gesellschaftlich-sozial bedingte Einflüsse wiederfinden lassen. So hängen kindliche Entwicklungen in diesem Bereich neben der modellhaften Verarbeitung anderer Subjekte insbesondere von der Internalisierung sozialer Normen und damit von dem Ausmaß ab, mit dem Kinder in ihrem Umfeld mit solchen Normvorstellungen konfrontiert werden.
Soziale Verhaltensweisen bzw. Einstellungen werden im Rahmen der Sozialisation erworben. Das bedeutet, dass Einstellungen sich stets unter den Verhältnissen der jeweiligen Gesellschaftsordnung bilden, unter denen die Heranwachsenden leben und sozialisiert werden.
"Im heute allgemein vorherrschenden Verständnis wird mit Sozialisation der Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und dinglich-materiellen Lebensbedingungen verstanden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft existieren." (K. HURRELMANN 1995, 14).
Einstellungen bilden sich somit durch Aufnahme von Information und durch aktive, sich in der materiellen und psychischen Form der Tätigkeit abspielende Auseinandersetzung mit der Umwelt. Vergegenständlichung menschlicher Wesenskräfte bedeutet dabei, sich die Existenz einer bestimmten Gesellschaftsstruktur mit ihren Besonderheiten (Klassencharakter, Institutionen, Wertesysteme, Verhaltensnormen, Einstellungen etc.) anzueignen. Die Aneignung von Welt ist in diesem Sinne die in der aktiven Auseinandersetzung mit den Sozialisationsinstanzen stattfindende Aneignung von Weltbildern.
Die bestehende Einstellungsstruktur eines Individuums bezeichnet RUBINSTEIN (vgl. SCHWARZ 1978) als "Einstellungshintergrund". Die vorhandenen Einstellungen, also die inneren Bedingungen, brechen laut RUBINSTEIN die äußeren Einflüsse. Generell sind Einstellungsstrukturen am stabilsten, wenn die vorhandenen Einstellungen von einem Individuum als persönlich bedeutsam erlebt werden. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn Menschen ihre Einstellung in tätiger Auseinandersetzung, in einem kooperativen und dialogischen Miteinander und unter Herausbildung von entsprechenden Sinn- und Bindungsstrukturen erwerben konnten.
Aus der Sozialisationsforschung ist bekannt, dass gesellschaftliche Strukturen indirekt (über vermittelnde Sozialisatoren) auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen einwirken[15]. Dass die sozialen Umweltbedingungen, z.B. Interaktions- und Kommunikationsstile primärer und sekundärer Sozialisationsinstanzen (Eltern, Kindergartengruppe, Schulklasse), abhängig sind von der jeweiligen gesellschaftlichen Einbindung, ist deutlich. Genauso trifft dies indes auch für die physisch-materiellen Umweltbedingungen zu: Spielzeug, Wohnort, Spielplatz etc. Die gesamte materielle Umwelt befindet sich in keinem natürlichen Urzustand, sondern ist stets gesellschaftlich geformt. TILLMANN (1989, 11) hält dazu fest:
"Alle sozialen und materiellen Umweltfaktoren sind somit gesellschaftlich beeinflusst, sie alle können als Bedingungen des Sozialisationsprozesses Bedeutung erlangen."
Das Modelllernen scheint für die Ausbildung der sozialen Einstellungen bei Kindern von entscheidender Bedeutung zu sein. Über die Erwartungshaltung der Umwelt sowie über die vorgelebten Beziehungen in der Umgebung internalisiert das Subjekt schließlich die Struktur der gesellschaftlichen Verhältnisse. Unbewusste Nachahmung oder bewusste Imitation setzen "die Gegenwart von mindestens zwei Personen - Modell und Beobachter - voraus; dabei kann die Gegenwart des Modells auch medial vermittelt sein" (ebd., 77). Medien allgemein bzw. Kinder- und Jugendliteratur im speziellen können gemeinhin auch als Sozialisatoren, also als Mittler menschlicher Kommunikation, wirken. Welche Menschenbilder in Kinder- und Jugendbüchern als Träger von (verdeckten) Einstellungen existent sind und inwieweit sie der gesamtgesellschaftlichen (offenen) Einstellungsstruktur ent- oder widersprechen, soll im folgenden Teil herausgearbeitet werden.
Kind: Behinderte sind Mißgeburten.
Franz: Was ist eine Mißgeburt? Wenn jemand behindert ist?
Lehrerin: Das Kind meint es nicht so. Es war im Haus der Natur. Dort hat es konservierte Mißgeburten gesehen.
Franz: Ist Margit in meinem Buch eine Mißgeburt?
Kind: Ja, Alle Behinderten sind Mißgeburten.
(aus: FRANZ-JOSEPH HUAINIGG:
"Was hat`n der? Kinder über Behinderte."
Klagenfurt 1993, S. 59)
[1] Die originalen englischsprachigen Begriffe der WHO sind bei der Adaptation durch die deutschsprachige Fachwelt von unterschiedlichen Autoren unterschiedlich übersetzt worden. Ich habe daher die originalen Begriffe sowie mehrere mir bekannte Übersetzungen angeführt.
[2] Diese Irrelevanz wird ebenso augenscheinlich im Hinblick auf bauliche Infrastrukturen, bei denen etwaige Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung noch immer nicht ausreichend wahrgenommen werden.
[3] HAMBURGER (1985, 55ff) bietet einige (u.a. historische) Aspekte, die es erlauben, Mitleid als Folge von Angstempfinden zu verstehen. So kann Mitleid seine Wurzeln in der Furcht haben, das Übel des anderen könne einen selbst treffen. Die an sich altruistische Regung verkehrt sich in seinen offenbaren Gegensatz. Nach HOBBES wird die altruistische Haltung durch eine egoistische ersetzt. ROUSSEAU versucht in "Emile" eine Erklärung des Mitleids, nach der man bei anderen nur die Übel beklagt, vor denen man selbst nicht gefeit ist. Daher sei die Mitleidslosigkeit einiger daraus zu schließen, dass es sich dabei um Personen handele, die das Übel anderer nicht zu fürchten brauchen (z.B. Reiche - Arme). Nach ARISTOTELES, dem Begründer der Furchttheorie des Mitleids, entstehe Mitleid nur, wenn einer, der es nicht verdient, in Unglück gerät. Wenn ein Gleicher oder Ähnlicher in Unglück gerät, löse dies Furcht aus, weil es sich bei ihm um einen Menschen handele, der wie wir alle sei.
[4] Dieser Mechanismus kommt m.E. deutlich im sog. "Flensburger Urteil" zum Ausdruck: "Der unausweichliche Anblick der Behinderten auf engem Raum bei jeder Mahlzeit verursachte Ekel und erinnerte ständig in einem ungewöhnlichem Maße an die Möglichkeiten menschlichen Leidens." (vgl. z.B. die randschau 5/92, S. 3). Das beeinträchtigte Wohlbefinden der Kläger wird hier von der bundesdeutschen Judikative in die beeinträchtigten Personen projiziert und als Ausdrucksform menschlichen Leidens aufgefasst.
[5] FRüHAUF / NIEHOFF (1994) stellen auch die Widersprüchlichkeit der Entwicklung heraus: Auf der einen Seite sich mehrende Übergriffe auf beeinträchtigte Personen und Lebensrechtdiskussion, auf der anderen Seite Entwicklungen wie der Integration oder der Schaffung eines Antidiskriminierungsgesetzes. Sie stellen diese Entwicklungen in den Kontext eines Kosten-Nutzen-Denkens: Engagemant für sich artikulierende (mithin in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weit vorangeschrittene und somit ihre Arbeitskraft betreffend eher verwertbare) beeinträchtigte Menschen vs. Kürzung von Sozialleistungen und bewusste Ablehnung gegenüber schwerer beeinträchtigter Menschen. Möglich wäre indes auch eine Interpretation einer Thesen-Antithesen-Beziehung: Bewegung erzeugt Gegenbewegung, zwei gegensätzliche Strömungen entwickeln sich.
[6] Laut GERAEDTS / ZUPER (1990) sei unter negativer Eugenik die Vermeidung von unerwünschten Phänomen im Gegensatz zur positiven Eugenik, die die Züchtung bestimmter Menschentypen, -rassen etc. beschreibt, zu verstehen
[7] vgl. dazu z.B. die Ausführungen in einem der EG-Kommission 1989 vorgelegten - und "vorläufig eingefrorenen" Forschungsvorhaben (vgl. NIEHOFF 1990, 93f): Es gelte "Personen vor Krankheiten zu schützen, für die sie von der genet. Struktur her äußerst anfällig sind und ggf. die Weitergabe der genetischen Disponiertheit an die folgende Generation zu verhindern. Da es unwahrscheinlich ist, daß wir in der Lage sein werden, die umweltbedingten Risikofaktoren vollständig auszuschalten, ist es wichtig, daß wir soviel wie möglich über Faktoren der genetischen Prä-Dispostion lernen und somit stark gefährdete Personen identifizieren können". Auf welche Weise die Weitergabe der genetischen Disponiertheit verhindert werden soll, wird nicht ausgeführt.
[8] Vorsichtige Schätzungen gehen heute von etwa jährlich 1200 beeinträchtigten Neugeborenen aus, die in bundesdeutschen Krankenhäusern "liegengelassen" werden. (vgl. FRüHAUF / NIEHOFF 1994, 63). Siehe dazu auch die 1986 erschienene "Einbecker Empfehlung" (vgl FEUSER 1995, 54f), in der zu der Schlußfolgerung gekommen wird, dass die Einschränkung der ärztlichen Behandlungspflicht u.a. auch dann als gegeben angesehen werden kann, wenn es "trotz der Behandlung ausgeschlossen ist, dass das Neugeborene jemals die Fähigkeit zur Kommunikation mit der Umwelt erlangt", wobei vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem medizinischen (vgl. z.B. die Arbeiten von ZIEGER, BERGER u.a.) wie auch aus dem nicht-medizinischen Bereich (lern-, kommunikations- und systemtheoretische Ansätze) nicht zur Kenntnis genommen werden. Das Nicht-Erlangen der Fähigkeit zur Kommunikation ist nach heutigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand einem sich selbstorganisierend-lebendigem System bereits auf Einzeller-Niveau (!) nicht mehr möglich. [Der Vollständigkeit halber ist zu sagen, dass sich in der inzwischen vorliegenden revidierten Fassung der "Einbecker Empfehlung" von 1992 dieser Passus nicht mehr finden lässt. Vielmehr wird davon gesprochen, dass "der Umstand, daß dem Neugeborenen ein Leben mit Behinderungen bevorsteht, [...] es nicht [rechtfertigt], lebenserhaltende Maßnahmen zu unterlassen oder abzubrechen." (Kopie der revidierten Fassung liegt mir vor; Veröffentlichungsquelle ist jedoch nicht bekannt). Ob sich nun wirklich die Auffassungen der Unterzeichner/innen geändert haben, oder ob die revidierte Fassung lediglich eine formal veränderte, auf höhere gesellschaftliche Akzeptanz abzielende Korrektur darstellt, erscheint zumindest fraglich. So wird an anderer Stelle ausgesagt, dass "das Prinzip der verantwortungsvollen Einzelfallentscheidung nach sorgfältiger Abwägung" nicht aufgegeben werden darf, wobei im Einzelfall keine absolute Verpflichtung zu lebensverlängernden Maßnahmen besteht.]. Auch auf der Basis des Europäischen Parlaments werden solche Gedanken kundgetan (und hier sogar ohne jeglichen Begründungsnachweis, sondern lediglich auf der Basis fadenscheinig anmutender Annahmen zum »Lebenswert« eines Menschen). In einem 1988 vorgelegten (und später vorläufig gestoppten) Gesetzentwurf zur "Verringerung der Zahl anormaler Kinder" sollte es in Artikel 1 heißen: "Ein Arzt begeht weder ein Verbrechen noch ein Vergehen, wenn er einem Kind von weniger als 3 Tagen die zum Überleben notwendige Pflege verweigert, wenn dieses Kind ein unheilbares Gebrechen aufweist, derart, dass man voraussetzen kann, dass es niemals ein lebenswertes Leben führen können wird." (zit. n. BLEIDICK 1990, 516.). Zu weiteren Beispielen. z.B. in bezug auf prädiktive Medizin und eugenischen Denkens innerhalb der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vgl. BLEIDICK 1995.
[9] FREDI SAAL beschreibt den innerpsychischen Vorgang dieser Entmenschung so: "Natürlich fiele es schwer, einen Menschen gleichgültig in eine Abtötungsmaschine geraten zu lassen, hätte man eine enge Beziehung zu ihm, die mich selbst im Mitmenschen widerspiegelte. Solange ich mich im anderen mitsehe, bin ich gehindert, ihn ernstlich um sein Leben zu bringen. Darum werden ihm alle humanen Attribute abgesprochen. Er wird ein Gegenstand, dem man auch mit innerlich unbeteiligten Eingriffen zu Leibe rücken kann. [...] Die Bereitschaft zum »Totmachen« und Töten erfordert dabei die Entpersonalisierung eines Individuums und seine Degradierung zum bloßen Objekt, mit dem sich emotionslos wie mit einem zu entsorgenden Abfallprodukt hantieren läßt." (SAAL, FREDI: "Euthanasie" - eine schleichende Infizierung der Gesellschaft mit dem Selbstmordbazillos. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 3/1992, Seite 51-55. Zit.n. FRüHAUF / NIEHOFF 1994, 68).
[10] Der englische Ökonom Thomas Robert MALTHUS († 1834) stellte zu Beginn des 19. Jh. sein Malthusisches Bevölkerungsgesetz auf. Seiner Theorie nach erfolge das Wachstum der Bevölkerung in geometrischer Progression, die Nahrungsmittelproduktion jedoch nur in arithmetischer Reihe. Die Folge wäre eine zunehmende Verknappung von Lebensmitteln und eine zunehmende Verelendung. Die politische Konsequenz, die Anhänger dieser Theorie formulierten, müsse daher eine radikale Geburtenbeschränkung sein. Der Malthusianismus wird auch als Vorentwicklung bzw. als Baustein zum sich später entwickelnden Sozialdarwinismus bezeichnet.
[11] Unter dem Utilitarismus wird die etwa 1850 auf der Basis von ARISTOTELES (also aus dem Idealismus heraus) entwickelte philosophische Ausrichtung des Nützlichkeitsdenkens verstanden, dessen ethische Lehre davon ausgeht, dass der Zweck sittlichen Handelns der Menschen darin zu sehen sei, zum Glück beizutragen und somit nützlich zu sein. Zu unterscheiden sind dabei die Summe des Glücks aller und die Summe des Glücks für den Einzelnen. SINGER begreift den Präferenz-Utilitarismus als Maxime der maximalen Befriedigung von Präferenzen, die es gegeneinander abzuwegen gelte. THEUNISSEN (1990) stellt dar, dass die Wurzeln des utilitaristischen Lebensprinzips zurückreichen bis in die feudalistische Ideologie (vgl. dazu auch JANTZEN z.B. 1974). Der Mittelklassestandard der Nützlichkeit bildete sich aus. In kapital-orientierten Systemen müsse sich ein Händler oder Produzent bei der Bewertung von Folgen eigener Handlungen mithin nicht an moralischen Vorstellungen, sondern an rationalen Maßstäben (Kalkulation) der Verwertbarkeit orientieren. Randgruppen wie z.B. Menschen mit schweren Beeinträchtigungen sind als Arbeitskräfte minderer Güte aus der Sicht des Ulitarismus nicht verwertbar. Folglich hänge ihr Schicksal davon ab, was die Gesellschaft bereit sei, für die Fürsorge dieser Personen zu investieren, wobei ökonomische Krisensituationen die Situation von Menschen mit Behinderung zwangsläufig verschärfen.
[12] vgl. die Gegenüberstellung von SINGER und BINDING / HOCHE im Anhang.
[13] Dabei muß beachtet werden, dass es nicht möglich ist, innerhalb von Integrationsklassen, die ja im Prinzip (je nach Modell in unterschiedlichem Maße) durch das Nichtbestehen von Ausschluss- und Aussonderungsfaktoren charakterisiert sind, behinderte Schüler/innen als eine eigenständige Gruppe zu fassen und zu Untersuchungszwecken zu isolieren. Die Überschneidungsflächen mit anderen Variablen als "Behinderung" sind vielfältig, weswegen alle aufzuführenden Ergebnisse eher als tendenzielle Ausrichtung verstanden werden müssen. Generell scheinen solche Daten stark abhängig zu sein vom jeweiligen Aufbau des Schulmodells, in dem die Erhebung vollzogen wird. Zur Erfassung des wahren Gehaltes solcher Untersuchungen kommt es darauf an, zu berücksichtigen, in welchem Maße die selektierenden und segregierenden Bedingungen des heutigen Erziehungs- und Bildungswesens ausgeschaltet wurden. Die Ausschaltung dieser Bedingungen ist nicht in allen als "integrativ" plakatierten Schulmodellen gegeben. Sie ist in der vollständigen Form eher die Ausnahme (vgl. FEUSER 1995).
[14] Studien, die sich mit der gesellschaftlichen Lebenssituation von Frauen mit Behinderungen auseinandersetzen (SCHILDMANN 1983, EWINKEL / HERMES 1985, BARWIG / BUSCH 1993, ARNADE 1992, FRSIKE 1995) kommen zu dem Schluss, dass Frauen mit Behinderungen gesellschaftlich doppelt benachteiligt würden: zum einen als Frau, zum anderen als Mensch mit einer Behinderung. Die dieser Benachteiligung zugrunde liegenden hierarchischen Strukturen (geschlechtsspezifische und behinderungsspezifische) ließen sich ergänzen durch die kulturelle Herkunft, so dass letztendlich das schwarze Mädchen / die schwarze Frau mit einer Behinderung am unteren Ende dieser etablierten Hierarchien wiederzufinden ist. So verwundert es nicht, dass trotz eines relativ hohen Anteils von Sonderschüler/innen nicht-deutscher Herkunft so gut wie keine ausländischen Mädchen mit einer Behinderung in Integrationsklassen zu finden sind. (vgl. SCHöLER 1993).
[15] Für das subjektive Erleben von Behinderung hält Kron (1994) fest, dass Vorgänge auf interpersoneller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene maßgeblich die Vorgänge der innerpsychischen Ebene beeinflussen, d.h. die Art und Weise, wie Behinderungen anderer Menschen subjektiv verarbeitet werden. Umgekehrt würden jedoch die Vorgänge auf psychischer Ebene alle anderen Ebenen beeinflussen, da auf diesen Ebenen Menschen agieren, deren psychische Widerspiegelung entscheidend sein dürfte für die Ausprägung der sie umgebenen Bereiche. Integration als veränderte Struktur der interpersonellen, institutionellen und gesellschaftlichen Ebene könne also Vorgänge der innerpsychischen Ebene jedes in die integrativen Prozesse eingebundenen Individuums maßgeblich verändern, wobei es, eine große Verbreitung der integrativen Prozesse vorausgesetzt, anzunehmen sei, dass diese Veränderungen zu Veränderungen aller sonstigen Ebenen führen werden.
Subjekt und Gesellschaft stehen mithin in einem sich gegenseitig beeinflussenden Wechselverhältnis, dabei bleibe die Gesellschaft jedoch stets das führende und bestimmende Moment. Geulen / Hurrelmann (1980, angef. n. Tillmann 1989) haben ein "Strukturmodell der Sozialisationsbedingungen" vorgelegt (vgl. Tillmann 1989, 18), das vier Bedingungsebenen der Subjektentwicklung aufzeigt. Tillmann (ebd., 17) schreibt dazu: "Strukturen und Abläufe der unteren Ebene wirken immer auch auf die nächsthöhere zurück und können dort Veränderungen bewirken. Auf diese Weise sind Prozesse der gesellschaftlichen Makroebene (gesamtgesellschaftliche Strukturen, Institutionen) mit Prozessen der Mikroebene (Interaktion, Subjektentwicklung) verknüpft."
Inhaltsverzeichnis
- 6. Begriffsbestimmung
- 7. Historischer Abriss der literalen Darstellung von Behinderung
-
8. Das Thema "Behinderung" in der Kinder- und Jugendliteratur
- 8.1 Verteilungshäufigkeit von Behinderungsformen: Kinder- und Jugendliteratur vs. Realität
- 8.2 Das Behinderten-Bild: Visualisierung von Behinderung
- 8.3 Prinzipien der Darstellung einiger Behinderungsformen
- 8.4 Darstellung der behinderten Person: Strukturelle "Strickmuster"
- 8.5 Literarische Umgangsformen mit "Behinderung"
- 8.6 Darstellung von gesellschaftlichen Reaktionen auf behinderte Personen
- 9. Ergebnisse der medienbezogenen Wirkungsforschung
- 10. Schlussbetrachtung
Unter Kinder- und Jugendliteratur ist Literatur, die speziell für Kinder und Jugendliche geschrieben wird, zu verstehen. Historisch betrachtet reichen ihre Wurzeln zurück bis ins späte Mittelalter, wobei Kinder- und Jugendliteratur immer im Kontext des historischen Verständnisses von "Kindheit" und "Jugend" verstanden werden muss. Kindheit bzw. Jugend galten im Mittelalter als Vorbereitungsphasen auf das Erwachsenenalter. Entsprechend dienten die zu lesenden Texte ausschließlich belehrenden Zwecken. Kinder nahmen zudem am Literalisierungsprozess der Erwachsenen teil.
Die Anfänge der modernen Kinder- und Jugendliteratur sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fixierbar (DAHRENDORF 1980). Mit der Epoche der Aufklärung, die eng mit dem Namen ROUSSEAU verbunden ist, bildete sich nicht nur der Begriff "Kindheit", wie er heute gebraucht wird, aus, sondern auch die Kinder- und Jugendliteratur als eigenständiger Literaturzweig. In den folgenden Jahrzehnten der Romantik gewannen Kinderreime, Sagen, Legenden etc. an Einfluss. Die Romantik wandte sich mit ihrer Betonung von Gefühlen gegen die Aufklärung. Deutlich wird, dass gesellschaftliche Epochen auch in der Kinder- und Jugendliteratur Niederschlag finden, so auch etwa 100 Jahre später, in der nationalsozialistischen Zeit.
Bei der Betrachtung der Entwicklung der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden drei aufeinanderfolgende Phasen unterschieden (TABBERT 1986):
-
1950 - ca. 1965: Restaurative Phase: Die Suche nach Ordnung drückte sich in der Darstellung einer heilen Welt / eines Schonraums, bei gleichzeitigem Erziehungsziel des Gehorsams, aus. Die eigene Kindheit wurde von vielen Autor/innen reproduziert, Kinder wurden nicht in der Weise dargestellt, wie sie waren, sondern wie sie gewünscht wurden, dass sie seien.
-
ca. 1965 - ca. 1980: Oppositionelle Phase: Statt einer heilen Welt wurden nun zunehmend Probleme der Gesellschaft, die sich im Erlebnishorizont des Kindes befanden, dargestellt. Deutlich wurde dabei stets, dass auch Kinder an der Veränderung einer Gesellschaft beteiligt sind.
-
ca. 1980 - heute: Emotionale Phase: Etwa mit dem bundesdeutschen Regierungswechsel drückte sich die gesellschaftliche Veränderung auch in der Kinder- und Jugendliteratur aus. Der Blick wurde zunehmend auf das Kind gelenkt bzw. auf das Innere des Kindes. Kinder sollten sich in einem Buch wiederentdecken, sich einfühlen können, wobei Einfühlung wichtiger erschien als Einsicht. Die aufklärerische Betrachtung wurde weitgehend zurückgenommen.
Die geschilderte Entwicklung beschreibt in ihrer knappen Darstellung selbstverständlich lediglich eine Tendenz und besitzt keine Allgemeingültigkeit.
Zusammenfassend kann präzisiert werden, dass Kinder- und Jugendliteratur
-
sowohl in Gattungen wie Romane (Unterteilt in Epik, Dramatik, Lyrik etc.) als auch in Form von Sach- und Fachbüchern vertreten ist, wobei Romane wiederum unterteilt werden in verschiedene Genres, von denen vor allem die realistische von der phantastischen Erzählung zu unterscheiden ist;
-
unterschieden wird in Bilderbücher (für Kinder in der präliteralen Phase, d.h. ohne Lesekenntnisse), Kinderbücher (als Gattung für Jungen und Mädchen vom ersten Lesealter bis etwa zehn / zwölf Jahre) und Jugendbücher (konzipiert für Heranwachsende vom zwölften Lebensjahr an);
-
abhängt ist von drei raum-zeitlichen Bedingungsfaktoren: dem Kindheitsbild einer Zeit, dem Kindheitsbild einer Kultur und dem Bild von der eigenen Kindheit;
-
heute in Prinzip zwei Hauptfunktionen wahrnehmen will: die Erziehung zur Literatur (im Sinne von Einführung in Literatur als Prozess der Literalisierung) sowie die Erziehung durch Literatur (durch Vermittlung von Kenntnissen und Normen sowie durch Anbieten modellhafter Konfliktlösestrategien als Teil einer Hilfe zur Lebensbewältigung) (DAHRENDORF 1980).
Besonders die Vermittlung von Normen in Anlehnung an eine Orientierung an historisch-konkrete Gesellschaftstrukturen ist es, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit von Interesse scheint. Dabei wird der überwiegende Teil der heutigen Kinder- und Jugendliteratur, der sich mit Behinderung bzw. dessen Trägern auseinandersetzt, der problemorientierten, realistischen Erzählung zugerechnet. Diese versucht, in erzählerischer Weise die Widersprüchlichkeit der Realität kindgerecht abzubilden. "Das problemorientierte Kinderbuch will ganz bewußt Wirklichkeitserfahrungen vermitteln, bezieht sich dabei aber auf Situationen und Verhältnisse, die Komplikationen enthalten (...). Im Grunde genommen handelt es sich um Konfliktliteratur" (SAHR 1987, V).
Die realistischen, problemorientierten Erzählungen, werden ergänzt durch Sachbücher, die beispielsweise den Tagesablauf eines beeinträchtigten Kindes beschreiben, sowie selten durch phantastische Erzählungen. Märchen und Comics stellen besondere Gattungen dar, die im Verlauf dieser Arbeit nur am Rande Beachtung finden werden.
Die Darstellung von Menschen mit Behinderung lässt sich über die Zeit der eigentlichen Kinder- und Jugendliteratur hinaus zurückverfolgen. Dies erscheint deshalb interessant, da diese alte Literatur zum einen als historischer Vorläufer der heutigen Literatur zu betrachten ist und zum anderen Literatur zu allen Zeiten - so RADTKE (1982) - ein (wenn auch gebrochenes) Abbild der jeweiligen Situation behinderter Menschen darstellte, wobei die literarische Verarbeitung von "Behinderung" wesentlich von den literarischen Strömungen einer Epoche und damit auch von den historisch-gesellschaftlichen Gegebenheiten einer Zeit bestimmt war.
In der griechischen Mythologie beispielsweise galt Blindheit als die schwerste Strafe, die die Götter über die Menschen verhängen konnten. Doch selbst die Götter empfanden diese Strafe als derart furchtbar, dass sie den betroffenen Personen zum Ausgleich übermenschliche Kräfte schenkten. Geheimnisvolle Kräfte werden auch in der nordischen Mythologie bzw. der germanischen Sagenwelt verwandt. Hier sind vor allem Krüppel und Bucklige Träger eben dieser Kräfte (ZIMMERMANN 1982).
Der Gedanke der überirdischen Fähigkeiten ist der altjüdischen Mythologie fremd. Sie attribuiert blinden Menschen in erster Linie Hilflosigkeit und verbindet dies mit der Auffassung der sozialen Nutzlosigkeit. Dem entspricht, dass in der hebräischen wie übrigens auch in der ägyptischen Kultur die meisten Blinden Bettler waren.
In der Bibel finden neben Blinden auch Taubstumme und Gelähmte Erwähnung. Während im Alten Testament Behinderung oft als Strafe Gottes für begangenes Unrecht aufgefasst wird, nutzt das Neue Testament die Wunderheilungen Jesus´, um sein göttliches Wirken zu offenbaren, wobei der Sündengedanke ausdrücklich abgelehnt wird.
Die Darstellung behinderter Menschen während des Mittelalters kann an dieser Stelle nicht ausreichend differenziert ausgeführt werden. In Fabeln, Sprichwörtern wie auch in Schelmenromanen und in Schwänken wurden in dieser Zeit behinderte Menschen in unterschiedlicher Weise dargestellt (ZIMMERMANN 1982, UTHER 1981), wobei sich die dort zum ersten Mal beobachtete Gebrestenkomik in veränderter Form (sog. "Behindertenwitze") bis heute erhalten hat. Die allgemein-literarische Darstellung von Menschen mit Behinderung (vgl. ebd.) soll an dieser Stelle verkürzt werden auf die Darstellung in Texten, die sich an Kinder wenden.
Märchen gelten dabei als ein Genre, das ursprünglich für erwachsene Rezipienten konzipiert war und sich erst allmählich in Richtung einer Kindheitsliteratur entwickelte. In ihnen wurde die Figur eines behinderten Menschen zur Verdeutlichung bestimmter Charakteristiken relativ häufig verwendet, wobei diese Rollenverteilung als stereotyp angesehen werden kann. Den buckligen oder blinden Bösewichten standen laut LüTHI (vgl ebd., 65) jedoch viel häufigere positive Darstellungen gegenüber, in denen behinderte Personen ihre moralische Kraft besonders entfalten.
In der frühen Kinder- und Jugenderzählung (im 19. Jahrhundert) kamen behinderte Protagonisten dagegen eher selten vor (R. KAGELMANN 1984). Wenn sie auftraten, wurden sie als ungewöhnlich geduldige, tapfere und selbstlose Menschen dargestellt. Mit der Zunahme der sogenannten realistischen Kinderbücher zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der Darstellungen zu. Die Schilderungen sogenannter realer Lebensumstände wurden jedoch von unrealistischen Happy-End-Lösungen begleitet. Mit den allgemeinen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg bezüglich der Auffassungen von Kindheit, Kinder- und Jugendliteratur sowie deren Aufgaben und Funktionen fand neben anderen ehemals tabuisierten Themen, die im "Schonraum Kindheit" nicht thematisiert wurden, auch Behinderung bzw. die Lebensumstände von Menschen mit Behinderung allmählich zunehmende Beachtung. Diese Entwicklung setzte sich fort in der unterschiedlichen Darstellung von Behinderung: Abgesehen vom historisch-konkreten Kontext, in dem Behinderung unterschiedlich definiert wurde, waren es in den frühen Erzählungen (in der Restaurativen Phase) fast ausschließlich körperbehinderte und blinde Menschen, die dargestellt wurden. Die Darstellung von geistig behinderten Menschen erfolgte weitestgehend erst Anfang der 70er Jahre (Oppositionelle Phase). Die zunehmende Darstellung dieser auch in der Realität am längsten und am stärksten von der gesellschaftlichen Teilhabe isolierten Menschen wird als Reaktion auf die zunehmende öffentliche Beachtung dieser Menschen gewertet. Seit dem Ende dieser literalen Epoche wurden auch vereinzelt psychische Beeinträchtigungen in Kinder- und Jugendbüchern thematisiert.
Worte und Bilder bestimmen unser Denken. Manchmal geben sie Hoffnung. Entscheidend ist, daß sie uns helfen zu lernen. Was wir zu lernen haben, ist so schwer und doch so einfach und klar: Es ist normal, verschieden zu sein.
RICHARD V. WEIZSäCKER
Die umfangreichen Untersuchungen von AMMAN / BACKOFEN / KLATTENHOFF (1987) und ZIMMERMANN (1982) kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die quantitative Darstellung einzelner Behinderungsformen in der Kinder- und Jugendliteratur ein großes Übergewicht der Körperbehinderungen erkennen lassen. Diese werden mit deutlichem Abstand gefolgt von den Sehbeeinträchtigungen und den geistigen Behinderungen. Menschen mit Sprach- oder Hörbehinderungen werden dagegen seltener erwähnt. Lernbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychische Beeinträchtigungen und andere Behinderungsarten tauchen in der Kinder- und Jugendliteratur nur vereinzelt auf.
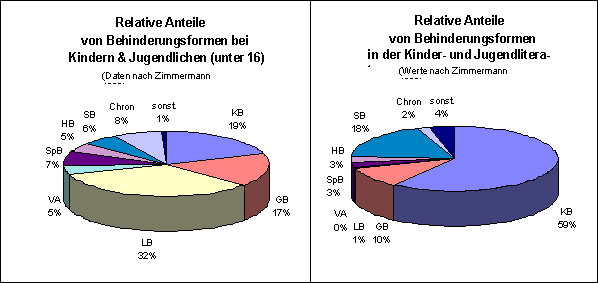
Abb.2: Relative Anteile von Behinderungsformen bei Kindern & Jugendliche (unter 16) und Relative Anteile von Behinderungsformen in der Kinder- und Jugendliteratrur.
|
Behinderungsform |
Realität |
Kinder- und Jugendliteratur |
|
|
Körperbehinderungen |
KB |
19,6 |
60,0 |
|
Geistige Behinderungen |
GB |
16,8 |
10,0 |
|
Lernbehinderungen (incl. LRS) |
LB |
33,4 |
0,5 |
|
Verhaltensauffälligkeiten |
VA |
4,7 |
0,0 |
|
Sprachbehinderungen |
SpB |
6,6 |
2,7 |
|
Hörbehinderungen |
HB |
4,6 |
3,2 |
|
Sehbehinderungen |
SB |
6,0 |
17,7 |
|
Chron. Kranke & Anfallsleiden |
Chron. |
7,6 |
1,9 |
|
sonstige |
Sonst. |
0,7 |
4,0 |
|
Gesamt |
110,0 |
100,0 |
Die Darstellung von Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur entspricht quantitativ in keiner Weise den realen Gegebenheiten. Sie stellt kein repräsentatives Abbild der Verteilung in der Realität dar, sondern orientiert sich an medialen Bedingungen
Die Gründe für die Bevorzugung einzelner Behinderungsformen dürften im gesellschaftlichen Verständnis von Behinderung liegen, nach dem Beeinträchtigungen in erster Linie anhand von Visibilität und funktionalen Kommunikationsproblemen markiert werden. Zudem lassen sich evidente Beeinträchtigungen sowohl in Schrift als auch im Bild leichter darstellen als andere.
Die Abbildung einzelner Behinderungsformen folgt dem in den sozialpsychologischen Untersuchungen festgestellten Grundsatz, dass je schwerer eine Beeinträchtigung sei, desto leichter die Kategorisierung erscheint. Durch höhere Schulanforderungen erst beobachtbare "Behinderungen des Lernens" werden zum einen gesellschaftlich nur bedingt als Behinderung begriffen und lassen sich zum anderen in Kinder- und Jugendbüchern schwerer darstellen als Behinderungsformen, dessen Schwere oder Visibilität eine bestimmte Kategorisierung impliziert.
Blindheit gilt laut der Sozialpsychologie neben der geistigen Behinderung als eine der Beeinträchtigungen, die gesellschaftlich als besonders schwere Beeinträchtigungen aufgefasst werden. Gleichzeitig werden blinden Menschen - den Untersuchungen entsprechend - eine große soziale Akzeptanz entgegengebracht. Dies kann als ein Interpretationsmodell für die überrepräsentative Darstellung von blinden Menschen in der Kinder- und Jugendliteratur verstanden werden. Die verstärkte Darstellung von sozial akzeptierten Beeinträchtigungen bei weitgehender Negierung anderer Beeinträchtigungen macht die soziale Distanz von Kinder- und Jugendbuchautor/innen zu bestimmten Formen von Behinderungen (bzw. deren Trägern) deutlich.
Nach THIMM (in: AMMAN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987, 9-12) ist es angesichts der zahlenmäßigen Überrepräsentanz einzelner Behinderungsformen zudem denkbar, dass Körperbehinderungen und vor allem Blindheit noch immer den Reiz des "Andersartigen", des "Heroischen" ausmache, das mit "geheimnisvollen, übernatürlichen Begabungen" verbunden sei, und deshalb als beliebter literarischer Inhalt herhalten müsse.
Die Visibilität einer Beeinträchtigung gilt den Ergebnissen der Einstellungsforschung zufolge als bedeutendste Determinante der Sozialen Reaktion. Die visuelle Darstellung von Kindern mit Behinderung in Kinder- und Jugendbüchern orientiert sich an diesem Grundsatz: Eine eindeutige Darstellung erleichtert die Kategorisierung.
Bild und Text eines Buches können einander unterstützen oder sich auch widersprechen. Bilder sollten im Idealfall die Botschaft des Textes steigern, sie eignen sich jedoch auch dazu, eine geschilderte, problematische Wirklichkeit durch freundliche, niedliche Bilder zurückzunehmen.
Die Fokussierung des Blickwinkels auf bestimmte Elemente menschlicher Erscheinungsformen erscheint insofern schwierig, als dass beim Betrachten des Bildes nicht der Mensch oder sein Erleben, sondern einzig und allein seine von der Norm abweichende optische Erscheinung im Mittelpunkt der Betrachtung steht.

Abb.3: Beispiel Down-Syndrom Tveit 1991

Abb.4: Beispiel FLEMING / COOPER 1998
Das in Bilderbüchern oft verwendete Kindchenschema (übergroßer Kopf, Kulleraugen, kleiner Mund) lässt in Verbindung mit anderen Klischees (übergroße Hornbrille etc.) ein behindertes Kind als schwach erscheinen. Eine solche Darstellung appelliert auf einer vordergründigen, visuellen Ebene an den Pflege- und Schutztrieb der Leser/innen (HUMBERT in: AMMAN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987, 74ff).

Abb.5: Beispiel: "Dann kroch Martin durch den Zaun", DESMAROWITZ 1979
Der Bilderbuch-Martin - von KRENZER (1981) ironisch als Universal-Behinderter bezeichnet - soll offensichtlich emotional betroffen machen und an den Pflege- und Schutztrieb der Leser/innen appellieren.
Damit er so recht armselig wirkt, müssen alle nur erdenklichen Behinderungen auf ihn einwirken: Geistige Behinderung, Motorische Behinderung, Sprachbehinderung (Stottern), Sehbehinderung. Der "krumme dumme Martin" kann schlecht laufen, schlecht sprechen, er hält den Kopf schief, hinter dicken Brillengläsern wirken die Augen riesig. "Martin sieht wirklich anders aus: Sein Mund steht meistens offen und auf der Unterlippe glänzt ein Speicheltropfen."
Verstärkt wird die Personenbeschreibung durch die Beschreibung der Interaktionen von Martin mit seiner Umwelt: Von den anderen Kindern wird er gehänselt, von Erwachsenen als behindert abgestempelt. Martin scheint gesellschaftlich hochgradig isoliert.
Doch auch ohne die schriftsprachlich codierten Informationen des Textes gelingt es der Autorin anhand nur einer einzigen Darstellung, ihren Protagonisten auf der visuellen Ebene für die Rezipient/innen so schutzbedürftig wie nur irgend möglich darzustellen, um an das Mitleid der Leser/innen zu appellieren.
(rtf-Version, ohne Bild)
In dem beschriebenen Beispiel handelt es sich eindeutig nicht um die Zurücknahme einer gesellschaftlichen Wirklichkeit durch "niedliche" Bilder. Dieses Buch ist ein Beispiel für eine Kompatibilität von Bild und Text: Beide Botschaftsebenen unterstützen sich gegenseitig. In guter Absicht hat hier eine Autorin versucht, Emotionalität (Mitleid) für behinderte Personen zu wecken. Für diesen Zweck bedient sie sich neben der angesprochenen Visualisierung mehrerer linearer Denkmuster, die ich etwas später unter dem Begriff "Strukturelle Strickmuster" aufzeigen werde. Zu vermuten wäre, dass die Einstellung der Autorin wesentlich auf Mitleid gegenüber behinderten Menschen basiert. Dabei kann sie als Repräsentantin des überwiegenden Teils unserer Gesellschaft gelten: Laut VON BRACKEN (1976) empfanden 98,6% aller Respondenten seiner Studie Mitleid gegenüber einem Kind mit einer geistigen Behinderung. Dass Mitleid gegenüber behinderten Personen eine Form eigenen, projizierten Leids darstellen kann und dabei stark isolierend wirkt, wurde im ersten Teil der Arbeit bereits deutlich gemacht.
Zu vermuten ist weiterhin, dass Menschen, die eigene Erfahrungen mit Behinderung oder mit behinderten Menschen gemacht haben, ihre Erfahrungen auch in Bildern ausdrücken. Das veränderte Welt- und Menschenbild derjenigen Autor/innen drückt sich entsprechend in ihren Werken aus, die mithin andere "Behindertenbilder" vermitteln, als dies beispielsweise DESMAROWITZ tut.

Abb.6: Meine Füße sind der Rollstuhl", HUAINIGG 1992
Ein Beispiel für diese Hypothese ist das Bilderbuch von FRANZ-JOSEPH HUAINIGG, dessen eigene Erfahrungen als Mensch mit einer körperlichen Behinderung in seinem Werk verarbeitet sind. Dabei wird der Blick der betrachtenden Person weder in Text noch in Bild auf die Beeinträchtigung oder auf äußere, phänomenologische Erscheinungen gelenkt: Beim Betrachten seines von ANNEGRET RITTER illustrierten Werkes richtet sich die Aufmerksamkeit des Betrachters / der Betrachterin auf das Leben mit einer Behinderung, was an nachfolgendem Beispiel veranschaulicht werden soll. Möglich wird eine solche Betrachtungsweise erst durch die Abkehrung von personenzentrierten Portraits und durch die Hinwendung zur Darstellung von Tätigkeiten, die die betroffene Person ausführt.
Beispiel: Meine Füße sind der Rollstuhl", HUAINIGG 1992
Erzählt wird die Geschichte eines fiktiven Tages aus dem Leben Margits. Der Tag beginnt mit der Darstellung des Aufstehens. Die Illustration leitet das Buch ein; der Blick der rezipierenden Person richtet sich auf die behinderte Person Margit; dies jedoch in einem sozialen Kontext, d.h. bei der Verrichtung alltäglicher Vorgänge. Deutlich werden die Schwierigkeiten, die sich bereits mit der Verrichtung von Alltagstätigkeiten (z.B. Aufstehen, Einkaufen) ergeben sowie die Selbstverständlichkeit, mit der Margit mit diesem Handicap umgeht.
Im Vordergrund steht somit das Leben mit der körperlichen Behinderung und nicht die Behinderung an sich. Anders ausgedrückt ist die aufgeworfene Frage nicht mehr, welche Behinderung ein Mensch ´hat`, sondern durch welche Gegebenheiten das Leben erschwert, d.h. behindert wird.
(rtf-Version, ohne Bild)
Im Hinblick auf Visualisierung von Behinderungen verdient die Kategorie "Comic", die in den sonstigen Teilen dieser Arbeit weitestgehend unberücksichtigt bleibt, besondere Beachtung. Comics mit ihrem dominierenden Bildcharakter sind auf starke Visualisierungsmechanismen angewiesen. Hier werden oftmals ganze Persönlichkeitsmerkmale verbildlicht: Bösewichter haben in der Regel einen Holzfuß oder auch andere unästhetische Merkmale. Diese Botschaften können mit Hilfe einer Zeichnung verschlüsselt werden, so dass Leser/innen sie implizit aufnehmen. Die Art der Zeichnung ermöglicht es, daß charakterliche Eigenschaften wie Bosheit, Kriminalität etc. von den Leser/innen so verstanden werden, wie sie vom Zeichner / von der Zeichnerin intendiert sind.
Zusätzlich bedienen sich Comics dem Prinzip der zeichnerischen Schlüsselsymbole. Menschen mit Behinderung können als solche mit Hilfe eines Schlüsselsymbols, wie z.B. Rollstuhl, Blindenhund oder Langstock gekennzeichnet werden, ohne dass die Behinderung im Text erwähnt werden muss. Mit diesen Schlüsselsymbolen werden dann in der Regel Attribute wie Schwäche und Hilfsbedürftigkeit verbunden (ZIMMERMANN 1982).
Neben der Bevorzugung evidenter Behinderungsformen ist als eine zweite Tendenz die Reduzierung der Ausprägungen einzelner Beeinträchtigungen auf Extreme festzustellen (ZIMMERMANN 1982). Differenzierungen innerhalb einer Kategorie sind selten zu finden.
Die dargestellten körperlich beeinträchtigten Personen in der Kinder- und Jugendliteratur werden zumeist entweder als Rollstuhlfahrer/innen oder als Gehbehinderte abgebildet. Das körperliche Erscheinungsbild ist in 64% der von ZIMMERMANN (1982) untersuchten Werke als nicht abweichend dargestellt, was darauf schließen lässt, dass sich ein Großteil der dargestellten Beeinträchtigungen auf evidente und leicht darstellbare Einschränkungen der Fortbewegungsmöglichkeit beschränkt. Schwieriger darzustellende Beeinträchtigungen wie z.B. Cerebralparese kommen nur selten vor. Diagnosen oder Hintergrundinformationen finden sich nur selten, die Darstellung bleibt, die Schädigung betreffend, verkürzt (BACKOFEN / SCHWEDES in: AMMAN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987, 129ff). Unterstützende Hilfsmittel, z.B. alternative Kommunikationsmethoden (BLISS, u.a.) finden sich meines Wissens in Kinder- und Jugendbüchern nicht.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, in denen vermehrt Kinder mit geistigen Behinderungen (darunter auch zunehmend Kinder mit sog. "Schwerstbehinderungen") als Haupt- und damit auch als Identifikationsfigur dargestellt wurden, erscheint meiner Ansicht nach noch nicht abgeschlossen. So sind die meisten Bücher, die von Menschen mit geistiger Behinderung handeln, für Jugendliche und weniger für Kinder konzipiert. Offensichtlich wird die Konfrontation von Kindern mit solchen Entwicklungsformen menschlichen Lebens noch immer nicht als angebracht empfunden.
Zudem fehlt es den Autor/innen augenscheinlich an geeigneten literarischen Mitteln, geistige Behinderung im Kinder- und Jugendbuch adäquat abzubilden. In der Regel sind die Bücher, in denen geistige Behinderung thematisiert wird, in der Form eines äußeren Erzählers aufgebaut; dies ist in vielen Fällen ein Geschwisterkind des behinderten Kindes. Mir ist - autobiografische Werke wie z.B. NIGEL HUNTs "Tagebuch eines mongoloiden Jungen" ausgenommen - kein Kinder- oder Jugendbuch bekannt, das die Welt aus der Sicht eines geistig behinderten Kindes beschreibt und sich dazu der Ich-Form bedient.
Meiner Ansicht nach spiegelt sich darin die gesellschaftliche Einstellungsstruktur wider. Die Einstellungsforschung hat sehr deutlich beschrieben, dass die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung diejenige Gruppe unter den behinderten Menschen ist, deren Behinderung als besonders schwer angesehen wird, ihnen gleichzeitig jedoch sehr negativ mit Ekel und Abscheu sowie mit Mitleid begegnet wird. Quantitativ stellen Menschen mit geistiger Behinderung mit 10% die drittgrößte Gruppe unter den einzelnen, dargestellten Behinderungsformen innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur. Qualitativ gesehen scheint es den Autor/innen nicht zu gelingen, sich in das Wahrnehmungs- und Denkniveau eines Menschen hineinzuversetzen, der allgemein als geistig behindert bezeichnet wird. Dies drückt sich u.a. darin aus, dass sich kaum ein Autor / eine Autorin darauf einlässt, die Perspektive eines Menschen mit einer geistigen Behinderung einzunehmen. Ein Versuch, dieses zu tun, ist z.B. PETER HäRTLINGs "Das war der Hirbel", in dem der Autor zusätzlich unterschwellig Kritik übt am Anstaltswesen und damit an bestehenden gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen.
Wenn Menschen mit einer geistigen Behinderung sowie ihre Handlungen und Verhaltensweisen dargestellt werden sollen, verwenden Autor/innen sehr häufig die Darstellung aus der Sicht einer Person, die der behinderten Person sehr nahe steht, wie z.B. Geschwister. Von einigen Autor/innen, denen es auf diese Weise gelungen ist, Menschen mit geistiger Behinderung adäquat darzustellen (wie z.B. RENATE WELSH), ist bekannt, dass sie sich selbst in ihrem Leben mit Menschen auseinandergesetzt haben, die wir als geistig behindert bezeichnen. Die freiwillige, emotional positiv erlebte Auseinandersetzung scheint auch bei Autor/innen Schrittmacher bei der Entwicklung einer positiven Einstellung zu sein, die sie dazu bewegte, ihre Erfahrungen an junge Leser/innen weitergeben zu wollen.
In den von ZIMMERMANN (1982) untersuchten Werken, in denen sehbehinderte Personen dargestellt wurden, waren 95% dieser Menschen als blind charakterisiert. Sehbehinderung wird mithin zu einem - unrealistischen - Extrem polarisiert. Laut SCHNEIDER (in: AMMANN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987, 99) erlangen blinde Menschen in vielen Büchern ihr Augenlicht wieder: oftmals auf sehr wunderlicher Weise, weniger durch konkrete medizinische Eingriffe. Dies kann ich bei der Durchsicht heutiger Werke nicht bestätigen.
Bei der von SCHNEIDER beobachteten Darstellung wird die stärkere, kompensatorische Herausbildung der anderen Sinne bei Beeinträchtigung des visuellen Systems in der Regel nicht als ein logisches Produkt menschlicher, sensomotorischer Entwicklung erklärt, sondern meistens als eine "Gabe an die vom Schicksal Benachteiligten" gedeutet. Menschen mit einer Sehbehinderung werden - im Gegensatz zu Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen - in ihrem äußeren Erscheinungsbild oft als ausgesprochen schön beschrieben. Hilfsmittel (z.B. Braille) sind in den Darstellungen der Kinder- und Jugendliteratur wiederzufinden.
Auch bei dieser Gruppe innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur wird deutlich, wie sehr der gesellschaftliche Eindruck von Behinderung optisch vermittelt ist. Die bildlichen Darstellungen in den Kinder- und Jugendbüchern stellen - ja nach Intention des Buches - Kinder entweder in Spielsituationen dar (in denen optisch keine Beeinträchtigung ausgemacht werden kann), oder sie zeigen die Kinder in Therapiesituationen, in denen durch die inhaltliche Gestaltung das Augenmerk auf die Hörschädigung gelenkt wird.
Selten wird zwischen angeborener und später erfolgter Hörbeeinträchtigung unterschieden. Die Darstellungen konzentrieren sich in der Regel auf defektologische Schädigungen, während durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen forcierte Schwierigkeiten im alltäglichen Leben wie auch Hilfsmittel, die die Lebensführung mit einer Hörbeeinträchtigung erleichtern, nur in wenigen Büchern dargestellt werden.
Gebärdensprache wird gelegentlich, aber nicht durchgehend in Kinder- und Jugendbüchern geschildert. Hier könnte möglicherweise das "orale Dogma" präsent sein. Dass durch das Erlernen der Gebärdensprache hörende Menschen in die Lage versetzt würden, in einen Dialog mit hörbeeinträchtigten bzw. gehörlosen Menschen zu treten, wird weitestgehend ausgeklammert.
Die meisten Darstellungen von Personen mit Sprachbehinderungen beziehen sich auf Menschen, deren Redefluss gestört ist (meist: Stottern). Andere Sprachbeeinträchtigungen werden so gut wie nicht aufgegriffen.
Diese Reduktion sowie die Tatsache, dass nur wenige stotternd gesprochene Sätze in einem Text ausreichen, um eine Person negativ zu typisieren, lässt vermuten, dass die Darstellung von sprachbehinderten Menschen ein vergleichsweise negatives Bild zeichnet.
Dieses Schema findet sich sehr häufig in Comics. Dort werden sie als humoristisches Element verwandt. Comic-Figuren werden Sprachfehler attribuiert, damit sich die Rezipient/inn/en über diese Figuren amüsieren können.
Es stellt sich die Frage, warum ausgerechnet die Behinderungsform der Sprachbehinderung verwendet wird, um Komik zu erzielen. Eine mögliche Antwort gibt ZIMMERMANN (1982). Sie ist der Meinung, dass z.B. Menschen mit einer Blindheit oder einer Körperbehinderung als schwer behindert gelten, sie folglich vor offenen negativen Reaktionen (wie Auslachen, Verspotten etc.) geschützt würden. Diese Ansicht wird unterstützt durch die in dieser Arbeit bereits dargelegten Ergebnisse der Einstellungsforschung. Einer Sprachbehinderung würde laut ZIMMERMANN ein solcher Behindertenstatus nicht oder nur teilweise zuerkannt. Somit entfallen die Schutznormen vor negativen Reaktionen.
Bei der Durchsicht der Kinder- und Jugendliteratur fällt auf, dass es eine Reihe von Grundformen und Verarbeitungsmuster gibt, die in der Realität, im Leben von Kindern mit Behinderung eher selten, in der Literatur jedoch sehr häufig auftreten. Der von BACKOFEN (in: AMMAN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987, 18-23) verwendete Begriff des "Strickmusters" verdeutlicht die stereotype Ausrichtung bestimmter Darstellungsformen, von denen einige im Folgenden dargestellt und mit Beispielen belegt werden sollen. Werden stereotype "Strickmuster" stark vereinfacht oder überzogen, entsteht die Gefahr, dass bei der rezipierenden Person ein stark vereinfachtes, verzerrtes und stereotypes Bild von Menschen mit Behinderung verfestigt wird. Die Häufung von solchen Strickmustern ist ein Anzeichen für sehr dominante stereotype Einstellungsmuster auf Seiten der Autor/innen.
Diese Sichtweise von Behinderung bezieht sich im Wesentlichen auf die alten Volksmärchen. Behinderung in Verbindung mit den Märchen der GEBRüDER GRIMM löst in der Regel Assoziationen an die böse Hexe mit ihrer langen krummen Nase (in "Hänsel und Gretel") oder an Bucklige, die immer das Böse darstellen, aus.
Körperlich unattraktiven Personen werden nach den Ergebnissen der Einstellungsforschung eher sozial unerwünschte Attribute zugeordnet. Die Verbindung zwischen (zumeist körperlicher) Behinderung und Boshaftigkeit scheint ein häufiges Merkmal in Märchen zu sein. Menschen mit Behinderung werden als schlecht, hintertrieben, listig und abstoßend dargestellt. Da ein Mensch mit einer Behinderung nur selten zum Märchenheld werden kann, wird er von vornherein dazu bestimmt, den negativen Part zu übernehmen.
Neben den körperlichen Beeinträchtigungen werden in vielen Märchen (besonders stark in den russischen Volksmärchen) "dumme" Menschen dargestellt, oftmals in der Form des dritten Sohnes, der von seinen Brüdern verspottet wird.
Beispiel: "Das fliegende Schiff", MäRCHEN DER VöLKER DER SOWJETUNION 1987
"Es lebte einst ein alter Mann mit seinem Weib. Sie besaßen drei Söhne: Zwei waren klug, der dritte war ein Dummerjan. Die alten Leutchen liebten die klugen Söhne (...), mit Dummerjan aber trieben alle ihren Spott und schalten ihn"
Beispiel: "Die goldene Gans", GEBRüDER GRIMM 1977
"Es war ein Mann, der hatte drei Söhne, davon hieß der jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt"
Während die Brüder meist habgierig erscheine n, ist der "Dumme" hilfsbereit und teilt das Wenige, was er hat, gerne. Der "Dumme" wird hier jedoch keinesfalls mit dem geistig behinderten Menschen gleichgesetzt. Mit dem "Dummerling" ist meistens der reine Tor gemeint, der unerfahren, tolpatschig und nicht gescheit wirkt (KRENZER1981). Seine Gutherzigkeit wird meist erst gegen Ende des Märchens deutlich. Menschen mit Behinderung können in Märchen somit durchaus auch als sympathische Handlungsfigur erscheinen, der in der literalen Handlung Vorurteile entgegengebracht werden. KILIAN (1967, vgl. ZIMMERMANN 1982, 66) differenziert den "Dummen" im Märchen dahingehend, dass es neben anderen Darstellungen eine Ausrichtung auf "Dumme" gibt, die nicht aus Erfahrungen lernen, sondern vielmehr immer dieselben Fehler begehen. Mit diesen Darstellungen dürften am ehesten die Menschen geschildert worden sein, die allgemein als "geistig behindert" bezeichnet werden.
Die Darstellung von Behinderung als (göttliches) Schicksal ist in verstärktem Maße in der älteren Kinder- und Jugendliteratur zu finden (vgl. auch UTHER 1981). Eine Behinderung ist von der sie tragenden Person sowie von dessen Umfeld als unabänderlich hinzunehmen. Diese Auffassung ist auch in der gesellschaftlichen Einstellungsstruktur wiederzufinden: Laut der Untersuchung VON BRACKENs (1976) wird Behinderung von etwa 38% (ebd., 358) der Gesellschaft und von 66% der Elternschaft behinderter Kinder (ebd., 375) als Schicksalsschlag des Lebens empfunden, der hingenommen werden müsse. Die Einstellungsforschung macht ebenfalls deutlich, dass (zumindest bis in die jüngere Vergangenheit) die Geburt eines behindertes Kind von vielen Mitgliedern der Gesellschaft als Strafe für das Fehlverhalten der Eltern aufgefasst wurde (ebd., 362).
Die Auffassung von Behinderung als Schicksalsschlag und vor allem als Strafe wird in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur nur noch selten aufgegriffen.
Beispiel: "Gänseblümchen für Christine", RüCK 1989
» Alle sagen immer: Ich weiß es nicht, oder sie sagen gar nichts. Und doch ist Gott schuld daran. Vielleicht, ja wahrscheinlich, ganz sicher sogar hat er Mama und Papa bestrafen wollen, weil sie irgend etwas getan haben, was er nicht wollte. Aber was? Es muß etwas sehr Schlimmes gewesen sein, wofür sie eine solch strenge Strafe bekommen haben." « (S.18)
Die Darstellung von Behinderung als Strafe ist eng verknüpft mit der Darstellung von behinderten Menschen als Musterkrüppel. Es entstand ein Bild des lieben und geduldigen Behinderten, der keinerlei Schwächen oder negative Verhaltensformen zeigt. Ein solcher Mensch, angepasst und liebenswürdig, stellt keine Bedingungen und keine Forderungen. Dieses Strickmuster entspricht durchaus gesellschaftlichen Ansichten: Nach SAXER (1970, angef. n.: LENZEN 1985, 48) sei Dankbarkeit für 45% der Befragten eine Eigenschaft, die behinderte Menschen charakterisiere.
Beispiel: "Heidi", SPYRI (vgl. AMMAN / RIES in: AMMAN / BACKOFEN, KLATTENHOFF 1987, 58-73)
Die im Rollstuhl sitzende Klara entspricht dem Idealbild eines "Musterkrüppels": Sie ist dankbar, sanftmütig, beklagt sich nie und stellt keine Forderungen an ihre Mitmenschen.
Mit der Oppositionellen Phase Anfang der Siebziger Jahre änderte sich diese Darstellungsweise. Während wenige Autor/innen die bisherige Darstellung und gesellschaftliche Denkweise des Musterkrüppels in ihren Werken kritisch karikierten (z.B. KLEE 1974), erwuchs durch viele Darstellungen ein neues Stereotyp (ZIMMERMANN 1982, 141f). Nun wurden Menschen mit Behinderung auch unfreundlich oder aggressiv dargestellt; dies indes nicht im Rahmen sozialer Interaktionen, sondern als Teil ihrer Persönlichkeit. Behinderte Menschen seien zynisch, argwöhnisch, undankbar, verbittert und aggressiv, wobei einer dieser Menschen alle behinderte Menschen symbolisieren sollte: Das Erscheinungsbild wurde verallgemeinert (BACKOFEN in: AMMANN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987, 18f).
Bei der Darstellung eines Menschen mit Behinderung als einen Tyrannen leiden die Personen in seiner Umgebung unter dessen negativen Eigenschaften. Nur wenigen Autor/innen ist es dabei gelungen, die eigentlichen Ursachen für diese Verhaltensweisen, seien es Mitleid, Ausgrenzung oder andere sozial-gesellschaftliche Erfahrungen, aufzuzeigen.
Da die Umgebung der behinderten Person Mitleid empfindet, lässt sie sie aufgrund ihrer Behinderung gewähren. Gemäß des Normalisierungspostulats sind viele Autor/innen bemüht, die Figur des behinderten Menschen in Richtung einer verständnisvollen Person zu entwickeln. Oft endet eine solche Geschichte damit, dass eine einzige Person (häufig ein Mädchen) sich dazu berufen fühlt, das Wesen des behinderten Menschen völlig umzukrempeln, bis er endlich "gut" wird: Die Umwelt quittiert die große Tat der nicht-behinderten Person mit Hochachtung. Es wird nicht vermittelt, dass die Verhaltensveränderung der behinderten Person auf die Verhaltensveränderung der Umwelt zurückzuführen ist.
Eine äußergewöhnliche Leistung, die ein behindertes Kind vollbringt und die ihm endlich die Achtung und Akzeptanz der Umwelt einbringt, kann zu Recht als ein klassisches und sehr häufig auftretendes Darstellungsstereotyp bezeichnet werden. Mut und Tapferkeit, zwei Eigenschaften, die laut SAXER (1970; angef. n.: LENZEN 1985, 48) von 63% der Bevölkerung als charakteristisch für behinderte Menschen empfunden werden, finden sich auch in der Kinder- und Jugendliteratur wieder.
Beispiel: "Dann kroch Martin durch den Zaun", DESMAROWITZ 1979
Der "kleine hilflose Junge" mit dem "krummen Rücken" darf nicht mit den gesunden Kindern zum Schulhaus am Ende der Allee gehen - er besucht die Sonderschule im Park, dort ist er mit anderen behinderten Kindern zusammen. In den Pausen beobachtet er ein Pferd auf der naheliegenden Wiese. Einmal kriecht er durch den Zaun und darf anschließend auf dem Pferd reiten. Als dieses Pferd eines Tages ausbricht, sich in den Verkehr wagt, nervös wird und ausschlägt, fürchten sich die Kinder und ein paar Männern gelingt es nicht, das Pferd zu beruhigen. Nur der "kleine Kerl mit der dicken Brille", der "seit seiner Geburt im Kopf einen Schaden haben soll" ist, läßt sich nicht beirren, rettet das hilflose Pferd aus dem Verkehr und bringt es in Sicherheit. Jetzt wollen die nichtbehinderten Kinder auf dem Heimweg ganz nahe bei Martin sein: "Zum ersten Mal passen sie ihre große Schritte seinen kleinen an."
Eine universelle, da sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart vorkommende und auf alle Behinderungsarten zutreffende Lösung der Probleme von Menschen mit Behinderung ist deren Heilung, d.h. die Aufhebung ihrer Schädigung.
Die Reduktion der Behinderung auf eine biologische Schädigung geht oft einher mit einer wundersamen Heilung, bei der deren Hintergründe ebenso unbekannt bleiben wie die Ursache der eigentlichen Schädigung. Psychosoziale Elemente bleiben in Geschichten, die sich dieses Strickmusters bedienen, weitestgehend ausgeklammert.
Beispiel: "Heidi", SPYRI [o.J.] (vgl. AMMAN / RIES in: AMMAN / BACKOFEN, KLATTENHOFF 1987, 58-73)
Ohne Hintergrundinformationen über Klaras Beeinträchtigung erfährt die rezipierende Person, wie sehr die heilenden Kräfte der Alpenwelt den Heilungsprozess Klaras beschleunigen bzw. erst ermöglichen.
In Fantasien haben Kinder die Gelegenheit, Aufmerksamkeit und Anerkennung, Zuwendung und Liebe zu erlangen, die sie in ihrem realen Leben nicht bekommen. Behinderte Kinder, vor allem Kinder mit Körperbehinderungen, aber auch Kinder mit Sinnesbeeinträchtigungen oder Außenseiter ziehen sich in Kinder- und Jugendbüchern aus einer sie isolierenden Umgebung in eine Traumwelt zurück und erleben spannende Abenteuer. BACKOFEN (in: AMMAN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987) verdeutlicht an einem Unterrichtsbeispiel, dass Kinder die gedankliche Flucht eines behinderten Kindes als befriedigende Lösung seiner Probleme empfinden.
Das Weglaufen von Kindern ist ein häufiges Moment in der allgemeinen Kinder- und Jugendliteratur. Auch Kinder mit Behinderung, speziell Kinder mit geistiger Behinderung, verlaufen sich oder laufen gezielt weg, worauf die verzweifelten Angehörigen ihr Verhalten dem Kind gegenüber überdenken und meistens reuevoll zu dem Ergebnis kommen, dass sie das Kind in der Vergangenheit entweder vernachlässigt oder falsch behandelt haben. Das Verschwinden eines Kindes und das Nachdenken der Angehörigen über die Beweggründe, leitet im Allgemeinen eine Wendung zum Guten ein.
Beispiel: "Eine Schwester so wie Danny" , KRENZER 51995
In diesem Buch schildert der elfjährige Oliver seine Gefühle seiner 15jährigen Schwester Danny gegenüber, die eine geistige Behinderung hat. Die Schwester gilt für Oliver als Auslöser vieler Probleme. Die Eltern von Oliver verlangen von ihm Hilfe und Unterstützung bei den alltäglich wiederkehrenden Alltagsverrichtungen. So erhält Oliver z.B. die Aufgabe, seine Schwester zum Bus zu begleiten. Als Danny sich verläuft bzw. mit dem Bus verfährt und nicht auffindbar ist, fühlt sich Oliver für das Verschwinden verantwortlich. Am Ende des Buches lernt Oliver, dass seine Ängste im Umgang mit seiner Schwester unbegründet waren. Von nun an steht er zu Danny und wird dafür von seinen Schulkamerad/innen mit Freundschaft belohnt.
Wie bereits beschrieben, übernehmen in vielen Büchern, vor allem in solchen, in denen Kinder mit einer geistigen Behinderung vorkommen, nicht die behinderten Kinder, sondern ihre nicht-behinderten Geschwister die Hauptfigur der Erzählung. Dies unterstreicht die Tatsache, dass es im Bereich der Bücher mit Kindern mit geistigen Behinderungen nur sehr wenigen Autor/innen gelungen ist, die Perspektive eines Menschen einzunehmen, den wir als geistig behindert bezeichnen. Die Geschwister beschreiben das Verhältnis zu ihrem behinderten Bruder bzw. ihrer behinderten Schwester aus ihrer eigenen Sicht. Sie schildern beispielsweise ihre Angst, von ihren Freunden nicht mehr anerkannt oder von fremden Leuten angegafft zu werden. Im Vordergrund steht das psychische Erleben des nichtbehinderten Kindes und nicht das der behinderten Person.
Das Geschwisterkind eines behinderten Kindes besitzt selbst Einstellungen gegenüber dem Bruder / der Schwester. Die eigenen Einstellungen werden ebenso aufgegriffen wie die Reaktionen der Umwelt, die das Geschwisterkind erlebt. Die Schilderung eines (geistig) behinderten Menschen aus der Geschwisterperspektive bietet dadurch die Möglichkeit, in verstärktem Maße gesellschaftliche Einstellungen und Verhaltensweisen zu thematisieren.
Die behinderten Geschwisterkinder sind doppelt so häufig männlich wie weiblich. Bei den nichtbehinderten Geschwisterkindern verhält es sich genau umgekehrt. Dort überwiegen die Mädchen. Der Grund für diese Vorgehensweise ist möglicherweise die geschlechtsstereotype Vorstellung, dass Mädchen eher in pflegenden, dienenden Rollen vorstellbar seien als Jungen (vgl. AMMANN in: AMMANN / BACKOFEN / KLATTENHOFF 1987).
Dazu passt, dass in der Untersuchung von ZIMMERMANN (1989) 2/3 aller dargestellten behinderten Personen männlichen Geschlechts waren. Die untersuchten Werke richteten sich zu 82% ohne eindeutigen Geschlechtsadressaten, zu 15% an Mädchen und nur zu 3% eindeutig an Jungen. Das Thema "Behinderung" in der Kinder- und Jugendliteratur scheint in den Augen der Autor/innen und der Verlage eher ein Mädchen- als ein Jungenthema zu sein.
Beispiel: "Ben lacht", LAIRD 1991
Die Darstellung der Schwester des behinderten Ben, die sich in die pflegende, beschützende Mutter-Rolle hineinträumt, wird im nächsten Kapitel ("Darstellung der gesellschaftlichen Reaktionen ...") noch einmal aufgegriffen.
Beispiel: "Eine Schwester so wie Danny", KRENZER 51995
Oliver beschreibt, wie er sich schämt, sich mit seiner geistig behinderten Schwester Danny in der Öffentlichkeit sehen zu lassen, da er dann das Gefühl hat, ständig von allen Leuten angegafft zu werden. Eines Tages setzt sich Danny in den Kopf, zu ihren Großeltern nach Heidelberg zu fahren. Während die Eltern glauben, Danny auf die kommenden Ferien vertröstet zu haben, setzt sich Danny eines Morgens nicht in den Schulbus, sondern in den Linienbus, von dem sie eigentlich weiß, dass sie ihn nicht nehmen darf. Sie ist sich sicher, dass dieser Bus sie nach Heidelberg bringen wird. Am Hauptbahnhof endet die Fahrt schließlich - zu einem Zeitpunkt, zu dem alle schon nach ihr suchen.
Der Autor ROLF KRENZER, Rektor an einer ‚Sonderschule für Geistigbehinderte´ in Hessen, schildert im Nachwort des Buches, dass die Geschichte authentisch sei, die Namen jedoch geändert wurden und es sich eigentlich um einen Jungen und nicht um ein Mädchen mit einer geistigen Behinderung handele. Als Grund für diese geschlechtsspezifische Veränderung der Handlung wird genannt, dass dem Jungen das Missgeschick mit dem falschen Bus peinlich gewesen sei: "Schreib doch einfach, es wäre ein anderer gewesen!" meinte er dann. "Vielleicht ein Mädchen!" (S. 87).
Auch wenn es hier nicht um die pflegende Rolle von Mädchen geht, scheinen hier tiefverwurzelte geschlechtsspezifische Klischees zum Tragen zu kommen.
Die Geschwisterperspektive wird auch oft dazu verwandt, Informationen über die Art der Behinderung an die Leser/innen zu bringen. Der Bruder oder die Schwester erzählt aus seinem / ihrem kindlichen Verständnis heraus, um welche Diagnose es sich handelt. Neben kindgemäßen Schilderungen und Erklärungen existieren dabei auch Erklärungen, bei denen auf die Richtigkeit der Aussagen zugunsten einer angeblich kindgerechen Anschauung verzichtet wird:
Beispiel: "Mein kleiner großer Bruder" , TVEIT 1991
Ein Beispiel für die Vermittlung von falschen und stigmatisierenden Kenntnissen über eine Behinderungsform ist die folgende: Der zehnjährige, kleine Bruder von Kjell schildert, welche Schwierigkeiten er im Umgang mit seinem großen Bruder hat und wie er diese bewältigt. Im Vordergrund steht das psychische Erleben von Kjells Bruder. Das Besondere an Kjell erklärt er wie folgt:
"Kjell hat etwas schräge Augen. Deswegen ist er den Menschen in China und Japan ein wenig ähnlich. Die Menschen, die dort wohnen, gehören der mongolischen Rasse an. Deswegen sagt man auch, daß mein Bruder mongoloid ist. Es gibt auch andere Namen dafür: Aber ich finde "mongoloid" in Ordnung. Denn das ist irgendwie, als ob er einer anderen Rasse angehören würde. Trotzdem ist er mein Bruder" (S. 8).
In einer Reihe von Kinder- und Jugendbüchern erscheint das behinderte Kind nicht im Mittelpunkt der Handlung, sondern in einer unbedeutenden Rolle am Rand. Dabei werden sie jedoch nicht als integrierte Selbstverständlichkeit dargestellt (solche Bücher, in denen Kinder mit Behinderung auf diese Weise und nicht als Protagonisten dargestellt werden, existieren nahezu nicht), sondern zu dramaturgischen Zwecken eingesetzt. Sie eignen sich dazu, die Hilfsbereitschaft und den guten Charakter der Hauptperson zu demonstrieren oder die Dramatik von Geschichten bestimmter Genres (z.B. Liebesgeschichten oder Katastrophenschilderungen) zu verstärken.
Beispiel: "Die letzten Kinder von Schewenborn. Oder ... sieht so unsere Zukunft aus?", PAUSEWANG 1983
Bei GUDRUN PAUSEWANGs Werk handelt es sich um ein Buch, das den atomaren Wahnsinn deutlich machen soll. Bei ihrem Bemühen, die Gefahren der Atomnutzung deutlich zu machen, ergibt sich aus der Darstellung der Konsequenzen ein Nebeneffekt, der Leser/innen eine "heimliche" Botschaft übermittelt: PAUSEWANG benutzt "Behinderung" als eines von mehreren Abschreckungsmerkmalen, die das Grauenhafte der Geschichte steigern sollen. In dem preisgekrönten Werk sind Passagen enthalten, die die Auffassung von Behinderung als schlimmere Alternative zum Tod, als Aufforderung zur aktiven Sterbehilfe und sogar als Rechtfertigung für einen Mord an einem Neugeborenen mit schwersten Beeinträchtigungen vermitteln. Die traditionellen Denkmuster, nach denen die Autorin verfährt, werden von ihr weder kritisch beleuchtet noch in irgendeiner Weise in Zweifel gezogen.
BOBAN / HINZ (1990, 42f) kommen zu folgenden Aussagen: "Gudrun Pausewang bietet ein ganzes »Menü der Behindertenfeindlichkeit« an, das dramaturgisch gekonnt, eine zunehmend schärfere Würzung aufweist. (...) Die Bilder und Lösungsvorschläge von Gudrun Pausewang, deren Bücher mehrfach ausgezeichnet wurden, fügen sich reibungslos in ein wachsendes gesellschaftliches Klima der Behindertenfeindlichkeit ein und wirken - wenn auch unbeabsichtigt - mit ihr zusammen. Atomare Bedrohung und Behindertenfeindlichkeit sind zwei existentiell wichtige Themen unserer Zeit. Beide müssen dringend thematisiert werden. In diesen Büchern [ergänzend zu "Die letzten Kinder von Schewenborn" ist "Die Wolke" gemeint, ein Buch von PAUSEWANG mit der gleichen Thematik; SN] werden sie unselig miteinander verknüpft." Nach der Herauskristallisierung der "heimlichen Lernziele" bringen BOBAN / HINZ das vermittelte Behindertenbild mit einem Ausspruch von FRANZ CHRISTOPH auf den Punkt: "Es gibt Entsetzlicheres als den Atomtod. Nämlich mich."
"Jeder sieht sich am deutlichsten in den Augen des anderen"
(aus: "Die Reise zum Meer", GüNTHER 1994, S. 59)
"Der Mensch wird am Du zum Ich." (MARTIN BUBER)
"Er wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind." (GEORG FEUSER)
Die Hauptproblematik von Kindern mit Behinderung innerhalb der Darstellungen in der Kinder- und Jugendliteratur liegt eindeutig in der sozialen Isolation (ZIMMERMANN 1982). Die Ursachen dieser Isolation werden häufig reduziert auf ablehnende Nachbarskinder etc.; andere Gründe, wie z.B. getrennte Schulbesuche, die eine soziale Integration erschweren, finden selten Niederschlag in der Kinder- und Jugendliteratur. Entsprechend werden Annahmen, Setzungen wie auch Vorurteile selten hinterfragt und deren mögliche Gründe wie politische und soziale Funktionen nicht aufgezeigt.
Anhand der Interaktionen in einem literalen Werk kann bewertet werden, inwieweit es der Autorin / dem Autor gelungen ist, soziale Sachverhalte einer gesellschaftlich theoretischen Ebene zu konkretisieren und auf einer sozialen Mikroebene als Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen abzubilden.
Die typische Entwicklung einer kinder- und jugendliteralen Handlung beginnt mit der Darstellung der gesellschaftlichen Isolation und der Angst vor Mitleid. Durch die Vermittlung von Information und Wissen sowie möglichst damit einhergehende persönliche, emotionale Auseinandersetzung mit der behinderten Person, verändert sich die Einstellung ihr gegenüber deutlich. Zu beobachten ist außerdem ein wachsendes Selbstbewusstsein bei allen literalen Figuren - bei der behinderten Person wie auch bei den Personen, die sich in stärkerem Maße mit ihr umgeben.
Das aufgezeigte Muster folgt eindeutig der Intention von Kinder- und Jugendliteratur, die Modelle aufzeigen und Problemlösungsmöglichkeiten anbieten will. Die Häufung von "Strickmustern" wie in DESMAROWITZ 1979 ("Dann kroch Martin durch den Zaun") sind die Ausnahme. ZIMMERMANN (1982, 124) kam schon vor zehn Jahren zu folgender Auffassung: "Einer Mehrzahl von Erzählungen, in denen gegen übertriebene Hilfsbereitschaft, falsch verstandene Rücksichtnahme und Fürsorge, gegen Bewunderung und Mitleid Stellung bezogen wird, steht eine kleinere Anzahl von Geschichten gegenüber, in denen eine ´Sonderbehandlung` des fiktiven Behinderten befürwortet wird."
Diese Auffassung besitzt meiner Ansicht nach mehr Gültigkeit denn je. Dies entspricht ebenso der Veränderung der gesellschaftlichen Einstellungsstruktur, da vor allem schulische Sonderbehandlung in immer stärkerem Maße zugunsten der Integration und des Normalisierungsprinzips abgelehnt wird.
Ein verschöntes Bild wird in den aktuellen Werken der Kinder- und Jugendliteratur in aller Regel ebensowenig gezeichnet wie stereotypes Darstellen mittels bekannter "Strickmuster". Kinder- und Jugendbücher greifen die aus dem ersten Teil dieser Arbeit bekannten Kategorien auf und verarbeiten sie literarisch im o.g. Sinne, d.h. im Verlauf der Handlung ist immer eine Lösung der Probleme zu erkennen. Begonnen wird die Darstellung zumeist mit der Darstellung negativer Reaktionen.
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995.
»Kaum war die junge Frau ausgestiegen, begannen die Fahrgäste zu reden.
"Armes Tschapperl, ich mag gar nicht hinschauen, wenn ich so was seh`".
"Die hat es nötig, sich so auffallend herzurichten! Mit so einem Kind lackiert man sich doch nicht die Fingernägel blau."
"Bin ich froh, daß meine Tochter nicht mitgefahren ist, eigentlich wollte sie, aber dann hat sie sich`s anders überlegt. Sie ist schwanger, und wer weiß, wenn sie so was sieht..."
"Also ich würde nicht mit so einem Kind auf die Straße gehen, das kann man doch den Leuten nicht zumuten."
Anne wollte sich die Ohren zuhalten, aber sie saß steif da, und die Sätze prasselten weiter:
"Was hat denn so ein Kind von seinem Leben?"
"Unverantwortlich ist das, was die Ärzte heute tun, früher wär so ein armes Wurm einfach gestorben."
"Aber eines muss man sagen, sie war nett zu dem Kind."
Anne stand auf, (...).« (S. 35)
Eine solche Kumulation von offenen, verbalisierten Einstellungen gegenüber einem Kind mit einer geistigen Behinderung, in der Abscheu / Ekel, Scham, Hintergründe von Isolation, Mitleid, projiziertes Leid und sogar Lebensrechte innerhalb nur weniger Zeilen angesprochen werden, ist selten. Häufiger beziehen sich Situationen einer literalen Handlung auf einzelne Elemente.
Negative, von der Sozialpsychologie festgestellte Reaktionen werden in der Kinder- und Jugendliteratur oft als Reaktion eines Erstkontaktes dargestellt. Dabei handelt es sich vorwiegend um das Anstarren und das Ausdrücken von Abscheu bzw. Ekel. Das "Übersehen" im Sinne der Irrelevanzregel findet keine Beachtung in Interaktionen, sondern allenfalls in der Schilderung baulicher Infrastrukturmängel.
Beispiel: "Die Reise zum Meer", GüNTHER 1994
»Alles in mir protestierte gegen das, was ich sah. In der Kinderkarre lag ein Gesicht. Ja, so war es. Das Gesicht eines Mädchen. Eingerahmt von langem braunen Haar. Große Augen. Das Gesicht war ungefähr so alt wie die vermeintlichen Eltern. Aber alles andere, die Arme, die Beine, der übrige Körper, war wie bei einem höchstens siebenjährigen Kind. Spindeldürre Beine, spindeldürre Arme. Die Arme nach oben angewinkelt, kleine, verkrüppelte Hände nach innen gerollt. Die Augen sahen mich neugierig an und lächelten.
Ich wollte es nicht, aber ich lief weg.
Erst langsam, dann immer schneller. Ich lief und lief, und der hölzerne Steg knarrte ohrenbetäubend, wie Hohn und Spott.« (S. 9)
Im Verlauf der Handlung, in der die rezipierende Person etwas über das behinderte Kind des Buches erfährt, wenden sich die dargestellten literalen Figuren neuerer Werke überwiegend gegen Mitleid. Die Wirkungsweise von Mitleid als Form der Ausgrenzung wurde offensichtlich vom überwiegenden Teil der Autor/innen erkannt.
Beispiel: "Die Reise zum Meer", GüNTHER 1994
»"Mit mir braucht keiner Mitleid haben. Ich leide doch nicht."
Ungläubig starrte ich sie an.« (S. 35)
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995
»"Und Mitleid brauchen wir erst recht nicht."« (S. 88)
Dass Mitleid eine verpackte negative Einstellung darstellen kann, wird manchmal auch auf andere Weise deutlich gemacht:
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995.
»"Hoffentlich macht der Herr Spitzner heute keinen Mittagschlaf", sagte die Mutter ängstlich. Nicht daß die Spitzners sich je beklagten über den Lärm nebenan. Sie sagten nur mitleidig: "Das muß ja heute nacht sehr schlimm gewesen sein für Sie", oder "Gibt es denn gar nichts, womit man ihn etwas ruhiger halten kann? Ich weiß nicht, wie Sie das aushalten. Ich bewundere Sie." Und die Mutter schrumpfte und fühlte sich verantwortlich für die Störung, und die Spitzners wußten das und wußten, daß jede offene Beschwerde nicht halb so wirkungsvoll gewesen wäre.« (S. 79f)
Gelegentlich wird indes deutlich, dass die Autor/innen Mitleid mit behinderten Menschen positiv werten und den Leser/innen als Akt der Nächstenliebe darlegen. Dies ist z.B. im folgenden Beispiel der Fall, in dem die "Besonderheit" einer lebenslang notwendigen Pflege und Betreuung eines Menschen unreflektiert als Mittel zur Selbststabilisierung einer Außenseiterin herhalten muss, was durch das geschlechtsspezifische Stereotyp der weiblichen Beschützer/innen- und Pfleger/innen-Rolle verstärkt wird. In der Untersuchung VON BRACKENs (1976) äußerten über 50% der Befragten, dass sie es als ihre Aufgabe empfinden, ein Kind mit einer geistigen Behinderung zu umsorgen. Zu vermuten ist, dass die literale Auseinandersetzung der folgenden Autorin auf eigene Erfahrungen und Einstellungen basiert, die von ähnlicher Anschauung geprägt sind.
Beispiel: "Ben lacht", LAIRD 1991.
» "Es ist mir egal, wie behindert du bist", flüsterte ich ihm zu. "Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich beschützen und für dich sorgen. Wenn jemand gemein zu dir sein will, dann kriegt er es zuerst mit mir zu tun." (S.22)
"Ich bemerkte kaum, daß sein großer Kopf immer größer wurde und daß sein armer kleiner Hals zu schwach war, um ihn zu halten. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, seine Windeln zu wechseln und seinen kleinen Hintern zu pudern. Mam lachte über mich.
"Eines Tages wirst du eine wunderbare Mutter sein", sagte sie.
"Was soll das heißen, eines Tages?" dachte ich empört. "Ich wäre schon jetzt eine wunderbare Mutter." (S.23)
"Ich wollte einfach wieder mit einem Kind zusammensein. Mit einem besonderen Kind, das mich brauchte. Ein Kind wie Ben." « (S. 147)
In aller Regel richten sich die Aussagen der Werke, wie bereits beschrieben, jedoch gegen das Mitleid als positiv zu bewertende Umgangsform mit behinderten Menschen. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde geschildert, dass sich Mitleid auch im konkreten, sog. "diffusen" Hilfeverhalten ausdrücken kann. Laut JANSEN sprachen sich 1972 65% der Befragten eindeutig für materielle, unpersönliche Hilfe aus. Obwohl seine Untersuchung bereits 25 Jahre alt ist, muss angesichts aktueller, institutionell organisierter Spendenaktionen davon ausgegangen werden, dass auch heute ein Großteil dieser Bevölkerung diese Ansicht unterstützt.
Die konkrete Gewissensbefriedung durch materielle Hilfen drückt HUAINIGG in seinem Bilderbuch so aus:
Beispiel: "Meine Füße sind der Rollstuhl", HUAINIGG 1992
»"Weil du so arm bist", sagt die Frau. Sie drückt Margit einen Geldschein in die Hand. (...) da fragt der Mann mitleidig: "Was ist denn dir passiert?"
Margits Gesicht wird ganz rot vor Zorn.
"Was wollen die denn alle von mir?" « (o.S.)
Das Werk von HUAINIGG ist das einzige mir bekannte Bilderbuch, das in einem Werk für sehr junge Leser/innen gesellschaftliche Einstellungen in angemessener Weise thematisiert.
Obwohl viele Bücher einzelne Fragmente gesellschaftlicher Verhaltensweisen kritisch beleuchten, findet sich nur selten die Diskussion darüber, dass ein "richtiges" Verhalten schwierig zu bestimmen ist:
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995
»" (...) ist zurückgekommen und hat mir Geld in die Hand gedrückt, und dem Jakob hat sie den Kopf gestreichelt."
"Na und?"
"Wie einen Hund hat sie ihn gestreichelt!"
"Und woher weißt du, daß es nicht freundlich gemeint war?", fragte Lea. "Du tust ja so, als hätte sie auch ´Spasti` geschrien."
"Es kommt auf dasselbe heraus", sagte Anne. "Beide haben nichts kapiert. Gar nichts."
"Du hilfst ihnen auch nicht zu kapieren. Du willst nicht, daß einer schaut, und nicht, daß einer wegschaut. Du willst nicht, daß sie fragen, und nicht, daß sie schweigen. Was willst du eigentlich?"
Anne zuckte mit den Schultern.« (S. 89)
Nachdem in Kinder- und Jugendbüchern die negativen Reaktionen der Umwelt (Anstarren etc.) aufgegriffen wurden, wird in einigen Werken auch deutlich, dass diese gesellschaftliche Reaktionen nicht ohne Auswirkungen auf die beteiligten Personen bleibt.
Die bisher genannten Einstellungsmuster werden in erster Linie in Werken aufgegriffen, die von Kindern mit geistigen Behinderungen handeln. Da diese Werke überwiegend nicht aus der Perspektive des behinderten Kindes geschrieben sind, steht bei der Schilderung des Erlebens und der Verarbeitung gesellschaftlicher Reaktionen auf Behinderung die psychische Situation der Person im Vordergrund, die die Erzählung übernommen hat (meist Geschwister).
Beispiel: "Ben lacht", LAIRD 1991.
» "(...) Du schämst Dich doch nicht wegen Ben?"
"Natürlich nicht", sagte ich, aber das stimmte nicht.« (S. 34)
Dabei sind gelegentlich Werke zu finden, die Umgangsweisen und Problemlösungsmöglichkeiten unmittelbar und nicht erst später im Verlauf der Handlung aufzeigen. Im folgenden Beispiel lassen die Eltern von Kjell ihren nichtbehinderten Sohn an ihrer eigenen Entwicklung teilhaben. Ihm wird gewissermaßen ein Probehandeln ermöglicht, ein Modell vorgezeigt und begründet:
Beispiel: "Mein kleiner großer Bruder", TVEIT 1991.
» "Ich habe Kjell gern", sagte ich zum Schluß. "Ich habe ihn gern! Aber ich ..."
"Wir verstehen, was du meinst", sagte Vater. "Es ging uns auch lange Zeit so"
"Seid ihr auch ... verlegen geworden wegen Kjell?" fragte ich erstaunt.
"Ja" sagte Vater. "Sicher"
"Wenn wir mit Kjell in ein Geschäft oder in ein Café gingen, war es mir oft peinlich", sagte Mutter. "Wenn er etwas Ungewöhnliches machte, fühlte ich, wie ich rot anlief. Ich glaubte, alle Leute sehen uns an."
"Und jetzt?" fragte ich.
"Es war lange Zeit schwer", sagte Vater. "Ich habe mich nie entspannen können, wenn Kjell dabei war. Ich wartete die ganze Zeit darauf, daß etwas passieren würde. Aber jetzt kümmert mich das nicht mehr."
"Mich auch nicht", sagte Mutter. "Aber es ist schwer, und es dauert. (...)"
"Weißt du, wenn wir Kjell nicht so akzeptieren wie er ist, dann können wir auch nicht erwarten, daß andere es tun. (...) Wenn sie ihn mögen sollen, müssen sie ihn kennenlernen. Und das können sie nur, wenn wir mit ihm ausgehen. Er muß überall sein können, wo wir sind.« (S. 21f)
Kann die Bewältigung der eigenen Emotion (Scham) zunächst nicht geleistet, eigene Einstellungen mithin nicht verändert werden, ist eine soziale Isolation eine mögliche Folge, die auch in der Kinder- und Jugendliteratur thematisiert wird:
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995.
»" (...) Übrigens, Anne, in zwei Wochen hast du doch Geburtstag. Du solltest dir langsam überlegen, wen du einladen willst."
Anne nickte, obwohl sie jetzt schon wußte, daß sie niemanden einladen wollte. Die Leute aus ihrer Klasse bekamen alle solche Augen, wenn sie Jakob sahen. Starrten ihn an oder blickten weg, und beides war gleich schlimm. Nein, sie wollte niemanden von denen hier in der Wohnung haben. Wirklich nicht.« (S. 13)
Beispiel: "Katja und die Buchstaben", NAHRGANG 1995.
Ohne es in kurzen Dialogen darzustellen, gelingt es der Autorin, zu verdeutlichen, dass die Angst von Katjas Mutter, als funktionale Analphabetin entlarvt zu werden, sie und ihre Tochter in eine gesellschaftliche Isolation zieht. Mutter und Tochter leben unter dem Druck, gesellschaftklich nur nicht auffallen und nicht "anders" sein zu wollen. Die Folge ist eine selbsttätige Reduktion ihrer gesellschaftlichen Teilhabe und eine immer stärker werdende Isolation.
Das So-Sein von Personen, die mit ihrem Verhalten ungeschriebene Normen verletzen, wird - gemäss der Stigmatisierungstheorie GOFFMANs mit einem Stigma belegt. Ein Verhalten, dass nicht verstanden wird (im folgenden Beispiel: MCD, Hyperaktivität), wirkt "anders" und macht Angst. Um diese Angst zu kontrollieren, wird die Konfrontation mit Menschen, die sich entsprechend verhalten, vermieden:
Beispiel: "Zappelhannes", RUSCH 1993.
» "Sie hat es verboten, verstehst du?" sagt Sven heftig. Nein, Hannes versteht nicht. Svens Mutter hat verboten, Hannes zum Geburtstag einzuladen?
"Warum?" fragt Hannes.
Es dauert einen Augenblick, bis Sven antwortet. "Du bist immer so wild, hat meine Mutter gesagt." Hannes hört, wie Sven schluckt. "Sie hat gesagt, du bist so anders."
Hannes fühlt sich plötzlich, als ob er krank wäre.« (S.43)
Eine andere Ebene der Stigmatisierung kann die Etikettierung der eigenen Person durch die Identifizierung mit einem behinderten Familienmitglied sein:
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995.
»"Welche Anne meist du?" fragte der Leiter der Musikschule eben, und Lea antwortete: "Die mit dem behinderten Bruder."
Anne drehte sich auf dem Absatz um, rannte die Treppe hinunter, rannte aus dem Haus, rannte über die Straße. (...) Sie rannte einfach weiter, einfach geradeaus, bis sie nicht mehr konnte (...).
Die mit dem behinderten Bruder.
Das war alles, was Lea über sie sagen konnte?« (S. 63)
Bereits im eingehenden Defintionsversuch von "Behinderung" zu Beginn dieser Arbeit wurde deutlich, dass individuelle Schuldzuweisungen heute auch auf breiter Basis hinter ein gesellschaftliches determiniertes Verständnis von Behinderung zurückgetreten sind. Entsprechend wird das Schuldempfinden nur noch ebenso gelegentlich wie die nicht mehr weit verbreitete Auffassung von Behinderung als göttlicher Strafe thematisiert. Die Sichtweise von Behinderung als einem persönlichen Schicksal, mit dem man sich abfinden muss, dürfte heute angesichts bekannterer Ursachen von Schädigungen und verbreiteter Unterstützungmaßnahmen (z.B. familienentlastende Dienste) nicht mehr so verbreitet sein wie 1976, als VON BRACKEN diese Auffassung bei etwa 40% seiner Respondenten ermitteln konnte. In der erzählenden Kinder- und Jugendliteratur wird Behinderung nur sehr selten als persönliches Schicksal definiert, Möglichkeiten der Hilfe zur Bewältigung des Lebensalltags werden allerdings auch nur vereinzelnd genannt.
Beispiel: "Sei nett zu Eddie", FLEMING / COOPER 1998
» "Ihre Mitter sagte, sie solle nett sein zu Eddie. (...) Bloß weil er anders war.
"Ihre Mutter sagte, Gott habe ihn so gemacht. Aber Christina dachte, dass sich ihre Mutter dieses eine Mal vielleicht irrte. Gott macht keine Fehler, und wenn es überhaupt einen Fehler gab, dann war es Eddie." (ohne Seitenzahl)
Beispiel: "Die Reise zum Meer", GüNTHER 1994
» "Eine Zeitlang haben wir Schuldgefühle gehabt", erzählte er weiter.« (S. 57)
Beispiel: "Gänseblümchen für Christine", RüCK 1989
» "Gott ist schuld, nicht wahr, Juli? Er hätte machen können, daß Christinchen ein normales gesundes Kind geworden wäre. Oder nicht?« (...)
Alle sagen immer: Ich weiß es nicht, oder sie sagen gar nichts. Und doch ist Gott schuld daran. Vielleicht, ja wahrscheinlich, ganz sicher sogar hat er Mama und Papa bestrafen wollen, weil sie irgend etwas getan haben, was er nicht wollte. Aber was? Es muß etwas sehr Schlimmes gewesen sein, wofür sie eine solch strenge Strafe bekommen haben." (S.18)
" (...) Auf welcher einsamen Insel haben wir gelebt, daß wir die ganze Zeit geglaubt haben, Chrsitinchen sei unser Schicksal, unsere Strafe. (...)" « (S. 59f)
Bei der Untersuchung der Darstellung gesellschaftlicher Einstellungen und Verhaltensweisen konnten auch Werke gefunden werden, die die Diskussion über das Lebensrecht aufgreifen. Während HäRTLING diese Auffassung einer negativ besetzten Figur zuschreibt, so dass sich Leser/innen des Buches nicht mit dieser Ansicht identifizieren, müssen Rezipient/innen des idealistisch geprägten Buches von RüCK annehmen, dass einerseits das Leben mit einem schwerstbehinderten Kind auf Nächstenliebe und Mitleid basiert und dass andererseits das Leben des Kindes selbst höchstgradig leidvoll ist. In diesem Beispiel wird sehr deutlich, wie die Belastungen des eigenen Lebens auf das Kind projiziert werden, um dessen Leben als leidvoll zu deklarieren, bei dem der Tod des Kindes schließlich als Erlösung aufgefasst werden kann. Dass dies eine stark verbreitete Ansicht ist, macht die Untersuchung VON BRACKENs (1976) deutlich, nach der über 70% (!) zumindest bedingt der Ansicht sind, dass es gut wäre, wenn ein Kind mit einer geistigen Behinderung früh sterben würde.
Beispiel: "Das war der Hirbel", HäRTLING 211994
» (...) so sagte Herr Schoppenstecher, die Sach für die Freßsäck zu holen, und fügte hinzu, die fressen uns überhaupt noch die Haare vom Kopf! solche Kinder sind nichts wert. « (S. 44)
Beispiel: "Gänseblümchen für Christine", RüCK 1989
» Aber dann fällt mir ein, daß Mama immer gesagt hat, welche Erlösung es für Tinchen wäre, wenn sie sterben könnte, und Oma hat genickt.« (S. 9)
» Juli sagt (...), darüber, daß Chrsitinchen gestorben ist, könnte niemand weinen. Da müßte man eher lachen und sich mit ihr freuen, daß die Plagerei für sie nun beendet ist und sie ihren Frieden gefunden hat.
Das ist genau das, was ich auch schon gedacht habe, denn eigentlich war das Leben für Christinchen nicht so schön. Das haben ja auch Mama und Oma immer gesagt und Papa sowieso (...).« (S.20)
» "Siehst du nicht, daß sie viel mehr zu tun haben, als einem Kind ihre Liebe aufzudrängen, die es gar nicht will."
"Christinchen will Liebe", widersprach Mama. « (S. 31)
» "Ich tu`s", sagte Papa mit einer ganz fremden Stimme. Oder klang sie nur so fremd, weil ich sie schon so lange nicht mehr gehört hatte? (...)
"Wofür?" fragte Papa. "Wofür lebt sie eigentlich? Erkennt sie uns überhaupt? (...)"
"Aber warum denn nicht?" fragte Papa.
"Warum denn nicht? Wofür lassen wir sie am Leben?" (..)
"(...) Aber ich kann doch nichts dafür, es kommt aus mir, einfach so, diese furchtbaren Gedanken, obwohl ich sie gar nicht will. Hast du niemals solchen Gedanken?"
"Doch", sagte Mama, aber ich verbiete sie mir. « (S. 39ff)
» Juli sagt:"Nun ist Christinchen erlöst". Und dann sagte sie noch: "Eure Insel könnt ihr jetzt wohl verlassen, und überhaupt wird wohl irgendwie alles anders werden."« (S.60)
[Anmerkung: Christine starb eines natürlichen Todes].
Dass Lebensrechte von Menschen mit Behinderung nicht ausschließlich wegen des "lebensunwerten" Lebens, sondern aufgrund ökonomischer Kosten-Nutzen-Überlegungen in Frage gestellt werden, wird in der Kinder- und Jugendliteratur weitestgehend ebenso ausgeblendet wie die Verknüpfung solcher Überlegungen mit historischen Ereignissen in der Zeit des Nationalsozialismus. Gelegentlich finden sich kurze Stellen, in denen diese Bereiche angeschnitten werden.
Beispiel: "Drachenflügel", WELSH ³1995.
» "Vater sagt, die Nazis hätten ihn umgebracht, wenn er vierzig Jahre früher auf die Welt gekommen wäre. Weißt du, wie die Leute heute reden in der Straßenbahn?"«
(S. 89)
Die nationalsozialistischen Verbrechen an Menschen mit Behinderung werden detalliert in nur einem mir bekannten Kinder- oder Jugendbuch dargestellt. JUNGs (1996) Werk ist nicht unter dem Stichwort "Behinderung", sondern allgemein unter "Geschichte" katalogisiert. Das Besondere an diesem Buch ist, dass der Ich-Erzähler selbst körperbehindert ist, und sich sein neu erworbenes Wissen um die "Euthanasie" in seine Träume mischt, bis er die Angst so real erlebt, dass er Traum und Realität nur schwer auseinanderhalten kann.
Beispiel: "Auszeit oder Der Löwe von Kaúba", JUNG 1996
» Ich bin froh, daß ich heute lebe. Hätte ich damals gelebt, wäre ich heute ein Überlebender. Oder auch nicht. Damals war so einem wie mir der Tod zugedacht. Lebensunwertes Leben. Eigentlich bin ich aber auch so ein Überlebender: Ich habe meine Geburt überlebt. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Eltern, die diese Last nicht auf sich nehmen wollen; und es gibt Ärzte, die das wissen.
Ich lebe.
Obwohl - gentechnisch dürfte es mich gar nicht geben. Ich bin nicht so, wie man es sich wünscht. Und trotzdem denke ich oft, daß ich Glück habe. Ich lebe richtig gerne! « (S. 6)
Während JUNGs Verknüpfung von Historie und heutigen gesellschaftlichen Problemen den Schwerpunkt auf die NS-Zeit legt, betrachtet das weitgehend unbekannte Werk[16] von THüMINGER (1992) diese Verknüpfung insbesondere aus der Sicht heutiger Entwicklungen. In THüMINGERs Werk muss sich eine Familie entscheiden, ob sie ihr Kind mit Down-Syndrom zur Welt bringen will oder nicht. Die Autorin beschreibt darin die Auseinandersetzung der ganzen Familie mit der Thematik "Behinderung" wie auch mit den gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber behinderten Menschen, denen in Zukunft auch sie unterworfen sein würden.
Beispiel: Die Entscheidung", THüMINGER 1992
» "Ich war vorgestern in der Stadtbibliothek und habe mir Informationen über mongoloide Kinder geholt. Auch über behinderte Menschen im allgemeinen", sagt die Oma.
Da habe ich also das Wort "mongoloid" das erste Mal gehört.
"Bis man nicht selber mit so einem Problem konfrontiert ist weiß man ja nichts. Man kümmert sich einfach um nichts. Was übrigens ein Fehler ist."
"Daß derart geschädigte Menschen immer noch mongoloid genannt werden, geht auf den englischen Arzt Langdon Down zurück. Der hat ihm bekannte Schwachsinnszustände beschrieben und geglaubt, zu ihrer Kennzeichnung Rassenmerkmale verwenden zu können", fährt Oma fort zu erzählen. "Es ist ein rassistischer Ausdruck"
"Ich glaube, dieser Arzt hat im vorigen Jahrhundert gelebt, oder?", fragt der Papa.
Die Oma nickt. "Genau. Ich habe übrigens keine Ahnung gehabt, wie das Thema heute diskutiert wird. Habt ihr das gewußt, daß einige Wissenschaftler das ganze Problem auch unter dem Aspekt ´Kosten-Nutzen` betrachten?
Ich wundere mich, verstehe nicht, was das bedeuten soll. Auch die Mutti schüttelt den Kopf.
"Nun, wenn die Wissenschaft schon so weit ist, daß man die Behinderung bereits im Mutterleib erkennen kann, sollten solche Kinder, die nur Geld kosten, aber keinen Nutzen bringen, gar nicht auf die Welt gebracht werden."
Nun braust die Mutti auf. "Was redest du daher?"
"Nun, so ist es nun einmal, Monika. Ich habe gelesen, daß eine Dissertation über den volkswirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Nutzen von vorgeburtlichen Untersuchungen den Gesundheitsökonomiepreis erhalten hat. In Deutschland. Aber bei uns wird in Fachkreisen ähnlich diskutiert."
Ich verstehe zuerst überhaupt nicht, was die Oma damit meint. Nach einigem Hin und Her erst wird mir klar: Manche Leute sind tatsächlich davon überzeugt, daß es besser ist, wenn behinderte Kinder nicht auf die Welt kommen, weil sie gepflegt und betreut werden müssen, was eben Geld kostet. (...)
"Du hast recht, Mama", sagte der Papa zur Oma. "Probleme, die behinderte Menschen haben könnten, interessieren einen nicht, man denkt nicht darüber nach, und plötzlich betrifft es die eigene Familie."
Die Oma nickt. "Ich finde solche Kosten-Nutzen-Rechnungen, auf Menschen bezogen, furchtbar unmenschlich. Einfach entsetzlich. Mich erinnert das an die Nazizeit. Damals war ich ja noch ganz jung, aber da haben wir in der Schule so ähnliche Sachen gelernt. Ich habe geglaubt, das ist nun vorbei, aber siehe da, nichts ist vorbei."
Da habe ich mich auch erinnert, nämlich an das Flugblatt, das die zwei Skins vor unserer Schule verteilt haben. Ich erzähle das (...).« (S. 32f)
Die Theorien, die die Soziale Reaktion auf Menschen mit Behinderung zu erklären versuchen, führen als gemeinsame Kategorie die "Angst vor Behinderung" an. Dass eine verdeckte Angst Hintergrund für viele ablehnende Reaktionen sein kann, wird leider so gut wie nie beschrieben. Es muss davon ausgegangen werden, dass dieser Zusammenhang vielen Autor/innen nicht explizit bewusst ist.
Eine der seltenen Ausnahme stellt TVEIT dar, der die Leser/innen durch die Identifikation mit der Hauptfigur Anteil haben lässt am langsamen Begreifen der gesellschaftlichen Hintergründe.
Beispiel: "Mein kleiner großer Bruder", TVEIT 1991
» Dann hörte ich die Frau mit lauter Stimme sprechen: "Ich habe gedacht, daß man hier in aller Ruhe sein Essen zu sich nehmen könnte. Aber es sieht nicht so aus. Komm, laß uns gehen!"
Der Mann hat nichts gesagt. Beide sind aufgestanden. "Wie kann man so einen mit ins Restaurant nehmen", sagte die Frau. "Sie könnten doch etwas Rücksicht auf andere nehmen!" (...)
Es hat immer noch in mir gekocht. Vater und Mutter aßen weiter, als ob nichts passiert wäre. Wie konnten sie nur so ruhig bleiben?
"Was für eine beschissene Ziege", sagte ich.
Vater schaute mich mit strengen Augen an.
"So was darfst du nicht sagen", sagte er.
"Das muß ich doch", sagte ich erzürnt. "Sie war dumm!" Vater legte Messer und Gabel beiseite.
"Du weißt, was Kjell gemacht hat, war falsch", sagte er. "Es ist also kein Wunder, daß sie ärgerlich wurde."
"Es war doch nicht nötig zu ... sagen, daß wir Kjell nicht ins Restaurant hätten mitnehmen sollen", sagte ich.
"Nein, das war nicht nötig. Aber eigentlich tut sie mir ein bißchen leid", sagte Vater.
"Die dumme Frau?" fragte ich ganz überrascht. Mir tut sie kein bißchen leid!" (...)
"Vielleicht hat sie noch nie Kontakt mit Leuten wie Kjell gehabt", sagte Vater. "Stell` dir vor, wir würden Kjell heute zum ersten Mal sehen ...
Dann hätten wir uns vielleicht auch dumm benommen. Sie war wohl unsicher. Und vielleicht auch ein bißchen ängstlich."
"Man braucht doch keine Angst vor Kjell haben", sagte ich.
"Wenn uns etwas begegnet, das wir nicht kennen und nicht verstehen, dann werden wir oft ängstlich", sagte Mutter. "Und wenn wir ängstlich und unsicher sind, werden wir oft böse. Das ist eine Möglichkeit, seine Angst loszuwerden."
Ich schwieg und dachte darüber nach. Sie hatten wahrscheinlich recht.
"Glaubt ihr ... glaubt ihr, daß sie böse wurde, weil sie Angst hatte?" fragte ich.
"Ja, das glaube ich", sagte Vater und fing wieder an zu essen.
"Es ist wichtig, daß wir das kennenlernen und zu verstehen versuchen, wovor wir Angst haben", sagte Mutter.
Ich mußte noch mal nachdenken. Vielleicht hatte ich doch nicht ganz verstanden, was sie meinten. Aber ich fühlte, wie ich innerlich ruhiger wurde.« (S. 44ff)
Die Bedeutung der Medien als Sozialisationsfaktor ist heute allgemein anerkannt und wird hoch eingeschätzt (SCHORB / MOHN / THEUNERT 1991). Besonders bei Kindern und Jugendlichen wird von einem verhältnismäßig hohen Grad der Beeinflussbarkeit ausgegangen, da bei ihnen Medien bzw. die von ihnen transportierten Inhalte und damit auch Werte, Normen, Einstellungen und Anschauungen, in den Prozess der affektiven und kognitiven Entwicklung eingreifen. Inwieweit (Massen-)Medien als Sozialisationsfaktoren im Vergleich zu anderen Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule oder peer-group abschneiden, ist heute noch weitgehend unbekannt. Auf jeden Fall lassen sich Medien laut SCHORB / MOHN / THEUNERT (ebd, 495) "als fremdbestimmte Instrumente der Sozialisation nutzen, als Hilfsmittel der Enkulturation, also der Übertragung des in einer Gesellschaft für verbindlich erachteten Wissens- und Normenkanons."
Die Annahme der frühen Medienwirkungsforschung, bei der Medienwirkung handele es sich um einen einseitigen Beeinflussungsprozess, wird heute als widerlegt betrachtet. Medien sind nicht nur gesellschaftliche Einflussgrößen, sondern unterliegen ebenso einerseits gesellschaftlichen Vorgaben, die festlegen, in welchem Ausmaß eine mediale Artikulation möglich ist, andererseits der selektiven Auswahl der Rezipienten, die dadurch wie auch durch ihre innerpsychische Verarbeitung medialer Inhalte die Wirkung von Medien mitbestimmen. Medien, Gesellschaft und Individuum stehen somit in einem Wechselverhältnis, in dem jeder Faktor den anderen beeinflusst (vgl. ebd.).
Die vier folgenden, in Fragen der Medienwirkung immer wieder auftauchenden Hypothesen, können aufgrund ihrer Linearität die Medienwirkung nur begrenzt erklären:
-
Stimulationshypothese
-
Durch bestimmte Darstellungen kann ein entsprechendes Verhalten der Rezipienten stimuliert werden, indem sie das beobachtbare Verhalten imitieren.
-
Katharsishypothese
-
Ein populärwissenschaftlicher Ansatz der Darstellung beabsichtigt durch die emotionale und moralische Überwältigung des Betrachters / der Betrachterin durch Grauen und Entsetzen beim Rezipienten eine katharsische (reinigende, abreagierende) Wirkung zu erzielen.
-
Inhibititionshypothese
-
Entsprechend beobachtete Verhaltensweisen werden von Rezipienten deswegen nicht dargestellt, weil die negative Sanktionierung dieses Verhaltens beobachtet wurde.
-
Habitualisierungshypothese (auch: Nullhypothese)
-
Aufgrund der eintretenden Gewöhnung an das beobachtete Verhalten findet keine spezifische Wirkung auf die Rezipienten statt.
Neuere Ansätze gehen davon aus, dass sozialisationsrelevante Effekte des Medienkonsums in Form von Handlungsorientierungen nur nachweisbar seien, wenn medial vermittelte Botschaften mit entsprechenden Alltagserfahrungen der Rezipienten korrespondieren oder wenn sie in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu ihrer Realität stehen. (SCHORB / MOHN / THEUNERT 1991). Bezogen auf Einstellungen zu Menschen mit Behinderung würde dies bedeuten, dass ein gebildeter Einstellungshintergrund als stabile, fixierte Einstellungsstruktur eines Individuums durch medial dargebotene Botschaften nur verstärkt, nicht aber verändert werden kann. Ist noch kein stabiler Einstellungshintergrund gebildet, werden rezipierte Botschaften adaptiert. Insofern kommt - die bereits nachgewiesene, auf Ablehnung ausgerichtete, gesellschaftliche Einstellungsstruktur zugrunde gelegt - der negativen Darstellung von behinderten Menschen in Medien zum einen die Rolle des Verstärkers dieser gesellschaftlichen Einstellungen, zum anderen die Orientierung auf eben diese Einstellungen zu, während positive Darstellungen lediglich als Orientierung für die Personen dienen können, die noch keinen fixierten Einstellungshintergrund gebildet haben. Eine Veränderung bestehender Einstellungen allein durch medial verschlüsselte Botschaften scheint nicht realistisch zu sein.
Die frühen ideologiekritischen Ansätze (z.B. ADORNO) bieten in bezug zur vorliegenden Arbeit wertvolle Anregungen, indem sie sozialisationsrelevante Effekte der Medien insbesondere darin sehen, dass Medien Ideologien im Bewusstsein der Rezipienten verfestigen und so einen Beitrag zur Stabilisierung gesellschaftlicher Strukturen leisten. In neueren Ansätzen, die sich auf die sog. Frankfurter Schule um ADORNO berufen, werden diese Aussagen dahingehend ergänzt, dass davon ausgegangen werden muss, dass massenmedialen Aussagen durch das Aufdecken des Ideologiegehaltes und der Manipulationsmechanismen entgegengewirkt werden kann. HOLZER (vgl. SCHORB / MOHN / THEUNERT 1991, 503) misst den Massenmedien okönomisch wie ideologisch Bedeutung für die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems zu.
Dieser mediale Ideologietransport (vgl. DAHRENDORF 1979) wie auch die durch bestimmte Mechanismen der Darstellung intendierte Funktion der Aufrechterhaltung bestehender Strukturen scheinen ebenso im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur nachvollziehbar zu sein. Auf Kinder- und Jugendbücher bezogen hat die Lesewirkungsforschung jedoch ebenso feststellen müssen, dass einer Beeinflussung der kindlichen Einstellung allein durch Lesetexte klare Grenzen gesetzt sind (SAHR 1981). Ihre Wirkung würde dann am größten sein, wenn - bei Annahme einer entsprechenden Konsistenz der einzelnen Komponenten - alle drei Komponenten der 3-Ebenen-Theorie angesprochen werden. Ein Text sollte also die kognitive, die affektive sowie die konative Komponente ansprechen. Der Prozess, der hinter der Einstellungsveränderung steht, ist der der Identifikation eines Rezipienten mit der Hauptfigur des Textes, wobei diese protagonistische Figur eher durch die Erzählung als durch Beschreibung charakterisiert wird. Obwohl Texte die Bereiche "Wissen" und "Fühlen" durchaus zu behandeln wissen, führen Änderungen im kognitiven und im affektiven Bereich nicht notwendigerweise zu Veränderungen im Handlungsbereich. Neue Fakten bzw. ein erhöhtes Wissen, wie es durch einige der Sachbücher vermittelt wurde, haben nur Einfluss auf unstrukturierte, unklare Situationen. Auf Menschen, die bereits einen stabilen Einstellungshintergrund gebildet haben, besitzen sie nur sehr geringen Einfluss. Das Verhalten eines Menschen wird - wie bereits festgehalten wurde - um so stärker von einer Einstellung beeinflusst, desto wichtiger diese Einstellung für die Orientierung und den Lebenszusammenhang derjenigen Person ist. Um Wirkungen im Handlungsbereich zu erzielen, erscheint es daher notwendig, solche Lebenszusammenhänge herzustellen, in denen interpersonelle Auseinandersetzungen möglich werden, beispielsweise indem direkte Kontakte zu den Objekten des Textes (hier: Kontakte zu Menschen mit Behinderung) hergestellt oder modellhafte Interaktionen (Rollenspiele) durchgeführt werden, falls diese Objekte zwecks eines direkten Kontaktes nicht zur Verfügung stehen bzw. entsprechende Kontakte durch gesamtgesellschaftliche Strukturen systematisch verhindert werden.
Eine weitere Einschränkung der Wirkungsmöglichkeiten erfahren Bücher dadurch, dass an eine Rezeption Vorbedingungen geknüpft sind. Zum einen müssen Bücher gelesen werden, zum anderen kann sich die kommunikative Struktur des Werkes erst durch die Beteiligung des Lesers / der Leserin entfalten. Nun ist bekannt, dass es vielen Kindern und Jugendlichen Mühe macht, schriftsprachlich codierte Bedeutungen in eigene Vorstellungen umzusetzen. Im Zuge der sich verändernden kindlichen Lebensbedingungen (Schlagwort: "Veränderte Kindheit") stehen Kinder- und Jugendbücher heute neben einer wachsenden Anzahl anderer Medien. Die Folgen dieser Mediatisierung können hier keinesfalls auch nur ansatzweise beschrieben werden. Deutlich ist jedoch, dass problemorientierte Kinder- und Jugendliteratur andere Anforderungen an Kinder und Jugendliche stellen als Darstellungen omnipotenter Helden in audiovisuellen Medien. SCHöN (angeführt nach B. HURRELMANN 1992) versucht verschiedene Niveaus der Verstehensfähigkeit zu beschreiben. Danach sind Betroffenheit und die Substitution (der Vorgang der Illusionsbildung, in dem das Ich die Teilnahme am fiktiven Geschehen quasi durch eine Selbstversetzung der eigenen Person in die literale Handlung realisiert) Voraussetzung für affektive Beziehungen zu literalen Figuren. Die literale Erfahrung im Kindesalter ist eine wesentliche Variable bei der Frage nach den Wirkungschancen von Kinder- und Jugendliteratur.
Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Kinder- und Jugendbücher einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es um die Herausbildung von positiven Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung geht, indem sie durch die Identifikation mit dem Protagonisten ein Probehandeln ermöglichen, bei dem Verhaltensmuster sozialer Interaktion sprachlich, also gedanklich vorweggenommen werden (ELBRECHTZ 1979). So weist SAHR (1983) am Beispiel des Buches "Die Vorstadtkrokodile" von MAX VON DER GRüN nach, dass Einstellungen durch die unterrichtliche Behandlung eines Jugendbuches verändert werden können, sofern möglichst günstige Ausgangs- und Randbedingungen (kaum Sachkenntnis über die zu behandelnde Sache sowie keine festen Einstellungshintergründe) die Wirkungschancen eines Textes positiv beeinflussen.
PROCHNOW / MüHL (1996) relativieren den "Enthusiasmus von Experteren und Parktikern in bezug auf den Einfluß von Kinder- und Jugendliteratur auf die Einstellungen von nichtbehinderten Schülern/Schülerinnen gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung" (ebd., 216). In ihrem Versuch konnten sie lediglich einen begrenzten Einfluß auf die kognitive Komponente der Einstellung nachweisen; dies ist jedoch aufgrund der Struktur ihres Vorgehens auch zu erwarten gewesen. Zudem verwenden sie einen sehr engen Lernbegriff, bei dem Einstellungen vor und nach einer "Behandlung des Buches im Unterricht" per Interview gemessen wird. Aussagen über Veränderungen des konkreten Verhaltens der Einzelnen erlauben solche Untersuchungen m.E. nicht.
Ich gehe davon aus, dass methodische Unterschiede bei dem unterrichtlichen Einsatz eines Buches von Bedeutung auf des Ergebnis einer Einstellungsveränderung sein wird. Dieses wird - zusammen mit einem Resumee der gesamten Arbeit - in der folgenden Schlussbetrachtung etwas genauer ausgeführt werden.
Wenn ich an behinderten Personen vorbeigehe, habe ich so ein komisches Kribbeln im Bauch. Meistens sehe ich nach und denke: "Sieht der aber komisch aus. Die Behinderten müssen arm sein."
Doch in kann mir keinen Überblick schaffen, weil ich noch nie mit einem Behinderten zusammen war. Ich würde es besser finden, wenn Behinderte hier selbständig so leben könnten wie Nichtbehinderte. Natürlich brauchen wir Geld dazu. Das ist meine Meinung. Und ich hoffe aufrichtig, daß dieser Brief einmal Wirklichkeit wird.
Susanne, 9 Jahre
(aus: FRANZ-JOSEPH HUAINIGG:
"Was hat`n der? Kinder über Behinderte."
Klagenfurt 1993. S. 92f & Rückcover)
Die von ZIMMERMANN (1982) und AMMANN U.A. (1987) angeführten Stereotypen der Darstellung haben meiner Ansicht nach heute keine Gültigkeit mehr. Die Definition von Behinderung als etwas Böses oder als Strafe wird in den heutigen Werken ebenso wenig verwendet wie die historisch später einsetzende Charakterisierung von behinderten Menschen als unterwürfige "Musterkrüppel" oder die unrealistischen Darstellungen von plötzlichen "Heilungen".
Im ersten Teil der Arbeit ist deutlich geworden, dass ablehnende Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung nicht anders als ein gesellschaftlich determiniertes, in ökonomischen Zusammenhängen stehendes Produkt auf der Basis geltender Herrschafts- und Normenstrukturen verstanden werden kann.
Bei der Beurteilung der Abbildung dieser gesellschaftlichen Sachverhalte in Werken der Kinder- und Jugendliteratur kann eine historische Entwicklung festgestellt werden. Während vor etwa 20 Jahren im Mittelpunkt stand, welche Beeinträchtigung ein Kind "hat", liegt das Augenmerk heute stärker auf dem Kind selbst, seinem Leben und seinem Erleben. Dieses Erleben beinhaltet die Behinderung in ihrer Ausprägung als organische und als soziale Kategorie.
Die gesellschaftlichen Reaktionen wurden hauptsächlich in Werken thematisiert, in denen Behinderungsformen aufgegriffen wurden, die von der Gesellschaft nicht verstanden werden. Dies sind in der Regel geistige Behinderungen sowie Verhaltensweisen, die von der sozialen Norm abweichen. Dies entspricht den geschilderten Ergebnissen der sozialpsychologischen Untersuchungen, die zu dem Schluss kommen, dass die soziale Akzeptanz desto geringer sein wird, je weniger seine Beeinträchtigung oder sein Verhalten verstanden wird.
Das, was sich Menschen nicht erklären können, ist fremd und macht Angst. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde dargestellt, dass "Angst" die zentrale Kategorie darstellt, mit der gesellschaftliche Reaktionen auf Menschen mit Behinderung erklärt werden kann. Die quantitative Zunahme der Werke, in denen Menschen mit geistigen (Schwerst-) Behinderungen geschildert werden und die immer häufiger werdende Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Ablehnungs- und Aussonderungstendenzen können als ein Indiz dafür gewertet werden, dass die Autor/inn/en von Kinder- und Jugendbüchern erkannt haben, dass insbesondere die Verhaltensweisen, die nicht verstanden werden können, Auslöser für ablehnende Reaktionen sind. Sie versuchen daher, durch das oben beschriebene Vorgehen mit dem "Fremden" zu konfrontieren, um das Empfinden von Angst und die folgenden Ablehnungsreaktionen zu erschweren.
Auffällig ist jedoch auch, dass z.B. sozialdarwinistische Auffassungen, Kosten-Nutzen-Diskussionen oder die durch eine Behinderung verminderte menschliche Arbeitskraft und deren mindere kapitalistische Verwertung in Kinder- und Jugendbüchern fast vollständig ausgeklammert bleiben.
Dies ist zu einem Teil dadurch zu erklären, dass diese Thematiken nicht unbedingt dem Erfahrungs- und Informationsfeld der meisten Kinder und Jugendlichen entstammen, so dass die Autor/innen auf eine Auseinandersetzung mit ihnen weitestgehend verzichten. Möglich ist indes auch, dass die Autor/innen in ihren eigenen Einstellungen dem sog. "falschen Bewusstsein" unterliegen oder sich dieser Sachverhalte selbst nicht bewusst sind.
Kinder- und Jugendbuchautor/innen stellen keinen repräsentativen Ausschnitt der gesellschaftlichen Einstellungsstruktur dar. Als Träger sozialer Einstellungen werden sie jedoch durch gesellschaftliche Einstellungen geformt. Daher kommen in ihren Werken eigene, soziale Einstellungen zum Tragen, die die Darstellung von Menschen mit Behinderung beeinflussen.
Autor/innen sind, da sie in konkreten historischen Situationen leben, immer von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werten beeinflusst. Entweder schließen sie sich den gängigen Auffassungen an oder sie stellen sie in Frage. Ihre literarischen Produkte sind also entweder Spiegelbild von Normen und Werten der entsprechenden Zeitepoche oder sie enthalten Kritik an bestehenden Verhältnissen. Die Darstellung von Menschen mit Behinderung in Medien ist somit raum-zeitlich variabel, sie ist abhängig vom Welt- und Menschenbild einer Zeit und einer Kultur. Dabei fällt auf, dass viele positiv auffallende Werke von Autor/innen verfasst wurden, die entweder selbst Träger einer Behinderung sind (z.B HUAINIGG) oder selbst einen positiven, emotionalen Kontakt zu Menschen mit Behinderung erlebt haben (z.B. WELSH, HäRTLING, VON DER GRüN, GäRTNER und vermutlich andere mehr). Der Zusammenhang von emotional positiv erlebten Kontakten und positiven Einstellungen ist ersichtlich.
Kinder- und Jugendliteratur als eine Ausprägung medialer Normenvermittlung sind nicht zu isolieren aus dem gesellschaftlichen Gesamtkontext, dem sie entstammen, auf den sie sich beziehen und auf den sie einwirken. Damit besitzen Kinder- und Jugendbücher neben der literalen und der pädagogischen auch eine politische Funktion. Als Teil der Gesellschaft kann sie gesellschaftliche Verhältnisse verändern. In Anlehnung an BASAGLIA ist damit jedes Kinderbuch auch politisch. Diese Funktion muss berücksichtigt und reflektiert werden. Darstellungen von Menschen mit Behinderung lassen somit einen Schluss über die politische Aussage der Autor/innen zu.
Die Nichtbeachtung einzelner Momente isolierender Bedingungen, wie z.B. die weitestgehende Ausklammerung schul-integrativer Bestrebungen, wirkt verfestigend auf bestehende Strukturen. Herrschende Verhältnisse werden in diesen Fällen nicht kritisch hinterfragt und dadurch automatisch tradiert. Nicht die Verhaltensweisen sog. behinderter Menschen sind das eigentliche Problem, sondern die Verhältnisse, die diese Verhaltensweisen produzieren. Diese Erkenntnis wird innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur nach meinen Beobachtungen lediglich auf einer personalisierten sozialen Mikro-Ebene thematisiert, d.h. Einstellungen werden zumeist in Form individueller Verhaltensweisen einzelner Menschen dargestellt, wobei gesellschaftliche Strukturen, die den Boden dieser Verhaltensweisen darstellen, weitestgehend unberücksichtigt bleiben.
Auffällig ist, daß es sich bei den Werken, die Mechanismen der gesellschaftlichen Ausgrenzung behinderter Menschen kritisieren - sieht man von den frühen Werken von HäRTLING und KLEE ab - vor allem um neuere Werke handelt, die in den letzten Jahren erschienen sind. Auch wenn Aspekte der schulischen Integration und der Problematik vom Kosten-Nutzen-Rechnungen vom überwiegenden Teil der Werke noch ausgeblendet bleiben, kann dies als Zeichen einer sich verändernden Einstellungsstruktur interpretiert werden. Es wäre wünschenswert, wenn diese Beobachtung und die damit verbundene These mittels standardisierter Verfahren (z.B. inhaltsanalytisch an einer größeren Anzahl von Werken oder mit Hilfe halb-standardisierter Interviews mit den Autor/innen) empirisch überprüft werden würde, was innerhalb dieser Arbeit aus Kapazitätsgründen nicht geleistet werden konnte.
Die Sachbücher der 70er Jahre versuchten, durch die Schilderung von Lebensalltagen kognitives Wissen zu vermitteln. Die Belehrungssucht vieler Texte aus diesen Jahren erscheint aus heutiger Sicht zweifelhaft (B. HURRELMANN 1992). Heute werden Menschen mit Behinderung hauptsächlich in Erzählungen dargestellt. In ihnen werden verstärkt auch emotionale Aspekte angesprochen und den Leser/innen ein modellhaftes Probehandeln ermöglicht. Viel wichtiger als die Ebene der übermittelten Textinhalte ist nach B. HURRELMANN die Ebene der Einübung sozial-emotionaler Kommunikation. Der Zugewinn an literarischer Differenziertheit ermöglicht einen größeren Spielraum für die Imaginationsfähigkeit junger Leser/innen. "Gesellschaftliches ist damit nicht abwesend, es bildet nicht das Thema, eher das Erfahrungsmuster der Geschichten" (ebd., 11). Dieses Vorgehen erscheint richtig, beachtet man die Ergebnisse der Sozialpsychologie, nach denen eine Einstellungsveränderung nur erreicht werden kann, wenn alle Komponenten einer Einstellungen angesprochen werden, eine reine Wissensvermittlung mithin nicht ausreicht.
In den Werken der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur kann ein Modell beobachtet werden, nach dem zu Beginn des Buches gesellschaftliche ablehnende Haltungen geschildert werden. Im Verlauf der literalen Handlung verändert sich die Einstellung einer oder mehrerer Personen durch den positiv erlebten Kontakt. Durch ein erzählliterales Vorgehen wird versucht, den jungen Leser/innen durch den fiktiven Kontakt sowohl mit der beeinträchtigten Person als auch mit Personen, die sie umgeben, ein Probehandeln zu ermöglichen, das durch Modelllernen in das reale Verhalten der Leser/innen übernommen werden soll.
Wichtig erscheint mir dabei, neben dem emotionalen Aspekt den konativen Bereich hervorzuheben, da dieser in der Regel außerhalb der Rezeption von Kinder- und Jugendbüchern liegt. Daher erscheinen die Möglichkeiten der Kinder- und Jugendliteratur, zu einer positiven Einstellungsbildung beizutragen, stark begrenzt, solange gesellschaftlich tradierte Segregationsmechanismen (z.B. getrennte Schulbesuche) nicht aufgegeben werden. Wichtiger als jeder mediale Kontakt mit behinderten Figuren ist der persönliche Kontakt mit behinderten Menschen. Dennoch können Kinder- und Jugendbücher helfen, die Unsicherheit im Umgang mit behinderten Menschen zu überwinden, indem sie ein Handlungsmodell anbieten, an dem sich junge Leser/innen orientieren können.
Die Möglichkeit einer solchen Orientierung ist m.E. in Abhängigkeit von der didaktischen Aufbereitung des Literatur-Einsatzes zu sehen. Bisherige Versuche (vgl. PROCHNOW / MüHL 1996) unterstanden einem recht engen Lernbegriff: Auf die rein sprachliche Erfassung vorhandener Einstellungen folgte der m.E. stark kognitiv ausgerichtete 9- bzw 14-stündige Unterrichtsversuch, in dem ein literales Werk interpretierend und vorwiegend sprachlich angegangen wurde. Abschließend wurden die Einstellungen erneut in einem Interview-Verfahren ermittelt. Angesehen von der Gefahr der Verfälschung durch sozial erwünschte Antworten kann m.E. von diesen Aussagen kaum auf ein tatsächliches Verhalten geschlossen werden. Die Feststellung, dass der Einfluss des Unterrichtsversuches überwiegend auf die kognitive Komponente, also auf die reine Wissensvermittlung begrenzt blieb (ebd., 216), ist m.E. bereits durch das Untersuchungssettting mitbedingt gewesen und hätte gar vorausgesagt werden können.
Es erscheint als eine Farce, wenn "die Behandlung eines Kinderbuches zum Thema »geistige Behinderung« im Unterricht von Grundschulklassen einen Beitrag zur Vorbereitung nichtbehinderter Kinder auf mögliche Kontakte mit Kindern mit geistiger Behinderung leisten" soll, "indem Vorstellungen über sie positiv beeinflußt" werden (PROCHNOW / MüHL 1996; Hervorhebungen SN). Was Kinder benötigen, um positive Einstellungen zu entwickeln, ist die Handlung, also die konkrete Auseinandersetzung mit behinderten Menschen, aber keine Be-Handlung eines Kinderbuches zur Vorbereitung evtl. möglicher Kontakte.
Werden Kontakte zu behinderten Kindern durch gesamtgesellschaftliche Strukturen erschwert, bietet sich m.E. eine Möglichkeit durch eine handelnde Unterrichtsgestaltung, wie sie im "handlungs- und produktionsorientierten Literaturansatz" (vgl. WALDMANN 1984, HAAS / MENZEL / SPINNER 1994; in Einzelaspekten auch: ALTENBURG 1991, FORYTTA 1991, MENZEL 1994; überblicksartig auch: NICKEL 1997) beschrieben wird. Eine Untersuchung mit einem solchen Setting soll möglicherweise Thema einer weiteren Arbeit des Verfassers werden, weswegen der Ansatz abschließend an dieser Stelle kurz skizziert werden soll.
Aus der Rezeptionsforschung ist schon länger bekannt, dass Rezeption ein aktiver und produktiver Vorgang ist. Auch die Literaturdidaktik nimmt dieses seit etwa 15 Jahren in ihrem "handlungs- und produktionsorientierten Literaturansatz" auf, einem Ansatz, der die traditionelle Textanalyse und -interpretation ergänzt, indem er die Leser/innen auch in ihrem Empfinden, ihren Gefühlen und ihrer Fantasie anspricht. Bisher herrschte das interpretierende Gespräch über den Text vor, kaum einmal wurde etwas mit einem Text getan. Zunehmend wird erkannt, dass an einem Text didaktisch gesehen nicht mehr allein seine Bedeutung wichtig ist, also das, was er ausdrücken will, sondern viel mehr das, was er macht oder mit sich machen läßt. Es geht - vereinfacht gesagt - nicht mehr darum, "was der Dichter uns wohl sagen will", sondern vielmehr darum, was der Text in uns bewirkt, was er in uns auslöst.
Der Doppelbegriff "handlungs- und produktionsorientiert" meint einerseits das praktische Handeln, also den aktiven Umgang mit gegebenen Texten, andererseits das produktive Erzeugen von neuen Texten, Textteilen oder Textvarianten. "Mit dem Begriff ´handlungsorientiert` ist dementsprechend der Aspekt des tausend Möglichkeiten einschließenden bildlich-illustrativen, musikalischen, darstellenden und spielenden Reagierens auf Texte bezeichnet; der Begriff ´produktionsorientiert` meint dagegen die stärker das kognitive Vermögen beanspruchende Erzeugung von neuen Texten" (ebd., 18).
Lesen als Rezeption ist aber weit mehr als nur kognitive Übernahme einer im Text enthaltenen Botschaft. Der Leser / die Leserin entnimmt beim Lesen dem Text nicht nur etwas sondern gibt eigene Erfahrungen und Gefühle hinzu. Erst dadurch entsteht der persönliche Sinn, den der Text für den Einzelnen hat. "Sinn ist nicht einfach etwas, das im Text enthalten ist, das sozusagen an den Wörtern und Sätzen und Textteilen haftet und automatisch und mechanisch mit ihnen übernommen wird, sondern Sinn ist Geschehen zwischen Text und Leser innerhalb eines übergeordneten Sinnsystems" (WALDMANN 1984, 101). "Verstehen ist somit nicht das bloße Zurkenntnisnehmen dessen, was da steht, sondern das Aufnehmen in umfassende Sinnzusammenhänge" (ebd., 102). Das Gelesene muß in das persönliche Sinnsystem eingeordnet werden, wobei sich das Sinnsystem modifiziert und aktualisiert. Lesen als elementare, schriftkulturelle Tätigkeit entspricht somit einer Sinnkonstruktion, d.h. der Sinn eines Textes wird vom Leser / von der Leserin mitgeschaffen.
Lesen trägt demnach dazu bei, "soziale Phantasie" (WALDMANN) zu entwickeln, indem er dem Leser / der Leserin die Möglichkeit eröffnet, vorstellungsmäßig neue Erfahrensbereiche zu erkunden. Die Identifikation mit der fiktionalen literalen Figur erlaubt gedankliches Probehandeln, das Vorwegnehmen realer Situationen. Dadurch können Texte Hilfe bieten zur Ich-Findung und Wertorientierung. Die Leser/innen können im Schutz der Fiktion (versteckt hinter den Handlungsträgern) über sich selbst reden, ohne sich preis zu geben.
Ich gehe davon aus, dass Kindern erst mit einem handlungs- und produktionsorientierten Vorgehen die Möglichkeit zu einem Probehandeln in interagierenden Situationen gegeben wird und dass solche Erfahrungen auch auf die emotionale und die konative Ebene einer Einstellung wirken, die als Variable der Sozialen Reaktion wirksam werden kann.
Für die weitere Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur ist zu hoffen, dass Autor/innen einerseits Menschen mit Behinderung als in eine integrierte Persönlichkeiten darstellen, ohne das Phänomen "Behinderung" in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken und zu problematisieren. Andererseits wäre es erstrebenswert, wenn mehr Autor/innen bei ihrem Bestreben nach Identifikation und Empathie gegenüber behinderten Menschen verstärkt Momente der sozialen Makroebene einbeziehen, um den gesamten Bedingungskomplex für Vor-Urteile und Isolation umfassend und adäquat in ihren Werke abbilden zu können. Ausgrenzende Verhaltensweisen beschränken sich nicht auf Anstarren oder Mitleidsäußerungen. Die Basis der Segregation ist in gesamtgesellschaftlichen Zusamenhängen und ihren volkswirtschaftlichen, politischen und philosophischen Hintergründen zu suchen. Die Aspekte Kosten-Nutzen-Denken, segregierendes Schulsystem u.v.m. sollten daher in Zukunft stärker Berücksichtigung in Kinder- und Jugendbüchern finden.
"Alles wäre leichter, wenn Tag für Tag, in der Schule, in der Arbeit, in der Freizeit, immer und überall behinderte Menschen mit uns leben würden und wir mit ihnen. Als Selbstverständlichkeit. Aber dazu müßte vieles anders sein. (...) Da braucht es einen nicht zu wundern, daß man im täglichen Leben so wenigen behinderten Menschen begegnet." (THüMINGER: "Die Entscheidung", 1992, S. 75).
Wie wahr.
Anschrift des Verfassers: s.nickel@iname.com
[16] B. HURRELMANN (1992) beobachtet auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt neben einer steigenden Zahl von Neuerscheinungen eine wachsende Orientierung des Marktes an Novitäten. "Immer mehr Titel erscheinen nur kurz, um ebenso schnell zu verschwinden. Offenbar ist es Ziel der Verlage geworden, einen großen Teil der Auflage eines neuen Buches gleich nach dem Erscheinen abzusetzen. Weniger gängige Titel werden immer rascher wieder vom Markt genommen und durch neue ersetzt. Auf diese Weise beschleunigt sich der Umschlag von Büchern. (...). Genau dieser Mechanismus ist es dann auch, der dafür sorgt, daß wichtige Bücher sich nicht durchsetzen können, weil sie gar nicht wahrgenommen werden" (ebd., 9)
Inhaltsverzeichnis
Altenburg, Erika: Wege zum selbständigen Lesen. 10 Methoden der Texterschließung. Cornelsen: Frankfurt / Main 1991
Ammann, Wiebke / Backofen, Ulrike / Klattenhoff, Klaus (Hrsg.): Sorgenkinder - Kindersorgen. Behindert-werden, behindert-sein als Thema in Kinder- und Jugendbüchern. Bibliotheks- und Informationssystem der Univ. Oldenburg, 1987
Bächthold, Andreas: Soziale Reaktionen auf behinderte Jugendliche. Einstellungen und gesellschaftliche Hintergründe. In: Geistige Behinderung, Heft 1/1984, S. 30-39.
Bahr, Albrecht-Johannes: Zum Vorurteilsverhalten von Grundschülern gegenüber Sonderschülern - Dargestellt am Beispiel des Kooperationsvorhabens der Schulen am Ellenerbrokweg in Bremen. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 3/1987, S. 299-312.
Basaglia, Franco (Hrsg.): Die negierte Institution oder: Die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Frankfurt / Main 1973.
Becker-Gebhard, Bernd: Ansätze zur Förderung sozialer Beziehungen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern.. In: Staatsinstitut für Frühpädagogik und Familienforschung, München: Handbuch der integrativen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder. München / Basel 1990; S.82-94.
Becker-Gebhard, Bernd: Auswirkungen integrativer Erziehung auf nichtbehinderte Kinder. In: Staatsinstitut für Frühpädagogik und Familienforschung, München: Handbuch der integrativen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder. München / Basel 1990 (a); S.95-102.
Binding, Karl / Alfred Hoche: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. Leipzig ²1922.
Bleidick, Ulrich: Pädagogik der Behinderten. Grundzüge einer Theorie der Erziehung behinderter Kinder und Jugendlicher. Berlin 51984.
Bleidick, Ulrich (Hrsg): Handbuch der Sonderpädagogik; Band 1: Theorie der Behindertenpädagogik. Berlin 1985
Bleidick, Ulrich: Die Behinderung im Menschenbild und hinderliche Menschenbilder in der Erziehung von Behinderten. In: Z. für Heilpädagogik, Heft 8/1990, S. 514-534.
Bleidick, Ulrich: Gewalt gegen Behinderte. In: Z. für Heilpädagogik, Heft 6/1994, S. 399-411.
Bleidick, Ulrich: Allgemeine Übersicht: Begriff, Bereiche, Perspektiven. In: vds, Verband Deutscher Sonderschulen - Fachverband für Behindertenpädagogik: Materialien - Sonderpädagogische Förderung in der Bundesrepublik Deutschland, ²1995; S. 3f. (gleichzeitig in: Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 10/1994, S. 680f).
Bleidick, Ulrich: Behindertsein als menschliche Bedrohung. Die Geschichte der Bewertung behinderten Lebens in Wissenschaft und Politik. In: Z. Vierteljahreschrift für Heilpädagogik und ihrer Nebenwissenschaften, Heft 3/1995, S. 301-320.
Bleidick, Ulrich / Ursula Hagemeister u.a.: Einführung in die Behindertenpädagogik Band 1. Stuttgart 1977.
Bless, Gérard: Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt. Haupt 1995.
Boban, Ines / Andreas Hinz: Latent behindertenfeindlich. Oder: Warum man Gudrun Pausewangs Buch "Die letzten Kinder von Schewenborn" nicht in der Grundschule lesen sollte. In: Z. Die Grundschulzeitschrift Heft 40/1990, S. 42f.
Boban, Ines / Hinz, Andreas: Geistige Behinderung und Integration. Überlegungen zum Verständnis der "Geistigen Behinderung" im Kontext integrativer Erziehung. In: Z. für Heilpädagogik, Heft 5/1993, S. 327-340.
Böttger, Andreas / Dietlinde Gipser / Gerd Laga: Vorurteile? Einstellungen von Lehrer/innen und Lehrern gegenüber Menschen mit Behinderung. Eine zeitvergleichende empirische Studie. Hamburg 1995.
Bonfranchi, Riccardo: Ethik und Behinderung. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 1/1992, S. 41-51.
Bonfranchi, Riccardo: Die Mitschuld der Sonderpädagogik an der "Neuen Euthanasie". In: Z. für Heilpädagogik, Heft 9/1992(a), S. 625ff.
Bonfranchi, Riccardo: Welche Konsequenzen zieht die Sonderpädagogik aus der Diskussion um die "Neue Euthanasie"? In: Mürner, Christian / Susanne Schriber (Hrsg): Selbstkritik der Sonderpädagogik? Stellvertretung und Selbstbestimmung. Luzern 1993, S.75-96.
Bonfranchi, Riccardo: Ästhetik und Behinderung. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 3/1994, S. 274-283.
Bracken, Helmut von: Vorurteile gegen behinderte Kinder, ihre Familien und Schulen. Berlin 1976.
Breitenbach, Erwin / Harald Ebert: Verändern Formen schulischer Kooperation die Einstellungen von Schülerinnen und Schülern gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung? In: Z. Behindertenpädagogik 1/1997, S. 53-67.
Breitenbach, Erwin / Harald Ebert: Einstellungen von Eltern, deren Kinder die Regelschule besuchen, gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung. In: Z. Behindertenpädagogik 4/1998, S. 393-411.
Brill, Werner: Pädagogik im Spannungsfeld von Eugenik und Euthanasie. Die "Euthanasie"-Diskussion in der Weimarer Republik und zu Beginn der neunziger Jahre. Ein Beitrag zur Faschismusforschung und zur Historiographie der Behindertenpädagogik. St. Ingbert 1994.
Bundespräsidialamt: Ansprache von Bundespräsident Richard von Weizsäcker bei der Eröffnungsveranstaltung der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte" im Gustav-Heinemann-Haus in Bonn am 1. Juli 1993. Bonn, 1993.
Cloerkes, Günther: Einstellungen und Verhalten gegenüber Behinderten. Eine kritische Bestandsaufnahme internationaler Forschung. Berlin ³1985.
Dahrendorf, Malte: Der Ideologietransport in der klassischen Kinderliteratur: Vom Struwwelpter zum Anti-Struwwelpeter. In: Ruckteischel, Annamaria (Hrsg.): Kinder- und Jugendliteratur. München 1979.
Dahrendorf, Malte: Kinder- und Jugendliteratur im bürgerlichen Zeitalter. Königstein / Ts. 1980.
Daniels, Susanne von: Mädchen mit Behinderungen - ein neues Thema der Integrationsforschung. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 2/1994, S. 122-127.
Demmer-Dieckmann, Irene: Zum Stand der Realisierung schulischer ´`Integration in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. In: Z. Behindertenpädagogik Heft 1/1989, S. 49-97.
Demmer-Dieckmann, Irene: Bibliographie zu einzelnen integrativ arbeitenden Schulversuchen. In: Z. Behindertenpädagogik Heft 1/1991, S. 68-92.
Degener, Theresia / Swantje Köbsell: Hauptsache, es ist gesund? Weibliche Selbstbestimmung unter humangenetischer Kontrolle. Hamburg 1992.
Deppe-Wolfinger, Helga (Hrsg.): Behindert und abgeschoben. Zum Verhältnis von Behinderung und Gesellschaft. Weinheim / Basel 1983.
Diakonisches Werk Schweinfurt: Behinderte in Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern. Bearb. Herbert Rupp. Schweinfurt 1983.
Dumke, Dieter / Georg Schäfer: Entwicklung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Intergrationsklassen. Einstellungen, soziale Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmale und Schulleistungen. Weinheim 1993.
Eberwein, Hans (Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim 1988.
Eberwein, Hans: Zur Kritik des sonderpädagogischen Paradigmas und des Behinderungsbegriffs. Rückwirkungen auf das Selbstverständnis von Sonder- und Integrationspädagogik. In: Z. für Heilpädagogik, Heft 10/1995, S. 468-476. [ vgl. auch Stellungnahmen in Heft 2/1996, S. 18-21.]
Elbrechtz, R.: Die Behindertenproblematik im Kinder- und Jugendbuch. In: Grützmacher, J.: Diadaktik der Jugendliteratur. Stuttgart 1979, S. 263-269.
Ewinkel, Carola / Gisela Hermes u.a. (Hrsg.): Geschlecht: behindert - besonderes Merkmal: Frau. AG SPAK Publikationen M68: München.
Faust-Siehl, G. / A. Garlichs / J. Ramseger / H. Schwarz / U. Warm: Die Zukunft beginnt in der Grundschule. Empfehlungen zur Neugestaltung der Primarstufe. Arbeitskreis Grundschule Bd. 98, Frankfurt / Main 1996. [ebenfalls bei Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1996]
Feuser, Georg: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Ein Zwischenbericht. Selbstverlag Diakonisches Werk, Bremen 1984.
Feuser, Georg :Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik.(Stand:13.09.2005, Link aktualisiert durch bidok) In: Behindertenpädagogik, 1/1989, S. 4-48.
Feuser, Georg: Entwicklungspsychologische Grundlagen und Abweichungen in der Entwicklung. Zur Revision des Verständnisses von Behinderung, Pädagogik und Therapie. In: Z. für Heilpädagogik, Heft 7/1991, S. 425-441. [vgl auch die Aussprache zwischen K.-L. Holtz und G. Feuser in: ZfH Heft 2/1992, S. 114-131.
Feuser, Georg: Integration und/oder Kooperation? Wohin mit der "Sonder"-Pädagogik? In: Behindertenpädagigik, 1/1993, 2-22
Feuser, Georg: Pädagogik ohne Ausgrenzung - Ethische Aspekte gegen die "Euthanasie". Statement während des Fachforums: "Gegen die neue Lebensunwert-Diskussion. Nie wieder "Euthanasie"" des Arbeitskreises zur Erforschung der "Euthanasie"-Geschichte am 10.11.1993 im Wissenschaftzentrum des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Bonn 1993 (a), unveröffentlicht.
Feuser, Georg: Vom Weltbild zum Menschenbild. Aspekte eines neuen Verständnisses von Behinderung und einer Ethik wider die "Neue Euthanasie". In: Merz, Hans-Peter / Eugen X. Frei (Hrsg.): Behinderung - verhindertes Menschenbild? Luzern 1994.
Feuser, Georg: Behinderte Kinder und Jugendliche: Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt 1995.
Feuser, Georg: "Geistigbehinderte gibt es nicht!" Projektionen und Artefakte in der Geistigbehindertenpädagogik. In: Z. Geistige Behinderung, Heft 1/1996, S. 32-39.
Feuser, Georg / Heike Meyer: Integrativer Unterricht in der Grundschule. Solms-Oberbiel 1987.
Feyerer, Ewald: Lernen nichtbehinderte Kinder in Integrationsklassen weniger? Hand-out zu einem Vortrag an der Univ. Bremen, Okt. 1997, unveröffentlicht. (vgl. auch: Feyerer, Ewald: Behindern Behinderte? Auswirkungen des integrativen Unterrichts auf der Sekundarstufe I. Studien-Verlag: Innsbruck, Wien 1998.)
Forytta, Claus: Verstehen durch Handeln. In: Wissenschaftliches Institut für Schulpraxis Bremen (Hrsg.): Fachtag Deutsch 90. WIS-Arbeitsbericht 78/1991, Bremen.
Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung. (S. 314-333). Opladen 131985.
Fries, Alfred / Ralf Gollwitzer: Kinderantworten zur Körperbehindertenproblematik. Meinungen und Einstellungen von nichtbehinderten Grundschulkindern zu körperbehinderten Kindern hinsichtlich ausgewählter Dimensionen. In: Z. Heilpädagogische Forschung,, Heft 1/1993, S. 20-31.
Frühauf, Theo / Ulrich Niehoff: Gewalt gegen behinderte Menschen. In: Behindertenpädagogik Heft 1/1994, S. 58-74.
Geraedts, Regine / Claudia Zuper: Zur Geschichte und Gegenwart der Humangenetik. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 1/1990, S. 23-39.
Gerspach, Manfred: Integrative Erziehung im Kindergarten. Eine Bestandsaufnahme. In: Z. Behindertenpädagogik. Heft 1 /1996, S. 17-36.
Göttler, Hans: Moderne Kinderbücher in der Schule. Modelle zu einem handlungs- und produktionsorientiertem Literaturunterricht. Schneider, Baltmannsweiler, 1993.
Goffman, Erving: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt Main 1975 (121996).
Haas, Gerhard: Das Elend der didaktisch ausgebeuteten Kinder- und Jugendliteratur. In: Praxis Deutsch, Heft 89/1988, S. 3-5.
(vgl. dazu die Kontroverse:
Hurrelmann, Bettina: Wider die neue Eindimensionalität. (Stellungnahme zum Artikel von G. Haas) In: Praxis Deutsch, Heft 90/1988?, S. 2f; sowie
Haas, Gerhard: Wider die alte Eindimensionalität. (Stellungnahme zu Hurrelmann, Bettina) In. Praxis Deutsch, Heft ???, S. 8-9; sowie
Praxis Deutsch: Kinder- und Jugendliteratur zwischen poetischen und pädagogischen Ansprüchen. Zur Kontroverse um die Kinder- und Jugendliteratur. Heft ???, S. 5-7)
Haas, Gerhard / Wolfgang Menzel / Kaspar H. Spinner: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. In: Z. Praxis Deutsch, Heft 123/1994. Friedrich: Velber, S. 17ff.
Haeberlin, Urs u.a.: Die Integration von Lernbehinderten. Bern / Stuttgart 1990.
Hamburger, Käte: Das Mitleid. Stuttgart 1985.
Heindl, Hildegard: Angst vor Behinderten... Angst vor Behinderungen... liegen die Ursachen in der unbewältigten faschistischen Vergangenheit? In: Z. Heilpädagogik (Beiblatt der Z. Erziehung und Unterricht),Heft 3/1987, S. 89-93.
Hensle, Ulrich: Einführung in die Arbeit mit Behinderten. Heidelberg 1979.
Heusmann, Silvia / Beate Laue: Pilotstudie über Einstellungen zur gesellschaftlichen Integration behinderter Kinder und Erwachsener. Schriftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen. Univ. Bremen 1983, unveröffentlicht.
Hiebsch, Hans/ Manfred Vorweg: Einführung in die marxistische Sozialpsychologie. Berlin (DDR) 1973.
Hiebsch, Hans / Manfred Vorweg (Hrsg.): Sozialpsychologie. Berlin / DDR 1978.
Hinz, Andreas:Heterogenität in der Schule. .(Stand:13.09.2005, Link aktualisiert durch bidok) Integration - Interkulturelle Erziehung - Koedukation. Hamburg 1993.
Höhn, Elfriede: Die geschichtliche Entwicklung der Einstellung der Gesellschaft zu geistig Behinderten. In: Geistige Behinderung, Heft 4/1982, S. 214-223.
Huainigg, Franz-Joseph: Was hat`n der? Kinder über Behinderte. Selbstverlag: Klagenfurt 1993.
Hurrelmann, Bettina: Lesen und soziale Erfahrung. In: Praxis Deustch 13/1975, S. 39-42.
Hurrelmann, Bettina: Wider die neue Eindimensionalität. s. unter Haas, G. 1988.
Hurrelmann, Bettina: Aktuelle Kinder- und Jugendliteratur. In: Praxis Deutsch, Heft 111/1992, S. 9-18.
Hurrelmann, Klaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim / Basel 41991.
Hurrelmann, Klaus: Einführung in die Sozialisationstheorie. Über Zusammenhang von Sozialstruktur und Persönlichkeit. Weinheim / Basel 51995.
Jansen, Gerd W.: Die Einstellung der Gesellschaft zu Körperbehinderten. Rheinstetten 1972 (41984).
Jantzen, Wolfgang: Sozialisation und Behinderung. Gießen 1974.
Jantzen, Wolfgang: Materialistische Behindertenpädagogik. In: Bleidick, Ulrich (Hrsg): Theorie der Behindertenpädagogik: Handbuch der Sonderpädagogik Band 1. Berlin 1985, S. 322-342
Jantzen, Wolfgang: "Praktische Ethik" als Verlust der Utopiefähigkeit - Antropologische und naturphilosophische Argumente gegen Peter Singer. In: Z. Behindertenpädagogik Heft 1/1991, S. 11-25. [vgl. dazu auch in Heft 2/1992 die Stellungnahme von Anstötz, Christoph, S. 186-191 und Jantzens Replik, S. 191-197.]
Jantzen, Wolfgang: Glück - Leiden - Humanität. In: ZfH, Heft 4/1991 (a), S. 230-244.
Jantzen, Wolfgang: Psychologischer Materialismus, Tätigkeitstheorie, marxistische Anthropologie. Hamburg / Berlin 1991 (b).
Jantzen, Wolfgang: Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd.1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Beltz: Weinheim, ²1992.
Jantzen, Wofgang: Menschen mit geistiger Behiderung - veränderte Sichtweisen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 12/1998, S. 526-532.
Jonas, Monika: Behinderte Kinder - behinderte Mütter? Frankfurt / Main 1990.
Kagelmann, Hans-Jürgen / Rosemarie Zimmermann (Hrsg.): Massenmedien und Behinderte. Im besten Falle Mitleid? Weinheim / Basel 1982.
Kagelmann, Rosmarie: Behindertsein. In: Gründewald, D. / W. Kaminski (Hrsg.): Kinder- und Jugendmedien. Weinheim / Basel 1984, S. 303-312.
Kiper, H.: Kinderbücher über behinderte Kinder - eine kritische Annäherung. In: Z. Förderschulmagazin, Heft 4 / 1995, S. 5-7.
Klauß, Theo: Ist Integration leichter geworden? Zur Veränderung von Einstellungen für die Realisierung von Leitideen. In: Z. Geistige Behinderung, Heft 1/1996, S. 56-68.
Köbsell, Swantje: Was ist das eigentlich: "Behindert"? Behinderung als Unterrichtsgegenstand in einer Lerngruppe mit behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem 3./4. Schuljahr der Grundschule an der Robinsbalje. Bremen 1992. [Schriftliche Hausarbeit zum 2. Staatsexamen; unveröffentlicht]
Köbsell, Swantje: Dreht euch nicht rum, die Angst geht um ... . In: Mürner, Christian / Susanne Schriber (Hrsg): Selbstkritik der Sonderpädagogik? Stellvertretung und Selbstbestimmung. Luzern 1993, S. 179-188.
Köbsell, Swantje / Monika Strahl: "Meine Füße sind der Rollstuhl". Mädchen und Jungen mit Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur. In: Z. die randschau, Heft 3/1994, S. 25-27.
Köbsell, Swantje / Anne Waldschmidt: Pränatale Diagnostik, Behinderung und Angst. In: Bradish / Feyerabend / Winkler (Hrsg.): Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologie. München 1989.
Köhne, Anne-Lore: Diskriminierungsprobleme. Dargestellt am Beispiel der Einstellungen zu geistig behinderten Kindern. In: Neumann, Lothar F. (Hrsg.): Sozialforschung und soziale Demokratie - Festschrift für Otto Blume zum 60. Geburtstag. Bonn 1979, S. 166-174.
Krenzer, Rolf: Das behinderte Kind im Jugendbuch. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 3/1981, 229-240.
Kron, Maria: Kindliche Entwicklung und die Erfahrung von Behinderung. Eine Analyse der Fremdwahrnehmung von Behinderung und ihre psychische Verarbeitung bei Kindergartenkindern. Afra: Frankfurt / Griedel, ²1994.
Krüppelzeitung: Krüppel im Märchen. Nicht namentlich gekennzeichneter Beitrag. o.J. (etwa 1983, exakte Ausgabe unbekannt, Kopie liegt vor), S. 5-9.
Kurth, Erich / Dietrich Eggert / Paul Berry: Einstellungen deutscher (ost/west) Oberschüler gegenüber geistig behinderten Menschen - ein Vergleich mit Befragungsergebnissen bei australischen und irischen Schülern. In: Sonderpädagogik, Heft 1/1994, S. 34-40.
Lenzen, Heinrich: Das Image von behinderten Kindern bei der Bevölkerung der Bundesrepublik. In: Heilpädagogische Forschung, Bd.12, Heft 1/1985, S. 43-72.
Nickel, Sven: Sich dem Text allmählich nähern. Begründungen und Anregungen für ein handlungsorientiertes Lesenlernen. In: Z. Alfa-Rundbrief, Zeitschrift für Alphabetisierung und Elementarbildung, Heft 36/1997, S. 19-23.
Niehoff, Ulrich: Tendenzen einer neuen (alten) Behindertenfeindlichkeit. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 1/1990, S. 86-103.
Maikowski, Rainer / Podlesch, Wolfgang: Zur Sozialentwicklung behinderter und nichtbehinderter Kinder. In: Projektgruppe Integrationsversuch: Das Fläming-Modell: Gemeinsamer Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Kinder an der Grundschule. Weinheim / Basel 1988; S. 232-251.
Mattenklott, Gundel: Buch-Befragung. Von der Schwierigkeit, Kinder- und Jugendbücher zu bewerten. In: , S146-151.
Mentzendorff-Mitlehner, Martina: Integration behinderter Kinder in Regeleinrichtungen unter Berücksichtigung des geschlechtsspezifischen Verhaltens von Jungen und Mädchen. Diplomarbeit TU Berlin 1992, unveröffenlicht.
Mentzendorff-Mitlehner, Martina: Annäherung und Abgrenzung. Mädchen und Jungen in einer Integrationsklasse. In: Pfister, Gertrud / Valtin, Renate (Hrsg.): MädchenStärken: Probleme der Koedukation in der Grundschule. Arbeitskreis Grundschule Bd. 50, Frankfurt / Main 1993, S. 92-96.
Mentzendorff-Mitlehner, Martina: Mädchen und Jungen in Integrationsklassen. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 2/1994, S. 127-147.
Menzel, Wolfgang: Literatur erschließen - operativ. In: Grundschulzeitschrift, (Themen-)Heft 79/1994. Friedrich: Velber.
Münzing, Ilse: Soziale Verhaltensweisen von körperbehinderten und unbehinderten Kindern. In: Thimm, Walter (Hrsg.): Soziologie der Behinderten. Neuburgweier / Karlsruhe 1972; S. 169-188.
Neubert, Dieter / Peter Billich / Günther Cloerkes: Stigmatisierung und Identität. Zur Rezeption und Weiterführung des Stigma-Ansatzes in der Behindertenforschung. In: Z. für Heilpädagogik, Heft 10/1991, S. 673-688.
Niedecken, Dietmut:Geistig Behinderte verstehen. (Stand:13.09.2005, Link aktualisiert durch bidok) dtv: München 1993.
Nölling, Claudia: Behindertsein im Kinderbuch. (div. Rezensionen) In: Z. Die Grundschulzeitschrift, Heft 29/1989. S. 42f.
Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation: Behinderte Menschen und Massenmedien. Behindern Massenmedien behinderte Menschen? Behindern behinderte Menschen die Massenmedien? Skript zum Anlass des 7. Internationalen Kongresses für Sozialarbeit und Rehabilitation 5. - 8. August 1985. Wien.
Petermann, Franz (Hrsg.): Einstellungsmessung - Einstellungsforschung. Göttingen / Toronto / Zürich 1980.
Podlesch, Wolfgang / Ulf Preuss-Lausitz: Soziale Integration - Ziele und Ergebnisse nach 15 Jahren gemeinsamer Erziehung. In: Heyer, Peter u.a. (Hrsg.): Zehn Jahre wohnortnahe Integration. Behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam an ihrer Grundschule. Arbeitskreis Grundschule / Der Grundschulverband: Beiträge zur Reform der Grundschule Bd. 88/89. Frankfurt / Main 1993, S. 65-72.
Prengel, Annedore: Mädchen und Jungen in Integrationsklassen an Grundschulen. In: Z. Die Deutsche Schule. Beiheft 1/1990, S. 32-43.
Preuss-Lausitz, Ulf: Soziale Beziehungen in Schule und Wohnumfeld. In: Heyer, Peter / Ulf Preuss-Lausitz / Gitta Zielke: Wohnortnahe Integration. Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Uckermark-Grundschule in Berlin; S. 95-128.
Prill, Renate: Menschen mit geistiger Behinderung in der neueren Jugendliteratur. In: Z. Geistige Behinderung, Heft 1 / 1991, S. 44-52.
Prochnow, Sybille / Heinz Mühl: Zur Veränderbarkeit von Vorstellungen über geistige Behinderung bei Grundschulkindern durch Unterricht mit Hilfe eines Kinderbuchs. In: Beck, Iris (Hrsg.): Normalisierung: Behindertenpädagogische und sozialpolitische Perspektiven eines Reformkonzeptes. Winter / Ed. Schindele: Heidelberg 1996, S. 194-220.
Radtke, Peter: Behinderte Menschen in Werken der Weltliteratur. Literatur - ein Abbild, das Wirklichkeit schafft. In: Kagelmann, Hans-Jürgen / Rosemarie Zimemrmann (Hrsg.): Massenmedien und Behinderte. Weinheim und Basel 1982 (a), S. 54-80.
die randschau / Zeitschrift für Behindertenpädagogik: "KrüppelMEDIAL - Der öffentliche Blick auf Behinderung", Heft 5/1992.
Reicher, Hannelore: Zur schulischen Integration behinderter Kinder. Eine empirische Untersuchung der Einstellungen von Lehrern/-/innen. In: Z. Erziehung und Unterricht, Heft 9/1990, S.540-551.
Reichmann, Erwin: Geschichte und Formen der Aussonderung behinderter Menschen. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 2/1986, S. 114-122.
Reinhardt, Petra: Behinderung als Politikum. Behinderungspolitik für Kinder mit Behinderungen: Konzeptionen der Parteien im Bayerischen Landtag. Klinkhardt: Bad Heilbrunn 1996.
Reisbeck, G.: Massenmedien und psychische Störungen. Ein wissenschaftlicher Bezugsrahmen. In: Faust, Volker / Günter Hole (Hrsg.): Psychiatrie und Massenmedien. Stuttgart 1983, S. 92-97.
Rohr, Barbara: "Wie gut, dass ich nicht so aussehe"..(Stand:13.09.2005, Link aktualisiert durch bidok) Eine Auseinandersetzung mit unseren Schönheitsnormen aus der Sichtweise einer nichtbehinderten Behindertenpädagogin. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 4/1982, S. 310-318.
Rohr, Barbara: Topfit und schön! - 5 Szenen über Schönheit, Leistung und Zerstörung. In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 3/1995, S. 241-253.
Sahr, Michael: Wirkung von Kinderliteratur. Kempten 1981.
Sahr, Michael: Abbau von Vorurteilen durch Kinderbücher? Betrachtungen zum Behindertenproblem am Beispiel des Buches "Vorstadtkrokodile" von Max von der Grün. In: Die Deutsche Schule, Heft 2/1983, S. 139-151.
Sahr, Michael: Problemorientierte Kinderbücher im Unterricht der Grundschule. Kempten 1987.
Schäfer, Bernd / Franz Petermann (Hrsg.): Vorurteile und Einstellungen. Sozialpsychologische Beiträge zum Problem sozialer Orientierung. Festschrift für Reinhold Bergler. Deutscher Institus-Verlag: Köln 1988.
Scheu, Ursula: Wir werden nicht als Mädchen geboren - wir werden dazu gemacht. Frankfurt am Main 1977.
Schiefele, Ulrich: Einstellung, Selbstkonsistenz und Verhalten. Verlag für Psychologie Hogrefe: Göttingen 1990.
Schildmann, Ulrike: Lebensbedingungen behinderter Frauen. Focus: Gießen, 1983
Schmidt-Dumont, G.: Tabu-Thema: Behinderte in der Kinder- und Jugendliteratur. In: Z. Jugendliteratur und Medien, Heft 6 / 1981, S. 106f.
Schmitt, Rudolf: Kinder und Ausländer. Einstellungsänderung durch Rollenspiel - eine empirische Untersuchung. Braunschweig, 1979.
Schnack, Dieter / Rainer Neutzling: Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach Männlichkeit. Rowohlt 1990
Schnittka, Thomas / Elisabeth Sommer: "Nee, der soll noch hierbleiben. Wir wollen weiterspielen!" Außerschulische Aktivitätern zwischen behinderten und nichtbehinderten Grundschüler/innen. Eine empirische Studie in einem Bremer Stadtteil. Diplomarbeit Stg. Behindertenpädagogik, Univ. Bremen, unveröffentlicht. 1994.
Schöler, Jutta: Integrative Schule - Integrativer Unterricht. Reinbek b. Hamburg 1993.
Schönwiese, Volker: Das Bild von Behinderung als Phantasma und Möglichkeiten des "begleitenden Ich". In: Z. Behindertenpädagogik, Heft 1/1995, S. 25-33.
Schorb, Bernd / Erich Mohn / Helga Theunert: Sozialisation durch (Massen-)Medien. In: Hurrelmann, Klaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim und Basel ²1991, S. 493-508.
Seifert, Karl-Heinz: Einstellungen von Nichtbehinderten zu Behinderten. In: Z. Erziehung und Unterricht Heft 2/84, S. 100-111.
Seebaum, Katja / Bundesverband für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte e.V. (Hrsg): Die Bedeutung kosmetischer Pflege für körperbehinderte Mädchen. Düsseldorf, o.J..
Seywald, Ajga: Physische Abweichung und soziale Stigmatisierung. Rheinstetten 1976.
Seywald, Ajga: Körperliche Behinderung. Grundfragen einer Soziologie der Benachteiligten. Frankfurt a.M. / New York 1977.
Seywald, Ajga: Anstossnahme an sichtbar Behinderten: Soziologische und psychologische Ansätze zur Erklärung der Stigmatisierung physisch Abweichender. Rheinstetten 1980.
Sierck, Udo / Didi Danquart (Hrsg.): Der Pannwitzblick. Wie Gewalt gegen Behinderte entsteht. Verlag Libertäre Assozaition: Hamburg, 1993.
Singer, Peter: Praktische Ethik. Stuttgart 1984.
Der Spiegel: "Im Eiltempo, aber blind". [Titelstory über Genmanipulation] Heft 30/1991, S. 98-114.
Spöhring, Walter: Qualitative Sozialforschung. (S. 189-210). Stuttgart 1989.
Stadtbibliothek Bremen (Hrsg.): Behindert? Nein: Kind! Kinder mit Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur. Literaturverzeichnis; Zusammenstellung: Sven Nickel / Anke Uttecht). Bremen 1994
Stadtbibliothek Duisburg: Behinderte im Kinder- und Jugendbuch. Auswahlverzeichnis hrsg. zur 8. IKiBu 1981. Bearb.: Imma Wick. Duisburg 1981.
Steffens, Wilhelm: Literarische und didaktische Aspekte des modernen realistischen Kinderbuches. Teil 1 in: Z. Die Grundschulzeitschrift, Heft 39/1990, S. 30-34. Teil 2 in: Z. Die Grundschulzeitschrift, Heft 40/1990 (a), S. 28-29.
Stein, Anne-Dore (Hrsg.): Lebensqualität statt Qualitätskontrolle menschlichen Lebens. Marhold: Berlin, 1992.
Steinhausen, Hans-Christoph: Einstellungen gegenüber körperbehinderten Kindern und Jugendlichen. In: Heilpädagogische Forschung, Bd.VIII, Heft 3/1980, S. 310-316.
Tabbert, Reinbert: ... 1986 (exakte Quelle nicht bekannt, Angaben gem. Lehrveranstaltung "Kinder in der Kinderliteratur", SoSe 1995, Univ. Bremen, Dr. Claus Forytta)
Tillmann, Klaus-Jürgen: Sozialisationstheorien. Reinbek bei Hamburg 1989.
Theunissen, Georg: Behindertenfeindlichket und Menschenbild. In Z. für Heilpädagogik, Heft 8/1990, S. 546-552.
Tröster, Heinrich: Interaktionsspannungen zwischen Körperbehinderten und Nichtbehinderten. Göttingen 1988.
Tröster, Heinrich: Einstellungen und Verhalten gegenüber Behinderten: Konzepte, Ergebnisse und Perspektiven sozialpsychologischer Forschung. Bern 1990.
Ulich, Michaela / Dieter Ulich: Literarische Sozialisation: Wie kann das Lesen von Geschichten zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen? In: Zeitschrift für Pädagogik, 40/1994, S. 821-834.
Uther, H.-J.: Behinderte in populären Erzählungen. Studien zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin 1981.
Waldmann, Günter: Grundzüge von Theorie und Praxis eines produktionsorientierten Literaturunterrichts. In: Hopster, NORBERT (Hrsg.): Handbuch "Deutsch". Schöningh: Paderborn 1984, S. 98-141.
Wallrabenstein, Karin: Leserbrief zum Thema "Behinderung im Bilderbuch". In: Z. Die Grundschulzeitschrift, Heft 47/1991, S. 3. (bezugnehmend auf Unterrichtsarbeitsblatt, veröffentlicht in: Z. Die Grundschulzeitschrift, Heft 46/1991, S. 40.)
Warzecha, Birgit: "Verhaltensstörungen" im Spannungsfeld von Prävention und Segregation. In: Z. Behindertenpädagogik 1/1998, S. 2-11.
Weser-Kurier: "Die Medizin hält den Tod an". Gespräch mit Prof. Dr. Hegselmann über Probleme der Euthanasie-Debatte. Ausgabe vom 19.Januar 1993.
Weiser, M. / W.R. Wilms: Zur Geschichte des Sonderschulwesens. In: Weiser P. und M. (Hrsg.): Eine Schule für alle, S. 11-23, St. Ingbert, 1991.
Wildner, Kurt: Monster, Wilde und die Brüder Löwenherz. Behinderte in Kinderbüchern und Erwachsenenliteratur: Ein historischer Abriß von Darstellungen zwischen Sensationsmache und Sachkenntnis. In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 44/1981, S. 1384-1386.
Wocken, Hans : Soziale Entwicklung behinderter Kinder. In: Wocken, Hans / Georg Antor: Integrationsklassen in Hamburg. Oberbiel 1987; S. 203-275.
Wörmann, Dagmar: Sie gehören doch zu uns! Eine Befragung von Kindern in Berliner Integrationsklassen. Heft 31 der "Beiträge aus dem FB 1 der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin", 1994.
Zielke, Gitta: Zum Wandel des Behindertenbegriffs. In: Behindertenpädagogik, Heft 3/1992, S. 314-324.
Zimmermann, Rosi: Immer wieder strahlende Kinderaugen. Das Bild des Behinderten in der Presse. In: Z. Psychologie heute, Heft Jan. 1977, S. 26-31
Zimmermann, R.: Bücher über Behinderte im "Jahr der Behinderten". In: Z. Jugendliteratur und Medien, Heft 6 /1981, S. 102-105.
Zimmermann, Rosemarie: Behinderte in der Kinder- und Jugendliteratur. Spiess: Berlin 1982.
Zimmermann, Rosemarie: Behinderte in der realistischen Kinder- und Jugenderzählung. In: Kagelmann, Hans-Jürgen / Rosemarie Zimmermann (Hrsg.): Massenmedien und Behinderte. Weinheim und Basel 1982, S. 177-206.
Achilles, Ilse / Karin Schliehe: Meine Schwester ist behindert. Bundeszentrale Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.: Marburg, ³1993.
Boie, Kirsten: Eine wunderbare Liebe. Oetinger: Hamburg 1996.
Bongartz, Dieter: Humpelstilzchen. Patmos: Düsseldorf 1995.
Brand, Matthias: Stärker als Supermann. Elefanten-Press: Berlin, 1981.
Desmarowitz, Dorothea: Dann kroch Martin durch den Zaun. Maier: Ravensburg 1979.
Fleming, Virginia / Floyd Cooper: Seid nett zu Eddie. Lappan: Oldenburg ²1998.
Gärtner, Hans: Johanna ist anders. Echter: Würzburg 1996.
Gleitzman, Moritz: Quasselstrippe. Anrich: Weinheim 1995
Grün, Max von der: Vorstadtkrokodile. Rowohlt: Reinbek b. Hamburg 1993.
Günther, Herbert: Die Reise zum Meer. Oetinger: Hamburg 1994.
Haberzeth-Grau, Edith: Ein Tag mit Kai im Heim. Saatkorn: Hamburg, o.J.
Härtling, Peter: Das war der Hirbel. dtv junior: München 1978 (211994).
Huainigg, Franz-Joseph / Annegret Ritter: Meine Füße sind der Rollstuhl. Ellermann: München 1992.
Jung, Reinhardt: Auszeit oder der Löwe von Kaúba. Jungbrunnen: Wien 1996.
Kautz, Gisela: Eine Chance für Barbara. Thienemann: Stuttgart / Wien 1994.
Klee, Ernst: Der Zappler. Schwann: Düsseldorf. 1974.
Klare, Margaret: Hallo hier ist Felix.. Bitter: Recklinghausen, 1994.
Krenzer, Rolf: Und darum muß ich für dich sprechen. Bitter: Recklinghausen 1981.
Krenzer, Rolf: Eine Schwester so wie Danny. Arena: Würzburg 51995.
Kutsch, Angelika: Eine Brücke für Joachim. Rowohlt: Reinbek. b. Hamburg, 1979.
Laird, Elizabeth: Ben lacht. Oetinger: Hamburg, 1991.
Lindquist, Bosse: Ausflug ins Glück. Eine Liebesgeschichte im Rollstuhl: Stuttgart u.a., 1996.
Little, Jean: Ein Wunsch geht in Erfüllung. Carlsen: Hamburg 1991.
Nahrgang, Frauke: Katja und die Buchstaben. Beltz: Weinheim / Basel 1995.
Neumann-Skara, Wolfgang: Paul und Rita. Die Kronenklauer: Bielefeld. 1986
Pausewang, Gudrun: Die letzten Kinder von Schewenborn. Oder .... sieht so unsere Zukunft aus? Maier, Ravensburg 1983.
Peter, Diana: Heike und Jutta können nicht hören. Finken: Oberursel / Taunus 1979.
Petersen, Palle: Susanne kann nicht sehen. Finken: Oberursel / Taunus 1979.
Petersen, Palle: Thorsten lernt jetzt laufen. Finken: Oberursel / Taunus 1979.
Pressler, Mirjam: Stolperschritte. Maier: Ravensburg 1981.
Rosen, Lillian: Greller Blitz und stummer Donner. Herder: Freiburg / Basel / Wien 1983
Ruegenberg, Lukas / Willi Fährmann: Karl-Heinz vom Bilderstöckchen. Middelhauve: Köln / Zürich 1990.
Rück, Solfried: Gänseblümchen für Christine. Bitter: Recklinghausen 1989.
Rusch, Regina: Der Zappelhannes. Anrich: Kevelaer 1988.
Schröder, Silke / Elisabeth Reuter: Carla. Ein Bilderbuch über Epilepsie. Ellermann: München, 1996.
Steinbach, Peter: Benni Sprachlos. dtv: München 1991
terHaar, Jaap: Behalt das Leben lieb. dtv junior: München 81985.
Thüminger, Rosmarie: Die Entscheidung. Dachs (Jugend & Volk): Wien 1992.
Tveit, Tore: Mein kleiner großer Bruder. Bitter: Recklinghausen 1991.
Welsh, Renate: Stefan. Jungbrunnen: Wien / München 1989.
Welsh, Renate: Wer fängt Kitty? dtv junior: München. 1992.
Welsh, Renate: Drachenflügel. dtv junior: München ³1995.
White, Paul: Andrea kann nicht laufen. Finken: Taunus / Oberursel 1979.
Wölfel, Ursula: Mannis Sandalen. In: Die grauen und die grünen Felder. Maier: Ravensburg 1982, S. 37-40.
Brandt, Rudolf: Lektüre als Auseinandersetzung mit dem geistigbehindertem Kind. Unterrichtsmodell zu "Das war der Hirbel" von Peter Härtling,. In: Z. Praxis Deutsch, Heft 29/1978, S. 46-48.
Deubert, Hannelore: Peter Härtling im Unterricht. Klassen 3-6. Weinheim und Basel 1996.
Dorst, Gisela: Renate Welsh: "Drachenflügel" (4./5. Schuljahr). In: Lesen in der Schule mit dtv junior. Lehrertaschenbuch 7: Unterrichtsvorschläge für die Altersstufen 9 bis 12 Jahren. München 1996.
Höfelmann, M. und G.: Peter Härtling: "Das war der Hirbel". In: Lesen in der Schule mit dtv junior. Lehrertaschenbuch 1 für die Primarstufe. München 31994.
Hurrelmann, Bettina: Lesen und soziale Erfahrung. [Unterrichtsmodelle für: Ursula Wölfel "Mannis Sandalen", Irmela Brender "Von einem Kindergarten mit Thomas, Friederike, und anderen"] In: Praxis Deutsch 13/1975, S. 39-42.
Göttler, Hans: Moderne Kinderbücher in der Schule. Modelle zu einem handlungs- und produktionsorientiertem Literaturunterricht (darin Unterrichtsmodell für: Mirjam Pressler "Stolperschritte", S. 78-105). Schneider, Baltmannsweiler, 1993.
"Meine Füße sind der Rollstuhl": Didaktisches Begleitheft und Dias zum Kinderbuch von Franz-Joseph Huainigg. Stuttgart 1994
Neumeister, Stephanie: Literaturkartei zu "Vorstadtkrokodile" (Max von der Grün). Mülheim an der Ruhr 1996.
Inhaltsverzeichnis
1. Setzungen / Annahmen / Folgerungen
BINDING / HOCHE (1920) (²1922)
"Das Wesentliche ist das Fehlen der Möglichkeit, sich der eigenen Persönlichkeit bewusst zu werden, das Fehlen des Selbstbewußtseins. Die geistig Toten stehen auf einem intellektuellen Niveau, das wir erst tief unten in der Tierreihe wieder finden, und auch die Gemütsregungen erheben sich nicht über die Linie elementarster, an das animalische Leben gebundene Vorgänge." (S. 57)
SINGER (1984)
"Ein Schimpanse, ein Hund oder ein Schwein etwa wird ein höheres Maß an Bewusstsein seiner selbst und eine größere Fähigkeit zu sinnvollen Beziehungen mit anderen haben als ein schwer zurückgebliebenes Kind oder jemand im Zustand fortgeschrittener Senilität. Wenn wir also das Recht auf Leben mit diesen Merkmalen begründen, müssen wir jenen Tieren ein ebenso großes Recht auf Leben zuerkennen oder sogar ein noch größeres als den erwähnten zurückgebliebenen oder senilen Menschen." (Singer 1982, 40 zit. n. Feuser 1995, 77)
"Weder der Fötus noch das neugeborene Kind ist ein Individuum, fähig, sich selbst als distinkte Endität zu betrachten, und mit einem Leben begabt, das es als sein eigenes zu führen hat." (S. 186)
2. Tötungsrechtfertigungen
BINDING / HOCHE (²1922)
"Wieder finde ich weder vom rechtlichen, noch sozialen, noch vom sittlichen, noch vom religiösen Standpunkt aus schlechterdings keinen Grund, die Tötung dieser Menschen, die das furchtbare Gegenbild echter Menschen bilden und fast Jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet, freizugeben" (S. 32)
"Wer also einem Paralytiker am Anfang von dessen vielleicht auf Dauer von Jahren zu berechnenden Krankheit auf dessen Bitte oder vielleicht sogar ohne diese die tödliche
Morphiumspritzung macht - bei dem kann von einer reinen Bewirkung der Euthanasie keine Rede sein. [...] Das ist keine Tötungshandlung im Rechtssinne, deren Vernichtung nicht mehr gelingen kann: Es ist in Wahrheit eine reine Heilbehandlung." (S. 17f)
" Es ist eine peinliche Vorstellung, daß ganze Generationen von Pflegern neben diesen leeren Menschhüllen dahinalltern, von denen nicht wenige 70 Jahre und älter werden. Die Frage, ob der für diese Kategorien von Ballastexistenzen notwendigen Aufwand nach allen Richtungen hin gerechtfertigt sei, war in den verflossenen Zeiten des Wohlstands nicht dringend, jetzt ist es anders geworden, und wir müssen uns ernstlich mit ihr beschäftigen. [...] Der Erfüllung dieser Aufgabe steht das moderne Bestreben entgegen, möglichst auch die Schwächlinge einer Sorte zu erhalten, allen, auch den zwar nicht geistig toten, aber doch ihrer Organisation nach, minderwertigen Elementen Pflege und Schutz angedeihen zu lassen - Bemühungen , die dadurch ihre besondere Tragweite erhalten, daß es bisher nicht möglich ist, auch nicht im Ernst versucht worden ist, diese Defektmenschen von der Fortpflanzung auszuschließen." (S. 55)
SINGER (1984)
"Einige Ärzte, die an schwerer Spina bifida leidende Kinder behandeln, sind der Meinung, das Leben mancher Kinder sei so elend, daß es falsch wäre, eine Operation vorzunehmen, um sie am Leben zu erhalten. Das bedeutet, daß ihr Leben nicht lebenswert ist.
Veröffentlichungen, die das Leben dieser Kinder beschreiben, stützen dieses Urteil. Wenn das stimmt, dann legen utilitaristische Prinzipien den Schluß nahe, daß es richtig sei, solche Kinder zu töten. (S. 181)
"Sie [missgebildete Säuglinge, SN.] zu töten kann daher nicht gleichgesetzt werden mit dem Töten normaler menschlicher Wesen" (S. 179)
"Der Kern der Sache ist freilich klar: die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht." (S. 188)
"Und es ist ebenfalls plausibel anzunehmen, daß die Aussichten auf ein glückliches Leben für ein normales Kind besser wären als für ein hämophiles. Sofern der Tod eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die Gesamtsumme des Glücks größer, wenn der behinderte Säugling getötet wird." (S. 183)
"Sterbenlassen - "passive Euthanasie" - wird in bestimmten Fällen bereits als eine menschliche und angemessene Handlungsweise akzeptiert. Wenn es zwischen Töten und Sterbenlassen keinen moralischen Unterschied an sich gibt, dann sollte "aktive Euthanasie" ebenfalls unter bestimmten Umständen menschlich angemessen akzeptiert werden." (S. 207)
..."auch sollte man dabei die Belastung für das Personal und die Apparaturen des Krankenhauses nicht außer Acht lassen." (S. 208)
Quelle:
Sven Nickel: Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 13.09.2005
