Wo liegen die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland?
Universität Bremen: Masterarbeit am Zentrum für Sozialpolitik; September 2013
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorwort und Idee
- 2. Einleitung
- 3. Inklusion als Theorie: Konzept, Ausgangslage und Wirkungen
-
4. Systemtheoretischer Zugang
- 4.1. Inklusion zwischen zwei Sphären sozialer Gerechtigkeit
- 4.2. Inklusion und der Capability Approach (CA)
- 4.3. Inklusion im Licht einer liberalen Marktwirtschaft
- 4.4. Macht, Hierarchie und Inklusion
- 4.5. Defizitkriterien und Potentiale
- 4.6. Inklusion und Armut
- 4.7. Der systemtheoretische Zugang zu Inklusion - Inklusion und Exklusion
- 4.8. Hypothese: "Inklusion bietet zentrale Aspekte eines neuen sozialpolitischen Leitbildes"
-
5. Struktureller und rechtlicher Zugang: Gesetze, Institutionen und sozialstaatliche Leistungen
- 5.1.Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
- 5.2. Die UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit Behinderung
-
5.3. Bundesdeutsche Gesetze
- 5.3.1. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- 5.3.2. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
- 5.3.3. Das SGB II und III, Grundsicherung für Arbeitssuchende und Arbeitsförderung
- 5.3.4. Das SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe
- 5.3.5. Das SGB IX: Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen
- 5.3.6. Das SGB XI, soziale Pflegeversicherung
- 5.3.7. Das SGB XII, Sozialhilfe
- 5.4. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 2011 zur Umsetzung der UN-BRK
- 5.5.Hypothese: "Inklusion steht im Widerspruch zum konsumtiven Sozialstaat"
- 6. Kultureller, gemeinschaftlicher und persönlicher Zugang
-
7. Praktischer Zugang: Soziale Unterstützersysteme
- 7.1.Inklusionsanspruch in der Behindertenhilfe
- 7.2.Inklusionsanspruch in der Jugendhilfe
- 7.3.Inklusion in Bezug auf die Migrationsthematik
- 7.4.Inklusion in Sport, Freizeit, außerschulischer Bildung, Kultur und Tourismus
- 7.5.Inklusion in der Ausbildung, Arbeit und Arbeitsförderung
- 7.6. Praktische Inklusion in sozialen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden
- 7.7.Hypothese: "So lange der Widerspruch zwischen Inklusion und Zielgruppenlogiken / Anspruchsberechtigungen nicht gelöst wird, istInklusion nicht greifbar"
- 8. Bewertung der Ergebnisse und Fazit
- I Abbildungsverzeichnis
- II Literatur
- III Eigenständigkeitserklärung
Die Idee zu der vorliegenden Arbeit entsprang meinen Erfahrungen und Eindrücken aus verschiedenen Bereichen der sozialen und sozialpolitischen Arbeit. Neben dem Studium der Politikwissenschaft und nun Sozialpolitikwissenschaft arbeite und arbeitete ich in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Behindertenhilfe, in Schulen, bei dem Quartiersmanagement Bremen Tenever und in verschiedenen (jugend-)politischen Gremien. Diese interdisziplinären Erfahrungen in Politik, Koordination und Pädagogik passen gut zu der Umsetzung des inklusiven Gedankens. Dieser setzt an den Schnittstellen verschiedener Organisations- und Systemformen an und könnte als verbindendes Element zwischen Politik und den Bürgern, zwischen Verwaltungen und Organisationen und zwischen verschiedenen politischen Ressorts wirken. Die gemeinsame Grundlage ist der Gedanke einer allgemeinen Zugänglichkeit für alle Lebensbereiche für alle Menschen, der damit überall Gültigkeit besitzt: bei dem Einzelnen und seinen gesellschaftlichen und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten, wie auch in den sozialpolitischen Leistungs- und Sicherungssystemen und damit auch in der konkreten Arbeit vieler (sozialer) Organisationen und Institutionen. Die Komplexität dieses Gedankens war für mich Ansporn und Ehrgeiz zugleich, das Konzept Inklusion in Bezug auf das sozialpolitische System Deutschlands und seinen Wirkungsebenen zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
Der aktuelle Begriff `Inklusion` und viele Begleitdiskussionen, beispielsweise um Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, Chancengleichheit, Teilhabe, Selbstbestimmung, Maßnahmen zur Abbremsung gesellschaftlicher Exklusionstendenzen, aber auch `New Social-` und `Diversity Management` für Firmen und soziale Organisationen und `Kundenorientierung` in den Verwaltungen und De-Institutionalisierung in sozialpolitischen Systemen, zeigen schon in Ansätzen, welches Potential in dem inklusiven Gedanken steckt und aber eben auch welche Herausforderungen bzw. Tragweiten. Der inklusive Gedanke ist spätestens seit der Verabschiedung der Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung von 2006 (UN-BRK) Gegenstand breiter wissenschaftlicher und bildungs-, sowie sozialpolitischer Debatten. Sie beschreibt eine für alle gleiche Zugangsvoraussetzung zur vollen Teilhabe in allen Lebensbereichen eines Menschen, die unabhängig von Defizitkriterien einer Person geschaffen, ermöglicht und / oder unterstützt werden müssen. Ausgehend von einer bildungspolitischen und pädagogischen Strömung, verstärkt seit Anfang der 1990er Jahre, wird der Begriff und seine Intentionen mittlerweile breit für viele Ebenen und Bereiche genutzt. Er findet als pädagogisches Konzept genauso Anwendung wie als Beschreibung (wünschenswerter) gesellschaftlicher Zustände, oder als Herangehensweise in sozialräumlich orientierten, politischen wie sozialen Arbeiten oder auch als Wert in einer Gerechtigkeitsfrage, also mit normativem Charakter. Verkürzt gesagt, er findet nach und nach überall dort Anwendung, wo es um die Verbindung von politischen und gesellschaftlichen Systemen mit dem Individuum geht. Damit bekommt er eine sozialpolitische Dimension, denn während noch vor ein paar Jahren die (pädagogische) Frage wichtig war, wie einem Kind unabhängig seines Status die bestmögliche Beschulung ermöglicht werden kann, ist es logisch darüber hinaus zu fragen, wie Chancen unabhängig individueller Eigenschaften und Status für jeden Menschen und alle (Unterstützer)- Systeme gleichermaßen hergestellt werden können. Mit diesem Ansatz wird der Begriff noch einmal größer und bietet innovatives Denken. Die Größe ist an vielen Stellen der Grund, warum tatsächlich inklusive Strukturen, Praktiken und Werte (noch) selten sind, da schlicht der "Auftrag" im Sinne einer Pflicht und eines Fortschritts einerseits nicht eindeutig genug sind und andererseits dadurch Adressaten, Impulsgeber und Verantwortlichkeiten undefiniert bleiben.
Der "Auftrag" des inklusiven Gedankens wird sehr unterschiedlich wahrgenommen: manche sehen ihn als Innovation und Chance, andere als Pflicht und Schwierigkeit. Er stellt so grundsätzlich die bestehenden gesellschaftlichen Systeme in Frage, dass er gleichermaßen als utopisch abtuende wie begeisternde Reaktionen hervor ruft. Aber auch in der Wirkungsweise werden völlig unterschiedliche Auffassungen vertreten: einige sehen in dem inklusiven Gedanken die gesellschaftlichen Systeme und letztlich das Miteinander entscheidend verändert, andere denken nüchterner und sprechen Barrierefreiheit und mehr Unterstützung für benachteiligte Menschen an. Diese differenzierten Sichtweisen und Vorstellungen, die Sehnsüchte genauso ansprechen, wie Missmut des Veränderungsauftrages, sind spannend und bieten die große Aufgabe, die Komplexität stückweise zu entwirren und eine klare Zielvorstellung wie auch Prozesse, die dorthin führen, auszuarbeiten.
Die vorliegende Arbeit versucht einen kleinen Teil dazu beizutragen. Einerseits möchte sie einen Überblick über die Dimensionen des Begriffes und seine möglichen Wirkungsweisen geben, andererseits die Theorie der Inklusion in den Kontext der Machbarkeit im sozialpolitischen Sinne stellen, um damit eine Bewertung nach Chance und Schwierigkeit für die deutsche Sozialpolitik vorzunehmen. Wichtig ist dabei der Fokus: bewusst werden die Bereiche Bildungspolitik und Bildungssysteme im Kontext der Inklusion außer Acht gelassen, weil 1. darüber schon an vielen Stellen aktuell geschrieben wurde[1] und m.E. nach hervorragende Ansätze und Vorschläge für eine möglich (verbesserte) Schul- und Erziehungsstruktur und eine (inklusive) Praxis bestehen und 2. Diese Masterthesis als Adressaten des inklusiven Gedankens nicht einzig Menschen mit Behinderung hat, sondern alle marginalisierten Gruppen und Menschen, die mit Exklusionserfahrungen leben. Damit werden auch Menschen angesprochen, die aus unterschiedlichen Gründen sozial benachteiligt sind und häufig mit sozialpolitischen Leistungssystemen zu tun haben. Dafür werden an einigen Stellen praktische Methoden aus der (Sonder-)Pädagogik geschildert, die in allen Fällen auch als Methoden zur Bewältigung sozialer Anliegen genutzt werden können. Die Thesis diskutiert Möglichkeiten und Probleme der Umsetzung der Inklusion als programmatische und strukturelle Zielrichtung der Sozialpolitik.
Die Forschungsfrage "wo liegen die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland?" liefert den Rahmen der Masterarbeit und wird in Form einer explorativen, theoriebasierten Untersuchung beantwortet.
Das Konzept der Inklusion[2] wird in der Wissenschaft, wie auch in der Sozialpolitik und in der Praxis kontrovers und interdisziplinär diskutiert und ist an vielen Stellen positiv, wie negativ hoch aufgeladen[3]. Dem entsprechend wird dem Konzept paradigmatische Qualität in der sozialen Praxis und Sozialpolitik zugesprochen. Das liegt einerseits an der Mehrdimensionalität und der grundlegenden Veränderungsaufforderung an sozial- und bildungspolitische Systeme, wie auch an dem starken Aufforderungscharakter an Praktiker und soziale Unterstützungsstrukturen und letztlich an dem Potential, als Bild des Zusammenlebens in Gänze nützlich zu sein. "Der neue Dekadenbegriff heißt Inklusion", skizziert Dr. Karl-Heinz Imhäuser, Vorstand der Montag Stiftung (Imhäuser, 2011), die positive Tragweite des Begriffs. Gleichzeitig wird das Konzept Inklusion aber auch an vielen Stellen als Kritik an den bisherigen Errungenschaften und Arbeitsweisen im Bereich der sozialen Unterstützungsstrukturen gedeutet. Manche fragen, braucht es überhaupt ein neues Wort[4] für die gute bestehende Praxis der Integration? Andererseits spricht das Konzept der Inklusion eine starke Sehnsucht nach einem grundlegend sich zu verändernden Blickwinkel auf sozial- und bildungsstaatliche Leistungen und auf das Zusammenleben und -arbeiten insgesamt an.
Eben diese Ausgangslage birgt die große Chance, in dieser Arbeit mit geeigneter Struktur, das Konzept der Inklusion ein Stück weit zu entmystifizieren, Einfluss und Aufforderung zu ordnen und nach Wirkungen zu sortieren. Die Arbeit ist in drei Schritten strukturiert:
Der erste Schritt ist es, Inklusion in ihren zentralen Aspekten zu verdeutlichen und Wirkungsebenen zu identifizieren. Auf Grund der Tatsache, dass diese Thematik noch verhältnismäßig jung in Wissenschaft und Praxis ist und zudem (immer) noch vorrangig im schulischen und sonderpädagogischen Kontext diskutiert wird, lautet eine zweite Anforderung an diese Arbeit, theoriebasiert die Zusammenhänge und Berührungspunkte von Inklusion und Sozialpolitik und Inklusion und sozialen Unterstützersystemen explorativ[5] aufzuzeigen. Dazu dient die Identifizierung der Wirkungsebenen. Wo findet der Gedanke der Inklusion überall Anwendung und auf welchen Ebenen ist er in welcher Stärke relevant? Wie stark wirkt sich der Inklusionsgedanke auf soziale und sozialpolitische Systeme aus? Die Ergebnisse liefern im dritten Schritt die Grundlage für eine Bewertung nach Chancen und Schwierigkeiten, Inklusion in sozialpolitischen und sozialpraktischen Bereichen umzusetzen.
Folgende wissenschaftliche Ziele werden verfolgt:
Zum einen gebe ich einen Überblick zu der aktuellen sozialen und sozialpolitischen Thematik `Inklusion` in der Bundesrepublik Deutschland. In Form einer Literaturrecherche und unstrukturierten Beobachtungen wird das Konzept Inklusion, seine normative Ausgangslage und die Begrifflichkeit definiert und Abgrenzbarkeiten, insbesondere in Bezug zu dem Begriff der "Integration", heraus gearbeitet. In diesem Abschnitt werden zudem vier Wirkungsebenen identifiziert, die für den weiteren Verlauf die Struktur der Arbeit vorgeben.
Innerhalb dieser vier Wirkungsebenen werden die Bereiche entdeckt, die mittel- und unmittelbar mit dem Inklusionskonzept in Berührung stehen. Die Wirkungsebenen definieren jeweils die Zugangsebenen, die das Konzept der Inklusion und seine Einflüsse strukturieren. In Anlehnung an den kommunalen Index der Montag Stiftung (2010) verwende ich folgende Ebenen: Die Praxis in den Unterstützersystemen durch soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände ("Praxis"), die Strukturfragen und Tragfähigkeit durch Gesetze und Institutionen ("Struktur"), und die Haltungsfragen der Gesellschaft und des Einzelnen ("Kultur"). Darüber hinaus identifiziere ich eine vierte Ebene: der systemtheoretische Zugang zu Inklusion. Dieser Zugang bietet eine grundsätzliche Einordnung des Inklusionskonzeptes als einen Teil einer sozialen Gerechtigkeit und als Maßstab, insbesondere in Abgrenzung zu Exklusion, für die Einordnung sozialer Gruppen in Gesellschaften. Das impliziert die mögliche normative Wirkung des Inklusionsgedankens, insbesondere als Gerechtigkeitsfrage.
Das zweite Ziel besteht darin, in Form einer theoriebasierten Exploration Hypothesen zu generieren, die Wirkungsweisen und Zusammenhänge des inklusiven Gedankens auf soziale und sozialpolitische Systeme und Chancen und Schwierigkeiten beschreiben. Die Hypothesen werden dadurch gewonnen, dass die unterschiedlichen Aspekte der Inklusion mit der Wirkungsebene in Verbindung gesetzt werden und idealtypische Annahmen des Inklusionsgedanken in den Wirkungsebenen "Kultur" und "Praxis" den beobachtbaren Ist-Zuständen gegenüber gestellt werden.
Drittens wird durch die Auswertung der Ergebnisse der voran gegangenen Untersuchungsschritte eine Bewertung der Chancen und Schwierigkeiten, Inklusion umzusetzen, möglich. In der abschließenden Diskussion werden die Stärke und Form des Einflusses des Inklusionsgedankens auf soziale und sozialpolitische (Sub-)Systeme für die Bundesrepublik und damit die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung eingeordnet und damit der Umsetzungsfortschritt ein Stück weit skizziert.
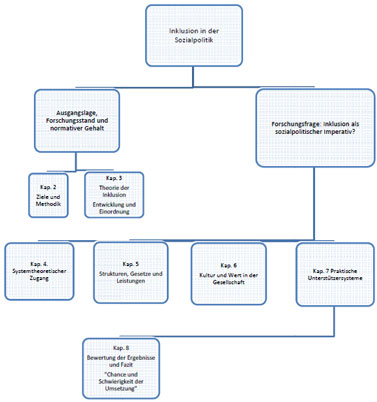
Abbildung 1: Skizze der Arbeit "Inklusion als sozialpolitischer Imperativ"
Die Abbildung 1 skizziert den Aufbau der vorliegenden Arbeit. in Kapitel 3 die theoretische Dimension von Begriffsdiskussion der Definitionen, auch in Abgrenzung zu Integration, Aspekte des inklusiven Gedankens anspricht. Begriffes Inklusion zu erfassen und die theoretische Ausgangslage für die folgende legen. Zudem werden die Ebenen skizziert, die Berührung mit dem Begriff de im Folgenden die Struktur der Arbeit vorgeben.
Kapitel 4 widmet sich der ersten Zugangsebene zu Inklusion, indem das Konzept in einen systemtheoretischen Kontext gestellt wird. Dazu dient die Diskussion, ob und inwiefern der inklusive Gedanke als (Teil einer) Gerechtigkeitstheorie zu sehen ist und wie sich der Inklusionsgedanke systemisch auswirkt, insbesondere in Abgrenzung zur Exklusion. Zentrale Fragen in diesem Kapitel sind: Was bedeutet dieser Gedanke für den Einzelnen, wie auch für die Sozialpolitik und soziale Organisationen grundsätzlich und in Bezug auf eine Gerechtigkeitsvorstellung? Worin besteht die neue Aufforderung an die Wohlfahrtsstaatlichkeit? Wie ist der inklusive Gedanke im Zusammenhang mit Fragen der (sozialen) Gerechtigkeit, des Wirtschaftssystems, kapitalistischen Leistungskriterien und Arbeitshierarchien zu sehen? Kapitel 4 bietet damit die Voraussetzung, die (möglichen) Einflüsse des Konzeptes auf die folgenden Ebenen zu entdecken.
In dem anschließenden Kapitel 5 werden die gesetzlichen Grundlagen und Mechanismen, die sozialpolitisch mittelbar oder unmittelbar auf die Menschen und Leistungssysteme im inklusiven Sinne wirken (könnten), dargestellt und diskutiert. Zudem werden aktuelle Policy-Dimensionen im Kontext von Inklusion dargestellt, wie beispielsweise die aktuelle Erarbeitung des nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2006.
Das Kapitel 6 beschreibt gesellschaftliche Werte und persönliche Haltungen, die das Konzept Inklusion fordert. Dazu gehören sprachliche Gegebenheiten und die Situation der Individuen, einmal der Menschen, die im Licht der UN-BRK an objektiven Rechten "gewinnen"[6] und einmal der Menschen, die Inklusion als neues Bild entweder persönlich und / oder beruflich als Haltung und Arbeitsweise implementieren (müssen).
Das Kapitel 7 widmet sich der Ebene der praktischen Unterstützersysteme und den Bereichen, die die größte alltägliche und praktische Berührung mit dem Konzept der Inklusion aufweisen. Mit der Erarbeitung der normativen Soll-Zustände und der Deskription der tatsächlichen Ist-Zustände auf der Ebene der sozialen Unterstützersysteme werden Diskrepanzen zwischen inklusiven Anspruch einer Idealnorm und der Realität herausgearbeitet, um mit diesen Ergebnissen eine Einschätzung des "Inklusionsfortschritts" und den Einflussstärken in der sozialen Praxis tätigen zu können. Zudem wird die Situation der Wohlfahrtsverbände und sozialen Einrichtungen dargestellt, die Inklusion als Auftrag, auch Druck und gleichzeitig als mögliche (Unternehmens-)Strategie erleben.
Kapitel 8 wertet die Wirkungsflüsse in und zwischen den Ebenen aus. Positive und negative Wirkungen des Inklusionsansatzes werden nach Chancen und Schwierigkeiten der Umsetzung gewertet. Die gewonnenen Hypothesen dienen der Orientierung, indem die Zugangsebenen von ihrer zentralen Fragestellung hier diskutiert werden. Abschließend wird die Forschungsfrage anfänglich beantwortet.
Diese Diskussion der vier Zugänge wird ergänzt durch Best-Practice-Bespiele, um erste praktische Erfahrungen exemplarisch darzustellen. Zudem werden prägnante, aktuelle Diskussionen in dem jeweiligen Kontext vorgestellt.
Explorative Studien dienen zur Erforschung von sozialen Strukturen, (sub-)Kulturen, Zusammenhängen und Handlungen, die weitestgehend unbekannt sind. Das impliziert offene Fragen, die das Feld zunächst offen und "breit entdeckungsfähig" lassen, um nicht Erkenntnissen durch einen starren oder zu fokussierten Blick den Weg zu versperren. Nach Bortz und Döring lassen sich vier Explorationsstrategien identifizieren, "die theoriebasierte Exploration, methodenbasierte Exploration, empirisch-quantitativ und empirisch qualitativ[7]" (Bortz & Döring, 2006, S. 358). Kernelement der Exploration ist die Bildung von Theorien und Hypothesen (ebd. S. 356). Insbesondere qualitative Methoden und Analysen sind geeignet, um "bisher vernachlässigte [oder neue] Phänomene, Wirkungszusammenhänge, Verläufe etc. erkennbar zu machen" (ebd. S. 380). In jedem Fall dient die Exploration dazu, unbekanntes Terrain wissenschaftlich zu erkunden um mit ersten Erkenntnissen falsifizierbare/verifizierbare Theorien bilden zu können.
Die drei skizzierten Ziele aus Kapitel 2.1 formulieren dabei die Methodik: die Exploration (und Bewertung) der Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik wird überwiegend theoriebasiert mit Literaturanalysen und Beobachtungen angegangen. Als Extrakt der Exploration einer Zugangseben werden Hypothesen formuliert, die die zentralen Erkenntnisse des jeweiligen Kapitels wiedergeben.
Die Dimension der hier formulierten Fragestellung wurde schon angedeutet, es fehlt sowohl an Theorien, "die eine Gestaltung und Bewertung konkreter Interventionsmaßnahmen erlauben" (Bortz & Döring, 2006, S. 354), als auch an praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, die großflächiger und universaler anzuwenden wären. Der inklusive Gedanke beginnt gerade erst "zu wirken", die sozialen Bereiche beginnen gerade erst erste Maßnahmen und Umsetzungslogiken zu entwickeln, wobei momentan sogar noch Schritte davor, nämlich die der "Auftragsklärung" und Sensibilisierung zu beobachten sind. Das belegen alleine in Bremen eine Vielzahl an Fachtagen in Jugend- und Behindertenhilfe, die alle zum Ziel haben, den Begriff und "Auftrag" zu klären[8].
[1] Beispiele: (Mittendrin e.V. , 2011); (Moser, 2012); (Saldern, 2012); (Heimlich & Kahlert, 2012)
[2] Der Begriff Inklusion wird in der Literatur sehr vielfältig umschrieben; er wird als Konzept, Idee und Gedanke, über Leitbild, Wert oder Vorhaben bis hin als Paradigma oder Theorie bezeichnet. In dieser Arbeit spreche ich von dem Konzept oder dem Gedanken der Inklusion, da er mehr ist als eine Idee, aber als Leitbild nur anfänglich nutzbar ist und als ganze Theorie erst noch verifiziert werden muss.
[3] Beispielsweise die Debatte zwischen Andreas Hinz und Helmut Reiser in Katzenbach (2007) oder Wocken (2010).
[4] Zum Beispiel Michael Wunder: "Inklusion. Nur ein neues Wort oder ein anderes Konzept?" (Wunder, 2011)
[5] Meines Wissens existiert keine wissenschaftliche Arbeit, die das Konzept der Inklusion in Bezug zur Sozialpolitik insgesamt analysiert.
[6] Für eine ausführliche Diskussion, welche Rechte "gewonnen" und welche individuellen (einklagbaren) Rechte daraus hervor gehen, siehe Punkt 5.2.1.
[7] Viele Forscher sehen einen Hauptunterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung in dem Erkenntniskontext induktiv und deduktiv. Ersteres führt zu Erkenntnissen vom "Einzelnen zum Ganzen", deduktiv bedeutet das Gegenteil. Quantitative deduktive Schlüsse werden dabei aber als "redundantes Wissen" bezeichnet, und liefert demnach wenig "Überraschendes" (Bortz & Döring, 2006, S. 300). Im Gegensatz dazu stehen induktive Schlüsse, die durch qualitative Methoden gewonnen werden und "Neues" zulassen, gleichzeitig aber den sog. Induktionsproblem unterliegen, d.h. "immer unsichere" Schlüsse liefern (vgl. ebd.). In dem Zusammenhang dieser Arbeit ist der Hinweise wichtig, da thematisch bedingt tendenziell induktive Schlüsse gezogen werden.
[8] Fachtag "..ich bin dann mal inklusiv" des Martinsclubs im September 2012, Fachtag im AK West "Inklusion und Jugendhilfe" im Oktober 2012, mehrere Fachtage am Landesinstitut für Schule Bremen, Fachtag des Landesjugendamtes im Mai 2013, Diskussionen zu "Inklusion" der Grünen im April und Oktober 2012, Fachtag "Inklusion und Jugendhilfe" in Berlin im Dezember 2012.
Inhaltsverzeichnis
Ursprünglich wurde der Begriff Inklusion vor allem im soziologischen Kontext genutzt und diente als Gegenpart zu Exklusion für die Beschreibung der soziologischen Verortung gesellschaftlicher Gruppen. Die Soziologie gebraucht die Begriffe Inklusion und Exklusion als "Grundkategorien systemtheoretisch orientierter Gesellschaftsanalysen" (Gestrich, 2007, S. 9) zur Erforschung gesellschaftlicher Spannungsfelder wie beispielsweise Armut und Reichtum, Einheimische und Fremde oder bürgerrechtlich Zugehörige und nicht Zugehörige. Auch Niklas Luhmann benutzte den Begriff in Abgrenzung zu Exklusion, wenn er von den "verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten und -schwierigkeiten des Individuums in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft" (Speck, 2010, S. 63) spricht. Aus diesem Gebrauch heraus wurde der Begriff dann auch in anderen Disziplinen, zunächst vor allem innerhalb der Bildungspolitik und im (sonder-)pädagogischen Kontext, in seiner direkten Übersetzung genutzt: "Einschluss" oder auch "Dazugehörigkeit".
Der pädagogische Begriff Inklusion wurde erstmals in den USA im Zuge der "kritischen Auseinandersetzung mit der Praxis schulischer Integration und ihrer Selektivität" von Reynolds (1976) (in Hinz, Körner, & Niehoff, 2012, S. 34) verwendet. Im Folgenden wurden die Ansätze - "De-Kategorisierung", "allgemeine Schule" und "unified system" (ebd. S. 35) auf der Ebene der Schule diskutiert und weiter verfeinert. Seitdem hat sich der Begriff am stärksten im Zusammenhang mit Bildungsfragen und pädagogischen Aufgaben entwickelt. Dabei wird deutlich, dass ein Ursprung der Inklusion in Bildungsfragen liegt und mit der kritischen Diskussion um Bildungsgerechtigkeit bzw. - gleichheit zusammenhängt, da die schulische Inklusion ein Ausschlussverbot fordert.
Aber auch in Bezug zu anderen Kriterien mit Diskriminierungspotential oder auch "Teilhabebarrieren" wurde schon in den 80iger Jahren der Begriff Inklusion genutzt, wie das Beispiel Mithu Alur zeigt. Sie beschreibt im Kontext eines Forschungsprojektes in Indien drei Barrieren gesellschaftlicher Partizipation: Armut, kulturelle Vorurteile und systemischer Ausschluss bestimmter Gruppen (ebd. S. 38) und nennt die Aufhebung dieser strukturellen Barrieren Inklusion. Dieses Beispiel verdeutlicht die (sozial-)politische Dimension des Begriffes.
Zu Beginn der 1990er Jahre wurde `Inklusion` in Bezug zu der "inklusiven Schule" und der "inklusiven Pädagogik, insbesondere mit der Salamanca Erklärung der Unesco[9] von 1994 weiter verbreitet und begann sich in der Bildungspolitik und Sonderpädagogik zu etablieren. Die Salamanca Erklärung formuliert im 2. Abschnitt:
"we believe and proclaim in regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes , creating welcoming communities , building an inclusive society and achieving education for all; more over, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system" (Unesco, 1994).
Damit sind wichtige, erste Definitionsbestandteile wie "welcoming communities", "education for all" und die Überzeugung, die "most effective education" sei eine inklusive, genannt worden und in den vergangenen 20 Jahren sind diese Elemente in immer größeren Umfang und weiteren Horizonten diskutiert worden:
"Inklusion vom lateinischen inclusio (Einschließung) zielt in der Sozialethik auf die Gleichwertigkeit eines Individuums als Vielfalt in der Differenz. In der soziologischen Systemtheorie ist sie die Art und Weise, wie soziale Systeme Menschen bezeichnen, die sie in ihren Relevanzraum aufnehmen, ihren Handlungsraum zugleich entfalten und eingrenzen"
(Jantzen, 2010, S. 98).
Dieses Zitat bringt das Kriterium "Vielfalt" mit, das wichtige Aspekte liefert: Vielfalt als Gewinn, Heterogenität als Normalität und "Vielfalt ist bunt und bunt ist gut". Der Ansatz, dass die Menschen, unabhängig, ob wir sie gruppenbezogen oder gesamtgesellschaftlich oder sogar weltweit betrachten, unterschiedlich sind, es nicht "den" Menschen mit einer klaren Vergleichbarkeit oder mit dem Zuweisungspotential standardisierter und administrativer Kriterien gibt und er mit seinen Eigenschaften immer individuell bleibt - und damit nie in umfassende Systeme homogenisierbar ist - markiert einen neuen Blick, der die "Willkommenskultur" anspricht:
"Inklusion heißt, Menschen willkommen zu heißen. Niemand wird ausgeschlossen, alle gehören dazu: in unserer Gesellschaft, unserer Kommune, zu jeder kleinen oder großen Gruppe und Gemeinschaft" (Montag Stiftung , 2011, S. 18)
In Bezug auf das "Willkommensein" oder auch die grundsätzliche Anerkennung des Individuums schreibt Monika Seifert zudem:
"Sie [die Inklusion] ist Ausdruck einer Philosophie der Gleichwertigkeit jedes Menschen, der Anerkennung von Verschiedenheit, der Solidarität der Gemeinschaft und der Vielfalt von Lebensformen" (Seifert, 2006a, S. 100),
und nennt damit einen wichtigen weiteren Aspekt: die Gleichwertigkeit. Diese skizzierten Ansätze beziehen sich auf das Gebot der Anerkennung der Einzigartigkeit des Menschen, und des daraus resultierenden Rechts auf Gleichwertigkeit. Dario Ianes nennt das sogar Normalität:
"Der Normalität muss eine erste Bedeutung (und Wert) als Gleichheit der Rechte zugewiesen werden: Normalität als gleicher Wert jedes Einzelnen, mit gleichen Rechten unabhängig von persönlichen, sozialen Beziehungen etc.". Und weiter: "Das Bedürfnis nach Normalität ist also die Suche nach der Bestätigung, die gleichen Rechte wie alle zu besitzen, ein Mensch mit gleichem Wert wie alle anderen zu sein, die gleichen Chancen zu haben" (Ianes, 2009, S. 10).
Damit kommt ein weiteres zentrales Element zum Tragen: die Chancengleichheit. Inklusion fordert gleiche Chancen für die bewusst gewünschte Verwirklichung des eigenen Lebens, und dazu gehören ggf. fördernde Elemente, die den Menschen befähigen, die Chancen wahrnehmen zu können. Dieses Gebot kann noch um eine Forderung ergänzt werden und wird damit im Umkehrschluss ein Verbot:
"Inklusion wendet sich gegen jede Form der administrativen Etikettierung, denn sie hält sie für einen Ausdruck von Diskriminierung, der die Teilhabe am öffentlichen Leben mindert" (Amrhein, 2011, S. 19).
Die Punkte `Vielfalt ist die Realität` und jegliche Stigmatisierungs- und Diskriminierungsverbote korrespondieren eng mit `Gleichwertigkeit` und der damit einhergehenden Anerkennung von Verschiedenheit. Hinzu kommt die Ansicht, dass "administrative Etikettierung" dem Menschen in seiner Verschiedenheit nicht per se gerecht werden kann. Daraus resultiert eben auch der Ansatz, dass es nicht um Gleichartigkeit (Herstellung von Homogenität durch Etikettierung beispielsweise), sondern um Gleichwertigkeit geht. Damit ist in der Diskussion um den Begriff und seinen Interpretationsspielraum der Raum gegeben, Inklusion auf bisher unterschiedlich definierte Zielgruppen anzuwenden, wie auch in unterschiedlichen sozialpolitischen und wissenschaftlichen Bereichen. Damit geht es nicht mehr nur um das Zusammendenken auf der individuellen (Gruppen-)Ebene, beispielsweise behinderter und nicht behinderter Menschen, v.a. in Schule und Behindertenhilfe, sondern um systemrelevante Aspekte, die originäre Systemlogiken in Frage stellen und auch, neben dem Einzelnen, systemische Barrieren anspricht:
"Inklusion kann jedoch nicht wirksam voran getrieben werden, wenn sie sich ausschließlich auf die Teilhabe von Individuen konzentriert. Stattdessen müssen die Barrieren bedacht werden, die sich im Umfeld und im System befinden und die individuelle Teilhabe behindern." (Booth, 2012, S. 54).
In diesem Kontext und am Beispiel der Praxis der Institutionalisierung behinderter Menschen
schreibt Andreas Hinz:
"Erst der Schritt von der De-Institutionalisierung zum ‚Leben mit Unterstützung' hat tatsächlich eine paradigmatische Qualität, denn hier wird die Zweiteilung der Menschen in die ‚Eigentlichen' und in die ‚Auch-Menschen' als PatientInnen oder KlientInnen aufgegeben zugunsten der Anerkennung aller als BürgerInnen - und nichts anderes ist das Anliegen der Inklusion" (Hinz, 2004, S. 42)
Damit werden Systembarrieren sprachlicher, formeller und informeller Art angesprochen, die inkompatibel mit dem Gedanken der Inklusion sind. Neben den positiven Formulierungen und Inhalten des Begriffes Inklusion, die ein soziales Bild von einem gleichwertigen Miteinander ansprechen, liefert Inklusion auch eine Reihe von Verboten. Diese Komplexität in einem Begriff, zum Beispiel in Bezug auf die Abgrenzbarkeit zu anderen Leitideen und die fehlende Spezifizierung für die Praxis, ruft dadurch auch Kritik hervor:
"Wie auch andere Begriffe, wie soziale Gerechtigkeit oder Freiheit, zeichnet sich Inklusion dadurch aus, dass sie jedermann plausibel oder selbstverständlich erscheinen. Ihr Nachteil besteht darin, dass sie wegen ihres allzu allgemeinen Inhalts nicht klar definierbar sind, zwar eine neue Richtung angeben, aber simplifiziert werden und damit an Durchschlagskraft verlieren" (Speck, 2010, S. 68)
Ein Problem sind sicher die unterschiedlichen Ebenen, die mit dem Begriff angesprochen werden und damit die fehlende Spezifizierung, wie auch die fehlende Trennschärfe zu anderen Begriffen. Das ist dann zum einen die Abgrenzungsfrage zur `Integration´, wenn zum Beispiel Hinz schreibt:
"Inklusion ist keine (modernisierte) Integration, sondern ein bürgerrechtlich basierter Ansatz, der die Begrenzungen der Heil- und Sonderpädagogik sowie der Behindertenhilfe überwindet. `Inklusion von Behinderten` ist ein Widerspruch in sich selbst" (Hinz, 2009, S. 5).
Und zum anderen die Frage nach den Wirkungsebenen. So schrieb "Miteinander Leben Lernen e.V.", schon 1984: "Inklusion heißt Willkommen-Sein!!" (Definitiv-Inklusiv) und Clemens Dannenbeck sagt: "der Weg der Inklusion beginnt beim Nachdenken über den eigenen Standpunkt" (Dannenbeck & Dorrance, 2011, S. 208). Damit sprechen die Autoren eine Haltungsfrage an, die jeden persönlich betreffen. Aber wie geschildert, spricht Inklusion auch ein (sozial-)politisches System wie auch ein gesellschaftliches Miteinander an. Zuletzt fordert Inklusion in der Umsetzung praktische Aufgaben in der Pädagogik, Verwaltung, Schule und weitere gesellschaftliche Systeme. Die Montag Stiftung brachte es mit der Entwicklung des "kommunalen Index für Inklusion", (Montag Stiftung , 2011), wie schon eingangs beschrieben, auf den (einen) Punkt: Inklusion ist Haltung, Struktur und Praxis. Eine andere, vergleichbare Unterteilung nimmt Tony Booth vor und spricht an dieser Stelle von drei Perspektiven von Inklusion, die alle miteinander durch den Wert `Teilhabe` verbunden sind: die Perspektive auf "die Teilhabe von Individuen, die Perspektive auf die Teilhabe an Systemen und die Perspektive auf die Teilhabe von Werten" (Booth, 2012, S. 53). Und der deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge nennt - auch orientiert an einem zentralen Bestanteil von Inklusion: der Teilhabe - drei Faktoren, die die Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben behindern oder erleichtern: "die Zugänglichkeit öffentlicher Infrastruktur, die Struktur und Ausrichtung der Hilfesysteme sowie die Einstellung und das Verhalten der Mitmenschen" (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2012, S.5). Pauser und Pinetz umschreiben die Wirkungsebenen mit einer Mikro, Meso- und Makroebene. Es werden also die Gesellschaft insgesamt, wie auch das Individuum, angesprochen. Hinzu kommt die Mesoebene, die Institutionen und (Verwaltungs- )Strukturen meint (Pauser & Oinetz, 2009, S. 250). Alle vier Ansätze gehen in dieselbe Richtung: Inklusion beinhaltet die praktische Frage, zum Beispiel der Zugänglichkeit und der pädagogischen Ausrichtung, die strukturelle Frage, beispielsweise die Ausrichtung von Hilfesystemen und die Frage nach den Werten und Haltungen der Individuen. Und angesprochen sind damit die Individuen, wie auch die Gesellschaft und die Institutionen.
Zu diesen angesprochenen differenzierten Wirkungsebenen durch das "Wer?" und "Worauf?" kommen zudem unterschiedliche Ausgangslagen: Die Begriffsentwicklungen, - (pädagogischer) Handlungsmaßstab in der Praxis, Kategorie in der Soziologie, Bestandteil von Gerechtigkeitsvorstellungen und Leitbild gesellschaftlicher Entwicklung - machen das definitorische Verorten schwierig. Es kommen also unterschiedliche Entstehungskontexte und Wirkungsebenen zusammen. Es werden unterschiedliche Adressaten, das Individuum wie das Kollektiv, das Hilfesystem wie das praktische Arbeiten mit Methoden, angesprochen, wie auch in unterschiedlicher Aufforderungstiefe, nämlich gleichzeitig als praktischen Prozess, Pflicht, Denkmaßstab und Ziel. Zu der Frage "was und wer wird angesprochen?" kommt also noch "wie und wo wird angesprochen?" und "in welcher Stärke (als Leitbild oder gesetzliche Pflicht?) wird angesprochen" und damit wird der "Auftrag" von Inklusion an vielen Stellen sehr umfassend.
Zusammengefasst lässt sich der Begriff Inklusion in seiner Entwicklung und seinen Bestandteilen folgendermaßen beschreiben: Zunächst genutzt als Kategorie in der Soziologie für Gruppenanalysen, dann in Kanada und den USA als Begriff der Bewegung der "Behinderten" in den 1970er Jahren und der daraus resultierenden Forderung nach Abbau von Barrieren, die zu "be-hindernden Bedingungen durch die Gesellschaft führen" (Dore-Stein, 2011, S. 95) verwandt und heute gebraucht als Leitziel des gemeinsamen Lernens und Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung, das auch das "community living" und die "Schule für alle" beinhaltet. In diesem Kontext wird der Begriff also einerseits als Zuschreibung genutzt, andererseits als Paradigma für gesellschaftliche Prozesse bzw. gesellschaftlich wünschenswerte Entwicklungsprozesse. Darüber hinaus wird er aber auch in der Praxis als Aufforderung für ein bestimmtes Handeln genommen, wenn zum Beispiel Feuser die Allgemeine Pädagogik mit klar ausgearbeiteter Didaktik und Methode beschreibt (vgl. Feuser, 1989) und als diskriminierungsfreie Haltung des Einzelnen in der Gesellschaft. Und: "obwohl der Schwerpunkt der Konferenz von Salamanca (1994) auf sonderpädagogischem Förderbedarf lag, lautete das Fazit: ‚Die Pädagogik für besondere Bedürfnisse - ein wichtiges Thema für Länder im Norden wie im Süden - kann sich nicht in Isolation weiterentwickeln. Sie muss Teil einer allgemeinen pädagogischen Strategie sein und wohl auch einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Politik.'" (Deutsche UNESCO-Kommission e.V., 2009, S. 8). Damit wird die Stellung der Inklusion, eben auch außerhalb der Pädagogik und Schule, noch einmal deutlich. Und das nicht nur Lernende angesprochen werden, verdeutlicht dieses Zitat:
"In several countries, inclusion is still thought of simply as an approach to serving children with disabilities within general education settings. Internationally, however, it is increasingly seen more broadly as a reform that supports and welcomes diversity amongst all learners. It presumes that the aim of inclusive education is to eliminate social exclusion resulting from attitudes and responses to diversity in race, social class, ethnicity, religion, gender and ability. As such, it starts from the belief that education is a basic human right and the foundation for a more just society. In this sense, it is the means of ensuring that Education for All really does mean all" (United nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2008, S.70).
Diese vielfältigen Aspekte, Dimensionen und Kerngedanken werden im Folgenden in den drei beschriebenen Wirkungsebenen, Praxis, Struktur und Haltung, verortet. Zudem führe ich eine weitere systemtheoretische Ebene ein, da Inklusion auch einen systemtheoretischen Horizont, wie ich darstellen werde, hat. Dementsprechend verfolgt diese Arbeit den "roten Faden" durch vier Zugänge zu Inklusion.
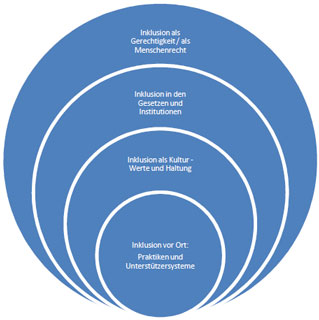
Abbildung 2: "Inklusionsebenen", eigene Darstellung
Diesen vier Wirkungsebenen, wie Abb.2 zeigt, werden unterschiedliche Einflussstärken zugeschrieben werden. Dabei wird hier als die einflussstärkste Ebene der normative Zugang zu Inklusion definiert, wenn Inklusion als grundlegendes Recht der vollen Teilhabe aller Menschen an allen gesellschaftlichen Systemen verstanden wird. Das wird bekräftigt durch die UN-Konvention der Rechte für Menschen mit Behinderung[10]. Diese Wirkung umfasst damit auch alle anderen Ebenen, Gesetze und Institutionen sind darunter angesiedelt, da diese direkt geprägt sind von der normativen Ebene und deren Aufforderungscharakter. Der Zugang durch die Frage nach einer "inklusiven Kultur" als gesellschaftlicher Wert und individuelle Haltung wiederum beeinflusst stark die sozialen Unterstützersysteme und die konkrete Praxis. Zudem ist sie dazu stark von Gesetzen geprägt, wie sich das beispielsweise durch das Antidiskriminierungsgesetz zeigt. Aber die Zugänge Kultur und Struktur sind sehr eng beieinander stehend, und sie wirken interdependent.
Diese Zugänge beinhalten in der Diskussion und Implikation in die Sozialpolitik und deren Ausgestaltung differenzierte Anwendungsbereiche: Während der gerechtigkeitstheoretische Zugang normative Elemente des Inklusionsgedankens bezogen auf die Sozialstaatlichkeit anspricht, die Gerechtigkeits- und Begründungstheorien sozialstaatlichen Handelns diskutiert, nimmt die "kulturelle" Wirkung des inklusiven Gedankens Einfluss auf gesellschaftliche Vorstellungen und die Sprache und Haltung des Einzelnen. Strukturfragen beziehen sich auf gesetzliche Grundlagen und die konkrete Leistungsausgestaltung in der Verwaltung und den Institutionen. Die soziale Praxis wiederum spiegelt die Umsetzung sozialstaatlicher Anforderungen wider. Diese Praxis ist an vielen Stellen "abhängig" von den sozialstaatlichen Zielen, entwickelt aber auch eigene Legitimations- und Aufforderungsmuster, beispielsweise durch das Sprachrohr der Wohlfahrtsverbände. Diese Untersuchung der Ebenen und ihren Berührungspunkte in den beschriebenen Bereichen dienen als Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage. Und auch wenn Inklusion Interdisziplinarität und einen politisch bereichsübergreifenden Blick fordert, bietet es sich hier an, diese Ebenen mit der dazugehörigen Trennung von sozialen und sozialpolitischen Bereichen zu nutzen und zu beschreiben.
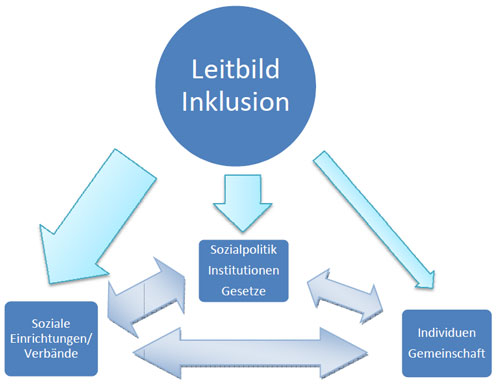
Abbildung 3: "Wirkungszusammenhänge"
Des Weiteren geht die vorliegende Arbeit von der These zweier Wirkungsdreiecke aus. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist es unerlässlich, die Zusammenhänge in Form von Wirkungen darzustellen. Wenn bekannt ist, welche Ebenen im inklusiven Sinne miteinander interagieren, eine Bewertung nach Chance und Schwierigkeit in der Umsetzung möglich, da diese von den jeweiligen anderen Ebenen abhängt, wie Abbildung 3 skizziert. Diese grundsätzliche Annahme wird in allen Teilen der Arbeit mit diskutiert. Einmal wirken die Diskus Leitbild der Inklusion auf drei grundsätzlichen Ebenen. Sie sind in der Abbildung 3 als hellblaue Pfeile dargestellt und markieren schon die relative, geschätzte Einflussstärke durch die unterschiedliche Breite der Pfeile. Die "Wirkungsebenen" gliedern sich wie folgt:
1. Strukturell und institutionell: Das Leitbild der Inklusion wirkt durch wissenschaftliche praktische Diskussionen und die UN Aufträge und sozialpolitische Umsetzbarkeit und Wirkungsweise diskutiert und Bereichen.
2. Praktisch und kommunal: Das Leitbild wird zunehmend in sozialen insbesondere der Behindertenhilfe, diskutiert und gilt für viele als grundlege Ausrichtung.
3. Kulturell und individuell: Inklusion spricht eine Haltung an, die bei dem Einzelnen beginnt und beginnen muss. Diese Wirkung auf das Individuum und darüber hinaus auf die Gesellschaft, wird an vielen Stellen gefordert und mit einer Vielzahl an Veranstaltungen und Diskussionen begleitet.
Das zweite Wirkungsdreieck (dargestellt durch dunkelblaue Pfeile) beschreibt wiederum die und Intradependenz der Inklusionsdiskussion zwischen und innerhalb der Ebenen. Denn sie können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, viel mehr berühren und überschneiden sie sich und
sind voneinander, wie auch die Ebenen als einzelne in sich wie folgt darstellen:
A. Die sozialpolitische Diskussion um Inklusion wirkt sich auf die Organisationen aus, wie auch auf die praktische Arbeit der Wohlfahrtsverbände und auf den Einzelnen.
B. Das Individuum wiederum nimmt Einfluss durch politische Partizipation und gesellschaftliches Engagement auf Praktiken vor Ort in den Organisationen und auf sozialpolitische Struktur.
C. Die Praktiken der Wohlfahrtsverbände und sozialen Dienstleister wiederum wirken sich in der Diskussion um inklusive Prinzipien und Handlungsmaßstäbe auf den Einzelnen, wie auch auf die Sozialpolitik aus.
Die Darstellung angenommener Wirkungsebenen und - zusammenhänge gibt der vorliegenden Arbeit eine Struktur und birgt zweitens den Vorteil, dass Diskussionen um Wirkungen und Wirkungsrichtungen nicht im "luftleeren" Raum stattfinden, sondern der Leser eine grundsätzliche Verortung bekommt. In Kapitel 8 - Bewertung nach Chance und Schwierigkeit - werden die grafischen Annahmen anfänglich verifiziert.
Kapitel 3.1 zeigte verschiedene Bestandteile der Inklusion auf und Kapitel 3.2 definiert die unterschiedlichen Wirkungsebenen. Die folgende Tabelle 1 fasst die zentralen Aspekte der Inklusion thematisch gelistet auf. Dazu werden konkrete Beispiele genannt, die veranschaulichen, wo schon inklusive Aspekte zu finden sind. Diese Tabelle dient stichwortartig der Orientierung für die vier Zugänge zu Inklusion der Kapitel 4-7.
Abbildung 4: Inklusionsbestandteile und Beispiele, eigene Darstellung
|
Systemtheoretischer Zugang (Kapitel 4) |
|
|
Inklusionsbestandteile |
Beispiele |
|
Inklusion als "soziale Gerechtigkeit" (Kap. 4.1) |
Beobachtbare Inklusionsprozesse in der Behindertenhilfe UN-BRK |
|
Menschenrecht (Kap. 4.1 und 5.2) |
Recht auf Besuch einer allgemeinen Schule Recht auf Antidiskriminierung / Ausschlussverbot (z.B. Zugang zur Justiz) |
|
Begründungstheorien: Empowerment und der Capability-Approach (Kap. 4.2) |
Befähigung als Schlüssel zur Teilhabe, Beispiel §1, SGB IX |
|
Chancengleichheit in der Teilhabe (Kap. 4.3) |
Grundsätzliche Öffnung der gesellschaftlichen Systeme, Gebärdendolmetscher im öffentlichen rechtlichen Rundfunk |
|
Flache Hierarchien, Teamverantwortung (Kap. 4.4 und 4.5) |
Kollegien in "Einer Schule für alle" |
|
Anpassungsfähigkeit des Systems, Anpassungsfähigkeit der (Unterstützer- )Systeme (Kap. 4.7) |
Individuelle Hilfepläne (im Gegensatz zum HMB-W Verfahren beispielsweise) Individuelle Bedarfsanalysen |
|
Keine dichotomen Einteilungen bestimmter Gruppen (Kap. 4.5 und 6.1.1) |
"Wir- und die Denken" überwinden, Beispiel: Interkulturelles Café, Gesellschaft für integrative Beschäftigung Bremen |
|
Vorsorgender Sozialstaat (Kap. 4.7 und 7.1) |
Aktivierung, Prävention, Vorsorge, Beratung in SGB III,V,VIII,IX,XI und XII |
|
Investive, präventive Maßnahmen + Instrumente |
Schulpflicht und freie Bildung Weiterbildung SGB III |
|
Keine "administrative Etikettierung" (Kap. 4.5 und 3.3) |
Schulgesetz in Bremen (Keine Etikettierung durch Wahlfreiheit, jedoch starke individuelle Fähigkeitsetikettierung) |
|
Gesetzlich - Struktureller Zugang (Kapitel 5) |
|
|
Behindernde Faktoren im System entdecken (Kap. 5.1) |
Projekt "Ideal" (Integration durch ein aktives Leben, 2008) |
|
Stigmatisierungs- und Diskriminierungsverbot (Kap. 5.2 und 5.3.1) Ausgrenzungsverbot, Ausschlussverbot (Kap. 5.2 + 5.3.1) Gleiche Rechte und Pflichten für alle (Kap. 5.3.1.) |
Einstellungsverfahren in Firmen AGG und BGG Ausgleichsabgabe Art. 3 GG |
|
Chancengleichheit in Form von Zugänglichkeit zu Systemen und Lebensbereichen (Kap. 5.3.1) |
AGG |
|
Barrierefreiheit, sprachlich, formell, informell (Kap. 5.3.2.) |
Formulare in leichter Sprache, Niederflurfahrzeuge, "Arbeitslosen-und Studententarife" |
|
Direkte Hilfen, persönliche Budgets (Kap. 5.3.5 und 7.1.2) |
Budget für Arbeit ("Job Budget" - Kap. 7.5.2.4.), Persönliches Budget §17, SGB IX |
|
Volle (soziale) Teilhabe, Gleichstellung der Rechte (Kap. 5.3ff) |
Gleichstellungsgesetze, Quotenregelungen |
|
Investive, präventive Maßnahmen + Instrumente zur Vermeidung von Marginalisierung (Kap. 5.3.ff) Sensibilisierung |
Aktivierung, Aufklärung, Prävention in SGB III,V,VIII,IX,XI und XII Kampagne "Einfach Teilhaben" der Bundesregierung (www.einfach-teilhaben.de) |
|
De-Institutionalisierung (Kap. 5.4) |
Ambulante Wohnform, Beispiel Stiftung Alsterdorf Hamburg (www.alsterdorf.de), Beispiel Abgabe städtischer Wohnangebote an privaten Träger (Städtische Deputation für Kinder, Jugend, Soziales Bremen, 2013) Lebensweltnahe Versorgung |
|
Trägerbudgets, Sozialraumbudgets (Kap. 7.2) |
Sozialraumbudgets der Kinder- und Jugendförderung in Bremen |
|
Gesellschaftliche(r) Zugang + Werte + Sprache (Kapitel 6) |
|
|
Ressourcenorientierung (auch in der Sprache - Kap. 6.1.1 und 7.6.2.2) |
Diversity Management |
|
"Heterogenisierendes Denken" - "Vielfaltsdenken" (Kap. 6.1.1.) |
Inklusive Betriebsliga Bremen (Landesbetriebssportverband Bremen) |
|
Neutrale Sprache (Kap. 6.1.2) |
Genderspezifische Sprache, "Leichte Sprache" |
|
Keine Reduzierung auf ein Merkmal (6.2.1ff und 7.1.1) |
Negativbeispiel: Förderplan der Agentur für Arbeit (BA) für "Betreuungskunden" |
|
Wertschätzung jedes Individuums, Vielfalt, Gleichwertigkeit (Kap. 6.1.1.1 und 6.1.3) |
§1, GG Methode: "Der kommunale Index für Inklusion" (Montag Stiftung, 2011) |
|
Partizipation und Empowerment (Kap. 6.2.1.2) |
Mitbestimmung, Fähigkeit zur Mitbestimmung |
|
Praktische Unterstützersysteme (Kapitel 7) |
|
|
Allgemeine Lebens-, Wohn- und Arbeitswelten (Kap. 7.1) |
Leben und Arbeiten im Stadtteil, Beispiel Stiftung Alsterdorf Hamburg |
|
Vernetzung von Unterstützersystemen (Kap. 7.1 und 7.2) |
Kooperationen zwischen verschiedenen Leistungsträgern |
|
Sozialraumorientierung, Gemeinwesensarbeit und Dezentralität (Kap. 7.1, 7.2 und 6.2.1.2.) |
Leistungsträger arbeiten dezentral und sozialraumorientiert (Mitarbeiter kennen Sozialstrukturen vor Ort) |
|
Community Living, Beteiligungsverfahren, Lebensweltorientierung (Kap. 7.1, 6.2.1.7 und 7.3) |
Gemeinschaftsleben, soziale Unterstützung durch Nachbarschaften, "Sozialkapital"[a] |
|
Ent-spezialisiert (auch multiprofessionell), "Unterstützermix" (Kap. 7.6) |
Leistungen können direkt erbracht werden oder jemand wird vermittelt. Beispiel Quartiersmanagement in benachteiligten Stadtteilen |
|
Individuelle Unterstützung und nonkategorialer Zugang zu Leistungen (Kap. 7.5) |
Freie Budgets in der Arbeitsvermittlung ("freie Förderung" nach §§16f SGB II) |
|
Systemische (Person + Umwelt behindernde Faktoren) Suche nach Benachteiligung |
Bedarfsanalyse mehreren Jugendeinrichtungen im Stadtteil - Beteiligungsverfahren |
|
[a] Dazu ausführlich: Dill (2012) |
|
Trotz der vielfältigen Aspekte und Dimensionen, die dem Begriff "Inklusion" zugeschrieben werden, erfolgt hier eine Arbeitsdefinition, wohlwissend[11], dass sie sicher Aspekte außer Acht lässt bzw. Gewichtungen anders vornimmt, als andere es tun würden. Dennoch ist es für die vorliegende Arbeit wichtig, einen definitorischen Rahmen anzubieten.
Sehr umfassend hat Franz Fink eine Definition von Inklusion beschrieben:
"Inklusion bedeutet, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, unter denen alle Bürger- /innen eines Gemeinwesens ihre selbstbestimmte Teilhabe verwirklichen können. Und das Neutrale Sprache (Kap. 6.1.2) Genderspezifische Sprache, "Leichte Sprache"
Keine Reduzierung auf ein Merkmal wiederum bedeutet, Zugang zu allen materiellen sozialen und kulturellen Möglichkeiten und Prozessen einer Gesellschaft zu haben" (Fink, 2011, S. 21).
Die Unesco hat ebenfalls eine hier in dieser Arbeit genutzte Definition geliefert, wobei diese auf das System Schule angewandt ist und ich sie aber für alle sozialen Systeme nutze:
"Inclusion is a process. That is to say, inclusion has to be seen as a never-ending search to find better ways of responding to diversity. It is about learning how to live with difference and learning how to learn from difference. In this way differences come to be seen more positively as a stimulus for fostering learning, amongst children and adults. Inclusion is concerned with the identification and removal of barriers. Consequently, it involves collecting, collating and evaluating information from a wide variety of sources in order to plan for improvements in policy and practice. It is about using evidence of various kinds to stimulate creativity and problem-solving. Inclusion is about the presence, participation and achievement of all students." (UNESCO, 2005, S. 15)
Damit sind die Wirkungsweise, wie auch "Sender und Empfänger" der Inklusion gut umschrieben und beinhaltet grundsätzlich folgende Definitionskriterien: Gleiche, uneingeschränkte Zugangsmöglichkeiten zu allen für den Menschen relevanten gesellschaftlichen Bereichen, Vielfalt nutzen und unterstützen, prozesshaft arbeiten ohne stigmatisierende, askriptive, kategorisierende und dichotome Kriterienzuschreibungen als Ideal gesellschaftlicher Entwicklung im Zusammenleben. Dazu zählt auch das selbstverständliche Miteinander in allen Bereiche ohne Augenmerk auf eine verengte Kriteriensicht, d.h. auch im Umkehrschluss dürfen nun nicht Gruppen explizit genannt werden oder sogar bevorzugt werden.
Inklusion bedeutet jeden so anzunehmen wie er ist und mit ihm wertschätzend, respektvoll, gleichberechtigt und auf Augenhöhe und selbstverständlich zu kommunizieren bzw. zu arbeiten und solidarisch zu sein. Jegliche Stigmatisierungen, Vorurteile oder verkürzte und nicht kontinuierliche überprüfte Kriterienzuschreibungen sind danach nicht gültig. Strukturell bedeutet Inklusion die vollständige Barrierefreiheit, das flexible, systemische (Re-)agieren auf sich verändernde Ausgangslagen, das Sichern und Etablieren gleicher Rechte und das Sichern und Befähigen der individuellen Chancen auf Partizipation und Lebensselbstverwirklichung (Chancengleichheit). Praktisch bedeutet Inklusion den Fokus auf eine neutrale Sprache zu legen, Stigmatisierungen im Arbeitskontext abzulegen und Zugänglichkeiten zu eröffnen (Zielgruppenlogik überdenken). Grundsätzlich gilt das Anerkennen vom Vorteil der positiven (und verwertbaren) Unterschiedlichkeit im Handeln und Denken, als den Fokus auf Defizite und homogenisierte Gruppen zu legen. Inklusion bedeutet das Recht und die Pflicht eines jeden an der Gesellschaft voll teilzuhaben und teilzunehmen, ohne dabei mit eben diesem Recht das gleiche Recht der Mitbürger einzuschränken. "Grundlegend ist ein Perspektivenwechsel von einer Politik der Fürsorge zu einer Politik der Rechte" (Verein für Sozialplanung e.V., 2012, S. 3). Inklusion ist also in allererster Linie eine strukturelle, persönliche und emotionale Zugangsform und kann dann damit besten durch eine Negierung beschrieben werden: ein inklusiver Zugang ist dann geschaffen, wenn er nicht strukturell, individuell oder praktisch ausgeschlossen oder unmöglich ist.
Integration bedeutet "Herstellung des Ganzen" (Dollezal, 2008, S. 6), wohingegen `Inklusion` das Gegenteil von Exklusion beschreibt und somit "Einschluss" bedeutet. Im Gegensatz zu Integration, die auch die Unterschiedlichkeit der Menschen erkennt, aber versucht an vielen Stellen anzugleichen und damit die einen in das andere System zu integrieren, propagiert Inklusion das Annehmen der Unterschiedlichkeit und damit das Leben und Arbeiten mit der Unterschiedlichkeit, ohne den Zwang zunächst Unterschiedlichkeit systemkompatibel anzugleichen. Der Integration gehen (mindestens) zwei unterschiedliche Systemzugehörigkeiten voraus, wobei der Prozess der Integration Menschen vom einen in das andere System integrieren möchte. Dazu gehört ein "Angleichungsprozess".
Inklusion wiederum beschreibt nur eine Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen und universellen System. Mit anderen Worten: "Integration is its most negative connotation stands for integration by location, whilst providing a watered-down variant of the regular curriculum" (Meijer, Pijl, & Hegarty, 2012). Durch die mangelhafte Übersetzung der UNESCO Erklärung von 1994[12] und der UNKonvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung hat sich die Wahrnehmung des Konzeptes der Inklusion im deutschsprachigen Raum verzögert und so lässt sich erklären, dass z.T. noch heute Inklusion synonym mit Integration gesehen wird (vgl. Dollezal, 2008, S. 11). Nach Wilhelm, Eggertsdóttir und Marinóssen (2006) bedeutet `Inklusion` die qualitative Weiterentwicklung von `Integration` (wobei es freilich auch gegenläufige Ansichten gibt, wie beispielsweise Reiser (2007, S. 99)). Inklusion geht von einer von Vornherein nicht separierten Gesellschaft aus. Das Integrieren in Systeme wird dann überflüssig. In sofern kann sich Inklusion nur auf zukünftiges Handeln und ein zukünftiges gesellschaftliches Bild beziehen, während Integration dafür vorbereitend an den Stellen zunächst stattfinden muss, wo vorher separiert wurde. Trotzdem ist es klug, nur noch von Inklusion zu sprechen, um die Intention der Selbstverständlichkeit im menschlichen (unterschiedlichen) Sein und Handeln hervorzuheben. Mittlerweile wurde der Begriff Integration, zumindest im Bereich der Bildungs- und Behindertenpolitik, aber vielerorts abgelöst, was auch an der zunehmenden "Inflationierung des Integrationsbegriffes" (Hinz, 2007, S.83) liegt, wobei nach wie vor die unterschiedlichen Konzepte gesehen werden müssen und nicht einfach nur die Auswechslung der Begriffe als "Refreshment" in politisch-fachlichen Diskussion fungieren darf. Integration kann als Prozess verstanden werden, Inklusion als Ziel. Oder mit den Worten Georg Theunissens und Helmut Schwalbs: "Denn solange Menschen [...] ausgegrenzt werden, bedarf es ihrer Integration, die es dann in ein "Leben in Inklusion" zu überführen gilt" (Theunissen & Schwalb, 2009).
Inhaltsverzeichnis
- 4.1. Inklusion zwischen zwei Sphären sozialer Gerechtigkeit
- 4.2. Inklusion und der Capability Approach (CA)
- 4.3. Inklusion im Licht einer liberalen Marktwirtschaft
- 4.4. Macht, Hierarchie und Inklusion
- 4.5. Defizitkriterien und Potentiale
- 4.6. Inklusion und Armut
- 4.7. Der systemtheoretische Zugang zu Inklusion - Inklusion und Exklusion
- 4.8. Hypothese: "Inklusion bietet zentrale Aspekte eines neuen sozialpolitischen Leitbildes"
Durch die Menschenrechtsdimension der UN-Konvention von 2006 und die hohen moralischen und praktischen Aufforderungen, die in der Diskussion um Inklusion mitschwingen, wird das Konzept auch in Verbindung mit Gerechtigkeitsvorstellungen und -theorien gebracht. Insbesondere Teilaspekte von Inklusion, wie Chancengleichheit, Teilhabemöglichkeiten oder Empowerment[13] sind starke Elemente in Gerechtigkeitstheorien, zum Beispiel in der Theorie der Gerechtigkeit von Rawls (Rawls, 1975) oder in dem Capability Approach von Sen und Nussbaum (Sen, 2009; Nussbaum, 1999). Inklusion bezieht also tendenziell Position in den Diskussionen um Gerechtigkeit, wobei die Frage ist, inwiefern Inklusion eine eigene Theorie liefert oder als Teilaspekt in einer größeren Gerechtigkeitstheorie verortet werden kann. Dahinter steht die praktische Frage, ob das Konzept Inklusion einen systemtheoretischen Zugang zur sozialpolitischen Legitimation bietet, also inwiefern das Konzept als Werte- und Handlungskanon für die Grundausrichtung der Sozialpolitik nützlich ist. Zur Beantwortung dieser Frage wird das Konzept Inklusion im Folgenden mit verschiedenen Aspekten gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen konfrontiert.
In der politischen Theorie[14] wird über die Legitimation staatlicher Gewalt diskutiert, und damit ein Horizont der Gerechtigkeit beschrieben. Dabei existieren bekanntermaßen unterschiedliche "Füllungen" und Dimensionen von Gerechtigkeit und somit unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte. Das deutet schon die Vielfalt der Begrifflichkeiten an: soziale Gerechtigkeit, Bedarfs- und Chancengerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Ergebnis- und Leistungsgerechtigkeit (vgl. auch Schmidt, 2004). Im Allgemeinen wird der Begriff `Gerechtigkeit` mit folgenden Teilwerten belegt, die aber in ihrer Priorität durchaus von den verschiedenen politischen Ideologien und der dahinter stehenden politischen Philosophie auch unterschiedlich bewertet werden: Während der Liberalismus Gerechtigkeit stark mit dem Wert Freiheit, und dabei insbesondere mit negativen Freiheiten, d.h. den Abwehrrechten, verbindet [15] , propagiert der Sozialismus[16] Gleichheit und der Konservatismus[17] legt besonderen Wert auf Tradition und das Anerkennen "natürlicher Ungleichheit", das auch Hierarchien begründet. Neuere Formen der Gerechtigkeitsdiskussionen differenzieren innerhalb dieser Dimensionen, so dass eine Vielzahl von "Teil-Gerechtigkeiten" die Legitimation vom gerechten Staat, Markt und Gesellschaft begründen wollen. Zu den liberalen Ansätzen zählen dabei Leistungs- und Verfahrensgerechtigkeit, konservative Ansätze betonen Paradigmen der Besitzstands- und Generationengerechtigkeit und sozialistische Ideen verfolgen kollektiv geleitete Bedarfsgerechtigkeit, möglichst unabhängig von individuellen igenschaften der Menschen. Relativ neu in der politischen Theorie ist die "Teilhabegerechtigkeit", deren Grundlage eine Art "Garantismus" wäre, der Wert auf "Menschenrechte und universalistische Religionen" (Opielka, 2008, S. 49) legt. Aber auch innerhalb der unterschiedlich gewichteten "Grundwerte" bestehen weitere "Unterkategorien". Das zeigt besonders eindrucksvoll die Diskussion um die soziale Gerechtigkeit, die Aspekte von konservativen Werten wie Barmherzigkeit und Fürsorge, über sozialistische Ansätze der stringenten Umverteilung bis hin zu modernen sozialstaatlichen Leitsätzen wie das "Fördern und Fordern" behandelt (vgl. Höffe, 2005). Zudem existieren Mischformen in der politischen Theorie, wie der liberale Egalitarismus, dem auch Rawls` "Theory of Justice" (Rawls, 1975) zugerechnet wird. In dem Werk wurden auch zwei Gerechtigkeitsgrundsätze definiert, und im Kontext dieser Arbeit ist insbesondere der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz Rawls`[18] einer (sozialen) Gerechtigkeit interessant und daraus abgeleitete Interpretationen und zentrale Aspekte der Chancengleichheit. Des Weiteren ist mit dem Gedanken der Inklusion der Befähigungsansatz von Sen und Nussbaum in Verbindung zu bringen. Im Folgenden gehe ich auf die Grundlagen theoretischer Gerechtigkeitsüberlegungen mit eben diesem Fokus ein, da sie das Konzept Inklusion betreffen.
Es wurde gezeigt, dass zentrale Elemente des inklusiven Gedankens Chancengleichheit, gleiche Zugangs- und Partizipationsmöglichkeiten zu und an allen relevanten Lebensbereichen, individuelle Unterstützung ("Befähigung"), präventive Maßnahmen, keine dichotome Einteilung nach Defizitkriterien oder Gruppen und daraus resultierende Vermeidung von Zielgruppenlogiken und Verhinderung von Diskriminierung sind. Eine wichtige Abgrenzung besteht in der inneren Logik des Aspektes Gleichheit: Inklusion fordert nicht Gleichheit zwischen den Menschen, sondern Gleichheit der individuellen Chancen für die autonome Lebensführung[19] und dazu gehört das Verbot von strukturellem Ausschluss an Teilhabe. Diese Aspekte finden sich auch in Gerechtigkeitstheorien wieder, und somit hat der Inklusionsgedanke einen gerechtigkeitstheoretischen Anspruch und liefert damit eine Zugangsmöglichkeit, die hier skizziert werden soll.
Die Aspekte Chancengleichheit und Zugangsmöglichkeit stehen im Widerspruch zu sozialer Ungleichheit und Ausschluss. Nach Rawls sind aber soziale Ungleichheiten zwischen den Menschen erstens "natürlich", da Talente und Begabungen einerseits ungleich verteilt sind, und andererseits vererbtes (materielles und immaterielles) Vermögen ungleich weiter gegeben wird, und zweitens dann legitim, wenn soziale Ungleichheit zum Vorteil aller ist. Andererseits gelten als Referenz für Ungleichheit nicht andere Teilnehmer der Gesellschaft sondern Positionen. Ungleichheit ist also zu akzeptieren, wenn grundsätzlich (neben den sog. Grundfreiheiten) Positionen für jedermann erreichbar sind (vgl. Windolf, 2009). Diese Prämisse erlaubt dann Ungleichheit zwischen Positionen. Auf den Aspekt `Ausschlussverbot` angewendet bedeutet dies, dass der strukturelle Ausschluss von Teilen der Gesellschaft dann ungerecht ist, wenn dadurch nicht jede gewünschte Position erreicht werden kann. Zudem formuliert Rawls Grundgüter, die jeder Teilnehmer der Gesellschaft als gleiche "Startbedingung" besitzen muss, da unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und der Markt alleine keine gerechten Zustände schaffen können. Diese Grundgüter sind u.a. gleiche Rechte, Freiheiten und Chancen, und wenn diese unausgewogen verteilt sind, gilt nach dem zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz, umzuverteilen. Damit propagiert Rawls eine Verteilungsgerechtigkeit der "Gleichheit der Chancen", die auch dem Gedanken der Inklusion nahe steht (vgl. Merkel, 2012).
Diese Argumentation fußt stark auf der Annahme gleicher Chancen der Menschen, und wenn das nicht gegeben ist, der Herstellung dieser durch Umverteilung. Zudem geht es um die Befähigung und die Ausgangslagen, zukünftig sein strukturelles Handeln so verwerten zu können, dass es den eigenen Wünschen und Bedarfen gerecht wird. Dieser Fokus der "Gleichheit der Chancen" ist wichtig, da er eine wichtige Abgrenzung zum Postulat der "Gleichheit der Resultate" darstellt, die besagt, dass insbesondere nachträglich und häufig lediglich materiell ausglichen wird. Beide Begründungsmuster sind aber in einer "sozialen Gerechtigkeit" verortet, die in der BRD traditionell ihre Mitte zwischen den Werten Gleichheit (Umverteilung) und Freiheit (Wert auf das Recht des Einzelnen; Identität) sucht (vgl. Nolte, 2005). Traditionell und in Anlehnung an Esping-Anderson, der in der BRD einen konservativen Wohlfahrtsstaat[20] sieht, begründet sich sozialstaatliches Handeln im konservativen Wohlfahrtsstaat auf Umverteilung nach Bedarfen. Diese Perspektive änderte sich leicht mit den "Hartz-Reformen" und den Reformen der Sozialgesetzbücher um die Jahrtausendwende in der BRD, die auch Elemente der Aktivierung und Teilhabe verstärkt aufnahmen und in der Gerechtigkeitsdimension nun auch Aspekte der Chancengleichheit ansprechen. So wurden beispielsweise 2001 in dem neuen SGB IX Vorstellungen der Teilhabe von Menschen mit Behinderung und im SGB III der Vorrang der aktiven Arbeitsförderung (§5, SGB III), mit Präventiv- und Nachhaltigkeitscharakter, aufgenommen. Dabei waren aber weniger Gerechtigkeitsfragen relevant, so die Unterstellung, als eher fiskalische Sparannahmen. Soziale Gerechtigkeit bewegt sich also zwischen den Begründungsmustern: Gleichheit der Chancen und Gleichheit der Resultate, die auch beide für die Inklusion relevant sind. Inklusion als Menschenrecht fordert eine soziale Gerechtigkeit, die nicht ausschließt und die allen alle Chancen ermöglicht. Die Ausschlussgefahr hat mitunter aber auch einen rein existenziellen Hintergrund, wonach, bevor Elemente wie Aktivierung und Befähigung in sozialstaatliches Handeln münden, grundlegende Nöte gemindert werden müssen. Ein neugeborenes Kind mit einer schweren Behinderung, hat zunächst basale Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Dort geht es um Gleichheit der Resultate, indem Sozialtransfers stattfinden müssen - erst danach sind Aktivierungs- und Befähigungsmaßnahmen möglich. Aus diesem Grund bewegt sich Inklusion zwischen zwei Dimensionen sozialer Gerechtigkeit.
In dieser theoretischen Abgrenzung - Gleichheit der Chancen bzw. (materielle) Gleichheit der Resultate - finden sich auch die unterschiedlichen Begründungsmuster und Einordnungsmerkmale sozialstaatlicher Transferleistungen, die folgende Tabelle skizziert. Darin werden die Einordnungsmerkmale nach Defizitkriterien geordnet, und den beiden Gleichheitsparadigmen gegenüber gestellt. Dadurch entsteht, neben der praktischen Leistungsabgrenzung, auch eine sprachliche Abgrenzung, die im Inklusionssinne den Wert auf Potentiale, statt auf Defizite legt:
Abbildung 5: Gleichheit der Resultate - Gleichheit der Chancen, eigene Darstellung
|
Exklusionskriterium Defizitorientierung Fokus: Was kann / hat der Mensch nicht? |
Differenziert nach |
Fokus auf Gleichheit der Resultate |
Bestehende sozialstaatliche Leistungen |
Fokus auf Gleichheit der Chancen |
"Inklusionskriterium" Potentiale Fokus: Was kann / hat der Mensch? |
|
Armut |
Materielle Armut |
Existenzminim um erreichen |
Sozialhilfe |
Bildung Aktivierungsmaßnahmen Präventiv: Weiter-/ Fortbildung Armutsvermeidungstrategien |
Recht auf volle Teilhabe |
|
Kulturelle Armut |
"Grundversorgung" Bsp. "Sozial- Ticket" |
Teilhabeleistungen durch SGB VIII,IX,XII u.a. Bildungsgutscheine |
Bildung Gesellschaftliche Netzwerke |
Recht auf volle Teilhabe |
|
|
Soziale Armut |
Grundversorgung der Teilhabe an Gesellschaft |
Kommunale Leistungen, Nachbarschaftstreff s u.a. |
Bildung Freie Kultur |
Recht auf volle Teilhabe |
|
|
Behinderung |
Geistige Behinderung |
Rehabilitation Förderung Hilfen zur Bewältigung des Alltags |
Ausgleichsleistungen SGB IX, XII |
Beispiel: Unterstützte Beschäftigung Persönliche Assistenz |
Keine behindernde Gesellschaft / Systeme Recht auf volle Teilhabe "Experte in eigener Sache" Soziale Kompetenz (z.B.) |
|
Körperliche Behinderung |
Ausgleichsmaterialien |
SGB IX, XII |
Barrierefreiheit |
Keine behindernde Gesellschaft / Systeme |
|
|
Seelische Behinderung |
Rehabilitation Förderung |
SGB VIII, IX, XII |
Unterstützung in allen Lebensbereichen Assistenz |
Keine behindernde Gesellschaft / Systeme |
|
|
Pflegebedarf / Krankheit |
Rehabilitation und Betreuung Pflegeleistungen |
SGB XI SGB V PKV |
Medizinische Vorsorge Unterstützerkreise für die Pflege |
Allgemeiner und gleicher Zugang zur Gesundheitsvorsorge / Rehabilitation |
|
|
"schwaches" soziales Umfeld / benachteilig ender Sozialraum |
Geringe soziale Disparitäten durch materiellen Ausgleich Kriminalitätsbekämpfung |
"Sozialbau" Ausgleichsprogram m "Soziale Stadt" Quartiersmanagement |
Stadtentwicklung Quartiersmanagement |
"Lebensweltexperten" Gemeinwesensolidarität Nachbarschaft Häufig: Kulturelle Vielfalt |
|
|
Migrationshintergrund |
Sprachkurse Einseitige Integration durch Anpassung |
AufHG, EU Richtlinien |
Gegenseitige Integration Bewusstsein der Biografien Offenheit |
Mehrsprachigkeit Kulturelle Vielfalt |
|
|
Alter |
Rente Rücklagen Sozialhilfe |
SGB VI, XII |
Teilhabe, Flexible Mobilität Generationenvertrag |
Erfahrung Wichtige Stellung in der Gesellschaft |
|
|
Arbeitslosigkeit |
Existenzsicherung |
SGB II, III |
Prävention Umschulung, unterstützte Personalplanung |
Potentiale suchen |
Praktisch bedeutet das, dass soziale Gerechtigkeit hier einen zweiseitigen Fokus inne hat, der auch unterschiedliche soziale und gesellschaftliche Funktionen bzw. Wirkungen generiert, wobei Inklusion beide Ansätze vereint, aber die Priorität auf die Gleichheit der Chancen legt. Bei einer Gleichheit der Resultate geht es um existenzielle Bedürfnisse, die nach dem Ausschlussverbot in Inklusion gegeben sein müssen, und nach der Gleichheit der Chancen geht es um das Recht, individuelle Chancen nutzen zu können und nicht strukturell von diesen ausgeschlossen zu sein, sei es durch Institutionen, Stigmata oder persönliche Merkmale.
In dem Aufsatz "Equality of what?" (1979) entwickelt Amartya Sen mit der Analyse und der Frage, ob nicht die drei Gleichheits-Paradigmen, Utilitarian Equality, Total Utility Equality und Rawlsian Equality miteinander kombiniert werden können, die Theorie der Basic Capability Equality (vgl. Sen 1979, S. 217). Im Gegensatz zu dem Utilitarismus und den Total Utility Ansätzen, in dem der Nutzen als Maßstab (Utilitarismus: Grenznutzen; Total Utility Ansätzen: Gesamtnutzen) einer Verteilung dient und im Gegensatz zu der Bereitstellung von "primary goods" (Rawls) schlägt Sen den Begriff der Basic Capabilities (grundlegende Befähigung) vor. Interessen und Wünsche, (existenzielle) Bedürfnisse und Ziele könnten über diese grundlegenden Befähigungen in der politisch-theoretischen Verteilungsgerechtigkeit zusammen genommen artikuliert werden. Dieses erste Konzept der Grundbefähigung geht auf den Grundsatz der Chancengleichheit von Rawls Theory of Justice (1971) zurück; formuliert aber den Anspruch interpersonelle Vergleichbarkeit herstellen zu können (Heinrichs, 2005, S. 178) und verbindet im Gegensatz zu den vorig genannten Theorien den Anspruch objektive und subjektive Präferenzen (im Sinne von Wertschätzung zu Tätigkeiten und Eigenschaften) der Menschen messen zu können bzw. diese abbilden zu können.
Erstmals zusammengefasst wurde der Ansatz der Grundbefähigungen in seiner Gänze in dem Buch "The Quality of Life" von 1993, das Sen mit Nussbaum schrieb (vgl. Des Gaspers, 2006). Der CA gewann seine Attraktivität durch seine mehrdimensionale Charakteristik, "to focus on what people are effectively able to do and to be" und dieser im Gegensatz zu anderen "philosophical approaches that concentrate on people´s happiness or desire-fulfilment, or on income, expenditures, or consumption" (Robeyns, 2005). Er definierte einen "Standard of Living".
Der Befähigungsansatz nach Sen und Nussbaum fordert ein institutionelles und gesellschaftliches Gerechtigkeitssystem, dass allen gleichermaßen und unmittelbare Lebensverwirklichungschancen offeriert. Damit fügt sich inklusives Denken und auch Handeln gut in diese Gerechtigkeitsvorstellung ein, da er den Aspekt der Chancengleichheit maßgeblich mit trägt und hervorhebt. Befähigung legt damit den Fokus, wie Rawls auf die Gleichheit der Chancen, wobei die Mittel dazu bei Sen und Rawls unterschiedlich sind: Rawls schlägt den unabdingbaren und gleichen Besitz oder Erhalt von Grundgütern vor und schlägt ggf. eine Umverteilung vor, die den Schlechtgestelltesten in der Gesellschaft noch nützen, während Sen und Nussbaum das "subjektive" Kriterium der Befähigung zur Nutzung gleicher individueller Chancen nennen.
In der deutschen "Marktgesellschaft kommen Exklusionsmechanismen ungehindert zum Einsatz und sorgen dafür, dass als nicht mehr verwertungsgeeignete eingestufte Personen `freigesetzt` werden" (Schiedeck & Stahlmann, 2010, S. 82). In einer stark lohnabhängigen Gesellschaft, wonach sich Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit dadurch maßgeblich definiert, ist eine Geltendmachung von Werten, die nicht vorrangig monetär messbar sind, schwierig. Kapitalistische Herangehensweisen sind geprägt von Angebot und Nachfrage und von Wettbewerbsvor- und nachteilen. Qualifizierung und Arbeitskraft sind Kriterien (Privateigentum der Produktionsmittel), wonach sich Leistung definiert und diese ist im kapitalistischen Sinne kurzlebig und monetär deklariert. Die kapitalistische Theorie, die maßgeblich die Selbstverwirklichungsmöglichkeit des Individuums durch das Recht auf Eigentum und Akkumulation des Kapitals (wonach auch ein Gewinnstreben erfolgt) im Zentrum ihrer Legitimation sieht, legt damit den Fokus auf das Individuum. Dies birgt einerseits Chancen, aber eben auch Schwierigkeiten, da der Markt nicht in der Lage ist auszugleichen und nicht-gleiche Chancen zu kompensieren. Dieser Ansatz hat zur Folge, dass eine "Individualisierung der Ursachen sozialen Ausschlusses" (Schiedeck & Stahlmann, 2010, S. 82) stattfindet, wonach Defizite individuell "verschuldet" sind und damit auch individuell verantwortet werden müssen. Das bietet eine beobachtbare Gefahr: wenn Inklusion den individuellen Blick fordert und Chancengleichheit propagiert, dann können alle diesen Blick fordern und damit marktwirtschaftlichen Tendenzen "in die Hände spielen". Denn "wenn Verschiedenheit normal ist, also jeden betrifft, können - so zynisch es ist - individuelle Hilfsansprüche nur schwer eingeklagt werden" (ebd.). Inklusion fordert Wahlmöglichkeit durch das Recht der vollen Teilhabe, andersherum müssen dann aber auch die Konsequenzen des eigenen Handelns verantwortet werden. Das betrifft nicht nur das Handeln sondern auch die Voraussetzungen. Und wenn diese schlechter sind in der normgeprägten Realität, dann kann im liberalen Sinne auf die Chancen eines Jeden verwiesen werden und diese werden strukturell für diejenigen verschlechtert, wenn Ausgleichs- und (kostenintensive) Befähigungsmechanismen für "Chancenschwächere" in Kraft treten, da sie "Chancenstärkere" belasten. Inklusion ist also auch eine klare Umverteilung, nicht nur materiell, sondern auch der Chancen[21] . Es ist daher nicht die Frage im marktwirtschaftlichen Sinne, wie sozial schwächeren Menschen die gleichen Chancen offeriert werden können bei gleichbleibenden Chancen aller anderen, sondern im inklusiven Sinne müssen Umverteilungsprozesse stattfinden, die sich in den Werten der Marktwirtschaft schlecht abbilden lassen. Nicht direkt "verwertbare" Ressourcen und langfristige Erträge sind dabei aber nicht mitgerechnet, da der Kapitalismus diese nur schwer erfasst, insbesondere in einer technisierten und globalisierten Welt. Der gesellschaftliche Stand zeigt eben diesen Zwiespalt. Gesellschaftich sind wir nicht nur marktwirtschaftlich geprägt, sondern von dieser abhängig. Das ist der Grund warum Inklusion sich klar dem Diktat der Geldressourcen unterworfen sehen muss, was Beobachtungen und die Expertenbefragung[22] verdeutlichen. Inklusion ist im Grunde ein "anderer" bzw. "erweiterter" Blick auf die gesellschaftlichen und auch marktwirtschaftlichen Verhältnisse, inklusive der daraus resultierenden Machtstrukturen. Aber bisher wird Inklusion nicht im Setting einer anderen Wirtschaftsform diskutiert, sondern sämtliche Gebote aus diesem Gedanken unterliegen klar den Prioritäten der heutigen Marktwirtschaft. Somit wird Inklusion am Jetzt gemessen. In diesem Sinne wäre eine Neuausrichtung der Erfolgskriterien wünschenswert, wobei der Blick auf schlicht mittel- und langfristige "Erträge" eines inklusiven Miteinanders an vielen Stellen schon Aufschluss gäbe. Erste Anhaltspunkte für einen gesamtgesellschaftlichen Ertrag von Inklusion liefern betriebliche Konzepte wie das Diversity Management (Kapitel 7.6.2.2).
Es wurde dargestellt, dass sich soziale Ungleichheit, (vererbte) unterschiedliche Ausgangslagen, Reduktion auf eine Eigenschaft und askriptive Merkmale negativ auf die Chancengleichheit auswirken, die aber elementar für den inklusiven Gedanken ist. Nach Rawls sind Ungleichheiten "normal" und sie sind auch in der Realität selbstverständlich beobachtbar. Nun sagt der Gerechtigkeitsansatz nach Rawls, dass Ungleichheiten dann legitim sind, wenn der Schlechtgestellteste in der Gesellschaft dennoch einen Vorteil durch Umverteilung erfährt. Zudem dürfen Ungleichheiten nicht zwischen Personen und deren Chancen existieren, sondern nur zwischen Positionen. Als ein wichtiges Mittel zum Zweck wurde Empowerment vorgestellt. Rainer Forst sagt beispielsweise aber deutlich, dass "die erste Frage der Gerechtigkeit die Frage der Macht ist" (Forst, 2005, S.28). Er schlägt eine "Grundstruktur der Rechtfertigung" als "fundamentale Gerechtigkeit" und eine "umfassend gerechtfertigte Grundstruktur" als "maximale Gerechtigkeit" vor (ebd. S. 29). Er meint damit das Recht jedes Einzelnen "reale Möglichkeiten" zu haben und damit "Rechtfertigungsmacht". Dazu unterscheidet er zwischen zwei Teilhabegerechtigkeiten, die erste, die "primär güter- und empfängerzentriert ist" und Ausfälle kompensiert (Gleichheit der Resultate). Diese nennt er auch "basale soziale Inklusion". Die zweite Teilhabegerechtigkeit sieht er in der Aufgabe des Sozialstaats "institutionelle Schritte hin zur Realisierung fundamentaler Gerechtigkeit" zu gehen, mit Hilfe der Bereitstellung von Produktionsmitteln "in die Hände aller" (ebd. S. 30). Dazu zählen vor allem Bildung, Wissen und geschulte Fertigkeiten, also über die Methode des Empowerments. Dieser Ansatz ist im Kontext dieses Abschnittes wichtig, da Forst die Teilhabegerechtigkeit direkt mit einer sozialen Inklusion benennt und zweitens er den gerechtigkeitstheoretischen Zugang in erster Linie über (Rechtfertigungs-)macht sieht. Wie also wirken sich diese Gedanken von Inklusion auf Machtstrukturen und Hierarchien aus? Hierarchien sind erst einmal Ungleichheiten in den Positionen. Sind Hierarchien erlaubt bzw. können sie evt. sogar helfen, den Inklusionsgedanken umzusetzen? Zu Annäherung an die Beantwortung dieser Fragen unterscheide ich zwischen struktureller und qualitativer Macht bzw. struktureller Hierarchie und qualitativer Hierarchie im folgenden Kapitel.
Qualitative Macht begründet sich auf einen qualitativen Vorsprung, den sich eine Person erarbeitet hat. Diesen Vorsprung muss er im Gerechtigkeitssinne (immer wieder) rechtfertigen. Daraus resultierende Hierarchien sind also nach einer "Inklusionsgerechtigkeit" legitim, da dieses Bild (theoretisch) keinen ausschließt und seine Chancen mindert. Qualitative Macht kann als genutzte Chance gesehen werden, die ein Zusammenspiel von Voraussetzungen, Befähigung, Erlerntem und gleichem Zugang darstellt. Diese Macht begründet sich nicht auf vererbter und damit askriptiver Struktur oder ungleichem Auswahlverfahren, sondern auf Transparenz in dem Auswahlverfahren, demokratischen Berufungsprozess und vorhandener (und besserer) Qualifikation. Der Schlüssel ist die gleiche Chance, die jeder bekommt und dann das Auswahlverfahren nach qualitativen und transparenten Fragestellungen stattfindet. Auf diesen Grundsatz begründet sich auch Hierarchie, die der Inklusion nicht im Wege stehen muss, sofern sie einerseits Durchlässigkeit und andererseits regelmäßige qualitative Reflexionsprozesse zulässt. Diesen legitimen Qualitätsvorsprung sieht auch Annedore Prengel, indem sie die Verschiedenheit der Menschen und nach Gleichberechtigung gleichzeitig fragt. Sie nennt das egalitäre Differenz, wobei beide Aspekte sich gegenseitig bedingen: "Keine der beiden Dimensionen ist in diesem Zusammenhang verzichtbar, denn Gleichheit ohne Differenz würde undemokratische Gleichschaltung und Differenz ohne Gleichheit undemokratische Hierarchie hervorbringen" (Prengel, 2001, S.93). Sie plädiert also indirekt für eine "demokratische und persönliche Qualität", die dann Macht und Hierarchie erlaubt.
Das Pendant ist weitaus häufiger zu beobachten und steht dem inklusiven Gedanken entgegen, da gleiche Zugangschancen, z.B. in dem Auswahlverfahren für eine Leitungsposition, eben nicht für die Bewerber bestehen. Diese "strukturelle" Macht, die sich wiederum aus Macht generiert und häufig mit ökonomischer Macht einhergeht, produziert dann Hierarchien, die eine Eigendynamik des Machterhalts entwickeln und im schlimmsten Fall eine immer größer werdende Abgrenzungsspirale, die entgegen der Chancengleichheit wirkt, in Gang setzt. Im Zusammenhang mit dem Anti-Bias- Ansatz (Kap. 6.2.1.4) lässt sich feststellen, dass Vorurteile, insbesondere wenn sie im Verbund mit Macht auftreten, zu Diskriminierungen führen können. Vorurteilen zu begegnen aber bedeutet sich einer kritischen Reflexion zu unterziehen und auch Dritte mit einzubeziehen und ihnen die "Macht" zu gewähren, sich selbst zu spiegeln zu lassen. Das bedeutet aber das Zulassen der Kritik und auch des Aushandelns, womöglich sogar in Teams. Wer Macht als alleinige Durchsetzungskraft empfindet ohne klare Begründungsmuster für Entscheidungen liefern zu müssen, bzw. diese rechtfertigen muss, baut auf strukturelle Macht, die nicht in erster Linie per Qualifikation, auch in den sog. "weichen" Kompetenzen, entstanden ist. Wer Macht als übertragene Verantwortung mit der Pflicht qualitativ zu wirken und mit allen davon Betroffenen gemeinsam zu agieren, anerkennt, kann den Gedanken der Inklusion, insbesondere seines Kerngedankens der Chancengleichheit, zulassen. Das setzt voraus, dass das "Machtwesen" reflexionsfähig und systemisch "eingegrenzt" ist, also Kontrollstrukturen auf systemischer (Beispiel: Betriebsverfassungsgesetz) und individueller Ebene (Beispiel: Kritikfähigkeit) existieren. Andrea Alexander (2011, S. 9ff) unterscheidet nach gleichen Kriterien und nennt zwei verschiedene Autoritäten: die positionale und funktionale Autorität. Bei ersterer korreliert nicht automatisch Kompetenz mit der Stellung, im Gegensatz zu dem zweiten Beispiel der funktionalen Autorität. Diese Unterscheidung wird auch als Argument für Teamorganisationen genutzt, die im Gegensatz zu hierarchischen Organisationen stehen und Vorteile bieten, insbesondere bei der Kommunikation und der Reaktionsgeschwindigkeit in Bezug auf Veränderungen. Teamorganisationen mit Personen mit funktionalen Autoritäten werden tendenziell den inklusiven Gedanken besser umsetzen können im Gegensatz zu strukturellen Hierarchien, da die Entscheidungswege kürzer, Entscheidungen transparenter und damit die Akzeptanz der Arbeit größer ist, wie das nächste Beispiel zeigt.
Professor Hinz beschreibt die Problematik der Hierarchien im Zusammenhang mit der Inklusion in Schulen folgendermaßen:
"Es geht los bei den Lehrerinnen und Lehrern, die traditionell gewohnt sind, alleine für eine Lerngruppe verantwortlich zu sein und die Klassentür geschlossen zu halten. So ist Inklusion längerfristig nicht denkbar. Inklusion braucht Teamstrukturen, Teamarbeit und Prozesse des sich miteinander Beratens. Im Alltag passiert es oft, dass Inklusion mit bestehenden Hierarchien in Konflikt kommt. Nämlich dann, wenn von oben nach unten entschieden wird und die, die weiter unten stehen, keine Möglichkeit zur Partizipation haben. Dieses Spannungsverhältnis von Hierarchie und inklusivem Aushandeln finden wir sowohl in den einzelnen Schulen als auch in den einzelnen Kultusministerien" (Hinz, 2013).
Hier lässt sich strukturelle Macht erkennen, die dem Gedanken der Anerkennung von Chancengleichheit, Partizipationsmöglichkeit, kritischer (Selbst-)Reflexion und gemeinsamen Entscheidungen entgegen stehen könnte. Aber es muss auch festgehalten werden: Macht und Hierarchie sind möglich und stehen dem Inklusionsgedanken nicht im Wege, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
-
Prozesshafte und kontinuierliche Überprüfung und ggf. Neuausrichtung von Macht- und Hierarchiestrukturen
-
Grundsätzliche Möglichkeit der Partizipation aller an allen Aushandlungsprozessen innerhalb von Macht und Hierarchie
-
Gleiche Zugangschancen zum Erhalt von Positionen, dazu gehört
-
das gleiche Tragen von Rechten und Pflichten
-
Verantwortungsbereitschaft und qualitatives Vermögen, Verantwortung tragen zu können
Zu diesen Voraussetzungen gehört, dass die Akteure sich ihrer jeweiligen Verantwortung bewusst sind, dass sie Aushandelsprozesse zulassen und sie mit Qualität (Argumenten und kritische Reflexion) ihre Machtposition immer wieder bewähren.
In der Bundesrepublik Deutschland existiert ein hoch differenzierendes Stufensystem in der Bewertung von Defiziten und Potentialen, die bildungs- und sozialpolitisch relevant für die Begründung staatlicher Leistungen sind, wie beispielsweise Lehrmaterialien für Kinder einkommensschwacher Familien oder die Eingliederungshilfe. Eben diese vorherrschende Vorstellung von (sozialer) Gerechtigkeit, bei Bedarf materiell auszugleichen, begründet das differenzierte Stufensystem der BRD in der Definition und Bewertung von Defiziten und damit der Anspruchsberechtigungen. Diese "administrative Etikettierung" kann zu Stigmatisierungen und gedanklicher, emotionaler und praktischer Ausgrenzung führen. Aber: "über diesen negativen Umstand kann auch hinweghelfen, dass diese dann mit Vergünstigungen oder zusätzlichen Ressourcen versorgt werden müssen" (Amrhein, 2011, S. 19). Analog zu den o.a. Ausführungen sozialer Gerechtigkeit bildet diese Praxis die Grundlage für das vorherrschende soziale Sicherungssystem in Deutschland: es wird an vielen Stellen auf das vorläufige Resultat geschaut, zum Beispiel auf eine bestehende Behinderung, und diese als Rechtfertigung staatlicher Ausgleichsleistungen genommen. Es sollen Ausgleiche zwischen den Menschen vorgenommen werden, die Diskriminierung und Benachteiligung entschärfen und beseitigen. Das Problem ist: der Ausgleich findet statt, wenn der auszugleichende Faktor schon Realität ist und schlimmstenfalls Exklusion und Diskriminierung schon begann bzw. sich festsetzte. Ein inklusives Sozialsystem ließe diese Exklusion und Diskriminierung gar nicht erst zu, so der theoretische Ansatz. Danach wären sozialstaatliche Leistungen, die die Chancen eines Einzelnen angleichen, und damit jedem individuell die Möglichkeit (durch Unterstützung, Begleitung etc.) geben, die gleichen Startbedingungen zu erhalten. Das ist nicht immer möglich, aber in den meisten Fällen. Der erste Ansatz propagiert also den konsumtiven Sozialstaat, der reagiert, indem er nach Defiziten und schlechten Positionen in der Gesellschaft fragt und diese ggf. ausgleicht. Den zweiten Ansatz verfolgt der investive Sozialstaat, der agiert und präventiv Maßnahmen und Leistungen bereit stellt, die schlechte Positionen und Defizite gar nicht erst zulassen bzw. diese von Vornherein weniger prekär werden lassen. Diese beiden konträren Positionen lassen sich auch in der Sprache und den verwendeten Definitionen für Defizite und Potentiale erkennen. Hinzu kommt, dass z.T. Kriterien für Leistungsansprüche heran gezogen werden, die keine universale Bedarfsidentifikation und daraus resultierende Leistungsansprüche und Arbeitsweisen zulassen, und damit im Inklusionssinne unzulässig sind. Kriterien, die Gruppen von Menschen auf Grund äußerer und nicht ganzheitlich betrachteten Merkmale bestimmen, aber keinen Rückschluss auf die einzelne Person allgemeingültig zulassen, können im inklusiven Sinne nicht heran gezogen werden zur Beurteilung von Leistungsberechtigungen. Es ist nach der Theorie inhaltlich nicht zu vertreten, dass äußere und askriptive Merkmale von Gruppierungen Rückschlüsse auf Bedarfe des Einzelnen geben könnten, da dies dem Gesetz der Einzigartigkeit und Verschiedenheit des Menschen widerspricht. Zu hoch ist die Gefahr, dass "gute" oder wertgeschätzte Faktoren damit nicht einmal die Chance bekommen, erkannt zu werden.
Relative Armut und geringes Einkommen sind quantitativ und qualitativ der größte Exklusionsfaktor unserer Gesellschaft, obwohl keine automatische und vollständige Kausalität besteht[23]. Relativ arme Menschen sind nicht grundsätzlich exkludiert oder exklusionsgefährdet, aber es bestehen starke Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Armut, wie auch Armut und Exklusion. Der vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2012 führt auf, das 50% der Haushalte mit 1% des deutschen Gesamtvermögens auskommen müssen, während die obersten 10% der Haushalte über 50% des Nettovermögens besitzen. 10,4% der deutschen Bevölkerung lebten 2009[24] in relativer Armut[25], weitere 13% beziehen Sozialtransfers, um nicht in Armut zu geraten (vgl. Gern, 2010). "2011 lag die Armutsquote der unter 18-Jährigen um 3,8 Prozentpunkte, das heißt, 2.457.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre leben unter der Armutsschwelle" (Seils & Meyer, 2012). Zusätzlich müssen ca. 1,3 Millionen Menschen zusätzlich zu ihrer Arbeit Sozialtransfers beziehen. Menschen mit Migrationshintergrund und behinderte Menschen sind explizit von Armut bzw. Armutsgefährdung betroffen (ca. 30% der alleinlebenden behinderten Menschen haben ein Haushaltsnetto-Einkommen von unter 700€ - (Sozialverband Deutschland, 2012) und es sind ca. doppelt so viele Menschen mit Migrationshintergrund relativ arm im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund (vgl. Schröer, 2012)). In der Dissertation von Stephanie Kern wurde zudem empirisch heraus gearbeitet, dass Armut in "bestimmten sozialen Bereichen Deprivationen" (Kern, 2002, S. 285) hervor ruft. Sie deutet v.a. auf Isolation des Einzelnen und Ausschluss von geselligen Aktivitäten durch Armut hin, die Aspekte der Teilhabe ansprechen. Wenn nun Exklusion Ausschluss bedeutet und dieser am Grad der Teilhabechance und Zugangsmöglichkeit gemessen wird, dann definieren Armut, Arbeitslosigkeit, Behinderung, Migrationshintergrund, Familienstand, sexuelle Orientierung, Alter, soziale Herkunft, Geschlecht und Bildungsstand Kriterien, die zwischen einer teilweisen Ausschlussgefahr bis hin zur vollständigen Exklusion von gesellschaftlichen Teilhabesystemen diese Spannen abbilden.
"Armut ist einer der Hauptauslöser vermeidbarer Ursachen von Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen und daraus resultierender Behinderungen. Insofern steht Armut nicht nur für einen Mangel an finanziellen Mitteln eines Menschen oder seiner Familie, sondern auch für kulturelle Barrieren in Familien, für unzureichende Bildungsmöglichkeiten (d.h. Lese- und Schreibfertigkeiten sowie Zugang zu Informationen), für ungenügende Verfügbarkeit und Barrierefreiheit von Gesundheits- und Rehabilitationsdienstleistungen für Missbrauch von Geldern und Abhängigkeit von Gebern" (Department for international Development, 2012).
Exklusionsfaktoren sind und wirken aber mehrdimensional, da die Teilhabesysteme und -subsysteme ineinander greifen und z.T. interdependent sind. Dennoch möchte ich an dieser Stelle die Exklusionsdramatik durch einige ausgewählte Kriterien eindimensional darstellen. Ich unterstelle, dass Menschen, die ein oder mehrere Kriterien, die oben aufgeführt sind, erfüllen, strukturell weniger oder gar keine Möglichkeit haben, volle Teilhabe an allen von ihnen gewünschten gesellschaftlichen Systemen zu er/behalten. Nach dieser Rechnung sind ca. 15% der deutschen Bevölkerung durch Armut, ca. 10% durch Behinderung und ca. 5,5% durch Arbeitslosigkeit teilweise oder ganz ausgeschlossen bzw. zumindest benachteiligt. Martin Kronauer schreibt in Anlehnung an den Soziologen Robert Castel, dass die zentralen Ausgrenzungsfaktoren "Marginalisierung am Arbeitsmarkt auf der einen Seite und Schwächung der sozialen Bindungen" (Kronauer, 2012, S. 18) sind. Und da die Kriterien häufig kumuliert zu betrachten sind, ist die Gefahr der Exklusion umso stärker, je mehr Kriterien erfüllt sind. Eine zentrale Aufgabe "der Inklusion" als Sozialpolitik ist also, Armut zu vermeiden, da sie alle anderen Exklusionsfaktoren tendenziell noch verschärft[26].
Es wurde gezeigt, dass zentrale Elemente der beiden vorgestellten Gerechtigkeitstheorien auch im Gedanken der Inklusion zu finden sind. Dazu zählen insbesondere gleiche Rechte, Chancen und Freiheiten (Stichwort: Selbstbestimmung). Zudem kommen Methoden wie die Befähigung und das grundsätzliche Postulat der vollständigen Teilhabe (2. Gerechtigkeitsgrundsatz Rawls) bzw. des Nicht- Ausschlusses. Die Begriffe Inklusion, Grundfreiheiten und Befähigung (worauf sich der CA stützt) haben also eine Nähe zu einander. Das zeigt auch die Praxis: viele sozial- und bildungspolitische Programme werden mit diesen Begriffen versehen, mitunter mit sehr unterschiedlichen Intentionen[27], ohne dabei auf die Zusammengehörigkeit zu achten. Denn ein gemeinsamer Nenner spricht die "Dazugehörigkeit" oder die "Teilhabe" an, wobei Inklusion als Zweck zu verstehen ist, und die Befähigung als ein Mittel. Wenn Inklusion die gleichberechtigte und vollständige Teilhabe an allen Gesellschaftssystemen fordert, ist Befähigung ein wichtiges Mittel dazu. Damit kann die Inklusion als ein wichtiger Beitrag zu einer Vorstellung von gesellschaftlicher Gerechtigkeit gesehen werden. Wenn Befähigung als eine gesellschafts- und sozialpolitisch grundlegende Methode zur Herstellung von sozialer Gerechtigkeit angesehen wird, weil "die Hilfe zur Selbsthilfe" - als theoretisches Modell - die umfassende Möglichkeit bietet, sich seine selbst verantwortete und selbst bestimmte Lebens- und Handlungswelt gestalten zu können, dann ist Inklusion die Maxime.
Praktisch heißt das, es wird dem Arbeitslosen oder dem Menschen mit Behinderung nicht mehr Barmherzigkeit oder Fürsorge zuteil, mit entsprechender externer Deklarierung und Distribution von Hilfsgütern, sondern sie selbst werden beraten und erhalten die Chance (v.a. durch Bildung) auf Erreichen der eigenen gewünschten Fähigkeiten und Bedürfnisbefriedigung. Doch damit entsteht auch eine Pflicht. Diese ist in diesem Ansatz noch gar nicht thematisiert worden - dennoch beinhaltet praktische Befähigung und die Überzeugung, dass das gerecht ist, die Pflicht aller, sich Befähigung gegenüber zu öffnen. In der Praxis ist das häufig schwierig, da Hilfsempfang sicher leichter an vielen Stellen ist. Zum anderen beschreibt die Befähigung eine Methode, die die konkreten Handlungen und den Alltag leiten sollte und trotzdem auch sphärisch gedacht werden kann, denn Befähigung wie auch Inklusion lässt sich nur als wachsender bzw. lebendiger Prozess in Denken und Handeln begreifen. Dadurch, das Inklusion zugleich einen "Fahrplan", wie auch ein Ziel anbietet, indem Methoden zur Erreichung des Ziels angeboten werden, kann Inklusion auch als Teil einer Gerechtigkeitsvorstellung dienen, zumal Inklusion durch ihre differenzierten Wirkungsebenen sowohl psychische wie auch soziale Systeme anspricht und damit eine Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft bildet (Mayrhofer, 2009). Systemtheoretisch wird in dieser Frage nach psychischen und sozialen Systemen unterschieden werden, die aus "Kommunikationen" bestehen und "rekursiv, d.h. im Rückgriff auf frühere Kommunikationen und im Vorgriff auf künftige Kommunikationen" (Stichweh, 2005, S. 68) verbunden sind. Der systemtheoretische Begriff der Inklusion impliziert auch immer den Begriff Exklusion und lässt damit auch den politischen Zugang zu Inklusion zu, weil er sich damit auf "die Form der Berücksichtigung oder der Bezeichnungen von Personen in Sozialsystemen" (ebd.) bezieht und Exklusion ist dementsprechend die Kehrseite: "jemand wird in den Kommunikationsprozessen sozialer Systeme nicht bezeichnet; er oder sie wird nicht zum Anlaß der Bildung von Konstrukten, die eine Personalisierung tragen" (ebd.). Eine Form der politischen Inklusion ist also zunächst die Nennung aller Adressaten in sozialen Systemen. Aus systemtheoretischer Sicht wäre diese Unterscheidung zwischen Exklusion und Inklusion erst einmal "wertneutral", da es "Inklusion [...] ohne Exklusion gar nicht geben" (Schiedeck & Stahlmann, 2010, S. 79) kann. Aber wenn durch die Analyse der funktional differenzierten Gesellschaft Inklusion und Exklusion identifiziert wird (und die Gegensätze als kritisch empfunden werden), leitet das automatisch eine Aufforderung an die politische Inklusion ab. Dementsprechend ist für Stichweh politische Inklusion, "zunächst, daß man über das aktive und passive Wahlrecht verfügt und in diesem Sinn in die Leistungs- und Komplementärrollen des politischen Systems inkludiert ist" und darüber hinaus "als Leistungsempfänger des Wohlfahrtsstaates in Frage kommt" (Stichweh, 2005, S. 77). Diese als grundlegend bezeichneten Eigenschaften des Begriffes Inklusion in systemtheoretischer Hinsicht, die sich auf politisches Handeln beziehen, ebnen das Verständnis eines Grundprinzips von Inklusion: zunächst meint Inklusion die Teilhabe am sozialen System durch "Wahrgenommenwerden" und durch die Möglichkeit der politischen Einflussnahme. Dabei muss schnell zu bedenken gegeben werden, dass Exklusion dann faktisch schnell ebenso eine (politische) Rolle spielt, da beispielsweise diese o.g. Prinzipien nicht für Nicht-Staatsbürger per se gelten. "Die These der Vollinklusion scheint also eine Konstruktion. Und Selbstreflexionsebene des Systems zu meinen, die nicht automatisch mit Selbstverwirklichungsmöglichkeiten ausgestattet ist [...]. Viel plausibler scheint die Annahme systematischer Defizite und Selektivität in diesen Wahrnehmungsrastern von Funktionssystemen - und dies ungeachtet eines zweifellos beobachtbaren Imperativs der Vollinklusion" (Stichweh, 2005, S. 72), der sich "aus Gleichbehandlungsansprüchen" (Bora, 2005) ableitet. Diesen Ansatz bestätigen auch Schiedeck und Stahlmann: "so entsteht ein verschachteltes System von Inklusions- und Exklusionsprozesse; Zugehörigkeit / Nichtzugehörigkeit werden damit partiell und episodisch. Eine gesamtgesellschaftliche Steuerung von Inklusion wird in individualisierten Gesellschaften der Postmoderne immer schwieriger, was zur Folge hat, dass Inklusion nicht mehr zwangsläufige gesellschaftliche Integration bedeutet" (Schiedeck & Stahlmann, 2010, S. 80). Dazu stellt sich die Frage, ob Inklusion tatsächlich die bevorzugte Variante gesellschaftlicher Funktionsfähigkeit darstellt, wenn doch die "Bedingung [der segmentär, stratifikatorisch und funktional differenzierten Gesellschaft], der erfolgreiche Ausschluss aus den allermeisten Sozialsystemen" ist (Bora, 2005, S. 21). Exklusion kann als präferiertes Modell angesehen werden, wenn es um die persönliche Autonomie und Freiheitsrechte geht, und demnach die "Einbeziehung in Sozialsysteme als Übergriff" (ebd.) gesehen wird. Soziale Ungleichheit wird also nur an den Stellen "verurteilt", an denen Exklusion als "Problemsemantik" (ebd.) angesehen wird.
Mit der dargestellten Diskussion verschiedener Aspekte der politischen Inklusion und Sphären der Gerechtigkeit soll die Frage des gerechten "Werte- und Handlungskanons" für die Grundausrichtung moderner Sozialpolitik anfänglich beantwortet werden, wobei als eigener Begriff am ehesten dann eine "Teilhabegerechtigkeit" als Zielpunkt sozialstaatlichen Handelns im Inklusionssinne gesetzt werden kann. Nach Nolte ist "damit die Fähigkeit gemeint, an den allgemeinen Chancen der Gesellschaft teilnehmen zu können - nicht so sehr im Sinne einer materiellen Ausstattung etwa in Form von sozialen Transferzahlungen derart, dass sie den Erwerb einer Theater- oder Kinokarte einschließen, sondern im Sinne der grundlegenden Lebenschancen in den Bereichen Bildung, Erwerbsarbeit und Gesundheit" (Nolte, 2005, S. 18). Er verbindet damit drei Formen von Gerechtigkeit, die der Identität, der Fairness und Gleichheit. Ersteres bedeutet den fundamentalen Anspruch "man selbst sein zu können" in sozialer und kultureller Hinsicht. Hier liegt der Fokus auf Verschiedenheit und Individualität, die ihre Berechtigung in jeglicher Hinsicht hat und somit nicht teilbar ist. Zweiteres bedeutet, "so behandelt zu werden, wie man es verdient hat", wobei dazu ethische Maßstäbe und politische Übereinkünfte gelten müssen und an erster Stelle die "Gleichheit von Staatsbürgern vor dem Gesetz und der Grundsatz `ohne Ansehen der Person`" stehen. Der dritte Satz spricht die Gleichheit der Chancen bzw. auch der materiellen Ausstattung an (ebd. S. 19). Alle drei Punkte sind in dem Gedanken der Inklusion zu finden, 1. als Wertschätzung und Respektierung des Individuums[28], 2. als gleiches Recht für alle Menschen und 3. als Chancengleichheit, wie auch materieller Ausgleich. Damit bildet die Teilhabegerechtigkeit eine soziale Gerechtigkeit, die eine Nähe zu Sen und Rawls hat, aber noch weiter gefasst wird, da sie auch eine Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft skizziert.
Die Beleuchtung des systemtheoretischen Zugangs zu dem Konzept Inklusion hat gezeigt, dass zentrale Punkte als Grundausrichtung einer modernen Sozialpolitik gelten könnten und an einigen Stellen dies auch schon der Fall ist. Wie also lässt sich das normgebende Bild von Inklusion als sozialpolitisches Leitbild und als handlungsrelevant interpretieren? Es existiert die Schwierigkeit, dass Theorien "nicht direkt Handlungsanleitungen zu geben" vermögen (Mayrhofer, 2009, S. 1). Dennoch ist es aber ein Ziel dieser Arbeit genau das zu tun, indem eine "Übersetzung" der Theorie in die Praxis in Anfängen geliefert wird. Inklusion ist also "Zielpunkt moderner Sozialpolitik" (Fuchs-Goldschmidt, 2010), so die Annahme. Das Potential des inklusiven Gedankens ist aber in seiner Ausgestaltung stark vom soziapolitischen Aktivierungsmodell[29] des jeweiligen Staates abhängig. In dem hier diskutierten Fall der Bundesrepublik Deutschland muss sich Inklusion - sofern sie praktisch werden will - also in einer konservativen Wohlfahrtsstaatlichkeit zwischen einer überwiegenden Praxis der "Gleichheit der Resultate" und einem Anspruch der "Gleichheit der Chancen" im sozialstaatlichen Handeln positionieren. Die Diskussionen bis hier zeigten das Potential des Inklusionskonzeptes auf, als sozialpolitisches Leitbild gelten zu können, wenn Faktoren wie Aktivierung, Empowerment und transparente und qualitative Machtstrukturen in den sozialpolitischen Entwicklungen mehr und mehr selbstverständlich werden. Insbesondere Inklusionsmerkmale wie Selbstbestimmung, Teilhabe, Potentiale und Chancen finden als Gerechtigkeitsdimensionen in systemtheoretischen Überlegungen großen Anklang, die sich auch nach und nach in Strukturen auswirken, wie das folgende Kapitel zeigt. Insofern ist die Hypothese, dass Inklusion als neues sozialpolitisches Leitbild wirken könnte, nicht unrealistisch und wird in Kapitel 8 für die Bewertung der Chancen und Schwierigkeiten diskutiert.
[13] "Empowerment kann mit einer zweiseitigen Dimension ausgelegt werden; als `politisches Programm` (dann geht die Übersetzung in die Richtung "übertragene Verantwortung"; Ermächtigung), wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen unterschiedlichster Art (Frauen-, Friedens-, Behindertenbewegungen etc.), die politischen Einfluss nehmen wollen und "den Konflikt mit politischen und gesellschaftlichen Mächten nicht scheu[en]t" (Theunissen, 2000, S. 100) und als `Lebensweltbezogene Empowerment-Perspektive`, also als Praxis (dann geht die Übersetzung in Richtung Befähigung). Das "sich-Bewusstwerden und die Selbstaneignung von Lebensgestaltungskräften, dient dabei im wesentlichen dem Ziel, [...] um ein möglichst unabhängiges, selbstbestimmtes Leben verwirklichen zu können" (ebd. S. 101). In dieser Arbeit werden die Begriffe Empowerment und Befähigung gleichgesetzt.
[14] In anderen Disziplinen sind die Grundfragestellungen differenzierter, aber verfolgen das gleiche Ziel: die Antwort auf die Frage nach übergeordneten Normen, die universal gelten und dem Menschen, dem Zusammenleben, dem Agieren und Reagieren in der Gesellschaft und der Interaktion zwischen Lebenswesen und seinen Systemen eine allgemein anerkannte und unteilbare Gültigkeit geben. Dazu fragt die Philosophie "Was ist Gerechtigkeit?", die Soziologie "Wie ist die gerechte Gesellschaft?" und die Wirtschaftswissenschaften "was ist der gerechte Markt", diese alle wiederum andere Disziplinen prägen.
[15] Libertäre Gerechtigkeit: u.a. Hayek, Friedmann
[16] Marxistische Gerechtigkeit: u.a. Marx, Kropotkin
[17] Kommunitäre Gerechtigkeit: u.a. Walzer
[18] "Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen" (Rawls, 1975, S. 81).
[19] Ein praktisches Beispiel aus dem häufigen Missverstehen dieses Gedankens soll hier angemerkt werden: Die Behindertenhilfe sieht sich an vielen Stellen als Vorreiter der Umsetzung des inklusiven Gedankens, da dieser ursprünglich und am häufigsten im Kontext der Sonderpädagogik diskutiert wurde. Dementsprechend werden nun Angebote "geöffnet" und Menschen ohne Behinderung ebenso zur Verfügung gestellt. Wie auch in anderen zielgruppenorientierten Einrichtungen erfolgt nun häufig eine gegenseitige Öffnung, wie zum Beispiel in der Erwachsenenbildung, in der Jugendhilfe oder im Sportverein. Freilich wird nach dieser formellen Öffnung das Wort Inklusion groß über das Angebot geschrieben und hat häufig zur Folge, dass die Öffnung nicht eine strukturelle Öffnung und damit Chance der Teilnahme bleibt, im Sinne des Ausschlussverbots bestimmter Gruppen (das dem Aspekt der gleichen Zugangschance gerecht wird), sondern die Vermischung definierter Menschen in der Angebotsteilnahme sein muss. Mit anderen Worten, wenn das Angebot dann nicht erwiesenermaßen von behinderten und nicht behinderten Menschen auch tatsächlich genutzt wird, dann ist es nicht inklusiv. Das hat die ernste Folge, dass nach wie vor nach Zielgruppen sortiert/gemischt wird, wenn nun auch im umgekehrten Sinne: im Sinne des Einbezugs von bestimmten Menschen und Gruppen. Das ist ein Fehlschluss, der sich nach Kapitel 3.3 erklärt. Dennoch muss einschränkend gesagt werden, dass eine bewusste sprachliche und praktische Hervorhebung des "Vermischungsgedankens" zunächst im Prozess der Inklusion gut ist, um Jahrhunderte alte Segregation zunächst "umzudrehen" und überhaupt für den "Selbstverständlichkeitsgedanken" der strukturellen Öffnung mit Fakten zu werben. Anders ausgedrückt ist eine zeitlich begrenzte positive Diskriminierung wahrscheinlich förderlich, um das gesellschaftliche Bewusstsein des Gemeinsamen zu stärken und zu etablieren.
[20] (Esping-Andersen, 1998)
[21] Beispiele für eine marktwirtschaftliche Betrachtung von "Chancenverlust":
− Der "Soli" - Solidaritätszuschlag
− Solidarprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung
− Der Generationenvertrag in der Rentenversicherung
− Die Ausgleichsabgabe
− überfüllte Hörsäle an der Universität
− "schlechtere" Bedingungen an der "Schule für alle"
[22] (Goldschmidt, 2012)
[23] Das hängt stark an der Bemessungsgrundlage und den Dimensionen der Betrachtung ab. Es konkurrieren zwei Ansätze: der Lebenslagenansatz und der Ressourcenansatz. Der erste Ansatz liefert mehrere Teilhabedimensionen und setzt Armut als einen Exklusionsindikator voraus. Der Ressourcenansatz ist eindimensional und liefert Armut als Mangel an Einkommen und verbindet diesen nicht mit Exklusion. Für die Erklärung exkludierender Indikatoren wird relative Armut als nur ein, wenn auch wichtiger, Faktor ausgemacht (Buhr & Leibfried, 2009)
[24] (Statistisches Bundesamt, 2011); Genutzte Nettoäquivalenzeinkommensgrenze: 40%
[25] Relative Armut = weniger als 40% vom Median des Nettoäquivalenzeinkommens; Armutsgefährdungsgrenze bei weniger als 60% vom Median des Nettoäquivalenzeinkommens nach dem Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2012). Der Datenreport von 2011 weist als relative Armut weniger als 50% vom Median des Nettoäquivalenzeinkommens aus. Die OEDC nutzt die 60%-Grenze.
[26] Gemäß dem Grundsatz: "alle Formen der Unterdrückung sind miteinander verbunden" (Kugler, 2012)
[27] Dabrock sagt dazu, dass jede sozialethische Theorie freilich selbst nicht politische Entscheidungen treffen muss, aber begründungstheoretisch in der Lage sein sollte eine "Brücke zum Implementierungsdiskurs bauen" zu können, um sich "nicht dem Verdacht eines modelltheoretischen Fehlschlusses" auszusetzen (Dabrock, 2010, S. 18). Diese Ansicht wird in dieser Arbeit in den Analysen beider "Theorien", dem CA und der Inklusion, geteilt.
[28] Hier gilt auch der kategorische Imperativ nach Kant: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde".
[29] Aktivierung bedeutet in diesem Kontext die Vermeidung von Exklusion und Armut durch unterschiedliche Aktivierungssysteme, entweder durch den Markt, sozialpolitische Maßnahmen in unterschiedlicher Ausgestaltung oder einer Mischung daraus. Nach Esping-Anderson und seiner Klassifizierung der Wohlfahrtsstaatlichkeit wird Deutschland dem konservativen Wohlfahrtsstaatregime zugerechnet, das weniger De-Kommodifizierungseffekte, als die Sicherung des Lebensunterhalts durch Lohnarbeit vorsieht (Esping-Andersen, 1998, S. 43ff).
Inhaltsverzeichnis
- 5.1.Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
- 5.2. Die UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit Behinderung
-
5.3. Bundesdeutsche Gesetze
- 5.3.1. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- 5.3.2. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
- 5.3.3. Das SGB II und III, Grundsicherung für Arbeitssuchende und Arbeitsförderung
- 5.3.4. Das SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe
- 5.3.5. Das SGB IX: Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen
- 5.3.6. Das SGB XI, soziale Pflegeversicherung
- 5.3.7. Das SGB XII, Sozialhilfe
- 5.4. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 2011 zur Umsetzung der UN-BRK
- 5.5.Hypothese: "Inklusion steht im Widerspruch zum konsumtiven Sozialstaat"
Im vorangegangenen Kapitel wurde der systemtheoretische Zugang zu Inklusion geschildert: was bedeutet er aus einer Perspektive der Gerechtigkeit und wie ist sein Verhältnis zu Exklusion? Dabei ist insbesondere das letztgenannte Paar für die soziologische Betrachtung wichtig. Der Begriff beinhaltet aber auch eine Menschenrechtsdimension und damit ist damit normativ relevant. Ethischmoralisch bedeutet Inklusion, dass "jedes Mitglied der Gesellschaft seinen Beitrag zur Gemeinschaft leistet und für das ganze wichtig ist" (Wunder, 2010, S. 26). Strukturell gesehen verlässt Inklusion diesen philosophischen Ansatz und wird "untrennbar mit der Sozialstaatsidee verbunden" (ebd.). Der Zugang zum strukturellen Verständnis von Inklusion korrespondiert eng mit einem bürgerrechtlichen Ansatz, da dieses Verhältnis einen Umgang zwischen Staat und Individuum beschreibt. Wenn wir davon ausgehen, dass Inklusion eine menschenrechtliche Dimension mit begreift, dann sind die daraus resultierenden Bürgerrechte die volle Teilhabe. Inklusion an sich ist insofern nicht ein Menschenrecht, da Inklusion eine systemische und kulturelle Ausrichtung auf verschiedenen Ebenen beschreibt und damit nicht zwangsläufig eine Subjektbezogenheit hat. Die volle Teilhabe(-möglichkeit) eines Einzelnen aber beschreibt ein individuelles Recht, dessen Existenz im Sinne eines Menschenrechts individuell geprüft werden könnte. Inklusion ist also ein normatives Ziel im "Miteinander" und subsumiert Individualrechte, wie beispielsweise Bürgerrechte. Die Teilhabeverwirklichung jedes Einzelnen ist dann ein Weg zur Inklusion und damit ein (wichtiger) Aspekt der Inklusion. In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen rechtlich- und institutionellrelevanten Ausgangslagen, im Sinne der Strukturwirkung von Inklusion, erläutert, die den bürgerrechtlichen Zugang zu Inklusion zulassen oder zulassen sollten. Die folgenden Punkte erläutern relevante Gesetzgebungen, den einen (bürger-)rechtlichen Zugang zur Inklusion zulassen.
2001 hat die WHO ein Instrument der Klassifikation von Behinderung und Gesundheit in der ICF beschrieben. Dieser Ansatz verfolgt eine positive und ressourcenorientierte Deklaration von Behinderung und Gesundheit, im Gegensatz zu früheren Klassifikationen, die defizitorientiert sind. Das Instrument ICF unterscheidet auf zwei Komponentenebenen jeweils zwei Bereiche, die im Wechselspiel zueinander zu sehen sind und demnach alle Auswirkungen auf eine potentielle Behinderung haben können. Die Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung bestehen aus dem Bereich des Körpers und dem Aspekt Teilhabe. Die Kontextkomponenten beschreiben äußere, umweltbezogene und innere, personenbezogene Faktoren (WHO, 2001). Die Abbildung 6 zeigt wie Wechselwirkungen der Faktoren, die sich auf die Aktivitätenpotentiale in der Interaktion Mensch und Umwelt auswirken, den Gesamtkomplex der Autonomie eines Menschen ausmachen.
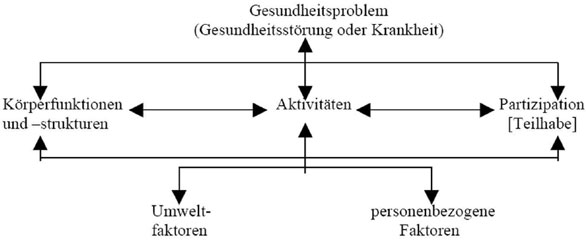
Abbildung 6: Struktur ICF (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2004)
Zentral ist der Begriff Teilhabe, um den sich alle anderen behindernden Faktoren platzieren können, da nach der neuen Deklaration, Behindert-sein mehr bedeutet als eine Funktionseinbuße, da die gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt ist. Dabei ist "gelingende Partizipation" subjektiv empfunden, da die Menschen "Akteure des eigenen Lebens" und "Experten in eigener Sache" (vgl. Wacker, 2006) sind und demnach sie individuell entscheiden müssen, wann sie in gesellschaftlichen Lebensbereichen teilhaben können und wann nicht. Die ICF ist mit dieser Definition Wegbereiter für die im Folgenden beschriebene UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit Behinderung.
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde nach vierjähriger Entstehungsdauer von den Vereinten Nationen 2006 verabschiedet. Bisher unterschrieben 155 Staaten (Stand Dez. 2012, Aktion Mensch) die Konvention und 54 das Fakultativprotokoll, das die konkreten Umsetzungsschritte und -organisation, wie beispielsweise den "Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen" regelt. "In 125 Staaten, sowie in der Europäischen Union ist die UN-Konvention nach Ratifizierung geltendes Recht" (ebd.). Die UN-BRK wurde in Deutschland am 24. Februar 2009 ratifiziert und ist seit März 2009 in Kraft. Grundlage der UN-BRK ist nach Bielefeldt das "menschenrechtliche Empowerment", das zur Voraussetzung hat, dass ein "Bewusstsein der Menschenwürde - der eigenen und der anderen" (Bielefeldt, 2006, S. 4) vorliegt. Wie in allen Menschenrechtskonventionen liegt ein besonderer Fokus auf den "gleichen und unveräußerlichen Rechten aller Mitglieder der menschlichen Familie", was bedeutet, dass die "Menschenwürde (wie immer sie in der religiös, weltanschaulich, und kulturell pluralistischen Weltgesellschaft ansonsten interpretiert werden mag) den tragenden Grund der menschenrechtlichen Gleichheit, d.h. des Prinzips der Nicht-Diskriminierung, bildet (ebd. S. 5). Mit dieser umfassenden völkerrechtlichen Konvention wird erstmals die programmatische Zielrichtung festgelegt, die das jeweilige Unterzeichnerland mit seinem fördernden System auffordert, sich nach den individuellen Bedürfnissen der Menschen (mit Behinderung) zu richten und zwar in dem Maße, dass die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung voll in Anspruch genommen werden können (u.a. das Recht der Freiheit und Sicherheit, das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, das Recht auf Bildung, um drei wesentliche zu nennen). Die UN-BRK fasst dabei lediglich die Menschenrechte (1948), die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (1966) und die bürgerlichen und politischen Rechte (1966) noch einmal zusammen und nennt explizit Menschen mit Behinderung als Adressaten.
Des Weiteren leitet die UN-BRK vom Recht auf Bildung das Recht auf inklusive Bildung[30] ab. Danach sollen nach der Intention der Konvention nicht mehr verschiedene gesellschaftliche Bildungssysteme nebeneinander (z.B. Regelschule und Sonderschule) stehen, die es in jüngster Entwicklung bisher zu harmonisieren galt (Integration), sondern weiter noch, es soll nur noch eines geben, das sich nach den Bedarfen der Menschen individuell ausrichtet (Inklusion).
Und auch wenn diese Konvention explizit Menschen mit Behinderung als Adressaten nennt, die zudem (noch) vorrangig in schulischen Debatten Grundlage findet, geht die UN-BRK darüber h wenn sie von "der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren[31] entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern" spricht (Präambel E, UN-BRK, 2006). Es werden also auch behindernde Systemfunktionen angesprochen, und damit alle Teile der Gesellschaft. Außerdem verweist die BRK auf den Zusammenhang dieser Konvention zu vorherigen Konventionen, die Diskriminierung, Ausgrenzung und den Ausschluss von politischen, bürgerlichen und kulturellen Rechten versagen (Präambel D). Zudem wird in Abschnitt P der Präambel aufgeführt, dass sich die Mitgliedsstaaten "besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind" (UN-BRK, 2006), sehen. Mit diesem Ansatz gewinnt der Begriff Inklusion an Universalität - die zwar auf der einen Seite zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen kann, andererseits aber große Interpretationsspielräume und -Aufforderungen und damit Chancen zulässt. Diese programmatischen Elemente müssen nun in nationales Recht umgesetzt werden, wobei die Art und Weise, wie auch der Rechtscharakter - insbesondere auf individueller Ebene - noch unklar sind und eines definierten Zielprozesses bedürfen, der bis dato noch fehlt. Aber mit der UN-Konvention nahm die Diskussion über (inklusive) Werte wie Teilhabe, Selbstbestimmung, politische und bürgerrechtliche Unabhängigkeit und letztlich sogar Freiheit, wieder zu bzw. bekam einen neuen Kontext: es ist nicht mehr eine fachgebundene Frage der Ausgestaltung, wie Menschen, die einem ursprünglich gesellschaftlich entwickelten, nicht normalitätskonformen Verständnis entsprachen, zu behandeln sind, sondern ein Menschenrecht, Individualität zu leben und jede Unterstützung zu bekommen, die einem den strukturellen Ausschluss aus jeglichen für den Menschen relevanten Teilhabebereichen verhindert. Das bedeutet einen erheblichen Umdenkprozess in der Praxis der sozialen Unterstützersysteme, da es nun notwendig wird, bestehende Strukturen im System aufzubrechen, so dass jetzt "das System die Anpassungsleistung erbringt und nicht mehr der Mensch mit Behinderung" (Sozialverband Deutschland, 2009, S. 3). Dieser Wandel vom Fürsorge- zum Rechtssubjektprinzip, in dem nicht mehr Fürsorge, Förderung und Unterstützung für Menschen mit Behinderung politisch abhängig sind, sondern Förderung und Teilhabechancen rechtlich verbindlich werden, stellt einen Perspektivwechsel in der Sozialpolitik dar, der auch dem zweiten Satz Artikel 3, Abs. 3 von 1994 des Grundgesetzes gerecht wird. Inklusion ist also ein "Bild", bestehend aus einem hohen normativen Anspruch in Bezug auf Chancengleichheit, Autonomie des Einzelnen und Selbstbestimmung. Andererseits formuliert Inklusion ein klares Ziel, dass gesamtgesellschaftlich über den Weg der Fortentwicklung seiner Einzelbereiche beschritten werden muss. Es ist die sozialpolitische Struktur, die genauso und gleichzeitig angesprochen wird, wie der Einzelne und die Praxis in sozialen und öffentlichen Einrichtungen. Letztlich definiert das Paradigma der Inklusion die Verpflichtung aller, jedem Mitglied seiner Gesellschaft strukturell alle Chancen zu ermöglichen. Mit diesen aufgeführten Bestandteilen der UN-BRK ist Inklusion unteilbar.
Es ist umstritten, ob und in welchem Umfang eine UN-Konvention und in diesem Fall die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung subjektives Recht implizierten. Mehrere Zeitungsartikel[32] in den vergangenen Jahren haben darauf hingewiesen, dass die Rechtslage nicht eindeutig ist und mehrere Experten gehen davon aus, dass die UN-Konvention individuell einklagbares Recht zulässt, wie z.B. Preuss-Lausitz und Riedel. Erste Präzedenzfälle vor deutschen Gerichten wiederum signalisieren das Gegenteil. Das Urteil vom 12.11.2009 - Az. 7 B 2763/09 vom hessischen Verwaltungsgericht stellt fest, dass in der Frage, ob der Artikel 24 der UN-Konvention auf den einzelnen Schüler anwendbar ist und er somit das Recht auf den Besuch der Regelschule hat, die UN-Konvention einerseits nicht konkret genug ist und der Anspruch aus der Konvention andererseits zwar in Bundes- oder, wie im Fall der Bildung, in Länderhand gehört, sie aber erst rechtliche Rahmenbedingungen setzen müssen, damit diese dann den Rechtsanspruch definieren (Hessischer Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, 2009). Professor Riedel von der Universität Mannheim hat in einem vielbeachteten Gutachten[33] die Wirkung der UN-BRK auf das deutsche Schulsystem untersucht und kommt zu folgenden zentralen Ergebnissen:
-
der Artikel 24 der UN-BRK definiert gleiche Zugangschancen auf allen Ebenen und auch wenn die deutsche Übersetzung `inklusiv` mit `integrativ` übersetzte und damit unterschiedliche pädagogische Konzepte gemeint sind (siehe Abschnitt 3.3), hat der Bundestag u.a. am 4.8.2008 klargestellt, dass er "einschränkende Vorbehalte oder Erklärungen klar verneint (Riedel, 2010, S. 49). Damit und in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbots in der UNBRK, aber auch des Artikel 3, Absatz 3 GG, stellt Riedel einen rechtlichen Individualanspruch auf einen Regelschulplatz fest.
-
Weiter formuliert Riedel eine Bildungsqualität in der Ableitung der UN-BRK, demnach das "Recht auf Bildung dazu [dient], die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken; es soll Menschen mit Behinderungen ermöglichen, ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen" (Riedel, 2010, S. 57).
-
Durch die Ratifizierung der UN-BRK durch die BRD und die Bundesländer haben diese sich in der Bildungspolitik dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen. Dieses unterliegt aber in gewissem Maße dem "Ressourcenvorbehalt", der auch schon in ersten Schulgesetzen (u.a. in Bremen, NRW und Schleswig-Holstein) niedergeschrieben ist. Der Staat muss nach Riedel grundsätzlich nichts "leisten, wozu er nicht im Stande ist" (ebd. S. 58). Aber er hat sämtliche Ressourcenkapazitäten zu berücksichtigen - und muss also im Einzelfall beweisen, dass die Ressourcen nicht vorhanden sind.
-
Die UN-BRK hat programmatischen Charakter und unterliegt auch deshalb der "progressiven Realisierung". D.h. der Staat und die Länder müssen nach und nach die Grundsätze der BRK in gesetzliche Grundlagen überführen und gleichzeitig aber zielgenaue und einzelfallbezogene Unterstützung eines Schülers schon heute gewährleisten.
-
Das wichtigste Ergebnis des Gutachtens ist eben diese Einzelfallbezogenheit. In Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot und der progressiven Realisierung ist nicht sofort das Schulsystem inklusiv anzugleichen, aber der einzelne Schüler ist diskriminierungsfrei, transparent und umfassend zu beschulen - wenn dieses Recht eingeschränkt wird, trifft die Beweislast den Staat hinsichtlich "Zweckmäßigkeit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Schranke" (Riedel, 2010, S. 54).
Zusammengefasst bedeutet dies die grundsätzliche Möglichkeit der Einklagbarkeit, wie es auch der Verwaltungsgerichtshofes Hessen ausformuliert. Momentan liegt die Rechtsprechung aber noch auf dem Fokus, dass die UN-BRK zunächst in nationale Gesetze überführt werden muss, bevor sie individuelles Recht zulässt. Es wird also darauf ankommen, welche Gesetze ausgearbeitet werden und wie stark sie der Intention der UN-BRK folgen.
Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) beschreibt in §1 das Ziel des Gesetzes: danach sind "Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen" (§1, AGG). Mit dem in 2006 durch die parlamentarische Mehrheit von SPD und CDU/CSU verabschiedeten Gesetz wurde ein weiterer gesetzlicher Schritt in die Richtung gleichstellungsorientierte Behindertenpolitik gesetzt. Im Gegensatz zu dem "medizinischen Defizitmodell" (Bösl, 2010, S. 7) wurde mit dem AGG arbeits- und zivilrechtlich eine Diskriminierung durch o.g. Gründe verboten und damit ein individuelles Recht auf Gleichberechtigung verankert (vgl. auch BMFSFJ 2010). Das AGG folgte in weiten Teilen dem Gesetzesentwurf des Antidiskriminierungsgesetzes (ADG) der rot-grünen Regierung in der 15. Legislaturperiode und entspricht der nationalen Festschreibung der inhaltlichen Vorgaben der EUGleichbehandlungsrichtlinien (die Antirassismusrichtlinie (2000/43/EG), die Rahmenrichtlinie Beschäftigung (2000/78/EG), die "Gender-Richtlinie" (2002/73/EG) und die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter auch außerhalb der Arbeitswelt (2004/113/EG), siehe auch: Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2012).
Das BGG von 2002 entstand unter starker Mitwirkung von Verbänden und Organisationen der Behindertenhilfe in der Zeit der Rot-Grünen Regierung unter Schröder (vgl. Spörke, 2008, S. 111). Das Ziel des Gesetzes ist "die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen" (§1, BGG). Das gilt besonders für die Beseitigung von Barrieren auf kommunikativer, baulicher und informeller (alle Lebensbereiche sollen ohne weitere Erschwernisse erreichbar werden) Ebene. Des Weiteren verpflichtet das Bundesgesetz öffentliche Träger und Einrichtungen des Bundes, Menschen mit Behinderung nicht zu benachteiligen. Analog dazu wurden die Länder aufgefordert Gleichstellungsgesetze zu formulieren. Das geschah zuletzt 2008 in dem Bundesland Niedersachsen (vgl. "www.einfach-fuer-alle.de"). Das BGG stellt ein Novum insofern dar, als das zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik aktiv Behindertenverbände und Interessenvertreter in eigener Sache an der Entstehung des Gesetzes beteiligt waren (Bösl, 2010, S. 11). Durch die breite Policy- Dimension eines Gesetzes und den "Durchbruch" in dem Bereich der sozialpolitischen Interessenvertretung gelangte das Gesetz nicht nur durch den Inhalt zu besonderer Bedeutung.
Das Sozialgesetzbuch - drittes Buch -, Arbeitsförderung, beschreibt die meisten Instrumente und Fördermöglichkeiten, die der aktiven Arbeitsmarktpolitik zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den kompensatorischen Leistungen bei Arbeitslosigkeit durch das SGB II (Arbeitslosengeld 2) und III (Arbeitslosengeld 1), zielt die aktive Arbeitsmarktpolitik auf die Vermittlung und Herstellung verbesserter Chancen der (Wieder-) Eingliederung in Arbeit ab. Der Fokus der aktiven Arbeitsmarktinstrumente liegt auf der Beratung, Vermittlung Aktivierung und Eingliederung. Unter den Stichpunkt Vermittlung fallen alle Leistungen der Agenturen für Arbeit, sowie privaten Dienstleistern, die den Arbeitssuchenden die berufliche (Wieder-)Eingliederung ermöglichen. Aktivierung beinhaltet alle Leistungen, die in Form der Aus- und Weiterbildung qualifizieren, sowie die Heranführung an den Arbeitsmarkt oder auch den Abbau von "Vermittlungshemmnissen". Die Beratung erklärt sich von selbst und bezeichnet die Prozessbegleitung (Beratung durch einen Casemanager). Im Folgenden gebe ich einen Überblick über die Instrumente im SGB III.
-
Das Vermittlungsbudget nach §45, SGB III fördert Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht, arbeitslos oder ausbildungsplatzsuchend sind. Die Anbahnung oder Aufnahme einer Arbeit kann durch das Budget gefördert werden. Der Vermittlungsgutschein nach §421g SGB III stärkt die individuelle Möglichkeit, private Arbeitsvermittler für die Arbeitssuche einzusetzen. Die Vermittlungsgutscheine sind seit dem "Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente", das 2009 in Kraft trat, noch einmal gestärkt worden und haben die "freie Förderung" abgelöst.
-
Nach §46 SGB III können Maßnahmen für Menschen mit Behinderung gefördert werden, die die Heranführung an den Arbeitsmarkt ermöglichen, Vermittlungshemmnisse abbauen, die Vermittlung in Arbeit erfolgreich machen oder stabilisierend auf den Arbeitssuchenden in neu aufgenommener Arbeit wirken. Dazu gehören Praktika, Probearbeiten und Hilfen zur Arbeitsausstattung.
-
Das SGB III fördert Qualifizierungsmaßnahmen wie die berufliche Aus- und Weiterbildung, oder Bildungsmaßnahmen, wie das Nachholen von Schulabschlüssen (3.-5. Abschnitt SGB III).
-
Eingliederungszuschüsse werden nach Zielgruppen differenziert gewährt und haben zum Ziel, Vermittlungs- und Stabilisierungshemmnisse abzubauen (§§88ff).
-
Existenzgründungszuschüsse fördern die Aufnahme einer Selbstständigkeit, maximal für drei Jahre
-
Die berufliche Rehabilitation und Eingliederung behinderter Menschen kann durch das SGB III gefördert werden. Diese beinhalten auch Möglichkeiten von Trainingsmöglichkeiten, Praktika und Job Rotation (vgl. Agentur für Arbeit 2010, S. 47ff).
Es wird ein großes Förderangebot deutlich, dass auf unterschiedlichen Ebenen ansetzt und wirken soll. Es kann individuell auf Arbeitnehmer-, wie -geberseite, strukturell und/oder punktuell (zum Beispiel Kostenübernahme für Arbeitshilfen) gefördert werden. Für den Bereich aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen sind nach dem SGB III insbesondere die Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber und umfassende Qualifikationsmöglichkeiten für Arbeitnehmer zu nennen. Arbeitsmarktprogramme wiederum entstehen mit der Intention strukturell zu wirken, wie beispielsweise durch die Förderung für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.
Das Sozialgesetzbuch II, Grundsicherung für Arbeitssuchende, sieht ebenso Maßnahmen im Bereiche der aktiven Arbeitsförderung vor. Ein Überblick:
-
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten (§16D SGB II) sind befristete Arbeiten, die im öffentlichen Interesse, zusätzlich und wettbewerbsneutral sind. Mit den Hartz-Gesetzen wurden die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen weitestgehend durch Arbeitsgelegenheiten in Entgeltvariante oder mit Mehraufwandsentschädigung abgelöst.
-
Beschäftigungszuschüsse nach §16A oder Einstiegsgelder nach §16B SGB II sind Maßnahmen, die den langfristigen oder dauerhaften Verbleib des Arbeitnehmers im Betrieb gewährleisten sollen.
-
Die "freie Förderung" nach §16f SGB II umfasst die Möglichkeit der Nutzung individueller Mittel und Maßnahmen, die den hilfebedürftigen Erwerbsfähigen die Eingliederung in Arbeit ermöglicht. Es dürfen bis zu 10%, wie ehemals im SGB III verortet, des Eingliederungstitels in freie Maßnahmen fließen. Dazu gehören auch Trainingsmaßnahmen und Maßnahmen der Eignungsfeststellung (vgl. SGB II).
Das SGB II hat eher eine kompensatorische Funktion, das anders als das SGB III in erster Linie Ausgleichsleistungen vorsieht. Dennoch sind aktive Elemente in beiden Sozialgesetzbüchern zu finden, die den Umstand produzieren, den arbeitslosen oder -suchenden Menschen zunächst nach Art der Hilfebedürftigkeit einzuteilen und damit dem Leistungserbringer zu zuordnen.
Nach dem achten Sozialgesetzbuch hat "jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" (§1, Abs.1, SGB VIII). Darunter fallen Hilfen zur Erziehung (2. Kapitel, 2. Abschnitt), Jugendförderung (2. Kapitel, 1. Abschnitt), Förderungen von Kindern durch Kindertagesstätten bzw. Kindertagespflege (2. Kapitel, 3. Abschnitt), die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige (2. Kapitel, 4. Abschnitt) und Schutzmaßnahmen (3. Kapitel, 1. Abschnitt), die unter der Jugendhilfe subsumiert sind. Das SGB VIII regelt auch die Zuständigkeiten von Bund und Länder. Demnach wird nach §69, SGB VIII die Jugendhilfe durch (Landes-)Jugendämter organisiert, die nach § 82, SGB VIII auch für die Umsetzung, Wirksamkeit und Weiterentwicklung der Jugendhilfe zuständig sind. Der Bund unterstützt die Jugendhilfe durch Sachverständige und Jugendberichte. Direkte Leistungen werden durch freie und öffentliche Träger organisiert und örtlich, bzw. überörtlich kontrolliert, d.h. auf kommunaler oder Landesebene. Der § 78 SGB XIII strebt eine Zusammenarbeit örtlicher Jugendhilfeträger in Arbeitsgemeinschaften an. Darin ist ein "Netzwerkgedanke" zu identifizieren, der u.a. die Idee von Sozialraumbudgets möglich macht. Es werden nicht zentral Mittel für Jugendhilfeangebote vergeben, sondern in partizipativen Entscheidungsgremien Mittelgeber, wie -empfänger zusammen angehört und gemeinsam Budgets vergeben. Diese Sozialraumbudgets haben zwei wesentliche Vorteile für die Kinder- und Jugendhilfe vor Ort: einerseits finden transparente und nachvollziehbare Mittelvergaben statt und andererseits entsteht durch das gemeinsame Entscheiden über Mittel eine qualitative Kontrolle der Angebote. Kinder und Jugendliche können theoretisch damit auf eine transparente und kontrollierte Angebotsstruktur zurück greifen. Andererseits entstehen durch solche Art der Sozialraumbudget, die, wie Budgets es schon ausdrücken, immer begrenzt sind, Konkurrenzen und Verdrängungswettbewerbe. Politisch können also zwei Ziele identifiziert werden, die in der Ausgestaltung paradox in der Wirkung sind: durch entstehende Konkurrenzen, indem Mittelvergabeprozesse eines knappen Budgets weitestgehend demokratisch gestaltet werden, leidet die Qualität der Einrichtungslandschaft insgesamt und das "Klima des Sozialraums" verschlechtert sich, andererseits steigt die Qualität in den einzelnen Einrichtungen. Sozialraumbudgets können also gleichzeitig zwei entgegen gesetzte Wirkungen generieren.
Nach SGB IX gelten Förderungsmöglichkeiten zur "vollständigen Teilhabe am Arbeitsleben" nach §§33 -43 SGB IX, die dem Grundsatz folgt: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG). Das SGB IX ist auf die Zielgruppe der behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen anwendbar und maßgeblich von der ICF von 2001 geprägt (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2012). Maßnahmen nach SGB IX werden immer erst nach Feststellung des zuständigen Rehabilitationsträgers gewährt. Dabei ist der Grad der Behinderung ausschlaggebend, bzw. die Gleichstellung, die individuell möglich wird, bei einem Grad der Behinderung von wenigstens 30. Die Rehabilitationsträger prüfen mitunter selbst und gewähren Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im "Reha-Fall". Der Paragraf 33, Absatz 3, SGB IX formuliert mögliche aktive Instrumente, die teils Ansprüche aus dem SGB III wiederholen, im SGB IX aber im Gegensatz zum SGB III Pflichtleistungen bedeuten:
-
"Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich vermittlungsunterstützende Leistungen,
-
Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,
-
individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung,
-
berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,
-
berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,
-
Gründungszuschuss entsprechend § 57 des Dritten Buches durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,
-
sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten" (SGB IX, §33 Abs.1).
Diese Rechtsvorschriften beinhalten breite Möglichkeiten der Heranführung von Menschen mit Behinderung an den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es sind also individuelle Leistungen im Bereich der Beratung, Qualifizierung, Aktivierung und Eingliederung möglich, wobei die Grundsätze im SGB IX entweder mit den Trägern des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) oder mit der Agentur für Arbeit nach SGB III (Arbeitsförderung) verbunden werden, da "die Leistungen der zuständigen Rehabilitationsträger [...] nicht disparat nebeneinander stehen" sollen (Schröder, Knerr, Wagner 2009, S. 9). Das SGB III regelt dabei in Abschnitt sieben die Teilhabeleistungen[34] für Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben, welche "Instrumente des SGB IX übernommen bzw. durch eigene Instrumente des SGB III ergänzt werden" (ebd. S. 13).
Kernelemente der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) sind Selbstbestimmung (§2), Prävention (§5), Beratung (§§7,7A) und Leistungen zur Pflege, um "die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten" (§2, Art.1). Dabei hat die häusliche Pflege Vorrang vor stationären Pflegediensten (§3). In der Ausgestaltung bedeutet dies, dass Pflegebedürftige nach Stufen Leistungen erhalten können[35], um ein menschenwürdiges und weitest gehend selbstbestimmtes Leben führen zu können. Damit finden im inklusiven Kontext wichtige Grundsätze Anwendung: wie Prävention vor Nachsorge, ambulant vor stationär und Aufklärung und Beratung vor Pflegeleistungen. Kritisch im inklusiven Sinne ist die Einstufung nach Pflegestufen, die rein quantitativ aufgebaut sind (Pflegestunden).
Artikel 1, SGB XII, definiert die Grundsätze: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken" (SGB XII, Art. 1). Das SGB XII ist 2003 im Zuge der Hartz-Gesetze neu ausgerichtet worden und trat 2005 in Kraft. Die größte Neuerung betrifft die Trennung der Leistungsberechtigten nach erwerbsfähig und nicht erwerbsfähig[36]: das SGB XII betrifft nur nicht erwerbsfähige Menschen und Menschen unter 15 bzw. über 65 Jahren. Alle anderen Personen werden im Bedarfsfall nach dem SGB II - Grundsicherung - behandelt. Die Sozialhilfe ist personengebunden und nach Bedürftigkeit, sowie Zielgruppen geordnet: Behinderte Menschen (§§53ff - Eingliederungshilfe), alte Menschen (§§41ff - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), bedürftige Menschen (Hilfen zur Gesundheit (§§47ff) und Hilfen zur Pflege (§§61ff). Zudem sind besondere "Fälle" der Hilfen möglich, wie die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67ff) und auch die Hilfe bei Bestattungskosten (§74). Allgemeine Grundsätze, wie die Hilfen für Bildung, Unterkunft, Heizung und Beiträge für (Pflicht-)Versicherungen sind ebenso Bestandteil des SGB XII, wobei interessant ist, dass die Hilfen sehr spezifiziert sind und klare Regelprüfungen und daraus resultierende Regelsätze und -bedarfe die Logik des SGB XII ausmachen, aber dennoch aktivierende, individuelle und präventive Elemente wie Befähigung (§1), Sozialhilfe nach Besonderheit des Einzelfalls[37] (§9), Beratung (§11) und Vorrang von Prävention und Rehabilitation (§14) enthalten sind.
Am 15.6.2011 wurde von der Bundesregierung ein "Maßnahmepaket" ohne Gesetzeskraft verabschiedet: der "Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention". Es werden folgende Absichten festgehalten:
-
Die sog. "große Lösung SGB VIII". Die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB XII und die Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII zusammenzuführen.
-
Es wird die inklusive Schule gefordert, aber mit Wahlfreiheit für eine Schulform, also entweder Regel- oder Förderschule.
-
Der Aktionsplan definiert auch das Ziel einer inklusiven Arbeitswelt. Angeführt werden Beispiele wie die "Initiative Inklusion[38]", die dieses Ziel möglich machen sollen.
-
Darüber hinaus wird ein inklusiver sozialer Nahraum und bauliche, wie sprachliche und informelle Barrierefreiheit gefordert.
-
Außerdem wird die Weiterentwicklung des SGB IX, um Trägerkollisionen, wie beim persönlichen Budget zu vermeiden, per Aktionsplan gefordert[39].
-
Zuletzt wird die volle Teilhabe im politischen und gesellschaftlichen Leben zum sozialpolitisches Ziel erklärt (vgl. BMAS, 2011, S. 32ff).
Der nationale Aktionsplan ist ein Resultat der Vorgaben der UN-Konvention von 2006. Darin wird in Artikel 33 und 35 festgehalten, dass staatliche Strukturen und ein Berichtswesen auf- oder ausgebaut werden müssen, die die Intention der UN-Konvention verbindlich umsetzen und dokumentieren müssen. Insbesondere hält Artikel 35, Absatz 1 fest, dass innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens in dem jeweiligen Unterzeichnerland umfassende nationale Maßnahmen deklariert bzw. eingesetzt werden müssen. Dabei sind aber nach wie vor die Sanktionsmechanismen, wie es grundsätzliche Problematik bei völkerrechtlichen Verträgen ist, unklar. Somit bleibt auch der nationale Aktionsplan lediglich bei der Beschreibung von Maßnahmen und Zielformulierungen, die v.a. die Wiedergabe schon existierender Regelungen beinhalten. Dabei ist zu beachten, dass die UN-Konvention, wie auch die Zielformulierungen des Aktionsplans, strukturelle Veränderungen im Sinne einer inklusiven Gesellschaft insgesamt fordern, der Aktionsplan aber lediglich Initiativen, Einzelmaßnahmen in sozial- und bildungspolitischen Bereichen und bestehende (kompensatorische) Gesetze wie das AGG, BGG und SGB IX anführt.
Durch die Ratifizierung der UN-BRK haben sich Bund und Länder nach § 4 "Implementierungsklausel" verpflichtet, "die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern, indem es alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken trifft" (Aichele, 2010 A). Der Bund hat 2011 den nationalen Aktionsplan verabschiedet, kurze Zeit darauf wurde vom Kabinett der 1. Staatenbericht der Bundesrepublik am 3.8.2011 verabschiedet. Für die Länder gilt ebenso die Implementierungsklausel, so dass sie in der Aufforderung stehen, zunächst Aktionspläne und (dann) Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung zu erstellen. Die meisten Länder wurden in parlamentarischen Debatten und von Selbsthilfegruppierungen, wie auch Behindertenverbänden aufgefordert, Aktionspläne zu erstellen. Mittlerweile haben 13 Bundesländer einen Aktionsplan erstellt. In Bremen haben die Arbeiten daran begonnen[40], in Niedersachsen existiert ein Entwurf und Mecklenburg Vorpommern hat bisher keinen Aktionsplan (Stand April 2013).
Es existiert in der BRD (noch) kein "Inklusionsanspruch" im Rechtssinne, der auch als solcher deklariert wäre, für sozialstaatliches Handeln. Aber Teilaspekte von Inklusion wie die Begriffe Teilhabe und Aktivierung[41] sind wiederum mittlerweile gesetzlich verankert[42]. Die Notwendigkeit heutiger Sozialpolitik begründet sich nach Lampert und Althammer aus vier Begründungsmustern: 1. Kompensation von keiner oder verminderter individueller Erwerbsleistung bei dem Menschen. Dazu gehören häufig Personen mit Behinderungen. 2. Kompensation ungeplanter Erwerbsausfälle oder existentieller Kosten. 3. Kompensation von verminderter oder wegfallender "Anpassungsleistung" bei industriellen Entwicklungsprozessen, die nach Schumpeter gleich "schöpferischer Zerstörung" (Schumpeter, 1950 in Lampert, 2007, S. 18) sind und damit Anpassungslasten der Menschen produzieren, die nicht zu jeder Zeit in vollem Umfang erbracht werden könn(t)en. 4. Herstellung oder Anpassung von Chancen für materielle Freiheit und soziale Gerechtigkeit für jedes Mitglied der Gesellschaft (vgl. Lampert, 2007, S. 17ff). Diese vier Begründungsmuster liefern die normativen Argumente sozialstaatlichen Handelns, die auch im Grundgesetz in Artikel 28 ("sozialer Rechtsstaat") verankert sind und in der rechtlichen Ausgestaltung in erster Linie in den Sozialgesetzbüchern[43] definiert werden. Artikel 1, SGB I, beschreibt diesen sozialen Rechtsanspruch:
"das Recht des Sozialgesetzbuches soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen" (Art. 1, SGB I).
Artikel 2, Absatz 2, SGB I, formuliert aber auch zugleich die Möglichkeit der Inanspruchnahme sozialer Rechte. Dann nämlich, wenn deren "Voraussetzungen und Inhalt[e] durch die Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs [SGB I] im einzelnen bestimmt sind." Damit existiert ein struktureller Widerspruch zu dem Inklusionsgedanken: Sozialleistungen werden grundsätzlich nur dann erbracht, wenn der Anspruch klar identifiziert ist. Der Ursprung ist also ein anderer, was sich auch schon in den drei ersten Begründungsfaktoren von Lampert und Althammer erkennen lässt: Kompensation von Benachteiligung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sämtliche Leistungen und die Anspruchsgruppen im Vorfeld definiert werden müssen. Dies geschieht u.a. mit einer Abweichdefinition vom "typischen Zustand" einer Altersgruppe. Dazu kommt, dass die Sozialgesetzbücher den "gesetzlich normierten Anspruch" definieren, aber die Umsetzung bei den Sozialhilfeträgern liegt, die in vielen Fällen nach "Ermessen" zu handeln haben (Schablon, 2010, S. 33) und damit in jedem Fall nach "Recht und Gesetz" (ebd.) entscheiden müssen. Soziale Anliegen lassen sich eben nicht in Schablonen abbilden, und somit arbeitet das gesamte Sozialhilfeträgersystem immer auch im eigenen Ermessen, wobei die grundlegende Sozialleistungsstruktur dahinter kategorial angelegt ist. Das sind die größten Schwierigkeiten, die sich in dem Zusammendenken der inklusiven Theorie und der strukturellen, sozialpolitischen Praxis ergeben und demnach auch in allen Feldern, die im Folgenden diskutiert werden, zu finden sind. Die folgende Tabelle skizziert beispielhaft konkurrierende Aspekte, wie sich Sozialpolitik strukturell auswirkt bzw. auswirken könnte. Dabei zeigt der Aufbau die unterschiedlichen Herangehensweisen und Begründungsmuster, wenn nach originärer und "inklusiver" Sozialpolitik unterschieden würde. Diese Unterscheidung korrespondiert eng mit der Unterscheidung zwischen investiven und konsumtiven Sozialstaat[44] (Opielka, 2008, S. 92), wobei der investive Sozialstaat den Fokus auf "Maßnahmen zur Verbesserung der Gelegenheitsstrukturen" (ebd.), also Chancen, legt und sich damit von dem nachsorgenden Sozialstaat abgrenzt. Dieser "reagiert" auf Bedarfe, indem er Defizite definiert und diese dann ausgleicht[45].
Abbildung 7: Originäre und inklusive Sozialpolitik - Strukturen, eigene Darstellung, teils in Anlehnung an Hinz, 2012, S. 43
|
Originäre Sozialpolitik |
"Inklusive Sozialpolitik" |
|
Kapitel 5 - Gesetzlich - Struktureller Zugang |
|
|
Häufige indirekte Hilfen über Träger |
Direkte Hilfen |
|
Sachleistungen (Fremdbestimmung über Dienstleistungen) |
Geldleistungen (Selbstbestimmung über Dienstleistungen) |
|
Persönliches Budget über unterschiedliche Leistungsträger |
Persönliches Budget aus "einer Hand" |
|
Grundsätzliche Teilnahme als Recht |
Volle Teilhabe als Recht |
|
Personengebundene Leistung |
Trägerbudgets (personenungebunden), Sozialraumbudgets |
|
Barrieren: sprachlich, (in-)formell |
Barrierefreiheit |
|
Standardisierte / externe Verfahren zur Hilfebedarfsfeststellung |
Individuelle / eigene (mit erstellte) Verfahren |
|
Soziale Sicherheit für den "worst case" (SGB XII) |
Soziale Teilhabe |
|
Systemimmanenz |
Anpassungsfähigkeit des Systems |
|
Konsumtive Sozialleistungen |
Investive, präventive Maßnahmen + Instrumente |
|
Diskriminierungsverbot |
Inklusionsgebot |
|
Institutionalisierte Hilfen |
De-Institutionalisierte Hilfen |
|
Leistungen nach Reduzierung auf ein "Bedarfsmerkmal" Defizitsuche in der Person |
Leistungen für den "Menschen als ganzes" Systemische Suche nach behindernden Faktoren |
Die Tabelle zeigt grundlegende Unterschiede zwischen der heute beobachtbaren Praxis und Ansätzen einer inklusiven Praxis. Es sind aber auch in vielen Feldern Mischformen zu finden, d.h. die Punkte sind nicht alle dichotom. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht die Hypothese, dass die heutige strukturelle Sozialpolitik in großen Teilen im Widerspruch zu einem "inklusiven" Sozialstaat steht, insbesondere auf Grund der Tatsache, dass sozialstaatliche Leistungen überwiegend konsumtiv und kategorial definiert sind. Zudem existieren in der Bundesrepublik hauptsächlich konservative Begründungsmuster sozialstaatlicher Leistungen, die mehr Wert auf Kompensation, denn auf Chancenherstellung legen. Diese Analyse lässt den Schluss zu, dass der bestehende Sozialstaat große Schwierigkeiten in der Umsetzung des inklusiven Gedankens haben wird.
[30] Die UN-Konvention leitet somit durch das Recht auf inklusive Beschulung eine Umsetzungspflicht der "inklusiven Schule" in den Staaten ab, da das Recht auf Bildung für jedes Kind ein Menschenrecht ist und kein Kind auf Grund von Behinderung ausgeschlossen werden darf (Art. 24 UN-BRK: "Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability");. Diese Interpretation ist in der Umsetzung für die nationale Bildungspolitik umstritten, da Völkervertragsrecht dem subjektiven Recht gegenüber stehen kann (vgl. z.B Eichholz, 2009 und Kap. 5.2.1)
[31] Ein schönes Beispiel, wie Barrieren gelöst werden können zeigt ein Film von der Aktion Mensch: http://www.aktionmensch.de/inklusion/un-konvention-leicht-erklaert.php
[32] Z.B. zum Thema Regelschulbesuch die taz vom 27.1.2010 (Schumann, 2010) oder die Welt vom 29.1.2010 (Alexander & Frigelj, 2010) oder zum Thema Zwang in der Psychiatrie der Spiegel (Rytina, 2012)
[33] "Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem" (Riedel, 2010)
[34] Siehe auch 7.1.2.1
[35] "Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muß wöchentlich im Tagesdurchschnitt 1) in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen, 2) in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen, 3) in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen" (Art. 3, §15 SGB XI).
[36] Voll nicht erwerbsfähig ist, wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, teil erwerbsunfähig ist, wer täglich mehr als drei, aber weniger als sechs Stunden arbeiten kann. Weitere Kriterien können qualitative Merkmale sein.
[37] "(1) Die Leistungen richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfs, den örtlichen Verhältnissen, den eigenen Kräften und Mitteln der Person oder des Haushalts bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. (2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der Leistung richten, soll entsprochen werden, soweit sie angemessen sind. Wünschen der Leistungsberechtigten, den Bedarf stationär oder teilstationär zu decken, soll nur entsprochen werden, wenn dies nach der Besonderheit des Einzelfalles erforderlich ist[....]" §9, SGB XII
[38] Siehe Kapitel 7.5.2.2
[39] Trägerkollisionen sind möglich, da das persönliche Budget Teilhabeleistungen aus den Bereichen SGB III, V, VI, IX und XII ermöglicht, beispielsweise durch die Agentur für Arbeit für Weiterbildungsmaßnahmen oder durch die Krankenversicherung für gesundheitlich relevante, rehabilitative Maßnahmen.
[40] Ich selbst arbeite in dem "Temporären Expertinnen und Expertenkreis" zur Erstellung eines bremischen Aktionsplans unter dem Vorsitz des bremischen Landesbehindertenbeauftragten mit. Dieser Kreis soll einen Entwurf eines Aktionsplans bis zum Herbst 2013 erstellen.
[41] Vgl. Punkt 3.3
[42] Bundesgesetzlich verankert sind diese Begriffe im SGB II, III, VIII und IX (siehe Kapitel 5.3ff)
[43] Neben den zwölf Sozialgesetzbüchern existieren weitere zwölf Gesetzestexte, die der Sozialgesetzgebung zugerechnet werden, u.a. das Ausbildungsförderungsgesetz und das Bundeskindergeldgesetz
[44] Auch: vorsorgender und nachsorgender Sozialstaat. Das systemtheoretische Äquivalent hinter beiden Sozialstaatsideen finden sich in Kapitel 4.1 - Gleichheit der Resultate bzw. Gleichheit der Chancen
[45] Siehe auch Kapitel 4.5
Inhaltsverzeichnis
Das Kapitel kultureller, gemeinschaftlicher und persönlicher Zugang führt zur Identifizierung des inklusiven Gedankens eine individuelle und gemeinschaftliche Ebene ein. Inklusion als Konzept wirkt in gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen genauso wie in strukturellen Umsetzungen. Dabei ist eine Grundannahme, dass Inklusion in ebendieser Reihenfolge wirkt[46]. Erst kommen normative Überlegungen, dann Strukturen und daraufhin individuelle Handlungs- und Identifizierungsmuster. Kapitel 3.2 beschreibt aber auch die Interdependenz der Ebenen Struktur und Kultur. Errungenschaften im inklusiven Sinne gehen von beiden Seiten aus und wirken auch auf beide Seiten. Das folgende Kapitel teilt sich in normative Annahmen und beobachtbare Ist-Zustände auf. Die dabei herauszuarbeitende Diskrepanz zeigt ein stückweit den Umsetzungsstand des inklusiven Gedankens auf der individuellen und gemeinschaftlichen Ebene auf.
Der Zugang "Kultur" skizziert die interdependente Wirkung von inklusivem Handeln und Denken des Individuums auf die Gesellschaft. Der kulturelle Zugang zu Inklusion formuliert also die Haltung, die Einstellung und den personalen Wert eines Einzelnen, den er anderen gegenüber einnimmt. Damit ist er gleichzeitig aber auch Teil von Normvorstellungen, die gesellschaftlich existieren. Es lässt sich also eine individuelle Ebene des Inklusionsgedankens und eine kollektive ausmachen. Auf der individuellen Ebene kann zudem noch zwischen Individuen unterschieden werden, die Inklusion "per Auftrag" im Beruf umsetzen müssen, und denen, die privat Elemente der Inklusion für sich begreifen. Die Unterscheidung ist deshalb wichtig, da der "Professionelle" - theoretisch - in jedem Fall inklusiv handeln muss, im privaten Umfeld kann solch ein Ansatz aber nicht vorgeschrieben werden, wenngleich er wünschenswert wäre. Stereotypes Denken, Stigmata und Vorurteile sind in bestimmten Situationen sicherlich negativ anzusehen, aber in einem professionellen Umfeld[47] sind solche persönliche Denkweisen, die de facto zu einem Ausschluss Anderer führen könnten, an vielen Stellen nicht erlaubt. Privat ist das anders und insofern folgt hier eine Einschätzung der normativen Annahmen, also eines Idealbildes für den inklusiven Gedanken für den Einzelnen, der Inklusion beruflich greifbar machen muss.
Auf einem Workshop der "Inklusiven Stadt Bremen" [48] wurde folgende wichtige Erkenntnis formuliert: "Inklusion beginnt bei der eigenen Haltung" (Inklusive Stadt Bremen). Dies korrespondiert eng mit der Aufforderung, die auch in Kap. 3.3 genannt wurde: "der Weg der Inklusion beginnt beim Nachdenken über den eigenen Standpunkt" (Dannenbeck & Dorrance, 2011, S. 208). Auch die Experten, die zur Inklusionsfähigkeit zweier sozialpraktischer Bereiche befragt wurden[49], waren sich einig, dass "Inklusion als Auftrag im Denken, also in den "Köpfen" der Menschen" beginnt (Goldschmidt, 2012). Durch den humanistischen[50] und sozialen Horizont des Inklusionsgedanken, ist unweigerlich der Einzelne gefragt, inklusive Elemente umzusetzen, da sich eine "Art des Miteinanders" nicht strukturell und wenig praktisch vorschreiben lässt. Folgende Faktoren hat die Montag Stiftung als wichtig für die individuelle Umsetzung definiert:
-
Freundlichkeit
-
Respekt
-
Gemeinsame Verpflichtung zum inklusiven Handeln
-
Wertschätzung
-
Unterstützung
-
Teamarbeit
-
Praxis gegen Diskriminierung (vgl. Montag Stiftung, 2010)
Nun sind diese sozialen Werte nicht absolut und quantitativ messbar, und demnach nicht nach einheitlichen Maßstäben überprüfbar. Alle diese Kriterien sind individuell empfundene Haltungen und Handlungsmaßstäbe, die subjektiv unterschiedlich bewertet werden. Es existiert eine Vorstellung davon, welche grundsätzliche Bewertungen hinter diesen Begriffen liegen, so sind alle Begriffe eher positiv konnotiert und drücken ein humanistisches Weltbild aus, doch bleiben die Bewertungen willkürlich. Auch formulieren sie ein Miteinander, dass zunächst niemand ablehnen wird. Aber die jeweilige Stärke und Ausgestaltung dieser Kriterien bleibt nicht fassbar, und ruft deshalb Kritik hervor. Die Ausgestaltung vieler dieser Elemente sind in Kommunikationsformen verortet, und lassen sich schwer vereinheitlichen und es stellt sich die Frage, wie sinnvoll das wäre, wie folgender Abschnitt zeigt.
Im inklusiven Sinne, insbesondere unter Beachtung des Ausschlussverbots ist die Kommunikation und Sprache von existenzieller Bedeutung. Andreas Hinz stellte 2009 fest: "nun scheint es im deutschen Sprachraum eine starke kulturelle Tradition zu geben, die Differenz sehr schnell hierarchisch definiert" (Hinz, 2009). Das ist die Ursache für das sog. Etikettierungs-Ressourcen- Dilemma, das "Wir - und Die - Denken", das Kategorisieren von Bedarfen der Menschen und damit des gesamten Menschen, das darin mündet, dass "je mehr man etikettiert, je mehr Ressourcen hat man zur Verfügung" und demnach, als ein Beispiel, zu der "Absurdität" führt, "dass man bei uns Menschen über die Eingliederungshilfe ausgliedert" (Kron, 2009, S. 14). Ein Vorschlag zur Lösung dieses grundlegenden Problems lautet: "prävalenzbasierte Ressourcenakquise", d.h. "dass die notwendigen Ressourcen nicht an einzelne diagnostizierte Kinder mit Behinderung gebunden sind, sondern nach einer festgesetzten Häufigkeitsquote pauschal an einzelne Schulen vergeben werden" (Wocken, 2012, S. 55). Hier wird ein Plädoyer für Träger- und Sozialraumbudgets gehalten. Dies kann nicht nur für Kinder, nicht nur für das Schulsystem und nicht nur für Behinderungen gelten. Dazu gehört auch das Entwickeln einer neuen Fachsprache, die Diskriminierung und Stigmatisierung vermindert und bestenfalls ausschließt. Gregor Renner schlägt dafür eine "Dekonstruktion und Analyse auf unzulässige Generalisierungen" (Renner, 2009, S. 54) und Re-Konstruktion der Kategorien des Behinderungsbegriffs vor, der insbesondere im sozial-strukturellen Kontext die sprachliche Benennung von partizipationseinschränkenden Umweltfaktoren (ebd. S. 55) beinhaltet. Und ebenso wichtig ist seiner Ansicht nach die strikte Vermeidung der Gleichsetzung von Fähigkeitseinschränkungen mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, da sich beispielsweise ein Mensch mit Behinderung sich nicht durch seine Behinderung definiert, sondern z.B. durch seine Interessen und Sichtweisen. Positiv ausgedrückt bedeutet dies eine sprachliche und sozialstrukturelle Ressourcenorientierung durch die Frage nach den Fähigkeiten, Plänen und Vorstellungen mit gleichzeitiger Vermeidung aller generalisierenden und ausschließenden Benennungen von Einschränkungen. Dieses Beispiel aus der Behindertenhilfe kann ebenso auf andere Bereiche und andere Gruppen übertragen werden, da eine Ressourcenorientierung in der Sprache in jedem Fall Sinn macht, unabhängig davon, um welche Arten es sich bei den Ressourcen handelt.
Das "Kategorien-Denken", die "Handlungssprache" administrativen Denkens und der Gesellschaft ist aber nur die eine Seite. Die andere ist die praktisch-alltägliche, wie auch die Kommunikation auf formeller und informeller Ebene. Im inklusiven Sinne dürfen unverständliche Kommunikationen ohne Erklärung, die dazu führen, dass ein Mensch nicht teilhaben kann, nicht angewandt werden. Praktisch heißt das beispielsweise die Verwendung von "leichter Sprache". Dazu hat das Netzwerk "Leichte Sprache" Regeln[51] entwickelt, die mittlerweile breit anerkannt sind. Diese Standards können sowohl im Schriftbild, wie auch verbal genutzt werden. Zudem werden Elemente dieser Regeln auch in Standards des "Barrierefreien Internets" genutzt, wie beispielsweise die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 und die neue Verordnung BITV 2.0, die seit September 2011 gilt.
Viele große Einrichtungen, v.a. aber auch Behinderteneinrichtungen nutzen diese entwickelten Standards, wie zum Beispiel die Selbsthilfegruppe "People 1", der Bundesverband der Lebenshilfe oder auch die Initiative der Bundesregierung "Einfach teilhaben" (www.einfach-teilhaben.de). Einen prägnanten Überblick über Inhalte und Formen liefert www.innovia.at. "Leichte Sprache" im Sinne des Verstehens ist aber differenziert zu sehen, da die Kompetenzen von Mensch zu Mensch stark variieren, und es dementsprechend keinen Sinn macht, dieses Konzept nur im Kontext von Menschen mit Behinderung zu sehen[52]. Andererseits kann auf Grund dieses Argumentes die definierte "Leichte Sprache" nur einen "kleinsten gemeinsamen Nenner" liefern. Universalität liefert dieser Ansatz nicht. Im inklusiven Sinne schlage ich also folgende Logik vor: Bereiche, die von öffentlichem Interesse und Zugang sind, müssen mit leichter Sprache begleitet werden[53], damit die Zugangschance zunächst strukturell gegeben ist. Das betrifft insbesondere Verwaltungen, institutionelle Vorgänge und politische Zusammenhänge. Im Sinne der selbstwählbaren Zutritte zu Lebensbereichen sollten diese, sofern sie öffentlich sind, auch in leichter Sprache zugänglich sein. Wenn "leichte Sprache" nicht eingeführt wurde, müssen alternativ individuelle Unterstützerformen vorhanden sein. Konkret hieße das beispielsweise eine Person, die während eines Amtstermins dabei sitzt und Inhalte erklärt. Da Inklusion im gewissen Sinne Standards (Kategorien) ablehnt, ist also das konsequente Verwenden von "leichter Sprache" kritisch zu sehen, da sie nicht immer individuelle Lösungen liefert. Aber dennoch bildet sie eine Verständigungsbasis.
In Hinblick auf die informellen Sprachelemente sind inklusive Lösungsansatze schwieriger zu formulieren. Umgangsformen, Gewohnheiten, regionale Unterschiede in der Sprache sind ausschlaggebende Faktoren, die Menschen immer wieder in einen (objektiv oder subjektiv empfundenen) Ausschluss drängen. Hier können lediglich die grundsätzlichen Werte aus Kap. 6.1.1. genannt werden, die sprachleitend, im inklusiven Sinne, sein sollten. Grundsätzlich bietet aber die Sprache nur "Transportwege" an, die kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zu begreifen und daran zu partizipieren, indem sie - systemtheoretisch gesprochen - das soziale System "kommunikationszusammenhängend" (Stichweh, 2005) abbildet. Insofern ist eine ausschlussfreie Sprache von der Voraussetzung einer ausschlussfreien Gesellschaft abhängig und bedingt sie ebenso in entgegen gesetzter Richtung.
In Anlehnung an den Abschnitt 3.2 findet der Gedanke der Inklusion stark auf der Ebene des gesellschaftlichen Miteinanders statt. Es gilt: "Inklusion verfolgt das Ziel, das Menschenrecht einzelner Personen auf Teilhabe am Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen zu etablieren". Kulturell bedeutet das "Inklusion bestätigt und bekräftigt - in Grundsätzen und in Praxis - die Erkenntnis und Anerkenntnis der Gleichheit aller Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit, der Gleichheit der Verschiedenheit" (Lüpke, 2010, S. 38). Die Montag Stiftung hat beispielsweise folgende kulturelle Punkte als wichtig deklariert:
-
"Inklusion versteht die Verschiedenheit (Heterogenität) von Menschen als bereichernde Vielfalt und versucht, sie aktiv zu nutzen. Dazu gehören verschiedene Arten von Heterogenität: persönlich, regional, sozial, kulturell und anders bedingte Eigenschaften und Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkunft, Nationalitäten, Erstsprachen, Rassen, soziale Milieus, Religionen, weltanschauliche Orientierungen, körperliche Bedingungen etc.
-
Inklusion begreift Verschiedenheit und Vielfalt ganzheitlich und wendet sich gegen Zwei-Gruppen- Kategorisierungen wie `Deutsche und Ausländer`, `Behinderte und Nichtbehinderte`, `Heterosexuelle und Homosexuelle`, `Reiche und Arme` etc. Diese Kategorien reduzieren die Komplexität menschlicher Vielfalt und werden einzelnen Personen nicht gerecht.
-
Inklusion erkennt jede Person in ihrer Einmaligkeit an und begreift die Gruppe als unteilbares Spektrum von Individuen. Dabei geht es auch um die Vielfalt (in) einer Person, die, in unterschiedlichen Zusammenhängen, bereits unterschiedliche Kompetenzen, Bedarfe und Stärken zeigen kann.
-
Inklusion wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen an den Rand zu drängen. Inklusion stellt vielmehr Brücken und `Sprungbretter` für Teilhabe bereit, um die Vision einer inklusiven Gesellschaft zu realisieren. Inklusion vermittelt das Bewusstsein und die Kompetenz, die vielfältigen Quellen, Formen und Strukturen von Diskriminierung erkennen zu lernen und nachhaltig zu beseitigen" (Montag Stiftung , 2010, S2f).
Diese Aufzählung kann durch eine Auswahl der zehn Thesen von Klaus von Lüpke ergänzt werden:
-
1Anerkenntnis von Verschiedenheit
-
Inklusion orientiert sich an "übergeordneten Kulturinhalten"
-
Inklusion "kein Ergebnis, sondern ein Prozess. Inklusion ist eine Leitidee, an der wir uns konsequent orientieren [...] (Montag Stiftung, 2010, S.3). Inklusion ist ein "learning by doing" und "development in action" (Lüpke, 2010, S. 38)
-
Inklusion ist Ehrenamt und mehr noch: "aus Ehrenamtlern können und sollten gute Nachbarn, hilfreiche Kollegen, verlässliche Freunde werden" (ebd.).
-
Inklusion braucht Inklusionshelfer
-
Inklusion braucht Bildung (vgl. ebd. S. 38ff).
Zusammengefasst sind diese Forderungen ein Apell an die kulturelle Verständigung auf gemeinsame Werte. Dabei ist die Frage nach Interessen und der Vorstellung des Miteinanders immanent. Eine jahrhundertalte Entwicklung des "Wir- und Die - Denkens" muss im inklusiven Sinne überdacht und aufgehoben werden. Dafür müssen an erster Stelle zunächst positive Erfahrungen der Begegnung[54] gemacht werden. Die Kultur der Gesellschaft prägt sich durch gemeinsame Wertvorstellungen, insofern müssen Werte sich entwickeln, die den Vorteil aller durch Nichtausschluss abbilden. Es braucht ein "selbstverständliches Selbstverständnis" von Zusammengehörigkeit. Der folgende Abschnitt zeigt Möglichkeiten der sozialen und sozialpolitischen Arbeit im positiven Denken mit marginalisierten Gruppen auf, die auch interdisziplinär gelten könnten.
Es lässt sich an dieser Stelle schwierig ein Bild 2013 abbilden, inwiefern der Gedanke der Inklusion bei dem Einzelnen und gesellschaftlich eine relevante Rolle spielt. Meine Beobachtung ist folgende: Menschen, die professionell mit dem Konzept in Berührung kommen, sind an vielen Stellen unsicher und auch überfordert, da eine individuelle Praxis nicht genannt wird. Idealistische Vorstellungen im "Miteinander" werden gepriesen und häufig mit der UN-BRK als Gebot untermauert. Für den Einzelnen bleibt aber eine Aufforderung unklar. Aufgrund dieser Tatsache bietet es sich an, in späteren Untersuchungen sich auf die Subjektebene zu beziehen und in Form empirischer Sozialforschung aktuelle Entwicklungen heraus zu arbeiten[55]. Für diese Arbeit können auf die Ergebnisse einer Expertenbefragung[56] verwiesen werden:
"Insgesamt lässt sich eine positive und zunehmende Entwicklung in Umfang, Tragweite, Verpflichtung und Durchsetzbarkeit des inklusiven Gedankens entdecken. Aber auch die Einschätzung, dass das Konzept eher zunimmt und eher strukturell wirken wird, stützt den Verbindlichkeitsgedanken zumindest im sozialen Feld. Die inklusive Aufforderung mindestens wird auch durch ein `Inklusionsgebot` deutlich, dass die Befragten als positive Aufforderung begreifen, Inklusion umzusetzen" (Goldschmidt, 2012, S. 30). Und "die Bereitschaft Inklusion zu `denken` und umzusetzen ist tendenziell eher positiv, so die Einschätzung der Befragten. [...] Das Wissen um die Theorie wird in dem Arbeitsumfelder Experten als eher verbreitet gesehen, viele kennen den theoretischen Ansatz von Inklusion, wobei das Wissen um die konkrete Praxis schlechter in der Einschätzung ausfällt. Das kann mit schlichter fehlender Praxis erklärt werden; diese Tatsache lässt sich auch in vielen Alltagssituationen beobachten: Institutionen, Politiker und Praktiker sind im Zuge das Konzept Inklusion zu verstehen und die Intention praktikabel zu machen. Konkrete, und sogar etablierte Arbeitsweisen sind aber bisher selten, selbst der Schulbereich, der als einziges System Inklusion per Gesetz in Bremen umsetzen muss, kann nicht auf eine gute Praxis zurückgreifen [57] " (ebd. S. 31).
An vielen Orten finden Tagungen und auch Fortbildungen zu dem Thema "Praxis der Inklusion" statt - Mitarbeiter, insbesondere sozialer Einrichtungen, aber auch anderer Bereiche bilden sich dafür weiter. Ausbildungsgänge werden nach und nach "inklusiv" ausgerichtet, so gibt es beispielsweise keinen Studiengang Sonderpädagogik an der Bremer Universität mehr, sondern inklusive Pädagogik. Auch im Bereich der Barrierefreiheit sind viele Entwicklungen sichtbar, leichte Sprache wird an immer mehr Stellen gefordert und umgesetzt, zum Beispiel hat die CDU-Fraktion in Bremen einen Antrag diesbezüglich gestellt, nach dem Bürgerschaftsnachrichten und Verwaltungsvorschriften in leichter Sprache zu verfassen sind (Drucksache 18/275 von 2012)[58]. Aber eine wirkliche Kultur und ein gesamtgesellschaftliches Verständnis von Inklusion lässt sich nicht identifizieren, aber ein positiver Trend, zumindest in Bereichen der sozialen Praxis. Der folgende Abschnitt zeigt konkrete Methoden auf, die im Grundsatz für alle sozialen Anliegen genutzt werden könnten und damit den inklusiven Gedanken auf der individuellen Ebene fördern könnten.
Die folgende kurze Methodenübersicht bietet Herangehensweisen zu inklusivem Denken. Die Methoden werden immer häufiger angewandt und könnten auch außerhalb einer sozialen Praxis eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel bei sozialstaatlichen Leistungsvorgängen. Damit bieten die Methoden konkrete Zugänge zu einer kulturellen und persönlichen Umsetzung von Inklusion und werden aus diesem Grund hier aufgeführt.
Stefan Doose beschreibt die Methode der persönlichen Zukunftsplanung (PZP), indem er sagt, "PZP ist ein stärken- und ressourcenorientierter Planungs- und Handlungsansatz, bei dem es darum geht durch konkrete Schritte die Lebensqualität der planenden Person in ihrem Sinne zu verbessern" (Doose, 2011, S.4). Die Grundidee ist die, dass Menschen mit sozialen Anliegen, wie beispielsweise die Suche nach einer adäquaten Arbeit, einem barrierefreien Sportangebot, das Nutzen kultureller Möglichkeiten, dem Beheben finanzieller Schwierigkeiten oder allgemein gesprochen, das Lösen von Problemen, die jemand auf Grund von sozialen Nachteilen wie Behinderung hat und dem Ermöglichen des Erreichens persönlicher Ziele. PZP kann also als Konzept genutzt werden, soziale Schwierigkeiten zu lösen, wie auch (Lebens-)Ziele zu ermöglichen. Dafür werden sog. "Unterstützerkreise" initiiert, die die betroffene Person selbst sucht. Neben vertrauten Menschen, wie aus der Familie, Freunden und Kollegen, werden aber auch Professionelle hinzu gezogen, um gemeinsam an einem oder mehreren "Zukunftsplanungstreffen" (ebd. S. 6), zu überlegen und zu planen, wie und mit welchen Schritten Probleme gelöst und Ziele erreicht werden können. Neben den unterschiedlichen Perspektiven, die diese Experten, sei es fachlich, menschlich oder erfahrend in den Kreis mit einbringen, spielt die Komponente Netzwerk und unterschiedliche Blickwinkel eine wichtige Rolle. Gemeinsam werden dann Strategien entwickelt, die sich an Machbarkeit, Wunsch und Priorität bemessen, und die unterstützte Person erfährt sehr individuelle, auf Sie abgestimmte und emanzipatorische Lösungs- und Verwirklichungsstrategien.
Dieses Konzept ist zunächst im Bereich der Pädagogik angesiedelt, aber Doose spricht explizit auch den Bedarf an strukturellen Voraussetzungen an und definiert die Wirkungskreise: Es sind strukturelle Gegebenheiten nötig, um das Konzept PZP fachlich durch staatliche oder beauftragte Stellen anbieten zu können. Denkbar waren beispielsweise Arbeitsagentur, Sozialamt oder Jugendhilfeträger. Ein funktionierender Sozialraum bzw. ein solcher Bezug ist ebenfalls wichtig, da die unterstützte Person in ihrem Lebensraum agiert und demnach PZP auch dort angesiedelt sein muss. Und das Netzwerken, einmal innerhalb des Unterstützerkreises, wie auch außerhalb mit Stellen, die direkt oder indirekt durch die Lebensplanung / Problemlösung involviert sind, ist ebenfalls ein Kriterium funktionierender Zukunftsplanung.
Diese Methode findet auch ihren Ansatz in dem Konstrukt des Normalitätsprinzips, wobei dieses nicht als "Zwang zur Norm" (Schablon, 2010, S. 111) missverstanden werden darf. Aber das Prinzip beinhaltet konkrete praktische Aufforderungen, wie auch einen Rahmen für sozialpolitische Prozesse, da es zum einen "die statistisch konkret feststellbare Dimension der Lebensstandards und zum anderen die Ebene der tragenden Werte, die die Partizipation fördern oder verhindern und die gleichzeitig die vorfindbare durchschnittliche Normalität" (ebd.) abbildet und damit sozialpolitische Imperative generiert.
Wolfgang Hinte hat den Satz geprägt "von Fall zum Feld" (Hinte, 2011, S. 105). Damit wird ein zentraler Aspekt der Inklusion angesprochen. Nach Hinte müssen zwei Veränderungen grundsätzlicher Art stattfinden, damit Inklusion möglich wird: 1. die soziale Arbeit muss in das "Feld", in dem die betroffenen, marginalisierten Menschen leben und 2. muss die soziale Arbeit sich selbst als inklusiver Teil eines Sozialraumes verstehen, sozusagen als "interessierter Nachbar". Die jahrelange Praxis der Etikettierung der Individuen nach "hilfsbedürftig", nach "schwierig" oder "desintegriert" legitimierte zwar die Praxis der sozialen Arbeit nach außen, ist im inklusiven Sinne aber kontraproduktiv (ebd.). Das Leben, Lernen und Arbeiten findet im Sozialraum statt, den der Mensch sich als solchen setzt. Dementsprechend entstehen dort auch die sozialen Anliegen und können bestmöglich auch vor Ort gelöst werden. Der Deutsche Verein für die öffentliche und private Fürsorge beschreibt dies mit "integrierten, wohnortnahen Sozialberatungen" (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2011). Dort könnte Vernetzung und Moderation[59] stattfinden, aber die Beratung muss dann auch über die "Kompetenz verfügen verschiedenste Personengruppen zu beraten" (ebd. S. 8). Ein weiterer Punkt ist die Barrierefreiheit, die es nicht nur herzustellen gilt, sondern auch am ehesten identifiziert werden kann, wenn Akteure und Bürger sozialraumbezogen zusammen arbeiten. Barrierefreiheit ist eine Voraussetzung des Inklusionsgedanken, unabhängig davon, ob es Barrieren informeller, formeller oder sächlicher Art sind. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist ein Prozess, der auch den Stand der Inklusion kontinuierlich abbildet.
Das Konzept "positive Verhaltensunterstützung" baut auf dem Ansatz des Empowerments auf und ist deshalb auch gemeinsam mit diesem zu betrachten. Empowerment wird hier, kommend aus dem (sonder-)pädagogischen, synonym mit dem gerechtigkeitsphilosophischen Begriff aus Kap. 4.1 genutzt. Das Konzept schlägt die umfassende Befähigung oder "Selbstbemächtigung" vor, so dass eine Person in der Lage versetzt wird, ihre Belange, Interessen, Wünsche und Ziele selbst zu vertreten und umzusetzen. Hilfsstrukturen im Umfeld sind nach dem Empowerment-Ansatz dazu da, advokatorisch zu wirken und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die die Potentiale der Person erkennen und stärken, den Freiraum er- und sicherstellen und auch das Umfeld derjenigen Person mit einbeziehen (Partizipation an Entscheidungen). Wichtig ist, dass nicht aversive Haltungen und begrenzende Strukturen in dem Empowerment-Prozess einfließen. Einen umfassenden Überblick über Methode und Ausgestaltung liefert Theunissen (2009). Das Konzept der positiven Verhaltensunterstützung definiert klare, positive Interview- und Kommunikationsformen, die konkrete Ziele und Wünsche einer Person identifizieren sollen und Handlungsvorschläge erarbeiten, um diese umsetzbar zu gestalten. Dieses Vorgehen ähnelt dem Konzept der persönlichen Zukunftsplanung[60], aber mit dem Unterschied, dass positive Verhaltensunterstützung insbesondere dann zum Tragen kommt, wenn von anderer Stelle am jetzigen Zustand "herausfordernde Verhaltensweisen" (Theunissen, 2009) beklagt werden.
Der Anti-Bias-Ansatz stammt ursprünglich aus den USA und wurde dort Anfang der 1980er Jahre von Louise Derman-Sparks und Carol Brunson-Phillips am Pazifik Oak College entwickelt. Grundkonzept des Anti-Bias-Ansatzes ist, "sich gegen jegliche Form von Ausgrenzung, Diskriminierung und Unterdrückung [aktivierend zu] richten" (Herdel, 2011). Aktivierend bedeutet, nicht nur "non-biased" zu sein, und mit der daraus resultierenden Passivität Unterdrückungen zumindest durch Nicht- Eingreifen zu tolerieren, sondern im Gegenteil aktiv gegen Schieflagen und Voreingenommenheiten "auf allen Ebenen" (ebd.) vorzugehen. Das Ziel ist es, durch Sensibilisierung und aktive Reflexion der eigenen Person, wie auch seines Umfeldes, jegliche Ebenen und Formen von Diskriminierung zu erkennen, anzusprechen und zu verhindern. Diskriminierungen sind nach den Autoren auf der institutionellen, zwischenmenschlichen und kulturellen Ebene zu finden und haben eigene subjektive Muster in Auslegung und Schwere und verlaufen entlang der Linien der jeweiligen sozialen Konstruktionen, wie beispielweise Geschlecht oder Ethnie. Damit weist dieser Ansatz hohe Übereinstimmungen in der inhaltlichen Verortung mit dem Konzept der Inklusion auf, wobei der Anti-Bias-Ansatz als konkrete Methode gegen Diskriminierungen zu sehen ist und die Inklusion einen theoretischen Rahmen liefert, in dem Diskriminierung keine Rolle spielt (spielen darf). Einen guten Überblick über Konzept und Wirkungsweise liefert die Anti Bias Werkstatt (2012).
Hinter dem Peer-Ansatz verbergen sich mehrere Funktionsmöglichkeiten, wie das "Peer-Consulting", das "Peer-Education" oder "Peer-Tutoring". Alle Ansätze haben zwar in den Zielgruppen (leicht) unterschiedliche Fokusse, sind aber im Ansatz gleich. Peer aus dem englischen bedeutet "gleich" oder auch "gleichrangig" und verfolgt die Methode, dass Menschen mit gleichen Erfahrungen, gleichen Bedingungen, in gleichen Situationen und/oder gleichen Lebensmustern sich einseitig oder gegenseitig helfen. Das Besondere ist die große Chance, dass die Empathiefähigkeit der "peers" größer ist, da sie "sich besser in die Rolle des Anderen versetzen können". Peers unterstützen sich individuell und häufig methodenlosgelöst, wie auch situations- und personalkommunikativ. Wichtig sind dabei die Gleichrangigkeit der Beteiligten und auch die unterstützte Selbstverantwortung. Die zu lösenden Probleme geben die Beteiligten selbst an und überlegen auch nur gemeinsam, wie sie zu lösen sind. Dabei kann der Fokus ebenso auf Lernzielen oder dem "Erfahrungs- und Informationsaustausches" (Unterberger, 2009, S. 46) liegen.
Das Konzept stammt aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, findet aber auch in den Disziplinen der "Medizin, Philosophie, Psychologie, Sozialpsychologie, Politologie, Ökonomie und Soziologie" (Schablon, 2010, S. 209) Anklang und ist damit interdisziplinär. Vergleichbar mit dem Empowerment-Ansatz [61] ist das Ziel, die "objektiven Lebensbedingungen und die subjektive Zufriedenheit" (Seifert, 2006a) eines Menschen zu analysieren und daraufhin Veränderungen anzustreben. Nach Seifert gibt es acht Indikatoren, die als Operatoren zur Bewertung einer persönlichen Lebensqualität dienen: "Rechte, Soziale Inklusion, Selbstbestimmung, Physisches Wohlbefinden, Persönliche Entwicklung, Materielles Wohlbefinden, Zwischenmenschliche Beziehungen, Emotionales Wohlbefinden" (ebd.). Die Ausgangslage ist folgende: wenn nicht mehr Fürsorge und evt. auch Bevormundung durch Hilfsstrukturen das Ziel sozialpraktischer Arbeit sind, dann kommen Ansätze wie die Analyse der Lebensqualität zum Zuge, da sie individuell und nach klar definierten subjektiven und objektiven Kriterien persönliche Umstände identifizieren und im Zuge eines gemeinsam erarbeiteten "Entwicklungsplans" individuelle Wege vorschlagen. Das Konzept ist stark in der Behindertenarbeit verortet, im Zuge des Normalisierungsprinzips wurden solche Ansätze methodisch-pädagogisch wichtig und üblich. Aber auch auf andere sozialpraktische Bereiche lässt sich das Konzept anwenden[62] und wird deshalb an dieser Stelle genannt. Dieses Konzept kann Ansätze eines gesellschaftlichen Verständnisses von Inklusion mit seinen zentralen Werten methodisch abbilden und damit praktikabel machen.
"Lebensweltorientierung in der sozialen Arbeit ist eine höchst differenzierte Antwort auf die wachsende Erosion bestehender Lebensstrukturen und -muster in einer zunehmend sich ausbreitenden Wissens- und Informationsgesellschaft, die sich im Zeichen von Globalisierung entwickelt." (Rauhes Haus, 2011). Dieser Ansatz, der gewissermaßen sehr umfassend klingt, hat auch ganz praktische Elemente: Zuerst "kommt die Lebenswelt" der Menschen mit Behinderung (oder anderen), dann die individuelle Unterstützung. Der Ansatz ist ganzheitlich orientiert und nimmt die Menschen nicht nur in ihren Wünschen und Vorhaben ernst, sondern bezieht auch ihre Umwelt mit ein. Neben den persönlichen Vorstellungen werden also auch die Erfahrungen und Muster ihrer Lebensumwelt analysiert. Jeder Mensch träumt, lebt und verwirklicht sich. Er hat Grundbedürfnisse und Ziele im Leben. Diese sind geprägt durch seine ganz eigene Biografie, durch sein Umfeld und durch seine Interaktionen mit anderen ihm wichtigen Menschen und gesellschaftlichen Strukturen. Die Lebensweltorientierung ist eine Antwort auf die Frage nach dem gesellschaftlichen Umgang mit Differenz: "Es impliziert nicht die Gleichheit der Ergebnisse, sondern die Gleichbehandlung von Individuen im Sinne der Nichtbeachtung askriptiver Kriterien [...]" (Nunner-Winkler, Meyer-Nikele, & Wohlrab, 2006, S. 148) und liefert damit einen methodischen Blickwinkel auf eine ganzheitliche Sozialpraxis.
In Anlehnung an die "Gemeinwesensarbeit" oder auch "Gemeinwesenseinbindung", die auch eine der möglichen Übersetzungen von Community Care darstellt, oder auch die Sozialraumorientierung der praktischen, sozialen Arbeit, wird das Konzept so verstanden "dass Menschen [...] in der örtlichen Gesellschaft leben, wohnen, arbeiten und sich erholen und dabei auch von der örtlichen Gesellschaft unterstützt werden" (Schablon, 2010, S. 295f), dazu benötigt Community Care von Seiten der Politik "Subsidiarität staatlichen Handelns" und von Seiten der Bürger und professionellen Mitarbeiter eine "Ethik der Achtsamkeit, Anerkennung und der Gerechtigkeit gegenüber marginalisierten Positionen"(ebd.). Ein gutes Beispiel der Verwirklichung solcher Ansätze finden sich in der Kommune Olpe[63].
Eine Bestandanalyse in Bezug auf den Stand der Barrierefreiheit im sprachlichen und baulichen Bereich existiert für Deutschland nicht. Im inklusiven Sinne ist aber die Umwelt auf Barrierefreiheit zu überprüfen, da "Behinderung dann entsteht, wenn individuelle Beeinträchtigungen in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft einschränken" (Bethke, 2011). Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der öffentliche Nahverkehr in Deutschland gut aufgestellt; z.B. sind ca. 90% aller Stadtbusse niederflurig und viele Haltestellen barrierefrei (Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen, 2003). Das BGG von 2002 ist dabei die wichtigste Rechtsgrundlage und gibt das Ziel vor: "Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind" (§4, BGG). Das bedeutet in der Umsetzung, dass Verordnungen und Umsetzungsgesetze den Rahmen für die Umsetzung, zumeist auf örtlicher Ebene regeln, wie Abbildung 8 beispielhaft zeigt:
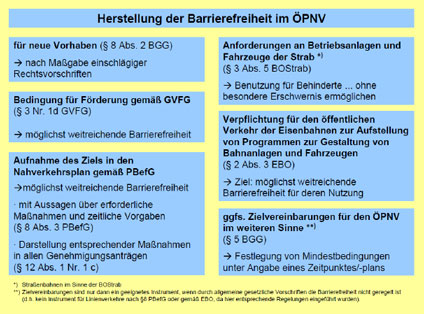
Abbildung 8: Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV (Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen, 2003, S. 9)
Dabei ist der unbestimmte Rechtsbegriff "möglichst weitreichende Barrierefreiheit" kritisch zu sehen. Im Bereich des Tourismus liefert die Broschüre "Barrierefreier Tourismus für Alle in Deutschland - Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWI, 2008) interessante Entwicklungen in diesem Bereich. Aber auch hier existiert nicht eine Gesamtübersicht der touristischen Angebote, die als barrierefrei gelten. Aber die Tendenz ist eindeutig: eine Studie des BMWi von 2003 hat errechnet, dass sich der Nettoumsatz durch mehr barrierefreien Tourismus um 4,8 Milliarden Euro steigen könnte (BMWi, 2003). Diese Berechnung erklärt auch den Trend zu mehr barrierefreien Angeboten. Jedes Bundesland bietet mobilitätseingeschränkten Gästen barrierefreie Informationen, die Bahn als größtes Verkehrsunternehmen bietet ihre Informationen barrierefrei an und vermittelt barrierefreie Destinationen. Viele Urlaubsregionen sind barrierefrei gestaltet, mit zunehmender Tendenz (vgl. (BMWI, 2008). Zum Beispiel gibt es auch unterschiedliche Siegel in den Bundesländern, die auf einen Blick Barrierefreiheit in Urlaubsregionen und -unterbringungen ausweisen oder auch einen barrierefreien Stadtführer, wie z.B. in Bremen (http://www.bremen.de/leben-inbremen/ stadtteile/barrierefreier-stadtfuehrer)[64].
Laut Bethke sind Internetangebote auf Bundesebene häufig schon barrierefrei[65], aber die leichte Sprache ist bisher selten Standard, insbesondere bei Verwaltungsvorgängen (vgl. Bethke, 2011).
Barrierefreiheit ist auch ein wichtiges Thema der Sozialplanung: "Sozialplanung ist fachlichinhaltliche Politikberatung, die sich in Sozialstruktur- und Bedarfsplanung, sowie in Bereiche wie Jugendhilfe-, Pflegeleistungs-, Behinderten-, Gesundheits- und Altenhilfeplanung aufgliedert. Die Planung ist teilweise gesetzlich normiert. Sie dient der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Sozialpolitik und liefert die Basis für die fachliche Verantwortung der Verwaltung für soziale Dienste und Einrichtungen und für die Beteiligung von Adressaten" (Kühn D., 2005, S. 22). In Anlehnung an das Konzept der Sozialraumorientierung dient die Sozialplanung als Steuerungsinstrument, die Lebenslagen der Menschen in den Kommunen auf allen Ebenen zu verbessern. In der Analyse des Sozialraumes und der Bedürfnisse der Menschen, die dort leben und arbeiten, entwirft die Sozialplanung Vorschläge und Handlungsmuster für die Kommune in sozialpolitischer wie auch praktisch-sozialer Hinsicht. Zentrale Elemente dabei sind das ressortübergreifende Arbeiten und das Einbeziehen aller Akteure aus dem Sozialraum ("Beteiligungsverfahren"). Diesem Konzept wird praktisch durch den Einsatz von Quartiersmanagern begegnet, die vermittelnd und vernetzend auftreten und dadurch den "integrierten Sozialraum" verbessern. In Deutschland wird damit sozialpraktisch und städtebaulich der "zunehmenden sozialen Segregation nach Stadtteilen" (Goldschmidt, 2008) entgegen gewirkt. Einen Überblick über die 603 Gebiete der "Sozialen Stadt", ein Bundesprogramm zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf kommunaler Ebene in Deutschland, gibt die Webseite www.städtebauförderung.info . Folgende Punkte sind in dem Instrument einer inklusiven Sozialplanung aufgeführt: "Sozialplanung, Bewusstseinsbildung für inklusive Grundeinstellung, Entwicklung eines inklusiven Sozialraums, Schaffung inklusiver Bildung und Beschäftigung, Inklusives Wohnen, Barrierefreiheit, barrierefreie Mobilität, Inklusive Kultur, Entwicklung Gesundheitsförderung, Eingliederungshilfe und Pflege" (Richter, 2012), dabei bringt "auf Grund ihres interdisziplinären, integrierenden Vorgehens [die] Sozialplanung auf kommunaler Ebene die besten Voraussetzungen für eine inklusive Planung mit" (Verein für Sozialplanung e.V. , 2012, S. 4).
Die Diskussion in Kapitel 6 zeigte die Schwierigkeiten auf, die unter dem Stichwort "inklusive Kultur" auszumachen sind. Die wichtigsten Werte der Inklusion in diesem Zugang sind Chancengleichheit, Individualität (Selbstbestimmung) und Teilhabe. Um diese Werte positionieren sich Herangehensweisen wie individuelle Unterstützung oder eine "Willkommenskultur". Die folgende Tabelle führt die angeführten Punkte und deren Pendants, wie sich Inklusion kulturell auswirkt bzw. auswirken könnte, tabellarisch auf.
Abbildung 9: Originäre und inklusive Sozialpolitik - Kultur und Werte, eigene Darstellung, teils in Anlehnung an Hinz, 2012, S. 43
|
Originäre Sozialpolitik |
"Inklusive Sozialpolitik" |
|
Kapitel 6 - Gesellschaftliche(r) Zugang + Werte + Sprache |
|
|
Defizitorientierung (v.a. in der Sprache) für Hilfen |
Ressourcenorientierung (v.a. in der Sprache) für Begleitung und Unterstützung |
|
"Homogenisierendes Denken" |
"Heterogenisierendes Denken" |
|
Stigmatisierende, Einteilung nach Gruppen |
Keine Gruppen - individueller Blick |
|
"Wir und Die-Denken" |
"Wir-Denken" |
|
Stigmatisierende Sprache |
Neutrale Sprache |
|
Grundsätzliche Teilnahme |
Volle Teilhabe |
|
Sprachbarrieren, sächliche, formelle und informelle Barrieren |
Keine Barrieren |
So wünschenswert ein "Wir-Denken" oder auch ein respektvoller Umfang miteinander ist, so unklar ist aber dessen Bestimmung und kann im schlechtesten Fall genau die gegenteilige Intention hervor rufen. Jedes Individuum nimmt `Respekt` anders wahr, jeder Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen von `freundlich`. In einer funktional differenzierten Gesellschaft (Luhmann) können Individuen nicht inklusiv miteinander umgehen, wenn zugleich exklusive Strukturen bestehen. Wenn zum Beispiel die persönliche Haltung einem offenen und unterstützenden Charakter in der sozialen Arbeit entspricht, diese Arbeit gleichzeitig aber durch exklusive Strukturen konterkariert wird, wird Inklusion in ihren Facetten jeweils gegeneinander ausgespielt. Umgekehrt gilt das auch, wenn beispielsweise die "inklusive Schule" per Gesetz bindend ist, gleichzeitig aber ein behindertes Kind de facto wegen fehlender Bereitschaft der Mitarbeiter nur ein Toilettengang pro Schulvormittag zugesprochen wird. In diesem Fall schließt die Praxis die strukturellen Vorgaben aus und Inklusion kann nicht automatisch in allen Facetten wirken. Mit anderen Worten, das Recht auf Inklusion hört an der Stelle auf, wo sie das Recht auf Inklusion anderer begrenzt. Es ist nicht klar, was "zuerst kommen muss", die Strukturen oder die Kultur. Es gibt viele Beispiele, die die Strukturen als Voraussetzung für eine inklusive Kultur erachten, wenn beispielsweise wegen Personalmangel schlicht keine individuelle und chancengleiche Behandlung von Klienten auf dem Arbeitsamt möglich ist. Andersherum können Gesetze oder Personaleinsatz die Inklusion in seiner Ausgestaltung möglich machen, eine diskriminierungsfreie und chancengleiche Behandlung impliziert das dennoch nicht automatisch. Wenn die kulturelle Inklusion ein Miteinander anspricht, dann können Individuen per Selbstbestimmung und Chancengleichheit auch weit definieren, was sie darunter verstehen. Die Verpflichtung dann inklusiv miteinander umzugehen, kann dieser Selbstbestimmung im Wege stehen. Ein konkretes Beispiel sind (öffentliche) Interessengemeinschaften. Jeder soll strukturell und kulturell die Chance haben, an gesellschaftlichen Bereichen partizipieren zu können. Zielgruppenlogiken gilt es demnach zu überdenken, da sie per Definition ausschließen. Nun gibt es einen breiten Konsens, dass bestimmte Interessensgemeinschaften mit einer Zielgruppe in sich geschlossen bleiben sollten, beispielsweise geschlechtsspezifische Angebote in der Jugendhilfe. Die kulturelle Wirkung von Inklusion ist also zum Teil widersprüchlich, bzw. uneinheitlich. Die kulturelle Inklusion stößt an Grenzen, die es für eine konkrete Arbeit mit dem Konzept zu bearbeiten gilt.
[46] Siehe Kapitel 3.2
[47] Beispiele: Schule, Pädagogik, Verwaltung
[48] www.inklusive-stadt-bremen.de
[49] Goldschmidt, Nikolai: "Erkundung der `Inklusionsfähigkeit` der Jugend- und Behindertenhilfe in Bremen"
[50] Humanistisch deshalb, weil Werte wie Würde und Toleranz eine zentrale Rolle spielen.
[51] (Netzwerk Leichte Sprache, 2012)
[52] Beispiel: viele werden, unabhängig von einer Behinderung, Schwierigkeiten haben ihre Steuererklärung alleine verstehen zu können.
[53] Unabhängig davon, ob "leichte Sprache" andere Sprachen ergänzt oder substituiert.
[54] Ein Gespräch, das diesen Ansatz verdeutlicht: auf einem Fest in einem Bremer Stadtteil sprach mich ein älterer Herr freundlich an und interessierte sich für die Materialien, die ich für eine soziale Einrichtung zu Informationszwecken ausgelegt habe. Er sagte: "Die Behinderten sind gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Letztens war ich auf einer Sportveranstaltung und da liefen auch diese Menschen rum und früher hatte ich immer Angst, aber die waren ja ganz normal". Dieser Satz beinhaltet zwei wichtige Realitäten. Einerseits wird die Gruppe der "Behinderten" als homogene Gruppe mit nahezu gleichen Eigenschaften und Merkmalen gesehen, vor denen man ggf., wie in diesem Fall, Angst haben kann. Andererseits wird dieser Gruppe pauschal unheilvolle Charakteristika zugeschrieben, vor denen "normale" Menschen Skepsis haben müssen. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie negativ sich stigmatisierende und in-individuelle oder pauschale Eigenschaftszuschreibungen über Jahre und Jahrzehnte negativ auf die Sozialisierung der Gesellschaft auswirken kann. Dieser Mann hatte tatsächlich Angst vor behinderten Menschen und hatte diese erfreulicherweise auf der Sportveranstaltung überwunden, als die bisher nur durch Erzählungen konstruierte Realität mit eigenen Beobachtungen falsifiziert wurde.
[55] Ein erstes Beispiel: Knorre, 2013
[56] Goldschmidt: "Erkundung der Inklusionsfähigkeit der Behinderten- und Jugendhilfe in Bremen", 2012). In einem
schriftlichen, qualitativen Interview wurden vier aus der Jugend- und fünf Experten aus der Behindertenhilfe befragt.
[57] Das verdeutlicht u.a. ein Artikel im Weser Kurier (2012).
[58] Einschränkend ist hier zu sagen, dass dort nur leichte Sprache in Schriften gefordert wird, die "Menschen mit Behinderung betreffen".
[59] Diese Gedanke findet sich auch ansatzweise in den Pflegestützpunkten nach §92c, SGB XI wieder.
[60] Siehe Kap. 6.2.1.1
[61] Siehe Kapitel 6.2.1.3
[62] Denkbar ist die Umsetzung beispielsweise in benachteiligten Quartieren, in der Arbeitsvermittlung und dort insbesondere in dem Feld "Übergang Schule und Beruf"
[63] Best Practice: http://www.inklusion-olpe.de
[64] Eine neue Auflage ist seit dem Frühjahr 2013 von einem Architekturbüro in Bremen in Arbeit.
[65] Siehe auch Kapitel 6.1.2
Inhaltsverzeichnis
- 7.1.Inklusionsanspruch in der Behindertenhilfe
- 7.2.Inklusionsanspruch in der Jugendhilfe
- 7.3.Inklusion in Bezug auf die Migrationsthematik
- 7.4.Inklusion in Sport, Freizeit, außerschulischer Bildung, Kultur und Tourismus
- 7.5.Inklusion in der Ausbildung, Arbeit und Arbeitsförderung
- 7.6. Praktische Inklusion in sozialen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden
- 7.7.Hypothese: "So lange der Widerspruch zwischen Inklusion und Zielgruppenlogiken / Anspruchsberechtigungen nicht gelöst wird, istInklusion nicht greifbar"
Das Kapitel "Praktischer Zugang: soziale Unterstützersysteme" beleuchtet die Strukturen und Praktiken der sozialen Dienste, die Arbeit mit den Zielgruppen und die Einrichtungen. Zudem wird hier aber auch der Blick auf relevante Lebensbereiche der Menschen geworfen, insbesondere in Kapitel 7.4: "Sport, Freizeit außerschulische Bildung, Kultur und Tourismus". Die einzelnen Bereiche sind untergliedert in normative Annahmen im Kontrast zu beobachtbaren Ist-Zuständen und Entwicklungen. Zudem werden aktuelle bereichsspezifische Diskussionen vorgestellt.
Die Behindertenhilfe ist in der Wahrnehmung der Meisten der Hauptempfänger, aber auch -geber des inklusiven Gedankens und inklusiver Praktiken. Neben der Debatten über "die Schule für alle", sind es Einrichtungen für Menschen mit Behinderung die gleichermaßen im Zuge der Inklusionsdiskussionen in der Kritik wie auch in der Pflicht stehen, beispielhaft, praxisorientiert und innovativ zu sein. Das gilt insbesondere noch einmal seit der UN-Konvention von 2006. Damit stehen Behinderteneinrichtungen in der subjektiven Wahrnehmung vieler in einem Paradoxon. Denn einerseits wird Behinderteneinrichtungen zugeschrieben, exkludierende Systemlogiken zu entwickeln und entwickelt zu haben, da sie in Deutschland eine sehr gut ausgebautes, an vielen Stellen autarkes System in der Versorgung mit stationären/zentralen Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Pflegeangeboten darstellen, andererseits aber eben auch wertvolle Expertise in der spezifischen, alltagsbegleitenden Pädagogik bereit halten. Damit ist die Behindertenhilfe im originären Selbstverständnis eher inklusionserschwerend, bringt aber auf der anderen Seite eine Praxis und an vielen Stellen gute Werte und die Expertise mit, die für die Umsetzung des inklusiven Gedankens nützlich sind.
Was aber würde eine konsequente Umsetzung inklusiver Zugangsvoraussetzungen und - Arbeitsweisen für die Behindertenhilfe in Deutschland bedeuten? Ein inklusives Denken wird in der Behindertenhilfe als "Paradigmenwechsel" (Fink, 2011, S. 13) angesehen. Wenn davon ausgegangen wird, dass sich mit dem Inklusionsgedanken "Veränderungen der Bedarfserhebung, der Leistungen für Menschen mit Behinderung, der Angebots- und Finanzierungsformen" (ebd. S. 14), entwickeln, ist der Begriff Paradigmenwechsel richtig. Ein wichtiger Aspekt ist die Aufforderung, traditionelle, geschlossene Hilfesysteme, die auf Fürsorge und Hilfen für Menschen mit Behinderung aufgebaut sind, in ein konsequent sozialraumorientiertes und selbstbestimmtes Unterstützersystem zu überführen. Praktisch heißt das die Auflösung sämtlicher stationärer Dienste und Angebote oder "die tradierte Orientierung auf eine spezifische Klientel sowie spezifische Einrichtungen und Dienste für sie aufzugeben, zugunsten von Gemeinwesensarbeit im Stadtteil und in der Gemeinde" (vgl. Hinz, 2009). Sozialräume sind die Bereiche, in denen die Menschen hauptsächlich ihre "Aktivitäten, Vorlieben und Beziehungen" (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2011) leben. Ein inklusiver Sozialraum bietet Nachbarschaft, Barrierefreiheit, Freizeitangebote etc. für jeden Bewohner des Quartiers. Die Behindertenhilfe bietet nicht einen Raum für Angebote und Hilfen an, sondern bietet Unterstützung und Alltagsbegleitung raumübergreifend im normalen Leben und Bewegen des Menschen, der diese Dienste in Anspruch nehmen möchte. Die Behindertenhilfe steht passiv zur Seite, bietet aber im Bedarfsfall (ambulante) Unterstützerkreise (Krach, 2010, S. 79), Beratung, (professionelle) Netzwerke und assistiert bei Interessenvertretungsprozessen. Zu dem Aspekt der Sozialraumorientierung gehört die Auflösung stationärer, gesonderter Wohn- und Arbeitswelten. Der inklusive Gedanke beschreibt keine "Systeme im System", sondern fordert eines für alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen. Die Wandlungsfähigkeit des Systems ist entscheidend, der allgemeine Arbeitsmarkt genauso wie der Wohnungsmarkt. Es ist aber auch eine ökonomische Frage, wie auch der Begriff `Markt` schon suggeriert. Die Forderung nach Inklusion generiert sich aus der Beobachtung zunehmender Exklusion; am deutlichsten erkennbar durch jahrelang progressiv entstehende gesonderte Wohn- und Arbeitswelten. Das betrifft Menschen mit Behinderung häufig genauso wie andere marginalisierte Gruppen, die in den meisten Fällen eine gemeinsame "Schwäche" haben: geringes oder kein ökonomisches Kapital in Form eigener Arbeitskraft und -fähigkeiten. Anne-Dore Stein sagt zu der Tatsache der "Verbesonderung" nach bestimmten Merkmalen: "die tiefere Ursache jedoch liegt in dem gemeinsamen `Merkmal` der mangelnden Leistungsfähigkeit hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft" (Stein, 2012, S. 74). Gesonderte Wohn- und Arbeitsformen lassen sich mit diesem Gedanken nach innen wie außen beobachten: durch die Institutionalisierung in Heimen und stationäre Betreuungsformen, aber auch durch die Segregation in sozial benachteiligte Quartiere[66]. In der Arbeitswelt gilt ein ähnliches Bild, der erste Arbeitsmarkt wird flankiert durch einen zweiten und dritten, wobei der dritte einen reinen "beschäftigungsorientierten" Charakter hat und weitestgehend über öffentliche Gelder (Eingliederungshilfe) finanziert wird. Inklusion hieße an dieser Stelle demnach in erster Linie die Kernursachen zu bekämpfen, was nur die Forderung nach einem breiteren Sozialstaat mit mehr Umverteilung zum Ausbau der Chancen des Einzelnen und stärkeren Regulativen der Marktwirtschaft heißen kann. Die Besonderung, gleich ob in Schule, Arbeit, Freizeit oder Wohnen in mehr oder weniger in sich abgeschlossene "Subsysteme", und damit der Versuch, defizitäre Merkmale zu homogenisieren und akkumulieren, widersprecht dem inklusiven Gedanken, der den konstruktiven Umgang mit Heterogenität im Leistungs-, Bedürfnis- und Merkmalskontext sieht. Für das Wohnen und Arbeiten bedeutet das, Unterstützerstrukturen in finanzieller, individueller und soldidarischer Weise zu organisieren, so dass gemeinsames Arbeiten und Wohnen mit Menschen unterschiedlichster Merkmale und Fähigkeiten möglich wird.
Neben diesem Aspekt der Verortung einer inklusiven Behindertenhilfe muss im inklusiven Sinne die Anspruchslogik überdacht werden: soziale Leistungen sind in hohem Maße an Anspruchskriterien[67] gekoppelt, denen wiederum Defizitidentifizierungen vorausgehen. Der Sozialstaat der Bundesrepublik ist zudem stark lohnarbeitszentriert, was die Abhängigkeit persönlicher und gesellschaftlicher Chancen stark von diesem Aspekt prägt. Demnach werden auch Defizite deklariert: wenn die Leistungsfähigkeit oder -bereitschaft eines Einzelnen aus welchen Gründen auch immer weniger ausgeprägt ist, als es der/ein Markt verlangt, und er dazu noch strukturelle Benachteiligungen erfährt, wie durch Behinderung oder prekäre soziale Herkunft[68], beispielsweise im Bildungs- und Arbeitssystem, greift auf unterschiedlichen Ebenen ein soziales Sicherungssystem. Dieses ist aber zu großen Teilen existenzsichernd aufgebaut und hat wenig aktivierende und präventive Ausrichtungen[69]. Defizite sind demnach strukturell wichtig, da sich Ansprüche aus einem "Mangel" generieren. Diese sind zu einem großen Teil in den Sozialgesetzbüchern festgeschrieben; für die Behindertenhilfe sind Ansprüche auf Hilfen jeglicher Art genau definiert und gehen meist dem Gedanken nach, was der Mensch nicht kann. Behinderungen und der Indikator "Grad der Behinderung" werden wiederum in Ausführungsgesetzen und Verwaltungsvorschriften definiert. Strukturell und sozialpolitisch müssten im inklusiven Sinne beide Ansätze verankert sein: zum einen die Existenzsicherung, die positive Integration durch Nachteilausgleich, bei drohender oder tatsächlicher Behinderung, wie auch in anderen einschränkenden Fällen, andererseits muss nicht per Gesetz gefragt werden, "sag mir was du hast, dann sage ich dir die richtige Maßnahme", sondern "sage mir was du kannst, dann nenne ich dir Möglichkeiten".
Die Behindertenhilfe stellt Leistungen zur Hilfe, Teilhabe und Unterstützung für die Zielgruppe Menschen mit (drohender) Behinderung[70] bereit. Nach dem SGB IX werden vier Leistungsgruppen unterschieden: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (vgl. §5, SGB IX). Darunter fallen viele Individualleistungen, die hier nicht alle im Einzelnen aufgeführt werden können, aber die wichtigsten sind in der Eingliederungshilfe im SGB XII zusammengefasst, wovon beispielsweise Werkstattarbeitsplätze (25%)[71], heilpädagogische Leistungen für Kinder (16%) und auch Leistungen zur Teilhabe am "Leben in der Gemeinschaft" (12%); (§53, SGB XII) bezahlt werden. Die Nettoausgaben der Eingliederungshilfe lagen 2010 bei 12,5 Milliarden Euro, der größte Teil entfiel auf Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen (34%). Es ist erfasst, dass immer mehr Hilfebezieher Leistungen außerhalb der Einrichtungen bekommen; zwischen 1998 und 2010 fand eine Abnahme von 43% auf nun 26% für Menschen in stationären Einrichtungen[72] statt (Destatis, 2010). Damit ist ein Trend zu einem ambulanten Unterstützungssystem zu beobachten. Insgesamt nimmt die Anzahl behinderter Menschen, wie die Inanspruchnahme der Eingliederungshilfe zeigt, zu. Zwischen 1995 und 2009 stieg die Zahl der schwerbehinderten[73] Menschen von 6,5 auf 7,1 Millionen an. Die Empfängerzahl der Eingliederungshilfe stieg von ca. 400.000 1995 auf ca. 770.000 2010 an (Destatis, 2012). Alle Leistungen, außer dem persönlichen Budget, werden einrichtungsbezogen und zentral gewährt. Konkret bedeutet das, dass Antragssteller bzw. Träger zunächst Zuständigkeiten[74] klären müssen; Vorrang haben Krankenkasse, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitsagentur (zunächst Versicherungen), erst dann kann bei einer vorliegenden oder drohenden Behinderung Eingliederungshilfe beantragt werden, die über das jeweilige Sozialamt mit den Einrichtungen, die die Leistung erbringen, organisiert werden. Das heißt, beispielsweise eine ambulant versorgte Wohngemeinschaft, ein Werkstattarbeitsplatz oder Mobilitätshilfen werden über das Sozialamt koordiniert und abgerechnet. Sozialraumbudgets, wie es sie ansatzweise in der Kinderund Jugendhilfe gibt, existieren nicht für Ansprüche aus der Eingliederungshilfe. Die Sozialhilfe nach SGB XII leistet auch Hilfen zur Pflege, womit erhebliche Teile des stationären Wohnens von Menschen mit Behinderung bezahlt werden. 2010 wurden 3 Milliarden Euro dafür aufgebracht, das entspricht einen Anstieg im Vergleich zu 2009 von 3,1%, wonach auf eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit geschlossen werden kann (vgl. Destatis, 2010). Das bestätigt auch Monika Seifert: die "Zahl der geistig behinderten Menschen in Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach SGB XI steigt", stellt sie fest (2006b).
Das Bundesamt für Arbeit und Soziales schlägt in dem Behindertenbericht 2009 eine Reform der Eingliederungshilfe vor, die "personenzentrierte Teilhabeleistungen" und "durchlässigere Hilfesysteme" fokussiert (BMAS , 2009, S. 65). Das sind Elemente des inklusiven Gedankens, die auch das sog. persönliche Budget aufgreifen: seit dem 1.1.2008 existiert ein Rechtsanspruch auf das persönliche Budget als Leistungsform der Eingliederungshilfe, die mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zum Ziel hat. Danach können Leistungen trägerübergreifend genutzt werden, indem sie individuell und monetär zur Verfügung gestellt werden. Koordiniert wird dieses Verfahren vom zuständigen Sozialamt. Das große Problem ist, dass die Empfänger des persönlichen Budgets mit z.T. konkurrierenden Zuständigkeiten arbeiten müssen, da theoretisch neun Leistungsträger[75] in Frage kommen. Dieses Problem schlägt sich auch in der Akzeptanz des Instrumentes nieder: 2009 haben lediglich 3669 Menschen das persönliche Budget in Anspruch genommen. Im Vergleich dazu bekamen 2009 725.000 Menschen Eingliederungshilfe (Destatis, 2009, S. 11). Diesem Koordinations- und Organisationsproblem wurden schon 2001 die Einrichtung der "gemeinsamen Servicestellen" entgegen gesetzt, die werden aber in erster Linie von den Renten- und Krankenversicherungsträgern getragen (BMAS , 2009, S. 78).
Es wurde schon angedeutet, dass die vollstationären Wohnformen, wenn auch schleppend, abnehmen. Im Jahr 2003 existierten ca. 5100 stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung mit knapp 180.000 Bewohnern[76] (BFSFJ, 2006). Dem gegenüber leben 2007 36% aller behinderte Menschen in ambulanten, betreuten Wohnformen (Theunissen, 2011, S. 32). Dabei ist aber zu beachten, dass viele behinderte Menschen in teilstationären Wohnformen leben, so dass die Zahlen der Eingliederungshilfe deutlicher sind: 2009 haben ca. 490.000 Menschen Hilfen in Einrichtungen (voll- und teilstationär) erhalten, dem gegenüber stehen knapp 300.000 Menschen, die ambulante Hilfen (u.a. betreutes Wohnen) bekamen. Der Großteil erhält also Eingliederungsleistungen nach wie vor in (teil-)stationären Einrichtungen, wenn auch mit abnehmender[77] Tendenz. Es ist also nach wie vor eine Besonderung zu identifizieren, zumal der vierte Bericht der Bundesregierung zur Lage der Menschen mit Behinderung davon ausgeht, dass "der größte Teil der behinderten Menschen in Einrichtungen mit mehr als 24 Plätzen lebt" (BFSFJ, 2006). Diese Besonderung in der Lebens- und Wohnwelt lässt sich auch im Arbeitsmarkt analog beobachten, und hier sogar mit zunehmender Tendenz: im Jahr 2006 haben 268.000 Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen gearbeitet, das ist ein Anstieg von 2001 zu 2006 um 23%. Dieser "boomende" dritte Arbeitsmarkt wird flankiert vom einen zweiten Arbeitsmarkt, der nach den Hartzgesetzen v.a. sog. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung beinhaltet.
Im Sozialgesetzbuch IX - Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen - wird ein besonderer Fokus auf den programmatischen Punkt `Teilhabe` gelegt, was sich allein durch die Überschrift des Buches ausmachen lässt. Artikel 1 gibt die Intention des Buches vor:
"Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen" (§1, SGB IX),
In §4, "Leistungen zur Teilhabe" findet der Aspekt Teilhabe besonderes Augenmerk:
"die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung, 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern, 3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder 4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern" (Art. 1, §4, SGB IX).
Besonders auffällig ist im inklusiven Sinne der Begriff "unabhängig", der eine gewisse Kategorienfreiheit impliziert. Und des Weiteren steht in Abschnitt 3, dass "Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder [...] so geplant und gestaltet [werden], dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können" (Abschnitt 3, §4, SGB IX). Diese Richtung der Ausgestaltung sozialstaatlicher Leistungen für Menschen mit Behinderung durch den Begriff Teilhabe kann strukturell als stärkster Inklusionsfaktor verstanden werden.
Strukturell wären für die Jugendsozialarbeit Finanzierungs- und Unterstützungsformen zu entwickeln, die folgender Forderung folgen: "in einem Haus wären multiprofessionelle Teams zu bilden, die sozialräumlich verortet sind und die flexible Hilfe in der gesamten Spannbreite anbieten können, sodass sie der Bedarfslage der Adressaten entspricht - die also offene Beratung, Begleitung, Berufsorientierung, Beschäftigung und Beschäftigungsentwicklung, Ausbildung bis hin zur finanziellen Hilfe im Repertoire haben" (Oehme, 2011, S. 15). Diese Orientierung nach "sozialen Anliegen" oder anders gesagt: "biografieorientierte Beratung und Vermittlung" (ebd.), legt einen starken Wert auf kommunikative, sozialräumliche und individuelle Lösungen, die nur erreicht werden können, wenn solche Teams mit pauschalen Budgets arbeiten könnten. Eine weitere Voraussetzung ist die kommunikative und praktische Vernetzung aller Akteure und Institutionen nicht nur der Jugendhilfe, eines Quartiers, die mit den Adressaten zusammen arbeiten.
Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt - wenn auch sensibler angelegt, gerade im Bereich der Inobhutnahme - die gleiche Forderung. Relevante Akteure der Familienhilfe, Erziehungsbeistand, (Kindertages-)Pflege und Erziehungsberatung müssen vernetzt und gemeinsam das individuelle Anliegen des Kindes und/oder Familie begleiten und Lösungsstrategien anbieten, die eine "Institutionen unabhängige Hilfeplanung" (Meyer, 2011) ermöglichen. Auch hier werden multiprofessionelle Teams präferiert, aber für die Prozessbegleitung eines "Falls" wird ein Verantwortlicher (sog. Case Manager) bestimmt, der die Koordination gewährleistet. Dieser arbeitet unterstützend, advokatorisch und vermittelnd und keinesfalls bevormundend.
Der Bereich Kindertagesstätten und andere Formen der einrichtungsbezogenen und familienfernen Begleitung von Kindern und Jugendlichen, wie auch Heimerziehung, müssen konsequent auf ihre Dringlichkeit im Einzelfall überprüft werden. Nach dem inklusiven Ansatz sind sämtliche stationäre und Pflege- und Wohnformen zu überprüfen und es gelten die Prämissen nach Dezentralität vor Wohnortferne und "ambulant vor stationär". Dennoch gibt es Bereiche, gerade für den Aspekt Kindeswohlgefährdung, die unter staatlicher Aufsicht und innerhalb eines Hauses koordiniert werden müssen. Aber auch hier gilt der Grundsatz, nicht nach innen wie außen zu homogenisieren. Nach innen nicht, beispielsweise in einem Heim nur für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche, und nach außen nicht durch Quartiersferne. Diese Einrichtungen müssen sich nach innen inklusiv aufstellen, indem unterschiedliche Kinder und Jugendliche mit sozialen Anliegen innerhalb eines Hauses betreut werden und nach außen, indem die oben beschriebene Vernetzung mit anderen Jugendhilfe- wie auch Bildungs- und anderen Trägern des Quartiers stattfindet. Der inklusive Ansatz in der Jugendhilfe postuliert an dieser Stelle also die Perspektive "Vielfalt in der Differenz" (Jantzen, 2010, S. 97) nach innen wie außen.
Insgesamt sind auch in diesem Kontext grundlegende Elemente der Inklusion ausschlaggebend: Barrierefreiheit, die Öffnung in fachlicher, finanzieller und angebotsbezogener Hinsicht, starke kooperative Strukturen zwischen den Trägern, Subjektorientierung und Selbstbestimmung, wie der Blick auf die Bedürfnisse des Kindes/Jugendliche, organisiert aus einer (multiprofessionellen) Hand (vgl. auch Dannenbeck & Dorrance, 2011). Dannenbeck zieht damit ein Fazit in Abgrenzung zur Schule: "die offene Kinder- und Jugendarbeit ist prädestiniert dafür, soziale, kulturelle und personale Begegnungen strukturell anzulegen, zu ermöglichen und zu leben, während die Schule im Gegensatz dazu erfolgreiche Lernprozesse allzu oft nur unter der Bedingung hergestellter Homogenität erzielen kann. [...] Die Offene Kinder- und Jugendarbeit kann und muss somit die Vorreiterrolle auf dem Weg zur Herstellung inklusiver Lernwelten und Teilhabe auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Vielfalt spielen" (Dannenbeck 2011 in Meyer, 2012).
Ein Inklusionsanspruch im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung von Problemen und systemunabhängigen Hilfen existiert in der Logik des SGB VIII nicht. Das SGB VIII formuliert sozialpolitische Ziele und den Rahmen. Ausführungsgesetze und Richtlinien auf Landesebene regeln die (den) Umsetzung (-sanspruch). Das SGB VIII ist stark einrichtungsorientiert, d.h. Förderungen durch das Sozialgesetzbuch werden nach Konzept und Angebot der Jugendhilfeträger gewährt, nicht unbedingt nach (individuellem) Bedarf. Zuwendungen sind zudem immer zweckgebunden, ein "Transfer" von Mitteln zu anderen, verwandten Zwecken ist meist nicht möglich. In Bezug auf die Eingliederungshilfe wird diesem nicht inklusiven Umstand in einer Stellungnahme der Bund-Länder- Arbeitsgruppe "Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung" mit der Aufforderung Rechnung getragen, Leistungen zukünftig weitestgehend personenzentriert zu organisieren (vgl. ASMK, 2009, S.3)[78]. Kommunale Sozialraumbudgets, wie sie in Bremen für die Kinder- und Jugendarbeit existieren, sind nicht im SGB VIII vorgesehen (verbieten es aber auch nicht, da die Ausführung den Ländern obliegt). Direkte Hilfen für Kinder und Jugendliche sind aus dem SGB VIII nur ableitbar, tatsächliche Höhe und Form der Hilfen regeln die Träger und Jugendämter. Insgesamt ist das SGB VIII zielgruppenorientiert, d.h. die direkten Hilfen und Förderungen durch das SGB VIII werden nach Bedarfsfall gewährt und setzen immer eine Prüfung voraus.
2009 wurden mit dem 13. Kinder- und Jugendbericht erstmals inklusive Ansätze auch als sozialpolitisches Ziel in der Jugendhilfe beschrieben. "Sonderbezirke oder sog. Schonbereiche für bestimmte Gruppen von Menschen (z.B. Menschen mit Behinderung, Menschen aus anderen Ländern Zugewanderte, sozial Benachteiligte etc.)" (BFSFJ 2009, S. 35), sind demnach nicht zu schaffen, sondern Inklusion und Beteiligung sollen als "Herausforderung, Verpflichtung und Aufgabe einer sozialen Gemeinschaft verstanden" (ebd.) werden. Auch werden konkrete Ziele für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe benannt: Aussonderung ist abzubauen (vgl. ebd. S. 40), Armut und der sog. "doppelte Benachteiligung" durch fehlendes materielles und Bildungskapital, das die Chancengleichheit und Teilhabemöglichkeit tatsächlich oder vom Grundgefühl her ausschließt (vgl. ebd. S. 48) sind entgegen zu wirken und Strategien für eine kommunale Inklusion sind zu entwickeln (ebd. S. 258). Dieser letzte Punkt beinhaltet auch eine Kernforderung eines inklusiven Ansatzes:
"Familien mit behinderten Kindern ebenso wie Jugendliche mit Behinderung haben derzeit einen hohen Aufwand zu erbringen, um über Systemgrenzen zwischen Gesundheits-, Eingliederungshilfe, Bildungssystem hinweg im ausreichenden Maße die von ihnen gewünschten und passgenauen Beratungen, Unterstützungen und Teilhabegelegenheiten für ein gesundes Aufwachsen zu realisieren" (Bundesministerium für Familie, 2009, S. 258).
Aber auch hier gilt, dass Zielgruppenlogiken überdacht werden müssen und Kinder und Jugendliche nicht nach Defiziten in den Genuss von Leistungen kommen sollten. Beispielansätze dazu lassen sich bundesweit identifizieren: Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe bezieht Position für eine grundsätzliche Öffnung der Kinder- und Jugendhilfe zu einem zielgruppenlosgelösten, wie auch zielgruppenspezifischen Hilfesystem (Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe, 2012), die Stiftung Alsterdorf, die eine bewegte Geschichte prägt[79] setzte sich das Ziel, das jedes Kind einen Anspruch auf einen individuellen Entwicklungsplan hat (Stiftung Alsterdorf, 2012) und das Bundesjugendkuratorium spricht sich in einer Stellungnahme deutlich gegen die Schnittstellenproblematik aus, die unterschiedliche zielgruppenspezifische Hilfesysteme generieren (Bundesjugendkuratorium, 2012).
Der Inklusionsansatz wird v.a. in der Bildungspolitik wahrgenommen und danach häufig im Kontext von Kindergärten und -tagesstätten (Kita). Durch die pädagogischen Fragen und Entwicklungen, zunächst geprägt durch die Integrations- und Normalitätsprinzipienbewegungen, zu dem gemeinsamen Erziehen und Beschulen von Kindern mit und ohne Behinderung etablierte sich der inklusive Ansatz sukzessive auch im Erziehungswesen[80]. Etablieren ist hier tatsächlich die richtige Beschreibung, da 61,5% der Kindertagesstätten inklusiv aufgestellt sind und arbeiten (Klemm, 2010, S. 8)[81]. Hier gelten auch Bestimmungen aus dem SGB VIII, die Ziel, Förderung und Sicherstellung des erzieherischen Auftrages regeln (§§22ff, SGB VIII). Das SGB VIII sieht keine grundsätzliche inklusive Struktur im vorschulischen Bereich vor, weshalb auch in den Ausführungsgesetzen auf Landesebene sehr unterschiedliche pädagogische und strukturelle Voraussetzungen für die Aufnahme und Arbeit von Kindern in Kitas vorherrschen. In
"Sachsen-Anhalt beispielsweise besuchen alle Kinder mit besonderem Förderbedarf integrative Einrichtungen. Auch in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig- Holstein werden weniger als zehn Prozent der Kinder mit besonderem Förderbedarf in Sondereinrichtungen betreut. In Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachen hingegen besuchen über 50 Prozent der Kinder mit besonderem Förderbedarf eine gesonderte Einrichtung" (UNESCO - Forum Menschenrechte, 2011, S. 61).
Integrative Einrichtungen werden an dieser Stelle gleichgesetzt mit inklusiven Einrichtungen, da sie die strukturelle Zugangsmöglichkeit meinen. Insbesondere in Bremen existiert eine lange "Tradition" integrativer Kindergärten, was einerseits mit starken Elternbewegungen und einer "sozialdemokratischen Integrationskultur" zusammenhängt, andererseits mit den damaligen Arbeiten Professor Feusers der Universität Bremen, der ein Verfechter der integrativen Pädagogik war (ist) (vgl. z.B. Feuser, 1995, S. 133). Dennoch sprechen diese Entwicklungen in erster Linie pädagogische und behinderungsbezogene Aspekte an. Im Inklusionssinne, der einen umfassenden und ausschlussfreien Zugang für alle Kinder in die frühkindliche Bildung fordert, werden Behinderungs- und Pädagogikaspekte zweitrangig. Strukturell müssen auch die Indikatoren Armut, Migration, sozialer Status und Bildungsferne in die Praxis der Aufnahme und Erziehung mit einfließen und auch wenn die Kinderrechtskonvention von 1989 und die UN-BRK nicht explizit ein Recht auf frühkindliche Bildung bestimmen, dürfen keine ausschließenden Sondersysteme im Sinne der Inklusion existieren, da sie die Teilhabe- und Diskriminierungsverbotsbestimmungen konterkarieren. Dennoch ist der Stand im Bereich der vorschulischen Erziehung und Bildung im Vergleich zu allen anderen sozialen Systemen, die in dieser Arbeit angesprochen werden, am weitesten fortgeschritten.
In der außerschulischen Kinder- und Jugendförderung, wie auch in der Jugendsozialarbeit zeichnet sich von Einrichtung zu Einrichtung, von Region zu Region, ein sehr unterschiedliches Bild. Während sich viele Regionen und Träger "auf den Weg machen" [82], gibt es wiederum andere, die bisher wenig mit dem Leitbild Inklusion Berührung hatten. M.W. gibt es keine Studie in der BRD, die Quoten abbildet, aber die - nicht erschöpfende - Recherche zeigt folgende Entwicklungen auf: Träger der Kinder- und Jugendförderung, wie Jugendverbände und Jugendclubs oder -initiativen haben Auffassungen in ihrer Arbeitsweise, die Inklusion gut zulassen. Elemente wie das informelle, selbstbestimmte und themenspezifische Lernen und Organisieren eigener Interessen, wie auch die häufige strukturelle Offenheit der Einrichtungen, bilden gute Wege für den inklusiven Gedanken. Dennoch sind gerade Jugendverbände auch mit einem Selbstverständnis von der Herstellung von Homogenität, wie beispielsweise die Pfadfinderbewegungen, ausgestattet, die, gepaart mit dem Gedanken der starken Identifizierung gemeinsamer, abgrenzender Leitbilder zu anderen, den inklusiven Gedanken wiederum erschweren. Dennoch sind viele Jugendförderungsträger gerade auch durch die Diskussion der Kooperation mit Schule auf der Suche nach inklusiven Strukturen, die nicht zu letzt auch ihr eigenes Angebotsfeld und ihre Attraktivität erhöhen. Der Bundesjugendring als Interessenvertreter der Jugendverbände bzw. der Landesjugendringe aber ließ bisher nichts zu dem Thema Inklusion verlauten, im Gegenteil wurde 2010 noch von der Integration vom Jugendlichen mit Migrationshintergrund gesprochen (Deutscher Bundesjugendring, 2010). Die Landesjugendringe sind fortgeschrittener: in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Berlin beispielsweise haben bereits Fachtage stattgefunden, der niedersächsische unterstützt die inklusive Schule und Schleswig-Holstein hat seine sozialpolitischen Forderungen mit dem Ziel Inklusion erweitert und viele Verbände arbeiten aktiv an dem Thema (vgl. www.alle inklusive.de, 2012). Auch Jugendgruppen und Initiativen sind an vielen Stellen mit dem Thema konfrontiert, dabei lässt sich konstatieren, dass in den Stadtstaaten dieses Thema am stärksten behandelt wurde. Das hat zwei Gründe, einerseits sind die Staatstaaten traditionell stärker mit der Suche nach Lösungsmöglichkeiten mit dem Umgang von Diversität konfrontiert, v.a. als präventives Mittel zur Gefahrenabwehr durch soziale Desintegritäten, Kriminalität oder sich verschärfende soziale Kontraste in der Gesellschaft, insbesondere durch ungleiche Einkommen. Zweitens haben die drei Staatstaaten überwiegend eine sozialdemokratisch gefärbte Tradition, die von ihrer ideologischen Norm (vgl. Kap. 4.1) her das Thema Inklusion besser zulässt, als konservative Bilder. Dieser Gedanke lässt sich auch überregional festhalten: inklusive Ansätze in der Kommunikation und Publikation innerhalb der Jugendförderung sind v.a. in den östlichen Bundesländern, den Stadtstaaten, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zu finden.
Der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung von 2009 empfiehlt zwölf Leitlinien zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe und schlägt in dem Bericht auch die sog. "große Lösung SGB XIII vor. Die Leistungsansprüche für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind derzeit hoch differenziert. Geistig und körperlich behinderte, oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sind momentan im Anspruchsbereich des SGB XII, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche wiederum über Teilhabeansprüche des SGB VIII verortet. Diese sog. "Kleine Lösung" mit unterschiedlichen gesetzlichen Anspruchsgrundlagen hat mehrere Nachteile, zum einen praktische, zum anderen im Sinne der Inklusion: Einerseits bestehen so unterschiedliche fachliche, strukturelle und organisatorische Praktiken und Hilfeleistungen, die die Orientierung für Kinder und Jugendliche und deren Eltern schwer machen. Hinzu kommt eine strikte Trennung von der Kinder- und Jugendhilfe mit der Eingliederungshilfe und damit unterschiedliche Finanzierungen, da kommunale Leistungen in Konkurrenz zu staatlichen Leistungen stehen. Die Gefahr der "Verschiebebahnhöfe" und "schwarzer Löcher" (Keupp, 2010) ist damit größer und in jedem Fall fördert es die Tendenz zur Abkehr des "individuellen Blicks". Es findet eine "Orientierung an Behinderungsformen und Institutionenlogik statt an individuellen Ressourcen und Bedürfnissen" (ebd.) statt, wobei der Inklusionsgedanke keine Abgrenzung zwischen den Behinderungsarten, keine Zuordnungsprobleme und kein "Wetteifern von KJH und Sozialhilfe (und auch Krankenkassen) um "Nicht-Zuständigkeit" (vgl. ebd. S. 14) fordert. Vorgeschlagen wird von verschiedener Seite die "große Lösung SGB VIII", die Zusammenführung aller Ansprüche unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen. Auch der 13. Kinder- und Jugendbericht stellt diese Forderung erneut mit auf, da es "Reibungsverluste" (Bundesministerium für Familie, 2009, S. 13) gibt, schränkt aber gleichzeitig ein, dass diese Variante nur in Frage kommt, wenn "die damit vorhandenen finanziellen, personellen und strukturellen Fragen gelöst werden können" (ebd. S. 15).
So wie grundsätzlich eine Inklusionsannahme lautet, dass die "Zwei-Gruppen"-Theorie aufgehoben werden muss, ist es nicht die Frage nach alt oder jung oder mit Migrationshintergrund oder ohne. Wie in Kapitel 4.5 dargestellt sind Kriterienzuschreibungen, kategoriale Zugehörigkeiten und askriptive Merkmale, die keine pauschalisierende Bedarfs- oder Fähigkeitsbeschreibung zulassen und daraus resultierende Leistungsansprüche und Arbeitsweisen, im Inklusionssinne unzulässig. Kategorien wie z.B. Staatsangehörigkeit erklären nicht per se besondere Bedarfe beispielweise in der Sprachkompetenz. Ein Kriterium wie Alter erklärt nicht grundsätzlich einen Pflegebedarf. Auch in weit verbreiteten (Vor-)Urteilen lassen sich solche verkürzten Rückschlüsse erkennen: "Soziale Probleme und Integrationsdefizite, die in der öffentlichen Debatte häufig mit dem Begriff Migrationshintergrund assoziiert sind, bestehen überwiegend in traditionsverwurzelten und prekären Migranten-Milieus. Das heißt: Integrationsproblematiken sind eher schichtspezifisch denn migrationsspezifisch - wie in der deutschen Bevölkerung ohne Migrationshintergrund" (Seifert & Harms, 2012, S. 73). In Bezug auf die normativen Annahmen einer inklusiven Praxis[83] der Hilfen für Migranten ist demnach auch hier der Fokus auf das Verhindern von strukturellem Ausschluss zu legen, das bedeutet, die sozialen Lagen der Menschen im Vordergrund zu sehen. Armut ist auch hier ein extremer Ausschlussfaktor, zudem kommen restriktive Verordnungen und Praktiken in der Verwaltung, die v.a. aus dem Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz entspringen[84]. Hier werden Menschen mit Migrationshintergrund einer starken Kategorisierung nach (familiärer) Herkunft, Dauer des Aufenthalts, Qualifikation und Arbeitsabsichten, Art des Aufenthaltswunsches (z.B. Asylbeantragung aus völkerrechtlichen, politischen oder humanitären Gründen) und anderen Kriterien [85] unterworfen, was auch eine Vielzahl an Verwaltungsbezeichnungen verdeutlicht: Asylsuchender, Geduldeter, Flüchtling, Eingewanderter oder z.B. Arbeitsmigrant. Nach dem inklusiven Gedanken ist dieser Bereich schwierig in eine chancengleiche und merkmalsfreie Praxis zu überführen. Jegliche Stigmatisierungen, die durch die Einteilung nach Herkunft und Einwanderungsinteresse mehr oder weniger automatisch erfolgen, müssten im Grundsatz überprüft werden. Auf Grund völkerrechtlicher Verträge sind beispielsweise EU-Bürger und NATO-Angehörige durch das Freizügigkeitsgesetz grundsätzlich anders gestellt als Menschen aus sog. Drittstaaten. Wenn, dann findet Integration statt, da nach äußeren Merkmalen differenziert wird und diese ggf. an definierte Umgebungen angeglichen werden müssen. "Inklusion letztlich geht einen Schritt weiter, da sie die grundlegende Überprüfung der strukturellen Exklusion fordert, die Migranten nicht von vornherein gleiche Chancen einräumt, sei es in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche, indem strukturelle Diskriminierungen ausgeräumt werden und deren besondere Fähigkeiten, die sie durch die Kenntnis von zwei Sprachen und Kulturen erworben haben, als Gewinn an Vielfalt und Bereicherung verstanden werden" (Akademie für Inklusion, 2012). Und: "Inklusion kann ohne die selbstverständliche Grundvoraussetzung des Zugeständnisses einer individuellen Chance nicht realisiert werden" (Amjahid, 2009, S.1). Das gilt insbesondere bei Menschen mit Migrationshintergrund, da sie stark äußeren Bewertungskriterien unterliegen, die sie nicht beeinflussen können.
In Deutschland leben rund 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, davon sind im Jahr 2002 711.000 Ausländer im Alter von 60 und älter (vgl. Schubert, 2005). Insgesamt beträgt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung 18,6 Prozent. Davon sind 8.6% Ausländer und 10% Deutsche mit Migrationshintergrund[86] (vgl. Bundesgentur für Arbeit, 2012). 96 % leben im alten Bundesgebiet sowie Berlin und nur vier Prozent (600.000) in den ostdeutschen Ländern (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 2010). Heute hat sich die aktive Einwanderung nach Deutschland verringert. Das hängt zum Teil mit der Drittstaatenregelung aus dem Jahr 1993 zusammen, die eine Regelung im Asylrecht ist, nach der Personen, die im Ursprungsstaat zwar politisch verfolgt wurden, aber über einen für sie sicheren Drittstaat einreisen und nicht das Recht auf Asyl wegen politischer Verfolgung geltend machen dürfen. Im Kontext der Migrationspolitik ist häufig die Rede von `Integration`, dabei bezieht sich diese häufig auf das einseitige Integrieren der Menschen mit Migrationshintergrund in die deutsche Gesellschaft. Zudem kommt, dass sich die gesellschaftliche Debatte "kaum auf die aktuelle aktive Einwanderung, sondern auf die bereits ansässigen Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Teil bereits in der vierten Generation in Deutschland leben" (Akademie für Inklusion, 2012) bezieht. Es lässt sich Leistungen und Leistungsbedarfe beobachten, dass in der Migrationspolitik im Vergleich zu allen anderen sozialpolitischen Bereichen am stärksten nach askriptiven Merkmalen, zugeschrieben werden. Der Immigrationsprozess ist dabei zweiseitig: zunächst wird ein formeller Aufenthaltsstatus formuliert[87], der ist stark von äußeren Merkmalen abhängig. Dieser Verwaltungsprozess ist aber relativ starr und undurchsichtig (insbesondere für einen zugegezogenen Menschen), was alleine die Vielzahl an involvierten Ämtern und möglichen Aufenthaltstiteln bestätigt wird[88]. Hier wird eine schwierige Praxis im inklusiven Sinne erkennbar, insbesondere wenn nationale Ausführungsgesetze Menschenrechten entgegen stehen. Das Recht auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung ("Substantiv Issues arising in the Implementaion of the international convenant on economic, social ans cultural rights", 2000) beispielsweise kann dem §55 AufenthG - "Ermessensausweisung" entgegen stehen. Andererseits bleibt es eine schwierige sozialpolitische Frage, wie eine inklusive Politik der gleichen Chancen tatsächlich allen offeriert werden kann, ohne dabei Abgrenzungen in der Zahl von `allen` vorzunehmen.
Die Grundannahmen sind die gleichen wie in den anderen schon beschriebenen Bereichen. Im Sinne der Inklusion darf es keinen strukturellen Ausschluss aus Angeboten aus dem öffentlichen Leben für bestimmte Menschen geben. Dazu gehören auch Angebote der Freizeitgestaltung, der außerschulischen (Erwachsenen-) Bildung und im Tourismus. Für den Bereich Freizeit[89] und Sport, der viel über private Träger und Vereine organisiert wird, ist eine Abgrenzung schwierig, inwiefern solche Träger sich "ihre Kundschaft" aussuchen können. Grundsätzlich ist die Autonomie privater Firmen, Träger oder Vereine zu achten und der Inklusionsanspruch gilt nicht uneingeschränkt in der praktischen Umsetzung. Anders wird es, wenn diskriminierende und willkürliche Elemente dazu kommen, da diese grundgesetzlich verboten sind. Zudem ist es auch eine Frage, welche Stellung der Verein gesellschaftlich einnimmt und ob der Träger staatlich gefördert wird, um bestimmte Leistungen anzubieten. V.a. bei Sportvereinen und Angeboten freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, wie auch der Alten- und Behindertenhilfe, ist häufig eine staatliche Subventionierung der Fall und damit gilt dann auch der Inklusionsanspruch. Für den Bereich der außerschulischen Bildung in der Kinder- und Jugendförderung, wie auch im Erwachsenenbildungsbereich gilt das gleiche Prinzip. Abhängig von öffentlicher Förderung und gesellschaftlicher Stellung müssen Bildungseinrichtungen alle Menschen aufnehmen und individuelle Hilfeleistungen zum Lernen anbieten. Für eine Volkshochschule gilt dies insbesondere[90]. Der Tourismus ist hingegen überwiegend privatwirtschaftlich organisiert. Es existieren auch staatlich subventionierte Reisen und Erholungsangebote, insbesondere organisiert über die Jugend-, Behinderten-, und Altenhilfe. Aber der Tourismus im Sinne der Organisation von Unterkunft, Programm und Fahrten liegt in privater Hand und unterliegt damit - wiederum einer eigenen - Rechtsautonomie. Es ist aber interessant, dass gerade dieser Bereich, Barrierefreiheit und strukturelles Öffnen, seine Angebote für Menschen mit (v.a. körperlicher) Behinderung immer häufiger beachtet, da dies im Zuge des demografischen Wandels und zunehmender eingeschränkter Mobilität der Menschen, einen Markt darstellt. Andere Gruppen, die Exklusion ausgesetzt sind, wie arme oder geistig behinderte Menschen werden aber nicht angesprochen. Auch der Kulturbereich ist sehr differenziert zu betrachten, da Form, Inhalt und Organisation im hohen Maße unterschiedlich sein können. Auch hier gilt: staatliche Einrichtungen, wie teils die Museen, Theater und offene (Musik-)Veranstaltungen sind zugänglich zu gestalten, private Träger und Kulturinitiativen unterliegen keinem "Inklusionszwang", aber dürfen nicht diskriminieren.
Es ist schwierig einen Überblick über einen deutschlandweiten Stand für die Bereiche Sport und Freizeit, außerschulische Bildung und Tourismus zu geben, da es eine Vielzahl an Organisationen, Vereinen und Firmen gibt, die je nach Region, unternehmerischer Ausrichtung und Kundenklientel mehr oder weniger mit den Gedanken der Inklusion in Berührung kommen. Aber es ist zu konstatieren, dass für die Bereiche Sport und Freizeit an vielen Stellen inklusive Ansätze in Form sich öffnender Angebote sichtbar sind. Der DFB als größter deutscher Sportverband hat in mehreren Projekten das Thema Inklusion aufgenommen, beispielsweise durch initiierte und finanzierte Vorhaben der Sepp-Herberger Stiftung oder die Blindenfußballliga. Der deutsche Handballbund hingegen hat in Leitbild und inhaltlicher Ausrichtung wenig bis gar keinen Bezug zur Inklusion, ähnlich sieht es bei dem deutschen Basketballbund aus. Auf der anderen Seite existiert in Deutschland ein gut ausgebauter Behindertensportbereich; der deutsche Behindertensportverband mit 17 regionalen Unterverbänden organisiert eine Vielzahl an Sportangeboten für Menschen mit Behinderung. Wie Einrichtungen der Behindertenhilfe steht aber ein solch zielgruppenspezifischer Verband dem Gedanken der Inklusion kritisch bzw. abwägend gegenüber: "im Bereich Bewegung, Spiel und Sport sollen Menschen mit Behinderung die Wahlmöglichkeit haben, zwischen Angeboten in z.B. homogene Behindertensportgruppen (sogenannten "Schutzräumen") oder in Sportvereinen, ohne speziellen Bezug zum Sport von Menschen mit Behinderung" (Deutscher Behindertensportverband, 2012) heißt es beispielsweise in einem Positionspapier zur UN-BRK des Verbandes. Der Bereich Sport, der sich gut für die Aufnahme des inklusiven Gedankens anbietet, birgt also das Problem, dass er an vielen Stellen hoch differenziert ausgestaltet und organisiert ist, insbesondere wenn es in den Leistungssportbereich geht. Je höher dabei der Leistungsanspruch in Vereinen und Organisationen, desto schwieriger ist in der Wahrnehmung vieler die Aufnahme des inklusiven Gedankens, wobei sich dieser fast nur auf die Zielgruppe der behinderten Menschen bezieht. Die nicht existierende Kausalität, die häufig geäußert wird: "behinderte Sportler sind per se nicht so leistungsstark"[91] bzw. "das Leistungsvermögen korreliere stark mit der Stärke einer Behinderung", ist im inklusiven Sinne doppelt falsch, einerseits wird ein Schluss gezogen, der mit einer pauschalen Kategorisierung ein individuelles Merkmal generiert, und andererseits bildet solch eine Aussage, die auf eine Annahme beruht, häufig den Vorläufer für einen strukturellen Ausschluss. Im Breitensportbereich wiederum findet häufig ein selbstverständliches Miteinander statt, ohne auf Besonderheiten etc. explizit zu achten - das hängt aber sehr von den Kriterien: Offenheit, regionaler Bezug, Tradition des Vereins und sportliche Ausrichtung ab[92].
Die Freizeit als "Zeit, die einem Individuum zur Selbsterhaltung zur Verfügung steht" (Mann, 2006) ist in der Ausgestaltung jedem frei überlassen und kann in vielfältiger Weise wahrgenommen werden. Und auch hier lässt sich konstatieren, dass die Variation an Freizeitmöglichkeiten die gleiche Variation an Inklusion zulässt. Grundsätzlich steht jedem Menschen, insbesondere für Menschen mit Behinderung nach der UN-BRK, das Recht auf freie Freizeitgestaltung zu. Einrichtungen, Vereine, Häuser und Anlaufstellen für die Freizeitgestaltung sind in höchst unterschiedlicher Art anzufinden, aber wie auch im Bereich der kulturellen Partizipation gibt es gute und schlechte Beispiele der Öffnung von Angeboten. Während etablierte Einrichtungen, die soziale Benachteiligungen ausgleichen wollen, wie zum Beispiel Stadteilhäuser in sog. benachteiligten Stadtteilen, Cafés und Treffs mit barrierefreien Zugang oder Freizeitangebote der Behindertenhilfe sich stärker dem Prozess der Inklusion öffnen, sind Freizeitorte für eine "breite Masse", wie Schwimmbäder, Freizeitparks oder Kinos häufig weniger allen grundsätzlich gegenüber geöffnet, was sich durch teure Eintrittspreise, Barrieren in Sprache und Organisation oder fehlende Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort äußert. Auch hier lässt sich, ohne dass das meines Wissens aber bisher belegt worden wäre, die grundsätzliche Tendenz erkennen, dass staatliche, halbstaatliche und staatlich subventionierte Freizeitträger und -orte eher fortgeschrittener im Inklusionssinne sind, als private Träger und Vereine.
Die Heinrich Böll Stiftung hat in ihrer Reihe Wirtschaft und Soziales, Band 7: "Wege in eine inklusive Arbeitsgesellschaft" (2011) das Ziel ausgegeben für alle Erwerbsfähigen die "gesellschaftliche Teilhabe auf drei Ebenen der sozialen Inklusion zu ermöglichen: als Fähigkeit und Gelegenheit zur ökonomischen Existenzsicherung, in Gestalt des Zugangs zu bzw. der Mitgliedschaft in sozialen Beziehungsnetzen und als reale Chance zur persönlichen Entwicklung durch Qualifizierung und beruflichen Aufstieg" (ebd. S. 10). Diese Ziele und Aufgaben können als stärkste inklusionsrelevante Normen gesehen werden, da sie das Gegenteil exkludierender Tendenzen für die volle Teilhabe am Gesellschaftssystem beschreiben. Positiv formuliert wäre die Erreichung dieser Ziele einer der nachhaltigsten Schritte in Richtung inklusive Gesellschaft. Wie das Kapitel 4.6 Inklusion und Armut beschreibt, ist einer der gefährlichsten Exklusionsaspekte materielle, kulturelle und soziale Armut. Chancengleichheit und Selbstbestimmung korrelieren stark mit der Verfügbarkeit sozialer, kultureller und materieller Ressourcen. In diesem Sinne fordert der inklusive Gedanke ein Ausbildungs- und Arbeitssystem, dass mit "vielfältigen Mobilitätspfaden" (ebd. S. 35) versehen ist, differenziert (auch: menschlich, begleitend, prozesshaft) und durchlässig ist und das präventiv und aktivierend wirkt. Der DGB weist darauf hin, dass mehr Ausbildungsplätze für junge Menschen mit untypischen Biografien[93] notwendig sind, beispielsweise sind nur 0,9% der Auszubildenden schwerbehinderte Menschen. Es existiert ein fast automatisierter Übergang von Sonderschulen zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder Berufsbildungswerke (vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund, 2010), den es aufzubrechen gilt. Eine Fachkonferenz des Sozialverbandes Deutschland und der BAG Selbsthilfe hat 2009 Forderungen ausgearbeitet, die den inklusiven Gedanken in Arbeit und Ausbildung etablieren könnten:
-
Frühzeitige Einbeziehung der Menschen in Form des Wunsch- und Wahlrechts, effektive Beratung und prozesshafte Begleitung in den Übergängen Schule, Ausbildung und Beruf
-
Die Aufnahme aller in Ausbildung ist Voraussetzung für einen inklusiven Arbeitsmarkt
-
Aufbau und Etablierung von Beratungs- und Expertenstrukturen bei den SGB II - Trägern, mit gleichzeitig enger und verzahnter Zusammenarbeit mit den Integrationsfachdiensten
-
Keine "schnelle" Vermittlung, sondern eine gesichert
-
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, die besondere Hilfsstrukturen vorhalten
-
Überprüfung der Beschäftigungspflichtquote für schwerbehinderte Menschen von derzeit 5%
-
Barrierefreiheit in der Vermittlung, Begleitung und konkreten Arbeit
-
Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik (vgl. SoVD und BAG Selbsthilfe, 2009)
Diese Punkte beinhalten den Fokus auf Menschen mit Behinderung, aber die Forderungen könnten ebenso für andere Menschen mit sozialen Anliegen gelten. Insgesamt müsste im Sinne inklusiver Ausbildung und Arbeit der Fokus von der Alimentierung hin zu der Aktivierung verschoben werden. Im Sinne des aktivierenden Sozialstaates können marktinkonforme Vermittlungs- oder Arbeitshemmnisse zu einem System der Alimentierung führen, dessen Ausgestaltung die berufliche Selbstverwirklichung weitestgehend unmöglich macht.
In der Bundesrepublik leben knapp sieben Millionen Menschen mit schwerer Behinderung (Stand 2009), also einem diagnostizierten Grad der Behinderung von mindestens 50. Den Grad der Behinderung stellen die Versorgungsämter fest. Von den knapp sieben Millionen Menschen sind etwas mehr als drei Millionen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65, davon sind wiederum 331.000 Menschen erwerbslos, was einer Quote von 14,5% entspricht (vgl. IAW 2011, S. 6ff). Es gilt aber als sicher, dass die "versteckte" Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung wesentlich höher ist (vgl. Pfahl & Powell, 2010). Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Migrationshintergrund lag Anfang 2012 bei 15%, die der Deutschen bei 6,7% und gesamt bei 7,3% (Bundesgentur für Arbeit, 2012, S. 38). Diese Zahlen verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und definierten sozialen Schwächen.
Im Folgenden werden verschiedene zielgruppenorientierte Arbeitsmarktprogramme skizziert, die diesen Zahlen entgegen wirken sollen.
Im Zuge der Debatten um das "Normalisierungsprinzip" in den USA Ende der 1970er Jahre wurde das "Supported Employment" entwickelt und 1984 in den USA verankert (vgl. Bungart, 2010). In der BRD wurde mit dem Artikel 38A, SGB IX 2009 die Maßnahme unterstützte Beschäftigung[94] als aktive, arbeitsmarktpolitische Leistung gesetzlich verankert. Im Gegensatz zu dem Konzept des "Supported Employment", das umfangreiche, individuelle Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung zur erfolgreichen Arbeitsaufnahme und -etablierung auf dem 1. Arbeitsmarkt vorsieht, ist die Maßnahme nach §38A SGB IX aber weniger umfassend und (u.a. zeitlich) tief wirkend. Das Konzept sieht vor, dass die Elemente Vorbereitung, Akquisition, Job Coaching, Vermittlung und Stabilisierung aufeinander aufbauen und gleichzeitig - auch mit der Möglichkeit des Überspringens - ineinander greifen. Dabei wird die unterstütze Beschäftigung so lange durchgeführt, wie erforderlich (vgl. Bungert, 2010). Das ist der erste große Unterschied zu der gesetzlichen Maßnahme, die nur maximal einen Leistungszeitraum von drei Jahre vorsieht. Ein zweiter Unterschied ist der, dass das Konzept davon ausgeht, dass alle Menschen in jedem Fall in dem 1. Arbeitsmarkt etablierbar sind und damit Sondersysteme wie die Werkstätten für Menschen mit Behinderung überflüssig sind. Damit ist die Maßnahme im SGB IX ein weitere "Testmöglichkeit auf Arbeitsmarkttauglichkeit", weniger ein grundsätzliches Recht auf den 1. Arbeitsmarkt. Das theoretische Konzept geht im Bedarfsfall von einer arbeitslebenslangen Unterstützung aus
Nach §38a SGB IX können Menschen mit Behinderung die Maßnahme "Unterstützte Beschäftigung" in Anspruch nehmen, die seit 2009 eine Schnittstelle zwischen dem 1. Arbeitsmarkt und den Werkstätten für Menschen mit Behinderung für diesen Personenkreis darstellt. Das Konzept umfasst folgende Merkmale:
-
"Unterstützte Beschäftigung ist ein Konzept für alle Menschen mit Behinderung unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung und dem Leistungsvermögen, also auch für Menschen mit erheblichen Leistungseinschränkungen.
-
Unterstützte Beschäftigung findet immer in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes statt.
-
Ausgangspunkt im Konzept Unterstützte Beschäftigung ist der behinderte Mensch, seine Fähigkeiten, seine Interessen und seine Potentiale. Auf dieser Basis wird ein Arbeitsplatz gesucht und gegebenenfalls angepasst.
-
Unterstützte Beschäftigung bezieht die Vorbereitung in der Schule ein, um erste betriebliche Erfahrungen und dort entwickelte Fähigkeiten und Fertigkeiten nahtlos für den Übergang von der Schule in den Beruf nutzen zu können.
-
Unterstützte Beschäftigung bedeutet die Unterstützung nach dem individuellen Bedarf, um eine betriebliche Beschäftigung zu ermöglichen und langfristig zu sichern. Sie kann die Vorbereitung, die Qualifizierung, die Stabilisierung und auch die dauerhafte Unterstützung des behinderten Menschen umfassen.
-
Unterstützte Beschäftigung führt nur dann zur umfassenden Teilhabe, wenn die Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit in ihren Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Unterstützte Beschäftigung bezieht sich somit auch auf das Konzept der Sozialraumorientierung[95].
-
Unterstützte Beschäftigung fördert die Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeiten und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von Menschen mit Behinderung" (Bungert, 2010).
Das Konzept sieht also eine hochgradig individuelle und zeitlich ungebundene Unterstützung vor, die eine inklusive Herangehensweise markiert. Eine praktische Frage aber resultiert aus dem Verhältnis Unterstützung und Mitarbeit des Assistenten.
Das Arbeitsmarktprogramm Job 4000 ist eine bundesweite seit 2007 und bis Ende 2013 befristete Maßnahme der Vermittlung und Bereitstellung von Arbeit für Menschen mit Behinderung. Das Programm fördert entweder Arbeitgeber, sofern sie einen Menschen mit Behinderung und ohne Ausbildung beschäftigen. Oder es können Ausbildungsplätze im Betrieb gefördert werden oder auch, v.a. junge Menschen mit Behinderung, durch die Integrationsfachdienste, mit bis zu 250€ pro Unterstützungsfall gefördert werden. Zudem sollen insbesondere Menschen unterstützt werden, die "besonders" (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010) benachteiligt sind, wie "schwerbehinderte Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung sowie behinderte Schulabgänger (vgl. ebd.).
Der Vorgänger des o.g. Programms ist das Arbeitsmarktprogramm "Job - Jobs ohne Barrieren", dass seit 2004 existiert und das Programm "Job 4000" subsumiert. Ursprünglich ausgelegt als Förderung der "Ausbildung behinderter Jugendlicher, Verbesserung der Beschäftigungschancen schwerbehinderter Menschen, insbesondere in kleinen und mittelständischen Betrieben und Stärkung der betrieblichen Prävention" (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010) greift das Programm breit die Problemlage bei der Vermittlung behinderter Menschen auf, bleibt aber quantitativ auf niedrigem Niveau, da das ausgesprochene Ziel von Job 4000 beispielsweise die Schaffung von 1000 neuen Arbeitsplätzen und 500 betrieblichen Ausbildungsplätzen vorsieht.
Die "Initiative Inklusion" des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde für den Zeitraum 2011 bis 2018 als Arbeitsmarktprogramm für schwerbehinderte Menschen aufgelegt. Insbesondere junge Menschen, die vor dem Übergang Schule zu Beruf stehen, können durch Bundesmittel gefördert werden. Außerdem sollen mindestens 1300 neue Ausbildungsstellen auf dem 1. Arbeitsmarkt entstehen. Das BMAS sieht insgesamt eine Fördersumme von 100 Millionen Euro vor, die in Abstimmung mit den zuständigen Länderministerien an Träger und Betriebe fließen können. Es werden drei Hauptziele in dem Programm definiert, zum ersten, dass schwerbehinderte Schüler über ihre beruflichen Möglichkeiten informiert und beraten und bei ihrem Übergang von der Schule in das Arbeitsleben unterstützt werden. Zum Zweiten soll der erfolgreiche Einstieg schwerbehinderter junger Menschen in eine betriebliche Berufsausbildung durch die Schaffung neuer Ausbildungsplätze unterstützt werden und drittens schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, vermehrt in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011).
Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland hat das Programm "Job Win Win" aufgelegt, das mit Mitteln aus dem Ausgleichfonds des BMAS gefördert wird. Das Programm verfolgt das Ziel, Arbeitgebernetzwerke aufzubauen, um regional Arbeitgeber von dem Nutzen und den positiven Erfahrungsmöglichkeiten zu überzeugen, wenn sie Menschen mit Behinderung beschäftigen. Das Programm zielt also nicht unmittelbar auf die Arbeitsförderung oder - vermittlung ab, sondern beginnt einen Schritt davor, indem aufgeklärt, sensibilisiert und beraten wird. Dazu werden Mentoren gesucht, die in regionalen Kleingruppen agieren und Arbeitgebernetzwerke aufbauen, letztlich mit dem Ziel, mehr Arbeitgeber zu Einstellungen von Menschen mit Behinderung zu bewegen (vgl. auch http://www.job-win-win.de).
Das Job Budget beschrieb eine bundesweite Modellmaßnahme in der aktiven Arbeitsmarkpolitik, die individuell und federführend durch die örtlichen Integrationsfachdienste und Beratungsstellen wirken sollte. Das Projekt lief in 2011 aus, der Erfolg quantitativ und qualitativ wurde bis dato jährlich evaluiert. Dabei steht eine Gesamtevaluation für den Zeitraum 2004 -2011 noch aus. Im Gegensatz zu Zielen anderer behindertenspezifischer Arbeitsmarktprogramme basiert das Job Budget auf einer freiwilligen und individuell auslegbaren Vermittlung und Begleitung in die Integration auf den Arbeitsmarkt, da der Betroffene "sein" persönliches Budget (§17, SGB IX) dafür nutzt, Informationen, Begleitung und Unterstützung für Praktika, Probezeiten und Übergangszeiten vom 3. zum 1. Arbeitsmarkt zu erhalten. Ein "Job Coach" begleitet dann die Person, stellt Kontakte her und vermittelt und berät insbesondere zwischen Werkstätten für behinderte Menschen und Betrieben des 1. Arbeitsmarktes.
Die Agentur für Arbeit kann Instrumente der Weiterbildung aus den Rechtskreisen SGB III und IX für Menschen mit Behinderung nutzen. Zunächst aber werden arbeitslose Menschen mit Behinderung "eingestuft", indem sie in dem ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit vorstellig werden und eine "Eignungsfeststellung" bekommen. Erst danach folgt eine individuelle Beratung, die auch präventive und vermittelnde Weiterbildungen zur Folge haben kann. Je nach Eignung und Interesse können die berufliche Aus- und Weiterbildung, wie auch Trainings und Reha-Lehrgänge als zielführend angesehen werden (vgl. Agentur für Arbeit, 2008).
Zudem existieren viele (lokale) Arbeitsmarktprogramme, die sich den Themen Alter, Migration, Alleinerziehend und schlechten Ausbildungsstand widmen. Hier kann beispielhaft das Arbeitsmarktprogramm des Job Centers Kiel von 2012 genannt werden. Darin werden konzeptionell Schritte und Vorhaben beschrieben, die sich älteren Arbeitnehmern ("50 Plus"), ehemaligen Strafgefangenen ("Xenos"), Migranten und Alleinerziehenden zuwenden. Dabei kann sich jedes Job Center in Art und Weise, sowie konzeptionell autonom aufstellen, hat aber nur die festgeschriebenen Mittel zur Verfügung und unterliegt einem strengen Controlling (Jobcenter Kiel, 2012).
Mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, das 2009 in Kraft trat, wurde die "freie Förderung" zu Gunsten des "Vermittlungsbudgets" aufgegeben, das insbesondere zur Folge hat, dass die Instrumente "Job Rotation" und "Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen" wegfallen. Aber auch die individuelle und unbürokratische Aktivierung durch Instrumente wie Leistungen "zur Unterstützung der Beratung und Vermittlung" und "Maßnahmen der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen soll dadurch gefördert werden" (vgl. §45, SGB III).
Die Steuerungspraxis der Bundesagentur für Arbeit lässt den inklusiven Gedanken an vielen Stellen nicht zu: seit den Hartz-Gesetzen wurde die "wirkungsorientierte und wirtschaftliche" (Schütz, 2009, S. 168) Arbeitsweise in der BA noch einmal hervor gehoben. Dafür wurden Steuerungselemente eingeführt, die betriebswirtschaftliche Vorgaben, insbesondere aus Effizienzgesichtspunkten, erfüllen: - Zielvereinbarungen, Controlling, Vorabselektion der "Kunden", hohe fachliche Spezialisierung, bundeseinheitliche und zentrale EDV-gestützte Prozessstrukturen, Matching, "Kennziffermentalität", Fokus auf die arbeitgeberorientierte Vermittlung (Sowa & Theuer, 2010, S. 6) und Organisationstrukturen, die nur einseitige (und häufig v.a. quantitative) Zielsysteme zulassen (Schütz, 2009, S. 174). Aus dieser Entwicklung resultiert v.a. der Effizienzgedanke. Dieser bemisst sich am deutlichsten durch die passgenaue Vermittlung der gut vermittelbaren Kunden, d.h. zwei Gruppierungen ziehen Vorteile aus diesem Prozess. Der Arbeitgeber wird bevorzugt behandelt, Sowa und Theuer sprechen von einer "Subjektivierung" der Arbeitgeber, während die Arbeitnehmer tendenziell zum "Produkt", also "objektiviert" werden (Sowa & Theuer, 2010, S. 9f). "Kunden", die als "Marktkunden" eingestuft wurden, werden ebenso am ehesten den "Matching-Vorgaben" gerecht - also dem schnellen Reagieren auf Angebot und Nachfrage. Kennziffern, starke Arbeitsteilung und standardisierte Verfahren in der Vermittlung runden das Bild der Effizienzorientierung ab, wobei zwei Kriterien den "Erfolg" der BA mittlerweile hauptsächlich ausmachen: das passgenaue Verwenden der verfügbaren Mittel und des Erfüllen individuellen Rechts, ohne aber dabei die qualitative und nachhaltige "Brille" aufzusetzen.
Dabei stehen der Agentur für Arbeit -theoretisch- die quantitativ meisten und qualitativ stärksten Instrumente zur Umsetzung inklusiver Vorgaben zur Verfügung: insbesondere für Menschen mit Behinderung können innerhalb des SGB IX und III, als auch SGB II Rechtsgrundlagen genutzt werden. Das betrifft im Detail "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft" (Agentur für Arbeit 2008, S. 8). Flankierend dazu arbeitet die BA mit Integrationsfachdiensten und Integrationsämtern zusammen. Integrationsfachdienste sind darauf spezialisiert, Menschen mit Behinderung individuell und prozesshaft (beispielsweise durch Jobcoaching und unterstützte Beschäftigung) in Arbeit zu vermitteln. Durch Beratung und Schulungen von Arbeitgebern in privaten und öffentlichen Betrieben liegt der Fokus der Arbeitsvermittlungspolitik des Integrationsamtes wiederum auf Arbeitgeberseite. Auf der anderen Seite werden diese sozialpolitischen Prämissen, die auch den Gedanken der Inklusion durchaus zulassen, durch die Praxis an vielen Stellen konterkariert: "erstens [hat] die veränderte Vermittlungslogik [...], zur Folge, dass der arbeitssuchende Mensch nicht als Individuum wahrgenommen wird. [...] Zweitens kommt es zu einer verstärkten Selektion der Arbeitslosen in `markt-konforme` und weniger `markt-konforme` Menschen" (Sowa & Theuer, 2010, S. 11). Daraus resultieren differente Zielsysteme und -richtungen, die sich teilweise gegenseitig ausschließen: zentrale vs. dezentrale Arbeitslogik, Standardisierung vs. individuelles Vorgehen, hohe fachliche Aufteilung vs. "Beratung aus einer Hand", Objektorientierung vs. Subjektorientierung, wozu auch die Präselektion nach Gruppen (nach dem 1. Beratungsgespräch) und der quantitativer Zuordnung "verwertbarer" Leistungskriterien gehören. Schnelles Matching steht prozesshaften und nachhaltigem Vermitteln entgegen und der "Kennziffernlogik", die vorschreibt, eine möglichst hohe Quote von Vermittlungen (zunächst: Eingliederungsvereinbarung) und Aktivierungsmaßnahmen zu erreichen, ohne dabei die Qualität und damit den nachhaltigen Erfolg der Maßnahme oder Vermittlung zu bewerten[96].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für den Bereich Arbeitsvermittlung nach inklusivem Ansatz gelten müsste, dass die Agentur für Arbeit und weitere arbeitsmarktrelevante Vermittler ihre Betreuungs- und Vermittlungsbemühungen so organisieren müssen, dass die jeweils bestmöglichste Chance des "Kunden" ergriffen werden kann. Es kann dabei ein Minimum definiert werden, aber kein Maximum. Individuelle Beratung, bestmögliche Vermittlung unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten und ein nicht "etikettierendes Vorgehen" sind dabei Mindestmaßstäbe. Aber in diesem Kontext gilt auch: ein sozialpolitischer Anspruch auf qualitative Vermittlung und Verbleib mit dazugehöriger, prozessualer Unterstützung auf den 1. Arbeitsmarkt besteht, ein Anspruch auf jeden beliebigen Job nicht.
Das bedingungslose Grundeinkommen wird von den Befürwortern als Zugang zur vollen gesellschaftlichen Teilhabe gewertet durch den Ausschluss von finanzieller Exklusion. Das bedingungslose Grundeinkommen definiert sich wie folgt: es stellt einen "individuellen Rechtsanspruch eines jeden einzelnen Menschen" dar, es soll "die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen", es bedarf "keine[r] sozialadministrative[n] Bedürftigkeitsprüfung", und es stellt "keinen Zwang zur Arbeit oder einen Zwang zu einer anderen Gegenleistung" dar (Netzwerk Grundeinkommen, 2008). Kritiker sprechen von Lohnsubventionen, die tatsächliche Qualifikation und Produktion würde nachrangig werden. Erwerbslose würden "auf Kosten der Lohnarbeitenden" (Reitter, 2008) leben und damit wäre der Anreiz zu arbeiten produktivitätsschmälernd und wirtschaftliche riskant. Letztlich ist die Debatte normativ aufgeladen, da es um die grundsätzliche Unterscheidung von Gerechtigkeit geht: einer Leistungsgerechtigkeit im Gegensatz zu einem Gleichheitsansatz innerhalb einer Verteilungsgerechtigkeit. Vorherrschende marktwirtschaftliche Prinzipien, insbesondere die der Akkumulation, verhindern konkrete Ansätze eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dennoch ist festzuhalten, dass nach inklusiven Aspekten ein grundsätzliches Einkommen unabhängig individueller Eigenschaften teilhabefördernd ist, da dieses "eine ökonomische Absicherung gesellschaftlicher Teilhabe auf der Ebene des Individuums herstellt" (Blaschke, 2010, S. 12).
Die Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen sind zentrale Akteure in dem Angebot sozialer Dienstleistungen. Häufig sind sie gemeinnützig tätig, da sie dem Gemeinwohl und damit der Wohlfahrt dienen. Damit sind sie ein wichtiger sozialpolitischer und sozial kompensierender Faktor, der in der Gesellschaft eine wichtige integrierende und ausgleichende Rolle einnimmt. Die Spanne der Dienstleistungen ist groß: während die sechs großen Wohlfahrtsverbände viele eigene Dienste anbieten, aber eben auch als Interessenvertreter und sozial- und gesellschaftspolitische Sprecher auftreten, sind soziale Einrichtungen und Vereine häufig "nur" mit Dienstleistungen direkt vor Ort und mit "ihrer" Zielgruppe tätig. Die beiden häufigsten Formen sind freie Träger in Vereinsstruktur, wie auch als gemeinnützige GmbH und dazu kommen staatliche Träger oder Gesellschaften. Über die fachliche Qualifizierung, Sensibilisierungs-, Stadtteil,- Selbsthilfe- und Öffentlichkeitsarbeit, meist in Bezug zu einer bestimmten Klientel, über Dienstleistungen im Kinder-, Jugend-, Behinderten-, und Altenbereich bis hin zu medizinischen, erzieherischen und therapeutischen Angeboten finden eine Vielzahl an sozialen Dienstleistungen durch die Einrichtungen statt. Damit sind alle Träger auch mit dem Inklusionsgedanken konfrontiert, da sie eine Schnittstelle zwischen den sozialen Anliegen der Menschen und der gesetzlichen Anspruchsstruktur bilden. Sozialpolitisch relevant sind dabei vor allem die Wohlfahrtsverbände, da die meisten sozialen Einrichtungen von ihnen sozialpolitisch vertreten werden.
Grundsätzlich steht mit der Inklusionsauffassung den Wohlfahrtsverbänden einerseits großes Innovationspotential zur Verfügung, andererseits stehen die heutigen strukturellen und wertebehafteten Arbeitsweisen in den Wohlfahrtsverbänden im (z.T.) großen Widerspruch zum Inklusionsgedanken. Die Wohlfahrtsverbände mit ihren Landes- und Ortsverbänden, kooptierten Einrichtungen und von ihnen vertretenen sozialen Vereinen und gemeinnützige Träger arbeiten an vielen Stellen in erster Linie noch advokatorisch und stellvertretend in sozialpolitischer und pädagogischer Hinsicht für marginalisierte Gruppen. Die grundsätzliche Frage lautet also:
"Korrekterweise [im Inklusionssinne] (und paradoxerweise) müssten also die Verbände die Betroffenen zu selbstbewussten Kontrahenten heranbilden - aber ob sie das wirklich können und wollen?" (Fischer, 2012). Es existieren differenzierte und teils disparate Arbeits- und Wirkungsweisen in den einzelnen Wohlfahrtsverbänden, die im Inklusionssinne aufeinander abgestimmt und harmonisiert werden müssten: das betrifft insbesondere die strukturelle Frage. Wohlfahrtsverbände arbeiten - gerade auf der Bundes- und Landesebene - sozialpolitisch und gesellschaftlich (mit-)gestaltend. Sie verstehen sich als Interessenvertretungen, fachpolitische Sprecher und Kommunikatoren für ihre sozialen Anliegen - freilich mit unterschiedlichem Fokus und historischer Herkunft - und für die Menschen, die diese sozialen Anliegen betreffen. Dabei liegt die Priorität auf "ihrer" vertretenen Klientel, aber alle sechs Wohlfahrtsverbände sehen sich (zu Recht) auch als gesellschaftspolitische Akteure für den gesamten sozialen Bereich; sie nehmen also eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahr und nehmen innerverbandliche Diskurse und Entwicklungen regelmäßig in Stellungnahmen, Positionspapieren und Anmerkungen in die Bundesund Landespolitik mit auf.
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) schreibt in ihrem Leitbild, dass ihr "Handeln durch die Werte des "freiheitlichdemokratischen Sozialismus: Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit" geprägt ist (AWO, 1998). Sie sind demnach stark von dem Gedanken einer freiheitlichen Arbeiterschaft geprägt. Das Deutsche Rote Kreutz (DRK) hingegen hat seine Wurzeln in der Versorgung leidgeprägter Menschen aus dem Krieg. Bis heute liegt der Fokus auf der medizinischen Versorgung kranker und verletzter Menschen; daraus resultierte auch ein klarer sozialer Auftrag: Die Bewegung des (Internationalen) Roten Kreuzes "ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen und der Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern" (Deutsches Rotes Kreuz, 1965). Der Paritätische kommt von dem Gleichheitsgedanken unter den Menschen:
"Getragen von der Idee der Parität, d. h. der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, getragen von den Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt, will der PARITÄTISCHE Mittler sein zwischen Generationen und zwischen Weltanschauungen, zwischen Ansätzen und Methoden sozialer Arbeit, auch zwischen seinen Mitgliedsorganisationen" (Der Paritätische, 2012).
Er versteht sich als Ausgleichsorganisation: "der PARITÄTISCHE nimmt wahr, dass unsere Gesellschaft trotz ihres Reichtums auch soziale Notlagen erzeugt. Sie entstehen durch biografische Verstrickungen, strukturelle Benachteiligungen, ökonomische Interessen sowie durch soziale und technologische Wandlungsprozesse" (ebd.). Die hier genannten drei Wohlfahrtsverbände sind konfessionell unabhängig, im Gegensatz zu den hier weiter aufgeführten Verbänden der drei größten Kirchen Deutschlands: Die Diakonie der evangelischen Kirche legt genau wie die katholische Kirche mit dem Caritas Verband Wert auf den Hilfe- und Fürsorgegedanken, der aus dem Glauben zu Gott entstehe: "Gott will und liebt jeden Menschen, unabhängig davon, was er ist und was er kann" (Diakonie, 1997), oder "ihre Wurzeln hat sie in der Liebe Jesu zu den Menschen" (Caritas, o.A.). Diese religiöse Begründung für Wohltätigkeit und Humanität ist im Inklusionssinne nur unzureichend valide, da diesem starke Annahmen von Selbstbestimmung, persönlicher Entwicklungsautonomie und Chancengleichheit zu Grunde liegen. Faktoren wie Barmherzigkeit und Fürsorge haben ein fremdbestimmtes und altruistisches Element, das dem "Hilfesystem" dem Vorrang vor dem "Patienten" oder "Hilfebedürftigen" gibt, während Inklusion den sozialen Anliegen der Menschen und sich daran anpassende (Befähigungs-)Systeme propagiert. Dazu kommt, dass die Herstellung von Chancengleichheit im - freilich bisher noch nicht gesetzlich, wie gewohnheitsrechtlich verankerten - Menschenrechtssinne rechtlich objektivierbar ist, das von dem Fürsorgeprinzip der Kirchen nicht gesagt werden kann. Auch die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, als kleinste Wohlfahrtsverband[97], rekrutiert sein Arbeitsideal "Zedaka[98]" aus einer Vorstellung der jüdischen Wohltätigkeit, die sich aber zu christlichen Mildtätigkeits- und Barmherzigkeitsgedanken abgrenzt: "Zedaka ist keine Wohltätigkeit im christlichen Sinne, keine Mildtätigkeit, kein Almosengeben, sondern ein Gebot zum Schutz der Benachteiligten - mehr noch, sie ist eine Mitzwa[99], deren Befolgung sowohl dem Gebenden als auch dem Empfänger zugute kommt" (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, 2011).
Die Wohlfahrtsverbände haben eine Vielzahl an Einrichtungen und -formen, entweder im "eigenen Haus", das betrifft insbesondere die kirchlichen Verbände, oder sie fungieren als Dachverband vieler unterschiedlicher sozialer Einrichtungen. Das betrifft insbesondere den Paritätischen. Alle Verbände organisieren oder begleiten Einrichtungen aus allen Bereichen der sozialen Hilfen, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die kirchlichen Verbände sind traditionell stark im Bereich der Gesundheitsfürsorge, Alten-, Familien- und Behindertenpflege tätig. Dazu kommen private, konfessionelle Schulen und Kindertagesstätten. Die AWO bietet auch alle Einrichtungsformen, hat aber einen traditionellen Fokus auf die Jugendhilfe, das DRK auf die Gesundheitsver- und vorsorge. Die Strukturen der Einrichtungen sind nicht im Allgemeinen (leicht) zu benennen, da die Vielzahl, Qualität und Quantität der Einrichtungen stark variiert, und von im Inklusionssinne modernen, ambulanten, sozialräumlichen Wohnquartieren bis hin zu "stationären Sonderwelten" (Theunissen, 2011) alle Formen der sozialen Hilfen in 2012 in Deutschland existieren. Analog dazu kann das auch für die anderen sozialen Bereiche genannt werden. Dieser Widerspruch, traditionelle und gewachsene soziale Dienstleistungsstrukturen der Wohlfahrtsverbände, inklusive finanzieller, gesetzlicher und praktischer Routinen, und aktueller Auftrag der Inklusion, Struktur, Herangehensweise und letztlich das "Bild" der eigenen sozialen Arbeit zu überdenken, birgt große Chancen und auch Herausforderungen.
Das spricht die zweite große Frage, die der Haltung und des Selbstverständnisses der jeweiligen Wohlfahrtseinrichtung, an. Wie schon angedeutet birgt der Inklusionsgedanke Ansätze, die in den Leitbildern, Arbeitsweisen und Köpfen der Mitarbeitenden in den Wohlfahrtsverbänden große Offenheit, Auseinandersetzung und Neuausrichtung verlangt. Gewachsene Leitbilder und kulturelle, soziale Legitimationen und Selbstverständnisse in den Wohlfahrtsverbänden stehen z.T. im erheblichen Wiederspruch zu dem Inklusionsgedanken. Es müsste eine strukturelle Offenheit und Veränderungswille von "oben", wie von "unten" in den Verbänden für den Gedanken der Inklusion entstehen. Von oben per Überzeugung und Beschluss, seine Verbandswerte auf den Inklusionsgedanken hin zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten; von unten per Weiterbildung, Qualifizierung und Kommunikation mit den Klienten, wie auch der Mitarbeitenden. Prinzipen wie die Systemlogik (diagnostizierte Hilfebedürftigkeit erzeugt sozialen Anspruch), wie auch (traditionelle) Arbeitsauffassungen mit starken Elementen der Fürsorge, passiver Leistungserbringung, "Perspektivenstarre" und "professioneller" Fremdbestimmung ("ich sage dir was gut für dich ist") müssten im Inklusionssinne konsequent überdacht und verändert werden.
Die sechs großen Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie, DRK, AWO, ZWST und der Paritätische haben sich alle zu dem Leitbild der Inklusion grundsätzlich positiv positioniert. Auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge hat in einer Reihe Schriften sich positiv und unterstützend zu dem Thema Inklusion positioniert [100] . Konkrete Vorstellungen der Umsetzung in der Verbandsphilosophie, den Strukturen und den Arbeitsauffassungen und -weisen fallen aber unterschiedlich aus. Während sich die katholische Kirche eher vorsichtig dem Gedanken öffnet, deklarieren der Paritätische, das DRK, die Diakonie, die ZWST und die AWO uneingeschränkt Inklusion als gesellschafts- und sozialpolitisches Ziel, zu dessen "Umsetzer" sie sich selbst auch dazu zählen. Das Beispiel DRK verdeutlicht dies: der "Kern des Roten Kreuzes ist unsere Fähigkeit, uns selbst aufnahmefähig und aufnahmewillig für von Ausgrenzung bedrohte Menschen zu machen und die Gesellschaft hierbei zu unterstützen" (Deutsches Rotes Kreuz, 2011). Das steht in dem Grundsatzprogramm des DRK für die Arbeit der nächsten acht Jahre. Auch die "AWO tritt [...] verstärkt für die Umsetzung der Leitidee der Inklusion ein. Wir sind der Auffassung [...], dass Inklusion nur in einer Gesellschaft möglich ist, in der die Menschen sozial gesichert leben und arbeiten können. Hierfür müssen endlich die rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen geschaffen werden" (Arbeiterwohlfahrt, 2012), und der Paritätische formuliert in einem Positionspapier zur inklusiven Schule: "Wir sagen JA zur inklusiven schulischen Bildung" (Der Paritätische, 2010, S. 3) und begründet das vorbehaltslos mit der Unterzeichnung der UN-Konvention von 2009. Zu beachten ist aber, dass diese Positionspapiere bis auf das des DRK einen Aufforderungscharakter an Politik, Gesellschaft und Systeme haben, und weniger den eigenen Verband selbst in seinem Handeln ansprechen. Zudem wird der Horizont inklusiver Strukturen unterschiedlich gezogen: der Paritätische bezieht sich ausschließlich auf das Schulsystem, die Diakonie und die ZWST nehmen explizit den gesamten sozialen Bereich mit auf, wenn beispielsweise der ZWST schreibt: "Soziale Inklusion geht über die formale Gleichstellung hinaus und hegt einen ganzheitlichen Anspruch: die Gesellschaft und die entsprechenden Subsysteme - beispielsweise das Bildungssystem - so zu gestalten, dass alle Menschen sich darin selbstverständlich zugehörig fühlen" (ZWST, 2010). Die Caritas hält sich am stärksten zurück und schreibt zu dem Bereich der Wohlfahrtspflege:
"Die selbstbestimmte Teilhabe des Menschen begründet sich aus seiner Würde als Mensch, denn der Mensch ist ein autonomes Wesen, das zur Selbstbestimmung fähig ist und durch Gott zur Freiheit und Verantwortung berufen wurde. Er ist jedoch nicht nur ein vernunftbegabtes und autonomes Subjekt, sondern ein bedürftiges, verletzliches und sterbliches Wesen, das auch auf Fürsorge angewiesen ist. Diese Seite des Menschen stand für den Sozialstaat, die Wohlfahrts-pflege und das berufliche Hilfesystem bisher im Vordergrund. Die Prinzipien der Katholischen Soziallehre betonen das Selbstbestimmungsrecht und die Förderung vorhandener Ressourcen" (Deutscher Caritasverband, 2011).
Und bezogen auf das Schulsystem steht in einer Pressmitteilung der Bischofskonferenz: "Deshalb ist es besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass alle Menschen freien Zugang zu Bildungsinstitutionen haben. Bildungsgerechtigkeit verlangt nach Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Annehmbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Bildungseinrichtungen für alle Menschen" um dann zwei Seiten weiter zu sagen: " für jede Schülerin und jeden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist abzuwägen, welche Schule die besten Chancen der Förderung bietet. Die Möglichkeit, eine Förderschule zu besuchen, muss auch in Zukunft gewährleistet bleiben" (Caritas, 2012). Diese inkonsequente Sichtweise spiegelt die Beobachtung, dass Inklusion als Begriff schnell und häufig öffentlichkeitswirksam verwendet wird, tatsächliche Inhalte aber verhalten umgesetzt werden. Dennoch sind alle Wohlfahrtsverbände in den Diskursen um Inklusion, die Entwicklung inklusiver Praktiken und der kritischen (Selbst-)reflexion bemüht und beteiligt.
Wie wirkt sich der Inklusionsanspruch auf das strategische Management in Organisationen und sozialen Einrichtungen aus? Wie viel Innovationspotential steckt in der Ausrichtung und wie passt eine inklusive Leitlinie zu marktwirtschaftlichen Behauptungstendenzen in der "sozialen Branche"? Der sehr interessante Satz: "Inklusion postuliert einen Wandel von marktliberalen Dienstleistungsunternehmen hin zu Netzwerkern in lokalen Verantwortungsgemeinschaften" (Wasel, 2012), da nun sozialraumorientiert, ambulant und zielgruppenlosgelöster gearbeitet werden soll, formuliert eine neue Ausrichtung. Damit werden "effiziente und effektive Strukturen" im Sinne der Refinanzierung aufgegeben und genau das begreifen nicht wenige als "Angriff auf die Corporate Identity" (ebd. S. 85). Damit bewegen sich Sozialunternehmen in einem Dilemma, das schwer lösbar scheint. Kostendruck und in diesem Kontext mühsam entwickelte, effizient ausgearbeitete Strukturen stehen im scheinbaren Widerspruch zur Inklusion, insbesondere bei Einrichtungen der Behindertenhilfe[101]. Dabei ist es nicht eine Frage, ob Inklusion in der eigenen Arbeit adaptiert wird, da sie rechtlich und gesellschaftlich immer mehr "Programm" sein wird, sondern es ist die Frage der methodischen Umsetzung, insbesondere in Bezug zu der finanziellen und rechtlichen Planbarkeit. Damit sind die Pole der Diskussion auch benannt: Inklusion mit ihren "Aufforderungen" und Potentialen, wie das sozialräumliche Arbeiten (vgl. Kap. 6.2.1.2) bietet Neuausrichtungen für Sozialunternehmen v.a. in Bezug auf seine Imagekraft in Bezug auf die Entwicklung der (lokalen) Gesellschaft insgesamt. Innovative Sozialunternehmen positionieren sich als Träger, der gesellschaftliche wichtige Entwicklungen begleitet und positiv stärkt und sich damit als "Adresse Nr. 1" postulieren. Andererseits stehen "alte" Denk- und Leistungsstrukturen im Betrieb, wie auch in dem finanziellen, sozialpolitischen "Overhead" dem gegenüber. Nach innen: es bedarf einer kritischen Reflexion der Organisationsstruktur insgesamt (vgl. ebd. S. 88) und einen Umgang mit dem Wissen, dass Widerstände hoch funktional und dysfunktional gleichzeitig sind, da einerseits ein langsam und etabliertes System belastbar ist, aber andererseits eben diese Belastbarkeit auch "Anpassungsprozesse" verhindert (ebd. S. 88). Eine "Umentwicklung" muss also auf vielen Ebenen stattfinden, mit klarer Zielsetzung im Bereich Personal, Qualitätsmanagement, Organisationsstrukturen und Fachlichkeiten. Und nach außen: sozialräumliche, kategorienlosgelöste, soziale Dienstleistungen brauchen finanzielle und rechtliche Sicherheiten, die Sozialpolitik und Verwaltung gewährleisten müssen. Dazu zählen Träger- und Sozialraumbudgets und ein sog. "Welfare-Mix", also der "sektorenübergreifende[r] Mix aus institutionellem und informellem, professionellem und nicht-professionellem bzw. bezahltem wie unbezahltem Handeln" (Thiel, 2007).
Das Konzept des Diversity Management hat einen unternehmerischen und einen bürgerrechtlichen Ursprung. Unternehmerisch deshalb, da die Intention der aus den USA stammenden Strategie den Wert auf die Frage legt, wie die Unternehmensführung eines Betriebes mit ihrer vielfältigen Belegschaft umgeht oder umgehen könnte. Eine weitere Intention besteht darin, dass Vielfalt und Unterschiedlichkeit in der Belegschaft betriebswirtschaftlich genutzt werden könnten und sollten. Aber schon vor dem ökonomischen Gebrauch wurden auf bürgerrechtlicher Ebene Konzepte zur Nutzung und Anerkennung von Unterschiedlichkeit diskutiert, zum Beispiel in der 1913 gegründeten NGO Anti-Defamation League (Kugler, 2012). Ausgehend also von der Herausforderung Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Eigenschaften positiv in der Unternehmenskultur einerseits zu akzeptieren und andererseits diese auch zu nutzen, etabliert sich Diversity Management als zukunftsweisendes Konzept mit möglichen Win-Win-Effekten: Minoritäten in der Belegschaft oder die bewusste Einstellung von Menschen einer Minorität und die daraus resultierenden unterschiedlichen Eigenschaften bei den Mitarbeitern werden für den Betrieb genutzt und die Mitarbeiter selbst werden mehr wertgeschätzt, während sich dadurch die Akzeptanz der Anerkennung von Unterschieden nach innen wie außen erhöht. "Die Ziele von Diversity Management sind es, eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen zu erreichen, soziale Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern und die Chancengleichheit zu verbessern. Dabei steht aber nicht die Minderheit selbst im Fokus, sondern die Gesamtheit der Mitarbeiter in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten" (Akademie für Inklusion, 2012). Eine Unternehmensstrategie, die dieses Konzept umsetzt, erfährt folgende mögliche Gewinne:
Abbildung 10: Gewinne durch Diversity Management in Anlehnung an Paireder & Niehaus (2005)
|
Ökonomischer Gewinn: |
Moralischer / kultureller Gewinn |
|
Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, sind seltener krank, weniger demotiviert und dadurch leistungsstärker, sowie eher zu Mehrarbeit bereit. |
Einhaltung von gesetzlichen Grundlagen, insbesondere des Diskriminierungsverbots. |
|
Personalanwerbung kann offener und leichter stattfinden, da der Pool an Bewerbern und Talenten größer wird. |
Imagegewinn, durch das (Vor-)leben einer lebendigen Unternehmenskultur mit akzeptierenden und fördernden Anerkennungsprinzipien. Dies wirkt sich nach innen wie außen aus. |
|
Marketingerfolg: meint, dass unterschiedliche Mitarbeiter mit differenzierten Eigenschaften und Blickwinkeln besser auf Kunden eingehen kann. Eine verstandene "Kaufkultur" bestimmter Kunden kann eher nachvollzogen und demnach genutzt werden. Zudem ist ein Imagegewinn zu verzeichnen, der sich auf die Kaufkultur möglicher Kunden auswirkt. |
Diversity Management bildet gesellschaftliche Realitäten in der Belegschaft ab. Im Kontrast zu der häufigen beobachtbaren Praxis, möglichst homogene Belegschaften in Typus und Biografie zu halten, geht DM bewusst den Weg der Vielfalt um letztlich damit näher an der Realität (inklusiver der unterschiedlichen Kunden), den die Gesellschaft mit sich bringt, zu sein |
|
"Homogene Gruppen können zwar Probleme schneller lösen, Heterogenität in Teams [...] kann jedoch zu qualitativ verbesserten Lösungen führen (Paireder & Niehaus, 2005). |
"Social washing": dieser Begriff ist an vielen Stellen negativ geprägt, da er häufig unterstellt, soziale und mehr noch, gemeinnützige Aktionen einer Organisation werden nur zum Zweck des Imagebuildings betrieben. Dennoch beinhaltet der Begriff auch etwas moralisch weniger überhöhtes, da social washing, u.a. durch Diversity Management, die tatsächliche Kultur einer Branche oder der Dienstleitungen eines Betriebes verbessern kann. Social washing legt in diesem Fall Wert auf "washing" im positiven Sinne. Eine erhöhte Identifikation mit den Produkten und Dienstleistungen kann die Folge sein und das wird auch durch die vielen mittelständischen Betriebe, die beispielsweise mit ihrem Ortssitz verbunden sind, und deshalb auch überbetriebliche Aufgaben wahrnehmen, an vielen Stellen bewiesen. Imagebuilding ist dabei nur ein Aspekt, Verantwortung für die Menschen einer Region zu übernehmen ein anderer. |
|
Das Niveau der Kreativität und Innovation wird durch vielfältige Perspektiven erhöht. |
|
|
Die Flexibilität der Organisation / des Betriebes erhöht sich, da vielfältige Mitarbeiter besser auf Umweltbedingungen eingehen können und weniger Standardisierung notwendig ist, die Zeitverlust und hindernde Hierarchien in Entscheidungsprozessen mit sich bringen. |
DM erhöht die Verantwortungsbereitschaft nach innen und außen. Gesetzliche Grundlagen nicht nur einzuhalten, sondern bewusst zu leben und darüber hinaus zu übertreffen, bildet starke Identifikationen und damit Verantwortungsbereitschaften aus. |
Trotz dieser Argumente sind solche Strategien und die Umsetzung noch selten zu erleben. Das hat mehrere Gründe:
-
Bestehende Hierarchien sind häufig relativ starr, da sie Machtkonstellationen festigen. Macht ist eine menschlich starke Antriebskraft, die einen individuellen Blick auf Vielfalt und Teamarbeit und damit "Gleichordnung [102] ", verklärt. Es ist schlicht einfacher (und v.a. schneller) alleine zu entscheiden, als sich auf Augenhöhe mit anderen gleichberechtigt auszutauschen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Teamentscheidungen sind aber stabiler. Zudem wird Macht häufig mit Verantwortung verwechselt - Verantwortung kann auch in Teams wahrgenommen werden und letztlich sogar besser sichergestellt werden, wohingegen sich Macht schlecht in Teams abbilden lässt, somit begründet Verantwortung nicht automatisch Macht, aber Macht muss mindestens zwingend Verantwortung begründen - die in komplexen Zusammenhängen aber fast gar nicht alleine tragbar ist.
-
Der offene Blick auf Unterschiedlichkeit erfordert eine große Bereitschaft der (Selbst-)Reflexion, insbesondere auf den eigenen Umgang mit Vorurteilen, die im Management anfangen muss (Paireder & Niehaus, 2005, S. 8). Dies bedeutet für viele Mitarbeiter in Leitungspositionen einen schwierigen Weg, da die "Gefahr" besteht, Verhaltensmuster und Blickwinkel neu auszurichten oder ausrichten zu müssen. Diese sind aber häufig gefestigt und mögliche Korrekturen bedeuten in der Wahrnehmung vieler paradoxerweise eine Führungsschwäche.
-
Diversity Management erfordert das Einbeziehen aller in die Ausgestaltung der Unternehmenskultur. Diese erfordert einen hohen Grad an Organisation und die Bereitschaft komplexe Identifikations- und Lösungsstrategien zu entwickeln. Das übersteigt - einfach gesprochen - die Qualifizierung vieler Führungskräfte, die solch einen Prozess moderieren und verstetigen müssen.
Insgesamt bietet DM ein Konzept an, das weniger aus "gutmenschlichen" oder auch menschenrechtlichen Gründen entstanden ist, sondern viel einfacher zu sehen ist, da gesellschaftliche Trends und rechtliche Rahmenbedingungen DM mittel- bis langfristig unverzichtbar machen, wenn sicher auch noch in unbekannter Ausgestaltung. "The changing composition of the workforce, the influence of new values and lifestyles, a change in the way that business is conducted from a national to a global economy, and a trend away from hierarchical command and control models towards more decentralized team-based management" sind Gründe, die Harvey und Allard schon 1995 festhielten (Harvey & Allard, 1995). Auch eine konsequente Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in der Bundesrepublik fordert betriebliche Maßnahmen, die DM (ansatzweise) erfüllen kann.
Abbildung 11: Originäre und inklusive Sozialpolitik - Praktiken, eigene Darstellung, teils in Anlehnung an Hinz, 2012, S. 43
|
Originäre Sozialpolitik |
"Inklusive Sozialpolitik" |
|
Kapitel 7 - Praktische Unterstützersysteme |
|
|
Gesonderte Lebens-, Wohn- und Arbeitswelten |
Allgemeine Lebens-, Wohn- und Arbeitswelten, Community Living |
|
"Nebeneinander" von Unterstützersystemen |
Vernetzung von Unterstützersystemen |
|
Zentrale, geschlossene Leistungen |
Sozialraumorientierung und Dezentralität, teilweise pauschale Leistungen |
|
Kategorial, Bedürftigkeitsbezogen |
Non-Kategorial, Chancenbezogen |
|
Spezialisierte Pädagogik |
Allgemeine Pädagogik - individuelle Unterstützung, multiprofessionell |
|
Definierte Zielgruppen nach "Schwächen" |
Durchlässige Zielgruppen nach "Stärken" |
|
Leistung nach einmaliger oder seltener Diagnose und Prä- Selektion |
Prozessbegleitend |
Die Abbildung 11 zeigt die Unterschiede in die Praktiken der Unterstützersysteme auf, wobei den unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich ausgeprägte Herangehensweisen zugeordnet werden könnten. Auffällig ist im Vergleich der "definitorische" Charakter der o.g. Aspekte. Die linke Spalte setzt an vielen Stellen voraus, dass die Aspekte eingrenzend definiert werden müssen. Eine gesonderte Arbeitswelt muss genau als solche deklariert werden, wie geschlossene Leistungen nach Zielgruppen oder der "Fall" für die spezialisierte Pädagogik. Aspekte der rechten Spalte sind "freier": inklusive Herangehensweisen sind offener und damit insgesamt durchlässiger.
In den Diskussionen um die normativen Annahmen und die beobachtbaren Praktiken in den sozialen Unterstützerstrukturen wurde deutlich, dass zentrale Elemente der Inklusion bisher nicht oder nur marginal umgesetzt werden. Sozialraumbezug, Vernetzung, Multiprofessionalität und offene, durchlässige Systeme in den Anspruchsberechtigungen sind an vielen Stellen nach den Sozialgesetzbüchern nicht möglich und in der Praxis der Unterstützersysteme wenig vorhanden. Dennoch nehmen diese Aspekte langsam zu.
In der Behindertenhilfe ist die Kategorisierung nach Anspruchsberechtigungen stark ausgeprägt. Dementsprechend sind auch die Bedürftigkeitsmerkmale stark differenziert und die Hilfesysteme sehr geschlossen. Der Grad einer Behinderung (nach Kriterienkatalog) entscheidet über Anspruchsberechtigungen. Eine Einschätzung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung über die "Arbeitsmarktfähigkeit" entscheidet über den Verbleib im 3. Arbeitsmarkt[103] oder den Übergang zum 1. Arbeitsmarkt. Die Eingliederungsquote von Menschen mit Behinderung der Werkstätten in den 1. Arbeitsmarkt lag 2003 bei 0,3%, was dem gesetzlichen Auftrag nach §136, SGB IX widerspricht. Es besteht insbesondere in der Behindertenhilfe, die eine große zielgruppenorientierte und an vielen Stellen autarke Infrastruktur aufgebaut hat, in den letzten Jahrzehnten ein Selbsterhaltungsprinzip, das oftmals dem inklusiven Gedanken entgegen steht. Es wird also vielerorts auf der praktischen Ebene versucht, die bestehende Zielgruppenlogik und die starren Anspruchskriterien beizubehalten, da sie auch bestehende Infrastrukturen stützen.
Die Jugendhilfe ist diesbezüglich offener. Das hat u.a. zwei starke Gründe: die Jugendhilfe ist in erster Linie der Zielgruppenlogik `Alter` unterworfen. Diese Zielgruppenlogik wird weit weniger in Frage gestellt als andere Merkmalssetzungen. D.h. alle Maßnahmen sind zeitlich begrenzt. Der zweite Grund spricht die "Tradition" der Jugendhilfe an, die sich an vielen Stellen als Ergänzung zu Familie und Alltagsstrukturen der Kinder und Jugendlichen versteht, nicht als Ersatz. Natürlich existieren auch beispielsweise Kinderheime und Fremdplatzierungen. Aber die Jugendhilfe ist auf Grund der Unterstützung vor Ort eher sozialräumlich organisiert und kann teilweise auf fallunspezifische Mittel zurück greifen. Auch sind kommunale Budgets für die Jugendförderung durch klamme Haushalte paradoxerweise förderlich für die Vernetzung der Träger. Hier gilt ein weniger stark ausgeprägter Anspruchszwang, zumal das SGB VIII präventive und aktivierende Leistungen ermöglicht.
Die Hilfen für Migranten oder für Menschen mit Migrationshintergrund unterscheiden sich stark nach dem Status; sie sind also sehr an Anspruchskriterien gekoppelt. Menschen mit Migrationshintergrund und deutschem Pass können uneingeschränkt Hilfen der Sozialgesetzbücher in Anspruch nehmen. Menschen ohne deutschen Pass unterliegen einer starken Kategorienzuweisung, die in den wenigsten Fällen individuell geschieht. Hier werden sowohl für die Einwanderungspolitik, wie auch für die Migrationspolitik in der BRD Zielgruppen definiert, die ein Raster des Einschlusses / Ausschlusses bilden. Hier werden wenig prozesshaft und individuell (sich verändernde) Bedarfe oder besser, Chancen, gesehen.
Im Bereich Sport, Freizeit, außerschulische Bildung, Kultur und Tourismus findet auf Grund des starken privatwirtschaftlichen Charakters eine verstärkte Selektion nach Zielgruppen statt. Kein Verein oder Tourismusanbieter ist verpflichtet, jedem Menschen das Mitmachen zu ermöglichen. Andererseits gibt es in diesen Bereichen viele gute Beispiele inklusiver Ansätze, insbesondere im barrierefreien Tourismus, in offenen Sportvereinen oder Kultureinrichtungen. Inklusive Herangehensweisen hängen stark von staatlichen Förderungen ab.
Durch die Existenz eines ersten, zweiten und dritten Arbeitsmarktes gibt es naturgemäß Verschiebungen zwischen diesen. Nach den SGB II und III stehen viele Maßnahmenmöglichkeiten und Programme zur Verfügung, die das Eingliedern in jeweils bestehende Arbeitsmarktsysteme ermöglichen. Das verdeutlicht aber auch, dass es keinen offenen und chancengleichen Arbeitsmarkt gibt, der prozesshaft und individuell unterstützt zunächst jeden Menschen aufnimmt. Hier finden Bedarfseinschätzungen, Leistungstests, Präselektion und Kategorisierungen im unangenehmen Ausmaß statt, so dass im Bereich der Arbeitsmarktpolitik die o.a. These stark bestätigt wird.
[66] Beispielsweise ist die Stadt Bremen stark nach Stadt-/Ortsteilen nach dem Indikator Armut/Reichtum segregiert (vgl. Schwarzer, 2009)
[67] Siehe Kapitel 4.5
[68] Zu dem negativen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschance existieren viele Arbeiten, wie z.B. Klemm (2008) oder Schimpl-Neimanns, (2000)
[69] Einschränkend muss man sagen, dass der präventive Faktor, insbesondere mit dem SGB IX von 2001, an Bedeutung gewonnen hat, wie auch aktivierende Elemente im SGB II und III.
[70] Dabei stützen sich diese Leistungen auf die Definition des Sozialgesetzbuches IX: Grundsätzlich gilt eine Person als behindert, wenn "die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist" (§2, Abs.1 SGB IX).
[71] Siehe auch Kapitel 5.3.7
[72] Best-Practice: "In Schweden wurden Heimplätze für Menschen mit Behinderung sukzessive von 14.000 Ende der 1960er Jahre auf 170 im Jahre 2001 abgebaut. Seit 2001 besteht ein Unterbringungsverbot für Menschen mit Schwerst- Mehrfachbehinderung in Heimen" (Netzwerk Artikel 3, 2006)
[73] Schwerbehinderte Menschen haben einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.
[74] "Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass die beteiligten Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen funktionsbezogen feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. Die Leistungen werden entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf ausgerichtet" (SGB IX, §10).
[75] Sozialhilfeträger, Krankenkasse, Bundesagentur für Arbeit, Unfallversicherungsträger, Rentenversicherungsträger, Träger der Alterssicherung für Landwirte, Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge, Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Pflegekasse und Integrationsamt.
[76] Also ca. 2,5%
[77] Die Nettoausgaben für den stationären Bereich stiegen zwischen 1996 und 2009 um 11%, die für den ambulanten Bereich stiegen um 65% (vgl. Destatis, 2009).
[78] Aber das gilt für die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII, wobei diese Forderung logischerweise auch für die Eingliederungshilfe im SGB VIII gelten sollte.
[79] (Kühn H., 1987)
[80] Best Practice: Die Kita "Li-La-Sausewind" in Neuruppin nimmt alle Kinder unabhängig des Alters und einer Beeinträchtigung auf. Dabei werden beispielhafte Synergien frei: "Jasmin, 11 Jahre, bemüht sich vorsichtig Vé, 3 Jahre, die dicken Winterstiefel an die kleinen Füße zu ziehen. Nicht, weil sie es müsste, sie tut dies freiwillig, da beide laut eigener Aussage Freunde sind. So lernen die Kinder Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse anderer zu respektieren" (Denk, 2012).
[81] Im Gegensatz zu der Quote inklusiven Unterrichts in Regelschulen in Deutschland. Diese liegt bei 18,4% (Klemm, 2010).
[82] Best Practice: Die Pfadfinderschaft Sankt Georg organisiert grundsätzlich ihre Jugendverbandsangebote inklusiv, denn "es sollen keine Pauschalisierungen und Denkmuster gefördert werden" und sie verzichten "bewusst auf theoretische medizinische Erklärungen und Ursachen" (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, 2012)
[83] Best-Practice: Interkulturelles Café Hamburg der Diakonie. In dem Café ist jeder Mensch willkommen. Es werden Sprachkurse angeboten, das Café lädt zu kulturellen Anlässen ein, Workshops finden statt und man findet Beratung oder schlicht einen Kaffee (Diakonie Hamburg, 2013).
[84] "Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet" von 2004 und "Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern" von 2005.
[85] Z.B. Vorstrafen
[86] Ausländer = im Ausland geboren; Deutsche mit Migrationshintergrund = mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren
[87] Der ist an einer Vielzahl an Kriterien und Auflagen gebunden: Grund der Einreise, Passbesitz, gesicherte Identität, Fähigkeit des Aufkommens für den eigenen Lebensunterhalt, evt. politische, humanitäre oder völkerrechtliche Gründe inkl. Nachweise, Meldepflichten, Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme der Beschäftigung etc.
[88] Ausländeramt, Bundesagentur für Arbeit, Sozialamt, Job-Center - Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Daueraufenthalt, Visum, Blaue Karte EU
[89] Best-Practice: Der Verein Miteinander Leben Lernen e.V. Das Projekt "Freizeit Inklusive" bietet Assistenzen für alle Kinder und Jugendliche an, damit diese an Freizeitangeboten ihrer Stadt teilnehmen können. Dabei werden ca. 15 Kinder und Jugendlich wöchentlich in Angeboten begleitet. Dabei wird skeptisch gesagt, dass die Betreuungen zwar erfolgreich waren, das Umfeld und insbesondere der Kompetenztransfer, also die Befähigung der Übungsleiter die Gruppen irgendwann ohne Assistenzen zu leiten, nicht gut funktioniert. Dennoch sehen sich die Initiatoren auf dem richtigen Weg, sie bemängeln aber gleichzeitig das "nicht inklusive" Umfeld (vgl. Fertig, 2009)
[90] Exkurs: Die VHS Bremen hat 2012 diesbezüglich einen Kooperationsvertrag mit einem Träger der Behindertenhilfe unterzeichnet, um genau diesem inklusiven Anspruch gerecht zu werden.
[91] Ich trainiere seit sieben Jahren eine Fußballmannschaft mit behinderten und nicht behinderten Sportlern. Ich habe in der Zeit die klare Beobachtung gemacht, dass eine Behinderung oder auch eine Behinderungsart nicht pauschal auf eine Leistungsstärke schließen lässt.
[92] Best Practice: Der "I-Cup" auf einem Bremer Sportgelände. An einem Tag im Jahr treffen sich Sportler aus den Bereichen Fußball, Volleyball, Klettern, Trampolinspringen und Basketball, um gemeinsamen Sport zu treiben und auch Neues auszuprobieren. Die Klientel, Leistungsstärke und evt. Benachteiligungen jeglicher Art spielen keine Rolle, zum Beispiel ist der gesamte Tag umsonst; nur das Grillessen gibt es zum Selbstkostenpreis. Des Weiteren sind Personen für die individuelle Unterstützung bei Bedarf vor Ort.
[93] Behinderung, Migrationshintergrund, Schulabbruch etc.
[94] Best Practice: Der Verein "Cooperative Beschützende Arbeitsstätten" wurde 1985 in München gegründet und bietet Menschen mit Behinderung und aber auch insbesondere Menschen mit Lernbehinderungen individuelle Unterstützung, Kooperationen mit anderen Betrieben, ortsübliche Bezahlung, Dauerarbeitsplätze und differenzierte Arbeiten, die nach individuellen Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten ausgestaltet werden. Die mittlerweile über 90 Mitarbeiter starken Projektfirmen sind sehr erfolgreich und beschäftigen Menschen mit unterschiedlichsten Eigenschaften (vgl. Neukirchen, 2009).
[95] Siehe Kapitel 6.2.1.2
[96] beispielsweise war das Budget für "spezielle Maßnahmen zur Rehabilitation" in 2011 in Bremen auf 2.640.416€ begrenzt oder für "beschäftigungsschaffende Maßnahmen auf dem 2. Arbeitsmarkt" in 2011 auf 21.542.614 €. Im Vergleich zu 2010 entspricht dies im zweiten Fall eine Abnahme von 2290 Fällen, die nicht mehr gefördert werden können (Jobcenter Bremen, 2011, S. 13).
[97] Sortiert nach Größe (Zahl der Mitarbeiter, Stand 2004 ): Caritas 499.300, Diakonie 452.200, Paritätischer 169.900, AWO 87.000, DRK 75.500 (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2004)
[98] Zedaka (hebr.) = Gerechtigkeit
[99] Mitzwa (hebr.) = "einzelne Pflicht"
[100] Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2011 und Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2012.
[101] In diesem Sinne scheint der Widerspruch zwischen alter Struktur der Behindertenhilfe mit gut ausgestatteten Kostenbedarfen und inklusiven Gemeinwesensarbeiten schwer lösbar. Einrichtungen, die beide Ansätze verwirklichen wollen, befinden sich in einem Dilemma: sie können nur über die alten Kostenstrukturen abrechnen, d.h. de facto suchen sie klar diagnostizierte Menschen mit Behinderung, die stationär oder ambulant in verschiedenerlei Hinsicht betreut werden können, da sie diese Menschen über SGB IX, XI und XII abrechnen können, andererseits können inklusive Herangehensweisen nicht finanziert werden, außer u.U. über befristete Projektanträge. Ein Umbau der Kostenstruktur in der Einrichtung gestaltet sich demnach schwierig und damit die Umsetzung von Inklusion. Das Dilemma bezieht sich also auf die Frage, wie können neue programmatische und rechtliche Voraussetzungen in den Einrichtungen umgesetzt werden, obwohl diese nicht finanziert sind?
[102] Nicht Unter- oder Überordnung.
[103] Die sog. "Diagnose der Arbeitsfähigkeit besonders betroffener behinderter Menschen" (DIA-AM)
Inhaltsverzeichnis
Es wurde gezeigt in Kapitel 4, dass zentrale Aspekte der Inklusion auch Gegenstand moderner Gerechtigkeitstheorien bzw. -ausrichtungen sind. Begriffe (bzw. deren Intentionen) wie Teilhabe, Selbstbestimmung, Empowerment und Chancengleichheit finden sich sowohl nach dem 2. Gerechtigkeitsgrundsatzes von Rawls, als auch in dem Capability Approach von Sen und Nussbaum wieder. Beide Ansätze verfolgen den Gedanken der gleichen Chancen (Positionserreichung), nicht aber der Gleichheit unter den Menschen. Auch bewegt sich Inklusion zwischen einer materiell ausgleichenden und chancenbezogenen sozialen Gerechtigkeit, wobei der Fokus auf den Chancen liegt. Es wurde heraus gearbeitet, dass auch die existenzielle Sicherheit durch materielle Kompensation mit dem inklusiven Gedanken vereinbar ist. Inklusion propagiert demnach eine soziale Gerechtigkeit, die das Individuum und seine Ausgangslagen stärkt; sie anerkennt also Unterschiede zwischen den Menschen, erlaubt aber nicht, dass sich diese unveränderbar und im Vorfeld in der Wahrnehmung der Verwirklichung der eigenen Biografie auswirken. Diese Vorstellung einer sozialen Gerechtigkeit findet auch mehr und mehr Anklang in sozialpolitischen Strukturen und Leistungen, wie das SGB IX, XI und XII zeigen (die Bücher sind zuletzt erheblich verändert worden / entstanden). Aber auch aktuelle sozialpolitische Diskussionen sind geprägt von diesen Begriffen und einer chancenbezogenen Sozialpolitik, wie beispielsweise Debatten um Sozialraumbudgets, um den Kita- Ausbau oder um die Ambulantisierungsprozesse in Pflege und Behindertenhilfe zeigen.
Die Chance liegt insbesondere darin, dass bestehende Sozialpolitik mit verstärkt kompensierendem Charakter nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird durch das Konzept der Inklusion, sondern dadurch nur bestehende Leistungen in ihrer Intention erweitert werden oder aber weitere Leistungen dazu kommen. Als Zielpunkt moderner Sozialpolitik genügt damit das Konzept der Inklusion und kann auf Grund seiner zentralen Elemente gut als neues sozialpolitisches Leitbild genutzt werden, obgleich viele kompensierende Leistungen gleichzeitig erhalten bleiben können.
Schwierigkeiten sind wiederum im Kontext der marktwirtschaftlichen Verhältnisse zu erkennen, dessen "Gesetze" insbesondere die persönliche Verwertbarkeit der eigenen Person betreffen. Es wird eine Leistungsfähigkeit definiert, die in allgemeiner Form immer mehr Menschen nicht erbringen können. Anlehnend an den Satz von Anne-Dore Stein (2012), nachdem Merkmale von Menschen an den Stellen homogenisiert werden, wo eine gemeinsame Schwäche der "Leistungsfähigkeit hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft" (ebd.) identifiziert wird, bieten kapitalistische Strukturen durch wenige "Leistungskriterien" auch nur wenig Ansatzpunkte für Chancengleichheit, da definierte, kurzfristige und standardisierte Leistungen (monetäre Produktivität, Effizienz) erbracht werden müssen, die viele Menschen in einem zu starren Raster ausschließen. Andererseits ist auch die Sozialpolitik stark von der eigenen Legitimation durch eine monetäre Verwertbarkeit abhängig, und sie kann dafür einerseits den Chancencharakter der Inklusion auch nutzen, da dieser auch einen individuellen Forderungscharakter enthält, aber andererseits auch viele Leistungen nach wirtschaftlichen Maßstäben nicht legitimieren. Das gleiche gilt für die sozialen Unterstützersysteme. Diese können nur in wirtschaftlichen Komplexen agieren, und Aufgaben die keine monetäre Aufrechnung zur Folge haben, sind nicht dauerhaft leistbar. Auf der individuellen Ebene wiederum werden diese Erkenntnisse durch das Kapitel "Inklusion und Armut" bestätigt. Ein verkürzter Blick auf die Verwertbarkeit in kapitalistischen Strukturen der eigenen Person wird vordergründig, unrentable Menschen und Einrichtungen nach wie vor stark ausschließen.
Eine Abkehr von Prinzipien der "Fürsorge" und "Barmherzigkeit", die willkürlich und definiert hilfsbezogen die Sozialpolitik lange Zeit geprägt haben, ist mit dem inklusiven Konzept wiederum gut möglich. Aber hier muss noch der Gedanke angebracht werden, dass das "Verbot" von einer im Vorfeld definierter Hilfsbedürftigkeit und daraus resultierenden Barmherzigkeitsgedanken auch den Weg einer Marktwirtschaft ebnet. Wenn nun von Chancengleichheit und Befähigung gesprochen wird, werden diese Elemente zwangsläufig mit der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Einzelnen in Verbindung gebracht und evt. daran gemessen. Darin liegt die Gefahr, die der Satz "Fördern und Fordern" verdeutlicht: wir fördern die Chancen, die eine marktwirtschaftliche Verwertbarkeit verbessern, wir fordern aber gleichzeitig dasselbe, gemessen am gleichen Gedanken. D.h. nicht individuelle Chancen der eigenen Lebensführung stehen im Vordergrund, sondern "Chancenherstellung" zur Entlastung der Sozialsysteme, sprich Herstellung von irgendeiner Art Arbeitsfähigkeit. Viele Menschen werden durch dieses "Raster" fallen, u.a. auch dadurch, weil ihnen keine "Hilfsbedürftigkeit" und auch "Abhängigkeit" von anderen, durch inklusive Konzepte "erlaubt" werden[104]. Hier steht die teilweise erwünschte "Hilfsabhängigkeit" der individuellen Autonomie und dem Empowerment des Einzelnen entgegen.
Ein inklusives sozialpolitisches Bild wird also auch eine Vereinbarkeit von gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen und marktwirtschaftlichen Verhältnissen aufzeigen müssen, zudem wird die Frage nach "erlaubten" Definitionen und v.a. Berechnungsgrundlagen von Defiziten und Potentialen geklärt werden müssen, worin ich eine große Schwierigkeit sehe.
Das Kapitel 5 skizzierte strukturelle und rechtliche Zugänge zu Inklusion. Auf der Ebene der UN existieren wichtige Errungenschaften im inklusiven Sinne, wie das ICF und die UN-BRK, wobei letzteres verbindliches Völkerrecht markiert. Aber auch moderne sozialpolitische Gesetzgebungen in der Bundesrepublik sind, wie gezeigt, mehr und mehr mit Elementen der Inklusion gespickt. Chancen liegen also in den aufgenommen Begriffen und deren (zukünftige) Auswertung. Das betrifft insbesondere "Teilhabe", die in den meisten SGB aufgenommen ist (außer SGB X und XII), wie auch "Aktivierung" (in sieben von zwölf Büchern), "Chancengleichheit" (SGB II und III), "Selbstbestimmung" (SGB I, VIII, IX, XI) und Prävention (in sechs von zwölf Büchern). Interessanterweise ist der Begriff "Befähigung" im Sinne von Empowerment nicht vorhanden, sondern nur in Form von "Hilfe zur Selbsthilfe". Wie in Kapitel 5.5 beschrieben ist dabei einer der wichtigsten Grundsätze der Artikel 1, SGB I. Dort geht es um die "freie Entfaltung der Persönlichkeit" und ein "menschenwürdiges Dasein". Und gleichzeitig sollen "Belastungen des Lebens" abgewendet oder ausgeglichen werden. Die Ausgestaltung dieses Grundsatzes bieten also eine strukturelle Chance den inklusiven Gedanken voran zu treiben, wenn zukünftig auch Interpretationen in diese Richtung fallen, insbesondere durch Richterrecht und Präzedenzfälle.
Schwierigkeiten sind in dem Bereich der Identifikation von Hilfsbedürftigkeit und Inanspruchnahme von sozialen Leistungen zu sehen. In diesem Punkt existieren auch viele sog. Schnittstellenproblematiken[105], einerseits zwischen den unterschiedlichen Gesetzgebungsebenen (UN-BRK vs. deutsche Sozialgesetzbücher) und innerhalb der Sozialgesetzbücher (Beispiel: SGB XI und XII für Pflegeleistungen für beeinträchtigte Menschen - das SGB XII prüft grundsätzlich Einkommen und Vermögen vor dem Erbringen einer Leistung, das SGB XI nicht) und andererseits auch zwischen den Begriffen und Zuständigkeiten. Der Begriff "Rehabilitation" (Wiederherstellung zu einem definierten Status) beispielsweise ist inkongruent mit Selbstbestimmung (Erreichen eines willkürlichen Status). Oder das Wunsch- und Wahlrecht im SGB IX steht im Widerspruch zu Teilen der Eingliederungshilfe im SGB XII. Zudem existiert eine Vielzahl von zuständigen Stellen, die den inklusiven Grundsatz der individuellen Unterstützung und "koordinierten Leistung" in der Praxis erschweren.
Das SGB ist in seiner "Tradition" durch den konsumtiven Sozialstaat geprägt. In erster Linie werden materielle Ausgleiche in erschwerten Lebenslagen mit dem SGB ermöglicht. Die Begründung sozialstaatlicher Leistungen ist in erster Linie dem Gedanken eines "Regulativs" der Marktwirtschaft und dem sozialen Rechtsstaat aus Artikel 28, GG, geschuldet. Dabei wird an den meisten Stellen reagiert und nicht wie im inklusiven Sinne gefordert, im Vorfeld agiert. Das Reagieren besteht zudem noch darin, Menschen mit sozialen Anliegen so zu unterstützen, dass sie in definierte Regelsysteme zurück kehren können. Das zeigt u.a. der Begriff "Eingliederungshilfe" im SGB XII. Eine inklusive Gesetzgebung ginge von individuellen Teilhabechancen aus und würde nicht eingliedern, sondern unterstützen. Diskussionen um Anspruchsberechtigungen, Abweichungen von einem "typischen Zustand" oder dem Ermessensspielraum der Rehabilitationsträger zeigen diese Diskrepanz zwischen heutiger Praxis und einem inklusiven Anspruch und bergen demnach erhebliche Schwierigkeiten in der Umsetzung.
Die Hypothese, dass "Inklusion im Widerspruch zum konsumtiven Sozialstaat steht", beschreibt die Chancen und Schwierigkeiten: so lange der Fokus auf materiellen Ausgleich, pauschale Kategorien der Anspruchsberechtigungen und das Eingliedern in definierte Systeme mit dem Ziel der monetären Unabhängigkeit der Menschen, wird es schwierig sein, inklusive Ansätze zu praktizieren. Auf der anderen Seite existieren Chancen durch investive Elemente im SGB, wie zum Beispiel den Vorrang der Prävention in §3, SGB IX, durch zentrale Begriffe in der Gesetzgebung und durch erste Umsetzungsstrategien, die individuelle und weitestgehend unstandardisierte Vorgänge zulassen, wie zum Beispiel die Unterstützte Beschäftigung nach §38A, SGB IX. Aber auch insbesondere die UN-BRK birgt die große Chance als normgebende und programmatische Konvention ein Umdenken zu erzeugen und auch Präzedenzfälle zu produzieren, sowie bestehende Regelsysteme in der BRD sozialpolitisch zumindest auf den Prüfstand zu stellen. Dies geschieht schon durch die Erarbeitung der Aktionspläne. Aber diese Prüfungen sollten auch in anderen Bereichen stattfinden und nicht nur im Bereich der Behindertenhilfe.
Kapitel 6.3 stellt die Hypothese auf, dass "eine inklusive Kultur wenig konkrete Handlungsmaßstäbe bietet und demnach gegen eine inklusive Struktur ausgespielt wird". Wenn eine inklusive Kultur also solche (noch) nicht definiert ist, bzw. die Auslegungen zwischen den Individuen sehr unterschiedlich bis konträr sein könnten, dann bietet eine inklusive Kultur wenige Handlungsmaßstäbe. Respektvoller und diskriminierungsfreier Umgang sind dabei noch Aspekte, die am ehesten messbar und damit verwertbar sind, aber viele weitere Punkte, wie "Freundlichkeit", "Wertschätzung", "Offenheit" oder auch die Vermeidung von dichotomen Kategorien, wie das "Wir und Die" unterliegen einer individuellen und subjektiven Einschätzung, die wenige konkrete, für alle verbindliche Handlungen implizieren. Ein zweiter Grund für diese These ist die Inklusion eines Individuums, die nicht durch die Inklusion eines Anderen beschnitten werden darf. Wenn jemand nicht freundlich sein möchte, oder auch dichotome Kategorien nutzen möchte, kann dies schwerlich verwehrt werden. Sicher darf in der Konsequenz keine Diskriminierung oder tatsächlicher Ausschluss stattfinden, aber die Übergänge sind schwer zu definieren. Wann beginnt eine "Willkommenskultur" und wann hört sie auf? Eben diese Ausgangslage erklärt die Suche nach Strukturen, nach verbindlichen Maßstäben. Andererseits wehren sich Befürworter der inklusiven Kultur gegen zu starre Strukturen, da sie wichtige Punkte der Inklusion "einengen" könnten. Es existiert also ein Widerspruch, inklusive Strukturen und Maßstäbe könnten inkompatibel mit einer Kultur der Offenheit und Individualität sein. Das zeigt beispielsweise die Diskussion um "sozial Schwache". Hier findet eine zwei Gruppen-Kategorisierung statt, die nicht pauschal ablehnbar ist, denn hierdurch ergibt sich durch diese Deklaration eine häufig erwünschte Anspruchsberechtigung. Kulturell (und sprachlich) könnte der Begriff abzulehnen sein, strukturell gibt er die Chance, individuelle Unterstützung zu bekommen. Ein anderes Beispiel ist eine Frage aus der Praxis, wann, unter welchen Umständen und wie lange ein schreiender Schüler aus einem Unterricht mit mehreren Schülern genommen werden muss, um die Inklusion der anderen zu schützen? Auch hier werden Strukturen gefunden werden müssen, die alle Aspekte verbinden: die individuelle und gleichberechtigte Unterstützung zur Wahrung der eigenen Chancen v.a. im Miteinander und Strukturen, die konkrete Verbindlichkeiten aufzeigen. So lange diese nicht existieren, können beide Zugänge, Struktur und Kultur, immer wieder gegeneinander ausgespielt.
Die Schwierigkeit liegt also in der Umsetzung der Koexistenz vieler Ansprüche einer strukturellen und kulturellen Inklusion. Zudem sind inklusive Aspekte teilweise inhaltlich inkompatibel. Das Beispiel leichte Sprache verdeutlicht dies: hier wird ein standardisiertes Verfahren gewählt um die Teilhabechance behinderter Menschen zu erhöhen. Die Annahme dabei ist ein "kleinster gemeinsamer Nenner" in der Sprache, der eine starre Definition der Leser und pauschale Einschätzungen der Lesefähigkeit zur Folge hat. Das wird dem Gedanken der Vielfalt und individuellen Unterstützung nicht gerecht. Auch hier wird eine prozesshafte und individuelle Unterstützung nötig sein, die sich an Elementen der leichten Sprache bedienen kann, aber nicht muss. Zudem ist die Gefahr groß, dass sich Unterstützerstrukturen hinter dem Verfahren "verstecken", indem individuelle Unterstützung mit dem Angebot leichter Sprache ausgetauscht wird.
Andererseits liegen große Chancen in einer kulturellen Inklusion, die an vielen Stellen ein humanistisches Weltbild ausdrückt. Die Besinnung auf Begriffe und Umgangsformen, die die Wertschätzung des Einzelnen erhöhen, die Selbstachtung und Autonomie des Individuums stärken und Diskriminierung minimieren, sind gute Begleiterscheinungen in der Diskussion um Inklusion und damit als Chance zu sehen.
Es besteht kein gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Konsens über das Richtig / Falsch einer Zielgruppenlogik und daraus resultierender Anspruchsberechtigungen. Es wird genauso das "Ob" in Frage gestellt, wie eine Antwort auf "angemessene" und "nicht angemessene" Zielgruppen gesucht. Auch ist der Zeitpunkt, ab wann und für wie lange eine Anspruchsberechtigung angemessen ist, in den Debatten um Inklusion unklar. Manche lehnen kategorisch alle Zielgruppenlogiken ab, und plädieren für einen individuellen und uneingeschränkten Umgang mit Heterogenität in allen Bereichen. Andere definieren bestimmte Zielgruppen als angemessen, andere wiederum nicht. Genderspezifisches Arbeiten ist in der modernen Pädagogik sehr anerkannt. Auch gilt es "Behinderten" zu helfen. "Bingo-Runden" mit älteren Menschen stellt auch keiner in Frage. Das Problem ist, dass Heterogenität nur durch einen "Vergleich zwischen Personen oder Merkmalen" (Saldern, 2009, S. 56) entsteht. Diese "definierten Unterschiede zwischen Personen entstehen deshalb immer aus dem Vergleich mit dieser Person mit irgendwelchen Normen". Die Zuschreibung von Merkmalen hängt also von sozialen Normen und persönlichen Werten ab. Diese "sind aber nicht wissenschaftlich begründbar, sondern Setzungen" (ebd. S. 57). Das impliziert, dass diese Setzungen auch einer Variabilität unterliegen, die von Region zu Region, von Unterstützersystem zu Unterstützersystem unterschiedlich ausfällt oder ausfallen könnte. Diese Problematik ergibt sich in allen Sozial- und Bildungssystemen - und im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Durchschnitte oder Ideale gebildet werden müssen, woran sich Zielgruppen eingliedern lassen. Die Sozialgesetzbücher schreiben dann von einer Abweichung von einem "typischen Zustand", beispielsweise im SGB IX. Dieser Versuch der "Homogenisierung" kann aber nicht im inklusiven Sinne funktionieren, denn letztlich könnte, wenn überhaupt, nur nach einem Merkmal homogenisiert werden, nie aber nach mehreren (ebd. S. 58). In jedem Fall also bleibt der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit reduziert auf einzelne, willkürlich gesetzte Merkmale oder Eigenschaften.
Das zweite Problem ist, dass Anspruchsberechtigungen für die Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen über die Unterstützersysteme sich aus diesen Zielgruppenlogiken generieren. Und diese Anspruchsberechtigungen werden in überwiegender Zahl der Fälle im Vorfeld (und einmalig) einer Leistung getätigt. Die Entwicklung der These in Punkt 7.7 zeigt eben diese Problematik im Zusammenhang mit inklusiven Herangehensweisen auf. Ein Mensch mit Behinderung bekommt ein Etikett, genauso wie ein Mensch mit Migrationshintergrund oder ein "sozial schwacher" Mensch. Natürlich sind Statusänderungen möglich, insbesondere durch die Aufnahme von Eigeninitiative, aber per Anspruchsberechtigung sind prozesshafte und kontinuierliche Unterstützung, mit dem Ziel der Statusänderung, selten.
Ein drittes Problem besteht in der "Tradition" der Unterstützersysteme, Zielgruppenlogiken aus Selbsterhaltungsgründen beizubehalten oder sogar noch zu verstärken. Gut lässt sich das in der o.a. sehr schwachen Eingliederungsquote in den 1. Arbeitsmarkt der Werkstätten für Menschen mit Behinderung erkennen (s. Kapitel 7.7).
Inklusive Ansätze haben in der Umsetzung also direkte Auswirkungen auf die Praxis der sozialen Einrichtungen. Aber auch unabhängig von gesetzlichen Aufträgen, Fördervereinbarungen und "institutionalisierten Aufgaben"[106] positionieren sich die einzelnen Einrichtungen zu dem Thema Inklusion, wobei sie an vielen Stellen in einem "strategischen Dilemma" stehen, weil sie zwischen "Bedrohung ihrer bisherigen Arbeit" und modernen "Netzwerkern in lokalen Verantwortungsgemeinschaften" hin und her pendeln (Wasel, 2012, S. 85).
Diese aufgeführten Schwierigkeiten lassen sich alle unter die Überschrift der Hypothese stellen. "Wann, unter welchen Umständen und wie sind Zielgruppen sinnvoll und im inklusiven Sinne erlaubt?" sind die Fragen, die geklärt werden müssen, damit sich inklusive Aspekte in den Unterstützersystemen etablieren können.
Andererseits birgt das Konzept Inklusion durch die Debatten, die Neuartigkeit und Größe eine große Chance für die soziale Praxis, da sich diese damit als innovativ und zukunftsweisend beweisen kann. Dennoch bleibt die Frage der eigenen Überzeugung bzw. der der Einrichtung, Inklusion umzusetzen. Wer das nicht möchte kann auf Grund der bestehenden Struktur mit allem Recht sich auf diese Struktur zurück ziehen (beispielsweise steht die finanzielle Existenz über dem Auftrag Inklusion umzusetzen). Es besteht aus diesem Grund eine große Gefahr eines "Image-Missbrauchs" durch das Wort, ohne Inhalte tatsächlich darauf auszulegen. Eine Beobachtung zeigt, dass Inklusion nur an den Stellen anfänglich umgesetzt wird, wo Mehrwerte, zumeist in Form von Geldmitteln, daraus resultieren. Zudem gibt es Befürworter einer "Top-Down-Strategie", insbesondere unter den Mitarbeitern außerhalb der Führungsebenen, und Befürworter einer "Bottom-Up-Strategie" in der Umsetzung von Inklusion, insbesondere in der Führungsebene. An dieser Stelle wird der Handlungsauftrag "hin- und hergeschoben". Inklusion wird bisher nicht aus sich heraus als Handlungsauftrag verstanden.
Allgemein
Die Inklusion existiert nicht. Es kann nicht davon gesprochen werden, ob Inklusion umgesetzt wird oder nicht. Ein Zugang kann strukturell, kulturell, gerechtigkeitstheoretisch oder praktisch gesucht werden. Inklusion besteht aus so vielen Facetten, dass die Zugänge die Vorstellungen und Machbarkeiten konkretisieren können, aber nicht den Begriff und die Aufforderung als Ganzes fassen können. Zudem kommen starke interdependente Wirkungen zwischen den Bestandteilen. Eine wissenschaftliche Differenzierung durch die Zugänge macht Sinn an den Stellen, wo konkrete Einzelwirkungen gesucht werden. Insgesamt ist das Konzept aber eine Aufforderung, die nur ganzheitlich und interdisziplinär gesehen werden kann, um mit "Leben gefüllt" werden zu können. Diese Aussage macht die sozialpolitische Umsetzung so schwierig, dass nur zwei Möglichkeiten bleiben: unrealistischerweise werden entweder die gesamten Sozialsysteme umfassend und in einem Zug reformiert oder es werden immer nur Einzelbestandteile der Inklusion in den Anfängen umgesetzt. Dann wiederum kann nicht von Inklusion gesprochen werden, sondern es muss als Weg in die Richtung Inklusion betitelt werden. Jede Aussage, "wir setzen nun Inklusion um", ist dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt verkürzt. Möglicherweise ist die Besinnung auf einzelne, wichtige Aspekte zunächst zielführender.
Wirkungen
Eine Auswertung der Wirkungen (Kapitel 3.2) ergibt folgendes Bild: die Inklusion bewegt sich in einer Vielzahl von Spannungsfeldern. Zum einen wird die inhaltliche und strukturelle Aufforderung durch die UN-Konvention und wissenschaftliche Erkenntnisse als tatsächlicher Druck in der Legislative und in den Unterstützersystemen wahrgenommen. Gleichzeitig sind an vielen Stellen die Strukturen und Ausrichtungen der Unterstützersysteme (bisher) nicht fähig, diese Aufforderungen umzusetzen. An vielen Stellen ist die Inklusionsaufforderung schlicht inkompatibel mit bestehenden Gesetzen, Abrechnungsmodi und Ausrichtungen. Beispiele dafür sind Einschränkungen des Wahlrechts für Menschen mit rechtlicher Betreuung in allen Belange im Kontrast zu Artikel 29 UN oder die Existenz eines dritten Arbeitsmarktes im Gegensatz zu Artikel 27 UN-BRK.
Des Weiteren nehmen die sozialen Unterstützersysteme die Aufforderung wahr, wissen aber an vielen Stellen nicht wie, und mit welchen Mitteln der inklusive Gedanke umzusetzen ist. Es gleicht einer Operation am lebenden Körper ohne Narkose: um Schmerzen zu vermeiden, werden nur punktuell Eingriffe getätigt, andererseits sagt aber der Operateur, dass eine große Operation unvermeidlich ist, nur das Narkotikum kann Aufforderung stark wirkt, die sozialen Unterstützersysteme sich aber auf fehlende Umsetzungsstrategien und -strukturen (Mittel zur Umsetzung) berufen und abwarten. Andererseits sind sozialpolitische Strukturen überwiegend inkompatibel mit dem Inklusionskonzept, so dass hier die politischen Aufforderungen im Raum stehen, die Unterstützersysteme sollen doch "Fakten
schaffen". Eine gemeinsame Linie ist selten zu erkennen, der Wille gemeinsam Strukturen und Inhalte in Richtung Inklusion umzubauen, ebenso wenig. Stattdessen werden gegenseitige Forderungen gestellt, die sich dann in der Wirkung neutralisieren.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich in dem Wirkungszusammenhang Inklusion und Kultur/Gesellschaft. An vielen Stellen wird die Verantwortung des ersten Schrittes auf den jeweils anderen geschoben, so dass der Mitarbeiter in der sozialen Einrichtung sagt, erst die Strukturen und Mittel, dann kann ich "inklusiver" arbeiten. Andersherum wird erst von dem Einzelnen eine verbesserte Haltung gefordert. Dieses Spannungsfeld lässt sich an einer Vielzahl Workshops und Fachtagen in diesen Tagen erkennen, wo immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden: "erst ich, oder erst die Strukturen bzw. wie soll ich Inklusion umsetzen, wenn ich nicht die Mittel dafür habe?
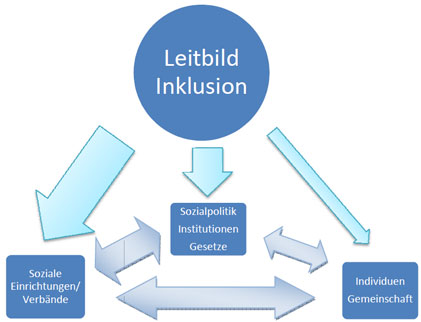
Abbildung 12 - Wirkungen, eigene Darstellung
Zusammengefasst lässt sich also konstatieren: das Leitbild Inklusion wirkt auf mehreren Ebenen, die alle miteinander verbunden sind. Dabei sind die Wirkungen unterschiedlich stark, wie die Pfeilstärken in Abbildung 12 verdeutlichen. Die Umsetzung findet dann in den Ebenen statt, maßgeblich aber in dem Zusammenhang der Ebenen; dort sind insbesondere die Chancen und Schwierigkeiten angesiedelt. Dort wo Schwierigkeiten gesehen werden, werden Verantwortungen der Umsetzung auf die jeweils anderen Ebenen verlagert, dort wo Chancen bestehen, grenzen sich die Ebenen voneinander ab. Beispiele für diese Beobachtung finden sich zahlreich in dieser Arbeit.
Das Wirkungsdreieck zeigt, wie ganzheitlich Inklusion zu betrachten ist. Das ist gleichzeitig auch die größte Chance dieses Ansatzes. Die UN-BRK hat eine breite Diskussion entfacht, die sich nicht auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern Gesamtzusammenhänge, insbesondere die der sozialen Unterstützersysteme und der Sozialpolitik thematisieren. Ein kooperatives Denken auf sozialpolitischer und praktischer Ebene ist also unverzichtbar. Das ist ein Grund, warum beispielsweise ressortübergreifend am Inklusionsgedanken gearbeitet werden muss wie auch Organisationsübergreifend.
Hypothesen
Die vier genutzten Zugänge zur Inklusion in dieser Arbeit bieten einen Überblick über die Bestandteile und Wirkungsweisen von Inklusion, die sozialpolitisch relevant sind. Dabei wurde explorativ gearbeitet, in dem in Teilen normative Annahmen und heutige Beobachtungen gegenüber gestellt wurden. Daraus konnten vier Hypothesen extrahiert werden, die das Potential unter bestimmten Voraussetzungen des jeweiligen Zugangs verdeutlichen.
Die These "Inklusion bietet zentrale Aspekte eines neuen sozialpolitischen Leitbildes" aus Kapitel 4 wurde durch die Erkenntnis gewonnen, dass gerechtigkeitstheoretische Grundannahmen moderner Sozialpolitik eine große Nähe zu Inklusion aufzeigen. Moderne Legitimationen des Sozialstaates werden durch ungleiche Verteilungen im marktwirtschaftlichen System und zunehmende Individualisierung der Gesellschaft mit gleichzeitiger Loslösung von sichernden Familienstrukturen, dem demografischen Wandel und dem Fokus auf Bildung (in einer technisierten Welt) begründet. Dafür werden zunehmend Elemente wie Empowerment, die Herstellung von Chancengleichheit und Selbstbestimmung genutzt, da diese eine methodische Brücke bauen zwischen Existenzabsicherung und Prekariat. Aus diesem Grund kann Inklusion mit ihren Aspekten als neues sozialpolitisches Leitbild genutzt werden, da beide sozialstaatlichen Begründungsmuster, Ausgleich und Befähigung, vom inklusiven Gedanken getragen werden.
Ein rein konsumtiver Sozialstaat aber steht im Widerspruch zu Inklusion, formuliert die Hypothese aus Kapitel 5. Das begründet sich vorwiegend durch die "Tradition" der deutschen Sozialgesetzgebung und die Wirkungsweisen von Anspruchsberechtigungen, die ein definiertes Defizit als Voraussetzung haben muss. Die strukturellen und gesetzlichen Maßgaben überwiegen und definieren heute die Sozialstaatlichkeit und stehen demnach im Widerspruch zur Inklusion. Dennoch lassen sich Umbrüche erkennen, an erster Stelle durch die UN-BRK, aber auch innerstaatliche Entwicklungen, die sich durch neue Begriffe und zunehmend fallunspezifische Strukturen in der Sozialgesetzgebung ausmachen lassen.
Was eine inklusive Kultur eigentlich meint und wie ein anerkanntes Verständnis davon sein könnte, ist die zentrale Frage in dem Kapitel 6. Es wurde heraus gearbeitet, dass allgemein gültige Vorstellungen und Praktiken im gesellschaftlichen Miteinander nicht existieren. Übergeordnete Maßstäbe, wie der Kant`sche Imperativ oder ein respektvoller Umgang werden überwiegend nicht in Frage gestellt. Wie aber Inklusion im individuellen Handeln mit anderen Personen aussehen müsste, ohne dass "die Inklusion des anderen" evt. beschnitten wird, ist ungeklärt. Zudem werden inhaltliche Überschneidungen in Bezug zu Inklusion formuliert, die nicht im kulturellen Sinne parallel existieren können, bzw. wenn, dann müssten sie eine Abgrenzung zueinander erfahren. Da gilt insbesondere für das Beispiel Standardisierungsverbot vs. leichte Sprache. Durch diese "Schwammigkeit" kann der kulturelle Begriff von Inklusion leicht gegen inklusive Strukturen ausgespielt werden, indem das eine "erst" das andere fordert. Die skizzierten Werte in Kapitel 6 zeigen dabei das Potential in beide Richtungen auf: Inklusionskritiker können viele Werte genauso nutzen wie - befürworter, da sie alle die Basis der individuellen Selbstbestimmung haben, die eben für alle gilt. Konkrete Handlungsmaßstäbe bleiben häufig unentdeckt und so wie "Idealisten" ein hehres Bild vom Miteinander ohne Missgunst, Ausschluss und Diskriminierung malen, zeichnen Kritiker eine Skizze von hoher individueller Selbstbestimmung, Recht auf persönliche Autonomie und schlichter Realitätsbeobachtungen in dem destruktiven Umgang der Menschen miteinander. Ein unbestrittener Hang zur Exklusion und exklusiven Merkmalen der Menschen wird nicht durch ein inklusives Konzept aufgelöst werden können (Stichwort: VIP). Vielmehr wird die Frage sein, wie ein gesamtgesellschaftliches Verständnis von Umgangsformen und Inklusionsbestrebungen in produktiver Koexistenz mit exklusiven Vorstellungen sein könnte. Hier kann ein Rückgriff auf die menschenrechtliche Dimension von Inklusion und die darunter positionierten Diskriminierungsverbote hilfreich sein und eine inklusive Enkulturation fördern, wobei die Frage zu klären ist, wie sich daraus Handlungsmaßstäbe folgern lassen, die "nur" den kulturellen Ausschluss, beispielsweise das "Hänseln" eines behinderten Mitarbeiters, betreffen.
Die Praxis in den sozialen Unterstützersystemen findet hochgradig zielgruppenorientiert statt. Im Grunde ist jede Klientel definiert, wobei die Definitionen sich zumeist an einmalig messbaren und askriptiven Merkmalen orientieren. Diese Beobachtung impliziert das große Problem, dass Inklusion an vielen Stellen nicht funktionieren kann, weil 1. eigene Inhalte einer Zielgruppenlogik entgegen stehen und 2. diese aber die Anspruchsberechtigungen generieren, die die Existenz (herkömmlicher) sozialer Unterstützersysteme, wie Behindertenhilfeeinrichtungen, legitimieren und sichern. Die praktische Inklusion muss sich also zwischen diametral entgegen gesetzten Interessen positionieren: als Chance für die Einrichtungen, neue Leitsätze und soziale Praktiken, die näher an gesellschaftlichen und auch (völker-)rechtlichen Entwicklungen sind, umzusetzen und als Schwierigkeit, gleichzeitig alte Abrechnungsstrukturen zu nutzen.
Chance und Schwierigkeit: Inklusion als sozialpolitischer Imperativ?
Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit wurde mit vier Zugängen beschritten, wobei folgende Fragen jeweils dahinter stehen:
-
Gerechtigkeitstheoretischer Zugang: Warum ist Inklusion gerecht und wie könnte Inklusion als Gerechtigkeitsvorstellung dienen, die dann sozialstaatliches Tun legitimiert?
-
Struktur und Gesetze: welchen Rahmen finden wir zu Umsetzung vor, bzw. welche Strukturen müssten gegeben sein, um Inklusion umzusetzen?
-
Kultur und gemeinschaftlicher Zugang: wie müssen die Menschen im inklusiven Sinne miteinander umgehen und welche gesellschaftlichen Werte(-veränderungen) spielen dabei eine Rolle?
-
Praxis: wie arbeiten konkret Einrichtungen und Institutionen im inklusiven Sinne? Wie ist sichergestellt, dass relevante Lebensbereiche von allen Menschen auch praktisch erreicht werden können? Welche Methoden und Didaktiken werden angewendet?
Diese Fragen wurden anfänglich in dieser Arbeit beantwortet. Das Fazit daraus ist, dass Inklusion große Chancen hat, als sozialpolitischer Imperativ vermehrt zu wirken, insbesondere in den Fragen gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen und dem Umbau des rechtlichen Sozialstaates zu mehr Selbstverantwortung und Chancengleichheit. Inklusion wirkt als Leitbild, als Ziel. Schwierigkeiten sind insbesondere in den kulturellen und praktischen Fragen zu sehen, da diese stark abhängig sind von den Strukturen. Inklusion kann aber nicht funktionieren, so lange sich Erfolg oder Misserfolg des Mitarbeiters oder der sozialen Einrichtung nach heutigen Kriterien der wirtschaftlichen Verwertbarkeit bemisst. Inklusion als sozialpolitisches Leitbild wird die Frage des kollektiven und individuellen Mehrwertes durch Inklusion beantworten müssen, wobei Mehrwerte sich auf viele, teils neue Indikatoren stützen müssen, die zum Teil noch gar keinen Stellenwert in marktwirtschaftlichen Zusammenhängen haben. Wenn die Schere zwischen "alter" Struktur und neuer Aufforderung geschlossen wird, kann Inklusion mehr werden als ein sozialpolitisches Leitbild.
[104] Im Subsystem Schule lässt sich dieser Gedanke im Kleinen gut verdeutlichen: die beginnende Inklusion an Schulen ist am bestehenden System ausgerichtet, d.h. behinderte Schüler werden an der Leistungsfähigkeit und an den Umgangsstandards des ursprünglichen Systems gemessen und nicht an individuellen (neuen) Maßstäben. Das hat zur Folge, dass in der Wahrnehmung vieler, die behinderten Schüler schlichtweg leistungsschwach sind, dabei bezieht sich Leistung auf definierte Kriterien im Lehrplan. Wenn dann gefördert wird, dann in Richtung der definierten Leistungskriterien, die häufig nicht vereinbar sind mit individuellen Behinderungen. Ein großer Indikator dieser Problemlage ist das bestehende Notensystem, das lediglich eine Vergleichbarkeit der zu beurteilenden Schüler anhand von definierten Kriterien zulässt, aber eben nicht absolute Leistungen. Auch Kriterien wie "Sozialkompetenz" oder "Personalkompetenz" lassen zwar neue Maßstabsgedanken zu, andererseits sind sie aber, solange sie in Noten abgebildet werden, nur relativ und damit nichts aussagend, da standardisierte Verhaltensmuster dem Recht auf Individualität entgegen stehen. Die inklusive Schule kann also nur mit individuellem Curricula, unabhängigen und prozesshaften Leistungsmaßstäben und absoluten Leistungsbewertungen (z.B. in individueller Textform) funktionieren, mit dem Ziel der bestmöglichen Chancenherstellung für die eigene Lebensführung. Einfache Vergleichbarkeiten zwischen den Menschen sind damit ausgeschlossen, diese existieren aber auch nicht.
[105] Diese produzieren auch die sog. "Grenzgänger". Menschen, die nicht eindeutig einem Anspruch zugeordnet werden können, weil die SGB-Paragrafen zu starr sind. Das betrifft z.B. Menschen, die Leistungen nach dem SGB XI oder XII erhalten können (Pflegemaßnahmen), oder auch Jugendliche, die zwischen einer geistigen und psychischen Beeinträchtigung liegen (SGB VIII und IX).
[106] Beispiel: Assistenz in bremischen Schulen. Diese staatliche Aufgabe im Zuge des inklusiven Schulgesetztes wurde bisher vollständig an private Träger abgegeben.
Abbildung 1: Skizze der Arbeit "Inklusion als sozialpolitischer Imperativ"
Abbildung 2: "Inklusionsebenen"
Abbildung 3: "Wirkungszusammenhänge"
Abbildung 4: Inklusionsbestandteile und Beispiele
Abbildung 5: Gleichheit der Resultate - Gleichheit der Chancen
Abbildung 6: Struktur ICF (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2004)
Abbildung 7: Originäre und inklusive Sozialpolitik - Strukturen
Abbildung 8: Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV (Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen, 2003, S. 9)
Abbildung 9: Originäre und inklusive Sozialpolitik - Kultur und Werte, eigene Darstellung, teils in Anlehnung an Hinz, 2012, S. 43
Abbildung 10: Gewinne durch Diversity Management in Anlehnung an (Paireder & Niehaus, 2005) - S. 80
Abbildung 11: Originäre und inklusive Sozialpolitik - Praktiken, eigene Darstellung, teils in Anlehnung an Hinz, 2012, S. 43
Abbildung 12 - Wirkungen, eigene Darstellung
Agentur für Arbeit. (2008). Chancen für Menschen mit Behinderung. Abgerufen am 12.2.2013 von http://www.wege-ins-studium.de/data/File/BBZ_Menschen_mit_Behinderung.pdf
Aichele, V. (2010). Behinderung und Menschenrechte. Aus Politik und Zeitgeschichte - Ausgabe 23 , S. 13-19.
Aichele, V. (2010 A). Die unabhängige Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland: Hintergrund, Ausrichtung, Wirkungszusammenhang. Abgerufen am 08.05 2013 von Zeitschrift für Inklusion Nr. 2: http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/52/56
Akademie für Inklusion. (2012). Europäische Akademie für Inklusion. Abgerufen am 27.04.2013 von http://www.inklusion-sh.eu/menschen_migrationshintergrund.0.html
Aktion Mensch. (kein Datum). Aktion Mensch. Abgerufen am 20..09.2012 von http://www.aktionmensch.de/inklusion/un-konvention.php
Alexander, A. (2011). Teamentwicklung. Edu Media: Ilmenau.
Alexander, R. & Frigelj, K. (29. 01.2010). Behinderte können sich in Standartschule einklagen. Die Welt. Abgerufen am 01.08.2012 von http://www.welt.de/welt_print/politik/article6022831/Gutachten-Behinderte-koennen-sich-in-Standardschulen-einklagen.html
Alle Inklusive.de. (2012). Alle Inklusive. Abgerufen am 27.08.2012 von http://www.alleinklusive.de/landesjugendring/
Amjahid, M. (2009). Neue Diversität für den Aufstieg, bitte! Ein Plädoyer für Barrierefreiheit in den Köpfen. Berlin: Heinrich-Böll Stiftung.
Amrhein, B. (2011). Inklusion in der Sekundarstufe. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Anti Bias Werkstatt. (2012). Abgerufen am 03.12.2012 von http://www.anti-bias-werkstatt.de/
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. (2012). Die Gleichbehandlungsrichtlinien der Europäischen Union. Abgerufen am 01.02.2013 von http://www.antidiskriminierungsstelle.de/ADS/Das-Gesetz/eurichtlinien,did=102794.html
Arbeiter Samariter Bund. (2012). Arbeiter Samariter Bund. Abgerufen am 22.08.2012 von http://www.asb.de/leitbild.html
Arbeiterwohlfahrt. (2012). Gleichstellung vom Menschen mit Behinderung muss endlich kommen. Abgerufen am 24.08.2012 von http://www.awo-bbsued.de/public/773426_Gleichstellung_von_Menschen_mit_Behinderung_muss_endlich_kommen/?mx=fe53386dd59e5ebf0eca923c3c79a662
Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe. (2012). Auf dem Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Berlin.
AWO. (1998). Arbeiterwohlfahrt . Abgerufen am 22.08.2012 von Grundsatzprogramm der AWO: http://www.awo.org/fileadmin/user_upload/documents_Awo/Die_Arbeiterwohlfahrt/Grundsatzprogramm_Layout_neu_09.pdf
Bethke, A. (2011). "Barrierefreiheit: ein Schlüssel zur Enthinderung der Gesellschaft". Abgerufen am12.01.2013 von Institut für Menschenrechte: http://www.institut-fuermenschenrechte.de/de/aktuell/news/meldung/article/barrierefreiheit-ein-schluessel-zurenthinderung-der-gesellschaft.html
BFSFJ. (2006). Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Abgerufen am 01.09.2012 von http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/heimbericht/7-Stationaereeinrichtungen-der-behindertenhilfe/7-5-strukturdaten-der-stationaeren-behindertenhilfe.html
Bielefeldt, H. (2006). Zum Innovationspotential der UN-Behindertenrechtskonvention. Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin.
Blaschke, R. (2010). Denk´mal Grundeinkommen. Geschichte, Fragen und Antworten einer Idee. In R.
Blaschke, A. Otto, & N. Schepers, Grundeinkommen (S. 9-292). Berlin: Dietz Verlag.
Blindenmission, C. (2012). Der Teufelskreis von Armut und Behinderung. Abgerufen am 09.5.2013 von http://www.cbm.de/artikel/Artikel_262748.html
BMAS . (2009). Behindertenbericht 2009. Berlin.
BMWI. (2008). Barrierefreier Tourismus für Alle. Berlin.
BMWi. (2003). Ökonomische Impulse für einen barrierefreien Tourismus für alle. Berlin.
Boban, I. (2000). It´s not inclusion... der Traum von einer Schule für alle Kinder. In M. Hans, & A.
Ginnold, Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa (S. 238-247). Berlin: Luchterhand.
Bohn, C. (2009). Geld und Eigentum - Inkludierende und exkludierende Mechanismen in der Wirtschaft. In R. Stichweh, & P. Windolf, Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit (S. 241-257). Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften.
Booth, T. (2012). Ein internationaler Blick auf inklusive Bildung. Wert für alle? . In A. Hinz, & U. N. Ingrid Körner, Von der Integration zur Inklusion (S. 53-74). Marburg: Lebenshife Verlag.
Bora, A. (2005). Partizipation als politische Inklusionsformel. In C. Gusy, & H.-G. Haupt, Inklusion und Partizipation (S. 15-34). Frankfurt Main : Campus .
Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation. Heidelberg: Springer Verlag.
Bösl, E. (2010). Die Geschichte der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik. Aus Politik und Zeitgeschichte - Ausgabe 23 , S. 6-12.
Buhr, P., & Leibfried, S. (2009). Ist die Armutsbevölkerung in Deutschland exkludiert? . In R. Stichweh, & P. Windolf, Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit (S. 103- 123). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Bundesgentur für Arbeit. (2012). Analyse des Arbeitsmarktes für Ausländer. Nürnberg.
Bundesjugendkuratorium. (12 2012). Bundesjugendkuratorium . Abgerufen am 11.12.2012 von http://www.bundesjugendkuratorium.de/pdf/2010-2013/Stellungnahme_Inklusion_61212.pdf
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2010). Brücken in den Arbeitsmarkt für junge Menschen mit Behinderung. Abgerufen am 12.10.2012 von http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabebehinderter-Menschen/Initiative-Jobs-ohne-Barrieren/Programm-Job4000/job4000-bruecken-inden-arbeitsmarkt.html
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (09 2011). Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Abgerufen am 13.05.2013 von http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a740-nationaler-aktionsplan-barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile
Bundesministerium für Familie, S. F. (2009). 13. Kinder- und Jugendbericht . Berlin.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2011). Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Konvention. Abgerufen am 09.09.2012 von http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a740-nationaler-aktionsplanbarrierefrei.pdf;jsessionid=7A6C96CEAC73DE94A6641CBA73A500F8?__blob=publicationFile
Bundeszentrale für politische Bildung. (2010). Bundeszentrale für politische Bildung. Abgerufen am 08.11.2012 von http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69050/16-millionen-migranten-indeutschland-16-07-2010
Bungert, Jörg: "Konzept und Gesetz "Unterstützte Beschäftigung" - eine aktuelle Standortbestimmung", Zeitschrift für Inklusion, 2010
Caritas. (o.A.). Die Caritas. Abgerufen am 22.08.2012 von http://www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/
Caritas. (2012). Pressemitteilung der deutschen Bischofskonferenz - Inklusive Bildung von jungen Menschen mit Behinderungen. Abgerufen am 26. 08 2012 von http://www.katholischeschulen.de/fileadmin/downloads/2012-074a-Inklusive-Bildung-Empfehlung-Kommission-Erziehung-Schule.pdf
Dabrock, P. (2010). Befähigungsgerechtigkeit als Ermöglichung gesellschaftlicher Inklusion. In Otto, Hans-Uwe; Ziegler, Holger (Hrsg.):, Capabilities - Handlungsbefähigung und Verwirklichungschancen in der Erziehungswissenschaft, Verlag für Sozialwissenschaften, 2. Auflage, S. 17 - 53
Dannenbeck, C., & Dorrance, C. (2011). Inklusion in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - ein Fortbildungsmodul . In P. Flieger, & V. Schönwiese, Menschenrechte Integration Inklusion (S. 205- 212). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Definitiv-Inklusiv. (kein Datum). Definitiv inklusiv.org. Abgerufen am 21. 05.2013 von www.Definitivinklusiv.org
DeGEval. (2012). Deutsche Gesellschaft für Evaluation. Abgerufen am 07.05.2013 von www.degeval.de
Denk, A. (2012). Theo Stadtmagazin. Abgerufen am 27.09.2012 von http://www.theostadtmagazin.de/neuruppin/2012/02/paradebeispiel-fur-inklusion-kita-li-la-sausewind/
Department for international Development. (2012). Handicap-International. Abgerufen am 20.09.2012 von http://www.handicap-international.fr/bibliographiehandicap/4PolitiqueHandicap/hand_pauvrete/DFID_disability.pdf
Der Paritätische. (2012). Grundsätze des Paritätischen. Abgerufen am 22.08.2012 von http://www.derparitaetische.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/grundsaetze.pdf&t=1346496414&hash=bfffc6f87732762808af5bd4ac053772bcffce1d
Der Paritätische. (2010). Positionspapier zur inklusiven schulischen Bildung. Abgerufen am 24.08.2012 von http://www.inklusive-schule-bayern.de/upload/positionspapier_inklusion_v_11_3.pdf
Des Gasper, R.: "What is the capability approach? Its core, rationale, partners and dangers", The Journal of Socio-Economics 36, 2007, S. 335-359
Destatis. (2009). Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Nürnberg
Destatis. (2010). Sozialhilfe in Deutschland. Nürnberg.
Destatis. (2012). Besondere Leistungen. Abgerufen am 01.09.2012 von https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Sozialhilfe/BesondereLeistungen/Tabellen/ZRBehMenschenJahreGeschlOrtHgew.html
Detmar W. et al. (2008). Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Berlin.
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg. (2012). Nix besonderes. Abgerufen am 27.09.2012 von http://www.dpsg.de/aktivdabei/behindertenarbeit/files/dpsg_behindertenarbeit.pdf
Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2009). Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik . Bonn.
Deutscher Behindertensportverband. (2012). Inklusion durch Sport. Abgerufen am 27.09.2012 von www.dps-npc.de: http://www.dbs-npc.de/inklusion-durch-sport.html
Deutscher Bundesjugendring. (2010). Jugendverbandsarbeit und Integration. Abgerufen am 27.08.2012 von http://www.dbjr.de/positionen/2010.html?eID=dam_frontend_push&docID=237
Deutscher Caritasverband. (2011). Sozialpolitische Positionierung zur Kamagne 2011 "Selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung". Abgerufen am 24.08.2012 von http://downloads.eo-bamberg.de/9/863/1/85134634925817552309.pdf
Deutscher Gewerkschaftsbund. (2010). Eine Arbeitswelt für alle. Berlin: DGB.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge. (2011). Eckpunkte für einen inklusiven Sozialraum. Berlin.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge. (2012). Empfehlungen zur örtlichen Teilhabeplanung für ein inklusives Gemeinwesen. Berlin.
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2004). Medizinische
Dokumentation und Information. Abgerufen am 12.08.2012 von http://www.dimdi.de/static/de/index.html
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2012). Anwendung des ICF in Deutschland. Abgerufen am 13.11.2012 von http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/anwendung.htm
Deutsches Rotes Kreuz. (1965). Deutsches Rotes Kreuz - Grundsätze. Abgerufen am 22.08.2012 von http://www.drk.de/ueber-uns/auftrag/grundsaetze.html
Deutsches Rotes Kreuz. (2011). Grundlagenpapier zur strategischen Weiterentiwicklung des DRK 2011 bis 2020. Abgerufen am 24.08.2012 von http://lvsaarland.drk.de/fileadmin/user_upload/Download_allgemein/Grundlagenpapier_finaleFassung_2011_09_21.pdf
Diakonie Hamburg. (2013). Interkulturelles Café. Abgerufen am 13.04.2012 von http://www.diakoniehamburg.de/web/rat-und-hilfe/migration/Interkulturelles-Caf
Diakonie . (1997). Leitbild der EKD. Abgerufen am 22.08.2012 von http://www.diakonie.de/Leitbild_DWEKD.pdf
Dill, A. (2012). Gemeinsam sind wir reich. München: Okoem Verlag.
Dollezal, D. (2008). Gemeinsamer Unterricht für alle? Schriften aus dem Institut für Rehabilitationswissenschaften. Berlin.
Dore-Stein, A. (2011). Inklusive Schule in Kanada. In K. Ziemen, A. Langner, A. Köpfer, & S. Erbring, Inklusion - Herausforderungen, Chancen und Perspektiven (S. 93-109). Hamburg: Dr. Kovac.
Dux, G. (2006). Kritik der Gleichheit - Inklusion und Integration als Postulat der Gerechtigkeit. Frankfurt: Campus Verlag
Eichholz, R. (2009). Gibt es ein Recht auf eine Schule für alle? Abgerufen am 08.5.2013 von http://www.k1-mediendesign.de/eifer/download/BRK-Vortrag-Eichholz_8-5-09.pdf?PHPSESSID=8e723206c4d931f1fbe4abc0b596d3d7
Esping-Andersen, G. (1998). Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Zur politischen Ökonomie des Wohlfahrsstaats. Frankfurt: Campus Verlag.
Fertig, T. (2009). "Freizeit inklusive" - ein saarländisches Projekt. In H. Schwalb, & G. Theunisse, Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit (S. 189-199). Stuttgart: W. Kohlhammer.
Feuser, G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. Behindertenpädagogik Heft 1 , S. 4-48.
Feuser, G. (1995). Behinderte Kinder und Jugendliche . Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Feuser, G. (2000). Zum Verhältnis von Sonder- und Integrationspädagogik - eine Paradigmendiskussion: Zur Inflation eines Begriffes, der bislang ein Wort geblieben ist. In A. H. F. Albrecht, & V. Moser, Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplin und professionsbezogene Standortbestimmung (S. 20-44). Berlin: Luchterhand.
Fink, F. (2011). Der steinige Weg zur Inklusion. In T. H. Franz Fink, Inklusion in der Behindertenhilfe und Psychatrie (S. 13-28). Freiburg: Lambertus Verlag.
Fischer, K. (2012). Kein Mensch ist perfekt. Abgerufen am 22. 5.2013 von blog.kein-mensch-istperfekt.de/behinderte-menschen-muessen-sich-selbst-vertreten/
Flick, U. (2006 ). Qualitative Evaluationsforschung . Reinbeck: Rowohlt.
Forst, R. (2005). Die erste Frage der Gerechtigkeit. Aus Politik und Zeitgeschehen , S. 24-31.
Fuchs-Goldschmidt, I. (2010). Inklusion als Zielpunkt moderner Sozialpolitik. Abgerufen am 08.05 2032 von abp-tutzing.de: http://web.apb-tutzing.de/apb/cms/uploads/media/FUCHSGOLDSCHMIDT_Inklusion_als_Zielpunkt_moderner_Sozialpolitik_01.pdf
Gern, W. (2010). Zeitschrift für Inklusion. Abgerufen am 21.09.2012 von Armut und Ausgrenzung überwinden: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/91/94
Gestrich, A. (2007). Inklusion / Exklusion . Trier: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Goes, T., & Kröcher, U. (2010). Weiterbildung unter den Bedingungen flexibilisierter und zunehmend prekärer Arbeitsverhältnisse. In U. in Kröcher, H. Schwab, Tute, & W. (Hrsg.), Weiterbildung in Unternehmen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Goldschmidt, N. (November/Dezember 2012). Erkundung der Inklusionsfähigkeit der Behinderten und Jugendhilfe in Bremen. Bremen.
Goldschmidt, N. (2011). Ist die bremische inklusive Schule chancengerechter als die mehrgliedrige Schule? - Der Capability Approach und seine Anwendbarkeit auf den Gedanken der Inklusion in dem bremischen Schulgesetz von 2009. Bremen.
Goldschmidt, N. (2008). Quartiersmanagement am Beispiel Bremen Tenevers. Bremen.
Gollwitzer, M., & Jäger, R. S. (2007). Evaluation. Basel: Beltz .
Harvey, C., & Allard, M. (1995). Understandig Diversity. Reading, Cases and exercises. New York: Harper Collins College Publication.
Heimlich, U., & Kahlert, J. (2012). Inklusion in Schule und Unterricht: Wege zur Bildung für alle. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Heinrich Böll Stiftung . (2011). Wege in ein inklusive Arbeitsgesellschaft. Berlin : Heinrich Böll Stiftung.
Heinz Lampert, J. A. (2007). Lehrbuch der Sozialpolitik, 7. Auflage. Berlin: Springer.
Herdel, S. (2011). www.anti-bias-werkstatt.de. Abgerufen am 09.12.2012 von www.anti-biaswerkstatt.de
Hessischer Verwaltungsgerichtshof 7. Senat. (12. 11.2009). Landesrechtssprechungsdatenbank.
Abgerufen am 02.05.2012 von http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/s15/page/bslaredaprod.psml?&doc.id=MWRE100000199%3Ajuris-r01&showdoccase=1&doc.part=L
Hinte, W. (2011). Sozialräume gestalten statt Sondersysteme zu befördern. Teilhabe Ausgabe 3/2011, S. 100-106.
Hinz, A. (2000). Niemand darf in seiner Entwicklung behindert werden - von der integrativen zur inklusiven Pädagogik? In L. Kunze, & U. Sassmannshausen, Gemeinsam weiter.. 15 Jahre integrative Schule Frankfurt (S. 69-82). Frankfurt: Selbstverlag.
Hinz, A. (2004). Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In I. Schnell & A. Sander. Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
Hinz, A. (2006). Inklusion - mehr als nur ein neues Wort?! Lernende Schule 6 - Heft 23 , S. 15-17.
Hinz, A. (2006). Inklusion und Arbeit - wie kann das gehen? . Impulse Nr. 39 , S. 3-12.
Hinz, A. (2009). Vortrag: Aktuelle Erträge der Debatte um Inklusion - worin besteht der ‚Mehrwert' gegenüber Integration. Abgerufen am 08.05.2013 von http://www.nrweineschule.de/sites/default/files/Hinz%20Aktuelle%20Ertraege%20der%20Debatte%20um%20Inklusion.pdf
Hinz, A. (2013). Aktion Mensch. Abgerufen am 17.05.2013 von http://www.aktionmensch.de/presse/hintergrundinformationen/interview_hinz.php
Hinz, A. (2012). Inklusion - historische Entwicklungslinien und internationale Kontexte. In A. Hinz, I. Körner, & U. Niehoff, Von der Integration zur Inklusion (S. 33-52). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
Hinz, A., Körner, I., & Niehoff, U. (2012). Von der Integration zur Inklusion. Marburg: Lebenshilfe Verlag.
Höffe, O. (2005). Soziale Gerechtigkeit - ein Zauberwort? Aus Politk und Zeitgeschehen - 37 , S. 3-6.
Hussy, W. (04 2006). Evaluation und Forschungsmethodik. Köln, NRW, D.
Ianes, D. (2009). Die besondere Normalität - Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung. München: Ernst Reinhardt.
IAW. (2011). Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Abgerufen am 21.07.2012 von Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt: http://www.iaw.uni-bremen.de/ccm/cms-service/stream/asset/?asset_id=995009
Imhäuser, K.-H. (2011). www.montag-stiftung.de. Abgerufen am 12.12.2012 von http://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugendgesellschaft/projektbereich-inklusion/kommunaler-index-fuer-inklusion/vernetzungsveranstaltungkoeln.html
Inklusive Stadt Bremen. (kein Datum). Abgerufen am 01.12.2012 von http://www.inklusive-stadtbremen.de/index.php/impressum/1-workshop
Institut der deutschen Wirtschaft Köln. (2004). Auf den Schultern der Schwachen. Abgerufen am 23.08.2012 von http://ahz-ochs.de/pdf_dateien/IWStudieWohlfahrt.pdf
Integration durch ein aktives Leben. (2008). Barrieren finden und überwinden. Abgerufen am 13.10.2012 von http://www.projekt-ideal.de/fileadmin/Fotoausstellung/barrieren_finden.pdf
Jantzen, W. (2010). Integration und Exklusion. In A. Kaiser, D. Schmetz, P. Wachtel, & B. Wernder, Bildung und Erziehung (S. 96-104). Stuttgart: Kohlhammer.
Jobcenter Bremen. (2011). Jobcenter Bremen. Abgerufen am 01. 05.2013 von http://www.bbabremen.de/documents/Jobcenter_Bremen_AMIP_2011_Stand_22-2-11_1.pdf
Jobcenter Kiel. (2012). Jobcenter Kiel - Arbeitmarktprogramm 2012. Abgerufen am 06.05.2013 von http://www.jobcenterge.de/lang_de/nn_506448/Argen/ArgeKiel/SharedDocs/Publikationen/Arbeitsmarktprogramm_202012,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Arbeitsmarktprogramm%202012
Katzenbach, D. (2007). Vielfalt braucht Struktur. Frankfurt am Main: Kolloquien 12.
Kern, S. (2002). Führt Armut zu sozialer Isolation? Universität Trier.
Keupp, H. (2010). GEW. Abgerufen am 20.08.2012 von Profession braucht Inklusion: http://www.gew.de/Binaries/Binary78118/Pr%C3%A4sentation-Keupp.pdf
Klemm, K. (2010). Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Abgerufen am 27.08.2012 von http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_32811_32812_2.pdf
Klemm, K. (2008). Hans Böckler Stiftung . Abgerufen am 01.04.2013 von http://www.boeckler.de/pdf/pm_stufoe_bab_2008_01_23_klemm.pdf
Knorre, S. (2013). Wie steht es um die Inklusionsbereitschaft der deutschen Bevölkerung? Eine Evaluation der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung. Bremen.
Kowitz, D. (2013). Wie viel anders ist normal? Die Zeit vom 29.3.2013. Ausgabe 13/2013.
Krach, S. (2010). Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe durch stadtteilorientierte Netzwerkarbeit. In A.-D. Stein, S. Krach, & I. Niediek, Integration und Inklusion auf dem Weg ins Gemeinwesen (S. 78-88). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Kron, M. (2009). Einführung. In Jo Jerg, K. Merz-Atalik, R. Thümmler, & H. Tiemann, Perspektiven auf Entgrenzung (S. 14). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Kronauer, M. (2012). Die neue soziale Frage: Ausgrenzung in der Stadt heute. In H. Keupp, R. Rudeck, H. Schröer, M. Seckinger, & F. S. (Hrsg.), Armut und Exklusion (S. 15-27). Tübingen: Leske & Budrich.
Kugler, T. (2012). Diversity - eine neue Methode im Umgang mit Vielfalt. Ohne Angabe.
Kühn, D. (2005). Sozialplanung und Controlling. In U. Feldmann, & D. Kühn, Steuerungsunterstützung durch Sozialplanung und Controlling (S. 21-24). Berlin: Lambertus.
Kühn, H. (1987). Löst die Anstalten auf. Abgerufen am 12. 12.2012 von http://bidok.uibk.ac.at/library/mabuse_kuehn-anstalt.html
Lüpke, K. v. (2010). Inklusion: eine Frage der Kultur. In H. Wittig-Koppe, F. Bremer, & H. Hansen, Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausgrenzung (S. 38-45). Neumünster: Paranus.
Mann, N. (2006). Freizeit ohne Behinderung? Abgerufen am 21.9.2013 von http://bidok.uibk.ac.at/library/mann-freizeit-dipl.html
Mayrhofer, H. (2009). Soziales Kapital . Abgerufen am 13. 11.2012 von http://www.sozialeskapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/108/145.pdf
Meijer, C. J., Pijl, S. J., & Hegarty, S. (12. 10 2012). Introduction. Abgerufen am 01.06.2013 von http://bidok.uibk.ac.at/library/sander-inklusion.html#ftn.id770205
Merkel, W. (2012). Friedrich Ebert Stiftung. Abgerufen am 12.12.2012 von http://library.fes.de/pdffiles/akademie/online/06078.pdf
Meyer, T. (2011). Inklusion von Anfang an. Fellbach.
Meyer, T. (2012). Alles schon inklusive?. Abgerufen am 23.9.2013 von www.jakaka.de/uploads/media/Vortrag_Alles_schon_Inklusive.pdf
Mittendrin e.V. . (2011). Eine Schule für alle: Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
Mittler, P. (2000). Towards inclusive Education. London: Falmer.
Montag Stiftung . (2011). Inklusion vor Ort - der kommunale Index für Inklusion - ein Praxishandbuch. Bonn: Brandenburgische Universitätsdruckerei .
Montag Stiftung. (2010). Montag Siftung. Abgerufen am 06.08.2012 von http://www.montagstiftungen.com/fileadmin/Redaktion/Jugend_und_Gesellschaft/PDF/Projekte/Kommunaler_Index/KommunenundInklusion_Arbeitsbuch_web.pdf
Moser, V. (2012). Die inklusive Schule. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Netzwerk Artikel 3. (2006). Einfach Europa?. Abgerufen am 12.09.2012 von http://www.netzwerkartikel-3.de/dokum/europa_standard_monitor.pdf
Netzwerk Grundeinkommen . (2008). Fragen und Antworten... zum bedingungslosen Grundeinkommen. Abgerufen am 21.12.2012 von https://www.grundeinkommen.de/dieidee/fragen-und-antworten
Netzwerk Leichte Sprache. (2012). Abgerufen am 01. 12.2012 von http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln_Netzwerk_Leichte_Sprache.pdf
Neukirchen, R. (2009). Menschen mit Behindeurng auf dem 1. Arbeitsmarkt - es geht! In H. Schwalb, & G. T. (Hrsg.), Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit (S. 116-124). Stuttgart: Kohlhammer.
Nolte, P. (2005). Soziale Gerechtigkeit in neuen Spannungslinien. Aus Politik und Zeitgeschehen - 28 , S. 16-23.
Nolte, P. (2005). Soziale Gerechtigkeit in neuen Spannungslinien. Aus Politik und Zeitgeschehen , S. 16.23.
Nunner-Winkler, G., Meyer-Nikele, M., & Wohlrab, D. (2006). Integration durch Moral. Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften.
Nussbaum, M. C. (1999). Gerechtigkeit oder das gute Leben. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
Oehme, A. (2011). Inklusion & JUgendsozialarbeit - inklusive Jugendsozialarbeit? dreizehn - Heft 5 , S. 14-17.
Opielka, M. (2008). Sozailpolitik. Hamburg: Rowohlt.
Paireder, K., & Niehaus, M. (2005). Diversity Management als betrieblicher Integrationsansatz für (ausländische) Mitarbeiter/innen mit Behinderung. Heilpädagogik online , S. 4-33.
Pauser, N., & Oinetz, P. (2009). Diversity und / oder Inklusion - Konzepte zur Qualitätsentwicklung in Organisationen?! In J. Jerg, K. Merz-Atalik, R. Thümmler, & H. Tiemann, Perspektiven auf Entgrenzung (S. 247-253). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Pfahl, L., & Powell, J. (2010). Draußen vor der Tür: die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung. Aus Politik und Zeitgeschehen - Heft 23 .
Prengel, A. (2001). Open Access Erziehungswissenschaften. Abgerufen am 26. 12.2012 von Unterschiedlich verschieden: http://www.pedocs.de/volltexte/2010/2621/pdf/Prengel_Annedore_Egalitaere_Differenz_in_der_Bildung_D_A.pdf
Preuss-Lausitz, U. (2002). Integrationsforschung. Ansätze, Ergebnisse, Perspektiven. In H. Eberwein, & S. Knauer, Integrationspädagogik (S. 458-470). Weinheim und Basel : Beltz Verlag.
Rauhes Haus. (2011). Das Konzept des Rauhen Hauses zur Stärkung von Selbstbehauptung und Kompetenzentwicklung. Abgerufen am 12. 12.2012 von http://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Veroeffentlichungen/Kinder-und-Jugendhilfe/Konzeptentwicklung/Konzept_Lebensweltorientierung_01.pdf
Rawls, J. (1975). Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt: Suhrkamp.
Reiser, H. (2007). Inklusion - Vision oder Illusion. In D. Katzenbach, Vielfalt braucht Struktur (S. 99- 108). Johann-Wolfgang-Goethe Universität. Frankfurt.
Reitter, K. (2008). Rainer Roth: Zur Kritik des Bedingungslosen Grundeinkommens. Abgerufen am 20. 12.2012 von http://www.grundrisse.net/buchbesprechungen/rainer_roth.htm
Renner, G. (2009). Bringt die De-Kategorisierung und Entgrenzung der Kategorien der Behinderung Fortschritte bei Partizipation, Integration und Inklusion. In J. Jerg, K. Merz-Atalik, R. Thümmler, & H. Tiemann, Perspektiven auf Entgrenzung (S. 59-56). Bad Heilbrunn : Klinkhardt.
Reynolds, M. (1976). New Perspectives on the instructional cascade. Paper presented at the conference "The least restrictive alternative: a partnership of general and special education". Minneapolis.
Richter, J. (2012). Inklusion als Ansatz für die kommunale Sozialplanung. Leipzig.
Riedel, E. (01 2010). Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihres Falkultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem. Dortmund, NRW: Gemeinsam leben - gemeinsam lernen / Sozialverband Deutschland .
Robeyns, I.: "The Capability Approach: a theoretical Survey", Journal of Human Development, Vol. 6, No. 1, March 2005
Rytina, S. (06. 06 2012). Der Spiegel. Abgerufen am 01.08.2012 von http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/zwang-in-der-psychiatrie-das-letzte-mittel-a-836111.html
Saldern, M. v. (2009). Heterogenität - eine Herausforderung für die Bildung. In Andreas Hinz, Auf dem Weg zur Schule für alle. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Saldern, M. v. (2012). Inklusion: Deutschland zwischen Gewohnheit und Menschenrecht. Books on Demand.
Sanacore, J. (1996). Ingredients for Successful Inclusion. Journal of Adolescent and Adult Literacy , S. 222-226.
Schablon, K.-U. (2010). Community Care: Professionelle unterstützte Gemeinwesenseinbindung erwachsener geistig behinderter Menschen. Marburg: Lebenshilfe Verlag.
Schiedeck, J., & Stahlmann, M. (2010). Neoliberales Inklusionsregime. In H. Wittig-Koppe, F. Bremer, & H. Hansen, Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausgrenzung (S. 78-86). Neumünster : Paranus.
Schimpl-Neimanns, B. (2000). Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Heft 4, Jg 52 , S. 636-669.
Schmidt, M. G. (2004). Wörterbuch zur Politik. Stuttgart: Kröners Verlag.
Schröder, H., Knerr, P., & Wagner, M. (2009). Vorstudie zur Evaluation von Maßnahmen zur Förderung behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.
Schröer, H. (2012). Exklusion, Armut und Migration - Interkulturelle Arbeit als Inklusions- und Integrationsstrategie. In H. Keupp, R. Rudeck, H. Schröer, M. Seckinger, & F. S. (Hrsg.), Armut und Exklusion (S. 45-61). Tübingen: dgvt Verlag.
Schubert, H. (2005). Auf dem Weg zur einer kultursensiblen Altershilfe. In U. Otto, Partizipation und Inklusion im Alter (S. 85-120). Jena: Edition Paideia.
Schumpeter, J. (1950). Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie (Bd. 2. Auflage). München. Ohne Angabe.
Schütz, H. (2009). Neue und alte Regelsteuerung in der deutschen Arbeitsverwaltung. In S. Bothfeld,
W. Sesselmeier, & C. Bogedan, Arbeitsmarktpolitik in der sozialen Marktwirtschaft (S. 163-177). Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften.
Schwarzer, T. (2009). Institut für Arbeit und Wirtschaft. Abgerufen am 08.04.2013 von http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Schwarzer_Huchting_26%203%2009.pdf
Seifert, M. (2006a). Inklusion ist mehr als Wohnen in der Gemeinde. In M. Dederich, H. Greving, C. Mürner, & P. Rödler, Inklusion statt Integration? Heilpädagogik als Kulturtechnik (S. 98-113). Psychosozial Verlag.
Seifert, M. (2006b). Lebensqualität von Menschen mit schweren Behinderungen Forschungsmethodischer Zugang und Forschungsergebnisse . Abgerufen am 13.01.2013 von Inklusion Online: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/7/7
Seifert, M., & Harms, J. (2012). Migration und Behinderung. Teilhabe - Ausgabe 2, Jg 51 , S. 71-78.
Seils, E., & Meyer, D. (19. 12.2012). Hans Böckler Stiftung. Abgerufen am 02.01.2013 von www.boeckler.de/pdf/p_wsi_kinderarmut_2012_12.pdf
Sen, A. (2009). Die Idee der Gerechtigkeit. München: C.H.Beck.
Sen, A. (1979). Equality of what? Abgerufen am 20.5.2013 von http://culturability.fondazioneunipolis.org/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1270288635equalityofwhat.pdf
Sozialgesetzbuch II. Grundsicherung für Arbeitssuchende. Abgerufen am 19.9.2013 von http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbii/1.html
Sozialgesetzbuch III. Arbeitsförderung. Abgerufen am 19.9.2013 von http://www.sozialgesetzbuchsgb.de/sgbiiI/1.html
Sozialgesetzbuch VIII. Kinder- und Jugendhilfe. Abgerufen am 19.9.2013 von http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html
Sozialgesetzbuch IX. Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen. Abgerufen am 19.9.2013 von http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/1.html
Sozialgesetzbuch 12. Sozialhilfe. Abgerufen am 19.9.2013 von http://www.sozialgesetzbuchsgb.de/sgbxii/1.html
SoVD und BAG Selbsthilfe. (2009). Wege zu einem inklusiven Arbeitsmarkt. Köln.
Sowa, F., & Theuer, S. (2010). Vom Subjekt zum Objekt? Die Reform der öffentlichen Arbeitsverwaltung und ihre Konsequenzen für Arbeitslose in Deutschland. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Sozialverband Deutschland. (2012). Behinderung und Armut. Abgerufen am 21.04.2013 von http://vdk.de/cgi-bin/cms.cgi?ID=de25236
Sozialverband Deutschland. (2009). UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen -inklusive Bildung verwirklichen. Abgerufen am 20.05.2013 von http://www.sovd.de/fileadmin/downloads/broschueren/pdf/unbehindertenrechtskonvention_umsetzen.pdf
Speck, O. (2010). Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht - Rhetorik und Realität. München: Ernst Reinhardt.
Spörke, M. (2008). Behindertenpolitik im aktivierenden Staat. Abgerufen am 23. 05.2013 von http://www.upress.uni-kassel.de/online/frei/978-3-89958-419-6.volltext.frei.pdf
Städtische Deputation für Kinder, Jugend, Soziales Bremen. (2013). Soziales Bremen. Abgerufen am 01. 05 2013 von http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Protokol_Stadt_2012-11-08.pdf
Statistisches Bundesamt. (2011). Datenreport 2011. Berlin: Bundeszentrale für politische Bildung.
Stein, A.-D. (2012). Die Bedeutung des Inklusionsgedanken - Dimensionen und Handlungsperspektiven . In A. Hinz, I. Körner, & U. Niehoff, Von der Integration zur Inklusion (S. 74- 90). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
Stichweh, R. (2005). Inklusion und Exklusion. Bielefeldt: transcript.
Stiftung Alsterdorf. (2012). Stiftung Alsterdorf. Abgerufen am 11.12.2012 von http://www.alsterdorf.de/skj/schule_kinder_jugendhilfe__7FD9191EB2F84D03B61741B5DA0C9F34.htm
Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen. (2003). Barrierefreier ÖPNV in Deutschland. Abgerufen am 12.01.2013 von http://www.mobiwissen.de/sites/default/files/barrierefreier_oepnv_in_deutschland.pdf
taz. (27. 01.2010). Schumann: Brigitte: Wenn der Elternwille gegen das Recht der Kinder gestellt wird. Abgerufen am 01.03.2012 von http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bi&dig=2010%2F01%2F27%2Fa0126&cHash=de90a82581/
Theunissen, G. (2011). Brauchen wir stationäre Sonderwelten? In F. Fink, & T. Hinz. Freiburg: Lambertus.
Theunissen, G. (2009). Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und soziale Arbeit. Freiburg: Lambertus-Verlag.
Theunissen, G. (2009). Empowerment und Inklusion durch positive Verhaltensunterstützung. In H. Schwalb, & G. Theunissen, Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit (S. 231-251). Stuttgart: Kohlhammer.
Theunissen, G. (2000). Wege aus der Hospitalisierung . Dortmund: Psychatrie Verlag .
Theunissen, G., & Schwalb, H. (2009). Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Thiel, W. (2007). Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Welfare Mix. Abgerufen am 02.01. 2013 von Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen: http://www.nakos.de/site/data/DAGSHG_shgJB2007_Thiel_BE_Welfaremix.pdf
UN. (2006). UN Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung. New York.
UNESCO - Forum Menschenrechte. (2011). Menschenrechte und frühkindliche Bildung in Deutschland 2011.
UNESCO. (2005). Guidlines for inclusion. Paris. Unesco. (06 1994). http://www.unesco.org/. Abgerufen am 18.02.2013 von http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
United nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2008). International Conference on Education: Forty-eighth session. Geneva. Abgerufen am 30.9.2013 von unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182999e.pdf
Unterberger, C. (2009). Peer Counseling - Beratung von Menschen mit Behinderung.Diplomarbeit. Abergerufen am 12.9.2013 von http://othes.univie.ac.at/4938/
Verein für Sozialplanung e.V. (2012). Inklusive Sozialplanung. Speyer.Abergerufen am 12.9.2013 von www.vsop.de/files/PP_2012__Inklusive_Sozialplanung.pdf
Wacker, E. (2006). Umgang mit Vielfalt, ressourcenförderliche Umwelten und die Konstruktion der "Behinderung" nach dem ICF. Kassel.Abergrufen am 12.9.2013 von http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/18437/ssoar-2008-wackerumgang_mit_vielfalt.pdf?sequence=1
Wasel, W. (2012). Inklusion - eine strategische Herausforderung für Sozialunternehmen. Teilhabe 2 / 2012, Jg. 51 , S. 85-89.
WHO. (2001). Internationale Klassifikation der Funktionsfähgikeit, Behinderung und Gesundheit. Abgerufen am 12. 2.2013 von http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf
WHO. (2001). www.who.org . Abgerufen am 20.07.2012 von http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf
Wilhelm, M., Eggertsdóttir, R., & Marinóssen, G. L. (2006). Inklusive Schulentwicklung. Beltz Sonderpädagogig Verlag .
Windolf, P. (2009). Inklusion und soziale Ungleichheit. In R. Stichweh, & P. Windolf, Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit (S. 11-28). Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften.
Wocken, H. (2012). Das Haus der inklusiven Schule . Hamburg: Wertdruck.
Wocken, H. (2010). Über Widersacher der Inklusion und ihre Gegenreden. Aus Politik und Zeitgeschehen - Ausgabe 23 , S. 23-35.
Wunder, M. (2011). Die deutsche Liga für das Kind. Abgerufen am 12. 1.2013 von http://ligakind.de/fruehe/611_wunder.php
Wunder, M. (2010). Inklusion - nur ein anderes Wort oder ein anderes Konzept. In H. Wittig-Koppe, & H. H. Fritz Bremer, Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausgrenzung (S. 22-37). Neumünster: Paranus.
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden. (2011). ZWST.org. Abgerufen am 22.08.2012 von http://zwst.org/cms/documents/110/de_DE/Zedaka%20-%20Leitbild.pdf
ZWST. (2010). Perspektivwechsel. Abgerufen am 26.08.2012 von http://www.zwstperspektivwechsel.de/pdf/pw-broschuere-methodenbuch-web.pdf
Hiermit versichere ich, dass ich die hier vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe. Alle Quellen und Hilfsmittel, die ich verwendet habe, sind entsprechend kenntlich gemacht.
Wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen übernommene Stellen sind als solche deutlich
erkennbar und mit einem Verweis auf die Originalquelle versehen.
Bremen, Juni 2013 Nikolai Goldschmidt
Quelle:
Nikolai Goldschmidt: Inklusion als sozialpolitischer Imperativ? - Wo liegen die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland?: Universität Bremen: Masterarbeit am Zentrum für Sozialpolitik; September 2013;
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 04.03.2014
