Die Bewertung freizeitpädagogischer Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung durch deren Eltern
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät der Philosophie und Bildungswissenschaft, Wien
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Der Begriff "Geistige Behinderung"
- 3. Zur Bedeutung der Freizeitpädagogik
- 4. Exkurs: Zur Lebenssituation von Familien mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern
-
5. Freizeitgestaltung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
- 5.1 Freizeitbedürfnisse
- 5.2 Erschwernisse
- 5.3 Empirische Studien zur Freizeitgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.4 Reisen, Urlaub und Tourismus
- 5.5 Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen in der Freizeit
- 5.6 Die Rolle der Eltern und des unmittelbaren sozialen Umfeldes bei der Freizeitgestaltung
- 5.7 Schlussfolgerungen
-
6. Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung
- 6.1 Angebotsformen
- 6.2 Angebotsbereiche
- 6.3 Ansprüche an freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung
- 6.4 Gestaltung und Planung von Freizeit- und Ferienangeboten
- 6.5 Kontaktaufnahme zwischen Angebot und Eltern
- 6.6 Erreichbarkeit als Leitprinzip
- 6.7 Integration im Rahmen von Ferien- und Freizeitangeboten
- 6.8 Schlussfolgerungen
- 7. Eltern-Interviews: Datenerhebung und -auswertung
-
8. Auswertung der Eltern-Interviews zum Thema Freizeitgestaltung und Ferienangebote
-
8.1 Freizeitgestaltung
- 8.1.1 Elterliche Auffassungen von "Freizeit" bzw. "Freizeitgestaltung"
- 8.1.2 Die Freizeitsituation in der Familie
- 8.1.3 Freizeitgestaltung in der Familie
- 8.1.4 Freizeitgestaltung außerhalb der Familie
- 8.1.5 Feriengestaltung
- 8.1.6 Freizeitaktivitäten
- 8.1.7 Freizeit in Verbindung mit Therapien, Förderungen und Rehabilitationsmaßnahmen
- 8.2 Integration im Freizeitbereich
- 8.3 Ferienangebote
-
8.1 Freizeitgestaltung
- 9. Resümee und Ausblick
- 10. Literaturverzeichnis
- 11. Anhang
- 12. Lebenslauf des Autors
Freizeit ohne Behinderung für Menschen mit Behinderung? Utopie oder ernstzunehmende Möglichkeit? Menschen mit Behinderungen sehen sich in weitgehend allen Lebensbereichen mit Einschränkungen, Barrieren und Ausgrenzungen konfrontiert, sei es mangelnder Rücksichtnahme oder aus mutwilliger Diskriminierung. Dieser Sachverhalt zieht sich auch in den Lebensbereich der Freizeit, der in Zusammenhang mit dem Phänomen "Behinderung" im Gegensatz zu Schule und Arbeitsleben bisher noch wenig Beachtung gefunden hat. Menschen mit Behinderung und vor allem Menschen mit Einschränkungen im intellektuellen Bereich gelten in diesem Bereich als wenig beachtete Randgruppe. Aus diesem Grund ist es notwendig auch im wissenschaftlichen Diskurs eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik anzustreben. In Form dieser Diplomarbeit geschieht dies mit besonderem Augenmerk auf Ferienangebote für als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche.
Im Laufe meiner mehrjähriger Erfahrung im Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wurde ich immer wieder mit für diesen Bereich spezifischen Problematiken konfrontiert, was mich schließlich dazu bewog meine Abschlussarbeit für das Studium der Sonder- und Heilpädagogik diesem Thema zu widmen. Es ist mir ein Anliegen in der Forschungsarbeit zu dieser Diplomarbeit mehr Licht in die teilweise noch sehr dunklen Gebiete dieser Problematik zu bringen und vielleicht auch damit zu positiven Veränderungen und Weiterentwicklungen beizutragen. Mein spezieller Dank gilt dabei den Eltern, die mich bei meinen Untersuchungen unterstützten. Bereitwillig stellten sie mir Zeit und Informationen zur Verfügung und zeigten sich an meinem Vorhaben sehr interessiert. Darüber hinaus danke ich weiter Herrn Dr. Gottfried Biewer, der ebenfalls Vertrauen in mein Vorhaben setzte und die wissenschaftliche Betreuung und Begleitung dieser Diplomarbeit übernahm.
Nikolaus Mann (Wien, Oktober 2006)
In der nun folgenden Einleitung wird die Grundthematik dieser Diplomarbeit angerissen und die darauf aufbauende Forschungsfrage sowie die Forschungsmethodologie und -methode vorgestellt. Die dieser Arbeit grundlegende Literatur wird in kurzer Form dargestellt und abschließend der Aufbau der Diplomarbeit mit bündigen Beschreibungen der jeweiligen Teile geschildert. Zu Beginn dieses Kapitels steht nun die Fragestellung. Anschließend wird in einer Hinführung zu dieser Fragestellung die Entstehung dieser Forschungsfrage genauer beleuchtet.
Fragestellung
Wie werden institutionalisierte freizeitpädagogische Ferienangebote für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung von deren Eltern wahrgenommen?
Hinführung zur Fragestellung
Die grundlegende Thematik dieser Diplomarbeit ist das Angebot an institutionalisierten Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Als Auswahlkriterium für das Alter der Zielgruppe dieser Diplomarbeit ist der Schulbesuch gewählt, da sich dadurch in Österreich eine relativ gut abgrenzbare Altersgruppe ergibt. Freizeit-bzw. Ferienaktivitäten als Untersuchungsgegenstand dieser Diplomarbeit stellen einen von der Schule getrennten Lebensbereich dar. Schule bildet durch den gesetzlich vorgeschriebenen und verpflichtenden Besuch eine eigene Lebenssphäre, die somit auch gut von dem Lebensbereich der Freizeit, auf den sich die Fragestellung dieser Diplomarbeit konzentriert, zu trennen ist. Vor Eintritt in die Schule ist dieser Bereich durch teilweise sehr unterschiedliche Tages- und Jahresstrukturen von Kindern mit geistiger Behinderung schwerer von anderen Lebensbereichen zu abzugrenzen. Nach dem Schulaustritt und durch den Eintritt in das Arbeitsleben (z.B. betreute Werkstätten) wird die arbeitsfreie Zeit in der Regel eher individuell eingeteilt und kann deshalb nicht eins zu eins mit Schulferien während der Schulzeit verglichen werden. Ferienangebote als spezifische Freizeitaktivitäten werden dabei als ein Lebensbereich angesehen, der in der als schulfrei deklarierten Zeit des Jahres stattfindet und unter dem Schuljahr nicht im selben Maß oder der selben Form erfolgt.
Das Freizeitverhalten von Kindern und vor allem von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung hängt eng mit Lebensstil und Lebensgewohnheiten der Eltern zusammen (vgl. Flieger 2000, 54ff). Dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung mehr noch als Kinder und Jugendliche ohne Behinderung bei der Gestaltung ihrer Freizeit von der Unterstützung ihrer Eltern abhängig sind. Durch einen gewissen Mangel an außerfamiliären bzw. professionellen Unterstützungen bei der Organisation, Gestaltung und Erreichung von Freizeitaktivitäten (vgl. ebd., 44ff) sind Eltern oft dazu gezwungen diese Aufgaben selbst zu übernehmen, auch wenn sie durchaus dazu bereit wären diese Angelegenheiten abzugeben. Dies bedeutet einen zusätzlichen Zeit-und Arbeitsaufwand für die Eltern, der zeitweise das Maß des Machbaren überschreitet. Für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung heißt die diesbezügliche Abhängigkeit von den Eltern, dass ihre Freizeitgestaltung weitgehend durch Motivation, Geschmack, Organisationstalent und Zeitressourcen der Eltern geprägt ist, auch wenn die Eltern bemüht sind ihre Kinder in die Auswahl der Freizeitaktivitäten miteinzubeziehen (vgl. ebd., 54ff). Aus diesem Grund spielen Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in der Forschungsarbeit dieser Diplomarbeit eine wichtige Rolle. Durch die Einbeziehung von Eltern in Form von qualitativen Interviews soll ihre Bewertung von freizeitpädagogischen Ferienangeboten verdeutlicht und mögliche Ansatzpunkte für Änderungen und Verbesserungen herausgearbeitet werden. Die im Normalfall sehr ausgeprägte Einbindung der Eltern in die Freizeitgestaltung ihrer Kinder mit geistiger Behinderung ermöglicht es, durch Interviews eine guten Einblick in die Freizeitsituation von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und ihre diesbezügliche Abhängigkeit von den Eltern zu erlangen.
Diese Aspekte und die Tatsache, dass die elterliche Perspektive im Rahmen institutionalisierter freizeitpädagogischer Ferienangebote bisher nur wenig untersucht wurde, bewogen mich dazu die Fragestellung, die als grundlegende Basis für die gesamte Diplomarbeit gilt, wie zuvor angeführt, auszurichten. Im Laufe dieser Diplomarbeit wird auch auf Teilbereiche dieser Thematik eingegangen. So wird untersucht, welchen Anteil Eltern geistig behinderter Kinder an der Organisation der Freizeitaktivitäten ihrer Kinder haben und weiters ebenfalls darauf eingegangen, welche Bedeutung institutionalisierten freizeitpädagogischen Ferienangebote für Eltern teilnehmender Kinder und Jugendlicher mit geistiger Behinderung haben. Auch mögliche Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge von elterlicher Seite aus werden in dieser Diplomarbeit berücksichtigt.
Grundlegende Literatur - aktueller Forschungsstand
Ein großer Teil dieser Diplomarbeit stützt sich auf aus der wissenschaftlichen Fachliteratur zur Forschungsfrage gewonnene Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Verständnis von "Behinderung" und "Freizeitpädagogik", wie es in dieser Arbeit gebraucht wird. Wissenschaftliche Literatur spiegelt dabei den aktuellen Forschungsstand zu diesen Thematiken wider. Weiters ist wissenschaftliche Literatur grundlegend für den empirischen Teil dieser Diplomarbeit. Die in der Literatur angeführten Ansichten zu relevanten Themen nahmen Einfluss auf die Gestaltung des für die empirischen Untersuchungen dieser Arbeit notwendigen Interviewleitfadens und sind auch in der schlussendlichen Zusammenführung von Ergebnissen aus der Forschungsarbeit und Erkenntnissen aus der Fachliteratur von Bedeutung. Des weiteren wurde auch zur Ausformung des methodischen Vorgehens fachspezifische Literatur herangezogen.
Im Hinblick auf die Methodologie der qualitativen Sozialforschung liegen dieser Diplomarbeit zwei Handbücher zugrunde. Einerseits das Lehrbuch "Qualitative Sozialforschung" von Siegfried Lamnek (2005), in dem in aufbauender Herangehensweise auf verschiedene Aspekte und Methoden der Qualitativen Sozialforschung eingegangen wird und in dem ein Kapitel explizit qualitativen Interviews gewidmet ist, die in der Forschung zu dieser Diplomarbeit einen wichtigen Platz einnehmen. Andererseits wurde das umfassende von Uwe Flick, Ernst Kardorff und Ines Steinke (2000) herausgegebene Handbuch "Qualitative Forschung" herangezogen, in dem verschiedene Autoren zu verschiedenen Thematiken qualitativer Forschung Aufsätze veröffentlichen. Zur Thematik des episodischen Interviews als spezielle Form des qualitativen Interviews wird im Rahmen dieser Diplomarbeit neben dem Lehrbuch von Lamnek auch das Werk "Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften" von Uwe Flick (1995) sowie die Studie "Psychologie des technisierten Alltags" ebenfalls von Uwe Flick (1996) als Grundlage verwendet.
Die Begriffsklärung von "geistige Behinderung" stützt sich zu großen Teilen auf das Werk "Soziologie der Behinderten. Eine Einführung" von Günther Cloerkes (2001), der in diesem Buch die Thematik "Behinderung" in soziologischer Perspektive aufrollt und dabei alle wesentliche Bereiche im Leben behinderter Menschen abdeckt. So wird in diesem Buch auch ausführlich auf die Thematik "Freizeit behinderter Menschen" bezug genommen, was im Hinblick auf die Fragestellung dieser Diplomarbeit von großer Relevanz ist.
Bezüglich "Freizeit" und "Freizeitpädagogik" nimmt diese Diplomarbeit zu großen Teilen bezug auf den Freizeit- und Tourismusforscher Opaschowski und sein Werk "Pädagogik der freien Lebenszeit" (1996), in dem das Handlungsfeld Freizeit und die damit in Verbindung stehende Pädagogik sehr genau beleuchtet werden.
Bezüglich der Freizeitgestaltung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen stützt sich diese Diplomarbeit auf die sozialwissenschaftliche Studie "Freizeit mit Hindernissen. Wie Kinder mit Behinderung ihre Freizeit erleben, die Sicht ihrer Eltern und was Anbieter von Freizeitaktivitäten dazu sagen" von Petra Flieger (2000), die im Rahmen des "Berichts zur Lage der Kinder 2000" der katholischen Jungschar herausgebracht wurde. Die Autorin begleitete im Rahmen dieser Studie in Form von teilnehmender Beobachtung sieben Kindern mit geistiger Behinderung in unterschiedlichen Freizeitsituationen und führte Interviews mit Mitarbeitern von Anbieterorganisationen aus dem Freizeitbereich durch.
Im Laufe dieser Diplomarbeit wird abschnittsweise auch auf eine Reihe weiterer wissenschaftlicher Werke bezug genommen, die hier aus Platzgründen jedoch nicht explizit angeführt werden.
Forschungsmethodologie - Qualitative Sozialforschung
Methodologisch stützt sich diese Diplomarbeit neben der eben beschriebenen Literaturrecherche und den daraus gewonnenen Erkenntnissen auf qualitative Sozialforschung in Form von qualitativen Interviews. Qualitative Forschung hat den Anspruch Lebenswelten aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Ziel dabei ist es ein besseres Verständnis sozialer Wirklichkeiten durch das Eingehen auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale zu ermöglichen. Qualitative Sozialforschung zielt auf genaue und dichte Beschreibungen von Sachverhalten ab, um dadurch erweiterte Möglichkeiten von Erkenntnis zu schaffen. Ein Charakteristikum dabei ist die Offenheit für Neues, Unbekanntes und andere Erfahrungswelten, wodurch ebenfalls die Gewinnung neuer Erkenntnisse begünstigt wird. Die Zugangsweisen in dieser Forschungsrichtung gelten als offener als andere Forschungsstrategien die mit größeren Fallzahlen stärker standardisiert, objektiviert und normativ arbeiten (z.B. quantitative Forschung). Durch die Berücksichtigung der Sichtweisen der beteiligten Subjekte und deren subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Welt bildet die qualitative Forschung ein weitaus plastischeres und konkreteres Bild aus der Perspektive der Betroffenen als die meisten anderen Forschungsrichtungen (vgl. Flick, u.a. 2000, 14ff).
Die Forschungsmethodologie der qualitativen Forschung scheint zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes dieser Diplomarbeit dahingehend relevant zu sein, indem sie auf das Verständnis sozialer Wirklichkeiten abzielt. So gesehen bietet sie eine gute Herangehensweise, um die elterliche Wahrnehmung von freizeitpädagogischen Ferienangeboten befriedigend zu erforschen und wiederzugeben. Ein weiterer Grund für die Entscheidung für qualitative Forschungsmethoden ist die Ermöglichung neuer Erkenntnisse durch die weitgehend offene Form dieser Methodologie. Da es zu dem Forschungsgebiet dieser Diplomarbeit bis dato verhältnismäßig wenige wissenschaftliche Studien und Ergebnisse gibt, scheint qualitative Forschung geeignet neue und bisher vielleicht noch nicht berücksichtigte Aspekte aufzuzeigen.
Qualitative Sozialforschung stützt sich in ihrer Praxis auf verschiedene Grundannahmen und ist durch verschiedene Kennzeichen geprägt. Sie orientiert sich stark am Alltagsgeschehen und Alltagswissen der Untersuchten. Die Daten werden zu diesem Zweck in ihrem natürlichen Kontext bzw. in einer von den Befragten ausgewählten Umgebung erhoben. Kennzeichnend für qualitative Sozialforschung ist auch das Abzielen auf ein Verstehen von eher komplexen Zusammenhängen und auf den Nachvollzug anderer Perspektiven. Um dem nachzukommen, sieht sich diese Forschungsmethodologie dem Prinzip der Offenheit verbunden. Im Falle des qualitativen Interviews, das in Kapitel 7.2 dieser Diplomarbeit noch genauer behandelt wird, werden aus diesem Grund Fragen weitestgehend offen formuliert, um weite Räume für Antwortmöglichkeiten zu eröffnen. Aufgrund der oft hohen Datenmengen, die in qualitativen Methoden erhoben werden, geht qualitative Sozialforschung häufig von der Analyse weniger Fälle aus. Das grundlegende Medium qualitativer Forschung sind weitgehend Texte (z.B. transkribierte Interviews), die in verschiedener Weise entstehen können und die Arbeitsgrundlage für weiterführende Analysen und Interpretationen liefern (vgl. ebd., 22ff).
Aufbau der Diplomarbeit
Nach dieser Einleitung werden die zum Verständnis der Thematik notwendigen Diskussionen der beiden Begriffe "geistige Behinderung" und "Freizeitpädagogik" durchgeführt. Eingehend auf den Begriff der "geistigen Behinderung" wird vorerst die defektorientierte Sicht von Behinderung angeführt, die in der Geschichte dieses Begriffs lange Zeit eine führende Rolle einnahm. In dieser Ansicht werden durch Behinderung bedingte Defizite und Abweichungen von einer als Standard angenommenen Norm in den Mittelpunkt gestellt. Dem wird unter Stützung auf Cloerkes, Theunissen und Feuser die Auffassung von "geistiger Behinderung" als eine "soziale Etikette" entgegengestellt. In dieser Ansicht wird Behinderung als eine Kategorie wahrgenommen, die im gesellschaftlichen Kontext durch Normvorstellungen und Abgrenzungsmechanismen entsteht. Darüber hinaus werden auch international anerkannte Definitionen bezüglich Behinderung werden behandelt. Dazu wird die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgebrachte "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" genauer beleuchtet und die darin enthaltenen Aspekte bezüglich Behinderung und geistiger Behinderung herausgearbeitet. Darauf folgend werden auch einige rechtliche Auffassungen von "Behinderung" geschildert, um einen Einblick in gesetzlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderung zu bieten. Darüber hinaus werden statistische Daten über Menschen mit Behinderung bzw. Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung dargebracht. Da es jedoch wenig eindeutige Daten auf diesem Gebiet gibt, stützt sich ein Großteil der angeführten Daten auf Schätzungen.
Um an den Begriff der "Freizeitpädagogik" heranzugehen wird vorerst der zugrundeliegende Begriff der "Freizeit" abgeklärt. Dabei wird auf die geschichtliche Entwicklung von Freizeit eingegangen und auch Theorien zur zukünftigen Entwicklungen im Freizeitbereich dargebracht. Mit dieser Basis wird Opaschowskis Auffassung von Freizeit als "Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" geschildert und verschiedene auf Freizeit bezogene Bedürfnisse angeführt. Nach der Diskussion des zugrundeliegenden Begriffs der "Freizeit" wird das Gebiet "Freizeitpädagogik" von seinen geschichtlichen Wurzeln bis hin zum aktuellen Stand in seinen verschiedenen Facetten nachvollzogen. Schließlich wird hier dann noch "Freizeitpädagogik" in Verbindung mit dem Phänomen "geistige Behinderung" gesetzt.
Nach der Behandlung dieser beiden für die Thematik dieser Diplomarbeit essentiellen Begriffe wird in einem Exkurs auf die Lebenssituation von Familien mit als geistig behinderten Kindern eingegangen. Die Lebenssituation der Familien wirkt sich umgehend auch auf die Freizeitsituation der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung aus. Deshalb findet auch dieser Bereich in dieser Diplomarbeit Platz. Die Lebenssituation von Familien mit geistig behinderten Kindern wird in diesem Kapitel anhand verschiedenen Komponenten wie die soziale Lage der Familien, die Rolle des behinderten Kindes in den Familien, die Einbettung der Familien in das soziale Umfeld und der finanziellen Situation der Familien beschrieben.
Anschließend wird die Freizeitgestaltung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung näher betrachtet. Dabei werden generelle Aspekte der Freizeitsituation von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung sowie die Rolle der Eltern bei der Freizeitgestaltung beleuchtet. Es werden diesbezügliche Bedürfnisse wie durch Behinderungen entstehende Erschwernisse angeführt. In diesem Kapitel finden auch eine Reihe empirischer Studien zum Freizeitverhalten geistig behinderter Menschen Beachtung. Darüber hinausgehend wird auch das oft unklare Verhältnis zwischen Therapien und Freizeit behandelt.
Schließlich werden Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung als Grundthematik dieser Diplomarbeit behandelt. Es werden dabei verschiedene Angebotsformen und -bereiche und deren Organisation und Planung beleuchtet. Auf Ansprüche, die von verschiedenen Seiten an diese Angebote gestellt werden, wird ebenfalls eingegangen. Die Kontaktaufnahme mit und die Erreichbarkeit von Freizeit-und Ferienangeboten finden in diesem Kapitel als eine gewichtige Problematik Platz. Abschließend wird auch das Thema "Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher bei Freizeit-und Ferienangeboten" in den Blickpunkt gerückt, welches vor allem in den letzten Jahren in der öffentlichen Diskussion immer mehr Beachtung findet.
Auf dieser Grundlage werden danach im Rahmen des empirischen Teils dieser Diplomarbeit die durchgeführten qualitativen Interviews mit Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher behandelt und analysiert. Dazu wird die Auswahl der Fälle offengelegt und Datenerhebung sowie Datenauswertung beschrieben. Daran anschließend werden die Ergebnisse der Analyse in der Auswertung der Eltern-Interviews dargebracht. Die Daten werden dabei in die drei Gebiete "Freizeitgestaltung", "Integration im Freizeitbereich" und "Ferienangebote" unterteilt. Diese Themengebiete stellen die Schwerpunkte dar, die in den qualitativen Interviews mit den Eltern am meisten Gewicht hatten und zu denen die meisten Informationen preisgegeben wurden.
Den Abschluss des inhaltlichen Teils der Diplomarbeit bildet das Resümee und der Ausblick, in dem die im Laufe der Arbeit hervortretende Aspekte und Erkenntnisse nochmals explizit angesprochen und zusammenfassend wiedergegeben werden. In diesem Kapitel werden die gewonnenen Daten interpretiert und bis zu einem gewissen Grad verallgemeinert, um daraus Tendenzen allgemein gültiger Auffassungen ableiten zu können, aus diesen dann Hypothesen gefolgert werden. Dies geschieht im Hinblick auf die in der Einleitung gestellten Fragestellung. Auf die Hypothesen aufbauende werden zum Abschluss Denkanstöße dargebracht und Ansätze für neue Forschungsansätze genannt.
Das folgende Kapitel stellt nun den Beginn der Begriffsklärungen zu dieser Diplomarbeit dar, indem das Phänomen "Geistige Behinderung" genauer beleuchtet wird.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel wird nun auf den Begriff der "Geistigen Behinderung" eingegangen, der ein komplexes Phänomen widerspiegelt. Der Komplexität des Phänomens entsprechend gibt es auch vielerlei Auffassungen, was die Bedeutung dieses Begriffes betrifft. In der Folge wird nun ein kurzer Überblick über die vorherrschenden Meinungen geboten.
"Es ist das Menschenbild in unseren Köpfen, das die gesellschaftliche Praxis hervorbringt, die ihrerseits wiederum das Menschenbild konstituiert wie modifiziert." (Feuser 1996, 2, online im WWW). Es ist also das Menschenbild und im Falle von Menschen mit Behinderung auch das Behinderungsbild, das handlungsleitend für den Umgang innerhalb der Gesellschaft mit dieser Personengruppe ist. Das Bild einer Person in den Köpfen der Menschen in ihrer Umgebung hat direkte Folgen für das gesellschaftliche Leben dieser Person (vgl. ebd.). Dies kann sich sowohl positiv als auch negativ auswirken. Wie aus dem oben angeführten Zitat ebenfalls hervorgeht ist dieses Menschenbild, wie es in den Köpfen kursiert, auch kein fixes, sondern wird im Laufe der Zeit und damit dem gesellschaftlichen Umgang mit diesem Bild immer wieder und weiter verändert. Setzt man diese Aspekte in Verbindung mit dem Begriff "Geistige Behinderung" bedeutet dies, dass die jeweilige Auffassung dieses Begriffs direkte Folgen für das Menschenbild und in weiterer Folge auch für den Umgang mit als "geistig behindert" bezeichneten Personen hat.
Durch die über die Jahre immer weitergeführte Modifizierung dieses Begriffs in verschiedenen Fachrichtungen ist eine gewisse Diffusion entstanden, was die Bedeutung von "Geistige Behinderung" betrifft. Durch die verschiedene Modifizierungen gibt es keinen einheitlichen, allgemein anerkannten Behinderungsbegriff, an dem man sich orientieren kann (vgl. Sander 1997, 99; Rosenkranz 1998, 11). In Anbetracht dessen scheint es von Bedeutung zu klären, mit welchem Verständnis von "Geistiger Behinderung" im Rahmen dieser Diplomarbeit in den Diskurs eingetreten wird. Deshalb werden in weiterer Folge dieses Kapitels einige Auslegungen des Begriffs "Geistige Behinderung" dargelegt und letztendlich ein für diese Diplomarbeit relevanter und gültiger Begriff abgesteckt. Dabei wird auf die über lange Zeit präsente Anbindung "Geistiger Behinderung" an Defizite und Defekte eingegangen und darauf aufbauend auf aktuelle Auffassungen dieses Begriffs hingeführt, die von dieser Ansicht Abstand nehmen. Letztendlich werden noch internationale und rechtliche Definitionen sowie statistische Daten dargebracht, um den Blick auf die derzeitige Situation von Menschen mit geistiger Behinderung zu erweitern.
Um an den Begriff der "Geistigen Behinderung" heranzuführen werden hier folgend kurz einige defizit-und defektorientierte Auffassungen des zugrunde liegenden Begriffs der "Behinderung" angeführt, dessen Definition auch immer Auswirkungen auf den darauf aufbauenden Begriff der "Geistigen Behinderung" hat. Der Terminus "Behinderung" wird erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts als eigenständiger Begriff in Rechts- und Alltagssprache gebraucht. Eine der frühesten sonderpädagogischen Begriffsdefinitionen stammt aus dem Jahre 1969 und sieht Behinderung folgendermaßen: "Behinderung sind individuale Beeinträchtigungen, die umfänglich (d.h. mehrere Lernbereiche betreffend) und schwer (d.h. graduell mehr als ein Fünftel unter dem Regelbereich liegend) und langfristig (d.h. in zwei Jahren voraussichtlich nicht dem Regelbereich anzugleichen) sind." (Bach 1975, zit. n. Sander 1997, 101). Behinderung wird hier in einer defektorientierten Sicht personorientiert am behinderten Menschen selbst festgemacht. Die Einordnung "Behinderung" gilt dabei als eine individuelle Kategorie, die an einem objektivierbaren Defekt fixiert wird. Das Behindertsein wird demnach als ein persönliches, unabhängiges und hinzunehmendes Schicksal gesehen und so werden in dieser an Naturwissenschaft und Medizin orientierten Vorgehensweise die Ursachen der Behinderung in der betroffenen Person selbst gesucht (vgl. Cloerkes 2001, 9).
In einer defizitorientierten Sichtweise von Behinderung steht ein an Defizite und Heilen gebundenes Menschenbild im Mittelpunkt, in dem biologische bzw. körperliche Aspekte einen hohen Stellenwert einnehmen. Mit der Orientierung an Defekten und Defiziten und damit auch Negativzuschreibungen gehen in der Regel Etikettierungs- und Aussonderungsprozesse zum Nachteil von Menschen mit Behinderung einher. Medizinische Diagnosen und Prognosen gelten dabei als besonders wichtig und biologische Faktoren treten über ein vertretbares Maß hinaus in den Vordergrund. Personen mit Behinderung werden in der defizitorientierten Sicht an Normen von Menschen ohne Behinderung gemessen und das Wort "Behinderung" ist als Abweichung von einem als normal geltenden Zustand negativ besetzt. ProfessionalistenInnen, die nach dieser Auffassung arbeiten, versuchen behinderte Menschen an diese Norm heranzubringen. Die Beseitigung der Schädigung und damit der Abweichung vom "Normalzustand" tritt ins Zentrum des professionellen Umgangs mit behinderten Menschen (vgl. Flieger 2000, 18f).
Bei Menschen mit (schwerer) geistiger Behinderung führte in der Vergangenheit diese Defekt- und Defizitorientierung häufig zu einer psychiatrisch-nihilistischen Haltung auf Seiten der ProfessionalistInnen. In einer medizinischen Orientierung wurde geistige Behinderung als statische und zukunftslose Form menschlichen Daseins ohne Chance auf Veränderung bzw. Verbesserung gesehen, was von Begriffen wie "Bildungsunfähigkeit" untermauert wurde. Menschen mit geistiger Behinderung wurde somit das Recht auf Förderung, Weiterbildung und Entwicklung verweigert. Dass sich eine solche Sichtweise leider bis in die jüngste Vergangenheit zieht, kann daran erkannt werden, dass geistig schwerstbehinderte Kinder bis vor nicht allzu langer Zeit aufgrund von ärztlich bescheinigter "Schulbildungsunfähigkeit" vom Schulunterricht befreit wurden. Hier schlägt ein therapeutischer Nihilismus durch, der Menschen mit geistiger Behinderung das Recht und die Möglichkeit auf Weiterbildung und Weiterentwicklung abspricht (vgl. Theunissen 2000b, 17f).
Bezogen auf den Begriff der "Geistigen Behinderung" setzte in den 1950er Jahren die Elternvereinigung "Lebenshilfe" eine fachliche Diskussion in Gang. Ziel dabei war es an die anglo-amerikanische Terminologie der "mental retardation" anzuschließen und Begriffe wie "Schwachsinn", "Idiotie" und "Blödsinn" aufgrund ihrer negativen Behaftung aus dem Fachvokabular zu streichen (vgl. Theunissen 2000b, 13). In der Folge trat dann der Terminus der "Geistigen Behinderung" im deutschsprachigen Raum dem angloamerikanischem Begriff der "mental retardation" gegenüber. Doch auch dieser Begriff war vor negativen und defizitorientierten Aussagen nicht gefeit. So standen lange Zeit Absolutaussagen ("ist unfähig...") und Normabweichungen im Mittelpunkt von Definitionen in Zusammenhang mit "geistiger Behinderung" (vgl. ebd., 18). Personen mit geistiger Behinderung wurden als "hilfebedürftige Mängelwesen" (Theunissen 1999, 98; ders. 2000, 19) gesehen, denen die Fähigkeit zu Autonomie und Selbstständigkeit zu großen Teilen abgesprochen wurde.
Diese Orientierung an Defiziten und Abweichungen fand auch geraume Zeit in der klinischen Psychologie ihren Platz, indem in besonderer Bezugnahme auf Intelligenzquotienten und damit in Verbindung stehenden Tests geistig behinderte Menschen ausschließlich nach ihrer intellektuellen Leistung und der dementsprechenden Abweichung von einer angenommenen Norm beurteilt wurden. Eine ausschließliche Beurteilung nach diesen Tests ist in Frage zu stellen, denn die mit Intelligenztests verbundenen Problematiken durch Implikation herrschender Moralnormen, Ignoranz schichtenspezifischer Sozialisationserfahrungen, sowie Vernachlässigung kreativer, emotionaler und sozialer Kompetenzen sind hinlänglich bekannt (vgl. Theunissen 2000b, 20). Somit sind IQ-Test in alleiniger Form als Beurteilungsinstrument für Menschen mit geistiger Behinderung nicht zulässig.
Generell wurde in der Vergangenheit das Phänomen "Geistige Behinderung" zum Großteil in einer stigmatisierenden und aussondernden Weise betrachtet. Diese Auffassungen ziehen sich in manchen Bereichen bis in die heutige Zeit. In aktuellen Auffassungen wird jedoch das komplexe Phänomen "Geistige Behinderung" in Abkehr von einer defekt-und defizitorientierten Sicht gesehen und angenommen, dass es "unterschiedliche Persönlichkeitsbereiche in individueller Ausprägung berührt, nicht aber das Personsein oder die Subjekthaftigkeit verringert" (vgl. Theunissen 1999, 98). Auf dementsprechende Ansichten wird nun im folgenden Unterkapitel genauer eingegangen.
Der Oberbegriff "Behinderung" und damit auch der ihm untergeordnete Begriff der "geistigen Behinderung" unterliegt gesellschaftlichen Normvorstellungen und Rollenzuschreibungen (vgl. Bundschuh, Heimlich, Krawitz 1999, 39). Dadurch wird diesem Begriff in verschiedenen Disziplinen und damit einhergehend auch verschiedenen Blickwinkeln unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben. Demnach gibt es keine eindeutige und allgemein gültige Definition, was "Behinderung" sei und daraus resultierend befindet sich der Begriff "Behinderung" in einem ständigen wissenschaftlichen Diskurs in dem die Grenzen und Bedeutungen dieses Begriffs immer neu verhandelt werden (vgl. Cloerkes 2000, 3ff; Flieger 2000, 16). Bei der Klärung des Behinderungsbegriffes ist deshalb zu berücksichtigen, dass "Behinderung" eine von Fachdiskurs und Gesellschaft geschaffene Norm darstellt und in dem Sinn nicht als natürliche Gegebenheit betrachtet werden darf.
Rosenkranz sieht "Behinderung" im Sinne von Häußler als Resultat des Zusammenwirkens verschiedener Komponenten: auf der einen Seite die medizinisch feststellbare somatische Beeinträchtigung und auf der anderen Seite die Behinderung aufgrund gesellschaftlicher, sozialer, personaler und ökologischer Bedingungen. Behinderung entsteht somit im sozialen Kontext und damit einhergehend in der Beziehung zur sozialen Umwelt. Behinderung kann also in diesem Zusammenhang als soziales Phänomen bezeichnet werden, das eine bedingte Folge von Beeinträchtigung darstellt. Behinderung ist demnach kein unveränderbares Merkmal einer Person, sondern entsteht durch eine gestörte und ungenügende Integration in die umgebende gesellschaftliche Umwelt (vgl. Rosenkranz 1998, 12).
Sander definiert in ähnlicher Weise einen ökosystemischen Begriff von Behinderung folgendermaßen: "Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch aufgrund einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges Mensch-Umwelt-System integriert ist" (Sander 1988 zit. n. ebd., 13). Ein Mensch gilt demnach also als "behindert", wenn er an seinem gesellschaftlichen Umfeld nur ungenügend oder unbefriedigend teilnehmen kann bzw. die dafür nötige Anerkennung, Hilfe und Unterstützung fehlt. So hängt es von den gesellschaftlichen Normen, Einstellungen, Wertvorstellungen und Vorurteilen ab, ob eine Person als behindert gilt oder nicht. (vgl. ebd.).
Ähnlich definiert Cloerkes Behinderung als eine soziale Kategorie und macht den Begriff nicht mehr an bestimmten körperlichen und psychischen Merkmalen bzw. Normabweichungen fest. Behinderung gilt laut ihm als ein sozialer Bewertungs- und Abwertungsprozess mit den daraus resultierenden Konsequenzen. Als diese möglichen Konsequenzen können bei Betroffenen über die Behinderung hinausgehende Schädigungen und Funktionsstörungen hervorgerufen oder bereits vorhandene weiter verstärkt werden. Cloerkes geht davon aus, dass außergewöhnliche Merkmale bei einer Person Spontanreaktionen und Aufmerksamkeit bei anderen Menschen hervorruft. Durch seine Andersartigkeit stellt das Merkmal eine Abweichung von sozialen Erwartungen dar. Cloerkes will jedoch erst dann von einer Behinderung sprechen, wenn diese Andersartigkeit in einer bestimmten Kultur als negativ bewertet wird, was von jeweiligen Normen und Erwartungen abhängt. So sieht Cloerkes Behinderung als "eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird" (Cloerkes 2001, 7).
Einen Menschen sieht Cloerkes als behindert an, "wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist." (ebd.). Die Dauerhaftigkeit unterscheidet dabei die Behinderung von einer Krankheit, somit sind chronische Krankheiten (z.B. AIDS) in Cloerkes' Definition unter Behinderung einzuordnen. Die im Zitat angeführte Sichtbarkeit geht über das rein optische Erscheinungsbild hinaus und beinhaltet auch das Wissen der anderen Menschen um die Abweichung. Die im Zitat erwähnte soziale Reaktion meint die Gesamtheit der Einstellungen und Verhaltensweisen in der zwischenmenschlichen Interaktionen. Somit ist Behinderung "nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar. Nicht der Defekt, die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum." (ebd., 8).
Cloerkes nimmt auch auf die Relativität von Behinderung bezug und sieht Behinderung als relativ in vier Zusammenhängen: Nach der zeitlichen Dimension kann ein Mensch zeitlich begrenzt als behindert gelten, sofern sich die Behinderung nur über einen begrenzten Lebensabschnitt auswirkt (z.B. Lernbehinderung während der Schulpflicht). In der subjektiven Auseinandersetzung mit der Behinderung kann diese für betroffene Menschen unabhängig von der eigentlichen Schwere der Behinderung völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Die Relativität von Behinderung kann sich auch in verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen zeigen. In Beruf, Schule, Freizeit und Familie können Behinderungen völlig unterschiedlich zum Tragen kommen. So kann eine blinde Telefonistin weitgehend ungehindert ihren Beruf ausüben, ist aber in anderen Lebensbereichen schwer eingeschränkt. Schlussendlich ist Behinderung auch von der (kulturspezifischen) sozialen Reaktion abhängig. Wie zuvor schon erwähnt bedingt die soziale Reaktion das Vorliegen einer Behinderung. So wird eine Behinderung relativ zu der jeweiligen Kultur und des jeweiligen sozialen Umfelds als solche wahrgenommen und bezeichnet (vgl. ebd., 5ff).
Wie beim Begriff der "Behinderung" sind auch gewisse Unklarheiten die Bedeutung von "Geistiger Behinderung" betreffend zu beklagen (vgl. Hinz 1996, 2, online im WWW; Theunissen 2000b, 13), bei dem es ein weit gestreutes Spektrum an Bedeutungen gibt, das sich über dementsprechend viele Fach- und Lebensbereiche erstreckt (vgl. Theunissen 2000b, 14). In der von Theunissen und Speck vertretenen Bedeutung gilt "Geistige Behinderung" als eine "‚normale' Variante menschlicher Daseinsform" (Speck 1997 zit. n. Theunissen 1999, 98) und wird nicht mehr an Defiziten und Abweichungen festgemacht. Es werden in gegenteiliger Herangehensweise Kompetenzen, positive Fähigkeiten, individuelle Bedürfnisse und Potentiale von Menschen mit geistiger Behinderung hervorgehoben. Auch der Begriff der "Geistigen Behinderung" an sich wird von Theunissen in Frage gestellt, da er oft mit Intelligenzschädigung oder intellektueller Beeinträchtigung eins zu eins gleichgesetzt wird, ohne Rücksicht auf andere Lebensbereiche der betroffenen Personen zu nehmen.
Geistige Behinderung vollzieht sich laut Theunissen in Wechselwirkungen und zirkulären Prozessen und als wechselseitiges Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren. Geistige Behinderung ist also als ein komplexes soziales Phänomen von sich wechselseitig bedingenden und verstärkenden Faktoren abhängig. Beteiligt sind Faktoren, die sich auf medizinische Ursachen und Aspekte von geistiger Behinderung beziehen. Sie umfassen die biologischen Gegebenheiten, die einen Menschen charakterisieren. Darüber hinausgehend sind Faktoren involviert, die sich im Lern-und Entwicklungsbereich auf kognitiver, sensorischer, motorischer und aktionaler Ebene ansiedeln. Weitere wichtige Faktoren sind die gesellschaftliche Benachteiligung sowie protektive soziale Ressourcen und kritische Lebensereignisse. Schlussendlich ist auch die Subjekt-Perspektive ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Phänomen geistige Behinderung, die Aspekte wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, subjektive Ereigniswahrnehmung, Selbstbild, Selbsterfahrung, Einschätzung der eigenen Person, etc. beinhaltet und das Selbst-Konzept eines Menschen repräsentiert (vgl. Theunissen 1999, 98f; ders. 2000b, 27ff).
Theunissen vertritt einen kompetenzorientierten Standpunkt in bezug auf "Geistige Behinderung", wobei er Kompetenz als eine zum Menschsein gehörige Fähigkeit ansieht. Somit werden in seinem Sinn "Menschen mit geistiger Behinderung als aktiv handelnde, situationswahrnehmende, -verarbeitende und mitgestaltende, eben als kompetente Individuen betrachtet und entsprechend wertgeschätzt" (Theunissen 2000b, 27). Wie die Kompetenzen eines Menschen verwertet werden, hängt einerseits von der Persönlichkeitsstruktur und andererseits von äußeren sozialen Faktoren ab. Um diese sozialen Faktoren in eine positive Richtung zu beeinflussen sollte das gesellschaftliche Bild von als "geistig behindert" bezeichneten Menschen aus einem defizitorientierten Licht heraus-und in eine kompetenzorientierte Sicht hineingerückt werden. Mängel, Defizite und Funktionsabweichungen verlieren damit an Bedeutung und eine verbesserte Nutzung von vorhandenen Fähigkeiten und sozialen Ressourcen wird möglich. Geistige Behinderung ist also kein in der Person innewohnendes Merkmal, sondern ein soziales Etikett, das ein von der Umwelt mitkonstruiertes Phänomen widerspiegelt (vgl. Theunissen 1999, 98f; ders. 2000, 27ff).
Feuser nimmt im Diskurs um den Begriff "Geistige Behinderung" eine Extremposition ein und behauptet: "Geistigbehinderte gibt es nicht!" (Feuser 1996, 1, online im WWW). So sieht er Behinderung nicht als Tatsache sondern als "'Verhältnisse' zwischen den Verhaltensweisen" (ebd., 3) einzelner Menschen. Behinderung ist somit in seinen Augen der Ausdruck der Aneignung beeinträchtigender, behindernder und isolierender Bedingungen durch einen unter diesen Bedingungen handelnden Menschen. Er koppelt also den Begriff der "Behinderung" von einer Auffassung der Naturgegebenheit ab und nimmt ihn als Resultat von zwischenmenschlichen Beziehungen an (vgl. ebd., 3f).
Die Bezeichnung "Geistige Behinderung" kennzeichnet für Feuser einen phänomenologisch-klassifikatorischen Prozess, in dem von anderen Menschen wahrgenommene Merkmale in Merkmalsklassen zusammengefasst zu Eigenschaften gemacht werden. Diese Zuschreibung von (negativen) Eigenschaften begünstigt eine gesellschaftliche Ausgrenzung, die in Abstraktion der Individualität und der Subjekthaftigkeit der betroffenen Menschen geschieht. Eigenschaften werden in den Mittelpunkt gerückt und die betroffene Personengruppe wird unter Berufung auf diese an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Diese Ausgrenzungs- und Zuschreibungsprozesse spiegeln ein Machtgefälle wieder, denn eine Etikettierung in Form einer Abwertung wird von den Mitgliedern einer Gesellschaft praktiziert, die sich selbst für höherwertig einstufen als die Menschen, die von ihnen ausgegrenzt werden. Feuser bringt hier als Beispiel für dieses Machtgefüge und diese Ausgrenzung, dass es oft als unmöglich angenommen wird, jemanden, der als "geistig behindert" klassifiziert wird, als ebenbürtige, gleichberechtigte und gleichwertige Person wahrzunehmen. Feuser stellt als Folgerung aus dieser Argumentation das Zuschreibungsrecht gegenüber anderen und somit auch die Klassifizierung "Geistige Behinderung" in Frage. Er sieht somit auch nicht die "Behinderung" als das eigentliche Problem einer beeinträchtigten Person[1], sondern die Qualität der Beziehungen, die zwischen ihr und den Menschen in ihrem Umfeld hergestellt werden. In einer gleichberechtigten Wahrnehmung des Gegenübers tritt das Phänomen Behinderung in den Hintergrund, denn "für den Menschen ist es so »normal« ‚behindert' zu sein, wie es »normal« ist, nicht ‚behindert' zu sein." (ebd., 10). Feuser zitiert zur Untermauerung seiner Argumentation Vygotskij heran, der schon 1975 in ähnlicher Weise gedacht hat: "In unseren Händen liegt es, so zu handeln, daß das gehörlose, das blinde und das schwachbegabte Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt." (Vygotskij 1975 zit. n. ebd., 11).
Hinz nimmt unter Stützung auf Feuser eine dialogische Haltung gegenüber dem Phänomen "Geistige Behinderung" ein. Dabei wird geistige Behinderung nicht als Zustand und Eigenschaft gesehen, sondern als dynamischer Prozess, der sich ökologisch im wechselseitigen Austausch zwischen inneren und äußeren Bedingungsfaktoren vollzieht. So spricht er von Menschen, "deren Entwicklung durch verschiedenste ‚geistige Behinderungen' inneren und äußeren Ursprungs beeinflußt wird" (Hinz 1996, 2, online im WWW) und deren Handlungen und Verhaltensweisen subjektiv logische und sinnvolle Aktionen und Reaktionen auf die Umwelt sind. In einer dialogischen Perspektive werden Personen mit geistiger Behinderung als autonome und gleichzeitig abhängige Subjekt angesehen, die primär eine aktive Rolle einnehmen sollten. Das bedeutet eine Offenheit für gemeinsame Situationen und Erfahrungen und die Anwendung von individuellen Maßstäben sowie der Planung individueller Schritte. In einer Ansicht, in der die gleichzeitige Gleichheit und Verschiedenheit aller Menschen akzeptiert wird, werden die Kompetenzen eines Menschen mit geistiger Behinderung in den Mittelpunkt gerückt, um darauf aufbauend Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Gemeinsamkeit wird dabei in der dialogischen Haltung als selbstverständlich angenommen und Aussonderung für begründungspflichtig erklärt (vgl. ebd., 2f).
Wie aus den angeführten Auffassungen hervorgeht, gibt es wie für "Behinderung" auch für "Geistige Behinderung" keine einheitliche allgemein anerkannte Definition. Selbst der Begriff "Geistige Behinderung" an sich wird teilweise als unzureichend kritisiert, doch mangels brauchbarer Alternativen halten große Teile der Fachwissenschaft weiter an diesem Begriff fest. In der Suche nach anderen Bezeichnungen für das Phänomen geistige Behinderung muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass Lernschwierigkeiten und Verhaltensaufälligkeiten nicht durch Reduktion auf positive Aspekte bagatellisiert werden (vgl. Theunissen 2000b, 25). In dieser Zwickmühle zwischen Überbetonung von Defiziten und Bagatellisierung von vorhandenen Schwierigkeiten befindet sich die derzeitige Diskussion um den Begriff "Geistige Behinderung". Die Weltgesundheitsorganisation setzte in den letzten Jahren viel daran eine international und allgemein gültige Auffassung von Behinderung zu definieren. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird nun im nächsten Kapitel eingegangen.
Die Weltgesundheitsorganisation versuchte mit der 2001 veröffentlichten "International Classification of Functioning, Disability and Health" (WHO 2001), die ins deutsche mit "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" (DIMDI[2] 2004, online im WWW) übersetzt wurde und kurz "ICF" genannt wird, ein medizinisches Modell von Behinderung mit einem sozialen Modell zu verbinden. So sollte Behinderung als ein Problem, das unmittelbar durch gesundheitliche Komplikationen verursacht wird und das medizinischer Versorgung bedarf mit der Auffassung von Behinderung als eine gesellschaftlich verursachte Problematik verbunden werden. Die ICF zielt darauf ab diese beiden teilweise gegensätzliche Modelle zu integrieren, um dadurch einen "biopsychosozialen" (ebd., 25) Ansatz zu schaffen, in dem Perspektiven von Gesundheit auf biologischer, individueller und sozialer Ebene berücksichtigt werden. Das biopsychosoziale Modell geht von einer ganzheitlichen Sicht des Menschen aus, in dem Einflüsse aus möglichst vielen Lebensbereichen einer Person berücksichtigt werden, insbesondere die Bereiche der Körperstrukturen (bio), der Psyche (psycho) und des sozialen Umfeldes (sozial).
Die ICF gilt als ein von den Vereinten Nationen anerkanntes Modell. Sie sieht sich als wissenschaftliche Grundlage für das Studium von Gesundheitszuständen und damit zusammenhängenden Zuständen sowie deren Ergebnisse und Determinanten. Ziel dabei ist es eine gemeinsame Sprache für Beschreibung von Gesundheitszuständen zu finden, wobei Menschen mit Behinderung hier explizit in die Zielgruppe der ICF eingeschlossen werden. Das ICF versteht sich als eine Klassifikation menschlicher Funktionsfähigkeit und Behinderung, in der systematisch Gesundheits-und gesundheitsbezogene Kategorien gruppiert werden, wobei diese Klassifikation jedoch nicht auf Menschen mit Behinderung beschränkt, sondern auf alle Menschen universell anwendbar ist. Die ICF will auch nicht Menschen abklassifizieren, sondern im Endeffekt die Situationen der jeweiligen Personen beschreiben (vgl. ebd., 11ff). Da die deutsche Übersetzung der ICF durch das DIMDI noch keinen vollkommen anerkannten Status hat und noch teilweise im Entwicklungsprozess steckt, werden die wichtigsten Begriffe und Begriffsdefinitionen in den folgenden Zeilen auch im englischsprachigen Originalwortlaut angeführt, um eine unsachgemäße Bedeutungsverfälschung zu vermeiden.
Die ICF zielt darauf ab ein breites und angemessenes Bild über die Gesundheit von Menschen bzw. von Populationen zu zeichnen. Dazu werden Komponenten von Gesundheit sowie einige mit Gesundheit zusammenhängende Komponenten von Wohlbefinden definiert. Diese Komponenten werden in zwei Hauptlisten aufgelistet bzw. beschrieben: einerseits den Körperfunktionen (body functions) und Körperstrukturen (body structures) und andererseits den Aktivitäten (activity) und der Partizipation bzw. Teilhabe (participation). Diese beiden Hauptlisten bilden den ersten Teil der ICF. Den zweiten Teil bilden die Kontextfaktoren (contextual factors) in Form von Umweltfaktoren (environmental factors) und personenbezogenen Faktoren (personal factors), die damit in Wechselwirkung stehen (vgl. DIMDI 2004, 9f, online im WWW). Zum besseren Verständnis ist die Struktur des ICF in Abbildung 1 auf Seite 25 dargestellt.
Die "Funktionsfähigkeit und Behinderung" (functioning and disability) ist in die Komponente "Körperfunktionen und Körperstrukturen" und die Komponente "Aktivität und Partizipation" aufgeteilt. Als "Körperfunktionen" werden in diesem Zusammenhang die physiologischen Funktionen von Körpersystemen und als Körperstrukturen die anatomischen Teile des Körpers verstanden. Mit "Aktivität und Partizipation" werden die Aspekte der Funktionsfähigkeit aus individueller und gesellschaftlicher Sicht beschrieben. "Aktivität" bedeutet die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch eine Person und Partizipation das Einbezogensein eines Menschen in eine Lebenssituation (vgl. ebd., 13ff).
Die "Kontextfaktoren" teilen sich in die Komponenten "Umweltfaktoren" und die "Personenbezogene Faktoren" auf. "Umweltfaktoren" bezeichnen dabei den fördernden oder beeinträchtigenden Einfluss von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Umwelt und werden in der ICF auf zwei Ebenen aufgeteilt. Einerseits die Ebene des "Individuums" als unmittelbare und persönliche Umwelt eines Menschen und andererseits die Ebene der "Gesellschaft" als die formellen und informellen sozialen Strukturen in der Gemeinschaft, die einen Menschen beeinflussen. Die "Personenbezogenen Faktoren" beschreiben den speziellen Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen, sind jedoch nicht Teil des Gesundheitsproblems oder -zustands. Diese Faktoren sind in der ICF nicht näher klassifiziert (vgl. ebd., 13ff). Die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF sind in Abbildung 2 auf Seite 26 näher beschrieben.
|
Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung |
Teil 2: Kontextfaktoren |
|||
|
Komponenten |
Körperfunktionen und -strukturen |
Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] |
Umweltfaktoren |
personenbezogene Faktoren |
|
Domänen |
Körperfunktionen, Körperstrukturen |
Lebensbereiche (Aufgaben, Handlungen) |
Äußere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung |
Innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung |
|
Konstrukte |
Veränderungen in Körperfunktionen (physiologisch) Veränderung in Körperstrukturen (anatomisch) |
Leistungsfähigkeit (Durchführung von Aufgaben in einer standardisierten Umwelt) Leistung (Durchführung von Aufgaben in der gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt) |
fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt |
Einflüsse von Merkmalen der Person |
|
positiver Aspekt |
Funktionale und strukturelle Integrität |
Aktivitäten Partizipation [Teilhabe] |
positiv wirkende Faktoren |
nicht anwendbar |
|
Funktionsfähigkeit |
||||
|
negativer Aspekt |
Schädigung |
Beeinträchtigung der Aktivität Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe] |
negativ wirkende Faktoren (Barrieren, Hindernisse) |
nicht anwendbar |
|
Behinderung |
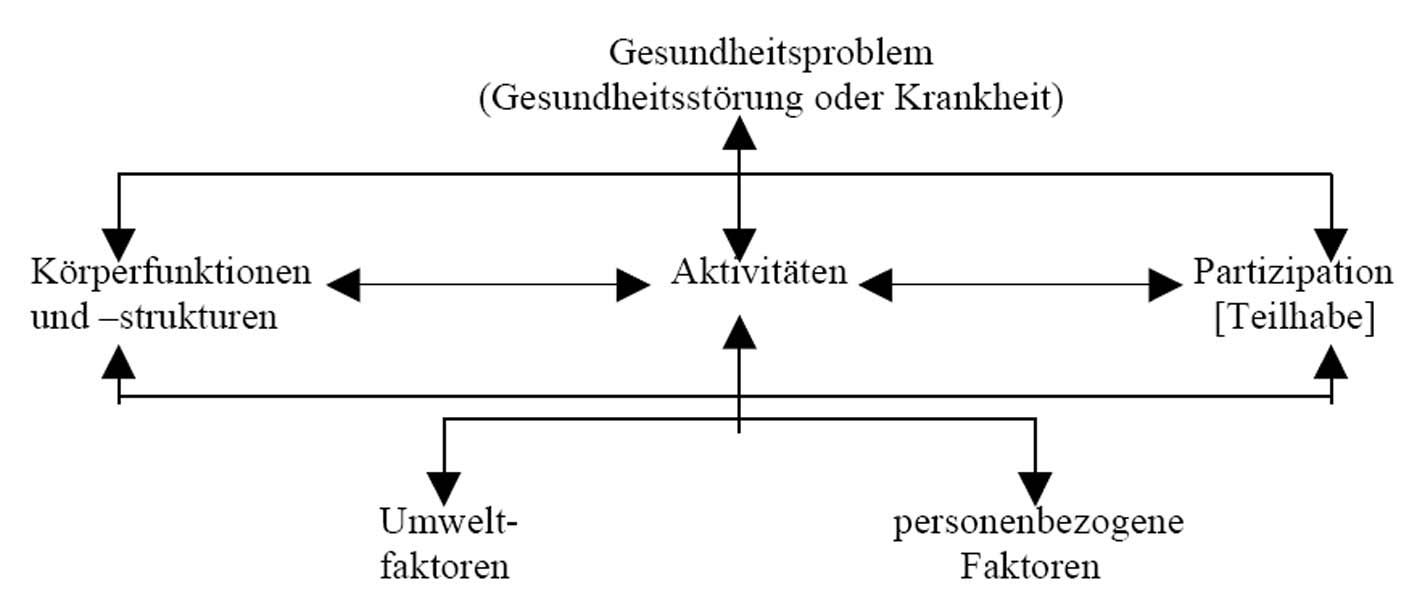
Abb. 2: Wechselwirungen zwischen den Komponenten der ICF (DIMDI 2004, 23, online im WWW)
"Behinderung" (disability) wird in der ICF folgenderweise definiert: "disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions" (WHO 2001, 3) Somit kann "Behinderung" als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigung der Partizipation gehandhabt werden (vgl. DIMDI 2004, 9, online im WWW). Der Oberbegriff "Behinderung" dient also dazu Probleme aufzuzeigen. Der Oberbegriff "Funktionsfähigkeit" wird im Gegensatz dazu folgendermaßen definiert: "Functioning is an umbrella term encompassing all body functions, activities and participation" (WHO 2001, 3) "Funktionsfähigkeit" dient also ein Oberbegriff für alle Körperfunktionen, Aktivitäten und Partizipation (vgl. DIMDI 2004, 9, online im WWW). Er bezieht sich auf die nicht-problematischen Aspekte des Gesundheitszustandes. Funktionsfähigkeit und Behinderung werden dabei zusammengenommen als dynamische Interaktion zwischen Gesundheitsproblemen und Kontextfaktoren betrachtet. Eine "Schädigung" wird in diesem Kontext als eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur verstanden. "Beeinträchtigung der Aktivität" meint die Schwierigkeiten, die eine Person bei der Durchführung einer Aufgabe oder Handlung haben kann und "Beeinträchtigung der Partizipation" meint die Probleme, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation erleben kann (vgl. ebd., 14ff). Die ICF sieht Behinderung "gekennzeichnet als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen personenbezogenen Faktoren einerseits und der externen Faktoren, welchen die Umstände repräsentieren, unter denen Individuen leben, andererseits." (ebd., 22) und weiterführend als ein "mehrdimensionales Phänomen [...], das aus der Interaktion zwischen Menschen und ihrer materiellen und sozialen Umwelt resultiert." (ebd., 170). Somit kann Behinderung ebenso eine Folge von Barrieren in der Umwelt als auch von Krankheiten oder Schädigungen sein (vgl. ebd., 171).
Der Begriff "Körper" umfasst in der ICF den menschlichen Organismus als Ganzes und somit beinhalten Körperfunktionen auch die mentalen Funktionen eines Menschen. Dies ist vor allem bezüglich Menschen mit geistiger Behinderung von Relevanz, da in diesem Zusammenhang, auch im Rahmen der mentalen Funktionsfähigkeit, Schädigung als Abweichung von allgemein anerkannten Standards des biomedizinischen Zustands des Körpers und der Körperfunktionen gewertet werden (vgl. ebd., 17f). Weiterführend wird in der Klassifikation der ICF statt der Bezeichnung "geistig behinderte Person" die Umschreibung "Person mit einem Problem in Lernen" gebraucht, um betroffene Menschen nicht auf ihre Schädigung bzw. Beeinträchtigung zu reduzieren (vgl. ebd., 170).
Aus der Sicht von Menschen mit Behinderung hat die ICF im Gegensatz zu ihren Vorgängermodell ICIDH durchaus Fortschritte gemacht. Dennoch wird sie von Menschen mit Behinderung kritisiert, da aus ihrem Gesichtspunkt noch weitere Verbesserungen notwendig sind, "um der Sicht von Menschen mit Behinderung, welche Faktoren Behinderung verursachen oder verstärken, noch mehr zu entsprechen." (Meyer 2004, 85).
Die Thematik "Behinderung" spielt durch die Zuerkennung von Unterstützungen verschiedenster Art auch eine Rolle in der Gesetzgebung. Das deutsche Bundessozialhilfegesetz von 1961 brachte den Begriff "Behinderung" erstmalig in adäquater Form in den rechtlichen Raum, indem es einige Kategorien darbrachte unter die von Behinderung betroffene Menschen eingegliedert wurden ("Eingliederungshilfe für Behinderte") (vgl. Sander 1997, 100).
Über 20 Jahre später (1988) beauftragte das österreichische Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Komitee für Soziale Arbeit damit den Begriff "Behinderung" zu prüfen und eine einheitliche Definition zu finden, die in der Folge auch Konsequenzen für das österreichische Rechtssystem haben sollte. Das Komitee veranstaltete zu diesem Zweck ein Symposium, in dem folgende zwei Definitionen erarbeitet wurden, in dem auch Aspekte geistiger Behinderung berücksichtigt werden:
1. "Behinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchtigung in absehbarer Zeit droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung." (BfAuS[3] 1993, 7; BfsSGuK[4] 2003, 9).
2. "Behindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht möglich ist, geregelte soziale Beziehungen zu pflegen, sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben und angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen." (ebd.).
Trotz dieser gefassten Definitionen bleibt es vom rechtlichen Standpunkt her gesehen schwierig eine genaue und allgemeingültige Definition von Behinderung zu finden, da das Behindertenrecht sich über zahlreiche Bundes-und Landesgesetze aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen erstreckt. Schließlich gibt es auch eine dementsprechende Anzahl von verschiedenen rechtlichen Definitionen dieses Begriffs, die mehr oder weniger von der oben genannten Definition abweichen. Von Seiten des Staates gelten diese unterschiedlichen Definitionen jedoch als nötig, um eine klare Ausführung der verschiedenen Gesetze zu ermöglichen (vgl. BfsSGuK 2003, 9). Eine gewisse Widersprüchlichkeit ist dieser Auffassung innewohnend.
In Österreich gibt es keine Meldepflicht für Behinderungen und somit gibt keine verlässlichen offiziellen Statistiken wie viele Menschen bzw. Kinder und Jugendliche mit Behinderung es in Österreich gibt. Auch die zuvor angeführten unterschiedlich gefassten rechtlichen Begriffsdefinitionen von Behinderung tragen dazu bei, dass es diesbezüglich keine eindeutigen Zahlen gibt. Ein weiterer Grund für das Fehlen genauer statistischer Daten ist die Tatsache, dass ein Großteil aller Behinderungen durch kombinierte und schwer eindeutig zuordenbare Funktionseinschränkungen entstehen und somit die Gefahr der statistischen Vernachlässigung oder von Mehrfachzählungen gegeben ist (vgl. Rosenkranz 1998, 5). Zeitweise haben auch zur Erhebung befragte Angehörige ein anderes Verständnis von Behinderung als Experten bzw. verschwiegen die Behinderung eines Familienmitgliedes (vgl. Cloerkes 2001, 18). Im folgenden Kapitel werden nun dennoch einige statistische Daten angeführt, die diesen Bereich betreffen. Dies soll ermöglichen einen gewissen zahlenmäßigen Überblick über die Anzahl an als geistig behindert bezeichneten Kindern und Jugendlichen in Österreich zu gewinnen.
Nach Schätzungen liegt der durchschnittliche Prozentsatz an behinderten Kindern und Jugendlichen einer Bevölkerung bei 2,5% der 0-15jährigen. Auch das Unterrichtministerium geht von einer ähnlichen Zahl aus und nimmt an, dass 2,7% aller SchülerInnen zwischen sechs und 15 Jahren sonderpädagogischen Förderbedarf haben und somit als Kinder mit Behinderung einzustufen wären (vgl. Flieger 2000, 16). Je nach Definition und damit Eingrenzung von Behinderung wird angenommen, dass in Österreich zwischen 40.000 und 110.000 Menschen als körperlich und/oder geistig behindert gelten. In Prozenten gerechnet bewegen sich die Zahlen zwischen 0,7% und 7,4% aufgerechnet auf die Gesamtbevölkerung (vgl. Badelt, Österle 1993, 8f). Andere Zahlen ergeben wiederum Untersuchungen die in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurden. In einer Erhebung von 1995 wurden 6,7% der Gesamtbevölkerung als schwerbehindert bzw. als mit einem Behinderungsgrad von über 50% eingestuft. In einer weiteren amtlichen Untersuchung in Deutschland wurde die Quote der als "schwerbehindert" eingestuften Menschen als etwas über 8% ermittelt (vgl. Cloerkes 2001, 18). Da die Gesellschaftsstrukturen in Deutschland und Österreich ähnlich sind, sollten die Prozentzahlen in den Ergebnissen vergleichbar sein.
Die Zahl geistig behinderter Menschen wird in Österreich anhand international anerkannter Richtwerte auf ca. 0,6 % der Bevölkerung geschätzt, was in etwa einer Anzahl von 47.000 bis 48.000 Personen entspricht (vgl. BfsSGuK 2003, 11; Badelt, Österle 1993, 6). Bezieht man sich auf statistischen Daten, die in Krippen und Kindergärten gewonnen wurden, so besuchten im Schuljahr 1991/92 1.321 Kinder in Österreich Sonderkindergärten, was in etwa 0,7 % der in Kindergärten untergebrachten Kinder entsprach. Weiters wurden in diesem Schuljahr auch die Behinderungsformen eruiert, die in Krippen und (allgemeinen und Sonder-) Kindergärten auftraten. Laut dieser Erhebung galten 745 Kinder als geistig behindert und 833 Kinder als mehrfachbehindert, was eine Kombination von körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen bedeutet (vgl. Badelt, Österle 1993, 6ff). Auch in Untersuchungen in der Bundesrepublik Deutschland ergaben sich ähnliche Zahlen. So lag der Prozentsatz der als "geistig behindert" eingestuften Sonderschüler 1999 bei 0,693% aller Schüler (vgl. Cloerkes 2001, 21).
In den Schuljahren 1990 bis 1992 wurde auch das österreichische Schulsystem bezüglich Kindern und Jugendlichen mit Behinderung untersucht. So wurden 375 Kinder wegen "Schulunfähigkeit" von der Schulpflicht befreit (vgl. Badelt, Österle 1993, 11), was bedeutet, dass die Behinderungen dieser Kinder von offizieller Seite als so schwer eingestuft wurden, dass eine Beschulung als nicht zielführend erachtet wurde. Zum Glück ist man in den letzten Jahren von dieser Art des Umgangs mit schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen abgekommen und es wird im aktuellen Schulbetrieb auch die Eingliederung schwerstbehinderter Kinder forciert. Im Schuljahr 1991/92 besuchten insgesamt 18.491 Kinder und Jugendliche eine Sonderschule. Davon besuchten 2.911 Schüler und Schülerinnen eine Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder und 350 eine Schule für mehrfachbehinderte Kinder. Das entspricht zusammengenommen einem Prozentsatz von 17,7 % aller Schüler und Schülerinnen von Sonderschulen (vgl. ebd., 12f). Auch hier ist keine genaue Angabe der Anzahl bzw. des Prozentsatzes von als geistig behindert bezeichneten Kindern und Jugendlichen zu finden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Schüler und Schülerinnen in Sonderschulen für schwerstbehinderte und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche eine geistige Beeinträchtigung haben.
1992 wurde in Österreich in etwa 44.000 Fällen erhöhte Familienbeihilfe bezogen. Voraussetzung für den Bezug von erhöhter Familienbeihilfe ist ein "erheblich" behindertes Kind im familiären Haushalt. Es kann also von einer Zahl von etwa 44.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgegangen werden, die dieser Kategorie unterliegen. Leider werden weitergehende Informationen zum Bezieherkreis nicht systematisch erfasst (vgl. ebd., 23) und somit bleiben nähere Informationen zu diesen 44.000 Fällen verschlossen.
Der Behinderungsbegriff, der in dieser Diplomarbeit gebraucht wird, wendet sich von der Festmachung an Defiziten und Defekten ab. Mit dem Hintergrund, dass "Behinderung" ein soziales Etikett darstellt, das gesellschaftliche Normvorstellungen und Rollenzuschreibungen widerspiegelt, wird "Behinderung" als eine von der Gesellschaft geschaffene Norm und nicht als natürliche Gegebenheit wahrgenommen. "Behinderung" lässt sich somit als Zusammenwirken verschiedener Komponenten im Sinne eines sozialen Phänomens definieren. Eine grundlegende Problematik und somit auch ein definitorischer Eckpfeiler von Behinderung ist die ungenügende und unbefriedigende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die durch sozialen Bewertungs-und Abwertungsprozessen bedingt wird (vgl. Rosenkranz 1998; Cloerkes 2001; Schönberger 1997).
So wie "Behinderung" wird in dieser Diplomarbeit auch "Geistige Behinderung" wertfrei als normale Variante menschlicher Daseinsform gesehen. In einer kompetenzorientierten Sichtweise gelten in dem in dieser Diplomarbeit gebrauchten Begriff Menschen mit geistiger Behinderung als aktiv handelnde, situationswahrnehmende, -verarbeitende und mitgestaltende Individuen und unterscheiden sich dahingehend nicht von allen anderen Menschen. Menschen mit geistiger Behinderung werden somit als ebenbürtige, gleichberechtigte und gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen, denen im Sinne einer dialogischen Haltung Interaktion im gleichberechtigten kooperativen Miteinander zu gewähren ist. So sind auch Handlungen und Verhaltensweisen von Menschen mit geistiger Behinderung, mögen sie auf den ersten Blick auch als sinnlos erscheinen, als subjektiv logische und sinnvolle Reaktion auf die Umwelt zu betrachten (vgl. Theunissen 2000b; Feuser 1996).
Mit dieser Auffassung von "Behinderung" und "Geistiger Behinderung" wird nun auf andere, im Hinblick auf die Fragestellung relevant Aspekte eingegangen. Den Anfang macht dabei die Klärung der Bedeutung des Begriffs der "Freizeitpädagogik".
Inhaltsverzeichnis
Um auf die Bedeutung von "Freizeitpädagogik" als grundlegenden Begriff für diese Diplomarbeit einzugehen, wird in diesem Kapitel vorerst der Begriff der "Freizeit" näher beleuchtet, da die jeweilige Auffassung von "Freizeit" auch immer Auswirkungen auf den darauf aufbauenden Terminus der "Freizeitpädagogik" hat. Nach der Klärung des Grundbegriffs "Freizeit" werden dann über die Geschichte der Freizeitpädagogik herangehend heutige Ansichten aus diesem Bereich geschildert. Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Freizeitpädagogik beschränkt sich dabei zum Großteil auf Deutschland, das diesbezüglich großen Einfluss auf den österreichischen Raum genommen hat.
Freizeit bezeichnet ein gesellschaftliches Phänomen. Eine genaue Abgrenzung des Begriffs "Freizeit" ist jedoch problematisch und die diesbezügliche gegenwärtige Fachdiskussion ist durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen geprägt. So sieht die Erholungstheorie Erholung als zentrale Funktion der Freizeit und die Kompensationstheorie Freizeit als Ausgleich von Mängeln und Versagungen. Die Katharsistheorie nimmt Freizeit als Befreiungselement für unterdrückte Emotionen wahr und die Ventiltheorie in ähnlicher Weise als Ventil zum Abreagieren überschüssiger Energien. Für die Konsumtheorie ist Freizeit das Mittel des Verbrauchs und Verschleißes und für die Kontrasttheorie steht Freizeit im deutlichen Gegensatz zu Arbeit. Die Kongruenztheorie sieht hingegen Freizeit als arbeitsähnlichen Lebensbereich und die Absorptionstheorie versteht Freizeit auch arbeitsbezogen als Aufsaug-und Kanalisationsinstrument für Arbeitsunzufriedenheit. Die Selektionstheorie definiert Freizeit als Ausleseprodukt von biographischer Entwicklung und Lebensgeschichte. Die Sozialisationstheorie sieht Freizeit schließlich als einen von Bildungs- und Erziehungsprozessen abhängigen Faktor. Es gibt also eine Vielzahl an Freizeittheorien, die sich jedoch meist nur mit einzelnen Aspekten von Freizeit beschäftigen. Opaschowski geht über solche monokausalen Erklärungsansätze hinaus und erklärte Freizeitverhalten aus dem Zusammenhang vieler Beziehungen, Einflüsse und Wirkungen gesellschaftlicher Bedingungen. Er sieht Arbeitssituation und Freizeitverhalten als zwei Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Opaschowski 1996, 82ff), stellt diese jedoch nicht als Gegensätze gegenüber. Mehr zu Opaschowskis Definition ist in Kapitel 3.1.4 ("Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit") dieser Diplomarbeit zu lesen.
Etymologisch gesehen geht der Begriff "Freizeit" auf das mittelalterliche "frey zeyt" zurück, das in seiner Bedeutung als "Marktfriedenszeit" Menschen in einem Frieden auf Zeit die Möglichkeit des Freiraums und der Marktfreiheit mit gesteigertem Rechtsschutz gab. Dieser Begriff fand zum ersten Mal 1350 in der deutschen Literatur Erwähnung und bezeichnete die Zeit zwischen dem 7. September und dem 1. Oktober, in der der Marktfrieden in seiner Bedeutung als persönlicher Schutzbann die gefahrlose Reise zum oder vom Markt ermöglichen sollte. Friedenbrüche in dieser Zeitspanne wurden doppelt bestraft (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 1996, 100).
Freizeit wird wie schon erwähnt häufig als Komplementärbegriff zu Arbeitszeit gebraucht. So wird mit Freizeit die Lebenszeit bezeichnet, die nicht direkt den Anforderungen gesellschaftlich strukturierter Arbeit unterliegt und auch nicht zur unmittelbaren Reproduktion der Arbeitsfähigkeit dient. Freizeit steht als Teil der arbeitsfreien Zeit stärker einer selbstbestimmten und selbstgestalteten individuellen Praxis zur Verfügung ist somit in seiner Bedeutung mehr als lediglich arbeitsfreie Zeit. Freizeit ist die Zeit, die einem Individuum zur Selbsterhaltung zur Verfügung steht (vgl. Brockhaus Enzyklopädie 1988, 640f).
Generell sind zwei Hauptrichtungen in der Fachdiskussion zum Begriff "Freizeit" zu erkennen. Eine Richtung geht davon aus, dass "Freizeit" von Arbeit abhängig ist, während die andere "Freizeit" als einen eigenständigen Lebensbereich sieht. Giesecke differenziert diese Sicht noch weiter und unterscheidet drei Positionen gegenüber "Freizeit". Die erste geht davon aus, dass es keine autonome von der Berufswelt emanzipierte Freizeit mit eigenständigem Sinngehalt gibt und das sinnvolle Freizeit nur in Verbindung mit sinnvoller Arbeit gesehen werden kann. Die zweite Position sieht Freizeit als autonomen Lebensbereich, der in Gegensatz und Verhältnis zu einer funktionalisierter Arbeit steht, die wenig Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Entfaltung und Bildung fällt somit hier in den Bereich der Freizeit. Die dritte Position geht zwar auch davon aus, dass sich Arbeit und Freizeit gegenseitig bedingen, räumt aber der Freizeit eine Rolle als Gegenkraft zur Arbeit ein, in dieser sie sich teilweise emanzipatorisch von dem Begriff "Arbeit" befreien kann (vgl. Markowetz 2001, 261).
Freizeit galt in antiken feudalen Gesellschaftsformen als Muße und als Privileg des herrschenden Adels, das für die Entwicklung der Persönlichkeit als erforderlich angesehen wurde. Die damalige Gesellschaft teilte sich somit in die Mußebesitzer mit viel Freizeit und die (arbeitenden) Mußelosen auf, die meist zu den unteren Bevölkerungsschichten zählten und über wenig Freizeit verfügten. Mit dem Mittelalter nahm die Arbeit einen immer größeren Stellenwert im Leben der Menschen ein und der zuvor beschriebene Begriff der "frey zeyt" kam auf (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 99f).
Mit Martin Luther, der Reformation und damit dem Beginn der Neuzeit um das Jahr 1517 fand ein allgemeiner Kulturwandel statt. Das Leben der Menschen wurde zusehends in öffentlich verpflichtete Zeit und private freie Zeit unterteilt. Arbeit und Erwerben und damit verpflichtete Zeit wurde von vielen Seiten her zum dominierenden Zweck des Lebens erklärt. Die nicht-verpflichtete Zeit war als Restzeit der Arbeit untergeordnet. Dies gipfelte in einer regelrechten Verachtung jedes Lebensgenusses und der berufs-und arbeitsfreien Zeit. Mitte des 16. Jahrhunderts trat Johannes Calvin in Erscheinung, der in dieser Tradition Muße als unnütz ansah und die systematische Ausnutzung der Zeit zum Ordnungsprinzip des Lebens erklärte. Er schuf damit die Basis für eine "Religion der Arbeit" (Opaschowski 1996, 110). In dieser auf die Arbeit fixierten Lebensweise stieg jedoch bald in der Bevölkerung der Wunsch nach einer privaten, heilen und freien Gegenwelt zur Arbeit, was zu einer radikalen Trennung von Lebenszeit in determinierte Zeit in Form von Arbeit und in disponible Zeit in Form von Freizeit führte (vgl. ebd., 100ff).
Der Stellenwert der Arbeit hielt an bzw. vergrößerte sich durch die zunehmende Industrialisierung im 19. Jahrhundert und gipfelte in der Idealvorstellung eines Leistungsmenschen, dessen Schaffung auch als Ziel der sogenannten "Berufspädagogik" und "Arbeitschulen" galt. Freizeit wurde zu dieser Zeit der industriellen Revolution als der Arbeit untergeordnete Nebensache gesehen, die höchstens zur Rekreation für anstehende Arbeit da war. In der Folge verhärtete sich der Gegensatz zwischen Arbeit und Freizeit und der Wunsch nach Ruhe, Geborgenheit und Harmonie zog sich ins Private zurück. Dies fand in der bürgerlichen Wohnkultur des Biedermeier seinen Ausdruck, die zu dieser Zeit aufkam (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 1996, 110).
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in der Theorie des Sozialismus Arbeitszeit ebenfalls als Grundlage der Freizeit gesehen. Freizeit galt dabei jedoch nicht mehr als Nebensache, sondern als Raum für die volle Entwicklung des Individuums, die auch wiederum auf die Produktivkraft der Arbeit zurückwirkt (vgl. Nahrstedt 1993, 52f). So sah Marx frei Zeit als "disponible Zeit" und gab ihr großen Wert für die Emanzipation des Menschen. Sie dient in seiner Perspektive der Wiedergewinnung der Menschlichkeit, indem sie als eine von der Arbeit befreite Zeit einem Individuum die Möglichkeit gibt, sich besonders gut zu entfalten, was sich wiederum positiv auf die Produktivkraft auswirkt (vgl. Markowetz 2001, 261; Opaschowski 1996, 110).
Auch von anderen wurde die Bedeutung der Freizeit zur Jahrhundertwende wiedererkannt. So stellte Friedrich Naumann in seinem "Arbeiter-Katechismus" von 1889 die missliche Lage der Arbeiterklasse, die weder Geld noch Freizeit hatte, zur Diskussion und sprach jedem Menschen ein notwendiges Maß an Erholungs-und Ruhezeit für Leib und Seele zu. Er erkannte ebenfalls, dass die Freizeitgestaltung auch Einfluss auf die anderen Lebensbereiche nimmt. Unter anderem auch in Hinblick auf diese Forderungen wurde 1891 von der "Centralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen" eine Konferenz in Berlin veranstaltet, in der erstmals auch auf Fragen der Erholung der Arbeiter und auf eine zweckmäßige Verwendung der Sonn- und Feiertage eingegangen wurde (vgl. Opaschowski 1996, 112).
Nach dem ersten Weltkrieg herrschte in Europa die Tendenz Arbeitszeit zu kürzen und es kam eine Freizeitbewegung auf, die sich auf Gestaltung und Erfüllung der dadurch gewonnen Freizeit konzentrierte. Es wurden vor allem vom "Reichsausschuß der Deutschen Jugendverbände" regelmäßig Beiträge zur Freizeitproblematik herausgebracht und es fand mit Fritz Klatt auch erstmals eine Pädagogisierung der Freizeit statt. Diese Zeit gilt als der eigentliche Beginn der deutschen Freizeitpädagogik (vgl. ebd., 112f).
Die Entwicklung des Freizeitverhaltens nach dem zweiten Weltkrieg im deutschen Raum sieht Opaschowski folgendermaßen: vom Ende des zweiten Weltkrieges bis in die 1950er Jahre galt Freizeit hauptsächlich der Erholung von getaner und noch zu erledigender Arbeit, war also noch sehr auf die Arbeit als Komplementär bezogen. Bezüglich der Freizeit wurde, durch die hohe Geburtenrate bedingt, in weiten Teilen der Bevölkerung die Familie zum eigentliche Zentrum der arbeitsfreien Zeit. Familienbezogene Freizeitaktivitäten hatten dadurch zu dieser Zeit einen hohen Stellenwert. In den 1960ern richtete sich durch einen Geburtenrückgang der Fokus in der Freizeit von der Familie weg und hin zu kulturellen und sozialen Aktivitäten. Das Freizeitverhalten war zu weiten Teilen durch häufige Besuche von kulturellen Veranstaltungen geprägt. Die Aktivitäten in der Freizeit waren sehr von sozialen Normen und Erwartungen abhängig und wurden gepflegt, um das soziales Ansehen nicht zu verlieren. Durch den wachsenden Wohlstand der Bevölkerung tritt mit den 1960ern das Freizeit und Konsumverhalten immer mehr ins Zentrum des Lebens und ein Verbrauchsbedürfnis und Überflussbewusstsein entsteht. In den 1970er Jahren stand bezogen auf die Freizeit der Konsumgenuss im Mittelpunkt, in der große Befriedigung im Geldausgeben und in der sozialen Selbstdarstellung gefunden wurde. Auch der Medienkonsum wurde zu einem Leitmedium des Freizeitverhaltens. Immer breitere Bevölkerungsschichten stellten den Anspruch auf Nichtstun und Faulenzen in ihrer Freizeit. Das Freizeitverhalten der Menschen wurde zusehends durch Medien und Werbung von außen her gesteuert. In den 1980er Jahren bewegte sich der Lebensstil vom Konsum weg hin zu gemeinsamen Erleben und zur Entwicklung einer eigenen Lebensart im Sinne einer Erlebnissteigerung. Dennoch blieb der hohe Medienkonsum bestehen, zu diesem sich nun auch das Telefonieren als Freizeitbeschäftigung gesellte. In den 1990er Jahren wurden die elektronischen Freizeitmedien immer bedeutsamer, doch im Gegenzug zeigten sich die Menschen auch wieder eher mußeorientiert. Dem Bedürfnis nach Ruhe, innerer Muße und der Befriedigung persönlicher Interessen wurde nachgegangen und es kam ein regelrechter Selbstbestimmungsboom in Gang. Die Bedeutung von Freizeit als Kontakt-und Sozialzeit nahm ebenfalls zu und schließlich begann in den 90ern auch der Trend ursprüngliche Freizeit als Arbeitszeit zu nützen. Es kamen Formen freier Eigenarbeit auf, die als persönliche Betätigungs-und Bestätigungsmöglichkeiten Spaß und Sinn stiften sollten (vgl. Markowetz 2001, 261; Opaschowski 1996, 21ff).
Der Beginn des 21. Jahrhundert zeichnet sich durch eine Konsum-und Erlebnisgesellschaft aus, die sich vom Bewusstsein des zweigeteilten Lebens in Arbeit und Freizeit emanzipiert hat. Somit wird die Aufteilung des Lebens in freie und unfreie Zeit immer schwerer möglich. Durch wandelnde Berufsethik, organisatorische Veränderungen und Flexibilisierung wird es denkbar Freiheit auch in der Arbeit zu verwirklichen und umgekehrt Freizeit zu Arbeitszeit zu machen (vgl. Opaschowski 1996, 84). In den nächsten Jahren findet nach Prognosen ein Übergang in eine nachindustrielle "postmateriale"(Nahrstedt 1993, 52) Gesellschaft statt, in der Anstrengungen durch harte Produktionsarbeit überwunden sind. In dieser Gesellschaftsform wird die Bedeutung von Freizeit, sowie die Freizeit an sich immer mehr zunehmen und somit werden sich auch Freizeit und Freizeitwerte zu dominanten Aufgaben der Pädagogik entwickeln (vgl. ebd., 52f).
Schon in den 1960er Jahren sagten die Zukunftsforscher Kahn und Wiener ein immer weiterwachsendes Ausmaß an Wohlstand und Überfluss voraus und damit auch einen Anstieg des Ausmaßes sowie der Bedeutung von Freizeit bis zur Jahrtausendwende. Sie sahen die Folgen dieser Entwicklung jedoch eher negativ. So wird sich in ihrem Sinne das hohe Ausmaß an Freizeit und Wohlstand in einem immer größer werdenden Egoismus und einer immer weiter wachsenden Interesselosigkeit der Gesellschaft gegenüber manifestieren. Sie sagten auch einen Anstieg des Drogenmissbrauches, der Kriminalität und der Extremistenbewegungen voraus und führten dies auf die oben genannten Faktoren zurück. Ebenso sahen sie ein Ende der Ideologien und der traditionellen Religionen zugunsten von allgemeinem geistigen und politischen Individualismus als Zukunft der Freizeitgesellschaft (vgl. Opaschowski 1996, 115f).
Durch die derzeitige Entwicklung und zunehmende Arbeitslosigkeit in Europa wird die Überflussgesellschaft bald zu einer Nach-Überflussgesellschaft werden. Durch die Kommerzialisierung der Freizeit und die dadurch gestellten finanzielle Ansprüche werden sich große Teile der Bevölkerung bis zu einem gewissen Maße zu sehr verschuldet haben, um in der Freizeitgesellschaft mithalten zu können. Der schwindende Wohlstand wird existenzielle Probleme hervorrufen. Durch die Lustbetonung in der Überfluss-und Freizeitgesellschaft werden jedoch nur wenige Teile der Bevölkerung bereit sein Arbeitsstellen anzunehmen, die mit wenig Freiheit und Freude verbunden ist. Opaschowski sieht in dem daraus resultierenden wachsenden sozialen Gefälle sozialen Zündstoff, der ein rasches Umdenken im Bereich Freizeit erfordert. Eine von ihm angebotener Lösungsweg wäre ein Abwenden vom Konsum hin zu einer Nutzung der Zeitressourcen (Zeitwohlstand) zu fördern. Um dies zu ermöglichen, muss in der Bevölkerung der jeweilige schätzende Umgang mit dem Zeitbudget wieder erlernt werden (vgl. ebd., 127f). Opaschowski definiert dazu einen Begriff von "Freizeit" als "Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit", auf den im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen wird.
Opaschowski sieht Freizeit nicht bloß als Gegenteil bzw. als Abwesenheit von Arbeit, sondern in einer positiven Weise als "freie Zeit" durch Wahlmöglichkeiten, individuelle Entscheidungen und soziales Handeln geprägt ("frei für ..."). Er nimmt also Abstand von einer negativen Definition des Begriffs "Freizeit" ("frei von Arbeit") und plädiert dafür, von der Spaltung der Lebenszeit in Arbeit und Freizeit abzusehen. Um der Gesellschaftsform zu Beginn des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden, sollte in seinen Augen von einem ganzheitlichen Lebenskonzept ausgegangen werden, in dem der Begriff "Lebenszeit" eine zentrale Rolle einnimmt. Die Lebenszeit ist von einer Vielzahl Tätigkeiten geprägt, die einen zusammenängenden Komplex bilden. Berufsarbeit stellt dabei nur einen begrenzten Abschnitt des menschlichen Tätigkeitsfeldes dar (vgl. Markowetz 2001, 262; Opaschowski 1996, 85).
Lebenszeit ist laut Opaschowski durch mehr oder minder große Dispositionsfreiheit charakterisiert. Die Lebenszeit, die jedem Menschen zur Verfügung steht, teilt er in drei unterschiedliche Zeitqualitäten ein, die vom Grad individueller Verfügbarkeit über Zeit und dem Ausmaß an Wahl-, Entscheidungs-und Handlungsfreiheit abhängig sind - in "Dispositionszeit", in "Obligationszeit" oder in "Determinationszeit". Die Zeitqualität "Dispositionszeit" sieht er als frei verfügbar, wahlfrei, einteilbar und selbstbestimmt. Sie ist unabhängig nach eigenen Bedürfnissen und Interessen gestaltbar. So können auch spielerische Arbeit bzw. freie, spielerische Tätigkeiten mit Arbeitscharakter zu dieser Zeitqualität gezählt werden. Dispositionszeit kann einerseits personen-, gesellschafts- oder sachbezogene zielgerichtete Beschäftigung bedeuten, oder andererseits durch zwanglose Muße in Form von individuell verfügbarer Zeit für Eigentätigkeiten oder zweckfreie Zeit für Nichtbeschäftigtsein geprägt sein. Diese Muße im Rahmen der Dispositionszeit setzt jedoch ein Mindestmaß an materieller Sicherung voraus, da in Zeiten Existenzangst solche Muße keinen Platz findet (vgl. Markowetz 2001, 262; Opaschowski 1996, 86ff).
"Obligationszeit" ist verpflichtend, bindend und verbindlich, die Teilnahme an Aktivitäten dieser Zeitqualität ist jedoch freiwillig. Im Rahmen der Obligationszeit kann sich eine Person zu einer bestimmten Tätigkeit subjektiv verpflichtet fühlen oder objektiv aus beruflichen, familiären oder anderen Gründen an diese gebunden sein. In Obligationszeit können auch Tätigkeiten fallen, die zu Beginn zwar freiwillig sind, jedoch mit der Zeit einen verpflichtenden Charakter annehmen und die Wahl- und Entscheidungsfreiheit eines Menschen erheblich einschränken. So ist zwar noch ein gewisser Freiheitsgrad vorhanden, doch Pflichtcharakter und Zweckbindung bleiben dennoch bestehen (vgl. ebd.).
"Determinationszeit" ist festgelegt, fremdbestimmt und abhängig. In diesen Bereich fallen speziell auf Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung bezogen Schule, institutionalisierte Nachmittagsbetreuung und Therapien. Auch innerhalb des Familienlebens und des Freundeskreises können Zeitabschnitte, die durch Rituale streng formalisiert werden, als Determinationszeit gesehen werden (vgl. ebd.).
Die selbe Tätigkeit kann im Rahmen dieses Modells von Dispositions-, Obligations- und Determinationszeit für Individuen ganz unterschiedlichen Qualitätscharakter haben. So kann Arbeit spielerische Züge haben und Freizeit Zwangscharakter haben. Von diesem Standpunkt aus gesehen sagt das Ausmaß an Freizeit und Freizeitaktivitäten wenig über die tatsächlichen Freiheitsgrade im Verhalten eines Menschen aus. Viel aussagekräftiger ist hingegen die Intensität und Qualität von Freizeittätigkeiten, sowie die Beweggründe, Zielsetzungen und innere Anteilnahme, die damit in Verbindung stehen (vgl. Opaschowski 1996, 87). So sieht Opaschowski Freizeit im Sinne von "freier Zeit" als "qualitative Handlungseinheit von spielerischer Arbeit, zielgerichteter Beschäftigung und zwangloser Muße" (ebd., 89), wobei die Person auch die darin gegebene Chance zur Selbstverwirklichung in der Gesellschaft auch zu nutzen begreifen muss. In diesem Sinn zielt eine bedürfnisorientierte Pädagogik im Freizeitbereich auf eine Begünstigung der Selbstverwirklichung ab (vgl. ebd., 90). Um die Gestaltung der Freizeit und damit Selbstverwirklichung zu begünstigen müssen als Freizeit deklarierte Lebenssituationen relativ frei sein "von physiologischen Grundbedürfnissen und ökonomischen, sozialen und normativen Zwängen" (ebd., 95) und frei sein "für Wahlmöglichkeit, Entscheidungsmöglichkeit und Initiativmöglichkeit im sozialen Bezug." (ebd.).
Institutionalisierte Freizeitaktivitäten werden von Opaschowski unter der Qualität der Obligationszeit eingeordnet. In Verbindung mit Kindern und Jugendlichen und besonders mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen stellt sich hier jedoch die Frage inwieweit die Teilnahme als freiwillig gewertet werden kann. Oft übernehmen Eltern die Wahl bzw. die Entscheidung für eine institutionalisierte Freizeitaktivität des Kindes (vgl. Flieger 2000, 7f). So können diese Freizeitaktivitäten von Seiten der Eltern durchaus als Obligationszeit gerechnet werden, jedoch aus Sicht des Kindes als Determinationszeit empfunden werden.
Opaschowski nennt acht Freizeitbedürfnisse, die in verschiedener Ausprägung auf alle Menschen zutreffen. Sie sind ineinander verschränkt und voneinander abhängig und weisen bei jedem Individuum unterschiedliche Akzentuierungen, Gewichtungen und Reihenfolgen auf. Schule und Beruf befriedigen meist nicht alle der angeführten Bedürfnisse und deshalb wird die Befriedigung dieser Bedürfnisse auf den Freizeitbereich verlagert. Von diesen acht Bedürfnissen sind vier stark am Individuum orientiert: die Rekreation, die Kompensation, die Edukation und die Kontemplation. Die Rekreation stellt dabei das Bedürfnis nach Erholung, Ruhe, Wohlbefinden, angenehmem Körpergefühl und sexueller Befriedigung dar. Kompensation bedeutet das Bedürfnis nach Ausgleich, Ablenkung und Vergnüge. Edukation steht für das Bedürfnis nach Kennenlernen sowie nach Weiter-und Umlernen in verschiedenen sachlichen und sozialen Handlungsebenen. Die Kontemplation gibt schließlich die Selbsterfahrung und Selbstfindung wieder. Die restlichen von Opaschowski angeführten Freizeitbedürfnisse sind gesellschaftsorientierte Bedürfnisse und werden als Kommunikation, Integration, Partizipation und Enkulturation bezeichnet. Kommunikation meint hierbei Mitteilung, Geselligkeit und vielfältige soziale Beziehungen. Integration steht für Zusammensein, Gemeinschaftsbezug und soziale Stabilität. Partizipation steht für Beteiligung, Mitbestimmung und Engagement und Enkulturation schließlich für kreative Entfaltung, produktive Betätigung und Teilnahme am kulturellen Leben (vgl. Markowetz 2001, 263f; Opaschowski 1996, 90ff). Die Befriedigung dieser Bedürfnisse kann bei Menschen mit Behinderung auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigt sein. Darauf wird in Kapitel 5 genauer eingegangen.
In dem nun folgenden Abschnitt wird über die Entwicklung der Freizeitpädagogik herangehend, Freizeitpädagogik auch als Wissenschaft beschrieben. Darüber hinaus wird das positive Menschenbild als Grundlage der Freizeitpädagogik herausgestrichen und freizeitpädagogische Kompetenzen beleuchtet. Schlussendliche werden noch einige Leitprinzipien für die Didaktik im Handlungsfeld "Freizeit" angeführt.
Die Aufteilung der Lebenszeit in relativ eigenständige Bereiche trat als erstes im Bereich der Schule zutage und so wurde mit der Einführung der Schulpflicht Freizeit zu einem gesellschaftlich relevanten Thema (vgl. Opaschowski 1996, 103). Der Begriff der "Freizeit" ist somit schon länger in der Geschichte der Pädagogik zugegen. Schon Comenius, ein Vordenker des öffentlichen Schulwesens, forderte in seiner "didacta magna" aus dem Jahre 1657 Erholungspausen während der täglichen Schularbeit und eine Polarisierung von Unterricht und Freizeit. Dies sollte einer deutlichen und gesetzmäßigen Abwechslung von schulischer Arbeit und der erholsamen Ruhe dienen. Pestalozzi, der in der Tradition von Comenius stand, sprach 1774 von einer "Erziehung in Freiheit", die für vielfältige Möglichkeiten der individuellen Freizeitbeschäftigung in der unterrichtsfreien Zeit eintrat. Fröbel, ein Schüler Pestalozzis, definierte 1823 die Pausen zwischen den Lernzeiten als Freizeit, in der die Kinder "frei gelassen" sind. Er brachte auch Ferien im heutigen Sinne als Freizeit in Diskussion, indem er nach einer gewissen Anzahl von Monaten in der Schule eine Zeit forderte, die für persönliche und individuelle Bedürfnisse freigegeben ist und bezeichnete diese als "ganz freie Erholungszeit" (Fröbel 1823 zit. n. Opaschowski 1996, 105). Lange, der von Fröbel beeinflusst wurde, forderte 1861 nach jeder Schulstunde ein gewisses Ausmaß an Freizeit zur Entspannung. Diese Art von Freizeit kann mit den heuten Pausen während der Schulzeit verglichen werden. (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 1996, 102ff). Alle diese Autoren und Denker beschäftigten sich aber nicht direkt mit der Pädagogik in der Freizeit, wie es in der heutigen Auffassung von Freizeitpädagogik zugegen ist, sondern sahen Freizeit als Zeit zwischen oder nach pädagogischen Maßnahmen.
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich parallel zu dem oben angeführten Auffassungen eine Freizeiterziehung im Rahmen der Protestantischen Seelsoge. Diese sah Freizeit nicht als freie Zeit in dem Sinne, sondern als Zeit der Besinnung und religiösen Betrachtung. So war in diesem Rahmen alle individuelle Freizeitbeschäftigung verboten und Kinderspiele wurden aus vermeintlichem Mangel an Muße und Erholung abgelehnt. In starker Missions- und Erziehungstätigkeit wurde auf gemeinsame Besinnung und gegenseitige Förderung hingearbeitet. Schleiermacher, der auch in dieser Tradition stand, sah die Aufgabe der Freizeiterziehung um das Jahr 1826 jedoch schon liberaler als eine Zeit der freien gemeinsamen Tätigkeit, die dazu diente auf das Leben vorzubereiten und zu lernen mit Freiheit umzugehen. Den Schlüssel dazu sah er in einer Aufteilung der Zeit zwischen strenger Übung und freier Tätigkeit (vgl. Opaschowski 1996, 106ff).
Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Vielzahl an evangelischen Bibelkreisen aus denen 1913 erstmals die vom evangelischen Verband für die weibliche Jugend Deutschlands organisierten "Freizeiten" hervorgingen. Diese Freizeiten waren eine Art Camp, das der Vertiefung des inneren Lebens und der Weckung des sozialen Sinnes dienen sollte. In Gruppenform wurde auf diesen Lagern der Festigung von Lebensfragen im Kreise Gleichgesinnter nachgegangen und das Verantwortungsbewusstsein der TeilnehmerInnen gestärkt. Diese Bewegung zog eine Vielzahl von verschieden gearteten Freizeiten (Singe-, Wander-, Gymnastik- und Erholungsfreizeiten) nach sich, die sich in einem zeitlichen Ausmaß von drei bis acht Tagen der Besinnung und der Behandlung biblischer Themen annahmen (vgl. ebd., 108f).
Fritz Klatt, Begründer und zu diesem Zeitpunkt Leiter des Volkschulheims Prerow auf dem Draß in Pommern, führte erstmals den Begriff "Freizeitpädagogik" im Jahre 1927 ein (vgl. Nahrstedt 1982, 11). Er hatte die Idee einer Freizeithochschule, deren Aufgabe er darin sah "die übrigen arbeitsfreien Zeiten des beruflich gebundenen Menschen zu verlebendigen und gestalten" (Klatt 1929 zit. n. Nahrstedt 1982, 15), um somit eine "Pädagogisierung der Gesamtfreizeit" (ebd.) in Gang zu setzen. Klatt entwarf auch erste Ansätze eines Qualifikationsprofils für FreizeitpädagogInnen. So sollten sie alle freie Zeit im Leben eines arbeitenden Menschen zu einem "einheitlichen hellen Band" (ebd., 16) verbinden und dadurch die berufliche Arbeit sinnvoll und tragbar machen. Klatt sah neue pädagogische Einrichtungen für den Freizeitbereich als erforderlich, die er "Freizeithochschulen" nannte und schuf dazu den Pädagogentyp des "Freizeitpädagogen". Klatts Freizeitpädagogikbegriff zeigte sich also als stark schulisch konzipiert und an der Berufstätigkeit orientiert (vgl. Nahrstedt 1982, 15ff).
Zwischen 1933 und 1945 stagnierte die Weiterentwicklung des Freizeitpädagogikbegriffs im deutschsprachigen Raum weitgehend. Zu dieser Zeit herrschten freizeitrelevante Organisationsformen, die sich durch ein totalitäres und nationalsozialistisches Führungsprinzip kennzeichneten (z.B. Hitlerjugend). Dennoch erschienen einige wenige theoretische Beiträge (Feige 1936, Flitner 1937, Geck 1936), die auf den Zusammenhang der Freizeitpädagogik mit dem Übergang in die moderne Industriegesellschaft und damit der Aufgliederung der Lebensordnung in Arbeits- und Freizeitbereich bezug nahmen. In Folge dieser Stagnation befand sich nach dem zweiten Weltkrieg der deutschsprachige Raum bezogen auf die Freizeitpädagogik stark im Rückstand gegenüber anderen Staaten (vgl. Nahrstedt 1982, 18f).
In der Nachkriegszeit kamen freizeitpädagogische Impulse vor allem aus dem amerikanischen Ausland. Diese Tendenzen führten zu einer Wiederaufnahme der Diskussion über Freizeitpädagogik, diesmal unter amerikanischem Einfluss. Als Folge daraus wurde 1951 in Deutschland die "Arbeitsgemeinschaft für Freizeitgestaltung" gegründet, die die Forderung nach pädagogisch qualifizierten "Freizeitleitern"[5] forcierte. 1953 wurden in den "Gautinger Beschlüssen" erste Qualifikationsbestimmungen für die Mitarbeiter der "Heime der offenen Tür" als Freizeitzentren vorgenommen. Damit wurden erste Anforderungsprofile für Freizeitpädagogen geschaffen, die sich sehr auf erzieherische Grundlagen stützten (vgl. Nahrstedt 1982, 19ff).
Um das Jahr 1970 fand eine Institutionalisierung des neuen Pädagogentyps statt und erste Ausbildungsstätten entstanden. 1972 wurde eine "Studienkommission für Aus- und Fortbildungsfragen der Deutschen Gesellschaft für Freizeit" gebildet, die verschiedene Thesen zu einer freizeitorientierten Aus- und Fortbildung entwarf und die Aufnahme von Freizeitpädagogik als neuen pädagogischen Schwerpunkt in die Prüfungsordnung forderte. 1974 wurden von der deutschen Bundesregierung einige Forschungsaufträge zum Thema Freizeit vergeben, in Verbindung mit der Bereitstellung größerer Finanzsummen zur Klärung und Förderung der Freizeitfrage. Durch die Forschungsergebnisse wurde die Notwendigkeit einer freizeitpädagogischen Qualifizierung und Professionalisierung bestätigt und daraus resultierend wurden Ausbildungsangebote zum Thema "Freizeitpädagogik" an Fachschulen, Fachhochschulen und Hochschulen geschaffen (vgl. Nahrstedt 1982, 22ff).
1976 wurde von ELRA (European Language Ressources Association) eine "Freizeit-Charta" verabschiedet, in welcher versucht wurde eine knappe Definition des Begriffs "Freizeitpädagogik" zu finden. Man einigte sich auf folgende Definition: "Freizeitpädagogik ist (danach) die Pädagogik, die schwerpunktmäßig in der Freizeit ansetzt, sich jedoch auf das Gesamtleben richtet." (Nahstedt, Mugglin 1977 zit. n. Nahrstedt 1993, 56). So soll Freizeitpädagogik dem Individuum helfen sich zu erkennen, sich zu entfalten und die Kontaktfähigkeit mit anderen zu verbessern. Außerdem soll sie die Möglichkeit zur kreativen individuellen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung geben und darf nicht als Kompensation für überfordernde Arbeitsbedingungen und Gesellschaftsformationen missbraucht werden (vgl. Nahrstedt 1982, 22ff; Nahrstedt 1993, 56f).
Auf internationalen Ebene gründete die "World Leisure and Recreation Association" 1977 die "International Commission on Advancement of Leisure Education (Intercall)". Diese Kommission fasste den Begriff "Freizeitpädagogik" in verschiedenen Dimensionen. So stellt Freizeitpädagogik in ihrem Sinn einen lebenslangen Lernprozess durch Freizeiterfahrungen dar. Diese Freizeiterfahrungen werden in der Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert erhalten. Menschen sollen befähigt werden Freizeit selbstbestimmt für sich selbst und für die Gesellschaft förderlich zu verwenden. Freizeitpädagogik hat außerdem die Aufgabe der Aus- und Fortbildung von Freizeitpädagogen durch Kurse und in Schulen, Fachschulen oder Hochschulen und ist als Zielkonzept und Leistung von Freizeitpolitik und Freizeitplanung zu verstehen (vgl. Nahrstedt 1993, 54f). In den folgenden Jahren wurde der internationale Austausch über die Qualifizierung von Freizeitpädagogen in verschiedenen Freizeitsymposien intensiviert (vgl. ebd., 22ff).
In aktueller Bedeutung sieht Nahrstedt Freizeitpädagogik als Dienstleistungsaufgabe im relativ neuen Freizeitbereich mit einer wachsenden Bedeutung für alle Bildungs- und Sozialinstitutionen. So stellt Freizeitpädagogik in seinem Sinn ein immer entscheidenderes Element der Gesellschaftsstruktur dar, das immer dominanter für Persönlichkeits-und Gesellschaftsentwicklung in heutigen Gesellschaften wird. Nahrstedt erblickt in der Freizeitpädagogik den modernen pädagogischen Zugang zu Gesellschaftsentwicklung und Demokratisierung. Mit der Entwicklung und somit einem Wandel der Gesellschaft geht ein Wandel der Wert-und der Lebensstruktur der Bevölkerung einher. Postmateriale Werte wie Selbstbestimmung und Lebensqualität gewinnen immer mehr an Bedeutung und durch vermehrte Freizeit entstehen neue Möglichkeiten zur Entwicklung von Persönlichkeit mit dem Ziel der Selbstverwirklichung. Die Freizeitpädagogik steht mit diesem Wandel eng in Verbindung und wird daher in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen (vgl. Nahrstedt 1993, 51ff).
Mit dem 21. Jahrhundert und den damit einhergehenden weiteren Veränderungen in der Gesellschaft muss sich die Pädagogik immer relevanter werdenden Zukunftsfragen stellen. Mit der Jahrtausendwende bewegt sich die Menschheit immer mehr in ein Informations- und Erlebniszeitalter (vgl. Opaschowski 1996, 167), in dem Fragen der Freizeit einen immer größeren Stellenwert einnehmen werden. Eine Anzahl von Kennzeichen sprechen für die zunehmende Erweiterung des Freizeitbereichs. So gibt es eine immer größer werdende Anzahl an Freizeiteinrichtungen und Freizeitmaßnahmen mit dem dementsprechenden Bedarf an qualifiziertem Personal, das freizeitpädagogische Kompetenzen aufweist. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, werden in letzter Zeit zusehends nationale Organisationen zur Koordinierung und zur Festlegung der Ausbildungsstandards gebildet und Ausbildungsgänge für Freizeitfachleute geschaffen. Damit findet im Moment auch eine zunehmende Professionalisierung und Spezialisierung der Freizeitfachleute statt. Auch von staatlicher Seite wurde die zunehmende Bedeutung von Freizeit erkannt und Stellen für Freizeitreferenten, besondere Freizeitabteilungen und eine systematische Freizeitforschung geschaffen (vgl. Nahrstedt 1993, 151f). Auf diese systematische Freizeitforschung wird im nächsten Unterkapitel "Freizeitpädagogik als Wissenschaft" genauer eingegangen.
In bezug auf Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wurde diesem Personenkreis bis in die 1970er von Seiten der Freizeitpädagogik wenig Beachtung geschenkt. Als Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich dann zu dieser Zeit als mögliche Zielgruppe in Erscheinung treten, zeigt sich die diesbezüglich Freizeitpädagogik sehr leitfadenorientiert und programmatisch. Mit der Grundlage eines defektorientierten Menschenbildes zielte die sogenannte "Freizeiterziehung" auf besseres Funktionieren der Menschen mit geistiger Behinderung und bestand zu einem Großteil aus therapieartigen Übungen (vgl. Flieger 2000, 19). Von dieser Fixierung auf therapeutische Aspekte in der Freizeitpädagogik wird in den letzten Jahren jedoch mehr und mehr Abstand genommen. In der Freizeitgestaltung für als geistig behindert bezeichnete Menschen tritt immer mehr die Freude und der Spaß an der Aktivität in den Vordergrund und der selbstbestimmten Gestaltung der Freizeit wird ein immer höherer Stellenwert eingeräumt.
Die Freizeitpädagogik vereinigt als "Spektrumswissenschaft" (Opaschowski 1996, 165) Teilaspekte mehrerer Wissenschaftsformen. So berührt sie als Querschnittswissenschaft eine Vielzahl von verschiedenen Fachbereichen und auch mitunter deshalb als Integrationswissenschaft auf Interdisziplinarität und Kooperation mit Basiswissenschaften (Soziologie, Psychologie, etc.) angewiesen. Darüber hinausgehend gilt Freizeitpädagogik in wissenschaftlicher Auslegung als Gesellschafts-, Handlungs- und Erziehungswissenschaft. In ihrer heutigen Funktion wird Freizeitpädagogik am ehesten als eine erziehungswissenschaftliche Teildisziplin angesehen, deren Aufgabe es ist die Entwicklung eines bewussten und kritischen Freizeitverhaltens zu fördern. So soll die "Pädagogik der freien Lebenszeit" (ebd., 168) in reflektierter Weise an Erziehung und Bildung mit dem Ziel eines sozial-kulturellem und kreativ-kommunikativen Handelns herangehen. Dabei soll kommunikative, soziale und kulturelle Handlungskompetenz vermittelt werden, um mehr freie Entfaltung im sozialen Bereich zu ermöglichen. Diese freizeitpädagogischen Orientierungen sollen im Sinne der Freizeitpädagigk in der freien Zeit, durch die freie Zeit und für die freie Zeit vermittelt werden. Die Freizeitpädagogik als Wissenschaft wird von ihren Vertretern nicht als isolierte Teildisziplin der Erziehungswissenschaft angesehen, sondern bereichert und ergänzt andere pädagogische Teildisziplinen durch ihre Einflüsse. Als Spektrumswissenschaft erstreckt sie sich auch über Hauptbereiche der Freizeit (Tourismus - Mobilität, Medien - Kommunikation, Kultur - Kulturelle Bildung, Sport -Spiel und Konsum -Unterhaltung) und besitzt somit vielseitige individuelle und gesellschaftliche Bezüge (vgl. ebd., 165ff).
Freizeitpädagogik hat nach Opaschowski von einem positiven Menschenbild auszugehen, das den Menschen als ein freihandelndes Wesen ansieht. Freiheit im Sinne von Befreiung, Fortschritt im Sinne von Entwicklung und Vervollkommnung im Sinne von Selbstverwirklichung nehmen dabei einen wichtigen Standpunkt ein. Tätigkeit in freiverfügbarer Zeit ist als Chance zu persönlicher und sozialer Entwicklung in diese Richtung zu sehen. Zu dem grundlegenden positiven Menschenbild gehört laut Opaschowski die "Anerkennung der Unvollkommenheit des Menschen" (Opaschowski 1996, 183) und somit die gleichwertige Akzeptanz von Scheitern sowie von Gelingen. Freizeitbildung und Freizeiterziehung sind in diesem Zusammenhang als Angebote zu sehen, die Freiheit und Selbstbestimmung respektieren. Auf diesem positiven Menschenbild aufbauend definiert Opaschowski Freizeitpädagogik als eine "Pädagogik der freien Lebenszeit" folgendermaßen: "Eine Pädagogik der freien Lebenszeit bietet auf freiwilliger Basis Orientierungshilfen für die persönliche Lebensführung, dient der Entwicklung individueller Fähigkeiten, Neigungen und Interessen und sichert den nötigen Wahl-, Entscheidungs-und Handlungsspielraum. Die Erlangung der Handlungskompetenz muß daher vorrangiges Ziel einer Pädagogik der freien Lebenszeit sein." (ebd., 183).
Eng mit dem zugrundeliegenden positiven Menschenbild geht auch ein positives Denken einher, das in der Freizeitpädagogik ebenso einen wichtigen Stellenwert aufweist. Es zählt laut Opaschowski in Zusammenhang mit Einfühlungsvermögen, Kritikfähigkeit und Frustrationstoleranz zu den zentralen Eigenschaften von Freizeitpädagogen. So gilt es in diesem Rahmen Sachzwänge als kreative Herausforderung und als Ausgangspunkt für neue Problemlösungen und Handlungsmöglichkeiten zu sehen. Über Problemlösungen können weitergehend neue Ideen, Impulse und Initiativen für ein lebenswertes Leben entwickelt werden. Letztendlich können über positives Denken auch andere Mitmenschen für die Entwicklung und Veränderung der eigenen Person und der sozialen Umwelt gewonnen werden (vgl. ebd., 182ff). Die freizeitpädagogische Grundhaltung, die ein positives Menschenbild und positives Denken impliziert, wird durch freizeitpädagogische Kompetenzen ergänzt und verstärkt.
Um adäquat freizeitpädagogisch arbeiten zu können, sind gewisse freizeitpädagogische Kompetenzen vorausgesetzt. So muss laut Opaschowski ein Freizeitpädagoge im Rahmen der "Interdisziplinären Kompetenz" auch für andere Fachrichtungen (Psychologie, Soziologie, etc.) offen sein und sich in diese Richtung Kompetenzen aneignen. Die "Prospektivische Kompetenz" zeichnet einen Freizeitpädagogen als Vor-und Querdenker in gesellschaftlich zentralen Fragen aus, der in seinem Handeln und in seinen Aussagen, die gesellschaftliche Diskussion über Zukunftsentwicklung von Arbeit und Freizeit beeinflussen kann. Die "Holistische Kompetenz" soll einen Freizeitpädagogen dazu befähigen die Spaltung der Lebenszeit in Arbeit und Freizeit weitgehend aufzuheben, um somit ein ganzheitliches Lebenskonzept zu fördern. Dabei sollen körperliche, intellektuelle und geistige Fähigkeiten gleichsam von Bedeutung sein und nicht mehr von Arbeit abhängig sein. Die "Didaktische Kompetenz" bezieht sich auf das freizeitpädagogische Handeln in offenen Situationen (vgl. Opaschowski 1996, 190f).
Solche offenen Freizeitsituationen stellen u.a. Jahresfreizeit und damit Urlaub bzw. Ferien dar, die als eine Kategorie neben teiloffenen Freizeitsituationen (Erholungspausen, Wartezeiten, etc.) und nichtoffenen Freizeitsituationen (Freizeit von Patienten in Krankenhäusern) gerechnet werden. Offene Freizeitsituationen als Feld der Freizeitpädagogik sind geprägt durch eine nicht genau einplanbare Anzahl von TeilnehmerInnen, hohe Fluktuation der TeilnehmerInnen, Freiwilligkeit der Teilnahme, flexible individuelle Verweildauer, unterschiedliche Teilnahmeintensität, unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche soziale Herkunft der TeilnehmerInnen sowie ständige Situationsveränderungen durch spontan auftretende Bedürfnisse. Dadurch wird eine nichtdirektive Handlungskompetenz der Anregung, Förderung, Ermutigung und Anleitung als Herausforderung an die Freizeitpädagogik gestellt (vgl. ebd., 96f), die frei bleiben sollte von Verwertungsabsichten, verbindlichen Leistungsansprüchen und Sanktionen (vgl. ebd., 191). Freizeitpädagogische Kompetenzen sind auch für die Didaktik im Handlungsfeld Freizeit von Bedeutung, für die es im wissenschaftlichen Diskurs einige Leitlinien gibt.
Opaschowski führt neun Leitprinzipien für die Didaktik im Handlungsfeld an, die weitgehend auf dem Konzept der nichtdirektiven Anregung und Förderung basieren und Orientierungspunkte für die freizeitpädagogische Praxis liefern. Das erste Leitprinzip ist das Prinzip der "Erreichbarkeit". Freizeitangebote sollten in einem hohen Maße teilnehmerorientiert und zielgruppenspezifisch sein, was bedeutet, dass sie sich auf herangetragene Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen zu beziehen haben. Das Leitprinzip der Erreichbarkeit zieht sich über mehrere Dimensionen. So kann zwischen einer räumlichen (z.B. Wohnungsnähe), einer zeitlichen (z.B. zeitliche Orientierung an der Zielgruppe), einer informatorischen (z.B. Bekanntheitsgrad), einer motivationalen (z.B. Orientierung an Neigungen der Zielgruppe) und einer aktivitätsbezogenen Erreichbarkeit (z.B. Voraussetzungslosigkeit) unterschieden werden (vgl. Opaschowski 1996, 204f). Die Bedeutung des Leitprinzips der Erreichbarkeit in Verbindung mit Freizeit-und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wird in Kapitel 6.6 näher beleuchtet.
Das Leitprinzip der "Offenheit" besagt, dass ein Freizeitangebot jederzeit flexibel zugänglich sein sollte. Es sollte also freies Kommen und Gehen möglich sein. Weiters bedeutet Offenheit, dass ein Freizeitangebot immer für neue Anregungen aufnahmefähig sein sollte und diese auch einbeziehen sollte. Genau bedeutet Offenheit als Strukturmerkmal von Freizeitsituationen eine nicht genau einplanbare Zahl von TeilnehmerInnen, eine hohe Fluktuation der TeilnehmerInnen durch permanente Zugänglichkeit, eine unterschiedliche Verweildauer der TeilnehmerInnen, die Zulassung einer Teilnehmerschaft aus unterschiedlichen Sozial- und Altersgruppen, kaum Sanktionen, Pflichten und Kontrollen, bedingte Planbarkeit und eine gewisse Zugänglichkeit für Gestaltungs- und Änderungswünsche (vgl. ebd., 206f).
Im Rahmen des Prinzips des "Aufforderungscharakters" sollte bei Freizeitangeboten eine anregungsreiche und anziehungskräftige Atmosphäre geschaffen werden, die eine Teilnahme an dem Angebot attraktiv erscheinen lässt. Diese Attraktivität kann durch anregungsreiche Bedingungen der Umwelt, durch eine gute materiale Ausstattung, durch den Einsatz attraktiver Medien oder durch persönliches Ansprechen von möglichen TeilnehmerInnen hergestellt bzw. gesteigert werden. Ziel dabei ist es, das Neugierverhalten anzuregen und Spontaneität, Eigenaktivität und Eigeninitiative zu fördern (vgl. ebd., 208).
Das Leitprinzip der "Freien Zeiteinteilung" steht für die Möglichkeit der TeilnehmerInnen zu flexibler Zeiteinteilung und Zeitverwendung im Rahmen der äußeren Bedingungen. Freie Zeiteinteilung dient dazu individuelle Überforderung zu verhindern und Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, um somit zu einer selbstbestimmten Programmgestaltung beizutragen (vgl. ebd., 209f).
"Freiwilligkeit" als Leitprinzip bedeutet, die Möglichkeit zu schaffen sich im Rahmen des Freizeit-und Ferienangebotes nach eigenen Neigungen verhalten zu können. So sollte auch ein Minimum an Kontinuität der Teilnahme ohne Diskriminierung toleriert werden. Eine Voraussetzung für die Freiwilligkeit ist die prinzipielle Anerkennung der von Mensch zu Mensch verschiedenen Bedürfnis- und Motivationsstruktur (vgl. ebd., 210).
Das Prinzip der "Zwanglosigkeit" geht darauf ein, dass TeilnehmerInnen die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich ungezwungen geben zu können. Von Reglementierung, Erfolgszwang und Konkurrenzkampf sollte also Abstand genommen werden. Die Möglichkeit zur spontanen Bildung von informellen Gruppen begünstigt die Zwanglosigkeit eines Angebots und sichert somit eine gewisse innere Freiheit. Zwanglosigkeit gilt als Voraussetzung für Offenheit, Flexibilität, Spontaneität und Kreativität.
"Wahlmöglichkeit" als Leitprinzip heißt zwischen Alternativen wählen zu können. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich um echte Alternativen handelt und nicht um unattraktive Aktivitäten, die angeboten werden, um die Illusion einer Wahlmöglichkeit zu schaffen. Ziel bei diesem Leitprinzip ist es, auf unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen von TeilnehmerInnen bezug zu nehmen. Dazu ist es auch wichtig Wechsel zwischen Aktivitäten zu ermöglichen (vgl. ebd., 212).
Das Leitprinzip der "Entscheidungsmöglichkeit" soll den TeilnehmerInnen einen Rahmen dafür bieten, eigene Entschlüsse fassen zu können, um dadurch eigene Interessen in das Angebot einfließen zu lassen. Dies bedeutet das individuelle Entscheidungen sowohl erwartet als auch ernstgenommen werden. Bei Kindern und vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung ist dabei zu beachten, dass der Entscheidungsspielraum nicht zu groß wird, um Überforderung und Leistungsdruck zu verhindern (vgl. ebd. 213f).
Schließlich zielt das Prinzip der "Initiativmöglichkeit" darauf ab, TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben, Eigenaktivität entwickeln zu können und eigene Bedürfnisse befriedigen zu können. Mit zunehmender Eigenaktivität steigt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und es können nach und nach auch Leitungsfunktionen innerhalb des Freizeitangebots übernommen werden (vgl. ebd., 214f).
Die angeführten Leitprinzipien gelten natürlich auch für die freizeitpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Besondere Aspekte von Freizeit und Freizeitpädagogik in Verbindung mit dem Phänomen "Geistige Behinderung" werden nun beleuchtet.
Theunissen verbindet im wissenschaftlichen Diskurs die Begriffe "Freizeit" und "Freizeitpädagogik" mit dem Phänomen "Geistige Behinderung". Er sieht Freizeit als grundsätzlich bedeutend für menschliche Lebensverwirklichung, Lebenszufriedenheit und das Lebensglück. Somit ist Freizeit auch für Menschen mit geistiger Behinderung von großer Wichtigkeit. Dabei ist besonders im Zusammenhang mit Menschen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich hervorzuheben, dass in der Zeitqualität "Freizeit" kein Zwang und Leistungsdruck ausgeübt wird und diese Zeit auf Freiwilligkeit, Freiheit und Eigenentscheidungen beruht. Freie Zeit sollte auch für als "geistig behindert" bezeichnete Menschen individuell frei verfügbar und selbst gestaltbar sein sowie die Möglichkeit bieten eigene Initiativen zu verwirklichen. So ist freie Zeit durch Subjektivität, Spontaneität, Zufall, Erholung, Unterhaltung, Intimität, Privatheit, Spiel, Geselligkeit, Hobby, ästhetische Kulturbetätigung, Lebensfreude und Freiheit geprägt und zeichnet sich durch subjektive Zielsetzungen sowie Wahlmöglichkeiten nach eigenen Bedürfnissen und Geschmack aus. Sie ist ein Zeitraum, über dessen Zweck und Verwendung selbst bestimmt werden kann. Die Gestaltungsmöglichkeiten in der freien Zeit hängen von den gegebenen Verhältnissen ab, die besonders bei Menschen mit geistiger Behinderung vielerlei Gestaltungsmöglichkeiten einschränken bzw. verhindern. Dennoch sollte viel daran gesetzt werden freie Entscheidung und Spontaneität als Kern der freien Zeit auch bei Menschen mit geistiger Behinderung zu erhalten (vgl. Theunissen 2000b, 94ff).
Die Aufgabe der Freizeitpädagogik in Verbindung mit Menschen mit geistiger Behinderung sieht Theunissen darin "geistig behinderte Menschen zu befähigen, Freizeit als freie, selbstgestaltete Zeit zur Daseinsverwirklichung zu erleben" (ebd., 100). Dazu ist für Freizeitpädagogen ein Wissen um die Bedeutung von Freizeit und um die Freizeitbedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung notwendig. Mit diesem Wissen können sie einen Zeitraum für individuelle Selbstentfaltung absichern. Um diesen Zeitraum gebührend auszufüllen, ist ein gewisses Repertoire an Freizeitfertigkeiten und -kompetenzen notwendig, die es wiederum ermöglichen, dass Fähigkeiten, Interessen und Neigungen von Menschen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich in der freien Zeit zur Geltung kommen und auch weiterentwickelt werden. Dazu ist ein breites Spektrum an Freizeitangeboten und diesbezüglichen Anregungen von Vorteil. Theunissen sieht hier eine wesentliche freizeitpädagogische Aufgabe darin, Menschen mit geistiger Behinderung Freizeit als einen frei gestaltbaren Raum näher zu bringen, der nach eigenen Wünschen gestaltet werden kann. Hier ist zu berücksichtigen, dass auch eine ungeplante Zeit, über diese ganz alleine verfügt werden kann, als Teil der freien Zeit gerechnet werden muss. Oft wird übersehen, dass vor allem auch für Menschen mit geistiger Behinderung eine solche Zeitqualität notwendig ist, um nicht permanent pädagogischen Anforderungen zu unterliegen. Diese Einberechnung einer ungeplanten Zeit in der Freizeitpädagogik spiegelt eine Respektierung des Soseins von Menschen mit Behinderung und eine Anerkennung der Bedürfnisse nach Entspannung, Wohlbefinden, Muße, Unterhaltung und Selbstverwirklichung im zweckfreien Tun wider (vgl. ebd., 100ff).
In Anlehnung an Opaschowski teilt Theunissen die Lebenszeit von als "geistig behindert" bezeichneten Menschen in sechs zentrale Zeitmodelle: in Versorgungszeit, Arbeitszeit, Verpflichtungszeit, Bildungszeit, Ruhe-und Schlafzeit sowie in freie Dispositionszeit. Er räumt jedoch ein, dass es oft zu Vermischungen dieser drei Zeitmodelle kommt bzw. bestimmte Zeitmodelle im Leben eines Menschen wesentlich dominieren können mit Folgen für die jeweilige Persönlichkeitsentwicklung. Die "Versorgungszeit" steht für die alltägliche Versorgung. Bei Menschen mit geistiger Behinderung ist diese Zeitqualität sehr von anderen Personen abhängig und nimmt viel Raum in Anspruch. Die Versorgungszeit ist weitgehend festgelegt und setzt den zeitlichen Rahmen für alle anderen Aktivitäten. Die "Arbeitszeit" wird von geistig behinderten Menschen in der Regel in tagesstrukturierenden Angeboten wie Werkstätten oder vergleichbare Einrichtungen außerhalb der primären Lebenswelt (Wohnstätte) verbracht. Die "Verpflichtungszeit" ist auf bestimmte Zwecke gerichtet, hat häufig sozialverpflichtenden Charakter und gilt für ein soziales Zusammenleben als unverzichtbar. Diese Zeitqualität spielt in der Kontrolle der eigenen Lebensumstände und der autonomen Lebensbewältigung eine große Rolle. In positiver Weise führen sozialverpflichtende Tätigkeiten im Rahmen der Verpflichtungszeit zu sozialer Anerkennung in der Umgebung. Die "Bildungszeit" ist vor allem für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung von Bedeutung. Zu ihr zählt die Zeit, die in diesbezüglichen tagesstrukturierenden Angeboten (Sonderschule) verbracht wird. Solche Angebote zeichnen sich durch spezifisch aufbereitete Lehrziele, klar strukturierte Lernsituationen und Organisation sowie sorgfältig geplante methodische Vorgehensweisen aus. Das Bedürfnis nach Schlaf und Ruhe ist für alle Menschen selbstverständlich und so nimmt auch die "Schlaf-und Ruhezeit" in der Lebenszeit geistig behinderter Menschen ihren Platz ein. Die diesbezüglichen Bedürfnisse sind jedoch für jeden Menschen individuell unterschiedlich. Schließlich ist noch die "freie Dispositionszeit" als Zeitqualität zu nennen, die als selbstbestimmte Freizeit unterschiedliche Funktionen übernehmen kann und so rekreativ-kompensatorisch, anthropologisch-komplementär, sozial-integrativ, hedonistisch, kommunikativ, bildend, katharisch-magisch, kulturell-partizipierend, musisch-kontemplativ, therapeutisch und gesundheitsfördernd genutzt werden kann. Freizeit ist auch bei Menschen mit geistiger Behinderung als frei verfügbare Zeit einzustufen, die natürlich von subjektiven Faktoren abhängt, aber in dessen Kern freie Entscheidung und Spontaneität liegen sollte (vgl. Theunissen 2000a, 139ff).
"Freizeit" wird in dieser Diplomarbeit als ein gesellschaftliches Phänomen betrachtet, das mit der Konsum- und Erlebnisgesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts im weiter an Bedeutung zunehmen wird. Es findet in der heutigen Zeit des weiteren eine Abkehr vom zweigeteilten Leben in Arbeit und Freizeit statt und somit wird Freizeit nicht mehr unbedingt als Gegenteil bzw. als Abwesenheit von Arbeitszeit definiert, sondern als "freie Zeit". Diese freie Zeit zeichnet sich durch Wahlmöglichkeiten, individuelle Entscheidungen und soziales Handeln aus und ist als eines von vielen Teilen des ganzheitlichen Konzepts "Lebenszeit" zu sehen. Diese Lebenszeit eines Menschen kann in die Zeitqualitäten Dispositionszeit, Obligationszeit und Determinationszeit unterteilt werden. Die Gestaltung der freien Zeit findet dabei weitgehend ausschließlich in den Zeitqualitäten Dispositionszeit und Obligationszeit statt. In der freien Zeit versuchen alle Menschen und somit auch Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung verschiedene Freizeitbedürfnisse zu befriedigen, zu denen Rekreation, Kompensation, Edukation, Kontemplation, Kommunikation, Integration, Partizipation und Enkulturation zählen (vgl. Opaschowski 1996; Markowetz 2001; Nahrstedt 1993).
Mit der Zunahme des Stellenwertes der freien Zeit in den nächsten Jahren wird auch die Bedeutung der Pädagogik in der freien Lebenszeit wachsen. Somit wird auch eine Auseinandersetzung der Freizeitpädagogik mit der Freizeitgestaltung bezogen auf Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung notwendig. In ihrem Status als Spektrumswissenschaft, die mehrere Bereiche in sich vereinigt (Teile der Psychologie, Soziologie, Pädagogik, etc.), hat Freizeitpädagogik auch vielseitige Bezüge zu anderen Fachbereichen der Wissenschaft und kann dadurch in einem ganzheitlichen Konzept an diese Thematik herangehen. Dabei geht die Pädagogik der freien Zeit von einem positiven Menschenbild und von positivem Denken aus, indem sie sich auf Stärken und mögliche Fortschritte bezieht, was einhergeht mit einer Abkehr von Defizitorientierung und Leistungsgedanken. Als Basis der Freizeitpädagogik ist die Freiwilligkeit zu sehen, die den Wahl-, Entscheidungs-und Handlungsspielraum als Charakteristikum der Pädagogik der freien Zeit überhaupt erst ermöglicht. Für die praktische pädagogische Arbeit im Freizeitbereich sind verschiedene Kompetenzen, wie interdisziplinäre, didaktische, prospektische oder holistische Kompetenzen, von Vorteil. Diese Kompetenzen ermöglichen eine befriedigende Arbeit in den für freizeitpädagogische Angebote charakteristischen offenen Situationen. Dabei sind für die Didaktik im Freizeitbereich verschiedene Leitprinzipien zu beachten. Dazu zählen die Erreichbarkeit, die Offenheit, der Aufforderungscharakter, die freie Zeiteinteilung, die Freiwilligkeit, die Zwanglosigkeit, Wahlmöglichkeit, Entscheidungsmöglichkeit und Initiativmöglichkeit (vgl. Opaschowski 1996, Nahrstedt 1993).
Die angeführten Charakteristiken und Leitprinzipien gelten natürlich auch für Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. In diesem Bereich kann es jedoch zeitweise notwendig sein, TeilnehmerInnen in der Entscheidungsfindung und der Ausführung von Mit-und Selbstbestimmung zu unterstützen, da die diesbezüglichen Möglichkeiten durch behinderungsbedingte Beeinträchtigungen eingeschränkt sein können. Dies bedeutet zeitweise einen erhöhten Arbeitaufwand, der jedoch in Anbetracht der Leitprinzipien der Didaktik in der freien Zeit gerechtfertigt scheint.
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Exkurs soll ein Überblick über die Lebenssituation von Familien mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern gegeben werden. Dies soll zum grundlegenden Verständnis der Lebenslage dieser Familien beitragen und somit auch einen Hintergrund für das Verständnis das darauf folgende Kapitel schaffen, das sich der Freizeitgestaltung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen widmet. In diesem Exkurs wird auf die Situation der Kinder mit Behinderung und ihr Verhältnis zu Eltern und Geschwistern eingegangen. Weiters wird auch das soziale Umfeld und die finanzielle Situation der Familien beleuchtet und die mögliche Doppelbelastung von Eltern durch Berufstätigkeit und Kind mit Behinderung kurz angeschnitten. Da dies ein Exkurs ist, der einen Überblick bieten soll, wird hier kein Anspruch auf Abdeckung aller aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse erhoben.
Die Geburt eines behinderten Kindes führt wie die Geburt eines nichtbehinderten Kindes eine plötzliche Veränderung der familiären Situation herbei (vgl. Cloerkes 242). Hat das Kind eine Behinderung, wird es jedoch in der Regel notwendig die familiäre Lebensorientierungen neu zu überdenken. Da die Behinderung des Kindes häufig erst nach der Geburt diagnostiziert wird, trifft die Eltern die Notwendigkeit einer Umorientierung eher unerwartet. Vor der Geburt herrscht in den Köpfen der Eltern ein Bild von einem fiktiven und idealen Wunschkind, das in der Regel auch mit Ansprüchen in der Gesellschaft konform geht. Wird nach der Geburt eine Behinderung diagnostiziert, weicht das elterliche Bild des realen Kindes oft weit von dem zuvor gefassten Bild des Wunschkindes ab. Es wird also der Verlust eines Idealkindes erlebt und Familien bekommen durch die Geburt des behinderten Kindes häufig das Gefühl aus der "normalen" Gesellschaft ausgeschlossen zu werden (vgl. Rosenkranz 1998, 6). Da die Eltern diese Nachricht üblicherweise weitgehend unvorbereitet trifft, werden zuvor gefasste Vorstellungen, Hoffnungen, Träume und Erwartungen enttäuscht. Es wird den Eltern klar, dass das Kind nicht den normativen Erwartungen unserer Leistungsgesellschaft entspricht und entsprechen wird. Diese Situation ist für die verschiedenen Familienmitglieder psychisch sehr belastend und frustrierend. Die Intensität dieses Frustrationserlebnisses ist abhängig von der elterlichen Einstellung zu behinderten Menschen allgemein und den vor der Geburt gehegten elterlichen Erwartungen an das Kind (vgl. Rosenkranz 1998, 27; Cloerkes 2001, 236f).
Familien mit behinderten Kindern sind in weiterer Folge erheblichen zeitlichen, psychischen und finanziellen Belastungen ausgesetzt, was leicht zu einer Überforderung der Ressourcen der Familie führen kann (vgl. Badelt, Österle 1993, 21). Diese Belastungen werden von betroffenen Familien unterschiedlich erlebt und verarbeitet. Auf diese Aspekte wird nun in den folgenden Kapiteln genauer eingegangen, mit Rücksichtnahme darauf, dass behinderte Kinder nicht ausschließlich eine Belastung für die jeweilige Familie darstellten, sondern dass im Gegenteil auch mit behinderten Angehörigen Freude, Zufriedenheit und Bereicherung erlebt werden kann (vgl. Rosenkranz 1998, 28f).
Die Lebenssituation geistig behinderter Kinder und Jugendlicher sowie deren Angehöriger ist in der Regel als schwieriger einzuschätzen als die Situation bei Altersgenossen ohne Behinderung. Sie sehen sich mit einer gewissen Aussonderung in der Gesellschaft konfrontiert, die zu spezifischen Sozialisationsmängeln und -abweichungen führen kann. Durch Vorurteile und Barrieren verschiedener Art werden Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung von verschiedenen, in der Gesellschaft als normal geltenden Entwicklungs- und Lebensbedingungen bzw. -möglichkeiten ausgeschlossen. Dies schafft eine ungünstige Ausgangsposition für die weitere Entwicklung und gibt geringe Chancen zu einer vollen gesellschaftlichen Teilhabe und Integration. Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich sehen sich trotz verschiedener Integrationsbemühungen immer wieder Erschwernissen, Problemen und Defiziten in den Bereichen Schule, Ausbildung, Arbeitswelt, Wohnsituation und Freizeit gegenüber. Auch in dem bisher weitgehend tabuisierten Bereich der Partnerschaft und Sexualität erfahren vor allem Jugendliche mit geistiger Behinderung gewisse Benachteiligungen durch Aussonderung und Diskriminierung. Sondereinrichtungen und -maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung verstärken die soziale Ausgrenzung noch zusätzlich. Daraus resultierend leben viele Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in sozialer Isolation fern von einer befriedigenden Integration in ihre unmittelbare soziale Umwelt. Sie sind zu großen Teilen in einer "Behindertendienstleistungsinfrastruktur" (Hovorka 1990, 632) gefangen, die durch die Unterbringung, Ausbildung und Betreuung von geistig behinderten Menschen in Sondereinrichtungen eine soziale Integration erschweren (vgl. Hovorka 1990, 621ff).
Bis auf einige wenige, die in pädagogisch betreuten Wohngemeinschaften oder geschlossenen Anstalten untergebracht sind, wohnen die meisten als "geistig behindert" bezeichneten Kinder und Jugendliche, wie nicht behinderte Kinder und Jugendliche im Familienverband. Ein Auszug aus dem familiären Umfeld in betreute Wohnformen findet meist erst mit dem Erreichen des Erwachsenenalters statt. Eine große Anzahl von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen besuchen außerdem Sonderschulen, in denen sie abgekoppelt vom restlichen Schulwesen unterrichtet werden. Durch diese Tatsache wird ein späterer Berufseinstieg durch negative Assoziationen in Verbindung mit dieser Schulform von Seiten der Arbeitgeber und der dementsprechenden Stigmatisierung erschwert. Außerdem scheint für Menschen mit geistiger Behinderung in einer Arbeitswelt, die fast ausschließlich auf Leistung ausgelegt ist, wenig Platz zu sein (vgl. ebd., 627ff). Die Rolle, die das behinderte Kind im Familienverband einnimmt, wird nun detaillierter behandelt.
Den Platz, den ein Kind mit geistiger Behinderung in der Familie einnimmt, ist maßgeblich von der Fähigkeit der Eltern abhängig, mit dieser Situation umzugehen. In bezug auf die Beziehungsdynamik der Familie und die mögliche ambivalente Beziehung zwischen Eltern und behindertem Kind kann es zu problematischen Rollenzuschreibungen das Kind betreffend kommen. So kann das behinderte Kind als Sorgenkind, als Partnerersatz oder als Sündenbock innerhalb der Familie gelten. Hier sollte jedoch von einer generellen Pathologisierung von Familien mit behinderten Kindern Abstand genommen werden, da solche Rollenzuschreibungen auch in Familien mit nicht behinderten Kindern stattfinden können und auch stattfinden (vgl. Cloerkes 2001, 245).
Die Geburt eines behinderten Kindes bedeutet, wie zuvor beschrieben, häufig den Verlust des zuvor gefassten Bildes eines Idealkindes, was für die Eltern große psychische Belastungen zur Folge haben kann. Nach der Geburt beginnt ein Trauerprozess, in dem der Verlust dieses idealen Kindes verarbeitet wird. Im günstigsten Fall mündet dieser Trauerprozess in die vollwertige Akzeptanz des behinderten Kindes. In der Regel ist aber die elterliche Auseinandersetzung mit dem behinderten Kind als ein lebenslanger Prozess zu sehen. Im Verhältnis zu nicht behinderten Kindern verzögerte Entwicklungsfortschritte beim Kind können dabei zu Rückschlägen, Niedergeschlagenheit und Verzweiflung innerhalb der Familie führen. Oft ergeben sich im Heranwachsen des Kindes auch weitere nicht prognostizierbare und kalkulierbare Probleme und Belastungen, die die innerfamiliäre Situation noch weiter verschärfen. Dennoch kann die Geburt eines behinderten Kindes von der Familie als Chance oder Herausforderung wahrgenommen werden, das Leben neu zu ordnen und neue Wertmaßstäbe zu entwickeln. Solche Tendenzen gehen meist mit einer emotionalen Stabilisierung der Eltern und einer zunehmenden Annahme der Behinderung des Kinde einher (vgl. ebd., 32ff).
Das psychische Befinden der Eltern und die emotionale Beziehung zwischen Eltern und Kind beeinflussen die Entwicklung des Kindes maßgebend. Um eine förderliche Umgebung für die Entwicklung des Kindes zu schaffen, ist die Akzeptanz der Behinderung innerhalb der Familie wichtig. Das Annehmen der Behinderung ermöglicht es Eltern eine neue eigenständige Identität zu finden und Kompetenzen zu entwickeln, um in weiterer Folge die Entwicklung und Selbstständigkeit des Kindes zu fördern. Es ist ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz der Behinderung, dass das behinderte Kind nicht mehr ausschließlich im Mittelpunkt der Familie steht und somit Freiraum für die eigenen Lebens-und Alltagsplanung der restlichen Familienmitglieder entsteht (vgl. Rosenkranz 1998, 52f).
Vor allem bei Kindern mit geistiger Behinderung ist es relevant, dass die gelebte Elternschaft im Falle von Familien mit geistig behinderten Kindern meist länger als üblich andauert und sich intensiver gestaltet. Entwicklung, Selbstständigwerden und Ablösungsprozess beim Kind sind häufig verzögert und die Eltern sind dadurch gezwungen längere Zeit Verantwortung oder Betreuungsaufgaben für das Kind zu übernehmen. So passiert es oft, dass Eltern ihr Kind mit geistiger Behinderung bis ins hohe Alter versorgen, wodurch die psychische und körperliche Belastung weiter erhöht und die Ablösung von den Eltern zusehends erschwert wird. Oft wird auch der Auszug eines behinderten Kindes von den Eltern als Versagen der eigenen Belastbarkeit und der eigenen Familie gewertet. Diese Problematik stellt sich eher bei älteren Müttern und Vätern, während in der heutigen Zeit jüngere Eltern den Auszug des behinderten Kindes eher als entlastendes Ereignis und als Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des behinderten Kindes sehen (vgl. Rosenkranz 1998, 61f; Cloerkes 2001, 245).
Häufig ist das Verhältnis zwischen Eltern und behindertem Kind durch ein ambivalentes Grundgefühl zwischen Zuneigung und Ablehnung geprägt. Die Eltern sehen sich mit Vorurteilen gegenüber behinderten Menschen in der Gesellschaft konfrontiert, gelten aber auch selbst als Teil dieser Gesellschaft. Auch elterliche Schuldgefühle wie religiös bedingte Sündenvorstellungen, Glaube an die Erblichkeit der Behinderung und unbewusste Ablehnung des behinderten Kindes (Aggressionen, Todeswünsche) können in das Verhältnis zwischen Eltern und behinderten Kindern miteinfließen. Dazu können noch Schuldzuweisungen aus der sozialen Umwelt der Eltern kommen (Alkohol- und Tablettenmissbrauch, Inzucht, mangelnde Zuwendung, etc.) (vgl. Cloerkes 2001, 238). All diese Faktoren können die Ambivalenz im Verhältnis zwischen Eltern und behindertem Kind verschärfen.
Der elterliche Verarbeitungsprozess der Behinderung des Kindes wird in der Literatur oft als typischer Phasenverlauf skizziert (vgl. Stegie 1988; Kerkhoff 1981; Schuchardt 1996). Solche Phasenmodelle sind jedoch problematisch, weil sie oft unzulässige Verallgemeinerungen beinhalten. Weiters verläuft der Verarbeitungsprozess der Eltern zeitweilig nicht linear in aufeinanderfolgenden Phasen, was ebenfalls gegen diverse Phasenmodelle spricht (vgl. Cloerkes 2001, 239f; Rosenkranz 1998, 35). Fest steht, dass die meistens Eltern behinderter Kinder nach der Geburt einen Trauerprozess durchmachen. Dabei steht die Trauer um das erwartete ideale Kind im Mittelpunkt. Ein erfolgreich durchgangener Trauerprozess wirkt sich günstig für eine nachfolgende Akzeptanz der Behinderung des Kindes aus. Generell ist aber beim elterlichen Verarbeitungsprozess zu berücksichtigen, dass dieser Prozess von Individuum zu Individuum verschieden verläuft und somit auch jeweils verschiedene individuelle, situative und gesellschaftliche Faktoren miteinwirken (vgl. Cloerkes 2001, 240).
In der Regel sind vor allem die Mütter von der Behinderung des Kindes betroffen. Es wird heutzutage immer noch größtenteils von ihnen erwartet, dass sie die Versorgung und Betreuung des behinderten Kindes übernehmen. Es findet also eine gewisse Fixierung der Zuständigkeit auf die Frauen innerhalb der Familie statt, was leicht zu Verunsicherung, Überforderung und Vermeidungsreaktionen auf Seiten der Mutter führen kann (vgl. Flieger 2000, 23f). Auf der einen Seite wird die traditionelle Rolle der Frau als Hausfrau verstärkt, was oft dazu führt, dass Mütter behinderter Kinder keine Arbeitsstellen annehmen. Auf der anderen Seite bekommt die Aufgabe der Erziehung in Verbindung mit behinderten Kindern eine besondere Bedeutung, was auch eine Stabilität in der Rolle als Hausfrau verleihen kann (vgl. Cloerkes 2001, 243).
Die traditionelle Vaterrolle erfährt durch die Geburt eines behinderten Kindes keine Verstärkung. Gegenteilig gehen Väter eher ein distanziertes Verhältnis zum behinderten Kind ein und versuchen die dadurch erfahrene Frustration in anderen Lebensbereichen zu kompensieren. Die männliche Geschlechtsrolle verlangt eine Sachlichkeit und Selbstkontrolle im Umgang mit der Problematik. Dem versuchen viele Väter nachzukommen, was in einigen Fällen die emotionale Verarbeitung der Behinderung erschwert. Die Distanz zum behinderten Kind wird weitergehend dadurch verstärkt, dass Vätern in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen eher eine Nebenrolle in der Erziehung des behinderten Kindes zugeschrieben wird. Dadurch werden besondere Chancen gehemmt, die durch die Erziehung eines behinderten Kindes Vätern gegenüber offen stehen. Solche Chancen wären das Erleben eines verstärkten Elternseins und die Förderung von Gefühls-und Kontaktoffenheit (vgl. ebd., 244f). Generell sind solche Rollenmodelle jedoch schwer verallgemeinerbar und in dem Sinne mit Vorsicht zu behandeln. Ähnliches gilt auch in Verbindung mit Rollenmodellen, die sich auf Geschwister geistig behinderter Kinder und Jugendlicher beziehen.
Oft richtet sich der Lebensalltag einer Familie mit einem behinderten Kind zu großen Teilen nach den Bedürfnissen des behinderten Kindes. Geschwister erleben sich dabei häufig in einer Nebenrolle und im Vergleich zu anderen Altersgenossen sehen sie sich meistens zusätzlichen Belastungen verschiedener Art ausgesetzt. Durch den Betreuungsaufwand des behinderten Kindes sind Geschwister häufig in den eigenen Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt und fühlen sich zurückgesetzt, da die Eltern dazu gezwungen sind einen Großteil ihrer zeitlichen, materiellen und psychischen Ressourcen dem behinderten Kind zu widmen. Geschwisterkinder können dadurch manchmal in der erwarteten Selbstständigkeit überfordert werden. Weitere Belastungen, die sich auf Geschwister von behinderten Kindern auswirken können, sind Diskriminierungen im sozialen Umfeld, die Angst hinsichtlich späterer Versorgungspflichten für das behinderte Geschwisterkind, die Angst hinsichtlich möglicher Behinderungen bei eigenen Kindern, Fragen nach dem Sinn der Behinderung, Normenkonflikte zwischen Familie und Gesellschaft sowie erlebte Verantwortung für das behinderte Geschwisterkind oder die belasteten Eltern. Das Geschwisterverhältnis bei behinderten und nicht behinderten Kindern ist natürlich nicht nur von Belastungen geprägt. Als mögliche positive Faktoren ist zu sehen, dass Geschwisterkinder von behinderten Kindern in der Regel eine positive, offene und soziale Einstellung gegenüber Menschen (mit Behinderung) mit ins Leben nehmen, dass sie größere Frustrationstoleranz und besseres Konfliktverhalten zeigen und dass in einigen Fällen ein intensiveres Familienleben mit mehr Emotionalität stattfindet (vgl. Rosenkranz 1998, 67ff; Cloerkes 2001, 245f).
Generell ist hier festzustellen, dass Geschwisterkinder von behinderten Kindern nicht mehr und nicht weniger Verhaltensstörungen zeigen als andere Kinder und eine Vielzahl von Verarbeitungsformen der Behinderung des Geschwisterkindes zeigen. Um die Verarbeitung der Familiensituation bei Geschwistern behinderter Kinder zu fördern, ist es hilfreich das Zulassen von positiven wie auch negativen Gefühlen dem behinderten Kind gegenüber zu ermöglichen, die Auseinandersetzung mit der Behindertenproblematik zu forcieren und die Gleichbehandlung aller Kinder anzustreben. Es sollten auch Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten für alle Kinder der Familie zur Verfügung stehen (vgl. Cloerkes 2001, 246f). Solche Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten können auch im sozialen Umfeld der Familie gefunden werden.
Das soziale Umfeld von Familien mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern hat einen großen Einfluss auf die Familie und ihre Bewältigung der Situation. Negative Reaktionen der Umwelt können zu Isolation der Familie führen, während im positive Reaktionen zu einer Nutzung von Ressourcen im sozialen Umfeld zu einer besseren Bewältigung der Situation beitragen können. Diese beiden Aspekte werden nun näher betrachtet.
Isolation ist eine Problematik, die in vielen Familien mit behinderten Kinder auftritt. Oft erfordert die Behinderung des Kindes durch dementsprechenden Versorgungs- und Betreuungsaufwand eine ständige Präsenz von Bezugspersonen. Dies stellt eine große zeitliche und psychische Belastung für diese Bezugspersonen dar. Durch den hohen zeitlichen Aufwand verringern sich Kontakte zu Verwandten und Bekannten und die Familie schlittert immer mehr in eine soziale Isolation. Auch die mangelnde Akzeptanz einer Behinderung in der Gesellschaft kann dazu führen, dass sich Familien mit behinderten Kindern immer mehr in den eigenen Bereich zurückziehen (vgl. Rosenkranz 1998, 54f).
Rückzugsverhalten der Eltern nach der Geburt eines behinderten Kindes bzw. der Diagnosestellung einer Behinderung beim Kind gilt als üblich und hilfreich bei der Wiederherstellung von psychischem Gleichgewicht und Rollengleichgewicht innerhalb der Familie. Es dient dazu, für die Bewältigung der Situation hinderliche Einflüsse von außen einzuschränken, um somit eine möglichst gute und schnelle Verarbeitung zu ermöglichen. Problematisch wird es, wenn diese Isolation zu einem dauerhaften und realitätsfernen Zustand wird, da Kontakt zu anderen Menschen ein wichtiger Baustein für die Sozialentwicklung der Kinder mit Behinderung sind (vgl. Cloerkes 2001, 252f).
Eine mögliche Isolation der Familie wirkt sich auch auf die Beziehung zwischen dem behinderten Kind und den Eltern aus. In der Konzentration auf die innere Familie wird die dieser Beziehung häufig innewohnende Ambivalenz noch weiter verstärkt. Diese Ambivalenz setzt sich dadurch zusammen, dass einerseits von gesellschaftlicher Seite aus eine gewisse Aufopferung für das behinderte Kind erwartet wird und andererseits sich Eltern mit den Vorwürfen konfrontiert sehen, sich emotional zu eng an das Kind zu binden, wodurch eine spätere Ablösung erschwert wird (vgl. Rosenkranz 1998, 55). Eltern begeben sich hier oft in eine Zwickmühle widersprüchlicher gesellschaftlicher Erwartungen, aus der nur schwer ein Ausweg zu finden ist.
Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Mobilisierung von Ressourcen im familiären Umfeld zur eigenen Unterstützung gilt als familiärer Schutzfaktor. Familien mit behinderten Kindern müssen oft viele innere Hürden und Schamgefühle überwinden, bis sie bereit sind ihre Probleme auch nach außen zu tragen und somit Hilfe von außen zu mobilisieren. So wird oft versucht Problematiken vorerst familienintern zu klären, da eigene Schwächen und vermeintliche Fehlleistungen aus Schamgefühlen heraus nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Daraus kann die im vorigen Kapitel beschriebene Isolation von Familien mit behinderten Kindern entstehen. Ein gezielter und intelligenter Einsatz von außerfamiliären Ressourcen kann jedoch für Familien bei der Bewältigung dieser belastenden Situation sehr hilfreich sein. Wichtig hierbei ist kritischer, aufgeklärter, selbstbewusster und nicht überfordernder Umgang mit familienexternen Ressourcen und Dienstleitungen von Seiten der Familie (vgl. Herriger 2002, 180).
Eltern behinderter Kinder können durch eine enge emotionale Verbundenheit innerhalb des weiteren Familienumfeldes eine große Unterstützung in ihrer belastenden Situation erfahren. Gemeinsame Betroffenheit und geteilte Verantwortung unter anderen Angehörigen der Familie und im Freundeskreis können die Eltern in ihrer Situation sehr entlasten. Die innere Struktur des Familienumfeldes kann somit im Hinblick auf den erhöhten Betreuungsaufwand eines behinderten Kindes dahingehend geändert werden, dass diese Belastung auf mehrere Personen aufgeteilt wird. Auch die Unterstützung eines optimistischen Zukunftsbildes durch die weitere Familie und Bekannte kann sich durch den daraus resultierenden positiven Zugang förderlich auf die Entwicklung des behinderten Kindes und der Beziehung zwischen Eltern und Kind auswirken. Ein emotional verbundene Familie kann des weitern durch das Anbieten von Rückzugsraum für betroffene Eltern eine Nische bieten um seelisch wieder aufzutanken und neue Kräfte zu schöpfen (vgl. ebd.,181).
Familien mit geistig behinderten Kindern bekommen auf der einen Seite verschiedene finanzielle Unterstützungen von staatlicher Seite. Auf der anderen Seite bedeuten Kinder mit geistiger Behinderung ein Mehr an finanziellen Belastungen für die Familie. Diese beiden Seiten werden nun einander gegenübergestellt.
Eltern von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern können erhöhte Familienbeihilfe beantragen. Diese finanzielle Unterstützung soll dazu dienen den finanziellen Mehraufwand, der durch ein Kind mit Behinderung entsteht, zu decken. Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe haben Eltern von "erheblich" behinderten Kindern. "Erheblich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass " deren körperliche oder geistige Entwicklung infolge eines Leidens oder Gerbrechens so beeinträchtigt ist, dass sie im vorschulpflichtigen Alter voraussichtlich einer dauernden Pflege bedürfen, deren Schulbildung im schulpflichtigen Altern infolge eines Leidens oder Gebrechens voraussichtlich dauernd und wesentlich beeinträchtigt ist oder die überhaupt schulunfähig sind, deren Berufsausbildung auf Grund eines Leidens oder Gerbrechens voraussichtlich dauernd und wesentlich beeinträchtigt ist, die infolge eines Leidens oder Gebrechens voraussichtlich dauernd unfähig sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen." (Badelt, Österle 1993, 23). Eine weiter Auflage für den Erhalt von erhöhter Familienbeihilfe ist, dass die Bezieher zu den Unterhaltskosten des Kindes mindestens in Höhe der erhöhten Kinderbeihilfe beitragen. Hier ist schon impliziert, dass Eltern in der Regel mehr für ihre Kinder mit geistiger Behinderung ausgeben, als sie über die erhöhte Familienbeihilfe erhalten. Eine erhebliche Problematik im Zusammenhang mit der erhöhten Familienbeihilfe ist das Fehlen von Abstufungen. So bedeutet ein Kind mit hohem Pflegeaufwand bis zu einem Altern von drei Jahren, ab dem erst Unterstützungszahlungen für pflegende Eltern geleistet werden, eine finanzielle Belastung für die Eltern. Auch praktisch-administrative Hürden und enge Fristen erschweren Eltern von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern den Zugang zu finanziellen Beihilfen (vgl. ebd., 21ff).
Neben der erhöhten Familienbeihilfe und dem Pflegegeld, die oft einen Großteil der finanziellen Unterstützung von staatlicher Seite ausmachen, gibt es noch andere Beihilfen und Begünstigungen. So haben Eltern von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern Anspruch auf Schulfahrtsbeihilfe, unentgeltliche Schulbücher, Geburtenbeihilfe, Schülerbeihilfe und Begünstigung nach dem Einkommenssteuergesetz (vgl. ebd., 22). Auf diese Unterstützungen wird hier jedoch nicht näher eingegangen, da sie nur geringe Teile der Kosten abdecken, die durch Kinder mit Behinderung entstehen.
Es ist als ein generelles Problem im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen und Unterstützungen zu sehen, dass diese im Normalfall von den Eltern beantragt werden müssen. Es besteht also eine Holschuld von Seiten der Eltern aus. Da die Möglichkeiten finanzieller Unterstützungen jedoch selten lückenlos an die Eltern herangetragen werden, werden viele gar nicht erst beantragt bzw. beansprucht. Dies spiegelt sich auch im Wunsch vieler Eltern nach vermehrter Information wieder, um vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten auch wirklich ausnützen zu können (vgl. ebd., 28).
Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bedeuten durch mit der Behinderung zusammenhängende Aspekte eine gewisse Belastung für das familiäre Budget. So werden vielen Fällen zur adäquaten Förderung von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen ergänzende medizinisch-therapeutische Unterstützungen oder technische Hilfsmittel benötigt. Diese Unterstützungen und Hilfsmittel sind in der Regel sehr kostspielig und verschlingen einen großen Teil der finanziellen Mittel, die der Familie zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu diesen therapeutischen und technischen Hilfsmitteln fallen oft zusätzliche Ausgaben für angepasste Kleidung, besondere Ernährung oder für unterstützende Dienste an (vgl. Badelt, Österle 1993, 25ff).
Häufig ist ein Elternteil durch den erhöhten Betreuungsaufwand von Kindern mit geistiger Behinderung gezwungen, längerfristig auf Erwerbstätigkeit zu verzichten. Dies ist, wie schon erwähnt, in den meisten Fällen die Mutter. Oft ist es auch schwierig eine Anstellung zu finden, die sich mit dem Zeitaufwand für das Kind mit geistiger Behinderung vereinbaren lässt (vgl. ebd., 25ff). Der Verzicht auf Berufstätigkeit ist natürlich mit finanziellen Einbußen im Familieneinkommen verbunden und verschärft zusätzlich zu den erhöhten Ausgaben für ein Kind mit geistiger Behinderung die finanzielle Situation im Familienhaushalt.
Von der Doppelbelastung durch Beruf und behindertes Kind sind am öftesten alleinerziehende Mütter betroffen. Sie sind aus finanziellen Gründen häufig dazu gezwungen eine berufliche Tätigkeit anzunehmen, um die Familie im Alltag finanziell über Wasser zu halten. Beruf und die Betreuung eines behinderten Kindes ergeben in der Folge eine hohe Belastung der alleinerziehenen Elternteile. Für Eltern behinderter Kinder stellt, wie zuvor bemerkt, das Finden einer Tätigkeit, die sich mit dem Betreuungsaufwand und den Betreuungszeiten des behinderten Kindes vereinbaren lässt, oft ein großes Problem dar. Gründe dafür sind einerseits das Fehlen von Betreuungspersonen, die für die etwaige Arbeitszeit die Betreuung des behinderten Kindes übernehmen könnten. Andererseits verhindert häufig mangelnde Flexibilität der Arbeitszeit eine Anstellung, da der Betreuungsaufwand für ein behindertes Kind selten mit regulären Arbeitszeiten vereinbar ist (vgl. Rosenkranz 1998, 57f).
Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sehen sich mit einer gewissen Diskriminierung in der Gesellschaft konfrontiert. Diese Diskriminierung und der daraus resultierende Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben kann zu Sozialisationsmängeln und -abweichungen bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen führen. Sie haben gegen Vorurteile und Barrieren verschiedenster Art anzukämpfen, die auch in der heutigen Gesellschaft noch weiter existieren. Der Ausschluss aus der Gesellschaft wird durch eine Unterbringung und Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in Sondereinrichtungen noch weiter verstärkt. Durch die Errichtung von Sonderinstitutionen wird die Integration dieser Kinder und Jugendlicher weiter erschwert und einen Einbindung in das gängige Gesellschaftsleben nahezu unmöglich gemacht (vgl. Hovorka 1990).
Der teilweise Ausschluss von Kindern und Jugendlichen aus der Gesellschaft wirkt sich natürlich auch auf das familiäre Umfeld aus, das in der Folge auch davon betroffen ist. Dennoch unterscheiden sich die Problematiken bei Familien mit geistig behinderten Kindern verhältnismäßig wenig von den Problematiken bei Familien mit nicht behinderten Kindern. Die Gemeinsamkeiten überwiegen. Tatsache ist jedoch, dass die Geburt eines behinderten Kindes bzw. die Diagnose einer Behinderung bei einem Kind die Eltern in der Regel unerwartet und plötzlich trifft. Das Erkennen einer Behinderung macht eine Umorientierung in der weiteren Lebensplanung notwendig und bedeutet eine gewisse psychische Belastung für die Familie. Auch das Herausfallen des Kindes aus der gesellschaftlichen Norm und der Abschied von dem während der Schwangerschaft gefassten Bildes eines idealen Wunschkindes ist als psychisch belastend für die Eltern zu werten. Nach der Geburt eines behinderten Kindes setzt im Normalfall ein Trauerprozess um das verlorengegangene ideale Wunschkind bei den Eltern ein, der üblicherweise mit einem Rückzug aus dem gesellschaftlichen Umfeld einhergeht. Ein erfolgreich durchstandener Trauerprozess resultiert im günstigsten Fall in der vollwertigen Akzeptanz der Behinderung des Kindes und in der Wahrnehmung des behinderten Kindes als Chance und Herausforderung. In weniger günstigen Fällen kann die durch den Trauerprozess forcierte soziale Isolation zum Dauerzustand der Familie werden. Erhöhter Zeit- und Betreuungsaufwand für das behinderte Kind können diese Situation dann noch weiter verschärfen. Um dem entgegenzuwirken können sich Eltern der möglichen Ressourcen in ihrer Umgebung bewusst werden und in Eigeninitiative versuchen, diese zu mobilisieren. Schafft es eine Familie die Ressourcen im familiären Umfeld gezielt zu nutzen und auch Kompetenzen weiterzuentwickeln, so bedeutet dies eine zunehmende Entlastung der Familie im Alltag (vgl. Rosenkranz 1998; Cloerkes 2001, Herriger 2002).
Von der finanziellen Seite her bekommen Familien mit geistig behinderten Kindern diverse staatliche Unterstützungen, wie erhöhte Familienbeihilfe, Pflegegeld und sonstige Begünstigungen. Diese Unterstützungen sollen den finanziellen Mehraufwand, der durch ein Kind mit geistiger Behinderung entsteht, aufwiegen. In der Regel übersteigen jedoch die Ausgaben, die Eltern durch ein geistig behindertes Kind haben, die staatlichen Unterstützungen um einiges. Therapien, technische Hilfsmittel, Betreuung und Begleitung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sind sehr kostspielig und somit müssen Familien mit geistig behinderten Kindern häufig ihren Lebensstandard zurückschrauben, um diese meist notwendigen Ausgaben finanzieren zu können (vgl. Badelt, Österle 1993). Auch die im nächsten Kapitel genauer behandelte Freizeitgestaltung für die Kinder mit Behinderung ist üblicherweise mit zusätzlichen Kosten für die Familie verbunden.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Freizeitbedürfnisse
- 5.2 Erschwernisse
- 5.3 Empirische Studien zur Freizeitgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.4 Reisen, Urlaub und Tourismus
- 5.5 Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen in der Freizeit
- 5.6 Die Rolle der Eltern und des unmittelbaren sozialen Umfeldes bei der Freizeitgestaltung
- 5.7 Schlussfolgerungen
In der Vergangenheit wurde Menschen mit geistiger Behinderung zu einem Großteil eine sinnerfüllte, selbstbestimmte und selbstgestaltete Freizeit vorenthalten. An diesem Umstand maßgeblich beteiligt war eine Unterschätzung der Ressourcen von als "geistig behindert" bezeichneten Menschen, distanzierende und ausgrenzende Reaktionen der Umwelt sowie eine repressive Kontrollpädagogik. Auch die hauptsächlich nur auf Versorgung angelegte Unterbringung in Großanstalten, wo klinisch organisierte Regelungen den Alltag bestimmten, schränkte die Möglichkeiten der selbstbestimmten Freizeitgestaltung bei Menschen mit geistiger Behinderung sehr ein (vgl. Theunissen 2000b, 99f). In den 1960ern wurde das sonderpädagogische Augenmerk hauptsächlich auf die Bereich Schule, Arbeit und Berufsausbildung gelegt. Dem Freizeitbereich wurde dabei noch wenig Beachtung geschenkt. In den 1970ern wurde der Freizeitbereich als Aufgabenbereich der Rehabilitation entdeckt und in ihm Möglichkeiten für eine bessere Integration von behinderten Menschen gesehen. Dieser Gedanke wurde in den 1980ern weitergeführt bis schließlich heutzutage Freizeit immer mehr als nahezu gleichberechtigt neben Schule, Arbeit und Berufsausbildung angesehen wird (vgl. Ebert 2000, 43).
Dennoch sind auch heute noch geistig behinderte Menschen im Freizeitbereich benachteiligt. Durch verschiedene ökonomische und soziale Benachteiligung können sie an diversen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung nicht teilhaben (vgl. Markowetz 2001, 262). In einer Gesellschaft, in der die Bedeutung der Freizeit immer mehr zunimmt, heißt dies jedoch, dass Menschen mit Behinderung aus einem immer größer werdenden Teil des Alltagslebens ausgeschlossen werden. Auch die österreichische Bundesregierung hat in ihrem Behindertenkonzept aus dem Jahr 1993 erkannt, dass Freizeit in der Gesellschaft und somit auch für Menschen mit Behinderung eine immer größere Bedeutung erlangt. Der befriedigenden Gestaltung der Freizeit stehen jedoch neben baulichen oft auch psychische Barrieren gegenüber. Grade deshalb sollte laut dem Konzept der österreichischen Bundesregierung Menschen mit Behinderung die Teilnahme an allgemeinen Freizeitangeboten ermöglicht werden und auch für diese Gruppe geltende gleiche Möglichkeiten zur Gestaltung der Freizeit geschaffen werden. Ein Ansatzpunkt dabei wäre es durch kompensatorische Hilfsmittel und Einrichtungen die Teilnahme zu ermöglichen. Die österreichische Bundesregierung setzt sich in ihrem Behindertenkonzept die Ziele eine behindertengerechte Gestaltung aller Freizeiteinrichtungen zu erreichen und den unbeschränkten Zugang für behinderte Menschen zu diesen zu forcieren. Voraussetzung dafür ist der weitere Ausbau von technischen Hilfsmitteln in Einrichtungen und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel (vgl. BfAuS 1993, 50ff).
Das folgende Kapitel widmet sich nun dem Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Freizeitverhalten wird hierbei im Sinne Markowetz' (2001, 272) gesehen als "Ausdruck der Befriedigung von Freizeitbedürfnissen", der "hinsichtlich Intensität, Quantität, Qualität und freier Verfügbarkeit von Zeit und entsprechender Wahl-, Entscheidungs -und Handlungsfreiheit universell verschieden" ist. Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung haben wie Kinder und Jugendliche ohne Behinderung Vorlieben, Interessen und Wünsche bei ihren Freizeitaktivitäten. Diesbezüglich bestehen also keine gravierenden Unterschiede zur Freizeitgestaltung nicht behinderter Kinder und Jugendlicher (vgl. Flieger 2000, 35; Markowetz 2001, 265). Eine vorhandene Behinderung stellt bezogen auf das Freizeitverhalten auch nur einen Einflussfaktor neben vielen weiteren dar. So sind für die Freizeitsituation von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen neben der Art, Schwere und Sichtbarkeit der Behinderung auch noch die rehabilitativen Möglichkeiten, die Bildung, die sozioökonomischen Verhältnisse der Familie, das eigene Vermögen, das soziale Netzwerk, die ökosystemischen Verhältnisse, das Ausmaß an subjektiv erlebten sozialen Vorurteilen und Stigmatisierungen und weitere untereinander in Wirkungszusammenhang stehende Faktoren von Relevanz (vgl. Markowetz 2001, 266f). Viele dieser Faktoren sind auch für die Freizeitsituation von nicht behinderten Kindern und Jugendlichen von großer Bedeutung. Dennoch bleiben Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten durch bauliche Hindernisse, Unsicherheiten und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung sowie mangelndem Interesse an deren Integration verwährt (vgl. Hovorka 1990, 631), wodurch die Freizeitsituation in vielen Fällen nicht den persönlichen Wünschen der Betroffenen entspricht. Oft werden passiv-rezeptive Freizeittätigkeiten zu Hause ausgeführt (z.B. Fernsehen) und weniger gesellige, offene Aktivitäten mit Außenkontakten ausgeübt, die von den Menschen mit Behinderung häufig als langweilig und wenig sinnerfüllt erlebt werden (vgl. Markowetz 2001, 280). Auf mögliche Erschwernisse und diesbezügliche Einschränkungen der Freizeitbedürfnisse wird nun im folgenden Kapitel eingegangen.
Wie alle anderen Menschen haben auch als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche ihre Freizeit betreffende Bedürfnisse. So gelten die in Kapitel 3.1.5 schon angeführten von Opaschowski definierten Freizeitbedürfnisse auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Im Gegensatz zu Menschen ohne Behinderung sieht sich diese Personengruppe jedoch mit einigen Barrieren konfrontiert, die einer Befriedigung dieser Bedürfnisse im Wege stehen.
Für Menschen mit Behinderung entstehen oft Barrieren bei der Befriedigung ihrer Freizeitbedürfnisse. Im Folgenden wird genauer auf diese Barrieren eingegangen. Das Freizeitbedürfnis Rekreation (Erholung, Ruhe, sexuelle Befriedigung) können behinderte Menschen häufig durch eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen und damit einhergehend erschwerten Rückzugsmöglichkeiten nur schwer befriedigen. Auch das Ausleben sexueller Bedürfnisse ist bei Menschen mit Behinderung aufgrund einer häufigen Abweichung von einer generellen gesellschaftlichen Vorstellung von "Schönheit" bzw. besonders bei geistig behinderten Menschen durch verhindernde Interventionen von außen (Eltern, BetreuerInnen) nur erschwert möglich. Der Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompensation (Ausgleich, Ablenkung, Vergnügen) stehen häufig Barrieren in Form von mangelnder Mobilität durch nicht behindertengerechte Umwelt und ungenügendem Freizeitangebot im Weg. Edukation (Weiter-, Umlernen) wird durch eine geringe Auswahl an Bildungseinrichtungen und eingeschränkte Berufswahl für Menschen mit geistiger Behinderung unverhältnismäßig begrenzt. Das Freizeitbedürfnis der Kontemplation (Selbsterfahrung, Selbstfindung) findet oft durch Abhängigkeit von und Bevormundung durch Betreuungs-und Pflegepersonen und durch Isolation von Menschen mit Behinderung nur mangelhaft Erfüllung. Von der bei als "geistig behindert" bezeichneten Menschen oft gegebenen gesellschaftlichen Isolation und damit einhergehend der eingeschränkten Erreichbarkeit und Auswahl von Kommunikationspartnern ist auch das Bedürfnis der Kommunikation (Mitteilung, soziale Beziehungen) betroffen. Die Isolierung und Diskriminierung in der Gesellschaft hat ebenfalls negative Auswirkungen auf das Freizeitbedürfnis der Integration (Zusammensein, Gemeinschaftsbezug, soziale Stabilität). Auch häufige Wechsel von Bezugspersonen oder Bezugsgruppen entgegen den persönlichen Interessen der behinderten Menschen, wie es oft in institutionalisierten Einrichtungen geschieht, erschweren eine Integration. Konsequente Fremdbestimmung und Ausklammerung der Menschen mit geistiger Behinderung von essentiellen Entscheidungen, wie es leider immer noch oft der Fall ist, wirkt sich negativ auf die Erfüllung des Freizeitbedürfnisses nach Partizipation (Beteiligung, Mitbestimmung, Engagement) aus. Schließlich ist das Bedürfnis der Enkulturation (kreative Entfaltung, produktive Betätigung, Teilnahme am kulturellen Leben) durch mangelnde Möglichkeiten an kreativer und produktiver Freizeitgestaltung und durch nicht behindertengerechte kulturelle Angebote eingeschränkt (vgl. Markowetz 2001, 264f). Durch eine Behinderung können auch besondere Bedürfnisse bei Freizeitaktivitäten entstehen, auf die nun eingegangen wird.
Menschen mit geistiger Behinderung haben in manchen Bereichen der Freizeit noch zusätzliche besondere Bedürfnisse, die in der Gestaltung und Planung von Freizeitaktivitäten berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise besteht eine Differenz zwischen geistig behinderten und nicht behinderten Kindern meist darin, dass sich die Interessen geistig behinderter Kinder nicht zwingend mit Interessen gleichaltriger ohne Behinderung decken. Diese besonderen Bedürfnisse sind in der Freizeitgestaltung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen, tun jedoch keinen Abstrich daran, dass als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche ebenso an der Gestaltung ihrer Freizeit interessiert sind wie Gleichaltrige ohne Behinderung. Weiters bei der Freizeitgestaltung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung ist zu berücksichtigen, dass sie in ihrem Lebensvollzug oft besondere Bedürfnisse haben, die einen bestimmten Bedarf nach Unterstützung zur Folge haben. Diese Bedürfnisse müssen wahrgenommen werden und auf diese muss eingegangen werden, um Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen im intellektuellen Bereich eine befriedigende Freizeitgestaltung zu bieten. So sollten auch Ängste und spezielle Neigungen ernst genommen werden und bei Bedarf Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden (vgl. Flieger 2000, 35ff).
Die meisten Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung im Freizeitbereich sind erst im letzten Jahrzehnt entstanden (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 362), was auf eine zunehmende Bewusstwerdung über die Bedeutung des Freizeitbereichs auch für Menschen mit geistiger Behinderung hindeutet. Dennoch sehen sich Menschen mit geistiger Behinderung mit einigen Erschwernissen in der Gestaltung ihrer Freizeit konfrontiert. Diese werden nun in diesem Kapitel beleuchtet.
Kerkhoff (1982) nennt einige Erschwernisse, die einer Person im Freizeitbereich durch eine Behinderung entstehen können. Dazu zählen die Unmittelbaren Folgen der Schädigung wie eingeschränkte Mobilität, Erfordernis einer Begleitperson oder negative Reaktionen aufgrund der Sichtbarkeit der Behinderung. Auch eine zeitliche Ausdehnung der täglichen Versorgungs-, Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen kann die frei verfügbare Zeit einschränken. Im Kontext von geistig schwer- und mehrfachbehinderten Personen spricht Theunissen hier, wie schon erwähnt, von der Zeitqualität der Versorgungszeit, die auf Kosten der frei verfügbaren Zeit geht (vgl. Markowetz 2001, 263). Auch problematische familiäre Bindungen in Form von Überbehütung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung können den Ablösungsprozess in Richtung außerfamiliären Freizeitaktivitäten erschweren. Ein bei Menschen mit Behinderung häufig gegebenes Übermaß an Rehabilitationsmaßnahmen kann ebenfalls die frei verfügbare Zeit der betroffenen Person sehr einschränken. Bezogen auf integrative Freizeitaktivitäten erschweren und verhindern häufig fehlende Kontaktstellen zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen die Teilnahme. Unzulänglichkeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln und bauliche Barrieren in Freizeiteinrichtungen sowie weiterer Erreichbarkeitsprobleme können ebenfalls die Möglichkeiten der Teilnahme an Freizeitaktivitäten einschränken. Selbstisolierungstendenzen bei behinderten Menschen und deren Familien können dazu führen, dass Freizeitaktivitäten aus Angst vor Zurückweisung und negativen Reaktionen gemieden werden. Schließlich sind Freizeitgewohnheiten und -interessen bei einigen Menschen mit Behinderung aufgrund mangelnder Förderung und Zuschreibung von passiven Freizeitverhalten nur gering ausgebildet (vgl. ebd. 266), wodurch sie in der Selbstverwirklichung im Lebensbereich "Freizeit" schwer benachteiligt sind.
Je nach Art und Weise der Behinderung ist häufig eine genau überlegte Planung und Organisation der Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung notwendig. Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich haben selten den notwendigen vollständigen Überblick bzw. genügend Orientierungsmöglichkeiten, um das Angebot an öffentlichen Freizeitangeboten selbstständig und ohne Unterstützung wahrnehmen zu können (vgl. Ebert 2000, 39). Deshalb besteht oft ein Bedarf nach Assistenz und materiellen Hilfen, der in der Organisation berücksichtigt werden muss. Dadurch entsteht eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen und äußeren Begebenheiten, die die Verfügbarkeit über Zeit und die Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in diesem Bereich einschränkt. Auch Defizite im kommunikativen Bereich, die häufig mit einer geistigen Behinderung einhergehen, können das Freizeitverhalten beeinflussen bzw. die Teilnahme an Freizeitaktivitäten erschweren. Durch eine Einschränkung der kommunikativen Fähigkeiten wird oft der Aufbau von sozialen Kontakten für die Betroffenen komplizierter oder zum Teil ganz verhindert (vgl. Markowetz 2001, 267ff). Somit werden die Kontaktaufnahme mit Freizeitangeboten und die Eingliederung bei Freizeitaktivitäten zeitweise enorm erschwert.
Hilfsmittel verschiedener Art sowie personelle Hilfen, durch die behinderungsbedingte Einschränkungen kompensiert werden, erleichtern Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung die Teilnahme an verschiedenen Freizeitaktivitäten. Dazu müssen jedoch vorerst einige "Barrieren in den Köpfen" (ebd., 270) überwunden werden und diese Unterstützungen zur Verfügung gestellt werden. So sollte auf die Mobilitäts-und Kommunikationswünsche von Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Freizeit Rücksicht genommen und reagiert werden. Dies bedeutet eine Neuschaffung bzw. Nutzung von vielfältigen Realisierungsmöglichkeiten und eine Abkehr von einer Orientierung an einer angenommenen Norm des Freizeitverhaltens (vgl. ebd.). Nur so wird es auch Menschen mit geistiger Behinderung möglich ein ebenso erfülltes Freizeitleben zu führen wie nicht behinderte Menschen.
Letztendlich ist trotz allen angeführten Erschwernissen zu bemerken, dass eine Behinderung zwar einen gewissen Einfluss auf das Freizeitverhalten eines behinderten Menschen hat, jedoch nicht zwangsläufig zu einer unbefriedigenden, fremdbestimmten und von der Assistenz anderer abhängigen Freizeitsituation führen muss. Ebenso wie nicht jeder nicht behinderte Mensch automatisch seine Freizeit sinnerfüllt, selbstbestimmt und hochwertig gestaltet (vgl. ebd., 272).
Die Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung wurde bis dato nur spärlich und unregelmäßig empirisch erfasst. Im Folgenden werden nun einige der wenigen Untersuchungen zu dieser Thematik kurz geschildert. Die verschiedenen zu den Studien gehörigen Tabellen sind am Ende des Unterkapitels nachzuschlagen.
In Deutschland führte das Bundesministerium für Familie und Senioren 1994 eine Studie durch, in der die durchgeführten Freizeitaktivitäten von verschiedenen Gruppen behinderter Menschen innerhalb der letzten vier Wochen vor der Befragung erfasst wurden. Die Ergebnisse der Untersuchung bezogen auf Menschen mit geistiger Behinderung sind in Abbildung 3 genau ausgeführt. In dieser Studien wurde von auf eine Gesamtzahl von 267.000 Menschen mit geistiger Behinderung geschlossen und die verschiedenen Ergebnisse ebenfalls hochgerechnet in Tausend dargestellt. Interessant bei dieser Studie ist, dass Spazieren gehen bei weitem die am häufigsten genannte Freizeitaktivität darstellt, gefolgt Zeitung bzw. Zeitschriften lesen und Besuche abstatten bzw. empfangen. Auf der anderen Seite zeigen sich Menschen mit geistiger Behinderung laut dieser Studie in ihrer Freizeit wenig politisch engagiert und leisten auch wenig Hilfsdienste für andere. Ein Ergebnis, das bedenklich stimmt, ist, dass keiner der Befragten in den letzten Wochen an einer Weiterbildung teilgenommen hatte. Leider ist an dieser Untersuchung schwer zu bemängeln, dass Medienkonsum (Fernsehen, Radio) als Freizeitaktivität nicht berücksichtigt wurde. Eine solche Art der Freizeitbeschäftigung hätte sicher einen vorderen Rang in den Nennungen eingenommen (vgl. Markowetz 2001, 273).
Schmidt-Thimme führte 1971 eine allererste Bestandsaufnahme zum Freizeitverhalten von geistig behinderten Menschen durch, indem Interviews mit 100 MitarbeiterInnen von Werkstätten für behinderte Menschen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse wurden in einer Rangliste aufgeführt, die die Häufigkeit der Aktivitäten widerspiegelt. Diese Rangliste ist in Abbildung 4 angeführt. Pohl bestätigte 1982 zum Großteil die Ergebnisse von Schmidt-Thimme, indem er ebenfalls die in einer Studie ermittelten Freizeitaktivitäten von Menschen mit geistiger Behinderung in einer Rangliste anführte. Diese Rangliste ist zum Vergleich in Abbildung 5 angeführt. In diesen beiden Studien wurde im Gegensatz zur Studie des Bundesministeriums für Familie und Senioren von 1994 der Medienkonsum als Freizeitaktivität berücksichtigt und nimmt auch gleich den obersten Rang ein. Sowohl bei Schmidt-Thimme als auch bei Pohl steht Fernsehen an erster Stelle der Freizeitaktivitäten. Was diese beiden Untersuchungen mit der Studie des Bundesministeriums gemein haben, ist, dass Spazieren gehen, Besuche und Ausflüge ebenfalls als häufige Freizeitaktivitäten angeführt sind. Interessant in bezug auf die Thematik dieser Diplomarbeit ist, dass von Pohl im Gegensatz zu den beiden anderen Studien auch explizit die Teilnahme an Freizeitangeboten als Freizeitaktivität angeführt wird und mit dem siebten Rang auch eine gewisse Häufigkeit im Leben geistig behinderter Menschen widerspiegelt. Generell sagen die Ergebnisse von Schmidt-Thimme und Pohl durch den Vergleich mit Studien zur Freizeitgestaltung nicht behinderter Menschen aus, dass geistig behinderte Mensch durchaus gleiche Freizeitbedürfnisse haben wie Menschen ohne Behinderung und auch ähnlichen Freizeitaktivitäten nachgehen (vgl. ebd., 276).
Wocken untersuchte 1982 das Freizeitverhalten und das Freizeitinteresse von 515 Schülern aus Haupt- und Sonderschulen. Bei Sonderschülern und damit auch Kindern und Jugendlichen, die als "lern-bzw. geistig behindert" bezeichnet werden, kam er zu dem Ergebnis, dass diese einen weniger differenzierten Freizeitstil pflegen als Altersgenossen in anderen Schulformen. Laut Wocken scheitern die freizeitbezogenen Selbstgestaltungstendenzen an mangelnder Variabilität, Ausgeglichenheit und stetiger Dynamik. Auch die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe an Freizeitaktivitäten sieht Wocken bei Sonderschülern als eingeschränkt, was in einem Defizit in sozialen Kontakten resultiert. In der Folge bleiben Sonderschüler in der Freizeit öfters aus Angst vor Öffentlichkeit und Stigmatisierung sowie aus Resignation zu Hause als Altersgenossen. Dennoch betont Wocken, dass die Gemeinsamkeiten in der Freizeitgestaltung zwischen Haupt- und Sonderschülern im Vergleich zu den Unterschieden überwiegen (vgl. ebd., 274f).
Laut Flieger, die 2000 in Wien eine Studie zur Freizeitgestaltung von geistig behinderten Kindern durchführte, unterscheiden sich Kinder mit geistiger Behinderung im Spiel in der Freizeit kaum von nicht behinderten Kindern. Sie sind ebenso an bekannten Spielformen wie an neuen und innovativen Spielen und Materialien interessiert. Alle im Rahmen der Studie beobachteten Kinder spielten vielfältig mit unterschiedlichen Materialien alleine oder mit anderen Personen. Somit zeigten sie ein reichhaltiges Spektrum an Spielaktivitäten ebenso wie nicht behinderte Kinder. Natürlich sind die Spielmöglichkeiten abhängig von den materiellen Ressourcen, persönlichen Vorlieben, Interessen und der pädagogischen Haltung der Eltern, aber auch dies unterscheidet als "geistig behinderte" bezeichnete Kinder nicht von nicht behinderten Kindern. Wichtig um Kindern mit geistiger Behinderung Möglichkeiten zum ausgedehnten Spiel zu geben, ist es laut Flieger, Freiräume und Nischen dafür zu schaffen, die ohne Probleme genutzt werden können. Aus dieser Studie geht ebenfalls hervor, dass Kinder mit geistiger Behinderung einen vertrauten, selbstverständlichen und routinierten Umgang mit Medien und dementsprechenden Geräten in ihrer freien Zeit pflegen (vgl. Flieger 2000, 37ff).
Abschließend ist hier festzustellen, dass sich die bevorzugten Freizeitaktivitäten von Menschen mit geistiger Behinderung nicht sehr von denen der nicht behinderten Bevölkerung unterscheiden. Es überwiegen in diesem Sinn eher die Gemeinsamkeiten anstatt der Unterschiede. Eine spezifische Art der Freizeitgestaltung stellen Urlaube und Reisen dar, die in Verbindung mit dem Phänomen "Behinderung" im nächsten Unterkapitel behandelt werden.
Abb. 3: Freizeitaktivitäten von geistig behinderten Menschen (ab 16 J.) der letzten 4 Wochen (Bundesministerium für Familie und Senioren 1994 zit. n. Markowetz 2001, 273)
|
Geistige Behinderung/ Geistiger Abbau |
|
|
Basis: hochger. t. Tsd. Freizeitaktivitäten der letzten 4 Wochen |
267 |
|
Spazieren gegangen |
53.9 |
|
Sportlich betätigt |
11.8 |
|
Im Garten oder auf dem Balkon gearbeitet |
11.4 |
|
Gemalt, musiziert, gebastelt |
14.7 |
|
Handarbeiten gemacht |
9.2 |
|
Bücher gelesen |
14.0 |
|
Regelmäßig Kreuzworträtsel gelöst |
4.1 |
|
Regelmäßig Zeitung gelesen |
25.4 |
|
Regelmäßig Zeitschriften gelesen |
20.9 |
|
Sich politisch engagiert |
0.3 |
|
Kirchliche oder caritative Veranstaltungen besucht |
10.8 |
|
Seniorenclub besucht |
3.2 |
|
Club für Behinderte besucht |
7.0 |
|
An Selbsthilfegruppen beteiligt |
4.7 |
|
An Weiterbildung teilgenommen |
- |
|
Geselliges Beisammensein |
14.8 |
|
Kurzbesuche abgestattet |
28.1 |
|
Kurzbesuche empfangen |
47.1 |
|
Café oder Restaurant besucht |
12.9 |
|
Reisen, Ausflüge gemacht |
6.5 |
|
Längere Besuche gemacht |
14.8 |
|
Familienmitgliedern, Freunden geholfen |
4.7 |
|
Probleme anderer besprochen |
10.6 |
|
Hilfsdienste für andere |
0.5 |
|
Weiß nicht |
5.5 |
Abb. 4: Freizeitaktivitäten von Menschen mit geistiger Behinderung nach Schmidt-Thimme (Schmidt-Thimme 1971 zit. n. Markowetz 2001, 277)
|
Reihen-folge |
Freizeitaktivitäten von Menschen mit geistiger Behinderung nach Schmidt-Thimme (1971) |
|
1. |
Fernsehen |
|
2. |
Mithilfe im Haushalt |
|
3. |
Spazieren gehen |
|
4. |
Radio, Schallplatten, Tonband hören |
|
5. |
Spielen, Basteln, Musizieren, Handarbeiten, Sammeln |
|
6. |
Körperbetonte Neigungen wie Schlafen, Essen, Waschen |
|
7. |
Besuche bei Verwandten und Bekannten |
|
8. |
Einkaufen (meist allein) |
|
9. |
Lesen, Schularbeiten |
|
10. |
Veranstaltungen besuchen, z.B. Kino, Fußballplatz, Bierchen trinken |
|
11. |
Illustrierte ansehen, Bilder betrachten |
Abb. 5: Freizeitaktivitäten von Menschen mit geistiger Behinderung nach Pohl (Pohl 1982 zit. n. Markowetz 2001, 277)
|
Reihen-folge |
Freizeitaktivitäten von Menschen mit geistiger Behinderung nach Pohl (1982) |
|
1. |
Fernsehen |
|
2. |
Musik hören |
|
3. |
Spiele, und zwar allein mit Puzzles, Stechspielen, Puppen, usw. |
|
4. |
Ausflüge machen und spazieren gehen |
|
5. |
Arbeiten im Haus |
|
6. |
Bilder betrachten in Büchern, Illustrierten und Katalogen |
|
7. |
Teilnahme an Freizeitangeboten |
|
8. |
Bilder ausschneiden und sammeln |
|
9. |
Spiele mit anderen (Gesellschaftsspiele, Ballspiele, usw.) |
|
10. |
Fußballspielen |
|
11. |
Fahrradfahren |
|
12. |
Zeichnen und Abschreiben |
|
13. |
Mit Tieren spielen |
|
14. |
Tanzen |
|
15. |
Kaffeetrinken und unterhalten |
|
16. |
Die Umwelt beobachten |
|
17. |
Handarbeiten |
|
18. |
Schwimmen, Gymnastik |
|
19. |
Allein spielen |
|
20. |
Stereotype Handlungen |
Urlaub dient dazu auszuspannen, sich zu erholen, eine schöne Zeit zu verbringen, neue Menschen kennen zu lernen und andere Kulturen zu erfahren. Diese Wünsche haben natürlich auch als "geistig behindert" bezeichnete Menschen (vgl. Niehoff 2000, 310). Menschen mit geistiger Behinderung haben ebenso das Bedürfnis nach Reise, Urlaub und Tourismus wie nicht behinderte Menschen. Die Tourismusbranche reagiert jedoch dieser Zielgruppe gegenüber eher verhalten und die Öffnung des Reisemarktes für Menschen mit Behinderung lässt weiter auf sich warten. Die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im Tourismusbereich steckt noch in den Kinderschuhen (vgl. Markowetz 2001, 290f). So sind zahlreiche Urlaubs-, Ferien und Reisebedingungen immer noch so gestaltet, dass Menschen mit Behinderung unnotwendige Nachteile entstehen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass ein gutes Drittel bis ein Viertel der reisewilligen Bevölkerung, durch Nichtberücksichtigung behinderungsspezifischer Bedürfnisse im Tourismusbereich betroffen ist. Diese Zahl setzt sich aus Menschen mit Behinderung selbst sowie deren Angehörige und Freunde, die mit ihnen gemeinsam auf Urlaub fahren, zusammen (vgl. Wilken 2000, 185f).
Möglichkeiten, um die Integration von Menschen mit Behinderung im Tourismusbereich voranzutreiben, gibt es einige. Die Notwendigkeit solchen Möglichkeiten zu schaffen, wurde in den letzten Jahren auch von der UNO und der Europäischen Kommission in Brüssel erkannt. So wurde von der Vollversammlung der Vereinten Nationen 1993 Standardregeln über die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung verabschiedet, in denen auch festgelegt wurde, dass "Einrichtungen, die mit der Organisation von Freizeit(angeboten) und Reisen befaßt sind, (...) ihre Dienste auch behinderten Menschen anbieten und deren besondere Bedürfnisse beachten" (Wilken 2000, 1991) sollten. Hier wird also im diesem eine Öffnung von allgemeinen Freizeitangeboten gefordert. Im darauf folgenden Jahr wurde von der Europäischen Kommission die Arbeitsgruppe "Indepentend Living - Tourism for All" gegründet, deren Aufgabe es war "Empfehlungen auszuarbeiten, damit europaweit die Bedingungen für angemessene Reisestandards zugunsten behinderter Personen entwickelt und koordiniert werden können" (ebd.). So wurde die Etablierung von zentralen Informationsstellen in Form von nationalen Koordinationsstellen forciert, die auf Reisen für behinderte Menschen spezialisiert sind. Weiters wurden Bemühungen daran gesetzt spezifische Reiseführer für behinderte Personen herauszugeben und bestimmte Kriterien für behindertenfreundliche Tourismusbetriebe zu entwickelt. Außerdem sollte die Thematik "Reisen für Menschen mit Behinderung" in die Ausbildung in Tourismusberufen mit einfließen, um die zukünftige Situation zu verbessern (vgl. Markowetz 2001, 290f; Wilken 2000, 190f).
Mehrere größere Reisebüros bieten mittlerweile schon spezielle Angebote für behinderte Menschen an und passen sich damit der immer weiter wachsenden diesbezüglichen Nachfrage an. Die Zahl der behinderten Reisenden, die diese Angebote nutzen, ist in den letzten zwanzig Jahren um ein vielfaches gestiegen und auch die Anzahl der "behindertenfreundlichen" Hotels und Ferienanlagen hat sich dementsprechend vergrößert. Somit steht behinderten Personen mittlerweile auch schon eine gewisse Auswahlmöglichkeit bereit (vgl. Wilken 2000, 187). Dennoch wird in manchen Betrieben die Anwesenheit von behinderten Menschen an Urlaubsorten als geschäftsschädigend empfunden. Laut einer Studie von Wilken aus dem Jahr 1997 fühlen sich nicht behinderte Touristen an ihrem Urlaubsort eher durch Menschen mit geistiger Behinderung (4,1 %) gestört als durch körperlich behinderte Menschen (1,9 %). Generell ist aber ein Rückgang der negativen Reaktionen von nicht behinderten Menschen gegenüber Menschen mit Behinderung am Urlaubsort festzustellen (vgl. Markowetz 2001, 290f).
Neben großen Reisebüros gibt es noch einige Spezialanbieter, die ihr Angebot auf die Interessen, Bedürfnisse und Problematiken von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderung abgestimmt haben. Von manchen dieser kleineren Reiseagenturen wird zusätzlich zur eigentlichen Reise noch Betreuungs- bzw. Assistenzpersonal zur Verfügung gestellt, was reisewillige Menschen mit Behinderung jedoch oft vor hohe Zusatzkosten stellt (vgl. Markowetz 2001, 292). Gegenüber möglichen Kostenträgern ist es oft schwer eine (teilweise) Übernahme von diesen zusätzlichen Urlaubskosten durchzusetzen. Um eine Übernahme dieser Kosten zu erreichen, muss in der Regel pädagogisch, therapeutische oder rehabilitativ argumentiert werden (vgl. Niehoff 2000, 310). Urlaub als Zeit der Entspannung gilt hier selten als Argument. Generell stehen diese Spezialanbieter vor dem Problem, dass die Organisation von Reisen für behinderte Menschen sehr beratungs-und zeitintensiv ist, was auch zu einer zusätzlichen Erhöhung der Kosten führt. Als Folge daraus bieten viele Anbieter nur mehr behindertengerechte Reisen anbieten, klammern aber die notwendige Betreuung bzw. Assistenz am Urlaubsort aus dem Angebot (vgl. Markowetz 2001, 292). Diese problematische Situation führt zu einem zunehmenden Zusammenschluss von Spezialanbietern und zu Kooperationsinitiative der verschiedenen Reiseagenturen (vgl. Wilken 2000, 187).
Für Menschen mit Behinderung ist es oft schwierig an Informationsmaterial bezüglich behindertengerechter Reise- und Urlaubsangebote heranzukommen, was die soziale Integration behinderter Menschen in das allgemeine Reise-und Urlaubsgeschehen natürlich nur noch weiter erschwert (vgl. Markowetz 2001, 292). Für Menschen mit Mehrfachbehinderung, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stellt sich außerdem häufig die Problematik der Mobilität und Barrierefreiheit am Urlaubsort, die bei der Planung berücksichtigt werden muss (vgl. Flieger 2000, 49). Somit ist abschließend zu sagen, dass sich der Tourismusmarkt zwar zunehmend für Menschen mit Behinderung öffnet. Dennoch bedeutet die Urlaubsplanung und - gestaltung für behinderte Menschen immer noch einen zeitlichen und geldmäßigen Mehraufwand gegenüber nicht behinderten Menschen.
Im wissenschaftlichen Diskurs ist es strittig ob Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen zur Zeitqualität der "Freizeit" zu zählen sind. Viele Autoren vertreten die Meinung, dass Therapiezeiten als Obligationszeiten gerechnet nur am Rande zu Freizeitaktivitäten zu zählen sind, da sie von Betroffenen selten als Freizeit gesehen und erlebt werden. In der "Rehabilitationseuphorie" (Niehoff 2000, 309) der 1970er Jahre war die als Freizeit deklarierte Zeit von Menschen mit Behinderung häufig durch Rehabilitationsmaßnahmen und Therapien geprägt. Der Fördergedanke stand im Mittelpunkt und es wurde die Tatsache vernachlässigt, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung einer zweckfreien Zeit bedürfen (vgl. Niehoff 2000, 309; Ebert 2000, 44). Mit der Zeit wurden als geistig behindert bezeichnete Menschen immer mehr in ihrem Sosein akzeptiert. Dennoch erhält ein großer Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung auch heute noch regelmäßig therapeutische Förderungen. Therapie ist demnach im Leben vieler Kindern und Jugendlicher mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich ein fixer Bestandteil des Alltags und auch bis zu einem gewissen Maße als notwenig einzustufen. Sie findet oft neben der Schulzeit statt und zieht sich auch über die Schulferien (vgl. Flieger 2000, 44ff). Von Verantwortlichen sollte dabei zu berücksichtigt werden, dass Fördermaßnahmen und Therapien nicht die gesamte als frei bezeichnete Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung einnehmen, da die Teilnahme an diesen, wie schon angeführt, selten als freiwillige und gewollte Aktivität zu sehen ist. Vielmehr geht es darum, neben diesen teilweise notwendigen Maßnahmen auch noch Platz für freie und selbstbestimmt gestaltete Zeit zu lassen. Diese Freizeit darf dann jedoch nicht als Korrektur-und Erholungsphase für übermäßige und falsch verstandene Rehabilitation gelten (vgl. Heß 2000, 310), sondern muss als wirkliche freie Lebenszeit zur Verfügung stehen. Die Schaffung dieser freien Zeit ist zu gewissen Teilen als Aufgabe der Eltern und des sozialen Umfeldes zu sehen. Die generelle Rolle der Eltern und des sozialen Umfeldes bei der Freizeitgestaltung geistig behinderter Kinder-und Jugendlicher wird nun im Folgenden ins Licht gerückt.
Die familiäre Situation spielt für das Freizeitverhalten von Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung eine große Rolle. Da sie aufgrund diverser Einschränkungen im Alltag weitgehend auf die Hilfe anderer Personen angewiesen sind, ist die Familie in ihrer kompensatorischen und entlastenden Funktion für die Freizeitsituation von großer Bedeutung (vgl. Markowetz 2001, 281). Die Unterstützung von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich wird zurzeit zum Großteil von Eltern und anderen Verwandten geleistet. Es gibt diesbezüglich wenig unterstützende Dienste. Dies bedeutet oft eine zusätzliche Belastung der Eltern und Erschwernisse beim Ablösungsprozess des Kindes von den Eltern. So ist für die Freizeitgestaltung das Ausmaß der Ressourcen der Eltern wichtig, die für die Gestaltung der freien Aktivitäten freigemacht werden. Die Arrangements, die Eltern getroffen haben damit das Kind Zeit selbst gestalten kann, sind ebenfalls von Bedeutung. Des weiteren haben zusätzliche Angebote durch Freunde und Verwandte und Angebote von außen, die speziell an das Kinder mit Behinderung gerichtet sind, Einfluss auf die Freizeitgestaltung (vgl. Flieger 2000, 35ff). Die Bedeutung der Familie für das Freizeitverhalten eines Menschen mit geistiger Behinderung nimmt meist erst mit dem Erwachsenenalter und damit mit der Ablösung von den Eltern und zunehmender Verselbständigung durch Wechsel in andere Betreuungssysteme ab. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Freizeitverhalten jedoch, wie schon erwähnt, größtenteils abhängig von den Ressourcen der Eltern, die noch neben Pflege, Betreuung, Versorgung und Assistenz für Freizeitgestaltung übrig bleiben. Schließlich hängt das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung durch die unweigerliche Abhängigkeit auch mit der Motivation sowie den Freizeitinteressen und -gewohnheiten der Eltern zusammen. So sind Eltern im Normalfall als die üblichen Freizeitpartner von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu sehen. Dennoch oder vielleicht sogar genau aus diesem Grund hegen einige Eltern den Wunsch nach Veränderung der familiären Freizeitsituation in Richtung Selbstständigkeit ihrer Kinder, u.a. auch um dadurch ihren Kindern eine bessere Ablösung vom Elternhaus zu ermöglichen und somit auf einen möglichst normalen Lebenslauf hinzuarbeiten (vgl. Markowetz 2001, 281ff).
Menschen mit geistiger Behinderung haben wie Menschen ohne Behinderung Vorlieben, Interessen und Wünsche bei ihren Freizeitaktivitäten. Wie aus einigen empirischen Studien hervorgeht, weicht die Art und Weise der durchgeführten Freizeitaktivitäten dabei nicht gravierend von praktizierten Freizeitaktivitäten der nicht behinderten Bevölkerung ab. Vor allem geistig behinderte Menschen sehen sich im Freizeitbereich jedoch mit Benachteiligungen verschiedener Herkunft konfrontiert. Manche der Barrieren und Erschwernisse, die sich geistig behinderten Menschen im Freizeitbereich stellen, sind direkt durch die der Behinderung zugrunde liegende Schädigung bedingt, andere sind wiederum auf negative soziale Reaktionen und Diskriminierungen zurückzuführen. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass eine vorhandene Behinderung bezogen auf das Freizeitverhalten nur einen Einflussfaktor neben vielen weiteren darstellt und somit auch mit Behinderung Freizeit durchaus positiv erlebt werden kann (vgl. Markowetz 2001; Flieger 2000; Hovorka 1990; Kerhoff 1982; Ebert 2000).
Therapie-, Förder- und Rehabilitationsmaßnahmen, die oft viel Zeit im Leben behinderter Menschen einnehmen, sind nur am Rande zur Zeitqualität der "Freizeit" zu zählen und als Obligationszeit zu rechnen. Mit besonderem Augenmerk auf Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung gilt der Besuch solcher Maßnahmen selten als freiwillig und selbstbestimmt. Somit sind diese Maßnahmen nicht bzw. nur schwer als Freizeitangebote zu werten. Im Zusammenhang mit Therapie-, Förder- und Rehabilitationsmaßnahmen ist weiters zu beachten, dass die Zeit, die neben diesen Maßnahmen als freie Lebenszeit bleibt, nicht ausschließlich zur Regeneration für diese Maßnahmen genutzt wird. Schließlich sollten solche Maßnahmen auch nicht die gesamte als "frei" definierte Lebenszeit einnehmen (vgl. Niehoff 2000; Ebert 2000; Heß 2000, Flieger 2000).
Abschließend ist noch zu bemerken, dass die Freizeitgestaltung von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen durch die häufige enge Bindung an die Eltern auch dementsprechend von deren Ressourcen abhängt. Somit haben sich Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich in der Regel nach den freien Zeitressourcen und den Freizeitinteressen der Eltern zu richten. Unterstützende Dienste bieten hier eine entlastende und entschärfende Funktion (vgl. Markowetz 2001; Flieger 2000).
Inhaltsverzeichnis
- 6.1 Angebotsformen
- 6.2 Angebotsbereiche
- 6.3 Ansprüche an freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung
- 6.4 Gestaltung und Planung von Freizeit- und Ferienangeboten
- 6.5 Kontaktaufnahme zwischen Angebot und Eltern
- 6.6 Erreichbarkeit als Leitprinzip
- 6.7 Integration im Rahmen von Ferien- und Freizeitangeboten
- 6.8 Schlussfolgerungen
In diesem Kapitel werden institutionalisierte Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung näher behandelt. Charakteristisch für diese Angebote sind eine gewisse Regelmäßigkeit und Struktur. Institutionalisierte Angebot finden im Rahmen eines Vereins oder einer Organisation statt und zeichnen sich durch gestaltete Beschäftigung, fixe Termine und regelmäßige Beteiligung aus. Auch die Inhalte sind üblicherweise reglementiert (vgl. Flieger 2000, 44).
Punktuell gibt es für Menschen mit geistiger Behinderung zwar diesbezüglich annähernd bedarfsdeckende Modelle, flächendeckend ist das Angebot aber bei weitem noch nicht ausreichend (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 360). Im Sinne der Gleichstellung sollten jedoch alle Menschen mit Behinderung alle Lebensbereiche so nützen können wie Menschen ohne Behinderung. Dies bedeutet, dass allgemeine Freizeiteinrichtungen und -angebote ihre Rahmenbedingungen so schaffen müssen, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung daran teilnehmen können (vgl. Flieger 2000, 6). Dafür spricht sich auch die österreichische Bundesregierung in ihrem Behindertenkonzept aus dem Jahr 1993 aus: "Die österreichische Bundesregierung bekennt sich zum Grundsatz, dass behinderte Menschen die gleichen Möglichkeiten wie Nichtbehinderte zur Gestaltung ihrer Freizeit haben sollen" (BMAGS 1993 zit. n. Flieger 2000, 77). Somit ist im Rahmen von Freizeit-und Ferienangeboten die Eröffnung derselben Bewegungs-, Zeit-, Spiel- und Entwicklungsräume für Kinder mit Behinderung als deren Recht zu sehen (vgl. Flieger 2000, 79f).
Im folgenden Kapitel werden nun Freizeit-und Ferienangebote in bezug zu Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung gesetzt und verschiedene diesbezügliche Aspekte herausgearbeitet. So wird auf Angebotsformen und -bereiche eingegangen und auf Ansprüche, die von verschiedenen Seiten her an diese Angebote gestellt werden. Auch die Gestaltung und Planung solcher Angebote, die Kontaktaufnahme mit möglichen TeilnehmerInnen bzw. deren Eltern sowie die Erreichbarkeit von Angeboten werden thematisiert. Schließlich wird noch die Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher im Rahmen von Freizeit-und Ferienangeboten ins Licht gerückt. Der bezug zu Ferienangeboten wird dabei zeitweise nicht explizit angeführt. Da Ferienangebote jedoch als eine Unterkategorie von Freizeitangeboten gelten, ist anzunehmen, dass Freizeitangebote betreffende Aspekte auch auf Ferienangebote zutreffen.
In der Folge werden nun Formen von Freizeitangeboten geschildert, die prinzipiell Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung offen stehen. Im Grunde gesehen werden dabei verschiedene Kategorien von Angeboten unterschieden, die sich einerseits auf die zeitliche Ausdehnung des Angebots oder andererseits auf den Grad der Öffnung für TeilnehmerInnen mit Behinderung beziehen.
Grundsätzlich können Freizeitangebote in punktuell, kurzfristige und kontinuierlich, längerfristige Angebote unterteilt werden. Punktuelle und kurzfristige Freizeitangebote sind "einzelne Aktivitäten, die für einen abgegrenzten, kürzeren oder längeren Zeitraum stattfinden" (Flieger 2000, 55). Dazu zählen stunden-, tage- oder wochenweise organisierte Angebote und damit auch Urlaubsaktionen, Ferienlager und die meisten anderen Ferienangebote. Die TeilnehmerInnen bilden bei solchen Angeboten temporäre Gruppen unter einer pädagogischen Leitung. Die Zusammensetzung der Gruppe endet mit Ende der Aktivität. Dieser Form von Angeboten stehen kontinuierliche und längerfristige Freizeitangebote entgegen, die sich meist über das ganze Jahr ziehen. Bei diesen Angeboten nehmen dieselben TeilnehmerInnen regelmäßig an pädagogisch geleiteten Gruppenstunden teil. Ferienangebote, wie sie in dieser Diplomarbeit behandelt werden, sind zu ersteren Gruppe von Freizeitangeboten zu zählen. Beide dieser Formen von Freizeitangeboten können noch zusätzlich über ihre Öffnung für Menschen mit Behinderung in allgemeine, integrative und spezielle Angebote kategorisiert werden.
Bezogen auf Menschen mit Behinderung können zwei Ansätze unterschieden werden im gesellschaftlichen Kontext mit der Thematik "Behinderung" umzugehen. Einerseits werden behinderten Personen als besondere Gruppe besondere finanzielle Mittel, Hilfsmittel, Maßnahmen, Dienste und Institutionen zur Verfügung gestellt. In diesem Sinn wird einem Prinzip der Solidarität und des Sozialstaates nachgegangen. Andererseits wird im Ansatz der Gleichstellung davon ausgegangen, dass behinderte Menschen zunächst nicht als eine besondere Bevölkerungsgruppe zu behandeln sind. Dies beinhaltet, dass allgemeine Vorschriften und Gesetze auch auf behinderte Personen anzuwenden sind und dass behinderten Menschen auch der Zugang zu Maßnahmen, Diensten und Institutionen für Gesamtbevölkerung gewährt werden soll. Mit den 1990er Jahren näherten sich diese beiden Ansätze immer mehr an, so dass Aspekte beider Ansätze berücksichtigt wurden und versucht wurde in der Verschmelzung dieser beiden Aspekte ein Optimum zu kreieren (BfsSGuK 2003, 43). Diese Tendenz ist auch bei Freizeitangeboten zu spüren. Auf der einen Seite werden zusehends allgemeine Angebote für Menschen mit Behinderung geöffnet. Auf der anderen Seite besteht immer noch die Nachfrage nach speziellen Freizeitangeboten für Menschen mit Behinderung.
Unter allgemeinen Angeboten sind solche Freizeitangebote einzuordnen, die generell auf alle Kinder und Jugendliche abzielen. Viele Anbieter aus diesem Bereich stehen laut eigenen Aussagen TeilnehmerInnen mit Behinderung grundsätzlich positiv gegenüber, dennoch findet die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bei allgemeinen Angeboten eher zufällig und sporadisch statt (Flieger 2000, 55ff). Allgemeine Freizeitangebote sollten daher laut Flieger in bezug auf ihre Zielgruppe mehr in die Breite gehen und in einer explizit toleranten Grundhaltung Rahmenbedingungen schaffen, die allen Menschen eine Teilnahme an den Angeboten ermöglichen. So werden Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sehr selten explizit von Angeboten ausgeschlossen. Eine Teilnahme scheitert jedoch meist an nicht behindertengerechten Rahmenbedingungen (vgl. ebd. 59f).
Spezielle Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung schlagen einen gegenteiligen Weg ein und konzentrieren sich in Planung und Durchführung besonders auf diese Zielgruppe. Die Auswahl an solchen Angeboten ist jedoch meist beschränkt. So gibt es nur wenige solcher Angebote und noch weniger solcher Angebote mit besonderem Bezug auf die Ferienzeit im Raum Wien. Im Stadtführer "Kind in Wien" (Heindl 2005), der doch 495 Seiten aufweist, sind lediglich zwei Ferienangebote auszumachen, die speziell für Kinder und Jugendliche mit Behinderung konzipiert sind. Diese Tatsache kann einerseits darauf hinweisen, dass von Seiten verschiedener Organisationen und der Politik diesem Bereich bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Andererseits kann das geringe spezielle Angebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung jedoch auch darauf hindeuten, dass in letzter Zeit das Augenmerk mehr auf die Schaffung von integrativen Angeboten gelegt wurde und mehr Ressourcen in den Ausbau dieses Bereiches gesteckt wurden (vgl. Flieger 2000, 58). Charakteristikum von speziellen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ist, dass diverse Aktivitäten in der Regel in Gruppen bestehend aus Kindern und Jugendlichen mit verschiedensten Behinderungen durchgeführt werden. Das Auftreten dieser Gruppen in der Öffentlichkeit verschärft jedoch das Bild einer Aussonderung von behinderten Menschen und erschwert eine Integration in das Freizeitleben. So werden die Teilnahme solcher Gruppen an Freizeitaktivitäten häufig als beschwerlich und mühsam erlebt (vgl. ebd., 69). Andererseits können Gruppen Gleichbetroffener von den TeilnehmerInnen auch als stärkend empfunden werden, da ähnliche Voraussetzungen bestehen und Erfahrungen ausgetauscht werden können. Partielle Separierung von Menschen kann auch dazu beitragen, dass auf individuelle und sozial-kommunikative Fähigkeiten eingegangen werden kann und somit bessere Voraussetzungen für Integration geschaffen werden können (vgl. Ebert 2000, 17). Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese Gruppen nicht ausschließlich auf die vermeintliche Andersartigkeit der TeilnehmerInnen reduziert werden (vgl. Hinz 2000, 76). Laut Markowetz (2000b, 367) haben spezielle Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung dort ihre Berechtigung, wo sie von den TeilnehmerInnen nachhaltig gewünscht sind oder wo sie vorübergehend nicht anders organisiert und finanziert werden können. In allen anderen Fällen sieht er integrative Angebote als zu bevorzugen an. Integrativen Angeboten als die dritte Form von Freizeitangeboten ist im weiteren Verlauf dieser Diplomarbeit ein ganzes Unterkapitel gewidmet, in dem explizit diese Angebotsform betreffende Aspekte eingegangen wird. Vorerst wird jedoch auf verschiedene durch Freizeitangebote abgedeckte Bereiche bezug genommen.
Bestehende Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich können in verschiedene Bereiche unterteilt werden: in "Kurse, Bildung und kreative Angebote", in "Sportbezogene Angebote", in "Offene Angebote" und in "Urlaubsangebote, Ferienangebote und Ferienlager". Diese Unterteilung ist an ein Modell von Theunissen, Dieter, Neubauer und Niehoff (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 362ff) angelehnt, in dem diesbezügliche Freizeitangebote kategorisiert wurden.
Die meisten Freizeitangebote, die in diesen Bereich einzuordnen sind, beschäftigen sich mit Basteln, Werken, Kochen, Backen, Tanz, Musik und bildnerischem Gestalten. Angebote dieser Art sind laut Theunissen oft weniger integrativ und beziehen sich sehr auf die Zielgruppe "Menschen mit Behinderung". Angebote speziell für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sind in diesem Bereich dennoch unterrepräsentiert, da es kaum altersbezogenen Angebote gibt. Somit nutzen Kinder und Jugendliche in der Regel solche Angebote gemeinsam mit Erwachsenen, die diesbezüglich oft altersbedingt andere Interessen haben. Ebenfalls zu diesem Bereich zählen Angebote, die das Erlernen bzw. Förderung verschiedener Kulturtechniken (autonome Lebensführung, Selbstbestimmung, Selbstdarstellung, Selbstdurchsetzung, Sexualität, Freundschaft, Partnerschaft) im Empowerment-Ansatz anbieten. Diese haben zum Ziel Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeiten und Kompetenzen zu geben, mehr Einfluss auf das eigene Leben und dessen Gestaltung zu nehmen. Solche Angebote sind im Gegensatz zu den oben angeführten Freizeit noch in der Unterzahl (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 362ff), doch ist auf diesem Gebiet ein fortwährender Fortschritt zu bemerken.
Zu offenen Freizeitangeboten zählen Angebote, bei denen die Teilnahmemodalitäten und Verpflichtungen möglichst gering gehalten werden. Im Mittelpunkt steht die freiwillige Teilnahme und das Prinzip der Offenheit, das ein jederzeitiges Kommen und Gehen im sinne einer selbstbestimmten Zeitgestaltung forciert. Die am häufigsten angebotenen diesbezüglichen Freizeitangeboten für Menschen mit geistiger Behinderung stellen Feste, Discos und dementsprechende gemeinschaftliche Aktivitäten dar. Diese Angebote werden auch oft von als schwer behindert geltenden Personen in Anspruch genommen. Auch jüngere Menschen mit geistiger Behinderung nehmen häufig an diesen Angeboten teil. Feste und Discos finden in der Regel in Großgruppen statt mit verhältnismäßig viel Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. Diese Form von offenen Angeboten weist auch im Vergleich zu anderen Angeboten einen relativ hohen integrativen Charakter auf (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 364f). Dies liegt zum Großteil daran, dass sie in der Regel allen interessierten Besuchern offen stehen und dass somit auch Menschen ohne Behinderung leicht Zutritt zu diesen Angeboten haben (vgl. Theunissen 2000b, 103).
Einen großen Teilbereich der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich stellen sportbezogene Angebote dar. Sowohl von den Kindern und Jugendlichen als auch von ihren Eltern geht häufig ein starkes Interesse an sportlichen Betätigungen aus. Für Eltern stehen dabei meist gesundheitsförderliche und -erhaltende Aspekte sowie die Möglichkeit soziale Kontakte zu schließen im Vordergrund. Die Kinder und Jugendlichen machen sich diesbezüglich selten so weitreichende Gedanken, sondern finden einfach nur Spaß am Sport und der Bewegung. So werden häufig positive Assoziationen und Vorerfahrungen mit Sport verbunden und in der Regel verfügen Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung zumindest über grundlegende Kompetenzen in Verbindung mit verschiedenen Sportarten (vgl. Markowetz 2001, 285; Flieger 2000, 35f). Unter sportlichen Aktivitäten gilt Schwimmen, Kegeln und Gymnastik unter Menschen mit geistiger Behinderung als besonders beliebt und wird auch dementsprechend häufig in der Freizeit angeboten (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 364).
Leider sehen sich Menschen mit geistiger Behinderung bei Integration im Sportbereich oft mit einer Selektion konfrontiert, die eine Teilnahme an einer sportlichen Aktivität verhindert. Kapustin sieht, um dem entgegenzuwirken, die Möglichkeit sowohl behinderungsspezifischen Angebote (Sport für behinderte Menschen), behinderungsgerechte Angebote (Sport mit behinderten Menschen) als auch selbstbestimmte Angebot der behinderten Menschen (Sport der behinderten Menschen) anzubieten. Zusätzlich können geeignete Hilfsmittel die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten erleichtern bzw. ermöglichen (vgl. Markowetz 2001, 285; Flieger 2000, 35f). Reincke teilt in ähnlicher Weise Freizeitangebote mit Sportbezug in zwei Formen auf: in integrative und normalitätsorientierte Angebote sowie in spezielle und behinderungsorientierte Angebote. Integrative und normalitätsorientierte Angebote zielen darauf ab behinderte Menschen im Sport nicht behinderten Menschen gleich zu stellen. Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Die Behinderung wird dabei im Rahmen des Sports als prinzipiell kompensierbar verstanden. Normalitätsorientierte Sportangebote nehmen auf den allgemeinen Sport bezug und orientieren sich dadurch an sportlichen Leistungs- und Wettkampfgedanken, unter anderem auch mit dem Ziel Beachtung und Anerkennung in der nicht behinderten Bevölkerung durch öffentliche Darstellung der Leistungen zu gewinnen. Zeitweise wird im Rahmen dieser Angebote auch auf eine Teilnahme an Sportveranstaltungen nicht behinderter Menschen hingearbeitet. Durch das Erbringen dieser Leistungen entfernen sich diese Personen subjektiv von der Situation des Behindertseins und fühlen sich immer mehr zur gesellschaftlich-sozialen Allgemeinheit dazugehörig (vgl. Reincke 2000, 110ff). Im Sport ist generell eine Integration von gesellschaftlichen "Randgruppen" leichter zu erreichen als in vielen anderen Lebensbereichen. Sportart bieten sozial definierte Situationen statt, wodurch einige Unsicherheiten im Umgang mit fremden Personen(gruppen) aufgefangen werden. Das definierte Regelwerk und bekannte Spielfelder sowie Sportgeräte schaffen eine gemeinsame Atmosphäre, in der die Beteiligten sofort zu einer gemeinsamen Aktion kommen können. Somit erleichtert Sport sogenannten "Randgruppen" die soziale Integration in die Gesellschaft. Dennoch ist Integrationssport bis dato immer noch eher eine Randerscheinung (vgl. Rheker 2000, 292f).
Auf der anderen Seite gibt es spezielle und behinderungsorientierte Sportangebote, die davon ausgehen, dass behinderte Menschen besonderer und spezieller Anstrengungen und Zuwendungen bedürfen. Sport wird dabei in "Sondergruppen" vollzogen, die separiert von allgemeinen Sportangeboten organisiert werden. Diese Art von Sportangeboten wird vor allem von geistig behinderten, psychisch behinderten und schwer-und schwerstbehinderten Personen in Anspruch genommen. Behinderungsorientierte Sportangebote vergrößern auf der einen Seite die soziale Ausgrenzung, ermöglichen jedoch auf der anderen Seite eine Entfaltung im behinderungsspezifischen Kontext. Ein Grund dafür, dass geistig behinderte Menschen zum Großteil solche speziellen Sportangebote in Anspruch nehmen, liegt darin, dass viele Sportarten im allgemeinen Bereich einem komplexen Regelwerk unterliegen, die für als geistig behindert bezeichnete Personen oft nur schwer zu verstehen sind. Generell sollte laut Reincke ein Bereich mit Sportangeboten ohne Leistungsaspekt geschaffen werden, an dem sowohl nicht behinderte als auch schwer behinderte Personen teilnehmen können. Losgelöst vom Leistungsgedanken sollte hier vordergründig der Spaß von Bedeutung sein, sodass kein Sportler wegen seiner Behinderung ausgeschlossen wird, denn ">Integration< meint grundsätzlich die chancengleiche und gleichberechtigte Teilhabe der Behinderten an den allgemeinen materiellen und immateriellen Gütern und damit an der >Normalität< unserer Gesellschaft. Zu dieser gehört auch der allgemeine Sport." (Reincke 2000, 118).
Auf die Thematik "Reise, Urlaub und Tourismus" in Verbindung mit der Freizeitgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung wurde schon in Kapitel 5.4 eingegangen. In der Folge werden nun diesbezügliche Angebote näher beleuchtet.
In diesem Bereich werden am häufigsten Tagesfahrten angeboten Der Anteil an schwer behinderten TeilnehmerInnen ist in diesem Angebotsbereich verhältnismäßig hoch. Reise- und Urlaubsangebote werden laut empirischen Studien oft in Großgruppen von über 20 TeilnehmerInnen mit Behinderung durchgeführt und zeigen selten einen integrativen Charakter. Laut Theunissen ist es fraglich, ob solch große Gruppen der Integration in diesem Bereich zuträglich sind und ob bei dieser Anzahl zu genüge Bedürfnissen und Interessen einzelner TeilnehmerInnen nachgegangen werden kann (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 365). Die Gestaltung eines Urlaubsangebots für geistig behinderte Kinder und Jugendliche erweist sich oft als schwierig. So müssen vor allem für mehrfachbehinderte Kinder ein geeignetes und barrierefreies Quartier gefunden werden sowie viele Rahmenbedingungen beachtet und im Vorhinein geklärt werden. Die besonderen Bedürfnisse und Interessen der behinderten TeilnehmerInnen müssen berücksichtigt und Ort und Aktivitäten demnach selektiert werden. Aus diesem Grund sind laut dem österreichischen Bundesministerium für Arbeit und Soziales in diesem Bereich spezifische Angebote für geistig behinderte Kinder und Jugendliche hilfreich und zur Zeit nicht ersetzbar (BfAuS 1993, 52).
Einige Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung fahren wie nicht behinderte Kinder in den Schulferien auf Ferienaktionen und Ferienlager. Dort erfahren sie Erholung und Abenteuer und erleben sich einer aktiven Gemeinschaft. Ferienaktionen außerhalb der gewohnten Umgebung und ohne die Eltern sind in der Regel als begünstigend für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu sehen, da dadurch die Loslösung von der Familie und damit die Selbstständigkeit gefördert werden. Des weiteren wird Aktivität herausgefordert und dadurch die eigene Leistungsfähigkeit gesteigert (vgl. Ebert 2000, 45). In Österreich bieten verschiedene Organisationen Ferienaktionen an, die speziell auf Kinder mit Behinderung zugeschnitten sind. In den letzten Jahren wird jedoch verstärktes Augenmerk drauf gelegt, solche Angebote generell integrativ zu gestalten, um somit Kinder und Jugendliche mit Behinderung in bestehende Ferienaktionen miteinzubinden. Bisher nehmen Kinder und Jugendliche mit Behinderung aber nur punktuell und sporadisch an integrativen Ferienaktionen teil (vgl. Flieger 2000, 50).
Ansprüche, die von verschiedenen Seiten an die Angebote aus den eben angeführten Bereichen gestellt werden, werden nun in den folgenden Zeilen thematisiert.
Von verschiedenen Seiten her werden Ansprüche an freizeitpädagogische Angeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung gestellt. Als eine Aufgabe der Angebote ist es zu sehen, diesen Ansprüchen nach Möglichkeit gerecht zu werden, um somit auch genauer auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen bezug nehmen zu können.
Ein oft strittiger Punkt, der besonders bei der Integration von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen in Freizeitangebote auftritt, ist die Frage nach der notwendigen Qualifikationen der BetreuerInnen (vgl. Flieger 2000, 54ff). So können, wie schon erwähnt, bei PädagogInnen, die sich in ihrer Ausbildung nicht speziell mit dem Thema "Behinderung" auseinandergesetzt haben, negative Gefühle wie Unsicherheit, Nervosität, Angst und Schuldgefühle im Umgang mit Kindern mit geistiger Behinderung eine Rolle spielen, woraus ein gewisses Distanzverhalten resultieren kann (vgl. Cloerkes 2001, 90). Eine genauere Beschäftigung mit der Thematik "Behinderung" könnte dementsprechende Ängste und Unsicherheiten beseitigen. Jedoch wird in allgemeinen pädagogischen Ausbildungen wird wenig auf dieses Thema eingegangen. Dies führt immer wieder zu Problemen bei der Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Bereichen, in denen keine speziell in diesem Fachbereich ausgebildeten PädagogInnen tätig sind, wie dies zeitweise auch im Bereich der allgemeinen freizeitpädagogischen Angebote der Fall ist.
Natürlich sind auch allgemeine pädagogische Qualifikationen und darüber hinaus psychologische und soziologische Kenntnisse in der freizeitpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendliche mit geistiger Behinderung von Bedeutung. Unter Stützung auf Opaschowski werden nun einige dieser relevanten Qualifikationen angeführt, denn "kein Freizeitberuf kommt künftig ohne Grundkenntnisse der Pädagogik und Didaktik, der Psychologie und Soziologie aus." (Opaschowski 1996, 271). So sind auch alle Mitarbeiter von Freizeitangeboten speziell für als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche darauf angewiesen, sich freizeitpädagogische Grundkenntnisse anzueignen, um ein adäquates Angebot bieten zu können. Zusätzlich sollten sie im Sinne Opaschowskis in der Lage sein, Beratungsaufgaben und Aufklärungsarbeit gegenüber Eltern zufriedenstellend leisten zu können, sowie praktisch anzuleiten und zu betreuen. Auch organisatorische und koordinierende Fähigkeiten, das Übernehmen von Fort-und Weiterbildungsaufgaben und nicht zuletzt Einfühlungsvermögen, Überzeugungskraft, sowie weitere pädagogische Fähigkeiten sind gefordert (vgl. ebd., 271f). Somit sehen sich Mitarbeiter von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung einem breiten Spektrum an Anforderungen gegenüber, denen sie gerecht werden sollten.
Opaschowski führt darüber hinaus weitere freizeitpädagogische Qualifikationsanforderungen an, die natürlich auch in der Arbeit mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen von Bedeutung sind. So ist die "Fähigkeit zur Ermöglichung von Kommunikation" hilfreich für den Abbau von Kommunikationsbarrieren und Schwellenängsten und den Aufbau von Dialog und Gedankenaustausch. Die "Fähigkeit zur Freisetzung von Kreativität" setzt schöpferische Kräfte bei TeilnehmerInnen frei und fördert Spontaneität und aktive Teilnahme. Für die Vermittlung von Gruppenerlebnissen und die Realisierung von Gruppenzielen ist ein gewisses Maß an "Fähigkeit zur Förderung von Gruppenbildung" notwendig. Die "Fähigkeit zur Erleichterung von Teilnahme und Mitwirkung am kulturellen Leben" begünstigt die Schaffung angemessener Bedingungen für die TeilnehmerInnen. Als Eingangsvoraussetzung sind Praxiserfahrungen und im Fall von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung besonders praktische Erfahrungen mit Kindern sowie mit Menschen mit Behinderung von großem Vorteil. Natürlich sind auch bestimmte persönliche Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen und Offenheit als günstig für die Arbeit im freizeitpädagogischen Bereich zu werten (vgl. ebd., 284f).
Abschließend ist zu sagen, dass es in diesem Bereich vor allem im Hinblick auf integrative Angebot wichtig ist, eine Pädagogik zu verfolgen, die allen Kindern und Jugendlichen gegenüber offen ist und somit Möglichkeiten schafft alle diese Kinder und Jugendlichen miteinzubeziehen. Toleranz und das Arbeiten gegen Aussonderung sind dabei wichtige Kriterien. Somit sollten Freizeitangebote, die für geistig behinderte Kinder und Jugendliche offen stehen möglichst wenige Kompetenzen voraussetzen, um auch schwerer behinderten Kindern und Jugendlichen Platz zu bieten. Außerdem sollte von konkurrenzorientierten Gedanken Abstand genommen werden und Kooperation zwischen den TeilnehmerInnen gefördert werden (vgl. Flieger 2000, 58). Dazu sollte in einer allgemein offenen Pädagogik eine tolerante und flexible Grundhaltung eingenommen werden, die es ermöglicht individuelle Bedürfnisse der TeilnehmerInnen zu erkennen und flexibel darauf einzugehen (vgl. ebd. 70f). Mehr zu integrativen Freizeit- und Ferienangeboten ist in Kapitel 6.7 zu lesen.
In der Durchführung von Freizeitangeboten mit geistig behinderten TeilnehmerInnen ergeben sich natürlich immer wieder Veränderungs-und Verbesserungswünsche. Theunissen, Dieter, Neubauer und Niehoff führten diesbezüglich im Sommer 1998 eine Studie durch, in der 166 für die Freizeitarbeit verantwortlich nicht behinderte Mitarbeiter der Lebenshilfe Deutschland unter anderem zu ihren Veränderungswünschen bei Freizeitangeboten befragt wurden. In dieser Untersuchung kam man zu folgenden in Abbildung 6 angeführten Ergebnissen:
|
Rang |
Nennungen |
Verteilung für Katgorie "wichtig, sehr wichtig" |
|
|
1 |
Selbstbestimmung der Nutzer |
120 |
76% |
|
2 |
Angebote für Menschen mit schwerer u. mehrfacher Behinderung |
120 |
73% |
|
3 |
gesicherte Fahrtmöglichkeit |
123 |
70% |
|
4 |
genügend Helfer |
128 |
70% |
|
5 |
Erfahrungsaustausch mit anderen Anbietern |
109 |
70% |
|
6 |
Angebote für alte Menschen mit geistiger Behinderung |
115 |
68% |
|
7 |
Wertschätzung der Öffentlichkeit |
127 |
67% |
|
8 |
Zuverlässigkeit der Teammitglieder |
114 |
65% |
|
9 |
eigene Räume für Freizeitangebote |
113 |
63% |
|
10 |
Angebote für Jugendliche |
111 |
63% |
|
11 |
Einrichtung von Planstellen |
110 |
61% |
|
12 |
Erfahrungsaustausch innerhalb der Einrichtung |
109 |
61% |
|
13 |
Eigenverantwortung des Freizeitbereichs |
113 |
60% |
|
14 |
Nutzung öffentlicher Einrichtungen |
122 |
59% |
|
15 |
Angebote für Kinder |
110 |
63% |
|
16 |
Wertschätzung der vorgesetzten Instanzen |
127 |
56% |
|
17 |
Angebote in den Ferienzeiten |
117 |
55% |
|
18 |
mehr nicht behinderte TeilnehmerInnen |
118 |
55% |
|
19 |
organisatorische Abläufe (Verwaltung) |
110 |
51% |
|
20 |
zertifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten |
103 |
49% |
|
21 |
Wertschätzung der Kolleg(inn)en |
111 |
47% |
|
22 |
organisatorische Abläufe (konkrete Angebote) |
109 |
46% |
|
23 |
eigenes Büro bzw. Vorbereitungsraum |
112 |
37% |
Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass über drei Viertel (76%) der befragten Freizeitverantwortlichen eine Veränderung in Richtung mehr Selbstbestimmung der Nutzer wünschen. Auch die Zahl an Freizeitangeboten für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung dürfte die Nachfrage nicht decken (73%). Interessant ist ebenfalls, dass eine gesicherte Fahrtmöglichkeit als wichtig eingeschätzt wird (70%). Dies deutet darauf hin, dass auch das problemlose Erreichen eines Freizeitangebots von großer Wichtigkeit und nur selten garantiert ist. Weiters geht aus dieser Studie hervor, dass eine Verbesserung des Angebots für Jugendliche (63%) und für Kinder (63%) mit geistiger Behinderung von Bedeutung ist. Auch das Angeboten in der Ferienzeit (55%) und die verstärkte Integration durch mehr nicht behinderte TeilnehmerInnen (55%) wurden von über der Hälfte der Befragten als wichtig erachtet.
In derselben Studie wurden auch 735 Nutzerinnen und Nutzer von Freizeitangeboten für geistig behinderte Menschen zu Verbesserungswünschen im Freizeitbereich befragt. Knapp unter zwei Drittel (64%) der Befragten sprachen sich für mehr Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten mit nicht behinderten Menschen aus, was auf ein großes Bedürfnis nach Integration im Freizeitbereich hindeutet. Weiters wünschten sich die befragten NutzerInnen mehr Helfer (53%) und eine Verbilligung der Angebote (53%). Außerdem besteht der Wunsch nach einer besseren Information über Angebote (49%) sowie nach einer größeren Anzahl an Angeboten bzw. einer größeren diesbezüglichen Wahlmöglichkeiten (48%) (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 369).
Theunissen, Dieter, Neubauer und Niehoff folgern aus den Ergebnissen der Studie, dass eine gewisse Vielfalt an Freizeitangeboten für Menschen mit geistiger Behinderung geschaffen werden muss, die auf mehr Selbst-und Mitbestimmungsmöglichkeiten hinzielt. Eine solche Vielfalt bietet potentiellen NutzerInnen auch ein gewisse Wahlmöglichkeit in bezug auf Freizeitangebote. Außerdem sollte ebenfalls eine größere Vielfalt an Angeboten für Kinder und Jugendliche geschaffen werden, die eigens auf alterspezifische Aspekte eingeht. Diese Gruppe an NutzerInnen wurde bisher nur spärlich berücksichtigt. Die Autoren folgern aus den Ergebnissen weiters, dass verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dazu dienen kann, die Gesellschaft auf die Freizeitbedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung hin zu sensibilisieren, Begegnungen zu initiieren und neue Helfer im Freizeitbereich zu gewinnen. Überhaupt sollte die Integration im Rahmen von Freizeitangeboten vorangetrieben werden und auch nicht behinderte Personen verstärkt in die Angebote miteinbezogen werden. Dies kann durch Zusammenarbeit mit Anbietern von Angeboten erreicht werden, die nicht explizit behinderte Menschen als Zielgruppe haben. Generell brächte eine lokale und überregionale Vernetzung von Freizeitangeboten organisatorische, politische und die Integration betreffende Vorteile, durch Austausch und aktive Einmischung, so die Autoren. Aus der Studie geht ebenfalls hervor, dass die Organisation von Fahrten bzw. die Erreichbarkeit von Freizeitangeboten noch deutlich verbessert werden muss. Schließlich sehen es Theunissen, Dieter, Neubauer und Niehoff als notwendig, eine bessere und sichere Finanzierungsgrundlage für Freizeitangebote zu schaffen. Stabile Finanzierungsgrundlagen führen auch zu einer Stabilisierung und Kontinuität von Freizeitangeboten (vgl. ebd., 370ff). Die angeführten Aspekt sind in der Planung von Freizeit-und Ferienangeboten zu berücksichtigen. Auf diese Thematik wird nun eingegangen.
Bei der Gestaltung und Planung von Freizeit-und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sind vielerlei Aspekte zu beachten. Es ist außerdem notwendig bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen und Leitlinien für die Durchführung zu setzen. Ein organisiertes Vorgehen erleichtert die Durchführung des Angebots und trägt auch zu einer gewissen Professionalisierung in diesem Bereich bei. Dementsprechende Leitlinien und Rahmenbedingungen werden nun in den Mittelpunkt gerückt.
Opaschowski führt bestimmte Leitlinien für die Planung von Freizeitangeboten an, deren Einhaltung ein qualitativ hochwertiges Angebot als Ergebnis verspricht. So sollte "wohnungsnah geplant" werden, also der Kontakt und die Nähe zur Zielgruppe gesucht werden. Eine wohnungsnahe Planung ermöglicht eine gute Erreichbarkeit (vgl. Kap. 6.6) des Angebots und auch wieder eine problemlose Rückkehr, womit Unsicherheiten und Ängste im Teilnehmerkreis vermindert werden können (Opaschowski 1996, 216). Dies bedeutet, dass Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung dezentral in kleineren Gruppen angeboten werden sollten. Somit wird es möglich viele kleinere Angebote in Wohnungsnähe zu setzen, um somit lange Anfahrtswege und -zeiten zu verhindern.
Hilfreich ist es auch, unterschiedliche Freizeitangebote so zu planen, dass sie weitgehend unter einem gemeinsamen Dach stattfinden. Dies ermöglicht ein zwangloses Versammeln und Treffen und beinhaltet auch eine räumliche Nähe von verschiedenen Angeboten, womit der Wechsel zwischen Angeboten leichter möglich wird (ebd., 216f). Bezogen auf Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bedeutet dies, dass die Angebote, wenn möglich, in räumlicher Nähe stattfinden sollten, sodass die Auswahl an möglichen Aktivitäten steigt. Es wäre auch günstig, diesbezügliche Freizeitangebote mit dementsprechenden Angeboten für Eltern zu kombinieren, um damit eine räumliche Nähe herzustellen. Dies könnte helfen, Trennungsängste zu überwinden und den Zeitaufwand der An-und Abfahrt auch für die Eltern lohnend zu machen. Das Prinzip des gemeinsamen Daches steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zur zuvor angeführten Leitlinie der wohnungsnahen Planung, in der dezentrale Angebote favorisiert werden. Zur Zeit werden nicht genügend Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche angeboten, um gleichzeitig eine Vereinigung mehrerer Angebote unter einem Dach und zusätzlich Wohnungsnähe anbieten zu können.
Um auf verschiedenen Interessen und Neigungen einer Zielgruppe eingehen zu können, ist als Voraussetzung eine gewisse Angebotsvielfalt zu arrangieren. Bei der Planung eines Freizeitangebots sollte also die Möglichkeit der Befriedigung verschiedener Freizeitbedürfnisse acht gegeben werden (z.B. Bewegung und Erholung und Unterhaltung und Spaß) (vgl. ebd., 217). Für Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bedeutet dies, eine Einseitigkeit im Angebot zu vermeiden und durch eine Vielfalt an Aktivitäten die Attraktivität für die TeilnehmerInnen zu erhöhen.
Freizeitangebote sollten auch als "Vertrauensoase" zur Verfügung stehen, in der "soziale Geborgenheit" erlebt wird. In der Planung ist aus diesem Grund darauf zu achten, dass Fremdheits- und Risikogefühle so gering wie möglich gehalten werden. Im dies zu erreichen sollte das Angebot den TeilnehmerInnen durchschaubar, überzeugend und glaubwürdig präsentiert werden (vgl. ebd., 219f). Für Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bedeutet dies, dass das Angebot einerseits den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen und andererseits den Eltern in adäquater Weise nähergebracht werden sollte, um eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Offenheit und Transparenz spielen dabei eine große Rolle.
In der Planung eines Freizeitangebots sollten auch "Freiräume für Eigeninteressen" berücksichtigt werden. Dadurch kann der Gefahr entgegengewirkt werden in der Gemeinschaft unterzugehen (vgl. ebd. 220). Speziell bei als geistig behindert bezeichneten Kindern und Jugendlichen sind diese Freiräume wichtig. Sie bieten Rückzugsmöglichkeiten für besondere Interessen und Bedürfnisse, die zum Teil durch die Behinderung bedingt sein können (z.B. Autismus).
Freizeitangebote sollten bereits in der Planung schon als "spielerische Aktivitäten" angesehen werden. Von Leistungs- und Bewertungssystemen sollte daher Abstand genommen werden und neue Anregungen sollten auf spielerische Art vermittelt werden. Dadurch wird der persönliche Freiraum erweitert und die Experimentier-und Probierbereitschaft gefördert (vgl. ebd, 220f).
Schließlich sollte schon in der Planungsphase das persönliche Gespräch mit den TeilnehmerInnen angestrebt werden, um direkte, aktuelle und unmittelbare Eingaben von dieser Seite her zu erhalten. Besondere Probleme und Wünsche der Zielgruppe können somit schon in der Planung berücksichtigt werden und es können praktische Konsequenzen daraus gezogen werden (vgl. ebd, 221). Bei Freizeit-und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung ist hier wiederum wichtig sowohl die Gruppe der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen als auch die Gruppe der Eltern miteinzubeziehen. Wenn Bedürfnisse und Wünsche beider dieser Gruppen in die Planung miteinfließen, verspricht dies eine verhältnismäßig gute Zielgruppenorientierung. Dennoch entscheiden über die Konzeption von Freizeitangeboten bis dato zu einem Großteil die Leitung bzw. leitende Mitarbeiter. TeilnehmerInnen sind im Gegensatz dazu eher gering an Planungs- und Gestaltungsentscheidungen beteiligt. Positiv zu werten ist, dass bei vielen Angeboten die Notwendigkeit der Beteiligung der TeilnehmerInnen immer mehr erkannt wird und klar in Richtung mehr Autonomie und Entscheidungskompetenz für die TeilnehmerInnen gearbeitet wird (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 366).
Auf handlungspraktischer Ebene können Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung durch verschiedene Maßnahmen gestärkt werden. Zu solchen Maßnahmen zählen Vernetzung von Initiativen und Freizeitangeboten, Kooperation zwischen verschiedenen Anbietern, wissenschaftlich und praktisch fundierte Konzeptionsentwicklung, gesicherte Finanzierung, vielfältige Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, Einrichtung von Planstellen sowie Werbung und Begleitung von neben-und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 360). Im Sinne einer Sensibilisierung der Gesellschaft auf Freizeitbedürfnisse und kulturelle Partizipation ist auch einen gewisse Öffentlichkeitsarbeit als Aufgabe von Freizeitangeboten zu sehen (vgl. ebd. 367), die in Gestaltung und Planung berücksichtigt werden muss. Somit kann die Wertschätzung und Akzeptanz in der allgemeinen Öffentlichkeit gesteigert und Unterstützungen verschiedener Art verstärkt werden. Weiters kann somit eine Sensibilisierung von allgemeinen Einrichtungen für die Freizeitbedürfnisse von geistig behinderten Menschen erreicht werden (vgl. Theunissen 2000b, 103).
Schließlich stellt die Finanzierung der Angebote einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt dar. Eine unsichere bzw. unzureichende Finanzierung zählt zu den größten Problematiken bei Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 367). Dies macht es notwendig in dieser Richtung genau zu planen, um eine finanzielle Absicherung und somit das weitere Bestehen von Angeboten zu sichern. Zeitweise wird hier von staatlicher Seite in Form von Förderungen unterstützend eingegriffen. Die meisten Freizeit-und Ferienangebote werden jedoch über Teilnehmerbeiträge finanziert. Für einige Menschen mit geistiger Behinderung bedeuten diese Kosten aber eine nur schwer zu überwindende finanzielle Hürde, die möglicherweise eine Teilnahme verhindert. Um die Teilnahmemöglichkeit an einem Angebot nicht an den finanziellen Mitteln von potentiellen TeilnehmerInnen festzumachen, ist es notwendig diverse Gebühren dementsprechend niedrig zu halten. Um dies zu erreichen gibt es weitere Finanzierungsmöglichkeiten über Eigenanteile des Trägers oder Spenden. Schließlich werden auch manche Kosten von Krankenkassen übernommen (vgl. Theunissen, u.a. 2000, 365f).
In der Planung und Gestaltung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung ist es auch notwendig Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu dieser Zielgruppe zu eruieren und zu nutzen. Möglichkeiten der Kontaktaufnahme werden nun genauer beleuchtet.
Vor allem allgemeine Freizeitangebote zeigen selten besonderes Engagement Kinder und Jugendliche mit Behinderung gezielt einzuladen und sich diesbezüglich auch an die Eltern zu wenden. Somit wird in der Regel nicht explizit drauf hingewiesen, dass teilnehmende Kinder und Jugendliche mit Behinderung beim Angebot gerne willkommen sind. Viele Eltern behinderter Kinder interpretieren dies als eine ablehnende Haltung der Teilnahme ihrer Kinder gegenüber und nehmen an, dass bei diesen Angeboten keine besondere Rücksichtnahme auf ihre behinderten Kinder geboten ist. Integrative und spezielle Freizeitangebote schlagen hier in der Regel einen anderen Weg ein. So sprechen sie in Aussendungen Kinder und Jugendliche mit Behinderung direkt an und machen auf die Teilnahmemöglichkeit aufmerksam (vgl. Flieger 2000, 60ff). Markowetz hält darüber hinaus ein Netz an wohnortnahen Beratungsstellen für wünschenswert, die sich schnell und unbürokratische mit Problemen bei der Freizeitgestaltung behinderter Menschen in einer kundenorientierten Art und Weise befassen (vgl. Markowetz 2000b, 367). So kann der Informationsfluss über Freizeitgestaltungsmöglichkeiten verbessert, systematisch erfasst und kundenorientiert publiziert werden (vgl. ebd., 372). Opaschowski führt einige Methoden an, die eine Kontaktaufnahme zwischen Angebot und TeilnehmerInnen bzw. deren Eltern erleichtern können.
Um einen möglichst guten Kontakt zwischen Eltern und Anbietern von freizeitpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung herzustellen, sind gewisse freizeitpädagogische Methoden seitens der Anbieter hilfreich. Opaschowski schildert einige dieser Methoden: "Informative Beratung" dient dazu vorhandene Freizeitangebote bekannt zu machen. Hierzu zählt der Einsatz und die Vermittlung verschiedener Informationsträger sowie die Beratung in pädagogischen, sozialen und kulturellen Freizeitfragen. Wichtig hierbei ist es zu berücksichtigen, dass Freizeitangebote dem Prinzip der Freiwilligkeit unterliegen und somit jede Art von Druck und Zwang zu vermeiden ist. Informative Beratung ist als Bewusstmachungsprozess zu verstehen, in dem gewisse Zielgruppen dazu angeregt werden sollen ihre Freizeitbedürfnisse bewusster zu erkennen und zu reflektieren. In einem Kommunikationsprozess sollte dazu eine offene und zwangsfreie Beratungssituation geschaffen werden, in dieser auf nichtdirektive Art und Weise Zielgruppen von Freizeitangeboten beraten werden (vgl. Opaschowski 1996, 192ff). Bezogen auf Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bedeutet dies, dass von Seiten der Anbieterorganisationen Informationsstellen geschaffen werden sollten, bei denen sich Eltern sowie die als "geistig behindert" bezeichneten Kinder und Jugendlichen informieren und beraten lassen können. Die Beratung sollte darauf abzielen Freizeitbedürfnisse bewusst zu machen und dementsprechende Angebote anzuführen. Dabei ist es in erster Linie notwendig an Familien mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung heranzutreten, um sie über diese Möglichkeit der Beratung zu informieren.
Einen weiteren Schritt stellt die "Kommunikative Animation" dar. Diese beinhaltet über die Beratung hinausgehende aktivierende Methoden der Ermutigung, Anregung und Förderung. So soll die Kommunikations- und Kontaktfähigkeit von Zielgruppen von Freizeitangeboten verbessert werden. Ziel dabei ist eine höhere Bereitschaft an Freizeitangeboten teilzunehmen. In einer anforderungsorientierten Art und Weise sollen in einer kommunikationsfreudigen Atmosphäre anregende äußere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört es auch unterschiedliche Bedürfnisse der TeilnehmerInnen zu akzeptieren. Für Freizeitpädagogen bedeutet dies in der Kommunikativen Animation eine Mischung aus Ansprechpartner, Motivierungshelfer und Interessenberater darzustellen. In dieser Funktion sollten sie auf Menschen zugehen, Kontaktängste, Organisationsbarrieren und Schwellenängste abbauen, Menschen dazu ermutigen, selbst aktiv und kreativ zu werden, emotionale Gruppenerlebnisse fördern sowie Möglichkeiten für Eigeninitiative schaffen (vgl. ebd., 195f). In Freizeit-und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sollte also in bezug auf Kommunikative Animation über die bloße Information über Möglichkeiten hinausgegangen werden. Auf eine motivierende Art und Weise sollte Eltern die Inanspruchnahme von Freizeit- und Ferienangeboten in nichtdirektiver Weise nähergebracht werden. Sowohl die Freizeitbedürfnisse der Eltern sowie der als "geistig behindert" bezeichneten Kinder und Jugendliche sollten dabei berücksichtigt und respektiert werden.
Noch weitergehend zielt die "Partizipative Planung" darauf ab Teilnahme- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Freizeitangeboten zu fördern, um somit eine aktive Mitwirkung der Zielgruppe zu bewerkstelligen. Dies bedeutet Rahmenbedingungen, Erwartungen und Vorstellungen von TeilnehmerInnen in die Planung miteinzubeziehen und auch spezifische Interessen und Sachkompetenz aus der Alltagserfahrung der Zielgruppe zu berücksichtigen. Wichtig hierbei ist es keinen Leistungsdruck zu erzeugen und vom Leistungsgedanken Abstand zu nehmen, da man sonst Gefahr läuft dem Prinzip der Freiwilligkeit zuwider zu handeln (vgl. ebd., 197ff). In der Partizipativen Planung sollten also auch Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sowie deren Eltern in die Überlegungen bezüglich der Umsetzung von Freizeit-und Ferienageboten miteinbezogen werden. Zu diesem Zweck sollten schon in der Planungsphase eines Projektes Menschen aus der Zielgruppe kontaktiert werden, um das Angebot von Anfang an nach den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen auszurichten. Dies verspricht eine gute Ausrichtung des Freizeit-und Ferienangebotes und minimiert Anpassungen, die im Nachhinein vorgenommen werden müssen.
Generell ist zu diesen drei freizeitpädagogischen Methoden anzumerken, dass sie häufig gravierenden Vermittlungs-und Organisationsproblemen unterliegen. Diesbezügliche Strukturen, Methoden und Techniken sind laut Opaschowski noch nicht gut genug entwickelt, um eine reibungslose Anwendung dieser Methoden zu ermöglichen. Es fehlen integrale Organisationsformen und die Vermittlung und Initiierung von Möglichkeiten zur Eigenaktivität von TeilnehmerInnen (vgl. ebd., 198). Für einen ersten Schritt in die richtige Richtung und damit eine bessere Information, Animation und Einbindung von Eltern und deren Kindern mit geistiger Behinderung scheint es notwendig hinderliche organisatorische Strukturen aufzubrechen, um diesbezügliche Barrieren zu beseitigen. Da viele Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung jedoch von größeren Organisationen mit dementsprechenden hierarchischen Strukturen angeboten werden, könnte dies zu einem längeren und beschwerlichen Prozess werden. Erfahrungsgemäß unterliegen größere Organisationen starren Strukturen, die nur schwer äußere Einflüsse zulassen bzw. die Einbindung organisationsfremder Personen, wie z.B. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, erlauben. Dennoch ist es notwendig in diese Richtung weiterzuarbeiten, um auf diesem Weg eine qualitative Verbesserung von Ferien-und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung herbeizuführen.
Schlussendlich ist die Teilnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen mit geistiger Behinderung an einem Freizeitangebot immer noch zu einem Großteil von Engagement der Eltern abhängig. Dies ist auch bei Familien ohne behinderte Kinder festzustellen (vgl. Flieger 2000, 68). Bei Familien mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen wird dieses Phänomen jedoch durch die verstärkt Abhängigkeit verschärft. Ein zukünftiges Ziel für Freizeitangebote wäre es daher, die Teilnahme an Freizeitangeboten nicht mehr von dem Engagement und den Ressourcen der Eltern abhängig zu machen, sondern unterstützende Strukturen bei der Planung von Freizeitaktivitäten sowie der Teilnahme an Freizeitangeboten zu schaffen. Dies hätte sowohl entlastende Funktion für die Familie, als auch positive Auswirkung auf das Kind mit geistiger Behinderung (vgl. ebd. 69). Unterstützung bei der Erreichung des Freizeitangebots (Anfahrt, Rückfahrt) ist ebenfalls als ein Faktor bei der Abkoppelung der Teilnahme vom Engagement der Eltern zu sehen. Mehr zur Erreichbarkeit von Freizeitangeboten gibt es nun im folgenden Unterkapitel zu lesen.
Die Erreichbarkeit von Freizeitangeboten ist in Verbindung mit verschiedenen Faktoren für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung von Relevanz. Wie in Kapitel 3.2.5 schon angeführt, zählt die "Erreichbarkeit" zu den Leitprinzipien der Freizeitdidaktik und kann laut Opaschowski in die Dimensionen räumliche, zeitliche, informatorische, motivationale und aktivitätsbezogene Erreichbarkeit unterteilt werden (vgl. Opaschowski 1996, 205). Für die freizeitpädagogische Arbeit mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen gilt dieses Leitprinzip natürlich auch. Aus diesem Grund wird nun auf die verschiedenen Dimensionen von Erreichbarkeit eingegangen.
Bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung gilt die "räumliche Erreichbarkeit" von Freizeit-und Ferienangeboten als wichtiger Faktor für die Teilnahme. Häufig finden sich diese Kinder und Jugendlichen aufgrund von Einschränkungen in Orientierungsfähigkeit und mangelnder Gefahreneinschätzung nur schwer alleine im Straßenverkehr zurecht. Deshalb ist es für sie sehr schwierig bzw. zeitweise unmöglich Angebote ohne Begleitung oder Unterstützung zu erreichen, wodurch die Abhängigkeit von familiären Ressourcen und Engagement der Eltern wieder verstärkt werden. Die Situation wird dadurch verschärft, dass sich die meisten Anbieter von Freizeitangeboten für Anfahrt zum Angebot und die Rückfahrt nach Hause nicht zuständig fühlen und im allgemeinen keine diesbezügliche Unterstützung zur Verfügung stellen. Deswegen erleichtert eine gute räumliche Erreichbarkeit eines Angebots mit möglichst wenig benötigter Unterstützung geistig behinderten Kindern und Jugendlichen die Teilnahme (vgl. Flieger 2000, 44ff). Sollte diese gute räumliche Erreichbarkeit nicht gegeben sein, ist zumindest auf Seiten das Angebots dafür Sorge zu tragen, dass eine gewisse Unterstützung bei Anfahrt und Rückfahrt zur Verfügung gestellt wird. Dies kann in positiver Weise die elterliche Bereitschaft erhöhen, die Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung an den Angeboten teilhaben zu lassen.
Bezogen auf räumliche Erreichbarkeit von Freizeitangeboten ist laut Markowetz ein eindeutiges Stadt-Land-Gefälle erkennbar. In Ballungszentren ist eine gewisse Auswahl an Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung vorhanden, während in ländlicheren Gegenden oft eine lange Wegzeit gerechnet werden muss, um zu einem Angebot zu gelangen (vgl. Markowetz 2001, 280f). Deshalb ist es notwendig Fahrtendienste und Unterstützungen bei An-und Rückfahrt dort einzurichten und zu finanzieren, wo attraktive Freizeitangebote nicht in leicht erreichbarer Nähe liegen. Dies kann auch teilweise als Aufgabe der Freizeitangebote gesehen werden. Eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystem in Richtung Barrierefreiheit könnte hier ebenfalls Abhilfe schaffen (vgl. Markowetz 2000b, 371).
Bauliche Barrieren stellen ebenfalls oft ein Erschwernis beim Besuch von Freizeitangeboten dar und sind besonders bei mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen aufgrund der körperlichen Behinderung von großer Bedeutung. So werden Freizeitangebote von Eltern häufig nach Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und barrierefreien Ausstattung ausgewählt und nicht nach persönliche Interessen und Vorlieben des Kindes. Der Pool an möglichen Aktivitäten wird dadurch eingeschränkt und Wahlfreiheit und Selbstbestimmung dementsprechend beschnitten. Bauliche Barrierefreiheit begünstigt folglich die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (vgl. Flieger 2000, 54ff) und erweitert das Spektrum an möglichen Freizeitangeboten.
Neben der räumlichen Erreichbarkeit sind auch andere Formen von Erreichbarkeit für die Inanspruchnahme von Freizeitangeboten ausschlaggebend. Diese werden nun kurz geschildert.
Auch in zeitlicher Dimension ist in Form der "zeitlichen Erreichbarkeit" auf die Voraussetzungen und die Bedürfnisse der Zielgruppe "Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung" einzugehen (vgl. Opaschowski 1996, 205). Speziell bei Freizeitangeboten für diese Zielgruppe ist auch auf das Zeitbudget der Eltern zu achten, da diese, wie bereits erwähnt, häufig die Begleitung zum Angebot übernehmen. Somit sollten die Beginn-und Schlusszeiten der Angebote so gewählt sein, dass sie sich gut mit durchschnittlichen Arbeitszeiten vereinbaren lassen.
Bei der "informatorischen Erreichbarkeit" ist hier auf das Kapitel 6.5 zu verwiesen, in dem genauer auf die Kontaktaufnahme zwischen Freizeitangeboten und Eltern teilnehmender Kinder und Jugendlicher eingegangen wurde. Ergänzend zu diesem Kapitel ist hier zu sagen, dass ein hoher Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung die informatorische Erreichbarkeit und somit die Teilnahmemöglichkeiten an einem Angebot erhöht (vgl. ebd.). Deshalb ist im Sinne der informatorischen Erreichbarkeit dafür Sorge zu tragen, dass Freizeitangebote in möglichst breiten Teilen der Bevölkerung publik gemacht werden.
Die "motivationale Erreichbarkeit" nimmt Bezug auf die Interessen und Neigungen der TeilnehmerInnen. Dies bedeutet, dass auf spezielle Interessen und mentale Voraussetzungen einer Zielgruppe eingegangen werden muss (vgl. ebd.). Teilnehmende Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung sollten demnach weder über-noch unterfordert werden und auf teilweise von der gesellschaftlichen Norm abweichende Interessen und Neigungen sollte Rücksicht genommen werden. Da unter dem Etikett "Geistige Behinderung" Benachteiligungen in verschiedensten Bereichen subsummiert werden, sollte eine größere Auswahl an Aktivitäten angeboten werden, um auch eine gute motivationale Erreichbarkeit zu bieten. So bietet sich teilnehmenden Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eine Aktivität zu wählen, die am ehesten ihrem Interesse und ihren Neigungen entspricht.
Letztendlich setzt die "aktivitätsbezogene Erreichbarkeit" einen Minimierung der Anforderungen an die TeilnehmerInnen voraus (vgl. ebd.). Vor allem bei als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen gibt es eine erhebliche Bandbreite an unterschiedlichen Fähigkeiten und Entwicklungsniveaus. Es liegt im Sinne des Freizeitangebots die Anforderungen für die Teilnahme am Angebot so niedrig zu halten, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich daran teilhaben können. Das bedeutet, dass die Voraussetzungen für eine Teilnahme am jeweiligen Angebot so gewählt werden müssen, dass sie von dem Großteil der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung erfüllt werden. Des weiteren müssen die im Angebot durchgeführten Aktivitäten auch so durchgeführt werden, dass durch ein Minimum an Anforderungen Kinder und Jugendliche mit verschiedensten geistigen Behinderungen daran teilhaben können. Dies ist auch für integrative Freizeitangebote von Relevanz, auf diese nun eingegangen wird.
Im Freizeitbereich werden wie in anderen Lebensbereichen Sozialisationseffekte bewirkt und verstärkt, so auch bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In einer negativen Ausrichtung kann dies veranlassen, dass die Ausgrenzung, Isolierung und Privatisierung dieser Personengruppe in der Freizeit noch weiter vergrößert werden. Im positiven Sinn kann jedoch eine gute und wünschenswerte soziale Eingliederung im Freizeitbereich stattfinden (vgl. Ebert 2000, 10). Integrative Angebote, denen eine integrative Pädagogik zugrunde liegt, begünstigen diese soziale Eingliederung.
Der Paradigmenwechsel von einer aussondernden und abschottenden Sonderpädagogik hin zu einer integrativen Pädagogik im Zusammenhang mit behinderten Menschen zieht sich mittlerweile auch in den Bereich der freien Lebenszeit. Im Zentrum dieser integrativen Pädagogik stehen das Individuum in seiner Subjektivität und seine Beziehungen zu anderen Subjekten. Sie erhebt den Anspruch allen Subjekten gleichermaßen zur Verfügung zu stehen und die Subjekte einander näher zu bringen, wodurch neue Sozial-und Umgangsformen hervorgebracht werden. Somit beschäftigt sich die integrative Pädagogik verstärkt mit kommunikativ-sozialen Aspekten der Beziehungen zwischen den InteraktionsteilnehmerInnen. Das Augenmerk liegt also auf den Beziehungen, in denen identitätsrelevante Erfahrungen gemacht werden, und auf der Art und Weise der stattfindenden Kommunikation. Integrative Pädagogik im Handlungsfeld Freizeit bietet somit "ein interaktionistisches, beziehungsförderndes und identitätsstiftendes Konzept zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderung im Lebensbereich Freizeit" (Markowetz 2000a, 62), in dem "behinderte und nichtbehinderte Menschen als gleichberechtigte Interaktionspartner zu Akteuren und Konstrukteuren ihres gemeinsamen Freizeit(er)lebens werden, in Beziehung zueinander treten und miteinander eine solidarische Grammatik des sozialen Umgangs hervorbringen (ebd.).
Dem Konzept der Integration liegt ein integrierendes Menschenbild zugrunde, das sich nach Goll einem distanzierenden Menschenbild gegenüberstellt, in dem Behinderung und Besonderheiten im negativen Sinn im Mittelpunkt stehen und Aussonderung gefördert wird. Beim integrierenden Menschenbild ist im Gegensatz dazu der Mensch und seine Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen von essentieller Bedeutung. Bezogen auf behinderte Menschen steht also das Mensch-Sein im Vordergrund und nicht die Behinderung. Ein integrierendes Menschenbild steigert die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Behinderung und erleichtert es dieser Personengruppe von einer isolierten Rand-bzw. Außenseiterposition in die Gesellschaft hereinzutreten. (vgl. Goll 1993 zit. n. Rosenkranz 1998, 14). Bundschuh, Heimlich und Krawitz definieren Integration in einer ähnlichen aber allgemeiner gehaltenen sozialen Bedeutung als "die Durchsetzung der uneingeschränkten Teilhabe und Teilnahme behinderter Menschen an allen gesellschaftlichen Prozessen" (Bundschuh, u.a. 1999, 144). Somit sollen behinderte Menschen die Chance erhalten grundsätzlich und unabhängig von der Art und dem Schweregrad der Behinderung an allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft teilzuhaben und teilzunehmen (vgl. ebd.). So auch im Bereich der Freizeitangebote.
Integrative Pädagogik betont die Eingebundenheit behinderter Menschen in ihre Umwelt und in die Gesellschaft und sieht somit Menschen mit und ohne Behinderung als ihre Zielgruppe. Ziel dabei ist es Kinder mit Behinderung wie alle anderen Kinder zu akzeptieren und einzubinden. Kindern mit Behinderung wird genauso zugesprochen, Neugier und Lust daran zu haben ihre soziale und materielle Umwelt zu erforschen, Menschen zu begegnen und Dinge auszuprobieren. Integrative Pädagogik bedeutet somit eine akzeptierende Grundhaltung allen Kindern gegenüber gepaart mit einer reflektierenden Grundhaltung dem eigenen Verhalten gegenüber. Grundlegend ist dabei eine allgemeine kindzentrierte Pädagogik, die Kindern ihre Individualität zugesteht und in weiterer Folge individuellen Eigenschaften des Kindes erkennt und akzeptiert (mit und ohne Behinderung). Pädagogik muss in diesem Sinn den Kindern gerecht werden und nicht umgekehrt (vgl. Flieger 2000, 78ff; Bundschuh, u.a. 1999, 146f). Dieser Gedanke der integrativen Pädagogik ist mittlerweile auch in den Bereich der freizeitpädagogischen Angebot eingeflossen und gewinnt dort auch immer mehr an Bedeutung. Um dort Integration von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen bei Freizeitangeboten zu begünstigen, sind gewisse Voraussetzungen zu schaffen.
Integrative Freizeitangebote, die auch Kindern und Jugendlichen mit einer geistige Behinderung die Teilnahme ermöglichen wollen, müssen konkrete Strategien entwickeln und Ressourcen frei machen, um das Angebote auch für diese Personengruppe zugänglich zu machen. Dies kann durch Bereitstellung gezielter und meist zusätzlicher Unterstützung geschehen, die jedoch leider oft mit zusätzlichen Kosten verbunden ist (vgl. Flieger 2000, 61). Diese zusätzliche Kosten stellen Freizeitangebote häufig vor Probleme der Finanzierung, die häufig nur schwer zu überwinden sind. Eine Einbindung von integrativen Freizeitangeboten in größere organisatorische Strukturen könnte in dieser Hinsicht Abhilfe schaffen, da größere Organisationen üblicherweise über größere finanzielle Ressourcen verfügen, die diese zusätzlichen Kosten bis zu einem gewissen Teil decken könnten. Außerdem könnte in größeren Organisationen besser Strukturen geschaffen werden, die Eltern und PädagogInnen dabei unterstützen Kinder und Jugendliche mit Behinderung in allgemeine Angebote miteinzubeziehen (vgl. ebd., 88).
Eine weitere Herangehensweise an diese Problematik ist, die Politik auf den Stellenwert von integrativen Angeboten für die Gesellschaft aufmerksam zu machen und somit einen gewissen Druck auszuüben, damit in der Folge Finanzierungsmöglichkeiten für innovative und integrationsstarke Ansätze und Angebote im Freizeitbereich geschaffen werden. Der Freizeitbereich sollte demnach von der Politik nicht mehr als randständiges Handlungsfeld betrachtet werden und folglich sollte von sozialpolitischer Seite her eine solide Finanzierungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden. Dies kann einerseits durch einen Rechtsanspruch auf finanzielle Förderungen und andererseits durch verlässliche sowie unbürokratische Regelungen für die Inanspruchnahme von finanziellen Mitteln geschehen (vgl. Markowetz 2000b, 368).
Um Kindern und Jugendlichen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich eine befriedigende Teilnahme und integrative Begegnung im Rahmen von Freizeitangeboten zu ermöglichen, ist auf Seiten der PädagogInnen eine akzeptierende Grundhaltung ihnen gegenüber von Nöten. So sollten die FreizeitpädagogInnen im Rahmen der zuvor schon erwähnten kindzentrierten Pädagogik offen für die Bedürfnisse und Kompetenzen aller Kinder und Jugendlichen sein und so auch für diese von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Dadurch wird die Integration dieser Teilnehmergruppe zu einer Selbstverständlichkeit und zu einer positiven Herausforderung. Als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche sollten in erster Linie in ihrem Sosein als gleichberechtigte TeilnehmerInnen akzeptiert werden. Erst in zweiter Linie sollten die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe thematisiert und berücksichtigt werden, die in manchen (und nicht in allen) Situationen zum Vorschein kommen und angemessenes Handeln erfordern. Zeitweise ist es auch notwendig Spielmaterialien bereitzustellen, die den aktuellen Fähigkeiten und Interessen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden, um über diese angepassten Materialien Wege für Kontakte und Kooperation im gemeinsamen Spiel zu ebnen. Ziel dieser Bemühungen sollte es sein allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen weitgehend derselbe Bewegungs-, Zeit-, Spiel- und Entwicklungsraum zu eröffnen (vgl. Flieger 2000, 77ff). Weiters ist es notwendig diese offene Form des Freizeitangebots nach außen zu tragen und sich klar und explizit zur Integration behinderter Kinder zu bekennen. Dies beinhaltet auch in Einladungen, Aussendung und Aushängen ausdrücklich die mögliche und gewünschte Integration behinderter Kinder und Jugendlicher zu erwähnen (vgl. ebd., 88), um möglichen TeilnehmerInnen und deren Eltern eine gewisse Schwellenangst, die sie an der Teilnahme hindern könnte, zu nehmen.
Von Anbieterorganisationen her wird in bezug auf die Thematik "Behinderung" häufig ein Mangel an Ausbildung und viele Unsicherheiten auf Seiten der MitarbeiterInnen beklagt. Deshalb ist diesbezüglich Hilfe und Unterstützung notwendig (vgl. Flieger 2000, 76f). Vertreter von Anbieterorganisationen geben an, zuwenig über Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu wissen, was laut ihren Aussagen an einem gewissen Ausbildungs-und Informationsmangel liegt. Eine Möglichkeit hier Abhilfe zu schaffen besteht darin, diesbezüglich die Eltern teilnehmender Kinder und Jugendlicher mit geistiger Behinderung direkt als Experten in eigener Sache in beratender Funktion miteinzubeziehen. Diese Eltern können in der Regel befriedigende Auskunft über die Behinderung und die Bedürfnisse ihrer Kinder geben und auch hilfreiche Ratschläge und allgemeine Informationen zu Behinderungen bieten (vgl. ebd. 86f). Eine weitere Möglichkeit um diesbezügliche Unsicherheiten und Wissenslücken zu beseitigen besteht darin, zumindest zu Beginn der Teilnahme bedürfnisorientierte Unerstützung zu bieten. Im Idealfall steht diese Unterstützung in Form eines unterstützendes Dienstes sowohl für das Kind oder den Jugendlichen mit Behinderung, als auch für BetreuerInnen und PädagogInnen des Angebots, die noch wenig Erfahrung mit Menschen mit Behinderung haben, zur Verfügung. Sogenannte "IntegrationsbegleiterInnen" (ebd., 90) können diese Funktion übernehmen. In einer kontinuierlichen Begleitung während der Anfangszeit in einem Freizeitangebot können IntegrationsbegleiterInnen sich an den konkreten Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung sowie an den gegebenen Bedingungen orientieren, entsprechend Unterstützung bieten und damit einen guten Einstieg in das Angebot ermöglichen. In diesbezüglichen Pilotprojekten wurde die Arbeit von IntegrationsbegleiterInnen als entlastend und hilfreich empfunden (vgl. Flieger 2000, 90f; Markowetz 1998; Markowetz 2000a).
Werden die angeführten Voraussetzungen weitgehend erfüllt, so eröffnen sich bestimmte Möglichkeiten der Integration im Rahmen von Freizeitangeboten, die nun thematisiert werden.
Durch gemeinsame Aktivitäten und Spiele von geistig behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen entsteht Begegnung, Kommunikation und Dialog, wodurch negative Aspekte wie Ausgrenzung, Isolierung und Privatisierung eingeschränkt werden. Unterstützend wirkt hierbei, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung ebenso gerne ihre Freizeit gestalten wie Kinder und Jugendliche ohne Behinderung. Weiters findet vor allem bei Kindern die Begegnung zwischen behinderten und nicht behinderten Altersgenossen zu großen Teilen spontan und unkompliziert statt und ist von einem gegenseitigem natürlichen Umgang geprägt (vgl. Flieger 2000, 76). Im institutionalisierten Rahmen von Freizeitangeboten können Räume, Gelegenheiten und Anreize geschaffen werden, die Gemeinsames Tun von Kindern mit und ohne Behinderung ermöglichen (vgl. ebd., 82ff). Somit verringern integrative Freizeitangebote die soziale Distanz zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen und ermöglichen diesbezügliche Kontakte, die eine positivere Einstellung Menschen mit Behinderung gegenüber bei der nicht behinderten Bevölkerung bewirken können (vgl. Theunissen 2000b, 103). Bezogen auf das soziale Umfeld kann die Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in wohnortnahe Freizeitangebote dazu führen, dass diese Kinder und Jugendliche sowie ihrer Familien im direkten sozialen Umfeld besser integriert werden, was sich entlastend auf die Familien auswirken kann (vgl. Markowetz 2000a, 97).
Integrative Freizeitangebote schaffen also Räume, Gelegenheiten und Anreize, durch die ein gemeinsames Tun von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen ermöglicht wird. In gemeinsamen Gruppentätigkeiten können durch Dialog und Kooperation Zusammengehörigkeitsgefühle und "Wir-Gefühl" (Flieger 2000, 82) entstehen. Die Behinderung verliert dadurch im Geschehen immer mehr an Bedeutung und der Mensch tritt in den Mittelpunkt (vgl. ebd.,82ff), wodurch eine vollständige Integration in das gesellschaftliche Leben einen Schritt näher rückt. Den Möglichkeit, die sich durch Integration im Rahmen von Freizeitangeboten eröffnen, stehen jedoch einige Problematiken gegenüber, die bei integrativen Freizeitangeboten immer wieder auftreten.
Eine der Hauptproblematiken, die hier angeführt werden müssen, ist, dass integrative Freizeitangebote, an denen Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung teilnehmen können, immer noch eine Ausnahme im mittlerweile beachtlich großen Bereich der Freizeitangebote darstellen. Der Lebensbereich der Freizeit hinkt in Sachen Integration geistig behinderter Menschen den Bereichen Schule und Beruf, in denen in letzter Zeit diesbezüglich große Schritte gemacht wurden, immer noch nach (vgl. Markowetz 2000a, 81). Diese Zielgruppe ist an regulären institutionalisierten Angeboten im Freizeitbereich ausgesprochen wenig beteiligt. Sie werden meistens auf exklusive Angebote für Menschen mit Behinderung verwiesen bzw. sind mangels passender Rahmenbedingungen auf solche Arten von Angeboten angewiesen. Dadurch wird die Partizipationsmöglichkeit dieser Kinder und Jugendlichen im Freizeitbereich erheblich beeinträchtigt und eine Aussonderung in spezielle Angebote vorangetrieben (vgl. Markowetz 2001, 276ff).
Weiters wird Menschen mit geistiger Behinderung auch oft ein passives Freizeitverhalten zugeschrieben, was auch dazu beiträgt, dass diese Personengruppe immer wieder in eigene Angebote ausgesondert wird. Dieses vermeintlich passive Freizeitverhalten ist jedoch als Konsequenz sozialer Isolationsprozesse, die unter anderem auch im Freizeitbereich wurzeln, zu sehen und wird somit durch solche Maßnahmen nur weiter verstärkt (vgl. Ebert 2000, 11). Bei Eltern von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung besteht im Gegensatz zu solchen Tendenzen jedoch durchaus der Wunsch nach Teilnahmemöglichkeiten an integrativen Freizeitangeboten, der mit dem Wunsch nach vermehrten Kontakten und gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit nicht behinderten Kindern und Jugendlichen einhergeht (vgl. Markowetz 2001, 283f).
Problematisch im Zusammenhang mit der Integration von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen in bestehende Freizeitangebote ist weiters die Tatsache, dass integrative Maßnahmen oft von Engagement einzelner Personen abhängen. Interne Vereinsstrukturen zeigen sich hier häufig eher hinderlich für die Integration behinderter NutzerInnen (vgl. Markowetz 2000a, 96). So sind es oft einzelne MitarbeiterInnen oder Eltern, die sich für die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher einsetzen. Im strukturellen, organisatorischen und offiziellen Bereich vieler Organisationen fehlt immer noch ein klares Bekenntnis zu Integration und gleichberechtigter Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen sowie klare allgemeine Richtlinien. Dementsprechende feststehende Regelungen, die die Integration behinderter Kinder forcieren, hätten zur Folge, dass von verschiedenen Anbietern eine langfristige Auseinandersetzung und die Entwicklung von unterstützenden Strukturen, Verhaltensweisen und Ressourcen gefordert würde (vgl. Flieger 2000, 62). Dies würde einen Grundstein für eine positive Weiterentwicklung von integrativen Freizeitangeboten legen.
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sind im Sinne Fliegers als punktuell, kurzfristige Angebote zu sehen, die weiters in allgemeine, integrative und speziell auf Menschen mit Behinderung ausgerichtete Angebote unterteilt werden können. Allgemeine Angebote stellen dabei eine Angebotsform dar, die prinzipiell für alle Zielgruppen offen ist. Bezüglich Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen wird hier jedoch selten speziell auf diese Personengruppe Rücksicht genommen. Bei integrativ ausgerichteten Angeboten ist im Gegensatz dazu eine Teilnahme von geistig behinderten NutzerInnen erwünscht und wird auch dementsprechend gefördert. Hier müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, um eine befriedigende Integration zu ermöglichen. Spezielle Angebote als dritte Angebotsform sind explizit auf die Zielgruppe Menschen mit Behinderung zugeschnitten und erlauben üblicherweise nur in Ausnahmefällen die Teilnahme von NutzerInnen ohne Behinderung. Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich sind über mehrer Angebotsbereiche aufgeteilt. So finden in diesem Rahmen Kurse, Bildungsangebote, kreative Angebote, sportbezogene Angebote und offene Angebote statt. Für Ferienangebote von besonderer Relevanz ist der Bereich der Urlaubsangebote und der Ferienlager (vgl. Bundschuh, u.a. 1999; Ebert 2000; Flieger 2000; Hinz 2000; Markowetz 2000a; Markowetz 2000b; Reincke 2000; Rosenkranz 1998; Theunissen, u.a. 2000).
Von verschiedenen Seiten her werden gewisse Ansprüche an Ferienangebote für geistig behinderte Kinder und Jugendliche gestellt, die sich hauptsächlich auf die pädagogischen Qualifikationen der MitarbeiterInnen beziehen. So sollten in diesem Bereich tätige Personen über allgemeine pädagogische, freizeitpädagogische und integrativpädagogische Qualifikationen verfügen. Auch Kenntnisse aus Nachbardisziplinen der Pädagogik (Psychologie, Soziologie, etc.) werden als positiv gewertet. An bestehende Freizeit-und Ferienangebote für geistig behinderte Menschen werden gewisse Veränderungs-und Verbesserungswünsche gerichtet. So wird ein höheres Maß an Selbstbestimmung bei den Angeboten, eine größere Auswahl an Angeboten, mehr integrative Angebote, eine bessere Erreichbarkeit und geringere Beitragskosten gewünscht (vgl. Cloerkes 2001; Flieger 2000; Opaschowski 1996; Theunissen, u.a. 2000).
In der Gestaltung und Planung von Ferienangeboten für geistig behinderte Kinder und Jugendliche sind gewisse Leitlinien zu beachten. Im Sinne der räumlichen Erreichbarkeit der Angebote ist eine wohnungsnahe, dezentrale Planung angebracht. Gibt es in einem gewissen Umkreis jedoch mehrere adäquate Angebote, so können diese zum Vorteil der TeilnehmerInnen unter einem Dach vereinigt werden. In der Gestaltung von solchen Angeboten sollten verschiedene Interessen und Neigungen der NutzerInnen berücksichtigt werden und Freiräume für Eigeninteressen geschaffen werden. Persönlicher Kontakt zu TeilnehmerInnen und deren Eltern schafft Vertrauen und verbessert dadurch die Nutzerfreundlichkeit des Angebots. Im Sinne der informativen Beratung, kommunikativen Animation und der partizipativen Planung können Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sowie deren Eltern in die Gestaltung und Planung von Ferienangeboten miteinbezogen werden (vgl. Flieger 2000; Opaschowski 1996; Theunissen, u.a. 2000).
Inhaltsverzeichnis
Die Interviews mit Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher stellen den empirischen Teil dieser Diplomarbeit dar. In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung dieser qualitativen Interviews geschildert.
Zur Datenerhebung wurden fünf Familien mit einem oder mehreren als "geistig behindert" bezeichneten Kindern herangezogen. Die Kontaktaufnahme fand über persönliche Verbindungen des Autors dieser Diplomarbeit zu diesen Familien statt. Die Familien stammen aus unterschiedlichen Wohnsituationen (Dorf bis Großstadt) und sind auch von Bildungstand und Einkommensstand her breit gestreut. Die Interviews zur Datenerhebung wurden vom Autor durchgeführt. Alle befragten Eltern gaben bereitwillig viele Informationen zu den gefragten Themengebieten preis und zeigten sich motiviert sowie am Thema interessiert. In der Folge werden nun die Familien und ihre Lebenssituation kurz im Detail geschildert.
Frau N. lebt zusammen mit ihren beiden Söhnen, Peter und Manfred[6], die beide eine ähnliche geistige Behinderung haben, in der näheren Wiener Umgebung. Peter ist 19 und Manfred 17 Jahre alt. Die Behinderung ist von ärztlicher Seite her als unbekanntes Dysmorphiesyndrom, also als "morphologische Fehlbildung" (RSuB[7] 2003, 246), diagnostiziert worden. Peter ist aufgrund der Behinderung in der Feinmotorik leicht beeinträchtigt und hat außerdem einen angeborenen grauen Star, der jedoch mittlerweile operiert worden ist. Manfred hat eine Schallleitungsstörung auf beiden Ohren und trägt aufgrund dessen Hörgeräte. Die Behinderung äußert sich laut der Mutter vor allem dadurch, dass sich Peter und Manfred nicht verbal äußern können. Ihre Kommunikation läuft deshalb zu einem Großteil über Gestik, Mimik, einzelne Laute und Bilder ab. Auf emotionaler und kognitiver Ebene weisen beide zwar Entwicklungsrückstände auf, finden sich aber im Großen und Ganzen gut im Alltag zurecht und treten auch mit anderen Menschen adäquat in Kommunikation und Interaktion. Peter besucht eine Tageswerkstätte und Manfred eine Schwerstbehindertenklasse in einem Sonderpädagogischen Zentrum. Frau N. ist zur Zeit nicht berufstätig und lebt als Alleinerzieherin mit ihren beiden Söhnen in einem gemeinsamen Haushalt. Sie wird im Alltag einerseits von Seiten der Familie (Mutter, Schwiegermutter, Großtante) und andererseits von bezahlten FreizeitassistentInnen unterstützt. Frau N. zeigt sich sehr engagiert für ihre beiden Söhne und ist auch in diversen Elterninitiativen tätig. Unter anderem organisiert sie auch einen regelmäßigen Jugendtreff für Jugendliche mit geistiger Behinderung und setzt sich auch für die Anliegen anderer Eltern geistig behinderter Kinder ein.
Familie S. wohnt in einem kleineren Dorf (ca. 500 bis 1000 Einwohner) etwa eine halbe Autostunde nördlich von Wien. Die Eltern sind verheiratet und leben gemeinsam mit zwei ihrer drei Söhnen in einem Einfamilienhaus mit angeschlossenem Garten. Markus, mit 17 Jahren der jüngste Sohn der Familie, hat eine geistige Behinderung, die sich in autistischen Zügen und einer Entwicklungsverzögerung äußert. Daniel (19 Jahre) wohnt noch im gemeinsamen Haushalt der Familie, meidet aber laut Aussagen der Mutter den Kontakt mit Markus. Der älteste Sohn der Familie (29 Jahre) lebt nicht mehr im Haus und kommt ab und zu bei Gelegenheit zu Besuch. Herr S. arbeitet in der Bauwirtschaft und ist öfters längere Zeit auf Montage. Frau S. ist Hausfrau und geht nur gelegentlich kleineren Beschäftigungen nach. Markus besucht eine Sonderschule in Wien. Er fährt jeden Tag mit der Mutter in die Stadt und wieder zurück. Seine Mutter ist die Hauptbezugsperson für Markus. Die meisten Aktivitäten in seiner Freizeit unternimmt er auch gemeinsam mit ihr. Markus ist mit seiner Familie oft in der Natur und scheint dies laut Aussagen der Eltern auch zu genießen. Er zeigt eine besondere Vorliebe für Haare und Pflanzen, die sein Verhalten sowie seine verbalen Äußerungen prägt. Frau S. zeichnet im Interview ein positives Bild ihres Sohnes Markus und scheint ihn sowie seine Behinderung zu akzeptieren.
Familie O. wohnt im Wiener Stadtrandgebiet (22. Bezirk) in einem Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus ist in eine kleine Siedlung eingebunden, die laut Aussage von Frau O. eher einen Dorfcharakter aufweist, obwohl sie noch zum Wiener Stadtgebiet gehört. Bei der zwölfjährigen Daniela, die die zweitjüngste von vier Töchtern der Familie ist, wurde eine geistige Behinderung festgestellt. Die Mutter konnte jedoch keine genaue Diagnose nennen bzw. gab an, dass es keine genaue Diagnose gäbe. Die Eltern sind verheiratet und wohnen, wie Danielas Schwestern (10, 15 und 17 Jahre alt), im gemeinsamen Haushalt. Die Familie besitzt eine Landwirtschaft für die hauptsächlich der Vater zuständig ist. Die Mutter übernimmt in dem Zusammenhang nur gelegentlich anstehende Arbeiten und widmet sich zu großen Teilen der Familie. Daniela besucht in der Regel Vormittags eine Sonderschule in Wien. Die Nachmittage verbringt sie meistens zu Hause bzw. geht von Zeit zu Zeit zu ihrer Großmutter, die nicht weit vom Haus der Familie O. entfernt wohnt. Danielas Behinderung äußert sich großteils durch eine Entwicklungsverzögerung in vielen Bereichen und eine Muskelschwäche. Es fehlen ihr auch gewisse sprachliche Fähigkeiten, innerhalb der Familie kann sich Daniela laut Aussage der Mutter jedoch bestens verständlich machen. Daniela hat in der Feinmotorik gewisse Probleme, ist aber im Gegensatz dazu in der Grobmotorik relativ gut entwickelt (Schaukeln, Radfahren mit Stützrädern, Trampolinspringen, Schwimmen ist möglich). Daniele hat auch Grundkenntnisse in Rechnen und Schreiben. Frau O. ist Daniela und ihrer Behinderung gegenüber positiv eingestellt und akzeptiert sie zu großen Teilen in ihrem Sosein als Mensch.
Familie T. wohnt im dreizehnten Wiener Gemeindebezirk in einem Einfamilienhaus. Die Mutter der Familie bezeichnet ihren Sohn Michael als mehrfachbehindert. Sie sieht also bei ihrem Sohn neben der geistigen Behinderung noch eine motorische Einschränkung. Michael kann sich aber dennoch eigenständig gehend fortbewegen. Michael hat eine ältere Schwester und zwei jüngere Geschwister, die laut Aussage der Mutter eine fördernde und positive Wirkung auf Michael haben. Neben der Motorik ist auch Michaels Wahrnehmungsvermögen eingeschränkt. Dadurch und durch autistische Züge bedingt äußert sich Michael nicht verbal und tritt auch sonst eher selten von sich aus in Interaktion und Kontakt mit anderen Menschen.
Frau T. beschreibt Michael als einen freundlichen, frohen und offenen Menschen, sieht aber wiederum Probleme in der Grenzenlosigkeit ihres Sohnes. Frau T. arbeitet zeitweise in der Firma des Familienvaters. Sie kann sich ihre Arbeitszeiten dort vorwiegend flexibel einteilen und somit auch nach den Bedürfnissen der Familie ausrichten. Die familiäre Betreuung und Erziehung von Michael unterliegt hauptsächlich der Mutter. Die Geschwister werden von der Mutter vorsätzlich nicht mit solchen Aufgaben betraut, um das Geschwisterverhältnis nicht zu belasten. Vom familiären Umfeld bekommt Familie T. dahingehend Unterstützung, indem Verwandte finanziell unter die Arme greifen. Der Schwager von Frau T. unternimmt auch von Zeit zu Zeit Freizeitaktivitäten mit Michael. Michael ist unterm Jahr in einem Halbinternat untergebracht (8:00-17:00) und ist auch zeitweise (z.B. manche Wochenenden) zu Vollzeit dort beherbergt. Die Schulferien verbringt er bei der Familie und nimmt zu dieser Zeit üblicherweise auch drei Wochen an Ferienangeboten teil.
Familie C. besteht aus den verheirateten Eltern und aus Robert, der als Einzelkind aufwächst. Bei Robert wurde knapp nach der Geburt eine geistige Behinderung diagnostiziert, die sich durch autistische Verhaltensweisen und damit Einschränkungen in der Fähigkeit Wahrnehmungen zu differenzieren, zu verarbeiten und einzuordnen äußert. Robert kann sich zeitweise nonverbal verständlich machen und ist laut Aussagen der Eltern im Alltag auf viel Hilfe und Unterstützung angewiesen. Robert ist durch einen Spitzfuß auch in seinen motorischen Fähigkeiten eingeschränkt, kann jedoch diese Gehbehinderung gut kompensieren. So ist es ihm auf seine Art und Weise gut möglich zu gehen, Stiegen zu steigen und sogar zu laufen. Familie C. lebt in einer Wohnung im vierten Wiener Gemeindebezirk (dicht bebautes Gebiet), die sich im dritten Stock eines Wohnhauses befindet. Beide Eltern sind berufstätig, wobei die Mutter Teilzeit und der Vater Vollzeit beschäftigt ist. Unter dem Jahr besucht Robert eine Schule. Die Sommermonate verbringt er in verschiedenen Ferienaktionen bzw. fährt auch mit der Familie auf Urlaub. Herr und Frau C. zeigen sich sehr engagiert für ihren Sohn und versuchen Robert viele verschiedene Arten von Aktivitäten und Förderungen zu ermöglichen. Die Freizeit gestaltet Robert vorwiegend mit seinen Eltern. Zu bevorzugten Freizeitaktivitäten zählen längere Wanderungen in der Natur, die Robert meist mit seinem Vater unternimmt. Neben der Freizeitgestaltung mit den Eltern und konkreten Freizeitangeboten wird Robert in der Freizeit auch zeitweise von bezahlten FreizeitassistentInnen unterstützt, die verschiedene Aktivitäten mit ihm unternehmen, jedoch meist laut Aussage der Eltern mit Robert innerhalb der Wohnung bleiben.
Nach der Beschreibung der herangezogenen Fälle wird nun näher auf die Datenerhebung in Form von qualitativen Interviews eingegangen. Die Eltern wurden dazu nach den Kriterien qualitativer Sozialforschung interviewt. Diese Form der Datenerhebung wird nun genauer behandelt.
Der gängigste Ansatz qualitativer Sozialforschung ist, wie schon in der Einleitung angeführt, das qualitative Interview, das einen zentralen Stellenwert im empirischen Teil dieser Diplomarbeit einnimmt. Ein Interview gilt dabei als "ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlaßt werden soll" (Scheuch 1967 zit. n. Lamnek 2005, 330). Qualitative Interviews gehen subjektiven Bedeutungen und individuellen Sinnzuschreibungen nach und streben demnach weniger nach messbaren Größen und Zahlenwerten, wie es in der quantitativen Forschung üblich ist (vgl. Flick, u.a. 2000, 18f; Lamnek 2005, 329f).
Die Forschungsarbeit im Rahmen dieser Diplomarbeit stützt sich auf die Form des informatorischen Interviews, das seinen Fokus in der deskriptiven Erfassung von Tatsachen aus dem Wissen der Befragten hat. Der Befragte wird dabei als Experte angesehen und sein Wissen als Fachwissen betrachtet. Er ist somit Informationslieferant für Sachverhalte, die im Interesse des Forschers liegen (vgl. Lamnek 2005, 329f). In dieser Diplomarbeit werden Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher im Sinne des "Empowerments" (Stark 1996, Herriger 2002) als "Experten in eigener Sache" gesehen. Deshalb scheint die Methode des informatorischen Interviews als angebracht für die Ermittlung grundlegender Informationen zur Fragestellung dieser Arbeit. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden qualitative, informatorische Interviews in Form von episodischen Interviews durchgeführt. Auf diese Interviewform wird nun genauer eingegangen.
Die Methode des episodischen Interviews schien eine für die Fragestellung dieser Arbeit sinnvolle Herangehensweise zu sein, da in dieser Interviewform Gesprächspartner die Möglichkeit erhalten, frei zur Thematik Stellung zu nehmen und somit neue Aspekte, die bis dahin nicht berücksichtigt wurden, hervortreten können. Weiters kann aber auch durch den Leitfaden des episodischen Interviews in die Erzählung eingegriffen werden, um einerseits zu große Themenabweichungen zu verhindern, oder um andererseits noch nicht angesprochene, aber relevante Punkte in den Mittelpunkt des Gesprächs zu rücken.
Das episodische Interview wurde von Flick auf dem Modell des narrativen Interviews von Schütze aufgebaut. Bei dieser Vorgangsweise wird versucht die Vorteile des narrativen Interviews mit den Vorteilen von leitfadenorientierten Interviews zu verbinden. So wird versucht einerseits Erinnerungen an konkrete Begebenheiten sowie andererseits daraus abgeleitetes Wissen (Generalisierungen, Abstraktionen, etc.) beim Befragten zu mobilisieren. Dadurch wird neben der Ermittlung von Fakten auch das semantische Wissen bzw. Gedächtnis des Interviewpartners angesprochen (vgl. Flick 1996, 147ff). Um diese beiden Formen des Wissens anzusprechen werden im episodischen Interview neben der erstrebten Erzählung auch zielgerichtete Fragen gestellt und beantwortet. Somit soll durch eine Kombination von Erzählungen mit Argumentationen beiden Formen des Wissens eine Plattform gegeben werden. Es wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, Erfahrungen einerseits in allgemeiner und vergleichender Form und andererseits in bezug zu subjektiven Relevanzsetzungen widerzugeben. Zu diesem Zweck liegt dem Interview ein Leitfaden zugrunde, der alle anzusprechenden Themen beinhaltet und dem Interviewer dadurch die Möglichkeit gibt im richtigen Moment Erzählungen zu stimulieren bzw. nachzufragen (vgl. Lamnek 2005, 362f; Flick 1995, 124f; Flick 1996, 151).
Zur Durchführung der Interviews nahm wurde Kontakt mit Eltern aufgenommen, die als Fallbeispiele relevant für die Fragestellung schienen. Der Kontakt zu Eltern wurde über ein Ferienangebot einer Wiener Organisation und private Verbindungen der Autors hergestellt. Die Gespräche fanden ausschließlich in den Wohnungen der Familien, also in für die Eltern vertrauter Umgebung, statt. Die Interviews orientierten sich an einem zuvor entworfenen Leitfaden. Nach Möglichkeit wurde versucht die Interviewdauer auf eine halbe Stunde zu beschränken, um eine zu große Ausuferungen und Themenabweichungen zu verhindern. Fragen aus dem Leitfaden, die schon im Rahmen einer anderen Frage angemessen beantwortet wurden, wurden aus Gründen der Gesprächskontinuität und aus Zeitgründen nicht noch einmal explizit gestellt. Die auf diese Weise durchgeführten Gespräche wurden auf Tonband aufgenommen, transkribiert und, wie folglich beschrieben, ausgewertet.
Die Auswertung der aus den Interview erhaltenen Daten geschah in vier Phasen: der Transkription der Gespräche, der Einzelanalyse der jeweiligen Interviews, der generalisierenden Analyse und der abschließenden Kontrollphase (vgl. Lamnek 2005, 402ff). Auf die verschiedenen Phasen der Datenauswertung wird nun genauer eingegangen.
Die auf Tonband aufgenommenen Gespräche wurden im Zuge der Datenauswertung zu Texten transkribiert. Da verschiedene Formen der Verschriftlichung möglich sind, werden nun in der Folge die für die Transkripte dieser Diplomarbeit geltenden Regeln offen gelegt und erläutert. Die Verschriftlichung der Interviews erfolgte in Standardorthographie, das heißt die Transkripte orientieren sich an den Normen geschriebener Sprache. Dies sorgt für ein besseres Verständnis der verschiedenen Textpassagen. Da die Darstellung in mundartlicher Sprache in Form von literarischer oder phonetischer Umschrift für die Fragestellung dieser Diplomarbeit und die dementsprechende Auswertung wenig Relevanz zu haben scheint, wird von diesen Methoden der Transkription Abstand genommen. Die Verschriftlichung prosodischer Merkmale der Sprache wurde, wie folgt, vorgenommen: Sprechpausen wurden mit «...» und gehobene Lautstärke mit einem Rufzeichen gekennzeichnet. Betonungen wurden kursiv gedruckt. Parasprachliche Merkmale wie Lachen oder Seufzen wurden zwischen doppelte Klammern gesetzt. Falls ein Satz unterbrochen wurde, so wurde dies mit drei Punkten am Ende des Satzes dargestellt (vgl. Kowal, O'Connell 2000, 437ff; Knoblauch 2003, 159f; Lamnek 2005, 403). Die Transkripte der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Interviews befinden sich in voller Länge im Anhang.
Im Anschluss an die Transkription wurden die einzelnen Interviews noch ohne gegenseitige Vergleiche einer Einzelanalyse unterzogen. Zu diesem Zweck wurde vorerst eine Kurzdarstellung des jeweiligen Falles formuliert. Anschließend wurden für die Fragestellung relevante Passagen aus den Gesprächen hervorgehoben und mit Hilfe der Methode des "Theoretischen Kodierens" ausgewertet, um als Ergebnis eine jeweilige Charakteristik des Falles bzw. des Interviews zu erhalten (vgl. Lamnek 2005, 403f).
Die Einzelauswertungen der Interviews erfolgten im Rahmen des "Theoretischen Kodierens" in drei Arbeitsschritten, die sich in der Verarbeitung teilweise überschnitten. Die drei durchgeführten Arbeitsphasen waren das "Offene Kodieren", das "Axiale Kodieren" und das "Selektive Kodieren" des vorhandenen Datenmaterials (vgl. Flick 1995, 197ff; Böhm 2000, 477ff). Die Methode des theoretischen Kodierens baut auf dem Modell der "Grounded Theory" (vgl. Böhm, 476f; Corbin 2003, 70ff) auf. Diese von Anselm Strauss und Barney Glaser geschaffene Theorie kann als eine gegenstandsbegründete und verankerte Theorie bezeichnet werden, die es erlaubt "auf der Basis empirischer Forschung in einem bestimmten Gegenstandsbereich, eine dafür geltende Theorie zu formulieren, die aus vernetzten Konzepten besteht und geeignet ist, eine Beschreibung und Erklärung der untersuchten sozialen Phänomene zu liefern." (Böhm 2000, 476). Das Modell der Grounded Theory ist durch das besondere Augenmerk auf Unterschiede und Ähnlichkeiten hin gut dafür geeignet die Relevanz verschiedener Variablen bezogen auf die Fragestellung zu eruieren und zu ermitteln. Außerdem kann auf diese Weise gut herausgearbeitet werden in welchem Bezug sie zu untersuchten Phänomenen stehen. In den meisten Ergebnissen geht dieses Modell über die Eindimensionalität hinaus und bietet dadurch einen umfassenderen und ganzheitlichen Blick auf untersuchte Phänomene. Ziel des Modells der Grounded Theory ist es eine empiriebasierte Theorie zu bilden (vgl. Corbin 2003, 70ff). Aus Gründen des in diesem Modell besonders berücksichtigten Prinzips der Ganzheitlichkeit und aus der Tatsache heraus, dass die Methode des theoretischen Kodierens als eines der Standardauswertungsverfahren für episodische Interviews gilt, wurden die in den Eltern-Gesprächen gewonnen Daten auf diese Weise analysiert und bearbeitet.
Im ersten Schritt der Auswertung, dem "Offenen Kodieren", wurden bestimmten Absätzen, Sätzen und Phrasen des transkribierten Interviews Begriffe im Sinne von Kodes zugeordnet. Die Kodes stellten die wesentlichen Grundaussagen des kodierten Abschnittes des Textes dar und wurden nach Möglichkeit in den Worten des Interviewpartners gefasst. Auf diese Weise wurde der gesamte Interviewtext systematisch durchgearbeitet und mit Kodes versehen. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden Kategorien formuliert, denen die verschiedenen Kodes untergeordnet wurden. Diesen Kategorien wurden wiederum übergeordnete Kategorien zugeordnet. Diese Prozedur wurde solange durchgeführt bis sich eine Hierarchie bzw. Struktur der Kategorien ergab, die eine zielführende Strukturierung der Daten ermöglichte. Ziel dieser Phase des offenen Kodierens war es, das Gesagte aufzubrechen und in eine Ordnung zu bringen, um so ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
In der anschließenden Phase des "Axialen Kodierens" wurden die aus dem offenen Kodieren gewonnenen Kategorien untereinander in Beziehung gesetzt. Dabei wurden Konsequenzen, Kontexte und ursächliche Bedingungen zwischen Kategorien und untergeordneten Kategorien, sowie zwischen den übergeordneten Kategorien untereinander herausgearbeitet. Diese Beziehungen wurden anhand des Ursprungstextes überprüft und mit Aussagen unterlegt, um ungesichertes Abweichen vom Ursprungsmaterial zu verhindern.
In der abschließenden Phase des "Selektiven Kodierens" wurde ein Phänomen als Kernkategorie hervorgehoben, das in Verbindung mit der Fragestellung besonders relevant schien. Bezogen auf die Fragestellung dieser Diplomarbeit war dies die Kategorie "Freizeit- und Ferienangebote". Die im axialen Kodieren ermittelten Beziehungen wurden dann in weiterer Folge in einer netzwerkartigen Form zusammengefügt, in dessen Mittelpunkt die Kernkategorie "Freizeit-und Ferienangebote" stand. Auf einem höheren Abstraktionsniveau, wie zuvor bei den beiden anderen Kodierungsphasen, wurden Beziehungsstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der Kernkategorie gesetzt und somit das Erkennen von Zusammenhängen erleichtert. Die Ergebnisse des selektiven Kodierens wurden letztendlich am Originaltext rückgeprüft und nahmen auch in einer neuerlichen Überarbeitung wieder auf die Ergebnisse der anderen beiden Beabreitungsphasen Einfluss.
Die Ergebnisse des theoretischen Kodierens wurden im weiterführenden Schritt der "Generalisierenden Analyse" mit Ergebnissen aus anderen Einzelanalysen verglichen wurden, um allgemeine Tendenzen zu erkennen bzw. allgemeinere Theorien formulieren zu können.
In der "Generalisierenden Analyse" als weiteren Arbeitsschritt wurden über die einzelnen Interview hinausgehend die Ergebnisse aus den verschiedenen Befragungen mit einander verglichen. Dabei wurden Gemeinsamkeiten und ähnliche Aussagen herausgearbeitet und zusammengefügt, um somit schon erste generalisierenden Erkenntnisse herausarbeiten zu können. Dem gegenüber wurden auch Unterschiede zwischen den Interviews hervorgehoben, um unrechtmäßige Generalisierungen zu vermeiden. In Anbetracht der Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden dann mögliche Grundtendenzen herausgearbeitet, die möglicherweise typisch für die Zielgruppe "Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher" sein könnten. Unterschiedliche oder gegensätzliche Aussagen wurden in der Auswertung dennoch berücksichtigt und im Kontext der jeweiligen Einzelfälle bearbeitet und interpretiert (vgl. Lamnek 2005, 404). Die Ergebnisse der generalisierenden Analyse wurden in einer abschließenden Kontrollphase mit dementsprechenden Passagen aus dem Originaltext (Transkription) verglichen und belegt, um diesbezügliche Abweichung zu verhindern. Schließlich fand eine Gesamtinterpretation und Verallgemeinerung der gewonnen Daten statt. Dieser Arbeitsschritt wird nun beschrieben.
In der abschließenden Gesamtinterpretation der gesammelten Daten wurden Muster und Erklärungen herausgehoben, die auch auf andere Fälle verallgemeinerbar sind. Die detaillierten Einzelfallbeschreibungen, die durch die Interviews mit den Eltern der an der Studie beteiligten Familien entstanden, wurden als Ausgangspunkt genommen, um allgemeingültige, intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen zu treffen. Im Sinne einer "Explorativen Untersuchung" (Bortz 2003, 360) wurde dabei auf das Generieren von wissenschaftlich prüfbaren Hypothesen und Theorien abgezielt. Durch das detailreiche qualitative Datenmaterial wurde auch die Möglichkeit eröffnet, neue bisher im wissenschaftlichen Kontext noch nicht berücksichtigte Aspekte bezüglich des Untersuchungsgegenstandes aufzudecken. In der Interpretation wurde besonderes Augenmerk darauf gerichtet, welche Erklärungen die InterviewpartnerInnen für bestimmte Phänomene angaben, um somit diverse Ursachen aufzudecken. Es wurde ebenfalls beachtet, wo und inwiefern betroffene Eltern selbst aktiv wurden, um Veränderungen herbeizuführen. Dies kann wertvolle Information über die Entstehung und Beseitigung von Problematiken geben. Schließlich wurden in die Gesamtinterpretation auch die in der generalisierenden Analyse gewonnenen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Einzelfällen miteinbezogen (vgl. ebd. 2003, 335ff).
Im Zuge der Interpretation wurden die Ergebnisse der eigenen Forschungsarbeit auch mit Ergebnissen anderer Untersuchungen zu ähnlichen Themen verglichen. Dies diente dazu die Ergebnisse aus den eigenen Interpretationen mit Ergebnissen aus anderen Forschungsprojekten zu untermauern bzw. abweichende Schlüsse aufzudecken. Somit werden in diesem Vorgehen zum einen "die Empirischen Ergebnisse innerhalb der Untersuchung interpretiert. Zum anderen werden Ergebnisse und Folgerungen aus der Untersuchung mit bestehenden Theorien oder anderen Forschungsergebnissen verglichen und verknüpft" (Atteslander 2003, 355). Der Prozess der Interpretation ist hierbei im Sinne Budes als Kunst zu sehen, die darin besteht mit Mehrdeutigkeiten umgehen, Begrenztheit erfassen und Getrenntes mischen zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Interpretation immer von einem Subjekt durchgeführt wird und somit unweigerlich mit diesem verbunden ist. Es ist der Interpret, der Entscheidungen trifft und die Stellen selektiert, die herausgegriffen und interpretiert werden. Dennoch ist im Sinne der Wissenschaftlichkeit vom Interpreten zu verlangen seine Affekte zu zügeln und im Hintergrund zu lassen, um somit unvoreingenommen Strukturen im zugrundeliegenden Material erkennen zu können. Im Zuge der Forschung durchgeführte Interpretationen zielen auf die Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse ab. Diese Generalisierung peilt in der qualitativen Sozialforschung eine schlüssige Rekonstruktion der Verlaufsdynamik sozialer Phänomene an. Die Ergebnisse des Prozesses der Interpretation in der qualitativen Forschung sind jedoch nicht als generelle Theorien mit universeller Gültigkeit zu sehen, sondern als kontextualische Erklärungen von befristeter Gültigkeit (vgl. Bude 2000, 569ff). Im Rahmen dieser Diplomarbeit finden die Ergebnisse der zur Fragestellung durchgeführten Forschungsarbeiten und Interpretationen in den nächsten beiden Kapiteln Platz. In Kapitel 8 werden dazu vorerst nur die Ergebnisse der Auswertung der Interviews dargebracht. Im darauf folgenden Resümee werden diese Ergebnisse der Auswertung dann noch weitergehend interpretiert und mit Ergebnissen aus anderen Untersuchungen und weiteren wissenschaftlichen Aussagen verglichen.
Inhaltsverzeichnis
-
8.1 Freizeitgestaltung
- 8.1.1 Elterliche Auffassungen von "Freizeit" bzw. "Freizeitgestaltung"
- 8.1.2 Die Freizeitsituation in der Familie
- 8.1.3 Freizeitgestaltung in der Familie
- 8.1.4 Freizeitgestaltung außerhalb der Familie
- 8.1.5 Feriengestaltung
- 8.1.6 Freizeitaktivitäten
- 8.1.7 Freizeit in Verbindung mit Therapien, Förderungen und Rehabilitationsmaßnahmen
- 8.2 Integration im Freizeitbereich
- 8.3 Ferienangebote
Im folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse der Auswertung der Elterninterviews dargestellt und mit Zitaten aus den Interviews unterlegt. Die Ergebnisse teilen sich in die drei großen Gruppen "Freizeitgestaltung", "Integration im Freizeitbereich" und "Ferienangebote" auf. Diese Gruppen stellen die von den Eltern in den Interviews hervorgehobenen Themengebiete dar und werden nun detailliert geschildert.
Die InterviewpartnerInnen wurden vorerst allgemein zur Freizeitgestaltung und -situation der Familie befragt. Im Speziellen wurde in den Gesprächen dann auf die Freizeitbeschäftigungen der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung eingegangen. Dabei wurden auch diverse außerfamiliäre Freizeitaktivitäten berücksichtigt. Weiters wurde im Hinblick auf die Fragestellung dieser Diplomarbeit auch besonderes Augemerk auf die Gestaltung der Schulferien gelegt. Als eine Thematik, die ursprünglich nicht im Interviewleitfaden explizit angeführt war, aber von vielen Eltern angesprochen wurde, trat die Thematik der Therapien und Förderungen in Verbindung mit Freizeit zu Tage.
Die Eltern wurden im Rahmen der Interviews zu ihrer Auffassung von "Freizeit" und "Freizeitgestaltung" im allgemeinen und in Verbindung mit ihrem als "geistig behindert" bezeichneten Kind im besonderen befragt. Dies wurde deshalb eruiert, da diese Auffassung legt den Grundstein dafür legt, wie in der Freizeitgestaltung agiert wird:
Frau N.: "Freizeit ist für mich etwas zu tun, was nicht unter Zwang fällt und was ich nicht unbedingt tun muss. [...] Für mich ist es irgendwo sich frei zu bewegen. Was Spaß macht [...]"
Herr C.: "Ja, er genießt das schon, jetzt auch Zeiten in der Woche zu haben, wo nicht der schulische Druck klarerweise da ist, wo er sich total daheim gehen lasst oder draußen seine überschüssigen Kräfte abarbeitet, seine Runden dreht."
Frau S.: "Freie Zeiteinteilung. Was nicht eingeteilt ist. Was tun wir? Ich versuch, und das hab ich immer mit ihnen versucht, erst zu zweit mit den zwei Buben, möglichst viele Sachen anschauen, entdecken, hingehen, damit er seine... seine Möglichkeiten, dass ich sag, tut er das oder das, dass das größer wird. Das kann ich ja nur indem ich dorthin gehe und ihm das einmal zeige. Sonst weiß er ja gar nicht, dass es das gibt."
Freizeit wird hier als der Teil der Lebenszeit angesehen, der frei von Zwang und Druck ist und der dadurch von der jeweiligen Person selbst gestaltet werden kann. Freizeit wird außerdem mit Spaß und Genuss verbunden, wird also von allen befragten Eltern als eine Zeitqualität gesehen, die zur Befriedigung von lustbetonten Bedürfnissen da ist. Darüber hinaus wird Freizeit als eine Zeit wahrgenommen in der überschüssige Kräfte abgebaut, in der neue Eindrücke gemacht und in der die eigenen Möglichkeiten erweitert werden können. In diesem Zusammenhang ist ein gewisses Maß an Selbstbestimmung in der Freizeitgestaltung notwendig, die es den Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung gestattet, ihre Kompetenzen und Möglichkeiten zu erweitern. Dies wurde auch von einigen Eltern explizit angesprochen:
Frau N.: "[...] frag sie dann natürlich, oder auch die Assistenten fragen sie dann: was möchtest du machen? Das geht dann mit Bildern, mit... mit Gestik können sie das sehr wohl. Das ist mir auch wichtig, dass sie selber das ausdrücken können. Nicht über mich immer als Sprachrohr, sondern dass sie das sehr wohl selber machen können."
Herr C.: "Beim Wandern ist er, auch wenn wir auf gleicher Höhe sind, so vom Gefühl, wir führen ihn nicht, sondern er führt, weil ich immer wollt, dass er selbst gelenkt ist, nach seinen Möglichkeiten halt. Und es ist auch immer sein Ausflug, wenn wir gemeinsam weggehen, wo ma eigentlich nie... Es ist kein Thema, es ist sein Ausflug [...]"
Diese Selbstbestimmung kann jedoch oft durch nicht mehr tolerierbare Gefahren oder durch Schwierigkeiten in der Ausdrucksfähigkeit und der Kommunikation eingeschränkt sein:
Herr C.: "Ja, weil er mit seiner Behinderung nicht sagen kann, dass er zu dem und dem und dem fahren will. Wir haben diese Dinge eher in Richtung »welchen Ausflug möchtest du machen?«. Da hamma so eine Mappe mit Fotos und da hamma ihn vorm Ausflug gefragt bis vor einem Jahr, aber dann hamma aufgehört. Das bringt nichts. Wir haben vier, fünf Jahre lang die vorgelegt und gefragt »willst du den, den oder den?«, also drei maximal damit ma ihn nicht überfordert und dass er dann einen nimmt und er weiß dann wo. Ich mein, da hamma eh vorgefühlt, wir wollen ungefähr in die Richtung. Aber das ist's auch nicht wirklich gewesen. Wir haben uns da wirklich sehr bemüht, nachdem der Markus die Fotos aber ganz anders sehen wird, die Fotos aus seiner Sicht zu machen. Also wie schaut's dort auf dem Kahlenbergausflug aus? Aus seiner Sicht, wenn man aus dem Auto aussteigt. Das ist auf keinem Foto drauf, weil er sieht's ja selber auch nicht sonst. Das ist auch wieder so diffus gewesen. [...] Ja, zum Teil wirklich, wie wenn's ihm wurscht wäre. Manchmal kommt's mir so vor wie »es wird schon passen, wenn's die Eltern machen«, obwohl er schon einen eigenen Willen hat, weil ein Sturschädel ist er. Das hat er aber auch von den Eltern. Das hat nichts mit seiner Behinderung zu tun. ((lacht)) [...] wo man Grenzen vorgibt, wo sie Spaß haben, aber es doch auch »Neins« gibt. [...] Ja, wenn Gefahr im Verzug ist auf jeden Fall und wenn halt irgendwas extrem im Übermaß ist und sei's denn, dass er irgendwo eine Stunde wackelt, das ist dann auch irgendwo aus."
Letztendlich wurde vor allem von einer Interviewpartnerin betont, dass Freizeitgestaltung bei als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen teilweise vom Charakter abhängig sei und teilweise von den Eltern vorgelebt wird. Die Behinderung als bestimmender Faktor bei der Freizeitgestaltung tritt hier also in den Hindergrund. Somit wird von dieser Mutter der Unterschied zur Freizeitgestaltung von nicht behinderten Kindern und Jugendlichen als nicht so groß angesehen:
Frau N.: "Ja, jetzt sind sie natürlich in der Pubertät, wie es jetzt ist, wie bei anderen Jugendlichen, gerne vor dem Fernseher, gerne Musik hören, gerne Computer spielen «...» hauptsächlich eigentlich, muss ich sagen, wobei natürlich die Interessen auch verschieden sind. Peter ist gerne zu Hause - der tut sich nicht viel bewegen, außer Fußballplatz gehen, aber sonst nichts ((lacht)) und der Manfred ist eher der, der gerne unterwegs ist, einfach viel erlebt, was ich dann verbinde eben mit Bewegung. Das ist für mich wichtig, aber das ist... ich glaube das ist Charaktersache einfach. Das ist nicht nur vorgelebt, weil ich bewege mich auch gerne und ich bin auch gerne in der frischen Luft und das haben nicht beide in sich. Also ich denke mir, das ist... teilweise ist Freizeit vorgelebt von den Eltern und teilweise ist es aber auch was jeder für einen Charakter... also charakterlich ist."
Neben der Auffassung der Eltern von "Freizeit" und "Freizeitgestaltung" ist auch die generelle Freizeitsituation der Familie für die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung ausschlaggebend. Deswegen soll nun die Freizeitsituation der fünf in dieser Studie herangezogenen Fälle genauer beleuchtet werden.
Eine Interviewpartnerin führte an, dass für sie Freizeit und Alltag nicht genau trennbar sind und deshalb eine genaue Abgrenzung der Zeitqualität Freizeit schwer fällt:
Frau T.: "Nachdem bei uns so Alltag und Freizeit in einander überfliesen mit den Kindern [...] heut war's so: zu Mittag waren alle zu Hause und jetzt sind sie teilweise wieder gegangen und dann kommen sie dazwischen wieder. Es sind so kurze Phasen immer. Also ich hab nicht, nachdem sich mein Alltag mehr so auf die Kinder konzentriert, hab ich jetzt nicht bis um vier Dienst und dann Freizeit, weil dazwischen machst noch schnell Haushalt und dann sollt ma eigentlich noch ein Buch vorlesen und dann..."
Der Alltag im Haushalt und die tägliche Freizeit fließen für diese Mutter ineinander. Es gibt keine genaue Trennlinie zwischen Alltagstätigkeiten und Freizeit, weder durch fixe Zeitpunkte, noch durch bestimmte Tätigkeiten. Von einer anderen Mutter wird diese tägliche Alltagsroutine dahingehend kritisiert, dass sich eine zu regelmäßige Tagesplanung hinderlich auf eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung auswirkt:
Frau O.: "Also das ist jetzt bei uns schon... sind gewisse Dinge schon sehr sehr eingefahren, ja, und es wird halt oft immer schwieriger da wirklich was neues auch ihr anzubieten [...]"
Unter dem Schuljahr wird die Freizeit, die den Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung unter der Woche täglich zur Verfügung steht, von einigen Eltern auf drei bis fünf Stunden geschätzt. Dies stellt die Zeit zwischen der Ankunft aus der Schule und dem Zu-Bett-Gehen dar. Hier wird von den Eltern also schulfreie Zeit mit Freizeit gleichgesetzt.
Herr C.: "Also wenn die Schulzeit ist, kommt er um halb fünf cirka und geht um neun schlafen. Oder sag ma, um neun leg ma ihn nieder. Das geht dann meistens eh noch zwei Stunden bis..."
Frau T.: "Er kommt abends um fünf nach Hause und geht um acht schlafen. Das sind einmal drei Stunden, wobei wir davon eine halbe Stunde, Stunde abendessen und baden und ins Bett bringen auch. Also ja, acht ist zu früh. Halb neun, neun ist es jetzt oft, weil er ist auch schon groß. Ich kann ihn nicht mehr so wie früher sieben, halb acht ins Bett legen. Es geht einfach nicht."
Zur Freizeitsituation der Familien bemerkten auch einige Eltern, dass in Bezugnahme auf die Wohnsituation ein eigener Garten, der an den Wohnbereich angeschlossen ist, erhebliche Vorteile für die Freizeitgestaltung des behinderten Kindes birgt:
Frau O.: "wir haben das Glück, dass wir einen Garten haben. Wir haben jetzt seit zwei Jahren ein tolles Schwimmbecken da draußen [...] Sie ist relativ glücklich. Auch weil's dann draußen warm ist und wenn sie schwimmen kann und... und... Also wir haben Gott-sei-Dank das Glück, ja, dass wir... dass sie jederzeit rausgehen kann, ja, also dass sie nicht in einer Wohnung wohnt, wo ma uns immer zusammenpacken müssen, irgendwohin fahren müssen und so. Ich denk mir, dass ist ein viel, viel größerer Aufwand und... und da hamma echt das Glück [...] Der Garten ist ein Luxus ((lacht)) und auch das Schwimmbecken ist ein Luxus, weil ich sagen muss, sie schwimmt irrsinnig gerne [...]"
Ein Garten bedeutet dem Kind oder dem Jugendlichen mit geistiger Behinderung einen größeren geschützten Freiraum zu bieten, in es sich weitgehend ungestört und uneingeschränkt bewegen kann. Dadurch steigen die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Haushalt und damit auch die Lebensqualität und das Wohlbefinden des Kindes oder des Jugendlichen. Aus der Auffassung der Eltern von "Freizeit" und der Freizeitsituation der Familie als Einflussfaktoren resultieren das Ausmaß und die Qualität der Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich. Das nächste Unterkapitel beschäftigt sich daher mit der Freizeitgestaltung in der Familie. Danach wird die Freizeitgestaltung außerhalb der Familie und in Anbetracht der Fragestellung dieser Diplomarbeit auch explizit die Gestaltung der Schulferien ins Visier genommen.
Die Freizeitgestaltung für ihr Kind mit geistiger Behinderung wird von allen befragten Eltern als ihre Aufgabe angesehen. Sie sehen ihre Rolle in der Initiative bezüglich der Freizeitgestaltung ihres Kindes und in der Auswahl, Organisation und Durchführung der Freizeitaktivitäten:
Interviewer: "[...] welche Rolle nehmen Sie bei der Freizeitgestaltung vom Michael ein?"Frau T.: "Ähm. die Initiative, das Aussuchen und das Durchführen."
Frau S.: "Das habe ich immer gemacht und das versuch ich noch nach wie vor. Also ich bin immer wieder so am Schauen in Zeitungen, oder wenn irgendwas ist, dann schaue ich immer so bissi nebenbei. Könnt ma sich das auch noch anschauen, könnt ma dort hingehen, könnt ma das irgendwie so... also ich hab das immer gemacht. Also ich bin mit ihm unterwegs gewesen, sag ich mal so. Ferienprogramm und weggefahren. Und schau halt immer was neues, dass mir was einfällt."
Frau N.: "Sie sind immer vorausgeplant von den Eltern «...» der Mütter hauptsächlich, ja. [...] Ich organisiere natürlich sehr viel. Ich muss die Freizeitassistenten organisieren. Durch das, dass sie sich eben verbal nicht äußern können, können sie auch nicht... können sie jetzt auch nicht jemanden anrufen und jetzt sagen: »Komm her und ich will das und das machen«. Also ich organisiere einmal grundsätzlich, dass sie jemanden haben in der Freizeit [...]
Herr C.: "Es ist kein Thema, es ist sein Ausflug, wobei wir dann halt schon schaun, dass in Summe, wir kennen sein Repertoire mit den eineinhalb Stunden, dass das halt... dass ma dann wieder zurückkommen bevor er komplett von der geistigen Konzentration oder von der Körperkraft nicht mehr kann. Also so wird's schon gelenkt, aber... Wo ma hinfahren auch wir, weil das geht irgendwie nicht."
Neben der Planung der Freizeit des Kindes mit geistiger Behinderung übernehmen die Eltern auch in den meisten Fällen die Begleitung ihrer Kinder zu und bei Freizeitaktivitäten. Als entlastend bei manchen Familien mit mehreren Kindern wurde empfunden, dass das als "geistig behindert" bezeichnete Kind über einen bestimmten Zeitraum mit der familiären Freizeitgestaltung mitgelaufen ist, wie diese Mutter berichtete:
Frau O.: "Und ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass wir eben vier Kinder haben, ist sie immer irgendwie so mitgelaufen, ja. Ich mein, das war jetzt... ich hab bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie für sie ein besonderes Programm gestalten muss, oder so. Sie ist halt mit den anderen Geschwisterkindern dabei gewesen. Ob's jetzt Spielplatz war, oder irgendein Ausflug war, oder so. Das ist irgendwie so eins ins andere übergegangen. Das war nie wirklich Thema und sie war dann... wir waren dann oft mit Freunden unterwegs, die auch Kinder hatten und... Also es war irgendwie sehr natürlich, ja. Jetzt ist sie zwölf Jahre alt und jetzt hab ich das Gefühl, dass sich... ähm... schon ein bissl was verändert irgendwie. Ich mein, sie verändert sich, ja, und die beiden größeren Geschwisterkinder die sind natürlich jetzt schon alleine unterwegs, ja. Also die sind 15 und 17. Haben einfach ihren eigenen Freundeskreis, ja, und gehen auch alleine weg. Also die brauchen jetzt uns als Eltern nicht mehr. Und die jüngere Schwester, die ist jetzt 10, also die baut sich jetzt auch schon irgendwie einen Freundeskreis auf und geht jetzt auch schon oft halt allein zu einer Freundin, wo dann auch oft die Daniela nicht so mitkann, ja, und ich denk mir, jetzt wird's dann schon ein bissl Thema, was... was tu ich mit ihr, ja. [...] Es hat jetzt schon eine bedeutende Rolle... Also ich mein, sie merkt auch schon, dass die Geschwisterkinder jetzt auch was unternehmen. Sie kriegt das natürlich voll mit und ich denk mir, sie hat auch das Bedürfnis natürlich auch was zu tun. Sie sieht's ja bei den anderen und sagt es halt auch oft. [...] Ich mein, für mich war das halt immer so. Sie ist halt immer so mitgelaufen mit meiner jüngeren Tochter, ja."
Wie hier berichtet wurde, weichen die Freizeitinteressen meist mit zunehmendem Alter der Geschwisterkinder ohne Behinderung immer stärker von denen des Kindes mit geistiger Behinderung ab und somit wird es immer schwieriger ein gemeinschaftliches familiäres Freizeitprogramm zu gestalten. Es wird notwendiger eigene Freizeitaktivitäten für das als "geistig behindert" bezeichnete Kind zu organisieren und durchzuführen, was die Eltern vor zusätzliche organisatorische Schwierigkeiten bzw. erhöhte Belastungen im Alltag stellen kann. Ein Weg um mit diesen Belastungen umzugehen ist, die Aufgaben, die in der Freizeitgestaltung für das geistig behinderten Kind anfallen, auf beide Elternteile aufzuteilen, um so eine mögliche Überlastung eines Elternteils zu vermeiden:
Herr C.: "[...] dass sich die Freizeitbeschäftigung sich dann ein bissl so in die Richtung konzentrierter... dass dann eher nur mehr ein Elternteil gewisse Sachen macht. Arbeitsaufteilung. So wie's jetzt bei uns auch ist. Man braucht auch eine Zeit für sich alleine [...]"
Eine Mutter sieht es als Entlastung die eigene Freizeit auch teilweise getrennt von der Freizeit des Kindes verbringen zu können. Somit kann auch einer Überlastung der Eltern vorgebeugt werden. Voraussetzung, um Teile der Freizeit getrennt verbringen zu können, ist jedoch ein verfügbarer Lebensgefährte, der bereit ist, diesbezügliche Aufgaben zu übernehmen.
Ein Netz an Personen, die für diese Zeit die Aufsicht über das Kind mit geistiger Behinderung übernehmen bzw. ein eigenes Freizeitprogramm für das Kind gestalten, ist in dieser Hinsicht auch als entlastend zu werten:
Frau N.: "Ja, ich habe eigentlich Gott-sei-Dank ein ziemlich engmaschiges Netz, muss ich sagen. Also, dass ich auch meine Freizeit alleine einmal verbringen kann [...]"
Ein solches Netz kann auch in der weiteren Familie bzw. im Familienumfeld gefunden werden:
Frau T.: "Mein Schwager geht oft... also »oft«... geht immer am öftesten mit ihm spazieren. Der hat selber keine Kinder, ist aber sein Taufpate und traut ihn sich voll zu. Der ist auch der einzige, der sich ihn auch wirklich zutraut."
Frau O.: "Es gibt einmal die Großeltern natürlich, die sich da auch sehr engagieren. Also das ist meine Schwiegermutter, die da auch gleich in der Nähe wohnt, die... die wirklich jederzeit verfügbar ist und die Daniela auch wirklich sehr sehr gern zu ihr geht. Also die haben da auch eine ganz eine eigenen Beziehung zueinander und Oma lebt schon sehr lange allein. Also die freut sich auch wirklich, wenn die Daniela kommt und da wird viel vorgelesen und da wird viel gesungen. Also es läuft zwar eher ruhiger ab, aber das ist auch das, was sie manches Mal braucht, weil es zu Hause oft sehr turbulent zugeht und sie oft zur Oma gegangen ist, um sich anscheinend auszurasten oder wirklich ein bissl zur Ruhe zu kommen."
Frau S.: "Die H. hat den Vorteil gehabt, dass sie ein bissi vielleicht zu Oma und Opa auch noch gehen hat können."
In den meisten Fallbeispielen dieser Studie übernehmen Großeltern bzw. Verwandte die Begleitung bei diversen Freizeitaktivitäten und entlasten dadurch die Eltern. In den Interviews wurde jedoch auch erwähnt, dass zeitweise Personen von außerhalb der Familie Teile der Freizeitgestaltung für das Kind oder den Jugendlichen mit geistiger Behinderung übernehmen.
Von Zeit zu Zeit übernehmen auch familienfremde Personen aus unterschiedlichen Motivationen die Begleitung der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in ihrer Freizeit:
Frau O.: "Ich hab auch dann immer also... da war die Daniela... ja, drei oder vier Jahre alt, also ab diesem Zeitpunkt hab ich dann immer geschaut, dass da wirklich auch eine... noch eine zusätzliche Hilfe kommt. Das war meistens auch eine Studentin, die gekommen ist ein Mal in der Woche und die sich so für drei Stunden cirka auch mit der Daniela beschäftigt hat und... Also für mich war auch wichtig, dass irgendwie von außen auch noch wer kommt, damit die Daniela auch... Die war immer sehr auf bestimmte Personen fixiert und damit sich das halt ein bissl lockert, wo ich mir denk, OK, wenn die Oma halt wirklich einmal nicht Zeit hat, oder so, dass sie halt auch ein bissl Zugang hat zu jemanden anderen hat und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und ich hab auch jetzt eine ältere Frau, die schon erwachsene Kinder hat, die halt jetzt regelmäßig kommen kann. Ja, mit der Daniela spielt, mit ihr in den Garten geht, spazieren geht, oder so. [...] auch mit der Frau, die da halt... «...» Na ja, es ist nicht jeder... Es kommt nicht jede Woche, aber zumindest zwei Mal im Monat halt einer und da... [...] Ja, ich mein, es ist noch nicht... Also es ist halt eher noch ein Spazieren-Gehen, oder Spielplatz-Gehen, oder so. Also aber nicht jetzt wirklich irgendwohin fahren, ja. Also ich weiß auch nicht, ob sie's auch tun würde."
Voraussetzung dafür ist, wie eine Mutter betont, dass Eltern eines behinderten Kindes dazu bereit sind Hilfe von außen in der Freizeitgestaltung anzunehmen:
Frau C.: "Zuerst einmal haben wir uns eingestehen müssen, dass es nicht schlecht wäre, wenn wir so etwas hätten [...]"
Ist diese Bereitschaft Hilfe anzunehmen vorhanden, stellt sich bei vielen der befragten Eltern die Frage, welche Personen außerhalb des Familienumkreises die Begleitung ihrer Kinder mit Behinderung bei Freizeitaktivitäten übernehmen könnten:
Frau O.: "man sagt's ja auch schon oft, dass sie gern irgendwohin gehen würde, auch alleine, ja. Ich mein, ich kann sie zwar... ich kann sie alleine nirgends hinschicken. Und es ist für mich so die Frage, wer geht mit ihr, ja. Such ich jetzt jemanden, der das mit ihr macht, wo ich nicht unbedingt involviert bin und wo so bisschen ein Loslösungsprozess natürlich auch stattfinden soll, ja. Ich mein, es wird sicher noch ein eigenes Thema werden. Es wird wirklich ganz ganz schwierig werden, aber ich denk mir, man muss irgendwann auch anfangen damit."
Es wurde von einigen Eltern angeführt, dass es schwierig ist solche Personen, die im Idealfall über ein gewisse Qualifikation verfügen sollten, zu finden:
Frau C.: "Was sehr schwierig war, ist jemanden zu finden, der ein bissi Zeit mit ihm verbringt."
Herr C.: " [...] dass man bei Kindern doch sehr, sehr, sehr genau aussucht, «...» wenn man nicht grad selbst die beaufsichtigende Person ist, wer ist das und so."
Des weiteren stellt es für viele der befragten Eltern ein Problem dar, Vertrauen in familienfremde Personen zu fassen und ihre Kinder in die Obhut dieser Personen abzugeben. Deshalb ist es für viele Eltern von großer Bedeutung in einer Kennenlernphase Vertrauen in diese unterstützenden Kräfte von außen zu fassen:
Frau O.: "Und von dem her weiß ich auch... Ich mein, es ist natürlich auch so eine Vertrauenssache, ja. Kann ich jetzt jemanden auch mein Kind so anvertrauen, dass ich weiß, es ist gut aufgehoben. Ich denk mir, das ist halt auch noch einmal so ein Thema, ja, wo ich auch nicht, wenn jetzt irgendwer kommt... Ich glaub, ich würd sie nicht sofort jetzt jemanden mitgeben, ja, sondern ich denk mir, es ist einmal ein Kennenlernen wär für mich wichtig und ich möchte auch einmal schaun, wie der- oder diejenige mit ihr einfach kann, ja, und dann könnt ich sie einmal so wirklich da hinauslassen."
Ist dieses Vertrauen in die familienfremden Personen hergestellt, so wird die Freizeitgestaltung mit diesen Personen von einigen Eltern als durchaus positiv für den Loslösungsprozess der Kinder vom Elternhaus und als Bereicherung des Spektrums der Freizeitaktivitäten gewertet:
Frau O.: "Such ich jetzt jemanden, der das mit ihr macht, wo ich nicht unbedingt involviert bin und wo so bisschen ein Loslösungsprozess natürlich auch stattfinden soll, ja. [...] Und es ist für mich halt schon oft schwierig irgendwie auch ein Programm zu finden, wo ich mir denk «...» das könnte ihr Spaß machen, oder das tut sie auch und ich bin draufgekommen, dass das, wenn das jemand anderer macht, dass das sehr wohl auch «...» Spazieren jetzt zum Bespiel..."
So genannte "FreizeitassistentInnen" bieten Begleitung von behinderten Menschen in ihrer Freizeitgestaltung gegen Bezahlung an. Die Dienste dieser Personen, die meist eine fachspezifische Ausbildung haben oder in diesbezüglicher Ausbildung sind, werden von den meisten der befragten Eltern gerne in Anspruch genommen. Meist sind mehrere FreizeitassistentInnen an der Freizeitgestaltung eines Kindes oder eines Jugendlichen mit geistiger Behinderung beteiligt. Im Rahmen dieser Freizeitassistenz werden verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten und mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt:
Frau S.: "Und da hab ich noch nicht die Idee gehabt, man könnte ja einen Freizeitassistenten nehmen. [...] Dann hab ich die I. Das ist die Holländerin, die holt ihn von der Schule und dann kann er auch sagen... Also die wohnt in G. drüben an der D.. Und das hat dem Markus natürlich getaugt. Dorthin fahren und einfach mit ihr zusammen sein. Und dann auch durch diese Au gehen und dann mit der Fähre fahren und das ist halt dann auch so ein bissl... Und die I. einmal im Haus des Meeres. Dann sind sie einmal nur Schnellbahn gefahren mit dem Wiesel, weil er wollte mit dem Wiesel fahren. Dann hat sie das gemacht. Solche Sachen halt. Wo dann sonst ich mit ihm sitzen würde. «...» Die T. ist ein bissl mit ihm gewesen schon. Die hat auch schon ein paar Sachen gemacht. Einmal Ausstellung und so... Dann hab ich eine Zeit lang einen U. gehabt. Der hat ihn immer Sonntags gehabt, da war ma immer in Wien. Ist auch irgendwohin gegangen. Einmal Schönbrunn oder so. «...» Und es hat eigentlich keiner Probleme gehabt."
Herr C.: "Es waren lauter Frauen, die haben meisten in so sozialen Berufen ihre Ausbildung gehabt oder haben's studiert. Und die haben das wirklich gut gemacht. Die haben das super gemacht und die haben ihn alle gerne gehabt und der Markus hat sie alle gerne gehabt. Die haben wirklich super daheim in der Wohnung mit ihm gearbeitet, gespielt, irgendwas."
Der Kontakt zwischen diesen FreizeitassistentInnen und den Eltern entsteht auf verschiedene Weise, geschieht aber meist über Mundpropaganda oder Selbsthilfegruppen. Von einem Vater wurde dabei das in vielen Ausbildungen vorgeschriebene Praktikum als vorteilhaft in diesem Zusammenhang angesehen. Verschiedene Personen in Ausbildung absolvieren ihr Praktikum in der Rahmen Freizeitassistenz für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Dies kann die Suche der Eltern nach potentiellen FreizeitassistentInnen erleichtern:
Herr C.: "Da war ma bei den Autisten und einmal dort und einmal dort und einmal dort. Das waren so fünf, sechs junge Frauen und dann vielleicht wieder einmal, wenn eine aufgehört hat, eine gesagt, ich weiß wen und so. Das ist aber eigentlich nie aus dem Ansatz gekommen, dass das jemand so von sich anbietet, sondern das war immer Gott-sei-Dank in der schulischen Ausbildung mit vorgeschrieben. [...] Wir haben uns, glaub ich, bei den Autisten eingeschrieben und die haben dann gesagt, es gibt so was."
Frau C.: "Die erste haben wir da vom Nachbarschaftszentrum gehabt. Ich glaub, das hab ich einmal in der Zeitung gelesen, dass es da jetzt was neues gibt, ein Nachbarschaftszentrum, das auf gegenseitige Hilfe aufgebaut ist. Und dort hab ich dann einmal angerufen."
Für manche Eltern stellt die Kontaktaufnahme zu FreizeitassistentInnen jedoch ein Problem dar:
Frau T.: "[...] sie sucht immer wieder wirklich dringend auch junge Leute, die bereit wären einen Nachmittag sich mit der T. zu beschäftigen und das ist gar nicht leicht. Also wirklich jemanden zu finden, der regelmäßig auf ein behindertes Kind aufpasst, ist fast, «...» selbst wenn man's bezahlt, sehr schwierig. [...] Aber ich weiß noch nicht wo ich anfang zu suchen. Mit allen reden, allen weitererzählen. Irgendwer schreit dann »hier«."
Die Umgangsweise der FreizeitassistentInnen mit ihren behinderten Kindern wurde von vielen Eltern als überaus positiv erlebt. Dabei wurde auch das selbstbewusste und entspannte Auftreten der FreizeitassistentInnen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in der Öffentlichkeit erwähnt und hervorgehoben:
Frau S.: "Aber wer sich getraut hat, waren diese Freizeitassistenten. Die haben gesagt: »OK«
Frau O.: "[...] ich müsste das irgendwie in Kauf nehmen, dass es zu Konflikten kommt. Also das wär jetzt natürlich auch eine Schwierigkeit und ich denk mir, das hätt ich vielleicht auch ganz gerne abgegeben, ja, ((lacht)) wo ich mir denk, OK, vielleicht nimmt's jemand, der mit ihr da unterwegs ist für drei Stunden, auch lockerer als ich als Mutter, wo ich mich immer auch sehr persönlich irgendwie angegriffen gefühlt hab, ja."
Zwei befragte Elternteile führten an, dass der Besuch bei Freuden als außerfamiliäre Freizeitbeschäftigung weitgehend wegfiele, da ihre Kinder mit geistiger Behinderung nur schwer in Kontakt mit anderen Menschen treten können und dadurch auch nur sehr wenige Beziehungen bzw. Freundschaften entstehen. Daraus resultierend ist der Freundeskreis dieser Kinder und Jugendlichen sehr eingeschränkt. Auch über die Schule, die für nicht behinderte Kinder oft einen Ort darstellt, an dem freundschaftliche Kontakte geknüpft werden, bietet laut Aussagen einiger Eltern für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung häufig nur wenig Gelegenheit Freundschaften zu schließen. Begründet wird dies damit, dass die Klassen oft sehr klein sind und somit nur wenige soziale Kontakte bieten. Zusätzlich bedeutet es für die Eltern auch zeitweise eine gewisse Belastung, wenn ein weiteres Kind mit Behinderung zusätzlich zu dem eigenen behinderten Kind längere Zeit im Haushalt verbringt, so ein Vater:
Frau T.: "Was bei ihm wegfällt, sind Freunde besuchen und Freunde kommen, weil er nicht die Beziehungen aufbaut in dem Sinn. Also das ist auch bei den gesunden Kindern ein großer Freizeitfaktor - mit Freunden etwas unternehmen. Das fällt bei ihm weg."
Herr C.: "Ja, was sich bei uns eigentlich selbst reduziert, ist die Freizeitbeschäftigung privater Natur, Freundeskreis. Das ist halt sehr klein. «...» Weil die Schulklassen sehr klein sind, weil wahrscheinlich Behinderten-Eltern noch eher mauern, weil sie selber schon so überfordert sind. Jetzt wollen sie nicht mit einem Kind noch irgendwo hingehen und dafür dann in zwei Wochen das andere Kind dann dazu nehmen, weil's dann zwei haben, auf die sie aufpassen müssen. Aber vierzehn-, fünfzehnjährige sonst auf die braucht man nicht aufpassen. Die sind halt in der Wohnung und schlafen dann in der Nacht und irgendwann um drei muss man schaun, dass sie schlafen gehen. Man kennt ja die Gschichteln von den Kolleginnen und so. «...» Ja, diese Freizeitbeschäftigung die eigentlich nichts kostet und die eigentlich für viele Kinder sehr viel der Freizeit ausmacht, der Freundeskreis, der ist einfach nicht wirklich da, weil eigentlich die Eltern immer andrücken müssen. So die Verbindung herstellen."
Die Schulferien werden von Eltern geistig behinderter Kinder meist als Belastung erfahren, da sie in dieser Zeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung auch die Zeit gestalten müssen, die sie unter dem Jahr in der Schule verbringen. Für die Eltern bedeutet dies, dass in den Schulferien auch für die Vormittage eine Betreuung gesichert werden muss. Diese Betreuung übernehmen sie entweder selbst, geben sie an andere Familienmitglieder bzw. bezahlte Kräfte ab oder nehmen verschiedene Ferienangebote in Anspruch. Vor allem für berufstätige Eltern stellt die Sicherung der Betreuung während der schulfreien Zeit häufig ein erhebliches Problem dar:
Frau N.: "Das heißt er ist im Sommer nur zwei Wochen zu Hause und das ist, muss ich sagen, ist schon sehr angenehm seit es das Tagesheim gibt. Weil die Schulferien sind dann mitunter schon sehr lang - neun Wochen. Es war früher so, dass ich halt nur für die Kinder da war, wie beide noch in der Schule waren, die ganzen Schulferien. Also wirklich für mich habe ich da überhaupt keine Zeit gehabt. Jetzt hat sich das so ergeben, seit der Peter im Tagesheim ist und ich hab angefangen damals eben im Beruf wieder. Habe ich dann etwas suchen müssen, das war für mich dann auch... irgendwie eine ganz andere Situation neun Wochen den Manfred irgendwo unterzubringen und ich habe nur selber zwei Wochen Urlaub gehabt."
Meistens verstehen die Eltern auch die Gestaltung der Schulferien als ihre Aufgabe. Sie sind in dieser Zeit dann durch die vermehrte Freizeit der Kinder als Organisatoren und Begleiter bei Freizeitaktivitäten umso mehr gefordert. Die Planung erfolgt dabei zeitweise von Jahr zu Jahr unterschiedlich:
Frau S.: "Aber ich mache ja dann in den Ferien schon auch was mit ihm. Da kommt dann immer wieder das Programm, was ich machen werde. Was unternehme ich mit ihm?"
Herr C.: "Für uns passt's jetzt, wobei jetzt dann in einer relativ absehbaren Zeit das Thema sein wird, jetzt einfach von Jahr zu Jahr zu schauen. [...] Jetzt sind wir auf dem Status und nächstes Jahr schauen wir weiter und über die vergangenen Jahre freuen wir uns. ((lacht))"
Die befragten Eltern haben in punkto Feriengestaltung für ihre Kinder mit geistiger Behinderung verschiedene Lösungen gefunden, die von einer geförderten Kurzzeitunterbringung in einem Wohnheim über Unterbringung bei Ferienangeboten und mehrtägigen Förderangeboten bis hin zur Feriengestaltung zu Hause bzw. im Rahmen der Familie reichen:
Frau N.: "Das heißt, ich hab damals eben dieses Förderzentrum in G. gefunden. Da macht man normalerweise zuerst Intensivwochen, drei Wochen, mit Elternteil und dann gibt es jetzt eben seit ein paar Jahren, also die... die Kinder und Jugendlichen bis 18 können im Sommer zwei Wochen, zwei Intensiv-Förderwochen oben verbringen. Das wird vom Land Niederösterreich mitfinanziert. Da habe ich jetzt den Manfred jedes Mal angemeldet. [...] wenn sie in einem Tageheim sind, können sie ja dann kurzzeituntergebracht werden im Wohnheim auch. Also die meisten Behindertenwerkstätten haben ja dann Wohnheime. Das heißt ich könnte mein Kind drei Wochen unterbringen, kurzzeitunterbringen und das zahlt auch einen Teil davon das Land Niederösterreich und holt sich dann von den Eltern dann eben einen Kostenanteil."
Herr C.: "Wir haben Gott-sei-Dank die K., die bis jetzt immer so quasi übern Daumen vier, fünf Wochen von den neun abgedeckt haben. Zwei verbringen wir mit ihm im Familienurlaub mit Wandern in Salzburg und dann ist er zwei Wochen im Förderzentrum G. in Niederösterreich."
Frau T.: "[...] sonst ist er im Sommer ähm bei der D. als Kurzzeitunterbringung einmal für drei Wochen für'n Sommerurlaub auch und ich hab das große, große Glück, dass ich noch ein Kinderheim noch in Niederösterreich kenn, die ihn mir ganz spontan manchmal nimmt. [...] Er ist der ersten Juliwochen und in der ersten Augustwochen dabei und dann fährt er eine Woche nach K. mit."
Frau O.: "Ja, sie ist zwei Monate schon zu Hause. Ähm... «...» wobei ich sagen muss, sie ist gern zu Hause. Sie... wir haben das Glück, dass wir einen Garten haben. Wir haben jetzt seit zwei Jahren ein tolles Schwimmbecken da draußen [...]"
Bei Eintritt der Jugendlichen mit geistiger Behinderung in das Arbeitsleben und somit in der Regel in Werkstätten ändert sich die Feriengestaltung oft erheblich. Wie bei den meisten anderen Arbeitsstellen auch haben Jugendliche mit geistiger Behinderung in Werkstätten bzw. Tagesstrukturen fünf Wochen Urlaub zur Verfügung, die sie nach Belieben über das ganze Jahr verteilt in Anspruch nehmen können. Für die Eltern bedeutet dies, dass im Gegensatz zu den erheblich längeren Ferienzeiten während der Schulzeit weniger Freizeit gestaltet, geplant und mit Betreuung abgedeckt werden muss. Außerdem kann diese Freizeit auch flexibler gestaltet werden und ist somit nicht mehr an fixe Zeiträume gebunden wie etwa die Schulferien. Von einigen Eltern wird dies als eine erhebliche Entlastung empfunden:
Frau T.: "Wobei dann ist eh auch Werkstatt und weniger Urlaub und es strukturiert sich dann um, wobei eben dann der Feriencharakter fehlt [...]"
Frau S.: "Mit der H. zusammen machen wir dann Ausflüge mit den Kindern. Bei ihr wird's jetzt anders sein. Der G. hat die letzten Ferien und der Q. ist auch schon in der Werkstatt. Es schaut dann schon ein bissl anders aus [...]"
Frau N.: "Ich meine, der Peter ist jetzt schon im Tagesheim. Das heißt er hat keine Ferien in dem Sinne - er hat Urlaub. Er hat genauso Urlaub wie jeder Berufstätige - fünf Wochen und das teilt sich dann auf. Das heißt er ist im Sommer nur zwei Wochen zu Hause und das ist, muss ich sagen, ist schon sehr angenehm seit es das Tagesheim gibt."
Unweigerlich mit der Freizeitgestaltung verbunden sind Freizeitaktivitäten, auf die nun eingegangen wird.
Die Eltern wurden im Rahmen dieser Studie auch zu den Freizeitaktivitäten ihrer Kinder befragt. Nach Aussagen einiger Eltern steht Wünschen von Seiten der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung nach mehr Freizeitaktivitäten eine geringe Auswahl an möglichen Freizeitaktivitäten gegenüber. Diese geringe Auswahl kann einerseits durch behinderungsbedingte Einschränkungen und andererseits auch durch einen Mangel an verfügbaren Begleitpersonen erklärt werden:
Frau S.: "Und er würde sich noch mehr wünschen, wo die Leute dann aber nein gesagt haben, wo ich oft so gefragt hab. Und das war dann einfach so nicht zum kriegen, auch im Bekanntenkreis nicht. Die haben dann gesagt: ich würde mich nicht trauen."
Frau T.: "Ja, wobei die Auswahl nicht sehr groß ist. Nachdem er nicht spielt, nicht sich mit etwas von außen beschäftigt [...]"
Zu der Gestaltung der Freizeitaktivitäten wurde von einer Mutter angeführt, dass eine Auswahl der Freizeitaktivitäten und eine gewisse Anleitung bei der Ausführung dieser notwendig sei:
Frau S.: "Aber er mag auch andere Sachen machen. Wenn man ihn gut anleitet. Er tut überall mit. Er kennt sich auch gut aus. [...] Also man kann mit ihm alles machen. Wir sind ins Museum auch schon gegangen. Also wenn die Freundinnen kommen im Sommer oder so mit den Kindern, dann mach ma immer wieder Programme. Natürlich auf sie abgestimmt."
Aus diesem Zitat geht auch hervor, dass viele Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung prinzipiell für verschiedene Arten von Freizeitaktivitäten offen sind. Dies stellt für Eltern häufig einen Grund dar immer wieder neue Freizeitaktivitäten zu suchen und anzubieten:
Frau T.: "Es wird ihm immer wieder angeboten, weil es geht dann... Immer wieder geht wieder was neues. Man sollte niemals nie sagen."
Von den befragten Eltern wurden vielerlei Freizeitaktivitäten aufgezählt, die sie mit ihren Kindern mit geistiger Behinderung durchführen bzw. die von ihren Kindern gerne durchgeführt werden. Natürlich wichen die Vorlieben von Fall zu Fall ab, da selbstverständlich auch bei als "geistig behindert" bezeichneten Menschen die bevorzugten Freizeitaktivitäten ja nach Charakter unterschiedlich sind, wie zuvor von einer Mutter schon erwähnt wurde. Zu den Aktivitäten, die angeführt wurden, zählen Malen, Lesen, Fernsehen, Trampolinspringen, Reiten, Schaukeln am Spielplatz, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Spazieren, Kinobesuche, Tiergartenbesuche, Rodeln, Essen-Gehen und das Feiern von Festen:
Herr C.: "[...] wo er sich total daheim gehen lasst oder draußen seine überschüssigen Kräfte abarbeitet, seine Runden dreht. «...» Beim Wandern [...] Ja, dieses Trampolinspringen. Das Reiten hamma aufgehört [...] Fernsehen ist beim Relaxen beim Markus zu Hause eine gute Freizeitbeschäftigung, die er jetzt auch aktiv annimmt."
Frau O.: "sie kann sich auf dem Spielplatz eigentlich wirklich ganz frei bewegen. Sie kann... ja, ich mein, Rad fahren jetzt ohne Stützen funktioniert zum Beispiel nicht. Aber ich denk mir, es gibt trotzdem genügend Möglichkeiten, sich, jetzt bei ihr, zu betätigen. Wir haben im Garten ein ganz ein tolles Trampolin, auf dem sie sehr gerne hüpft und springt und wo sie sich halt auch ein bissl austoben kann. Von der Feinmotorik her ist es so, dass sie jetzt so weit ist, dass sie... ähm... Sie malt sehr großflächig im Moment. [...] Sie erkennt ihren Namen und sie hat jetzt in der Schule quasi schon ein Heft, das sie für sie angelegt haben, mit Wörtern, die sie regelmäßig quasi jetzt liest, ja und das sind jetzt doch einige Seiten von Wörtern auch, die sie erkennt, ja, und es werden halt immer mehr und ich denk mir, das ist... Also es macht ihr irrsinnig viel Spaß, ja, und sie freut sich da wirklich total. [...] Ich mein, die Daniela geht irrsinnig gern zum Beispiel nach wie vor auf den Spielplatz und das machen wir jetzt schon Jahre lang [...] Ich mein, sie kann stundenlang schaukeln [...] weil ich sagen muss, sie schwimmt irrsinnig gerne [...]"
Frau T.: "Dieses Wandern-Gehen und Spazieren-Gehen und prinzipiell wär auch Kino dabei und Tiergarten besuchen und ins Schwimmbad einmal gehen oder... [...] im Winter gehen wir spazieren. Rodeln auch [...] Also wir gehen nicht sehr oft irgendwo auswärts was essen, weil wir einfach mit vier Kindern das sowieso nicht drinnen ist, aber wenn wir's einmal machen oder Eis essen gehen, probier ich's auch immer wieder ihn zu nehmen und das geht in letzter Zeit auch ganz gut. [...] Tiergarten gehen wir gerne und auch oft [...] Spielplatz mag er gerne, also schaukeln, rutschen kamma. Wenn irgendwo ein Grätzelfest ist und es sind dort irgendwelche äh Pferde, die im Kreis gehen, dann lass ich ihn auf den Pferden im Kreis gehen. Das mag er gerne. Schwimmen geht er sehr, sehr gerne."
In den Interviews kam darüber hinaus zu Tage, dass für die meisten Eltern Natur und Bewegung in der Natur eine große Rolle bei den Freizeitaktivitäten ihrer Kinder mit geistiger Behinderung spielt. Es wurde angeführt, dass sich die Kinder und Jugendlichen besonders in der Natur wohlfühlen und deswegen regelmäßige Ausflüge ins Grüne oder die Beschäftigung im hauseigenen Garten einen großen Teil der Aktivitäten in der Freizeit ausmachen. Diese Bewegung in der Natur wird von vielen Eltern als positiv erlebt. Eine Mutter bezeichnete den Garten sogar als Therapiefeld für ihren als "geistig behindert" bezeichneten Sohn:
Frau T.: "Wenn schönes Wetter ist und wir in den Garten können, ist es ganz einfach, weil er sehr, sehr gerne draußen ist und es für ihn Freizeit ist, wenn er draußen sein kann. Also wirklich dann ist es für ihneine schöne Beschäftigung, wo ich weiß er fühlt sich sehr wohl. Ähm, ja, das tut ihm einfach wirklich gut. [...] am besten ist man in der Natur [...]"
Herr C.: "Der Markus ist sehr gern draußen, Bewegung im Freien"
Frau S.: "Früher war das zu Hause und ein großer Garten. Wir haben einen sehr großen Garten gehabt, wo er auch sehr viel Bewegung... Also das Therapiefeld. [...] Er geht unheimlich gerne in den Wald."
Regelmäßig durchgeführten Freizeitaktivitäten stehen Freizeitaktivitäten gegenüber, die aus gewissen durch die Behinderung bedingten Gründen nicht durchgeführt werden können. So fiel bei einem Kind die Freizeitbeschäftigung Fernsehen über lange Zeit weg, da es durch die Sinneseindrücke des Fernsehens in der Wahrnehmungsfähigkeit überfordert war. Aus ähnlichen Gründen wurden auch bei anderen Kindern der befragten Eltern gewisse Freizeitaktivitäten eingeschränkt:
Herr C.: "Vorher hamma immer nur heimlich mit Kopfhörern geschaut, weil ihm das alles zu viel war."
Frau O.: "Aber ich denk mir zum Beispiel, wenn ich so das Thema Kino hernehm, sie geht schon sehr gern ins Kino, aber es ist ihr sehr oft zu laut da drinnen [...]"
Frau T.: "Ins Kino bin auch eine Zeit... hab ich angefangen mit ihm zu gehen und dann haben seine epileptischen Anfälle angefangen und jetzt trau ich mich nicht mehr. [...] ich trau mich seit dem nicht mehr wirklich mit ihm ins Kino, weil das sind einfach zu viele Eindrücke für ihn, dass ich Angst hab, dass das wieder einen Anfall auslöst."
Die befragten Eltern berichteten weitergehend von Freizeitaktivitäten in der Öffentlichkeit, die aufgrund negativer Reaktionen des Umfeldes wieder aufgegeben wurden bzw. aufgrund befürchteter negativer Reaktionen erst gar nicht versucht wurden:
Frau O.: "[...] es war mit ihr immer ein Riesenproblem in ein öffentliches Bad zu fahren, weil sie das Element Wasser sehr ausreizt. Sie spritzt wahnsinnig, ja, ((lacht)) und sie spritzt mit Händen und Füssen und es hat jedes Mal reisengroße Probleme gegeben mit den Gästen, mit den Badegästen, die sich aufgeregt haben, ja, weil sie so gespritzt hat und ich mein, es war ihr wurscht, wer da in der Nähe war. Sie hat halt irgendwie gespritzt und es sind halt dann sehr viele irrsinnig nass geworden und... und es hat immer wirklich sehr große Konflikte gegeben, dass ich mich ganz zum Schluss wirklich nicht mehr mit ihr irgendwo in ein Bad fahren getraut hab, weil ich mir gedacht hab das... ja, ich will mir das nicht mehr anhören."
Frau T.: "Wobei ich die öffentlichen Bäder nicht allzu sehr strapazier, weil er hat Windeln und ich muss mich erst wieder um eine neue Inkontinenzhose bemühen, weil sonst hab ich immer Sorge, dass sie das Becken auslassen müssen. ((lacht))"
Größere Menschenmengen können als Problem bei Freizeitaktivitäten gelten. Sie bergen die Gefahr der Überforderung des Kindes bzw. die Gefahr, dass das Kind oder der Jugendliche mit geistiger Behinderung in der Menge verloren geht:
Frau T.: "[...] ja, aber das geht, wenn nicht zu viele Menschen auf einmal sind, dann wird's auch schwierig. [...] Er ist schwerer zu halten. Irgendwie ist er unruhiger. Ich kann ihm nicht die gewisse Freiheit geben, dass er halt einmal vor oder zurück geht, weil da sind ja so viele Menschen, da muss er bei mir bleiben. Das mag er dann auch nicht. Also ich hab ihn einmal in ein Museum mitgenommen, das war knallvoll und es war unmöglich."
Frau S.: "Auf so große Veranstaltungen hab ich mich nicht so richtig reingetraut, weil da hab ich Angst gehabt, dass ich ihn verliere. Ich hab ja eine Zeit lang ein Pickerl ihm hinaufgehängt, dass ich mich nicht umdreh und er ist weg und er kann nicht einmal sagen..."
Körperliche Behinderungen, die im Falle von Mehrfachbehinderungen mit geistigen Behinderungen einhergehen können, machen ebenfalls manche Freizeitaktivitäten (z.B. Wandern) nur erschwert möglich:
Frau T.: "Wandern macht er eigentlich brav große Strecken. [...] Da hat er sich sehr geplagt, weil das Steile ist gar nicht seins. Also da sind wird beide fast abgestürzt, aber wir haben's geschafft. [...] Er geht gut. Er geht aber sehr stacksig. Er kann nicht laufen. Er hat nicht die runden Bewegungen und das fehlt ihm scheinbar auch beim bergab und bergauf gehen."
Schlussendlich fallen verschiedene Freizeitaktivitäten wie Museumsbesuche, Reiten, Schwimmbadbesuche und Spazieren aus Mangel an Interesse bei den Kindern und Jugendlichen mit Behinderung weg:
Frau T.: "Museen: er geht mit, aber es interessiert ihn nicht. Es sagt ihm nichts. Es ist ihm dann wurscht, ob er durch ein Kaufhaus oder ein Museum durchgeht vom Anschaun her."
Herr C.: "Das Reiten hamma aufgehört, nachdem das so »ist es, ist es gut, ist es nicht, ist es auch gut« [...] Das war im Bad, das wollt er nie [...]"
Frau O.: "[...] sie ist nicht eine, die unbedingt gerne Spazieren geht."
Therapie-, Förder-und Rehabilitationsmaßnahmen wurden von befragten Eltern in Verbindung mit Freizeit auf unterschiedliche Art und Weise gesehen. So wurden sie auf der einen Seite als Freizeitaktivitäten wahrgenommen und auf der anderen Seite mit Arbeit verglichen.
Von einigen der befragten Eltern wurden bei der Frage nach der Freizeitgestaltung auch das Thema "Therapien" angesprochen, weswegen hier abschließend auch noch diese Thematik berücksichtigt wird. Es stellte sich für manche InterviewpartnerInnen die Frage, ob Therapien und Förderungen zur Zeitqualität "Freizeit" zu zählen sind, oder nicht:
Frau O.: "[...] Therapie ist für mich auch was, was Spaß machen soll, weil sonst hat's nicht wirklich viel Sinn und sie hat sich dann auch wirklich nicht geöffnet für gewisse Dinge [...] Für mich war das immer irgendwie so eine Gratwanderung, also Therapie und Freizeit, ja. Ich mein, ist Therapie jetzt auch ein Stück weit Freizeit? Und dann vielleicht auch, dass sie das macht, was ihr Spaß macht, ja. ähm... ich mein, wir sind dann zum Beispiel zu Heilpädagogischem Voltigieren gegangen und ich mein, das hat ihr wirklich irrsinnigen Spaß gemacht und ich hab das dann schon auch so ein bisschen als Freizeitgestaltung gesehen, ja. Also jetzt nicht so unbedingt als Therapie, sondern es war für mich sehr wohl auch irgendwie Freizeitgestaltung, ja. Also da vermischt sich halt manches. Also für mich vermischt es sich manches Mal ein bisschen, ja."
Hier wird Therapie, die Spaß bereitet, also lustvoll besetzt ist, als eine Art von Freizeitbeschäftigung gesehen. Auch von anderen Eltern wird Therapie, die dem behinderten Kind Freude bereitet, als Freizeitaktivität betrachtet:
Herr C.: "Und dann mach ma noch diese Musiktherapie unterm Schuljahr [...] Das wäre noch eine Freizeitbeschäftigung, die ihm sehr taugt, weil da kann er schrein und brüllen und der Mann imitiert ihn. Also der versucht ihm Dinge zu entlocken."
Andererseits wird von manchen Eltern Therapie in gegensätzlicher Perspektive als Arbeit betrachtet. Diese Sichtweise von Therapie und Förderung kann durch Fixierung von Eltern auf Therapien und damit einhergehendem dementsprechend großen Zeitaufwand noch weiter erhärtet werden. In dieser Sicht von Therapie und Förderung als Anstrengung und Arbeit scheint es den Eltern notwendig nebenher auch Freiraum zur Entspannung in Form von Freizeit zu schaffen:
Frau N.: "Es gibt verschiedenen Therapieangebote. Das sind... das sind eigentlich keine Ferien, das ist Arbeit, sag ich jetzt einmal, für den lieben Burschen, weil da muss er sehr viel tun."
Frau O.: "Waren am Anfang viele Therapien angesetzt, aber es ist mir dann eigentlich Gott-sei-Dank relativ schnell klar geworden, dass es das halt nicht wirklich ist, ja, sondern ich denk mir, sie braucht genauso ihre Zeit einmal, wo sie nichts tut und wo sie auch wirklich einmal Freizeit hat, wo sie das machen kann, was sie will und wenn sie nur eine Stunde sitzt und nichts tut, ist das auch OK, ja."
Für viele der befragten Eltern stellt die Integration im Freizeitbereich ein gewichtiges Thema dar, weswegen sich hier nun ein eigenes Unterkapitel mit dieser Thematik beschäftigt. Die von den Eltern getätigten Aussagen zu Voraussetzungen, positiven Aspekte und Problematiken von Integration werden dabei hervorgehoben.
Viele Eltern geistig behinderter Kinder ziehen integrative Freizeitaktivitäten speziellen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung vor:
Frau S.: "Mir würd ja was integratives fast besser gefallen."
Die integrative Gestaltung von Freizeitaktivitäten birgt jedoch mehrere Aspekte, die in Planung, Organisation und Durchführung berücksichtigt werden müssen. Generelle Voraussetzung ist die Bereitschaft behinderte Menschen zu integrieren und weitergehend ein gewisses Engagement dafür in der Durchführung der Aktivität. So müssen zeitweise Voraussetzungen geschaffen werden, die die Teilnahme behinderter Kinder und Jugendlicher an Freizeitaktivitäten ermöglichen bzw. erleichtern:
Frau N.: "Es hat manches Mal total gut funktioniert, sogar teilweise dann ohne Assistenz, aber da muss eine Person vorhanden sein, die offene Ohren hat für das, die einfach sich damit ein bisschen konfrontiert sieht, die einfach auf das eingeht. Die muss einfach vorhanden sein - anders geht es nicht."
Frau O.: "Ich denk mir, man muss Voraussetzungen schaffen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht muss man manches Mal... Ich mein, wenn ein Rollstuhlkind mit ist, dann muss es natürlich auch rollstuhlgerecht sein, die Unterkunft, ja, die WC-Anlagen, oder so irgendwas. Also ich denk mir, man muss schon schauen, dass von vornherein einmal das Angebot diesbezüglich passt, nicht."
Eine Mutter war im Interview der Annahme, dass jedes Kind mit Behinderung in eine Gruppe integriert werden kann, solange die Rahmenbedingung dafür geschaffen werden und stimmen:
Frau O.: "Ich mein, es ist oft sehr unterschiedlich, aber ich denk mir, es müsste an und für sich bei jedem Kind funktionieren, ja, wenn... wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ja."
Andere befragte Elternteile machten die Möglichkeit der Integration von der Art und Schwere der Behinderung abhängig. So schien es einigen Eltern einfacher Kinder und Jugendliche mit leichteren Behinderungen im Freizeitbereich zu integrieren als schwerer behinderte Kinder und Jugendliche:
Frau N.: "Und es kommt auf die Behinderungsart darauf an. Viele haben noch nie mit behinderten Menschen zu tun gehabt, die können dann nicht mit behinderten Menschen, die einfach ihre Ticks haben, die einfach anders agieren bei manchen Sachen, die einfach... ja... schwierig... ganz schwierig. [...] Bei unserem Projekt hat sich das gezeigt, dass es bei manchen recht gut funktioniert. Da war so ein Bursche, aber das war auch so ein »Grenzfall« unter Anführungszeichen. Der hat eine ganz leichte Behinderung gehabt. Der ist bei der Feuerwehr dann gelandet. Die haben nach wie vor einmal in der Woche Zur-Feuerwehr-Gehen - kein Problem."
Von einer Mutter wurde es auch als vorteilhaft gesehen, wenn Integration im Freizeitbereich vereinzelt geschieht. Dies verringert in ihren Augen die Wahrscheinlichkeit einer Überforderung der betreuenden Personen und kann den Einstieg in eine Gruppe erleichtern:
Frau N.: "Wenn man es probiert hat einmal, vielleicht geht es vereinzelt, dass man einen Jugendlichen dann nämlich... das war immer unser Ziel: So Jugendliche vereinzelt [...] Aber wir können nicht fünfzehn Jugendliche mit Behinderung in eine Gruppe einfach dazustoßen lassen zu nicht-behinderten. Die sind überfordert damit, ja."
Wie diese Mutter ebenfalls anführt ist es auch wichtig, dass (vor allem in ländlichen Gebieten) Integration vor Ort stattfindet, damit Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung nicht lange Wegstrecken zurücklegen müssen, um an integrativen Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können. Eine Integration vor Ort hat den weiteren Vorteil, dass diese im direkten sozialen Umfeld stattfindet und die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung nicht aus ihrer sozialen Umgebung herausgerissen werden:
Frau N.: "[...] gerade in der Ortschaft... es soll einfach Integration vor Ort stattfinden -in der Ortschaft in eine Gruppe zu integrieren. [...] In seinem Ort, was uns immer wichtig war. Nicht irgendwo hinführen die Jugendlichen. Weil das ist ja wieder nicht vor Ort."
Frau O.: "[...] dass ich wirklich vor Ort jetzt die Möglichkeit habe, mein Kind dort unterzubringen, ja, wo... wo sie vielleicht hinwill, ja, dass sie nicht von wem, weiß ich nicht, in den 23. fahren muss, nur weil's dort grad zufällig was gibt [...]"
Vorraussetzung für Integration vor Ort ist, dass sich bestehende allgemeine Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung öffnen und ihre Struktur dahingehend verändern, dass auch diese Zielgruppe problemlos an den angebotenen Freizeitaktivitäten teilnehmen kann:
Frau O.: "Und das ist das, was ich mir eigentlich halt so vorstelle, ja, dass man in bestehenden Angeboten mehr oder weniger auch so irgendwie ein Struktur bilden könnte, wo halt ein Kind mit Behinderung mehr oder weniger problemlos mitmachen könnte, ja, oder rein kann und... und... Also das wär so halt dieser Wunschgedanke irgendwie. [...] sondern dass sich einfach die vorhandenen Angebote eben, also dass sich die Vereine, oder so weiter, dass sich die öffnen würden und sagen: OK, wir strukturieren so um, dass Kinder mit Behinderung da auch teilnehmen können."
Um bestehenden Freizeitangeboten notwendige Strukturveränderungen zu erleichtern wäre es hilfreich Unterstützung, Information und Beratung zum Thema Integration von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen anzubieten:
Frau O.: "Also eben, eh schon wie gesagt, ja, irgendwie würd ich ein... eher mich so an bestehende Vereine oder Angebote auch irgendwie wenden und ich denk mir, «...» vielleicht gibt's auch irgendwie so... so Möglichkeiten, sich irgendwie ein bissl zu informieren, auch Unterstützungsmöglichkeiten irgendwie anzubieten, weil ich denk mir, die sind ja auch irgendwie... ja, ich mein, sie wissen vielleicht... sie würden's vielleicht gern machen, aber sie wissen jetzt nicht unbedingt wie's geht und da denk ich mir, wenn's da einfach ein paar Leute gibt, die da hingehen und sagen, ok, so und so und so könnte das laufen, ja, und... [...]"
Einige Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher wären auch durchaus bereit Teile dieser Beratung und Unterstützung zu übernehmen. Für die Angebote wäre diese Zusammenarbeit mit Eltern eine kostengünstige Variante, um kompetente Informationen für eine Umstrukturierung in Richtung Integration behinderter TeilnehmerInnen zu erhalten:
Frau O.: "Ich mein, ich denk mir, ich kann's mir auch vorstellen, dass ich da hingeh und sag, ok, das und das und das könnt ma jetzt umstrukturieren und dann könnten sie sich wirklich öffnen für behinderte Kinder oder Jugendliche oder so. Also ich würd wirklich an bestehende Vereine herangehen und jetzt nicht wirklich irgendwie so eigene Strukturen bilden. Also das hätt ich... ich mein, das wär für mich so dieses um und auf irgendwie, ja, da eine Veränderung auch wirklich mit anzufangen."
Gelingt diese Umstrukturierung auf befriedigende Art und Weise, so birgt die Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in bezug auf Freizeitaktivitäten positive Aspekte für alle beteiligten. Einige dieser Aspekte werden nun im folgenden Unterkapitel angeführt.
Durch die Umstrukturierung von allgemeinen Freizeitangeboten in Richtung integrative Angebote entsteht für die Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung eine größere Auswahl an möglichen Freizeitaktivitäten. Diese größere Auswahl ist hilfreich dabei die Freizeit selbstbestimmt gestalten zu können:
Frau O.: "Also für mich geht's schon sehr wohl auch um die Auswahlmöglichkeiten, ja. Ich mein, das, denk ich mir, ist auch wichtig, um Selbstbestimmung überhaupt ausleben zu können, ja. Ich denk mir, ich hab ein breites Angebot und da kann ich auswählen, ja, wo... oder sie kann dann vielleicht später einmal auswählen, was sie möchte und... und nicht, ja, es gibt halt nur das und fertig und... Also für mich ist eine breite Palette irgendwie auch wichtig, Auswahlmöglichkeiten. Und ich denk mir, es gibt ja so viele bestehende Angebote schon und wenn man die ein bissi umstrukturiert, dann hat man schon von vornherein eine andere Auswahlmöglichkeit und sagt: »OK, ich will jetzt zwar kein Tenniscamp machen, aber ich will zum Beispiel irgendwie ein Reitcamp machen oder so irgendwas« und nicht nur jetzt gibt's nur Reitcamp und sonst gar nichts zum Beispiel."
Integration im Freizeitbereich beinhaltet nicht nur für als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendlichen Vorteile. Das Beisein von Personen mit Behinderung kann darüber hinaus für die ganze Gruppe als Bereicherung gelten. Somit bieten integrative Angebote die Möglichkeit, dass sowohl Menschen mit als auch Menschen ohne Behinderung von Gruppengeschehen profitieren. So werden Kontakte geknüpft, andere Lebensmodelle kennen gelernt und soziales Verhalten erlernt:
Frau O.: "Also man profitiert ja irgendwie von den Unterschiedlichkeiten, ja. Also ich denk mir, wenn irgendwie alle gleich sind, dann kann man nie so profitieren, als wie wenn sehr viele unterschiedliche Kinder zum Beispiel in einer Gruppe sind. Also jedes Kind ist irgendwie anders und man kann sich was abschaun davon, oder man muss vielleicht auch einmal eingehen auf eine Situation und ich denk mir, man lernt von den Unterschiedlichkeiten sicher mehr, als wie wenn eine Gruppe sehr gleich ist, ja. [...] Ich würd's als Bereicherung sehen. Ja genau. Also wenn einfach dieses Umfeld passt... [...]"
Herr S.: "Klar. Da lernen ja auch gesunde Kinder Sozialverhalten kennen."
Von einem Vater wurde Integration auch als Möglichkeit gesehen durch Abgabe von Aufgaben an nicht behinderte TeilnehmerInnen die PädagogInnen im Freizeitbereich zu entlasten:
Herr S.: "Der Vorteil von Integration ist, dass, wenn eine Gruppe von Kinder beinander ist, dann gibt's immer welche, die Verantwortung für andere übernehmen. Und das wär dann dieser natürliche Zyklus. Das heißt, du könntest riskieren, nicht mehr mit eins zu zwei fahren, sondern vielleicht sogar mit eins zu drei oder mit eins zu vier. Wenn du dementsprechend viele Kinder hast. Also bei so vierzehn-, fünfzehn-jährigen ist hundertprozentig einer dabei, der Verantwortung über einen schwächeren übernimmt."
Ein befragte Mutter berichtete von einem positiven Erlebnis in Richtung Integration ihrer geistig behinderten Tochter. Dabei hob sie die Selbstverständlichkeit hervor, mit der ihre Tochter in der Gruppe aufgenommen und in ihrem Sosein akzeptiert wurde:
Frau O.: "Und ich hab dann zwar «...» es war irgendwie so ein Turnen von einem Verein, wo meine Tochter ursprünglich gehen wollte, die dann gesagt haben, die Daniela kann jederzeit mitkommen, also das ist überhaupt kein Problem. Also das war irgendwie ganz selbstverständlich, ja, wo gar nicht viel gefragt worden ist, was mit ihr los ist, oder so. Und ich mein, es war das Glück, dass da zwei Betreuerinnen waren, die halt diese Kindergruppe betreut haben und... und... Also das hätte an und für sich gut funktioniert, aber es hat sich dann irgendwie verlaufen, weil meine Toch... meine andere Tochter nicht wollte und es war dann von der Zeit her nicht möglich. Aber ich denk mir, das war einmal so ein Angebot, wo ich mich irrsinnig gefreut hab, wo ich mir gedacht hab, ich muss da gar nicht viel erzählen und muss gar nicht viel fragen, sondern sie soll reinkommen, sie soll mitmachen und..."
Den positiven Aspekten in Verbindung mit Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher im Freizeitbereich stehen auch einige Problematiken gegenüber, auf die nun eingegangen wird.
Einige der befragten Eltern erzählten in den Interviews neben positiven Erlebnissen auch von einigen negativen Erlebnissen, die in Zusammenhang mit Integration ihrer Kinder mit geistiger Behinderung im Freizeitbereich gemacht wurden. Bei manchen Eltern waren auch die zuvor in Schule und Kindergarten gemachten Erfahrung mit Integration so abschreckend, dass sie erst gar nicht versucht haben ihr Kind im Freizeitbereich zu integrieren. Bei anderen Eltern scheiterte die Integration am mangelnden Interesse der nicht behinderten Bevölkerung:
Herr C.: "Er hat an nichts teilgenommen, weil wir da schon im Kindergarten gehört haben, dass er oft einmal nicht gscheit im selben Raum ist, geschweige denn dabei."
Frau O.: "Sie ist halt immer so mitgelaufen mit meiner jüngeren Tochter, ja. Es war eigentlich nie irgendwie möglich sie «...» punkto Freizeit auch irgendwo gemeinsam mit meiner nicht behinderten Tochter irgendwo unterzubringen. Ich mein, es war so: sie ist überall mitgefahren, ob's jetzt eine Ballettstunde war, wo sie am Anfang irgendwie hinein durfte, sich austoben durfte mit den Kindern. Aber wenn der Unterricht begonnen hat, wurde sie höflichst hinausgebeten, ja. Sie hat's irgendwie am Anfang nicht wirklich verstanden, aber gut, es war halt so, ja. ähm. Das war dann immer irgendwie so, ja. Sie durfte zwar ein bisschen hinein, aber halt nicht wirklich, ja."
Frau N.: "Und jetzt haben wir eben dann die Idee gehabt, dass wir einen Freizeittreff machen. Ursprünglich war auch gedacht ein integrativer Freizeittreff, was auch überhaupt schiefgelaufen ist, weil keine nicht-behinderten Jugendlichen zu einem integrativen Freizeittreff kommen."
In vielen Freizeitangeboten wurde somit laut Aussage der Eltern die Anwesenheit des geistig behinderten Kindes oder des Jugendlichen geduldet, aber von wirklicher Integration war diese Art des Umgangs mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen weit entfernt. Oft war es auch notwendig, dass die Eltern die Initiative ergriffen und selbst nach Möglichkeiten der Integration suchten:
Frau S.: "Ich bin mit dem Daniel gegangen und hab gefragt und sie haben ja gesagt."
Andere Eltern sahen in integrativen Freizeitangeboten keinen Nutzen für ihr Kind mit geistiger Behinderung:
Frau T.: "Also es sind so die Kleinigkeiten und der Michael hätte auch nichts davon und wie gesagt."
Manchmal ist es bei als integrativ angeschriebenen Freizeitangeboten der Fall, dass "Integration" als weitgehend inhaltsloses Schlagwort gebraucht bzw. in unbefriedigender Art und Weise an das Thema herangegangen wird. So wird einer wirklichen Integration von behinderten Menschen nur mangelhaft nachgegangen, wie ein Vater berichtete:
Herr S.: "Es kommt darauf an von welcher Richtung der Gedanke Integration kommt, was da dahintersteht. Weil da gibt's sehr wohl Ambitionen, wo wirklich der Behinderte genutzt wird quasi, damit der Normale, der auf Karriere hingezielt wird eigentlich, locker damit umgehen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass da wirklich im Sozialverhalten und in der Menschlichkeit was gelernt wird, sondern im rationalen Verhalten. [...] Integration ist zwar nur ein Wort, aber das geht von null bis hundert und da ist unheimlich viel Möglichkeit drinnen. [...] Da muss man unserem Staat ein Armutszeugnis aussprechen, weil einfach der Bedarf überhaupt nicht abgedeckt wird und weil überhaupt kein Interesse besteht diesen Bedarf abzudecken beziehungsweise dafür allzu viel Geld auszugeben."
Ein weiteres Problem, das bei der Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher im Freizeitbereich entsteht, stellt der höhere Betreuungsaufwand dar, der durch die Teilnahme behinderter Menschen entsteht und für viele Angebote schwer abzudecken ist. Auf der einen Seite kann ein zu geringer Betreuerschlüssel in diesem Zusammenhang schnell zu einer Überforderung des betreuenden Personals führen. Auf der anderen Seite bedeutet eine höhere Anzahl an MitarbeiterInnen für die Freizeitangebote höhere finanzielle Kosten, die das Budget von so manchem Angebot übersteigen. Es stellt sich hier also eine schwer zu lösende Problematik:
Frau S.: "[...] man hat halt einen Betreuer gehabt und dann wäre er mitgefahren mit den K.. Aber du brauchst dann wen und das ist auch dort dann nicht mehr so gegangen, weil du brauchst wen, der ein bissi schaut, was er tut. Und wenn er dann auch nicht mitkommt dann in diese, dann fangt er ja auch zum Stören an und zum Sekkieren. Das habe ich auch gesehen."
Frau O.: "Ich mein, ich hab auch einmal versucht in der Volksschule in der selben Gasse mit einem Hortbetrieb und die Daniela ist dort nicht in die Volksschule gegangen, sondern sie ist in S. in die Volksschule gegangen. Und die haben da einen wunderschönen Garten, ja, mit vielen Schaukeln und so. Und wir sind da oft vorbeigegangen und sie hätt da so gern hineinwollen und ich hab mir gedacht, so in den großen Ferien, wo halt auch Betrieb ist, ja, wo aber nicht soviel los ist, und... und da hab ich mir gedacht, es wär irgendwie ganz nett, wenn sie da so zwei, drei Stunden am Tag so reinschnuppern dürfte, oder auch vielleicht zwei Mal in der Woche... ähm... da mitspielen dürfte, oder so. Und ich hab mich dann erkundigt auch «...» bei der Gemeinde Wien und so und es war halt... es war absolut nicht möglich, ja. Also... [...] Na ja, es ist von der Betreuung her im Sommer sowieso also ein reduzierter Stand da und... Also sie haben sie da irgendwie sehr, sehr abgeputzt, ja, und es war einfach grundsätzlich nicht möglich."
Frau N.: "Man kann es vielleicht so machen, wie gesagt, es gibt dort einen Jugendtreff und wir schauen, dass wir ein, zwei Jugendliche mit einer Behinderung dort einbeziehen - so wie in einer Integrationsklasse. Aber wir können nicht fünfzehn Jugendliche mit Behinderung in eine Gruppe einfach dazustoßen lassen zu nicht-behinderten. Die sind überfordert damit, ja."
Frau O.: "[...] dass ich einfach die vorhandenen Angebote eben, also dass sich die Vereine, oder so weiter, dass sich die öffnen würden und sagen: ok, wir strukturieren so um, dass Kinder mit Behinderung da auch teilnehmen können. Ich mein, ist natürlich eine finanzielle Frage. Ich glaub, an dem scheitert's halt irgendwie meistens."
In den durchgeführten Interviews kam ebenfalls die Problematik zu Tage, dass bei integrativen Angeboten oft eine Selektion der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit Behinderung stattfindet. Es werden häufig leichter behinderte TeilnehmerInnen eher in das Angebot aufgenommen als schwerer behinderte InteressentInnen:
Frau S.: "Da haben sie ihn dann nicht genommen. Da hab ich auch eingereicht und da musst du halt eine Beschreibung schicken und die passen dann auch die Kinder irgendwie an. «...» und da ist ein Rollstuhlkind zum Teil leichter als er. Der lauft ja nicht weg."
Frau O.: "[...] dann ist es oft so, dass ma halt vielleicht auch einmal Kinder nimmt, die «...» jetzt sag ma mal unter Anführungszeichen, »nicht so behindert« sind, ja."
Im Gruppengeschehen können auch Hindernisse und Barrieren entstehen, die eine Integration von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen erschweren. So wird die Teilnahme dieser Personengruppe manchmal als Störung bei gewissen Freizeitaktivitäten gesehen, die von dieser Gruppe nicht so problemlos durchgeführt werden kann wie von nicht behinderten TeilnehmerInnen:
Frau T.: "Allein wenn die bei einem Ausflug alle laufen und Dings und dann hinten nach. Der Michael kann nicht sehr schnell gehen, er würde die ganze Gruppe aufhalten «...» zum Beispiel."
Auch Konkurrenzverhalten und Lagerbildung können eine Integration geistig behinderter Jugendlicher erschweren. Dies geschieht laut einem Vater oft in Gruppen von pubertierenden Jugendlichen. Die Einschränkungen, die durch die Behinderung entstehen, können in diesen Situationen zum Nachteil der Betroffenen auf unangenehme Weise in den Mittelpunkt gestellt werden. Dies führt im Regelfall eher zu einer Ausgrenzung als zu einer Integration:
Herr C.: "Das hört sich dann auch oft auf mit der Pubertät in den Integrationsklassen, wo dann wirklich beinhart gespielt wird: du hast ja nur zwei Streifen auf der Hose und ich hab drei. Aus diesem Ansatz. Man hat ja gelernt mit Behinderten umzugehen in solchen Klassen über die Jahre, aber das ist dann noch der zusätzliche Aufhänger in der Pubertät, wo geschaut wird, wer hat das schönere Gewand und diese Gruppenbildung eben. Irgendwo hört sich die Integration auf aus dem, wie der Mensch ist. Kinder sind gnadenlos. Vielleicht funktioniert's unter der Stunde, aber in der Pause ist es dann aus. Es ist einfach ein Ausprobieren, wie könnten die Regeln in unserer Gruppe sein und da haben die Behinderten schlechtere Karten."
Ein weiterer erschwerender Faktor im Jugendalter ist, dass hier meist der Entwicklungsniveauunterschied zu nicht behinderten Gleichaltrigen, der durch die häufige Entwicklungsverzögerung bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung entsteht, immer mehr zu tragen kommt. Dadurch bedingt weichen Interessen und Vorlieben immer weiter voneinander ab und eine gemeinsame Freizeitgestaltung von gleichaltrigen Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung wird zunehmend schwieriger:
Frau S.: "Er kann nicht mitlernen. [...] Und dort waren immer die Kinder und er war von Anfang an eigentlich in Kindergruppen dabei. Jetzt war das für mich dann schon irgendwie, wo ich gesagt hab: da hat er eh erstens einmal schon viele Kinder immer, aber es ist immer schwieriger geworden. Es ist immer komplizierter geworden. Die Kinder spielen und die Kinder machen... Er konnte bei so vielen Sachen nicht mitmachen. Es wird wirklich schwieriger. Also ich hab schon gesagt, man muss schon... es wird wirklich schwer mit ihm. Es ist einfach so, dass die Schere dann doch auseinander geht. Also ich hab das dann so erlebt."
Die Integration von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich sieht sich noch weiteren Barrieren gegenüber. So herrscht in der nicht behinderten Bevölkerung oft ein Mangel an Interesse, was die Integration geistig behinderter Menschen im Freizeitbereich betrifft. Des weiteren scheitert Integration nach Aussagen einiger Eltern auch häufig an mangelnden Kompetenzen der betreuenden Personen oder an deren Angst Verantwortung zu übernehmen. Dies geht oft mit Berührungsängsten gegenüber behinderten Menschen einher. Auf der anderen Seite verhindern zeitweise verschiedene Ängste der Eltern eine befriedigende Integration ihrer Kinder mit geistiger Behinderung. Barrieren bei der Kontaktaufnahme können sich ebenfalls negativ auf die Integration auswirken. Daher ist häufig massive Initiative und Einbringung von Seiten der Eltern oder von FreizeitassistentInnen notwendig , damit Integration im Freizeitbereich stattfindet:
Frau N.: "Also an und für sich, bevor wir zum Beispiel den Jugendtreff hatten, gab es kein Freizeitangebot. In unserer Region gibt es kein Freizeitangebot für behinderte Jugendliche. Wir sind draufgekommen durch unser Projekt, dass wir einfach... also dass sich einfach die Jugendlichen mit Behinderung entweder selbst einbringen müssen. Von sich aus kommt niemand und sagt: »wir nehmen jemand, der auch eine Behinderung hat«. Das habe ich nicht mitgekriegt. Was auch sehr schwer ist, auch wenn sich die Jugendlichen... die tun sich auch schwer, dass sie sich anbieten, sag ich auch einmal. Wie sollen sie sich auch anbieten, ja? Sie haben ja keine Ahnung was dort passiert in einem Freizeittreff oder in ein... Also wir haben sehr viele Jugendliche gehabt, die wollten gerne zur katholischen Jugend, die wollten zur Feuerwehr, etc. Diese Leute bei diesen Organisationen waren dadurch heillos überfordert, weil sie einfach mit denen nicht zu tun gehabt haben. Jetzt haben wir aber gesagt... ein bisschen organisiert auch, dass die Assistenten eventuell den Jugendlichen ein bisschen einbringen. Eltern tun sich auch sehr schwer. Die müssen immer für ihre Jugendlichen reden, kämpfen. Dann wollen sie einfach in der Freizeit nicht auch noch. Und außerdem haben sie dann Ängste: Wie wird das dort sein? Und jetzt dann drück ich den Jugendlichen denen aufs Auge auf deutsch gesagt ((lacht)). Was kriegt er jetzt damit, ja? [...] Viele haben noch nie mit behinderten Menschen zu tun gehabt, die können dann nicht mit behinderten Menschen, die einfach ihre Ticks haben, die einfach anders agieren bei manchen Sachen, die einfach... ja... schwierig... ganz schwierig. [...] von die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen können sich die wenigsten so richtig gut einbringen."
Frau O.: "Wegen zusätzlicher Betreuung, ja. «...» Also das war immer irgendwie ein Problem. Ich denk mir, so Kinder... Angebote für Kinder sind überhaupt oft... Also ich glaub, das macht... das traun sich auch nicht sehr viele zu, hab ich irgendwie rausbekommen, weil behinderte Kinder irgendwie so ein eigenes Klientel sind, wo halt auch viel passieren kann, ja, und es gibt auch nicht sehr viele, die wirklich mit Kindern erstens einmal gut umgehen können und die auch wirklich mit Kindern was machen und... «...»"
Eine Mutter berichtete im Interview, dass Integration von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich häufig an vielen Kleinigkeiten scheitere, die in Planung, Organisation und Durchführung nicht berücksichtig werden:
Frau T.: "Also es sind so die Kleinigkeiten und der Michael hätte auch nichts davon und wie gesagt."
Manche Eltern brachten zur Sprache, dass es notwendig sei, neben integrativen Freizeitangeboten auch Angebote zur Verfügung zu stellen, die speziell auf Kinder mit Behinderung zugeschnitten und ausgerichtet sind. Dies wurde damit argumentiert, dass behinderte Menschen manchmal vielleicht ganz gerne unter sich sind, da sie sich in integrativen Gruppen häufig als die Schwächsten wahrnehmen. Daher kann sich eine entweder dem behinderten Menschen oder dem Freizeitangebot aufgezwungene Integration, die sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung richtet, dementsprechend negativ auf die Betroffenen auswirken:
Frau O.: "Also ich mein, «...» ich seh's manchmal schon auch so, dass jetzt so «...» die behinderten Menschen, dass das vielleicht auch so eine eigene Kultur vielleicht auch ist, ja, die vielleicht auch ganz gern unter sich sein wollen, ja. So wie, weiß ich nicht, Harley-Davidson-Fahrer, oder keine Ahnung, irgend so was, ja. ((lacht)) Dass sie vielleicht schon auch sehr wohl ganz gern unter sich sind. Also ich seh's jetzt nicht unbedingt so als Nachteil, wenn jetzt so eine Gruppe mit behinderten Kindern jetzt irgendwie unterwegs ist."
Frau N.: "Und jetzt dann drück ich den Jugendlichen denen aufs Auge auf deutsch gesagt ((lacht))."
Frau T.: "Ich bin jetzt nicht primär ein Verfechter der Integration, weil der Michael so schwerst behindert ist, dass es weder den anderen Kindern, noch dem Paul etwas bringt rasend viel zu integrieren. Also es kann durchaus auch Sachen geben, die sie auch gemeinsam machen, aber ich bin nicht für Integration um jeden Preis. Und das ist das, was von Politikern im Moment angestrebt wird. Sie wollen alle integrieren und haben überhaupt kein Gefühl dafür, dass das für unsere Kinder nicht das beste ist, irgendwo immer mitlaufen zu müssen, immer die Schwächsten zu sein in einer Gruppe, immer irgendwo hintendran gehängt zu sein [...]"
Mit dem Hintergrund der Aussagen der Eltern zur Freizeitgestaltung und zur Integration ihrer Kinder mit geistiger Behinderung im Freizeitbereich wird nun im nächsten Kapitel die Thematik der Ferienangebote angesprochen.
Im letzten Kapitel der Auswertung der Eltern-Interviews werden nun die Aussagen der Eltern zu Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung näher betrachtet. Ferienangebote stellen eine spezifische Form von Freizeitangeboten dar. Deshalb werden hier auch Ausführungen zu Freizeitangeboten allgemein berücksichtigt und behandelt, sofern sie auch für Ferienangebote relevant sind. Die in den Interviews gewonnenen Information zur dieser Thematik wurden in vier Gruppen unterteilt: in positive Aspekte von Ferienangeboten, in Ansprüche an Ferienangebote, in Problematiken bei Ferienangeboten und in Erreichbarkeit von bzw. Kontaktaufnahme mit Ferienangeboten. Diese vier Gruppen stellen auch die nun folgenden Unterkapitel dar.
Ferienangebote wurden von vielen der befragten Eltern als eine Möglichkeit für ihr geistig behindertes Kind gesehen Sozialkontakte zu knüpfen und soziale Kompetenzen zu erwerben:
Frau S.: "Und darum ist es mir so wichtig, dass er irgendwie so zu seinen Leuten kommt, dass diese Freizeitgruppe wirklich bleibt, dass die... Die sind irgendwie miteinander schon so groß geworden."
Herr C.: "Also ist an und für sich sehr wichtig, weil Kinder, egal welche, nicht ausschließlich zu Hause, sondern auch unter ihres-und seinesgleichen, Gleichaltrigen sein sollen. Darum ist es sehr wichtig. Wo dann vielleicht auch ganz andere Grundregeln passieren, nämlich so wie sie sich grad ergeben in der jeweiligen Gruppe, wie's da ausgemacht wird, wie's in der Kommunikation... Jede Gruppe hat eine andere Dynamik und die ist mit denselben Leuten in zwei Wochen wieder ein bissl anders. (...) Die Interaktionund in unserem Fall wieder, was von Anfang an sehr wichtig war, die Übung, dass Personen, die man halt mag oder nicht mag, dass das immer wieder wechseln kann. Das Anpassen an neue Gruppen. Hineinfinden in neue Gruppen. [...] Dass der Robert Freunde und alte Bekannte trifft, neue vielleicht kennen lernt."
Über das Knüpfen von Sozialkontakten hinaus wurden von einigen Eltern auch die Bedeutung von Ferienangeboten für die Weiterentwicklung der Selbständigkeit ihrer Kinder betont. So wurden Ferienangebote als eine Gelegenheit gesehen neue Eindrücke zu gewinnen und neue Vorlieben zu entdecken, was sich positiv auf das eigenständige Handeln und die damit in Verbindung stehenden Kompetenzen auswirkt. Voraussetzung dafür ist, dass in der Gestaltung der Ferienangebote eine gewisse Abwechslung geboten wird:
Frau O.: "Ich mein, sie war voriges Jahr das erste Mal weg auf Schullandwoche, wo sie wirklich ganz alleine weg war. Das hat gut funktioniert. Aber das war halt einfach der erste Schritt halt, wo ich mir gedacht hab, ja, das tut ihr auch gut. Auch für die Selbstständigkeit ist das irgendwie wichtig, ja."
Herr C.: "Dass was los ist. Abwechslung, vielleicht auch draußen. Auch wenn das dann nicht in Bewegung ist, so wie am H. auf einem Grundstück. Dass er dann vielleicht auch draufkommt, dass Sachen auch recht nett sind, die er zu Hause so mit den Eltern nicht macht, so wie ins Wasser gehen. [...] Dass wir ihm möglichst ein bissi eine Abwechslung bieten. Das eine ist dann verwickelt mit Koffer packen und, nach G. bringen wir in selber, weit mit dem Auto fahren oder mit einem Bus, wie's dann in K. ist, dass das da möglichst vom Ablauf verschieden ist."
Als weiteren positiven Aspekt von Ferienangeboten führten viele Eltern an, dass sie die Unterbringung ihrer Kinder mit geistiger Behinderung bei Ferienangeboten als Entlastung empfinden. Besucht ihr Kind ein Ferienangebot, so bedeutet es für sie eine zeitliche Entlastung und auch eine Entlastung bezüglich ihrer persönlichen Ressourcen. Diese Erleichterung kann unter Umständen auch dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung länger im familiären Haushalt bleiben können und nicht an institutionelle Einrichtungen abgegeben werden müssen. Des weiteren können durch die Unterbringung des Kindes mit geistiger Behinderung in Ferienangeboten zeitliche Ressourcen bei den Eltern frei werden, die etwaigen Geschwisterkindern gewidmet werden können:
Frau T.: "Für mich persönlich eine ungemeine Entlastung und ohne die würde ich es nicht schaffen. Das ist wirklich so, dass ohne diese zusätzlichen Teilentlastungen... Vor drei, vier Jahren war ich soweit, dass ich mir gedacht hab, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's zu Hause einfach nicht mehr. Da war er noch nicht im Internat. Und da war dann die Frage, ob ich ihn ins Heim geb. Ich mein, noch nicht ganz, weil da war er erst elf oder zwölf. Für mich zu jung. Aber im Prinzip war's so »Was mach ich? Zu Hause geht's nicht mehr.« und mit der Teilzeitentlastung geht's zu Hause. (...) Und ich sag, deswegen sind diese so wahnsinnig wichtig, weil die Kinder viel länger zu Hause bleiben können, weil wir unsere Energien aufteilen. [...] Bei mir ist es die zeitliche Entlastung, weil ich neun Wochen drinnen hab und bei der Frau
L. ganz spezifisch auch noch das Ferienprogramm. Nicht nur dass sie jetzt betreut ist, fremdbetreut ist, sondern dass sie wirklich dieses Ferienprogramm hat."
Frau O.: "Ja, und deswegen ist es immer in den Ferien... ich mein... Irgendwie denk ich mir, es wär schon auch ganz gut, so auch in bezug auf die Geschwisterkinder, ich mein, dass ma mal vielleicht auch in Ruhe was mit den anderen unternehmen könnte, jetzt speziell einmal mit der jüngeren Schwester, ja. Ich mein so Ausflüge und so, wo sie dann vielleicht einmal so eine Woche nicht da wäre, ja."
Die befragten Eltern wurden in des Interviews auch zu Ansprüchen befragt, die sie an Ferienangebote stellen. Auf die Aussagen der Eltern in diesem Zusammenhang wird nun näher eingegangen:
Viele der befragten Eltern sahen Ferienangebote als ein Stück Normalität, das auch ihrem als "geistig behindert" bezeichneten Kind zur Verfügung stehen sollte. Somit soll im Rahmen dieser Angebote auch ihnen das Recht auf Ferien gegeben werden, die sich vom sonstigen Alltag abheben. Die durch Angebote gewonnene Abwechslung in den Schulferien wurde von Eltern als durchaus positiv und förderlich für das Kind eingestuft. Als vorteilhaft wurden auch Freizeitaktivitäten abseits der Eltern mit jüngeren BegleiterInnen bewertet, die im Rahmen dieser Angebote stattfinden:
Frau T.: "[...] am H. wird echt Ferien gemacht und spezielles Programm und Kugelbad und Wasser plantschen und Schwimmen gehen und mit der Straßenbahn fahren und wirklich Spaß gemacht und ein Unterschied zum Alltag und das spürt er auch."
Frau S.: "Ich geh mit ihm spazieren und das und so. Aber dann so... Man macht was anderes. Das so Rumblödeln oder so irgendwas, das braucht er, er ist siebzehn. Er braucht wen in seinem Alter und ein bissl, aber er braucht nicht mich und so irgendwie. Uns auch, ja. Aber er braucht das andere auch. [...] ich mag halt, dass er mit jüngeren Leuten was tut."
Frau N.: "Das, was für mich dann wichtig ist, ist dass das Jugendliche sind, die... die einfach andere Sachen machen mit den beiden, die mir nicht viel Spaß machen. Oder einfach anders agieren wie ich. Ich bin die Mutter. Ich gib immer vor und ich bin erzieherisch tätig sozusagen ((lacht)) und das ist einfach irgendwie anders dann. Was... was ja auch Spaß machen soll."
Frau T.: "Er war jetzt auf Projekttagen auch mit der Schule, dass er auch auf Projekttage fährt und auch ein Ferienlager hat. Das ist auch für die Geschwister so wichtig, dass da auch etwas ist, was ihm Spaß macht, das so ein bisschen mit der Normalität verbindet."
Freizeitaktivitäten im Rahmen der Ferienangebote sollten nach den Bedürfnissen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ausgerichtet werden. Zwang sollte laut Aussagen der Eltern vermieden und Offenheit bei den Aktivitäten gefördert werden. Viele der befragten Eltern hoben eine gute Ermöglichung von Selbstbestimmung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen als einen wichtigen Anspruch an Ferienangeboten hervor. Dies beinhaltet eine gewisse Auswahlmöglichkeiten bei den Aktivitäten zu stellen, was dazu beiträgt, dass die TeilnehmerInnen nach den eigenen Interessen entscheiden können und somit auch mehr Abwechslung in der Gestaltung haben:
Frau O.: "Für mich wär so ein bissl Selbstbestimmung halt schon wichtig, ja, wo sie selber auch entscheiden kann, das oder das will ich machen, ja. Ich mein... Oder wo man halt irgendwie so einen Zugang findet, um auch herauszufinden, was macht ihr Spaß, ja. Also und nicht darüber bestimmt, »ok, du machst jetzt das und das und das« und fertig, sondern wo sie mehr oder weniger sagen kann, ok, halt so auf ihre Art, wie sie's halt irgendwie auch mitteilen kann, »das will ich jetzt gern machen«, ja. [...] Also für mich geht's schon sehr wohl auch um die Auswahlmöglichkeiten, ja. Ich mein, das, denk ich mir, ist auch wichtig, um Selbstbestimmung überhaupt ausleben zu können, ja. Ich denk mir, ich hab ein breites Angebot und da kann ich auswählen, ja, wo... oder sie kann dann vielleicht später einmal auswählen, was sie möchte und... und nicht, ja, es gibt halt nur das und fertig und... Also für mich ist eine breite Palette irgendwie auch wichtig, Auswahlmöglichkeiten."
Frau S.: "Es reicht ihm oft nur, dass er dabei ist. Er tut dann bei den Sachen gar nicht mit, aber das Da-bei-Sein ist schon... [...] Und wenn ihn wer lasst, dann ist er draußen und wen wer sich die Mühe macht ihn so immer ein Stück hineinzuholen, aber ihn auch immer wieder gehen lasst, weil sonst ist er ja fertig.[...] Überfordert [...]"
Herr C.: "[... ]deswegen hamma da auch so möglichst unterbrochen, dass ma sagt, da H. zwei Wochen. Es wäre ihm sonst wahrscheinlich... Ich kann immer nur Mutmaßungen anstellen, weil er redet ja nichts. ((lacht)) Dass wir ihm möglichst ein bissi eine Abwechslung bieten."
Durch besondere Bedürfnisse dieser Zielgruppe ist es auch notwendig das Programm von Ferienangeboten auf diese Bedürfnisse einzustellen. Somit ist es nach den Aussagen einer Mutter als nötig anzusehen, neben den Gruppenaktivitäten auch spezielle Aktivitäten für TeilnehmerInnen anzubieten, die aus verschiedenen Gründen am Gruppengeschehen nicht teilnehmen können oder wollen:
Frau S.: "Wenn er gebaut hat so Sachen, dann hat er total alleine für sich gebaut. Wenn sich der Daniel dazugesetzt hat und einmal mittun wollte, dann ist der Markus weggegangen. [...] Also es gibt, glaub ich, schon Sachen, wo man so miteinander tun kann. Aber es gibt Sachen, wo er's gar nicht kann, denk ich mir."
Ein weiterer Anspruch, den befragte Eltern an Ferienangebote stellten, war, dass die MitarbeiterInnen des Angebots fachspezifisch geschult sein sollten und motiviert an ihre Aufgabe herantreten sollten. Es war ihnen in dieser Hinsicht wichtig, dass das Personal aufmerksam mit den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen umgeht und auf aufmerksame Weise auch Gefahrenquellen identifizieren und dadurch Unfälle verhindern kann:
Frau S.: "Natürlich: man muss schauen, weil er auch gerne anschaut und so. [...] bin ich mir sicher, dass du mehr den Markus im Auge behalten musst. Dass die anderen mehr bei dir bleiben, aber er auf die Sachen so fixiert ist, dass er dich vergisst und dann ist er weg. [...] Und da braucht man wen, der geschult ist und das will. [...] man hat immer irgendwie dieses Schauen."
Herr C.: "Weil ich denk mir, eine Person, die mit einer anderen Jugendgruppe fährt, die sind zwar genauso gefordert, weil sie auf der anderen Seite viel mehr haben wahrscheinlich, Jugendliche zu beaufsichtigen, aber das ist einfach anders. Da macht's auch nichts, wenn man... weil da passt das Kind ja eh auf sich selber auf, so quasi. Aber da muss man schaun."
Ein ebenfalls wichtiger Punkt, der von den Eltern angesprochen wurde, war das Vertrauen in die MitarbeiterInnen von Ferienangeboten. Viele Eltern sind sich des erhöhten Betreuungsaufwands und des erhöhten Gefahrenpotentials bei ihrem Kind mit geistiger Behinderung bewusst. Gerade deshalb ist es für die Eltern von großer Bedeutung Vertrauen in das Angebot zu haben, an das sie ihr Kind abgeben. Sie wollen ihr Kind gut aufgehoben wissen. Als hilfreiche Methoden um dieses Vertrauen zu gewinnen wurde von einigen Eltern Kennenlernrunden und die Teilnahme an vorausgehenden persönlichen Gespräche angeführt. Diese tragen dazu bei Trennungsängste bei der Eltern zu lindern. Als weiteres Argument für die Wichtigkeit des Vertrauens in die MitarbeiterInnen wurde von befragten Eltern angegeben, dass sich ihre Kinder mit geistiger Behinderung nur schwer äußern können und dadurch auch nur schwer über etwaige Missstände bzw. Unstimmigkeiten berichten können. Aus diesem Grund ist ein gewisses Vertrauen in das Ferienangebot unabdingbar:
Herr S.: "Ich war beim Vorstellungsabend, weil da warst du nicht da in dieser Zeit und da habe ich schon mit dem Betreuer gesprochen, zu dem der Markus gekommen ist. [...] Weil da hat der Kontakt stattgefunden. Weil da hat man geschaut und so und dann hab ich mir gedacht: der ist geeignet. Dann bin ich mit dem Markus hingegangen und hab sofort gesehen die zwei können miteinander. Und der hat sich dann auch bemüht darum, dass der Markus in seine Gruppe gekommen ist und das ist dann alles so gelaufen. Also das hat gepasst."
Frau S.: "Das ist sicher ein Punkt, ganz sicher. Und der zweite Punkt ist, was auch Eltern sagen, und das sag ich auch. Das ist ein gutes Wort, das immer gesagt wird: »lasst's los«, aber man weiß oft wirklich nicht wohin loslassen. [...] Auch, weil nur einfach loslassen tust auch nicht. Also das ist etwas, das musst dir schon gut anschauen und eben da tut einem wieder gut dieses... Aber es ist ein schwerer Prozess immer wieder für einen Menschen. Wie geht's dem dann und so. [...] Da musst auch ein bissl irgendwie die Leute kennenlernen und ein bissl vorhergehendes Vertrauen brauchst auch und das ist... Ich hab mir oft immer nur gedacht: Wenn er's dann nicht... Erstens hab ich... Oft hab ich mir gedacht: Vielleicht ist jemand nicht nett zu ihm. Er kann mir's ja nicht sagen. Er kann mir's ja gar nicht erzählen. Manche Kinder drücken es dann schon irgendwie aus, ja. Oder er kann nicht richtig sagen, was irgendwie ist. Oder wenn er heim will."
Herr C.: "In erster Linie das, dass wir wissen, dass er quasi gut aufgehoben ist. [...] das ist eigentlich das wichtigste, weil er selber kann ja nicht sagen »so, ich geh jetzt« oder »mir gefallt's nimmer« oder irgendwas sagen, wenn was schreckliches passiert ist. Das Grundvertrauen ist eigentlich das wichtigste bei einem Kind, das geistig und mehrfach und in dieser Art und Weise behindert ist. [...] Nachdem das eine sehr abstrakte Sache ist, es müsste so sein, das muss einfach vor der ersten Inanspruchnahme in einem persönlichen Gespräch... Das muss man spüren und dann vielleicht nach dem ersten Stattfinden gespürt wieder zurückkommen. [...] Weil ich gesagt hab, das Vertrauen muss da sein. Das muss man spüren beim ersten Gespräch."
Werden von einem Ferienangebot die in diesem Kapitel angeführten Ansprüche der Eltern berücksichtigt, so erhöht das die Qualität und Benutzerfreundlichkeit des Angebots. Natürlich treten beim Eingehen auf diese Ansprüche auch zeitweise Probleme auf. Auf diese Probleme und auch auf andere Problematiken, die in Zusammenhang mit Ferienangeboten für als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche entstehen können, wird nun im nächsten Kapitel näher eingegangen.
Ein generelles Problem, das von vielen der befragten Eltern angeführt wurde, ist die mangelnde Auswahl an Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Im Gegensatz zu Ferienangeboten für nicht behinderte Kinder und Jugendliche schien es für viele Eltern besonders schwierig Ferienangebote zu finden, an denen auch ihre Kinder mit geistiger Behinderung problemlos teilnehmen können. Von einigen InterviewpartnerInnen wurde angegeben, dass als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche in diesem Bereich noch viel zu wenig Beachtung fänden. Vor allem für Familien aus ländlichen Gebieten stellte sich die Problematik, dass dementsprechende Angebote fast ausschließlich in Ballungsräumen angeboten werden und somit für sie nur schwer erreichbar sind. Auch ein Mangel an Ferienangeboten über die Schulpflicht hinaus und ein Mangel an mehrtägigen Ferienangeboten wurden ebenfalls beklagt:
Herr C.: "Die Angebote sind eh spärlich, wenn man jetzt sagt, zu wem kann man gehen. [...] Wenn man Standardangebote, die billig sind und für jedermann erreichbar, ist es wahrscheinlich mit einem geistig nicht behinderten Kind einfacher [...]"
Frau N.: "Hat es natürlich nicht allzu viel gegeben [...]das Problem ist halt, dass das alles dann altersbegrenzt ist. [...] Und ich denke mir, auch wenn sie in einem Tagesheim sind, auch wenn sie dann nur Urlaub haben ein paar Wochen. Trotzdem wäre es nicht schlecht jetzt für die Selbstständigkeit, dass sie dann trotzdem mit anderen Organisationen noch mitfahren könnten. [...] Ich würde mir wünschen eine Organisation, die auch Ferienangebote über 18 anbietet. Und wenn es nur eine Woche im Jahr ist."
Frau S.: "Eine Woche und das haben wir auch voriges Jahr gehabt. Und was hat er den Ferien noch einmal gehabt? Ein Mal in der W., wie er geschnuppert hat, und sonst weiß ich nichts, wo er weggefahren ist in den Ferien. Da hat's nichts gegeben. [...] Es sind schon Mitteilungen gekommen «...» in Wien. In K. gibt's nichts. In Niederösterreich ist da gar nichts. Also nur was die V. anbietet."
Weitere Schwierigkeiten die bei Ferienangeboten für geistig behinderte Kinder und Jugendliche auftreten können, sind mit Trennungsängsten der Eltern und mangelndem Vertrauen der Eltern in die MitarbeiterInnen eines Angebots verbunden. Bei manchen der befragten Eltern führten Missverständnisse, Versäumnisse und Zurückhaltung von Informationen von Seiten verschiedener Ferienangebote dazu, dass sie nur schwer Vertauen in weitere Angebote fassen konnten. Trennungsängste sind besonders bei Eltern von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen relevant, da hier durch den hohen Betreuungsaufwand häufig eine starke Bindung gegeben ist, die manche Eltern nur schwer lösen können. Weiters können auch Schwierigkeiten des Kindes bei der Einfügung in eine Gruppe das Loslassen der Eltern erschweren:
Frau C.: "Es war auch schwierig im Nachhinein dort irgendetwas zu erfahren. Wie sie nach Hause gekommen sind. [...] Das war für uns dann erledigt. Wir haben ihn nie wieder mitgeschickt. Das Vertrauen war aus."
Frau N.: "[...] ich weiß ja nicht, ob ich sie früher irgendwo mitschicken hätte können, ob sie schon... ob ich schon loslassen hätte können - das ist auch schwierig. Das Vertrauen in jemanden zu setzten ist auch schwierig dann, der mein Kind eigentlich Tag und Nacht übernimmt. Da tue ich mir immer schwer... also jetzt nicht mehr, aber bis vor drei, vier Jahren habe ich mir da sehr schwer getan, muss ich sagen."
Herr S.: "Meistens haben ja die Mütter mehr Probleme mit Loslösungsprozessen als die Kinder. [...] Dass das Loslassen für die Mütter oft viel komplizierter ist, als es für das Kind ist, wegzufahren."
Frau O.: "Ja, also zumindest einmal vielleicht halt tageweise zu Beginn. Nicht jetzt wirklich ein Wochemit Übernachtung. Weiß ich nicht, weil ich denk mir, mit der Schule ist es doch was anderes, wo sie die Kinder kennt, wo sie die Lehrerin kennt, als wie, wenn ich sie jetzt mit einer Gruppe vielleicht mitschick, wo sie gar niemanden kennt. Vielleicht schafft sie das auch. Ich mein, man unterschätzt ja oft die Kinder irgendwie, ja. Gerade als Elternteil traut man ihnen, glaub ich, viel viel weniger zu ((lacht)), als sie eigentlich können würden [...]"
Frau S.: "Die haben viele klasse Sachen gemacht, aber das war für den Markus damals noch schwierig. Eben dieses immer mit der Gruppe. [...] Es ist nicht so leicht mit ihm eine Gruppengeschichte zu machen, weil er dann bei Sachen, wo man dann miteinander... er sich was eigenes sucht."
Frau C.: "Und das er sehr schwer in der Gruppe zu integrieren war, dass es ihm quasi zu viel war in der Gruppe. Und da haben wir dann sehr große Bedenken gehabt und wollten ihn das nächste Mal gar nicht mehr mitschicken."
Probleme in Organisation und Struktur können sich ebenfalls negativ auf Ferienangebote auswirken, wie einige der befragten Eltern schildern:
Frau T.: "An der Struktur. Weil ich weiß nicht warum die Stadt Wien lieber ganz viel Geld für eine Vollzeitunterbringung ausgibt und nicht ein bissi Geld für eine Kurzzeitunterbringung. Das ist einfach noch nicht im Kopf drinnen. So wie Spitalsaufenthalte werden gezahlt, wenn man dort übernachtet. Wenn man heimgeht und das ambulant macht die gleichen Behandlungen, wenn man täglich dorthin geht und seine Infusion kriegt oder was auch immer, dann wird's nicht gezahlt. Ich mein, das ist einfach in ihrem Kopf noch falsch programmiert, obwohl das andere wesentlich billiger wäre. [...] Wesentlich mehr finanziell zur Verfügung stellen, damit mehr Gruppen wie die K. arbeiten könnten. Es wär auch ein größeres Budget von der Stadt Wien aus notwendig, um Vereine, die interessiert wären für die Behinderten etwas zu tun, zu unterstützen. Ich glaube, dass es sehr viele gäbe, auch in Eigeninitiative und in Kleingruppen und was auch immer, die an der Bürokratie scheitern. [...] Ja, weil ich glaube, dass es langfristig billiger kommt, weil die Eltern entlastet werden."
Oft stellen anfallende Kosten für Ferienangebote eine Barriere für die Teilnahme dar. So können einige Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung verschiedene Ferienangebote nicht in Anspruch nehmen, da die dadurch anfallenden Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Familie übersteigen. Diese finanzielle Lücke wird laut Aussagen einiger Eltern auch nicht ausreichend durch Förderungen von staatlicher Seite gedeckt:
Frau N.: "Es gibt schon eine Dame, die hat so eine Privatinitiative aufgezogen. [...] das ist aber relativ kostspielig, muss ich sagen. Also unter 700 Euro, was ich da so mitgekriegt habe, ist keine Woche drinnen. Und das ist mir ehrlich gesagt für alle zwei zu teuer. [...] Das ist natürlich auch Rundumbetreuung, aber die hat anscheinend nicht so großartige Förderungen, muss das irgendwie selber finanzieren und natürlich auch genügend Betreuer mitnehmen und ist natürlich sehr teuer. Da habe ich sie auch schon tageweise mitgeschickt. Die sind einmal ins Thermenbad B. gefahren. Einmal wollten sie Rodeln fahren am S., ist dann aber auch nur stundenweise und da kostet so ein Tag um die 100 Euro und das ist... das ist bei vielen Eltern - ich spreche da nicht nur von mir - einfach eine finanzielle Frage. [...] Natürlich ist in zweiter Hinsicht das Finanzielle, das muss ich auch sagen, weil viele Mütter sind einfach nicht berufstätig. Das ist so, weil es einfach nicht gegangen ist, wie auch immer."
Frau T.: "Ähm, es hat sich einmal vorgestellt eine Frau, die organisiert Urlaub für Behinderte, die aber mehr Körperbehinderte sind, die sonst besser beisammen sind und halt so mehr Betreuung brauchen, die außerdem exorbitant teuer sind. Ich mein einfach, weil's hat was kostet so eine intensive Betreuung. Das ist vollkommen klar. Ich mein die K., wenn sie nicht subventioniert wären, wären sie auch so teuer, weil es kostet einfach."
Herr C.: "[...] weil die zahlen das dann ab einem gewissen Alter nicht mehr und damit machen sie es auch nicht mehr."
Frau S.: "Aber ich glaub so zum Wegfahren... Die L. sind mir zu teuer."
Eine befragte Mutter gab gegensätzlich zu den anderen Aussagen an, dass für sie die Frage der Finanzierung der Ferienangebote keinen so hohen Stellenwert hat:
Frau O.: "...und ich hab mir gedacht, ich hätt vielleicht auch mehr gezahlt, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt so... so... ja, jetzt nicht so ein Thema gewesen."
Ein befragter Vater führte im Interview an, dass es schwierig sei ein Angebot zu schaffen, das für Menschen mit allen Arten von Behinderung gleichermaßen zugänglich ist. Die Heterogenität der verschiedenen in der Gesellschaft auftretenden Behinderungen hat ein dementsprechend breites Spektrum an Bedürfnissen und Ansprüchen zur Folge, die nur schwer von einem Angebot zu decken sind:
Herr C.: "Es ist wahrscheinlich sehr schwer, dass man ein allgemeines Angebot für Mehrfachbehinderte bietet. Es wird ein jeder wahrscheinlich so anders sein, wo man wirklich sagt, dass das alle abdeckt."
Es wurde auch die Frage gestellt, ob der Besuch eines Ferienangebotes ihres Sohnes mit intellektueller Beeinträchtigung als freiwillig zu werten sei, da häufig die Eltern über die Teilnahme entscheiden, da viele Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich ihre Bedürfnisse und Wünsche nur schwer kommunizieren können:
Frau S.: "Er kann mir's ja nicht sagen. Er kann mir's ja gar nicht erzählen. Manche Kinder drücken es dann schon irgendwie aus, ja. Oder er kann nicht richtig sagen, was irgendwie ist. Oder wenn er heim will. Er kann das nicht wirklich... Da fragt man sich wirklich: will er das? Weil ich schicke ihn ja."
Viele der befragten Eltern gaben auch an, Probleme bei der Kontaktaufnahme mit Ferienangeboten oder der Erreichbarkeit von diesbezüglichen Angeboten zu haben. Die Thematik der Kontaktaufnahme und Erreichbarkeit stellte sich in den Interviews als so bedeutend für die befragten Eltern heraus, dass diesem Thema deshalb hier nun ein ganzes Unterkapitel gewidmet ist.
Für einen Großteil der befragten Familien war die Teilnahme ihrer Kinder mit besonderen Bedürfnissen im intellektuellen Bereich an diversen Ferienangeboten durch erschwerte Erreichbarkeit und mangelnde Möglichkeiten der Kontaktaufnahme problematisch. In der Regel mussten die Eltern selbst die Initiative ergreifen, um ihren Kindern mit geistiger Behinderung die Teilnahme an Ferienangeboten zu ermöglichen. Oft war es schon schwierig Informationen über das bestehende Angebot an erreichbaren Freizeit- und Ferienaktivitäten einzuholen:
Frau N: "Also an und für sich ist es sehr schwierig Freizeitangebote überhaupt zu finden [...] Ja, man muss es sich holen, ja. [...] Also man muss, jetzt gelinde gesagt, einfach immer aktiv sein, dann erfährt man auch viel."
Frau C.: "Es gibt in den Schulen meist so Sozialarbeiter, die mit den Schulen zusammenarbeiten und die geben interessierten Eltern, weil wir haben schon nachfragen müssen, Tipps, wie man das machen kann, was es für Angebote gibt."
Herr C.: "[...] aber mit der geistigen Behinderung und Mehrfachbehinderung hab ich wirklich den Eindruck, dass es selektiv an den Eltern hängt, oder dass es zumindest an den Eltern hängt, selbst etwas zu finden."
Frau T.: "Wobei ich allen Hinweisen immer nachgeh. Also da bin ich sehr hellhörig. Wenn irgendetwas ist, schauen wir, ob das was wäre für unsere Kinder und die Frau L. so wie ich. Also wir schauen, horchen uns gut um und gehen den Sachen auch wirklich nach."
Die befragten Eltern nannten unterschiedliche Quellen, aus denen sie Informationen über Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung schöpften. Eine zuvor schon erwähnte Quelle sind SozialarbeiterInnen an Schulen bzw. andere schulinterne Personen, die diesbezügliche Informationen an die Eltern weitergeben. Viele Informationen haben die befragten Eltern auch über andere Eltern behinderter Kinder bzw. über Mundpropaganda erfahren. Auch das Medium des Internets bietet Möglichkeiten sich über Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung zu informieren:
Frau S.: "Also ich hab's durch die H. erfahren. Mütter zu Müttern hauptsächlich und eine Zeit lang hab ich beim Elternverein gearbeitet in Wien und da hab ich mir dann auch Freizeitangebote schicken lassen. [...] Was aber auch ist, das weiß ich vom Elternverein und von unserer Schule, die Schulen werden angeschickt. Die kriegen Informationen und dann sind sie in der Schule und dann kommen aber viele Eltern überhaupt nicht... Also man schickt's dann mit. Also bei uns ist es dann auch so gewesen, dass es im Mitteilungsheft mitgeschickt worden ist. Also Eltern haben schon Informationen gekriegt von dem. Die beste Beratung war aber, wenn wer selber schon dort war. Weil mit dem Zettel alleine, der dort ausgehängt ist und so irgendwie... Da fehlt wieder dieses Gespräch in der Elterngruppe, wo eine Mutter zu der anderen sagt: »heast, das kannst wirklich probieren, das ist gut«. Oder mir ist es auch so gegangen. Ich hab mich total gefürchtet und es ist doch gut gegangen oder so. Weißt, der Austausch."
Frau O.: "Wir kriegen das zwar immer von der Schule aus, aber irgendwie hab ich mich noch nicht dazu entschlossen. Aber ich habe jetzt schon von anderen Eltern eben auch gehört, dass das eigentlich, speziell jetzt von den K., glaub ich, sehr gut organisiert ist und dass die Betreuung auch gut ist und der Betreuungsschlüssel anscheinend auch sehr gut ist und ja..."
Frau T.: "Ja, Elternkontakte, sicher. Aber sicher nicht Zuschriften oder so. Keine Werbung, sicher über Elternkontakte."
Frau N.: "Ja, man muss es sich holen, ja. Weil man kriegt es... oder durch andere Mütter auch natürlich."
Herr C.: "Ich möchte jetzt alle die Möglichkeiten, die das Internet heutzutage bietet... das kann ich nicht verifizieren, wie viel in der Sache selber besser geworden ist, oder um wie viel es heutzutage leichter zu erfahren ist, weil es einfach dieses Internet gibt. Das ist sicher ein Medium, das wir nimmer mehr so nutzen, wollen, brauchen, müssen. Und man kann aber nicht sagen, alles was man heute im Internet findet, wird es vor zehn Jahren zum Teil noch gar nicht gegeben haben."
Für einige befragte Eltern ist der persönliche Kontakt zu den Ferienangeboten, an denen ihre Kinder teilnehmen, besonders wichtig. Manchen hielten auch weitergehend eine persönliche Beteiligung an Organisation und Durchführung der Angebote für vorteilhaft und hilfreich:
Frau S.: "Die beste Beratung war aber, wenn wer selber schon dort war."
Herr C.: "Dadurch haben's meiner Meinung nach, wo Eltern dahinter sind, sicher eine besser Qualität [...] alle Eltern Mehrfachbehinderter und Geistigbehinderter, die dem ganzen den Feinschliff geben müssen.
Außerdem wurde die Erreichbarkeit von potentiellen Ferienangeboten kritisiert. Generell wurde eine mangelhafte Erreichbarkeit von relevanten Angeboten beklagt und die örtliche Nähe eines Angebots als Vorteil gewertet. Andererseits wurde von manchen Eltern auch längere Anfahrtszeiten in Kauf genommen und ihren Kindern mit geistiger Behinderung die Teilnahme zu ermöglichen. Ein in das Angebot integrierter Fahrtendienst wurde von Eltern als Entlastung angesehen:
Frau N.: ": Ja, also Niederösterreich ist da sicher nicht so gut bestückt. Kommt jetzt natürlich darauf an wie die Infrastruktur ausschaut, wo man wohnt. Also wir zum Beispiel sind ja bald in Wien, mit einem Zug auch - das ist sicher kein Problem. Es ist halt die Frage wie weit man sich das antut, dann vielleicht eventuell mit Gepäck und Kinder etc. oder was wir mitnehmen usw. - da ist natürlich das Auto bequemer. Aber natürlich wenn jemand wohnt in einem kleinen Ort, wo die Erreichbarkeit einfach schwierig ist, ist man aufs Auto angewiesen. [...] Ja, es sind immer die Eltern gefragt, dass sie sie irgendwo hinbringen. Es gibt nicht in dem Sinn einen Busverkehr oder so irgend... Und die meisten können nicht... sind auch nicht so selbstständig, dass sie alleine wohin fahren. Sehr schwierig - das muss man ja auch antrainieren, ja."
Frau O.: "Also da gibt's jetzt in meinem Umfeld eigentlich «...» gar nichts [...] Also ich kann mir's gut vorstellen, aber so mein Wunschziel wär halt wirklich, dass sich jetzt... dass ich wirklich vor Ort jetzt die Möglichkeit habe, mein Kind dort unterzubringen, ja, wo... wo sie vielleicht hinwill, ja, dass sie nicht von wem, weiß ich nicht, in den 23. fahren muss, nur weil's dort grad zufällig was gibt [...]"
Frau T.: "Ja, also dieses bis zum frühen Nachmittag, das ist schon notwendig und dass der Fahrtendienst eingebunden ist, ist eine Riesenhilfe. Ich mein, ich hätt's zum H. nicht weit. Ja, das ist ja wirklich um's Eck, aber viele kommen aus Floridsdorf und das Hinbringen und Abholen... Er war ja früher im 17. Bezirk. Also da würde man sich auch überlegen, wie weit man das macht. Ich würd sicher eine Wochen machen. Einfach weil's so wichtig ist für den Michael, aber so von der Entlastung her ist das eben in der Kombination mit dem Fahrtendienst und der Zeit bis um vier echt großartig. «...» Also es muss eine Zeitentlastung auch dabei sein. [...] Das könnte genauso gut in Floridsdorf sein, wobei ich's auch in Floridsdorf in Anspruch nehmen würde, selbst wenn er da eine Stunde im Auto sitzt."
Im nun folgenden Resümee werden die in diesem Kapitel angeführten Erkenntnisse aus den Elterninterviews mit Aussagen aus der wissenschaftlichen Literatur verglichen. Überschneidung und Unterschiede werden herausgearbeitet und abschließende Hypothesen gebildet. Auch Denkanstöße und Anregungen zu neuen Forschungsansätzen finden im folgenden Kapitel Platz.
Inhaltsverzeichnis
Das Resümee stellt nun das abschließende Kapitel dieser Diplomarbeit dar. Hier wird noch einmal auf die zu Anfang gestellte Forschungsfrage "Wie werden institutionalisierte freizeitpädagogische Ferienangebote für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung von deren Eltern wahrgenommen?" zurückgegangen. Zu diesem Zweck werden die aus den Eltern-Interviews gewonnenen Erkenntnisse mit wissenschaftlichen Aussagen aus der Literatur verknüpft, um somit Hypothesen zu Teilbereichen dieser Thematik zu bilden. Abschließend werden diese Ergebnisse herangezogen, um Denkanstöße und Vorschläge zu neuen Forschungsansätzen zu bilden.
Hier werden nun die in den Interviews getätigten Aussagen von Eltern von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen mit Aussagen aus der dieser Arbeit zugrunde liegenden wissenschaftlichen Literatur verglichen und hinterlegt. Hierbei wird die schon in der Interviewauswertung getroffene Unterteilung in "Freizeitgestaltung", "Integration" und "Ferienangebote" beibehalten.
Freizeit wird von Eltern geistig behinderter Kinder als eine Zeitqualität angesehen, die frei von Zwang und Druck ist und zu größten Teilen selbst gestaltet werden kann. Es ist anzunehmen, dass sich diese Ansicht nicht signifikant von der Freizeit-Auffassung anderer Bevölkerungsteile unterscheidet. Freizeit wird von Eltern unweigerlich mit den Begriffen Spaß und Genuss verbunden, dient also in ihrer Sicht zur Befriedigung von lustbetonten Bedürfnissen. Diese Auffassung ist mit der Erholungstheorie der Freizeit vergleichbar, die Erholung als zentrale Funktion der Freizeit ansieht (vgl. Opaschowski 1996, 82ff). Weiters wird Freizeit von einigen Eltern als Raum gewertet, in dem überschüssige Kräfte abgebaut werden können. Dies entspricht einer Ventiltheorie, die Freizeit als Ventil zum Abreagieren überschüssiger Energien wahrnimmt (vgl. ebd.). Darüber hinausgehend wird von Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher Freizeit als eine Zeit wahrgenommen, in der neue Eindrücke gewonnen und eigene Möglichkeiten erweitert werden können. In dieser Position gilt Freizeit als autonomer Lebensbereich, der Raum zur Entfaltung und Bildung bietet (vgl. Markowetz 2001, 261).
In der Freizeitgestaltung wird von vielen Eltern als "geistig behindert" bezeichneter Kinder und Jugendlicher Selbstbestimmung groß geschrieben. Dies geht mit Opaschowskis Ansicht von Freizeit als durch Wahlmöglichkeiten, individuelle Entscheidungen und soziales Handeln geprägt einher (vgl. Markowetz 2001, 262; Opaschowski 1996, 85ff), da eine Vorraussetzung für Wahlmöglichkeiten, individuelle Entscheidungen und soziales Handeln ist ein gewisses Maß an Selbstbestimmung ist. Ein auf Selbstbestimmung aufbauender Freizeitbegriff ist somit mit Opaschowskis Zeitqualität der Dispositionszeit vergleichbar, die er als frei verfügbar, wahlfrei, einteilbar und selbstbestimmt ansieht (vgl. ebd.). Ausschlaggebend ist hierbei die Intensität und Qualität von Freizeittätigkeiten, sowie die Beweggründe, Zielsetzungen und innere Anteilnahme, die damit in Verbindung stehen (vgl. Opaschowski 1996, 87).
Demgegenüber steht die Auffassung nahezu aller Eltern, in der die Freizeitgestaltung für ihre Kinder mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich weitgehend als ihre Aufgabe ansehen. Diese Aufgabe setzt sich für die Eltern aus Initiative, Auswahl, Organisation, Durchführung und Begleitung in bezug auf Freizeitaktivitäten zusammen. Das geht mit den Erkenntnissen von Flieger einher, die in ihrer Studie ebenfalls anführt, dass die Unterstützung von als "geistig behindert" bezeichneten Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich zum Großteil von Eltern und anderen Verwandten geleistet wird, da es in diesem Bereich wenig unterstützende Dienste gibt. Somit ist das Ausmaß der Ressourcen der Eltern, die für die Gestaltung der Freizeit ihrer Kinder mit geistiger Behinderung freigemacht werden können, für die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen ausschlaggebend (vgl. Flieger 2000, 35ff). Das Kind mit geistiger Behinderung kann teilweise mit der familiären Freizeitgestaltung mitlaufen. Ist das jedoch nicht möglicht, führt dies zu einer höheren Belastung der Familie im Alltag. Die gemeinsame Freizeitgestaltung in der Familie kann dadurch erschwert werden, dass durch eine gewisse Entwicklungsverzögerung bedingt die Freizeitinteressen geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in der Regel mit zunehmenden Alten immer mehr von denen etwaiger Geschwister abweichen.
Das Risiko einer Überlastung in dieser Hinsicht kann durch diesbezügliche Arbeitsteilung innerhalb der Familie oder durch ein gut ausgebautes soziales Netz, in dem die Familie aufgefangen wird, vermindert werden. Innerhalb der Familie kann eine enge emotionale Verbundenheit, die sich durch gemeinsame Betroffenheit und geteilte Verantwortung auszeichnet, zu einer besseren Bewältigung dieser Belastung im Alltag beitragen (vgl. Herriger 2002, 180f). Zur Nutzung von außerfamiliären Ressourcen muss laut Herriger bei den Eltern die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Mobilisierung von Hilfen im familiären Umfeld vorhanden sein. Eine gezielte, intelligente, kritische, aufgeklärte, selbstbewusste und nicht überfordernde Nutzung von familienexternen Ressourcen und Dienstleitungen kann hier sehr entlastend wirken (vgl. ebd.). Natürlich muss laut Aussagen einiger Eltern ein gewisses Vertrauen in familienfremde Personen vorhanden sein, die ihr Kind mit geistiger Behinderung in der Freizeitgestaltung unterstützen. Solche unterstützende Dienste werden oft von so genannten "FreizeitassistentInnen" übernommen. Dies sind bezahlte Kräfte mit meist einschlägigen Ausbildungen, die Organisation und Ausführung von Freizeitaktivitäten mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen übernehmen. Die Kontaktaufnahme zwischen Eltern und FreizeitassistentInnen geschieht meist über Mundpropaganda oder Selbsthilfegruppen.
Ihre Freizeitsituation betreffend fällt es vielen Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich schwer alltägliche Aufgaben im Haushalt und Freizeit exakt zu trennen. Darüber hinausgehend wird eine zu rigide Tagesplanung im Alltag von einigen Eltern als hinderlich für die Freizeitgestaltung betrachtet. Somit ist diese Zeitqualität nicht mehr mit Opaschowskis Begriff der "Dispositionszeit", sondern ist eher unter Opaschowskis Begriffe der "Obligationszeit" oder "Determinationszeit" einzuordnen, die vom Begriff der "Freizeit" weiter entfernt sind. So ist Obligationszeit subjektiv verpflichtend, bindend und verbindlich, die Teilnahme an Aktivitäten dieser Zeitqualität ist jedoch freiwillig (vgl. Markowetz 2001, 262; Opaschowski 1996, 86f). Determinationszeit ist festgelegt, fremdbestimmt und abhängig. Durch streng formalisierte Rituale können auch Zeitspannen innerhalb des Familienlebens solchen Charakter annehmen (vgl. Markowetz 2001, 262; Opaschowski 1996, 86f). Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher setzten weitgehend schulfreie Zeit mit Freizeit gleich. Dies ist mit einer Verwendung des Freizeitbegriffs als Komplementärbegriff zu Arbeit vergleichbar (vgl. Brockhaus Enzyklopädie 1988, 640f) bei dem der Begriff der "Freizeit" in direkter Verbindung zu dem der "Arbeit" steht.
Die Schulferien ihrer Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung werden von vielen Eltern als Belastung empfunden. Hier muss in vielen Fällen von Seiten der Eltern auch die Betreuung und Versorgung während des Vormittages gewährleistet werden, da viele dieser Kinder und Jugendlichen nicht in der Lage sind die Eigenversorgung während dieser Zeit zu bewerkstelligen. Die Eltern sind in den Schulferien also vermehrt gefordert, was vor allem berufstätige Elternteile vor große Probleme stellt.
Bezüglich der Durchführung von Freizeitaktivitäten wird von zahlreichen Eltern angeführt, dass eine diesbezügliche Anleitung ihrer Kinder mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich notwendig sei. Dies bedeutet, dass bei der Ausführung der Aktivitäten immer wieder Hilfe und weiterführende Unterstützung benötigt wird. Dadurch entsteht ein Bedarf nach Assistenz und materiellen Hilfen und eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen und äußeren Begebenheiten (vgl. Markowetz 2001, 267ff; Ebert 2000, 39). Von vielen Eltern werden in regelmäßigen Abständen neue Freizeitaktivitäten gesucht und angeboten, um ihren Kindern mit geistiger Behinderung neue Anregungen zu verschaffen. Das Spektrum an durchgeführten Freizeitaktivitäten ist groß und von den jeweiligen Vorlieben abhängig. Auffallend ist jedoch eine generelle Favorisierung von Aktivitäten in der freien Natur. Deshalb wird von einem Großteil der Eltern bezüglich der Wohnsituation ein eigener Garten als Vorteil angesehen. Diese Tendenzen gehen mit den Ergebnissen der meisten bisher durchgeführten Studien zu Freizeitaktivitäten geistig behinderter Menschen einher (vgl. Markowetz 2001, 276ff; Flieger 2000, 37ff). Das Repertoire an möglichen Freizeitaktivitäten kann durch Aspekte der Behinderung oder durch befürchtete negative Reaktionen im sozialen Umfeld eingeschränkt sein. Auch der Besuch bei Freunden als Freizeitaktivität ist bei manchen Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung im Vergleich zu Gleichaltrigen sehr zurückgestellt. Durch die Behinderung und damit einhergehenden Einschränkungen im kommunikativen und sozialen Bereich sind die Fähigkeit und Möglichkeit Beziehungen aufzubauen und Freundschaften zu schließen zum Teil erheblich vermindert (vgl. Markowetz 2001, 267ff).
In der Forschungsarbeit zu dieser Diplomarbeit stellte sich auch die Frage, ob Therapie-und Förderangebote zur Zeitqualität der Freizeit zu rechnen wären. Die Aussagen von Eltern geistig behinderter Kinder zu diesem Thema bewegen sich zwischen zwei konträren Standpunkten. Auf der einen Seite wird Therapie, die Spaß bereitet, als Freizeitbeschäftigung angesehen. Auf der anderen Seite werden Therapie-und Förderangebote als Arbeit und Anstrengung wahrgenommen. Für die Eltern, die diese Ansicht vertreten, bedeutet dies, dass noch zusätzliche Freizeit zur Erholung von diesen Therapie-und Förderangeboten geschaffen werden muss. Laut Niehoff ist Therapie als Obligationszeit nur am Rande zu Freizeitaktivitäten zu zählen, da sie von Betroffenen selten als Freizeit gesehen und erlebt wird. Deshalb ist besonders darauf zu achten, dass Fördermaßnahmen und Therapien nicht die gesamte als frei bezeichnete Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung einnehmen, da die Teilnahme an diesen selten als freiwillige und gewollte Aktivität zu sehen ist. Freizeit darf demnach nicht als Korrektur-und Erholungsphase für übermäßige und falsch verstandene Rehabilitation, Therapie und Förderung gelten (vgl. Heß 2000, 310), sondern muss als wirklich freie, selbstbestimmte und zwanglose Lebenszeit zur Verfügung stehen.
Bei Eltern von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung besteht durchaus der Wunsch nach Teilnahmemöglichkeiten an integrativen Freizeitangeboten, der mit dem Wunsch nach vermehrten Kontakten und gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit nicht behinderten Kindern und Jugendlichen einhergeht (vgl. Markowetz 2001, 283f). Um diese Integration zu ermöglichen müssen gewisse Vorraussetzungen geschaffen werden. So muss zu aller erst einmal die Bereitschaft in Form einer akzeptierenden Grundhaltung (vgl. Flieger 2000, 77ff) auf Seiten der nicht behinderten Bevölkerung vorhanden sein, behinderte Menschen im Rahmen von Freizeitaktivitäten zu integrieren. Diese Bereitschaft ist Vorrausetzung dafür, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine Teilnahme von Menschen mit Behinderung ermöglichen und somit eine Öffnung bestehender Freizeitangebote geschieht. Es müssen laut Flieger konkrete Strategien entwickelt und Ressourcen frei gemacht werden, um Angebote auch für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich zugänglich zu machen (vgl. ebd., 61). Die Zusammenarbeit mit Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher als Experten in eigener Sache kann für diese Öffnung hilfreich sein, da von Anbieterorganisationen her in bezug auf die Thematik "Behinderung" häufig ein Mangel an Ausbildung und viele Unsicherheiten auf Seiten der MitarbeiterInnen beklagt wird (vgl. ebd. 76f). Laut den Aussagen einiger Eltern ist die Möglichkeit der Integration vom Schweregrad der Behinderung abhängig und einigen Eltern schien es des weiteren vorteilhafter Kinder und Jugendliche mit intellektuellen Beeinträchtigungen in diesem Bereich vereinzelt zu integrieren und nicht große Gruppen auf einmal zu anderen Gruppen dazustoßen zu lassen. Auch wohnortnahe Integration wird von vielen Eltern angestrebt, da ihre Kinder so nicht aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden. Die entlastende Funktion von integrativen wohnortnahen Freizeitangeboten für die Familien geistig behinderter Kinder und Jugendlicher wird auch von Markowetz bemerkt (vgl. Markowetz 2000a, 97).
Eine Öffnung von allgemeinen Freizeitangeboten für die Teilnahme von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen hat einerseits den Vorteil, dass sich für diese Personengruppe eine größere Auswahl von Freizeitaktivitäten eröffnet. Andererseits kann die Teilnahme von Menschen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich als Bereicherung für das Gruppengeschehen angesehen werden. So können Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen geknüpft werden und soziales Verhalten auf beiden Seiten erlernt werden. Laut Flieger werden im Rahmen der Integration Räume, Gelegenheiten und Anreize geschaffen, durch die ein gemeinsames Tun ermöglicht wird. In gemeinsamen Gruppentätigkeiten können durch Dialog und Kooperation Zusammengehörigkeitsgefühle entstehen. Die Behinderung verliert dadurch immer mehr an Bedeutung und der Mensch tritt in den Mittelpunkt (vgl. Flieger 2000, 82ff). Somit verringern integrative Freizeitangebote, wie Theunissen anführt, die soziale Distanz und ermöglichen diesbezügliche Kontakte, die eine positivere Einstellung Menschen mit Behinderung gegenüber bei der nicht behinderten Bevölkerung bewirken können (vgl. Theunissen 2000b, 103). Durch Unterstützung behinderter TeilnehmerInnen durch nicht behinderte TeilnehmerInnen kann auch eine Entlastung der in diesem Bereich tätigen FreizeitpädagogInnen herbeigeführt werden.
Integrative Freizeitangebote, an denen Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung teilnehmen können, stellen noch immer eine Ausnahme dar. Der Lebensbereich der Freizeit hinkt in Sachen Integration den Bereichen Schule und Beruf noch nach (vgl. Markowetz 2000a, 81). Dies ist auf zahlreiche Probleme zurückzuführen, die einer zunehmenden Integration in diesem Bereich im Wege stehen. So wird Integration zeitweise als bloßes Schlagwort ohne theoretischen Hintergrund gebraucht, was in der Regel zu einer unbefriedigenden Umsetzung führt. Für Angebote im Freizeitbereich ist es teilweise auch schwierig den höheren Betreuungsaufwand zu decken, der durch die Teilnahme von Menschen mit geistiger Behinderung entsteht. Im Gruppengeschehen können laut Elternaussagen vor allem bei pubertierenden Jugendlichen Ausgrenzungstendenzen von Schwächeren in Zusammenhang mit Konkurrenzverhalten und Lagerbildung eine Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich erschweren. Längerfristig gesehen ist der durch Entwicklungsverzögerungen bedingte Entwicklungsniveauunterschied zwischen geistig behinderten Kindern und Jugendlichen und nicht behinderten Gleichaltrigen ebenfalls hinderlich für eine befriedigende Integration, wie neben einigen Eltern auch Flieger bemerkt (vgl. Flieger 2000, 35ff). Schließlich tragen noch mangelndes Interesse der Bevölkerung an Integration, mangelnde diesbezügliche Kompetenzen bei verantwortlichen PädagogInnen, Ängste der Eltern und weitere zahlreiche Faktoren dazu bei, das die Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher im Freizeitbereich nur schleppend vorangeht.
Integrativen Tendenzen im Freizeitbereich steht jedoch auch ein Verlangen der Eltern nach speziellen Freizeitangeboten für ihre Kinder mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich gegenüber, die in ihren Augen besser auf die Freizeitbedürfnisse ihrer Kinder eingehen. Auch Ebert vertritt die Meinung, dass Gruppen Gleichbetroffener von den TeilnehmerInnen auch als stärkend empfunden werden können, da ähnliche Voraussetzungen bestehen und Erfahrungen ausgetauscht werden können (vgl. Ebert 2000, 17). Diese Auffassung steht konträr zu diversen anderen wissenschaftlichen Auffassungen, die diese Art von Freizeitangeboten weitgehend als negativ und integrationsfeindlich bewerten (vgl. Markowetz 2001, 276ff; Flieger 2000, 69).
Ferienangebote bieten Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung aus Sicht der Eltern die Möglichkeit Sozialkontakte zu knüpfen und Kompetenzen dahingehend zu erweitern. Ferienangebote können laut Aussagen einiger Eltern darüber hinausgehend durch Anregungen und Anforderungen, die im Rahmen dieser Angebote gestellt werden, zur Weiterentwicklung der Selbstständigkeit der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen beitragen. Die im Rahmen dieser Angebote durchgeführten Freizeitaktivitäten abseits der Familie können ebenfalls die Entwicklung einer gewissen Selbstständigkeit begünstigen. Schließlich stellen Ferienangebote eine Entlastung der Eltern während der Ferienzeit dar. Diese haben dadurch mehr Ressourcen zur Verfügung, um mehr auf die Bedürfnisse der Familie bzw. auf ihre eigenen Bedürfnisse eingehen zu können.
Ferienangebote werden von Eltern als ein Stück Normalität betrachtet. Die Teilnahme an solchen Angeboten gilt für viele Eltern als Recht ihrer Kinder mit Behinderung. Eltern erheben in Zusammenhang mit Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich den Anspruch, dass diese Angebote nach den Freizeitbedürfnissen der TeilnehmerInnen ausgerichtet werden und ihnen somit ein hohes Maß an Selbstbestimmung, Auswahlmöglichkeiten und Verwirklichung eigener Interessen bieten. In diesem Zusammenhang ist auch eine Berücksichtigung der durch die Behinderung bedingten besonderen Bedürfnisse notwendig. Aus diesem Grund heißen viele Eltern eine fachspezifische Ausbildung der MitarbeiterInnen eines Angebots gut, was das Vertrauen der Eltern in ein Ferienangebot erhöht. Durch eine fachspezifische Ausbildung kann auch bei MitarbeiterInnen die Wahrscheinlichkeit eingeschränkt werden, dass negative Gefühle wie Unsicherheit, Nervosität, Angst und Schuldgefühle im Umgang mit dieser Personengruppe und daraus resultierend Distanzverhalten entstehen, wie es zeitweise bei PädagogInnen, die sich in ihrer Ausbildung nicht speziell mit dem Thema "Behinderung" auseinandergesetzt haben, der Fall ist (vgl. Cloerkes 2001, 90). Für MitarbeiterInnen von Ferienangeboten sind natürlich neben fachspezifischem Wissen auch allgemeine pädagogische Qualifikationen bezogen auf den Freizeitbereich von Bedeutung (vgl. Opaschowski 1996, 271; Markowetz 2000b, 368f). Des weiteren werten viele Eltern Kennenlernrunden und persönliche Gespräche im Vorfeld eines Angebots, um Vertrauen in die Mitarbeiter fassen zu können, als positiv. Dies kann auch diversen Trennungsängsten auf Seiten der Eltern entgegenwirken.
Von Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher wird fast durchgehend eine mangelnde Auswahl an Ferienangeboten für ihre Kinder beklagt. Es wird dabei die Mutmaßung gestellt, dass diesem Bereich in Politik und öffentlicher Diskussion bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Des weiteren werden auch Probleme in Organisation und Struktur als Hindernisse genannt. Dies ist besonders relevant, da laut Ebert häufig durch besondere Bedürfnisse bedingt eine genau überlegte Planung und Organisation der Freizeitaktivitäten notwendig ist (vgl. Ebert 2000, 39). Hohe Teilnahmekosten, die durch vermehrten Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung entstehen (vgl. Markowetz 2001, 267ff), stellen für viele Eltern ebenfalls eine Barriere dar. Die erhöhte finanzielle Belastung der Familien in diesem Bereich wird bisher nur ungenügend durch Förderungen gedeckt. Schließlich kann laut Aussagen einiger Eltern auch die Heterogenität der in der Gesellschaft auftretenden Behinderungen und die damit einhergehenden unterschiedlichen bzw. zeitweise gegenläufigen Bedürfnisse zu Problemen bei der Gestaltung von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung führen.
Die Kontaktaufnahme mit Ferienangeboten wird von vielen Eltern als schwierig eingestuft. Oft ist eine dementsprechende Initiative von Seiten der Eltern notwendig, um an Informationen bezüglich solcher Angebote zu kommen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass vor allem allgemeine Freizeitangebote selten besonderes Engagement zeigen Kinder und Jugendliche mit Behinderung gezielt einzuladen und sich diesbezüglich auch an Eltern zu wenden, wie Flieger schreibt (vgl. Flieger 2000, 60ff). Hierbei sei darauf verwiesen, dass "Erreichbarkeit" und "Aufforderungscharakter" im wissenschaftlichen Diskurs als ein Leitprinzipien für die Didaktik im Handlungsfeld Freizeit gelten (vgl. Opaschowski 1996, 204ff).Quellen für die Eltern sind beim Einholen von Informationen über Ferienangebote in der Regel Schulen und dort angestellte SozialarbeiterInnen, Kontakte zu anderen Eltern und das Internet. Ist dann eine Verbindung mit einem Ferienangebot hergestellt, ist für viele Eltern der persönliche Kontakt mit diesem wichtig, um genügend Vertrauen in das Angebot und die MitarbeiterInnen fassen zu können. Einige Eltern können sich auch eine persönliche Beteiligung an Organisation und Durchführung eines Angebots vorstellen. Hierbei sei auf Opaschowskis Begriffe der "Informativen Beratung", der "Kommunikativen Animation" und der "Partizipative Planung" verwiesen (vgl. Opaschowski 1996, 192ff). Diese in Kapitel 6.5.1 angeführten Modelle von Opaschowski können Ferienangeboten für geistig behinderte Kinder und Jugendliche durchaus Anregungen in Richtung Organisation und Planung bieten. Abschließend wurde von einigen Eltern auch die mangelnde Erreichbarkeit vieler Ferienangebote kritisiert. Nur selten sind solche Angebote in der direkten örtlichen Umgebung der Familien zu finden. Somit nehmen Eltern häufig lange Anfahrtszeiten in Kauf. Ein in das Angebot integrierter Fahrtendienst wurde hierbei von zahlreichen Eltern als Vorteil gewertet.
Aus diesen hier angeführten Hypothesen werden nun Denkanstöße und Vorschläge zu neuen Forschungsansätzen herausgefiltert, die im folgenden explizit angeführt werden.
In der Folge werden nun einige Denkanstöße geschildert, die sich aus den Forschungsarbeiten zu dieser Diplomarbeit ergaben. So bedeutet die Freizeitgestaltung ihrer Kinder mit geistiger Behinderung für viele Eltern eine Belastung. Dies ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass es hier wenig unterstützende und entlastende Dienste gibt. Die am häufigsten genutzte Unterstützung in der Freizeitgestaltung ist über sogenannte "FreizeitassistentInnen" gegeben, die jedoch meist privat gesucht, angestellt und bezahlt werden. Würde diese Freizeitassistenz im Rahmen eines öffentlichen bzw. institutionalisierten Dienstes angeboten, so eröffnet sich die Möglichkeit diese Unterstützung flächendeckender, kostengünstiger und vor allem organisierter und strukturierter zu gestalten. Außerdem würde die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen mit Benachteiligung im intellektuellen Bereich somit nicht mehr zu so großen Teilen vom Engagement der Eltern abhängen. Tendenzen in diese Richtung sind durchaus schon vorhanden, nur stecken die meisten Entwicklungen bis dato noch in den Kinderschuhen.
Wie die Unterstützung bei der Freizeitgestaltung ist auch die Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher im Freizeitbereich noch in den Anfängen begriffen. Die Öffnung allgemeiner Angebote für diese Teilnehmergruppe ist noch lange nicht vollständig vollzogen und positive Beispiele geglückter Integration bilden hier immer noch die Ausnahme. Es wäre hier vor allem Aufgabe der Politik auf diese Thematik genauer einzugehen und die Öffentlichkeit in diese Richtung hin zu sensibilisieren. Es ist weiters als Aufgabe der Politik zu sehen dementsprechende Strategien zu entwickeln und (finanzielle) Ressourcen frei zu machen. Eine Möglichkeit hier zu einer befriedigenden Integration zu gelangen ist es, die Zusammenarbeit der Politik mit verschiedenen Organisation und auch mit Eltern, die als Experten in eigener Sache zu sehen sind, zu forcieren. Dabei ist auf die positiven Aspekte hinzuweisen, die die Integration von als "geistig behindert" bezeichneten Kinder und Jugendlichen im Freizeitbereich mit sich bringt. Einerseits bietet sich durch die Öffnung allgemeiner Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung für diese eine weitaus größere Auswahl an Aktivitäten. Andererseits kann einen Integration, die auch im Freizeitbereich stattfindet, zu einer Verringerung der sozialen Distanz zwischen nicht behinderten und behinderten Bevölkerungsteilen führen.
Eine weitere Aufgabe der Politik wäre es in diesem Zusammenhang die Nutzung von Ferienangeboten als ein Stück Normalität zu sehen, das somit auch geistig behinderten Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen sollte. Im Sinne der Gleichberechtigung ist eine solche Bereitstellung von Ferienangeboten sogar als Recht auf Seiten der behinderten Bevölkerung zu sehen. Diesem Recht kann auf der einen Seite durch die zuvor erwähnte integrative Öffnung von allgemeinen Angeboten nachgegangen werden. Auf der anderen Seite sollten dennoch auch Ferienangebote geschaffen werden, die Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung als spezielle Zielgruppe haben, da von verschiedenen Seite her eine Nachfrage nach solchen speziellen Angeboten besteht. Generell sollte vor allem bei integrativen und bei speziellen Angeboten eine fachspezifische Ausbildung der MitarbeiterInnen gefordert werden, um auf besondere Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung besser eingehen zu können.
Schließlich wäre noch eine Verbesserung des Informationsflusses und der Kontaktaufnahme zwischen Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher und diesbezüglichen Ferienangeboten wünschenswert. Die Kontaktaufnahme zwischen Angebot und Eltern funktionierte bis dato zeitweise nur unzureichend. Um dem entgegenzuwirken wäre es hilfreich zentrale Informationsstellen zu schaffen, die einerseits für Anfragen von Seiten der Eltern offen stehen und andererseits auch von sich aus aktiv an Eltern herantreten. Das Internet würde dafür ein gutes Medium darstellen. Im Zuge einer Internet-Plattform könnte so für Eltern ein weitgehend von überall zugängliches Informationsportal geschaffen werden. Dennoch sollte das aktive Herantreten an die Eltern hier nicht in den Hintergrund rücken.
Im Rahmen der Untersuchungen zu dieser Diplomarbeit ergaben sich einige Möglichkeiten zu neuartigen Forschungsansätzen. So trat in den Recherchen zu dieser Diplomarbeit zu Tage, dass die Problematik der Gestaltung der Schulferien bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung bisher nur wenig in empirischen Untersuchungen berücksichtigt wurde. Eine genauere Analyse der Problematik der Unterbringung und der Sicherstellung der Betreuung während der Ferien wäre hier wünschenswert und bietet einen vielversprechenden Forschungsansatz.
Um die Glaubwürdigkeit der in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse zu erhöhen bzw. nicht wahrheitsgemäße Ergebnisse zu falsifizieren, könnten die Ergebnisse aus der Forschungsarbeit zu dieser Diplomarbeit in einen Fragebogen umgesetzt werden, der einer größeren Auswahl an ProbandInnen zur Beantwortung vorgesetzt wird (vgl. Bortz 2003, 337). Somit würde es möglich ein noch detaillierteres Bild der Thematik "Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung" zu skizzieren. Interessant wäre es hierbei auch an Eltern heranzutreten, die sich weniger engagiert in der Freizeitgestaltung für ihre Kinder mit geistiger Behinderung zeigen. Diese Versuchsgruppe war den Forschungsarbeiten zu dieser Diplomarbeit nicht oder nur schwer zugänglich, da der Kontakt zu den InterviewpartnerInnen dieser Studie über Freizeit-und Ferienangebote hergestellt wurde. Somit gaben die befragten Eltern auf freiwilliger Basis, unentgeltlich und bereitwillig Auskunft zu den relevanten Themen. Die Gruppe an Eltern, die der Freizeitgestaltung ihres Kindes mit Benachteiligungen im intellektuellen Bereich keinen so hohen Stellenwert einräumen, erscheint hier unterrepräsentiert.
Inhaltsverzeichnis
ATTESLANDER, P.: Methoden der empirischen Sozialforschung. - Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003
BADELT, C., ÖSTERLE, A.: Zur Lebenssituation behinderter Menschen in Österreich. - Wien: Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 1993
BÖHM, A.: Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory. - In: FLICK, U., KARDORFF, E., STEINKE, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000, S. 475-485
BORTZ, J.: Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler. - Berlin, u.a.: Springer, 2002
BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE: Band 7. - Mannheim: Brockhaus, 1988
BUDE, H.: Die Kunst der Interpretation. - In: FLICK, U., KARDORFF, E., STEINKE, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000, S. 569-578
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (Hrsg.): Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung. - Wien: Styria, 1993
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (Hrsg.): Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderterMenschen in Österreich. - Wien: Eigenverlag, 2003
BUNDSCHUH, K., HEIMLICH, U., KRAWITZ, R. (Hrsg.): Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis. - Bad Heilbronn: Klinkhardt, 1999
CLOERKES, G.: Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. - Heidelberg: Winter, 2001, 2. Aufl.
CORBIN, J.: Grounded Theory. - In: BOHNSACK, R., MAROTZKI, W., MEUSER, M. (Hrsg.): Hauptbegriffe Qualitative Sozialforschung. Ein Wörterbuch. - Opladen: Leske + Budrich, 2003, S. 70-75
CROPLEY, A., J.: Qualitative Forschungsmethoden: eine praxisnahe Einführung. - Eschborn: Klotz, 2002
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT: Standards erziehungswissenschaftlicher Forschung. - In: FRIEBERTSHÄUSER, B., PRENGEL, A. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. - Weinheim, München: Juventa, 2003, S. 857-864
EBERT, H.: Menschen mit geistiger Behinderung in der Freizeit. Wir wollen überall dabei sein. - Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2000
EBERWEIN, H. (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. - Weinheim / Basel: Beltz, 1997, 4. Aufl.
FLICK, U.: Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1995
FLICK, U.: Psychologie des technisierten Alltags. Soziale Konstruktion und Repräsentation technischen Wandels in verschiedenen kulturellen Kontexten. - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996
FLICK, U., KARDORFF, E., STEINKE, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000
FLIEGER, P.: Freizeit mit Hindernissen. Wie Kinder mit Behinderung ihre Freizeit erleben, die Sicht ihrer Eltern und was Anbieter von Freizeitaktivitäten dazu sagen. Bericht zurLage der Kinder 2000. - Wien: Katholische Jungschar Österreichs, 2000
FRIEBERTSHÄUSER, B.: Interviewtechniken - ein Überblick. - In: FRIEBERTSHÄUSER, B., PRENGEL, A. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. - Weinheim, München: Juventa, 2003, S. 371-395
FRÖHLICH, W.: Wörterbuch Psychologie. - München: DTV, 2002, 24. Aufl.
HEINDL, G. (Hrsg.): Kind in Wien. Ein Stadtführer für alle, die in Wien mit Kindern zu tun haben. - Wien: Falter Verlag, 2005, 19. Aufl.
HERRIGER, N.: Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. - Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 2002, 2. Aufl.
HESZ, G.: Wie viel Pädagogik verträgt die Freizeit? - In: Geistige Behinderung 39 (2000), Heft 4, S. 309-312
HINZ, A.: >Behinderung< und die Gestaltung integrativer Lebensbereiche - Überlegungen zu Erfahrungen und Perspektiven. - In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000, S. 69-80
HOPF, C.: Qualitative Interviews - ein Überblick. - In: FLICK, U., KARDORFF, E., STEINKE, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlts, 2000, S. 349-360
HOVORKA, H.: Die Soziale Lage behinderter Jugendlicher . - In: JANIG, H., u.a. (Hrsg.): Schöner Vogel Jugend. Analysen zur Lebenssituation Jugendlicher. - Linz: Trauner, 1990, 2. Aufl., S. 621-641
KERKHOFF, W.: Paradigmen des wissenschaftlichen Zugangs zum Problemkreis "Familie mit behindertem Kind". - In: Heilpädagogische Forschung 9 (1981), S. 38-55
KERKHOFF, W.: Behindert in die Freizeit. - In: KERKHOFF, W. (Hrsg.): Freizeitchancen und Freizeitlernen für behinderte Kinder und Jugendliche. - Berlin: Marhold, 1982, S. 1-14
KNOBLAUCH, H.: Transkription. - In: BOHNSACK, R., MAROTZKI, W., MEUSER, M. (Hrsg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. Ein Wörterbuch. - Opladen: Leske + Budrich, 2003, S. 159-160
KOWAL, S., O'CONNELL, D., C.: Zur Transkription von Gesprächen. - In: FLICK, U., KARDORFF, E., STEINKE, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000, S. 437-446
LAMNEK, S.: Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. - Weinheim: Beltz PVU, 2005, 4. Aufl.
LANGHAMMER, K.: Erlebnispädagogische und handlungsorientierte Projekte für Menschen mit und ohne Behinderung. Zum Integrationsgedanken in der Freizeitpädagogik. - Wien: Diplomarbeit, 2001
MARKOWETZ, R.: Soziale Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in wohnortnahe Vereine. - In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000a, S. 81-105
MARKOWETZ, R.: Freizeit im Leben behinderter Menschen - Zusammenfassung, Ausblick und Forderungen. -In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000b, S. 363-374
MARKOWETZ, R.: Freizeit behinderter Menschen. - In: CLOERKES, G.: Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. - Heidelberg: Winter, 2001, 2. Aufl., S. 259-293
MEYER, A.-H.: Kodieren mir der ICF: Klassifizieren oder Abklassifizieren? Potenzen und Probleme der "Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung undGesundheit". Ein Überblick. - Heidelberg: Winter, 2004
NAHRSTEDT, W.: Der Freizeitpädagoge: Freizeitberatung - Animation - Freizeitadministration. Neue Aufgaben für Sozialarbeiter, Erwachsenenbildner und Sportpädagogen. - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982
NAHRSTEDT, W.: Zur Freizeit berufen: Berufsperspektiven, Handlungsfelder, Ausbildungsgänge für Freizeit- und Kulturpädagogen im internationalen Vergleich. - Bielefeld: IFKA, 1993
NIEHOFF, U.: Wie viel Pädagogik verträgt die Freizeit? - In: Geistige Behinderung 39 (2000), Heft 4, S. 309-312
OLBRICH, E.: Das Kompetenzmodell des Alterns - In: DETTBAR-REGGETIN, J., REGGETIN, H. (Hrsg.): Neue Wege in der Bildung Älterer, Bd. 1. - Freiburg: Lambertus, 1992
OPASCHOWSKI, H., W.: Pädagogik der freien Lebenszeit. - Opladen: Leske und Budrich, 1996, 3. Aufl.
REDAKTION STUDIUM UND BERUF: Duden. Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. - Mannheim, u.a.: Dudenverlag, 2003, 7. Aufl.
REINCKE, W.: Zur Integration Geistigbehinderter durch Bewegung Spiel und Sport. - In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000, S. 107-121
RHEKER, U.: Sport für alle - auch für und mit behinderten Menschen? - In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000, S. 289-302
ROSENKRANZ, T.: Familienentlastung. Dienste für Familien mit behinderten Angehörigen, unter besonderer Berücksichtigung der Lebens- und Alltagssituation der Eltern. - Linz: edition pro mente, 1998
SANDER, A.: Behinderungsbegriffe und ihre Konsequenzen für die Integration. - In: EBERWEIN, H. (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. - Weinheim / Basel: Beltz, 1997, 4. Aufl., S. 99-107
SCHÖNBERGER, F.: Die Integration Behinderter als moralische Maxime. - In: EBERWEIN, H. (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. - Weinheim / Basel: Beltz, 1997, 4. Aufl., S. 80-98
SCHUCHARD, E.: Integration: Zauberformel oder Konzeption eines pädagogischen Weges wechselseitiger Interaktion. - In: ZWIERLEIN, E. (Hrsg.): Handbuch Integration und Ausgrenzung. Behinderte Menschen in der Gesellschaft. - Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand, 1996, S. 3-36
STARK, W.: Empowerment. Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis. - Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1996
STEGIE, R.: Familien mit behinderten Kindern. In: KOCH, U., LUCIUS-HOENE, G., STEGIE, R. (Hrsg.): Handbuch der Rehabilitationspsychologie. - Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1988, S. 120-139
TERHART, E.: Entwicklung und Situation des qualitativen Forschungsansatzes in der Erziehungswissenschaft. - In: FRIEBERTSHÄUSER, B., PRENGEL, A. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. - Weinheim, München: Juventa, 2003, S. 27-42
THEUNISSEN, G.: Geistige Behinderung. - In: BUNDSCHUH, K., HEIMLICH, U., KRAVITZ, R. (Hrsg.): Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis. - Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1999, S. 96-99
THEUNISSEN, G.: Lebensbereich Freizeit - ein vergessenes Thema für Menschen, die als geistig schwer- und mehrfachbehindert gelten. - In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000a, S. 137-149
THEUNISSEN, G.: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Kompendium für die Praxis. - Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2000b, 3. Aufl.
THEUNISSEN, G., u.a.: Zur Situation geistig behinderter Menschen in ihrer Freizeit. Eine Umfrage bei der Lebenshilfe Deutschland. - In: Geistige Behinderung 39 (2000c), Heft 4, S. 360-372
WILKEN, U.: Urlaub, Reisen und Tourismus für behinderte Menschen. - In: MARKOWETZ, R., CLOERKES, G. (Hrsg.): Freizeit im Leben behinderter Menschen. - Heidelberg: Edition S, 2000, S. 185-194
WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO): ICF. International Classification of Funtioning, Disability and Health. - Genv: Eigenverlag, 2001
DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION (Hrsg.): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. - Köln: 2004 - Online im WWW unter URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/ICF/icf_dimdi_final_draft_1.pdf [17.3.2006]
FEUSER, G.: "Geistigbehinderte gibt es nicht". Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration. - Referat am 11. Österreichischen Symposium für die Integration behinderter Menschen 6.-8. Juni 1996 in Innsbruck. - In: Geistige Behinderung 35 (1996),
S. 18-25. - Online im WWW unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-geistigbehinderte.html [16.2.2006]
HINZ, A.: "Geistige Behinderung" und die Gestaltung integrativer Lebensbereiche - Überlegungen zu Erfahrungen und Perspektiven. - In: Sonderpädagogik 16 (1996),
S. 144-153. - Online im WWW unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-lebensbereiche.html [10.11.2005]
MARKOWETZ, R.: Zur Wirksamkeit der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung im Lebensbereich Freizeit. Modelle - Konzepte - Fallbeispiele - Praktische Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt PfiFF. - 1998 - Online im WWW unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/markowetz-freizeit.html [16.2.2006]
THEUNISSEN, G., GARLIPP, B.: Kompetente Eltern. Vergessen in der Professionalität der Behindertenarbeit?. - In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, 1999, Nr.4/5. - Online im WWW unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-vergessen.html?hls=theunissen [30.5.2005].
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeine Lebenssituation
Könnten Sie Ihr Kind kurz beschreiben?
Woher bekommen Sie Unterstützung im Alltag mit Ihrem Kind?
In welchem Ausmaß sind Sie berufstätig? Inwieweit können Sie Berufstätigkeit und Elternschaft verbinden?
Welche Einrichtungen besucht ihr Kind? Wie viel Zeit verbringt Ihr Kind in Einrichtungen?
Was verstehen Sie unter "geistige Behinderung"?
Was bedeutet es für Sie ein als "geistig behindert" bezeichnetes Kind zu haben?
2. Freizeitsituation
Was verbinden Sie mit "Freizeit"?
Welche Rolle spielt Freizeit für Sie? Welche Rolle spielt Freizeit für ihr Kind?
Wie verbringt Ihr Kind seine Freizeit?
Wer unterstützt Ihr Kind bei Freizeitaktivitäten? Wie wird Ihr Kind bei Freizeitaktivitäten unterstützt?
Wie viel Freizeit hat Ihr Kind?
Welche Rolle nehmen Sie bei der Freizeitgestaltung Ihres Kindes ein?
3. Freizeitangebote allgemein
Was zeichnet für Sie ein Freizeitangebot aus? Welche Ansprüche stellen Sie an Freizeitangebote?
Welche Bedeutung messen sie Freizeitangeboten zu?
Welche Erfahrungen haben Sie mit Freizeitangeboten gemacht? Können Sie sich an konkrete Situationen erinnern?
4. Ferienangebote
Wie gestalten Sie und Ihr Kind die Schulferien?
Was zeichnet für Sie ein Ferienangebot aus?
Welche Bedeutung messen sie Ferienangeboten zu?
Was erwarten Sie sich von einem Ferienangebot? Welche Vorteile haben Ferienangebote? Welche Vorteile für Ihr Kind haben Ferienangebote?
Wie erfahren Sie von Ferienangeboten? Wie funktioniert die Kontaktaufnahme?
Welche Angebote während der Schulferien nimmt Ihr Kind in Anspruch? An welchen integrativen Angebot nimmt Ihr Kind teil? An welchen Angeboten spezielle für Kinder mit geistiger Behinderung nimmt Ihr Kind teil?
In welchem Zeitraum bzw. wie häufig nimmt Ihr Kind Ferienangebote in Anspruch?
Wie werden die Ferienangebote finanziert? Bedeuten Ferienangebote eine finanzielle Belastung für Sie?
Sind Ferienangebote von ihrem Wohnort aus gut erreichbar? Gibt es Probleme bei der Erreichbarkeit?
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ferienangeboten gemacht? Können Sie sich an konkrete Situationen erinnern?
Wenn Sie etwas an der derzeitigen Situation rund um Ferienangebote ändern könnten, was würden Sie ändern?
11.2 Interview 1 (Frau N.)
Interviewer: Wie alt sind deine beiden Söhne?
Frau N.: Der Peter[8] wird am 30. April 20 und der Manfred wird im August 18.
Interviewer: Das heißt es sind eigentlich beide im Erwachsenenalter.
Frau N.: Jugendlich würde ich einmal sagen - spätjugendlich ((lacht)). Für mich sind es noch Kinder - meine Kinder ((lacht)).
Interviewer: Was haben sie eigentlich für eine Beeinträchtigung?
Frau N.: Also an und für sich offiziell heißt es unbekanntes Dismorphiesyndrom. Was immer das heißt. Es heißt... es ist nicht bekannt bisher, was es eigentlich für eine Behinderung ist. Wenn mich jemand fragt... mir gefällt das einfach besser... statt geistiger Behinderung sage ich immer sie haben eine mentale Behinderung und Peter ist motorisch auch etwas beeinträchtigt... in der Feinmotorik eigentlich beeinträchtigt. Und hauptsächlich... was halt wirklich das Hauptsächliche ist, was auffällt ist, dass sie sich einfach nonverbal hauptsächlich ausdrücken. Das heißt mit Gestik, Mimik, Bildern. Wir haben untersuchen lassen die Gene. Also es sind Papa untersucht worden, ich bin untersucht worden. Da ist nichts gefunden worden. Weil die Kinder die Chromosomen haben nichts. Eine Stoffwechselerkrankung, eine gängige, ist auch nicht eruiert worden.
Interviewer: Das heißt die Ärzte stehen...
Frau N.: Sie stehen ziemlich an. Wir haben... ein paar Symptome wurden herausgefiltert, aber das ist nicht wirklich jetzt Tatsache, dass es das ist. Es gibt so ein Syndrom, was so als letztes herausgefiltert wurde. Das ist das Demel-Gallopi-Simpson-Syndrom und das hat überhaupt nichts für mich zum aussagen, weildie Dr. Demel ist eine Ärztin in Graz, die dieses Syndrom erstmalig irgendwie aufgezeichnet hat. Gallopi und Simpson sind Familien, wo dieses Syndrom einmal beschrieben wurde. Und dann haben sie mir einmal die Beschreibung dieses Syndroms geschickt und da sind sehr viele Sachen, die nicht wirklich stimmen - bei beiden nicht. Und wir waren im Kinderzentrum in M. zwei Mal. Das ist eine große humangenetische Station und da ist sogar ein sehr dicker Akt angelegt worden - vom Peter und vom Manfred. So im Vergleich, was bei beiden gleich ist, was auffällig ist bei beiden, was konträr ist und, ich muss sagen,da sind 60 Prozent, wo sie nicht gleich sind. Von den Äußerlichkeiten jetzt her und von den Krankheiten zum Beispiel. Peter hat ja zum Beispiel einen angeborenen grauen Star gehabt, der ist schon Star-operiert. Hat der Manfred nicht. Der Manfred hat dafür einen ganz leichten Herzfehler von Geburt her gehabt. Manfred hat eine Schallleiterstörung, trägt deshalb Hörgeräte - der Peter hört supergut.
Interviewer: Da sind einfach doch ziemliche Differenzen.
Frau N.: Es ist einfach für mich abgeschlossen. Ich sage einfach, es ist Wurst, was sie haben - sie sind so wie sie sind und ich kann es nicht ändern. Und mich ödet das furchtbar an, das muss ich jetzt auch dazu sagen ((lacht)), wenn so wie mein Großvater immer fragt: und wann fangen sie jetzt einmal zum Reden an? - das ödet mich furchtbar an. Dass ich sage, das ist aber meins, weil ich mir denke, sie sollen sie einfach so akzeptieren, wie sie sind - Punkt.
Interviewer: Das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass es gut funktioniert. Was besuchen sie jetzt eigentlich für Einrichtungen?
Frau N.: Der Peter geht jetzt in die Tageswerkstätte der Behindertenhilfe Bezirk K. - das ist ein privater Verein, ein Elternverein und der Manfred geht jetzt bis im Sommer, also Juni 2006 ins Sonderpädagogische Zentrum in K. Ein S-Klasse - also Schwerstbehinderten-Klasse.
Interviewer: Und was verstehst du eigentlich unter Behinderung, weil das ist immer ein Thema und da wollte ich einmal nachfragen, was Eltern unter dem verstehen?
Frau N.: Unter dem verstehe ich... Unter Behinderung verstehe ich, dass ich halt gehandicapped bin in viele Sachen, die vielleicht zum Alltag gehören würden. Andererseits, wenn man tiefer in die Materie geht, denk ich mir immer, gibt es so viele Leute die unter Anführungszeichen nicht behindert sind und auch viele Sachen nicht können, oder wollen, oder wie auch immer, ja. Für mich ist in erster Linie bei meinen Kinder die Behinderung, dass sie sich verbal nicht ausdrücken können - das andere ist mir Wurst. Mich stört es nicht, wenn sie nicht lesen oder schreiben können. Ich denk mir: OK - wäre super, wenn sie es machen könnten, aber mich... ich will nicht sagen mich stört es... aber es... es ist für mich immer noch so ein wunder Punkt, dass sie sich verbal nicht ausdrücken können und das ist für mich eine Behinderung. Also das stellt wirklich eine starke Behinderung dar. Für mich ist es keine Behinderung, dass der Manfred ein Hörgerät hat. Ich denke mir, das ist... obwohl das für mache auch eine Behinderung ist... oder wenn jemand schlecht sieht, das ist auch eine Behinderung. Aber für mich stellt das die größte Behinderung dar, weil sie sich in der Gesellschaft aufgrund dessen «...» schlecht etablieren können.
Interviewer: OK - also einfach der gesellschaftliche Faktor...
Frau N.: Genau. Weil Sprache ist für mich eigentlich das Um und Auf in der Gesellschaft, bin ich schon draufgekommen. Die Leute gehen wenig auf Emotionen, wenig auf Gestik, wenig auf Mimik - es hört dir keiner zu, wenn du nicht lautstark irgendwas sagst.
Interviewer: Eben - und deswegen tun sich die beiden zeitweise ziemlich schwer... wahrscheinlich.
Frau N.: Genau, genau...
Interviewer: Und was verbindest du so mit Freizeit? - Also Freizeit in Zusammenhang mit deinen Kindern und Freizeit allgemein.
Frau N.: Freizeit ist für mich etwas zu tun, was nicht unter Zwang fällt und was ich nicht unbedingt tun muss. Sei es jetzt für mich und meine Kinder ist das einfach Rad fahren. Für mich ist es irgendwo sich frei zu bewegen. Was Spaß macht, sei es jetzt Fußball spielen am Fußballplatz gehen etc. -nur als Beispiel jetzt. Das ist für mich einfach Freizeit.
Interviewer: OK - also einfach ein Zeit, die nicht vordefiniert ist.
Frau N.: Genau, genau...
Interviewer: Und spielt das eine große Rolle für dich? - Freizeit, oder?
Frau N.: Spielt eigentlich schon eine relativ große Rolle, weil ich mir denke: sie sind ja nicht so lange betreut jetzt neben der Schule und auch in der Werkstatt nicht und da ist doch noch ein relativ... speziell im Sommer... doch noch ein relativ großer Teil an Freizeit bis jetzt Schlafenszeit ist. Also die Zeit von Werkstatt-Nach-Haus-Kommen bis... bis Schlafenszeit ist eigentlich doch eine relativ lange Zeit. Also ich denke mir es ist schwierig auch immer wieder etwas zu finden für die Freizeit.
Interviewer: Also das sind so... sechs Stunden sicher.
Frau N.: Vier, fünf, sechs, sieben, acht,... ja, fünf Stunden mindestens. Sechs Stunden - ja kann man schon sagen.
Interviewer: Also schon längere Zeit...
Frau N.: Beziehungsweise dann am Wochenende.
Interviewer: Und wie verbringen sie ihre Freizeit, der Peter und der Manfred?
Frau N.: Ja, jetzt sind sie natürlich in der Pubertät, wie es jetzt ist, wie bei anderen Jugendlichen, gerne vor dem Fernseher, gerne Musik hören, gerne Computer spielen «...» hauptsächlich eigentlich, muss ich sagen, wobei natürlich die Interessen auch verschieden sind. Peter ist gerne zu Hause - der tut sich nicht viel bewegen, außer Fußballplatz gehen, aber sonst nichts ((lacht)) und der Manfred ist eher der, der gerne unterwegs ist, einfach viel erlebt, was ich dann verbinde eben mit Bewegung. Das ist für mich wichtig, aber das ist... ich glaube das ist Charaktersache einfach. Das ist nicht nur vorgelebt, weil ich bewege mich auch gerne und ich bin auch gerne in der frischen Luft und das haben nicht beide in sich. Also ich denke mir: das ist... teilweise ist Freizeit vorgelebt von den Eltern und teilweise ist es aber auch was jeder für einen Charakter... also charakterlich ist.
Interviewer: Dass man das auch auslebt in der Zeit, die man zur Verfügung hat. Und... wie werden Peter und Manfred unterstützt bei der Freizeit - ich weiß, es gibt Freizeitassistenten und sonst... oder wie äußert sich das?
Frau N.: Ja - ich habe eigentlich Gott-sei-Dank ein ziemlich engmaschiges Netz, muss ich sagen. Also, dass ich auch meine Freizeit alleine einmal verbringen kann, sind hauptsächlich auch Familienmitglieder miteinbezogen, wie meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Großtante - das sind fixe, drei Mal in der Woche und hauptsächlich auch Freizeitassistenten. Das, was für mich dann wichtig ist, ist dass das Jugendliche sind, die... die einfach andere Sachen machen mit den beiden, die mir nicht viel Spaß machen. Oder einfach anders agieren wie ich. Ich bin die Mutter. Ich gib immer vor und ich bin erzieherisch tätig sozusagen ((lacht)) und das ist einfach irgendwie anders dann. Was... was ja auch Spaß machen soll. Andere Jugendliche haben ja auch den Spaß, dass sie vom Elternhaus wegkommen und einfach das machen können, was sie wollen. Das haben behinderte Jugendliche fast nie. Sie sind immer vorausgeplant von den Eltern «...» der Mütter hauptsächlich, ja. Wenn die Mutter dorthin geht, muss das Kind dort auch mitgehen. Und das fehlt... das tut mir irrsinnig weh, wenn ihnen das fehlt und darum denke ich mir... wie... dass sie einfach sagen können: Ich möchte das machen, ich brauche eine Begleitung. Und der-oder diejenige begleitet dich dann.
Interviewer: OK - und der Vorteil war... das Gute daran ist, dass es möglichst gleichaltrige...
Frau N.: Schon - ja, ja
Interviewer: OK «...» ja, welche Rolle nimmst du ein bei der Freizeitgestaltung von Manfred und Peter? Wo siehst du deine Rolle?
Frau N.: Ich organisiere natürlich sehr viel. Ich muss die Freizeitassistenten organisieren. Durch das, dass sie sich eben verbal nicht äußern können, können sie auch nicht... können sie jetzt auch nicht jemanden anrufen und jetzt sagen: Komm her und ich will das und das machen. Also ich organisiere einmal grundsätzlich, dass sie jemanden haben in der Freizeit, der sie begleitet und frag sie dann natürlich, oder auch die Assistenten fragen sie dann: was möchtest du machen? Das geht dann mit Bildern, mit... mit Gestik können sie das sehr wohl. Das ist mir auch wichtig, dass sie selber das ausdrücken können. Nicht über mich immer als Sprachrohr, sondern dass sie das sehr wohl selber machen können. Natürlich bereite ich mir dann meistens die Assistenten vorher vor, wenn irgendwas organisiert werden muss, wo man einfach... was weiß ich... eine Kegelbahn vorbestellen muss oder in ein Kino geht oder so - muss natürlich hauptsächlich ich machen, ja.
Interviewer: Das Organisatorische - OK - verstehe... Und wenn man jetzt Freizeitangebote nimmt - diverse Einrichtungen oder Organisationen. Was zeichnet für dich so ein Freizeitangebot aus? Jetzt zum Beispiel dieser Jugendtreff?
Frau N.: Also an und für sich, bevor wir zum Beispiel den Jugendtreff hatten, gab es kein Freizeitangebot. In unserer Region gibt es kein Freizeitangebot für behinderte Jugendliche. Wir sind draufgekommen durch unser Projekt, dass wir einfach... also dass sich einfach die Jugendlichen mit Behinderung entweder selbst einbringen müssen. Von sich aus kommt niemand und sagt: wir nehmen jemand, der auch eine Behinderung hat. Das habe ich nicht mitgekriegt. Was auch sehr schwer ist, auch wenn sich die Jugendlichen... die tun sich auch schwer, dass sie sich anbieten, sag ich auch einmal. Wie sollen sie sich auch anbieten, ja? Sie haben ja keine Ahnung was dort passiert in einem Freizeittreff oder in ein... Also wir haben sehr viele Jugendliche gehabt, die wollten gerne zur katholischen Jugend, die wollten zur Feuerwehr, etc. Diese Leute bei diesen Organisationen waren dadurch heillos überfordert, weil sie einfach mit denen nicht zu tun gehabt haben. Jetzt haben wir aber gesagt... ein bisschen organisiert auch, dass die Assistenten eventuell den Jugendlichen ein bisschen einbringen. Eltern tun sich auch sehr schwer. Die müssen immer für ihre Jugendlichen reden, kämpfen. Dann wollen sie einfach in der Freizeit nicht auch noch. Und außerdem haben sie dann Ängste: Wie wird das dort sein? Und jetzt dann drück ich den Jugendlichen denen aufs Auge auf deutsch gesagt ((lacht)). Was kriegt er jetzt damit, ja? Also an und für sich ist es sehr schwierig Freizeitangebote überhaupt zu finden - also im Weinviertel - ich sprich jetzt für das Weinviertel, ja. Und jetzt haben wir eben dann die Idee gehabt, dass wir einen Freizeittreff machen. Ursprünglich war auch gedacht ein integrativer Freizeittreff, was auch überhaupt schiefgelaufen ist, weil keine nichtbehinderten Jugendlichen zu einem integrativen Freizeittreff kommen. Man kann es vielleicht so machen, wie gesagt, es gibt dort einen Jugendtreff und wir schauen, dass wir ein, zwei Jugendliche mit einer Behinderung dort einbeziehen - so wie in einer Integrationsklasse. Aber wir können nicht fünfzehn Jugendliche mit Behinderung in eine Gruppe einfach dazustoßen lassen zu nicht-behinderten. Die sind überfordert damit, ja. Also das geht alles... Und es kommt auf die Behinderungsart darauf an. Viele haben noch nie mit behinderten Menschen zu tun gehabt, die können dann nicht mit behinderten Menschen, die einfach ihre Ticks haben, die einfach anders agieren bei manchen Sachen, die einfach... ja... schwierig... ganz schwierig.
Interviewer: Kommen dann, wie gesagt, die Ängste ins Spiel?
Frau N.: Ja, da kommen sehr viele Ängste ins Spiel - von beiden Seiten. Die Ängste der Eltern natürlich, dieÄngste der Jugendlichen und... und eigentlich die Ängste natürlich der Leute, die keine Behinderung haben. Wenn man es probiert hat einmal, vielleicht geht es vereinzelt, dass man einen Jugendlichen dann nämlich... das war immer unser Ziel: So Jugendliche vereinzelt -gerade in der Ortschaft... es soll einfach Integration vor Ort stattfinden -in der Ortschaft in eine Gruppe zu integrieren. Es hat manches Mal total gut funktioniert, sogar teilweise dann ohne Assistenz, aber da muss eine Person vorhanden sein, die offene Ohren hat für das, die einfach sich damit ein bisschen konfrontiert sieht, die einfach auf das eingeht. Die muss einfach vorhanden sein - anders geht es nicht.
Interviewer: OK, also es muss... es muss wer dabei sein, der dahintersteht...
Frau N.: Genau, von die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen können sich die wenigsten so richtig gut einbringen.
Interviewer: Also es braucht einen gewissen Wegbereiter, der das ganze dann ins Laufen bringt...
Frau N.: Genau, genau...
Interviewer: Aber wenn es laufen würde...
Frau N.: Es hat bei machen funktioniert. Bei unserem Projekt hat sich das gezeigt, dass es bei manchen recht gut funktioniert. Da war so ein Bursche, aber das war auch so ein Grenzfall unter Anführungszeichen. Der hat eine ganz leichte Behinderung gehabt. Der ist bei der Feuerwehr dann gelandet. Die haben nach wie vor einmal in der Woche Zur-Feuerwehr-Gehen - kein Problem. In seinem Ort, was uns immer wichtig war. Nicht irgendwo hinführen die Jugendlichen. Weil das ist ja wieder nicht vor Ort. Aus meiner eigenen Erfahrung, muss ich sagen, ist es bei mir so, dass zum Beispiel meine Kinder am Fußballplatz recht gut integriert sind. Sie können wohl nicht mitspielen jetzt bei den Jugendgruppen, aber der Peter zum Beispiel hat einfach als Linienrichter fungiert bei den Jugendlichen. Sie kennen ihn alle... einfach toll.
((kurze Unterbrechung wegen eines Telefonats für Frau N.))
Interviewer: Dann wollte ich auf die Ferien genauer eingehen. Wie gestaltet ihr die Schulferien? Es ist ja dann so, dass der Vormittag mehr oder weniger auch zu gestalten wäre oder ist.
Frau N.: Naja, es ist schon so, also an und für sich schlafen wir natürlich ein bisschen länger in den Ferien. Dadurch ziehe ich den Tag so ein bisschen hinaus... kürzer eigentlich, indem wir ein bisschen länger schlafen. Und Vormittag, muss ich sagen, also die Kinder... Ich meine, der Peter ist jetzt schon im Tagesheim. Das heißt er hat keine Ferien in dem Sinne -er hat Urlaub. Er hat genauso Urlaub wie jeder Berufstätige - fünf Wochen und das teilt sich dann auf. Das heißt er ist im Sommer nur zwei Wochen zu Hause und das ist, muss ich sagen, ist schon sehr angenehm seit es das Tagesheim gibt. Weil die Schulferien sind dann mitunter schon sehr lang - neun Wochen. Es war früher so, dass ich halt nur für die Kinder da war, wie beide noch in der Schule waren, die ganzen Schulferien. Also wirklich für mich habe ich da überhaupt keine Zeit gehabt. Jetzt hat sich das so ergeben, seit der Peter im Tagesheim ist und ich hab angefangen damals eben im Beruf wieder. Habe ich dann etwas suchen müssen, das war für mich dann auch... irgendwie eine ganz andere Situation neun Wochen den Manfred irgendwo unterzubringen und ich habe nur selber zwei Wochen Urlaub gehabt. Hat es natürlich nicht allzu viel gegeben, aber wer suchet der findet. Das heißt ich damals eben dieses Förderzentrum in G. gefunden. Da macht man normalerweise zuerst Intensivwochen, drei Wochen, mit Elternteil und dann gibt es jetzt eben seit ein paar Jahren, also die... die Kinder und Jugendlichen bis 18 können im Sommer zwei Wochen, zwei Intensiv-Förderwochen oben verbringen. Das wird vom Land Niederösterreich mitfinanziert. Da habe ich jetzt den Manfred jeden Mal angemeldet. Er hat eigentlich immer einen Platz bekommen, weil sie nehmen auch gerne Kinder, die schon oben waren, dass sie sie einfach weiter fördern. Es gibt verschiedenen Therapieangebote. Das sind... das sind eigentlich keine Ferien, das ist Arbeit, sag ich jetzt einmal, für den lieben Burschen, weil da muss er sehr viel tun. Sei es jetzt Ergotherapie, Heilpädagogik, etc., alles mögliche. Das zweite ist, dass ich dann im Internet gesucht habe und dann bin ich eben auf die K. gestoßen. Gott-sei-Dank muss ich sagen ((lacht)) - spät, aber doch. Und das ist auch sehr angenehm und bis jetzt ist er auch schon zwei Mal mitgefahren. Und nur ich glaube, dass ich einfach zu spät auf das ganze gekommen bin, aber ich weiß ja nicht, ob ich sie früher irgendwo mitschicken hätte können, ob sie schon... ob ich schon loslassen hätte können - das ist auch schwierig. Das vertrauen in jemanden zu setzten ist auch schwierig dann, der mein Kind eigentlich Tag und Nacht übernimmt. Da tue ich mir immer schwer... also jetzt nicht mehr, aber bis vor drei, vier Jahren habe ich mir da sehr schwer getan, muss ich sagen. Der Peter war mit...schon einmal mit dem Österreichischen Jugendrotkreuz. Ja... das sind so Sachen, die ich mir einfach aus dem Internet herausgesucht habe und wo ich einfach geschaut habe ob das für mich passen würde. Wo jetzt die Gegend ist? Ob es für die Kinder passt, ja? Und... und in der Waldschule gibt es auch eine Möglichkeit in W., die machen auch Ferienbetreuung. Da war der Peter auch einmal eine Woche. Also... nur... das Problem ist halt, dass das alles dann altersbegrenzt ist. Da, muss ich sagen, machen die K. das eh relativ lang, aber bei den anderen ist es so mit sechzehn... fünfzehn oder sechzehn aus. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, dass sie mitfahren.
Interviewer: Also da, wo die normale Schulpflicht enden würde.
Frau N.: Ja, da machen sie das dann so... Und ich denke mir, auch wenn sie in einem Tagesheim sind, auch wenn sie dann nur Urlaub haben ein paar Wochen. Trotzdem wäre es nicht schlecht jetzt für die Selbstständigkeit, dass sie dann trotzdem mit anderen Organisationen noch mitfahren könnten. Es gibt schon eine Dame, die hat so eine Privatinitiative aufgezogen. Das nennt sich "Die Lebensfreunde". Die ist... das ist aber relativ kostspielig, muss ich sagen. Also unter 700 Euro, was ich da so mitgekriegt habe, ist keine Woche drinnen. Und das ist mir ehrlich gesagt alle zwei zu teuer.
Interviewer: Ist klar, das sind dann schon 1400 Euro in der Woche.
Frau N.: Das ist natürlich auch Rundumbetreuung, aber die hat anscheinend nicht so großartige Förderungen, muss das irgendwie selber finanzieren und natürlich auch genügend Betreuer mitnehmen und ist natürlich sehr teuer. Da habe ich sie auch schon tageweise mitgeschickt. Die sind einmal ins Thermenbad B. gefahren. Einmal wollten sie Rodeln fahren am S., ist dann aber auch nur stundenweise und da kostet so ein Tag um die 100 Euro und das ist... das ist bei vielen Eltern - ich spreche da nicht nur von mir - einfach eine finanzielle Frage.
Interviewer: Diese Freizeitangebote kosten eben gewisses Geld und bedeuten dadurch eine gewissen Belastung.
Frau N.: Genau. Und die K., muss ich sagen, alle Achtung. Von denen bin echt begeistert, weil es einfach nicht teuer ist ((lacht)), weil es gut ist und... ja... Schade, dass es jetzt zu Ende ist ((lacht)).
Interviewer: Blöderweise gibt es jetzt dort auch Altersbeschränkungen.
Frau N.: Ja, das ist halt... das nagt an mir sehr ((lacht)). Aber wenn man endlich was gefunden hat als Elternteil, was ja auch schwierig ist, wie gesagt, das abzugeben, sein Kind abzugeben. Wie weit ist er schon selbstständig? Wie weit kann derjenige, der ihn jetzt übernimmt, mit ihm gut umgehen? Man muss einfach ein Vertrauen in andere Personen setzen. Das ist für Eltern schon sehr schwer. Speziell, wenn ich mir denke,sie können es nicht sagen, was sie wollen, ja. Aber das ist... ich glaube die Ängste haben alle Eltern und ich denke mir im schlimmsten Fall passiert eh nichts... meistens nichts ((lacht)) es ist eh jeder... Aber trotzdem, es ist da. Es ist nicht nur bei mir da. Ich habe jetzt so viele Eltern kennen gelernt im ganzenWeinviertel und die Ängste sind ur da jemand anderem sein Kind anzuvertrauen. Weil jeder will das beste für sein Kind und jeder steckt sich die Ziele sehr hoch, das muss ich auch sagen.
Interviewer: Meistens sind die Kinder auch relativ betreuungsintensiv und die Kinder dort abzugeben oder zu schaffen dort abzugeben...
Frau N.: Natürlich ist in zweiter Hinsicht das Finanzielle, das muss ich auch sagen, weil viele Mütter sind einfach nicht berufstätig. Das ist so, weil es einfach nicht gegangen ist, wie auch immer. und... und...
Interviewer: Zeitaufwand?
Frau N.: Ja, solange sie in die Schule... zum Beispiel jetzt Wien ist vielleicht anders mit Horts. Ja, da gibt es die Horts in den Schulen, aber in Niederösterreich gibt es das nicht für behinderte Kinder und jetzt natürlich ist das Kind einfach da... um zwölf... Wo kann man da arbeit gehen? Das ist schwierig. Wo soll man dann wieder schnell einsteigen? Bei mir ist es überhaupt schwierig gewesen mit beiden und dann ist die finanzielle Seite so, dass jeder sagt: na gut, es gibt das Pflegegeld, davon kann man ja die Betreuung bezahlen. Nur: die Mütter leben einfach dann vom Pflegegeld, das ist... das sag ich einfach so.
Interviewer: So mehr oder weniger als Art Bezahlung für das, was man macht.
Frau N.: Genau, das ist es ja auch. Das sagt man eh: das Pflegegeld steht mir zu, weil ich meine Kinder pflege, auf deutsch gesagt, ja. Aber nur kann man da nicht zusätzlich noch großartigen Sprünge machen.
Interviewer: Aber es ist nicht soviel, dass man wahnsinnig gut davon leben könnte... verstehe. Also das meiste hast du über das Internet erfahren über die Ferienangebote... das heißt man muss es sich selber holen?
Frau N.: Ja, man muss es sich holen, ja. Weil man kriegt es... oder durch andere Mütter auch natürlich.
Interviewer: Also über Mundpropaganda
Frau N.: Über Mundpropaganda, ja. «...» Teilweise habe ich auch sehr viel erfahren über das Ambulatorium in S., aber in früherer Zeit schon. Das ist es eigentlich hauptsächlich um Therapiemöglichkeiten gegangen, um finanzielle Unterstützungen gegangen. Also man muss, jetzt gelinde gesagt, einfach immer aktiv sein, dann erfährt man auch viel.
Interviewer: Wenn du etwas ändern könntest an der derzeitigen Situation rund um Ferienangebote, was würdest du ändern?
Frau N.: Ich würde mir wünschen eine Organisation, die auch Ferienangebote über 18 anbietet. Und wenn es nur eine Woche im Jahr ist. Ich meine... wie auch immer. Natürlich werden da viele wahrscheinlich auch wieder sein, wo dann selektiert wird, das ist schon klar, aber das würde ich mir einfach wünschen.
Interviewer: Also, dass nicht so die Grenze ist und nachher ist dann relatives Brachland.
Frau N.: Genau «...» Oder ich würde mir wünschen, das wäre das zweite, wenn ich meine Kinder in den Urlaub mitnehme, dass es eine finanzielle Unterstützung für eine Rundumbetreuung oder stundenweise Betreuung durch einen Assistenten gibt. Das habe ich voriges Jahr versucht - das gibt es nicht. Das Land Niederösterreich hat mir gesagt, weil ich angesucht habe, ob ich, wenn ich einen Studenten mitnehme, eine Unterstützung bekommen - zumindest ein Drittel davon oder die Hälfte, dass ich bezahlt kriege, weil der kriegt ja auch die Unterkunft bezahlt und bekommt eben dann die Assistenzstunden noch bezahlt. Ist mir gesagt worden: nein, da gibt es keinen Paragraphen dafür. Gibt es nicht. Jetzt habe ich irgendwie argumentiert, wenn ich mein Kind, weil, wenn sie in einem Tageheim sind, können sie ja dann kurzzeituntergebracht werden im Wohnheim auch. Also die meisten Behindertenwerkstätten haben ja dann Wohnheime. Das heißt ich könnte mein Kind drei Wochen unterbringen, kurzzeitunterbringen und das zahlt auch einen Teil davon das Land Niederösterreich und holt sich dann von den Eltern dann eben einen Kostenanteil. Das zahlen sie! Da muss ich fast nichts zahlen, ja... und das kostet aber zum Beispiel dem Land wesentlich mehr, als wie der Assistent kosten würde für die Woche, ja... und das habe ich von der Logik her nicht verstanden.
Interviewer: Sind das dann so diese rechtlichen Barrieren?
Frau N.: Ja, genau «...» Ich habe gesagt den Assistenten würde ich mir wünschen, was weiß ich, 400 Euro, dass sie mir einen Zuschuss geben, ja... für zehn Tage Italien zum Beispiel und wenn der Peter im Wohnheim untergebracht wird, zahle ich pro Tag... weiß ich nicht... 77 Euro oder so. Das wäre wesentlich mehr, weil sie holen ja von mir nichts... fast nichts zurück, weil ich ja kein... offiziell kein Einkommen habe und das ist der Witz dabei ((lacht)). Das habe ich nicht verstanden, weil ich gesagt habe, ich will ihn eigentlich nicht ins Wohnheim geben, weil ich möchte, dass er gern... ich möchte, dass er auch Urlaub erlebt, ja... einfach mitfahren ans Meer und ich brauche Unterstützung, weil das mit beiden kein Urlaub ist.
Interviewer: Wenn es nicht irgendwo aufgeschrieben steht, wird es nicht gemacht «...» Wie schaut es mit der Erreichbarkeit von Ferienangeboten aus? Da muss man selber wahrscheinlich beide mit dem Auto hinbringen?
Frau N.: Ja, also Niederösterreich ist da sicher nicht so gut bestückt. Kommt jetzt natürlich darauf an wie die Infrastruktur ausschaut, wo man wohnt. Also wir zum Beispiel sind ja bald in Wien, mit einem Zug auch - das ist sicher kein Problem. Es ist halt die Frage wie weit man sich das antut, dann vielleicht eventuell mit Gepäck und Kinder etc. oder was wir mitnehmen usw. - da ist natürlich das Auto bequemer. Aber natürlich wenn jemand wohnt in einem kleinen Ort, wo die Erreichbarkeit einfach schwierig ist, ist man aufs Auto angewiesen.
Interviewer: Ist natürlich auch zeitaufwendig.
Frau N.: Ja - es sind immer die Eltern gefragt, dass sie sie irgendwo hinbringen. Es gibt nicht in dem Sinn einen Busverkehr oder so irgend... Und die meisten können nicht... sind auch nicht so selbstständig, dass sie alleine wohin fahren. Sehr schwierig - das muss man ja auch antrainieren, ja.
Interviewer: Ja - Fahrtentraining - das dauert meistens bis das halbwegs sitzt. «...» Gibt es hier in der Gegend eigentlich auch integrative Ferienangebote?
Frau N.: Es gibt von der Volkshilfe etwas. Kenne ich selber nicht, muss ich sagen. In L. gibt es da Ferienaktionen, aber da nehmen sie auch nur bis fünfzehn oder sechzehn Jahren mit.
Interviewer: Das war es eigentlich.
Frau N.: Das war es schon ((lacht))
Interviewer: Ja... alle mir wichtigen Punkte wurden angeschnitten... Danke für das Interview.
Interviewer: Könntest du deinen Sohn Markus kurz beschreiben?
Frau S.: Also ich tät ihn einmal... ganz grob tät ich ihn... tät ich sagen... «...» ein sehr mmh... lebensfreudiger, interessierter, ich hab immer gesagt Entdecker. Also er ist irrsinnig gern unterwegs und schaut neue Sachen... kennen zu lernen und Dinge.. vielmehr auf Dinge konzentriert als mit... als mit Menschen. Aber auch sehr lieb zu den Menschen hin. Also dass er eigentlich immer so einen guten Kontakt hat. Er geht so gern auf die Leute zu und sagt: die sind lieb. Früher hat er immer gesagt: sind sie alle lieb. Irgendwie ist von ihm so was positives ausgegangen. Also so würd ich ihn...
Interviewer: So als positiven Menschen?
Frau S.: Eigentlich schon, ja. Der halt wahrscheinlich auch... Also ich denk mir oft, total eingeschränkt ist mit seine Ideen oder was er kann. Und ich glaub, dass er es zum Teil auch weiß, dass er seine Grenzen einfach immer... dass er gern mehr täte. Früher wie er kleiner war hat er sich das für den Bereich, wo es für ihn machbar war, hat er gemacht und wo er Hilfe gebraucht hat, ist er gekommen und hat meine Hand geholt. «...» Er hat einfach immer so seine Ziele gehabt, hat immer versucht sie zu erreichen und hat aber Hilfe geholt, wenn er gewusst hat... Es war ganz toll zum zuschauen bei ihm. Und jetzt denk ich mir oft, jetzt wird der Raum größer. Früher war das zu Hause und ein großer Garten. Wir haben einen sehr großen Garten gehabt, wo er auch sehr viel Bewegung... Also das Therapiefeld. Und jetzt ist es aber größer. Das Therapiefeld muss sich ausdehnen...
Interviewer: Da muss er sich jetzt wieder irgendwie zurechtfinden.
Frau S.: Jetzt brauchen wir wieder diese Hände, wenn es ist. Was kann er alleine? Wenig. Es wird immer weniger, je weiter raus das geht. Das heißt, das Bedürfnis wird er wahrscheinlich genauso haben und er braucht jetzt die Leute, die mit ihm gehen und die Hand, die ich vorher gemeint hab, beim kleinen. Jetzt muss sich das ausdehnen, jetzt braucht ich mehr Hände. Jetzt braucht er mehr Leute, die mit ihm gehen, weil er alleine nicht gehen kann bei gewissen Sachen. Aber sonst ist er eher so... Also ich glaub, dass er gerne auf der Welt ist.
Interviewer: Und wie läuft es so im Alltag mit ihm? Gibt's da Unterstützungen von familiärer Seite? Also wie einfach der Alltag abläuft beim Markus.
Frau S.: Also die Hauptsache ist meine. Wir haben keine Großeltern in der Nähe und ja... Das ist aber das Hauptdings. Was ich... wen ich gehabt hab am Anfang, war meine Schwester, die im Behindertenbereich ist. Aber ich habe ja lang gebraucht, bis ich das rauslassen hab können. Ich hab mir da echt schwer getan. Ich habe immer geglaubt das muss ich machen und das ist meine Aufgabe und das kann ich einem anderen nicht zumuten.
Interviewer: Also doch anstrengend auch?
Frau S.: Ja. Der Daniel war sein bester Therapeut, sag ich einmal am Anfang. 20 Monate auseinander und der mag ihn heute überhaupt nicht mehr.
Interviewer: OK... Interessant... aber OK...
Frau S.: Der sagt: «...» »nervt mich«
Interviewer: OK... na ja, ist auch sein gutes Recht ((Interviewer und Frau S. lachen))
Frau S.: Also ich bin zu Hause, also von dem her...
Interviewer: Also du bist nicht berufstätig?
Frau S.: Also ich mache nur so kleine Jobs. Das ist auch so im Betreuungs- und eben auch im Behindertenbereich und Kinderbetreuung, aber arbeiten geht nicht. Wenn er krank ist, wer ist da? Es wäre keiner da. Und der G. hat einen Job eigentlich gehabt die ganzen Jahre auf Montage, also der war viel weg.
Interviewer: sehr viel unterwegs.
Frau S.: Sehr viel unterwegs, ja.
Interviewer: Aber alleine zu Hause wäre nichts für ihn, für den Markus. Dass er alleine zu Hause bleiben würde, geht das eine Zeit lang?
Frau S.: Ja. Es kommt halt darauf an, wie lange.
Interviewer: Also würde er es schon schaffen, so eine halbe Stunde.
Frau S.: Ja, ich mein... eine halbe Stunde ja... Also eine halbe Stunde habe ich ihn sicher noch nicht... Ich würde nicht zu einem Geschäft gehen. Natürlich gehst du einkaufen und zurück... Also das, das kann ich schon sagen
((Herr S. meldet sich aus der Küche zu Wort))
Herr S.: Also ich habe ihn schon alleine gelassen.
Frau S.: Wo hast ihn du alleine gelassen?
Herr S.: Ich hab einmal fortfahren müssen alleine. Ich hab mit ihm alles besprochen.
Frau S.: Wie lang war das?
Herr S.: Eine halbe Stunde sicher oder länger wie eine halbe Stunde. Alles besprochen...
Frau S.: Also wie ich den Daniel aus E. abgeholt habe vom Bus... Also das sind halt so Sachen. Ich hab auch schon den Daniel vom Bus abgeholt und da hab ich gefragt: »Fahrst mit ihn holen?« Hat er gesagt: »nein« und dann setzt er sich vorm Fernseher und dann komm ich wieder. Also das ist schon so ein... «...»
Interviewer: Also längere Zeit ist natürlich...
Frau S.: Nein. Mag ich nicht, ehrlich gesagt. Also das ist für mich...
Interviewer: Auch falls irgendwas passieren sollte. Er kann ja selber keine Rettung anrufen.
Frau S.: Also das dürften wir gar nicht. Wenn du in dem Moment... und es kann sein. Du kannst raus gehen und es kann was passieren.
Interviewer: verhindern kann ma's...
Frau S.: Verhindern kann ma's nicht, aber ja... Aber ich lass ihn im Auto sitzen und gehe ins Geschäft einkaufen. Er ist noch nie ausgestiegen und weggegangen. Tut er Kassetten hören. Wenn er nicht weggehen will.
Interviewer: Also da hat er auch kein Problem damit.
Frau S.: Nein, er ist noch nie ausgestiegen. Das verwenden wir auch als Strafe. ((lacht))
Interviewer: Wieso?
Frau S.: Weil er gerne einkaufen geht und wenn er sich wirklich aufgeführt hat und ich weiß, er geht gern zu B. «...» und anschauen, einfach anschauen in den Geschäften. Er tut das total gerne. Und dann muss ich ihn irgendwie eine Maßnahme setzen. Und dann sagen: »siehst, weil du das gemacht hast, dafür musst jetzt. Und da kannst jetzt nachdenken darüber.«
Interviewer: Und funktioniert's?
Frau S.: Ja, es tut ihm dann schon ein bisschen leid, dass er nicht mitgehen kann. Und da kann ich dann hoffen, dass beim nächsten Mal irgendwas ein bissl besser... Er kriegt das aber auch als Belohnung, dass ich mit ihm extra hinfahre in ein Geschäft, das er gerne mag.
Interviewer: Blumen schaut er sich ganz gerne an, oder?
Frau S.: Ja die Bogeln. Und da gibt's den L. in Wien. Und zum B.[9] mag er gern, gern gehen. Irgendwie verschwindet er. Wir gehen dann bei der Tür rein und er macht nichts kaputt und er tut dann die Sachen anschauen und stellt sie auch wieder schön hin.
Interviewer: Also es ist kein Problem im Endeffekt.
Frau S.: Nein, nein.
Interviewer: Was besucht er denn für Einrichtungen eigentlich? Also Schule...
Frau S.: Der Markus geht in Wien in die H.. Kennst du die Sonderschule?
Interviewer: Ja, sagt mir schon was. Also gehört hab ich davon.
Frau S.: Ja das ist eine gute Schule und die hat einen Hort dabei. Er hat angefangen in K. zwei Jahre und dort war's dann zu wenig. Mir war's zu wenig. Ich hab mir gedacht: um 11, um 12 wieder nach Hause. Wir kommen nicht auseinander. Die H. hat den Vorteil gehabt, dass sie ein bissi vielleicht zu Oma und Opa auch noch gehen haben können. Und ich weiß nicht, ob sie damals schon Freizeitassistenten gehabt hat, oder nicht. Ich bin irgendwie nicht ausgekommen, also aus diesem um 11 schon wieder da sein und was mach ma mit ihm, oder irgendwie. Also ich hab das Gefühl gehabt, ich möchten ihm gern länger die Möglichkeit... Und das haben's auch alle immer gesehen. Also irgendwie war's der Markus, der eh selber nach dem Signale setzt. Also auch die Lehrerin. Was gehen würde und so. Und da hab ich noch nicht die Idee gehabt, man könnte ja einen Freizeitassistenten nehmen. Dass der zwei mal in Woche ihn holt und ein bissi mit ihm zusammen ist «...» war nicht. War ich noch nicht so weit.
Interviewer: Das heißt, er fahrt jetzt in der Früh rein nach Wien.
Frau S.: Ja, ich bring ihn dort hin und da... und um dreiviertel vier spätestens hol ich ihn wieder ab dort. Und da geht er Essen und der hat vom ersten Tag an kein Problem gehabt.
Interviewer: Das war absolut unproblematisch?
Frau S.: Überhaupt nicht. Und die Kinder waren »Haare, Haare«. Er hat nur von Haaren geredet. Ich glaube, dass das sein Zugang war. Dass die Autisten die Personen nicht so wahrnehmen und ich hab auch einmal in einem Buch gelesen, dass sogar Gesichter verschwimmen, was ich aber nicht glaube bei ihm. Und trotzdem von der Wahrnehmung hat er nur von den Haaren geredet. Schwarze Haare und goldene Haare und Haare anblasen und dann sind schon Namen auch dazugekommen.
Interviewer: Aber das dürfte so das erste sein, was er wahrnimmt so an Menschen.
Frau S.: Wie eine Brücke, habe ich mir oft gedacht.
Interviewer: Haare sind halt schon kein Gesicht, aber dort in der Nähe und...
Frau S.: und sie gehören zu einer Person und irgendwann haben diese Haare auch einen Namen gehabt, irgendwie so. ((lacht))
Interviewer: Ja und was würdest du unter... ich meine, es gibt ja den tollen Begriff geistige Behinderung. Was würdest du darunter verstehen? Markus würde offiziell unter geistige Behinderung eingeordnet werden. Was bedeutet das für dich, geistige Behinderung? Wie würdest du das interpretieren?
Frau S.: Naja, ich kann das jetzt ganz idealistisch aussprechen... Tatsache ist einfach, dass er, wenn wir soviel zur Verfügung haben ((Frau S. zeigt mit beiden Händen einen Abstand von ungefähr 50 cm)) mit dem wir Regeln lernen können, Sachen lernen können, um in dieser Gemeinschaft zu leben mit Geld oder irgendwas, hat er so einen kleinen ((Frau S. zeigt mit beiden Händen einen Abstand von ungefähr 20 cm)) und das andere fehlt ihm alles. Das ist jetzt einmal die geistige Behinderung, wie's unsere Gesellschaft irgendwie... Das kann er nicht. Ich selber sage: wir haben alle verschieden mitgekriegt an... und ja, das ist seins, sein Selbstpotential und wenn er sein bestes findet oder er seine beste Möglichkeit findet, dann passt das für ihn. So wie der andere so einen Level ((Frau S. zeigt wieder mit beiden Händen einen Abstand von ungefähr 50 cm)) mitkriegt und der hat die Aufgabe in dem Level sein bestes zu finden und der andere da ((Frau S. zeigt mit beiden Händen einen Abstand von ungefähr 40 cm)), hat's er da ((Frau S. zeigt wieder mit beiden Händen einen Abstand von ungefähr 20 cm)). Also es gibt für mich zwei Sichtweisen. Für mich ist er in seiner... «...»
Interviewer: in seiner Welt?
Frau S.: in seiner Persönlichkeit sehr kreativ, sehr einfallsreich, sehr lieb, sehr praktisch, sehr gescheit, sehr lustig... Also taugt mir einfach so wie er... toll, was der alles drauf hat. Aber ich darf ihn nicht mit dem vergleichen, der... Er ist er und dann «...» passt das. Und was ich von dem gelernt hab und gesehen hab. Wo ich, wenn ich mich ein bissi auf ihn eingelassen habe, welche Tiefen er mir aufzeigt mit Sachen, wo ich mir oft gedacht hab: der zeigt mir das ja viel direkter. Wir müssen dann wieder in Dinge... Wie er die Natur beobachtet. Ich hab mir gedacht: wir gehen dann wieder in Seminare und gehen wieder schnuppern und riechen und schauen und er tut das die ganze Zeit.
Interviewer: Er macht das tagtäglich.
Frau S.: Egal... Wenn ich mich auf ihn einlasse, gehe ich oft in Bereiche, wo ich mir denke: Bub, was du mir alles zeigst. Also wenn ich mich einlasse auf das, was zu geben hat, dann ist das eine ganz eine tolle Sache. Also ein Stück von etwas, was mir vielleicht fehlt, diese Art zu leben.
Interviewer: Was ma irgendwann einmal verlernt.
Frau S.: Was die auch haben. Und ich hab mir selber immer gedacht, dass die Kinder, wenn ich in die Schule gekommen bin, was da oft für eine Herzlichkeit entgegengekommen ist. Ich hab gedacht, da finde ich überhaupt keine Zeit mehr dafür. Oder wo wir denken, oder wir berechnen, wir denken, oder was ich alles denke, was der andere nicht weiß. Weißt, diese Masken und dieses schöne Gesicht machen und da schaut's ganz anders aus.
Interviewer: So: was könnte der andere von mir denken?
Frau S.: Das können sie nicht. Die sind so direkt.
Interviewer: Das hat was.
Frau S.: Das hat auch was. Also ich hab ihn schon sehr positiv erlebt, muss ich sagen. Ich hab auch meine Grenzen mit ihm erlebt. Aber im Grunde sag ich... also ich sag einmal er ist eine Bereicherung für mein Leben.
Interviewer: Und wie schaut's mit der Freizeitsituation aus. Also was verbindest du überhaupt einmal mit Freizeit, Freizeit vom Markus?
Frau S.: Freie Zeiteinteilung. Was nicht eingeteilt ist. Was tun wir? Ich versuch, und das hab ich immer mit ihnen versucht, erst zu zweit mit den zwei Buben, möglichst viele Sachen anschauen, entdecken, hingehen, damit er seine... seine Möglichkeiten, dass ich sag, tut er das oder das, dass das größer wird. Das kann ich ja nur indem ich dorthin gehe und ihm das einmal zeige. Sonst weiß er ja gar nicht, dass es das gibt.
Interviewer: Also den Erfahrungshorizont erweitern.
Frau S.: Genau. Das habe ich immer gemacht und das versuch ich noch nach wie vor. Also ich bin immer wieder so am Schauen in Zeitungen, oder wenn irgendwas ist, dann schaue ich immer so bissi nebenbei. Könnt ma sich das auch noch anschauen, könnt ma dort hingehen, könnt ma das irgendwie so... also ich hab das immer gemacht. Also ich bin mit ihm unterwegs gewesen, sag ich mal so. Ferienprogramm und weggefahren. Und schau halt immer was neues, dass mir was einfällt.
Interviewer: Also das heißt die Organisatorenrolle ist mehr oder weniger deins dann?
Frau S.: mmhm
Interviewer: Dass du schauen musst, was er in der Freizeit macht.
Frau S.: Was könnt ma noch mit ihm machen?... Also... ich überleg mir immer: was könnt ich ihm noch zeigen? Was könnte ihm noch gefallen?
Interviewer: Und was macht der Markus dann meistens in der Freizeit eigentlich?
Frau S.: Wenn wir zu Hause sind?
Interviewer: Ja, so überhaupt... oder ja... Was macht er eigentlich, wenn er zu Hause ist?
Frau S.: Da wird er wahrscheinlich drüben sitzen und Video schauen und nebenbei so Lockerl stecken und irgendwie zwischendurch einmal daherhupfen und ja... Wenn er alleine für sich ist, tut er jetzt das am liebsten. Und mit Lego hat er viel gebaut. Also solche Sachen.
Interviewer: Beschäftigt er sich die meiste Zeit alleine?
Frau S.: Alleine oder man beschäftigt sich mit ihm. Also wie wir dort noch am Land waren, haben wir eh immer wieder Möglichkeiten gehabt. Er geht unheimlich gerne in den Wald. Also der Wald ist... ((wendet sich zu Herrn S., der in den Raum gekommen ist)) Gö G., der Markus geht total gerne in dem Wald.
Herr S.: Das ist Medizin für ihn.
Frau S.: Aber er mag auch andere Sachen machen. Wenn man ihn gut anleitet. Er tut überall mit. Er kennt sich auch gut aus. Wir gehen ins Kino, wenn wir wegfahren. Wir haben alle Tierparks, wir haben alle «...» Bergerl angeschaut, was da schon war in der Gegend. Also was er so...
Interviewer: Also schon ziemlich viel unterwegs?
Frau S.: Eigentlich schon. Ich glaub schon.
Interviewer: Und er ist da immer voll dabei? Ist das was, was ihm taugt?
Frau S.: Immer. Also man kann mit ihm alles machen. Wir sind ins Museum auch schon gegangen. Also wenn die Freundinnen kommen im Sommer oder so mit den Kindern, dann mach ma immer wieder Programme. Natürlich auf sie abgestimmt. Ich war noch nie im Theater mit ihm, oder so was, weil ich mir denk, da muss es ruhig sein und wenn er dann laut... Würd ich jetzt von der Umgebung nicht so wählen, aber man kann Kino gehen. Das möchte ich jetzt so... Konzerte würd ich jetzt gern einmal ausprobieren. So richtige Popkonzerte.
Interviewer: War er schon einmal auf einem?
Frau S.: Nein. Auf so große Veranstaltungen hab ich mich nicht so richtig reingetraut, weil da hab ich Angst gehabt, dass ich ihn verliere. Ich hab ja eine Zeit lang ein Pickerl ihm hinaufgehängt, dass ich mich nicht umdreh und er ist weg und er kann nicht einmal sagen...
Interviewer: Also wo seine Adresse draufgestanden ist?
Frau S.: Ja genau. ((lacht)) Das hab ich mir wirklich gemacht für ihn, damit ich... So einen Anhänger damit er irgendwen.... Also wenn ich ihn verlier...
Interviewer: Also selber kann er's wahrscheinlich nicht so richtig artikulieren.
Frau S.: Ja genau. Und das hab ich so eben bei Großveranstaltungen eher... Und wie er kleiner war, war ich einmal auf einem Konzert mit ihm und da hat er das nicht ausgehalten: die vielen Leute drinnen sitzen und der Lärm, also der hat dann nur mehr... Dann bin ich hinaus mit ihm. Also es müsste Freiluft sein und man müsste mit ihm so am Rand gehen.
Interviewer: OK, so langsam hintasten.
Frau S.: Ja. Umgekehrt täte er aber gerne wahrscheinlich zuschauen den Musikern. Die täte er wieder gerne vorne sehen. Aber das ist so das nächste, was ich so ein bissl anpeile.
Interviewer: Also das ist so in Planung. Hast du auch Freizeitassistenten jetzt im Moment?
Frau S.: Ja. Also was ich jetzt hab, ist der C., der zukünftige Schwager. Der ist im Behindertenbereich. Der hat das Klettern übernommen. Dann hab ich die I. . Das ist die Holländerin, die holt ihn von der Schule und dann kann er auch sagen... Also die wohnt in G. drüben an der D.. Und das hat dem Markus natürlich getaugt. Dorthin fahren und einfach mit ihr zusammen sein. Und dann auch durch diese Au gehen und dann mit der Fähre fahren und das ist halt dann auch so ein bissl... Und die Ines einmal im Haus des Meeres. Dann sind sie einmal nur Schnellbahn gefahren mit dem Wiesel, weil er wollte mit dem Wiesel fahren. Dann hat sie das gemacht. Solche Sachen halt. Wo dann sonst ich mit ihm sitzen würde. «...» Die T. ist ein bissl mit ihm gewesen schon. Die hat auch schon ein paar Sachen gemacht. Einmal Ausstellung und so... Dann hab ich eine Zeit lang einen U. gehabt. Der hat ihn immer Sonntags gehabt, da war ma immer in Wien. Ist auch irgendwohin gegangen. Einmal Schönbrunn oder so. «...» Und es hat eigentlich keiner Probleme gehabt.
Interviewer: Also auch von der Reaktion her?
Frau S.: Nein. Überhaupt nicht. Und er würde sich noch mehr wünschen, wo die Leute dann aber nein gesagt haben, wo ich oft so gefragt hab. Und das war dann einfach so nicht zum kriegen, auch im Bekanntenkreis nicht. Die haben dann gesagt: ich würde mich nicht trauen. Aber wer sich getraut hat, waren diese Freizeitassistenten. Die haben gesagt: OK...
Interviewer: OK, das mach ma jetzt...
Frau S.: das passt so. Und es ist immer die Meldung gekommen: es gibt eigentlich eh keine wirklichen Probleme. Natürlich: man muss schauen, weil er auch gerne anschaut und so. Aber nach zwei, drei Mal hat man gesagt: das geht, das passt, das ist...
Interviewer: Natürlich: Aufmerksamkeit...
Frau S.: braucht er.
Interviewer: braucht er auch. Man muss natürlich auch aufmerksam sein, weil er schnell weg ist, denk ich.
Frau S.: Genau, wennst jetzt mit ihm mit drei aufm Christkindlmarkt gehst, bin ich mir sicher, dass du mehr den Markus im Auge behalten musst. Dass die anderen mehr bei dir bleiben, aber er auf die Sachen so fixiert ist, dass er dich vergisst und dann ist er weg.
Interviewer: Dann verschwindet alles andere rundherum.
Frau S.: Wie zum Beispiel dem G. ist es wichtiger, dass er dich daneben hat und dann schaut er mit dir die Sachen an und der Markus vergisst dich, weil er auf die Dinge so konzentriert ist und dann gibt's da noch was und da noch was. Und er täte sich das nur anschauen. Also er täte nicht weggehen, aber die Sachen... Ich bin immer so gegangen. Ich hab immer gesagt, ich bin sein Wächter oder sein Wachhund. Er geht und ich geh nach und pass auf.
Interviewer: Er ist aber eh auch ein eigentlich vorsichtiger Mensch, oder?
Frau S.: Schon, aber merk ich dann halt irgendwie...
Interviewer: Es könnte sein, dass er andere Sachen, die gefährlich wären, ausschaltet.
Frau S.: Ja, ja. Und wir haben ihn in W. «...» Einmal hat ihn der G. im Wald verloren. Da ist er auch heimgegangen, allein. Und das zweite Mal bin dann ich mit ihm gegangen und da hab ich ihm nicht richtig gesagt... ((Markus klopft im Wohnzimmer zwei Mal laut auf den Tisch)) Also ich wollte dann heim. Er wollt noch mehr und es zum regnen angefangen und ich bin dann so vorausgegangen und hab unter anderem einmal so gesagt: na ja, gut, gemma halt beim Förster vorbei und bin dann nicht beim Förster vorbeigegangen. Und dadurch, dass ma jetzt einen Abstand gehabt haben, hab ich immer wieder geschaut, ist er dann zum Förster abgezweigt. Er dürfte mich nicht gesehen haben und ich hab mir dann gedacht: er kommt eh, er kommt eh und dann ist er aber nicht gekommen und ich hab mir gedacht: ja der ist jetzt zum Förster gegangen. Und tatsächlich hat er diesen Weg dann so genommen, hat aber kein Problem gehabt, dass ich nimmer da war, auch beim Förster nicht. Aber ich hab mir dann gesagt: so und jetzt schau ich einmal, wie er tut. Immer in einem Abstand bin ich ihm hintennach, dass er mich nicht sieht. Und er hat dann tatsächlich diese ganz große Runde gemacht, auch durch diese Siedlung, zu diesen Plätzen, zu denen wir immer gehen. Ist auf der Straße total rechts gegangen, hat total aufgepasst und ist dann nach Hause gegangen. War ihm aber eigentlich egal. Also er hat kein Gefühl von Angst. Du hast nichts gesehen, dass er irgendwie: die Mama ist nicht da, oder so. So mit einer Ruhe ist er seine Wegerl gegangen,zu den Bäumen mit dem ganzen... aber ich war erstaunt, wie toll er das dann gemacht hat, mit dem Über-Die-Straße-Gehen, mit dem Rechts-Gehen und mit dem ganzen. Aber er kennt die Gegend.
Interviewer: OK, also wenn das irgendetwas unbekanntes wäre...
Frau S.: Dann kann er sich verirren. «...» Es war aber nicht so, dass er dort eine Panik gehabt hat. Ist er dann doch heimgegangen. Find ich auch toll.
Interviewer: Eben. Spricht eigentlich dafür, dass er irrsinnig viel mitkriegt, versteht.
Frau S.: Mitkriegt, wo wir nicht wissen... oder braucht wahrscheinlich einfach in der Situation... Ich mein, ist ein gutes Gefühl solche Sachen zu wissen.
Interviewer: Dass man sich doch bis auf einen gewissen Punkt auf ihn verlassen kann
Frau S.: Ja... aber... für mich sehr wage halt, wie ich das... Also ich würd's nicht herausfordern.
Interviewer: Und wie schaut's mit Freizeitangeboten da in der Gegend aus eigentlich, oder überhaupt. Also Freizeitangebote versteh ich jetzt so als was, was von einer Organisation angeboten wird, abseits von Schule und Werkstätte.
Frau S. Nein... nein «...» Einmal hat die Schule was angeboten. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Die hat für Kinder das angeboten, aber Daniel hat gesagt, ich weiß nicht, »Schule der Phantasie«. Das hat in den Freizeitbereich hineingehört ((Markus macht im Hintergrund Laute mit seiner Stimme)). Die haben viele klasse Sachen gemacht, aber das war für den Markus damals noch schwierig. Eben dieses immer mit der Gruppe.
Interviewer: OK - also das ist auch nicht so seins.
Frau S.: Es ist nicht so leicht mit ihm eine Gruppengeschichte zu machen, weil er dann bei Sachen, wo man dann miteinander... er sich was eigenes sucht. Ihr kennt das beim Kegeln, gäh?
Interviewer: ja, ja
Frau S.: Genau. Aber er ist zufrieden. Er ist dabei mit sein Dings und es passt. Er geht total... wir gehen und...
Interviewer: Aber er muss nicht immer unbedingt dabei sein, wenn eine Aktivität ist?
Frau S.: Nein, er kann in der Gruppe. Es reicht ihm oft nur, dass er dabei ist. Er tut dann bei den Sachen gar nicht mit, aber das Dabei-Sein ist schon...
Interviewer: Das Gefühl, dass er dabei ist, aber nicht mitmachen muss?
Frau S.: Ja und das weiß ich jetzt aber nicht, wie er das einhalten könnte. Jetzt musst du ihm immer beim Kegeln sagen: Markus, du bist dran. Der andere bleibt da und wartet bis er dran kommt und den Markus musst du immer herholen und sagen: so jetzt bist du dran. Das ist das, was ihm da so fehlt. Dieses Jetzt-Bin-Ich, Jetzt-Bist-Du. Ich könnte auch Mensch-Ärgere-Dich-Nicht mit ihm nicht spielen...
Interviewer: Also diese Abwechslung...
Frau S.: Genau: jetzt bist du, jetzt bist du, jetzt bist du. Das ist so schwierig.
Interviewer: Also würde ihn das überfordern, oder?
Frau S.: Wenn er gebaut hat so Sachen, dann hat er total alleine für sich gebaut. Wenn sich der Daniel dazugesetzt hat und einmal mittun wollte, dann ist der Markus weggegangen. Hüpfen, springen, plantschen, klettern - das geht alles miteinander. Das ist gegangen, wie sie noch kleiner waren. Da hast richtig zuschauen können. Wenn man probiert hat. Der Markus hat irgendwas gemacht. Wenn man probiert hat so... war schwer mit ihm. Malen ist vielleicht noch gegangen, dass der eine dort sitzt und der andere da. Aber hättest auf seinem Blatt gemalen...
Interviewer: Er steht dann einfach auf und geht?
Frau S.: Kann man nicht mehr weitertun, nein.
Interviewer: OK - also das bringt ihn ziemlich aus dem Konzept
Frau S.: mhmm. Also es gibt, glaub ich, schon Sachen, wo man so miteinander tun kann. Aber es gibt Sachen, wo er's gar nicht kann, denk ich mir.
Interviewer: Wo ihm die anderen Leute einfach zu viel sind und er damit nicht umgehen kann.
Frau S.: Ja, ja. Aber ich hab gesehen, dass ich... Fotos, ich hab's dann auch... mit Luftballons hab ich's gemacht
((Frau S. zeigt einige Fotos von Markus her und es folgt eine kurze Abschweifung vom Thema, die hier nicht transkribiert ist, da sie für die Fragestellung nicht von Relevanz ist. Frau S. kehrt dann wieder zum Thema "Freizeitangebote" zurück))
Frau S.: Ja, es gibt da ja nicht soviel Sachen.
Interviewer: Also Angebot ist gleich null, oder?
Frau S.: Und wenn Kinder versucht haben, mit ihm zu tun, war er der, der gegangen ist. Also das ist dann auch so an dem auch wieder gescheitert. Wenn sie zum Beispiel in dieser Gruppe... und es... gegeben, gegeben... Das war das einzige, wo wir eigentlich dann so hingegangen sind. Also wirklich gegeben... Er kann nicht mitlernen. Was gibt's denn für Freizeitangebote für Kinder? Sportvereine gibt's, Musikvereine, das kann er alles nicht. Für ihn in seinem Bereich, es gibt nichts.
Interviewer: OK. Und so spezifisch für behinderte Kinder und Jugendliche gibt's nichts?
Frau S.: Du, also ich wüsst jetzt aber nichts. Also für mich jetzt.
Interviewer: Also er könnte höchstens bei anderen mitmachen?
Frau S.: Ja, die gibt's auch nicht. Ich mein, die gibt's für uns nicht. Also das war das einzige. Wir haben... Ich bin mit dem Daniel gegangen und hab gefragt und sie haben ja gesagt.
Interviewer: OK - da muss man dann als Elternteil auch ziemlich dahinter sein, dass man an dieser Angebote herankommt?
Frau S.: Ich glaub schon.
Interviewer: Also da hat man anders relativ wenig Chance?
Frau S.: Ja.
Interviewer: Es ist zum Beispiel nie jemand zu dir gekommen und hat gesagt: OK, wir hätten das und das Angebot.
Frau S.: Mir ist das nur im Kindergarten passiert, dass sie gesagt haben: wir wollen ihn integrieren, hätten's was dagegen. Das war wirklich toll, aber sonst...
Interviewer: Sonst war das alles von deiner Seite aus?
Frau S.: Ja und wir sind jahrelang in Wien in die F. reingefahren, das ist so eine Freikirche. Und dort waren immer die Kinder und er war von Anfang an eigentlich in Kindergruppen dabei. Jetzt war das für mich dann schon irgendwie, wo ich gesagt hab: da hat er eh erstens einmal schon viele Kinder immer, aber es ist immer schwieriger geworden. Es ist immer komplizierter geworden. Die Kinder spielen und die Kinder machen... Er konnte bei so vielen Sachen nicht mitmachen. Es wird wirklich schwieriger. Also ich hab schon gesagt, man muss schon... es wird wirklich schwer mit ihm. Es ist einfach so, dass die Schere dann doch auseinander geht. Also ich hab das dann so erlebt.
Interviewer: Also die Entwicklungsschere?
Frau S.: Ja «...» Aber man muss dann eben, so wie der G. gesagt hat, man hat halt einen Betreuer gehabt und dann wäre er mitgefahren mit den K.. Aber du brauchst dann wen und das ist auch dort dann nicht mehr so gegangen, weil du brauchst wen, der ein bissi schaut, was er tut. Und wenn er dann auch nicht mitkommt dann in diese, dann fangt er ja auch zum Stören an und zum Sekkieren. Das habe ich auch gesehen.
Interviewer: Dann macht er irgendwas halt, damit er Aufmerksamkeit kriegt?
Frau S.: Genau. Und wenn das nicht, dann geht er irgendwohin und macht auch einen Unfug. Also da muss dann wirklich für ihn wiederum einer sein, der...
Interviewer: der mehr oder weniger zumindest ein Auge hat auf ihn.
Frau S.: Genau. Und der ihn immer wieder herholt, so wie beim Kegeln. Du musst ihn herholen, dass er so ein bissl hinein und ein bissl hinaus kann und da glaub ich schon, dass das das Autistische ist, dass er eben nicht so kann. Und wenn ihn wer lasst, dann ist er draußen und wen wer sich die Mühe macht ihn so immer ein Stück hineinzuholen, aber ihn auch immer wieder gehen lasst, weil sonst ist er ja fertig.
Interviewer: Also eingesperrt?
Frau S.: Überfordert, oder... Aber doch irgendwie... Aber ich glaube auch, dass sich das entwickelt, nehm ich einmal an.
Interviewer: Also dass er immer noch Fortschritte machen kann in die Richtung?
Frau S.: Und da braucht man wen, der geschult ist und das will.
((Tonbandwechsel. Herr S. hat sich mittlerweile auch an den Tisch gesetzt))
Interviewer: Wie schaut's denn eigentlich in den Schulferien aus mit dem Markus? Ist er da die ganz Zeit lang zu Hause?
Frau S.: Mhmm. Also jetzt haben wir die K., wo er wegfährt. Das haben wir jetzt einmal fix.
Interviewer: Das ist eine Woche.
Frau S.: Eine Woche und das haben wir auch voriges Jahr gehabt. Und was hat er den Ferien noch einmal gehabt? Ein Mal in der W., wie er geschnuppert hat, und sonst weiß ich nichts, wo er weggefahren ist in den Ferien. Da hat's nichts gegeben.
Interviewer: Aber das Alleine-Wegfahren war eigentlich kein Problem?
Herr S.: Nie
Frau S.: Also das erste Mal ist er mit der Schule weggefahren. Das war im ersten Jahr, wie wir nach Wien gegangen sind. Und die Lehrerin, die hat damals... Das war schon schwer irgendwie: wie wird er schlafen und das ganze. Aber es war total gut. Aber er hat sie als Bezugperson gehabt. Und sie hat gesagt, er ist in der Nacht auch aufgestanden, also am Abend noch. Sie hat auch in dem Zimmer geschlafen, wo er ist. Und dann ist er hin, und das hat sie mir dann gesagt, und dann ist er hingegangen und hat gefragt: K., bist du eh da? Und dann ist er wieder zurück in sein Bett und dann hat das gepasst.
Interviewer: Also er hat eine Bezugsperson einfach gebraucht?
Frau S.: Das war wichtig, ja. Und dieses Wegfahren mit der Schule war dann nie ein Problem eigentlich.
Interviewer: OK. Das war also nie sonderlich problematisch.
Frau S.: Nein. Nein gar nicht. Also da hab ich mir mehr... Das war ganz toll. Das ist total OK. Und sonst hat'snicht so viel Übernachtungssachen gegeben. In den Ferien... Ferienaktionen haben wir einmal versucht mit der V. wollt ich einmal. Die fahren aber drei Wochen.
Interviewer: Durchgehend?
Frau S.: Ja. Ans Meer, aber das ist damals... Sein Nagel war auf der Seite eingewachsen damals. Also er konnte da nicht mitfahren und ich glaube auch, dass es nicht gut gewesen wäre. Also ich glaube der Zehennagel hat das gerettet. Weil drei Wochen so weit weg. Bei den K. hat er auch niemanden gekannt, aber ich habe beim ersten Mal geschaut und da hat die Nora das so organisiert, dass der G. in der gleichen Gruppe war. Also wir sind miteinander zum Bus hineingefahren und die sind miteinander... Jeder geht auf seinen Platz und doch war was da...
((Herr S. klinkt sich in das Interview ein))
Herr S.: Ich war beim Vorstellungsabend, weil da warst du nicht da in dieser Zeit und da habe ich schon mit dem Betreuer gesprochen, zu dem der Markus gekommen ist.
Frau S.: Das auch, ja.
Herr S.: Weil da hat der Kontakt stattgefunden. Weil da hat man geschaut und so und dann hab ich mir gedacht: der ist geeignet. Dann bin ich mit dem Markus hingegangen und hab sofort gesehen die zwei können miteinander. Und der hat dann auch bemüht darum, dass der Markus in seine Gruppe gekommen ist und das ist dann alles so gelaufen. Also das hat gepasst.
Frau S.: Ja, von dem her. Aber ich sage einmal, so die kleinen Dingen sind schon wichtig. Und jetzt fährt er heuer noch einmal mit und sonst hab ich von dem her jetzt keine Erfahrung. Schule, aber da kennt er ja alle das ganze Jahr. Also von dem...
Interviewer: OK. Also so ein, zwei Mal im Jahr fährt er weg für eine Woche?
Frau S.: Jetzt fährt er dann Ende Mai eine Woche und in den Ferien dann wieder eine Woche. Ich würde ihn aber mehr schicken jetzt mittlerweile.
Interviewer: Also wär schon auch mehr drinnen.
Frau S.: Doch, ja. Als ich denk mir einfach, ist ihm ja fad und so wie ihr seid. Ihr seid junge Leute. Ich mein, ihr macht's ja da ganz was anderes. Ich mach ja nicht. Ich geh mit ihm spazieren und das und so. Aber dann so... Man macht was anderes. Das so Rumblödeln oder so irgendwas, das brauch er, er ist siebzehn. Er braucht wen in seinem Alter und ein bissl, aber er braucht nicht mich und so irgendwie. Uns auch, ja. Aber er braucht das andere auch. Der Daniel würde auch nicht mehr mit uns irgendwohin fahren. Und wenn ein siebzehnjähriger...
Interviewer: Ja, er ist halt siebzehn.
Frau S.: Genau. Der hat sein Clique und würde sagen: na schön, mach ma mal, aber...
Interviewer: Aber ich fahr dann wieder mit meinen Leuten weg.
Frau S.: Genau, ja. Und darum ist es mir so wichtig, dass er irgendwie so zu seinen Leuten kommt, dass diese Freizeitgruppe wirklich bleibt, dass die... Die sind irgendwie miteinander schon so groß geworden.
Interviewer: Dass er einen gewissen Freundeskreis hat, mit dem er was machen kann?
Frau S.: Ja.
Interviewer: Ferien sind ja zwei Monate in Sommer. Wird ihm das dann zu viel, zwei Monate zu Hause?
Frau S.: Also er schläft dann lang. Er faulenzt herum und ich denke mir einfach, ja, zum Teil wird da halt viel Zeit versandelt und so. Aber ich mache ja dann in den Ferien schon auch was mit ihm. Da kommt dann immer wieder das Programm, was ich machen werde. Was unternehme ich mit ihm? Ich habe vor wieder nach Tirol zu fahren. Dann haben wir immer so Sachen gemacht. Mit der H. zusammen machen wir dann Ausflüge mit den Kindern. Bei ihr wird's jetzt anders sein. Der G. hat die letzten Ferien und der Q. ist auch schon in der Werkstatt. Es schaut dann schon ein bissl anders auch und wenn wir Glück haben... Also Glück... Also jetzt geht der Markus auch ab Herbst in die Werkstätte. Aber trotzdem: du brauchst ein bissi Programm, du musst was unternehmen, weil sonst sitzt du dort... Also das geht nicht. Ich hab dann immer mit der K. zusammen Ausflüge dann auch gleich gestartet, wo ich sage: die wollen irgendwas unternehmen und die unternimmt...
Interviewer: Also einfach schauen, dass man mal rauskommt.
Frau S.: Ich komm auch zu Sachen. Das, was auch so schön war. Bratislava-Ausflug. Wir sind dem Schnellflügelboot nach Bratislava gefahren und sind dann in die Stadt. Also da waren der Q., der G. und er, die H. und ich und dann mit dem Zug zurück rauf. Mit dem Zug möchte ich jetzt sowieso mehr machen, weil er zahlt die Hälfte, glaub ich, und ich fahre gratis mit diesem Behindertenausweis. Also wie, die Erwachsenen, fahren gratis mit, wir zahlen nichts. Und für sie muss man was zahlen und ich denke das ist eine super Sache. Er mag so gern Zug fahren und er ist total happy. «...» Also ich komm schon auch zu was dadurch. Das ist das eine, aber ich mag halt, dass er mit jüngeren Leuten was tut.
Interviewer: Also, dass er auch andere Leute kennen lernt, andere Eindrücke kriegt?
Frau S.: Ja, sowieso.
Interviewer: Das ist auch die Bedeutung, die diese Ferienangebote für dich haben?
Frau S.: Ja «...» und es ist eine Entlastung. In der Zeit kann man was für sich tun.
Interviewer: Also das ist auch ein wichtiger Punkt?
Frau S.: Ganz ein wichtiger Faktor, dass also ich sagen kann: das ist jetzt meine Zeit. Weil man kommt aus dieser Aufpasser-Rolle eigentlich nicht hinaus.
Interviewer: Und dann kann man mal entspannen für eine Woche, oder?
Frau S.: pah... sowieso. Tut total gut, dass du das Gefühl hast, jetzt kann ich für mich ganz alleine auch irgendwas machen. Ja, weil es ist ja so viel abgestimmt auf das. So viel auf das auch abgestimmt und wenn man eben auch so Sachen hat, was einem total taugen würde, aber man hat immer irgendwie dieses Schauen.
Interviewer: Das ist schon so automatisiert, glaub ich.
Frau S.: Ja. Ich hab früher zu den Leuten immer gesagt. Wenn ich mit wem geredet habe, habe ich gesagt: darf dich nicht stören, dass ich immer wegschaue, aber ich muss immer schauen, wo er ist. Man findet kein Gesprächs...
Interviewer: Ja. Und wie hast du jetzt eigentlich erfahren von jetzt zum Bespiel K. oder so? Oder wie funktioniert das mit der Kontaktaufnahme und so was?
Frau S.: Also ich hab's durch die H. erfahren. Mütter zu Müttern hauptsächlich und eine Zeit lang hab ich beim Elternverein gearbeitet in Wien und da hab ich mir dann auch Freizeitangebote schicken lassen. Das habe ich sogar in einem Ordner dann gesammelt. Da bin ich dann auch zur V. hingekommen. Irgendwie hat sich das ergeben, dass ich dann die einzelnen angeschrieben hab und da hab ich ein paar Unterlagen zusammengesammelt. Also man muss...
Interviewer: Man muss schon ein bissl dahinter sein, oder?
Frau S.: Ja.
Interviewer: Also es ist nicht so, dass da irgendwer zu dir gekommen wäre und gesagt hätte: wir haben da jetzt ein Angebot, wo er unter Umständen mitfahren könnte.
Frau S.: Von den Organisationen selber nicht. Also irgendwie durch... Eltern beraten Eltern, heißt's immer. Also ich sag weiter und ich krieg.
((Markus kommt zu Frau S., hält ihr seine Hand hin und sagt: "die Finger gehören zam". Frau S. schiebt die Finger zusammen und sagt: "ja, die Finger gehören zam".))
Frau S.: Was aber auch ist, das weiß ich vom Elternverein und von unserer Schule, die Schulen werden angeschickt. Die kriegen Informationen und dann sind sie in der Schule und dann kommen aber viele Eltern überhaupt nicht... Also man schickt's dann mit. Also bei uns ist es dann auch so gewesen, dass es im Mitteilungsheft mitgeschickt worden ist. Also Eltern haben schon Informationen gekriegt von dem. Die beste Beratung war aber, wenn wer selber schon dort war. Weil mit dem Zettel alleine, der dort ausgehängt ist und so irgendwie... Da fehlt wieder dieses Gespräch in der Elterngruppe, wo eine Mutter zu der anderen sagt: heast, das kannst wirklich probieren, das ist gut. Oder mir ist es auch so gegangen. Ich hab mich total gefürchtet und es ist doch gut gegangen oder so. Weißt, der Austausch.
Interviewer: Also eine gewisse Qualitätssicherung einfach?
Frau S.: Genau, ja. Also das ist schwierig, das einfach einmal so ganz neu anzufangen.
Herr S.: Meistens haben ja die Mütter mehr Probleme mit Loslösungsprozessen als die Kinder.
Frau S.: Ja, es ist auch schwer.
Herr S.: Dass das Loslassen für die Mütter oft viel komplizierter ist, als es für das Kind ist, wegzufahren.
Frau S.: Das ist sicher ein Punkt, ganz sicher. Und der zweite Punkt ist, was auch Eltern sagen, und das sag ich auch. Das ist ein gutes Wort, das immer gesagt wird: »lasst's los«, aber man weiß oft wirklich nicht wohin loslassen. Das ist das zweite.
Interviewer: Also da muss ein gewisses Vertrauen da sein?
Frau S.: Auch, weil nur einfach loslassen tust auch nicht. Also das ist etwas, das musst dir schon gut anschauen und eben da tut einem wieder gut dieses... Aber es ist ein schwerer Prozess immer wieder für einen Menschen. Wie geht's dem dann und so.
Herr S.: Das ist das wichtigste. Ich mein, wenn man wohin geht, dass man einfach mitkriegt, das passt oder es passt nicht. Und wenn's nicht passt, dann musst wieder gehen.
Frau S.: Da musst auch ein bissl irgendwie die Leute kennenlernen und ein bissl vorhergehendes Vertrauen brauchst auch und das ist... Ich hab mir oft immer nur gedacht: Wenn er's dann nicht... Erstens hab ich... Oft hab ich mir gedacht: Vielleicht ist jemand nicht nett zu ihm. Er kann mir's ja nicht sagen. Er kann mir's ja gar nicht erzählen. Manche Kinder drücken es dann schon irgendwie aus, ja. Oder er kann nicht richtig sagen, was irgendwie ist. Oder wenn er heim will. Er kann das nicht wirklich... Da fragt man sich wirklich: will er das? Weil ich schicke ihn ja.
Herr S.: Na ja. Er äußert sich aber. Also die letzten Male hat er... war er darauf vorbereitet, dass er in den Urlaub fährt und er hat eigentlich ganz normal die Entwicklung. Die Aufregung vorher, dann das Packen und so weiter. Er hat da viel mitgemacht, oder?
Frau S.: Ja, es war kein Problem. Wie ich das erste Mal gesagt habe, er fährt wieder dorthin, also nach K., das hat ihm weniger was gesagt, aber dort wo die Hunde sind, das war dann irgendwie... Und dann hat er zu mir gesagt: »war ich eh schon«. Also wie ich sage: »geh Zähne putzen«, sagt er: »hab ich schon«. War er schon dort irgendwie. Aber dann hab ich gemeint, ja das ist wieder das, das gleiche und er macht's wieder und dann hat das auch gepasst. Er hat aber nicht gesagt, »ich will dorthin fahren«. Aber es passt.
Herr S.: Nein, das ist nicht sein Gedankenschritt.
Frau S.: Nein «...» Aber auf die Frage noch einmal, wo wir da waren, diese Mitteilungen, ja. Es sind schon Mitteilungen gekommen «...» in Wien. In K. gibt's nichts. In Niederösterreich ist da gar nichts. Also nur was die V. anbietet.
Interviewer: Das heißt, das Ferienangebot könnte besser sein, oder passt es so, wie es im Moment ist?
Frau S.: Ich würde noch was nehmen, wenn ich was passendes hätte. Also wenn ich mir noch was finden täte, aber ich hab mich jetzt auch nicht wirklich nach was anderem... Aber ich glaub so zum Wegfahren... Die
L. sind mir zu teuer. Da haben wir so Tagesausflüge gemacht damals. Herr S.: Da braucht man mehr Betreuer für die Behinderten. Das ist vorgeschrieben. Also Betreuer sind das teuerste.
Frau S.: Und die Rundumbetreuung. «...» Mir würd ja was integratives fast besser gefallen. Also ich hab bei der V., das wäre integrative Ferienbetreuung gewesen. An und für sich war das ein total lieber Trupp, aber waren so drei Wochen durch und das, glaub ich, ist ein bissl viel für ein Kind.
Herr S.: Das muss man probieren, so was. Kann man überhaupt nicht sagen. Außerdem ist ja, wenn man so was macht, besteht ja sowieso immer die Möglichkeit sofort hinzufahren und das Kind abzuholen.
Frau S.: Ja, aber die Integration wär ganz gut, weil man die Kinder da ja auch miteinbezieht. Dass ich sag, geht einmal mit. Das läuft ja in der Betreuung ja auch... Da gibt's eine zweite, also die machen auch integrative Ferien. Da haben sie ihn dann nicht genommen. Da hab ich auch eingereicht und da musst du halt eine
Beschreibung schicken und die passen dann auch die Kinder irgendwie an. «...» und da ist ein Rollstuhlkind zum Teil leichter als er. Der lauft ja nicht weg.
((im Hintergrund Staubsaugergeräusche, weil Markus mit einem Handstaubsauger hantiert))
Herr S.: ((zu Markus)) Jetzt mach keinen Unfug. Du kann in deinem Zimmer aufsaugen.
Frau S.: Da musst vielleicht ein bissl mehr Körperpflege und irgendwo, aber sonst...
Herr S.: Der Vorteil von Integration ist, dass, wenn eine Gruppe von Kinder beinander ist, dann gibt's immer welche, die Verantwortung für andere übernehmen. Und das wär dann dieser natürliche Zyklus. Das heißt, du könntest riskieren, nicht mehr mit eins zu zwei fahren, sondern vielleicht sogar mit eins zu drei oder mit eins zu vier. Wenn du dementsprechend viele Kinder hast. Also bei so vierzehn-, fünfzehnjährigen ist hundertprozentig einer dabei, der Verantwortung über einen schwächeren übernimmt.
Interviewer: Das denke ich auch.
Herr S.: Klar. Da lernen ja auch gesunde Kinder Sozialverhalten kennen. Es kommt darauf an von welcher Richtung der Gedanke Integration kommt, was da dahintersteht. Weil da gibt's sehr wohl Ambitionen, wo wirklich der Behinderte genutzt wird quasi, damit der Normale, der auf Karriere hingezielt wird eigentlich, locker damit umgehen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass da wirklich im Sozialverhalten und in der Menschlichkeit was gelernt wird, sondern im rationalen Verhalten.
Interviewer: Also einfach damit der irgendwie bessere Social Skills...
Herr S.: Ja, der holt sich Vorteile raus aus dem Ganzen. Der merkt sich daraus Vorteile.
Interviewer: Bringt aber den Menschen mit Behinderung an sich relativ wenig.
Herr S.: Gar nichts. Integration ist zwar nur ein Wort, aber das geht von null bis hundert und da ist unheimlich viel Möglichkeit drinnen.
((das Gespräch weicht in der Folge in Richtung schulische Integration ab. Da dieses Thema jedoch für die Fragestellung dieser Diplomarbeit nicht von Relevanz ist, wurde dieser Teil des Gespräches nicht transkribiert. Herr S. kommt dann wieder auf Integration allgemein zu sprechen))
Herr S.: Da muss man unserem Staat ein Armutszeugnis aussprechen, weil einfach der Bedarf überhaupt nicht abgedeckt wird und weil überhaupt kein Interesse besteht diesen Bedarf abzudecken beziehungsweise dafür allzu viel Geld auszugeben.
Interviewer: In der Leistungsgesellschaft ist es halt...
Herr S.: Ja, was weiß ich. Es ist einfach schwierig. Ob es bei Altenpflege ist, oder bei Pflegeheimen ist. Da wird auf der einen Seite abgecasht und auf der anderen Seite stimmt Angebot und Nachfrage überhaupt nicht zusammen. Dann musst vielleicht noch irgendwelche Schieber haben und Kontakte haben und was weiß ich was alles. Das ist nicht wirklich... «...» und das müsste die Politik bestimmen, weil die Gesellschaft zahlt eh sowieso Länge mal Breite, egal was da oben passiert. Und wenn die Politik das nicht schafft, dann wird es nicht geschaffen. Das ist einfach das traurige.
((das restliche Gespräch weicht zu weit von der Fragestellung ab und wurde deshalb nicht transkribiert))
Interviewer: Könnten Sie einfach Ihre Tochter kurz beschreiben?
Frau O.: Meine Tochter ist jetzt 12 Jahre alt. Wir haben eigentlich jetzt keine Diagnose für sie. Wobei das jetzt im Moment auch nicht wirklich wichtig ist. Ich denke mir, sie ist halt so, wie sie ist. «...» Also es ist so: sie hat ein großes Sprachdefizit. Sie hat bis vor wenigen Jahren überhaupt nichts gesprochen und sie kann jetzt ein paar Wörter, die sie relativ gut formuliert und aussprechen kann und sie spricht sehr viele Wörter, die eigentlich nur innerhalb der Familie verstanden werden, aber wir können annehmen, dass sie sehr sehr gut kommunizieren kann.
Interviewer: Also so eine eigenen Sprache?
Frau O.: Sie hat so eine eigene Sprache entwickelt. Ja, die... die für mich... ich denk mir, für mich ist es so wie das erlernen einer Fremdsprache, ja, aber sie hat für jeden Ausdruck immer dasselbe Wort halt und wir können... wir verstehen sie eigentlich alle sehr sehr gut und das ist für sie ein riesengroßer Vorteil. Weil das war eben früher halt oft ein Problem, obwohl sie sich nonverbal auch sehr gut verständigen konnte, also mit Zeigen, mit Hinführen. Also es war nie so, dass sie für sie selber auch das Gefühl gehabt hat, sie kann sich jetzt überhaupt nicht verständigen oder sie kann nicht kommunizieren. Also ich denk mir, es war von Anfang an irgendwie... Is es damit eigentlich ganz gut gelaufen, zumindest innerhalb der Familie. Was so außerhalb ist mit Leuten, die sie nicht kennen, oder... Da hat sie sehr wohl Probleme und ich denk mir...
Interviewer: Jetzt von der Kommunikation her?
Frau O.: Von der Kommunikation her, ja. Ich mein, wenn man sich ein bissi einhört in sie, dann kann man sie eigentlich sehr schnell sehr gut verstehen, ja. Und das ist für sie auch ein großer Vorteil und sie ist dadurch auch viel ausgeglichener geworden, viel ruhiger geworden und ja...
Interviewer: Dadurch, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie sich auch mitteilen kann?
Frau O.: Ja genau. Ich mein von der Motorik her. Grobmotorisch ist sie ganz gut, glaub ich, beieinander. Sie kann gehen, sie kann laufen, sie kann sich auf dem Spielplatz eigentlich wirklich ganz frei bewegen. Sie kann... ja, ich mein, Rad fahren jetzt ohne Stützen funktioniert zum Beispiel nicht. Aber ich denk mir, es gibt trotzdem genügend Möglichkeiten, sich, jetzt bei ihr, zu betätigen. Wir haben im Garten ein ganz ein tolles Trampolin, auf dem sie sehr gerne hüpft und springt und wo sie sich halt auch ein bissl austoben kann. Von der Feinmotorik her ist es so, dass sie jetzt so weit ist, dass sie... ähm... Sie malt sehr großflächig im Moment. Sie kann Stifte halten. Das ist zum Beispiel von ihr ((Frau O. zeigt auf ein Bild das an der Wand lehnt mit Kreisen)) Also es gehen auch schon Kreise ((lacht)) fast genau angemalt. Also schaut schon relativ gut aus und ja... Also Schwierigkeiten hat sie sicher noch bei den Buchstaben, die für auch schwer hinzukriegen sind. Es gehen halt eher Großbuchstaben, die sie nachziehen kann. Das funktioniert gut. Zahlen kann sie... Bei Zahlen ist es fast noch schwieriger, weil ich sagen muss, sie kennt alle Buchstaben. Sie kennt Zahlen sicher bis hundert. Also sie erkennt sie, wenn sie sie sieht. Sie kann auch Wörter, die sie sich eben durch das Bild merkt, auch lesen. Also jetzt nicht zusammenhängend lesen, sondern sie erkennt das Schriftbild mehr oder weniger
Interviewer: OK. Also ihren Namen könnte sie zum Beispiel...
Frau O.: Sie erkennt ihren Namen und sie hat jetzt in der Schule quasi schon ein Heft, das sie für sie angelegt haben, mit Wörtern, die sie regelmäßig quasi jetzt liest, ja und das sind jetzt doch einige Seiten von Wörtern auch, die sie erkennt, ja, und es werden halt immer mehr und ich denk mir, das ist... Also es macht ihr irrsinnig viel Spaß, ja, und sie freut sich da wirklich total.
Interviewer: Und es geht auch was weiter?
Frau O.: Und es geht diesbezüglich auch was weiter, ja genau, mhm.
Interviewer: OK, und wie schaut's mit Geschwistern aus?
Frau O.: Ja, sie hat drei Geschwister, also zwei ältere und eine jüngere Schwester und ja... Also ich denk mir, für sie ist das ein riesengroßer Vorteil, wenn durch die Geschwisterkinder einfach so viel automatisch passiert, ja, und ich mir als Mutter das ja... ich hätt mir vieles nicht... ihr so vieles nicht zugetraut, was ihr die Geschwister zutrauen, ja, und die fordern sie natürlich auch sehr.
Interviewer: Wie Geschwister halt sind, ja.
Frau O.: Wie Geschwister halt sind. Ich mein, es wird auch gestritten und so weiter. Aber ich denk mir, das ist ganz normal, ja, und sie hat wirklich ein... ich glaub, ein ganz ein gutes Umfeld, wo sie sich wirklich auch toll entwickeln kann, ja.
Interviewer: Also fühlt sie sich eigentlich wohl da?
Frau O.: Ja, sie fühlt sich sehr wohl. Also es gibt so, ja, Reiberein, so wie es sie halt überall gibt und ich mein, sie harmonieren dann teilweise auch wieder sehr sehr gut miteinander. Sie gehen auch sehr sehr unterschiedlich auf sie ein. Ich find das irgendwie recht spannend, da zuzuschauen. Es hat doch jeder einen anderen Zugang zu ihr und ja... Aber es passt irgendwie ganz gut, ja.
Interviewer: Also die Familie passt?
Frau O.: Ja, also ich glaub auch so von der Familie her ist... ist sie gut aufgehoben ((lacht)).
Interviewer: Wie schaut's mit der Unterstützung im Alltag aus? Also haben Sie da irgendwen außerhalb von der Schule jetzt?
Frau O.: Es gibt einmal die Großeltern natürlich, die sich da auch sehr engagieren. Also das ist meine Schwiegermutter, die da auch gleich in der Nähe wohnt, die... die wirklich jederzeit verfügbar ist und die Daniela auch wirklich sehr sehr gern zu ihr geht. Also die haben da auch eine ganz eine eigenen Beziehung zueinander und Oma lebt schon sehr lange allein. Also die freut sich auch wirklich, wenn die Daniela kommt und da wird viel vorgelesen und da wird viel gesungen. Also es läuft zwar eher ruhiger ab, aber das ist auch das, was sie manches Mal braucht, weil es zu Hause oft sehr turbulent zugeht und sie oft zur Oma gegangen ist, um sich anscheinend auszurasten oder wirklich ein bissl zur Ruhe zu kommen.
Interviewer: Ist sie dann von selber gekommen und hat gemeint, sie möchte hingehen?
Frau O.: Ja, ja. Also das sagt sie mittlerweile schon selber: zur Oma gehen, und so. Und die Oma hat fast immer Zeit. Also ((lacht)) die freut sich. Also das passt und es sind meine Eltern auch da. Die sind zwar weiter weg, aber es geht auch ab und zu sogar für ein Wochenende, wo sie dann auch dort schlafen kann.
Interviewer: Das funktioniert?
Frau O.: Das funktioniert problemlos und jetzt... Ich hab auch dann immer also... da war die Daniela... ja, drei oder vier Jahre alt, also ab diesem Zeitpunkt hab ich dann immer geschaut, dass da wirklich auch eine... noch eine zusätzliche Hilfe kommt. Das war meistens auch eine Studentin, die gekommen ist ein Mal in
der Woche und die sich so für 3 Stunde cirka auch mit der Daniela beschäftigt hat und... Also für mich war auch wichtig, dass irgendwie von außen auch noch wer kommt, damit die Daniela auch... Die war immer sehr auf bestimmte Personen fixiert und damit sich das halt ein bissl lockert, wo ich mir denk, OK, wenn die Oma halt wirklich einmal nicht Zeit hat, oder so, dass sie halt auch ein bissl Zugang hat zu jemanden anderen und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und ich hab auch jetzt eine ältere Frau, die schon erwachsene Kinder hat, die halt jetzt regelmäßig kommen kann. Ja, mit der Daniela spielt, mit ihr in den Garten geht, spazieren geht, oder so.
Interviewer: OK, da gibt's ein ganz gutes Netzwerk.
Frau O.: Es gibt ein... ein gutes Netzwerk, ja.
Interviewer: Ist das hilfreich so im Alltag?
Frau O.: Ja, es ist schon sehr hilfreich, weil ich denk mir, ich mein, ich kenn sehr viele Familien mit Kindern mit Behinderung, die das jetzt in dem Ausmaß nicht haben. Ich denk mir, da gibt's sehr sehr viel mehr... na ja, Schwierigkeiten würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach für die Eltern ein wirklich großer Aufwand. Also man ist sehr gefordert. Ich mein, ich bin jetzt «...» sicher nicht total entlastet, aber es ist einfach eine Entlastung, ja.
Interviewer: Ja, mit drei anderen Kindern auch noch dazu.
Frau O.: Ja, ich mein, es ist... ja... Es gibt genug zu tun, sag ma's so ((lacht)).
Interviewer: OK. Sind sie eigentlich berufstätig, oder?
Frau O.: Na ja, wir haben eine Landwirtschaft. Also wir sind selbstständig. Aber ich helf ein bisschen mit, sag ma's so, ja. Mein Mann macht sehr viel alleine und es ist nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag gefordert bin. Das ist es nicht.
Interviewer: Das sind eher flexible Zeiten?
Frau O.: Das sind flexible Zeiten. Es gibt Zeiten, wo einfach mehr zu tun ist, ja. So wie Sommer. Frühjahr, Sommer, Herbst. Winter ist dann eher eine ruhigere Zeit, wo halt, ja... wo wir einfach mehr Zeit haben auch als Familie oder für die Familie, ja. Es gibt halt im Sommer oft wirklich auch Wochenenden, wo gearbeitet wird, ja. Wo ma halt... ja, wo's halt doch eher ein bissl stressig ist, aber dafür ist halt dann der Winter wieder, wo mehr Zeit ist, wo auch einfach unter der Woche mehr Zeit ist, wo man auch unter der Woche ein bissl mehr unternehmen kann.
Interviewer: Wo man sich dann wieder mehr auf die Familie konzentrieren kann.
Frau O.: Ja, genau. mhm
Interviewer: OK. Ja, Jetzt wollt ich noch ein bissi auf den Begriff Behinderung halt eingehen, mehr oder weniger was Sie als Elternteil unter geistige Behinderung verstehen. Das ist halt der tolle Begriff, der überall auftaucht, und da würde mich einfach interessieren, was Sie als Elternteil dazu sagen.
Frau O.: Also der Begriff gefallt mir überhaupt nicht. ((lacht)) Ich mein, jetzt wenn ma schon über Begriffe reden, ich mein, es gibt ja auch Behindertenorganisationen und so weiter, die sich da auch damit auseinandersetzen, andere Begriffe zu entwickeln, äh wo jetzt nicht unbedingt geistige Behinderung, ja... total im Vordergrund steht. Es gibt... Es gibt einen Begriff. Das zum Beispiel »Kind mit Lernschwierigkeiten«. Das ist jetzt quasi... ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben.
Interviewer: Ja, ja.
Frau O.: Ich hab dieses... dieses Buch der Begriffe. Ich wollt's eigentlich mit runter nehmen. Ich such's dann.
Interviewer: Ich hab's eh zu Hause.
Frau O.: Oder haben Sie's eh zu Hause, ja. Und jetzt heißt's eigentlich, ja, Kind mit Lernschwierigkeiten. Ich mein, mit dem kann ich auch nicht sehr viel anfangen, weil das drückt jetzt nicht wirklich alles aus, ja. Also ich hab für mich noch nicht wirklich einen Begriff gefunden, der zu meiner Tochter passen würde, wobei ich nicht so sicher bin, ich mein «...» besondere Bedürfnisse klingt vielleicht ein bissl besser als geistige Behinderung, aber das ist es auch nicht, ich mein...
Interviewer: Also geistige Behinderung ist schon ein bissl stigmatisierend?
Frau O.: Es ist stigmatisierend und ah... Es war auch so am Anfang... ich mein Diagnose, ich mein sie haben uns halt dann gesagt, na ja, Ihre Tochter hat halt eine geistige Behinderung. Das war so dieser eine Bereich der Ärzte. Die anderen haben gesagt, sie wird so eine... eine Muskelschwäche haben und sie wird nie gehen können. Und ich muss sagen, ich hab mich da eher so an dieser Muskelschwäche gehalten, weil das klingt auch schlimm, aber es klingt nicht so schlimm, als wie wenn jemand sagt, ihr Tochter hat eine geistiger Behinderung, ja. Das klingt... Also für Eltern, die das irgendwie diagnostiziert bekommen ganz am Anfang, klingt das ganz fürchterlich. Und ich hab das auch nie irgendwie ausgesprochen, ja.
Interviewer: OK. Und Muskelschwäche deswegen, weil's was konkretes ist?
Frau O.: Es ist vielleicht was konkretes, wo ich mir gedacht hab, OK, das Umfeld kann vielleicht was damit anfangen. Ich mein, das ist mir im Moment... also jetzt ist es mir schon egal, aber das war so am Anfang, wo man irgendwie nichts greifbares in der Hand hatte und es ist sicher am Anfang vielleicht auch leichter eine bestimmte Diagnose zu haben, wo man sagt, OK, das ist es und... und ich kann das auch so an die Umwelt weitergeben. Das ist jetzt nicht mehr wichtig, ja, weil ich denk ma, es ändert sich ja nichts, ja. Ob sie das, das, das oder dieses Syndrom hat oder das hat. Das ist nicht wichtig, weil sie ist so und ich kann's ja nicht ändern, ja. Und wenn ich es... wenn ich es... Also wie ich gelernt hab sie so zu akzeptieren, wie sie ist, dann ist es mir auch besser gegangen, ja, und dann waren mit auch diese Begriffe nicht mehr wichtig. Und ich denk mir, das ist einfach ein Lernprozess für alle Eltern, ja, ihr Kind auch so zu nehmen, wie es ist und... und... ja, ich denk mir, vielleicht kommen eh dann die Therapien und das weiß ich nicht, ob das auch noch kommt ((lacht)). Aber es gibt halt auch... ja, es ist so der Ansatz immer dieses Kind so viel wie möglich zu therapieren, damit es halt besser wird und... und ich mein, da muss man irgendwie dann auch durch und ja...
Interviewer: Also am Anfang waren relativ viele Therapien?
Frau O.: Waren am Anfang viele Therapien angesetzt, aber es mir dann eigentlich Gottseindank relativ schnell klar geworden, dass es das halt nicht wirklich ist, ja, sondern ich denk mir, sie brauch genauso ihre Zeit einmal, wo sie nichts tut und wo sie auch wirklich einmal Freizeit hat, wo sie das machen kann, was sie will und wenn sie nur eine Stunde sitzt und nichts tut, ist das auch OK, ja.
Interviewer: Was wir ja eigentlich auch machen, oder?
Frau O.: Es machen wir auch irgendwo ((lacht)). Ich mein, können. Ich weiß gar nicht. Ich mein, wir sind ja schon irgendwie in so einer schnelllebigen Zeit, dass es also fast nicht mehr möglich ist, ja. Und ich denk mir oft... Meine Tochter ist oft, wenn ich sie vom Kindergarten abgeholt hab, ist sie so rausmaschiert da auf den Gehsteig und dann hat sie sich einmal auf so ein sonniges Platzerl gestellt und dort ist sie zehn Minuten gestanden, ja, und ist nicht weggegangen. Und ich mein, ich hab's ja oft schon sehr eilig gehabt, weil ich hab dann die andere Tochter noch holen müssen und so und dann: Daniela, geh weiter, geh weiter. Und dann kommt eine Kindergärtnerin vorbei und meint, mein Gott ist das schön. Sie steht da in der Sonne und tankt Energie. Man kann eigentlich so viel lernen von ihr und... und ich mein, sie hat das gemacht, wenn's ihr danach war. Wir tun ja das fast nicht, ja, weil wir hetzen da von einem Termin zum anderen und ich hab mir gedacht, OK, schön, sie kann's genießen einfach in der Sonne zu stehen, wenn ihr danach ist und sich die Zeit zu nehmen, ja. ((lacht))
Interviewer: Also so einfach da jetzt über den Dingen zustehen und die Zeit zu nehmen und das einmal zu genießen.
Frau O.: Genau, ja.
Interviewer: Ja, hab ich auch schon lange nimmer gemacht ((lacht)).
Frau O.: Es ist schwer das für andere irgendwie so hinzunehmen, aber ich denk mir, sie hat's eigentlich gut, wenn sie das kann und man macht's ja selber auch viel zu wenig, ja. Man nimmt sich viel zu wenig für sich selber Zeit und... Aber sie kann das relativ gut ((lacht)).
Interviewer: Das heißt, die Therapien sind jetzt, sag ma mal, zurückgeschraubt oder weniger geworden?
Frau O.: Ja, es ist weniger geworden. Ich mein, sicher hat's Zeiten gegeben, wo wir sehr viel unterwegs waren, aber... äh... also... Ich hab mir gedacht, ich mein, sie lernt zu Hause auch sehr viel und wenn einfach Kinder kommen, ja, die mit ihr spielen. Ich denk mir, das ist viel mehr... es gibt ihr viel mehr, als wie wenn ich sie mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, ist es einfach immer ein großer Zeitaufwand gewesen, ja, und... und ich hab mich dann dazu entschlossen wirklich nur das zu machen, was ihr wirklich Spaß macht, ja. Ich mein, Therapie ist für mich auch was, was Spaß machen soll, weil sonst hat's nicht wirklich viel Sinn und sie hat sich dann auch wirklich nicht geöffnet für gewisse Dinge und ich habe mir gedacht, OK, es ist... es bringt nicht wirklich was, ja.
Interviewer: Diese Therapien wurden dann auch...
Frau O.: Wir haben dann auch wieder damit aufgehört, ja. Ich mein, das ist auch oft... war auch oft sehr personenbezogen und es mir dann auch eine Musiktherapeutin gesagt, also sie kann sich das auch gar nicht mehr vorstellen mit der Daniela zu arbeiten, sie kann einfach nicht mit ihr. Und das hab ich sehr geschätzt, muss ich sagen, ja...
Interviewer: An der Therapeutin?
Frau O.: An der Therapeutin, ja. Hab ich gesagt, OK, für sie passt's halt nicht und ich mein, das waren dann schon die Zeiten, wo ich nicht mehr mit drinnen war, wo ich einfach auch nicht mehr diesen Einblick hatte und sie ist dann aber zu mir gekommen und hat gesagt, OK, es passt irgendwie für sie nicht und ich muss sagen, das find ich auch OK, ja.
Interviewer: Zeugt von Professionalität im Endeffekt.
Frau O.: Ja, genau, mhm. Und damit ist das beendet und ich denk mir, es gibt dann vielleicht eine andere Person, wo man halt einen besseren Zugang findet und das ist dann OK und dann bringt's auch wirklich was, ja.
Interviewer: Das heißt sie ist jetzt wirklich nur mehr in Therapien, wo sie ihren Spaß hat?
Frau O.: Wo sie ihren Spaß hat und wo ich das Gefühl hab, ja, es bringt halt wirklich für sie was, ja.
Interviewer: Jetzt würde ich einfach gerne auch die Freizeitsituation weitergehen. Was verbinden Sie denn so mit Freizeit? Jetzt Freizeit auf ihre Tochter bezogen.
Frau O.: Für mich war das immer irgendwie so eine Gradwanderung, also Therapie und Freizeit, ja. Ich mein, ist Therapie jetzt auch ein Stück weit Freizeit? Und dann vielleicht auch, dass sie das macht, was ihr Spaß macht, ja. ähm... ich mein, wir sind dann zum Beispiel zu Heilpädagogischem Voltigieren gegangen und ich mein, das hat ihr wirklich irrsinnigen Spaß gemacht und ich hab das dann schon auch so ein bisschen als Freizeitgestaltung gesehen, ja. Also jetzt nicht so unbedingt als Therapie, sondern es war für mich sehr wohl auch irgendwie Freizeitgestaltung, ja. Also da vermischt sich halt manches. Also für mich vermischt es sich manches Mal ein bisschen, ja. Und ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass wir eben vier Kinder haben, ist sie immer irgendwie so mitgelaufen, ja. Ich mein, das war jetzt... ich hab bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie für sie ein besonderes Programm gestalten muss, oder so. Sie ist halt mit den anderen Geschwisterkindern dabei gewesen. Ob's jetzt Spielplatz war, oder irgendein Ausflug war, oder so. Das ist irgendwie so eins ins andere übergegangen. Das war nie wirklich Thema und sie war dann... wir waren dann oft mit Freunden unterwegs, die auch Kinder hatten und... Also es war irgendwie sehr natürlich, ja. Jetzt ist sie zwölf Jahre alt und jetzt hab ich das Gefühl, dass sich... ähm... schon ein bissl was verändert irgendwie. Ich mein, sie verändert sich, ja, und die beiden größeren Geschwisterkinder die sind natürlich jetzt schon alleine unterwegs, ja. Also die sind 15 und 17. Haben einfach ihren eigenen Freundeskreis, ja, und gehen auch alleine weg. Also die brauchen jetzt uns als Eltern nicht mehr. Und die jüngere Schwester, die ist jetzt 10, also die baut sich jetzt auch schon irgendwie einen Freundeskreis auf und geht jetzt auch schon oft halt allein zu einer Freundin, wo dann auch oft die Daniela nicht so mitkann, ja, und ich denk mir, jetzt wird's dann schon ein bissl Thema, was... was tu ich mit ihr, ja. Weil oft sitz ich jetzt schon wirklich alleine hier am Nachmittag... also oft... aber es kommt halt vor zeitweise, wo ich mir denk, OK, jetzt bin nur mehr ich und sie und was mach ma jetzt, ja. Ich mein, es ist schon so, dass wir ganz gern... also, dass sie schon auch sehr gern mit mir was unternimmt, aber ich denk mir, es kommt vielleicht die Zeit, wo sie halt... man sagt's ja auch schon oft, dass sie gern irgendwohin gehen würde, auch alleine, ja. Ich mein, ich kann sie zwar... ich kann sie alleine nirgends hinschicken. Und es ist für mich so die Frage, wer geht mit ihr, ja. Such ich jetzt jemanden, der das mit ihr macht,ja, wo ich nicht unbedingt involviert bin und wo so bisschen ein Loslösungsprozess natürlich auch stattfinden soll, ja. Ich mein, es wird sicher noch ein eigenes Thema werden. Es wird wirklich ganz ganz schwierig werden, aber ich denk mir, man muss irgendwann auch anfangen damit, ja.
Interviewer: Mit dem Loslösungsprozess?
Frau O.: Ja genau, mhm und ja...
Interviewer: Also spielt Freizeit schon eine relativ große Rolle oder zumindest eine bedeutende Rolle?
Frau O.: Es hat jetzt schon eine bedeutende Rolle, ja, ja... Also ich mein, sie merkt auch schon, dass die Geschwisterkinder jetzt auch was unternehmen, ja. Sie kriegt das natürlich voll mit, ja, und ich denk mir, sie hat auch das Bedürfnis natürlich auch was zu tun. Sie sieht's ja bei den anderen und sagt es halt auch oft. Zur Oma gehen. Ich mein, das reicht ihr manches Mal. Es ist ja schön bei der Oma, aber sie will dann auch wohin gehen, wenn alle anderen weg sind und nicht unbedingt so, dass ich dabei sein muss, ja. Also ja, ich denk mir...
Interviewer: Dieses mehr oder weniger auch Alleine-was-unternehmen?
Frau O.: Genau, ja. mhm.
Interviewer: OK. Und ja... «...» Also die Unterstützung der Freizeitaktivitäten wär dann... Macht sie eigentlich meistens mit der Oma, oder?
Frau O.: Ja, eben mit den Eltern mehr oder weniger, auch mit der Frau, die da halt... «...» Na ja, es ist nicht jeder... Es kommt nicht jede Woche, aber zumindest zwei Mal im Monat halt einer und da... «...»
Interviewer: und unternimmt etwas mit ihr.
Frau O.: Ja, ich mein, es ist noch nicht... Also es ist halt eher noch ein Spazieren-gehen, oder Spielplatz-gehen, oder so. Also aber nicht jetzt wirklich irgendwohin fahren, ja. Also ich weiß auch nicht, ob sie's auch tun würde. Wir haben noch nicht wirklich darüber gesprochen, weil... Ich mein, die Daniela ist natürlich, wenn man sie noch nicht so gut kennt... Ich mein, sie lauft nicht weg, oder so, aber man... Sie hat so ihre Eigenheiten, ja ((lacht))
Interviewer: Sie ist aktiv.
Frau O.: Sie ist aktiv, ja genau((lacht)). Aber ja... Und von dem her weiß ich auch... Ich mein, es ist natürlich auch so eine Vertrauenssache, ja. Kann ich jetzt jemanden auch mein Kind so anvertrauen, dass ich weiß, es ist gut aufgehoben. Ich denk mir, das ist halt auch noch einmal so ein Thema, ja, wo ich auch nicht, wenn jetzt irgendwer kommt... Ich glaub, ich würd sie nicht sofort jetzt jemanden mitgeben, ja, sondern ich denk mir, es ist einmal ein Kennenlernen wär für mich wichtig und ich möchte auch einmal schaun, wie der-oder diejenige mit ihr einfach kann, ja, und dann könnt ich sie einmal so wirklich da hinauslassen.
Interviewer: OK. Also es muss ein gewisse Vertrauen da einmal zu der Begleitperson, oder welche Personen da auch immer dabei sind, muss vorhanden sein?
Frau O.: Das muss vorhanden sein, ja. Aber ich denk mir, das ist eh klar. ((lacht))
Interviewer: Wär bei anderen Kindern, oder bei den anderen drei Kindern auch nicht anders?
Frau O.: Ist es auch nicht anders, ja, und ich denk mir, sie wären ja auch nicht mit jedem gleich mitgegangen, ja. Und ich denk mir, es soll ja gar nicht so sein, ja, weil... «...»
Interviewer: Ein Sicherheitsfaktor ein gewisser, dass man sich da verlassen kann.
Frau O.: Genau.
Interviewer: OK. Und was ist Ihre Rolle dann mehr oder weniger bei der Freizeitgestaltung? Also was...
Frau O.: ((seufzt)) Also meine Rolle, hm... «...» Na ja... Es ist halt so. Ich mein, die Daniela geht irrsinnig gern zum Beispiel nach wie vor auf den Spielplatz und das machen wir jetzt schon Jahre Jahre lang, ja, und ich hab nicht mehr viel Lust dazu, dort zu stehen und zuzuschaun, wie sie... Ich mein, sie kann stundenlang schaukeln, ja, und... und... Ja, also es ist für mich einfach manches Mal schon... Also ich bin da oft sehr ausgepowert schon, wo ich mir denk, eigentlich hab ich keine Lust jetzt da zwei Stunden zu stehen und... und ich mein... ja, ihr zuzusehen beim Schaukeln, weil sie ist nicht eine, die unbedingt gerne Spazieren geht. Also sie will halt eher irgendwo vor Ort wo bleiben. Und es ist für mich halt schon oft schwierig irgendwie auch ein Programm zu finden, wo ich mir denk «...» das könnte ihr Spaß machen, oder das tut sie auch und ich bin draufgekommen, dass das, wenn das jemand anderer macht, dass das sehr wohl auch «...» Spazieren jetzt zum Bespiel...
Interviewer: Also dass sie mehr darauf anspringt?
Frau O.: Ja genau. Also das ist jetzt bei uns schon... sind gewisse Dinge schon sehr sehr eingefahren, ja, und es wird halt oft immer schwieriger da wirklich was neues auch ihr anzubieten, ja und wo halt, wenn da jemand von außen dazukommt, dass gewisse Dinge vielleicht noch ein bissi einfacher «...» funktionieren.
Interviewer: Und da mehr oder weniger ein neues Input reinkommt, oder?
Frau O.: Ja genau, mhm.
Interviewer: Neue Anregungen.
Frau O.: Genau, ja. Ich mein, sie kann sich dann auch ganz gut darauf einlassen, aber das ist einfach eine andere Person, wo man andere Dinge macht, ja, und... und bei uns ist sehr vieles schon sehr automatisiert irgendwie, ja.
Interviewer: So die Alltagsroutine?
Frau O.: Ja genau. Genau, ja. Und man hat auch selber oft nicht wirklich mehr großartige Ideen. Also großartge Ideen, aber es ist halt oft immer das selbe irgendwie.
Interviewer: Es ist natürlich was anderes, wenn was neues kommt von außen.
Frau O.: Ja genau, ist es, ja.
Interviewer: Hat sie eigentlich viel Freizeit?
Frau O.: Ja, also im Moment hat sie relativ viel Freizeit. Sie hat halt zwei Mal in der Woche lang Schule. Also das ist bis halb vier und ansonsten hat sie um ein Uhr aus und... und ja... Wir machen im Moment halt nur die Logopädie. Das ist ein Zehnerblock und der hört jetzt mit übernächstem Donnerstag mehr oder weniger auf. Also sie hat dann eigentlich an den Nachmittagen mehr oder weniger Zeit, ja, ja...
Interviewer: Die Nachmittage könnte man dann mehr oder weniger als Freizeit bezeichnen?
Frau O.: Könnte man als Freizeit betrachten, ja.
Interviewer: Und Wochenenden wahrscheinlich auch?
Frau O.: Und die Wochenenden auch, ja.
Interviewer: OK. Ja, dann könnt ma ja gleich auf die Freizeitangebote eingehen. Also gibt's da in der Gegend Freizeitangebote? Oder was haben Sie für Freizeitangebote... Oder wovon haben Sie gehört? Genau, fang ma einmal so an.
Frau O.: Also spezielles für Kinder mit Behinderung oder generell jetzt eigentlich?
Interviewer: Sag ma einfach einmal Freizeitangebote, an denen Kinder mit Behinderung teilnehmen können.
Frau O.: Also da gibt's jetzt in meinem Umfeld eigentlich «...» gar nichts ((lacht)) ähm «...» Ich mein, für mich war das halt immer so. Sie ist halt immer so mitgelaufen mit meiner jüngeren Tochter, ja. Es war eigentlich nie irgendwie möglich sie «...» punkto Freizeit auch irgendwo gemeinsam mit meiner nicht behinderten Tochter irgendwo unterzubringen. Ich mein, es war so: sie ist überall mitgefahren, ob's jetzt eine Ballettstunde war, wo sie am Anfang irgendwie hinein durfte, sich austoben durfte mit den Kindern. Aber wenn der Unterricht begonnen hat, wurde sie höflichst hinausgebeten, ja. Sie hat's irgendwie am Anfang nicht wirklich verstanden, aber gut, es war halt so, ja. ähm. Das war dann immer irgendwie so, ja. Sie durfte zwar ein bisschen hinein, aber halt nicht wirklich, ja. Und ich hab dann zwar «...» es war irgendwie so ein Turnen von einem Verein, wo meine Tochter ursprünglich gehen wollte, die dann gesagt haben, die Daniela kann jederzeit mitkommen, also das ist überhaupt kein Problem. Also das war irgendwie ganz selbstverständlich, ja, wo gar nicht viel gefragt worden ist, was mit ihr los ist, oder so. Und ich mein, es war das Glück, dass da zwei Betreuerinnen waren, die halt diese Kindergruppe betreut haben und... und... Also das hätte an und für sich gut funktioniert, aber es hat sich dann irgendwie verlaufen, weil meine Toch... meine andere Tochter nicht wollte und es war dann von der Zeit her nicht möglich. Aber ich denk mir, das war einmal so ein Angebot, wo ich mich irrsinnig gefreut hab, wo ich mir gedacht hab, ich muss da gar nicht viel erzählen und muss gar nicht viel fragen, sondern sie soll reinkommen, sie soll mitmachen und...
Interviewer: Also es war relativ problemlos.
Frau O.: War problemlos. Und das ist das, was ich mir eigentlich halt so vorstelle, ja, dass man in bestehenden Angeboten mehr oder weniger auch so irgendwie ein Struktur bilden könnte, wo halt ein Kind mit Behinderung mehr oder weniger problemlos mitmachen könnte, ja, oder rein kann und... und... Also das wär so halt dieser Wunschgedanke irgendwie.
Interviewer: Also allgemeine Angebote dann so umzugestalten, dass Kinder mit Behinderung daran problemlos teilnehmen können.
Frau O.: Ja, genau. Also ich halt nicht viel davon von diesen speziellen Programmen, ja, die da nur für Kinder mit Behinderung angeboten werden. Ich denk mir, es ist auch gut, aber ich hab's... ich mein, ich hab's noch nie in Anspruch genommen, ja. Ich kenn viele Mütter, die das in Anspruch nehmen, die total begeistert sind. Ich denk mir, es lauft sich auch gut, wenn der Betreuungsschlüssel stimmt. Also ich kann mir's gut vorstellen, aber so mein Wunschziel wär halt wirklich, dass sich jetzt... dass ich wirklich vor Ort jetzt die Möglichkeit habe, mein Kind dort unterzubringen, ja, wo... wo sie vielleicht hinwill, ja, dass sie nicht von wem, weiß ich nicht, in den 23. fahren muss, nur weil's dort grad zufällig was gibt, sondern dass ich einfach die vorhandenen Angebote eben, also dass sich die Vereine, oder so weiter, dass sich die öffnen würden und sagen: OK, wir strukturieren so um, dass Kinder mit Behinderung da auch teilnehmen können. Ich mein, ist natürlich eine finanzielle Frage. Ich glaub, an dem scheitert's halt irgendwie meistens.
Interviewer: Ja, wegen zusätzlicher Betreuung, oder?
Frau O.: Wegen zusätzlicher Betreuung, ja. «...» Also das war immer irgendwie ein Problem. Ich denk mir, so Kinder... Angebote für Kinder sind überhaupt oft... Also ich glaub, das macht... das traun sich auch nicht sehr viele zu, hab ich irgendwie rausbekommen, weil Kinder irgendwie so ein eigenes Klientel sind, wo halt auch viel passieren kann, ja, und es gibt auch nicht sehr viele, die wirklich mit Kindern erstens einmal gut umgehen können und die auch wirklich mit Kindern was machen und... «...»
Interviewer: Also dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen, oder?
Frau O.: Ja genau.
Interviewer: OK. Dass sie mit Behinderung nicht so viel anfangen können und deswegen keine Verantwortung übernehmen wollen?
Frau O.: Ja, ja genau. Ich mein, sicher... Ich mein, manchmal ist es auch erforderlich, vielleicht am Anfang auch eine Eins-zu-eins-Betreuung irgendwie anzubieten, ja. Ich denke, das kann sich dann auch irgendwie geben im Laufe der Zeit, ja, aber vielleicht ist es am Anfang irgendwie notwendig und... Aber es war halt irgendwie kaum... kaum möglich irgendwie, ja.
Interviewer: Ja, also bis jetzt Ihre Tochter unterzubringen...
((Tonbandwechsel))
Frau O.: ...und ich hab mir gedacht, ich hätt vielleicht auch mehr gezahlt, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt so... so... ja, jetzt nicht so ein Thema gewesen. Ich mein, ich hab auch einmal versucht in der Volksschule in der selben Gasse mit einem Hortbetrieb und die Daniela ist dort nicht in die Volksschule gegangen, sondern sie ist in S. in die Volksschule gegangen. Und die haben da einen wunderschönen Garten, ja, mit vielen Schaukeln und so. Und wir sind da oft vorbeigegangen und sie hätt da so gern hineinwollen und ich hab mir gedacht, so in den großen Ferien, wo halt auch Betrieb ist, ja, wo aber nicht soviel los ist, und... und da hab ich mir gedacht, es wär irgendwie ganz nett, wenn sie da so zwei, drei Stunden am Tag so reinschnuppern dürfte, oder auch vielleicht zwei Mal in der Woche... ähm... da mitspielen dürfte, oder so. Und ich hab mich dann erkundigt auch «...» bei der Gemeinde Wien und so und es war halt... es war absolut nicht möglich, ja. Also...
Interviewer: Wie haben die argumentiert, oder was haben sie gesagt?
Frau O.: Na ja, es ist von der Betreuung her im Sommer sowieso also ein reduzierter Stand da und... Also sie haben sie da irgendwie sehr, sehr abgeputzt, ja, und es war einfach grundsätzlich nicht möglich.
Interviewer: Von vornhinein eigentlich?
Frau O.: Von vornhinein. Es ist eigentlich gar nicht irgendwie weiter besprochen worden, sondern ich wurde ziemlich schnell abgewimmelt eigentlich.
Interviewer: War frustrierend?
Frau O.: War frustrierend, ja, wobei es auch damals so war, dass es glaub ich auch... ich glaub, es gibt's jetzt schon, dass... dass es integrative Horte auch gibt. Das hat's früher überhaupt nicht gegeben. Also es wurden behinderte Kinder in den Horten nicht aufgenommen und... und ich glaub, da hat sich jetzt ein bissl was getan. So genau weiß ich gar nicht bescheid, aber ich glaub, es gibt's jetzt schon, ja. Und vielleicht ist man jetzt schon irgendwie ein bissl offener geworden und...
Interviewer: Aber es dauert.
Frau O.: Es dauert halt, ja. Es dauert einfach sehr lange.
Interviewer: Es dauert... manchmal dauert's einfach zu lange.
Frau O.: Ja, ja. Es hat oft so eine lange Anlaufzeit. Dann ja... dann entschließt man sich halt einfach dazu und dann ist es oft so, dass ma halt vielleicht auch einmal Kinder nimmt, die «...» jetzt sag ma mal unter Anführungszeichen, nicht so behindert sind, ja. Ich mein, das ist ja in Integrationsklassen auch oft so, dass
man halt sagt, OK, wir haben Integration, aber wir haben da halt Kinder, die halt vielleicht eine Lernschwäche in Mathematik haben, oder in Deutsch, oder so, ja. Ich... das ist...
Interviewer: Wo dann selektiert wird?
Frau O.: Wo dann auch selektiert wird, ja genau.
Interviewer: OK. «...» Es gibt wahrscheinlich bestimmte Kriterien, nach dem sie's beurteilen, die meistens damit zu tun haben, wie aufwendig eine Betreuung wär und deswegen...
Frau O.: Ja natürlich.
Interviewer: Ähm «...» Ja, also was würde für Sie so ein brauchbares Freizeitangebot auszeichnen, das für ihre Tochter plausibel wär?
Frau O.: Mhm, also... Ich mein, nachdem sie jetzt mittlerweile schon zwölf ist und ich denk mir, irgendwie auch schon «...» weiß, was sie will. Für mich wär so ein bissl Selbstbestimmung halt schon wichtig, ja, wo sie selber auch entscheiden kann, das oder das will ich machen, ja. Ich mein... Oder wo man halt irgendwie so einen Zugang findet, um auch herauszufinden, was macht ihr Spaß, ja. Also und nicht darüber bestimmt, OK, du machst jetzt das und das und das und fertig, sondern wo sie mehr oder weniger sagen kann, OK, halt so auf ihre Art, wie sie's halt irgendwie auch mitteilen kann, das will ich jetzt gern machen, ja. Und wenn's jetzt zum Beispiel nur ist, ich mein nur unter Anführungszeichen, aber sie fährt irrsinnig gerne Lift zum Beispiel, ja. Und sie schaut auch gerne zu, wie der Lift auf und abfährt, wo man sagt, OK, heute fahr ich mit ihr, was weiß ich, ins D. oder irgendwohin Lift schaun, oder so. Ich mein, das ist für mich einfach... das ist für sie. Ich weiß, das macht ihr Spaß und... und das würd sie irrsinnig gern machen und OK, sie kann das entscheiden, was sie machen würde.
Interviewer: Ja, also eigentlich relativ unkonventionell, oder?
Frau O.: Ist unkonventionell und es ist nicht sehr aufwendig ((lacht)) und ich denk mir, das kann man leicht bewältigen und ja... Aber ich denk mir zum Beispiel, wenn ich so das Thema Kino hernehm, sie geht schon sehr gern ins Kino, aber es ist ihr sehr oft zu laut da drinnen, ja, und ich denk mir schon auch sie sagt, OK, bin ich heut soweit, dass ich das Kino schaff, auch in dieser Lautstärke, dann ja und wenn nicht, dass man sagt, OK heute halt kein Kino, oder so, ja. Nur weil heute Kino angesetzt ist, dass man halt...
Interviewer: Dass da auch eine gewisse Flexibilität drinnen ist?
Frau O.: Ja genau, mhm.
Interviewer: OK... ja... «...» Wie schaut's denn in den Ferien aus eigentlich? Wie sind die Schulferien gestaltet? Also es ist eine relativ lange Zeit...
Frau O.: Ja, sie ist zwei Monate schon zu Hause. Ähm... «...» wobei ich sagen muss, sie ist gern zu Hause. Sie... wir haben das Glück, dass wir einen Garten haben. Wir haben jetzt seit zwei Jahren ein tolles Schwimmbecken da draußen und also es... ich glaube...
Interviewer: Ist sie relativ glücklich damit?
Frau O.: Sie ist relativ glücklich. Auch weil's dann draußen warm ist und wenn sie schwimmen kann und... und... Also wir haben Gott-sei-Dank das Glück, ja, dass wir... dass sie jederzeit rausgehen kann, ja, also dass sie nicht in einer Wohnung wohnt, wo ma uns immer zusammenpacken müssen, irgendwohin fahren müssen und so. Ich denk mir, dass ist ein viel, viel größerer Aufwand und... und da hamma echt das Glück, dass sie da wirklich...
Interviewer: Also der Garten ist definitiv ein Vorteil?
Frau O.: Der Garten ist ein Luxus ((lacht)) und auch das Schwimmbecken ist ein Luxus, weil ich sagen muss, sie schwimmt irrsinnig gerne und es war mit ihr immer ein Riesenproblem in ein öffentliches Bad zu fahren, weil sie das Element Wasser sehr ausreizt. Sie spritzt wahnsinnig, ja, ((lacht)) und sie spritzt mit Händen und Füssen und es hat jedes Mal reisengroße Probleme gegeben mit den Gästen, mit den Badegästen, die sich aufgeregt haben, ja, weil sie so gespritzt hat und ich mein, es war ihr wurscht, wer da in der Nähe war. Sie hat halt irgendwie gespritzt und es sind halt dann sehr viele irrsinnig nass geworden und... und es hat immer wirklich sehr große Konflikte gegeben, dass ich mich ganz zum Schluss wirklich nicht mehr mit ihr irgendwo in ein Bad fahren getraut hab, weil ich mir gedacht hab das... ja, ich will mir das nicht mehr anhören. Also wenn wir das jetzt nicht hätten, dann denk ich mir, ich mein, sie fährt gern schwimmen und ich müsste das irgendwie in Kauf nehmen, dass es zu Konflikten kommt. Also das wär jetzt natürlich auch eine Schwierigkeit und ich denk mir, das hätt ich vielleicht auch ganz gerne abgegeben, ja, ((lacht)) wo ich mir denk, OK, vielleicht nimmt's jemand, der mit ihr da unterwegs ist für drei Stunden, auch lockerer als ich als Mutter, wo ich mich immer auch sehr persönlich irgendwie angegriffen gefühlt hab, ja.
Interviewer: Stimmt, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. «...» Also waren wirklich handfeste negative Reaktionen darauf?
Frau O.: Ja, total, total, ja. Obwohl auch, ich mein, viele Kinder, die auch reinspringen, spritzen auch, ja, und... aber es ist, glaub ich, schon auch irgendwie... ((seufzt)) Ja, ich mein, sie... sie... sie nimmt rundherum gar nichts mehr wahr, ja, wenn sie da spritzen kann, ja, ((lacht)) und sie spritzt halt auch manchmal wirklich jemanden sehr... und ich mein, sicher ich versteh's auch. Die glauben, sie macht das absichtlich. Ich mein, es hat dann Gespräche gegeben, die positiv verlaufen sind, wo ich gesagt hab, bitte, wenn's irgendwie möglich ist, dann machen Sie halt einen großen Bogen um sie und ich mein, das war dann auch OK, ja. Es hat aber auch dann Gespräche gegeben, wo ja... wo wir sehr auf Unverständnis gestoßen sind und ja...
Interviewer: Ja, ich denk mir mal, es ist ein Schwimmbad. Da wird man halt nass, aber ja... ((lacht))
Frau O.: Ich denk mir auch, wenn man da drinnen ist, muss man damit rechnen, dass man nass wird. Und wenn man halt hochgesteckt Haare hat und irgendwie eine schöne Frisur, ich mein, dann geh ich da nicht hinein, wenn ich... ja... OK...((lacht)) «...» Ja, und deswegen ist es immer in den Ferien... ich mein... Irgendwie denk ich mir, es wär schon auch ganz gut, so auch in bezug auf die Geschwisterkinder, ich mein, dass ma mal vielleicht auch in Ruhe was mit den anderen unternehmen könnte, jetzt speziell einmal mit der jüngeren Schwester, ja. Ich mein so Ausflüge und so, wo sie dann vielleicht einmal so eine Woche nicht da wäre, ja. Das hab ich mir schon auch überlegt. Nur ich hab mich... Es gibt ja von der Schule her...
Interviewer: Also so Ferienlager.
Frau O.: Angebote, ja, die auch nur tageweise sind, wo sie auch jetzt nicht übernachten müsste. Aber irgendwie hab ich mich... äh... pfff... nicht darrübergetraut, oder... ich weiß es nicht. Ich mein, sie war voriges Jahr das erste Mal weg auf Schullandwoche, wo sie wirklich ganz alleine weg war, ja, das hat gut funktioniert, aber das war halt einfach der erste Schritt halt, wo ich mir gedacht hab, ja, das tut ihr auch gut. Auch für die Selbstständigkeit ist das irgendwie wichtig, ja.
Interviewer: Also wär schon eine Möglichkeit sie auf solche Lager zu schicken?
Frau O.: Ja, also zumindest einmal vielleicht halt tageweise zu Beginn. Nicht jetzt wirklich ein Woche mitÜbernachtung. Weiß ich nicht, weil ich denk mir, mit der Schule ist es doch was anderes, wo sie die Kinder kennt, wo sie die Lehrerin kennt, als wie, wenn ich sie jetzt mit einer Gruppe vielleicht mitschick, wo sie gar niemanden kennt. Vielleicht schafft sie das auch. Ich mein, man unterschätzt ja oft die Kinder irgendwie, ja. Gerade als Elternteil traut man ihnen, glaub ich, viel viel weniger zu ((lacht)), als sie eigentlich können würden, ja, aber... «...»
Interviewer: OK. Aber es ist... es müsste so eine langsame Aufwärmphase sein. Einfach so langsam darauf hinarbeiten.
Frau O.: Aber ich glaub, sie wird das auch brauchen.
Interviewer: Dass sie einmal wegkommt, oder?
Frau O.: Ja, aber ich denk mir, wenn sie jemanden dann gut kennt, dann ist es für sie eigentlich kein Problem, ja. Wenn sie mit jemanden gut kann, dann kann ich mir das auch sehr wohl gut vorstellen.
Interviewer: Ja, aber es müsste eben eine gewisse Aufwärmphase sein?
Frau O.: Ja genau, mhm.
Interviewer: OK. Haben Sie schon so Angebote in Anspruch genommen, die eben nur für die Ferien da sind, oder so was wie Ferienlager?
Frau O.: Nein, bis jetzt noch nie. Wir kriegen das zwar immer von der Schule aus, aber irgendwie hab ich mich noch nicht dazu entschlossen. Aber ich habe jetzt schon von anderen Eltern eben auch gehört, dass das eigentlich, speziell jetzt von den K., glaub ich, sehr gut organisiert ist und dass die Betreuung auch gut ist und der Betreuungsschlüssel anscheinend auch sehr gut ist und ja...
Interviewer: Es ist halt kein integratives Angebot.
Frau O.: Ja, ich mein, das hat mich am Anfang schon ein bissl... ich mein gestört, aber «...» das ist so eine Gradwanderung. Ich mein, ich hab jetzt... ich mein, ich setzt mich auch sehr viel irgendwie schon damit auch... mit dem Thema Behinderung auseinander, weil ich bin bei I. auch tätig und habe einige Seminare da auch besucht. Also ich mein, «...» ich seh's manchmal schon auch so, dass jetzt so «...» die behinderten Menschen, dass das vielleicht auch so eine eigene Kultur vielleicht auch ist, ja, die vielleicht auch ganz gern unter sich sein wollen, ja. So wie, weiß ich nicht, Harley-Davidson-Fahrer, oder keine Ahnung, irgend so was, ja. ((lacht)) Dass sie vielleicht schon auch sehr wohl ganz gern unter sich sind. Also ich seh's jetzt nicht unbedingt so als Nachteil, wenn jetzt so eine Gruppe mit behinderten Kindern jetzt irgendwie unterwegs ist. Trotzdem «...» ja...
Interviewer: ...wär ein bissi Außenkontakt doch nicht so übel, oder?
Frau O.: Wär das sicher auch nicht schlecht. Ich mein auch für die Gemeinschaft und so irgendwie, ja. Und ich denk mir die Daniela kennt das sehr gut von zu Hause. Sie kennt's eben auch vom Kindergarten, von der Schule. Also sie ist irgendwie so aufgewachsen, ja, und... und... Also sie fühlt sich sehr wohl, ja. Vielleicht gibt's Kinder, die sich... Ich mein, es ist oft sehr unterschiedlich, aber ich denk mir es müsste an und für sich bei jedem Kind funktionieren, ja, wenn... wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ja. Und ich denk mir, wenn jetzt auch jetzt bei den K. so ein toller Betreuungsschlüssel ist und man den nimmt und auf eine... auf ein anderes Angebot jetzt überträgt, ja, dann kann das sehr wohl auch in einem normalen Angebot inkludiert irgendwie werden, ja. Wenn das jetzt ist, OK, ein Camp dort und dort mit behinderten und nicht behinderten Kindern und man nimmt diesen Schlüssel und setzt ihn so um, funktioniert das wahrscheinlich auch, ja. Also ich denk mir auch...
Interviewer: Man könnte den Schlüssel sogar erweitern wahrscheinlich.
Frau O.: Kann ihn auch erweitern und es haben alle Kinder wahrscheinlich sogar, also wirklich mehr davon, ja, wenn... wenn...
Interviewer: Also dass ein integratives Angebot eigentlich eine Bereicherung wäre für alle Kinder?
Frau O.: Ja, ja. Also ich glaub das eigentlich schon.
Interviewer: OK. Warum, wenn ich fragen darf.
Frau O.: Ja, ja. ((lacht)) Ich denk mir, es ist vielleicht... Also für mich ist immer wichtig so ein... ein... Also man profitiert ja irgendwie von den Unterschiedlichkeiten, ja. Also ich denk mir, wenn irgendwie alle gleich sind, dann kann man nie so profitieren, als wie wenn sehr viele unterschiedliche Kinder zum Beispiel in einer Gruppe sind, ja. Also jedes Kind ist irgendwie anders und man kann sich was abschaun davon, oder man muss vielleicht auch einmal eingehen auf eine Situation, ja, und ich denk mir, man lernt von den Unterschiedlichkeiten sicher mehr, als wie wenn eine Gruppe sehr gleich ist, ja.
Interviewer: mhm. OK. Also als Bereicherung im sozialen Umgang?
Frau O.: Ich würd's als Bereicherung sehen. Ja genau. Also wenn einfach dieses Umfeld passt... Ich denk mir, man muss Voraussetzungen schaffen, ja. Vielleicht, ja. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht muss man manches Mal... Ich mein, wenn ein Rollstuhlkind mit ist, dann muss es natürlich auch rollstuhlgerecht sein, die Unterkunft, ja, die WC-Anlagen, oder so irgendwas. Also ich denk mir, man muss schon schauen, dass von vornherein einmal das Angebot diesbezüglich passt, nicht. Aber ich seh's dann irgendwie... ich seh's eigentlich schon als Bereicherung für die Gruppe an, ja.
Interviewer: Und zwar für alle beteiligten?
Frau O.: Für alle beteiligten, ja genau.
Interviewer: OK. Ja, würd ich auch so sehen, ehrlich gesagt. ((beide lachen)) Trotzdem gibt's halt relativ wenig, denk ich.
Frau O.: Ja, es gibt wirklich wenig, also fast gar nichts eigentlich, ((lacht)) weil ja...
Interviewer: Ja «...» Also das heißt, Sie würden sich im Endeffekt mehr Angebot wünschen, wo Ihre Tochter teilnehmen könnte?
Frau O.: Also für mich geht's schon sehr wohl auch um die Auswahlmöglichkeiten, ja. Ich mein, das, denk ich mir, ist auch wichtig, um Selbstbestimmung überhaupt ausleben zu können, ja. Ich denk mir, ich hab ein breites Angebot und da kann ich auswählen, ja, wo... oder sie kann dann vielleicht später einmal auswählen, was sie möchte und... und nicht, ja, es gibt halt nur das und fertig und... Also für mich ist eine breite Palette irgendwie auch wichtig, Auswahlmöglichkeiten. Und ich denk mir, es gibt ja so viele bestehende Angebote schon, ja, und wenn man die ein bissi umstrukturiert, dann hat man schon von vornherein eine andere Auswahlmöglichkeit, ja, und sagt, OK, ich will jetzt zwar kein Tenniscamp machen, aber ich will zum Beispiel irgendwie ein Reitcamp machen oder so irgendwas und nicht nur jetzt gibt's nur Reitcamp und sonst gar nichts zum Beispiel.
Interviewer: Genau, weil wir müssen jetzt das Reitcamp nehmen, weil das ist das einzige, was für behinderte Kinder... oder wo behinderte Kinder mitmachen können und alles andere fallt flach.
Frau O.: Fallt flach, genau.
Interviewer: Also so, dass dann wirklich noch eine Wahlmöglichkeit besteht.
Frau O.: Ja genau.
Interviewer: OK. Eine letzte abschließende Frage jetzt: Wenn Sie irgendwas ändern könnten an der derzeitige Situation zu Freizeitangeboten, Ferienangeboten, was würden Sie da ändern? Was wären so die ersten Prioritäten, was geändert werden müsste?
Frau O.: Mhm. Also eben, eh schon wie gesagt, ja, irgendwie würd ich ein... eher mich so an bestehende Vereine oder Angebote auch irgendwie wenden und ich denk mir, «...» vielleicht gibt's auch irgendwie so... so Möglichkeiten, sich irgendwie ein bissl zu informieren, auch Unterstützungsmöglichkeiten irgendwie anzubieten, weil ich denk mir, die sind ja auch irgendwie... ja, ich mein, sie wissen vielleicht... sie würden's vielleicht gern machen, aber sie wissen jetzt nicht unbedingt wie's geht und da denk ich mir, wenn's da einfach ein paar Leute gibt, die da hingehen und sagen, OK, so und so und so könnte das laufen, ja, und... und ist wurscht, ob's da jetzt zum Beispiel die Jungschar ist, die's da gibt, oder irgendwelche kirchlichen Vereine, oder irgendwas anderes. Also «...» vielleicht... Ich mein, ich denk mir, ich kann's mir auch vorstellen, dass ich da hingeh und sag, OK, das und das und das könnt ma jetzt umstrukturieren und dann könnten sie sich wirklich öffnen für behinderte Kinder oder Jugendliche oder so. Also ich würd wirklich an bestehende Vereine herangehen und jetzt nicht wirklich irgendwie so eigene Strukturen bilden. Also das hätt ich... ich mein, das wär für mich so dieses um und auf irgendwie, ja, da eine Veränderung auch wirklich mitanzufangen.
Interviewer: Also einfach bestehende Strukturen so zu ändern oder so aufzubereiten, dass behinderte Kinder auch daran teilnehmen können.
Frau O.: Ja genau, mhm. Egal was es jetzt wirklich ist. Und vor allem... ich mein, mir ist es auch sehr wichtig, äh... «...» so vor Ort, ja, also so im eigenen Umfeld. Nicht... Also auch mit den Kindern, die man kennt, ja. Also wir sind jetzt da zwar in Wien, aber es ist so, B. ist doch noch so wie ein kleines Dorf. Nicht mehr lange, weil da vieles zugebaut wird. Also es bleibt dieser Dorfcharakter sicher nicht mehr lange erhalten. Aber dass man da mit den Kindern, die quasi da jetzt schon das Umfeld zum Beispiel meiner Tochter bilden, dass man jetzt irgendwie auch diese Angebote setzt, ja, und nicht jetzt irgendwo anders, ja.
Interviewer: Also das direkte soziale Umfeld.
Frau O.: Ja genau, mhm.
Interviewer: Natürlich. Dass sie nicht herausgerissen wird aus dem, wo sie eigentlich drinnen steckt.
Frau O.: Wo sie irgendwie aufwächst, oder wo sie halt auch drinnen steckt, ja genau.
Interviewer: Ja das Problem kenn ich auch: Fahrtendienst und anderes Ende von Wien.
Frau O.: Ja, genau so. ((lacht)) Ja, es ist halt leider so und...
Interviewer: Alle Angebote sind so verteilt über ganz Wien. Das ist ein generelles Problem, glaub ich.
((durch einen Bandfehler verursacht endet hier das Interview))
Interviewer: Wie würden Sie den Michael beschreiben?
Frau T.: Der Michael ist ein mehrfachbehindertes Kind. Er lebt zu Hause im Rahmen der Familie und die beste Therapie, die wir ihm bieten können, sind die Geschwister. Also er hat eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder und das ist was ganz wertvolles für die Kinder glaub ich und er hört nichts, er versteht nicht auf unserer Ebene, sondern eher auf der emotionalen Ebene. Er kann sich sehr wenig ausdrücken. Also er kann mir zeigen, wenn er hungrig ist, aber nicht, wenn er durstig ist, oder kalt ist, oder was er lieber ist, oder so - das geht alles nicht. Er ist ein unglaublich freundliches und fröhliches Kind, ein sehr offenes Kind, also «...» zu seinen Defiziten gehört wohl auch seine Grenzenlosigkeit, die aber im dem Fall ihm zu gute kommt, weil er sehr offen auch auf Betreuer zugeht und auf die Menschen. Ich sag immer, das ist eigentlich ein Engel auf der Erde, weil er war noch nie aggressiv, noch nie böse, noch nie zornig, nicht nachtragend, nie irgendetwas... Natürlich wirft er oft was runter, oder stößt jemanden einmal zu fest, weil er seine Grenzen nicht... also seine Kräfte nicht einschätzen kann. Oder es passieren schon viele Dinge, aber vom Wesen her ist er ein unglaublich gutes Kind.
Interviewer: OK, und wie alt ist er?
Frau T.: Er wird jetzt im August 15. Und jetzt ist er doch voll in der Pubertät und er entwickelt sich doch sehr deutlich zum jungen Mann, was aber in der Pflege jetzt einen deutlichen Sprung macht, weil's auch in der Betreuung jetzt deutlich schwieriger wird, Fremdbetreuung zu finden, also entweder wirklich professionelle, die aber dann relativ teuer ist, oder aber sonst... wie gesagt, Freunde, Babysitter, junge Mädchen und sonstige sind einfach heillos überfordert.
Interviewer: OK, warum?
Frau T.: Ähm, weil er ganz genau spürt, ob sich jemand wirklich seiner Sache sicher ist und weiß »OK Michael, wir machen das so«, oder »Wenn ich ihn jetzt nehm, kommt er dann mit mir?«. Auch wenn das auch nur ein Funke im Hinterkopf ist, macht der Michael einmal ffft und ist weg. Da folgt er nicht. Da hat er ein unglaubliches Gespür. Wie gesagt, wenn da nur der Funke eines »Wie geh ich das an?« ist. Und er ist irrsinnig stark natürlich schon auch mit seinen fast 15 Jahren.
((Einer von Michaels kleinen Brüdern, der auch am Tisch sitzt meldet sich zu Wort))
Er ist wahnsinnig stark. Frau T.: Ja "...» daher braucht er viel Sicherheit. Ich tu auch schon manchmal aufpassen auf ihn. Frau T.: Ja, du passt eh auch schon manchmal auf, das stimmt. "...» äh Interviewer: OK "...» ähm, wo wir eh gleich bei nächsten Frage wären. Wie schaut's mit der Unterstützung im Alltag aus?
Frau T.: Die Schule hat ein Internat angeschlossen, in dem ich ihn einmal angemeldet hab und er damit, wenn ich Bedarf hab, also wenn ich am Abend einmal weggehe, kann er dort schlafen und jedes zweite, eigentlich im Schnitt ist es jedes dritte Wochenende, kann er einmal dort bleiben. Das heißt, primär ist er zu Hause und ich nehm das Internat eher so für Zusatz-äh zeiten in Anspruch. Auch damit's Wochenenden gibt, die wir mit der Familie anderes Programm auch machen können, oder mit den Geschwistern. Das ist mir eine Riesenhilfe, ohne die würd ich's nicht schaffen. Kurzzeitbetreuung gibt's in Wien so gut wie keine. Das wär das, was für die Unterstützung am wertvollsten wär, um die Kinder langfristig in der Familie behalten zu können.
Interviewer: Also einfach kurzfristige...
Frau T.: Ja, einfach kurzfristige für ein paar Tage, ein langes Wochenende, ein Mal im Monat, äh, ja.
Interviewer: Oder auch nur für Stunden.
Frau T.: Ja, also Stunden wird schwieriger sein, aber teilweise auch. Das weiß ich von einer Freundin, deren Tochter jetzt in einer Werkstatt ist. Die schließt um drei. Das Mädchen ist um halb vier zurück. Nachdem die Werkstatt erst um neun beginnt, ist sie in der Früh ausgeschlafen und nicht ausgelastet ähm und sie sucht immer wieder wirklich dringend auch junge Leute, die bereit wären einen Nachmittag sich mit der T. zu beschäftigen und das ist gar nicht leicht. Also wirklich jemanden zu finden, der regelmäßig auf ein behindertes Kind aufpasst, ist fast, «...» selbst wenn man's bezahlt, sehr schwierig.
Interviewer: Ja, also Leute die sich's zutraun und die Kompetenzen in die Richtung haben.
Frau T.: Die kompetent sind und die sich dann auch auf ein regelmäßiges "...» Helfen einlassen.
Interviewer: OK, also das ist relativ schwer zu finden?
Frau T.: Ja.
Interviewer: OK, sind Sie eigentlich berufstätig?
Frau T.: Ich arbeite bei meinem Mann im Büro mit und das ist vorne im Hof. Also das lässt sich so weit gut vereinbaren. Ich sag immer, primär bin ich bei den Kindern zu Hause und was sich noch erübrigen lässt, schieb ich halt irgendwo dazwischen hinein.
Interviewer: Also ich denk, das wir relativ flexibel sein.
Frau T.: Das ist sehr flexibel. Meinen eigentlichen Beruf übe ich zur Zeit nicht aus.
Interviewer: OK, also wir haben's eh schon kurz angeschnitten. Also welche Einrichtungen besucht der Michael? Also die Schule und das Internat, gibt's sonst noch...
Frau T.: Das Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, da geht er in die Schule. Dort ist er im Halbinternat, also bis fünf ist er immer dort und fallweise das Internat «...» und sonst ist er im Sommer ähm bei der evangelischen Diakonie als Kurzzeitunterbringung einmal für drei Wochen für'n Sommerurlaub auch und ich hab das große, große Glück, dass ich noch ein Kinderheim noch in Niederösterreich kenn, die ihn mir ganz spontan manchmal nimmt.
Interviewer: OK, also einfach, wenn's notwendig ist.
Frau T.: Ja, wenn's notwendig ist für ein paar Tage. Das ist aber «...» ein Glück, dass ich das gefunden habe und die hilft einfach einmal, wenn irgendwo Not am Mann ist.
Interviewer: «...» ähm, ja und ich möchte Sie als Elternteil auch gerne noch dazu fragen, was für Sie eben dieser Begriff »Geistige Behinderung« bedeutet? Nachdem der in der Literatur relativ oft auftaucht interessiert's mich einfach, was Eltern dazu sagen.
Frau T.: Beim Michael ist es einmal ganz, ganz klar, nachdem er unseren Normen an Denken und Tun nicht entspricht und auch wenig versteht, dass er unter »geistig behindert« fällt. Ich ((seufzt)) halte auch dann jemanden auch für geistig behindert, wenn er es nicht schafft den Alltag altersentsprechend alleine zu meistern. Also Kinder halt in der Familie und Erwachsene dann...
Interviewer: Also wenn Assistenz bis zu einem gewissen Level gebraucht wird?
Frau T.: Ja.
Interviewer: OK, dann komma einmal zur Freizeitsituation. Also was verbinden Sie mit Freizeit? Was bedeutet Freizeit für Sie?
Frau T.: Prinzipiell und mit dem Michael?
Interviewer: Prinzipiell jetzt einmal.
Frau T.: ((seufzt)) Freizeit «...» ist... «...» Nachdem bei uns so Alltag und Freizeit in einander überfliesen mit den Kindern, weil viele Dinge, die man da mit den Kindern extra macht, natürlich auch in Freizeit hineinfallen. Dieses Wandern-Gehen und Spazieren-Gehen und prinzipiell wär auch Kino dabei und Tiergarten besuchen und ins Schwimmbad einmal gehen oder...
Interviewer: Aber man kann's nicht so wirklich abgrenzen?
Frau T.: Mmm, schwer, weil wenn ich am Nachmittag mit den Kindern zu Hau... heut war's so: zu Mittag waren alle zu Hause und jetzt sind sie teilweise wieder gegangen und dann kommen sie dazwischen wieder. Es sind so kurze Phasen immer. Also ich hab nicht, nachdem sich meine Alltag mehr so auf die Kinder konzentriert, hab ich jetzt nicht bis um vier Dienst und dann Freizeit, weil dazwischen machst noch schnell Haushalt und dann sollt ma eigentlich noch ein Buch vorlesen und dann...
Interviewer: Ja, und wie ist die Freizeit in Verbindung mim Michael jetzt?
Frau T.: Wenn schönes Wetter ist und wir in den Garten können, ist es ganz einfach, weil er sehr, sehr gerne draußen ist und es für ihn Freizeit ist, wenn er draußen sein kann. Also wirklich dann ist es für ihn eineschöne Beschäftigung, wo ich weiß er fühlt sich sehr wohl. Ähm, ja, das tut ihm einfach wirklich gut. Bei schlechtem Wetter ähm reicht ihm unsere Freizeit »Wochenende bei Regen zu Hause« nicht. Er möchte spazieren gehen.
Interviewer: Wie äußert sich das? Frau T.: Er wird unrund. Er ist einfach... «...» Interviewer: Man merkt's?
Frau T.: Man merkt's, ja. «...» ein bis zwei Mal am Tag muss ich mit ihm raus. Also ein Mal Minimum und besser noch zwei Mal muss ich mit ihm raus. Eine kleine Runde spazieren, und wenn's nur um den Häuserblock ist und äh... oder wir machen... wir gehen einmal in den Tiergarten oder... Zum Einkaufen nehm ich ihn auch mit, wobei das wohl unter »rausgehen« läuft, aber für ihn nicht Freizeit ist. Das hat er nicht so gern, eigentlich. Das hab ich inzwischen schon mitgekriegt. Er geht halt mit, aber das hat er in Wirklichkeit eigentlich nicht so wirklich gerne. «...» Und das mach ich ihm... Also einkaufen mach ich mir zuliebe schon lieber alleine, weil ich brauch so schon vier Hände und mit ihm acht. Ja, weil er überall... «...»
Interviewer: Angreift?
Frau T.: Nein, nicht angreift, aber er ist einfach so schnell, immer überall weg und legt sich dazwischen am Boden und wenn ich dann in den Einkaufswagen und zahl und ich weiß nicht was und er fffft, ja.
Interviewer: Ist dann nur ein zusätzlicher Stressfaktor.
Frau T.: Ja, wie gesagt, das bringt uns beiden nicht viel. Machen wir manchmal, weil's einfach zum Alltag dazugehört, aber jetzt nicht als «...» Programmpunkt. In's Kino bin auch eine Zeit... hab ich angefangen mit ihm zu gehen und dann haben seine epileptischen Anfälle angefangen und jetzt trau ich mich nicht mehr. Weil da waren wir im IMAX-Kino und haben uns das ganz große angeschaut und es hat ihm schon sehr gut gefallen, aber in dem Sommer drauf, also es war im Spätfrühling, Frühsommer irgendwann und im Sommer drauf haben... nicht, also das war nicht ausschlaggebend, aber es war halt völlig und ich trau mich seit dem nicht mehr wirklich mit ihm ins Kino, weil das sind einfach zu viele Eindrücke für ihn, dass ich Angst hab, dass das wieder einen Anfall auslöst.
Interviewer: Also laut und groß.
Frau T.: Ja, laut würd mich weniger stören, aber eher die Bilder. Also auch die... er spürt's sehr stark, also das wär ja trotzdem ein starker Eindruck »laut«, aber ähm die Bilder, diese Lichtreize, die schnell wechselnden Bilder. Ich glaube, das würde ihm nicht gut tun.
Interviewer: Das heißt er verbringt sehr viel Zeit einfach im Garten draußen?
Frau T.: Also im Sommer im Garten und im Winter gehen wir spazieren. Rodeln auch, aber das ist sehr schwierig, weil er das nicht ganz versteht und nicht wirklich heraußen hat. Es wird ihm immer wieder angeboten, weil es geht dann... Immer wieder geht wieder was neues. Man sollte niemals nie sagen.
Interviewer: Also probieren Sie ab und zu einmal was neues?
Frau T.: Wir probieren immer wieder was neues, und ja. Wir gehen auch... wir nehmen ihn auch... Also wir gehen nicht sehr oft irgendwo auswärts was essen, weil wir einfach mit vier Kindern das sowieso nicht drinnen ist, aber wenn wir's einmal machen oder Eis essen gehen, probier ich's auch immer wieder ihn zu nehmen und das geht in letzter Zeit auch ganz gut. Ich mein, am Sonntag in die Messe gehen, das war früher sehr schwierig, aber wir haben ihn immer mitgehabt und inzwischen geht das auch schon recht gut.
Interviewer: Also das schwierige war das Ruhig-Sitzen?
Frau T.: Also ruhig, dass er da bleibt und es ist ja, weil er einfach so die Grenzen gebraucht hat und dann ist er zwischen uns gesessen und das ging dann ganz gut, aber er war halt teilweise auch relativ unruhig auch und inzwischen geht das sehr, sehr gut. Also wie weit das für ihn Freizeit ist, oder er diese unsere Sonntagsstimmung mitnimmt, kann ich nicht sagen. Aber da ist er einfach mit dabei und gehört dazu.
Interviewer: Und lauft einfach mit?
Frau T.: Lauft einfach mit, ja.
Interviewer: OK, gibt's irgendwelche, sag ma mal, Menschen, Bekannte, Freunde, bezahlte Kräfte, die ihn unterstützen in der Freizeit, also bei Freizeitaktivitäten?
Frau T.: Mein Schwager geht oft... also oft... geht immer am öftesten mit ihm spazieren. Der hat selber keine Kinder, ist aber sein Taufpate und traut ihn sich voll zu. Der ist auch der einzige, der sich ihn auch wirklich zutraut.
Interviewer: Und sie kommen auch gut miteinander aus?
Frau T.: Ja, die kommen sehr gut miteinander aus. Der macht das ganz toll. Und bei den Bezahlten, also sonst Familie eigentlich nicht. Ich mein, ich krieg sehr viel mentale Unterstützung und von meinen Eltern und von meiner Tante auch finanzielle Unterstützung, wenn's um Betreuungssachen geht, aber die schaffen's nicht, ihn mir wirklich abzunehmen.
Interviewer: Also wär ihnen das zu viel?
Frau T.: Das wär ihnen zu viel und kräftemäßig schaffen sie's nicht und zutraun tun sie sich's auch nicht ganz. Also wir er kleiner war schon, aber jetzt ist er einfach zu groß. Und bei den Bezahlten haben wir erst gestern wieder darüber gesprochen, weil wir sind am Samstag eingeladen und ich so »Na, da ist der Michael zu Hause. Ich kann nicht.«. Ob ich denn niemanden hab, der dann wirklich babysitten kann. Hab ich gesagt, dann fang ich halt wieder von vorne an zu suchen. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Die große ist sechzehn, aber der möchte ich ihn auch nicht zumuten, auch die Verantwortung nicht überlassen. Sie passt super auf die kleinen auf und ist an sich eine tolle... Geht auch woandershin babysitten, aber der Michael, das ist einfach eine Stufe zu hoch.
Interviewer: Es ist auch... Er verlangt relativ viel Aufmerksamkeit?
Frau T.: Es geht nicht um die Aufmerksamkeit, aber es soll auch die Bruder-Schwester-Beziehung nicht mehr noch belasten und er ist ihr Bruder und sie können alle drei sehr, sehr gut mit ihm und sind wahnsinnig lieb mit ihm und dürfen sich auch abgrenzen. Sie dürfen jetzt immer zusperren. Er nimmt ja alles in den Mund, was er so erwischt und so und sie wollen ja doch nicht dauernd aufräumen und es geht an und fürsich wirklich gut, aber es wäre eine echte Überforderung, die ich nicht möchte, wenn sie auf ihn aufpasst. Da hab ich gesagt, ich fang wieder von vorne an. Ich brauch wirklich jemanden, der dann spontan kommt, der ihn auch ins Bett bringen kann, der mit ihm einmal spazieren geht, der einmal, wenn das Internat zu ist und das ist leider oft zu, weil sobald ein längeres Wochenende ist, ist so und so zu und sie nehmen am Wochenende zwei bis drei Kinder. Ich mein, das ist wenig. Wir müssen's uns teilen.
Interviewer: Wie groß ist das Kontingent an Kindern dort?
Frau T.: Ähm. Es sind insgesamt neun Internatskinder.
Interviewer: OK, das heißt ein Drittel ungefähr.
Frau T.: Ja und dann ist ein langes Wochenende. Das wird nicht mitgezählt und dann ((seufzt)) ja. Also es ist wirklich ja das... Aber ich weiß noch nicht wo ich anfang zu suchen. Mit allen reden, allen weitererzählen. Irgendwer schreit dann »hier« ((Interviewer und Frau T. lachen))
Interviewer: Also einfach einmal Kontakte ausnutzen. Vielleicht ergibt sich da was. Ähm, ja. Hat der Michael viel Freizeit, wenn ma's so rechnet neben Schule und Internat?
Frau T.: Er kommt abends um fünf nach Hause und geht um acht schlafen. Das sind einmal drei Stunden, wobei wir davon eine halbe Stunde, Stunde abendessen und baden und ins Bett bringen auch. Also ja, acht ist zu früh. Halb neun, neun ist es jetzt oft, weil er ist auch schon groß. Ich kann ihn nicht mehr so wie früher sieben, halb acht ins Bett legen. Es geht einfach nicht.
Interviewer: Da wird er auch nicht ganz so einverstanden sein, oder?
Frau T.: Nein, er kann nicht schlafen. Er wird sich nicht wehren dagegen, aber ja... Er kann einfach nicht schlafen. Tut halt noch im Zimmer herum, aber das will ich nicht, weil dann schläft er auch noch später ein. Das funktioniert ganz schlecht. Und ich mein, die Großen gehen auch nicht mehr schlafen.
Interviewer: OK, und wann steht er immer in der Früh auf?
Frau T.: Ähm, das ist unterschiedlich. Also so zwischen sechs und sieben, wobei er in die Pubertät kommt und auch wenn er früh schlafen geht für sein Alter, hab ich gesagt, ich kann allen Mütter von pubertierenden Kindern nur mehr sagen »Es sind die Hormone.« Sie kommen in der Früh nicht mehr aus dem Bett, weil der Michael kommt auch nicht mehr aus dem Bett. Den weck ich manchmal drei Mal auf und er schläft mir dauernd wieder ein und ich muss ihn richtig aufsetzen im Bett und kaum dreh ich mich um, legt er sich weder hin und versucht weiterzuschlafen. Also es ist... Da ist er einfach wie ein gesundes pubertierendes Kind. Manchmal wacht er auch zwischen sechs und sieben auf, ja, aber er kann auch einmal bis um halb zehn schlafen.
Interviewer: OK, also stört ihn überhaupt nicht.
Frau T.: Nein, das ist also wirklich... Das find ich ja sehr erfreulich an und für sich, dass es so eine gesunde Sache ist. Ich kann jetzt allen Müttern nur sagen: »Eure Kinder gehen nicht nur zu spät schlafen, schaun nicht nur zu viel fern, sondern es liegt auch an den Hormonen«. ((lacht))
Interviewer: OK, und jetzt noch einmal explizit: welche Rolle nehmen Sie bei der Freizeitgestaltung vom Michael ein?
Frau T.: Ähm. die Initiative, das Aussuchen und das Durchführen.
Interviewer: Also schon eigentliche alles im Endeffekt.
Frau T.: Ja.
Interviewer: OK, also das heißt, Initiative heißt schaun, was es so gibt?
Frau T.: Ja, wobei die Auswahl nicht sehr groß ist. Nachdem er nicht spielt, nicht sich mit etwas von außen beschäftigt ähm ist es... am besten ist man in der Natur, weil Museen: er geht mit, aber es interessiert ihn nicht. Es sagt ihm nichts. Es ist ihm dann wurscht, ob er durch ein Kaufhaus oder ein Museum durchgeht vom Anschaun her. Tiergarten gehen wir gerne und auch oft, weil der ist so nah bei uns, und, wobei ich auch nicht weiß, wie sehr er es wahrnimmt, oder wie sehr er auch einfach durch... ja, aber das geht, wenn nicht zu viele Menschen auf einmal sind, dann wird's auch schwierig.
Interviewer: OK, also zu viele Menschen, dann wird er nervös?
Frau T.: Nein, er wird nicht nervös. Er ist... «...» Er ist schwerer zu halten. Irgendwie ist er unruhiger. Ich kann ihm nicht die gewisse Freiheit geben, dass er halt einmal vor oder zurück geht, weil da sind ja so viele Menschen, da muss er bei mir bleiben. Das mag er dann auch nicht. Also ich hab ihn einmal in ein Museum mitgenommen, das war knallvoll und es war unmöglich. Wir haben uns dann abgewechselt und waren dann teilweise mit ihm draußen im Park und haben's uns abwechselnd angeschaut, weil da ist er wirklich sehr... Stehen bleiben und ruhig stehen bleiben mag er auch nicht und davon hat er gar nichts gehabt.
Interviewer: OK, also das war mehr Stress als Erholung.
Frau T.: Das war mehr Stress. Spielplatz mag er gerne, also schaukeln, rutschen kamma. Wenn irgendwo ein Grätzelfest ist und es sind dort irgendwelche äh Pferde, die im Kreis gehen, dann lass ich ihn auf den Pferden im Kreis gehen. Das mag er gerne. Schwimmen geht er sehr, sehr gerne. Das ist... Wobei ich die öffentlichen Bäder nicht allzu sehr strapazier, weil er hat Windeln und ich muss mich erst wieder um eine neue Inkontinenzhose bemühen, weil sonst hab ich immer Sorge, dass sie das Becken auslassen müssen. ((lacht)) Und ja, aber im Teich oder im See und so macht's ihm wahnsinnigen Spaß. Wandern macht er eigentlich brav große Strecken. Wir haben uns erst am Muttertag heillos verirrt und sind dann fünf Stunden unterwegs gewesen recht steil rauf und runter. Da hat er sich sehr geplagt, weil das Steile ist gar nicht seins. Also da sind wird beide fast abgestürzt, aber wir haben's geschafft «...»
Interviewer: Vom Motorischen her?
Frau T.: Er geht gut. Er geht, aber sehr stacksig. Er kann nicht laufen. Er hat nicht die runden Bewegungen und das fehlt ihm scheinbar auch beim bergab und bergauf gehen.
Interviewer: OK, deswegen ist es schwierig.
Frau T.: Deswegen ist's schwierig. Er hängt sich dann immer sehr ein, also nicht nur ein, sondern auch an. Also das... Man spürt's dann schon sehr auch körperlich, wenn man mit ihm unterwegs war.
Interviewer: OK, also es ist direkt anstrengend?
Frau T.: Ja.
Interviewer: Gut. Und die meisten Freizeitaktivitäten, die er macht, macht er mit Ihnen, oder eben mit dem Schwager.
Frau T.: Ja, oder eben mit dem Internat. Die gehen auch Eis essen oder gehen spazieren oder schwimmen oder reiten oder eben auch diese Sachen.
Interviewer: Ja und wie schaut's mit Freizeitangeboten aus? Jetzt so einmal allgemein. Kennen Sie da welche?
Frau T.: Die K. sind das einzige, was ich kenn. Ähm, es hat sich einmal vorgestellt eine Frau, die organisiert Urlaub für Behinderte, die aber mehr Körperbehinderte sind, die sonst besser beisammen sind und halt so mehr Betreuung brauchen, die außerdem exorbitant teuer sind. Ich mein einfach, weil's halt was kostet so eine intensive Betreuung. Das ist vollkommen klar. Ich mein die K., wenn sie nicht subventioniert wären, wären sie auch so teuer, weil es kostet einfach.
Interviewer: Es ist einfach der Betreuungsaufwand.
Frau T.: Ja, der ist einfach groß.
Interviewer: Das ist eigentliche eh das, was am meisten Geld frisst. Ähm, was würde für Sie so ein Freizeitangebot auszeichnen? Also was hätten Sie für Ansprüche an ein Freizeitangebote, an dem der Michael teilnehmen könnte?
Frau T.: Ich finde den H. einfach grandios, weil es ist wirklich Ferien für die Kinder. Weil wenn er irgendwo kurzzeitbetreut ist, da läuft's dort meistens mit im Alltag und das ist wie zu Hause auch, aber am H. wird echt Ferien gemacht und spezielles Programm und Kugelbad und Wasser plantschen und Schwimmen gehen und mit der Straßenbahn fahren und wirklich Spaß gemacht und ein Unterschied zum Alltag und das spürt er auch. Und deswegen sind mir die Wochen auch so wichtig und das K. passt mir meistens, also eben nur, »nur« unter Anführungszeichen - ich bin froh, dass es das gibt, von Sonntag bis Freitag ist, was mit der Wochenplanung immer vorne und hinten nicht passt, aber es ist mir ganz wichtig, weil K. das ist so ein echtes Freizeitferienwochencamp.
Interviewer: Also es geht einfach darum, dass das vom Alltag einfach was anderes ist und dass es Spaß macht.
Frau T.: Weil die anderen Kinder fahren auch auf Zeltlager mit den Pfadfindern, mit den Ministranten auf Lager und sind einmal weg von der Familie und haben einmal ganz was anderes. Einer, der das gemacht hat vor der K., ist sogar auf Zeltlager mit ihnen gefahren, irgendwo nach Kärnten. »Wie? Der Michael auf Zeltlager? Bitte gerne!«. ((lacht)) Ist gut gegangen, aber ich weiß nicht wie und ich fand's einfach wahnsinnig toll. Auch die Kinder finden's einfach toll, wenn sie... Er war jetzt auf Projekttagen auch mit der Schule, dass er auch auf Projekttage fährt und auch ein Ferienlager hat. Das ist auch für die Geschwister so wichtig, dass da auch etwas ist, was ihm Spaß macht, dass so ein bisschen mit der Normalität verbindet.
Interviewer: OK, so, dass er einfach auch die Chance hat diesem Teil des Alltags, der für andere Kinder selbstverständlich ist, teilzunehmen.
Frau T.: Ja. «...» Was bei ihm wegfällt, sind Freunde besuchen und Freunde kommen, weil er nicht die Beziehungen aufbaut in dem Sinn. Also das ist auch bei den gesunden Kindern ein großer Freizeitfaktor - mit Freunden etwas unternehmen. Das fällt bei ihm weg. Er hat eine... dort, wo er schon einmal immer wieder aufgenommen wird, dort hat er inzwischen einen Freund, der sich immer wahnsinnig freut, aber da hat, glaub ich, der andere mehr Beziehung zum Michael und dadurch ist da auch eine Beziehung. Und in G. hat er sich mit einem älteren Bewohner angefreundet, der sonst sehr reserviert ist und niemanden an sich heranlässt, weil er erst sehr, sehr spät... Also der hat lang bei der Mutter gelebt bis über vierzig und war dann erst dort und lässt immer... Und der Michael, der also keine Grenzen kennt... und der hat ihn akzeptiert und die haben sich auch angefreundet in einer Form. Aber wie gesagt, auch wenn ich nicht da bin, ist es nicht tragisch. Also er braucht jetzt nicht die Bezugperson. «...» Wir haben auch eine... Also meine Freundin mit einem behinderten Kind, die sind auch immer wieder da. Mit der versteht er sich auf seine Art auch ganz gut. Die versteht mehr. Die ist körperlich mehr behindert, aber versteht eine bissl mehr. Und die versteht auch »Gib den Paul weg!«, wenn er ihr in den Mund greifen will und so. Also die kennen sich gut und sind miteinander aufgewachsen, aber es ist keine Freundschaft in dem Sinn wie sie meine gesunden Kinder haben.
Interviewer: Also wenn, dann wär's was total anderes. Also einfach eine gewisse Beziehung, aber nicht Freundschaft.
Frau T.: Ja.
Interviewer: OK. «...» Das heißt die K. sind so die einzigen Freizeitangebote, an denen der Michael teilgenommen hat und von denen Sie wissen?
Frau T.: Ja. «...» Wobei ich allen Hinweisen immer nachgeh. Also da bin ich sehr hellhörig. Wenn irgendetwas ist, schauen wir, ob das was wäre für unsere Kinder und die Frau L. so wie ich. Also wir schauen, horchen uns gut um und gehen den Sachen auch wirklich nach.
Interviewer: Also das ist einfach... vom Informationsfluss her bekommen Sie nicht wirklich viel?
Frau T.: Nein.
Interviewer: Es ist auch nicht so, dass jemand zu Ihnen kommen würde und sagen »OK, wir hätten das und das und interessiert Sie das?«, aber das ist sowieso utopisch, denk ich.
Frau T.: Ganz, ja. Da erfährt man nicht einmal, dass man einen Anspruch auf Windeln hat oder sonst etwas. Das ist alles nur von Mutter zu Mutter.
Interviewer: OK, also es ist einfach dieses Netzwerk unter Eltern, da wird dann...
Frau T.: Ja, ich sag immer, die Frau L. und ich sind unsere Selbsthilfegruppe.
Interviewer: Ja. «...» Das heißt es waren eigentlich nur Ferienangebote, an denen er teilgenommen hat.
Frau T.: Ja.
Interviewer: Unterm Jahr waren dann keine Freizeitangebote?
Frau T.: Nein.
Interviewer: Ja, ähm was bedeuten diese Ferienangebote für Sie jetzt, für Sie persönlich?
Frau T.: Für mich persönlich eine ungemeine Entlastung und ohne die würde ich es nicht schaffen. Das ist wirklich so, dass ohne diese zusätzlichen Teilentlastungen... Vor drei, vier Jahren war ich soweit, dass ich mir gedacht hab, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's zu Hause einfach nicht mehr. Da war er noch nicht im Internat. Und da war dann die Frage, ob ich ihn ins Heim geb. Ich mein, noch nicht ganz, weil da war er erst elf oder zwölf. Für mich zu jung. Aber im Prinzip war's so »Was mach ich? Zu Hause geht's nicht mehr.« und mit der Teilzeitentlastung geht's zu Hause. «...» Und ich sag, deswegen sind diese so wahnsinnig wichtig, weil die Kinder viel länger zu Hause bleiben können, weil wir unsere Energien aufteilen.
Interviewer: Das heißt die Geborgenheit in der Familie noch länger raus...
Frau T.: Genau, wesentlich länger.
Interviewer: OK. «...» Das geht ja bis 18 das Ferienangebot der K..
Frau T.: Wobei dann ist eh auch Werkstatt und weniger Urlaub und es strukturiert sich dann um, wobei eben dann der Feriencharakter fehlt: Die Frau L. nimmt die T. extra aus der Werkstatt raus, weil sie sagt, es ist ihr so wichtig, dass die T. genau dieses Ferienangebot hat und warum soll sie das, weil sie jetzt 17 ist, nicht mehr haben und die Frau I. hat auch wirklich noch ein Loch gefunden «...» und dass sie auch wirklich eine Woche oder zwei Wochen mitfahren kann.
Interviewer: OK, also es ist einfach die Entlastung, die zeitliche?
Frau T.: Bei mir ist es die zeitliche Entlastung, weil ich neun Wochen drinnen hab und bei der Frau L. ganz spezifisch auch noch das Ferienprogramm. Nicht nur dass sie jetzt betreut ist, fremdbetreut ist, sondern dass sie wirklich dieses Ferienprogramm hat.
Interviewer: Ja, was erwarten Sie dann von diesem Ferienangebot? Eh dass es den Kindern Spaß macht, dass es eine Entlastung ist für Sie. Gibt's sonst noch irgendwas?
Frau T.: «...» Kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Also wenn's nur von acht bis zwölf wär und ich müsst ihn irgendwo in die Stadt bringen und wieder abholen, wäre der Aufwand einfach zu groß.
Interviewer: OK, also es muss schon über einen gewissen Zeitraum gehen.
Frau T.: Ja, also dieses bis zum frühen Nachmittag, das ist schon notwendig und dass der Fahrtendienst eingebunden ist, ist eine Riesenhilfe. Ich mein, ich hätt's zum H. nicht weit. Ja, das ist ja wirklich um's Eck, aber viele kommen aus Floridsdorf und das Hinbringen und Abholen... Er war ja früher im 17. Bezirk. Also da würde man sich auch überlegen, wie weit man das macht. Ich würd sicher eine Wochen machen. Einfach weil's so wichtig ist für den Michael, aber so von der Entlastung her ist das eben in der Kombination mit dem Fahrtendienst und der Zeit bis um vier echt großartig. «...» Also es muss eine Zeitentlastung auch dabei sein.
Interviewer: OK, und wie haben Sie von dem Angebot von den K. erfahren? Also wie hat die Kontaktaufnahme funktioniert?
Frau T.: ((seufzt)) Ich weiß es nicht, wie ich ursprünglich davon erfahren hab, ob das nicht die Frau L. herausgefunden hat?
Interviewer: Also auch wieder über Elternkontakte?
Frau T.: Ja, Elternkontakte, sicher. Aber sicher nicht Zuschriften oder so. Keine Werbung, sicher über Elternkontakte.
Interviewer: Haben Sie da mit den K. oder mit der Sonderbetreuung Kontakt aufgenommen? Frau T.: Ja, da hab ich mich dann direkt an die Sonderbetreuung gewendet. Interviewer: OK, gut. Also hat auch wieder von Ihnen ausgehen müssen? Frau T.: Ja, ja. Interviewer: Ja und ich welchem Zeitraum nützt er diesen Sommer zum Beispiel Ferienangebote? Frau T.: Er ist der ersten Juliwochen und in der ersten Augustwochen dabei und dann fährt er eine Woche nach
K. mit. Interviewer: Also drei Wochen sind's dann insgesamt. «...» Ja, also von hier ist es ja relativ gut erreichbar das Ferienangebot, oder? Frau T.: Ja, aber da hab ich wirklich mehr Glück als sonst was. Das könnte genauso gut in Floridsdorf sein, wobei ich's auch in Floridsdorf in Anspruch nehmen würde, selbst wenn er da eine Stunde im Auto sitzt. Interviewer: Um da teilnehmen zu können?
Frau T.: Ja
((Bandwechsel))
Interviewer: Also es ist sehr mühsam da zu suchen und zu finden?
Frau T.: Ja. «...» Der vom Fond Soziales Wien wollt mir das voriges Jahr nicht bewilligen G. und hat gefragt, warum ich bis nach Oberösterreich fahr, ob ich dort Urlaub mach? Da hab ich gesagt »Nein, ich fahr extra dort hin meinen Sohn dort abzugeben.«. Wenn er mir was in Wien sagt, bitte danke. Ich muss nicht zweieinhalb Stunden im Auto hin und wieder zurück. Und da hat er mir eine ganze Liste geschickt, die das machen könnten und ich hab sie alle durchtelefoniert und es war niemand mit Kurzzeitunterbringung dabei. Also es gab's damals wirklich nicht. Ich hab jetzt wieder eine Adresse bekommen vom Verein K.. Da war aber die Frau letzte Woche nicht da, die muss ich die Woche noch einmal anrufen.
Interviewer: OK, aber es klingt so als ob es für einfach wahnsinnig aufwendig wäre.
Frau T.: Es ist auch so. Das ist es ganz bestimmt. «...» Wobei im Prinzip die Einrichtungen oft ganz interessiert wären, aber es von der... Also am H. zum Beispiel. Sie hat auch gesagt, sie würde das gerne unterstützen und ich soll einen Antrag schreiben, was ich bräuchte, damit sie Unterlagen hat, dass es den Bedarf gibt, aber das hat nichts bewirkt.
Interviewer: Woran scheitert das am meisten?
Frau T.: An der Struktur. Weil ich weiß nicht, warum die Stadt Wien lieber ganz viel Geld für eine Vollzeitunterbringung ausgibt und nicht ein bissi Geld für eine Kurzzeitunterbringung. Das ist einfach noch nicht im Kopf drinnen. So wie Spitalsaufenthalte werden gezahlt, wenn man dort übernachtet. Wenn man heimgeht und das ambulant macht die gleichen Behandlungen, wenn man täglich dorthin geht und seine Infusion kriegt oder was auch immer, dann wird's nicht gezahlt. Ich mein, das ist einfach in ihrem Kopf noch falsch programmiert, obwohl das andere wesentlich billiger wäre.
Interviewer: Mhm, das heißt, es ist eher von der politischen Seite her?
Frau T.: Ja, das ist eine eindeutig politische Sache.
Interviewer: OK, also dass da einfach das Bewusstsein für die Problematik fehlt?
Frau T.: Ja, aber wie gesagt, das fehlt überall. Das fehlt im Gesundheitswesen und ja...
Interviewer: OK und eine abschließende Frage noch. Wenn Sie die derzeitige Situation rund um die Ferienangebote und Freizeitangebote ändern könnten, wie würden Sie's machen oder was wären so Ihre Ziele?
Frau T.: Wesentlich mehr finanziell zur Verfügung stellen, damit mehr Gruppen wie die K. arbeiten könnten. Es wär auch ein größeres Budget von der Stadt Wien aus notwendig, um Vereine, die interessiert wären für die Behinderten etwas zu tun, zu unterstützen. Ich glaube, dass es sehr viele gäbe, auch in Eigeninitiative und in Kleingruppen und was auch immer, die an der BürOKratie scheitern.
Interviewer: Also dass es einfach diese politischen und finanziellen Hürden sind, die das ganze...
Frau T.: Und die K. hatten, glaub ich, die Möglichkeit von ihrer Grundstruktur her, da sie politisch total verankert sind und ein sehr funktionierendes Netzwerk für Gesunde aufgebaut haben, da noch mithinein zu rutschen. Aber das haben andere Einrichtungen wahrscheinlich scheinbar nicht. Ich glaub, dass es eine politische Sache ist. Politisch, weil finanziell.
Interviewer: OK, also von politischer und finanzieller Seite her mehr Offenheit und mehr Zugang und einfach mehr Bewusstheit für das?
Frau T.: Ja, weil ich glaube, dass es langfristig billiger kommt, weil die Eltern entlastet werden. Was machen bitte Eltern, die berufstätig, die wirklich irgendwo anwesend sein müssen mit neun Wochen Freizeit? Ich mein, das geht einfach nicht. Da leb ich ja wirklich im Schlaraffenland, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Für kleinere und gesunde Kinder gibt's, glaub ich, gibt's eher noch Möglichkeiten, obwohl ich das auch problematisch find für Berufstätige neun Wochen Ferien, mit dem momentanen Trend, dass alle sofort wieder arbeiten gehen.
Interviewer: Ähm «...» Was würden Sie zu integrativen Angeboten sagen?
Frau T.: Das kann ich schwer beurteilen. Ich bin jetzt nicht primär ein Verfechter der Integration, weil der Michael so schwerst behindert ist, dass es weder den anderen Kindern, noch dem Paul etwas bringt rasend viel zu integrieren. Also es kann durchaus auch Sachen geben, die sie auch gemeinsam machen, aber ich bin nicht für Integration um jeden Preis. Und das ist das, was von Politikern im Moment angestrebt wird. Sie wollen alle integrieren und haben überhaupt kein Gefühl dafür, dass das für unsere Kinder nicht das beste ist, irgendwo immer mitlaufen zu müssen, immer die Schwächsten zu sein in einer Gruppe, immer irgendwo hintendran gehängt zu sein und beim Michael ist es eh klar, dass es nicht normal geht, weil ich hätt ihn integrieren können, hätt aber in die Schule gehen müssen, zum Wickeln und Füttern, weil das macht ja dort niemand. Das kommt sowieso nicht in Frage, aber ich hab auch von einem Rollstuhlkind gehört, das geistig ganz fit ist, das gesagt hat »Bitte, ich möchte in eine Schule, die abgestimmt ist auf meine Bedürfnisse.«
Interviewer: OK, also dass es manchmal schon ein Vorteil ist, wenn man spezielle Angebote, jetzt zum Beispiel für Kinder mit geistiger Behinderung, hat?
Frau T.: Ja schon, wenn man immer wieder die Gruppen... sollen sie nebeneinander auch laufen in einem Haus und man macht dann wieder gemeinsam irgendwas auch einmal, aber im Prinzip gehört eine spezielle Förderung. Und eine Schullandwoche mit gesunden Kindern ist was anderes als eine Schullandwoche mit unseren Kindern, auch vom Betreuungsaufwand. Allein wenn die bei einem Ausflug alle laufen und Dings und dann hinten nach. Der Michael kann nicht sehr schnell gehen, er würde die ganze Gruppe aufhalten «...» zum Beispiel. Also es sind so die Kleinigkeiten und der Michael hätte auch nichts davon und wie gesagt. Aber der Michael hat den Vorteil auch in einer Familie mit gesunden Geschwistern zu sein, die ihm ganz wichtig sind. Sie sollen jetzt nicht ausgegrenzt sein. Das ist keineswegs mein Ziel, dass man sie ausgrenzt, aber dass man sie auch mit ihren Bedürfnissen wahrnimmt und sie nicht immer die Schwächsten in einer Kette sind.
Interviewer: OK, also dass sie in integrativen Gruppen oftmals die Schwächsten sind und die... Frau T.: Viele Kinder spüren das aber auch immer. Sie können nicht auf die Sessel raufsteigen, sie können nicht
die Stiegen runterlaufen. Sie können nicht... ((seufzt)) Interviewer: Sie nehmen sich selber immer als die wahr, die etwas nicht können, was die anderen können. Frau T.: Ja und das ist eigentlich Schade. Das nimmt ihnen viel Selbstvertrauen. Während in einer Gruppe, wo sie alle mit einem Handicap leben, dann das leichter ist. Sie können eben... Die einen können schon zeichnen und die anderen können dafür gehen und die anderen können... «...» Interviewer: Ja, würde Ihnen sonst noch zum Thema irgendetwas einfallen, was Sie gerne noch sagen würden?
Frau T.: Nein, eigentlich, glaub ich, ist alles gesagt.
Interviewer: OK, dann danke ich einmal für das Interview.
((Fragen zur Anamnese bzw. zur Lebenssituation von Familie C. wurden in einem Interview im Rahmen der bislang unveröffentlichten Studie "Integration geistig behinderter Kinder" des Institutes für Kinderrechte und Elternbildung in dieser Diplomarbeit gleicher methodischer Herangehensweise - qualitatives Interview -abgeklärt. Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich diesen Teil hier zu abzudrucken. Aus diesem Grund beginnt dieses Interview direkt mit Fragen zum Thema "Freizeit"))
Interviewer: Jetzt am Anfang zur Freizeitsituation allgemein. Was würden Sie mit Freizeit verbinden? Was bedeutet das für Sie?
Herr C.: Jetzt im Zusammenhang mim Robert?
Interviewer: Ja, beides, allgemein und mit dem Robert.
Herr C.: «...» Der Robert ist sehr gern draußen, Bewegung im Freien und ich glaub es «...» wird... «...» Es ist wahrscheinlich sehr schwer, dass man ein allgemeines Angebot für Mehrfachbehinderte bietet. Es wird ein jeder wahrscheinlich so anders sein, wo man wirklich sagt, dass das alle abdeckt. «...» Sag ma über Jahre hinweg, wenn ma jetzt sagt Wochenende zu Beispiel, ist das...
Interviewer: Ist das eher problematisch in die Richtung?
Herr C.: Problematisch, ja. Ich könnt mir's vorstellen, wenn ma jetzt sagt, wir machen jetzt irgendeine Freizeitaktivität, wo zwanzig Rollstuhlfahrer miteinander teilnehmen können, die aber nicht geistig behindert sind, ist das wieder eine andere Geschichte.
Interviewer: OK, also das das absolut behinderungsspezifisch ist, wie's ausschaut bei den Angeboten oder wie weit man's anbieten kann?
Herr C.: Mhm
Interviewer: OK, und welche Rolle spielt Freizeit für den Robert eigentlich?
Herr C.: Ja, er genießt das schon, jetzt auch Zeiten in der Woche zu haben, wo nicht der schulische Druck klarerweise da ist, wo er sich total daheim gehen lasst oder draußen seine überschüssigen Kräfte abarbeitet, seine Runden dreht. «...» Beim Wandern ist er, auch wenn wir auf gleicher Höhe sind, so vom Gefühl, wir führen ihn nicht, sondern er führt, weil ich immer wollt, dass er selbst gelenkt ist, nach seinen Möglichkeiten halt. Und es ist auch immer sein Ausflug, wenn wir gemeinsam weggehen, wo ma eigentlich nie... Es ist kein Thema, es ist sein Ausflug, wobei wir dann halt schon schaun, dass in Summe, wir kennen sein Repertoire mit den eineinhalb Stunden, dass das halt... dass ma dann wieder zurückkommen bevor er komplett von der geistigen Konzentration oder von der Körperkraft nicht mehr kann. Also so wird's schon gelenkt, aber... Wo ma hinfahren auch wir, weil das geht irgendwie nicht. «...» Aber dort kann er dann wirklich links gehen, rechts gehen, fünf Minuten eine Blume anschaun oder joggen ein paar hundert Meter, also was er halt so unter joggen versteht.
Interviewer: Da hat er volle Freiheiten?
Herr C.: Ja.
Interviewer: Ja, in der Freizeit ist er meistens zu Hause oder unterwegs? Oder gibt's da sonst noch irgendwas?
Herr C.: Ja, dieses Trampolinspringen. Das Reiten hamma aufgehört, nachdem das so »ist es, ist es gut, ist es nicht, ist es auch gut« und es wär dann schon zu gefährlich gewesen von Runterfallen her, weil er doch sehr... «...»
Interviewer: Seine Bewegungen einfach?
Herr C.: Ja. «...» Und da hamma aber den Eindruck nachdem ma die Reitlehrerin zwei Mal getroffen haben, dass... ja, es war schön dass' war, aber er hat eher sie angestrahlt als das Pferd, obwohl... ja, es ist so »ist es, ist es gut, ist es nicht, ist es auch gut«. Das ist, glaub ich, schon wichtig, weil das hamma cirka sieben Jahre betrieben. Wir haben da in irgendeinem Urlaub damit angefangen, haben uns dann da in Wien irgendwie durchgehantelt, bis wir irgendwas passendes gefunden haben. Das ist halt bezüglich Freizeitangebot, das ist in Wien das Problem, dass es da zum Beispiel sehr wenig gibt, wenn ma jetzt sagt, Reiten für Behinderte «...» wirklich behinderte vor allem, weil ein Down-Syndrom-Kind, das kamma eigentlich wahrscheinlich ganz normal auf ein Pferd setzen und braucht nicht über die Maßen mitgehen und schaun, dass... «...» Fernsehen ist beim Relaxen beim Robert zu Hause eine gute Freizeitbeschäftigung, die er jetzt auch aktiv annimmt. Das hamma jetzt seit drei Jahren cirka. Vorher hamma immer nur heimlich mit Kopfhörern gehört, weil ihm das alles zu viel war. Und die Sendungen werden natürlich auch gezielt ausgesucht. In erster Linie Sport. Die brutalen oder die ganz blöden Sachen werden einfach gefiltert, die spielt's einfach nicht. Ich mein, alles mit Maß und Ziel, weil ein bissi muss man ihn schon vorbereiten auf das wirkliche Leben. Dass er das kennt und dazusagen »das ist schade« oder »das ist schlecht« oder »das ist traurig« oder »das tut man nicht«. So wie man eben mit Kindern über das Fernsehen redet.
Interviewer: OK. Und wie schaut das mit der Unterstützung bei so Freizeit, Freizeitaktivitäten aus? Wer unterstützt ihn da oder wie wird er unterstützt meistens?
Herr C.: Von den Eltern. Bei meinen Eltern geht's so eigentlich nimmer mehr, außer er ist bei ihnen draußen.
Interviewer: Vom körperlichen her?
Herr C.: Wie meine Frau eigentlich. Da sind diese Ausflüge, wo man weiter geht, nimmer mehr drin, weil er eben sehr schnell ist und keine Gefahrenabschätzung hat und sehr spontan ist, sag ma's so ((lacht)).
Interviewer: Ähm, hat er jetzt eigentlich viel Freizeit? Wann kommt er denn von der Schule?
Herr C.: Also wenn die Schulzeit ist, kommt er um halb fünf cirka und geht um neun schlafen. Oder sag ma, um neun leg ma ihn nieder. Das geht dann meistens eh noch zwei Stunden bis... «...» Und dann mach ma noch diese Musiktherapie unterm Schuljahr, weil die auch noch unterm Schuljahr ist. Hat mit der Schule nichts zum tun, aber der ist im Sommer auch nicht da der Mann. Das wäre noch eine Freizeitbeschäftigung, die ihm sehr taugt, weil da kann er schrein und brüllen und der Mann imitiert ihn. Also der versucht ihm Dinge zu entlocken.
Interviewer: Und es macht ihm Spaß? Also die Therapie sieht er als Spaß?
Herr C.: Das ist ein voller Spaß. Da freut er sich. Das ist gigantisch. «...» Und sonst sind halt wir beide seine Freizeitgestalter, Mitgestalter.
Interviewer: Also das ist ihre Rolle mehr oder weniger die Freizeitgestaltung und -ausführung?
Herr C.: Genau.
Interviewer: OK. Ja dann zu Freizeitangeboten allgemein einmal. Was würde für Sie so ein Freizeitangebot auszeichnen? Was müsste so ein Freizeitangebot haben?
Herr C.: Ja eigentlich das, was bei den K. ist. In erster Linie das, dass wir wissen, dass er quasi gut aufgehoben ist.
Interviewer: OK, also ein gewisses Vertrauen in die Leute, die dort arbeiten?
Herr C.: Genau. Was dann dort passiert, ist eigentlich nebensächlich, weil das dann eh in der Interaktion passiert.
Interviewer: Also ein gewisses Grundvertrauen muss da sein?
Herr C.: Genau, das ist eigentlich das wichtigste, weil er selber kann ja nicht sagen »so, ich geh jetzt« oder »mir gefällt's nimmer« oder irgendwas sagen, wenn was schreckliches passiert ist. Das Grundvertrauen ist eigentlich das wichtigste bei einem Kind, das geistig und mehrfach und in dieser Art und Weise behindert ist.
Interviewer: Und wie muss ein Angebot ausschauen, dass dieses Grundvertrauen da ist oder was braucht man dann, dass das da ist?
Herr C.: Pff... Nachdem das eine sehr abstrakte Sache ist, es müsste so sein, das muss einfach vor der ersten Inanspruchnahme in einem persönlichen Gespräch... Das muss man spüren und dann vielleicht nach dem ersten Stattfinden gespürt wieder zurückkommen. Das ist irgendwie schwer zu erklären.
Interviewer: Also es ist einfach auf der emotionalen Ebene.
Herr C.: Eigentlich voll, genau, ja. Weil wir, glaub ich, durch den Robert, der nicht spricht, vielleicht noch ein bissl feinfühliger sind. So wie's Kinder überhaupt sind. Nur wir haben's nicht so verlernt wie andere Erwachsene, die sich dann vielleicht von Worten leicht prägen lassen. Also das zu erkennen, was wirklich dahinter steckt, was Leute sagen. Aber dieses Vertrauen kann man am besten gewinnen in einem Gespräch.
Interviewer: Also dass man vorher die Leute kennen lernt, die dort arbeiten.
Herr C.: Einen kurzen Kontakt halt.
Interviewer: OK und wenn dieser Kontakt passt, dann hat man kein großartiges Problem mehr?
Herr C.: Man sieht's ja dann in der Rückkoppelung, wie's dem Robert danach geht. Ist das jetzt vielleicht eine Verwirrung, weil's was neues ist, oder ist er irgendwie so unruhig, weil's nicht gepasst hat? Das erkennen wir eigentlich schon. Das wird wahrscheinlich jemand der ein Kind, das genau in dieser Art und Weise behindert ist und das Kind ist erst drei oder vier Jahre alt, noch nicht können. Wir sind jetzt mit ihm fast siebzehn Jahre mitgewachsen. Das geht vielleicht auch erst ab einem gewissen Punkt.
Interviewer: Man lernt einfach über die Jahre?
Herr C.: Ja, ohne Sprache auszukommen.
Interviewer: Ja, welche Bedeutung messen Sie Freizeitangeboten zu? Was bedeuten die für Sie?
Herr C.: Also ist an und für sich sehr wichtig, weil Kinder, egal welche, nicht ausschließlich zu Hause, sondern auch unter ihres-und seinesgleichen, Gleichaltrigen sein sollen. Darum ist es sehr wichtig. Wo dann vielleicht auch ganz andere Grundregeln passieren, nämlich so wie sie sich grad ergeben in der jeweiligen Gruppe, wie's da ausgemacht wird, wie's in der Kommunikation... Jede Gruppe hat eine andere Dynamik und die ist mit denselben Leuten in zwei Wochen wieder ein bissl anders. «...» Die Interaktion und in unserem Fall wieder, was von Anfang an sehr wichtig war, die Übung, dass Personen, die man halt mag oder nicht mag, dass das immer wieder wechseln kann. Das Anpassen an neue Gruppen. Hineinfinden in neue Gruppen.
Interviewer: Also ein gewisse soziale Kompetenz?
Herr C.: Genau. Die hat er eigentlich sehr rasch erlangt, kommt aber... Ich glaub, so was kann auch nur gut gehen, wenn dieses Urvertrauen, was man sagt, das können Kinder bis zum dritten Lebensjahr entwickeln... Wenn das passt, dann passt das. Und das hat er. «...» Er ist ein geliebtes Wunschkind. Wir waren immer für ihn da. Wir haben ihn nie angelogen. Wir haben immer gesagt, wenn was schrecklich wird, dass es schrecklich wird. «...» Das kann man, wenn man mit möglichst vielen verschiedenen Leuten Umgang hat, immer besser lernen. «...» Ja, was sich bei uns eigentlich selbst reduziert, ist die Freizeitbeschäftigung privater Natur, Freundeskreis. Das ist halt sehr klein. «...» Weil die Schulklassen sehr klein sind, weil wahrscheinlich Behinderten-Eltern noch eher mauern, weil sie selber schon so überfordert sind. Jetzt wollen sie nicht mit einem Kind noch irgendwo hingehen und dafür dann in zwei Wochen das andere Kind dann dazu nehmen, weil's dann zwei haben, auf die sie aufpassen müssen. Aber vierzehn-, fünfzehnjährige sonst auf die braucht man nicht aufpassen. Die sind halt in der Wohnung und schlafen dann in der Nacht und irgendwann um drei muss man schaun, dass sie schlafen gehen. Man kennt ja die Gschichteln von den Kolleginnen und so. «...» Ja, diese Freizeitbeschäftigung die eigentlich nichts kostet und die eigentlich für viele Kinder sehr viel der Freizeit ausmacht, der Freundeskreis, der ist einfach nicht wirklich da, weil eigentlich die Eltern immer andrücken müssen. So die Verbindung herstellen.
Interviewer: Weil sie sich in der Interaktion relativ schwer tun, oder?
Herr C.: Ja, weil er mit seiner Behinderung nicht sagen kann, dass er zu dem und dem und dem fahren will. Wir haben diese Dinge eher in Richtung »welchen Ausflug möchtest du machen?«. Da hamma so eine Mappe mit Fotos und da hamma ihn vorm Ausflug gefragt bis vor einem Jahr, aber dann hamma aufgehört. Das bringt nichts. Wir haben vier, fünf Jahre lang die vorgelegt und gefragt »willst du den, den oder den?«, also drei maximal damit ma ihn nicht überfordert und dass er dann einen nimmt und er weiß dann wo. Ich mein, da hamma eh vorgefühlt, wir wollen ungefähr in die Richtung. Aber das ist's auch nicht wirklich gewesen. Wir haben uns da wirklich sehr bemüht, nachdem der Robert die Fotos aber ganz anders sehen wird, die Fotos aus seiner Sicht zu machen. Also wie schaut's dort auf dem Kahlenbergausflug aus? Aus seiner Sicht, wenn man aus dem Auto aussteigt. Das ist auf keinem Foto drauf, weil er sieht's ja selber auch nicht sonst. Das ist auch wieder so diffus gewesen. Es war schon ein bissi was da und er hat sich gefreut, wie ma das foliert haben und beschriftet haben, da hat er immer schön mitgedreht, das geht mit Handführung.
Interviewer: Die Frage ist, wie viel er wahrnimmt?
Herr C.: Ja, zum Teil wirklich, wie wenn's ihm Wurscht wäre. Manchmal kommt's mir so vor wie »es wird schon passen, wenn's die Eltern machen«, obwohl er schon einen eigenen Willen hat, weil ein Sturschädel ist er. Das hat er aber auch von den Eltern. Das hat nichts mit seiner Behinderung zu tun. ((lacht))
Interviewer: OK, das heißt, er weiß teilweise schon ganz genau, was er will?
Herr C.: Ja, das andere ist halt, es ist halt alles gut. Vielleicht auch der Vorteil, dass man bei Kindern doch sehr, sehr, sehr genau aussucht, «...» wenn man nicht grad selbst die beaufsichtigende Person ist, wer ist das und so. Dadurch ist vielleicht auch seine Lebensqualität «...» höher.
Interviewer: Ja, wenn man die Personen, die mit ihm Freizeit oder was auch immer gestalten, ziemlich genau aussucht?
Herr C.: Ja, erstens genau aussucht und die einfach dadurch, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, anders einsteigen. Weil ich denk mir, eine Person, die mit einer anderen Jugendgruppe fährt, die sind zwar genauso gefordert, weil sie auf der anderen Seite viel mehr haben wahrscheinlich, Jugendliche zu beaufsichtigen, aber das ist einfach anders. Da macht's auch nichts, wenn man... weil da passt das Kind ja eh auf sich selber auf, so quasi. Aber da muss man schaun. «...» Dadurch haben's meiner Meinung nach, wo Eltern dahinter sind, sicher eine besser Qualität und dadurch ist vielleicht auch der Anspruch nicht so stark, irgendwas so zu wollen, wie sie das wollen. Da verstehen wir unsere Kinder auch besser, weil ma ((lacht)) gar nicht mehr auf das hören, was er sagt, weil man das eh nicht versteht, sondern »was fühlt er?«. Und es ist wahrscheinlich halt auch bei den meisten, dass es gar nicht anders geht. Es wahrscheinlich doch noch die klassische alte Erziehung, wo man Grenzen vorgibt, wo sie Spaß haben, aber es doch auch »Neins« gibt. Das braucht man in der Erziehung, wo die Familie eigentlich keine DemOKratie ist und die Eltern bestimmen, aber halt immer zum besten des Kindes und das ist bei uns halt so.
Interviewer: Also natürlich hat er seine Grenzen auch?
Herr C.: Ja, wenn Gefahr im Verzug ist auf jeden Fall und wenn halt irgendwas extrem im Übermaß ist und sei's denn, dass er irgendwo eine Stunde wackelt, das ist dann auch irgendwo aus.
Interviewer: Und welche Erfahrungen haben Sie so mit Freizeitangeboten gemacht, so konkrete Erfahrungen? Gibt's da irgendwas, was erzählenswert wäre?
Herr C.: Da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, weil die, was eine sehr gute Geschichte ist eigentlich zum Beispiel in den Sommerferien, dieses Ferienspiel, das kommt absolut nicht in Frage. Bei dem kann ich mir vorstellen, dass viele Sachen für Rollstuhlfahrer durchaus ein Thema ist, aber mit der geistigen Behinderung und Mehrfachbehinderung hab ich wirklich den Eindruck, dass es selektiv an den Eltern hängt, oder dass es zumindest an den Eltern hängt, selbst etwas zu finden.
Interviewer: OK, haben Sie das schon einmal ausprobiert so Freizeitspiel in den Ferien, so mit dem Robert?
Herr C.: Nein, die Ferienpässe, wenn wir uns die angeschaut haben. Das war im Bad, das wollt er nie und das sind wirklich Supersachen, diese Museumsbesuche, das kann man so ziemlich alles machen. Als Kind, denk ich mir, wenn ich nicht fortfahre und schau mir das alles an und schau ich's mir zwei Mal an, ist's auch eine Hetz. Das ist schon sehr ausgereift.
Interviewer: Ja, apropos Ferien. Also die Schulferien, wie werden die gestaltet beim Robert?
Herr C.: Wir haben Gott-sei-Dank die K., die bis jetzt immer so quasi übern Daumen vier, fünf Wochen von den neun abgedeckt haben. Zwei verbringen wir mit ihm im Familienurlaub mit Wandern in Salzburg und dann ist er zwei Wochen im Förderzentrum G. in Niederösterreich. Das ist aber auch wieder selbst gesucht, weil das ist uns zufällig zugeflogen, weil als Wiener hat man zu dem gar keinen Zugang, net. Und auf der anderen Seite und wenn, dann muss man's sich selber voll zahlen und bei den Niederösterreichern lauft das über die Krankenkasse. Ist gut, ist sauteuer, ist's uns wert und da wissen wir, er ist gut aufgehoben.
Interviewer: Zwei Wochen bliebt er dort?
Herr C.: Das ist zwei Mal Montag bis Freitag. Also scharfgestellt ist's eigentlich Montag Mittag bis Freitag Mittag.
Interviewer: Was ist das genau dieses Förderzentrum?
Herr C.: Äh, das ist eine im Waldviertel für große Regionen zuständige Einrichtung, wo unterm Schuljahr für die Kinder dort aus dem weitesten Umkreis, die werden dort zum Teil sogar beschult oder anschließend unterstützend zur Schule gefördert und bieten auch unterm Schuljahr so wochenweise Förderung an, wo die Eltern dabei sein können. Das haben wir auch schon einmal eine Woche gemacht. Das wollten sie auch als Grundlage für die erste Alleine-Woche draußen. Und im Sommer halt ausschließlich Förderungen, wo die Kinder oder Jugendlichen alleine dort sind, also eben eine Woche oder zwei Wochen oder zwei Wochen im Block. «...» Und die sind sehr kompetent.
Interviewer: Und was zeichnet für Sie so ein Ferienangebot aus?
Herr C.: Dass der Robert Freunde und alte Bekannte trifft, neue vielleicht kennen lernt. Dass was los ist. Abwechslung, vielleicht auch draußen. Auch wenn das dann nicht in Bewegung ist, so wie am Himmelhof auf einem Grundstück. Dass er dann vielleicht auch draufkommt, dass Sachen auch recht nett sind, die er zu Hause so mit den Eltern nicht macht, so wie ins Wasser gehen. Das tut er jetzt wieder mit dem T.. Das ist für mich unvorstellbar. Wir gehen schon lang nimmer mit ihm in ein Bad. Am Anfang hat er das sehr gerne getan als Baby und dann dürfte er das irgendwie realisiert haben, das Wasser und fremdes Element und was dort ist, wird mein Körper und ich tauch da ein und dann war's aus.
Interviewer: Ähm, also eine gewisse Abwechslung in den Ferien?
Herr C.: Mhm, deswegen hamma da auch so möglichst unterbrochen, dass ma sagt, da Himmelhof zwei Wochen. Es wäre ihm sonst wahrscheinlich... Ich kann immer nur Mutmaßungen anstellen, weil er redet ja nichts. ((lacht)) Dass wir ihm möglichst ein bissi eine Abwechslung bieten. Das eine ist dann verwickelt mit Koffer packen und, nach G. bringen wir ihn selber, weit mit dem Auto fahren oder mit einem Bus, wie's dann in Klaffer ist, dass das da möglichst vom Ablauf verschieden ist.
Interviewer: Also dass er eine gewisse Abwechslung drinnen hat.
Herr C.: Die Angebote sind eh spärlich, wenn man jetzt sagt, zu wem kann man gehen. Das Rote Kreuz bietet an und für sich gute Sachen an, aber auch wieder Down-Syndrom und Rollstuhlfahrer, aber Geistig-und Mehrfachbehinderung fällt noch ziemlich durch den Rost. «...» Es gibt nichts. Man könnte jetzt vielleicht sagen, wo der Robert größer ist, das erwägen wir auch für's nächste Jahr, wenn seine Lage so stabil bleibt, mit diesem Mariensee, also dass man schon ein bissi so schnuppern geht, wo man vielleicht später einmal wohnt für zwei Wochen. Wenn man sich das rechtzeitig mit den Leuten dort ausmacht. Das war immer sehr gut.
Interviewer: OK. Wie schaut's eigentlich mit integrativen Angeboten aus. Haben Sie davon schon gehört, oder hat der Robert schon einmal an so etwas teilgenommen?
Herr C.: Er hat an nichts teilgenommen, weil wir da schon im Kindergarten gehört haben, dass er oft einmal nicht gscheit im selben Raum ist, geschweige denn dabei. Und beim In-die-Schule-Gehen haben wir's wirklich auch sehr genau genommen und wir wollten zuerst integrieren und waren dann in diesem Sonderpädagogischen Zentrum, wo er dann in die Schule gegangen ist. Die Direktorin dort hat gemeint, dass wir's uns genau überlegen sollen. Dann haben wir gesagt, ja doch dieses Sonderpädagogische Zentrum. Dann hat sie eben gesagt, nur wenn Sie voll dahinter stehen und hat gesagt, was dafür und was dagegen spricht. Und wir haben dann gesagt, das ist eine Frau, die hat schon hunderte, tausende Kinder durch ihre Hände gehen gesehen und da gibt's sicher viele die so sind wie der Robert und da gibt's auch bestimmte Muster und sie muss es wissen und es hat auch gut gepasst.
Interviewer: OK.
Herr C.: Mit Integration, auch in den Schulen, das ist haglich, weil es gibt so viele Eltern, wo die Kinder nicht behindert sind, die schauen, dass sie ihre Kinder in die Integrationsklassen bringen unter dem Deckmäntelchen »Mein Kind soll behinderte Kinder kennen lernen«, weil sie in Wirklichkeit zumindest unbewusst wissen, dass es mit ihren Kindern zumindest vom Verhalten her auch irgendwas hat und da sind dann wenigstens zwei Lehrer und da hat das Kind dann zwei. Nur hat der Lehrer dann nicht die vier Behinderten und die zwanzig anderen sondern eigentlich 26 Behinderte.
((Bandwechsel))
Herr C.: Das hört sich dann auch oft auf mit der Pubertät in den Integrationsklassen, wo dann wirklich beinhart gespielt wird: du hast ja nur zwei Streifen auf der Hose und ich hab drei. Aus diesem Ansatz. Man hat ja gelernt mit Behinderten umzugehen in solchen Klassen über die Jahre, aber das ist dann noch der zusätzliche Aufhänger in der Pubertät, wo geschaut wird, wer hat das schönere Gewand und diese Gruppenbildung eben. Irgendwo hört sich die Integration auf aus dem, wie der Mensch ist. Kinder sind gnadenlos. Vielleicht funktioniert's unter der Stunde, aber in der Pause ist es dann aus. Es ist einfach ein Ausprobieren, wie könnten die Regeln in unserer Gruppe sein und da haben die Behinderten schlechtere Karten.
Interviewer: Und wie erfahren Sie von den Ferienangeboten? Wie hat das zum Beispiel bei den K. funktioniert?
((Frau C., die in der Zwischenzeit den Raum betreten hat, beteiligt sich in der Folge auch am Interview))
Frau C.: Ähm, ich glaub, das war von der Schule her. Es gibt in den Schulen meist so Sozialarbeiter, die mit den Schulen zusammenarbeiten und die geben interessierten Eltern, weil wir haben schon nachfragen müssen, Tipps, wie man das machen kann, was es für Angebote gibt. Und in der Schule haben wir jetzt auch was bekommen, so von wegen wollen Sie nicht da und da hin. Also das vom Roten Kreuz kriegen wir eigentlich über die Schule.
Herr C.: Und das ist nichts für uns, wissen wir mittlerweile. «...» Ich glaub, dass wir dann doch wieder der einzigen sind. Also nicht wir, sondern alle Eltern Mehrfachbehinderter und Geistigbehinderter, die dem ganzen den Feinschliff geben müssen. Da war so eine Gruppenaktion vom Magistrat vor einem Jahr und die ist ziemlich in die Hose gegangen und da haben wir ihn holen müssen. Und das war aber an dieser Schule angeschrieben als Ferienaktion am schwarzen Brett. Wie wir dann gesagt haben, was dort wirklich los ist, haben sie's dann rausgenommen.
Frau C.: Na, na. Wir haben's nimmer gekriegt. Die anderen haben's sehr wohl noch gekriegt.
Herr C.: Ja, aber diese Nachbesserungen sind dann sehr wohl noch Elternaufgabe.
Interviewer: Also dass man sehr wohl auch dahinter sein muss, oder mal schauen, ob das passt?
Herr C.: Weil ich gesagt hab, das Vertrauen muss da sein. Das muss man spüren beim ersten Gespräch. Da hat man dort einmal die handelnden Personen nicht wirklich gesehen. Das war, soweit ich mich erinnern kann, vom Magistrat ein großer Festsaal. War wirklich lieb aufgezogen. Und wenn ich mir denke, wenn ich ein Down-Syndrom-Kind hab, dann klappt das sicher.
Frau C.: Es war auch schwierig im Nachhinein dort irgendetwas zu erfahren. Wie sie nach Hause gekommen sind... Also zuerst einmal haben sie drei Postkarten geschickt, die hätt ich auch schreiben können. So genau das: sind gut angekommen, das Essen ist gut. So, dann einmal ist eine Postkarten gekommen, wo gestanden ist, Robert kommt immer mehr zu den anderen dazu. Da hab ich mir gedacht: na ja, sehr interessant. Und dann ist die dritte gekommen, wo drinnen gestanden ist: hol mich bitte da und da ab um die Uhrzeit. Und das haben wir auch gemacht und das war's auch mehr oder weniger. Die waren dort schon fix und fertig. Jetzt haben wir nicht weiter nachgefragt. Und ich hab dann angerufen und wollte Auskunft haben, wie das jetzt gelaufen ist, wie's dem Robert gegangen ist, weil es kam ja gar nichts außer den dreiPostkarten. Das hat mich sehr viel Überredungskunst gekostet, dass die überhaupt irgendwas gesagt haben, weil die gemeint haben, das ist intern. Ich bin zwar die Mutter, aber es geht mich nichts an. Dann haben sie mir dann doch den Akt ein bissi so vorgelesen und da ist schon gestanden, dass das scheinbar schon sehr, sehr, sehr schwierig gewesen ist. Es ist drinnen gestanden, dass man ihn füttern hat müssen, dass man ihn wickeln hat müssen. Das haben wir vorher alles gesagt. Und das er sehr schwer in der Gruppe zu integrieren war, dass es ihm quasi zu viel war in der Gruppe. Und da haben wir dann sehr große Bedenken gehabt und wollten ihn das nächste Mal gar nicht mehr mitschicken, Nur haben uns dann Lehrer und Horterzieher alle zugeredet, wir sollen's probieren. Wenn's nicht geht, werden wir's dann eh hören, aber man glaubt quasi schon, dass das gehen wird. Und da haben sie ihn dann am dritten Tag heimgeschickt. Also der H. hat ihn holen müssen. Ein Klo hat er ruiniert angeblich. Und ich hab dann einen geharnischten Brief geschrieben, weil da war ich wirklich sehr zornig. Ich hab dann einen Brief geschrieben, ob man glaubt... wieso man ein Kind, das seine Umwelt vorwiegend schleckend erkundet, solange alleine am Klo lässt, dass es es ruinieren kann, so quasi. Und außerdem hat er eine wirklich neue Zahnbürste, die haben wir daheim aus der Verpackung herausgenommen, mitgehabt und die war voller Bissspuren und hin und her die Borsten. Da hab ich ihnen geschrieben, ob sie geglaubt haben, dass er sich selber die Zähne putzen kann. Das war für uns dann erledigt. Wir haben ihn nie wieder mitgeschickt. Das Vertrauen war aus.
Herr C.: Wenn man Standardangebote, die billig sind und für jedermann erreichbar, ist es wahrscheinlich mit einem geistig nicht behinderten Kind einfacher, weil in unserem Bereich dann Kinder wie der Robert beinhart mit Heimkindern zusammenkommen. Und die haben kein Grundvertrauen, die haben nichts. Die sind furchtbar und können nichts dafür. Die haben, glaub ich, gehabt 80 Prozent Heimkinder, die hat keiner gern. Wo sich wahrscheinlich die Betreuer bemühen, die sie sonst haben. Dort waren dann andere Betreuer. Also die waren für die auch weg die Bezugspersonen. «...» Die meisten Menscherln waren das erste Mal mit von der Schule, fast alle. Da muss man eine vernünftigen Schlüssel haben.
Frau C.: Die waren einfach überfordert.
Herr C.: Dieses Zusammenprallen. Ein nicht behindertes Kind, wann kommt das mit einem Heimkind zusammen in einer freizeitmäßigen Aktion? Da prallen wirklich Welten aufeinander.
Interviewer: Die Kombination mit geistig behinderten Kindern funktioniert da nicht wirklich, oder?
Herr C.: Aber die Regeln sind die selben. Die sind die Raubritter.
Interviewer: Da geht's hart zu, denk ich mal, ja.
Herr C.: Wenn man dann nicht reden kann auch, die einen aber fertig machen, weil sie so ungestüm sind. «...» Das heißt das beschränkt sich wieder, weil die Aktion wär super gewesen. Wir haben dann im zweiten Jahr gesagt, wir fliegen fort. Wir brauchen nämlich zwei Wochen, die der Robert fort ist, um selber eine Woche fortfahren zu können. Das geht sich nicht aus. Meistens ist es mit Flug und so... Da hab ich zu meiner Frau gesagt: Schau ma noch. Ich bleib da. Flieg du mit deinen Verwandten fort. Und wirklich: Samstag ist er gefahren und am Montag in der Früh der Anruf, super. Wir haben ihn dann geholt. Da war mein Vater dann auch noch mit. Da bin ich Mittag weggefahren ins Salzkammergut 270 Kilometer. Den Robert ins Auto gesetzt und 270 Kilometer wieder zurück. Das hat sein müssen. Und dann die restliche Woche Urlaub jeden Tag Aktivitäten mit dem Robert. «...» Was wahrscheinlich auch ein Thema ist, wir können das... ((zu Frau C.)) Können wir das von anderen Leuten auch bestätigen mit geistig behinderten Kindern? ...dass sich die Freizeitbeschäftigung sich dann ein bissl so in die Richtung konzentrierter... dass dann eher nur mehr ein Elternteil gewisse Sachen macht. Arbeitsaufteilung. So wie's jetzt bei uns auch ist. Man braucht auch eine Zeit für sich alleine, eine Zeit für den Partner.
Interviewer: Das heißt, man muss diese Zeitressourcen ganz gut aufteilen?
Herr C.: Aber ich mach's ja selber auch gerne, diese kilometerlangen Wanderungen mit dem Robert.
Interviewer: Vom Zeitraum der Ferienangebote ist er eigentlich die ganzen Ferienzeit durch?
Herr C.: Für uns passt's jetzt, wobei jetzt dann in einer relativ absehbaren Zeit das Thema sein wird, jetzt einfach von Jahr zu Jahr zu schauen. Wenn er einmal arbeitet, hat er eh ausschließlich diese vier, fünf Wochen, wo wir sicher den Familienurlaub beibehalten werden. Aber wenn er dann einmal 30 Jahre ist... Und blöd wird's möglicherweise dort, wo er noch in der Schule ist, aber wo man sagt: Das geht nimmer und G. geht vielleicht nimmer. Bei G. haben wir den Vorteil, dass wir Wiener sind und das selber zahlen. Das ist nur ein Thema für die Niederösterreicher, weil die zahlen das dann ab einem gewissen Alter und damit machen sie es auch nicht mehr. Wir sind eh gewohnt, dass das kommt. Da kommen dann die Kinder von selber nicht mehr, weil der Selbstbehalt zu hoch ist. «...» Das Angebot ist natürlich viel weniger, weil nichts verlangt wird von den Kindern und weil halt weniger da ist. Weil die Behindertensparte gibt's da noch nicht so lang. «...» Jetzt sind wir auf dem Status und nächstes Jahr schauen wir weiter und über die vergangenen Jahre freuen wir uns. ((lacht))
Interviewer: Ja, wir haben's eh schon leicht angeschnitten: Wie schaut's mit der Finanzierung aus? G. zahlen Sie selber.
Herr C.: Es ist so. Dadurch, dass der Robert eher anstrengend ist durch seine Mehrfachbehinderung, haben wir ein relativ gutes Pflegegeld und das ist seins. Wir sind nicht solche, wo beim Pflegegeld einer daheim bleibt und nichts arbeitet, oder alle beide, oder jedes Mal ein neues Auto. Sondern das ist einfach seins. Wir wissen, was solche Dinge kosten. Die sind's ja wert.
Frau C.: Man kann aber sehr wohl ansuchen bei der Krankenkassa. Die gibt manchmal so einen Kur-Zuschuss. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Bei uns war es so, dass man das nur vier Mal oder so beantragen hat können. Das haben wir schon ausgereizt gehabt. Und das muss drei Wochen sein. Und beim Bundessozialamt kann man ansuchen und, ich glaub, beim Fonds Soziales Wien, oder das war ja damals noch was anderes. Bei der MA17 war das damals. Aber da darf man halt nicht zu viel verdienen. Ich arbeite Teilzeit und beide bei der Gemeinde - Großverdiener ((ironisch betont)). Aber wir verdienen für so was zu viel.
Herr C.: Immer können's die Eltern nicht sein. Das heißt, alles andere kostet nicht wenig und dazu wär's ja eigentlich da das Pflegegeld.
Interviewer: Das heißt, im Endeffekt wird's dann zum Großteil vom Pflegegeld gezahlt, finanziert?
Herr C.: Diese nicht von uns durchgeführten Freizeitaktivitäten, ja. Weil es ist ja eine Betreuung, wo man weiß, die ist gut und auf die kann man sich verlassen.
Interviewer: Und wie schaut's mit der Erreichbarkeit der Angebote aus? Zum Himmelhof gibt's ja einen Fahrtendienst.
Herr C.: Das andere, da bringen wir und holen wir ihn. Das ist halt so in G. .
Interviewer: OK. Ist das ein Problem oder funktioniert das ganz gut?
Herr C.: Nein, weil Autofahren geht ganz gut mit dem Robert und das kennt er schon und das ist so ein Ritual auch.
Interviewer: OK, so zum Abschluss. So wie es derzeit mit den Ferienangeboten ausschaut, sind Sie da zufrieden damit, oder würden Sie da gerne etwas ändern?
Herr C.: Also so wie's uns wir jetzt gerichtet haben, passt's.
Interviewer: Aber Sie haben es sich vorher richten müssen.
Herr C.: Ja, so schauen... «...»
Frau C.: Was sehr schwierig war, ist jemanden zu finden, der ein bissi Zeit mit ihm verbringt.
Interviewer: Warum war das so schwierig? Also kompetente Leute zu finden?
Frau C.: Überhaupt einmal zu sehen, wo kriegt man so was her. Zuerst einmal haben wir uns eingestehen müssen, dass es nicht schlecht wäre, wenn wir so etwas hätten und dann einmal das Vertrauen haben und...
Herr C.: Dann ist es oft noch so, dass es nur stundenweise ist, wo man dann praktisch auf Befehl an einem bestimmten Tag in der Woche für zwei Stunden fortgehen muss. Und der Robert hat noch mehr Bewegung gebraucht und ist größer geworden und das waren zum Teil wirklich so schwache Fräuleins. Es waren lauter Frauen, die haben meisten in so sozialen Berufen ihre Ausbildung gehabt oder haben's studiert. Und die haben das wirklich gut gemacht. Die haben das super gemacht und die haben ihn alle gerne gehabt und der Robert hat sie alle gerne gehabt. Die haben wirklich super daheim in der Wohnung mit ihm gearbeitet, gespielt, irgendwas. Und da war ma auch immer... Da war ma bei den Autisten und einmal dort und einmal dort und einmal dort. Das waren so fünf, sechs junge Frauen und dann vielleicht wieder einmal, wenn eine aufgehört hat, eine gesagt, ich weiß wen und so. Das ist aber eigentlich nie aus dem Ansatz gekommen, dass das jemand so von sich anbietet, sondern das war immer Gott-sei-Dank in der schulischen Ausbildung mit vorgeschrieben.
Interviewer: OK. Also es war eher zufällig, dass man die gefunden, getroffen hat?
Herr C.: Wie war das ursprünglich? Wir haben uns, glaub ich, bei den Autisten eingeschrieben und die haben dann gesagt, es gibt so was.
Frau C.: Die erste haben wir da vom Nachbarschaftszentrum gehabt. Ich glaub, das hab ich einmal in der Zeitung gelesen, dass es da jetzt was neues gibt, ein Nachbarschaftszentrum, das auf gegenseitige Hilfe aufgebaut ist. Und dort hab ich dann einmal angerufen.
Herr C.: Per Zufall. Nur muss man jetzt eins dazusagen. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist jetzt zehn Jahre her und das hat es damals alles noch nicht gegeben und wir sind sowieso Steinzeitmenschen, was das betrifft. Ich möchte jetzt alle die Möglichkeiten, die das Internet heutzutage bietet... das kann ich nicht verifizieren, wie viel in der Sache selber besser geworden ist, oder um wie viel es heutzutage leichter zu erfahren ist, weil es einfach dieses Internet gibt. Das ist sicher ein Medium, das wir nimmer mehr so nutzen, wollen, brauchen, müssen. Und man kann aber nicht sagen, alles was man heute im Internet findet, wird es vor zehn Jahren zum Teil noch gar nicht gegeben haben.
Frau C.: Es gibt heute sicher mehr, weil dieser Verein Lebensfreunde, wo die einmal da war, den gibt's jetzt auch schon...
Herr C.: Diese ganzen Magistrats-Webseiten, das ist alles wirklich strukturiert, aber ich kann nicht sagen wie gut das ist, oder was uns das helfen würde, wenn der Robert jetzt acht Jahre wäre und das erst irgendwo ein bissl beginnen würde.
Interviewer: OK. Also das heißt, es war nicht einfach, aber Sie haben sich's im Endeffekt dann gerichtet?
Herr C.: Ja.
Interviewer: Ja, dann danke ich einmal.
Herr C.: Bitte. ((lacht))
((Ende der Aufnahme))
Nikolaus MANN
20.9.1980 geboren in Wien.
1986 - 1990 Besuch der Volksschule Corneliusgasse.
1990 - 1998 Besuch des neusprachlichen Gymnasiums Amerlingstraße. Abschluss mit Matura.
Sep. 1998 - Feb. 1999/Feb. 2000 - Juli 2003 Beschäftigung als Rezeptzionist im Jugendwohnhaus Ober St. Veit (20 Wochenstunden).
Feb. 1999 - Feb. 2000 Zivildienst in der WG-Vogelsanggasse des ÖHTB (Österreichisches Hilfswerk für Taubblinde und hochgradig Hör- und Sehbehinderte).
Feb. 2000 - Sep. 2000 Medizinstudium (nach einem Semester abgebrochen).
Okt. 2000 - laufend Studium der Sonder- und Heilpädagogik an der Universität Wien
Aug. 2002 (2 Wochen) Feb. 2003 (1 Woche) Aug. 2003 (3 Wochen) Feb. 2004 (1 Woche) Aug. 2004 (3 Wochen) Feb. 2005 (1 Woche) Aug. 2005 (3 Wochen) Feb. 2006 (1 Woche) Aug. 2006 (3 Wochen) Tätigkeit als Betreuer bei einem Feriencamp für Kinder und Jugendliche mit geistigerund mehrfacher Behinderung der Wr. Kinderfreunde in Klaffer (OÖ).
Feb. 2003 - Mai 2003 Praktikum bei einem Computerkurs für Menschen mit Behinderung des Vereins "biv-integrativ".
Okt. 2003 - Jän. 2004/Okt 2004 - Dez. 2004 Leitung eines Computerkurses für Menschen mit Behinderung an der Volkshochschule
Sep. 2003 - Mai 2004/ Sep. 2004 - Feb. 2006 Anstellung als Assistenzdienst im Wohnverbund Bernsteinstraße des Vereins "Balance" (Sep. - Dez. 2003 10 Wochenst., Jän. - Mai 2004 20 Wochenst., Sep. 2004 - Feb. 2006 10 Wochenst.).
Juni 2003 Abschluss des ersten Studienabschnittes des Studiums der Sonder- und Heilpädagogik.
Juli 2004/Juli 2006 Tätigkeit als Betreuer beim Projekt "Himmelhof" der Wr. Kinderfreunde - Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung (45 Wochenstunden).
Feb. 2005 - Feb.2006 Einzelwohnungsbegleitung für die BewohnerInnen dreier an die WG Phönix der Wiener Caritas angeschlossenen Wohnungen (10 Wochenstunden).
März 2006 - Juni 2006 Mitarbeit an einer Studie zur Integration geistig behinderter Kinder des "Instituts für Kinderrechte und Elternbildung".
Sep. 2006 - laufend Anstellung als Betreuer in der WG Kondor der Wiener Caritas (30 Wochenstunden)
Okt. 2006 - laufend Organisation und Durchführung eines Jugendtreffs für Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen im Rahmen der Wr. Kinderfreunde.
Quelle:
Nikolaus Mann: Freizeit ohne Behinderung? Die Bewertung freizeitpädagogischer Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung durch deren Eltern
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät der Philosophie und Bildungswissenschaft, Wien
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 10.05.2010
