Intersektionale Perspektiven auf die sexualpädagogische Arbeit mit LSBT* mit Behinderung
Diplomarbeit. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Philosophische Fakultät III. Institut für Pädagogik/Institut für Rehabilitationspädagogik. Eingereicht von Susan Monat (aktueller Name der Verfasserin: Susan Rothe). Gutachter: Prof. Andreas Hinz
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die emanzipatorische Sexualpädagogik - theoretische Ausrichtung und Gegenstandsbereich
- 2 Behinderung als Strukturkategorie - Einführung in die Disability Studies
-
3 Geschlecht und Sexualität als Strukturkategorien - Einführung in die Queer Theory
- 3.1 "Doing Gender" - Geschlecht als Strukturkategorie
- 3.2 Sexualität als soziales Konstrukt - queere Perspektiven auf Zweigeschlechtlichkeit
- 3.3 Heteronormativität und die Unterwanderung der Zweigeschlechtlichkeit
- 3.4 Identitätskritik
- 3.5 Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung in der Queer Theory
- 4 "queering disability" - Potenziale in der Auseinandersetzung mit Geschlecht und Behinderung
-
5 Intersektionalität
- 5.1 Definition und Theoriegenese des Intersektionalitätskonzeptes
- 5.2 Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Intersektionalitätsansätze
- 5.3 Unterschiede in den Intersektionalitätsdebatten
- 5.4 Methodologie des Intersektionalitätskonzeptes
- 5.5 Intersektionale Kritik an den Queer Studies und den Disability Studies
-
6 "Intersektionales Mainstreaming" - Implementierung der intersektionalen Perspektive in die pädagogische Praxis
- 6.1 Gender Mainstreaming - Organisationsentwicklung zur Gleichstellung von Frauen und Männern
- 6.2 Gender Mainstreaming als "Stabilisierung von Marginalisierungsprozessen"? - Kritik am Konzept
- 6.3 Gender Mainstreaming und Sexualpädagogik
- 6.4 "Intersektionales Mainstreaming"
- 7 Intersektionales Mainstreaming in der sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung
- 8 Resümee
- Anhang
- Eidesstattliche Erklärung
- Literatur
- Internetquellen
"Wie heute gelebt, geliebt und gesext wird, ist - glaubt mensch dem Tenor von Familiensoziologie bis hin zur Sexualwissenschaft - in allen denk- und vorstellbaren Facetten möglich".[1] Das Zusammenleben in Beziehungen jenseits der heterosexuellen Norm scheint in der postmodernen Gesellschaft frei wählbar. Ebenso scheint das Recht auf selbstbestimmte Sexualität von behinderten Menschen wissenschaftlicher Konsens. Doch wie steht es um die Selbstverständlichkeit homosexueller Beziehungen von Menschen mit Behinderung? Ist die Beziehung zwischen einer transsexuellen behinderten Frau und einem nicht behinderten Mann genauso denkbar wie die Beziehung einer vermeintlich biologischen, behinderten Frau und einem nicht behinderten Mann?
Sprich: Ist die freie Wählbarkeit der Lebensweise und der sexuellen Orientierung tatsächlich auch für LSBT*[2] mit Behinderung möglich?
Schaut man sich die sexualpädagogische Theorie und die Praxis vergleichend an, werden schnell Unstimmigkeiten deutlich: Sexualität behinderter Menschen als Thema behindertenpädagogischer Arbeit erfreut sich steigender Popularität, immer mehr sonderpädagogische Institutionen nehmen sexualpädagogische Arbeit in ihre Konzeption auf und in der Ausbildung sonderpädagogischer Berufe ist die Sexualität behinderter Menschen in die Curricula integriert.[3] Dabei wird sich stets am Paradigma der Selbstbestimmung orientiert. Der vermeintlich selbstbestimmten Sexualität behinderter Menschen wird allerdings dadurch ein normativer Rahmen gesetzt, dass sie sich an der Heterosexualität orientiert. So sind die häufigsten Themen beispielsweise Sexualassistenz, Elternschaft von Menschen mit Behinderung oder Prävention von sexueller Gewalt.[4] Sexuelle Orientierungen jenseits der Heterosexualität werden nur peripher diskutiert. Explizit möchte ich das an einem Materialienband zur sexualpädagogischen Arbeit mit geistig behinderten Menschen verdeutlichen. Das Buch "Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen"[5] wurde herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe und erschien 2009 in der 5. Auflage. In diesem Buch werden im ersten Teil sexualpädagogische Grundlagen erläutert, sowie Didaktik und Methodik der Sexualpädagogik vorgestellt. Der praxisorientierte zweite Teil enthält eine Vielzahl an von Fachleuten praktisch erprobten Methoden zu 18 verschiedenen Themenschwerpunkten. Der Band schließt mit dem dritten Teil, in dem erfolgreiche sexualpädagogische Fortbildungsseminare vorgestellt werden. Zudem enthält das Buch eine Vielzahl an Literaturempfehlungen. Dieser Band, den ich auf den ersten Blick für sehr gelungen für die sexualpädagogische Arbeit mit geistig behinderten Menschen befunden habe - vor allem auf Grund seiner Fülle an Materialien - scheint mir auf den zweiten Blick für ebenso ungeeignet. Denn das komplette Buch ist auf die Beziehung zwischen Frauen und Männern ausgerichtet. Heterosexualität als Norm durchzieht den kompletten Band, ebenso wie die Tatsache, sich als Mann oder Frau positionieren zu müssen. So wird im Kapitel über die sexualpädagogischen Grundlagen Sexualität als "alle Aspekte des Mann- oder Frauseins"[6] definiert. Ein Blick auf die Themenschwerpunkte und die dazugehörigen Materialien macht meinen Vorwurf noch deutlicher: Im Schwerpunkt "Körper Mann/Frau außen"[7] geht es beispielsweise um das "Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts"[8]. Männer und Frauen sollen als sich äußerlich unterscheidende Geschlechter wahrgenommen werden. Dazu dient unter anderem eine Übung zur unterschiedlichen Kleidung von Frauen und Männern (siehe Anhang 1).[9] Das interessante an diesem Arbeitsblatt ist meiner Meinung nach, dass die möglichen Kleidungsstücke von ihrem Zuschnitt her immer nur einer Kleiderpuppe zugeordnet werden können. Das bedeutet, dass die Kleidungsstücke immer nur der männlichen Puppe oder der weiblichen Kleiderpuppe angezogen werden können und damit als "richtig" gelten. Hier finde ich es problematisch, dass durch den Zuschnitt der Puppen verhindert wird, dass bestimmte Kleidungsstücke dem "falschen" Geschlecht zugeordnet werden können. Ein Kleid passt nur an den Zuschnitt der weiblichen Kleiderpuppe ebenso wie der Anzug nur an die männliche Kleiderpuppe anzulegen geht. Mit dieser Übung werden meiner Meinung nach nicht nur zwei Geschlechter als einzig möglich vorgegeben, sondern auch Vorstellungen, wie diese sich geschlechtsspezifisch zu kleiden haben, produziert. Der Themenschwerpunkt "Ich als Mann"[10] beziehungsweise "Ich als Frau"[11] beinhalten zwar die Aspekte "Beziehungen zwischen Männern"[12] und "Beziehungen zwischen Frauen und Männern und zwischen Frauen"[13], allerdings bleibt das Thema Homosexualität in den methodischen Umsetzungsmöglichkeiten zu diesem Schwerpunkt unreflektiert. Als abschließendes Argument möchte ich die Grafiken des Materialienbandes anführen. Nicht nur inhaltlich ist das Buch auf die zwei Geschlechter Mann und Frau und deren Bezogenheit aufeinander gekennzeichnet, auch grafisch gelingt es dem Band nicht andere Lebensformen, außer der heterosexuellen Partnerschaft darzustellen. So geschieht dies zum Beispiel auf dem Arbeitsblatt "Freundschaftsanzeige"[14] oder den Bildergeschichten zu "Streit und Versöhnung"[15] und "Eifersucht"[16] (siehe Anhang 2-4).
Bei LSBT* zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Zwar gibt es sexualpädagogische Angebote zum Beispiel zur Outing-Beratung oder Aufklärungsprojekte zum Thema "sexuelle Orientierungen und Lebensweisen", allerdings bleibt hier der gesunde Körper (und Geist) als status quo meist unhinterfragt. So ist beispielsweise in den Büchern "Sexuelle Vielfalt lehren. Schulen ohne Homophobie"[17], ""Es ist normal verschieden zu sein!" Homosexualität als Thema der Sexualerziehung"[18] und "Homosexualität im Schulunterricht"[19] Behinderung kein Thema.
Auch ein Blick in Handbücher der Sexualpädagogik zeigt kein anderes Bild auf: Der Band "Sexualpädagogik lehren. Didaktische Grundlagen für die Aus- und Fortbildung"[20] von Vatl/Sielert, zeigt Sexualpädagogik bei behinderten Menschen als extra Handlungsfeld auf[21] und unterteilt dieses Handlungsfeld in verschiedene Schwerpunktthemen, wobei sexuelle Orientierungen keinen davon ausmacht.[22] Andersherum bleibt in den Kapiteln "Geschlechterpädagogik und Sexualerziehung"[23], "Lesbische und Schwule Lebensweisen"[24] und "Die (anderen) Gesichter der Sexualität"[25] Behinderung als Gegenstand unreflektiert.
Beide Personengruppen - sowohl Menschen mit Behinderung als auch LSBT* - finden zwar eine sexualpädagogische Verankerung, allerdings ohne sich in Beziehung zueinander zu setzen. Dies führt zu einer paradoxen Situation: So beschäftigen sich die Sexualpädagogik für behinderte Menschen ebenso wie die Sexualpädagogik für LSBT* mit gesellschaftlichen Minderheiten. Im Materialband der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. heißt es: "Sexualität ist so vielfältig wie die Menschen. Sie passt in keine Norm [...] Behinderte Sexualität kann und soll nicht "zurechtnormalisiert" werden. Ihre Unterdrückung, ihre Diskreditierung, ihre Behandlung mit dem Ziel der Unauffälligkeit muss aufhören."[26] Doch während die Sexualpädagogik auf der einen Seite bestrebt ist, Normen zu hinterfragen und Behinderung bzw. sexuelle Orientierung als diskriminierte Sexualitäten zu unterstützen, setzt sie auf der anderen Seite selbst normative Rahmen (bei Behinderung in Bezug auf Heterosexualität und bei LSBT* in Bezug auf den nicht-behinderten Körper) und produziert somit Ausschlüsse.
Aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive finde ich diesen Widerspruch auf zwei Ebenen sehr spannend: Auf theoretischer Ebene interessiert es mich, wie diese Situation zustande kommt. Das heißt, wie kommt es dazu, dass Sexualpädagogik sich bisher nur auf eine Kategorie - Sexuelle Orientierung oder Behinderung - bezieht. Zweitens: Inwiefern kann es sinnvoll sein, sich mit mehreren Diskriminierungskategorien auseinanderzusetzen?
Auf einer handlungspraktischen Ebene möchte ich herausfinden, wie mehrere Kategorien, vor allem mehrere Marginalitäten, in der sexualpädagogischen Arbeit Beachtung finden können und welche Konzepte sich eignen, auf multiple Diskriminierung sexualpädagogisch zu reagieren.
Meine Arbeit baut sich demnach wie folgt auf:
Im ersten Kapitel der Arbeit möchte ich die emanzipatorische Sexualpädagogik vorstellen, als die Disziplin, auf die sich meine Untersuchungen beziehen. Ich möchte darin den Anspruch dieser Wissenschaft darlegen und mögliche Gründe vorstellen, die meiner Meinung nach Ursache dafür sind, dass LSBT* mit Behinderung bisher als Klientel der sexualpädagogischen Arbeit vernachlässigt wurden.
Meine erste zentrale These lautet, dass sowohl Behinderung als auch sexuelle Orientierung und Geschlecht soziale Differenzkategorien bilden, die gesellschaftliche Ausschlüsse produzieren. Um dies zu begründen, werde ich im 2. und 3. Kapitel die Theoriegenese der Disability Studies nachvollziehen, die Behinderung als Strukturkategorie entlarven und anschließend Sexualität und Geschlecht als Strukturkategorien mittels der Queer Theory einführen.
In Kapitel 4 wird es darum gehen, aufzuzeigen, dass die Verhältnisse, Wechselwirkungen, Verstärkungen und auch Abschwächungen der verschiedenen Strukturkategorien sexuelle Orientierung, Geschlecht und Behinderung bisher zu wenig reflektiert wurden, sondern sich je nach Forschungsschwerpunkt auf eine Masterkategorie gestützt wurde. In Bezug auf mein Arbeitsthema Sexualpädagogik mit LSBT* mit Behinderung lautet mein zweites zentrales Argument, dass eine Analysekategorie aber nicht ausreicht, um verschiedene Arten von Diskriminierung zu erklären. Ich möchte aufzeigen, dass eine umfassende Analyse der Strukturkategorien Behinderung und Geschlecht/sexuelle Orientierung ohne den gegenseitigen Bezug aufeinander nicht möglich ist. Dazu werde ich aufzeigen, wo die Disability Studies und die Queer Theory Lücken in ihren Untersuchungen aufweisen, aber auch welche Anknüpfungspunkte beide Theorien für eine Analyse des Verhältnisses von Behinderung und Geschlecht/sexuelle Orientierung beinhalten.
An dieser Diskussion ansetzend, werde ich in Kapitel 5 das Konzept der Intersektionalität als neues Schlagwort in der Auseinandersetzung um Überschneidung mehrerer Diskriminierungskategorien und die Analyse von Herrschaftsverhältnissen vorstellen. Meiner Auffassung nach ist dieses Konzept aufgrund seiner konsequenten Fokussierung auf Mehrdimensionalität in der Lage auf das beschriebene Ausgangsdilemma zu reagieren.
An die theoretische Auseinandersetzung anknüpfend, werde ich die Übertragung der Ergebnisse auf die sexualpädagogische Praxis erörtern. Dazu werde ich in Kapitel 6 zunächst das Modell des "Intersektionalen Mainstreaming"[27] vorstellen, welches sich an dem praktischen Ansatz des "gender mainstreaming"[28] orientiert. Nachfolgend gebe ich einen Ausblick über den Nutzen und die mögliche Umsetzung des "Intersektionalen Mainstreaming"-Ansatzes in der sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung.
Aus einer wissenschafts-theoretischen Perspektive soll das Ziel meiner Arbeit sein, die Bedeutsamkeit der umfassenden Analyse verschiedener Wechselwirkungen innerhalb und zwischen den Kategorien sexuelle Orientierung, Geschlecht und Behinderung herauszustellen und die Wirksamkeit des Intersektionalitätskonzeptes für die Auseinandersetzung mit eben jenen Wechselwirkungen zu überprüfen.
Auf handlungspraktischer Ebene verfolge ich die Absicht, Möglichkeiten der konkreten sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung vorzustellen und Vorstellungen in Richtung einer intersektionalen Sexualpädagogik zu geben.
[1] Tuider,: 2008: 251
[2] Diese Bezeichnung wird als Abkürzung benutzt und setzt sich aus den Begriffen der verschiedenen sexuellen Orientierungen Lesbisch, Schwul, Bisexuell und den geschlechtlichen Positionierungen Transsexuell beziehungsweise Transgender zusammen. Es handelt sich hierbei um die deutsche Übersetzung des international gebräuchlichen Kürzel LGBT (lesbian, gay, bi- & trans*sexual) und fasst die häufigsten und bekanntesten Formen der Sexualität jenseits der Heterosexualität zusammen. Für die Untersuchungen in meiner Arbeit habe ich mich für dieses Kürzel entschieden. Ich bin mir darüber bewusst, dass es alternativ zu oben genannten weitaus mehr sexuelle Spielarten und Orientierungen gibt, die ebenfalls für den Zusammenhang meiner Fragestellung von Bedeutung wären. (Als Beispiele seien hier angeführt: Intersexualität, BDSM, Fetische, etc.) Die Verwendung des Kürzels LSBT* ist deshalb zum Einen eine pragmatische Entscheidung, da es im Rahmen dieser Arbeit schlichtweg unmöglich ist, jede Art der geschlechtlichen Lebensweise und sexuellen Orientierung zu benennen und in der Argumentation zu berücksichtigen. Zum Anderen soll mit der Verwendung des Kürzels der Lesefluss erleichtert werden, wobei ich ausdrücklich darauf verweisen möchte, dass das *-Symbol auf eben jene angesprochenen Zwischenräume verweisen und eine Offenheit für weitere Positionierungen einschließen soll. Deshalb möchte ich auch die/den Leser_in sensibilisieren, diese Vielfalt innerhalb des Korsetts LSBT* stets mitzudenken.
[3] Vgl.: Walter: 2008: 11
[4] vgl.: Specht: 2008: 295
[5] Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009
[6] ebd.: 10
[7] vgl.: ebd.: 35
[8] ebd:
[9] vgl.: ebd.: 40f ; eine Kopie der Arbeitsmaterialien befindet sich im Anhang
[10] vgl.: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 65
[11] vgl.: ebd.: 69
[12] vgl.: ebd.: 65
[13] vgl.: ebd.: 69
[14] vgl.: ebd.: 72f; Kopie befindet sich im Anhang
[15] vgl.: ebd.: 89; Kopie befindet sich im Anhang
[16] vgl.: ebd.: 91; Kopie befindet sich im Anhang
[17] vgl.: Dijk/Driel: 2008
[18] vgl.: Heitmüller: 1992
[19] vgl.: Anglowski: 2000
[20] vgl.: Sielert/Vatl: 2000
[21] vgl.: ebd.: 46f
[22] vgl.: ebd.
[23] vgl.: Sielert/Vatl: 2000: 387fff
[24] vgl.: ebd.: 417fff
[25] vgl.: ebd.: 451fff
[26] vgl.: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009:7
[27] vgl.:Scambor/Busche:2009:http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=14&Itemid=89
[28] vgl.: Doblhofer/Küng: 2008; Meuser/Neusüß: 2004
Inhaltsverzeichnis
Den ersten Abschnitt möchte ich dafür nutzen Sexualpädagogik als Disziplin vorzustellen, mit ihren Handlungsfeldern, ihrer theoretischen Ausrichtung und ihrem Verständnis von Sexualität. Damit möchte ich zum Einen das Praxisfeld konkretisieren, auf das sich meine Aufmerksamkeit für diese Arbeit richtet. Zum Anderen soll damit ein Widerspruch aufgezeigt werden zwischen dem theoretischen Anspruch heutiger emanzipatorischer Sexualpädagogik und der praktischen Realität, aus der sich mein weiteres Vorgehen ableiten wird.
Die erste Assoziation zum Thema Sexualpädagogik dürfte wohl die des berühmten "Aufklärungsgespräches" sein. Für einen Großteil der Bevölkerung ist dies die einzige Aufgabe, die der Sexualpädagogik zugeschrieben wird - eben jene Sexualaufklärung. Allerdings hat die Sexualpädagogik als eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaft ein weit umfassenderes Selbstverständnis. FRIEDRICH KOCH beschreibt sie 2008 als " die theoretischen Voraussetzungen für gezielte Maßnahmen im Bereich der Praxis, der Sexualerziehung"[29] und weiter als die "intensionalen Unterweisunge[n], mit klar definierten Zielen, unter Berücksichtigung der erzieherischen Voraussetzungen, der methodischen Schritte und der medialen Möglichkeiten"[30]. In diesem Zitat kommt bereits zum Ausdruck, wie komplex diese Disziplin tatsächlich ist.
UWE SIELERT liefert 2005 eine ausdifferenzierte Beschreibung der einzelnen Aspekte sexualpädagogischer Arbeit. Dabei beschreibt er Sexualpädagogik als Oberbegriff für die Disziplin, die "sowohl die sexuelle Sozialisation als auch die intentionale erzieherische Einflussnahme auf die Sexualität von Menschen erforscht und wissenschaftlich reflektiert."[31]Sexualerziehung als praktischer Anwendungsbereich der Sexualpädagogik "meint die kontinuierliche, intendierte Einflussnahme auf die Entwicklung sexueller Motivationen, Ausdrucks- und Verhaltensformen sowie Einstellungs- und Sinnaspekten der Sexualität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen."[32] Die eingangs erwähnte Sexualaufklärung bietet einen Aspekt dieser praktischen Ausübung und bezeichnet "in der Regel die Information über Fakten und Zusammenhänge zu allen Themen menschlicher Sexualität [...] meist als einmaliges Geschehen, mehr oder weniger an Zielgruppen orientiert"[33]. Während es sich bei der Sexualerziehung um "intentional gelenkte Lernprozesse"[34] handelt, kann die sexuelle Sozialisation (oder auch "Sexualisation") "auch unabhängig von Sexualerziehung stattfinde[n], so z.B. durch unbedachte alltägliche Selbstverständlichkeiten, mediale Einflüsse und positiv oder negativ empfundene Irritationen der sexuellen Identität im Laufe der persönlichen Entwicklung."[35]
Je nach aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Tatsachen, können unterschiedliche Strömungen der Sexualpädagogik unterschieden werden.[36] Aktuell stellt die emanzipatorische Ausrichtung das Selbstverständnis der Sexualpädagogik dar, eingeführt durch HELMUT KENTLER[37]. Mit Bezug zur kritisch-reflexiven Erziehungswissenschaft steht die emanzipatorische Sexualpädagogik in der Tradition der Aufklärung. Ihr Interesse liegt in der "wachsende[n] Mündigkeit des Subjekts und der dazu notwendigen Befreiung aus inneren - biografischen - und äußeren - gesellschaftlichen - Zwängen"[38]. Als Richtziel steht die Selbstbestimmung im Zentrum. Dabei gilt folgende Auffassung von Selbstbestimmung:
"Das emanzipatorische Interesse ist das Interesse des Menschen an der Erweiterung und Erhaltung der Verfügung über sich selbst. Es zielt auf die Aufhebung und Abwehr irrationaler Herrschaft, auf die Befreiung von Zwängen aller Art. Zwingend wirkt nicht nur materielle Gewalt, sondern auch die Befangenheit in Vorurteilen und Ideologien."[39]
Die emanzipatorische Sexualpädagogik versteht sich als eine Art Hilfestellung, die konkrete Erziehungsziele an[gibt], ohne dadurch auf ein bestimmtes Verhalten festzulegen"[40]. Vielmehr geht es darum, Kompetenzen zu schulen, die einer Selbstbestimmung des Menschen förderlich sein sollen. Dazu zählt nach SIELERT/VATL zum Beispiel:
"Kennen der eigenen Bedürfnisse und partnerschaftsrelevanten Verhaltensmuster, Einfühlungsvermögen, Sich-Mitteilen- und Streiten-Können, die Folgen des eigenen Handelns für sich und andere abschätzen können, ideologisch und ökonomisch motivierte Versuche zur Manipulation des sexuellen Verhaltens als solche erkennen können u.v.m."[41]
Neben der Befähigung des Menschen zur Autonomie und der Ablehnung jeglicher Bevormundung, geht es der emanzipatorischen Sexualpädagogik ebenfalls um die realistische Einschätzung von Sexualität. Das heißt, dass sie neben der positiven Einstellung gegenüber Sexualität versucht über tatsächliche Gefahren und negative Seiten der Sexualität aufzuklären (sexualisierte Gewalt, Pornografie, sexuell übertragbare Krankheiten, etc.), aber auch ihre Banalität und Alltäglichkeit zu verdeutlichen - so wird Sexualität in modernen Gesellschaften längst nicht mehr als die einzige Quelle des Glücks überhöht.[42]
Da sich Sexualpädagogik nicht nur im Kontext der gesellschaftlichen, sondern auch der herrschenden und politischen Verhältnisse sieht, versteht sie sich gleichzeitig auch als politisches Projekt: "Emanzipatorische Sexualpädagogik bezieht Position gegen jede Form von Diskriminierung von Minderheiten, sie tritt ein für die Gleichberechtigung von Homo- und Heterosexuellen sowie von Frauen und Männern, sie ergreift Partei gegen individuelle und strukturelle patriarchale Gewalt [...]. Emanzipatorische Sexualpädagogik hält darüber hinaus eine kritische Distanz zu staatlichen Programmen für sexuelle Erziehung [...], da Sexualpädagogik in der Vergangenheit zu oft als Instrument sozialer Kontrolle missbraucht worden ist und ihre Aufgaben zu oft von den Herrschenden gestellt wurden."[43]
Damit ist denke ich deutlich geworden, dass die Sexualpädagogik weit über die bekannte Sexualaufklärung hinaus geht. UWE SIELERT führt dies noch einmal treffend aus, wenn er schreibt:
"Menschliche Sexualität ist mehr als Genitalität, beschränkt sich also nicht auf Körperfunktionen und das Fortpflanzungsgeschehen, sondern umfasst als wesentliches "Querschnittsthema" der Persönlichkeit sowohl Fruchtbarkeits- als auch Lust-, Identitäts- und Beziehungsaspekte. Sexualerziehung und Sexualpädagogik beschränken sich entsprechend auch nicht auf Fortpflanzungs- und Körperfunktionen, sondern enthalten [...] Unterthemen, die je nach gesellschaftlicher Entwicklung in unterschiedlichem Maße bedeutsam werden."[44]
Dementsprechend fällt unter Sexualpädagogik ein weites Spektrum an Themengebieten, die SIELERT folgendermaßen einteilt:
-
Körper- und Sexualaufklärung
-
Ethik, Moral und Wertorientierung/Persönlichkeitslernen
-
Sprechen über Sexuelles
-
Geschlechterverhältnis
-
Sexuelle Orientierungen
-
Sexualität im Spannungsfeld der Kulturen
-
Sexualität und Behinderung
-
Sexualität im Alter
-
Sexualität und Gewalt
-
Sensibilisierung der Sinne und Sinnlichkeit[45]
Diese Fülle an Themenfeldern dürfte klar aufzeigen, dass Sexualpädagogik als eine Querschnittsaufgabe angesehen werden muss. Sie ist "als eine spezielle Erziehungswissenschaft anzusehen, die nicht einer einzelnen Institution (wie beispielsweise Schulpädagogik), sondern grundsätzlich mehreren Erziehungsinstitutionen zuzuordnen ist."[46] Sie gehört damit zu den ""nicht-institutionalisierten Pädagogiken""[47], die verschiedene Institutionen und Disziplinen übergreifend verantwortlich werden lässt, wie zum Beispiel "Vorschul-, Sonder-, Sozial-, Schul-, Medienpädagogik und Erwachsenenbildung"[48].
Nachdem die Aufgaben und Themengebiete der Sexualpädagogik und ihre Bedeutung in der Gegenwart ausgeführt wurden, bleibt ein Sachverhalt seine Definition schuldig - und zwar der Gegenstand der Sexualpädagogik: Sexualität. Kaum ein anderer Teil menschlichen Zusammenlebens wird so stark diskutiert, mystifiziert, und ideologisiert, wie die menschliche Sexualität. Sexualität ist widersprüchlich und irrational und wird zum Teil nur oberflächlich beleuchtet. Wie schwierig es deshalb ist, Sexualität als Gegenstand zu definieren, zeigen beispielhaft die folgenden Definitionen:
Sexualität ist demnach das,
Oder
"Sexualität (Geschlechtlichkeit): beim Menschen Gesamtheit der Lebensäußerungen, die auf dem Geschlechtstrieb, einem auf geschlechtl. Beziehung und Befriedigung gezielten Trieb beruhen"[51]
Eine Definition, die versucht die unterschiedlichsten Phänomene der Sexualität zusammenzufassen, kommt von dem Sexualtherapeuten OFFIT:
""Sexualität ist, was wir daraus machen. Eine teure oder eine billige Ware, Mittel zur Fortpflanzung, Abwehr gegen Einsamkeit, eine Form der Kommunikation, ein Werkzeug der Aggression (der Herrschaft, der Macht, der Strafe und der Unterdrückung), ein kurzweiliger Zeitvertreib, Liebe , Luxus, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse oder das Gute, Luxus oder Entspannung, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, eine Form von Zärtlichkeit, eine Art der Regression, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, Vergnügen, Vereinigung mit dem Universum, mystische Ekstase, Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Form, Neugier oder Forschungsdrang zu befriedigen, eine Technik, eine biologische Funktion, Ausdruck psychischer Gesundheit oder Krankheit oder einfach eine sinnliche Erfahrung""[52]
Die bisher systematischste Definition für die sexualpädagogische Arbeit lieferte schließlich SIELERT 2005. Er versteht Sexualität
-
"als allgemeine, auf Lust bezogene Lebensenergie,
-
die sich des Körpers bedient,
-
aus vielfältigen Quellen gespeist wird,
-
ganz unterschiedliche Ausdrucksformen kennt und
-
in verschiedener Hinsicht sinnvoll ist."[53]
Diese verschiedenen Definitionen zeigen auf, wie komplex und vielschichtig das Thema Sexualität tatsächlich ist. Auf diese Komplexität werde ich im Laufe der Arbeit immer wieder zurück kommen. Besonderes Augenmerk möchte ich allerdings darauf legen, Sexualität als eine Disposition vorzustellen, die entlang bestimmter Kategorien gesellschaftliches Zusammenleben strukturiert und durch Normierungen Ein- und Ausschlüsse aus dem gesellschaftlichen Leben produziert. Dies werde ich in Kapitel 3 genauer ausführen.
Ich denke nach den bisherigen Ausführungen ist bereits deutlich geworden, dass eine Diskrepanz vorliegt, zwischen dem sexualpädagogisch emanzipatorischen Anspruch, jegliche Diskriminierung zu bekämpfen und die individuellen sexuelle Identität zu fördern einerseits und der realen sexualpädagogischen Praxis - wie ich sie anhand der sexualpädagogischen Fachliteratur beschrieben habe - andererseits. Doch woran liegt diese Ignoranz gegenüber der Kopplung sexualpädagogischer Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung jenseits der heterosexuellen Norm? Ich möchte einige Gründe aufzählen, die meiner Meinung nach Ursache dafür sein könnten, dass spezielle Interessen bestimmter Personengruppen bisher in der sexualpädagogischen Arbeit nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Daraus werde ich schließlich das weitere Vorgehen meiner Arbeit ableiten.
-
LSBT* mit Behinderung waren bisher als Klientel der sexualpädagogischen Arbeit nicht bekannt
Ein möglicher Faktor für die bisher unzureichende Bearbeitung der Interessen behinderter Menschen jenseits der heterosexuellen Norm könnte tatsächlich sein, dass es sich bei diesen Personen um so eine kleine Gruppe handelt, dass sie als potenzielles Klientel nicht in Frage kommen. Diesen Punkt kann ich allerdings gleich redigieren. Das Thema "Homosexualität und Behinderung" ist kein neues in der Sonderpädagogik, auch wenn es immer noch zum Teil sehr zaghaft behandelt wird.[54] Dass auch Trans- und Bisexualität im Leben behinderter Menschen eine Rolle spielen, wurde 2010 deutlich während der Fachtagung "Inklusive Leidenschaft - Lesbische, schwule, transgeschlechtliche Menschen mit Behinderung"[55] in Berlin. Inhalt dieser Veranstaltung war es darüber zu diskutieren, "was notwendig ist, damit sexuelle Selbstbestimmung in den Behindertenszenen und - einrichtungen Wirklichkeit wird. Außerdem ging es darum, dass Menschen mit Behinderungen in den LSBT*-Szenen willkommen sind und barrierefreie Zugänge finden."[56] Als ein weiteres Argument sei an dieser Stelle auf die vielfältige Vernetzung von LSBT* mit Behinderung über Internetforen verwiesen[57]. Zudem hat das "LesBiSchwule Jugendnetzwerk Lambda" Jugendliche mit Behinderung als Adressat_innen erkannt und bietet vielfältige Projekte für lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche mit Behinderung an[58]. Meines Erachtens ist Lambda e.V. leider derzeit der einzige Anbieter solcher Projekte. Ich denke, dass die Schwierigkeit hier nicht in der Unwissenheit um das Klientel besteht, sondern eher in der Unklarheit der Zuständigkeiten. In Punkt 1.1 habe ich aufgezeigt, dass Sexualpädagogik eine Querschnittsdisziplin darstellt. Daraus kann sich natürlich das Problem ergeben, dass verschiedene Institutionen sich nur für bestimmte Aufgaben zuständig sehen. So beschäftigt sich beispielsweise die Sonderpädagogik mit der Sexualität behinderter Menschen, während sexuelle Orientierung im Feld der Sozialpädagogik bearbeitet wird.
-
Sexualität als intimes, persönliches und gleichzeitig normiertes [59] Thema
Die Ausführungen zur emanzipatorisches Sexualpädagogik haben gezeigt, dass es sich bei Sexualität um ein sehr individuelles und intimes Thema handelt. Dennoch ist es nicht vollends möglich, eine Individualität in allen Bereichen auszuleben. Auch wenn es in der modernen Gesellschaft zu einer Pluralisierung von Lebensstilen und Lebensformen gekommen ist und unterschiedlichste "Neosexualitäten"[60] im Alltag zu beobachten sind, geht die Dynamisierung der Lebensstile dennoch einher mit der "Normierung entlang der altbekannten Differenzen"[61]. Dies bedeutet, dass es eine wirkliche Wahlfreiheit nur in bestimmten Bereichen gibt. Die sexuelle Orientierung betreffend kann eine Person sich für Hetero-, Homo- oder Bisexualität entscheiden (ungeachtet der Vorurteile mit denen die eine oder andere Orientierung belegt ist). Die geschlechtliche Positionierung schreibt allerdings eine klare Zuordnung zu Mann oder Frau vor (vorauf ich in Kapitel 3 ausführlicher eingehen werde). So ist es in Deutschland nicht möglich, sein Geschlecht frei zu wählen oder sich geschlechtsneutral zu positionieren.[62] Kontrolliert wird dies durch juristische und gesellschaftliche Normen.[63] So entsteht ein "eigentümliche[s] Spannungsverhältnis aus Pluralisierung und Norm(alis)ierung"[64], welches zwar Vielfalt postuliert, aber dennoch bestimmte Lebensformen unterdrückt. Nach LAUTMANN funktioniert diese Regulierung der Sexualität entlang der Ebenen "Typik, Normalität und Normativität"[65]. Typisiert werden einzelne sexuelle Begehrensarten, "indem sie einen Namen bekommen, mit Erzählungen versehen und bewertet werden". Normalisiert wird sexuelles Verhalten, wenn es "für die Situation und die daran Beteiligten als selbstverständlich durchgeht."[66]Normierung sexueller Verhaltensweisen bedeutet schließlich, dass "dem Handelnden der Charakter des Erlaubten, Geforderten bzw. Verbotenen"[67] hinzugefügt wird.
Auch wenn sich die emanzipatorische Sexualpädagogik gegen jede Art von Entmündigung und Ideologie richtet, sollte sie meiner Meinung nach als kritische Wissenschaft hinterfragen, in wieweit sie selbst an dieser Normierung beteiligt ist.
-
Abweichung schafft Verunsicherung
Für das schlagkräftigste Argument halte ich die Tatsache, dass es sich bei der Sexualpädagogik mit LSBT* mit Behinderung um ein Thema handelt, dass enorme Verunsicherung hervorruft. Wie ich im weiteren Verlauf der Arbeit darstellen werde, handelt es sich bei Behinderung und bei Geschlecht beziehungsweise sexueller Orientierung um Kategorien, die entlang bestimmter Normen definiert werden. Wie sich zeigen wird, gilt Behinderung als Abweichung von der gesunden Körpernorm und LSBT* steht für ein abweichendes Sexualverhalten, weil es nicht der Heterosexuellen Norm entspricht. Dieses Leben jenseits der Norm verursacht Verunsicherung. Normen und klare Regeln schaffen Sicherheit im Zusammenleben von Menschen. Uneindeutigkeit dagegen verunsichert und verängstigt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass viele Menschen sich nicht an das Thema Behinderung und LSBT* heran wagen, da sie mit starken Vorurteilen belegt sind. Für viele Menschen ist der Umgang mit Menschen mit Behinderung nach wie vor schwierig, speziell bei sogenannter "geistiger Behinderung". LANGNER konstatiert: "Durch den bestehenden defizitären Blick auf "geistige Behinderung" entwickelt sich [....] eine Hilflosigkeit im Umgang mit einem menschlichen Grundbedürfnis - der Sexualität."[68] Bei sexueller Orientierung und geschlechtlicher Positionierung verhält es sich nicht anders: Auch wenn die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare durch das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 2006 scheinbar formal erreicht ist, sieht die Realität anders aus. So ist beispielsweise Homosexualität nach neuem Report zur Jugendsexualität 2010 der BZgA kaum Thema im Schulunterricht[69]. Bisexualität als selbstbestimmte Form der sexuellen Orientierung wird ebenfalls oft diskreditiert. So wird sie oft mit Promiskuität gleichgesetzt oder aber als eine rehabilitierungsbedürftige Sexualität von Menschen angesehen, die sich quasi nicht "für eine Seite" (Hetero- oder Homosexualität) entscheiden können.[70] Viele andere sexuelle Lebensweisen und geschlechtliche Positionierungen (beispielsweise BDSM, Drag Kings oder Queens, Butches and Femmes, Fetische, etc.) werden als krank oder pervers abgestempelt[71]. Da LSBT* und Menschen mit Behinderung starken Vorurteilen ausgesetzt sind, scheint eine Kopplung beider Kategorien eine Potenzierung der Vorurteile und der damit verbundenen Ängste zu produzieren. Die Angst, mit diesen Gruppen in Verbindung gebracht zu werden und dadurch selbst diskriminiert zu werden, scheint da nicht fern zu liegen. Deshalb erscheint es erforderlich sich selbst zu schützen vor Angst und Irritation. Ein gutes Beispiel dafür bietet eine heute sehr typische Situation auf Schulhöfen, wie sie HÖFS in einem Aufsatz über "Kritische Männerforschung und Behinderung"[72] beschreibt. Eine der häufig beobachtbaren Provokation unter Schüler_innen ist die Frage "Bist du schwul?" oder "Bist du behindert?". Beide Fragen scheinen nach HÖFS beinahe austauschbare Diskreditierungen zu sein für ein abweichendes Verhalten[73] und liefern als provokativer Angriff der Person gegenüber gleichzeitig eine eigene Abgrenzung gegenüber dieser Normabweichung.
Zu den bisherigen Diskussionen möchte ich die folgenden Ergebnisse festhalten:
-
Die emanzipatorische Sexualpädagogik hat den Anspruch Diskriminierung zu beseitigen, und vielfältige sexuelle und geschlechtliche Identitäten zu fördern. Diesem Anspruch kann sie aktuell allerdings nicht gerecht werden, wie die Betrachtung aktueller Methoden- und Handbücher der Sexualpädagogik aufgezeigt hat.
-
LSBT* mit Behinderung werden aus dem sexualpädagogischen Diskurs bisher ausgeschlossen, wofür mehrere Gründe sprechen können, wie vielfältige Vorurteile, Normierungen, die Angst vor Unbekanntem oder unklare Zuständigkeiten.
-
Ich gehe davon aus, dass sich die genannten Gründe auf die gleiche Ursache zurückführen lassen: LSBT* mit Behinderung bilden eine Gruppe von Menschen, mit der sich bisher unzureichend auseinandergesetzt wurde, wie die Tagung "Inklusive Leidenschaft" 2010 verdeutlichen wollte. Vorurteile, Unsicherheiten und Ängste entstehen durch Unwissen. Zwar ist innerhalb der Sexualpädagogik evident, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden. Meiner Meinung nach hat es die sexualpädagogisches Theorie jedoch bisher verpasst ihren Gegenstandsbereich - nämlich Sexualität - auf ihre Bezugskategorien - im Fall meiner Untersuchung der Kategorien Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung - zu untersuchen, diese in Verbindung zu bringen und die Auswirkung ihrer Koppelung zu analysieren.
-
Ich gehe weiterhin davon aus - und es ist meine Absicht dies in den nachfolgenden Kapiteln zu beweisen - dass sexuelle Orientierung, Behinderung und Geschlecht Kategorien sind, die Ausschlüsse aus dem gesellschaftlichen Leben - und damit auch die Verweigerung eines selbstbestimmten sexuellen Verhaltens - entlang von vielfältigen Normen produzieren. Weiterhin bin ich davon überzeugt, dass die Betrachtung dieser verschiedenen Kategorien nicht nur sinnvoll ist, um die Auswirkungen multipler Diskriminierungserfahrungen auf eine Personengruppe zu untersuchen (wie in meinem Beispiel LSBT* mit Behinderung). Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass eine Analyse der Verbindung verschiedener Kategorien notwendig ist, um überhaupt erst die Wirkungsweisen jeder einzelnen Kategorie richtig verstehen zu können.
Sprich: ich möchte zeigen, dass die Kategorie Behinderung ohne Geschlecht und sexuelle Orientierung gar nicht denkbar ist, genauso wie sexuelle Orientierung und Geschlecht nicht ohne Behinderung komplett verstanden werden können. Daraus resultiert, dass auch die Sexualpädagogik als Disziplin sich nicht nur auf einen Handlungsschwerpunkt allein beziehen darf, beziehungsweise ihr Verständnis von Sexualität erweitern muss um Diskriminierungsprozesse verstehen und gegen diese handeln zu können. Die nächsten zwei Kapitel werde ich daher dazu nutzen, zunächst Behinderung als Strukturkategorie einzuführen - mittels der Disability Studies - und anschließend das Gleiche für die Kategorien Geschlecht und sexuelle Orientierung anhand der Queer Theory zu verdeutlichen.
[29] Koch: 2008: 23, Hervorhebung im Original
[30] vgl.: Koch: 2008: 23
[31] Sielert: 2005: 15
[32] Sielert: 2005: 15
[33] ebd.
[34] ebd.
[35] ebd.
[36] Zu einer Einführung in die Geschichte und Entwicklung der Sexualpädagogik siehe Koch: 2008; Kluge: 1984
[37] Kentler: 1970
[38] Sielert: 2005:24
[39] Lempert: 1971: 164, zit. n.: Sielert/Vatl: 2000: 31
[40] Sielert/Vatl: 2000: 31
[41] ebd.
[42] vgl.: Sielert/Vatl: 2000: 37f
[43] Sielert/Vatl: 2000: 33f
[44] Sielert: 2005:26
[45] vgl.: Sielert: 2005: 26ff
[46] Kluge: 1984: 19
[47] Paschen: 1981: 32, zit. n. Kluge: 1984:19
[48] Sielert: 2005: 23
[49] Kentler im Taschenlexikon Sexualität 1982, zit. n. Zimmermanns: 1999: 18
[50] Fricker/Lerch, zit. n. Zimmermanns 1999: 18
[51] Meyers großes Taschenlexikon von 1983, zit. n. Zimmermanns: 1999: 16
[52] Offit: 1979: 16, zit.n.: Sielert: 2005: 37
[53] Sielert: 2005: 41
[54] Jeltsch-Schudel: 2010:50
[55] Die Veranstaltung der Landesstelle für Gleichbehandlung-gegen Diskriminierung fand statt am 21./22.09.2010 in der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin mit 200 Teilnehmer_innen
[56] http://www.inklusive-leidenschaft.de / (Zugriff 19.07.2011)
[57] Ein Überblick findet sich auf der Seite des bundesweiten Netzwerkes für LSBT mit Behinderung http://www.queerhandicap.de
[59] Die Begriffe der Norm und der Normalität sind schwierig, weil sie je nach Kontext unterschiedlich gebraucht werden und unterschiedliche Bedeutungen in sich tragen. In dieser Arbeit soll keine Abhandlung zu diesen Begriffen erfolgen. Ich gehe in dieser Arbeit - mit Ausnahme von Zitaten und Kontextbezügen - von einem Normverständnis aus, dass das gesellschaftlich "Unhinterfragte" impliziert und bestimmte Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften als richtig und erwünscht einschätzt. Normalität hingegen verwende ich als Verweis auf Verhaltensweisen und Eigenschaften, die eine statistische Häufigkeit abbilden und von der Mehrzahl der Menschen als "selbstverständlich" aufgefasst werden. Zur Vertiefung des Normalitätsbegriffes siehe Link: 1997; in Bezug auf Normalität und Behinderung insb.: Schildmann: 2001.
[60] Dieser Begriff wurde eingeführt durch den Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch und bezeichnet "eine sich neu etablierende Sexual-, Intim- oder Geschlechtsform, die sich den alten Ängsten, Vorurteilen und Theorien entzieht. [...] die neosexuelle Revolution [eröffnet] neue Freiräume und installiert zugleich neue Zwänge." (Sigusch: 2005:7)
[61] Tuider: 2008: 253
[62] Tuider
[63] vgl.: Lautmann: 2008: 210
[64] Hartmann: 1998: 33
[65] Lautmann: 2008: 209
[66] ebd.
[67] ebd.
[68] Langner: 2010: 154
[69] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 2010: 42f
[70] vgl.: Fritzsche: 2007: 119ff
[71] Vgl.: die Klassifikation von Fetisch, BDSM und Transvestitismus als Störungen der Geschlechtsidentität beziehungsweise der Sexualpräferenz in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 (Dillinger: 2011: 45)
[72] Höfs: 2007
[73] Höfs: 2007: 89
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Kapitel versuche ich einen kurzen Überblick zur Theoriegenese der Disability Studies zu geben und damit Behinderung als Strukturkategorie einzuführen. Danach werde ich die Übertragung in die deutsche Diskussion um Behinderung nachvollziehen und mit dem aktuellen Stand der Debatte zu Geschlecht und Behinderung in der deutschen Sonderpädagogik abschließen.
Behinderung galt bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein vor allem als Gegenstand der sogenannten angewandten Wissenschaften, wie der Medizin, Psychologie oder Pädagogik. Dabei wurde die körperliche, geistige oder psychische Einschränkung und sozialen Ausgrenzung aneinander gekoppelt gedacht. Das heißt, dass eine Schädigung automatisch als ein individuelles, der Person anhaftendes Problem betrachtet wurde. In diesem medizinischen Modell von Behinderung dominierte der "klinische Blick"[74], der die Heilung, Rehabilitation oder Überwindung dieser "Andersartigkeit" der Person fokussierte. Anfang der 1980er Jahre kam es zu einer Verschiebung dieser Sicht auf Behinderung, die wesentlich durch Behindertenbewegung Großbritanniens initiiert wurde. Die Union oft the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) veröffentlichte 1976 die Fundamental Principles of Disability, in denen sie eine klare Trennung der bisher einheitlich gedachten Komponenten impairment (Schädigung) und disability (Behinderung) postulierten.[75] Nach Ansicht der UPIAS ist es keineswegs die (körperliche) Schädigung, die als natürliche Konsequenz die Behinderung einer Person nach sich zieht und somit die Behinderung zu einem natürlichen untrennbaren Bestandteil der Person macht. Im Gegenteil ist die Behinderung ein Phänomen, das durch die Gesellschaft erst erzeugt wird. Die Definition der UPIAS lautet wie folgt:
-
"Impairment: Lacking part or all of a limb, or having a defective limb, organ or mechanism oft the body.
-
Disability: The disatvantage or restriction of activity caused by a contemporary social organization which takes no or little account of people who have physical impairments and thus excludes them from participation in the mainstream of social activities"[76]
Getreu dem Satz: "Behindert ist man nicht, behindert wird man!", erarbeiteten die Behindertenbewegungen ein soziales Modell von Behinderung, "das die Erfahrungen des "Behindertwerdens" anhand der historischen, sozialen und politischen Bedingungen einer Gesellschaft analysiert".[77] Damit werden soziokulturelle Praxen als Ort der Herstellung von Differenz entlarvt. Den Disability Studies gelingt es somit, die körperliche und soziale Ebene voneinander zu trennen. Auch das US-amerikanische Disability Rights Movement beginnt etwa zeitgleich sich mit Fragen des "behindert-werdens", nicht nur gesellschaftspolitisch sondern auch wissenschaftlich auseinander zu setzen. Der behinderte Soziologe Irving Zola gründete 1982 die "Society of Disability Studies". Mit dem Anspruch, mehr Menschen mit Behinderung in Forschung und Wissenschaft zu bringen, verband sich gleichzeitig die Forderung, die Forschung zu Behinderung "von einer Forschung über Objekte zu einer Forschung von Subjekten zu machen."[78] Behinderten Wissenschaftler_innen gelang es, die Disability Studies als eine "eigenständig[e] Wissenschaft zur Analyse und Kritik der historisch und kulturell bedingten gesellschaftlichen Situation Behinderter"[79] an Universitäten zu etablieren. Während in den USA längst behinderte Menschen an den Universitäten studieren und sich bereits Magisterstudiengänge der Disability Studies entwickeln konnten, hängt die Entwicklung der Disability Studies und deren universitäre Etablierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz allerdings erheblich im internationalen Vergleich hinterher.[80] Neben der Frage der sozialen Konstruktion von Behinderung und deren Folgen, ist die Frage nach der kulturellen Repräsentation von Behinderung entscheidend. So treten neben den sozialwissenschaftlichen Perspektiven in den neuen Ansätzen der Disability Studies auch kulturwissenschaftliche Disziplinen dazu. Seit Mitte der 1990er Jahre untersuchen diese Disziplinen wie Behinderung in Kunst, Literatur, Film et cetera dargestellt und konstruiert wurde.[81] In einer makrosoziologischen Denklogik kritisieren die Disability Studies zunächst, wie bereits angesprochen, die Naturalisierung von Behinderung. Da sie "Behinderung [...] als kontingentes soziales Ereignis"[82], welches durch soziokulturelle Praxen erst erzeugt wird, betrachten, entziehen sie dem Phänomen Behinderung jeglichen essenziellen Charakter, denn ohne einen sozialen Kontext wird Behinderung nun nicht mehr definierbar[83]. Im Zuge dessen erwächst Kritik an bestehenden gesellschaftlich verteilten Machtverhältnissen beziehungsweise der Repräsentation und Artikulation von Behinderung[84]. Schließlich wird aus der wissenschaftlichen Perspektive die Forderung nach konsequenter Transdisziplinarität laut. Diese beruft sich auf die Kritik an der bisher arbeitsteiligen und fachdisziplinären Logik[85]. Die Disability Studies wollen nicht zu einer neuen, weiteren Wissenschaft werden, die sich ausschließlich mit dem Phänomen Behinderung befasst. Die Frage ist eher, welche spezifischen Mechanismen Behinderung als Ergebnis sozialer Organisation erst erzeugen und unter welchen sozialen, kulturellen und historischen Bedingungen sich diese Prozesse vollziehen? Den Fokus setzen die Wissenschaftler_innen deshalb auf die soziokulturellen und historischen Kontexte innerhalb derer Behinderung entsteht und betrachten die unterschiedlichen Erfahrungen von Behinderung in diesen Zusammenhängen. Das Ziel ist, die unterschiedlichsten Studien zu Behinderung unter dem Dach der "Disability Studies" zusammenzufassen, womit gleichzeitig eine Kritik an den bisher etablierten Rehabilitationswissenschaften geübt wird. Diese betrachten nämlich, aus Sicht der Disability Studies, Behinderung bisher als einen Gegenstand, der nur betroffene Personen selbst und sich damit auseinandersetzende Disziplinen berührt. Natürlich spielen auch persönlich-psychologische Motivationen eine Rolle[86], wie sich an der folgenden Aussage der behinderten Wissenschaftlerin SIMI LINTON erkennen lässt:
"We are everywhere these days, wheeling and loping down the street, tapping our canes, sucking on our breathing tubes, following our guide dogs, puffing and slipping on the mouth sticks that propel our motorized chairs. We may drool, hear voices, speak in staccato syllables, wear catheters to collect our urine, or live with a compromised immune system. We are all bound together, not by this list of our collective symptoms but by the social and political circumstances that have forged us as a group. We have found a voice to express not desperate our fate but outrage a tour social positioning. Our symptoms, though sometimes painful, scary, unpleasant, or difficult to manage, are nevertheless part of the dailiness of our life. They exist and have existed in all communities throughout time. What we rail against are the strategies used to deprive us of rights, opportunity, and the pursuit of pleasure."[87]
Aber gelten die Disability Studies damit als ein identitätspolitisches Projekt? Die Disability Studies, zwar von behinderten Menschen ins Leben gerufen und zum Teil bis heute überwiegend durch diese vertreten, sind keineswegs als Forschung gedacht über einen ausschließlich marginalisierten Ausschnitt der Wirklichkeit[88]und sind auch nicht nur behinderten Wissenschaftler_innen vorbehalten. Vielmehr sind die Disability Studies als emanzipatorisches und sozialpolitisches Projekt[89], als Lebenserfahrung für die Gesellschaft allgemein und das Zusammenleben von Menschen generell wesentlich[90], wie MARKUS DEDERICH folgendermaßen beschreibt:
"Die Disability Studies rücken gesellschaftliche und kulturelle Wandlungsprozesse im Umgang mit den grundlegenden Erfahrungen menschlicher Vergänglichkeit, Krankheit, Gebrechlichkeit und Abhängigkeit in den Blick; sie untersuchen, wie, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen Deutungsmuster, Theorien und Modelle von körperlicher, geistiger, wahrnehmungs- und verhaltensbezogener, moralischer und kultureller Abweichung, von Abnormität, Andersheit oder Fremdheit entstehen; sie untersuchen ferner, welche Praxen sich um "widersinnige" Formen des Wahrnehmens, Erlebens und Denkens, um erwartungswidrige Formen der Kommunikation, des Verhaltens, des Aussehens und des körperlichen und intellektuellen Funktionierens organisieren. Schließlich fragen sie, wie Gesellschaften Normen herausbilden, und unter welchen Umständen und Voraussetzungen sie Normalitäten produzieren: starre oder flexible Grenzen, die im gesellschaftlichen Feld eine Mitte und einen Rand, aber auch ein Innen und ein Außen erzeugen."[91]
Wurde das soziale Modell innerhalb der Disability Studies lange Zeit als Errungenschaft gefeiert, häufen sich mittlerweile immer mehr kritische Stimmen innerhalb der eigenen Reihen. Zwar wird die Bedeutung des sozialen Modells nicht komplett in Frage gestellt, dennoch wird angemahnt, dass das soziale Modell nach wie vor die Beeinträchtigung des Menschen als Problem darstellt. Die soziale Konstruktion der Behinderung wird erkannt, doch "impairment" selbst wird als natürlich vorausgegeben gedacht. Anne Waldschmidt mahnt dagegen an, "impairment" und "disability" als sozial konstruiert zu verstehen, da beide gleichermaßen durch diskursive[92] Praktiken hergestellt werden[93]. Begründet wird diese Argumentation mit der fehlenden Kausalität von Behinderung und Beeinträchtigung. Während die Vertreter des sozialen Modells die Beeinträchtigung als Voraussetzung für die kulturell und sozial konstruierte Behinderung verstehen, stimmt das kulturelle Modell dieser Kausalität nicht zu bzw. entlarvt ihre Kurzsichtigkeit. Konkret heißt das, dass aus einer (körperlichen) Schädigung nicht zwangsläufig eine Behinderung folgen muss bzw. andersherum eine Schädigung keine Voraussetzung für eine Behinderung sein muss. Beispielsweise gilt ein Mensch, der eine Brille tragen muss, zwar als sehgeschädigt, aus dieser Einschränkung wächst aber keine gesellschaftliche Benachteiligung, im Gegenteil wird das Tragen einer Brille zum Teil sogar als modischer Trend entdeckt. Auf der anderen Seite ist durchaus denkbar, dass ein Mensch, der zwar keinerlei physische, psychische oder geistige Einschränkung aufweist, dennoch eine gesellschaftliche Behinderung im Sinne einer Benachteiligung erfährt, zum Beispiel aufgrund seines Geschlechts, der Hautfarbe oder Religion.
Dementgegen argumentieren die Vertreter des sozialen Modells, dass das soziale Modell "nie den Anspruch gehabt [habe], eine umfassende Theorie der Behinderung zu sein, vielmehr sei es ein Werkzeug, das man anwenden solle, um politischen und sozialen Wandel zu bewirken, anstatt darüber zu diskutieren."[94]
Wie die Argumentation der Disability Studies in der deutschen Debatte um Behinderung aufgegriffen wurde, werde ich im nächsten Abschnitt diskutieren. Außerdem werde ich speziell den Diskurs um Behinderung in der Sonderpädagogik nachvollziehen, da sie als eine Schwesterdisziplin der Erziehungswissenschaft gilt und sie damit als Bezugsdisziplin der Sexualpädagogik einer besonderen Aufmerksamkeit für mein Arbeitsthema bedarf.
Die deutschsprachigen Disability Studies sind noch eine sehr junge Disziplin. Seit etwa 2001 werden sie zunehmend diskutiert.[95] In Deutschland selbst gab es keine explizite Formulierung eines sozialen Modells von Behinderung, auch wenn es im Zuge der deutschen Behindertenbewegung viele Veröffentlichungen gab, die aus heutiger Sicht den Disability Studies zugeordnet werden können.[96]
Schaut man sich die deutsche Diskussion zum Thema Behinderung an, wird klar, dass Behinderung als Kategorie hier auch von einer enormen Komplexität geprägt ist. Eine theoretisch einwandfreie, historisch und kulturell universelle Definition von behindert/nicht behindert ist auch heute noch nicht in der Sonderpädagogik vorzufinden, wie MARKUS DEDERICH festhält:
"Nach Gröschke ist Behinderung ein Begriff, mit hohem metaphorischem Gehalt und starken sozial-normativen Bezügen. Obwohl er aus diesem Grund kaum als deskriptiver und klar eingegrenzter Grundbegriff der Behindertenpädagogik fungieren kann, bildet er bis heute ihr terminologisches Zentrum"[97]
Das liegt darin begründet, dass Behinderung im Prinzip für jeden Menschen eine Option darstellt und nicht als absolut verstanden werden kann. Zwar wird Behinderung als Differenzkategorie meist an körperlichen (weil sichtbaren) Merkmalen festgemacht, allerdings ist sie dadurch längst nicht klar abzugrenzen. Unter Behinderung werden die unterschiedlichsten Phänomene gefasst - von Blindheit, über Autismus zu Neurodermitis oder Alkoholabhängigkeit.[98] Die Grenze zu anderen Kategorien wie Alter oder Fitness scheint hier fließend. Dennoch scheint es eine konstante Bereitschaft zu geben, eine Trennung vorzunehmen, was WALDSCHMIDT/SCHNEIDER in der Notwendigkeit begründet sieht, eine bestimmte soziale Ordnung und "kulturell vorgegebene Vorstellungen von Körperlichkeit und Subjektivität aufrechtzuerhalten."[99]Einigkeit besteht im sonderpädagogischen Diskurs derzeit aber - analog zu den Disability Studies - darüber, Behinderung "als soziales Konstrukt, als Folge von Zuschreibung, Etikettierung und Stigmatisierung sowie Systemeffekten"[100] zu verstehen, was sich in sonderpädagogischen Diskursen wie soziale Teilhabe, Integration oder Inklusion manifestiert[101].
Wie die deutsche Sonderpädagogik sich dem Thema Geschlecht/Sexualität widmet, möchte ich nun in den Blick nehmen.
Geschlecht und sexuelle Orientierung wurden bisher in der Sonderpädagogik wenig aufgegriffen. Behinderung als Merkmal steht zumeist als dominantes Merkmal im Vordergrund der Forschung und birgt die Gefahr einer tendenziellen Vernachlässigung anderer Ungleichheitsdimensionen.[102] Seit Kurzem werden allerdings auch geschlechtsspezifische Fragen im sonderpädagogischen Diskurs untersucht. Dabei wird sich allerdings fast ausschließlich auf die Lebenssituationen junger Frauen mit Behinderung beziehungsweise behinderter Mädchen konzentriert. Männlichkeit und Behinderung sind dagegen äußerst selten Untersuchungsgegenstand.[103] Die Ursache dafür liegt in der schleierhaften Zuständigkeit unterschiedlicher Disziplinen für diese Thematik. Die deutsche Frauenbewegung sah es nicht als ihre Aufgabe, sich behinderten Frauen zu widmen, da für sie geschlechtsspezifische Interessen im Vordergrund standen. Die Behindertenbewegung ihrerseits ist überwiegend männlich geprägt. Dass Geschlecht auch innerhalb der Behindertenbewegung eine Differenzkategorie bildet, zeigte sich daran, dass behinderte Männer frauenspezifische Themen nicht als relevant sahen und sich auf Benachteiligung aufgrund vermeintlicher Behinderungen konzentrierten.[104]Dennoch gab es durchaus Frauen mit Behinderung, die die spezifischen Erfahrungen als Frauen mit Behinderung zum Thema gemacht haben. Vor allem Frauen mit körperlichen Behinderungen trafen sich ab 1970, um über verschiedene geschlechtsspezifische Probleme zu diskutieren. Ausschlaggebend war das UN-Jahr der Behinderten 1981, in dessen Rahmen es zu bedeutenden Publikationen kam wie "Geschlecht behindert. Besonderes Merkmal: Frau"[105] oder "unbeschreiblich weiblich?"[106]. Behinderte Frauen kritisierten zum einen die fehlende Barrierefreiheit, wenn es um den Zugang zu Diskussionen oder Informationen ging. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass die Frauenbewegung gegenüber den behinderten Frauen zum Teil stark unterschiedliche Ansichten in ihren Inhalten aufwies.[107] Damit wurde vor allem auf die Thematiken weibliche Sozialisation, Schönheitsideale Geschlechtsstereotype, (Zwangs-) Sterilisation oder Gewalterfahrungen rekurriert. So unterschieden sich beispielsweise die Kämpfe zum Thema Abtreibung folgendermaßen: Während Frauen mit Behinderung keine Kinder bekommen sollten und deshalb um ihr Recht auf Schwangerschaft und Mutterschaft kämpften, suchten Frauen ohne Behinderung ihre Selbstbestimmung in dem Recht auf Abtreibung eines behinderten Kindes. Wie festgefahren die Situation in Bezug auf die Auseinandersetzung von Geschlecht und Behinderung in den Disability Studies beziehungsweise der Sonderpädagogik bis in die Gegenwart hinein ist, zeigt das folgende Zitat aus dem Buch "Geschlecht behindert. Besonderes Merkmal: Frau":
"Wir Krüppelfrauen sind Frauen, die behindert sind, wir werden als Behinderte behandelt, die nebenbei weiblich sind. Behinderte gelten als eine Gruppe zwischen den Geschlechtern, die dritte Gruppe zwischen Männern und Frauen"[108]
Während sich Stimmen behinderter Frauen mehrten, die ihre Rechte einforderten, sieht die Erforschung von Männlichkeit und Behinderung bis heute ernüchternd aus. Geschlechterforschung in Verbindung mit Behinderung ist bislang Thema der Frauenbewegung gewesen, weshalb überwiegend Frauenthemen diskutiert wurden.[109] Während behinderte Frauen sich seit den frühen 1990er Jahren auf Landesebene und seit 1998 bundesweit in dem Netzwerk "Weibernetz"[110] organisieren, gibt es kein vergleichbares Netzwerk für Männer mit Behinderung, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. In den deutschsprachigen Disability Studies gibt es ebenso quasi keine Auseinandersetzung mit männerspezifischen Themen.[111] KARSTEN EXNER konstatiert 1997, "daß die Sonderpädagogik bis heute für Jungen keine überzeugenden Konzepte vorweisen kann, die ihren geschlechtsspezifischen Belangen gerecht werden, um sie so zu unterstützen, gleichberechtigte und selbstbewußte Männer zu werden"[112]. Doch nicht nur die Betrachtung von Geschlecht und Behinderung erfolgte unzureichend. Auch das Thema Begehren - in jeder Hinsicht, auch jenseits der heterosexuellen Norm - wird in der Sonderpädagogik bis heute größtenteils verschwiegen.[113][114] Die Vermeidung der Thematik macht Ortland sowohl an der Verunsicherung der Eltern und Lehrer behinderter Schüler_innen besonders bei schwerer kognitiver Beeinträchtigung fest, als auch an den fehlenden sexualpädagogischen Informationen.[115]
Nach dieser Darstellung sollte folgendes deutlich geworden sein:
-
Behinderung gilt als eine Form der sozialen Unterdrückung, die zwar eigenen Regeln folgt, aber nach BARNES/MERCER mit Unterdrückungsmustern wie Rassismus und Sexismus vergleichbar ist.[116] So wird innerhalb der Disability Studies ähnlich zu den Unterdrückungsmechanismen Rassismus (racism) und Sexismus (sexism) von "ableism" gesprochen, abgeleitet vom englischen "be able" (befähigt sein). Damit rekurriert ableism auf einen Differenzierungsmechanismus, der Menschen einteilt in gesunde und fähige Menschen und Menschen mit vermeintlich eingeschränkten Fähigkeiten, die den nichtbehinderten Menschen unterlegen sind.[117]
-
Die Disability Studies als Forschungsrichtung versuchen die bisherige wissenschaftliche Ordnung in Bezug auf Behinderung durcheinanderzubringen. Ihr Anspruch liegt darin, eine bisher als klar gedachte Kategorie zu hinterfragen und ihre kulturellen sowie sozialen Konstruktionsmechanismen und Bedeutungsebenen sichtbar zu machen.
-
Die Disability Studies haben nicht den Anspruch, ein spezielles Phänomen innerhalb der Gesellschaft zu erklären, sondern aus einer "dezentrierten"[118] Perspektive, die Mehrheitsgesellschaft zu analysieren. Damit geben sie "Aufschluss über das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Kultur"[119]
-
Trotz des Anspruchs das Phänomen Behinderung universell zu analysieren, haben es die Disability Studies und die deutsche Sonderpädagogik bisher versäumt, die Kategorie Behinderung im Zusammenhang mit anderen Strukturkategorien zu analysieren. So zitiert MARKUS DEDERICH den Sozialwissenschaftler GARY ALBRECHT:
"Tatsächlich ist das American Disability Movement Albrecht zufolge mit großer Mehrheit aus weißen, privilegierten, gebildeten Erwachsenen mit sichtbaren Behinderungen zusammengesetzt. "Die Anführer der Behindertenbewegung predigen öffentlich Einigkeit und Inklusion, aber wo sind die Armen, die farbigen Menschen, die Individuen mit nicht sichtbaren Behinderungen und die Geistigbehinderten?"[120]
Kritisiert wird auch von Ulrike Schildmann im Besonderen der fehlende Zusammenhang von Behinderung, Geschlecht und Alter:
"Behinderung ist nie geschlechtsneutral und altersunabhängig zu denken; denn behinderte Menschen sind wie andere Menschen auch (abgesehen von vereinzelten Ausnahmen: Stichwort Intersex) Mädchen und Jungen oder Frauen und Männer und lassen sich bestimmten Altersgruppen zuordnen."[121]
Im anknüpfenden Kapitel sollen nun vergleichbar Geschlecht und sexuelle Orientierung als Strukturkategorien eingeführt werden. Dies wird durch die Perspektive der Queer Theory erfolgen.
[74] vgl.: Foucault:1988:134
[75] vgl.: Barnes/Mercer: 2003:11
[76] UPIAS 1976: 3-4, zit. n. Barnes/Mercer: 2003: 11
[77] Tervooren: 2002a
[78] Tervooren: 2002b
[79] Dederich: 2007: 18
[80] vgl.: Schönwiese: 2005: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-studies.html
[81] vgl.: Tervooren: 2002b
[82] Schillmeier: 2007:80
[83] vgl.: Dannenbeck: 2007: 116
[84] vgl.: ebd.: 110
[85] vgl.: ebd.: 109f
[86] vgl.: Dederich: 2007: 18
[87] Linton: 1998: 4
[88] vgl.: Dederich:2007:19
[89] vgl.: Waldschmidt/Schneider:2007:13
[90] vgl.: ebd.
[91] Dederich: 2007: 19f
[92] Ich verwende Diskurs im Sinne Foucaults als "systematische Aussagen über einen Gegenstand in einem historisch spezifischen Kontext" (Wartenpfuhl: 2000: 29). Diese Aussagen über Gegenstände, Sachverhalte oder Individuen bilden keine gesellschaftlichen Realitäten ab, sondern konstruieren erst die Gegenstände, von denen sie reden. (vgl. Foucault: 1969: 74)
[93] vgl.: Waldschmidt: 2007:57
[94] Köbsell: 2007: 42
[95] Vgl.: Köbsell: 2007: 39
[96] vgl.: ebd.
[97] Dederich, 2009: 36f, zit. n. Schildmann: 2010: 36
[98] vgl.: ICD-10- WHO 2011: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/index.htm
[99] Waldschmidt/Schneider:2007:10
[100] Dederich, 2009:37, zit. Schildmann: 2010: 37
[101] vgl: Schildmann: 2010: 37
[102] ebd.
[103] vgl.: Thielen: 2011: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/100/102
[104] vgl.: Köbsell: 2007: 31
[105] vgl.: Ewinkel/ Hermes: 1985
[106] vgl.: Barwig/Busch: 1993
[107] vgl.: Walgenbach et al: 2007: 30ff
[108] Ewinkel/Hermes: 1985: 8, zit.n. Walgenbach et al: 2007: 31
[109] vgl: Köbsell: 2007: 34
[111] Eine der wenigen deutschen Ausnahmen bildet Karsten Exner: 1997
[112] Exner: 1997: zit.n. Köbsell: 2007: 38
[113] vgl. Jeltsch-Schudel: 2010: 50
[114] Als Ausnahme im englischsprachigen Raum gilt Robert McRuer: 2006 und für den deutschsprachigen Raum Heike Raab: 2006
[115] Ortland: 2008: 93
[116] Barnes/Mercer:2003:20f
[117] Vgl.: Hutson: 2010: 61
[118] Waldschmidt/Schneider: 2007:15
[119] ebd:13
[120] Albrecht: 2003:40, zit.n. Dederich: 2007: 54
[121] Schildmann: 2010: 37
Inhaltsverzeichnis
- 3.1 "Doing Gender" - Geschlecht als Strukturkategorie
- 3.2 Sexualität als soziales Konstrukt - queere Perspektiven auf Zweigeschlechtlichkeit
- 3.3 Heteronormativität und die Unterwanderung der Zweigeschlechtlichkeit
- 3.4 Identitätskritik
- 3.5 Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung in der Queer Theory
Analog zu der Einführung in die Disability Studies möchte ich folgendes Kapitel nutzen, um mittels der Queer Theory Geschlecht und Sexualität als Strukturkategorien einzuführen. Im Anschluss daran erfolgt die Betrachtung der Debatte um Behinderung, Geschlecht und Sexualität in der Queer Theory.
Für die meisten Menschen gehört es zum selbstverständlichen Alltagswissen, dass es von Natur aus Frauen und Männer gibt und das beiden Geschlechtern bestimmte Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften wesenhaft sind. Die Frauenforschung begann seit den 1970er Jahren sich mit der Naturhaftigkeit der Geschlechter kritisch auseinanderzusetzen und die Verbindung von biologischem Geschlecht und daraus resultierenden sozialen Eigenschaften zu hinterfragen. Als klassischer Verweis auf dieses Denken, gilt der viel zitierten Satz von SIMONE DE BEAUVOIR: "Man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird es."[122] Innerhalb der Frauenforschung entstand ein neues Verständnis von Geschlecht, dass dem bisher als Einheit gedachten biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht jegliche Kausalität abspricht. "Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und insbesondere die Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen sollten als Ergebnis von Geschichte statt als Effekte natürlicher Unterschiede und damit als veränderbar begriffen werden."[123] In der amerikanischen Debatte wurde diese Unterscheidung terminologisch als "sex" (für das biologische Geschlecht) und "gender" (für die soziale und kulturelle Ausformung des biologischen Geschlechts) gefasst. Diese Terminologie wurde in die deutsche "sex/gender-Debatte"[124] übernommen, da es einen adäquaten Begriff für gender im Deutschen nicht gibt und eine Unterscheidung zwischen "sex" und "gender" im Deutschen ebenfalls sprachlich nicht vorhanden ist[125][126].
"Gender" wurde in der "sex/gender-Debatte" als sozial konstruiert aufgefasst damit nicht als die Konsequenz des natürlich vorausgesetzten "sex" verstanden. Umgekehrt ging es darum aufzuzeigen, dass das biologische Geschlecht keine Voraussetzung für eine unterschiedliche gesellschaftliche Behandlung darstellt. "Gender" wurde vielmehr als die "Übersetzung in kulturelle Zuschreibung von "Mannsein" und Frausein""[127] verstanden. In Verbindung mit diesen Gedanken steht das von ZIMMERMANN/WEST in den 1980er Jahren eingeführte Konzept des "doing gender"[128]. Dieses besagt, dass gender stets das Ergebnis sozialen Handels ist und damit ein "zirkulärer Prozess zwischen DarstellerIn und BetrachterIn"[129]. Das bedeutet, dass Menschen kein Geschlecht haben, sondern es "tun". In der Interaktion mit andern Menschen wird gender immer wieder erst hergestellt und wahrgenommen. Demnach ist gender kein Ergebnis von Biologie, sondern dem vermeintlichen Wissen darüber, was Männer oder Frauen "sind".
Ein typisches Beispiel dafür bildet die Anrede als "Frau" oder "Herr". Eine Person wird mit "Herr" angesprochen, aufgrund sozial und kulturell vereinbarter biologischer Merkmale, die ihn als Mann "kennzeichnen" (zum Beispiel breite Schultern, kräftiger Körperbau, Bartwuchs). Diese körperlichen Merkmale sagen aber grundsätzlich nichts über ihre Bedeutung aus. Erst in der Anrede der Person als "Herr", wird diesen Merkmalen Bedeutung verliehen und die Person als männlich identifiziert und in der weiteren Interaktion als männlich wahrgenommen. "Doing gender" bedeutet allerdings nicht nur, dass Menschen das Geschlecht des Gegenübers permanent herstellen, auch das eigene Geschlecht wird ständig inszeniert. Beispielsweise durch das Tragen bestimmter Frauen- oder Männerkleidung, Schminke oder das Benutzen einer Damen- beziehungsweise Herrentoilette.
Mit der "sex/gender-Debatte" verschob sich der Fokus der feministischen Forschung weg von Geschlechterverhältnissen und der Frage, warum die Geschlechter ungleich behandelt werden, zu der Betrachtung von Geschlechterkategorien und dem Fokus auf die Konstruktion von Geschlecht.[130]
Doch aus den eigenen Reihen kam Kritik gegenüber dieser neuen Perspektive auf. Beanstandet wurde, dass mit der Trennung von "sex" und "gender" zwar ein erster Schritt getan wurde, um Geschlecht als Konstruktion zu entlarven, aber dass die Unterscheidung in Natur und Kultur dabei aufrecht erhalten wurde. Das heißt, "gender" wurde zwar als sozial hergestelltes Phänomen erkannt, aber "sex" als biologisches Geschlecht natürlich vorausgesetzt. An dieser Stelle setzt die Queer Theory an.
Queer Theory[131] kann im Gegensatz zur Frauenforschung nicht als eigenständige akademische Disziplin aufgefasst werden und verfügt über kein einheitliches Theoriegebäude. Vielmehr ist die in den 1990er Jahren entstandene Queer Theory als ein transdisziplinäres Projekt zu verstehen, das eine kritische "Frageperspektive"[132] einnimmt. Queer Theory wurzelt zum Teil in der Frauen- und Geschlechterforschung, der Schwulen- und Lesbenbewegung und auch in poststrukturalistischen[133] Strömungen.[134] Aus der Übersetzung des Wortes "queer" können die ersten Ideen für das Selbstverständnis der Queer Theory erschlossen werden. Als Adjektiv bedeutet queer so viel wie ""seltsam, komisch, unwohl" oder "gefälscht, fragwürdig"[135] . Mit dieser negativen Konnotierung wurde queer vor allem in den USA als Schimpfwort für Sexualitäten jenseits der Heterosexualität benutzt. Etwa seit den 1980er Jahren wurde er von der Lesben- und Schwulenbewegung selbstbewusst als Kampfbegriff übernommen.[136]
Inhaltlich knüpft die Queer Theory an verschiedenen Themen an. Hauptschwerpunkt bilden die Analyse und Kritik von Ungleichheit, Herrschaft und der Normalität vermeintlich natürlicher Kategorien, vor allem in Beug auf Sexualität, wie ANDREAS KRAß folgendermaßen beschreibt:
"Queer Studies zielen [...] auf die Denaturalisierung normativer Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit, die Entkoppelung der Kategorien des Geschlechts und der Sexualität, die Destabilisierung des Binarismus von Hetero- und Homosexualität sowie die Anerkennung eines sexuellen Pluralismus, der neben schwuler und lesbischer Sexualität auch Bisexualität, Transsexualität und Sadomasochismus einbezieht."[137]
Ich möchte Queer Theory vor allem als Heteronormativitätskritik und Identitätskritik vorstellen.
Wie bereits geschildert knüpft die Queer Theory zum Teil an die "sex/gender-Debatte" der Frauenforschung an. Allerdings gehen in die Queer Theoretiker_innen davon aus, dass nicht nur gender eine soziale Kategorie bildet, sondern dass auch sex der Kultur nicht natürlich vorausliegt, sondern gleichursprünglich mit ist[138]. Diese Ansicht kann durch das folgende Zitat von dem Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch untermauert werden:
"Wer von "natürlicher" Sexualität als biologisch vorausgegebener, gesunder, normaler, richtiger, als nur gesellschaftlich überlagerter oder als der ungebrochenen, ungehemmten des "einfachen Menschen" redet, leugnet die gattungsspezifische Besonderheit des Menschen, die in seiner gesellschaftlichen Geschichtlichkeit besteht. [...]Wer in diesem Sinne von natürlicher Sexualität redet, will menschenfeindliche medizinische Attacken rechtfertigen (Beispiel Eingriffe in die organische Basis durch Psychochirurgie), will bestimmte Ausdrucksformen von Sexualität als von der Natur Gewollte proklamieren (Beispiel der naturrechtlichen Sexualmoral des Vatikans), entschuldigen und vorm Zeigefinger bewahren (Beispiel: Homosexualität), will "alternative Lebensformen" unter die Leute bringen (Beispiel Psychosekten mit Programm zur "freien Liebe"). Wer von natürlicher Sexualität redet, kocht in jedem Fall "sein eigenes Süppchen" und hat Grund dazu."[139]
In Anlehnung an Foucault[140] wird sex - also die Einteilung in Mann und Frau - genauso wie gender als konstruiert verstanden. "Das heißt aus der Sicht der Queer Theory - wie überhaupt der Postmoderne[141] - werden Subjekte erst durch gesellschaftliche Diskurse, Bezeichnungs-, Regulierungs- und Normierungsverfahren geformt."[142] Eine queere Perspektive versteht Sexualität also nicht als eine private Angelegenheit, sondern als eine Machtkategorie und gesellschaftliches Regulierungsprinzip.[143] Die Natürlichkeit der Sexualität erscheint nur als Wahrheit, die nach Foucault zu verstehen ist "als ein Ensemble von geregelten Verfahren für Produktion, Gesetz, Verteilung, Zirkulation und Wirkungsweise der Aussagen"[144]. Queer Theory versucht diese machtvollen Mechanismen der Wahrheitsproduktion sichtbar zu machen und normative Konzepte von Geschlecht zu entnaturalisieren. Als zentraler Begriff dieser Kritik gilt der der Heteronormativität. Heteronormativität meint die unhinterfragte und als natürlich wahrgenommene Norm der Heterosexualität und damit verbunden ein System von Zweigeschlechtlichkeit, welches ausdrücklich nur zwei Geschlechter produziert. "Der Begriff benennt Heterosexualität als Norm der Geschlechterverhältnisse, die Subjektivität, Lebenspraxis, symbolische Ordnung und das Gefüge der gesellschaftlichen Organisation strukturiert. [...] Was ihr nicht entspricht, wird diskriminiert, verfolgt oder ausgelöscht (so in der medizinischen Vernichtung der Intersexualität) - oder den Verhältnissen in ästhetisch-symbolischer Verschiebung dienstbar gemacht."[145] Nach dem Verständnis der Heteronormativität erscheinen Heterosexualität und Humanität demnach als synonym[146]. Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität sind in einer Art funktional miteinander verbunden. Das bedeutet, dass es einen kulturellen Zwang gibt, sich in Abgrenzung und Unterscheidung zum anderen Geschlecht zu definieren[147] und das jegliche sexuelle Orientierung außerhalb der Heterosexualität und jede geschlechtliche Verortung außerhalb der Binarität Mann/Frau als anders, fremd und abweichend empfunden wird. ROBERT MCRUER beschreibt treffend: "Compulsion is here produced and covered over, with the appearance of choice (sexual preference) mystifying a system in which there actually is no choice."[148] Heterosexualität als Institution soll hinterfragt werden, in dem jene Reproduktionsmechanismen, Vernetzungen und institutionellen Zwänge in den Mittelpunkt gerückt werden, die dafür sorgen, dass Heterosexualität als prähistorisch erscheint. Dabei ist Heterosexualität als Norm ""unentrinnbar" - und dies gilt auch für diejenigen, die nicht heterosexuell leben."[149] Queer Theory verbindet also gleichzeitig eine Kritik an der natürlich unterstellten Verbindung zwischen dem anatomischen Geschlecht (sex), der sozialen Geschlechtsidentität (gender) und dem Begehren (desire)[150]. Judith Butler bezeichnet diesen Mechanismus, der die Einheit sex-gender-desire organisiert und aufrecht erhält als "heterosexuelle Matrix". Weiterhin führt Butler den Begriff der "Performativität" in die Diskussion ein. Demnach sind die heterosexuelle Matrix selbst, als auch die einzelnen Kategorien sex-gender-desire Produkte sich ständig wiederholender performativer Akte, bei denen die Positionen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, ausgeschlossen werden[151]. Das bedeutet, dass nicht nur, wie im "doing gender" Geschlecht durch Interaktion hergestellt wird, sondern auch Sexualität und Begehren soziale Effekte sind, die immer wieder performativ (durch Sprache, Handlungen, Gesten, Kleidung, etc.) hergestellt werden.[152] Ich möchte den performativen Akt am Beispiel der Eheschließung vorstellen - konkret an dem alles entscheidenden Satz: "Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau". Durch die einleitenden Worte "Hiermit erkläre ich Sie" stellt eine machtvolle Handlung dar, denn sie entscheidet darüber, was mit den beiden Menschen im Anschluss passiert. Viel bedeutender ist allerdings der zweite Teil "zu Mann und Frau". Mit diesen Worten werden zwei Personen in zwei verschiedene Geschlechter geteilt und als diese bestimmt. Darüber hinaus wird bestimmt, dass sie sich in ihrem Begehren aufeinander beziehen. Diese Handlung ist nur ein Beispiel dafür, wie Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität durch ständige (??) als natürlich erscheinen und somit zur "Wahrheit" werden.
Das bedeutet allerdings nicht, dass Heterosexualität als sexuelle Orientierung generell kritisiert wird. Es geht vielmehr darum zu erkennen, dass Sexualität und Geschlecht dichotom organisiert sind und in sich hierarchisch strukturiert sind. Denn binäre Kategorien wie Geschlecht und Sexualität existieren nicht gleichwertig nebeneinander, sondern eine Kategorie ist stets der anderen unterstellt, wobei die erstgenannte Kategorie die Norm darstellt und die zweitgenannte deren Abweichung - so zum Beispiel männlich/weiblich, hetero-/homosexuell, Weiß/Schwarz.[153]
Die deutschsprachigen Queer Studies schließen vor allem an die identitätskritische und dekonstruktivistische Perspektive[154] von JUDITH BUTLER an.[155] Sie kritisiert die Annahme einer Geschlechtsidentität (männlich oder weiblich), die in dem biologischen Geschlecht (Mann oder Frau) festgeschrieben ist und somit ein natürliches Geschlecht vorgibt:
"Akte, Gesten, artikulierte und inszenierte Begehren schaffen die Illusion eines inneren Organisationskerns der Geschlechtsidentität (organizing gender core), eine Illusion, die diskursiv aufrechterhalten wird, um Sexualität innerhalb des obligatorischen Rahmens der reproduktiven Heterosexualität zu regulieren."[156]
In einem radikalen Verständnis von "gender" als sozial und kulturell konstruiert wird diese "Kohärenz"[157] von biologischem Geschlecht und sexueller Identität jedoch in Frage gestellt. Nach Butler können "[d]ie Begriffe Mann und männlich [...] dann ebenso einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich."[158]
Resultierend aus der Kritik an der zwanghaften Zuordnung zu einer bestimmten Geschlechts- und Sexualitätsgruppe, übt die Queer Theory ebenfalls generelle Kritik an festen Identitätszuschreibungen. Als politisches Projekt tritt Queer vor allem gegen Identitätspolitik und insbesondere gegen die Bildung von homogenen und marginalisierten Gruppenidentitäten an, so zum Beispiel gegen die Identität "der Schwulen" oder "der Lesben". Mehr noch: Queer kritisiert, dass durch vorherrschende Diskurse und soziale Praktiken, Gruppenidentitäten erst hergestellt werden. Das heißt, in dem von Minderheitsbewegungen versucht wird, kollektive Merkmale zu definieren, um auf Grundlage dieser Gemeinsamkeiten eine Einheit zu bestimmen, in deren Namen Forderungen zur Gleichstellung mit der Mehrheit gestellt werden können, konstruieren sie sich selbst erst als Minderheit in Abgrenzung zu der hegemonialen Mehrheit. Das folgende Zitat soll diese Position noch weiter verdeutlichen:
""Queere TheoretikerInnen haben die Sicht kritisiert, Homosexualität sei ein Persönlichkeits- oder Gruppenmerkmal, gleich, ob dieses mit einem natürlichen oder sozialen Ursprung erklärt wird. Sie argumentieren, dass diese Perspektive die Binarität von Heterosexualität/Homosexualität als Meisterrahmen für die Konstruktion von Selbst, sexuellem Wissen und sozialen Institutionen intakt lasse. Ein theoretisches und politisches Projekt, das ausschließlich darauf zielt, Homosexualität zu normalisieren und Lesben und Schwule als soziale Minderheit zu legitimieren, stellt jedoch keine Herausforderung dar für ein Regime, das Körper, Begehren, Verhalten und soziale Beziehungen definiert im Rahmen einer binär organisierten Begrifflichkeit von sexueller Präferenz.""[159]
Identitätsbildung ist demnach immer mit machtvollen Differenzierungen verbunden. TUIDER/TIETZ stellen fest: "Das Denken und Handeln in festen Identitäten gilt als psychisch wie politisch beschränkend und potenziell leidproduzierend"[160]. Denn eine potentielle Vielfalt wird durch die hierarchische Anordnung der Geschlechter und die geschlechtlichen Normierungen eingeschränkt.[161] Damit bezieht sich Queer Theory nicht nur auf sexuelle Identitäten, sondern auf alle Menschen, "die der gesellschaftlich herrschenden Norm nicht entsprechen oder nicht entsprechen wollen"[162], was auch Kategorien wie beispielsweise Religion oder Hautfarbe einschließt. Queer fordert deshalb dazu auf, Identitäten als "Provisorien"[163] zu verstehen und stellt "ein Spektrum von Möglichkeiten zu existieren gegenüber"[164]. Damit verbunden sind Strategien der "VerUneindeutigung", "Vervielfältigung" und "Auflösung"[165] eindeutiger Identitäten und der Dekonstruktion fester Kategorien. Damit meint Queer nicht, dass alles möglich ist und Identitäten von heute auf morgen beliebig austauschbar sind. Vielmehr sollen Handlungsspielräume für Menschen eröffnet werden, sich jenseits der bipolaren Geschlechterordnung zu platzieren. Eine Möglichkeit dazu liegt in dem Performanzkonzept von BUTLER selbst. Denn die performative Wiederholung geschlechtlicher Normen kann in Form von Parodie eine Möglichkeit der Subversion der bestehenden Geschlechterordnung darstellen. BUTLER verdeutlicht dies in ihrem Buch "Das Unbehagen der Geschlechter" anhand der Beispiele der Travestie, des Drag und der butch-/femme-Identitäten.[166]Den Nutzen der Parodie für die Unterwanderung der Geschlechterordnung beschreibt DAGMAR VON HOFF folgendermaßen:
"Die parodistische Aneignung heterosexueller Geschlechternormen in nicht-heterosexuellen Kontexten vollzieht demnach einen Prozess der Regulierung von Bedeutungen, der beständigen Verschiebung von Zeichen, die den normativen Gebrauch irritieren und verworfene Bezeichnungen wie beispielsweise queer, dyke, fag etc. durch eine parodistische Wiederholung von ihren abwertenden Bedeutungen ablösen und reformulieren."[167]
Queer versteht sich selbst also nicht als klar umrissene Identitätskategorie, beziehungsweise als austauschbar zu marginalisierten Identitäten. In Deutschland wird queer allerdings zum Teil noch als Synonym für lesbisch oder schwul gebraucht, was nach DEGELE vor allem daran festzumachen ist, dass queer in Deutschland ein Modebegriff ist für alle, die nicht in gesellschaftliche sexuelle Norm passen.[168] Das Anliegen ist jedoch aufzuzeigen, dass Identitäten kein "angeborener Wesenskern"[169] eines Menschen sind, sondern Positionierungen in einem jeweiligen Kontext. Das heißt, Frau, Mann, bisexuell oder transsexuell stellen keine Identität dar, die ein Mensch ist, sondern Taten, die ein Mensch tut. Dabei gelten diese Kategorien als "eine gesellschaftliche, normative Anweisung an die Menschen, der aber nie ganz entsprochen werden kann"[170].
Am Beispiel der konsequenten Identitätskritik habe ich aufgezeigt, dass die Queer Theory als " Denkbewegung zu verstehen [ist], die auf Erkenntnissen und Errungenschaften der Geschlechterforschung aufbau[t], diese aber zu erweitern versuch[t], in dem sie Kategorien wie Alter, Hautfarbe, Ausbildung, Religion und Sexualität in die Analyse von Macht und Ungleichheit einbezieh[t]"[171]
Allerdings hat sich ein Großteil der bisherigen Argumentation auf die Kategorien Sexualität und Geschlecht beschränkt. Das liegt daran, dass diese Kategorien nach wie vor den Schwerpunkt der Auseinandersetzung ausmachen, wie GUDRUN PERKO[172] betont. Allerdings gibt es im deutschsprachigen Raum mittlerweile auch Ansätze, die "nach der Übertragbarkeit von Queer auf andere gesellschaftliche Bereiche jenseits von Sex und Gender"[173] fragen.
Mit der Anknüpfung an Geschlecht und Sexualität gelingt es der Queer Theory immerhin, sich mit zwei Strukturkategorien auseinander- und diese in Beziehung zu setzen. Dennoch stimme ich mit Tuider überein, dass die Herstellung von Geschlecht und Sexualität nur in Wechselwirkung mit anderen Normsystemen wie Klasse/Rasse/Ethnizität etc.[174] verstanden werden kann.
Als Ergebnisse der vorangegangenen Ausführungen können die folgenden festgehalten werden:
-
Geschlecht und sexuelle Orientierung gelten als soziale und kulturelle Konstruktionen mit gesellschaftsregulierender Wirkung.
-
Queer Theory zielt auf die radikale Transformation bestehender Geschlechter- und Sexualverhältnisse mittels einer konsequenten Identitäts- und Heteronormativitätskritik.
-
Trotz der Identitätskritik rekurriert Queer Theory zumeist auf "sex" und "gender" als thematische Schwerpunkte. Die Auseinandersetzung mit anderen Kategorien wurde, wie dargestellt, in Deutschland bisher bis auf wenige Ausnahmen versäumt.
[122] Beauvoir: 1951: 334
[123] Gildemeister/Wetterer: 1995: 205
[124] Degele 2008: 67
[125] vgl.: Wartenpfuhl: 2000: 35
[126] Aufgrund dieser Schwierigkeiten der adäquaten Übersetzung möchte ich darauf verweisen, dass ich mit der Benennung meiner Untersuchungskategorien "Geschlecht" sowohl gender als auch sex umfassen werde und ich mit der Kategorie "sexuelle Orientierung" die Ausrichtung des Begehrens benenne.
[127] Degele: 2008: 67
[128] West/Zimmermann: 1987
[129] Degle: 2008: 80
[130] vgl.: Degele: 2008: 82
[131] In der Literatur werden sowohl die Begriffe Queer Theory als auch Queer Studies benutzt. Ich werde mich auf den Begriff der Queer Theory beschränken (ausgenommen von Zitaten), da es mir vorrangig darauf ankommt, theoretische Inhalte dieses Projektes darzustellen. Queer Studies verstehe ich eher als akademische Verortung der Queer Theory. (vgl.: Hark: 2005: 286)
[132] Kraß: 2003: 20
[133] Der in der Sprachwissenschaft verwurzelte Poststrukturalismus definiert sich als eine Strategie der Postmoderne, die Realität als sprachlich konstruiert versteht. Das heißt, dass "Bedeutungen nicht vor der Sprache existieren, also nicht das Ergebnis eines bereits vorhandenen, immer schon dagewesenen Gesellschaftskörpers sind, sondern, daß Bedeutungen durch die Sprache geschaffen werden." (Wartenpfuhl: 2000: 28) Zur Einführung siehe Münker/Roesler: 2000
[134] Vgl.: Hark: 2005: 296; Degele: 2008: 10
[135] Degele: 2008: 11
[136] vgl.: Perko: 2005: 15
[137] Kraß: 2003: 18
[138] Hark: 205: 285
[139] Sigusch: 1988: 187f., zit.n. Sielert: 2005:42
[140] Foucault: 1983
[141] Die Postmoderne "vereint unterschiedliche Theorien und Denkströmungen sowie ästhetische und politische Praktiken" (Dornhof: 284). Etwa seit den 60er Jahren beschäftigt sich die Postmoderne kritisch mit kulturellem und gesellschaftlichem Wandel. Sie setzt sich vor allem mit den "moderne[n] Oppositionen und Differenzen von Natur und Kultur, Subjekt - Objekt, Rationalität - Irrationalität, Hochkultur - Massenkultur, Mensch - Maschine, Körper - Geist" (Dornhof:290f) kritisch auseinander. Dabei versteht sich die Postmoderne nicht als Korrektur, sondern als Radikalisierung der Moderne, was Behrens folgendermaßen beschreibt:
"Die Postmoderne stellt die Frage von Macht und Herrschaft neu - sie betont die Unterschiede statt der Gegensätze. [...] So plädiert die Postmoderne für Toleranz und radikale Pluralität. [...] Postmoderne [vertraut] weniger auf Logik und Kontinuität, sondern setzt auf die Diskontinuität, die Kontingenz, den Zufall. Die Verunsicherung des postmodernen Menschen spiegelt dieser zurück, verwandelt in eine Strategie der Irritation. [...] Es gibt kein Original mehr, nur noch Zitat, die Postmoderne zitiert sich selbst. [...] So wird die postmoderne Welt als Text neu geschrieben im Sinne der Dekonstruktion." (Behrens: 2008: 84f, Hervorhebung im Original); Zur Vertiefung siehe: Engelmann: 2007; Bauman: 1992
[142] Tuider/Tietz: 2003: 160
[143] Hark: 2005: 298
[144] Foucault: 1978: 55
[145] Wagenknecht: 2007: 17
[146] Hark: 2005: 293
[147] Hartmann: 2002: 59
[148] McRuer: 2006: 7
[149] Hark: 2005: 295
[150] Hark: 2005: 285
[151] vgl.: Hark: 2005: 289
[152] Kraß: 2003: 20
[153] Tuider: 2004: 119
[154] Der Begriff Dekonstruktion geht zurück auf den französischen Philosophen Derrida und bezeichnet eine Strategie, "die binäre Gegenstände aufgreift und auf die Interdependenzen von Begriffen aufmerksam macht." (Wartenpfuhl: 2000: 30) Dekonstruktion untersucht soziale Ordnung auf sprachlicher Ebene und versucht Abhängigkeitsbeziehungen in binären Logiken zu erkennen (vgl.: Wartenpfuhl: 2000: 123). Zur Vertiefung siehe Engelmann: 2007
[155] vgl.: Degele: 2008: 54
[156] Butler: 1991: 200; Hervorhebung im Original
[157] vgl. ebd.: 200
[158] ebd.: 23
[159] Seidmann, S., übers. von und zit. n. Hark: 2005: 286
[160] Tuider/Tietz: 2003: 163
[161] Wagenknecht: 2007: 17
[162] Perko: 2005: 19
[163] Wagenknecht: 2007: 17
[164] ebd.
[165] Tuider/Tietz: 2003: 163
[166] Vgl.: Butler: 2001: 201ff
[167] Hoff: 2009: 191
[168] Degele: 2008: 53
[169] Tuider: 2008: 258
[170] Tuider: 2004: 118
[171] Degele: 2008: 35
[172] Perko: 2005: 27
[173] Perko: 2005: 28
[174] Tuider; 2004: 123
Inhaltsverzeichnis
Nach den Darstellungen der Queer Theory und der Disability Studies, soll im folgenden Abschnitt eine Betrachtung beider Forschungsrichtungen und ihrer zentralen Analysekategorien erfolgen. Dadurch sollen Ansatzpunkte herausgestellt werden für eine Verbindung beider Ansätze, die schließlich einer intersektionellen Perspektive unterzogen werden.
In den vorangegangenen Kapiteln habe ich bereits aufgezeigt, dass sowohl Geschlecht als auch Behinderung als gesellschaftliche Strukturkategorien zu bewerten sind. Das heißt, entlang dieser Kategorien finden Ein- und Ausschlüsse in/aus gesellschaftlicher Teilhabe statt.
Bei der Kategorie Geschlecht handelt es sich um eine Einteilung in zwei Gruppen: Männer oder Frauen. Dabei ist diese Trennung nicht nur dichotom, sondern auch hierarchisch zu verstehen.[175]Männer sind gesellschaftlich höher gestellt als Frauen. Das Männliche entspricht der Norm, das Weiblich wird verstanden, als die Abweichung von der Norm. Diese Differenzierung ist als historisch gewachsen und relativ stabil zu verstehen . Stabil bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Geschlecht eine relativ homogene Masse darstellt und den Menschen allgemein ganz klar bewusst ist, wie diese definiert ist - nämlich männlich oder weiblich und was es bedeutet, einem bestimmten Geschlecht zuzugehören. Diese Bedeutung wird durch das "doing gender" immer wieder neu produziert.
Bei der Kategorie Behinderung verhält es sich dagegen etwas komplexer: Behinderung wird als relativ und flexibel verstanden. Das liegt daran, dass Behinderung nicht so einfach zu definieren ist. LINTON macht dies mit folgendem Zitat noch einmal deutlich:
"For "disability" is the most labile and pliable of categories: it names thousands of human conditions and varieties of impairment, from the slight to the severe, from imperceptible physical incapacity to inexplicable developmental delay."[176]
Ich habe aufgezeigt, dass es keine allgemeingültige Definition von Behinderung gibt und dass Behinderung ein Zustand ist, der potenziell jeden Menschen im Laufe des Lebens betreffen kann, (besonders im Hinblick auf Alter). In Bezug auf die Kategorie Behinderung wirken nach KÖBSELL "gesellschaftliche Definitions- bzw. Ausgrenzungsprozesse, die an beeinträchtigten Körpern festgemacht werden und historischen und kulturellen Bedingungen - und damit Veränderungen - unterworfen sind"[177].
Auch wenn beide Kategorien unterschiedlich eng gefasst sind, kann festgehalten werden, dass Behinderung, Geschlecht und Sexualität "gesellschaftliche Zuschreibungen und performative Effekte diskursiver Praxen"[178] sind. Das heißt, sowohl Behinderung als auch Geschlecht und Sexualität gelten als soziale Konstrukte, die in sozialen Praxen (Sprechen, Handeln, etc) immer wieder neu hergestellt werden. Für die Kategorie Geschlecht hatte ich diesen Prozess bereits als das "doing gender" vorgestellt. Vereinzelt gibt es auch Vorschläge für ein Konzept des "doing handicap"[179], welches diesen Prozess des immer wieder Produzierenden auf die Kategorie Behinderung zu übertragen versucht.
Beide Kategorien beinhalten allerdings nicht nur in sich selbst eine Hierarchie (männlich/weiblich; nicht behindert/behindert), sondern auch untereinander. Das heißt, dass das weibliche Geschlecht nicht nur die Abweichung der männlichen Norm darstellt und Behinderung die Abweichung zur nicht behinderten Körpernorm, sondern dass Behinderung generell, unabhängig vom Geschlecht als die Abweichung von der männlichen beziehungsweise weiblichen Norm verstanden wird.[180]
Das hat zur Folge, dass behinderte Menschen in ihrem Geschlecht oft nicht wahrgenommen werden. Besonders behinderte Frauen sind von dieser Tatsache betroffen. Soziokulturelle Geschlechterrollen wie Ehefrau, Mutter etc. werden ihnen nicht anerkannt[181]. Dennoch besteht eine Parallele zwischen Weiblichkeit und Behinderung. Denn beide Kategorien werden als die Abweichung der Norm, Behinderung auch als das Fremde beschrieben und als minderwertig angesehen. Beiden Kategorien werden gleiche Eigenschaften zugeschrieben, wie die folgende Tabelle[182] verdeutlichen soll:
|
männlich |
behindert |
weiblich |
|
stark |
schwach |
schwach |
|
aktiv |
passiv |
passiv |
|
unabhängig |
abhängig |
abhängig |
|
selbständig |
unselbständig |
unselbständig |
|
mutig |
hilfsbedürftig |
hilfsbedürftig |
|
"hart" |
kindlich |
kindlich |
|
potent |
machtlos |
machtlos |
|
attraktiv |
unattraktiv |
attraktiv |
|
rational |
emotional |
|
|
Geist |
Körper |
Körper |
Wichtig ist festzuhalten, dass die Zugehörigkeit zu den Kategorien Behinderung und Frau den Ausschluss von der Teilhabe am gesellschaftlichen und ökonomischen Leben zur Folge hat[183].
Die Grundlage der Disability Studies und der Queer Theory bildet die Kategorie Körper. Die Disability Studies orientieren sich an dem als behindert wahrgenommenen Körper und die Queer Theory an dem geschlechtlichen Körper.
Ohne den Bezug auf den Körper können die Kategorien Behinderung und Geschlecht nicht gedacht werden, denn ohne Körper können wir uns weder Mann oder Frau noch behindert oder nicht behindert vorstellen. Dass heißt, beide Kategorien sind in den Körper eingeschrieben (durch Kleidung, Gestik, Schminke etc.) und bestimmen dadurch maßgeblich die Identität des Menschen. Denn am Körper festgemachte Merkmale werden mit einer gesellschaftlichen Erwartung und Bedeutung belegt, die dann erst die Kategorien Behinderung und Geschlecht/Sexualität als solche hervorbringt. Begegnen wir beispielsweise einer Person mit langen Haaren, schmalem Körperbau im Abendkleid, sagt uns unser soziokultureller Hintergrund, dass diese Merkmale auf das Geschlecht "Frau" zutreffen. Dementsprechend werden wir auf diese Person auch mit der Erwartung des weiblichen Geschlechts herantreten, sie als "Frau" anreden und somit durch den Sprechakt und den Umgang mit der Person in einer spezifischen Weise, diese Person als Frau erst herstellen. Analog funktioniert dieser Prozess zur Kategorie Behinderung. Damit sind "Körper und Identität eine untrennbare Einheit"[184], wobei der Körper in "wesentliches Medium und Handlungsort des Selbst"[185] darstellt. Die im vorangegangenen Punkt angesprochenen Hierarchien innerhalb und zwischen den Kategorien Geschlecht und Behinderung werden dementsprechend ebenfalls entlang des Körpers interpretiert. REISS stellt insbesondere für weibliche Körper fest, dass sie "zentral[e] Ort[e] der Inszenierung und Organisation genderbezogener Hierarchien"[186] bilden. In der postmodernen Gesellschaft spielt Schönheit eine bedeutende Rolle. Körper müssen gesund, fit und vor allem attraktiv sein. Körper sind dem Zwang zur Perfektion unterworfen. REISS geht dementsprechend weiter davon aus, dass weibliche Körper stark an die Vorstellungen von Schönheit gebunden sind und zwar stärker als behinderte Körper. Denn Frauen werden sexualisiert und Weiblichkeit mit Schönheit in Verbindung gesetzt. Weiblichkeit im Sinne dieser verkörperten Erotik ist im Kontext von Behinderung allerdings nicht möglich, da Behinderung als unschön und nicht sexy wahrgenommen wird. Identität wird demnach auch im Kontext von Schönheitsidealen produziert und normiert[187].
An dieser Stelle möchte ich auf einen interessanten Punkt in Bezug auf die Frage der sexualpädagogischen Arbeit hinweisen. KÖBSELL argumentiert, Behinderung wäre weiblich konnotiert. Schaut man sich die Tabelle von KÖBSELL noch einmal genau an, wird deutlich, dass Behinderung und Weiblichkeit in allen Punkten synonym gedacht werden, außer im Bereich Attraktivität. Auch REISS vertritt den Standpunkt, Behinderung würde im Bereich Erotik, Sexualität und Attraktivität grundsätzlich geschlechtsneutral gedacht. Meiner Meinung nach zeigt sich hier die Begründung für meine Annahme aus Kapitel 1, dass Sexualpädagogik für LSBT* mit Behinderung mit Stereotypen und Vorurteilen belegt ist und deshalb Unsicherheit produziert. Wenn es schon nicht möglich ist, Behinderung überhaupt geschlechtlich zu denken, scheint sich Sexualpädagogik von vornherein auf schwierigem Terrain zu befinden. Spielen dann auch noch sexuelle Lebensformen außerhalb der Norm eine Rolle, stehen Sexualpädagog_innen zusätzlich vor erschwerten Bedingungen.
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Disability Studies und der Queer Theory bildet die Kritik an Normen. Beide Forschungsrichtungen konzentrieren sich dabei auf die Kritik an Körpernormen. Die Queer Theory richten ihren Blick dabei auf geschlechtlich und sexuell von der Norm abweichende Körper, während die Disability Studies sich an als behindert bezeichnete Körper richten. Ich werde mich in meinen Ausführungen zu diesem Punkt vor allem an Arbeiten der Politologin HEIKE RAAB halten.
Die Disability Studies stützen sich auf das Foucault'sche Normalitätsdispositiv[188], das Behinderung als historisches Konstrukt darstellt. Im Kontext moderner Normalisierungsgesellschaften wird Normalität permanent zwanghaft durch institutionalisierte und nicht institutionalisierte Normen hergestellt. So sind beispielsweise "medizinische Definitionen von Behinderung bzw. diskriminierende gesellschaftliche Alltagsnormen [...] Praxen normalisierender Körpertechniken", die die "a-normalen" Körper erst hervorbringen und sie anschließend disziplinieren. MCRUER bezeichnet diese Prozesse in Anlehnung an die Zwangsheterosexualität beziehungsweise Zwangszweigeschlechtlichkeit nach BUTLER als "compulsory able-bodiedness" - also einen Zwang zum "Befähigt-Sein"/ zum "Nicht-Behindert-Sein". Ein Beispiel dafür ist das deutsche Schulsystem. Mittels der Klassifikation von Intelligenzquotienten werden Kinder in behindert und nicht behindert unterteilt. Diese Definition, die das behinderte Kind erst hervorbringt, dient im Nachhinein als Voraussetzung um das Kind in einer Sonderschule unterzubringen. Dort wird es entsprechend seiner "speziellen Bedürfnisse" gefördert, die ihm erst aufgrund der Klassifikation als "behindert" zugesprochen wurden.
RAAB kritisiert allerdings an Foucault, dass er die Mechanismen der Normalisierungsgesellschaft als für alle Menschen gleichverlaufend beschreibt, dabei finden "[d]ie unterschiedlichen dem Normalitätsdispositiv inhärenten asymmetrischen Stile und Systeme in denen Frauen, Männer, Homosexuelle und Behinderte ins Räderwerk der Norm geraten bzw. davon hervorgebracht werden, [...] keine Erwähnung."[189] Dementsprechend wirft sie den Disability Studies in ihrer Bezogenheit auf Foucault ebenfalls vor, dass diese das Verhältnis von Körpernormen, Geschlecht und Behinderung vollkommen unterbelichtet lassen.[190]
Auch die Queer Theory übt in der Tradition der Behindertenbewegung Kritik an Körpernormen. Auch sie stellen in Frage, dass - in ihrem Fall geschlechtlich - markierte Körper vorkulturellen Ursprungs sind. Queer Theory orientiert sich dabei ebenfalls an FOUCAULT, aber vor allem an JUDITH BUTLER und dem Konzept der Heteronormativität. Im Zentrum steht dabei die Analyse der Produktion, Organisation und Regulation von Sexualität und Geschlecht entlang der Kategorien Mann/Frau und Hetero-/Homosexualität. JUDITH BUTLER versteht Heteronormativität als Zwang zum Frau- beziehungsweise Mann-Sein und damit den Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit. Damit arbeitet BUTLER Geschlecht beziehungsweise Sexualität als ein Konstrukt heraus, welches Heterosexualität privilegiert. Als eine Möglichkeit, diese Norm zu destabilisieren, habe ich in Kapitel 3.4 die Paradosierung der Geschlechterdichotomie beschrieben.
Doch auch hier übt RAAB Kritik in Bezug auf die Kategorie Behinderung. Denn die heteronormative Ordnung verläuft RAAB zufolge nicht nur entlang der Kategorien Körper, Geschlecht, sondern auch der Kategorie Behinderung. Heteronormativität erzeugt nicht nur eine Vorstellung von weiblich oder männlich und Homosexualität beziehungsweise Heterosexualität, sondern auch ein generelles Verständnis von Sexualität und A-Sexualität beziehungsweise Geschlechtlichkeit und A-Geschlechtlichkeit.[191] Homosexualität gilt damit als Bedrohung der sexuellen Ordnung, Behinderung als eine "sexuell[e] und geschlechtlich[e] Seinsverfehlung"[192]. Demnach fallen behinderte Menschen auch aus der Geschlechterperformance nach BUTLER heraus. Die Zitation von Geschlecht und Sexualität und deren Dekonstruktion sind über Behinderung quasi nicht möglich. "Denn um ein Geschlecht dekonstruieren zu können, muss man erst über Geschlechtlichkeit verfügen"[193].
Ich möchte dies an einem Beispiel konkretisieren. Es handelt sich um das Mädchen Ashley und einen Beitrag aus der amerikanischen Fachzeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine"[194]. In diesem Fall ging es um ein von Geburt an schwer mehrfachbehindertes Mädchen. Die Eltern des zu diesem Zeitpunkt 6-jährigen Mädchens hatten ihre Ärzte darum gebeten, "das Wachstum und die sexuelle Entwicklung ihrer Tochter aufzuhalten"[195], was in einer "Hormontherapie, Gebärmutter- und Brustdrüsenentfernung"[196] mündete. Die Operation, wurde von den Ärzten vor allem durch eine erleichterte Versorgung des Kindes begründet:
""The primary benefit offered by growth attenuation is the potential to make caring for the child less burdensome and there for more accessible. A smaller person is not as difficult to move and transfer from place to place. Although this may seem to be an advantage that accrues to the caretakers rather than the child, it offers several distinct benefits to the child as well. A child who is easier to move will in all likelihood be moved more frequently. Being easier to move means more stimulation, fewer medical complications, and more social interaction.""[197]
Die Eltern von Ashley argumentierten hingegen, im Interesse des Kindes gehandelt zu haben.
"Sie heben hervor, dass Ashley ja nie das Leben einer erwachsenen Frau führen und somit ihre Gebärmutter und Brüste nie brauchen werde; insofern habe man Menstruationsbeschwerden und späteren Krebserkrankungen an den Geschlechtsorganen vorbeugen wollen. Um eine spätere Sexualisierung des Kindes zu vermeiden, sollten auch die Brüste nicht wachsen. Einer Schwangerschaft auf Grund von sexualisierter Gewalt [...] sollte mit der Entfernung der Gebärmutter ebenfalls präventiv begegnet werden."[198]
Der Fall Ashley zeigt in einer erschütternden Art und Weise auf, wie Behinderung als sexuelles Neutrum konstruiert wird und somit aus der heteronormativen Ordnung heraus fällt. MCRUER hat ebenso die Verwobenheit von Heteronormativität und der Norm der Nicht-Behinderung erkannt und stellt fest:
"compulsory able-bodiedness, which in a sense produces disability, is thoroughly interwoven with the system of compulsory heterosexuality that produces queerness: that, in fact, compulsory heterosexuality is contingent on compulsory able-bodiedness, and vice versa."[199]
In Anschluss an das Argument von MCRUER möchte ich ein zweites Beispiel aufzeigen, das in umgekehrter Richtung deutlich macht, wie nicht nur Heteronormativität durch Behinderung (mit-) konstruiert wird, sondern wie "compulsory abled-bodiedness" - also der "Zwang zur Nicht-Behinderung" durch Heteronormativität aufrecht erhalten wird.
Es handelt sich bei meinem Beispiel um die aktuellen Diskurse zu Trans*- und Intersexualität.
Transsexualität beschreibt Menschen mit eindeutigen körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Allerding fühlen sie sich psychisch einem Geschlecht zugehörig, welches nicht durch ihren eigenen Körper repräsentiert wird.[200]
Intersexualität beschreibt hingegen Menschen, die "sowohl männliche als auch weibliche Merkmale aufweisen. Dies kann [...] bedeuten, dass ein Individuum uneindeutige Genitalien besitzt, aber auch, dass es eindeutig erscheinende männliche oder weibliche Genitalien hat, jedoch nicht die entsprechenden Chromosomen."[201]
Beide Sexualitäten werden nicht als geschlechtliche Identitäten verstanden, sondern in Deutschland als "Krankheiten" definiert, die behandelt oder beseitigt werden müssen und somit zur Aufgabe der Medizin und Psychologie werden. Transsexualität beispielsweise ist in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) von 2011 unter dem Kapitel V "Psychische und Verhaltensstörung" unter dem Gliederungspunkt F64.0 als "Störung der Geschlechtsidentität" zu finden.[202] Auch der Intersexualität können einige Klassifikationen aus dem ICD-10 zugeschrieben werden. Zum Beispiel
E 25 = Adrenogenitale Störungen
E 34.5 = Androgenresistenz-Syndrom
E 28 = Ovarielle Dysfunktion
E 29 = Testikuläre Dysfunktion
Q 96 = Turner Syndrom
Q 97 = Anomalien der Genosomen bei weiblichem Phänotyp
Q 98 = Anomalien der Genosomen bei männlichem Phänotyp[203]
Diese Beschreibungen unterstreichen die heteronormative Annahme, dass Menschen sich ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt einem Geschlecht zuordnen (lassen) müssen und dieses ihr Leben lang beibehalten müssen. Andernfalls - wie hier im Beispiel von Intersesxualität und Trans*sexualität - zeigt sich, dass die Abweichung von der heteronormativen Norm verbunden ist mit Zuschreibungen von "Störung", "Krankheit" und damit einer Konstruktion von (körperlicher beziehungsweise psychischer) Behinderung. Gestützt wird dieses System nicht nur durch medizinische und gesellschaftliche Normen, sondern auch durch juristische Direktiven. In Deutschland gibt es das sogenannte "Transsexuellengesetz"[204], welches für trans*sexuelle Menschen zwei Optionen bereit stellt. Die sogenannte "kleine Lösung" ermöglicht Personen, ihren Namen entsprechend dem Geschlecht anzupassen, zu dem sie sich zugehörig fühlen. Die "große Lösung" hingegen würde bedeuten, nicht nur den Namen, sondern auch die körperlichen Merkmale dem Geschlecht anzupassen, dem sich die betroffene Person zugehörig fühlt. Beide Optionen sind von einer Verwobenheit von "compulsory abled-bodiedness" und "compulsory heterosexuality" durchzogen. Denn die Angleichung an die bevorzugte Geschlechtsidentität erfolgt nur unter bestimmten Bedingungen. So muss die betreffende Person mehrere Jahre ernsthaft "unter dem Zwang"[205] stehen, das Geschlecht ändern zu wollen, was psychologische Gutachten zur Folge hat. Nach dem die Person nach ICD-10 als "gestört" definiert wurde, kann ihr Körper dem des gewünschten Geschlechts angepasst werden - das heißt so operiert werden, wie ein Mann oder eine Frau vermeintlich auszusehen hat. Es geht dabei vor allem um die Anpassung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Dabei ist eine Voraussetzung, dass diese Menschen, die sich der Angleichung unterziehen, lebenslang unfruchtbar gemacht werden. Ich finde es erschreckend, in welcher - meiner Auffassung nach - grausamen Art auch in diesem Moment der (Wieder-) Herstellung der heteronormativen Ordnung Behinderung - durch eine Manipulation am Körper - hergestellt wird.
Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wie Herrschaftsverhältnisse in Bezug auf Behinderung und Geschlecht/Sexualität sich gegenseitig bedingen und speziell an diesem Beispiel noch einmal verdeutlichen, wie die Kategorien Behinderung, Sexualität und Geschlecht in den Körper eingeschrieben sind.
Diese drei Punkte sollten deutlich machen, wie ähnlich die Kategorien Behinderung, Sexualität und Geschlecht konstruiert werden. Außerdem bedingen sich die Mechanismen der "compulsory abled-bodiedness" und "compulsory heterosexuality" gegenseitig.
Deshalb schlussfolgere ich daraus, dass eine komplexere Betrachtung der dargestellten Kategorien und vor allem ihrer Verwobenheit und gegenseitigen Aufrechterhaltung notwendig ist, um die Kategorien umfassend zu verstehen, als auch die spezifischen Diskriminierungserfahrungen von LSBT* mit Behinderung nachzuvollziehen. Es geht darum, ein Konzept zu finden, das die Prozesse untersucht, die Körper in ihrer Gesamtheit und ihrer Vielfältigkeit zu devianten und nicht-normativen Körpern macht.
Im nächsten Kapitel möchte ich mit "Intersektionalität" ein Konzept vorschlagen, das meiner Auffassung nach großes Potenzial besitzt, diese bisherigen theoretischen Lücken zu schließen.
[175] Schildmann: 2007: 18
[176] Linton, Simi : 1998: vii
[177] Köbsell: 2010: 21
[178] Reiss: 2007: 51
[179] vgl.: Köbsell: 2010: 32
[180] vgl: ebd: 17
[181] vgl:Köbsell: 2010: 21
[182] ebd.: 23
[183] vgl.: Köbsell: 2010: 23
[184] Reiss: 2007: 53
[185] ebd.
[186] ebd.: 54
[187] Reiss: 2007: 56
[188] vgl.: Foucault: 1973
[190] vgl.: ebd.
[191] vgl.: ebd.
[192] ebd.
[193] Raab: 2010: 81
[194] Gunther/Diekema: 2006:, vgl.: Waldschmidt: 2010: 38
[195] Waldschmidt: 2010: 39
[196] ebd.: 38
[197] Gunther/Diekema: Attenuating Growth: 2006: 1016, zit. n. Waldschmidt: 2010: 39
[198] Waldschmidt: 2010: 39f
[199] McRuer: 2006: 2
[200] vgl.: Jensen: 2009: 134
[201] ebd.
[202] ICD-10-WHO 2011: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2011/block-f60-f69.htm
[203] ebd.
[204] Eigentlich: "Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen" vgl.: http://www.gesetze-im-internet.de/tsg/BJNR016540980.html#BJNR016540980BJNG000100311
[205] ebd.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Definition und Theoriegenese des Intersektionalitätskonzeptes
- 5.2 Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Intersektionalitätsansätze
- 5.3 Unterschiede in den Intersektionalitätsdebatten
- 5.4 Methodologie des Intersektionalitätskonzeptes
- 5.5 Intersektionale Kritik an den Queer Studies und den Disability Studies
In diesem Abschnitt möchte ich mich nun eingehend dem Intersektionalitäts-Konzept widmen. Zunächst werde ich beschreiben, was sich hinter dem Begriff "Intersectionality" verbirgt und anschließend die Theoriegenese sowie die Entwicklung der deutschen Diskussion zu Intersektionalität nachvollziehen.
Ausgehend davon werde ich intersektionale Kritik an der Queer Theory sowie den Disability Studies vorstellen und versuchen die Potenziale herauszustellen, die das Intersektionalitätskonzept für eine Verbindung der Kategorien Behinderung, Geschlecht, Sexualität und Körper bereit stellt.
Allgemein gefasst analysiert das Intersektionalitäts-Konzept die soziale Positionierung von Subjekten oder Gruppen als ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kategorien. Der Begriff "Intersection" verweist dabei auf die Überschneidung beziehungsweise Überkreuzung dieser verschiedenen Kategorien (aus dem Englischen: "to intersect" = sich schneiden; durchkreuzen). Wer in diesem Konzept die neueste, vollkommen ausbuchstabierte Strategie der Ungleichheitsforschung erhofft, muss allerdings enttäuscht werden. Dies hat zwei Gründe:
-
Bei dem Begriff Intersektionalität handelt es sich keineswegs um ein einheitliches Forschungsvorhaben beziehungsweise verweist er auf keine übereinstimmende Definition. Vielmehr handelt es sich um eine sehr dehnbare, zum Teil ambivalente und hybride Idee der Ungleichheitsanalyse, wie im nachfolgenden Kapitel ausgeführt wird.
-
Die Idee der Überschneidung verschiedener Kategorien ist zudem nicht neu. Auch wenn Intersektionalität derzeit als Zeichen eines "neu erwachenden Interesses an kritischer Gesellschaftstheorie"[206] gilt, gab es bereits seit den 1970er Jahren in Deutschland und den USA durch die Frauenbewegung vielfältige Debatten über die Kopplung von Gender mit weiteren Ungleichheit generierenden Kategorien wie Behinderung, Klasse, Ethnizität, Sexualität, etc.[207]
Der Begriff Intersektionalität "funktioniert mittlerweile vielmehr als eine Art Oberbegriff, unter dem verschiedene Vorschläge, wie gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse in ihrer Komplexität und vor allem Verflechtung erfasst werden können, subsumiert werden."[208] So beschreibt KATHY DAVIS Intersektionalität als "buzzword" - als ein neues Modewort innerhalb der Gender Studies, dessen Erfolg sie an vier Merkmalen festmacht: 1. Die Vagheit und Offenheit der inhaltlichen Konzeption, 2. die absolute Neuartigkeit des Konzepts 3. den fundamentalen und durchdringenden Betreff der Analyse von Machtverhältnissen und 4. den Anspruch, sowohl speziellen Interessen im Sinne der Betrachtung marginalisierter Gruppen gerecht zu werden als auch der allgemeinen Analyse von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen.[209]
NINA DEGELE und GABRIELE WINKER ebenso wie LESLIE MCCALL entdecken das methodische Potenzial des Konzeptes für eine empirische Analyse gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse, wobei DEGELE/WINKER eine praxeologisch orientierte Mehrebenenanaylse[210] vorschlagen und MCCALL sich auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der kategorialen Untersuchung konzentriert[211]. Beide Konzepte werde ich im Verlauf des Abschnitts genauer erklären.
Zunächst möchte ich mich den Gemeinsamkeiten aller Intersektionalitätsansätze widmen.
Gemeinsam ist allen Ansätzen der intersektionellen Analyse der Fokus auf gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse.
""Intersectionality" refers to the interaction between gender, race, and other categories of difference in individual lives, social practices, institutional arrangements, and cultural ideologies and the outcomes of these interactions in terms of power."[212]
Es geht also darum, Macht- und Herrschaftstechniken sichtbar zu machen und deren Bedeutung für die Positionierung von Individuen und Gruppen zu untersuchen.
Einstimmigkeit besteht zudem über die Herkunft des Begriffes. Verwurzelt ist er in der US-amerikanischen Frauenforschung beziehungsweise im US-amerikanischen Antidiskriminierungsrecht und geht zurück auf die amerikanische Juristin KIMBERLÉ CRENSHAW. Diese führte den Begriff 1989 ein, in ihrem Text "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine".[213] In diesem Text zeigt sie die spezifischen mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Frauen auf und kontrastiert diese mit den eindimensionalen Analysen der antirassistischen Politik und der feministischen Theorie anhand verschiedener Beispiele. Bei dem bekanntesten und meist rezipierten Beispiel handelt es sich um eine Klage von fünf Schwarzen Frauen gegen General Motors, die dem Unternehmen vorwarfen Schwarze Frauen zu diskriminieren, da seit 1964 keine Schwarzen Frauen mehr eingestellt wurden. Die Klage wurde vom Gericht zugunsten General Motors entschieden mit der Begründung, dass Schwarze Frauen keinen Anspruch haben, eine eigenständig zu schützende Gruppe darzustellen. Handlungsbedarf sah das Gericht nur entweder aufgrund von rassistischer oder sexistischer Diskriminierung, aber nicht der Kombination beider. Die Klägerinnen bestanden aber gerade auf diese spezifische Diskriminierungserfahrung als Schwarze und als Frauen.[214] CRENSHAW macht anhand dieses Beispiels deutlich, wie innerhalb marginalisierter Gruppen - in diesem Beispiel Schwarze und Frauen - wiederum Privilegierungen und Marginalisierungen zustande kommen, die bestimmte, mehrdimensionale Diskriminierungen letztendlich ausblenden. Die Juristin führt weiter aus, dass sich das Forschungsinteresse diskriminierter Gruppen immer an den Erfahrungen der privilegierten Mitglieder der jeweiligen Gruppe orientiert - das heißt, feministische Theorie orientiert sich an den Interessen Weißer Mittelschichtsfrauen, während die antirassistische Politik an Erfahrungen Schwarzer Männer anknüpft.[215] Demnach würden Schwarze Frauen mit ihren spezifischen Erfahrungen in beiden Gruppierungen außen vor bleiben, da beide Antidiskriminierungspolitiken diesen besonderen Verknüpfungen von Geschlecht und Rasse nicht gerecht würden. Entgegen dem Urteil des Gerichtes in der Klage gegen General Motors argumentiert CRENSHAW, dass Schwarze Frauen sich nicht einfach in einer der diskriminierten Gruppen subordinieren könnten und begründet dies folgendermaßen:
"These problems of exclusion cannot be solved simply by including Black women within an already established analytical structure. Because the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, any analysis that does not take intersectionality into account cannot sufficiently address the particular manner in which Black women are subordinated."[216]
Den Begriff "intersectionality" und die benannte "intersectional experience" verdeutlicht sie im Verlauf des Textes anhand der Metapher einer Straßenkreuzung:
"Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four directions. Discrimination, like traffic through an intersection, may flow in one direction, and it may flow in another. If an accident happens in an intersection, it can be caused by cars travelling from any number of directions, and sometimes, from all of them. Similarly, if a Black woman is harmed because she is in the intersection, her injury could result from sex discrimination or race discrimination."[217]
Dieser analytische Fokus, Diskriminierungserfahrungen nicht im Sinne einer additiven Mehrfachunterdrückung zu verstehen, bei der die jeweiligen Erfahrungen aufsummiert werden, sondern die - wie auch immer definierte - Kreuzung, Überlagerung beziehungsweise Überschneidung von Unterdrückungsverhältnissen in den Blick zu bekommen, ist bis heute konstant. So beschriebt Helma Lutz 2001:
""Ausgangspunkt...ist die Feststellung, dass Menschen sozusagen im Schnittpunkt (intersection) dieser Kategorien positioniert sind und ihre Identitäten, Loyalitäten und Präferenzen entwickeln.""[218]
Schließlich stellt eine der zentralen Gemeinsamkeiten in der Intersektionalitätsdebatte die Annahme dar, dass die untersuchten Strukturkategorien, einschließlich ihrer Bedeutungen kulturelle Konstrukte sind. Analog zu den Disability Studies und der Queer Theory ist die Kritik an vermeintlich natürlichen Kategorien und den damit verbundenen Erwartungen an eine Person verknüpft mit einer generellen Identitätskritik. Das heißt, die Homogenität einer Gruppe wird in Frage gestellt, wie es CRENSHAW deutlich gemacht hat. In einem intersektionellen Fokus gibt es keine stabilen Gruppenidentitäten, die unterstellen, jedes Gruppenmitglied würde dieselben Erfahrungen und Interessen teilen. Es besteht eine "Skepsis gegenüber jeglicher Form von Kategorisierung, die nunmehr unter Verdacht steht, die Wirklichkeit nur in reduktionistischer Form abbilden zu können."[219]. Damit gemeint sind die starren Einteilungen in Kategorien und die damit verbundene Binarität von Mann/Frau, Weiß/Schwarz, Hetero-/Homosexuell etc.
Diese Kritik an Gruppenidentitäten hat ebenfalls eine konsequente Individualisierung zur Folge. Denn die Annahme, dass es keine Eigenschaften oder Merkmale gibt, die eine Gruppe von Menschen gleichermaßen "auszeichnet", bedeutet im Rückkehrschluss, dass es auch keinen Menschen gibt, dessen Identität auf ein ausgewähltes Merkmal zurückgeführt werden kann. So gibt es beispielsweise keinen Menschen, der nur "Frau" ist, sondern gleichzeitig Mutter, alleinerziehend, Kollegin, Nicht-Behindert, Hispanic, Amerikanerin. Das Intersektionalitätskonzept zielt darauf eine Offenheit für genau diese Vielfalt an Identitätspositionen zu signalisieren:
"Intersectionality fit neatly in into the postmodern project of conceptualizing multiple and shifting identities. It coincided with Foucauldian perspectives on power that focused on dynamic processes and the deconstruction of normalizing and homogenizing categories."[220]
So übereinstimmend die verschiedenen Intersektionalitätsansätze in ihren Grundgedanken sind, so unterschiedlich sind sie vor allem in der tatsächlichen Konzeptualisierung des Zusammenspiels der unterschiedlichen Strukturkategorien und deren Verhältnis untereinander. Sind marginalisierte Positionen als Kreuzung im Sinne CRENSHAWS zu denken, als Verknüpfungen oder aber als Interdependenzen, wie WALGENBACH ET. AL.[221] vorschlagen?
Die am häufigsten und stark kontrovers diskutierte Frage ist die nach den zu analysierenden Kategorien. Umstritten ist dabei, ob überhaupt und wenn ja, wie viele Kategorien zur Analyse sinnvoll und notwendig sind. Im US-amerikanischen Kontext steht die Triade Rasse-Klasse- Geschlecht stets im Mittelpunkt der Untersuchung[222], während in der deutschen Debatte derzeit zwei Tendenzen zu beobachten sind: Zum einen gibt es Ansätze, die auf neue beziehungsweise weitere Kategorien fokussieren, wie bspw. Behinderung, körperliche Fitness beziehungsweise Attraktivität, oder sogar 12 Differenzlinien, wie sie HELMA LUTZ unterscheidet[223]. WALGENBACH ET AL weisen im Zusammenhang damit auf den Abstraktionsgrad der einzelnen Kategorien hin. So ist es fraglich, ob Kategorien wie sex und gender oder Rasse und Ethnizität als einzelnen Kategorien aufgeführt werden müssen oder zusammengefasst analysiert werden können. Dieser Fokus der ausdifferenzierten Aufzählung ist oft verbunden mit einer Kritik an Ansätzen, die weniger Auswahl treffen und somit "blind" gegenüber den vorgeschlagenen Marginalisierungen sind. Dieser Versuch die Komplexität sozialer Ungleichheit adäquat erfassen und konzeptualisieren zu können[224] birgt die Gefahr, so viel wie möglich Kategorien nennen zu wollen, die für eine Analyse unabdingbar sind und diesem Anspruch mit der Anführung eines "etc." gerecht werden zu wollen. Für JUDITH BUTLER stellt dieses "verlegene "usw.""[225] "ein Zeichen der Erschöpfung wie ein Zeichen für den unbegrenzbaren Bezeichnungsprozeß selbst"[226] dar. Demnach stellt diese Art Aufzählung einen Versuch dar, Menschen in ihrer Identität vollständig beschreiben zu wollen, was aber von Vornherein zum Scheitern verurteilt ist, da die Identität eben unbegrenzbare Beschreibungsmöglichkeiten liefert.
Dennoch möchte ich auf einen wichtigen Punkt hinweisen, der mit dieser ausdifferenzierten Aufzählung zusammenhängt. Ich stimme mit WEINBACH überein, dass eine größere Offenheit gegenüber den Kategorien einen besseren "Zugriff auf die soziale Wirklichkeit erlaubt"[227]. Denn eine Vielzahl an Kategorien beziehungsweise Identitätspositionen erlaubt es nicht nur, eine Person umfassender und komplexer wahrzunehmen, sondern ermöglicht es überhaupt erst zu erfassen, welche Kategorien tatsächlich einen Einfluss auf die Teilhabe des Menschen an der Gesellschaft haben, sprich: welche Kategorien tatsächlich Ungleichheit generieren. Denn die jeweiligen Kategorien können in unterschiedlichen Situationen für eine Person von unterschiedlicher Bedeutung sein, manche können je nach Zusammenhang stärker hervortreten oder gar verschwinden. Zudem können einige dieser Identitätspositionen für die betreffende Person wichtig sein, während sie für das Umfeld keine Bedeutung erlangen und umgekehrt. Ich möchte zur Erläuterung noch einmal auf das Beispiel der Frau aus Abschnitt 5.2 zurückkommen. Zur Erinnerung: Es handelt sich um eine Frau, von der als weitere Identitätskategorien die der alleinerziehenden Mutter, hispanischer Herkunft bekannt sind. Zudem ist sie Amerikanerin und Nicht-Behindert. In diesem Beispiel kann sich die Frau in ihrem Privatleben in erster Linie in ihrer Identität als alleinerziehende Mutter wahrnehmen, während sie von ihrer Nachbarschaft vielleicht vor allem als Frau mexikanischer Herkunft wahrgenommen wird. Aus diesen beiden Situationen erwächst zunächst keine soziale Benachteiligung. Wird diese Person in einem anderen Kontext betrachtet- beispielsweise Erwerbsarbeit - kann sich ein ganz anderes Bild entwickeln. So gerät vielleicht die Position der alleinerziehenden Mutter in den Vordergrund und verhindert, dass die Frau einem Beruf nachgehen kann, da sie keine Betreuung für ihr Kind findet. Eine Betreuung für das Kind kann sie deshalb nicht finden, da sie kein Geld hat, diese zu bezahlen. In diesem Setting ist die Position der alleinerziehenden Mutter somit zu einer Ungleichheitskategorie geworden. Demnach hat WEINBACH meines Erachtens nach Recht, wenn sie feststellt:
"Meiner Ansicht nach muss davon ausgegangen werden, dass personale Kategorien erst im Rahmen spezifischer sozialer Kontexte als Kategorien sozialer Ungleichheit aufscheinen (können). Der Fokus sollte von den personalen Kategorien abgewendet werden und auf die sozialstrukturellen Kontexte gerichtet werden."[228]
Die zweite Tendenz der deutschen Debatte zeigt sich in einer forschungsbedingt begründeten Begrenzung von Kategorien welche zumeist in der Übertragung der race-class-gender-Triade mündet.[229] So vertritt beispielsweise KLINGER die Ansicht, die Analyse von der Mikroebene der Subjektpositionen auf die Makroebene gesellschaftlicher Strukturen zu verlagern und die Triade Klasse-Rasse-Geschlecht als "Zentralkategorien der Gesellschaftsanalyse"[230] zu bestimmen. Dies begründet sie mit Bezugnahme auf eine kapitalistisch geprägte Gesellschaft folgendermaßen:
"Die Scheidemarke zwischen "spielerischen Differenzen" und "welthistorischen Herrschaftssystemen", d.h. zwischen Differenz und Ungleichheit liegt in ihrer Bezogenheit auf Arbeit. Klasse, Rasse und Geschlecht sind nicht bloß Linien von Differenzen zwischen individuellen oder kollektiven Subjekten, sondern bilden das Grundmuster von gesellschaftlich-politisch relevanter Ungleichheit, weil Arbeit und zwar namentlich körperliche Arbeit ihren Existenzgrund und Angelpunkt ausmacht."[231]
Mit SCHILDMANN möchte ich an dieser Stelle allerdings anmerken, dass auch die Kategorie Behinderung in den kapitalistischen Bezugsrahmen einzuschließen ist. Denn "die Klassifizierung eines Individuums als behindert ist dessen nicht erbrachte, an einem fiktiven gesellschaftlichen Durchschnitt gemessene Leistung."[232] So bildete bis 1985 der "Begriff der Minderung der Erwerbsfähigkeit [...] die Definition von Schwerbeschädigung"[233].
Die Triade class-race-gender kam in den späten 1970er/frühen 1980er Jahren in den USA auf durch die "Kritik an dem Mittelschichtbias und einem unreflektierten Ethnozentrismus"[234]. Ziel war es, die speziellen Unterdrückungserfahrungen von Schwarzen Frauen zu erforschen und das spezifische Verhältnis von Rasse und Geschlecht (und zunehmend Klasse) in der feministischen Theorie zu reflektieren. Seither erfolgte die Übernahme der Masterkategorien in Verbindung mit dem Intersektionalitätskonzept auch in die europäische Feminismusforschung. Die Übertragung auf den europäischen Raum ist nach KNAPP allerdings mit einer Bedeutungsverschiebung verbunden, da die Triade "in hohem Maße die Sozialstruktur und politische Kultur der USA reflektier[t]"[235] und somit "die Grenzen der Übertragbarkeit dieser Perspektive genauer aus[zu]loten"[236] sind. So ist beispielsweise der Begriff "Rasse" in Deutschland aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit derart "aufgeladen", dass er oft durch eine andere Schreibweise (kursiv, in Anführungszeichen oder im englischen Original) oder durch den Begriff "Ethnizität" ausgetauscht wird. Dieser scheint im Deutschen vor allem besser dazu geeignet, kulturelle Differenzen, Religion und das Anhalten an Traditionen besser zu fassen als "Rasse"[237].
Im Zusammenhang mit der Bedeutung und Definition verschiedener Kategorien stellt sich für WALGENBACH ET. AL. gleichzeitig die Frage der Epistemologie:
"Können Kategorien überhaupt für sich definiert werden, oder müssen sie nicht schon im Definitionsprozess intersektional bzw. interdependent perspektiviert werden? Zum zweiten: benötigen Definitionen nicht immer auch ein jeweiliges "konstitutives Außen" und produzieren insofern durch die Arbeit des Definierens selbst unerwünschte Ausgrenzungen?"[238]
Wie auch immer die Kategorien tatsächlich gefüllt werden und welche Kategorien für die Analyse gewählt werden ist letztendlich oft abhängig von Forschungsinteressen oder historischen, geografischen beziehungsweise kulturellen Faktoren oder individuellen Präferenzen.[239]
Nachfolgend möchte ich auf die Methoden intersektionaler Analysen eingehen.
Auch wenn Intersektionalität als Theorie seit ihrem ersten Auftreten vielfältig und kontrovers diskutiert wurde, gab es im Gegensatz dazu sehr wenige Diskussionen darüber, wie Intersektionalität genau untersucht werden sollte.[240] Ich möchte nachfolgend zwei Möglichkeiten dazu darstellen. Zum einen eine Variante zur Analyse der Beziehung von Ungleichheitskategorien und zum anderen eine Methodik, die sich der Analyse der verschiedenen Ebenen widmet, auf denen sich Intersektionalität auswirken kann.
Was das Verhältnis der Analysekategorien untereinander betrifft, so schlägt LESLIE MCCALL ein Modell drei verschiedener Ansätze vor, die je nach Untersuchungsgegenstand und Forschungsschwerpunkt angewendet werden können[241]. Ich werde versuchen jeden Ansatz durch ein Beispiel zu ergänzen, was in Zusammenhang mit den von mir untersuchten Kategorien Behinderung, Geschlecht und Sexualität steht.
Der antikategoriale Ansatz steht in der Denktradition der Dekonstruktion. Das heißt er nimmt grundsätzlich eine kritische Sichtweise auf jede Art von vorgegebener Kategorie ein. Diese Position wird dadurch begründet, dass die Annahme von vorgegebenen Kategorien eine Abgrenzung zu bestimmten Gruppen und damit Exklusionspraktiken darstellt.[242]Dementsprechend wird der Fokus darauf gelegt, wie Subjekte erst durch diese Kategorisierung sozial positioniert werden. Als Beispiele für diese Art der Untersuchung können die Debatten um die Kategorie Behinderung genannt werden, wie ich sie in Kapitel 2 beschrieben habe.
Der Intrakategoriale Ansatz hingegen fokussiert eine spezifische soziale Gruppe und untersucht Überschneidungen und Durchkreuzungen dieser Gruppe mit anderen sozialen Kategorien innerhalb verschiedener Kontexte. Die Untersuchung zielt dabei auf Gruppen, die von einer gesellschaftlichen Norm abweichen. Dieser Ansatz vermeidet zwar eine Dekonstruktion von Kategorien bleibt ihnen gegenüber allerdings kritisch. Problematisch an dieser Untersuchungsmethode kann werden, dass die analysierte marginalisierte Gruppe meist an der Normgruppe kontrastiert wird, was zur Folge haben kann, dass die untersuchte Gruppe zwar sehr differenziert beschrieben wird, die Normgruppe allerdings als homogene stabile Einheit konstruiert wird.[243] Als Beispiel aus dem Bereich der Sexualpädagogik (unter Bezug auf meine Untersuchungskategorien) könnte sich eine intrakategoriale Untersuchung mit dem Thema der Erfahrung von sexueller Gewalt bei Behinderten und Nicht-Behinderten beschäftigen.
Schließlich betrachtet der Interkategoriale Ansatz die Beziehungen zwischen bereits konstituierten sozialen Kategorien, wobei diese Kategorien selbst als different gefasst werden. Damit setzt dieser Ansatz Kategorien als Ungleichheit produzierende Orte analytisch voraus. Diese Möglichkeit ist damit komplexer und aufwendiger als die anderen beiden Ansätze.[244] In der sexualpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen kann sich eine interkategoriale Analyse beispielsweise mit dem Zeitpunkt des "ersten Mal" - also dem Zeitpunkt des ersten Geschlechtsverkehrs bei hetero- und homosexuellen Jugendlichen mit und ohne Behinderung, befassen. Wieder unter Fokussierung auf die Kategorien Behinderung, Geschlecht und Sexualität würde sich eine Fülle an möglichen Schnittstellen von Kategorien ergeben, die es zu analysieren gilt. Gehe ich von binären Kategorien aus, ergeben sich für meine Analyse demnach folgende Konstellationen:
-
Behindert - weiblich - homosexuell
-
Behindert - weiblich - heterosexuell
-
Behindert - männlich - homosexuell
-
Behindert - männlich - heterosexuell
-
Nicht-Behindert - weiblich - homosexuell
-
Nicht-Behindert - weiblich - heterosexuell
-
Nicht-Behindert - männlich - homosexuell
-
Nicht-Behindert - männlich - heterosexuell
Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie unterschiedlich die drei Ansätze in ihrem Aufwand und ihrem Nutzen für verschiedene Forschungsthemen sind. Meiner Auffassung nach ist es ein großer Verdienst von MCCALL diese Ansätze herausgearbeitet zu haben und damit Wissenschaftler_innen ein Instrument entsprechend ihrer Fragestellung in die Hand zu geben.
Eine Methode, die ich in Hinsicht auf die Ebenen der Ungleichheitsanalyse für ebenso gelungen halte, kommt von NINA DEGELE und GABRIELE WINKER.
Wie ich bereits beschrieben habe, wird die Verortung der Ungleichheitspositionen auf der Subjektebene zum Teil heftig kritisiert. CORNELIA KLINGER konstatiert, dass Ungleichheitsverhältnisse nur durch die Untersuchung auf gesellschaftlicher Ebene erschließbar sind, wobei sie, wie beschrieben, auf der race-class-gender Triade als Analysekategorien beharrt:[245]
"Es ist sinnlos, auf die sich überlagernden oder durchkreuzenden Aspekte von Klasse, Rasse und Geschlecht in den individuellen Erfahrungswelten hinzuweisen, ohne angeben zu können, wie und wodurch Klasse, Rasse und Geschlecht als gesellschaftliche Kategorien konstituiert sind."[246]
Die Konzeptualisierung einer intersektionalen Methodik von DEGELE/WINKER schlägt nun eine Analyse der Ungleichheitsverhältnisse sowohl auf der Mikro- als auch der Meso- und Makroebene vor und führt zusätzlich die Repräsentationsebene ein. Damit werden sowohl Ungleichheitsverhältnisse im Bereich gesellschaftlicher Strukturen, wie Institutionen und Organisationen (Makro- und Mesoebene) und im Bereich der Identitätskonstruktion (Mikroebene) untersucht, als auch ihre Verbindung mit sozialen und kulturellen Ideologien, Normen und Werten (symbolische Repräsentation).[247] Die zu untersuchenden Kategorien betreffend, schlagen sie vor, diese vom ausgesuchten Zugang abhängig zu machen. So ist es beispielsweise bei Sozialstrukturanalysen sinnvoll, die Kategorien möglichst klein zu halten, bei der Untersuchung von Identitätskonstruktionen sollte die Auswahl der Kategorien allerdings möglichst offen gehalten werden[248]
Ebenso wie WEINBACH gehen DEGELE/WINKER in Anlehnung an BOURDIEUS Theorie der Praxis[249] davon aus, dass sich die Bedeutung von sozialen Kategorien erst in bestimmten Kontexten zeigt. Das heißt auch, dass Identitäten, Repräsentationen und Strukturen nicht nur durch soziale Praxen (verstanden als "das auf Körper und Wissen basierte Tun von Handelnden - das auch Sprechen einschließt"[250]) hervorgebracht werden, sondern diese auch wieder neu konstruieren.[251]
DEGELE/WINKER gelingt es mit dieser "Mehrebenenanalyse" meiner Auffassung nach bisher am besten, die Komplexität des Intersektionalitätskonzeptes methodisch greifbar zu machen.
Ausgehend von den bisherigen theoretischen und methodischen Ausführungen, möchte ich nun diskutieren, wie eine Analyse der Kategorien Behinderung, Sexualität, Geschlecht und Körper, wie sie bisher durch die Disability Studies und die Queer Theory stattgefunden hat, durch eine intersektionale Perspektive sinnvoll ergänzt werden kann.
Ich habe bereits aufgezeigt, dass Behinderung als mehrdimensionale Kategorie bisher nicht in den Disability Studies in den Blick genommen wurde. Die Fokussierung auf Behinderung als Masterkategorie schließt andere Unterdrückungsmechanismen aus der Forschung aus und Sexualität beziehungsweise Geschlecht werden in Form eines biologistisch binären Systems allenfalls als gesondertes Feld innerhalb der Sonderpädagogik betrachtet. Auch den Queer Studies ist es bisher nicht gelungen, den Zusammenhang von Behinderung, Geschlecht und Sexualität systematisch zu theorisieren. Dabei haben sich innerhalb der Behindertenbewegung und der Frauenbewegung seit den 1970er Jahren Stimmen gemehrt, die auf die spezifischen Zusammenhänge hingewiesen haben. Aus heutiger Sicht können diese Beispiele als erste intersektionale Ansätze innerhalb der jeweiligen Zusammenhänge verstanden werden.
Behinderung, Sexualität und Geschlecht sind zentrale gesellschaftliche und hierarchische Differenzierungsprinzipien, die nicht getrennt voneinander als Analysekategorien gedacht werden sollten, sondern in Beziehung zueinander stehen. Deshalb muss eine Forschung über Behinderung mehrdimensional erfolgen und analysiert werden, inwieweit Behinderung durch Sexualität und Geschlecht konstituiert wird und umgekehrt. Dieses Potenzial hat das Intersektionalitätskonzept. Denn es handelt sich um ein Analysemodell, das vielfältige Kategorien in einer nicht-hierarchischen Anordnung untersucht. Das bedeutet, es ist in der Lage, die Verwobenheit der verschiedenen Strukturkategorien Behinderung, Geschlecht und Sexualität zu untersuchen, ohne dabei eine als Masterkategorie in den Vordergrund zu stellen.
Ein weiterer Punkt, an dem Intersektionalität an die Disability Studies und die Queer Theory anknüpft, ist die Identitätskritik. Doch anders als Disability Studies und Queer Theory, richtet sich die Kritik der Intersektionalität nicht an einzelne Identitätspositionen, sondern konzentriert sich auf die komplexe Verwobenheit und Vielfalt innerhalb und zwischen Kategorien. Mit der Dekonstruktion bisher stabil gedachter Gruppenidentitäten gelingt es Intersektionalität damit auch neue Möglichkeiten der Positionierungen für Menschen zu schaffen. Für eine intersektionale Perspektive bedeutet Identität immer Differenz im Sinne von Verschiedenheit. Jede Identität setzt sich aus vielen unterschiedlichen Positionierungen zusammen, die je nach Kontext anders gewichtet sein können. Demnach kann es, anders als in den Disability Studies, in denen Behinderung die Ungleichheit generierende Kategorie darstellt, in einer intersektionalen Perspektive dazu kommen, dass Behinderung gar keine Rolle für Ausschließungsprozesse spielt. Damit gelingt Intersektionalität gleichermaßen eine Perspektive auf Differenz außerhalb von hierarchisierenden Binaritäten und ermöglicht eine Hinwendung zu Verständnis einer positiven, schöpferischen Vielfalt.
Als Weiterentwicklung für den wissenschaftlichen Diskurs zu Behinderung sieht RAAB zudem, dass Intersektionalität eine stärkere Verbindung zu den Kultur- und Geisteswissenschaften schafft und eine Entkoppelung von den subjekt- und handlungszentrierten Wissenschaften.[252]
Nach dieser ausführlichen Darstellung des Intersektionalitätskonzeptes und seiner Verbindung mit den Queer Studies beziehungsweise Disability Studies möchte ich ebenso wie in den vorangegangenen Kapiteln die wichtigsten Punkte zusammenfassen:
-
Bei aller Ambiguität und Offenheit des Konzeptes, halte ich Intersektionalität dennoch als äußerst fruchtbar für eine Untersuchung von Machtstrukturen und die Analyse von multiplen Diskriminierungen. Denn diese Offenheit ermöglicht es, immer wieder "für neue mögliche Auslassungen, Entnennungen und Exklusionen sensibel zu bleiben"[253]. Egal wie die Kategorien und Ebenen in die Analyse einbezogen sind, bleibt Intersektionalität ein Instrument, um das komplexe Zusammenspiel von Machtstrukturen, Marginalisierung und Privilegierung zu untersuchen. Zudem verstehe ich Intersektionalität ebenso wie Queer Theory und Disability Studies als ein trans- beziehungsweise interdisziplinäres Projekt, was die Analyse der unterschiedlichsten Zusammenhänge in den verschiedensten Themenfeldern ermöglicht.
-
Intersektionalität kann sowohl als Theorie der Ungleichheitsforschung verstanden werden als auch als Methodik für die wissenschaftliche Empirie. Dies haben McCall mit ihren verschiedenen Ansätzen zur kategorialen Analyse und Degele/Winker mit ihrer Mehrebenenanalyse meines Erachtens eindrucksvoll aufgezeigt. Im Gegensatz zur Queer Theory, die "verstören [soll], anstatt theoretische, methodische oder disziplinäre Sicherheiten zu schaffen"[254] und den Diability Studies, die ebenso kaum methodische Vorschläge liefern[255], Behinderung oder Geschlecht/sexuelle Orientierung als Konstruktionen zu untersuchen, schafft es das Intersektionalitätskonzept, ein theoretisches "Werkzeug" zu sein, um nicht nur bestimmte Kategorien wie Behinderung oder Geschlecht zu dekonstruieren, sondern auch in ihrer Interdependenz und Verwobenheit zu analysieren.
-
Das Intersektionalitätskonzept zeigt im Gegensatz zu den Disability Studies und der Queer Theory auf, dass Praxen des Ein- und Ausschließens nicht durch die Analyse einer Masterkategorie ausreichend erfasst werden können.
-
Das Intersektionalitätskonzept hinterfragt in postrukturalistischer-dekonstruktivistischer Weise die Natur/Kultur- Dichotomie[256] von Kategorien und ist damit in der Lage pädagogische Konzepte wie Integration oder auch Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Pädagogik zu hinterfragen. Denn Integrationspädagogik beispielsweise geht von natürlich vorhandenen behinderten Körpern aus, die in die gesunde Mehrheitsgesellschaft integriert werden sollen. Damit werden Menschen in homogenisierten Gruppen zusammengefasst und entlang vermeintlich natürlicher Differenzlinien normiert. Ebenso führt die Einteilung in verschiedene Disziplinen (Sonderpädagogik oder Migrationspädagogik) dazu, dass Menschen auf ein bestimmtes identitätsstiftendes Merkmal reduziert werden.
-
Für die pädagogische Arbeit halte ich für besonders wichtig, dass das Intersektionalitätskonzept, mehr noch als Queer Theory und Disability Studies, Differenzen nicht nur zwischen den Kategorien sondern auch innerhalb dieser aufzeigen. Damit meine ich nicht nur die Möglichkeit Ungleichheiten zwischen Menschen auszumachen, sondern ebenso bedeutend zeigt Intersektionalität die Verschiedenheit von Menschen und provoziert mit dem Verschieben von Grenzziehungen und der Auflösung eindeutiger Identitäten. Damit halte ich Intersektionalität für eine positive Herausforderung an die Pädagogik.
Nachdem nun ausführlich die Bedeutung der intersektionalen Theorie für die Analyse multipler Diskriminierung dargestellt wurde, geht es anschließend darum zu erarbeiten, wie eine intersektionale Perspektive in der praktischen pädagogischen Praxis eingenommen werden kann.
[206] Soiland: 2008
[207] vgl.: Walgenbach et. al.: 2007: 27ff ; Davis (2008b): 20
[208] Oloff: 2010: 328
[209] Davis: 2008a: 67fff
[210] Degele/Winker: 2009
[211] McCall: 2005
[212] Davis:2008a: 68
[213] Crenshaw: 1989
[214] Crenshaw: 1989: 141ff
[215] vgl.: Crenshaw: 1989: 140
[216] ebd.
[217] Crebshaw: 1989: 149
[218] Lutz: 2001: 222, z.n. Weinbach: 2008: 172
[219] Soiland: 2008: http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/694/702
[220] Davis: 2008a: 71
[221] Walgenbach et al: 2007
[222] vgl.: Davis: 2008b: 24
[223] vgl.: Weinbach: 2008: 172
[224] Soiland: 2008: http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/694/702
[225] Butler: 1991: 210
[226] ebd.
[227] Weinbach: 2008: 174
[228] ebd.; Hervorhebung im Original
[229] vgl.: Davis: 2008b: 22ff; Walgenbach et al: 2007: 42
[230] Klinger: 2003: 26
[231] ebd.
[232] Schildmann: 2004: 20f
[233] ebd.: 21
[234] Knapp: 2005: 69
[235] Knapp: 2006: http://www.univie.ac.at/gender/fileadmin/user_upload/gender/abstracts_ringvorlesung/Knapp.doc.
[236] ebd.
[237] Davis: 2008b: 24
[238] Walgenbach et al:2007:15
[239] vgl.: Walgenbach et. al.: 2008: 42f
[240] McCall: 2005: 1771
[241] McCall: 2005: 1773fff
[242] ebd.: 1777
[243] ebd.: 1783
[244] ebd.: 1784fff
[245] Klinger: 2003: 23, z.n. Weinbach: 2008: 172
[246] Klinger: 2003: 25
[247] Degele/Winker: 2009: 18ff
[248] ebd.: 2008: 195
[249] vgl.: Bourdieu/Wacquant: 1996; Bourdieu: 1976
[250] Degele/Winker: 2009: 66
[251] ebd.
[252] Raab: 2007: 143
[253] Lutz/Vivar/Supik: 2010:12
[254] Degele: 2008: 11
[255] Mit Ausnahme des partizipativen Ansatzes, vgl: Flieger: 2005; Flieger/Schönwiese: 2007
[256] vgl.: Raab: 2007: 143
Inhaltsverzeichnis
- 6.1 Gender Mainstreaming - Organisationsentwicklung zur Gleichstellung von Frauen und Männern
- 6.2 Gender Mainstreaming als "Stabilisierung von Marginalisierungsprozessen"? - Kritik am Konzept
- 6.3 Gender Mainstreaming und Sexualpädagogik
- 6.4 "Intersektionales Mainstreaming"
- 7 Intersektionales Mainstreaming in der sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung
In diesem Abschnitt möchte ich schließlich ein Konzept vorstellen, welches die intersektionale Perspektive in der praktischen pädagogischen Arbeit festigen soll. Dazu werde ich zunächst den Ursprung dieses Konzeptes - das "Gender Mainstreaming" vorstellen, um zu verdeutlichen, auf welchen Ideen das "Intersektionale Mainstreaming" aufbaut. Dieses werde anschließend in Anlehnung an SCAMBOR/BUSCHE (2009) darstellen. Darauf berufend möchte ich letztlich eine Möglichkeit der intersektionalen Sexualpädagogik vorschlagen.
"Gender Mainstreaming ist eine Europäische Gleichstellungsstrategie, die die Geschlechterperspektive in alle "...Maßnahmen auf allen Ebenen und auf allen Stadien durch ihre Akteur_innen, die normalerweise in politische Entscheidungsprozesse beteiligt sind" integriert. Gender Mainstreaming fördert die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Die Gleichstellungsperspektive konzentriert sich auf zwei Aspekte: " die soziale Konstruktion der Geschlechter und die Beziehung zwischen den Geschlechtern.""[257]
Gender Mainstreaming setzt sich aus den Wörtern "gender" und "Mainstream" zusammen. "Gender", wie bereits an früherer Stelle beschrieben, steht für das soziale Geschlecht und wird als englische Bezeichnung auch im Deutschen Diskurs übernommen. Während das Substantiv "Mainstreaming", abgeleitet vom englischen "Mainstream", so viel wie "Hauptrichtung" bedeutet, soll das Verb "mainstreaming" jene Prozesse beschreiben, die dazu führen, eine Mehrheit - hier in Bezug auf Gender-Fragen - entstehen zu lassen.[258] Wichtig ist, dass Mainstream als das, was die Mehrheit denkt oder tut, verstanden wird, im Sinne des " dominierenden Teils der Gesellschaft, der die alltäglichen Normen definiert. Das kann zahlenmäßig eine Minderheit sein, die jedoch die Mehrheit der Macht hat."[259] In Bezug auf die Gender-Problematik kann man davon ausgehen, dass der Mainstream momentan patriarchal strukturiert ist und Gender Mainstreaming versucht "Gender-Fragen - d.h. Fragen des sozialen Geschlechts in seiner Konstruiertheit - im Mainstream Eingang finden und zum integralen Bestandteil des Mainstreams"[260] werden zu lassen. Gender Mainstreaming wurde kreiert als ein Instrument der Organisations- und Personalentwicklung und hat den "Anspruch, über die bisherige Gleichstellungspolitik hinauszugehen und die Geschlechterverhältnisse in Organisationen grundlegend neu zu gestalten."[261]
DOBLHOFER/KÜNG formulieren in ihrem Praxisbuch "Gender Mainstreaming" folgende sechs Gleichstellungsziele, die mittels Gender Mainstreaming erreicht werden sollen:
" 1 Gleichberechtigte Teilhabe an wichtigen Gütern
2 Adäquate Teilnahme an Gestaltung und Entscheidung
3 Auflösung der geschlechterstereotypen Rollenerwartungen
4 Struktur und Kultur ohne Geschlechterstereotype gestalten
5 Ausgeglichene Verteilung von Belastungen
6 Geschlechtergerechte Verteilung der öffentlichen Mittel und staatlichen Leistungen"[262]
Für Deutschland wurde die Gleichstellung von Frauen und Männern als Querschnittsaufgabe erstmals 1998 in der Koalitionsvereinbarung der damals rot-grünen Bundesregierung festgelegt. Seit dem erfolgten erste Schritt zur Umsetzung auf der Länderebene. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen sind seit 2000 mit Gender Mainstreaming beschäftigt.[263]Nach über einem Jahrzehnt ist die Gleichstellung von Frauen und Männern allerdings noch lange nicht erreicht.[264]
Da Gender Mainstreaming auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen stattfinden soll (Gleichstellung im Beruf, gleiche Behandlung und gleiche Chancen für Mädchen und Jungen in Schulen, Anpassung von Elternzeit, etc.) und Gleichstellung damit ein vielschichtiges Thema ist, gibt es auch keine "Masterstrategie", die im Gender Mainstreaming umgesetzt werden könnte. Jede Organisation braucht spezifische Methoden und Instrumente, um Gleichstellung in ihren Strukturen zu verwirklichen. Einige haben SCHAMBACH/BARGEN vorgeschlagen.[265]
6.2 Gender Mainstreaming als "Stabilisierung von Marginalisierungsprozessen"[266]? - Kritik am Konzept
Der Gleichstellungsansatz weckt allerding nicht nur Begeisterung. Immer mehr Kritiker_innen betonen die Gefahren, die hinter diesem Ansatz lauern. Ich möchte hier die wichtigsten Punkte vorstellen, die ich für den Zusammenhang zu meinem Thema für relevant halte.
Von vielen Kritiker_innen wird konstatiert, dass sich im Gender Mainstreaming die Grundannahme der "natürlichen" Zweigeschlechtlichkeit wieder findet und an Heteronormativität orientiert bleibt. Die Konstruiertheit des "sex" steht vollkommen außen vor. So entpuppt sich Gender Mainstreaming nach WETTERER ""bei genauerer Betrachtung recht schnell als Re-Aktivierung tradierter zweigeschlechtlicher Denk- und Deutungsmuster (...)und nicht als deren Verabschiedung oder gar Unterminierung""[267]Mit dem Versuch Frauen und Männer gleich zu stellen, werden stets bestimmte Gruppen als Frauen und Männer angesprochen und als diese identifiziert. Um sie gleichzusetzen, werden Männer und Frauen miteinander verglichen und damit wiederum erst als diese hergestellt. Damit gelingt es Gender Mainstreaming nicht Geschlecht zu dekonstruieren, im Gegenteil: "Indem Gender Mainstreaming Geschlecht überall als eine Beobachtungskategorie einführt (in jeder Organisation, bei jeder Maßnahme), bekräftigt es die Annahme einer "Omnirelevanz" der Geschlechterdifferenz. Diese Annahme besagt, dass es kein soziales Handeln gibt, in dem nicht "doing gender" stattfindet."[268]
Damit verbunden werden andere gesellschaftliche Machtdimensionen ausgeblendet. Während formal eine Gleichstellung intendiert wird, handle es sich tatsächlich um eine (Re-)Produktion von Machtungleichheit. Das bedeutet, dass z.B. nur bestimmte Interessen im Gender Mainstreaming umgesetzt werden. So gelangen nach Rosenstreich nur "Frauen der Dominanzkultur"[269] in den Mainstream. Ausgrenzung, Zugehörigkeit sowie Ressourcenzugänge erfolgen aber aufgrund verschiedenster Merkmale von Menschen. Es ist fraglich, welche davon tatsächlich im Gender Mainstreaming erfasst werden.[270]
Nach SCAMBOR/BUSCHE schafft Gender Mainstreaming "es nicht, die multikomplexen Lebenssituationen von Menschen zu erfassen, die nicht Teil der "Mainstream"-Gesellschaft oder der dominanten führenden Gruppe sind."[271]
Wie verhält es sich nun in Bezug auf das von mir untersuchte Feld der sexualpädagogischen Arbeit?
Im Anschluss an die eben erwähnte Kritik konstatiert SIELERT, dass Sexualpädagogik nicht umhin kommt "die in der feministischen Geschlechterforschung herausgearbeitete heterosexuelle Matrix der Dreieinigkeit von Sex, Gender und Begehren als wesentliche Stütze der Zweigeschlechtlichkeit zu thematisieren."[272] Er weist erneut darauf hin, dass Menschen nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch durch den Zwang sich überhaupt einem Geschlecht zuordnen zu müssen, diskriminiert werden.[273] Daraus schlussfolgert er, "Heterosexualität, Generativität und Kernfamilie zu "ent-naturalisieren" und Sexualpädagogik daraufhin zu überprüfen, inwiefern sie die Möglichkeit zur selbstbestimmten Lebensführung einschränkt, wenn durch ihre Intentionen und Maßnahmen explizit oder implizit nahe gelegt wird, heterosexuell und in Kernfamilien mit leiblichen Kindern zu leben."[274] Nach SIELERT geht es nicht nur darum, die dichotome Geschlechterordnung in Frage zu stellen, sondern auch die Bipolarität der sexuellen Orientierungen Hetero- und Homosexualität in den Blick zu bekommen sowie für vielfältige Lebensweisen und Familienformen einzutreten.[275] Deshalb schlägt SIELERT eine geschlechtssensible Arbeit innerhalb der Sexualpädagogik vor, die eine möglichst große Offenheit gegenüber Vielfalt und die Fähigkeit fördern soll, sich auf jede/n Adressat_in einzulassen.
Auch wenn es SIELERT gelingt, "Gender Mainstreaming" auf eine vielfältige Sexualpädagogik auszudehnen, indem er eine dekonstruktivistische Perspektive auf Geschlecht behält, so ist diese Strategie meiner Meinung nach immer noch unzureichend um Machtverhältnisse außerhalb der Kategorie Geschlecht/Sexualität zu berücksichtigen. So sagt die Offenheit gegenüber der Vielfalt sexueller Identität nichts über den sexualpädagogischen Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund aus oder über Menschen mit Beeinträchtigung.
Eine Strategie, die sich meiner Meinung nach sehr gut eignet, diese Lücken zu schließen, möchte ich nun genauer vorstellen.
Bei dieser Strategie handelt es sich um einen Implementierungsprozess der intersektionalen Perspektive in die pädagogische Praxis. Sie wurde 2009 von SCAMBOR und BUSCHE entwickelt und stützt sich im Wesentlichen auf einen Implementierungsplan für die institutionalisierte Kinderbetreuung.[276]
Intersektionales Mainstreaming baut auf fünf Kernelementen auf, die keinen abgeschlossenen Prozess bilden, sondern spiralförmig gestaltet werden sollten (siehe Grafik).
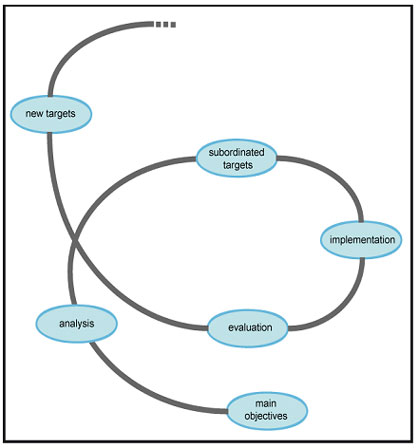
Quelle: Scambor/Krabel: 2008 vgl.: Scambor/Krabel: 2008: http://www.genderloops.eu//files/3699beadb445035efa18dae6c06f8fe6.pdf
Es handelt sich dabei in idealtypischer Abfolge um die
-
"Formulierung der Hauptziele,
-
Intersektionale Analysen,
-
Beschreibung der Teilziele
-
Implementierung von Maßnahmen
-
Evaluation"[277]
Die Grundideen bauen auf dem Konzept des Gender Mainstreaming auf, werden aber um die intersektionale "Brille" ergänzt. Intersektionales Mainstreaming ist demnach ein Prozess, "in dem sich eine Organisation (ein Programm, Module etc.) mit einer vorherrschenden hegemonialen Kultur (z.B. überwiegend weiße, männliche, heterosexuelle Praktiken und Werte), die Ausschlüsse produziert und Diskriminierung aufrecht erhält, in eine Organisation verwandelt, die mit diesen Praktiken kritisch umgeht oder diese sogar auf einer individuellen und strukturellen Ebene in Richtung weniger Dominanz und mehr sozialer Gerechtigkeit verändert"[278]
Das intersektionale Mainstreaming ist in quasi jeder Organisation anwendbar und gestaltet sich ähnlich wie das Gender Mainstreaming als eine "top-down"-Strategie, die zwar von der Leitungsebene einer Organisation ausgeht, um einen großen Teil der Verantwortung von den Mitarbeiter_innen zu nehmen, aber dennoch auf dem Engagement aller Beteiligten einer Organisation aufbaut.[279]
Für das intersektionale Mainstreaming bestehen SCAMBOR/BUSCHE darauf, die Hauptzielsetzung - also einen kritischen Umgang mit Diskriminierungspraktiken und Herstellung von Gerechtigkeit - für ein klares Interessenfeld zu definieren. Anschließend erfolgt die Analyse der Bereiche, in denen Intersektionalität umgesetzt werden soll. Diese Analyse soll zwar so komplex wie möglich, aber dennoch überschaubar gestaltet werden.[280]SCAMBOR/BUSCHE erkennen folgende vier Bereiche, die relevant für die pädagogische Praxis sind:
-
Institutionelles/Organisatorisches Bezugssystem
In diesem Bereich gilt es vor allem zu erkunden, über welche finanziellen, zeitlichen und strukturellen Ressourcen eine Organisation verfügt, um ein intersektionales Mainstreaming-Programm zu implementieren. Die Philosophie der Organisation spielt in so fern eine wichtige Rolle, als dass ein solcher Gestaltungsprozess innerhalb einer Organisation nur dann fruchtbar sein kann, wenn alle Akteur_innen die Motivation besitzen, Veränderungen zu bewirken und gleichermaßen an der Verwirklichung mitarbeiten.[281] Zu guter Letzt sollte untersucht werden, mit welcher Art pädagogischer Arbeit sich die Institution beschäftigt, denn "Kurzzeit-Pädagogik, soziale Gruppenarbeit, Schulprojekte und andere Formen bieten unterschiedliche Möglichkeiten und Grenzen."[282]
-
Belegschaft
Diese Analyse teilt sich in zwei Bereiche und zwar die strukturelle und die Teamanalyse. Strukturell ist die Aufteilung der pädagogischen Arbeit interessant, das heißt: welche Mitarbeiter arbeiten vorwiegend in welchen Bereichen? (gibt es beispielsweise eine Einteilung der Zuständigkeiten nach Migrationshintergrund? Oder werden bestimmte Themen/Arbeit ohne besondere Begründung vorwiegend von Frauen erledigt?)
Die Teamanalyse zielt auf die Zusammensetzung des Teams. Es ist wichtig herauszufinden, welchen sozialen Gruppen die Teammitglieder angehören. Denn eine stark homogene Gruppe wird wahrscheinlich eher Schwierigkeiten in der Umsetzung eines intersektionalen Programms besitzen, als ein heterogenes Team. Ebenso ist die Frage nach der Zusammenarbeit ein wichtiger Ansatzpunkt und in Zusammenhang mit der Organisationsphilosophie spielen natürlich die Analysen der Einstellungen der Teammitglieder zu bestimmten Themen und der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der eigenen gesellschaftlichen Positionierung eine wichtige Rolle.
-
Teilnehmer_innen
Die Adressat_innen eines intersektionalen Programms stehen natürlich im Mittelpunkt. Wichtig ist es sich an Interessen und Ressourcen der Teilnehmer_innen zu orientieren. SCAMBOR/BUSCHE verweisen darauf, dass es wichtig ist, die Selbstdarstellungen der Kinder und Jugendlichen zu respektieren. Ebenso ist eine Voraussetzung für das Gelingen des Mainstreaming-Programms, die Anerkennung aller Teilnehmer_innen in ihrer Individualität und die Vermeidung von Einordnung in Stereotypen.
-
Inhalt und Methoden
Wie beim Gender Mainstreaming sind auch in intersektionalen Programmen die möglichen Inhalte und Methoden vielfältig und hängen zum Beispiel von der Zielsetzung oder den Interessen der Teilnehmer_innen ab.
Um die Hauptzielsetzung verwirklichen zu können, sollen nach der intersektionalen Analyse konkrete Etappenziele definiert werden. Sinnvoll ist es nach SCAMBOR/BUSCHE lang- und kurzfristige Ziele zu setzen.
Für das generelle Gelingen einer Umsetzung des "intersektionalen Mainstreamings" und für die Formulierung der Zielsetzungen, ist es notwendig, den Intersektionalitätsgedanken für das eigene Tätigkeitsfeld zu konkretisieren. Das bedeutet beispielsweise sich zu vergewissern, welche Kategorien in meinem Interessengebiet von Bedeutung sind und wie diese miteinander wechselwirken. Dabei kann die Auseinandersetzung mit dem in Kapitel 5 vorgestellten Ansatz von LESLIE MCCALL[283] hilfreich sein oder die 3-Ebenen-Analyse von DEGELE/WINKER[284] als Ansatzpunkt dienen. Denn darin haben beide aufgezeigt, dass Ungleichheit auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen produziert wird. Demnach ist es für die praktische Umsetzung des Intersektionalitätsgedankens notwendig zu untersuchen, welche Ebenen wie mit der spezifischen Institution wechselwirken.
Nach der Zielsetzung und der Analyse können entsprechend Maßnahmen angepasst werden, mit denen die praktische Umsetzung des Intersektionalitätskonzeptes erfolgen kann.
Eine Evaluation am Ende der Implementierung oder während des Prozesses ist hilfreich, um den Nutzen des jeweiligen Projektes festzustellen oder um neue Ziele zu formulieren, beziehungsweise bestehende abzuändern. Bei der Evaluation schlagen SCAMBOR/BUSCHE ein multidimensionales Vorgehen vor, um die verschiedenste Aspekte mit einzubeziehen und beziehen sich auf die "Qualitative Evaluation" nach Mayring.
Bisher sind intersektionale Perspektiven für die Praxis noch nicht umfassend erforscht, beziehungsweise gibt es wenige Beispiele für die intersektionale pädagogische Arbeit[285].
Ich möchte im nachfolgenden Abschnitt einige Vorschläge dahingehend diskutieren, wie das intersektionale Mainstreaming für eine sexualpädagogische Praxis fruchtbar gemacht werden könnte.
Das Konzept des intersektionalen Mainstreamings von SCAMBOR/BUSCHE war der erste Ansatz zur praktischen Implementierung von Intersektionalität und muss sicherlich mehr als eine Art Leitfaden statt als klare Konzeption verstanden werden. Ich werde deshalb im Folgenden das Verfahren von Scambor/Busche als Orientierungsrahmen benutzen.
-
Hauptzielsetzung
Im Kontext der emanzipatorischen Sexualpädagogik geht es mir nun um eine intersektionale Erweiterung des sexualpädagogischen Selbstverständnisses. Dabei greife ich die Idee einer "Sexualpädagogik der Vielfalt"[286] auf, wie sie TIMMERMANNS/TUIDER in Anschluss an PRENGEL und ihr Konzept der "Pädagogik der Vielfalt"[287] vorschlagen. Sexualpädagogik der Vielfalt geht über die emanzipatorische Sexualpädagogik hinaus, denn sie
-
"stellt Alltagsannahmen über die vermeintlichen Grundfesten sexueller Identität infrage,
-
erkennt Ausgeschlossenes und weicht hierarchische Anordnungen auf,
-
ist wachsam gegenüber der Festschreibung, d.h. Verdinglichung von Identitäten,
-
bejaht Unentscheidbares, Nicht-Identisches und Fremdes,
-
unterstützt die Menschen bei der Auseinandersetzung mit subjektiven, sozialen und politischen Realitäten, die Denken, Fühlen und Handeln "schubladisieren",
-
gestaltet Erlaubnisräume, in denen sich Vielfalt entwickeln kann."[288]
Das intersektionale Moment kommt vor allem dann zum Tragen, wenn es darum geht, diskriminierten und marginalisierten Gruppen nicht einfach eine Plattform zu geben, sondern die Diskriminierung selbst als machtvollen Prozess zu erkennen. In einer intersektionalen Sexualpädagogik sollten verschiedene Differenz- und Diskriminierungskategorien "sowohl zusammen [gedacht] als auch vervielfältigt und veruneindeutigt"[289] werden. Einem dekonstruktivistischen Verständnis folgend, sollte eine Pädagogik gestaltet werden, die andere Sexualitäten und Lebensformen nicht der heterosexuelle Norm gleichsetzt, sondern von vornherein die Möglichkeit der vielfältigen Positionierung bietet. Damit werden zugleich Ansätze der Toleranz, Integration oder Akzeptanz konsequent in Frage gestellt. Denn Toleranz kann keine Veränderung in dichotomen Verhältnissen von Sexualität bewirken. Andere Lebensweisen außerhalb der heterosexuellen, weißen, nicht-behinderten Norm, dürfen dieser nicht einfach angepasst werden. Denn damit würde die Vorstellung entstehen, die abweichende Form würde sich der Norm freiwillig anpassen wollen.
Die Hauptzielsetzung der intersektionalen Sexualpädagogik fasse ich demenstprechend in folgenden zwei Punkten zusammen:
-
Intersektionale Sexualpädagogik sollte dazu beitragen, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufzuzeigen, die Menschen in ihrer geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt begrenzen oder hierarchisch anordnen.
-
Daraus resultierend sollte intersektionale Sexualpädagogik Menschen dazu befähigen, sich selbst in ihrer Identität zu bestimmen und diese Identität als einzigartig und besonders anzuerkennen.
-
Intersektionale Analyse der relevanten pädagogischen Bereiche
Ich habe im ersten Kapitel zur Sexualpädagogik bereits beschrieben, wie vielfältig die Themengebiete der Disziplin sind und dass sie vor allem von verschiedenen Teildisziplinen ausgeübt wird. Deshalb möchte ich mich in der Analyse der pädagogischen Bereiche und der daraus folgenden Zielsetzungen auf ein konkretes Beispiel sexualpädagogischer Arbeit beschränken, was sich in Bezug auf mein Arbeitsthema an Menschen mit Behinderung richtet. Dieses Beispiel mag in der weiteren Beschreibung eventuell etwas idealtypisch klingen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich um ein fiktives Beispiel handelt, das ich, soweit es nötig ist, ausbuchstabieren werde, um das "intersektionale Mainstreaming" so anschaulich und nachvollziehbar wie möglich zu machen. Das Setting werde ich voraussetzen, ohne mich dabei bewusst auf bereits in der Entstehung befindende oder existierende Aufklärungsprojekte zu beziehen. Ich schlage als "Muster" zur Erarbeitung des Implementierungsprozesses ein Projekt zum Thema "sexuelle Orientierungen und Lebensweisen" vor. Dieses Projekt wird von einem Freizeit- und Begegnungszentrum für Menschen mit und ohne Behinderung initiiert und richtet sich an Schüler, zwischen 14 und 16 Jahren.
-
Institutionelles/Organisatorisches Bezugssystem
Das beschriebene Aufklärungsprojekt findet in dem Freizeit- und Begegnungszentrum statt, deshalb handelt es sich dabei um Kurzzeitpädagogik. Die Zeiträume, in denen das Projekt stattfinden kann, müssen also abgeklärt werden: Soll das Aufklärungsprojekt als einmaliges Ereignis oder als Angebot über mehrere Termine stattfinden? Werden dabei ganze Tage eingeplant oder Seminareinheiten von 90 Minuten? Die Frage der Finanzierung spielt eine weitere wichtige Rolle. Es sollte klar gestellt werden, ob das Beratungszentrum über ausreichend Mittel verfügt, die pädagogische Arbeit zu bezahlen sowie ausreichend Räume und Materialien zur Durchführung des Projektes bereit zu stellen. Gegebenenfalls ist es sinnvoll Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung ausfindig zu machen. Es sollte untersucht werden, welche Einstellung alle Mitarbeiter_innen der Einrichtung in Bezug auf "sexuelle Orientierungen und Lebensweisen" vertreten und wie die gesamte Organisation in Bezug auf die involvierten Kategorien Behinderung und Sexualität auftritt.
-
Belegschaft
Hier ist es zum einen sinnvoll zu betrachten, wer innerhalb der Einrichtung welche Aufgaben übernimmt: Sind zum Beispiel 90 Prozent der Freizeit- und Betreuungsangebote von Frauen besetzt? Welche Angebote halten sie bereit? Welche Ansprechpartner haben die Jugendlichen, die das Zentrum aufsuchen in welchen Bereichen? Diese Fragen können sehr aufschlussreich für ein intersektionales Vorhaben sein. Angenommen das Zentrum bietet "Mädchennachmittage" an, an denen alle Freizeitmöglichkeiten auf vermeintlich "typisch weiblichen" Interessen beruhen (z.B.: Schminken, Tanzen, Reitstunden) und nur von Frauen durchgeführt werden. Dann ist wichtig herauszufinden, welche Einstellung die Mitarbeiter_innen beispielsweise gegenüber Rollenverhalten und Sexualität einnehmen und wie sie sich selbst in ihrer geschlechtlichen Positionierung wahrnehmen. Denn das Beispiel des "Mädchennachmittags" wirkt dem intersektionalen Gedanken entgegen. Mit JUTTA HARTMANN stimme ich überein, dass überprüft werden muss, "wo wir als PädagogInnen und ErziehungswissenschaftlerInnen an der Instandsetzung binärer Konstruktionen beteiligt sind"[290]. Werden nun spezielle Angebote für Mädchen kreiert, so wird auch die Gruppe der Jugendlichen, die als Mädchen bezeichnet werden konstruiert. Für die Arbeit im Team ist es deshalb notwendig zu erfahren, welche Positionen die einzelnen Teammitglieder zum Beispiel zum Thema Geschlechterrollen einnehmen, ob sie bereit sind zu diesem Thema zusammenzuarbeiten und inwieweit sie in der Lage sind, ihre eigene Position im Hinblick auf Privilegierung oder Benachteiligung zu reflektieren. Die Zusammensetzung des Teams ist ebenfalls interessant. In dem fiktiven Beispiel des Begegnungszentrums ist herauszufinden, welche Zugehörigkeiten die Mitarbeiter_innen repräsentieren: nicht nur in Bezug auf Behinderung, Geschlecht und Sexualität, als die von mir besonders visierten Kategorien, sondern auch in Bezug auf Religion, Bildung, Familienstand, etc.
-
Teilnehmer_innen
Bei den Teilnehmer_innen aus meinem Beispiel ist bekannt, dass es sich um Schüler im Alter von 14 bis 16 handelt, sowohl behindert als auch nicht behindert. Auch wenn von mir bisher Behinderung und Sexualität/Geschlecht als die relevanten Kategorien für dieses Beispiel eingegrenzt wurden, geht es in einer intersektionalen Analyse der Teilnehmer_innen darum, für andere Kategorien offen zu bleiben. Die Jugendlichen sollten möglichst in ihrer Individualität wahrgenommen werden und nicht auf Defizite reduziert werden. Ihre Verschiedenheiten sollten als Ansatzpunkte für die pädagogische Arbeit genutzt werden. Deshalb sollte, wie bereits erwähnt die Selbstdarstellung der Jugendlichen beachtet werden, auch wenn dies nach SCAMBOR/BUSCHE "scheinbar paradoxe Praktiken"[291] einschließt. Damit meinen die Autor_innen vor allem den unterschiedlichen Gebrauch von Identitätskonstruktionen der Jugendlichen in bestimmten Kontexten. So kann sich ein/e Teilnehmer_in in einer Situation der Mehrheit anschließen, weil diese Position vorteilhaft erscheint. In einer anderen Situation kann wiederum auf die eigene Individualität durch Abgrenzung zur Mehrheit bestanden werden. SCAMBOR/BUSCHE weisen darauf hin, dass es durchaus sinnvoll ist, Jugendliche in diesen Praxen zu ermutigen.[292] Denn dadurch kann die Festlegung von Menschen auf bestimmte Identitätspositionen in Frage gestellt werden.
Auch wenn das Thema des Projektes durch den Titel "sexuelle Orientierungen und Lebensweisen" bereits eingeschränkt wurde, so sollten die Pädagog_innen offen sein für die Interessen und die Kenntnisse, die die Teilnehmer_innen mit in das Projekt bringen.
-
Inhalte/Methoden
Die Inhalte sind zum Teil durch das Thema und die Hauptzielsetzung vorgegeben. So ist die Sensibilisierung für sexuelle Vielfalt und die Betrachtung des Zusammenwirkens verschiedener Kategorien ein inhaltlicher Schwerpunkt. Abgesehen von der Vermittlung von theoretischem Wissen, können die spezifischen Erfahrungen und Erlebnisse der Teilnehmer_innen zum Projektthema betrachtet werden. Zudem bietet das Projekt die Möglichkeit auch Sozialkompetenzen in der Zusammenarbeit mit anderen Jugendlichen zu entwickeln.
Methodisch bietet die Sexualpädagogik eine Fülle an Möglichkeiten. Als Anhaltspunkt möchte ich hier auf den Methoden- und Materialband von TUIDER/TIMMERMANNS "Sexualpädagogik der Vielfalt"[293] verweisen.
-
Beschreibung der Teilziele
Die für das Aufklärungsprojekt relevanten Kategorien habe ich bereits durch mein Setting und meine übergeordnete Betrachtung der Sexualpädagogik mit LSBT* mit Behinderung von vornherein eingegrenzt. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich nicht noch weitere Kategorien als wichtig für das Projekt ergeben können. Ist die Teilnehmer_innengruppe zum Beispiel mit unterschiedlichen Religionen vertreten, kann diese Kategorie ebenfalls von Bedeutung für die Bearbeitung "sexueller Orientierungen und Lebensweisen" werden.
Stehen die Kategorien fest, kann untersucht werden, welche Ebenen für das pädagogische Projekt von Bedeutung sind und welches Verhältnis der Kategorien untereinander betrachtet werden soll. Ich möchte das Verhältnis der Kategorien als Entscheidungsfaktor für die Zielsetzung des sexualpädagogischen Projektes anhand des Ansatzes von MCCALL erläutern. Es gilt zu erfragen, ob das Projekt einer antikategorialen Methodik folgen soll, damit würde die Dekonstruktion der Kategorien Behinderung, Sexualität und Geschlecht im Mittelpunkt des Projektes stehen. Einem intrakategorialen Ansatz folgend, könnte die Dichotomie zwischen Homosexualität und Heterosexualität den Fokus des Projektes bestimmen. Soll dem intrakategorialen Ansatz nachgegangen werden, zielt das Aufklärungsprojekt vor allem darauf, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der unterschiedlichen Kategorien in sich selbst und untereinander zu thematisieren.
Ebenso kann die Spezifizierung des Projektes auf verschiedenen Analyseebenen erfolgen, in Bezug auf DEGELE/WINKER.
Als die relevanten Kategorien für das Aufklärungsprojekt habe ich Behinderung, Geschlecht und Sexualität bestimmt. Den Intersektionalitätsansatz betreffend, den ich für die Umsetzung des Projektes präferiere, habe ich dafür entschieden, dass das Aufklärungsprojekt die Verhältnisse der unterschiedlichen Kategorien in allen drei Varianten untersuchen soll, die MCCALL vorschlägt. Daraus entwickle ich folgende Teilziele für das sexualpädagogische Aufklärungsprojekt:
-
Im Sinne der Dekonstruktion soll ein kritischer Umgang mit Rollenerwartungen und Identitätszuschreibungen erfolgen.
-
Gesellschaftliche Normen sollen hinterfragt und die Hierarchisierung sexueller Orientierungen und Lebensweisen kritisch hinterfragt werden
-
Offenheit gegenüber vielfältigen Identitätspositionen und die Flexibilität von Identitäten soll befördert werden
-
Implemtierung von Maßnahmen
Entsprechend der formulierten Teilziele sollten folgende Maßnahmen zur Durchführung realisiert werden:
Um eine identitätskritische Perspektive zu behalten, ist es sinnvoll sexualpädagogische Arbeit nicht nach Gruppen zu ordnen, sondern themenspezifisch zu arbeiten. In meinem gestellten Setting ist es deshalb beispielsweise wenig produktiv für eine dekonstruktivistische Herangehensweise, die Teilnehmer_innen in Gruppen heterosexuell/homosexuell oder behindert/nicht behindert einzuteilen. Vielmehr soll durch die gemeinsame Bearbeitung in der heterogenen Gruppe aufgezeigt werden, dass Identitäten dehnbare Gebilde sind.
Zur kritischen Hinterfragung gesellschaftlicher Normen und Hierarchisierungen kann es lohnend sein verschiedene Lebensweisen nicht additiv zu behandeln. Es geht nicht darum, Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensweisen zu ignorieren oder sie in Stereotypen festzuhalten, sondern darum sie zu relativieren. Sexuelle Lebensweisen sollten nicht eingeteilt werden in das "normale heterosexuelle Verhalten" und "die anderen Orientierungen", die als Gegenpol dazu dargestellt werden, sondern gleichwertig zu betrachten sind, unabhängig von ihrer statistischen Häufigkeit.[294]
Um eine positive Einstellung gegenüber Vielfalt zu bewirken, halte ich es für zweckmäßig, Aufklärungsarbeit zu sexueller Vielfalt nicht prinzipiell von marginalisierten Gruppen durchführen zu lassen. Aufklärungsprojekte zu sexueller Orientierung werden zumeist von Menschen durchgeführt, die sich selbst als schwul, lesbisch, etc. beschreiben. Damit wird das Thema schnell zu einem identitätspolitischen. Für Timmermanns bedeutet dies,
"dass keine grundlegende Auseinandersetzung mit der Normierung sexueller Identitäten und Orientierungen in Schule und Erziehung stattfindet. Das heißt die Aufgabe, sich hiermit zu beschäftigen, ist nicht selbstverständlich, sondern wird marginalisierten Gruppen überlassen. [...] Eine kritische Reflexion der Heteronormativität darf nicht mehr nur Aufgabe von Minderheiten sein, sondern muss im pädagogischen Alltagsgeschäft selbstverständlich werden."[295]
-
Evaluation
Eine Evaluation halte ich in Anschluss an SCAMBOR/BUSCHE ebenfalls für sehr nützlich, auch während des Implementierungsprozesses.
"Intersektionales Mainstreaming" ist in der Realität noch viel komplexer, als es mir möglich ist, in diesem, von mir bereits eingegrenztem, Beispiel aufzuzeigen. Deshalb "müssen Kriterien und Indikatoren auf eine multi-dimensionale Weise definiert werden"[296] um eine umfassende Evaluation zu gewährleisten. Ein Kriterium für die Auswertung meines intersektionalen Beispiels könnte die Zusammensetzung des Projektteams darstellen, welches in Bezug auf das Projektthema möglichst heterogen in seiner sexuellen Orientierung und Lebensweise sein sollte. Indikatoren für die Evaluation könnten dann, hier wieder in Bezug auf die von mir vorgegebenen Kategorien, dahingehend lauten, dass verschiedene Geschlechter, sexuelle Orientierungen als auch Menschen mit und ohne Behinderung innerhalb des Teams verkörpert werden sollten. Anhand der Überprüfung der Kriterien und Indikatoren lässt sich feststellen, inwieweit die Umsetzung des intersektionalen Ansatzes bereits vorangeschritten ist, beziehungsweise an welcher Stelle eventuelle Änderungen vorgenommen werden müssten.
Dieses Kapitel hat nur ein Muster für intersektionale Sexualpädagogik aufgezeigt. Die Punkte zwei (Intersektionale Analyse der relevanten pädagogischen Bereiche) bis fünf (Evaluierung) des Implementierungsprozesses variieren selbstverständlich je nach sexualpädagogischem Vorhaben. Allerdings kann die Hauptzielsetzung und die Bezugnahme auf das Konzept der "Sexualpädagogik der Vielfalt" generell für eine inklusive Sexualpädagogik geltend gemacht werden.
[257] Scambor/Busche: 2009: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=14&Itemid=89
[258] vgl.: Rosenstreich: 2002: 26
[259] Rosenstreich: 2002: 26
[260] ebd.:27
[261] Döge/Stiegler: 2004: 152
[262] Doblhofer/Küng: 2008:7
[263] vgl.: Göge/Stiegler: 2004: 135
[264] vgl.: Doblhofer/Küng: 2008: V
[265] vgl.: Schambach/von Bargen: 2004
[266] ebd.: 33
[267] Wetterer: 2002: 129, zit. n. Meuser: 2004: 329
[268] Meuser: 2004:330
[269] Rosenstreich: 2002: 29
[270] vgl.: ebd.: 30
[271] Scambor/Busche: 2009: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=14&Itemid=89
[272] Sielert: 2004: 97
[273] vgl.: ebd.: 98
[274] ebd.:
[275] vgl.: Sielert: 2004: 98
[276] vgl.: Scambor/Krabel: 2008: http://www.genderloops.eu//files/3699beadb445035efa18dae6c06f8fe6.pdf
[277] Scambor/Busche: 2009: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=14&Itemid=89
[278] ebd.
[279] vgl.: Schambach/Bargen: 2004: 275
[280] vgl.: Scambor/Busche: 2009: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=
doc_view&gid=14&Itemid=89
[281] vgl.: ebd.
[282] ebd.
[283] vgl.: McCall: 2005
[284] vgl.: Degele/Winker: 2009
[285] Siehe z.B.: "respect"( vgl.: http://www.bremer-jungenbuero.de/respect.html; Akka/Pohlkamp: 2010) oder "PeerThink" (http://www.peerthink.eu/peerthink/index.php?lang=de)
[286] vgl.: Timmermanns/Tuider:2008: 18
[287] vgl.: Prengel: 2006
[288] Sielert: 2005: 98
[289] Tuider: 2008: 255
[290] Hartmann: 1998: 36f
[291] Scambor/Busche: 2009: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=
doc_view&gid=14&Itemid=89
[292] vgl.: ebd.
[293] vgl.: Timmermanns/Tuider: 2008
[294] Vgl.: Timmermanns: 2004: 82
[295] Timmermanns: 2004: 96
[296] vgl.: Scambor/Busche: 2009: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=
doc_view&gid=14&Itemid=89
Ich hoffe, dass durch die vorangegangene Diskussion folgende Punkte deutlich geworden sind:
In Kapitel 1 habe ich aufgezeigt, dass Sexualpädagogik ein komplexes Themengebiet ist, das zwar den Anspruch hat, Individualität zu fördern und Diskriminierung aufgrund sexueller oder geschlechtlicher Merkmale zu bekämpfen, diesem Anspruch allerdings nicht nachkommt. Durch die Zuweisung spezifischer sexualpädagogischer Themen an "Spezialpädagogiken"[297] werden immer nur bestimmte "Masterkategorien" in den Fokus der Theorie genommen. Wie Kapitel 2 und 3 gezeigt haben, bilden die Kategorien Behinderung, sexuelle Orientierung und Geschlecht jeweils gesellschaftliche Strukturkategorien, die entscheidend an der Diskriminierung beziehungsweise Privilegierung von Menschen beteiligt sind. Den Disability Studies und der Queer Theory ist es bisher nicht gelungen die Verwobenheit der Kategorien zu fokussieren. Stattdessen haben sie sich in ihrer Analyse jeweils auf eine Masterkategorie gestützt. Die Argumentation in Kapitel 4 sollte verdeutlichen, dass "[i]nsbesondere die in den Queer Studies aufgeworfene Kritik an Körper-, Sexualitäts- und Geschlechternormen [...] eine Überschneidung mit den Disability Studies"[298] bietet. Vor allem die Ansätze von HEIKE RAAB und ROBERT MCRUER sollten gezeigt haben, dass Menschen einem Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit sowie einem Zwang zur "Nicht-Behinderung" unterlegen sind. Dass sich diese machtvollen Prozesse entlang vielfältiger juristischer, medizinischer und gesellschaftlicher Normen gegenseitig produzieren und unterstützen, habe ich am Beispiel der Intersexualität und der Trans*sexualität aufgezeigt. Mit dem Intersektionalitätskonzept habe ich in Kapitel 5 eine Möglichkeit beleuchtet, wie verschiedene Differenzkategorien in ihrer Verschränkung miteinander untersucht werden können (durch den Mehrebenenansatz von DEGELE/WINKER und den kategorialen Ansatz von MCCALL) und sich somit in einer produktiven Weise mit der Entstehung von multipler Diskriminierung auseinandergesetzt werden kann. Das Verständnis vom Zustandekommen dieser multiplen Diskriminierung ist hilfreich in der praktischen sexualpädagogischen Arbeit. Eine Idee für die intersektionale pädagogische Arbeit lieferten SCAMBOR/BUSCHE mit dem "intersektionalen Mainstreaming" (Kapitel 6), welches, wenn auch nicht als ausbuchstabiertes Konzept, sondern als erste Idee angelegt, einen Leitfaden für weitere intersektionale Projekte bietet. Einen Versuch für die Implementierung des intersektionalen Mainstreaming in weitere pädagogische Arbeitsfelder, habe ich im Kapitel 7 mit dem Beispiel der intersektionalen Sexualpädagogik gewagt. Mit diesen Ausführungen habe ich sicherlich kein konkretes Konzept für die zukünftige sexualpädagogische Arbeit vorlegen wollen. Vielmehr war es meine Absicht, Anregungen für eine Auseinandersetzung der emanzipatorischen Sexualpädagogik mit der intersektionalen Perspektive zu geben und aufzuzeigen, wie die Sexualpädagogik von einem intersektionalen Fokus profitieren kann. So ist mit der intersektionalen Sexualpädagogik möglich "sich an den Bedürfnissen, Lebenslagen, Wünschen, Fähigkeiten, Interessen und Fragen von Menschen [zu orientieren], ohne diese in geschlechts-, kultur- oder sexualspezifische Gruppen/Kategorien einzuteilen."[299] Mit der sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung habe ich nur ein Beispiel für die mögliche intersektionale Sexualpädagogik innerhalb eines bestimmten Settings diskutiert. Auch wenn ich immer wieder auf die Offenheit in Bezug auf die Identitätskategorien innerhalb der sexualpädagogischen Arbeit verwiesen habe, so habe ich dennoch selbst immer wieder einen Rahmen gesetzt. Mir ist bewusst, dass die Betrachtung der Kategorein Behinderung, Sexualität und Geschlecht auch nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit abbilden. Ich habe mich aus pragmatischen Gründen für diesen Ausschnitt entschieden. Ich denke, dass es mir auch mit dieser Eingrenzung gelungen ist, aufzuzeigen, wie komplex sich intersektionale sexualpädagogische Arbeit gestaltet, selbst wenn sie auf eine bestimmte Gruppe zugeschnitten ist. Dementsprechend bleibt eine Vielzahl von Fragen, die es zukünftig zu erforschen gilt. So zum Beispiel die praktische Realisierbarkeit intersektionaler Pädagogik (etwa in Bezug auf die Zusammensetzung eines vielfältigen Teams, Kostenübernahme, Zuständigkeiten, etc.). Ebenso könnten Untersuchungen zu Intersektionen weiterer Kategorien, beispielsweise von Behinderung, Geschlecht und Hautfarbe, aufschlussreich für die sexualpädagogische Arbeit sein.
Ich hoffe, dass ich mit dieser Arbeit und den abschließenden Anregungen einen Anstoß für weitere Überlegungen zu einer Neugestaltung der sexualpädagogischen Arbeit geben konnte.
Anhang 1: Kleiderpuppen zum Schwerpunkt "Körper Mann/Frau außen"
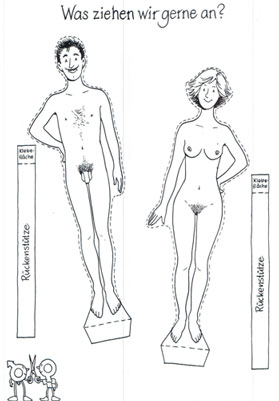
Quelle: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 40
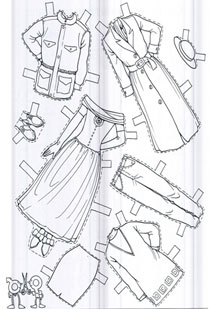
Quelle: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 42

Quelle: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 43
Anhang 2: "Freundschaftsanzeige"
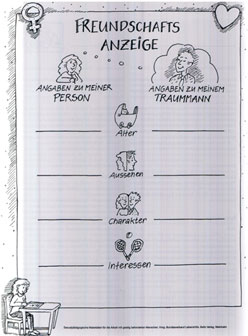
Quelle: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 72
Anhang 3: Bildergeschichte "Streit und Versöhnung"
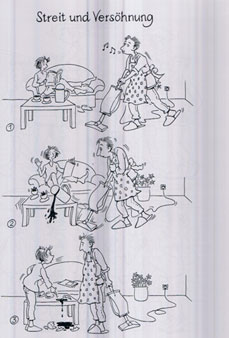
Quelle: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 89
Anhang 4: Bildergeschichte "Eifersucht"

Quelle: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 91
Ich versichere, dass ich die vorliegende Diplomarbeit ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Ich bestätige ausdrücklich, Zitate und Quellenangaben mit größter Sorgfalt in vorgeschriebener Art und Weise kenntlich gemacht zu haben.
Zwickau, den 20. September 2011 Susan Monat
Anglowski, Dirk Ch. (2000): Homosexualität im Schulunterricht, Marburg: Tectum.
Barwig/Busch (Hrsg.) (1993): "Unbeschreiblich weiblich!?", München: AG SPAK.
Bauman, Zygmunt (1992): Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Hamburg: Junius.
Behrens, Roger (2008): Postmoderne, 2., korrigierte Aufl., Hamburg: EVA.
Bourdieu/Wacquant (1996): Reflexive Anthropologie, Frankfurt: Suhrkamp.
Bourdieu: 1976: Entwurf einer Theorie der Praxis, Frankfurt: Suhrkamp.
Beauvoir, Simone de (1951): Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Reinbek: Rowohlt.
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. (Hrsg.) (2009): Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen, 5. Aufl, Weinheim und München: Juventa.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.) (2010): Jugendsexualität. Repräsentative Wiederholungsbefragung von 14- bis 17-Jährigen und ihren Eltern - Aktueller Schwerpunkt Migration, Köln.
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt: Suhrkamp.
Crenshaw, Kimberlé W. (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. In: The University of Chicago Legal Forum, S. 139-167.
Dannenbeck, Clemens: Paradigmenwechsel Disability Studies? Für eine kulturwissenschaftliche Wende im Blick auf die Soziale Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. In: Waldschmidt/Schneider (Hrsg.) (2007): Disability Studies: Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung, Bielfeld: transcript, S.103-125.
Davis, Kathy (2008a): Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. In: Feminist Theory, Vol. 9 (1), London: Sage, S. 67-85.
Davis, Kathy ( 2008b): Intersectionality in Transatlantic Perspective. In: Klinger, Cornelia/Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen: Fremdheit, Ungleichheit, Differenz. Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Band 23, Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 19-35.
Dederich, Markus (2007): Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability Studies, Bielefeld: transcript.
Degele, Nina (2008): Gender/Queer Studies. Eine Einführung, Paderborn: Wilhelm Fink.
Degele, Nina/Winker, Gabriele (2008): Praxeologisch differenzieren. Ein Beitrag zur intersektionalen Gesellschaftsanalyse. In: Klinger, Cornelia/Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen: Fremdheit, Ungleichheit, Differenz. Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Band 23, Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 194-209.
Dijk/Driel(Hrsg.) (2008): Sexuelle Vielfalt lehren. Schulen ohne Homophobie, Berlin: Querverlag.
Dilling/Mombour/Schmidt/Schulte-Markwort (Hrsg.) (2011): Weltgesundheitsorganisation. Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis, 5., überarbeitete Aufl. nach ICD-10-GM 2011, Bern: Hans Huber Verlag.
Doblhofer, Doris/Küng, Zita (2008): Gender Mainstreaming. Gleichstellungsmanagement als Erfolgsfaktor - das Praxisbuch, Heidelberg: Springer.
Döge, Peter/Stiegler, Barbara (2004): Gender Mainstreaming in Deutschland. In: Meuser/Neusüß: Gender Mainstreaming. Konzepte, Handlungsfelder, Instrumente, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 135-157.
Dornhof, Dorothea (2005): Postmoderne. In: Braun/Stephan (Hrsg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, 2., überarbeitete Auflage, Köln: Böhlau, S. 285-308.
Engelmann,Peter (Hrsg.) (2004): Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart: Reclam.
Exner, Karsten (1997): Deformierte Identität behinderter Männer und deren emanzipatorische Überwindung. In: Warzecha, Birgit (Hrsg.): Geschlechterdifferenz in der Sonderpädagogik: Forschung - Praxis - Identität. Hamburg, S. 67-87.
Ewinkel /Hermes, u.a. (Hrsg) (1985): Geschlecht: behindert. Besonderes Merkmal:
Frau. München: AG SPAK.
Foucault, Michel (1969): Die Archäologie des Wissens, Frankfurt: Suhrkamp.
Foucault, Michel (1988): Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, Frankfurt: Suhrkamp.
Foucault, Michel (1978): Dispositive der Macht. Über Sexualität, wissen und Wahrheit, Berlin: Merve Verlag.
Foucault, Michel (1973): Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt: Suhrkamp.
Foucault, Michel (1983): Sexualität und Wahrheit, Frankfurt: Suhrkamp.
Fritzsche, Bettina (2007): Das Begehren, das nicht eins ist. Fallstricke beim Reden über Bisexualität. In: Hartmann/Klesse/Wagenknecht/Fritzsche/Hackmann (Hrsg.): Heteronormativität. Empirische Untersuchungen zu Geschlecht, Sexualität und Macht, Wiesbaden: VS Verlag, S. 115-131.
Gildemeister/Wetterer (1995): Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung. In: Knapp/Wetterer (Hrsg.): Traditionen Brüche. Entwicklungen feministischer Theorie, 2. Aufl., Freiburg: Kore, S. 201-254.
Hark, Sabine (2005): Queer Studies. In: Braun/Stephan (Hrsg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, 2., überarbeitete Auflage, Köln: Böhlau, S. 308-326.
Hartmann, Jutta (1998): Die Triade Geschlecht-Sexualität-Lebensform. Widersprüchliche gesellschaftliche Entwicklungstendenzen und neue Impulse für eine kritische Pädagogik. In: Hartmann et al (??) (Hrsg.): Lebensformen und Sexualität: Herrschaftskritische Analysen und pädagogische Perspektiven, Bielefeld: Kleine, S. 29-41.
Heitmüller, Jessica (2000): "Es ist normal verschieden zu sein!" Homosexualität als Thema der Sexualerziehung, Marburg: Tectum.
Hoff, Dagmar von (2005): Performanz/Repräsentation. In: Braun/Stephan (Hrsg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, 2., überarbeitete Auflage, Köln: Böhlau, S. 185-202.
Höfs, Manuel (2007): Kritische Männerforschung und Behinderung. In: Jacob/Wollrad (Hrsg.): Behinderung und Geschlecht - Perspektiven in Theorie und Praxis. Dokumentation einer Tagung, Oldenburg: BIS, S. 85-98.
Hutson, Christiane (2010): mehrdimensional verletzbar. Eine Schwarze Perspektive auf Verwobenheiten zwischen Ableism und Sexismus. In: Jacob/Köbsell/Wollrad (Hrsg.): Gendering Disability: Intersektionale Aspekte von Behinderun und Geschlecht, Bielefeld: transcript, S. 61-72.
Jeltsch-Schudel, Barbara (2010): Statement zur Strukturkategorie "Geschlecht/Gender". In: Schildmann, Ulrike (Hrsg.): Umgang mit Verschiedenheit in der Lebenspanne. Behinderung - Geschlecht - kultureller Hintergrund - Alter/Lebensphase, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 48-52.
Jensen, Heike (2005): Sexualität. In: Braun/Stephan (Hrsg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, 2., überarbeitete Auflage, Köln: Böhlau, S. 123-184.
Kentler, Helmut (1970): Sexualerziehung, Reinbek: Rowohlt.
Kluge, Norbert (1984): Sexualpädagogik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft. In: ders. (Hrsg.): Handbuch der Sexualpädagogik, Band 1, Düsseldorf: Schwann, S. 19-46.
Klinger, Cornelia (2003): Ungleichheit in den Verhältnissen von Klasse, Rasse und Geschlecht. In: Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika: Achsen der Differenz. Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II, Münster, S. 14-49.
Kluge, Norbert (1984): Sexualpädagogik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft. In: ders. (Hrsg.): Handbuch der Sexualpädagogik, Band 1, Düsseldorf: Schwann.
Knapp, Gudrun-Axeli (2008): Verhältnisbestimmungen: Geschlecht, Klasse, Ethnizität in gesellschaftstheoretischer Perspektive. In: Klinger, Cornelia/Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen: Fremdheit, Ungleichheit, Differenz. Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Band 23, Münster: Westfälisches Dampfboot, S.138- 170.
Knapp, Gudrun-Axeli (2006): "Intersectionality": Feministische Perspektiven auf Ungleichheit und Differenz im gesellschaftlichen Transformationsprozeß, Vortragsmaniuskript, Wien, 30.11.2006. URL: http://www.univie.ac.at/gender/fileadmin/user_upload/gender/abstracts_ringvorlesung/Knapp.doc (letzer Zugriff: 03.06.2011)
Knapp, Gudrun-Axeli (2005): "Intersectionality" - ein neues Paradigma feministischer Theorie? Zur transatlantischen Reise von "Race, Class, Gender". In: Feministische Studien, Heft 1/2005, Stuttgart: Lucius & Lucius, S. 68-81.
Köbsell, Swantje (2010): Gendering Disability: Behinderung, Geschlecht und Körper. In: Jacob/Köbsell/Wollrad (Hrsg.): Gendering Disability: Intersektionale Aspekte von Behinderun und Geschlecht, Bielefeld: transcript, S. 17-33.
Köbsell, Swantje (2007): Behinderung und Geschlecht -Versuch einer vorläufigen Bilanz aus Sicht der deutschen Behindertenbewegung. In: Jacob/Wollrad (Hrsg.): Behinderung und Geschlecht - Perspektiven in Theorie und Praxis. Dokumentation einer Tagung, Oldenburg: BIS, S. 31- 49.
Koch, Friedrich (2008): Zur Geschichte der Sexualpädagogik. In: Schmidt/Sielert (Hrsg.) (2008): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, Weinheim und München: Juventa, S. 23-38.
Kraß, Andreas: Queer Studies - eine Einführung. In: ders. (Hrsg.) (??): Queer denken. Gegen die Ordnung der Sexualität (Queer Studies): Suhrkamp, S. 7-24.
Lagner, Anke (2010): Eine Ohnmacht - Geschlecht und "geistige Behinderung". In: Jacob/Köbsell/Wollrad (Hrsg.): Gendering Disability: Intersektionale Aspekte von Behinderun und Geschlecht, Bielefeld: transcript, S. 131-152.
Lautmann, Rüdiger (2008): Gesellschaftliche Normen der Sexualität. In: Schmidt/Sielert (Hrsg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, Weinheim und München: Juventa, S. 209-223.
Link, Jürgen (1999): Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, 2., aktualisierte u. erweiterte Aufl., Opladen: Westdt. Verlag.
Linton, Simi (1998): Claiming Disability. Knowledge and Identity, New York/London: New York University Press.
Lutz /Vivar /Supik (2010): Fokus Intersektionalität - eine Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Intersektionalität: Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes, Wiesbaden: VS, S. 9-30.
McCall, Leslie (2005): The Complexity of Intersectionality. In: Signs. Journal ofWomen in Culture and Society 30, S. 1771-1800.
McRuer, Robert (2006): Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability, New York/London: New York University Press.
Meuser, Michael (2004): Gender Mainstreaming: Festschreibung oder Auflösung der Geschlechterdifferenz? Zum Verhältnis von Geschlechterforschung und Geschlechterpolitik. In: Meuser/Neusüß: Gender Mainstreaming. Konzepte, Handlungsfelder, Instrumente, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 322-336.
Münker/Roesler (2000): Poststrukturalismus, Stuttgart: Metzler.
Oloff, Aline (2010): Theorien der Intersektionalität, Werkstattgespräche. In: Feministische Studien, Heft 2/2010, Lucius&Lucius, Stuttgart, S. 328-331.
Ortland, Barbara (2008): Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik, Stuttgart: Kohlhammer.
Perko, Gudrun (2005): Queer-Theorien. Ethische, politische und logische Dimensionen plural-queeren Denkens, Köln: PapyRossa Verlag.
Prengel, Annedore (2006): Pädagogik der Vielfalt: Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik, 3. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag.
Raab, Heike (2003): Queering (Dis)abled Theories and Politics - Lesben und Behinderung. URL: http://www.behinderte.de/disabilitystudies/qdtextsommeruni2003.htm#F* (letzter Zugriff 28.06.2009)
Raab, Heike (2010): Shifting the Paradigm: "Behinderung, Heteronormativität und Queerness". In: Jacob/Köbsell/Wollrad (Hrsg.): Gendering Disability: Intersektionale Aspekte von Behinderun und Geschlecht, Bielefeld: transcript, S. 73-94.
Raab, Heike (2007): Intersectionalität in den Disability Studies. Zur Interdependenz von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht. In: Waldschmidt/Schneider (Hrsg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld. Bielefeld: transcript, S. 127-148.
Reiss, Kristina (2007): Behinderung und Geschlecht - Zur Exklusion von Geschlecht durch Behinerung und Produktion des Anderen. In: Jacob/Wollrad (Hrsg.): Behinderung und Geschlecht - Perspektiven in Theorie und Praxis. Dokumentation einer Tagung, Oldenburg: BIS, S. 51-63.
Rosenstreich, Gabriele (2002): Gender Mainstreaming: für wen? In: Nohr, Barbara/Veth, Silke (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Kritische Reflexionen einer neuen Strategie, Berlin: Karl Dietz Verlag, S. 26-36.
Scambor /Busche (2009): Intersektionales Mainstreaming. URL: http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=14&Itemid=89 (letzter Zugriff: 03.06.2011).
Schambach /Bargen (2004): Gender Mainstreaming als Organisationsveränderungsprozess - Instrumente zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. In: Meuser/Neusüß: Gender Mainstreaming. Konzepte, Handlungsfelder, Instrumente, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 274-290.
Schildmannn, Ulrike (2010): Welche Perspektiven eröffnet der Blick auf die gesamte Lebensspanne für das Verständnis von Behinderung? In: der. (Hrsg.): Umgang mit Verschiedenheit in der Lebenspanne. Behinderung - Geschlecht - kultureller Hintergrund - Alter/Lebensphase, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 36-47.
Schildmann, Ulrike (2007): Behinderung und Geschlecht - Datenlage und Perspektiven der Forschung. In: Jacob/Wollrad (Hrsg.): Behinderung und Geschlecht - Perspektiven in Theorie und Praxis. Dokumentation einer Tagung, Oldenburg: BIS, S. 11-24.
Schildmann, Ulrike (Hrsg.) (2001): Normalität, Behinderung und Geschlecht. Ansätze und Perspektiven der Forschung, Opladen: Leske + Budrich.
Schillmeier, Michael: Zur Politik des Behindert-Werdens. Behinderung als Erfahrung und Ereignis. In: Waldschmidt/Schneider (Hrsg.) (2007): Disability Studies: Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung, Bielfeld: transcript, S. 79-99.
Schönwiese, Volker (2005): Perspektiven der Disability Studies.
URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-studies.html (letzter Zugriff 19.08.2011).
Sigusch, Volkmar (2005): Neosexualitäten: Über den Wandel von Liebe und Perversion, Frankfurt/New York: Campus.
Sielert, Uwe (2005): Einführung in die Sexualpädagogik, Weinheim und Basel: Beltz.
Sielert, Uwe (2004): Gender Mainstreaming im Kontext einer Sexualpädagogik der Vielfalt von Geschlecht, Generativität, Lebensweise und Begehren. In: Timmermanns/Tuider/Sielert (Hrsg.): Sexualpädagogik weiter denken. Postmoderne Entgrenzungen und pädagogische Orientierungsversuche, Weinheim und München: Juventa, S. 97-112.
Sielert, Uwe/Vatl, Karlheinz (Hrsg.) (2000): Sexualpädagogik lehren. Didaktische Grundlagen und Materialien für die Aus- und Fortbildung, Weinheim und Basel: Beltz.
Soiland, Tove (2008): Die Verhältnisse gingen und die Kategorien kamen. Intersectionality oder Vom Unbehagen an der amerikanischen Theorie. In: Querelles-net 26 (2008).
URL: http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/694/702 (letzer Zugriff: 03.06.2011).
Specht, Ralf (2008): Sexualität und Behinderung. In: Schmidt/Sielert (Hrsg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, Weinheim und München: Juventa, S. 295-308.
Tervooren, Anja (2003): DisabilityStudies - Vom Defizit zum Kennzeichen. URL: http://www.bidok.uibk.ac.at/library/tervooren-defizit.html (letzter Zugriff 20.07.2009).
Tervooren, Anja (2002): Den Diskurs anreizen. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/tervooren-differenz.html (letzter Zugriff 20.07. 2009).
Thielen, Marc (2011): "Bist du behindert Mann?" - Überlegungen zu Geschlecht und Geschlechterinszenierung in sonder- und integrationspädagogischen Kontexten aus einer intersektionalen Perspektive. In: Zeitschrift für Inklusion 1/2011. URL: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/100/102 (letzter Zugriff: 03.06.2011).
Timmermanns/Tuider (2008): Sexualpädagogik der Vielfalt. Praxismethoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und Jugendarbeit, Weinheim und München: Juventa.
Timmermanns, Stefan (2004): Raus aus der Schublade, rein in die Schublade oder quo vadis, lesbisch-schwule Aufklärung? In: Timmermanns/Tuider/Sielert (Hrsg.): Sexualpädagogik weiter denken. Postmoderne Entgrenzungen und pädagogische Orientierungsversuche, Weinheim und München: Juventa, S. 79-96.
Tuider, Elisabeth (2008): Diversität von Begehren, sexuellen Lebensstilen und Lebensformen. In: Schmidt/Sielert (Hrsg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, Weinheim und München: Juventa, S. 251-260.
Tuider, Elisabeth: Im Kreuzungsbereich von Geschlecht - Sexualität - Kultur: Herausforderungen der Intersektionalität an eine queere (Sexual-)Pädagogik. In: Tietz, Lüder (Hrsg.) (2004): Homosexualität verstehen. Kritische Konzepte für die psychologische und pädagogische Praxis, Hamburg: MännerschwarmSkript Verlag, S.115-141.
Tuider, Elisabeth/Tietz, Lüder (2003): Queer Theory verständlich - Kritik der Identitätspolitik. In: Steffens/Ise (Hrsg.): Jahrbuch Lesben - Schwule - Psychologie, Lengerich: Pabst, S. 155-168.
Wagenknecht, Peter (2007): Was ist Heteronormativität? Zu Geschichte und Gehalt des Begriffs. In: Hartmann/Klesse/Fritzsche/Wagenknecht/Hackmann (Hrsg.): Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht, Wiesbaden: VS Verlag, S. 17-34.
Waldschmidt, Anne (2010): Das Mädchen Ashley oder: Intersektionen von Behinderung, Normalität und Geschlecht. In: Jacob/Köbsell/Wollrad (Hrsg.): Gendering Disability: Intersektionale Aspekte von Behinderun und Geschlecht, Bielefeld: transcript, S. 35-60.
Waldschmidt /Schneider (2007): Disability Studies und Soziologie der Behinderung. Kultursoziologische Grenzgänge - Eine Einführung. In: Waldschmidt/Schneider (Hrsg.): Disability Studies: Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung, Bielfeld: transcript,S. 9-28.
Waldschmidt, Anne (2007): Macht - Wissen - Körper. Anschlüsse an Foucault in den Disability Studies. In: Waldschmidt/Schneider (Hrsg.): Disability Studies: Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung, Bielfeld: transcript,S. 55-77.
Walgenbach /Dietze /Hornscheidt /Palm (2007): Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität, Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich.
Walter, Joachim (Hrsg.) (2008): Sexualbegleitung und Sexualassistenz bei Menschen mit Behinderungen, 2. Aufl., Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
Wartenpfuhl, Birgit (2000): Dekonstruktion von Geschlechtsidentität - Transversale Differenzen. Eine theoretisch-systematische Grundlegung, Opladen: Leske + Budrich.
Weinbach, Christine (2008): "Intersektionalität": Ein Paradigma zur Erfassung sozialer Ungleichheitsverhältnisse? Einige systhemtheoretische Zweifel. In: Klinger, Cornelia/Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen: Fremdheit, Ungleichheit, Differenz. Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Band 23, Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 171-193.
West/Zimmermann (1987): "Doing Gender". In: Gender & Society I, S. 125-151.
Winker, Gabriele/Degele, Nina (2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten, Bielefeld: transcript.
Zimmermanns, Susanne (1999): Sexualpädagogik in der BRD und in der DDR im Vergleich, Gießen: Psychosozial-Verlag.
Fachtagung Inklusive Leidenschaft - Lesben, Schwule, transgeschlechtliche Menschen mit Behinderung: URL: http://www.inklusive-leidenschaft.de/ (letzter Zugriff: 20.08.2011)
Jugendnertzwerk Lambda e.V. - Referat für Jugendliche mit Behinderungen: URL: http://www.lambda-online.de/beratung/lambda-barrierefrei (letzter Zugriff: 20.08.2011)
Bundesweites Netzwerk für LSBT mit Behinderung "queer handicap": URL: www.queerhandicap.de (letzter Zugriff: 20.08.2011)
"PeerThink"-Projekt: URL: http://www.peerthink.eu/peerthink/ (letzter Zugriff: 20.08.2011)
"Respect" - antirassistische Jungen- und Mädchenarbeit: URL: http://www.bremer-jungenbuero.de/respect.html (letzter Zugriff: 20.08.2011)
Weibernetz e.V. - die politische Interessenvertretung behinderter Frauen: URL: http://www.weibernetz.de/ (letzter Zugriff: 20.08.2011)
ICD-10 -Die internationale Klassifikation der Krankheiten: URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/ (letzter Zugriff: 20.08.2011)
Gesetz über die Veränderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen: URL: http://www.gesetze-im-internet.de/tsg/BJNR016540980.html#BJNR016540980BJNG000100311 (letzter Zugriff: 20.08.2011)
Quelle:
Susan Monat: "Differing desire"- Intersektionale Perspektiven auf die sexualpädagogische Arbeit mit LSBT* mit Behinderung
Diplomarbeit. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Philosophische Fakultät III. Institut für Pädagogik/Institut für Rehabilitationspädagogik
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 19.11.2013
