Zur Bedeutung der Gender-Analyse für das Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Menschen
Abschlussarbeit des Masterstudiengangs "Lehramt für Sonderpädagogik" an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Rehabilitationswissenschaften
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 3 Gender Analyse
- 4 Hierarchie Dimensionen im Kontext von Behinderung und Nicht-Behinderung
- 5 Fazit
- 6 Literatur- und Quellenverzeichnis
- Anhang
Tabelle 1 Zwei-Kolonnen-Schema zum Protonormalismus und Flexibilitätsnormalismus
Tabelle 2 13 bipolare hierarchische Differenzlinien
Tabelle 3 Anteil der Lehrerinnen und Lehrer an allen hauptberuflichen Lehrkräften im Schuljahr 2001/2002, in %
Tabelle 4 Die Verteilung von männlichen und weiblichen Lehrkräften, differenziert nach der Art der Beschäftigung im Schuljahr 2001/2002
Tabelle 5 Sonderschulzugehörigkeit und soziale Schicht der Herkunftsfamilie
Tabelle 6 Kinder mit SEN in Berlin in GU und in S insgesamt 2000/01-2006/07
Tabelle 7 Percentage of being in work among the populations with severe, moderate and no disability, by country and sex, age 16-64, 1996
Differenz ohne Gleichheit bedeutet gesellschaftlich Hierarchie, kulturell Entwertung, ökonomisch Ausbeutung.
Gleichheit ohne Differenz bedeutet Assimilation, Anpassung, Gleichschaltung, Ausgrenzung von 'Anderen'.
Annedore Prengel Pädagogik der Vielfalt
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2009 verpflichtete sich Deutschland deren Bestandteile umzusetzen. Demzufolge müssen die Vertragsstaaten der Konvention ein inklusives (in der offiziellen deutschen Übersetzung ist Inklusion durch Integration ersetzt worden) Bildungssystem etablieren. "Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live;" (UN-KONVENTION 2008, Art. 24 (2) b). Weiter heißt es: "Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;" (a.a.o. Art. 24 (2) d). Somit muss Deutschland sein hochgradig selektives Bildungssystem zu einem inklusiven umstrukturieren. Die Lösung für dieses Vorhaben kann nur eine Gemeinschaftsschule sein, da inklusiv meint, dass alle Schüler und Schülerinnen gemeinsam an einer Schule lernen. Es könnte nicht plausibel begründet werden, in welcher der drei weiterführenden Schulformen (Haupt-, Real-, bzw. Sekundarschule und Gymnasium) etwa lern- oder geistig behinderte Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden sollten.
Annedore Prengel hat sich ausführlich mit den möglichen pädagogischen Grundsätzen eines solchen Schulsystems auseinandergesetzt. Es müsse von Egalitärer Differenz geprägt sein. Diesen Aspekt empfinde ich als besonders interessant. In der Hoffnung, dass der Umbau des Bildungssystems nicht für Budgetkürzungen instrumentalisiert wird, sondern dass vielmehr eine Schulkultur geschaffen wird, in der mit einem professionellen, interdisziplinären Schulkollegium auf die Bedürfnisse jedes und jeder Einzelnen eingegangen wird, bin ich der Überzeugung, dass der Heterogenität der Schüler und Schülerinnen adäquat begegnet werden kann. Diese Heterogenität betrifft jedoch zumeist die Organisation von Unterricht, also letztendlich vor allem die Heterogenität von Kompetenzen und Leistungen. Egalitäre Differenz geht über diesen Aspekt hinaus und betrifft in besonderem Maße auch das soziale Miteinander der Lernenden. So solle eine inklusive Schule die Gleichwertigkeit ihrer Mitglieder herausstellen. Gleichheit und Differenz werden als zwei sich notwendig bedingende Aspekte betrachtet, da es bei einem Übergewicht einer Seite entweder zur bedingungslosen Anpassung und Assimilation käme, oder andererseits zur Herabwürdigung von Andersartigkeit, zu Hierarchie, so wie es das einleitende Zitat benennt (vgl. PRENGEL 1995, 184).
Meines Erachtens ist der Punkt des sozialen Miteinanders, der Egalitären Differenz, die weder Assimilation noch Hierarchie zuließe, bisher zu wenig thematisiert und erforscht. Neben Annedore Prengel befassen sich verschiedene Autoren und Autorinnen beiläufig mit dem Thema dergestalt, dass das Verhältnis, bzw. ein spezieller Aspekt des Verhältnisses von behinderten und nicht behinderten Menschen pauschal als von Hierarchie gekennzeichnet dargestellt wird (vgl. Schuhmann 2001, Lutz und Wenning 2001, Dörner 2007). Die einzelnen betrachteten Aspekte dienen vor allem der Darstellung der Situation behinderter Menschen. Diese Darstellungen sind zwar durchaus kritisch, besonders deutlich wird dies etwa anhand des Aspektes der Selbstbestimmung, verknüpfen die Kritik jedoch nur selten mit dem Konzept von Hierarchie. Die wenigen Verknüpfungen mit Hierarchie die vorliegen, verbleiben dann eben im Rahmen der einzelnen Aspekte, wie der Dimension der Selbstbestimmung. Diese Darstellungen gehen jedoch oftmals von einem spezifischen Personenkreis aus, etwa geistig behinderten Menschen. Eine Abhandlung, die umfassend das Konstrukt Behinderung per se als hierarchisch im Vergleich zu Nicht-Behinderung kennzeichnet und dabei untersucht, was Hierarchie in diesem Fall ist, wie und auf welchen Ebenen sie wirkt, liegt nicht vor.
Eventuell liegt es an der herrschenden deutschen Mentalität, dass vor allem 'Leistung' im Fokus des Interesses steht. Mich interessiert am sozialen Miteinander vor allem der Aspekt von Hierarchie, da dieser über einen schulischen Rahmen hinaus weist und eng verbunden ist mit gesellschaftlichen Einstellungen und Herrschaftsverhältnissen. Eine inklusive Schule kann ohne eine inklusive Gesellschaft nicht sein. Hierarchie betrifft somit sowohl das Miteinander von Schülern und Schülerinnen, als auch ein gesellschaftliches Selbstverständnis. Aus diesem Grund möchte ich in der vorliegenden Arbeit den Aspekt der Hierarchie im Verhältnis behinderter und nicht behinderter Menschen genauer untersuchen. Im Fokus steht dabei die Frage, welche Aspekte von Hierarchie der Gender Analyse sich auf das Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Menschen übertragen lassen, wie sie wirken und worin sie sich äußern.
Nach einer Klärung theoretischer Grundlagen zu Behinderung, Normalität, Gleichheit, Differenz und Macht soll zu diesem Zweck eine ausführliche Analyse der Geschlechterverhältnisse erfolgen. Dieses Vorgehen ist dem Umstand geschuldet, dass nur wenige Veröffentlichungen existieren, die Behinderung und Hierarchie untersuchen. Meines Erachtens ist das Geschlechterverhältnis bereits ausführlich erforscht, auch und gerade unter dem Aspekt von Hierarchie. Zudem gehe ich davon aus, dass gewisse Parallelen zwischen Geschlecht und Behinderung existieren, die es erlauben, einen Vergleich der hierarchiebildenden gesellschaftlichen Mechanismen vorzunehmen, die bei beiden Konstrukten wirken. So werden dann auch die aus der Analyse des Geschlechterverhältnisses gewonnenen Hierarchie Dimensionen auf den Kontext von Behinderung und Nicht-Behinderung übertragen.
Zum besseren Verständnis sollen kurz die angenommenen Parallelen zwischen den Konstrukten Gender und Behinderung ausgeführt werden. 'Alison Lapper Pregnant' ist der Titel einer Skulptur des Künstlers Marc Quinn, welche von 2005 bis 2007 auf dem Trafalgar Square in London ausgestellt wurde. Dargestellt wurde die schwangere Alison Lapper, ebenfalls Künstlerin, welche ohne Arme und mit verkürzten Beinen geboren wurde und dementsprechend als behindert gesehen wird[1]. Ursula NAUE gibt an, dass mit dieser Skulptur gleich zwei Aspekte an einem zentralen Ort Londons der Öffentlichkeit präsentiert wurden, welche eher im Bereich des Privaten, die Öffentlichkeit nicht betreffenden anzusiedeln seien: Schwangerschaft und Behinderung (vgl. NAUE 2006, 3). Dass beide Aspekte zusammen in einem Körper vorhanden sind, habe in der englischen Öffentlichkeit eine Debatte darüber ausgelöst, "wem Sexualität sowie auch die Entscheidung zur Reproduktion zugestanden wird" (ebd.). NAUE gibt an, dass "behinderte Frauen [...] in diesem Zusammenhang in mehrfacher Weise von Normalisierungs- und Hierarchisierungsstrategien betroffen [sind]: Zum einen über die soziale Konstruiertheit der Kategorie Behinderung, zum anderen über jene der Kategorie Geschlecht" (ebd.). Die hier angesprochene Verbindung von Behinderung und weiblichem Geschlecht macht es interessant, beide Aspekte genauer zu untersuchen, da sowohl Frau als auch Behinderung Abweichung von Normalität und einer damit verbundenen Hierarchisierung bedeuten.
Zusammenfassend ist das Ziel der Arbeit, dem Aspekt des sozialen Miteinanders von behinderten und nicht behinderten Menschen[2] in Gesellschaft und Schule mehr Aufmerksamkeit zu geben, als dies bisher der Fall ist, um gleichzeitig auf die Probleme hinzuweisen, die der Verwirklichung von Egalitärer Differenz entgegen stehen.
[1] vgl. Anhang S. I, 'Bild der Skulptur Alison Lapper Pregnant'
[2] um Missverständnissen vorzubeugen: Die Formulierung 'behinderte Menschen' wird in der vorliegenden Arbeit bewusst anstelle 'Menschen mit Behinderungen' verwendet. Dem zu Grunde liegt die Annahme des sozialen Konstrukts 'Behinderung'. 'Behinderte Menschen' betont diesen sozialen Konstruktcharakter deutlicher, als dies 'Menschen mit Behinderungen' vermag, da mit dieser Formulierung der Blickwinkel auf die in dem betreffenden Individuum liegende Behinderung tradiert wird (vgl. RÖDLER 2000, 24 f.).
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Kapitel liegt der Fokus auf der Betrachtung und der Analyse des Verhältnisses zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Es dient als Basis für die später erfolgende Analyse von hierarchischen Aspekten im Verhältnis zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen.
Das Kapitel unterteilt sich dabei in drei Schwerpunkte: Normalismus und Behinderung; Hierarchie im Spannungsfeld von Gleichheit und Differenz; Macht. Die drei Bereiche sollen abschließend als zusammen gedacht dargestellt werden.
"[...] the problem is not the person with disabilities; the problem is the way that normalcy is constructed to create the problem of the disabled person [...] the idea of a norm is less a condition of human nature than it is a feature of a certain kind of society." (DAVIS 2010, 3). Mit Lennard DAVIS möchte ich einleitend auf zwei Grundaspekte von Normalität und Behinderung hinweisen: das Konzept der Normalität ist einerseits entscheidend für das Bild von Behinderung, welches in der nicht behinderten Gesellschaft vorherrscht; andererseits ist dieses Bild nicht etwas Naturgegebenes, sondern wird durch die entsprechende Gesellschaft konstruiert. Damit unterliegt es historischer Wandelbarkeit. DAVIS (vgl. a.a.o. 4) gibt an, dass Begrifflichkeiten wie Normalität, Norm und normal in den europäischen Sprachen Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch getreten seien. Dieser Zeitpunkt gehe einher mit der einsetzenden Industrialisierung und den in Gebrauch kommenden Statistiken für alle Bereiche der Gesellschaft. Die Folge sei die Entstehung eines Mittelwerts gewesen. Die Gaußsche Normalverteilung sei das Symbol der "tyranny of the norm" (a.a.o. 6). Dieser Mittelwert sei in der Folge, und dies bis heute, für die Menschen zum Orientierungspunkt geworden. Dem Durchschnitt zu entsprechen stelle das Ideal dar (vgl. a.a.o. 5). Entsprechend dem Bild der Gaußschen Normalverteilung gebe es innerhalb einer Verteilung sogenannte Normalitätsgrenzen (vgl. SCHILDMANN 2004, 23). "So with the concept of the norm, comes the concept of deviation and extremes.", formuliert es DAVIS (2010, 7). Die Ränder der sogenannten Normalverteilung stellten demnach Abweichung und Extremwerte dar. Folglich seien auch behinderte Menschen, da außerhalb der Norm, hinter der Normalitätsgrenze stehend, als Abweichung zu sehen (vgl. a.a.o. 7). Auch Michel FOUCAULT (2003, 417) beschreibt die Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts als aufgeteilt in normal und anormal, getrennt durch eine medizinisch-psychiatrisch zu bestimmende Normalitätsgrenze. Jürgen LINK beschreibt diese Grenze genauer. Er untersucht die Änderung, welche die Grenze zwischen normal und abweichend erfährt. So könne eine Normalitäts-Zone, also der Bereich, der gesellschaftlich als normal angesehen ist, maximal komprimiert, aber auch maximal expandiert werden. Für eine stark komprimierte Zone, also einen sehr eng gefassten Begriff von Normalität, wählt Link die Bezeichnung protonormalistische Strategie. Eine expandierte Zone, also einen weiter gefassten Begriff von Normalität, bezeichnet er als flexibel-normalistische Strategie (vgl. LINK 1999, 77 f.). Dass es keine festgeschriebenen Normalitätsgrenzen gibt, unterstreicht die historische Wandelbarkeit. So kann gegenwärtig etwas als normal gelten, beispielsweise sexuelle Vorlieben, was vor 60 Jahren als abweichend bezeichnet worden wäre. Trotzdem existiert weiterhin eine Normalitätsgrenze. Der Raum dessen, was als normal und innerhalb dieser Grenze liegend betrachtet wird, vergrößert sich nur entsprechend der flexibel-normalistischen Strategie. Einen Überblick über Protonormalismus und Flexiblen Normalismus bietet ein Ausschnitt aus Links Zwei-Kolonnen-Schema (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: "Zwei-Kolonnen-Schema zum Protonormalismus und Flexibilitätsnormalismus", LINK 1999, 79.
|
protonormalistische Strategie |
flexibel-normalistische Strategie |
|
Status der Normalitätsgrenze |
|
|
• fixe und stabile Grenze = Stigma-Grenze • 'harte' semantische und symbolische Markierung der Grenze • Taktik 'reiner' Exklusion (z.B. Stigmatisierung aller "Auffälligen" als "Minusvarianten") • Tendenz zur 'Anlehnung' der Normalität an materielle Sonderterritorien (z.B. Gefängnis, Irrenanstalt) • Tendenz zur Bildung fixer "anormaler" biographischer und "Abstammungs-" Identitäten |
• dynamische und in der Zeit variable Grenze = Passage-Grenze • 'weiche' und 'lockere' semantische und symbolische Markierung der Grenze • Taktik von Exklusion-Inklusion (z.B. breites Spektrum von Behinderungen) • Tendenz zur stochastischen Marginalisierung von 'locker gefügten' Minoritäten • Statuswechsel "normal"-"anormal" in Biographie und Generationenfolge |
LINK betont, dass sich beide Strategien nicht gegenüberständen, oder gar ausschlössen. Beide Strategien könnten kombiniert werden und partiell Anwendung finden (vgl. a.a.o. 81). Die Ursache hierfür sei in der Selbst-Normalisierung der Individuen zu suchen. Link geht davon aus, dass "[...] die Grund-Angst der Moderne keine andere als die sein [kann], nicht normal zu sein (bzw. zu werden)" (a.a.o. 337). So verorteten Menschen sich selbst und andere permanent in Bereich von normal und anormal. Sie bewerteten ständig "ob das, was X und Y gemacht haben bzw. machen, noch normal ist" (ebd.) und distanzierten sich ggf. ex- oder implizit (vgl. ebd.). Diese Distanzierung bezeichnet LINK als Selbst-Normalisierung, da sie dafür verantwortlich sei, dass Individuen handelnd tätig werden in dem Sinn, dass ihr Handeln weg führe von anormalem Verhalten, hin zu einer imaginierten Mitte, hin zum Durchschnittswert des betreffenden Bereichs (vgl. ebd.). Ulrike SCHILDMANN bezeichnet dieses Phänomen als Denormalisierungsangst der bürgerlichen Gesellschaft (vgl. SCHILDMANN 2004, 100) und bezieht sich dabei auf einen Aufsatz von Ilse ABÉ und Annedore PRENGEL. Beide Autorinnen charakterisieren die bürgerliche Gesellschaft als eine, die in ständiger Furcht vor abweichendem Verhalten existiere. Zur Kontrolle ihrer Mitglieder habe die bürgerliche Gesellschaft verschiedenste Institutionen hervorgebracht (z.B. Schule), welche ein Sozialisationsmuster der Individuen generierten, das die Selbst-Normalisierung befürworte und Angst vor dem eigenen Herausfallen aus dem Bereich des Normalen verstärke. Die Autorinnen orientieren sich in diesen Aussagen an Foucaults Gesellschaftsanalyse (vgl. ABÉ; PRENGEL 1979, 24).
"Die Angst, unter Umständen in eine Zone von Anormalität geraten, anormal werden zu können, stößt von der Normalitätsgrenze nach innen hin ab, macht den Mittelwert also maximal attraktiv, weil in der Mitte die Distanz zu beiden Extremen maximal ist." (LINK 1999, 338f.). Auch Individuen mit flexibel-normalistischen Strategien würden sich aus diesem Grund nicht permanent in all ihren individuellen Bereichen (z.B. sexuelle Orientierung, Essgewohnheiten, Freunde, politische Ansichten, usw.) am Rande der Normalitätsgrenze bewegen, sondern in gewissen Bereichen immer wieder zur Mitte hin, zum Durchschnitt tendieren. Sich permanent am Rand der Normalität zu bewegen, ließe das Risiko aus eben dieser herauszufallen, zu groß werden (vgl. ebd.).
SCHILDMANN betrachtet Behinderung als Abweichung von männlicher bzw. weiblicher Normalität. Die Kategorie Behinderung diene dazu, die Abweichung zu klassifizieren. Folglich definiert sie "Behinderung als (eine mögliche) Form der Abweichung von der gesellschaftlichen Normalität [...] gemessen an einer Leistungsminderung im Zusammenhang mit gesundheitlichen Schädigungen und/oder intellektuellen Einschränkun gen." (SCHILDMANN 2003). Somit ordnet die Autorin, wie in diesem Kapitel eingangs bereits getan, Behinderung als von gesellschaftlicher Normalität abweichend ein. Wird Behinderung dementsprechend definiert, macht es meiner Auffassung nach keinen Sinn, Behinderung in diverse Unterkategorien zu unterteilen. Ob sehbehindert, nicht-hörend, körper- oder geistigbehindert (usw.) macht für die beschriebenen Sichtweise von Behinderung als Abweichung von Normalität keinen Unterschied. Somit wird in dieser Arbeit generell von Behinderung gesprochen.
Cornelia BOHN formuliert, dass alles nur in "Differenz zu anderen" bestimmbar sei (BOHN 2003). Im Zusammenhang von behindert und nicht behindert bedeutet dies, dass Behinderung nur in Abgrenzung zu Nicht-Behinderung deutlich wird. Behinderung wird als das beschrieben, was der Normalität entgegen steht. In dieser Lesart würde Behinderung dadurch greifbar, dass sie aus der Norm heraus abgeleitet und ins Negative verkehrt werde. Bezugspunkt und Ausgangslage für Behinderung sei damit die gesellschaftliche Normalität (vgl. MOSER 1997, 142). Somit ist nicht das Individuum als solches behindert, sondern die gegenwärtig vorherrschende Normalitätsgrenze schließt es aus dem Bereich der Normalität aus. Da nicht behinderte Individuen durch die oben angesprochenen vielfältigen Sozialisationserfahrungen über entsprechende Normalitätsgrenzen in ihrem Denken verfügen, sind faktisch diese für das Ausschließen aus Normalität verantwortlich. PRENGEL gibt einen weiteren möglichen Grund für das Ausgrenzen hin zur Anormalität an. Behinderte Menschen riefen in nicht behinderten Individuen Empfindungen der Begrenztheit und Verletzbarkeit des eigenen Lebens hervor, da behinderte Menschen oftmals mit den entsprechenden Ängsten lebten: "abhängig von anderen sein, auf Hilfe angewiesen sein, körperlich verletzt zu sein, diskriminiert werden, nicht mithalten können, krank, oder sogar sterbenskrank sein" (PRENGEL 1995, 165). Diese unbewussten, aber durch Behinderung hervorgerufenen Ängste trügen ebenfalls zu einem Ausgrenzen aus der Normalität bei (vgl. ebd.).
Gleichwohl Behinderung bisher im Spannungsfeld von Normalität und Anormalität, als Produkt der Denormalisierungsangst der bürgerlichen Gesellschaft verortet wurde, ist diese Sichtweise keineswegs konsensfähig, oder gesellschaftlich anerkannt. Die Sichtweise von Behinderung als biologistisches Konzept, als intraindividuelles Merkmal, als Defekt, hält sich nach wie vor. Beispielsweise ist für das Bundesland Berlin im Feststellungsverfahren für den sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen festgelegt, dass "die Sonderpädagogin oder der Sonderpädagoge [...] auf der Grundlage behinderungsspezifischer diagnostischer Verfahren Stellung zu Umfang, Grad und Art des son2 Theoretische Grundlagen 10 derpädagogischen Förderbedarfs [nimmt]. Bei Kindern oder Schülerinnen und Schülern, bei denen kognitive Einschränkungen vermutet werden, erhebt sie oder er zusätzlich psychometrische Daten. Der kognitiven Leistungsüberprüfung sind zwei wissenschaftlich anerkannte Testverfahren zu Grunde zu legen, von denen mindestens ein Test sprachfrei sein muss. [...]" (VO SONDERPÄDAGOGIK 2005, § 32 (3)). Die kognitive Leistungsüberprüfung, also das intraindividuelle Merkmal Intelligenz, wird zum ausschlaggebenden, messbaren Faktor, der über den sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen entscheidet. Ein weiterer Faktor, welcher die Fokussierung auf das Individuum tradiert, ist der der Ressourcenorientierung. So "ist die Feststellung von 'Behinderung' und ihres Grades nach wie vor Grundlage für die Mobilisierung von Ressourcen, deren Diagnose in der Regel ausschließlich von Mediziner/innen vorgenommen wird." Hierin zeige sich das Fortbestehen "eines außergesellschaftlichen, körpereigenen Kerns von Behinderung" (beide MOSER 2010, 299 f.). Die beiden Beispiele sollen genügen, um das gesellschaftlich konsensfähige Paradigma von Behinderung zu erläutern. Für die Arbeit soll hingegen der ausführlich vorgestellte Ansatz von Behinderung als Abweichung von Normalität, mit der Fokussierung auf Interaktionsprozesse zwischen behinderten und nicht behinderten Individuen, wie der Denormalisierungsangst und Abgrenzungstendenzen des eigenen Seins von als anders wahrgenommenen Individuen von Bedeutung sein. Der letzte Aspekt soll im folgenden Kapitel ausführlicher vorgestellt werden.
Gleichheit und Differenz können beide ohne den jeweils anderen Begriff nicht definiert werden. Sie "sind in einem Abhängigkeitsverhältnis aufeinander bezogen: Gleichheit kann nicht bestimmt werden ohne Verschiedenheit. Die Existenz von Verschiedenheit ist die Voraussetzung für das Feststellen von Gleichheit." (PRENGEL 1995, 30). In ihrer Pädagogik der Vielfalt widmet sich PRENGEL ausführlich der Bedeutung von Gleichheit und Differenz für die menschliche Entwicklung. Dabei betont sie, dass es nie vollkommene Gleichheit zwischen Individuen geben könne, genauso wie vollkommene Verschiedenheit zwischen Individuen nicht vorkommen werde. Vollkommene Gleichheit bedeute Identität, vollkommene Verschiedenheit sei schon deshalb unmöglich, da es sich bei allen Individuen um Menschen handele, die kommunizierten, usw. (vgl. a.a.o. 30 f.). Folglich könnten die Begriffe Gleichheit und Differenz stets nur Aussagen über festzulegende Bereiche (z.B. Augenfarbe, verwendete Sprache, usw.) treffen, jedoch seien sie nicht in der Lage, Aussagen über "die generelle Beziehung [von Individuen] mit allen Aspekten zu machen" (a.a.o. 33). Die Pädagogik der Vielfalt beschreibt PRENGEL als Möglichkeit ein inklusives Schulsystem zu etablieren, in dem alle Schüler und Schülerinnen, unabhängig von ihren Voraussetzungen, Kompetenzen und Schwierigkeiten gleichberechtigt miteinander lernen könnten. Dabei gibt PRENGEL an, dass Verschiedenheit ausdrücklich nicht als hierarchisierende Systematisierung, als Polarität zwischen Individuen verbunden mit Höher- und Minderwertigkeit zu verstehen sei (vgl. a.a.o. 32). Hierfür prägt sie den Begriff der Egalitären Differenz. "Die Option für Vielfalt impliziert die Option für Gleichheit. Egalität und Diversität werden nicht als gegensätzlich entworfen, sondern als einander bedingend. Denn Gleichheit ohne Offenheit für Vielfalt würde eine das Andere ausgrenzende Angleichung bedeuten und Vielfalt ohne Gleichheit eine das Andere unterordnende Hierarchisierung des Verschiedenen." (PRENGEL 2007, 52). Gleichheit und Differenz bildeten dementsprechend zwei gleichberechtigte Impulse der menschlichen Entwicklung. "Egalitäre Differenz ist die grundlegende Idee der Pädagogik der Vielfalt, die ein nichthierarchisches, freiheitliches und entwicklungsoffenes Miteinander der Verschiedenen anstrebt." (PRENGEL 2001, 96). Diesem Gedanken folgt auch Helmut REISER (1991, 14), wenn er die menschliche Entwicklung als durch zwei Tendenzen gekennzeichnet erläutert. Einerseits die Tendenz zur Gleichheit mit anderen Menschen, zur Verbundenheit, zur Annäherung an Andere. Anderseits die Tendenz zur Abgrenzung, zur Differenz, zur Autonomie der Person. "Ohne Entwicklungeiner persönlichen Identität wird die soziale Identität zur Anpassung, zur Reduktion des selbstbestimmten Lebens, ohne Entwicklung einer sozialen Identität wird die persönliche Durchsetzung zum inhumanen Egoismus." (ebd.). Das heißt, es müsse eine ständige Balance zwischen Gleichheit und Differenz, sowohl zwischen Gruppen, Individuen als auch inneren Persönlichkeitsanteilen geben. Auch Andreas HINZ formuliert: "Da wir gleichzeitig gleich und verschieden sind, muß es auch gegensätzliche Anteile bei jeder Persönlichkeit, in jedem Dialog, in jeder gemeinschaftlichen Situation geben. Demnach sind Verhaltensweisen der Abgrenzung und Distanzierung genauso wichtige Anteile wie solche der Annäherung und der Harmonie." (HINZ 1993, 34). "Normative Voraussetzung dieser Sichtweise ist, daß beiden Partnern oder Gruppen von Personen ein Eigencharakter, eine eigene Identität und eine grundsätzliche Gleichberechtigung auch bei unterschiedlicher Leistungsfähigkeit zugestanden wird." (REISER 1991, 16).
Dieses Verständnis von Egalitärer Differenz beschreibt sowohl den Weg hin zu, als auch das Ziel einer inklusiven Schule. Differenz ist gleichwertig, alle Menschen sind gleichwertig. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass in einer Gesellschaft, wie folglich auch in deren Schulsystem, in der proto- und flexibel-normalistische Grenzen bestehen, diese Idee der Egalitären Differenz nicht verwirklicht ist. Demnach führt Differenz zwischen Individuen zu hierarchisierenden Systematisierungen und damit zu Höher- und Minderwertigkeitsvorstellungen. Helma LUTZ und Norbert WENNING beschreiben die Gesellschaft als durchdrungen von solchen Polaritäten, die nicht auf Egalitärer Differenz beruhen. Die Tabelle 2 nennt 13 dieser Gegensätze.
Tabelle 2: 13 bipolare hierarchische Differenzlinien, LUTZ; WENNING 2001, 20.
|
Kategorie |
Grunddualismsus |
|
Geschlecht |
Männlich - weiblich |
|
Sexualität |
Hetero - homo |
|
"Rasse"/ Hautfarbe |
Weiß - schwarz |
|
Ethnizität |
Dominante Gruppe - ethnische Minderheit(en) = nicht ethnisch - ethnsich |
|
Nation/Staat |
Angehörige - Nicht Angehörige |
|
Klasse |
Oben - unten, etabliert - nicht etabliert |
|
Kultur |
"zivilisiert" - "unzivilisiert" |
|
Gesundheit |
Nicht-behindert - behindert |
|
Alter |
Erwachsene - Kinder, alt - jung |
|
Sesshaftigkeit/Herkunft |
Sesshaft - nomadisch/angestammt - zugewandert |
|
Besitz |
Reich/wohlhabend - arm |
|
Nord - Süd/Ost - West |
The West - the rest |
|
Gesellschaftlicher Entwicklungsstand |
Modern - traditionell (fortschrittlich - rückständig, etnwickelt - nicht entwickelt) |
LUTZ und WENNING (vgl. 2001, 20) geben an, dass die Grunddualismen zwar komplementär scheinen, jedoch hierarchisch wirken, indem die linke Seite, z.B. nichtbehindert oder männlich, als Norm gelte und die rechte Seite, z.B. behindert oder weiblich, als Abweichung von der Norm zu bewerten sei. PRENGEL verknüpft in ihrer Analyse solcher Polaritäten Ungleichheit mit undemokratischen Denken und schlussfolgert, dass Unterschiede von Menschen zwangsläufig zu einer Über- und Unterordnung führten. "Entscheidend für undemokratische Denkstrukturen in all ihren Variationen ist, daß aus Unterschieden Rangordnungen gebildet werden. Undemokratisches Denken vollzieht Hierarchisierung, wenn es von Gleichheit und Differenz spricht." (PRENGEL 1995, 34). Dabei prägt sie die Bezeichnung eines konservativen und eines demokratischen Gleichheitsbegriffes. Der konservative Gleichheitsbegriff wirke hierarchielegitimierend und ausschließlich gruppenintern, beachte also z.B. Gleichheitsforderungen für bürgerliche Frauen in Europa, statt für Frauen an sich. Im Gegensatz dazu wirke der demokratische Gleichheitsbegriff hierarchieauflösend und universell (vgl. a.a.o. 35).
Monika SCHUHMANN beschreibt das zuletzt geschilderte Verhältnis von Gleichheit und Differenz, dem ein konservativer Gleichheitsbegriff zugrunde liegt, als Dominanzkultur. "Die Festschreibung von Differenz [...] legitimiert soziale Ausgrenzung und dient der Aufrechterhaltung der ungleichen gesellschaftlichen Verhältnisse." (SCHUHMANN 2001, 3). Dabei sei Dominanzkultur auch immer Herrschaftskultur, welche darauf basiere, dass die Selbstkonstruktion darauf beruhe, dass Andersartigkeit abgespalten werde (vgl. ebd.). Dies wurde im Kapitel 2.1 bereits beschrieben. Wichtig sei zu betonen, dass "das Andersartige [...] in der Dominanzkultur aber nicht nur als Differenz empfunden [wird], sondern zugleich als minderwertig" (ebd.). Behinderte Menschen würden somit zum Objekt "hierarchischer und paternalistischer Fürsorge und Fremdbestimmung" (a.a.o. 3 f.). Dominanz- und Herrschaftskultur beschreibt in diesen Formulierungen am Treffensten das hierarchische Verhältnis zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen.
Da Herrschaft und Dominanz eng mit Macht verknüpft sind, soll im folgenden Teil der Machtbegriff Foucaults kurz erörtert werden, um das Verständnis von ungleicher Differenz zu vervollständigen.
Macht kann "weder in bestimmten Institutionen noch im Staatsapparat [fest gemacht werden]. Diese greifen auf sie zurück; sie benützen, fördern oder erzwingen ihre Prozeduren. Aber sie selbst mitsamt ihren Mechanismen und Wirkungen liegt auf einer anderen Ebene. Es handelt sich gewissermaßen um eine Mikrophysik der Macht, die von den Apparaten und Institutionen eingesetzt wird; ihre Wirksamkeit liegt aber sozusagen zwischen diesen großen Funktionseinheiten und den Körpern mit ihrer Materialität und ihren Kräften." (FOUCAULT 1994b, 37 f.). Damit beschreibt FOUCAULT den Grundgedanken des von ihm erforschten Konzepts der Macht. Zwar gebe es durchaus auch Institutionen, welche Macht auf ihre Mitglieder ausübten, um sie zu normalisieren und im Sinne des Herrschaftssystems zu disziplinieren, wie beispielsweise Psychiatrie, Gefängnis aber auch Schule (vgl. FOUCAULT 2008, 40). Macht als solche herrsche jedoch vielmehr jenseits solcher Institutionen und präge das Handeln eines jeden Individuums. Innerhalb einer Gesellschaft existiere kein machtfreier Raum (vgl. POLAT 2010, 42). "Die Macht wirkt durch kleinste Elemente: die Familie, die sexuellen Beziehungen, aber auch: Wohnverhältnisse, Nachbarschaft, etc." (FOUCAULT 1976, 114). FOUCAULT unterscheidet grundsätzlich zwei Machtformen, juridische und produktive Macht. Die juridische Form sei vor allem durch ein negatives Verhältnis gekennzeichnet, welches "Verwerfung, Ausschließung, Verweigerung, Versperrung, Verstellung oder Maskierung" thematisiere (POLAT 2010, 27). Diese negative Machtform erfülle vor allem regelnde Funktionen innerhalb einer Gesellschaft und könne dabei eine unterdrückende Wirkung auf den Menschen entfalten (vgl. ebd.). Die produktive Machtform hingegen verkörpere das Gegenteil, "sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion" (FOUCAULT 1994b, 249 f.).
Macht befinde sich in einem ständigen Austausch zwischen Individuen, die in ihrer Beziehung Macht ausübten, um gegenseitig Einfluss aufeinander zu nehmen (vgl. POLAT 2010, 32). Somit ist "die Macht [...] niemals voll und ganz auf einer Seite. So wenig es einerseits die gibt, die die Macht haben, gibt es andererseits die, die überhaupt keine haben." (FOUCAULT 1976, 115). Folglich unterscheidet FOUCAULT zwischen einem Gewalt- und einem Machtverhältnis. Ein Gewaltverhältnis wirke auf einen Körper ein, "es zwingt, beugt, bricht, es zerstört: es schließt alle Möglichkeiten aus; es bleibt ihm kein anderer Gegenpol als der der Passivität" (FOUCAULT 1994a, 254). Hingegen sei das Machtverhältnis dadurch gekennzeichnet, dass das Individuum Subjekt seines Handelns bleibe und ihm Möglichkeiten zur Handlung, Reaktion und Antwort zur Verfügung stünden (vgl. ebd.). FOUCAULT prägt dabei den Begriff des Regierens: "Regieren heißt [...] das Feld eventuellen Handelns der anderen zu strukturieren." (a.a.o. 255). Dieses Verständnis von Regieren - Gouvernement - meine explizit kein Gewaltverhältnis oder die juridische Machtform (vgl. ebd.).
Die herrschende Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine proto- und flexibel-normalistische Struktur. Es existieren enger und weiter gefasste Normalitätsgrenzen, die bestimmen, welches Verhalten und welche Individuen gesellschaftlich als normal, bzw. anormal betrachtet werden. Behinderung wird in diesem Kontext als Abweichung von Normalität beschrieben, behinderte Menschen werden als anormal gekennzeichnet, da ihre Behinderung als ein Wesensmerkmal ihres Körpers betrachtet wird.
Das Verhältnis von Menschen untereinander wird als durch Gleichheit und Differenz geprägt beschrieben. Jeder Mensch benötigt für die Ausbildung seiner oder ihrer Identität beide Anteile. Somit sind Gleichheit und Differenz dialektisch aufeinander bezogen und ausbalanciert. In Bezug auf Behinderung und Nicht-Behinderung ist dieses Verhältnis nicht ausgeglichen. Zwischen Beidem existiert eine hierarchische Differenzlinie, wobei Nicht-Behinderung als Norm charakterisiert wurde, die nur dadurch greifbar wird, dass sie sich von Behinderung abgrenzt und diese ausschließt. Im Verhältnis von Nicht-Behinderung und Behinderung entsteht somit Hierarchie. Dieses hierarchische Verhältnis wurde als Dominanz- und Herrschaftskultur gekennzeichnet, wodurch Behinderung als minderwertig stigmatisiert wird.
Macht existiert in jedweder Interaktion. Sie lässt sich unterteilen in juridische Macht und in produktive Macht, oder anders formuliert in ein Gewaltverhältnis und in ein Machtverhältnis. Nach FOUCAULT existiere zwischen Individuen eher ein Machtverhältnis, da beide Interagierenden über Macht verfügten.
Das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung wurde als ein hierarchisches gekennzeichnet. Unbeantwortet ist bisher jedoch, ob ein behinderter Mensch in jedem Fall noch über Macht und in der Interaktion zum nicht behinderten Menschen über Handlungsmöglichkeiten verfügt, oder ob die Interaktion eher mit FOUCAULTS Konzept eines Gewaltverhältnisses zu beschreiben ist. Die Frage der Ausprägung der Hierarchie wurde demnach bisher nicht angesprochen. Da sich diese Frage nicht definitiv und für alle Situationen beantworten lässt, soll im Folgenden der Versuch gemacht werden, das hierarchische Verhältnis von Nicht-Behinderung und Behinderung genauer zu fassen, um eine Beurteilung hinsichtlich der Ausprägung von Macht- oder Gewaltverhältnis adäquater treffen zu können. Dazu soll die Gender Analyse als Grundlage dienen.
Inhaltsverzeichnis
Das folgende Kapitel dient einer Analyse der Geschlechterverhältnisse. In 1 Einleitung wurde bereits kurz erläutert, warum die Gender Analyse geeignet erscheint, um Aspekte zur Kennzeichnung des hierarchischen Verhältnisses von Behinderung und Nicht-Behinderung zu erlangen. Folgend soll aus dem Blickwinkel einer dekonstruktivistischen Analyse heraus das Geschlechterverhältnis betrachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass die getroffenen Aussagen nicht das Verhältnis eines jeden Mannes zu einer jeden Frau wiedergeben. Die Beschreibungen stellen eine Tendenz dar und sind allgemein gehalten, um den Sachverhalt darstellbar zu machen. Abschließend werden die wichtigsten Aspekte der Dimensionen noch einmal zusammengefasst.
Die folgenden Hierarchie Dimensionen werden von mir selbst gewählt und benannt, um einen besseren Überblick über die Thematik zu ermöglichen. Die Ausführungen der verschiedenen Autoren und Autorinnen zu Aspekten der Gender Analyse werden den einzelnen Dimensionen zugeordnet, um eine klare Struktur zu erhalten. 'Dimension' beschreibt dabei ein nicht eindeutig abgrenzbares Phänomen, was der Überschneidung der einzelnen Aspekte Rechnung tragen soll. Eine einzelne Betrachtung der Dimensionen ist folglich nur theoretisch sinnvoll. Um ein Gesamtbild des hierarchischen Geschlechterverhältnisses zu erlangen, müssen die einzelnen Hierarchie Dimensionen als zusammen gedacht und sich wechselseitig bedingend wahrgenommen werden.
"It is no accident that women's rights are rising as the strategic value of masculine brawn declines. Who need 10 or 15 percent more muscle power when the decisive processes of production take place in automated factories or while people sit at desks in computerized offices?" (HARRIS 1996, 75). Diese Sichtweise von Marvin HARRIS hat populärwissenschaftlich betrachtet vieles für sich. Benennt sie doch offensichtliche biologische Unterschiede, die angesichts sich modernisierender Produktions- und Arbeitsweisen zunehmend marginal erscheinen. Dessen ungeachtet werden Frauen und Männer in biologisch eindeutig von einander unterscheidbare Kategorien (Muskelkraft) klassifiziert. Diese Lesart findet sich auch in der Unterscheidung der englischen Begriffe 'sex' und 'gender' wieder. 'Sex' bezeichne dabei das biologische Geschlecht, wie Chromosomen, Genitalien und auch Muskelkraft. 'Gender' hingegen untersuche das soziale Geschlecht, also jenes, welches durch Sozialisation und Normen erworben werde (vgl. MILLER 1996, 4). Kritiker und Kritikerinnen bemängeln an dieser Aufteilung in biologische und soziale Aspekte, dass biologische Unterschiede weiterhin herangezogen würden, um ein Frausein und ein Mannsein zu begründen, als existierten naturgegebene Aspekte, welche dafür sorgten, dass Frauen im Vergleich zu Männern dieses oder jenes könnten oder nicht könnten, besser oder schlechter zu tun vermögen (vgl. GILDEMEISTER 2001, 66 f.). Als erste formulierte so Simone de BEAUVOIR: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt." (BEAUVOIR 1992, 334). Rolf EICKELPASCH (2001, 58) unterstützt dies: "Geschlecht ist [...] weniger etwas, das wir haben, als etwas, was wir tun. Die Geschlechterdifferenz ist keine naturhafte Eigenschaft von Individuen, sondern eine Vollzugswirklichkeit, die fortlaufend interaktiv inszeniert wird." Biologische Aspekte seien demnach bedeutungslos dafür, wie Frauen und Männer sind. Vielmehr konstruiere die soziale Welt "den Körper als geschlechtliche Tatsache und als Despositorium von vergeschlechtlichten Interpretationsund Einteilungsprinzipien" (BOURDIEU 2005, 22). Pierre BOURDIEU gibt damit an, dass biologische Unterschiede der Rechtfertigung von Unterschieden der sozialen Geschlechter dienten. In Folge dessen würden die konstruierten sozialen Unterschiede zur Legitimation für die jeweils herrschende Form der Gesellschaft genutzt, obwohl genau diese herrschende Form der Gesellschaft die Gender Unterschiede erst hervorgebracht habe (vgl. a.a.o. 22 f.). Dies bezeichnet er als "zirkelhafte Kausalbeziehung" (a.a.o. 23). Damit unterstreicht BOURDIEU die historische Wandelbarkeit von Geschlechterrollen, da jede Gesellschaftsformation auf unterschiedlichen Herrschafts- und Produktionsweisen beruhe, bedürfe es einer spezifischen Legitimation für eben diese. In Bezug auf Frauen bedeutet dies für eine vergangene europäische Gesellschaftsformation, dass sie als nicht fähig erachtet werden, Eigentum zu besitzen. Diese vermeintliche Eigenschaft der Frauen wird wiederum als Begründung herangezogen, weshalb sie kein Eigentum besitzen, gerade weil dies der Legitimation der herrschenden Gesellschaftsformation entspricht. BOURDIEU verknüpft also Geschlechterrollen mit Herrschaft.
Gemeinsam sei allen Gesellschaften, dass sie das für ihre Ordnung konstruierte soziale Geschlecht auf biologische Unterschiede von Mann und Frau zurückführten. Hierin sieht Bourdieu die Ursache der angesprochenen Herrschaft, denn anstelle vermeintlicher natürlicher Gegebenheiten von Mann und Frau "ist es eine willkürliche Konstruktion des Biologischen und insbesondere des - männlichen und weiblichen - Körpers, seiner Gebrauchsweisen und seiner Funktionen vor allem in der biologischen Reproduktion,die der männlichen Sicht der Teilung der geschlechtlichen Arbeit und der geschlechtlichen Arbeitsteilung und darüber hinaus des ganzen Kosmos ein scheinbar natürliches Fundament liefert" (BOURDIEU 2005, 44). Herrschaft, welche BOURDIEU als männliche Herrschaft kennzeichnet, basiere demnach darauf, dass soziale Konstrukte als naturgegeben dargestellt würden und die männliche Herrschaft somit legitimierten. Zu beachten sei dabei, dass Natur selbst nur ein soziales, naturalisiertes Konstrukt darstelle (vgl. a.a.o. 44 f.). Regine GILDEMEISTER beschreibt den Prozess der Geschlechtszuweisung wie folgt: Mit der Geburt, bzw. der pränatalen Feststellung von Genitalien oder dem Chromosomensatz würde die Zuordnung zu einer Geschlechtsklasse vorgenommen. Mit dieser Zuordnung "setzt ein Prozess ein, in dem die Klassifikation mit einer Mitgliedschaft [...] verbunden wird [...]" (GILDEMEISTER 2001, 72). Diese Mitgliedschaft würde nach außen und nach innen validiert - Gender entstehe. Beides, sowohl Klassifikation, als auch Mitgliedschaft seien keine natürlichen, sondern soziale Prozesse. "Aus am Körper verorteten Genitalien entstehen [...] noch keine Geschlechter und auch keine Geschlechterordnung - aber aus einer Geschlechterordnung können Genitalien zu Geschlechtszeichen, zu einem zentralen Bedeutungsgehalt werden." (a.a.o. 69 f.). Auch Dagmar VINZ und Katharina SCHIEDERIG kritisieren die Tendenz von biologisierten Erklärungsversuchen. So seien Ergebnisse der Hirnforschung, welche anhand von stärker oder schwächer ausgeprägten Hirnarealen eine besser oder schlechter Eignung von Frauen und Männern für spezifische Kompetenzen wie Sprachvermögen oder Orientierungssinn postulieren, skeptisch zu sehen. Es gebe keine homogene Gruppe Frau, deren Sprachvermögen stärker entwickelt sei, als das der Gruppe Mann. Die Verteilung innerhalb der vermeintlich homogenen Gruppen variiere zum Teil stärker als im Vergleich zur anderen Geschlechtsklasse. Des weiteren sei das Hirn dynamisch konzipiert, entsprechend seiner Beanspruchung. Je stärker also ein Teil beansprucht würde, desto mehr sei er auch entwickelt (vgl. VINZ; SCHIEDERIG 2009, 16). Hier setzt wiederum BOURDIEUS Konzept der zirkelhaften Kausalbeziehung an, wenn biologistische Begründungen für eine Frauen zugeschrieben Kompetenz (Sprachvermögen) herangezogen werden. Obwohl die Ausprägung dieser Kompetenz eng verknüpft mit der sozialen Zuschreibung sei, dass Frauen sprachlich kompetent wären und sie dementsprechend mehr Gelegenheit bekämen, das entsprechende Hirnareal zu 'trainieren' und zu entwickeln. DieProphezeiung erfülle sich selbst (vgl. BOURDIEU 2005, 109 f.). Eine Trennung in 'sex' und 'gender' legitimiert folglich weiterhin eine männliche Herrschaft, statt diese als Herrschaft und Dominanz zu kennzeichnen. BOURDIEU untersucht in verschiedenen Werken, warum diese Herrschaft jedoch als naturgegeben, als in den Körper eingezeichnet erscheint. Er spricht von der "Somatisierung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse" (BOURDIEU 2005, 45). Diese Somatisierung, oder Inkorporierung (vgl. a.a.o. 63), kennzeichnet er wie folgt: "Es scheint durchaus, als würden die mit bestimmten sozialen Verhältnissen gegebenen Konditionierungsprozesse das Verhältnis zum eigenen Leib festschreiben - in eine ganz bestimmte Weise, seinen Körper zu halten und zu bewegen, ihn vorzuzeigen, ihm Platz zu schaffen, kurz: ihm soziales Profil zu verleihen" (BOURDIEU 1989, 739). Dabei bedeutend ist der Habitusbegriff BOURDIEUS (vgl. BOURDIEU 2005, 45). Habitus sei die durch Sozialisationserfahrungen in den Körper eingeschriebene Art, sich zu verhalten, zu bewegen, Geschmack auszubilden, Vorlieben und Abneigungen zu haben, Moral und Werte zu entwickeln, usw. Dies geschehe nicht willkürlich, sondern entsprechend der sozialen Position, die ein Individuum innehabe: "Als eine Art gesellschaftlicher Orientierungssinn[...], als ein praktisches Vermögen des Umgangs mit sozialen Differenzen, nämlich zu spüren oder zu erahnen, was auf ein bestimmtes Individuum mit einer bestimmten sozialen Position voraussichtlich zukommt und was nicht, und untrennbar damit verbunden, was ihm entspricht und was nicht, lenkt der Geschmack die Individuen mit einer jeweiligen sozialen Stellung sowohl auf die auf ihre Eigenschaften zugeschnittenen sozialen Positionen als auch auf die praktischen Handlungen, Aktivitäten und Güter, die ihnen als Inhaber derartiger Positionen entsprechen, zu ihnen 'passen' [...]." (BOURDIEU 1989, 728). Dies trifft im selben Maß auf Männer und Frauen zu, die entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einem biologischen Geschlecht entsprechende männliche und weibliche Sozialisationserfahrungen machen. BOURDIEU sieht durchaus etwas Positives in diesem Prozess, wenn er formuliert: "Resultat der Inkorporierung der Grundstrukturen einer Gesellschaft und allen Mitgliedern derselben gemeinsam, ermöglichen diese Teilungs-und Gliederungsprinzipien [Alters-, Geschlechts-, Gesellschaftsklassen] den Aufbau einer gemeinsamen sinnhaften Welt, einer Welt des sensus communis." (a.a.o. 730). Der Prozess der Inkorporierung der sozialen Verhältnisse, also dessen, was als weiblich und was als männlich betrachtet wird, führt einerseits zu einer gewissen Vorhersagbarkeit von Welt und damit zu sinnhafter Orientierung. Anderereits wird jedoch die männliche Herrschaft mit somatisiert. Diese Argumentation widerspreche auch einer Sichtweise von Frauen als mit schuldig an ihrer gesellschaftlichen Position. Die sozialen Verhältnisse, welche Männer als dominierend den Frauen gegenüber determinierten, würden nicht in einem bewussten Prozess inkorporiert. Folglich sei ein sich Bewusstmachen auch keine umfassende Lösungsstrategie (vgl. BOURDIEU 2005, 72 ff.). Somatisierung sei im Sinne des Wortes zu verstehen, als in die tiefsten Körperstrukturen eingeschriebene Dispositionen, welche den Habitus einer Person ausmachten. Gesten, die Art zu reden und sich zu Bewegen usw., entzögen sich der bewussten Kontrolle und kennzeichneten doch die männliche Herrschaft. In diesem Zusammenhang spricht BOURDIEU auch nicht von Geschlechterrollen, wie dies oben teilweise erfolgt ist, da Rollen beliebig an- und abgelegt werden könnten. Treffender sei die Bezeichnung Geschlechterordnung, da diese nicht durch Umdefinitionen von Begriffen und Tätigkeiten aufgehoben werden könnten (vgl. a.a.o. 178). Demnach darf der Konstruktionscharakter von Geschlechterordnung nicht bedeuten, dass das Konstrukt einfach dekonstruiert werden könne. Gerade durch die Inkorporierung erscheine es so manifest wie naturgegebene Aspekte, welche nicht verändert werden könnten (vgl. GILDEMEISTER 2001, 82 f.). In den folgenden Betrachtungsebenen soll genauer auf das Geschlechterverhältnis eingegangen werden, welches in diesem Abschnitt als somatisiert gekennzeichnet wurde.
Nach Esther GOODY diene Ideologie dazu, "die Herrschaft der Männer in unterschiedlicher Weise zu rechtfertigen und zu befestigen" (GOODY 1991, 93). Den Ursprung der herrschenden Ideologie macht sie an der christlich-jüdischen Mythologie fest. Demnach habe Eva Adam zum Essen vom Baum der Erkenntnis verführt, wofür Gott sie bestrafe. Einerseits, indem sie unter Schmerzen Kinder gebären solle und andererseits, indem sie Adam Untertanin sein solle. Dies gibt GOODY als religiöse Legitimation für die herrschenden Gesellschaftsformationen an, in denen Frauen den Männern untergeordnet seien (vgl. a.a.o. 89 f.). Ähnliche Erklärungsmuster fänden sich auch in vielen weiteren Kulturen und ihren religiösen Vorstellungen (vgl. a.a.o. 92). Männliche Herrschaft sei demnach nicht verhandelbar, sondern natürlich und gottgegeben. Diese quasi natürliche, religiöse Ideologie der Herrschaftsverteilung von Mann und Frau habe über Jahrhunderte dafür gesorgt, dass sich Frauen in das Machtsystem gefügt hätten und ihre durch die Ideologie legitimierte Rolle akzeptierten (vgl. a.a.o. 93). Nach de BEAUVOIR finden sich in der christlich-jüdischen Mythologie weitere Aspekte, welche die Geschlechterordnung bestimmen. "Eva wurde nicht gleichzeitig mit dem Mann erschaffen; sie wurde weder aus einem anderen Stoff noch aus dem gleichen Lehm geformt wie Adam: sie wurde aus den Rippen des ersten Mannes genommen." (BEAUVOIR 1992, 192). Die jüdisch-christliche Mythologie propagiere damit ein Verständnis von weiblich als das Unwesentliche, als das vom Männlichen Abgeleitete, als das Andere, welches das Eine - das Männliche - nur ergänzen könne und ihm dabei stets untergeordnet sei. Norm sei folglich an sich männlich. Männlich als das Ursprüngliche, das Wesentliche, das Eine, woraus weiblich abgeleitet sei (vgl. MOSER 1997, 142). "So erschien die Frau als das Unwesentliche, das nie zum Wesentlichen wird, als das absolute Andere ohne Wechselseitigkeit." (BEUAVOIR 1992, 192). In dieser Lesart sei Eva von Gott für den Mann bestimmt. "Sie hat ihren Ursprung und ihren Zweck in ihrem Gatten und ist im Grunde seine unwesentliche Ergänzung." (ebd.). Mann und Frau werden somit "als zwei hierarchisierte Wesenheiten konstruiert" (BOURDIEU 2005, 44).
In Folge dessen bezeichnet auch Luce IRIGARAY die Gesellschaft als phallokratische Ordnung, in der das Männliche dominiere und die Norm darstelle. Entsprechend ihrer psychoanalytischen Sichtweise macht sie diese Annahme vor allem an Sexualität und Genitalien fest. Als Beispiel für den phallokratischen Charakter der Gesellschaft gibt IRIGARAY Freuds These vom 'Penisneid' an, anhand derer deutlich würde, dass das eigentliche Geschlecht das männliche sei und Frauen sich dadurch definierten, 'männlich' sein zu wollen (vgl. IRIGARAY 1979, 70 f.). Die Frau wird darin als "negative, einzig durch Mangel definierte Entität" betrachtet (BOURDIEU 2005, 51). Das Geschlecht der Frau "wird als kein Geschlecht gezählt. Als Negativ, Gegenteil, Kehrseite dessen, das einzig sichtbare und morphologisch bezeichenbare [...] Geschlecht zu besitzen: den Penis." (IRIGARAY 1979, 26). "Niemals geht es in diesen Aussagen um die Frau. Das Weibliche wird als das notwendige Komplement zum Funktionieren der männlichen Sexualität definiert." (a.a.o. 72).
Im Kontext von männlicher Norm ist auch die oben bereits angesprochene Denormalisierungsangst (vgl. SCHILDMANN 2004, 100) von Bedeutung. Die Motivation für viele männliche Aktivitäten sei die Angst die Männlichkeit zu verlieren. Sie müsse immer wieder unter Beweis gestellt werden (vgl. BOURDIEU 2005, 96 ff.). "Männlichkeit [ist] ein eminent relationaler Begriff, der vor und für die anderen Männer und gegen die Weiblichkeit konstruiert ist, aus einer Angst vor dem Weiblichen, und zwar in erster Linie in einem selbst." (a.a.o. 96).
BOURDIEU beschreibt die bisher angeführten Thesen über das Männliche als die Norm, über Menschlichkeit als Männlichkeit, während Weiblichkeit aus diesem nur abgeleitet würde und quasi einen Sonderfall der Menschlichkeit darstelle (vgl. PRENGEL 1995, 102), als im Spannungsfeld um die Kontrolle von Klassifikations- und Ordnungssystemen angesiedelt (vgl. BOURDIEU 1989, 749). "Darum geht es in den Auseinandersetzungen um die Definition des Sinns der Sozialwelt: um Macht über Klassifikations- und Ordnungssysteme, die den Vorstellungen und damit der Mobilisierung wie Demobilisierung der Gruppen zugrundeliegen." (a.a.o. 748). Der Sinn der Sozialwelt, durch Macht und Kontrolle über Klassifikations- und Ordnungssysteme bestimmt, sei männlich. "Jede bisherige Theorie des Subjekts hat dem 'Männlichen' entsprochen." (IRIGARAY 1980, 169). BOURDIEU formuliert, um diesen Sachverhalt zu fassen, das Konzept der Symbolischen Gewalt. Diese komme ohne physischen Zwang aus, wirke jedoch unmittelbar auf den Körper (vgl. BOURDIEU 2005, 71). So äußert sie sich beispielsweise darin, dass Frauen sich fast immer einen, im Vergleich zu sich selbst, körperlich größeren Mann wählten, der zusätzlich älter sein solle. Männer wählten sich Frauen entsprechend unter umgekehrten Vorzeichen. Frauen definierten sich somit über den größeren, älteren Mann, erführen dadurch Sicherheit und sozialen Status (vgl. a.a.o. 67 f.). Diese Definitionsfunktion sei der herrschenden männlichen Norm geschuldet. Symbolische Gewalt erkläre auch die Ausnahmen, die gewissermaßen die Regel bestätigen. So sei es zwar nicht verboten, wenn eine Frau körperlich größer als der Mann sei, jedoch rufe dies bei allen Beteiligten ein merkwürdiges Empfinden hervor (vgl. ebd.). Genau darin liege die Macht der Symbolischen Gewalt, deren (männliche) Normen so sehr inkorporiert seien, dass sie sich in Empfindungen wie Unwohlsein mit einer Situation wie der oben geschilderten äußerten. "Die Akte des praktischen Erkennens und Anerkennens der magischen Grenze zwischen den Herrschenden und den Beherrschten, Akte, die die Magie der symbolischen Macht auslöst und mit denen die Beherrschten, oft ohne ihr Wissen und bisweilen gegen ihren Willen, dadurch selbst zur Herrschaft beitragen, daß sie die auferlegten Schranken stillschweigend akzeptieren, nehmen häufig die Form von Leidenschaften oder Gefühlen (Liebe, Bewunderung, Respekt) oder körperlichen Emotionen (Scham, Erniedrigung, Schüchternheit, Beklemmung, Ängstlichkeit, aber auch Zorn oder ohnmächtige Wut) an." (a.a.o. 72).
Das Problem der Symbolischen Gewalt macht BOURDIEU auch daran fest, dass für die Untersuchung der Geschlechterordnung und der männlichen Herrschaft Denkweisen benutzt würden, die eben dieser männlichen Herrschaft entsprängen und dadurch so sehr in Einklang mit dieser männlichen Welt seien, dass ihre Prägung durch männliche Herrschaft kaum sichtbar sei (vgl. a.a.o. 14). "Wenn die Beherrschten auf das, was sie beherrscht, Schemata anwenden, die das Produkt der Herrschaft sind, oder wenn, mit anderen Worten, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmungen den Strukturen der Herrschaftsbeziehung, die ihnen aufgezwungen ist, konform strukturiert sind, dann sind ihre Erkenntnisakte unvermeidlich Akte der Anerkennung, der Unterwerfung." (a.a.o. 27 f.). In diesem Sinn kritisiert auch IRIGARAY (1979, 86) das Konzept der Gleichstellung von Mann und Frau, da diese Gleichstellung eine Hinwendung zu männlichen Normen bedeute.
BOURDIEU (1979, 219) beschreibt die männliche Herrschaft nur als ein Teil der Symbolischen Herrschaft, der Symbolischen Gewalt, die weitaus mehr Facetten habe, als männliche Normen. Wichtig seien auch Aspekte der sprachlichen Herrschaft und der sozialen Klasse. Beide Komponenten sollen in den folgenden Absätzen behandelt werden.
"Sprachliche Kompetenz, bzw. sprachliches Kapital als eine Komponente kulturellen Kapitals steht im Zusammenhang mit der Ausübung symbolischer Macht und fungiert damit als zentrales Instrument sozialer Herrschaft." (RADEMACHER 2001, 48). Sprache ist demnach nicht einfach Sprache die Dinge benennt, sie ist eng verknüpft mit der Ausübung von Herrschaft. Sprache fungiere als "Wirklichkeit generierende Instanz" (VILLA 1997, 133). Sprachliche Kategorien seien dem zu Folge keine Abbilder der Wirklichkeit, sondern gestalten die soziale Wirklichkeit aktiv, seien performativ (vgl. RADEMACHER 2001, 47). Elinor OCHS (1996, 156) misst diesem Umstand große Bedeutung bei, wenn sie formuliert: "One important tool of socialization is language. Not only the content of language but the manner in which language is used, communicates a vast range of sociocultural knowledge to children and other novices." BOURDIEU (2001, 24) gibt ein Beispiel für die performative Kraft von Sprache an: Männer würden in sprachlichen Stereotypen als groß, stark, kräftig, hervortretend, dominierend usw. bezeichnet. Frauen hingegen würden mit den genau entgegengesetzten Attributen in Verbindung gebracht: mit klein, zart, zurückhaltend usw. Dementsprechend seien Männer mit den Teilen ihres Körpers am meisten unzufrieden, die sie als zu klein und zart empfänden; wohingegen Frauen am meisten Unzufriedenheit mit den Körperteilen empfänden, welche sie als zu groß wahrnehmen. Sprache hat in diesem Kontext klar identitätsstiftende Eigenschaften und generiert darüber soziale Wirklichkeit.
Auch das hierarchisierte Geschlechterverhältnis wird durch diese performative Sprache tradiert. OCHS (1996, 146) formuliert: "Gender hierarchies display themselves in all domains of social behavior, not the least of which is talk. Gender ideologies are socialized, sustained, and transformed through talk [...]." und "Mundane, prosaic, and altogether unsensational though they may appear to be, conversational practices are primary resources for the realization of gender hierarchy." So sei Frau-Sein verbunden mit Bildern des Mutter-Seins, welche über den alltäglichen Gebrauch von Sprache vermittelt würden (vgl. ebd.). IRIGARAY (1979, 84 f.) betont dieses Aspekt ebenfalls, insbesondere in Verbindung mit geschlechtlicher Arbeitsteilung. So werde die Frau in ihrer Berufstätigkeit immer auch als Mutter wahrgenommen, die sich um die Kinder zu kümmern habe, wohingegen der Mann in seiner Berufstätigkeit selten auch als Vater betrachtet und bezeichnet werde. Sprache ist hier eng verknüpft mit sozialen Erwartungen und Normen und lässt sich von diesen nicht trennen, sondern muss als mit diesen verbunden und diese beeinflussend betrachtet werden. Barbara Diane MILLER (1996, 7) führt schließlich ein Beispiel aus dem Bereich der Sexualität an: "Implied in the phrase one above the other is a notion of dominance and control by the top party over the lower party." Auch hierin zeigt sich performative Sprache, wenn der Mann als beim Geschlechtsakt oben seiend beschrieben wird, während die Frau unter ihm liege. Oben und unten als zwei entgegengesetzte Begrifflichkeiten, welche zugleich ein Herrschaftsverhältnis beschreiben und im Sinne der hier vorgestellten Überlegungen tradieren.
Würde die Kategorie Frau losgelöst von anderen Sozialkategorien betrachtet, wäre dies ein unvollständiger Blickwinkel, der nur einen Ausschnitt wahrnimmt. Jedes Individuum sei zugleich immer mehreren Kategorien, oder Kollektiven, zugehörig. Eine Person sei also nie nur Frau, sondern gehöre auch immer noch einer sozialen Klasse, beispielsweise der Bourgeoisie, an (vgl. PRENGEL 2001, 100). "Die Geschlechtssozialisation ist von der Sozialisation für eine soziale Position nicht zu trennen." (BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 222). BOURDIEU (1989) untersucht den Umstand der klassenbezogenen Sozialisation ausführlich in 'Die feinen Unterschiede'. Wichtig sei zu betonen, dass wissenschaftlich nicht auseinander gehalten werden könne, was in der Sozialisation dem Gender und was der Klasse entspränge (vgl. BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 225). Entsprechend der klassenbezogenen Sozialisation, hängt das, "was wir von wo aus sagen und/oder tun, um ein Geschlecht zu werden, [...] von den Ressourcen ab, die dafür zur Verfügung stehen und die aufgrund von Herrschafts- und Besitzverhältnissen ungleich zugänglich sind." (VILLA 1997, 135). Hierin wird die Auswirkung der Verbindung von Geschlecht und Klasse besonders deutlich. Gesamtgesellschaftlich betrachtet existiere ein Kampf um "Teilhabe an ungleich verteilten Lebenschancen" (RADEMACHER 2001, 44). Die Geschlechterungleichheit sei zugleich Teil als auch Ausdruck dieses Kampfes. Doing difference sei damit gleichzusetzen mit doing inequality (vgl. ebd.). IRIGARAY (1979, 85) formuliert dies wie folgt: "Die patriarchalische Ordnung ist doch diejenige, die als Organisation und Monopolisierung des Privateigentums zugunsten des Familienoberhauptes funktioniert."
Ein weiterer Aspekt von Klasse und Geschlecht sei, dass, je mehr kulturelles Kapital (Bildung) zur Verfügung stehe, desto weniger sei die Geschlechterordnung ausgeprägt. Dies werde beispielhaft deutlich an den weniger stark ausgeprägten Vorurteilen gegenüber Homosexualität im Vergleich zu Klassen mit weniger kulturellem Kapital (vgl. RADEMACHER 2001. 46).
Die Ausprägung der normativen Geschlechterordnung ist demnach eng verbunden mit der sozialen Klasse der entsprechenden Person. Die Ungleichheit der Geschlechter, die der Aufrechterhaltung der männlichen Herrschaft dient, ist Teil der Ungleichheit der sozialen Klassen und damit eingebettet in Auseinandersetzungen um den Zugang zu Besitzverhältnissen. Friedrich ENGELS (1955, 209) formuliert dazu: "Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts unter das männliche."
Ein Aspekt, an dem die Unsichtbarkeit von Frauen sehr deutlich hervortritt, steht in enger Verbindung mit performativer Sprache. So benötige die männliche Norm keinerlei Legitimationsgrund, sie gelte als naturgegeben, als neutral. (Auf dieses Punkt wurde unter 'Die männliche Norm' bereits eingegangen.) Diese neutrale, allumfassende Sichtweise manifestiere sich auch in Sprache und Schrift, wenn die männliche Form (die Schüler), sowohl für Jungen (die Schüler), als auch für Mädchen (die Schülerinnen) benutzt werde (vgl. BOURDIEU 2005, 21). Das Weibliche verschwindet gewissermaßen, geht im Männlichen auf und bedarf keiner weiteren Nennung. Die männliche Norm wird mit dieser Art des Sprechens und Schreibens bestärkt und tradiert. Männer würden vielmehr als Frauen dazu erzogen, sich in den Vordergrund zu drängen, sich zu präsentieren. "In unseren Gesellschaften, selbst im häuslichen Bereich, sind es immer wieder die Männer, die wichtige Entscheidungen treffen, aber diese Entscheidungen werden von den Frauen vorbereitet." (BOURDIEU 2001, 14). Männer würden dabei jedoch durch offensiveres Auftreten in den Vordergrund treten, während sich Frauen tendenziell eher zurücknähmen "oder fast wörtlich verschwinden" (ebd.). Dieses 'Verschwinden' manifestiere sich auch an Redeanteilen in Diskussionen. Frauen "werden weniger darauf vorbereitet, sich zu Wort zu melden" (ebd.). In Folge dessen müssten Frauen, im Vergleich zu Männern, mehr kämpfen, um an einer Diskussion teilzunehmen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, usw. (vgl. BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 228). Brigitte BURCHARDT, Schulleiterin des Diesterweg-Gymnasiums in Berlin Mitte bestätigt dies: "Zuerst sage ich etwas und man hört mir nicht zu. Dann melde ich mich und werde nicht zum Sprechen aufgefordert. Am Ende sitze ich da und denke: 'Soll ich in die Runde brüllen?'" (BURCHARDT; TIERSCH; GODDAR 2011, 10). Claudia TIERSCH, Professorin für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin bestätigt das Zurücktreten hinter Männer: "Frauen arbeiten sachorientierter, dass heißt, sie äußern eine Idee, die nicht zur Kenntnis genommen wird und wenn 10 Minuten später die Idee von einem Mann nochmal geäußert wird und begeistert aufgenommen wird, denkt sie sich, Hauptsache die Idee kommt durch, statt zu sagen, das war meine Idee von vor 10 Minuten." (ebd.).
"Das sind lauter Mini-Entscheidungen des Unbewußten, aber in ihrer Häufung führen sie zu der zutiefst ungerechten Situation, die die Statistiken über die Vertretung der Frauen in Machtpositionen, vor allem in denen der Politik, regelmäßig dokumentieren." (BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 228). Das hier geschilderte unbewusste Verhalten von Frauen und Männern führt dazu, dass Frauen deutlich seltener in Macht- und Führungspositionen vertreten sind. Die erste Studie, welche den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen aller DAX-Unternehmen untersucht, verdeutlicht diesen Umstand drastisch. Demnach gibt es nur zwei Unternehmen, in denen gleich viele Männer wie Frauen im Vorstand und nur ein Unternehmen, in dem gleich viele Männer wie Frauen im Aufsichtsrat vertreten sind3. Der Aspekt von Führungspositionen, welche durch Frauen besetzt sind, soll im folgenden Kapitel stärker aufgegriffen werden.[3]
Arbeit könne als rühmlich und schwierig gelten, wenn sie von Männern verrichtet wird, jedoch als belanglos, leicht und unwichtig, wenn Frauen sie ausübten. Das Ansehen von Arbeit ändere sich also nach dem Geschlecht, dass die entsprechende Arbeit ausübe (vgl. BOURDIEU 2005, 107). Diese Charakterisierung ist grundlegend für die Arbeitsteilung moderner Gesellschaften. Die Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, werde grundsätzlich als weniger qualifiziert, als weniger wertvoll angesehen. "[...] obwohl Frauen auf allen Ebenen des sozialen Raumes anzutreffen sind, [...] sind ihre Zugangschancen (und ihre Vertretungsrate) um so geringer, je seltener und gefragter die Positionen sind (so daß der aktuelle und potentielle Frauenanteil wohl das beste Indiz für die relative Position und den relativen Wert der verschiedenen Berufe ist)." (a.a.o. 159). Deutlich wird dies an dem bereits angesprochenen Anteil von Frauen in Führungspositionen, aber auch am Anteil männlicher Lehrer an den verschiedenen Schulformen. Je höher die Schulform, desto höher ist auch der Anteil von Lehrern (vgl. Tabelle 3). Das Gymnasium genießt in dieser Lesart das meiste Ansehen, während Grundschulen am wenigsten attraktiv erscheinen. Kombiniert wird das Ansehen eines Berufs auch mit der Annahme der Eignung von Männern und Frauen für die entsprechende Tätigkeit.
Tabelle 3: "Anteil der Lehrerinnen und Lehrer an allen hauptberuflichen Lehrkräften im Schuljahr 2001/2002, in %", ROISCH 2003, 27.
|
Allgemein bildende Schulen |
Weibliche Lehrkräfte in % |
Männliche Lehrkräfte in % |
Insgesamt |
|
Grundschulen |
85 |
15 |
189814 |
|
Sonderschulen |
72,9 |
27,1 |
68096 |
|
Hauptschulen |
54,3 |
45,7 |
73659 |
|
Realschulen |
61,2 |
38,8 |
74824 |
|
Gymnasium |
48,4 |
51,6 |
154075 |
|
Integrierte Gesamtschule |
58,7 |
41,3 |
42393 |
|
Freie Waldorfschulen |
55 |
45 |
5504 |
|
Schulartunabhängige Orientierungsstufe |
71,6 |
28,4 |
26158 |
|
Schularten mit mehreren Bildungsgängen |
70,2 |
29,8 |
32155 |
|
Abendschulen mit Kollegs |
47,7 |
52,3 |
3066 |
|
Gesamt |
66 |
34 |
669744 |
"Ein Frauenberuf ist ein fraulicher Beruf, also untergeordnet, den Männern untergeordnet, oft schlecht bezahlt, und schließlich eine Tätigkeit, bei der die Frau ihre natürlichen Neigungen entfalten soll, oder was dafür gehalten wird: [...] Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Hingabe, Opferbereitschaft, usw." (BOURDIEU 2001, 20). Dies korreliert mit der hohen Anzahl von Lehrerinnen an Grundschulen und Sonderschulen, da dort Aspekte wie 'sich um Kinder kümmern' (bzw. um behinderte Menschen kümmern, die in ihrer stereotypisierten Hilfslosigkeit mit Kindern gleichgesetzt werden) und 'Empathie' stärker den weiblichen Anteilen des naturalisierten sozialen Geschlechts entsprechen. An Gymnasien hingegen würden Aspekte der Wissensvermittlung in den Vordergrund treten, was mehr mit männlich assoziiert sei (BmFSFJ 2005, 1.4.4). In dieser Hinsicht sei zwar positiv zu vermerken, dass es im 20. Jahrhundert eine kontinuierliche Zunahme weiblicher Berufstätigkeit außerhalb von Haushalt und Kinderpflege, also der traditionellen Arbeits-Sphäre der Ehefrau, gegeben habe, gleichzeitig beschränke sich diese Zunahme der Berufstätigkeit auf sogenannte Frauenberufe, die den vermeintlichen Eigenschaften von Frauen am meisten entsprächen. "Mit der Feminisierung des Arbeitsmarktes entstand nicht auch eine wirklich gemischte Arbeitswelt. Vielmehr wurden die vorwiegend weiblichen Berufe weiter feminisiert, während die Männerberufe männliche Festungen blieben. Die Konzentration der Frauenbeschäftigung auf bestimmte Bereiche und Berufe bleibt charakteristisch für die Arbeitswelt." (MARUANI 1997, 54). Demnach seien 1990 in Frankreich 75% der Frauen und 50 % der Männer im Dienstleistungsbereich und 18 % der Frauen und 40 % der Männer in der Industrie tätig. 60% der berufstätigen Frauen seien in nur sechs Berufskategorien wiederzufinden: Angestellte im öffentlichen Dienst, Verwaltungsangestellte in Unternehmen, Angestellte im Handel, Dienstleistungspersonal bei Privatpersonen, Grundschullehrerinnen und mittlere medizinische Berufe (vgl. ebd.). Folge dieser Aufteilung in Frauen- und Männerberufe sei, dass Frauen schlechter entlohnt würden, da deren Berufe im Vergleich zu männlich dominierten Berufen schlechter und als unqualifizierter betrachtet würden (vgl. a.a.o. 59). Der Umstand der geringeren Entlohnung bestätigt BOURDIEUS eingangs vorgestellte Annahme der weiblichen Arbeitstätigkeit als weniger wertvoll. Ein weiterer Umstand, der die Trennung in Männer- und Frauenberufe tradiert, sei die geschlechtliche Identitätsbildung über den Beruf. Demnach verteidigten Männer ihren männlich dominierten Beruf gegenüber dem Eintritt von Frauen, da ihr Männlichkeitsbild sehr stark mit der männlichen Exklusivität des Berufs zusammen hänge (vgl. BOURDIEU 2005, 166).
Ein weiteres Merkmal weiblicher Berufstätigkeit ist die Teilzeitbeschäftigung. Frauen arbeiteten sehr viel häufiger in Teilzeit als Männer (vgl. a.a.o. 160). "Wer Teilzeit sagt, meint Frau" (MARUANI 1997, 62). Tabelle 4 bestätigt dies für Lehrer und Lehrerinnen.
Tabelle 4: "Die Verteilung von männlichen und weiblichen Lehrkräften, differenziert nach der Art der Beschäftigung im Schuljahr 2001/2002", ROISCH 2003, 25.
|
Art der Beschäftigung |
Lehrer |
Lehrerinnen |
||
|
Anzahl |
in % |
Anzahl |
in % |
|
|
Vollzeit |
193067 |
76,6 |
214659 |
44,4 |
|
Teilzeit |
34536 |
13,7 |
227482 |
47 |
|
Stundenweise Beschäftigung |
24430 |
9,7 |
41805 |
8,6 |
Mehr als die Hälfte der Lehrerinnen arbeitete 2001/2002 demnach in Teilzeitbeschäftigung oder wurde stundenweise beschäftigt. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung 2007 seien in 83 % der ostdeutschen Paarhaushalte sowohl der Mann als auch die Frau erwerbstätig (unabhängig von Kindern). Im Westen seien dies 73 %. Allerdings verfügten insgesamt nur 34 % der Frauen über eine Vollzeitstelle, 48 % seien in Teilzeit, 18 % seien Freiberuflerinnen. Insgesamt wiesen dahin gegen nur 4 % der Männer eine Teilzeitbeschäftigung auf (vgl. SCHMOLLACK 2011, 7). Weiteren Aufschluss über die Berufstätigkeit von Frauen liefert das Statistische Bundesamt. Demnach seien 2009 8,0 % der Männer zwischen 15 und 65 Jahren erwerbslos und 9,4 % Nichterwerbspersonen. Bei Frauen zwischen 15 und 65 Jahren liege der Anteil der Erwerbslosigkeit bei 4,9 % und der Anteil der Nichterwerbspersonen bei 21,2 % (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, 104). Nichterwerbspersonen werden dabei wie folgt definiert: "Diese Gruppe umfasst alle Befragten, die sich in der Referenzwoche nicht in Bildung oder Ausbildung befanden sowie weder erwerbstätig noch erwerbslos waren. Grundsätzlich zählen auch Schüler/- innen und Studierende, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen beziehungsweise Auszubildende sind, als Nichterwerbspersonen; sie werden hier jedoch wie beschrieben den Gruppen 1 oder 2 zugerechnet." (a.a.o. 102). Es wird folglich nicht erläutert, was Nichterwerbspersonen sind, nur was sie nicht sind, obwohl fast ¼ der Frauen zwischen 15 und 65 zu dieser Gruppe gerechnet werden. Aufschluss über diese Gruppe könnte Simone SCHMOLLACK (2011, 7) geben: "Insgesamt arbeiten einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zufolge derzeit 5,6 Millionen Frauen nicht, weil sie für die Familie da sein wollen oder müssen. Diese Frauen sind nahezu 'unsichtbar', denn sie sind nicht arbeitslos gemeldet und tauchen auch sonst in keiner Statistik auf." Laut WZB wollten 80 % dieser Frauen arbeiten (vgl. ebd.). An dieser Stelle besteht eine Verbindung zur männlichen Norm und zum naturalisierten sozialen Geschlecht von Frauen, wenn, wie durch SCHMOLLACK erläutert, eine wesentliche Aufgabe von Frau-Sein bedeute, Mutter zu sein.
Die mit Mutterschaft, wohlgemerkt nicht mit Vaterschaft, wie IRIGARAY (1979, 84 f.) herausgestellt hat, auftretenden Probleme der Betreuung der Kinder, führten ebenfalls zum Phänomen der Teilzeitbeschäftigung von Frauen. Teilzeitbeschäftigung und weibliche Arbeit als mit geringerem Wert als männliche Arbeit verbunden, führten zum bereits angesprochenen Nicht-Vorhandensein von Frauen in Führungspositionen. "Die Aussichten, höhere Stellen in der Hierarchie einnehmen zu können, bleiben für die meisten Frauen äußerst mäßig." (MARUANI 1997, 54). BOURDIEU (2001, 17) hält fest: "Um Vorstandsvorsitzende zu werden, muß eine Frau sehr viel mehr Fähigkeiten mitbringen als ein Mann." Und selbst in weiblich dominierten Bereichen, würden eher Männer für Führungspositionen bestimmt, als Frauen (vgl. a.a.o. 16). So erklärt sich, warum trotz der quantitativen Überlegenheit der Frauen als Lehrerinnen in Schulen, 1993/1994 ca. 70 % der Schulleitungen Männer und nur 30 % Frauen gewesen seien (ROISCH 2003,39). Das Problem weiblicher Führungskräfte beschreibt BOURDIEU als sehr komplex, da sie einen Balanceakt zwischen ihrer Weiblichkeit und der männlichen Position (Autorität, Weisungen erteilen), die sie einnähmen, aushalten müssten. "Die weibliche Führungskraft muß sehr viel weniger Frau sein als die Sekretärin, oder vielmehr muß sie ganz anders sein: weiblich, aber nicht zu sehr, sie muß Autorität zeigen, und dabei ihre Weiblichkeit behalten, etwa durch die Unterwerfung unter einen Kleiderzwang, dem auch die Männer unterliegen (ein strenger Haarschnitt, gedeckte Farben), der aber noch ausreichend auf das Geschlecht verweist (Rock, leichtes Make-Up, diskreter Schmuck, usw.)." (BOURDIEU 2001, 19). Diesen Druck, dem weibliche Führungskräfte ausgesetzt sind, bezeichnet BOURDIEU auch als "die herrschende Definition der Praxis", denn "es ist die Besonderheit der Herrschenden, daß sie in der Lage sind, ihrer besondere Seinsweise die Anerkennung zu verschaffen, die Seinsweise schlechthin zu sein." (BOURDIEU 2005, 110). Demnach seien Normen, an denen Frauen für eine Führungsposition gemessen werden keine universalistischen, sondern männliche Normen (vgl. a.a.o. 111).
Der weiblicher Körper stelle ein Objekt dar, das betrachtet wird und den männlichen Normen dieser Betrachtung entsprechen müsse. Dies führe zu Defizit-Ängsten vieler Frauen in Hinblick auf ihren Körper, da die Definition ihres eigenen Körpers dadurch geprägt sei, durch Männer Gefallen zu finden und gesehen zu werden (vgl. BOURDIEU 2005, 119 ff.). Der Körper der Frau existiert so keineswegs als Selbstzweck, sondern als Zweck für den Mann.
Maxine MAROLIS und Marigene ARNOLD bezeichnen sexuelle Aktivität als Symbol für die männliche Kontrolle über die Frau. "Men are expected to initiate sex and women are expected to submit. Men are the consumers, women the providers." (MARGOLIS; ARNOLD 1996, 335). Laut Untersuchungen der beiden Autorinnen verkehrt sich dieses Verhältnis auch nicht bei männlichen Strip-Shows in sein Gegenteil. Selbst wenn sich Männer für Frauen darböten und entkleideten, übten sie starke Kontrolle über das weibliche Publikum aus, so dass der männliche Künstler weiterhin dominant bliebe, während die weiblichen Kundinnen weiterhin dominiert würden. So sei das Auftreten des männlichen Tänzers nicht entsprechend eines sexuellen Angebots an die Frauen, sondern das eines sexuellen Aggressors (vgl. a.a.o. 342 f.). Das im obigen Zitat formulierte Verhältnis von der Frau als unterwürfige Anbieterin und dem Mann als Initiator und Konsument scheint erhalten zu bleiben.
Demnach stellt Kontrolle einen wesentlichen Teil der menschlichen Sexualität und einen bedeutenden Aspekt der Geschlechterhierarchie dar. "Wenn die Sexualbeziehung als Herrschaftsverhältnis erscheint, dann deshalb, weil sie anhand des fundamentalen Einteilungsprinzips zwischen dem Männlichen, Aktiven, und dem Weiblichen, Passiven, konstruiert wird und weil dieses Prinzip den Wunsch hervorruft, ausformt, ausdrückt und lenkt, den männlichen Wunsch als Besitzwunsch, als erotisierte Herrschaft und den weiblichen Wunsch nach männlicher Dominanz, als erotisierte Unterordnung oder gar, im Extremfall, als erotisierte Anerkennung der Herrschaft." (BOURDIEU 2005, 41). Der Mann ist der aktivere, dominierende, kontrollierende Part. Das Herrschaftsverhältnis ist demnach am stabilsten, je größer das Gefälle zwischen Mann und Frau ist.
Eine Zuspitzung dieses Herrschaftsverhältnisses stellt der sexuelle Missbrauch dar. Entsprechend dem in dieser Arbeit dargelegten Verständnis eines hierarchisierten Geschlechterverhältnisses ist auch sexueller Missbrauch Ausdruck von Hierarchie und Ausübung von Kontrolle. Da Kontrolle am Leichtesten über Schwächere ausgeübt werden kann, formuliert Ursula ENDERS (2003, 40): "In der geschlechtsbedingten geschwächten Widerstandskraft, und nicht in der sexuellen Fixierung der Täter (Täterinnen[4]), liegt die Tatsache begründet, dass zwei drittel der Opfer des sexuellen Missbrauchs weiblich sind." Weiblichkeit entspricht hier, wie in den vorangegangenen Betrachtungsebenen dargestellt, Attributen wie: schwach, klein, zart usw. Das Hierarchiegefälle und damit die Kontrollfähigkeit des starken, dominanten, hervortretenden Mannes, scheint im Falle des sexuellen Missbrauchs sehr hoch. Am Größten ist dieses Hierarchiegefälle zwischen erwachsenem Mann und minderjährigen Mädchen, da zu den als weiblich erachteten Attributen noch der Aspekt der großen Altersspanne, und der kindlichen Hilflosigkeit hinzukommt.
Sexueller Missbrauch sei demnach Ausdruck des männlichen Besitzdenkens und die Überspitzung patriarchaler Gesellschafts- und Familienstrukturen (vgl. ebd.).
-
'sex' und 'gender' Trennung legitimiert männliche Herrschaft, da weiterhin biologisierte Begründungen für Frau- und Mann-Sein herangezogen werden
-
Betonung der sozialen Konstruktion von Geschlecht, die inkorporiert wird
-
Inkorporierung so tiefgehend, dass auch durch Bewusstmachung kaum änderbar → Habitus
Die männliche Norm
-
mythologischer Ursprung bei Eva, Frau als vom Mann abgeleitet
-
Frau als Sonderfall der Menschlichkeit = Männlichkeit
-
damit männliche Norm als Norm schlechthin → phallokratische Ordnung
-
Denormalisierungsangst der Männer, Angst vor Verlust der Männlichkeit
-
Kontrolle der Klassifikations- und Ordnungssysteme als Bedingung für
-
Herrschaft, daraus folgt männliche Norm
-
symbolische Gewalt als Äußerung der männlichen Norm
Performative Sprache
-
Sprache benennt nicht nur, sie kreiert Wirklichkeit z.B. männlich als hervortretend und stark; weiblich als zurückhaltend und zart → Auswirkung, wie männliche und weibliche Körper betrachtet werden
-
mit dieser Funktion ist Sprache Instrument sozialer Kontrolle und Herrschaft
Geschlecht und Klasse
-
jede Person immer auch Mitglied mehrerer Kollektive
-
klassenbezogene Sozialisation
-
Gender-Ungleichheit als Teil der Klassen-Ungleichheit
-
je mehr kulturelles Kapital, desto weniger deutlich ist Genderordnung
Unsichtbarkeit von Frauen
-
männliche Sprach- Schreibform als die neutrale, hinter der das Weibliche verschwindet
-
Männer stärker dazu erzogen im Vordergrund zu sein als Frauen; dies äußert sich auch an Redeanteilen der Geschlechter
Weibliche Berufstätigkeit
-
weibliche Arbeit als unqualifizierter und weniger wertvoll
-
Aufteilung in männliche und weibliche Berufe, entsprechend dem naturalisierten sozialen Geschlecht
-
Frauen deutlich mehr in Teilzeit als Männer
-
bedeutend weniger Frauen in Führungspositionen
Sexualität und Kontrolle
-
Frau und ihr Körper definiert durch männliche Normen
-
Mann als sexueller Aggressor, als Konsument; Frau als unterwürfige Anbieterin
-
Sexualität als Ausdruck des Herrschaftsverhältnisses
-
sexueller Missbrauch als Zuspitzung des Herrschaftsverhältnisses
Inhaltsverzeichnis
Im vorangegangenen Kapitel wurde das Geschlechterverhältnis analysiert, wobei der Fokus vor allem auf der untergeordneten Rolle des Weiblichen lag. In diesem Kapitel sollen die Hierarchie Dimensionen auf den Kontext Behinderung und Nicht-Behinderung übertragen werden. Dazu erfolgt ihre teilweise Umformulierung. Anschließend soll anhand sonderpädagogischer Literatur aufgezeigt werden, dass die einzelnen Dimensionen innerhalb der Sonderpädagogik thematisiert werden. Dies dient der Darstellung der hierarchischen Verhältnisse zwischen Behinderung und Nicht-Behinderung. Die verwendete Literatur kann dabei nur eine Auswahl darstellen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr soll verdeutlicht werden, welche Hierarchie Dimensionen bei Behinderung wirken können, ohne dass sie in ihrer Ganzheit wirken müssen. So ist beispielsweise der Aspekt der Kontrolle und Selbstbestimmung bei geistig behinderten Menschen von größerer Bedeutung, als bei sehbehinderten Menschen. Insofern muss die im Kapitel 2 Theoretische Grundlagen getroffene Entscheidung, von Behinderung als Konstrukt unabhängig von etwaigen Unterkategorien zu sprechen, teilweise revidiert werden. Die Hierarchie Dimensionen veranschaulichen mögliche Bereiche von Hierarchie die mit Behinderung verknüpft sind, ohne dass diese bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen tatsächlich zum Tragen kommen müssen. In der Betrachtung von Hierarchie im Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Menschen muss demzufolge die im Folgenden vorgenommenen Erläuterungen stets neu angepasst und individualisiert werden.
|
Inkorperierung sozialer Verhältnisse |
Inkorporation sozialer Verhältnisse |
|
Die männliche Norm |
Nicht-Behinderung als Norm |
|
Performative Sprache |
Performative Sprache |
|
Geschlecht und Klasse |
Behinderung und Klasse |
|
Unsichtbarkeit von Frauen |
Unsichtbarmachung von Behinderung |
|
Weibliche Berufstätigkeit |
Berufstätigkeit und Behinderung |
|
Sexualität und Kontrolle |
Kontrolle und Selbstbestimmung |
Vera MOSER beschreibt die sozialen Verhältnisse als in den (behinderten) Körper eingeschrieben. Der Körper fungiere dabei als identitätsstiftendes Merkmal, denn er sei "Ausgangspunkt der Idee einer sichtbaren, darstellbaren und kommunizierbaren Identität" (MOSER 1997, 140). So würden in Interaktionen körperliche Merkmale zu einer sozialen Zuschreibung und in der Folge zu einer sozialen Identität. Diese Identität beschreibt sie als in den Körper eingeschrieben, bzw. mit FOUCAULTS Begrifflichkeiten, als diskursiv erworben (vgl. a.a.o. 139 f.). Diese Einschreibung sei so manifest, dass sie ihren Ausdruck im biologistischen Verständnis von Behinderung (vgl. a.a.o. 139; SCHILDMANN 2003) wiederfände, welches Behinderung im Körper verorte, anstelle soziale Interaktionen und Konstruktionen von Normalität in den Fokus zu rücken. MOSERS Ausführungen zur Inkorporierung sollen an dieser Stelle beispielhaft stehen für eine Reihe ähnlicher konstruktivistischer und kulturhistorischer Auffassungen.
Die Inkorporierung der sozialen Verhältnisse, welche Behinderung als natürliches, sich biologisch darstellendes Faktum erscheinen lässt, bewirkt demnach eine Betrachtung von Behinderung als unzulänglich, in gewisser Weise unvollkommen. Behinderung wird innerhalb der Person verortet. Ein vom eigenen nicht behinderten Körper abweichender Körper wird als minderwertig angesehen. Das Bild der körperlichen Abweichung, welche Behinderung darstelle, ist wie in Kapitel 2 Theoretische Grundlagen beschrieben auch innerhalb der Sonderpädagogik nach wie vor weit verbreitet. Beispielhaft soll dafür Thomas HÜLSHOFFS (2005) 'Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik' angeführt werden. Dort werden diverse medizinischen Aspekte als ursächlich für Behinderung dargestellt und als für die Förderung unabdingbar postuliert (vgl. a.a.o. 10).
Elsbeth BÖSL (2009, 31) beschreibt Behinderung als abhängig von gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen, welche nach MOSER (1997, 142) per se männlich definiert seien. Beobachtetes würde demzufolge mit den eigenen Normvorstellungen verglichen und ggf. als abweichend befunden (BÖSL 2009, 32). Gleichzeitig sei Abweichung minderwertig (SCHUMANN 2001, 3). Susan WENDELL (2010, 345) formuliert diesen Sachverhalt wie folgt: "When we make people other, we group them together as the objects of our experience instead of regarding them as fellow subjects of experience with whom we might identify. If you are other to me, I see you primarily as symbolic of something else - usually, but not always, something I reject and fear and that I project onto you. We can all do this to each other, but very often the process is not symmetrical, because one group of people may have more power to call itself the paradigm of humanity and to make the world suit its own needs and validate its own experience." Das Paradigma der Menschlichkeit kann demzufolge als das Paradigma von nicht behindert Sein gesehen werden. Die Definitionsmacht ist in diesem Bereich der Nicht-Behinderung angesiedelt, deren Angehörige die Welt entsprechend ihren Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten, kaum in der Lage, von den eigenen Erfahrungen und Vorstellungen zu abstrahieren. In diese Normalitätsvorstellung kann dann auch der Beitrag von tagesschau.de[5] anlässlich der PID-Debatte im Bundestag eingeordnet werden:
Wie sinnlos ist das denn?
Do, 14.04.2011 - 13:42 - holle
Es entscheidet sich also jemand für ein Kind. Nun darf der Arzt also nicht die Embryonen testen und nur gesunde Embryonen einsetzen, sondern er muss auf gut Glück irgendwelche Embryonen nehmen. Besitzen diese dann genetische Defekte, sterben sie entweder von allein ab oder werden nach einer entsprechenden Untersuchung abgetrieben. Denn wer für die PID ist, der treibt auch ab. Das passiert dann ein paar mal und irgendwann kann oder möchte die Frau keine Kinder mehr bekommen. Wie kinderfeindlich kann ein Staat denn noch sein?
Bei uns zum Beispiel besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass unser Kind mit einem Down-Syndrom zur Welt kommt. Mein Schwager hat Down. So etwas möchte ich nicht für mein Kind. Ganz ehrlich: Da ist es besser gar nicht erst zu leben.
Die Aussage, dass es besser sei nicht zu leben, als mit einer Behinderung zu leben, spiegelt die mangelnde Abstraktionsfähigkeit von den eigenen Lebensverhältnissen wider und die Vorstellung von Behinderung als Leiden. Die Norm des eigenen Lebens gilt für alles Leben. Urs HAEBERLIN (1996, 62) formuliert in diesem Sinn drastisch: "[Es] gibt [...] die leitende Grundmeinung, daß Behindertsein als Abnormität des betroffenen Individuums zu erklären ist. Aufgrund dieses Bildes vom Behinderten erscheinen behinderte Menschen als 'anormal', 'krank', 'defekt'. Da sich der 'Defekt' häufig nicht beheben läßt, haben die professionellen 'Behindertenhelfer' [...] dafür zu sorgen, daß der 'anormale' Mensch die 'normalen' Menschen wenigstens nicht belästigt."
Diese beständige Konstruktion von Behinderung als Abweichung von bürgerlicher Normalität, welche Elisabeth von STECHOW (2004, 155-177) ausgehend vom Ende des 18. Jh. bis in die Gegenwart hinein untersucht hat, führe zu einer Anthropologisierung der behinderten Menschen (vgl. MOSER 2003, 53). Damit wird das Anders-Sein von Behinderung, das Abweichen von dem, was als normal erachtet wird, verfestigt. Ausdruck dessen sei auch der ständige Zwang von Professionellen, (behinderte) Menschen zu kategorisieren und zu klassifizieren, um bestimmen zu können, was an einem Menschen normal, und was nicht normal sei (vgl. HAEBERLIN 1996, 61).
Im extremsten Fall führt diese Anthropologisierung zum Absprechen des Lebensrechts: "But if there is great physical suffering or distress, or if their capacities are so limited that they are not able to obtain any enjoyment from life, then an ideal society would not be misled by ideas of the sanctity of (merely biologically) human life into believing that it was wrong to end a human life when it can contain only suffering, or has no positive experiences." (SINGER 2003, 57). Wird bezweifelt, dass Freude am Leben empfunden werden kann, ja sogar behauptet, es handele sich nur noch um bloßes biologisches Leben, statt um Mensch-Sein, führt die Unfähigkeit zur Anerkennung anderer Lebensmöglichkeiten als der eigenen letztendlich, in der bioethischen Sichtweise Peter SINGERS, zur Beendigung nicht von unvorstellbarem Leid, sondern zur Beendigung von unvorstellbarem Leben und dessen grundsätzlichen Möglichkeiten der Entfaltung.
Sprachliche Wendungen und Bezeichnungen generalisieren ein Merkmal auf die Gesamtperson und diskriminieren diese dementsprechend. Behinderung als Begriff stelle somit eine reduktionistische Bezeichnung dar (vgl. HEßMANN 1998, 172). "Soweit es überhaupt darum gehen soll, Individuen unter einer Bezeichnung zu versammeln, die zunächst einmal nichts verbindet außer einer gewissen körperlichen oder geistigen Abweichung vom Normalmaß, wird man dem Diskriminierungsverdacht schlechterdings nicht entgehen können." (a.a.o. 173). Dabei stellt Hans-Walter SCHMUHL heraus, dass der Begriff Behinderung bei seiner Etablierung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die vorhandenen Diskriminierungen aufzuheben trachtete. Er sei als positiv betrachtet worden, im Vergleich zu Bezeichnungen, wie 'Krüppel' oder 'Schwachsinnige' (vgl. SCHMUHL 2010, 85 f.). SCHMUHL verweist auf die mit dem Begrifflichkeiten-Wandel einhergehende Veränderungen der Sozial- und Arbeitswelt. So sei zur selben Zeit, als sich der Begriff 'körperbehindert' durchgesetzt habe, auch eine erhöhte Nachfrage nach der Arbeitskraft von körperbehinderten Menschen zu verzeichnen gewesen. Die fortschreitende Integration von körperbehinderten Menschen ließe sich also sowohl arbeitsmarktpolitisch, als auch sprachlich festhalten. Die Integration habe jedoch nur solche Menschen betroffen, die ein Mindestmaß an verwertbarer Arbeitskraft aufwiesen, wohingegen beispielsweise geistig behinderte Menschen weiterhin nicht als Arbeitskräfte betrachtete worden seien. Damit sei der Integrationsprozess eng verbunden mit einem Exklusionsprozess und das Ziel eine neue, nicht diskriminierende Begrifflichkeit zu etablieren, gescheitert. Eine veränderte Bezeichnung müsse einhergehen mit sich verändernden gesellschaftlichen Praxen. Insofern geistig behinderte Menschen weiterhin, z.B. arbeitsmarktpolitisch als nicht wertschöpfend gesehen würden, verkomme die als Nicht- Diskriminierung gemeinte Begrifflichkeit zu ihrem Gegenteil: zur fortgesetzten sprachlichen Diskriminierung, welche die fortgesetzte herrschende Praxis der Diskriminierung behinderter Menschen widerspiegele. Und so stelle 'behindert', vor allem in der Jugendsprache, heute nach wie vor ein Schimpfwort dar (vgl. SCHMUHL 2010, 92 f.). "Begriffswandel ist [somit] eine nötige, aber keine hinreichende Bedingung gesellschaftlichen Wandels." (a.a.o. 93).
Beate FIRLINGER beschreibt die Unfähigkeit von nicht behinderten Menschen mit Behinderung adäquat umzugehen. Nicht behinderte Menschen seien peinlich berührt, hilflos und überfordert, wenn sie physisch und psychisch behinderten Menschen begegneten. Diese Unfähigkeit manifestiere sich auch im Sprachgebrauch. Beispiele dafür seien: "an Behinderung leiden", "einen Schicksalsschlag erleiden", "sein Leben fristen müssen", "hilfsbedürftig" oder "an den Rollstuhl gefesselt sein" (FIRLINGER 2003, 7 f.). Sprachliche Bezeichnungen geben so das Bild von nicht behinderten Menschen wider, was diese von Behinderung verinnerlicht haben: Ihre Überforderung und ihre Vorstellung vom leidenden behinderten Menschen. Behinderung bleibt in diesem Kontext eine Beschimpfung und tradiert die herrschende Praxis der Exklusion.
"Maßstab der Andersheit waren primär Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit einer Person. An Leistung, Produktivität und Normentsprechung waren wiederum Vorstellungen über den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wert des Individuums geknüpft, denn mit dem Bürgertum war die produktive Erwerbsarbeit ins Zentrum der gesellschaftlichen Hierarchien vorgedrungen. Nutzbringende Arbeit schien die wesentliche Daseinsform des Menschen und Ausweis seiner gesellschaftlichen Integrität zu sein." (BÖSL 2009, 32). Das Zitat beschreibt die besondere Bedeutung der produktiven Erwerbsarbeit, welche grundlegend für die bürgerlichen Gesellschaften ist. Nicht-Erfüllung dieser produktiven Erwerbsarbeit kennzeichne ein Individuum dementsprechend als Arbeitskraft minderer Güte. Behinderte Menschen seien, in einer verallgemeinernden, von individuellen Ausnahmen absehenden Darstellung, per se solche Arbeitskräfte minderer Güte (vgl. JANTZEN 1992, 30). In diesem Sinn sei Behinderung gekennzeichnet durch eine "reduzierte Ausbeutungsbereitschaft" (a.a.O. 41), da sie sich ohne zusätzliche Investitionen nicht in die Kapitalverwertung einfüge. So beschreibt Wolfgang JANTZEN die höheren Kosten, die für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes anfielen, beispielsweise für sehbehinderte Menschen, und die höheren Kosten der Ausbildung des behinderten Menschen. Dies wirke sich negativ auf die Profitspanne aus und sei der Grund, weshalb behinderte Menschen in Zeiten von Konjunktur und nicht in einer Krise eingestellt würden (vgl. ebd.). In dem Maße, wie Behinderung weniger attraktiv für Profitinteressen sei, seien behinderte Menschen überproportional häufig in prekären Lebensverhältnissen wiederzufinden (WEISSER 2005, 60). Gerhard KLEIN hat hierzu eine Vergleichsstudie über den sozialen Hintergrund von lernbehinderten Schülern und Schülerinnen der Jahre 1969 und 1997 durchgeführt, und kommt zu dem Schluss, dass diese zum Großteil aus Familien stammten, die erhöhte soziale Risikofaktoren aufwiesen. Insofern die Eltern berufstätig seien, arbeiteten diese als meist ungelernte oder einfache Angestellte. Die Wohnungen der Familien befänden sich vor allem in unattraktiven Gebieten, an einer verkehrsreichen Straße, neben einem Industriegebiet, usw. Im Vergleich zur Anzahl der Familienmitglieder wiesen die Wohnungen beengte Räumlichkeiten auf (vgl. KLEIN 2001, 52 ff.). Auch JANTZEN bestätigt die Verbindung von prekären Lebensverhältnissen und Behinderung. Vor dem in Tabelle 5 verdeutlichten Hintergrund spricht JANTZEN (1992, 33) vom "sozialen Tatbestand Behinderung" und legt den Zusammenhang von Behinderung und sozialer Randständigkeit und deren historische Herausbildung ausführlich dar (vgl. a.a.o. 46-75).
Die Problematik der Schichtzugehörigkeit spiegele sich auch in der Verfügbarkeit über Soziales Kapital wieder. "Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen." (BOURDIEU 1997, 63). In dieser Lesart, verfügten behinderte Menschen über sehr viel weniger Soziales Kapital (vgl. JANTZEN 2003, 306).
Tabelle 5: "Sonderschulzugehörigkeit und soziale Schicht der Herkunftsfamilie", JANTZEN 1992, 33.
|
Schicht |
% Bev. |
% GB |
% SB |
% LB |
|
Oberschicht |
0,5 |
0,2 |
0 |
0 |
|
Obere Mittelschicht |
6 |
4,1 |
2 |
0,3 |
|
Mittlere Mittelschicht |
11 |
3,5 |
6 |
1,5 |
|
Untere Mittelschicht |
38 |
17,2 |
29 |
7,3 |
|
Obere Unterschicht |
30 |
32,8 |
35 |
37,5 |
|
Untere Unterschicht |
13 |
19,4 |
27 |
48,1 |
|
Sozial Verachtete |
2 |
22,4 |
1 |
5,3 |
|
Anzahl der Untersuchten (N) |
680 |
891 |
397 |
Dies bedeutet weniger gesellschaftliche Anerkennung und Achtung, verbunden mit weniger Zugang zu Ressourcen des sozialen Austausches und der damit einhergehenden Anerkennung und Zugang zu verschieden gesellschaftlichen Bereichen für behinderte Menschen. JANTZEN beschreibt eine weitere, mit dem Sozialen Kapital eng verbundene, bourdieusche Kapitalform, die mit Behinderung weniger zur Verfügung stehe. Mit Geburt eines behinderten Kindes sinke das symbolisches Kapital der Eltern, also "ihr im sozialen Austausch zuerkannter Wert" (JANTZEN 2002, 352), ihr Prestige, ihr Ansehen, ihre Anerkennung, wodurch das Soziale Kapital unmittelbar mit betroffen sei. Mit der beschriebenen sozialen Randständigkeit verbunden sind auch das Weniger-Vorhandensein von Ökonomischen und Kulturellen Kapital (vgl. WEISSER 2005, 59 f.; JANTZEN 2003, 306).
Befragungen von körperbehinderten Menschen ergäben, dass, obwohl sie geradezu herausstächen durch Rollstuhl usw., sie von einem Gefühl der Unsichtbarkeit berichteten. Dieses Gefühl speise sich aus unterschiedlichen Quellen. Eine sei die durch infrastrukturelle Gegebenheiten hervorgerufene Isolation von verschiedenen Bereichen, zu denen dann körperbehinderte Menschen keinen Zugang hätten, in denen sie also nicht ten, quasi unsichtbar seien (vgl. MASKOS 2004, 58). Ähnlich sei der Ausschluss von allgemeinen Institutionen und der Einschluss in Heime und Sonderschulen zu bewerten (vgl. JANTZEN 1992, 42). Vor allem geistig behinderte Menschen sind ihr Leben lang in speziellen Einrichtungen untergebracht, wodurch kaum eine Interaktion mit nicht behinderte Menschen, von Professionellen abgesehen, zustande kommt. Unsichtbarkeit und Ausgrenzung eines Aspektes von Mensch-Sein setzt auch an diesem Punkt an. So könne die Unterbringung in Heimen für geistig behinderte Menschen als Schutz der Gesellschaft vor diesen Menschen und umgekehrt verstanden werden (vgl. THEUNISSEN 2006, 60), als Unsichtbarmachung eines Aspekts, mit dem sich nicht auseinandergesetzt werden möchte. Die Tabelle 6 von Ulf PREUSS-LAUSITZ (2008, 5) gibt Aufschluss darüber, wie die Verteilung von gemeinsamen Unterricht (GU) und Unterricht getrennt nach Regel- und Sonderschulen (S) in Berlin von Schülern und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gestaltet ist.
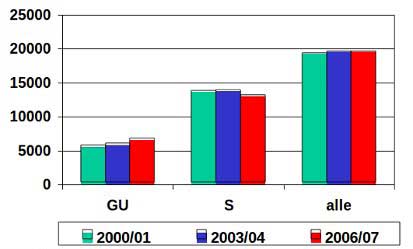
Tabelle 6: "Kinder mit SEN in Berlin in GU und S insgesamt 2000/01 - 2006/07", PREUSS-LAUSITZ 2008, 5.
Demnach sei zwar die Zahl der integriert unterrichteten behinderten Kinder von 2001-2006 gestiegen, jedoch seien immer noch mehr als die Hälfte in Sonderschulen unterrichtet worden.
Einen weiteren Aspekt von Unsichtbarkeit stelle laut Rebecca MASKOS (2004, 58) die Unterrepräsentanz von behinderten Menschen in Medien wie Fernsehen und Radio dar. Dort setzt sich demnach der organisierte Ausschluss aus dem öffentlichen Leben fort.
An dem Punkt des Überganges von Schule und Beruf, ergäben sich für behinderte Menschen mehrere Schwierigkeiten. Antje GINNOLD beschreibt diese Schwierigkeiten als sich verändernde Einstellungen zu Behinderung und zu Integration, als dies an den Sonderschulen oder integrativen Schulen der Fall gewesen sei. So seien Vorstellungen über gemeinsames Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung nur wenig in die nachschulische Berufswelt vorgedrungen und es herrschten ganz andere Vorstellungen und auch Vorurteile im Beruf gegenüber Behinderung (vgl. GINNOLD 200, 25). Zudem käme erschwerend für behinderte Jugendliche hinzu, dass "sie die schlechteren Ausgangschancen aufgrund eines geringerwertigen Sonderschulabschlusses oder fehlenden Schulabschlusses" hätten (a.a.o. 23). Das Ziel sei zwar die Integration in den ersten Arbeitsmarkt (vgl. MÜLLER 2009, 207), jedoch verlange dieser in zunehmenden Maße eine immer höhere Qualifikation, wodurch "viele Behinderte [...] bisher für Tätigkeiten ausgebildet [wurden], die heute am ehesten abgebaut werden" (HASEMANN 2001, 10). Viele erwerbsfähige behinderte Menschen würden somit keine Anstellung mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt finden, sondern von Unterstützungsleistungen abhängig gemacht werden (vgl. ebd.). Als Anzeichen für diese enorm schwierige Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt könne auch die Entwicklung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung gesehen werden. Von 2003 auf 2004 sei die Anzahl der Beschäftigten um 4,3 % gestiegen (vgl. HOHNHEIMER 2007, 143). "Darunter befinden sich zunehmend mehr junge Menschen, die mit geeigneten Fördermaßnahmen [...] eine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben könnten." (ebd.).
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung symbolisieren demnach die Unproduktivität der Beschäftigen in Hinsicht auf Kapitalverwertungsinteressen. Auf den Aspekt der Arbeitskraft minderer Güte wurde bereits eingegangen. Gleichzeitig stellen die Werkstätten, gerade in ökonomischen Krisenzeiten, auch ein Auffangbecken für Menschen dar, die zwar auf dem ersten Arbeitsmarkt als nicht produktiv erachtet werden, denen jedoch ein gewissen Mindestmaß an Produktivität zugestanden wird. Für Menschen ohne dieses Mindestmaß gestaltet sich die Situation weitaus schwieriger. Michael WUNDER plädiert deshalb für einen veränderten Arbeitsbegriff. Wichtig sei es, einen Begriff zu finden, der den sozialen und rehabilitativen Charakter von Arbeit als mindestens gleichbedeutend mit dem ökonomischen Wert betrachte. Der Fokus müsse von den verwertbaren Ergebnissen auf den Sinn und Nutzen für das arbeitende Individuum erweitert werden. Jedoch herrsche in allen Arbeitsdefinitionen die Antizipation des Ergebnisses vor und wirke demnach exkludierend auf schwer behinderte Menschen. So könne der Begriff der Tätigkeit in den Mittelpunkt gerückt werden, da dieser Kompetenzen von schwer behinderten Menschen mit einschließe, ohne Aspekte des traditionelleren Arbeitsbegriffes auszuschließen (vgl. WUNDER 2002, 323).
Entsprechend der verminderten erwarteten Produktivität befinden sich behinderte Menschen deutlich häufiger in Arbeitslosigkeit, als nicht behinderte Menschen, wie Tabelle 7 verdeutlicht.
Tabelle 7: "Percentage of being in work among the populations with severe , moderate and no disability, by country and sex, age 16-64, 1996", EUROSTAT 2001, 37.
|
Disability |
Germany |
EU 1996 |
|
Both sexes |
||
|
Severe |
26,40% |
24,30% |
|
Moderate |
53,80% |
46,20% |
|
No |
69,30% |
61,90% |
|
Men |
||
|
Severe |
30,30% |
27,90% |
|
Moderate |
67,30% |
57,60% |
|
No |
81,40% |
75,10% |
|
Women |
||
|
Severe |
21,50% |
20,50% |
|
Moderate |
41,40% |
36,70% |
|
No |
57,70% |
49,30% |
Die Einteilung 'severe' und 'moderate' Behinderungen sei aufgrund einer Selbsteinschätzung der befragten Menschen hinsichtlich der Beeinträchtigungen in ihrem Alltag erfolgt (EUROSTAT 2001, 6).
Bei dem Aspekt der Selbstbestimmung handele es sich nicht um absolute Selbstbestimmung. Zu jeder sozialen Interaktion zähle auch Fremdbestimmung, um für den Anderen oder die Andere da zu sein, um notwendig zu sein, und sich selbst als sozial sinnvoll zu empfinden (vgl. DÖRNER 2007, 49). Die Balance zwischen Selbst- und Fremdbestimmung sei entscheidend. Klaus DÖRNER verortet diese Balance im Spannungsfeld der Übernahme der Positionen der Stärkeren durch die Schwächeren. "Die Macht des Stärkeren über den Schwächeren, insbesondere in Institutionen, ist [...] so groß, dass das, was formal als Selbstbestimmungsrecht der Schwächeren gilt, z.B. 'ich habe keine Veränderungswünsche' in Wirklichkeit oft nur die Übernahme der Perspektive der Stärkeren ist. Dies einen Konsens zu nennen, wäre dann zwar formal korrekt, in Wirklichkeit aber zynisch." (DÖRNER 2007, 44). Auch Willem KLEINE SCHAARS (2003, 27) kennzeichnet das Verhältnis von Betreuenden und Klienten als ein Verhältnis von Abhängigkeit, in dem die Betreuenden über mehr Macht verfügten, als die Klienten.
Dieses Verhältnis unterliege in der Selbstwahrnehmung der Betreuenden jedoch nicht unbedingt einem negativen Verständnis: "Die dem Paternalismus unterworfenen Subjekte stellen folglich in den Augen der paternalistischen Herrschaft eine moralisch inkompetente Population dar. Auf der Basis der von den Überlegenen beanspruchten höheren moralischen Kompetenz wird die Verfügbarkeit über letzte Entscheidungsinstanzen beansprucht, was die wirklichen Interessen der Unterlegenen sind." (JANTZEN 2003, 293). In dieser Lesart können die wirklichen Interessen der behinderten Menschen von diesen selbst nur ungenügend erkannt werden. Aus diesem Grund bedarf es professioneller Betreuenden, womit diese die letzte Entscheidungsgewalt innehaben. Entscheidungsgewalt ist hier gleichzusetzen mit Kontrolle. Dieser Zustand wird dadurch verstärkt, dass sowohl ein "Mangel an ambulanten Unterstützungen", als auch an "Förderung individueller Selbstbehauptungsstrategien in pädagogischen Konzepten für behinderte Menschen" herrsche (beide DREBLOW 1999, 134 f.).
Wiederum sei die Zuspitzung dieser Kontrolle im sexuellen Missbrauch zu sehen. Das Hierarchiegefälle sei vom erwachsenen, nicht behinderten Mann zu einem geistig behinderten Mädchen, bzw. einem schwer behinderten Mädchen sehr groß. Aus diesem Grund seien (geistig) behinderte Kinder und Jugendliche häufiger von sexuellem Missbrauch betroffen, als nicht behinderte Kinder und Jugendliche (vgl. Brill in ENDERS; WEILER 2003, 125). Verschiedene Aspekte verstärken dieses Hierarchiegefälle. Sylvia SEELIGMANN sieht sowohl die mangelnde sexuelle Aufklärung von geistig behinderten Kindern, als auch institutionelle Rahmenbedingungen als ausschlaggebend an. Dadurch könnten sie schlechter benennen, was im Falle eines Missbrauchs geschehen sei und sich aufgrund der Rahmenbedingungen von Schule, Heimen und Wohngruppen nur mangelhaft abgrenzen und nur unzureichend 'nein' sagen (vgl. SEELIGMANN 1996, 78 ff.). Maike GERDTZ sieht einen entscheidenden Punkt in der Personalpolitik der Institutionen. So hätten Schüler und Schülerinnen, sowie Klienten und Klientinnen kaum eine Wahl bei denjenigen Personen, die sie pflegten (vgl. GERDTZ 2003, 38). Insgesamt herrsche ein Täter und Täterinnen freundliches Klima, aufgrund der hohen Abhängigkeit seitens der Schüler und Schülerinnen, Klienten und Klientinnen, aufgrund des starken hierarchischen Gefälles, der hohen Fremdbestimmung durch Professionelle und ggf. mangelnde Ausdrucksmöglichkeiten der geistig behinderten Betroffenen, sei es aus mangelnder Aufklärung oder eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. a.a.o. 33).
Inkorporierung sozialer Verhältnisse
-
biologistische Tendenz des Behinderungsverständnisses
-
damit Festschreibung von Behinderung als unvollkommen und minderwertig
Nicht-Behinderung als Norm
-
Norm wird als Nicht-Behinderung definiert; in diesem Sinn ist Behinderung abweichend und minderwertig
-
Konstruktion von Behinderung als Abweichung führt letztendlich zu einer Anthropologisierung von Behinderung
-
im extremsten Fall ist Abweichen von der Norm so groß, dass sogar Lebensrecht in Frage gestellt wird
Performative Sprache
-
sprachlicher Begriff der Behinderung spiegelt herrschende Praxis der Diskriminierung und Exklusion behinderter Menschen wider
-
Verbindung von Behinderung und Leid in entsprechenden sprachlichen Mustern drückt Überforderung von nicht behinderten Menschen aus
Behinderung und Klasse
-
behinderte Menschen als Arbeitskräfte minderer Güte, weil ihre Einbeziehung in die Kapitalverwertung mit zusätzlichen Investitionen verbunden ist
-
Behinderung überproportional häufig in unteren sozialen Schichten der Gesellschaft vertreten → sozialer Tatbestand Behinderung
-
mit Behinderung stehen weniger Soziales, Symbolisches, Kulturelles und Ökonomisches Kapital zur Verfügung
Unsichtbarkeit von Behinderung
-
Ausschluss von öffentlichem Leben und Teilhabe und Einschluss in spezielle Institutionen wie Sonderschulen, als nicht vorhandene Interaktion von behinderten und nicht behinderten Menschen
-
Unterrepräsentanz in öffentlichen Darstellungen und Medien
Berufstätigkeit und Behinderung
-
Schwierigkeiten der Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt durch weiterhin manifeste Vorurteile gegenüber Behinderung, und als gemindert betrachtete Produktivität
-
häufig Verdrängung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und deutlich erhöhte Arbeitslosigkeit im Vergleich zu nicht behinderten Menschen
-
exkludierender Arbeitsbegriff
Kontrolle und Selbstbestimmung
-
hohe Fremdbestimmung im Zusammenhang eines paternalistischen Bildes von behinderten Menschen, die selbst nicht genau wissen, was für sie richtig ist
-
Kontrolle über abschließende Entscheidungsgewalt bei Professionellen
-
hoher sexueller Missbrauch von geistig behinderten und schwer behinderten Kindern und Jugendlichen aufgrund starken hierarchischen Gefälles und Täter und Täterinnen freundlichen Rahmenbedingungen
[5] http://meta.tagesschau.de/id/48019/ernste-debatte-ueber-praeimplantationsdiagnostik#c omment- 348929
Inhaltsverzeichnis
Im Kapitel 2 Theoretische Grundlagen wurde die herrschende Normalitätskonstruktion als Mischung einer proto und flexibel normalistischen Strategie charakterisiert. Behinderung stellt in diesem Verständnis eine Abweichung von bürgerlicher Normalität dar. Menschen, die der Normalität entsprechen, sind bestrebt, ihren Status aufrecht zu erhalten. Dies wurde als Denormalisierungsangst gekennzeichnet. Hierarchie wurde im Spannungsfeld von Gleichheit und Differenz verortet. Beide Aspekte sind aufeinander als gleichwertig angewiesen. Differenz ohne Gleichheit bedeutet Hierarchie und Entwertung von Andersartigkeit. Gleichheit ohne Differenz bedeutet Assimilation. Die Festschreibung von Differenz ohne Gleichheit wurde als Herrschaftskultur dargelegt. Herrschaft ist eng Verbunden mit Macht, demnach erfolgte eine Charakterisierung des Machtbegriffs in der Lesart Foucaults.
Im Kapitel 3 Gender Analyse erfolgte eine dekonstruktivistische Analyse des Geschlechterverhältnisses, welches in der Folge als ein hierarchisches gekennzeichnet wurde. Dabei wurde die Analyse nach sieben selbstgewählten Hierarchie Dimensionen strukturiert.
Im Kapitel 4 Hierarchie Dimensionen im Kontext von Behinderung und Nicht-Behinderung wurden die aus der Gender Analyse gewonnen Dimensionen auf den Zusammenhang Behinderung und Nicht-Behinderung angewandt. Dazu wurde beispielhaft auf sonderpädagogische Literatur verwiesen, die die jeweilige Dimension erläuterte.
Mittels der sieben Hierarchie Dimensionen kann das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung nicht mehr nur pauschal als hierarchisch beschrieben werden, sondern es wurde aufgezeigt, auf welchen Ebenen und in welcher Form sich diese Hierarchie äußert. Wie einleitend beschrieben, ist dies innerhalb der sonderpädagogischen Literatur bisher nicht erfolgt.
Darin liegt die Stärke, der in dieser Arbeit vorgestellten Hierarchie Dimensionen. Das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung wird als hierarchisch charakterisiert und umfassend aufgezeigt, in welchen Bereichen dies geschieht. Dabei soll noch einmal ausdrücklich betont werden, dass die Dimensionen nicht einzeln zu betrachten sind, sondern sich wechselseitig beeinflussen und bedingen, so dass Hierarchie nicht nur einzelne Aspekte, sondern Behinderung als Ganzes betrifft. Liegt die Stärke darin zu betonen, dass das Konstrukt Behinderung als von Hierarchie durchdrungen ist, so kann die Schwäche in eben diesem Versuch der Generalisierung gesucht werden. Die Begrifflichkeit Behinderung umfasst einen so heterogenen Personenkreis, dass die einzelnen Dimensionen es nicht vermögen, die spezifischen Bedingungen aller als behindert geltenden Personen wiederzugeben. Ohnehin stellt die Arbeit eher ein theoretisches Vordenken dar. Um gesicherte Ergebnisse hinsichtlich der Hierarchie von Behinderung und Nicht-Behinderung zu erhalten, müssen in der Folge empirische Untersuchungen erfolgen, für die die hier zusammengetragenen Dimensionen grundlegend sein können. In solchen Untersuchungen muss dann das Forschungsdesign ggf. an die spezifischen Personen angepasst werden, da, wie beschrieben, das Konstrukt Behinderung als zu allgemein und oberflächlich wirkt, als dass es die Lebenswirklichkeiten aller behinderter Menschen einzuschließen vermag. Mittels solcher Forschung kann dann die am Ende von Kapitel 2 Theoretische Grundlagen aufgeworfene Frage, ob das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung einem Macht- oder einem Gewaltverhältnis entspricht, in welchen Situationen dies in welcher Ausprägung so ist und ob es Lebensumstände gibt, die das eine oder das andere befördern, beantwortet werden.
Die Hierarchie Dimensionen vermögen einen Beitrag zur Kritik am etablierten Behinderungsbegriff zu liefern. So gewinnen progressive Forscher und Forscherinnen eine weitere Analyseebene des Behinderungsbegriffes hinzu, mittels der dieser dekonstruiert werden kann. Für das Zusammenleben von behinderten und nicht behinderten Menschen, in dem (neue) Begrifflichkeiten nicht stigmatisieren und nicht hierarchisieren dürfen, können mit der vorliegenden Analyse Hinweise auf die notwendig zu verändernden Bereiche einer inklusiven Gesellschaft gewonnen werden. So kann Egalitäre Differenz nicht ausschließlich durch zu ändernde Begriffe erreicht werden, sondern genauso müssen ökonomische, normalistische, usw. Aspekte berücksichtigt werden.
Die vorliegende Analyse vermochte das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. So wurde betont, dass die Mechanismen der Hierarchisierung bei Weiblichkeit und bei Behinderung äquivalent sind. Behinderung stellt demnach keinen Sonderfall dar, sondern ist, wie andere normabweichende Gruppen auch, Teil des männlich dominierten, bürgerlichen Herrschaftssystems. Die Mechanismen der Ausgrenzung, der Herrschaftssicherung, sind bei allen ausgegrenzten Gruppen die gleichen. Trotz dieser, vor allem durch Bourdieu festgehaltenen Erkenntnis, ist eine deutliche Sonderstellung der Sonderpädagogik im wissenschaftlichen Diskurs zu verzeichnen. So gibt es eine Vielzahl an Literatur, die sich mit gesellschaftlichem Ausschlussmechanismen der Strukturkategorien 'gender', 'race' und 'classes' auseinandersetzt. Bei der Betrachtung der Geschlechterverhältnisse sowie normabweichenden sexuellen Orientierungen, bei Migrations- und Kulturaspekten, als auch bei sozioöknomischen Überlegungen verwundert es, dass Behinderung fehlt, da doch die Mechanismen dort ähnlich wirken. Am ehesten vorhanden sind Überschneidungen von Behinderung und gender, teilweise von Behinderung und classes, wobei dies deutlich von Behindertenpädagogen und Behindertenpädagoginnen ausgeht, die sich auch mit der Genderfrage, bzw. der Verknüpfung von Behinderung und sozioökonomischen Aspekten auseinandersetzen. Die Sonderpädagogik hat es noch nicht vermocht ihre wissenschaftliche Sonderstellung in dem Maße zu verlassen, als dass sie Teil des kritischen Diskurses der Herrschaftsverhältnisse geworden ist. Warum dies so ist, lässt sich nur vermuten. Behinderung könnte von anderen Disziplinen als so besonders wahrgenommen werden, dass sie sich kaum trauen, sie in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen. Diese Vorstellung von Behinderung als Unikum sehe ich auch in der Sonderpädagogik verbreitet. Die fehlende Interdisziplinarität beschränkt in jedem Fall den fruchtbaren Austausch und neue Erkenntnisse der aufgeführten Disziplinen und sollte zweifelsohne überwunden werden.
Die Hierarchie Dimensionen geben in begrenzten Umfang auch für die schulische Praxis Hinweise zur Gestaltung des pädagogischen Alltags. So können aus ihr Überlegungen gewonnen werden, in welchen Bereichen hierarchiebildende Strukturen herrschen und in welcher Form diese in der Folge bearbeitet werden können. Insofern Schule als systemimmanent begriffen wird, lassen sich mit einer das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung betreffenden hierarchiefreieren Schule zwar nicht gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse ändern, diese kann jedoch einen Teil dazu beitragen, dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft näher zu kommen.
ABÉ, Ilse; PRENGEL, Annedore: Sonderschule - Möglichkeiten und Grenzen. In: Informationsdienst Arbeitsfeld Schule, Heft 39, 1979, 5-36.
BEAUVOIR, Simone de: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1992.
BÖSL, Elsbeth: Politiken der Normalisierung. Zur Geschichte der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. transcript Verlag, Bielefeld 2009.
BOHN, Cornelia: Mediatisierte Normalität. Normalität und Abweichung systemtheoretisch betrachtet. In: LINK, Jürgen; LOER, Thomas; NEUENDORFF, Hartmut: "Normalität" im Diskursnetz soziologischer Begriffe, Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, Heidelberg 2003, 39-50.
BOURDIEU, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 3. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989.
BOURDIEU, Pierre: Die männliche Herrschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005.
BOURDIEU, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht. In: STEINRÜCKE, Margareta: Schriften zur Politik und Kultur Band I. VSA-Verlag, Hamburg 1997.
BOURDIEU, Pierre: Teilen und herrschen. Zur symbolischen Ökonomie des Geschlechterverhältnisses. In: RADEMACHER, Claudia; WIECHENS, Peter: Geschlecht - Ethnizität - Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie und Differenz. Leske und Budrich, Opladen 2001, 11-30.
BOURDIEU, Pierre; DÖLLNG, Irene; STEINRÜCKE, Margareta: Eine sanfte Gewalt. Pierre Bourdieu im Gespräch mit Irene Dölling und Margareta Steinrücke (März 1994). In: DÖLLING, Irene; KRAIS, Beate: Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, 218-230.
BUNDESMINISTERIUM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gender-Datenreport. 1. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland. München 2005. http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/1-Bildung-ausbildung-undweiterbildung/ 1-4-Schulische-bildung/1-4-4-lehrkraefte.html [30.04.2011]
BURCHARDT, Brigitte; TIERSCH, Claudia; GODDAR, Jeannette: Nehmen Sie doch mal die Frau dran! Gespräch über Karrierewege von Frauen mit Schulleiterin Brigitte Burchardt und Professorin Claudia Tiersch. In: Erziehung und Wissenschaft Jg. 63, 2011, Heft 3, 10-12.
DAVIS, Lennard, J.: Constructing Normalcy. In: DAVIS, Lennard J.: The Disability Studies Reader. 3. Auflage. Routledge, New York und London 2010, 3-19.
DÖRNER, Klaus: Verantwortung vom Letzten her. Der innere Impuls des Sorgens um den anderen. In: HINZ, Andreas: Schwere Mehrfachbehinderung und Integration. Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven. Lebenshilfe-Verlag, Marburg 2007, 42-56.
DREBLOW, Franka: Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbestimmung im Wohnheim. In: WEINWURM-KRAUSE, Eva-Maria: Autonomie im Heim. Auswirkungen des Heimalltags auf die Selbstverwirklichung von Menschen mit Behinderung. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 1999, 125-177.
EICKELPASCH, Rolf: Hierarchie und Differenz. Anmerkungen und Anfragen zur "konstruktivistischen Wende" in der Analyse sozialer Ungleichheit. In: RADEMACHER, Claudia; WIECHENS, Peter: Geschlecht - Ethnizität - Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie und Differenz. Leske und Budrich, Opladen 2001, 53-63.
ENDERS, Ursula: Gewaltverhältnisse: Ursachen sexuellen Missbrauchs. In: ENDERS Ursula: Zart war ich, bitter war's. Handbuch gegen sexuellen Missbrauch. vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2003, 35-52.
ENDERS, Ursula; WEILER, Julia: Das perfekte Verbrechen. Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Jungen mit Behinderungen. In: ENDERS Ursula: Zart war ich, bitter war's. Handbuch gegen sexuellen Missbrauch. vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2003, 125-128.
ENGELS, Friedrich: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich: Ausgewählte Schriften. In zwei Bänden. Band 2. Dietz Verlag, Berlin 1955, 159-304.
EUROSTAT: Disability and social participation in Europe. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
FIDAR: Women on Board Index. 2011. http://www.fidar.de/Index-Aufsichtsrat-Vorstand.113.0.html [30.03.2011]
FIRLINGER, Beate: Buch der Begriffe. Sprache Behinderung Integration. Integration: Österreich, Wien 2003. wiederveröffentlicht bei bidok: http://bidok.uibk.ac.at/library/firlinger-begriffe.html [19.04.2011]
FOUCAULT, Michel: Die Anormalen: Vorlesungen am Collège de France (1974 - 1975). Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003.
FOUCAULT, Michel: Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin. Merve Verlag, Berlin 1976.
FOUCAULT, Michel: Nachwort In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul: Michel Foucault: jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Beltz, Weinheim 1994a, 241-161.
FOUCAULT, Michel: Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisse. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994b.
FOUCAULT, Michel; CHOMSKY, Noam ; ELDERS, Fons: Absolute(ly) Macht und Gerechtigkeit. Orange Press, Freiburg 2008.
GERDTZ, Maike: Auch wir dürfen NEIN sagen! Sexueller Missbrauch von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Ein Handbuch zur Prävention. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003.
GILDEMEISTER, Regine: Soziale Konstruktion von Geschlecht: Fallen, Missverständnisse und Erträge einer Debatte. In: RADEMACHER, Claudia; WIECHENS, Peter: Geschlecht - Ethnizität - Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie und Differenz. Leske und Budrich, Opladen 2001, 65-87.
GINNOLD, Antje: Schulende - Ende der Integration? Integrative Wege von der Schule in das Arbeitsleben. In: SCHÖLER, Jutta: Buchreihe Gemeinsames Leben und Lernen: Integration von Menschen mit Behinderungen. Luchterhand, Neuwied und Berlin 2000.
GOODY, Esther: Warum die Macht Recht haben muss. Bemerkungen eines Geschlechts über das andere. In: LÜDKE, Alf: Herrschaft als soziale Praxis. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1991, 67-112.
HAEBERLIN, Urs: Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft. Ein propädeutisches Einführungsbuch in Grundfragen einer Pädagogik für Benachteiligte und Ausgegrenzte. Paul Haupt, Bern u.a. 1996.
HARRIS, Marvin: The evolution of human gender hierarchies. In: MILLER, Barbara Diane: Sex and gender hierarchies. Cambridge University Press, Cambridge 1996, 57-79.
HASEMANN, Klaus: Innovative Perspektiven für den Übergang behinderter Jugendlicher in die Arbeitswelt. In: HASEMANN, Klaus; MESCHENMOSER, Helmut: Auf dem Weg zum Beruf. Der Übergang behinderter und benachteiligter Jugendlicher von der Schule in die Arbeitswelt. Schneider Verlag, Hohengehren 2001, 10-17.
HEßMANN, Jens: Behinderung und sprachliche Diskriminierung am Beispiel von Gehörlosen. In: EBERWEIN, Hans; SASSE, Ada: Behindert sein oder behindert werden? Interdisziplinäre Analysen zum Behinderungsbegriff. Luchterhand, Neuwied u.a. 1998, 170-194.
HINZ, Andreas: Heterogenität in der Schule. Integration-Interkulturelle Erziehung-Koedukation. Curio-Verlag, Hamburg 1993.
HOHNHEIMER, Jürgen: Unterstützte Ausbildung und Beschäftigung. Neue Wege in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen. In: CLOERKES, Günther; KASTL, Jörg Michael: Leben und Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Menschen mit Behinderungen im Netz der Institutionen. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2007, 143-170.
HÜLSHOFF, Thomas: Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik. Reinhardt, München 2005.
IRIGARAY, Luce: Das Geschlecht, das nicht eins ist. Merve-Verlag, Berlin 1979.
IRIGARAY, Luce: Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980.
JANTZEN, Wolfgang: Allgemeine Behindertenpädagogik. 2. korrigierte Auflage. Beltz, Weinheim und Basel 1992.
JANTZEN, Wolfgang: ...die da dürsten nach Gerechtigkeit. Deinstitutionalisierung in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Edition Marhold, Berlin 2003.
JANTZEN, Wolfgang: Identitätsentwicklung und pädagogische Situation behinderter Kinder und Jugendlicher. In: Sachverständigenkommission Elfter Kinder und Jugendbericht: Gesundheit und Behinderung im Leben von Kindern und Jugendlichen. Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 2002, 317-394.
KLEIN, Jürgen: Sozialer Hintergrund und Schullaufbahn von Lernbehinderten / Förderschülern 1969 und 1997. In: ZfH, 52 (2001) 2, 51-61.
KLEINE SCHAARS, Willem: Durch Gleichberechtigung zur Selbstbestimmung. Beltz, Weinheim 2003.
LINK, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Westdeutscher Verlag, Opladen und Wiesbaden 1999.
LUTZ, Helma; WENNING, Norbert: Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. Leske und Budrich, Opladen 2001. wiederveröffentlicht bei pedocs: http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=2539&la=de [02.03.2011]
MARGOLIS, Maxine L.; ARNOLD, Marigene: Turning the tables? Male strippers and the gender hierarchy in America. In: MILLER, Barbara Diane: Sex and gender hierarchies. Cambridge University Press, Cambridge 1996, 334- 350.
MARUANI, Margaret: Die gewöhnliche Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. In: DÖLLING, Irene; KRAIS, Beate: Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, 48-72.
MASKOS, Rebecca: Leben mit dem Stigma: Identitätsbildung körperbehinderter Menschen als Verarbeitung von idealisierenden und entwertenden Stereotypen. 2004. veröffentlicht bei bidok: http://bidok.uibk.ac.at/library/maskos-stigma-dipl.html [21.04.2011]
MILLER, Barbara, Diane: The anthropology of sex and gender hierarchies. In: MILLER, Barbara Diane: Sex and gender hierarchies. Cambridge University Press, Cambridge 1996, 3-31.
MOSER, Vera: Behinderung oder Risiko? Ein Beitrag zum sonderpädagogischen Selbstverständnis. In: SCHILDMANN, Ulrike: Umgang mit Verschiedenheit in der Lebensspanne. Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb 2010, 298-304.
MOSER, Vera: Geschlecht: behindert? Geschlechterdifferenz aus sonderpädagogischer Perspektive. In: Behindertenpädagogik 36 (1997) 2, 138-149.
MOSER, Vera: Konstruktion und Kritik. Sonderpädagogik als Disziplin. Leske und Budrich, Opladen 2003.
MÜLLER, Sabine: Facetten oder Ganzheitlichkeit? Integration wird Thema des ganzen Systems. In: Lernen Fördern: Teilhabe ist Zukunft. Berufliche Integration junger Menschen mit Behinderung. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau 2009, 207-210.
NAUE, Ursula: Exklusion/Inklusion: Alison Lapper Pregnant und die Frage behinderter Reproduktion. In: Politix, Ausgabe 22, 2006, 20-23. http://politikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_politikwiss/Politix/P olitix22online.pdf [23.02.2011]
OCHS, Elinor: Indexing gender. In: MILLER, Barbara Diane: Sex and gender hierarchies. Cambridge University Press, Cambridge 1996, 146-169.
POLAT, Elif: Institutionen der Macht bei Michel Foucault: zum Machtbegriff in Psychiatrie und Gefängnis. Tectum Verlag, Marburg 2010.
PRENGEL, Annedore: Diversity Education - Grundlagen und Probleme der Pädagogik der Vielfalt. In: KRELL, Gertraude; RIEDMÜLLER, Barbara; SIEBEN, Barbara; VINZ, Dagmar: Diversity Studies - Grundlagen und disziplinäre Ansätze. Campus-Verlag, Frankfurt am Main u.a. 2007, 49-67.
PRENGEL, Annedore: Egalitäre Differenz in der Bildung. In: LUTZ, Helma; WENNING, Norbert: Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. Leske und Budrich, Opladen 2001, 93-107. wiederveröffentlicht bei pedocs: http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=2539&la=de [02.03.2011]
PRENGEL, Annedore: Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. 2. Auflage. Leske und Budrich, Opladen 1995.
PREUSS-LAUSITZ, Ulf: Zahlen zur Integrationsentwicklungen in Berlin und in den einzelnen Bezirken. 2008. http://www.akgem-berlin.org/index.php?menuid=24&downloadid=6&reporeid=23 [21.04.2011]
RADEMACHER, Claudia: Geschlechterrevolution - rein symbolisch? Judith Butlers Bourdieu-Lektüre und ihr Konzept einer 'subversiven Identitätspolitik'. In: RADEMACHER, Claudia; WIECHENS, Peter: Geschlecht - Ethnizität - Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie und Differenz. Leske und Budrich, Opladen 2001, 31-51.
REISER, Helmut: Wege und Irrwege zur Integration. In: SANDER, Alfred; RAIDT, Peter: Integration und Sonderpädagogik. Referate der 27. Dozententagung für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern im Oktober 1990 in Saarbrücken. 2. Auflage. Röhrig, St. Ingbert 1991, 13-33.
RÖDLER, Peter: geistig behindert: Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen? Grundlagen einer basalen Pädagogik. 2. überarbeitete Auflage. Lichterhand, Neuwied 2000.
ROISCH, Henrike: Die horizontale und vertikale Geschlechterverteilung in der Schule In: STÜRZER, Monika (u.a.): Geschlechterverhältnisse in der Schule. Leske und Budrich, Opladen 2003, 21-52.
SCHILDMANN, Ulrike: Geschlecht und Behinderung. Bundeszentrale für politische Bildung 2003. http://www.bpb.de/publikationen/GGOTEJ,0,0,Geschlecht_und_Behinderung.html#ar t0 [23.02.2011]
SCHILDMANN, Ulrike: Normalismusforschung über Behinderung und Geschlecht. Eine empirische Untersuchung der Werke von Barbara Rohr und Annedore Prengel. Leske und Budrich, Opladen 2004.
SCHMOLLACK, Simone: In der Geschlechterfalle. Teilzeit und Billigjob als Handicap für Frauen. In: Erziehung und Wissenschaft Jg. 63, 2011, Heft 3, 7-8.
SCHMUHL, Hans-Walter: Exklusion und Inklusion durch Sprache. Zur Geschichte des Begriffs Behinderung. Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft. Berlin 2010.
SCHUHMANN, Monika: Verschieden und gleich!. Als Leitprinzip für die Theorie und Praxis sozialer Arbeit mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft (5) 2001. wiederveröffentlicht bei bidok: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh5-01-schumann-verschieden.html [20.02.2011]
SEELIGMANN, Sylvia: Sexueller Missbrauch von Kindern. Ansätze einer Prävention für Sonderschulpädagogik. Kovač, Hamburg 1996.
SENATSVERWALTUNG für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin: Verordnung über die sonderpädagogische Förderung. Berlin 2005.
SINGER, Peter: Interview: Peter Singer. In: Heilpädagogik online, 1 / 2003, 49-59. http://www.heilpaedagogik-online.com/heilpaedagogik_online_0103.pdf [22.04.2011]
STATISTISCHES BUNDESAMT: Wirtschaft und Statistik Februar 2011. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikat i onen/Querschnittsveroeffentlichungen/WirtschaftStatistik/Monatsausgaben/WistaFeb ruar11,property=file.pdf [30.03.2011]
STECHOW, Elisabeth von: Erziehung zur Normalität. Eine Geschichte der Ordnung und Normalisierung der Kindheit. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.
THEUNISSEN, Georg: Zeitgemäße Wohnformen - Soziale Netze - Bürgerschaftliches Engagement. In: THEUNISSEN, Georg; SCHIRBORT, Kerstin: Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen - Soziale Netze - Unterstützungsangebote. Kohlhammer, Stuttgart 2006, 59-96.
UN-KONVENTION über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Bonn 2008. http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf [22.04.2011]
VILLA, Paula Irene: Feministischer Guerilla-Krieg oder materialistischer Konstruktivismus? In: REHBERG, Karl-Siegbert: Differenz und Integration. Die Zukunft moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 28. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Oktober 1996 in Dresden. Band II. Westdeutscher Verlag, Opladen und Wiesbaden 1997, 131-136.
VINZ, Dagmar; SCHIEDERIG, Katharina: Gender und Diversity - Vielfalt verstehen und gestalten. In: politische bildung. Beiträge zur wissenschaftlichen Grundlegung und zur Unterrichtspraxis. Jg. 42, 2009, Heft 4, 9-32.
WEISSER, Jan: Behinderung, Ungleichheit und Bildung. Eine Theorie der Behinderung. transcript Verlag, Bielefeld 2005.
WENDELL, Susan: Toward a Feminist Theory of Disability. In: DAVIS, Lennard J.: The Disability Studies Reader. 3. Auflage. Routledge, New York und London 2010, 336-352.
WUNDER, Michael: Der Begriff der Tätigkeit und die Teilhabe schwer- und mehr- fachbehinderter Menschen am Arbeitsleben. In: FEUSER, Georg; BERGER, Ernst: Erkennen und Handeln. Momente einer kulturhistorischen (Behinderten-)Pädagogik und Therapie. Verlag Pro BUSINESS, Berlin 2002, 320-331.
Inhaltsverzeichnis
Bild der Skulptur 'Alison Lapper Pregnant'
Women On Board Index
http://www.fidar.de/Index-Aufsichtsrat-Vorstand.113.0.html
[30.03.2011]
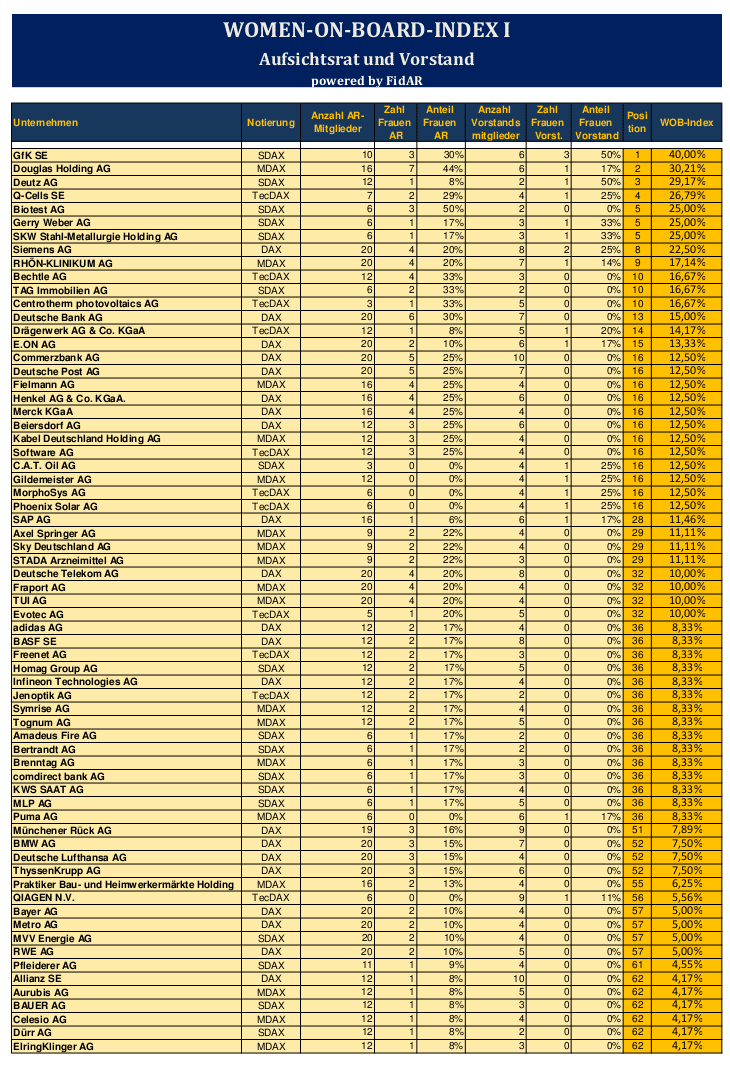
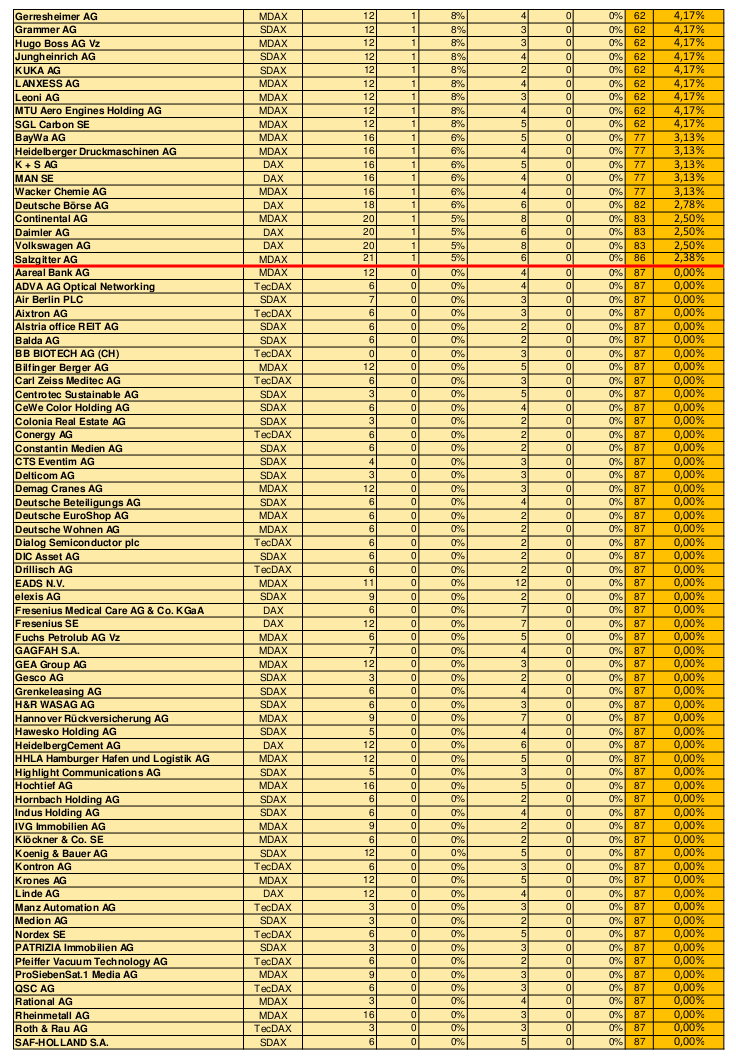
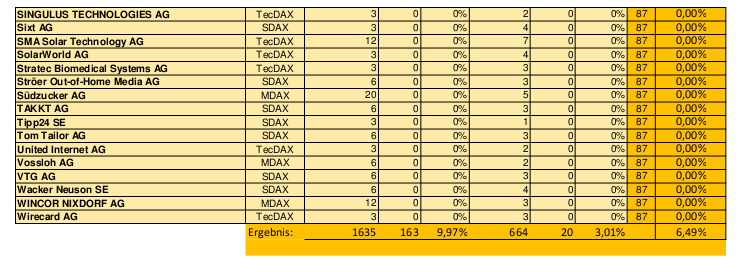
Quelle:
Sascha Hornemann: Behinderung und Hierarchie - Zur Bedeutung der Gender-Analyse für das Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Menschen
Abschlussarbeit des Masterstudiengangs "Lehramt für Sonderpädagogik" an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Rehabilitationswissenschaften
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 17.01.2012

