Examensarbeit zur Erlangung des Ersten Staatsexamens für das Lehramt an Sonderschulen an der Philosophischen Fakultät III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Erziehungswissenschaften. Eingereicht bei: Ines Boban und Prof. Dr. Andreas Hinz. März 2005
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Respekt?
- 3. Methodische Grundlagen
-
4. Institutionelle Rahmenbedingungen des Schulsystems und entwicklungspsychologische Aspekte der Entstehung von Respekt unter Jugendlichen
- 4.1 Schule als Grundlage für die Entwicklung von Anerkennung und Toleranz?!
- 4.2 Exkurs: Zur Diskrepanz von Lob und Anerkennung
- 4.3 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte des Jugendalters
- 4.4 Gruppenbildung/ Gruppenidentität als Voraussetzung für ein solidarisches Miteinander
- 4.5 Folgen mangelnden Respekts - Aggression und Gewalt als Antwort auf Mangel an Partizipation
- 4.6 Dimensionen von Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen (nach Köbberling/ Schley 2000, 136ff.)
-
5. Inklusive Schule als "guter Nährboden" für Toleranz und Anerkennung oder Utopie im Strudel der Realität? - Betrachtungen am Beispiel der IGS Köln-Holweide
- 5.1 Inklusive Schule - eine begriffliche Annäherung
- 5.2 Phasen der Entwicklung von der ‚Exklusion' zur ‚Vielfalt als Normafall'
- 5.3 Qualitative Weiterentwicklung der Schule von der Integration zur Inklusion
- 5.4 Der Index für Inklusion und dessen Übertragung auf die vier Anerkennungskategorien (vgl. Kap. 3.3.2)
- 5.5 Fazit
- 5.6 Die IGS Köln-Holweide - eine inklusive Schule im Hinblick auf wechselseitige Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen?
- 5.7 Aussagen von SchülerInnen des 10. Jahrgangs zu Anerkennungsverhältnissen unter Jugendlichen
- 5.8 Schlussfolgerung
- 6. Ausblick
- 7. Literatur
- 8. Anlagen:
Emotionale Kälte, Verrohung und Gewalt - täglich flimmert es auf unseren Bildschirmen und hält Einzug in unseren Köpfe - das Bild von der brutalen erbarmungslosen Welt. Was haben wir als PädagogInnen dem entgegenzusetzen? Angst oder Vertrauen, Enttäuschung oder Hoffnung, Resignation oder Zuversicht?
Die Reaktion auf die Welle des Tsunami in Südostasien konnte uns kürzlich das Gegenteil beweisen. "Die größte solidarische Hilfsaktion aller Zeiten", hieß es in den Medien. In der Erfahrung des Verlustes von Sicherheit und Lebensglück erkannten Millionen von Menschen plötzlich den eigentlichen Wert ihres Wohlstands. Die eigene emotionale Betroffenheit löste eine Welle der Hilfe und Solidarität unter den Menschen aus. Dies ist der jüngste Beweis dafür, dass es in unserer leistungsorientierten Gesellschaft noch nicht zu völliger Gefühlskälte, Egoismus und Intoleranz gekommen ist, sondern noch ein Funke dessen, was sich Mitgefühl nennt, in jedem Menschen vorhanden ist.
Wenn diese Hoffnung trägt, kann sie im Hinblick auf die aktuelle Situation an deutschen Schulen auch bewirken, dass ein winziger Funke ein ganzes Feuerwerk entfacht. Jean Paul hat dies in einer Rede sehr treffend ausgedrückt: "Leben entzündet sich nur am Leben" (Paul, zit. in Kahl 2004).
Im Hinblick auf Schule, im antiken Griechenland als Muße, Innehalten, wissenschaftliche Arbeit während der Mußestunden (vgl. Drosdowski 1989, 653) verstanden, sollte gerade dieser Grundsatz im Zentrum der Betrachtung stehen. Kinder und Jugendliche brauchen Räume, in denen sie sich frei entfalten können, ohne durch die sie umgebenden materiellen, sozialen oder institutionellen Rahmenbedingungen behindert zu werden.
Im Zentrum dieser Arbeit soll eine Gruppe von Menschen stehen, die sich gerade in einer Phase des Umbruchs, der Krise und der Neuorientierung befindet. Jugendliche benötigen in dieser wechselhaften Zeit Bestätigung und Anerkennung durch ihre Umwelt, um zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten heranzureifen. In dieser Arbeit soll dahingehend auf drei wesentliche Schwerpunkte eingegangen werden:
Ein erster Schwerpunkt liegt auf den Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Respekt. Diesbezüglich soll geklärt werden, welche Dimensionen Respekt, verstanden als Form der wechselseitigen Anerkennung, in sich trägt. Die Grundlage meiner Überlegungen bildet ein von Honneth (1992) entworfenes Gesellschaftsmodell, in welchem drei Formen der Anerkennung drei entsprechenden Formen der Missachtung gegenüber gestellt werden. In einem nächsten Schritt wird aufgezeigt, inwiefern sich die von Honneth (1992) erarbeiteten Dimensionen der Anerkennung auf den Bereich Schule als eine Lebenswelt junger Menschen übertragen lassen.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Analyse von Entwicklungsbedingungen der Jugendphase. Hierbei wird zum einen auf wesentliche entwicklungspsychologische Determinanten wie Identität und Selbstkonzept eingegangen. Des Weiteren sollen Prozesse der Ablösung aus dem familiären Kontext und der stärkeren Hinwendung zur Gruppe der Gleichaltrigen dargestellt werden. In diesem Zusammenhang wird v.a. die Wirkung von Anerkennungsbeziehungen innerhalb von Peer-Gruppen beleuchtet.
Die Kehrseite von Respekt in Form von Aggression, Gewalt und Mobbing und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen wird in einem weiteren Punkt aufgezeigt. Gerade in der Adoleszenz, einer Zeit voller Spannungen, Umbrüche und Grenzerfahrungen, wird Gewalt oftmals als probates Mittel angesehen, um Konflikte zu lösen.
In einem dritten Schwerpunkt wird das schulische Umfeld beschrieben, welches den Rahmen bildet, in den die beschriebenen Prozesse eingebunden sind.
Die Schule ist eine Institution, in der Kinder und Jugendliche Wissen, Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Häufig stellt sie aber auch einen Ort des Misstrauens, der Demütigung und der Gewalt dar. Dies bildet den Ausgangspunkt für die Darstellung eines Konzepts von Schule oder vielmehr einer Philosophie, welche Schule als Quelle der Entstehung von Freude, Kreativität und Humanität in Gemeinschaft versteht. Die Grundidee ist das Verständnis von Schule als Schule für alle, in der die uneingeschränkte Teilhabe aller SchülerInnen, gleich welcher physischen, psychischen, sozialen oder kulturellen Voraussetzungen, nicht nur gewährleistet, sondern erwünscht ist. Respekt stellt hier eine der wesentlichen Grundlagen für die Realisierung dieser "Schule der Vielfalt" dar (vgl. Prengel 1993, 2005).
Methodische Grundlage der Arbeit bilden Gruppendiskussionen, welche in einer Klasse des 10. Jahrgangs an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Köln-Holweide durchgeführt wurden. Die Idee der Durchführung dieser Gruppendiskussionen entstand aufgrund von Fragen, die in Zusammenhang mit der Auswertung der im Juli 2004 durchgeführten Schülerbefragung entstanden sind. Diese Grundfragen, welche ebenfalls wesentliche Fragen der vorliegenden Arbeit darstellen, stehen in Verbindung mit Phänomenen der Abgrenzung bzw. Ausgrenzung von SchülerInnen durch Gruppenprozesse. Sie stellen den Ausgangspunkt für die Diskussion um Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen mit unterschiedlichen physischen, psychischen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen dar. Die Gesamtschule Köln-Holweide, die sich auf den Weg zu einer inklusiven Schule begeben hat, steht vor der Herausforderung ihr Selbstverständnis zu klären: Inwiefern kann sie dem Anspruch inklusiv zu sein gerecht werden und damit respektvolle Verhältnisse zwischen SchülerInnen initiieren, obgleich Faktoren gegen diesen Anspruch der "Entwicklung einer Atmosphäre der gegenseitigen Achtung" wirken? Dabei geht es um das Spannungsverhältnis zwischen dem Konzept der inklusiven Schule und dessen Realisierung durch die Schulgemeinschaft, insbesondere die Schülerschaft. Inwiefern besteht an dieser Schule die Gefahr, dass ein Mangel an gegenseitiger Wertschätzung durch die Ausbildung interner Hierarchien und ungeklärter Konflikte zu gegenseitigem Misstrauen, Degradierung oder gar Gewalt führen? In diesem Zusammenhang soll v.a. beleuchtet werden, inwiefern Prozesse der Gruppenbildung unter SchülerInnen hemmend oder fördernd auf die uneingeschränkte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen wirken. Die Bedeutung der Identifikation von Jugendlichen mit einer Gruppe und die damit verbundene Schaffung von "Schutzräumen" steht eng mit diesem Aspekt in Verbindung.
Respekt wird somit zum Schlüsselbegriff gesellschaftlichen und damit auch schulischen Zusammenlebens. Dahingehend analysiere ich richtungsweisende Determinanten wie Schulstrukturen, Gruppenprozesse und entwicklungspsychologische Faktoren. Neben einer Situationsanalyse werden Widersprüche aufgedeckt und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Analyse des Status quo an deutschen Schulen, exemplarisch am Beispiel der IGS Köln-Holweide erörtert, sowie die Darstellung verschiedener Bedeutungsebenen des Schlüsselbegriffes Respekt.
Anhand der aufgezeigten Schwerpunkte ist die Arbeit in vier Kapitel unterteilt, wobei die ersten drei Kapitel den Theorieteil und das vierte die Auswertung der theoretisch und empirisch gewonnenen Ergebnisse darstellt.
Im ersten Kapitel (2.) wird zum einen auf Dimensionen wechselseitiger Anerkennung bzw. Missachtung eingegangen. Zum anderen findet eine erste Darstellung von Anerkennungsverhältnissen im schulischen Kontext statt.
Das zweite Kapitel (3.) beinhaltet die methodischen Grundlagen dieser Arbeit und die Kategorien für die Analyse der Gruppendiskussionen in Kapitel 5.
Im Lichte der dargestellten Dimensionen von Anerkennung bzw. Missachtung kommt es im dritten Kapitel (4.) zur Darstellung von Voraussetzungen des Schulsystems für die Entstehung von Anerkennung. Daraufhin diskutiere ich in einem kleinen Exkurs die Diskrepanz von Lob und Anerkennung. Anschließend erfolgt eine Analyse entwicklungspsychologischer Determinanten des Jugendalters, die für Identitätsbildung und Selbstkonzept relevant sind. Darauf aufbauend werden Prozesse der Gruppenbildung als auch Phänomene der Ausgrenzung und Gewalt unter Jugendlichen dargestellt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Betrachtung des Verhältnisses von Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen anhand der Ergebnisse einer Untersuchung an Integrativen Hamburger Gesamtschulen Im vierten, analytisch-empirisch angelegten Kapitel (5.) werden die theoretisch gewonnenen Ergebnisse exemplarisch auf die Entstehung und Wirkung von Anerkennungsverhältnissen an der IGS Köln-Holweide, einer Schule, die beansprucht ein inklusives Konzept zu realisieren, übertragen. Anspruch dieser Schule ist es, dass alle SchülerInnen als wertvoll für die Gemeinschaft anerkannt und in Leben und Lernen unterstützt werden. Ausgangspunkt dieser Betrachtung bilden Gruppendiskussionen, welche ich mit SchülerInnen des 10. Jahrgangs dieser Schule geführt habe.
Abschließend folgt ein Ausblick, in dem die Ergebnisse der Arbeit kritisch reflektierend betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
Dieses Kapitel bildet den Einstieg in die Thematik. Hier sollen wesentliche Definitionsfragen sowie die Darstellung der Gesellschaftsanalyse und Herausarbeitung der drei
Formen von Anerkennung bzw. Missachtung erfolgen und die Frage nach der Übertragbarkeit dieser theoretisch gewonnenen Erkenntnisse gestellt werden. Durch dieses Kapitel werden wesentliche theoretische Grundlagen der vorliegenden Arbeit gelegt. Insbesondere dient Honneths Systematik als Basis für die Analyse psychosozialer Prozesse der Gruppenbildung bzw. für die Betrachtung entwicklungspsychologischer Aspekte des Jugendalters.
Wir Menschen als soziale Wesen wollen wahrgenommen, respektiert und angenommen sein. Nur so fühlen wir uns sicher. Daher stellt Respekt eine Art Grundbedürfnis dar, welches allen Menschen eigen ist. Wo es an Respekt und Anerkennung mangelt, erscheint die Welt grau, kalt und leer und jeder scheint ein Leben für sich selbst zu führen, immer bedacht, besser zu sein als die anderen. In der heutigen Leistungsgesellschaft scheint in vielen Bereichen solch eine "Knappheit von Respekt" (Sennett 2004, 15) zu herrschen, die dazu führt, dass Konflikte durch Gewalt ausgetragen werden, dass Menschen ihre Träume nicht verwirklichen können oder dass Kinder in der Schule versagen. Gerade hier, in diesem engen sozialen Gefüge, ist dieses Phänomen besonders zu spüren.
Und dennoch scheint der Wunsch nach Anerkennung damals wie heute und über alle Kulturen hinweg ein gemeinsames Bedürfnis zu sein.
Das Wort Respekt erscheint in der postmodernen Welt vorerst etwas verstaubt. Dennoch hat es gerade in der heutigen Zeit des steten Wandels nicht an Aktualität eingebüßt. Wie Prengel (2005) schreibt, ist es ein "Element der sozialen Welten" (16) und taucht in vielen Jugendkulturen als Songtext oder Forderung auf. Was ist aber nun eigentlich genau Respekt und wie kann man sich dieser scheinbar vieldeutigen, kaum fassbaren sozialen Dimension nähern und kann man Respekt mit Anerkennung gleichsetzen?
Es gibt verschiedene Wege, sich dem Phänomen Respekt zu nähern. Eine Möglichkeit der Annäherung kann auf der präskriptiven Ebene in Form einer sozialphilosophischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen dem Ich und dem Du bzw. dem Ich und dem Wir und den damit verbundenen Phänomenen von Anerkennung bzw. Missachtung geschehen. Richtungsweisend ist hier das Werk von Axel Honneth (1992), welches eine der wesentlichen theoretischen Grundlagen dieser Arbeit darstellt.
Die zweite Möglichkeit des Zugangs besteht in der deskriptiven Annäherung durch die Betrachtung verschiedener soziologischer, psychologischer bzw. biographischer Aspekte, die mit Respekt bzw. Anerkennung in Verbindung stehen. Hierin stehen konkrete gesellschaftliche Prozesse und Erfahrungen, welche auf empirischen Daten oder Fakten basieren, im Vordergrund. Diese zwei Herangehensweisen bieten sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen Respekt. Dennoch möchte ich im Folgenden versuchen, sie zu verknüpfen, da ich der Ansicht bin, dass die eine Sichtweise nicht ohne die andere auskommt. Eine Theorie oder ein gesellschaftliches Konstrukt, welches aus einer gedanklichen Auseinandersetzung heraus entwickelt wurde, sucht seine Entsprechung in der Praxis.
Doch zuerst möchte ich das Wort Respekt in seiner etymologischen Bedeutung untersuchen. Aus etymologischer Sicht (vgl. Matschiner 1998, 525) findet man eine französische und eine lateinische Wurzel (frz.: réspect bedeutet soviel wie Achtung, Hochachtung, und die lateinische Bedeutung mit respectare trägt die Bedeutung von Rückblick, Rücksicht). Betrachtet man diese beiden etymologischen Herleitungen näher, so fällt auf, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Bedeutungszugänge handelt. Achtung bzw. Hochachtung beinhaltet stärker eine Art Ehrerbietung, im Sinne von Achtung vor einer höheren Autorität. Dies beschreibt mehr die einseitige Form der Achtung, insofern dass etwas oder jemand geachtet wird, weil er, sie oder es größer, stärker oder mächtiger ist als man selbst. In diesem Zusammenhang ist hier eher das Verständnis im Sinne von einseitigem Respekt gemeint. Einen anderen Bedeutungszusammenhang liefert die lateinische Wortwurzel. Der "Rückblick" oder die "Rücksicht" kann zweierlei bzw. sogar dreierlei Richtungen zeigen: Den Blick auf den anderen oder den Blick auf sich selbst bzw. den Blick auf sich selbst durch den Spiegel des anderen. Bezeichnend für diese Blickrichtung ist, dass der Blick nicht nach oben gerichtet ist, sondern zurück, d.h. auf den Menschen, der mir gegenüber steht, sich mit mir auf einer Ebene befindet.
So trägt das Wort Respekt zwei Aspekte in sich. Einmal einen einseitig ausgerichteten, im Sinne von jemanden achten, weil er mächtiger ist oder bestimmte herausragende Eigenschaften besitzt, die es zu achten gilt. Der andere Aspekt beschreibt mehr die wechselseitige Form von Respekt, welche über die Achtung hinausgeht, da sie das Rücksichtnehmen auf jemanden beschreibt, welches nicht nur auf dessen Macht oder Größe, herausragenden Eigenschaften oder Fähigkeiten beruht. Um diese Form des Respekts soll es im Folgenden gehen. In der Literatur (Honneth 1992; Prengel 1993, 2005; Dederich 2001) wird, bezogen auf diese Bedeutungsdimension, der Begriff "Anerkennung" verwendet, welcher durch den Aspekt der Gegenseitigkeit mit dem Wort Respekt in der lateinischen Wortbedeutung gleichzusetzen ist. Daher werde ich im Folgenden beide Begriffe synonym verwenden, vor dem Hintergrund, dass Respekt den Aspekt der Gegenseitigkeit beinhaltet.
Folgende Arbeitsdefinition kristallisiert sich aus dem bisher Diskutierten heraus:
Respekt stellt eine Form der wechselseitigen Achtung dar, bei der beide Partner symmetrisch miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig in ihrem Sosein anerkennen (vgl. Honneth 1992, Sennett 2004).
Hartkemeyer und Dhority (2001) gehen sogar noch einen Schritt weiter: "Diese Anerkennung des anderen kann so weit führen, dass wir uns vorstellen können, wir würden genau so denken und handeln wie er - wenn wir genau sein Leben hätten leben müssen, sein Schicksal erfahren hätten" (S. 79). Damit postulieren sie eine Haltung der Offenheit und der "aktiven Toleranz" (ebd.), welche eine der von ihnen beschriebenen Kernfähigkeiten des Dialogs bildet. Im Dialog werden alle Vorurteile abgelegt und versucht, dem anderen mit Offenheit und Verständnis zu begegnen. Diese sehr reine und intensive Form des respektvollen Austauschs bedarf allerdings einer grundlegenden Offenheit für den Anderen in seinem Sosein. Vor allem im Hinblick auf schulische Umgangsformen bedeutet dies, sowohl die Gleichheit als auch die Verschiedenheit des Anderen anzuerkennen (vgl. Prengel 2005, 16).
Anerkennung kann auch als Abenteuer betrachtet werden, da nicht gewiss ist, welche Wirkungen unser Handeln auf andere Menschen hat (vgl. Prengel 2005, 16 in Anlehnung an Todorov), oder welche Gefühle mit der Anerkennung des anderen ausgelöst werden. Hartmut von Hentig (in Kahl 2004) vertritt eine ähnliche Ansicht, in dem er betont, dass die Ungewissheit zur Grundstruktur des Lebens gehören sollte, um wach und offen für neue Impulse zu bleiben. Dies entspricht auch der von Hartkemeyer und Dhority (2001, 78) postulierten ersten Kernfähigkeit des Dialogs, bei der die "Haltung eines Lerners" eingenommen werden soll.
Wenn wir einen Menschen z.B. negativ bewerten, weil er einen Fehler gemacht hat und diesen Menschen fortan nur als fehlerbehaftetes Wesen betrachten, dann nehmen wir nur noch diese eine Seite der Unvollkommenheit an ihm wahr. Wenn wir aber offen sind für neue fruchtbringende Impulse des anderen, können wir eher über seine Fehler und Schwächen hinwegsehen und ihn in seiner Ganzheit verstehen lernen.
Fazit ist, dass Respekt sich uns in sehr unterschiedlichen Facetten und Dimensionen zeigt, d.h. ein sehr vielschichtiges Gefüge von Werten, Emotionen und normativen Vorstellungen darstellt. So lässt sich Respekt nicht als eine feste Größe oder statische Qualität betrachten, sondern "erweist sich als sozial und psychologisch komplex" (Sennett 2004, 79). In meinen Augen beschreibt Anerkennung einen wechselseitigen Erkenntnisprozess, an dem beide Partner wachsen können.
Honneth (1992) unterscheidet in diesem Zusammenhang drei Dimensionen von Anerkennung, die ein Pendant in drei Formen der Missachtung finden, welche ich im Folgenden darstellen möchte. Ich habe Honneths Konstrukt als theoretische Grundlage meiner Arbeit gewählt, da es einerseits eine klare Strukturierung und Orientierung aufweist, andererseits aber offen lässt, inwiefern diese theoretisch gewonnenen Dimensionen auf das System Schule übertragbar sind. Dies erzeugte eine kreative Spannung in mir.
Honneth (1992) arbeitet in seinem sozial- und geschichtsphilosophischen Werk "Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte" in Anlehnung an Hegel und Mead drei verschiedene, aber dennoch miteinander verbundene Formen intersubjektiver Anerkennung heraus, die die Grundlage für den Aufbau wechselseitigen Respekts darstellen sollen. Den Ausgangspunkt der von Honneth entworfenen Gesellschaftstheorie bilden drei Anerkennungsdimensionen:
-
emotionale Zuwendung
-
rechtliche Anerkennung
-
solidarische Zustimmung
Jede dieser Anerkennungsformen entspricht einer Form der Selbstachtung. Honneth (1992) geht davon aus, dass die Form der Gewährung einer Art der Anerkennung einer Form der Selbstachtung zugeordnet ist, dessen Grad sich "in der Abfolge der drei Anerkennungsformen (...) schrittweise steigert" (ebd.,151). "Mit jeder Stufe der wechselseitigen Achtung (wächst - K.F.) auch die subjektive Autonomie des Einzelnen" (ebd.).
a) Emotionale Zuwendung
Diese beschreibt die elementarste Form der Anerkennung, welche durch die Wahrnehmung und Beachtung der individuellen Bedürfnisse des Anderen entsteht. Honneth (1992, 153) spricht hier von der "Liebe", welche er in einen relativierenden Kontext einbindet, indem er angibt: "Unter Liebesverhältnissen sollen hier alle Primärbeziehungen verstanden werden, soweit sie nach dem Muster von erotischen Zweierbeziehungen, Freundschaften und Eltern-Kind-Beziehungen aus starken Gefühlbindungen zwischen wenigen Personen bestehen" (ebd.).
Die Liebe bildet die erste Stufe der wechselseitigen Anerkennung und beschreibt eine starke emotionale Bindung, welche auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen entsteht. Einerseits entsteht diese Verbindung als primäre Beziehung zwischen Eltern und Kind, welche von ihrer Grundstruktur eine asymmetrische Form der Bindung darstellt, da das Kind abhängig von der Zuneigung der Eltern ist und deren Fürsorge bedarf. Von der anderen Seite her betrachtet, sind die Eltern dafür verantwortlich, dass das Kind sich geborgen und sicher fühlt und seine Bedürfnisse nach körperlicher Versorgung und emotionaler Zuwendung geachtet werden. Dies bildet die Grundlage für den Aufbau einer positiven Beziehung des Kindes zu sich selbst. Am Anfang einer solchen Primärbeziehung steht die Symbiose - die Verschmelzung und die "undifferenzierte Intersubjektivität" (ebd., 158). Erst später beginnt das Kind seine eigene Identität auszubilden und wird somit schrittweise zum unabhängigen Subjekt (vgl. ebd., 159). Die Herausforderung bezüglich dieser stark individuellen Form der Anerkennung besteht in der Spannung, die beim Ablösungsprozess des Kindes von den Eltern und umgekehrt entsteht. Es kann in diesem Zusammenhang dazu führen, dass die Mutter der Spannung nachgibt und das Kind, obwohl es bereits Schritte zur Selbstständigkeit gegangen ist, weiterhin in dem Maße umsorgt und vor äußeren Einflüssen schützt, wie sie es anfänglich getan hat. Dies kann beispielsweise durch das Erscheinungsbild einer Behinderung verstärkt werden, wodurch die Mutter für längere Zeit als bei einem nichtbehinderten Kind von dessen Bedürftigkeit ausgeht. Es ist aber immer aus dem situativen und individuellen Kontext heraus zu betrachten und zu entscheiden, inwiefern das Kind fähig ist eigene Schritte ins Leben zu gehen. Denn dieses "Fürsorgeprinzip", wie es bspw. Dederich (2001, 211) beschreibt, ist zwar gesamtgesellschaftlich gesehen als durchaus sinnvoll anzusehen, aber bezogen auf die Situation der/des Einzelnen immer im Hinblick auf dessen individuelle Voraussetzungen zu betrachten. Eine fürsorgliche Haltung, welche mit der Übernahme von Verantwortung korreliert, birgt die Gefahr in sich, dass Eltern und Kind eine sehr lange Zeit im Stadium der Symbiose verharren und die Persönlichkeiten beider Seiten dadurch einer sehr starken wechselseitigen Abhängigkeit unterliegen, die der Entwicklung einer eigenständigen Identität des Kindes im Wege stehen. Die Erfahrung der Eigenständigkeit und der Zuwachs von Vertrauen zum eigenen Fühlen, Denken und Handeln können dadurch maßgeblich beeinträchtigt werden.
Obwohl die enge positive emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind für die Ausbildung des Selbstvertrauens von zentraler Bedeutung ist (vgl. Bern in Dederich, 2001, 211), stellt der Abgrenzungsprozess eine wesentliche Voraussetzung für die spätere emotionale Eigenständigkeit dar (vgl. Honneth 1992, 161). Daher ist es wichtig, dass Eltern das Kind bei den Schritten in Richtung eines selbstständigen Lebens unterstützen und durch Anerkennung in dieser Entwicklung bestärken.
Eine weitere Form der emotionalen Zuwendung besteht in der symmetrischen Beziehung zwischen engen Freunden oder in Intimpartnerschaften. Hier handelt es sich im Unterschied zur Eltern-Kind-Beziehung vom Ansatz her um eine emotionale Bindung zwischen zwei Partnern, die sich auf einer Ebene befinden. Am Anfang einer solchen Beziehung, v.a. im Hinblick auf Partnerschaft, kommt es häufig auch zu einer Symbiose, aus dieser heraus die Partner sich ihrer selbst im anderen bewusst werden. Aber erst aus der Erfahrung der Trennung heraus kann eine "produktive Balance zwischen Abgrenzung und Entgrenzung entstehen" (Honneth 1992, 169), welche die Grundlage für eine gereifte Liebesbeziehung bildet. Diese kann unterschiedliche Gestalt annehmen, z.B. das Erlebnis eines intensiven selbstvergessenen Gesprächs in Freundschaften oder die sexuelle Vereinigung in erotischen Beziehungen (vgl. ebd.).
Somit stellt die emotionale Zuwendung die am stärksten durch wechselseitiges Vertrauen und das Gefühl von Nähe und emotionaler Sicherheit geprägte Form der Anerkennung dar.
b) Rechtliche Anerkennung
Die Form der rechtlichen Anerkennung steht in engem Zusammenhang mit Gleichberechtigung gesetzlicher Absicherung. Hierin sind wesentliche Voraussetzungen für die gesellschaftliche Anerkennung von Menschen als gleichberechtigte BürgerInnen gesetzt.
"Als Rechte haben wir zunächst [...] diejenigen individuellen Ansprüche begriffen, auf deren soziale Erfüllung eine Person legitimer Weise rechnen kann, weil sie als das vollwertige Mitglied eines Gemeinwesens an deren institutioneller Ordnung gleichberechtigt partizipiert" (Honneth 1992, 216).
Als Rechte sind sowohl elementare Rechte wie Menschenrechte, Freiheitsrechte bis hin zu Mitbestimmungsrechten gefasst. Honneth (1992, 186) geht von einer Dreiteilung von Rechten aus. Diese stellt zum einen den Schutz vor unbefugten Eingriffen in die persönliche Freiheit dar. Zum anderen beinhaltet sie die Möglichkeit der Teilnahme an Prozessen der öffentlichen Willensbildung. Und zum dritten umfasst sie die Teilhabe an der Verteilung von Grundgütern, wie z.B. der sozialen Grundsicherung.
Diese Form der Anerkennung steht in Verbindung mit dem ethischen Prinzip der Universalität von Rechten. Jedes Mitglied der Gesellschaft besitzt danach gleiche Rechte und kann an Entscheidungen partizipieren (vgl. Dederich 2001, 212). Die Anerkennung von Rechten bildet die Voraussetzung für moralische Achtung und Integrität. Wenn dies gewährleistet ist, kann auch die Voraussetzung für Selbstachtung geschaffen werden.
Allerdings fehlen bei dieser Form der Anerkennung wesentliche Aspekte, die die Individualität einer Person in den Blick nehmen bzw. die Achtung der Fähigkeiten einer Person betrachten. Daher genügt die Sicherung dieser Form der Anerkennung nicht, um eine Wertschätzung der Gesellschaftsmitglieder herbeizuführen. Dies leisten in erster Linie die erste und die dritte Form intersubjektiver Anerkennung. Dennoch ist es entscheidend für die Erhaltung der moralischen Wertstruktur einer Gesellschaft und damit der Integrität des Einzelnen, diese Form der Anerkennung zu gewährleisten. Vor allem im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Menschen ausländischer Herkunft sowie Menschen mit Beeinträchtigungen oder anderer Minoritäten ist die rechtliche Anerkennung von großer Bedeutung. Insbesondere §3 des Grundgesetzes, welcher den Schutz vor Diskriminierung postuliert, nimmt hier einen zentralen Stellenwert ein. Dennoch ist zu bedenken, dass solch ein Gesetz allein nicht bewirkt, dass es von allen Mitgliedern der Gesellschaft beachtet wird. Daher ist es entscheidend, diese universellen Rechte konkret in allen Instanzen und Institutionen der Gesellschaft einzuklagen und z.B. im schulischen Kontext auf allen Ebenen immer wieder von Neuem bewusst zu machen (vgl. Dederich 2001, 213).
c) solidarische Zustimmung
Solidarische Zustimmung beinhaltet die symmetrische Wertschätzung von Fähigkeiten des Einzelnen, die für die gesellschaftliche Entwicklung bzw. gesellschaftliche Gruppierungen relevant sind (vgl. Honneth, 1992, 203).
Zentral sind in diesem Zusammenhang die Begriffe der Ehre und des Prestiges eines Menschen zu sehen. Diese Begriffe werden von Honneth (1992) und Sennett (2004) jedoch kontrovers diskutiert:
Anerkennung und soziale Ehre entsprechen nach Sennett (2004, 73f.) mehr dem Charakter von Respekt. Honneth (1992, 203ff.) dagegen führt an, dass der Begriff der sozialen Ehre etwas veraltet ist. Heutzutage wird dieser durch den Begriff des sozialen Prestiges übersetzt, da wir nicht mehr in einer Ständegesellschaft leben, die sich über bestimmte Rangfolgen definiert. Vielmehr leben wir heute in einer Gesellschaft, die durch einen hohen Wertepluralismus geprägt ist. Allerdings gebraucht Sennett den Begriff der Ehre nicht in Zusammenhang mit Ständegesellschaft, sondern beschreibt einen "Verhaltenskodex" (ebd., 74), dessen Einhaltung zur Aufhebung sozialer Grenzen führen soll.
Dem Prinzip der Ehre steht die Würde des Menschen gegenüber, die unabhängig von jedem Ehrenkodex ist. Das Konzept beruht auf der Achtung vor der Integrität des Körpers (ebd., 76). Jefferson (in Sennett 2004, 76) führt in diesem Zusammenhang an: Die Achtung vor dem Schmerz verleiht dem Menschen eine Art "säkularisierte Würde, ähnlich wie die Achtung vor dem Göttlichen in traditionelleren Gesellschaften."
Den zweiten Aspekt bildet die Würde vor der Arbeit des Menschen. In Anlehnung an Max Weber nennt Sennett (2004, 77) den Begriff des "Sich Beweisens", das heißt der Beweis des eigenen Wertes durch die Arbeit. Dahinter steht das Konstrukt einer Arbeitsethik, die den Wert des Menschen an seiner geleisteten Arbeit bemisst. Hierin fehlen aber wichtige Elemente der Freude und des Genusses. Dieses Verständnis von Arbeitsethik passt nach Meinung Sennetts (2004, 77) dennoch in das soziale Gefüge, da es konkurrenzorientiert und wertvergleichend ausgerichtet ist.
Die Würde des Körpers unterscheidet sich somit von der Würde der Arbeit, wie sie in diesem Kontext beschrieben wurde: "Beides sind universelle Werte. Die Würde des Körpers ist allen gemeinsam, die Würde der Arbeit mögen nur wenige erlangen" (Sennett 2004, 78). Somit entsteht hier die Basis für ein Ungleichgewicht, da die Würde des Körpers gleichgeachtet, die Würde der Arbeit aber meist sehr subjektiv betrachtet wird und unterschiedlichen Wertmaßstäben unterliegt.
Voraussetzung für die Entstehung von respektvollen Verhältnissen untereinander bildet hingegen die Entdeckung der Gleichheit im Anderen. Die Umsetzung dieser Gleichheit gestaltet sich häufig als schwierig. "Hier entsteht oft eine Kluft zwischen dem Willen, andere gut zu behandeln und dem tatsächlichen Erfolg" (ebd.). In diesem Prozess spielt die Subjektivität eine entscheidende Rolle. Selbst wenn man sich Gebote wie "Du sollst andere respektieren!" (ebd., 79), zu eigen macht, spielen die eigenen Bedürfnisse, Sympathien und Wünsche, welche die eigenen Reaktionen beeinflussen, eine nicht zu unterschätzende Rolle im Prozess der Anerkennung.
Der ethische Aspekt des Kommunitarismus steht mit der solidarischen Zuwendung eng in Verbindung (vgl. Dederich 2001, 210). Hier steht die Gesellschaft mit bestimmten normativen Wertvorstellungen im Vordergrund. Die Fähigkeiten des Einzelnen sollen danach dem Gemeinwohl dienen. Dies bildet die Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Andererseits wird die Unfähigkeit, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln (z.B. durch eine Behinderung) mit Missachtung bzw. Ausgrenzung aus der Gesellschaft quittiert. Hierin liegt meines Erachtens eine entscheidende Wurzel für Prozesse der Stigmatisierung und Entwertung. Sennett (2004) betrachtet dies unter dem Aspekt der Ungleichheit als gesellschaftlichem Phänomen.
Ziel sollte es daher sein, den Anderen in seiner Einzigartigkeit auch im Hinblick auf seine Fähigkeiten zu betrachten und wertschätzen zu lernen und nicht nur mit Mitleid zu begegnen. Sennett (2004, 85) sieht in der Äußerung von Mitleid eine Form der Verachtung des Anderen, da diese seine Unfähigkeit dokumentiert.
Honneth (1992, 209f.) fasst den Aspekt der solidarischen Zustimmung folgendermaßen zusammen: "Sich in diesem Sinne symmetrisch wertschätzen heißt, sich reziprok im Lichte von Werten zu betrachten, die die Fähigkeiten und Eigenschaften des jeweils anderen als bedeutsam für die gemeinsame Praxis erscheinen lassen." Es steht hier also nicht nur die passive Form der Toleranz im Vordergrund, sondern die "affektive Anteilnahme an dem individuell Besonderen der anderen Person" (ebd.), sodass deren Eigenschaften und Fähigkeiten zur Entfaltung gelangen. Durch diese Form der Wertschätzung kann der Mensch auch zu einer positiven Beziehung zu sich selbst gelangen. Honneth (1992, 211) fasst dies unter den Begriff der "Selbstschätzung".
Fazit
Die Erfahrung aller drei Formen der Anerkennung bildet die Grundlage für autonomes Handeln. Erst wenn ein Mensch sowohl in seinen individuellen Bedürfnissen anerkannt, seine Rechte gewahrt werden und er in seinen Fähigkeiten und Eigenschaften wertgeschätzt wird, kann er sich entfalten und selbst verwirklichen. Erfährt sie/er diese Anerkennung nicht, kann dies zu Prozessen der Stagnation der Entwicklung bzw. zu Formen von Aggression und Gewalt führen (vgl. Kahl 2002, 42).
Den drei beschriebenen Formen der Anerkennung stehen drei entsprechende Formen der Missachtung gegenüber, welche aus der Sicht Honneths wesentlichen Einfluss auf die Identität desjenigen, der die Missachtung erfährt, haben.
a) Misshandlung, Vergewaltigung
Unter dem Aspekt der Misshandlung und Vergewaltigung fasst Honneth (1992, 214) alle Formen der körperlichen Demütigung (z.B. durch Folter) und der Bemächtigung des Leibes eines anderen (z.B. durch sexuellen Missbrauch). Das Gravierende an dieser Form der Missachtung ist, dass sie tiefer und einschneidender für den Menschen ist als jede andere Form der Missachtung. Dies liegt nicht nur darin begründet, dass einer Person Schmerzen zugefügt werden, sondern dass diese Erfahrung der Demütigung mit dem Gefühl verbunden ist, dem anderen schutzlos ausgeliefert zu sein. Diese Form der Missachtung tritt in den meisten Fällen zwischen einer körperlich überlegenen oder mächtigeren und einer unterlegenen, schwächeren Person auf. Dadurch handelt es sich hierbei um ein massives Ungleichgewicht der Kräfte, sodass eine eigenständige Lösung aus der Situation kaum möglich erscheint.
Diese Erfahrungen können in Abhängigkeit von Dauer und Intensität der Misshandlung für den geschädigten Mensch zur Folge haben, dass das Selbstvertrauen des Opfers stark verletzt und gefährdet bis dahin, dass das Vertrauen in die autonome Koordinierung des Körpers stark eingeschränkt wird (z.B. durch unwillkürliche Angstreaktionen oder traumatische Zustände) (vgl. ebd.). Der Sicherheitsverlust steht häufig in Verbindung mit dem Zusammenbruch des Vertrauens in die Zuverlässigkeit der sozialen Welt und damit der eigenen Selbstsicherheit. Dederich (2001, 211) nennt in diesem Zusammenhang weitere Formen der Missachtung, die keine aktive Gewalteinwirkung beinhalten, wie Isolation, emotionale Kälte und Gleichgültigkeit, wodurch das Selbstvertrauen ebenfalls gefährdet bzw. geschwächt werden kann. Diese erweiterten Formen körperlich erfahrbarer Demütigung treten oftmals in Institutionen wie Pflege- oder Behinderteneinrichtungen, häufig aber auch in Schulen auf. Meist handelt es sich hier um Einrichtungen mit einem stark hierarchischen Aufbau. Die Wirkung dieser Deprivation kann je nach Intensität u.U. gravierender sein als bei direkter körperlicher Misshandlung. Denn diese Formen der Missachtung dauert meist über einen längeren Zeitraum an. Durch die statische Struktur vieler Institutionen stellen diese Phänomene der Vernachlässigung und Isolierung häufig einen dauerhaften Zustand dar, der langfristig schädigend auf die Persönlichkeit der Betroffenen wirken kann. Hauptursache für diese Umstände stellen die strukturellen menschenunwürdigen Bedingungen vieler Einrichtungen dar, aber auch die degradierende Sichtweise der MitarbeiterInnen dieser Institutionen auf die Betroffenen (vgl. Fliegel 2000). Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der seelische Rückzug zu betrachten, der bis zur Unfähigkeit führen kann, sich selbst als liebenswertes Wesen zu betrachten. Der seelische Rückzug oder die Introversion kann auch in Verbindung mit Autoaggression stehen, durch die ein Ventil für den Hass auf die demütigende Person geschaffen wird, in dem sich die betroffene Person selbst Schaden zufügt.
b) Entrechtung und Ausschließung
Die Entrechtung und Ausschließung beinhaltet die Aberkennung des Status als vollwertigen Mitglied der Gesellschaft. Dies geschieht durch den Entzug elementarer Rechte (z.B. Bürgerrechte wie Mitbestimmung oder moralische Zurechnungsfähigkeit). Damit wird nicht nur die Autonomie dieses Menschen eingeschränkt, sondern in diesem Zusammenhang steht das Gefühl als nicht vollwertige/r moralisch gleichberechtigte/r InteraktionspartnerIn zu gelten.
"So wurde häufig beschrieben, dass Entrechtung und soziale Ausschließung psychisch lähmend wirken und soziale Scham erzeugen, dass aus fehlender Achtung durch andere ein Mangel an Selbstachtung entstehen kann" (Dederich 2001, 214).
Dadurch wird in starkem Maße die soziale Integrität des Einzelnen eingeschränkt, da er sich nicht als rechtlich gleichwertig anerkannt fühlt.
c) Entwürdigung, Beleidigung
In diesem Zusammenhang fasst Honneth die gesellschaftliche Herabstufung bestimmter Verhaltensweisen, Einstellungen, Lebensformen und Überzeugungen. Dies steht in Verbindung mit einer "entwertenden Verweigerung an sozialer Zustimmung" (Dederich 2001, 216).
Damit wird dem Subjekt die Möglichkeit genommen seinen Fähigkeiten einen sozialen Wert beizumessen, wodurch ein Verlust an persönlicher Selbstschätzung entstehen kann. Die/der Betroffene empfindet sich den anderen gegenüber unterlegen und wird dadurch in seiner Selbstverwirklichung gehemmt.
Es ist dennoch anzumerken, dass es sehr stark von der Deutung und dem individuellen Erfahrungszusammenhang abhängt, inwiefern eine Person sich von der Bewertung anderer beeinflussen lässt und fähig ist, eigene Quellen und Strategien der Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls zu finden (z.B. die Fähigkeit sich in einem Hobby, wie dem Spielen eines Instruments zu verwirklichen) und darin aufzugehen. Es hängt häufig auch davon ab, inwiefern ein Wert kollektiv verankert ist und das Individuum abhängig ist von der positiven Bewertung durch eine bestimmte Gruppe von Menschen bzw. welche Priorität bestimmte Werte oder Personengruppen für das Individuum besitzen (s. Kap. 4.3.3.2). Sennett (2004) führt in diesem Zusammenhang drei Gebote an, die in diesem Zusammenhang zu Ungleichheit und damit zu einer Knappheit von Respekt führen (S. 315):
Mach etwas aus dir!
Sorge für dich selbst!
Hilf anderen!
Hier entsteht das Bild eines autonomen und erfolgreichen Menschen, der darüber hinaus soziales Engagement zeigt. Wer diesem Bild nicht entsprechen kann, wird von der Gesellschaft nicht als gleichwertig betrachtet und somit auch nicht mit der Wertschätzung versehen wie Menschen, die diese Werte verwirklichen können.
Sennett zieht daraus den Schluss: "Wenn wir die praktischen Leistungen würdigten, statt potentielle Talente zu bevorzugen, wenn wir die berechtigten Anforderungen einer Abhängigkeit im Erwachsenalter akzeptierten und den Menschen eine aktivere Teilhabe an den Bedingungen der ihnen gewährten Hilfe ermöglichten" (ebd.), würde dies zu einem Zuwachs an gegenseitigem Respekt führen. Das bedeutet, dass unter Gewährung einer größeren Handlungsfreiheit bzw. der Akzeptanz bestimmter Abhängigkeiten der Respekt zwischen den Menschen wachsen könnte. Damit würde eine höhere Achtung und Förderung der individuellen Fähigkeiten des Einzelnen ohne zwanghafte Einhaltung dieser Gebote einhergehen. Außerdem könnte ein stärkerer Fokus auf die emotionalen Werte eines Menschen zur Bereicherung des sozialen Miteinanders beitragen.
Abschließend ist zu sagen, dass die von Honneth (1992) entworfenen Dimensionen der Anerkennung eine wichtige und logisch sowie sozial- und geschichtsphilosophisch wohl durchdachte theoretische Grundlage darstellen. Dennoch ist anzuführen, dass in der Realität die einzelnen Dimensionen nicht immer in der dargestellten analytischen Trennschärfe existieren. Hier wird deutlich, dass es sich bei dem von Honneth entworfenen Gesellschaftsmodell um ein philosophisch eruiertes und nicht ein empirisch gewonnenes Konstrukt handelt. Gerade im Hinblick auf den letzten Punkt der solidarischen Zustimmung entfalten sich zahlreiche Facetten, die auch auf der emotionalen Ebene zum Tragen kommen. Honneth (1992) gibt in diesem Zusammenhang selbst an: "In der Bewährung am Material empirischer Untersuchungen wird sich dann zeigen müssen, ob sich die drei Beziehungsmuster tatsächlich so voneinander unterscheiden lassen, dass sie im Hinblick auf das Medium der Anerkennung, die Art der ermöglichten Selbstbeziehung und das moralische Entwicklungspotential eigenständige Typen bilden" (ebd., 152f.). Es hat sich im Laufe der Entstehung dieser Arbeit herausgestellt, dass die drei von Honneth (1992) erarbeiteten Anerkennungs- und Missachtungsdimensionen als analytische Vorlage dienen, aber aufgrund der komplexen und speziellen Fragestellung (mit dem Fokus auf schulisches Miteinander) adaptiert und erweitert werden mussten (s. Kap. 3.3.2). Folgende Überlegungen tragen zur weiteren Klärung dieses Widerspruches bei.
Wenn man versucht, die von Honneth (1992) erarbeiteten Dimensionen von Anerkennung bzw. Missachtung auf Schule zu übertragen, stehen zwei wesentliche Fragen im Vordergrund. Zum einen stellt sich die Frage, ob sich allgemeine gesellschaftliche Prozesse auf Schule als "Gesellschaft im Kleinen" übertragen lassen und zum anderen, ob diese Dimensionen, wie sie von Honneth entworfen wurden, für Schule als Kategorien der Analyse des schulischen Zusammenlebens zu operationalisieren sind.
Krüger und Helsper (2003) haben dies bereits in ihrem Forschungsprojekt, in welchem rechte politische Orientierungen bei SchülerInnen im Rahmen schulischer Anerkennungsbeziehungen untersucht wurden. Ich habe geprüft, inwiefern diese empirisch gewonnen Kategorien im Hinblick auf meine Fragestellung stimmig sind und habe im Anschluss an deren Analyse einige dieser Kategorien übernommen, da sie mir für den schulischen Rahmen geeigneter erschienen als die von Honneth (1992) gewonnenen Kategorien. Die einzelnen Kategorien werden im folgenden Kapitel zur methodischen Herangehensweise (v.a. 3.2) näher erläutert.
In der Schule finden sich potentielle Anerkennungsverhältnisse auf unterschiedlichen Systemebenen. Dies macht Schule mit Gesellschaft im Allgemeinen vergleichbar. Der Unterschied besteht darin, dass Schule einen ganz bestimmten Auftrag, den Bildungsauftrag innehat, während in der Gesellschaft der Bildungs- und Erziehungsauftrag nur einer von vielen Aufträgen darstellt.
So finden sich Anerkennungsverhältnisse zum einen als Bindeglied zwischen verschiedenen Ebenen, z.B. in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Zum anderen manifestieren sie sich zwischen Vertretern einer Ebene, z.B. Lehrer-Lehrer oder Schüler-Schüler-Beziehung. Die Qualität schulischer Anerkennungsverhältnisse stellt einen Indikator für das Klima an Schulen dar. Bisher sind wenige Studien veröffentlicht worden, die sich explizit mit Anerkennungsverhältnissen an Schulen auseinandersetzen. Dagegen sind zu Jugend und Gewalt seit Anfang der neunziger Jahre zahlreiche Studien erschienen (z.B. Heitmeyer u.a. 1995). Nur wenige Studien beziehen den schulischen Kontext in ihre Betrachtung mit ein (vgl. Krüger/Helsper 2003). Dennoch finden sich einige Anhaltspunkte, v.a. in Studien zur Gewaltprävention an Schulen (z.B. Knopf u.a. 1996; Olweus 1992; s. Kap. 4.5.5).
Das Gelingen schulischer Anerkennungsverhältnisse hängt von verschiedenen Systemebenen und deren Akteuren ab (vgl. Prengel 2005, 17; in Anlehnung an Bertram, Helsper, Idel 2000):
-
zwischen Schulleitung und Lehrerschaft,
-
innerhalb des Kollegiums
-
zwischen Angehörigen verschiedener Berufe, wie LehrerInnen, SonderpädagogInnen, ErzieherInnen, Schulaufsicht
-
zwischen Lehrkräften und SchülerInnen
-
zwischen den SchülerInnen innerhalb der Peer-Group
Eine weitere Ebene bildet die übergeordnete Dimension des Schulprogramms. Hier werden zentrale Ziele festgelegt, die durch die Schule vertreten werden sollen. Diese bilden die theoretische bzw. ethisch-moralische Grundlage für das schulische Miteinander. Für die Umsetzung dieser Vorgaben und Handlungsziele spielt die Struktur der Schule eine zentrale Rolle. Es stellt sich die Frage: Ist die Schule weitgehend hierarchisch-administrativ strukturiert mit starker Einschränkung der Partizipation von SchülerInnen oder bieten die schulischen Grundstrukturen eine mehr pluralistisch-demokratische Ausrichtung, in der ein hohes Maß an Mitbestimmung der einzelnen Ebenen gewährleistet ist? Über die oben genannten Ebenen hinaus ist die Dimension des Unterrichts von entscheidender Bedeutung für den gegenseitigen Umgang v.a. zwischen SchülerInnen und LehrerInnen bzw. der SchülerInnen untereinander (vgl. Prengel 2005, 17f.). Hier spielen sowohl Methoden des Unterrichts als auch die ausgewählten Inhalte eine wesentliche Rolle in Bezug auf die Ausbildung von Anerkennungsverhältnissen unter SchülerInnen als auch zwischen SchülerInnen und LehrerInnen.
Ich werde in dieser Arbeit v.a. die Ebene der Anerkennung der SchülerInnen untereinander fokussieren. Dabei ist im Hinblick auf den Kontext Schule die Ganzheit des Anerkennungsgefüges, v.a. in Hinblick auf die Lehrer-Schüler-Interaktion in den Blick zu nehmen. Das Verhalten der Lehrerin, des Lehrers den SchülerInnen gegenüber kann in diesem Zusammenhang hemmend oder fördernd auf die Anerkennung unter SchülerInnen wirken (vgl. z.B. Knopf u.a. 1996). Auf der anderen Seite besitzt das Verhalten der Lehrerin, des Lehrers Modellcharakter für das Verhalten von SchülerInnen. Gerade bei der Betrachtung heterogener Lerngruppen kristallisiert sich ein sehr vielfältiges Bild von gegenseitigen Anerkennungs- aber auch Missachtungsphänomenen, welche v.a. in Punkt 4.6 und konkret auf eine Klasse bezogen in Kap. 5.7 betrachtet werden sollen.
Schlussfolgerung
Dieses Kapitel, welches sich mit dem Begriff Respekt, dessen Dimensionen in Gesellschaft und Schule und damit zusammenhängenden Phänomenen und Fragen befasste, bildet den Ausgangspunkt und die theoretische Basis der vorliegenden Arbeit. Als Ergebnis dieser ersten und grundlegenden Überlegungen sehe ich zum einen die Heraushebung des Wertes Respekt als Grundlage persönlichen und sozialen Wachstums. Zum anderen bildet Respekt als Form der wechselseitigen Anerkennung und Wertschätzung einen Maßstab für das Gelingen gesellschaftlichen und damit auch schulischen Miteinanders. Dieser bildet den Ausgangspunkt für die Diskussion um Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen und zentrale Fragen von Bildung. Als besonders relevant bezüglich der Fragestellung dieser Arbeit zeigt sich die Auseinandersetzung mit Anerkennungsverhältnissen in heterogenen Lerngruppen v.a. im Hinblick auf die Entwicklung hin zu einer inklusiven Pädagogik. Hier kann Respekt als Wert und Maßstab ebenfalls als Schlüsselbegriff gesehen werden (vgl. Kap. 5). Das menschliche Bedürfnis nach Anerkennung kann als "Triebfeder" gesellschaftlichen und schulischen Bestrebens nach einem konstruktiven und vertrauensvollen Miteinander gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
Bei meinen Ausführungen zur Methode der Gruppengruppendiskussion habe ich mich stark an den sehr ausführlichen und umfangreichen Ausführungen von Petra Gehrmann (2001, 143ff.) orientiert, die in ihrer Studie zu Demokratie und Humanität im Gemeinsamen Unterricht auf der Basis von Gruppendiskussionen geforscht hat und in diesem Zusammenhang sehr detailliert sowohl die Hintergründe als auch die Umsetzung dieser Methode beschreibt.
Die Methode der Gruppendiskussion, welche eine Methode qualitativer Sozialforschung darstellt, wurde um die Jahrhundertwende in den USA aus der experimentellen Gruppenforschung entwickelt. Am Anfang der Entwicklung stand die Untersuchung von Gruppen fremder Völker und Kulturen, "deren ‚Andersartigkeit' dann mit Hilfe von umfangreichen Forschungen beschrieben werden konnte" (Gehrmann 2001, 143).
In Deutschland begannen die ersten Untersuchungen zu Gruppen in den 30er Jahren. Die Entwicklung der Gruppendiskussion als Methode empirischer Sozialforschung im deutschsprachigen Raum wurde durch das Frankfurter Institut für Sozialforschung, welches in den 50er Jahren wieder neu aufgebaut wurde, fortgesetzt.
In den 70er und 80er Jahren, in denen eine sehr intensive Auseinandersetzung mit qualitativen Forschungsmethoden stattfand, fanden zwar Gruppendiskussionen im Rahmen soziologischer, psychologischer und pädagogischer Forschung statt, aber eher vereinzelt (vgl. Gehrmann, 2001, 149).
"Eine weite Verbreitung haben Gruppendiskussionen im Bereich der kommerziellen Markt- und Meinungsforschung, besonders bei Industrieunternehmen gefunden" (ebd., 150). In diesem Zusammenhang stellt v.a. die Effektivität der Methode im Hinblick auf Zeit- und Kapitalinvestition eine geeignete Variante dar, an umfangreiches Datenmaterial zu gelangen.
Weitere Anwendung findet das Verfahren in der Milieuforschung. Bohnsack (1997, 492) führt dazu aus: "Milieutypische Orientierungen und Erfahrungen können in valider, d.h. gültiger Weise nicht auf der Grundlage von Einzelinterviews, also in individueller Isolierung der Erforschten erhoben und ausgewertet werden." Hier steht der gemeinsame Erfahrungsbezug im Vordergrund.
Prozentual gesehen kommt dem Verfahren im sozialwissenschaftlichen Forschungs-zusammenhang nur eine geringe Bedeutung zu und scheint nach den Aussagen von Gehrmann (2001, 151) in Berufung auf Diekmann (1995) und Lamnek (1993) auf dem Stand der Ausführungen von Mangold in den 70er Jahren stehen geblieben zu sein. Gründe für diese Entwicklung könnten einerseits im Mangel an der Erfüllung von Gütekriterien (wie Validität, Reliabilität, Objektivität etc.) liegen. Andererseits könnte auch die Bandbreite der sehr unterschiedlichen Begrifflichkeiten (Gruppengespräch, Gruppenexperiment, Diskussionsrunde etc.) zu diesem Ergebnis führen, da es keine klare und eindeutige Definition gibt und so ein hohes Potential an Unsicherheit bezüglich des Einsatzes der Methode unter Beachtung der Gütekriterien entsteht.
Trotz der begrifflichen Verwirrung kristallisiert sich im Hinblick auf das Gruppendiskussionsverfahren ein "Minimalkonsens" (Gehrmann, 2001, 151) heraus. Das Untersuchungsobjekt stellen Gruppen dar und es handelt sich bei der Befragung um eine Form des Interviews. Aus der gemeinsamen Bezeichnung "Gruppe/Gruppen" wird deutlich, dass hier mindestens zwei Personen gleichzeitig befragt werden.
"In einer Gruppendiskussion erörtern die Beteiligten Erfahrungen, Ansichten und Argumente, wobei das Thema der Diskussion dem Interesse von ForscherInnen entspricht" (Heinzel, 2000, 118). Lamnek (in ebd.) definiert Gruppendiskussion als "Gespräch einer Gruppe zu einem bestimmten Thema unter ‚Labor'-Bedingungen." Diese Labor-Bedingungen können in unterschiedlichem Maße von der jeweiligen Forscherin oder dem Forscher vorstrukturiert sein.
Heutzutage stellt der Begriff der Gruppendiskussion einen Sammelbegriff für mehrere Verfahren zur qualitativen Erhebung von Datenmaterial durch die Zusammenarbeit mit Gruppen dar. Heinzel (2000, 118) unterscheidet in Anlehnung an Lamnek ermittelnde und vermittelnde Gruppendiskussionen. Erstere fokussieren die Untersuchung von Meinungen und Einstellungen innerhalb einer Gruppe, während letztere stärker Gruppenprozesse und dadurch bedingte Veränderungen einzelner Subjekte in den Blick nehmen.
Ermittelnde Gruppendiskussionsverfahren sind für die Sozialforschung von wesentlich größerer Bedeutung als vermittelnde (vgl. ebd.).
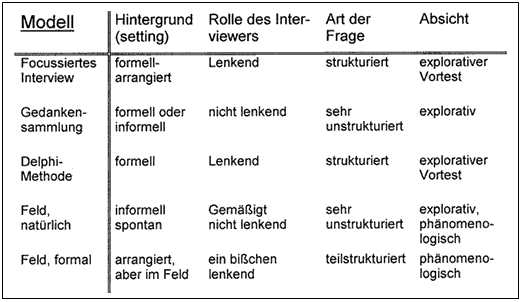
Abb. 1: Gruppendiskussionsmodelle und Forschungsdimensionen Quelle: Gehrmann (2001, 154) in Anlehnung an Denzin und Lincoln (1992)
Das von mir verwendete Verfahren der Gruppendiskussion habe ich an das von Gehrmann (2001, 154) übersetzte Schema Abb.1 angelehnt. Sie orientierte sich dabei an Denzin und Lincoln (1992). Bei den von mir durchgeführten Gruppendiskussionen handelt es sich ebenfalls um das von den beiden Forschern letztgenannte Modell des Typs "formale Feldforschung". Das bedeutet, dass das Setting arrangiert, aber das Diskussionsverfahren dennoch im Feld, hier direkt in einem Raum der Schule stattfindet. Dieser Raum ist den SchülerInnen zwar nicht vertraut, dennoch befinden sich hier Rechner, Tische und Stühle, deren Anblick den SchülerInnen nicht unbekannt oder unnatürlich erscheint. Außerdem sitzen sie in ähnlicher Konstellation auch in ihrer Tischgruppe zusammen, was eine weitere Voraussetzung für Offenheit und Vertrautheit untereinander darstellt. Die Fragen sind teilweise strukturiert, teilweise impulsartig aufgebaut, da ich den SchülerInnen Gelegenheit geben wollte, die Gespräche frei zu entfalten. Durch dieses Verfahren sollen Phänomene herausgearbeitet werden, die im Zusammenhang mit dem gegenseitigem Umgang in der Klasse sowie in Hinblick auf Gruppenbildung über die Klassengrenzen hinaus bedeutungsvoll erscheinen.
Die detaillierte Beschreibung des Verfahrens erfolgt ab Kap. 3.2.3 dieser Arbeit.
Die Diskussion kann entweder mit einer "natürlichen" Gruppe, die untereinander einen großen Bekanntheitsgrad aufweist, oder mit einer "künstlichen" Gruppe, die eine rein zu Forschungszwecken zusammengesetzte Konstellation von Mitgliedern darstellt, durchgeführt werden (vgl. Heinzel 2000, 118).
Eine der Gruppe nicht angehörende Moderatorin oder ein Moderator leitet die Diskussion. Die Intensität der Lenkung dabei ist sowohl abhängig vom Untersuchungsgegenstand als auch von der Zusammensetzung der Gruppe (Alter, Erfahrenheit in Gruppendiskussionen etc.). In diesem Fall war ich selbst Leiterin der Diskussionen.
Hier steht insbesondere die "Reproduzierbarkeit der Ergebnisse" (Bohnsack 1997, 496) im Vordergrund. Es wurden daraufhin Möglichkeiten geschaffen, "dass die Struktur des Falles sich in der für ihn typischen Eigengesetzlichkeit zu entfalten vermag" (ebd.). So basiert die Validität von Gruppendiskussionen nicht auf - wie in der Naturwissenschaft angewendeten standardisierten Verfahren, sondern auf "rekonstruktiven Verfahren" (ebd.), welche wiederum "'Standards' alltäglicher Kommunikation" (ebd.) zur Grundlage haben. Bei offenen Verfahren wird seitens der Forscherin, des Forschers weitgehend auf eine Standardisierung verzichtet. Hier steht die "Strukturierung durch die Erforschten selbst auf dem Wege von Prozessstrukturen" (ebd.) im Vordergrund, welche aber nach Meinung des Autors "nicht systematisch Rechnung" getragen werden kann. Daher habe ich die Diskussionen nach einem bestimmten Schema vorstrukturiert, aber dennoch Freiräume zur Entfaltung des Gesprächs offen gelassen.
Im Folgenden sollen Chancen und Probleme für diese Form der qualitativen Datenerhebung angeführt werden. Dabei stütze ich mich hauptsächlich auf die Ausführungen von Heinzel (2000, 119ff.) und adaptiere ihre Aussagen zu Gruppendiskussionsverfahren mit Kindern auf Jugendliche, da sich hier zahlreiche Parallelen ergeben.
Chancen dieser Methode liegen v.a. in der gemeinsamen Erfahrung, die Jugendliche in Gruppendiskussionen wiedergeben und welche positiv auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe wirken. Nach Heinzel (2000, 120) handelt es sich hierbei um "Gespräche als Dokumente kollektiver Erfahrungen", die für die Jugendlichen prägend in Hinblick auf das eigene Erleben in Zusammenhang mit dem Erleben der anderen Gruppenteilnehmer sein können.
Im Gegensatz zur Einzelbefragung können sich die Jugendlichen bei dieser Methode durch gegenseitige Impulse zu neuen Gedankengängen anregen und somit zu einer Vielfalt in den Aussagen führen.
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen "lassen darüber hinaus Einsichten in die Struktur und Prozesse individueller und kollektiver Stellungsnahmen zu und eröffnen einen Zugang zu latenten und unbewussten Sinnstrukturen" (ebd.). So erhält die Forscherin, der Forscher Einblick in die Art und Weise der Wahrnehmung der Umwelt sowie ein Bild von der Art der Erfassung der Wirklichkeit.
Das Gefühl, Zugehörigkeit und Bestätigung zu erfahren, spielt insbesondere bei Jugendlichen in Gruppendiskussionen eine zentrale Rolle, was durch die Verwendung anderer Interviewtechniken in Einzelbefragungssituationen in dem Maße nicht zum Tragen käme.
Durch die Bestätigung der eigenen Aussage werden Jugendliche ermutigt, sich stärker in die Situation einzubringen, bzw. die Scheu zu verlieren, sich in dieser "gestellten" Situation zu äußern.
Aus meiner eigenen Erfahrung in der Diskussion mit den Jugendlichen hat es sich als entkrampfend erwiesen, dass keine Lehrperson bei dem Verfahren anwesend war. Dies führte meines Erachtens zu einer stärkeren Öffnung der SchülerInnen.
Probleme bzw. Risiken der Methode können sich durch Hemmungen bei den SchülerInnen aufgrund der öffentlichen Gruppensituation ergeben, welche sich durch Scham oder geringes Vertrauen in die Wichtigkeit der eigenen Aussage äußern können. Daher sollten "natürliche" Gruppen bevorzugt werden, sodass ein hohes Maß an Vertrautheit vorausgesetzt werden kann.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass sich im Laufe der Gruppendiskussion Meinungsführer bilden, die die Argumentation wesentlich dominieren. Dadurch könnten andere SchülerInnen, die nicht in diesem Maße dominant auftreten, in den Hintergrund geraten bzw. sich der Meinung der Vorredner unreflektiert anschließen. In Gruppendiskussionen kommt es so häufig zu Anpassungsmechanismen, die die individuelle Meinungsäußerung einschränken können. So könnte ein verzerrtes Meinungsbild entstehen, dass dem Ziel der Objektivität entgegenwirkt.
Im Ganzen betrachtet, sehe ich die Methode der Gruppendiskussion trotz der angeführten Zweifel als sehr geeignet an, um die Situation von Jugendlichen zu erfassen. In Hinblick auf diese Arbeit steht hier v.a. das Argument im Vordergrund, dass die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen durch die gemeinsam im Dialog entwickelten Sichtweisen sehr vielschichtig und transparent widergespiegelt werden kann. Außerdem wählte ich diese Methode, da ich etwas über Gruppen und Gruppenprozesse an der Schule in Erfahrung bringen wollte und die Diskussion in der Gruppe zu diesen Zwecken wesentlich geeigneter betrachte als eine Einzelinterviewsituation. In diesem Zusammenhang spielt der gemeinsame Erfahrungsbezug für die Erforschung von Phänomenen der Gruppenbildung eine zentrale Rolle.
Die Gruppendiskussionen wurden an der IGS Köln-Holweide in einer Klasse des 10. Jahrgangs durchgeführt. Die Entscheidung fiel auf diese Schule, da hier im vorangegangenen Sommer eine repräsentative Schülerbefragung im Rahmen des "Index für Inklusion"[1] von der dortigen Schülervertretung durchgeführt wurde. Da die Ergebnisse in Bezug auf Ausgrenzung und Abgrenzung von Gruppen nicht eindeutig ausfielen, bedurften diese einer näheren Untersuchung (siehe Einführung). Die zehnte Klasse wählte ich als Untersuchungsgruppe, da diese als Abschlussklasse (für einen Großteil der SchülerInnen) auf den längsten gemeinsamen Erfahrungszeitraum an dieser Schule zurückblicken konnte und hier noch eine relativ starke Heterogenität gegeben war (im Gegensatz zu den Klassenstufen 11 und 12). Es folgte in Absprache mit den Verantwortlichen der Auswertung der Befragung (Ines Boban und Andreas Hinz) eine Abstimmung mit der Schule bezüglich meines Vorhabens. Im Anschluss daran nahm ich direkt Kontakt zu den entsprechenden LehrerInnen der Schule auf. Anfang Dezember 2004 fanden im Rahmen einer Unterrichtswoche die Gruppendiskussionen statt.
Zu Beginn des Verfahrens stand die Auswahl der Teilnehmenden. Dabei bestand das Ziel darin, ein möglichst breitgefächertes Meinungsbild zu erhalten. Mein erster Plan bestand darin, feste Gruppen von SchülerInnen zu befragen. Das heißt Gruppen, die sich regelmäßig treffen und einen starken Zusammenhalt aufweisen. Aufgrund der Knappheit der Zeit von einer Woche war es mir aber nicht möglich solch eine Gruppe herauszufinden, zumal es von der Organisation aufgrund der Gruppenstrukturen über die einzelnen Klassen hinaus schwierig gewesen wäre, eine Gruppendiskussion in dieser kurzen Zeit zu organisieren. So beschränkte ich mich auf eine einzelne zehnte Klasse. Hier bestand außerdem die Gelegenheit, ein Bild des Klassenklimas zu erhalten.
Nach zwei Tagen Unterrichtshospitation wählte ich aus einer der 10. Klassen zwei Tischgruppen für die Gruppendiskussion aus. Dies stellte jeweils eine geeignete Zahl an TeilnehmerInnen, hier waren es 5, dar, da ich die Gruppen aus Gründen der Überschaubarkeit und Offenheit nicht zu groß gestalten wollte (vgl. Gehrmann 2001, 191, in Anlehnung an Lamnek). Darüber hinaus stellt die Struktur der Tischgruppe eine gute Voraussetzung für die Durchführung der Diskussion dar, da die SchülerInnen untereinander vertraut sind und ich so mit einer relativen Offenheit rechnen konnte - relativ, da ich durch mein geringes Vorwissen zu den Tischgruppen nur sehr schwer einschätzen konnte, über welchen Zeitraum die Tischgruppen bereits in dieser Konstellation zusammen saßen. Daher ließ ich mich auch von der zuständigen Tutorin im Hinblick auf die Auswahl der Tischgruppen beraten. So wählte ich eine Gruppe, die nach Meinung der Lehrerin eine hohe Gesprächskompetenz aufzuweisen schien, da es sich bei den Jugendlichen dieser Gruppe um sehr leistungsstarke SchülerInnen handelte und der Schülersprecher der Klasse in dieser Tischgruppe saß. Ziel der Diskussion mit dieser ersten Gruppe war es, ein möglichst breites Meinungsbild über die Situation von Gruppen und Mechanismen von gegenseitigem Respekt bzw. Ausgrenzung innerhalb des Klassen- und Teamzusammenhangs zu erhalten. Die Zweite Gruppe bestand, wie sich später herausstellte, aus SchülerInnen, die erst seit kurzer Zeit in dieser Konstellation zusammensaßen. Dadurch gestaltete sich die Gruppe als sehr meinungsheterogen. Ich wählte diese Gruppe, da hier ein sehr auffälliger Schüler mit einer Hörstörung saß, dessen Meinung zu der beschriebenen Problematik besonders interessant im Hinblick auf die Vielschichtigkeit der Ansichten erschien. Darüber hinaus verfolgte ich mit der Auswahl dieser Gruppe das Ziel, eine Kontrastierung des Meinungsbilds im Vergleich zur ersten Gruppe zu erlangen.
Um eine Vergleichbarkeit der Gruppendiskussionen hinsichtlich der Rahmenbedingungen zu gewährleisten, wählte ich in Absprache mit den TutorInnen der Klasse einen möglichst neutralen und funktional eingerichteten Raum (einen Vorbereitungsraum eines Lehrers) für die Durchführung der Gruppendiskussionen (vgl. Gehrmann 2001, 193). Diese fanden jeweils in einer Unterrichtsstunde am Vormittag statt, was eine relativ starke zeitliche Eingrenzung darstellte. So achtete ich darauf, dass das Gespräch möglichst in einer Unterrichtsstunde vor einer größeren Pause stattfand, um einen Zeitpuffer einzuräumen, was sich auch als sinnvoll herausgestellt hat. Von zentraler Bedeutung für den Ablauf von Gruppendiskussionen ist die Störungsfreiheit des Raumes. Dies konnte nicht vollständig gewährleistet werden, da der Raum von mehreren Lehrern als Vorbereitungsraum genutzt wurde. So kam es bei der Durchführung der zweiten Diskussion zu einer kurzen Störung. Weitere Störungen traten nicht auf, da es sich auch um einen Raum im Nebentrakt der Schule handelte und störende Außengeräusche dadurch sehr gering waren.
Zu Anfang der Gruppendiskussion stand eine kurze vorbereitete Begrüßung, in der die Intention der Befragung dargelegt wurde. Es folgte ein kurzer Test des Aufnahmegerätes[2], welcher neben der Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes zur Auflockerung der Stimmung unter den Jugendlichen beitrug. Anschließend wurde an den Wahrheitsgehalt der Aussagen appelliert und die SchülerInnen ermuntert Offenheit im Gespräch zu zeigen. Nun folgte die Darstellung des Ablaufs der Diskussion. Die Dynamik der Auseinandersetzung sollte von den Jugendlichen weitgehend selbst bestimmt werden. Dies realisierte sich aber nur bedingt, vermutlich aufgrund der Unerfahrenheit in Gruppendiskussionen. Ich hatte die Diskussion in zwei wesentliche Phasen unterteilt. Die erste Phase sollte eine weitgehend freie und wenig strukturierte Phase sein, in der die SchülerInnen unterschiedliche Meinungen zu dem Impulsthema frei äußern sollten. Der zweite Teil bestand aus etwas stärker strukturierten Frageimpulsen, in denen ich auf spezifische Aspekte des qualitativen Teils der Schülerbefragung Bezug nahm.
Diese Struktur stellte sich aber rückblickend betrachtet als ungünstig dar, da die Jugendlichen zu Beginn der Diskussion eher gehemmt wirkten und ich dadurch am Anfang mehr Impulse als geplant setzen musste, um das Gespräch zu entfalten.
Mein erster Impuls stellte eine Grafik (s. Anhang) dar, die Ergebnisse der Schülerbefragung hinsichtlich der Ausgrenzung von SchülerInnen in unterschiedlichen Jahrgängen an der Schule repräsentierte. Ich wählte diesen Impuls, um eine direkte Verbindung zur Schülerbefragung herzustellen und eine eigene Stellungnahme der Jugendlichen diesbezüglich zu provozieren. Einen ähnlichen Impuls gab ich nochmals in der Mitte der Diskussion hinein. Auf dieser Grafik waren die Ergebnisse spezifiziert auf Abgrenzung von Gruppen dargestellt. Die detaillierte Auswertung der Ergebnisse der Befragung, auch hinsichtlich der Reaktion auf die Grafiken folgt im 5. Kapitel. Im Laufe der Diskussionen gab es mehrere Impulse, die sich auf die Schülerbefragung bezogen, v.a. auf den qualitativen Teil der Fragen, der den Abschluss des Fragebogens bildete[3].
Die Diskussionsleitung erfolgte durch eine thematische Steuerung, da die SchülerInnen aufgrund ihres Alters und der Unerfahrenheit in Gruppendiskussionen einen relativ hohen Bedarf an Impulsen zeigten. Dennoch beschränkte ich mich auf diese Impulse und versuchte, mich weitgehend aus der Diskussion herauszuhalten und habe lediglich an manchen Stellen eine Aussage wiederholt, um Verständnisschwierigkeiten zu klären. Es stellte sich, wie oben bereits angedeutet, heraus, dass einige SchülerInnen das Gespräch stark dominierten und andere sich weitgehend heraushielten. So versuchte ich an einigen Stellen durch gezieltes Fragen diese SchülerInnen ins Gespräch einzubeziehen mit dem Resultat, dass sie nach einer kurzen Äußerung wieder in Schweigen verfielen.
Ein weiteres Problem stellte der zeitliche Rahmen dar. So musste ich bei beiden Diskussionen einen künstlichen Schlusspunkt setzen, was ich im nachhinein als sehr nachteilig betrachte.
Die Gruppendiskussionen wurden, wie bereits erwähnt, durch ein Tonbandgerät aufgezeichnet. Die Jugendlichen reagierten zu Anfang etwas irritiert auf die Technik, aber durch den Aufnahmetest konnte die Scheu vor der Aufnahmetechnik weitgehend abgebaut werden. Die Tonaufnahmen wurden anschließend von mir selbst transkribiert. Dies hatte ich den SchülerInnen versprochen, da es ihnen sehr wichtig war, dass eine Identifizierung weitgehend ausgeschlossen bleibt. Außerdem stellte der Prozess des Transkribierens für mich einen Erkenntnisprozess dar, bei dem sich viele entscheidende Punkte für die spätere Auswertung herauskristallisierten. Alle Äußerungen wurden wortwörtlich transkribiert. Auch alle "ähs" und "hms" sind erfasst worden. Nonverbale Äußerungen, die für den Sinnzusammenhang bedeutungsvoll erschienen, wie "lachen" oder "leise" wurden kursiv in Klammern hinter die jeweilige Aussage gesetzt. Die Namen der TeilnehmerInnen wurden kodiert und die in der Diskussion angeführten Namen so verändert, dass eine Identifizierung der einzelnen SchülerInnen ausgeschlossen bleibt. Worte, die auch nach mehrmaligem Hören nicht verstanden werden konnten, wurden mit "(unverständlich)" gekennzeichnet.
Ein anschließender Schritt der Auswertung bestand in der inhaltlichen Analyse des Datenmaterials. Hierbei habe ich mich nochmals an den Ausführungen Gehrmanns (2001, 208ff.) orientiert, da die sonstige Literatur kein detailliertes Auswertungsverfahren bot, was Gehrmann selbst in ihren Ausführungen anmerkt (S. 208). In der Auswertung in Kapitel 5.7 werde ich aber lediglich Resultate, die in Hinblick auf die Fragestellung bzw. für den Zusammenhang mit dem Konzept der inklusiven Schule relevant sind, darstellen, da dies sonst den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Ein erster Schritt stellte das parallele Lesen der Gesprächsverläufe dar, wodurch sich wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Diskussionen herauskristallisiert haben. Diese werden aber bei der Auswertung nicht explizit den einzelnen Gruppen zugeordnet, sondern als Gesamtbild dargestellt, da es sich hier zwar um unterschiedliche Gruppen handelt, aber dennoch ein überblicksartiges Bild der Klasse dargestellt werden soll.
Ein zweiter Schritt besteht in der Bildung von Schlagworten, welche die einzelnen Gespräche charakteristisch darstellen sollen. Diese sind in die zwei Diskussionsphasen geordnet (allgemeiner, explorativer Teil; spezifischer Frageteil).
Die letzte Auswertungsphase bildete die gruppenübergreifende Analyse und Interpretation der Diskussionen anhand eines Kategoriensystems. Das von mir erarbeitete System entwickelte ich in Anlehnung an die in Kapitel 2.2, 2.3 dargestellten Anerkennungs- bzw. Missachtungsdimensionen nach Honneth (1992). Da diese, wie in Kapitel 2.4 aufgezeigt, auf Schule und Anerkennungs- bzw. Missachtungstendenzen von SchülerInnen nicht direkt übertragbar sind, orientierte ich mich an einer adaptierten Variante der Kategorien von Krüger u.a. (2003). So entstanden vier bzw. acht zentrale Kategorien, anhand derer die Diskussionen ausgewertet wurden:
-
emotionale Anerkennung (Vertrauen untereinander, persönliche Bestätigung und Bestärkung) - persönliche Demütigung, körperliche Angriffe
-
moralische Anerkennung (Toleranz und Offenheit) - Ausschluss aus der Gemeinschaft, Aberkennung von Mitspracherechten
-
individuelle Anerkennung (Wertschätzung der Fähigkeiten des Einzelnen) - individuelle Degradierung, Abwertung der Fähigkeiten der Person, mehr Schwächen als Stärken sehen
-
Zusammenhalt in der Klasse - Zerklüftung/Trennung/fehlender Zusammenhalt
Drei der vier Kategorien beziehen sich auf Anerkennungsverhältnisse zwischen einzelnen Personen bzw. zwischen einer einzelnen Person und einer Gruppe. Den Kategorien, welche mit Anerkennung verbunden sind, stehen Aspekte gegenüber, die gegenseitige Missachtung beschreiben. Die Kategorien beziehen sich jeweils ausschließlich auf das Verhältnis der SchülerInnen untereinander.
Im Anschluss werden Themen genannt, welche spontan entstanden sind und nicht in direkter Verbindung mit den genannten Kategorien stehen.
Zusammenfassend betrachtet verliefen die Gruppendiskussionen insofern nach meinen Vorstellungen ab, dass viele Informationen und interessante Aspekte in Bezug auf meine Fragestellung erörtert werden konnten und die SchülerInnen im Gespräch sehr aufgeschlossen, kritisch und souverän gewirkt haben.
Für mich persönlich stellte die Durchführung der Diskussionen und die damit verbundenen Erfahrungen mit den Jugendlichen eine große Bereicherung dar. Gerade die Methode der Gruppendiskussion bietet ein großes Potential in der empirischen Arbeit mit Jugendlichen.
[1] Der Index für Inklusion stellt ein Evaluationsverfahren für Schulen dar, welches aus dem Englischen von Ines Boban und Andreas Hinz (2003) adaptiert wurde (vgl. Kap. 5.4).
[2] Es handelte sich hierbei um ein Tonbandgerät.
[3] In diesem Teil der Schülerbefragung ging es um die Aufzählung von Aspekten der positiven Bewertung als auch um veränderungswürdige Aspekte hinsichtlich der Sichtweise auf die eigene Schule
Inhaltsverzeichnis
- 4.1 Schule als Grundlage für die Entwicklung von Anerkennung und Toleranz?!
- 4.2 Exkurs: Zur Diskrepanz von Lob und Anerkennung
- 4.3 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte des Jugendalters
- 4.4 Gruppenbildung/ Gruppenidentität als Voraussetzung für ein solidarisches Miteinander
- 4.5 Folgen mangelnden Respekts - Aggression und Gewalt als Antwort auf Mangel an Partizipation
- 4.6 Dimensionen von Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen (nach Köbberling/ Schley 2000, 136ff.)
Nachdem die methodischen Grundlagen dargelegt wurden, sollen nun die Erkenntnisse im Zusammenhang mit Anerkennung und Missachtung auf den Umgang von Jugendlichen untereinander im schulischen Kontext dargestellt werden. Nach einer kurzen, kritischen Analyse des schulischen Umfelds, in dem Jugendliche einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen, soll ein Blick in die entwicklungspsychologischen Prozesse der Entwicklung von Identität und Selbstkonzept erfolgen. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit Prozessen der Gruppenbildung und Gruppenidentität. Es stellt sich anschließend die Frage: Welche Folgen hat ein Mangel an Respekt unter SchülerInnen? Hier sollen Formen und Ursachen von Gewalt im schulischen Kontext dargestellt werden. Den Abschluss des Kapitels bildet die Betrachtung von Dimensionen der Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen.
Die Schule nimmt heutzutage einen Großteil der Zeit eines Kindes oder Jugendlichen ein und bildet somit oftmals deren Hauptbeschäftigung (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 230) während dieser Entwicklungsphase. Daher wirken sich die dortige Anerkennung bzw. Missachtung in entscheidendem Maße auch auf die Persönlichkeitsbildung aus.
Durch die Ergebnisse von PISA, TIMMS, IGLU und anderen Studien, die die Lernergebnisse und das Lernverhalten von SchülerInnen evaluiert haben, sind deutsche Schulen stark in die Kritik geraten. Die Grundfragen hierbei sind: Was muss Schule als Sozialisationsinstanz in der heutigen Zeit leisten, um den hohen Anforderungen in der freien Wirtschaft, der zunehmenden Globalisierung und dem Wertpluralismus gerecht zu werden? Trägt dieses stark selektiv ausgerichtete Schulsystem weiterhin oder braucht es neue innovative Schulstrukturen und wie könnten diese aussehen? Im Vordergrund steht nach wie vor der Bildungs- und Erziehungsauftrag, den die Schule zu erfüllen hat. Bisher wurde dies im Rahmen eines stark auf die Bildung homogener Schülergruppen ausgerichteten Systems realisiert. So gibt es in der Sekundarstufe I die Dreiteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium, durch welche der Bildungsweg von SchülerInnen vorbestimmt wird, wenn sie keine Gesamtschule besuchen. Daneben existiert ein stark differenziertes Sonderschulsystem, dessen einzelne Richtungen dem jeweils diagnostizierten Förderbedarf entsprechen. Im Vergleich mit anderen europäischen Schulsystemen ist Deutschland somit an der Spitze der Ausdifferenzierung von SchülerInnen. Folgen eines solchen Systems sind erhöhte Schulangst, Misstrauen und Konkurrenz unter den SchülerInnen (vgl. Knopf 1996, Weißmann 2003). In einer Heterogenität der Schülerschaft wird in diesem Zusammenhang eher Störung, Bedrohung und Hindernis gesehen als Kreativität, Bereicherung oder Neugier. Was an deutschen Schulen häufig fehlt, ist nach Hannah Arendt und Reinhard Kahl (2002, 43) das "Zwischen", die Kommunikation und das Bauen von Brücken untereinander, um sich gegenseitig wertungsfrei wahrnehmen und verstehen zu können.
Es stellt sich an dieser Stelle auch die Frage, welches Bild von Welt den SchülerInnen durch ein solch selektives Schulsystem vermittelt wird und welche Auswirkungen dies auf die Herausbildung elementarer sozialer Fähigkeiten wie Kooperations- und Teamfähigkeit hat (vgl. BMBF-Interview mit Reinhard Kahl 2004). Hier wächst Schule ein ganz klarer Auftrag zu, der im Familienkontext in diesem Maße kaum erfüllt werden kann.
In Anbetracht dieser Strukturen ist zu erörtern, inwiefern Toleranz und Anerkennung dazu beitragen können, dass SchülerInnen mutiger, selbstbestimmter und angstfreier lernen können und dadurch höhere Lernerfolge erzielen. Dies soll im Folgenden, bezogen auf die Ebene des Unterrichts und des Klassenklimas betrachtet werden.
Der produktive und kreative Umgang mit Heterogenität wird maßgeblich durch eine entsprechende demokratisch ausgerichtete Pädagogik und damit auch Unterrichtsgestaltung getragen. Die Ebene des Unterrichts stellt die "Keimzelle" für Prozesse der Achtung oder Missachtung dar. Somit ist die Frage nach der Unterrichtsgestaltung sowohl eine der Didaktik und Methodik als auch eine des Inhalts. In den meisten Schulen steht die Frage des Inhalts, der Curricula im Vordergrund, hinter der sich viele LehrerInnen häufig verstecken, da diese zwingend erfüllt werden müssten (vgl. Kahl 2002, 43). Weniger findet die Beachtung der Individualität einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers auf dieser Ebene statt, da allgemein davon ausgegangen wird, dass alle SchülerInnen in der gleichen Zeit das Gleiche lernen könnten. Daher findet hier mehr frontaler fragend generierter Unterricht statt, der den individuellen Bedürfnissen der einzelnen SchülerInnen meist wenig entspricht und es sich nach der Meinung Reinhard Kahls (2004a) eher um Belehrungsanstalten als um Lebens- und Lernräume handelt. Er zitiert in diesem Zusammenhang Sloterdijk, welcher die Ansicht vertritt, dass Lernen die Lust auf sich selbst wecken sollte (vgl. Kahl 2002, 43).
Doch was können Toleranz und Anerkennung zur Herausbildung mündiger BürgerInnen beitragen? Wie nachfolgend beschrieben werden soll (Kap. 4.2), ist es entscheidend, Stärken von SchülerInnen zu erkennen und diese zu fördern und nicht, wie es weitgehend praktiziert wird, deren Fehler zu bekämpfen. Dazu ist es notwendig, den Jugendlichen Räume zu bieten, ihre Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen und vor allem die Neugier auf mehr zu wecken: "Schule soll Schüler hungrig machen und nicht satt" (Kahl 2004a). Hierbei stehen die Entwicklung von Kompetenzen im Vordergrund, welche hinsichtlich des späteren selbstbestimmten Erwachsenenlebens relevant sind und welche über die bloße Wissensvermittlung hinaus gehen (vgl. Kap. 4.2). Dies sind zum einen kommunikative und soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Verantwortungsbewusstsein. Zum anderen sind es auch Fähigkeiten, die für die spätere Rolle als BürgerIn einer demokratischen Gesellschaft relevant sind, wie die Entwicklung ethisch-moralischer Vorstellungen, die Vertretung eines selbst erarbeiteten Standpunktes und die Fähigkeit ein eigenständiges Leben führen zu können.
Anerkennung und Toleranz stellen wesentliche Indikatoren für die Entstehung des Klassenklimas dar (vgl. Minderop 2004, Bülter/Meyer 2004 u.a.). Es ist erwiesen, dass ein positives Klassenklima zu einer höheren Lernmotivation und damit auch zu höheren Schulleistungen führen kann. Bülter und Meyer (2004, 31) nennen diesbezüglich verschiedene Faktoren, die in Zusammenhang mit der Entstehung eines lernfördernden Klimas relevant erscheinen. Ein zentraler Faktor dabei ist die Selbstachtung. Hier wird vor allem die Selbstachtung der Lehrerin, des Lehrers als Voraussetzung für eine ausgeglichene in sich ruhende Persönlichkeit genannt, welche so in viel höheren Maße den SchülerInnen gegenüber eine aufmerksame und zugewandte Haltung entwickeln kann als unter Anspannung und Stress (vgl. ebd.). Im Gegenzug, oder besser als Ergänzung dazu, ist es wichtig, dass auch SchülerInnen ein hohes Maß an Selbstachtung zeigen, um durch Misserfolge nicht so schnell aus der Bahn geworfen zu werden. So stellt eine positive Einstellung sich selbst gegenüber eine Art "Schutzfilm für die Seele" dar (s. auch Kap. 4.3.3.2). Ein zweiter wichtiger Punkt, den Bülter und Meyer (2004) nennen, ist "wechselseitiger Respekt" (S. 31). Neben dem Respekt, den die Lehrerin, der Lehrer den SchülerInnen gegenüber zeigen sollte, möchte ich hier vor allem den Aspekt der gegenseitigen Anerkennung zwischen SchülerInnen in den Vordergrund stellen. "Unterricht findet im Zusammenspiel einer in der Regel unfreiwilligen Gemeinschaft von 30 Schülerpersönlichkeiten und Lehrkräften (...) statt" (Minderop 2004, 27). Das bedeutet, das Vertrauen zwischen den einzelnen SchülerInnen entwickelt sich erst langsam, meist über viele Jahre hinweg, und kann nicht vorrausgesetzt werden. Einen wesentlichen Faktor diesbezüglich bildet die von der Lehrerin, vom Lehrer initiierte Reflexion des Umgangs mit der Einzigartigkeit einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers. Andersartigkeit wird vor diesem Hintergrund nicht als Hindernis gesehen, sondern als Bereicherung aufgefasst.
Ein vertrauensvolles Verhältnis unter SchülerInnen wirkt sich in erster Linie positiv auf das Selbstwertgefühl der Einzelnen aus, da ein fester freundschaftlicher Zusammenhalt, der durch gegenseitige Achtung und Wertschätzung geprägt ist, entsteht. Wenn Erfolge die Neugier und den Mut zu Neuem wecken und Misserfolge relativieren, dann müssen leistungsstarke SchülerInnen nicht mehr zu "Strebern" und leistungsschwache ebenso wenig zu "Nichtskönnern" degradiert werden.
Als einen dritten Aspekt, der zu einem lernfreudigen Klassenklima beitragen kann, nennen Bülter und Meyer (2004, 33) die Bereitschaft zur Kooperation. Im Vordergrund steht hier die "Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Gruppen mit unterschiedlichen Teilaufgaben zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels" (ebd.). Dies sollte nicht nur ein Klassenziel, sondern auch übergeordnetes Ziel der ganzen Schulgemeinschaft sein. Wenn LehrerInnen und SchülerInnen gemeinsam ein Ziel erreichen wollen und jeder Einzelne sich aktiv für dieses Ziel einsetzt, kann eine motivierende Lernatmosphäre geschaffen werden. Kennzeichen einer solchen Entwicklung sind nach Bülter und Meyer (2004, 33) "Vertrauen, verlässlich eingehaltene Regeln, geteilte Verantwortung, Fürsorge, Begeisterung und Humor."
Vertrauen stellt, wie bereits erwähnt, eine wichtige Grundlage für gute Zusammenarbeit dar, bei der tragende Beziehungen möglich werden. Klare und eindeutige Regeln und Grenzen sind wichtig, um Räume zur Entfaltung zu schaffen. Dies mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, aber Kinder und Jugendliche brauchen Regeln, um sich orientieren zu können und Sicherheit zu finden: Schule soll ein Ort sein, wo SchülerInnen sich wohlfühlen und nicht unter Angst vor Strafe oder Misserfolg leiden müssen. Daher ist es wichtig, Regeln im gemeinsamen Konsens zwischen SchülerInnen und LehrerInnen zu entwickeln und zu achten.
Darüber hinaus sind demokratische Rituale von großer Bedeutung, da die SchülerInnen sich dadurch ernst und wahr-genommen fühlen. Dies spielt für die Entwicklung der eigenen Identität eine entscheidende Rolle (vgl. Kap. 4.3.3.1 u. 4.4.2). Verantwortung bedeutet hier v.a. das Beswusstmachen des eigenen Lernprozesses, um auch im Umgang mit Alltagsproblemen Selbstsicherheit und Lösungskompetenz zu erlangen.
Eine auf Gerechtigkeit ausgerichtete Unterrichtspraxis bietet Gelegenheit zur Reflexion von Erfahrungen und die Möglichkeit, gestellten Forderungen widersprechen zu können und fördert damit die Bildung eines demokratischen Wertesystems.
Fürsorge stellt hier die Voraussetzung dafür dar, dass SchülerInnen lernen, ohne Angst verschieden zu sein. Hier trägt die Lehrerin, der Lehrer eine hohe Verantwortung bezüglich der Entwicklung "unverwechselbarer Individuen" (Bülter und Meyer 2004, 33).
Begeisterung und Humor wirken aufbauend und auflockernd auf SchülerInnen. Daraus erwachsen Motivation und Unverkrampftheit, welche für hohe Lernerfolge entscheidend sind und auch widrige Umstände gelassen ertragen helfen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es zum einen von großer Bedeutung für die Entwicklung einer autonomen und starken Schülerpersönlichkeit ist, als Mensch mit allen Stärken und Schwächen anerkannt zu werden. Zum anderen gibt es trotz der teilweise schwierigen und hemmenden Lernbedingungen des heutigen Schulalltags Wege, ein Schulklima der Toleranz und der Offenheit gemeinsam zu entwickeln. Denn die "Vorbereitung auf das Leben beginnt im Leben" (Kahl 2004a). So ist es der Auftrag der Schulen, dieses Leben auch in der Schule zu ermöglichen, denn diese bildet einen zentralen Bestandteil der Lebenswelt eines jeden Kindes bzw. Jugendlichen.
An dieser Stelle soll ein kleiner Exkurs zu einem Kernstück alltäglichen Lehrerhandelns unternommen werden. Dieser soll zum einen eine begriffliche Differenzierung aufgrund der häufigen Gleichsetzung von Lob und Anerkennung aufzeigen und zum anderen für die Gefahr des Einsatzes von Lob als Form der "objektiven" Leistungsbeurteilung sensibilisieren.
Zu Beginn scheinen die Begriffe synonym nebeneinander zu stehen - Lob als Form der Anerkennung einer Person. Wenn wir aber tiefer in die Bedeutung hineinschauen bzw. durch das Gegenteil die Wortbedeutungen kontrastieren, wird deutlich, dass es zwischen den beiden Begriffen wesentliche qualitative Unterschiede gibt.
Lob stellt häufig das Erreichen eines Messwertes auf einer Skala dar. Die Schülerin/ der Schüler wird danach beurteilt, inwiefern sie/er diesen Wert erreicht hat oder nicht. Anerkennung hingegen bedarf keines Maßstabes, keiner Kategorie von Werten, nur dem Gefühl des tiefen Respekts vor dem Anderen und der eigenen Präsenz. Anerkennung bedeutet, den Anderen sehen, seine Leistung sehen und wertschätzen so wie sie ist und nicht be-werten. Lob erscheint vielleicht im ersten Moment objektiv, kann aber gleichzeitig subjektiv entwertend sein, indem es den anderen zum Objekt degradiert, ihn nicht wirklich wahrnimmt, sondern nur einen kleinen Teil von ihm - die "objektiv" erbrachte Leistung. Dadurch laufen SchülerInnen Gefahr entwurzelt und dadurch abhängig von dem subjektiven Urteil der Lehrerin, des Lehrers zu werden. Dieses Phänomen ist häufig in Schulen zu finden und es macht auch Sinn - SchülerInnen sollen lernen, sich in ein System von Leistung und Bewertung einzufügen, sie sollen sich aneinander messen und die Leistungsanforderungen so gut wie möglich erfüllen. Wer sich diesem System wiedersetzt, wird sanktioniert, zurechtgewiesen, getadelt. Somit stellt Lob einen wesentlichen Teil des Machtinstrumentariums einer Lehrerin, eines Lehrers dar (vgl. Ulich 2001, 79). Es herrscht ein Gefälle von stärker zu schwächer und ein Dialog wird aufgrund der einseitigen Abhängigkeit unmöglich.
Eine sehr problematische Form des Lobes entsteht auch dann, wenn beispielsweise in Integrationsklassen SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf von ihren MitschülerInnen für eine Leistung wohlmeinend beklatscht werden, die im sozialen Vergleichsmaßstab eher als gering wahrgenommen würde; hier kann sich geradezu eine Tendenz zur Entwertung durch Lob einstellen.
Im Verhalten der SchülerInnen spiegelt sich die Diskrepanz wirkliche Anerkennung zu brauchen, aber nur Lob oder Tadel zu bekommen, in Erscheinungen wie Verhaltensauffälligkeiten oder angepasstem konformem Verhalten wider (vgl. Mann 1994). Es stellt sich die Frage, wie dieses Dilemma, in dem viele SchülerInnen und auch LehrerInnen stecken, zugunsten der Entwicklung einer Kultur der gegenseitigen Achtung und des Verstehens untereinander zu lösen ist.
Anerkennung entsteht nicht durch einen einfachen Fingerschnipp und dem Vortäuschen einer "heilen" Klassengemeinschaft, in der sich alle verstehen. Es bedarf der Auseinandersetzung mit der eigenen Lehrerrolle, der aufmerksamen Reflexion des eigenen Handelns und damit nicht zuletzt des eigenen Unterrichts (s. Kap. 4.1).
Iris Mann (1994, 69) sieht in diesem Kontext "'verhaltensauffällige' Kinder als ‚emanzipatorisches Moment' für Lehrer und angepasste Schüler." Durch diese Sichtweise wird deutlich, dass das Verhalten von sogenannten auffälligen SchülerInnen als Chance für eine erkenntnisfördernde, vorranbringende Entwicklung einer "menschlichen" Lehrer-Schüler-Interaktion (Mann 1978, 10) genutzt werden kann ohne Verhalten verurteilen zu müssen. Bei der wechselseitigen Anerkennung, wie sie Honneth (1992) beschrieben hat (s. Kap. 2.), handelt es sich nicht um einen Zustand oder eine herausragende Eigenschaft, sondern um einen lebendigen Prozess der tagtäglichen Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem Anderen. Dabei geht es um ganzheitliche sensible Wahrnehmung.
"Präsenz" ist der zentrale Begriff in der von Marshall B. Rosenberg (2002) geprägten "Gewaltfreien Kommunikation". Er schreibt (2004) über "Erziehung, die das Leben bereichert" und meint damit nicht nur die Kommunikation, die achtsamer gestaltet werden sollte, sondern die gesamte Wahrnehmung des Mitmenschen. Lob wird in diesem Zusammenhang nur als positiver Verstärker erwünschten Verhaltens betrachtet, während Anerkennung die tiefere Wertschätzung der Gesamtpersönlichkeit des Anderen beinhaltet.
Für den Fortgang dieser Arbeit bedeutet diese Erkenntnis, dass gerade in Bezug auf schulische Leistungsbewertung die Anerkennung der individuellen Leistung einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers bei der Förderung dessen Persönlichkeitsentwicklung und damit dem Aufbau eines positiven Selbstbildes eine zentrale Rolle spielt. Im Hinblick auf Integration stellt der auf gegenseitiger Anerkennung basierende Dialog zwischen SchülerInnen und LehrerInnen ein wesentliches Element im Prozess der Entstigmatisierung dar (vgl. Boban/Hinz 2003).
Bei der Betrachtung des Phänomens "Jugend" stößt man auf sehr unterschiedliche Interpretationen, Herangehensweisen und Perspektiven (medizinisch, soziologisch, juristisch, entwicklungspsychologisch, etc.). Es ist auch häufig von einem gesellschaftlichen Idealbild die Rede, geradezu ein Mysterium, welches vielfältig v.a. in der klassizistischen und romantischen Lyrik als "ewige Jugend" stilistischen Ausdruck findet. Viele Menschen streben danach "ewig jung" zu bleiben und verbinden mit Jugendlichkeit Schönheit, Spontaneität und die Leichtigkeit des Seins. Welche Umbrüche, Krisen und Probleme mit dieser Phase verbunden sind, wird in diesem Zusammenhang häufig nicht betrachtet. So möchte ich in meinen Ausführungen zum einen Aspekte der entwicklungspsychologischen Entwicklung beschreiben und zum anderen diese Lebensphase aus soziologischer Perspektive in den Blick nehmen. Ich habe diese Herangehensweise gewählt, da diese Blickrichtung in Bezug auf die Entstehung von Anerkennungsverhältnissen im schulischen Kontext hohe Relevanz besitzt.
Im Mittelpunkt meiner Betrachtung steht die individuelle Bewältigung dieser Phase der Veränderung und des Umbruchs, d.h. nicht der Blick auf diese Lebensphase, sondern der Blick vom sich entwickelnden Individuum aus gesehen. Ich wählte diesen Ansatz, da dessen Ausgangspunkt (entwicklungspsychologisch, soziologisch) zwar auf der theoretischen Ebene liegt, aber dennoch direkte Grundlage und Orientierung für pädagogisches Handeln darstellt (vgl. Fend 2003, 205). Somit handelt es sich hierbei um ein "handlungstheoretisches Paradigma" (ebd.), welches von der "'handelnden Bewältigung von Entwicklungsaufgaben'" (ebd.) ausgeht. Die pädagogische Leitidee, welche Fend (2003) hinter diesem Paradigma betrachtet, beschreibt den "Prozess der Entwicklung um eine immer stärkere ‚Ermächtigung' der Person (...), selbstverantwortlich ihre Entwicklung zu gestalten" (ebd.). Wie meinen Ausführungen bereits in Kap. 4.1 zu entnehmen ist, besteht hier eine wesentliche Aufgabe der Schule als Sozialisationsinstanz.
Der Beginn der Lebensphase Jugend wird übereinstimmend mit dem Eintreten der Geschlechtsreife, d.h. der Pubertät bestimmt (vgl. Grob/Jaschinski 2003; Hurrelmann 2004; Oerter/Montada 2002; Fend 2003). In der Literatur wird die Jugendphase weitgehend einheitlich in drei Abschnitte unterteilt (Grob/Jaschinski 2003; Oerter/Montada 2002, 259):
-
frühe Adoleszenz (11-14 J.)
-
mittlere Adoleszenz (15-17 J.)
-
Spätadoleszenz (18-21 J.)
Physiologisch ist das Einsetzen der Pubertät zum einen durch die Herausbildung primärer (bei Mädchen Menarche, bei Jungen Spermarche) und sekundärer Geschlechtsmerkmale (Brustwachstum, Schambehaarung, etc.) gekennzeichnet. Neben diesen anatomischen Veränderungen kommt es zu hormonellen und physiologischen (z.B. Längenwachstum) Veränderungen. Diese sind verbunden mit einem "abrupten Ungleichgewicht in der körperlichen Entwicklung und psychischen Dynamik der Persönlichkeit" (Hurrelmann 2004, 26) im Gegensatz zum Erleben während der Kindheit. Diese "Entwicklungsexplosion" hat starke Auswirkungen sowohl auf der seelischen als auch auf der sozialen Ebene. Hurrelmann (2004) spricht in diesem Zusammenhang von einer "Neuprogrammierung" (S. 26), nicht nur bezogen auf die körperliche, sondern insbesondere auch auf die psychosoziale Entwicklung hinsichtlich von Regulierungs- und Bewältigungsmustern (vgl. ebd.). So wird die/der Jugendliche, die/der gerade noch als Kind bezeichnet wurde, vor ihr/ihm neue Anforderungen auf der körperlichen, psychischen, sozialen und ökologischen Ebene gestellt. Diese werden in der Entwicklungspsychologie übereinstimmend als sogenannte Entwicklungsaufgaben bezeichnet.
"Unter einer Entwicklungsaufgabe werden die psychisch und sozial vorgegebenen Erwartungen und Anforderungen verstanden, die an Personen in einem bestimmten Lebensabschnitt gestellt werden" (Hurrelmann 2004, 27).
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde in den 40er Jahren in den USA von Havighurst entwickelt (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 56) und für den deutschen Raum adaptiert und weiterentwickelt.
Die Erfüllung der Entwicklungsaufgaben bildet die Grundlage für weitere psychosoziale Wachstums- und Reifungsprozesse, die für die Bewältigung von Anforderungen in der darauf folgenden Lebensphase des Erwachsenseins relevant sind.
Für die Jugendphase werden vier zentrale Entwicklungsaufgaben benannt, welche aber nicht klar voneinander abgegrenzt sind bzw. ineinander übergehen (Hurrelmann 2004, 27):
1. Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz
Diese bildet die Voraussetzung für einen selbstverantwortlichen Umgang mit schulischen und später beruflichen Herausforderungen, "mit dem Ziel, eine berufliche Erwerbsarbeit aufzunehmen und dadurch die eigene ökonomische Basis für die selbstständige Existenz als Erwachsene zu sichern" (ebd.).
2. Entwicklung des inneren Bildes von der Geschlechtszugehörigkeit
Mit dieser Entwicklungsaufgabe korreliert die Akzeptanz der körperlichen Erscheinung und der Aufbau einer sozialen Bindung zu Gleichaltrigen beiden Geschlechts, verbunden mit dem Ziel des Aufbaus einer heterosexuellen oder homosexuellen Partnerbeziehung, welche die spätere Basis für die Gründung einer Familie und der Erziehung eigener Kinder darstellen kann. In Verbindung mit der Hinwendung zu Gleichaltrigen und dem Aufbau eigener sozialer und emotional stabiler Beziehungssysteme steht auch der emotionale Ablösungsprozess von den Eltern und anderen Erwachsenen (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 57; Kap. 4.3.1.2).
3. Entwicklung selbstständiger Handlungsmuster für die Nutzung des Konsumwarenmarktes
Dazu gehört der eigenverantwortliche Umgang mit finanziellen Mitteln sowie die selbstverantwortliche Nutzung von Medien. Ziel ist es, durch Erlangen dieser Kompetenzen "einen eigenen Lebensstil zu entwickeln und zu einem kontrollierten und bedürfnisorientierten Umgang mit den ‚Freizeit'- Angeboten zu kommen" (Hurrelmann 2004, 28).
4. Entwicklung eines Werte- und Normensystems und eines ethischen und politischen Bewusstseins
Dies bildet die Voraussetzung für die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung "als Bürger im kulturellen und politischen Raum" (ebd.). Entscheidend ist hier, dass die selbst vertretenen Werte und Normen auch mit dem eigenen Verhalten und Handeln in Übereinstimmung stehen.
Die Erfüllung dieser Entwicklungsaufgaben steht in direkter Verbindung mit der Übernahme gesellschaftlich geprägter Rollen- und Handlungsmuster, denen die/der Jugendliche sich im Laufe der Adoleszenz stellt. Dadurch "kommt es zum ersten Mal im Lebenslauf zu einer bewussten oder bewusstseinsfähigen Entwicklung eines Bildes vom eigenen Selbst und einer Ich-Empfindung" (ebd.). Auf den Aspekt der Identität und Identitätsentwicklung werde ich im nächsten Punkt (4.3.2) näher eingehen. Die Aspekte dieser Entwicklung umfassen sowohl biologisch fundierte (2.) und damit universelle, gesellschaftliche (4.), kulturrelative, teilweise aber auch individuell-subjektive (2.) Aspekte (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 57). Somit ergibt sich hierin eine Differenzierung der einzelnen Entwicklungsaufgaben. Zum einen liegt diese in der Unterteilung der Entwicklungsaufgaben in verschiedene Kategorien. Entwicklungsaufgaben, welche sich auf die biologische Reifung beziehen, wie der Umgang mit dem eigenen Körper und dessen Veränderungen, werden von einem Großteil der Jugendlichen in ähnlicher Weise vollzogen. Variationen gibt es in diesem Zusammenhang lediglich in Alter und Geschlecht. Auf der anderen Seite sind Entwicklungsaufgaben, welche kulturellen bzw. gesellschaftlichen Ursprungs sind, wie die Entstehung bestimmter Normen- und Wertvorstellungen oder das Verhältnis der Geschlechter untereinander, sind von Kultur zu Kultur verschieden und darüber hinaus einer historischen Entwicklung unterzogen. Die Entwicklungsaufgaben, welche sich auf das Individuum selbst beziehen, wie die emotionale Ablösung vom Elternhaus, können von Subjekt zu Subjekt stark variieren. Wobei an dieser Stelle anzumerken ist, dass diese Kategorien nicht immer klar zu trennen sind. So hat beispielsweise die körperliche Veränderung nicht nur biologische Aspekte, sondern auch kulturelle (z.B. unterschiedliche Idealvorstellungen des menschlichen Körpers, die die Sichtweise auf den eigenen Körper beeinflussen) und subjektive (z.B. individuelle Verarbeitung von körperlicher Veränderung). Eine Differenzierung der Entwicklungsaufgaben kann aber auch auf der subjektiven Ebene vorgenommen werden, insofern, dass für den Jugendlichen die Entwicklungsaufgaben in unterschiedlichen Phasen eine unterschiedliche Bewertung erfahren, welche von der Prioritätensetzung der Eltern und anderer Erwachsener wie z.B. LehrerInnen abweichen kann. So hat diesbezüglich Siegfried (1987, in Flammer/Alsaker 2002, 58) ermittelt, dass z.B. der Umgang mit Gleichaltrigen für Jugendliche höchste Wichtigkeit besitzt, während die Eltern dies nur bei mittlerer Wichtigkeit ansiedelten.
Derartige Differenzierungen und Bewertungen haben einen entscheidenden Einfluss auf den Umgang mit Jugendlichen im schulischen Kontext. Dies bezieht sich sowohl auf den Umgang der SchülerInnen untereinander als auch auf die Beziehung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen und die damit verbundene Verantwortung hinsichtlich der Förderung der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben.
In der Schule steht erfahrungsgemäß die Bildung der ersten (kognitive Entwicklung) und der vierten Entwicklungsaufgabe (Entwicklung von Normen und Wertvorstellungen) im Vordergrund. Kritisch zu betrachten ist in diesem Zusammenhang der damit verbundene Mangel an Förderung in Bezug auf Kompetenz und Souveränität in den anderen beiden Entwicklungsbereichen. Da die Jugendlichen einen Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen und nicht alle die gleichen sozialen Voraussetzungen haben, sollte an dieser Stelle vielmehr die Förderung von Kommunikation und Auseinandersetzung mit eigenen Rollenvorstellungen, diesbezüglichen Normen, sowie dem eigenen Verhältnis zum jeweils anderen Geschlecht erfolgen. Soziales und kommunikatives Handeln sollte als Ausgleich bzw. Erweiterung der Ausbildung intellektueller Fähigkeiten hierbei im Vordergrund stehen (vgl. Wöll 1998, 132). Dies ist insbesondere bezogen auf das Lernen in heterogenen Gruppen von zentraler Bedeutung. Darauf werde ich in Kapitel 4.6 sowie in Kap. 5 näher eingehen.
Mit der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben ist nach Hurrelmann (2004, 28) die Jugendphase abgeschlossen und somit "die ‚Selbstbestimmungsfähigkeit' des Individuums erreicht." Somit ist der Status des Erwachsenenalters durch entsprechende "Persönlichkeitsmerkmale, die sich durch einen hohen Grad an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Umgang mit den inneren und äußeren Anforderungen" (ebd., 29) gekennzeichnet sind "und zugleich Verantwortlichkeit gegenüber den Belangen und Interessen anderer Menschen zum Ausdruck bringen" (ebd.). Dies bezieht sich zum einen auf die Persönlichkeitsentwicklung, die aus der unruhigen Phase herausgetreten ist und in eine zumindest vorläufig ruhigere Phase übergeht. Die/der Jugendliche hat "seine Motive, Bedürfnisse und Interessen in eine vorläufige persönliche Ordnung gebracht" (ebd.). Nach Erikson (1968) handelt es sich hier um einen "Reifungsprozess", der die Voraussetzung für die soziale Anerkennung als Erwachsener darstellt (vgl. ebd.).
Darüber hinaus ist die Ablösung vom Elternhaus eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung von Autonomie und mündet im Aufbau eines neuen gleichberechtigten Verhältnis zu den Eltern (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 108).
Dennoch kann man hier keinesfalls von einer klaren Grenzziehung - weder bezogen auf das Alter, noch auf bestimmte Prozesse, wie dies mit dem Einsetzen der Pubertät für die Jugendphase der Fall war - sprechen. Gründe dafür sind einerseits in den sehr komplexen Vorgängen der inneren Entwicklung zu suchen, andererseits in der Art der äußeren Zuschreibung des Erwachsenenstatus. So wird der Übergang in das Erwachsenenalter zwischen 18 und 21 Jahren gesellschaftlich festgesetzt. Dennoch führt Hurrelmann (2004, 29) an, dass aufgrund der sozialstrukturellen Vorgaben (z.B. Ausdehnung der Ausbildungszeit und damit finanziellen Abhängigkeit) "erheblich mehr Zeit (benötigt wird - K.F.), um die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters abzuschließen und sich den psychischen Herausforderungen zu stellen, die typisch für das Erwachsenenalter sind."
In diesem Zusammenhang sehe ich die Wirkung von positiven Anerkennungsverhältnissen, insbesondere auf der emotionalen und sozialen Ebene, als entscheidende Quelle der Unterstützung dieser Prozesse an, v.a. für den Ablösungsprozess vom Elternhaus. Einerseits spielt hier die Entwicklung neuer Beziehungen emotionaler Art zu Peers oder später zu Intimpartnern eine entscheidende Rolle, denn diese stellen einen Ausgleich zur intensiven emotionalen Bindung zu den Eltern dar. Andererseits findet auch bei den Eltern ein Prozess der Bewusstseinsentwicklung statt, insofern, dass sie ihrem Kind den Status eines Erwachsenen zuerkennen und ihr/ihm die Verantwortung für dessen Lebensführung Schritt für Schritt überlassen. In diesem Zusammenhang spielen v.a. Ängste vor Kontrollverlust bezüglich des beschrittenen Weges der/des Jugendlichen eine Rolle. Oft haben die Eltern Bedenken, dass die Heranwachsenden aufgrund der selbst gewonnenen Autonomie den Anforderungen in Schule und Berufsausbildung nicht entsprechen. Den Eltern wird außerdem durch die zunehmende Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Jugendlichen sowohl das eigene Altern als auch der emotionale Verlust stärker ins Bewusstsein gerückt (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 108). Die dadurch verursachten inneren Konflikte können nach einer Zeit der Krise aber auch zur Neuorientierung und Öffnung der Lebensperspektiven führen. Daher ist dieser Ablösungsprozess sowohl für die Eltern als auch für den Jugendlichen selbst ambivalent zu betrachten.
Neben den Eltern haben auch LehrerInnen im Prozess des Erwachsenwerdens ihrer SchülerInnen Verantwortung zu tragen, in dem sie ihren Blickwinkel auf die Schülerin, den Schüler in dieser Phase bewusst reflektieren sollten, um seiner individuellen Entwicklung gerecht zu werden. Häufig geschieht dies dadurch, dass SchülerInnen ab der 9. oder 10. Klasse gesiezt werden und sich teilweise dadurch eher befremdet fühlen, was ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann. Denn dies ist nur eine formale Änderung des Beziehungsverhältnisses zwischen SchülerIn und LehrerIn. Vielmehr sollte hier bewusst die Übertragung wichtiger Aufgaben und Verantwortungen bspw. für kleine Projekte o.ä. übertragen werden, um Eigenverantwortung und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu unterstützen. Dies erfordert insbesondere in dieser Phase der Pubertät große Sensibilität und Vertrauen in die Fähigkeiten von SchülerInnen. Daher sollte die Übertragung von Verantwortung immer in Verbindung mit der individuellen Anerkennung der Schülerin oder des Schülers stehen (vgl. Kap. 4.2). Ziel dabei ist es, ihr/ihm den Zuwachs an Selbstständigkeit und Kompetenzen im entsprechenden Bereich bewusst zu machen und sie zu motivieren, weiterhin eigene Schritte zu gehen.
Nach Hurrelmann (2004) stellt der Übergang von der Kindheits- in die Jugendphase eine Form der "Statuspassage" (S. 32) dar, d.h. des Übergangs von einer sozialen Position, hier die Abhängigkeit und Unselbstständigkeit eines Kindes, in eine andere Position, die des selbstständigen Erwachsenen (vgl. ebd., 31). Gekennzeichnet ist dieser Übergang durch die verstärkte "Hinwendung zur Gleichaltrigengruppe" (ebd., 32), sowie der Distanzierung von den Eltern und der damit verbundene verstärkte Aufenthalt außerhalb des Elternhauses. Weiterhin kann festgestellt werden, dass hier eine "schrittweise Erweiterung der Handlungsspielräume erkennbar (wird - K.F.), die eine Vergrößerung der Rollenvielfalt mit sich bringt" (ebd.). Mit dem Übergang von Kindheit zu Jugend sind aber auch verstärkte Anforderungen hinsichtlich der "Selbstverantwortung des eigenen Handelns" (ebd.) verbunden.
Im Hinblick auf die vier oben benannten Entwicklungsaufgaben kann eine Verbindung bezüglich der Erweiterung des Handlungs- und Rollenspektrums beschrieben werden.
Nach Hurrelmann (2004, 33) bestehen diese zum einen im "Leistungsbereich", d.h. einem Anstieg der Lernleistung auf ein immer komplexeres Niveau. Die Aufgabe besteht darin, Verantwortung für die eigenen Erfolge und Misserfolge auf schulischer Ebene zu übernehmen.
Ein zweiter Schritt besteht in der Ablösung vom Elternhaus sowie der Hinwendung zur Gleichaltrigengruppe. Damit steht die "Verselbstständigung der sozialen Kompetenzen und Kontakte" (ebd.) in Verbindung sowie die Übernahme selbstverantwortlicher sozialer Rollen. Diesbezüglich ist die Gleichaltrigengruppe insofern entscheidend, dass sie den individuellen Ablösungsprozess vom Elternhaus maßgeblich unterstützt. So findet eine Solidarisierung der Jugendlichen in Hinblick auf dieses gemeinsame Ziel der Ablösung statt. Auf diesen Aspekt wird in Kap. 4.4 näher eingegangen.
Der dritten Entwicklungsaufgabe entspricht die Orientierung auf dem Konsum- und Warenmarkt. In diesem Zusammenhang geht es um den Umgang mit der Vielfalt der Konsumgüter und den damit verbundenen Kaufverlockungen, denen die Jugendlichen begegnen. Hier spielt die Aufrechterhaltung der finanziellen Autonomie und die damit verbundene Entscheidungsfähigkeit eine zentrale Rolle.
Bezüglich der vierten Entwicklungsaufgabe, welche mit der "ethische(n) und politische(n) Orientierung" (ebd., 34) in Verbindung steht, gelangt die/der Jugendliche zur "Selbstdefinition des sozialen und des politischen (Bürger)status". Diese stellt das Ergebnis der politischen, moralischen und religiösen Auseinandersetzung mit der Umwelt dar und mündet in eine gesellschaftliche Handlungsautonomie.
Es konnte gezeigt werden, dass die soziale Entwicklung in enger Verbindung mit psychischen Reifungsprozessen steht. Die Bewertung der eigenen Entwicklung durch die Außenwelt, z.B. die Zuschreibung oder Aberkennung eines bestimmten sozialen Status, korreliert mit der eigenen Bewertung und Einordnung in ein gesellschaftliches System. Dieser Aspekt der Identität bzw. des eigenen Selbstkonzepts soll im Folgenden näher betrachtet werden.
Warum spricht man innerhalb der Phase der Adoleszenz von einem eigenständigen und sehr bedeutsamen Abschnitt in der psychischen Entwicklung des Menschen?
In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass hier "ein Prozess der selbstständigen und bewussten ‚Individuation' einsetzt und zu einem vorläufigen Abschluss kommt" (Hurrelmann 2004, 30). Mit Individuation wird die "Entwicklung einer besonderen, einmaligen und unverwechselbaren Persönlichkeitsstruktur" (ebd.) bezeichnet, durch die "das Individuum in die Lage versetzt (wird - K.F.), sich durch selbstständiges autonomes Verhalten mit seinem Körper, seiner Psyche und seinem sozialen und physischen Umfeld auseinander zu setzen" (ebd.). Die Individuation stellt einen wichtigen Teil der Identitätsentwicklung dar. In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen des Identitätsbegriffes. Ich möchte hier zwei dieser Definitionen gegenüber stellen:
nach Erikson (1968), in Flammer/Alsaker 2002, 157:
"Identität ist als ein Gefühl der Identität, d.h. der Kontinuität und Einigkeit mit sich selbst, zu verstehen. Dieses Gefühl der Identität wird durch Interaktion mit anderen und im Kontext der eigenen Kultur gebildet, und es ist als ein Prozess zu verstehen, der legenslang dauert."
nach Waterman (1985), in Fend 1991, 17:
"Identität bezieht sich auf klar beschriebene Selbstdefinitionen, die jene Ziele, Werte und Überzeugungen enthalten, die eine Person für sich persönlich als wichtig erachtet und denen sie sich verpflichtet fühlt."
"Im Mittelpunkt steht nach Erikson (...) das Bewusstsein von sich selber als Subjekt, als kohärente Einheit, als Gefühl des ‚Bei-sich-selber-Seins'" (Fend 2003, 410). Waterman in Anlehnung an Marcia (1980 in ebd.) sieht dem gegenüber eine klare Überzeugung von sich selbst, eine Festlegung auf bestimmte Werte und Normen, die das Individuum für sich als bedeutungsvoll erachtet. Dieser Prozess findet mehr auf der rationalen Ebene statt.
So geht es zum einen um das Gefühl des Sich-Erlebens und zum anderen um die Selbstdefinition, das eher kognitiv gesteuerte Festlegen auf bestimmte Werte und Überzeugungen. In der Synthese beider Definitionen bedeutet dies, dass es sowohl einen emotional-intuitiven als auch einen rational-kognitiven Aspekt in der Entwicklung von Identität gibt und dass beides eine Einheit bildet.
Identitätsarbeit
Die Entwicklung der Identität korreliert stark mit der Bewältigung der genannten Entwicklungsaufgaben. "In dieser Auseinandersetzung und Bewältigung bildet sich der ‚psychische Kern' der jugendlichen Persönlichkeit" (Hurrelmann 2004, 30). Dem gegenüber stehen die von Erikson (1968, in Fend 2003, 403) benannten Krisen der Jugendphase und die damit verbundene Gefahr der "Identitätsdiffusion". Im Vordergrund steht hier das Zusammenspiel von positiver und negativer Identität, ebenso das der Ich-Identität und der Gruppen-Identität. Diese Auseinandersetzung stellt die Suche nach Orientierung und Sinngebung dar. Damit steht das Hinterfragen von Werten und Normen sowie des eigenen Verhaltens (beispielsweise in Gruppensituationen) in Verbindung,. Außerdem findet die "Verarbeitung der inneren (körperlichen und psychischen) Realität und ihrer Abstimmung mit den Ergebnissen der Verarbeitung der äußeren Realität (soziale und physische Umwelt) statt" (Baacke in Hurrelmann, 2004, 30).
In dieser Phase erfolgt häufig ein Ausloten der eigenen körperlichen und geistigen Grenzen, welches mit der Verweigerung bestehender Regeln und Normen korreliert.
So lässt sich zusammenfassend sagen, dass Identität keine feste Größe darstellt, sondern einen über einen längeren Zeitraum andauernden Prozess beschreibt.
Der Begriff des Selbstkonzepts bezieht sich auf die Bewertung des eigenen Ichs, welche durch die Bewertung durch die Außenwelt maßgeblich beeinflusst wird. Das Selbstkonzept unterscheidet sich daher von der Identität, da diese das Resultat einer Selbstbewertung darstellt, "während die Identität das Ergebnis einer aktiven Suche, Definition oder Konstruktion des Selbst beinhaltet" (Flammer/Alsaker 2002, 157). Dennoch stehen Selbstkonzept und Identität in einem engen Verhältnis zueinander, nämlich in der Art und Weise des "Sich-selbst-Erlebens".
Gerade in der Adoleszenz spielt dieser Aspekt der Selbstwahrnehmung durch die Bewertung von anderen eine entscheidende Rolle im Prozess der Entwicklung des Selbstkonzepts (vgl. ebd., 144). In diesem Zusammenhang existieren verschiedene Modelle, die den Aufbau des Selbstkonzepts beschreiben. An dieser Stelle soll exemplarisch für diese Modelle das von Rosenberg (1979, in Flammer/Alsaker 2002, 145ff.) dargestellt werden. Rosenberg geht davon aus, dass das Selbstkonzept in drei Bereiche unterteilt ist:
-
Das Konzept des aktuellen Selbst, d.h. die Selbstwahrnehmung einer Person
-
Das Konzept des erwünschten Selbst, d.h. wie die Person gern sein möchte
-
Das Konzept des sich darstellenden Selbst, d.h. wie eine Person sich selbst darstellt
1. In das aktuelle Selbstkonzept fließen verschiedene Faktoren, wie Inhalt, Struktur und Dimensionen ein. Ich möchte hier schwerpunktmäßig auf die in der Kategorie des Inhalts beschriebenen sozialen Identität eingehen, da diese meines Erachtens eine hohe Relevanz in Bezug auf die Entstehung und Wirkung positiver Anerkennungsverhältnisse hat. Mit der sozialen Identität sind alle die Merkmale und Kategorien gemeint, mit denen Personen von anderen beschrieben werden (vgl. ebd.). Hier sind Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, Religion oder Familienstatus u.a. einzuordnen. Eine entscheidende Kategorie stellt diesbezüglich die soziale Etikettierung dar. Damit verbunden ist ein spezifisches Rollenverständnis und die Einordnung in einen sozialen Status (s. Kap. 4.3.2). Die Bewertung des eigenen Verhalten durch andere steht darüber hinaus auch in Verbindung mit dem öffentlichen Prestige bestimmter Elemente, wie z.B. Eigentum, religiöse Einstellungen, etc.
Die Kategorie des Inhalts setzt sich über die soziale Identität hinaus aus Dispositionen (innere Organisation von eigenen Handlungen, Eigenschaften, Werten etc.) und physischen Merkmalen (Körperbild) zusammen.
Die Struktur des aktuellen Selbstkonzepts stellt die Beziehungen zwischen den genannten Kategorien dar. Hier spielen die Wichtigkeit in Form von zentraler Bedeutung der Bewertungsaspekte (z.B. Körperbild für die Adoleszenz), die hierarchische Organisation dieser, sowie die Beziehung der einzelnen Bereiche des Selbstkonzepts zum Ganzen eine Rolle.
Die von Rosenberg beschriebenen Dimensionen sind mit den häufiger verwendeten "Einstellungen" (ebd., 146) zu vergleichen. Richtung (positiv-negativ), Intensität, Konsistenz und Stabilität sind in diesem Zusammenhang zu betrachtende Aspekte.
Eine weitere Kategorie stellen die Ego-Erweiterungen dar. Diese bezeichnen Sachen oder Personen (z.B. berühmte Personen wie Popstars), die in die Selbstbeschreibung einfließen (vgl. ebd.).
2. Das Konzept des erwünschten Selbst bezieht sich nach Rosenberg im Wesentlichen auf drei Bereiche: a) das Idealselbst, welches meist nicht realisierbare Vorstellungen enthält und zu übersteigerten Ansprüchen sich selbst gegenüber und dadurch ausgelösten Krisen führen kann; b) dem verpflichteten Selbstkonzept, welches aus individuell anstrebenswerten, aber realistischen Vorstellungen besteht und c) dem moralischen Selbstkonzept, welches sich auf gesellschaftlich erstrebenswerte Verhaltensweisen und Einstellungen bezieht; das sozusagen, was man tun sollte oder müsste, um gesellschaftlich anerkannt zu sein.
In diesem Punkt sehe ich eine klare Verbindung zur Honnethschen Theorie (1992) der Anerkennung, da hier die Herausbildung eines Idealbildes in Bezug auf die selbst angestrebte Anerkennung entsteht. Dies bezieht sich v.a. auf die soziale und rechtliche Ebene, da hier von erstrebenswerten Fähigkeiten als auch gesellschaftlichen Kategorien und Meinungsbildern, durch die das Individuum sowohl von außen als auch durch die Selbstbewertung Anerkennung oder Ablehnung erfährt.
3. Das Konzept des darstellenden Selbst beinhaltet die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Wirkung, die eine Person auf andere ausübt, v.a. mit dem dadurch entstehenden Bild bei den anderen. Daher ist dieser Aspekt des Selbstkonzepts oft situationsbedingt und dadurch variabel durch die unterschiedlichen Rollen, die ein Individuum vertritt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Selbstkonzept Ergebnis der eigenen Verarbeitung äußerer Bewertung durch Interpretation und Selektion darstellt.
In diesem Zusammenhang wäre es auch von Interesse die Wirkung von Rollenerwartungen bzw. antizipierten Rollen-Bildern junger Menschen zu betrachten, z.B. unter dem Aspekt der geschlechtsspezifischen Verarbeitung von Rollenbildern. Eine ausführliche Betrachtung dieses Aspektes würde allerdings den Rahmen der Arbeit sprengen und soll daher nur am Rande Erwähnung finden.
Selbstkonzept und Selbstachtung
Hier sollen einige Aspekte, die sich auf Selbstachtung als Teil des Selbstkonzepts beziehen, betrachtet werden. Selbstachtung stellt eine positive Einstellung sich selbst gegenüber dar und kann als Voraussetzung für entwicklungsfördernde Prozesse angesehen werden. Die Anerkennung des eigenen Selbst führt zu dessen positiver Bewertung. Honneth (1992) unterscheidet in diesem Zusammenhang drei Dimensionen der Selbstachtung:
-
Selbstvertrauen (emotionale Sicherheit)
-
Selbstachtung (Anerkennung von Rechten)
-
Selbstschätzung (Bewertung der eigenen Fähigkeiten im gesellschaftlichen Kontext).
Im Gesamtbild betrachtet stellt die Ausbildung aller drei Dimensionen die ganzheitliche Grundlage für ein positives Selbstkonzept dar. Dem gegenüber steht die Missachtung der eigenen Person, welche sich in Form von selbstzerstörendem bzw. autoaggressivem Verhalten äußern kann und deren Ursachen u.a. in einer verzerrten Selbstwahrnehmung liegen.
Betrachtet man die Verbindung von Identität und Selbstachtung, stellt sich die Frage, ob eine Identität in einem noch nicht vollständig ausgeprägten Stadium auch ein unvollständiges Bild oder ein Mangel an Selbstachtung darstellt. Nach dem Modell von Marcia (1980, in Oerter/Montada 2002, 297; Flammer/Alsaker 2002, 160) muss dies nicht grundsätzlich stimmen. Eine im Moratorium (Phase der Suche und Auseinandersetzung) befindliche Person setzt sich beispielweise sehr intensiv mit der Umwelt auseinander und kann über die hier gewonnenen Erkenntnisse eine Achtung für sich selbst entwickeln. Allerdings ist in diesem Zusammenhang das Risiko der negativen Bewertung des Selbst höher als bei einer erarbeiteten Identität, welche sich durch einen "festen Standpunkt, Zielstrebigkeit und Bestimmtheit" (Flammer/Alsaker 2002, 161) äußert. Dennoch können solche "erarbeiteten Identitäten" (ebd.) in ihrer Entwicklung zahlreiche negative Erfahrungen gemacht haben und sich selbst wenig Achtung und Wertschätzung beimessen. Man kann hier also nicht von einer direkten Kausalität zwischen noch nicht entwickelter Identität und mangelnder Selbstachtung sprechen, sondern muss das Individuum in seinem sehr vielschichtigen Beziehungs- und Wertgeflecht betrachten. Diesen Feststellungen entgegen korreliert eine hohe Selbstachtung direkt mit einer positiven Entwicklung der Identität und kann bei Störungen Potentiale zur Selbsterkenntnis und zum Gefühl des Eins-Seins mit sich selbst aktivieren. Dies bestätigt Honneth (1992), in dem er betont, dass durch die Selbstachtung, bezogen auf die drei beschriebenen Dimensionen, ein Zuwachs an Autonomie und damit Selbstsicherheit entsteht (vgl. ebd., 151; Kap. 2.2 dieser Arbeit). So kann durch den Zugewinn an Selbstsicherheit ein positiver Kreislauf der Achtung und Wertschätzung des Selbst in Gang gesetzt werden.
Abschließend steht die Frage, ob gesellschaftliche Etikettierungsprozesse sich zwangsläufig negativ auf das Selbstkonzept auswirken oder ob sie durch andere Faktoren, wie emotionale oder solidarische Anerkennung, kompensierbar sind. Fend (1997, 232f.) gibt in Anlehnung an Rosenberg an, dass die Selbstakzeptanz, ich habe es Selbstachtung genannt, mit der Art der Bewertung von Erfolg und Misserfolg zusammenhängt. Die Frage, auch in Bezug auf die Wirkung von Anerkennung oder Missachtung ist, wie bedeutsam diese Resonanz der oder des Anderen für die/den Betroffenen ist. So nimmt eine Schülerin oder ein Schüler die Kritik seiner Freunde viel ernster als die Meinung einer oder eines Außenstehenden. Das bedeutet, dass man nicht generell davon ausgehen kann, dass SchülerInnen, die einer gesellschaftlichen Stigmatisierung unterliegen (z.B. SchülerInnen mit Beeinträchtigungen), eine niedrige Selbstachtung oder ein niedriges Selbstwertgefühl zeigen müssen. Dies hängt maßgeblich von der inneren Verarbeitung der Bewertung ihres Umfeldes sowie der Gewichtung dieser Bewertung ab. Frey (in Cloerkes 2001, 149) spricht in diesem Zusammenhang von einem "sozialen" und einem "privaten Selbst", welche in der "balancierten Identität" ausgeglichen werden. Eigenes Handeln wird sowohl durch die Bewertung der Informationen der Umwelt als auch der eigenen Bewertung von sich selbst abgeleitet. Hierin wird zum einen deutlich, dass eine enge Verbindung zwischen Selbstwert und Identität besteht und zum anderen diese beiden Ebenen der Selbstwahrnehmung sich wechselseitig bedingen. Frey zeigt so mit seinem Modell, "dass Stigmatisierung keineswegs als Automatismus verstanden werden muss, dem der Betroffene ohne Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten ausgeliefert ist" (Cloerkes 2001, 150). Jedes Individuum geht anders mit Stigmatisierungsprozessen um. So kann man zwei Haupttendenzen feststellen. Zum einen kann die/der Jugendliche die Situation als Herausforderung auffassen oder Meinungen der anderen ablehnend begegnen. Dies wird in der Literatur als Resilienz (vgl. Fend 2003, 432) bezeichnet. Auf der anderen Seite kann sie/er aber auch den Rückzug antreten und in ihrer/seiner Entwicklung stagnieren. Dies wird als Vulnerabilität bezeichnet (vgl. ebd.). Es ist jedoch möglich, dass beide Wege von der gleichen Person in unterschiedlichen Situationen und Lebensphasen gegangen werden können. Daher ist der Umgang mit Krisen und Konflikten nicht eindeutig vorhersehbar und kausal zu betrachten, sondern immer im individuellen Kontext zu sehen.
Fend (2003, 420) nennt in diesem Zusammenhang "drei ineinandergreifende(n) Teilprozesse(n): einer Stärkung der Person durch steigende Kompetenzen, einer gelungenen Individuation und einer sozialen Integration." Es geht hier also um die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um die Erarbeitung eines autonomen Selbst sowie die Einbindung in den gesellschaftlichen Lebenskontext. Dieser entscheidenden Entwicklungstendenzen lassen sich zwei wesentliche Risikokategorien zuordnen (ebd.):
"Die Individuation ist dann gefährdet, wenn die Person nicht auf dem Weg der Entfaltung und Produktivität ist, sondern auf dem Weg in die Selbstablehnung, auf einem Weg, immer ‚kleiner' und immer ‚unscheinbarer' zu werden. Die Handlungskompetenzen werden dadurch nicht erweitert, sondern bleiben unterhalb der objektiven Möglichkeiten.
Die soziale Integration ist dann gefährdet, wenn die Person die sozialen Lebenszusammenhänge nicht mitgestaltet, sondern stört und wenn sie andere ‚zerstört'. In antisozialem Verhalten wird Ko-Regulation aufgekündigt und Gemeinschaft geschädigt."
Ursachen für diese beschriebenen depressiven bzw. destruktiven Verhaltensweisen sind ebenfalls auf den verschiedenen Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung zu suchen. Meine Schlussfolgerung im Hinblick auf die Wirkung intersubjektiver Anerkennung ist, dass eine gelungene Identitätsentwicklung immer mit Anerkennung und Wertschätzung der Person durch ihre Umwelt in Verbindung steht. Diese Phänomene der Anerkennung, aber auch der Missachtung im gesellschaftlichen, familiären sowie sozialen Kontext sollen in den folgenden Punkten dargestellt werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Wirkung von Anerkennung bzw. Missachtung auf das Selbstkonzept bzw. die Selbstachtung nochmals näher betrachtet werden, da mir dies in Bezug auf die Art der Darstellung schlüssiger erschien.
Nachdem Identität und Persönlichkeitsentwicklung auf der subjektiven Ebene betrachtet wurden, erfolgt nun eine Hinwendung zu Gruppenbildung und Gruppenidentität. Dabei soll vor allem herausgearbeitet werden, welche Rolle die Gleichaltrigengruppe, die Peer-Gruppe[4], für die Entwicklung Jugendlicher spielt. Welche Bedeutung hat die Gruppe und die Bildung einer Gruppenidentität für die Entwicklung der eigenen Identität? Welche Rolle spielt die Peer-Gruppe im Prozess der Ablösung vom Elternhaus und der Entwicklung der Autonomie des einzelnen? Was können Gruppenprozesse nach außen hin bewirken? Welche Rolle spielt die Bildung von Gruppen für die Entwicklung von Respekt untereinander und was geschieht, wenn statt Respekt Misstrauen, Aggression und Gewalt herrschen? Aus diesen Fragen resultiert eine weitere Dimension von Gruppenbildung, nämlich die der Abgrenzung von Gruppen und der daraus resultierenden Wirkung sowohl auf die Identitätsentwicklung der Gruppenmitglieder selbst und deren Selbstkonzept als auch nach außen auf andere Gruppen. Mein Fokus soll v.a. auf der Peer-Gruppe als zentrale Formation von Gruppen in der Adoleszenz gerichtet sein.
Als Peer-Gruppen werden etwa gleichaltrige Jugendliche verstanden, "die eine zentrale Bezugsgruppe füreinander bilden" (Weißmann 2001, 65). Die Beziehungen untereinander werden informell ausgehandelt, während nach außen eine relative formale Gleichheit herrscht (Alter, Entwicklungsaufgaben etc.).
Beziehungen unter gleichaltrigen Gleichgesinnten stellen aufgrund der Ausbildung vielseitiger Beziehungsstrukturen die Grundlage für ein solidarisches Miteinander bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben dar. Peers kann man somit als wichtige "Sozialisationsagenten" (Hartup 1983, zit. nach Flammer/Alsaker 2002, 194) begreifen.
Die Bedeutung von Beziehungen zu Gleichaltrigen wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dadurch geprägt, dass Jugendliche länger im Bildungssystem verbleiben als früher. Ein wesentlich höherer Prozentsatz junger Menschen verkehrt hauptsächlich mit Gleichaltrigen (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 195, in Anlehnung an Fend 1998) als dies früher der Fall war. Diese Beziehungen sind v.a. durch die Erweiterung des sozialen Umfeldes geprägt. "In der Adoleszenz bekommen Beziehungen neue Inhalte und Funktionen" (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 195). Klassen- und Spielkameraden werden bspw. zu Arbeitspartnern.
"In der peer-group entwickeln Jugendliche spezifische Handlungskompetenzen und erproben diese bei der Bewältigung des Alltags" (Kühnel/Matuschek 1995, 129). Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung des Selbstkonzepts. Hier werden alternative Verhaltensweisen erprobt und durch den intensiven Kontakt zu Gleichaltrigen ausgebaut und differenziert.
"Im Gegensatz zu anderen ‚Quellen' des Selbstwerts (z.B. dem Status in Schule und Beruf) kann Anerkennung und Respekt über eine Gruppe relativ einfach - und weitgehend unabhängig von den Erwachsenen - hergestellt werden" (Eckert u.a. 2000, 17). Allerdings lassen sich Anerkennung und Respekt nicht direkt erstreben, da sie an die Freiwilligkeit der Vergabe gebunden sind. So findet in Gruppen häufig eine Art "Kampf um Anerkennung" (ebd.) statt, welcher in Situationen des gemeinsamen Aushandelns, bspw. in Freizeitaktivitäten "ausgetragen" wird.
Nach Eckert u.a. (2000, 399ff.) hat die Herstellung sozialer Identitäten über Gruppenzugehörigkeit vier Bezugspunkte:
-
gemeinsame Biographie
-
Kreativität, jugendkultureller Stil, Weltanschauungen
-
Geschlecht
-
ethnische Zugehörigkeit
1.Gruppenbildung über gemeinsame Biographie
"Vorrang hat die über z.T. lebenslange Bekanntschaft entstandene Bindung der Mitglieder" (ebd., 400). So handelt es sich hier meist um Cliquen, die durch langjährige Freundschaften geprägt sind. Gehäuft sind diese in ländlichen Regionen zu finden (vgl. ebd., 399).
2.Gruppenbildung über stilistische Kreativität, jugendkultureller Stil, Weltanschauungen
Hiermit sind sogenannte Jugendszenen gemeint, welche unterschiedliche Stile bzw. Anschauungen aufweisen können. "Welche Elemente des jugendkulturellen oder weltanschaulichen Bedeutungsarsenals der Szenen aber herangezogen und in die Wirklichkeit eingebaut werden, entscheidet sich letztlich in der konkreten Gleichaltrigengruppe" (ebd., 401). Das bedeutet, die Gruppe definiert und identifiziert sich nicht mit einer "reinen" Kultur oder einer "reinen" Weltanschauung, sondern es entsteht immer eine ganz eigene Mischung verschiedener kultureller und ideologischer Einflüsse. Beispiele für solche Szenen sind Skins, Anarchoveganer oder Breakdancer.
3. Gruppenbildung über askriptive Kategorien: Männlichkeit
Die von Eckert u.a. untersuchten Cliquen bestanden hauptsächlich aus Jungen und dies erscheint ihnen auch nicht zufällig. Der Feststellung liegt die Annahme zugrunde, dass Mädchen ihre Anerkennung mehr über persönliche Beziehungen zu den Eltern, zu "besten" Freundinnen oder dem Freund bekommen. Dennoch erscheint vor dem Hintergrund der beschriebenen Gruppenkonstellationen in den von mir geführten Gruppendiskussionen, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen in Cliquen integriert sind. Allerdings ist es möglich, dass unterschiedliche Definitionen von Clique diesen widersprüchlichen Ergebnissen zu Grunde liegen oder in verschiedenen Kontexten (Freizeit-Kontext, schulischer Kontext) untersucht wurden.
4. Gruppenbildung über askriptive Kategorien: Ethnische Grenzen
"Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie hat bei den Gruppen aus eingewanderten Minderheiten eine hohe Bedeutung für die kulturelle Selbstvergewisserung" (ebd., 403).
Anders als bei den stilistisch kulturell gebildeten Gruppen ist hier die Verwurzelung mit dem eigenen Herkunftsland als nicht wählbare Kategorie richtungsweisend. Daher finden sich bei Auseinandersetzungen häufig Verbündete der gleichen Ethnie, welche aber gar nicht mit den angegriffenen Jugendlichen befreundet sind. Eckart u.a. sprechen diesbezüglich vom Phänomen der "Selbstethnisierung", durch welche Solidarität eingefordert werden kann.
Weitere Motive für die Bildung von Gruppen können in der gemeinsamen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, wie dem Streben nach Autonomie gesehen werden. Es muss sich dabei nicht zwingend um eine dieser beschriebenen Kategorien handeln, sondern kann auch in gemeinsamen Interessen und Neigungen begründet liegen oder in Sympathie zueinander. Die gemeinsame Bewältigung von Behinderung kann ebenfalls zum Zusammenschluss von Gleichaltrigengruppen führen. Hier steht, wie bei der Bildung anderer Gruppen auch, v.a. die Suche nach Gleichgesinnten und Bestätigung im Vordergrund. Es geht aber nicht nur um die gemeinsame Bewältigung oder Auseinandersetzung mit der Behinderung, sondern eher um den Umgang mit den damit verbundenen Etikettierungs- und Stigmatisierungsprozessen. Daher kann der Zusammenhalt und die Anerkennung durch die Gruppe eine gute Basis für den Aufbau von Selbstvertrauen darstellen. Andererseits könnte dies aber auch zu einer noch stärkeren Stigmatisierung von außen führen, da die Gruppe durch ihren Zusammenschluss eine größere Angriffsfläche bildet. Dennoch ist sie für die einzelnen Mitglieder von großer Bedeutung für die eigene Persönlichkeitsbildung.
Somit kann man bei der Unterscheidung verschiedener Gruppen sowohl askriptive als auch deskriptive, d.h. sowohl von außen zugeschriebene als auch beschriebene Gruppenbildungsmerkmale konstatieren. Beide Seiten sollten hier Beachtung finden, da durch eine askriptive Gruppendefinition allein nicht alle Facetten und Einstellungen der einzelnen Gruppen erfasst werden können.
Gegenseitige Achtung und Anerkennung nach innen, aber Abgrenzung nach außen spielen für die Herausbildung einer Gruppenidentität eine wesentliche Rolle. (Flammer/Alsaker 2002, 195). "Im Weiteren fördern die steigende kognitive Differenziertheit sowie Selbstreflexion und verbesserte Perspektivenübernahme das Verständnis für das Verhalten und die Gefühle anderer Personen und führen zu einer höheren Beziehungsqualität" (ebd.). Damit verbunden ist auch die gegenseitige Unterstützung und steigender Respekt untereinander. Diese Fähigkeiten bilden sich allerdings erst schrittweise während der Adoleszenz heraus. Während der Pubertät findet eher eine Abgrenzung nach außen statt. Der Fokus liegt vorerst auf der Durchsetzung eigener Bedürfnisse (vgl. Jugendwerk der deutschen Shell 2002, 150). Diese Haltung wandelt sich zunehmend in eine stärker tolerante und nachgiebige Einstellung, welche durch Prozesse der Verantwortungsübernahme bspw. innerhalb von Gruppen unterstützt wird.
Eine weitere Funktion der Peers in Bezug auf die Entstehung von Anerkennungsverhältnissen stellt die Sensibilisierung für die Bedürfnisse der Anderen "durch größere Spontaneität und Direktheit" (Flammer/Alsaker 2002, 197) dar. Dies geschieht v.a. in Zusammenhang mit der Aushandlung von Konflikten und der damit verbundenen Abwehr von Aggressionen.
Die Kehrseite dieser engen Anerkennungsverhältnisse innerhalb der Gruppe besteht in der Abgrenzung und fehlenden Solidarisierung nach außen hin. Somit bilden sich zwar innerhalb der Gruppe solidarische Strukturen aus, werden aber oftmals nicht gegenüber anderen Gruppen oder Außenstehenden gewährt (Flammer/Alsaker 2002, 195).
Wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, stellt die Jugendphase für die meisten Menschen eine Zeit der Neuorientierung und des Umbruchs dar. Vor allem durch den Wandel der Beziehungskonstellation (Peers gewinnen gegenüber den Eltern an Bedeutung) findet eine soziale und emotionale Neuorientierung statt. Dadurch entstehen häufig Unsicherheiten im Hinblick auf die Neudefinition von Beziehungen. Der Zusammenschluss in der Gruppe bildet eine geeignete Möglichkeit diese Unsicherheiten aufzufangen, zu kompensieren und neue Perspektiven zu gewinnen. In diesem Zusammenhang spielt ebenfalls der in Kapitel 4.3.1 beschriebene Statuswechsel vom hilfe- und schutzbedürftigen Kind zum eigenständigen, selbstverantwortlichen Erwachsenen eine entscheidende Rolle. Die Gruppe kann der/dem Jugendlichen zu einem eigenen Status verhelfen, in dem diese selbst einen Status erarbeitet (vgl. Olweus 2002, 51). So bildet die Gemeinschaft einen Auffangort für Jugendliche in schwierigen psychischen Situationen darstellen (vgl. Weißmann 2001, 66). Hier steht vor allem die identitätsstabilisierende Wirkung von Vorbildern im Vordergrund (vgl. Olweus 2002, 51).
Der Aufbau von sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen stellt eine der zentralen Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz dar. Hierdurch erringen die Heranwachsenden Sicherheit und Autonomie im Zuge der Ablösung vom Elternhaus (Flammer/Alsaker 2002, 194). Beziehungen können als Quelle der Selbsterfahrung und Selbstdefinition angesehen werden, welche sich strukturierend auf das Selbstkonzept bzw. die Identitätsbildung auswirken (ebd.).
Die Hinwendung zur Peer-Gruppe bildet eine wesentliche Voraussetzung für die spätere soziale Einbettung (vgl. ebd., 195). Die Peer-Gruppe "ist ein Interaktionsfeld, wo Jugendliche ihre Selbstbilder entwerfen und ausprobieren können. Auch wenn sie aus der Familie bestimmte Vorstellungen von sich selbst mitbringen und bestimmte Begabungen bei sich erkannt haben, brauchen sie doch die Anerkennung dieser Selbstbilder durch andere, insbesondere durch die Altersgleichen, die Peers" (Eckert u.a. 2000, 17). In diesem Zusammenhang ist die Kluft zwischen Individuation, also der bewussten Abgrenzung von anderen, und der Einpassung in das soziale Gefüge zu meistern. "Die Peer-Gruppe bietet Bestätigung der eigenen Interessen und des eigenen Geschmacks" (Flammer/Alsaker 2002, 197). Dadurch findet die Identifikation mit der Gruppe statt und die Bildung und Bestätigung der eigenen Einstellungen und Präferenzen. Es entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl. Das Gefühl der Konformität bildet die Basis für die wechselseitige Anerkennung innerhalb der Gruppe. Durch den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe bildet sich darüber hinaus ein Gefühl der Sicherheit heraus, welches die einzelnen Mitglieder vor Angriffen von außen schützen kann (vgl. Eckert 2000, 19). "Auch werden persönliche Emotionen und Wunschträume eher fassbar, wenn sie miteinander geteilt werden" (ebd.). So kann die/der Einzelne über das Zugehörigkeitsgefühl hinaus Sicherheit im Schutz einer Gruppe finden.
"Gruppen, welche ein hohes Ausmaß an Homogenität anstreben, werden Cliquen genannt" (Flammer/Alsaker 2002, 197). Diese zeigen meist ein enger definiertes Einstellungs- und Verhaltensrepertoire, welches die Gefahr in sich bergen kann, dass der Wechsel zu einer anderen Gruppe schwer möglich wird (z.B. bei gewaltbereiten Cliquen). Die Identifikation mit der Gruppe kann so stark ist, dass ein Verlassen derselben einen starken Einschnitt in die Identitätsentwicklung zur Folge haben würde (z.B. bei rechtsorientierten Cliquen oder religiösen Gemeinschaften) (vgl. ebd.). Hier wird die Kehrseite einer starken Gruppenidentität offenbar.
"Damit aus der Gruppenzugehörigkeit ein positives Selbstwertgefühl für die Mitglieder abgeleitet werden kann, müssen sich ‚In-Group' und ‚Out-Group' voneinander unterscheiden. Häufig werden daher Fremdgruppen ‚abgewertet'" (Eckert u.a. 2000, 17). So bildet die Gruppe die Grundlage für die Herausbildung einer positiven sozialen Identität.[5] "Jedes Individuum ist bestrebt, eine positive soziale Identität zu haben. Diese kann nur dann erreicht werden, wenn die eigene Gruppe positiv von relevanten Vergleichsgruppen abgesetzt wird'" (Wagner 1994, zit. nach Eckert u.a. 2000, 18). Dieser Punkt wird sich als entscheidend bei der späteren Interpretation der Gruppendiskussionen (Kap. 5.7) herausstellen.
Eckert u.a. (2000, 403ff.) unterscheiden drei wesentliche Formen der Abgrenzung von Gruppen gegenüber anderen Gruppen und Kategorien:
-
Distanz
-
Rivalität
-
Feindschaft
Meist kommen diese Formen jedoch gemischt vor oder können sich auch abwechseln (vgl. ebd.).
Distanz
Typisch für diese Form der Abgrenzung ist die "kulturelle Fremdheit und getrennte Territorien zwischen den Gruppen. Man will ‚nichts miteinander zu tun haben'" (ebd., 404).
In der Regel kennen sich die einzelnen Gruppen untereinander kaum und es besteht ein geringes Interesse daran, sich anzunähern. "Die Einstellung gegenüber anderen reicht von Gleichgültigkeit bis Ablehnung" (ebd.). Es herrscht also keine Gewalt zwischen den Gruppen, sondern eher Separation und Distanz. "Verständigung ist zwar prinzipiell denkbar, aber findet nicht statt und ist auch nicht gewünscht. Die positive Selbstbewertung rührt aus dem Gefühl von eigener Kompetenz und Überlegenheit oder auch moralischer ‚Reinheit' im Vergleich zu den ‚Kategorien' mit denen man nichts zu tun haben will" (ebd.). Bei den von mir geführten Gruppendiskussionen war diese Form der Abgrenzung am stärksten vertreten (s. Kap. 5.7). So stellt sich die Frage, welche pädagogischen Wege es geben kann, hier mehr Solidarität unter den Gruppen zu bewirken, um das Klima in einer Klasse dahingehend zu verbessern, dass SchülerInnen solidarischer miteinander umgehen und gemeinsam gestaltete Lernprozesse möglich werden. Ein Ansatzpunkt könnte der gegenseitige Austausch in Form gemeinsam durchgeführter Aktivitäten außerhalb der Schule sein. Dabei können sich die SchülerInnen besser kennenlernen und durch die Veränderung des Kontextes und die intensiv gemeinsam verbrachte Zeit die MitschülerInnen aus einer anderen Perspektive betrachten lernen. Dadurch entstehen neue Verbindungen zwischen den Gruppen. Allerdings wäre hier auch eine andere Richtung denkbar: Die Ignoranz verstärkt sich. Die Gruppen grenzen sich noch stärker voneinander ab, da sie weitere, für sich nicht zu vertretende Eigenschaften der Anderen entdecken. Deshalb ist in diesem Zusammenhang großes pädagogisches Geschick bezüglich der Initiierung gemeinschaftlicher Aktivitäten gefragt.
Rivalität
Hier besteht nicht die Abgrenzung durch Fremdheit, sondern aufgrund von Ähnlichkeit. Es handelt sich hier meist um szeneinterne Konkurrenzkämpfe, welche mit Rangordnung und Authentizität in Verbindung stehen ("Reals" gegen "Nachahmer", "Mitläufer"). Hier geht es v.a. um das Abheben aus der Masse, um den Kampf für die selbst erarbeiteten Werte, welche durch die "Nachahmer" einfach unreflektiert übernommen oder "erkauft" wurden. Darüber hinaus spielt die Würde der "Echten" eine entscheidende Rolle. Diese sehen ihre Leistungen und Fähigkeiten sich nicht genügend gewürdigt, da von außen die Unterschiede zwischen ihnen und den "Nachahmern" nicht erkannt werden.
Im schulischen Kontext treten sicher ähnliche Phänomene auf, die aber in den Gruppendiskussionen nicht explizit genannt wurden. Dies liegt sicher darin begründet, dass sich jugendkulturelle Szenen über Jahre etablieren, bzw. sich eher in den Freizeitaktivitäten zeigen. Daher sehe ich es als schwierig an, hier pädagogisch wirksam zu werden. Die LehrerInnen können meist den Unterschied zwischen den "Reals" und den "Nachahmern" kaum wahrnehmen. Dennoch sollte derartigen Rivalitäten, wenn sie in der Schule auftreten, offen begegnet werden und in Form von Klärungsgesprächen bzw. Mediation aufgedeckt und reflektiert werden.
Feindschaft
Feindschaft beinhaltet nicht nur die bloße Distanzierung vom anderen, sondern die Erklärung eines Gegners, den es zu bekämpfen gilt. "Die Abwertung des anderen ist intendiert" (Eckert u.a. 2000, 406). Es genügen hier nicht nur die Ablehnung des Gegners und die Vorurteile gegen ihn. Vielmehr erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Gegner, um Argumente gegen ihn ins Feld zu führen und ihn aktiv zu bekämpfen. Territoriale Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Sonst erfolgt deren gewaltvolle Verteidigung, die aus Sicht der "Revierbesitzer" durchaus legitim erscheint. Eine Lösung finden diese Konflikte meist nicht in der Erarbeitung eines gemeinsamen Konsens, sondern in einer Art "Koexistenz" (ebd.), bei der die Reviere klar abgesteckt sind. Meist stecken hinter diesen feindseligen Einstellungen naive Alltagssichten und ein "Ethnozentrismus der Gefühle" (ebd.). Dieser bestimmt die eigenen Gefühle als auch das eigene Handeln insofern, dass die Aversion z.B. gegen andersartige Menschen, unreflektiert als Wahrheit definiert und in das eigene Handlungsrepertoire aufgenommen wird.
Relevant ist ebenfalls, dass durch die Abwertung und Bekämpfung von anderen Gruppen der eigene Selbstwert gesteigert werden kann, in dem die Anderen zu "Sündenböcken" gemacht werden. Diese Verhaltensweisen bilden oftmals das Ventil für die Entladung eigener Frustrationen. Derartige Phänomene sind häufig im schulischen Kontext zu beobachten. Zu sogenannten Sündenböcken, wie später noch beschrieben werden soll (Kap. 4.5), werden meist schwächere SchülerInnen, die eine starke, für ihre MitschülerInnen oftmals provokativ empfundene Andersartigkeit darstellen (vgl. Knopf u.a. 1996, 156). Dies zeigte sich auch in einigen Aussagen der Gruppendiskussionen. Als LehrerIn ist es wichtig, diese Strukturen zu erkennen und aufzudecken. Meist handelt es sich hier um einige wenige Initiatoren dieser feindlichen Haltung gegenüber einzelnen MitschülerInnen. Daher gilt es hier Verbündete zu suchen, welche den Mut aufbringen, sich mit den betroffenen SchülerInnen zu solidarisieren oder sie zumindest vor weiteren Übergriffen zu schützen. Darüber hinaus sind hier klärende Mediationsgespräche mit den feindselig eingestellten Jugendlichen wichtig. Es gilt deren Motive zu erkennen und zu hinterfragen und somit ein Nachdenken über das eigene Handeln anzuregen.
Im Zusammenschluss von Jugendlichen ähnlicher Gesinnungen, v.a. wenn diese von allgemein gültigen Normen abweichen bzw. gegen grundlegende Menschenrechte verstoßen, kann es wie bereits angedeutet, zur Verletzung bzw. Schädigung sowohl von Gruppenmitgliedern als auch von Außenstehenden kommen. Diese oft devianten Verhaltensweisen werden meist durch die Gruppe legitimiert oder gar belohnt und dadurch die Hemmschwelle zur Gewaltbereitschaft verringert. Damit korreliert ebenfalls die Abschwächung des Gefühls individueller Verantwortlichkeit durch den Schutz der Gruppe (vgl. Olweus 2002, 52). Die Jugendlichen empfinden dadurch geringere Schuldgefühle bei abweichendem, v.a. gewaltförmigem Handeln (vgl. Kap. 4.5). In derartigen Gruppenprozessen spielt sowohl die Zusammensetzung der Gruppe als auch der sog. Gruppendruck eine Rolle. Dies kann sowohl positive als auch negative Folgen haben. Modellernen und positive Verstärkung der gezeigten Norm- und Wertvorstellungen sowie das daraus resultierende Verhalten bilden die Grundlage für Prozesse der Legitimierung von Gewalt (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 199).
"Gewalt kann ein Mittel der Abgrenzung gegenüber anderen bzw. der Herstellung von Macht und damit positiver sozialer Identität sein" (Eckert u.a. 2000, 19).
Diese Konstellation liegt insbesondere vor, wenn wenig Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Es kann nur auf wenige Handlungsmuster zurückgegriffen werden, wodurch häufig eine gewaltsame Auseinandersetzung mit Konflikten erfolgt. Häufig scheint dies die einzig effektive Lösung zu sein (vgl. Kühnel/Matuschek 1995, 203). Oftmals steht das Zurückgreifen auf derartige Muster und Verhaltensweisen in Korrelation mit einem niedrigen Selbstwert. Wenn sowohl das Handlungsrepertoire gering ist als auch ein geringes Selbstwertgefühl besteht, wird häufig dieser Mangel durch Gewalt kompensiert. In diesem Zusammenhang ist v.a. die geringe Flexibilität bezüglich des Umgangs mit Veränderungssituationen zu betrachten (vgl. ebd.).
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Gruppenprozesse sowohl in ihrer Ausformung als auch in ihrer Wirkung sehr vielschichtig sind. Die Einbindung in eine Peer-Gruppe oder Clique stellt so gesehen eine wesentliche Basis für die spätere soziale Einbindung in die Gesellschaft als auch für die Herausbildung der eigenen Identität der Gruppenmitglieder dar. Daher ist im Hinblick auf die pädagogische Verantwortung im schulischen Kontext die Reflexion des Verhaltens etablierter Gruppen unabdingbar. Frühzeitige Symptome von Devianz (z.B. aggressiver oder abwertender Umgangston untereinander) können sollten hinterfragt und Handlungsalternativen gesucht werden. Allerdings stellt es sich häufig als schwierig dar, derartige Gruppenprozesse im schulischen Kontext aufzudecken. Hierfür bedarf sowohl einer regelmäßigen Beobachtung und Analyse von Gruppenprozessen innerhalb der Klasse als auch der Kooperation mit den Eltern und anderen Bezugspersonen der SchülerInnen, z.B. Freizeitpädagogen oder Sozialarbeitern.
Schläge, Tritte, Erpressungen und Raufereien stellen im heutigen Schulalltag keine Seltenheit mehr da, ja erscheinen fast "normal". Hartmut von Hentig (1993) spricht hier sogar von Gewalt unter Jugendlichen als einer Art "Zeitkrankheit" (S. 11). Vor allem der Aspekt der "versteckten Gewalt", also des Mobbings verdient hier besondere Beachtung. In diesem Kapitel möchte ich mich hauptsächlich mit drei Fragen auseinandersetzen. Zum einen geht es um die Frage, welche Rolle die Institution Schule bezüglich der Ursachen von Aggression, Gewalt bzw. Missachtung spielt, d.h. inwiefern sie die Bühne für gewaltförmiges Handeln bildet. Die zweite Frage befasst sich mit den Voraussetzungen in Form von individuellen "Drehbüchern", die die SchülerInnen mitbringen und damit, inwiefern dieses "Szenario" durch die Lehrerin oder den Lehrer angeleitet, kontrolliert, verstärkt oder ignoriert wird. Die dritte Frage zielt auf die Wirkung bzw. die Folgen solcher Inszenierungen ab, sowohl auf die vermeintlichen Gewinner - die Täter, als auch auf die Opfer.
Konflikte
Zunächst ist zu sagen, dass Aggression und Gewalt immer im Zusammenhang mit "verschiedene(n), gegensätzliche(n) oder unvereinbare(n) Merkmale(n)" (Knopf u.a. 1996, 35) steht, welche an einem Punkt zusammentreffen. Konflikte können einerseits zur Neuausrichtung der eigenen Handlung führen und so die Aufmerksamkeit für sich selbst und die Umwelt erhöhen. Andererseits lösen sie aber auch häufig Gefühle der Wut, Unzufriedenheit oder gar des Hasses aus, welche die Grundlage für gewaltförmiges Handeln sein können. Dabei ist sowohl die Interpretation der Situation als Konflikt als auch der Umgang mit dieser als subjektiv zu betrachten, da derartige Prozesse der individuellen Wahrnehmung unterliegen (vgl. ebd.). So stellen aggressives oder gewaltförmiges Handeln nur eine mögliche Antwort auf Konflikte dar.
Begriffe Gewalt, Aggression
Die Begriffe Aggression und Gewalt sind, ebenso wie der des Respekts, äußerst vielschichtig zu betrachten. Durch deren häufige Verwendung im Alltag findet sich hier ein Konglomerat nur unzureichend wissenschaftlich fundierter Meinungen und Vorstellungen. Dadurch herrscht diesbezüglich eine gewisse begriffliche Unklarheit. So gilt es, zuerst eine Arbeitsdefinition der beiden Begriffe zu entwickeln.
a) Aggressives Verhalten - Aggression - Aggressivität (lat. aggredi - angreifen)
Die Meinungen darüber, was als aggressiv zu bezeichnen ist, gehen stark auseinander, da es oftmals schwer nachweisbar erscheint, ob eine schädigende Absicht hinter der Äußerung oder Handlung einer Person steht. In diesem Zusammenhang stellt es sich auch als ungünstig heraus, wertende Kriterien wie "gegen den Willen anderer, Unangemessenheit oder Ungerechtigkeit" anzulegen (Knopf u.a. 1996, 38). Eine mögliche Definition von aggressivem Verhalten wird von Flammer und Alsaker (2002, 295) vorgeschlagen. Sie bezeichnen damit "ein Verhalten (...), dessen Ziel die Verletzung einer anderen Person ist oder das wenigstens mit dem Bewusstsein der verletzenden Wirkung ausgeübt wird." Das bedeutet die Schädigungsabsicht oder zumindest das Bewusstsein, jemanden verletzen zu können, wird als aggressives Verhalten bezeichnet.
In der Psychologie wird darüber hinaus zwischen aggressivem Verhalten, Aggressionen und Aggressivität unterschieden. "Als Aggressionen sollen hier starke, unangenehm besetzte innere Erregungen, Gefühle bzw. Bedürfnisse bezeichnet werden" (Knopf u.a. 1996, 41). Aggressionen im Sinne von aggressiven Gefühlen oder Bedürfnissen können aggressives Verhalten auslösen, aber nicht zwangsläufig. Sie können auch aus einer anderen Motivation heraus entstehen, z.B. bewusst eingesetzt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Aggressivität bezeichnet eine "verfestigte, relativ stabile psychische Eigenschaft (...), die in einer erhöhten Bereitschaft zu aggressivem Verhalten besteht" (ebd.).
So kann aggressives Verhalten im Grunde genommen von jeder Schülerin, jedem Schüler und jeder Lehrerin, jedem Lehrer gezeigt werden. "Als ‚aggressiv' kann aber nur derjenige bezeichnet werden, der dies relativ häufig und in erhöhter Intensität zeigt" (ebd.). Konsens dieser Definitionen ist, dass ein "zielgerichtetes Schädigen" (Nolting 1993, zit. in Knopf u.a. 1996, 39) erkennbar ist.
b) Gewalt
Der Begriff Gewalt kann je nach Kontext, Intention und Intensität verschiedene Verhaltensweisen, Zustände und Einstellungen beinhalten. Unter Gewalt im juristischen Sinne "fällt sowohl die absolute Gewalt (lat. vis absoluta), d. h. das Unmöglichmachen der Willensbildung oder -betätigung, wie die kompulsive Gewalt (lat. vis compulsiva), d. h. das Zufügen gegenwärtiger Übel, um einen psychischen Zwang auszuüben" (Bertelsmann Universallexikon 2001). Im schulischen Kontext kann Gewalt als destruktives Verhalten Personen oder Sachen gegenüber bezeichnet werden (vgl. Knopf u.a. 1996, 42), wobei Mobbing und permanente Ignoranz hier ebenfalls in die Definition eingeschlossen sind. Daher kann aggressives Verhalten nicht von gewaltförmigem getrennt werden, sondern beide bedingen sich gegenseitig.
Jede Art von Gewalt stellt somit einen massiven Eingriff in die Intimsphäre einer Person dar. Je nach Dauer und Intensität kann dies weitreichende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung der/des Betroffenen haben. Daher ist es wichtig, in diesem Zusammenhang immer beide Seiten zu betrachten: Täter und Opfer (vgl. Knopf u.a. 1996, 41).
Gewalt weist einerseits eine destruktive und "schreckliche" Seite auf, andererseits kann es aber auch Faszination, Gefühle der Stärke und der Macht auslösen, andere zu schädigen oder zu erniedrigen und kann durchaus als gerechtfertigt (bspw. in Form von Vergeltung) angesehen werden.
Fazit ist, dass Gewalt einen Ausdruck eines akuten Mangels an Respekt darstellt und gewaltförmiges Verhalten daher in jedem Falle hinterfragt werden muss.
Formen von Gewalt
Ich werde im Folgenden den Begriff der Gewalt für alle Formen destruktiven Verhaltens verwenden und nicht getrennt von Aggression und Gewalt sprechen, da aggressives und gewaltförmiges Verhalten sich in diesem Zusammenhang stark überschneiden (vgl. Knopf u.a. 1996, 43). Des Weiteren werde ich hier ausschließlich auf Phänomene der Gewalt im schulischen Kontext eingehen, da dies sonst den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Wenn man das Phänomen der Gewalt aus der Perspektive der von Honneth (1992) entworfenen Dimensionen der Missachtung betrachtet, wird deutlich, dass Gewalt alle drei Formen der Missachtung beinhalten kann.
In der Literatur wird zwischen direkter oder unmittelbarer (z.B. körperlich, verbal) und indirekter oder mittelbarer (z.B. psychisch, Ausgrenzung, ohne direkte Konfrontation) Gewalt unterschieden (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 296; Olweus 2002, 70). Flammer/Alsaker (2002, 296) führen noch eine weitere Form der Gewalt, die relationale Gewalt (z.B. Sachbeschädigung) an, welche ich in meine Übersicht mit aufnehme, da dies v.a. für die Betrachtung des Phänomens Mobbing relevant erscheint.
1) Direkte Formen der Gewalt
Körperliche Gewalt findet ein Pendant in den von Honneth (1992) dargestellten Formen von Misshandlung oder Vergewaltigung. Diese extremen Ausmaße finden sich im schulischen Kontext seltener, dennoch existieren leichtere Formen wie Schlagen, Treten oder andere körperliche Angriffe auf MitschülerInnen oder LehrerInnen. Diese Form der Gewalt ist eher bei Jungen als bei Mädchen zu beobachten (vgl. Weißmann 2003, 45).
Verbale Gewalt steht v.a. in Verbindung mit der dritten Dimension von Missachtung im Honnethschen Sinne. Hierzu zählen bspw. Spotten, Beschimpfen oder herabwürdigende nonverbale Gesten (vgl. Knopf u.a. 1996, 21). Dadurch erfährt die angegriffene Person zum einen eine Abwertung als Mitglied der Gruppe und zum anderen die Herabwürdigung ihrer Fähigkeiten und wird somit in ihrer Selbstverwirklichung gehemmt.
2) Indirekte Formen
Die sogenannte psychischeGewalt, welche wesentlich subtiler ist als die dargestellten direkten Gewaltformen, äußert sich u.a. durch üble Nachrede, Ignoranz oder Ausschluss aus der Klassengemeinschaft. Diese Form der Gewalt ist meist über einen längeren Zeitraum beobachtbar und findet sich im Grunde genommen in allen drei von Honneth (1992) erarbeiteten Dimensionen wieder. Sie kann sowohl Formen der körperlichen Demütigung wie Isolation darstellen, als auch den Entzug von Mitbestimmungsrechten bei Entscheidungen darstellen. Bezogen auf die dritte Dimension von Missachtung ist hier die Entwürdigung durch üble Nachrede oder Verweigerung von Kommunikationsangeboten und sozialen Beziehungen zu betrachten.
Eine weitere Form indirekter Gewalt besteht in der Instrumentalisierung von MitschülerInnen für Gewalthandlungen (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 296).
3) Relationale Formen
Bei dieser Form der Gewalt wird versucht, der Selbstwert einer Person durch die Schädigung oder Zerstörung einer ihr bedeutsamen Sache zu verletzen. Hier werden v.a. Beziehungen geschädigt, die einer Person wichtig sind (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 296 in Anlehnung an Crick/Grotpeter 1995). Diese Form entspricht in erster Linie der ersten und der dritten Dimension der von Honneth (1992) beschriebenen Missachtungsformen und damit kann in durch diese Gewaltanwendung sowohl das Selbstvertrauen als auch das Selbstwertgefühl der Person verletzt werden.
4) Mobbing
Mobbing stellt eine Gewaltform dar, bei der eine Person über einen längeren Zeitraum hinweg von mehreren Personen ihres direkten Umfeldes (hier die Schulklasse) schikaniert wird. Diese sehr intensive Form der meist subtilen Gewalt kann alle bisher beschriebenen Gewaltformen beinhalten. Charakteristisch ist hier im Unterschied zu den anderen Formen das bewusste Schädigen einer einzelnen Person durch eine größere Gruppe von SchülerInnen. Bezeichnend ist diesbezüglich auch die Dauer der Entwicklung und Einwirkung dieser Gewalthandlungen. Mobbingstrukturen äußern sich anfänglich durch "harmlose" verbale Formen, nehmen später massivere Formen der Sachbeschädigung an und reichen bis hin zu schweren Formen des Ausschlusses aus der Klassengemeinschaft und massiven körperlichen Angriffen (vgl. Fliegel 2000, Renges 2003). Mobbing kann von mehreren Monaten bis zu Jahren anhalten. Opfer sind meistens Personen, die eine von der Gruppe nicht zu akzeptierende bzw. beneidete Form der provozierenden Andersartigkeit aufweist (z.B. körperliche Makel, überdurchschnittliche schulische Leistungen). Meist sind die Opfer den Tätern körperlich unterlegen (vgl. Knopf u.a. 1996, 156). Dadurch dass andere Personen der Gruppe keiner Aggression ausgesetzt sind, besitzen die Täter einen relativ hohen Status in der Gruppe, "denn Mobbing verleiht den Tätern und Täterinnen Macht und Respekt und somit Selbstbestätigung und ein Gefühl der eigenen Kompetenz" (Flammer/Alsaker 2002, 297).
5) Weitere Formen der Gewalt
Über die genannten Formen der Gewalt hinaus existieren Vandalismus, strukturelle und institutionelle Gewalt, welche meist über den Angriff auf einzelne Personen hinausgehen. Im Hinblick auf die institutionelle Gewalt kann auch Schule durch den stark hierarchischen Aufbau und die damit verbundenen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse als Austragungsort von Gewalt auf verschiedenen Ebenen angesehen werden (z.B. durch Diskriminierung und Bloßstellung) (vgl. Klewin u.a. 2002, 1078). Meist sind diese meist subtilen Formen der Gewalt nicht bewusst wahrnehmbar, sondern es sind nur deren Auswirkungen, wie z.B. Schulangst oder -absentismus erkennbar.
Zahlreiche Studien (zusammengefasst durch Knopf u.a. 1996, Weißmann 2003, Klewin u.a. 2002) in unterschiedlichen Bundesländern zu Gewalt an Schulen haben ergeben, dass Gewalt an allen untersuchten Schulen in unterschiedlichem Ausmaß auftritt. Die Meinung, welche häufig in den Medien vertreten wird, Gewalt an Schulen habe in den letzten Jahren drastisch zugenommen, kann empirisch nur eingeschränkt bestätigt werden, da diesbezüglich nur Querschnittstudien und keine Längsschnittuntersuchungen existieren (vgl. Fuchs 1997 in Weißmann 2003, 38). Knopf (1996, 28) dagegen gibt an, dass zwar kein genereller Anstieg der Gewalt an Schulen[6] zu verzeichnen ist, aber dennoch bezüglich einzelner Formen wie verbale und körperliche Gewalt eine Steigerung stattgefunden hat. Krüger u.a. (2003) schlussfolgern daraus, dass es wichtig ist zwischen einzelnen Schulformen als auch Einzelschulen zu differenzieren.
Bezüglich der auftretenden Formen von Gewalt sind verbale Attacken wie Beschimpfungen und Beleidigungen am häufigsten zu verzeichnen. Schubarth (1997, in Weißmann 2003) belegte dies in einer Studie, bei der ermittelt wurde, dass etwa die Hälfte aller SchülerInnen diese Form der verbalen Gewalt täglich beobachten. In Bezug auf physische Gewalt ist diese am häufigsten bei 13-15jährigen männlichen Jugendlichen zu beobachten. Schülerinnen zeigen mehr verbale oder psychische Formen der Gewalt (vgl. ebd.). Diesbezüglich nimmt die Gewalt von Gruppen gegenüber der Einzelgewalt tendenziell zu. Ebenfalls ist zu beobachten, dass nicht die Quantität gewaltförmigen Verhaltens zunimmt, sondern mehr die Qualität und Intensität. Ein deutlicher Beweis dafür war der Amoklauf von Erfurt 2002. Dennoch ist zu bemerken, dass die Mehrheit der SchülerInnen als nicht gewalttätig anzusehen ist. "Den harten Kern der Tätergruppen bilden etwa 3 - 4 % der Schüler." Zu diesem Ergebnis kam Melzer (1998, in Weißmann 2003, 32) in einer Studie in Sachsen und Hessen. Vorreiter in Bezug auf die Quantität der beobachteten Gewalt sind v.a. die Schulen für Lernbehinderte, gefolgt von Hauptschulen. Hier wurde überreinstimmend die höchste Rate an Gewalttaten verzeichnet (vgl. Weißmann 2003, 34; Knopf u.a. 1996, 24; Klewin u.a. 2002, 1095). Dies fand Tillmann (1999, in Weißmann 2003, 34) bei einer Untersuchung in Hessen heraus. Dennoch ist dies nicht unreflektiert zu generalisieren, da immer die Schule in ihrer spezifischen Konstellation von SchülerInnen (z.B. Quantität, Einzugsgebiet) und LehrerInnen, finanzieller Ausstattung sowie spezifischen innerschulischen Strukturen gesehen werden muss (vgl. Krüger u.a. 2003). Allerdings lässt die Tendenz der Akkumulation von Gewalttaten an Schulen für Lernbehinderte einen Hinweis auf die Auswirkungen des selektiven Schulsystems erkennen. Im Folgenden soll dieses Phänomen der Gewaltanhäufung aufgrund von Stigmatisierungsprozessen anhand der Betrachtung der Ursachen genauer herausgearbeitet werden.
Bei der Erforschung der Ursachen gewaltförmigen Handelns spielt die Perspektive, von der aus das Phänomen Gewalt betrachtet wird, eine entscheidende Rolle. Handelt es sich um eine medizinisch-biologische Blickrichtung, werden eher die genetischen Dispositionen, welche Gewalthandeln begünstigen, betrachtet. Wird eine mehr entwicklungspsychologische Herangehensweise gewählt, stehen unterschiedliche Prozesse der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Erfahrungen im Vordergrund. Daneben existieren weitere Ansätze, welche sich dem Phänomen Gewalt und dessen Ursachen nähern, wie soziologische, juristische, historische u.a. Möglichkeiten. Ich möchte v.a. die psychologischen und sozialen Hintergründe, welche gewaltförmiges Handeln begünstigen, betrachten. Der schulische Kontext soll dafür als Rahmen dienen.
Wie bereits in Kap. 4.1 beschrieben, bietet das Schulsystem zahlreiche Ausgangspunkte für die Entstehung von Konflikten unter Jugendlichen, auf welche diese u.a. mit Aggression oder Gewalt reagieren können. Zum einen liegen die Ursachen für die Entstehung dieser Konflikte im System Schule selbst, d.h. in dem äußeren Zwang, den Schule ausübt und der nicht in jedem Fall den Interessen und Bedürfnissen der SchülerInnen entspricht.
In Deutschland besteht eine 9jährige Schulpflicht. Darüber hinaus lernen die SchülerInnen meist in altershomogenen von außen determinierten Gruppen mit anderen SchülerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft zusammen (vgl. Klewin u.a. 2002, 1095). Der Unterricht wird oftmals stark durch die Lehrerin, den Lehrer vorbestimmt, sodass für die individuellen Fragen und Interessen der SchülerInnen meist nur wenig Raum bleibt. Dadurch wird häufig Langeweile unter den SchülerInnen hervorgerufen (vgl. Kiel 1993, zit. in Weißmann 2003, 62). Hier könnte Gewalt als eine Möglichkeit betrachtet werden, den Unterricht etwas "interessanter" zu gestalten, um auf diesen Missstand hinzuweisen.
Einen weiteren, sehr entscheidenden Faktor stellt die Leistungsbewertung dar, da über diese oftmals eine Unterscheidung in "gut" und "schlecht" vorgenommen wird (vgl. Kap. 4.2). In diesem Punkt sehe ich die zentrale Ursache für schulische Konflikte, da Leistungsbewertung nie ganz frei von Subjektivität ist. So kann dies einerseits aus der Sicht der SchülerInnen eine ungerechtfertigte Bewertung sein, andererseits unterliegen die SchülerInnen meist durch die Erwartungshaltung der Lehrerin, des Lehrers einer Etikettierung, welche sie versuchen durch kompensatorisches (Gewalt)verhalten auszugleichen. Es ist nachgewiesen, dass SchülerInnen mit schlecht bewerteten Schulleistungen häufiger gewalttätig werden (v.a. körperlich) als leistungsstärkere SchülerInnen (vgl. ebd.). Die Etikettierung oder gar Stigmatisierung durch die Lehrerin, den Lehrer könnte sich sowohl auf die Stellung der betroffenen SchülerInnen in der Klasse als auch auf ihr Selbstwertgefühl auswirken. So versuchen einige SchülerInnen durch gewalttätiges Verhalten sowohl ihr Ansehen in der Klasse als auch ihre Selbstachtung z.B. durch Angriffe auf schwächere SchülerInnen zu kompensieren. Gerade in der Phase der Pubertät, in der Jugendliche häufig in Konflikt mit sich selbst stehen, kann die Ausübung von Gewalt auch die eigene Unsicherheit ausgleichen helfen (Klewin u.a. 2002, 1081).
Einen dritten Ursachenkomplex bildet das soziale und familiäre Umfeld der SchülerInnen. Hier steht v.a. das Elternhaus der Jugendlichen im Vordergrund. Die hier praktizierten Erziehungsmethoden und das Toleranzverhalten gegenüber gewaltförmiger Lösungsstrategien bei Konflikten stellen einen wesentlichen Einflussfaktor auf das Verhalten Jugendlicher dar. Darüber hinaus spielt die zunehmende Perspektivlosigkeit in der Gesellschaft hinsichtlich der Zunahme von Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel eine entscheidende Rolle bei der Entstehung aggressiven und gewaltförmigen Verhaltens (vgl. Knopf, 26). Diese äußert sich sowohl im Verhalten der Eltern (mögliche zunehmende Aggression durch Frustration) als auch der Übernahme dieser Gedankenmuster und Ansichten durch die Jugendlichen selbst. Gewalt kann auch eine Antwort auf fehlende Anerkennung bzw. Ärger und Kummer zu Hause anzusehen (ebd.). Reinhard Kahl (2002) sieht in Phänomenen von Aggression und Gewalt einen "Heißhunger nach Anerkennung" (S. 42). Ein starkes Bedürfnis nach Zuneigung und Ansprache wird dabei signalisiert. Die Kompensation durch Aggression oder Gewalt stellt in meinen Augen einen Aufschrei dar. Jugendliche wollen damit sagen: "Wir sind da und wir haben auch was zu sagen, hört uns!"
Einen weiteren Aspekt in der Ursachenbetrachtung stellt der Einfluss der Peers dar (Weißmann 2003, 65ff.; Klewin u.a. 2002, 1081). Wie bereits in Kapitel 4.4 beschrieben, nimmt die Tendenz der Hinwendung zur Gleichaltrigengruppe in der Zeit der Pubertät zu. Dadurch gewinnt die Peer-Gruppe in diesem Alter an Relevanz. Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die Integration in einer Gruppe devianter Jugendlicher zu betrachten, da das Gruppenverhalten einer Art intern legitimierten Norm folgt, welche aber stark von der gesellschaftlichen Norm abweichen kann. So ist den Jugendlichen ihr verletzendes Verhalten meist nicht direkt bewusst.
Eine wesentliche Quelle gewaltförmigen Handelns ist darüber hinaus in der häufig verherrlichenden Gewaltdarstellung in den Medien zu suchen. Hier wird Gewalt häufig als wirksame bzw. anerkannte Möglichkeit dargestellt, um Konflikte zu lösen. Problematisch sind in dieser Hinsicht v.a. gewaltverherrlichende Computerspiele (vgl. Weißmann 2003, 69) anzusehen, da hier eine aktive Übernahme der gezeigten Verhaltensweisen durch die Identifikation mit den "Helden" erfolgen kann, wenn diese nicht oder nur unzulänglich durch Schule bzw. Elternhaus hinterfragt und reflektiert werden.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass gewaltförmiges Verhalten als destruktive Antwort auf bewusst oder unbewusst wahrgenommene Konflikte vor allem gewählt wird, wenn das Umfeld, sei es Schule, Elternhaus oder Peer-Gruppe, ebenfalls systemisch oder von ihren Einstellungen her direkte oder indirekte Formen von Missachtung, Demütigung oder Unterdrückung zeigen.
Die weitreichenden Folgen, welche durch gewaltförmiges Verhalten über die sichtbare Schädigung hinaus entstehen können, sollen hier exemplarisch an der Form der Mobbings als Form mangelnden Respekts bzw. Missachtung unter SchülerInnen dargestellt werden. Dieses Thema findet meines Erachtens nur ungenügend Beachtung an Schulen, kann sich aber durch die Dauer und Intensität der hier stattfindenden Gewalteinwirkung wesentlich einschneidender auf die Persönlichkeitsentwicklung von SchülerInnen auswirken als bloße physische Gewalt. Vor allem sollen hier Auswirkungen auf die Selbstachtung bzw. das Selbstwertgefühl von SchülerInnen betrachtet werden. Ein Schüler äußerte sich wie folgt dazu: "Gewalt ist nicht nur die sogenannte körperliche Gewalt, sondern auch die schlimmere seelische Gewalt. Schläge und Tritte kann man leichter wegstecken, als wenn andere einen ignorieren" (Roy, 16 Jahre in Krefft 2002, 13). Dies zeigt eine entscheidende Dimension von Mobbing unter SchülerInnen auf. Wenn einer/einem Jugendlichen von einer Gruppe von SchülerInnen während eines längeren Zeitraums die Beachtung und Anerkennung sowohl seiner Fähigkeiten als auch seiner Person verweigert wird, beginnt dieser, wenn ihm keine kompensatorischen Mittel bzw. unterstützende Freundschaften oder Peers zur Verfügung stehen, an sich selbst zu zweifeln. Es denkbar, dass die/der Jugendliche sich aufgrund dieser Selbstzweifel völlig in sich zurück zieht, um nicht weitere Angriffspunkte für Mobbingattacken zu bieten. Dies korreliert mit einem starken Absinken des Selbstwertgefühls und wird oftmals von Depressionen begleitet. Diese Entwicklung kann bis ins Erwachsenenalter fortbestehen (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 153, 198).
Mobbing bedeutet für die Betroffenen akuter Stress, da sie zu jeder Zeit neue Angriffe befürchten (vgl. Fliegel 2000, Renges 2003). Als besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Machtverteilung anzusehen. Das Opfer hat so kaum eine Chance, allein gegen die Mobber anzukommen. Auf der Seite der Täter steht der Wunsch nach Anerkennung und Erfolg gegenüber ihren MitschülerInnen (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 297). Opfer sind meist schwächere SchülerInnen, bei denen die Täter von vorn herein wissen, dass diese ihnen eindeutig unterlegen sind (vgl. ebd.). Das Paradoxe an dieser Situation ist aber, dass mobbende SchülerInnen früher oft selbst Mobbingopfer waren (vgl. Fliegel 2000). So liegt die Vermutung nahe, dass bei den Tätern die Angst besteht, wieder Opfer zu werden oder hier ein "Racheakt" vollzogen wird, der meist gegen die nächstschwächeren MitschülerInnen gerichtet ist. Wenn diese Phänomene zur gleichen Zeit auftreten, sprechen Flammer und Alsaker (2002, 297) auch von "Täter-Opfern" oder Olweus (2002, 64) von "herausfordernden Opfern". Diese besitzen aber ein wesentlich geringeres Ansehen als die "reinen" Täter.
Durch den akuten Stress, dem die Opfer unterliegen, kommt es auch oftmals zum Abfall der schulischen Leistungen, da die Konzentration stark auf das Verhalten der MitschülerInnen gelenkt ist. So kann ein Teufelskreis des Leistungsversagens entstehen, der bis zum Schulabsentismus oder gar bis hin zu Suizidgedanken führen kann (vgl. Renges 2003). Kritisch ist in diesem Zusammenhang auch das Verhalten vieler LehrerInnen zu sehen, die die Ausmaße des Mobbings meist nicht ausreichend ernst nehmen oder bewusst wegsehen (vgl. Olweus 2002, 56). Hier besteht dringender Aufklärungs- und Handlungsbedarf, da hier Grundrechte einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers auf Freiheit von Bedrängnis gefährdet sind. Daher sollen im Folgenden einige Maßnahmen der Prävention und Intervention, die derartigem Verhalten vorbeugen bzw. es verhindern helfen sollen, vorgestellt werden.
Prävention und Intervention von Gewalt sind in Anbetracht der derzeitigen Situation und den beschriebenen Folgen von Gewalt an Schulen sehr wichtige Aufgaben. Ich möchte an dieser Stelle nur überblicksartig auf Möglichkeiten der Vorbeugung bzw. der Eindämmung von Gewalt an Schulen eingehen, da ich in Kapitel 5.6 sehr konkret einige Möglichkeiten diskutieren werde und dies im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit als sinnvoller erachte als eine allgemeine Beschreibung möglicher Präventions- und Interventionsmaßnahmen.
Ziel von Gewaltprävention und -intervention sollte es nicht nur sein, Gewalt zu vermindern, sondern ebenfalls Formen des solidarischen und respektvollen Umgangs miteinander zu entwickeln und zu fördern. Hier sehe ich es als bedeutsam an, ein gemeinsames positives Ziel für das Etablieren gemeinschaftsfördernder Maßnahmen zu formulieren. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf einzelne SchülerInnen oder eine einzelne Klasse, sondern für die gesamte Schule. Exemplarisch soll hier das Interventionsprogramm von Olweus (2002, 69ff.) dargestellt werden. Ich habe dieses Programm ausgewählt, da es Ähnlichkeiten im Vergleich zur Arbeit mit dem Index für Inklusion, welcher in Kapitel 5 näher beschrieben werden soll, aufweist. Dreh- und Angelpunkt des Ansatzes von Olweus ist die Kooperation zwischen den einzelnen Handlungsebenen der Schule, d.h. zwischen Schulleitung und LehrerInnen, zwischen LehrerInnen und Eltern, zwischen LehrerInnen und SchülerInnen und zwischen SchülerInnen und SchülerInnen. Dadurch wird die gesamte Schule in das Programm mit einbezogen und es kann ein gemeinsames und ganzheitliches System der Suche nach Strategien zur Verminderung von Gewalt und zur Schaffung eines positiven Schulklimas etabliert werden. So finden diesbezüglich unterschiedliche Maßnahmen auf Schulebene, auf Klassenebene sowie auf der persönlichen Ebene statt (vgl. Olweus 2002, 69f.).
"Die Hauptziele des Interventionsprogramms sind, soweit wie möglich bestehende Gewalttäter/Gewaltopfer-Probleme innerhalb und außerhalb der Schulumgebung zu vermindern und die Entwicklung neuer Probleme zu verhindern - idealerweise vollständig zu beseitigen" (ebd., 70). Der Fokus liegt dabei auf der Verminderung direkter körperlicher Gewalt, aber auch subtilerer indirekter Formen, wie Mobbing sollen in den Blick genommen werden. Es ist wichtig, diese negativ formulierten Ziele auch durch positive Ziele zu ergänzen. Hier nennt Olweus "bessere Beziehungen zwischen Gleichaltrigen in der Schule zu erreichen und Bedingungen zu schaffen, unter denen sowohl Opfer als auch Täter besser miteinander auskommen und innerhalb und außerhalb der schulischen Umgebung zurechtkommen können" (ebd., 71).
Bedingung für die Vermeidung von Gewalt ist nach Ansicht von Olweus das Herstellen eines Problembewusstseins bei allen Beteiligten des Programms (LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen). Dazu gehört das Erkennen der aktuellen Verhältnisse an der Schule als problematisch sowie der Wille zur Veränderung dieser Situation.
Zu Beginn des Programms steht eine Fragebogenerhebung, welche die Spezifika der Schule in Hinblick auf gewaltförmiges Verhalten erfassen soll. Dieser Fragebogen wird von allen SchülerInnen und LehrerInnen ausgefüllt. Anschließend erfolgt die Auswertung des Fragebogens und die gemeinsame Planung konkreter Maßnahmen auf allen Schulebenen. Exemplarisch sollen mögliche Maßnahmen in Hinblick auf die Klassenebene dargestellt werden, da diese den hauptsächlichen Austragungsort für Gewalt unter SchülerInnen, v.a. auch bezüglich subtilerer Formen von Gewalt, wie Mobbing, darstellt.
Zum einen sollen hier Klassenregeln und Klassengespräche zur Verbesserung des Klassenklimas und zur Bekämpfung von Gewalt dienen und zum anderen konkrete Aktivitäten wie Klassenfahrten oder Ausflüge initiiert werden, um den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken und auszubauen. Darüber hinaus ist es entscheidend, auch durch die Wahl von Unterrichtsmethoden (kooperative Unterrichtsformen) und -inhalten Phänomene und Auswirkungen von Gewalt zu untersuchen und Konsequenzen für den Alltag zu erörtern. Ein ausgewogenes Maß an Lob und Strafe trägt dazu bei, die gewonnenen Erkenntnisse und aufgestellten Regeln zu verinnerlichen. Im Gegensatz zur weitverbreiteten Praxis, auffällige SchülerInnen durch Ermahnen zur Räson zu rufen, kann die gemeinsame Zielsetzung Gewalt zu vermindern und eine positive Lernkultur zu entwickeln, SchülerInnen viel stärker motivieren und sie darin bestärken eine Atmosphäre der Anerkennung zu schaffen.
So gesehen zeigt das Programm von Olweus durch die Gewährleistung der Anpassung an die jeweils herrschenden schulischen Verhältnisse und dem Ansatz der ganzheitlichen Veränderung von Schule wesentliche Stärken. Schwierigkeiten könnten mit der Frage der Autonomie und des Vertrauens der Lehrerin, des Lehrers in die Wirksamkeit dieses Programms und der damit verbundenen Verantwortung liegen.
Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Betrachtungsweise von Gruppenprozessen innerhalb heterogener Lerngruppen. Grundlage dieser Betrachtung bildet eine qualitative Längsschnittuntersuchung von Almut Köbberling und Wilfried Schley (2000) innerhalb eines Schulversuchs in Hamburg.[7] Mein Schwerpunkt soll in diesem Zusammenhang auf der Auswertung der untersuchten Gruppenprozesse aus Schülersicht bilden. Die Untersuchung von Köbberling und Schley gibt Aufschluss über die Entwicklung von Gruppen in Integrationsklassen der Sekundarschule im Rahmen der Evaluation eines Schulversuchs an Hamburger Gesamtschulen. Fokus der Untersuchung liegt auf der Betrachtung der Entwicklung von Strukturen bezogen auf die Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen[8]. Zu betrachtende Punkte bei der Darstellung der Gruppenprozesse sind:
-
Rolle von Heterogenität (besonders in Bezug auf die Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen)
-
Rolle der Pubertät
-
Stadien der Entwicklung
in Bezug auf Anerkennung und Missachtung bzw. Ausgrenzung.
Heterogene Lerngruppen sind Konstellationen von SchülerInnen mit unterschiedlichen kognitiven als auch sozialen und kulturellen Voraussetzungen, die sich gemeinsam Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen. Bei den von Köbberling und Schley (2000) untersuchten Lerngruppen handelte es sich um Integrationsklassen der Sekundarstufe I, in welchen SchülerInnen der 5. bis 10. Klasse unterrichtet wurden. In der Regel bestanden die Klassen aus jeweils 20 SchülerInnen, meist in der Zusammensetzung 17 + 3 von SchülerInnen mit und ohne diagnostizierten Beeinträchtigungen (sonderpädagogischem Förderbedarf). Den größten Anteil dabei bildeten die SchülerInnen mit Lernbeeinträchtigungen (46 %). Danach folgten SchülerInnen mit Beeinträchtigungen im kognitiven und motorischen Bereich mit jeweils 20 %. SchülerInnen mit starken körperlichen und intellektuellen Beeinträchtigungen wurden zur Gruppe der SchülerInnen mit motorischen Spezifika gezählt. So ergibt sich ein relativ heterogenes Bild der Schülerschaft, wenn man neben den SchülerInnen mit Förderbedarf auch den der SchülerInnen mit Migrationshintergrund betrachtet, welcher hier aber nicht angegeben wurde. Auch der Anteil verhaltensauffälliger SchülerInnen ohne festgestelltem Förderbedarf wurde hier nicht eindeutig erfasst.
Leitfaden des Schulversuchs waren die "Weiterführung von gewachsenen Lerngruppen" und "Offenheit für alle SchülerInnen" (ebd., 36). Zum Schulversuch ist darüber hinaus zu sagen, dass versucht wurde, bereits integrativ beschulte Kerngruppen aus der Grundschule zu übernehmen, was sich positiv auf den weiteren Zusammenhalt in der Sekundarstufe auswirkte (vgl. ebd., 37, 137).
Im Unterschied zu sich freiwillig formierenden Gruppen stellt die Lerngruppe eine von außen determinierte Gruppe dar. Daher lassen sich Gruppenprozesse von natürlich gebildeten Gruppen mit den in der Klasse stattfindenden Prozessen nur schwer vergleichen. Es lässt sich dennoch feststellen, dass homogene Gruppenbeziehungen den Gruppenzusammenhalt unterstützen. Options- und Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Jugendlichen sind jedoch eingeschränkt. Hingegen gestaltete sich in heterogenen Gruppenkonstellationen der Zusammenhalt beweglicher und der Options- und Interaktionsraum wird erweitert (vgl. Kühnel/Matuschek 1995, 129). Hierin ist eine wesentliche Chance für die Entstehung von Anerkennungsverhältnissen zu sehen, aber dennoch auch das Risiko der Zerklüftung der Gruppe bei zu hoher Flexibilisierung.
"Die Pubertät stellt für alle Heranwachsenden eine krisenhafte Phase der Neudefinition ihrer selbst und ihrer Beziehung zur Umwelt dar" (Köbberling/Schley 2000, 44). "Jugendliche mit Beeinträchtigungen werden aufgrund ihrer eingeschränkten Möglichkeiten zur selbstständigen Bewältigung von Lebenssituationen eine Zeit erhöhter Belastungen erleben und aufgrund ihrer Abweichung von sozialen Erwartungen u.U. schwer zu einer positiven Identität finden können. Sie sind daher als besondere Risiko-Gruppe zu betrachten" (ebd. in Anlehnung an Markowetz 1997).
Dies sollte allerdings nicht generalisiert werden, denn wie bereits in Kap. 4.3.3.2 beschrieben, handelt es sich bei der Bewältigung von Problemen oder Krisen immer um die persönliche Bewertung von Erlebtem in Verbindung mit sozialen Ressourcen. Daher ist es entscheidend ein Netzwerk der Unterstützung unter den Jugendlichen aufzubauen und zu festigen. Gerade in der Pubertät als Phase der Selbstdefinition und Identitätsentwicklung sind positive und anregende Feedbacks nicht nur durch die Anerkennung ihrer Leistungen, sondern darüber hinaus durch den Respekt vor ihrer Persönlichkeit für alle SchülerInnen wichtig.
Einen weiteren entscheidenden Aspekt bilden Bewertungs- und Leistungsmaßstäbe in Form von Vergleichen untereinander durch die Setzung von Wertmaßstäben. Hier kommt es durch den hohen Grad an Verschiedenartigkeit häufig zu Konflikten und Auseinandersetzungen innerhalb der Klasse. Daher sollten LehrerInnen darauf achten, Möglichkeiten des Ansatzes unterschiedlicher Bezugssysteme ohne Gefährdung des Selbstwertes durch Akzeptanz von Unterschiedlichkeit zu gewährleisten.
Die Entwicklung von Anerkennung bzw. Ausgrenzung oder Missachtung (aus Sicht der SchülerInnen) findet in drei wesentlichen Phasen statt.
1. Phase: Klasse 5 + 6 - "sonnige Verhältnisse"
Aus den Untersuchungen von Köbberling und Schley ergab sich, dass der Zusammenhalt in der ersten Phase der Sekundarstufe I durch Neuorientierung geprägt war. "Mit neu hinzugekommenen SchülerInnen und neu gebildeten, bislang völlig unerfahrenen Teams beginnen neue Prozesse der Kontaktaufnahme, der Selbstdefinition, der Bildung einer sozialen Ordnung" (ebd., 136f.).
Laut der beiden AutorInnen war es, besonders für die SchülerInnen mit Beeinträchtigungen wichtig, einen gemeinsamen Klassenwechsel von der Grundschule in die Sekundarstufe zu vollziehen. Dadurch blieben für die SchülerInnen sehr bedeutsame vertraute Gruppenstrukturen und Freundschaften erhalten, welche "für viele die wichtigsten und verlässlichsten Bezugspersonen auch in ‚Krisenzeiten'" (ebd.) darstellten.
Auf der anderen Seite wirkte das Hinzukommen neuer SchülerInnen anregend und gleichzeitig entlastend in Bezug auf alte Rollenstrukturen.
Darüber hinaus spielten äußere Determinanten in Form der Gestaltung des Klassenraumes (z.B. Kuschelecke) sowie gemeinsame unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten, z.B. Gruppenarbeit und Klassenfahrten, eine ebenfalls prägende Rolle hinsichtlich des Zusammenhalts innerhalb der Klasse.
2. Phase: 7 + 8 - "Krise"
Bereits am Ende der sechsten Klasse beginnt eine Phase der sozialen Ausdifferenzierung im Zuge der Neuorientierung nach außen. Der soziale Explorationsdrang führt zur Ausweitung der Bildung von Freundschaften und Gruppen über den Klassenverband hinaus. Dadurch kristallisieren sich spezifische eigene Interessen heraus, welche für die Bildung von Gruppen relevant sind. Gemeinsame Interessen führen ebenfalls zur Bestätigung der eigenen Person und zu Prozessen der Solidarisierung, oftmals auch über diese Interessen hinaus. Im Zuge dieser Neuorientierung, mit welcher häufig auch eine Neuausrichtung der eigenen Persönlichkeit verbunden ist, findet eine Reduktion der Kontakte zwischen SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen statt. Es kommt zu einer Spaltung der Gruppen. SchülerInnen mit Beeinträchtigungen rücken häufig klassenübergreifend näher zusammen, verabreden sich und unternehmen gemeinsame Freizeitaktivitäten. Dennoch sind sie häufig durch die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen von der Klasse isoliert und "treten eher an den Rand des sozialen Geschehens" (ebd.). In den Klassen 7 + 8 kommt es zur zunehmenden Leistungsorientierung und äußerer Differenzierung durch ein Kurssystem (vgl. Haß 1995, in ebd., 138). Dies führte teilweise zur Isolation von SchülerInnen mit Beeinträchtigung, v.a. wenn Unterschiede im Verhalten, den Interessen und der damit verbundenen Kommunikation auftreten. Im Zuge der stärkeren Leistungsorientierung findet darüber hinaus eine stärkere Individualisierung und damit auch Interessenverlagerung in Richtung schulische Leistungssteigerung statt, wobei jeder auch ein Stück weit an sein eigenes Fortkommen denkt. Eine weitere Auswirkung der Leistungsorientierung ist nach Völz (1996, in Köbberling/Schley 2000, 138) die Einschränkung sozialer Freiräume als Gelegenheiten für Sozialkontakte durch die Einteilung der SchülerInnen in Kurse. Dadurch findet eine Abnahme der Kontakte zu SchülerInnen mit Beeinträchtigungen statt. Es kommt ebenfalls zu einem Wandel im Bewusstsein der SchülerInnen. Eine Ausdifferenzierung der eigenen Interessen und der Wandel von eigenen Normen und Werten trägt dazu bei, dass vorerst eine bewusste Abgrenzung zu dem erfolgt, was den eigenen Vorstellungen nicht entspricht. Diese Vorstellungen zeigen Auswirkungen auf die Sichtweise des eigenen Körpers. Sie können sich durch Schamgefühle und zunehmende körperliche Bewusstheit äußern. Als Folge des unterschiedlichen Umgangs mit Körperlichkeit kann es ebenfalls zu Gefühlen der Befremdung oder gar des Ekels führen.
Im Übergang vom Kind zum Erwachsenen findet die Orientierung an neuen Rollenbildern eine statt. Es kommt zu einer starken Distanzierung von alten kindlichen Rollen und Verhaltensweisen. SchülerInnen mit Beeinträchtigungen gehen hier oftmals andere Wege, verharren oftmals länger in Spielphasen als ihre Klassenkameraden. Dies führt häufig zu Interessenkonflikten oder zur Abgrenzung von SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen. Es wurde hingegen beobachtet, dass SchülerInnen mit Beeinträchtigungen, welche sich an die Interessen der MitschülerInnen anpassen, eine höhere Akzeptanz von diesen erhalten.
Durch das zunehmende Bewusstsein hinsichtlich der eigenen Rolle und Stellung innerhalb und außerhalb der Klasse findet eine Sensibilisierung für die Wahrnehmung anderer sozialer Rollen statt; Unterschiede werden hier u.U. sehr kritisch betrachtet und auf wahrgenommene Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang werden die SchülerInnen mit Beeinträchtigungen meist sehr eifersüchtig oder gar zornig bezüglich ihrer Sonderrolle betrachtet (vgl. Boban/Mathies 1994 in ebd., 139). Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit wird hier deutlich, welches bis zum Ende der Schulzeit oftmals Diskussionsstoff darstellt.
Die Auseinandersetzung mit Gleichheit und Verschiedenheit findet in einem sehr intensiven Maße statt. Es spiegelt die Suche nach der eigenen Identität wider - das Bedürfnis nach Zugehörigkeit einerseits und nach Abgrenzung andererseits (vgl. Kap. 4.4). "Manche Jugendliche haben zeitweise große Schwierigkeiten, Abweichungen von den Regeln und Werten der eigenen Bezugsgruppe zu akzeptieren; sie meiden die Nähe behinderter SchülerInnen, insistieren vielleicht auf der Betonung des Trennenden, verhalten sich beleidigend und kränkend" (Köbberling/Schley 2000, 140).
Von einigen SchülerInnen erhielten die MitschülerInnen mit Beeinträchtigungen trotz der fremd empfundenen Unterschiede Anerkennung. Gründe dafür könnten im selbst empfundenen Kampf um Anerkennung liegen.
3. Phase: 9 + 10 - "Reintegration"
Zum Ende der Schulzeit konnte eine Reintegration von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen in die Klassengemeinschaft festgestellt werden. Zu erkennen ist, "dass nach der Phase turbulenter Differenzierungsprozesse Beruhigung, Annäherung und Entspannung eintritt" (ebd., 141).
Dies hat einen entscheidenden Einfluss auf das Klassenklima, v.a. hinsichtlich des neugewonnenen Zusammengehörigkeitsgefühls und der Akzeptanz unter den SchülerInnen. Maßgeblich ist für alle das Gefühl, einbezogen, akzeptiert und sozusagen in der gemeinsamen Schule ‚zu Hause' zu sein" (ebd.). Gründe für diese Reintegration sind zum einen in der gestiegenen Bewusstheit und der ausdifferenzierten Reflexionsfähigkeit zu suchen. Leistungsunterschiede können so leichter relativiert werden und die Sonderstellung der SchülerInnen mit Beeinträchtigungen rückt durch die Reflexion der eigenen Person, das Nachdenken über Behinderung und die damit verbundenen Schwierigkeiten in ein neues Licht. Zum anderen ist diese Zeit in hohem Maße durch Gedanken an Zukunft und Neuorientierung im Anschluss an die Schule geprägt. So finden sich die SchülerInnen im Bewusstsein der baldigen Trennung noch einmal zusammen und denken darüber nach, was sie an Positivem, Freude und Spaß in der Klassengemeinschaft gehabt haben.
Köbberling und Schley (2000, 142) haben den sozialen Prozess, der über die Jahre stattgefunden hat, sehr treffend in Form einer Zwiebel dargestellt (Abb. 3):
"Auf die Phase der Grundlegung eines tragenden Wurzelbodens in Jahrgang 5/6 folgt die der Differenzierung mit den Kennzeichen des spannungsreichen Auseinanderdriftens, die jedoch in eine Phase erneuter Annäherung einmündet; Reintegration auf einer veränderten Basis wird möglich: Zugewandtheit, Wärme, Humor und Verständnis kennzeichneten in der Abschlussphase den Umgang miteinander" (ebd.).
"Basis für das erneute Zusammengehörigkeitsgefühl ist nun allerdings ein Bewusstsein für all die Verschiedenheiten, die durchlitten, erkämpft und behauptet wurden" (ebd.).
Nun ist wieder eine stärkere Zusammenarbeit möglich. Die Akzeptanz und Toleranz gegenüber der Andersartigkeit der MitschülerInnen mit Beeinträchtigungen ist gestiegen.
Allerdings wurde ebenfalls festgestellt, dass v.a. SchülerInnen mit kognitiven Beeinträchtigungen kaum persönliche Freunde unter den "nichtbehinderten" SchülerInnen fanden. Dies war meist nur außerhalb der Klasse möglich. Hingegen funktionierte die Integration ausnahmslos für SchülerInnen mit leichteren Beeinträchtigungen, da diese häufig nicht als "behindert" erlebt wurden. Daraus wird deutlich, dass Beeinträchtigungen (z.B. Lernbeeinträchtigungen), welche nicht offensichtlich sind, mehr toleriert werden als sichtbare oder spürbare Beeinträchtigungen. Dies ging auch aus den Aussagen der SchülerInnen der IGS Köln-Holweide hervor (s. auch Kap. 5.7).
Darüber hinaus erlebten es viele SchülerInnen als Vorteil, "Sicherheit und Toleranz im Umgang mit behinderten Menschen erworben zu haben und darüber hinaus insgesamt mehr Hilfsbereitschaft, Offenheit und Fähigkeit zur Auseinandersetzung untereinander entwickelt zu haben" (ebd., 145). Am Ende steht die Erfahrung, einer sinnvoll miteinander verbrachten Lebenszeit und "(...) ganz wichtig - die Erfahrung, viel Spaß mit einander gehabt zu haben" (ebd.).
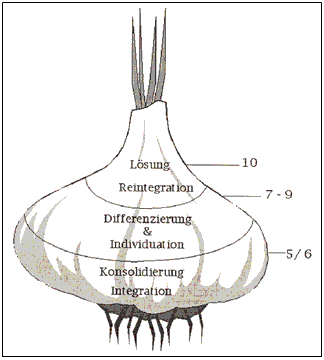
Abb. 3: Der Prozess von "Integration und Differenzierung" Quelle: Köbberling/Schley 2000, 142
Aus den geschilderten Erfahrungen geht hervor, dass Heterogenität durchaus positiv in Bezug auf die Entwicklung von Respekt untereinander wirken kann. Allerdings ist es wichtig im schulischen Kontext sensibel und einfühlsam auf die aktuellen Bedürfnisse und spezifischen Entwicklungsschritte der SchülerInnen einzugehen und sie in ihrer Autonomie zu unterstützen. Dennoch konnte herausgestellt werden, dass das Klima in der Klasse entscheidend auf das Gewähren von Anerkennung bzw. Prozesse der Missachtung Einfluss nimmt (vgl. Kap. 4.1).
Es stellt sich am Ende dennoch die Frage, ob diese Prozesse der Abspaltung und der Suche nach Sicherheit und Schutz durch die Peers eine Besonderheit heterogener Lerngruppen darstellt. Vielmehr gilt es zu erörtern, inwiefern die Abspaltungs- und Reintegrationsprozesse auch in homogeneren Lerngruppen (rein homogene Lerngruppen wird es wohl nie geben - vgl. Sander 2004, 243) stattfinden. Zu vermuten wäre auch, dass es sich bei diesen Prozessen um eine nötige psychosoziale Entwicklung in der Adoleszenz handelt (vgl. Kap. 4.4). Um dies empirisch zu belegen, müssten allerdings Vergleichsstudien innerhalb einer Schule (Vergleich heterogene Lerngruppe mit homogenerer Lerngruppe) durchgeführt werden. Darüber hinaus kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen und aus Gesprächen mit SchülerInnen der IGS Köln-Holweide (welche nicht in GU-Klassen waren) sagen, dass in Klassen, welche ein geringeres Maß an Heterogenität aufweisen, ebenfalls starke Abspaltungsprozesse zu beobachten sind. Dies könnte auf eine Art Konkurrenzverhalten (vgl. Kap. 4.4.3) unter den SchülerInnen zurückzuführen sein. Im Gegensatz dazu ist zu vermuten, dass in Klassen mit einem höheren Maß an Homogenität die Bereitschaft zur Solidarisierung weniger ausgeprägt ist. Hier spielt Rationalität und das Fehlen von im gemeinsamen Miteinander erworbenen sozialen Kompetenzen eine entscheidende Rolle bei der Abgrenzung von Gruppen bzw. der Isolierung einzelner MitschülerInnen.
Es stellt ein sehr bedeutsames Forschungsanliegen dar, soziale Prozesse in heterogenen Lerngruppen zu untersuchen und deren Ergebnisse in Bezug auf die pädagogische Praxis zu reflektieren. Dennoch empfand ich es als schwierig, lediglich die Gruppe von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen, sozusagen als "Risikogruppe" herauszugreifen, da heterogene Lerngruppen nicht nur das Verhältnis zwischen SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen ausmachen. Denkbare Facetten wären in diesem Zusammenhang die Integration von SchülerInnen mit Migrationshintergrund bzw. auch sehr unauffällige ruhige SchülerInnen und deren soziale Entwicklung im Vergleich zur Gruppe zu betrachten. So entstand ein Bild von einer Gruppe, in der SchülerInnen mit Beeinträchtigungen eine besonders zu beachtende und entwicklungsschwierige Rolle spielen. Sie sind besonders in den Fokus der Betrachtung gerückt. Es wäre dann zu fragen, ob nicht Menschen ohne diagnostizierte Beeinträchtigungen ein ähnliches Recht auf derartige Beachtung haben und im Gegenzug SchülerInnen mit Beeinträchtigungen für sich auch zeitweise beanspruchen können, frei von ständiger Beobachtung und Begutachtung zu sein.
[4] In der Literatur werden unterschiedliche Bezeichnungen für die Gleichaltrigengruppe verwendet. Ich verwende hier einheitlich den Begriff Peer-Gruppe, ausgenommen der Zitate, in denen die ursprünglich im Text vorkommende Bezeichnung verwendet wird.
[5] Soziale Identität wird folgendermaßen definiert: "Aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und aus der Beschaffenheit der Beziehungen dieser zu anderen sozialen Gruppen wird die soziale Identität eines Individuums bestimmt (...)" (Mummendey 1985, zit. nach Eckert u.a. 2000, 18)
[6] Knopf untersuchte Schulen in Sachsen-Anhalt
[7] Bei dieser Untersuchung handelte es sich um eine dialogische Entwicklungsbegleitung von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen (v.a. kognitive; von Köbberling und Schley als geistige Behinderung bezeichnet) aus drei Jahrgängen des Schulversuchs, welche durch die jeweiligen Teams wesentlich mitbestimmt wurden (Auswahl des Schülers und Einbringung konkreter Fragestellungen - ebd., 45)
[8] Köbberling und Schley (2000) verwenden hier durchgehend den Begriff der Behinderung, den ich aber als sehr etikettierend empfinde und deshalb durchgehend den Begriff der Beeinträchtigung gebrauche.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Inklusive Schule - eine begriffliche Annäherung
- 5.2 Phasen der Entwicklung von der ‚Exklusion' zur ‚Vielfalt als Normafall'
- 5.3 Qualitative Weiterentwicklung der Schule von der Integration zur Inklusion
- 5.4 Der Index für Inklusion und dessen Übertragung auf die vier Anerkennungskategorien (vgl. Kap. 3.3.2)
- 5.5 Fazit
- 5.6 Die IGS Köln-Holweide - eine inklusive Schule im Hinblick auf wechselseitige Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen?
- 5.7 Aussagen von SchülerInnen des 10. Jahrgangs zu Anerkennungsverhältnissen unter Jugendlichen
- 5.8 Schlussfolgerung
In diesem Kapitel soll die dritte Dimension dieser Arbeit - die inklusive Schule - in den Blick genommen werden. Im Vordergrund meiner Betrachtungen soll dabei die Frage stehen, inwiefern Schule, verstanden als eine "Schule für alle" (Boban/Hinz 2003, 3), eine gute Basis für Toleranz und Anerkennung v.a. unter SchülerInnen darstellen kann. Dafür soll im ersten Schritt der Begriff der inklusiven Pädagogik geklärt und einzelne Entwicklungsstufen auf dem Weg dahin erläutert werden. In einem zweiten Schritt werden auf der Grundlage des Index für Inklusion (ebd.) Indikatoren für Respekt unter SchülerInnen herausgearbeitet und anschließend exemplarisch auf die IGS Holweide übertragen und ausgewertet. Grundlage dieser Auswertung bildet das Schulprogramm[9], die von Ratzki u.a. erarbeiteten Grundlagen des Team-Kleingruppen-Modells (TKM) sowie die Schülerbefragung vom Juli 2004. Anschließend werden diese allgemeinen Ergebnisse auf der Basis von Gruppendiskussionen einer Klasse des 10. Jahrgangs analysiert. Die methodischen Grundlagen der Gruppendiskussionen wurden bereits in Kap. 3 erläutert.
Der Begriff Inklusion wird international als auch im deutschsprachigen Raum sehr unterschiedlich verwendet (vgl. Sander 2004, Hinz 2002). Dazu werde ich an erster Stelle betrachten, was Inklusion nicht ist, um anschließend mit Hilfe einer begrifflichen Abgrenzung von Sander (2004, 240-244; 2004a, 11-22) den Terminus Inklusion näher zu beschreiben.
Inklusion ist nicht...
-
die Aussonderung von SchülerInnen, die aufgrund verschiedener als störend empfundener Auffälligkeiten in ihrer Bewegung, ihrem Denken und Handeln eingeschränkt sind und dadurch nicht den gleichen Unterrichtsstoff im selben Tempo absolvieren können wie die "normalen" SchülerInnen oder den Unterricht stören oder einen hohen Pflegebedarf aufweisen oder, oder... und deshalb die anderen SchülerInnen vom Lernen abhalten.
-
ein System der starken Leistungsdifferenzierung und Hervorhebung trennender und hemmender Unterschiedlichkeiten.
-
die Etikettierung von SchülerInnen durch die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs.
-
Andersartigkeit als Problem oder gar Bedrohung.
So gilt es nun zu betrachten, was Inklusion ist, wenn die aufgeführten Punkte dem Konzept der inklusiven Pädagogik widersprechen.
Hierzu gibt es unterschiedliche Sichtweisen, welche durch Sander (2004, 2004a) dargestellt werden.
-
Gleichsetzung von Integration und Inklusion, "die Wörter sind gleichbedeutend und austauschbar" (Sander 2004a, 11). So gesehen würde eine begriffliche Neuorientierung kaum einen Sinn machen (vgl. Hinz 2002, 254)
-
Von Fehlformen bereinigte optimierte Integration, "Schwächen der real existierenden (schulischen) Integrationspraxis (z.B. Integration als Synonym für Aussonderung - vgl. Sander 2004, 241, K.F.) werden bei Inklusion systematisch vermieden" (Sander 2004a, 11).
-
Inklusion als optimierte und umfassend erweiterte Integration; auf diese Form soll im Folgenden etwas näher eingegangen werden.
"Inklusion als optimierte Integration verändert nach und nach den Unterricht, weil die Unterschiedlichkeit der Kinder nicht mehr als Störfaktor betrachtet wird, sondern als Ausgangslage und auch als Zielvorstellung der pädagogischen Arbeit Die Akzeptanz der Unterschiede steht im Zentrum" (Sander 2004, 242).
Um den qualitativen Unterschied zwischen Integration und Inklusion tiefer zu verstehen, wird nun ein Blick in die Entwicklung des Schulsystems in Bezug auf die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen geworfen. Ausgehend von Überlegungen des Schweizer Heilpädagogen Alois Bürli (1997, zit. in Sander 2004a, 12), der im Konzept der Inklusion "eine gänzlich neue historische Entwicklungsphase" (ebd.) sieht, hat Sander (ebd.) in fünf Phasen der Entwicklung des deutschen Schulwesens unterschieden[10]. Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden - kurz, da hier der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung in Richtung inklusive Pädagogik im Vordergrund stehen soll. Dennoch ist es sehr bedeutsam für die Analyse der derzeitigen Situation bzw. die Planung erster Schritte, die historische Entwicklung in den Blick zu nehmen.
Exklusion:
"Behinderte Kinder waren bzw. sind von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen" (ebd.). Diese Praxis war bspw. im 18. Jahrhundert üblich, ist es in einigen Bundesländern (meist bei schwerer Mehrfachbehinderung) aber noch heute (vgl. Sander 2004a, 14).
Separation:
"Behinderte Kinder besuchen eigene Bildungseinrichtungen (Sonderschulen)" (Sander 2004, 242). In Deutschland wird dies seit Ende des 19. Jh. praktiziert. Die meisten SchülerInnen mit Beeinträchtigungen besuchen heutzutage diese Einrichtungen. Der Anteil der integrativ beschulten Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen liegt lediglich bei ca. 14 % (vgl. Sander 2004a, 14).
Integration:
"Behinderte Kinder können mit sonderpädagogischer Unterstützung Allgemeine Schulen besuchen" (Sander 2004, 243). "Die Integrationsphase hat inzwischen in fast allen Bundesländern begonnen (...) und hat in einigen Ländern (...) die Quote von 20% der behinderten Schülern und Schülerinnen überschritten" (Sander 2004a, 14).
Inklusion:
"Alle behinderten Kinder besuchen wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen Allgemeine Schulen, welche die Heterogenität ihrer Schüler und Schülerinnen schätzen und im Unterricht fruchtbar machen" (Sander 2004, 243). Nach Sander (ebd.) ist das deutsche Schulsystem noch weit entfernt von dieser Stufe.
Vielfalt als Normalfall:
"Inklusion wird überall zur Selbstverständlichkeit, der Begriff Inklusion kann daher in einer ferneren Zukunft vergessen werden" (ebd.). Bis es soweit ist, werden wohl noch einige Jahrzehnte vergehen müssen. Dennoch gilt es als ein langfristiges Entwicklungsziel, eine Art Nordstern, an welchem sich die derzeitig praktizierte Pädagogik orientieren kann - mit dem Bewusstsein: Bereits heute können wir erste Schritte auf diesem Weg gehen.
Im nächsten Schritt soll die qualitative Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion nochmals differenziert dargestellt werden, um die Weiterentwicklung gerade zwischen diesen beiden Stufen zu verdeutlichen.
Hinz (2002; 2004) hat die wesentlichen Unterschiede zwischen einer integrativen und einer Praxis auf Grundlage dieses Verständnisses von Inklusion tabellarisch dargestellt:
Tab. 1: Praxis der Integration und der Inklusion Quelle: Hinz (2002, 359)
|
Praxis der Integration |
Praxis der Inklusion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Darstellung zeigt einen wesentlichen qualitativen Sprung in Richtung Barrierefreiheit, Teilhabe von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen und der Entwicklung eines demokratischen Systems, in dem Wertschätzung und Autonomie des einzelnen sowie der einzelnen Ebenen stärker entwickelt werden können. Aus der Tabelle geht hervor, dass sich nicht nur die einzelne Schule ändert, sondern das gesamte System einem Wandel vollzieht. So wird die Koexistenz bzw. Kombination von Sonderschulen und Allgemeinen Schulen stark durch die inklusionistische Denkweise in Frage gestellt. Es geht also nicht darum, Systeme ineinander fließen zu lassen, sondern grundlegend zu verändern. Das gilt sowohl für das Sonderschulwesen als auch für das bestehende System der Allgemeinen Pädagogik neu zu gestalten. Ziel dieser Veränderung ist es, die bestehenden, größtenteils immer noch auf Separation ausgerichteten Strukturen (vgl. Sander 2004a, 14) neu zu überdenken. Weiterhin sollen Akzeptanz und Wertschätzung aller Mitglieder des Systems forciert als auch innovative Möglichkeiten der Teilhabe am gemeinsamen Leben und Lernen über die Grenzen des Schulsystems hinaus initiiert werden. Dieses Ziel haben sich Pädagogen und Integrationsforscher[11] gesetzt, in dem sie einen Index für Inklusion erarbeitet haben. Dieser soll im Folgenden vorgestellt werden. Einige der darin enthaltenen Indikatoren stellen die Grundlage meiner Betrachtungen der IGS Köln-Holweide im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Entstehung von wechselseitiger Anerkennung dar.
In den USA angeregt, in Großbritannien[12] konzipiert und veröffentlicht und anschließend in über 13 andere Sprachen übersetzt bzw. adaptiert (vgl. Hinz 2004, 247), stellt der Index für Inklusion eine Möglichkeit der Selbstevaluation von Schulen dar. Die hier verwendete Analysegrundlage bildet die von Ines Boban und Andreas Hinz (2003) adaptierte deutsche Version des Index. Der Index für Inklusion bietet sowohl eine Zusammenstellung von Indikatoren, welche eine inklusive Schule kennzeichnen als auch Anregungen für die Arbeit mit dem Index - dem Index-Prozess. So gesehen stellt der Index keinen Test dar, der ergibt, inwiefern eine Schule als inklusiv zu bezeichnen ist oder nicht, sondern bietet viel mehr die Möglichkeit, sich anhand der Indikatoren zu orientieren und zu überlegen, welche Schritte der Veränderung an der eigenen Schule möglich bzw. nötig sind, um die uneingeschränkte Teilhabe aller SchülerInnen am Leben und Lernen zu gewährleisten (vgl. Boban/Hinz 2003, 3). Grundsätzlich ist der Index auch kein von höherer Instanz oktroyiertes Evaluationsinstrument, sondern jede Schule entscheidet von der Basis (Lehrerschaft, Elternschaft, Schülerschaft) ausgehend, ob und inwiefern sie mit dem Index arbeiten möchte und welche Indikatoren im Vordergrund der Betrachtung stehen.
"Der Rahmen für die Bestandsaufnahme und die Entwicklung von Zielperspektiven der inklusiven Schule wird durch drei miteinander verbundene Dimensionen gebildet, mit denen das Schulleben erforscht wird: Es gilt inklusive Kulturen zu schaffen, inklusive Strukturen zu etablieren und inklusive Praktiken zu entwickeln" (ebd., 14). Dies soll die folgende Darstellung (Abb. 4) aus dem Index (S. 15) verdeutlichen.
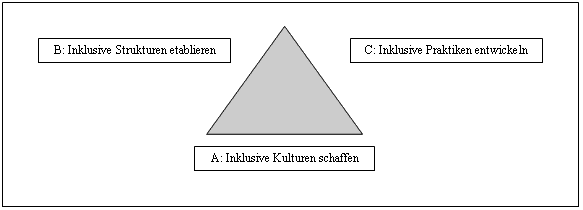
Abb. 4: Die drei Dimensionen des Index Quelle: ebd., 15
Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen
Bereich A 1: Gemeinschaft bilden
Bereich A 2: Inklusive Werte verankern
Basis für die Entstehung einer inklusiven Schule bildet die Schaffung einer inklusiven (Schul)kultur. "Diese Dimension zielt darauf, eine sichere, akzeptierende, zusammen arbeitende und anregende Gemeinschaft zu schaffen, in der jede(r) geschätzt und respektiert wird - als Grundlage für die bestmöglichen Leistungen aller" (ebd., 15). Es geht hierbei um die Entwicklung inklusiver Werte und deren Vermittlung an alle Mitglieder und Gremien der Schule. "Diese Prinzipien und Werte innerhalb inklusiver Schulkulturen sind leitend für alle Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken, so dass das Lernen aller durch einen kontinuierlichen Prozess der Schulentwicklung verbessert wird. Eine inklusive Schulkultur wird getragen von dem Vertrauen in die Entwicklungskräfte aller Beteiligter und dem Wunsch, niemanden je zu beschämen" (ebd.).
In dieser Dimension liegt eine Hauptwurzel für die Ausbildung von Anerkennungsverhältnissen an der Schule - sowohl zwischen den einzelnen Ebenen als auch innerhalb der Ebenen (vgl. Kap. 2.4). Daher soll hierin der Schwerpunkt meiner Analyse liegen. Dabei werden zum einen gemeinschaftsfördernde Aspekte (s. einzelne Indikatoren) untersucht und zum anderen das Programm der Schule (Köln-Holweide) als Grundlage für angestrebte Wertstrukturen in den Blick genommen.
Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren
Bereich B.1: Eine Schule für alle entwickeln
Bereich B.2: Unterstützung für Vielfalt organisieren
Allein die Postulierung von Werten genügt nicht, um eine inklusives System von Schule zu etablieren. Dazu braucht es konkrete Strukturen, die auf der Basis eines inklusiven Verständnisses von Schule entwickelt werden. Diese "erhöhen die Teilhabe aller SchülerInnen und KollegInnen von dem Moment an, indem sie in die Schule hineinkommen, sie begrüßen alle SchülerInnen der Gegend und verringern Tendenzen zu Aussonderungsdruck (...). Dabei wirken alle Aktivitäten als Unterstützung, die zur Fähigkeit einer Schule beitragen, auf die Vielfalt der SchülerInnen einzugehen. Alle Arten der Unterstützung werden auf inklusive Prinzipien bezogen und in einen einzigen Bezugsrahmen gebracht" (ebd.).
Im Zusammenhang mit der zweiten Dimension soll die Struktur der Schule im Hinblick auf ihre Unterstützung bzw. Hemmung der Entstehung und Wertschätzung von Vielfalt betrachtet werden. Der Schwerpunkt meiner Analyse liegt darin, Strukturen zu erfassen, die bezüglich der Entstehung von gegenseitiger Achtung und Anerkennung unterstützend wirken bzw. einen Beitrag zu gewaltfreier Lösung von Konflikten leisten.
Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln
Bereich C.1: Lernarrangements organisieren
Bereich C.2: Ressourcen mobilisieren
Diese Dimension steht in Zusammenhang mit der Realisierung von Praktiken, die "inklusive(n) Kulturen und Strukturen der Schule widerspiegeln" (ebd., 16). Hier geht es v.a. um die Entwicklung von Unterrichtspraktiken, bei denen die SchülerInnen angeregt werden, "aktiv auf alle Aspekte ihrer Bildung und Erziehung Einfluss (zu) nehmen" (ebd.). Weiterhin werden gemeinsam Ressourcen für die Förderung der Teilhabe aller Mitglieder der Schule gefunden. Sowohl persönliche als auch materielle Ressourcen innerhalb und außerhalb des schulischen Kontexts werden hierbei mobilisiert und fruchtbar für die Gemeinschaft gemacht.
Der Schwerpunkt meiner Analyse soll hierbei v.a. auf der Organisation von Lernarrangements und deren Bedeutung für die Entstehung und Förderung wechselseitiger Anerkennung liegen.
Auf Grund der Fülle an Indikatoren wurden für jeden Bereich exemplarisch 1 bis 3 Indikatoren herausgegriffen, die mit der Entstehung wechselseitiger Anerkennung direkt oder indirekt in Verbindung stehen.
Tab. 2: Dimensionen, Bereiche, Indikatoren im Hinblick auf Anerkennung unter SchülerInnen Eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Boban/Hinz (2003, 17)
|
Dimensionen |
Bereiche |
Indikatoren [a] |
|
A Inklusive Kulturen schaffen |
A.1 Gemeinschaft bilden |
1. Jede(r) fühlt sich willkommen. 2. Die SchülerInnen helfen einander. 3. Die MitarbeiterInnen arbeiten zusammen. |
|
A Inklusive Kulturen schaffen |
A.2 Inklusive Werte verankern |
2. MitarbeiterInnen, SchülerInnen, Eltern und schulische Gremien haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion. 6. Die Schule bemüht sich, alle Formen der Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren. |
|
B Inklusive Strukturen etablieren |
B.1 Eine Schule für alle entwickeln |
5. Allen neuen SchülerInnen wird geholfen, sich in der Schule einzugewöhnen. 6. Die Schule organisiert Lerngruppen so, dass alle SchülerInnen wertgeschätzt werden. |
|
B Inklusive Strukturen etablieren |
B.2 Unterstützung für Vielfalt organisieren |
7. Druck zu Ausschluss als Strafe wird vermindert. 9. Mobbing und Gewalt werden abgebaut. |
|
C Inklusive Praktiken entwickeln |
C.1 Lernarrangements organisieren |
3. Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden 7. Die Disziplin in der Klasse basiert auf gegenseitigem Respekt |
|
C Inklusive Praktiken entwickeln |
C.2 Ressourcen mobilisieren |
1. Die Unterschiedlichkeit der SchülerInnen wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt. |
|
[a] Die vorliegende Reihenfolge der Indikatoren richtet sich nach den Vorgaben des Index und ist daher nicht in chronologischer Reihenfolge geordnet. |
||
Stellt man diesen Dimensionen die von Honneth (1992) entworfenen Formen der Anerkennung bzw. den für die Auswertung der Gruppendiskussionen adaptierten Kategorien (s. Kap. 3.3.2) gegenüber, entsteht folgendes Bild:
Die Grundfrage, die meinen Überlegungen vorausging, war:
Welche Bedingungen fördern die gegenseitige Anerkennung von SchülerInnen durch die Realisierung inklusiver Prinzipien? Diese führt, bezogen auf die Dimensionen des Index, zu einem spezifischen Fragenkatalog.
Aufgrund der Überschneidungen zwischen den einzelnen Formen der Anerkennung kam es auch zu inhaltlichen Überlappungen hinsichtlich der Darstellung der Dimensionen. Daher stand der vorherrschende Charakter der Dimension (eher emotional, eher moralisch, eher individuell oder eher solidarisch) im Vordergrund.
Welche Bedingungen fördern die Entstehung emotionaler Anerkennung (Vertrauen untereinander, persönliche Bestätigung und Bestärkung) und schränken dadurch Demütigung, Gewalt und Misstrauen ein?
Indikator A.1.1:
Fühlen sich alle SchülerInnen willkommen?
Das bedeutet im Hinblick auf Respekt unter SchülerInnen, dass einerseits neuen SchülerInnen, gleich welcher Herkunft und mit welchen Fähigkeiten ausgestattet, freundlich und anerkennend begegnet wird. Anderseits bedeutet dies auch für den Alltag, dass Vielfalt unterstützt und gewürdigt wird (z.B. durch kulturspezifische Rituale).
Indikator A.1.2:
Helfen die SchülerInnen einander?
In diesem Punkt wird v.a. die emotionale und solidarische Zuwendung und Unterstützung unter SchülerInnen beleuchtet. Dies kann sowohl während des Unterrichts stattfinden als auch in der Freizeit. Dabei spielt die Bildung von Freundes- und Unterstützerkreisen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung uneingeschränkter Teilhabe am Leben und Lernen in der Schule.
Welche Bedingungen fördern die Entstehung moralischer Anerkennung? Genauer betrachtet: Wird jedes Mitglied der Klasse/Schule als gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinschaft anerkannt und wird versucht, Ausschluss bzw. Aussonderung aus der Gemeinschaft zu vermindern und dadurch Barrieren für die Teilhabe am Leben und Lernen abzubauen?
Indikator A.2.6:
Bemüht sich die Schule, alle Formen der Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren?
Dies gilt sowohl bezogen auf das Verhältnis zwischen SchülerInnen untereinander als auch zwischen SchülerInnen und LehrerInnen, zwischen LehrerInnen untereinander und zwischen Schulverwaltung und LehrerInnen bzw. SchülerInnen.
Indikator B.2.7:
Wird der Druck zu Ausschluss als Strafe vermindert?
Unter diesem Aspekt wird betrachtet, inwiefern Ausschluss als Strafe sinnvoll erscheint bzw. wie diese Art der Strafe aufgrund ihres exklusiven Charakters vermieden werden kann. Damit verbunden ist die Sicherung von Partizipation sowohl an der Klassengemeinschaft als auch am Unterricht.
Indikator B.2.9:
Werden Mobbing und Gewalt abgebaut?
Dieser Indikator umfasst alle vier Formen intersubjektiver Anerkennung. Hier soll er in Zusammenhang mit dem Recht auf Integrität und uneingeschränkte Teilhabe am Unterricht stehen, welches oftmals durch Gewalt und Mobbing erheblich, v.a. auf der psychischen Ebene, beeinträchtigt wird.
Voraussetzung für den Abbau von Mobbing und Gewalt stellt die Kenntnis über Formen der Missachtung und deren Wirkung dar. Für den gezielten und umfassenden Abbau von Gewalt ist zum einen ein sehr weitgefasstes Verständnis von Mobbing und Gewalt, v.a. im Hinblick auf institutionelle Gewalt oder sehr subtile Formen des Mobbing nötig. Zum anderen stellt die Kooperation mit den Eltern und innerhalb des Kollegiums eine entscheidende Voraussetzung für den kontinuierlichen Abbau von Gewalt und Mobbing und die Etablierung gewaltfreier Umgangsformen mit Konflikten dar.
Welche Bedingungen fördern die Entstehung individueller Anerkennung, gleichbedeutend mit der Wertschätzung der Fähigkeiten des Einzelnen, und hemmt dadurch individuelle Degradierung, Abwertung der Fähigkeiten einzelner Mitglieder der Schulgemeinschaft durch die Hervorhebung der Schwächen im Gegensatz zu Stärken einer Person?
Indikator B.1.6:
Organisiert die Schule Lerngruppen so, dass alle SchülerInnen wertgeschätzt werden?
Dieser Indikator stellt die Frage nach der Art und Weise der Zusammensetzung von Lerngruppen nach bestimmten Kriterien. Diese Kriterien können sich allerdings sehr diskriminierend auf einzelne SchülerInnen bzw. Schülergruppen auswirken. Daher gilt es, die Bildung von Gruppen möglichst heterogen zu gestalten, um niemanden zu benachteiligen oder auszugrenzen.
Indikator C.2.1:
Wird die Unterschiedlichkeit aller SchülerInnen als Chance für das Lehren und das Lernen genutzt?
Dieser Aspekt bezieht sich auf den individuellen Wert einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers für das Lehren und Lernen innerhalb der Klasse. Darin wird betrachtet, inwiefern SchülerInnen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen haben, die sie für das gemeinsame Lernen in der Klassengemeinschaft fruchtbar machen können.
Was kann einen solidarischen Zusammenhalt innerhalb der Klasse bzw. Schulgemeinschaft fördern und Zerklüftung, Trennung und Separierung auflösen?
Indikator A.1.3:
Arbeiten die MitarbeiterInnen zusammen?
Voraussetzung bzw. Vorbild für den Respekt unter SchülerInnen ist der Respekt unter den MitarbeiterInnen. Wenn die Zusammenarbeit sowohl im Team als auch interdisziplinär funktioniert, kann gemeinsam konstruktiver auf entstehende Konflikte eingegangen werden.
Indikator A.2.2:
Haben alle MitarbeiterInnen, SchülerInnen, Eltern und schulische Gremien eine gemeinsame Philosophie der Inklusion?
Damit ist das gemeinsame Verständnis inklusiver Pädagogik als richtungsweisend für alle Handlungen und Strukturen, einschließlich der Denkstrukturen, gemeint. Dies steht in Verbindung mit der Verringerung aller Barrieren der Teilhabe aller SchülerInnen sowohl am Zugang zur Schule als auch am Lernen und der ungehinderten Bewegung innerhalb des Schulgeländes. Hinter diesem Verständnis von Inklusion als gemeinsamer Philosophie steht ebenfalls die Verantwortung der gesamten Schulgemeinschaft für die inklusive Weiterentwicklung der Schule.
Indikator B.1.5:
Wird allen neuen SchülerInnen geholfen, sich in der Schule einzugewöhnen?
In diesem Zusammenhang werden Maßnahmen der Unterstützung bezüglich der Eingewöhnung neuer SchülerInnen in ihre Klasse bzw. die gesamte Schulgemeinschaft betrachtet (z.B. ein Einführungsprogramm, Orientierungshilfen, PatInnen für die Begleitung in den ersten Schulwochen).
Ähnlich wie mit der Anerkennung verhält es sich auch mit der Inklusion. Genau wie Respekt, kann man sie nicht erzwingen. Das Geniale an der Idee der Inklusion ist dennoch, dass sie keine einzige Wahrheit fordert, sondern jedem die Möglichkeit bietet, seine eigene Wahrheit in der Vielfalt der Wahrheiten zu finden. Diesen Prozess zu unterstützen und zu versuchen aus der Vielfalt eine Ganzheit, ein tragfähiges System entstehen zu lassen, bildet die zentrale Herausforderung in Hinblick auf die Neugestaltung von Schule.
In einem zweiten Schritt gilt es nun, die herausgearbeiteten Indikatoren für ein respektvolles Miteinander an der Schule auf die IGS Holweide zu übertragen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Schulgrundsätzen und der Schulstruktur. Die IGS Holweide ist die größte allgemeinbildende Schule in Nordrhein-Westfahlen (NRW). Mit ca. 1750 SchülerInnen und 153 LehrerInnen[13] steht die Gesamtschule vor einer ganz besonderen Herausforderung im Hinblick auf die Etablierung einer inklusiven Schulkultur, insbesondere der Schaffung und Erhaltung von Anerkennungsverhältnissen. An dieser Stelle ist dennoch zu betonen, dass die IGS Holweide bereits günstige strukturelle Voraussetzungen für die Etablierung einer inklusiven Schulkultur insofern besitzt, dass sie als Integrierte Gesamtschule ein Stück weit das selektive Schulsystem überwunden hat. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die IGS seit 1986 integrativ arbeitet und hier bereits ein Erfahrungspotenzial besitzt.
In Anlehnung an die dargestellten Dimensionen, Bereiche und Indikatoren des Index soll nun anhand von drei Schwerpunkten - der heterogenen Schülerschaft, dem Team-Kleingruppen-Modell und ausgewählter Projekte - erörtert werden, inwiefern die IGS Holweide eine inklusive Schule hinsichtlich ihrer Voraussetzungen für die Entstehung von Toleranz und Anerkennung ist, aber auch an welchen Punkten noch "Baustellen" bestehen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern die Schule offen für alle Kinder und Jugendlichen ist - gleich welcher Herkunft sie sind und welche physischen und kognitiven Voraussetzungen sie mitbringen. Generell ist die Gesamtschule Holweide für alle SchülerInnen der Umgebung offen, dennoch gibt es Einschränkungen im Rahmen der Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums, da es sich hierbei um einen Schulversuch handelt. Diese Offenheit spiegelt sich auch in der Präambel des Schulprogramms wider, in der es heißt: "Unser Ziel ist eine Schule der Vielfalt, in der Menschen ohne Angst verschieden sein können, jeder seinen Möglichkeiten entsprechend gefordert und gefördert wird, und jeder sich seine Lebenswelt kritisch aneignen und kreativ verändern kann."
Die IGS Holweide entstand Mitte der 1970er Jahre aus dem Gymnasium Holweide und nimmt seit 1986 auch SchülerInnen mit Beeinträchtigungen auf (vgl. Schwager 2004, 21). Momentan haben 125 SchülerInnen, d.h. ca. 7 % der SchülerInnen einen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf. So findet pro Jahrgang jeweils in fünf bis sechs der neun Parallelklassen Gemeinsamer Unterricht statt. 20 der ca. 153 Lehrerstellen sind mit SonderpädagogInnen besetzt. Die SchülerInnen lernen in heterogen gemischten Tischgruppen. Es wird größtenteils versucht, die Jugendlichen binnendifferenziert zu unterrichten, d.h. gemeinsam in einer Klasse. Doch je höher die Klassenstufe, desto höher ist die Leistungsorientierung und damit auch der äußere Differenzierungsgrad. So wird der Schule vorgeschrieben, Äußere Differenzierung in Englisch (ab Klasse 7) und in Mathematik (ab Klasse 9) durchzuführen (vgl. ebd., 25). Dies ist im Vergleich zu anderen Gesamtschulen ein verhältnismäßig geringer Anteil an äußerer Differenzierung. Grundlage des Unterrichts mit SchülerInnen, welche Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich als auch im Bereich Lernen haben, bilden allerdings weiterhin die entsprechenden Curricula der Geistigbehinderten- bzw. Lernbehindertenschule (s. Schulprogramm). Daraus wird ersichtlich, dass weiterhin eine Orientierung am Sonderschulwesen existiert. Dabei baut die Förderung von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen zu einem Teil immer noch auf Richtlinien der Sonderschule auf und kann somit separierend und damit etikettierend wirken. Es stellt sich hier die Frage, ob es Sinn macht, unterschiedliche Curricula als Grundlage für den Gemeinsamen Unterricht zu verwenden. Anfänglich bietet dies vielleicht Sicherheit und Orientierung im Unterricht, aber auf Dauer kann es dazu führen, dass zu starke Grenzen im Hinblick auf die Fähigkeiten der SchülerInnen zur Einschränkung der kreativen Entfaltung ihrer Ressourcen führen. Daher sollte hier eine stärkere Hinwendung zu allgemeinen Lernzielen erfolgen bzw. die Förderung sozialer Lernprozesse zu einer stärkeren Kooperation und gegenseitigen Unterstützung unter den SchülerInnen führen.
An der Schule lernen SchülerInnen aus ca. 36 Nationen. Besondere Beachtung finden dabei SchülerInnen aus Zuwandererfamilien, welche keine oder nur sehr geringe Deutschkenntnisse aufweisen. Für sie besteht die Möglichkeit, während der Anfangszeit wöchentlich 15 Stunden Deutsch als Fremdsprache in einer eigenen international gemischten Klasse zu belegen. Die restliche Zeit verbringen die SchülerInnen aber in ihren Teamklassen (s.u.). Weiterhin wird für SchülerInnen türkischer Abstammung muttersprachlicher Unterricht angeboten. Dies stellt sowohl eine Förderung ihrer sprachlichen Fähigkeiten dar als auch die Würdigung ihrer kulturellen Wurzeln. Ein weiteres Ziel der Schule ist es, eine Förderstunde Deutsch für alle SchülerInnen ausländischer Herkunft anzubieten, um die sprachlichen Fähigkeiten auszubauen und damit einer Benachteiligung dieser SchülerInnen vorzubeugen. Kritisch zu betrachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass hier eine Separierung der SchülerInnen erfolgt, was zusätzliche personelle Ressourcen in Anspruch nimmt. Sinnvoll wäre im inklusiven Sinne der Versuch, diese sprachliche Förderung im Hinblick auf interkulturelles Lernen mit in den Deutschunterricht innerhalb der Teams zu integrieren. Denn vielleicht können auch andere SchülerInnen mit Schwierigkeiten im Bereich Rechtschreibung, Grammatik oder Lautsprache von diesem Unterricht profitieren. So würde eine Etikettierung sowohl der ausländischen SchülerInnen als auch der SchülerInnen mit sprachlichen Auffälligkeiten oder Beeinträchtigungen nivelliert werden.
Im Freizeitbereich wird ebenfalls auf die Vielfalt der Schülerschaft eingegangen. So gibt es zum einen Möglichkeiten des Rückzugs und der Entspannung wie z.B. das Café Oriental, welches von türkischen SchülerInnen betreut wird sowie das Teehaus, welches auch für Unterrichtszwecke, z.B. für den Religionsunterricht genutzt wird. Darüber hinaus werden für SchülerInnen mit Beeinträchtigungen, v.a. im kognitiven Bereich sowohl Lebenspraktische Übungen als auch verschiedene Betriebsprojekte (z.B. das Printteam) angeboten (vgl. Schwager 2004, 26). Allerdings ist hierbei zu bemerken, dass dort zwar praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert werden, aber dennoch durch die Ausschließlichkeit der Gruppe eine Etikettierung erfolgt, welche weitreichende Folgen auf die Einbindung dieser SchülerInnen in die Gleichaltrigengruppe haben kann. Dies wurde aus einer Diskussion, die unter Schülern eines Betriebsprojektes während unseres Besuches in Köln geführt wurde, sehr deutlich.
Aus den aufgezeigten Aspekten geht hervor, dass die Schule zwar bereit ist, alle SchülerInnen aufzunehmen und auch stolz ist darauf (s. Schulprogramm), diese Vielfalt zu haben; jedoch sind einige Aspekte, wie bspw. die Betriebsprojekte, die ausschließlich für SchülerInnen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten werden, kritisch zu betrachten. Vertiefend dazu hat sich auch Michael Schwager (2004) in seinem Artikel zur Zwei-Gruppen-Theorie geäußert. Aus diesem geht hervor, dass unter den momentan an der Schule vorhandenen Bedingungen die etikettierende Unterscheidung zwischen SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen weitgehend aufgehoben wird, aber dennoch einige Kritikpunkte bleiben. In Bezug auf die Förderung von Anerkennungsverhältnissen unter SchülerInnen bedeutet dies, dass Barrieren hinsichtlich der sprachlichen Verständigung ausländischer SchülerInnen durch den zusätzlichen Deutschunterricht weitgehend aufgehoben werden. Hingegen ergeben sich hinsichtlich der Akzeptanz von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen, v.a. im Bereich Kommunikation als auch von SchülerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten, Einschränkungen der Teilhabe an der Klassengemeinschaft. Dies wurde durch die Aussagen der SchülerInnen in den Gruppendiskussionen bestätigt (s. Kap. 5.7). Im Hinblick auf die Ausgrenzung von SchülerInnen aufgrund ihrer Andersartigkeit (Hautfarbe, Sprache, Nationalität, Geschlecht, Behinderung) wurden durch die Schülerbefragung keine eindeutigen Ergebnisse erzielt. In diesem Zusammenhang wird aber der bereits erwähnte Aspekt der Abspaltung von Gruppen relevant, welcher den Gegenstand der Gruppendiskussionen darstellte. Dennoch wurde die gegenseitige Hilfe innerhalb der Klasse durch die Schülerschaft größtenteils bestätigt. So scheint die gegenseitige Hilfe entweder nicht an Gruppenbildungsprozesse gebunden zu sein, sondern lediglich an die Bereitschaft zur Solidarität; andererseits könnte die gegenseitige Hilfe aber auch auf die Tischgruppen oder andere Gruppen innerhalb der Klasse beschränkt bleiben. Dies konnte allerdings weder durch die Ergebnisse der Befragung noch durch die Aussagen der SchülerInnen in den Gruppendiskussionen klar herausgestellt werden.
Das Team-Kleingruppenmodell (TKM) bildet die konzeptionelle wie strukturelle Basis der IGS Holweide. Es stellt dennoch kein bis ins Detail geplantes pädagogisches Konzept dar, sondern bildet vielmehr den organisatorischen Rahmen, der dem Lehren und Lernen völlig neue Möglichkeiten eröffnen kann (vgl. Ratzki 1996, 284). In diesem Zusammenhang soll dargelegt werden, inwiefern dieser Rahmen die Entstehung von Toleranz und Anerkennung fördern kann.
"Das Holweider TKM basiert auf einem anthropologisch fundierten Erziehungskonzept, in dessen Zentrum das Soziale Lernen steht" (Keim 1996, 22). Soziales Lernen bedeutet hier den Erwerb von Kompetenzen durch Erfahrungen mit einer Gruppe, hier der Lerngruppe. Dennoch kann soziales Lernen zwei sehr gegensätzliche Dimensionen beinhalten. Zum einen kann soziales Lernen durch den Erwerb kommunikativer Fähigkeiten und die Förderung eigenverantwortlichen Handelns positiv für die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit und die Gruppenentwicklung gesehen werden. Andererseits besteht aber auch die Möglichkeit, destruktives Verhalten als Weg zur Lösung sozialer Konflikte im Zuge sozialer Lernprozesse als legitim anzusehen. Letzteres führt zwar u.U. zum gewünschten Erfolg (z.B. sich behaupten zu können, eigene Ziele zu erreichen), wirkt sich aber kontraproduktiv im Hinblick auf die Entstehung einer solidarischen Gemeinschaft aus. Daher soll die erste Verständnisweise als Grundlage für die Entstehung einer auf gegenseitigem Respekt basierenden Gemeinschaft im Vordergrund der nachfolgenden Betrachtungen stehen.
Das TKM bildet den organisatorischen Rahmen für alle Ebenen der Schule. Hier sollen hauptsächlich die Ebene der Klasse und die Prozesse unter SchülerInnen betrachtet werden. Grundlage des TKM auf Klassenebene bilden heterogen zusammengesetzte Tischgruppen von jeweils fünf bis sechs SchülerInnen. Jeweils drei Klassen bilden darüber hinaus ein Team, dem ein Team von sechs bis acht LehrerInnen zugeordnet ist (vgl. ebd., 14). Diese handeln weitgehend eigenverantwortlich und strukturieren Lerninhalte sowie planen den Unterricht eigenständig.
Durch die kooperative Arbeit in den Gruppen sollen sowohl soziale als auch kognitive Lernprozesse verschränkt werden. Zu Beginn der fünften Klasse finden regelmäßige Teamtrainings statt, durch die die SchülerInnen soziale Kompetenzen im Hinblick auf kooperative Lernformen erwerben sollen.
"Grundaxiom dieses Erziehungskonzepts ist die Annahme, dass der Mensch von Natur aus ein soziales, auf Kooperation hin angelegtes Wesen ist und nicht (...) der Kampf aller gegen alle das Leben als Grundprinzip durchzieht" (ebd., 18).
Die Legitimation dieses Konzeptes ergibt sich aus Art. 2 des Grundgesetzes, welcher ein Grundverständnis im Hinblick auf die Wahrung der Menschenrechte postuliert:
"Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz verstößt." Dieser Grundsatz entspricht der von Honneth (1992) aufgezeigten Dimension der rechtlichen Anerkennung. Übertragen auf Schule bedeutet dies, "dass der Ort des Sozialen Lernens nur die Gesamtschule sein kann, in der allen Kindern gleich welcher Begabung und sozialen Herkunft ein gemeinsamer Rahmen eröffnet wird" (Keim 1996, 20).
Zentrale Voraussetzung für diesen gemeinsamen Rahmen, in dem alle SchülerInnen gleichberechtigt lernen können, ist die Förderung demokratischer Prozesse der Partizipation. Zum einen wird dies in Holweide durch die Strukturen der Teams ermöglicht. Hierbei entscheidet jedes Team autonom über die jeweilige Umsetzung der Lehrpläne. Dadurch können auch fachliche Ressourcen adäquat im Hinblick auf die Unterstützung der Vielfalt genutzt werden. Die schulische Förderung bleibt damit nicht nur auf der Vorgabe durch den sonderpädagogischen Förderbedarf beschränkt, sondern kann die finanziellen und personellen Ressourcen gleichmäßig und entsprechend des jeweiligen Unterstützungsbedarfs auf alle SchülerInnen verteilen.
Zum anderen werden demokratische Prinzipien in Form von Transparenz und Offenheit durch die LehrerInnen und durch die Möglichkeit der freiwilligen Mitwirkung in der Schülervertretung (SV) auf Schülerebene realisiert. Die SchülerInnen gestalten ihren Klassenraum selbst, so dass es ein Raum wird, in dem sie sich wohl fühlen können. Einmal pro Woche findet eine Tutorenstunde statt, in der anliegende Probleme oder organisatorische Fragen geklärt werden können. Über die Inhalte der Tutorenstunden entscheiden die SchülerInnen meist selbst. Darüber hinaus wird großen Wert auf offene und kooperative Unterrichtsmethoden gelegt, welche die Voraussetzung für selbstverantwortliches und soziales Lernen darstellen sollen. Durch die Arbeit in den Kleingruppen soll darüber hinaus die Förderung eines solidarischen Zusammenhalts unter den Mitgliedern der Klasse im Hinblick auf die Wertschätzung der Fähigkeiten des einzelnen erreicht werden. Durch gegenseitige Hilfe und Unterstützung können somit vorhandene Schwächen kompensiert werden. Dies kann allerdings nur auf der Basis gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung der unterschiedlichen Fähigkeiten des einzelnen realisiert werden.
Das TKM bildet somit eine wertvolle Grundlage für die Entstehung von Anerkennungsverhältnissen unter SchülerInnen und LehrerInnen und kann dadurch die Teilhabe aller SchülerInnen an Lehr- und Lernprozessen unterstützen.
Dennoch ist trotz der zahlreichen positiven Aspekte des TKM auch ein kritischer Aspekt anzuführen: Das TKM kann meiner Meinung nach nur funktionieren, wenn sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft der Verantwortung gegenüber ihren KollegInnen bzw. (Mit)schülerInnen bewusst sind. Anderenfalls kann Vertrauen sonst sehr schnell missbraucht und Konkurrenz und Misstrauen an die Stelle von gegenseitiger Anerkennung treten. Deshalb ist es ein zentrales Ziel der Schule, Gewalt und Mobbing entgegenzuwirken, in dem die Vielfalt der SchülerInnen für die Entstehung verschiedener Projekte an der Schule genutzt wird.
Die Förderung gegenseitiger Achtung und Wertschätzung ist ein zentrales Ziel des Unterrichts and der Gesamtschule Holweide. Auch außerhalb des Unterrichts finden zahlreiche Projekte statt, die dieses Ziel unterstützen. Durch den Ganztagsbetrieb der Schule ist es für den Ausgleich von Spannung und Entspannung wichtig, Nischen und Räume des Rückzugs zu haben. Räume der Ruhe und Entspannung sind sowohl die Bibliothek als auch das Teehaus bzw. das Café Oriental (s.o.). Darüber hinaus bieten diese Räume auch die Möglichkeit informeller Treffpunkte von SchülerInnen zur gemeinsamen Entspannung bzw. Freizeitaktivität. Für SchülerInnen mit Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich gibt es neben diesen Räumen zusätzlich den sogenannten "Anna-Raum", in dem sich diese SchülerInnen mit Gleichgesinnten (Peers) treffen können. Andere SchülerInnen haben zu diesem Raum keinen Zutritt. Trotz des positiven Ansatzes, Rückzugsmöglichkeiten gerade für diese Schülergruppe zu bieten und den Austausch in der Peer-Gruppe zu unterstützen, ist die Einrichtung eines solchen Raumes auch unter dem Aspekt der Etikettierung bzw. Stigmatisierung kritisch zu betrachten. Hier sollte mehr Wert auf eine gemeinsame Freizeitgestaltung unter der Partizipation aller SchülerInnen unterstützt werden.
Neben Räumen des Rückzugs und der Entspannung in der Freizeit, stoßen die zahlreichen sportlichen Angebote auf großen Zuspruch bei den SchülerInnen (vgl. Auswertung der Schülerbefragung). Durch gemeinsame sportliche Aktivitäten kann ein positiver Zusammenhalt innerhalb von Gruppen gefördert werden.
Ein weiteres zentrales Ziel der Schule stellt die Prävention der Entstehung von Aggression und Gewalt unter SchülerInnen dar. Zum einen geschieht dies über die gezielte Förderung sozialer Kompetenzen und Teamfähigkeit, v.a. zu Beginn der Sekundarstufe I (s.o.). Zum anderen bietet die Möglichkeit der Streitschlichtung eine gute Voraussetzung für die gewaltfreie Lösung von Konflikten.
Das Streitschlichterprojekt soll hier exemplarisch als Möglichkeit der Prävention von Gewalt vorgestellt und auch kritisch in Hinblick auf den Ausbau der Potenziale dieser Konfliktlösungsmethode an der IGS Holweide betrachtet werden.
Ziel der Streitschlichtung ist es, durch vermittelnde Dritte die Klärung eines Konflikts zwischen zwei Parteien herbeizuführen (vgl. Faller 1996). Dabei sind die Streitschlichter nicht Richter, sondern Unterstützer bei der gemeinsamen Suche nach Lösungen. Am Ende gibt es keinen Verlierer, sondern es wird eine Lösung angestrebt, die für alle Parteien akzeptabel ist. Streitschlichtung als peer mediation wird an der IGS Holweide seit 1998 praktiziert. Z.Zt. fungieren ca. 16 SchülerInnen des zehnten Jahrgangs als StreitschlichterInnen. Im 9. Jahrgang werden derzeit etwa 18 SchülerInnen ausgebildet. Die Vorstellung des Konzeptes innerhalb einer Unterrichtsstunde in den neun Klassen des 5. Jahrgangs führt in der Regel dazu, dass diese SchülerInnen sich in der Pause oder Mittagsfreizeit bei den SchlichterInnen in deren Raum melden, wenn sie Schlichtungsbedarf haben. Insgesamt kommen die meisten Streitenden aus den Klassen 5 -7, seltener aus den oberen Klassen. Inzwischen suchen die jüngeren SchülerInnen selbstständig den Kontakt zu den SchlichterInnen, werden aber auch von LehrerInnen beraten.[14] Durch die Aussagen in den Gruppendiskussionen wurde dies dahingehend bestätigt, dass die StreitschlichterInnen in den oberen Klassen scheinbar ein geringeres Ansehen besitzen als in den unteren Altersgruppen. Dies könnte mit der zunehmenden Eigenständigkeit der Jugendlichen in Zusammenhang stehen oder mit dem eigenen Image frei nach dem Motto: "Ich bin doch kein Versager und gehe zur Schlichtung. Das habe ich nicht nötig. Ich kann meine Konflikte selbst klären." Ein weiterer Grund könnte aber auch in der fehlenden Anerkennung der Fähigkeiten der Streitschlichter aufgrund von zu großer Unkenntnis bzw. Anonymität bestehen. So wird die Möglichkeit der gewaltfreien Konfliktlösung nur von einem sehr geringen Teil der Schülerschaft genutzt.
Um eine effektivere Konfliktlösung zu forcieren, plädiere ich dafür, Streitschlichtung nicht nur auf Schulebene, sondern auch auf Klassen- oder Teamebene zu etablieren, um eine direkte Konfliktlösung an Ort und Stelle des Entstehens herbeiführen zu können und nicht zu akkumulieren bzw. bis zur Eskalation zu bringen.
Durch die Etablierung eines solchen Systems wäre soziales Lernen auch in höheren Klassenstufen auf Klassenebene integriert und nicht nur abgekoppelt als anonyme Instanz auf Schulebene verankert bzw. in unteren Klassen im Form von Teamtraining gewährleistet. Vertreter der Schülervertretung führten an, dass es sich aufgrund der Größe der Schule schwierig darstellt, das System Streitschlichtung publik zu machen. Ein weiteres Problem besteht in der generellen Anerkennung der Streitschlichtung als Möglichkeit Probleme zu klären. In diesem Zusammenhang steht die freiwillige und eigenständige Nutzung der Streitschlichtung als mögliche Konfliktlösungsvariante (vgl. Gruppendiskussion 2/J1a/307). Meist sind es LehrerInnen, die die SchülerInnen dahin verweisen. So wäre eine Streitschlichtung auf Klassenebene zur Lösung dieses Problems sinnvoll, da innerhalb der Klasse eine höhere Transparenz und gegenseitiges Vertrauen gewährleistet wäre. Ein weiterer Aspekt, der für die Streitschlichtung auf Klassenniveau spricht, ist die Gleichaltrigkeit der SchülerInnen. So kann ein wesentlich höheres Problemverständnis unter den SchülerInnen gewährleistet werden.
Probleme bei diesem Modell sehe ich einerseits in der sehr großen Vertrautheit unter den SchülerInnen, die durch die Klasse gegeben ist, sodass die StreitschlichterInnen zu stark in den Konflikt involviert sind. In einem solchen Fall könnte aber die Klärung des Konflikts durch eine Schlichtungsgruppe aus einer Parallelklasse passieren, um dadurch die Neutralität wieder zu gewährleisten. Andererseits kann aber auch gerade das Vertrauen untereinander förderlich für den Schlichtungsprozess sein, da sich SchülerInnen in solch einer Atmosphäre häufig besser öffnen können.
Andererseits sehe ich allerdings bei der Durchführung der Streitschlichtung durch jüngere SchülerInnen eine Schwierigkeit aufgrund des noch nicht genügend ausgeprägten Reifegrades der SchülerInnen. Dies könnte aber durch gezieltes Training bzw. eine Schulung durch ältere SchülerInnen kompensiert werden.
Im Ganzen betrachtet sehe ich gerade für die IGS Holweide durch die günstigen strukturellen Möglichkeiten des TKM Chancen, solch ein System zu etablieren.
Aufgrund der relativ hohen Anzahl an SchülerInnen ist eine Flexibilisierung der Konfliktlösung nötig, um ggf. adäquat auf entstehende Aggression und Gewalt eingehen zu können.
Sowohl aus dem Schulprogramm als auch aus den Ergebnissen der Schülerbefragung wurde ersichtlich, dass sich die Gesamtschule Holweide auf einem guten Weg im Hinblick auf die Förderung von Toleranz und Anerkennung unter SchülerInnen befindet und hier auch ihre Schwerpunkte (soziales Lernen) gesetzt hat. Allerdings sind bezüglich der Partizipationsmöglichkeiten von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen, v.a. im kognitiven Bereich, zwar Möglichkeiten bspw. durch die Betriebsprojekte geschaffen worden, aber durch die ausschließliche Beteiligung dieser SchülerInnen an den genannten Projekten, wird eher Etikettierung und Stigmatisierung im Gegensatz zu gegenseitiger Wertschätzung gefördert. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Schülerbefragung insofern wider, dass nur sehr wenige SchülerInnen gern in den Betriebsprojekten mitarbeiten würden.
Aus den Ergebnissen der Schülerbefragung ging darüber hinaus hervor, dass Ausgrenzung von SchülerInnen ein brisantes Thema unter den SchülerInnen darstellt und eine starke Tendenz zur Abspaltung von Gruppen besteht. Diese Phänomene, die innerhalb des Schulprogramms kaum Beachtung finden, sollen nun anhand der Ergebnisse der Gruppendiskussionen erörtert werden.
Im Folgenden sollen die von mir geführten Gruppendiskussionen hinsichtlich der in Kapitel 3.3.2 aufgestellten Kategorien ausgewertet werden. Dabei ist einzuwenden, dass genau wie bei der Einordnung der Indikatoren des Index häufig keine eindeutige Trennschärfe zwischen den einzelnen Kategorien hergestellt werden kann. Daher sollen hier die Aussagen der SchülerInnen schwerpunktartig in Bezug auf die Themen Ausgrenzung bzw. Abgrenzung von Gruppen und deren Wirkung hinsichtlich des Zusammenhalts innerhalb der Klassengemeinschaft untersucht werden. Zentral sind somit die Aspekte der Abgrenzung von Gruppen, welche schwerpunktmäßig in der ersten Gruppendiskussion thematisiert wurden und zum zweiten das Phänomen der Ausgrenzung einzelner SchülerInnen, welches in der zweiten Gruppe den thematischen Schwerpunkt bildete.
In beiden Diskussionen wurde ein eher negatives Bild sowohl im Hinblick auf die Situation in der Klasse (Klassenklima, fehlender Zusammenhalt - vgl. 1/561ff., 1/J1/648; 2/615ff.) als auch bezüglich der schulischen Bedingungen (v.a. hinsichtlich der Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen - 1/M2/920f.) beschrieben. Vor allem in der ersten Gruppe wurde dies klar herausgestellt. In der zweiten Gruppe wurde diese Tendenz anhand konkreter Beispiele, wie das eines Schülers mit Verhaltensauffälligkeiten (vgl. 2/J1a/211ff.) deutlich.
Auf der anderen Seite konnte herausgestellt werden, dass wie in Kap. 4.4 beschrieben, die Peer-Gruppe einen für die SchülerInnen sehr bedeutsamen sozialen Rückhalt bietet und in Bezug zur Abgrenzung gegenüber anderen eine zentrale Funktion einnimmt. Andererseits bildet das Wissen darum, dass niemand allein ohne Freunde und Unterstützung einer Gruppe ist, die Legitimation der Abgrenzung der eigenen Gruppe: "Nee klar, ich mein jetzt für die Leute, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun hab, die ich jetzt nicht so mag, die ham ja auch ihre Gruppen. Und für die ist das auch dann ok" (1/M2/1207). Es konnte nicht eindeutig erfasst werden, welche Prinzipien der Gruppenbildung hier dominierend sind, d.h. es wurden keine eindeutigen Neigungen, gemeinsame Hobbys oder Ähnliches angeführt. In diesem Zusammenhang wurden lediglich gemeinsame Interessen und das Gefühl, mit den anderen auf einer Wellenlänge zu sein (vgl. 1/M1/242ff.), genannt. Es handelt es sich hier auch häufig um Gruppen bzw. Netzwerke von Freundeskreisen, die sich über die Schule hinaus treffen (vgl. 1/M2/425f.). Häufig fielen auch die Begriffe "mögen" und "nicht mögen":
"Ja, ich bin halt mit den Leuten, die ich mag, befreundet und mit den andern will ich halt auch eigentlich nicht so viel zu tun haben" (1/M2/1196).
Diese Aussage weist auf eine aus einer willkürlichen Entscheidung heraus vollzogene Abgrenzung von anderen hin. Dies wurde häufig in Verbindung mit der Abwertung anderer genannt, v.a. hinsichtlich Gruppen oder Personen, deren Verhalten von den SchülerInnen als abweichend empfunden wurde (vgl. 1/J2/471, 1/M2/878ff.).
"Die raufen sich halt zusammen, sind dann so ne Gruppe und die sind halt meistens alle so. Und wenn man halt dann denkt, ja ok, der eine ist so, dann sieht man die anderen nur oberflächlich und will die anderen gar nicht anders kennenlernen, wenn die noch in einer Klasse sind" (1/M2/481ff.).
Hier wird ein typisches Übertragungs- und Abgrenzungsphänomen unter SchülerInnen erkennbar, welches vermutlich aus einem kategorialen Abgrenzungsdenken mit dem Ziel der Konstatierung der eigenen positiven sozialen Identität resultiert. Diese Denkweise und die damit verbundenen Überzeugungen wurden von den SchülerInnen, v.a. in der ersten Gruppendiskussion, häufig zum Ausdruck gebracht. Dahinter ist, wie bereits in Kap. 4.4 beschrieben, ein Distanzverhalten zu vermuten, welches zwar auf den ersten Blick neutral erscheint, aber die Offenheit der SchülerInnen für Verschiedenartigkeit von SchülerInnen stark einschränkt. Besonders deutlich wird dies im Hinblick auf den Umgang mit MitschülerInnen, welche aufgrund ihrer Andersartigkeit und der damit verbundenen Auffälligkeiten, v.a. bezogen auf die Bereiche Kommunikation und Verhalten, kaum Anerkennung finden: "(...) worüber soll ich mich mit der unterhalten?" (1/M2/1046), wurde als eine Barriere im gegenseitigen Verstehensprozess dargestellt.
Vor allem SchülerInnen mit physischen oder kognitiven Beeinträchtigungen, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten wurden in diesem Zusammenhang genannt. Kurz ausgedrückt: "(...) alle eigentlich, wo man's sieht oder merkt, die werden ausgeschlossen" (1/M2/955). Dies stellte einen der zentralen Betrachtungspunkte in Bezug auf Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt dar. Es wurden v.a. Formen physischer und verbaler Gewalt, wie körperliche Angriffe und Beschimpfungen genannt bis hin zu schwereren körperlichen Verletzungen (z.B. 2/M1a/222ff.). Aber auch Formen der Isolation wurden erwähnt:
"Und früher war das ja so meistens, dass in der Klasse die Maria [15] ausgegrenzt wurde, weil die eben keine Freunde hatte, weil die eben behindert war" (1/M2/909).
Es liegt die Vermutung nahe, dass SchülerInnen, die ihren Klassenkameraden körperlich unterlegen sind, als eine Art "Sündenbock" die angestauten Aggressionen der MitschülerInnen auffangen. Dies scheint Teil einer Reiz-Reaktionskette zu sein, in der die/der Stärkere die/den Schwächeren und die/der Schwächere wiederum die/den Nächstschwächeren angreift usw. (vgl. 2/J1a/525). Gründe für die Ausgrenzung von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen werden in der fehlenden Integration in die Klassengemeinschaft zum einen durch den Mangel an Unterstützung durch die LehrerInnen (vgl. 1/J1/1049) und zum anderen in der Gruppenbildung und räumlichen Abgrenzung (Anna-Raum) gesehen. Die äußere Differenzierung bildete ebenfalls einen der Kritikpunkte (vgl. 1/M2/1089).
In enger Verbindung mit der Auseinandersetzung hinsichtlich der Ausgrenzung von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen steht eine generelle sehr kritische Betrachtung der Umsetzung von Integration an dieser Schule. Wesentliche Argumente sind hier die starke Einschränkung der persönlichen Entfaltung der betroffenen SchülerInnen durch körperliche Gewalt und Mobbing. Es wird in diesem Zusammenhang die Ansicht vertreten, SchülerInnen mit Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten (v.a. im Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich) bevorzugt an der Sonderschule zu unterrichten, da sie hier unter ihres gleichen wären und dadurch eine größere Akzeptanz erfahren würden:
"Und ich denk wirklich, das ist für die besser, wenn die dann in so'ner Umgebung sind, wo sie halt irgendwie gemocht werden und wo alle irgendwie so sind wie sie, und wo die dann halt auch denken: Ja super und so. So kann ich jetzt irgendwie mal mehr aus mir rausholen" (vgl. 1/M2/1026).
Solidarität bzw. Verständnis für die Betroffenen wurde lediglich in Form von Mitleid deutlich: "Die Behinderten sind hier eigentlich die Ärmsten (...)" (1/M1/932). Diese Aussagen stehen im eklatanten Widerspruch zu den in der Präambel des Schulprogramms postulierten Zielen. Sicherlich lassen sich diese Aussagen nur bedingt verallgemeinern. Dennoch scheinen hier zwischen der Wahrnehmung der SchülerInnen und der LehrerInnen bezüglich des Phänomens der Ausgrenzung von SchülerInnen mit Auffälligkeiten oder Beeinträchtigungen gravierende Unterschiede zu bestehen. Diese Kritik wurde durch die Aussagen in den Gruppendiskussionen, v.a. in der zweiten Gruppe bestätigt. Hier kamen klare Defizite im Hinblick auf die Bereitschaft von LehrerInnen, Probleme hinsichtlich Gewalt und Mobbing zu sehen und zu lösen, zur Sprache (vgl. 2/J1a/449). Darüber hinaus wurde von einigen der SchülerInnen das geringe Engagement der LehrerInnen in Bezug auf gemeinsame Unternehmungen mit der Klasse stark bemängelt:
"Mir kommt das auch so vor, dass z.B. die Lehrer aus der drei irgendwie viel mehr machen mit ihren Schülern, als z.B. unsere Lehrer (...)" (1/J1/588).
Durch Vergleiche mit anderen Klassen, haben die SchülerInnen den Schluss gezogen, dass der Mangel an Engagement durch die LehrerInnen eine Ursache für den geringen Zusammenhalt in der Klasse darstellen könnte.
Bezüglich der Integration von SchülerInnen mit Migrationshintergrund, war erkennbar, dass diese SchülerInnen es als selbstverständlich ansehen, mit deutschen MitschülerInnen befreundet zu sein:
"Aber wir haben jetzt keine Gruppe - Türkengruppe, Deutschengruppe. Das ist einfach so gemischt" (1/M1/510).
Aus dieser Aussage wird deutlich, dass die Kategorisierung in Türkengruppe - Deutschengruppe von den Schülerinnen abgelehnt wird.
Bei der Betrachtung der Entwicklung der Klassengemeinschaft in den letzten Jahren fällt auf, dass es scheinbar bis zur neunten Klasse eine wesentlich stärkere Abgrenzung zwischen den Gruppen und ein höheres Aggressions- und Gewaltpotential bei einzelnen SchülerInnen gab als es heute der Fall zu sein scheint.
In der 10. Klasse wird die Situation wieder etwas ruhiger wahrgenommen. Allerdings ist es nicht so, dass die Teilnehmer der Diskussionsgruppen ein harmonisches Miteinander geschildert haben, sondern eher eine Art friedliche Koexistenz: "(...) jetzt lässt eigentlich jeder jeden in Ruhe (...)" (vgl. 1/M2/355). Dies steht im Widerspruch zu den in Kapitel 4.6 aufgezeigten Ergebnissen der Untersuchung von Köbberling und Schley (2000). Die Klasse wird nicht als Gesamtgruppe wahrgenommen. Dennoch ist anzuführen, dass die Konsolidierung von der 9. zur 10. Klasse auf die zu Beginn der 10. Klasse durchgeführte Teamfahrt maßgeblich zurückzuführen ist. Dies wurde durch die Aussagen der SchülerInnen sehr lebhaft hervorgehoben:
"Durch aber die Teamfahrt, also Klassenfahrt, waren ja alle zusammen eben und danach hat man sich viel besser verstanden und das hält immer noch (...)" (1/J1/107ff.).
Dies zeigt, dass durch die gemeinsam verbrachte Zeit der Zusammenhalt innerhalb des Team wesentlich gestärkt werden konnte. Ein weiterer Aspekt, der sich scheinbar beruhigend auf das Klassenklima ausgewirkt hat, besteht in der Ausgliederung von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen aus der Schule bzw. Klasse am Ende der neunten Klasse oder früher (vgl. 1/M2/921ff.). Dies wurde anhand der Beschreibung der Situation eines verhaltensauffälligen Schülers, der jetzt die 9. Klasse noch einmal wiederholt, deutlich:
"Seit dem der Paul auch von uns weg ist, ist die ganze Klasse ruhiger geworden. Wo der noch da war, war Chaos (...)" (2/J2/507).
Einen weiteren Anhaltspunkt für die gestiegene Ruhe und das Absinken von Spannungen, Aggression und Gewalt bildet die Tatsache, dass die 10. Klasse die Abschlussklasse für viele der SchülerInnen bildet und daher für alle das letzte Jahr in dieser Konstellation darstellt. Es hat sich herausgestellt, dass SchülerInnen, die in die Oberstufe (Sek.II) weiter die Schule besuchen werden, bereits Gruppen gebildet haben (vgl. 1/J1/376). Dieser Aspekt birgt zwei Betrachtungsdimensionen in sich. Es scheint einerseits, als ob sich SchülerInnen mit objektiv höheren Schulleistungen und SchülerInnen mit niedrigeren Leistungen solidarisieren. Das bedeutet, sie bilden homogene Gruppen, die sich u.a. am Leistungsstand zu orientieren scheinen. Andererseits erscheint die Abnahme von Aggression, Gewalt und abnehmender aktiver Abspaltung von Gruppen innerhalb der Klasse in der zunehmenden Beschäftigung mit dem eigenen Abschluss und dem darauf folgenden beruflichen Werdegang stärker ins Blickfeld der SchülerInnen zu rücken:
"Man will halt auch irgendwie nicht mehr den ganzen Stress haben, wenn man irgendwelchen Stress mit irgendwelchen Leuten hat, dass man sich so vom Schulischen ablenkt oder so. Dann denkt man, dann lass ich die lieber so in Ruhe oder so. Dann lass ich die so wie die sind und ich mach halt mein Ding" (1/M2/548ff.).
Die Zusammenarbeit innerhalb der Tischgruppe und deren Funktion im Hinblick auf die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten in bestimmten Fächern wie z.B. Mathematik bildete einen weiteren Diskussionspunkt. In diesem Zusammenhang wurden meist positive Äußerungen gemacht, insofern dass die Tischgruppe eine Art Sicherheit für die einzelnen SchülerInnen bietet und hier die Grundlage für eine solidarische Zusammenarbeit untereinander gelegt wird (s. Kap. 5.6.2). Dies ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Tischgruppen eigenverantwortlich durch die SchülerInnen gewählt werden und oftmals relativ stabil über Jahre bestehen. Dadurch besteht die Möglichkeit, eine vertraute Lernumgebung für die SchülerInnnen zu schaffen. Aus den Aussagen der SchülerInnen geht hervor, dass es durchaus eine solidarische Zusammenarbeit in der Tischgruppe gibt (vgl. 2/J1a/284ff.), auch wenn dies nicht immer den Vorstellungen der Gruppenarbeit im Sinne des selbsttätigen Lernens entspricht.
Nach den Aussagen der SchülerInnen sind die SchülerInnen innerhalb der Tischgruppen meist untereinander befreundet (vgl. 1/M2/657). Allerdings wurde von der zweiten Tischgruppe angegeben, dass es oft Spannungen innerhalb der Tischgruppe gibt. Grund dafür könnte in diesem Fall im fehlenden Zusammengehörigkeitsgefühl der SchülerInnen untereinander liegen, da die zweite Tischgruppe erst seit zwei Wochen in dieser Konstellation zusammensaß.
Einen Schüler (J2a) dieser Tischgruppe habe ich im Anschluss an die Gruppendiskussion noch einmal einzeln zu seiner speziellen Situation befragt, da ich vermutete, dass er Schwierigkeiten hat, sich offen in der Gruppe über seine Probleme bezüglich Ausgrenzung zu äußern. Aus dem Gespräch ging hervor, dass dieser Schüler, welcher durch seine Hörgeräte und seine etwas verwaschen wirkende Sprache auffällt, geäußert hat, dass er die Hänseleien und Demütigungen nicht mehr hören würde, d.h. er hat versucht sich vor derartigen Äußerungen durch Ignorieren zu schützen. Außerdem fiel mir an ihm auf, dass er eine relativ hohe Affinität zu gewaltförmigem Verhalten aufwies. Dies scheint für ihn ein legitimes Mittel der Konfliktlösung und des Schutzes vor körperlichen Angriffen zu sein. Darüber hinaus scheint er sich durch die Demonstration körperlicher Macht bei seinen Klassenkameraden Respekt zu verschaffen, welcher ihn vor weiteren körperlichen Angriffen zu bewahren scheint.
Das abschließende Beispiel von Lasse (J2a) zeigt, wie Gewalt als probates Mittel vor Demütigung und fortschreitender Missachtung schützen kann. Dennoch sollte es nicht als vorbildhaftes Beispiel angesehen werden, um Konflikte zu lösen, da Gewalt die Freiheit des anderen massiv einschränken kann (s. Kap. 2.3, 4.5).
Stellt man den Anspruch der IGS Holweide, auf dem Weg zu einer inklusiven Schule zu sein, den Aussagen der SchülerInnen des 10. Jahrgangs gegenüber, wird ein klarer Widerspruch deutlich. Einerseits sollen SchülerInnen ohne Angst ihre kreativen Potentiale entfalten können, andererseits werden sie tagtäglich mit Aggression, Gewalt und Ausgrenzung konfrontiert.
Gerade im Hinblick auf die Entstehung wechselseitiger Anerkennung und eines solidarischen Zusammenhalts innerhalb der Klasse, scheinen diese Bedingungen eher hemmend zu wirken. So wird deutlich, dass die Gruppe hier eine zentrale Schutzfunktion einnimmt, sowohl im Hinblick auf die Abgrenzung nach außen als auch bezüglich des Aufbaus einer positiven sozialen Identität. So bleibt zu fragen, inwiefern diesen Strukturen bewusst begegnet werden kann. In den Augen der SchülerInnen stellte der von ihnen beschriebene Zustand keine veränderungswürdige Situation dar, bzw. hätte ihrer Meinung nach die Intervention durch die LehrerInnen viel früher beginnen sollen (vgl. 1/M2/609ff.). Dennoch wurde der Ruf nach Engagement von Seiten der LehrerInnen an mehreren Stellen direkt oder indirekt deutlich (s.o.). Daraus wird erkennbar, dass die Rolle der Lehrerin, des Lehrers in Bezug auf die Entstehung von wechselseitiger Anerkennung unter den SchülerInnen nicht zu unterschätzen ist. Schwerpunkt des Engagements sollte nach den Aussagen der SchülerInnen einerseits in der Intervention von Mobbing und Gewalt und andererseits in der vermehrten Initiierung gemeinschaftsförderlicher Aktivitäten außerhalb der Schule liegen.
Abschließend betrachtet würde ich die IGS Holweide in Bezug auf die Förderung der Entstehung wechselseitiger Anerkennung unter SchülerInnen nur bezüglich ihren Ansätzen und ihrer Zielsetzung als "inklusiv" bezeichnen. Das System des TKM bietet hier meiner Meinung nach ein weitaus größeres Potential v.a. in Hinblick auf die Prävention und Intervention von Gewalt (s. Kap. 5.6.2, 5.6.3). Diesbezüglich sollte eine wesentlich stärkere Kooperation innerhalb der einzelnen Teams als auch zwischen den Teams eines Jahrgangs erfolgen.
[10] Darüber hinaus waren Wilhelm und Bintinger (2001) an der Entwicklung dieses Phasenmodells beteiligt (vgl. Sander 2004a, 12).
[11] Vielleicht kann man hier bereits von "Inklusionsforschern" sprechen.
[12] Dort wurde er von Tony Booth und Mel Ainscow (2002) herausgegeben (vgl. Boban/Hinz 2003, Hinz 2004).
[13] vgl. http://www.igs-holweide.kbs-koeln.de/seiten/service/datenfakten.htm#Kopf; Schwager 2004, 22
[14] Die Informationen zur Streitschlichtung an der IGS Holweide wurden mir freundlicherweise von einer der für die Ausbildung der StreitschlichterInnen verantwortlichen Lehrerinnen zur Verfügung gestellt.
[15] alle Namen, die die in SchülerInnen ihren Aussagen verwendeten, wurden geändert.
Abschließend möchte ich sowohl rückblickend die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammenfassen als auch Fragen darstellen, die sich aus diesen Erkenntnissen ergeben haben, aber in einem anderen Forschungszusammenhang geklärt werden sollten.
Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, inwiefern Schule, verstanden als "Schule der Vielfalt" (s. Einleitung) Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen, insbesondere Jugendlichen, initiieren kann und welche Hindernisse deren Realisierung im Wege stehen. Schwerpunkt bildete dabei die Betrachtung von Gruppenbildungs- bzw. Ausgrenzungsprozessen innerhalb von Schülergruppen. Im Laufe der Arbeit wird diese Frage in unterschiedlichen Zusammenhängen erörtert. Konsens der gewonnenen Erkenntnisse aus entwicklungspsychologischen und schultheoretischen als auch empirischen Betrachtungen ist, dass Gruppenbildungsprozesse und die darin entstehenden Anerkennungsverhältnisse für die Entwicklung und Festigung der Identität Jugendlicher (s. Kap. 4.4) eine zentrale Rolle spielen. Für die Persönlichkeitsentwicklung ist es entscheidend sich abzugrenzen. Im Gegenzug dazu kann diese bewusste Abgrenzung aber auch dazu führen, dass sich andere Jugendliche nicht frei entfalten und eine starke Persönlichkeit entwickeln können. Diesem zentralen Konflikt offen zu begegnen, sollte eines der zentralen Anliegen von Schule neben dem Bildungsauftrag sein. Die IGS Köln-Holweide versucht dies zu realisieren und durch gezielte Maßnahmen, wie die Ausbildung von Streitschlichtern, die Schaffung von Rückzugsräumen für SchülerInnen mit Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich, wie dem ANNA-Raum, zu initiieren. Andererseits wird versucht, berufliche Kompetenzen dieser SchülerInnen mit Unterstützungsbedarf durch das Angebot von Betriebsprojekten zu fördern. Dennoch hat die Gruppendiskussion gezeigt, dass - nach Einschätzung der SchülerInnen - es in dieser Hinsicht noch einige Hürden zu bewältigen gilt und dass die ergriffenen Maßnahmen z.T. auch das Gegenteil von dem bewirken, was sie ursprünglich bewirken sollten. Letztendlich bedeuten diese Feststellungen für mich, dass nicht allein das Schulprogramm mit den darin enthaltenen Maßnahmen und Projekten dazu führt, dass gegenseitige Anerkennung unter SchülerInnen gefördert wird. In den Gruppendiskussionen hat sich gezeigt, dass es oftmals von der Qualität des persönlichen Engagements von LehrerInnen und auch SchülerInnen abhängt, inwiefern Gruppenprozesse positiv bzw. negativ die Persönlichkeitsentwicklung einzelner SchülerInnen beeinflussen.
Prozesse von Anerkennung bzw. Missachtung finden immer auf mehreren Ebenen statt. So gesehen ist es bedeutsam, auf allen Ebenen wirksam zu werden und dort bewusst Anerkennungsprozesse zu initiieren (vgl. Kap. 2.4).
Es scheint leichter gesagt als getan, Anerkennungsverhältnisse anzuregen oder gar bewusst zu schaffen. Gegenseitige Achtung kann nicht erzwungen werden, sie ist ein Geschenk an die/den Anderen mit der Botschaft: "Du bist hier willkommen, egal wie du bist." Somit geht es um Einstellungsänderung nicht nur in den Köpfen und Herzen der LehrerInnen und SchulleiterInnen, sondern v.a. in den in den Köpfen und Herzen der SchülerInnen selbst.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Lebensraum Schule sowohl Chancen als auch Risiken birgt, wechselseitige Anerkennung entstehen zu lassen. Dabei gilt es die Chancen zu nutzen und auszubauen, sich den Problemen bewusst zu stellen und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.
Offen bleibt am Ende, wie protektive bzw. kompetenzfördernde Maßnahmen für einzelne SchülerInnen oder -gruppen so zu gestalten sind, dass sie nicht ausgrenzend wirken. Daneben steht die Frage, inwiefern das persönliche Engagement von LehrerInnen durch bewusstes Initiieren gemeinschaftsfördernder Prozesse zu einem Wachstum von Respekt unter SchülerInnen führen kann. Welche Maßnahmen wären in diesem Zusammenhang besonders wirksam und wie könnte man diese in den regulären Unterricht integrieren?
Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob es an einer so großen Schule wie der IGS Holweide nicht "natürlich" ist, dass sich Gruppen abgrenzen, um ihre eigene Identität im großen "Schulgewirr" zu finden. Daraus ergibt sich die Frage, wie viel Heterogenität und Kapazität von SchülerInnen und LehrerInnen für eine "Schule der Vielfalt" tragbar ist bzw. welche stabilisierenden und Sicherheit schaffenden Verfahren und Strukturen an einer solchen Schule etabliert werden müssten, um für alle Beteiligten eine angenehme, anerkennungs- und wachstumsfördernde Atmosphäre zu schaffen.
Respekt als Schlüsselbegriff und somit als wesentliches Qualitätskriterium für eine "Schule für alle" bilden den Ausgangspunkt und empirischen Rahmen dieser Arbeit.
Am Ende steht das Ziel und die Ermutigung, dass der Leistungsgedanke und die Entwicklung des Einzelnen stärker in Zusammenhang mit der Wertschätzung dessen gesehen wird, was jemand ist und nicht was sie/er sein könnte.
Mit dieser Arbeit möchte ich dazu anregen, sich mit dem vielschichtigen und diffizilen Phänomen der wechselseitigen Anerkennung und deren Wirkung in Gruppenprozessen auseinander zu setzen und sich mit mir gemeinsam nicht nur theoretisch auf den Weg zu mehr Respekt an Schulen zu machen.
Bertelsmann Universallexikon 2001. Gütersloh: Bertelsmannverlag
Boban, I.; Hinz, A. (2004): Erste Ergebnisse der Schülerbefragung an der IGS Köln-Holweide. MLU Halle-Wittenberg (unveröffentlicht)
Boban, I.; Hinz, A. (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. MLU Halle-Wittenberg
Bohnsack, R. (1997): Gruppendiskussionsverfahren und Milieuforschung. In: Prengel,
A.; Friebertshäuser, B. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. München: Juventa Verlag
Bretz-Kuhlmann, R. (2003): Rezension zu Victoria Caesars Dissertation: Verbreitung, Umsetzungspraxis und Wirksamkeit von Peer Mediation im Kontext schulischer Gewaltprävention URL: http://www.kommotions.de/rezension.pdf [Stand 07.02.05]
Bülter, H.; Meyer, H. (2004): Was ist ein lernförderliches Klima?. Voraussetzungen und Wirkungen. In: Pädagogik. 56. Jhrg., 11/04, S. 31-36
Cloerkes, G. (2001): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. 2.Aufl. Heidelberg: Winter (Edition S.)
Dederich, M. (2001): Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
Dillon, Robin S. (2003): Respect URL: http://plato.stanford.edu/entries/respect/ [Stand 07.02.05]
Drosdowski, G. (1989): Duden. Etymologie. 7. Band. 2. Aufl. Mannheim u.a.: Duden Verlag
Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T. (2000): Ich will halt anders sein als die anderen. Abgrenzung, Gewalt und Kreativität bei Gruppen Jugendlicher. Opladen: Leske und Budrich
Erste Ergebnisse der Forschungsprojekts von Krüger, H.-H.; Helsper, W., u.a. (2002- 2005): Politische Orientierungen bei Schülern im Rahmen schulischer Anerkennungsbeziehungen. Eine quantitative und qualitative Studie in den neuen und alten Bundesländern. Forschungsprojekt am ZSL der MLU Halle-Wittenberg URL: http://www.zsl.uni-halle.de/anerkennung/Resultate.htm [Stand 16.01.05]
Faller, K.; Kerntke, W.; Wackmann, M. (1996): Konflikte selber lösen. Mediation für Schule und Jugendarbeit. Mühlheim a.d.R.: Verlag an der Ruhr
Fend, H. (1997): Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz. Aufbau und Verlust von Lernmotivation, Selbstachtung und Empathie. Bern u.a.: Huber
Fend, H. (2003): Entwicklungspsychologie des Jugendalters. 3. Aufl., Opladen: Leske und Budrich
Flammer, A.; Alsaker, F.D. (2002): Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Bern u.a.: Verlag Hans Huber
Fliegel, S. (2000). Mobbing in der Schule.URL: http://www.wdr.de/radio/wdr2/westzeit/psychologie001108.html [Stand: 19.01.05]
Fragner, J.: Achtung, Anerkennung und Gerechtigkeit. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 4/5/2002, S.37-48
Gehrmann, P. (2001): Gemeinsamer Unterricht. Fortschritt an Humanität und Demokratie. Opladen: Leske und Budrich
Grob, A.; Jaschinski, U. (2003): Erwachsen werden. Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Basel: Beltz Verlag
Häcker, H.; Stapf, K.H. [Hrsg.] (1998): Dorsch. Psychologisches Wörterbuch.13. Aufl., Bern: Verlag Hans Huber
Hartkemeyer, M. u. J.F.; Dhority, L.F. (2001): Miteinander Denken. Das Geheimnis des Dialogs. 3. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta
Heinzel, F. [Hrsg.] (2000): Methoden der Kindheitsforschung. Ein Überblick über Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive. Weinheim und München: Juventa
Heitmeyer, W. u.a. (1995): Gewalt. Weinheim/München: Juventa
Hentig, H.v. (1993): Die Schule neu denken. Wien, München: Carl Hanser
Hinz, A. (1993): Heterogenität in der Schule. Integration - Interkulturelle Erziehung - Koedukation. Hamburg: Curio URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html [Stand 13.12.2001]
Hinz, A. (2002): Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung?. In: Zeitschrift für Heilpädagogik. 53. Jhrg., S. 354-361
Hinz, A. (2004): Entwicklungswege zu einer Schule für alle mit Hilfe des "Index für Inklusion". In: Zeitschrift für Heilpädagogik. 55. Jhrg., S. 245-250
Homepage der Gesamtschule Köln-Holweide: Schulprogramm URL: http://www.igs-holweide.kbs-koeln.de/seiten/schulprogramm/800/start.html [Stand 11.11.04]Zahlen und Fakten URL: http://www.igs-holweide.kbs koeln.de/seiten/service/datenfakten.htm#Kopf [Stand 11.11.04]
Honneth, A. (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Hurrelmann, H. (2004): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. 7., vollst. überarb. Aufl., Weinheim u.a.: Juventa Verlag Informationen zum Thema Identität des Institutes für Psychologie der Uni Augsburg URL: http://www.philso.uni-augsburg.de/lehrstuehle/Psychologie1/Kratzer/seminar1_kratzer.php.html [Stand 09.01.05]
Jugendwerk der deutschen Shell [Hrsg.] (2002): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robusten Materialismus. Frankfurt a. M.: Fischer
Kahl, R. (2002): Was uns fehlt: Respect. In: Pädagogik 12/2002, 54. Jhrg., S. 42-45
Kahl, R. (2004): Leben entzündet sich nur an Leben. Über Erziehung, Bildung und das Generationenverhältnis URL: http://www.reinhardkahl.de/artikellesen30r_5.html [Stand 07.02.05]
Kahl, R. (2004a): Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland gute Schulen gelingen. Dokumentarfilm. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Keim, W. (1996): Außenansichten eines Insiders - Theoretische Grundlagen und pädagogische Praxis des TKM. In: Ratzki, A.; Keim, W.; Mönkemeyer, M.; u.a. [Hrsg.]: Team-Kleingruppen-Modell Köln-Holweide. Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: P. Lang, S.13-41
Krefft, S. (2002): Austeilen oder einstecken. Wie man mit Gewalt auch anders umgehen kann. München: Kösel Verlag
Knopf, H. (Hrsg.); Gallschütz, C.; Grützemann, W.; Horn, H. (1996): Aggressives Verhalten und Gewalt in der Schule. München: Oldenbourg Verlag
Köbberling, A.; Schley, W. (2000): Sozialisation und Entwicklung in Integrationsklassen. Untersuchungen zur Evaluation eines Schulversuchs in der Sekundarstufe. Weinheim, München: Juventa Verlag
Krüger, H.-H. u.a. (2003): Rechte politische Orientierungen bei Schülern im Rahmen schulischer Anerkennungsbeziehungen. In: Zeitschrift für Pädagogik., 49. Jhrg., 6/2003, S. 797-816
Kühnel, W.; Matuschek, I. (1995): Gruppenprozesse und Devianz. Risiken jugendlicher Lebensbewältigung in großstädtischen Monokulturen. Weinheim u.a.: Juventa
Lutz, R. (2000): Gehen wir vom Menschen aus. Anthropologische Ansätze einer partizipatorischen Pädagogik. In: Dialogische Erziehung. Vierteljahreszeitschrift der Paulo Freire Kooperation. 4. Jahrgang. Ausgabe 3/2000
Mann, I. (1994): Schlechte Schüler gibt es nicht. Initiativen für die Grundschule. 6. Auflage. einheim, Basel: Beltz
Mann, I. (1978): Die Kraft geht von den Kindern aus. Die stufenweise Befreiung von der Lehrerrolle. Lollar: Verlag A. Achenbach
Matschiner, H. (1998): Herkunftswörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag
Minderop, D. (2004): Unterrichtsklima: beobachtbar - messbar?. In: Pädagogik 11/04, 56. Jhrg., S. 26-30
Oerter, R.; Montada, L. (2002): Entwicklungspsychologie. 5.Aufl., Berlin: Beltz
Olweus, D. (2002): Gewalt in der Schule. Was Eltern und Lehrer wissen sollten - und tun können. 3. Aufl. Bern u.a.: Huber
Prengel, A. (1993): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Opladen: Leske und Budrich
Prengel, A. (2005): Anerkennung von Anfang an - Egalität, Heterogenität und Hierarchie im Anfangsunterricht und darüber hinaus. In: Geiling, U.; Hinz, A. [Hrsg.]: Integrationspädagogik im Diskurs. Auf dem Weg zur inklusiven Pädagogik?. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (im Druck)
Preuss-Lausitz, U.; Maikowski, R. [Hrsg.] (1998): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Jugendlicher. Weinheim und Basel: Beltz
Ratzki, A.; Keim, W.; Mönkemeyer, M. u.a. [Hrsg.] (1996): Team-Kleingruppen-Modell Köln-Holweide. Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: P. Lang
Ratzki, A.: Von der Übertragbarkeit eines Modells. In: Ratzki, A.; Keim, W.; Mönkemeyer, M.; u.a. [Hrsg.] (1996): Team-Kleingruppen-Modell Köln-Holweide. Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: P. Lang, S. 283-292
Renges, A. (2003): Mobbing in der Schule URL:http://www.schulberatung.bayern.de/vpmob.htm [Stand 10.01.05] Respect-Research-Group URL: http://www.respectresearchgroup.org/respekt_119__kernthema_erz.htm [Stand 07.02.05]
Rosenberg, M. B. (2002): Gewaltfreie Kommunikation. Aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen. Paderborn: Junfermann Verlag
Rosenberg, M. B. (2004): Erziehung, die das Leben bereichert. Gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag. Paderborn: Junfermann Verlag
Schmidt, A.: Vertrauen und Dialog. Das religiöse Denken Martin Bubers URL: http://www.buber.de/de/vertrauen_dialog.shtml#Dialogik [Stand 07.02.05]
Sander, A. (2004): Konzepte einer Inklusiven Pädagogik. In. Zeitschrift für Heilpädagogik. 55. Jhrg., S. 240-244
Sander, A. (2004a): Inklusive Pädagogik verwirklichen - zur Begründung des Themas. In: Schnell, I.; Sander, A. (Hrsg.) (2004): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 11-22
Schulz-Wensky, G.: Gruppenunterricht - viel mehr als Wissensvermittlung. In: Ratzki, A.; Keim, W.; Mönkemeyer, M.; u.a. [Hrsg.] (1996): Team-Kleingruppen-Modell, S.101-117
Schwager, M. (2004): Die Überwindung der Zwei-Gruppen-Theorie als Indikator für Inklusion. Erfahrungen der Gesamtschule Köln-Holweide. In: Reader zum 7. Integrationstag 2004. MLU Halle-Wittenberg, S.19-31
Sennett, R. (2004): Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Berlin: Berlin Verlag
Speck, O. (1996): Erziehung und Achtung vor dem Anderen. Zur moralischen Dimension der Erziehung. München, Basel: E. Reinhardt Verlag
Ulich, K. (2001): Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. Basel: Beltz
Website Ganztagsschule des BMBF (2004): Schulen, die gelingen. Interview mit Reinhard Kahl URL: http://www.ganztagsschulen.org [Stand 07.02.05]
Weißmann, I. (2003): Formen und Ausmaß von Gewalt in den Schulen. Modelle der Gewaltprävention. Marburg: Tectum Verlag
Wöll, G. (1998): Handeln. Lernen durch Erfahrung. Handlungsorientierung und Projektunterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren
Anlage 1:
"An dieser Schule bilden Schülerinnen oder Schüler Gruppen, die mit den anderen nichts zu tun haben möchten." in Jahrgängen
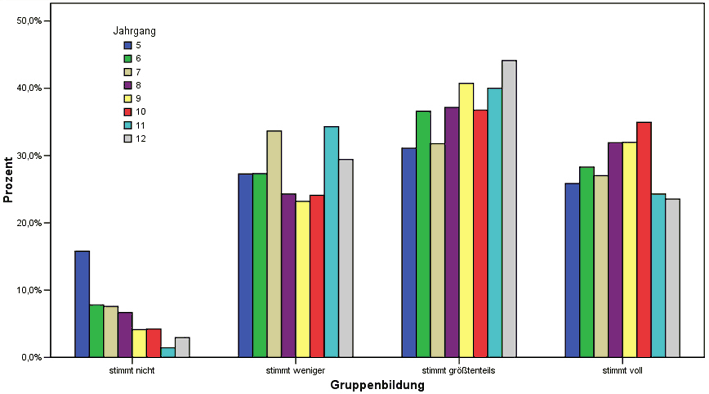
Abb.: Gruppenbildung
Anlage 2:
"Ich denke, dass an dieser Schule niemand ausgegrenzt wird."
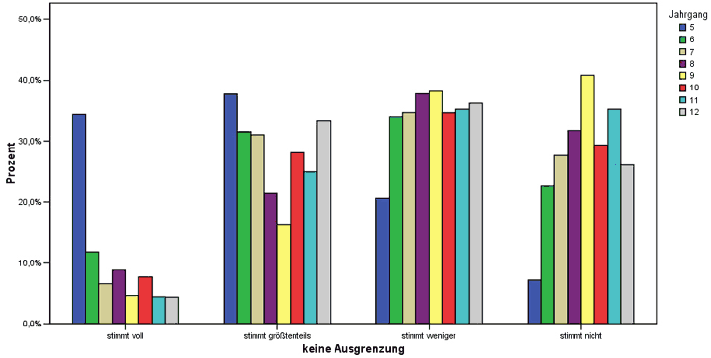
Abb.: keine Ausgrenzung
Quelle:
Katharina Furcht: Respekt unter Jugendlichen an der inklusiven Schule
Examensarbeit an der Philosophischen Fakultät III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Erziehungswissenschaften. März 2005
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 24.10.2006
