Texte und Wirkungen von Ludwig-Otto ROSER
Hrsg: Jutta Schöler. Mit 14 Beitr. von Ludwig-Otto Roser aus den Jahren 1969-1995 sowie Beitr. von: Klaus Christ ...Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1998, ISBN 3-472-03413-0
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Florenz: Neue Auffassungen der Integrierung Behinderter in Schule und Arbeit - Ludwig-Otto Roser
- Integrationspädagogische Impulse durch Ludwig-Otto ROSER - Alfred Sander
- Integration Behinderter in Italien: Anspruch und Realität - Ludwig-Otto Roser
- Non Emarginazione! Integration heißt Ausschluß vermeiden! - Wolfgang Jantzen
- Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation - Voraussetzung für die reale Anpassung Behinderter - Adriano Milani-Comparetti/Ludwig-Otto Roser
- Es war einmal ...? - Barbara Forst
- Vom Recht auf Anderssein - Michael Wunder
- Wer hat Angst vorm behinderten Schüler? Gemeinsam Leben und Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten in Italien - Ludwig-Otto Roser
- Zurück zu den Anfängen ... - Helga Deppe-Wolfinger
- Hilfe für Behinderte in der Gemeinde - Ursache oder Folge der Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen? - Ludwig-Otto Roser
- Schule ohne Aussonderung in Italien - Ludwig-Otto Roser
- Politische Zeiten, sachbegeisterter Mittler - Michael Göhlich
- Brücken zu Schwerstbehinderten - Ludwig-Otto Roser
- Wege und Brücken zu Normalität und Integration - Klaus Christ
- Die Förderung der Normalität der behinderten Kinder - Ein Beitrag von Medizinern und Psychologen - Ludwig-Otto Roser
- Ein unbequemer Mensch - Ludwig-Otto Roser
- Gegen die Logik der Sondereinrichtung - Ludwig-Otto Roser
- »... Integration ist Ausdruck einer hoffenden, sich entwickelnden Welt.« - Georg Feuser
- Chronik einer Wunscherfüllung - Ludwig-Otto Roser
- Erfahrungen - Volker Schönwiese
- Die Förderung der Normalität des »behinderten« Kindes - Ludwig-Otto Roser
- Den Eltern die Normalität ihres Kindes zurückgeben! - Jutta Schöler
- Vorschlag und Gegenvorschlag: Der Dialog in der Vielfalt der Lebenswelt behinderter Menschen - Ludwig-Otto Roser
- Zur Utopie der Freundschaft - Ludwig-Otto Roser
- Persönlicher Bericht über meine Begegnungen mit Otto ROSER - Rainer Hoehne
- Liste der Veröffentlichungen von Ludwig-Otto ROSER
- Literatur, auf die sich Ludwig-Otto ROSER bezieht
- Autorinnen und Autoren dieses Buches
Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Buchreihe begonnen, die den Anspruch hat, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen sowie die gemeinsame, keinen Menschen aussondernde, Erziehung zu unterstützen. Sie trägt den Titel:
Gemeinsames Leben und Lernen: Integration von Menschen mit Behinderungen - Praxis und Theorie
Mit dieser Buchreihe verpflichte ich mich als Herausgeberin, Texte von Autorinnen und Autoren aufzuspüren, die den Erwerb von Autonomie als einen lebenslangen Prozeß begreifen. Der Erwerb von Autonomie und die schrittweise Emanzipation aus der Abhängigkeit von anderen Menschen wird dabei als ein flexibler Prozeß verstanden, der am ehesten mit einer offenen Spirale verglichen werden kann. Mit zunehmender Autonomie erkennt jeder Mensch nicht nur seine eigenen Fähigkeiten, sondern vor allem die Mittel und Hilfen, die in einem kooperativen Prozeß von Mitmenschen geboten werden können. Erst das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und die Sicherheit der Nähe zu anderen Menschen erlauben eine autonome Lebensführung und die Gestaltung der eigenen Vorstellungen von einem erfüllten und sinnvollen Leben. Dieses Prinzip gilt für alle Menschen - auch für Menschen mit einer schweren Behinderung.
Autonomie ist von den einzelnen Menschen nicht alleine zu erreichen. Ein selbstbestimmtes Leben bedarf anderer Menschen, die die Emanzipation von Fremdbestimmung als ein Grundrecht für alle Menschen akzeptieren, Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg in der realen Welt begleiten und das Erreichen dieses Zieles erleichtern: Selbstbestimmt leben!
Eine Form der Unterstützung auf diesem Weg kann darin bestehen, theoretische Texte in einer gut lesbaren Form zur Verfügung zu stellen, die den Menschen dazu verhelfen, die notwendige innere Sicherheit zu gewinnen, um Phasen von Angst und Pessimismus zu überwinden. Zugleich sollen praktische Beispiele Mut machen. Es sollen Anregungen gegeben werden, wie Lernprozesse gestaltet werden können, damit alle Kinder und Jugendlichen in der Verschiedenheit ihrer Aneignungsformen respektiert werden.
Ich bedanke mich beim Hermann Luchterhand Verlag, der diese neue Buchreihe unterstützt. Ich bitte alle Leserinnen und Leser, über den Verlag Texte an mich einzureichen, die für diese Buchreihe als geeignet eingeschätzt werden. Dabei denke ich vor allem an Abschlußarbeiten (Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten), die sich einer nichtaussondernden pädagogischen Theorie verpflichtet fühlen und einer pädagogischen Praxis, die die Autonomie von Menschen versteht als die Fähigkeit, etwas alleine zu machen, mit dem eigenen Kopf zu denken, die die Freiheit zum Handeln nutzen mit Respekt vor der Freiheit der anderen Menschen.
Mit dieser Buchreihe möchte ich auch Mut machen, damit die Menschen, die gegenwärtig noch die Sonderinstitutionen als notwendige (Zwischen) Station für Menschen mit Behinderungen ansehen, diese gesellschaftlichen Nischen verlassen. Lange genug ist bewiesen worden, daß die Sondereinrichtungen Menschen mit Behinderungen nicht auf ein Leben in dieser Gesellschaft vorbereiten können. Die Gesellschaft kann sich nicht entwickeln, um Menschen zu akzeptieren, welche anders, langsamer oder in ungewohnten Formen leben und lernen, wenn Kinder nicht von klein auf die Gelegenheit haben, diese Lebensform gemeinsam zu lernen.
Sonderpädagogik und Regelpädagogik als bisher getrennte Wissenschaften müssen sich dahin entwickeln, daß das gemeinsame Lernen und die Unterstützung von Autonomiebestrebungen Aufgabe jeglicher Pädagogik wird: Normalität ist das gemeinsame Leben mit den Menschen, die gegenwärtig noch als »Behinderte« bezeichnet werden. In ihrer realen Umwelt zu leben und dort mit ihnen zu arbeiten »erfordert ein ständiges Überdenken und Suchen, erfordert Kreativität, Flexibilität, Auseinandersetzung. Wir sollten uns nicht davor fürchten, denn Sondereinrichtungen sind Ausdruck von Angst und Pessimismus; Integration ist Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden Welt«. (Ludwig-Otto ROSER)
Mit dem Erscheinen des ersten Bandes der Buchreihe »Gemeinsames Leben und Lernen: Integration von Menschen mit Behinderungen - Praxis und Theorie« verweise ich auf einen »Vorläuferband«, der auf meine Anregung im Frühjahr 1998 vom Hermann Luchterhand Verlag veröffentlicht wurde: Rene J. MÜLLER/Maren HANS (Hrsg.): Hörgeschädigte in der Schule. Als Band zwei der Reihe wird eine Veröffentlichung zum Englischunterricht in Integrationsklassen erscheinen. Veröffentlichungen zum Mathematik- und Musikunterricht, zu den Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie zur Fortbildung für integrativen Unterricht werden vorbereitet.
Jutta Schöler
Berlin, im Mai 1998
Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Texte und Wirkungen von Ludwig-Otto ROSER
Ludwig-Otto ROSER reiste am 1. Januar 1954 gemeinsam mit seiner Frau Renate von Wiesbaden nach Florenz - drei Monaten zuvor hatte er sein Psychologiestudium mit der Promotion abgeschlossen - vor drei Tagen hatte er geheiratet.
Diese Reise, besser »Auswanderung«, war schon lange geplant gewesen -:beide kannten sich seit vielen Jahren, und sie hatten diesen Plan für ihre gemeinsame Zukunft: Sobald Otto sein Studium abgeschlossen haben würde, wird nach Italien ausgewandert (Renate hatte ihre Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin bereits beendet). Otto kannte Italien, denn seine Mutter war Italienerin - er selbst wurde 1926 in Rom geboren. Einen großen Teil seiner Ferien verbrachte er bei der Familie der Mutter. Während seiner Kindheit und Jugend lebte er als einziger Sohn bei seinem deutschen Vater und der italienischen Mutter in Wiesbaden. Von 1948-1953 studierte er zunächst drei Semester in Heidelberg und danach in Mainz.
Das wesentliche Motiv für den Weggang des jungen Paares aus Deutschland war das zunehmende Unbehagen über das Wiedererstarken faschistischer Gedanken nach dem Krieg. Zu viele, die während der Zeit des Nationalsozialismus an Kriegsvorbereitungen, Aussonderungen von Menschen und Machtmißbrauch beteiligt waren, kamen wieder in einflußreiche Positionen. Zu wenig wurde über eine grundlegende demokratische Erneuerung des Gesellschaftssystems - insbesondere der gesundheitlichen und psychiatrischen Versorgung - nachgedacht.
Die erste Zeit in Florenz war nicht leicht. Otto und Renate ROSER mußten sich irgendwie durchschlagen; zunächst mit den Übersetzungen und Deutschkursen von Renate und einer Beteiligung Ottos an den Arbeiten des Psychologischen Instituts der Stadt Florenz. In dieser Institution ergab sich eine Zusammenarbeit mit einem »Harvard Florence Research Project« genannten Forschungsteam, das, in Verbindung mit der städtischen Kinderklinik, die psychologische Situation der Florentiner Nachkriegskinder untersuchte (1954 und 1959). Diese Tätigkeit brachte Otto mit dem damals an der Kinderklinik tätigen Adriano MILANI-COMPARETTI zusammen. Otto wurde dadurch auch psychologischer Berater der Kinderklinik, insbesondere in der neurologischen Abteilung. Adriano MILANI-COMPARETTI wurde 1956 vom Italienischen Roten Kreuz beauftragt, ein Heim für spastisch gelähmte Kinder aufzubauen. Bei dieser Gründung stand auch Otto dem Freund Adriano mit Rat und Tat zur Seite, eine Zusammenarbeit und eine Präsenz, die bis zu MILANIS Tod (1985) angedauert hat. In den Jahren der Gründung dieses Instituts (»Anna Torrigiani«) für Spastischgelähmte, wandten die beiden Freunde sich an eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen, die sich im Hause einer Pädagogikprofessorin trafen. Um Margherita FASOLO (1905-1956)[1] fanden sich Lehrerinnen und Lehrer zusammen, die zwei Interessen gemeinsam hatten: die Auseinandersetzung mit ihrer antifaschistischen Vergangenheit und das Arbeiten für die Vision einer offenen, demokratischen Schule für alle Kinder. Viele aus dieser Gruppe hatten als Partisanen gegen die deutsche Besatzung und gegen den Mussolini-Faschismus, z.T. auch zuvor in Spanien auf der Seite der Kommunisten, gekämpft. Zu dieser Gruppe gehörte - aufgrund der gemeinsamen politischen Vergangenheit - der Mediziner Adriano MILANI-COMPARETTI.
Diese Gruppe hatte auch intensive politische und pädagogische Kontakte zur französischen FREINET-Bewegung und gründete das italienische Pendant zu dieser pädagogischen Reforminitiative: Die »Centri Esperienze Metodi Educazione Attiva«[2] (CEMEA). Diese Zentren waren eine Art von »Sommer-Ferienlagern«, in denen Kinder und Jugendliche betreut wurden.
Nachdem Adriano MILANI-COMPARETTI das Kinderheim für spastisch behinderte Kinder »Anna Torrigiani« 1957 in Florenz gegründet hatte, begann er damit, dieses Heim durch eine Schule zu ergänzen.
Adriano MILANI-COMPARETTI suchte sich für diese Schule die Lehrerinnen aus dem Kreis der CEMEA; er ließ sich bei dieser Auswahl auch von Margherita FASOLO beraten. Eine dieser jungen Lehrerinnen war Maria-Teresa TASSIMARI, die von 1957-1980 an der Schule des Instituts »Anna Torrigiani« unterrichtete. Sie gehört damit - neben Ludwig-Otto ROSER - zu den wenigen Personen, die am Institut von Adriano MILANI-COMPARETTI von der Gründung der Sonderschule für spastisch behinderte Kinder bis zu ihrer Auflösung gearbeitet haben.[3]
Nachdem Otto sich in diesen Jahren um die italienische Übersetzung und Anpassung vieler deutscher und amerikanischer Tests im Auftrag der »Organizzazioni Speciali« bemüht hatte, übernahm er die psychologische Beratung in einer Mailänder Behinderteneinrichtung und »pendelte« von 1962 bis 1970 jede Woche für zwei Tage von Florenz nach Mailand. In einem seiner Texte verarbeitete er die Erfahrungen der Tätigkeit in diesem Heim: »Brücken zu Schwerstbehinderten«.
Mitte der 60er Jahre war es auch in Italien noch ein Problem, daß für viele Kinder mit Behinderungen keine Betreuungseinrichtungen zur Verfügung standen. Die erste Stufe einer Entwicklung hin zu einem Leben in der Normalität für Kinder mit einer spastischen Behinderung war deshalb, die Bildungsfähigkeit dieser Kinder zu beweisen. Zehn Jahre später - etwa ab 1967/68 - wendeten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER immer häufiger nach außen, um die von ihnen betreuten und geförderten Kinder auf ihrem Weg in die Gesellschaft zu begleiten. Zunächst bezogen sich diese Eingliederungsversuche auf den »freien« Arbeitsmarkt. In einer alten Fabrik wurde eine Art »beschützende Werkstatt« eingerichtet (seit 1966). Danach wurden Kinder, die im Haus »Anna Torrigiani« ihre Grundschulzeit verbracht hatten, in die Mittelschulen am jeweiligen Wohnort integriert. Bis 1972 war erreicht, daß alle Kinder die Schule an Wohnort besuchen konnten.
Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER standen in engem Kontakt zu internationalen - vorwiegend medizinisch orientierten - Organisationen, die sich die Förderung der spastisch behinderten Menschen zur Aufgabe gemacht hatten. Zahlreiche Besuchergruppen aus dem -anglo-amerikanischen, dem französischen und dem deutschen Sprachraum besuchten das Zentrum »Anna Torrigiani«, das damals wegen der umfassenden medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Betreuung, die den Kindern und ihren Familien geboten wurde, etwas einzigartiges in Europa war. Außerdem boten Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER - zum Teil gemeinsam, zum Teil einzeln - Fortbildungskurse für Mediziner und Therapeuten an und wurden dann ab Anfang der 80er Jahre immer häufiger zu Vorträgen eingeladen.
Ludwig-Otto ROSER hat in seinen Vorträgen zahlreiche Zuhörer tief beeindruckt: Mit seiner überzeugenden Art des Auftretens, mit seiner großen Glaubwürdigkeit, den anschaulichen Berichten über die Menschen, zu denen er in festem Kontakt stand und die er mit ihren Familien begleitete. Seine deutsche »Vater«-sprache erleichterte ihm die Vortrags- und Diskussionstätigkeit.[4] Aus diesen Vorträgen sind die zahlreichen Aufsätze entstanden, von denen eine Auswahl in dem hier vorliegenden Buch zusammengestellt wurde. Alle deutschen Autoren und Autorinnen, die sich an diesem Buch beteiligt haben, lernten Ludwig-Otto ROSER zu Beginn der 80er Jahre kennen - bei einem Vortrag oder bei einem Besuch in Florenz. Viele dieser Menschen kennen Ludwig-Otto ROSER nur unter dem Namen Ludwig ROSER. Manche haben in ihrem eigenen Sprachgebrauch die Namensgebung Otto-Ludwig oder Ludwig-Otto aufgenommen. Diese unterschiedlichen Namen werden bewußt für dieses Buch nicht geglättet, aber das Rätsel soll gelöst werden:
Otto ROSER lebte in Deutschland immer unter dem Namen »Otto«. Alle seine Zeugnisse, selbst sein »militärisches Soldbuch«, das ihm Ende des 2. Weltkrieges noch ausgestellt wurde, lauteten auf den Namen »Otto«. Erst als er nach Italien ging und für die dortigen Behörden seine Identität nachweisen mußte - u.a. zur Anerkennung seiner Promotion - stellte es sich heraus, daß er im Geburtenregister der Stadt Rom geführt wird als Ludwig ROSER (und der zweite Name ist Otto). Er mußte deshalb den »offiziellen« Namen Ludwig übernehmen. Für seine Freunde und seine Familie war er immer Otto. Für viele Menschen aus Deutschland, die ihn aus beruflichen Zusammenhängen kennengelernt hatten, war er immer Ludwig. Für dieses Buch haben Otto ROSER und ich als Herausgeberin uns deshalb dazu entschieden, diese beiden Beziehungen erkennbar bleiben zu lassen: Ludwig-Otto ROSER.
Von seinen 22 in deutscher Sprache veröffentlichten Texten habe ich 14 ausgewählt, z.T. leicht bearbeitet oder gekürzt. Es erschien mir wichtig, in einer Zeit, in der die gemeinsame Erziehung und das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung zunehmend mehr unter den Aspekten der »Machbarkeit« diskutiert wird, sich auf die grundlegenden Ideen zu beziehen. Gemeinsam mit Otto ROSER habe ich überlegt, welche Kolleginnen und Kollegen Anfang der 80er Jahre den Kontakt nach Italien und speziell zu ihm und Adriano MILANI-CoMPARETTI gesucht haben. Fast alle, die ich für dieses Projekt zum ersten Mal im Herbst 1996 angesprochen habe, beteiligten sich, indem sie einen Text schrieben, der deutlich macht, welche Wirkungen die Begegnung mit Ludwig-Otto ROSER bei ihnen und für ihre Arbeit in Deutschland hinterlassen hat. So konnten 14 Texte von Ludwig-Otto ROSER und 11 Texte, die seine Wirkungen dokumentieren, zu diesem Sammelband zusammengefaßt werden.
Jutta Schöler
Berlin, im Mai 1998
[1] Ein Lehrbuch von Margherita FASOLO war in den 50er und 60er Jahren in Italien die wesentliche Grundlage für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern: Orientamenti sul Problems Educativo. Firenze 1953 (La Nuova Italia Editrice).
[2] »Zentren der Erprobung von Methoden einer aktiven Erziehung«
[3] Dem Gespräch mit ihr und ihrem Mann, Prof. Gastone TASSINARI, verdanke ich im wesentlichen die Informationen über die Anfänge der Tätigkeit von Ludwig-Otto ROSER im Behindertenzentrum »Anna Torrigiani«.
[4] Auch Adriano MILANI-COMPARETTI sprach gut deutsch. Er nutzte diese Sprachkenntnisse jedoch zumeist nur in kleinen Diskussionsrunden.
Florenz: Neue Auffassungen der Integrierung Behinderter in Schule und Arbeit[5] - Ludwig-Otto Roser
Florenz ist nicht die einzige Stadt und die Toskana nicht das einzige Land in Italien die mit großer Entschiedenheit die Integrierung Behinderter durchgeführt haben. Ich berichte von Florenz, weil ich dort seit 25 Jahren als Psychologe tätig bin. In dieser Zeit habe ich (vom Ausbau der Sonderschulklassen zur Entwicklung der Sonderpädagogik, von der Errichtung der Tages- und Daueraufenthaltszentren für geistig und körperlich Behinderte bis zur fast totalen Auflösung aller dieser Institutionen) miterlebt, wie nach der bewußten oder unbewußten Isolierung durch das Alibi der Rehabilitation, eine Gesellschaft entdeckt, welches die wahren Bedürfnisse der Behinderten sind.
Ich selbst hatte eine Sonderschule für Körperbehinderte mit aufbauen helfen, die unter Prof. Adriano MILANI-COMPARETTIs Leitung, während der fünfziger und sechziger Jahre, in Florenz und in Italien maßgebend geworden war für intensive und hoffnungsvolle Rehabilitation.
Der Weg zu dem, was nunmehr in Deutschland oft als Florentiner Modell bezeichnet wird, hat vier Phasen durchlaufen:
-
Kritische Analyse der Rehabilitation und ihre Entmystifizierung
-
Bewußtwerdung der Behinderten vor allem in Bezug auf die im Namen der Rehabilitation isolierende und auslesende Tendenz der Gesellschaft
-
Bewußtwerdung der nichtbehinderten Bürger und Ausweitung des Begriffs »Behinderung« auf alle Situationen, die das Leistungsprinzip und die gängige Wertskala hervorrufen
-
Überregionale Gesetzgebung des Staates (keine neuen Zugänge mehr in die Nervenheilanstalten, Dezentralisierung des Gesundheitswesens, Abschaffung der Noten in der Regelschule usw.)
1. Kritische Analyse der Rehabilitation und ihre Entmystifizierung
Die Entwicklung des gesunden Kindes vollzieht sich im Kontakt mit der Realität der Außenwelt. Beim zerebral geschädigten Kinde wird ein Anderssein vorbereitet und bekräftigt z. B. auf dem Weg von der Mutter fort in die Kinderklinik, in den Sprachunterricht, in die Heilgymnastik, in den besonderen Kindergarten, in die Sonderschule, in die geschützte Werkstatt.
Warum geschieht das?
Es gibt zwei grundlegende Ursachen: die eine ist gegeben durch die Hypothese, daß die Rehabilitationsarbeit mit dem Kinde intensiv und individuell und deshalb getrennt von den normalen Erziehungseinrichtungen zu erfolgen hat, damit es sich »wieder« sozial den anderen annähern kann (wobei impliziert ist, daß es erst dann ein soziales Wesen wird, wenn es normal ist). Die zweite Ursache der Entwicklung in die falsche Richtung ergibt sich dadurch, daß Rehabilitation schließlich Selbstzweck wird. Die Auflösung der Tagesstätten und Heime in Florenz hat diesen sehr menschlichen Konflikt ganz deutlich gezeigt: viele in der Rehabilitation tätigen Fachkräfte fürchteten Arbeitslosigkeit, weil sie nicht in der Lage waren, umzudenken.
Dabei ist nicht bedacht, daß jedes Arbeiten mit dem Kinde oder mit dem behinderten Erwachsenen, das aus dem Bereich einer natürlichen Motivation herausreicht, entfremdet und absondert, selbst beispielsweise die so unerläßliche Physiotherapie bei Körperbehinderten, wenn es sich darum handelt, das Kind dreimal in der Woche eine halbe Stunde lang aus den Armen der Mutter zu nehmen, statt die Mutter zu unterweisen, die den ganzen Tag Bewegungsabläufe und Haltungen motivieren kann.
Aber kurz zurück zu der Hauptursache, die in der Rehabilitation den Behinderten von der Normalität fortführt: die Isolierung von der Außenwelt. Warum kommt sie zustande? Nur einige der häufigsten Argumente: Eltern erwarten, daß für ihr Kind etwas besonderes getan wird; man delegiert an den Fachmann, die Gesundung des Kindes in einer zu diesem Zweck besonders ausgestatteten Umwelt zu fördern; die Kinder (und auch die Eltern) sollen nicht leiden, wenn sie sich mit anderen vergleichen; ihr langsames Lernen würde in der Regelschule für die nichtbehinderten Kinder ein Hindernis darstellen; oder auch Angst vor dem Unbekannten und vor den Problemen, die der Behinderte im normalen sozialen Kontakt stellt. Und, ganz allgemein, um den gesellschaftlichen Maßstäben gerecht zu werden (Leistung, Schönheit, Gesundheit).
Aber schließlich: Rehabilitation ist notwendig - wann und wo soll sie durchgeführt werden?
Wenn ihr Hauptziel Eingliederung in die Umwelt ist, dann kann sie sich nur im Bereich der Familie und der Umwelt vollziehen.
Wer muß sich nicht gestehen, daß jahrelanger Besuch der Sonderschule oder Aufenthalt in perfekt ausgestatteten Zentren nur in ganz seltenen Fällen Eingliederung in den normalen Lebensbereich bedeutet haben? Rehabilitation beginnt schon damit, daß die Eltern nicht dem Fachmann alleine überlassen, ihr Kind wieder in Ordnung zu bringen, sondern mit ihm in der Realität des täglichen Lebens alles versuchen, ihn - den Fachmann selbst - (um es überspitzt auszudrücken) überflüssig zu machen. Die eigentliche Aufgabe des Fachmanns in der Rehabilitation ist, den Behinderten zu sich selbst zu führen, indem er - der Fachmann - so wenig wie möglich in Erscheinung tritt (denn sein Wirken bekräftigt in dem Behinderten das Anderssein).
Seit in Florenz diese Überzeugungen Fuß gefaßt haben, wehrt sich kein Kindergarten und keine Schule mehr, auch Schwerbehinderte aufzunehmen. Sonderschulen gab es im Grunde weil die Regelschule Behinderte nicht wollte! Man hat also aus der Not eine Tugend (Rehabilitation) gemacht. Die Rehabilitierung ist demnach ein soziales Problem und nicht eine Frage der »Gesundung« des Behinderten.
In den letzten sechs Jahren haben die Erfahrungen gezeigt, in wie starkem Maße Sprachtherapie, Physiotherapie und Beschäftigungstherapie sich als überflüssig oder sogar als die soziale und geistige Entwicklung hemmend erwiesen haben. Keine Sprachtherapie ist z.B. besser als die Notwendigkeit, mit normalen Altersgenossen zu kommunizieren (ganz abgesehen davon, daß sprachgestörte Kinder untereinander sich in der Schwierigkeit zu kommunizieren nur bestätigen können).
Allein aus den Ambulatorien[6] für Körperbehinderte sind in Florenz in den letzten fünf Jahren 150 Behinderte zuerst in den Kindergärten und dann in den Regelschulen aufgenommen worden (die italienische »Pflicht«-schule reicht vom sechsten bis zum vierzehnten Lebensjahr). Als alter »Sonderpädagoge« kann ich versichern, daß mich die Resultate dieser Integrierungsarbeit oft tief beschämt haben: jahrelang mit einem Kinde arbeiten und sehen, wie es in wenigen Monaten aufblüht und Unglaubliches leistet, weil es mit normalen Altersgenossen verkehrt.
2. Bewußtwerdung der Behinderten vor allem in bezug auf die im Namen der Rehabilitation isolierende und auslesende Tendenz der Gesellschaft
Die Widerstände von Behörden, von Elterngruppen (die Zentren und Sonderschulen beibehalten wollten), von Erziehern der Regelschule, von Therapeuten und Ärzten haben vor dem unglaublich rasch sich aufhäufenden Beweismaterial, vor der Evidenz des (sowohl vom menschlichen als auch vom fachlichen her gesehen) Besseren, bald kapitulieren müssen. Gruppen und Organisationen von Eltern Behinderter haben einen immer größeren Druck (selbst mit Demonstrationszügen durch die Stadt) ausgeübt, um die öffentliche Meinung zu gewinnen. Am verblüffendsten aber waren die Lehrkräfte der Regelschulen, die ohne Spezialisierung und nur mit ihrem Berufsethos ausgestattet, diese Integrierung durchgeführt haben: nach wenigen Wochen wurde von vielen die Hilfeleistung der Fachleute als überflüssig empfunden. Meist galt es nur, eine Ängstlichkeit zu überwinden.
3. Bewußtwerdung der nichtbehinderten Bürger und Ausweitung des Begriffs »Behinderung« auf alle Situationen, die das Leistungsprinzip und die gängige Wertskala hervorrufen
Diese Entwicklung hat, dank auch der immer populärer werdenden Gedanken von Leuten wie BASAGLIA, PIRELLA, Don Lorenzo Adriano MILANI-COMPARETTI u.a. eine starke Wirkung auf die Welt der Schule gehabt; und dadurch sind weite Kreise der Bevölkerung mit den Problemen der Behinderten in Berührung gekommen. Die Eingliederung selbst schwerbehinderter Kinder in die Normalschule, nicht so sehr des Lernens wegen, sondern um mit anderen Kindern zu wachsen und sich in den Grenzen ihrer Möglichkeiten zu entwickeln, hat Diskussionen entfacht, die zum Hauptthema des menschlichen und politischen Fortschritts geworden sind. Dabei denke ich, daß eine Gesellschaft »fortschrittlich« ist, wenn sie die Belange der Schwächeren, der Gestörten, der Behinderten konstant in ihre Entwicklung einbezieht statt diesen Menschen goldene Käfige zu bauen. Freilich ist es mit der Integrierung Behinderter im Schulalltag nicht getan. Es handelt sich um einen vorbereitenden Schritt, der nicht ohne Folge auf die Integrierung auch des erwachsenen Behinderten bleiben kann. Aber erst wenn es allgemein akzeptiert werden wird, daß es Menschen gibt, die weniger arbeiten, weil sie behindert sind, ohne deshalb weniger wert zu sein, hat sich Integration wirklich vollzogen. n ist noch ein langer Weg.
Die italienische Metallarbeitergewerkschaft hat z. B. in den letzten Arbeitsvertragvertrag eine Klausel aufgenommen, nach der Integrierung Behinderter nicht von der Großmut des Arbeitgebers abhängen darf, sondern ein Prinzip der Solidarität der arbeitenden Bevölkerung darstellen soll. Das Gesetz über die Anstellung von Behinderten hatte in der Tat auch in Italien wenig Erfolg gehabt (ganz abgesehen von der wirtschaftlich bedingten Arbeitslosigkeit). Erst seitdem die Gesamtbevölkerung und die Behinderten selbst diese Probleme nicht mehr am Rande erleben, sondern in den Brennpunkt der Fragen des Zusammenlebens stellen, rührt sich auch etwas für die Integration auf dem Gebiete der Arbeit. Z.B. besteht seit wenigen Monaten ein Abkommen zwischen der Stadt Florenz und den Handwerkerverbänden, Lehrstellen auch für Schwerbehinderte einzurichten, mit dem Ziel - auch hier - nicht in künstlichen Situationen zu schulen, sondern, was gerade für den behinderten Lehrling oder Arbeiter notwendig ist, in der Bereitstellung und in dem Erleben eines Arbeitsplatzes »nach Maß«. So erkennt man, daß es in jedem Betrieb auch für Schwerbehinderte etwas zu tun gibt.
4. Überregionale Gesetzgebung des Staates (keine neuen Zugänge mehr in die Nervenheilanstalten, Dezentralisierung des Gesundheitswesens, Abschaffung der Noten in der Regelschule usw.)
Im wachsenden Maße hat die von der Gesellschaft ausgehende Bewegung gegen Isolation in der zentralen und regionalen Gesetzgebung ihren Ausdruck gefunden: Dies sind z.B. die Sozialisierung und Dezentralisierung des Gesundheitswesens, das Verbot von Neuaufnahmen in Nerven »heil« anstalten, das Gesetz der staatlichen Versorgung aller Behinderten und all die legislativen Initiativen, die es behinderten Kindern ermöglichen, mit ihren nichtbehinderten Altersgenossen zu wachsen und im Leben zu stehen. Von diesen letzteren nur einige Maßnahmen: Abschaffung der Notengebung in den acht Klassen der Normalschule; nicht mehr als zwanzig Kinder in den Klassen, in die Behinderte aufgenommen worden sind; Bereitstellung von zusätzlichem Personal in den schweren Fällen (das aber nicht auf das behinderte Kind »aufpassen« soll, sondern für alle mit da ist); Abschaffung aller Sonderklassen und Einbeziehung des vorher zur Verfügung gestandenen »spezialisierten« Personals in den Personalbestand der Schule.
Zum Abschluß: Wenn man sich diese Entwicklung vor Augen hält wird bewußt, wie stark Sonderpädagogik isoliert. Denn so lange Sinn der Rehabilitation ist, den Behinderten zu den Zielen zu führen, die den Nichtbehinderten systemnotwendig erscheinen, bleib sie ein Mechanismus der Isolierung und der Auslese. Erst wenn als richtig empfunden wird, dass jeder das Recht hat, sein Selbst unter anderen gleichberechtigt zu realisieren, wird auch das Lernen für den Behinderten wieder sinnvoll. Pädagogik müsste dann vornehmlich die Aufgaben haben, denen zu helfen, sich das Erbgut der Gesellschaft anzueignen, die nicht in den dazu optimalen Bedingungen leben. Die hierarchisch geordnete Gesellschaft fördert Priviligierte, solche die Besseres leisten.
[5] Ludwig-Otto ROSER hat den folgenden Text 1979 auf dem Kongreß des Verbandes Deutscher Sonderschullehrer vorgetragen. Auf diesen Vortrag bezieht sich Alfred SANDER in seinem nachfolgenden Beitrag (siehe S. 21-25)
[6] Die Ambulatorien wurden seit Mitte der 70er Jahre den Wohnquartieren zugeordnet und dienten einer umfassenden, nicht behinderungsspezifischen medizinisch-therapeutischen Versorgung aller Bewohner. Die zuvor existierenden behinderungsspezifischen Versorgungszentren wurden nach und nach aufgelöst. (Anmerkung J. SCHÖLER)
Meine erste Begegnung mit Dr. Ludwig Otto ROSER fand im Juni 1979 in Frankfurt am Main statt. Es ist nicht möglich, daß er sich daran erinnert; denn ich war einer der Zuhörer seines Vortrags »Florenz: Neue Auffassungen der Integration Behinderter in Schule und Arbeit« im Rahmen des bundesweiten sonderpädagogischen Kongresses über »Die pädagogische Förderung Behinderter im Aufgabenfeld praxisorientierter Wissenschaften« des Verbands Deutscher Sonderschulen (vds). Bei diesem Kongreß spielte aus aktuellem Anlaß die amtliche Zuerkennung des Schwerbehindertenstatus eine zentrale Rolle; statt der Messung in % MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) wurde erstmals die in % GdB (Grad der Behinderung) gefordert, unter anderem weil diese Skala auch auf Kinder im vorschulischen und schulischen Alter anwendbar ist. Von Ludwig-Otto ROSERS Beitrag war ich besonders beeindruckt; im Kongreßbericht für die Vierteljahreszeitschrift »Sonderpädagogik« schrieb ich damals, daß Ludwig-Otto ROSER »eine besonders progressive Antwort auf das (...) Problem der amtlichen Zuerkennung des Behindertenstatus gab. Ludwig-Otto ROSER berichtete aus Italien (...). Dort wurden amtlicherseits die sonderpädagogischen Institutionen aufgelöst und ihre Zöglinge, getragen von breiter gesellschaftlicher Zustimmung, zum größten Teil in Regelschulen integriert (gleichzeitig wurde in den acht Pflichtschuljahren der Regelschulen die Notengebung abgeschafft). Der Behindertenstatus wurde also geradezu amtlich aberkannt.« (SANDER 1979, S.141). Die Botschaft war: Manche Kinder sind verschieden, aber sie gehören dennoch dazu; und bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß alle Kinder verschieden sind. Ein von Amts wegen festzustellender Behindertenstatus ist insoweit verzichtbar.
In der Bundesrepublik Deutschland gab es damals immerhin schon fast sechs Jahre lang die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates »Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher«, ein Dokument, das von vielen Fachleuten immer noch als Meilenstein der deutschen Integrationsentwicklung und Wendepunkt der sonderpädagogischen Förderungskonzepte bezeichnet wird.
Aber es gab in Deutschland damals nur an wenigen Orten erste entsprechende Schulversuche; und landesweite schulische Integrationsregelungen auf gesetzlicher Ebene lagen noch in ferner Zukunft. In dieser Situation gab Ludwig-Otto ROSERs Frankfurter Kongreßvortag den Anstoß zu lebhaften Diskussionen bei seinen deutschen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ludwig-Otto ROSER gab Einblick in die pädagogische Praxis eines Landes, das sich entschlossen hatte, auf Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen gänzlich zu verzichten; in Deutschland hingegen wurden damals viele Kräfte gebunden durch weitläufige theoretische Grundsatzdiskussionen im Gefolge der Bildungsratsempfehlung. Der Philosoph Hermann KRINGS als Vorsitzender der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hatte mit seiner Formulierung »soviel Integration wie möglich; soviel Sondereinrichtungen wie nötig« (KRINGS 1973, S.5) auch denjenigen, die die Bildungsratsempfehlung nicht gelesen hatten, reichlich Diskussionsstoff für theoretische Erörterungen über das, was für behinderte Kinder und Jugendliche möglich und nötig sei, geboten. Für manche Frankfurter Kongreßteilnehmer und -teilnehmerinnen, mich eingeschlossen, machte Ludwig-Otto ROSERs Vortrag überraschend deutlich, daß man mit diesen Fragen auch ganz anders verantwortlich umgehen kann und dabei handlungsfähig bleibt. Knapp gesagt, der Unterschied lag auf der Ebene des Handelns: in Deutschland wurde die Theorie, diskutiert, in Italien wurde die Praxis reformiert. Mir erscheint bemerkenswert, daß der Deutsche Bildungsrat sich in seiner behindertenpädagogischen Empfehlung auf integrationsorientierte Entwicklungen in Schweden, in den USA, in Jugoslawien, Belgien, der UdSSR, Polen, Frankreich, angelsächsischen Ländern und den Niederlanden berief, Italien aber nicht erwähnte (Deutscher Bildungsrat 1973, S.30f.). In Italien hatte die schulische Integration mancherorts schon zu Beginn der siebziger Jahre radikal begonnen (Ludwig-Otto ROSER 1982, S.115).
Ludwig-Otto ROSER wurde Ende der 70er Jahre zu einem begehrten Gastreferenten auf integrationspädagogischen Tagungen im gesamten deutschsprachigen Raum und zu einem vielbeschäftigten Vermittler von Exkursionen und Studienaufenthalten deutscher Gruppen in Italien, insbesondere in der Toskana. Florenz und viele andere norditalienische Kommunen wurden vor allem in den 80er Jahren von zahlreichen interessierten Fachleuten aus Deutschland und aus anderen Ländern besucht, um die Integrationswirklichkeit vor Ort studieren und erleben zu können. Das Interesse und die Studienreisen aus Deutschland nahmen so stark zu, daß schon 1981 der Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Sonderschulen auf dem Sonderpädagogischen Kongreß in Braunschweig die unglückliche Äußerung von der »italienischen Seuche« tat, die in Deutsch-1j d »nicht grassieren« dürfe (Bruno PRÄNDL, siehe Briefwechsel 1981, S.804). Er erläuterte später, daß er damit nicht die italienische Integrationsbewegung insgesamt gemeint hat, sondern vor »offensichtlichen Schwierigkeiten in der Bildungswirklichkeit« warnen wollte (ebd.).
1980 besuchten zwei meiner Saarbrücker Examenskandidatinnen Ludwig-Otto ROSER in Florenz und wurden von ihm sehr freundlich bei einem längeren Studienaufenthalt beraten. Das war der Beginn einer Reihe von Begegnungen und direkten Gesprächen zwischen Ludwig-Otto ROSER und Integrationspädagoglnnen aus dem Saarland. Wir trafen ihn auf mehreren internationalen Fachtagungen, aber wir besuchten ihn auch in seiner Wahlheimat Toskana (vgl. CHRIST 1985, S.7) und er uns in Saarbrücken (vgl. GUTHÖRL 1982). Zurückblickend kann ich sagen: Die italienische Integrationsbewegung und insbesondere Ludwig-Otto ROSER hatten erheblichen Einfluß auf die Entwicklung der Integrationspädagogik im Bundesland Saarland. Als im Saarland 1985 aufgrund politischer Veränderungen endlich mit schulischer Integration in der Praxis begonnen werden konnte, stand ein großer Teil der Praktikerinnen der ersten Stunde noch unter den anregungsreichen Eindrücken der Toskana-Exkursion, die wir 1984 durchgeführt hatten.
Wie in Italien folgten wir im Saarland von Anfang an dem Prinzip der wohnortnahen Integration und wählten damit einen anderen Weg, als ihn die Integrationsschulversuche in anderen deutschen Bundesländern vorgezeichnet hatten. Diese Schulversuche galten durchweg der Erprobung von »Integrationsklassen« im engeren Sinne, also von Klassen mit Zwei-LehrerInnen-System und drei bis fünf verschiedenartig behinderten Kindern neben einer zweistelligen Zahl nichtbehinderter Kinder. Die behinderten Kinder in diesen Integrationsklassen mußten oft aus einem größeren Einzugsbereich als ihre nichtbehinderten MitschülerInnen herbeigeholt werden; das erschwert die Gemeinsamkeit im außerschulischen Freizeitbereich. In Volterra (Toskana) fanden wir hingegen die wohnortnahe schulische Integration erfolgreich praktiziert: Jedes behinderte Kind besuchte dieselbe Regelschule wie seine gleichaltrigen Nachbarskinder. Zwar resultierte daraus durchweg, daß in einer Regelschulklasse höchstens ein bis zwei Kinder mit Behinderungen waren und deshalb eine permanente Doppelbesetzung mit zwei Lehrkräften nicht eingerichtet werden konnte; aber die Vorteile im Hinblick auf außerschulische, gesellschaftliche Integration waren unseren italienischen Freunden wichtiger, und wir ließen uns davon überzeugen. Ludwig-Otto ROSER betonte in seinen Vorträgen und im Gespräch immer wieder, daß die schulische Integration nur ein Einzelaspekt der gesellschaftlichen Integration behinderter Menschen ist und daher nicht für sich alleine betrachtet und erstritten werden sollte. Aus diesem zweifellos richtigen Gedanken zogen wir im Saarland die Folgerung, daß wir nicht (mehr oder weniger perfekte) Integrationsklassen an wenigen ausgewählten Standorten, sondern wohnortnahe Integration an beliebigen Schulen im Lande verwirklichen wollten. Das Landesparlament und der zuständige Minister sind dieser Überlegung gefolgt. So haben wir im Saarland bis heute immer noch weit mehr »integrative Klassen« mit wohnortnaher Einzelintegration als »Integrationsklassen« mit mehreren behinderten Kindern und durchgehender Doppelbesetzung. In den integrativen Klassen arbeitet nur für einige Stunden pro Woche eine sonderpädagogische Lehrkraft mit; wir wollten sie nach italienischem Vorbild Stützlehrerin (insegnante di sostegno) nennen lassen, aber die saarländische oberste Schulbehörde zog die amtliche Bezeichnung AmbulanzlehrerIn vor.
Wohnortnahe schulische Integration führt selbstverständlich nicht ohne weiteres und in jedem Einzelfall zur Eingliederung des behinderten Menschen in das Nachbarschafts- und Gemeindeleben. Schon 1982 hat Ludwig-Otto ROSER auf der internationalen Tagung »Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemeinschaft« in München darauf hingewiesen, daß die Integration in das Gemeindeleben mit einer schwierigen und langwierigen Bewußtseinsveränderung der Bürger und Bürgerinnen einhergeht. Bei diesem Prozeß muß in der Öffentlichkeit auch »der Widerstand zutage treten, d.h. die eigentlichen Gründe des Isolierens, die sich hinter den Worten >heilen< oder >rehabilitieren< verstecken, müssen bei ihrem wahren Namen genannt werden. Eine solche Diskussion und die Verarbeitung dieser Probleme dauert Jahrzehnte« (Ludwig-Otto ROSER 1982, S.116). In Deutschland stehen wir heute noch inmitten dieser Diskussion. Wir müssen in unserem Lande gegenwärtig sehr darauf achten, daß der ideelle Kern der Diskussion nicht durch finanzielle Argumentationen immer mehr verdeckt wird. Die Veröffentlichungen von Ludwig-Otto ROSER können wesentlich dabei helfen, den ideellen Kern nicht aus dem Sinn zu verlieren.
Literatur
BRIEFWECHSEL im Nachgang zum Sonderpädagogischen Kongreß 1981 in Braunschweig. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 32, 1981, S.802-804
CHRIST, Klaus: Italienreise - Ein Bericht im Überblick. In: Sonderpädagogik im Saarland 17, 1985, Heft 1, S.3-9
DEUTSCHER BILDUNGSRAT, Empfehlungen der Bildungskommission: Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Verabschiedet 1973 in Bonn. Stuttgart (Klett) 1974
GUTHÖRL, Volker: Damit die Barriere zwischen Behinderten und Nichtbehinderten fällt. Zur Idee der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Italien. In: Arbeitnehmer (Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes) 30, 1982, S.366-370
KRINGS, Hermann: Vorwort. In: Sonderpädagogik 1 - Behindertenstatistik, Früherkennung, Frühförderung. (Deutscher Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, Band 25). Stuttgart (Klett) 1973, S.5-6
ROSER, Ludwig-Otto: Florenz - Neue Auffassungen der Integration Behinderter in Schule und Arbeit. Vortrag auf dem vds-Kongreß im Juni 1979 in Frankfurt/Main
ROSER, Ludwig-Otto: Hilfe für Behinderte in der Gemeinde - Ursache oder Folge der Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen. In: Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten. Neue Wege gemeindenaher Hilfen zum selbständigen Leben. Kongreßbericht der internationalen Tagung »Leben , Lernen Arbeiten in der Gemeinschaft«, München, 24.-26. März 1982. München ( Vereinigung Intergrationsförderung e. V ) 1982, S.114- 119
SANDER, Alfred: die pädagogische Förderung im Aufgabenfeld praxisorientierte Wissenschaften. In: Sonderpädagogik 9, 1979, S.140- 141
Integration Behinderter in Italien: Anspruch und Realität[7] - Ludwig-Otto Roser
Im Bereich der Sonderpädagogik und der Rehabilitation spricht man häufig von einem italienischen Integrationsmodell. Dadurch entsteht aber eine falsche Vorstellung von dem, was sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren in der Psychiatrie, in der Behindertenversorgung und im Gesundheitswesen in Italien tatsächlich vollzogen hat. Ein Modell in diesem Bereich entsteht meist aus einem wissenschaftlichen Entwurf, au dem Versuche eines neuen Weges. Es soll als Ausgangspunkt und Vorbild dienen. Der Ruf BASAGLIAS und der sogenannten demokratisches Psychiatrie nach Auflösung der psychiatrischen Anstalten, der Abbau der in italienischen Sonderschulen und der auf bestimmte Behinderungen eingestellten Reha-Zentren, der Kampf Adriano MILANI-COMPARETTIS gegen defektbetonte Therapie und der Versuch einiger, leider recht isolierter Pädagogen, mit der selektiven und nur Wissen vermittelnden Tradition der Schule zu brechen, sind jedoch keinem besonderen Modell gefolgt und nicht von bestimmten Versuchen ausgegangen. Sondern: Ende des 60er, Anfang der 70er Jahre gab es in Italien eine umfassende gesellschaftliche Bewegung, die zunächst nichts anderes zum Ziel hatte, ah aufzuzeigen, was den Behinderten, den Schwachen, den von jeher auch kulturell und ökonomisch an den Rand gedrängten Menschen in ihre Entwicklung geschadet hat und heute noch schadet.
Der Versuch, möglichst vielen Menschen, die vorher ausgeschlossen waren, in ihrer sozialen Umwelt ein menschenwürdiges Leben zu verschaffen, ist also zunächst nichts weiter als der Erfolg einer Einstellung, die sich in den letzten Jahren ausgebreitet hat. Die durch diese Einstellung entstandene Bewegung hebt in Italien »anti-emarginazione« (gegen Aussonderung), d. h. Kampf gegen das Abschieben in Randgruppen.
»Wir >schließen< die Logik der Klinik. Ob die Mauern stehen bleiben, kümmert uns nicht. Aber indem wir die Klinik inner- und außerhalb der Mauern verändern, durchbrechen wir die Logik der Institution« - diese Worte Franco BASAGLIAS bedeuten in der Tat auch, daß nicht alles erreicht ist, was zu diesem Ziel führt. Sondern: Im Fortbestehen einer isolierenden Mentalität in den Menschen und in den Institutionen ist zu ergründen, warum Behinderte isoliert werden, um dann zunächst einmal diese »Logik« abzubauen. Am Beispiel der Psychiatrie hieße das: Es ist nicht so wichtig, daß ein italienisches Gesetz 1978 Neuzugänge in die Nervenheilanstalten verboten hat, daß die Anstalten allmählich geschlossen werden, vielmehr ist es wichtig zu ergründen, was in der sozialen Umwelt des Erkrankten zu seiner Erkrankung geführt oder beigetragen hat. Welche Ängste in seinen Mitmenschen lassen den Wunsch nach seiner Isolierung entstehen, welche Voraussetzungen sind notwendig, die es er-möglichen, ihn ambulant zu behandeln, damit er nicht aus seinem natürlichen Lebensraum gerissen wird? Dazu bedarf es der Unterrichtung einer breiten Schicht der Bevölkerung und der Weckung ihres Einverständnisses.
Es ist weiterhin unerläßlich, daß die Fachleute ihr Betätigungsfeld nicht in der Institution sehen und dort festungsartig konsolidieren, sondern in die Bereiche verlegen, in denen Behinderung entsteht.
In dieser Sicht sollten Depressionen nicht nur behandelt werden (wo-möglich vorwiegend mit Psychopharmaka), sondern man müßte sich beispielsweise fragen, wieviel Depressionen etwa die Leistungsschule produziert. Oder: Man sollte ein körperbehindertes Kind nicht so sehr als ein Wesen erleben, das einen motorischen Defekt hat, sondern wie ein Kind, das zwar in bestimmten Aktionsmomenten des Alltagslebens behindert ist, in anderen aber die positiven Aspekte seiner Persönlichkeit zum Ausdruck bringen kann. Dieses Konzept - es ist zunächst eine Einstellung und keine modellartige Verhaltensvorschrift - hat zu der Vorstellung geführt, daß man in Italien mehr Gewicht auf den sozialen Kontakt legt als auf eine ernsthafte Therapie, und so auch in der Pädagogik für den Behinderten (aber auch für den Nichtbehinderten) mehr auf das soziale als auf das kognitive Lernen schaut. In der Tat handelt es sich nicht um zwei verschiedene Methoden, die sich auf zwei trennbare Seinsweisen des menschlichen Lebens beziehen, sondern um Aspekte, die sich gegenseitig bedingen. Wenn es aber dazu gekommen ist, daß seit etwa zehn Jahren in Italien alle behinderten Kinder, auch die schwerbehinderten, Zugang zur Vorschule und zur Pflichtschule (scuola dell'obbligo) von sechs bis vierzehn Jahren haben und die an die Reha-Einrichtungen geknüpften Sonderschulen abgeschafft worden sind, wie ist dies ohne Modelle und ohne wissenschaftlich dokumentierte Versuchsperioden möglich gewesen? D. h. wie hat sich die zum Teil von der Psychiatrie ausgehende neue Einstellung dem »Pathologischen« gegenüber so schnell und scheinbar so allgemein ausgebreitet? Liegt es am Volkscharakter, hat es ökomische oder politische Gründe? Um diese Fragen zu beantworten, muß zunächst einmal ganz klar gesagt werden, daß der Gedanke der »antie-marginazione« längst nicht so ausgebreitet ist, wie die durch die Gesetzgebung sanktionierten Schritte (Aufnahme aller Kinder in die Pflichtschule, Abschaffung der Noten, Zusammenarbeit zwischen dezentralisierter Stadtverwaltung, den Gesundheitsdistrikten und der Schule, Gesundheitsreform, Psychiatriereform) vermuten lassen.
Nach der 68er Bewegung ist viel fortschrittliches Gedankengut von allen politischen Parteien aufgenommen worden. Dazu gehören die Vorschläge der Psychiatriereformatoren wie der Kampf eines Don Lorenzi MILANI (Barbianaschule) gegen die auslesende Tendenz der Schule.[8] In den ganzen 70er Jahren gehörte der Gedanke der »anti-emarginazionet zum Repertoire jeder politischen Versammlung (mit Ausnahme der Rechten). Die in ihren Grundsätzen auf »anti-emarginazione« angelegte Gesundheitsreform ist im italienischen Parlament mit den Stimmen sowohl der Kommunisten als auch der Christdemokraten durchgekommen. Vor allem die Behinderten selbst und ihre Betreuungsvereine gründeten Komitees gegen die Tendenz, Behinderte in besonderen Institutionen zusammenzudrängen, nachdem sie jahrelang für immer schönere Zentren gekämpft hatten. Zugleich wurden, vor allem was die Integration in des Schulen anbetraf, zwei Tatsachen klar:
-
Die Anwesenheit der geistig und körperlich Behinderten in der Schult war sehr viel weniger dramatisch als man es zunächst befürchtet hatte.
-
Die Entwicklung der potentiellen Möglichkeiten dieser Kinder erfolgte ungemein schneller im Kontakte mit der Normalität als in den Sonderschulen. (Die Schwierigkeiten, die sich durch das Entstehen von Verhaltensstörungen in der Schule ergeben, sollen in einem nachfolgenden Abschnitt besprochen werden.) Diese Erfahrungen und die geistesgeschichtliche Zäsur, die mit den 68er Bewegungen verknüpft ist, hat also zu politisch und gesetzlich fixierten Ergebnissen geführt.
Trotzdem ist, wie gesagt, nicht die ganze Bevölkerung von dem Antiemarginationsgedanken erfaßt; viele, die nicht direkt in Kontakt mit der Problematik des behinderten Menschen gekommen sind, bleiben indifferent, wenngleich heute fast alle Kinder in der Schule erfahren, was das Zusammensein mit einem behinderten Kind bedeutet. Viele Eltern (und vor allem Lehrer) wehren sich noch gegen diese Störung, die einen, weil es der Förderung des eigenen »gesunden« Kindes abträglich sein könnte, die anderen, weil es eine berufliche Belastung mit sich bringt. Aber auch auf der ideologischen Ebene wurden und werden wieder Stimmen laut, die die Erziehung der Kinder stark differenzieren möchten, um den Begabten nicht den Weg zur führenden Oberschicht durch eine noch grundsätzlichere >Popolarisierung<, d. h. in diesem Falle >Pathologisierung<, der Schule zu erschweren. Es gibt keine Studien über die zahlenmäßige Verteilung der Befürwortung aller Maßnahmen gegen das Abschieben Behinderter in Randzonen. Das Interesse, das die Bevölkerung dieser Problematik gegenüber zeigt, die Aussagen in den Elternversammlungen, die relative Einmütigkeit der Parteien in Bezug auf die Behindertenversorgung lassen vermuten, daß etwa 55% der Bevölkerung der »anti-emarginazione« positiv gegenüber stehen. In der Restgruppe ist nicht nur der Widerstand, sondern auch die Indifferenz enthalten. Befürworten bedeutet aber noch nicht aktiv mitmachen, persönlich bereit sein. Deshalb ist der Prozentsatz der Menschen, die wirklich bereit wären, sich um den schizophrenen Nachbarn mitzubemühen oder ein behindertes Kind zu Gast zu haben, viel geringer als es die obigen Zahlen vermuten lassen. Die allgemeine Einstellung ist aber immerhin die, das Prinzip anzuerkennen und gesetzlich zu verankern. Die »Anti-emarginationsbewegung« hat zur Integrierung der behinderten Kinder in die Regelschule geführt. Und das bedeutet in Zukunft: Die Kinder, die heute mit Behinderten aufwachsen, kennen deren Probleme, haben zum Teil Freundschaft mit ihnen geschlossen, verstehen sie weitaus besser und werden als Erwachsene anders auf Behinderte eingestellt sein.
Der Anspruch ist also, niemanden aus der natürlichen sozialen Umwelt auszuschließen und alle diejenigen, die ausgeschlossen wurden, in ihren Lebensbereich so schnell wie nur möglich wieder einzugliedern (dies gilt vor allem für die Erwachsenen mit seelischen und sozialen Problemen). Kinder, auch Schwerbehinderte sollen von vornherein nicht ausgeschlossen werden, sondern möglichst von den ersten Lebensmonaten an, sobald eine körperliche, sensorielle oder geistige Störung klar ersichtlich ist, in den normalen Einrichtungen (Kinderkrippe, Vorschule und Schule) ihres Lebensbereiches leben und lernen, daneben aber ambulant behandelt werden, wenn sich dieses als notwendig erweist. Die Verwirklichung dieser Einstellung und dieses (von der Verfassung gestützten) Anspruchs wird durch die Gesundheitsreform ermöglicht, trotz des Widerstandes auf den sie bei vielen Ärzten, Fachleuten der »Sonderbehandlung« und Institutionen gestoßen ist. Die augenblickliche Situation der Integration Behinderter in Italien läßt sich nur verstehen, wenn man auch die Entwicklung der letzten zehn Jahre berücksichtigt. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wäre es noch nicht möglich gewesen, ein autistisches oder psychotisches Kind für die Aufnahme an die Pflichtschule vorzuschlagen. Geistig- und körperbehinderte Kinder wurden integriert, wo sich das Lehrpersonal dazu bereit erklärte. Dazu muß man wissen, daß Lehrer und Schulleitung in Italien nie verpflichtet waren, den Übergang in eine Sonderschule von amtswegen zu veranlassen; der Besuch der Sonderschule wurde nahegelegt, aber nicht erzwungen. Das Für und Wider der Eingliederung wurde noch 1975 in Eltern- und Lehrerversammlungen lebhaft diskutiert, in denen von der Integration überzeugte Fachleute einen schweren Stand hatten. Meist wurde akzeptiert, einen Versuch zu machen, der dann fast immer zur endgültigen Eingliederung führte, sobald die Angst vor dem Neuen und Fremdartigen überwunden war. Erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre überrannte die Integrationswelle Skeptiker und Opponenten, vor allem weil die Vorteile der Förderung behinderter Kinder im normalen Lebensbereich im Vergleich zu sehr viel langsameren und einseitigeren Entwicklungen in den Sonderschulen und Reha-Zentren klar hervorgetreten waren. Die Schwierigkeiten wurden durch den auf der Hand liegenden moralischen und menschlichen Fortschritt in den Schatten gestellt. Erst nach der Verabschiedung des Gesetzes 517 (1976) und der endgültigen Sanktionierung des Rechtes nicht nur des Schulbesuchs (denn dies wurde ja auch von den Sonderschulen garantiert), sondern des gemeinsamen Lebens und Lernens, begannen wieder Stimmen laut zu werden, die sich gegen die Integration aller behinderter Kinder wendeten.
Es sind im Grunde die gleichen Stimmen, die sich gegen jede Neuerung wenden, vor allem im pädagogischen Bereich, weil Flexibilität in der Erziehung zur Relativierung von bisher für unüberwindbar gehaltenen Wert- und Normvorstellungen führt. So ist es für viele undenkbar, daß ein Mensch, der nicht lesen und schreiben lernt, weil er behindert ist, sich unter denen behaupten und leben kann, die diese Fähigkeiten besitzen. Dieses Vorurteil, das sich auch der Polaritäten von Schön und Unschön, von Tüchtig und Nichttüchtig, von Gut und Böse bedient, hatte mit zur Isolation des Behinderten beigetragen; es führte zur Logik des »Schonraums«, der speziell »fördernden« Einrichtungen usw. Die Argumente des Widerstandes behaupten in der Tat: in den normalen Einrichtungen der Schule und des Alltagslebens kann nicht auf die Bedürfnisse der Behinderten eingegangen werden, sie erfahren keine Förderung, sie würden am ständigen Vergleich zerbrechen. Noch heute stellt man gerne die Schwierigkeiten in den Vordergrund, die zweifellos vorhanden sind, und maskiert mit ihnen das Fehlen einer gegen Isolation gerichteten Einstellung und Ängste, die alles Unbekannte, Fremde und alle Mehrarbeit auslösen.
Infolge des Widerstandes in den Schulen (etwa 30% der Lehrkräfte sind gegen die Integration), der Unkenntnis der menschlichen und sozialen Probleme der Behinderten einerseits, andererseits der durch die Abschaffung der Sondereinrichtungen entstandenen organisatorischen und strukturellen Schwierigkeiten, aber auch in Folge des Fortbestehens einiger weniger Heime und geschützten Werkstätten, sowie der objektiven Schwierigkeiten, die beispielsweise Verhaltensgestörte im Zusammenleben mit ihren Mitmenschen hervorrufen, sind tatsächlich viele Behinderte (vor allem der Sonderschulgeneration) noch nicht adäquat, d. h. nicht im normalen persönlichen Lebensbereich versorgt worden. Es handelt sich dabei vor allem um Schwerbehinderte, deren Besuch der normalen Pflichtschule zur Zeit der ersten Integrationsversuche wegen ihres Alters als nicht mehr angebracht erschien. In den Schulen entstehen heute noch Schwierigkeiten vor allem aus Starrheit des bürokratischen Apparates, aus der schlechten Lehrerausbildung und aus der Vorstellung heraus, daß die Schule sich vor allem um die Lernfähigen kümmern sollte. Auch der an sich weitverbreitete Einsatz von Stützlehrerinnen wird noch von vielen mißverstanden, weil auch deren Aufgaben noch nicht theoretisch erarbeitet werden konnten. Anfänglich gab es auch einen gewissen Widerstand gegen Integration in die Normalschule von seiten einiger Eltern behinderter Kinder, die die Auflösung des Schonraums und eine geringere spezifische Stimulation ihrer Kinder befürchteten, in der Annahme, daß Rehabilitation nur durch intensive Behandlung zustande komme. Widerstand gab es schließlich auch unter dem Personal der aufzulösenden Sondereinrichtungen, das den Übergang zu einer neuen Denkweise nicht imstande war mitzuvollziehen. Dieses Personal ist jedoch heute in den Unitä Sanitarie Locali aufgenommen und wird in den zu jedem Distrikt gehörenden Rehabilitationseinrichtungen eingesetzt (aber nicht in den Schulen, denen es nur beratend zur Seite steht).[9]
Wie sieht nun die Realität heute aus, und welche Probleme, die die totale Integration behinderter Kinder in die Pflichtschule aufgeworfen hat, warten noch auf eine Lösung?
Zunächst einmal muß gesagt werden, daß alle Kritik und aller Widerstand nicht an den auf der Hand liegenden Erfolgen vorbeigehen können. Es handelt sich natürlich nicht nur um einzelne oder häufige Erfolge funktioneller Rehabilitation, die man statistisch erfassen könnte, um den Skeptikern Zahlen vorzuhalten. Die Bewegung gegen »Emargination« und die aus ihr erwachsene Annäherung aller Behinderter an das Wahrnehmungsfeld der Gesellschaft stellt den eigentlichen Erfolg all dieser Bemühungen dar und ist in seiner Auswirkung noch nicht zu »ermessen«. Diese Erfolge reichen von einer echten politischen Einbeziehung Behinderter (die sich nicht in der Bereitstellung von Geldmitteln erschöpfen darf) bis zur Erkenntnis der moralischen und psychologischen Unbestimmtheit von Normalität, reichen von der pädagogischen Besinnung im Schulwesen und der Suche nach kindgerechten Inhalten bis zur Aufnahme einer Klausel in dem Tarifvertrag der Metallarbeitergewerkschaft, in der die Verpflichtung eines jeden Arbeiters ausgesprochen wird, sich seines behinderten Arbeitsgenossen anzunehmen, reichen schließlich von der besseren Kenntnis der Behinderungsarten in der Bevölkerung zu besseren Möglichkeiten der Vorbeugung.
Ob aber, was das Individuum anbetrifft, ein Körperbehinderter besser zur Kompensation seiner motorischen Schwierigkeiten gebracht werden kann, wenn er in einer normalen Schule lebt, oder ob ein blindes Kind sich besser orientiert, ein sprachgestörtes schneller lernt, sich korrekt mitzuteilen, ein hörbehindertes Kind mehr »hört« oder aus der Lippenbewegung ersieht als wenn es unter Hörbehinderten lebt, ob ein geistigbehindertes Kind mehr lernt, wenn es die Nichtbehinderten lernen und leben sieht, ob ein psychotisches Kind sich eher der Realität annähert, wenn es in ihr lebt - all dies können nur diejenigen sagen, die Integration versucht oder erlebt haben, nicht aber wer in den Arabesken von sich immer mehr spezialisierenden Sondereinrichtungen der Gesellschaft befangen bleibt. Behinderte Kinder in der Vorschule und Pflichtschule werden nicht nur sehr viel stärker zur Überwindung oder Kompensation ihrer Behinderung stimuliert, sondern sie lernen auch allmählich mit dem Unvermeidlichen der Behinderung auszukommen und zwar um so eher und um so gründlicher als sie von den anderen mit dieser Behinderung akzeptiert werden. Diese unglaubliche Zukunft des gemeinsamen Lebens (die ja meist auch die einzige Freude eines jeden Kindes beim erzwungenen Schulbesuch ist) hat selbst rehabilitierende Wirkung. Wo aus Widerstand oder aus Mangel an pädagogischer Bereitschaft der Lehrer sich dem behinderten Kindes weniger als dem nichtbehinderten zuwendet, d. h. selbst da, wo alle Voraussetzungen, z. B. auch die von der Unitä Samtarie Locali zu stellende, außerschulische ambulante Behandlung aus organisatorischen Gründen fehlt, ist die Chance einer Zuwendung, einer Freundschaft, eines spontanen Lernens so groß, daß sie nicht zu vergleichen ist mit der auf die Erwartungen des Erwachsenen abgestimmten Rehabilitationsbehandlung in der isolierenden Sondereinrichtung. Behandlung ist aber, wie gesagt, nicht beiseite gestellt worden, sie erfolgt, wenn sie aus objektiven Gründen als notwendig erachtet wird, in den ambulanten Rehabilitationseinrichtungen, der Unitä Sanitaria Locale, und nicht in der Schule, weil es nicht Aufgabe der Schule ist, einen geistigen, seelischen oder körperlichen Defekt zu heilen, vor allem weil es im Schulalter allemal zu spät wäre. Das behinderte Kind trotz seiner Schwierigkeiten an das Kulturgut der Gesellschaft heranzuführen und an dem Leben aller Kinder teilnehmen zu lassen, ist dann Aufgabe einer Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheitsorganisation, wobei nicht der Defekt des Kindes, sondern seine Möglichkeiten in den Vordergrund gestellt werden.
Ungemein wichtig ist dabei natürlich wieder eine Grundeinstellung: tüchtig ist nicht, wer mehr leistet als andere, sondern der, der alles das leistet, was potentiell in ihm möglich ist.
Die Abschaffung der Noten in der italienischen Pflichtschule ist zweifellos Ausdruck dieser Grundeinstellung. Aus dieser Realität erwächst die Notwendigkeit, den aus der Pflichtschule entlassenen Behinderten im gleichen »normalen« Lebensbereich je nach seinen Kräften Lehrstellen, Höhere Schulen, Berufsschulen besuchen zu lassen. In den Regionen, in denen die Durchführung der entsprechenden Bestimmungen als vordergründig erachtet wird, bekommen auch Schwerbehinderte eine Arbeitsstelle aufgrund des Gesetzes, das die prozentuale Verteilung Behinderter in private und öffentliche Betriebe vorschreibt und von dem es nicht möglich ist, sich freizukaufen. Dabei hat sich interessanterweise herausgestellt, daß sich leichter Arbeitsplätze für Behinderte finden lassen, indem man in den einzelnen Betrieben analysiert, welches eine Arbeitsmöglichkeit für die betreffende Behinderung sein könnte, als durch Vorzeigung eines Diploms eines Rehabilitationskurses, das die Suche nach einer realen Arbeitsmöglichkeit ungemein einengt. Auch die Arbeitssuche erfolgt, zusammen mit dem Behinderten, durch das Personal der Ambulatorien und die Mitarbeit des zuständigen Arbeitsamtes. Während es im allgemeinen keine Schwierigkeit mehr mit sich bringt, auch schwer geistig oder körperlich Behinderte vom Kindergarten in die Pflichtschule, von dieser in berufsbildende Institutionen und schließlich zu einer Arbeit zu führen, entstehen in Fällen, in denen die Verhaltensstörung im Vordergrund steht, oft sehr große Probleme. Man könnte sagen, daß Kinder, die Konflikte zwischen Eltern, Lehrern und Arbeitskräften der Ambulatorien auslösen und dadurch oft das Prinzip der Integration in Frage stellen, fast immer nur verhaltensgestörte Kinder sind. Dabei handelt es sich sowohl um diejenigen, die durch den Schulzwang oder aus anderen sozialen Gründen rebellisch und nicht einer Disziplin unterzuordnen, aggressiv und unberechenbar sind, als auch um die Kinder, die sekundär, aus ihrer im Familien- oder dem Schulbereich nicht verarbeiteten eigentlichen Behinderung heraus mit Verhaltensstörungen reagieren.
Dazu muß gesagt werden, daß diese Konflikte in den letzten Jahren seltener geworden sind und das könnte bedeuten, daß eine weitverbreitete Kenntnis des Problems und das frühzeitige Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Kindern schon eine Wirkung auch in diesem Bereich gezeigt hat. Wenngleich Kinder verhaltensgestörte Mitschüler meist noch ertragen, bedeutet im Unterricht die Gegenwart eines verhaltensgestörten Mitschülers die Auslösung von Frustrationen und Angstmechanismen, die fast nie aufzuhalten sind und schließlich die ganze Gruppe mitreißen. Das Problem ist in diesen Fällen eigentlich gar nicht, wie aus dieser Situation herauszukommen ist; in den seltensten Fällen gelingt es. Schulleiter wehren sich mit Disziplinarverfahren, die meist alles verschlimmern, die Psychologen der U. S. L. intervenieren mit Ratschlägen und Psychotherapie, oft auch mit Familientherapie, während aber das Problem in der Schule fast immer weiter besteht. Der korrekte Ansatz liegt in den Vorbeugungsmaßnahmen. Schwierigkeiten in der emotionalen Verarbeitung lassen sich früh erkennen, und auch hier ist nicht so ausschlaggebend die Behandlung, sondern das Vorbeugen, d. h. die Wahrnehmung der im Lebensbereich der Bevölkerung entstehenden Spannungen.
Der gleiche Problemkreis betrifft ja dann zum großen Teil die Arbeit der Psychiatrie und hier schließt sich der Kreis: das Anliegen BASAGLIAS, das sich im Ruf nach einer neuen Einstellung mitmenschlichen Zusammenlebens ausgedrückt hat, entsteht aus der Frage »Wie verarbeite ich das Andersartige, das Fremde, das Kranke?«.
Haben nun die Italiener diese Frage gelöst? Sicherlich kann man das nicht behaupten, aber sie haben sie als die eigentliche Frage erkannt und kommen allmählich dazu, sie nicht mehr mit dem immerhin realen Rehabilitationsbedürfnis des Behinderten zu maskieren.
Das Problem der Gewalt, den Dualismus von Macht und Machtlosigkeit, rückte Basaglia immer wieder in den Mittelpunkt, die »Zerstörung des Autoritätsprinzips« war ihm ein wichtiges Anliegen, nicht als Wegwischen von menschlicher und fachlicher Kompetenz, sondern als Zersetzen des Mechanismus, in dem die Argumente des Mächtigen von selbst als die besseren gelten oder gar von bloßer Gewalt ersetzt werden. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, daß man sich diesem Machtproblem tagtäglich stellen muß - und er hat es in der Praxis versucht.
[7] Der Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 3/1981, S. 28-33.
[8] vgl. hierzu: MILANI, Lorenzo: Lettere alla mamma - 1943-1967, Milano 1973; Scuola di Barbiana; deutsch: Die Schülerschule. Briefe an eine Lehrerin. Berlin 1970; BRINK, Lisa u.a Nachforschungen in Barbiana. Weinheim und Basel 1984
[9] Zur Arbeitsweise der Unitä Sanitaria Locale vgl. SCHUMANN, Monika, in: SCHÖLER 1987, S. 81-98
Anfang April 1978 fuhren Georg FEUSER und ich, begleitet von unseren Frauen, für eine Woche nach Italien. Erst kurz vorher hatten wir uns zu dieser Fahrt entschlossen. Unser Besuchsprogramm trug unserer beider Vorkenntnisse und Interessen Rechnung. Und es fußte auf einer Reihe eigener Arbeiten, die sensibel genug für das neue gemacht hatten (vgl. z.B. meine beiden Sammelbände JANTZEN 1978, 1980). In Arezzo hatten wir Gespräche in der psychiatrischen Klinik mit TRANCHINA und MARZI. Wir nahmen teil an der Vollversammlung und später an der "Verifikation« es folgte ein Gespräch mit Bruno BENIGNI von der Provinzialverwaltung. In Triest hatten wir zwei Gespräche mit Franco BASAGLIA. Dann fuhren Renate und ich zu GIACANELLI (dem dortigen Psychiatriechef) nach Parma, während Georg und Helene einen freien Tag einlegten. Und zusammen ging es am Abschluß der Reise nach Florenz zu Ludwig-Otto ROSER.
Von dem auf Tonband mitgeschnittenen fachlichen Gespräch habe ich in meinen Unterlagen noch eine unkorrigierte Abschrift von fast 30 Seiten gefunden. Wir müssen also ca. zwei Stunden miteinander geredet haben. Aber dann kam noch eine Einladung zu den ROSERs nach Hause. Über den Dächern von Florenz saßen wir an einem lauen Frühlingsabend bis spät in die Nacht auf der Terrasse. Einen kleinen Oleanderbusch nahmen wir als Geschenk mit nach Hause. Er hat im rauhen Norden nicht allzu lange überlebt. Überlebt aber hat ein Gefühl von Freundschaft und Berührtsein durch eine gemeinsame Sache. (Ansonsten sollte es mehr als zwölf Jahre dauern, bis wir uns bei einer Tagung in Linz wiedersahen.) Dem Protokoll unseres ersten Gesprächs entnehme ich eine Diskussion über eine Skizze, vermutlich die folgende (zit. nach Ludwig-Otto ROSERs Vortrag am 20. Juni 1979 in Frankfurt einschließlich der dort gegebenen Erläuterung):
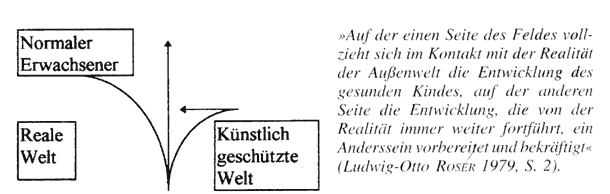
Auf der einen Seite des Feldes vollzieht sich im Kontakt mit der Realität der Außenwelt die Entwicklung des gesunden Kindes, auf der anderen Seite die Entwicklung, die von der Realität immer weiter fortführt, ein Anderssein vorbereitet und bekräftigt (Ludwig-Otto Roser 1979, S.2).
In unserem Gespräch vom April 1978 kommentierte Ludwig-Otto ROSER diese Abbildung so: »Sobald das Kind aus dieser Normalsituation heraustritt, sofort sind Leute da, die es irgendwie herausnehmen. Diese Leute sind natürlich Spezialisten. In diesem Moment wird das Kind ein Spezialkind, je nachdem ob die Herausnahme gelingt. Darum diese Spezialsituation. Und das hier (rechts) ist der Brutkasten, das hier ist der Spezialkindergarten, das ist die Sonderschule. Etwas Gutes zu tun, entspricht vielleicht dem Willen dieser Institution. Hier entstehen ja Berufe, Leute, die das machen. Es ist ganz klar, wenn diese Institution besteht, muß sie ja Kinder reintun (...). Am Schluß ist es dann der goldene Käfig, aus dem Du nicht mehr herauskommst und das Alibi muß dann perfekt sein. Nicht nur es muß perfekt sein in seiner ganzen Struktur, sondern Du mußt auch perfekte Leute um Dich herum haben. Deshalb mußt Du Leute schaffen, die gewillt sind, in dieser Situation perfekt zu sein. Und dadurch entsteht wieder das Ziel. Es ist nicht hier (links, in der realen Welt) sondern hier (rechts) (...). Wenn diese Bewegung nach da (links) erfolgen würde, von vornherein! Statt dessen besteht heute die Tendenz, Seuchen in Brutkästen zu vermeiden (...). Es ist ganz klar, daß unser Bewußtsein in dem Moment, wo ich es (das Kind) in den Brutkasten tue, eine Sondersituation schafft. Wenn ich jetzt versuche, hier so herumzuschieben (Pfeil in der Abbildung), dann kann ich diese Situation retten. Das Problem der Integration ist also: Hören wir hier (links) auf und tun das Kind sofort hier herein (in die Sondersituation, den >Brutkasten<) dann kann es sein, daß dieses Ziel nicht erreicht wird. Das Kind aber, es könnte immer so bleiben. Hier erreicht es bestimmt nichts. Denn hier zieht ... ja alles, was geschaffen wird, (das Kind) von dieser (realen) Welt hinweg.« (Einfügungen in Klammern von mir; W.J.)
Dem Besuch in Florenz folgten Arbeitskontakte. Hellga BALTSCHUN und Annegret MERKE, beide studierten in meinem ersten Lehrprojekt an der Universität Bremen über die »Soziale und psychische Situation der Behinderten in der BRD«, schrieben ihre Diplomarbeiten über einen "Vergleich der Psychosozialen Versorgung körperbehinderter Kinder in Bremen und Florenz». In ihrem Bericht aus Florenz in dem Buch »Kopfkorrektur« schreibt Monika ALY (Aly u.a. 1981, S. 38): »25.1.79.: Heute vormittag hatten wir ein Gespräch mit Adriano MILANI-COMPARETTI (Hellga aus Bremen, Monika, Annegret und ich). Und es war toll. Die Studentin hatte Fragen vorbereitet: Welche Theorien Adriano MILANI-COMPARETTII verwendet habe, was seine politische Vergangenheit sei usw.« Beide Diplomarbeiten leisteten einen vorzüglichen Vergleich der deutschen und der italienischen Situation. Und kurze Zeit später bestand die Möglichkeit, das deutsche Vergleichsobjekt, einen Sonderkindergarten der Spastikerhilfe umzugestalten und für Integration zu öffnen (vgl. SEIDLER 1992). Zu Ende war dies unter massivem politischem Druck bereits nach zwei Jahren. - Erzähle niemand, in Bremen sei Integration einfach durch-zusetzen gewesen! Aber der Titel von SEIDLERS Buch ist Ludwig-Otto ROSERS Gedanken gewidmet, so wie ihn Dietlind SEIDLER (die damalige Leiterin des Integrationskindergartens) den Arbeiten von Hellga BALTSCHUN und Annegret MERKE entnommen hat: Non Emarginazione - »Integration heißt: Ausschluß vermeiden!« Die Anregungen über eine andere Sicht cerebralparetischer Kinder leben weiter (vgl. die gerade abgeschlossene Diplomarbeit von Annett THIELE, 1998). Mehrfach habe ich Lehrveranstaltungen über vorgeburtliche Entwicklung durchgeführt und jeweils auf Adriano MILANI-COMPARETTI zurückgegriffen. Bei dem von Inge FLEHMIG 1983 in Hamburg durchgeführten ersten Europäischen Symposium zur Entwicklungsneurologie trafen wir uns persönlich in einer Podiumsdiskussion zur Integration, von Hamburger Studentlnnen organisiert. Doch dies ist schon wieder eine andere Geschichte. Die durch Ludwig-Otto ROSER und Adriano MILANI-COMPARETTI gewonnenen Anregungen zählen für mich heute zu jenen Anregungen, die in Theorie und Praxis gewogen und nicht zu leicht befunden wurden. Sie sind ein Teil des eigenen Denkens geworden - und was könnte man besseres sagen.
Literatur:
ALY, Monika u.a.: Kopfkorrektur oder der Zwang, gesund zu sein. Ein behindertes Kind zwischen Therapie und Alltag. Berlin (Rotbuch) 1981
BALTSCHUN, Hellga: Zur Bedeutung gemeindenaher Versorgung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen unter Berücksichtigung sozialpolitischer Wirkungszusammenhänge - dargestellt am Beispiel Bremen und Florenz. Universität Bremen, SG Sozialpädagogik, Diplomarbeit, 1979
JANTZEN, W.: Behindertenpädagogik, Persönlichkeitstheorie, Therapie. Köln (PRV) 1978
JANTZEN, W.: Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. Bern (Huber) 1980
MERKE, Annegret: Psychosoziale Versorgung von körperbehinderten Kindern in Bremen und Florenz: Ein sozialpädagogischer und persönlichkeitstheoretischer Vergleich. Universität Bremen, SG Sozialpädagogik, 1979
ROSER, Ludwig-Otto: Florenz: neue Auffassung der Integration Behinderter in Schule und Arbeit. Referat auf dem sonderpädagogischen Kongreß. (Manuskript). Frankfurt/M. 1979
SEIDLER, Dietlind: Integration heißt Ausschluß vermeiden! Umwandlung einer Sonderkindertagesstätte in eine Integrationseinrichtung. Münster (LIT) 1992
THIELE, Annett: Zum Verhältnis von Bewegung, Sprache und Entwicklung unter den besonderen Bedingungen einer Infantilen Cerebralparese in Hinblick auf eine frühe Förderung sprach-, sprech- und kommunikationstragender Prorozesse. Universität Bremen, SG Behindertenpädagogik, Diplomarbeit, 1998
Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation - Voraussetzung für die reale Anpassung Behinderter [10] - Adriano Milani-Comparetti/Ludwig-Otto Roser
Die neuen Vorstellungen von Gesundheit und Normalität, von Rehabilitation und Behindertenversorgung, von Behandlung und Vorbeugung, die in den letzten fünfzehn Jahren viele italienische Fachleute aus den verschiedensten Bereichen sowie weite Kreise aller politischen Richtungen beschäftigt haben, werfen im Ausland immer mehr Fragen auf, aus denen nicht nur Interesse, sondern weit häufiger Furcht, Skepsis und Unkenntnis herausgelesen werden können. Politisierung der Wissenschaft, einseitige Bevorzugung des sozialen Aspektes, Abwertung des kognitiven Lernens und demzufolge Senkung des allgemeinen Bildungsstandes, mediterrane Oberflächlichkeit, Süd-Nord-Gefälle eines gewissen Fatalismus, mangelnde Bereitstellung der notwendigen Geldmittel für den Ausbau von Institutionen usw., sind Befürchtungen, die nicht nur im Ausland, sondern auch in Italien selbst immer wieder laut werden. Vor allem die Integration behinderter Kinder in die normale Regelschule hat viel Staub aufgewirbelt, weil durch diese Aktion fast die ganze Bevölkerung an die Probleme der Behinderten herangeführt worden ist.
Die »wilde«, scheinbar nur politischen Kriterien folgende Eingliederung der Behinderten, der Rausch des Erlebnisses von Solidarität und Gemeinsamkeit, die Popularisierung der existentiellen Werte des Pathologischen (die nicht nur in der Rauschgiftphilosophie enthalten sind) schienen das Rationale, das Wissenschaftliche, das Überkommene beiseite gedrängt zu haben. So wie dies von den Italienern empfunden wurde, so nährt es heute im Ausland die Vorstellung einer gefährlichen Entwicklung.
Es ist bezeichnend, daß diese in bestimmten Kreisen mit einer linksgerichteten Politik identifiziert wird. Daß die 68er Bewegung mit von dem Kampf gegen das Abdrängen in Randpositionen getragen worden ist, daß die italienische »psichiatria democratica« sich stark im politischen Leben engagiert hat, daß Männer wie BASAGLIA gegen das Autoritätsprinzip und die Gewalt der Institutionen auch ideologisch vorgegangen sind (wenngleich gerade BASAGLIA dies durch die Erhaltung menschlicher und fachlicher Kompetenz zu erreichen suchte), daß in dieser, sagen wir ruhig, revolutionären Entwicklung das Ideologische viele Anstöße gegeben hat, darf nicht davon ablenken, daß im Grunde die Frage »Was ist Gesundheit?« in der Luft liegt. So war die italienische Gesundheitsreform ein Anliegen fast aller Parteien, so ist es in Deutschland 1980 zum ersten Gesundheitstag gekommen, so empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine neue Sicht: »From cure to care« (Vom Heilen zum Vorsorgen).
In der Tat wäre der italienische Versuch, Behinderte in einer neuen Weise zu fördern, nichts weiter als eine ideologische Seifenblase, ließe sich nicht erweisen, daß die diesem Versuch zugrundeliegenden Überlegungen einer wissenschaftlichen Wahrheit gerecht werden. »From cure to care«, d.h. die Verpflichtung, von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um die Gesundheit überzugehen, ist in der Tat sehr viel mehr als ein elegantes Wortspiel und sehr viel mehr als ein dahergeworfener Slogan. Diese Verpflichtung erfordert ein durchgreifendes, die gesamte menschliche Kultur und Wissenschaft erfassendes Umdenken. Sie verlangt die Bereitschaft zur Revision der fundamentalen theoretischen Aspekte, die die Methodologie und Struktur des Gesundheitswesens bestimmen. Es handelt sich um eine kulturelle Erneuerung, die zur Grundlage einer Reform aller die Gesundheit betreffenden Maßnahmen der Vorbeugung, der Behandlung und der Rehabilitation wird. Wenn wir aber wollen, daß sich die Medizin der Gesundheit zugunsten der Medizin als Wissenschaft entwickelt und sich nicht gegen die Medizin wendet, wie es in den ideologischen Stoßtheorien Ivan ILLICHS vorgeschlagen ist, muß der Unterschied zur traditionellen Medizin theoretisch korrekt erarbeitet werden, damit die fachliche Kompetenz nicht im rein Humanitären und in der oft verschwommenen Ideologie des Sozialen versinkt.
Am Beispiel der Rehabilitation im Bereich der Zerebralparesen läßt sich dieses Konzept besonders klar erläutern:
Der vor dreißig Jahren als Verpflichtung der Gesellschaft begonnene Einsatz zur Behandlung und Betreuung der durch Zerebralparese Behinderten hat das heute bekannte, unglaubliche Gewirr inadäquater Bemühungen produziert und zwar in einem solchen Maße, daß, wenn wir eine rationale und maßvolle Bewertung ansetzen wollen, dem Behinderten mehr geschadet als geholfen worden ist. Erst heute sind wir vielleicht durch die erneuernde Dimension einer Medizin der Gesundheit in der Lage zu erkennen, welches der eigentliche Sinn des antiken Gebots »primum non nocere« ist. So wird es unerläßlich herauszufinden, welches die oft listigen und perversen Gefahrenmomente sind, die die Medizin der Krankheit hervorruft und welches dagegen die fördernden Mechanismen des Wohlergehens im Dienst der Gesundheit sein sollten.
Die möglichen Schäden der Medizin der Krankheit lassen sich im Begriff »Mißbrauch« (italienisch abuso) kondensieren. Niemand will der traditionellen Medizin ihre Gültigkeit als Wissenschaft mit ihren Kenntnissen im Kampf gegen die Krankheit streitig machen, aber ebenso absolut muß der Mißbrauch verdammt werden, der durch den irrigen und ungerechtfertigten Gebrauch des Instrumentariums der Medizin entsteht. Abuso (Mißbrauch) hat vor allem in den angelsächsischen Ländern als »abuse« die Bedeutung von Mißhandlung und Gewalt angenommen, besonders was die Mißhandlung des Kindes anbetrifft. Der italienische Verein für die Bekämpfung von Kindesmißhandlung erweitert den Begriff: man solle, wie es auch Renata GADDINI vorschlägt, unter »abuso« nicht nur die physische Gewalt verstehen, sondern alle »auch unwillentlich fortdauernden Situationen, die aktiv oder passiv von Einzelnen oder von den Institutionen ausgehen, von denen das Individuum, das noch nicht die Kraft besitzt, seine Rechte geltend zu machen, überrannt wird«. Diese Definition scheint eigens für die Rehabilitation formuliert, so wie sie heute praktiziert wird.
Um besser zu verstehen, was Gewalt gegen das Kind ist, muß man versuchen, seine Bedürfnisse zu analysieren. Um dies zu vereinfachen, könnte man von der Unterscheidung der drei interaktiven Dimensionen ausgehen, in denen es lebt:
-
die ganzheitliche Dimension seiner Person,
-
die Dimension seiner Zugehörigkeit im Verhältnis zur physischen und menschlichen Außenwelt,
-
die Dimension seiner Entwicklung, die seine Zukunft betrifft.
Die traditionelle Medizin, die wir anfechten, und ganz besonders die rehabilitative Medizin, stellten wegen ihrer Kontinuität einen Mißbrauch, eine Gewaltaktion dar, weil sie das reale, in diesen drei Dimensionen lebende Individuum zerbricht und stattdessen die Vorstellung eines nicht-existierenden Wesens anbietet. Die Medizin der Vergangenheit ist in der Tat charakterisiert durch:
-
fachliche Teilhaftigkeit (ital. settorialitä), d.h. sie sieht und behandelt das Kind in der Unterscheidung von gesunden und kranken Teilen,
-
isolierend, denn sie behindert seine sozialen Beziehungen und
-
entwicklungsfeindlich, weil es seine Zukunft nicht einbezieht.
Dies gilt für die sogenannte Heilpädagogik ebenso wie für die Bereiche der Psychologie und der Pädagogik, die dieser die Hand reichen: der mit dem Ausdruck »defektbetont« charakterisierte Einsatz, der dem Reparaturbedürfnis und dem Erziehungswillen des Erwachsenen gegenüber dem Kinde entgegenkommt, zerstört im allgemeinen die Harmonie im Zusammenspiel der drei genannten Dimensionen mehr als es der Defekt selbst getan hätte. Noch allgemeiner könnte man sagen: Es ist typisch für unsere Kultur gewesen, die Erziehung des Kindes auf dem Mißtrauen für das Gelingen seiner Zukunft aufzubauen. Die Projektion entsteht fast immer durch die Zukunftsvorstellung des Erwachsenen, durch welche das Kind nicht in seinen realen Möglichkeiten gesehen wird, sondern in seinem Unvermögen, die in es gesetzten Erwartungen zu erfüllen.
Vielleicht ist aber auf keinem anderen Gebiet, selbst nicht in der Medizin, soviel Gewalt auf Kinder ausgeübt worden wie im Bereich der Rehabilitation. In der Tat sind Eltern und Ärzte, in ihrer Angst und im Bedürfnis Abhilfe zu schaffen, eine so perverse Allianz eingegangen. WINNICOTT beschreibt, daß sich die unwahrscheinlichsten und mystifizierendsten Aktionen der Rehabilitation vervielfältigt haben und zwar mit Kontinuität, in der die Ganzheitlichkeit des Kindes sowie die Dimension seiner Entwicklung verneint werden und die das Wesen des »abuso«, der mißbrauchenden Gewalt darstellt.
Gegenüber dem hirngeschädigten Kinde sich beispielsweise nur mit der Motorik zu befassen oder schlimmer noch mit seinem motorischen Defekt, bedeutet eine Ableugnung, eine Verdunkelungsaktion gegenüber dem nicht-so-gewollten Kinde und führt zur Negation seiner Persönlichkeit, seiner mitmenschlichen Beziehungen und seiner Zukunft. So ist die totalitäre und betrügerische These entstanden: mehr Therapie = mehr Resultate, während in jedem anderen, verantwortungsbewußteren Bereich der Medizin Therapie in dem Maße verabreicht wird, das der Notwendigkeit entspricht. So ist auch die Zwangsvorstellung aufgekommen, daß für den Behinderten alles besonders sein muß. Dies hat zur Absurdität der Institutionalisierung geführt hat, wobei die eigentlichen Probleme des durch den Defekt seines Kindes in Angst versetzten Erwachsenen maskiert werden konnten.
Alles wurde »besonders« - von der Schule zum Spielzeug, von der Behandlung zur pädagogischen Förderung, vom Schonraum zum Personal, das allein nur das »besondere« Kind zu verstehen in der Lage war. Das behinderte Kind war dazu verdammt, bei allem, was es tat und was es berührte, dem Besonderen zu begegnen; König Midas aber starb schließlich daran, daß alles zu Gold wurde, was er berührte.
Infolge des Mißbrauchs der Medizin und der Pädagogik durfte also das Kind nicht mehr am täglichen Leben teilhaben, wie es sich durch das Spiel, durch die Gemeinschaft der Gleichaltrigen, durch Musik, durch Bewegung, durch Schwimmen usw. ergibt, denn all dies wurde verwandelt in Beschäftigungstherapie, in Spieltherapie, in Heilgymnastik, in Sonderschule, in Physio-, in Musik-, in Wassertherapie. Jede dieser Aktionen wurde aus dem natürlichen Lebensraum herausgelöst und einem Fachmann anvertraut.
Aber wenn wir von der Rehabilitation nur als von einem Mißbrauch im Gegensatz zum Respekt der realen Bedürfnisse des Kindes sprechen, Müssen wir uns wieder darüber im klaren sein, daß wir damit nur auf moralischer und politischer Ebene argumentieren. Diese Beschränkung muß, wie gesagt, überwunden werden, damit diese Aussagen nicht als ein simpler Angriff auf die Medizin erscheinen. Das wirklich Neue, das die Medizin der Gesundheit als eine kulturelle Revolution qualifiziert, liegt nicht einfach in der Anpassung an moralische und politische Sensibilität, die sicherlich von größter Bedeutung ist, sondern wurzelt im wissenschaftlichen Fortschritt, von dem hier die Rede sein soll.
Als Alternative zur mißbrauchenden traditionellen Medizin muß die Medizin der Gesundheit per definitionem durch den Respekt der menschlichen Persönlichkeit bestimmt sein und es scheint uns, daß vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus dieser Respekt von der Erkenntnis einer fundamentalen Seinsqualität der menschlichen Person auszugehen hat, die in ihrer Fähigkeit zum Handeln zu suchen ist.
Das Individuum ist vornehmlich »ein problemlösendes und die Welt explorierendes Wesen«, wie POPPER in seiner Kritik der Verhaltenslehre und der Reflexologie sagt. Und wir glauben, daß in diese erneuerte Würdigung der Fähigkeit zum Handeln weitere Aspekte einbezogen werden müssen, nämlich die Fähigkeit des Vorwegnehmens, die kreative Kraft des Denkens und des Wünschens, jene Qualitäten also, die wir als vorschlagende Kompetenz bezeichnen könnten, in der Gegenüberstellung zum verhaltenstheoretischen Modell, das die Umwelt privilegiert und zur Vorstellung einer Menschmaschine geführt hat, die lediglich aus Reflexen besteht und nur die Fähigkeit zur Antwort besitzt. Die wissenschaftliche Erkenntnis der Fehlerhaftigkeit dieses Modells führt zur Überwindung der Reflexologie und der Verhaltenstheorie, sowie zur Einsicht, daß uns vor allem die Interaktion zu interessieren hat. Die Reflexologie bildet immer noch die Grundlage der neurologischen Diagnostik und der physiotherapeutischen Behandlung der Zerebralparese, deshalb muß dieses Problem auch in seinen praktischen Konsequenzen vertieft werden.
Selbst SHERRINGTON, dem wir das Modell des Reflexbogens zu verdankest haben, spürte, daß es sich um eine unwahrscheinliche, wenn auch Vorteilhafte Fiktion handelte. Aber gerade der Mißbrauch dieses Modells hat jahrzehntelang verhindert, die vor-rationalen und schöpferischen Ausdrucksgegebenheiten des Individuums wahrzunehmen, die vorhanden sind, noch bevor es der Sprache mächtig ist. Das mißverstandene Reiz-Antwort-Schema der Verhaltenstheoretiker und die Herrschaft des Reizes gegenüber der Antwort ist Schuld an so umfangreicher pädagogischer und rehabilitativer Gewalt. Heute dagegen wird wieder in den Vordergrund gerückt, was das Kind an Eigenem und Selbständigem besitzt, seine schöpferische Fähigkeit, sich selbst zu konstruieren und auf die Umwelt Einfluß zu nehmen, seine Möglichkeit, Vorschläge zu machen als Basis eines Dialogs und einer menschlichen Beziehung. Auf unserem Gebiet ist es vor allen Dingen die Beobachtung des motorischen Verhaltens des Neugeborenen und das faszinierende Schauspiel der fötalen Motorik gewesen, die uns dazu geführt haben, die Botschaften, die das find so reichlich anbietet, zu erkennen und zu respektieren.
Unsere Aufmerksamkeit ist also nicht so sehr auf das Studium der Antworten als auf das Studium der Vorschläge zu lenken und das bedeutet die reizgebende Arbeitsweise zu verlassen. Reize gibt man Versuchstieren, aber nicht Kindern, denn die reflexen Mechanismen und Antworten sind gerade die Negation der Botschaft, die wir erhorchen, und der Mitteilung, die wir fördern und des Dialogs, den wir beginnen wollen. Reiz und Antwort erschöpfen sich gegenseitig und schließen einen Kreis, der zweidimensional bleibt und die dritte Dimension der Entwicklung und des Schöpferischen ausschließt. Diese dritte Dimension existiert nur, wenn mehr vorliegt als nur ein Reiz-Antwort-Verhältnis. Dieses »Mehr« nennen wir »parametro positivo«. Seine Beachtung allein erlaubt einen positiven Dialog, durch den dialektisch aufbauende Vorschläge produziert werden können. Das Lesen der motorischen Botschaft ist uns erleichtert durch das Funktionsverständnis der fötalen und postnatalen Bewegungen. In der Tat sind die ersten Verhaltensmuster des motorischen Verhaltens, die in dieser Entwicklungsphase in ihrer genetischen Bestimmung und Artentsprechung vorherrschend sind, charakteristisch für ihre Möglichkeiten der vorschlagenden Identität, die es ihnen erlaubt, als Organisatoren der Ontogenese der motorischen Entwicklung tätig zu sein. Der unglaubliche Reichtum des Repertoirs der Bewegungsmuster, wie ihn JANNIRUBERTO und TAJANI im Fötus zwischen der 10. und der 20. Woche aufgezeigt haben, stellt das Alphabet dar durch welches sich, mit allmählich eintretenden Interaktionen und Integrationen, in der Gegenüberstellung mit der physischen und menschlichen Umwelt, die gesamte Sprache der Motorik entwickelt.
Unser theoretisches Modell, das wir aus der Analyse der Verhaltensmuster entwickelt haben, erlaubte uns, zu diesen ersten alphabetischen Elementen vorzustoßen, sie im Fötus zu erkennen, ihre Entwicklung zu verfolgen und so ihren Sinn zu erfassen. Auch das Alphabet der Mitteilung des noch zur Sprache unfähigen Kindes ist heute durch Ultraschall in der Fötalphase zu erkennen. Beobachtungen und diese Sprache verstehen war schon ein Vorschlag BARZELTONs, als er den Einfluß des Kindes auf seine Bezugsperson darstellte und in den jüngsten semantischen Untersuchungen zum kindlichen Verhalten im Dialog aufzeigte, wie selbst die einfache Beobachtung der »Mimik« des Fußes eines drei Monate alten Kindes festzustellen erlaubt, ob das Kind seine Mutter, den Vater oder einen leblosen Gegenstand vor sich hat. Gerade aus der vertieften und vor allem respektvollen semantischen Analyse der »Vorschläge« des Kindes ergibt sich durch die Prägnanz seiner provokatorischen Erfindungsgabe und durch seine reiche Beziehungs-Ausstrahlung ein wunderbares Verständnis seiner Botschaft, wie es auch in der wieder von BRAZELTON so definierten »Schmusigkeit« der Neugeborenen sichtbar wird. Unübersetzbar, weil es viel mehr als »passive Bereitschaft zum Schmusen« bedeutet, ist der japanische Begriff »amae«; man könnte von »aktiver Suche nach passiver Liebe« sprechen. Das Kind verstehen und kennenlernen bedeutet gegenseitige Mitteilung ermöglichen, und je weiter man zu den Quellen der Ontogenese aufsteigt, desto unpassender und einschränkender erscheint die Trennung in Sektoren, wie sie Neurologen, Psychiater und Psychologen produzieren, wenn es sich darum handelt, Kenntnisse der psycho-biologischen Ganzheit des Kindes zu erhalten.
Die Hypothese vom passiven Individuum, das wie eine Maschine auf die Umwelt antwortet, korreliert paradigmatisch mit dem Ansatz der Medizin der Krankheit: von ihm ausgehend, stützt sich die neurologische Semiotik fast ausschließlich auf die Suche nach dem Defekt. Die minutiöse und fast zwanghafte Suche nach dem, was dem Kind fehlt, bestimmt das ebenso zwanghafte Bemühen der verbessernden Therapie bei der völlig irrigen Voraussetzung, daß der Defekt im neurologischen Bereich heilbar ist. Aus diesen Gründen bekam nämlich die Diagnose und das verbessernde Verhalten die Oberhand.
Wir halten es dagegen für unerläßlich, der Suche nach den positiven Zeichen den Vorrang zu geben, d.h. all das hervorzuheben, was das Kind tun kann, nicht aber der Suche nach seinen Defekten. Es soll der Prognose statt der Diagnose, der Förderung der Normalität statt der Behandlung der Krankheit der Vorrang gegeben werden. Abgesehen von dem menschlichen Positivum, das durch diese Einstellung der Familie des behinderten Kindes zugute kommt, ist sie auch vom neurologischen Gesichtspunkt her korrekter, wie dieses Beispiel zeigen soll: wir wissen, daß die Physiotherapie der Neuromotorik keine heilende (verbessernde) Wirksamkeit gegenüber dem Defekt besitzt, sondern nur auf die Konstruktion von Alternativen zum sogenannten »pathologischen« Verhaltensmuster Einfluß haben kann. Im Repertoire der im Zentralnervensystem existierenden Automatismen, die wir benutzen, um das tägliche Leben zu meistern, gibt es aber keine »pathologischen« Verhaltensmuster. Z.B. die typische Haltung des Armes eines Hemiplegikers ist als solches nicht pathologisch, denn sie wird im Alltagsleben dazu benutzt, eine Tür aufzuziehen. Es handelt sich nicht um ein pathologisches Verhaltensmuster, sondern um eine Reduktion des Verhaltensrepertoirs, um ein Fehlen von Verhaltensmustern, durch das keine funktionalen Alternativen möglich sind. Aus dieser Feststellung geht klar hervor, daß die Physiotherapie nicht ein Übel kurieren kann, das nicht vorhanden ist, sondern daß sie nur Alternativen liefern kann. Mit anderen Worten: auch die Physiotherapie wie die neurologische Semiotik kann nur das Positive wollen; sie hilft aufbauen, was das Kind tun kann, und zwar durch Förderung von Normalität, während es nicht möglich ist, den Defekt zu eliminieren. Der in diesem Sinne arbeitende Therapeut muß geschult werden, die oben erwähnten drei Dimensionen des Kindseins zu respektieren, aber dann auch weiterhin zusammenhängend so zu handeln, d.h. nicht so zu tun, als könne der Defekt weggeturnt werden.
Wenn man es recht bedenkt, so gilt dies ebenso für die Denkleistungen, deren Substrat aus den gleichen Gründen des neuromotorischen Defekts oder aus degenerativen Gründen verschiedenster Art vermindert sind. Merkwürdigerweise nimmt man es einem Blinden ab, daß er nicht sehen kann und hilft ihm, Alternativen zu finden (wenn er nicht von selbst auf sie stößt), die ihm ein möglichst normales Leben erlauben; dies geschieht aber nicht beim geistigbehinderten Kind, dessen korrekte Antwort auf den gegebenen Reiz oder auf die zu leistende Aufgabe immer als eine Frage der Intensität, der besseren Sinnesvermittlung (im sensualistischen Sinne) oder der geschickten Motivation angesehen wird, auch hier nach dem Motto: je mehr Behandlung, desto mehr Resultate. Wir wissen ja, was die Verhaltenspsychologie in dieser Beziehung aus den Primaten herauszuholen imstande ist. Dabei geht man daran vorbei, daß zum Beispiel Lesen und Schreiben nicht eine für sich stehende, isolierte Funktion darstellen, durch die Autonomie verbrieft wird, sondern nur im Zusammenhang mit dem täglichen Leben gesehen werden kann. (Um es überspitzt auszudrücken, kann man einen durch geistige Behinderung nicht zum Lesen und Schreiben fähigen Menschen gut zu einem normalen Leben führen, wenn man die Bedeutung dieser Funktion verschiebt, während die zum Ziel des Lesens und Schreibens geführten sonderschulischen Bemühungen niemandem nützen, der im Heim lebt.) Heilpädagogik sollte (wenn man diesen Fachbereich überhaupt bestehen lassen will), also genau wie die Physiotherapie nicht nach den unmöglichen Zielen drängen, sondern nach dem Möglichen suchen, d.h. auch hier wieder die Prognose bevorzugen; so könnte vermieden werden, daß man jahrelang hinter Zielen herrennt (und der Behinderte mit, um dem Erzieher oder dem Therapeuten nicht zu mißfallen), die andressierte Normalität darstellen, sich aber nie zu wirklichen Alternativen, z.B. beruflicher Art, im normalen Lebensraum auswachsen.
Wie sieht dies alles nun in der Praxis aus?
Was den Respekt des ganzheitlichen Zusammenhangs anbetrifft, soll:
-
der therapeutische oder der pädagogische Ansatz durch eine strategische Beurteilung der im Längsschnitt sich darbietenden Möglichkeiten vollzogen werden und zwar vornehmlich in der Achtung des Kindes und seiner Familie in ihrer Ganzheit. Dies bedeutet, ein Kind mit Behinderung und nicht einen Behinderten behandeln, d.h. ein Kind, das handeln, gehen und schöpferisch tätig sein kann.
-
die Rehabilitation von ihrem medizinischen Heilungsbegriff befreien, jede Behandlung auf das unbedingt Unerläßliche reduzieren und auf den geringsten Zeitraum beschränken (genau das Gegenteil der Vorstellung »mehr Therapie = mehr Resultate«). Jeder übertriebene, nicht unbedingt notwendige ärztliche, psychologische oder pädagogische Eingriff erhöht die Gefahr der inneren und äußeren Isolierung des Individuums.
-
die therapeutische Übung, die therapeutische »Setzung« vermeiden, in der Überzeugung, daß vor allem im Kleinkind, das schwer durch Zukünftiges zu motivieren ist, es sehr viel konstruktiver und weniger schädlich ist, so zu handeln, daß an Stelle der Übung die Erfahrungen im täglichen Leben vorgezogen werden, deren Zusammenhang und Motive ihm ohne weiteres zugänglich sind und es befriedigen. Dies bedeutet fast immer, das fachliche Soll zu dekodifizieren, um das therapeutische Anliegen in das Leben des Kindes und seiner Familie einzuführen. So wird der Therapeut, der Neuropädiater, der Psychologe und der Pädagoge nicht zum Alleinwissenden und Alleinhandelnden, sondern Berater in der Übersetzung bestimmter fachlicher Kenntnisse in die Sprache des täglichen Lebens, d.h., er wird Förderer von Normalität und Autonomie. Ebensowenig wie der Therapeut die Delegierung der Aufgabe zu behandeln annehmen sollte, ebensowenig wird er sie der Familie übergeben, denn nichts ist gefährlicher für die Kind-Eltern-Beziehung, als Mutter und Vater zu Therapeuten zu machen. Der zur Bewegungsprothese oder zur geistigen und seelischen Stütze abgestempelte Therapeut oder Heilpädagoge verdammt den Patienten zur lebenslangen Therapie.
Was speziell den Fachbereich Physiotherapie anbetrifft, muß noch dazu unterstrichen werden:
-
Daß sich die physiotherapeutische Wirkung nicht auf die Fähigkeit der Heilung des Defekts aufbaut, sondern auf den Versuch, Normalität zu fördern. Wir sagten schon, daß es in der organischen Struktur keine »pathologischen« Verhaltensmuster gibt. Was z.B. in der speziellen Motoskopie als solche erscheint, ist in Wirklichkeit eine Pathologie von Verhaltensmustern, die an sich normal sind. Der Defekt besteht im Fehlen von Alternativen oder im Fehlen einer funktionellen Organisation. Die Behandlung fußt deshalb nicht auf der Verhinderung oder der Heilung des pathologischen Phänomens, sondern in seiner Überwindung durch den Aufbau eines weitläufigeren und besser organisierten Repertoirs, das für eine größere Freiheit der operativen und funktionalen Entscheidungen gebraucht werden kann. Dies geschieht aber, wie wir gesehen haben, nur durch das Hervorheben der Handlungen, die möglich sind. Semiotik der positiven Aspekte ist zugleich Semiotik der Prognose, auf der die therapeutische Entscheidung auf baut. Neuromotorische Physiotherapie, in der wir lange Erfahrung haben, ist deshalb per definitionem Teil der Medizin der Gesundheit, weil sie nicht die Krankheit heilt (den Defekt), sondern das Individuum - im Sinne von »from cure to care«. Das Resultat wird durch den Umfang der im Gesamtbild der Persönlichkeit gebildeten Fähigkeiten und nicht durch die Reduzierung der Pathologie ermessen.
-
Der Therapeut, der auf diese Weise aufbauend handeln will, muß versuchen, eine Situation entstehen zu lassen, in der auch unter fachlichem Aspekt ein therapeutischer Dialog entsteht. Dazu muß er überzeugt sein, daß das Kind Hauptperson seiner eigenen Entwicklung ist. Dialog heißt aber, wie wir in unserem Schema gesehen haben, Handlungen vermeiden, die nur den Charakter des Reizes haben.
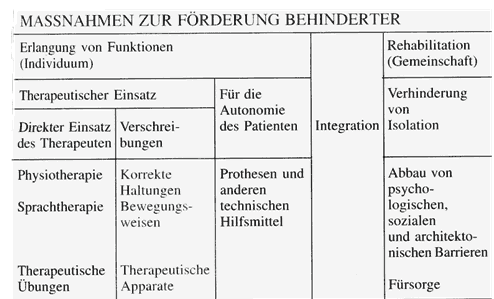
Maßnahmen zur Förderung Behinderter
Allgemeine Gegenüberstellung
|
ALLGEMEINE GEGENÜBERSTELLUNG: |
|
|
Medizin der Krankheit |
Medizin der Gesundheit |
|
Der Defekt |
Die Kompetenz |
|
Gegenstand der Behandlung: der Kranke, der Behinderte, der nach Behandlung Suchende |
Der Bürger |
|
From cure.... |
...to care |
|
Aufteilung in Fachbereiche |
Ganzheitliche Dienstleistungen |
|
Modelle des teilhaften Handelns: Reflexe, Tests, Entwicklungsphasen. Gegenwart |
Modelle des strukturellen Handelns: Ganzheit des Individuums in bezug auf seine physische und soziale Umwelt. Zukunft |
|
Erwarten von Antworten (Reize) |
Beobachten von schöpferischen Vorschlägen: Dialog, Amae. |
|
Negative Semiotik (Screening der Pathologie) Analytische Erfassung |
Positive Semiotik (Screening der Gesundheit) Strukturelle Erfassung |
|
Vorbeugung der Krankheit Therapie des Defekt |
Förderung der Gesundheit |
Allgemeine Rehabilitation
|
...UND IN DER REHABILITATION |
|
|
Therapeutische Übung Die therapeutische Sitzung (die Behandlung wird dem Therapeuten delegiert) Kenntnis von Methoden Isolierung Trennung vom eigentlichen Lebensraum |
Erfahrung Beratung (der Therapeut steht mit seinen Kenntnissen zur Verfügung) Fachkenntnis Teilnahme und Leben in der sozialen Umwelt |
Man kann behaupten, daß es fast immer möglich ist, im Alltag und in den normalen Lebenssituationen Gelegenheit zu finden, die die Wiederholung einer gewünschten Bewegung begünstigen. In der Erfahrung und durch Handeln in der Normalität ist Übung in allen Bereichen möglich, in denen es notwendig wird, Schwierigkeiten zu kompensieren oder Alternativen zu erarbeiten.
Der Vorschlag, so vorzugehen, daß man Normalität übt, ist so verstanden worden, daß es genüge, einfach mit dem Kinde zu spielen. Aber das geht am Problem vorbei: es handelt sich vielmehr darum, in der normalen Tätigkeit des Kindes die therapeutischen Qualitäten zu erspüren und sie so zu leiten, daß sie zu Gewohnheiten werden. Nur so können die alternativen Fähigkeiten im pathologischen Grenzbereich gefördert und die Übermacht der pathologischen Entscheidungen gemildert werden.
Diese Einstellung verlangt ein weitaus größeres Fachwissen als die Kenntnis der einen oder der anderen Methodik vorschreibt, weil sie die vorbereitende Fähigkeit des Beraters erfordert. Aber noch rigoroser kommt es zur Aufwertung der medizinischen und überhaupt der fachlichen Kompetenz und damit zur Fähigkeit, für die Gesundheit richtig zu handeln, wenn man den so stark verschwommenen Begriff der Rehabilitation schärfer definiert. Z.B. ‚Demedikalisierung' der Gesellschaft, wie man es im Italienischen ausdrückt, kann in der Tat nicht ein Verzicht auf die Leistungen der Medizin bedeuten. Es geht vielmehr darum, herauszuarbeiten, was wirklich Sinn und Aufgabe der Medizin oder der Psychologie oder der Pädagogik ist. Therapie ist dann der fachliche, spezifische Einsatz, um ein funktionelles Defizit in der oben vorgeschlagenen Weise zu reduzieren. Rehabilitation ist dagegen jeder nicht-medizinische Einsatz der Gemeinschaft um die Isolation der Behinderten zu vereiteln. Deshalb sollte man nicht von rehabilitativer Therapie sprechen.
Die Erreichung der persönlichen Autonomie ist das individuelle Korrelat der Rehabilitation und diese ist, wie gesagt, Aufgabe der Gemeinschaft. Eine solche Klarstellung ist unerläßlich, denn der Medizin aufzutragen die Ängste zu lösen, die der Behinderte im Bürger, in der Familie und in der sozialen Umwelt produziert, bedeutet die Medizin ihrer eigentlichen Aufgabe zu entfremden. Rehabilitation hat pädagogische, psychologische und sozialfördernde Aufgaben; Medizin beschäftigt sich, in der Bemühung um den Behinderten, mit seinen funktionellen Möglichkeiten. Die in dieser Weise zum Ziel gesetzte Integrierung Behinderter ist aber nicht logische Folge der Therapie, sondern geht ihr voraus. Genauer noch: um Therapie wirksam sein zu lassen, muß von vornherein verhindert werden, daß Integration notwendig wird, denn der Begriff setzt ja eine vorangegangene Isolation voraus. Rehabilitiert ist der Behinderte aber nicht, wenn er durch Therapie von seinem Defekt befreit ist, sondern wenn ihm von vornherein dazu verholfen ist, mit seinem Defekt in der Gemeinschaft zu leben, in der Normalität, durch die allein seine Rehabilitation Wahrheit wird.
In diesem Sinne dürfte es den Begriff der Rehabilitation gar nicht geben, und viel korrekter wäre es von all den Initiativen zu sprechen, die verhindern, daß schon das behinderte Kind (etwa durch falsch verstandene Therapie) an den Rand gedrängt wird. So ist zu verstehen, daß man in Italien versucht, eine Art der Behandlung des behinderten Kindes durchzusetzen, die es nicht sich selbst entfremdet, die es im Bereich der Familie nicht zu etwas Besonderem abstempelt und die es nicht von den anderen Kindern im Recht des gemeinsamen Lebens und Lernens unterscheidet.
Daher die Eingliederung aller behinderten Kinder, möglichst von den ersten Lebensmonaten an, in die Kinderkrippen und später in die Kindergärten, daher die vom italienischen Gesetz verfügte Aufnahme aller behinderter Kinder in die Regelschule. Schule ist dann nicht mehr das Sieb, durch dessen willkürlich bestimmte Maschen nur die sogenannten Guten fallen, sondern sie soll zu einem der vielen Lebensbereiche werden, in denen Kinder im engsten Kontakt mit der sozialen und kulturellen Realität ihres Lebensbereiches spielen und lernen.
Schon vor dem Schulbesuch wird das behinderte Kind die therapeutische Hilfe erfahren haben, die seinen wirklichen Bedürfnissen gerecht wird und seine Persönlichkeit, sowie die zukünftige Realität seiner vielleicht nicht reduzierbaren Behinderung in Betracht zieht. Der frühe Kontakt der nichtbehinderten Kinder mit den behinderten vermeidet die Isolation des erwachsenen Behinderten weit besser als z.B. der im Grund sehr formale und vom mitmenschlichen Gefühl weit entfernte Abbau architektonischer Barrieren oder die Linienbusse für Behinderte.
Gesundheit fördern heißt also im Bereich der Behindertenbetreuung nicht krank werden lassen, was nicht krank, was nur fremder und manchmal mühevoller ist.
Hamburg, Gesundheitstag 1981
[10] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/1981, S. 30 - 37. Grundlage dieses Beitrages ist der Vortrag, den Ludwig-Otto ROSER und Adriano MILANI-COMPARETT1 1981 beim Gesundheitstag in Hamburg vortrugen. Dieser Text wurde auch in der Zeitschrift »Forum für Medizin und Gesundheitspolitik«, 1982 und in der Dokumentation des Gesundheitstages veröffentlicht. Michael WUNDER und Udo SIERCK (Hrsg.): Sie nennen es Fürsorge. Behinderte zwischen Anpassung und Widerstand. Hamburg 1982, S. 77 - 88 Auf diesen Vortrag bezieht sich auch Michael WUNDER mit seinem Beitrag in dem hier vorliegenden Buch. (s. S. 56-64)
»Integrierung ist nicht eine Konsequenz der Rehabilitation, sondern ihre Voraussetzung...«, (Ludwig-Otto ROSER 1981). Noch heute ist dieser Satz aktuell, gemessen an dem, wie oft Integration geplant und umgesetzt wird. Meine Beobachtungen als beratende Physiotherapeutin bei einem großen Kindertagesstättenträger und auch anderen Organisationen, die sich mit Integration auseinandersetzen, sind die, daß oft der umgekehrte Weg diskutiert und auch beschritten wird.
Als ich 1979 als frisch gebackene BOBATH-Therapeutin meine Arbeit in einem Sonderkindergarten wieder aufnahm, war ich eine der Therapeutinnen, die genau wußte, was einem behinderten Kind auf seinem Lebensweg bevorstand. Es gab da allerdings die Möglichkeit der intensiven Therapie, die, vorausgesetzt, daß auch alle sich den Anforderungen entsprechend beteiligen würden, Linderung, wenn nicht sogar Heilung bringen könnte, zumindest annähernd.
Ich mußte sehr schnell erkennen, daß dies ein Konstrukt war, das jeder Realität entbehrte. Die Kinder lebten mir andere Realitäten vor. Trotz des Fehlens meiner heilenden Hände machten Kinder während der Ferien einen großen Entwicklungssatz, der evtl. nicht zu sehen war während intensiver Therapiephasen. Anfänglicher Verwirrung folgten Zweifel, Unsicherheit, Unzufriedenheit, Rückzug. Ich wußte, daß das Gelernte so nicht stimmen konnte, daß ich so nicht weitermachen wollte, doch wie dann?
Monika ALYs Erfahrungsbericht über ihre Zeit im Istituto Anna Torrigiani in Florenz, der 1980 zum Gesundheitstag in Berlin erschien, erlebte ich wie eine Befreiung. Ich fand den Mut, über meine Zweifel, meine Gedanken mit Kolleginnen zu reden und entdeckte, daß auch bei einigen von ihnen ähnliche Entwicklungen stattfanden. Ich hatte Verbündete gefunden. Gemeinsam gründeten wir eine Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit Texten aus Italien, aus Bremen, Dänemark u.a. zum Thema Integration auseinandersetzte. Unsere Gedanken trugen wir in die Mitarbeiterbesprechungen, zu den Eltern. Wir holten einen Spielkreis ins Haus, begannen gegen den Widerstand und die Unterlassungsdrohung eines unserer Vorgesetzten behutsam unser Netz zu knüpfen, meldeten uns für den Gesundheitstag 1981 in Hamburg an, um dort Erfahrungen auszutauschen, unser Netz vielleicht mit anderen zu verknüpfen.
Für mich entwickelte sich darüber hinaus die Notwendigkeit, selbst nach Florenz zu fahren, die Menschen und deren Arbeit, die mich so beeindruckten, kennenzulernen. Dr. Ludwig-Otto ROSER schickte mir die Einladung zu einer Hospitationswoche im Istituto Anna Torrigiani und anderen Einrichtungen in Florenz, die ich im Juli 1981 zusammen mit anderen Teilnehmerinnen aus Deutschland wahrnehmen durfte. Er war der konstante Begleiter durch eine Woche voller neuer Erfahrungen. Er faßte zusammen, vertiefte und verdeutlichte, machte Mut zur Auseinandersetzung. Ich erinnere mich noch gut, daß ich voller Verwunderung und Hochachtung war, daß er als deutscher Psychologe so selbstverständlich über Fragen der Integration und evtl. damit im Zusammenhang zu sehender nötiger politischer Aktionen sprach, wie ich es mir für meinen Arbeitsbereich zu dem Zeitpunkt im Traum nicht vorstellen konnte.
Diese Erfahrungen beflügelten mich für meine Arbeit in der Arbeitsgruppe. Unsere Veranstaltung während des Gesundheitstages wurde zum Erfolg.
Mir persönlich ging jedoch alles nicht schnell genug. Ungeduld und wieder Zweifel stellten sich ein. Ungeduld über innere und äußere Blockaden, Zweifel, ob dies wirklich mein Weg war.
1984 schließlich ging ich für ein Jahr nach Italien. Was war das für ein Land, was waren das für Menschen, die einen solchen Arbeitsansatz möglich machten? Hier begegnete ich Dr. Ludwig-Otto ROSER noch einmal, setzte mich noch einmal mit ihm über die Bedingungen der Menschen mit Behinderung in Italien auseinander, über neu aufgeworfene Fragen ob deren Integration bzw. Nichtaussonderung. Ich fand jedoch zunächst keine Antworten auf meine ganz persönlichen Fragen, für meine Entscheidung. Hilfreich waren sie dennoch, zunächst für eine erneute intensive Auseinandersetzung und weiterhin für meine persönliche und berufliche Entwicklung.
Zurück aus Italien fühlte ich mich frei und offen für alles, was sich mir beruflich bieten würde, solange diese Arbeit geprägt war von Achtung und Zurückhaltung den Menschen gegenüber, denen ich in meiner Arbeit begegnen würde. Dazu gesellte sich der Wunsch, mein Wissen, meine Ideen weiterzugeben, andere an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Auf Umwegen - Physiotherapieschule, Fortbildung, noch einmal Ausland -, kam ich schließlich zu der Arbeit mit Kindern zurück. In der Position einer beratenden Physiotherapeutin fließen meine Wünsche und Vorstellungen in eine breite interdisziplinäre Zusammenarbeit ein. Ich habe auch die Möglichkeit, durch Fortbildungen und Anleitung meine Kolleginnen in der Arbeit mit den Kindern und ihren Familien zu begleiten und damit mit der Basis vertraut zu bleiben.
1993 eröffnete der Träger die ersten Integrationsgruppen. Eine flächendeckende Integration ist gewünscht, aus vielerlei Gründen jedoch nicht so schnell umsetzbar. Viele Kinder mit Behinderung werden noch in speziellen Sondergruppen betreut, andere Kinder sind oft »nicht integrierbar« oder sollen erst einmal »passend« für eine Integrationsgruppe gemacht werden.
Wie kommen wir zu solchen Aussagen? Würden wir bei einem Kind, das nicht den Stempel der Behinderung trägt, auch Fragen nach dem »Passen« stellen? Wohl eher nicht. Wohl eher würden wir nach möglichen Hilfen fragen, den Verbleib eines Kindes in seiner vertrauten Gruppe zu sichern. Warum fällt es uns oft so schwer, ebenso bei den sogenannten behinderten Kindern zu verfahren?
Kinder lassen sich durch derartige Überlegungen nicht beeindrucken. Ich erlebe sie immer wieder in ihrem Kindergarten-Alltag, wie sie lebendig und problemlösend sich mit ihrer materiellen und personellen Umwelt auseinanderzusetzen suchen, ihrer natürlichen Neugier, ihren Bedürfnissen folgend, mutig und ausdauernd.
Meine Aufgabe in einem solchen Arbeitsumfeld sehe ich darin, die Bedingungen bereitzustellen, daß Kinder sich unbefangen auf den Weg machen können, ihre Umwelt zu erkunden. Für die Kinder, die dies nicht allein tun können, gilt es, sich mit ihnen auf den Weg zu machen, ihnen Begleiterin sein, die sich ihnen in den Weg stellenden Schwierigkeiten zu überwinden.
Was bedeutet mir diese Arbeit?
Ich möchte hier das von Ludwig-Otto ROSER und Adriano MILANI-COMPARETTI in ihrem Beitrag zum Gesundheitstag in Hamburg 1981 dargestellte Bild der offenen Spirale heranziehen. In einer Begegnung dieser Art kommt es zum positiven Dialog. Diesen möchte ich in meiner Arbeit nicht nur auf das Kind beschränken. Ich finde ihn ebenso bedeutsam für den Umgang mit dessen Familie, mit den Personen, die seinen Alltag mitgestalten und ebenso für die Auseinandersetzung in unserem interdisziplinär zusammengesetzten Beratungsteam. Diese Vielfältigkeit, die sich für mich deutlich von den Möglichkeiten der Arbeit in einer Physiotherapiepraxis oder Klinik unterscheidet, ist es, die mich trotz mancher Anstrengung und Hindernisse herausfordert, lebendig bleiben läßt mit anderen.
So ist es an meinem Arbeitsplatz in langen, oft schwierigen und manchmal auch schmerzhaften Auseinandersetzungen gelungen, ein Therapie-Konzept zu entwickeln, das handlungsorientiert an den Bedürnissen des Kindes anknüpft und Probleme dort lösen hilft, wo sie entstehen, im Kindergarten-Alltag. Diese Diskussion hat von allen Beteiligten viel Mut erfordert, Mut, sich einzulassen und damit einen Dialog möglich zu machen, aber auch Mut, querzudenken in einer Zeit, da die Gesundheitspolitik, die Krankenkassen und andere Kräfte zum Sparen aufrufen, und der Ruf nach schneller Heilung und Reparatur wieder laut wird. So wird es auch Mut erfordern, diese Meinung nach außen kundzutun und zu vertreten. Es braucht auch Mut, sich immer wieder den Fragen der Eltern zu stellen und sich selbst im eigenen Tun zu hinterfragen, ob wir verständliche und zuverlässige Partnerinnen und Begleiterinnen der Kinder und ihrer Familien sind.
Solche Gedankengänge zu entwickeln und deren Ziele zu verwirklichen, haben mir auf meinem beruflichen und persönlichen Weg viele Menschen geholfen. Von ganz besonderer Bedeutung war dabei auch das Zusammentreffen mit Dr. Ludwig-Otto ROSER und die nachfolgende Auseinandersetzung mit den »italienischen Verhältnissen«.
Es war einmal ...? Noch heute ist die Integrierung Behinderter keine Selbstverständlichkeit. Noch oft bestimmen Diagnosen die Therapie. Mit dem Betroffenen beobachten, handeln und warten fällt oft unendlich schwer. Das anfangs begonnene Zitat ist also nach wie vor aktuell, und es braucht Menschen wir Dr. Ludwig-Otto ROSER, die unsere Sinne wach halten für unsere Aufgaben. Mit der Fortführung des Zitats möchte ich deshalb meinen Beitrag schließen: »Der echte Wunsch, Behinderte am Leben aller teilnehmen zu lassen, kennt keine Begrenzungen materieller Art, ist also keine ökonomische oder therapeutische Instanz, sondern eine Frage des mitmenschlichen Gefühls«.
Literatur
ROSER, Ludwig-Otto: Die Förderung schwerstbehinderter Kinder im Florentiner Integrationsmodell - Individualisierte Betreuung in der sozialen Welt. In: Andreas FRÖHLICH (Hrsg.):Die Förderung Schwerstbehinderter. Verlag Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Luzern 1981, S. 199-222
MILANI-COMPARETTI, Adriano und Ludwig-Otto ROSER: Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation - Voraussetzung für die reale Anpassung behinderter Menschen. In: Michael WUNDER und Udo SIERCK (Hrsg.): Sie nennen es Fürsorge - Behinderte zwischen Vernichtung und Widerstand. Verlagsgesellschaft Gesundheit mbH, Berlin 1982, S. 77-88
ALY, Monika, ALY, Götz, TUMLER, Morlind: Kopfkorrektur - oder der Zwang gesund zu sein Rotbuch Verlag, 1991 und 1981
Als Ludwig-Otto ROSER vor einem überfüllten Hörsaal auf dem Hamburger Gesundheitstag 1981 zur Überwindung der defektbezogenen Denkweisen in Medizin, Psychologie und Pädagogik sprach, wurde ihm entgegengehalten, dies seien »schöne Theorien«. Es waren Vertreter der damals erst kürzlich gegründeten Krüppelgruppen, die diesen Einwand erhoben. Die Gesundheitstage und die Gesundheitsbewegung Anfang der 80er Jahre war eine Aufbruchbewegung, in der es um Demokratisierung der Strukturen im Gesundheitswesen ging, um Partizipation und Patientenrechte, und damit um das Selbstverständnis der Professionen und das Verhältnis der Professionellen zu den Betroffenen.
Es entspann sich eine Diskussion, wie sie typisch für die damalige Situation war, und die bis heute ihre Aktualität nicht eingebüßt hat. Hier der Vertreter der Profession, der deren desintegrativen, normierenden und pathologisierenden Charakter benennt und für eine andere Medizin, Psychologie und Pädagogik eintritt, dort die betroffenen Menschen mit Behinderungen, die eine andere Erfahrung gemacht haben, sich einer alltäglichen Behindertenfeindlichkeit ausgesetzt sehen und viele Beispiele von Ärzten, Psychologen und Pädagogen kennen, die sie pathologisieren.
Ich erinnere mich noch gut an diese Veranstaltung. Deutlich wurde, daß die Umorientierung innerhalb der Medizin, Psychologie und Pädagogik eine wichtige Voraussetzung für die Beendigung der Aussonderung von Menschen mit Behinderung durch Therapie und Sonderbehandlung ist. Die Professionen und die Professionellen müssen sich ändern, indem sie ihre defektbezogene und verbessernde Grundhaltung gegenüber Menschen mit Behinderung überwinden und zu einer verstehenden, fähigkeitsbezogenen Zusammenarbeit mit den Betroffenen kommen. Aber diese »neue Bescheidenheit« der Professionen und der Professionellen reicht nicht aus. Ein wirklicher Durchbruch und eine Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung kann erst erfolgen, wenn das Thema die Ebene der Fachdebatte verläßt und die Betroffenen selbst, wenn es nicht anders geht, auch ihre Eltern oder Angehörigen - ihre Normalität und ihre Integration in der Gesellschaft erkämpfen und durchsetzen. Die Gedanken von Ludwig-Otto ROSER und anderen bleiben »schöne Theorien«, wenn sie nicht von den Betroffenen oder ihren Vertretern durchgesetzt werden und - das zeigt die Entwicklung seither - immer wieder erneut durchgesetzt werden.
Ein junger, spastisch gelähmter Mann schilderte in der Veranstaltung des Gesundheitstages sein Beispiel: als Kind habe er jahrelang trainieren müssen, die Treppe vorwärts herunterzugehen. Dies sei das »normale« Bewegungsmuster gewesen. Seine Angewohnheit, die Treppe rückwärts herunterzugehen, sollte ihm abgewöhnt werden. Erfolglos seien aber alle quälenden Übungen dazu gewesen, weil er sich vor Angst noch mehr verkrampfte. Erst als er sich durchsetzte und als die Therapeutin sein Bewegungsmuster als normal für ihn ansah, konnte er das Treppengehen angstfrei üben und das Rückwärtsgehen so verbessern, daß er heute jede Treppe damit bewältigen könne. Ludwig-Otto ROSER beglückwünschte den Mann, daß er sich durchgesetzt hatte, beglückwünschte gleichzeitig aber auch die Therapeutin, die offensichtlich auf der Grundlage dessen, was wirklich ist, umgedacht hatte.
»Aber«, sagte Ludwig-Otto ROSER, »denkt daran, es reicht nicht, daß ein Spastiker die Treppe rückwärts gehen darf, die Gesellschaft muß dies auch für selbstverständlich halten.«
Ludwig-Otto ROSERS neues Denken
Obwohl ich vorher schon die Arbeit von Adriano Milani-Comparetti und Ludwig-Otto ROSER in Florenz kennengelernt hatte, machte mir erst diese Diskussion die ganze Tragweite des neuen Denkens aus Florenz klar. Die Überwindung der Verbesserungstherapien ist eine professionelle und eine gesellschaftliche Parteinahme für den jeweiligen Klienten. Nicht nur das Potential des Klienten wird nicht weiter in aggressiver Weise ignoriert und als Möglichkeit für neue und eigene Lösungen gesehen; er wird auch als Person nicht weiter abgewertet und als Träger von Defekten angesehen. Er wird in seinem Anderssein ernstgenommen, menschlich angenommen und als Subjekt akzeptiert. Medizin-ethisch ist gerade dieser Aspekt vor dem Hintergrund des Booms gentechnisch beflügelter Neoeugenik und bioethischen Verfügungsdenkens von hoher Aktualität.
Das Modell von Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER geht aber noch einen Schritt weiter: auch die klassische Therapeut-Klient-Beziehung wird aufgelöst. Der Therapeut ist ein genauer Beobachter, ein Fachmann für Sensibilität und Gewahrwerden des jeweils besonderen und persönlichen Potentials, ein Ratgeber, der, sparsam dosiert und zeitlich begrenzt, etwas anbietet und verschiedene Türen öffnet. Der Klient selbst muß entscheiden, welche Türe er nutzt und welchen Weg er geht. Ich habe mit den Jahren diese Konsequenzen aus dem Ansatz von Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER immer wieder neu erkannt und bewundert. Sie paßt sehr gut in das Menschenbild der humanistischen Psychologie und auch zu einem menschenrechtlich orientierten Ansatz der Sozialpolitik.
Heute wird in der Behindertenhilfe inflationär oft von Paradigmenwechseln gesprochen. Was Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre nach Deutschland brachten, war sicherlich ein solcher.
Der Anstoß, den Adriano MILANI-COMPARETTI mit seiner »positiven Semiotik« und Ludwig-Otto ROSER mit seiner Suche nach den eigentlichen Möglichkeiten des Individuums gegeben haben, bedeutete die heute in der Behindertenhilfe weitgehend durchgesetzte Abkehr vom Bild des Menschen mit Behinderung als »behandlungsbedürftiges Mängelwesen« hin zu einem bedarfs- und bedürfnisorientierten System der Hilfen. Insofern sind wichtige Teile ihres Ansatzes heute eingelöst oder zumindest als Standard anerkannt. Die weitergehende Konsequenz ihres Ansatzes aber, die Anerkennung der Menschen mit Behinderung als Subjekte, scheint mir dagegen in weiten Teilen uneingelöst. Auch die Diskussion, dies als Standard anzuerkennen, wird kaum geführt. Gerade bei Menschen mit schwereren Behinderungen, insbesondere Menschen mit schweren geistigen Behinderungen, die sich nur schwer oder erst nach längerem Training selbst entscheiden und selbst äußern können, dominieren auch heute Fremdentscheidungen der Helfer, der Institutionen oder der Angehörigen. Die Betroffenen werden allzu oft Objekte des institutionellen Handelns und Planens, selbst wenn dieses in bester Absicht geschieht. In welcher Institution der Behindertenhilfe ist es beispielsweise heute Standard, Hilfeplankonferenzen oder »Fallbesprechungen« mit den jeweils Betroffenen zusammen zu machen, statt in ihrer Abwesenheit über sie zu sprechen? - Ludwig-Otto ROSER hat oft genug von den Gesprächen direkt mit den Menschen mit Behinderungen berichtet.
Sterilisation ohne Einwilligung - Menschen mit Behinderung als Objekte
Symptomatisch zeigt sich die Behandlung von Menschen mit Behinderung als Objekte beim Thema Sterilisation ohne Einwilligung. Die Fremdentscheidung ist hier sogar gesetzlich ermöglicht. Seit 1990 ist die Sterilisation ohne Einwilligung durch das Betreuungsrecht erlaubt, wenn die Betroffene - es sind in der überwiegenden Zahl Frauen, wie der Gesetzgeber selbst immer wieder zugibt - dauerhaft nicht einwilligen kann, und damit eine Schwangerschaft vermieden wird, die eine körperliche Gefahr darstellen könnte oder eine seelische. Diese besteht dann, wenn nach Ansicht von Experten der Mutter das Kind später weggenommen werden müßte und dies der Mutter seelischen Schmerz bereiten würde. Die Sterilisation darf nicht »gegen den Willen«, aber »ohne den Willen« der Betroffenen erfolgen.
Die bundesdeutsche Regelung offenbart damit eine eklatante Mißachtung der Menschen mit Behinderung als Subjekte. Die geforderte Prognose von Experten, daß einer Mutter das Kind später weggenommen werden muß, ist geradezu die Aufforderung zu einer Defektdiagnose. Eine solche Prognose ist nach meiner Erfahrung überhaupt nicht seriös abzugeben. Die in der Praxis immer wieder beobachtete Entwicklungsfähigkeit der Betroffenen, bei Hilfen in der Familie, an der Erziehungsaufgabe zu wachsen, werden völlig außer acht gelassen.[11]
Auch die im Gesetz gemachte Unterscheidung »gegen den Willen« und »ohne den Willen« geht an den tatsächlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Betroffenen vorbei. Viele Menschen mit geistiger Behinderung können nach meiner Erfahrung im Falle einer Befragung durchaus den Eindruck der Willenlosigkeit machen, selbst wenn non-verbale Signale einbezogen werden. Die Verständnismöglichkeit für ein Geschehen wie eine Sterilisation und seine Konsequenzen, die Kinderlosigkeit, wächst oft langsam. Ich habe viele Menschen mit geistigen Behinderungen kennengelernt, die zum Zeitpunkt des Sterilisationseingriffes keinen Willen bezüglich des Eingriffs hatten oder diesem sogar oberflächlich zugestimmt haben.
Später haben dieselben Menschen aber die ganze Tragweite des Eingriffs verstanden. Für die Betroffenen sind Sterilisationen ohne persönliche und - so muß man hinzufügen - verstehende Einwilligung dann entgegen den Aussagen des Gesetzgebers Zwangseingriffe.
Ludwig-Otto ROSER hat genaues Hinsehen gelehrt und den absoluten Respekt im Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Beides wird bei der Prognostik und Diagnostik für Sterilisationseingriffe nach dem bestehenden Gesetz vorsätzlich vernachlässigt. Ganz davon abgesehen mißachtet das Gesetz insgesamt Menschen mit Behinderung und spricht ihnen ab, erlernen zu können, verantwortungsvoll mit dem Kinderwunsch umgehen zu können.
Ludwig-Otto ROSERs Ideen sind vor diesem Hintergrund tatsächlich nur »schöne Theorien« geblieben. Daran ändert auch nichts, daß nach dem Bericht der Bundesregierung die Zahlen der gemeldeten, von den Vormundschaftgerichten entschiedenen Fälle der Sterilisationen ohne persönliche Einwilligung mit ca. 240 in drei Jahren sehr viel niedriger sind als die vermutete Zahl von 1000 Fällen pro Jahr vor der Gesetzgebung.[12] Zum einen kann auf Grund sich häufender Einzelberichte vermutet werden, daß Personen zunehmend als zustimmungsfähig eingeschätzt werden und die Sterilisationen mit einer herbeigeredeten Zustimmung erfolgen, zum anderen bleiben auch 240 legale Sterilisationen ohne Einwilligung zwangsweise Eingriffe in die persönliche Integrität der Betroffenen.
Ludwig-Otto Rosa« Ideen in einem Entwicklungsland
Ortswechsel. Rumänien 1990. Nach dem Sturz der Ceausescu-Diktatur erreichten erschreckende Bilder aus dem Kinderheim Cighid in Westrumänien Deutschland. Die Bilder zeigten völlig vernachlässigte und dem Tode überlassene Kinder. Etwas mußte geschehen. In einer ersten Spendenaktion, die von den Zeitschriften Spiegel und Stern initiiert wurde, kam soviel Geld zusammen, daß das Kinderheim Cighid baulich saniert werden konnte und mit dem Rest des Geldes ein Programm der pädagogischen Beratung und Ausbildung für die Mitarbeiter des Kinderheimes organisiert werden konnte.[13]
Cighid war damals Endstation für alle die Kinder, die eine kinderärztliche Kommission auf Distriktsebene als nicht rehabilitierbar ausgemustert hatte, als nicht heilbar, als »incurabil«, wie es in Rumänien hieß. Die Sterblichkeit betrug 50% im Jahr. Durch die reichliche deutsche Hilfe änderten sich die Verhältnisse in Cighid recht schnell. Unsere Mitarbeiter vor Ort wurden deshalb bald mit einem anderen Problem konfrontiert: da die Kinder jetzt nicht mehr starben, die ärztliche Selektion in den Waisenhäusern und Kinderkrankenhäusern aber nachwievor weiterlief und Cighid drohte, überfüllt zu werden, wurden vor ihren Augen die älteren Kinder in eine entfernt gelegene Erwachsenen-Psychiatrie verschoben. Diese erwies sich als ein Elendsquartier unvorstellbaren Ausmaßes mit 400 völlig ausgemergelten und verwahrlosten Patienten. Unweigerlich stellten sich KZ-Assoziationen ein. Die Sterblichkeit in Nucet betrug 25% im Jahr. Ein Kinderheim wie Cighid und ein Psychiatrisches Krankenhaus wie Nucet gab es in fast jedem der 40 Distrikte Rumäniens. Es war ein System der »Euthanasìe durch die Verhältnisse«. Als wir in Nucet anfingen, sagte ein Arzt wegwerfend und in völligem Unverständnis, was wir »reichen« Deutschen denn in der rumänischen Provinz wollten, die Patienten von Nucet seien doch nur »zarzavat« (Gemüse).
Wie konnte in dieser Situation ein Ansatz, wie er von Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER vertreten wird, Bestand haben?
Es war klar, daß ein Hilfeprogramm aus Kapazitätsgründen regional begrenzt sein mußte, ansonsten aber das gesamte System der Heime, Krankenhäuser und Verwaltungen und ihrer jeweiligen Angestellten umfassen mußte, die an der Selektion und Verschiebung beteiligt waren. Die Sanierung eines einzelnen Heimes konnte keine wirkliche Veränderung bringen. Den Erfahrungen der italienischen Psychiatrie-Reform folgend, setzten wir am »nucleo duro«, dem harten Kern der Aussonderung an, konzentrierten unsere direkte Hilfe auf Nucet und den Aufbau ambulanter Hilfestrukturen und bauten die Zusammenarbeit mit allen Entscheidungsebenen des Distriktes aus. Natürlich konnte nicht die Auflösung der Asyle auf der Tagesordnung stehen, sondern erstmal die Sicherung des Überlebens und die Humanisierung der Anstalten. Von Integration konnte zu diesem Zeitpunkt nicht die Rede sein. Die Bürger von Nucet warfen zu diesem Zeitpunkt noch mit Steinen nach den Patienten, wenn sie außerhalb des Krankenhausgeländes gesehen wurden.
Baumaßnahmen, Spendentransporte, Mitarbeit auf den Stationen, Schulung des Personals und Beratung der Leitungen und Verwaltungen gingen Hand in Hand. Das Umdenken der Beschäftigten, das Mitmachen bei der Entwicklung eines völlig neuen Umgangs mit den Patienten und die enormen Fortschritte für die »vergessenen Menschen von Nucet«, wie wir die Patienten nannten, waren das Faszinierende an diesem Projekt.
Der Leitgedanke in unseren Ausbildungsprogrammen vor Ort, in den Beratungssitzungen und Deutschlandbesuchen unserer Projektpartner war das Normalisierungsprinzip. Behandle die Menschen mit Behinderung so, wie Du selbst behandelt werden willst und gib ihnen die Lebensbedingungen, die auch sonst die Menschen in der Gesellschaft haben. Dieser Imperativ des Normalisierungsprinzips hatte, wie zwei Jahrzehnte vorher in den westeuropäischen Staaten auch in Rumänien eine ungeheure Reformkraft.
Ich habe in Rumänien erfahren, daß Menschen durch Hunger, Nicht-Behandlung von Krankheiten und menschliche Mißachtung und Vernachlässigung so kaputt gemacht werden können, daß sie den abwertenden und zynischen Prognosen ihrer ärztlichen und pflegerischen Peiniger nahekommen und diese ihren Fatalismus, das jedes Engagement umsonst sei, bestärken können. Dies ist wie eine unausweichliche Spirale nach unten. Ich habe aber auch erlebt, daß sich diese Spirale nach oben wenden läßt. Die Elendsgestalten von Nucet haben sich nach und nach wieder zu Menschen mit Namen und Gesichtern entwickelt, zu Personen, mit denen sich die ehemals auch völlig abgestumpften Mitarbeiter auseinandersetzen konnten, bei denen sie Erfolge sehen konnten, sich freuen konnten und wieder anfingen, engagierter zu arbeiten.
Es gab auch Rückschläge: der Grundgedanke, im Menschen mit Behinderung in erster Linie den Mitmenschen zu sehen und nicht den Patienten, geriet angesichts jahrzehntelanger anderer Beeinflussung immer wieder ins Hintertreffen. Im Stalinismus galt, der Mensch ist Arbeit und wenn er nicht arbeitet, ist er nichts wert. In der vorherrschenden Psychiatrie Rumäniens galt, der Mensch ist sein Gehirn. Wenn dies nicht regelhaft funktioniert, ist er nichts mehr wert. Es kann deshalb nicht verwundern, daß das Normalisierungsgebot nach Arbeit von unseren Projektpartnern immer wieder in folgender Weise mißverstanden wurde und wird: Arbeit für die, die arbeiten können. Therapie, für die die therapierbar sind. Nichts für die, die unheilbar sind. Immer wieder droht somit, daß nach der Beseitigung der größten Not in den Institutionen, altes medizinisches Denken und die damit verbundenen Machtstrukturen wieder in Gang gesetzt werden und sich die Spezialisten wieder der Krankheit und der Kranken bemächtigten.
In dieser Situation waren Ludwig-Otto ROSERs Gedanken zur »Medizin der Gesundheit« sehr hilfreich, weil sie die Kompetenz des Individuums in den Mittelpunkt stellen. Das Normalisierungsprinzip alleine erwies sich für den Neubeginn in Rumänien als zu kurz und zu leicht vereinnahmbar von alten Denkweisen. Es bedurfte der Ergänzung, um die innerprofessionelle Kritik am Defektdenken und der Verbesserungsneigung der Medizin und der Thematisierung einer individualisierten, Potentiale unterstützenden Grundhaltung. Es gibt keine »untere Grenze« für Zuwendung, Entwicklungsmöglichkeiten und Förderung, - diese wichtige Konsequenz aus der »positiven Semiotik« erscheint mir eine wesentliche Ergänzung des Normalisierungsprinzips. Das Recht auf Anderssein ist umfassend. Letztlich - und das war für unsere ärztlichen Partner sicherlich der schwerste Brocken, ging es um die »neue Bescheidenheit der Medizin«, die einsehen muß, nicht mehr für die gesamte Lebensgestaltung der Menschen in den Anstalten zuständig zu sein.
Ich kann nach sieben Jahren Projektarbeit nicht sagen, daß dieser Prozeß wirklich abgeschlossen ist. Aber das Umdenken des Personals in den Einrichtungen der Region und den Verwaltungen und selbst der Bürger in Nucet ist weit vorangekommen. Schritte, wie die innere Differenzierung der Stationen sind heute ebenso erreicht, wie die Einführung von Werkstätten, Arbeitstherapie und Beschäftigungstherapie. Gelungen sind auch der Bau eines Rehabilitationshauses in der Ortschaft Nucet für 16 ehemalige Langzeit-Patienten, die Einrichtung eines Zentrums für ambulante Familienhilfe in der Distriktshauptstadt Oradea und der Bau eines Selbsthilfezentrums für psychisch Kranke und ihre Angehörigen.
Bedroht sind diese Entwicklungen in Rumänien natürlich stets von der immer größer werdenden wirtschaftlichen Katastrophe, die eine Gesellschaft ohne Tradition bürgerlicher Werte schnell wieder zur Abschaffung von Errungenschaften wie Fürsorge für die Schwachen, Akzeptanz von Menschen mit Behinderung als Mitbürger und gerade beginnender Integration bringen könnte.
Bedrohung durch Biomedizin und Bioethik
Zurück nach Deutschland. Die Bedrohung der erreichten Schritte zur Gleichbehandlung, Toleranz und Integration sind bei uns nicht nur auch spürbar, sondern nach meiner Wahrnehmung viel umfassender. Die bioethischen Diskurse über den rechtlosen Status von Menschen mit Behinderung als Menschen ohne Personeigenschaften haben mit SINGER, KUHSE und HOERSTER[14] die Grenze des Erträglichen schon vor Jahren überschritten. Dies mag man angesichts der in Deutschland starken und wachen Kritikbewegung noch etwas beiseite schieben, obwohl die Geschichte lehrt, daß keine Ausgrenzungstheorie davor gewahrt ist, mal die Grundlage für Handeln zu werden. Den sprachlichen Todesurteilen der »Euthanasie«-Autoren der 20er Jahre gegenüber Menschen mit Behinderungen und unheilbaren Krankheiten folgten die tatsächlichen Massenmorde der 40er Jahre an Anstaltsinsassen.
Hervorheben möchte ich hier die Artikel 17.2 und 20 der Bioethik-Konvention des Europarates.[15] In dem einen wird die fremdnützige Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen erlaubt, wenn dies nicht gegen, sondern ohne ihren Willen stattfindet (das Modell der deutschen Sterilisationsgesetzgebung hat hier Pate gestanden) und im anderen wird die Gewebeentnahme bei nicht einwilligungsfähigen Personen erlaubt. Beides sind tiefe Eingriffe in den bisher unumstößlich bestehenden grundgesetzlichen Schutz von Menschen mit Behinderungen. Medizinische Versuche ohne persönlichen Nutzen für die Betroffenen dürfen nur bei Menschen durchgeführt werden, die hierzu frei und informiert zustimmen. Menschen, die nicht einwilligen können, sind vor solchen Zugriffen bisher eindeutig geschützt. Trotzdem werden beide Einschnitte von einflußreichen Teilen unserer Gesellschaft für legitim angesehen und bald wahrscheinlich legal werden.
Ludwig-Otto ROSER zitierte vorzugsweise Renata GADDINI, die unter »abuso« nicht nur physische Gewalt verstand, sondern auch »unwillentlich fortdauernde Situationen, die aktiv oder passiv von Einzelnen oder von Institutionen ausgehen, von denen das Individuum, das noch nicht die Kraft besitzt, seine Rechte geltend zu machen, überrannt wird.«[16] Ludwig-Otto ROSER bezog damals diese Definition auf das System der Rehabilitation. Wird die Bioethik-Konvention Realität, müssen wir diese Definition auf die gesamte Medizin beziehen, die ihre Forschung auf uneingewilligte Medizinexperimente an wehrlosen Menschen aufbaut.
Ludwig-Otto ROSERS Gedanken zur Beendigung von Sonderbehandlung und Aussonderung sind angesichts der erneuten Bedrohungen der Rechte von Menschen mit Behinderungen eine weiter bestehende Herausforderung. Die Überwindung des Defektdenkens mag innerhalb der Behindertenhilfe ein Standard geworden sein. Die Anerkennung der Menschen mit Behinderung als Subjekte muß weiterhin ein großes Zukunftsthema innerhalb der Behindertenhilfe sein. Beides ist aber bedroht, wenn gesamtgesellschaftlich bioethisches Verfügungsdenken gegenüber Menschen mit Behinderungen um sich greift. Tun wir etwas dafür, damit Ludwig-Otto ROSERS Denkanstöße nicht wieder ferne »schöne Theorien« werden.
[11] vgl. PIXA-KETTNER, U. et al., »Dann waren sie sauer auf mich, daß ich das Kind haben wollte...«, Untersuchung zur Lebenssituation geistigbehinderter Menschen mit Kindern in der BRD, Bd.75 der Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Baden-Baden 1996
[12] Bundestagsdrucksache 13-3822
[13] Es handelt sich hier um das »Projekt Rumänienhilfe der Evangelischen Stiftung Alsterdorf«, das ich geleitet habe. 1990-1992 Durchführung des Programms pädagogische Beratung und Ausbildung der Mitarbeiter (Die Bausanierung Cighids wurde von anderen Hilfsorganisationen organisiert). Ab 1991 bis 1996 Ausweitung der Projektarbeit auf den gesamten Distrikt Bihor/Oradea.
[14] vgl. Singer, P., Kuhse, H.: Muß dieses Kind am Leben bleiben? Erlangen 1993 und HOER¬STER, N., Neugeborene und das Recht auf Leben, Frankfurt 1995
[15] Der genaue Titel ist: Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin, (November 1996), früher: Bioethik-Konvention, wurde mit Rücksicht auf die Kritik umbenannt.
[16] zit. nach Ludwig-Otto ROSER, Adriano MILANI-COMPARETTI: Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation, in: WUNDER, M., SIERCK, U. (Hg.) Sie nennen es Fürsorge, Frankfurt 1987, Seite 78
Wer hat Angst vorm behinderten Schüler? Gemeinsam Leben und Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten in Italien[17] - Ludwig-Otto Roser
Don Lorenzo MILANI, Pfarrer und Lehrer von Barbiana, schrieb 1963 in einem Brief an seine Mutter: »Ich habe Dr. Ludwig-Otto ROSER gebeten, mir etwas über Marcello zu sagen; er hält ihn für ein schwer geistig behindertes Kind. Aber ich habe ihm zu verstehen gegeben, daß er keine Ahnung hat: Marcello hat seine Intelligenz und kann vieles tun.« Don Lorenzo MILANI entschied damals, keine solche Diagnose zu akzeptieren und sich selbst um Marcello in besonderer Weise zu kümmern. Adriano MILANI-COMPARETTI rehabilitierte auf seine Weise dieses schwerbehinderte Kind. Um Erfolg zu haben, war es unerläßlich, das Kind in einer Umwelt voller Verständnis und Gefühl leben zu lassen. Adriano MILANI-COMPARETTl erreichte, daß Marcello zu sprechen begann.
Als Freunde und Bekannte von Don Lorenzo MILAN! fuhren wir anfangs der 60er Jahre oft nach Barbiana, einem kleinen Ort im toskanischen Apennin, wohin der florentinische Klerus den ungehorsamen Priester strafversetzt hatte. In Barbiana hatte Don Lorenzo MILANI, der Bruder Prof. Adriano MILANI-COMPARETTIS, die Jungen aus den entferntesten Gebirgsbehausungen an seine Schule in Barbiana geholt.
Zum ersten Mal stellte Don Lorenzo MILANI in einer dieser Begegnungen mit seinen »Schülern« meinen Beruf und mein Handeln in Frage. Das Motto der Schule war: »Nehmt nichts hin, worüber ihr nicht selber nachgedacht habt!« Dies galt auch gegenüber den Grundsätzen der Wissenschaft, die zum Instrument der Aussonderung und der Selektion geworden waren. Die Kritik Don Lorenzo MILANI an meiner fachlichen Begutachtung im Fall des kleinen Marcello hatte damals Ärger, Mißmut und Enttäuschung in mir aufkommen lassen. Ich war noch überzeugt, daß, ein Kind »einzustufen«, diesem selbst nützlich sein müßte; denn nur so ließ sich ja die Rehabilitation ansetzen!
Sondereinrichtungen in Italien erst seit 20 Jahren
Gerade hatte man in Italien begonnen, für behinderte Kinder Sondereinrichtungen aufzubauen. Am Ende der 50er Jahre begannen Tageszentren, Institute und Sonderschulen aus dem Boden zu schießen. 1956 arbeitete ich an der Seite von Don Lorenzo MILANIS Bruder, Adriano MILANI-COMPARETTI, der in Florenz das erste Zentrum für Körperbehinderte aufbaute; 1962 habe ich in Mailand am Ausbau eines der größten italienischen sogenannten »medizinisch-pädagogischen« Institute mitgearbeitet (eine Stadt der Behinderten, mit Sportplätzen, Kinos, Schulen und Werkstätten, in die das reiche Mailand, ohne Rücksicht auf Kosten, die Leistungsschwachen umgesiedelt hatte).
In den 60er Jahren gab es allein in Florenz (500.000 Einwohner) ein Tageszentrum für Hörbehinderte, drei Tages- und Daueraufenthaltszentren für Körperbehinderte, drei Internate mit angeschlossener Tagesstätte für geistig behinderte Kinder und Jugendliche, eine Institution für Schwerstbehinderte, Hilfsklassen an fast allen Elementarschulen, ein Zentrum für autistische Kinder und mindestens fünf Heime für Sozialgefährdete.
Manche dieser Einrichtungen wurden gegen Ende der 50er Jahre als unzureichend empfunden, insofern, als sie in den seltensten Fällen im sonderpädagogischen Sinne förderten: Die Hörbehinderten lernten nur, miteinander auszukommen; die Blinden wurden in ihrer Schrift und für ihre zukünftigen Berufsmöglichkeiten unterrichtet; die geistig Behinderten wurden isoliert und beschäftigt, wie es dem Denken des »normalen« Bürgers entsprach. Aus dieser Situation heraus entstand die Vorstellung, daß dem Behinderten sehr viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden müßte, wollte man ihn eines Tages in den Produktionsprozeß der Gesellschaft eingliedern. Spezielles Fördern bedeutete dann sehr bald, mit allen Kräften die Defekte und die fehlenden Funktionen in den Mittelpunkt zu stellen, für jede Behinderung besonderes Personal zu schulen, um sich immer spezifischere Anregungen und Übungen auszudenken.
Schon 1964 leitete ich zusammen mit Prof. Adriano MILANI-COMPARETTI einen Kindergarten und eine Elementarschule für Körperbehinderte, die von einem privaten Betreuungsverein der Stadt Florenz eröffnet worden waren. Was ein wie auch immer behindertes Kind nicht durch sein natürliches Wachstum erreichen konnte, sollte durch eine intensive Behandlung, besonderes Spielzeug, besondere Geräte erreicht werden, vor allem mit viel Therapie, viel Üben und mit ständiger Betreuung in einer Umwelt, die möglichst auf die Art der Behinderung abgestimmt war. Die Diagnose und die Qantifizierung des Defizits, mit der sich vor allem der Psychologe unentbehrlich machte, wurden die Voraussetzungen dafür, homogene Arbeitsgruppen aufzustellen, in denen sich die einzelnen »Reparaturmaßnahmen« besser ansetzen ließen. Wer hätte damals in dieser rationalen, fachlich immer differenzierteren Arbeitsweise Adriano MILANI-COMPARETTIS emotional vorgetragene Idee von einer Rehabilitation durch die soziale Umwelt ernst nehmen können? Und das um so weniger, als die Erfolge auf der Hand zu liegen schienen: Übung und ständige Stimulation, sanfter Druck und der Wettkampf der Behinderten untereinander förderten vor allem jene Kinder, die eine Frühbehandlung verpaßt hatten, weil sie damals noch nicht in ihrer Bedeutung erkannt worden war. Man zeigte den Eltern, wie sie zu Hause die Bombardierung fortsetzen konnten. Das Wort »Therapie« wurde großgeschrieben, und dementsprechend erklang der Ruf nach mehr Räumen, nach schöneren Zentren mit mehr Personal, möglichst im Grünen weit vor der Stadt, wo die gute Luft zur Gesundung mit beitragen konnte.
Impulse der »Demokratischen Psychiatrie«
Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung - aber schon in der Zeit, in der es klar wurde, daß dieses Bemühen nur zur Integration in das Zentrum der nächsthöheren Altersstufe führen konnte -, am Ende der 60er Jahre, wird ein Name bekannt, der bald in aller Munde ist: Franco BASAGLIA.
Wie war es in dieser optimistischen Situation möglich, daß innerhalb eines Jahres die Kritik an den Sondereinrichtungen und ihren Trägern so stark Fuß fassen konnte? Und wie kam es nicht nur zur Auflösung vieler sektorieller Rehabilitationszentren, sondern sogar zu einer gesetzlichen Abschaffung der Sonderschule als solcher? Das Gelingen einer solchen Umwälzung ist gewiß verschiedenen Faktoren zu verdanken. Bei anderer Gelegenheit habe ich die 68er Bewegung mit zu den möglichen Ursachen gezählt, aber sicher gehört sie nicht zu den entscheidenden Elementen, denn in den Ländern, in denen diese Bewegung besonders zum Ausdruck kam, wie z. B. in Frankreich, ist von Integration der Behinderten so gut wie gar nicht die Rede.
Einen großen Anteil haben zweifellos die Ideen der Psychiatriereform, die 1978 sogar zum Stop der Neuzugänge in die Nervenheilanstalten geführt hat. Sie stellte den Begriff der »emarginazione«, die Tatsache der an den Rand gedrängten Menschen, in den Vordergrund. In diesem Sinne hatte schon Don Lorenzo MILANI gehandelt; in diesem Sinne begann aber auch um 1970 sein Bruder Adriano MILANI-COMPARETTI als Neurologe und Kinderarzt Sondereinrichtungen und Therapie in Frage zu stellen. Noch stärker wirkte aber das Wissen darum, daß jede Sondereinrichtung isoliert und, daß Integration sehr wohl therapeutische Resultate zeitigt.
Erste Erfolge der Nichtaussonderung
Die Erfolge der Nichtaussonderung wurden nach den ersten, schüchternen Integrationsversuchen deutlich sichtbar, und zwar nicht nur im subjektiven Wohlbefinden des Behinderten selbst und in der Erschließung seiner Fähigkeiten innerhalb der normalen Umwelt, sondern auch für fast alle, die beteiligt waren: Angehörige, Lehrer, Pflegepersonal und Fachkräfte.
Trotz eines starken Widerstandes, über den ich gleich sprechen werde, hat sich die Integration weiterentwickelt: Wurden zunächst spezielle Zentren aufgelöst, so wurde schließlich die Aufnahme aller behinderten Kinder in die städtischen und staatlichen Kinderkrippen und Kindergärten sowie in die vom 6. bis 14. Lebensjahr dauernde Pflichtschule gesetzlich geregelt. Als feststehende Resultate können heute die großen Umwälzungen im Schulwesen gelten, wie z.B. die Abschaffung der Ziffer-Noten in der Pflichtschule, die Reduzierung der Klassenstärke, die Flexibilität in der Leistungserwartung und die immer stärkere Suche nach Programmen für einen kindgerechten Unterricht.
Angst vor Integration
Die beobachteten Widerstände entsprechen nicht nur einer konservativen Denkweise, sondern einer allgemeinen Einstellung, der verschiedene Erscheinungsweisen der Angst zugrunde zu liegen scheinen. Es ist vielleicht aufschlußreich, die Entwicklung der Integration behinderter Kinder und Erwachsener anhand der verschiedenen Formen des Widerstandes und der Angst zu beleuchten, so wie sie in Italien in Erscheinung getreten sind. Zunächst waren es die Scheu vor dem sogenannten Anormalen, die Angst vor unbekannten Reaktionen der Behinderten und dem Unberechenbaren, die Furcht zu berühren und nicht kompetent zuzufassen, die Scheu vor dem Unästhetischen, die einen meist markierten Widerstand hervorriefen, und zwar sowohl beim Lehrpersonal als auch bei den Eltern nichtbehinderter Kinder, niemals jedoch bei den Mitschülern selbst.
Die Eingliederung wurde als »selvaggia«, als wilde, übereilte und gefährdende Maßnahme empfunden. Eltern Nichtbehinderter nahmen ihre Kinder aus der Schule, um sie privat unterzubringen. (Noch heute machen private und auch konfessionelle Schulen Reklame, in dem sie darauf hinweisen, daß bei ihnen keine Behinderten den Unterrichtsverlauf »erschweren«)[18] Lehrer ließen sich versetzen; in vielen Schulen weigerte man sich, behinderte Kinder zur Toilette zu führen, weil es sich dabei um Pflegemaßnahmen handelte, für die sich kein Personal zuständig fühlen wollte. Für viele Erwachsene und Kinder war es der erste Kontakt mit einem spastischen Kind oder mit einer Trisomie 21 oder mit einem geistig gestörten Kind. Weitverbreitet war die Angst vor »Ansteckung«: Viele waren überzeugt, daß die normalen Kinder eher die Verhaltensweisen der Behinderten imitieren würden, als daß die Behinderten sich nach den »Normalen« richteten. Es war die Zeit, in der ein Ausflug des Reha-Zentrums für Körperbehinderte ins öffentliche Schwimmbad besorgte Anrufe und Protestbriefe an die Stadtverwaltung auslöste, mit der Anfrage, ob denn ein solches Zusammensein den Prinzipien der Hygiene entspräche. Hätte man angesichts dieser sehr elementaren Ängste die Alternativen zugelassen, ja oder nein zur Integration zu sagen, dann würde es heute noch die gleichen Sonderschulen geben wie vor zehn Jahren. Insofern war es gerechtfertigt, daß die Anti-Emarginations-Welle über die Furchtsamen hinweggeflossen ist.
Die positiven Resultate liegen auf der Hand: Wie stark auch die Kritik an den menschlichen und fachlichen Aspekten der Integration sein mag, die Behinderten werden nicht mehr als etwas Fremdes und Unheimliches empfunden. Man weiß heute so viel mehr über sie, nicht weil kostspielige Broschüren um Verständnis und Hilfe geworben haben, sondern weil die behinderten Kinder am täglichen Leben aller teilnehmen.
Die Idee der Psychiatrie-Reform und die immer intensivere Diskussion über die Tendenz der Gesellschaft, die Schwächeren auszuschließen (Anfang der 70er Jahre war dieses Thema auch in allen Parteien an der Tagesordnung), die Bereitschaft weiterer Kreise der Bevölkerung, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, haben schließlich eine Ablehnung der Integration behinderter Kinder in der Regelschule unmöglich gemacht, noch bevor die entsprechenden Gesetze verabschiedet wurden. Integration ist also nicht durch ein fachwissenschaftliches Modell zustande gekommen, sondern durch eine aus der Bevölkerung herausgewachsene Bewegung, die zwar rational unterbaut werden konnte und sich sehr bald durch ihre Erfolge selbst stützte, die aber nicht am grünen Tisch ausgearbeitet worden war.
Gerade an diesem Punkt setzte sehr bald die Kritik an: Es entwickelte sich eine Sorge, die sich vor allem am Mangel von ausgebildetem Personal und am Vorhandensein architektonischer Barrieren festmachte, was besonders die behinderten Kinder in der Regelschule betraf. Die Schließung der sektoriell spezialisierten Zentren ließ auch in vielen Angehörigen der Behinderten die Furcht aufkommen, daß die Behandlung des Behinderten, seine funktionelle Rehabilitation, durch die Förderung seiner sozialen Kontakte ersetzt werden könnte. Diese Angst wurde dann auch zur politischen Argumentation: Integration sei ein sozialistisches Steckenpferd, beträfe nur die mitmenschlichen Beziehungen, schade aber dem Behinderten auf anderer Ebene.
Interessanterweise ist als erste diese Angst der Angehörigen verschwunden. Besonders in den ersten Zeiten der Integrationsversuche löste der Kontakt mit der realen Umwelt in den meisten Kindern eine Entwicklung der potentiellen und kompensatorischen Kräfte aus, die die künstliche Welt der Rehabilitationsmaschine überhaupt nicht berührt hatte. Kinder imitieren gerne, was andere Kinder tun, und verstehen sehr oft die Erwartung des Erwachsenen nicht, der sich nur ihren Mängeln zuwendet. Andererseits geben sie sich sehr viel schneller zufrieden, wenn ihnen etwas nicht gelingt; der Erwachsene leidet aber, wenn das Kind sich von den anderen unterscheidet. Er möchte das behinderte Kind sogar vor der Möglichkeit dieses Vergleichs schützen und sich damit selbst dem schmerzlichen Problem entziehen. Die durch die Integration entstandenen Realitäten, haben diese Befürchtungen und Ängste sehr bald aus dem Weg geräumt; denn die Eltern der behinderten Kinder entdeckten, welche rehabilitative Zugkraft im gemeinsamen Lernen und Leben ihrer Kinder mit den sogenannten »Normalen« lag.
Das psychologische Problem entsteht dadurch, daß man durch Behandlung und Therapie das Kind anders haben möchte.
Heute wundert sich niemand mehr, wenn auch ein schwerstbehindertes Kind von vornherein am Leben der anderen teilnimmt. Die Integration selbst mindert also die Furcht vor ungenügender, spezieller Förderung, weil durch das einfache Mittel des Erlebens in der wirklichen Umwelt die Kompensationsmöglichkeiten am besten und ohne Druck, d. h. ohne Behandlung, stimuliert werden.
Angst vor Erneuerung des Schulsystems
Eine andere Angst ist allerdings bis heute noch sehr stark: Die Integration, d. h. die Auflösung des Sonderschulwesens und der Sondereinrichtungen, bedeutet im Endeffekt Erneuerung der Schule, Besinnung über die eigentliche erzieherische Arbeit des Lehrers; bedeutet auch, Rehabilitation im spezifischen Sinne anders, früher und kindgemäßer anzusetzen. Die Angst vor Erneuerung und auch vor der schwierigen Aufgabe läßt sich im Schulbereich recht genau an den Anträgen für eine Stützlehrerin erkennen. In den seltensten Fällen erweist sich die für das behinderte Kind bestimmte Hilfskraft als wirklich notwendig; sehr oft wird durch sie die früher in der Sondereinrichtung praktizierte Isolation weitergeführt. Man spricht aber nun eigentlich, nicht mehr von Integration, sondern man versucht, Isolation und Absonderung von vornherein zu verhindern; diese neue Aufgabe der Rehabilitation, die eng mit der Frühbehandlung verknüpft ist, scheint in letzter Zeit in Italien doch die meisten Fachleute zu überzeugen.
Der Übergang des behinderten Kindes von der Vorschule in die Regelschule ist keine Überraschung und kein besonderer Akt der Integration mehr, sondern erfolgt durch Absprachen, an denen das Personal des Kindergartens, der Schule und des Ambulatoriums teilnehmen sollten. Die Stützlehrerin wird in immer mehr Fällen gemeinsam beantragt, wenn sie wirklich gebraucht wird, so wie auch die pädagogischen und didaktischen Alternativen gemeinsam festgelegt werden. Trotzdem kommt es vor, daß Lehrer oder Lehrerin ein Kind in die Klasse bekommen, ohne von den positiven Aspekten der Integration überzeugt zu sein. Am meisten werden die Verhaltensgestörten gefürchtet, die in das traditionelle Lehrmodell nicht hineinpassen. Gerade der Verhaltensgestörte spürt aber als erster den Mangel an Bereitschaft, den Mangel an Zuwendung und Liebe, durch die die Verhaltensstörung sich ja meistens selbst definiert.
Wo und wann funktioniert Integration behinderter Kinder in der Pflichtschule?
-
In den Schulen, in denen der Schulleiter mehr Gewicht auf seine pädagogische Aufgabe legt und sich nicht hinter seinen bürokratischen Pflichten verschanzt, wie es in Italien leider sehr häufig ist.
-
In den Schulen, in denen die fortschrittlichen Lehrkräfte den Mut haben, Neues zu erproben, wie zum Beispiel Zusammenarbeit mit Klassen verschiedener Altersstufen.
-
Wenn Stützlehrerinnen und Fachkräfte am Gesamtunterricht mitarbeiten und nicht nur als Schutzengel des behinderten Kindes erlebt werden.
-
Wenn Fortbildung und ständige Diskussion erwünscht sind und die eigene Arbeitsweise immer wieder in Frage gestellt wird.
-
Wenn die therapeutische und heilpädagogischen Arbeit in den Vorschulbereich und noch besser in die früheste Kindheit verlegt wird.
Wo diese Voraussetzungen gegeben sind, ist es kein Problem, behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam zu unterrichten. Man kann aber beobachten, daß die Realisierung dieser Voraussetzungen ihre Grenzen nicht oder nur zum Teil in den objektiven Gegebenheiten der Außenwelt hat, sondern ein Problem der »professionalitä«, d. h., der beruflichen Bereitschaft ist. Angst vor der Sonderaufgabe, Angst vor stärkerer Verpflichtung, fachliche Unsicherheit, Bequemlichkeit, Unkenntnis und bürokratische Interpretation der Erziehungsaufgabe sind die wahren Gründe, aus denen heraus manche Lehrer, viele Fachleute auch heute noch in Italien die Schließung der Sondereinrichtungen als einen großen Fehler betrachten. Eine der merkwürdigsten Aspekte der bisher beschriebenen Entwicklung ist, daß dort, wo die Integration der behinderten Kinder nicht Widerstand, sondern berufliches Interesse ausgelöst hat, die Schule sich grundlegend zu verändern beginnt: Sie wird in weitem Maße kindgerechter, und so haben endlich einmal die Behinderten etwas für die sogenannten Normalen getan.
Medizin der Gesundheit - Pädagogik ohne Aussonderung
Voraussetzung dafür, daß sich die Nichtaussonderung weiterentwickelt, ist auch die Früherkennung und Frühbehandlung von Schwierigkeiten. Sie setzt wiederum zwei Einstellungen voraus: Die eine betrifft den Übergang von einer Medizin der Krankheit zu einer Medizin der Gesundheit; die andere stellt die therapeutische Aufgabe der Pädagogik in Frage. In dieser Beziehung war die italienische Gesundheitsreform von entscheidender Bedeutung: Sie widmet der Vorsorge mehr Aufmerksamkeit als dem Aufbau der Institutionen und Maßnahmen, die Krankheiten und Defekte kurieren sollen, die sich hätten vermeiden lassen. Wie aber sollte eine Medizin, eine Psychologie, eine Psychiatrie aussehen, die so beschaffen ist, daß sie sich im Idealfall erübrigt? Beispielhaft sind in dieser Beziehung die in Florenz und anderen italienischen Städten eingerichteten, kostenlosen Kurse zur Schwangerschaftsvorbereitung, die sich eines immer größeren Zulaufs erfreuen, selbst der beteiligten Väter. Die jungen Väter und Mütter haben vor allem erkannt, daß es wichtig ist, die Kurse und Gespräche, an denen auch Kinderärzte und Psychologen teilnehmen, im 1. Lebensjahr des Kindes fortzusetzen - nicht nur, um Schwierigkeiten früh erkennen zu können, sondern auch, um Ängste und Sorgen abzubauen, die sich mit der Ankunft des Neugeborenen entfalten und ebenso ein Risiko für das zukünftige seelische Gleichgewicht darstellen wie die nicht erkannte und nicht behandelte körperliche Dysfunktion.
Die Territorialisierung der Behandlung (jeder Bürger kann eine Antwort auf seine Probleme im unmittelbaren Lebensbereich finden) kommt diesem Versuch einer Medizin der Gesundheit in besonderer Weise entgegen. Neben der Vorsorge sollte die Frühbehandlung immer stärker in das Bewußtsein vor allem der Kinderärzte dringen.
Zu diesem Thema sind in Deutschland die Ausführungen Adriano MILANI-COMPARETTIS am meisten bekannt. Adriano MILANI-COMPARETTI geht davon aus, daß schon die Therapie an sich eine absondernde Wirkung hat und in der defektbetonten Behandlung mehr Schaden anrichtet, als es der Defekt selbst ergeben hätte, vor allem im Selbstgefühl des Betroffenen. Dies liegt daran, würde ich als Psychologe hinzufügen, daß das betroffene Kind in den ersten Lebensjahren gar nicht weiß, was der Erwachsene von ihm will. Es wird vorausgesetzt, daß das Kind die Sorge des Erwachsenen um seine physische und psychische Entwicklung als Liebe empfindet. Behandlung jeder Art geht also meist über die wirklichen Wahrnehmungsmöglichkeiten des Kindes hinweg; sie wird vom Erwachsenen als kleineres Übel empfunden, und das Verständnis des Kindes wird nicht als unerläßlich erachtet. Hier ist die Aussonderung schon im Keim vorhanden; das psychologische Problem entsteht dadurch, daß man durch Behandlung und Therapie das Kind anders haben möchte; das setzt voraus, daß es nicht einfach als Kind, sondern als krankes Kind erlebt wird und im Grunde unsere Erwartungen nie befriedigt.
Es geht also um eine Pädagogik ohne Aussonderung, die einem jeden Individuum dazu verhilft, zu sich selbst zu kommen, wie es auch immer beschaffen sein mag, während die große Mehrheit noch durch die Pädagogik des Vergleichens beeinflußt ist und so riskiert, das zu rehabilitierende »Opfer« in diesem Sinne zu traktieren. Sonderbehandlung ist eben doch immer ein Bedrängen, um des besseren Vergleichens willen, in der verwurzelten Überzeugung, daß man es nicht dem Kinde überlassen kann, wann und zu welchem Ziel es sich spontan entwickelt. Im Grunde hat der Erwachsene kein Vertrauen in den Anpassungs- und Lebenswillen des normalen Kindes, um so weniger in die Kompensationsmöglichkeiten des behinderten Kindes.
[17] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: päd. Extra 10/81, S. 40-44.
[18] Diese anfängliche Praxis wurde eingedämmt, indem die staatlichen Zuschüsse für private Schulen nur dann in vollem Umfang gezahlt werden, wenn die Schule nachweisen kann, daß sie dieselben Anteile von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung aufgenommen hat wie vergleichbare staatliche Schulen. (Anmerkung J. SCHÖLER)
Deutschland 1980: Die große Bildungsoffensive der Studentenbewegung war abgeebbt, die Forderungen nach Gleichheit und demokratischen Strukturen im Bildungswesen hatten ihre Nische in der Gesamtschule gefunden. Sie wurde nicht zur Regelschule für alle Kinder, sondern zur Angebotsschule neben dem traditionellen, gegliederten Schulsystem. Damit befand sie sich in Konkurrenz zu Schulformen, die Kinder nach ihren Voraussetzungen sortierte und in klar umgrenzte Räume verwies, in denen sie in vorgegebenen Zeiteinheiten das Gleiche lernten.
Das Dilemma der Gesamtschule ist bekannt. Nach Innen reproduzierte sie das gegliederte Schulsystem durch das Kurssystem. Nach Außen stellte sie eine Schule dar, die für eine bestimmte Schülerpopulation besonders attraktiv war: für diejenigen, die den Anforderungen in den überkommenen Schulformen nicht gerecht werden konnten oder wollten. Und in der Tat galt die Aufmerksamkeit der Gesamtschulen besonders den Kindern und Jugendlichen, die Lernschwächen aufwiesen. Sie erhielten besondere Förderung mit dem Ziel, ihnen eine erfolgreiche Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Unterricht hieß auch in der Gesamtschule: lernzielgleicher Unterricht.
Der Gedanke, daß Kinder im Klassenverband sinnstiftend miteinander lernen können, ohne das gleiche Lernziel erreichen zu können, wurde in der frühen Phase der Gesamtschulen nirgends realisiert. Auch die Grundschule als Schule für alle Kinder erkannte schon frühzeitig die Heterogenität ihrer Schülerschaft als pädagogische Herausforderung, ließ aber Kinder mit Behinderungen und gravierenden Lernbeeinträchtigungen und Verhaltensproblemen draußen vor. Schließlich gab es doch die Sonderschule, die - wiederum in neun Sparten gegliedert - für diese Kinder zuständig war. Deutschland verfügte über eine sehr lange Tradition der Sonderbeschulung und war gerade dabei, die Schule für geistig Behinderte auszubauen: Zweifellos ein Fortschritt gegenüber einer Zeit, in der Kinder mit geistigen Behinderungen zu Hause oder in Anstalten ohne schulische Förderung blieben.
In der Sonderschule hatten sich schon damals Unterrichtsformen etabliert, die die je spezifische Situation des einzelnen Kindes stärker berücksichtigten als andere Schulformen. Dennoch war sie in die Kritik geraten, weil bildungspolitische und bildungsökonomische Analysen die Randständigkeit der Hilfsschule und ihrer Schülerpopulation thematisiert hatten. Nicht mehr nur der pädagogische Blick auf das einzelne Kind, auf die Kindergruppe bestimmte die Diskussion in der Sonderpädagogik, sondern zunehmend die Bedeutung der Sonderschule im Kontext gesellschaftlicher (Fehl-)Entwicklungen. Erste vorsichtige Überlegungen zur Integration behinderter Kinder waren formuliert worden, so z.B. in den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher.
In dieser Situation erreichte uns ganz unkonventionelle Kunde aus Italien: Psychiatrische Anstalten hatten ihre Tore geöffnet, Zentren für Behinderte entließen ihre Klientel in die Familie und es gab ein Schulgesetz, welches allen Kindern - ohne Ausnahme - den Besuch der allgemeinen Schule ermöglichte.
Für deutsche Ohren klang dieses wie eine Provokation: bedürfen nicht Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen, Problemen des besonderen Schutzes, der besonderen Förderung, der besonderen Behandlung?
Ludwig-Otto ROSER war einer der ersten - für mich der erste -, der uns einführte in ein Denken, welches Abschied nahm von einer Klassifizierung von Menschen entlang ihrer Defizite, die es pädagogisch, psychologisch, medizinisch in den Griff zu nehmen galt. 1980 in einem Vortrag in Frankfurt, 1981 in einem gemeinsamen Rundfunkinterview, 1981 und 1983 zu Besuch in Florenz lernte ich, daß Fremdheit und Anderssein kein Grund ist für Ausschluß und Aussonderung, ja nicht einmal als Störung und Hemmnis begriffen werden muß.
Ludwig-Otto ROSER war deshalb besonders glaubwürdig, weil er selbst die Entwicklung von der geschlossenen Einrichtung zur nichtaussondernden Förderung mitvollzogen hat: gemeinsam mit Adriano MILANI-COMPARETTI öffnete er das Zentrum »Anna Torrigiani« zu einer ambulanten Einrichtung, gemeinsam mit den neu entstandenen USLs baute er einen regionalisierten Beratungsdienst auf, der Frühförderung, Erziehung und Schulausbildung integrierte.
Drei Zitate von Ludwig-Otto ROSER sind mir besonders in Erinnerung geblieben und haben mich auf meinem Weg zur Integration begleitet:
- Bei meinem ersten Besuch in Florenz leitete Ludwig-Otto ROSER seinen Vortrag mit einem Bild ein: »Stellen Sie sich vor, Sie steigen in einen Bus mit lauter schwerbehinderten Menschen. Ist es nicht normal, daß wir erschrecken? Unser Erschrecken gilt der Massivität von Anderssein, von Fremdheit, der wir in der Gesellschaft so nie begegnen. Normal ist es, daß wir einzelnen Menschen mit Behinderungen begegnen.«
Mir prägte sich dieses Bild in doppelter Weise ein: Zum einen thematisierte es unseren höchst persönlichen Umgang mit Behinderung. Und zum zweiten führte es uns die Situation von Menschen mit Behinderungen in Deutschland vor Augen, die durch Aussonderung von der Wiege bis zur Bahre geprägt war - mit der Folge, daß viele von uns diesen Menschen entweder nie begegneten oder ihnen nur mit Erschrecken und Abwehr gegenübertreten konnten.
- 1981 nahmen Ludwig-Otto ROSER und ich gemeinsam an einer Rundfunksendung teil. ROSER hatte gerade einige Behinderteneinrichtungen und Rehabilitationszentren besucht. Auf die Frage des Moderators, welchen Eindruck er gewonnen habe, antwortete er sinngemäß: »Ich bin tief beeindruckt von den baulichen Gegebenheiten und von der technischen Ausstattung: alle Häuser waren behinderungsgerecht ausgestattet und verfügten über gutes und differenziertes Material zur rehabilitativen Förderung. Wir in Italien gehen einen anderen Weg: Unsere Häuser haben selten Rampen und Fahrstühle, das Material ist dürftig - wir stecken alles Geld in die personelle Ausstattung, weil die beste Rehabilitation in der persönlichen Begegnung zwischen Menschen mit Behinderungen und kompetenten Fachleuten besteht.«
Da stießen sie sich wieder, die deutschen und die italienischen Verhältnisse: hier die »goldenen Käfige«, wie Ludwig-Otto ROSER einmal formulierte, dort die sprichwörtliche italienische »Mentalität«, die sich aus Toleranz, Emotionalität und geringer Autoritätsgläubigkeit speist. Zu dieser »Mentalität« gehört es auch, Reformen tatkräftig anzugehen, bevor fertige Konzepte auf dem Tisch liegen. In Deutschland wählen wir eher den umgekehrten Weg: Die Theoriediskussion geht der Praxis voraus, weil (Schul-) Reform sich stets zuerst legitimieren muß.
Befördert wurde mein pädagogisches Umdenken nicht zuletzt durch eine Aussage Ludwig-Otto ROSERS, die er in seinen Vorträgen oftmals wiederholte: »Tüchtig ist nicht, wer mehr leistet als andere, sondern der, der alles das leistet, was potentiell in ihm möglich ist.«
Für mich hieß es endgültig Abschied zu nehmen von einem konkurrenzbestimmten Leistungsbegriff, Abschied zu nehmen auch von einer defizitorientierten Pädagogik und mich statt dessen einzulassen auf eine Pädagogik, die zuallererst fragt, was ein Mensch kann. Ich lernte, größeres Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen zu entwickeln, in die Fähigkeiten der Kinder mit Behinderungen zum Wachsen an und in der Realität ebenso wie in die Fähigkeiten der nichtbehinderten Kinder im Umgang mit eigenen und fremden Stärken und Schwächen. Und ich lernte, daß die Normalität selbst - die Nichtaussonderung - Rehabilitation befördert.
Doch damit nicht genug: Es ging Ludwig-Otto ROSER nicht nur um die allseitige Akzeptanz verschiedenartiger Menschen, sondern um deren potentielle Möglichkeiten. Um diese zu entwickeln, konfrontierte er uns mit einem Therapiekonzept, welches sich nicht länger aus der »Logik« der Institutionen und ihrer Fachleute speiste, sondern aus dem Dialog mit dem Kind, um es innerhalb seiner normalen Tätigkeiten unterstützen und fördern zu können. Hierzu gehört auch ein Überschreiten der Fachgrenzen, das Ludwig-Otto ROSER eindrucksvoll demonstrierte.
Ausgestattet mit den Impulsen aus Florenz führte mich mein Weg in den nächsten Jahren nach Bologna (zwei Exkursionen) und zu einem Forschungsaufenthalt nach Rom, wo ich gemeinsame Erziehung im Spektrum von Akzeptanz bis Ablehnung kennenlernte, gleichsam unter normalen italienischen Bedingungen.
Schließlich trug der »Integrationstourismus« Früchte in Deutschland. In Frankfurt begleitete die »Forschungsstelle Integration« an der Goethe-Universität den von den Eltern erkämpften Weg der gemeinsamen Erziehung vom Kindergarten über die Grundschule bis in außerschulische Formen des Zusammenlebens. Unser wissenschaftliches Interesse galt den Modellversuchen in Hessen ebenso wie der Ausbreitung des gemeinsamen Unterrichts in der Fläche. In unserem größten Projekt beobachteten wir die Entwicklung von Kindern mit und ohne Behinderung sowie die Gestaltung des Unterrichts in den Klassen 1 bis 4 in mehreren hessischen Grundschulen, stets in Rückkoppelung mit den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern.
Kennzeichnend für das erste Jahrzehnt der Integration in der BRD waren enge Diskussionszusammenhänge zwischen den wissenschaftlichen Begleitungen in verschiedenen Bundesländern, die aufgrund der föderalen Struktur verschieden akzentuierte Wege der Integration beschritten. Hier bewährte sich die deutsche »Tugend« gründlicher Planung und Konzeptionalisierung für die Praxis, die bis heute andauert.
Gegenwärtig verfügen die Eltern in Hessen über weitreichende Rechte, ihre Kinder mit Behinderungen in allgemeinen Schulen anzumelden. Im Schuljahr 1997/98 besuchten 1587 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf die Grundschule, 581 Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe 1. Unter letzteren waren 371 lernhilfebedürftige und praktisch bildbare Schülerinnen und Schüler, die lernzieldifferent unterrichtet werden. 470 Grundschulen und 151 Sekundarstufenschulen bieten gemeinsamen Unterricht an. Für jedes Kind mit Förderbedarf stehen fünf bis zehn Sonderschullehrer(innen)stunden zur Verfügung. Diese Zahlen signalisieren eine Normalisierung der Integration.
Nichtaussonderung stellt jedoch noch ein Fernziel dar, denn noch immer besuchen ca. 90 % aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Sonderschule. So wie die Gesamtschule sich als Angebotsschule neben dem gegliederten Schulsystem behaupten muß, so stehen Sonderschule und gemeinsamer Unterricht im Wettbewerb miteinander. Die Zahl der Eltern, die ihre Kinder in die Regelschule schicken möchten, übersteigt indessen bei weitem die vorhandenen Möglichkeiten. Immer wieder müssen wir konstatieren, daß Schulreform in Deutschland vorzugsweise in Kompromissen endet, weil konservative Politikgestaltung und neoliberale Rahmenbedingungen den großen Entwurf verhindern.
Ludwig-Otto ROSER, Adriano MILANI-COMPARETTI, Andrea CANEVARO, Nicola Cuomo und viele andere waren Wegbereiter und Wegbegleiter der Integration in Deutschland. Sie haben uns immer wieder ermutigt im Sinne ROSERS, der 1987 schrieb: »Integration ist Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden Welt.«
Hilfe für Behinderte in der Gemeinde - Ursache oder Folge der Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen?[19] - Ludwig-Otto Roser
Die Betreuung und Behandlung Behinderter in ihrer sozialen Umwelt, wie sie in Italien in den letzten fünfzehn Jahren von den verschiedensten Seiten her vorgeschlagen wird, ist weder Ursache noch Folge der Auflösung von Heimen und Sonderschulen. Den Anstoß zu dieser neuen Arbeitsweise und zu einer neuen Einstellung haben Überlegungen gegeben, die Begriffe wie »Krankheit« und »Gesundheit«, zunächst unabhängig von den existierenden Einrichtungen und den bestehenden Betreuungsgewohnheiten, in ein neues Licht gerückt haben. Am Anfang dieser Entwicklung standen die Fragen: Wie entsteht Behinderung, was ist Normalität, wie kommt es zur Geistes-»krankheit«, welche Gegebenheiten menschlichen Zusammenlebens lassen Krankheiten und Behinderungen entstehen? Und vor allem: »Rehabiliert« Rehabilitation wirklich? Welches sind die Situationen, in denen Behinderung überwunden wird? Oder auch: Muß man mehr Gewicht legen auf die Medizin der Krankheit (Behandlung) oder auf die Medizin der Gesundheit (Verhütung)? Ist Behinderung als Krankheit anzugehen, kann man sie wegerziehen, oder liegt vielmehr das Hauptgewicht ihrer Problematik im Bereich der mitmenschlichen Beziehungen?
Beispiel: Psychiatriereform
Am Beispiel der italienischen Psychiatriereform ist zu sehen, daß Betreuung Behinderter in der Gemeinde zwar vom Gesetz her als eine Folge der Schließung der Nervenheilanstalten erscheint, in Wirklichkeit aber ein Ziel darstellt. Die italienischen und ausländischen Kritiker der Psychiatriereform stellen in der Tat fest, daß die vom Gesetz bestimmte Betreuung des geistig oder seelisch Kranken in vielen italienischen Regionen im Argen liegt. Der Vorwurf, nicht schon vor der Schließung der Anstalten und Institutionen für Alternativen gesorgt zu haben, ist auch in dem Widerstand enthalten gewesen, der die Schließung der Sondereinrichtungen für behinderte Kinder und ihrer Eingliederung in die Regelschule entgegengesetzt wurde. So klagte man über den Mangel geeigneter Schulräume, über das Fehlen von Stützlehrern, über die nicht erfolgte Vorbereitung des Personals usw. Man beachtete aber dabei nicht, daß Veränderungen nur zustande kommen, wenn die Idee, die ihnen zugrunde liegt, eine breite Bevölkerungsschicht erfaßt hat (so wäre es in den fünfziger Jahren nicht zur Errichtung von Rehabilitationszentren gekommen, wenn die vielen Geldaktionen nicht dafür das Klima geschaffen und das Problem zur allgemeinen Diskussion gebracht hätten). Deshalb kann man sagen, daß sich in Italien nur wenige mit den Geisteskranken und mit den seelischen Problemen des gemeinsamen Lebens und Arbeitens befaßt hätten, wenn die Tore der Anstalten verschlossen geblieben wären. Denn die Logik der Absonderung dieser Behinderten war ja die Angst vor ihnen, und ihre Isolierung in Stätten angeblicher Heilung erschien der einzige Weg. Deshalb hat die oft unüberlegte, fast gewaltsame Integration behinderter Kinder in die Regelschule zu Beginn der 70er Jahre mehr pädagogische Reflexion in Bewegung gesetzt als alle Schulreformen zusammengenommen. Heute kann man beobachten, wie die Faktoren, die zu seelischer und geistiger Erkrankung führen, von einer breiten Bevölkerungsschicht erkannt und diskutiert werden (man sprach in diesem Zusammenhang sogar von einer Gefahr zu starker Psychiatrisierung des politischen und sozialen Lebens).
Integration durch Konfrontation
Die Erkenntnis, daß Sonderschulen im Grunde deshalb bestehen, weil Behinderung die »Gesunden« stört, daß Rehabilitation zum Alibi der Aussonderung werden kann, daß die Nerven-»heil«-anstalten alles andere tun als heilen, daß, je perfekter eine sonderschulische oder betreuende Einrichtung ist, der Bürger desto ruhiger schlafen kann, daß das Normdenken ständig die mitmenschlichen Beziehungen behindert, diese Erkenntnisse lassen sich nicht verwaltungstechnisch programmieren. Gemeindenahe Versorgung Behinderter läßt sich nur verwirklichen, wenn die Gemeinde und möglichst alle Bürger in ihr, direkt mit den Problemen in Berührung kommen und ihre Lösung nicht an die Institutionen delegieren, die dazu die fachliche Kompetenz haben. Sonst entstehen, statt der großen, möglichst außerhalb der Stadt, im gesunden Grün liegende Anstalten und Rehazentren, viele kleine, scheinbar gemeindenahe Ambulatorien und Tagesaufenthaltszentren, um die ein Bogen zu machen nur etwas schwieriger wird. Um aber den Bürger teilnehmen zu lassen, müssen diese Probleme diskutiert werden, muß der Widerstand zutage treten; d. h. die eigentlichen Gründe des Isolierens, die sich hinter dem Wort »heilen« oder »rehabilitieren« verstecken, müssen bei ihrem wahren Namen genannt werden. Eine solche Diskussion und die Verarbeitung dieser Probleme dauert Jahrzehnte; auf der anderen Seite bemerkt man heute in Italien, daß gerade die Gegenargumente und die Widerstände dazu beigetragen haben, Schwierigkeiten zu erkennen und zu über-winden. Noch einschneidender für die augenblickliche Entwicklung ist aber der direkte Kontakt mit den Behinderten von seiten der Lehrer, der Eltern nichtbehinderter Kinder und der Bevölkerung im allgemeinen. Von dieser Bewußtwerdung, von der Wahrnehmung der eigentlichen Probleme des Behinderten, bis zur korrekten und vollständigen, gemeindenahen Betreuung aller Menschen, die Hilfe brauchen, ist aber noch ein weiter Weg.
Zusammenarbeit der Institutionen
Wenn auch das gemeinsame Leben und Lernen mit einem Schwerbehinderten Kind in der Schule selbstverständlich zu werden beginnt, so ist es weitaus schwieriger, zum Beispiel geistig gestörte Menschen in ihrem allernächsten Lebensbereich zu betreuen. Wie sieht das nun praktisch aus (dort wo es funktioniert; und das ist lange noch nicht überall)? Während früher z.B. ein geistig gestörtes Kind (fast immer erst im Augenblick seiner Einschulung als solches erkannt) in ein für geistig behinderte Kinder bestimmtes Rehabilitationszentrum mit Sonderschule kam, um schließlich in einer geschützten Werkstatt zu enden, während dieses Kind von einem fachspezifischen Rehabilitationsteam in einem oft weitabliegenden Zentrum versorgt wurde und somit auch kaum mit den Menschen seines Lebensbereiches in Kontakt kam, wird heute zunächst dafür gesorgt, daß es so früh wie nur möglich von seiner Familie und von den Menschen, die es pflegen, verstanden wird. Geistige Schwierigkeiten potenzieren sich in der durch den Behandlungsdruck und durch defekt-betontes Handeln gestörten Interaktion. Die Gefühlsbindung wird durch das Reparaturbedürfnis bestimmt. Dies zu verhindern, bedarf es nicht nur einer intensiven Elternarbeit in den schon erkannten Fällen, sondern einer breitangelegten Information über die Effekte erzieherischen Verhaltens. Die Gelegenheit dazu bietet sich z.B. in den Kursen für Schwangerschaftsvorbereitung der Ambulatorien, die nicht nur eine Angelegenheit der werdenden Mütter, sondern auch der werdenden Väter sind. Schon hier, in der Diskussion eines normalen, möglicherweise aber auch nicht normalen Prozesses wird Information über die Eigenarten menschlichen Verhaltens über körperliche und seelische Gesundheit gegeben. Ein in dieser Hinsicht vertrauenserweckendes Gespräch kann auch nach der Geburt des Kindes fortgesetzt werden, denn wieviel neue Probleme entfacht der Neuankömmling im bewußten und unbewußten Miteinanderleben!
Hilfe in der Gemeinde ...
Die Früherkennung von Behinderung kann auch in dem pädiatrischen Dienstleistungsambulatorium erfolgen, das mit den zuständigen, pädopsychiatrischen, psychologischen, rehabilitativen Institutionen des Wohnbereiches in Verbindung steht. Eventuelle Behandlung erfolgt also im Distrikt (kleinste Einheit der Unitä Sanitaria Locale: etwa 20.000 Einwohner) und zwar sowohl für das betroffene Kind als auch für die Angehörigen, damit die Mitarbeit so ausgewogen wie nur möglich wird. Bei festgestellter Behinderung wird also nicht nur lange vor der Einschulung Behandlung angesetzt, sondern die konkrete Verarbeitung des Problems in der Familie und frühzeitiges Zusammenleben mit nichtbehinderten Kindern wird als Behandlung betrachtet. Daher der Ausbau der Kleinstkinderkrippen (in Florenz hat fast jeder Distrikt eine Kinderkrippe), die nicht als Depot für Kinder arbeitender Mütter, sondern als erste Stufe gemeinsamen Lebens und Lernens betrachtet werden sollte. Hier können nicht nur die individuellen Bedürfnisse des betroffenen Kindes mit dem Personal der Kinderkrippe, den Fachleuten der einzelnen Reha-Ambulatorien und den Eltern besprochen werden, sondern hier haben die Eltern des Kindes auch Gelegenheit, mit anderen Eltern die allgemeinen Probleme der Erziehung und des kindlichen Verhaltens zu erörtern.
... und in der Schule
Von hier aus geht es selbstverständlich mit drei Jahren in den Kindergarten und das behinderte Kind, sei es körperbehindert, hörbehindert oder blind, geistigbehindert oder seelisch gestört, wächst weiter mit den Kindern seines Wohnbereiches auf, mit denen es eines Tages auch zur Schule gebracht wird. Behandlung wird so in den Vormittag eingebaut, daß alle daran teilnehmen können.
Die Anwesenheit des behinderten Kindes inspiriert Spiele und Arbeitsweisen, die allen zugute kommen (z.B. beim kleinen blinden Kind: Wiedererkennen durch Tasten, Musik, Blindekuh spielen, erzählen usw.). Fachleute beraten die Lehrer, aber die Lehrkräfte sind nicht in der Behandlung Behinderter spezialisiert, denn ihre Aufgabe ist ja, alle Kinder ihrer Anlage und ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern, jedem die Möglichkeit zu geben, der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu geben, auch wenn sie der Norm nicht entsprechen können. Vor allem soll auf dem aufgebaut werden, was das Kind kann und nicht auf dem, was es nicht kann oder noch nicht kann (oder nie können wird). Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Beispiel der Kinder ohne Behinderung sehr viel stimulierender wirkt als die künstliche Motivation der Rehabilitationssituation. Dies hat sich vor allem bei Sprachstörungen gezeigt.
Der Übergang des behinderten Kindes in die Pflichtschule ist flexibel und läßt sich zwei bis drei Jahre, je nach der Behinderung und dem Reiferhythmus des Kindes, hinausschieben. Wenn das behinderte Kind einmal in der Schule aufgenommen worden ist, nimmt es selbstverständlich auch an den außerhalb der Schule möglichen Veranstaltungen teil: also nicht Schwimmtherapie, Sport und Spiel für Behinderte, sondern: überall dabei sein und mittun, wo es nur irgendwie möglich ist. So kann auch verarbeitet werden, wenn das Mitmachen nicht möglich ist. Die Voraussetzung dafür ist nicht eine im karitativen Bereich errungene Solidarität, sondern eine von vorneherein nicht vollzogene Aussonderung. In dieser Hinsicht ist es interessant zu beobachten, wie sich heute Mitschüler einer Klasse z.B. psychotischen oder schwerverhaltensgestörten Kindern zur Seite stellen: das Absurde, das Aggressive, das Unberechenbare wird nicht mit der Angst erlebt, die dagegen noch viele Erwachsene erfaßt, sondern wird in die Möglichkeiten des Miteinanderlebens eingebaut. Die Beobachtung, daß in Klassen mit verhaltensgestörten Kindern die Klassengruppe im Gesamtverhalten viel reifer ist, wird immer häufiger in den Veröffentlichungen erwähnt, die sich mit dem Widerstand gegen Integration auseinandersetzen.
Hilfe durch ein neues Bewußtsein
Hilfe für Behinderte in der Gemeinde, bedeutet deshalb nicht nur ein gut funktionierendes Versorgungsnetz und spezielle Behandlung im unmittelbaren Wohnbereich, bedeutet auch nicht nur rollstuhlfreundliche Bürgersteige und moderne Wohngemeinschaften, sondern eine grundlegende Veränderung der Mentalität dem gestörten, dem leistungsschwachen, dem »häßlichen« oder überhaupt andersartigen Mitmenschen gegenüber. Daß dieses Ziel in Italien erreicht ist, kann bestimmt nicht behauptet werden; daß aber die Voraussetzungen ideologischer und gesetzlicher Art in diesem Lande, im Gegensatz zu anderen Ländern, vorhanden sind, das steht außer Frage. Die jetzt langsam anlaufende Gesundheitsreform, die die Wege der Betreuung und Behandlung in der sozialen Umwelt des Bürgers bestimmt und nach dem Prinzip einer Medizin der Gesundheit festlegt, sowie das Gesetz, das allen behinderten Kindern Zugang zur normalen Pflichtschule garantiert, wie auch die Psychiatriereform, haben Prinzipien festgelegt, an deren Durchführung noch lange zu arbeiten sein wird. Der Widerstand, der zum größten Teil in kulturell verankerten Vorurteilen, in der dunklen Angst vor dem sogenannten Anormalen und in der veralteten Tradition der Medizin und der Pädagogik wurzelt, wurde erst zum Teil gebrochen.
[19] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 2/1982, S. 21-25.
Schule ohne Aussonderung in Italien[20] - Ludwig-Otto Roser
Seit etwa 12 Jahren werden in Italien behinderte Kinder in der Regelschule aufgenommen, anfangs auf Grund der persönlichen Bereitschaft von Eltern und Lehrern, heute weil Gesetze die Integration fördern und die Aussonderung verhindern. Es gibt keine Sonderschulen mehr, nur noch einige Heime für die Pflege und Betreuung schwerstbehinderter Kinder und Erwachsener. Die Gesuche um Aufnahme kleiner schwerstbehinderter Kinder in diese Heime hat spürbar nachgelassen, denn heute werden auch Kinder, die keine Lernaussichten im Sinne der traditionellen Schule haben, in die Normalschule aufgenommen. Gerade bei besonders schwerer Behinderung wird vorgeschlagen, das Kind schon nach dem ersten Lebensjahr in der Kinderkrippe an die Umwelt zu gewöhnen. Diese natürliche Stimulation hat sich als wirksamer erwiesen als die meisten Rehabilitationstechniken. Kindergarten und Schule ergeben sich dann als natürliche Fortsetzung einer gemeinsam begonnenen Entwicklung.
Das Recht gemeinsam zu leben und zu lernen, ist amtlich bescheinigt: schwerkörperbehinderte, psychotische, autistische, lernschwache, sinnesbehinderte und geistiggestörte oder von Fehlbildungen entstellte Kinder besuchen zunächst normale Kindergärten, dann die Pflichtschule bis zum 14. Lebensjahr, schließlich, je nach ihrer Behinderung, Berufsschulen oder höhere Schulen. Die Pioniere und heutigen Vertreter dieser Entwicklung, die ihren Kampf nach den Thesen BASAGLIAS, JERVIS, PIRELLAS, Adriano MILANI-COMPARETTIS u.a. ausgerichtet haben, handeln nach dem Grundsatz: Schule ist nicht nur der Ort einer mechanistischen Wissensvermittlung, die den abstrakten Bedürfnissen der Gesellschaft genügt, aber sich fern von den Motivationen des heranwachsenden Menschen bewegt. Sondern: Schule ist vor allem der Ort, wo die Gelegenheit besteht zur Bewußtwerdung, der Suche nach dem Wissen und vor allem der Gestaltung der mitmenschlichen Beziehungen.
Die Widerstände gegen diese Vorstellung der schulischen Erziehung sollten bedacht werden, noch bevor man die Widerstände gegen die Integration Behinderter ins Auge faßt. Alle Reformen der Schule in die oben gekennzeichnete Richtung sind immer wieder in der bürokratisierenden Versteifung und in der Festlegung von Bildungsgut versunken. Versuche der pädagogischen Avantgarden, die Schule aus dieser versteiften Situation herauszuführen, wie sie beispielsweise in Italien das CEMEA (Centri Esperienze Metodi Educazione Attiva) in den fünfziger und sechziger Jahren vorgeschlagen und vorgelegt hat, sind immer wieder in die alte Ordnung zurückgeflutet, weil sie ganz bestimmten, meist bürgerlichen Vorstellungen der Erziehung (Einheit und Klarheit der Bildungsziele, Unverrückbarkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der menschlichen Werte, Sicherheit und Ordnung) widersprechen. Das Wechselspiel zwischen Fortschrittglaube und Verankerung im Gegebenen, entscheidet sich immer noch leichter zu Gunsten der konservativen Kräfte, so wie ja auch im Leben des einzelnen der Wille zur Verbesserung eher einschläft als zunimmt. Über die psychologischen Gründe dieses Phänomens ist in den Untersuchungen über »Angst« genügend gesagt worden.
Fortschrittliche kapseln sich dann, wie es das CEMEA getan hat, sektenhaft ab. Widerstand gegen Erneuerung, selbst im wissenschaftlichen Bereich, ist also eine dem Menschen von jeher anhaftende Eigenschaft. Wenige Menschen und wenige Ideen durchbrechen diesen Widerstand; sie leiten aber Bewegungen ein, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. So ist auch der Widerstand zu beurteilen, der in Italien nach der ersten Integrationswelle laut geworden ist. Heute aber dürfte es unmöglich sein, die erreichten Ziele für nichtig zu erklären, Sonderschulen neu zu institutionalisieren und die Erkenntnisse zu ignorieren, die aus der entwicklungorientierten Diagnose und Behandlung, sowie aus dem gemeinsamen Leben behinderter und nichtbehinderter Kinder entstanden sind. Die Integration behinderter Kinder in Italien ist, wie die Psychiatrieform, eine so durchdringende, tiefgreifende und, vom Pädagogischen her gesehen, so revolutionäre Aktion gewesen, daß selbst ihre Gegner sie nicht mehr im Prinzip, sondern nur in den Mängeln ihrer Durchführung anzugreifen wagen. Der Widerstand gegen die Integration behinderter Kinder in die Regelschule argumentiert auch in Italien folgendermaßen:
-
Das behinderte Kind absorbiert die Aufmerksamkeit und die Arbeitskraft des Lehrers und der Mitschüler, vermindert dadurch die Leistung des »gesunden« Kindes.
-
Der Lehrer ist dazu da, die Wissensvermittlung in der optimalen Erfüllung einer Curriculumkonstruktion zu gewährleisten, ist also weder Therapeut derer, die ihm nicht folgen können, noch Fürsorger.
-
Sondereinrichtungen bieten nicht nur behinderten Kindern geschultes Personal, sondern fördern das Kind durch intensive, individuelle Stimulation und schützen es vor der Wahrnehmung von Unterschieden.
-
Verzicht auf Konfrontation und Auslese läßt den Willen zur Leistung verblassen, die Faulheit des einzelnen findet ihr Alibi in der Unfähigkeit des Behinderten.
-
Es fehlen die Voraussetzungen personeller und räumlicher Art. Nur geschultes Personal kann mit Behinderten umgehen.
Wenn man diese Einwände genauer betrachtet, so sieht man bestätigt, daß sie aus einer Auffassung der Schule herrühren, die für das behinderte Kind genauso problematisch ist wie für das sogenannte normale. Amtliches Lernen, als Garantie zukünftiger Lebensberechtigung und Produktionsfähigkeit steht im Vordergrund und wird vom Erwachsenen als Pflichterfüllung erwartet. Natürliches Lernen durch Interesse und Erfahrung ist nicht zu dokumentieren und kann nicht standardisiert werden, es verlangt auch eine Zuwendung und eine Einfühlung, für die die meisten Eltern und Lehrer keine Zeit haben. Es wird erwartet, daß das Kind der industrialisierten Gesellschaft durch frühes Leisten ein produktives Mitglied wird, als einzige Garantie späteren »Wohlergehens«.
Es erscheint überflüssig, an dieses wohlbekannte Mißverhältnis zu erinnern, das die Beziehungen zwischen den Eltern, die sich mit den Belangen der Gesellschaft identifizieren, und den Kindern trübt, aber diese Betrachtungen sind unerläßlich, wenn man zu dem Schluß kommen will: In einer kindgerechten Schule kann auch ein behindertes Kind nie störend sein, sich nie an den Rand gedrängt fühlen, nie ungefördert bleiben.
Die Schule ist aber heute noch in den seltensten Fällen kindgerecht. Spielen und Entdecken wird von den meisten Erwachsenen immer noch als Zeitverlust empfunden. Somit ist im Grunde jedes Kind behindert: Angst, Minderwertigkeitsgefühle, Neid, Rivalität und Lüge sind die Bestandteile dieser »normalen« Behinderung. In den vielen gelungenen Fällen der Integration behinderter Kinder in der italienischen Regelschule hat sich gezeigt, daß sich die Lehrkräfte dem behinderten Kinde niemals mehr zugewandt hatten als den nichtbehinderten und diesen letzteren wiederum nicht mehr, als es ihren echten Bedürfnissen entsprach. Nur so ist es denkbar, das Anderssein des Behinderten nicht in Erscheinung treten zu lassen und alle Kinder in die Lage zu versetzen, ihrer individuellen Veranlagung Ausdruck zu geben. Der Einwand, daß Lehrer und Erzieher keine Therapeuten seien, ist richtig. Schule soll auch nicht heilen: Ein behindertes Kind darf nicht erst behandelt werden, wenn es in die Schule kommt. Das Aktionsfeld der Behandlung, wie es in Italien das neue Gesundheitsgesetz vorsieht, ist bestimmt durch Früherkennung, Frühberatung der Familie und Therapie, die in den dezentralisierten, in der sozialen Umwelt gelegenen, Ambulatorien zu vollziehen sind. Diese können später im Kinderarten oder in der Schule Informationen und Richtlinien geben, sowie an der Ausarbeitung pädagogischer Alternativen mitwirken.
Heilpädagogische Arbeit in der Schule dagegen stört fast alle behinderten Kinder, wie es die italienischen Erfahrungen gezeigt haben. Stützlehrerinnen, die das Kind aus der Klasse holen, stellen wieder den Defekt in den Vordergrund oder erinnern daran.
Sonderschulen fördern behinderte Kinder nur dem Anschein nach: Die erreichten Fortschritte legitimieren in der Praxis eigentlich nie den Übergang in die Normalschule. Das gleiche gilt für die Reha-Zentren: Sie rehabilitieren fast ausschließlich für die nächste Stufe der Aussonderung, zuletzt für die geschützte Werkstatt. Die Anpassung des behinderten Kindes erfolgt im allgemeinen nicht dadurch, daß es - nur mühsamer - die gleichen Ziele erreicht, sondern durch die Kompensation seiner Schwierigkeiten und durch ihre Verarbeitung. Dies kann aber nicht in den nur auf den Behinderten eingestellten Institutionen geschehen. Das Leben im Bereich der normalen sozialen Umwelt stellt die stärkste Motivation zur Anpassung, zur Nachahmung und zur Selbstbeurteilung dar. Nichts hat Eltern, Sonderschullehrer, Psychologen und Arzte mehr von der Problematik der Förderung behinderter Kinder in Sonderinstitutionen überzeugt als die rapiden Fortschritte, die diese Kinder ohne Sonderschulbehandlung nur durch das Zusammenleben im normalen Schulbereich gemacht haben (obwohl der größte Teil der Schulen in Italien alles andere als im obengenannten Sinne fortschrittlich ist).
Die formalen Gründe des Widerstandes gegen die Integration Behinderter sind relativ leicht vom Psychologischen und Pädagogischen her zu verstehen. Sie sind wohl in allen Ländern gleich, ebenso wie es in allen Ländern auf Widerstand stößt, Schulreformen durchzuführen. Warum ist es dann in Italien gelungen, wenigstens auf legislativer Ebene, die Integration Behinderter durchzuführen, trotz der Anwesenheit einer starken konservativen Mittelschicht, trotz einer nicht kindgerechten, traditionellen Schule? Wie ist es möglich, daß im Gegensatz zu allen Erwartungen nicht die Schule sich verändert hat, um die Behinderten aufzunehmen, sondern die Aufnahme der Behinderten allmählich die Schule verändert? Bei der Beantwortung dieser Fragen muß man von der Tatsache ausgehen, daß zunächst einmal nie, seit dem Bestehen der italienischen Verfassung, der Ausschluß der Behinderten aus der Normalschule und ihre Verteilung auf sektorielle Sonderschulen, gesetzlich festgelegt worden ist. Die Eltern, die sich gegen die Einweisung ihres Kindes in Sondereinrichtungen wehrten, sind niemals dazu gezwungen worden, gegen ihren Willen ihr Kind an eine Sonderinstitution abzugeben. Der Widerstand dieser Eltern zerbrach am Desinteresse und an der Regel, alle diejenigen sitzenbleiben zu lassen, die nicht mitkamen. Dagegen bot die Existenz der Sondereinrichtungen nicht nur Sicherheit vor der Indifferenz oder der Ablehnung der Mitmenschen, sondern ließ auch Rehabilitation erhoffen. Der Rehabilitationsoptimismus auf der einen Seite, die gute Gelegenheit einer politischen und scheinbar auch moralischen »Regelung« des Problems auf der anderen, hat in Italien zwischen 1958 und 1968 die Sonderschulen aus dem Boden schießen lassen. Die Entfernung der Behinderten aus dem Blickfeld des ängstlichen Bürgers war gleichermaßen den Behinderten und Nichtbehinderten recht. Die Gesetzgebung behandelte nur das Problem der Trägerschaft; und die Freiwilligkeit der Absonderung ließ alles in ruhigen Bahnen laufen. So hatte die um die 68er Jahre in Italien beginnende Bewegung der Psychiartriereform im Grunde, wenigstens was das Zusammenleben der Kinder in der Schule betraf, keine legislative Barrieren, sondern nur Gewohnheiten zu durchbrechen. Gleichzeitig haben die beiden Brüder MILANI, der eine als Priester im Kampf gegen das Ausleseprinzip der Schule, der andere als Neurologe und Kinderarzt gegen den Mythos (und das Alibi) der Therapie und der Notwendigkeit von Sonderbehandlungen, eine Polemik entfacht, die von großen Teilen der Bevölkerung mit Interesse verfolgt und schließlich Anstoß zum Umdenken wurde. In die gleiche Zeit fallen BASAGLIAS Initiativen für die Psychiatriereform. Die ersten behinderten Kinder wurden in der Normalschule akzeptiert, weil man in der Staatsverfassung ihr Anrecht darauf wiederentdeckte und weil man gleichzeitig die menschliche Berechtigung dazu, mit der für die italienische Bevölkerung charakteristischen Emotionalität, als begründet empfand. Viele gewannen schließlich die Einsicht, auch auf politischer und weltanschaulicher Ebene, daß Aussonderung und Auslese als Naturprinzip nur menschenunwürdige Lösungen darbieten können. In der stärkeren Berücksichtigung des Sozialen entdeckte dann auch die Rehabilitation, daß mit der Perfektion therapeutischer Praktiken das eigentliche Ziel, nämlich das Leben in der sozialen Umwelt, abstrakt geworden war und sich als unerreichbar erwies. Weiter noch: die Psychologie entdeckte, in welchem Umfang das therapeutische und das sonderpädagogische Handeln nicht vom Sachverhalt, sondern von affektiven Erwartungen bestimmt wird, d. h. von der durch das Anderssein ausgelösten Angst. Diese Faktoren betreffen jedoch immer noch die geschichtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, durch die die Integration möglich wurde, und erklärt noch nicht, warum sich die Antiaussonderungsbewegung erweitert und, trotz der heute recht spürbaren weltanschaulichen Reaktion (die Italiener sprechen von nach rechts tendierendem Zurückfluten), erhalten hat. Hier muß man wohl der charakteristischen Veranlagung der Italiener einen großen Raum zugestehen: Es gibt dominierende Eigenschaften, die kulturbestimmend sind und bei dem Willen, nicht auszusondern, eine große Rolle spielen. Dazu gehört zu-nächst einmal der starke Hang zum Individualismus.
In dem Maße, in dem die Italiener Toleranz und Zugeständnisse ihrem eigenen Verhalten gegenüber erwarten, sind sie auch in der Lage, zu-nächst das Eigenartige, dann das Besondere und Andersartige ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.
Soviel Negatives auch aus dieser Einstellung entstehen mag, sie wird in den mitmenschlichen Beziehungen im positiven bestimmend und führt zu einer großen Einfachheit des sozialen Lebens. Planung und Programmierung sind bei den Italienern nicht beliebt, denn sie beschneiden die persönliche Freiheit, lassen der Veränderung und damit auch dem Fortschritt weniger Raum. Daraus ergibt sich eine größere Flexibilität.
Eine andere, aus dem Individualismus erwachsene Charakteristik ist die geringe Autoritätsgläubigkeit. Man erwartet aber auch auf ganz natürliche Weise, daß die Autorität flexibel ist. Schließlich spielt im Verständnis der Integration behinderter Kinder in Italien auch das Verständnis der Italiener zu Kindern überhaupt eine Rolle. Dank der starken Emotionalität ist auch die Antwort auf die Bitte der Behinderten um Zuwendung zunächst emotional. Das Bedürfnis des behinderten Kindes, mit ein-bezogen zu werden, wurde sehr oft, gerade in der ersten Phase der Integration, für vordergründiger erachtet als die Probleme, die aus Leistungsschwäche entstehen. Es kann darum einen konservativen Gesamtwiderstand geben, aber persönliche Ablehnung oder Mangel an Teilnahme und Einfühlungsvermögen sind selten. Es wäre aber für die Überwindung der aussondernden Tendenzen der Gesellschaft und für die Erneuerung der Bildungspolitik gefährlich, anzunehmen, daß sie nur durch die emotionale Ausrichtung eines Volkscharakters erfolgen könne. Der rationale Schritt der Analyse und Verarbeitung der durch die Integration behinderter Kinder entstehenden pädagogischen, psychologischen und sozialen Probleme muß nicht nur im Vordergrund stehen, sondern Voraussetzung einer wissenschaftlichen Umbildung der vom Emotionalen her gegebenen Werte darstellen. Wenn man behaupten kann, daß es in Italien die behinderten Kinder sind, die einerseits die Schule dazu zwingen, sich wieder pädagogisch zu orientieren und andererseits eine Generation Erwachsener entstehen lassen, denen das Zusammenleben mit Behinderten vertraut ist, dann muß man annehmen, daß solche Wechselwirkungen das Fortschreiten einer Gesellschaft auf menschlicher Ebene überhaupt ausmachen, d.h. vor allem Wahrnehmung der Belange anderer. Diese Wahrnehmung ist durch den wirtschaftlichen Fortschritt, auf den die Leistungsschule hinzielt, nicht garantiert, im Gegenteil, er bietet in vielen Ländern die Mittel zur besseren Durchführung der Aussonderung. So sind auch wissenschaftliche Absicherung der Curricula, inhaltliche Normierungen und rechtliche Vervollkommnung der Leistungskontrollen, Reglementierung und fachliche Spezialisierung der Lehramtsstudien keine Garantie für eine kindgerechte Schule und die menschliche Bereitschaft im Lehrerberuf. Sie entsprechen den Bedürfnissen des Erwachsenen, wie die »goldenen Käfige«, die in Italien zu Beginn der 60er Jahre entstanden sind und heute noch, meist von der Kirche als Institutionen der Caritas oder scheinbar wissenschaftlich korrekter Rehabilitationen erhalten werden. Sehr wichtig ist es außerdem für die italienische Entwicklung gewesen, daß, was die Rehabilitation anbetrifft, viele Fachleute (Arzte, Pädagogen, Psychiater, Psychologen) ihre Arbeit in Frage gestellt haben. Die kritische Analyse des Erreichten, bzw. des Nichterreichten wird zum Antrieb des Umdenkens. Vieles hat sich dann ohne Planung und ohne Verwirklichung der Schulreform von selbst ergeben: auf legislativer Ebene die Abschaffung der Noten in den acht Jahren der Pflichtschule, Reduzierung der Klassenstärke in Klassen mit Behinderten, Einsatz von Stützlehrerinnen, Mitwirkung von spezialisiertem Personal der aufgelösten Sonderschulen, Regulierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Fachkräften im Sinne der jetzt zum Tragen kommenden Gesundheitsreform usw. Das wirkliche Problem ist nun nicht mehr so sehr die Integration des behinderten Kindes, die Arbeit am einzelnen Fall, sondern eine Basisarbeit der Früherkennung und der Vorsorge, um Aussonderung von vornherein zu verhindern.
[20] Dieser Beitrag erschien erstmals in: Helga DEPPE-WOLFINGER (Hrsg.): behindert und abgeschoben. Zum Verhältnis von Behinderung und Gesellschaft. Weinheim und Basel 1983, 5.155 - 161.
Erinnerung an Begegnungen mit Dr. Ludwig-Otto ROSER
»Daß sich um Integration nur die Linksparteien bemüht haben, ist nur zum Teil richtig. Ich glaube, daß hinter der Integration vor allem ein menschliches Interesse steht. «
Ludwig-Otto ROSER in einem Brief an die GEW Berlin 1980
Ludwig-Otto ROSER steht in meiner Erinnerung für einen bestimmten Impuls, nämlich: Auflösung der Sonderschulen und Integration Behinderter, in einer bestimmten Zeit: Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Die Begegnungen selbst sind rasch berichtet. Um 1980 hielt Ludwig-Otto ROSER einen Vortrag über den italienischen Weg der Integration Behinderter an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, an der ich damals Sonderpädagogik studierte. Im Rahmen der studentischen Fachschaftsarbeit hatten wir uns schon länger mit der Idee der Integration auseinandergesetzt, so daß Ludwig-Otto ROSERS Vortrag auf offene Ohren traf. Anfang 1981, unmittelbar nach Abschluß der letzten Prüfung zum ersten Staatsexamen, bat ich sowohl Ludwig-Otto ROSER als auch Adriano MILANI-COMPARETZI schriftlich um die Erlaubnis, sie in Florenz besuchen und bei ihnen hospitieren zu dürfen. Ludwig-Otto ROSER antwortete, auch im Namen Adriano MILANI-COMPARETTIS. Was schon im Vortrag zu erkennen war, wurde mir im Briefwechsel noch deutlicher. In bescheidener und zugleich engagierter Art übernahm Ludwig-Otto ROSER den Part eines Botschafters, eines Vermittlers des italienischen Weges und nicht zuletzt der Vorstellungen Adriano MILANI-COMPARETTIs im deutschsprachigen Raum. Nicht nur, daß seine Antwortschreiben durch Formulierungen wie »wir sind gerne bereit, Ihnen einige Stunden zu widmen und Sie an unserer Arbeit teilnehmen zu lassen«, »ich freue mich, Sie hier in Florenz kennen zu lernen« und »wir berichten Ihnen gerne von dieser Arbeit und können auch Kontakt mit italienischen Kollegen verschaffen« dem jungen Interessenten gänzlich ohne Herablassung begegneten und von vornherein eine solidarische Atmosphäre schafften. Seine Antworten gingen über bloße Terminklärung hinaus, boten immer auch inhaltliche Hinweise. Seiner zweiten Antwort legte er zudem ein knapp zehnseitiges dichtbeschriebenes Manuskript bei, in dem er auf einen Fragenkatalog der Berliner GEW antwortete, und half so bei der Vorbereitung des Besuchs in Florenz. Es müssen unzählige solcher Anfragen gewesen sein, die er auf einer offenbar altersschwachen Schreibmaschine persönlich beantwortete. Im Juni 1981 war es dann schließlich soweit. Zusammen mit zwei Kolleglnnen hospitierte ich bei Adriano MILANI-COMPARETTI in Florenz. Zu erleben, wie er in seiner Beratungsstunde mit behinderten Kindern und deren Eltern umging, war beeindruckend. Trotz der Hilfestellung durch kurze Übersetzungen der jeweiligen Wortbeiträge sowie unserer Rückfragen, die Ludwig-Otto ROSER auch hier vor Ort freundlich anbot, blieb jedoch - aus heutiger Sicht - ein unbefriedigendes Gefühl. Um den italienischen Weg ausreichend kennenzulernen, fehlten mir damals sowohl die italienische Sprachkenntnis als auch die professionelle Konsequenz, mehrere Monate bei Ludwig-Otto ROSER zu hospitieren, wie er selbst es in einem Schreiben vorgeschlagen hatte. Was sich längerfristig als Wirkung der Begegnung mit Ludwig-Otto ROSER und seinem Florenzer »Territorio« zeigte, war deshalb weniger die Kenntnis des italienischen Weges der Integration Behinderter als vielmehr die Erkenntnis: Wer einen pädagogischen Ansatz verstehen will, muß sich teilnehmend beobachtend und forschend in die Praxis begeben, die Sprache des jeweiligen Praxisortes erwerben, sich Kultur und Geschichte des jeweiligen Praxisortes öffnen und vor allem Zeit mitbringen! Daß ich wenige Jahre später auf diese Weise, nämlich dann italienisch-sprechend, kultur- und politgeschichtlich gut vorbereitet und mehr als einen Monat hospitierend, den faszinierenden pädagogischen Ansatz der kommunalen Kindertagesstätten in Reggio Emilia erkundete [21], kann deshalb auch als eine Folge der Begegnung mit Ludwig-Otto ROSER angesehen werden. So weit, kurz gefaßt, die persönliche Begegnung. Mindestens ebenso spannend, und natürlich ebenfalls von subjektiver Sicht geprägt, erscheint mir der Rückblick auf die Zeit, in der Ludwig-Otto ROSERS italienisch-deutsche Mittlertätigkeit zu wirken begann. Es war eine merkwürdige Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Über Deutschland lag die bleierne Zeit der Enttäuschung. Die Bildungsreform galt bereits als gescheitert, die Verwirklichung von Chancengleichheit, die Idee, mehr Demokratie zu wagen, all das verlor an Überzeugungskraft. Der deutsche Herbst 1977 hatte den (Selbst-)Vorwurf politischer und Gefühls-Kälte durch Ereignisse verwirklicht. Wer nicht den stalinistischen und maoistischen Weg der K-Gruppen gehen wollte, suchte nach einem undogmatischen linken Pragmatismus, wollte kleine konkrete Utopien in alternativen Projekten verwirklichen. Alle aber suchten nach Wärme.
Italien konnte das bieten. Nicht nur Sonne und Wärme für die Toscana-Fraktion, sondern auch die Spontaneität und das fruchtbare Chaos, das die vom polizeilich bzw. paramilitärisch durchorganisierten Deutschland gefrusteten undogmatischen Linken suchten. DARIO Fos komischer Blick auf den gesellschaftlichen Alltag erlaubte zu lachen. Die Feste der PCI-Zeitung L'Unita erlaubten zu tanzen und boten die Gemeinsamkeit kulturellen Erlebens für Arbeiter und Angestellte, Politiker und Intellektuelle. Der Historische Kompromiß konnte als Möglichkeit gesellschaftlicher Versöhnung gelesen werden.
Schließlich, und das war für deutsche Studierende »sozialer« Berufe besonders wichtig, wurde neues Denken in Italien in radikaler Weise praktisch. Während pädagogische Neuerungen wie etwa die Gesamtschulen in Deutschland sowohl pädagogisch als auch architektonisch in aufwendiger Weise wissenschaftlich geplant worden waren, vermittelten die verschiedenen italienischen Neuerungen den Eindruck, daß man ohne großes Tamtam einfach beginnen kann. Das paßte zur Philosophie alternativer Projekte in Deutschland. Zugleich paßte die Betonung des »Auflösens« (von psychiatrischen Einrichtungen, von Sonderschulen etc.) im italienischen Weg zum »Weg mit...!«-Nachhall auch der deutschen Studentenbewegung. Daß sich in den 80er Jahren in der Bundesrepublik dennoch nicht so sehr die Übertragung des praktischen italienischen Weges, sondern eher die theoretische FOUCAULT-Rezeption als Institutionenkritik durchsetzte, sei angemerkt, weil es wiederum kulturelle Differenzen beider Gesellschaften verdeutlicht. Dabei gab es zumindest im außerschulischen Bereich hierzulande ja durchaus praktische Ansätze zur Integration, oder sagen wir besser, zur Förderung gemeinsamen Lebens von Behinderten und Nichtbehinderten: Einrichtungen, wie z.B. der Club am Alexanderplatz in Stuttgart, der neben vielen anderen Jugendlichen auch mir selbst Anfang der 70er Jahre gemeinsame Erlebnisse mit behinderten Jugendlichen ermöglichte, oder z.B. die vom Bund der Katholischen Jugend Wernau organisierten gemeinsamen Freizeiten Behinderter und Nichtbehinderter. Der schulische Bereich jedoch sperrte sich (und sperrt sich, regional unterschiedlich, bis heute) bekanntlich gegen solche Tendenzen. Ein Grund, neben der traditionellen Hierarchisierung des deutschen Bildungswesens, war sicherlich, daß die Sonderschulen in »gutmeinender« Absicht der Förderungsoptimierung gerade erst wenige Jahre zuvor im Zuge des allgemeinen Bildungsbooms vielerorts als »schöne, neue, behindertengerechte Welt« erbaut oder ausgebaut worden waren. Auch wenn Aktivisten wie Franz CHRISTOPH, Initiativen wie die Krüppelbewegung oder lokale Zeitschriften wie der Tübinger »Ghettoknacker« dagegen ankämpften; die sonderschulischen Bastionen waren nicht so einfach zu knacken. So nahm ich, von 1979 bis 1983 in baden-württembergischen Sonderschulen tätig, es jedenfalls wahr. Daß ich schließlich ausstieg, die Stelle als Sonderschullehrer kündigte, war sicherlich auch durch die, von Ludwig-Otto ROSER vermittelten, italienischen Impulse motiviert. Aber statt in einem Integrationsprojekt arbeitete ich anschließend in einer Alternativschule. Für mich persönlich war es damals konsequent, weil ich den Eindruck hatte, daß im staatlich organisierten deutschen Schulwesen radikale Neuerungen nicht durchzusetzen sind. Entgegen Ludwig-Otto ROSERS Auffassung (siehe Zitat am Anfang des Textes) hatte ich damals den Eindruck, daß gerade noch im winzigen Sozialistischen Büro Offenbach und in den soeben entstandenen Alternativen Listen die Integration Behinderter als politisches Interesse artikuliert werden konnte, aber nicht in irgendeiner der etablierten Parteien. Erst heute kann ich, sei es allgemein aufgrund inzwischen vielschichtigerer Lebenserfahrung, sei es aufgrund der Erfahrung der Sorge um eigene Kinder oder aufgrund der Zusammenarbeit mit behinderten Kolleglnnen, in Ludwig-Otto ROSERS Formulierung, die mir damals so unpolitisch harmonisierend erschien, ein Körnchen Weisheit entdecken: »Ich glaube, daß hinter der Integration vor allem ein menschliches Interesse steht.«
[21] GÖHUCH, M.: Reggiopädagogik - Innovative Pädagogik heute. Zur Theorie und Praxis der kommunalen Kindertagesstätten von Reggio Emilia, Frankfurt/M 1988 (7. Aufl. 1997)
Brücken zu Schwerstbehinderten[22] - Ludwig-Otto Roser
Mailand, 18. Dezember 1963: Heute habe ich Luigi bei den Schwerstbehinderten, im obersten Stock, einen Weihnachtsbaum schmücken sehen. Nicht nur den Weihnachtsbaum: Alle Betten waren mit Lametta und Sternen behängt, billige Plastikkugeln dazwischen. Am Ende seiner Mühe sank er auf einen Stuhl und sagte: »... nur Francesco hat meine Bewegungen mit den Augen verfolgt. Es ist sinnlos!« - »Warum tust Du es dann, wenn Du meinst, daß sie es nicht aufnehmen?« - Er dachte lange nach: »... ich weiß nicht, vielleicht für mich - ich weiß nicht, ob ich in ihnen bin, oder sie in mir, wir sind eins geworden, und ich vermittle ihnen die Welt, aber die Welt will sie nicht!«
Seit zehn Jahren war Luigi der verantwortliche Pfleger dieser Abteilung. Nun saß er da und hatte Tränen in den Augen, wegen der Kinder? Seinetwegen? (Tagebuchaufzeichnung)
Florenz, 10. November 1983: Heute Eröffnung des Kongresses über die Probleme Schwerstbehinderter. Seit einem Jahr haben sich alle Fachleute der Stadt, die in ihrem Beruf mit Schwerstbehinderten zusammenkommen, zusammen mit den Eltern und Angehörigen, in Arbeitsgruppen mit dem Thema »Schwerstbehinderung« auseinandergesetzt. Zur Debatte standen folgende Argumente:
-
Analyse der Bedürfnisse Schwerstbehinderter
-
Probleme der Familien, der Betreuungsvereine, der Freiwilligenarbeit
-
Probleme der Helfer und des Personals: Ausbildung, Aufgaben, Ziele
-
Aufgaben der Gesundheitsorganisation und der Gesellschaft
Als ich aufgefordert wurde, mich an einer dieser Arbeitsgruppen zu beteiligen, fiel mir aus meiner Mailänder Zeit im Heilpädagogischen Institut »La Sacra Famiglia« Luigi wieder ein und alle die Menschen, die ich seitdem für Schwerstbehinderte habe arbeiten, leiden und ihnen Freude bereiten sehen. Eine Menschengruppe, die, eng mit der Realität des Schwerstbehinderten verknüpft, das eigene Schicksal an sie bindet und oft an den Unmöglichkeiten zerbricht.
Nichts, was wir vom Schwerbehinderten erfahren oder wissen, ist von den Personen zu trennen, die mit und für ihn handeln.
Die Vermittlung zwischen zwei Realitäten, die eine sprachlos, verkrümmt, gestört, die andere durch die Umwelt gegeben, vollzieht sich in den verschiedensten Weisen. Wie wird diese Vermittlung psychologisch erlebt? Wie sollte sie sein? Kann man sie erlernen? Ist sie ein Akt der Liebe, ein Opfer, eine ethische Entscheidung? Weiß der Fachmann mehr als die Mutter, die gelernt hat, aus den unscheinbarsten Zeichen und den kleinsten Reaktionen des schwerstbehinderten Kindes auf dessen Zustand zu schließen und dessen Bedürfnisse zu verstehen? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Miteinander der Pflege und der »therapeutischen« Aktion? In welchem Moment wird heilpädagogische Ausbildung in Kontakt mit Schwerstbehinderten hinderlich, oder überflüssig? Ist menschliche Zuwendung allein ausreichend? Auch die Frage, wer zur Arbeit mit Schwerstbehinderten gekommen ist und wer sie sucht, eröffnet eine lange Reihe von Gegebenheiten: vom persönlichen Betroffensein zur zufälligen Begegnung, von der Suche nach irgendeiner Arbeit zur Realisierung eines Missionsgedankens, von der bewußten Suche nach Möglichkeiten menschlichen Einsatzes zur unbewußten Kompensation eigener Ängste und Frustrationen. Aber auch das Betroffensein selbst, die Unmittelbarkeit des Problems in einer Familie oder in der nächsten Nachbarschaft, löst viele Fragen und die verschiedensten Einstellungen aus: Suche nach Solidarität oder Isolation. Suche nach Lösungen oder Resignation, Zusammenschluß der Familie oder Auflösung der Familie. Ganz stark spielen diese Aktionen und Reaktionen in die Behandlung und Pflege des Schwerstbehinderten auch außerhalb des Familienbereiches mit hinein. Das Zusammenspiel der Kräfte oder ihr Gegeneinanderwirken kann nicht Frage des Zufalls bleiben, ist aber auch nicht allein Sache von Fachleuten, beispielsweise eines spezialisierten Zentrums, nicht allein Sache der Sonderpädagogik, sondern kann sich nur zu einer zusammenhängenden Dynamik erweitern, weil wir alle »betroffen« sind.
In einer Gesellschaft, in der die Pflege Behinderter und vor allem Schwerstbehinderter, einfach nur kompetenten Pflege- und Therapiekräften übergeben wird, fühlt sich weder die Familie wirklich gestützt, noch können die dem Schwerstbehinderten sich widmenden Arbeitskräfte den Sinn des eigenen Handelns in den Griff bekommen. Sie leben langsam in eine Symbiose mit dem Schwerstbehinderten hinein, werden selber behindert. So wie auf der anderen Seite die Familie allmählich, von allen Hoffnungen verlassen, allein bleibt, sich schuldig fühlt oder resigniert.
Die Erinnerung an den Pfleger Luigi und die Erfahrung mit einer von der lebensnahen Umwelt und von der Familie isolierten Behindertenarbeit, das Phänomen Mensch als Medium zwischen totaler Abhängigkeit und der umgebenden Realität, haben mich bewogen, an der vorbereitenden Arbeitsgruppe des Kongresses teilzunehmen, die sich mit den Problemen des Personals befassen sollte. Am Anfang unserer Arbeit stand die Frage: »Wann liegt Schwerstbehinderung vor, welches sind die Bedürfnisse dieser Menschen?«
Als Voraussetzung zur Beantwortung dieser Frage wurden zunächst die folgenden Überlegungen erarbeitet:
-
Jede einem Menschenwesen zugedachte helfende Aktion enthält in irgendeiner Weise die Intuition eines Bedürfnisses, jenseits aller Allgemeinplätze, Vorurteile und Fachkenntnisse. Zuwendung ist deshalb die wichtigste Bedingung in der Zusammenarbeit mit Schwerstbehinderten und deren Familie.
-
Das Problem schwerer Behinderung betrifft alle Menschen, nicht nur das zur Heilung und Pflege berufene Personal oder die Familie, denn es geht um eine Frage der Menschlichkeit, der Kultur und des wissenschaftlichen Fortschritts.
-
Es besteht die Notwendigkeit, die individuelle und soziale Realität des Schwerbehinderten aus der Verdrängung der Gesellschaft herauszuführen, aber auch neue Arbeitsweisen zu erdenken, um Ziele zu erreichen, die bis heute undenkbar erschienen, d. h. Entwicklungsrhythmen zu beschreiben, zu bewerten und zu fördern, die bisher nicht in die normalen, sozialen Werthaltungen eingebaut wurden.
-
Es ist gewiß, daß die Gesellschaft mit den Behinderten leben muß und, daß aus dieser Begegnung stärkere ethische Bewußtheit erwachsen kann sowie ein Verhalten, das die Qualität des sozialen Gefüges und das menschliche Zusammenleben verbessert.
Aus diesen Überlegungen heraus erschien es der Arbeitsgruppe notwendig, die Frage nach dem Wesen der Schwerstbehinderung aus der Maskierung medizinischer Definitionen und fatalistischer Unabwendbarkeit herauszuheben, um den besonderen Zustand eines Individuums in den Vordergrund zu rücken, dies vor allem um den Akzent auf die Beobachtung und die bessere Kenntnis seiner Bedürfnisse zu setzen. Nur so erscheint es möglich, eine Verbesserung und eine Erleichterung des Zustandes zu erreichen.
Schwerstbehindert erscheint demnach das Individuum, das sich im Verhältnis zu seiner Umwelt in keiner Weise autonom bestimmen kann und deshalb eines Vermittlers bedarf, der für und mit ihm ein Verhältnis zur Umwelt herstellt.
Dieser Zustand bietet sich niemals als statisch und unveränderbar dar, und deshalb ist gegenüber einem Individuum, dessen Bezug auf sich selbst und die Umwelt stark behindert ist, nicht nur emotionales Interesse notwendig, sondern vor allem das Handeln. So verstanden, ruht eine solche Definition nicht in sich selbst, sondern wird zum Auftrag. In der Darlegung dieser Aufgabe liegt zugleich die Klärung der Rolle, die die Gesellschaft und insbesondere die Menschen, die mit dem Schwerstbehinderten leben und arbeiten, ergreifen sollten: zwischen ihm und der Außenwelt vermitteln, in dem Versuch der Rekonstruktion oder des Aufbaus einer Beziehung.
Eine weitere Vorfrage war: Wo soll diese Vermittlung stattfinden? Auch diese Frage bestimmt das Berufsbild des mit und für den Behinderten arbeitenden Personals, denn es ist ein Unterschied, ob es in der Isolation und der Weltferne eines Heimes, oder im engsten Lebensbereich des Behinderten, d. h. auch im Kontakt mit der Familie und anderen Gegebenheiten der unmittelbaren Umwelt tätig ist. Deshalb erschien es unerläßlich, aus den Erfahrungen aller Beteiligten und mit Bezug auf die augenblicklichen italienischen Verhältnisse eine Beschreibung der möglichen Arbeitsbereiche vorauszuschicken:
1. Pflege und Beschäftigung des Schwerbehinderten sollte möglichst in einem Tageszentrum erfolgen.
2. Dieses Tageszentrum müßte in seinem Lebensbereich liegen und so klein sein, daß ein ständiger Kontakt mit der Familie und den anderen Menschen der Nachbarschaft möglich ist.
3. Es sollte zwar nach den modernsten Richtlinien ausgestattet sein, aber familiären Charakter haben: vor allem sollte es Ausgangspunkt der Vermittlung zwischen Schwerstbehinderten und der Welt sein, und die Möglichkeit garantieren, sich in die verschiedensten Richtungen zu bewegen.
4. Diese Richtungen müßten folgende sein:
- Aktivierung aller Mittel, die dazu dienen können, die Bedürfnisse des Schwerstbehinderten zu erkennen und die entsprechenden Antworten zu geben in einem Zusammenspiel von Programmierung, Stimulation, Aktion und Vermittlung,
- Verbindung mit den schon bestehenden Einrichtungen und Rehabilitationsstrukturen der Gesundheitsbehörde, um den therapeutischen Bedürfnissen des Behinderten zu genügen, ohne aber das Zentrum selbst durch »Therapie« zu charakterisieren,
- Kontakte mit allen zum Wohngebiet gehörenden Institutionen und sozialen Einrichtungen, durch welche Ereignisse jeglicher Art zu vermitteln und soziale Beteiligung zu erreichen sind,
- Täglicher Kontakt mit der Familie, um den bestmöglichen Übergang von Haus zu Haus zu garantieren, um eine freundschaftliche Beziehung herzustellen, in der die gegenseitigen Erwartungen ihre korrekte Dimension finden und Informationen ausgetauscht werden können, als wichtigste Phase in der therapeutischen Stütze der Familie und der Zusammenarbeit mit dem Personal.
5. Das Zentrum sollte auch auf Übernachtung weniger Fälle eingerichtet sein, damit Familie oder Wohngemeinschaften in besonderen Situationen entlastet werden können.
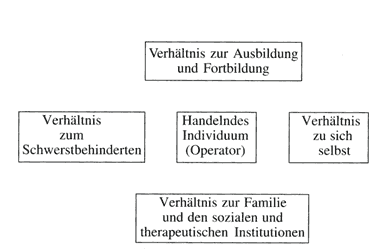
Verhältnisse eine Beschreibung der Arbeitsbereiche
Im Vordergrund steht bei diesem Modell die soziale Integration und nicht eine therapeutische Funktion. Es ist selbstverständlich, daß nichts unter-lassen werden darf, was die physische und seelische Situation des Schwerstbehinderten verbessern kann, aber das Risiko, daß Therapie zum Lebensinhalt wird, ist ungemein groß. Wo nichts anderes mehr zu tun ist, wird der therapeutische Leerlauf zu einer Aufgabe, die uns irgendwie zu beruhigen scheint. Das Schwerstbehinderte behandelnde und pflegende Personal soll aber mit dem Schwerstbehinderten selbst mitten im Leben stehen und nicht mit diesen auf das pseudotherapeutische Wartegleis abgeschoben werden.
Es geht mithin um ein Berufsbild, das sowohl im gesundheitlich-therapeutischen als auch im sozialpädagogischen Bereich geschult sein muß. In seinem Handeln ist der in einem solchen Beruf arbeitende Mensch etwa nach diesen Koordinaten zu verstehen:
Seine grundlegende Charakteristik ist, wie wir schon hervorgehoben haben, die Fähigkeit zur Vermittlung. Diese setzt als wichtigste Eigenschaft Flexibilität und vielschichtige Begabung voraus, denn als Vermittler hat sich dieser handelnde Mensch in die verschiedensten Richtungen zu bewegen, wie das folgende sternförmige Schema erläutern kann:
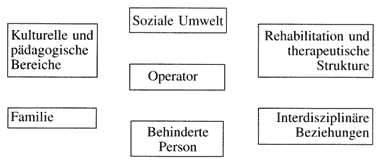
Das sternförmige Schema
Unsere Arbeitsgruppe bestand aus Fachleuten, die mit Behinderten in den verschiedensten Institutionen gearbeitet haben und noch tätig sind: In Therapiezentren für psychotische oder seelische und geistig schwerbehinderte Kinder, Ambulatorien für Schwerkörperbehinderte, Pflegeheimen in der Familienhilfe usw. Die Vorschläge zur Ausarbeitung eines einheitlichen, Berufsbildes sind also aus ganz verschiedenen Erfahrungsbereichen zusammengeflossen, und deshalb ist es nicht einfach gewesen, eine für alle Bereiche der Arbeit mit Schwerstbehinderten gültige Ausbildung von der Notwendigkeit spezifischen Fachwissens zu trennen. Alle Mitarbeiter waren sich aber zugleich darüber im Klaren, daß in der möglichen Differenzierung des Berufsbildes eine Zentralfigur zu ermitteln sei, gewissermaßen als Operator und Koordinator aller der um Vermittlung zwischen Schwerbehinderten und der Umwelt bemühten Personen.
Unter diesen letzteren spielte und spielt aber heute noch das am wenigstens ausgebildete, »stille«, oft vergessene Pflegepersonal eine entscheidende Rolle. Als Träger der mütterlich pflegenden Handlungsweise sind es die Personen, die am unmittelbarsten wichtige Augenblicke der Vermittlung innehaben. Es handelt sich um die Kontakte der körperlichen Pflege, die heute auch in ihrer psychologischen Funktion gewürdigt werden: Berührung des Körpers (Drücken, Streicheln, Säubern, Anziehen, Füttern, Lächeln, Flüstern, Küssen) - als fundamentale Ausgangsbasis der seelischen und körperlichen Entwicklung. Die Frage, ob es sich dabei um Personal der ersten Stufe eines um den Schwerstbehinderten bemühten Teams handeln soll, oder ob, in der Vorstellung eines vielschichtigen Berufsbildes, alle Mitarbeiter in der Lage sein sollten, auf sämtlichen Stufen der Vermittlung tätig zu sein, ist nicht von allen Teilnehmern unserer Arbeitsgruppe in gleicher Weise beantwortet worden. Die Mehrzahl war sich aber darüber einig, daß zwar alle mit den Schwerstbehinderten arbeitenden Menschen die gleichen grundlegenden Kenntnisse haben und die »gleiche Sprache« sprechen sollten, daß aber eine Arbeitsteilung und eine Differenzierung wünschenswert sei. Dies auch im Hinblick auf therapeutische und pädagogische Aktionen, die einer längeren spezifischen Ausbildung bedürfen (wie z. B. in der Behandlung und Pflege autistischer oder schwer psychotischer Kinder). Es sei darum zu unterscheiden zwischen einer ersten Stufe, der ein Personal zugehört, das hauptsächlich im Innendienst des Tageszentrums tätig ist und mehr Gewicht auf die Vermittlung zwischen dem Schwerstbehinderten und der Außenwelt im pflegerischen Bereich legt, während auf der zweiten Stufe die Aktion sich erweitert in Richtung auf Vermittlung zwischen Schwerstbehinderten, Tageszentrum, Familie und Gesellschaft.
Von dieser differenziert sich die Kategorie von Mitarbeitern, die allerdings nur in besonderen Fällen auftritt: Therapeuten, die mit psychotischen und autistischen Kindern nicht nur therapeutische Momente, sondern viele Stunden und oft den ganzen Tag zu verbringen haben. Dieses Personal ist von anderen therapeutischen Figuren zu unterscheiden (Physiotherapeuten, Sprachtherapeuten, usw.), die nicht zur Organisation des Tageszentrums gehören sollten, sondern zu den rehabilitatorischen Einrichtungen der zonalen Gesundheitsbehörde.
Vermittlung und Kontakt mit psychotischen und autistischen Kindern sind andererseits ohne psychotherapeutische Bereitschaft und ohne analytisches Training nicht denkbar. Besuchen mehrere solcher Kinder das Zentrum, ist die stundenweise oder totale Einbeziehung des in dieser Richtung ausgebildeten Personals unerläßlich. Zentralfigur der Arbeit um den Schwerstbehinderten ist aber das Personal der »zweiten Stufe«, denn es sollte die vielschichtigste und breiteste Ausbildung erfahren.
Gerade in dieser Kategorie ist es wichtig, der Ausbildung eine Analyse der Motivationen und der eigenen gefühlsmäßigen und kognitiven Einstellung vorauszuschicken. Zu häufig gelangen in diese Berufe Menschen, die die Unsicherheiten des eigenen Ichs mit der Hingabe an andere kompensieren. Gerade in diesem Beruf sind eine große Klarheit über sich selbst und Reife Bedingung. Je geringer diese sind, desto steifer wird z. B. das Anbringen des erreichten Fachwissens, desto seltener wird Flexibilität und Zusammenarbeit. Aber auch eine Klärung der eigenen existentiellen Position behinderten und nicht behinderten Mitmenschen gegenüber, oder die Ausarbeitung eines präzisen Ausbildungsprogramms dürften keine Garantie dafür sein, daß die Probleme der Behinderten und vor allem der Schwerstbehinderten richtig angegangen werden, solange nicht eine Sensibilisierung der Gesellschaft parallel läuft, durch die nicht nur die dem Staate zustehenden finanziellen Aspekte des Problems gelöst werden, sondern auch Grundeinstellungen verändert werden.
Bildungsprogramme und theoretisch erarbeitete Curricula lassen sich leicht darbieten. Ihre Realisierung hängt dann von den Menschen ab, die in einer Umgebung tätig sein sollen, in welcher menschliche Beziehungen überhaupt auf eine harte Probe gestellt werden.
Andererseits ist es aber auch klar, daß eine Ausbildung, die nicht nur therapeutische und pädagogische Kenntnis vermittelt, sondern zugleich auch kulturelle und soziale Aspekte des Zusammenlebens miteinschließt, ein Personal vorbereitet, das seinerzeit auf die Werthaltungen der Gesellschaft Einfluß nehmen kann.
Das in dieser Weise geschulte und durch reale Erfahrung gereifte Personal erlangt durch seine Rolle der Vermittlung, im Gegensatz zu den bisher zur Verfügung stehenden Fachkräften, eine privilegierte Position, die es ihm ermöglicht, durch seinen beruflichen Einsatz und sein persönliches Beispiel, eine neue Art vorzuschlagen, um auf Schwerstbehinderte einzugehen und sie in unser tägliches Leben einzubeziehen. Ähnliches hat sich in Italien durch die Integration behinderter und auch schwerstbehinderter Kinder in die normale Pflichtschule vollzogen: die Probleme sind in das Blickfeld aller gerückt, und auch an den Lösungsversuchen haben sich alle beteiligen müssen. Die Tatsache aber, im Handeln als Erzieher und Vermittler eine soziale Aufgabe zu haben, führt nicht allein zu der Möglichkeit, neue Verhaltensweisen im Zusammenleben vorzuschlagen und durchzuleben, sondern vor allem zu der Auflösung eines Verhältnisses zwischen dem Helfer und dem Behinderten, das in der Isolation einer therapeutischen (meist pseudotherapeutischen) und nur pflegerischen Institution früher oder später zu einer pathologischen Symbiose oder wenigstens zu einer ambivalenten Beziehung führen mußte. Auch die mechanistische Auffassung der Rotation von Personal, der »Ablösung« aus dem Mitleiden und dem Leiden an der scheinbaren Ausweglosigkeit, dürfte, nach allem Gesagten, nicht mehr zur Debatte stehen.
Schmücken wir also mit Luigi einen Weihnachtsbaum.
[22] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/1983, S. 53 - 57.
Der Beitrag von Ludwig-Otto ROSER zur Integrationsentwicklung im Saarland
Aktuelle Entwicklungen und Ereignisse überdecken oft die Vorgeschichte. Das gilt auch für die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher im Saarland, die natürlich wie anderswo eine lange und schwierige Vorgeschichte hat. Hier im Land, aber auch über die Landesgrenzen hinaus wird mehr auf das Erreichte geschaut, das ja auch immer wieder in Frage gestellt und bedroht ist, das nie selbstverständlich ist. Wenn überhaupt die Gegenwart verlassen wird, geht der Blick nach vom: Wie soll es weitergehen? Was wird kommen?
Zurückzuschauen, sich auf Quellen, auf Pioniere und Unterstützer der Integrationsentwicklung zu besinnen, macht dennoch Sinn. Es bedeutet in diesem Fall ein Stück Rekonstruktion der Anfänge der Integrationsgeschichte im Saarland und zugleich die Würdigung des Beitrags einer Person: Ludwig-Otto ROSER hat einen Mosaikstein seiner »Wirkungsgeschichte« im Saarland gesetzt. Rund 15 Jahre liegen die Begegnungen mit ROSER zurück. Einiges ist in lebendiger Erinnerung, anderes verblaßt. Auch wenn die Erinnerung an diese Spuren dünn geworden ist, will ich dem nachspüren, was ROSER - in subjektiver Sicht - an Bedeutung, an Wirkung zukommt.
Wirkung hat prinzipiell zwei Seiten - eine, von der die Wirkung ausgeht, und eine, die »Wirkung zeigt«. Es ist aber nicht so, als wäre das ein einfacher Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Reiz und Reaktion. Die Sache ist komplexer - die Seite, auf die eingewirkt wird, ist dem ja nicht passiv ausgesetzt, sondern aktiv beteiligt an der Wirkung - mit Interesse, Aufgeschlossenheit und Bereitschaft oder mit Verunsicherung, Widerständen und Abwehr.
Ludwig-Otto ROSER ist am 4. Mai 1982 auf Einladung der Arbeitseinheit Sonderpädagogik der Universität des Saarlandes und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - Landesverband Saarland zu einem Vortrag über »Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Florenz« nach Saarbrücken gekommen. Zwei »Welten«, zwei gegensätzliche Realitäten sind dabei in einem Saal zusammengetroffen: einerseits die Integrationspraxis in Italien durch den Vortrag von ROSER und andererseits die separierte Sonderschulpraxis im Saarland als Alltagserfahrung der saarländischen ZuhörerInnen. Was sich damals und in der Folge »bilateral« zwischen diesen beiden Welten getan hat und welche Rolle ROSER dabei gespielt hat, ist einen Rückblick wert.
Die integrationspolitische Situation im Saarland am Anfang der 80er Jahre
Das Ereignis, von dem hier die Rede ist, der Vortrag von ROSER, findet in einer Zeit statt, in der in Deutschland zwar bereits erste Modellversuche zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten SchülerInnen angelaufen sind, aber weithin eine theoretische Integrationsdiskussion vorherrscht. Im Saarland gibt es seit einigen Jahren in der Arbeitseinheit Sonderpädagogik der Universität und in der GEW eine rege Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Thema Integration, zaghafte Initiativen und einen Antrag auf einen integrativen Schulversuch, der abgelehnt wird - es wäre der erste im Saarland gewesen. In der Schulpolitik und -verwaltung herrscht eine strikte Ablehnung gegenüber einer Öffnung der Sonderpädagogik zur Regelschule; die einzige zugelassene Form einer Kooperation der Sonderpädagogik mit Regelschulen sind Sprachfördermaßnahmen, die von Sonderschullehrerinnen als ambulante Leistungen in Grundschulen eingebracht werden. Unter Kolleginnen wird Integration unterschiedlich, gegensätzlich diskutiert. Manche lehnen schon die Idee als Bedrohung der bewährten Praxis in den Sonderschulen ab. Viele Interessierte haben schon Kenntnisse über Integrationserfahrungen aus der Literatur (u.a. auch von ROSER), aber niemand hat Gemeinsamkeit in der Schule selbst praktiziert. Fast allen fehlt es an konkreten Vorstellungen, wie die Integrationsidee wirkungsvoll umgesetzt, wie gemeinsamer Unterricht praktiziert werden kann.
Die andere Wirklichkeit der Integration in Italien
Aus heutiger Sicht erscheint das, was ROSER vor über 15 Jahren über die »italienischen Verhältnisse« berichtet hat, wenig aufregend. ROSER hat den Entwicklungsprozeß der Integrationsbewegung in Italien sachlich und konkret beschrieben. (über den Vortrag liegen zwei Beiträge von CHRIST und GUTHÖRL, beide 1982, vor.) Es ist ein Vortrag, wie ROSER viele gehalten, über dessen Inhalte er mehrfach geschrieben hat. Aber für die damaligen Verhältnisse im Saarland - in Deutschland geht gerade das tendenziöse Wort von der »italienischen Seuche« um - wirkt das Gesagte progressiv, radikal (für manchen revolutionär).
Am Anfang der Entwicklung in Italien steht - wie in Deutschland - der Ausbau der Sondereinrichtungen, begleitet von der sich verstärkenden Erkenntnis, dass der Schonraum der Sondereinrichtungen unweigerlich mit Ausschluß aus den normalen Lebensvollzügen, mit einem »An den Rand drängen« verbunden ist. Die unseligen Nebenwirkungen der »goldenen Käfige« (BASAGLIA) behindern die normale Entwicklung der Menschen mit Behinderung. Ein Beispiel ROSERS wird zum eindrücklichen Bild der »Logik der Sondereinrichtung«, zum »Schlüsselerlebnis«. Es ist das Beispiel vom Schlüsselbrett: Menschen mit geistiger Behinderung trainieren, welche Schlüssel in die unterschiedlichen Schlüssellöcher eines Übungsbrettes passen; in Wirklichkeit haben sie aber keinen Schlüssel ihres Heimes, keinen freien Aus- und Zugang, keine »Schlüsselmacht«.
Die öffentliche Diskussion - ausgehend von Eltern und Fachleuten bis zu immer größeren gesellschaftlichen Gruppen - mündet in eine demokratische Bewegung gegen die Aussonderung, die »anti-emarginazione«. Zunehmend mehr Menschen gelangen zu der Überzeugung, daß Normalität rehabilitiert, daß das Ziel der Integration den Weg der Normalität braucht. Erst nach einer Phase der »wilden Integration« regelt die Gesetzgebung das gemeinsame Leben und Lernen in den Regeleinrichtungen rechtlich und führt zur Auflösung der Sondereinrichtungen. Gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten in der Normalität werden überzeugt und pragmatisch angegangen und auftretende Probleme begleitend gelöst. Theoretische Handlungskonzepte liegen nicht von Anfang an vor, sondern werden auf dem Weg entwickelt wie z.B. der Ansatz der »vorschlagenden Dimension« (MILANI-COMPARETTI).
ROSER belegt mit vielen »Lerngeschichten« behinderter Kinder, welche Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten in der Begegnung mit der Normalität liegen, beschreibt aber auch, wie immer wieder Schwierigkeiten im Einzelfall zu lösen sind. Etwa die Geschichte von dem blinden Kind: Als in der Klasse Fotos gezeigt werden, kann das blinde Kind zwar die glatte und rauhe Fläche der Fotos fühlen, aber nicht die Abbildung wahrnehmen. Die Lehrerinnen machen ihm daraufhin mit Hilfe eines Punktesystems erfahrbar, was abgebildet ist. So begegnet das behinderte Kind in der normalen Situation Dingen seiner Umwelt, lernt sie einzubauen in die Welt der anderen und in seine Welt, lernt diese Realitäten zu verarbeiten, eben auch die Realität, daß es blind ist.
Immer wieder betont ROSER, daß sich die Integrationsentwicklung und -praxis in Italien im Vortrag nur unzureichend wiedergeben lassen, daß man nach Italien kommen und vor Ort erleben muß, um sich ein »wahres« Bild zu machen. Und er stellt klar, daß der Weg zum Ziel heißen muss: Integration im Saarland hier und jetzt anzufangen und zu verwirklichen (»Italien ist kein Paradies für Menschen mit Behinderung«). Soweit Bericht und »Botschaft« von ROSER.
Wirkungen und Folgen
Eine heterogene Gruppe von Zuhörer/innen hört den Vortrag. Die anschließende Diskussion zeigt erste Wirkungen, offenbart Gegensätze. Zwei Lager sind zu erkennen: Die einen geben sich kritisch, zweifelnd bis offen ablehnend - einzelne sind es bis heute geblieben, verweigern oder behindern integrationspädagogische Arbeit. Die anderen lassen sich anstecken, fühlen sich bestätigt und ermutigt - viele von ihnen unterstützen auch heute noch aktiv und engagiert die Weiterentwicklung der Integration. Was sind - abgesehen von den individuellen Voreinstellungen und Interessen der Zuhörer/innen - die (positiven) Wirkungen und Folgen von ROSERS Vortrag?
ROSER informiert - besonnen, offen und ehrlich; er bezieht klar und deutlich Position, nimmt Partei für die Menschen mit Behinderung und die Sache der Integration, ganz selbstverständlich, nicht missionarisch. Durch seine Person, durch seine Art zu reden, zuzuhören, auf andere einzugehen vermittelt er glaubwürdig eine Vorstellung von der Selbstverständlichkeit italienischer Integrationswirklichkeit, mindert Zweifel, stärkt Gewißheit. Er öffnet den Blick über die Enge deutscher Begrenztheit hinaus, schlägt Brücken zwischen »Welten«, Kulturen, Konzepten. Er regt an und belebt die inhaltliche und emotionale Auseinandersetzung und gibt - zum rechten Zeitpunkt- wichtige Anstöße zu neuen Wegen.
In der Folgezeit nach dem Vortrag werden von GEW, Uni und Bündnispartnern starke Integrationsinitiativen in die Öffentlichkeit getragen und die Auseinandersetzung mit den Integrationserfahrungen in Italien und anderen Ländern verstärkt: Literatur wird aufgearbeitet; Seminare, Lehrerfortbildungen und große Podiumsdiskussionen finden statt; Studierende reisen nach Italien und schreiben Arbeiten usw. Was ROSER bei seinem Vortrag angestiftet hat, nämlich die italienische Integrationspraxis vor Ort anzusehen und zu erleben, wird schließlich 1984 verwirklicht: eine neuntägige Exkursion nach Volterra/Toskana mit 42 TeilnehmerInnen (vgl. CHRIST 1985; DECKER u.a. 1984). ROSER hat bei der Vorbereitung der Exkursion beraten und bei der Abschlussbesprechung in Volterra selbst mitgewirkt (Ein eingeplanter zweitägiger Aufenthalt in Florenz konnte aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht werden). Wichtige Ergebnisse dieser Exkursion sind u.a. das gemeinsame Erleben und der intensive Austausch, das Kennenlernen und Verstehen von Anspruch und Wirklichkeit, Organisationsformen und Regelungen, Unterstützungssystemen des italienischen Weges. Und es wird offenkundig, was ROSER schon vorher gesagt hat: die italienischen Lösungsmuster können nicht einfach übertragen werden; wir müssen eigene Wege entwickeln und gehen, wobei die Erfahrungen in Italien eine nicht wegzudenkende Rolle spielen.
Bereits ein Jahr nach der Italien-Exkursion, also 1985, ändert sich durch einen Regierungswechsel die bildungspolitische Lage im Saarland entscheidend: die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher wird zum erklärten Reformvorhaben. Die einsetzende, zeitweise stürmische Integrationsentwicklung folgt lange dem Weg, den ROSER gezeigt hat; die italienischen Erfahrungen, zu denen ROSER Brücken geschlagen hat, gehen in unterschiedlicher Form in den saarländischen Weg mit ein. Im Saarland sind Normalität und Integration für Menschen mit Behinderungen näher gerückt, aber längst keine Selbstverständlichkeit. Die Wiederherstellung und Verwirklichung des Rechts auf Normalität und Teilhabe am gemeinsamen sozialen Leben für alle, auch für die behinderten Menschen ist ein langer, immer wieder steiniger Weg.
Literatur
CHRIST, Klaus: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Florenz. Bericht über den Vortrag von Dr. Ludwig O. ROSER am 4.5.1982 in Saarbrücken. In: Saarländische Schulzeitung (GEW-LV Saarland) 29, 1982, Nr. 10, S. 13-15; Nr. 11, S. 9-10
CHRIST, Klaus: Italienreise - Ein Bericht im Überblick. In: Sonderpädagogik im Saarland (vds-LV Saarland) 17, 1985, Heft 1, S. 3-9 (und 6 weitere Beiträge zur Exkursion nach Volterra von 1984, a.a.O., S. 1-31)
DECKER, Ingrid u.a.: Integration auf italienisch. Modelle und Projekte der Integration behinderter Kinder in Italien. In: Saarländische Schulzeitung (GEW-LVSaarland) 31, 1984, Nr. 9, S. 12-14; Nr. 10, S. 15-17; Nr. 11, S. 12-13
GUTHÖRL, Volker: Damit die Barriere zwischen Behinderten und Nichtbehinderten fällt. Zur Idee der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Italien. In: Arbeitnehmer (Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes) 30, 1982, S. 366-370
Die Förderung der Normalität der behinderten Kinder - Ein Beitrag von Medizinern und Psychologen[23] - Ludwig-Otto Roser
Mir ist aufgefallen, daß man sich meist über den Begriff »Normalität« nicht genügend Gedanken macht. Man sagt so etwas leichthin: Was ist Normalität? Wer ist normal? Sind wir nicht alle ein bißchen normal und ein bißchen nichtnormal? Wo aber fängt das an, und wo hört es auf? Wo liegt der Maßstab, welche Werte setzen wir an? Diese Fragen können einen sehr stark beschäftigen. Wenn man sich z.B. vorstellt, daß ein Mensch zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt wird, ein an sich »normaler« Mensch. Er befindet sich in einer besonderen Situation, kommt in eine Zelle und muß sich darin einrichten, d.h., er muß sich neue Lebensziele, neue innere Ziele setzen. Er muß, um diese Situation durchstehen zu können, ohne an einer Depression zugrunde zu gehen, sich selbst Aufgaben stellen, ein anderer Mensch werden. Er muß mit der Behinderung fertig werden, muß einen Weg finden, mit der Behinderung von Kontakten mit der Außenwelt abgeschnitten zu sein, zurechtzukommen, muß sein Leben neu gestalten. Dabei fällt mir ein italienischer Dichter ein, der sich einen neuen Lebensraum geschaffen hat, indem der Tagesrhythmus normal verlief. Er, ein behinderter, verhinderter und ausgesonderter Mensch, hat sich das geschaffen, damit das Leben in irgendeiner Weise weitergeht.
Ich habe dieses makabre und etwas schreckliche Beispiel gewählt, weil es vielleicht einen Begriff der Relativität des Begriffs »Normalität« gibt und uns zeigen kann, wie man auch in sogenannten »nicht-normalen« Situationen einen Weg finden muß, also eine Normalität in der Anormalität. Und wenn wir von Qualität sprechen, müssen wir auch an die Gaußsche Kurve erinnern, die mathematisch die Normalität beschreibt.
Wenn ein Kind unterwegs ist, erwarten die meisten Eltern nicht nur die durchschnittliche Normalität, sondern in das werdende Kind werden unbewußt oder bewußt die Träume der Eltern projiziert, die sich in einem besonderen und überdurchschnittlichen Bereich verwirklichen sollen. Wenn das Kind dann geboren wird, ist die Erwartungsspannung unglaublich groß, es besteht oft die Angst, ob das Kind auch normal sein wird. Wenn es auf der Welt ist, gibt es ein Aufatmen, wenn keine Schwierigkeiten überwunden werden mußten, wenn sich das Kind sozusagen normal präsentiert. Dabei ist aber überhaupt noch nichts über sein künftiges Leben ausgesagt. Aber es hat die Augen offen, ist rosig, hat keine Defekte, und alle sind froh darüber.
Das ist natürlich nicht so, wenn sofort nach der Geburt des Kindes oder kurz darauf sogenannte Anomalien festgestellt werden. Beim Down-Syndrom (Mongolismus) ist es sofort sichtbar, bei motorischen Störungen oft nicht. Auch bei größeren körperlichen Defekten kann man sofort sehen, was vorliegt. Sinnesbehinderungen sind auch oft nicht sofort zu erkennen, aber sie treten meistens sehr bald zutage.
Diese Konfrontation der Realität des behinderten Kindes mit den Vorstellungen, die die Eltern von dem Kind haben, bestimmen viel stärker das zukünftige Leben des Kindes als die wirkliche Behinderung. Die Behinderung eines Kindes ist eingebettet in die Welt unserer Erwartungen, in die Welt der Kultur, in der wir leben. Die Behinderung des Kindes wird dann gemessen an dem, was wir für seine Zukunft erwarten und welche Anforderungen im normalen Lebensbereich gestellt werden. Da entsteht dann sofort die große Forderung danach, wo etwas nicht »normal« ist - ich sage dieses Wort immer in Anführungszeichen -, da muß es »normal« werden. Da muß alles getan werden, dieses »Nicht-Normale« zurechtzurücken, zurechtzuturnen, es zu reparieren und in irgendeiner Weise der von uns postulierten »Normalität« so nahe wie möglich zu bringen.
Wer öfters Kontakt mit Eltern gehabt hat, als sie bei ihrem Kinde eine Behinderung entdeckten und sich der Behinderung bewußt wurden, der weiß, was es bedeutet, was dieser Augenblick der Wahrheit bedeutet, was dieser riesige Kontrast zwischen der Erwartung der Eltern und der vorhandenen Behinderung bedeutet, und wie schwer es ist, auf all die vielen Fragen zu antworten, Fragen, die sich nicht nur auf das Jetzt, sondern auf die Zukunft des Kindes beziehen.
Sofort wird das Kind nicht als ein Kind mit einer Schwierigkeit gesehen, sondern es wird als ein schwieriger, als ein halber Mensch gesehen. Es wird sofort hineinprojiziert in das Leben, in den Beruf, in die sozialen Gegebenheiten unserer Umgebung. Was wird eines Tages aus diesem Kinde werden? Diese Frage ist so gewaltig, daß alles herangezogen wird, die Situation des Kindes zu verändern.
Wir haben in unserer Arbeitsgruppe in den vielen Jahren die Erfahrung gemacht, daß gerade dann, in diesem Augenblick, in dieser Situation, Fehler gemacht werden, die sehr viel größer sind als die Behinderung selbst. Die Fehler beziehen sich hauptsächlich auf die emotionale Ebene des Individuums. Wird das Kind ein Kind werden, das seiner selbst sicher ist, wird es ein Kind, das sich in irgendeiner Weise anpassen und ausgleichen kann? Diese Frage muß mit Nein beantwortet werden, wenn wir von vornherein als Eltern und als Fachleute dem Kind, so wie es ist, negativ gegenüber stehen. So darfst du nicht sein! So wie du bist, kannst du nicht leben. So bist du nur ein halber Mensch, und deshalb mußt du dieses tun, und du mußt turnen. Wir werden dir hier keinen Raum zum Leben lassen, denn die Reparatur ist lange und schwerwiegend.
Wir wissen alle, welch eine große Bedeutung das erste Lebensjahr für das Gefühlsleben eines Kindes hat, vergessen dies aber sofort, wenn es sich um ein behindertes Kind handelt. Denn wie sonst könnten wir es akzeptieren, ein behindertes Kind täglich zu traktieren, es turnen zu lassen, zu bombardieren, überlegen uns aber nicht, welches die gefühlsmäßigen Möglichkeiten der Verarbeitung dieses Reparationsdruckes des Kindes sind. Und was bedeutet es für ein Kind, ständig zu erleben, daß es den Eltern im Grunde so, wie es ist, nicht gefällt? Würden sich die Eltern sonst eine solche Mühe geben, es anders werden zu lassen, als es ist? Wenn man nun bedenkt, daß sich das ja nicht nur im ersten Lebensjahr vollzieht, sondern daß da eine Serie von sonderpädagogischen Bemühungen vorhanden ist, dann ist es nicht einmal die Frage des ersten Lebensjahres, sondern der Beginn eines Planes, der praktisch gar keine präzise Zielsetzung hat. Natürlich hat der Plan das Ziel, alles zu tun, damit das Kind »normal« werden wird. Das ist aber nur ein allgemeines Ziel. Wir überlegen uns jedoch nicht, wann, wie und wozu wir dieses alles tun. Das Kind ist ein spastisches Kind, also muß es turnen. Es muß eine Sprachtherapie haben, sonst wird es nicht lernen zu sprechen. Es muß dies und jenes tun, dann wird man sehen, und wenn es in zehn Jahren immer noch nicht repariert ist, dann geht das noch zehn Jahre so weiter. Vielleicht kann es gar nicht repariert werden, und es muß eben unter kaputten Autos leben. Verzeihen Sie, daß ich hier Ausdrücke aus der Maschinen- bzw. Autowelt gebrauche. Es muß dort leben, wo Menschen sind, die den Anschluß an die gegebene Realität nicht finden konnten und können.
Wie kann man dies verhindern? Sie werden nun sagen: In Wirklichkeit ist es ja gar nicht so schlimm, wie es hier dargestellt wurde. Wenn man als Heilgymnastin behutsam mit dem Kind umgeht, wenn man vorsichtig ist, wenn man sich genau überlegt, was man tut, daß man den Defekt nicht zu stark angreift, und auch entwicklungspsychologisch arbeitet, wenn man genügend Streicheleinheiten gibt, dann sind die körperliche und die gefühlsmäßige Seite gegeneinander ausgewogen. Dann kann sich auch das Kind weiterhin ein bißchen Mühe geben, besser zu werden und sich reparieren zu lassen, ohne daß der Bruch zwischen Kind und Erwachsenem vollzogen wird. Das mag ja in vielen Fällen auch so sein. Mir ist auch klar, daß ich hier eine Art Schwarz-Weiß-Malerei betreibe, und daß die Realität vielleicht sehr viel mehr Nuancen hat, die nicht so stark zu kritisieren sind. Ich habe aber so schwarz-weiß gemalt, um Ihnen einen Weg anzudeuten, der nach unserer Erfahrung eine bessere Beziehung des Individuums zu seiner Behinderung herstellen kann.
Professor MILANI-COMPARETTI sprach vor einigen Jahren in Hamburg und auch hier in Berlin von dem Begriff der positiven Semiotik, d.h. er meint, daß wir zwar sehr realistisch sein müssen, daß wir genau feststellen müssen, was das Kind hat, welche Behinderung vorliegt, aber wir dürfen nicht nur um diese Realität herum arbeiten. Wir müssen nicht nur mit den Eltern arbeiten, um sie zu trösten, sondern wir sollten versuchen, als Fachleute nicht mit einem spastischen Kind zu arbeiten; sondern mit einem Kind, das eine motorische Störung hat; nicht mit einem mogoloiden Kind, sondern mit einem Kind, das einige geistige Probleme mit der Verarbeitung seiner Umwelt haben wird. Diese Voraussetzung bringt uns dann dazu, nicht nur das zu sehen, was es nicht kann, sondern und vor allem auch das zu sehen, das zu verstehen, was das Kind kann. Das ist die Theorie, die ich Ihnen vorlegen wollte. Es genügt eben nicht, eine neuromotorische Untersuchung zu machen und festzustellen, daß diese oder jene Reflexe nicht vorhanden sind, daß das Kind auf diese oder jene Reize nicht reagiert. Es ist unglaublich wichtig für das Gleichgewicht der Eltern, daß wir als Fachleute so handeln, daß wir ihnen sagen, das eine kann es zwar nicht, aber das andere kann es. Hier liegt zwar etwas vor, aber dort liegt nichts vor, so daß wir von Anfang an einen positiven Ansatzpunkt bei unserer Arbeit mit den Eltern haben, daß wir mit den Eltern nicht an der »Reparatur« der Defekte arbeiten, sondern an der Förderung des seelischen Gleichgewichts. Wir müssen darauf hinarbeiten, daß die Eltern an ihrem Kind Dinge entdecken können, die positiv und die liebenswert sind, daß die Eltern mit dem Kind Momente erleben können, die ihr Bedürfnis in irgendeiner Weise befriedigen.
Wie kommt es nun zu dieser positiven Bedeutung? Wie kann sich das vollziehen? Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer sehr wichtigen Aktion, die wir als Dialog bezeichnen. MILANI-COMPARETTI spricht sogar von einem möglichen Dialog mit dem Fötus. Der Fötus hat mit dem Uterus einen Dialog. Was der Fötus tut, weiß der Uterus, das Kind arbeitet an der Geburt mit. Das beginnt nicht erst im Augenblick der Geburt, sondern geschieht schon lange vorher. Schon sehr früh bestehe eine Wechselbeziehung zwischen dem werdenden Kind und der Mutter, die es in ihrem Leibe trägt. Dieser frühe Dialog ist auch der Kernpunkt der späteren nachgeburtlichen Beziehung. Es ist sehr wichtig, daß ich die Möglichkeit habe, mein Kind zu verstehen, seine »Sprache« zu verstehen. Ein Kind spricht vom ersten Augenblick an in einer nichtverbalen Sprache, kann sich in dieser Sprache äußern. Wenn wir den Eltern helfen, diese nichtverbale Sprache von Anfang an einzusetzen, einen Dialog aufzubauen, dann werden die Eltern auch sofort spüren, daß es Normalitäten in ihrem Kinde gibt, daß ihr Kind eine lebendige Wirklichkeit ist, die sich auch allmählich erweitern kann, zu einer nicht und mit niemandem zu vergleichenden Realität. Der Vergleich ist notwendig. Das Kind ist ein lebendes Wesen, das, wenn man es richtig erkennt und einstuft, seine eigene, seine persönliche Normalität erleben kann, sei es auch noch so gefangen in seiner Behinderung. Wenn wir in der Lage sind, es zu seiner eigenen Normalität zu führen, dann wird es frei, dann wird es fähig, sich auch unter den anderen zu bewegen.
Nun muß ich Ihnen auch gleich sagen, daß es sehr, sehr schwierig ist, im ersten Lebensjahr Normalität zu entdecken, wenn die Sorge im Hintergrund steht, daß nicht alles »normal« ist. Es ist so schwierig, daß man sich immer wieder gleichsam dazu zwingen muß, um zu sehen, was das Kind an eigenen Möglichkeiten anbietet. Ich habe da nun meine eigenen Erfahrungen als Psychologe. Meine Technik ist es z.B., nicht sofort als Psychologe aufzutreten, wenn bei uns im Ambulatorium die Behinderung eines Kindes erkannt worden ist. Wenn z.B. der Neurologe die Notwendigkeit ganz bestimmter physiotherapeutischer Techniken andeutet oder auch psychopädagogische Techniken in Erwägung zieht, wenn es sich als notwendig erweist, auf der Sprach- und Sinnesebene ganz bestimmte Techniken einzusetzen, sollte der Psychologe nicht in jedem Fall auftauchen, sondern nur da, wo er bereits die Möglichkeit hatte, vorher das Kind beobachtet zu haben, ohne daß eine diagnostische Situation bestand. Wenn es nötig ist, kann der Psychologe im Hintergrund bleiben, er kann vor allen Dingen beobachten.
Das ist sehr wichtig. Denn wenn wir nicht so handeln, wenn wir sagen, ein Kind muß dieses und das und jenes tun, dann sind wir diejenigen, die die Normalität bestimmen, und wir sagen, was wir tun müssen, um die Normalität zu erreichen. Aber das sind unsere Normalitäten, es sind nicht die Normalitäten, die im Kinde vorhanden sind, die es uns aufzeigen kann. Deshalb ist es also wichtig, daß ich nicht mit unseren Schemata, mit unseren Vorstellungen von Normalität an das Kind herantrete. Wenn ich sage: Ein Kind von drei Jahren muß ein kleines Männchen zeichnen können, ein vierjähriges Kind muß ein bestimmtes räumliches Vorstellungsvermögen haben, es muß dieses können, es muß jenes können. Dann bin ich derjenige, der das weiß, daß es das können muß. Aber das Kind weiß es deshalb noch lange nicht. Wir sagen, was es tun muß. Viele sagen, die Hauptsache ist, daß ich weiß, was es tun muß, das Kind muß es ja gar nicht wissen. Es muß durch diesen Engpaß hindurchgehen, um seine Ziele und seine Lebensmöglichkeiten zu beweisen. Es ist also ein Fehler, nicht von dem Kinde auszugehen. Ich muß, wenn ich dem Kinde gerecht werden will, es von ihm ausgehend beobachten, einen Dialog einleiten, seine Sprache verstehen, seine Bedürfnisse ermessen, seine Möglichkeiten abwägen, also auch in der Lage sein, als Fachmann eine Prognose aufzustellen, ob dieses Kind wohl eines Tages wird lesen können. Vielleicht kann ich das auch ausschließen. Vielleicht ist das für dieses Kind nicht so wichtig, wie es andere Dinge sind. Kann ich dann in diesem Fall mit dem Kind auf einem Gleis fortfahren, auf dem man konsequent weiter versucht, dem Kind Lesen und Schreiben beizubringen?
Immer muß ich versuchen zu verstehen, was das Kind mit dem, was es innerlich fühlt, leisten kann, was es mir geben kann. Es muß also ein Dialog entstehen, daß das Kind mir sagt, was es kann und was es möchte. Und ich sage ihm, was ich möchte. Aber es muß möglich sein, sich am richtigen Punkt zu treffen. Es ist also nicht so, daß ich mich da nur hinsetze und warte, bis das Kind spricht und mir sagt. Sondern: Ich muß dem Kind auch sagen können: »Das möchte ich von dir, wenn du es kannst.« Zu diesem Dialog sollte man fähig sein, und so sollte man handeln. Man sollte sich aber nicht darauf einstellen, wenn es das noch nicht tun kann. Ich sage: noch nicht. Denn beim entwicklungsbetonten Arbeiten bleibe ich ja nicht aus dem Spiel. Ich schlage ihm immer wieder etwas vor, was es vielleicht in seiner Entwicklung gebrauchen kann. Dieses Warten, Beobachten, Abwarten, Zuschauen bedeutet jedoch nicht, daß ich es nicht fördere. Im Gegenteil: Wenn ich die Geduld habe, bei einem Kind ganz bestimmte Fähigkeiten ausreifen zu lassen, fördere ich diese Fähigkeiten viel besser, als wenn es vorher durch die Frustation gegangen ist, die dadurch entsteht, daß wir von dem Kind etwas verlangen, das es noch nicht kann. Wir sollten also auf sein Zeichen warten.
Mir fallen dazu zwei Jungen mit Down Syndrom aus meinem Arbeitsbereich ein, die gleich auf die Regelschule gekommen sind. Einer ist Lukas der andere ist Markus. Hier sind zwei Beispiele, die uns ganz klar zeigen, wie verschieden sich zwei fast identische Krankheitsbilder entwickeln, wenn man sie auf der einen Seite mit der beobachtenden, abwartenden und nicht zu stark fördernden Methode und auf der anderen Seite mit einer reflexiologischen Abrichtungsmethode behandelt, die dem Kind keinen eigenen Raum läßt, sondern nur das verwirklicht, was der Erwachsenen möchte. Markus ist ein Einzelkind von einem Elternpaar, das es nicht geschafft hat, die Realität eines behinderten Kindes innerlich zu verarbeiten. Es ist ihr ganzes Bestreben, alles zu tun, daß Markus nicht mehr wie ein mongoloides Kind aussieht, lebt und dadurch Schwierigkeiten mit der Umwelt hat. Er wußte mit sieben Jahren alle italienischen Autokennzeichen auswendig; und das sind wohl etwa fünfundfünzig. Dafür hat sein Vater gesorgt. Er weiß unglaublich viel auswendig. Er hat gespürt, daß seine Eltern mit ihm Probleme haben und von seinen Lehrern verlangt, daß er das Mathematikbuch vorgelegt bekommt. Während die anderen Schüler ihre Mathematikarbeit schreiben, schreibt auch er seine Mathematikarbeit, ohne etwas Sinnvolles aufs Papier zu bekommen, weil er damit große Schwierigkeiten hat. Die Eltern zu Hause sind formal zufrieden, weil ja die Mathematikarbeit - auch wenn sie nicht gelungen ist - im Heft steht. Dieser Junge erlebt die Schule in einem Zwiespalt zwischen den Lehrern, die ihm helfen wollen, in seiner eigenen Dimension zu arbeiten, und den Eltern, die im Gegensatz dazu das Kind in eine Situation bringen wollen, die zwar ihrem Begriff von Normalität entspricht, aber leider nicht den realen Möglichkeiten des Kindes. Markus beginnt unruhig zu werden, er schafft es nicht mehr, fünf Stunden in der Schule zu sitzen. Das Problem ist nun nicht mehr das der geistigen Verarbeitung des Lernens, der geistigen Förderung, sondern für das Kind besteht hauptsächlich das Problem: »Was kann ich tun, um nicht auf der Ebene des Liebesbezuges verlassen zu werden?« Es ist also ein ganz anderes Problem.[24]
Lukas dagegen hatte ganz andere Voraussetzungen. Er hat Geschwister und ist in einer Familie aufgewachsen, die dieses »Unglück« mit sehr viel Weisheit aufgenommen hat, aber doch die Vorstellung hatte, mit Lukas unheimlich viel tun zu müssen, ihn formen, erziehen, abrichten zu müssen. Und das, was er nicht verstehen konnte, weil er geistig dazu nicht in der Lage war, wurde ihm dadurch beizubringen versucht, daß er den Po verhauen bekam, wenn er bestimmte Sachen nicht machen konnte. Dann kam Lukas in unser Ambulatorium, und wir fingen zunächst einmal an, den Eltern ihr Kind zu zeigen: Nun schaut einmal, wie Lukas lacht, und wie fröhlich er ist, und was er für lustige Sachen sagen kann, und wie er geschickt spielt, wie erlebnisfähig er ist, wie er selbst versucht, Erlebnisse zu haben. Das war schon ziemlich spät. Lukas war damals drei Jahre alt, und das alles kann man schon im ersten Lebensjahr machen. Das hat die Eltern gewundert. Wieso? - Aber es ist doch ein mongoloides Kind!? Ja, aber er ist ein Kind, das Erlebnismöglichkeiten verschiedenster Art hat. Und diese Eltern haben das verstanden. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, daß die Eltern fast drei Jahre lang jede Woche in mein Ambulatorium kamen. Wir haben lange darüber gesprochen, was wohl aus und mit ihm werden soll. Auf jeden Fall aber wird er bestimmt ein herzensguter und netter, lustiger Mensch.
Lukas, der in derselben Schule und in der gleichen Klassenstufe wie Markus ist, hat im ersten Jahr ein paar Verhaltensschwierigkeiten gehabt, weil er einfach zu lustig war. Er hat alles ein bißchen auf die leichte Schulter genommen, konnte noch nicht richtig das Lesen und Schreiben lernen. Aber die Lehrer in dieser Schule haben wirklich sehr gut mitgearbeitet und angefangen, ihn für ganz bestimmte Dinge zu interessieren. Also Lukas ist in diesem Jahr eine Bombe, denn er ist zur Mathematiklehrerin gegangen und hat gesagt: »Ich möchte auch Mathematik lernen!« Die Lehrerin hat angefangen, ihm leichte Rechenaufgaben zu geben. Und er kommt nach Hause und sagt zu seiner Mutter: »Ich möchte gerne die Aufgaben für meine Mathematik machen!« Während Markus, wenn er die Mathematik nur sieht, anfängt aufzuschreien und auf seine Eltern einzuschlagen. Mit Recht, ich sage: mit Recht, von ihm aus gesehen.
[23] Dieser Text wurde erstmals veröffentlicht in: PREUSS-LAUSITZ, Ulf/RICHTER, Uwe/SCHÖLER, Jutta (Hrsg.): Integrative Förderung Behinderung in pädagogischen Feldern Berlins 1985, S. 72-86. Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den Ludwig-Otto ROSER am 28.11.1984 an der Technischen Universität Berlin vorgetragen hat.
[24] Über die weitere Entwicklung von Lukas und Markus berichtet Otto ROSER auch etwas ausführlicher im Text: Gegen die Logik der Sondereinrichtungen.
Ein unbequemer Mensch[25] - Ludwig-Otto Roser
Erinnerung an Prof. Dr. Adriano MILANI-COMPARETTI
Partisan, Kinderarzt, Neurologe und Psychiater, Spezialist der Neuromotorik und Professor der Naturheilkunde und Rehabilitation, Präsident der International Palsy Society von 1973 bis 1978, Direktor verschiedener Rehabilitationseinrichtungen für Körperbehinderte in Florenz; in Deutschland bekannt durch seine Vorträge in Münster, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Prof. Dr. Adriano MILANI-COMPARETTI ist am 12. April 1986 im Alter von 66 Jahren gestorben. Ein unbequemer Mensch. Aggressiv und kompromißlos gegen alle, die in ihrer Arbeit mit Kindern deren Rechte und deren Realität nur als vordergründig erlebten, warm und verständnisvoll dagegen, wo er den Menschen spürte, der sich um Wahrhaftigkeit bemühte. So habe ich ihn 1954 kennengelernt, so ist er bis zu seinem Tode geblieben. Unermüdlich »dalla parte del bambino«, auf der Seite des Kindes, vor allem des behinderten Kindes und der betroffenen Eltern.
1954 war MILANI-COMPARETTI Assistent der neurologischen Abteilung der Florentiner Kinderklinik: An diesem Treffpunkt menschlichen Leidens war er der Ansicht, daß der Arzt von Mitarbeitern umgeben sein sollte, die nicht nur das Nervensystem im Kopf haben, sondern in der Lage sind, den Blick auf die mitmenschlichen Beziehungen, auf die Entwicklung des Individuums und auf seine ganzheitliche Erziehung zu richten. Aus dieser Zeit stammt meine Freundschaft mit MILANI-COMPARETTI. Damals schon erregte er im Establishment der Klinik großes Ärgernis: Im Vordergrund stand für ihn das leidende Kind und nicht die Karriere, nicht der Versuch, sich Privatpatienten zu verschaffen, nicht nur das Wissen um den neurologischen Befund, sondern das Vertrauen in die Kreativität des Kindes und die Möglichkeiten, eben diesen Befund zu überschreiten. Den Blick in die Zukunft gewendet, mit seinen Intuitionen immer allen weit voraus, überzeugter Demokrat im Dienste der Kollektivität, wurde er von den Kollegen der Ketzerei bezichtigt, als unbequem empfunden. Unfähig, sich der Autorität des Chefs zu beugen, hat er bald die Uniform des Arztes, den weißen Mantel, ausgezogen, um sich den behinderten Kindern, vor allem den Körperbehinderten zuzuwenden. Das Studium der Motorik und ihrer Behinderung wurde ihm zur Lebensaufgabe. Niemals hat er sich seit dieser Zeit Kindern und Eltern durch den weißen Mantel kenntlich gemacht.
MILANI-COMPARETFI ist als Mensch und Wissenschaftler nicht zu verstehen, sein Lebenswerk nicht in den Griff zu bekommen, wenn man nicht diese beiden Aspekte seiner Persönlichkeit nebeneinanderstellt: seine kompromißlose Suche nach der »sich entwickelnden Wahrheit« und seine große Zartheit im Umgang mit Kindern. Mit dem gleichen Respekt vor der Individualität des Erwachsenen, vor allem seiner Mitarbeiter, aber auch derer, die ihn anfeindeten, »berührte« er, »erfaßte« er die Kinder, die ihm zur Untersuchung gebracht wurden. Sie wurden nicht wie ein Paket abgeklopft, umgedreht oder geschüttelt. Sein stärkstes Bedürfnis war der Dialog. Seine Hände sprachen mit den Säuglingen, wie es oft selbst die Mutter nicht vermochte; ein Spiel, in dem er sehr bald in den Vordergrund rückte, was das Kind für Fähigkeiten hatte. Eltern, die mit einem Kind kamen, das so Vieles nicht konnte, erlebten es von einer ganz neuen Seite. Die Angst vor vermutlicher Behinderung hatte ihnen den Blick getrübt, denn dem »Arzt« wird doch das defekte Kind gebracht: Es geht um Arme und Beine, die sich falsch bewegen, nicht um das Kind selber. Der Teilhaftigkeit fast allen ärztlichen Handelns stellte MILANI-COMPARETTI die Ganzheitlichkeit erst des Kindes und dann seines Verhältnisses zur Umwelt gegenüber. Dabei hatte er seit den ersten Tagen seiner Tätigkeit mit behinderten Kindern das kulturelle, soziale und psychologische Drama der Angehörigen mit einbezogen, sowohl in der Vermittlung der Wahrheit, auch der schlechten, als auch in der Hoffnung auf Entwicklung und durch den Vorschlag, Behinderung zu verstehen, zu akzeptieren und zu kompensieren. Er sprach von der »positiven Semiotik«, der Suche nach den positiven Zeichen, die das Kind auszudrücken vermochte.
1956 erhielt MILANI-COMPARETTI vom italienischen Roten Kreuz den Auftrag, ein Zentrum für die Rehabilitation körperbehinderter Kinder in Florenz aufzubauen. Sogleich umgibt er sich mit Mitarbeitern, die ihm helfen sollen, das Zentrum zu einem Kinderhaus werden zu lassen, in dem es für die Kinder alle nur erdenklichen Möglichkeiten gibt, sich zu äußern, sich trotz der Behinderung autonom zu bewegen, zu spielen und zu lernen. Heute ist uns dies selbstverständlich, aber damals galt es, das Primat des Kurierens als Privileg des Arztes gerade in diesem Bereich einzudämmen. MILANI-COMPARETTI empfand sich als Erzieher, als Vermittler zwischen einer bewegungsbehinderten und einer Bewegung erwartenden Realität. Dies hat ihm viel Feindschaft von seiten seiner Kollegen eingebracht und viele hätten ihn gerne der Unwissenschaftlichkeit bezichtigt. Selbst vor kurzem empfand ihn eine Würzburger Professorengruppe, im Stile der Faustschen Wagnerfigur, als Mann ungenügender theoretischer Unterbauung: Sie nannten ihn in ihrem Bericht einen Rehabilitationsguru. Mit solchen Menschen hat es MILANI-COMPARETTI auch in Italien sein ganzes Leben lang zu tun gehabt. Erst in den letzten Jahren haben ihn die jungen Kinderärzte in Florenz verstanden. Die Wahrnehmung des Ganzen, seine Intuitionen auf psychologischem und pädagogischem Gebiet, seine Theorien der menschlichen Bewegungsabläufe und ihrer Entwicklung stammen dagegen sowohl aus einer genauen Kenntnis der Weltfachliteratur als auch aus dem Verständnis der Grenzbereiche bis hin zur Philosophie. Kinder - Erwachsene - Gesellschaft - Kultur - ein einziges Gewebe, in dem es Auswege des möglichen Leidens zu suchen gilt. MILANI-COMPARETTI war im Sinne des Philosophen BLOCH ein Mensch der sich entwickelnden Zukunft: Es ist noch nicht, aber es enthält die Möglichkeit des Werdens. Auch sein Suchen war oft durch das »noch nicht Bewußte« bestimmt. Auf die Frage eines deutschen Studenten: »Ja, woher wissen Sie das, wo steht das geschrieben?«, antwortete Milani-Comparetti in seinem guten Deutsch: »In meinem Unbewußten, in meinem Kopf«.
1957 wurde das »Centro di Educazione Motoria Anna Torrigiani« eröffnet. Aus diesem Zentrum heraus haben sich die Florentiner Rehabilitationseinrichtungen für Körperbehinderte und dann zahlreiche ähnliche Zentren in Italien entwickelt. Es bedeutete nicht nur die Verbreitung einer wissenschaftlichen und pädagogischen Methode, sondern einen politischen Kampf: die Hochburgen traditioneller Medizin, die Barone der Orthopädie oder der Pädiatrie, die Weisen der Sonderpädagogik, das auf Krankheit eingestellte Gesundheitswesen standen den im Lebensbereich der Behinderten entstehenden, vom Staat finanzierten Ambulatorien feindlich gegenüber. MILANI-COMPARETTI ging es darum, Kinder und Erwachsene so wenig wie möglich zu »medikalisieren«, d. h. nicht im hochdifferenzierten Spezialistenlabyrinth verirren zu lassen. Er suchte das tägliche Leben als »Therapie«, von den natürlichen Bewegungen und Verhaltensweisen im Mutter-Kind-Verhältnis (wie sie schon D. W. WINNICOTT beschrieben hatte[26]) bis zum selbstverständlichen Kontakt mit der sozialen Umwelt. Malen und Zeichnen, aber nicht Musik-»therapie« oder (so wenig wie möglich) Sprachtherapie, sich im Alltag beschäftigen aber nicht Beschäftigungs-»Therapie«.
So stellt er die drei politischen Linien des Gesundheitswesens gegenüber:
-
traditionelle Linie - maximale Entwicklung des Krankenhaus- und Fürsorgewesens, das durch die Existenz des Kranken lebt und gedeiht;
-
Linie der Rationalisierung und der Spezialisierung - der Handlungsbereich des Gesundheitswesens und der Fürsorge ist von der durch die Institutionen gewollten Sozialkontrolle bestimmt und wird durch die Fachleute determiniert;
-
MILANI-COMPARETTIS Linie - größtmögliche Einschränkung des Krankenhauswesens und der Fürsorge durch gesundheitliche und soziale Maßnahmen, die sich auf der Kenntnis des »natürlichen und sozialen« Menschen fundierten und von den individuellen und kollektiven Bedürfnissen des Individuums ausgehen.
Also vor allem: Kenntnis der realen Bedürfnisse und Vorsorge. Und in der Kenntnis besonders die Früherkennung. Diesem Thema hat MILANI-COMPARETTI die ersten zehn Jahre seiner wissenschaftlichen Tätigkeit gewidmet. Er nahm zunächst Abstand von der reflexologischen Diagnose, um sich dem Studium der Logik von Bewegungsbildern zu ergeben. Gerade auf der Suche nach dem phylogenetischen und ontogenetischen Sinn von Bewegung hat sich ihm die Ganzheit des Individuums offenbart. Die Entwicklung der Motorik, die logische Erfassung von »Patterns«, der in ihnen enthaltene Sinn führte zu einer Methode der Erfassung, die erst nach zehn Jahren von italienischen Kinderärzten und dann schließlich von vielen ausländischen Schulen adoptiert worden ist: die Motoskopie. Es ist hier nicht der Ort, ihre weitreichende Systematik zu erklären, noch steht es mir zu, die sich aus ihr entwickelnde Analyse der Fötalbewegung und die entsprechende, für das Verständnis der motorischen Behinderung ausschlaggebende neurologische Theorie zu erläutern. Den Psychologen interessiert die menschliche Dimension, die sich im Verhalten zum Kinde aus diesen Arbeiten entwickelt hat. Sie ergibt sich aus der Beobachtung, daß jedes Lebewesen über das elementare Reiz-Antwort-Schema hinaus eine eigene Möglichkeit der Interpretation der Reize und ihrer Beantwortung besitzt. Diese Möglichkeiten sind nicht nur zu respektieren, sondern therapeutisch zu aktivieren. Wir sagten schon, daß MILANI-COMPARETTI vornehmlich nach dem suchte, was ein Kind als einmaliges und lebenswilliges Individuum kann, um sich zu bewegen, um sich zu äußern, um den Kontakt mit seiner Umwelt aufzunehmen, und nicht nur nach Behinderungen, um diese diagnostisch einzustufen. Zwischen dem Kind und denen, die ihm helfen wollen, entsteht ein Dialog, der sich aus den Vorschlägen der Umwelt und den Vorschlägen des Kindes (seinem Wollen und seinen Möglichkeiten) in einer sich nach oben in der Entwicklung erweiternden Spirale vollzieht; nicht so sehr also Diagnose der Behinderung und Arbeit am nicht normalen »Teilaspekt«, wie wir schon sagten, sondern Verständnis der individuellen und sozialen Ganzheit in der Prognose. Therapie also nur im Hinblick auf das mögliche Werden, und dies auch nicht in der Beachtung der Grenzen, die durch den neurologischen Befund gegeben sind, sondern der Einstellung, die sich im Individuum diesem Befund gegenüber entwickelt.
Das Studium der fötalen Bewegungen krönte die Überzeugung, daß das Kind schon im Mutterleib sich seiner angelegten motorischen Möglichkeiten bedient, um »mitzuarbeiten«; schon im Mutterleib aber ist es »protagonista« und spielt die Rolle seines einmaligen Temperaments. Es ist schon darauf angelegt, z. B. die durch die Schwerkraft bedingten Positionen zu kompensieren, die Art und Weise dieser »Antworten« werden aber schon durch seine Persönlichkeit bestimmt, und schon ist es nicht mehr allein ein Reiz-Antwort-Mechanismus, sondern ein eigenes Wesen, in dem sich Spielräume für ganz persönliche Erfindungen erahnen lassen. Hieraus entwickelt MILANI-COMPARETTI seine Auffassung, daß Therapie nur eine Beihilfe in der Beachtung des im Kinde enthaltenen Entwicklungswillens und dessen individueller Varianten sein kann. Daher auch die These, daß nicht der Normalisierungswille der Eltern, der Spezialisten und der Therapeuten im Vordergrund stehen darf, denn dieser isoliert das Kind und läßt es sich als krank erleben; im Vordergrund sollte vielmehr die Auseinandersetzung des Kindes mit der normalen Umwelt stehen, durch die allein sich ein korrekter Dialog entwickeln kann.
So empfand MILANI-COMPARETTI in seinem Werdegang vom »heilenden« Arzt zum therapeutischen Erzieher den Begriff »Integration« des Behinderten als immer fragwürdiger. Das Nichtnormale beseitigen, damit die Normwelt das Individuum in seine Reihen eingliedern kann, ist nicht nur illusorisch, es verhindert den Prozeß der Anpassung und der Entwicklung des alternativen Potentials. Die Eltern (und die Gesellschaft) übergeben dem Spezialisten das Kind zur Reparatur, es geht aber nicht um die Würde des Kindes, sondern um die Angst, es könne in seiner Unvollkommenheit nicht akzeptiert werden. Diese Ängste und der archaische Widerstand der Gesellschaft gegen alles »Nichtnormale«, aber auch der naturwissenschaftliche Optimismus behavioristischer Prägung, wurden zum Treibstoff der Sondereinrichtungen. MILANI-COMPARETTI selbst hat bei ihrem Aufbau mitgemacht, wie er beschämt immer wieder feststellte: Wir haben die Zentren aufgebaut und an den behinderten Kindern herumgedoktert, sie in eine künstliche Welt gelockt, mit der Lüge, es käme ihnen zugute, fern von der Realität des täglichen Lebens, die allein nur das Terrain der Bewältigung darstellen kann. Viel Therapie war das Motto; Blindheit gegenüber den eigentlichen Bedürfnissen des Kindes und Aussonderung waren das Resultat. Immerhin wäre es nicht möglich gewesen, das Wesen des Behindertseins und die psychologischen Folgen der defektbetonten Behindertenarbeit zu erfassen, wenn es nicht diesen ersten Schritt der therapeutischen Segregation gegeben hätte. In ihr kamen die Grenzen zutage. MILANI-COMPARETTI war nicht der einzige in Italien, der am Ende der sechziger Jahre diese Grenzen und vor allem die »perverse Allianz« zwischen Spezialistentum und ängstlicher Gesellschaft erkannte. Sein eigener Bruder Don Lorenzo MILANI (Barbiana-Schule) kämpfte auf ganz anderem Gebiet um Nichtaussonderung, und mit ihm alle diejenigen (in der Psychiatrie, Psychologie und Pädagogik), die sich bemühten, Normalität in der Menschenwürde zu definieren, und das hieß, Unvollkommenes und Fehlerhaftes miteinzubeziehen. Seitdem alle behinderten Kinder, auch die psychotischen, die geistig Armen, die Häßlichen in der normalen Schule und später am Arbeitsplatz mit dabei sind, hat sich in der Einstellung zur Behinderung manches verändert. Nicht »integrieren«, sondern erst gar nicht ausschließen, ist, sehr entscheidend durch MILANI-COMPARETTIS Wirken, zur Therapie geworden, und erst im natürlichen Lebensbereich kamen die neurologischen, psychologischen und pädagogischen Kenntnisse wirklich zum Tragen, insofern das behinderte Kind in der Bewältigung realer Aufgaben und in seinem Lebenswillen gestützt werden konnte.
Wer sich in Frage stellt und verändert, das Hergebrachte und Gewohnte bezweifelt, wer Konvention und Formalität überschreitet, wer Wissen nur als eine provisorische Wahrheit empfindet, wer hilft, Ketten zu sprengen, ist ein unbequemer Mensch. MILANI-COMPARETTI war nicht religiös, er wollte kein kirchliches Begräbnis. Aber an seinem Sarg stand einer der bekanntesten italienischen Theologen und sagte: Wir dürfen nicht meinen, Christen zu sein, nur weil wir beten und in die Kirche gehen. Kampf und Hingabe, Festigkeit und Zweifel, Suche und Hoffnung haben Adrianos Leben bestimmt. - Das ist das Leben eines Christen.
[25] Adriano MILANI-COMPARETFI starb im April 1986, kurz vor einer geplanten Vortragsreise nach Deutschland. Der folgen0de Nachruf von Ludwig-Otto ROSER wurde in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/1986, S. 2 - 5 veröffentlicht.
Zur Arbeit von MILANI-COMPARETTI vgl. auch: Jutta SCHOLER: Die Arbeit von MILANI-COMPARETTI und ihre Bedeutung für die Nicht-Aussonderung behinderter Kinder in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland. In: Zs.: Behindertenpädagogik, Heft 1/1987, S. 2 - 16. Nachdruck in: Jutta SCHOLER (Hrsg.): »italienische verhältnisse«, insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin 1987, S. 334 - 351. Dort sind weitere Literaturhinweise zu finden über die Arbeit von MILANI-COMPARETTI und eine Zusammenstellung seiner deutsch-, italienisch- und englischsprachigen Veröffentlichungen.
[26] WINNICOTT, D. W.: The child and the outside World. London 1962
Gegen die Logik der Sondereinrichtung[27] - Ludwig-Otto Roser
Die Geschichte der Menschenwürde
Das Bedürfnis des Menschen, zu helfen wo ein Mitmensch in Not ist, hat seine Geschichte, ebenso wie das entgegengesetzte Bedürfnis, Krankes und Nicht-Normales zu meiden und zu verbannen. Vielleicht entstanden beide schon lange vor der Bewußtwerdung des Menschen aus seinem biologischem Ursprung, aus den Tiefen sowohl vormenschlicher Gruppensolidarität als auch der Angst. Auch hier ist Geschichte zum Verständnis der Gegenwart und zur Bereitung der Zukunft unerläßlich. Von Jane GOODALLS Beobachtungen während einer Kinderlähmungsepidemie in einer Gruppe von wilden Schimpansen zum »Narrenschiff« des Mittelalters, von der karitativen Zuwendung christlicher Krankenpflege zur nazistischen Euthanasie, von der spartanischen Sitte, von der uns PLUTARCH berichtet, mißlungene, dem kriegerischen Staat ungeeignete Kinder in einen Abgrund zu stürzen, zur organisierten Hilfe für alle Arten von Behinderung, reicht der Widerspruch zweier Grundhaltungen: auf der einen Seite der natürlichen Auslese freien Lauf zu lassen oder, auf der anderen, mit dem Erleben von Kranken ein Ganzes ins Auge zu fassen, in welchem wir immer mitbeteiligt sind.[28] Das interessante Werk Michel FOUCAULTS (Histoire de la Folie, 1972) erzählt uns wie kein anderes, am Beispiel des Übergangs vom mittelalterlichen Denken zu den Auffassungen der Aufklärung, welchen Weg diese widersprüchlichen Gefühle in unserer Kultur gegangen sind. Es ist die Geschichte der Menschenwürde, jenes Weges, der aus dem Dunkel animalischer Scheu und egoistischer Abgrenzung gegen Fremdes, allmählich emporsteigt zur Erkenntnis des Zusammenhangs alles Lebenden in seiner farbigen Vielfalt, Vollkommenheit und Unvollkommenheit. Aus den Toren der Städte verwiesene Narren und Krüppel, auf den Schiffen und zu Fuß auf der Suche nach dem Menschen, der ihr Überleben gewährleisten konnte, in Verliesen angekettete Irre, das Foltern und Hinrichten als Volksbelustigung, der Menschenhandel, die Unterdrückung von Menschen überhaupt - so weit liegt dies alles nicht zurück. Dies ist nicht nur Vergangenheit: wir sind (oft selbst unter dem Zeichen des Rechts oder einer Moral) davon noch umgeben. Keine 50 Jahre trennen uns von den Irrenhäusern, in denen Menschen oft nur mit einem Hemd bekleidet ihr Leben hinter Gittern verbrachten, um die Gesellschaft, die Vernünftigen und die Gerechten, von ihnen zu schützen. Der Geisteskranke - ein Feind, ein Dämon, ein Rebell, ein Fremder. Aber nicht nur die Gefährlichkeit bildete und bildet noch ein Kriterium, Menschen abzusondern (sie ist ja auch schwer zu erfassen), sondern vor allem war es die Unproduktivität, die es zu bekämpfen oder zu maskieren galt.
Blinde und Krüppel haben diese Probleme als erste gelöst: bettelnd produzierten sie mitmenschliche Gefühle und, da sie auch in der Bibel vorkommen, ist das lange Zeit gutgegangen. Ihrer langen Geschichte ist es zu verdanken, daß sie auch die ersten waren, für die die Gesellschaft unseres Kulturbereiches etwas getan hat. Hier entstand die Logik der Sondereinrichtung, besonders in den Bereichen, in denen sich die Gesellschaft direkt schuldig fühlte; und das waren vornehmlich die Kriegsinvaliden. Die Irrenanstalten waren schon lange in der Rechtgebung verankerte Institutionen. Heil- und Pflegeanstalten, auf karitativer Ebene, sind überall in Europa schon im vorigen Jahrhundert entstanden. Wir dürfen die Geschichte dieser Institutionen und ihrer Entwicklung nicht aus den Augen lassen, denn sie spricht von einer allmählichen Entfaltung eines Bewußtseins, das nicht aus einer plötzlichen Erhellung entspringen konnte, sondern aus der Kenntnis der Probleme, die sich ganz allgemein an jede Behinderung, an jede Besonderheit des Menschenwesens binden. So ist die Logik der Auflösung von Sondereinrichtungen, die wir für die Zukunft wünschen, nicht zu erfassen, wenn wir uns der Logik der Sondereinrichtung selbst verschließen; wir können uns selbst nur aus der Vergangenheit verstehen und müssen zugleich Ziele haben, die uns Entwicklung erleben lassen im Verein mit dem Geschehen in unserer Umwelt.
Die Logik der Sondereinrichtung
Viele identifizieren heute Sondereinrichtungen mit dem Willen zur Aussonderung. Sicherlich lag und liegt auch heute noch manchen Einrichtungen eine unbewußte Tendenz der Gesellschaft zugrunde, Krankes und Fremdes dort einzuordnen wo es nicht stört; bis ins vorige Jahrhundert hinein war dies nicht einmal so unbewußt. Andererseits sind viele Institutionen entstanden, vor allem karitativer Natur, gerade weil in der Bevölkerung die Tendenz bestand, Problemmenschen abzuschieben oder ungenügend zu versorgen. Es ist aber da zweifellos auch viel Gutes getan worden. Es entsprach ganz bestimmten Entwicklungsmomenten, und der karitative Aspekt hat schließlich dazu beigetragen, daß außer der Pflege auch das Verständnis von Behinderung gefördert wurde. Krankheiten und Verhaltensformen wurden beschrieben, klassifiziert und in ihrer Dynamik erfaßt; denken wir nur an den Philosophen JASPERS, der noch vor dem Studium allgemeinmenschlicher Belange als Psychiater die Psychopathologie des Menschen aufgesucht hat. Daß sich in diesen Bereichen heute ein neues verschiedenartiges Verständnis anbahnt, entspricht, wie gesagt, einer Entwicklung und ist kein Glücksfall der Wahrheitsfindung. Erst aus dem Verständnis der vorliegenden Krankheitsbilder erwuchs der Gedanke der Vorsorge und der Frühbehandlung. »Hilfs«-klassen sollten zunächst helfen und daß daraus eine Diskriminierung entstand, gehört in jenen Widerspruch, den wir, wie gesagt, in unseren Instinkten enthalten finden. Auch Sondereinrichtungen sollten fördern und helfen; so ist es zu verstehen, daß nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in dem Versuch einer neuen Zuwendung zum Menschen, Zentren entstanden, in denen vor allem Kindern geholfen werden sollte, Behinderung zu mindern oder zu beseitigen. Institutionen dieser Art waren schon vorher, vor allem für Sinnesbehinderte, entstanden, aber es gab auch schon »Heilgymnastik«, pädagogische Versuche für geistigbehinderte Kinder und die ersten Ansätze einer Kinderpsychotherapie.
Meine persönlichen Erfahrungen mit Sondereinrichtungen
Am Anfang meines beruflichen Weges (ich spreche von den fünfziger Jahren) stand diese Logik: Einrichtungen schaffen, in denen so früh und so intensiv wie möglich geheilt werden konnte. In diese Tendenz und die immer subtilere Differenzierung der Krankheitsbilder bin ich beruflich hineingewachsen. Der Optimismus war grenzenlos. Es galt, Zentren aufzubauen, vor allem Tagesstätten, denn schon am Ende der fünfziger Jahre war man allgemein darum bemüht, Kinder nicht von der Familie zu isolieren. Dies war ein Fortschritt gegenüber jenen Institutionen, die sich darboten, an Stelle der Angehörigen Pflege und Therapien zu übernehmen. Die Tageszentren sollten schön sein, im Grünen liegen, dem Kind viel mehr bieten als es zu Hause erwarten konnte, von der täglichen Therapie bis zum besonderen Spielzeug, von allen nur erdenklichen Hilfsmitteln für die Motorik zum individualisierten Lehrmaterial, von der Kochecke zum Planschbecken. Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Pflegepersonal und kinderfreundliche Kraftfahrer waren alle bemüht, nicht nur die Behinderung zu lindern, sondern waren auch bereit, um das betreffende Krankheitsbild ein Team aufzubauen, das sich immer intensiver zu spezialisieren wußte. Institutionen entstanden, in denen das Personal geschult wurde. Leichtere Fälle wurden von den schwereren getrennt, für diese neue Zentren geschaffen. Die Eltern lernten von den Spezialisten mit den Kindern umzugehen, sie sollten selbst Spezialisten werden, um auch zu Hause mit dem Kind zu arbeiten. Harte Arbeit, viel Therapie, viel Freude um den kleinsten Erfolg führten das Kind zur Wahrnehmung des Hauptgegenstandes: seine Behinderung. Für die meisten Eltern waren wir Engel voller Liebe und Wissenschaft; keine Fiktion, sondern realer, enthusiastischer Einsatz, der von dem festen Vertrauen ausging, daß alle diese Arbeit in dem Erfolg gipfeln könne, Behinderung ausgelöscht oder vermindert zu haben. Daß viel Therapie, viel Übung, viele Reize schließlich einen Erfolg zeigen müssen, entspricht einer uralten Vorstellung; Jahrtausende hat sich die Pädagogik auf diese Hypothese gestützt und schließlich hat sie der Positivismus (und der Turnvater JAHN) wissenschaftlich bekräftigt. Der Behaviorismus hat das Seine dazugetan. Sie ist in die Spontanpädagogik des Hausgebrauchs eingegangen und seitdem ist auch Lernen für viele, jenseits des Wollens, hauptsächlich wiederholen, üben, sich beugen (»früh übt sich ...«). Ausschlaggebend ist dann auch das kräftige Angebot von Reizen, von Bedingungen, die zum reflexologischen Ausbau der Automatismen führen. Das Individuum ist in diesem Erziehungsdruck oft nur ein zur Form und zur Norm zu führendes, amorphes Etwas. Für das Kind ist es nur der Erwachsene, der weiß, welches das Ziel ist, und wenn er auch die Konzession machen sollte, dieses zu motivieren, handelt der Erwachsene noch immer in dem festen Glauben, daß das Kind nicht weiß, was es will und was es kann. Die Logik dieser Pädagogik, in unserem Fall der Heil- und Sonderpädagogik, entbehrt jeglichen Vertrauens in die Lebenskraft des Kindes bei der Suche nach einer Realisierung und Vollendung des eigenen Selbst. Die Logik der Sondereinrichtungen, zur Zeit ihrer Entstehung war - trotz aller Mahnenden - durch die positivistische oder behavioristische Reparatur des behinderten Kindes bestimmt. Nirgends besser als in unseren hochspezialisierten Zentren ist dies zur Geltung gekommen, während die Schule ganz allgemein den alten Dreh der Züchtung von Normmenschen durch das Gießen mit gängigem Kulturgut, in der Resignation aller, weiterbetreibt. Tüchtig (und besser als andere) sein, um zu leben; leben, um tüchtig zu sein.
Ein anderer Aspekt, der die Sondereinrichtungen charakterisiert, ist die Rechtfertigung derer, die in ihr arbeiten: ich lerne mit Behinderten umzugehen, ich spezialisiere mich, mein Beruf wird der Behinderte. In der Institution ersetzen wir dem Behinderten die reale Welt und wir überzeugen uns, daß nur wir ihn verstehen, nur wir sein Schicksal einfühlend bestimmen können. Wenn aber das Ziel »Integration« sein soll, und niemand wird heute mehr daran zweifeln, dann bedeutet dies, den Behinderten in die Welt hinauszuführen, also von uns fort. Wie und wann soll sich das vollziehen? Hier liegt der Schlüssel: die Logik der Sondereinrichtung versetzt diesen Augenblick in die »Normalisierung« durch die der Behinderte sich in der normalen Umwelt behaupten kann. Man spricht von der Sondereinrichtung ja nicht umsonst als von einem Schonraum, in der Erwartung, daß der Behinderte durch unser Wirken eines Tages die Kraft erlangt, die harte Welt zu verkraften. Der Begriff »Rehabilitation« sollte uns, in diesem Zusammenhang, zu denken geben. Entspricht es wirklich unserer Erfahrung, daß der Behinderte allmählich, durch unser Werk gekräftigt, von der Umwelt akzeptiert (weil er nun mithalten kann) in die Welt hinaus geht? Ist es nicht doch so, daß für die größte Anzahl der Behinderten die Sondereinrichtung sich nur in der Dimension der Altersstufe verschiebt, in der statt Spielzeug und Spiel Werkzeug und Beschäftigung angeboten werden? Auch hier dann nur eine Scheinwelt, eine verständnisvoll »geschützte Produktivität«.
Die Erkenntnis, daß gemeinsam leben und lernen besser als hochspezialisierte Förderung in Sondereinrichtungen ist, basiert aber nicht auf der einfachen moralischen Forderung, Menschen, behinderte Menschen, nicht abseits von der Realität des täglichen Lebens zu erziehen, um sie zunächst einmal zu »heilen« oder zu kräftigen. Viel entscheidender ist eine theoretische Überlegung, wie sie beispielsweise M1LANI-COMPARETTI vorgeschlagen hat: der Mensch ist eben nicht nur ein Reiz-Antwort-Mechanismus. Er bringt im Wechselspiel zwischen Umwelt und eigener Persönlichkeit eine Entwicklung ins Rollen, in der durch den eigenen Lebenswillen Lösungen angeboten werden, die nur dort wirksam sein können, wo sie sich mit der Realität der Umwelt messen. Sondereinrichtungen, sagten wir, errichten aber eine künstliche Welt, in der die Forderungen vorsichtig abgestuft sind. In diesem Schonraum nimmt nicht nur das behinderte Kind keine Kenntnis von der realen Umwelt, sondern diese nimmt auch das behinderte Kind nicht wahr, es bleibt ein »Noch-nicht-Mensch«, ein Fremdes. Zwei Dinge werden also in der korrekten Behandlung unerläßlich: erstens, daß sich schon das kleine Kind mit seinen Problemen in der normalen Umwelt auseinandersetzt, und zweitens, daß diese Umwelt seine Probleme kennenlernt.
Im Mittelpunkt das Kind, das Schwierigkeiten hat
Um diesen Weg zu gehen, ist es zunächst von großer Bedeutung, daß bei der Evidenzierung einer Behinderung diese nicht in den Vordergrund gestellt wird: nicht als ein »behindertes Kind«, sondern zunächst einmal ein Kind, ein Individuum, das Schwierigkeiten hat. Dieser feine Unterschied bestimmt zwei grundverschiedene Wege: in der Logik der »Rehabilitation« und schließlich der Sonderpädagogik erleben die Eltern und das Kind selbst die Behinderung als eine Katastrophe. Der Defekt steht im Vordergrund und im Mittelpunkt steht, wenn wir genauer hinschauen, nicht das Kind, sondern das Bedürfnis der Erwachsenen, von der Norm Abweichendes zurechtzubiegen, zu heilen oder zu vertuschen. In erster Linie geht es um Krankheit und Therapie. Das Individuum und seine Realität, seine Fähigkeiten, das eigene Selbst wirken zu lassen, das Vertrauen auf seinen Lebenswillen geraten in den Hintergrund. Es erlebt sich als minderwertig, so sehr es auch geliebt werden mag, denn durch die Arbeit an ihm intuiert es früh seine Fehlerhaftigkeit. Wie teilhaft bei dieser Arbeit oft vorgegangen wird, ohne Rücksicht auf die psycho-physische Ganzheit des Kindes, zeigt sich besonders in einigen Methoden, in denen die Aggression, mit der der Defekt angegangen wird, schließlich das Nicht-akzeptieren des Kindes und seiner Behinderung zu symbolisieren scheint. Der andere Weg wäre dann, sich nicht zu fragen, was das Kind nicht kann, sondern auszugehen von dem was es kann. Hierbei ist der wichtigste Aspekt, daß die in seinem Lebenswillen verankerte Anpassung an die Umwelt zur vollen Geltung kommt. Keiner als WINNICOTT hat uns besser gezeigt, wie sehr wir dazu neigen, Kinder zu Handlungen zu zwingen, die sie schon selbst als Bedürfnis in sich tragen. Ganz besonders tritt dieses Phänomen bei ihrer Ernährung zutage. Aber auch das Vertrauen, daß ein Kind lernen will besteht so gut wie nie; es muß stimuliert oder gezwungen werden.
Wer mit den verschiedensten Arten von Behinderung in Kontakt gekommen ist, wird beobachtet haben, welche Lösungen schon ganz kleine Kinder anbieten, wo sie Hindernisse spüren, sehr oft selbst im Widerspruch mit den therapeutischen Indikationen. Das sprachlich retardierte Kind, das sich mit seiner Zeichensprache verständlich macht, das spastische Kind, das sich fortbewegt, wie es das eigentlich (aus therapeutischen Gründen) nicht tun sollte, das schwerstbehinderte Kind, das Wege der Kommunikation entdeckt, der kleine Mongoloide, der lieber auf dem Gesäß rutschend seine Umwelt erobert als die Fördergymnastik mitzumachen, das blinde Kind, das sehr bald besser hört und tastet als seine sehenden Altersgenossen. Zusammen mit den Eltern entdecken, wie ein behindertes Kind seine Probleme löst, führt dann auch dazu, seine Schwierigkeiten zu verstehen, sie fachlich einzuordnen, sie in der Sicht einer Entwicklung zu analysieren. Es führt vor allem dazu, sich zusammen mit dem Kinde in der Suche nach Ausdrucks-, Bewegungs- und Wahrnehmungsalternativen zu üben. Dies aber nun nicht losgelöst vom täglichen Geschehen in einer hypothetischen Umwelt, sondern Tag für Tag in der gewohnten Umgebung. Sie werden verstanden haben, daß ich für diesen zweiten Weg bin.
Rehabilitation = von vornherein nicht aussondern
Der Enthusiasmus, mit dem ich noch in den sechziger Jahren die Entwicklung von Sondereinrichtungen förderte und verfolgte, wurde zum erstenmal ganz stark gebremst, als ich damit beauftragt wurde, für die großgewordenen Betreuten eine geschützte Werkstatt aufzubauen. Aus dem von der realen Umwelt abgesonderten Schulleben sollte nun ein ebenso abgesondertes Arbeitsleben in Gang gebracht werden. So fragten wir uns: War dies das Ziel aller bisherigen Bemühungen? Wo blieb die Annäherung an die Welt, die wir hypothesiert hatten? Wir bemühten uns trotzdem, diese geschützte Werkstatt aufzubauen. Aber es war in einer Zeit, ich spreche von 1968, in der ohnedies unsere Kultur sich über das Verhältnis zwischen Bestimmenden und Betroffenen, zwischen Alt und Jung, zwischen Hergebrachtem und Zukünftigem mit großer Intensität befragte. Überall wurde diskutiert und auch in unserer geschützten Werkstatt versammelten sich die Behinderten, um über ihren Zustand und den Zustand der Welt nachzudenken. Die Behinderten selbst, nun fast schon Erwachsene, befragten sich nach dem Ziel der Rehabilitation, nach dem Sinn ihrer Tätigkeit. Hier wurde es mit einem Mal klar, wie wenig wir Experten darüber nachgedacht hatten. Entsprach es wirklich der Wahrheit, daß nur eine intensive Rehabilitation Hoffnung auf Integration garantieren konnte? Hatten wir die persönlichen Reserven und die alternativen Fähigkeiten des Behinderten genügend beachtet? Entsprach unser Ziel dem ihrigen? Oder hatten wir uns von vornherein von der Überzeugung leiten lassen, daß die Welt draußen nur produktive Menschen akzeptiert? Aus diesen Zweifeln heraus entstand der Gedanke, daß das von »vorneherein nicht aussondern« eine besondere Art der »Rehabilitation« darstellen konnte, ein Prüfen der Behinderung an der Realität des täglichen Lebens, eine Suche nach den Anpassungskräften des behinderten Kindes. Denn welche Vorstellungen von sich selbst und der Welt konnten in einer Einrichtung entstehen, in der Sprachgestörte mit Sprachgestörten, Blinde mit Blinden, Taube mit Tauben, Spastiker mit Spastikern und Geistiggestörte mit Ihresgleichen großgezogen wurden?
Die ersten formalen Versuche der Integration, die zunächst den Charakter der Sozialisierung hatten, fanden sofort in uns Fachleuten, in den Kindern, in den Erziehern der Normalschule eine ganz starke emotionale Reaktion: Verblüffung, Enthusiasmus, Wille zum Umbruch. Integration: eine menschliche, eine moralische Pflicht, eine soziale Aufgabe, eine Revolution. Die Gefahr, sich von den ersten Erfolgen, von der Lebenskraft des behinderten Kindes, von der Bereitschaft vieler Eltern und Erzieher hinreißen zu lassen, lag auf der Hand. Stattdessen galt es, sogleich eine Theorie zu entwickeln, die von diesen emotionalen Elementen absehen konnte und geeignet war, eine neue Einstellung gegenüber der Behinderung zu entwickeln und sie fachlich zu fundieren.
Ein Kind ist behindert: was eine solche Gegebenheit an Ängsten, falschen Vorstellungen und Hoffnungen, vor allem in den Eltern auslöst, ist unbeschreiblich. Verzweiflung, Sorge um die Zukunft, Unerfülltheit, Anklage konzentrieren sich in der Suche nach Lösungen. Hier gilt es fachlich zu wirken und zu beweisen, vom ersten Lebenstag an, daß dieses Kind trotz seiner Grenzen ein Mensch ist, der froh werden kann, wobei Voraussetzung ist, daß diese Grenzen erkannt und akzeptiert werden.
Die Bedeutung einer korrekten Prognose
Wenn es wahr ist, daß Depressionen und mangelnder Lebenswille dadurch entstehen, daß sich das Gleichgewicht zwischen Erwartungen und Möglichkeiten nicht herstellt, dann ist der erste und wichtigste Schritt in einer neuen Vorstellung der Rehabilitation eine korrekte Prognose. Diese entspringt nicht einer unmittelbaren Diagnose. Eine korrekte Prognose ergibt sich erst, wenn die genaue Kenntnis des Verlaufs eines Krankheitsbildes sich mit der Analyse der persönlichen Gegebenheiten des Individuums, d. h. seiner Einmaligkeit in seiner sozialen Umwelt, verbindet. Hieraus entwickelt sich die Vorstellung eines Ziels, das sich aber selbst wieder durch das Geschehen korrigiert und entfaltet.
Ich möchte Ihnen hierfür einige Beispiele bringen. Die Begegnungen, von denen ich Ihnen berichte, betreffen die Kinder, die alle eines gemeinsam haben: sie sind von vorneherein nicht ausgesondert worden, d. h. in keiner Sondereinrichtung, sondern ambulant behandelt worden.
Lukas und Markus
Lukas und Markus, beide mongoloide Kinder, kommen mit drei Jahren in den normalen Kindergarten. Die familiären Hintergründe sind sehr verschieden: Lukas hat einen älteren Bruder und wächst in einer Handwerkerfamilie auf die von vornherein mitarbeitet und die Bedürfnisse und Grenzen des Kindes richtig einordnet. Die Schwierigkeiten im Kontakt mit der Außenwelt, vor allem mit den Kindern im Kindergarten werden gut verarbeitet. Lukas macht komische Sachen - er ist putzig, lustig, aber gehorcht nicht, er zieht sich nackt aus, bleibt aber nicht in einem Raum, sondern sucht auch andere Kindergruppen auf. Die Erzieherinnen lernen mit Hilfe der Eltern und der beratenden Fachkräfte mit ihm umzugehen. Er wird nicht gezwungen, aber akzeptiert ganz allmählich die Regeln des Kindergartens, bleibt aber frei und unbekümmert.
Markus' Eltern dagegen verlangen vom Kinde und seinen Erzieherinnen strenge Disziplin und ständiges Lernen. Zu Hause gibt es nur Lernen. Er ist Einzelkind und die Eltern haben nur die Sorge, seinen geistigen Zustand zu vertuschen. Er ist im Unbewußten nicht akzeptiert, wird aber ein braver, wohlerzogener Junge, ständige Korrekturen und intensives Auswendiglernen lassen ihn zum Automaten werden. Den Eltern genügt die Stimulation des Kindergartens nicht, dreimal in der Woche kommt am Nachmittag zu ihm eine sonderpädagogisch ausgebildete Privatlehrerin. Sein Lebensinhalt wird dann auch in der normalen Grundschule Lesen und Schreiben; mit anderen Kindern und der Außenwelt hat er nur in der Schule Kontakt. Spielen darf er nur mit intelligenzförderndem Material.
Lukas dagegen will nicht Lesen und Schreiben, er will nur mit den Kindern und der Stützlehrerin spielen, malen und zeichnen, auf Bäume klettern. Er hat Kontakt mit seinen Mitschülern außerhalb der Schule; wenn er allein ist, bastelt er sich aus Holzresten Hütten und Schwerter. Beide Jungen sind durch die achtjährige Pflichtschule gegangen, wobei akzeptiert wurde, was sie jeweils geben konnten.
Markus kann auf dem Niveau einer dritten Grundschulklasse lesen und schreiben, auch rechnen; in der sechsten und siebten Klasse verlangten die Eltern von den Lehrern, daß sie ihm die gleichen Aufgaben stellen wie seinen Mitschülern, weil er sonst im Vergleich mit ihnen leide. In Wirklichkeit leiden die Eltern; Markus lebt isoliert und wird auf »normal« gedrillt. Ein »leichter Fall« sagen die Eltern überall.
Lukas hingegen geht alleine einkaufen, sucht seine Mitschüler auf »geht aus«. Heute besucht er eine Kunstschule, wo er, bei Ausschluß aller Fächer, die Schulisches verlangen, nur im Handwerklichen mitmacht. Er fährt allein zur Schule. Auch Markus besucht einen handwerklichen Kursus (Teppichknüpfen und Restaurieren) - wird aber von der Mutter zur Schule begleitet.
Was unterscheidet die beiden Situationen? Lukas ist frei, lebensfroh, gut integriert und trotz seiner Grenzen akzeptiert, Markus hat Integration nur auf formaler Ebene realisiert, er war auf der normalen Schule, hat lesen und schreiben gelernt, aber seine Eltern haben Integration als Gefahr erlebt und nicht in sich selbst vollzogen; gegen Gleichaltrige wird er immer häufiger aggressiv, die Eltern empfindet er als eine Last, manchmal wehrt er sich gegen ihren Erziehungsdruck.
Stephan und Richard
Stephan und Richard, durch den Inkubator in den ersten Lebenstagen erblindet, leben in Familien, die sich beide sogleich an unseren Betreuungsdienst gewandt haben, denn vom spezifisch Fachlichen her lagen die Dinge leider allzu klar, während bald die psychologischen, erzieherischen und sozialpädagogischen Aspekte in den Vordergrund rückten. Beide Familien waren sehr verzweifelt, aber während die Angehörigen von Stephan versuchten, mit unserer Hilfe die harte Tatsache zu verarbeiten, wehrte sich Richards Familie, vor allem die Mutter dagegen, die Realität zu erfassen. Dies wirkte sich sehr bald auch auf das Mutter-Kind-Verhältnis aus: Richard reagierte mit Schwierigkeiten in der Nahrungsaufnahme, der Mutter gelang es nicht, ein zärtliches Verhältnis zu dem Kinde herzustellen. Ganz offensichtlich wehrte sich in ihr alles gegen die Vorstellung, ein blindes Kind zu haben.
Stephans Eltern dagegen, wenn auch mit viel Mühe, helfen uns, in die »positive Semeiotik« einzusteigen; wöchentlich kommen sie, um uns über Stephans Fortschritte zu unterrichten, sie erzählen uns von seinem aufmerksamen Horchen, von seinem ersten Bedürfnis, Hautkontakt zu haben, von seinen ersten Bewegungsversuchen. Auch hier ist interessant, daß in Stephans Familie schon ein größerer Bruder da war. Richard dagegen war das erste Kind; von ihm erzählen die Eltern in den Begegnungen mit uns nur, daß er nichts ißt, daß er viel weint, daß er den Eltern den ganzen Tag Sorgen bereitet. Stephans Eltern akzeptieren bald, das Kind - anfangs stundenweise - in eine Kinderkrippe einzuschreiben, um unter vielen anderen Kindern mit der Umwelt vertraut zu werden. Er war erst zehn Monate alt. Es war nicht leicht, die Mutter zu überzeugen; zu-nächst war sie mit dabei. Unter diesen Kindern hat er laufen gelernt, aber, was noch wichtiger ist, er hat in dieser an Stimulationen reichen Umgebung seine Blindheit sehr frühzeitig mit Hören und Tasten kompensiert, intensiver als es zu Hause möglich gewesen wäre. Stephans Entwicklung verdiente einen ausführlichen Bericht; hier nur einige der wichtigsten Momente: mit fünfzehn Monaten hat er gelernt, sich in den einzelnen Räumen frei zu bewegen und nicht mit den anderen Kindern zusammenzustoßen. Er spürte am Widerhall, an welcher Stelle der Räume er sich befand, er erkannte die Kinder an der Stimme, entwickelte Sympathien, erkannte sie aber auch an ihrem Haar und ihrem Gesicht, das er oft betastete. Das Aufregendste war, wie die anderen Kinder spürten, daß Stephan sie nicht sehen konnte, sie machten ihm Platz, später begannen sie, ihn zu führen, legten ihm die Bausteine in die Hand. Der Übergang in den Kindergarten war ebenso positiv. Stephan äußerte sich immer sehr lebhaft, protestierte, wenn die anderen sagten »ich sehe ...«, er war es, der die anderen, vor allem die Kindergärtnerinnen, in die Lage versetzte, zu verstehen, welches seine Wahrnehmungsbedürfnisse waren. Alle Kinder brachten Fotos von zu Hause; Stephan protestierte, weil die Eltern sie ihm nicht geben wollten (... denn er kann ja nicht sehen); er wollte wissen, was Fotos sind. Eine glatte und eine rauhe Seite. Wir kamen mit den Eltern auf die Idee, ihm die Konturen durch Nadelstiche fühlbar zu machen. Spiele, in denen das Tasten wichtig war, wurden ein Spaß für alle. Das letzte Kindergartenjahr wurde zur Vorbereitung für die Blindenschrift benutzt. Stephan kommt dann in die Grundschule, bekommt eine spezialisierte Stützlehrerin zur Seite gestellt. Aber auch seine Lehrerin lernt Braille, die Blindenschrift. Die Schulbücher, die alle haben, werden in einem spezialisierten Zentrum für ihn in Braille übertragen.
Richard hat die Kinderkrippe nicht besucht. Es gab von Seiten der Eltern auch Schwierigkeiten, ihn im Kindergarten einzuschreiben. Er kommunizierte wenig, war von zu Hause gewohnt, nur Käsestückchen zu essen. Erst allmählich und nur dank einer psychotherapeutischen Behandlung der Eltern hat sich die Situation gebessert. Heute besucht Richard die gleiche normale Grundschule wie Stephan in einer Parallelklasse. Er beginnt etwas freier und gesprächiger zu sein, wendet sich der Umwelt zu und ist dadurch auch geistig regsamer geworden. [29]
Serena und Maximilian
Serena und Maximilian, Geschwister, Kinder tauber Eltern, selbst taub geworden, entwickeln sich in ganz verschiedener Weise: für Serena besteht gleich nach der Geburt der Verdacht erblicher Taubheit, die auch sogleich bestätigt wird. Beide Eltern haben sprechen gelernt und lesen die Sprache anderer von den Lippen ab. Den Fachkräften der ambulanten Sprachtherapie erscheinen aber die sprachlichen Fähigkeiten der Eltern nicht ausreichend, um Serena Sprache zu vermitteln. Der Familie wird eine geschulte Pflegerin zur Seite gestellt, die es einerseits erlaubt, daß die Eltern weiter ihrer Arbeit nachgehen, und andererseits ermöglicht, das Kind schon im ersten Lebensjahr zum korrekten Lippenablesen zu führen und seine Ausdrucksmöglichkeiten zu schulen. Diese Vermittlung zwischen den Eltern, dem Kinde und der Umwelt unter der Leitung des ambulanten Zentrums für Sprachtherapie hat dazu geführt, daß Serena schon mit drei Jahren im normalen Kindergarten mit dabei sein konnte. Es ist immer ein ruhiges, gut angepaßtes Mädchen gewesen; seine sprachliche Entwicklung vollzog sich unter optimalen Voraussetzungen, nicht nur was die Frühbehandlung anbetraf sondern vor allem den frühen Kontakt mit sprechenden Kindern, d.h. im besonderen die Gelegenheit, schon im Vorschulalter durch Lippenlesen die Kindersprache zu erleben.
Ganz anders vollzog sich die Entwicklung Maximilians, der mit dem gleichen Defekt geboren wurde, als Serena vier Jahre war. Aus ganz unverständlichen Gründen wehrten die Eltern sich, Maximilians Situation in Betracht zu ziehen: sie waren fest überzeugt, daß der Junge nicht dieselbe Behinderung haben könne, und deshalb ließen sie ihn gar nicht erst untersuchen. Die Pflegerin, die Serena geführt hatte, wurde nur noch selten in Anspruch genommen, und ihr Verdacht, daß Maximilian die gleichen Probleme haben könnte wie seine Schwester, erbrachte nur ein Erkalten des vorher guten Verhältnisses mit dem Mädchen und den Eltern. Auch unser Betreuungsdienst und unsere Fachkräfte trafen auf eine ablehnende Haltung, obwohl beide Eltern die Betreuung Serenas als positiv empfunden hatten. So gelangte Maximilian erst in fachliche Behandlung, als er vier Jahre alt wurde und im normalen Kindergarten klar herauskam, daß er völlig taub war. Vier kostbare Jahre waren verstrichen, und trotz sofortigen Eingreifens der Fachkräfte hat Maximilian nicht so sprechen gelernt wie seine Schwester. Auch er besucht nun die normale Pflichtschule, arbeitet mit, ist intelligent, kommuniziert aber lieber in der Zeichensprache, und die Mitschüler greifen diese Möglichkeit gerne auf; er ist ein gut angepaßter, lebhafter Spielgefährte, aber Lippenlesen ist ihm zu mühsam und seine Worte werden nicht gut verstanden. Der besondere Aspekt in diesem Beispiel ist der Unterschied zwischen dem frühbehandelten und früh integrierten Mädchen und dem durch die Ablehnung der Behinderung geschädigten Jungen.
Eine korrekte Prognose kann nur ambulant vollzogen werden
Wir waren davon ausgegangen, daß eine korrekte Prognose als Verbindung von Diagnose und Analyse der persönlichen und der Gegebenheiten der Umgebung des Kindes eine wichtige Arbeitshilfe in der Behandlung von Behinderung darstellt. Sie kann sich nur außerhalb der Sondereinrichtungen ambulant vollziehen. Die Beispiele, die ich Ihnen gebracht habe, führen uns aber noch zu anderen Voraussetzungen und Überlegungen: viele Variablen, die in die Entwicklung des Individuums und in die Realität seiner Umwelt eingreifen, sind nicht vorauszusehen. Dies gilt ja ganz allgemein für jede Entwicklung. Wir haben auch die Vorstellung, daß der sogenannte Normalmensch den Begegnungen mit dem - nennen wir es ruhig - Schicksal irgendwie gewachsen ist und die Kräfte in sich findet, Auswege zu suchen und die Widerstände zu bekämpfen. Ich würde behaupten, dies ist ebenso wahr wie die Vorstellung, daß Behinderte von der Umwelt verstoßen, im Dschungel unserer Gesellschaft untergehen. Ich kenne Behinderte, die weit lebenskräftiger sind als scheinbar Nichtbehinderte! Die alte Vorstellung, daß Kinder grausam sind und behinderte Altersgenossen seelisch mißhandeln, entspricht nicht unserer Erfahrung. Im Gegenteil! Die größte Gefahr der Sondereinrichtung liegt damit in der Überzeugung, daß das behinderte Kind das normale Leben nicht bestehen kann (oder erst, wenn es durch die Sonderschule gegangen ist).
Sind einmal Ängste und instinktives Schutzbedürfnis, vor allem in den Eltern des behinderten Kindes überwunden, ist in den Eltern selbst die Konfrontation mit der Realität akzeptiert, ist Vertrauen entstanden, nicht nur in die fachliche Stütze in der Außenwelt, sondern vor allem in die Fähigkeit des Kindes, jetzt und in der ferneren Zukunft Lebenskraft zu entwickeln, ist die Erfahrung gemacht, daß die Welt nicht voller Tiger ist, dann gehen die Dinge ihren Lauf auf einem Weg, der sicherlich nicht ohne Dornen ist, aber mitten ins Leben führt.
Wir sprachen zu Anfang von einem doppelten Effekt: nicht nur lernt das behinderte Kind und später der Erwachsene auf diese Weise seine Fähigkeiten und Grenzen kennen, sondern, was unter vielen Aspekten für unsere kulturelle Entwicklung vielleicht noch wichtiger ist: Seine Mitmenschen lernen Behinderung zu verstehen. So lange arbeite ich nun schon außerhalb der Sondereinrichtungen, daß ich bei vielen, frühzeitig integrierten Behinderten den Weg in die Welt der Arbeit verfolgen konnte.
Gibt es in uns Grenzen der Integration?
Was aber wird, so fragt man häufig, aus den Schwerst- und Mehrfachbehinderten? Gibt es Grenzen der Integration? Die Frage ist falsch gestellt, insofern sie nach den Grenzen im Behinderten fragt; gerade dieses gilt es zu überwinden. Wer Schwerbehinderte auch nur kurze Zeit aus den Pflegeheimen heraus in den lebendigen Alltag geführt hat, heraus aus den Räumen gemeinsamen Jammerns, weiß, welche glückliche Erregung diese Kinder erfaßt. Und dann die Frage: wer ist schwerbehindert? Wer kann dies theoretisch beantworten und quantitativ bestimmen? Die Antwort kann nur im Kontakt mit der Umwelt gegeben werden. Die Grenzen liegen nämlich nicht im Behinderten, sondern in uns. Die ungenügende menschliche und materielle Unterstützung der betroffenen Familien, die Hilflosigkeit gegenüber dem Auffälligen, das Verfangensein in Normen, die Müdigkeit, die durch das scheinbar Sinnlose überzeugt wird - sind alles Probleme, die aus unseren Schwächen und Grenzen erwachsen. Aber auch hier ist Vertrauen in eine menschliche und kulturelle Entwicklung unerläßlich. Es gibt da keine statische Wahrheit, denn wie käme es sonst zustande, daß z.B. ein großer Teil der Staaten auf dieser Erde in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die Todesstrafe in Frage gestellt hat, wo sie noch vor wenigen Jahrzehnten als Recht empfunden wurde.
Die Notwendigkeit einer fachlichen Absicherung von Integration
Kehren wir also zurück auf den Weg, von dem wir glauben, daß er aus der Logik der Sondereinrichtungen herausführen kann. Er darf uns nicht nur vom Menschlichen her überzeugen, sondern muß zunächst einmal rigoros im Fachlichen abgesichert sein. Da steht am Anfang eine soziale und gesundheitliche Organisation, die Früherkennung garantiert. Früherkennung erzeugt sogleich, vor allem in den betroffenen Eltern, Angst und Verzweiflung. Das Gleichgewicht der Familie, die Beziehung der Eltern zueinander, das Verhältnis schon vorhandener Geschwister untereinander, wird gestört. Es ist also wichtig, von vornherein, die Angehörigen psychologisch zu stützen; in einer solchen Familie sollte immer frühzeitig mit den Mitteln der Familientherapie gearbeitet werden. Diagnose und Prognose müssen unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Kindes und der Besonderheit seiner sozialen Umgebung vermittelt werden.
Die Therapie geht natürlich von den in der ambulanten Beratungsstelle festgelegten Richtlinien aus; hier werden nicht nur die Angehörigen beraten, sondern auch das Kind selbst wird behandelt, dort wo sich dies als notwendig erweist: Sprachtherapie für Hörbehinderte, Physiotherapie, Psychotherapie werden zum Ausgangspunkt all der Beobachtungen und Hinweise, die sich dann im täglichen Leben zu Hause als Wege entwickeln, auf denen Kinder und Eltern Behinderung zu kompensieren und zu lindern suchen. Ein solches Vorgehen verlangt große Geduld (denn Eltern sollen ja nicht zu Therapeuten werden), eine kontinuierliche interdisziplinäre Besprechung des Falls (Arzt, Psychologe, Therapeuten, Sozialdienst) und erfordert einen weitreichenden Plan (Diagnose und Prognose). Eine solche Arbeitsweise ist bei allen Behinderungsarten möglich. Dann schließlich der wichtigste Schritt: so früh es nur geht kommt das behinderte Kind mit Nichtbehinderten zusammen. Von vielen wird die frühzeitige Loslösung von den Eltern und der Besuch einer Kinderkrippe als negativ betrachtet. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß für behinderte Kleinstkinder der Besuch einer Kinderkrippe, wenigstens stundenweise, schon nach dem ersten Lebensjahr ausgesprochen positiv ist (zunächst natürlich sollte ein naher Angehöriger dabei sein), und zwar weil dadurch das Kind gerade in dieser so wichtigen Phase der Imitationen durch die Lebhaftigkeit der anderen Kinder stimuliert wird, und dann, weil dadurch eine der größten Ängste der Eltern verfliegt: die Furcht, daß das Kind sich nicht unter den anderen Kindern behaupten könne. Der Kontakt mit den anderen Eltern ermutigt, das Personal der Kinderkrippe beteiligt sich an den therapeutischen Indikationen, und so eben wird Therapie schon ganz frühzeitig in die normalen Tätigkeiten des Kindes, sagen wir ruhig »spielerisch« eingebaut. Von hier aus in den Kindergarten und dann in die Regelschule stellt nur dort ein Problem dar, wo Schule nicht als allgemeiner Lernprozeß, sondern als Auslese verstanden wird.
Sicherlich ist die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit/der realen Umwelt für das behinderte Kind oft hart und scheinbar unbefriedigend: Sie führt aber zweifellos zu einer optimalen Entwicklung seiner Möglichkeiten und zur Aktivierung seiner Lebenskräfte.
Worin unterscheidet sich der hier aufgezeigte Weg von der Praxis der Sondereinrichtungen? Dieser Weg ist der Schwierigere. Nichts gibt uns und den Angehörigen mehr Sicherheit und Genugtuung als das Wirken im geschlossenen Kreise einer Sondereinrichtung. Die Sondereinrichtung schützt nicht nur Behinderte, sondern auch uns. Eventuelle Mißerfolge bleiben in der Familie. Aber auch die Leute draußen können ruhiger schlafen. Dagegen, mit dem Behinderten in der realen Umwelt leben und wirken erfordert ein ständiges Überdenken und Suchen, erfordert Kreativität, Flexibilität, Auseinandersetzung. Wir sollten uns nicht davor fürchten, denn Sondereinrichtung ist Ausdruck von Angst und Pessimismus, Integration ist Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden Welt.
[27] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 2/1987, S. 36-53.
[28] GOODALL, Jane: Wilde Schimpansen. Reinbek 1972, vgl. auch: GOODALL, Jane: Chimpanzees of Gombe. Patterns of Behavior. Cambridge 1986 (Anm. J. SCHÖLER)
[29] Im Frühjahr 1982 durfte ich Ludwig-Otto ROSER zu einer Besprechung im Kindergarten begleiten, wo er mit der Mutter von Stefan, den Erzieherinnen, einer Sonderpädagogin und der »bidella« (Mehr als eine Putzfrau in italienischen Schulen) über die weitere Entwicklung von Stefan sprach. Diese Konferenzsituation, eine Beobachtung im Kindergarten sowie die weitere Entwicklung von Stefan und Richard habe ich ausführlich beschrieben in: SCHOLER 1987, S. 188 - 211. Dieser Bericht wird ergänzt durch die Beobachtungen und Gedanken zu Richards Entwicklung, welche eine der damaligen Exkursionsteilnehmerinnen aufgeschrieben hat. Vgl. Christine DAMM in: SCHOLER 1987, S. 212 - 220.
»... Integration ist Ausdruck einer hoffenden, sich entwickelnden Welt.«[30] - Georg Feuser
Während ich darüber nachdenke, was denn das Verhältnis von mir zu Ludwig-Otto ROSER zu begründen vermag, denn die Anzahl unserer Begegnungen ist in Relation zu der langen Zeit, in der wir uns kennen, wirklich gering zu nennen, kommen mir Worte von Jakob MUTH (1993) in den Sinn. Er schreibt mit Blick auf »Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates«, in dem er im wirklichen Sinne des Wortes als Promotor für die Integration tätig war, folgendes: »Ich bin der Auffassung, daß alle behinderten Kinder, die wir heute als sonderschulfähig ansehen, auch integrationsfähig sind . Integration, das will ich sagen, meine Damen und Herren, ist eigentlich unteilbar. Ich kann nicht sagen, Integration würde Ausnahmen zulassen. Wer der Integration das Wort redet, der würde ihr zuwider handeln, wenn er die Gruppe der Behinderten noch einmal unterteilte in eine Gruppe, die nicht integrationsfähig ist und in eine andere, die integriert werden kann.« (S. 23)[31]
Wie Jakob MUTH als einer der wenigen bezeichnet werden kann, der die Integration im deutschen Sprachraum als »Nicht-Sonderpädagoge« engagiert, überzeugt und in gleicher Weise reflektiert betrieben hat, habe ich in Italien Ludwig-Otto ROSER als einen ebenso engagierten, überzeugten und reflektierten Psychologen kennengelernt, mit dem die Verständigung in der gemeinsam vertretenen Sache von Anfang an gelang. Wolfgang JANTZEN berichtet in seinem Beitrag in diesem Band von unserer ersten Begegnung, in deren Folge dann die Einladung an Herrn ROSER zustande kam, in Frankfurt/Main bei einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung des Landesverbandes Hessen e.V. im Fachverband für Behindertenpädagogik (vds) und dem Institut für Sonder- und Heilpädagogik der Joh.-Wolfgang-Goethe-Universität vom 07.-09.11.1980 zu referieren. Auch Kolleginnen und Kollegen aus Dänemark waren eingeladen. Wenn man sich heute das - wie ich annehmen muß -vergessene, weil nirgendwo mehr zitierte Heft 20(1981)1 der Zeitschrift Behindertenpädagogik vornimmt, in dem die damals gehaltenen Beiträge abgedruckt sind, findet man dort Aussagen von solcher Grundsätzlichkeit aber auch derart weitreichender Art, daß sie heute, nach vielen Jahren der wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich, ohne wesentliche Abstriche nicht nur aufrechterhalten bleiben können, sondern noch immer in eine Zukunft der Integration weisen.
Als eine Art Pendant zu der eingangs zitierten Aussage von Jakob MUTH erscheint mir die damals von Ludwig-Otto ROSER in seinem Vortrag gemachte Anmerkung: »Wo pädagogische Fähigkeiten vorhanden sind, wird das Dabeisein der Behinderten auch im traditionellen Schulbetrieb möglich.« (S. 19)[32] Er sagt damit zweierlei aus, das noch heute in der internen deutschsprachigen Integrationsdebatte nicht hinreichend gesehen wird und auch ein zentrales Anliegen meiner Grundpositionen ist:
-
Was zu entwickeln ist, sind »pädagogische Fähigkeiten«, damit Lehrerinnen einer heterogenen Schülerschaft gegenüber nicht mehr zum Mittel der Selektion und Segregierung, damit zur diagnostischen Stigmatisierung und sozialen Ausgrenzung greifen müssen, um »lehren« und Kinder und Jugendliche unterschiedlichster individueller Lebensgeschichten, Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen nach ihren Möglichkeiten fördern zu können. Dies dadurch, daß sie an »Gemeinsamen Gegenständen« kooperieren (FEUSER) und sich mit den »epochaltypischen Schlüsselproblemen unserer Zeit« (KLAFKI) auseinandersetzen. Das verweist auf die Entwicklung einer Allgemeinen Pädagogik, die integrationspotent ist, wie ich sie in vielen Zusammenhängen zu skizzieren versucht habe.[33]
-
Integration bedarf, um sie beginnen zu können, nicht schon der Voraussetzungen, die ohnehin nur dadurch zu bestimmen und zu erreichen sind, daß sie praktiziert wird. Sie kann jederzeit und an jedem Ort versucht werden, wenn eben die Bereitschaft besteht, neue pädagogische Fähigkeiten zu entwickeln. Dies allerdings ohne ihre Grundanliegen zu verwässern, d.h. sie zum akzeptierten, weil Reformen signalisierenden Instrument einer neuen Balancierung des segregierenden Systems zu machen. Vor allem muß heute klarer denn je der Widerspruch gesehen und artikuliert werden, der einerseits zwischen der Tendenz zur Verschärfung gesellschaftlicher Gegensätze besteht, die im Kontext einer äußerst problematischen Bevölkerungspolitik, mit Kosten-Nutzen-Kalkülen im Hintergrund, als Selbstbestimmung und Formen neuer demokratischer Freiheiten verkauft werden und andererseits dem Versuch, neue Formen des Gemeinsinns zu entwickeln, der Integration längst als globale und multikulturelle Angelegenheit begreift.
Im Grunde ist dem ein drittes Moment implizit, nämlich die fundamentale Abkehr von einem Verständnis von Behinderung als defekte und defizitäre individuelle Existenz, die so lange bearbeitet und modifiziert, d.h. pädagogisch und therapeutisch behandelt werden muß, bis ihre Passung in das jeweils dominierende gesellschaftliche Verständnis von Normalität erreicht ist. Ohne den fundamentalen Wechsel im Menschenbild, der in Deutschland wesentlich durch die Entwicklung der »Behindertenpädagogik«[34] vorbereitet wurde, dahingehend, daß, was wir als Behinderung klassifizieren, genau durch diesen Zwang zur Passung, d.h. zur »Normalisierung« entsteht, wir also mit den Mitteln der Heil- und Sonderpädagogik ein selbst geschaffenes Artefakt behandeln, ist Integration weder denk- noch realisierbar. Im noch nicht gelungenen Vollzug der Revision unseres Menschenbildes in unseren Köpfen[35], mag ein Haupthindernis für die Realisierung der Integration begründet liegen. Andrea CANEVARO hat das in seiner Unterscheidung von »Autarkie« und »Autonomie« deutlich herausgearbeitet. Es geht, wie er betont, nicht primär darum, eine Person durch Maßnahmen, die nur sie isoliert betreffen, dazu zu befähigen, alles zu machen und möglichst alleine, sondern Ziel ist eher die Autonomie im Sinne der Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur Nutzung von Hilfsmitteln und Fähigkeiten der anderen; das meint die Einbeziehung in die soziale Situation möglichst vieler Menschen der Lebensumwelt, wie von BORSTEL (1995) darlegt.[36] Das von KLAFKI (1991) grundgelegte Verständnis von Bildung als Zusammenhang der drei Grundkategorien der »Fähigkeit zur Selbstbestimmung«, der »Mitbestimmungsfähigkeit« und der »Solidaritätsfähigkeit« (S. 52) als bildungstheoretische Grundlage einer neuen Allgemeinbildungskonzeption korrespondiert sehr gut mit diesen Auffassungen.[37]
Die Sicherheit in den vorstehend skizzierten Grundlagen von Menschenbild und Integration, mit der Ludwig-Otto ROSER an der Seite von Adriano MILANI-COMPARETTI Integration im Bereich von Pädagogik und Therapie entwickelt hat und ihre Konkordanz mit den eigenen Auffassungen, mag eine Antwort auf die eingangs von mir gestellte Frage nach der von mir empfundenen Übereinstimmung mit Ludwig-Otto ROSER begründen.
Das Verdienst von Jakob MUTH, aus der Restauration des Bildungswesens der BRD heraus - von FRIEDEBURG hat sie hervorragend analysiert [38] - Integration zu betreiben, ist nicht hoch genug zu schätzen. Dennoch stellt es sich mir eindeutig so dar, daß die zentralen Anstöße zur Integration in der BRD weder aus den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates noch aus dem Modell der skandinavischen Länder und dem dort favorisierten »Normalisierungsprinzip« resultieren, sondern aus der Bewegung der »Demokratischen Psychiatrie« in Italien, wie sie von Franco BASAGLIA begründet wurde. MILANI-COMPARETTI und ROSER sind ihrerseits von den damit verbundenen Prozessen der Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung beeinflußt. Dies in dem Sinne, daß gerade diese Grundpfeiler sehr stark in die entstehenden Konzepte der schulischen Integration in Italien hineingewirkt haben und zwar weit mehr, als dies z.B. bei der in gleicher Weise sehr stark von der Bewegung der Demokratischen Psychiatrie beeinflußten DGSP (Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie) der Fall war, die ihre Arbeit schwerpunktmäßig auf die Dezentralisierung von Großeinrichtungen gerichtet hat, was nicht immer auch in die Überwindung des psychiatrischen Grundkonzeptes mündete. Quecksilber, wenn es zu Boden fällt, zerstiebt zwar in tausend Kügelchen - aber es bleibt giftig![39] Die Ausstrahlung der Demokratischen Psychiatrie in Italien und vor allem die Grundpositionen und -analysen, wie sie Franco BASAGLIA und Franca BASAGLIA-ONGARO entwickelt haben, waren Motor einer Integrationsentwicklung in der BRD, die eine Gesellschafts- und Institutionsanalyse in ihre Konzeptionen eingebunden hat. Gefährdet, als »neue Modelle der Segregierung mit Spareffekt« mißbraucht zu werden, sind vor allem jene als Integration imponierende Konzeptionen, die sich auf den schulischen Kontext begrenzen, einer Allgemeinbildungskonzeption entbehren und die Geschichte der Demokratischen Psychiatrie negiert oder nicht zur Kenntnis genommen haben. Sie überschlagen sich heute darin, Umetikettierungen von Sonderinstitutionen in Förderzentren bzw. Kooperationsmodelle zu favorisieren, die gesellschafts- und auch bildungspolitisch letztlich insofern neutral bleiben, weil sie das gegliederte Schulwesen und damit den ständischen Charakter eines das »Bildungsprivileg« wahrenden Schulsystems nicht wirklich in Frage stellen. Nur um diesen Preis werden sie heute, wo Integration im dargelegten Sinne eindeutig und bundesweit zurückgedrängt wird, hoffähig. Wie sehr der Einfluß der Integrationsbewegung in Italien auf die damalige BRD von den Traditionalisten und Separisten der Heil- und Sonderpädagogik gefürchtet war, wird in der laut Tonbandprotokoll getätigten Aussage des damaligen Bundesvorsitzenden des Verbandes Deutscher Sonderschulen e.V., Herrn PRÄNDL, in einem Gespräch mit dem Bundesbildungsminister, deutlich. Sie lautete: »Die italienische Seuche darf in Deutschland nicht grassieren - ich muß es so sagen.« Herr PRÄNDL wies den Vorwurf, die »besonderen Bemühungen um Integration behinderter Menschen in Italien als >italienische Seuche< diffamiert« zu haben, entschieden zurück[40] Wenn man sich klar macht, daß Seuche sich aus »Krankheit«, »Siechtum« herleitet und seit dem 17./18. Jh. im deutschen Sprachraum im Sinne einer »ansteckenden Epidemie«, einer »Verunreinigung mit Krankheitskeimen« gebraucht wird, wird die Ungeheuerlichkeit einer solchen Aussage deutlich.[41]
Der Weg kann, wie ich aufgezeigt habe (FEUSER 1995, Anm. 3), auch über »Förderzentren« und durch »Kooperation« zur Integration führen - aber nur dann, wenn man sich genau der Dimensionen bewußt sieht, deren Negation mir in Theorie und Praxis der Integrationsentwicklung und -forschung offensichtlich scheint - es sind die »beiden Gesichter« der Realität des Kranken (Behinderten; G.F.), von denen BASAGLIA spricht und mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Gerade das letzte Heft der Österreichischen Zeitschrift »Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft« 21(1998)1, das die Bedeutung von MILANI-COMPARETTI und (insbesondere mit den Beiträgen von Petra WEIS und Nadja KAUERMANN) von Andrea CANEVARO für die Integration hervorhebt, die durchaus auch in der Tradition von Franco BASAGLIA stehend betrachtet werden kann, dürfte eine ideale Ergänzung zu diesem Band für Ludwig-Otto ROSER sein.
»Haben nun die Italiener diese Frage gelöst? Sicherlich kann man das nicht behaupten, aber sie haben die eigentliche Frage erkannt und kommen allmählich dazu, sie nicht mehr mit dem immerhin realen Rehabilitationsbedürfnis des Behinderten zu maskieren.« (S. 32)[42] Ludwig-Otto ROSER verweist an dieser Stelle auf einen Nachruf zum Tode von Franco BASAGLIA und zitiert daraus: »Das Problem der Gewalt, den Dualismus von Macht und Machtlosigkeit, rückte Basaglia immer wieder in den Mittepunkt, die >Zerstörung des Autoritätsprinzips< war ihm ein wichtiges Anliegen: nicht als Wegwischen von menschlicher und fachlicher Kompetenz, sondern als Zersetzen des Automatismus, in dem Argumente der Mächtigen von selbst als die besseren gelten und gar von bloßer Gewalt ersetzt werden. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, daß man sich diesem Machtproblem tagtäglich stellen muß - und hat es auch in der Praxis versucht.« (S. 149/159)[43] BASAGLIA fordert die Auseinandersetzung damit, daß wir einen kranken (behinderten; G.F.) Menschen vor uns haben, der psychopathologische Probleme aufwirft, die dialektisch, nicht ideologisch zu verstehen sind und damit, daß wir einen Ausgeschlossenen, einen gesellschaftlich geächteten Menschen vor uns haben.[44] Das verweist uns auch bezüglich der Praxis der Integration sowohl auf ihre gesellschaftliche als auch auf ihre sozusagen interne, erziehungswissenschaftliche Dimension, die ich gerade im Werk von Adriano MILANI-COMPARETTI u. Andrea CANEVARO, so weit ich es mir erschließen kann, in besonderer Weise repräsentiert sehe. Ich habe diese schon mit dem von mir skizzierten Modell einer integrativ kompetenten Allgemeinen Pädagogik angesprochen, deren Kernstück eine »entwicklungslogische Didaktik« ist und mithin die Dimensionen einer »Kooperation am gemeinsamen Gegenstand« auf der Basis einer »Inneren Differenzierung durch (entwicklungsadäquate) Individualisierung« zum Integration begründenden Prozeß von Lehren und Lernen macht, das die BASAGLIA' sche Maxime berücksichtigt. Ludwig-Otto ROSER schreibt in seinem vorstehend schon zitierten Aufsatz: »Tüchtig ist nicht, wer mehr leistet als andere, sondern der, der alles das leistet, was potentiell in ihm möglich ist.« (S. 32, Anm. 13) Das wiederum steht dem sehr nahe, was ich nach Martin BUBER als zentrales Anliegen von Pädagogik schlechthin sehe, nämlich, daß es primär um das geht, was aus seinem Menschen seiner Möglichkeit nach werden kann. Das verweist Pädagogik und Therapie auf die Funktion, Handlungs- und damit Lernfelder und Lebensräume zu schaffen, die den Kindern und Jugendlichen, seien sie nun »behindert« oder »nichtbehindert«, Alternativen liefert in der Bewältigung ihres Lebens, in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse - auch der nach Bildung und Gesundheit. Es geht nicht um die Behandlung einer »Behinderung«, die aus unseren Annahmen über den anderen Menschen resultieren, sondern darum, einen Menschen mit Beeinträchtigungen nicht durch sozialen Ausschluß und reduktionistische, parzellierte Bildungsangebote in der Entwicklung seines ihm Möglichen zu behindern. Mithin geht es in gleicher Weise um Vermeidung von Ausschluß wie um Vermeidung von Behinderung. In der Unterstützung des Menschen mit allen pädagogisch, therapeutisch und materiell zu Gebote stehenden Möglichkeiten, sind Pädagogik und Therapie einander gleichgestellt. Aus dieser Sicht ist es, erschreckend, zu sehen, wie Konzepte der Gewalt wie z.B. das »forced holding«[45] heute als generalisierbare Erziehungspraktiken propagiert werden. Wenn Glenn DOMAN in der Arbeit mit Kindern mit Bewegungsbeeinträchtigungen und Anfällen dazu anleitet, wiederholt durch Einsatz einer Atemmaske Anfälle zu provozieren und dieser Traktur in bezug auf das Zentrale Nervensystem noch heilende Kraft zuspricht, der Eltern begeistert folgen, wird die Diskrepanz deutlich, die z.B. seine Therapie von der Andriano MILANI-COMPARETTIS trennt. [46] Schlimm genug, daß solches Tun als »Therapie« zu bezeichnen überhaupt vorgenommen und akzeptiert wird.
»Integration« selbst ist ein Artefakt: Es ist Ausdruck der Tatsache permanenter Ausgrenzung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Diesem Prozeß einen ihn pädagogisch auflösbaren Namen zu geben, rechtfertigt ihn allein als Begriff. In dem Maße, in dem sich in uns der Wandel hinsichtlich des Menschen- und Behinderungsbildes vollzieht, das wir in uns tragen, und wir in der Lage sind »pädagogische Fähigkeiten« im Sinne einer »Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik« zu entfalten, d.h. Ausschluß zu vermeiden und die Ausgeschlossenen aus ihren sie verwaltenden Institutionen zu befreien, wird der Begriff der Integration wieder verschwinden. Integration als Begriff mag auch den Sinn haben, zu erkennen zu geben, daß wir begriffen haben: Begriffen, daß unsere Praxis des Aus- und Einschlusses der Menschen, die unserem Bild, das wir von ihrem So-Sein haben, nicht entsprechen, uns fragwürdig geworden ist. Vielleicht haben wir auch schon begriffen, daß wir mit dem Ausschluß aus regulären Lebens- und Lernfeldern viele der Probleme erst schaffen, die die Kinder nicht hätten, wenn wir sie nicht ausschließen würden. Das ist mir und vielen mitarbeitenden Studentlnnen gerade im Laufe des vergangenen Wintersemesters im Rahmen einer Therapie für ein Mädchen mit Autismus-Syndrom und schwersten selbstverletzenden Verhaltensweisen, die wir mit ihr in ihrer Grundstufenklasse mit sogenannten geistigbehinderten Mitschülerinnen durchgeführt haben, überaus deutlich geworden. Mehr als zwei Drittel der Probleme, die wir pädagogisch, didaktisch und methodisch zu bewältigen hatten, resultierten nicht aus der Tatsache der Beeinträchtigungen der einzelnen Schülerinnen, sondern aus der Tatsache, daß sie in einer Klasse für Geistigbehinderte mit ihren Beeinträchtigungen eine Zwangsgemeinschaft bilden müssen, in der kein Kind vom anderen etwas lernen und mit dem anderen etwas tun konnte, wo jedes der Kinder in einem regulären Klassenverband einer Grundschule sehr viel hätte von seinen Mitschülerinnen lernen können und ein reichhaltiges Angebot an Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten gehabt hätte.
In den Beiträgen der Tagung vom November 1980, auf die ich eingangs verwiesen habe, waren diese Erkenntnisse bereits deutlich artikuliert. Integration, so sagte ich damals, kann nichts anderes meinen und bedeuten, als die Wiederherstellung der durch den Ausschluß zerstörten gemeinsamen Lebensrealität, die es in kooperativen und kommunikativen Handlungen ständig neu herzustellen und zu erhalten gilt. [47] Ludwig-Otto-ROSER sagte in seinem Vortrag: »Dabei ist die Suche nach dem, was der Behinderte kann, wichtiger als die Arbeit an all dem, was er nicht zu tun vermag.« (S. 23, Anm. 13) Mit Integration, so könnten wir heute resümieren, geht es um die Schaffung von Lebenswelten, die sich dem Menschen anpassen, seinen Möglichkeiten, zu handeln, zu denken, zu lernen, sich zu entwickeln. Lernen in diesen Kontexten ist kooperatives Handeln, das Handlungen aller Kinder verändert. Die Veränderungen, die wir bislang von Kindern verlangen, auch von solchen mit schweren Beeinträchtigungen, müssen wir von uns selbst, von den Institutionen verlangen, die wir errichtet haben, damit Kinder sich ändern, wenn wir mit ihnen nicht übereinstimmen können. Die Energie, die wir in diese Passung stecken, würde ausreichen, uns und unsere Institutionen zu ändern, d.h. aus ihnen Stätten der Begegnung, des gemeinsamen Tuns und damit eines effizienten Lernens zu machen, denn, so Ludwig-Otto ROSER, »Behinderte und nichtbehinderte Kinder zusammen zu erziehen, ist also nicht nur eine moralische Frage, sondern auch eine der pädagogischen Effizienz.« (S. 22, Anm. 13). Pädagogische Effizienz wird in Deutschland von der absoluten Mehrheit derjenigen, die politische Verantwortung haben sowie von der Mehrheit der Lehrerinnen und Eltern immer noch und nur durch das selektierende und segregierende Schulsystem garantiert gesehen.
Die Momente der Integration, die ich in diesem knappen Beitrag aufzuzeigen versucht habe, stehen heute in Opposition zu Bestrebungen, Menschen mit schweren Beeinträchtigung aller Entwicklungs- bzw. Lebensaltersstufen als »lebensunwert« zu erachten und ihre Tötung i.S. einer »Neuen Euthanasie« ethisch zu rechtfertigen. Die Bioethik-Konvention, zynischerweise nach den erfolgten Protesten in »Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Menschenrechtsübereinkommen zu Biomedizin« 1996 umgetauft, sieht u.a. fremdnützige Eingriffe und die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei nicht einwilligungsfähigen Menschen vor. Die Spitze eines Eisberges der Nutzung und Vernutzung von schwer beeinträchtigten Menschen, die vielleicht - eine Horrorvision - zukünftig nur am Leben gelassen werden, wenn sie diesen Preis zu bezahlen bereit sind - den wir für sie bestimmen. Es tönen die Worte von Franz CHRISTOPH (1980) im Ohr: »Nichtbehinderte müssen endlich zugeben, daß sie an der gewaltsamen Ausgrenzung Behinderter beteiligt sind, daß sie Behinderten das Recht verweigern, für sich selbst zu sprechen, daß sie denken, wir Behinderte führten, gemessen an ihren Wertvorstellungen ein unwertes Leben. Nichtbehinderte müssen deshalb versuchen, ihre Normalität und ihre Wertvorstellungen zu überprüfen.« (S. 36)[48]
Ludwig-Otto ROSER hat mit seinem gesamten Wirken gerade auch zu dieser Forderung Wesentliches beigetragen. Zum Abschluß dieses Beitrages möchte ich Ludwig-Otto ROSER, in Ergänzug der Aussage, die ich als Überschrift meines Beitrages wählte, noch einmal zitieren: »Dagegen, mit dem Behinderten in der realen Umwelt leben und wirken erfordert ein ständiges Überdenken und Suchen, erfordert Kreativität, Flexibilität, Auseinandersetzung. Wir sollten uns nicht davor fürchten, denn Sondereinrichtung ist Ausdruck von Angst und Pessimismus, Integration ist Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden Welt.« (S. 53)[49]
[30] ROSER, O.: Gegen die Logik der Sondereinrichtungen. In: Behinderte 10 (1987) 2, 37-53
[31] MUTH, J.: Besondere Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher nach den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates von 1973. In: VBE (Hrsg.): Konzepte und Organisationsformen sonderpädagogischer Hilfen. Dokumentation der 1. Fachtagung Behindertenpädagogik des VBE am 27. und 28. Nov. 1986 in Wiesbaden. 1987, Heft 4, S. 15-23
[32] ROSER; O.: Keine Aussonderung Behinderter: Gemeinsam leben und lernen. In: Behindertenpädagogik 20(1981)1, 18-23
[33] siehe FEUSER, G.: Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt 1995; ders.: Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Behindertenpädagogik 28(1989)1, 4-48
[34] Siehe REICHMANN, E. (Hrsg.): Handbuch der kritischen und materialistischen Behindertenpädagogik. Solms-Oberbiel 1984
[35] FEUSER, G.: Integration muß in den Köpfen beginnen. Bedarf es einer eigenen Pädagogik zur gemeinsamen Erziehung Behinderter und Nichtbehinderter? In: Welt des Kindes 63(1985)3, 189-195
[36] BORSTEL, Anna von: Pedagogia Integrativa - Beispiel aus Italien. In: Behindertenpädagogik34(1995)4, 357-372
[37] KLAFKI, W.: Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein zeitgemäßes Konzept allgemeiner Bildung. In: KLAFKI, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel 19912
[38] FRIEDEBURG, L. von: Bildungsreform in Deutschland. Geschichte und gesellschaftlicher Widerspruch. Frankfurt/Main 1989
[39] Siehe FEUSER, G.: Die Lebenssituation geistigbehinderter Menschen. In: fib e.V. (Hrsg.): Leben auf eigene Gefahr. Geistig Behinderte auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. München 1995, 258-286
[40] Siehe hierzu: Aussprache. In: Zeitschrift für Heilpäd. 32(1981)11, 802-804
[41] Daß mit der damaligen Empörung über eine solche Aussage der Diffamierung der Integration ein Ende gesetzt worden wäre, erweist sich bis heute als Irrtum. Auch ich »verseuche«, wie ich durch verschiedene Telefonate gerade vergangene Woche »vertraulich« erfahren mußte, ganz Österreich
[42] ROSER, O.: Integration Behinderte in Italien: Anspruch und Realität. In: Behinderte 4(1981)3, 28-33
[43] Redaktion, Die: Zum Tode von Franco BASAGLIA. In: Behindertenpädagogik 230(1981)2, 148-150; Übernahme eines Beitrages aus der Zeitschrift Dr. med Mabus (1980)18, S. 27
[44] BASAGLIA, F.: Die Institution der Gewalt. In: BASAGL1A, F. (Hrsg.): Die negierte Institution oder Die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. FrankfurtlM. 19872, S. 122-161
[45] Siehe hierzu die in der Ausgabe 27(1988)2 der Z. Behindertenpädagogik umfassend geführte Diskussion
[46] Siehe Sendung von N3 zur Doman-Therapie vom 03.11.97 mit dem Titel »Eine Chance für Malin. Hilfe durch Hirntraining«
[47] FEUSER, G.: Integration statt Aussonderung Behinderter. In: Behindertenpädagogik 20(1981)1, 5-17
[48] CHRISTOPH, F.: Schizophrenie ist ein Teil unserer Realität. In: päd extra, Sozialarbeit, Heft 7/8, August 1980
[49] ROSER, O.: Gegen die Logik der Sondereinrichtung. In: Behinderte 10(1987)2, 37-53
Chronik einer Wunscherfüllung[50] - Ludwig-Otto Roser
Die Firma
»Nuovo Pignone« ist eine metallverarbeitende Industrie am Stadttand von Florenz. Sie beschäftigt 3.500 Arbeiter. Unter anderem werden hier die Kompressoren für die Erdgaszufuhr aus Sibirien gebaut. Im »Nuovo Pignone«, einem Betrieb mit finanzieller Beteiligung des Staates (Participazioni Statali), sind Arbeitsprozesse und Personalpolitik streng rationalisiert. Dennoch muß die Direktion, wie alle italienischen staatlichen und privaten Betriebe, sich dem Gesetz 482 aus dem Jahre 1968 abpassen, das in etwa die Anstellung von einem Behinderten je 20 Arbeiter bestimmt. Es ist nicht möglich, sich freizukaufen! Es war aber und Ist zum Teil heute noch üblich, mit dem Schweregrad der Behinderung zu jonglieren: Auch die Amputation eines Fingers ist eine Behinderung. Das Arbeitsamt erlaubte eine gewisse Auswahl der Behinderten unter Berücksichtigung der Charakteristik des zu besetzenden Arbeitsplatzes.
Der Betriebsrat fordert Einstellung von schwer Behinderten
1980 entschließt sich der Betriebsrat des »Nuovo Pignone«, die Direktion aufzufordern, bei dem nächsten Anstellungsschub »wirkliche« Behinderte mit einzubeziehen. Die Unterhandlung ist nicht einfach bringt aber den ersten Erfolg: Fünf schwer Behinderte, unter ihnen auch Geistigbehinderte, sollen eingestellt werden. Die Direktion nimmt mit dem Arbeitsamt Kontakt auf. Es werden fünf Namen genannt: darunter ist Carlos, ein Spastiker. Ich kenne Carlos seit seinem sechsten Lebensjahr und hatte ihn zuletzt im Frühjahr 1980 zu Hause besucht, weil er unter anderem auch unter Depressionen litt. Ein Jahr nach dem Abschluß der normalen Regelschule (1979) hatte ihm nämlich das Arbeitsamt noch keine Stelle vermittelt. Nun endlich: Die Anstellung in der wichtigsten Fabrik der Toskana! Sein Wunsch und der Traum seines nicht zum Fabrikarbeiter aufgestiegenen Vaters hatten sich erfüllt.
Carlos arbeitet: Botendienste und Postverteilung in den einzelnen Verwaltungsbereichen und Produktionsabteilungen. Vorher wurde diese Aufgabe von Arbeitern übernommen, die nicht mehr in den Werkhallen und an den Maschinen tätig sein konnten: Kranke, Arbeitsunfähige. Die Frustrationen dieser Menschen, ihr Gefühl, beiseite gestellt worden zu sein, brachte es mit sich, daß die Vermittlung zwischen den verschiedenen Sektoren des Betriebes nur sehr langsam lief und noch dazu in völlig unbefriedigender Weise. Carlos, in seinem erwachenden Metallarbeiter-stolz, hat diese Tätigkeit in wenigen Monaten zur Perfektion gebracht. Carlos hat schnell gelernt, sich in dem großen Fabrikgelände zu orientieren. Sein gutes Gedächtnis hilft ihm, Namen und Produktionsvorgänge, Werkhallen und Büros richtig einzuordnen. Er steht in ständigem und gutem Kontakt zu seinen Kollegen: Ingenieure, Technische Zeichner, Arbeiter haben gelernt, seine Sprache zu verstehen. Vertrauen wird in ihn gesetzt - in bezug zu seiner Arbeit hat er Selbstvertrauen gewonnen: Er fühlt sich wichtig. Er ist auch wichtig. Er läßt sich von niemandem gerne vertreten. »Wir haben bemerkt, daß Behinderte schneller und froher arbeiten als sogenannte Nichtbehinderte - vielleicht, weil sie sich beweisen wollten«, stellte die Direktion fest, als unser Team im Auftrag der Gesundheitsbehörde (USL) auf Einladung des Betriebsrates den »Nuovo Pignone« besuchte, um neue Arbeitsplätze für Behinderte ausfindig zu machen. Aber darüber zum Schluß.
Ein Problemkind
Carlos ist 1962 geboren. Seine Mutter war 44 Jahre alt und hatte die Schwangerschaft erst im siebten Monat bemerkt. Geburtsgewicht: 2,5 kg. Carlos Geburt vollzog sich normal. Seine langsame Entwicklung (laufen mit zwei Jahren, spätes Sprechen, begrenzte Wahrnehmung) wurde von den Kinderärzten auf das geringe Geburtsgewicht, also auf eine globale Unreife bezogen. Es ist die Zeit, in der Prof. MILANI-COMPARETTI in Florenz für Früherkennung kämpft und die Kinderärzte beschuldigt, mehr um die Beruhigung der Eltern besorgt zu sein als um das Erkennen entwicklungsstörender Krankheitsbilder.
Die durch ihr Alter und ihr Lebensschicksal überängstliche und sorgenvolle Mutter schickt das Kind Carlos nicht in den Kindergarten. Er wird als ein krankes Kind erlebt. Erst kurz vor dem Schulalter, am 10. 9. 1968, sehe ich Carlos zum ersten Mal. Es ist mir gleich klar, daß das Kind vor allem motorische Probleme hat, und ich schicke die Familie zu Prof. MILANI-COMPARETTI, der schon zu dieser Zeit Weltruf in der Behandlung körperbehinderter Kinder erlangt hatte. Seine Diagnose: Gemischte Kinderlähmung mit leichter Spastizität. Motorische Fehlfunktionen des Typs »Choreoathetose« (= schnelle, unwillkürliche Kontraktionen einzelner, wechselnder Muskeln oder Muskelgruppen; dadurch kommt das Bild allgemeiner motorischer Unruhe und ständigen Grimassierens zustande, unwillkürliches Schnalzen, Grunzlaute - mit zunehmendem Alter meist geringer werdend).
Mein Eindruck war, daß Carlos durch seine motorische Ungeschicklichkeit, sowie durch seine Sprachstörungen und die Überbehütung der Mutter seiner Intelligenz nicht hat Ausdruck geben können. Damals war noch der meistbegangene Weg in diesen Situationen die Einweisung in einen Sonderkindergarten. Carlos besuchte MILANI-COMPARETTIs »Istituto Anna Torrigiani«, machte Krankengymnastik und Sprachtherapie)[51]
Die Lösung von der Mutter während der acht Stunden des Tagesaufenthaltes im Sonderkindergarten fiel Carlos sehr schwer. Er reagierte mit großer Unruhe und Opposition. Drei Jahre lang bemühten sich Therapeuten, Ärzte und Psychologen, den Eltern Vertrauen in die Fähigkeiten Carlos zu vermitteln. Es waren schwierige Eltern: der Vater leicht erregbar und aufbrausend, immer auf der Suche nach den Schuldigen der Situation, immer bereit zu kämpfen. Er kämpfte allerdings auch, um aus der Situation des Kindes das Beste zu machen. Die Mutter müde und verängstigt, denn ihr Mann konnte auch gewalttätig sein. Von Carlos älterer Schwester war nie die Rede. Im Institut MILANI-COMPARETTIs, in dem ich damals als psychologischer Berater einmal in der Woche mitarbeitete, verbrachte Carlos zwei Kindergartenjahre und ein vorbereitendes Schuljahr. Schließlich, im Sommer 1971, mein Vorschlag: Carlos kann eine normale Regelschule besuchen, er ist intelligent, wird seinen Weg finden und das Versäumte im Kontakt mit einer normalen Umwelt schneller nachholen, vor allem lernen, sich besser auszudrücken, sich anzupassen und seine schon erreichte Autonomie auszunutzen. Die besten Fortschritte hatte er in der Fortbewegung erreicht: Er konnte ohne Stützen gehen und laufen, war in allem selbständig geworden. Nur die Arbeit der Hände war noch stark durch Lähmungen gestört. Zeichnen und schreiben waren für ihn sehr mühsam. Die Sprache hatte sich sehr bereichert, aber sie war - durch Störungen im Zentralnervensystem bedingt - noch schwer verständlich. Einmal aus dem Institut »Anna Torrigiani« entlassen, sollte Carlos nur noch ambulant Sprachtherapie und Gymnastik in dem seiner Wohnung am nächsten liegenden Zentrum machen. Sonst aber ein normales Leben leben.
»Wilde« Integration
1971 - das war die Zeit der ersten sogenannten »wilden« Integrationen in Italien. Die Schule hatte keine Rechtsmittel, behinderte Kinder abzulehnen! Aussonderung in Sonderschulen war nicht obligatorisch, sondern nur naheliegend und der immer noch am häufigsten gewählte Weg. Eine Idee hatte sich verbreitet, die bald weite Bevölkerungskreise beeindruckte: Sie hieß »anti-emarginazione«, d.h. dagegen zu sein, Menschen an den Rand zu drängen und in Heime oder Sonderschulen abzuschieben. Welcher Weg sollte da begangen werden, um die Idee nicht im akademischen Experimentieren und in reformistischen, zeitraubenden Projekten zu verwässern?
Der radikalste Weg führte zum Abstandnehmen von den Sondereinrichtungen, diesen sich selbst schließlich zum Ziel habenden Sondereinrichtungen. Durch ihre langsame Schließung wurde in eine neue Richtung gegangen: Rehabilitieren in der Normalität. Das bedeutet auch, eine Kritik unserer bisherigen Intentionen und Arbeitsweisen zu wagen. Gerade zwischen 1970 und 1975 (also in Carlos ersten »Normal«-Schuljahren) hat sich ein Kampf vollzogen, der den Beteiligten unvergeßlich bleiben wird. Vor allem: Dieser Kampf stützt sich auf einen Glauben von der Richtigkeit unserer Ziele: und nicht, wie heute, auf die Erfahrung der intensiven Förderung, die ein Kind in seiner funktionalen und sozialen Entwicklung erfährt, wenn es von vornherein nicht ausgesondert wird.
Wäre Carlos zehn Jahre später in Italien geboren,
-
dann wäre vieles Leiden am Sonderdasein vermieden worden,
-
dann wäre ein Junge wie Carlos in seinen Schwierigkeiten früherkannt worden,
-
er hätte die Kinderkrippe besucht, wie es heute für alle behinderten Kinder vorgeschlagen wird,
-
dann hätte er den örtlichen Kindergarten besucht,
-
seine Eltern wären frühzeitig psychologisch und sozialpädagogisch unterstützt worden,
-
er hätte die erste Elementarschulzeit nicht als ein Tauziehen zwischen Eltern, Therapeuten und widerständigen Lehrerinnen erlebt,
-
dann wäre ihm vielleicht auch noch der Besuch einer Berufsschule möglich gewesen.
Am 1. Oktober 1971, also erst mit neun Jahren, wird Carlos in die Regelschule seines Wohnbereiches eingeschrieben. Er ist immer noch ein sehr unruhiges Kind, schwierig im sozialen Kontakt. Der Direktor der Schule empfindet trotzdem die Eingliederung Carlos nicht als problematisch. Schwierigkeiten gibt es dagegen gleich mit seiner Lehrerin. Die Schule gehörte damals nicht in meinen Arbeitsbereich, aber die zuständige Kollegin des Ambulatoriums hat die Entwicklung Carlos sorgfältig aufnotiert.
Rückblick
Nach so langer Zeit und im Rückblick auf die damalige, im Vergleich zu heute völlig verschiedene Situation ist es nicht einfach, die Dynamik der Schwierigkeiten zu rekonstruieren, die diese Lehrerin mit Carlos hatte.
Sicherlich standen damals sehr viel mehr Eltern und Lehrer als heute der Integration behinderter Kinder in die Regelschule skeptisch oder gar feindlich gegenüber. Dies provozierte auch eine viel härtere Auseinandersetzung. Vielleicht war die gesellschaftliche Auseinandersetzung auch sehr viel emotionaler als beispielsweise in Dänemark, wo zur gleichen Zeit mit den gleichen Überlegungen der gleiche Weg eingeschlagen worden ist.
Behinderte Kinder, die mit neun oder gar mit zehn Jahren eingeschult wurden, empfand man als »Fremdkörper«, man war überzeugt, sie müßten unter dem plötzlichen Übergang leiden. In Wirklichkeit litten die Erwachsenen, denn trotz des Kontaktes mit den Fachleuten und trotz der sonderpädagogischen Programmierung wußte man nicht, wie der noch ganz auf Selektion eingestellte Schulbetrieb der neuen Situation hätte gerecht werden können. Der Blickpunkt ist der gleiche gewesen, der heute noch vor allem in Deutschland Befürchtungen wachruft: Wie reagiert das Kind auf den Übergang vom Schonraum in die »grausame« Realität? (Wobei die Grausamkeit meist als von den »normalen« Kindern ausgehend empfunden wird!) Was machen die Lehrer und die Lehrerinnen ohne sonderpädagogische Vorkenntnisse? Wie kann man im Betrieb einer normalen Klasse den »besonderen« Bedürfnissen eines Behinderten gerecht werden?
Die nachfolgenden Jahre haben die Antwort gegeben: Behinderte Kinder, die von vornherein mit Nichtbehinderten aufwachsen, haben nicht mehr Probleme des sozialen Kontaktes als andere Kinder. Die behinderten Kinder haben durch ihr Dabeisein das Schulwesen verändert, kindergerechter gemacht, sie haben der Regelschule die Selektionsangst genommen: Die Nichtfachleute unter den Erwachsenen haben eine »sonderpädagogische Phantasie« entwickelt: Es ist das Bemühen, für jedes Kind individuell, seinen Bedürfnissen entsprechend, die Mittel zu seiner Förderung zu entdecken.
Diese Gegenüberstellung von gestern und heute in Italien entspricht dem Vergleich zweier gegensätzlicher Einstellungen, die in der Art und Weise der menschlichen Zuwendung ihren Ausdruck finden. Gerade das Beispiel Carlos läßt es uns klar erkennen: Wir sagten, daß ihn die Lehrerin nicht akzeptierte. Es entstand ein Zirkel, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien. Das Gefühl dieser Lehrerin, nicht mit Carlos arbeiten zu können, traf zunächst ganz schwer Carlos Eltern, die von uns Fachleuten überzeugt worden waren, daß das Kind sich normal entwickeln könne. Die Ängste der Mutter entfachten die Aggressivität des Vaters. Carlos identifizierte sich mit der Kampfaktion seines Vaters und begann, seine Lehrerin zu ärgern und willentlich zu stören. Die Lehrerin quälte den Direktor, sie von diesem Joch zu befreien. Zwei Jahre blieb Carlos dennoch mit ihr zusammen. Auch eine Feindschaft wird zur Bindung, und wenngleich Carlos Vater im Pathos eines Kreuzzuges dafür gesorgt hatte, daß die Zeitungen über Carlos Lehrerin sprachen, und obgleich der Kampf mit der Versetzung der Lehrerin geendet hat, erbrachte diese Zeit für alle auch sehr positive Momente: z.B. lange Gespräche mit Lehrern, Schuldirektoren und Fachleuten über die Notwendigkeit, der Regelschule ein anderes Antlitz zu verleihen, oder auch die Erkenntnis, nicht die Belange des Erwachsenen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Interessen des Kindes.
Und hier die andere Einstellung: In der dritten Klasse bekommt Carlos einen Lehrer. Von ihm fühlte er sich akzeptiert, und von diesem Augen-blick an hat der Junge keine Probleme mehr mit der Schule gehabt: Ohne Unterbrechung hat er die Grundschule der Regelschule (Scuola Elementare) und dann die Mittelstufe (Scuola Media) absolviert.
Dieser Wandel ist nicht leicht zu analysieren. Es ist sicher zu einfach gesehen, wenn man behaupten will, dieser Lehrer hat Carlos lediglich besser zu nehmen gewußt. Ohne Zweifel hat die Verschiebung des Blickpunktes auf Carlos' Fähigkeiten sehr viel mehr erbracht als der intensive, ständig verbessernde Angriff auf seine Schwächen, wie es die Lehrerin versucht hatte. Der Lehrer hat Carlos die Angst und die Unsicherheit genommen, so konnte er dann auch die Leistungen erbringen, die vorher nicht denkbar waren (ein Problem, das ja bekannterweise nicht nur die behinderten Kinder betrifft). Eine große Rolle hat sicher aber auch gespielt, daß die Eltern mit Carlos Lehrerin sich nicht haben befreunden können. Die Verteidigungsmechanismen auf beiden Seiten hatten gleich zu Anfang jedes gegenseitige Verständnis zerstört.
Für den Lehrer dagegen war Carlos Dabeisein ganz selbstverständlich. Vater und Lehrer verstanden sich aber auch in der Zielsetzung: Ihr Kampfruf »Carlos wird eines Tages Arbeiter in einer Fabrik« wurde zum Symbol eines normalen Lebensweges. Carlos hat gewiß seine Kraft bewiesen, und eine fortgeschrittenere Gesellschaft hätte ihn darin unterstützt.
Entspannung in der Schule - Spannungen in der Familie
Mit dem Übergang zur Mittelstufe der Regelschule kam Carlos wieder in meinen Arbeitsbereich. Ich bemühte mich um einen häufigen Kontakt mit der Schule, aber eigentlich war Carlos ganz autonom: Er hatte schon seit einer Weile begonnen, mit besonderem Fleiß für die Schule zu arbeiten. Er war in vielem, auch durch sein Alter, reifer als seine Mitschüler. Sein Bemühen wurde zum Ansporn, alle hatten sich an seine immer noch schwierig zu verstehende Sprache gewöhnt. Die Fortsetzung der Sprachtherapie hat nicht viel gebracht. Auch die Schrift war schwer zu lesen, aber inzwischen hatte Carlos eine sehr leise elektrische Schreibmaschine bekommen, mit der er auch in der Klasse schreiben konnte ohne zu stören.
Meine Arbeit konzentrierte sich in den nachfolgenden Jahren auf den Versuch, durch häufige Gespräche mit der ganzen Familie Carlos Autonomie zu fördern. Die Mutter war ängstlich geblieben, aber Carlos holte sich die Freiheit, bestand darauf, trotz seiner motorischen Unsicherheit, allein zur Schule zu gehen. Carlos lernte auch, die Hilfe seiner Mitschüler zu suchen, wenn er bei den Hausarbeiten etwas nicht verstand. Allmählich wehrte er sich gegen den oft noch streitsüchtigen Vater, versuchte zwischen Mutter und Vater auszugleichen. Inzwischen verschob sich aber auch die Aufmerksamkeit, die bisher nur Carlos gewidmet war, auf die ältere Schwester, die mit einem von den Eltern nicht akzeptierten Freund ihre eigenen Wege gehen wollte. Carlos Behinderung und der Kampf um seine Emanzipation hatten sie an den Rand gedrängt. Zur gleichen Zeit begann der Vater an einer Nierenerkrankung zu leiden, die dann nach wenigen Jahren zu seinem Tode führen sollte. Im Februar 1978 (Carlos besuchte mit fast 16 Jahren das vorletzte Pflichtschuljahr) konsultierte die Familie Prof. MILANI-COMPARETTI, der den Jungen lange nicht mehr gesehen hatte. Er schreibt in Carlos Akte: »Die Eltern klagen über große Spannungen in der Familie; Carlos ist rebellisch und besessen in seinem Bedürfnis, in der Schule gut und pünktlich zu sein - zum Teil wird es sich um Spannungen des Entwicklungsalters handeln, zum Teil aber auch um Schwierigkeiten im Verhältnis zum Vater, der im Augenblick selbst große Probleme hat.«
Ich intensiviere meine Hausbesuche und die Gespräche mit Carlos: Ganz klar verträgt er auch nicht, daß er nicht mehr im Mittelpunkt steht. Seine Schwester ist aus dem Haus gegangen, und dieses Drama absorbiert alle Aufmerksamkeit, vermischt mit der Angst um die Gesundheit des Vaters. Carlos Vater hat sein eigenes Schicksal und die Außenwelt immer als etwas Feindliches erlebt. Carlos hat das von ihm übernommen und ist deprimiert. »Ich habe keine Freunde, weil ich Spastiker bin« sagt er zu mir. »Hat Dein Vater Freunde?« frage ich ihn und versuche ihm zu beweisen, daß alle Mitschüler ausgesprochen nett zu ihm sind, daß er es ist, der sich verschließt und der seinen Mißmut auf die Außenwelt projiziert. Im Gespräch mit der ganzen Familie kommt es zutage, wie pessimistisch im Augenblick in Carlos Zuhause das Leben und die Umwelt eingeschätzt wird. Ich sah damals den Vater täglich, denn er arbeitete als Koch in der geschützten Werkstatt, in der ich als Psychologe tätig war. Er versuchte, seiner Arbeit etwas Kreatives zu verleihen, indem er fast zu jedem Mittagessen mit neuen Gerichten überraschte. Weil er so gut kochen konnte, verziehen ihm alle sein grobes Wesen und seine Aggressionen. Er entschuldigte sie mit seiner Krankheit, aber eigentlich ist er immer so gewesen.
Auflösung der geschützten Werkstatt
Zwischen 1978 und 1980 ist es unser aller Bemühen, die 1966 aufgebaute geschützte Werkstatt aufzulösen. Fast täglich sitzen wir alle zusammen, Behinderte und Nichtbehinderte, Fachleute und Putzleute, und diskutieren; oft kommen auch die Angehörigen der Behinderten dazu. Carlos Vater ist immer dabei; er berichtet vom Leben und Lernen in der Normalität, was die Behinderten in unserer Werkstatt nicht kennengelernt hatten. Das Zentrum wird als Ghetto empfunden, als künstliche Arbeitswelt, ohne Kontakt mit der Außenwelt. Seit 1979 wird im Zentrum nicht mehr gearbeitet, sondern nur noch diskutiert: Es entsteht ein Programm der »Eroberung der Außenwelt«.
Sechsergruppen begeben sich mit den Bussen des Zentrums auf Arbeitssuche im Wohnbereich der einzelnen Behinderten. Carlos Vater verändert das Menü, damit die Speisen auf diese Exkursionen mitgenommen werden können. Es geht ihm immer schlechter, und er meldet sich oft krank. Diese Tatsache wird benutzt, um von unserer Verwaltung zu erbitten, nicht mehr die Mensa zu finanzieren, sondern den Behinderten und dem Personal zu erlauben, auf diesen Wanderungen durch die Stadt in Gasthöfen zu essen. Praktisch bleibt das Zentrum den ganzen Tag leer. Nicht alle Mitarbeiter haben diesen Weg gehen wollen. Das Zentrum bildet für sie einen ruhigen Bezugspunkt; es bietet Behinderten und Nicht-behinderten Sicherheit.
1980 schließt das Zentrum. Es hatte in seiner »Glanz«-zeit 50 jugendliche und erwachsene Körper- und Geistigbehinderte betreut. Ich hatte mich 1996 beigeistert um den Aufbau und den Ausbau bemüht. Nun hatten wir alles drangesetzt, diese leerlaufende Sondereinrichtung wieder abzubauen. Von den 50 »Betreuten« haben 39 Arbeit gefunden. Vier leben zu Hause und stehen durch zivildienstleistende junge Menschen im Kontakt mit der Außenwelt; drei leben in einer »Casa Albergo«, vier in einem Heim alter Prägung. Das Personal arbeitet heute in den Einrichtungen der nach der Gesundheitsreform entstandenen Gesundheitsbehörde, zum großen Teil in Ambulatorien, die sowohl die zu Haus gebliebenen Behinderten betreuen als auch die Arbeitenden, wenn sie Heilgymnastik, Untersuchungen, Prothesen oder Rollstühle brauchen.
Carlos Vater ist ein großer Kämpfer für diese Entwicklung gewesen; er hatte auch ein gewerkschaftliches und ein großes politisches Interesse für die Eingliederung Behinderter in die normale Arbeitswelt. Dies war ja auch von vornherein sein Traum für Carlos. 1979 bekommt Carlos seinen Regelschulabschluß: Ein reguläres Examen! Mit seinem Eifer und seiner Zähigkeit hat er großes Lob geerntet. Sicher hatte er das Bild seines kämpferischen Vaters vor Augen, wenngleich sie sich ständig in die Haare gerieten. Nach dem Schulabschluß war für Carlos klar, eine Arbeit suchen zu müssen. Jede Woche lief er aufs Arbeitsamt - ein ganzes Jahr lang. Der Mißerfolg und das Warten verstärken seine Depressionen. Sein Vater hatte nun schon nicht mehr die Kraft zu kämpfen und zu schimpfen. Dafür tat es Carlos um so mehr; bei Streiks und Umzügen humpelte er immer allen voran. Dann kam schließlich der große Tag »Nuovo Pignone« hatte fünf Behinderte angefordert. Carlos wurde angestellt.
Im November 1983 ist Carlos Vater gestorben. Carlos lebt nun allein mit seiner Mutter. Sie erzählt mir, daß er über seine Arbeit nach wie vor begeistert ist und, daß er in diesen Tagen im Fabrikbereich einer neuen, verantwortungsreichen Aufgabe zugewiesen werden wird. Er geht ganz in seiner Arbeit auf, macht aber zu Hause seiner Mutter das Leben schwer, wie es der Vater getan hatte. Mutter und Sohn leben nun alleine zusammen und werden alle Probleme durchleben, die ein solches Verhältnis mit sich bringt. Carlos sucht den Psychologen schon lange nicht mehr auf; aber die Mutter bittet öfters um Rat und Stütze.
Zwei Aspekte stehen in dieser Chronik im Vordergrund:
Der eine ist, daß nicht die Behinderung an und für sich hemmend in der Entfaltung eines Lebens ist, sondern wie sie vom betroffen Individuum und vor allem von der Umwelt verarbeitet wird. Diese Realität erklärt, warum Therapie und Rehabilitation oft mystifizierend an der Oberfläche der Probleme haften bleiben. Es ist nicht die Gesundung des Behinderten, die für die Erfüllung seines Lebenszieles entscheidend wird. Wie in jedem Menschen ist auch für ihn das Wohlbefinden ein Verschmelzen der individuellen Kräfte und Bedürfnisse mit den Bedingungen der Außenwelt. Im menschlichen Bereich kann die Verschmelzung nur als reziproker Prozeß verstanden werden.
Carlos Sprache ist heute noch genauso schwer zu verstehen wie vor den zahlreichen Therapieversuchen. Seine Bewegungen sind noch ganz charakteristisch für das klinische Bild, das seine Bewegungsstörungen determiniert hat. Sein Charakter erschwert Freundschaften, wie es schon dem Vater ergangen ist. Sein Erfolg in der Arbeit liegt in seiner Zähigkeit und in seinem Willen, tätig zu sein, was schon sein Verhalten in der Schule bestimmt hatte. Das Unverständnis seiner ersten Lehrerin hat ihn im Durchhalten geschult, das Vertrauen des nachfolgenden Lehrers hat sein Selbstvertrauen gestärkt.
Im Zusammenspiel von Selbstbestimmung und Umweltgegebenheiten vollzieht sich ein Schicksal, das aber nicht unbedingt charakteristisch für Behinderung ist. Carlos ist ein Mensch geworden mit Grenzen und Problemen, wie sie alle Menschen haben. Es ist auch bestimmt nicht die Schule gewesen oder die Jahre der Rehabilitation, die seine Behinderung kompensiert haben, noch hätte man sich eine Ausbildung denken können, die imstande gewesen wäre, ihn so perfekt in die Arbeitswelt zu integrieren. Wir hatten jahrelang den Fehler begangen, Rehabilitation als mechanistisches Ergebnis von Gesundung, Ausbildung und Anpassung an die Bedürfnisse der Umwelt zu verstehen. Wir vergaßen dabei, daß auch die menschliche Umwelt anpassungsfähig ist, daß Zivilisation sich entwickelt und, daß ein Mensch auch anders sein darf.
Und hier der zweite Aspekt, der diese Geschichte charakterisiert: Es gibt keine noch so hochgeschulte und spezialisierte Umwelt, selbst in einer Industriegesellschaft, in der nicht der Behinderte mitwirken kann. Es kommt nicht so sehr darauf an zu bestimmen, was er kann und wie er zu schulen sei, sondern es kommt darauf an, ob man ihn will.
Das Gleiche gilt für die Schule. Nehmen wir auch an, daß man sich der Logik beugen muß, einem Arbeiter, der die Beete in den Anlagen einer Fabrik säubert, kein Metallarbeitergehalt geben zu können. Die Leute im Betriebsrat des »Nuovo Pignone« haben mir das gut erklärt. Carlos Tätigkeit ist zu seinem Glück unmittelbar an den teuren Produktionsprozeß gebunden. Er bekommt heute das normale, gute Gehalt eines Metallarbeiters. Unsere Arbeitsgruppe (Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen) hat sich eine Woche lang, zusammen mit dem Betriebsrat des »Nuovo Pignone«, damit beschäftigt, in dem riesigen Betrieb zu entdecken, welche Arbeitsplätze für Ungeschulte, schwerer Behinderte, auch Geistigbehinderte sein könnten, die in der normalen Berufsschule nicht mitgenommen sind. Wo kann man in einer solchen Fabrik nur aus Erfahrung lernen? Die Arbeitsgruppe hat u.a. Tätigkeiten herausgearbeitet, die diesen Bedingungen entsprechen; z.B. streichen, spritzstreichen, säubern, ordnen, sammeln, stapeln, verpacken, in der Mensa Tische wischen, Erfrischungskarren schieben, Spülmaschinen vorbereiten, Botendienste leisten und vieles mehr. Diese Arbeitsgänge sind fast alle Firmen anvertraut, die nicht zum Betrieb gehören: Eine Arbeitsstunde in einer modernen, metallverarbeitenden Industrie kostet Unsummen (damit ist natürlich nicht das Geld gemeint, das dem Arbeiter für eine Arbeitsstunde zukommt). Deshalb werden Verpackungsprobleme, Pflege und Reinigung der Anlagen, Kantinenbetriebe usw. Firmen anvertraut, die mit geringen Kosten arbeiten können.
Der Betriebsrat des »Nuovo Pignone« versprach, nicht nur im Vertragsabschluß mit diesen Firmen sich dafür einzusetzen, daß diese Arbeiten Schwerbehinderten in immer größerem Maße zugänglich werden, sondern auch zusammen mit der Direktion die Kostenfrage und damit die Arbeitsverträge im Zuge der Besetzung von Stellungen dieser Art einer neuen gewerkschaftlichen Beurteilung zu unterziehen. Die Logik der Konkurrenzfähigkeit ist zwar vom wirtschaftlichen Geschichtspunkt aus verständlich, kann aber nicht der einzige Maßstab einer zivilisierten Gesellschaft sein, wenn sie nicht an Unmenschlichkeit erliegen will. Das Ziel ist auch, überhaupt Behinderte in der Arbeitsfindung zu privilegieren, denn für die meisten von ihnen wird Arbeit zur Kompensation und zum Lebensinhalt, viel mehr als das für Nichtbehinderte der Fall ist. Produktiv ist dann ein jeder, der sein Leben meistert.
Am 9.2.1982 richtet der Betriebsrat des »Nuovo Pignone« ein Schreiben an Presse, Gewerkschaften und Gemeindeverwaltung, das einen Erfahrungsbericht über die Integration Behinderter im Betrieb enthält. Unter anderem ist darin zu lesen: »... Aus dieser Erfahrung haben wir gelernt, daß es falsch ist, Menschen nach festliegenden Produktionsnormen zu beurteilen. Ein Behinderter wird von vornherein als unproduktiv erlebt und deshalb an den Rand gedrängt. Aber wir alle können behindert werden. Es handelt sich aber nicht darum, Menschlichkeit und Solidarität zu erwecken. Was wir wollen und was vorwärtsgetragen werden muß, ist ein politischer Kampf, der es allen Kräften unserer Gesellschaft erlaubt, sich zu entwickeln. Um dies zu bewirken, muß der Betriebsrat in engem Kontakt mit den Arbeiten stehen, die Probleme haben, denn nur so können falsche Vorstellungen und absurde Ängste abgebaut werden.«
[50] Der folgende Beitrag erschien erstmals in: Jutta SCHÖLER (Hrsg.): »italienische velhältnisse« in den Schulen von Florenz. Berlin 1987, S. 320 - 333.
[51] Im »Istituto Anna Torrigiani« wurden bis Mitte der 70er Jahre ca. 200-250 Personen mit motorischen Problemen betreut (vom Säugling bis zum Erwachsenen). Es gab eine Tagesstätte für spastisch behinderte Kleinkinder und eine Schule. vgl. auch in: Buch, Andrea u.a.: An den Rand gedrängt. Reinbek 1980, S. 114-135 (Anm. J. SCHÖLER)
In diesem Band sind schon viele Anmerkungen über die Wichtigkeit des Italienischen Intergations-Projektes für den deutschsprachigen Raum formuliert worden, in dessen Zusammenhang Ludwig-Otto Roser bedeutsam geworden ist. In meinen immer nur kurzen Begegnungen mit Ludwig-Otto ROSER hat sich das in einer Faszination umgesetzt, der Fülle und der Länge der Erfahrungen, aus denen Ludwig-Otto ROSER schöpfen kann, in Zusammenhang gebracht werden kann. mit drei kleinen Bruchstücken andeuten:
Mit größtem Vergnügen habe ich im Kaffehaus bei Kuchen zugehört, wie Ludwig-Otto ROSER lachend über den größten Schrecken in seiner Arbeits-Laufbahn berichtete. In einem seiner Texte ist es nur unvollständig angedeutet, wie Don Lorenzo MILANI den jungen Psychologen Ludwig-Otto ROSER behandelte, als er ein Kind der Schule in Barbiani als schwer behindert und einer Sonderförderung bedürftig diagnostizierte. Don Lorenzo MILANI hat offenbar Ludwig-Otto ROSER vor die Kinder der Schule gezerrt und ihnen sehr zornig Ludwig-Otto ROSER mit der Warnung vorgeführt, daß dieser Mann ein Psychologe sei, der etwas sehr Dummes gesagt hätte; und er rate allen Schülern für alle Zukunft, Psychologen zu meiden - womit Ludwig-Otto ROSER offensich vor die Türe des Schul-Pfarrhauses von Barbiani gesetzt wurde. Wer könnte sich dem Charm eines derartigen Miniatur-Stückes an Bildungs-Zeitgeschichte entziehen?
Otto ROSER kann von Begegnungen mit Babys erzählen, deren Laufbahn er bis zur Grundschule, zur Sekundarstufe und ins Erwachsenenalter begleitet hat. Wenn Ludwig-Otto ROSER in diesem Zusammenhang von Dialog spricht, so meint er lebensprägende Beziehungsformen, die er in Familien beobachtet hat, wo Begleitung nur als langfristiges Vorhaben tatsächliche Wirksamkeit haben kann. Die Achtung und Begleitung der Eigenentwicklung von behinderten Personen, deren Familien, deren Bezugspersonen, deren gesellschaftliches Umfeld - ein nur langfristig beschreibbarer Prozeß? Die Langfristigkeit der Perspektive relativiert manche forscherische Momentaufnahmen zur Integration, wie sie bei uns mit viel Aufwand produziert werden und die in der Hektik des Aktivismus zur Durchsetzung oder Verhinderung der Integration in unseren Landen unverhältnismäßig große Bedeutung erlangen. Bruchlose Entwicklungen gibt es eben nicht und lassen sich nicht über Momentaufnahmen legitimatorisch bewerten. Eine Dimension von Integrationsprozessen hat Ludwig-Otto ROSER nach meiner Erinnerung in einer Vorlesung einmal damit umschrieben, daß in der Integration in der Grundschulzeit der Kontakt zwischen den Kindern besonders tragfähig ist und es so etwas wie ein »sich aufrichten an der Norm« feststellbar ist. Der Unterschied kann emotional unmittelbar produktiv werden, Normen werden »spielend« überwunden. Im Übergang zum Jugendlich-Werden ensteht ein neues »Leiden an der Norm«, das in langjährigen Kämpfen und Schmerzen bearbeitet werden muß und neue Herausforderungen an Begleitung stellt. Mich hat immer fasziniert, wie klar der Erfahrene im Detail unendlich schwer und zwiespältig erscheinende Prozesse darstellen kann und Sicherheit geben kann, daß sie zu bewältigen sind.
Ludwig-Otto ROSER hat mit dem Arzt Adriano MILANI-COMPARETTI schon zu Beginn der 80er-Jahre theoretische Konzepte, wie z.B. das Prinzip der Selbstorganisation, als Achtung der Eigenaktivität des Kindes, und das Prinzip des Dialogs beachtet und praktisch umgesetzt. Erst spät, als es nochmal gelungen ist, den durch Schwerhörigkeit kommunikationsbeeinträchtigten Ludwig-Otto ROSER zu verlocken, sich unter viele Leute zu begeben und auf einer Tagung ein Hauptreferat zu halten (10. Jahrestagung der IntegrationsfoscherInnen des deutschsprachigen Raumes, Innsbruck 1995), hat er auch einen für das Denken von Adriano MILANI-COMPARETTI leitenden Gedanken, den der notwendigen Prägung der Beziehung zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen durch »Angstabwehr«, wieder aufgenommen und ihm das »Prinzip Hoffnung« gegenübergestellt. Ohne Hoffnung als treibende Kraft der Eigenaktivität ist wohl keine Entwicklung vorstellbar ...
Die Förderung der Normalität des »behinderten« Kindes[52] - Ludwig-Otto Roser
Wenn ein Kind geboren wird, gilt der erste Blick seiner äußerlich erfaßbaren Normalität. Diesem Blick ging Neugier, Erwartung und Sorge voraus, Angst um seine Lebensfähigkeit. Es ist noch gar nicht lange her, da sollte es vor allem ein Bub sein: der »Stammhalter« gehörte zur kulturellen Norm, blieb er aus, wurde zumindest Enttäuschung laut. Wie stark bestimmen solcherlei Erwartungen ein Leben? Aber nicht nur die Erwartung eines bestimmten Geschlechts und der körperlichen und geistigen Normalität fließen im Augenblick der Geburt zusammen: Vorstellungen drängen sich auf, die die Zukunft betreffen, in der das Kind unsere Träume erfüllt, unser Dasein fortsetzt, sich selbst, und damit uns, zur Vollkommenheit führt. In der Vergangenheit war das Kind oft auch der einzige Schutz für die alternden Eltern. Der erste Blick bedeutet also: ist es normal, hat es alle Gliedmaßen, ist es kräftig, ist es aller seiner Sinne mächtig? Mit der Tatsache vertraut zu werden, daß es nicht so ist, wie es sein sollte, stellt wohl die größte Anforderung an die Anpassungskraft eines Elternpaares dar. Kein anderes Ereignis ist so einschneidend und kein Schmerz ist zeitlich so unbegrenzt. Tod und Trennung lassen sich überwinden. Die Behinderung eines Kindes ist dagegen ein Dasein und bleibt als solches mit dem Dasein der Eltern lebenslänglich verknüpft. Selten steht diese Überlegung im Vordergrund, wenn der Fachmann sich dem mit Problemen zur Welt gekommenen Kinde und Seinen Eltern nähert. Setzen wir voraus, daß Früherkennung und Frühbehandlung unerläßlich sind, dann ist gerade das Element der Angst, der Sorge und der Verzweiflung eines der ersten Hindernisse in der Annäherung an die Probleme der Behinderung und an die Möglichkeiten ihrer Begrenzung und Überwindung. Von der brutalen Wahrheit in der Diagnostik bis zur vorsichtigen Vertuschung derselben reicht die Entfaltung einer Realität, die Eltern und Angehörige erleiden müssen, zunächst fast immer nur in der Begegnung mit der Figur des Arztes.
Wurde die Früherkennung nicht versäumt (erst seit wenigen Jahren ist man bemüht, auch die geringsten Zeichen einer Entwicklungsstörung zu erspüren), entfalten sich die verschiedensten Reaktionsweisen bei den Eltern: sie reichen von der durch den Schock bestimmten absoluten Negation, der Ablehnung der Diagnose, aber auch der oft unbewußten Ablehnung des Kindes, bis zur besonders liebevollen und intensiven Zuwendung. Die Persönlichkeit der Eltern, ihr Verhältnis zueinander, schon anwesende Geschwister, das Alter der Eltern und ihre soziale und ökonomische Stellung, das Vorhandensein von helfenden Strukturen, in denen sich verschiedene Fachkräfte zur Verfügung stellen, bestimmen nicht nur den therapeutischen Weg, sondern die Grundstimmung des Kindes und seiner Familie und damit den Lebensmut. Es ist bekannt, daß gerade das erste Lebensjahr für die Formung der Affekte und der emotionalen Reaktionen von entscheidender Bedeutung ist. Die angstfreie Beziehung von Mutter und Kind in der Ernährung und Pflege des Neugeborenen, die Verhinderung von Reizüberfluß, die Sicherheit, die für den Wahrnehmungsprozeß besonders wichtig ist und die von der Beständigkeit der Bezugsperson und der umgebenden Situation ausgeht, dies alles sind Elemente, die für eine normale Zuwendung der Umwelt gegenüber unerläßlich sind und die normale emotionale Verarbeitung der inneren und äußeren Realität des Kindes vorbereiten.
Was geschieht aber, wenn diese Bezugspersonen voller Angst und Sorge sind? Ganz gleich, um welche Behinderung es sich handeln mag, es entsteht das Bedürfnis, sie auszulöschen, sie zu kompensieren oder sie zu vertuschen. MILANI-COMPARETTI spricht in diesem Zusammenhang von einer »Aggression«, die sich zunächst gegen die Behinderung richtet, aber von dem Kinde in diesen frühen Entwicklungsphasen als »Nicht-Liebe« empfunden werden kann, also als Aggression gegen seine eigene kleine Persönlichkeit. Selbstverständlich wird dies nicht bewußt erlebt, wie ja überhaupt die Wahrnehmung des eigenen Ichs, des eigenen Aussehens und der eigenen Werte sich erst später entwickeln. Das Kind ist zunächst für viele Jahre das, was seine Angehörigen von ihm halten, ist also in seinem Lebensmut, in der Entwicklung innerer Sicherheit ganz auf die Zeichen angewiesen, durch die der Erwachsene zu verstehen gibt, daß es liebenswert ist, daß es verstanden und akzeptiert wird mit den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Angst vor allem, was nicht in die »Norm« paßt, und Sorge um die Zukunft des Kindes lassen sich sicherlich nicht verbergen. Diese Gefühle sind ebenso verständlich, wie der Wunsch, gleich etwas zu tun, um das Übel anzupacken und zu beseitigen. Wenn wir aber »Normalität« erreichen und dem Kind Lebensmut vermitteln wollen, dann wird die Einstellung gegenüber der Behinderung gerade im ersten Lebensjahr von größter Bedeutung. Man kann behaupten, daß es für die Entwicklung dieses Kindes fast wichtiger ist, die Eltern zu stützen, als alle Kräfte der Therapie zuzuwenden, die ohnedies nur in den wenigsten Fällen eine Behinderung ganz ausschalten kann. Frühbehandlung dürfte deshalb keineswegs bedeuten, nur die Behinderung (und damit das Kind selbst) anzugreifen, sondern sollte in erster Linie Verständnis der Probleme erzeugen, sowie die Kenntnis ihrer Folgen und ihrer Kompensationsmöglichkeiten vermitteln. Und dies im engsten Zusammenhang mit der Fähigkeit der Eltern, Angst und Sorge zu verarbeiten, sich an das Gegebene anzupassen und die Behinderung zu akzeptieren. Normalität kann nicht gefördert werden, wo nicht Normalität empfunden wird, wo das Kind im Zweifel aufwächst, liebenswert zu sein, weil es den Erwartungen seiner Umwelt nicht entspricht. In der Tat liegt das Schwerwiegende einer Behinderung in den Gefühlen, die sie auslöst, und nicht am Fehlen einer oder mehrerer körperlicher oder geistiger Funktionen. Eltern müssen also vorn Fachmann sehr gut informiert werden; und das ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe, wenn man ihren seelischen Zustand berücksichtigen und ihnen helfen will, eine gute Beziehung zu dem Problem aufzubauen. Es ist nicht nur eine Frage der Diagnose, also der Feststellung einer bestehenden Wahrheit, sondern erfordert die Erforschung einer möglichen Entwicklung, also eine Prognose, in der die Persönlichkeit der Eltern, ihre Wertwelt, die Gegebenheiten des Kindes und die fachlichen Kenntnisse eingebaut werden. Die Feststellung einer Entwicklungsstörung körperlicher, geistiger oder seelischer Art, aber auch einer nicht umkehrbaren Mißbildung genetischer Herkunft, stellt mithin einen Ausgangspunkt dar, von dem aus die »Normalität« zu erarbeiten ist.
Wie sieht aber eine solche Arbeit aus? Wer übernimmt sie? Wo wird sie vollzogen? Noch vor wenigen Jahren war es selbstverständlich, die Probleme des Kindes der Fachkraft anzuvertrauen. Die Eltern übergaben das Kind dem Experten zur »Heilung»; außerhalb seines natürlichen Lebensraumes wurde es »behandelt« und stimuliert, wobei die Eltern in ihrer Angst und Sorge nur eine abwertende, hoffende Rolle spielten oder im besten Falle als Hausaufgabe einige Teilaspekte der Behandlung weiterführten. Im Grunde waren sie an der Förderung der Normalität ihres Kindes nur wenig beteiligt, weil der Blick auf die Mängel des Kindes gerichtet blieb und sich nicht auf seine Möglichkeiten konzentrieren konnte. Ein spastisch gelähmtes, ein blindes, ein geistig begrenztes Kind kann seine Möglichkeiten aber nur in der Sicherheit seiner Umwelt entwickeln und auch nur dort, wo diese Sicherheit in das Gefühl der positiven Zuwendung eingebettet ist. Dabei ist hervorzuheben, daß von den ersten Lebenstagen an das Haus, in dem das Neugeborene aufwächst, alle Möglichkeiten bietet, die durch irgendwelche Schwierigkeiten des Kindes erschwerten Entwicklungsschritte zu kompensieren. Das gilt sowohl für die vorsichtig abgestufte Stimulation zur Teilnahme an der Umwelt, wie sie für das schwer- und mehrfachbehinderte Kind angezeigt ist, als auch für die Spiel- und Anpassungssituationen, die der natürliche Lebensbereich und die angstlose und liebevolle Zuwendung der Eltern dem geistig oder körperlich behinderten Kinde bereiten. Kein noch so gewandter und fachlich erfahrener Ratgeber kann Wege aufzeigen, bestimmte Aspekte mit dem Kind zu üben oder Möglichkeiten der Kompensation zu entdecken, ohne das Haus und die Eltern zu kennen. Und: wer könnte behaupten, daß die wenigen Stunden ambulanter Behandlung oder der Tagesaufenthalt in einem noch so gut ausgestatteten Zentrum mehr Gelegenheiten zur Entdeckung und Eroberung der Welt bieten als das Leben zu Hause, vor allem in den entscheidenden Entwicklungsmomenten der emotionalen Sicherheit, d. h. im ersten und zweiten Lebensjahr. Hier entdecken die Angehörigen, aber auch das Kind selbst, die Lösungen und Alternativen, die außer Hause nur künstlich sein können (wie die programmierten Spiel- und Therapiemomente), weil sie ein selbst nicht betroffener Therapeut erdacht hat, aus der Sicht, den Defekt zu kurieren, nicht aber, ihn in die Realität des Alltags einzubauen. Selbstverständlich kann dies nicht geschehen, ohne sich in der Beobachtung der von dem Kind gebotenen Ideen und Handlungen an die Seite der Eltern zu stellen und zwar, wie gesagt, in deren unmittelbaren Lebensbereich, in welchem Gewohnheiten, Stimmungen und materielle Möglichkeiten zutage treten. Krankenhaus, Ambulatorien, Therapiezentren, Sondereinrichtungen, besonders in den ersten Lebensjahren des Kindes, fördern keine seelische Normalität: sie nähren nur die Angst des Kindes und der Eltern. Angst zerstört aber auch die Wahrnehmung, die Beziehung zur Außenwelt und damit das emotionale Gleichgewicht, somit die Freude am Leben. Sicherlich kann man bei manchen Behinderungen nicht umhin, schon das Kleinkind fremden Fachkräften anzuvertrauen. Behandlung, Untersuchung und ambulatorische Beratung sind oft notwendig und unumgänglich. Aber wir fragen uns eben, wie diese erfolgen sollen und in welchem Maße sie den seelischen Bedürfnissen des Kindes und seiner Eltern Rechnung tragen. Denn in diesem Verständnis liegt das Geheimnis der »Normalität«. Keine Behandlung kann also ihr Ziel erreichen, wenn sie nicht in der Realität des täglichen Lebens als mitmenschliche Sicherheit zum Tragen kommt, und das bedeutet für jede Fachkraft, das Haus und die Menschen. die es bewohnen, verstehen zu lernen.
An dieser Stelle müssen wir uns über den Begriff »Integration« verständigen: Integration heißt, Abgetrenntes wieder zusammenführen. Ein behindertes Kind integrieren bedeutet demnach, ein außenstehendes, ein der Normalität ferngerücktes Individuum einzubeziehen. Die Abtrennung vollzog sich in der Vorstellung des Erwachsenen, daß die Behinderung (aus seelischen, kulturellen, sozialen oder physischen Gründen) nicht ohne weiteres in die Normalität einbezogen werden kann. Aber von der seelischen Entwicklung des Kindes aus gesehen ist die Behinderung von vornherein mit eingebaut, also »normal»; Gegebenheiten, mit denen es sich schon von den ersten Lebenstagen an auseinandersetzt und an die es sich gewöhnt, sehr viel früher als es die außenstehenden Beobachter und die teilnehmenden Eltern vermögen. So wächst das Kind mit der »Normalität« seiner Behinderung, jenseits sozialer oder psychologischer Wertbegriffe, spürt aber sehr bald, daß die Menschen, die ihm Sicherheit geben sollen, nicht zufrieden sind. Hier vollzog sich die »Trennung«, die Spaltung der Gefühle, die fast immer schwerwiegendere Folgen hat als die Behinderung selbst. Wenn wir daraus die Forderung entwickeln, nicht erst im Nachhinein zu integrieren, sondern erst gar nicht auszuschließen, dann ergibt sich wieder als erster Schritt in der Förderung von Normalität das Akzeptieren von Behinderung. Dies wiederum bedeutet nicht Resignation, sondern aktive Verarbeitung von Tatsachen.
Im Vordergrund steht das Kind, das in seiner Ganzheitlichkeit die Hemmnisse, die sich seiner Vitalität entgegenstellen, mit einbezieht. Wir wissen, daß in der Wechselbeziehung Mutter-Kind, die gegenseitige Versicherung eine große Rolle spielt; das behinderte Kind verunsichert aber Mutter und Vater und das Fehlen ihrer Zuversucht beeinträchtigt den Lebensmut des Kindes. Deshalb ist gerade in den ersten Lebensjahren die Suche nach den positiven Seiten des Kindes von vitaler Bedeutung für die Entwicklung eines gesunden Selbstgefühls und der sozialen Zuwendung. Ist die »hautnahe« Verbindung mit dem Kind, die Kommunikation, das Lachen und das Spielen für die Entwicklung eines jeden Kindes wichtig, so ist diese Art Zuwendung für das entwicklungsgestörte Kind unerläßlich: eine »Therapie«, die viel Zeit und Ruhe verlangt, damit schon das behinderte Kleinkind im ersten Lebensjahr seine Lösungen erproben und anbieten kann, die dann von den Eltern als positive Erfahrung in den Tagesablauf eingebaut werden können, um schließlich die Umwelt als Lebensziel und Lebenswunsch, ohne zu überfordern, schmackhaft zu machen. Mit Gleichaltrigen kann das behinderte Kind seine Anpassung erproben und seine Möglichkeiten ermessen. Wie sollte aber ein bewegungsgestörtes Kind unter anderen motorisch behinderten, ein blindes Kind unter anderen Blinden, ein sprachgestörtes Kind unter nicht sprechenden Kindern seine eigenen Grenzen zu überschreiten suchen und spüren, auf welche Normalität hin es sich entfalten soll? Sehr früh überall dabei sein, wo Kinder sind, entspricht den neuesten Vorstellungen von Förderung der Normalität. Das nicht Ausschließen, das Prinzip, gemeinsam zu leben und zu lernen, vor allem das Miteinbeziehen der Eltern, ist aber nicht nur ein moralisches Problem; oft wird heute noch Integration als eine nur soziale Aufgabe und als mitmenschliche Pflicht empfunden. Ebenso wichtig wäre es aber, die erwählten therapeutischen Vorteile in den Vordergrund zu stellen, zusammen mit den Bedingungen, die einer gesunden emotionalen Entwicklung zugrunde liegen. Schon in der Kinderkrippe könnte das behinderte Kind die Möglichkeit seiner Normalität erproben. Wurde bisher die Kinderkrippe für das sogenannte normale Kind als entwicklungsbegrenzend angesehen, als Notlösung für arbeitende Eltern, als Einschränkung der im familiären Raum gegebenen Stimulationen geistiger und affektiver Art (was heute nur noch selten ein Fall ist), so wird dagegen für das behinderte Kind der frühzeitige Kontakt mit der Kinderwelt und mit anderen Personen, die sich um Erziehung und Pflege bemühen, eine Quelle der inneren Bestätigung, aber auch der unbewußten, progressiven Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen. Den Eltern wird dabei klar, wie natürlich gerade Kleinkinder mit ihrem »Sorgenkind« umgehen und dies lindert gerade eine der größten Sorgen, die Eltern ihrem behinderten Kind gegenüber haben können: Wie wird es aufgenommen und wie paßt es sich an die sehr oft als feindlich empfundene Umwelt an?
Nur wer das Verhalten etwa des kleinen Kindes mit Down-Syndrom, des blinden Kindes, des motorisch behinderten Kindes unter problemlosen Kindern, vor allem in den frühesten Entwicklungsphasen (d. h. im ersten und zweiten Lebensjahr) hat beobachten können und zwar im Gegensatz zu den nur zu Hause oder in der Sondereinrichtung behandelten Kindern, kann sich darüber klar werden, wieviel Armut in der Aussonderung, in der Isolierung, in der defektbetonten Behandlung und in der lebensfernen Therapie enthalten ist. Daß in dem frühzeitigen Miteinbeziehen des behinderten Kindes in die Institutionen der »Normalität« (Kindergarten, Schule, Freizeit) seine besonderen Belange berücksichtigt werden müssen, ist selbstverständlich. Denn »Integration« heißt ja nicht, die Probleme des Kindes gelöst zu haben. »Integration«, also von vornherein Dabeisein, ist ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Schritt der Behandlung, sie ersetzt natürlich nicht automatisch die Notwendigkeit, die Eltern weiterhin zu stützen und dem Kinde die Schulung seiner Fähigkeiten mit all den Mitteln zuzusichern, die die wissenschaftliche Kenntnis zur Verfügung stellt. Ein solches Programm garantiert aber nur dann Erfolge in der Entwicklung des seelischen Gleichgewichtes eines Kindes, wenn im Respekt seiner Entwicklungsrhythmen, seiner Bedürfnisse, seiner Möglichkeiten und seiner Unmöglichkeiten seine einmalige Persönlichkeit zum Tragen kommt. Das heißt vor allem Beteiligung des Kindes am Aufbau seiner Normalität und in der Auseindersetzung mit der realen Umwelt.
[52] Dieser Beitrag erschien erstmals in: Manfred ROSENBERGER (Hrsg.): Ratgeber gegen Aussonderung. Heidelberg 1988, S. 31-35.
Im Frühjahr 1982 lief ich gemeinsam mit Otto ROSER durch »seinen Distrikt«, das Wohngebiet der Unità Sanitaria Nr. 10 im Norden von Florenz. Wir waren auf dem Rückweg von einem Gespräch, das Otto ROSER mit den Kindergärtnerinnen und den Eltern eines blinden Kindes geführt hatte.[53] Damals war ich noch in meiner »skeptischen Phase«. Ich wollte und konnte es damals noch nicht glauben, daß es möglich sei, Kinder mit Behinderungen gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern zu fördern. Fast 20 Jahre lang hatte ich mich als Lehrerin und später Hochschullehrerin in Berlin an zahlreichen Versuchen beteiligt, um auf einer breiteren Basis Gesamtschulen einzuführen. Oft hatte ich den Eindruck, daß die Widerstände gegen eine gemeinsame Erziehung aller Kinder zu groß seien. Die Trennung in Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten - in Berlin immerhin erst nach der 6. Klasse - schien unüberwindbar. Kinder mit Behinderungen kamen in meinen damaligen Überlegungen einfach nicht vor; ich muß es gestehen!
Etwa zwei Jahre vor diesem ersten Besuch in Florenz hatte ich die ersten Berichte in Fachzeitschriften gelesen: Italien - das Land, in dem es keine Sonderschulen mehr gibt! Otto ROSER wurde an die damals gerade in Auflösung befindliche Pädagogische Hochschule nach Berlin eingeladen. Bei seinem Vortrag verwandelte sich meine generelle Ungläubigkeit in skeptische Neugier. Dieser Vortrag motivierte mich, selbst nach Florenz zu fahren. Es war nicht leicht gewesen, die organisatorischen Hürden zu überwinden:
-
Italienisch lernen! Otto ROSER hatte mir gesagt, dies sei unabdingbare Voraussetzung, wenn ich wirklich verstehen wolle, wie die Italiener in den Schulen die Aufgaben der Gemeinsamkeit lösen.
-
Ein Quartier finden, in dem eine kleine Gruppe von Studentinnen und ich mit meinen damals sechs und vier Jahre alten Töchtern leben konnte, wo wir uns in der Betreuung der Kinder abwechselten und abends am Kaminfeuer in der kalten Küche hitzige Diskussionen führten über die Beobachtungen in den Schulen.
Nachdem ich diese beiden Probleme von Berlin aus gelöst hatte, gab mir Otto ROSER die notwendige Unterstützung, die Adressen und Telefonnummern, damit ich ausführliche eigene Eindrücke sammeln und mich von Tag zu Tag mehr von der Richtigkeit und Notwendigkeit dieser allgemeinen Reform überzeugen konnte.
Nun, im Frühjahr 1982, bei unserem Spaziergang unterhielten wir uns über die Vorbehalte der italienischen Lehrerinnen, über die bisherigen Kämpfe, über den Beginn der Integrationsbewegung in Florenz.
Immer wieder wurden wir in unserem Gespräch unterbrochen, wenn uns Kinder oder Erwachsene ansprachen, die Otto ROSER kannten. Kinder erinnerten ihn daran, wann er das letzte Mal in ihrer Klasse war, um die Paola oder den Markus, den Saverio oder die Francesca zu besuchen. Das beindruckte mich: Nicht nur die Familien mit behinderten Kindern oder deren Lehrerinnen kannten ihn, sondern auch die Mitschülerinen und Mitschüler jener Kinder. Nach jeder dieser kurzen Unterbrechungen erzählte mir Otto ROSER kurz die bisherige Geschichte »seiner Kinder«. dieser Kinder begegnen uns in seinen Texten.
Womit hatte für ihn jeweils eine solche Geschichte begonnen? - Mit Begegnung!
Eltern waren zu ihm gekommen, weil sie den Eindruck hatten, an diesem Kind sei etwas »nicht normal«. Als seine wichtigste und erste Aufgabe sah er in einer solchen Situation immer: Den Eltern bewußt machen, was dieses Kind alles kann. Seine Fähigkeiten müssen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt werden. Von diesen Fähigkeiten aus kann überlegt werden, wie es weitergehen kann. Dieser Gedanke durchzieht alle Veröffentlichungen von Otto ROSER und hat auch mich überzeugt.
Heute wenden sich in Deutschland häufig Eltern an mich mit der Bitte, sie in irgendeiner Form zu unterstützen, um für ihr Kind - trotz einer Behinderung - eine »normale« Umgebung möglich zu machen. Zumeist beginnen diese Eltern damit, daß sie mir alle die Schwierigkeiten darstellen, die ihr Kind bereitet. Erst, wenn es mir gelingt, mit den Eltern so ins Gespräch zu kommen, daß sie in ihrem eigenen Kind nicht mehr überwiegend die Probleme und den Pflegebedarf sehen, sondern wenn sie bewußt machen können, welche Anteile an Normalität ihr Kind hat - auch trotz einer schwersten Behinderung - erst dann können wir uns gemeinsam auf den Weg machen, um zu versuchen, andere Menschen - vor allem die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen und die Schulräte - von der Richtigkeit des gemeinsamen Weges zu überzeugen.
In meinen Veröffentlichungen der letzten Jahre habe ich Weggeschichten von einigen dieser Kinder dokumentiert.[54] Den Eltern dieser Kinder zu der inneren Sicherheit zu verhelfen, daß sie ihr Kind auch in seinen Fähigkeiten, seinen Stärken erkennen können und sich über die kleinen Entwicklungen freuen, das ist für mich zur wichtigsten Orientierung für meine Arbeit geworden.
[53] Diese Gesprächsrunde ist dokumentiert in: SCHÖLER, Jutta (Hrsg.): »italienische verhältnisse« insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin 1987, S. 188 - 220.
[54] SCHÖLER, Jutta: »Sono bambini - es sind Kinder.« Die Aufgabe einer gemeinsamen Schule für behinderte und nichtbehinderte Kinder in Italien und der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1994
SCHÖLER, Jutta: Kinder mit Behinderungen in integrativen Klassen. Fallbeispiele. In: HEYER, Peter/PREUSS-LAUSITZ, Ulf/SCHÖLER, Jutta: »Behinderte sind doch Kinder wie wir« - Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin 1997, S. 271 - 323
Vorschlag und Gegenvorschlag: Der Dialog in der Vielfalt der Lebenswelt behinderter Menschen[55] - Ludwig-Otto Roser
Alte Modelle zu überdenken, Veränderungen gegenüber aufgeschlossen Gegebenes aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sollte dem Erleben einer langen Berufstätigkeit ergeben und zum Bedürfnis; werden. Am Anfang stützt sich dagegen unser praktisches Verhalten auf das, was uns die Schule vermittelt. Da gibt es Tatsachen, die objektiven Wahrnehmungen entsprechen, Normen, Instrumente, Model der Interpretation und des Verhaltens, unter denen wir uns die heraussuchen, die uns am meisten überzeugen. Für den Psychologen heißt dies unter anderem, sich weltanschaulich mit einer Schule zu identifizieren und an Prozeduren zu glauben, die in Anlehnung an statistisch erarbeite Normen oder theoretische Überlegungen einige Wahrheiten zu vermitteln scheinen. Das Abweichen von der Norm zu bestimmen, die Werte oder die Defekte zu erkunden, Prognosen zu stellen in bezug auf die Anpassung an erprobte Lebensmodelle - das waren die Handwerkszeuge, mi't denen ich als junger Psychologe nach Italien kam. Recht bald erfaßte mich ein diffuses Unbehagen, dessen Grund ich mir zunächst nicht erklären konnte.
Den ersten Anstoß zum Nachdenken gab mir eine Episode, die mich stark frustrierte: Don Lorenzo MILANI bat mich (es ist jetzt wohl 30 Jahre her), in seine Schule nach Barbiana zu kommen, um ihm zu raten, wie einem kleinen Marcello zu helfen sei, der als einziger nicht so recht lernen wollte. Ich diagnostizierte eine geistige Behinderung und zweifelte an der Möglichkeit einer schulischen Entwicklung ohne ein sonderpädagogisches Vorgehen. Don Lorenzo MILANI wurde böse und erklärte vor allen Kindern und Jugendlichen, die er alle in einem Raum unterrichtete, sie sollten sich auch in Zukunft vor Psychologen hüten, denn sie verstünden nichts. In einem seiner nach dem Tode veröffentlichten Briefe an seine Mutter schreibt er erklärend: ROSER hat sich mit Marcello beschäftigt und hält ihn für nicht normal: das stimmt nicht, denn Marcello ist wie alle anderen Kinder, er hat seine eigene Intelligenz, seine Lebensfreude, seine Art, sich der Welt anzupassen und seine Probleme zu lösen.
Ohne näher auf meine Enttäuschung und auf meine Reaktion eingehen zu wollen, möchte ich behaupten, daß ich bei dieser Gelegenheit zum erstenmal der Polarität zweier Ansätze in der Behandlung Behinderter begegnet bin, auf die wir gleich näher eingehen sollten: auf der einen Seite die Feststellung eines Hindernisses und der Vorschlag des jungen Psychologen, alles zu tun, um den Defekt anzugehen, auf der anderen Seite ein totales Akzeptieren einer menschlichen Gegebenheit. Beides Extreme, auf die wir noch zurückkommen müssen.
Don Lorenzo MILANIS Bruder, der vor wenigen Jahren verstorbene Kinderarzt und Neurologe Adriano MILANI-COMPARETTI, hat einige Jahre nach meiner Begegnung mit Marcello einen Weg gewiesen, diese Polarität wissenschaftlich in ein Ganzes zu fassen, das den biopsychischen Fähigkeiten des Individuums und seiner Lebenswelt entspricht, ein offenes Modell, das in Italien, aber auch im Ausland, für viele eine der Grundlagen für die Arbeit mit Behinderten geworden ist. Der Weg ging über die Entlarvung der scheinbaren Objektivität »unreflektiert benutzter Modelle« (wie z.B. das Reiz-Antwort-Schema) bis zur Konzeption einer Form der Rehabilitation, die in der Philosophie des Dialogs gipfelt. Bekannt ist MILANI-COMPARETTIS Vorstellung der Entwicklung als einer Dimension der individuellen Kreativität, in die sich der Dialog spiralförmig hineinwindet. »Seine (des Dialogs) Elemente sind dann nicht mehr Reiz und Antwort, sondern Vorschlag und Gegenvorschlag.«
MILANI-COMPARETTIS Schülerin, Anna GIDONI, hat diese Ideen kürzlich sehr treffend zusammengefaßt: »Die Beziehung ist der Nährboden, auf dem sich die Persönlichkeit entwickelt. Werfen wir einen Blick auf gängige Einstellungen in der Beurteilung kindlicher Entwicklung, so stellen wir fest, daß hier Entwicklung dargestellt werden kann als ein Set von Hindernissen, die bewältigt werden müssen. Das Kind wird mit den Erwartungen der Umwelt konfrontiert und nach deren Vorstellungen vom Standard-Kind geformt. Mächtige Bilder, die Beziehungen derart prägen können, daß die Identität des individuellen Kindes nicht mehr zählt. Kinder, die sich dieser Anpassung verweigern, die an ihrer Identität festhalten oder beim Blick auf die vor ihnen liegenden Hindernisse entmutigt und passiv werden, laufen Gefahr, je nach Kontext als eigensinnig, verhaltensauffällig oder gestört angesehen und behandelt zu werden.« An diesem Punkt gilt es, sagt Anna GIDONI, eingefahrene Vorstellungen zu modifizieren: das Bild einer Entwicklung als einem vorgegebenen Weg, der immer von rechts nach links und von unten nach oben verläuft. Die Richtung unterliegt dabei einer qualitativen Bewertung: vorwärts und aufwärts ist gut, rückwärts und abwärts ist schlecht, ebenso Pausen, Abweichungen und Verspätungen.
Anna GIDONI bereichert daher das von MILANI-COMPARETTI entworfene Bild einer Entwicklung als aufwärtsstrebende Spirale, die sich im Dialog von Vorschlag und Gegenvorschlag erweitert, mit dem Bild eines Bandes, einer Art Schärpe aus biegsamen Material, das seine Form behält an außen aufgeprägte Formen annimmt. Dieses Band dreht sich, es rollt sich ein, entwickelt sich, biegt sich rückwärts und springt nach vorn. Eine Entwicklung also, die nicht linear, verläuft und an Hindernissen hängenbleibt, sondern sich windend andere Wege sucht, zurückfließt, um zu verhalten, nach vorne fließt, wenn sich individuelle Alternativen ergeben. Akzeptiert man die unregelmäßige Spirale als Metapher für Entwicklung, dann hat dies unmittelbar Konsequenzen für die Entwicklungsdiagnose und -prognose. Für beide können nicht mehr die herkömmlichen Verfahren angewendet werden, bei denen man testet, inwieweit ein Individuum dem Standard entspricht. Das bedeutet gleichzeitig, daß Interventionen nicht mehr darin bestehen können, das Kind durch bruchstückhafe, isolierte Subroutines, die Therapien, von außen zu formen. Subjektivität muß wieder als grundlegende Vorbedingung für Erkenntnis eingführt werden, denn sie läßt aus dem Beobachter einen Partner werden, einen Teilnehmer an der Interaktion im Dienst der Erkenntnis. Dabei ist von großer Bedeutung, zu bestimmen, in welchem sozialen, kulturellen und psychologischen Rahmen das individuelle Problem gelagert ist. Ein behindertes Kind entwickelt sich auch in ganz verschiedener Weise je nachdem, ob es erstgeboren ist, Einzelkind bleibt oder ältere, gesunde Geschwister hat. Das gilt natürlich für alle Kinder. Die Lebenswelt mit Erwartungen, mit ihrer Fähigkeit, korrekt zu intervenieren, mit ihrer Bereitschaft zu Verarbeitung wird jedesmal anders sein, so wie das betroffene Individuum ja selbst in seiner Aktion und Reaktion immer wieder ein neues Bild bietet, das deshalb auch einer individuellen Interpretation bedarf. Es entstehen Stauungen oder es vollzieht sich eine gestörte Entwicklung, wenn ein Schema angewandt wird, das aus dem starren Gleis fachlicher Überzeugungen und von außen bestimmter Normen gebildet ist. Ebenso falsch wäre es natürlich auch, gar keine »Vorschläge« zu machen, denn dies untergrübe die Möglichkeit der »Gegenvorschläge«.
Drei Beispiele sollen das eben Gesagte erläutern. Zunächst zwei Fälle von Down-Syndrom (im Quantum in der geistigen Behinderung außerordentlich vergleichbar), die ich in ihrer Entwicklung von den ersten Lebensjahren bis zum Erwachsenenalter verfolgen konnte.
-
Antonio, zweites Kind einer Familie, in der der Vater als Bäcker tätig ist, die Mutter als Hausfrau. Im Hause wohnt auch die Großmutter mütterlicherseits. Die Familie lebt am Rande der Stadt in einem Reihenhaus. Als Antonio zur Welt kam, wurde der erstgeborene Bruder 14 Jahre alt. Mutter und Vater waren beide über 40 Jahre.
-
Ilaria, zweites Kind, Tochter eines Angestellten, die Mutter Hausfrau. Ilarias Schwester war 5 Jahre alt, als Ilaria geboren wurde. Die Familie lebte in einer Mietwohnung nicht weit vom Stadtkern entfernt. Die Mutter starb an einer schweren Krankheit, als Ilaria 9 Jahre alt war.
-
Maria, bei der schon zwei Monate nach der Geburt eine dystonische Tetraparese diagnostiziert wurde, lebt mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in einem Häuschen im Grünen am Stadtrand von Florenz. Die Mutter ist Mathematiklehrerin und der Vater Kunstwissenschaftler. Marias Bruder war leicht verhaltensauffällig, schon bevor das Mädchen geboren wurde.
Diese drei Fälle sollen uns dienen, das Konzept der kreativen Individualität, der Subjektivität oder seine Verneinung wie auch die Varianten des Dialogs im Vorschlag und Gegenvorschlag besser zu verstehen.
Betrachten wir zunächst die Geschichte Antonios. Meine erste Begegnung mit Antonio erfolgte anläßlich eines Hausbesuches. Die Familie hatte gerade zu Mittag gegessen. ein Nachbar war zu Gast und alle saßen noch am Tisch: die Großmutter, der Vater, die Mutter, der Bruder und der Gast. Nur Antonio stand auf einem Stuhl (er war 3 Jahre alt) und war gerade dabei, eine Rede zu halten. Ich setzte mich dazu und ließ dem Redner, der sich durch meine Anwesenheit überhaupt nicht gestört fühlte, freien Lauf: es war eine Hymne auf die hiesige Fußballmannschaft, praktisch eine Reportage. Mit lauter Stimme, glücklich wieder einmal im Vordergrund zu stehen, schwafelte das Kind, dem damals nur wenige Worte zur Verfügung standen, mit erfundenen Lauten und Worten, löste dabei immer wieder den Applaus der Anwesenden aus. Die Mutter guckte stolz, der Vater amüsierte sich, die Großmutter hatte vor Lachen Tränen in den Augen, der Bruder saß ausdruckslos dabei, der Nachbar feuerte Antonio an. Antonio stand im Mittelpunkt, und so ist es bis heute geblieben. Von seiten der Familie wurde keine Frage an den Psychologen gerichtet, was man tun könnte, um das Kind zu fördern. Seine Sprache war allen recht; man verstand ihn. Und er verstand alles, was um ihn herum geschah, sagten die Eltern, jedenfalls in dem Maße, wie es ihren Erwartungen entsprach. Mein Vorschlag im nachträglichen Gespräch mit den Eltern war eine baldige Eingliederung in den nahen Kindergarten (1974 war in Italien die Eingliederung behinderter Kinder in den normalen Kindergarten schon sehr verbreitet). Die Eltern waren sofort einverstanden. Ihre Sorge war nur, daß Antonio von den Kindern und von den Lehrerinnen nicht hätte akzeptiert werden können. Schon in den ersten Tagen des Kindergartens wollte Antonio wieder im Mittelpunkt stehen, und wenn es ihm nicht gelang, zog er sich nackt aus.
Ilaria, das andere von Trisomie 21 bestimmte Kind, lernte ich dagegen nach einigen Gesprächen mit den Eltern im Kindergarten kennen, wo sie schon aufgenommen worden war. Sie war 5 Jahre alt. Das Kind saß still und schüchtern vor einem Spiel, sprach nicht mit den anderen Kindern, hielt das Köpfchen immer gesenkt und schaute nicht auf. Es folgte ein Hausbesuch, der mich sehr beeindruckte: die Wohnung war klein, Ilarias Bett stand im Zimmer der 5 Jahre älteren Schwester, die diesem Raum schon ihre eigene Prägung gegeben hatte (sie war inzwischen schon 10 Jahre alt). Dafür war die Küche für Ilaria sonderpädagogisch ausgebaut; kaum Platz zum Kochen, aber viel Gerät zum Lernen: Regale voller pädagogischer Spiele, Buchstaben in allen Formen, Bücher. An der Wand überall Ilarias erste Zeichenversuche. Die Mutter stand geduldig abseits, Ilarias Schwester war in ihrem Zimmer verschwunden, Maria saß in der Küche an ihrem Tischchen mit dem gleichen Ausdruck, den sie im Kindergarten hatte. Hauptperson war der Vater. Er hatte gleich nach Ilarias Geburt die Rehabilitation nach Doman in die Hand genommen und hielt mir einen langen Vortrag über seine Arbeit mit Ilaria; davon wollte er mir Verschiedenes vorführen, aber Ilaria senkte den Blick noch tiefer und schüttelte den Kopf. Die Schwester, jetzt 21 Jahre alt, ist heute meine Patientin, verschlossen und deprimiert, weil der Vater sich, als Ilaria geboren wurde, völlig von ihr entfernt und sie dann mit 15 den Tod der Mutter nicht verkraftet hat. Über meine erste Begegnung mit Maria auch nur einige wenige Worte, bevor wir die in diesen drei Anfängen vorgezeichneten Lebenswege beurteilen.
Maria beschäftigte mich schon vor ihrer Geburt. Ich kannte Mutter und Vater und den fünfjährigen Erstgeborenen, weil sie die neben unserem Haus gelegene Kirche besuchten. Wenngleich unsere Familie konfessionslos ist, hatte der Pfarrer uns als zur Gemeinde gehörig betrachtet und mich öfters beruflich um Rat gefragt. Marias Mutter war während der Schwangerschaft an einem schweren Nierenleiden erkrankt, und die Möglichkeit einer normalen Geburt schien fraglich. In der Tat lag die Mutter fast im Sterben, als Maria mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht wurde. Am Tag nach der Geburt habe ich aber das Baby ganz munter im Brutkasten liegen sehen. Nach vielen Monaten erst wurde die Mutter gesund, Maria hatte die Zeit in der Kinderklinik gut überstanden. Sie schien nur motorische Probleme zu haben. Die schon nach den ersten Lebenswochen gestellte Diagnose lautete »dystonische Tetraparese«, und ich riet deshalb der Familie, das Kind MILANI-COMPARETTI und seinen Therapeutinnen anzuvertrauen. Meine Aufgabe war es, die psychologischen Aspekte der Entwicklungsförderungen mit den Eltern zu beraten. Aber schon als Maria noch ganz klein war, spürte ich, daß die Eltern in der Erziehung des Kindes ihren eigenen Weg gehen wollten. Von mir nahmen sie nur die Ratschläge an, die sich mit ihrer Kenntnis des Kindes, mit ihrem Leben und mit ihren Vorstellungen vereinbarten. Sie hörten auch MILANI-COMPARETTI und seinen Therapeuten freundlich zu (z.B. »Maria darf noch nicht gehen, es ist noch nicht so weit«), dann entdeckte ich aber, beim sonntäglichen Blick aus unserem Fenster, daß Maria im Kirchhof kräftig strampelte und von der ganzen Gemeinde fröhlich ermutigt wurde.
Heute ist Maria 10 Jahre alt, besucht die Regelschule, und schon von den ersten Schultagen an hat sich die Familie immer weniger an uns Fachleute gewandt. Nach einer Besprechung mit den Lehrern und den Eltern, bei der Marias Fortschritte zutage kamen, sagte mir die Mutter: »Maria hat keine Probleme, sie ist klug, lernt ohne Schwierigkeiten, arbeitet selbst an ihren Hindernissen, läßt sich nicht entmutigen, sucht ihren eigenen Weg und wir denken, daß sie besser weiß als wir, was sie kann und was sie nicht kann. Und wenn sie etwas nicht kann, dann akzeptiert sie das als eine Gegebenheit, so wie wir das auch tun.«
Antonio, Ilaria und Maria, drei Kinder, die sich in drei verschiedenen Lebenswelten entwickeln, Lebenswelten, die sie bestimmten und die durch sie bestimmt werden. Hier treffen wir auf dieses vor- und rückwärts, auf-und abwärts fließende Band, das wir als Metapher für eine nie lineare und von Normen vorgezeichnete Entwicklung erwählt haben. In ihr begegnen wir drei Variablen: das Individuum, mit seinen charakterologischen und pathologischen Gegebenheiten, dann seine engere Umgebung, die Familie, und schließlich die soziale Umwelt, die mit ihren Vorschlägen, ihren Regeln und ihren Erwartungen Einfluß nimmt.
Die drei angedeuteten Geschichten (es sind nur drei, könnten aber hunderte sein) unterscheiden sich wesentlich voneinander:
-
Antonios Eltern lassen sich praktisch zunächst nur durch Antonio bestimmen,
-
Ilarias Vater stellt starke Forderungen an das Kind,
-
und nur Marias Eltern begehen den Weg, durch Vorschlag und Akzeptieren des Gegenvorschlags, der Entwicklung den Charakter der Kreativität zu verleihen.
Es ist natürlich nicht leicht, diese drei Fälle zu vergleichen, denn geistige Behinderung hat ein anderes Gewicht als eine motorische Behinderung; der eine Fall ist durch eine kulturell gehobene Denkweise gestützt, der andere durch emotionale Schwierigkeiten gestört, und schließlich haben wir ja vorausgesetzt, daß ohnedies jeder Fall mit seinen ihm eigenen Konstellationen und Variablen eine Geschichte für sich darstellt.
Wenn man aber nicht als Arzt, als Psychologe oder als Pädagoge sich nur einem Fachbereich zuwendet, sondern Behinderung im allgemeinen erlebt, bieten diese drei Variablen »Individuum, engere und weitere Umwelt« ein Ganzes, auf dem die Probleme sich immer wieder in ähnlicher Weise präsentieren, und dies gilt selbstverständlich nicht nur für Behinderte, denn welches Menschenleben könnte man als frei von Hindernissen bezeichnen?
Ilarias Vater, ein herrischer Ehemann und strenger Vater, ist ein Mann, der die Welt durch eine pessimistische Brille sieht. Er ist im Grunde ein ängstlicher Mensch, der sich an ein Schema klammem muß. Ilarias Krankheitsbild hat ihn tief getroffen, tief verletzt, als Mann in Frage gestellt, und sofort sucht er nach Hinweisen, um die Behinderung zu bekämpfen, um sie zu beseitigen. Unter den verschiedenen sich bietenden Methoden greift er auf, was ihm charakterologisch am nächsten liegt: alles zu tun, um den Defekt zu kompensieren; dabei will er nicht sehen, daß in der Prognose Grenzen gesetzt sind. Er bedrängt sein Kind viele Stunden am Tag, ärgert sich, wenn es ihn nicht versteht oder wenn es wieder alles vergißt und sich ihm gegenüber zur Wehr setzt. Zwar akzeptiert er, das Mädchen in den normalen Kindergarten zu schicken, aber er vertraut nicht darauf, daß dies spontan eine Förderung mit sich führen könnte. Kaum kommt Ilaria nach Hause, geht das Lernen wieder los. Die Erziehung seiner Frau ist ihm zu lasch, zu fatalistisch. Wir hörten schon, daß er sich um die erstgeborene Tochter nicht mehr kümmerte. Ilaria kommt schließlich in die Regelschule, wo sie nicht nur sofort von allen Kinder akzeptiert wird, sondern auch einem besonders zugewandten Lehrer begegnet, der eben durch diese liebevolle Zuwendung und dank der Stimulation der Klassengruppe in kurzer Zeit mehr erreicht als es der von der Selbstliebe des Vaters bestimmte Druck bis dahin vermocht hatte. Ilaria ist aber nun schon überzeugt, nichts zu können und nicht liebenswert zu sein, weil sie alles falsch macht. Trotzdem gelingt es dem Lehrer, dieses stille und verschüchterte Mädchen mit einzubeziehen. Ilaria lebt auf, sitzt nicht mehr mit gesenktem Kopf an ihrem Tisch, sucht sich Freundinnen. In den monatlichen Elternbesprechungen (Eltern, Lehrer, Stützlehrer, Psychologe) zeigt sich Ilarias Vater meist unzufrieden. Man müsse mehr tun und - Ilaria würde keine Fortschritte im Lesen und Schreiben machen, wenn er sie am Nachmittag nicht regelmäßig vornähme. Oft begegnete ich Ilaria mit dem Vater auf der Straße; sie wollte, als sie noch ein Schulkind war, nicht von ihm bei der Hand genommen werden und ging mit gesenktem Kopf neben ihm her.
Heute ist Ilaria 18 Jahre alt. Die Mutter ist gestorben, der Vater sorgt sich sehr rührend um alles. Ilaria hat die Regelschule hinter sich, kann schreiben und lesen. Die ältere Schwester lebt ihr eigenes, problemreiches Leben, steht Ilaria und dem Vater fern, war aber bereit, Ilaria zu versorgen, als der Vater wegen schwerer Depressionen drei Wochen in die Nervenklinik mußte. Wenn ich Ilaria und ihrem Vater heute auf der Straße begegne, gehen sie Arm in Arm, wie ein Paar. Neulich begrüßte ich die beiden und Ilaria sagt mir: »Er (der Vater) kocht sehr schlecht!« Zu Hause schläft sie an Stelle der Mutter im Ehebett. Tagsüber besucht sie ein Zentrum für Beschäftigungstherapie. Was hier geschehen ist, erklärt sich von selbst: eine Entwicklung voller Vorschläge, ein Kampf gegen die Hindernisse, ohne Raum für Gegenvorschläge, die trotz der geistigen Behinderung hätten erwachsen können, wie z.B. der Wille zur Autonomie, das Interesse zum sozialen Kontakt, das Bedürfnis nach Anerkennung, in den Aktionen, die Ilaria möglich waren (die aber nicht den genormten Erwartungen des Vaters entsprachen). Wir werden gleich sehen, wie dagegen Antonio vom ersten Schultag an erklärte, Lesen und Schreiben interessiere ihn nicht. Ilaria hätte das nie sagen dürfen; sie kann ein bißchen schreiben und lesen - aber was nützt es ihr?
Von Antonio wissen wir, daß er sich nackt auszog, wenn es ihm nicht gelang, das Interesse der Umwelt auf sich zu lenken. Er ließ es bald sein, denn ich hatte seinen Lehrerinnen vorgeschlagen, allen Kindern des Kindergartens zu sagen, daß das was ganz Natürliches sei: dem Antonio sei es einfach zu heiß, und deshalb wurden alle Fenster aufgerissen, bis Antonio fror und bat, wieder angezogen zu werden. Aber darauf hörte niemand und so lernte er, es selbst zu tun. Im Dialog »Vorschlag und Gegenvorschlag« dominierte stets, auch oft späterhin, Antonios Gegenvorschlag. Da die Familie ihn so akzeptierte, wie er war (sie sagte immer: »Er ist eben so«), bereitete Antonios Einschulung, aber auch seine Erziehung in der Familie große Schwierigkeiten. Die Eltern waren überzeugt, daß Antonios Eigensinn zu seinem Krankheitsbild gehöre. Geduldig, oft sogar stolz über seine Lebendigkeit, erlaubten die Eltern und der Bruder, daß er sich in der Familie als Hauptperson fühlte. Das ging in der Schule nicht, und statt die eigene Erziehungsmethode zu überdenken, beschuldigte die Mutter die Lehrerin, sie würde Antonio nicht lieben. Mit Tränen in den Augen bestätigte es mir die Lehrerin: sie könne mit Antonio nicht, sie hätte alles versucht, aber Antonio würde keine fünf Minuten still sitzen. Die Aufgabe des Psychologen war es nun, Eltern und Lehrerin zu versöhnen, eine Mühe, die zwei Jahre gedauert hat. In fast wöchentlichen Gesprächen mit den Eltern überzeugten sie sich, daß Antonio lernen müßte, bestimmte Regeln zu akzeptieren. Er ging gerne in die Schule. Wo hätte er sonst seine Starallüren anbringen können? Aber dann wurde entschieden, daß, wenn er sich der Lehrerin nicht fügte, ihn die Mutter nach Hause holen würde. Das geschah dann auch, und die Mutter sprach einen Tag lang nicht mit ihm. Das war für Antonio sehr schlimm (aber schlimmer war es noch für die Mutter); so lernte er, ruhig in der Klasse zu sitzen. Er malte oder bastelte mit Vorliebe Dinge, die zum Unterricht in der Klasse Bezug hatten, während er Lesen und Schreiben ablehnte. Auf diese Weise hat er die acht Jahre Pflichtschule verbracht und war wegen seiner Lustigkeit und der Freiheit seines Ausdrucks bei allen beliebt. Viele Mitschüler kamen nachmittags zu ihm, um mit ihm zu spielen. Auf längeren Ausflügen (z.B. zum Skifahren) stand er weiter-hin im Mittelpunkt, akzeptierte aber die Regeln und war in allem autonom. Heute, 19 Jahre alt, arbeitet er in einem kleinen Familienbetrieb der Lederverarbeitung, ist nicht sehr produktiv, weil er immer weiter große Reden schwingt, aber steht sozusagen mitten im Leben. Seine Probleme sind jetzt, wie er sagt, wenn er allein zu mir kommt, die Mädchen! Sie sind alle schön, alle freundlich - aber sie ziehen sich zurück, wenn er sie umarmen will. (Auf dieses Kapitel möchte ich ganz allgemein, leider nur in aller Kürze, noch am Schluß eingehen.)
Und nun noch eine kurze Beurteilung der Geschichte Marias. Sie erschien uns als die positivste, was die Entwicklung des Dialogs anbetrifft. Wir dürfen aber nicht denken, daß sie ohne Schmerzen verlief und noch verläuft. Vor ihren Hindernissen schwankte Maria von Arger zur Resignation, aber ihr Zurückschwingen in die Depression war schon immer wieder der Anlauf, sich den Problemen zu stellen. Zweifellos eine Veranlagung zur Stärke, aber diese war gestützt durch eine ständige Beurteilung der vorhandenen und der zu aktivierenden Kräfte, ein ständiges Suchen nach Lösungen, das von dem Kind selbst ausging und sich selbst gegen die fachlichen Einwände durchsetzte. Marias Subjektivität genüge getan zu haben, war sicher nicht nur Verdienst der Eltern, sondern auch der Lehrer und Therapeuten, vor allem, indem die letzteren die Interpretationen und den Willen der Eltern, aber auch des Kindes berücksichtigten.
Es ist nicht leicht, in einer fachlichen Überzeugung zu akzeptieren, daß ein zehnjähriges Mädchen oder seine Eltern etwas besser wissen. Die flexible Anpassung an die Menschen, um die es geht, die Gewißheit, daß auch sie etwas zu sagen und vorzuschlagen haben, erlaubt den Dialog und damit eine aufwärtsstrebende Entwicklung. Wir können nicht, weil wir von etwas theoretisch überzeugt sind und es in anderen Fällen praktisch erprobt haben, über die Gegebenheiten des Individuums hinwegspringen.
Die Probleme eines Behinderten und ihre Lösungen sind, wie bei allen Menschen, in seiner Umwelt eingebettet. Dies ist auch der Grund, weshalb Rehabilitationszentren nicht rehabilitieren; an ihren standardisierten Entwicklungsmodellen riskieren Eltern und Kinder zu zerbrechen oder zumindest stehenzubleiben. Das Hindernis bleibt immer dasselbe, man arbeitet an ihm, oft Jahre lang - dabei könnte es umgangen oder nicht beachtet werden (wie es in unserem Beispiel Antonio getan hat, der die Prognose am allerbesten erfaßt hatte, als er entschied, Lesen und Schreiben nicht zu brauchen).
Überhaupt ist die Arbeit der nichtbetroffenen, auf Hilfe und Beratung eingestellten Personen undenkbar, ohne ein Einfühlungsvermögen in die kulturelle, soziale und psychologische Situation der Menschen, die mit Hindernissen zu kämpfen haben. Denn wie sollte ein Dialog zustande kommen, wenn man sich gegenseitig nicht versteht?
Hier haben wir - die »Experten« - eine Verantwortung zu tragen, die sich nicht auf die Diagnose und auf die Arbeit an den Hindernissen beschränken kann, sondern durch die Teilnahme an der Entwicklung in die Zukunft projiziert werden muß. Nicht nur wir, sondern auch das Subjekt kann das Mögliche entdecken, es kann dies vielleicht noch besser. Aber auch dem scheinbar Unmöglichen sollte Raum gelassen werden, Wir wissen allerdings, was wir uns von bestimmten Krankheitsbildern erwarten können. Aber, so groß unsere Erfahrungen und Kenntnisse auch sein mögen, nichts ist so unsicher wie Prognosen. Lebenswege lassen sich nicht wissenschaftlich vorbestimmen, vor allem nicht in ihrer sozialen und psychologischen Dimension.
Wie oft fragen Eltern behinderter Kinder: »Was wird aus ihm, wenn es groß ist?« Eine schreckliche, verständliche, aber sinnlose Frage. Die Antwort müßte lauten: »Das werden wir uns zusammen überlegen, wenn es groß ist.« Dennoch sind Ziele in jedem Lebensweg impliziert, und wir können der Notwendigkeit nicht entrinnen, uns darüber Gedanken zu machen. Die Prognose wird dann das Nachdenken über ein mögliches Ziel, in das die überraschende Kraft der individuellen Kreativität, die Entwicklung der Umwelt, die Begegnungen usw. mit eingebaut sind. Das Ziel kann aber in jeglicher Behinderung nicht »Normalität« standardisiertes Erwartungspaket sein, denn dies hieße ja, wie wir gesagt haben, sich in den Hindernissen zu verrennen, sich zu versteifen, Entwicklung letztlich zu verhindern. Sehr deutlich wurde das an den Beispielen von Antonio und Ilaria. Ilaria ist in ihrem Kindsein stehengeblieben; sie kann zwar ein bißchen schreiben und lesen, aber sie lebt in einer irrealen Welt als unvollendetes Kind und unvollkommene Gefährtin des Vaters. Antonio schaut in die Welt hinein, sucht weiterhin einen Weg, vieles steht noch offen, es ist noch ein Dialog möglich. Das Ziel ist also, und da wird die Prognose gerechtfertigt, mit dem Gegebenen auszukommen, auf dem Gegebenen aufzubauen und dieses an die Erwartungen der Umwelt anzupassen. Selbstverständlich wird dann, daß die Umwelt lernt, die Behinderung richtig einzuordnen, nicht vor ihr zu fliehen. An anderer Stelle habe ich diesbezüglich herausgearbeitet, was Integration, d.h. Nicht-Aussonderung, für eine Bedeutung hat. Wenn die »normalen« Kinder von Anfang an am Dialog beteiligen, werden sie zu Erwachsenen, die Behinderung verstehen und in ihre Lebenswelt miteinbeziehen können. Wenn wir die behinderten Kinder getrennt erziehen, vertiefen Trennung von »normal« und »nicht-normal«.
Wie sollten wir also der Vielfalt der Lebenswelten behinderter Menschen begegnen? Doch nur, indem wir sie eben als Vielfalt ans in der Verschiedenheit, in der Fülle der Möglichkeiten, im Respekt der Individualität, im Vertrauen auf die subjektive Wahrheit, die Bewegungen dieses vor- und zurückfließenden Bandes mitmachen. Aber in dieser Vielfalt gibt es auch Grenzen. Im Falle Ilarias war die Grenze des therapeutischen Handelns weniger durch Ilarias Behinderung gegeben als vielmehr durch die psychologische Eigenart des Vaters und den nie auszusehenden Tod der Mutter. Mehrmals hatte ich versucht, den Vater zu bewegen, über sich selbst zu sprechen; aber immer schob er Ilarias Probleme zu oder Betrachtungen über die ungerechte Welt.
Wenn wir die familäre Umwelt des Behinderten an die erste Stelle in der Entwicklung des Dialogs setzen, dann wird uns klar, daß das Hauptgewicht unserer Arbeit (welcher Art die Behinderung des Kindes auch sein möge) auf dem Versuch liegen muß, die Eltern und die Verwandten der entstandenen Problematik zu stützen. Wohlgemerkt: ich nenne das nicht Elternberatung, denn diese setzt voraus, daß ich den richtigen Weg kenne und die Eltern nicht: sie führt selten zum Dialog, sie bleibt an der Oberfläche und setzt sich meist über die mögliche Erfindungsgabe des Subjekts oder über die möglichen inneren Grenzen der Verarbeitung hinweg. Wie oft wird zudem in der Beratung lediglich die Behinderung des Kindes in Augenschein genommen (denn dies wollen meist die Eltern) und nicht das Dabeisein der anderen Familienmitglieder und deren Stellung zueinander.
An zweiter Stelle beobachten wir dann, welche Vorschläge das in Frage gestellte Kind machen kann und will. Sehr beeindruckend fand ich, wie MILANI-COMPARETTI im Gespräch mit den Eltern zunächst nur herausarbeitete, was das Kind kann. Z. B. erfaßten Antonios Eltern ganz früh, daß Antonios Stärke die Sympathie war, die er in anderen erweckte. Sie haben sich um die Stärke bemüht.
Werden die Vorschläge des Kindes nicht wahrgenommen, bleibt der Defekt im Vordergrund und wird verstärkt. Gerade die Vielfalt der Lebenswelten enthält eine Vielfalt von Lösungen und Verarbeitungsmöglichkeiten, die nicht zum Tragen kämen, wollten wir mit unserem spezialisierten Wissen eine vorgefaßte und von Normen eingeengte Richtung einschlagen. Wenn sich schließlich der Dialog erweitert und die äußere Umwelt mit ihren Belangen hinzutritt, wird die Situation zweifellos komplexer. Ein Phänomen, an dem wir alle kranken, ist der Vergleich. Er läßt sich wohl nicht umgehen. Unser gesamtes pädagogisches System stützt sich auf ihn - seit Jahrhunderten: stark - schwach, schön - häßlich, groß -klein, klug - dumm. Wer ist nicht schon durch diese Mühle gedreht worden?
Wenn sich heute so viele Menschen Behinderten zuwenden, dann ist es der Humanität, eine Teilnahme des Gefühls, eine religiöse Verpflichtung. Selten ist es aber Kenntnis. Hier wieder tritt der Erfolg der Nicht-Aussonderung auf den Plan: mit Behinderten zu leben und zu lernen bedeutet eben nicht nur eine menschliche Verpflichtung, sondern eine Kenntnis der an Behinderung gebundenen Verhaltensweisen seitens der Behinderten. Gehen wir von diesen letzten aus, und die Wahrnehmung anderer Verhaltensweisen seitens der Behinderten. Gehen wir von diesen letzten aus, dann wird uns nach dem bisher Gesagten, klar, daß der Behinderte nur im engsten Kontakt mit den Vorschlägen der Umwelt seine Gegenvorschläge erarbeiten kann.
Daß es in der Realität des Zusammenlebens Schwierigkeiten gibt und in all diesen Jahren die Freude (oder sagen wir besser der Skeptiker der sogenannten Integrationsmodelle (vor allem des so rigorosen italienischen Modells) und der Kämpfer für die Erhaltung der Sondereinrichtungen und der psychiatrischen Anstalten. Institutionen, Anstalten, Zentren, so schön und reich wir sie auch ausstatten mögen, bieten aber keine vielfältigen Lebenswelten. Andererseits charakterisieren möglicher Mißerfolg und Schwierigkeiten ja nicht nur die Lebenswelt der Behinderten.
Wir können natürlich hier nicht über all die unzähligen Hindernisse sprechen, denen Menschen begegnen, vor allem behinderte Menschen und unter diesen besonders die Erwachsenen. Solange es sich um Kinder handelt, erscheint die Lebenswelt, trotz aller Schwierigkeiten behütet, voller Hoffnung auf Besserung, voller alternativer Möglichkeiten. Behinderte Kinder werden auch leichter akzeptiert als behinderte Erwachsene; die Umwelt projiziert ihr eigenes Hoffen in sie hinein. Beim Erwachsenen wird die Straße enger, wie jeder an sich selbst erleben kann.
Lassen Sie mich aber trotzdem zum Schluß eine Schwierigkeit unter den vielen in der Lebenswelt Behinderter wieder aufgreifen, die ich vorhin schon andeutete, als wir über Antonio sprachen. Als er zu mir kam und darüber klagte, daß die Mädchen ihn nicht wollen, berührte er eine Thematik, die im Leben Behinderter, vor allem geistig Behinderter, ein schier unüberwindbares Hindernis darstellt. Ganze Kongresse haben sich dieser Thematik gewidmet, denn es geht ja in der Realität der Sexualität nicht nur um die physiologischen Bedürfnisse, sondern um Partnerschaft, um Gleichberechtigung und um Lebensinhalte grundlegender Bedeutung: nämlich sich fortzusetzen, in gewissem Sinne, weiterzuleben - über den eigenen Tod hinaus.
Es gibt heute viele Lösungen, das Leben auch für erwachsene Behinderte lebensnah und menschlich zu gestalten. Sobald aber schwerer Behinderte oder gestörte Menschen in kleinen, familienähnlichen Gruppen zusammenleben, tritt sexuelle Problematik zutage, wenn ihnen der Kontakt mit der Außenwelt oder untereinander nicht verschlossen wird. Denn die sexuellen Funktionen und das sexuelle Bedürfnis sind ja am seltensten behindert, während ihre Ausübung auf große Schwierigkeiten oder auf Widerstände stößt. Wie selten haben Behinderte zum Beispiel Möglichkeit zu Intimität. Die kulturellen und sozialen Kriterien der »Erlaubtheit« von Sexualität sind außerordentlich eng gefaßt: Gesundheit, Schönheit und Jugend scheinen die Grenzen zu sein, in denen Sexualität erlaubt und verständlich ist. Mißgebildete, Kranke und Alte sollten sie meiden. Wer in Institutionen gearbeitet hat, die jugendliche oder erwachsene Behinderte versorgen, weiß, wenn er sich dieser Wahrnehmung nicht verschließt, daß das Bedürfnis nach Lieben, nach Partnerschaft und nach sexueller Befriedigung im Behinderten wie im Nichtbehinderten das gleiche ist, stärker noch als andere Bedürfnisse, die eher zu befriedigen sind wie z. B. Freiheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Teilnahme am Geschehen in der Umwelt, usw.
Erlauben Sie mir noch in Kürze dazu ein Beispiel aus meinem Erfahrungsbereich. Lebhaft erinnere ich mich noch an einen Fall aus einem nun schon lange aufgelösten) Tageszentrum für spastisch Gelähmte, in dem ich als Psychologe leitend tätig war: ein achtzehnjähriger Junge (dystonische Tetraparese) beklagte sich bei mir, weil er sich sexuell nicht mal selbst helfen konnte. Er bat, zu einer Prostituierten gebracht zu werden; die Familie sei einverstanden und würde es bezahlen. Ich erwiderte ihm, daß ich ihn verstünde, aber daß ich als Leiter des Zentrums so etwas nicht organiseren könnte, versuchte aber dabei auch mit ihm über Sexualität und Prostitution zu sprechen. Seine Idee ließ ihm aber keine Ruhe und es gelang ihm tatsächlich, einige Helfer des Zentrums zu bewegen, in ihrer Freizeit mit ihm diese Aktion zu starten, eine Prostituierte zu finden, die dazu bereit war. Ohne nun die Einzelheiten zu vertiefen kann ich sagen, daß er von dieser Lösung begeistert war und sie weiter praktizierte. Was mich an dieser Geschichte beeindruckt hat (ganz abgesehen von den möglichen moralischen Fragestellungen) war das Verhalten der Helfer und der Prostituierten. Ich hatte diesem jungen Mann gegenüber keine Vorschläge zu machen oder nur den der Verarbeitung eines Verzichts. Dagegen ist sein Gegenvorschlag zum Tragen gekommen: das scheinbar Unmögliche hat er möglich gemacht.
Selbst aber in einer geschlossenen (aber nicht verschlosssenen) Institution kann Liebe entstehen: beim Besuch eines Heimes für elternlose, erwachsene geistig Gestörte erblickte ich ein seltsames Paar - einen langen schizophrenen Mann Arm in Arm mit einer ebenso erwachsenen, rundlichen Frau (Trisomie 21), die im Park spazieren gingen und dann in einem Gärtnerhäuschen verschwanden. Der Leiter des Heimes blinzelte mir zu und sagte, sie »spielten« dort jeden Tag miteinander und wären auch sonst unzertrennlich.
Wo gibt es da Grenzen und wer sollte sie setzen, wenn wir dem Subjekt Raum lassen wollen und uns bemühen, Normen, in diesem Fall moralischer Art, flexibel in die möglichen Lebenswege einzubauen?
Im psychotherapeutischen Gespräch liegt sicherlich nicht immer der Schlüssel zur Heilung, aber das Miterleben errichtet eine Brücke des Verständnisses, die zum Patienten und zu uns zurückführt. Noch nie habe ich der Problematik des Lebens näher gestanden als im Gespräch mit Schizophrenen: Sinn und Unsinn des Lebens, Gottnähe und Gottferne, die Wahrnehmung der Geheimnisse, der geheimnisvollen Zusammenhänge, der Absurdität mancher Werthaltungen, das Träumen vom absolut Guten, die Angst vor dem Bösen, die Relativität der Beurteilungen. Da ist das Subjekt, dessen innerer Kampf tiefer beeindruckt als die Scheinsicherheit äußerst normaler Stammtischthemen.
Wenn wir uns sogenannter Behinderung in dieser subjektnahen Weise nähern, dann verschwimmen die Werte der Norm, wir entdecken im subjektiven und objektiven Leiden uns selbst, wenn wir ehrlich sind, und können diese Lebenswelt nicht mehr in »normal« oder »anormal« trennen. Behinderte gehören zu uns in dem Maße, in dem wir Behinderung, Schwäche, Grenzen und Fehler in uns selbst entdecken. Deshalb sollten wir eigentlich weniger über Behinderte sprechen und mehr über den Menschen überhaupt, mehr über die Erziehung zum Menschen.
Normen setzen, Mögliches oder Unmögliches zu bestimmen, Grenzen zu weisen ist dann eben der Fehler, auf den wir in allen bisherigen Überlegungen haben hinweisen wollen. In MILANIS Beispiel der aufstrebenden Spirale oder besser noch in Gidonis Metapher eines vor- und zurückfließenden Bandes ist in der Entwicklung eines Menschen die Bewegung nach allen Seiten offen; sie ist durch die Individualität des Subjekts, durch dessen Kreativität und die Natur der Umgebung gegeben. Das Geheimnis unserer Arbeit ist, diese Modalitäten zu entdecken, zu fördern, aber auch in ihren Grenzen zu respektieren und in unserer Umwelt mit einzubauen.
[55] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 3/1990 f., S. 11-22.
Zur Utopie der Freundschaft[56] - Ludwig-Otto Roser
Bei vielen anderen Gelegenheiten, zu denen ich eingeladen wurde, mich zum Problem der Integration Behinderter zu äußern, schloß ich meine Betrachtungen mit einem Hinweis auf Ernst BLOCHS Gedanken zum »Prinzip Hoffnung«. (Frankfurt/M. 1959) BLOCH war der Philosoph, der mir den besten Weg zu weisen schien, sich vom Realen zum Erwünschten zu bewegen.
Das Experiment hin zu einer möglichen besseren Welt
Heute möchte ich mit diesen Gedanken beginnen.
BLOCHS Begriff der Utopie, der in seinem Werk einen zentralen Platz einnimmt, betrifft nicht eine Denkform, in welcher Realität verdrängt oder degradiert werden soll, sondern den Versuch, das Reale zunächst zu verstehen und zu durchdenken, um es zu »überschreiten« auf der Suche und im »Experimentieren« eines Sinnes. Dabei ist der Sinn nicht schon utopisch vorausgesetzt und bestimmt, wie es den Ideologen gefällt. Suchen, fragen und experimentieren und schließlich auch aus dem Mißerfolg lernen sind die Meilensteine dieses Weges. BLOCH sagt wörtlich: »Die Welt bleibt, und sie bleibt es in ihrem Insgesamt, dasselbe höchst Laborierende, laboratorium possibilis salutis, Laboratorium eines möglichen Heils. Das macht ihre Experimentbeschaffenheit aus. Das macht die Welt zu einem experimentum mundi, zu einem Experiment von Welt, einer möglichen besseren Welt«. Als mir angetragen wurde, das heutige Zusammentreffen mit einem Beitrag zu eröffnen und ich mich betroffen fragte, was mir nach soviel Jahren Integrationspromotion über Gewordenes und Verdorbenes noch zu sagen übriggeblieben sei, fiel mir das Wort »Freundschaft« ein. Dabei lag mir die Anmaßung fern, die Kraft und das Wissen zu haben, einen so gewichtigen Begriff, wie es »Freundschaft« ist, in die letzten Winkel biologischen, seelischen und geistigen Seins zu verfolgen. Woher, fragte ich mich sogleich, ist mir dieser Gedanke gekommen? Was enthält er für die Arbeit mit Behinderten? Nur langsam wurde mir klar, daß dieses von mir eilig durchs Telefon angekündigte Thema, aus einem Gefühl der Unlust erwachsen war: ein Unbehagen, noch weiter über Dinge zu sprechen, die Menschen betreffen, welche wir Mühe haben, in unser Leben einzubeziehen. Wir tun es am Ende und handeln wie es unseren kulturellen und gefühlsmäßigen Geboten (oder Grenzen) entspricht. Aber das Einordnen in Kategorien jeglicher Art (die Alten, die Jungen, die Behinderten, die Schwarzen und die Weißen, die Tiere und die Menschen, die Armen und die Reichen) führt uns über das Individuum hinweg zur Erfindung von Sondergruppen, die uns der Aufgabe entheben, den Dingen auf den Grund zu gehen. So nennt der Arme den Reichen glücklich, und der Reiche den Armen untüchtig, wobei wir übersehen, daß ein Armer glücklich und ein Reicher untüchtig sein kann. Wir erfinden auch Maßnahmen, die uns das Einordnen erleichtern und rechtfertigen, die unsere Ängste beruhigen, und werden indessen blind für alles was verbindet und im Guten wie im Bösen gemeinsam ist.
Das Wesen der Freundschaft
Trete ich aber vor ein anderes Lebewesen wie vor mich selbst, dann entdecke ich mich in ihm, vor allem in dem gemeinsamen Ausgesetztsein: seine Leiden und seine Freuden, seine Ängste und seine Hoffnungen berühren den gleichen Grund unserer Gefühle, klingen in uns an, weil wir sie kennen und früher oder später selbst erleben werden oder schon erlebt haben. Deshalb hat mich das Thema »Freundschaft« angezogen und mich gedrängt, darüber nachzudenken, in der Hoffnung, daß es für unsere Arbeit und für unser Innenleben nützlich sein könnte. Welcher Art das Zurechtbiegen der Probleme durch religiöses, philosophisches oder verdrängendes Denken auch sein mag, Freundschaft erhellt und erwärmt einen Jeden. Freundschaft ist kein Gebot, ist unideologisch, ist nicht nur passiv empfundener Trost, sondern lädt ein zum aktiven Dabeisein. Das philosophische Wörterbuch definiert Freundschaft folgendermaßen: »Seit SOKRATES eine der Grundtugenden, die sich in dem bewußten, gegenseitigen Wohlwollen zweier Menschen ausdrückt, wobei jene Freundschaft einen wirklich sittlichen Charakter trägt, die auf wechselseitiger Liebe, Achtung, Aufgeschlossenheit und bedingungslosem Vertrauen basiert. Freundschaft führt zur Kommunikation und ist dadurch der Weg zur Verwirklichung des Selbst durch das Du. Wirkliche Freundschaft setzt innere und äußere Freiheit voraus und ist selbst Träger zur Steigerung der inneren Freiheit«. - Aber ist Freundschaft eine Tugend? Ist sie ein glücklicher Zufall?
Was verhindert Freundschaft?
Versuchen wir zunächst zu verstehen, was Freundschaft verhindert. Wenn wir die uns ähnlichen Säugetiere betrachten, dann fällt uns auf, daß die erwachsenen Individuen vor allem durch den Instinkt der Lebenserhaltung bestimmt sind, sei es eines jeden Einzelnen, sei es der Gruppe. Hier wächst bestimmt keine Freundschaft. Tierkinder verschiedener Arten dagegen können untereinander »befreundet« sein und es auch bleiben (wir werden später darauf zurückkommen). Um zu überleben, muß das erwachsene Individuum stark und gesund sein; zur Reproduktion gelangt das Stattlichste, das Erfahrenste, das Aktivste. Da taucht schon das Wort »tüchtig« zunächst als lebenstüchtig, auf. Das Vorbild der Natur, aus der der Mensch selbst gewachsen ist, begleitet unser Leben von Anfang an. Es ist also »natürlich«, daß er Natur in sich trägt und sie in seinem Bewußtsein miteinbezieht. So werden sein bewußter und unbewußter Wille, sowie die Prinzipien zur Erziehung seiner Kleinen, gerechtfertigt durch die Bedingungen, aus deren Schoß er entstammt. »Ertüchtigen« (wer hat dieses in der Geschichte unseres Jahrhunderts hervorgehobene Wort vergessen?) wird zur Aufgabe der Pädagogik: für den Lebenskampf vorbereiten, sich behaupten lernen, sich nicht beiseite drängen lassen, Erfolg haben, natürlich auch stark und schön sein, womöglich auch generös (wie uns das Märchen vom edlen Ritter vorschweben läßt).
Aber hier taucht der eigenartige Widerspruch auf: der Mensch soll auch verzeihen und verzichten können, Mitleid haben, Werte anstreben, die jenseits des Materiellen liegen, den Feind lieben, Freundschaft pflegen. In seiner Natur läge auch dieses Sollen, insofern es aus der menschlichen Vernunft erwachsen ist und deshalb auch im Kosmischen enthalten zu sein scheint. Dazu sagt der auch in Deutschland bekannte Theologe Enrico CHIAVACCI in seinem auf deutsch erschienen Aufsatz »Für eine Neuinterpretation des Naturbegriffes«: »Gemäß der Natur handeln will aber an erster Stelle sagen: Handeln zur Realisierung der letzten Bedeutung der menschlichen Existenz«. Hier halte ich an bevor ich mich auf moraltheologischen Gefilden verirre. Ich habe diese Gedanken nur gestreift, um mich dem Thema Freundschaft wieder zuzuwenden, das sich diesem, dem Menschen eigenen, Widerspruch bewegt. Denn wir fragten uns, welche Hindernisse hat Freundschaft? Sie erwachsen offensichtlich aus zahlreichen natürlichen und kulturellen Gegebenheiten: denken nur an die sicherlich auf Selbstbehauptung abgestimmte Eifersucht Kleinkindes gegenüber dem Neugeborenen; denken wir an den Neid des Mannes gegenüber dem Privileg der Erfahrung des Gebärens Und andererseits an das, was von den Freudianern als Penisneid bezeichnet wird. Denken wir an die geschlechtsbedingte Interaktion der bewußten oder unbewußten Bevorzugung eines Kindes im Familienverband. Auch »schön« und »häßlich« scheinen nicht nur kulturelle Kategorien zu sein: wir finden sie in den verschiedensten Nuancen als »artgerecht« auch in der Tierwelt. Z. B.: Welcher Widerstand ist schon in kleinen Kindern, eine Brille zu tragen, die sie von den anderen in als negativ empfundener Weise unterscheidet? Ihre Suche nach Freundschaft ist von innen und außen erschwert, dem erklärenden Eingriff des Erwachsenen zum Trotz. Aus diesen Verkrampfungen (es würde zu weit führen sie alle aufzuzählen), die uns am biologischen Untergrund unseres Daseins binden, wächst nun Kultur, sei es den biologischen Untergrund zu fördern, sei es, ihn zu hemmen. Es entsteht Erziehung. Es entstehen Erziehungsideale. Diese können zueinander im Widerspruch stehen und sich im Verhältnis zu weltanschaulichen Tendenzen entfalten.
Lassen wir aber alle pädagogischen Ideologien und Rechtfertigungen beiseite und fotografieren wir, was um uns herum geschieht (immer weiter im Hinblick auf die freundschaftsfördernden Aspekte): Eltern wünschen für ihre Kinder Erfolg, denn Erfolg wird in fast allen Gesellschaften als der Schlüssel zum guten Leben empfunden. Besser, schöner, stärker sein als andere ist die Devise, die uns alle umgibt und die selbst im Versuch entideologisierender Pädagogik durch alle Menschen dringt und der sich zu entziehen schier unmöglich erscheint. Der Eifer, sich vorzudrängen, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu beweisen, über den Irrtum anderer zu lachen, genährt durch die entsprechenden Erwartungen der Bezugsperson, ist uns aus der Kinderstube und später aus den Klassenzimmern bekannt. Andererseits die Tendenz, den Mißerfolg zu vertuschen, gar zu lügen, damit die Schwäche nicht gewahr wird, begleitet die Kinderwelt, die sich mit der des besorgten, drohenden, betroffenen Erwachsenen verstrickt. Neid entsteht. Man gönnt dem Beneideten seine Fähigkeiten, seinen Erfolg, sein Glück nicht. Neid vermischt sich mit Eifersucht, diese wird zur offenen oder verschleierten Feindschaft. Alles wird versucht, sich über den anderen zu stellen, ihn zu überrunden. Aber entspringen diese Gefühle nicht viel tieferen Wurzeln, deren Verzweigung die verschiedensten Nuancen menschlichen Verhaltens bestimmen?
Im Grunde ist es Angst
Auf der Suche nach diesen Wurzeln stoßen wir unvermeidlich auf Gefühle, denen sich zu entziehen schwierig erscheint: es sind die Gefühle der Angst. Und hier begegnen wir einem allen Menschen Gemeinsamen, das sich aus der Tatsache ergibt, daß wir als Individuum überleben wollen und uns zugleich auf demselben Schiff befinden. Gabriel MARCEL sagt es: »Wir sind alle eingeschifft!« HEIDEGGER drückt es dramatisch so aus »Wovor Angst sich ängstigt ist das In-der-Welt-sein selbst.« Angst dem, was wir nicht kennen, vor dem Fremden, Angst vor unserem , vor unserer Unfreiheit und vor unserer Freiheit, deren Folgen wir nicht übersehen. Wer vermag eine Liste unserer Ängste aufzustellen? Und wieviel ist über Angst gesagt und geschrieben worden? Sollten es also im Grunde die Ängste sein, die Freundschaft verhindern? Weiter oben sagten wir, daß Tierkinder der verschiedenen Arten (der uns ähnlichen Säugetiere) untereinander befreundet sein und es auch bleiben können. Tierkinder haben ein herzliebes Angesicht, sie rühren nicht nur uns, sondern sich selbst gegenseitig. Sie sagen allen: »Ich tue Dir nichts«; nicht umsonst legen wir unseren Kleinkindern ein Stofftier von freundlichem sehen ins Ärmchen, damit sie sich nicht allein fühlen und getröstet sind. Sie erhalten Sicherheit. Eine solche Sicherheit bleibt oft erhalten wie die uns verblüffenden Bilder bezeugen, auf denen eine Katze geduldig erträgt, daß eine mit ihr großgewordene Maus auf ihr Fell krabbelt oder ein Hund mit einer Katze im Körbchen schläft.
...das Eigenartige als Möglichkeit miteinbeziehen...
Beobachten wir nun unsere Kleinen beispielsweise in der Kinderkrippe, sehen wir, daß die meisten zunächst wenig Bezug auf den anderen nehmen, es sei denn sich eines Gegenstandes zu bemächtigen (der vielleicht ein Stück Sicherheit symbolisiert). Alle Merkwürdigkeiten wie Agressivität und andere emotionalen Äußerungen, aber auch Fremdartigkeit, den als etwas Gegebenes hingenommen. Es wird sich über nichts besonders gewundert, denn alles ist noch verwunderungswürdig und als Information akzeptiert. Noch ist kein Bewußtsein da vom eigenen Selbst. Aber auch nach dem Erwachen des Ichs ist der Grad der Toleranz bei Kleinkindern sehr viel höher als beim Erwachsenen. In den unzähligen Gelegenheiten, die ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit hatte, behinderte Kleinkinder in der Kinderkrippe und später im Kindergarten oder in der Schule zu begleiten, habe ich beobachtet, daß fast alle Kinder das Eigenartige in ihre Welt einbauen und als Möglichkeit miteinbeziehen. Unvergeßlich ist mir das Verhalten sehr kleiner Kinder in einer Kinderkrippe gegenüber einem blinden Kind: das Wunder, daß es nicht ausweicht, das dann selber Ausweichen und schließlich das aktive Bemühen, es vor Gefahr zu schützen. Die Kinder entdeckten, daß es nicht sehen konnte. Viele dieser Situationen habe ich über Jahrzehnte verfolgen können und nicht nur mit Sehbehinderten natürlich. Mit dem zunehmen den Bewußtsein des eigenen Selbst nahmen Zugewandtheit und Einbeziehung nicht ab: Die Toleranz, selbst Verhaltensstörungen ist bemerkenswert, besonders auch in dem gemeinsamen Aufwachsen mit einem psychotischen Kind: die Eigenart des Verhaltens, selbst die Aggressivität, werden nicht als persönlicher Affront erlebt, sondern in die Realität eingebaut, in dem Maße, in dem den Kindern bewußt wird, daß das merkwürdige Gruppenmitglied nicht anders kann.
Sicherlich vollzieht sich dieser Prozeß und erweist sich diese Toleranz nicht in allen Kindern; sie bedarf auch des erzieherischen Eingriffes. Aber in den meisten ist das Resultat ganz offensichtlich etwas, was interessiert: das Eigenartige und Fremde löst nur Angst aus, wo es plötzlich auftritt, wo kein Raum und keine Zeit zum Verstehen geboten wird, und nicht dort, wo es mit uns wächst. Wir könnten also behaupten, Freundschaft kann nur da entstehen, wo Freiheit von Angst gebildet wird, wo das Eigenartige von vornherein miterlebt wird.
Ich kenne dich
Ohne nun besonders an das Nicht-ausschließen (von Anfang an) von Behinderten oder von ihrer Herkunft nach fremden Kindern zu denken, fällt auf, daß die Freundschaften, die fast alle Lebensstürme überdauern, meist aus der gemeinsamen Kinderwelt stammen. Zusammen die Schulbank gedrückt zu haben, ist natürlich keine Garantie für Freundschaft, wenngleich im allgemeinen die Wiedersehensfreude beim Klassentreff groß ist. Man ist zwar verschiedene Wege gegangen, hat verschiedene Weltanschauungen erarbeitet, ist ganz verschiedenen Begegnungen ausgesetzt worden. Trotzdem wird wieder angeknüpft an eine gefühlsmäßige Sicherheit, die sich ehemals langsam gebildet hatte: ich kenne Dich, ich weiß, wer du bist, ich habe keine Angst vor Dir. Und das bei Persönlichkeiten, die die verschiedensten Welten vertreten. Die Eigenarten des anderen sind mit den unseren irgendwie verschmolzen: Verständnis Geduld, Toleranz Gewohnheit haben die Verschiedenheit in seltsamer Weise verbunden. Den anderen mit seinen Schwächen, seinen Fehlern seiner Denkweise zu akzeptieren, ist gebunden an eine gemeinsame Entwicklung in der umgebenden Realität. Wie oft ist z. B. Schulwechsel traumatisch; er ist wie eine Emigration. Wie ist dem »Neuen« der in die Klasse eintritt. Ist er nicht durch Angst stark behindert? Fehlen der Anonymität in der kleinen Stadt- oder Dorfgemeinde ist sehr wahrscheinlich auch in diesem Sinne freundschaftsfördernd, wenngleich behauptet wird, daß dort, wo ein jeder jeden kennt, Klatscherei und Neid besonders blühen. Aber wenn diese Menschen sich auch nicht immer besonders lieben, sie kennen sich: Furcht und Argwohn sind relativ neutralisiert. Zum Stammtisch haben alle Zugang, werden Meinungen bekämpft, aber auch verziehen; es verwischen die sozialen Barrieren. In den durch Gruppenzusammenhänge gegebenen Verschmelzungen, die der Freundschaft förderlich sein können, stagnieren natürlich auch noch alte, kulturelle Verhaltensweisen, die schwerwiegend sind: während dem Dabeisein eines Behinderten oder irgendeines Andersartigen in Kindergemeinschaften im allgemeinen nichts im Wege steht (mit Ausnahme des von den Erwachsenen gebotenen Leistungsprinzips), trennen sich noch, anscheinend spontan, Mädchen von Jungen. Man sagt, sie haben verschiedene Interessen und differenzert diese Interessen auch noch. Uns zu fragen, inwieweit solche Ballaste, z. B. Freundschaft zwischen männlich und weiblich, erschweren, würde hier zu weit führen und die Frage aufwerfen, in welchem Maße heute noch Mädchen und Frauen durch kulturelle Vorstellungen von vornherein behindert sind. Die Vernunft hat Gesetze formuliert, aber die angeblich aus der Natur gewachsene Kultur scheint immer noch stärker zu sein, vor allem, weil viele sich ideologisch darauf berufen möchten.
Aber zurück zur Freundschaft. Wir sagten, daß sie dort gedeihen kann, wo man sich gut kennt. Es ist also vor allem das Dabeisein, das Einbezogensein, das zunächst Angst (und damit Aggressivität) mildert und die Möglichkeit der »Freundschaft« als Hoffnung anbietet. Ich sage Möglichkeit und meine damit das Terrain, auf dem Freundschaft wachsen kann. Nun ist es gewiß nicht so, wie wir schon sagten, daß das gemeinsame Aufwachsen, das zusammen »Eingeschifft-sein« aller, notwendigerweise zur Freundschaft führt, denn diese ist aus unzähligen Variablen zusammengesetzt, die schwer zu erforschen sind, z. B. durch die Sympathie, die aus mysteriösen Quellen des Gefühls entspringt. Sie kann auch Menschen zusammenführen, die nicht miteinander aufgewachsen sind. Befreunden kann man sich in jedem Lebensabschnitt. Aber auch hier steht die Freiheit von Angst, das gegenseitige Vertrauen im Vordergrund. Wie oft wird beklagt, daß Freundschaft selten ist und es ist gewiß nicht leicht, als Erwachsener Freunde zu finden, die sozusagen »wirklichen« Freunde. Vor dem Akzeptieren des Anderen in all seinen Seinsweisen steht zweifellos das gegenseitge Kennenlernen. Es ist Voraussetzung zur Minderung der Angst.
Verlegen wir also wieder unser Laboratorium in die Kinderwelt und kommen wir zu dem, was uns hier eigentlich interessiert. In diesen Jahren ist vom »Gemeinsam leben und lernen« viel gesprochen worden. Alle, die hier versammelt sind, haben diese Worte auf ihre Fahnen geschrieben. Mädchen und Jungen, Behinderte und so erscheinende Nichtbehinderte, Schwarze und Weiße, die gemeinsam aufwachsen, lernen sich kennen. Dadurch befinden sie sich, bevor jeder seinen eigenen Kahn glaubt besteigen zu müssen, auf dem gleichen Schiff. Hier ist das Terrain der Hoffnung, hier sollte das Laboratorium eines möglichen Heils eingerichtet werden.
... andere Dimensionen erleben
Wieviele Erwachsene, die im Leben stehen, wissen z. B. etwas über Psychose (außer denen, die entschieden haben, sich damit zu beschäftigen)? Schulkinder, in deren Mitte auch ein psychotisches Kind weilt, lernen es kennen und erleben dieses seltsame Fernsein, dieses explosive Dabeisein, dieses Hineingeführtwerden in Alices Wunderland, in dem die merkwürdigsten Dinge geschehen, in dem Absurdes sich mit Realem vermischt. Im Ringelreien des Kindergartens wird das besondere, vielleicht autistische, Kind mit einbezogen, von den Kindern selbst. Sie erleben und experimentieren andere Dimensionen des Seins, beziehen es ein und sind dabei weit davon entfernt zu begreifen, daß ihr Verständnis nun wiederum von dem besonderen Kinde selbst einbezogen wird. (Sie werden mich fragen: Wie ist es anzustellen, ein psychotisches Kind der besorgten Familie und den Therapeuten zu entreißen, um es einen natürlichen Weg durch Kindergarten und Schule gehen zu lassen? Darüber habe ich schon zu oft gesprochen und deshalb verweise ich Sie auf den ROSER der Jahre des Kampfes für die Aufnahme aller ins Lebensschiff.) Man muß es gesehen haben, wie Kinder anscheinend Andersartige miteinbeziehen, noch bevor über die therapeutischen und pädagogischen Opportunitäten theoretisiert wird. Man muß gesehen haben, wie ein Kind seinen spastischen Weggenossen in der Pause mit kleinen Frühstücksbrotbröckchen füttert. Man muß gesehen haben, wie Kinder sich mit tauben Mitschülern verständigen, wie sie sich vor sie hinstellen, damit die ihre Lippen sehen. Man muß gesehen haben, wie sie das Gesabbere ertragen, das sich in einigen Behinderungen manifestiert. Und wie das psychotische Kind sich schließlich in den Kreis des Ringelreiens einordnet und ein Lächeln über sein Gesicht huscht.
Unvergeßlich ist mir Pino (ein durch Tetraplegie völlig blockierter Junge; nur mit einem Zeh konnte er eine Schreibmaschine bedienen). Pino, damals 13 Jahre alt, der während der Pause in die Klasse ruft: »Ist denn heute niemand da, der mich füttert?«, worauf ein Mitschüler, der gerade beschäftigt war, antwortete: »Ich kann jetzt nicht«, und ein anderer rief: »Ich komme gleich«. Pino hat später ein Universitätsstudium zu Ende gebracht und arbeitet heute in der Stadtverwaltung. Er hat immer weiter die gleichen Anliegen, z. B. daß ihm jemand die angezündete Zigarette in den Mund steckt. Heute helfen ihm seine Arbeitskollegen; sie gehören zur Generation der »gemeinsam Aufgewachsenen«. Es liegt mir, wie schon gesagt, fern, aus einer solchen Gemeinsamkeit zu schließen, daß aus ihr Freundschaft entstehen muß. Diese seltene Pflanze braucht nicht nur guten Boden; sie bedarf vieler anderer Dinge und ist Bedingungen unterworfen, die in ihrer gleichzeitigen Realisierung gewiß etwas Utopisches haben. Aber wir wollen uns auf den Boden konzentrieren: er betrifft das Allerwichtigste, er ist das Element des Ortes, in dem sich Wurzeln festigen und ausbreiten. Behinderungen jeglicher Art (auch die des Kindes getrennter Eltern, auch die in der eigenen Umwelt von Krankheit und Tod Betroffenen, und so fort), alle Behinderungen muß man kennenlernen, nicht nur, weil man sich mit ihnen beschäftigen will, sondern weil sie neben uns und in uns sein können.
Freiheit von Angst als Grundlage des Lernen
Unsere Gefühle und das Innenleben derer, die, wie wir, Angst in sich tragen und schließlich Angst auch in anderen produzieren, die uns verunsichern und uns vor uns selbst stellen, sind aber nicht in den Lehrprogrammen vorgesehen. In der Schule kann es sich ergeben, auf formaler Ebene über menschliche Probleme und über die Probleme der Welt zu sprechen; aber es handelt sich meist um Zufälliges oder um etwas, was im Augenblick die Gemüter bewegt. Lesen, Schreiben und Rechnen lernen und Wissen ist das Gebot der Schule, die dann auch Kultur vermittelt, welche ihrerseits, wie durch Magie, richtiges Verhalten generieren soll. Sicher ist Verstand auch eine Frage des Erkennens und des Wissens, aber ist er auch zugleich Vernunft? Vernunft als Welterkenntnis kann nicht ohne Weiteres vermittelt werden: sie muß auf einer Ebene entstehen, die mit dem Urgrund der Gefühle verbunden ist. Der Boden der Freundschaft, von dem wir sprachen, ist, meine ich, vor allem aus Gefühlen zusammengesetzt, z. B. Freiheit von Angst.
Die Aufgabe wäre nun, außer nur Lesen und Schreiben beizubringen, die verschiedensten Gefühle, die im Kinde aus unzähligen Quellen entspringen, miteinander in Einklang zu bringen und von den angstfördernden Elementen zu befreien. Stattdessen steht das Klassenziel, die Leistung und damit die ökonomische Zukunft und das Wohlleben im Vordergrund, wie sie den vom Erwachsenen bestimmten Kulturerwartungen und den hypothetischen Lebenszielen entsprechen. Wer »gut« ist und wer »schlecht« ist, wird dadurch bestimmt, wer sich Mühe gibt und wer nicht. Aber wer fragt nach den durch solche Urteile entstehenden Gefühle? Sie scheinen nicht wichtig zu sein, denn man ist sicher, das Beste zu tun, um anzuspornen, um den Willen zu schulen, um Lebenstüchtigkeit zu formen. Aber wieviel Minderwertigkeitsgefühle, wieviel Neid und Eifersucht entfacht dieser anscheinend edle Vorsatz? Entstehen hier nicht diese Ängste, die dann ein Leben lang die Individuen voneinander trennen und unterscheiden? Es liegt mir fern, Schule als Ort individual- oder gruppentherapeutischer Bemühungen vorzuschlagen. Psychologie in der Schule kann sich offensichtlich nur mit denen beschäftigen, die aus dem Rahmen zu fallen drohen.
Freundschaft ist die Erkenntnis von Ähnlichkeiten
Dagegen: Es würde genügen, die Verschiedenheit menschlicher Gegebenheiten und Möglichkeiten schon im Kindesalter sichtbar werden zu lassen. Welchen besseren Weg gäbe es da, von vorneherein niemanden auszuschließen oder zu brandmarken? Zur Toleranz, die durch Gewohnheit und Vertrautheit entsteht, würde sich so die vermittelte, diskutierte, durch Erziehung geförderte Toleranz gesellen. Wir sagten, Toleranz ist die Voraussetzung des Einbeziehens der Probleme anderer in unser Dasein und das Erkennen der Universalität dieser Probleme. Toleranz ist aber zu wenig, denn in ihr liegt das Gewicht auf dem Dulden; auch Solidarität ist zu wenig, denn sie ist eine Einbahnstraße. Freundschaft geht einen Schritt weiter: sie ist die Erkenntnis der Ähnlichkeit menschlicher Problematik: das Ich vermischt sich mit dem Du.
Ich habe mich verleiten lassen, mit meinen Ausführungen einen komplizierten Weg zu gehen. Man kann so viel sagen und man kann auch alles widerlegen. Aber ich bin nicht hierher gekommen, um einen philosophischen oder wissenschaftlichen Disput zu entfachen, sondern um einer Hoffnung Ausdruck zu geben. Ich denke es ist eine »fundierte Hoffnung«. So wie man hoffen konnte, daß die Aufhebung der Geschlechtertrennung in der Schule wenigstens auf der Ebene der Vernunft einen Fortschritt bringen würde, so könnte z. B. auch die Verschmelzung der Stämme und Völker die Hoffnung entstehen lassen, daß eines Tages ein angstfreies Menschengeschlecht unseren Planeten bewohnen wird. Utopie ist dies nur für den, der meint, daß die Dinge, wenn sie heute und jetzt nicht sind, auch nie sein werden, und der damit kein Vertrauen auf Entwicklung hat. Freundschaft, so können wir zusammenfassend sagen, entsteht also aus einem angstfreien Zusammenleben.
Indem Dietmut NIEDECKEN in ihrem Buch »Namenlos« den inneren Widerstand der einzelnen Individuen und dann der Gesellschaft gegen alle diejenigen analysiert, die von der hypothesierten Norm abweichen, stellt sie das Phänomen Angst in den Vordergrund)[57] Angst, uns in den Problemen anderer wiederzuerkennen, Angst zu versagen, Angst vor der Institution, Angst vor Aggression - und so fort. »Die Abwehr, in der die Betonung des Andersseins gründet, ist also die Angst, durch das Siebmaß der Normalität durchzufallen, Angst davor, aufzufallen und damit rauszufallen«. Ihre subtile Analyse der Gefühle, die zwischen Individuen und scheinbar Andersartigen entstehen, repräsentieren das Tiefste, was zu diesem Thema zu sagen ist, auch weil die Kenntnis darüber am eigenen Leben erlebt wurde. Die Aufgabe wäre also, angstfrei zu erziehen und, wo dieses versäumt wurde, die eigenen Ängste im mitmenschlichen Sein unter die Lupe zu nehmen. Ein Weg mit Hindernissen, an denen man schier verzweifeln könnte. Aber wir glauben, einen Anfang entdeckt zu haben, der uns vielleicht zuversichtlich macht. Er läßt sich in dem Satz erkennen, den wir sicher alle unterschreiben möchten: Von den ersten Lebenstagen an niemanden ausschließen oder an den Rand drägen, um dann gemeinsam zu leben und zu lernen. Ernst BLOCH denkt da an einen Menschen, der den Anspruch hat, das »Noch-nicht« in die Realität zu überführen, mit dem Wunsch, sich selbst zu überschreiten, und zitiert dabei HERAKLIT: »Wer das Unverhoffte nicht erhofft, wird es nicht finden«.
So steht es auch mit der Freundschaft.
[56] Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 2/95, S. 65-71; dieser Text basiert auf einem Vortrag, den Ludwig-Otto ROSER am 22. Februar 1995 in Innsbruck zur Eröffnung der Jahrestagung der Integrationsforscherinnen und -forscher aus den deutschsprachigen Ländern gehalten hat.
[57] Dietmut NIEDECKEN: Namenlos. Geistig Behinderte verstehen. München 1989. Neuauflage: 1993 (erscheint voraussichtlich 1998 neu im Hermann Luchterhand Verlag, Berlin. Anm. J SCHÖLER)
Es war im Juli 1981, daß ich mit meiner Familie, darunter dem halbjährigen Jüngstgeborenen, in der Pineta von Tirrenia nördlich von Livorno Ferien machte. Hitze, Mücken und sehr volle Strände bildeten den eher beschwerlichen Hintergrund. In dieser Situation rief mich eine Hamburger Freundin an, die in der Nähe von Florenz ein Ferienhaus gemietet hatte, und überredete mich, doch mit nach Florenz zu Prof. MILANI-COMPARETTI zu kommen, der für eine Gruppe von Pädagogen aus Deutschland eine Art Hospitationswoche anbot. Dabei sollten sein Zentrum und die verschiedenen Arbeitsbereiche vorgestellt werden. Ich weiß noch, daß ich in dieser Woche auch »den Psychologen Dr. ROSER« sah, mit ihm aber noch nicht gesprochen hatte.
Am letzten Abend lud Otto ROSER dann die Gruppe zu sich nach Hause ein, wo wir, großzügig bewirtet von seiner Frau Renate, einen traumhaften Abend vor dem Haus mit dem unbeschreiblich schönen Blick auf das abendliche Florenz genossen. Das zunächst noch fachlich geprägte Gespräch - wir hatten viele Fragen zu den »italienischen Verhältnissen« - mündete glücklicherweise mehr und mehr in ein gemütliches und schließlich persönlich gefärbtes Unterhalten und Plaudern.
Im nächsten Jahr verbrachten wir unsere Ferien auf Elba und nutzen die Rückfahrt durch Florenz, Otto und Renate ROSER zu besuchen und uns dabei langsam näher kennenzulernen. Von nun an blieben wir in brieflichem Kontakt. Im Herbst 1984 schließlich gelang es, mit Hilfe von Otto ROSER ein Praxis-Freisemester in Lüneburg genehmigt zu bekommen, so daß ich volle sechs Monate in Florenz in verschiedenen Einrichtungen hospitieren konnte.
Im einzelnen waren dies das Centro »Anna Torrigiani« von Prof. Adriano MILANI-COMPARETTI, die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität, verschiedene Krippen, Kindergärten und Schulen sowie vor allem die Unitá sanitaria locale, in der Otto ROSER tätig war. Ich habe ihn viele Wochen lang in allen seinen Gesprächen, Beratungen, Besuchen, .Konferenzen und Teamsitzungen begleitet. Dabei habe ich nicht nur intensiv seine fachliche Sichtweise, seine Kompetenz, seine berufliche und gesellschaftspolitische Stellungnahme und seine integre Persönlichkeit und Autorität kennen uns schätzen gelernt; sondern vor allem seine tiefe Menschlichkeit und - bei allem Sinn für Fröhlichkeit - seine tiefe Ernsthaftigkeit. Zwischen uns hat sich in dieser Zeit, deutlich gestützt durch seine Frau Renate, eine gute Freundschaft entwickelt, die bald neben dem fachlichen weite persönliche Bereiche mit einschloß. Dies hat sich bis heute so erhalten, wenn auch durch die Entfernung größere Unterbrechungen eintreten.
Ein wichtiger Gedanke von Otto ROSER damals war: »Ihr redet in Deutschland so viel von Integration. Das steht bei uns in Florenz gar nicht so sehr im Vordergrund. Für uns ist Nicht-Aussonderung, das Nicht-über-den-Rand-Hinausdrängen viel wichtiger.« Und in der Tat waren viele Maßnahmen des Staates, der Religion, der Stadt, der Bezirke und die von Otto ROSER eingeleiteten immer dabei orientiert, eine frühe Stigmatisierung von Kindern, eine Festlegung, eine Diagnose, einen Behindertenstatus zu vermeiden.
Diese Sichtweise von den Ursrüngen her, diese offene, akzeptierende Umgehensweise, dieses Einbeziehen von Variationen kindlicher Entwicklung hat mir nur eingeleuchtet und imponiert, sondern hat auch ganz wesentlich mein weiteres Denken und Handeln beeinflußt. Ich hatte mich schon vorher an die Integrationsbewegung in Deutschland angeschlossen, hatte mich intensiv für die Einrichtung der Integrationsklasse in Schenefeld (die zweite in Deutschland) eingesetzt und tue dies noch jetzt im Hamburger Raum, gedanklich bin ich aber wesentlich gestärkt worden durch Otto ROSERS Ideen und deren aktive Umsetzung.
Ein schöner Erfolg war für mich, daß ich ihn zusammen mit seiner Frau im Jahr 1986 nach Hamburg und Lüneburg locken konnte, so daß er auch von meinen Arbeitsbedingungen und den »Hamburger Verhältnissen« durch Augenschein erfahren konnte.
In vielen Artikel, die in diesem Buch abgedruckt erscheinen, kommt seine vorsichtige, zurückhaltende, bescheidene Art hervor. Das sollte nicht dazu führen, seine Aussagen leichter zu nehmen. Hinter seiner höflichen, abwägenden Sprache stecken wohlbegründete Beobachtungen und Erkenntnisse. Ich glaube, Otto ROSER würde niemals ein Dogma daraus machen - dafür ist er zu sehr ein Römer -, aber er tritt jederzeit für seine Überzeugung ein.
Die Förderung schwerstbehinderter Kinder im Florentiner Integrationsmodell - Individualisierte Betreuung in der sozialen Welt. In: Andreas A FRÖHLICH (Hrsg.): Die Förderung Schwerstbehinderter. Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Luzern 1981 S. 199-222
Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation - Voraussetzungen für die Integration Behinderter (MILANI-COMPARETTI und Ludwig-O. ROSER) S. 18-26, Bericht vom Hamburger Gesundheitstag 1981
Keine Aussonderung Behinderter: Gemeinsam Leben und Lerne Behindertenpädagogik. Heft 1/1981, S. 18-23
Integration Behinderter in Italien; Anspruch und Realität, In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft; Heft 3/1981: S. 28-33
Förderung der Normalität und der Gesellschaft in der Rehabilitation - Voraussetzungen für die reale Anpassung Behinderter (mit MILANI-COMPARETTI) In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft; Heft 4/1981, S. 30-37
Wo es keine Behinderung mehr gibt. Schule ohne Aussonderung in Italien. In: päd: extra, Heft 3, 1981, S. 16-21
Wer hat Angst vor dem behinderten Schüler? In: päd: extra, Heft 10, 1981 S. 40-44
Zur beruflichen Förderung Behinderter. In: Forum für Medizin und Gesundheitspolitik, Heft 18, 1982, S. 25-36
Hilfe für Behinderte in der Gemeinde. Ursache oder Folge der Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen? In: Forum, Heft 19, 1982, S. 10-13; auch in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 2/1982, S. 21-25
Schule ohne Aussonderung in Italien. In: Helga DEPPE-WOLFINGER (Hrsg.) behindert und abgeschoben. Weinheim und Basel 1983, S.155-161
Förderung Behinderter durch eine aufgeschlossene Umwelt im natürlichen Lebensbereich. Erfahrungen und Vorschläge. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 1/1983, S. 45-50
Brücken zu Schwerstbehinderten. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft; Heft 4/1983, S. 53-57
In Florenz ist die Sonderschule für Behinderte abgeschafft. Vorbild für westdeutsche Reformbestrebungen? In: Spiegel, Nr. 35, 37. Jg./29.4.1983, S. 66-72
Die Förderung der Normalität der behinderten Kinder. Ein Beitrag von Medizinern und Psychologen. TUB-Dokumentation Weiterbildung, hrsg. von Ulf PREUSS-LAUSITZ, Uwe RICHTER und Jutta SCHÖLER, 1985, Heft 12, S. 72-86
Gemeinsam lernen - gemeinsam arbeiten: Übergang von der Schule in den Beruf. ebenda, S. 87-90
Ein unbequemer Mensch. Erinnerung an Prof. Dr. A. MILANI-COMPARETTI. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/1986, S. 2-5
Gegen die Logik der Sondereinrichtung. In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 2/1987, S. 36-53
Chronik einer Wunscherfüllung. In: Jutta SCHÖLER (Hrsg.) »italienische verhältnisse« - insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin 1987, S. 320-333
Die Förderung der Normalität im behinderten Kind. In: Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen, beim Hamburger Integrationszirkus. Bericht vom 5. Bundestreffen; Hrsg. Andreas HINZ und Hans WOCKEN 1987, S. 97-103
Die Förderung der Normalität des »behinderten Kindes« In: Manfred ROSENBERGER (Hrsg.) Ratgeber gegen Aussonderung, 1988, S. 31-35
Vorschlag und Gegenvorschlag: Der Dialog in der Vielfalt der Lebenswelt behinderter Menschen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. Heft 3, 1990, S. 11-22
Zur Utopie der Freundschaft. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. Heft 2, 1995, S. 65-71
Die Veröffentlichungen von Ludwig-Otto ROSER enthalten zumeist keine Literaturaufgaben. Dies ist aus der Entstehung der Aufsätze zu erklären: Fast ausschließlich handelt es sich um Arbeiten, die zunächst als Vorträge veröffentlicht und erst nachträglich für eine gedruckte Textfassung bearbeitet wurden. (Zumeist nicht von Ludwig-Otto ROSER selbst.)
Ludwig-Otto ROSER und Jutta SCHÖLER haben für den hier vorliegenden Sammelband die Liste der Veröffentlichungen zusammengestellt, die als nützlich eingeschätzt werden, um eine theoretische Vertiefung seiner Arbeiten vornehmen zu können.
Die Literaturaufgaben zu den Texten aller Autorinnen und Autoren sind ausschließlich im Anschluß an die jeweiligen Texte zu finden.
BARTOLOMEIS, Francesco de: La ricerca come antipedagogia. Milano 1970
BASAGLIA, Franco: Was ist Psychiatrie? Frankf./M. 1974
BASAGLIA, Franco: Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Ein Experiment der psychiatrischen Klinik in Goerz. Frankf./M. 1971. (Zur Arbeit von BASAGLIA siehe unten: HARTUNG, Klaus)
BLOCH, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. Frankf./M. 1979
BOBATH, Berta: Abnorme Haltungsreflexe bei Gehirnschäden. Stuttgart 1971
BOBATH, Berta und BOBATH, Karel: Die motorische Entwicklung bei Zerebralparesen. Stuttgart 1977
BORGHI, Lamberto (Hrsg.): Scuola e ambiente. Ricerca su la scuola e la societa italiana in transformazione. Bari 1964
BORGHI, Lamberto: Perspectives in primary education. The Hague 1974
CHAVACCI, Enrico: Studi de teologia morale. Assisi 1971
DOMAN, Glenn: Was können Sie für Ihr hirnverletztes Kind tun? (Oder für ihr hirngeschädigtes, geistig behindertes celebral gelähmtes, verhaltensgestörtes, spastisches, hypotones, epileptisches, hyperaktives Kind). Freiburg im Breisgau 1980
FOUCAULT, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des
Wahnsinn im Zeitalter der Vernunft. Frankf./M. 1978
FOUCAULT, Michel: Von der Freundschaft als Lebensweise. Berlin 1984
GOODALL, Jane: Wilde Schimpansen. Verhaltensforschung am Gombe-Strom. Reinbeck 1994
GOODALL, Jane: Chimpanzees of Gombe. Patterns of Behavior. Cambridge 1986
HARTUNG KLAUS: Die neuen Kleider der Psychiatrie. Vom antiinstitutionellen Kampf zum Kleinkrieg gegen die Misere. Berichte aus Triest. Berlin 1980
ILLICH, Ian: Schulen helfen nicht. Über das mythenbildende Ritual der Industriegesellschaft. Hamburg 1984
ILLICH, Ivan: Schulen ins Museum. Phaidros und die Folgen. Bad Heilbrunn 1984
JERVIS, Giovanni: Die offene Institution: Über Psychiatrie und Politik. Frankf./M. 1979
KLEIN, Melanie: Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse. Stuttgart 1962
KLEIN, Melanie: Die Psychoanalyse des Kindes. München 1971
MILANI-COMPARETTI, Adriano: Grundlagen der Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Italien. In: Behindertenpädagogik. Vierteljahreszeitschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und; integration Behinderter. Heft 3/1987, S. 227-234
Die Arbeiten von Adriano MILANI-COMPARETTI sind bisher nicht in einer zusammenfassenden Form veröffentlicht worden und z. T. schwer zugänglich. Verwiesen wird hier auf:
BESIO, Serenella und CHINATO, Maria Grazia: Die Schulintegration in den Ideen von gestern und heute. Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept von Adriano MILANI-COMPARETTI. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. Heft 1/1998, S. 15-20
JAEGER, Eckhard: Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um die Gesundheit. Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano MILANI-COMPARETTI . Dokumentation einer Fachtagung des Paritätischen Bildungswerkes, Bundesverband. Frankf./M. 1986
PAPINI Massimo (Hrsg.): Development, handicap, rehabilitation. Practice and theory; proceedings of the International Congress on Development, Handicap, Rehabilitation: Practice and Theory; along the way of Adriano MILANI-COMPARETTIS experiences and philosophy, held in Florence, Italy, 9. - 11. November 1989. Amsterdam (u.a.) ed. Massimo Papini. International congress series. 1990
SCHÖLER, Jutta: Die Arbeit von MILANI-COMPARETTI und ihre Bedeutung für die Nicht-Aussonderung behinderter Kinder in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland. In: Behindertenpädagogik, Heft 1/1987, S. 2-16
SCHÖLER, Jutta: Deutsch-, englisch- und italienischsprachige Veröffentlichungen von und über Milani-Comparetti in: "italienische verhältnisse", insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin 1987, S. 351f.
MARCEL, Gabriel: Sein und Haben. Paderborn 1954
NIEDECKEN, Dietmut: Geistig behinderte verstehen. Ein Buch für Psychologen und Eltern. München 1993 - (Dieses derzeit vergriffene Buch wird im Herbst 1998 im Hermann Luchterhand Verlag neu aufgelegt, Anm. J. Schöler)
PIRELLA, Agostino: Gegen die Logik der Aussonderung. Psychisches Leiden und Behinderung zwischen Ausschluß und Befreiung. Erfahrungsaustausch mit Vertretern der Demokratischen Psychiatrie von Arezzo (Italien). München 1983
POPPER, Josef: Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben. (1. Auflage: Wien 1924; Reprint. New York 1972)
SHERRINGTON, Charles: Körper und Geist. Der Mensch über seine Natur. Bremen 1964
WINNICOOT, Donald Woods: Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. München 1974
Christ, Klaus, Jahrgang 1941. Leiter der Beratungsstelle Integrationspädagogik und der Lehrerfortbildung für Integration und Sonderpädagogik im Landesinstitut für Pädagogik und Medien in Saarbrücken. Studium an der Pädagogischen Hochschule in Saarbrücken, Tätigkeit an Hauptschulen, Aufbaustudium der Sonderpädagogik (Lern- und Verhaltenspädagogik) an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Mainz, Tätigkeit an Schulen für Lernbehinderte, Studium der Diplompädagogik (Pädagogische Diagnose und Beratung) an der Pädagogischen Hochschule und Universität des Saarlandes. Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes seit 1978. Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitseinheit Sonderpädagogik (Prof. Dr. A. SANDER) an der Universität des Saarlandes und Projektmitarbeiter (Integration behinderter Schüler/innen) von 1982-91. Erste Begegnung mit Dr. ROSER bei einem Vortrag 1982 in Saarbrücken (»Ansteckung« mit der italienischen Integrationsidee und »Anstiftung«, mich auf den Weg zu machen ...). 1983 und 1984 Exkursionen nach Volterra/Toskana. Seit 1985 verschiedene Aufgaben im Bereich schulischer Integration u.a. als Vorsitzender der Landeskommission für Integration, Landesfachberater für Integration, Lehrbeauftragter für Integrationspädagogik an den Studienseminaren des Landes, Lehrer in Integrationsklassen an einer Gesamtschule.
Deppe-Wolfinger, Helga, Jahrgang 1940. Professorin für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Allgemeine Sonderpädagogik und Soziologie der Behinderten an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (seit 1975).
1980 erste Begegnung mit Ludwig-Otto ROSER in Frankfurt. 1981 und 1983 Besuche in Florenz bei ROSER und MILANI-COMPARETFI. 1982 und 1983 Exkursionen mit Studierenden und Lehrer(inne)n nach Bologna. 1983 Forschungsaufenthalt in Rom. 1985 Verabredung einer Gastprofessur mit und für Adriano MILANI-COMPARETTI an der Goethe-Universität, die durch seinen Tod 1986 nicht realisiert werden konnte.
Seit 1982 Mitarbeit in der »Forschungsstelle Integration« an der Goethe-Universität. Mehrere Forschungsprojekte gemeinsam mit Helmut REISER und Mitarbeiterinnen und zahlreiche Veröffentlichungen zur Integration.
Feuser, Georg, Jahrgang 1941. Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschullehrer, Sonderschulrektor a.D., seit 1978 Professor für Behindertenpädagogik an der Universität Bremen. Forschung und Lehre in den Bereichen »Behindertenpädagogik, Didaktik, Therapie und Integration bei geistiger Behinderung und schweren Entwicklungsstörungen« mit den Schwerpunkten »Pädagogik und Therapie bei Menschen mit Autismus-Syndrom« und »Integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik«. Zahlreiche Veröffentlichungen. Gastprofessor an den Universitäten Innsbruck, Klagenfurt und Wien. Entwicklung einer umfassenden Konzeption einer »Allgemeinen (integrativen) Pädagogik« und deren Erprobung sowie wissenschaftlichen Begleitung in Regelkindergärten und - schulen. Entwicklung der »Substituierend Dialogisch-Kooperativen Handlungs-Therapie (SDKHT)«, einer Basistherapie zur Krisenintervention und Eingliederung bei Menschen, die als »austherapiert«, »nicht mehr rehabilitierbar« bzw. »nicht gemeinschaftsfähig« gelten (z.B. bei Koma, Apallischem Syndrom, schwersten Formen des Autismus-Syndroms). Erste Begegnung mit Otto ROSER 1980 in Frankfurt/M. nach vorausgegangener intensiver Befassung mit seiner Arbeit, der von MILANI-COMPARETTI und der Bewegung der »Demokratischen Psychiatrie« in Italien. Später persönliches Treffen bei ihm zu Hause und in der Folge bei Tagungen und anderen Anlässen. Seine Schriften und Erfahrungen bestätigten die eigenen Arbeiten und waren gleichzeitig orientierend. Trotz der insgesamt wenigen Begegnungen blieb eine tiefe geistige Verbundenheit, der Distanz in Raum und Zeit nichts anhaben konnten.
Forst, Barbara, Jahrgang 1949. Therapeutische Fachberaterin bei der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten e.V.,. Ausbildung zur Physiotherapeutin (1969-1971) und Bobath-Therapeutin (1978), Studium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 1978-1988 Tätigkeit als Physiotherapeutin in einer Sonderpädagogischen Kindertagesstätte in Buchholz in der Nordheide, in der eine Arbeitsgruppe intensiv an der Einrichtung zweier Integrationsgruppen arbeitete. Sommer 1988 bis Sommer 1991 Lehrkraft und Schulleiterin an der Berufsfachschule für Physiotherapie der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg. 1980 Lektüre des Buches »Kopfkorrektur - oder der Zwang gesund zu sein« von M. ALY/ G. ALY1M. TuMLER. Danach Kontaktaufnahme und Einladung durch Otto ROSER zu einer Hospitationswoche am Istituto »Anna Torrigiani« im Frühsommer 1981. Die Begegnung mit Otto ROSER, Adriano MILANI-COMPARETTI und den »Italienischen Verhältnissen« beeinflußten und veränderten meine therapeutische Identität. Sommer 1984 bis Sommer 1985 folgte ein »Besinnungsjahr« in Italien, wo ich noch einmal Otto ROSER begegnete.
Göhlich, Michael, Dr. phil., Jahrgang 1954. Lehramtsstudium Sonderpädagogik und Germanistik an der PH Reutlingen und der Uni Tübingen, 1979-1983 zunächst als Referendar, dann als Lehrer tätig an Sonderschulen in Stuttgart, Reutlingen und Mössingen; 1980 Vortrag ROSERS gehört; 1981 Hospitation bei MILANI-COMPARETTI und ROSER in Florenz; ab 1983 Studium der Psychologie, Erziehungswissenschaft, Politologie an der FU Berlin; zugleich weiter praktisch tätig: 1984-1986 als Bezugsperson an der Freien Schule Kreuzberg, 1986-1988 als Familienhelfer in Neukölln und Charlottenburg; 1985 und 1986 Hospitationen in den Kindertagesstätten der Stadt Reggio Emilia; 1988-1993 Wiss. Mitarbeiter am Institut für Erziehungswissenschaft der TU Berlin, Leitung der dortigen Lernwerkstatt, 1993-1994 als Fortbildner, Supervisor und Berater in verschiedenen Unternehmen tätig, zugleich Lehrbeauftragter an der TU Berlin und der TU Cottbus; 1994-1995 Akademischer Rat für Allgemeine Pädagogik an der PH Heidelberg; seit Herbst 1995 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Erziehungswissenschaft der Technischen Universität Berlin.
Hoehne, Rainer, Dr. med., Jahrgang 1939. Kinderarzt, Sozialpädiater. Studium der Medizin in Freiburg/Br., Wien und Berlin, Promotion an der FU Berlin. Ausbildung zum Kinderfacharzt und Kinderneurologen in Hamburg, Ulm und München. Seit 1974 als Sozialpädiatrie tätig in Hamburg am Werner Otto Institut, einem Zentrum zur Früherkennung und Behandlung entwicklungsgestörter und behinderter Kinder und Jugendlicher. - 1980 als Professor für Sozialpädiatrie an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fachbereich Sozialwesen, in Lüneburg berufen. Arbeitsschwerpunkte liegen in Bemühungen um die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher, in der Beschäftigung mit dem Phänomen autistischer Störungen, in der Vermittlung und theoretischen Weiterentwicklung des Physiotherapie-Konzepts nach BOBATH sowie in kritischen Überlegungen zu Therapien insgesamt.
Jantzen, Dr. Wolfgang, Jahrgang 1941. Universitätsprofessor, Studium in Gießen und Marburg, Sonderschullehrer (Lernbehinderte, Sprachbehinderte); Diplompsychologe, Promotion in Erziehungswissenschaft 1972. 1966-71 Lehrer an einer Schule für Lernbehinderte in Lich/Oberhessen. 1971-74 Studienrat i.H. am Institut für Sonderpädagogik, Universität Marburg. Ab Mai 1974 Professor für Behindertenpädagogik Universität Bremen. Entwicklung einer historisch und dialektisch-materialistischen Konzeption von Behindertenpädagogik in den Traditionen der kulturhistorischen Schule (VYGOTSKIJ, LEONT'EV, LURIJA). Erste Begegnung mit L.O. ROSER im April 1978. WS 1987/88 Wilhelm-Wundt-Professor für Psychologie an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Wichtigste Publikationen: »Sozialisation und Behinderung«, Gießen 1974; »Allgemeine Behindertenpädagogik« Bd. I und II, Weinheim 1987, 1990; zusammen mit W. LANWER-KOPPELD : »Diagnostik als Rehistorisierung«, Berlin 1966. Arbeitsschwerpunkte z.Z.: Ethikdebatte, Soziologie der Behinderung, Enthospitalisierung, Neuropsychologie der geistigen Behinderung.
Sander, Alfred, Jahrgang 1938. Professor für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Sonderpädagogik an der Universität des Saarlandes. Studium an der Pädagogischen Hochschule Saarbrücken, ab 1959 Volksschullehrer. Aufbaustudium der Sonderpädagogik in Stuttgart/Tübingen, danach Sonderschullehrer (Lb) im Saarland. Berufsbegleitendes Studium (Pädagogik, Psychologie, Soziologie) an der Universität Saarbrücken; ab 1966 Assistent für Psychologie an der PH, später Akademischer Rat für Sonderpädagogik. Gutachter für den Deutschen Bildungsrat, der damals seine integrationspädagogische Empfehlung erarbeitete. 1972 Professor für Entwicklungsgestörtenpädagogik; Lehrtätigkeit in Saarbrücken, Marburg, Heidelberg, Landau. Rufe auf ordentliche Professuren in Hamburg und Mainz (abgelehnt). Seit 1978 ordentlicher Professor an der Universität Saarbrücken. 1979 erste Begegnung mit Ludwig-Otto ROSER, seither immer wieder Kontakte mit Italien und seiner Integrationsentwicklung.
Schöler, Jutta, Jahrgang 1940. Professorin für Erziehungswissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Studium an der Pädagogischen Hochschule Berlin, Tätigkeit an einer Hauptschule, gleichzeitig Planung der ersten Gesamtschulen. 1967-1970 Lehrerin für Arbeitslehre (Textil) und Fachleiterin für Deutsch an der MARTIN-BUBER-Oberschule (einer der ersten vier Gesamtschulen in Berlin). Danach »Lehrerin im Hochschuldienst« im Bereich Grundschulpädagogik (bei Prof. Wolfgang SCHULZ); 1972 Berufung zur Hochschullehrerin für »Didaktik der Sekundarstufe 1«, ein Lehrgebiet, das 1980 mit der »Integration« der Pädagogischen Hochschule Berlin in die Universitäten wieder abgeschafft wurde. Herbst 1980 Lektüre eines Aufsatzes über die Abschaffung der Sonderschulen in Italien. Einladung von Dr. ROSER an die Pädagogische Hochschule Berlin. Der Vortrag hat meine skeptischen Zweifel in Neugierde verwandelt. Frühjahr 1982 erste Exkursion (mit fünf Studentinnen und meinen damals vier und sechs Jahre alten Töchtern) und erster Kontakt zu Adriano MILANI-CoMPARETTI. Herbst 1982 Exkursion mit 40 Lehrerinnen und Studentlnnen (Buch: Schule ohne Aussonderung in Italien, 1983). Seitdem regelmäßige Kontakte zu Schulen, den Universitäten Florenz und Bologna und zahlreiche Veröffentlichungen über die Integrationsentwicklung in Italien.
Schönwiese, Volker, Jahrgang 1948. A.o. Univ. Prof. Dr., seit 1983 am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck tätig. Arbeitsschwerpunkte: Psychosoziale Arbeit/Behindertenpädagogik/integrative Pädagogik, Rollstuhlfahrer und Mitarbeiter in der Behindertenselbsthilfe-Bewegung: »Selbstbestimmt Leben«. Initiator der Internet-Volltext-Bibliothek zu Integrationsfragen » http://bidok.uibk.ac.at/ «.
Wunder, Michael, Jahrgang 1952. Dr. phil., Diplom-Psychologe und Psychotherapeut, Studium in Köln und Bochum, Ausbildungen in Gesprächspsychotherapie und Gestalttherapie, Promotion zum Thema »Euthanasie in den letzten Kriegsjahren« an der Universität Bremen. 1981 erstmals Kontakt mit Ludwig ROSER im Rahmen einer Hospitation in der »Villa Torrigiani« in Florenz. Mitorganisator des Gesundheitstages Hamburg 1981, in diesem Rahmen Einladung Ludwig ROSERS und Adriano MILANI-COMPARETTIS nach Hamburg zu Vorträgen. 1985 bis 1990 Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Soziales der Grünen. Seit 1981 angestellt in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, Hamburg, einer Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen; dort in wechselnden Funktionen tätig, derzeit Leiter des »Zentrums für Beratung, Diagnostik und Psychotherapie«. Seit 1990 Leiter eines Entwicklungshilfeprojektes der Behindertenhilfe und der Psychiatrie in Rumänien. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Erforschung der Geschichte der »Euthanasie« und Zwangssterilisation im Nationalsozialismus, zur Wiedergutmachung für die »vergessenen Opfer«, zu heutigen Fragen der Behindertenhilfe und der Gesundheitspolitik sowie zur Anwendung der Biowissenschaften auf den Menschen und zur Bioethik
Die Integration von Menschen mit Behinderung ist seit Mitte der 80er Jahre eine umfassende pädagogische Refonp, die in den Kindergärten begann, inzwischen in Grundschulen weitergeführt und für die Sekundarstufe I sowie die Eingliederung in die Arbeitswelt vorbereitet wird.
Die in diesem Buch zusammengestellten Texte bilden die argumentative Grundlage für diese Reform. Es dokumentiert die jahrelangen Erfahrungen des Psychologen , Dr. Ludwig-Otto Roser, die er (als gebürtiger Deutscher) beim Aufbau der konsequenten Integration in Italien gesammelt hat, sowie die Impulse, welche namhafte deutsche Pädagoginnen und Pädagogen aufgenommen haben.
Die Herausgeberin ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der Technischen Universität Berlin und als Expertin für die europäische Entwicklung integrativer Erziehung bekannt (Schwerpunkt Italien). Durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge trägt sie zur Weiter entwicklung der Integrationspädagogik in Deutschland bei.
Als Mitautorin konnten gewonnen werden: Klaus Christ, Helga Deppe-Wolfinger, Georg Feuser, Barbara Forst, Michael Göhlich, Rainer Hoehne, Wolfgang Jantzen, Alfred Sander, Volker Scheinwiese, Michael Wunder.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Alle Rechte vorbehalten.
© 1998 by Hermann Luchterhand Verlag GmbH Neuwied, Kifftet Berlin. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Satz und Umschlaggestaltung: Andreas Wiesjahn Satz- und Druckservice, Berlin
Druck, Bindung: H. Heenemann GmbH & Co, Berlin
Printed in Germany, September 1998
Quelle:
Jutta Schöler, Ludwig-Otto Roser, Adriano Milani-Comparetti, Klaus Christ, Helga Deppe-Wolfinger, Georg Feuser, Barbara Forst, Michael Göhlich, Rainer Hoehne, Wolfgang Jantzen, Alfred Sander, Jutta Schöler, Volker Schönwiese, Michael Wunder: Normalität für Kinder mit Behinderung: Integration
Hrsg: Jutta Schöler. Mit 14 Beitr. von Ludwig-Otto Roser aus den Jahren 1969-1995 sowie Beitr. von: Klaus Christ ...Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1998, ISBN 3-472-03413-0
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 23.10.2007
