Sieben Essays
Cip-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek. Zur Internet-Ausgabe: Die Internet-Veröffentlichung erfolgt durch freundliche Zustimmung des Psychiatrie Verlags. Alle Rechte beim Psychiatrie Verlag, Bonn 1987. Originalausgabe im: http://psychiatrie.de/verlag/
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Kapitel 1: Eine Gesellschaft im Umbruch - Das »psychosoziale Projekt« im Umbruch?
- Kapitel 2: Helfer am Ende? Subjektive und objektive Grenzen psychosozialer Praxis in der ökonomischen Krise
- Kapitel 3: Psychisches Leid als gesellschaftlich produzierter Karriereprozeß
- Kapitel 4: Normalität und Abweichung - Psychisches Leiden in einer sich wandelnden gesellschaftlichen Ordnung
-
Kapitel 5: Soziale Netzwerke als alltägliche Lebenswelt und ihre Bedeutung für die Entstehung und Bewältigung psychosozialer Probleme
- 1 Meine Geschichte mit dem Netzwerkkonzept
- 2 Strukturwandel sozialer Beziehungen
- 3 Das Netzwerkkonzept in einem Modell psychischen Leidens
- 4 Zur Hauptquelle von Unterstützungsleistungen: Das nicht unerschöpfliche weibliche Arbeitsvermögen
- 5 Wohin sollen wir das Netzwerkkonzept weiterentwickeln
- 6 Soziale Netzwerke und Sozialpolitik
-
Kapitel 6: Alternativen zum Ausschluß - Perspektiven einer Psychiatriereform noch einmal neu durchdacht
- 1 Die Nachkriegsperiode: Der Dämmerzustand nach dem Grauen gerät unter Modernisierungsdruck
- 2 Deinstitutionalisierung und die Krise des Wohlfahrtsstaates: Eine Auflösung, die keine ist
- 3 Was läßt sich aus dein Scheitern der Psychiatriereform lernen?
- 4 Ausweg aus der Krise: Schritte in Richtung Selbstorganisation
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
- Kapitel 7:Gemeindepsychologische Perspektiven
- Bibliographische Notizen
- Literatur
Für diesen Aufsatzband habe ich Beiträge zusammengestellt, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind. Ihr gemeinsames Ziel ist der Versuch, in die »neue Unübersichtlichkeit«, die auch das Feld der psychosozialen Praxis erfaßt hat, einige ordnende Trassen zu legen. Meine Ausrüstung bei diesem Unternehmen will ich zur Einführung kurz beschreiben.
Ein Teil meiner Generation wurde in seinem Bewußtsein, in seinen Motivationen und in seinem konkreten Engagement durch die Studentenbewegung geprägt. Damals wurde die radikale Überwindung des bornierten Alltagsbewußtseins einer wohlstandsbefriedeten Konsumgesellschaft und die ihr zugrundeliegenden Organisationsprinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung auf die Tagesordnung gesetzt. Dagegen wurden die Ideen von Emanzipation, »aufrechtem Gang« und individueller Chancengleichheit gesetzt. Kritische Mediziner, Sozialwissenschaftler und Pädagogen spürten in Theorie und Praxis ihrer jeweiligen Disziplinen und Institutionen jene Anteile und Mechanismen auf, die als mehr oder weniger subtile Unterdrückungsinstrumente zur Produktion und Reproduktion jenes gesellschaftlich befriedeten Dämmerzustandes beigetragen hatten, der sich als Mischung von Angst, Unterwerfung und
»Konsumentenfreiheit« beschreiben ließ. In unseren Fächern haben wir verschüttete kritische Traditionen wiederentdeckt, wiederzubeleben und weiterzuführen versucht. Mit den dadurch entstandenen gedanklichen Alternativen haben wir die Ideologien unserer Disziplinen schonungslos aufgedeckt, entlarvt hieß das damals. Und natürlich sind die Institutionen der Medizin, Psychiatrie, Psychotherapie und Sozialpädagogik als Kontrollinstrumente systematisch durchleuchtet und gebrandmarkt worden.
Die berufliche Sozialisation zum Arzt, Psychologen oder Sozialarbeiter sollte uns nicht mehr zu willigen Handlangern, Funktionären dieser Institutionen machen können. »Befriedungsverbrecher« waren die etablierten Repräsentanten unserer Zünfte, wir wollten uns dazu nicht zurichten lassen. Mit Begeisterung entdeckten wir die Texte von Fachvertretern, die radikale Alternativen dachten, vertraten und lebten. Vor allem die englischen, französischen und italienischen Psychiatriekritiker, Antipsychiater und Historiker der Unterdrückungsgeschichte von Dissidenten der bürgerlichen Vernunftordnung fanden in uns aufmerksame Leser und Anhänger. Die eigenen Texte aus jener Periode belegen dies.
Die kulturrevolutionäre Aufbruchstimmung dieser Zeit läßt sich auf den einfachen Nenner bringen: »Wir wollen alles und wir wollen es sofort!« Ohne auch nur nennenswerte Erfahrungen mit der Innenwelt von Institutionen und ihren Insassen zu haben, forderten wir die sofortige Befreiung aller Internierten und eine restlose Beseitigung aller repressiven Institutionen. Im Grunde ging es auch gar nicht um die reale Befreiung etwa von Anstaltsinsassen. Es ging letztlich um die Befreiung unserer projektiven Identifikationen, also um uns selbst. Vor allem die antipsychiatrischen Ideen von der Schizophrenie als der befreienden Reise heraus aus dem stahlharten Gehäuse bürgerlicher Charakter- und Lebensformen prägten unsere Vorstellungen. Viele von uns haben nach den ersten konkreten Erfahrungen mit psychiatrischen Patienten und angesichts der Unbeweglichkeit und Widerstandsfähigkeit der institutionellen Bezirke der Psychiatrie resigniert und haben andere Reisen angetreten.
Sicherlich war es eine Minderheit der durch die Studentenbewegung mobilisierten Angehörigen psychosozialer Berufe, die sich auf den geduldigen Weg der Reform begeben haben. Die zu Beginn der 70er Jahre vorhandene wohlfahrtsstaatliche Reformbereitschaft eröffnete ja durchaus Gestaltungsfelder. Der katastrophale Zustand der bundesdeutschen psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung machte einen gewaltigen Modernisierungsschub notwendig, der dann faktisch durch die Enquete-Kommission planerisch entworfen wurde. Mehr oder weniger intensiv hat die gesamte psychosoziale Reformszene ihre Hoffnungen auf dieses sozialstaatliche Großprojekt gesetzt, wenngleich bereits mit der Veröffentlichung des gigantischen Kommissionsberichts erste Schatten auf diese Hoffnungen fielen. Die beginnende ökonomische Krise, die wir mehrheitlich allerdings nur als vorübergehende Wachstumskrise zu begreifen vermochten, ließ erste Zweifel aufkommen, ob die Reform so schnell zu ihrem Ziel gelangen könnte, wie es zunächst erwartet wurde. Diese Zweifel erhielten allerdings in der Folgezeit ständig neue Nahrung und niemand konnte sich ihnen mehr entziehen.
Allerspätestens die »Wende« hat uns deutlich gemacht, daß in den 70er Jahren der große Wurf, von dem wir geträumt hatten, nicht gelungen war. Resignation, Larmoyanz und Privatismus breiteten sich aus. Aber es gibt auch die trotzig-geduldigen von Aushaltestrategien. Alle diese Regungen kenne ich auch bei mir, mal gleichzeitig, mal nacheinander. Zugleich habe ich aber auch versucht, die veränderte Situation zu begreifen. Natürlich habe ich das mit dem Handwerkszeug getan, das ich mir als Sozialwissenschaftler erworben habe. Und natürlich von der Position aus, die ich mir in den hinter uns liegenden Jahren gesucht habe. Es ist eine Grenzgängerposition in mehrfacher Hinsicht: Es ist die Position eines Sozialpsychologen, der eine Perspektive jenseits der experimentellnaturwissenschaftlichen Selbstbegrenzung der akademischen Psychologie gesucht hat; es ist eine Position zwischen den Sozialwissenschaften als reflexivem Theoriefindungsprozeß und der psychosozialen Handlungspraxis; und es ist eine Position zwischen Hochschule und Initiativenpraxis im Kontext der sozialen Bewegungen der vergangenen Jahre.
Bei den Versuchen, das besser zu begreifen, was sich im gesellschaftlichen Rahmen, im politischen Kontext und vor allem in unserem kulturellen und theoretischen Selbstverständnis verändert hat, bin ich zunehmend zu der Überzeugung gelangt, daß wir mit unseren diversen Aushaltestrategien den Blick für das verstellen, was sich unter der Oberfläche vergänglicher politischer Moden und Konjunkturen tut. Mir wurde zunehmend klar, daß da etwas umbricht, was wir mit oberflächlichen Wendediagnosen nicht begreifen können. Mir wurde aber auch bewußt, wie problematisch es sein kann, auf diese Umbruchsituation mit eilfertigen Rettungsphantasien zu reagieren, die in der Gestalt hoffnungsträchtiger Interpretationsversuche daher kommen. Die Versuchungen der New Age-Ideologie, die uns ermuntert, den gläubigen Schritt über die Schwelle zu einem neuen Zeitalter zu tun, sind hier ebenso zu nennen wie die Propagierung eines neuen umfassenden Weltbildes, das sich als »ökologisches Paradigma« oder »Theorie der Selbstorganisation« anpreist. Skeptisch bin ich auch gegenüber dem Begriff der »Postmoderne«, der mir zu schnell überall dort aus dem Zylinder gezaubert wird, wo die Verhältnisse unübersichtlich geworden sind. All diesen eilfertigen Interpretationsalternativen ist gemeinsam, daß sie an jener Umbruchsituation ansetzen, die die Erklärungskraft bisheriger Paradigmen und Sichtweisen in Frage stellt und daß sie neue Befunde und veränderte Bedingungen für sich durchaus reklamieren können. Aber im Unterschied zu Ihnen plädiere ich für eine reflexive Haltung, die sich die veränderten Bedingungen nüchtern betrachtet, die auftretenden Widersprüche geduldig analysiert und bewährte Konzepte nicht einfach austauscht gegen den Jargon des intellektualistisch-modischen Schnellschusses.
Meine eigene Option versuche ich in immer wieder neu ansetzenden Versuchen zur Formulierung einer gemeindepsychologischen Perspektive zu artikulieren. Sie zielt nicht auf den bis in die letzten Feinheiten ausgeklügelten Plan zur Vollversorgung einer Gemeinde. Sie konstruiert keine lückenlosen Versorgungsnetze und -ketten. Sie will vielmehr Anstiftung zur Reflexion sein. Sie fragt nach der Entwicklungsdynamik einer Gesellschaft, die einen sich ständig verstärkenden »Hunger nach Psychologie« produziert. Diese Nachfrage soll allerdings weder einfach denunziert noch geschäftstüchtig befriedigt werden. Zunächst gilt es, sie zu verstehen. Welchen soziokulturellen Wandel bringt sie zum Ausdruck? Klar erkennbar ist eine Entwicklungslinie, die mit dem Entstehen der Moderne, der bürgerlichen Gesellschaft einsetzt, aber erst am Ende dieses »Projekts der Moderne« in seinen radikalen Konsequenzen faßbar wird. Es ist eine Entwicklung zur Individualisierung, zur Freisetzung der Individuen, denen ihr Lebenssinn und -plan durch keine Tradition, durch keinen fixen und unveränderlichen Kontext in selbstverständlicher Weise vorgegeben ist. Die Psychologie selbst ist Produkt dieses Freisetzungsprozesses und die Psychiatrie stellt den gesellschaftlich-institutionellen Versuch dar, die unerwünschten Nebenfolgen dieses Freisetzungsprozesses aufzufangen. Der zunehmende Hunger nach Psychologie kann nur auf diesem Hintergrund verstanden werden. Er scheint mir nicht hintergehbar und er ist kein Kunstprodukt einer psychologischen Warenästhetik, die mit professioneller Raffinesse den Menschen Bedürfnisse andreht, die sie von sich aus nicht hätten.
Die Diskussion um professionelle Alternativen muß mit der Frage beginnen, in welcher Weise wir Hilfe im Sinne des uns verfügbaren Repertoires von Handlungsmöglichkeiten einsetzen wollen. Liefern wir dem »Tanz um das goldene Selbst« die ideologische Rechtfertigung und Überhöhung? Vermitteln wir Psychotechniken zur Einübung von individuellen Inszenierungen artifizieller Lebensstile und Pirouetten? Die sich ausbreitende Psychokultur und Esoterik beweist die Kreativität psychologischer Choreographen. Oder wollen wir Psychologie als die vorläufige Endstufe der Modernisierung betreiben, die die Menschen zu allseits bereiten, flexiblen und überall einsatzfähigen Gesellschaftsmitgliedern macht, die nicht mehr durch »altmodische« Ängste an einer effektiven Ausschöpfung ihres Humankapitals gehindert werden?
Die von mir vertretene gemeindepsychologische Perspektive bezieht sich in anderer Weise auf den säkularen gesellschaftlichen Freisetzungsprozeß. Sie betrachtet ihn als Chance für die Gewinnung von Selbstbestimmung, »aufrechten Gang« und Emanzipation, die den Menschen aber nicht beschert wird, sondern die erarbeitet werden muß.
Letztlich versucht die Gemeindepsychologie eine alternative Perspektive zur unkritischen professionellen Partizipation an einer psychologisch-individualistischen Psychokultur zu formulieren. Sie setzt dabei an der Ambivalenz des gesellschaftlichen Transformationsprozesses an, der zur Individualisierung von Lebenslagen und zur gesellschaftlichen Desintegration führt, derjedoch zugleich die Spielräume für Individualität erweitert. Traditionsbrüche können neue Lebensperspektiven eröffnen, die von den Subjekten selbst gestaltet werden können und müssen. Der sich vergrößernde Handlungsspielraum ermöglicht neue soziale Beziehungen, die nicht durch starre Rollenmuster vordefiniert sind. Sie können und müssen ausgehandelt werden. Zugleich bedeutet dieser Freisetzungsprozeß den Verlust lebbarer Formen für den Alltag, zunehmende Krisenhaftigkeit von Identitätsbildungsprozessen sowie die wachsende Gefahr der Vereinzelung und Isolation. Die psychosoziale Praxis liefert beständiges Anschauungsmaterial dafür. Sie zeigt die Kostenseite dieser Freisetzung auf.
Für die positive Nutzung der gewachsenen individuellen Spielräume reichen die psychosozialen Ressourcen oft nicht aus. Insbesondere der Aufbau selbstbestimmter Vergesellschaftungsmuster übersteigt das Handlungspotential vieler Menschen. Für sie führt der gesellschaftliche Individualisierungsprozeß zum Typus des »homo clausus«. Gemeindepsychologie sucht eine Praxis, die eine lebbare Vermittlung der beiden Pole Individualität und neue solidarische Lebensformen zu initiieren vermag. Eine Psychologie, die auf die Individualitätspole alleine setzt, arbeitet der Psychokultur zu, die einen zur Lebensform erhobenen Narzißmus auslebt. Die andere Gefahr liegt in dem kollektiv-autoritären Infantilismus der Psychosekten, die mit der definitiven Verheißung des »wahren Selbst« durch Unterordnung unter die normativen Gruppenvorgaben den Pol einer emanzipatorischen Subjektivität zu eliminieren versuchen. Die gemeindepsychologische Perspektive zielt auf die Förderung aller Versuche von Selbstorganisation, die die Chancen für neue kollektive Handlungsmöglichkeiten erschließen können.
Wie die Netzwerkforschung (siehe ausführlich Kapitel 5: Soziale Netzwerke als alltägliche Lebenswelt und ihre Bedeutung für die Entstehung und Bewältigung psychosozialer Probleme) zeigt, entstehen vermehrt an Stelle oder als Ergänzung traditioneller Beziehungsformen (wie etwa die Kleinfamilie) neuartige Netzwerkmuster, Initiativen und Gruppen in bunter Vielfalt. Sie haben dort die besten Chancen, wo ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen in ausreichendem Maß vorhanden sind. Sozialpolitik muß Ressourcen für die Initiierung und Unterstützung sozialer Beziehungsmuster und Lebensformen schwerpunktmäßig dort bereitstellen, wo alltägliche Hilfssysteme zur Entwicklung positiver Identitätsentwürfe und zur Erarbeitung kollektiver Lebenspläne besonders notwendig sind, um sozioökonomische Unterprivilegierung pro-duktiv überwinden zu können.
In den folgenden Kapiteln gehe ich den hier angerissenen Fragen gezielter nach. Sie wählen sehr unterschiedliche Ansatzpunkte. Die ersten beiden Kapitel versuchen sich an der Identifizierung und Deutung jener Spuren, die gesellschaftliche Wandlungsprozesse im Handlungsfeld psychosozialer Helferberufe hinterlassen haben. Die Spurensuche richtet sich auf ihre Motivationen, Paradigmen und Handlungsperspektiven. In den nächsten Kapiteln geht es um veränderte Koordinaten für Normalität und Abweichung, die auf soziokulturelle Veränderungsprozesse bezogen werden und es geht um ihre institutionellen Bearbeitungsformen. Ein spezifischer Blick wird dann auf die Rolle alltäglicher sozialer Netzwerke für die Entstehung und Bewältigung psychosozialer Krisen geworfen und der Frage nachgegangen, in welcher Weise und in welchem Umfang sich sozialpolitische Steuerungsmechanismen auf alltägliche soziale Netze beziehen können und vor allem wie Bedingungen für selbstorganisierte Lebensformen gefördert werden könnten. Das ist auch die leitende Perspektive für die beiden letzten Beiträge, die sich um eine kritische Aufarbeitung unserer psychosozialen Reformgeschichte bemühen, um Orientierungen für die entscheidende Grundfrage zu finden: Wie können wir Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des psychosozialen Reformprojektes finden.
Bei der Zusammenstellung, redaktionellen und technischen Bearbeitung war mir Dieter Thamm eine wichtige Stütze. Renate Martiny danke ich für die Herstellung vorzeigbarer Manuskripte und Eva Kahlenberg hat sich um einen vollständigen Literaturservice verdient gemacht.
München im März 1987
Heiner Keupp
Inhaltsverzeichnis
In den 70er Jahren haben sich in vielen Städten und Regionen der Bundesrepublik Angehörige der verschiedenen psychosozialen Professionen zu Gruppen und Initiativen zusammengeschlossen, die sich für eine strukturelle Reform der psychosozialen Versorgung engagiert haben. Die aus diesen Initiativen hervorgegangenen Verbände (z. B. die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie oder die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie) haben durchaus bis heute Bestand und kämpfen um ihre Kontinuität als Reformverbände, aber viele Personen, die damals engagiert mitgearbeitet haben, haben sich aus der politischen Kultur dieser Szenen zurückgezogen.
Ich habe mich einmal in meiner eigenen Szene umgesehen und mich gefragt, was einige Kolleginnen und Kollegen heute machen, die vor fünf bis zehn Jahren in der psychosozialen Reformlandschaft aktiv waren. Zuerst fiel mir eine gute Freundin ein, die einen Sozialpsychiatrischen Dienst mit aufgebaut hat, zu Beginn der 80er Jahre sich dann von uns verabschiedet hat und in eine ökologisch-spirituelle Kommune in Schottland eintrat. Heute macht sie eine Ausbildung in Psychosynthese in London. Mir fällt ein Freund ein, der seinen Unijob aufgab, mit einigen Leuten einen Bauernhof kaufte, auf dem ein alternatives Lebens- und Arbeitsprojekt entstehen sollte. Einbezogen wurden auch ehemalige jugendliche Strafgefangene. Es entstanden einige Solaranlagen und es gab Aufträge für weitere, dann zerbrach das Projekt an nicht mehr lösbaren internen Konflikten. Nach einer Phase längerer Arbeitslosigkeit arbeitet der Freund heute halbtags in einer Behindertenwerkstatt.
Mir fällt ein Hochschulkollege ein, der die Marxsche Warenanalyse direkt mit kognitiven Kontrolltheorien zusammengeschlossen hat, um psychische Störungen bei Arbeitern zu erklären. Mittlerweile verstauben die blauen Bände im Bücherregal und den anderen Teil seiner Theorie hat er für die Zunft der akademischen Psychologie akzeptabel ausgebaut. Viele andere Freunde stecken mit einem großen Teil ihrer Freizeit in einer psychoanalytischen Ausbildung. Für einige meiner Sozialwissenschaftlerkollegen, mit denen ich die sozialpolitische Struktur und Veränderungsdynamik von psychosozialer Versorgung untersucht habe, ist aus diesem Thema die Luft raus und sie haben ihr Interesse auf neue, aktuellere Themen verlagert. Und natürlich gibt es die vielen, die sich in verschiedensten Alternativprojekten engagiert haben. Dort sind ihre Interessen und Energien voll gebunden.
Auch bei denen, die wir in den 70er Jahren als unsere Gegner betrachtet haben und mit denen wir auf den unterschiedlichsten institutionellen Ebenen unsere Konflikte ausgetragen haben, haben sich ähnliche Veränderungsprozesse vollzogen. Ich denke zum Beispiel an einen Hochschulkollegen, der einst den Geist des Eysenckschen Dogmatismus in aller Härte vertreten hat und den Einfluß von Psychoanalyse und kritischer Sozialpsychologie mit allen Mitteln auszuschalten versuchte. Er hat mittlerweile über eine gestalttherapeutische Konversion den Weg des Sufismus gewählt.
Wenn ich mich selbst und meine Identität auf diese unterschiedlichen Wege meiner Freunde und Bekannten beziehe, dann wird mir klar, daß ich in ihre Veränderungen selbst involviert bin, nicht alle finde ich gut, aber ich muß sie akzeptieren. Es wird mir klar, daß wir uns in einer tiefgreifenden Umbruchphase befinden, daß sich eine »Wende« vollzogen hat, die von einem ganz anderen Kaliber ist, als eine neue Runde im intriganten Machtspiel des parteipolitischen »Bäumchenwechsel-Dich«. Das ganze »psychosoziale Projekt« (PFEFFERER-WOLF, 1986) ist in der Krise und diese ist mehr als eine Krise unseres Arbeitsmarktes, der vom Sozialabbau geschüttelten Institutionen, in denen wir arbeiten, der Paradigmen, die wir unserer professionellen Arbeit zugrundegelegt haben. Diese Krisen gibt es natürlich auch, aber sie werden nicht aus sich selbst verständlich. Sie verweisen auf einen gesellschaftlich-kulturellen Umbruch, den wir ahnen und spüren, der unsere Sichtweisen und Verstehenshorizonte in einem spezifischen Sinne veralten läßt. »Wir schlittern in eine neue Gesellschaft, ... in ein neuartiges gesellschaftliches Gefüge, für das wir noch keinen Begriff und damit auch keinen Blick haben«, sagt der Soziologe U. BECK (1985, S. 90).
Wir erleben diesen Umbruch als eine Verschärfung von Widersprüchen in uns selbst, als widersprüchliche Wege, die wir zu gehen versuchen, die uns auseinander führen und die kollektive Orientierungen und Handlungsformen immer mehr auszehren. Ich möchte damit beginnen, einige dieser Widersprüche zu benennen, die im psychosozialen Bereich immer wieder aufreißen, uns spalten. Ich möchte dann etwas ausführlicher auf die gesellschaftlichen Hintergründe eingehen, die zur jetzigen Umbruchsituation geführt haben und möchte schließlich der immer wieder aktuellen und gerade gegenwärtig so schwierigen Frage nachgehen: »Was tun?«
Das psychosoziale Feld und sein spezifisches Verhältnis zur jeweiligen gesellschaftlichen Wirklichkeit ließ sich schon immer kaum anders als über typische Widerspruchskonstellationen charakterisieren: Die Dialektik von Hilfe und Kontrolle, von Befreiung und Repression, von Emanzipation und Abhängigkeit, von Kampf gegen das alltägliche Elend und esoterischer Flucht. In den letzten Jahren sind jedoch einige neue Widerspruchsfelder hinzu gekommen, in denen sich auch am ehesten die gesellschaftliche Umbruchsituation fassen läßt.
Der Widerspruch zwischen einem behaupteten grundlegenden Persönlichkeits- und Wertewandel und dem Revival traditioneller Welt- und Menschenbilder
Der bürgerliche Sozialcharakter zerfällt, so lauten sich häufende Aussagen von Sozialpsychologen und Soziologen. Als Folge des steigenden Massenwohlstandes würden zentrale bürgerliche Tugenden wie Verzicht, Sparsamkeit, Selbstdisziplin, Gratifikationsaufschub zugunsten »höherer Ziele und Werte« verfallen. Die entsprechende Forschung zeigt, daß vor allem in der jüngeren Generation ein Abbau von Werten wie »Höflichkeit« und »gutes Benehmen«, »ordentliche und gewissenhafte Arbeit«, »Sparsamkeit«, »Unterordnungsbereitschaft«, »Bescheidenheit« und »religiöse Bindung« stattfinden würde. Die »Pythia vom Bodense«, Elisabeth NOELLE-NEUMANN spricht von einer geradezu »unfaßbaren« Abnahme von Arbeitsmoral und Arbeitszufriedenheit der deutschen Arbeitnehmer (FAZ vom 14. 5. 1983). Waren sie einst so stolz auf ihre Arbeitsleistungen, hätten sie jetzt die traditionellen Tugenden zunehmend aufgegeben und würden sich eher an hedonistischen Werten orientieren. Von der wachsenden Bedeutung »postmaterieller Werte« müsse man jetzt sprechen. Typisch dafür sei die Äußerung eines jungen Selbständigen: »Die fünfziger bis Mitte der sechziger Jahre, da war es ja das Bestreben eines jeden Einzelnen, sich mal wieder ein nettes Leben aufzubauen, da ging es ja nicht so sehr um die selbstbestimmenden Faktoren wie Freizeit, überhaupt, sich selbst zu besinnen, oder sich selbst zu finden« (zit. in v. KLIPSTEIN und STRÜMPEL, 1984, S. 150). »Postmaterielle Werte« zielen auf soziale und individuelle Selbstverwirklichung, auf kreative und spontane Aktivitäten, richten sich gegen die persönlichen Reduzierungen und Verhärtungen, die den erfolgreichen Berufsmenschen auszeichnen. Das klingt nach dem Potential für eine neue Gesellschaft und es fehlt nicht an hoffnungsvollen Einschätzungen dieses Werte- und Persönlichkeitswandels. Hier ein Beispiel:
»Alles zusammengenommen, entsteht bei vielen Leuten ein Krisenbewußtsein, das die Leitideen der modernen Industrie- und Wachstumsgesellschaft grundlegend erschüttert. Die Kosten des industriellen Modernisierungsprozesses werden von den jeweils Betroffenen nicht mehr ohne weiteres als notwendig akzeptiert. Die technisch-industrielle Entwicklung, die ökologischen, sozialen und politischen Folgen neuer Technologien, das Verhältnis von fremdbestimmter Arbeit und selbstbestimmter Zeit, das Verhältnis zur Natur und zum eigenen Körper, die Form des Politischen, die Art und Weise des zukünftigen Lebens insgesamt werden damit Gegenstand gesellschaftlich-politischer Auseinandersetzungen« (BRAND, BÜSSER und RUCHT, 1983, S. 33).
Über die empirische Haltbarkeit all der unterschiedlichen Aussagen über den stattfindenden Wertewandel wird von den Spezialisten noch heftig gestritten (vgl. zuletzt REUBAND, 1985; THOME 1985). Gefragt wird vor allem danach, ob wir es bei diesen veränderten Grundhaltungen mit einem Wandlungsprozeß zu tun haben, der durch alle Bevölkerungsschichten geht oder ob es sich eher um Sichtweisen von Minderheiten handelt, die gerade in den Human- und Sozialwissenschaften ihre Anhänger hat[1]. Vermutlich ist es problematisch, nur global nach der Abwendung oder Hinwendung zur Arbeit zu fragen. Kern und Schumann (1984) haben in ihrer vielbeachteten Studie »Das Ende der Arbeitsteilung?« einen anderen Weg eingeschlagen. Sie haben Intensivstudien in den Kernindustrien (Auto, Werkzeug, Chemie) durchgeführt und haben vor allem die Konsequenzen der fortschreitenden Rationalisierung beachtet. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß man wohl von »Umbildungen im Produzentenbezug auf Arbeit« (KERN und SCHUMANN, 1983, S. 357) sprechen könne. Einerseits hätten sich die Spielräume für eine Abkehr von der Arbeit erweitert: Kamen Mitte der 50er Jahre bei einem männlichen Arbeiter im Jahresdurchschnitt auf eine geleistete Arbeitsstunde 2,9 Nicht-Arbeitsstunden, so hat sich dieses Verhältnis bis 1980 auf 1: 4,7 verändert; desweiteren hat sich der finanzielle Handlungsspielraum für Aktivitäten in der arbeitsfreien Zeit wesentlich vergrößert: wiederum seit Mitte der 50er Jahre ist der Anteil von Aufwendungen für grundlegende Reproduktionsnotwendigkeiten von 60 auf 40 % des ausgabefähigen Einkommens gefallen. Auf diesem Hintergrund ist für die Mehrheit der Bevölkerung:
»die emphatische Gleichsetzung von Arbeit und Lebenssinn und -erfolg ... kein Verhaltensmuster mehr, das fraglos hingenommen wird. An dem breiter werdenden Spektrum von Lebensentwürfen, zu denen inzwischen auch die aus expliziter Distanz zur Erwerbstätigkeit begründete Suche nach neuen Daseinsentwürfen gehört, kündigt sich bereits das Praktischwerden dieser Umorientierung an« (KERN und SCHUMANN, 1983, S. 356).
Mit aller gebotenen Vorsicht lassen sich Veränderungen in den grundlegenden Haltungen der Menschen zu ihrer Arbeit und dem, wie sie ihren Lebensentwurf anlegen, feststellen. Macht man sich klar, welchen zentralen Stellenwert die protestantische Arbeits- und Pflichtethik für den bürgerlichen Sozialcharakter, ja für den inneren Zusammenhalt des Kapitalismus als ganzem einnimmt, dann wird sofort deutlich, daß diese grundlegenden Umorientierungen ans »Eingemachte« der bestehenden Gesellschaftsordnung gehen. Sie bilden allerdings kein Potential, das die Revolution erneut auf die Tagesordnung setzen würde. Sie führen eher zu dem, was O. NEGT als »Erosionskrise« bezeichnet. Diese unterscheiden sich von herkömmlichen Krisen dadurch:
»daß diese sich vor allem unterhalb des öffentlichen Institutionensystems wirksam zeigen, daß sie die Subjekte in ihrer seelischen und geistigen Grundausstattung erfassen. Krisen diesen Typs verändern die Subjekte in ihren wichtigsten Lebensäußerungen, in ihrem Arbeitsverhalten, in ihrem Selbstwertgefühl, in ihren Wert- und Bedürfnisorientierungen. Was diese Subjektseite der Krise anbetrifft, so besteht eines ihrer hervorstechenden Merkmale darin, daß offenbar die Panzerungen der alten autoritär-autoritätsgebundenen Sozialcharaktere porös zu werden beginnen. Gewiß, sie sind nicht verschwunden, aber die geschichtlichen Bedingungen für deren Prägung (ungebrochene Vaterautorität, über Arbeit vermittelte Mechanismen der Triebunterdrückung, gesellschaftliche Ökonomie des Mangels beispielsweise) sind ungünstiger geworden« (1984, S. 62).
Diese tiefgreifende Krise versucht der Neokonservatismus mit der ideologischen Wiederbelebung traditioneller Werte zu bewältigen und begibt sich damit in ein unauflösbares Dilemma. D. BELL, der Chefideologe des amerikanischen Neokonservatismus, bringt es in seinem Buch über die »Kulturellen Widersprüche des Spätkapitalismus« deutlich zum Ausdruck. Er fragt sich, wie »die Ausbreitung einer postmaterialistischen, letztlich hedonistischen Alltagsethik eingedämmt und durch neue traditionelle Wertorientierungen ersetzt werden kann, die mit den funktionalen Erfordernissen des spätkapitalistischen Produktionsapparates kompatibel sind« (DUBIEL, 1985, S. 34). Der auf schrankenlosen Massenkonsum setzende Spätkapitalismus erzeugt und benötigt die Bereitschaft zum Genuß, zum schnellen Verbrauch. Diese in der Konsumptionssphäre erwünschten Merkmale stehen in offenkundigem Widerspruch zur asketischen Moral, zur Opfer- und Gehorsamsbereitschaft, die in den hochkomplexen und -empfindlichen Zentren der industriellen Produktion unabdingbar seien. Sie untergraben permanent Verzichtshaltungen, sozial erwünschte Sublimationen und die Bereitschaft zum Triebaufschub. Die Propagandisten des Neokonservatismus versuchen hier gegenzusteuern. Ich will ein Beispiel zitieren: Auf dem Raiffeisen-Wirtschaftstag hat im Juni 1985 die Vorzeigeintellektuelle der CDU, G. HÖHLER, einen Vortrag zum Thema »Die Jugend und die Wirtschaft« gehalten. 900 Unternehmer haben ihr gebannt gelauscht und begeistert applaudiert. Zu unserem Thema hat sie u. a. ausgeführt:
Die jungen Träger des Wertewandels sagen, wenn ich an meinem Arbeitsplatz eine Aufgabe habe, die mich 'nicht motiviert', da kann ich nichts machen. Da werde ich nicht meinem Wert als Mensch und als Staatsbürger entsprechend behandelt, also verweigere ich mich der Aufgabe. Der Ausgangspunkt war Unzufriedenheit, die Folge ist neue Unzufriedenheit. Warum? Weil ich nun nicht zu einer Leistung komme, die Anerkennung findet.
Da wir ... in einer Gesellschaft leben, die Askese nicht mehr zu den hohen Werten zählt, hat es jeder leistungsbezogene Mensch ungeheuer schwer, anderen klarzumachen, daß Leistung Freude bereitet. Es ist nämlich auch folgende Botschaft vergessen, die in allen Jahrhunderten, in allen Religionen und in der Philosophie immer bekannt war, übrigens auch in der linken Philosophie: Der Mensch bekommt Angst, wenn er untätig ist. Die Zukunftsangst ist ein großes Thema in diesem Staat; lauter sattgegessene Leute fürchten sich vor der Zukunft. Wer hungrig ist, sorgt fürs Essen, er kann gar keine Angst haben, es ist keine Energie dafür da. Energien für transzendente Befindlichkeiten werden erst frei, wenn die Menschen sattgegessen sind. Angst entsteht aus Untätigkeit. ( ... ) Wer entschlossen ist, ein Risiko einzugehen, eine Krise zu meistern, die Anforderungen der schnellen Entwicklung der Wissenschaft zu bewältigen, der kann keine Angst entwickeln, weil die Angst ihn Energien kostet. Risikobewußtsein ist gut und wichtig, weil Risikobewußtsein uns in einen Spannungszustand versetzt, der Energien freimacht. Das bedeutet, die Aufgaben, die wir haben, sollen uns sehr wohl mit Anspannung und mit dem Bewußtsein von hoher Verantwortung für die Zukunft erfüllen. Wer sich aber von dieser Verantwortung zurückzieht, wird nicht etwa ein glückliches Mitglied dieser Gemeinschaft.
Es ist sehr wesentlich, dies der Jugend deutlich zu erklären. Worte wie 'Pflicht (darf man ja kaum noch benutzen. Aber man kann der Jugend auch ohne diese Worte deutlich machen, daß Leben keinen Spaß macht, wenn man sich nicht an der Sache beteiligt. ( ... )
Der junge Mensch muß begreifen, daß der Luxus eines passiven, eines skeptischen Daseins die Ursache seiner Trübsal ist und nicht umgekehrt. Er zieht sich also nicht zurück, weil das Leben so traurig wäre. Vielmehr ist das Leben für ihn so traurig, weil er sich zurückzieht. ( ... ) Dies alles ohne den alten Tugendkatalog vorgetragen, also ohne die Fragen nach Pflicht, nach Leistungsbereitschaft findet häufig Anklang bei jungen Leuten. (...) Dies also kann man jungen Leuten klar machen: Daß man nur von anderen erfährt, wer man ist und was man kann. Daß unser Wirtschaftssystem zur Verwirklichung all der Träume von einem menschenwürdigen Leben führt. Und daß die zunehmenden Komplikationen in der technischen Welt nur deshalb weitergesteuert und weiterentwickelt werden müssen, weil der Mensch dadurch immer freier wird für ein menschliches Leben«
(aus einer Broschüre des Bayerischen Raiffeisenverbands).
Frau HÖHLER versucht hier die Aufhebung des angesprochenen Widerspruchs. Die alten Werte werden nicht gegen die neuen gehalten, sondern als die eigentliche Erfüllung der neuen Werte vorgeführt. Lust, Lebensfreude und Befriedigung können nur aus den Kernbestandteilen der neu aufgelegten protestantischen Ethik bezogen werden. Alles andere muß in die Hölle der Angst führen.
Der Widerspruch zwischen einer neuen ökonomisch-technologischen Wachstumseuphorie und einer davon abgekoppelten Teilgesellschaft ohne Perspektive.
Der Begriff von der »Zweidrittelgesellschaft« beginnt sich im politischen Sprachschatz zu etablieren. Er bringt eine Realität auf den Begriff, die sich immer weniger als vorübergehendes Phänomen in einer langsam wieder auf Hochtouren laufenden Wirtschaft bestimmen läßt. Er bringt zum Ausdruck, daß all die günstigen Wirtschaftsprognosen, mit denen wir immer wieder überzogen werden, nur für die etwas größere Hälfte der Bevölkerung gelten soll. Nicht hingegen für die wachsende Gruppe der dauerhaft Erwerbslosen, nicht für die Frauen, die zwangsweise wieder ihrer »eigentlichen Bestimmung« zugeführt wurden, für nur wenige Jugendliche, überhaupt nicht für Behinderte und ehemalige oder noch in Anstalten bzw. Heimen lebenden psychiatrischen Patienten, immer weniger für die ausländischen Bürger. Jede Wirtschaftskrise trifft die Bevölkerungsschichten am härtesten, die ohnehin die geringsten Ressourcen haben. Das besondere der gegenwärtigen Entwicklung ist das Nebeneinander von sich stabilisierender Perspektivlosigkeit und schrumpfenden materiellen Möglichkeiten auf der einen Seite und erhöhter Produktivität und verbesserten Gewinnerwartungen auf der anderen Seite. In der Weltwirtschaftskrise ging die Verarmung großer Bevölkerungsgruppen einher mit einem erheblichen Schrumpfungsprozeß des gesellschaftlichen Reichtums.
In der schon erwähnten Studie von KERN und SCHUMANN (1983) zeigt sich, daß infolge der umfassenden Rationalisierungsprozesse in der Industrie eine Segmentierung der Arbeitskräfte stattfindet. Für einen kleiner werdenden Teil entstehen in den Kernbereichen moderner Industrieproduktion Arbeitsplätze, die interessanter, vielfältiger und geeigneter sind, komplexe menschliche Fähigkeiten einzubringen. Für diese Kernbelegschaft »scheint Arbeit eine neue Bindequalität zu gewinnen« (KERN und SCHUMANN, 1983, S. 360 ). Diesen »Rationalisierungsgewinnlern«, die sich als relativ kleine und auf bestimmte Produktionszweige beschränkte Fraktion der Industriearbeiterschaft beschreiben läßt, stehen jene Teile der Belegschaft gegenüber, für die die technologischen Modernisierungsprozesse eine Zerstörung ihrer bisherigen Erwerbsperspektiven bringt. Die sich gegenwärtig vollziehende Umrüstung der industriellen Produktion führt zu »einer beträchtlichen Arbeitsplatzvernichtung mit der Folge der Marginalisierung von Arbeitskräftegruppen, die aus dem Produktionsprozeß herausgefallen sind oder gar nicht erst in ihn eintreten können« (ebd., S. 359).
Der sich immer klarer abzeichnende Aufspaltungsprozeß wird noch dadurch verschärft, daß sich die neokonservative Sozialpolitik gar nicht mehr zum Ziel setzt, die Folgen des technologisch-ökonomischen Strukturwandels wenigstens kompensatorisch abzumildern. Das Projekt des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates, das die unterschiedlichen Markt- und Lebenschancen der Menschen durch Sozial- und Bildungspolitik aufzufangen versuchte und sich am Ziel der Chancengleichheit für alle orientierte, kann als beerdigt gelten.
Es vollzieht sich also gegenwärtig der »Prozeß einer offenen Spaltung des Sozialstaats und einer Spaltung der Gesellschaft (LEIBFRIED und TENNSTEDT, 1985, S. 13).
»Immer mehr spaltet sich die Gesellschaft in einen 'Kern' von leistungsfähigen und -willigen, qualifizierten, angepaßten und gut funktionierenden Besitzern relativ sicherer Arbeitsplätze und Einkommen und eine wachsende 'Peripherie' von Ausgegrenzten und Marginalisierten. Die sozialen Unterschiede nehmen wieder zu: durch das Land zieht sich ein immer breiter werdender Riß« (HIRSCH, 1985, S. 81).
Wenn man sich diesem Thema der innergesellschaftlichen Spaltung vom Problemfeld Arbeitslosigkeit her noch einmal nähert, dann wird das Bild von der »Zweidrittel-Gesellschaft« in seinen Konturen besonders scharf. In der Dekade zwischen 1974 und 1983 sind in der BRD 12,5 Mill. Menschen arbeitslos gewesen, einmal oder mehrmals. Das ist jede dritte Erwerbsperson. Die in diesem Zeitraum registrierten 33 Millionen Fälle von Arbeitslosigkeit entfallen auf diese 12,5 Mill. Immer größer wird der Anteil der Langzeitarbeitslosen (1984 waren 28 % länger als einjahr und 10 % länger als zwei Jahre arbeitslos). Nur noch 65 % der registrierten Arbeitslosen sind überhaupt Leistungsempfänger.
Immer größer wird die Grauzone zu nichtregistrierter Schattenarbeitslosigkeit (u. a. Hausfrauenarbeit, ausländische Arbeiter, die wieder in ihre Heimatländer gehen). Neu im Erscheinungsbild der Erwerbslosigkeit ist das Faktum, daß keine Qualifikations- und Berufsgruppe mehr Schutz vor Arbeitslosigkeit bieten kann. Das Spezifikum der gegenwärtigen Massenarbeitslosigkeit ist die Tatsache, daß sie nicht als kollektives Massenschicksal erfahren wird. Betroffen ist eine »wachsende Nicht-mehr-Minderheit, die in der Grauzone von Unterbeschäftigung, Zwischenbeschäftigung und Dauerarbeitslosigkeit von den immer spärlicher fließenden öffentlichen Mitteln lebt oder von 'informeller' Arbeit« (BECK, 1986, S. 197). In diesen Grauzonen bleibt die Hoffnung der einzelnen, es doch wieder in den Kern hinein zu schaffen, Jobs und vorübergehende Beschäftigung nähren diese Hoffnung. Gerade in unserem eigenen Berufsfeld können wir ja die aus der Not geborene Virtuosität im Zerstückeln von Arbeitsplätzen und im Ergattern von Zipfeln professioneller Tätigkeitsfelder besonders gut beobachten.
Arbeitslosigkeit wird nicht zu der Erfahrung, der man sich und seine Identität voll ausliefert, sie wird eher zwischen den Ritzen und Brüchen Realität, die beim Zusammenstückeln von Jobs und Teilzeitbeschäftigungen auftreten. Dazu U. BECK:
»Massenhaftigkeit und Vereinzelung des 'Schicksals', Zahlen von schwindelnder Höhe und Konstanz, die sich doch irgendwie verkrümeln, ein zerkleinertes, nach innen gewendetes Massenschicksal, das in seiner ungebrochenen Schärfe dem einzelnen mit der Stimme des persönlichen Versagens seine Millionenhöhe verheimlicht und individuell ins Gewissen brennt« (1986, S. 201).
Die Massenarbeitslosigkeit der Weimarer Republik war eine sichtbare Realität, auch für die, die davon nicht betroffen waren. Die Massenarbeitslosigkeit unserer Tage und die beschriebene Spaltung läßt sich viel weniger als kollektive Wahrnehmung erfassen. Es läßt sich über unsere Gesellschaft so räsonieren, als gäbe es diesen Bereich gar nicht (die zum Verwechseln ähnlichen Neujahrsansprachen des Bundeskanzlers zeigen dies besonders klar). Die Spaltung ist mit dem verbunden, was M. WEBER einst mit »sozialer Schließung« (1964, S. 31 ff) meinte oder was BECK als »Abschirmung« (ebd., S. 197) des gesellschaftlichen Kerns von den wachsenden Randzonen bezeichnet. O. NEGT spricht von den »zwei Realitäten«, die sich herausgebildet haben, die sich nicht mehr berühren und verschränken. Menschen in der ersten Realität sehen die BRD als eine Gesellschaft an, in der sie einen sicheren Platz haben, eine Zukunft, die von ihnen geprägt wird und von ihrer Leistung abhängt. Sie können nicht verstehen, daß jemand das Möglichkeitsfeld dieser Gesellschaft nicht nutzt und können das Herausfallen nur als selbstverschuldet wahrnehmen. Gerade die scheinbar unbegrenzten technologischen Möglichkeiten, die sich gegenwärtig auftun, werden als eine besondere Chance gesehen, noch mehr zu schaffen. Die Menschen in der zweiten Realität erleben ihre Geschiedenheit von der ersten als ihnen aufgezwungen. Das Hauptmerkmal der Zugehörigkeit zu diesem Wirklichkeitsbereich besteht darin, »daß die Menschen, die hier ihre Erfahrungen machen, aus dem gesellschaftlich anerkannten System der Arbeit herausgefallen sind und alle darunter leiden, daß die gewonnene Zeit ihren Ernstcharakter verloren hat« (NEGT, 1984, S. 69).
Die psychosozialen Professionen sind in doppelter Weise von dieser Aufspaltung in zwei Wirklichkeitsbereiche betroffen. Zum einen sind sie selbst aufgespalten in diese zwei Realitäten. (Was hat etwa ein wohlsituierter Psychotherapeut in der Edelpraxis in Schwabing mit dem Psychologen gemeinsam, der seinen Unterhalt durch einen Volkshochschulkurs, eine Legasthenietherapie aus BSHG-Mitteln und stundenweisem Taxifahren bestreitet?) Zum anderen arbeiten psychosoziale Professionen auf beiden Seiten der Spaltungslinie. Diese Tätigkeiten lassen sich nicht mehr auf einer Dimension beschreiben. Der beschriebene gesellschaftliche Widerspruch zerreißt unsere Profession selbst.
Der Widerspruch von Rehabilitation durch Arbeit in die Arbeitsgesellschaft und Befreiung von falscher Arbeit
Kaum eine andere gesellschaftliche Gruppe dürfte in einem so totalen Sinne zu der zweiten Realität gehören wie die Gruppe der psychiatrischen Patienten. Bei keiner anderen Gruppe geraten deshalb auch alle Versuche, eine gesellschaftliche Wiedereingliederung über eine Arbeitsrehabilitation zu erreichen, in so aussichtslose und zynische Sackgassen hinein. Man denke an die Projekte der Arbeitstherapie und Behindertenwerkstätten, die in den frühen 70er Jahren gute Chancen hatten, Menschen zurück in die Arbeitsgesellschaft zu führen, die heute nur noch den Ernstcharakter der Arbeitswelt simulieren und real den Weg dorthin nicht mehr bahnen können.
Das Bedürfnis nach Normalisierung über ein anerkanntes Arbeitsverhältnis, der damit verbundenen sozialen Anerkennung und der Wunsch nach selbstverdientem Geld werden durch alle Versuche der Arbeitsrehabilitation stimuliert. Die Erfahrung, daß alle diese Versuche nicht ernst gemeint sein konnten, weil sie keine reelle Chance vermitteln können, verstärkt die Haltung der Demoralisierung und Hoffnungslosigkeit - zentrale Bedingungen der Chronifizierung. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich die Frage zwingend aufdrängt, ob es vertretbar ist, Menschen über Arbeit gesellschaftlich reintegrieren zu wollen, wenn »die Integration einer Gesellschaft durch Arbeit« (LEIBFRIED UND TENNSTEDT, 1985, S. 15) tiefgreifend erschüttert ist und Arbeitserprobung und -rehabilitation die Menschen nur noch mit der »bloßen Hülle der Arbeit« in Berührung bringt, wie es DAHRENDORF (1983, S. 30) formuliert hat. Welches ist denn der Stellenwert der Arbeit in der Bundesrepublik?
Die Arbeitslosenforschung hat deutlich gemacht, welche Persönlichkeitsbelastungen und -gefährdungen durch den Verlust von Arbeit erzeugt werden. Es sind nicht nur die materiellen Probleme, die sich enorm verschärfen. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Prozeß der Arbeit bedeutet in einem fundamentalen Sinne jene Personwerdung, die in unserer Gesellschaft über Sozialisationsprozesse und alltägliche Erfahrungen von Wertschätzung und Anerkennung vermittelt wird. M. JAHODA hat die verschiedenen Verlustdimensionen herausgearbeitet, die mit Arbeitslosigkeit verbunden sind. Es sind der Verlust der Zeitstruktur des Alltags; von sozialer Erfahrung und sozialer Unterstützung durch Arbeitskollegen; von Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Realisierung kollektiver Projekte; von Anerkennung durch die Gesellschaft; von Status und Rollenidentität; von regelmäßigen Aktivitäten (JAHODA, 1983).
Ich will FREUD nicht zum Arbeitspsychologen machen, aber von ihm stammen einige Beobachtungen und Analysen, die mir sehr wichtig erscheinen, um die psychologische Dimension der Erwerbsarbeit richtig zu verstehen. FREUD sagt:
»Keine andere Technik der Lebensführung bindet den einzelnen so fest an die Realität als die Betonung der Arbeit, die ihn wenigstens in ein Stück Realität, in die menschliche Gemeinschaft sicher einfügt. Die Möglichkeit, ein starkes Ausmaß libidinöser Komponenten, narzißtische, aggressive und selbst erotische auf die Berufsarbeit und auf die mit ihr verknüpften menschlichen Beziehungen zu verschieben, leiht ihr einen Wert, der hinter ihrer Unerläßlichkeit zur Behauptung und Rechtfertigung der Existenz in der Gesellschaft nicht zurücksteht« (FREUD, Studienausgabe, Bd. IX, 1975, S. 212 ).
In der Berufsarbeit findet das Realitätsprinzip Schablonen, in die sich die Subjekte mehr oder weniger gut mit ihren Bedürfnissen und Neigungen hineindefinieren können, in denen sie ihre Identität ansiedeln können und die sie auch schützen können. FREUD spricht von einer »Panzerung«, die »Leidensschutz« gewähren kann.
Berücksichtigen wir diese sozialpsychologische Bedeutung von Arbeit, dann wird sofort einsichtig, warum in der Sozialpsychiatrie die Bedeutung der Arbeit für die gesellschaftliche Integration so hoch angesetzt wird. Die Nicht-Anteilnahme an der Arbeitsgesellschaft scheidet die Menschen nicht nur von Möglichkeiten der Existenzsicherung ab, sondern zerstört auch einen Teil ihrer sozialen Identität und diese wiederum ist eine Grundvoraussetzung stabiler Persönlichkeitsbildung. K. DÖRNER hat auf diesen Zusammenhang eindringlich hingewiesen: »Arbeitslosigkeit bedeutet ... eine vollständige soziale und ökologische Entwertung. Bei der in unserer Gesellschaft nach wie vor geltenden Bewertung von Fremd- und Eigenarbeit kann sich ein Mensch, der von der lohnabhängigen Arbeit ausgeschlossen ist, nicht vollwertig, ja nicht mal als handelndes Subjekt empfinden« (1985, S. 22). Für die Praxis der Sozialpsychiatrie zieht K. DÖRNER dann die folgende Konsequenz:
»Da nun aber die meisten psychiatrischen Patienten arbeitslos sind und angesichts der Umstrukturierung der Wirtschaft auch arbeitslos bleiben werden, wächst uns unter ökologischem Konzept die Verantwortung zu, dafür auf die Barrikaden zu gehen, psychiatrischen Patienten zur Vermeidung ihrer totalen Entwertung ihr Recht auf Arbeit zu erkämpfen und zumindest unsere Arbeitszeit mit ihnen so zu teilen, daß wir nicht nur mit ihnen reden, sondern mit ihnen gemeinsam etwas tun« (ebd.).
Ich halte diese Überlegungen für richtig und unterstütze die gezogenen Schlußfolgerungen und gleichzeitig kann ich auch die andere Seite der Medaille nicht ausblenden. Kann ich die Kritik unterschlagen, die ich als Linker überjahre am kapitalistischen System der Lohnarbeit geübt habe? Sollen all die Einsichten zur persönlichkeitszerstörenden Qualität entfremdeter und restriktiver Arbeitsbedingungen nicht mehr gelten? S. SCHMIDT-TRAUB, die im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung von psychisch Kranken arbeitet, hat unter dem provokativen Titel »Der Irrsinn mit der beruflichen Rehabilitation« eine Aussage getroffen, deren Aktualität zunimmt:
»Einerseits wird dem psychisch Kranken in seiner Rolle als Arbeitskraft in der Regel eine eher kompromißlose Orientierung an bestehenden Arbeitsbedingungen abverlangt. Andererseits wird diesem Menschen versucht klarzumachen, daß er sich innerhalb einer beruflichen Betätigung in seiner sozialen Identität entfalten, wenn nicht sogar 'glücklich' schätzen könne. Insbesondere, da Arbeit heute so rar ist, versteigt sich manch arbeitswilliger psychisch Kranker in die gefährliche Illusion, jedwede Arbeit würde sehr viel zu seiner Gesundung beitragen« (1985, S. 184).
Wenn die Befunde der oben angesprochenen Wertewandelforschung einigermaßen verläßlich sind, dann stellt sich die Frage, ob die unveränderte rehabilitative Ausrichtung an dem Ziel der Wiedereinbindung ehemaliger Patienten in die Schablone der Lohnarbeiterexistenz dem Normalisierungsprinzip zu widersprechen beginnt. Wenn sich in der Durchschnittsbevölkerung die Bedeutung der Arbeit zu wandeln beginnt, dann sollte das auch Konsequenzen für rehabilitative Orientierungen haben. K. DÖRNER spricht von der in unserer Gesellschaft geltenden Bewertung von Arbeit, die es zwingend machen würde, für psychiatrische Patienten das Recht auf Arbeit zu erkämpfen. Müssen wir uns diese Bewertung zur uneingeschränkten Richtschnur machen? Und in welcher Weise müssen wir auf den veränderten Bezug zur Arbeit eingehen, der sich mit ihrer gesellschaftlichen Verknappung wahrscheinlich noch verstärken wird?
Ich möchte zur Beantwortung dieser Fragen noch einmal zurück zu den Klassikern. FREUD und M. WEBER meine ich. Wie kein zweiter hat M. WEBER den Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und der Entstehung von Persönlichkeitsmustern aufgezeigt, von denen diese getragen und vorangetrieben wird. Die »protestantische Ethik«, eine asketische Arbeitsmoral, habe sich zu einem »Gehäuse der Hörigkeit« für die Subjekte entwickelt, in dem ihre Bedürfnisse beherrscht und kanalisiert werden. WEBERs Formulierungen sind für mich von großer Klarheit und Eindringlichkeit:
»... indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung zu erbauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden - nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen -, mit überwältigendem Zwang bestimmt, vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist« (1963, S. 203).
Diese um die Jahrhundertwende entstandene Analyse und Prognose scheint eine besondere Aktualität zu gewinnen. Zwar ist der »letzte Zentner fossilen Brennstoffs« noch nicht verglüht, aber die Endlichkeit der Ressourcen und die Gefahr ihrer weiteren hemmungslosen Ausbeutung sind in unser Bewußtsein gedrungen.
Jedenfalls hat das »stahlharte Gehäuse« der asketischen Arbeits- und Alltagsethik erkennbare Risse bekommen. Die biblische Formel für diese protestantische Ethik: »Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen«, können und wollen wir nicht mehr ohne Einschränkungen akzeptieren. Hedonistische Bedürfnisse lassen sich nicht mehr in dieses Gehäuse bannen. Der Sozialcharakter, in dem dieses Gehäuse als quasi-natürliche Grundbestimmung des Menschen erscheinen konnte, beginnt zu zerfallen. In seinen kulturtheoretischen Schriften hat FREUD in spekulativer Präzision immer wieder auch die Kostenseite für die Subjekte beschrieben, die mit den positiven Leistungen der bürgerlichen Kultur verbunden ist. Er hat mit beeindruckender Sensibilität die Haarrisse im Stahlmantel der Charakterpanzerungen des bürgerlichen Sozialcharakters herausgearbeitet. Ich knüpfe an seinem Gedanken von oben an, in dem er die »psychohygienische« Bedeutung der Erwerbsarbeit anspricht. Zunächst geht er noch einmal auf die besonders positive Gestaltungsform beruflicher Arbeit ein:
»Besondere Befriedigung vermittelt die Berufstätigkeit, wenn sie eine frei gewählte ist, also bestehende Neigungen, fortgeführte oder konstitutionell verstärkte Triebregungen durch Sublimierung nutzbar zu machen gestattet. Und dennoch wird Arbeit als Weg zum Glück von den Menschen wenig geschätzt. Man drängt sich nicht zu ihr wie zu anderen Möglichkeiten der Befriedigung; die große Mehrzahl der Menschen arbeitet nur notgedrungen« (ebd., S. 212).
FREUD selbst hielt diese kulturnotwendige Zurichtung der Menschen und den von ihm geforderten Preis für nicht hintergehbar. Das gibt seiner Analyse eine pessimistische Grundtönung. Aber er liefert uns doch wichtige Ansatzpunkte für eine reflexive Überwindung quasi-natürlicher Bestimmungen des Menschen. Die gegenwärtige Krise der Arbeitsgesellschaft und die untauglichen Versuche der Neokonservativen, die Risse im Gehäuse der Hörigkeit zuzukleistern, so zu tun, als habe es noch immer eine ideale Paßform, bedeuten eine große Chance, über die »Befreiung von falscher Arbeit« (SCHMID, 1984) nachzudenken und sie experimentell zu erproben. Wie die Beobachtungen von S. SCHMIDT-TRAUB zeigten, bindet die Krise in fataler Weise an das Bestehende. Bis zur Selbstaufgabe kann die Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Lohnarbeiter das alles beherrschende Lebensziel werden. Der Wunsch nach einer Tätigkeit, die eigene Fähigkeiten und Bedürfnisse zuläßt und verwirklicht, ist verkümmert. Der Hunger nach Normalität wird zu einem Hunger nach Arbeit um jeden Preis.
Sollen wir solche Wege, die notwendigerweise in Sackgassen führen (die Sackgasse der Wahrscheinlichkeit, nicht einmal irgendeine Arbeit zu bekommen und die Sackgasse, daß die akzeptierten Arbeitsbedingungen die Menschen weiter zerstören), akzeptieren oder gar unterstützen? Ich sehe Wege aus diesen Widersprüchen nur dort, wo grundsätzlich neu über die Verteilung von Arbeit nachgedacht wird, wo im Sinne der Forderung nach einem garantierten Mindesteinkommen Arbeit und Existenzsicherung entkoppelt werden und wo vor allem neue Formen des Lebens und Arbeitens ausprobiert werden. Am meisten ermutigen sicherlich solche Ansätze, in denen eine Suche nach alternativen Arbeitsformen nicht nur für Rehabilitanden stattfindet, sondern auch die Professionellen die Chance nutzen, für sich neue Lebens- und Arbeitsformen zu entwickeln. Ich will solche Alternativprojekte nicht mythologisieren, sie befinden sich auf einer durchaus riskanten Gratwanderung, aber für sie gilt das, was O. NEGT über soziale Bewegungen generell sagt. Sie sind gekennzeichnet durch »ein überschüssiges Experimentierbewußtsein in einem gesellschaftlichen Laboratorium, in dem Erfolg und Scheitern nahe beieinanderliegen, in dem es jedoch eine Konstante gibt: die objektive Möglichkeit kollektiver Lernprozesse« (1984, S. 95).
Der Widerspruch zwischen einem anhaltenden (oder noch anwachsendem) Hunger nach Psychologie und der Perspektivelosigkeit von Psychologie als Beruf
Mit dieser Widerspruchsebene begebe ich mich nun endgültig in das psychosoziale Berufsfeld. Das ist der Schritt in ein vertrautes Revier, in dem eher Stichworte und Skizzierungen reichen, um sich auf spezifische Sachverhalte beziehen zu können, in dem sich aber zugleich Klüfte auftun, die kein noch so eleganter oder gewagter Spagat zu überwinden vermag.
Solange ist es noch nicht her, daß die zunehmende Nachfrage nach Psychologie in unserer Gesellschaft der Anbieterseite von psychosozialen Dienstleistungen zur Last gelegt wurde. Vor allem die zunehmende Professionalisierung der Psychologie und die rasante Zuwachsrate berufstätiger Psychologen wurden dafür verantwortlich gemacht, daß eine steigende Nachfrage zu verzeichnen war. Diese Interpretation braucht auch heute nicht aufgegeben zu werden, aber sie reicht nicht aus, um das zunehmende Interesse von Menschen in allen kapitalistischen Ländern an psychologischen Themen und Dienstleistungen zu erklären. Ich wage die These, daß dieses Interesse selbst dann anhalten wird, wenn die Psychologie als Beruf von der gegenwärtigen Krise verschlungen werden sollte.
Psychologen mit und ohne Diplom haben als Multiplikatoren und Mediatoren ihren Anteil an der Verbreitung psychologischen Wissens und psychologischer Deutungsmuster, aberdie gegenwärtige Psychokultur läßt sich nicht auf diesen Anteil reduzieren. Die Gründe für den Hunger nach Psychologie sind möglicherweise die gleichen wie jene, die so viele dazu gebracht haben, Psychologie zu ihrem Beruf machen zu wollen. Da ich später auf diese Gründe noch genauer eingehen möchte, beschränke ich mich an dieser Stelle auf eine möglicherweise verkürzende These: Der wachsende Hunger nach Psychologie ist Resultat eines Zerfalls traditioneller Lebensformen und Lebensmuster, der durch den Druck technologischer Modernisierungsprozesse gegenwärtig noch erheblich beschleunigt wird. Kaum ein Bewohner der Bundesrepublik kann bei der Strukturierung seines Alltags, bei den Versuchen seiner Lebensplanung auf Modelle und Lebensformen zurückgreifen, die für die Elterngeneration noch tragfähig gewesen sein mögen. Die einzelnen Subjekte werden zu Entscheidungsträgern für ihre eigenen Lebenswege und das auf der Basis von Sozialisationsprozessen, die für diesen Entscheidungsspielraum nicht vorbereiten konnten. Sie standen meist noch in jener sozialgeschichtlichen Tradition, die den »autoritären Charakter« als repräsentativen Typus aus sich hervorbrachte. U. BECK hat diesen rasanten Modernisierungsprozeß der Subjekte sehr eindringlich beschrieben:
»Niemand, der vom Fragestrom der Moderne wirklich erfaßt wurde, vermag mit ungebrochener Selbstverständlichkeit und Sicherheit aus der Vergangenheit die Vorbilder für die Zukunft zu schöpfen: Trägt denn das Modell der Familie, der Ehe, der Weiblichkeit, der Männlichkeit, der Elternschaft, der Ausbildung, des Berufes, der Karriere, in denen das Leben ein, zwei Generationen vorher noch weitgehend unbefragt verlief, auch für den eigenen Lebensentwurf, für den Lebensentwurf der kommenden Generationen? Aus den verblassenden sozialen Vorgaben schält sich, verletzt und zaghaft, voller Fragen, das nackte, verängstigte, aggressive, Liebe und Hilfe suchende Ich heraus. In der Suche nach sich selbst und einer zärtlichen Sozietät verläuft es sich leicht im Urwald des eigenen Selbst und wird so verirrt in sich - paradox genug zum Spielball gesellschaftlicher Moden und Verhältnisse« (1985, S. 88).
Dieser wachsende psychosoziale Freisetzungsprozeß bildet für mich den objektiven Hintergrund für die steigende Nachfrage nach Psychologie und zugleich natürlich auch für die Entscheidung zum Studium der Psychologie. Die Frage ist nun, ob die massenhaften Identitätskrisen und Suchprozesse nach einem lebbaren Lebenssinn die Psychologie in einer spezifischen Berufsförmigkeit benötigen. Für massive Belastungen und deren psychische Folgen wird ein professionelles Auffangnetz gesellschaftlich bereitgestellt werden. Es existiert ja auch bereits mehr oder weniger weit von Minimalstandards entfernt. In ihm sind Psychologen vielleicht noch immer die am wenigsten abgesicherte Berufsgruppe, aber sie werden den erreichten status quo wohl halten können. Der Hunger nach Psychologie wird sicherlich weiterhin auf einem »freien Markt« gestillt werden, jedenfalls von den gesellschaftlichen Gruppen, die finanzielle Ressourcen für die Arbeit an ihrer Identität investieren können.
Wenn ich mir das Programmangebot der Massenmedien anschaue oder die Programme der Volkshochschulen dann kommen mir allerdings zunehmend Zweifel, ob die Nachfrage nach psychologischem Wissen und Deutungsmustern identisch ist mit der Nachfrage nach Psychologen. In vielfältiger Weise ist eine scheinbar gebrauchsfertige Psychologie bereits in den Alltag eingesickert, hat die Sprache der Menschen durchsetzt und bietet unerschöpfliches Gesprächsthema für die Gelegenheiten, bei denen sich Menschen überhaupt noch unterhalten. Der holländische Soziologe und Psychotherapeut A. DESWAAN (1983) hat dafür das wichtige Konzept der »Protoprofessionalisierung« eingeführt. Es spricht die Entwicklung an, daß immer mehr Laien mit der Sprache und den Arbeitsformen der Psychotherapie vertraut werden und deshalb zu Partnern für die Professionellen werden, denen die Regeln der Kunst psychosozialer Arbeit nicht mehr vermittelt werden müssen. Sie kennen sie längst und finden deshalb von selbst die richtige Paßform für ihre Probleme und die richtige Form ihrer Bearbeitung. Der professionelle Helfer findet seinen kongenialen Partner. Gelegentlich stellt sich bei mir die Vorstellung ein, daß aus der Proto- eine volle Professionallsierung wird, die den Psychologen nicht mehr braucht. Die Psychokultur, die heute noch den professionellen Stichwortgeber und Anleiter braucht, hätte sich dann zu einer alltäglichen Normalkultur weiterentwickelt. Das kann sicher nur für den Bereich gelten, in dem Menschen heute neue Leitfäden für ihren Alltag suchen, in dem es um Selbsterfahrung geht, um die Befreiung von Schablonen, die es uns schwer machen, die Handlungsvorgaben und Chancen einer veränderten Gesellschaft aufzunehmen und umzusetzen.
Der Widerspruch zwischen vermehrten Helferkrisen und -leiden und dem hoffnungsvollen Aufbruch zu neuen Ufern
Kürzlich las ich ein Buch, das den Titel »Wounded healers« (RIPPERE UND WILLIAMS, 1985) trägt, in dem psychosoziale Praktiker über ihre Krisen, Leiden und Depressionen berichten. Ein Buch gleichen Titels ist wenige Jahre vorher erschienen (LIPP. 1980). Zum Thema »Ausgebrannt« (Burnout) gibt es mittlerweile eine kaum mehr übersehbare Flut von Büchern und Aufsätzen. Sie beleuchten alle die Kostenseite eines Berufes, in dem die eigene Person als Arbeitsinstrument zur Überwindung psychischer Krisen anderer Menschen eingesetzt werden muß. Sie handeln von dem Helferidealismus, der sich im beruflichen Alltag erschöpfen kann, der wie ein Feuer ohne Nachschub verglüht, der bei sich immer weniger Ressourcen für die Hilfe anderer Menschen spürt und stattdessen mit dem Gefühl der eigenen Hilflosigkeit konfrontiert ist.
Ich will ein Beispiel herausgreifen, das in der Literatur dokumentiert ist (ARONSON, PINES und KAFRY, 1983, S. 5 7 ff.): Es geht um eine junge Sozialarbeiterin, die sich mit vollem Engagement in die Arbeit einer therapeutischen Wohngemeinschaft mit ehemaligen psychiatrischen Patienten stürzte. Sie wollte »den Menschen helfen« und »die Welt besser machen«. Nach dreijahren gab sie diese Stellung auf und begründete es so:
»Ich hatte genug von der Arbeit mit chronischen Patienten, die Arbeit in der Therapie interessierte mich nach wie vor, aber die Möglichkeiten waren bei diesen Patienten sehr begrenzt. Man konnte nicht viel mehr tun, als für ihre Medikation sorgen und ihnen helfen, wieder im Leben außerhalb der Klinik zurechtzukommen. Diese Menschen waren sehr arm und sehr abhängig, ich fühlte mich erschöpft. Einige der jüngeren Patienten machten Fortschritte, aber bei den allermeisten waren die Veränderungen minimal«.
Die Sozialarbeiterin wechselte auf eine Stelle als Familienberaterin in einer Polizeidienststelle, die für Kriseninterventionen bei häuslichen Streitigkeiten zuständig war. Es war eine neue Einrichtung, die viel Publicity hatte. Die Arbeit war faszinierend, sie konnte sich als Pionierin, fühlen. Aber nach zwei Jahren waren auch hier Gefühle der Erschöpfung und auch Abstumpfung übermächtig:
»Die Situationen schienen mir alle so ähnlich, immer war alles das gleiche. Es waren immer die gleichen Leute in den gleichen Situationen. Ich wurde zornig, sobald ich in der Wohnung war. Nach einer Weile hörte ich nicht mehr zu. Einfühlung war nicht mehr möglich, ich konnte mir Mitleid nicht mehr leisten, wenn ich emotional überleben wollte«.
Die Sozialarbeiterin wollte immer weniger Kontakt mit ihren Klienten haben:
»Ich war negativ eingestellt, ehe ich auch nur in die Häuser hineinging; ich war schroff und ohne jede Wärme. Rückblickend glaube ich, daß ich diese Distanz schaffen wollte, weil ich nicht mehr wünschte, daß meine Klienten mich mögen. Ich dachte, daß sie auf weitere Verabredungen mit mir verzichten würden, wenn sie fanden, daß ich weder hilfsbereit noch mitfühlend war«.
Nach der Erprobung verschiedener Überlebensstrategien (z. B. Übernahme eines Lehrauftrags) gab sie schließlich ihre Stelle auf. »Ich habe bedürftigen, abhängigen, gequälten Menschen nichts mehr zu geben. Ich habe meinen Teil guter Taten getan. Ich habe meine Schuldigkeit getan«. Sie wünschte und suchte sich eine Stelle, in der sie Umgang mit Menschen haben könnte, die Freude an ihrem Beruf und ihrem Leben haben würden. Sie suchte eine Aufgabe, die Kreativität ermutigt und sowohl Unterstützung als auch Herausforderung bietet.
Daß psychosoziale Praxis eine krisenanfällige Tätigkeit ist, braucht nicht weiter erläutert zu werden. Ebensowenig, daß der Praxisschock in der Berufseinstiegsphase Belastungen und Enttäuschungen mit sich bringt. Jeder muß erst für sich eine Arbeitsform finden, die ihn zugleich schützt gegenüber den hohen Ansprüchen seiner Klienten und seiner eigenen und ihn gleichwohl beziehungsfähig bleiben läßt.
Auch der Stellenwechsel hat im psychosozialen Bereich seine Normalität als Bewältigungsmuster für drohenden Motivationsverlust. Gerade diese Verarbeitungsmöglichkeit von berufsbedingten Überbeanspruchungen ist in den letzten Jahren an der Realität des Arbeitsmarktes gestrandet. Das enorm gewachsene Interesse am Thema Burnout und beruflichem Überdruß scheint mir ein verläßlicher Indikator für einen gesellschaftlichen Umbruch der den psychosozialen Bereich im besonderen betrifft. Die ihn bestimmenden Professionen sind nicht nur selbst zu Risikoberufen im Sinne des Arbeitsamtes geworden, sie bekommen zunehmend auch Druck in den Institutionen, die mit den ausgegrenzten und ausgemusterten Menschengruppen zu arbeiten haben. Die an spezifischen Therapiezielen orientierten beruflichen Ansprüche in der psychosozialen Praxis geraten in verstärktem Maße in Widerspruch zu dem, was realistischerweise überhaupt gehen kann. Wenn in einer Rehabilitationseinrichtung immer seltener Rehabilitanden in einen normalen Betrieb vermittelt werden, dann sind nicht nur deren Enttäuschungen aufzufangen, sie sind zunehmend auch die der Helfer. Es gibt viel weniger Chancen für Erfolgserlebnisse.
Ein weiterer Punkt kommt hinzu. D. KLEIBER (1986) hat in einer Studie zeigen können, daß sich von motivationaler Auszehrung bedrohte Berufspraktiker sehr stark an personenbezogenen Bewältigungsstrategien orientieren und sich dadurch sicherlich auch Entlastungen erarbeiten können. Gleichzeitig ist immer wieder gezeigt worden, daß kollektive Aktivitäten zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen oder mit Kollegen geteilte ideologische Ziele und zu dessen Erreichung unternommene Aktivitäten den besten Schutz gegen die Entmutigung bilden können (vgl. CHERNISS und KRANTZ, 1983). Hier erscheint es mir besonders bedenklich, daß von den gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen auch die Organisationen und Verbände tief betroffen sind, die über Jahre eine identitätsstiftende politische Kultur gewesen sind und die heute oft durch ihre innere Lähmung oder Zerrissenheit zu einer zusätzlichen Belastung werden können.
Als ich kürzlich von einer italienischen Kollegin einen Brief erhielt, in dem sie mich um Literaturtips zum Burnout-Thema bat, war das für mich ein bedenkliches Zeichen dafür, daß die Krise auch an der so starken italienischen Reformbewegung nicht spurlos vorübergeht.
Ich war bislang nur auf der einen Seite des Widerspruchs. Die andere Seite wird von einer breiten Palette optimistischer Zukunftsentwürfe besetzt. Sie strahlen die Zuversicht aus, daß wir uns in einer besonders einschneidenden Entwicklungsphase der Menschheitsgeschichte befinden, in der sich eine grundlegende Transformation unseres Bewußtseins und unserer Lebensformen vollziehen würde. Der Psychologie kommt in dieser Transformation eine herausragende Rolle zu. Büchertitel, die stellvertretend für diese Perspektive stehen können, heißen »Wendezeit« (CAPRA, 1983), »Die sanfte Verschwörung. Persönliche und gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns« (FERGUSON, 1983), »New-Age - Zeugnisse der Zeitwenden« (GEISLER, 1984), »Psychologie in der Wende« (WALSH und VAUGHAN, 1985) oder »Die sanfte Wende« (LUTZ, 1984).
Die in diesen Titeln anklingende Transformationsperspektive hat ihren Ausgangspunkt in der zugespitzten Krise des kapitalistischen Industrialismus: mit den lebensbedrohlichen Folgen unkontrollierter Technikentwicklung, der damit verbundenen Zerstörung der natürlichen Grundlagen des Lebens, sind immer grundsätzlichere Fragen an das Selbstverständnis einer solchen Zivilisation gestellt worden. Nicht zuletzt der innere Zusammenhang zwischen der äußeren Naturbeherrschung und der Domestizierung der eigenen inneren Natur ist erkannt worden. In diesem Zusammenhang werden:
»viele jener sozialen und psychischen Entwicklungsschritte in Frage gestellt, die der Herausbildung der industriellen Gesellschaft zugrundeliegen. Die wachsende Distanzierung und Entfremdung sozialer Lebensgemeinschaften von unmittelbaren Naturkontakten, die Ersetzung personaler und direkter Gewaltverhältnisse durch verinnerlichte, psychische Kontrollmechanismen, also Phänomene, die als selbstverständliche Voraussetzung einer Erweiterung der menschlichen Freiheit gelten konnten, werden heute zunehmend als Anzeichen eines mit der Moderne einsetzenden Prozesses der Zerstörung humaner Entfaltungsmöglichkeiten gewertet« (HONNETH und JOAS 1980, S. 7).
Diesem Punkt habe ich mich schon mit verschiedenen meiner früheren Überlegungen genähert. Die kritische Befragung der Prämissen unserer gesellschaftlichen Lebensordnung ist ein unstrittiges Phänomen. Für viele bedeutet das eine tiefe Orientierungskrise, auch und gerade für die Linke. Deutlich vernehmbar rührt sich aber eine vielgestaltige Szenerie zu Wort, die die Krise zu ihrer Chance gemacht hat. Sie spricht die Sprache der Ökologie und verbreitet einen kaum glaublichen Optimismus. In einem Artikel der taz (vom 26.1.1985) konnte man lesen: »Welcher 'Linke' weiß schon noch, wo's langgeht; und in dieser Situation scheint es natürlich suspekt, wenn plötzlich aus völlig anderen Ecken Konzepte und Perspektiven angeboten werden, und zwar optimistische. Das draufgängerische Gefühl aus der Studentenbewegung leuchtet auf neuer - eben ganzheitlicher - Ebene wieder auf. Avantgarde-Bewußtsein, Vertrauen in eine bessere Zukunft, Selbstvertrauen, der Hang zum politischen Gesamtkunstwerk ... «.
Worin besteht die Botschaft? jede Krise ist auch eine Chance und richtig gedeutet und genutzt stehen uns längst alle Prinzipien und Potentiale zur Verfügung. Vor allem die Naturwissenschaften und die Technikentwicklung sind längst an einem Punkt, an dem sie sich mit Spiritualität und ganzheitlichem Denken verbünden können und so den endgültigen Auszug aus dem Gehäuse der Hörigkeit ermöglichen. Wir stehen an der Schwelle zu einem Zeitalter, in dem Schluß sein wird mit Krieg, Gewalt und Umweltzerstörung. Vor allem das spirituelle Erwachen von immer mehr Menschen stellt die Keimzelle des Neubeginns dar. In diesem Hochgefühl der Erweckungsbewegung können auch neue technologische Qualitäten wie die Computerisierung nicht schrecken. Sie werden als positive Möglichkeiten der umfassenden Vernetzung der Keimzellen des Neubeginns gedeutet. Für die Psychologen bleibt auf jeden Fall eine Menge sinnvoller Aufgaben.
Der amerikanische Zukunftsforscher J. NAISBITT nennt einen seiner zehn Megatrends, mit denen er die wichtigsten Gesellschaftsveränderungen der erwartbaren Zukunft zu fassen versucht: 'je mehr Hochtechnologie, desto größer das Bedürfnis nach Persönlich-Menschlichem ... Diese Gleichung symbolisiert im Prinzip das immer vorhandene Bedürfnis nach einer ausgeglichenen Balance zwischen unserer physikalischen und spirituellen Realität« (1984, S. 79). Der entscheidende Punkt ist der Durchbruch zu einer spirituellen Realität, die es mir erlaubt, diese ungeahnten neuen Möglichkeiten zu erkennen und ihnen zu vertrauen. Den größten Anstoß für den »Prozeß der persönlichen Umwandlung« sieht M. FERGUSON, die wichtigste Repräsentantin der Aufbruchsphilosophie, in den Angeboten der vielgestaltigen Psychokultur,
»die überall verfügbar sind: Pop-Psychologie, Bücher über Selbstfindung, Psychotherapie, Meditation, Traumjournale, Körpertraining, Yoga, Training für Biofeedback, Laufen, Wochenendseminare, esoterische Lehren. ( ... ) Der heroische Pfad ist das Selbst, ist nicht länger Stoff für Legenden, sondern das Potential von Jedermann und Jederfrau« (1984, S. 136).
Eine Psychologin schildert, was dieser Durchbruch für sie gebracht hat:
CAPRA hat daraufhingewiesen, daß die Chinesen für das Wort 'Krise' zwei Zeichen verwenden, das eine bedeutet 'Gefahr' und das andere 'Chance'. Darüber konnte ich wirklich Abschied nehmen vom Lamentieren, vom Festgefahrensein in der kritischen Analyse und dem Gefühl der Hilflosigkeit. ( ... )
Ich habe sowohl mit vielen Leuten, mit denen ich in der Arbeit zu tun habe, als auch mit meinen Eltern und Geschwistern und auch mit Leuten, die ich kurzfristig nur mal getroffen habe, darüber geredet. Es entstanden dabei tiefe Gespräche über unser Menschsein. ( ... ) Wir haben gemerkt, daß pessimistische Analysen uns nichts nützen, sie sind keine Quellen für Innovationen. ( ... )
Die Erfahrung ist ein In-Kommunikation-Sein, In-Verbindung-Sein. Das ist immer so, was ich erfahre, wenn ich etwas in meine Arbeit, in meine Gruppen einbringe: daß plötzlich ein Rahmen da ist, Menschen sagen können, »ich wünsche mir die Welt so ... und so«, so ganz einfach. Z. B. darin, Erinnerungen an die eigenen kindlichen Zukünfte wachzurufen, an die Wünsche und Gewißheiten über das »Gute« in der Welt. Dafür gibt es nun einen Rahmen, es wird wieder möglich, 'naiv' zu sein und die Verwirklichung von Grundbedürfnissen nach Liebe, Schöpfung und Ausdruck zu erwarten. Es ist wieder möglich, positive Gefühle auszudrücken, Verständnis zu erleben unter den Menschen und zu sehen, wo Menschen was Tolles anfangen und wirklich etwas in Gang setzen für uns alle« (D. EILERT, 1985, S. 9).
Es ist sicherlich eine ganz zentrale Einsicht, daß eine Krise neben ihrer Gefahrenseite auch die Chance zu einem entscheidenden Schritt nach vorne sein kann. Aber ist es so einfach, daß wir uns das nur klarzumachen hätten, um uns dann von den ungeahnten Möglichkeiten eines neuen Aufbruchs erfassen zu lassen? Für mich gehören beide Reaktionsmuster auf die Krise, die Mutlosigkeit, die Erschöpfung, das Burnout einerseits und die Euphorie eines neuen Anfangs in die gesellschaftliche Realität dieser Jahre, auch wenn es kaum vorstellbar ist, daß das noch eine Realität ist.
Der Widerspruch zwischen den beharrlichen gesundheitspolitischen Bemühungen um ein wohlfahrtsstaatliches Versorgungssystem und den Ansprüchen der Betroffenen auf das Recht der Selbstorganisation.
Im Dezember 1984 hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Grünen zu einer Tagung nach Berlin eingeladen. Es sollte um die Psychiatrie gehen. Herausgekommen sind dabei die viel diskutierten Thesen. Diese Tagung war bestimmt von einer erbitterten Auseinandersetzung der »Irrenoffensive«, einer Organisation ehemaliger Psychiatriepatienten, mit der professionellen Reformszene der Bundesrepublik. In erster Linie wurde die DGSP attackiert, aber sie stand wohl stellvertretend für alle Gruppierungen und Verbände fortschrittlicher Professioneller im psychosozialen Bereich im Kreuzfeuer. Unerbittlich klagten die Vertreter der Irrenoffensive das Recht für sich ein, ihre Lebensform autonom bestimmen zu können. Jeder Vorschlag zu veränderten Versorgungsformen, der von uns wohlmeinenden Professionellen kam, wurde mit empörter Schärfe zurückgewiesen, wurde als Versuch verstanden, die Herrschaft der Professionellen zu behaupten und auszubauen.
Mir hat es an diesem Wochenende die Sprache verschlagen. Die mitgebrachten Konzeptvorstellungen für ein verändertes psychosoziales Versorgungssystem konnte und wollte ich nicht mehr vortragen. Mir ist an diesem Wochenende ein Widerspruch klar geworden, über den sich die gesundheitspolitische Reformbewegung in den 70er und beginnenden 80erjahren hinweggesetzt hat.
Für uns war doch Reform der psychosozialen Versorgung in allererster Linie die Schaffung von Bedingungen für eine gute professionelle Arbeit. Wir wollten eine bessere Versorgung, die möglichst für alle erreichbar sein, die die Privilegien im Zugang zu therapeutischen Einrichtungen abbauen sollte. Wir haben gegen das bestehende Gesundheitssystem gekämpft, weil es nach den Prinzipien des Marktes funktioniert, der immer denen mehr gibt, die mehr bezahlen können. Wir wollten ein System erreichen, das öffentliche Wohlfahrt für alle ermöglicht, die Chancengleichheit im Zugang zu therapeutischen Dienstleistungen herstellt und das Monopol einer Profession bricht, der wir ein gutes therapeutisches Angebot allein nicht zugetraut haben. Psychiatriereform war ausschließlich als Therapiereform gedacht.
In nur wenigen Stellungnahmen tauchte die Idee der Bürgerbeteiligung auf, die z. B. bei der Verwaltung und Kontrolle öffentlicher ambulanter Therapieeinrichtungen herzustellen sei. Das war oft nur ein halbherzig vertretener Import aus der amerikanischen Community Mental Health Bewegung. Wir haben in den 70erjahren zuerst mit großem Pathos Programme für die Betroffenen gefordert, wir haben dann den sog. Betroffenenbezug gefordert. Wir sind uns selber nicht mehr sicher gewesen, ob wir die Bedürfnisse jener wirklich kennen, für die wir helfende Institutionen schaffen wollten. Wir haben uns kritisch mit der Linie der Psychiatrie-Enquete auseinandergesetzt, in der wir das Programm einer »Expertendiktatur über die Bedürfnisse« gesehen haben (festgemacht an der dort vertretenen Position, daß nur expertendefinierte Bedarfskriterien als Planungsgrundlage für Versorgungsstrukturen herangezogen werden dürften). Wir haben uns vor allem immer wieder als Advokaten einer Bevölkerungsgruppen verstanden, die an der Peripherie bleiben, die keine Lobby haben und die deshalb besonders unserer Hilfe bedürften. Wir waren bestimmt von einer Haltung advokatorischer Fürsorglichkeit, die natürlich immer von der unausgesprochenen Prämisse ausging, daß wir für die richtige Alternative sorgen könnten und daß sie im wesentlichen von uns auch getragen sein müßte.
Auch heute noch von solchen Prinzipien geprägt und sie für notwendig haltend, hat mich die Erfahrung mit der Irrenoffensive in Berlin sehr verwirrt. Ich hatte angenommen, wir Leute aus der Reformszene, die sich seit Jahren in einem aufreibenden Kampf mit den Vertretern und Institutionen der traditionellen Psychiatrie befinden, wären selbstverständlich Bündnispartner von Betroffenenorganisationen. Mir ist klar geworden, daß wir es schon deshalb nicht oder noch nicht sein können, weil wir die zentralen Forderungen dieser Initiativen noch nicht einmal ernst genommen hatten.
Bei allem, was kritisch zu den »Thesen zur Abschaffung und Überwindung der Psychlatrie« der Grünen zu sagen ist, es bleibt ihr zentraler Verdienst, daß sie das erste parteipolitische Dokument in der BRD sind, das die Frage der Menschen- und Bürgerrechte auch und gerade gegenüber unseren professionellen Handlungssystemen ins Zentrum gerückt hat.
Haben wir auf irgendeinem unserer Kongresse jemals über die Vereinbarkeit spezifischer therapeutischer Programme und dem Menschenrecht auf Selbstbestimmung diskutiert, über das Recht auf Ablehnung von therapeutischen Maßnahmen? Ober haben wir gar mit den Betroffenen selbst darüber diskutiert? Haben wir uns mit der Forderung auf selbstbestimmte und selbstorganisierte Lebensformen konfrontiert, in denen wir als wohlwollende Berater und Therapeuten gar nicht mehr vorkommen sollen? Oder gar mit jener anderen Forderung, sozialstaatliche Leistungen den Betroffenen direkt zugänglich zu machen, was ja bedeuten würde, daß daraus keine Stellen mehr für helfende Interventionen finanziert werden könnten?
Ich halte es für einen wichtigen Schritt, daß wir den möglichen Widerspruch zu sehen lernen zwischen dem, was Professionelle für therapeutisch notwendig halten (natürlich im »wohlverstandenen Interesse« der Patienten) und den Ansprüchen vieler Patienten auf ein Stück eigenes Leben. Ich ziehe daraus nicht die Schlußfolgerung, daß institutionelle Hilfen nicht mehr vertretbar und planbar wären. Ich halte es nach wie vor für unabdingbar, ein dezentrales bürgernahes System von Hilfen und Unterstützungssystemen aufzubauen. Die entscheidende neue Frage ist für mich, wie verhindert werden kann, daß es in Widerspruch zu Bedürfnissen nach Selbstorganisation gerät. Oder positiv formuliert, wie können psychosoziale Systeme so in den alltäglichen Lebenszusammenhang der Menschen integriert werden, daß sie den Aufbau, die Weiterentwicklung und die Verteidigung von sozialen Netzwerken unterstützen können, aus denen die Ressourcen für eine selbstbestimmte und bedürfnisbezogene Lebensplanung und -führung entstehen können. Einen kleinen, wenn auch wichtigen ersten Schritt in diese Richtung sehe ich in der Schaffung von kommunalen Fonds, aus denen Initiativen der verschiedensten Art finanziert werden können und die das experimentelle Feld für die Erprobung von sozialstaatlich ermöglichten selbstorganisierten Projekten herstellen sollten.
Der Widerspruch zwischen der individualisierten Arbeit am Subjekt (Psychotherapie in den verschiedensten Varianten) und einer gemeindepsychologischen Perspektive.
Die - häufig nur appelativ - das Anknüpfen an und die Unterstützung von kollektiven Lebensformen (der immer wieder betonte Gemeindebezug) fordert. Dieser Widerspruch zieht sich seit Jahren besonders durch die Kongresse der DGVT. Als vor 1982 das erste Mal die Flagge der »gemeindepsychologischen Perspektiven« gehißt wurde und ein Teil des Tagungsprogramms davon geprägt war, fand unter dem gleichen Dach noch ein anderer Kongreß statt, der von dem Interesse an speziellen psychotherapeutischen Verfahren und deren Anwendung auf spezifische Bevölkerungsgruppen bestimmt war. Die Kongreßorganisation hatte für ein schiedlich-friedliches Nebeneinander gesorgt. Zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Linien kam es nicht. Es blieb und bleibt ein weitgehend unausgetragener Widerspruch.
Als ich vor einiger Zeit in einem psychoanalytischen Ausbildungsinstitut über die Grundprinzipien einer gemeindepsychologischen Perspektive sprach, war die Resonanz ein wohlwollender Zuspruch einer Szene, die das Gehörte nicht mit der eigenen Praxis in Verbindung brachte. Man fand es beeindruckend, daß sich bestimmte Beratungsstellen und Sozialpsychiatrische Dienste auf Stadtviertel und Bevölkerungsgruppen einlassen, mit denen in der psychotherapeutischen Einzelpraxis des niedergelassenen Psychoanalytikers normalerweise kein Kontakt besteht. Auch Projekte, die sich eher auf Stadtteilarbeit, auf Initiativ- und Selbsthilfegruppen oder auf Institutionenberatung als auf die Arbeit mit einzelnen Klienten konzentrieren, stießen durchaus auf Interesse, aber eher im Sinne des Interesses für etwas Exotisches.
Es ist ja wohl auch eher zweifelhaft, ob ein Ingenieur oder eine Anwältin, die eine Einzeltherapie aufsuchen, um ihre sehr persönlichen Identitäts- und Sinnkrisen zu bearbeiten, für eine stadtteilbezogene Initiativgruppe zu gewinnen sein werden. Oder jemand, der die extrem rationalistischen und leistungsbezogenen beruflichen Alltagserfahrungen in einem körper- und gefühlsbetonten Gestaltwochenende kompensieren will, den interessieren sicherlich keine Nachbarschaftsaktivitäten, die zur besseren Bewältigung von alltäglichen Belastungen entwickelt worden sind. Ein Bankangestellter oder eine Stewardeß, die ihre Waren den ganzen Tag mit gleichbleibender Freundlichkeit zu verkaufen haben und damit in der Fassadenhaftigkeit emotionaler Ausdrucksformen zu erstarren drohen, haben einfach andere Bedürfnisse als allein erziehende Mütter in einem Stadtviertel, das die Menschen isoliert. Vernetzungen gegen die drohende Isolation, was für die Frauen ein besonderes Bedürfnis sein kann, wird für Angehörige bestimmter Dienstleistungsberufe ohne Bedeutung sein.
Es scheinen sich professionelle Handlungsmuster in Übereinstimmung mit spezifischen Bedürfnislagen herauszubilden, die nicht mehr zusammenpassen, die kaum mehr Berührungspunkte haben, deren Sprachen nicht mehr ineinander übersetzbar erscheinen. Für diese auseinanderdriftenden Kulturen jeweils einige exemplarische Beispiele.
Ein Psychologenkollege, der alle politischen und professionellen Wechselfälle der 70er Jahre hinter sich gebracht hat und nun in den Hafen der transpersonellen Psychologie eingelaufen ist, beschreibt seine gegenwärtige Situation so:
»Es ist schon eigenartig zu beobachten, was für ein Risiko ich auf mich nahm, ohne zu wissen, wo dies alles enden würde. Das alte negative Gefühl eines möglichen Versagens lauert zwar stets hinter der nächsten Ecke, aber mein stärkeres Gefühl, 'aus der Mitte meines Seins heraus zu handeln' stellt diese verdrießlichen Geschöpfe der Dunkelheit in den Schatten. Ich werde nach meinem nächsten Kubikzentimeter Chance Ausschau halten« (zit. bei FERGUSON, 1983, S. 110).
Er hat seine Lektion gut gelernt. Ein Hauptvertreter der humanistischen und transpersonalen Psychologie, J. BUGENTAL, schreibt uns unter der Überschrift »Das Primat des Subjektiven« eine ähnliche Botschaft auf:
»Wer wirklich in seiner Subjektivität ruht und dort präsent ist, entdeckt mühelos so manches, was ihm früher verschlossen war. (...) Man wird immer mehr 'Herr im eigenen Haus' und gewinnt immer mehr Entscheidungsfreiheit, je offener das Bewußtsein wird. Meine eigene Erfahrung und die Erfahrung derer, die ich als Therapeut begleite, überzeugt mich davon, daß ein großer Teil unserer Sorgen und Nöte darauf zurückzuführen ist, daß wir als Verbannte leben, verbannt aus unserer Heimat, der inneren Welt unserer subjektiven Erfahrung. Psychotherapie hilft uns, die soziale Konditionierung zu überwinden, die uns Argwohn und Schuldgefühle gegenüber einem aus der Mitte herausgeführten Leben empfinden läßt, die nicht zuläßt, daß wir der inneren Ganzheit höchste Priorität einräumen und unsere Entscheidungen nach dem richten, was wir als unsere wahren Bedürfnisse und Wünsche in uns spüren. (...) Unsere Heimat liegt innen, und dort sind wir souverän« (1985, S. 216 f).
Die Botschaft ist eindeutig und bedarf keiner riskanten Deutung: Die Wahrheit unseres Lebens können wir nur in uns selbst finden und auf dieses Selbst muß sich die ganze therapeutische Arbeit richten.
Mit zwei anderen Zitaten wechsle ich in eine andere Kultur. Es handelt sich um Personen, die regelmäßig einen Treffpunkt besuchen, der einer Familienberatungsstelle angeschlossen ist. Eine Frau sagt in einem Gespräch:
» ... ich bin ja eigentlich über die Familienberatung zum Treffpunkt gekommen. Wir hatten Schwierigkeiten mit unserem Sohn und waren deshalb zu therapeutischen Gesprächen im 'Familienzentrum'. Als damals der Treffpunkt als offenes Angebot geplant wurde, hat mich das gleich interessiert - und nach anfänglichen Schwierigkeiten gab's dann auch einige Mitarbeiter, die einfach sagten, wenn wir Ideen hatten: 'ja, o. k., das probieren wir aus.' Und so sind dann anfangs Unternehmungen entstanden, wie mal zusammen mit einigen Familien mit dem Bus wegzufahren oder einen regelmäßigen Kinonachmittag für Kinder. Das Tolle daran war, daß da nicht lange rumdiskutiert wurde, sondern einfach Ideen angepackt und verwirklicht wurden. Für mich persönlich hat die Mitarbeit im Treffpunkt sehr viel gebracht. Die Möglichkeit, eigene Ideen wie das Kino zusammen mit anderen zu verwirklichen oder auch mal Fähigkeiten, die ich habe, anderen anzubieten, haben mich in dieser Zeit extrem verändert. Ich bin viel selbstbewußter und aktiver geworden und auch die Probleme in unserer Familie haben sich gebessert. Ich kann sagen, daß im Treffpunkt das passiert ist, was ich in der Therapie vermißt habe.«
Eine andere Stimme aus dem gleichen Kontext:
»Ich habe erfahren, daß man sich selber helfen kann bei seinen Problemen, wenn man eine kleine Hilfe bekommt, wie etwa ein Raumangebot oder Zuspruch für Aktivitäten. Am Treffpunkt sind auch andere Leute da, Menschen wie du und ich, und da kann der Betroffene auch Hilfe bekommen und sich die suchen, die er braucht. Das Gefühl: 'Mensch, ich hab' was geschafft', ist oft viel wichtiger als alle Therapie« (aus einer in Vorbereitung befindlichen Broschüre »Gemeinsam handeln«, die wir im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erarbeitet haben).
Seit einiger Zeit bin ich Mitglied in einem Gremium, das Anträge von Münchner Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten Projekten auf Förderung aus einem Fond der Stadt München zu prüfen und zu empfehlen hat. Ich lerne dabei eine ungeheuere Vielfalt von Initiativgruppen kennen, die sich mit diversen Alltagsbelastungen und spezifischen Problemlagen auseinandersetzen und eigene Wege der Bewältigung suchen, die sich häufig einen eigenen Weg unterhalb, neben und auch in Opposition zu traditionellen bürokratischen Hilfeformen suchen. Es fällt mir nicht immer leicht, meinen therapeutischen Freunden und Kollegen zu vermitteln, daß sich hier eine Kultur entwickelt, in der der therapeutische Diskurs nicht im Zentrum steht, obgleich sie den Gruppenmitgliedern in einem spezifischen Sinne auch therapeutische Hilfe vermittelt. Für mich ist die Frage noch völlig offen, ob sich hier eine neue gesellschaftliche Qualität zeigt, die in der Schweizer Alternativszene als die Idee von den »kleinen sozialen Netzen« diskutiert wird. Gemeint ist damit eine autonome Lebenskultur, die sich von den vorherrschenden Verkehrsformen, von der Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft abkoppelt und zu neuen Solidargemeinschaften führt. Zugleich sehe ich in dieser Gruppenkultur auch Anzeichen für eine defensive Schildkrötenhaltung, die sich die Illusion ihrer eigenen abgeschirmten Idealwelt aufbaut. Aus dem Kampf gegen die Strukturen einer entfremdeten Gesellschaft, der auf die Veränderung des Ganzen zielte, ist etwas völlig anderes geworden, es »beginnt nun das warme Lampenlicht der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeit, der Gruppe zu leuchten«, stellt der Soziologe P. GROSS ironisch fest und fährt dann fort:
»Im kleinen überschaubaren Bereich, gleichsam insulär, zwischen, unter und neben den sogenannten Megastrukturen, entdeckt man sie wie Edelsteine im Kehrricht. (...) Die Gruppenbewegung der 70er und 80er Jahre ist nach innen marschiert oder angetreten gegen das Große, gegen die Einsamkeit, die Isoliertheit, die Melancholie und für die Kranken, die Verrückten, die Isolierten, die Arbeitslosen, die Studenten« (1985, S. 70f.).
Dieses Nebeneinander der einzeltherapeutischen Arbeit in vielfältigsten Spielarten, von Gruppen- und Initiativarbeit, ebenfalls in einer bunt schillernden Vielfalt, läßt sich als Beleg für ein breites Marktspektrum auffassen, aus dem sich jeder das holen kann, was seinen Bedürfnissen entspricht. Diese Einschätzung wäre mir zu oberflächlich. In dem aufgezeigten Widerspruch, der sich durch dieses Spektrum zieht, wird etwas von jenen zwei Realitäten sichtbar, von denen schon die Rede war. Die therapeutische Welt mit ihren hoffnungsvollen Versprechungen für das einzelne Subjekt erfaßt ein anderes Segment unserer Gesellschaft als der Initiativenbereich, in dem wir vor allem Bevölkerungsgruppen und Professionelle finden, die an den Rand der Gesellschaft geraten sind, denen kein wohlfahrtsstaatliches Programm mehr die Vollintegration in die Arbeitsgesellschaft versprechen kann oder die bewußt auf den Weg einer solchen potentiellen Zugehörigkeit verzichten.
In dem einen Segment geht es um die therapeutische Erarbeitung von Identitätsmustern, die die Bewältigung einer auf Konkurrenz und Leistung setzenden Fortschrittsgesellschaft erlauben, die die erforderliche Flexibilität und Angstfreiheit ermöglichen und die zunehmend veraltenden und zerfallenden traditionellen Lebensformen auffangen. In dem anderen Segment geht es um die Verarbeitung von Marginalisierung und das Knüpfen von informellen Auffangnetzen, aber auch um das hoffnungsvolle Erproben von alternativen Lebensformen, die sich als Ausweg aus der als rettungslos betrachteten Krise der in den Abgrund wachsenden Fortschrittsgesellschaft verstehen.
Dieser Versuch eines Widerspruchsprofils ergibt noch keine stimmige Deutung für die gegenwärtige Situation. Er ist eher ein Beleg für die unübersichtlich gewordene Situation, in der frühere Standortbestimmungen nicht mehr ganz passen oder veraltet erscheinen. Wohin diese Widersprüche treiben, vermag uns wohl gegenwärtig auch niemand schlüssig zu beantworten. Es ist kein entzifferbarer Plan und keine Logik erkennbar, die uns sichere Prognosen erlauben würden. Nach meiner Auffassung trifft die schon eingangs zitierte Formulierung von U. BECK unsere Situation sehr gut: »Wir schlittern ... in ein neuartiges gesellschaftliches Gefüge, für das wir noch keinen Begriff und damit auch keinen Blick haben« (1985, S. 90).
An diesem gesellschaftlichen Umbau sind jedoch zwei gesellschaftliche Prozesse beteiligt, die sich herausarbeiten lassen und die sowohl Aussagen zur vorherrschenden Verarbeitung der Krisenfolgen erlauben als auch gesellschaftspolitische Steuerungsprozesse erkennen lassen. Es sind Prozesse der Individualisierung und der Spaltung der Gesellschaft. In den meisten Widerspruchsmustern, die ich skizziert habe, tauchen sie als modellierende Größen auf. Der Prozeß der Individualisierung läßt sich als eine Entwicklung beschreiben, die nicht zu trennen ist von der langen Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, der aber doch für die hinter uns liegenden Jahre noch eine eigenständige Qualität angenommen hat. Der Prozeß der Spaltung der Gesellschaft ist ein Phänomen, das sich mit der Erschöpfung des wohlfahrtsstaatlichen Programms Ende der 70er Jahre abzuzeichnen begann und jetzt der bundesrepublikanischen Gesellschaft (wie den meisten spätkapitalistischen Gesellschaften) eine spezifische Signatur gibt.
In zwei kürzlich erschienenen Heften der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift »Soziale Welt«, die normalerweise über ein breites Themenspektrum von Untersuchungen zum Bildungswesen, zur Arbeitswelt, zur Technikentwicklung etc. streut, ist mir eine thematische Verdichtung aufgefallen, die sich in Themen der folgenden Art widerspiegelt: »Individualisierung als Hoffnung und Verhängnis« (BAETHGE, 1985), »Wege zum Ich vor bedrohter Zukunft« (ROSENMAYR, 1985) oder »Zweifel am Fortschritt und Hoffen aufs Individuum« (RAMMSTEDT, 1985). Die Gesellschaftsanalytiker kommen scheinbar immer mehr in das Revier der Psychologen. Entdecken sie jetzt endlich auch das Subjekt, von dem wir immer schon wußten, daß es unser Dreh- und Angelpunkt zu sein hätte? Sie entdecken einen »Freisetzungsprozeß« des Subjektes aus traditionsbestimmten Lebensformen und -entwürfen, der die Individuen in einem Maße zur Führungsgröße der eigenen Lebensorganisation macht, wie es historisch in diesem Umfang noch nie möglich war. Und in diesem Freisetzungsprozeß stecken Risiken und Probleme von neuer Qualität, aber auch Chancen zur Realisierung der Vorstellungen und Utopien von einem Stück eigenem Leben.
Wie läßt sich dieser »Freisetzungsprozeß« näher charakterisieren? Wodurch ist er möglich geworden? Vor allem aber, wodurch unterscheidet sich diese neue Phase der Freisetzung von jenen früheren, durch die der Kapitalismus möglich geworden ist? Die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise bedeutete eine Auflösung der feudalen Abhängigkeitsverhältnisse. Die gesellschaftliche Herstellung der »freien Lohnarbeiterexistenz« hat Menschen aus ihren traditionellen Lebenszusammenhängen herausgerissen, hat sie von ihrem Grund und Boden und aus ihren Herkunftsregionen getrennt, hat gewaltige Bevölkerungswanderungen in die neuen Industriezentren in Bewegung gesetzt. Aber dieser permanente Freisetzungs- und Vereinzelungsprozeß hat nicht zu einer Individualisierung geführt, sondern mündete in der Kollektiverfahrung der Verelendung und Ausbeutung. Die gemeinsame Erfahrung der fortschreitenden Verschlechterung der Lebenslage hat zur Solidarisierung und zum Zusammenschluß der Arbeiterklasse geführt. Individualisierung war der Prozeß, durch den sich das bürgerliche Subjekt herausbildete und dieser Prozeß beruhte entscheidend auf Kapitalbesitz und dessen Vermehrung.
Der Freisetzungsprozeß, der zu jener Individualisierungswelle geführt hat, die seit den 50er Jahren durch alle gesellschaftlichen Schichten geht, hat eine wohlfahrtsstaatliche Absicherung und einen Lebensstandard zur Voraussetzung, der den Entfaltungsspielraum des einzelnen vergrößert hat und zugleich die Notwendigkeit der Solidargemeinschaft aus der existenziellen Not heraus abgebaut. Nehmen wir dafür nur drei Indikatoren. Die Lebenszeit ist um mehrere Jahre gestiegen. Die Erwerbsarbeit ist seit den 50er Jahren um mehr als ein Viertel gesunken. Und die Reallöhne sind erheblich gestiegen. Entscheidend hat sich das Verhältnis von Arbeits- zur Reproduktionszeit verändert. Mehr verfügbare finanzielle Möglichkeiten können in einer gewachsenen Freizeitwelt verbraucht werden. Hiermit ist nicht eine Verbesserung von Lebensqualität behauptet, sondern zunächst nur das Faktum beleuchtet, daß die kollektiv erreichte Absicherung von Risiken und die veränderte Reproduktionssituation die Klassenbindungen gelockert haben. Behauptet ist ebenso wenig ein Abbau sozialer Ungleichheit, diese läßt sich in den relativen Einkommens- und Besitzunterschieden als fast unverändert nachweisen. Festgestellt ist eine Niveauverschiebung, die der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung eine Existenzbasis gesichert hat, die nicht mehr von Not und Elend bestimmt ist.
Eingebettet in und abgepuffert durch diese Ressourcen der spätkapitalistischen Wohlfahrtsstaaten hat die Dynamik von Arbeitsmarktprozessen zu einem tiefgreifenden Individualisierungsschub geführt, zu einem »sozialen und kulturellen Erosions- und Evolutionsprozeß von beträchtlicher Reichweite« (BECK, 1983, S. 42). Dieser spezifische Freisetzungsvorgang wird von BECK als »Arbeitsmarkt-Individualisierung« bezeichnet, die sich »im Kreislauf von Erwerb, Anbietung und Anwendung von Arbeitskompetenzen entfaltet«. Auf drei Dimensionen, die durch ihren unmittelbaren Arbeitsmarktbezug gekennzeichnet werden können, läßt sich dieser Freisetzungsprozeß aufzeigen:
Der Ausbau formaler Bildungsprozesse hat die Herauslösung aus traditionellen Orientierungen, Lebensstilen und Denkmustern erheblich beschleunigt. Die Verlängerung institutioneller Bildungsprozesse in den vorschulischen Bereich hinein und die Ausweitung schulischer Bildung hat den familiären Einfluß und den des Herkunftsmilieus erheblich geschmälert. Die permanenten Selektionsprozesse des Bildungssystems und die damit genährten Aufstiegsorientierungen fördern die Herausbildung von Einzelsubjekten, die Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen suchen. Je geringer diese Chancen werden, je mehr sie zu einem Nadelöhr werden, durch das nur noch wenige einzelne durchkommen, desto mehr entstehen individualistische Muster.
Auf dem Arbeitsmarkt wird durch soziale und geographische Mobilitätsprozesse eine spezifische Besonderung von Lebensläufen erzwungen. Der Bevölkerungsanteil von Menschen, die noch an dem gleichen Ort leben und arbeiten, an dem sie geboren wurden oder gar die Eltern- oder Großelterngeneration gelebt hat, wird immer kleiner. Auch innerhalb einer Arbeitsbiographie werden Arbeitsplatz-, Orts- und Berufswechsel immer häufiger. Langfristige nachbarschaftliche, freundschaftliche und berufliche Bindungen werden dadurch erheblich erschwert.
»Die Lebenswege der Menschen verselbständigen sich gegenüber den Bedingungen und Bindungen, aus denen sie stammen oder die sie neu eingehen, und gewinnen diesen gegenüber eine Eigenständigkeit und Eigenrealität, die sie überhaupt erst als ein persönliches Schicksal erlebbar und identifizierbar machen« (BECK, ebd., S. 46).
Ein Prozeß, der die Vereinzelung und gegenseitige Abschottung entscheidend befördert, ist die Konkurrenz, in die der Arbeitsmarkt die Menschen zueinandersetzt. Der Konkurrenzdruck ist mit dem Ausbau des Bildungssystems, der gleichzeitig wachsenden Arbeitslosigkeit und der Entwertung von Bildungsabschlüssen gewachsen.
»Konkurrenz beruht auf Austauschbarkeit und setzt damit den Zwang frei, diese Austauschbarkeit durch Betonung und Inszenierung der Besonderheit, Einmaligkeit und Individualität der eigenen Leistung und Person zu unterlaufen und zu minimieren« (ebd., S. 46).
Das Spektrum der Bedingungen und Konstellationen, die diesen Freisetzungsprozeß unterstützen und beschleunigen, läßt sich noch durch weitere Aspekte erweitern, die zum Teil von den drei genannten Dimensionen abhängig sind:
Die wohlfahrtsstaatlichen Programme (Kranken-, Sozial- oder Arbeitslosenversicherung) basieren auf der Individualisierung von Risiken und sichern diese Risiken auch nur aufgrund der Zurechnung zu einer bestimmten Person ab. In diesem sozialpolitischen Sicherungs- und Steuerungssystem vollzieht sich eine spezifische Sozialisation der Subjekte, die als »sozialpsychologische Infrastruktur« des sozialstaatlich durchwirkten Kapitalismus bezeichnet wurde (RÖDEL und GULDIMANN, 1978). Sozialstaatliche Leistungen können nur dann erwartet und eingeklagt werden, wenn die Staatsbürger Defizite und Probleme sich selbst zurechnen. Kollektive Betroffenheit von spezifischen Problemen und eine auf die strukturelle Ursache solcher Probleme zielende Intervention sind als sozialpolitische Definitions- und Handlungsmuster nicht möglich.
Alte Wohngebiete und die in ihnen über Generationen gewachsenen Bindungen verschwinden immer mehr aus dem Bild einer modernisierten Republik. Mit diesen Wohnformen verschwinden auch dichte Netzwerkbeziehungen und subkulturelle Milieus, in denen kollektive Erfahrungen und spezifische Lebensmuster weitervermittelt werden könnten. Für die neuen großstädtischen Wohngebiete sind gelockerte Bekanntschafts- und Nachbarschaftskreise typisch oder auch die isolierende Abgrenzung voneinander.
Lebensweltlich erworbenes Erfahrungswissen und dessen Weitergabe oder kollektive Deutungsmuster verlieren zunehmend an Orientierungsfunktion. In einer individualisierten Alltagskultur erscheinen sie schnell antiquiert. Immer größere Bedeutung erlangen massenmedial vermittelte Interpretationsfolien. Für Kinder erlangen sie immer früher den Status des Cicerone durch ihre Welt. Analysen der Massenmedien zeigen, daß sie immer stärker die Aufgabe übernehmen, Orientierungsleitfäden für den Alltag zu vermitteln. Psychologische Deutungsmuster durchwirken diese Leitfäden immer stärker und befördern den Individualisierungstrend auf ihre Weise.
Quer zu den arbeitsmarktbezogenen Freisetzungen haben sich durch die reale Infragestellung der klassischen Rollenverteilung der Geschlechter weitere Auflösungsprozesse von Sozialformen ergeben. Die Versuche vieler Frauen, für sich einen eigenen Weg zu finden, der die Option auf Beruf, Kinder und Partnerschaft beinhaltet, hat in die private Welt vieler Menschen eine experimentelle Offenheit gebracht, die nach keinem traditionellen Standardmuster kleinfamillärer Lebensformen gemeistert werden kann. Die Folge ist eine »Pluralisierung der Familienform«, »eine Vielfalt von Lebensformen, -bahnen, -verhältnissen und -irrgärten, die mit dem Begriff Familie so wenig einzufangen ist, wie Ameisen mit einem Schmetterlingsnetz« (BECK, 1985, S. 93).
Die Folgen dieser Freisetzungsprozesse gehen für die Subjekte weit über die Veränderungen äußerer Lebenskonturen hinaus. Sie fordern eine veränderte innere Ausstattung, um durch eine sich partikularisierende Welt und die ständig, geforderten situativen Umstellungen ohne Zerfall der Person durchzukommen. Stabile Handlungsorientierungen, Koordinaten, die für ein Leben lang sichere Bezugspunkte liefern könnten oder das Anknüpfen an Modellen aus der eigenen Elterngeneration sind kaum mehr möglich. Die Subjekte werden zum »Dreh- und Angelpunkt der eigenen Lebensführung« (BECK, 1985, S. 88), der einzelne muß lernen, »sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu begreifen« (BECK, 1985, S. 59). Die Biographien lösen sich immer stärker aus vorgegebenen Rollenmustern und Schablonen, sie werden entscheidungsoffener, sie müssen von den Subjekten selbst gestaltet werden.
»Wir sind darauf angewiesen, die 'Drehbücher' unseres individuellen Lebens selber zu schreiben, die 'Landkarten' für unsere Orientierung in der Gesellschaft selber zu zeichnen, über unsere Biographie, unsere Persönlichkeit, unser Selbstverständnis selber 'Regie zu führen' Unser Tages- und Lebenslauf ist gleichsam eine unstete und manchmal auch unsichere 'Wanderung', die wir so durch eine Vielfalt von Lebens-Welten unternehmen. Wir modernen Menschen sind nicht mehr 'zu Hause' in einem stimmigen Sinn-Kosmos, wir ähneln eher Vagabunden (oder allenfalls Nomaden) auf der Suche nach geistiger und gefühlsmäßiger Heimat« (HITZLER, 1985, S. 349).
Der Individualisierungsprozeß, der im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft von Anbeginn angelegt war, hat in seiner Dynamik mittlerweile unsere Gesellschaft ganz durchdrungen und alle gesellschaftlichen Schichten erfaßt. Durch den gegenwärtig sich vollziehenden neuen technologischen Rationalisierungsschub scheint der Freisetzungsprozeß an Durchschlagskraft noch zuzulegen. Der Mikrochip ist das Symbol für ein neues Niveau gesellschaftlicher Arbeit und mit ihm vollzieht sich ein Umbruch, der das ganze gesellschaftliche Gefüge erfaßt und gerne als »Modernisierung« bezeichnet wird. Er betrifft nicht nur veränderte Formen des Arbeitens, sondern hat Auswirkungen auf Lebensstile und normative Orientierungen und erfaßt die Sozialcharaktere und Identitätsmuster. BECK spricht von einem Prozeß der »Innenmodernisierung«, an dem das Instrumentarium der entwickelten Psychokultur seinen Anteil hat:
»In den Ruinen enttraditionalisierter Lebensformen und Lebenswelten breitet sich die Identitätskrise wie eine Epidemie aus. Diese wird nicht in dem Ausbruch aus der Passivität des Man in die Aktivität des Ich produktiv durchschritten, sondern öffnet das Innen der Menschen dem expansiven Zugriff florierender Erlebnisindustrien, Religionsbewegungen und politischer Doktrinen. Spaß und Freude, Schmerz und Tränen, Erinnerung, Phantasie und die Hingabe an den Augenblick, Hören, Sehen und Fühlen, werden aus ihrer noch verbliebenen traditionalen Ich-Zuständigkeit und Spontaneität herausgelöst und unter marktfördernden Moden wechselnder Innenstandardisierungen unterzogen« (BECK, 1985, S. 111).
Wichtig scheint mir, diesen soziokulturellen und psychosozialen Veränderungsprozeß nicht nur als Verfallsgeschichte zu beschreiben, in der bewährte und liebgewordene Lebensformen unterminiert und zermahlen werden. Er eröffnet auch die Chance für neue Lebensformen. Der tiefgreifende gesellschaftliche Transformationsprozeß führt zu gesellschaftlicher Desintegration und diese wiederum erweitert die Spielräume für Individualität, für Traditionsbrüche, die neue Lebensperspektiven eröffnen können. Die Subjekte verfügen über gewachsene Chancen, sich endlich eigene Wege zu wählen, sich gegenüber bornierten Nachbarn und umklammernden Familienmitgliedern ignorant zu zeigen und sich mit anderen Menschen zu assoziieren, mit denen sie gemeinsam Interessen verbinden. In Beziehungsnetzen, die auf einem solchen Hintergrund entstanden sind, entwickeln sich ungleich mehr Chancen für unterschiedliche Lebensentwürfe, für die Emanzipation aus zugeschriebenen Identitäten. Der hier entstehende Handlungsspielraum ermöglicht Beziehungen, die nicht nur durch starre Rollen und statusbestimmte Herrschaftsformen vordefiniert sind. Diese »Befreiung« hat aber auch ihren Preis. Das ständige Aushandelnmüssen ist anstrengend, ist ein kaum zu befriedender Krisenherd, jedenfalls solange keine neuen kollektiven Sinnhorizonte entstanden sind. Seine Bewältigung erfordert bei den Subjekten psychosoziale Ressourcen, die längst nicht immer vorhanden sind.
Von Krisen ist der Kapitalismus mit schöner Regelmäßigkeit geschüttelt worden, sie gehören geradezu gesetzmäßig zu seiner Entwicklungsdynamik. Befinden wir uns in einer solchen Krise mit erhöhter Arbeitslosigkeit, aber auch mit der Perspektive, daß dieser negativen Konjunkturschwankung auch wieder ein neuer Aufschwung folgen wird? Das besondere der gegenwärtigen Strukturkrise läßt sich auf den einfachen Nenner bringen: Der Aufschwung findet statt, aber er gilt nicht für alle.
Das klassische Krisenablaufmuster hat offensichtlich seine Gültigkeit verloren. Mit einer konjunkturellen Wiederbelebung wird der Arbeitslosensockel nicht weggeschmolzen, sondern sie beginnt erst oberhalb einer spezifischen gesellschaftlichen Schließungsgrenze neu gewonnene Ressourcen zugänglich zu machen. Der Arbeitsmarkt weist eine sich vertiefende Spaltung und Segmentierung auf. Diese Segmentierung geht weit über die diversen Randgruppen hinaus, die auch in früheren Perioden der Hochkonjunktur kaum in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Heute trifft diese Aufspaltung etwa ein Drittel der Erwerbsbevölkerung. »Das ausgegrenzte Drittel wies pro Kopf ca. 2,6 Arbeitslosigkeitsperioden auf und war im Durchschnitt 11,4 Monate, also ca. ein Jahr arbeitslos« (HANESCH, 1986, S. 42).
Die Ausgliederungsrisiken wachsen für die sogenannten Problemgruppen des Arbeitsmarktes und zugleich sinken ihre Chancen auf Eingliederung bzw. Wiedereingliederung. Die Problemgruppen sind insbesondere Frauen, Ausländer, ältere Arbeitnehmer, Behinderte und Jugendliche. Diesem Selektionsprozeß, der sich scheinbar naturwüchsig vollzieht, der als unvermeidliche Folge eines technologischen Modernisierungsprozesses betrachtet wird, wird durch keine beschäftigungs- oder sozialpolitische Gegenstrategie die Spitze genommen. Nach einer Periode, die unter Losungen wie Beschäftigung für alle und Chancengleichheit stand, schichtet sich das gesellschaftliche Gefüge neu. Es entstehen neue Hierarchien:
»oben diejenigen aus den mittelständischen Berufen mit Zukunft, die Minderheit der Arbeitenden mit festen, sozialstaatlich gesicherten Jobs, dann die breite Zahl jener, deren Arbeit sozial weniger gesichert ist, als Teilzeitarbeit kaum mehr den Lebensunterhalt für eine Familie, ja, oft nicht einmal fürs eigene Auskommen hergibt, schließlich diejenigen, die keine Arbeit bzw. kaum oder nur sehr gelegentlich Aussicht haben, eine solche zu bekommen. Wir wissen heute bereits, wo vor allem die Verlierer dieser Entwicklung zu finden sein werden: bei den Frauen und den Alten, die heute entlassen werden, denjugendlichen, die in ein geschlossenes System gar nicht mehr hineinkommen, den auf irgendeine Weise behinderten Menschen« (EVERS und OPIELKA, 1985, S. 32).
Dieser gesellschaftliche Umbau wird ideologisch begleitet von der Wiederbelebung neokonservativer Werte und Haltungen (vgl. DUBIEL, 1985). Die Grundprinzipien des sozialdemokratischen Gesellschaftsmodells:
»wie Fortschritt, Gleichheit, Solidarität, kollektive Wohlfahrt und materielle Sicherheit haben kaum noch Konjunktur. Statt dessen gelten eher wieder Leistung, individuelles Durchsetzungsvermögen, Ellbogencleverness, Privatismus, Familie, Opfer und Moral. Einer sich spaltenden, in konkurrierende Statusgruppen und ausgegrenzte Zonen zerfallenden Gesellschaft werden die entsprechenden Weltbilder verpaßt: bestehend aus einer widersprüchlichen Mischung von individualisiertem Leistungsmythos und autoritärem Sicherheitsbedürfnis, Gewaltbereitschaft und Angst, kollektiver Aggressivität und privatistischer Resignation, Pseudoliberalismus und stumpfer Moral, Single-Kultur und synthetischer Familienidylle. Nationalismus wird wieder brauchbar als Ersatz für den verschwundenen materialen Konsens der Gesellschaft, die sich vertiefenden sozialen Spannungen müssen mit dem Kitt alt-neuer Feindbilder verkleistert werden« (HIRSCH, 1985, S. 87).
Wie uns O. NEGT gezeigt hat, ist die Spaltung der Gesellschaft nicht nur eine analytisch zu fassende Kategorie. Vielmehr bilden sich zwei Realitäten heraus, die nicht für einander offen sind, die sich gegenseitig abschließen. Mir ist das nie so deutlich geworden wie bei einem Gespräch, das ich kürzlich mit einem erfolgreichen Kulturmanager hatte. Er gehört unzweifelhaft zu dem gesellschaftlichen Kern, obgleich vor einigen Jahren durchaus unklar war, ob er den Schritt dorthin würde schaffen können. Sein Assistentenvertrag lief endgültig aus. Für einen 45jährigen, der keine Aussicht auf eine Professur hatte, war das durchaus eine prekäre Situation. Aber er hat dann eine wichtige Stelle in der kommunalen Kulturpolitik bekommen. Natürlich hat er sich das verständlicherweise auf sein persönliches Konto im Sinne internaler Attribution geschrieben. Für alle die, die den Sprung nicht schaffen, hat er keinerlei Verständnis. Die strengen sich halt nicht genügend an, die sind nicht bereit, sich voll auf verantwortliche Aufgaben einzulassen. Als Vorgesetzter einer Reihe von städtischen Angestellten sieht er sein Weltbild beständig bestätigt. Da gibt es die Sekretärin, die sich für ihren Chef zerreißt, die für ihn das Modell abgibt für eine Arbeitshaltung, die auch unter den miesesten Arbeitsmarktbedingungen immer gebraucht werden wird. Und da gibt es andere Beschäftigte, die nur ihren hedonistischen Vorteil im Auge hätten und die sich nicht wundern dürften, daß man sie irgendwann einmal nicht mehr brauchen könnte. Für diesen hochgebildeten Bildungsbürger gibt es noch immer zu viele Hängematten, in die sich Leute zu gerne fallen lassen würden, anstatt sich voll einzusetzen. Mein Versuch, ihm etwas von jener zweiten Realität zu vermitteln, die ihm so ganz und gar fremd war, scheiterte kläglich. Die Situation psychiatrischer Patienten erreichte ihn nur durch den Filter karitativer Mildtätigkeit. Er zeigte Hochachtung für die psychosozialen Praktiker, die sich dieser Gruppe zuwenden, aber diese Haltung hat nichts mit einem Normalisierungsprinzip zu tun.
Das persönliche Fadenkreuz meines Gesprächspartners war ein Individualismus auf der Wolke des persönlichen Erfolgs. Er zeigte eine hohe Bereitschaft zu subtilen psychologischen Analysen, die sich auf sein eigenes Identitätsmanagement bezogen. In die Realität jener Menschen, die trotz hohem persönlichen Engagement keinen Weg in den gesellschaftlichen Kern finden können, findet dieser psychologische Habitus keinen Zugang mehr. Hier verknüpfen sich die beiden beschriebenen gesellschaftlichen Prozesse: In beiden Realitäten, die durch die innergesellschaftliche Spaltung entstehen, stehen individualistische Verarbeitungsmuster im Zentrum. Auch den von der Massenarbeitslosigkeit betroffenen Menschen wird diese Problemlage als
»persönliches Schicksal aufgebuckelt. (...) Die Betroffenen müssen mit sich selbst austragen, wofür armutserfahrene, klassengeprägte Lebenszusammenhänge entlastende Gegendeutungen, Abwehr- und Unterstützungsformen bereithielten und tradierten« (BECK, 1986, S. 197).
Wenn wir die individualistischen Freisetzungs- und die gesellschaftlichen Aufspaltungsprozesse als Interpretationsmöglichkeiten für die gegenwärtige soziale Umbruchsituation und die mit ihr verbundenen aufreißenden Widersprüche nehmen, dann wird das Nebeneinander von hoffnungsvollen Zukunftsdeutungen und resignativer Apathie, von Wertewandel und den Wiederbelebungsversuchen konservativer Werte, von der Erprobung neuer Lebensformen und der Verzweiflung an dem, was nicht mehr lebbar ist, verständlicher. Es hängt so viel ab von dem jeweiligen eigenen Realitätsspektrum, in dem wir unsere Erfahrungen machen. Es hängt so viel von unseren persönlichen und sozialen Ressourcen ab, ob wir den Erosionsprozeß in den traditionellen Lebensformen und Identitätsmustern als Chance für neue experimentelle Suchbewegungen wahrnehmen können oder erst einmal nur als Verlusterfahrung, auf die wir mit Ängsten reagieren oder mit Verhärtungen und Panzerungen.
Wir befinden uns in einer Phase, in der eine grundlegende technologische Modernisierung auf die Tagesordnung gebracht wird. Sie beginnt zu wirken und den Alltag vieler Menschen umzugestalten. Gleichzeitig wachsen die Zweifel an dem Fortschrittsdenken, aus dem heraus die Umgestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen zwingend gefordert erscheinen. Die Folgeprobleme einer ungebremsten industriellen Modernisierung sind für niemanden mehr zu übersehen und für immer mehr Menschen scheint der Preis zu hoch, den ein Weitermachen nach den bisher praktizierten Prinzipien fordern muß. Es hat sich ein Bewußtsein für Bedrohungen und Belastungen herausgebildet, die mit den konventionellen Problemlösungsstrategien nicht mehr bewältigt werden können. Es hat sich eine Sensibilisierung der öffentlichen Problemwahrnehmung für mindestens die folgenden Krisenherde herausgebildet:
-
»Die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen durch fortschreitende Umweltzerstörung und -vergiftung (ökologische Problematik);
-
die Gefährdungen des menschlichen Lebens durch einen wahrscheinlicher werdenden atomaren Konflikt (Sicherheitsproblematik);
-
die beschleunigte Zersetzung gewachsener Sozialzusammenhänge, die rasche Auflösung tradierter sowie die konflikthafte Freisetzung neuer Orientierungs-, Wert- und Handlungsmuster durch die fortschreitende Industrialisierung des gesamten Lebens (Lebenswelt- und Sinnproblematik);
-
die drastische Verschärfung des Elends in weiten Teilen der 'Dritten und 'Vierten Welt (als Folge weltmarktabhängiger industrieller Modernisierungsstrategien 'Nord-Süd-Problematik'« (BRAND, BÜSSER und RUCHT, 1983, S. 28).
An all diesen Modernisierungsrisiken und Bedrohungen sind in den vergangenen Jahren Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen entstanden, die eine große Vielfalt in die politische Kultur der Bundesrepublik gebracht haben. In der Geschichte der Bundesrepublik dürfte es noch nie einen so hohen Grad der Politisierung gegeben haben. Wenn wir von den großen Massendemonstrationen der vereinigten Friedensinitiativen im Herbst 1983 absehen, so wird dieses Potential der neuen Bewegungen weniger in machtvollen Großdemonstrationen sichtbar, sondern in der vielgestaltigen Landschaft von Initiativen, selbstorganisierten Projekten und Selbsthilfegruppen. Diese Gruppen beziehen ihre Identität nicht mehr aus den klassischen politischen Formationen und gesellschaftlichen Konflikten, sie definieren sich nicht aus der Tradition der Arbeiterbewegung wie es noch Teile der Studentenbewegung getan haben. Sie richten sich teilweise auf die Erprobung von neuen Lebensformen als Ersatz für die traditionellen Muster, die nicht mehr tragen und binden. Sie beziehen sich auf Probleme der Erziehung, des Wohnens und Arbeitens. Aus meiner Sicht hat sich die lebendigste Vielfalt aus der Frauenbewegung ergeben. Der Erosionsprozeß, in den geschlechtsspezifische Identitätsmuster geraten sind und der vor allem das Modell der Kleinfamilie erfaßt hat, hat zu immer neuen Suchbewegungen für einen lebbaren Alltag geführt und experimentelle Umgangsweisen gefördert.
Es ist sicherlich schwer, über diesen Bereich kleiner und kleinster Gruppen und Initiativen den Überblick zu gewinnen und sicherlich ist es deshalb noch problematischer, ihr politisches Gewicht taxieren zu wollen. Erkennbar scheint mir aber eine Tendenz, Autonomie gewinnen und verteidigen zu wollen, vor allem gegenüber den verwaltungsmäßigen und politischen Vereinnahmungs- und Anbindungsversuchen. Statt dessen bilden sich »Formen basisnaher und selbstverwalteter Organisationen« heraus (HABERMAS, 1985, S. 155). In der Terminologie von C. OFFE (1984) vollzieht sich Politik nicht nur in der Arena der politischen Eliten, die den Staatsapparat zu steuern versuchen oder von ihm gesteuert werden. Es gibt natürlich die zweite Arena der Interessengruppen, Verbände und Wirtschaftsvertretern, die den politischen Spielraum für sich zu nutzen versuchen und ihre politischen issues auf die politische Tagesordnung zu setzen versuchen.
Und schließlich gibt es die Arena, in der sich politische Kultur in der Auseinandersetzung mit zentralen alltäglichen Bedürfnissen herausbildet, die ein filigranes Netz von Verständigung ausbildet. Um diese dritte Arena geht es, wenn wir über soziale Bewegungen reden. HABERMAS hat die Themen und Strukturen dieser dritten politischen Arena zu fassen versucht:
»Es geht um die Unversehrtheit und Autonomie von Lebensstilen, etwa um die Verteidigung traditionell eingewöhnter Subkulturen oder um die Veränderung der Grammatik überlieferter Lebensformen. ( ... ) Diese Kämpfe bleiben meist latent, sie bewegen sich im Mikrobereich alltäglicher Kommunikation, verdichten sich nur dann und wann zu öffentlichen Diskursen und höherstufigen Intersubjektivitäten. Auf solchen Schauplätzen können sich autonome Öffentlichkeiten bilden, die auch miteinander in Kommunikation treten, sobald das Potential zur Selbstorganisation und zum selbstorganisierten Gebrauch von Kommunikationsmedien genutzt wird. Formen der Selbstorganisation verstärken die kollektive Handlungsfähigkeit ... « (1985, S. 159f.).
Ich sehe die Gefahr, die Bedeutung dieser neuen sozialen Formen zu überschätzen, ihnen mehr Hoffnungen aufzuladen, als sie tragen können. Sie werden nicht die Probleme bewältigen können, die in den beiden anderen politischen Arenen produziert werden. Es wird darauf ankommen, das Politisierungspotential dieser Initiativen und Bewegungen in den anderen Arenen sichtbar zu machen und dort auch abzusichern. Die Projekte, die neue Lebens- und Arbeitsformen erproben, brauchen Ressourcen aus staatlichen Fonds. Es gilt exemplarisch sichtbar zu machen, daß es Alternativen zu jenen Krisenstrategien gibt, die sich in geballter Anstrengung auf die Wege fixieren, die zu der Krise geführt haben. Für uns psychosoziale Professionelle sehe ich in der Kultur von Initiativen und Projekten vor allem den Ansatz zur Wiedergewinnung kollektiver Handlungsfähigkeit, die die hoffnungsvollste Antwort auf den Isolationismus freigesetzter Individuen darstellt.
Die von mir angerissenen Ausschnitte aus einer widersprüchlichen Gegenwartssituation lassen sich auch durch die vorgenommenen Deutungsversuche nicht auf einen stimmigen Nenner bringen. Klar dürfte geworden sein, daß die gesellschaftlichen Koordinaten und unsere daran festgehakten begrifflichen Verständigungsformen und Erklärungsmuster in Bewegung geraten sind. Nicht alles, was sich da bewegt, ist als Verfallsgeschichte zu beschreiben. Wir befinden uns nicht nur in einer Erschöpfungskrise, die uns alle Hoffnungen nimmt. Aber die zum Teil aufkeimenden neuen Hoffnungen haben noch nicht so klare Konturen, daß wir uns ihnen so ganz anvertrauen könnten. Es bleibt eine Mischung von Irritationen und dem vorsichtig tastenden Blick für Neues, von dem wir meist nicht so genau wissen, ob es nicht die modische Verkleidung des Alten ist. In einer solchen Situation ist es von besonderer Bedeutung, das widersprüchliche Feld nicht auf zu einfache Formeln zu bringen, die alles irgendwie stimmig machen, die uns die Belastungen und Orientierungskrisen ersparen könnten, die mit Widersprüchen notwendigerweise verbunden sind. HABERMAS hat unsere gegenwärtige Situation so treffend mit »neuer Unübersichtlichkeit« (1985) überschrieben und nichts spricht im Augenblick dafür, daß sich eine neue Klarheit in allernächster Zeit ergeben könnte.
In einer solchen Situation sehe ich die Gefahr durch die Versuchungen aller möglichen Varianten einer neuen Einfachheit. Die uns allseits angepriesenen Paradigmen, die verkündeten Transformationen in ein neues (goldenes) Zeitalter oder auch die bescheideneren Verlockungen einer »neuen Fachlichkeit« gehören für mich zu diesen Vereinfachungen. Mir fällt nur ein ehrwürdiges Konzept unserer Disziplin ein, wenn ich begrifflich zu fassen versuche, was wir gegenwärtig brauchen: »Ambiguitätstoleranz« (FRENKEL-BRUNSWIK, 1949 / 50), sich Widersprüchen gedanklich stellen, heißt das, sich nicht vorschnell auf eine Seite ziehen zu lassen, sie geduldig zu erkunden, um das, was durch sie in Bewegung kommt, auch wirklich erkennen zu können. Ambiguitätstoleranz verträgt sich aber durchaus mit dem Wunsch, etwas tun zu wollen, etwas voranzubringen. In einigen Punkten möchte ich abschließend Perspektiven für den psychosozialen Bereich und einige politische Konsequenzen andeuten, die in der gegenwärtigen Krisensituation erforderlich erscheinen.
Der gesellschaftliche Transformationsprozeß, der immer mehr Menschen »freisetzt« und zu gesellschaftlicher Desintegration führt, erweitert die Spielräume für Individualität. Traditionsbrüche können neue Lebensperspektiven eröffnen, die von den Subjekten selbst gestaltet werden können. Der sich vergrößernde Handlungsspielraum ermöglicht neue soziale Beziehungen, die nicht durch starre Rollenmuster vordefiniert sind. Sie können ausgehandelt werden. Zugleich bedeutet dieser Freisetzungsprozeß den Verlust lebbarer Formen für den Alltag, die zunehmende Krisenhaftigkeit von Identitätsbildungsprozessen und zunehmende Vereinzelung und Isolation. Die psychosoziale Praxis liefert dafür beständiges Anschauungsmaterial, sie zeigt uns die Kostenseite dieser Freisetzung. Für die positive Nutzung der gewachsenen individuellen Spielräume reichen oft die psychosozialen Ressourcen nicht aus oder es gibt auch die »Furcht vor der Freiheit«. Wir müssen unsere Praxis an dem Kriterium messen, ob es uns gelingt, eine lebbare Vermittlung der beiden Pole Individualität und neue solidarische Lebensformen zu unterstützen. Eine Psychologie, die auf den Individualitätspol alleine setzt, arbeitet der Psychokultur zu, die einen zur Lebensform erhobenen Narzißmus auslebt. Die andere aktuelle Gefahr sehe ich in dem kollektiv-autoritären Infantilismus der Psychosekten, die den Pol einer emanzipatorischen Subjektivität eliminieren. Fördern sollten wir alle Versuche der Selbstorganisation, die die Chancen für neue kollektive Handlungsmöglichkeiten erschließen.
Die innergesellschaftliche Spaltung zieht ihren Riß mitten durch das psychosoziale Handlungsfeld. Psychosoziale Praktiker haben mit Menschen aus den zwei beschriebenen sozialen Realitäten zu tun und sie und ihre Institutionen scheinen sich entweder in der einen oder anderen Realität anzusiedeln. Auf der einen Seite gibt es eine anhaltende Nachfrage jener Menschen, die zum »produktiven Kern« der Gesellschaft gehören und ihre Identitätsprobleme und Ängste angesichts eines steigenden individuellen Profilierungszwanges und veränderter Arbeitsbedingungen bearbeiten wollen. Sie haben genügend finanzielle Ressourcen, um sich auf dem Markt der Psychowaren auch die exquisitesten Angebote leisten zu können. Auf der anderen Seite hat psychosoziale Praxis mit all jenen zu tun, für die Reintegrationsmöglichkeiten in den gesellschaftlichen Kern immer unwahrscheinlicher werden. Eine Kultur der Ausgrenzung und Demoralisierung hat sich entwickelt und psychosoziale Praktiker, die in diesen Feldern arbeiten, drohen teilweise zu Ausgrenzungsfunktionären zu werden. Für viele Kollegen, die in der Psychiatrie, in Sondereinrichtungen oder im Bereich der Arbeitsverwaltung arbeiten, werden die Möglichkeiten für erfolgreiche Normalisierung immer geringer. Haben die psychosozialen Professionen eine Chance zur Überwindung jener scheinbar naturwüchsig entstehenden Kultur der Spaltung und Ausgrenzung beizutragen? Augenblicklich scheint sehr viel dagegen zu sprechen.
Wir reproduzieren professionsintern gegenwärtig verschiedene Aufspaltungen bzw. vertiefen sie noch. Über den privaten Ausbildungsmarkt versuchen sich Eliten zu etablieren, die hinter sich den Zugang zu den erreichten Finanzierungsquellen erschweren. Die Hochschulen versuchen einen eigenen Weg der Elitenbildung zu gehen. Es dürfte nicht schwerfallen, die klinischen Psychologen in eine nicht allzu große Gruppe von Privilegierten und dem größer werdenden Heer der Habenichtse aufzuteilen. Auch der Zustand der Verbände, deren Politik gegen eine Kultur der Spaltung gerichtet war, liefert ebenfalls kaum Gründe für eine optimistische Lageeinschätzung. Aus den engen professionellen Ressourcen wird sich keine erfolgreiche Gegenbewegung entwickeln können. Ich sehe einzig in den neuen sozialen Bewegungen ein Potential, das gegen die Vertiefung der Spaltung arbeitet. Ihre zentralen Themen wie Frieden, Ökologie oder die Suche nach neuen Definitionen für die Geschlechter- und Altersrollen sind ihrer Idee nach nicht aufspaltbar. Die gemeinsame Arbeit an diesen Themen in dezentralen Gruppen oder in überregionalen Zusammenschlüssen (wie beispielsweise auch in den psychosozialen Verbänden) könnte dazu beitragen, die sich ausweitende Kluft zu überwinden.
In den Gemeinden und Regionen, in denen wir leben und arbeiten, müssen wir uns für die Förderung von selbstorganisierten Projekten, Initiativen und Selbsthilfegruppen einsetzen. Es scheint wichtig, daß diese Förderung der Kontrolle der Verwaltungen und Wohlfahrtsbürokratien entzogen ist. Notwendig ist die Vergrößerung finanzieller und organisatorischer Autonomie. Das Modell der Schaffung regionaler Fonds wird gegenwärtig in einigen Großstädten erprobt. Die Verschiedenartigkeit dieser Modelle zeigt, mit welch unterschiedlichen politischen Interessen sie verbunden sind. Unübersehbar ist der Versuch neokonservativer Sozialpolitik, Initiativen und Projekte als Mittel zur Entlastung staatlicher Leistungen zu mißbrauchen. Es gibt jedoch auch Ansätze, in denen die experimentelle Erprobung neuer Wege ermöglicht wird und ein hohes Maß der Beteiligung der Initiativen an der Verteilung von Ressourcen eingeräumt wird. Es wäre sicherlich eine Illusion, sich auf diesem Wege eine Lösung der gegenwärtigen Arbeitsmarktprobleme zu versprechen. Es kann nur darum gehen, in exemplarischer Weise neue Umgangsweisen mit den Folgen der gesellschaftlichen Strukturkrise aufzuzeigen. Fünf oder zehn erfolgreiche Alternativprojekte für psychisch Kranke stellen keine gesellschaftliche Lösung für die wachsenden Gettos ehemaliger Patienten dar, aber sie können zu einem Symbol dafür werden, daß neue Formen des Miteinanderarbeitens und -lebens möglich sind, die auch für die normale Erwerbsbevölkerung Alternativen aufzeigen könnte.
Mit dem letzten und den beiden folgenden Punkten betreten wir den politischen Raum, in dem gesamtgesellschaftliche Perspektiven und Forderungen zur Debatte stehen, ohne die aber auch eine Überwindung der Strukturkonflikte im psychosozialen Arbeitsfeld nicht denkbar sind.
Sie betreffen zwei Forderungen, die sinnvollerweise nur im Zusammenhang gesehen werden können: Das Recht auf Erwerbsarbeit für jede und jeden bedeutet eine grundlegende Umverteilung der vorhandenen Arbeit und es bedeutet vor allem eine radikale allgemeine Arbeitszeitverkürzung (z. B. das utopisch erscheinende Ziel einer 20-Stunden-Normalerwerbswoche). Wie Untersuchungen zeigen (vgl. z. B. v. KLIPSTEIN und STRÜMPEL, 1985), gibt es in der Bevölkerung eine große Bereitschaft zu einer Umverteilung der Erwerbsarbeit. Da eine Halbierung der Arbeitszeit um die Hälfte bei vollem Lohnausgleich nicht realistisch erscheint, muß die Einführung eines »garantierten Grundeinkommens« als parallele Entwicklung hinzukommen (vgl. dazu SCHMID, 1984; OPIELKA und VOBRUDA, 1986).
Die Bereitschaft, sich mit solchen Überlegungen auseinanderzusetzen, wächst (vgl. dazu den ZEIT-Artikel von DAHRENDORF VOM 17.1.1986). Die damit implizierte Entkoppelung von Arbeit und Einkommen scheint auf dem Hintergrund der noch immer tief eingewurzelten neutestamentarischen Formel »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen« utopisch, aber die mehrfach angesprochene Erosionskrise unterspült gerade diese tragende Säule unserer Arbeitsgesellschaft. Gerade für jene Bevölkerungsgruppen, die durch die fortschreitende Abspaltung und Ausgrenzung um ihre Lebensperspektive gebracht werden, würde ein garantiertes Mindesteinkommen oberhalb der Armutsgrenze neue Lebenschancen eröffnen.
Das folgende Gedicht bringt den zentralen Widerspruch, in dem sich die Orientierung an subjektiven Wünschen und Psychologie als institutionelles Unternehmen insgesamt befindet, so treffend auf den Begriff.
Letzte Warnung
Wenn wir nicht aufhören
uns mit unseren kleinen
täglichen Sorgen
und Hoffnungen
unserer Liebe
unseren Ängsten
unserem Kummer
und unserer Sehnsucht
zu beschäftigen
dann geht die Welt unter
Und wenn wir aufhören
uns mit unseren kleinen
täglichen Sorgen
und Hoffnungen
unserer Liebe
unserem Kummer
und unserer Sehnsucht
zu beschäftigen
dann ist die Welt untergegangen
Erich Fried
[1] Der »Süddeutschen Zeitung« (vom 3.2.1986) konnte man entnehmen, daß Psychotherapeuten besonders exponierte Vertreter dieses Wertewandels sind. Werte wie »ein behagliches Leben« (Wohlstand) oder »nationale Sicherheit« zählen in dieser Berufsgruppe nicht viel. Persönlichkeitsmerkmale wie »gehorsam«, »sauber« und »strebsam« bildeten das Schlußlicht der Präferenzskala. Das positive Wertemuster oder die »allgemeine psychotherapeutische Weltanschauung läßt sich etwa als ein humanistisch geprägter Individualismus mit besonderem Akzent auf guten menschlichen Beziehungen charakterisieren«.
Inhaltsverzeichnis
Der Wind hat sich gedreht! Die Helferberufe spüren nach einer Phase anhaltenden Rückenwinds mit erheblicher Schubkraft, daß ihnen der Wind auf einmal ins Gesicht bläst. Sind sie am Ende oder nur am Ende einer Expansionsphase? In welcher Krise stecken sie eigentlich: Ist es eine die Existenz bedrohende oder nur eine Normalisierungskrise? Tut es nur weh, daß all die Blütenträume der frühen siebziger Jahre nicht gereift sind, daß die einst prognostizierte glänzende Zukunft, die von Freund und Feind gleichermaßen ausgemalt wurde, nicht eingetreten ist? Sind wir mitten in einer Phase der Enttäuschungsverarbeitung, der Trauerarbeit, die ihre Zeit braucht, aus der wir aber auch gestärkt hervorgehen könnten? Ist der Psychoboom wirklich an seine Grenzen gestoßen? War er nur der stolze Konjunkturritter einer wohlfahrtsstaatlichen Expansionsphase oder entfaltet er sich gerade in der Krise phantasievoll und vielgestaltig weiter? Gleichzeitig ist immer häufiger von Berufskrisen die Rede, vom »Ausbrennen« bei den Helferberufen. Wie paßt das alles zusammen? Um die Helferberufe hat sich ein Stimmungsnebel gelegt, der den klaren analytischen Blick auf die reale Situation erheblich trübt. Es ist Konjunktur für apokalyptische Lagebeurteilungen und Endzeitprognosen und zugleich durchaus auch für die Vision neuer Ufer, zu denen wir nur aufzubrechen brauchen, das Ufer zu einem »new age«, zu einer grundlegenden Transformation unserer kulturellen Grundlagen, die auch für den psychosozialen Sektor neue Perspektiven eröffnet.
Ich möchte mit meinem Beitrag den Versuch unternehmen, durch den angedeuteten Stimmungsnebel hindurch zu einer möglichst realistischen Einschätzung unserer Zunft und ihrer Zukunft zu gelangen. Ich gehe dabei von der für mich grundlegenden Prämisse aus, daß ich die Krise der Helferberufe nur dann einigermaßen adäquat begreifen kann, wenn ich mir die Gesellschaft genauer anschaue, die den Helferberufen ihr jeweiliges Terrain gibt, die Probleme produziert, an denen wir uns abzuarbeiten haben und in der jene Ideologien erzeugt werden, die auch unsere Köpfe und unsere Praxis durchdringen.
Beginnen möchte ich mit einer Analyse jenes expansiven Professionalisierungsschubes, den wir in den 70er Jahren erlebt haben. Auf seinem Hintergrund zeichnet sich erst das Krisenpanorama scharf ab, das gegenwärtig die Helferberufe umgibt. Dann versuche ich mich an einer Interpretation jenes tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbaus, der sich gegenwärtig vollzieht und der nicht ohne Folgen für die Helferberufe bleiben kann. Erst nach dieser Analyse wird vielleicht der Blick frei für Praxisansätze, die zur Hoffnung berechtigen und Perspektiven eröffnen könnten.
Das psychosoziale Arbeitsfeld ist in den 70er Jahren in explosiver Weise in den Konturen entstanden, die wir heute kennen. Vor allem Sozialarbeiter / Sozialpädagogen und Psychologen haben ihre Bestandsraten in wenigen Jahren vermehrfacht. Am Beispiel der Psychologen läßt sich das exemplarisch aufzeigen. In dem Zeitraum von 1961 bis 1974 hat sich die Zahl der Psychologen knapp verdreifacht, von 2.400 auf etwa 7.000 haben sie sich vermehrt. Seit der Mitte der 70er Jahre hat sich ihre Zahl noch einmal mehr als verdoppelt. Heute schätzt man etwa 17. 000 diplomierte Psychologen und an den Hochschulen sind bereits mehrere nachdrängende Generationen, die - unabhängig von der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage - ihr Studium abschließen werden und die Zahlen der Bestandsraten für psychologische Arbeitskräfte weiter nach oben treiben werden. Es wird vielleicht noch drei bis vier Jahre dauern und der Psychologenstand wird sich gegenüber 1961 verzehnfacht haben. Bis zum Jahre 1990 rechnet STEPHAN (1982) mit etwa 30.000 berufstätigen Diplom-Psychologen, ich würde allerdings eher von ausgebildeten Diplom-Psychologen sprechen. Mit dieser Entwicklung steht die Bundesrepublik nicht alleine da. In fast allen westeuropäischen Ländern und den USA hat sich ein ähnlich expansiver Professionalisierungsschub vollzogen.
Speziell am Beispiel der USA läßt sich nun zeigen, wie sich die zahlenmäßig beschreibbare Zunahme des Psychologenberufs im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Arbeitskräfteentwicklung ausnimmt. Zunächst ein paar allgemeine Trends (in den folgenden Zahlen stütze ich mich auf den äußerst informativen Artikel von PION und LIPSEY [1984]). Der Trend zu einem immer stärkeren Wachstum des Dienstleistungssektors hat angehalten. Längst ist die Mehrheit der berufstätigen Bevölkerung nicht mehr in Landwirtschaft und industrieller Produktion tätig. 1980 waren etwa 70 % der arbeitenden Bevölkerung im Dienstleistungssektor. In den zwei Jahrzehnten zwischen 1960 und 1980 hat das professionelle und technische Personal (das Wissenschaft, Gesundheitsleistungen und Bildungswesen umfaßt) um über 100 % zugenommen. Der öffentliche Sektor ist im gleichen Zeitraum um annähernd 90 % gewachsen. Innerhalb dieses Trends zu einer »personal service society« (HALMOS, 1970) lassen sich die Sozialwissenschaften mit besonderen Zuwachsraten herausheben (mit etwa 500% zwischen 1960 und 1979). Einen ausgesprochenen Spitzenplatz nehmen die Psychologen ein: Sie haben zwischen 1960 und 1979 um 435 % zugelegt und das hebt sie deutlich von den entsprechenden Zuwächsen bei den Ärzten von 58 % oder Lehrern von 64 % ab.
Wie können wir diese enorme Ausweitung psychosozialer Dienstleistungen in den spätkapitalistischen Gesellschaften erklären? Entspricht ihr eine veränderte Bedürfnislage oder ist es nur Ausdruck eines wildwüchsigen Psychobooms, der sich geschäftstüchtig seinen Markt erst schafft, ehe er sich auf ihm bedient? Was soll man von den Argumenten halten, die von den Berufsverbänden kommen, die sich ja in erster Linie darum bemühen, ihrem Berufsstand ein bearbeitbares Terrain zu sichern und dabei aber kaum an vorhandenen Bedarfslagen vollständig vorbei ihren spezifischen Kompetenzen Geltung verschaffen können? Und dann gibt es Argumente, die das ganze psychosoziale Arbeitsfeld als Ausdruck einer veränderten Systematik sozialer Kontrolle begreifen, die im Zugriff auf den subjektiven Faktor subtile Steuerungsmechanismen entwickelt hat. Damit konkurriert eine Position, die den Verelendungsprozeß im Spätkapitalismus zunehmend mehr auf der psychosozialen Ebene ansiedelt, in bezug auf den der psychosoziale Reparaturbetrieb eine gesellschaftlich notwendige Antwort darstellt.
Weitere Unsicherheiten kommen aus Befunden empirischer Benutzerforschung, die erhebliche Zweifel an professionellen Bedürfnisinterpretationen begründen. Sie belegen eindeutig eine zunehmende Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen, die nicht vollständig auf einen objektiven Zuwachs an psychosozialen Belastungen zurückgeführt werden kann. Bedeutet das, daß die Menschen zunehmend ihr Vertrauen in die traditionellen lebensweltlichen Bewältigungsmöglichkeiten verloren haben, vielleicht als Folge eines Überangebots professioneller Hilfsangebote, oder sind die Ressourcen für alltagsweltliche Selbsthilfelösungen durch industriegesellschaftliche Wandlungsprozesse zunehmend verloren gegangen oder zerstört worden?
In den letzten Jahren werden wir immer häufiger auch mit Deutungen konfrontiert, die von einem tiefgreifenden Wandel gesellschaftlicher Werte ausgehen, die die Menschen aus den Fesseln traditioneller Normierungen befreien könnten. Es wird die Chance behauptet, daß sich Menschen aus der individualistischen Leistungsethik der industriellen Arbeitsgesellschaft lösen könnten und statt dessen postmaterielle Werte und emanzipatorische Potentiale angestrebt und realisiert werden würden. Sind die psychosozialen Berufsgruppen in ihrer Mehrheit Transmissionsriemen dieses Wertewandels oder Hebammen einer solchen Entwicklung?
In diesen Fragen stecken fünf differenzierbare Deutungsmuster, die zur Interpretation des Professionalisierungsbooms aufgeboten werden, die sich nicht ganz trennscharf voneinander abgrenzen lassen, aber doch unterschiedliche Akzente setzen. Ich will versuchen, ihren inhaltlichen Kern darzustellen und ihr Erklärungspotential realistisch einzuschätzen (in einigen Teilen stütze ich mich auf eine frühere Darstellung: KEUPP, 1981).
Die fünf Deutungsmuster lassen sich in schlagwortartiger Form folgendermaßen benennen:
Das Brutstättenmodell psychischen Leidens (oder auch Stress- oder Noxenmodell); das Modell veränderter Konsumentenbedürfnisse (oder auch Nachfragemodell); das Modell 1984 auf psychologisch; das Modell der Machtergreifung der Experten; das Modell Hebammen der kulturellen Transformation.
Es läßt sich in folgender These zusammenfassen:
Gestiegene Lebensrisiken und Belastungen, die der Kapitalismus den Individuen Zumutet, schaffen einen wachsenden Bedarf an kompensativ-kurativen psychosozialen Dienstleistungen.
Eine immer wiederkehrende Behauptung, Vermutung oder Interpretation lautet, daß die gesellschaftliche Entwicklung ein steigendes Maß an psychischen Kosten produziert. Ein linkes Erwartungsmuster unterstellt dem Kapitalismus eine immer intensiver und subtiler werdende Ausbeutung des Individuums, es sieht im Kapitalismus eine immer produktiver werdende Brutstätte psychischen Leidens. Ein konservatives Deutungsmuster registriert überall den Zerfall bewährter und für die Soziabilität des Individuums unabdingbarer Wertsysteme und Vergesellschaftungsformen, ein Zerfall, der notwendig auch eine psychische Desorganisation zur Folge haben muß. Eine sich streng empirisch definierende Epidemiologie tut sich schwer, diesen Erwartungen mit beweiskräftigen Daten zu entsprechen.
Es scheint mir gegenwärtig kaum möglich, so etwas wie einen Index für die psychische Gesamtmorbidität einer Gesellschaft aufzustellen, dessen Zu- und Abnahme über die Zeit hinweg meßbar wäre. Die Versuchung es doch immer wieder zu probieren, ist verständlich. Es ist das Terrain, in dem einige Psychologen und Psychiater ihren Beitrag zur Kapitalismuskritik zu leisten versuchen. Dem kapitalistischen System per Saldo vorzurechnen, welche psychischen Kosten, Belastungen und Verelendung es produziert und in Kauf nimmt, hat sicherlich seinen agitatorischen Effekt, enthält jedoch eine Perspektive, in der das betroffene Subjekt nur noch als Objekt von Versorgungsmaßnahmen vorkommt. Eine solche Perspektive ist an den Besonderheiten psychischer Verarbeitungsformen und psychischer Widerstandspotentiale nicht interessiert, sondern nur an der zu quantitativ imposanten Indices führenden Aufsummierung von Verschleißerscheinungen, die man medizinisch, psychiatrisch oder psychologisch klassifizieren kann und die man problemlos in Planungsziffern für die Erweiterung des Versorgungssysterns übersetzen kann.
Eine solche Perspektive impliziert ein stresstheoretisches Noxenmodell oder auch eine »linke Variante der Medikalisierung«. Abweichendes Handeln kann nicht als erklärt gelten, wenn ausgesagt wird, daß gesellschaftlich produzierter Stress abweichendes Verhalten erzeugt. Es ist deshalb nicht erklärt, weil auf Belastungssituationen unterschiedliche Reaktionen möglich sind (etwa auch Rebellion oder Kriminalität) und deshalb der sich offensichtlich häufende Reaktionstyp psychischen Leidens selbst als gesellschaftlich vorgezeichnete und nahegelegte Handlungsmöglichkeit rekonstruiert werden muß. Es wird für mich zur entscheidenden sozialwissenschaftlichen Fragestellung, warum Menschen auf objektive Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Lebenspraxis mit Verhaltens- und Erlebnisweisen reagieren, die subjektiv und individualistisch sind. Das führt zum nächsten Deutungstyp:
DieThese, die diesem Modell zugrundeliegt, könnte so lauten:
Die alltagsweltlichen Bewältigungskapazitäten für Krisen und Belastungen reichen bei vielen Menschen nicht mehr aus und dies führt zu einem wachsenden Bedürfnis nach psychosozialen Hilfestellungen.
Eine Untersuchung zur Veränderung von Einstellungen zu professioneller Hilfe in psychischen Problemsituationen hat bei einer Repräsentativerhebung in den USA ergeben, daß sich in einem Zeitraum von 20 Jahren die Zahl derjenigen, die professionelle Hilfe aufsucht, fast verdoppelt hat (von 14 auf 26 %), wohingegen keine signifikanten Unterschiede im durchschnittlichen psychischen Wohlbefinden ermittelt werden konnten (VEROFF, KULKA und DOUVAN, 1981). Das ist eine empirische Bestätigung für ein Phänomen, das wir als »Psychoboom« zu bezeichnen uns angewöhnt haben.
Wichtig ist mir an dieser Stelle, daß die notwendige Kritik am Psychoboorn diesen nicht auf seine modischen und damit sicherlich schnell vergänglichen Komponenten reduziert. Was die erfolgreichen Psychomagier als Bedarf an ihrer Art von Seelenkunst anhand von Zahlen ständig steigender Nachfrage ausgeben, weist auf reale Bedürfnislagen, die kein noch so geschickt arrangierter Markt allein erzeugen könnte. Die Ideologiekritik hat schwerpunktmäßig an den Formen der Vermarktung dieser Bedürfnisse anzusetzen, deren Befriedigung sie versprechen, obgleich ihr Geschäft davon lebt, daß sie unbefriedigt bleiben. Die Analyse hat an den gesellschaftlichen Bedingungen solcher Bedürfnislagen anzusetzen, statt sie mit den fragwürdigen Methoden ihrer marktgerechten Zurichtung zu identifizieren.
Die Umwälzung der materiellen Verhältnisse hat auch die sozialen Lebensbedingungen und den Prozeß der Identitätsfindung des einzelnen tiefgreifend verändert. Traditionelle Sinnzusammenhänge, überkommene Normensysteme, bewährte Bewältigungstechniken und Interaktionsformen werden zunehmend dysfunktional, ohne daß sich neue stabile Orientierungsleitfäden herausgebildet hätten.
Die chronische Identitätskrise des Individuums im organisierten Kapitalismus begründet das wachsende Bedürfnis nach Orientierung und Sinn. Lebensbewältigung erscheint vielen ohne den Rat von Experten nicht mehr möglich. Für die Bearbeitung von Alltagsproblemen gibt es keine bewährten Repertoires von Bewältigungsmechanismen. Die »in einer neuen Qualität auftretenden Alltagsprobleme (müssen) auf dem Weg der systematischen Produktion von Leitfäden für den Umgang mit dem Alltag« bewältigt werden. Die entstandenen Leerstellen scheinen »nur noch mit Prothesen einigermaßen zu bewältigen zu sein« (SCHÜLEIN, 1976, S. 12).
Für unsere Frage nach der besonderen Qualität des psychosozialen Arbeitsfeldes folgt aus diesen Überlegungen zum Psychoboom, daß sich in diesem ein soziopsychisches Krisenpotential äußert, das gesellschaftliche Belastungen und Widersprüche in erster Linie über die Unfähigkeit, sie psychisch zu verarbeiten, zum Ausdruck bringt. Im psychosozialen Arbeitsfeld muß der Psychologismus nicht erzeugt werden - wie es oft anklagend behauptet wird -, er ist in dem Nachfrageverhalten der Rat- und Hilfesuchenden vorgebahnt. Er hat seine Absicherung jedoch auch in den Motivationssyndromen der professionellen Helfer selbst, die mit ihrer Berufsentscheidung selbst an diesem soziopsychischen Krisenpotential partizipieren. Die Kosten und Konsequenzen dieser spezifischen Verdichtung auf den »subjektiven Faktor« stehen im analytischen Zentrum des nächsten Deutungsmusters:
Die Grundthese lautet:
In spätkapitalistischer Gesellschaft entwickelt sich ein neuer verallgemeinerter Modus sozialer Kontrolle, der auf die Instrumentalisierbarkeit des »subjektiven Faktors« setzt und der für psychosoziale Berufe die Funktion von »Normalisierungskontrolleuren« schafft: In der Rolle von Konfliktmanagern, Sinnproduzenten oder »Nachsozialisierern«.
Die klassische Fragestellung von Sozialphilosophie und Soziologie: Wie denn soziale Ordnung möglich sei, hat uns das Thema soziale Kontrolle beschert. Soziale Kontrolle faßt dann genau jene gesellschaftlichen Mechanismen zusammen, die die Geordnetheit eines gesellschaftlichen Systems garantieren sollen. Dazu gehören Normen, gesetzliche Regelungen, Ideologien und vor allem die institutionellen Apparate, die auf ihre Einhaltung zu achten und Abweichungen zu sanktionieren haben (vgl. BLACK, 1984).
Theoretische Analysen von sehr unterschiedlichem paradigmatischen Zuschnitt kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß sich in spätkapitalistischen Gesellschaften die Kontrollstrukturen immer stärker von äußeren auf innere Kontrollapparaturen verlagert hätten und an deren Perfektionierung psychosoziale Dienstleistungen ihre hauptsächliche Funktion zu erfüllen hätten. In vielen kritischen Analysen etwa der neuen Psychotherapien wird ihre besondere Anpassungsleistung und ihre Fähigkeit zur Integration psychischer Ausbruchstendenzen angesprochen. Es wird ihr spezifisches Potential an Normalisierungskontrolle analysiert, das einerseits die Revolte der Menschen verständnisvoll aufnimmt, den Weg zu »neuen Ufern« verheißt, und zugleich ein Weg zu subtiler Anpassung und zu neuer Fungibilität ist. Die neuen, sanften Formen der sozialen Kontrolle treten als Psychologisierung oder Therapeutisierung auf (KEUPP, 1982) und werden vor allem vermittelt über die Medien zu einer verallgemeinerten kulturell-gesellschaftlichen Interpretationsfolie (vgl. REISBECK, 1985).
Den Zusammenhang von gesellschaftlichen Problemlagen und persönlichen Problemen reduziert der Psychologismus auf die Formel, daß alles nur psychologische Probleme sind. Alle materiell-gesellschaftlichen Problemkontexte werden auf ihre psychische Repräsentanz verkürzt oder wie v. HENTIG es formuliert, »Sachprobleme in Beziehungsprobleme umgedeutet« (1980, S. 9 1). Auf der subjektiv-psychologischen Ebene werden dann Ziele angeboten und ihre Realisierung versprochen (»Selbstverwirklichung«, »Authenzität«, »Liebesfähigkeit«), ohne daß die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Herstellung je thematisiert würden. Der Geltungsanspruch dieser Ziele erstreckt sich jedoch ohnehin nur auf den psychological man, für den sich die psychologische Weltdeutung totalisiert hat. Soziale Kontrolle, als gesellschaftlicher Funktionsbereich, der Abweichung einzudämmen und Konformität zu sichern und zu fördern hat, realisiert sich im Therapismus als allgegenwärtiges Angebot, Unbehagen, Leiden und Anderssein einer individualisierten therapeutischen Definition und Bearbeitung zu unterziehen.
Diesesläßt sich in folgender Weise zusammenfassen:
Die Professionalisierung der psychosozialen Helferberufe setzt einen Mechanismus beständiger Zuständigkeitserweiterung in Gang. Die Folgen davon sind die »Enteignung« alltäglicher Handlungskompetenz und die Abhängigkeit vom Expertenhandeln.
Eine eingehende Analyse der Professionisierungskritik ist hier nicht mein Thema. Wichtig erscheint mir, daß sie Sensibilitäten für Phänomene und Zusammenhänge gefördert hat, die in einer Einschätzung des psychosozialen Berufsfeldes nicht fehlen dürfen. Sie hat sensibilisiert a) für die »iatrogenen Störungen« und Abhängigkeiten, die professionelle Interventionen zur Folge haben können; b) für die Notwendigkeit der »Konsumentenkontrolle« gerade im personalen Dienstleistungssystem; und c) für die alltäglichen Bewältigungsmuster von Problemlagen, die unter dem Stichwort »Selbsthilfe« rubriziert werden.
Speziell der letzte Punkt enthält ein wichtiges Potential für ein angemessenes Verständnis von psychischem Leiden und auch für eine realistische Einschätzung, der Bedingungen, unter denen professionelle Hilfe angezeigt ist und für die Form, wie sie zu leisten wäre. Die psychosoziale Infrastruktur, die sozialen Netzwerke bilden jenen Bereich, in dem sich individuelle und gesellschaftlich-strukturelle Determinanten zu der spezifischen Lebenslage und Lebenswelt vermitteln, in denen die Individuen ihren Alltag mit seinen spezifischen Problemen verbringen und zu bewältigen versuchen. Bezogen auf die Anforderungen des psychosozialen Arbeitsfeldes sind auch erst mit Bezug auf diese Vermittlungsebene Aussagen zu treffen, die sich der professionellen Reduktionismen und Überforderungen bewußt bleiben, wie sie in den dargestellten Deutungsmustern herausgearbeitet wurden.
Die Hauptthese dieses Modells lautet:
Der Verfall traditioneller Wertmuster und die aus ihm folgenden persönlichen Sinn und Orientierungskrisen sollten nicht aus einer Defizitperspektive interpretiert werden. Sie drücken einen tiefgreifenden Wertewandel aus, der als kulturrevolutionäre Transformation neue Lebensperspektiven eröffnet. Die psychosozialen Helferberufe nehmen an dieser Transformation teil und könnten bei vielen Menschen zu deren Geburtshelfern werden.
Dieses Deutungsmuster setzt an der gegenwärtigen tiefgreifenden ökologischen Krise an, die zum Ausdruck bringen würde, daß der Industrialismus und sein unbegrenztes Wachstumsmodell in einer tödlichen Krise steckt. Für immer mehr Menschen, vor allem bei solchen mit bildungsmäßig gehobenem Niveau, hat das Bewußtsein dieser Krise zu einem Bruch mit bisher vorherrschenden Wertmustern geführt. In gewisser Weise hat sich der kapitalistische Vergesellschaftungsprozeß die eigene Wert- und Motivbasis unterminiert. Mit einem relativ hohen generellen Konsumniveau reproduziert sich der Kapitalismus so, daß er in sich Widerspruchsformen neuer Art produziert.
»Die von der Konsumgesellschaft stimulierten Bedürfnisse treten in fühlbaren Widerspruch zur geforderten Selbstabstraktion in Büro und Fabrik. Die Aufwertung von Freizeit und Konsum, aber auch die sozialstaatlichen Versprechungen und Garantien fördern die Ausbildung hedonistischer Werte und die Entwicklung von Bedürfnis- und Affektstrukturen, die in deutlichem Gegensatz zum bürgerlich-puritanischen Leistungsethos, zur Tugend des Verzichts und des Gehorsams stehen« (BRAND, BÜSSER und RUCHT, 1983, S. 30).
Der sich abzeichnende Wertewandel wird vor allem in derjüngeren Generation, die unter Bedingungen materieller Sicherheit groß geworden ist, nachgewiesen. Hier würden sich postmaterialistische Werte herausbilden wie das Streben nach Selbstverwirklichung, Partizipation oder die Betonung ästhetischer Bedürfnisse. Die traditionell vorherrschenden materiellen Sicherheits- und Ordnungswerte dagegen würden ihren zentralen Status verlieren.
»Alles zusammengenommen, entsteht bei vielen Leuten ein Krisenbewußtsein, das die Leitideen der modernen Industrie- und Wachstumsgesellschaft grundlegend erschüttert. Die Kosten des industriellen Modernisierungsprozesses werden von den jeweils Betroffenen nicht mehr ohne weiteres als notwendig akzeptiert. Die technisch-industrielle Entwicklung, die ökologischen, sozialen und politischen Folgen neuer Technologien, das Verhältnis von fremdbestimmter Arbeit und selbstbestimmter Zeit, das Verhältnis zur Natur und zum eigenen Körper, die Form des Politischen, die Art und Weise des zukünftigen Lebens insgesamt werden damit Gegenstand gesellschaftlich-politischer Auseinandersetzungen« (BRAND, BÜSSER und RUCHT, 1983, S. 33).
Nach den vorliegenden Untersuchungen und Einschätzungen kann man davon ausgehen, daß die postmaterialistischen Potentiale vor allem bei Beschäftigten im sozialen Dienstleistungsbereich ausgeprägt seien. Von ihnen läßt sich annehmen, daß sie in ihre spezifische Berufsarbeit auch diese Werthaltungen einzubringen versuchen. Zugleich ist zu vermuten, daß viele Nachfrager psychosozialer Dienstleistungen von der Krise tief verinnerlichter individualistischer und rationalistischer Lebensprinzipien persönlich erfaßt sind und sich im Kontakt mit psychosozialen Profis Hilfe bei der Erarbeitung neuer Sinnorientierungen erwarten. Hier verbünden sich Helferperspektive und Bedürfnisse von Hilfesuchenden.
Ob diese Indizien für die Veränderung grundlegender kultureller Selbstverständlichkeiten in spätkapitalistischen Industriegesellschaften zu einer großen gesellschaftlichen Transformation führen, wie wir es aus allen möglichen Publikationen der verschiedenen Psychokulturen vernehmen können (etwa neuerdings der Gruppe um W. ERHARD oder der Bestsellerautorin M. FERGUSON, 1982)? Oder ob es sich bei den verschiedenen New Age-Versprechungen nur um die neueste Variante einer sich modernistisch gebenden Normalisierungskontrolle handelt?
Ein kurzes Zwischenresümee: Die gesellschaftliche Schubkraft, die dem hinter uns liegenden Professionalisierungsboom zu einem solch expansiven Verlauf verholfen hat, ist nicht auf einen einzelnen Wirkmechanismus zurückzuführen. Hinter ihm steht sicherlich mehr als nur geschäftstüchtiges Agieren von psychosozialen Marktstrategen und Berufsverbänden, auch mehr als die Selbstläufigkeit eines einmal in Gang gesetzten Professionalisierungsprozesses. Die Zunahme psychosozialer Dienstleistungen ist sicherlich auch nicht als der ungefilterte Ausdruck eines Leidenspotentials zu bestimmen, das diese Gesellschaft produziert. Auch eine simple Kontrolltheorie greift zu kurz. Und gegenüber einer euphorisierenden Sichtweise, die in der ausgreifenden Psychokultur ihren Beleg für eine grundlegende gesellschaftliche Transformation sieht, besteht Grund zur Skepsis. Gleichwohl haben diese Erklärungsmuster durchaus ihren sachlichen Kern. Diese Schlußfolgerung scheint auf einen seichten Pluralismus hinauszulaufen.
Für eine weiterführende Analyse halte ich es für notwendig, nicht bei der Expansionsphase der 70er Jahre stehen zu bleiben. Auch die Deutungsmuster, die bisher genannt wurden, sind Kinder ihrer Zeit. Sie stammen aus einer Phase, in der die Prämisse galt, daß die Zunahme psychosozialer Dienstleistungen sich fortsetzen würde. Nach der stürmischen Initialphase vielleicht etwas abgebremst, aber mit dem sich fortsetzenden Trend zum weiteren Ausbau einer psychosozialen Dienstleistungsstruktur. Diese Prämisse gehört zu der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik, an die auch ihre Kritiker »glaubten«.
Hier müssen wir innehalten und uns fragen, was sich eigentlich in den letzten fünf Jahren vollzogen hat. Für einen ungebremsten Ausbau der psychosozialen Infrastruktur spricht nichts mehr, alles spricht für Stagnation und manches gar für Auszehrung und Abbau. Wir haben es mit einer Krise der psychosozialen Helferberufe ebenso wie mit einer Krise in der Deutung der Psychokultur zu tun.
Für mich lassen sich die psychosozialen Helferberufe als das »Krisengewerbe« schlechthin bezeichnen. Sie arbeiten an persönlichen Krisen und in diesen persönlichen Krisen lassen sich zugleich gesellschaftliche Veränderungen in ihren krisenhaften Zuspitzungen aufspüren. Ein Wunder ist es also nicht, wenn in den psychosozialen Helferberufen die langanhaltende und tiefgreifende gesellschaftliche Krise, in der wir uns befinden, ihre Spuren hinterläßt. In der psychosozialen Szene verbreitet sich Krisenstimmung. Gibt es dafür nicht Gründe genug? Für die Katastrophentheoretiker unter uns sprudeln die Quellen ergiebig. Ich möchte diese Krisenindikatoren im folgenden ordnen. Einige Kategorien werde ich nur kurz anreißen, weil sie ohnehin nur Bekanntes zusammenfassen. Andere Gruppen werde ich exemplarisch an mir zugänglichem Material erläutern und diskutieren.
1. Bevor die aktuellen Krisensymptome genannt werden, möchte ich den zentralen berufsimmanenten Krisenherd ansprechen. Was sind das eigentlich für Berufe, die wir als Helferberufe zusammenfassen? Für sie gilt allgemein, was FREUD für den Beruf des Psychoanalytikers gesagt hat: Es sind »unmögliche« Berufe. Im folgenden Zitat von FREUD steht der Analytiker für alle psychosozialen Berufe:
»Machen wir einen Augenblick halt, um den Analytiker unserer aufrichtigen Anteilnahme zu versichern, daß er bei der Ausübung seiner Tätigkeit so schwere Anforderungen erfüllen soll. Es hat doch beinahe den Anschein, als wäre das Analysieren der dritte jener 'unmöglichen' Berufe, in denen man des ungenügenden Erfolges von vornherein sicher sein kann. Die beiden anderen, weit länger bekannten, sind das Erziehen und das Regieren« (FREUD, GW XVI, S. 94).
Trotz aller Professionalisierungsbemühungen der psychosozialen Berufe sperren sie sich einer vollkommenen beruflichen Zurichtung. Die immer wieder unternommenen Versuche, psychosoziale Arbeit in Form von technisch beherrschbarem Handwerkszeug zu beschreiben und zu vermitteln, das hohe Spezialisierung und technische Kunstfertigkeit erfordert und herstellt, konnten das Faktum nicht aufheben, daß psychosoziale Praxis letztlich auf Haltungen und Fähigkeiten aufbaut, über die prinzipiell jeder Mensch verfügt (z. B. zuhören, Zeit dafür haben, zuzuhören, emotionale und soziale Unterstützunggeben, Vertrauen herstellen, Techniken der Alltagsbewältigung vermitteln, über den Sinn des Lebens reflektieren). Man könnte überspitzt formulieren, daß sich die psychosozialen Helferberufe eigentlich nur dadurch rechtfertigen lassen, daß diese Fähigkeiten und Haltungen im gesellschaftlichen Alltag für viele Menschen nicht in dem Umfang zugänglich und erreichbar sind, wie sie ihrer bedürfen.
Die Gesellschaft läßt es sich also etwas kosten, Defizite des Alltags über bezahlte Arbeit zu kompensieren. Gefühls- und Beziehungsarbeit wird zur Dienstleistung. Solche Dienstleistungen lassen sich institutionallsieren, aber das zu ihr erforderliche Arbeitsvermögen ist nicht auf die Helferberufe monopolisierbar. Und das erschwert die Herausbildung eines beruflichen »Produzentenstolzes«. Die andere Quelle beruflicher Aufgabenstellung für psychosoziale Berufe eignet sich noch weniger für den Aufbau einer positiven beruflichen Identität: Die Kontrollaufgaben, die Grenzwächterfunktionen zwischen gesellschaftlich lizensierter Normalität und nicht mehr tolerierbarer Abweichung.
Zusammenfassend ergibt das eine erste Feststellung über die prinzipielle Krisenhaftigkeit der psychosozialen Helferberufe, die natürlich durch weitere sozialpolitische, ökonomische, institutionelle und ideologische Randbedingungen verschärft werden kann. Das soll in den folgenden Punkten thematisiert werden.
2. Die neokonservative Wende hat uns unzweideutig klargemacht, daß wir Reformhoffnungen aus den frühen 70er Jahren endgültig aufgeben müssen. Gerade für die psychosoziale Versorgung gab es ein großangelegtes Modernisierungsprojekt, das für die psychosozialen Berufe zu weitreichenden Hoffnungen berechtigte. Diese Hoffnungen verflogen allerdings bereits zum Ende der 70er Jahre: Die Psychiatriereform blieb weitgehend in ökonomisch durchaus aufwendigen Sanierungsmaßnahmen stecken. Das Modellprogramm Psychiatrie war noch ein Hoffnungsträger auf Sparflamme, der nun auch schon seine Schuldigkeit getan hat. Wir Psychologen haben unsere entscheidende Enttäuschung mit dem Scheitern einer Psychotherapiegesetzgebung im Sinne einer grundlegenden Neustrukturierung der ambulanten Versorgung erlebt. Nicht einmal zu einer kleinen berufsrechtlichen Regelung hat der Anlauf der sozialliberalen Regierung gereicht. Mit der Ersatzkassenregelung für Verhaltenstherapie kam es zu einer Schmalspurkopie jener Lösung, durch die sich die Psychoanalyse privilegiert sieht. Ein Schritt in die gesundheitspolitisch falsche Richtung, der im übrigen jederzeit wieder zurückgenommen werden kann, übrigens auch für die Psychoanalyse. Auch den psychoanalytisch ausgebildeten Psychologen bläst der Wind eher ins Gesicht und die Privilegierung und Gesichertheit ihres Weges scheint mir erschüttert.
Einer expansiven Wachstumsphase mit illusionären Wachstumserwartungen, ist eine leicht resignative Normalisierungsphase gefolgt, in der die Berufsgruppen hofften, ihre Bestände zu sichern. Das ist wohl auch im großen und ganzen gelungen, sogar mit geringen Wachstumsraten. »Selbst mitten in der Rezession sind zwischen 1980 und 1982 noch rund 20.000 Arbeitsplätze (für Sozialpädagogen) neu besetzt werden« (STOOSS, 1984, S. 209). Auf dieses Faktum bezogen, ließen sich die psychosozialen Berufe sogar noch als »Zukunftsberufe« bezeichnen, in denen die Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze stetig ansteigt. Zugleich wurden sie jedoch auch als »Risikoberufe« gehandelt, bei denen die Zahl der Arbeitslosen fortlaufend zunimmt und die Arbeitslosenquote deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die psychosozialen Helferberufe haben die Krise der Weltökonomie und ihre neokonservativen-monetaristischen politischen Antworten relativ spät zu spüren bekommen, dafür um so härter. Innerhalb weniger Jahre ist der Arbeitsmarkt für psychosoziale Berufsgruppen völlig zusammengebrochen. Der Sozialabbau hat in erster Linie die von Sozialleistungen Abhängigen getroffen und nur in geringem Umfang zu einer realen Vernichtung von Arbeitsplätzen in der psychosozialen Versorgung geführt.
Aber die Hochschulen haben mit unverminderter Produktivität Sozialpädagogen, Psychologen und Mediziner ausgebildet. Mit jedem Examensjahrgang wird das Heer der arbeitslosen Kollegen vermehrt. Hinzu kommt der Verdrängungswettbewerb zwischen den Berufsgruppen, bei dem die Mediziner sicherlich die besten Karten ausspielen können. Den Bereich der Psychotherapie, insoweit er als Kassenleistung erbracht wird, werden die Mediziner vermutlich bald alleine kontrollieren. Diesen Verdrängungsprozeß und die Arbeitslosigkeit bekommen zwar vor allem die Berufsanfänger zu spüren, doch als psychosoziale Reservearmee bilden sie ein Druckpotential, das jeder Kollege zu spüren bekommt, der einen Arbeitsplatz hat. Es gehört heute schon viel Mut dazu, einen Job aufzugeben, weil er einen nicht mehr befriedigt. Die durchschnittlich nach zwei oder drei Jahren auftretenden Berufskrisen in einer spezifischen Institution oder in dem alltäglichen beruflichen Umgang mit einer Problemgruppe wurden bis zum Ende der 70er Jahre in der Regel durch Stellenwechsel oder durch eine schöpferische Pause von einem halben Jahr gelöst. Jetzt muß man durchhalten, sich arrangieren oder sich innerlich distanzieren.
3. Helfer am Ende, erschöpft, entmotiviert, ausgebrannt. Das ist seit dem Ende der 70er Jahre ein Thema, zu dem sich eine Literaturflut zunächst über den angloamerikanischen Markt ergossen hat. Nur mit geringer zeitlicher Verzögerung hat diese Flut auch uns erreicht. Inzwischen gibt es bereits das dritte aus dem Englischen übersetzte Buch auf dem deutschen Markt, das den gleichlautenden Titel trägt: »Ausgebrannt« (FREUDENBERGER, 1981;ARONSON, PINES und KAFRY, 1983;EDELWICH und BRODSKY, 1984).
Es ist sicher kein Zufall, daß mit Beginn der Stagnationsphase für die psychosozialen Helferberufe, auch deren Schatten- und Kostenseite zum Thema wurde. Es wurde jetzt thematisiert, daß die Ausübung einer helfenden Berufstätigkeit nicht nur ungeheuer befriedigend und den Helfer positiv ausfüllend sein kann, sondern daß sie auch den Helfer belasten kann und daß sie immer wieder auch an Grenzen stößt, die durch noch so viel therapeutisches Engagement nicht verrückbar sind. Der »therapeutische Triumphalismus«, mit dem sich vor allem die Psychologen in ihrer Expansionsphase dargestellt haben, ist nun verflogen und wird auf ein realistisches und lebbares Maß kleingearbeitet. Dazu gehört, sich auch ehrlicher mit den eigenen Motivationen auseinanderzusetzen.
Die Gleichung Helfen ist gleich Gutes tun wird als ein Bestandteil der eigenen beruflichen Mythologie enttarnt, das inzwischen mit annähernd 100.000 Exemplaren verkaufte Buch »Die hilflosen Helfer« (SCHMIDBAUER, 1977) machte sich auf den Weg zum Bestseller. So wie nach dem Scheitern der Studentenbewegung eine Phase der »neuen Innerlichkeit« diagnostiziert wurde, so läßt sich auch für die Situation der Helferberufe zum Ausgang der 70er Jahre eine Tendenz zur Innenschau feststellen, die nicht ganz ohne Züge von Selbstkasteiung war. Die Entdeckung des »Helfersyndroms« bei sich und anderen hatte durchaus masochistische Züge und war nur noch durch die Selbstbezichtigung des Vampirismus (DÖRNER, 1979) zu überbieten. In der zweiten Auflage der »hilflosen Helfer« (1980) versuchte W. SCHMIDBAUER der exzessiven psychodynamischen Innenschau durch die Betonung der Bedeutung gesellschaftlicher und institutioneller Randbedingungen für die Helferbefindlichkeit gegenzusteuern (in seinem letzten Buch, 1983, weitet er seinen Blick auf das externe Arrangement der Helfertätigkeit noch mehr).
Wie wird denn nun das »Burnout«-Syndrom beschrieben? In der einschlägigen Literatur (besonders wichtig sind hier: CHERNISS, 1980; PAINE, 1982; MASLACH, 1982; FARBER, 1983) wird »burnout« als ein Zustand der körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung beschrieben, als Überlastungszustand, wie er in der Streßforschung beschrieben wird (und letztlich ist »burnout« als Helferstreß zu betrachten, auf den die Befunde der Streßforschung anwendbar sind). Der professionelle Helfer empfindet sich ausgelaugt, müde, hoffnungslos und neigt zu zynischen Distanzierungen von seinen Klienten. Als typische Verlaufsgestalt hat sich immer wieder gezeigt, daß Helfer mit großem Enthusiasmus und Einsatzbereitschaft ihre Arbeit begonnen haben, dann aber eine Phase der emotionalen Auszehrung folgt und schließlich in Dehumanisierung und Herabwürdigung der Klienten umschlagen kann. Wenn im Verlauf dieses Umschlags nicht die Entscheidung zum Ausstieg aus dem Beruf oder dem belastenden Arbeitsfeld getroffen wird, stellen sich typische Ambivalenzspannungen ein, für deren Auflösung unterschiedliche Strategien denkbar sind:
Ich kann mich aus der Arbeit mit Klienten in die Verwaltung, in die Supervision oder auch in die Verbandspolitik zurückziehen etc.. In guter Psychologenmanier konzentriert sich die »Burnout«-Forschung sehr stark auf die individuellen Handlungsmuster. Wichtig für Motivation oder Motivationsverlust bei helfenden Berufen ist aber auch der institutionelle und vor allem auch der ideologische Kontext. CHERNISS und KRANTZ (1983) haben zeigen können, daß ideologische Gemeinschaften das beste Gegengift gegen Ausbrennen darstellen. Sich als Teil einer sozialen Bewegung definieren können und von dieser sich normative Zielorientierungen und solidarische Unterstützung holen zu können, ist eine wichtige Größe für die Etablierung einer positiven beruflichen Identität.
Als wir in München in der konfliktreichen und von der konservativen Psychiatrie heftig bekämpften Aufbauphase der ambulanten Psychiatrie waren, da war eine positive und sehr motivierende Aufbaustimmung zu spüren. Die Arbeit in diesem neu entstehenden institutionellen Feld war sehr viel mehr als ein Job unter anderen. Es bestand ein starkes gemeinsames Gefühl, Teil einer fortschrittlichen gesellschaftlichen Bewegung zu sein. Arbeit und Privatleben war nicht in der üblichen Form aufgespalten. Nach zwei oder drei Jahren ist die Anfangsbegeisterung spürbar in einen Realismus übergegangen. Aus dieser Zeit stammt folgende Beschreibung einer Kollegin aus einem SPDI:
»Für viele von uns ist gegenwärtig der Privatbereich sehr stark von der Arbeit her bestimmt. Freundschaften entstehen innerhalb des Arbeitsfeldes, die freie Zeit ist oft ausgefüllt mit Fortbildungen, Tagungen, der Lektüre von Fachliteratur. Ich glaube, daß wir durch die beruflichen Auseinandersetzungen freier und bewußter geworden sind. Ich sehe eine Gefahr darin, daß häufig wenig Zeit bleibt dafür, außerhalb der Arbeit etwas anderes zu machen und die Verbindungen zu Freunden aus anderen Lebenszusammenhängen nicht abbrechen zu lassen« (KÖPPELMANN-BAILLIEU, 1981, S. 147).
Seit sieben Jahren bin ich als Beirat in dem SPDI tätig, aus dem auch diese Kollegin stammte. Als ich etwa 1980 zu einer der monatlichen Beiratssitzungen kam und danach fragte, was denn auf der Tagesordnung stehen würde, kam das Stichwort »Bewegung«. Erst konnte ich damit nichts anfangen. Schließlich kam heraus, daß die Kollegen aus dem Dienst darüber reden wollten, wie ihnen das Fehlen einer breiten Psychiatriereformbewegung die alltägliche Arbeit erschweren würde. Es fehlt der ideologische Rückenwind, der neue Initiativen, ungewöhnliche Ideen und Zivilcourage fördern kann.
Die psychosozialen Helferberufe brauchen eine politische Kultur, die ihre Tätigkeit trägt, unterstützt und bei der Verarbeitung alltäglicher Mißerfolgserlebnisse hilft. In dem Maße, wie diese politische Kultur fehlt oder verloren geht, wird der einzelne Kollege auf sich selber und seine ungenügende persönliche Motivation, Qualifikation zurückgeworfen.
4. Ein Teil jener politischen Kultur, von der im letzten Punkt die Rede war, wird für professionelle Helfer in den reformorientierten Berufs- und Fachverbänden erfahrbar. Für viele von uns waren die Fahrten zum jährlichen »Mannheimer Kreis zur DGSP-Jahrestagung oder zu den gemeinsamen Kongressen von DGVT und GwG eine Ermutigung. Die Erfahrung, daß es in der eigenen Szene Konzepte und gemeinsame Ziele gab, für die es sich lohnte, in den verschiedenen Praxiszusammenhängen nach neuen Wegen zu suchen, das eigene Berufsbild progressiv zu definieren. Wer mit mir in den letzten Jahren weiterhin zu diesen Tagungen gefahren ist, wird meinen Eindruck teilen, daß die progressiven psychosozialen Verbände selbst in der Krise stecken. Viele Diskussionen, an denen ich selbst teilnehme, sind innerverbandliche Enttäuschungsverarbeitungen. Aber die Enttäuschung ist von außen produziert. Die großen sozialdemokratischen Modernisierungsprogramme gaben den Verbänden die Chance zur Politikberatung auf höchster Ebene. Das hat den Eindruck entstehen lassen, als hätte man echte politische Einflußchancen. In dieser Phase sind einige von uns echte Verbandsfunktionäre geworden, die sich wie gute Lobbyisten zu verhalten wußten.
Mit dem Ende der sozialliberalen Modernisierungsprojekte ist auch das Ende dieser Art von Verbandspolitik gekommen: Zu den neuen politischen Konfigurationen, die nach der Wende entstanden sind, ist die politische Kluft zu groß, als daß man einfach weitermachen könnte wie bisher. Und eine soziale Bewegung, die aus der Zugehörigkeit zur Alternativbewegung eine positive Identität beziehen könnte, ist man längst nicht mehr, eher schon eine Gewerkschaft progressiver Professioneller im psychosozialen Bereich. Die Berührungsängste, die die progressiven psychosozialen Verbände zur Bewegung der Gesundheitstage gezeigt haben, hat dieses Dilemma aufgezeigt. So beobachten wir Lethargie, regressive Bewegungen in Richtung auf »neue Fachlichkeiten« oder defensive Bemühungen, die Besitzstände zu wahren. Für den psychosozialen Helfer liefern also die Verbände gegenwärtig auch wenig Ermutigung. Sie reproduzieren auf verbandlicher Ebene die defensiv-ratlose Position, die für viele Helfer charakteristisch ist.
5. Die neokonservative Wende hat nicht nur durch den schrittweisen Abbau sozialstaatlicher Systeme zu einem verstärkten Druck auf die psychosozialen Helfer geführt, sondern auch durch eine ideologische Offensive, deren Stoßrichtung man als gegenreformatorischen Antisubjektivismus bezeichnen könnte. In den letzten Jahren hat sich als politische Antwort auf die tiefgreifende ökonomische, ökologische und kulturelle Krise ein regressives Modell der Krisenlösung herausgebildet, das sich durch eine äußere und innere gesellschaftliche Militarisierung kennzeichnen läßt. Die äußere Milltarisierung ist im Zuge der friedenspolitischen Auseinandersetzung präzise untersucht worden. Die innere Militarisierung hat sehr viel weniger Aufmerksamkeit gefunden.
Innere Militarisierung läßt sich an der innergesellschaftlichen Feindbildentstehung ebenso ablesen wie an ideologischen Offensiven, die für eine Philosophie der Stärke, für Leistungs- und Konkurrenzbereitschaft bis zur Eliteschulung plädieren und sich gegen Verweichlichung in der Erziehung aussprechen.
In den USA etwa wird gegenwärtig von neokonservativer Seite heftig für eine Bildungsreform agitiert, die solchen Zielen entspricht. Bekämpft werden soll der Einfluß von Strömungen, die das »persönliche Wachstum« und »Selbstfindung« fördern, die dazu führen würden, daß eine »Horde arbeitsscheuer, selbstmitleidiger Jammerlappen« die Schulen verläßt, die den Anforderungen der Berufswelt nicht gewachsen seien. Die Ausbreitung femininer Züge wird beklagt und die Förderung von männlichen Tugenden des erfolgreichen Lebenskampfes wird gefordert. In diese neokonservative Gegenreformation haben sich auch bekannte klinische Psychologen wie A. ELLIS eingereiht, der einem Teil seiner psychologischen Berufskollegen vorwirft, an der Unterminierung zentraler amerikanischer Erfolgstugenden entscheidend beteiligt zu sein. Vor allem an die Adresse von Psychoanalyse und Humanistischer Psychologie richtet sich dieser Vorwurf. Sie würden einen wesentlichen Anteil an der psychologischen Verweichlichung zu verantworten haben. Hier der Originalton ELLIS:
»Ich empfinde das, was wir in unserer Gesellschaft emotionale Störung nennen, immer öfter als Gejammer. Die Leute haben eine niedrige Enttäuschungsschwelle und meinen, daß in der permissiven Gesellschaft alles, einschließlich der Fähigkeit zu Arbeit, Liebe und Sex, leicht zu sein habe. Anstatt sich etwas nur zu wünschen, glauben die Menschen, es zu brauchen, es haben zu müssen. Und wenn sie es nicht bekommen, geraten sie außer sich. Sie suchen nach Garantien im Leben. Das ist tödlich - der sichere Weg zu Angst« (GROSS, 1984, S. 383).
ELLIS selbst setzt nach wie vor auf seinen kognitivistischen Moralismus, der den Geist der protestantischen Ethik atmet und damit - in Anlehnung an M. WEBER - den »Geist des Kapitalismus«. Ins Kreuzfeuer gerät die Psychologie, insofern sie auf eine emanzipatorische Subjektivität setzt. Ich möchte für diese Gegenbewegung zwei Beispiele herausgreifen.
M. L. GROSS, aus dessen Interview mit ELLIS eben zitiert wurde, hat bereits 1978 ein Buch geschrieben, das unter dem Titel »Die psychologische Gesellschaft« (1984) auch in deutscher Sprache erschienen ist. Als ich vor Jahren die englische Ausgabe kurz durchgeblättert habe, hatte ich zunächst den Eindruck, daß hier eine linksliberale Attacke auf den Psychoboom geritten würde. Dieser Ersteindruck ergab sich aus einzelnen Zitaten und aus den einschlägigen Quellen, die er ausgewertet hat. Eine genaue Lektüre dieses Buches hat mich schnell über meinen Irrtum aufgeklärt. Es handelt sich um einen 400-Seiten-Angriff auf den zunehmenden subversiven gesellschaftlichen Einfluß der Psychologie, vor allem der Psychotherapie und da insbesondere der Psychoanalyse. Wer einmal alle denkbaren Angriffe auf die Psychoanalyse und alle Hintertreppengeschichten über FREUD gesammelt nachlesen möchte, der greife zu diesem Buch. Einer der wenigen Psychologen, auf die sich GROSS überhaupt positiv bezieht, ist der genannte A. ELLIS. An ihm schätzt er seine Philosophie,
»erinnert sie doch an Gedanken aus der vorpsychologischen Zeit, daß nämlich der Mensch selbst für seine Taten verantwortlich ist. Diese Vorstellung verblaßt immer mehr, während ständig neue Therapien aus dem Boden schießen, um psychische Probleme zu lösen, die im gleichen Tempo geschaffen werden. In dem Maße, in dem die Anfälligkeit des Menschen gegen die moderne Zivilisation wächst, werden psychologische Technologien ersonnen, die dem Bürger helfen sollen, mit dem Streß fertigzuwerden - und die noch mehr Möglichkeiten für seine Anfälligkeit eröffnen. Dieser Zyklus sich selbst erzeugender Neurosen ist es, der der »psychologischen Gesellschaft« so zerstörerische Züge verleiht« (S. 384).
Die »psychologische Gesellschaft« ist jenes neue gesellschaftliche Selbstverständnis, in dem sich die Interpretationsangebote der Psychologie als Sinnsetzungsinstanz durchgesetzt haben, es ist eine Gesellschaft, in der sich die Menschen ideologisch und professionell von den psychosozialen Helferberufen abhängig gemacht haben. Hören wir einfach dem aufrechten Kämpfer gegen den psychologischen Ungeist ein bißchen zu. Seine Analyse vollzieht sich in sehr einfachen Schritten: Bislang die Menschen leitende Lebensprinzipien haben ihre Prägekraft verloren und in diese Lücke ist die Psychologie mit ihrem verlockenden Angebot eingesprungen, sie könnte die Richtung weisen:
Die gegenwärtige psychologische Gesellschaft ist die anfälligste Kultur in der Geschichte. Ihr Bürger ist ein neuer Menschentyp westlicher Prägung, jemand, der der Führung anderer bedarf, um zu erkennen, was richtig oder falsch ist. Angesichts seiner unsicheren Bewußtseinslage zweifelt er sogar an der Echtheit seiner eigenen Gefühle. Da sich die protestantische Ethik in der westlichen Gesellschaft abgeschwächt hat, wandte sich der irritierte Bürger der einzigen, ihm bekannten Alternative zu, dem Psychologieexperten, der behauptet, es gäbe einen neuen wissenschaftlichen Verhaltensstandard, der die dahinschwindenden Traditionen ersetzt (S. 8).
Der entscheidende Schritt in Richtung auf die »psychologische Gesellschaft« sieht M. GROSS in der Verwischung der Grenzen zwischen gesund und krank. Und dafür macht er FREUD verantwortlich. Er zitiert dessen Äußerung: 'Jeder normale Mensch ist eben nur durchschnittlich normal. Sein Ich nähert sich dem des Psychotikers in dem oder jenem Stück«. GROSS spricht in diesem Zusammenhang von einer »Theorie des universellen Wahsinns«, nach der jeder seine »kranken Anteile« hat. Dies führte notwendigerweise zu einer Entnormalisierung von all dem, was für GROSS unabdingbar zur Schicksalshaftigkeit des Lebens gehört. Diese Uminterpretation »hat die schmerzlichen Reaktionen auf das normale Auf und Ab des Lebens - Verzweiflung, Ärger, Frustration - genommen und sie als Fehlanpassung deklariert« (S. 11). Und er arbeitet diesen Gedanken noch ein bißchen weiter aus:
In der psychologischen Gesellschaft werden die Probleme des Menschen nicht mehr als normale Abweichungen oder unschöne Schicksalswendungen betrachtet. Wir sehen in ihnen heute das Ergebnis innerer psychologischer Fehlanpassungen. Wir gehen sogar so weit zu glauben, daß es weder Mißerfolge noch Verbrechen, Böswilligkeit oder Unglück gäbe, wenn der Mensch seine Seele nur begriffe und sie dann in einen metaphysischen, Anpassung genannten Zustand versetzen würde. Und während immer mehr von uns feststellen, daß die Zwänge des Lebens diesen Idealzustand vereiteln, bietet uns die Psychologie ihr entscheidendes Mittel, die Psychotherapie (S. 12).
Voller Trauer beklagt M. GROSS, daß die Interpretationsherrschaft der Psychologen die »Sicht des gesunden Menschenverstandes« unterminiert habe, »die sich viele tausend Jahre gehalten hat« und er würde diese Sicht zu gerne wieder in Kraft setzen:
Bei diesem alten, pragmatischen System sehen die Menschen den anderen so, wie er sich gibt: voller Haß, gütig, freundlich, stark, schwach, schlecht, reif, kindisch oder in jeder beliebigen Kombination dieser Eigenschaften. Man beurteilte sich selbst und die anderen danach, was man tat. Jeder war für sein eigenes Handeln verantwortlich, das mehr aussagte als unterstellte Motive. Hier gab es wenig Spielraum für Experten, denn das Verhalten war offenkundig, für alle sichtbar und einzuschätzen (S. 19).
Die Handlungs- und Urteilssicherheit des »gesunden Menschenverstandes« wünscht sich der Autor zurück. Ihm ist aber klar, daß diese sich nur einstellen kann, wenn sie von einem Kraftstrom ideologischer Gleichgerichtetheit getragen wird (z. B. von einer »organischen Sicht des Geistes als einer biochemischen Einrichtung mit einer relativ unbeweglichen, Gengesteuerten, vererbten Art, die wir im allgemeinen als »Wesen« oder »Temperament« eines Menschen bezeichnen« (S. 19) oder einer religiösen Sicht, »die den Menschen als ein Produkt der Schöpfung sieht. Bei dieser Sicht wurde das Verhalten des Menschen gemäß einer Vereinbarung mit Gott als rechtschaffen oder schlecht beurteilt« [ebd.]).
Ich habe mich hier etwas ausführlicher mit dem Buch von M. GROSS beschäftigt, weil ich seine idologische Ausrichtung und viele seiner Argumente als repräsentativ für die Grundhaltung eines erheblichen Teils des herrschenden konservativen Blocks ansehe. Der Antisubjektivismus ist nicht die einzige ideologische Strömung dieses Blocks, daneben sehe ich durchaus auch erhebliche Gruppierungen, die sich an der Psychowelle bedenkenlos als Konsumenten beteiligen. Die altkonservativen Strömungen dagegen versuchen an jenem Koordinatensystem festzuhalten, das wir bei GROSS kennengelernt haben. Hierfür mein zweites Beispiel aus der aktuellen politischen Szenerie der Bundesrepublik.
Zu Beginn der 80er Jahre hat F. J. STRAUSS in einem Interview ausgeführt, daß zu den gefährlichsten subversiven kulturrevolutionären Entwicklungen der 70er Jahre die »Entpsychiatrisierung der Geisteskrankheit« gehöre. Hier würden die Maßstäbe für normal und abweichend grundlegend aufgeweicht werden. Die Grenzen zwischen Vernunft und Unvernunft würden verwischt und das würde zur grundlegenden Infragestellung unserer Wertordnung führen. In der aktuellen Psychiatriepolitik in Bayern (aber nicht nur dort) sehen wir, daß hier die Grenzpfähle wieder einbetoniert wurden. Die Psychiatrie, die ja auch von ihrer gesetzlichen Grundlage her den Schutz der öffentlichen Ordnung aufgetragen erhielt, signallsiert hier einen Trend, der auch in anderen Politikbereichen sichtbar wird.
So etwa im Bereich der Jugendarbeit. In Bayern lief kürzlich eine heftige Diskussion über die Fortbildung der hauptamtlichen Mitarbeiter der Jugendarbeit. In mehreren Anläufen haben einflußreiche Kreise im Landkreisverband Bayern (die Organisation der regionalen und kommunalen Sozial- und Jugendhilfe) versucht, aus dem Fortbildungsprogramm für Jugendarbeiter psychologische Inhalte auszugrenzen. (bzw. zu »säubern« - wie es in einem der Schreiben heißt). Als anstößig werden »psychoanalytisch arbeitende Methoden der Gruppendynamik (Gruppenpsychotechnik) und sonstige psychologische Techniken« genannt und unter den Veranstaltungen, die abgeschossen werden sollen, werden etwa die folgenden genannt: »Einführung in das Psychodrama als Methode der Gruppenarbeit«, »Konflikte und Krisen in Gruppen - gestalttherapeutische Arbeit mit Gruppen«, »Haltung und Verhalten - Selbsterfahrung mit Themenzentrierter Interaktion und Körperarbeit«, »Gruppen leiten mit Themenzentrierter Interaktion« oder »Was wird aus der helfenden Beziehung? Der Sozialarbeiter zwischen neuen Fragen und alten Antworten«. Nun wird hier nicht einfach administrativ abgewürgt, sondern es werden auch beeindruckende Argumente aufgeführt. So wird generell festgehalten, daß »ein Ansatz, auch die Persönlichkeit der Bürger zu verändern« kaum mit der Verfassung vereinbar sei. Den »psychoanalytisch oder psychotherapeutisch gesteuerten Methoden« wird nicht nur dieses therapeutische Veränderungsinteresse unterstellt, der Vorwurf geht dahin, daß bei diesen Methoden »der Mensch (Klient im Jugendamt und der Fortzubildende) in die Gefahr einer Persönlichkeitszersetzung und unkontrollierten Manipulation« gerät. Instruktiv ist dann noch das Zitat einer »Fachautorität«, das in diesem Zusammenhang aufgeführt wird, der die gruppendynamische Bewegung als »Weltkulturrevolution« ansieht:
»Sie sei daraufangelegt, die utopischen Hoffnungen des Marxismus auf ein vollständig gesellschaftsgefügiges Individuum einzulösen. Im Blickpunkt steht das total vergesellschaftete und damit manipulierte Individuum, das keine Norm mehr kennt und sich für keinen Glauben mehr engagiert. So ist inzwischen die westliche Welt, von Südamerika bis über den nordamerikanischen Kontinent und Mitteleuropa zu einem einzigen großen Laboratorium geworden, in dem ständig in einer unendlichen Folge von Rollenspielen an der Verwirklichung dieses Sozialismus gearbeitet wird. Viele von denen, die sich daran beteiligen, haben überhaupt kein kulturrevolutionäres Bewußtsein. Sie glauben nur, daß sie eine Methode anwenden, die üblich und modern ist. Die Usurpation der Ausbildungszentren ist schon weit fortgeschritten. Schulen und Universitäten werden schon öffentlich als Trainingszentren zur Konditionierung des vergesellschafteten Menschen deklariert. Die gruppendynamische Bewegung befindet sich im Augenblick in der Phase ihrer expansiven euphorischen Verbreitung« (H. W. BECK in seinem Buch »Gruppenpsychotechnik - Von der Hoffnung, sich selbst und andere zu befreien«).
Bei der Einschätzung dieser konservativen Kreuzzüge gegen psychologische Handlungsformen, die emanzipatorische Subjektbildungsprozesse zu fördern beabsichtigen, entsteht für mich die Frage, ob wir es hier nur mit altbekannten konservativem Weltbild zu tun haben, das den politisch-ideologischen Nährboden der Krise zu seinen Gunsten auszuschlachten versucht. Das kann man sicher so sehen, allerdings bleibt mir das zu oberflächlich. Der konservative Diskurs und sein aggressiver Antisubjektivismus ist zwar mit universellem Geltungsanspruch formuliert, aber - wie wir aus unserem Beispiel aus dem Feld der Jugendhilfe gesehen haben wird zuallererst dort politisch eingesetzt, wo die Funktion der helfenden Berufe vor allem als Befriedung und die Verwaltung gesellschaftlicher Marginalisierung bestimmbar sind. Jugendhilfe bei Gruppen, für die keine gesellschaftliche Integrationsperspektive besteht und die deshalb als potentieller Störfaktor aus dem Kernbereich gesellschaftlicher Reproduktion herausgehalten werden müssen, die sich emanzipatorische Subjektivierungsprozesse zum Ziel gesetzt hat, muß anstößig werden. Ich komme auf diesen Punkt später noch einmal zurück.
Diesen etwas ausgeuferten Punkt zusammenfassend läßt sich sagen: Die neue Offensive eines konservativen Antisubjektivismus bekommen die Helferberufe gelegentlich als Eisregen zu spüren, vor allem wenn ihr Arbeitsfeld marginalisierte gesellschaftliche Gruppen einschließt.
Damit unser Krisenpanorama vollständig wird, möchte ich noch zwei weitere Strömungen nennen, die einem ungebrochenen Selbstbewußtsein der psychosozialen Helfer kaum förderlich sein können. Ich will sie nur noch kurz anreißen, obgleich ich sie für besonders wichtig halte. Sie sind allerdings häufig genug ausreichend präzise dargestellt worden.
6. Zur Kritik der psychosozialen Helfer von rechts kommt jene von links hinzu. Autoren wie FOUCAULT, CASTEL oder in Deutschland WAMBACH und HELLERICH haben uns in immer neuen Anläufen aufgezeigt, daß die Professionen des »PSY-Komplexes« (INGLEBY, 1983) zum System der sozialen Kontrolle gehören, weniger zu Funktionären der harten, repressiven gewaltförmigen Kontrolle, sondern eher zur Abteilung der Normalisierungskontrolle. Ich möchte mich in diesem Punkt auf ein Zitat des Ehepaars BASAGLIA beziehen, dessen Begriff der »Befriedungsverbrechen« (criminali di pace) - angewandt auf die psychosozialen Helferberufe und ihre sozialwissenschatlichen Herkunftsdisziplinen - irritiert und erschreckt, zumal die kritische Analyse nicht von einem Beobachtungsposten erfolgt, der sich zur psychosozialen Praxis auf Distanz hält. F. BASAGLIA und F. BASAGLIA-ONGARO schreiben:
»Die Geburt der Sozialwissenschaften schien dem Kampf für die Befreiung der Menschen zunächst neue Chancen und Ausblicke zu eröffnen. Psychiatrie, Psychologie und Psychoanalyse präsentierten neuartige Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zur Linderung menschlichen Leids ... Doch sobald die neuen Wissenschaften dem institutionellen Sog der Macht und der Imperative der Klassenteilung zu erliegen begannen, verkehrten sie sich zunehmend in Werkzeuge von Herrschaft und Herrschaftsausübung: Theoriebildung ‚von oben' Bereitstellung von Zähmungskenntnissen ... Die Sozialwissenschaften haben sich auf die Fokalisierung des Normalen gegenüber dem Pathologischen, des korrektem gegenüber dem devianten oder kriminellen Verhalten spezialisiert ... Ihr Geschäft ist es, 'normale' Verhaltensweisen festzuschreiben, die Grenzen der Norm zu bestimmen und die Abweichung durch Therapie und Aussonderung zu kontrollieren, freilich nicht aufder Basis der Bedürfnisse der Menschen (d. h. der Bedürfnisse aller Menschen, einschließlich derer, die abweichen), sondern nach Kriterien des ökonomischen Gesetzes und einer inzwischen überaus verfeinerten Herrschaftspraxis« (1980, S. 19 f.).
7. Zuletzt möchte ich noch auf ein Krisenpotential eingehen, das dem Helferselbstverständnis besonders zu schaffen machen kann: Die zunehmende Selbstorganisation von Betroffenen und die sich erhärtende Einschätzung, daß sich in diesen Zusammenschlüssen häufig sinnvollere und befriedegendere Hilfs- und Unterstützungsformen entwickeln, als sie von professionellen Helfern angeboten werden könnten. Viele dieser selbstorganisierten Gruppen fühlen sich als Opfer professioneller Kontrollsysteme bzw. organisieren sich an Erfahrungen der defizitären Form professioneller Hilfe. Aus solchen Defizit- und Opfererfahrungen heraus grenzen sich einige dieser Gruppen aggressiv von allen Helfern ab und das Dilemma für Angehörige der Helferberufe besteht darin, daß die Anklagen auf Menschenrechtsverletzungen in Institutionen der psychosozialen Versorgung begründet sind. Hier tun sich Widersprüche in und im Verhältnis zur eigenen Berufsrolle auf, die kaum aufgelöst werden können.
Besteht nicht aller Grund zur Klage über das traurige Schicksal der Helfer, die durch ein so vielfältiges Krisenpotential bedroht und gebeutelt werden? Zur Larmoyanz sehe ich keinen Grund wohl aber zu der Frage danach, was sich in den gesellschaftlichen Randbedingungen psychosozialer Praxis geändert haben mag. Bislang war immer nur die schon etwas abgedroschene Metapher der »Wende« herangezogen worden. Diese kann natürlich auf die Dauer eine genauere Analyse nicht ersetzen. Ich habe mich deshalb bei den Kollegen von der Sozialpolitikforschung umgesehen und habe dabei einige analytische Hilfestellungen bekommen, die ich zur Bewältigung meines Themas hier nutzen möchte.
Als ich mich mit den aktuellen Gesellschaftsanalysen beschäftigte und deren zentrale Aussagen in mir aufnahm, erinnerte ich mich an ein Papier, das ich vor vielen Jahren gelesen hatte und das mir damals als Karikatur sozialpsychiatrischen Größenwahns vorkam. Ich hatte seine Aussagen nicht glauben wollen und doch haben sie mich nachhaltig beeindruckt. Und jetzt suchte ich es mir wieder heraus. Es stammt von J. RUESCH, einem der führenden Sozialpsychiater der 50er und 60er Jahre. Er hat mit G. BATESON die Grundlagen jener Kommunikationstheorie gelegt, die dann WATZLAWICK und Kollegen popularisiert haben. Im September 1969 fand in Edinburgh ein Kongreß unter dem Titel »Towards a healthy community« statt, auf der RUESCH seine zukunftsbezogene Gesellschaftsanalyse vortrug und Konsequenzen für die Sozialpsychiatrie ableitete. Ich muß dem Autor heute Abbitte leisten. Wahrscheinlich war seine Gesellschaftsanalyse sehr viel hellsichtiger als meine Position, von der her ich mich über ihn lustig machte, obgleich die Gänsehaut, die ich damals auch gespürt hatte, mich hätte warnen sollen. Ich will die Aussagen von RUESCH kurz rekapitulieren.
Ausgangspunkt der Analyse ist der grundlegende gesellschaftliche Wandel, der mit der Veränderung der Produktionstechnologie einsetzt, die durch die Stichworte Atomenergie und Automation benannt sind. Sie haben das Arbeitsverständnis der westlichen Zivilisation grundlegend verändert. Gebraucht wird nicht mehr jede verfügbare Arbeitskraft, sondern die gesellschaftliche Produktion wird von einem relativ kleinen Kern hochqualifizierter Fachleute sichergestellt, RUESCH nennt sie die »neue Elite«:
»Den Kern der nachindustriellen Gesellschaft bilden Personen, die über symbolische Fähigkeiten verfügen - seien sie sprachlicher oder mathematischer Natur- und die diese Fähigkeiten aufdem Gebiet der Werbung, der Datenverarbeitung, der Finanzkontrolle und der Strukturierung der sozialen Ordnung einsetzen können« (1972. S. 82).
Diese Elite ist vor allem in Regierung, Industrie, Finanzwesen, Wissenschaft, Technik, Militär und Bildungswesen konzentriert. Für diesen gesellschaftlichen Kern gelten ganz andere Quallfikationsanforderungen als in der industriellen Arbeitsgesellschaft. Der klassische Facharbeiter, der mit seiner handwerklichen Qualifikation den Kern der industriellen Produktion darstellte, hat diesen Rang verloren:
»Doch seit die Maschine alle niederen Arbeiten verrichtet und wir über unerschöpfliche Energiequellen verfügen, hat die physische Leistung an Wert verloren, dagegen stehen heute rationales Denken und der Zugang zu Informationen hoch im Kurs. Unglücklicherweise verfügen aber nicht alle über die nötige Intelligenz, komplexe symbolische Systeme zu überschauen und haben auch nicht von klein auf in einem für eine solche Entwicklung günstigen Milieu gelebt« (S. 83).
Hier stellt sich nun für RUESCH die Frage nach den Größenordnungen: »Wie groß ist die Zahl der sozial Unfähigen, der Außenseiter, und wer gehört zur Kerngruppe der nachindustriellen Gesellschaft?« (ebd.). Neben diesen beiden Abteilungen wird noch eine dritte Gruppe eingeführt, die bis zum IQ-Wert von 111 reicht (hier beginnt dann die Elite), mindestens ein Jahr höhere Schulbildung hat und die vor allem als Verbraucher von Konsumgütern und Dienstleistungen wichtig sind. Unter Berücksichtigung verschiedener sozialstatistischer Indizes kommt RUESCH dann zu folgender quantitativen Einschätzung:
» ... der Kern umfaßt nur 10 Prozent, während die sich um den Kern formierende Gruppe 25 Prozent ausmacht. Somit verrichtet ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung eine bestimmte Arbeit und wird dafür entlohnt. Die Kranken (zu denen auch die Alten zählen), Arbeitsunfähigen und Kinder stellen 65 Prozent, das sind zwei Drittel der Gesamtbevölkerung. Diese Gruppe läßt sich als 'Nicht-Arbeitswelt' definieren« (S. 85).
Für RUESCH besteht das neu entstandene Hauptproblem für Sozialpsychiater darin, innerhalb dieser neu entstandenen gesellschaftlichen Konfigurationen regulative Funktionen zu übernehmen. Entscheidendes Problem für die postindustrielle Gesellschaft ist die hohe Störanfälligkeit im Kernbereich. Die dort tätige Elite darf keine nennenswerte Versagerquote beinhalten. Hier haben sich die diagnostischen Fähigkeiten der professionellen Menschendifferenzierer zu erweisen. Für RUESCH besteht die zentrale Aufgabe darin, die »sozial Unfähigen« auszusortieren und ihnen den Zugang zum Kernbereich zu verwehren. Da nicht nur mangelnde Intelligenz zum Störfaktor werden kann, sondern auch Persönlichkeitsfaktoren und kommunikative Kompetenzen relevant sind, wird eine entsprechende multifaktorielle Diagnostik entworfen, die RUESCH für weitestgehend computerisierbar hält.
Für die Praxis der helfenden Berufe leiten sich für RUESCH eine Reihe von Aufgaben ab, die ich ungekürzt zitieren möchte:
-
Wir müssen mehr Toleranz gegenüber abweichendem Verhalten in allen Lebenslagen aufbringen, aber die Toleranz der Institutionen für abweichendes Verhalten im technischen Bereich einschränken: niemand sollte unter Inkompetenz, Nachlässigkeit und Schikanen leiden müssen.
-
Alte Gewohnheiten, nach denen Personen mit geringerer Intelligenz oder begrenzter Fähigkeit, interpersonelle Beziehungen zu unterhalten, in eine bestimmte soziale Rolle gedrängt werden, müssen zugunsten neuer Gewohnheiten aufgegeben werden, die diesen Menschen ihren Platz in der Gesellschaft sichern.
-
Da die hochqualifizierte Kerngruppe der technologischen Gesellschaft an dem Prinzip der Arbeit orientiert ist, während die Massen notwendigerweise am Prinzip der Freizeit orientiert sind, müssen wir neue Schulprogramme und Bildungspläne schaffen, um die Gesellschaft auf die Rollenumverteilung vorzubereiten. In vergangenen Zeiten vergnügten sich die oberen Schichten, während die unteren arbeiteten.
-
In einer Phase des Umbruchs zwischen alten Wertvorstellungen, nach denen die Privatinitiative, der Befähigungsnachweis, das Wissen und die individuelle Überlegenheit sich besonderer Wertschätzung erfreuten, und einer neuen Ethik des Kollektivismus, der Automation der Empfindungen und Bilder, wird die Zahl der Personen zunehmen, die sich weder in der alten, noch in der neuen Welt zurechtfinden. Diese Außenseitergruppen sind zum Gegenstand der Herausforderung für die Disziplinen der »psychischen Gesundheit« geworden« (1972, S. 91 f.).
Mir kommen wesentliche Passagen dieser Analyse höchst aktuell vor. Hier wird ein Tätigkeitsprofil für die helfenden Berufe umrissen, das nicht so weit von dem entfernt ist, was sie faktisch tun. Einzig die wohlfahrtsstaatliche Fürsorglichkeit mit der Toleranz für abweichendes Verhalten und die Sicherung von einigermaßen lebenswerten Existenzbedingungen für die sozial Unfähigen wirken naiv oder schlagen in Zynismus um, wenn angedeutet wird, daß die unteren Schichten sich in Vergnügungen ergehen werden, während die Elite einzig hart zu arbeiten hat. Hier ist RUESCH von der Wohlfahrtsstaatsideologie der Kennedy-Ära geprägt. Das Realitätwerden vieler seiner Prognosen unter monetaristisch-konservativen Regierungen hat er sich in der Form von Verarmung und Verelendung kaum vorstellen können. In der Haltung der inneren Zustimmung entwarf RUESCH eine Gesellschaftsprognose, deren Realismus durch kritische Gesellschaftsanalytiker weithin bestätigt wird.
Die regierungsamtlich bestellten Auguren sagen uns eine rosige ökonomische Zukunft voraus. Die Krise wird als bewältigt bezeichnet. Ein paar Irritationen bleiben jedoch. Auch die so optimistischen Wirtschaftsgutachter sehen nicht, wie sich die gegenwärtige Erwerbslosenquote nennenswert reduzieren ließe. Für diese Gruppe bringt der Aufschwung offensichtlich nichts. Die Rentner müssen sich mit minimalen Rentenerhöhungen begnügen, die real eine weitere Verschlechterung ihrer Situation bedeuten. Das gleiche gilt für die wachsende Zahl der Sozialhilfeempfänger, deren »Warenkorb« immer leerer wird.
Wir haben also auf der einen Seite einen wachsenden Wohlstand bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Gesellschaft, der jedenfalls bedeutend größer ist als die klassischen »oberen Zehntausend«, für den die ökonomische Krise als beendet gelten kann. Und wir haben auf der anderen Seite einen anderen Teil unserer Gesellschaft, für den das »Ende der Arbeitsgesellschaft« verkündet wird, für den das Thema »Neue Armut« diskutiert wird und der als »Peripherie« bezeichnet wird, obwohl er wahrscheinlich längst die Mehrheit stellt (die »abweichende Mehrheit« im Sinne des Ehepaars BASAGLIA [1972]). Die Beendigung der Krise erfolgt nicht mehr nach dem klassischen Programm des wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus (von manchen als keynesianisches Modell von anderen als »sozialdemokratischer Staat« (BUCI-GLUCKSMANN und THERBORN (1982) bezeichnet), der dem Anspruch nach allen gesellschaftlichen Gruppen eine erträgliche Existenzsicherung versprach. Der neue »Aufschwung« erfolgt nicht in den gesellschaftlichen Formen, die wir aus der Nachkriegsentwicklung kennen. »Das Kapital muß sich eine neue, passendere Gesellschaft schaffen« (HIRSCH, 1985, S. 1).
Unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs vollzieht sich eine ökonomische Strukturveränderung, die keinen gesellschaftlichen Bereich unberührt läßt. Vor allem die mit hohem Innovationstempo eingeführten neuen Produktions- und Kommunikationstechnologien (Stichworte sind hier Computerisierung, Automation, Mikroelektronik, Robotereinsatz) führen im Unterschied zur Phase extensiven Wirtschaftswachstums zu einem verringerten Arbeitskräftebedarf. Alle groß- und kleingewerblichen, handwerklichen und auch häuslichen Produktionsformen werden durch diese technischen Veränderungen tiefgreifend verändert. Und diese haben einen gesellschaftlichen Wandel zur Folge:
»In gewisser Weise sind es die neuen Technologien selbst, die im internationalen Maßstab die Voraussetzungen für die Durchsetzung der ihnen entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen schaffen: je feiner zerlegbar und standardisierbar die Produktionsprozesse werden und je perfekter Transport- und Kommunikationstechnologien verfügbar sind, desto flexibler kann sich das Kapital die jeweils günstigsten Standorte rund um den Erdball aussuchen. Längst haben sich die weltweit operierenden internationalen Unternehmen von den einzelnen Nationalstaaten emanzipiert. Indem sie sich dort niederlassen, wo sie jeweils die günstigsten Bedingungen vorfinden, treiben sie die konkurrierenden kapitalistischen Länder (und nicht nur diese) in einen verhängnisvollen Wettlauf um Technologieförderung, Produktivitätssteigerung, Investitionsklimaverbesserung, Rationalisierung, schließlich Zerstörung menschlicher Arbeitskraft und Natur« (Hirsch, 1985, S. 2).
Die Folgen dieser Entwicklung sind eine tiefe innergesellschaftliche Spaltung. Der Anteil an qualifizierten Arbeitskräften, die die neuen Produktionstechnologien beherrschen und zu ihrem Funktionieren gebraucht werden, sinkt weiter und die Erwerbslosenquote wird hoch bleiben bzw. noch ansteigen.
»Immer mehr spaltet sich die Gesellschaft in einen 'Kern' von leistungsfähigen und -willigen, qualifizierten, angepaßten und gut funktionierenden Besitzern relativ sicherer Arbeitsplätze und Einkommen und eine wachsende 'Peripherie' von Ausgegrenzten und Marginalisierten. Die sozialen Unterschiede nehmen wieder zu: durch das Land zieht sich ein immer breiter werdender Riß« (ebd., S. 3).
Die Teilgesellschaft, die hier als »Peripherie« bezeichnet wird, dürfen wir uns nicht wie die »Lazarusschicht« des Frühkapitalismus vorstellen. Wir haben es mit einer relativen Verarmung zu tun, die eine gewisse Teilhabe am Massenkonsum noch ermöglicht, der ja eine wichtige Grundlage der kapitalistischen Ökonomie bleibt. So kann man in Obdachlosenquartieren durchaus Video und Telespiele antreffen, die die Funktion als »letzter dürftiger Ersatz für befriedigendes Arbeiten oder intakte soziale Umwelt« (S. 5) übernehmen sollen. Die Konsummuster verlaufen entlang dem tiefen gesellschaftlichen Riß:
»Banalisierter Massenkonsum inklusive trivialen Freizeitparks und industrialisierter Massentourismus für die Vielen, qualitativ hochstehende Ernährung, gentryfizierte, d. h. edelsanierte Innenstadtgebiete und teure Naturreservate für diejenigen, die dies alles bezahlen können« (S. 6).
Muß eine so zerfallende Gesellschaft nicht zugleich in hohem Maße revolutionäres Potential freisetzen? Lassen sich große gesellschaftliche Teilgruppen so ohne Widerstand einfach marginalisieren? Diese ökonomischen Prozesse erreichen Subjekte, die in hohem Maße bereits individualisiert sind und die vorhandenen kollektiven Handlungsmuster werden von der Neuartigkeit der Spaltungslinie selber gelähmt oder sie schlagen sich auf eine Seite (vgl. zum Beispiel wie schwer sich die Gewerkschaften, als die Organisation der Kernarbeiterschaft, mit den Arbeitslosen tun oder die SPD, die sich in Programmatik und Werbung voll auf den gesellschaftlichen »Kern« konzentrieren wird). Hinzu kommt die Neuformation der ideologischen Apparate. Der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat vertrat Werte wie Fortschritt, Gleichheit, materielle Sicherheit und die Absicherung existenzieller Risiken. Mit der neokonservativen Wende gelten auf einmal ganz andere Werte als zentral: Leistung, individuelles Durchsetzungsvermögen, Elitebewußtsein, Familie, Opfer und Moral. Die Ideologieproduktion hat ein deutlich anderes Profil gewonnen:
»Einer sich spaltenden, in konkurrierenden Statusgruppen und ausgegrenzte Zonen zerfallenden Gesellschaft werden die entsprechenden Weltbilder verpaßt: bestehend aus einer widersprüchlichen Mischung von individualisiertem Leistungsmythos und autoritärem Sicherheitsbedürfnis, Gewaltbereitschaft und Angst, kollektiver Aggressivität und privatistischer Resignation, Pseudoliberalismus und stumpfer Moral, Singlekultur und synthetischer Familienidylle. Nationalismus wird wieder brauchbar als Ersatz für den verschwundenen materiellen Konsens der Gesellschaft, die sich vertiefenden sozialen Spaltungen müssen mit dem Kitt alt - neuer Feindbilder verkleistert werden, die da sind: Ausländer, Aussteiger, Sozialparasiten und Unangepaßte, Kommunisten, Pazifisten, Russen - gegebenenfalls aber auch schon mal die Amerikaner« (S. 10).
Eine sich spaltende Gesellschaft hat ein erhöhtes Kontrollbedürfnis. Wie schon in den ersten Industrialisierungsschüben lösen sich unter den Bedingungen der gegenwärtigen Veränderung der Produktionsformen bestehende Formen sozialer Integration immer stärker auf. Traditionelle Sozialbeziehungen, die noch nicht von der Logik warenförmiger Austauschbeziehungen durchdrungen sind, werden von einem fortschreitenden gesellschaftlichen Atomisierungsprozeß erfaßt. Davon werden zunehmend auch traditionelle, einst homogene Arbeitermilleus erfaßt (BECK, 1983).
Diese fortschreitende Individualisierung bei gleichzeitig gewachsener gesellschaftlicher Störanfälligkeit fordert staatliches ordnungspolitisches Kontrollhandeln. In immer weitere Bereiche schaltet sich deshalb der Staat ein. Die wiederholt beschriebenen Tendenzen zur zunehmenden Verrechtlichung und Bürokratisierung immer weiterer gesellschaftlicher Bereiche sind empirische Indikatoren hierfür (vgl. FUNK, HAUPT, NARR und WERKENTIN, 1984). Staatliche Interventionen decken eine breite Skala von ordnenden Maßnahmen ab: helfende, stützende, korrigierende, verhütende oder kontrollierende. Wie schon zu Beginn angesprochen, muß man in dieser Entwicklung einen Grund für den Professionalisierungsboom der helfenden Berufe sehen. Die Politologen sprechen hier von einem »Durchstaatlichungsprozeß« (HIRSCH, 1980), der allerdings mit seinen ausgreifenden sozialadministrativen Eingriffen immer wieder neue Probleme schafft, die nur durch die Intensivierung und Verfeinerung staatlicher Überwachung aufgefangen werden können.
Bezog sich dieses Projekt des wohlfahrtsstaatlichen Staatsinterkonventionismus in den 70er Jahren noch auf die Gesellschaft als Ganze (hierfür sind Stichworte: Vollbeschäftigung, hohes Konsumniveau, Sozialpartnerschaft), so ist dieses Projekt heute an die Grenzen der Finanzierbarkeit gestoßen (das ist die viel diskutierte fiskalische Krise, die schon in den frühen 70er Jahren in dem Slogan »Privater Reichtum und öffentliche Armut« erkennbar wurde). Was die sozialliberale Koalition aus Mangel an alternativen Denkansätzen vorbereitet hat, ist dann von der konservativen Regierung offensiv zur »neuen Sozialpolitik« deklariert worden. Der »Umbau des Sozialstaates nach rechts« sucht folgenden Weg aus der Finanzierungskrise:
»Es soll ... ein duales Modell der sozialen Reintegration entstehen, parallel zur Spaltung der Gesellschaft in »Kern« und »Rand«: Ein Armen-Zwangs-Sozialstaat und daneben auf dem Markt käufliche soziale Reproduktionsleistungen plus hegemonial kontrollierte Selbsthilfe, sprich: Subsidiarität mittels ehrenamtlicher Arbeit von (Mittelschichts-) Frauen, über denen Kirche, Caritas und christliche Sozialmanager thronen« (DIEMER, 1984, S. 7).
Entsprechend der beschriebenen Spaltung der Gesellschaft werden für die beiden Teilgesellschaften zwei unterschiedliche Kontrolldispositive ausgebildet. Im »produktiven Zentrum« der gespaltenen Gesellschaft stellen sich die Steuerungs- und Legitimationsprobleme anders als auf der Seite der Marginalisierten. Wir können vom Doppelcharakter der Kontrollpolitik im gegenwärtigen Kapitalismus sprechen. Er ist in einer Intensivierung der »weichen« Kontrollen bei gleichzeitigem Ausbau der »manifest repressiven« beobachtbar.
Für den psychosozialen Bereich heißt das: Zunahme psychologisierender/therapeutisierender Dienstleistungsangebote bei gleichzeitiger Regeneration und Verstärkung ausgrenzender Kontrollsysteme. In den 70er Jahren gab es ja mal die - durchaus unterschiedlich bewertete - Vermutung oder Erwartung, daß sich der repressive Ausgrenzungsapparat nicht in Wohlgefallen, aber in das wohlfahrtsstaatliche Modell der 'fürsorglichen Belagerung' auflösen würde. Diese Erwartung hat sich als Fehlprognose erwiesen. Gefragt sind gegenwärtig weniger Modernisierungsagenten, die einen Normalisierungsanspruch für alle aufrechterhalten (z. B. Reintegration im beruflichen Bereich oder Reintegration in den durchschnittlichen Alltag). Gefragt sind vielmehr auf der einen Seite Grenzwächter an der gesellschaftlichen Selektionsgrenze (das Modell RUESCH) und Vollzugsfunktionäre einer gespaltenen Gesellschaft, die möglichst noch ein humanitäres Legitimationsbedürfnis symbolisch aufrechterhalten.
Gefragt sind auf der anderen Seite Anbieter von psychologischen Waren, Sinnproduzenten, die den hohen gesellschaftlichen Individualisierungsdruck für Menschen im »produktiven Zentrum« abpuffern und die Bearbeitung jener Ängste ermöglichen, die für bürgerliche Sozialcharaktere unter diesem individuellen Profilierungszwang entstehen. Als einen seiner 10 Megatrends, die der amerikanische Zukunftsprophet der »postindustriellen Gesellschaft« J. NAISBITT verkündet, nennt er den folgenden: »je mehr Hochtechnologie, desto größer das Bedürfnis nach Persönlich-Menschlichem« (1984, S. 79). Die neuen Technologien, die die Arbeitstätigkeit der gesellschaftlichen Eliten bestimmen werden, lassen Bedürfnisse entstehen, die zum Psychomarkt drängen.
In seinem kürzlich erschienenen Buch über »Die neue Unübersichtlichkeit« hat J. HABERMAS (1985) seine Sicht der Krise des Wohlfahrtsstaates formuliert. Er unterscheidet drei Reaktionsmuster auf die Krise:
-
Den »industriegesellschaftlichen-sozialstaatlichen Legitimismus« der rechten Sozialdemokratie, der auf das Ziel verzichtet hat, »die heteronome Arbeit so weit zu bezwingen, daß der in die Produktionsspäre hineinreichende Status des freien und gleichberechtigten Bürgers zum Kristallisationskern autonomer Lebensformen werden kann« (S. 152).
-
Den Neokonservativismus und
-
die Allianz der Dissidenten von der Wachstumsgesellschaft, die neuen sozialen Bewegungen.
HABERMAS ist nun sicherlich kein Prophet der alternativen Bewegungen, er hat ihnen vielmehr häufig die Leviten gelesen. Aber im Unterschied zu den, beiden erstgenannten eher sklerotischen politischen Reaktionsformen sieht er bei diesen Bewegungen noch am ehesten utopisches Potential in einer politischen Landschaft, die durch die »Erschöpfung utopischer Energien« gekennzeichnet ist - so der Untertitel seines Aufsatzes. HABERMAS beansprucht für sich nicht, einen analytischen und problemlos praktizierbaren Weg aus dieser »neuen Unübersichtlichkeit« weisen zu können, aber er setzt vorsichtig auf die neuen Verkehrsformen und Bedürfnisse, die in den verschiedenen sozialen Bewegungen sichtbar und lebbar geworden sind. In diesem Zusammenhang formuliert er sozusagen ins »normative Niemandsland« (S. 160) hinein:
»Moderne Gesellschaften verfügen über drei Ressourcen: Geld, Macht und Solidarität. Deren Einflußsphären müßten in eine neue Balance gebracht werden. Damit will ich sagen: die sozialintegrative Gewalt der Solidarität müßte sich gegen die ‚Gewalten' der beiden anderen Steuerungsressourcen, Geld und administrative Macht, behaupten können« (S. 158).
In den neuen sozialen Bewegungen sieht HABERMAS solche Solidaritätspotentiale. Hier würden sowohl »traditionell eingewöhnte Subkulturen« gegen den Modernisierungsdruck verteidigt oder an der »Veränderung der Grammatik überholter Lebensformen« gearbeitet (S. 159). In ihnen würden »Formen der Selbstorganisation« erkennbar, die »kollektive Handlungsfähigkeit« verstärken (ebd.). Auf dieser Grundlage wachsen dann auch Hoffnungen auf Widerstandspotentiale gegen die Verewigung der Spaltungstendenzen. So formuliert J. HIRSCH diese Hoffnung:
»Was als »neue Bewegungen« oder »zweite Gesellschaft« bezeichnet wird, ist... nicht eindeutig dem gesellschaftlichen »Kern« oder der »Peripherie« zuzurechnen, vielmehr beruht ihre Bedeutung und Stärke gerade darauf, daß sie eben diese sich ausweitende Kluft immer noch zu überspannen vermögen« (1985, S. 14).
Kehren wir zurück zu unserem Problem, wie sich die Spaltung der Gesellschaft auf die Helfersituation auswirkt und welche Handlungsalternativen sich hieraus ergeben. Die Helfer sind von ihrer Herkunft her wie von ihren Arbeitsfeldern betrachtet auf beiden Seiten des Grabens. Gerade an den Bruchstellen und Verwerfungen dieser Gesellschaft, an deren Spaltungslinie sind sie besonders massiert. Ein immer größerer Teil der Helferberufe - und das gilt insbesondere für die nachwachsenden Generationen - gehört existenziell zur Peripherie und hat nur geringe Chancen auf berufliche Integration in den gesellschaftlichen Kern. Es bleibt nur der Initiativenbereich (amtlich als »zweiter Arbeitsmarkt« tituliert) und die Mitarbeit bei Initiativen und Gruppen, die zu den neuen sozialen Bewegungen zu zählen sind. Hier zählen kaum mehr die »Sozialcharaktere« und »Wertorientierungen« der Produktionsethik, die für den »produktiven Kern« Gültigkeit besitzen. Hier werden experimentell neue Lebensformen ausprobiert, hier löst man sich von den Normen eines schalen Massenkonsums, hier zählen Autonomie und Selbstorganisation.
In diesem Sektor gesellschaftlicher Peripherie sind innovative Konzepte entstanden, z. B. die Idee solidaritätsstiftender »kleiner sozialer Netze«, die auch für die extrem marginalisierten Gruppen noch Lebensperspektiven eröffnen (z B. therapeutische WGs oder alternative Produktionsbetriebe). In dieser Verbindung von eigener Lebenswelt und in ihr verankerter Bedürfnisse und Initiativen zur eigenen beruflichen Reproduktion steckt für mich Potential zur Überwindung der Spaltung, vor allem dann, wenn sich diese Konzepte in der eigenen beruflichen Szene verallgemeinern lassen, auch über die Spaltung hinweg. Dafür brauchen wir im Augenblick fortschrittliche psychosoziale Verbände besonders dringlich, in denen über die verschiedenen beruflichen Arbeitsfelder hinweg Konzepte entwickelt werden müßten, die den Graben überspannen.
So politisch - regressiv auch die gesellschaftliche Entwicklung hin zu der beschriebenen Zerklüftung eingeschätzt werden muß, wir sollten uns in unserer Analyse nicht um die emanzipatorisch zu nützenden Spielräume betrügen, die in ihr auch stecken. Wir haben es nicht mit einem monolithischen, widerspruchsfreien Projekt der neokonservativen Formierung aus einem Guß zu tun. Der tiefgreifende gesellschaftliche Umbau führt zu gesellschaftlicher Desintegration und diese wiederum erweitert auch Spielräume für Individualität, für Traditionsbrüche, die neue Lebensperspektiven eröffnen können. Hieran sind Helfer auf beiden Seiten der Spaltung beteiligt. Sie sind nicht bloß Befriedungsagenten, wenngleich gefährdet genau dies vor allem zu sein. Wir müssen uns um eine politische Kultur in unseren eigenen Reihen bemühen, die das progressive Moment in unseren Berufsrollen befördert. Dazu gehört vor allem auch Analyse und Bewußtsein der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation. Hierzu sollte mit diesem Beitrag etwas beigesteuert werden.
Inhaltsverzeichnis
Die Rede über psychisches Leid erfolgt in der Alltags- wie in der Expertensprache meist in der Form von Zustandsbeschreibungen (»sie/er ist verrückt«, »... hat eine Neurose«, »... ist schizophren« etc.). Aber im Unterschied zu Behinderungen, die von Geburt an sichtbar und einer Person zurechenbar sind, treten psychische Störungen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Lebensgeschichte auf, haben eine spezifische Verlaufsgestalt und sind in der Regel durch professionelle Interventionen beeinflußbar.
In welchem Verhältnis stehen nun Verlaufsgestalten psychischer Störungen zur Biographie eines Individuums? Brechen sie als Prozesse mit einer autochthonen naturhaften Regelhaftigkeit in das Leben von Menschen ein und produzieren biographische Brüche? Oder lassen sie sich als sinnhaftes Resultat aus der psychodynamischen Mikrostruktur einer Lebensgeschichte rekonstruieren? Oder gibt es auch die Möglichkeit, die Verlaufsgestalt psychischer Störungen aus den gesellschaftlichen Erfahrungen abzuleiten, die eine Person als Folge der sozialen Reaktionen auf sein Anderssein zu verarbeiten hat? Diese Fragen haben in unterschiedlichen Paradigmen ihre positive Antwort gefunden.
Die Psychiatrie, als die für psychische Störungen zuständige medizinische Disziplin, hat sich in ihrer Geschichte darum bemüht, den Diskurs über psychische Störungen aus der moralischen Sphäre herauszulösen und auf eine naturwissenschaftliche Basis zu stellen. Entsprechend den Systematisierungsversuchen der medizinischen Pathologie sollte auch die Psychiatrie die Ordnung ihres professionellen Handlungsraums durch eine strikte Ausrichtung an den Eigengesetzlichkeiten naturbestimmter Abläufe erhalten. In der Annahme, daß die Gründe für das unverständliche Denken, Fühlen und Handeln in Abweichungen, Störungen und Schädigungen des biologischen Substrats auffindbar sein werden, versuchte man die beobachtbaren Symptome, ihre spezifischen Konfigurationen und die Verlaufsformen einer psychischen Störung präzise festzuhalten und in eine ordnende Systematik einzufügen. Wie für andere organmedizinische Krankheiten sollte auch für »psychische Krankheiten« die »Naturgeschichte« (»natural history of disease«) dokumentiert werden.
Es galt den reinen Typus zu finden, der sich aus der Eigenlogik des biologischen Prozesses ergibt.
Die naturhistorische Betrachtung von Krankheiten ist von dem gleichen Systemgedanken geprägt, der Mineralogie, Zoologie und Botanik so erfolgreich zu einer ordnenden Systematik ihres disziplinären Reviers verholfen hat. Sie kamen so zu natürlichen Ordnungen im Bereich der Mineralien, Tiere und Pflanzen und entsprechend klassifizierten Mediziner ihre Krankheiten und ordneten sie auf Grund von Symptomen nach Klassen, Familien und Arten. Diese Suche nach der »natürlichen Ordnung« der Krankheiten führte konsequenterweise zu einer Abstraktion vom individuellen Fall und dem spezifischen Krankheitserleben einer Person. Es interessierte nicht die individuelle Krankengeschichte, also die biographische Verarbeitung einer Krankheit, sondern die Krankheitsgeschichte. F. HARTMANN führt den »Sieg« des naturhistorischen über das personale Krankheitsverständnis auf den englischen Empirismus in der Medizin des 17. Jahrhunderts zurück:
»Die völlige Ablösung der Krankheit vom Kranken hat T. SYDENHAM (1624-1689) durchgeführt ... Der kranke Mensch kommt in dieser Krankheitsgeschichte nicht mehr vor. Das Persönliche variiert die Krankheitserscheinungen lediglich. Ihr Typus aber existiert außerhalb des Menschen ... Nur wer die Krankheit so betrachtet wie SYDENHAM hat Grund, nach der Ordnung des Krankheitsgeschehens, nach den Gesetzen des Ablaufs einer Krankheit und nach den Regeln der Zusammengehörigkeit ihrer Symptome zu forschen, mit denen sie sich dem Arzt zu erkennen gibt« (1966, S. 23 f.).
Der naturgeschichtliche Krankheitsbegriff konzentriert sich auf das somatische Substrat von dem angenommen wird, es »unterliege einem strengen naturgesetzlichen Determinismus, zeige eine große Homogenität und Konstanz ('natural history of disease')«. Ein psychosozialer Aspekt gilt als vernachlässigbar:
»entweder könne er das somatische Geschehen überhaupt nicht beeinflussen, sondern höchstens begleitend kommentieren; oder er setze per Verhalten gewisse Ausgangsbedingungen, die dann einen streng gesetzmäßigen, somatischen Prozeß auslösen« (MASCHEWSKY, 1984, S. 22).
Nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch in der Medizin insgesamt, ist das naturhistorisch-biomedizinische Modell ins Zentrum heftiger Auseinandersetzungen geraten (vgl. ENGEL, 1979). Psychologische und sozialwissenschaftliche Denkansätze, aber auch ökologische und ganzheitliche Vorstellungen, haben in Medizin und Psychiatrie die Vorherrschaft der »biomedizinischen Modelle« zumindest in Frage gestellt. Gleichwohl werden sie nach einer Phase defensiver Haltung von führenden Vertretern der Psychiatrie erneut als solide Basis ihrer Disziplin propagiert. Einen Artikel über die »Natur psychiatrischer Krankheit« faßt GUZE so zusammen:
»Die Anwendung des medizinischen Modells auf die Psychiatrie beruht auf den folgenden Prämissen. So wie es für die allgemeine Medizin gilt, so gibt es auch viele psychiatrische Krankheiten, von denen jede ein unterschiedliches klinisches Bild, eine natürliche Geschichte, Ätiologie, Pathogenese und Behandlungsreaktivität hat. Biologische Prozesse spielen eine wichtige spezifische Rolle bei der Entwicklung vieler psychiatrischer Störungen, genauso wie es bei allgemeinen medizinischen Störungen der Fall ist« (GUZE, 1978, S. 306).
Für die deutsche Psychiatrie hat diese Position in exemplarischer Weise K. SCHNEIDER formuliert:
Der Krankheitsbegriff ist für uns gerade in der Psychiatrie ein streng medizinischer. Krankheit selbst gibt es nur im Leiblichen und 'krankhaft' heißen wir seelisch Abnormes dann, wenn es auf krankhafte Organprozesse zurückzuführen ist« (19678, S. 7).
Beim naturhistorischen Krankheitsverständnis wird nicht danach gefragt, ob das Auftreten und die spezifische Form einer psychischen Störung aus dem bisherigen biographischen Lebensentwurf und den spezifischen Lebenserfahrungen einer Person verstanden werden könnte. Mit der von lebensgeschichtlichen Prozessen unabhängigen Eigenlogik bricht der Krankheitsprozeß in die Biographie einer Person ein und bestimmt für einen abgrenzbaren Zeitraum oder auf Dauer den Lebensverlauf der Person.
Im Unterschied dazu versuchen unterschiedliche psychosoziale Ansätze die Entstehung psychischen Leids als entzifferbare subjektive Antwort eines Individuums auf spezifische Lebensereignisse und Belastungen verständlich zu machen. Die spezifische Lebensgeschichte einer Person hat zu persontypischen Kompetenzen, Bedürfnissen, Erwartungen und Verletzlichkeiten geführt, mit denen aktuelle Lebensaufgaben, Belastungen und Krisen bewältigt werden müssen. Aus dem jeweils gelingenden bzw. mißlingenden Ineinandergreifen von aktuellen Anforderungen und subjektiven Ressourcen erwachsen biographisch neue Handlungschancen und Weiterentwicklungen oder neue Verletzlichkeiten und Mißerfolgserfahrungen. Entsprechend läßt sich psychisches Leiden biographisch entschlüsseln: Es wird rekonstruierbar aus dem spezifischen dialektischen Verhältnis von objektiven gesellschaftlichen Anforderungen, Belastungen und Widersprüchen und den subjektiven Handlungsbedingungen. In konzeptuell unterschiedlichen Akzentsetzungen wird dieser lebensgeschichtliche Ansatz (life history) von der Psychoanalyse ebenso herangezogen wie von dem sozialepidemiologisch begründeten Belastungs-Bewältigungs-Modell.
Innerhalb eines Interpretationsansatzes, der sich auf lebensgeschichtliche Erfahrungsbildungsprozesse konzentriert, kann der spezifischen biologischen Ausstattung einer Person sehr wohl Beachtung geschenkt werden. Allerdings wird sie als »gesellschaftlich bearbeitet« angesehen, ohne »in diesen Formen ihrer Bearbeitung« aufzugehen (HORN, 1974, S. 168). Lebens- und naturgeschichtliche Prozesse ergeben nicht in additiver Form eine vollständige Perspektive, sondern sie durchdringen sich.
Das naturgeschichtliche und - bis in einem gewissen Maße - auch das lebensgeschichtliche Modell konzentrieren sich auf das Individuum, das entweder passive Trägerinstanz eigengesetzlicher biologischer Prozesse ist (im naturhistorischen Verständnis) oder sich als Subjekt mit den Widrigkeiten seiner gesellschaftlichen Lebenssituation auseinanderzusetzen hat. Diese individualgeschichtliche Auseinandersetzung findet jedoch in einem sozialen Raum statt und wird in diesem auch als gelingend oder mißlingend bewertet. Das subjektive Handeln ist Teil komplexer Handlungsketten und fordert Resonanz und Intervention von jenen, die innerhalb dieser gesellschaftlichen Konfigurationen von diesem Handeln betroffen sind. Sie können die Situation eines Mitglieds ihres Sozialsystems für sich so interpretieren, daß ihre Hilfe erforderlich ist oder sie können darin eine Beeinträchtigung ihrer eigenen Lebenspläne und Bedürfnisse sehen. Was für ein Individuum eine lebbare Antwort auf seine spezifische Lebenssituation sein mag, wird möglicherweise von anderen Angehörigen seiner sozialen Mikrowelt als nicht mehr zu tolerierende Abweichung von Gruppennormen angesehen. Infolgedessen werden Anstrengungen unternommen, die Abweichung zu korrigieren. Sollte das in der mikrosozialen Konstellation von Primärgruppen nicht mehr gelingen, erfolgt möglicherweise der Ausschluß aus der Gruppe oder es wird die Intervention formeller Institutionen sozialer Kontrolle veranlaßt. In den vielfältigen Transaktionen zwischen dem Individuum, das mit seinem Handeln aus dem normativen Horizont seines sozialen Netzwerkes herausfällt und den unterschiedlichen Versuchen, eine lebbare Ordnung wieder herzustellen, konstituiert sich die Sozialgeschichte psychischen Leids.
Bei der Rekonstruktion der Biographie einer Person, die als psychisch krank angesehen wird, ist es wichtig, die Abfolge der sozialen Transaktionen rund um die als abweichend betrachtete Person zu verfolgen, die dabei beteiligten Akteure und Institutionen zu erfassen, sowie ihre spezifischen Vorstellungen und Wissensbestände, auf deren Grundlage sie helfend, korrigierend oder kontrollierend auf die Person einzuwirken versuchen. Entscheidend ist ebenso, in welcher Weise sich die Person mit diesen sozialen Reaktionen auf sein Anderssein auseinandersetzt; ob es deren normative Regelbestände akzeptiert oder sich von ihnen distanziert; ob es Interventionen, die vom Adressaten als Hilfe gemeint sind, als hilfreich oder als unzumutbares Eindringen in seine Privatsphäre erlebt; ob das eigene Anderssein als Belastung erfahren wird und Leidensdruck erzeugt; welches Verständnis von den aktivierten Institutionen vorherrscht und welche soziale Distanz zwischen der Person und den Institutionen besteht.
Eine mikrosozialgeschichtliche Perspektive auf psychisches Leid ist mit einer lebensgeschichtlichen Perspektive und auch mit Elementen einer naturgeschichtlichen Position durchaus vereinbar und erweitert diese zugleich um Dimensionen, ohne die psychisches Leid nicht voll erfaßt werden kann. Die natur- und lebensgeschichtlichen Aspekte bestimmen die Möglichkeiten des Subjektes in der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Reaktionen entscheidend mit. In den Identitätsmustern des Subjektes verschmelzen die individual- und sozialgeschichtlichen Prozesse zu biographiespezifischen Konfigurationen.
In der Kontroverse, die aus den konkurrierenden Antworten auf die Frage entstanden ist, was denn das Wesen psychischen Leids sei, präsentieren sich Vertreter des naturhistorischen (meist Psychiater), des lebensgeschichtlichen (in der Regel Psychologen/ Psychoanalytiker) und eines sozialhistorischen Herangehens (Sozialwissenschaftler) als Repräsentanten von jeweils überlegenen Erklärungsalternativen. Dieser Anspruch ist höchst fragwürdig und mit guten Argumenten ist gegenüber jeder Position auch bereits der Reduktionismusvorwurf erhoben worden (sie sei biologistisch, psychologistisch oder soziologistisch). Wenn ich mich im weiteren auf die Darstellung sozialwissenschaftlicher Analyseperspektiven psychischen Leids konzentriere, dann soll damit nicht der Anspruch erhoben werden, sie enthielten die »ganze Wahrheit«. Sie können allerdings für sich in Anspruch nehmen, Wirklichkeitsbereiche zu durchdringen, die psychisches Leid als sozialen Tatbestand herstellen.
Fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Auflage seines Buches "Being mentally ill" begründet der Soziologe T. SCHEFF in der zweiten Auflage, was es für den Sozialwissenschaftler notwendig macht, eine eigene Herangehensweise an das Phänomen psychischen Leids zu wählen. Genau das hat er mit seiner über Jahre heiß umstrittenen Labeling-Perspektive versucht. Er schreibt:
»Es scheint so, daß die Unklarheit psychiatrischer Theorie und Vorgehensweisen, die mit den Einstellungen der Personen in der Gemeinde, im Wohlfahrtsbereich und in Kontrollsituationen zusammenspielen, eine Situation herstellen, in der individualistische Konzepte, seien es medizinische oder psychologische, nur einen Teil der Umgangsformen mit psychisch Kranken erklären können« (1984, S. 211).
Eine wie immer beschaffene psychiatrische oder psychologische Theorie psychischer Störungen könne nicht erklären, in welcher Weise sich in einer Gesellschaft der Übergang aus dem Status des Normalbürgers in den des psychisch Kranken vollzieht. Für solch eine Statuspassage mag eine Person durch sein befremdliches und störendes Handeln Anlaß geliefert haben, aber was in einem gesellschaftlichen System konkret unternommen wird, um die Störung zu beseitigen und wie sich solche sozialen Reaktionsmuster ihrerseits wieder auf das weitere Handeln der Person auswirken können, wird von keiner psychiatrisch - psychologischen ätiologischen Theorie erklärt. An diesem Punkt setzt der Erklärungsspruch der Labeling-Perspektive an.
Die Labeling-Perspektive ist aus einem interpretativen Verständnis sozialwissenschaftlicher Vorgehensweise entstanden. Interpretative Sozialwissenschaften bemühen sich um die Rekonstruktion der alltäglichen Herstellungsprozesse von Bedeutung und Sinn, die Ereignissen und Handlungen zugemessen werden. Ein Ereignis oder eine Handlungsweise haben keine immer schon feststehende, ihnen innewohnende Bedeutung, sondern diese sind das Ergebnis sozialer Konstruktionen und Herstellungsleistungen. Ihr interpretativer Nachvollzug erfordert eine genaue Analyse der jeweiligen situativen Kontextbedingungen und ein verstehendes Anknüpfen an den Produzenten alltäglicher Sinnstiftung. Mit dieser Ausrichtung befindet sich interpretative Sozialwissenschaft im paradigmatischen Widerspruch zu allen »absolutistischen« oder »normativistischen« Positionen (so die Charakterisierung bei DOUGLAS und WAKSLER [1982]), für die gesellschaftliche Realität von einem fixen Koordinatensystem geordnet wird und in dem jede Handlung eine klare Zuordnung zu den Koordinaten hat.
Bezogen auf abweichendes Handeln heißt das, daß eine Handlung nicht per se abweichenden Charakter haben kann, sondern erst im Prozeß gesellschaftlicher Sinnsetzung zur Abweichung wird. Mit diesem konzeptuellen Kern begab sich die Labeling-Perspektive auf Konfliktkurs mit den vorherrschenden Devianztheorien, die entweder von der Annahme ausgingen, daß es benennbare Besonderheiten der abweichenden Person (biologische oder psychologische Merkmale) seien, die den abweichenden Status konstituieren, oder daß es eindeutige normative Kriterien gäbe, nach denen Devianz fixiert werden könne.
Die zentrale Prämisse der Labeling-Perspektive, daß Abweichung eine gesellschaftliche Konstruktion der sozialen Akteure ist (so etwa SCHUR (1979, S. 8) oder DOUGLAS und WAKSLER (1982, S. 23) stellvertretend für viele), führt zur Formulierung von Forschungsfragen des folgenden Typus: Was sehen verschiedene Gesellschaftsmitglieder für richtig oder falsch, gut oder böse, legal oder illegal, normal und abweichend an? Wann kommen ihre Definitionen zur Anwendung - in jedem Fall oder nur in einigen Situationen? Auf wen werden diese Definitionen angewendet - auf jeden unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status? Welches sind die Folgen der Anwendung solcher Definitionen auf einzelne Gesellschaftsmitglieder?
Bei der Suche nach jeweils spezifischen empirischen Antworten auf diese Fragen wird das sensibilisierende Potential der Labeling-Perspektive erkennbar. Das Wesen von Devianz wird nicht mehr essentialistisch bestimmt oder abstraktiv aus einem Modell gesellschaftlicher Geordnetheit abgeleitet. Vielmehr werden die Typisierungsschemata in ihrem je konkreten Gebrauch in einer spezifischen historischen Situation rekonstruiert (PFOHL, 1981). Mit E. SCHUR läßt sich die grundlegende Perspektive der Labeling-Perspektive am besten in der Frage zusammenfassen, »was aus einer Handlung gesellschaftlich gemacht wird« (1980, S. 10). Für jede Handlung läßt sich ein Kontext denken, in dem sie als regelverletzend wahrgenommen und entsprechend behandelt wird.
In der Sprache der Labeling-Perspektive wird die Wahrnehmung oder Unterstellung einer regelverletzenden Handlung als »primäre Abweichung« bezeichnet, deren individuelle Motive und Anlässe für die sozialen Reaktionen nicht determinierend sind. Für diese sind entscheidend, welche Motive und Gründe der Handlung zugeschrieben und ob sie als tolerierbare Rechtfertigung akzeptiert werden können oder ob sie als sanktionswürdig betrachtet werden. Im ersten Fall kann das Resultat als Normallsierung verstanden werden oder es könnten sogar soziale Wandlungsprozesse initiiert worden sein. Im zweiten Fall wird über die gesellschaftliche Reaktion der abweichende Status einer Person konstituiert, es kommt zum Stadium der »sekundären Abweichung«, in dem sich die Identität einer Person um das Merkmal ihrer so fixierten Abweichung stabilisieren kann. Im folgenden Schema 1 (das in großen Teilen auf NOOE (1980) zurückgeht) ist der Ablaufprozeß festgehalten, in dem Abweichung als sozialer Tatbestand hergestellt wird.
Nun ist es der Labeling-Perspektive nicht gelungen, allgemeine Zustimmung zu finden. Das hat sicherlich einerseits mit der Tatsache zu tun, daß sie - vor allem in Psychologie und Psychiatrie - gegen den Strom vorherrschender ätiologischer Theorieansätze schwimmt. Andererseits läßt sich das aber auch darauf zurückführen, daß sie ihr eigenes Verständnispotential vulgarisiert und damit einiges vergeben hat.
Die Labeling-Perspektive wird oft genug auf den einen Aspekt reduziert, daß ein bestimmtes Verhaltensmuster mit einem spezifischen Etikett belegt wird (deshalb wird die Labeling-Perspektive auch oft als »Etikettierungstheorie« bezeichnet). In manchen Primitivversionen erscheint es dann als völlig willkürlich, ob eine Person stigmatisiert wird. Der Willkürakt wird dann nur noch als moralische Qualität des Handelns von Psychiatern oder anderen Vollzugsagenten sozialer Kontrolle angesehen und angeklagt. Das Subjekt, das mit dem Stigma versehen wird, wird zum beklagenswerten Opfer, ohne eigenes Zutun, hilflos, ohne Gegenwehr. Das größte Defizit, das auch in der schematischen Darstellung oben noch enthalten ist, ist ein Determinismus, der die Labeling-Perspektive zu einem ätiologischen Modell werden läßt (Abweichung entsteht, wenn ... ) Das interpretative Potential, das eine richtig verstandene Labeling-Perspektive eröffnet hat (KEUPP, 1976; 1983), ist mit solchen Verkürzungen vertan.

Schema 1: Abweichung als hergestellte Wirklichkeit: Die Labeling-Perspektive
Für die Analyse der gesellschaftlichen Produktion psychischen Leids sehe ich bei aller berechtigten und notwendigen Kritik (vgl. neuerdings SCULL, 1984; PFOHL, 1985) in der konzeptuellen Einflußsphäre der Labeling-Perspektive wichtige Problemformulierungen und Einsichten. Einige gehen über den ursprünglichen Erklärungsanspruch der Labeling-Perspektive wesentlich hinaus (nimmt man etwa als Meßlatte für diesen Anspruch die paradigmatische Analyse von SCHEFF, 1966), lassen sich aber sehr wohl auf jene Diskussionen zurückführen, die mit ihr initiiert wurden. Daß die soziale Konstruktion von Devianz nur noch von einer umfassenden Theorie sozialer Kontrolle zureichend erfaßt werden kann (vgl. dazu MUTZ, 1983), wird heute auch von Protagonisten der Labeling-Perspektive vertreten (wiederum paradigmatisch von SCHEFF, 1984).
Abweichendes Verhalten wie unsere gesamte gesellschaftliche Realität ist kein natürliches Produkt, sondern hat einen Prozeß der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit zur Voraussetzung. Die Bedeutung, die ein Sachverhalt für uns hat, die Art, wie wir uns auf ihn beziehen, und das, was wir aus ihm machen, sind rekonstruierbare Prozesse. Sie sind eingebettet in kulturelle und normative Horizonte und werden praktisch in institutionellen Strukturen vollzogen. Die Rekonstruktion dieser Prozesse ist notwendig, um abweichendes Verhalten angemessen verstehen zu können (vgl. MISHLER, 1981).
Abweichendes Verhalten ist als soziales Phänomen erst dadurch möglich, daß es als Regelverletzung, Irritation oder Störung eingespielter sozialer Routinen wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung setzt Aktivitäten in Gang; es wird etwas unternommen, was zur Behebung der Störung als geeignet betrachtet wird. Es können auch Regeln so verändert werden, daß das zunächst normabweichende Handeln einen neuen Regelfall darstellen kann (im Bereich der Mode passiert das unentwegt). Abweichendes Verhalten setzt soziale Prozesse in Gang, die als soziale Kontrolle bezeichnet werden und in ihrer spezifischen Form entscheidend das »soziale Schicksal « von Devianz prägen.
Die soziale Gestalt, der Grad sozialer Organisiertheit oder Institutionalisierung von sozialer Kontrolle ist höchst unterschiedlich und entsprechend differenziell ist die jeweilige »Sozialgeschichte« von Devianz.
Die Bandbreite reicht von Korrektur- und Beeinflussungsversuchen in alltäglichen sozialen Beziehungen über die Zuständigkeitserklärung von Institutionen für spezifische Devianztypen (z. B. die Differenzierung in Gefängnis, Psychiatrie, Sozialfürsorge, Medizin) bis zur Verbreitung von Ideologien, die als Steuerungsinstrumente »angemessenes Verhalten« begünstigen sollen. Diese zielen in erster Linie auf die Verinnerlichung von Maßstäben, an denen Personen sich selbst und ihr Handeln überprüfen. Allen Maßnahmen sozialer Kontrolle ist gemeinsam, daß sie die Bandbreite menschlichen Handelns und subjektiver Entfaltung auf Typen von sozial erwünschten »Sozialcharakteren« einzuengen versuchen.
Institutionelle Felder (wie die psychosozialen Dienstleistungssysteme, das Gesundheitswesen, die sozialen Dienste) realisieren je spezifische Kontrollfunktionen. In ihnen arbeiten Berufsgruppen auf der Grundlage ihrer wissenschaftlichen Sichtweisen und berufsrechtlichen Normierungen. Zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen gibt es konkurrierende wissenschaftliche Paradigmen und Zuständigkeitsrivalitäten. Die jeweils realisierten Formen sozialer Kontrolle sind deshalb ebenso geprägt von solchen interprofessionellen Aushandlungsprozessen (Psychiater und Psychologen liefern dafür gegenwärtig Beispiele am laufenden Band).
Soziale Kontrolle weist durch die institutionelle Vielgestaltigkeit hindurch eine innere Systematik auf, die für ein soziales System ihre je typische Gestalt ausgebildet hat. Gesellschaften weisen ihrem Entwicklungsniveau entsprechend auch unterschiedliche Hauptströmungen praktizierter sozialer Kontrolle auf. In fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften können Kontrollprozesse auf die zunehmende Individualisierung von Lebenslagen und -wegen setzen und diese ihrerseits weiter verstärken (vgl. BECK, 1983). Häufiger wird der Zugriff auf Sozialisationsprozesse, die über Motivations- und Aspirationsprozesse steuerbar sind. Vorherrschend werden Kontrollprozesse, die die Menschen an sich selbst vollziehen oder mit denen sie sich positiv identifizieren können (z. B. Psychotherapie). Es nehmen präventive Strategien zu, die auf die Verhaltenssteuerung der Subjekte zielen und eine Lebensweise und -gestaltung fördern, in denen sich die Individuen für die Verringerung ihres eigenen Devianzrisikos verantwortlich fühlen (das heißt dann im entsprechenden Fachjargon »Verhaltensprävention«).
Gesellschaftliche Krisen und Widersprüche haben Auswirkungen auf die jeweiligen professionellen und institutionellen Formen der Mikropolitik der Devianzkontrolle. Das wird gegenwärtig besonders an den Folgewirkungen der krisenhaften Entwicklung der staatlichen Sozialpolitik erkennbar. Die wohlfahrtsstaatliche Programmatik der Sozialpolitik, wie sie für die 70er Jahre typisch war, wird immer weniger aufrechterhalten und realisiert. Es mehren sich die Indikatoren für eine Spaltung der Gesellschaft in einen »produktiven Kern« und eine stetig wachsende Teilgesellschaft von Randgruppen und Marginalisierten (vgl. LEIBFRIED und TENNSTEDT, 1985). Parallel zu dieser Spaltung entsteht »ein duales Modell der sozialen Reintegration« (DIEMER, 1984, S. 7).
Soziale Kontrolle läßt sich nicht mehr als nur eine homogene und die Gesellschaft filigran durchziehende Modalität bestimmen, wie es von den Kontrolltheorien der 70er Jahre prognostiziert wurde. Die gesellschaftliche Spaltung führt zu einer Intensivierung der »weichen« Kontrolle in Gestalt von psychologisierenden / therapeutisierenden Dienstleistungsangeboten für den gesellschaftlichen Kern bei gleichzeitiger Regeneration und Verstärkung ausgrenzender Kontrollsysteme für die Peripherie, für die eine Integration in die Arbeitsgesellschaft nicht mehr vorgesehen ist.
Das Differenzierungspotential für die Strukturmuster gesellschaftlicher Reaktion auf Normalitätsverlust, das in den aufgeführten Punkten erkennbar wird, zeigt, wie weit die Diskussion, die von der Labeling-Perspektive in Gang gesetzt wurde, über jene Simplifizierungen hinausgeführt hat, die in der Literatur immer wieder kolportiert wurden. Hierfür ein Beispiel aus einem durchaus anerkannten Lehrbuch über abweichendes Verhalten. Dort wird die Labeling-Perspektive ironisierend folgendermaßen geschildert:
»Menschen gehen ihren Angelegenheiten nach und dann: 'wumm', kommt die böse Gesellschaft daher und schlägt sie mit einem stigmatisierenden Etikett. In die Rolle des Abweichenden gezwungen, hat dann das Individuum kaum eine andere Wahl als abweichend zu sein« (AKERS, 1973, S. 24).
Frühe programmatische Formulierungen des Kerngedankens der Labeling-Perspektive haben einer solchen Simplifizierung sicherlich zugearbeitet. Es sind vor allem zwei zentrale Dimensionen, auf denen die konzeptuelle Entwicklung erheblich fortgeschritten ist und durch die Ansatzpunkte für Fehldeutungen reduziert wurden: a) Die Systematik gesellschaftlicher Kontrollreaktionen ist für das Problemfeld psychische Devianz unter sozialhistorischen, sozialpolitischen und organisationssoziologischen Aspekten gründlich untersucht worden. Dadurch ist es möglich geworden, die formgebenden Strukturelemente von psychiatrischen Karrieren zu rekonstruieren, die differenzierte Karriereverläufe erzeugen und nicht nur eine einzige Schablone, die sich in jedem einzelnen Fall eines Menschen mit psychischen Problemen zwangsläufig reproduziert. b) Die Differenziertheit in der Wahrnehmung möglicher Verläufe einer Normalitätskrise hat auch durch eine genauere Analyse der Subjektanteile an der Krise und der jeweiligen Formen ihrer Bewältigung zugenommen. Das Subjekt wird weniger unter einer Opferperspektive gesehen sondern als Person, deren Handeln einem rekonstruierbaren Sinn folgt und auch dann noch regelgeleitet und sinnorientiert ist, wenn es Regeln verletzt. Es wird als problemlösendes Handeln gefaßt, dessen Nachvollzug erfordert, daß der subjektive Problemraum und die Handlungsressourcen einer Person rekonstruiert werden. Diese beiden Punkte sollen in den beiden folgenden Abschnitten weiter vertieft werden.
Seit GOFFMAN'S klassischer Analyse der »moralischen Karriere des Geisteskranken« (1961, deutsch: 1972) ist der Begriff der Patientenkarriere schon beinahe Bestandteil der Alltagssprache geworden. Er formuliert eine alternative Perspektive zur Analyse von Krankheitsverläufen. Diese durchbricht den fatalistischen Determinismus des naturhistorischen Krankheitsbegriffs und rückt den Schnittpunkt ins Aufmerksamkeitszentrum, »an dem sich individuelle Lebensgestaltung und gesellschaftliche Strukturen verzahnen« (GERHARDT, 1984, S. 60). Diese Verzahnung von subjektiven und gesellschaftlich-strukturellen Anteilen betonte GOFFMAN ausdrücklich:
»Zu den Vorteilen des Begriffs der Karriere gehört seine Doppelseitigkeit. Einerseits berührt er jene hoch und heilig gehaltenen Dinge wie das Selbstbild und das Identitätsgefühl; andererseits betrifft er die offizielle Stellung, rechtliche Verhältnisse sowie den Lebensstil, und ist Teil eines der Öffentlichkeit zugänglichen institutionellen Ganzen. Der Begriff der Karriere erlaubt uns also, uns zwischen dem persönlichen und dem öffentlichen Bereich, zwischen dem Ich und der für dieses relevanten Gesellschaft hin und her zu bewegen, ohne daß wir allzu sehr auf Angaben darüber angewiesen sind, wie der betreffende Einzelne sich in seiner eigenen Vorstellung sieht« (1972, S. 127).
GOFFMAN hat die Karriere des psychiatrischen Patienten in drei Hauptphasen unterteilt, die »vorklinische«, die »klinische« und die »nachklinisehe Phase« und sich ausschließlich auf die beiden ersten konzentriert. In dieser Fokussierung kommt der Modus operandi einer Psychiatrie zum Ausdruck, die die Ausgrenzung von schwierigen Menschen aus dem Lebensalltag häufig irreversibel vollzog und sich als »Sozialisationsinstitution« für ein Leben in der Anstalt verstand. Eine »nachklinische Phase« gab es deshalb bei vielen Insassen gar nicht mehr und GOFFMAM konzentrierte sich auf das Identitätsmanagement von Menschen mit einer solchen Lebensperspektive: Die moralische Karriere des Geisteskranken sei »ein Beispiel für die Chance, daß der Mensch, der den Mantel seines alten Selbst von sich geworfen hat - oder dem er heruntergerissen wurde -, nicht mehr nach einem neuen Gewand oder nach einem neuen Publikum, vor dem er sich verbeugen könnte, zu suchen braucht« (1972, S. 167).
Seit den 50er Jahren, in denen GOFFMAN seine teilnehmenden Erfahrungen in der Anstaltspsychiatrie machte, hat sich die Funktion von Anstalten in den USA verändert. Aus einem schwer entwirrbaren Geflecht von humanitären, professionellen und ökonomischen Gründen (vgl. die kontroversen Deutungen dieser Entwicklung bei ROTHMAN (1971), SCULL (1980) oder BROWN (1985) läßt sich der Stellenwert der Anstaltsunterbringung vor allem seit den 60er Jahren anders bestimmen. Er soll möglichst kurz sein und sich auf die Behandlung eines akuten Zustands konzentrieren. In dem Maße, wie die Anstalt keine langfristige Unterbringung mehr ermöglichte oder anbot, mußten Betreuungs- oder Unterbringungsalternativen in der Gemeinde, in den Familien oder in neu zu schaffenden Institutionen gesucht und entwickelt werden. Nur wenn solche Alternativen nicht verfügbar sind, müssen die psychiatrischen Kliniken für eine Unterbringung herangezogen werden. Ein enorm anwachsender privater Markt für psychiatrische Heime auf einem minimalen Versorgungsstandard hat es den Kliniken allerdings erlaubt, asyläre Unterbringungsformen aus dem eigenen institutionellen System herauszulagern.
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung haben sich Karriereverläufe von psychiatrischen Patienten verändert. Die psychiatrische Klinik erhielt in den USA immer mehr den Charakter einer Institution für zeitlich befristete therapeutische Interventionen. Sie konnte um so wirksamer therapeutisch intervenieren, desto kooperativer die Betroffenen oder deren Angehörige sich auf die professionellen Angebote der Klinik beziehen konnten. Je bereitwilliger sich die Betroffenen oder deren Bezugspersonen auf das Problemverständnis der psychiatrischen Profession einlassen, desto effektiver können diese ihre Art von Dienstleistung hilfreich einsetzen. Diese Metamorphose der Anstalt zu einer Akutklinik kommt auch in den sozialwissenschaftlichen Analysen zum Ausdruck, die nach dieser Funktionsveränderung durchgeführt wurden. Hatten die klassischen Formulierungen der Labeling-Perspektive noch den Ausgrenzungs- und Stigmatisierungscharakter der psychiatrischen Institutionen ins konzeptuelle Zentrum ihrer Analysen gerückt, so werden in neueren Arbeiten Karriereverläufe häufig völlig ohne psychiatrie- und institutionenkritische Untertöne vorgelegt.
Ein elaboriertes Beispiel hierfür liefert die Untersuchung von PERRUCCI und TARG (1982). Sie interessierten sich weniger für die individuellen Merkmale des einzelnen Patienten und ihre Bearbeitung durch die institutionellen Reaktionsmuster des psychosozialen Versorgungssysterns, sondern für die Bedeutung des sozialen Netzwerkes bei der Problemdefinition und -bewältigung von psychischer Devianz. Ins Zentrum rückt bei dieser Akzentsetzung und auf dem Hintergrund des beschriebenen Funktionswandels psychiatrischer Institutionen das Ineinandergreifen von alltagsweltlichen Definitionen und Handlungsweisen im sozialen Netzwerk und dem professionellen Dienstleistungssystem. Aus der Integration von Labeling-Perspektive und Netzwerkansatz konstruieren PERRUCCI und TARG das in Schema 2 dargestellte Karrieremodell (das hier in der Bearbeitung durch v. KARDORFF (1986) übernommen worden ist).
Auf der Basis dieses Modells haben die Autoren eine Anzahl von psychiatrischen Patienten einer intensiven qualitativen Analyse unterzogen. Für die jeweilige Stufe ihres Modells haben sie differenzierte Möglichkeiten aufgezeigt, die unterschiedliche Karriereverläufe bedingen. Zentral scheint eine schichtspezifische Differenzierung zu sein. Beim Vorkommen von ungewöhnlichen Handlungsweisen tendieren Unterschichtnetzwerke zu einem längeren »Normalisierungsprozeß«, während in der Mittelschicht schneller »medikalisiert« wird. Entsprechend diesen unterschiedlichen alltagsweltlichen Definitionen sind auch die aus ihnen folgenden Konsequenzen deutlich verschieden.
Auf der Grundlage einer medikalisierenden Sichtweise wird sehr schnell der Kontakt zum professionellen System der psychiatrischen Versorgung aufgenommen. Die soziale Distanz zu diesem System ist relativ gering und es entwickeln sich Kooperationsformen, die zu einer zügigen Hospitalisierung, zu einem begrenzten Klinikaufenthalt und zu einer meist gelingenden sozialen Reintegration nach der Entlassung beitragen. Anders verlaufen Karrieren, die mit intensiven Normalisierungsversuchen beginnen, jedenfalls jene, bei denen diese Versuche zu keiner alltagsweltlichen Bewältigung führen. Wenn dann eine Hospitalisierung notwendig wird, erfolgt sie häufig unter Zwang und zu einem Zeitpunkt, an dem die Netzwerkressourcen an psychosozialer und materieller Unterstützung erschöpft wird.
Häufig zerfallen Netzwerke an solchen Zwangsentscheidungen. Es kommt zu keiner Abstimmung von alltagsweltlichem und professionellem Handlungssystem, im Gegenteil, es herrschen Mißtrauen und soziale Distanz vor. Von einer solchen Konstellation werden dann auch die Rehabilitationschancen negativ belastet. Bei diesem zweiten Verlaufsmuster wird auch erkennbar, daß Psychiatrie sich nur dann von ihrem traditionellen Bild der zwangskontrollierenden und stigmatisierenden Institution lösen kann, wenn ihre Konzepte in die Lebenswelt selbst eindringen und von den Netzwerkmitgliedern internalisiert werden (einen Prozeß, den DESWAAN (1983) treffend als »Protoprofessionalisierung« bezeichnet hat).
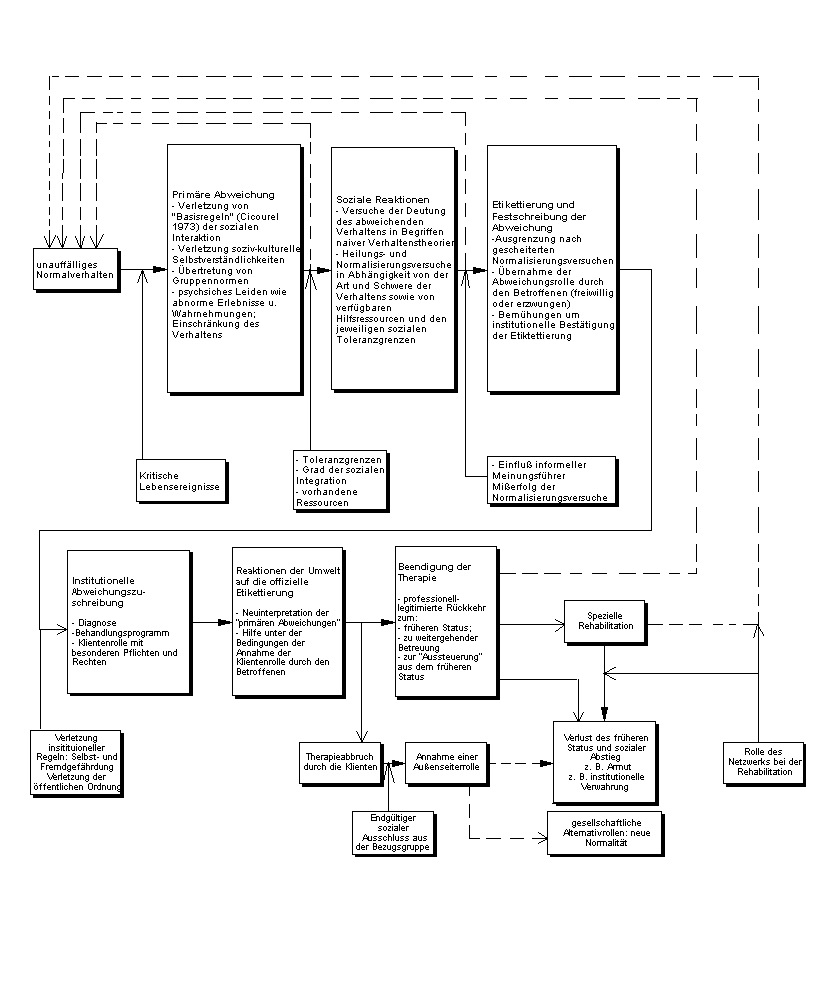
Schema 2. Die Karriere psychiatrischer Patienten und die Rolle sozialer Netzwerke
Das bedeutet keine Aufhebung der sozialen Kontrolle, sondern ihre diffundierende Infiltration in subjektive Handlungsentwürfe (vgl. dazu HORWITZ (1982); MUTZ 1983».
Die Untersuchung von PERUCCI und TARG konzentriert sich in der Nachfolge GOFFMANS auf die Bedeutung und Bewältigung der Hospitalisierung im Rahmen von Patientenkarrieren. Zwar geht sie stillschweigend von dem Funktionswandel der Anstalt aus, aber sie vernachlässigt die Tatsache, daß das institutionelle Handlungsgeflecht psychiatrisch-psychosozialer Intervention durch vielfältige Modernisierungsprozesse umgestaltet und ausgebaut wurde. Die Anstalt ist infolge dessen jetzt Teil eines differenzierten Versorgungssysterns, das im Vorfeld der Anstalt vielfältige Präventionsversuche unternimmt, Beratung und Krisenintervention anbietet und durch ambulante sozialpsychiatrische Zentren eine Anstaltsunterbringung zu vermeiden oder auf eine möglichst knappe Zeit zu reduzieren versucht. Für die Zeit nach einem Klinikaufenthalt gibt es soziale und berufliche Rehabilltationsprogramme. Für einen Teil der Patienten, die früher als chronische Langzeitpatienten einen Großteil ihres Lebens in der Anstalt verbrachten, werden betreute Wohngruppen und Treffpunkte geschaffen. In einigen Ländern verliert die Anstalt vollständig ihren zentralen Platz im institutionellen Dispositiv der Psychiatrie (z. B. in Italien, aber auch in England und einigen Bundesstaaten der USA). All diese Veränderungen, die auf eine Phase intensiver Psychiatriereform in allen spätkapitalistischen Gesellschaften zurückgehen, haben sich die denkbaren Karriereverläufe von Menschen, deren psychische Devianz im System der psychosozialen Versorgung bearbeitet wird, erheblich differenziert und das bedeutet auch eine angemessene Differenzierung des analytischen Instrumentariums.
Einen für die aktuelle psychiatriesoziologische Forschung fruchtbaren heuristischen Versuch haben FORSTER und PELIKAN (1977) in diese Richtung unternommen. In ihrem als »Prozeß-Karriere-Modell« bezeichneten Ansatz haben die Autoren die wesentlichen Komponenten der Entstehung und institutionellen Verarbeitung psychischer Devianz zusammengefaßt.
Dieses Modell enthält folgendes konzeptuelle Raster (vgl. Schema 2):
Karrierestufen: Idealtypisch betrachtet lassen sich psychische Störungen in ihrem jeweiligen Erscheinungsbild und bezogen auf spezifische Interventionsanforderungen als hierarchisch geordnete Sequenz von Karrierestufen darstellen.
Karriereentscheidungspunkte: Die Karriere kann alternative Verläufe nehmen (sie kann fortschreiten, sie kann aber auch gängig gemacht werden). Die Entscheidung über den Verlauf ist abhängig von Steuergrößen, über die betroffene Person oder andere Personen bzw. Institutionen verfügen. je weiter die Karriere fortgeschritten ist, desto geringer ist der Einfluß der Person gegenüber externen Kontrolleinflüssen.
Karrieredeterminanten: Personen- und situationsspezifische Entstehungs- und Bewältigungsmöglichkeiten von inneren und äußeren Einflüssen bestimmen die Karriere. Je verletzlicher eine Person aufgrund genetischer und lebensgeschichtlicher Bedingungen ist, desto eher können Lebensereignisse zu Auslösern oder Verstärkern einer Karriere werden. Für die Bewältigung belastender Ereignisse ist die jeweilige Kapazitätsstruktur der Person ausschlaggebend. Diese Kapazitätsstruktur sind die »körperlichen, psychischen und sozialen Kompetenzen« und die »spezifische Verfügung über universelle Ressourcen materieller, symbolischer und personeller Art in der handlungsrelevanten Situation« (FORSTER und PELIKAN 1977, S. 30). Wenn die persongebundenen Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen, um mit belastenden Lebensereignissen fertigzuwerden, dann hängt der Verlauf der Karriere entscheidend von dem gesellschaftlichen Dienstleistungsangebot ab.
Je differenzierter, adäquater, bedürfnisgerechter und zugänglicher die gesellschaftlichen Ressourcen und Möglichkeiten für eine Person sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein kritisches Ereignis erfolgreich bewältigt werden kann« (ebd., S. 30).
Karrieredynamik: Im Unterschied zu einem mechanischen Kausalmodell ermöglicht das Karrieremodell auch Aussagen über die sich im Verlauf einer Karriere verändernde Kapazitätsstruktur und Verletzlichkeitsfaktoren. Je länger man auf einer bestimmten Karrierestufe bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschlechterung der Lage der betroffenen Person. So kann es zu neuen Empfindlichkeiten oder zu einem fortschreitenden Kompetenzverlust (z. B. Hospitalisierungseffekte) kommen, die verfügbaren Ressourcen können sich verringern, ebenso die gesellschaftlichen Toleranzgrenzen und schließlich kann der Einfluß sozialer Kontrolle die persönlichen Steuerungsmöglichkeiten der eigenen Karriere immer vollständiger verdrängen.
Interventionsstrategien: Für jede Karrierestufe sind spezifische Interventionsstrategien zu bestimmen, die in der Lage sein könnten, Bewältigungsversuche der Betroffenen einzuleiten und zu unterstützen. Je nach Karrierestufe sind solche Interventionen eher alltagsweltliche Unterstützung, Solidarität und Hilfe, Krisenintervention, gezielte Therapie, Rehabilitation oder kompensatorische Versorgung. In Schema 3 werden die verschiedenen konstitutiven Bedingungen des Karriereverlaufs psychischer Störungen systematisch in ihrem Zusammenwirken dargestellt.
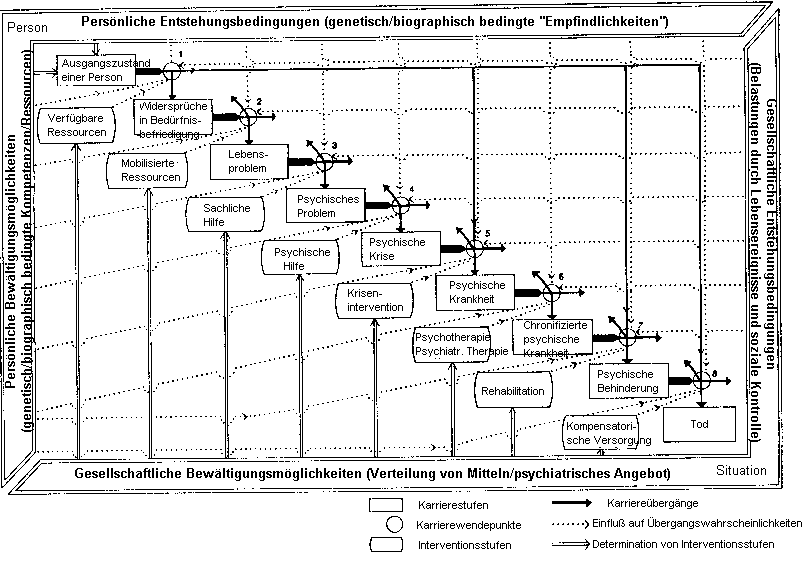
Schema 3: Ein Karrieremodell psychischer Störungen (nach Forster und Pelikan, 1977, S. 32/33).
Dieses Schema kann nur als idealtypischer Leitfaden genutzt werden und bedarf einer inhaltlichen Konkretisierung, um die spezifischen Leidensprozesse und deren gesellschaftliche Bearbeitung in einem sozialen System herausarbeiten zu können. Es besteht durchaus die Gefahr, daß bei einer zu rigiden Anwendung soziologischer Schematisierungen der naturhistorische Determinismus durch einen soziologistischen ersetzt wird. Deshalb scheint es angebracht, an jene Grundannahmen zu erinnern, die für GERHARDT (1981; 1984) bei der Anwendung des Karrierekonzepts auf Krankheitsverläufe sinnvollerweise gemacht werden sollten:
-
»Eine Ausrichtung der Patientenkarriere auf einen Endpunkt, der die Sukzession der Karrieremomente organisiert, wird nicht angenommen. ( ... )
-
Die Phasen, die in eine Karriere eingehen, - so folgern wir aus dem Fehlen eines strukturbildenden Endpunktes -, sind in ihrer Reihenfolge reversibel, d. h. ohne festgesetzte Sequenz aufeinander folgend. Regelmäßigkeiten, welche empirische Verlaufstypen konstituieren, ergeben sich aus dem Datenmaterial, können aber nicht als quasi-normative Verlaufskurve postuliert werden.
-
Allerdings bleiben Orientierungsschemata für den Patienten wirksam, die ihnen ein Bild von einer negativen Sequenz progredienten Statusverlustes vorgeben, von Verlustrisiken für ihre Existenz geprägt. ( ... )
-
Zu jedem Zeitpunkt der Patientenkarriere, besonders an den 'Wendepunkten' der Übergänge zwischen Phasen bei den Subkarrieren Behandlung, Beruf, Familie und Einkommenssituation ist soziales Handeln (Coping) empirisch aufzufinden. Nach Kräften wehrt sich solches Handeln gegen die Statusrisiken und Verschlechterungen der Karrieresituation; es strebt nach Wiedergewinnung einer residualen Normalität« (GERHARDT, 1984, S. 60 f.).
Auf zwei unterschiedlichen Wegen haben Sozialwissenschaftler schwerpunktmäßig ihren Versuch vorgetragen, zum naturgeschichtlichen Krankheitsverständnis eine Alternative zu formulieren. Den einen Weg haben wir in der Labeling-Perspektive bereits kennengelernt. Der zweite Versuch entwickelte sich aus der sozialepidemiologischen Forschung heraus. Durch den Nachweis systematischer Zusammenhänge zwischen soziokulturellen Variablen (wie Schicht, Stadt-Land-Differenz, unterschiedliche Arbeitsplätze etc.) und den Häufigkeitsraten psychischer Störungen konnte die Annahme einer autochthonen naturgeschichtlichen Entwicklung psychiatrischer Krankheiten erheblich erschüttert werden.
Auf beiden Wegen sind die sozialwissenschaftlichen Ansätze jedoch in durchaus vergleichbare Schwierigkeiten geraten. Die Konzepte der Labeling-Perspektive haben das Individuum zu einem passiven Objekt, zu einem Opfer gesellschaftlicher Ausgrenzung und Stigmatisierung werden lassen. An ihm vollzieht sich ein Prozeß, der ohne subjektive Anteile, aber mit höchst folgenreichen Konsequenzen für das Subjekt abläuft. Der Prozeß von der primären zur sekundären Abweichung hat etwas von einem mechanistischen Ablaufschema. Ebenfalls einen mechanistischen Determinismus kann man in klassischen sozialepidemiologischen Modellen nachweisen. Sie haben sich weitgehend an die modelltheoretischen Vorgaben des medizinischen Modells gehalten und lediglich biogenetische Kausalagenzien durch soziale ausgetauscht. So sind »soziale Noxenmodelle« (GLEISS, 1980) entstanden, in denen sozialpathologische Faktoren das Individuum »krank machen«. Wiederum ist das Individuum passive Prägefolie, in die die Gesellschaft ihre negativen Spuren eingräbt.
Innerhalb beider Paradigmen ist der soziologische Reduktionismus kritisiert worden, der das handelnde, sinnorientierte Subjekt auslöscht (exemplarisch für die Labeling-Perspektive: PIVEN (1981) und für die sozialepidemiologische Streßforschung: SCHIENSTOCK [1983]). Dieser soziologische Reduktionismus macht das Subjekt zum Appendix struktureller Konstellationen oder zum »Reaktions-Deppen«. Im Noxenmodell wie im Kontrollmodell fehlt der konzeptionelle Ort für ein Subjekt, das sich mit den Lebensbedingungen seiner Alltagswelt aktiv auseinandersetzt, sie bearbeitet, sie sich in spezifischer Weise aneignet und sie auf der Basis seiner psychischen, sozialen und materiellen Handlungsressourcen sinnvoll zu bewältigen versucht.
In der sozialwissenschaftlichen und sozialpsychiatrischen Erforschung psychischen Leidens hat sich eine »normalisierende« Perspektive durchgesetzt, die sich ein Verständnis dafür zu erarbeiten versucht, wie Subjekte die Widersprüche und Belastungen ihrer Alltagswelt deuten und verarbeiten, welche unterschiedlichen Krisenverläufe unter jeweils gegebenen gesellschaftlichen Kontextbedingungen real möglich sind.
Die Mikrostruktur des Zusammenhangs von Belastungen, Bewältigung und psychischem Leid wird im Rahmen der epidemiologischen Forschung meist in irgendeiner Variante des folgenden Modells gefaßt (vgl. etwa MOOS, 1984; COHEN und McKAY, 1984; LAZARUS und FOLKMAN, 1984): In welcher Weise belastende Lebensumstände zu depressiven Reaktionen oder Persönlichkeitsveränderungen führen, hängt von den persönlichen, sozialen und materiellen Ressourcen einer Person ebenso ab wie von ihrer Einschätzung der Situation und den Bewältigungsreaktionen. Die Handlungsressourcen haben Einfluß auf das Auftreten spezifischer Belastungen, formen die Bewältigungsmuster, die zu ihrer Bearbeitung gewählt werden und haben erheblichen Anteil am Erfolg oder Mißerfolg der Bewältigungsversuche. Das Verbindungsglied zwischen lebensweltlichen Belastungen und psychischen Störungen wird durch die dem Subjekt jeweils verfügbaren persönlichen und Umweltressourcen, seine kognitiven Deutungsmuster und Bewältigungshandlungen sowie das spezifische Beziehungsgeflecht dieser Variablen untereinander gebildet. Die persönlichen Ressourcen beinhalten Merkmale wie das Selbstkonzept, die Einschätzung eigener Chancen der Umweltbeeinflussung, Attributionsstile, Problemlösungsfähigkeiten und soziale Kompetenz. Umweltressourcen bezeichnen emotionale, materielle und informationsmäßige Unterstützung durch andere Personen und durch den jeweiligen sozialen Status. Die kognitiven Deutungsmuster schließen persönliche Wahrnehmungen und Erklärungen ebenso ein wie von den Subjekten übernommene kollektive Deutungen und ideologische Muster. Bewältigungsreaktionen reichen von Vermeidungsreaktionen über Umdefinitionen bis hin zu aktiven Strategien der Auseinandersetzungen mit den Bedingungen, die eine Person für die konkret erlebten Belastungen verantwortlich macht. Ein zentraler Bewältigungsmechanismus wird als Hilfesuchverhalten untersucht, das wesentlich von sozialen Netzwerkstrukturen geprägt wird (vgl. hierzu ausführlich BILLINGS und MOOS, 1982).
Von besonderer Relevanz ist im Rahmen der skizzierten Zusammenhangsvermutungen das Netzwerkkonzept. Eine umfangreiche Forschungsaktivität hat sich in den letzten Jahren auf dieses konzentriert (vgl. KEUPP und RÖHRLE, 1987). Im Schema 4 sind einige netzwerkbezogene und -vermittelte Prozesse visualisiert, die sich als relevant erwiesen haben.
Verglichen mit der Labeling-Perspektive, für die Interaktionen zwischen einem problembelasteten Individuum und seiner sozialen Umwelt in der Regel unter negativen Vorzeichen (z. B. Stigmatisierung, Ausgrenzung, soziale Kontrolle) thematisiert werden, rückt die Netzwerkperspektive die positiven Qualitäten von sozialen Reaktionen in den Mittelpunkt. Sie vermitteln Hilfe und Unterstützung, sie puffern Belastungen ab oder lassen sich als Schutzschild gegen belastende Lebensumstände fassen. Natürlich sind auch in der Netzwerkperspektive negative Konsequenzen für das Subjekt zu erfassen: Als Verlust, Abwesenheit oder als quantitativ und qualitativ unzureichende Quelle von sozialer Unterstützung.
Es scheint mir für ein angemessenes Verständnis der gesellschaftlichen Produktion von Karrieren psychischen Leids unerläßlich, die Sichtweisen der beiden Perspektiven für die Analyse der alltagsweltlichen Prozesse beim Auftreten psychischer Devianz zu verschränken. Erst bei ihrer Integration wird jene Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle zureichend erfaßbar, die in der Reaktion auf den Normalitätsverlust einer Person zum Ausdruck kommt. Hilfe und Kontrolle beginnen nicht erst mit der Intervention von Institutionen des Dienstleistungssystems oder Kontrollapparats wirksam zu werden, sie durchziehen auch das lebensweltliche Handeln.
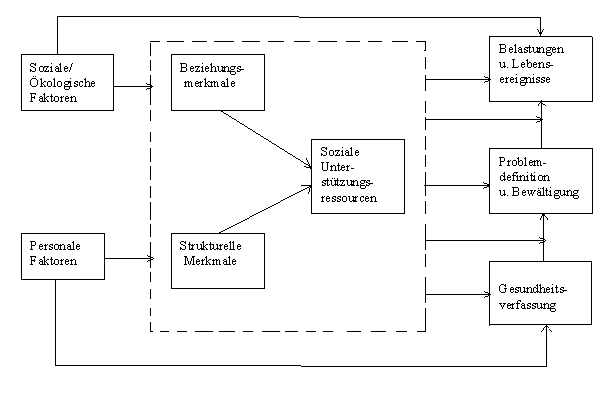
Schema 4: Das soziale Netzwerk als vermittelndes Konstrukt (nach Hall und Wellman, 1985, S. 34)
THOITS (1985) hat den Versuch der Integration von Kontroll- und Netzwerkperspektive unternommen. Sie geht davon aus, daß das Identitätsmanagement in komplexen Industriegesellschaften durch komplizierte Balanceakte erfolgt, die vor allem ein hohes Maß an selbstkontrollierender Gefühlsarbeit erfordern. Bei sich verschärfenden Widersprüchen, dadurch erhöhten Belastungen und Lebensereignissen gelingt es den betroffenen Individuen nur unzureichend, emotionale Reaktionen in gesellschaftlich lizensierte Paßformen zu bringen. Bezogen auf die Wahrnehmung und Verarbeitung solcher Reaktionen muß sich die positive Qualität sozialer Unterstützung im eigenen Netzwerk erweisen. THOITS nennt drei Funktionen sozialer Unterstützung:
-
Personen im eigenen Netzwerk können der betroffenen Person bestätigen, daß die spezifische emotionale Reaktion nachvollziehbar und verständlich ist.
-
Gerade bei sozial unerwünschten Reaktionen können solche Signale des Verstehenkönnens die Tendenzen zur Selbstherabsetzung verringern.
-
An der notwendigen Gefühlsarbeit können sich andere Personen hilfreich beteiligen (z. B. an der Trauerarbeit).
Fehlen soziale Rückkoppelungen dieser Art, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, daß das Subjekt die eigenen Gefühlsreaktionen als Ausdruck einer in ihm selbst liegenden Krankheit interpretiert. Auch wenn die Gefühlsreaktionen in der vom Netzwerk bereitgestellten Unterstützung nicht normalisiert werden können oder das Individuum aus der Sicht der Netzwerkmitglieder nicht genügend an dieser Normalisierung mitarbeitet, kann die Attribution einer psychischen Krankheit erfolgen, die die Intervention von Kontrollinstitutionen erforderlich macht. In diesen Transaktionen in der alltäglichen Lebenswelt werden entscheidende Weichen für die Einbeziehung formeller Kontrollinstitutionen, für deren Wahrnehmung (mit den polaren Möglichkeiten Hilfe und Kontrolle und spezifische Mischungen dieser beiden Dimensionen) und für die lebensgeschichtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, gestellt.
Ausgangspunkt der Überlegungen war die Differenzierung nach drei möglichen Herangehensweisen an die Historizität psychischen Leids: naturgeschichtlich, lebensgeschichtlich und sozialgeschichtlich. Für eine sozialwissenschaftliche Perspektive ist es grundlegend, die Verlaufsgestalten psychischer Störungen aus dem spezifischen Zusammenwirken von subjektiven Prozessen und gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Prozesse zu rekonstruieren. Zum paradigmatischen Zentrum ihres Ansatzes hat die Labeling-Perspektive die bislang vernachlässigten gesellschaftlichen Reaktionen gemacht. In kritisch-konstruktiver Weiterführung der Labeling-Perspektive wurde die Systematik gesellschaftlicher Reaktionen aus ordnungs- und sozialpolitischen Konfigurationen abgeleitet, die den Kontrollreaktionen den Charakter zufälliger und willkürlicher Muster nehmen. Eine in dieser Weise differenzierte Labeling-Perspektive ermöglicht die Rekonstruktion von gesellschaftlich produzierten Karrieren psychischen Leids.
Schließlich wurde gegen einen sozialwissenschaftlichen Reduktionismus argumentiert, der das Individuum zum passiven Objekt gesellschaftlicher Einflüsse und Institutioneller Verfahrensweise macht. Durch eine genauere Analyse der Mikrostrukturen, die in der Alltagswelt zur Bewältigung von Widersprüchen und Belastungen ausgebildet werden, wird es möglich, das Subjekt als handelndes zu sehen, das auf der Basis seiner psychischen, sozialen und materiellen Ressourcen sein Leben zu bewältigen versucht.
Inhaltsverzeichnis
Die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in und zwischen den psychosozialen Professionen geführte Auseinandersetzung um den Krankheitsbegriff beschränkte sich nicht auf einen streng abgegrenzten fachlichen Raum. Sie wurde zu einer öffentlich-kulturellen Debatte über Kriterien alltäglicher Normalitäten und die in ihnen enthaltenen Alltagspathologien. Zugleich gab es heftig diskutierte Versuche einer »Entpathologisierung der Geisteskrankheit«. Diese wurden nicht nur von den fachlichen Gralshütern der Psychiatrie heftig zurückgewiesen, sondern auch Politiker warnten davor, die Maßstäbe für das, was als normal und was als abweichend zu gelten habe, aufzuweichen. Für eine konservative Ordnungspolitik ist offenbar von entscheidender Bedeutung, daß die normativen Eckpfeiler für Normalität und Abweichung als unverrückbar anerkannt werden. Der »gesunde Menschenverstand«, das »gesunde Volksempfinden«, das klare Fadenkreuz für »gut« und »böse«, für »richtig« und »falsch«, für »normal« und »abnorm« werden als zentrale Steuerungsprinzipien des guten Staatsbürgers beschworen, als eine tief in den Individuen verwurzelte »Instinktsicherheit« für das angemessene Alltagshandeln. Das Rütteln an diesen normativen Grundfesten, das Entstehen von anomischen Situationen, in denen kein Konsens über die handlungsleitenden Normen mehr besteht, ja nur das Ansprechen der Relativität von normativen Regulierungen in einer Kultur beschwört die Angst vor dem Chaos, dem Umsturz, der Umwertung aller Werte herauf. In der gleichen Weise gefährdet ein konservatives Ordnungsverständnis das bloße Fragen, zu welchem Preis jene quasiinstinkthaft gedachte Normalität hergestellt wird, die sich mit der Ordnung identifiziert und in dieser Identifikation seine Handlungssicherheit erwirbt. Die konservative Kritik an der Psychoanalyse dient in erster Linie der Abwehr dieser Fragestellung und versucht sie als Verursacher für die Erosion zentraler Werthaltungen dingfest zu machen.
Das kürzlich in deutscher Übersetzung erschienene Buch von M. L. GROSS (1984) zeigt, was für einen Wertkonservativen durch eine reflexive Auflösung starrer Normalitätvorstellungen auf dem Spiel steht. Das ganze Buch stellt eine einzige großangelegte Attacke auf Freud dar, dem in erster Linie angelastet wird, daß sich eine »psychologische Gesellschaft« ausgebildet habe. Der Bürger dieser Gesellschaft habe die Urteilssicherheit für das verloren, »was richtig oder falsch ist. Angesichts seiner unsicheren Bewußtseinslage zweifelt er sogar an der Echtheit seiner eigenen Gefühle« (S. 8). Das Fadenkreuz ist verlorengegangen und die Menschen sind ziellos auf der Suche »nach dem schwer faßbaren Ziel Normalität« (S. 9). Die entscheidende Ursache dafür liegt in der
»Aufhebung der Trennung zwischen Gesundheit und Krankheit, sobald der Geist davon betroffen ist. Geschichtlich gesehen war Geisteskrankheit ein Leiden, das immer nur einige wenige traf. Alle übrigen fühlten sich verschont. Vielleicht waren sie bösartig oder unglücklich oder auch ausgefallen, doch wurden sie als geistig normal angesehen. Mittlerweile haben Psychologie und Psychiatrie diese Grenze zwischen gesund und krank verwischt. Eine Gemütserkrankung wird heute als unangenehme, aber natürliche Erscheinung betrachtet, die jeden von uns unterschiedlich stark trifft. 'Jeder normale Mensch ist eben nur durchschnittlich normal', rief uns FREUD kurz vor seinem Tod ins Gedächtnis. »Sein Ich nähert sich dem des Psychotikers in dem oder jenem Stück.« In die Sprache von heute übertragen heißt das, wir sind alle in einem gewissen Umfang krank. Man könnte das die Theorie des universellen Wahnsinm nennen« (S. 9 f.).
GROSS beklagt, daß diese Aufweichung aller Maßstäbe zum Verlust all jener Kategorien geführt hätte, mit deren Hilfe die Menschen die Phänomene ihrer Welt in einem gesicherten Kategorienschema unterbringen konnten. Es gäbe keine »unschönen Schicksalswendungen«, »Mißerfolge«, »Verbrechen«, »Böswilligkeit« oder »Unglück« mehr (S. 12). »Natürliche Gefühle wie Wut, Verzweiflung, Trauer, Eifersucht, Argwohn, Enttäuschung und vorübergehende Depression werden nicht nur als unerwünscht, sondern als anomal hingestellt« (S. 24). Das sichere Empfinden für das »Natürliche« sei den Menschen abhanden gekommen und werde geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Sich auf das Innere Koordinatensystem, das eigene Empfindungen, Gefühle oder instinkthafte Reaktionen zu verlassen, würde als anomal gelten.
Die von M. GROSS verteidigte klassische wertkonservative Normalitätsvorstellung wurzelt in einer spezifischen Mischung von Organizismus, Religiosität und Glaube an den gesunden Menschenverstand. Der Organizismus kommt in einer Sicht zum Ausdruck, die die psychische Struktur eines Menschen als »biochemische Einrichtung mit einer relativ unbeweglichen, Gen-gesteuerten, vererbten Art (sieht), die wir im allgemeinen als das Wesen oder Temperament eines Menschen bezeichnen«. Der Mensch als Produkt der Schöpfung ist die zweite Säule des Weltbildes. »Bei dieser Sicht wurde das Verhalten des Menschen gemäß einer Vereinbarung mit Gott als rechtschaffen oder schlecht beurteilt. Als Gegenleistung für Treue und Gehorsam bot Gott seine heilsame Kraft, die der Behauptung nach größer als die des Menschen war.« Die dritte Säule bildet die Überzeugung, daß der »gesunde Menschenverstand« über »viele tausend Jahre« die Menschen in ihrem Alltag sinnvoll gesteuert habe. »Bei diesem alten, pragmatischen System sehen die Menschen den anderen so, wie er sich gibt: voller Haß, gütig, freundlich, stark, schwach, schlecht, reif, kindisch oder in jeder beliebigen Kombination dieser Eigenschaften. Man beurteilte sich selbst und die anderen danach, was man tat. Jeder war für sein eigenes Handeln verantwortlich, das mehr aussagte als unterstellte Motive« (alle Zitate S. 19 f).
Jeder einzelne dieser Grundbausteine des Ordnungs- und Normalitätsverständnisses, das hier exemplarisch für die konservative Grundströmung an der Argumentation von M. GROSS aufgezeigt wird, hat die Funktion die Ordnungskoordinaten als unabänderlich gegeben auszuweisen. Sie sollen allen Relativierungen und Historisierungen entzogen werden. Sie sollen die Wesenhaftigkeit von Grundbestimmungen absichern, die nur um den Preis von Chaos, Verfall, Zerstörung preisgegeben werden dürfen.
Bei einer Beschäftigung mit den unterschiedlichen Vorstellungen vom »gestörten Seelenleben«, der »Verrücktheit«, dem Wahnsinn der »psychischen Krankheit« oder der »psychischen Störung«, die in der Geschichte der Psychopathologie entwickelt worden sind, fällt dieser Zug, den ich durch das Einstiegsbeispiel von GROSS deutlich machen wollte, als Grunddimension der Frage auf, was denn das Wesen psychischen Leids ausmachen würde. Es geht immer explizit oder zwischen den Zellen um die Frage, wie soziale Ordnung möglich sein kann, wie sie durch die Normalität der Mehrheit eines Volkes garantiert sein kann und wie mit der potentiellen Ordnungsstörung, die von jeglicher Art von Abweichung ausgeht, umgegangen werden soll. Nachfolgend sollen Aussagen über Normalität und Abweichung aus den unterschiedlichsten historischen Perioden und verschiedenen fachlichen Perspektiven diese Ordnungsqualität deutlich machen.
Wahnsinnig ist derjenige, »der von Gewohnheit aus keine Regel, kein Gesetz, keinen Brauch beachtet oder eher noch, der sie alle mißachtet und dessen Reden, Benehmen und Handeln fortwährend in Gegensatz nicht nur zu den Sitten seines Landes, sondern zu seiner eigenen Menschlichkeit und Vernunft treten« (E. E. FODÉRÉ, 1838, zit. nach CASTEL, 1979, S. 126)
»Nur durch die Unterordnung unter das göttliche Gesetz besteht die Gesundheit des menschlichen Seelenlebens, die Harmonie des Einzelnen mit dem Allgemeinen, und seine Mitwirkung zur Erfüllung der erhabenen Ziele des Schöpfers. Sobald das individuelle Seelenleben des Menschen den allgemeinen Naturgesetzen widerstrebt und egoistisch etwas für sich bedeuten will, fällt es der Krankheit anheim und beginnt seinen Kampf mit der Natur, welcher nur mit seiner Unterwerfung und Vernichtung enden kann« (P. W. JESSEN, 1838, zit. nach HERZOG, 1985, S. 63).
»Der Ausdruck 'Psychische Entartung' hat nicht anatomische Bedeutung im Sinne einer Entartung der Gehirnrinde als Organ der psychischen Functionen, sondern soll lediglich andeuten, daß functionell eine dauernde, weil konstitutionell begründete, krankhafte, vielfach geradezu perverse und progressive Entfernung von der Norm des psychischen Lebens - ein aus der Art schlagen, eine Entartung der Gesamtpersönlichkeit besteht« (KRAFFT-EBING, 1888, S. 423).
»Der Kampf gegen das Gewohnheitsverbrechertum setzt genaue Kenntnis desselben voraus ... Handelt es sich doch nur um ein Glied, allerdings um das bedeutendste und gefährlichste, in jener Kette sozialer Krankheitserscheinungen, welche wir unter dem Gattungsnamen des Proletariats zusammenzufassen pflegen. Bettler und Vagabunden, Gauner und Halbweltmenschen ... geistig und körperlich Degenerierte - sie alle bilden das Heer der grundsätzlichen Gegner der Gesellschaftsordnung, als dessen Generalstab die Gewohnheitsverbrecher erscheinen« (F. v. LISZT, 1904, S. 167).
»Gewiß, niemals werden wir alle geistig und sittlich Minderwertigen aus unserem Volkskörper ausschalten können, niemals die Entstehung des Krankhaften, der Entartung vermeiden können, selbst wenn wir nach dem Vorschlag des Amerikaners LAUGHLIN fortlaufend etwa ein Zehntel aller Lebenden sterilisieren würden. Aber wenn wir auch nur an hundert oder tausend oder zehntausend Stätten bewirken könnten, daß Krankhaftes sich nicht weitervererbt, daß den ungeborenen Geschlechtern der Fluch schlechter Erbanlagen erspart bleibe, so hätten wir als Ärzte Gutes und für unser Volk Wertvolles geleistet« (R. GAUPP,Berlin 1925, S. 43).
»Auch als Ärzte sind wir verantwortlich beteiligt an der Aufopferung des Individuums für die Gesamtheit. Es wäre illusionär, ja es wäre nicht einmal fair, wenn der deutsche Arzt seinen verantwortlichen Anteil an der notgeborenen Vernichtungspolitik glaubte nicht beitragen zu müssen. An der Vernichtung unwerten Lebens oder unwerter Zeugungsfähigkeit, an der Ausschaltung des Unwerten durch Internierung, an der staatspolitischen Vernichtungspolitik war er auch früher beteiligt« (V. v. WEIZSÄCKER,1933, zit. nach KLEE, 1985, S. 61).
»Die krankhafte Unzweckmäßigkeit der Veranlagung. wie wir sie als Ausdruck der Entartung kennengelernt haben, belastet nicht nur ihren Träger selbst mit einer Mitgift, die ihn im Wettbewerb des Lebens auf Schritt und Tritt hinter seinen glücklicheren Genossen zurückbleiben läßt, sondern sie bildet auch vielfach eine Gefahr für das menschliche Zusammenleben« (KRAEPELIN,1905, S. 330).
»Wenn ich es recht sehe, liegt es in derselben naturgesetzlichen Notwendigkeit, mit der es immer wieder zu Umsturzbewegungen kommen muß, begründet, daß Persönlichkeiten, die infolge ihrer disharmonischen Veranlagung der jeweiligen Gesellschaftsordnung fremd oder feindselig gegenüberstehen, in diesen Bewegungen mitzuwirken, solange derartige Persönlichkeiten sich in ihrer Eigenart entsprechend zum Schaden der Gesellschaft ausleben können« (KAHN, 1919, S 105),
»Der Psychoanalyse ist oft der Vorwurf gemacht worden, sie sei als Forschung und Therapie zersetzend und undeutsch ... Es ist zuzugeben, daß sie ein gefährliches Instrument in der Hand eines destruktiven Geistes ist, und daß es darum entscheidend ist, wessen Hand dieses Instrument führt... Die Psychoanalyse bemüht sich, unfähige Weichlinge zu lebenstüchtigen Menschen, Instinktgehemmte zu Instinktsicheren, lebensfremde Phantasien zu Menschen, die den Wirklichkeiten ins Auge zu sehen vermögen, ihren Triebimpulsen Ausgelieferte zu solchen, die ihre Triebe zu beherrschen vermögen, liebesunfähige und egoistische Menschen zu liebes- und opferfähigen, am Ganzen des Lebens Uninteressierte zu Dienern des Ganzen umzuformen. Dadurch leistet sie eine hervorragende Erziehungsarbeit und vermag den gerade jetzt neu herausgestellten Linien einer heroischen, realitätszugewandten, aufbauenden Lebensauffassung wertvoll zu dienen« (C. MÜLLER-BRAUNSCHWEIG, 1933, wiederabgedruckt 1984, S. 111 f).
» ... so kommen wir zu der Erkenntnis, daß Krankheit entweder Folge der Sünde ist, etwas zu tun hat mit dem Aus-der-Ordnung-fallen, daß sie ein Symbol ist, und ein Zeichen dafür sein kann, daß ein Mensch an den Problemen des Lebens zu scheitern droht und mit ihnen nicht fertig wird, und Krankheit kann weiter sein ein Anruf Gottes, ein Weg zur Reifung oder zur Vorbereitung auf den Tod« (A. JORES, 1967, S.12).
»Insgesamt kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Schizophrenen ein großes soziales Problem darstellen, nicht nur als Patienten ... Ich glaube, daß der politisch fanatische Typ, der sich an dunklen Stellen mit anderen gestörten Menschen trifft und manchmal von schlaueren, wenn auch nicht weniger gestörten Menschen ausgebeutet wird, die spezielle Gefahr unserer Zeit darstellen könnte« (L. BELLAK, 1970, S. 15).
»Die Spannungen und Belastungen, denen der einzelne ausgesetzt ist, beruhen nicht auf individuellen Störungen und Erkrankungen, sondern auf dem normalen Funktionieren der Gesellschaft (und des Individuums) ... Den Patienten auf diese Normalität auszurichten hieße, diese Spannungen und Belastungen normalisieren, oder um es krasser auszudrücken: es hieße ihn die Lage versetzen, krank zu sein und seine Krankheit als Gesundheit zu erleben, ohne daß er, der sich gesund und normal fühlt, diese Krankheit überhaupt noch bemerkt« (H. MARCUSE, 1967 (1980, S. 452 und 454))
» ... jeder Wahnsinn (ist) politische Dissidenz und jeder Wahn oder jede 'Delusion' (ist) eine politische Aussage. Verrücktheit ist Subversion, ein Subversionspotential in jedem von uns, nicht nur bei denen, die willkürlich für verrückt erklärt wurden. Ist der psychiatrische Prozeß jedoch erst einmal in Gang gesetzt - beginnend mit der diagnostischen Taufe -, so wird, wer sich für verrückt erklärt sieht, durch die 'Behandlung (und den Zugriff der psychiatrischen Institution fortschreitend zerstört. Der psychiatrisierte Patient wird systematisch zerbrochen, seine Subversivität wird ausgelöscht, selbst wo seine Verrücktheit (wie alle unsere Wahnsinne) revolutionär ist: in dem Versuch, durch Tod und Wiedergeburt eine entfremdete Existenz zu destrukturieren und zu restrukturieren. Diese Dialektik der Verrücktheit wird durch die Logik der Psychiatrie zerschlagen« (D. COOPER, 1979, S. 35 f.).
»Anormal ist also derjenige, der - auf eine nicht vorgesehene Art und Weise - diese Regeln, weil sie nicht seinen Bedürfnissen entsprechen, in Frage stellt, indem er die Regeln übertritt. Anormales Verhalten besteht also zunächst einmal in systematischen und systematisierbaren Regelverletzungen. Sie richten sich gegen Regeln, die als universell gültige aufgezwängt werden, d. h. als ob sie den Bedürfnissen und Interessen aller entsprechen würden, während sie tatsächlich nur den Ansprüchen und Interessen der Klasse entsprechen, die die Regeln eingesetzt hat. Die Übertretung steht in Relation zu den als absolut aufgezwängten Werten, und die ‚Antwort' auf Übertretungen kann innerhalb dieses Wertesystems ebenfalls nur absolut sein« (F. BASAGLIA, F. BASAGLIA-ONGARO und M. G. GIANICHEDDA, 1979, S. 328).
Durch die systematische Verknüpfung von Normalitäts- und Abweichungsvorstellungen mit den jeweils als verbindlich angesehenen Bedingungen sozialer Ordnung wird die historische Relativität jener Kriterien erkennbar, die als Meßlatte für Normalität und Abweichung jeweils Geltungsanspruch erlangt haben. So sehr sich das jeweils dominierende Verständnis mit Zügen universeller Gültigkeit auszustatten bemüht ist, so wenig kann dies letztlich gelingen. In der Regel bedarf es nur einer geringen historischen Distanz, um die Zeitgebundenheit der Definition offensichtlich werden lassen. Nur eingebunden in die ideologische Sogwirkung des jeweils herrschenden Bewußtseins kann der universelle Geltungsanspruch glaubwürdig behauptet werden.
Gerade in einer gesellschaftlichen Umbruchphase, in der sich die spätkapitalistischen Gesellschaften gegenwärtig befinden, wird erfahrbar, wie sich mit der Veränderung gesellschaftlichen Strukturen auch die normativen Regulative und ihnen zuordenbare passende »Sozialcharaktere« verändern. So beginnt der klassische »bürgerliche Sozialcharakter«, der sich an Prinzipien der individuellen Leistungs- und Aufstiegsorientierung ausrichtet, für den Besitzindividualismus und Autonomie zentrale Werte sind, die zur innersten motivationalen Basis seiner Person gehören, sich allmählich zu überleben. Die asketischen Tugenden und die mit ihnen verbundene protestantische Leistungsethik, auf die der bürgerliche Sozialisationsmodus abzielte, verlieren immer stärker ihren gesellschaftlichen Sinn. In dem Maße wie die ökonomische Bedeutung des Massenkonsums wuchs, verfielen zentrale bürgerliche Tugenden wie Verzicht, Sparsamkeit, Selbstdisziplin, Gratifikationsaufschub zugunsten »höherer Ziele«.
Ein Normalitätsmodell, das sich heute an solchen Zentralwerten orientiert, kann nicht mehr universelle Gültigkeit beanspruchen. Die protestantische Arbeits- und Pflichtethik, die nach M. WEBER (1963) so unauflöslich mit dem Aufstieg des Kapitalismus verbunden ist, hat ihre Verankerung noch in den alten Mittelschichten, wird allerdings auch hier zunehmend von Prinzipien einer hedonistischen Ethik und von Zielen einer expressiven Selbstentäußerung und grenzenloser Selbstverwirklichung abgelöst (vgl. BRAND, 1982).
Zwar versuchen die Ideologen der neokonservativen Wende an die bürgerliche Wertetradition anzuknüpfen. Doch die Prägekraft der klassischen ideologischen Grundströmungen der bürgerlichen Kultur, die sich in Stichworten wie Leistungswillen, individuelles Durchsetzungsvermögen, Elitebewußtsein, Familie, Opfer oder Moral ausdrücken, findet nicht mehr problemlos eine individuelle Verinnerlichungsbereitschaft. Zumindest für immer größere Teile der Bevölkerung können diese Wertmuster keine volle Akzeptanz mehr erlangen, wirken hohl bis lächerlich. Sie beanspruchen eine integrative Verbindlichkeit, für die gesellschaftliche Voraussetzungen immer weniger gegeben sind. Die Basis des Normalitätsmodells, das sich am Koordinatensystem der protestantischen Leistungsethik festmachen konnte, ist in einem strukturellen Erosionsprozeß teilweise bereits abgetragen und insgesamt vom Untergang bedroht.
Nach O. NEGT befinden wir uns mitten in einer tiefgreifenden »Erosionskrise«, die sich von herkömmlichen Krisen dadurch unterscheiden,
»daß diese sich vor allem unterhalb des öffentlichen Institutionensystems wirksam zeigen, daß sie die Subjekte in ihrer seelischen und geistigen Grundausstattung erfassen. Krisen diesen Typs verändern die Subjekte in ihren wichtigsten Lebensäußerungen, in ihrem Arbeitsverhalten, in ihrem Selbstwertgefühl, in ihren Wert- und Bedürfnisorientierungen. Was diese Subjektseite der Krise anbetrifft, so besteht eines ihrer hervorstechenden Merkmale darin, daß offenbar die Panzerungen der alten autoritär-autoritätsgebundenen Sozialcharaktere porös zu werden beginnen. Gewiß, sie sind nicht verschwunden, aber die geschichtlichen Bedingungen für deren Prägung (ungebrochene Vaterautorität, über Arbeit vermittelte Mechanismen der Triebunterdrückung, gesellschaftliche Ökonomie des Mangels beispielsweise) sind ungünstiger geworden« (1984, S. 62).
Mit dieser Erosionskrise verbindet sich eine tiefgreifende Normalitätskrise. Das Modell, das den Aufstieg der kapitalistischen Industriekultur ermöglichte und zugleich durch diese abgesichert wurde, bindet nicht mehr in ausreichendem Maße. In der treffenden Formulierung von M. WEBER vollzieht sich so etwas wie ein Ausbruch aus dem »Gehäuse der Hörigkeit«, in das die asketische Arbeitsmoral die Menschen eingeschlossen hat. Die entsprechende Analyse von M. WEBER ist lesenswert:
»... indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung zu erbauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden - nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen -, mit überwältigendem Zwange bestimmt, vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie 'ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte', sollte nach BAXTERs Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in der Geschichte. ( ... ) Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder aber - wenn keins von beiden - mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen« (1963, S. 203 f.).
Das »Gehäuse der Hörigkeit« hat Risse bekommen. Zwar ist noch nicht der »letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht«, aber die Grenzen der Naturausbeutung sind erfahrbar und bewußt geworden. Der Fortschrittsglaube, der von der Unerschöpflichkeit der natürlichen Ressourcen ausging, ist nach einer drei- bis vierhundertjährigen Expansionsphase schwer erschüttert.
»Mit den lebensbedrohlichen Folgen unkontrollierter Technikentwicklung werden viele jener sozialen und psychischen Entwicklungsschritte in Frage gestellt, die der Herausbildung der industriellen Gesellschaft zugrundeliegen. Die wachsende Distanzierung und Entfremdung sozialer Lebensgemeinschaften von unmittelbaren Naturkontakten, die Ersetzung personaler und direkter Gewaltverhältnisse durch verinnerlichte, psychische Kontrollmechanismen, also Phänomene, die als selbstverständliche Voraussetzungen einer Erweiterung der menschlichen Freiheit gelten konnten, werden heute zunehmend als Anzeichen eines mit der Moderne einsetzenden Prozesses der Zerstörung humaner Entfaltungsmöglichkeiten gewertet ... Die Geschichte der (nicht nur kapitalistischen) Industriegesellschaft wird nun primär in den Kategorien einer psychischen Verfeinerung von Zwangsverhältnissen, der Auflösung personaler und direkter Lebensgemeinschaften und der Zerstörung lebendiger Naturerfahrung interpretiert« (HONNETH und JOAS, 1980, S. 7 f.).
Gerade die Erkenntnis, daß die spezifische gesellschaftliche Form der Aneignung der äußeren Natur die Ausgestaltung unserer inneren Natur bestimmt, hat das Bewußtsein dafür geschärft, wie die sozioökonomischen Lebensbedingungen auch den historisch veränderbaren Rahmen unseres Individualitäts- und Normalitätsverständnisses bilden, sie hat uns »den sozialen Charakter unserer Normalitätsvorstellungen« bewußt werden lassen
(HONNETH und JOAS, 1980, S. 12).
Die bislang eher global angesprochenen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und ihre bewußtseinsmäßigen Begleitphänomene lassen sich bezogen auf die Lebensbedingungen der einzelnen Subjekte spezifischer fassen. Bei unverändertem Fortbestand sozialer Ungleichheitsrelationen (der Klassencharakter der kapitalistischen Gesellschaftsformation) hat sich in den hinter uns liegenden Jahrzehnten für alle Bevölkerungsschichten ein tiefgreifender Prozeß der Auflösung traditioneller Lebensformen vollzogen. Die Folge davon war und ist die Individualisierung von Lebenslagen und Lebenswegen. Als sozioökonomische und soziokulturelle Hintergrundbedingungen für diese Prozesse lassen sich benennen (vgl. BECK, 1983):
Auf der Grundlage ökonomischer Konzentrationsprozesse und von technologischem Strukturwandel ist es zu einer weiteren Zunahme der für die kapitalistische Gesellschaftsformation von Beginn an kennzeichnenden sozialen und geographischen Mobilitätsprozesse gekommen, die immer mehr Menschen aus ihren Herkunftsmilieus herausgelöst haben.
Sozialpolitische Sicherungs- und Steuerungssysteme basieren auf der Individualisierung von Risiken und »sichern« diese Risiken lediglich auf der Basis dieser Individualisierung ab (das sind die »sozialpsychologische Infrastruktur« (RÖDEL und GULDIMANN, 1978) oder der »keynesianische Sozialcharakter« (DIEMER, 1985) des sozialstaatlich durchgestalteten Kapitalismus).
Immer mehr gesellschaftliche Bereiche werden von der Logik kapitalistischer Konkurrenz durchzogen (die »Durchkapitalisierung« der spätkapitalistischen Gesellschaften wie sie HIRSCH (1980) ausführlich beschrieben hat) und verstärken die Tendenz zur Abschottung und Vereinzelung der Subjekte.
Alte Wohngebiete und die in ihnen ermöglichten und faktisch vorhandenen dichten Netzwerkbeziehungen werden endgültig und unwiederbringlich durch neue großstädtische Wohnformen verdrängt, in denen sich gelockerte Bekanntschafts- und Nachbarschaftskreise entwickeln (vgl. FISCHER, 1982; STROHMEIER, 1983; KEUPP, 1985 a).
Bei kontinuierlich sinkender Erwerbsarbeitszeit differenzieren sich gruppen- und generationsspezifische Gestaltungschancen in der Privatsphäre. An die Stelle von relativ homogenen und kollektiven Problemerfahrungen treten weit ausdifferenzierte Teil- und Subkulturen mit je eigenen Erfahrungen und Sichtweisen.
Kollektive Deutungsmuster und homogene Bewußtseinslagen sind fortschreitend zerfallen und werden zunehmend durch massenmedial vermittelte Interpretationsfolien ersetzt, die ihrerseits durch die Wahl ihrer Modelle den Individualisierungstrend verstärken (vgl. REISBECK, 1985).
Dieser aus mehreren Quellen gespeiste Individualisierungsdruck und der mit ihm verbundene Verlust an alltagsweltlich abgesicherten Handlungskompetenzen führt zu erhöhten Anforderungen an die Subjekte. Die für sie wichtigen Sozialbeziehungen und Kontaktnetze müssen individuell selegiert, hergestellt und immer wieder erneuert werden. Die Individuen werden immer mehr zu Initiatoren und Managern ihrer Beziehungsmuster bei gleichzeitigem Verlust an normativen Steuerungspotentialen, an gesellschaftlich unproblematisch geliefertem Handlungssinn. Vor allem in den kleinfamillären Monaden und in deren chronischer Verunsicherung bei der Wahrnehmung grundlegender Sozialisationsfunktionen werden dieser Individualisierungsdruck und seine Folgen sichtbar.
Der beschriebene gesellschaftliche Individualisierungsprozeß läßt sich durchaus unterschiedlich bewerten. Er läßt sich nicht nur als Verlust von Lebensqualität beschreiben, sondern durchaus auch als Chance zur Entwicklung neuer Lebensformen. Der tiefgreifende gesellschaftliche Transformationsprozeß führt zu gesellschaftlicher Desintegration und diese wiederum erweitert die Spielräume für Individualität, für Traditionsbrüche, die neue Lebensperspektiven eröffnen können. Die Subjekte verfügen über gewachsene Chancen, sich endlich eigene Wege zu wählen, sich gegenüber bornierten Nachbarn und umklammernden Familienmitgliedern ignorant zu zeigen und sich mit anderen Menschen zu assoziieren, mit denen sie gemeinsame Interessen verbinden. In Beziehungsnetzen, die auf einem solchen Hintergrund entstanden sind, entwickeln sich ungleich mehr Chancen für unterschiedliche Lebensentwürfe, für die Emanzipation aus zugeschriebenen Identitäten.
Der hier entstehende Handlungsspielraum ermöglicht Beziehungen, die nicht durch starre Rollen und statusbestimmte Herrschaftsformen vordefiniert sind. Diese »Befreiung« hat aber auch ihren Preis. Das ständige Aushandeln müssen ist anstrengend, ist ein kaum zu befriedender Krisenherd, jedenfalls solange keine neuen kollektiven Sinnhorizonte entstanden sind. Seine Bewältigung erfordert bei den Subjekten psychosoziale Ressourcen, die längst nicht immer vorhanden sind.
»Komplexe Gesellschaften bieten mehr Raum für verschiedene Lebensentwürfe; die Ausweitung und Differenzierung des gesellschaftlichen Prozesses führen zu einer Lockerung und Differenzierung individueller Lebenshorizonte. Damit wird jedoch auch die Herausbildung von Identität und ihre praktische Balance schwieriger, weil eine individualisierte Identität sich stärker selbst stabilisieren und einen komplexeren Austausch mit ihrer Umwelt erhalten muß. Auf der anderen Seite führt die gleiche Entwicklung dazu, daß von den technisierten Subsystemen immer speziellere Handlungsimperative ausgehen, denen der einzelne entsprechen muß ... Daraus ergibt sich eine neue Art von Entfremdung: die Notwendigkeit an technisch rationale, aber psychosoziale 'kalte' Systemzusammenhänge« (SCHÜLEIN, 1983, S. 261).
Die beschriebene Erosionskrise, die radikal veränderten Bedingungen psychosozialer Identitätsbildung und das neu entstehende ökologische Bewußtsein sind die entscheidenden Bedingungen für eine Vielzahl von sozialen Bewegungen, Projekten und Initiativen, die neue Vergesellschaftungsmodelle ausprobieren und die als »Alternativbewegung« zusammengefaßt werden. Sie stellen kollektive Versuche dar, die brüchig gewordenen Normalitätsmuster der spätkapitalistischen Gesellschaft zu verändern bzw. endgültig zu überwinden. Sie lassen sich sinnvollerweise als Opposition zur herrschenden Normalität bestimmen (Vgl. SCHÜLEIN, 1983). Und sie erproben neue Lebensentwürfe, in denen sich die Suche nach neuen lebbaren Normalitätsmustern erkennen läßt.
Nach BRAND, BÜSSERS und RUCHT haben sich in den neuen sozialen Bewegungen neue »humanistisch-emanzipative Wertvorstellungen« für den »Umgang mit der eigenen, inneren Natur« herausgebildet:
-
»die vereinseitigte instrumentelle Rationalität öffnet sich für bislang ausgegrenzte, spirituelle und ganzheitliche Denk- und Erfahrungsweisen;
-
die Sinnlichkeit des eigenen Körpers wird enttabuisiert, die verdrängten Bestandteile der triebhaften Bedürfnisse werden einer bewußteren, kommunikativen Form des Umgangs und der Befriedigung zugänglich;
-
die ins Private (oder in den Bereich des naturwüchsig Gesellschaftlichen) ausgegrenzten, autoritär sanktionierten, traditionellen Moralvorstellungen werden durch die Prinzipien einer diskursiven, hedonistisch-kommunitären Moral ersetzt« (1983, S. 252 f.).
Viele der angesprochenen Zielvorstellungen suchen speziell auch in den vielfältig verästelten Formen der Psychokultur ihre Realisierung und werden dort zugleich zur käuflichen Ware, die jene Logik transportiert, aus der man auszubrechen versucht. Aber in der Zunahme der Nachfrage nach Angeboten dieser Psychokultur kommt das wachsende Bedürfnis nach dem Abwerfen jenes Normalitätsgehäuses zum Ausdruck, das das »Projekt der Moderne« den Subjekten aufgeladen hat. Der Wunsch, dies möglichst schnell zu schaffen, macht für die Versprechungen vieler Psychosekten anfällig, die ein »neues Zeitalter«, die »große Transformation« oder den »neuen Menschen« versprechen.
Die tiefgreifende ökonomische, ökologische und kulturelle Krise, in der sich die spätkapitalistischen Industriegesellschaften befinden, läßt uns unmittelbar auch die Brüchigkeit des Normalitätsentwurfes spüren, den diese Gesellschaften produziert haben und von denen sie abhängig sind. Dieses Brüchigwerden hat entscheidend auch die Fragen nach dem historischen Werdeprozeß dieses Normalitätsentwurfs befördert. In dem Maße, wie die unhinterfragbare Naturhaftigkeit des herrschenden Normalitätsmodells (sich in Formulierungen wie »es ist unnatürlich sich so zu verhalten«, »es schlägt aus der Art«, »das ist entartet« ausdrückend) ihren Geltungsanspruch und ihre Verbindlichkeit verloren haben, sind die sozialgeschichtlichen Bedingungen der Möglichkeit dieses Modells zum Thema geworden. Für die wissenschaftliche Bewältigung der damit verbundenen Fragestellungen sind vor allem drei sozialwissenschaftliche Theorierichtungen von besonderer Bedeutung:
Die Kritische Theorie hat ein begründetes Mißtrauen gegen die Darstellung der Zivilisationsgeschichte als Sieg des Fortschritts geweckt. Vor allem in ihrem Buch aus den 40er Jahren, »Dialektik der Aufklärung«, versuchen HORKHEIMER und ADORNO den »Preis des Fortschritts« erkennbar zu machen. In ihrer »Archäologie der Moderne« (W. BENJAMIN) zeigen sie, wie sich die Zivilisationsgeschichte als zunehmend Reduktion der Vernünftigkeit auf die Perspektive einer instrumentellen Vernunft darstellen läßt, als Unterwerfung der Natur unter eine Zweck-Mittel-Rationalität. Dies ist die Linie, die in die Urgeschichte der Menschheit zurückverfolgt werden kann und die in der bürgerlichen Gesellschaft ihre verdichtete und herrschende Kerngestalt gewonnen hat.
»In dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewußtsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle die Zwecke, für die er sich am Leben erhält, der gesellschaftliche Fortschritt, die Steigerung aller materiellen und geistigen Kräfte, ja Bewußtsein selber, nichtig, und die Inthronisierung des Mittels als Zweck, die im späten Kapitalismus den Charakter des offenen Wahnsinns annimmt, ist schon in der Urgeschichte der Subjektivität wahrnehmbar« (1971, S. 51).
Von der Kritischen Theorie ist der Gedanke wichtig, daß die Fortschritte der Zivilisation ihren Preis in der Subjektbildung haben: Unter der Vorherrschaft der instrumentellen Vernunft wird eine Normalität erzwungen, die menschliche Potentialitäten unterdrückt, abspaltet, sie dadurch aber ihrer Wirksamkeit nicht beraubt. Sie bilden eine Basis für die Barbarei, die die zivilisierten Gesellschaften nie wirklich überwunden haben. Das faschistische Deutschland lieferte dafür den zentralen Beweis. Die FREUDsche Kulturtheorie hat für ADORNO hier grundlegende Einsichten vermittelt: »Unter den Einsichten von FREUD, ... , scheint mir eine der tiefsten die, daß die Zivilisation ihrerseits das Antizivilisatorische hervorbringt und es zunehmend verstärkt« (ADORNO, 1969, S. 85).
Die Figurationssoziologie von N. ELIAS hat überzeugend aufzeigen können, daß Strukturen in den Subjekten nicht unabhängig von der Gesellschaftsgeschichte verstanden werden können. Der Ausgangspunkt für die Geschichte der abendländischen Zivilisation, die sich ELIAS zum Ziel gesetzt hat, war die Erfahrung der Krise und das daraus folgende Erkenntnisinteresse an den Grundlagen dieser Zivilisation. Seine Untersuchung entspringt »den Erfahrungen, unter deren Eindruck wir alle leben, den Erfahrungen von der Krise und der Umbildung der bisherigen, abendländischen Zivilisation und dem einfachen Bedürfnis zu verstehen, was es eigentlich mit dieser 'Zivilisation' auf sich hat« (ELIAS, 1976, S. LXXX).
ELIAS unternimmt dann den faszinierenden Versuch, die über lange historische Spannen sich vollziehende Veränderung von Persönlichkeitsstrukturen mit sozialstrukturellen Prozessen zu verkoppeln. Für ELIAS besteht der Kern des Zivilisationsprozesses in der allmählichen Verinnerlichung zunehmender äußerer Kontrollen über alle Ausdrucksformen körperlicher und emotionaler Bedürfnisse. Die Ausbildung einer »Selbstzwangsapparatur« ermöglicht es, anstelle spontaner Äußerungsformen strategisch geplante und innengesteuerte Handlungsweisen zu setzen. Diese zunehmende Herstellung von Affektkontrolle und Selbstdisziplin ist die Folge zunehmender sozialer Verflechtung im makrogesellschaftlichen Raum, die ihren Niederschlag in der Herausbildung des absolutistischen Staates finden. In diesem Prozeß ist auch die sich verallgemeinernde ökonomische Tauschlogik bestimmend, die immer weitere Räume und Beziehungsketten erfaßt und die bei den Individuen mehr »Langsicht« (ELIAS) erfordern, »nämlich die Planung rationaler Verhaltensweisen und schließlich jene 'Frustrationstoleranz', die mit dem 'Muster der aufgeschobenen Befriedigung' gemeint ist« (DREITZEL, 1981, S. 181). Was ELIAS als »Selbstzwangsapparatur« beschreibt, läßt als sich Normalitätsinstanz verstehen, die in die Persönlichkeitsstrukturen eingelassen ist.
Am dichtesten an dem Thema Normalität und Abweichung liegen die Arbeiten von M. FOUCAULT. In zwei klassischen Werken hat er sich mit der Geschichte der Vernunft und der institutionellen Ausgrenzung der Unvernunft beschäftigt: »Psychologie und Geisteskrankheit« (1968) und »Wahnsinn und Gesellschaft« (1969). An der Geschichte der Psychiatrie zeigt er, daß die entstehende bürgerliche Gesellschaft das bis dahin vorherrschende Verhältnis zum Wahnsinn grundlegend revidierte. War dieser in den vorbürgerlichen Perioden toleriert, »als eine Art von existentieller Entscheidung, am geregelten Sozialzusammenhang nicht mehr teilzunehmen« (HONNETH und JOAS, 1980, S. 127), so setzte sich jetzt ein Normalitätsbegriff durch, der diese Toleranz nicht mehr enthielt. Der absolutistische Staat eröffnete die »Epoche der administrativen Ausgrenzung der Unvernunft« (DÖRNER, 1969, S. 28), er hatte das Gewaltmonopol um die neue Vernunftordnung gesellschaftlich herzustellen:
»Der Aufstieg des Zeitalters der Vernunft, des Merkantilismus und des aufgeklärten Absolutismus vollzog sich in eins mit einer neuen rigorosen Raumordnung, die alle Formen der Vernunft, die im Mittelalter zu der einen göttlichen, in der Renaissance zur sich säkularisierenden Welt gehört hatten, demarkiert und jenseits der zivilen Verkehrs-, Sitten- und Arbeitswelt, kurz: der Vernunftswelt, hinter Schloß und Riegel verschwinden ließ« (ebd., S.27).
Für die neu gezogene Grenze zwischen Vernunft und Unvernunft ist als Grenzwächterprofession und -institution die Psychiatrie entstanden, der wenig später auch die Psychologie folgte, die sich als Instanz der Selbstreflexion der bürgerlichen Vernünftigkeit entwickelte. Die Konzepte der Psychiatrie für Normalität und Abweichung trugen in sich die Bereitschaft das historische Mandat als Grenzwächterinstanz zu übernehmen. Die Erfüllung dieses Mandats war jeweils abhängig von der spezifischen inneren Dynamik der gesellschaftlichen Vernunftbezirke, aber es war immer das Ordnungsmandat leitend.
»Der Wahnsinnige zeigt auf, daß Risse in der Kontinuität der herrschenden Gesellschaftsordnung vorhanden sind, und er zeigt die Möglichkeit auf, »anders zu sein«, aber er liefert kein wirksames, verallgemeinerbares Modell des Andersseins: in der Wirklichkeit wird durch sein Leiden und sein negatives Schicksal - und dies entspricht dem Willen der herrschenden Macht - das Beispiel eines mißglückten Versuchs der Rebellion gegen die Normalität vermittelt« (G. JERVIS, 1978a, S. 219).
»Die radikal individuellen, unaufgelösten Züge an einem Menschen sind stets beides in eins, das vom je herrschenden System nicht ganz Erfaßte, glücklich Überlebende und die Male der Verstümmelung, welche das System seinen Angehörigen antut. In ihnen wiederholen sich übertreibend Grundbestimmungen des Systems: im Geiz etwa das feste Eigentum, in der eingebildeten Krankheit die reflexionslose Selbsterhaltung. Indem kraft solcher Züge das Individuum sich gegen den Zwang von Natur und Gesellschaft, Krankheit und Bankrott, krampfhaft zu behaupten trachtet, nehmen jene Züge selber notwendig das Zwanghafte an« (M. HORKHEIMER und T. W. ADORNO, 1971, S. 215).
»Zuerst und primär geht es um die Lockerung jener ‚ Selbstzwangsapparatur', die sozio-ökonomisch dysfunktional und damit potentiell politisch gefährlich geworden ist. Denn die Beziehung zwischen dem menschlichen Organismus und seiner Umwelt ist gegenwärtig am stärksten bedroht durch jene immer noch vorherrschende angespannte Selbstkontrolle des den Institutionen wohlangepaßten, leistungsorientierten Sozialcharakters, und nicht durch die wenigen, die, wie orientierungslos auch immer, mit direkteren Formen der Selbstdarstellung und Welterfahrung experimentieren. Vor allem die von der »Selbstzwangsapparatur« unterdrückte Aggressivität kristallisiert sich nur allzu leicht im Ressentiments und Vorurteilen und fördert eine Fixierung an den Status-quo, der gerade jene Kreativität erstickt, die angesichts der zunehmenden Komplexität unserer Gesellschaft so notwendig ist« (H. P. DREITZEL, 1981, S. 194).
»Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die psychologischen Bereiche der Krankheit ohne Trugschlüsse nicht als autonom betrachtet werden können. Gewiß läßt sich die Geisteskrankheit in bezug auf ihre Genese, in bezug auf die individuelle psychologische Geschichte, in bezug aufdie Existenzformen situieren. Aber man darf aus diesen verschiedenen Aspekten der Krankheit nicht ontologische Formen machen, wenn man nicht auf mythische Erklärungen, wie die Entwicklung der psychologischen Strukturen oder die Triebtheorie oder eine existentielle Anthropologie, rekurrieren will. In Wirklichkeit läßt sich allein in der Geschichte das einzige konkrete Apriori entdecken, aus welchem die Geisteskrankheit mit der leeren Öffnung ihrer Möglichkeit ihre notwendigen Figuren hernimmt« (M. FOUCAULT, 1968, S. 129).
»Gesundheit und das Phänomen des Leidens hatten zu verschiedenen Zeitaltern verschiedene Bedeutungen. Der Begriff der Gesundheit läßt sich wie der des Lebens nicht genau definieren; tatsächlich hängen beide eng zusammen. Was man mit Gesundheit meint, hängt davon ab, wie man den lebenden Organismus und seine Beziehung zu seiner Umwelt sieht. Das sich diese Anschauung von einer Kultur zur anderen und von einer Ära zur anderen wandelt, wandeln sich auch die Vorstellungen von Gesundheit. Den umfassenden Gesundheitsbegriff, den wir für den anstehenden kulturellen Wandel brauchen - ein Begriff, der individuelle, soziale und ökologische Dimensionen einschließt - wird ein Systembild der lebenden Organismen und dementsprechend ein Systembild der Gesundheit erfordern« (F. CAPRA, 1983, S. 132).
»Aber auf der anderen Seite delegiert die Gesellschaft in ihr auch ihre reflexiven und progressiven Anteile, die innerhalb der Normalität nur begrenzt realisierbar sind. Die 'Alternativbewegung' ist auch Avantgarde, probiert aus, was an Interaktionschancen vorhanden ist, erweitert damit das Spektrum gesellschaftlicher Möglichkeiten. Indem sie die aktive Auseinandersetzung mit psychischen und sozialen Themen sucht und diese Suche zugleich auf eine Weise praktiziert, die noch 'themafähig' ist bzw. eine gesamtgesellschaftliche Thematisierung zuläßt, erhöht sie den Legitimations- und Reflexionsdruck innerhalb der Normalität und regt damit Lernprozesse an. Sie fungiert teils als Konkurrenz, teils als 'Lehrstück', hält dabei auf alle Fälle Auseinandersetzungen in Gang, die sonst eher im integrativen Sog der Normalität zu ersticken drohen« (J. A. SCHÜLEIN, 1983, S. 271 f.).
»An die Stelle des im Glauben und der öffentlichen Moral abgestützten Dualismus von Geist (Rationalität) und Körper (Irrationalität) tritt eine (durch die strukturellen Veränderungen des industriellen Vergesellschaftungsprozesses bewirkte) Entdifierenzierung dieser Ebenen. Das erschüttert sowohl den darin implizierten Herrschaftscharakter, die moralisch-rationale Selbstdisziplinierung der eigenen Affektivität und Sinnlichkeit, als auch die Trennung in öffentliches (unpersönliches, affektives, selbstdiszipliniertes) und privates (persönliches, affektives, destruktiv-irrationales) Verhalten. Zugleich bilden sich neue Affektstrukturen aus, die durch eine starke Betonung hedonistischer Werte, durch eine stärkere Verschränkung von Rationalität und Affektivität und durch die Neubestimmung des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit geprägt sind« (K.-W. BRAND, D. BÜSSER und D. RUCHT, 1983, S. 252).
Es »könnte sein, daß besonders gesunde Menschen bestimmte Dinge nicht tun, die in der großen Mehrheit der Bevölkerung so verbreitet sind, daß sie als Bestandteil der menschlichen Natur gelten. Damit stellt sich die interessante Frage, ob Menschen von extremer psychischer Gesundheit uns übrigen nicht manchmal geradezu als bizarre oder zumindest geheimnisvolle Gestalten erscheinen ... je gesünder ein Mensch psychisch ist, desto mehr Bewußtseinszustände, vor allem höhere Bewußtseinszustände, werden ihm vermutlich zugänglich sein« (R. N. WALSH, F. VAUGHAN, 1985, S. 137f.).
Im Widerspruch zur Einsicht, daß die Beurteilungskriterien für Normalität und Abweichung historisch veränderliche Größen sind, die von der Wandlungsdynamik gesellschaftlicher Systeme abhängig sind, steht der Objektivierungsanspruch jener Professionen, die sich wissenschaftlich und institutionell als zuständige Instanzen für die Einordnung von Normalität und Abweichung verstehen. Die Hauptströmungen von Psychiatrie und Klinischer Psychologie haben in ihrer Professions- und Wissenschaftsgeschichte immer wieder neue Anläufe unternommen, sich dem Strudel des soziohistorischen Relativismus durch die Etablierung als zeitlos gültig angesehener Beurteilungsmaßstäbe zu entziehen. Die Orientierung an den Wissenschaftskriterien der Naturwissenschaften und einem »naturhistorischen Krankheitsbegriff« schienen dieses Problem am befriedigendsten lösen zu können. Der Lösungsanspruch des naturwissenschaftlichen Positivismus zielt darauf, Problemstellungen aus dem gesellschaftlichen Feld widerstreitender Interessen, moralischer Haltungen und ideologischer Glaubenskriege auf ein neutralistisches Terrain zu transferieren und nach den dort geltenden Regeln allein für bearbeitbar zu erklären. Die Neutralisierung vollzieht sich als sprachliche Transformation von werthaltigen Begriffen (im Extremfall von »gut« und »böse« oder von »normal« und »abnorm«) in objektivistische, die sich ihren Glaubwürdigkeitskredit aus der beanspruchten Naturwissenschaftlichkeit zu beziehen versuchen. Die Medizinisierung des Gesamtfeldes der psychischen Devianz in der Theorie, in der professionellen Zuständigkeit und in der entstehenden institutionellen Konfiguration gab dieser Neutrallsierungsstrategie den passenden und gesellschaftlich akzeptierten Rahmen.
Der von dem wichtigsten Psychiater des vergangenen Jahrhunderts, W. GRIESINGER, geprägte Kernsatz »Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten« bringt diese Entwicklung auf die prägnante und prägende Formel. Der am Gesamtfeld psychischer Devianz sicherlich wichtige körperliche Anteil wird zum paradigmatischen Angelpunkt, der die Suche nach Ursachen und die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung oder »Heilung« der Devianz entscheidend fokussierte. Der im vergangenen Jahrhundert sich verbreitende naturwissenschaftliche Optimismus, der sich in der medizinischen und auch psychiatrisch-neurologischen Forschung durchaus auf eindrucksvolle Befunde stützen konnte, führte zu einer Etablierung des »medizinischen Modells«, das bis heute das in der Psychiatrie vorherrschende Verständnis von Normalität und Abweichung ausrichtet. Die gleichwohl immer wieder aufflackernden Kontroversen um dieses paradigmatische Zentrum psychopathologischen Denkens zeigen, daß die Medikalisierung der Gesamtrealität psychischen Leidens kaum mehr als eine »Pseudo-Objektivierung« hat werden können (DÖRNER, 1974, S.46).
Die Geschichte der Psychopathologie ist bis heute von dem Objektivitätsanspruch, der Erwartung, ihn durch »harte« Fakten einlösen zu können und dem Eingeständnis bzw. dem kritischen Einwand, daß Subjektivismus und soziale Bewertung nicht auszuschalten seien, geprägt. Der von K. SCHNEIDER unternommene Versuch zu einer konsequenten Beschränkung des Krankheitsbegriffs in der Psychopathologie auf »krankhafte Organprozesse« (19678, S. 7) hat sich in der Psychiatrie nicht durchsetzen können.
Obgleich die genetische und biochemische Erforschung der Ursachen spezifischer psychischer Störungen durchaus relevante Befunde vorzuweisen hat, reichen sie bei weitem nicht aus, um die Paßform des »medizinischen Modells« für die Gesamtrealität psychischen Leidens überzeugend demonstrieren zu können. Sowohl im notwendigen Bezug auf Subjektives bei den Personen, die als psychisch gestört gelten, als auch bei dem Urteilsverhalten des Professionellen, der seine subjektiven Empfindungen und Werthaltungen als diagnostischen Resonanzboden nie vollständig ausschalten kann, werden die Grenzen der Objektivierung immer wieder erkennbar. In einer zeitgenössischen Definition des Krankheitsbegriffs in der Psychopathologie kommt dies sehr deutlich zum Ausdruck:
»Die wesentlichen Kriterien für eine Krankheit bestehen nicht in ihrer Beziehung zu einem zugrundeliegenden Krankheitsprozeß, sondern in den von den betroffenen Personen erlebten Leiden und Behinderungen, in der Beeinträchtigung der normalen Funktionen und in den daraus resultierenden biologischen und sozialen Benachteiligungen. Jede ‚Reaktion', die diese Kriterien erfüllt, ist ungeachtet ihrer Ursache in diesem Sinn eine Krankheit« (B. COOPER, 1980, S. 120f.).
Mit einem konkreten Beispiel möchte ich in die aktuelle Diskussion um die Sinnhaftigkeit des Krankheitsbegriffs in der Psychopathologie einführen, die in den vergangenen zwanzig Jahren mit großer Verbissenheit geführt wurde. Es geht in ihr unter anderem um den Objektivitätsanspruch einer sich im professionellen Hauptstrom der Medizin absichernden Psychopathologie.
In der Etablierungsphase der ambulanten Sozialpsychiatrischen Dienste Ende der 70er Jahre gab es in München heftige Konflikte mit der Anstaltspsychiatrie, die gelegentlich aus ihrem Schwelzustand eruptiv in die Öffentlichkeit durchbrachen. Die Anstaltspsychiatrie bzw. ihre leitenden Repräsentanten sprachen den ambulanten Diensten die Kompetenz ab, weil sie ihre Arbeit nicht im Rahmen und auf der Basis des psychiatrischen Krankheitsbegriffs verstehen würden. So wurde der Versuch eines ambulanten Dienstes, in seiner Selbstdarstellung etwas von der eigenen Arbeitshaltung sichtbar zu machen, heftig attackiert. In dem Tätigkeitsbericht des Sozialpsychiatrischen Dienstes wurde an Beispielen beschrieben, wie man sich um eine problemsensible und solidarische Beziehung zu den Menschen bemüht, die sich in schweren psychischen Krisen befinden, und dabei möglichst ganz auf diagnostische Einordnungen verzichtet, weil sie zu einer objektivierenden Distanzierung führen können. In der Reaktion des Anstaltsdirektors ist in bezug auf diesen Versuch vom »ideologisch eingeengten Blickfeld« die Rede und »vom Vokabular derjenigen Kräfte, welche die Psychiatrie aus der Medizin herauslösen wollen. Als Symptom dieser Tendenz wird die »Umfunktionierung von seelisch leidenden und hilfsbedürftigen Menschen, also Patienten in Klienten« gesehen. Auf den Hinweis im Tätigkeitsbericht, daß psychiatrische Diagnosen die Gefahr der Etikettierung und Stigmatisierung beinhalten und man deshalb in den ambulanten Diensten, so weit möglich, darauf verzichten wolle, wird bekennerhaft dagegen gehalten, daß die »Verwendung wertfreier medizinisch-wissenschaftlicher Begriffe keine 'Verurteilung'« darstelle.
Es ist danach zu fragen, welches die Gründe für die beinahe hektisch zu nennende Produktivität der Diskussion um den »Krankheitsbegriff« sind und woher ihre Verbissenheit und Gereiztheit kommt; es geht darum, zu bilanzieren, wohin uns diese Diskussion geführt hat.
Die Diskussion kreist um solche Fragen wie diese: Ist es sinnvoll, Individuen, die sich nicht in Übereinstimmung mit sozial weithin akzeptierten Normalitätsmodellen verhalten, als »psychisch krank« zu bezeichnen? Ist das so verfahrende »medizinische Modell« in der Psychopathologie durch vorhandene empirische Evidenzen begründbar? Ist dieses Krankheitsmodell nicht letztlich für einen Umgang mit psychiatrischen Patienten verantwortlich, der diese in inhumaner Weise gesellschaftlich diskriminiert und aus dem gesellschaftlichen Lebensprozeß ausgliedert? Oder weniger dramatisch: Wird nicht mit der »Medizinisierung« psychischen Leidens dessen Anklage gegen gesellschaftliche Lebensbedingungen, die diese systematisch produzieren, aufgehoben und durch Individualisierung und Personalisierung dem einzelnen Individuum zurechenbar gemacht?
KLERMAN (1977) zeigt, daß die Diskussion um den Krankheitsbegriff zunehmend zu einem öffentlichen Thema geworden ist und daß mit dem Begriff »medizinisches Modell« auf Grund seiner unterschiedlichen argumentativen Verwendungsweisen kaum mehr eine klare wissenschaftliche Diskussion geführt werden kann. Dieses Konzept ist überdeterminiert und wird im diskursiven Gebrauch zu einem Netz von Mehrdeutigkeiten. So wird von Psychiatern und Ärzteverbänden das »medizinische Modell« als Kristallisationskern all der Errungenschaften verstanden und vertreten, die Ärzte zu der Profession macht, die den einzig legitimen Anspruch auf die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die Behandlung »psychischer Krankheiten« erhebt. In dem Angriff auf das »medizinische Modell« sieht man den Versuch, die eigene Kompetenz in Frage zu stellen. Mit der Abschaffung des »medizinischen Modells« erfolgt der Einbruch der Inkompetenz in den Bereich der Versorgung psychisch Kranker.
So gibt es Beispiele dafür, daß ein Klinikdirektor von seinen Mitarbeitern geradezu das Bekenntnis verlangt, daß sie auf der Grundlage des »medizinischen Modells« arbeiten würden. Insofern in solchen Indoktrinationsstrategien in erster Linie der Machtanspruch einer Profession über konkurrierende andere zum Ausdruck kommt, provoziert sie bei Vertretern der in Konkurrenz stehenden Berufsgruppe entsprechende Reaktionen. Das läßt sich bei den Psychologen beobachten, die sich oft bekenntnisartig vom »medizinischen Modell« distanzieren oder sich opportunistisch auf dieses einlassen und behaupten, die Kompetenz zur Behandlung »psychischer Krankheiten« in weit höherem Maße zu besitzen als die Ärzte, denen ja meist eine psychotherapeutische Qualifikation ganz fehlt.
In deutlicher Abhängigkeit vom Definitionsmonopol der Ärzte vertreten die zuständigen politischen Körperschaften und Krankenkassen gegenüber dem Anspruch der Psychologen auf selbständige Heilbehandlung, daß man ihnen das vielleicht gestatten könnte, wenn sie den Nachweis erbringen würden, daß sie wirklich in der Lage sind, Krankheiten zu behandeln.
Die Diskussion um das »medizinische Modell« hat also eine ausgesprochen berufspolitische Ebene. Im Rahmen der verschiedenen berufsständischen »claims-making«- Aktivitäten erhält die Identifikation mit dem »medizinischen Modell« oder dessen entschiedene Ablehnung einen sehr spezifischen Sinn. Die Vagheit und Mehrdeutigkeit des Konzepts verschwindet und es gewinnt an strategischer Klarheit, allerdings nur für den, der das jeweilige Spiel und seine Regeln kennt.
Die Diskussion um den Krankheitsbegriff ist auch Teil der sozialpolitischen Debatte um die angemessene Organisationsform der psychosozialen Versorgung. Ein Verständnis von psychischen Störungen, das sich in der Tradition des »medizinischen Modells« befinde, würde über ein kuratives Handlungssystem der Versorgung nicht hinauskommen. Schließlich hat die Diskussion auch noch einen radikalen politischen Kern, geht es doch um die Frage, ob das »medizinische Modell« nicht letztlich nur die verwissenschaftlichte Legitimationsbasis für die Unterdrückung alternativer Lebensweisen darstellt, die zu einer Gefährdung der herrschenden Vernunft und Normalität geworden sind oder werden könnten.
Die Auseinandersetzung um das »medizinische Modell« ist seit mehr als 20 Jahren vor allem mit dem Namen und Schriften von T. S. SZASZ verknüpft. In einem neueren Aufsatz (1978) faßt er seine Haupteinwände gegen das Krankheitsmodell in der Psychopathologie noch einmal in folgenden drei Punkten zusammen:
Psychische Krankheit sei eine wörtlich genommene Metapher und dadurch zu einem Mythos geworden. Abweichungen im Verhalten, Erleben oder Denken werden so begriffen, als ob sie Krankheiten wären, als Symptome einer ihnen zugrundeliegenden krankhaften Veränderung des organischen Substrats. Da für die allermeisten psychischen Störungen eine organpathologische Grundlage nicht hat nachgewiesen werden können, muß es als kategorialer Fehler bezeichnet werden, Formen psychischer Devianz als Krankheiten verstehen zu wollen. Diesen kategorialen Fehler begehen auch solche Positionen, die den krankhaften Charakter spezifischer Handlungsmuster in Strukturkategorien der innerpsychischen Persönlichkeitsorganisation zu fassen versuchen.
Psychische Krankheit wird als Begriff so verwendet, als ob er eine Zuständlichkeit bezeichnen würde, wohingegen er faktisch nur eine soziale Rolle bezeichnet. Obwohl er also lediglich die Tatsache benennen könne, daß jemand als Patient behandelt wird, wird er benutzt, als sei mit ihm der Nachweis erbracht, daß eine Person krank ist.
Psychische Krankheit wird als beschreibender Begriff verwendet, obgleich sein Status nur als beurteilender bestimmt werden könne; er sei nicht deskriptiv, sondern präskriptiv. In ihn gehen Normen für das ein, was als richtig und falsch zu gelten hat, was akzeptiert ist und was nicht mehr toleriert werden kann.
Die Argumente von SZASZ haben in unterschiedlichen Mustern des laufenden Diskurses über Normalität und Abweichung Eingang gefunden, die sich oft nur in Randbereichen überlappen:
Psychologen und Sozialwissenschaftler kritisieren die Anbindung des Gegenstandsverständnisses von psychischen Störungen an die Paradigmen einer medizinischen Sichtweise als mit ihren empirischen Befunden nicht vereinbar. Weder eine auf die Suche nach organischen Ursachen allein gerichtete Orientierung noch eine daran auch nur metaphorisch gebundene Perspektive könnten die vielfältigen Einsichten in systematische Zusammenhänge von sozialer Lebenssituation und psychischen Störungen integrieren. Sozialwissenschaftliche Interpretationen epidemiologischer Befunde, kommunikationstheoretische Analysen und vor allem verhaltensanalytische Erklärungen akkumulieren sich aus diesen Perspektiven zu einer Legitimationskrise des »medizinischen Modells«.
Organisationsanalysen der vorhandenen Infrastruktur psychosozialer Dienste, Studien zu ihrer Effizienz und Kostenentwicklung führten dazu, die Qualität der psychosozialen Dienstleistungen als in hohem Maße defizitär zu diagnostizieren. In historischer Ungleichzeitigkeit, aber letztlich zu ähnlichen Ergebnissen gelangend, sind in allen westlichen kapitalistischen Ländern in den letzten Jahren großangelegte Bestandsaufnahmen der psychosozialen Versorgung durchgeführt worden. Wenn auch nicht jeweils mit der gleichen Konsequenz und Schärfe sind für viele Versorgungsmängel das »medizinische Modell« und die aus ihm folgende rein kurative und oft überhaupt nur verwahrende Praxis verantwortlich gemacht worden.
Der schärfste Angriff auf das »medizinische Modell« kam jedoch aus der politischen Kultur der weltweiten Studentenbewegung, die den Repressionscharakter der spätkapitalistischen Gesellschaftsformationen exemplarisch an der ausgrenzenden und stigmatisierenden Praxis gegenüber dem Wahnsinn zu entlarven versuchte. In der von SZASZ aufgezeigten bewertenden Struktur des Begriffes »psychische Krankheit« wird dessen eigentliches Wesen gesehen. Er erfüllt die Funktion einer scheinwissenschaftlichen Verschleierung dessen, was Psychiatrie und Psychotherapie unter Berufung auf ihn eigentlich nur tun: Sie sind Formen repressiver sozialer Kontrolle. Der Psychiatrie wird eine »Anti-Psychiatrie« entgegengesetzt, die sich die Befreiung der psychiatrisierten Menschen zum Ziel setzt. Sie will jenen Ausbruchsversuchen aus einer entfremdeten Welt eine Artikulations- und Realisierungschance geben, die durch das »medizinische Modell« als »Geisteskrankheiten« und damit als nicht mehr verständliche Reaktion auf eine Welt der Entfremdung, Unterdrückung und Ausbeutung »medizinisiert« wird.
Die um wissenschaftliche Beweisführung bemühte, die gesundheitspolitisch begründete und vor allem die radikale antipsychiatrische Kritik am »medizinischen Modell« machten auf einen großen Teil der psychiatrischen Profession und Wissenschaft nur geringen Eindruck. Nach einer Phase der verhaltenen Defensive ist in den letzten Jahren wieder eine zunehmend offensive Verteidigung des »medizinischen Modells« als notwendiger paradigmatischer Grundlage des psychiatrischen Denkens und Handelns zu beobachten.
Nach Auffassung von GUZE:
»stellt das medizinische Modell die Natur der Krankheit ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Andere Faktoren, ob soziale, familiale oder persönliche können sehr wichtig sein, aber ihre Bedeutung hängt von der Krankheit selbst ab« (1977, S. 227).
Psychische Störungen seien deshalb angemessen durch das »medizinische Modell« zu erklären, weil man sinnvollerweise von zwei prinzipiellen Annahmen ausgehen könne:
»a. Psychiatrische Bedingungen treten wie allgemeinmedizinische in einer Vielzahl getrennter Störungen auf, jede mit einer unterschiedlichen Ätiologie, Pathogenese, Verlaufsform, Behandlungsansprechbarkeit und -folge. b. Biologische Variation und Neurobiologie sind für ein optimales Verständnis und für die wirksamste Behandlung psychischer Störungen ebenso wichtig wie es die Biologie für den Rest der Medizin ist« (ebd., S. 228).
Diese Annahmen führen dazu, daß gesellschaftliche und lebensgeschichtliche Faktoren sowie ihre Auswirkungen auf psychische Leidensprozesse entweder vollständig aus dem Bereich der psychiatrischen Krankheitslehre ausgeschlossen werden (so bei LUDWIG und OTHMER, 1977, S. 1088) oder allenfalls als pathoplastische Variablen akzeptiert werden.
Spezifische Modifikation in der Darstellung der psychiatrischen Krankheitslehre sind allerdings als Folge der Angriffe auf ihre fragwürdige paradigmatische Basis erkennbar. Vielleicht sind sie aber auch nur Ausdruck der Tatsache, daß sich die Handlungsbedingungen in dem System der psychosozialen Dienstleistungen verändern (vgl. KEUPP, 1979). Das »medizinische Modell« wird jedenfalls kaum mehr mit dem Anspruch »ontologischer Gültigkeit« begründet. Der Begriff Modell wird akzeptiert und das beinhaltet folgende Perspektive:
»Modelle sind weder real noch sakrosankt; sie sind vom menschlichen Geist eingeführte Abstraktionen, um Fakten, Ereignisse und Theorien in einen systematischen Bezugsrahmen zu bringen ... Weil Modelle weder wahr noch falsch sind, können sie nur an ihrer relativen Nützlichkeit oder Nutzlosigkeit beurteilt werden« (LUDWIG und OTHMER, 1977, S. 1087).
Für KLERMAN sind das »medizinische Modell« und das Konzept von der »psychischen Krankheit« soziale Konstrukte (1977, S. 231) und die aus ihnen abgeleiteten Strategien der Diagnose, Behandlung, Prävention und Versorgung »beruhen auf sozialem Konsensus innerhalb der Gesundheitsprofessionen, zwischen den Gesundheitsprofessionen und zwischen den Professionen und der Gesellschaft als ganzer« (S. 221). Mit der Anerkennung des konstruktivistischen Charakters von Modellen wird einerseits die Erfahrungszugänglichkeit der Modelle konzidiert:
»Ein Modell, das nicht genügend umfassend ist, das widersprechende oder inkongruente Daten ausschließt oder das häufige Umstrukturierungen notwendig macht, damit neue Informationen berücksichtigt werden können, hört auf intellektuell befriedigend oder praktisch nützlich zu sein« (LUDWIG und OTHMER, 1977, S. 1087).
Die Autoren versichern zwar nachdrücklich, daß diese Bedingungen für das »medizinische Modell« in keiner Weise zutreffen, doch dies könnte prinzipiell der Fall sein. Die Betonung des Kriteriums der praktischen Nützlichkeit stellt eine Art »flexible response« der ob ihres Krankheitsmodells angegriffen psychiatrischen Profession dar. Sie sichert erst einmal seine weitere Verwendung ab und erspart ihr zugleich den »Wahrheitsbeweis« in einem fundamentalistischen Sinne. Typisch dafür ist eine Äußerung des führenden englischen Psychiaters J. K. WING:
»Psychiater ... stellen Krankheitstheorien zu bestimmten begrenzten psychologischen Syndromen auf und wenden sie auf Einzelfälle an, sofern sie glauben, Leiden und Individualität damit reduzieren können. Sie tun ihr Bestes, um diese Theorien zu testen, und sind bereit sie aufzugeben, wenn sie sich als nicht brauchbar erweisen« (1978, S. 245f.
Eine ähnliche Haltung bringen R. DEGKWITZ und Kollegen für die deutsche Universitätspsychiatrie zum Ausdruck:
»Unsere Argumentation läuft ... darauf hinaus, daß der menschliche Geist so beschaffen ist, daß wir nur um den Preis von Einseitigkeit erkennen und handeln können ... Ärztlich erkennen und handeln können wir nur auf der Grundlage analysierender Beobachtungen und Überlegungen, die grundsätzlich einseitige Reduktionen darstellen. Wir müssen versuchen, aus dieser Einseitigkeit möglichst viel Nutzen für unser Handeln zu ziehen und damit möglichst wenig Schaden anzurichten« (1982, S. 9).
Mit dem Verweis auf den sozialen Konsensus innerhalb und zwischen den Professionen sowie zwischen diesen und der Gesellschaft wird jedoch andererseits eine Dimension der gesellschaftlichen Absicherung von Paradigmen angesprochen, die jener anderen Ebene des wissenschaftlichen Erkenntniszuwachses und den dort geltenden Prinzipien progressiver Theorieentwicklung entgegenwirken könnten. Wenn man die relative Folgenlosigkeit der Paradigmadiskussion zum »medizinischen Modell« speziell in der Psychiatrie untersucht, dann stößt man auf das Faktum, daß die pragmatische Realität der psychiatrischen Versorgung in den Strukturen des »medizinischen Modells« durchaus seine Entsprechung hat und in ihm seine Identität finden kann. Juristische, verwaltungsförmige Regelungen und Finanzierungsbedingungen sichern das Monopol des medizinischen Krankheitsbegriffes gegen alle wissenschaftlichen und politischen Angriffe ab. Die pragmatische Dimension von Modellen und ihre Abhängigkeit von administrativen und professionsspezifischen Macht- und Selektivitätskriterien muß also notwendig ein Teil der Diskussion der geltenden Interpretationsmuster psychischer Störungen sein.
Was läßt sich als Reflexionsgewinn aus der Kontroverse um das Krankheitsmodell psychischen Leidens bilanzieren?
Es ist einsichtig geworden, daß psychische Störungen und Normalität keine naturgeschichtlichen Produkte sind, sondern nur eingebettet in die gesellschaftliche Lebenspraxis verstanden werden können. Es gibt deshalb auch keine universellen Kriterien für Normalität und für Störung. Was jeweils als angemessenes Handlungssystem, als sinnvolle Lebensperspektive und -praxis oder als deren Störung betrachtet wird, ist nur zu verstehen, wenn man den gesellschaftlichen Lebenszusammenhang kennt, in dem ein Individuum steht und seine Identität entwickelt. Wenn festgestellt wird, daß es zwischen Normalität und Devianz keinen qualitativen Unterschied im Entstehungsprozeß gibt, dann wird damit auf den gemeinsamen Lebenszusammenhang verwiesen, in dem beide Realität gewinnen.
In Frage gestellt wird die Diskontinuitätsannahme, die Normalität und Abweichung in ihren jeweils spezifischen Ausprägungen ontologisch auseinander dividiert. Mit dem Vertreten einer Kontinuitätsannahme wird nicht notwendig geleugnet, daß sich Normalität und Abweichung als etwas qualitativ Unterschiedliches phänomenal darstellen. Der Abweichende wird aber nicht mehr als der »ganz Andere« aufgefaßt, der sich qualitativ von denen unterscheidet, die ihn als Außenseiter wahrnehmen und behandeln. Er mag in vielen Fällen dieser »ganz Andere« geworden sein, zu dem kaum mehr ein verstehender und kommunikativer Zugang vorhanden ist, aber diese als qualitative Differenz erscheinende Verschiedenheit wird zunehmend als gesellschaftlich hergestellte begriffen. Diese Verschiedenheit sagt ebenso viel über Normalität wie über Abweichung aus, denn in den vielfältigen Austauschprozessen zwischen Normalität und Abweichung lassen sich Erklärungen für diese Verschiedenheit finden.
Die vor allem ideologiekritisch ansetzende Destruktion der Anwendung eines objektivistischen, naturalisierenden Krankheitsbegriffs auf Probleme psychischer Devianz führte zu einer relativistischen Perspektive und darüberhinaus zu der häufig vertretenen Aussage, psychische Störungen seien bloßes Resultat einer jeweils kultur-und subkulturspezifischen Definitionspraxis. Damit verbindet sich die weitere Annahme, psychisches Leiden sei im wesentlichen Resultat der Tatsache, daß bestimmte Formen der individuellen Lebensorganisation nicht toleriert und deshalb über spezifische institutionelle Formen der gesellschaftlichen Kontrolle und Disqualifikation stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Daß die Lebenspraxis eingespannt in gesellschaftliche Widersprüche und Belastungssituationen selbst die Realisierung einer sinnvollen Lebensperspektive verhindern kann, wird bei der Verabsolutierung der Definitionsdimension und bei einer Vernachlässigung der strukturellen Determination der Lebenspraxis nicht mehr zum Thema. Vor allem der Definitionsidealismus der Labeling-Perspektive hat hier zu einer Verkürzung der Problemsicht geführt (vgl. KEUPP, 1976).
Die sinnvolle Frage nach dem »Surplus-Leiden«, das durch eine bürokratisch-reglementierende und von professionellen Partikularinteressen dominierten Praxis sozialer Kontrolle erzeugt wird, darf nicht die Frage nach den primären Leidenszuständen verdrängen, die eine spezifische gesellschaftliche Realität aus sich heraus beständig produziert.
Die Kontroverse um das »medizinische Modell« ist sehr entscheidend von antipsychiatrischen Argumenten und Intentionen geprägt worden. Dieser Einfluß hat wichtigen Einsichten und Haltungen den Weg gebahnt, aber auch zu neuen Mythologisierungen geführt. JERVIS (1978b, S. 40) hat drei wichtige Leistungen der antipsychiatrischen Provokation festgehalten: a. Sie hat Formen des Verständnisses und der Hilfsbereitschaft gegenüber psychischer Devianz entworfen und erprobt, die objektivierende Distanzierungen aufgehoben haben und Solidarität und Sympathie zur Grundlage hatten. b. Sie hat das Bewußtsein dafür entwickelt, daß der Dissens gegenüber vorherrschenden Normalitätsmodellen ein Recht ist, das es als elementares Bürgerrecht zu proklamieren und zu verteidigen gilt. c. Sie hat schließlich auch die Einsicht vermittelt, daß der Dissens eine Aussage zur vorherrschenden sozialen und politischen Realität ist und deshalb auch in dieser zu einem politisierenden Faktor zu werden hat.
Die Mythologisierungstendenz der Antipsychiatrie andererseits ist etwa in der Annahme zu sehen, daß die Erfahrung der Schizophrenie etwas sei; »das immer mit einer positiven 'befreiten' und revolutionären Dimension der Existenz zu tun habe« (JERVIS, 1978 a, S. 84). Bei diesem Deutungsansatz wird psychische Devianz mystifiziert und dabei geht die Interpretationsmöglichkeit verloren, die so formuliert werden könnte: »Der Wahnsinn ist ein schlechter Rückfall in die Normalität, beim Versuch, sie zu verlassen« JERVIS, 1978 b. S. 57).
Der Diskurs zum »medizinischen Modell« ist einseitig als Modelldiskussion geführt worden, als Konkurrenz von theoretischen Perspektiven. Das gilt sowohl für die psychiatriegeschichtlichen Rekonstruktionen der jeweils dominanten Paradigmen wie sie von FOUCAULT oder DÖRNER vorgelegt wurden (vgl. KÖHLER, 1977), das gilt aber auch für die Bezugnahme auf aktuelle Paradigmakonkurrenzen. Diese Form der Auseinandersetzung setzt Theorie und praktisches Handeln in seinen jeweils spezifischen institutionellen Realisierungsformen tendenziell in ein deduktives Verhältnis: aus dem jeweils akzeptierten und in wissenschaftlichen Darstellungen vertretenen theoretischen Modell folgt eine spezifische und nur diese spezifische Praxis. Verloren geht dabei die Einsicht, daß der institutionelle Kontext seine eigene Rationalität hat, die durch das kognitive Raster eines Modells gar nicht angemessen zu erfassen ist. Die spezifischen rechtlichen, finanziellen und administrativen Strukturierungsbedingungen eines Handlungsfeldes können die explizit vertretene Position eines »sozialwissenschaftlichen Störungsmodells« durchaus in einer Weise unterlaufen, die das Handeln oft unbemerkt in die Gebrauchslogik des »medizinischen Modells« einfädeln.
In diesem Zusammenhang ist weiterhin von Bedeutung, daß ein Praktiker nie das »medizinische Modell« oder irgendeine Alternative zu diesem zu seiner Handlungsgrundlage macht oder machen kann, sondern nur in Form von praxisbezogenen »pragmatischen Alltagstheorien« (KEUPP, 1976), die es ihm erlauben, die Routine seines Alltags zu organisieren.
»Es scheint mir, jedes Übermaß an Leidenschaft, Vorurteil und Appetit, an Liebe, Angst, Neid, Eifersucht, Rache, Habsucht und Ehrgeiz, an Träumereien und Kaprizen der Phantasie, ebenso die Märchen von arabischen Nächten, kurz, praktisch alle Poesie und die Eloquenz, jede Abweichung vom puren logisch mathematischen Denken, all das kann man in irgendeiner Form als Geisteskrankheit bezeichnen« (J. ADAMS, 1774, zit. nach SARBIN und MANCUSO, 1982, S. 109).
»z. B. ist die Kinderliebe ein wesentlicher Zug des weiblichen Geistes; wenn ein Mann kleine Kinder abscheulich findet, so erregt das kein Bedenken, tut dies ein Weib, so ist sie stets mit Bestimmtheit als entartet zu bezeichnen« (MÖBIUS, 1900, S.104).
»... die vielgestaltigen Typen der angeborenen psychischen Entartung, die Haltlosen, die Psychopathen im engeren Sinne, die Degeneres, oder wie man sie sonst genannt hat ... Manche von ihnen sind zu Zeiten in jedem Sinne, also auch im sozialen, 'Geisteskranke', für andere läßt sich trotz einzelner Eigentümlichkeiten mit der gleichen Bestimmtheit das Gegenteil behaupten, für das Gros aber, das zwischen ihnen liegt, ist die Entscheidung in letzter Linie abhängig von dem persönlichen Maßstabe, den sich der einzelne Arzt für die Beurteilung der Frage: geisteskrank oder nicht? auf Grund seiner Erfahrung gebildet hat. Es liegt also kein sachlicher Widerspruch darin, wenn zwei Psychiater in solchen Fällen nicht einig werden können« (O. BUMKE, 1908, S. 26f.).
»Letzten Endes erwächst alle seelische und körperliche Artung aus Erbanlagen ... Daher sind die grundlegenden Maßnahmen und Forderungen der seelischen Hygiene eugenischer Natur ... Durch angeborene Anlagen sind dem betreffenden Menschen in seiner Wesensart und seinem Verhalten bestimmte Richtungen gewiesen ... katastrophale und unaufhebbare Mängel werden bedingt durch gewisse auf abnormer Anlage beruhende Grundeigenschaft. Z. B. kommen Psychopathien und viele Geisteskrankheiten so zustande ... Auf diesem Gebiet erstrebt die Rassenhygiene Verhinderung der Fortpflanzung Untüchtiger und Förderung der Fortpflanzung Tüchtiger ... « (P. NITSCHE und C. SCHNEIDER, 1930, zit.nach T. BASTIAN, 1981, S. 80).
'Jeder Versuch des Wiederaufbaus der aus ihrer Ganzheitsbezogenheit gefallenen Elemente ist daher hoffnungslos. Zum Glück ist ihre Ausmerzung für den Volksarzt leichter und für den überindividuellen Organismus weniger gefährlich als die Operation am Einzelkörper. Die große technische Schwierigkeit liegt in ihrem Erkennen. In dieser Beziehung kann uns die Pflege unserer eigenen angeborenen Schemata viel helfen. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange merkt sehr wohl, ob ein anderer ein Schuft ist oder nicht. Daraus ergibt sich ein vorläufiger Ratschlag, der im Munde eines kausalanalytischen Naturforschers vielleicht sonderbar klingt, nämlich der, daß wir uns in bezug auf den anzustrebenden Solltypus unseres Volkes auf die im Nicht-Analysierten wurzelnden Reaktionen unserer Besten verlassen sollen« (K. LORENZ, 1940).
»Der tiefgreifendste Unterschied im Seelenleben scheint der zu sein zwischen dem und ein einfühlbaren verständlichen und dem auf eigene Weise unverständlichen, im wahren Sinne verrückten, schizophrenen Seelenleben (ohne daß gerade Wahnideen da zu sein brauchen). Das pathologische Seelenleben der ersten Art können wir anschaulich erfassen als Steigerung oder Herabsetzung uns bekannter Phänomene und als Auftreten solche Phänomene ohne die normalen Gründe und Motive. Das pathologische Seelenleben der zweiten Art erfassen wir auf diese Weise unzureichend. Es treten hier vielmehr Veränderungen allgemeinster Art auf, die wir nicht anschaulich miterleben können, die wir jedoch von außen irgendwie faßbar zu machen versuchen« (K. JASPERS, 19485, S. 483).
»Der Krankheitsbegriff ist für uns gerade in der Psychiatrie ein streng medizinischer. Krankheit selbst gibt es nur im Leiblichen und 'krankhaft' heißen wir seelisch Abnormes dann, wenn es auf krankhafte Organprozesse zurückzuführen ist« (K. SCHNEIDER, 19678, S. 7).
»Nach meiner Überzeugung wird mit dem Gedanken der Geisteskrankheit heute die Vernebelung gewisser Schwierigkeiten betrieben, die gegenwärtig im sozialen Miteinander von Menschen wurzeln mögen, aber dabei nicht unveränderlich sein müssen. Wenn das zutrifft, dient das Konzept als Tarnung, als Maske. Statt die Aufmerksamkeit auf einander widersprechende menschliche Bedürfnisse, Ansprüche und Werte zu lenken, liefert das Konzept der Geisteskrankheit als Erklärung für Lebensprobleme ein amoralisches, unpersönliches Etwas - eine ‚Krankheit' ... Der Glaube an die Geisteskrankheit als nicht identisch mit den Schwierigkeiten des Menschen beim Zusammenraufen mit seinen Mitmenschen ist das rechte Erbe des Dämonen und Hexenglaubens. Geisteskrankheit ist 'real' oder existiert mithin in genau dem Sinne, in dem Hexen existierten oder 'real' waren ... Mit meiner Behauptung, daß Geisteskrankheiten nicht existieren, impliziere oder meine ich freilich nicht, daß auch die sozialen und psychologischen Vorkommnisse, die mit diesem Etikett versehen werden, nicht existierten. Wie die persönlichen und sozialen Schwierigkeiten der Menschen des Mittelalters, sind die heutigen menschlichen Probleme nur allzu wirklich. Mir geht es indessen um die Etiketts, die wir ihnen anheften, und um die Fragen, was wir nach erfolgter Etikettierung mit ihnen anfangen« (TH. S. SZASZ, 1961 (1978, S. 33 f.)).
»Szasz' postulierte Dichotomie zwischen körperlichen und seelischen Symptomen ist unhaltbar, weil die Beurteilung aller Symptome vom subjektiven Urteilsvermögen, von emotionalen Faktoren, ethisch-kulturellen Normen und vom persönlichen Engagement seitens des Beobachters abhängig ist« (D. AUSUBEL, 1972, S. 67f.).
»Psychiater ... stellen Krankheitstheorien zu bestimmten begrenzten psychologischen Syndromen auf und wenden sie auf Einzelfälle an, sofern sie glauben, Leiden und Invalidität damit reduzieren zu können. Sie tun ihr Bestes, um diese Theorien zu testen, und sind bereit sie aufzugeben, wenn sie sich als nicht brauchbar erweisen. Sie glauben nicht, daß eine Krankheitstheorie die gesamte Persönlichkeit und das gesamte Verhalten des Patienten erklärt, sondern nur sehr spezifische und begrenzte Aspekte. Sie verwenden auch viele andere Modelle, zusätzlich zu dem der Krankheit« (J. K. WING, 1978, S. 245f.).
»Der Psychiater darf mit dem gleichen Recht glauben, seine Theorie entspreche den objektiven Tatsachen, wie sein bankrotter Patient glauben darf, er sei ein Millionär. Die erkenntnistheoretischen Irrtümer der beiden klingen merkwürdig ähnlich, obwohl ein »Abgrund an Unterschied« zwischen ihnen liegt. ( ... ) Solange es dem objektiven Psychiater gelingt, sein eigenes Selbst aus dem Spiel zu lassen, erspart er sich die peinliche, nur nach kritischer Reflexion zu gewinnende Erkenntnis, daß seine angebliche Objektivität von subjektiven Werten durchlöchert ist. Die objektive Psychiatrie stützt sich auf Glaubenssätze, nicht auf die Biologie. Die Biologie an sich ist für die objektive Psychiatrie selbst nur ein Vorwand. Sie präsentiert sich als objektiv oder ist nur objektiv, sofern es dem un-objekten Zweck nützt, unerwünschtes Erleben und Betragen zu kontrollieren« (R. D. LAING, 1985, S. 55f.).
»... muß sich die Definition dessen, was als bedarfsgerecht anzusehen ist, an einem Krankheitsbegriff orientieren, der inhaltlich demjenigen entspricht, der für somatisch Kranke zur Anwendung kommt. Dabei sind nicht letztlich die subjektiven Befindlichkeitsstörungen bestimmend, sondern die vom Arzt objektivierten Befunde, die insbesondere wegen ihrer Auswirkungen auf das Leistungsvermögen des einzelnen eine Heilbehandlung erfordern« (BUNDESREGIERUNG, 1979, S. 11).
»Schizophrenie ist ein moralisches Urteil, das als medizinische Diagnose verkleidet auftritt. Wir sind für eine Demaskierung. Das Schizophreniemodell besteht nur wegen seiner mythischen Qualitäten weiter. Daher brauchen wir möglichst schnell neue Metaphern, um über unerwünschtes Verhalten zu sprechen. Hier wird eine solche Metapher vorgeschlagen: Das unerwünschte Verhalten, das als symptomatisch für Schizophrenie angesehen wird, entsteht aus der Abwertung der sozialen Identität, einem sozialen Prozeß also, der von identifizierbaren Umweltbedingungen abhängig ist. Kein Bruchteil eines Verhaltens ist per se unerwünscht. Nur in manchen Situationen - und nicht in anderen - wird eine Handlung Werturteilen unterworfen. Diese können sich sofort oder später auf die Beantwortung der wichtigsten aller menschlichen Fragen auswirken: Wer bin ich?« (TH. R. SARBIN und J. C. MANCUSO, 1982, S. 251).
»Die so entstandenen Irrenanstalten haben die Gewißheit erzeugt, daß die von ihnen erfaßten Menschen im medizinischen Sinne krank sind und die Psychiatrie als Wissenschaft zur Medizin gehört. Aus Geisteskrankheiten wurden erst Gehirnkrankheiten, dann Erbkrankheiten, Psychopathologie war der Überbau dazu. Und der Kulturpessimismus der Wende zum 20. Jahrhundert, geboren aus der Angst der herrschenden Bürger vor den sich verselbständigenden Arbeitern, aber auch vor den sich verselbständigenden Frauen, schuf durch KRAEPELIN und seine Mitstreiter eine Krankheitslehre und Diagnostik der psychischen Störungen aus ihrem gesamten Kontext herausoperierten, versehen mit der kulturpessimistischen Prognose, daß alle psychischen Störungen sich immer weiter verschlimmern, zu Defekten und Endzuständen führen. Wir wissen heute, daß diese Gewißheiten, ihrer Kontextwahrnehmung beraubt, zu Ideologien oder Wahngewißheiten wurden, so daß wir alle heute mit diesen damals geschaffenen Begriffen eigentlich nicht mehr arbeiten dürften« (DÖRNER, 1985, S. 21).
Die Hegemonie des »medizinischen Modells« ist auf der Ebene der institutionellen Konfiguration der psychosozialen Versorgung noch weitgehend intakt und hat unter den Bedingungen einer neokonservativen Gesellschafts- und Sozialpolitik eher wieder eine Stärkung erfahren. Gleichwohl hat sich in dem gesellschaftlichen und professionsspezifischen Diskursen über Normalität und Abweichung eine Pluralität unterschiedlicher Perspektiven herausgebildet, die sich in Konkurrenz untereinander befinden oder sich als »Enklavenwissen« spezifischer therapeutischer Subkulturen bestimmen lassen. Ich will nur die mir wichtigsten Perspektiven nennen und ihren Fokus schlagwortartig zusammenfassen:
Psychoanalyse: Pathologie der Normalität und die fließenden Übergänge von Normalität und Pathologie.
Ethnopsychoanalyse / transkulturelle Psychiatrie: Die Relativität kultureller Normalitätsstandards; die Auflösung kultureller Selbstverständlichkeiten; die im eigenen kulturellen System abgespaltenen Lebensmöglichkeiten.
Behaviorismus / Verhaltenstherapie: Normalität und Abweichung als gelernte Handlungsmuster; eine funktionalistische Eugenik: Lebensglück ist herstellbar - man muß nur wissen, welchen Gesetzmäßigkeiten menschliches Verhalten gehorcht.
Ökologisches Paradigma: menschliches Glück und Leid ist nur als Transaktion zwischen Individuum und seiner natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt zu begreifen; Unterscheidung von Mikro-, Meso- und Makroebenen, auf denen diese Transaktionen verfolgt werden können.
Entfremdungsparadigma: Subjektive Leidenszustände verweisen auf gesamtgesellschaftliche Entfremdungen und Zwangsverhältnisse, die Individuen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten systematisch behindern, sie demoralisieren.
Stigma- oder Labeling-Perspektive: Psychische Störungen werden durch die Etikettierung und Ausgrenzung spezifischer Handlungen und Personen hergestellt; ins Zentrum geraten die Personen und Institutionen, die die Macht und Legitimation zur Ausübung dieser sozialen Kontrolle haben.
Belastungs- und Bewältigungsparadigma: Epidemiologie, Streß-, »Life-event«- und Netzwerkforschung spezifizieren die gesellschaftlichen Belastungen für Individuen und Gruppen und die jeweils verfüg- und mobilisierbaren Ressourcen zur Bewältigung dieser Belastungen.
Bei einer ausführlichen Darstellung und Diskussion dieser unterschiedlichen Perspektiven und ihrer spezifischen Prämissen würden Schnittmengen zwischen den Sichtweisen, Berührungspunkte und Unvereinbarkeiten herausgearbeitet werden können. Ich werde im folgenden einige Thesen formulieren, die ihre Beeinflussung durch einzelne Perspektiven nicht verleugnen können (hierzu greife ich auf einen früheren Versuch zurück: KEUPP, 1981).
Psychisches Leiden geht nicht in den Formen seiner gesellschaftlichen Bearbeitung auf, ist aber auch nicht von diesen Formen unabhängig beschreibbar und verstehbar. Diese Prämisse grenzt die folgende Perspektive sowohl von rein ätiologisch ansetzenden Theorien ab, als auch von puristischen Kontrolltheorien.
Das leidende Individuum ist nicht einfach nur der Schnittpunkt spezifischer gesellschaftlicher Belastungsfaktoren, sondern beantwortet und verarbeitet diese Bedingungen als handelndes Subjekt. Diese Prämisse beinhaltet die Abgrenzung zu streßtheoretischen oder multifaktoriellen Ansätzen, die einen mechanistischen Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Individuum unterstellen und dadurch eine hohe Affinität zu medikalisierenden Positionen haben.
Das Individuum erfährt und reagiert auf Gesellschaft in seiner spezifischen Lebenswelt, in der sich objektive gesellschaftliche Lebenslagen und an sie gebundenen Entfaltungschancen und Belastungen subjektiv realisieren. Dies geschieht in der spezifischen Kollektivität der jeweiligen Lebenswelt.
Diese Prämisse weist in Richtung auf eine qualitative Epidemiologie, die Lebenlagen, Belastungen und Bewältigungskapazitäten mit den spezifischen alltagsweltlichen Aneignungen und Verarbeitungen vermittelt. Wichtig werden bei einer solchen Fragestellung vor allem die psychosozialen Ressourcen (darstellbar in der Form und Qualität der jewells verfügbaren Netzwerke).
Psychisches Leiden stellt eine Form abweichenden Handelns dar, das als eine Reaktionsform auf spezifische gesellschaftliche Lebensbedingungen zu verstehen ist. Es ist objektiv eine Reaktion auf die Vergesellschaftungsmodi, die die Hinnahme strukturell reduzierter Lebenschancen als die Norm erreichbarer Persönlichkeitsentfaltung in Form von Normalitätsmodellen behaupten. Die Verweigerung gegenüber diesen Normalitätsmodellen kann ein Ausdruck von Widerstand und Hoffnung sein, daß sich aus einem Leben mehr machen läßt, als das, was in den Konformitätserwartungen vorgegeben wird.
Erklärungsbedürftig ist die Form abweichenden Handelns in der spezifisch subjektivistischen und individualistischen Gestalt psychischer Devianz. Widerstand gegen Lebensbedingungen kann die Form von Protest und Rebellion gegen deren materielle Basis selbst annehmen. Psychische Devianz stellt eine Form von Abweichung dar, die den Widerstand gegen Lebensbedingungen nur noch gegen deren psychische Repräsentanzen autoplastisch zu realisieren vermag. Das individualpsychische Verarbeitungsmuster als sich gesellschaftlich durchsetzende und verallgemeinernde Devianzform ist als Typus nicht indivdiual-psychologisch erklärbar, sondern bedarf einer Deutung, die nach den gesellschaftlichen Bedingungen subjektivistischer Erfahrungen und deren Verarbeitung fragt.
Die Vergesellschaftungsprozesse im Spätkapitalismus laufen zunehmend auf die aktive Vermittlung von Individualitätsformen hinaus, die die Internalisierung universalistischer Verkehrsformen bedeuten. Diese trennen das Subjekt tendenziell von seinem unmittelbaren gesellschaftlichen Lebenszusammenhang. Das bürgerliche Subjekt bezieht sich auf die Gesellschaft in Form individuell zurechenbarer Leistungen und Ansprüche, die in rechtsförmigen Kategorien eingeklagt werden können. Familie als primäre Sozialisationsstrukur ist zunehmend weniger in der Lage diese Vergesellschaftungsprozesse zu realisieren.
Neben und in Ergänzung zur staatlichen Bildungspolitik hat auch die Sozialpolitik die Aufgabe zu übernehmen, jene normativen Handlungsorientierungen herzustellen, zu stabilisieren oder nachzusozialisieren, die eine tauschförmige und individuelle Interessenorientierung sichern (z. B. als individuelle Leistungs- und Aufstiegsorientierung, privatistische Lebensführung, Akzeptierung von monetären Entschädigungen). In diesem Sinne übernimmt Sozialpolitik die Funktion »aktiver sozialer Kontrolle«, die eine lediglich kompensierend und reaktiv (Ausgrenzung der Unvernunft und Arbeitsunfähigkeit) arbeitende sozialpolitische Konfiguration ablöst.
Subjektivistische und individualistische Formen abweichenden Verhaltens als quantitativ zunehmender Devianztypus bleiben im Reaktionsmodus individueller Handlungsorientierungen. Sie realisieren sich nicht als Widerstand oder Protest gegen die Zwänge und Repressionen der jeweiligen Lebensbedingungen, sondern als Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit zur individuellen Synthese widersprüchlicher sozialer Erfahrungen zu einem stabilen Identitätsmuster.
Soziale Kontrolle tritt weniger als repressiver Zugriff auf aktiven Widerstand in Erscheinung, sondern einerseits als Sozialisationsprozeß, der die soziopsychische Infrastruktur für individualisierende Verarbeitungsweisen herstellt und andererseits als sozialpolitisches System von Dienstleistungen, die eine Nachsozialisation der gesellschaftlich akzeptablen Verkehrsformen zum Ziel haben. Bisher noch vorherrschende ausgrenzende und stigmatisierende Formen sozialer Kontrolle abweichenden Verhaltens werden zunehmend durch sozialintegrative Formen der sozialen Kontrolle abgelöst. Bezogen auf eine Gesellschaft verläuft dieser Prozeß ungleichzeitig. In der Mittel- und Oberschicht verläuft der Prozeß sozialer Kontrolle weitgehend schon nach dem Muster individualistischer Anpassungs- und Verarbeitungsmodi. In den Unterschichten ist die dafür notwendige soziopsychische Voraussetzung noch viel weniger gegeben, deshalb laufen Prozesse sozialer Kontrolle noch eher nach dem Muster sozialer Ausgrenzung.
Entsprechend der sozialpolitischen Konfiguration, die auf aktive soziale Kontrolle durch die Förderung von Sozialisationsprozessen zielt, verändert sich auch das System von Dienstleistungen, die diese Funktion zu übernehmen haben. Das therapeutische und beraterische Element tritt gegenüber der segregativen Ausgrenzungspraxis stärker in den Vordergrund. Aktive soziale Kontrolle heißt auch, abweichendes Verhalten entweder zu verhindern, zumindest chronifizierte Karrierestadien zu vermeiden, die eine Re- oder Nachsozialisation nicht mehr zulassen. Für Angehörige der Mittel- und Oberschichten ist ein aktives Zugehen kaum mehr nötig. Aufgrund ihrer spezifischen Sozialisationsvoraussetzungen entwickeln sie ein Hilfesuchverhalten, das zu einer selbstläufigen Koordination von therapeutischen Angeboten und der eigenen Problemsituation führt. Für Angehörige der unteren Sozialschichten werden lebensweltnahe Dienstleistungstypen (z. B. Sozialdienste, ambulante sozialpsychiatrische Zentren) geschaffen, die man als aktive Ermunterung und Hilfestellung zu individuellen Problemlösungsmustern verstehen kann.
In dem thesenförmig umrissenen Verständnis psychischen Leidens als Reaktion auf gesellschaftliche Widersprüche sowie als Ziel und Produkt gesellschaftlicher Bearbeitung wird der psychologische Diskurs um Normalität und Abweichung aus einer Perspektive überschritten, die die soziohistorischen und sozialpolitischen Bearbeitungsformen als unabdingbare Bestandteile des gesellschaftlichen Normalitätsdiskurses betont. Diese Bearbeitungsformen als psychosoziale Dienstleistungen und als spezifische institutionelle Konfigurationen können nur angemessen begriffen werden, wenn ihr gesellschaftliches Doppelmandat herausgearbeitet wird: Sie leisten Hilfe dort, wo Menschen mit der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme nicht mehr zurecht kommen und sie üben Kontrolle gegenüber Handlungen und Individuen aus, die gesellschaftlich lizensierte Toleranzgrenzen überschreiten. Das Besondere an psychosozialer Praxis ist die dialektische Verklammerung von Hilfe und Kontrolle.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Meine Geschichte mit dem Netzwerkkonzept
- 2 Strukturwandel sozialer Beziehungen
- 3 Das Netzwerkkonzept in einem Modell psychischen Leidens
- 4 Zur Hauptquelle von Unterstützungsleistungen: Das nicht unerschöpfliche weibliche Arbeitsvermögen
- 5 Wohin sollen wir das Netzwerkkonzept weiterentwickeln
- 6 Soziale Netzwerke und Sozialpolitik
Ein Konzept geht um in der psychosozialen Szene, hat Eingang gefunden in unsere Sprache und bindet Interessen: Das Konzept vom »sozialen Netzwerk«. Zugleich ist es ein Konzept, dem sich die wenigsten mit fliegenden Fahnen verschreiben wie wir das von vielen Konjunkturen in der psychologisch-sozialwissenschaftlichen Welt so gut kennen. Auch diejenigen, die mit dem Netzwerkkonzept arbeiten, verbergen ihre Ambivalenzen nicht, stören sich an der Künstlichkeit und den technischen Konnotationen des Begriffs. Aber er hat eine metaphorische Kraft, der man sich so leicht nicht entziehen kann.
Wie konnte diese Metapher ihren spezifischen Siegeszug antreten? Begonnen hat ihre Geschichte nicht in irgendeiner der nordamerikanischen Wissensfabriken und mit der ihnen eigenen Vermarktungs-Schubkraft. Wenn wir die Spuren der Geschichte des Netzwerk-Begriffs zurückverfolgen, werden wir in den kleinen norwegischen Kirchensprengel Bremnes geführt, in dem der Anthropologe J. BARNES mit einer Gemeindestudie befaßt war. Es ist in den frühen fünfziger Jahren. J. BARNES möchte als Anthropologe die innere soziale Struktur dieses kleinen Fischerdorfes herausfinden. Wie soll er das, was er da gefunden hat, begrifflich abbilden? Und da wird nun folgende Geschichte erzählt.
In der Nachmittagssonne sitzt BARNES auf einem Dock, um ihn herum kleine Fischerboote, aus denen der Tagesfang ausgeladen wird. Ein Fischernetz wird ausgebreitet und aufgehängt. Als die Sonne durch das Muster von Knoten und Schnüren scheint, hatte der Anthropologe seine Metapher für die Symbolisierung der Beziehungsmuster, in die die Menschen in einer lokalen Gemeinde eingebunden sind. Die Vorstellung, Menschen und ihre Beziehungen zueinander als netzähnlich zu betrachten, ist von bemerkenswerter Schlichtheit: »Menschen werden mit Knoten gleichgesetzt, die durch Linien oder Bänder mit anderen Menschen, die ihrerseits Knoten darstellen, in Verbindung stehen« (KÄHLER, 1983b, S. 225).
Was kann von einer solchen eher formalen Perspektive sozialer Vernetzung für eine Faszination ausgehen? Schon um die Jahrhundertwende hat der Philosoph und Soziologe G. SIMMEL, der heute staunend wiederentdeckt wird, dafür die angemessene Überschrift geliefert: »Geometrie sozialer Beziehungen« (SIMMEL, 19685, S. 10). Ich wiederhole meine Frage: Wie konnte dieses Netzwerkkonzept, so formalgeometrisch wie es angelegt ist, zu einer so einflußreichen Metapher werden?
Ich möchte mit diesem Beitrag darauf eine Antwort zu geben versuchen. Ich fange damit an, daß ich zunächst einmal erzähle, wie sich diese Metapher bei mir selbst festsetzen konnte und mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil meines analytischen Handwerkszeugs hat werden können. Ich werde dann auf meine wissenssoziologische Frage zurückkommen. Mein nächster Schritt soll dann zeigen, wie das Netzwerkkonzept in meinem Verständnis des Zusammenhangs von Alltagswelt und psychischem Leiden einen spezifischen Stellenwert bekommt. Zugleich soll dieser Schritt einige Überlegungen darüber einleiten, wie die Netzwerkforschung in sozialwissenschaftliche Denktraditionen einbezogen werden könnte und dabei qualitativ gehaltvoller weitergeführt werden könnte. Schließlich möchte ich noch einige Bemerkungen zu den sozialpolitischen Konsequenzen anfügen, die aus der Netzwerkperspektive folgen.
Als ich vor mehreren Jahren zum ersten Mal dem Netzwerkkonzept begegnete, übte es auf mich spontan eine große Anziehungskraft aus, die allerdings mittlerweile von einer Ernüchterung abgelöst wurde. Ich las damals einen Literaturbericht über die Bewältigung von Krankheitsepisoden in Arbeiterfamilien (THORBECKE, 1975) und erfuhr dabei, daß ein großer Teil von auftretenden Krankheitsepisoden nie einer ärztlichen Begutachtung und Behandlung zugeführt wird. In traditionellen Arbeiterfamillen ist der Prozentsatz selbstbewältigter morbider Episoden noch erheblich höher als in geographisch und arbeitsplatz-mobilen Arbeiterfamilien. Wie vollzieht sich diese nichtprofessionelle Bewältigung von Krankheiten und wie lassen sich die Differenzen im Krankheitsverhalten zwischen diesen beiden Untergruppen aus der Arbeiterklasse erklären?
In der Antwort auf diese Fragen tauchte für mich als vielversprechende Kategorie das Netzwerkkonzept auf. Empirische Studien konnten zeigen, daß in traditionellen Arbeiterfamilien gut funktionierende Systeme wechselseitiger Hilfeleistung existieren, die im Krankheitsfalle sofort mobilisiert werden können. Wichtig ist dabei vor allem, daß sich die Hilfeleistung nicht auf die Monade Kleinfamilie beschränkt, sondern Verwandte, Nachbarn und Freunde einschließt. Bei der stadt'soziologischen Analyse von verschiedenen Wohnbezirken ist die Existenz und Bedeutung solcher Beziehungsgeflechte zuerst aufgezeigt worden und E. BOTT (1957) hat bei der Untersuchung eines Londoner Arbeiterbezirks den Begriff soziales Netzwerk eingeführt und die Engmaschigkeit der Beziehungsnetze in Arbeiterbezirken betont.
Das Konzept des engmaschigen Netzwerkes beinhaltet eine sehr dichte Interaktion innerhalb einer Gruppe von Menschen anstelle von abgesonderten dualen Partnerbeziehungen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und ziemlich verbindliche Verpflichtungen sowie das lokale Zusammenwohnen der in dieses Netzwerk einbezogenen Personen. Solche Netzwerke vermitteln sowohl unmittelbare materielle und soziale Hilfe als auch gemeinsame Deutungsmuster für Ereignisse und Phänomene in der gemeinsamen Lebenswelt. So werden beispielsweise Krankheitsepisoden oder auch psychosoziale Krisen häufig so gedeutet und »behandelt«, daß professionelle Zuständigkeiten und Hilfen dabei keine Rolle spielen.
Meine Faszination für das Netzwerkkonzept, seine etwas romantisierende positive Besetzung, erhielt weitere Unterstützung aus meiner Beschäftigung mit sanierungsbetroffenen Altbauquartieren. Hier wurde mir erschreckend klar, wie wenige dieser traditionellen Arbeiterwohnbezirke überhaupt noch existieren und wie die letzten Reste durch Sanierungsmaßnahmen beseitigt zu werden drohen. Die Trauer- und Verlustreaktionen von vor allem älteren Menschen, die aus den alten Wohnbezirken sanierungsvertrieben werden, vermittelten in den spezifischen Formen ihres Leids etwas von den positiven Qualitäten, die für sie in den alten Wohnquartieren existierten. Der Verlust für sie wichtiger sozialer Beziehungen, die an solche traditionellen Wohnmilieus gebunden sind, bedrückt die Menschen.
Meine eigene positive Einstellung zu solchen geschichtlich gewachsenen sozialen Strukturen und Milieus wurde sicherlich auch dadurch beeinflußt, daß die ökologische Bewegung sowohl das Mißtrauen gegenüber einem Fortschrittlichkeitsmythos genährt hat, der alles neu Produzierte und großräumig Geplante als überlegen verkauft, als auch mit der Idee der »kleinen Netze« eine gesellschaftliche Utopie entwarf, in der eine spezifische Netzwerkidee normativ überhöht wurde. Der Entwurf einer Gesellschaft, die sich als freie Assoziation von in sich überschaubaren Gruppen entwickelt, die auf der Basis solidarischer Beziehungen beruhen, zielte genau auf die Aspekte des Netzwerkkonzeptes, die ich in durchaus selektiver Wahrnehmung schon immer für mich herausgefiltert hatte.
Die intensivere Beschäftigung mit der sich schwunghaft entwickelnden Forschungskonjunktur des Netzwerkkonzeptes machten mir deutlich, daß mein Interesse sich nicht bruchlos mit dem anderer Forscher deckte, deren operationalisiertes Netzwerkkonzept in hohem Maße formal angelegt ist. Ein Teil der Netzwerkforscher hat sich lediglich durch den methodischen Appeal (im Sinne der Graphentheorie) des Netzwerkdenkens ansprechen lassen. Meine Hoffnungen auf neue Einsichten, die über das Netzwerkkonzept ermöglicht werden, können durch die vorhandenen Wissensbestände nur in kleinen Ansätzen als erfüllt angesehen werden. Bei aller Ernüchterung halte ich es doch für sinnvoll, sich mit der Netzwerkforschung auseinanderzusetzen, weil sie an Problemstellungen ansetzt, die im Rahmen einer gemeindepsychologischen Perspektive von großer Relevanz sind. Ob ihre konzeptuellen Ressourcen ausreichen, um diese Problemstellungen angemessen zu bearbeiten, bleibt im einzelnen zu prüfen.
Es sind aus meiner Sicht vor allem die folgenden Ansatzpunkte, die die Netzwerkforschung gemeindepsychologisch interessant machen:
Ihrem programmatischen Anspruch nach versucht eine gemeindepsychologische Perspektive den sozialen Alltag und die ihn prägenden spezifischen Lebenswelten sowie deren Bedeutung für die in ihnen lebenden Menschen zu rekonstruieren. Sie zielt damit über die »klinische Perspektive« hinaus, die sich auf die Persönlichkeit eines leidenden Individuums konzentriert und je nach theoretischer Ausrichtung ihre Spurensicherung auf im wesentlichen innerfamiliäre Beziehungskonstellationen oder situative Elemente, die mit den Leidenssymptomen eng verknüpft sind, richtet. Die Netzwerkanalyse stellt einen Versuch dar, die Struktur der sozialen Beziehungen eines Individuums zu beschreiben und unterschiedliche Typen von Netzwerkstrukturen in ihrer Bedeutung für die subjektiven und objektiven Handlungsmöglichkeiten eines Menschen zu ermitteln. Für eine gemeindepsychologische Perspektive ist es zentral, den »psychological sense of community« zu erfassen und genau dazu leistet der Netzwerkansatz einen Beitrag. Aus diesem Grunde schlägt S. SARASON (1976), für mich einer der originellsten Vertreter der »community psychology« vor, das Netzwerkkonzept zur gemeindepsychologischen Schlüsselkategorie zu machen.
Bei der Erforschung der Ursachen psychischen Leidens gibt es zwei sozialwissenschaftliche Linien, die meist unvermittelt nebeneinander verlaufen: Die mikroanalytische Richtung, die beziehungsgeschichtliche oder situative Bedingungen psychischer Probleme untersucht und die sozialepidemiologische Richtung, die makrosoziale Faktoren wie Schicht, Mobilität oder Stadt/Land mit dem Auftreten psychischer Störungen in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen versucht. Das Netzwerkkonzept wird von einigen Forschern als missing link zwischen der individuellen und makrostrukturellen Ebene angepriesen. Es würde einerseits die »vermittelnden Strukturen« (BERGER und NEUHAUS, 1977) zwischen der gesellschaftlichen Strukturebene und der individuellen Lebensform ins Blickfeld rücken und zum anderen die Bewältigungsmöglichkeiten von Belastungen thematisieren, die ein Individuum durch sein jeweils besonderes psychosoziales Beziehungsgeflecht hat (hier geht es vor allem um die Unterstützungsfunktion sozialer Netzwerke).
Für eine gemeindepsychologische Perspektive ist es wichtig, das professionelle System und die in ihm ablaufenden Dienstleistungsbeziehungen zuden Problemen und Bedürfnissen der Menschen in ihrer Lebenswelt in Beziehung zu setzen. Dadurch wird es möglich, danach zu fragen, ob die institutionellen Dienstleistungsangebote angemessene Antworten auf die Probleme der Menschen darstellen. Dabei wird dann sehr schnell offenkundig, daß nur ein mittlerer Prozentsatz der real vorhandenen psychischen Probleme professioneller Bearbeitung zugeführt wird. Daraus resultiert dann die Frage, wie Menschen im Alltag psychosozialen Belastungen und Krisen ohne professionelle Unterstützung meistern und was Gruppen, die sich in Behandlung oder Beratung begeben von solchen unterscheidet, die diesen Weg nicht sehen oder wählen.
Was die Psychiatrie-Enquete höchst vage als das »natürliche Selbsthilfepotential der Gesellschaft« (1975, S. 68) bezeichnet hat, ist vor allem im Gefolge der größer werdenden Selbsthilfebewegung und der sich damit verbindenden Kritik an der Expertendominanz analytisch zunehmend differenziert und empirisch untersucht worden. Das soziale Netzwerk ist auch hier zu einem vielgenutzten Konzept geworden, vor allem unter dem Aspekt, welche Schutz-, Bewältigungs- und Unterstützungsfunktionen verschiedene Netzwerktypen erfüllen können.
Unter Aspekten psychosozialer Praxis wird nach präventiven, therapeutischen und rehabilitativen Ansätzen gesucht, die das Individuum und seine Probleme im Kontext seiner soziokulturellen Lebenswelt angehen können. Das Netzwerkkonzept spielt auch in diesem Suchprozeß eine wachsende Rolle. Aus der Einsicht, daß sich die Lebensform eines Menschen nicht auf seine Familie eingrenzen läßt und auch nicht nur innerfamiliäre Beziehungsstrukturen das psychische Leiden einer Person aufhellen, sind einige Familientherapeuten zur Entwicklung eines Ansatzes von Netzwerktherapie übergegangen (z. B. SPECK und ATTNEAVE, 1976; RUEVENI, 1979).
Unter präventiven Gesichtspunkten wird versucht, die schützenden und unterstützenden Funktionen, die Netzwerke bei der Bewältigung alltäglicher Krisen und Belastungen übernehmen können, zu unterstützen. Im Bereich der sozialen Reintegration von psychiatrischen Patienten, die über längere Zeit in stationären Einrichtungen hospitalisiert waren und für die außerhalb der Klinikmauern kein integrationsfähiges Auffangnetz existiert, versucht man künstliche Netzwerke aufzubauen, etwa in Form von therapeutischen Wohngruppen oder Arbeitsplätze vermittelnde Kooperativen.
Ich möchte jetzt auf die Frage zurückkommen, die ich anfangs als die wissenssoziologische Problemstellung gekennzeichnet habe: Warum können wir mit der Netzwerkmetapher arbeiten und warum tun das immer mehr Sozialwissenschaftler? Einige Gründe habe ich schon angesprochen, die mir allerdings in ihrem Niveau noch nicht an die eigentlichen Ursachen heranzureichen scheinen.
Meine zentrale These lautet: Das Netzwerkkonzept hat für sich genommen nicht den geringsten intellektuellen Appeal, der die Faszination für dieses Konzept erklären könnte. Es ist vielmehr der Bereich der sozialen Beziehungen selbst, der sich tiefgreifend umgeformt hat, der in seinem Status als selbstverständlich funktionierender sozialer Kitt nicht mehr stimmt, der anstrengend geworden ist, für den wir so viel tun müssen, bei dem es uns an Modellen fehlt, wie wir mit ihm umgehen sollen, obgleich oder gerade weil sich mehrere Professionen darauf spezialisiert haben.
Der schon als »Geometer sozialer Beziehungen« eingeführte G. SIMMEL hat um die Jahrhundertwende eine Gesellschaftstheorie entwickelt, auf die wir heute noch mit Gewinn zurückgreifen können. Die Entwicklungsrichtung der Industriegesellschaften sieht er in den Prinzipien der Individualisierung und Funktionalisierung. Die zunehmende Arbeitsteilung und damit verbundene Spezialisierung führt zu sozialen Differenzierungen. Die Individualisierung aufgrund der geforderten Spezialisierung in arbeitsteiligen Strukturen behandelt SIMMEL zum Teil als Freisetzung von individuellen Energien, als Loslösung des Einzelnen von traditionellen Sozialbeziehungen, als Freiheitsgewinn.
Aber gleichzeitig entwickeln sich gesellschaftliche Gebilde und Strukturen, die immer stärker auf Funktionalität und Vereinnahmung des Einzelnen ausgerichtet sind, also die Gefahr der Entfremdung beinhalten. SIMMEL beschreibt das Paradox, daß eine zunehmende Vergesellschaftung der Individuen zugleich die Bedingung der Möglichkeit von Individualität ist. Diese Individualität entsteht im Schnittpunkt der sozialen Kreise, denen die Person zugehört, sie stellt - soziologisch betrachtet - die Summe der sozialen Beziehungen dar, die bei keinen zwei Menschen die gleiche ist (vgl. zu diesen Überlegungen die erschienene Aufsatzsammlung: SIMMEL, 1983).
SIMMEL hat diese Überlegungen zur sozialen Differenzierung empirisch in ersten Ansätzen belegen können, vom Typus sind sie allerdings eher prognostischer Art. Sie sehen eine gesellschaftliche Entwicklung voraus, wie sie sich für uns weitgehend vollzogen hat. Der Prozeß der Individualisierung ist zur herrschenden Normalität geworden. Traditionelle Vergesellschaftungsformen, die den Handlungsraum der Subjekte durch Status und Raum weitgehend vordefinieren, gibt es nur noch in exotisch gewordenen Restbeständen. Zugleich erfüllt uns das unwiederbringliche Verschwinden traditioneller Lebensformen und -entwürfe mit Trauer (wie es mit den Trauerreaktionen oben schon angesprochen war) und erzeugt kulturelleUntergangsstimmung. Das schmerzliche Bewußtwerden, daß das Modernisierungsprojekt der bürgerlichen Industriekultur ernst gemeint war, mischt die Trauer über den Verlust traditioneller Gesellschaftsformen mit der romantischen Überhöhung dessen, was sich hier aufgelöst hat. Das Unbehagen an der Moderne, ihre Funktionalität und Rationalität, ihrer Entfremdung ist der kompensatorischen Klage über die »verlorene Gemeinschaft« unterlegt. Beklagt wird der Verlust lokaler, nachbarschaftlicher Beziehungsmuster, die stabil und eng sind, die alltägliche Hilfe, Verbindlichkeit und Solidarität vermitteln. Sie seien abgelöst worden durch losere Muster, die sich zwar vermehrt hätten, die aber zugleich auch emotional und im Identifikationspotential ausgedünnt seien.
In dieser nach rückwärts gewandten kulturpessimistischen Klage wird eine wichtige Strömung faßbar, für die das Netzwerkkonzept Symbolkraft hat. In diesem Kontext erhält die Rede vom Netzwerk einen sehr spezifischen Klang: Es schwingt der Wunsch nach Nähe, Unmittelbarkeit, Überschaubarkeit, Verbindlichkeit des Zusammenlebens, Solidarität, auch ein bißchen moralischer Pietismus.
Das Netzwerkkonzept hat aber auch in einer anderen Strömung Symbolkraft gewonnen, die man als die Vorstellung von der »befreiten Gemeinschaft« zusammenfassen könnte. Sie setzt auf die befreienden Potentiale der sich vollziehenden Individualisierung: Auf die Überwindung von Enge und Dichte, von zugleich Fesseln und soziale Kontrolle bedeuten. Das Subjekt kann sich jetzt endlich seinen eigenen Weg wählen, sich gegenüber bornierten Familienmitgliedern und Nachbarn ignorant zeigen und sich mit den Leuten assoziieren oder befreunden, mit denen es gemeinsame Interessen hat. Das Subjekt muß sich nicht über die sozialen Rollen und Beziehungen definieren, in die es hineingeboren wurde, sondern über die die es sich aufgebaut hat. In Netzwerken, die auf einem solchen Hintergrund entstanden sind, entwickeln sich ungleich mehr Chancen für unterschiedliche Lebensentwürfe, für den virtuosen Beziehungskünstler, für Emanzipation aus zugeschriebenen Identitäten.
Für die besondere Qualität der hier angesprochenen Netzwerke hat M. GRANOVETTER (1973) mit der »Stärke schwacher Bindungen« die passende Charakterisierung gefunden. In den losen Beziehungsverknüpfungen entsteht jener Handlungsspielraum, der für das Subjekt der Moderne so typisch geworden ist. Er ermöglicht Beziehungen, die nicht durch starre Rollen und die in ihnen fixierte Herrschaftsform vordefiniert sind, sondern die verhandelt werden können, so man will immer wieder neu.
A. DE SWAAN (1981) spricht von dem »Beziehungsmanagement durch Aushandeln«, das die traditionelle statusbedingte Herrschaftsform von Beziehungsstrukturen abgelöst habe. Diese »Befreiung« hat aber auch ihren »Preis«. Das ständige Aushandelnmüssen ist anstrengend, ist ein nicht zu befriedender Krisenherd; erfordert psychosoziale Ressourcen, die uns längst nicht immer zur Verfügung stehen. Und oft werden wir zu nostalgischen Anhängern jener vergessenen Welt, in der Beziehungen zwar starrer, dafür aber auch klarer und weniger riskant waren, irgendwie entlasteter.
Ob wir uns auf die Seite der Klagen über die »verlorene Gemeinschaft« schlagen wollen oder uns über die Hoffnung auf die »befreite Gemeinschaft« definieren, in je spezifischer Weise signalisieren sie Wandel. Ich nehme beide Haltungen als Ausdruck der objektiven gesellschaftlichen Veränderungen der Bedingungen unter denen sich soziale Beziehungen formieren. In diesen Veränderungen spiegelt sich eine zunehmende Auflösung traditionsbestimmter Beziehungsmusten Sie müssen durch höhere Eigenleistung der Individuen modelliert werden. Dies kann sowohl Risiko wie auch Chance sein. Beide Alternativen beinhalten ein hohes Maß subjektiver Gestaltbarkeit, das wir je nach unseren materiellen kulturellen und persönlichen Ressourcen nützen können. Aber dies alles verläuft nicht selbstverständlich. Es erfordert unsere Aufmerksamkeit und Reflexion, an der sich auch die Sozialwissenschaften mit wachsender Intensität beteiligen. Beziehung, Kommunikation, »encounter« sind herausragende Themen.
Kürzlich ist bereits der fünfte Band über »persönliche Beziehungen« (DUCK, 1984) erschienen, und das Netzwerkkonzept darf auf diesem regen Markt der Möglichkeiten natürlich nicht fehlen. Es ist ja ein spezifischer Ausdruck der Bedarfslage, die zu diesem Markt geführt hat. Der Zwang zum »Beziehungsmanagement durch Aushandeln« schafft das Bedürfnis nach einer instrumentellen Sprache zur Abbildung jener Prozesse, an denen wir zu arbeiten haben. Der Netzwerkjargon bietet uns eine solche Sprache. Seine oft beklagte Technizität und Künstlichkeit hat bislang die wenigsten davon abgehalten, sich dieser Sprache zu bedienen. Diese synthetische Qualität ist aus meiner Sicht nicht in erster Linie Ausdruck eines technizistischen Wissenschaftsverständnisses, sondern eher Ausdruck der Tatsache, daß soziale Beziehungsmuster ihren Charakter der »Natürlichkeit« und Selbstverständlichkeit gründlich verloren haben.
Was kann das Bild von den Knoten und sie verbindende Linien zu einem Verständnis psychischen Leidens beitragen? Hören wir uns dazu die Antwort von PATTISON und Kollegen an:
»Das psychosoziale Netzwerk bildet eine fundamentale soziale Matrix, die entweder Gesundheit oder Pathologie fördern kann, je nach Komposition und Eigenart« (1979, S. 63).
Die vorhandene Forschungsliteratur zusammenfassend konstruieren sie dann drei Typen von persönlichen Netzwerken, die ihre allgemeine Aussage belegen soll: Sie zeichnen ein »normales«, ein »neurotisches« und ein »psychotisches Netzwerk«:
Normaler Typus: Es besteht aus 22-25 Personen, von denen jeweils 5 bis 6 sich auf vier Untergruppen (Familie, Verwandte, Freunde und Nachbarn und Arbeitskollegen) verteilen; das Subjekt hat häufig Kontakt und die damit verbundenen Erfahrungen sind positiv; die Netzwerkmitglieder geben sich untereinander instrumentelle Unterstützung und Beziehungen sind in symetrischer Weise wechselseitig. Das Netzwerk vermittelt konsistente Normen und Erwartungen, Ressourcen für Streßmanagement, emotionale Unterstützung, wenig Konflikt, ein Gefühl von Achtung und Distanz und Zugang zu größerem Netzwerk.
Neurotischer Typus: Etwa 15 Personen bilden das enge persönliche Netzwerk, die Person bezieht sich bevorzugt auf Mitglieder der Kernfamilie, viele Interaktionen sind negativ und emotional schwach, viele Netzwerkmitglieder werden selten oder überhaupt nicht kontaktiert. Die Verbindung der Netzwerkmitglieder untereinander ist uneinheitlich. Dieses Netzwerk ist ausgelaugt und isolierend. Interaktionen sind durch Kontaktvermeidung und ambivalente Verbindungen charakterisiert. Es herrscht Asymmetrie vor und zwanglose Wechselseitigkeit ist nicht der Normalfall. Es besteht keine verläßliche Gruppe sozialer Normen und Erwartungen, um Rückmeldung zu geben. Streß wird in Angst und Symptomatologie katalysiert.
Psychotischer Typ: Etwa 10 bis 12 Personen bilden das Netzwerk, die fast alle miteinander interagieren. Beziehungen sind negativ oder ambivalent und asymmetrisch. Die Person ist von einem »kollusiven engen System« mit wenigen Verbindungen nach außen eingeschlossen. Ein hohes Maß an Streß wird nicht abgepuffert, was zur Produktion dysfunktionaler instrumenteller Handlungen führt.
Lassen wir diese Typen zunächst einmal unkommentiert stehen. Sie geben strukturelle Querschnittsbilder von Netzwerken unterschiedlicher Populationsgruppen. Aber es sind statische, ergebnishafte Skizzen, aus denen noch nicht unbedingt verständlich wird, wie der besondere Typus eines Netzwerkes auf die psychische Situation einer Person wirken kann.
Ich möchte dafür ein Prozeßmodell umreißen, das sich wesentlich aus Anregungen und Befunden der sozialepidemiologischen Forschungen speist. In diesem hat der psychiatrische Krankheitsbegriff seine Funktion als paradigmatischer Fixstern längst verloren. Es beginnt sich ein Modell durchzusetzen, das gerade davon lebt, daß der Zusammenhang zwischen alltäglichen psychosozialen Belastungen und psychischem Leid nicht zerrissen, sondern in seiner Mikrostruktur aufgespürt wird. Hier zeichnet sich die Überwindung eines mechanistischen Krankheitsverständnisses ab, das es in mindestens zwei Grundformen gab: Das klassische »medizinische Modell«, das sich in Anlehnung an die Organmedizin entwickelt hat und wesentlich nach biologischen Determinanten »psychischer Krankheiten« gesucht hat bzw. von der Vermutung ihrer Existenz ausging. Zu einem wesentlich fortgeschrittenerem, aber immer noch mechanistischen Krankheitsverständnis haben die Sozialwissenschaften beigetragen.
Sie haben uns gezeigt, daß zentrale Faktoren, die die Lebensbedingungen prägen, mit psychischem Leid verknüpft sind (materielle Deprivation, Arbeitslosigkeit, spezifische Arbeitsbedingungen beispielsweise). Wie uns I. GLEISS (1980) klar gemacht hat, haben die Sozialwissenschaften dem klassischen medizinischen »Noxen-Modell« zu einer neuen Staffage verholfen, ohne daß es im Kern überwunden worden wäre. Gesellschaftliche Lebensbedingungen werden zu »sozialen Noxen« und in mechanistischem Fatalismus folgt daraus, daß Individuen unter solchen Bedingungen gar keine andere Chance haben, als mit »Krankheiten« zu reagieren. Das implizite Subjektmodell in diesem Noxenmodell ist das Individuum als »Reaktions-Depp«, als die Reaktionskopie der Summe aller auf es einwirkender Belastungsfaktoren. In diesen Noxenmodellen ist kein konzeptioneller Platz mehr für ein Subjekt, das sich mit den Lebensbedingungen seiner Alltagswelt aktiv auseinandersetzt, sie bearbeitet, sie sich in spezifischer Weise aneignet und sie auf der Basis seiner psychischen, sozialen und materiellen Handlungsressourcen aktiv verändert.
In der sozialwissenschaftlichen und sozialpsychiatrischen Erforschung psychischen Leidens hat sich eine »normalisierende« Perspektive durchgesetzt, die sich ein Verständnis dafür zu erarbeiten versucht, wie Subjekte die Widersprüche und Belastungen ihrer Alltagswelt deuten und verarbeiten, welche unterschiedlichen Krisenverläufe unter jeweils gegebenen gesellschaftlichen Kontextbedingungen real möglich sind. Genau diese Basis schneiden wir uns ab, wenn wir vorschnell einen »klinisch relevanten Ausschnitt« für uns definieren und konzeptuell abtrennen. Wir müssen eine Sichtweise psychischer Störungen überwinden, die aktuelle soziale Situationsbedingungen nur noch als Reizkonstellation begreift, die ein vorgeformtes Störungsmuster auslöst.
Nun sei nicht bestritten, daß die subjektiven Reaktionsmuster einer Person durch ihre spezifische Lebensgeschichte sehr stark präformiert sein können (wie uns das die Psychoanalyse überzeugend klar gemacht hat) und dann tatsächlich der situationsspezifische Anteil der je gegebenen sozialen Situation eine eher untergeordnete Rolle spielt. Als allgemeines Erklärungsmodell für psychisches Leiden erscheint mir eine so verstandene Interaktion von Person und situativen Lebensbedingungen fragwürdig.
Die Mikrostruktur des Zusammenhangs von Belastungen, Bewältigung und psychischem Leid wird im Rahmen der epidemiologischen Forschung meist in irgendeiner Variante des folgenden Modells gefaßt: In welcher Weise belastende Lebensumstände zu psychischen Störungen oder Persönlichkeitsveränderungen führen, hängt von den persönlichen, sozialen und materiellen Ressourcen einer Person ebenso ab wie von ihrer Einschätzung der Situation und den Bewältigungsreaktionen. Die Handlungsressourcen haben Einfluß auf das Auftreten spezifischer Belastungen, formen die Bewältigungsmuster, die zu ihrer Bearbeitung gewählt werden und haben erheblichen Anteil am Erfolg oder Mißerfolg der Bewältigungsversuche.
Das Verbindungsglied zwischen lebensweltlichen Belastungen und psychischem Leid wird durch die dem Subjekt jeweils verfügbaren persönlichen und Umweltressourcen, seine kognitiven Deutungsmuster und Bewältigungshandlungen sowie das spezifische Beziehungsgeflecht dieser Variablen untereinander gebildet. Die persönlichen Ressourcen beinhalten Merkmale wie das Selbstkonzept, die Einschätzung eigener Chancen der Umweltbeeinflussung, Attributionsstile, Problemlösungsfähigkeiten und soziale Kompetenz. Umweltressourcen bezeichnen emotionale, materielle und informationsmäßige Unterstützung durch andere Personen und durch den jeweiligen sozialen Status. Die kognitiven Deutungsmuster schließen persönliche Wahrnehmungen und Erklärungen ebenso ein wie von den Subjekten übernommene kollektive Deutungen und ideologische Muster. Bewältigungsreaktionen reichen von Vermeidungsreaktionen, über Umdefinitionen bis hin zu aktiven Strategien der Auseinandersetzungen mit den Bedingungen, die eine Person für die konkret erlebten Belastungen verantwortlich macht. Ein zentraler Bewältigungsmechanismus wird als Hilfesuchverhalten untersucht, das wesentlich von sozialen Netzwerkstrukturen geprägt wird (vgl. hierzu ausführlich BILLINGS und MOOS, 1982). Dieses knapp angerissene Modell psychischen Leidens im Kontext alltäglicher Belastungen und der darauf bezogenen Bewältigungsversuche stellt meines Erachtens einen bedeutenden Fortschritt dar und hat eine gut abgesicherte empirische Basis. Zugleich ist es geprägt von einem empiristischen sozialwissenschaftlichen Zugang zur sozialen Realität, der diese zergliedert in einzelne operationalisierbare Faktoren, die in der methodologischen Mechanik ihrer Kovarianz wieder zusammengepuzzelt werden. Besonders gut meßbar scheinen individuell zurechenbare Faktoren und sie bilden deshalb auch das Herzstück des Modells. Die Gesellschaft als Totalität sozialer Beziehungen wird häufig in Variablen dekompensiert, die in keinen inneren Zusammenhang mehr gebracht werden (zu einer ausführlichen Kritik vgl. YOUNG, 1980).
In dem umrissenen Modell psychischen Leidens taucht das Netzwerkkonzept etwas reduziert nur in seiner Unterstützungsfunktion auf, als Puffer gegen erfahrene Belastungen, vielleicht auch als Schutzschild gegenüber drohenden Ansprüchen und Belastungen. Das ist ein Funktionsbereich, der in der Literatur sehr überwertig behandelt wird, so daß die ganze Netzwerkmetapher schon beinahe die Konnotation des Stützsystems bekommen hat, das überall noch Balken und Mauern einzuziehen vermag, mögen der Druck und die Widersprüche auch noch so massiv sein. So wissen wir, daß chronische Erkrankungen besser ertragen werden können, wenn soziale Unterstützung vorhanden ist.
Und das gilt für eine Reihe weiterer Belastungs- und Krisensituationen: Bei positiver sozialer Unterstützung gibt es weniger Geburtskomplikationen, längere Phasen des Stillens, erfolgreichere Trauerarbeit nach dem Tod einer wichtigen Bezugsperson, bessere Bewältigung von Übergangssituationen (Einschulung, berufliche Veränderungen, Ruhestand etc.), von Arbeitslosigkeit oder vom Berufsstreß. Diese Liste läßt sich erheblich verlängern und immer liefert uns die produktive Wissenschaftsmaschinerie ein signifikantes Ergebnis. Die diffuse, wenngleich angenehm klingende Kategorie soziale Unterstützung erfreut sich eines inflationären Gebrauchs. Die Welt wird ausgehorcht und ausgeforscht nach Stützpotentialen und wird entlang von nur noch zwei Dimensionen rekonstruiert. Auf der einen Dimension werden die Belastungen und der uns allseits bedrohende Streß abgebildet, auf der anderen die ihnen zuordenbaren Stützsysteme in schier ungeahntem Ausmaß (auch ohne die politische Ermunterung: »Reden ist Silber und Helfen ist Gold«, auf die ich noch zurückkommen werde).
Ich möchte nicht mißverstanden werden: Ich bin in der Regel sehr beeindruckt von Studien, die mir nachweisen können, daß qualitativ gute psychosoziale Beziehungsmuster bei der Verarbeitung von Krisen und Widersprüchen eine große Bedeutung haben. Problematisch finde ich, daß die Gesellschaft im ganzen und die verschiedenen Lebenswelten nur noch als Quelle für Stützaktionen thematisiert werden.
Sind wir damit nicht bereits auf dem Dampfer einer defensiven, kompensatorischen Sozialpolitik, die sich auf die Realität mit der ständigen Frage bezieht, wie miese Lebensbedingungen vielleicht noch gerade erträglich abgefangen werden können, wie wir in Notzeiten besser zusammenrücken könnten und uns in Situationen helfen und unterstützen könnten, wo sich eine Sozialpolitik längst zurückgezogen hat? Mit der Reduktion der analytischen Netzwerkperspektive auf potentielle Stützaktionen wird deren Potential auch zu billig verschenkt. Gehen wir noch einmal kurz die verschiedenen Stufen unseres Prozeßmodells entlang und fragen uns jeweils nach dem spezifischen Netzwerkaspekt.
An der Produktion von Belastungssituationen und Krisen sind die jeweiligen strukturell gegebenen Beziehungsmuster ursächlich beteiligt. Der Vergleich der oben skizzierten Netzwerktypen gibt hierfür zahlreiche Ansatzpunkte. Ein Netzwerk kann spezifische Wünsche, Hoffnungen, ja ganze Lebensentwürfe ersticken. Neben der Unterstützungskomponente wird häufig die Kontrolldimension völlig vernachlässigt. Um so enger und dichter Netzwerke sind, desto einengender und kontrollierender können sie auch wirksam werden, desto weniger Selbständigkeit für eigenständige Lebensentwürfe lassen sie. Auch eine totale Beziehungslosigkeit verschiedener Netzwerksegmente kann die zu leistende Integrative Identitätsarbeit überfordern etwa wenn die Normen und Erwartungen im Berufsbereich immer weniger mit jenen in der Reproduktionssphäre noch vereinbar erscheinen. Doch auch das Gegenteil kann seine Tücken haben. Die zu starke Verschachtelung von Beziehungen, die sich um Arbeit und Beruf gruppieren, mit jenen der Privat- und Freizeitsphäre kann zu gefährlichen Identitätsbrüchen führen, vor allem wenn berufliche Leistungs- und Konkurrenzhaltungen untergründig auch die private Welt infizieren und unterminieren. Aus den Netzwerken sollen jetzt nicht als Gegenreaktion auf die Unterstützungseuphorie Horrorgebilde gemacht werden. Ich möchte nur mit einigen Beispielen deutlich machen, daß sich bereits in den Netzwerkstrukturen all die Widersprüche und Belastungen nachzeichnen lassen, die zu spezifischen Krisen und Leidenserfahrungen führen.
Wenn es zu einer krisenhaften Zuspitzung kommt, hängt viel von den mobilisierbaren Ressourcen ab, wie eine Person durch die Krise kommt. Konzentrieren wir uns nur auf mögliche Netzwerkressourcen bzw. auch auf deren Fehlen. Eine Krise bedeutet zunächst einmal eine Unterbrechung alltäglicher Routinen, beunruhigt, macht betroffen, involviert Personen aus dem Netzwerk, stört, ist lästig. Sie muß definiert werden und vor allem muß definiert werden, was zu tun ist.
An diesem Definitionsprozeß sind die Mitglieder des engeren Netzwerks beteiligt. Aus diesem Prozeß folgt, ob sich die Mitglieder selbst zuständig fühlen, für das, was zu tun ist; ob sie die Ereignisse und die Reaktion darauf normalisieren, verständnisvoll darauf eingehen, eine Krise mit durchstehen. Wie lange eine Krise, wie lange ein darauf bezogener Ausnahmezustand dauern darf, dies alles wird normativ abgesteckt. Ob für spezifische Probleme, externe Hilfe aufgesucht wird, hängt wesentlich von normativen Regulativen des Netzwerkes ab. Die so oft beschriebene Beratungsabstinenz der Unterschicht hängt neben Faktoren, die mit den Beratungsangeboten selbst zusammenhängen, entscheidend von dem ab, was die Forschungsgruppe um W. BUCHHOLZ (1984) »Veröffentlichungsbereitschaft« nennt, eine komplexe Haltung, die durch normative Vorgaben für das, womit man selbst fertig zu werden hat, geprägt ist. Das Reaktionsmuster des Netzwerkes besteht aus einer je spezifischen Mischung aus einfach Dasein, emotionaler Unterstützung, kognitiver Orientierung und Ratschlägen, materieller Hilfe und Dienstleistungen und sozialer Regulation. Diese Beziehungen sind mehrschichtig und überdeterminiert, ambivalent manche und einige durchaus negativ, helfend und zugleich kontrollierend.
Wenn eine Krise nicht schnell und produktiv verarbeitet werden kann, wenn sie Normalisierungsbereitschaft und -fähigkeit eines Netzwerkes überfordert, ist das Aufsuchen professioneller Hilfe oder Kontrolle der nächste Schritt. Für die Frage, ob aus diesem Schritt Hilfe oder Kontrolle werden, ist wiederum das Netzwerk sehr wichtig. Die häufig gute und produktive Kooperation des Mittelschichtpatienten und des Psychotherapeuten hat auf der Seite des Klienten spezifische Vorsozialisationen zur Voraussetzung.
In seiner klassischen Studie hat C. KADUSHIN (1969) zeigen können, daß Mittelschichtsubkulturen auch als »Circles« beschrieben werden können, in denen man sich gegenseitig sozialisiert für die Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Psychotherapie notwendig sind. A. DE SWAAN (1983) spricht hier von Protoprofessionalisierung. In dem »Circle of friends and supporters of psychotherapy« entstehen wichtige Vorbedingungen einer erfolgreichen Psychotherapie.
Für die psychiatrische Behandlung haben PERRUCCI und TARG (1982) gezeigt, daß die Infiltration des medizinischen Krankheitsverständnisses in die Laienkultur die beste Voraussetzung dafür ist, daß der Klinikaufenthalt kurz ausfällt, daß die Rehabilitation gelingt. Auch hier haben wir es mit einer Protoprofessionalisierung der Angehörigen zu tun. Wobei das auch das autoritäre ärztliche Professionsmodell der Psychiatrie beinhaltet. Eine autoritäre Struktur familiärer Entscheidungsfindung ist nachgewiesenermaßen die beste Garantie dafür, daß Familie und Klinik im »wohlverstandenen Interesse« des Patienten agieren und der Klinikaufenthalt auch vergleichsweise kurz ausfällt.
Netzwerke, in denen lange und intensiv Normalisierungsversuche abgelaufen sind, die deshalb auch die Zuständigkeit der psychiatrischen Profession ablehnen, zerfallen für die Personen häufig ganz, die in einem späten Stadium der Krise - meist zwangsweise - in eine Klinik eingewiesen werden. In mehreren Studien ist die dramatische Veränderung von Netzwerken für ehemalige hospitalisierte psychiatrische Patienten aufgezeigt worden (z. B. LIPTON, COHEN, FISCHER und KATZ, 1981). Sehr viele Fäden reißen nach der ersten Hospitalisierung ab. Neue Beziehungen werden häufig zu ehemaligen Mitpatienten aufgenommen oder ergeben sich in der spezifischen Lebenssituation von Teestubenpopulationen und Reha-Einrichtungen. Die neuen Netzwerke sind in das Beziehungsnetz der wachsenden »ambulanten Gettos« eingeflochten und damit zugleich Stabilisatoren der Ausgrenzung und Marginalisierung.
Die Reduktion der Netzwerkqualitäten auf die Bereitstellung von krisenabpuffernden Stützbalken bringt das Netzwerkkonzept um die Vermittlung eines differenzierenden Bildes von Beziehungsmustern, die vielfältige und komplexe psychische und soziale Funktionen haben können. Neben kognitiv-orientierenden, emotionalen, materiellen sind auch regulative-normierende Funktionen zu nennen und sie werden nicht eindimensional und widerspruchsfrei erbracht. Das Netzwerkkonzept verliert in dem Maße an Wert, wie es diese Qualitäten durch ein reduziertes theoretisches Modell und vor allem durch einen quantitativ-methodischen Schematismus verschenkt. Wir müssen uns einen Zugang zu den alltäglichen Netzwerkbeziehungen eröffnen, der sie in ihrer spezifischen Eigenqualität sensitiv ausleuchtet und damit ihre lebensweltliche Bedeutung aufspürt.
In meiner Auseinandersetzung mit den hochgelobten und überall wirksamen sozialen Unterstützungsnetzwerken bin ich immer noch nicht fertig. Wie sollen wir uns das Sprudeln dieser Quelle von Unterstützung vorstellen? Als zentrales Unterstützungssystem wird in der Regel die Familie thematisiert, in der jene kompensatorischen, abpuffernden und schützenden sozialen Beziehungsnetze geknüpft sein sollen, die die außerfamiliären Belastungen verhindern oder erträglicher gestalten könnten. Jener Typus von Beziehungsarbeit, der in diesem Kontext als Stützsystem angesprochen wird, ist im wesentlichen von Frauen zu leisten, die ihrerseits von der positiven Qualität dieses Systems in besonderer Weise abhängen (so herausgearbeitet von HOLAHAN und MOOS, 1982).
Auf dem Hintergrund einer fest etablierten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wird vor allem vom weiblichen Arbeitsvermögen die Bereitstellung emotionaler und psychosozialer Unterstützung und Kompensation erwartet. Die »Bilanz« der Frauen ist unausgeglichen, defizitär im Sinne der Norm der Reziprozität« (GOULDNER, 1984): Sie müssen im familiären Alltag beständig mehr an Stützleistungen erbringen als sie selbst erwarten können. Deshalb kann es eigentlich nicht verwundern, daß Frauen sich immer mehr in dieser Funktion »erschöpfen« und emotional »ausbrennen« (BELLE, 1982) und ich nehme die nachgewiesenermaßen höheren Depressionsraten von Frauen als einen Indikator dafür, daß das weibliche Arbeitsvermögen keine »unerschöpfliche Ressource« für die Bereitstellung von kompensatorischen Stützaktivitäten ist. Das sollte auch mal jemand unseren konservativen Sozialpolitikern erzählen, die immer mehr Hilfe- und Pflegeleistungen den Familien zurückgeben wollen[2].
Die geschlechtsspezifischen Differenzen bei der alltäglichen Beziehungsarbeit, bei der lebendigen Arbeit, die zur Verknüpfung von Beziehungen zu Netzwerken erforderlich ist, sind mir besonders am Beispiel des Vergleichs von Witwen und Witwern deutlich geworden. Unter der Frage »Wer leidet mehr?« sind in einer kürzlich erschienenen Literaturübersicht (STROEBE und STROEBE, 1983) die Gesundheitsrisiken von verwitweten Männern und Frauen verglichen worden. Nach dem vorhandenen empirischen Wissen kann es als gesichert gelten, daß Männer am Tod ihres Ehepartners schwerer zu tragen haben und daß ihr Gesundheitszustand stärker durch dieses Lebensereignis und seine Folgen beeinträchtigt wird. Der entscheidende Faktor zur Erklärung dieses Unterschieds dürfte die spezifische Struktur von Beziehungsmustern bei Frauen und Männern sein.
Entsprechende Studien zeigen, daß Frauen im Durchschnitt ein größeres Netz vertrauter Personen außerhalb des engeren familiären Kontextes haben, mit denen sie emotionale Probleme besprechen können. Die Netzwerke der Männer enthalten viele Personen, mit denen man über Beruf und Freizeitaktivitäten verknüft ist, für die Bearbeitung emotionaler Probleme bleibt als Ansprechpartner meist ausschließlich die Ehefrau. Genau dieser Partner ist Witwern verloren gegangen und so haben sie in der Regel keine anderen vertrauten Personen, die ihnen die erforderliche emotionale Unterstützung in der Phase der Trauerarbeit geben könnten.
Es schien mir äußerst wichtig von dieser Witwen/Witwer-Thematik zurückzufragen, wie auf dem Hintergrund geschlechtsspezifischer Sozialisationsprofile Netzwerke von den Subjekten gestaltet und getragen werden. Gerade im Kontext gesellschaftlicher Erosionsprozesse, denen traditionsgeleitete soziale Beziehungen immer mehr zum Opfer fallen, ist der aktive Herstellungsprozeß von Beziehungen und deren Aushandeln zunehmend in den Vordergrund getreten. Bringen dafür Frauen und Männer die gleichen psychosozialen Grundqualifikationen mit? Dafür spricht im Augenblick nicht so sehr viel. Ein lohnendes Forschungsthema ist hier entstanden.
Es wird Zeit zu bilanzieren und dies möchte ich unter der Frage tun, welches Potential das Netzwerkkonzept hat und wie wir dieses Potential auszuschöpfen vermögen. Für mich ist das Netzwerkkonzept eine analytisch vielversprechende Möglichkeit, jenen mikrosozialen Strukturzusammenhang durchsichtig zu machen, in dem sich der gesellschaftliche Alltag strukturiert und vollzieht. Es erschließt uns einen Wirklichkeitsbereich, der weder aus makrosoziologischen Strukturmustern deduziert werden kann, noch additiv aus individuellen Motiven und Handlungen entsteht. Das Netzwerk bildet ein »Scharnierkonzept« zwischen individuellen und sozialstrukturellen Prozessen und Gegebenheiten. In ihm lassen sich psychische und soziale Spuren und Einflüsse aufzeigen.
Das größte Problem der gegenwärtigen Netzwerkforschung sehe ich darin, daß sie eine echte Vermittlung subjektiver und sozialstruktureller Prozesse verhindert. Sie orientiert sich am mainstream einer quantitativen Methodologie, formalisiert zu schnell ihre Modelle und verstellt sich damit eine sensible Rekonstruktion der spezifischen Qualität von Netzwerkbeziehungen. Die oben angesprochene Widersprüchlichkeit und Ambivalenz von Beziehungen, die aktiven und subjektspezifischen Aneignungsprozesse werden in den meisten Netzwerkstudien nicht mehr sichtbar. Einzelne Netzwerkelemente werden gemessen und mechanistisch montiert, damit werden schematische Netzwerkkonfigurationen konstruiert, die uns äußerlich bleiben und die deshalb ungeeignet sind, alltägliche Lebenswelten zugänglich zu machen. Wir brauchen qualitative Fallstudien alltagsweltlicher Beziehungsmuster, die auf dem Hintergrund gesellschaftstheoretischer Reflexionen interpretiert werden müssen.
Ich habe das Netzwerkkonzept als »Scharnierkonzept« bezeichnet. Dazu möchte ich noch einige Anmerkungen machen. Wie kommen in diesem Konzept Subjekt und gesellschaftliche Struktur zusammen? Ich möchte es zunächst einmal metaphorisch formulieren: Netzwerke lassen sich als objektiv gegebene Gelegenheitsstrukturen fassen, ob diese Gelegenheiten vom Subjekt genutzt werden und wie sie genutzt werden, hängt von den Ansprüchen, Wünschen, Erfahrungen, Ängsten des Subjekts ab. Es ist erstaunlich, wie wenig wir über das »Nutzerverhalten« bislang wissen. Einsam in der Wissenschaftslandschaft steht immer noch die schon zehn Jahre alte Studie von TOLSDORF (1976), die uns das Konzept der »Netzwerkorientierung« beschert hat. Darunter versteht er einen »Komplex von Überzeugungen, Einstellungen und Erwartungen einer Person, die sich auf die potentielle Nützlichkeit ihrer Netzwerkmitglieder beziehen, ihr bei der Bewältigung von Lebensproblemen zu helfen« (S. 413).
Die von TOLSDORF untersuchte Gruppe schizophrener Patienten zeigte großes Mißtrauen gegenüber vielen Netzwerkbeziehungen und konnte und wollte sie nicht als Unterstützungssystem nutzen. Organisch Kranke bezogen sich im Durchschnitt sehr viel häufiger auf Netzwerkmitglieder und konnten sich auf diese Weise sehr viel Hilfe und Unterstützung organisieren.
Die schon mehrfach thematisierte Beziehungsarbeit im Sinne des aktiven Aushandelns von Beziehungen fordert geradezu eine Subjekttheorie, die das aktive gestaltende Handeln des Subjekts auf dem Hintergrund einer objektiv widersprüchlichen Lebenssituation ins Zentrum rückt. Weniger geeignet scheinen mir dafür die zu fundamentalistisch angelegten psychologischen Handlungstheorien zu sein, die uns das in »Einsamkeit und Freiheit« kognitiv ordnende und planende Subjekt präsentieren. Sie nehmen zu wenig von der komplexen Identitätsarbeit auf, die das Subjekt unter widersprüchlichen inneren und äußeren Bedingungen zu erbringen hat.
Der kürzlich verstorbene Soziologe E. GOFFMAN hat mit einer Reihe eindrucksvoller und lebensnaher Studien das Subjekt der Moderne als virtuosen Beziehungsmanager und Distanzierungstaktiker beschrieben. Das trifft eine entscheidende Dimension von Beziehungsarbeit, aber er bleibt bei der Darstellungstechnik der Schauspieler stehen. Auf welchen Bühnen zu agieren ist, bleibt ausgeklammert.
Hierzu habe ich sehr viel bei K. OTTOMEYER gelernt, der den gesellschaftlichen Rahmen für subjektive Lebensentwürfe und alltägliches Handeln aus den Konstitutionsprinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung ableitet und die Sphäre der Zirkulation, der Produktion und der Konsumtion unterscheidet. In diesen Sphären werden unterschiedliche Handlungsqualitäten und Beziehungsformen gefordert. Wie unter diesen segmentierten gesellschaftlichen Bedingungen, die zugleich auch eigene Netzwerksegmente bilden, Beziehungsarbeit zu einer lebbaren Identität führen kann, ist das Anliegen dieser Theorie und das scheint mir der angemessene subjekttheoretische Teil unseres Scharniers werden zu können.
Für den sozialstrukturellen Teil des Scharniers, der uns die Bedingungen für Gelegenheiten der Nutzung von Netzwerkressourcen zu rekonstruieren hätte, haben uns Stadt- und Gemeindesoziologie Materialien geliefert (Vgl. WELLMAN, 1979; FISCHER, 1982). Gerade uns Psychologen sollte klar sein, daß die gesellschaftliche Wirklichkeit strukturierte Rahmen liefert, innerhalb derer die subjektiven Nutzungsmöglichkeiten vorgegeben sind, an denen sich auch alle Bemühungen, »künstliche Netzwerke« zu fördern, orientieren müssen.
Zweifellos bildet die Sozialpolitik den traditionsreichsten Kontext für die Netzwerkmetapher: Sozialpolitik wird als soziales Netz begriffen, das die Menschen vor dem Absturz in existentielle Notlagen bewahren soll, das sie auffängt, wenn Krankheit, Not und Verlust von Arbeit die Eigenreproduktion von Arbeitskraft und den Erhalt der eigenen und der familiären materiellen Lebensgrundlage erschweren oder verunmöglichen. Von konservativer Seite wird dieses Netz auch gerne als Hängematte bezeichnet, in die man sich bequem fallen lassen kann. Spätestens seit die spätkapitalistischen Wohlfahrtsstaaten in fiskalische Krisen geraten sind und die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen im bisherigen Stil nicht mehr finanzierbar schienen, hat eine intensive Suche nach möglichen Entlastungsstrategien für staatliche Sozialpolitik begonnen und »entdeckt« wurden dabei die qualitativ jeder institutionellen Hilfe überlegenen »informellen Hilfenetze« im Alltag.
Der sich hier entfaltende Diskurs hatte für seinen Versuch, die Sozialstaatsorientierungen zu lockern und abzubauen, in der latenten Unzufriedenheit mit dem bürokratischen und unpersönlichen Stil staatlicher Wohlfahrtsleistungen einen geeigneten Einstieg gefunden. Einer der neokonservativen sozialpolitischen Chefdenker begründet den Rückzug staatlicher Sozialpolitik damit, daß diese gar nicht an die wirklichen Belastungen und Notsituationen des Menschen in der »nachindustriellen Gesellschaft« herankäme, jedenfalls auf diese nicht die notwendige Antwort geben könnte:
»Der Wohlfahrtsstaat hat ein engmaschiges soziales Netz geknüpft. Es ist ein staatliches Netz: ein Netz des Staates für seine Bürger, geknüpft mit Geld und Recht. Aber die Menschen leiden heute nicht so sehr an materieller, sondern an seelischer Armut. Ein neuer Mangel kennzeichnet Wohlstandsgesellschaften: der Mangel an Zeit, Zuwendung und Geborgenheit« (DETTLING, 1985, S. 59).
Die Analyse müßte jetzt eigentlich auf die gesellschaftlichen Ursachen für die beschriebenen Entfremdungsphänomene eingehen. Dieser Schritt wird ausgelassen und in der guten Tradition kompensatorischer Sozialpolitik soll eine »alternative Sozialpolitik« Geborgenheit und Unterstützungssysteme ermöglichen, in deren Schutz, die Entfremdung weniger auf den Einzelnen direkt durchschlagen kann. Aber das ist natürlich voreilige Interpretation. Die entsprechende programmatische Formulierung enthält diese Deutung keineswegs: »Eine Ordnung der Gesellschaft jenseits von Markt und Macht erfordert ... nicht zuletzt eine alternative Sozialpolitik, ein soziales Netz, das Menschen füreinander knüpfen: mehr Selbsthilfe, Nächstenliebe, Solidargemeinschaften, so wie es heute schon viele alternative Selbsthilfegruppen versuchen« (ebd., S. 60). Diese Argumentation hat sehr schnell Eingang in die neokonservative Regierungspolitik gefunden.
Nur kurze Zeit nach dem Regierungswechsel, der die »Wende« politisch markierte, hat der damalige Minister GEISSLER in seinem Grußwort zum 70. Fürsorgetag (1983) die angerissene Gedankenlinie aufgenommen und ausgebaut.
»Ich meine, daß die Begrenztheit finanzieller Ressourcen für die soziale Arbeit nicht nur negativ gesehen werden sollte, sondern auch eine Chance darstellt - eine Chance der Besinnung auf ... Tugenden, eine Chance für mehr Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft, für ein wachsendes soziales Verantwortungsbewußtsein der Bürger. Mitleid, Nächstenliebe und gute Nachbarschaft müssen sich ja nicht immer in Geld oder sonstigen Vermögenswerten ausdrücken. Persönliche, uneigennützige Hilfe ist wegen der damit verbundenen emotional erfahrbaren Zuwendung oft wichtiger.«
Etwas später führt ihn seine Rede zu folgender Einschätzung:
»Die stärkere Betonung des personalen Elementes bei der Hilfe für Bedürftige ist hier kein neuer Gedanke. Seit alters her wurde in familiärer, nachbarlicher oder örtlicher Gemeinschaft gepflegt und unterstützt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde diese Erfahrung etwas vernachlässigt. Das Bewußtsein einer moralischen Verpflichtung zur Hilfeleistung verkümmerte. Ich meine, daß es an der Zeit ist, diese 'schlummernden' Fähigkeiten unserer Gesellschaft wieder stärker zu beleben. ( ... ) Die Selbst und Nächstenliebe der Bürger füreinander wird die menschliche Dimension in unserer Gesellschaft spürbar erweitern.«
Mit seiner abschließenden Aussage faßt der Minister seine Programmatik noch einmal zusammen und verwendet dabei eine Sprache, die für Netzwerkforscher sehr vertraut klingt (z. B. die Verwendung des Ressourcenbegriffs):
»Jezt kommt es ... darauf an, ein soziales Netz zu ermöglichen, das Menschen füreinander und miteinander knüpfen: in Familie, Nachbarschaft und Selbsthilfegruppen. Die äußeren Ressourcen, das Wachstum der Wirtschaft sind begrenzt. Die inneren Ressourcen unseres Volkes für mehr Solidarität, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe liegen noch weitgehend brach. Lassen Sie uns gemeinsam arbeiten für eine menschliche reichere Gesellschaft« (aus dem verteilten Redemanuskript; Hervorhebung im Original).
Der neokonservative sozialpolitische Diskurs hätte vermutlich keine große Chance auf Zustimmung, wenn die kapitalistischen Wohlfahrtsstaaten sich nur in einer konjunkturbedingten quantitativen Finanzierungskrise befinden würden. Er versucht sich Unterstützung aus einer gesellschaftlich verbreiteten kritischen Grundstimmung gegenüber den »Segnungen« des Wohlfahrtsstaates anzuwerben. Neben der fiskalischen Krise gibt es eine qualitative Krise des Sozialstaates, die das SOZIALISTISCHE BÜRO eindringlich so zusammengefaßt hat:
»Zum ersten funktioniert das Reparaturunternehmen Sozialstaat immer schlechter: Die Schadensfälle, also körperliche, psychische und soziale Störungen infolge von Arbeitslosigkeit, Leistungsdruck und Existenzangst laufen der amtlichen Linderung zunehmend davon. Und wo repariert wird, erweist sich, daß der bürokratische, reglementierende Flicken die Brüche nicht heilen kann. Der Reparaturapparat richtet oft sogar neue Schäden an (siehe Beispiele in der naturwissenschaftlich-technologischen Medizin, die Verwahrung von Menschen in Anstalten)! Zum zweiten wollen immer mehr Menschen diese Reparatur nicht mehr: Sie lassen sich ihr Leben immer weniger mit Zuschlägen oder Leistungen abkaufen: Sie verweigern sich der »kompensatorischen Moral« der Sozialstaatlichkeit. Sie wollen ihre Lebensbedingungen selbst bestimmen und mit Leiden ohne Bevormundung umgehen« (1982).
Können die informellen Hilfssysteme, die sozialen Netzwerke in der Alltagswelt die Basis für eine neue Sozialpolitik sein? Kann staatliche Sozialpolitik zurückgenommen werden, weil das informelle Hilfesystem sehr viel wirksamer und für die Betroffenen befriedigender Hilfe leisten kann? Oder wie könnte eine staatliche Sozialpolitik als Mittel der Förderung und Ermöglichung soziale Unterstützungssysteme entwickelt werden?
Zur Beantwortung solcher Fragen muß man verschiedene Etappen zurücklegen. Mit der ersten möchte ich an dem Wissen ansetzen, das wir über den alltäglichen Umgang mit Krisen und Belastungen haben und welche Rolle für diesen Umgang die Ressourcen haben, die eine Person aus ihrem sozialen Netzwerk erhalten kann. Bei allen Spezialfragen im Detail, die noch einer präziseren Überprüfung bedürfen, können wir davon ausgehen, daß die alltägliche Verfügbarkeit von Unterstützungsressourcen aus dem eigenen Bezichungsnetz einen günstigen Einfluß auf die Bewältigung von Belastungen und Krisen hat (vgl. als zusammenfassende Überblicksarbeiten zu diesem Forschungsbereich: GOTTLIEB, 1983; SARASON und SARASON, 1985; COHEN und SYME, 1985; LIN, DEAN und ENSEL, 1986).
Soziale Unterstützung kann als Wirkgefüge begriffen werden, das verständlich machen kann, warum bestimmte Personen und Gruppen mehr und schwerere Gesundheitsprobleme haben (im Sinne eines direkten Effektes auf die Entstehung von Belastungen und Krisen). Soziale Unterstützung kann ebenfalls als Puffer wirksam werden und in diesem Sinne die negativen Auswirkungen von eingetretenen Belastungen und Krisen auffangen helfen bzw. eine Auseinandersetzung mit Bedrohungen unterstützen, die für eine Person zu positiven Konsequenzen führen kann.
Auf der Basis solcher Wissensbestände, die hier - zugegebenermaßen nur sehr verkürzt eingeführt worden sind, läßt sich sicherlich problemlos die sozialpolitische Konsequenz begründen, daß Sozialpolitik die alltägliche Produktion von sozialer Unterstützung im Sinne von psychosozialen, sozialen und materiellen Ressourcen zu fördern habe. Wenn weiter unterstellt wird, daß in der Lebenswelt selbst gefundene und erbrachte Bewältigungsformen wirksamer und für die Betroffenen befriedigender sind als von formellen Institutionen verordnete Hilfs- oder Kontrollmaßnahmen, dann folgt daraus, daß im informellen System alltäglicher Beziehungen entwickelte Handlungsmöglichkeiten nicht durch formelle sozialstaatliche Interventionen erschwert, verunmöglicht oder ersetzt werden dürfen.
Der neokonservative Diskurs suggeriert, daß informelle und formelle Systeme als Alternativen zu betrachten seien und der Ausbau staatlicher Wohlfahrtsprogramme die potentiellen alltäglichen Unterstützungs- und Hilfspotentiale erstickt und entwertet. Aus dieser Annahme läßt sich dann folgern, daß mit einem staatlichen Interventionsverzicht das informelle Hilfesystem ihre unausgeschöpften Potentiale voll entfalten könnte. Bei dieser Perspektive bleibt allerdings die Frage offen, welche Potentiale eigentlich noch auszuschöpfen sind oder ob hier die ideologische Meßlatte einer Gesellschaft herangezogen wird, die von dem gesellschaftlichen Modernisierungsprozeß längst außer Kraft gesetzt wurde.
Um aus diesem Dickicht von Unterstellungen und ideologischen Schablonen herauszufinden, ist es sicherlich ratsam, sich auf empirisch einigermaßen absicherbare Befunde zu stützen. Dieser Weg empfiehlt sich auch, wenn man von einer vergleichbaren sozialpolitischen Diskussion ausgeht, die im England des Thatcherismus mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf gegenüber der Bundesrepublik stattgefunden hat.
Der BARCLAY-Report (1982), die Empfehlungen einer offiziösen Enquete für Großbritannien, setzt ganz auf die »informellen sozialen Netzwerke«. Soziale Dienste sollen zu Partnern dieser informellen Hilfssysteme werden, zu »Stützen von Netzwerken«. Sie sollen »soziale Netzwerke ermöglichen, bemächtigen (empower), unterstützen und ermutigen, aber sie nicht übernehmen« (BARCLAY-Report, 1982, § 13.43). Die »Gemeinde«, auf die sich die Aktivitäten der sozialen Dienste beziehen sollen, wird bestimmt als diejenigen »lokalen Netzwerke formeller und informeller Beziehungen, zusammen mit ihrer Kapazität, individuelle und kollektive Antworten auf Belastungen zu mobilisieren« (ebd. § 13.3). An anderer Stelle heißt es, die »Gemeinde« sei
»ein Netzwerk oder Netzwerke von informellen Beziehungen zwischen Menschen, die miteinander verknüpft sind durch Verwandtschaft, gemeinsame Interessen, geographische Nähe, Freundschaft, Beruf sowie Erbringen oder Erhalten von Dienstleistungen - oder verschiedenen Kombinationen von diesen« (ebd., § 13.6).
Die Reaktion auf diese Enquete und ihr konzeptuelles Gegenstück, die »informellen sozialen Netzwerke«, zeigt, daß die Suggestivkraft der Netzwerkempfehlung groß ist, doch gibt es auch abwägende kritische Stimmen, die vor der Gefahr einer undifferenzierten programmatischen Formel warnen (z. B. ALLAN, 1983; PINKER, 1985; WALKER, 1985). Es wird von einer »ideologischen Naivität« (OLSEN, 1983, S. XIX) gewarnt, daß reale soziale Probleme wie die wachsende Erwerbslosigkeit durch eine große gemeinschaftliche Beziehungsarbeit überwunden werden könnten. Vor allem wird darauf aufmerksam gemacht, daß die gesellschaftlichen Bedingungen für lokale Netzwerke in den vergangenen Jahrzehnten immer ungünstiger geworden seien und auch durch professionelle Animation und Intervention nicht beliebig repariert werden könnten. Zweifel werden ebenfalls an der undifferenzierten Hoffnung auf umfassende Hilfe geäußert, die man sich von den informellen sozialen Netzwerken erwartet. Kontinuierliche Hilfe und Pflege bei schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind in der Regel nicht von Nachbarn und Freunden zu erwarten, vor allem, wenn sie über einen längeren Zeitraum notwendig sind. Pflege über einen längeren Zeitraum wird fast nur von Frauen (Mütter, Ehepartnerinnen oder Töchter) geleistet.
Dieser Bezug auf die englische Diskussion legt einen möglichst realitätsbezogenen Blick auf die Leistungen des informellen Hilfesektors nahe, ehe auf ihm gedankliche Konstruktionen errichtet werden, deren Realisierung er nicht gewährleisten könnte. Ein entscheidendes Merkmal dieses Sektors ist, daß er »sich auf Formen der Hilfe jenseits von Markt und Staat« bezieht, sie werden also »nicht gewinn-orientiert und nicht gegen Arbeitslohn für den individuellen oder kollektiven Eigenbedarf« (OLK und HEINZE, 1985, S. 239) erbracht. Zur Beschreibung der sozialen Muster, in denen sich Hilfe zwischen verschiedenen Personen realisiert und zur Beschreibung der Wege, die sie nimmt, wird immer wieder das Netzwerkkonzept herangezogen, gerade weil es nicht durch die Begrenzungen von Organisationen und Institutionen eingeschränkt wird. So lassen sich in diesem Zusammenhang soziale Netzwerke als »Gleisanlagen« charakterisieren, »auf denen Hilfeleistungen verschiedenster Art transportiert werden können« (OLK und HEINZE, ebd., S. 241) oder als ein »verzweigtes System von 'Bändern'«.
»Auf diesen 'Bändern' des Netzwerkes laufen nun die vielfältigsten Austauschprozesse zwischen den Individuen, die nicht lediglich Hilfeleistungen, sondern alle nur erdenklichen Transfers von Ressourcen materieller und immaterieller Art einschließen können« (OLK, 1985, S, 135).
Welche Art von Hilfe wird nun auf diesen Gleisanlagen transportiert? Und wie werden diese Übermittlungsbänder durch aktuelle und erwartbare gesellschaftliche Veränderungen betroffen?
Ich beschränke mich hier auf einige stichwortartige Informationen und stütze mich dabei weitgehend auf OLK (1985), OLK und HEINZE (1985), ALLAN (1983) und WALKER (1985) und GRIFFITH (1985). In Familien wird noch immer am meisten informelle Hilfe geleistet. Die ganze Hausarbeit läßt sich unter dieser Kategroie fassen und ohne die Infrastruktur, die sie schafft, würde das gesellschaftliche Gefüge schnell auseinanderbrechen.
Hilfsleistungen im engeren Sinne beziehen sich vor allem auf Pflegebedürftige, von denen 80 % von Familienangehörigen versorgt werden (in 7,6 % der Haushalte werden Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gepflegt. An diesen Hilfsleistungen sind in England dreimal so viele Frauen beteiligt wie Männer. Mit der zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Frauen und der Veränderung der Familien- und Haushaltsstruktur ist diese informelle Hilfsressource reduziert worden. Während 1961 rund 38 % der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren berufstätig waren, sind das heute bereits rund die Hälfte. Die Haushaltsstruktur der BRD hat sich drastisch verändert: Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt in einem Ein-Personen-Haushalt, die gerne beschriebene Kleinfamilie (Ehepaar mit zwei Kindern) ist in einer Minderheitenposition (14,6% der Haushalte; 17,7 % sind Drei-Personen-Haushalte).
Parallel zum Funktionsverlust und zur Schrumpfung kleinfamiliärer Systeme wächst die Zahl der Hilfsbedürftigen: Der Anteil der unterstützungsbedürftigen Alten wächst immer weiter an (die Zahl derer, die in England älter als 75 werden, ist zwischen 1901 und 1981 um über 600 % gestiegen und wird weiter steigen).
Diese wenigen Daten belegen, daß die ideologisch so hoch besetzten Familien kaum mehr ungenutzte Hilferessourcen aufweisen, im Gegenteil, ihr Grenznutzen ist längst erreicht und er wird weiter sinken. Verwandtschaftsbeziehungen werden vor allem genutzt, um Überlastungen von Kleinfamilien, in denen beide Ehepartner berufstätig sind (die »ambulante Großmutter«), aufzufangen, aber die zunehmende geographische Dispersion von Verwandtschaftsnetzen setzt hier schnell Grenzen. Die nachbarschaftlichen Hilfeleistungen sind besonders bei Familien mit Kindern hoch entwickelt. Es sind jedoch meist nicht mehr klassische Nachbarschaftsformen (Nachbarn im wörtlichen Sinne), sondern 'hochmobile Nachbarschaften' (vgl. BULMER, 1985), die mit steigender Schicht gut funktionieren.
Nehmen wir diesen Bereich traditioneller Elemente des informellen Hilfssektors, dann lassen sich eine Reihe von Punkten ansprechen, die zur Skepsis gegenüber einer Sozialpolitik Anlaß geben, die ihre qualitative Basis in diesem Sektor sucht:
Gerade die traditionellen familiären und verwandtschaftlichen Strukturen sind von dem im letzten Abschnitt beschriebenen gesellschaftlichen Strukturwandel und seinen Individualisierungstendenzen unter besonderem Wandlungsdruck. Die erkennbare Entwicklungsdynamik läßt die Prognose zu, daß die Ressourcen der traditionellen Vergesellschaftungsmuster weiter abnehmen werden. Auf diese Entwicklung beziehen sich OLK und HEINZE bei ihrer Analyse informeller Hilfesysteme. Sie stoßen auf
»das Problem, daß genau diese, mit dem sozialen Netzwerkkonzept erfaßbaren Beziehungssysteme selbst langfristigen Wandlungen unterliegen, die sie nur noch begrenzt wirksam erscheinen lassen. Entwicklungstendenzen wie Urbanisierung, Mobilisierung der Bevölkerung, Verkleinerung der Haushaltsgrößen aber auch und gerade die Erosion sozialer Netzwerke durch das exponentielle Wachstum formaler Bürokratien im Markt- und Staatssektor haben ihr Absorptionspotential zumindest eingeschränkt« (1985, S. 242).
Besonders fraglich ist das traditionelle Rollenverständnis der Frauen, aus dem heraus nicht nur ein großer Teil der gesellschaftlichen Beziehungsarbeit geleistet wird, die den Zusammenhalt und die Reproduktion von Familie und Verwandtschaft garantiert, sondern auch die Formen von Hilfe erbracht werden, die in Krankheits-, Not- und Krisenfällen notwendig sind. Aus dem weiblichen Arbeitsvermögen wird vor allem die»Ressource Liebe« (FINCH und GROVES, 1983) geschöpft, die in der Beziehungsarbeit gebraucht und verbraucht wird.
Auch die Netzwerke, die über den engeren Familienrahmen hinaus reichen wie beispielsweise Freundschaftskontakte, werden sehr viel mehr durch die aktive Kontaktpflege der Frauen zusammengehalten, selbst solche, die über Arbeitsbeziehungen oder frühere Bekannte des Mannes entstanden sind (WELLMAN, 1985). Es ist sicherlich wesentlich durch ein sich änderndes Rollenverständnis von Frauen bewußt und sichtbar geworden, daß die »Ressource Liebe« erschöpft ist bzw. von Frauen nicht mehr selbstverständlich eingesetzt wird, wenn Versorgungsaufgaben entstehen. Die emotionale Ausbeutung von Frauen wird zunehmend zum Thema und damit auch die »Kostenseite« oder »Schattenseite von sozialen Netzwerken« (TURKINGTON, 1985) für die Reproduktionsarbeit investierenden Frauen. Das Thema »The costs of caring« taucht immer häufiger in der Literatur auf (BELLE, 1982; KESSLER, McLEOD und WETHINGTON, 1985; HOBFOLL, 1985; SHINN, LEHMANN und WONG, 1984).
Besonders in der Verdichtung von Krisen- und Reproduktionsarbeit mit materiellen Notlagen ist eine emotionale Erschöpfung der Frauen wahrscheinlich. Frauen werden nicht weiter belastet werden können, und ein immer größer werdender Teil der Frauen wird die selbstverständliche Übernahme der gesellschaftlichen Beziehungsarbeit in Frage stellen oder verweigern.
Der informelle Hilfesektor reproduziert in sich und durch sich Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit. Die vorhandene Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen in dem weiter oben angesprochenen differenzierten Sinn von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital findet in den Möglichkeiten der informellen Systeme ihre Entsprechung. Der Abbau von staatlichen Sozialleistungen, die in der Programmatik des keyneseanisch konstruierten Wohlfahrtsstaates die schlimmsten Folgen der sozialen Ungleichheit in monetärer Form oder durch psychosoziale Dienstleistungen auffangen sollten, verschärft die Ungleichheitsrelationen. In die Austauschprozesse innerhalb der einzelnen informellen Hilfenetze können nur die Ressourcen eingebracht werden, auf die die Mitglieder Zugriff haben. Die Austauschökonomie der informellen sozialen Netzwerke kann deshalb in sozial benachteiligten sozialen Schichten allenfalls zu einer gerechteren Verteilung des Mangels führen. Sozialpolitische Lösungsansätze, die auf eine Neuverteilung von Ressourcen zielen, sind deshalb über die Strukturen der informellen Sozialsysteme prinzipiell nicht möglich (BRODY, 1985). Die Propagierung einer »solidarischeren Gesellschaft« oder einer »caring society«, die nur das Allheilmittel soziale Unterstützung anzupreisen hat, ohne ökonomische und makrogesellschaftliche Strukturfragen antasten zu wollen, kann kaum mehr als eine ideologische Befriedungsstrategie sein (vgl. dazu WALKER, 1985; PILISUK und MINKLER, 1985).
Die traditionellen Formen informeller Hilfe sind offenbar an institutionelle Muster (wie z. B. die Kleinfamilie) gebunden, die an gesellschaftlicher Funktion und Bedeutung fortschreitende Einbußen erfahren. Und gleichzeitig reproduzieren diese Systeme die gesellschaftliche Verteilung von Ressourcen. Beide Gründe sprechen eindeutig dagegen, dieses System informeller Hilfeleistung zur Basis neuer sozialpolitischer Strategien zu machen. Eine Gesellschaft, deren traditionelle Vergesellschaftungsmuster von einem fortschreitenden Individualisierungsprozeß aufgelöst werden, die immer mehr zu einer »Momentgesellschaft« (»instantaneous society«; FRANK, 1979) wird, kann auf die Institutionalisierung von formellen und für jedes Gesellschaftsmitglied erreichbaren Hilfen nicht verzichten. Bedeutet diese Schlußfolgerung, daß aus der angesprochenen Kritik an dem qualitativen Zustand staatlicher Sozialpolitik letztlich keine Konsequenzen gezogen werden können? Gibt es keine Alternative zu einer zentralistisch angelegten und bürokratisch vollzogenen staatlichen Sozialpolitik?
A. WALKER formuliert einen Weg, der die Kritik an einer rigiden staatlichen Wohlfahrtsbürokratie ernst nimmt, ohne daß daraus notwendigerweise die konservativ-liberalistische Alternative der Privatisierung folgt. Er sieht die Möglichkeit,
»die Struktur, die Tätigkeit und die Voraussetzungen formaler Dienste so zu ändern, daß sie zugänglicher für die Bedürfnisse von Individuen, Familie und Gemeinde werden, statt sie durch private oder informelle Alternativen zu ersetzen (1985, S. 46; Hervorhebung im Original).
Er plädiert dafür, nicht auf die informellen Unterstützungssysteme zu setzen, sondern auf »soziale Unterstützungsnetzwerke« (hier bezieht er sich auf den gleichlautenden Sammelband von WHITTAKER und GARBARINO [1983]). Im Unterschied zu den informellen Systemen sind sie nicht »natürlich«, sondern sind häufig auf die Initiierung, Anleitung und Förderung durch professionelle Helfer angewiesen. Vor allem brauchen sie sozialstaatlich bereitgestellte und einklagbare Ressourcen. Erforderlich scheint die Schaffung und Bereitstellung vonFonds, aus denen die Förderung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten Projektenbestritten werden kann. Notwendig scheint außerdem eine gemeindebezogene Öffnung professioneller Dienste wie es in gemeindepsychologischen, sozialpsychiatrischen und Arbeitsansätzen in Richtung Gemeinwesenarbeit diskutiert wird. In diesem Zusammenhang ist von der Strategie der»Netzwerkförderung« die Rede.
Dazu heißt es in einem Artikel über die Notwendigkeit einer veränderten Pflegepolitik:
»In der Zukunft sollten zusätzlich verstärkt Möglichkeiten der Hilfe zur Selbsthilfe, sollten Strategien der Netzwerkförderung, d. h. der Aktivierung gegenseitiger Hilfe und der Selbstorganisation der Betroffenen überdacht, erforscht und praktiziert werden« (BADURA, 1985, S. 88).
Speziellim Behinderten- (vgl. VIF, 1982; CREWE und ZOLA, 1983) und im Altenbereich (Vgl. WENGER, 1984; LITWAK, 1985; TENNANT und BAYLEY, 1985) gibt es schon eine Reihe von ermutigenden Netzwerkinitiativen, die eine Alternative zu verwahrenden Großinstitutionen darstellen. Sie drängen auf Autonomie und Selbstorganisation, aber sie fordern zugleich auch die sozialpolitische Infrastruktur, die dafür eine Bedingung ist.
Gerade in einer Gesellschaft, deren traditionelle Infrastruktur durch die beschriebenen Freisetzungsprozesse einer Erosion unterliegt, sind alternative Vergesellschaftungsmuster notwendig. Der Staat kann sie nicht durch formelle Megastrukturen der kompensatorischen Hilfe ersetzen. An Stelle der traditionellen Netzwerke entstehen in großer Vielfalt neue Netzwerke, die sich als Assoziationen von Menschen bestimmen lassen, die sie aus eigener Initiative starten. Sie haben dort die beste Chance, wo Ressourcen an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital in ausreichendem Maße da sind. Sozialpolitik muß Ressourcen dort schaffen, wo im System der gesellschaftlichen Ungleichheit das entsprechende Kapital fehlt, um soziale Netzwerke aufzubauen, die Unterstützung, die Entwicklung positiver Identitätsmuster und die Erarbeitung kollektiver Lebenspläne ermöglichen. Für Netzwerke mit dieser Funktionsbestimmung führen BERGER und NEUHAUS das soziologische Konzept der »vermittelnden Strukturen« ein und definieren es so: es sind
»solche Institutionen, die zwischen dem Individuum in seinem privaten Leben und den großen Institutionen des öffentlichen Lebens stehen« (1977, S. 2).
Das moderne Subjekt wird aus der Sicht der Autoren durch die immer größer werdende Kluft zwischen einer auf Mikrogrößen schrumpfenden privaten Welt und den staatlichen und ökonomischen Megastrukturen aufgerieben, von denen es abhängig ist, aber in denen es keinerlei Steuerungschance hat. Die vermittelnden Strukturen sollen diese Kluft überbrücken und sie können es dadurch, daß
»sie ein privates Gesicht haben, das dem privaten Leben ein Maß an Stabilität vermitteln können, und ein öffentliches Gesicht, das Bedeutung und Wert an die Megastrukturen weitergibt. ( ... ) Ihre strategische Position folgt daraus, daß sie sowohl die anomische Unsicherheit der individuellen Existenz in ihrer Isolation von der Gesellschaft reduzieren als auch die Gefahr der Entfremdung von der öffentlichen Ordnung« (ebd., S. 3).
Diese Formulierungen sind relativ vage und klingen harmonisierend, aber das Konzept der »vermittelnden Strukturen« halte ich für nützlich, um einen noch wenig sichtbaren und teilweise höchst unübersichtlichen Bereich neuer Vergesellschaftungsmuster anzusprechen, in dem sich nach Habermas letztlich »die Gestalt der politischen Kultur« und die »kulturelle Hegemonie« entscheiden. In dieser Arena geht es
»um die Unversehrtheit und Autonomie von Lebensstilen, etwa um die Verteidigung traditionell eingewöhnter Subkulturen oder um die Veränderung der Grammatik überlieferter Lebensformen. ( ... ) Diese Kämpfe bleiben meist latent, sie bewegen sich im Mikrobereich alltäglicher Kommunikationen, verdichten sich nur dann und wann zu öffentlichen Diskursen und höherstufigen Intersubjektivitäten. ( ... ) Formen der Selbstorganisation verstärken die kollektive Handlungsfähigkeit unterhalb einer Schwelle, an der sich die Organisationsziele von den Orientierungen und Einstellungen der Organisationsmitglieder ablösen und wo die Ziele vom Bestandserhaltungsinteresse verselbständigter Organisationen abhängig werden« (HABERMAS, 1985, S. 159f.).
[2] Den Politikern ist das Faktum gar nicht unbekannt. In seiner Rede auf dem 70. Deutschen Fürsorgetag (am 31.10.1983 in Berlin) hat der Bundespräsident CARSTENS ausgeführt: »Die pflegenden Helfer, meist sind es Frauen, tragen die Hauptlast an Zeit und Anstrengung, um Pflegebedürftigen die notwendige Hilfe, die menschliche und das heißt auch liebende Hilfe zuteil werden zu lassen. Oft müssen sie auf Urlaub verzichten, bleiben jahrelang an das Haus gebunden.« Die Verausgabung weiblicher Arbeitskraft bis zur totalen Erschöpfung wird offenbar bewußt in Kauf genommen, allerdings mit hoheitlichem Segen bedacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Nachkriegsperiode: Der Dämmerzustand nach dem Grauen gerät unter Modernisierungsdruck
- 2 Deinstitutionalisierung und die Krise des Wohlfahrtsstaates: Eine Auflösung, die keine ist
- 3 Was läßt sich aus dein Scheitern der Psychiatriereform lernen?
- 4 Ausweg aus der Krise: Schritte in Richtung Selbstorganisation
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Was wird ein Psychiatrieexperte, der 15 Jahre nicht mehr in der Bundesrepublik gewesen ist, an Veränderungen in der psychosozialen Versorgungslandschaft antreffen? Er wird die meisten psychiatrischen Anstalten baulich saniert finden, auch neue antreffen. Die Aufenthaltsdauer in den Anstalten ist reduziert, dafür sind die Einweisungs- und Wiedereinweisungsquoten angestiegen. Eine Reihe von Anstalten hat seine Betten reduziert. Dafür wächst die Anzahl von privat geführten Heimen für Langzeitpatienten, die dem Besucher bei einer offiziellen Psychiatrietour durch die Bundesrepublik aber eher vorenthalten werden.
In den Kliniken wird er eine Differenzierung vorfinden, die zu einem verstärkten therapeutischen Engagement im Akutbereich geführt hat, und zugleich eine anstaltsinterne Ausgrenzung von Langzeitinsassen in personell schlecht ausgestatteten Abteilungen zur Folge hatte. Beim Personal wird er die Angst vor Planstellenabbau zu spüren bekommen und die Sorge, daß eine weitere Reduzierung von Betten diese Gefahr noch verschärfen könnte. Das führt zu einer Skepsis gegenüber in der Öffentlichkeit noch immer erhobenen Forderungen nach einer Auflösung der Anstalten.
Die größte Neuerung, die der Besucher antreffen dürfte, sind erste ambulante Versuche zu einer lebensweltbezogenen psychosozialen Arbeit. Er wird aber zugleich registrieren, daß in der Bundesrepublik Versorgungsstrukturen politisch heiß umstritten sind, die in anderen Ländern der westlichen Welt längst zum selbstverständlichen Grundbestand der psychosozialen Versorgung zählen, ja die dort durchaus als Konstrollsysteme kritisch diskutiert werden. Es wird dem Besucher seltsam in den Ohren klingen, daß Sozialpsychiatrische Dienste in Teilen der Bundesrepublik als Einbruch des Sozialismus in das Gesundheitswesen bekämpft werden.
Die solchermaßen im Überlebenskampf befindlichen ambulanten Kümmerformen einer alternativen Versorgungsstruktur sind weit davon entfernt, die anstaltsförmige Versorgungsform in der Bundesrepublik in Frage zu stellen. Personen mit massiven psychischen Problemen werden nach wie vor im Regelfall - entsprechend den Vorgaben ordnungspolitisch geprägter Unterbringungsgesetze - in Anstalten eingewiesen, häufig ohne Wissen der vorhandenen ambulanten Dienste. Das Paradigma der Anstalt prägt nur unwesentlich verändert das Bild des »harten« Bereichs der Psychiatrie. Ist unser Besucher mit kalifornischen Zuständen eines schier unerschöpflichen Psychomarktes vertraut, wird er in den Großstädten der Bundesrepublik eine entsprechende produktive Umtriebigkeit vorfinden. Fast ohne Berührung zur Psychiatrie tut sich für die psychischen Krisen der bürgerlichen Schichten ein großes privates Angebot auf.
Das Fazit unseres Besuchers dürfte lauten: Das Erscheinungsbild der westdeutschen psychosozialen Versorgung hat sich in vielen Einzelaspekten verändert und internationalen Versorgungsstandards angenähert, aber eine tiefgreifende Strukturreform hat nicht stattgefunden. Der »Trichter des Ausschlusses« ist unverändert der vorherrschende Funktionsmodus, der durch die Auswirkungen der allgemeinen wohlfahrtsstaatlichen Krise gegenwärtig noch eine Verstärkung erfährt.
Diese insgesamt magere Bilanz ist für die Gruppen besonders enttäuschend, die auf eine Psychiatriereform in der Bundesrepublik große Hoffnungen gesetzt haben und in den vergangenen Jahren in ihrem unmittelbaren Versorgungsalltag und auf der politischen Ebene immer wieder mit vollem Einsatz für Veränderungen gearbeitet haben, die Ausgrenzung von Abweichung und Leid verhindern sollten. Nach einer Phase wohlfahrtsstaatlich angeleiteter Psychiatriereform mit großer Produktivität planerischer Phantasie für ein komplett reformiertes Versorgungssystem befinden wir uns in einer Situation, die von uns verlangt, eine mindestens doppelte Desillusionierung zu verarbeiten: Einerseits die Enttäuschung, daß die Blütenträume der Reformmanager nicht haben reifen können oder bestenfalls auf ein Modellformat en miniature ohne gesicherte Zukunft zusammengeschrumpft sind.
Die noch tiefgreifendere Desillusionierung bezieht sich auf die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer wohlfahrtsprogrammatischen Zielperspektive insgesamt, die sich nicht nur als fiskalische, sondern als qualitative Krise der kompensatorischen Logik des Sozialstaats erweist. Diese Desillusionierungen lähmen einen großen Teil der psychosozialen Reformszene. Diese hat mehr mit innerverbandlichen Enttäuschungsverarbeitungen zu tun oder läßt sich von regressiven Tendenzwenden mitziehen.
Ich sehe nur in einer nochmaligen Durcharbeitung und Bilanzierung der vergangenen Reformphase die Chance, das Thema Alternativen zum Ausschluß erneut zu thematisieren: Als Reflexion unseres eigenen reformpolitischen Lernprozesses.
Als habe nur ein allgemeiner gesellschaftlicher Ausnahmezustand geherrscht, der wie in der ganzen Gesellschaft auch in der Psychiatrie seine Spuren hinterlassen hat, kehrte die Nachkriegspsychiatrie in der Bundesrepublik zu ihrer Normalität zurück. Die Phase des Faschismus war abgeschlossen, ebenso die Phase der Ausmerzepolitik in der Psychiatrie. Das Grauen angesichts ihrer »vernichtenden« Vergangenheit - mindestens 10.000 Patienten wurden ermordet - kam in der westdeutschen Psychiatrie nicht auf, an einer Aufarbeitung dieser Periode bestand kein Interesse, eine Mauer des Schweigens sicherte die Definition des Ausnahmezustandes ab (SIEMEN, 1982).
In einer Art Dämmerzustand leistete das System Psychiatrie seine Dienstleistung als ausgrenzende Institution, in deren Zentrum jener Anstaltstyp steht, der sich um die Jahrhundertwende etablierte. Es gab keine nennenswerte Debatte um die Angemessenheit dieses Modells. Selbst als in Frankreich, England oder den USA wesentliche Transformationsschritte dieses Modells diskutiert und dann auch durchgeführt wurden, gab es in der westdeutschen Psychiatrie kaum Anzeichen für Veränderungen.
Im Zuge der Studentenbewegung sind auch in der Bundesrepublik die Texte der Antipsychiatrie, die aus England, Frankreich und später dann vor allem aus Italien kamen, rezipiert worden. Das Interesse an diesen Texten resultierte zunächst weniger aus einem Interesse an der Institution Psychiatrie und ihrer Veränderung, sondern eher aus einer Identifikation mit dem Wahnsinn, als einer Form des Ausbruchs aus dem Gehäuse einer eindimensionalen Gesellschaft. Die Psychiatrie als Institution kam ins Blickfeld als der gesellschaftliche Repressionsapparat, der den befreienden Wahnsinn, das Anderssein unterdrückt. Auf dieser Basis wurde er auch bekämpft, häufig ohne jemals einen Blick ins Innere getan zu haben.
Eine wichtigere Gruppe von Kritikern erwuchs aus jenen von der Studentenbewegung geprägten Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern, die sich ihren Arbeitsplatz nicht in feudal strukturierten, antitherapeutischen Institutionen vorstellen konnten und durch das Kennenlernen internationaler Reformansätze die Überzeugung gewonnen hatten, daß ihr Verständnis von ihrer eigenen Professionalität eine grundlegende Reform der Psychiatrie erforderlich macht.
Aus diesen beiden Strömungen - der antipsychiatrischen und der reformpsychiatrischen - bildete sich die Szene, die aktiv auf Reformen drängte und die sich in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie zu Beginn der 70er Jahre zusammenschloß. Aus dieser Szene kamen viele Initiativen zu praktischen Veränderungen in einer Reihe von Institutionen und von ihr kam sicherlich auch Druck in die Öffentlichkeit. Aber bildete sie den Motor, der dann den Bundestag zu einer Psychiatrie-Bestandsaufnahme antrieb? Ich glaube, man würde die Stärke dieser Reformgruppierung überschätzen.
Der entscheidende Anstoß für eine regierungsamtlich auf die Tagesordnung gesetzte Psychiatriereform war die Rückständigkeit einer Psychiatrie, was jeder Vergleich mit strukturell ähnlichen Industrieländern ergab, eine Rückständigkeit des Grundmodells der verwahrenden Ausgrenzung.
Zu Beginn der 70er Jahre wiesen die gesellschaftspolitischen Vorzeichen in Richtung Integration von allen verfügbaren Arbeitskraftreserven. Integration bedeutete die Konzeption und den Aufbau eines umfassenden wohlfahrtsstaatlichen Programms, in dessen Konturen der Zustand der bestehenden Psychiatrie nicht paßte. Sie geriet unter einen enormen »Modernisierungsdruck«. In dem 1975 vorgelegten Schlußbericht der eingesetzten Expertenkommission wird die hochgradige Rückständigkeit der bundesdeutschen Psychiatrie in schonungsloser Offenheit angesprochen, zu beschönigen gab es da wenig. Das Modernisierungsprogramm der Expertenkommission holte sich aus dem internationalen Erfahrungsraum alle Bausteine einer Psychiatrie, die im Vorfeld der Krankenhausversorgung, begleitend und komplementär zu dieser und schließlich im rehabilitativen Bereich Aufgaben wahrnimmt. Diese Bausteine werden zu einem lückenlosen und umfassenden System oder Versorgungsnetz verknüpft, Übergänge von einem System ins andere werden bedacht, die fortlaufende Planung und Weiterentwicklung wird eingebaut. Die Modernisierungsspezialisten aus dem Bereich der Systemplanung hatten die Psychiatrieexperten offensichtlich gut beraten.
Bereits bei der Zusammensetzung der Kommission waren nach gutem Integrationskalkül auch gezielt Vertreter der auf Reformen drängenden Szene einbezogen worden, allerdings dadurch von einer zuarbeitenden und kontrollierenden Basis abgeschnitten, daß die Kommissionsarbeit unter der Prämisse der Geheimhaltung abgewickelt wurde. Die Handschrift der Vertreter der Reformszene ist in verschiedenen Passagen der Enquete durchaus auffindbar, aber im Gesamtresultat ist die alte Psychiatrie »rundum erneuert«, aber mit der ungebrochenen Dominanz des »medizinischen Modells« und der ärztlichen Profession herausgekommen.
Das Herzstück, die Anstalt (natürlich heißt das jetzt nur mehr Krankenhaus oder Klinik), soll baulich saniert, auch verkleinert und ein bißchen dezentralisiert werden, das Personal soll besser ausgebildet werden und die Kooperation mit anderen psychosozialen Einrichtungen soll verbessert werden. Das vermutlich einzig innovative Strukturelement bildet der geforderte Sozialpsychiatrische Dienst.
Bei aller Kritik, die der Kommissionsbericht ausgelöst hat, ist er doch für die Psychiatriepolitik zum zentralen Bezugspunkt geworden. Er hat fast alle konzeptuellen Ressourcen gebunden, seine Sprachregelung hat schnell funktioniert und vor allem seine technokratische Planungsphilosophie hatte Prägungskraft. Keiner psychiatriekritischen Initiative ist der Prozeß letztlich erspart geblieben, die eigenen Vorstellungen in die Sprache des Enquete-Jargons zu übersetzen; er funktionierte wie eine Normalisierungsmaschine. Der dabei sich vollziehende Substanzverlust in bezug auf die ursprünglichen Ansprüche ließ sich oft kaum mehr direkt fassen.
Wenn man diesen Prozeß in der jetzt möglichen rückschauenden Perspektive betrachtet, dann ist zwar von der Planungsfolie der Enquete nur wenig realisiert worden. Ironischerweise hat sich aber vor allem ihre administrative und technokratische Rationalität in den Köpfen derer festsetzen können, die sich für die Psychiatrie interessiert haben. Sie ist zusammengeschmolzen mit einer wohlfahrtsstaatlichen Zielprogrammatik nach sozialdemokratischem Muster, das von der Idee einer umfassenden Absicherung und Kompensation aller Leiden ausgeht, die in einer Gesellschaft vom Typus der Bundesrepublik die Menschen bedrohen und gefährden. Da solche Existenzgefährdungen in jeder Nische der Gesellschaft lauern, muß ein dicht gefügtes System die Menschen schützen, unterstützen und anleiten.
Dieses Modell einer umfassenden »fürsorglichen Belagerung« hat in der beginnenden fiskalischen Krise keine Reallsierungschance mehr gehabt, aber als Zielprojektion hat sie viele Reformimpulse gefunden. Dieser technizistischen wohlfahrtsstaatlichen Planung im Großen entsprach eine technizistische Orientierung im professionellen Selbstverständnis der therapeutischen Berufe. Grundmuster dieser technizistischen Haltung auf der gesamtplanerischen wie auf der therapeutischen Ebene ist der Managementansatz: Vorhandene Probleme müssen bearbeitet und befriedet werden. Ihnen liegt eine kompensatorische Logik zugrunde, die nicht nach den gesellschaftlichen Ursachen von psychischem Leid fragt. Bei aller proklamierten Priorität für Prävention enthält die Psychiatrie-Enquete keinen Denkansatz, wie man sich den Zusammenhang von gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen und psychischem Leid vorstellen soll (Vgl. WAMBACH/HELLERICH, 1980).
Fast vier Jahre dauerte es, bis die Bundesregierung ihre Antwort auf den Expertenbericht vorlegte. Inzwischen hatte die fiskalische Krise voll eingesetzt, die Bundesregierung sah für sich keinen Spielraum mehr für nennenswerte Reforminitiativen. Abgesehen von einer Modellaktion, die noch nicht einmal vom zuständigen Ressort kam, gab es für die ungeduldig wartenden Psychiatriereformer keinen hoffnungsvollen Ansatz. Erbitterung machte sich in der Reformszene breit, die Loyalität gegenüber dem sozial-liberalen Regierungsblock bröckelte ab, eine trotzige Radikalisierung war die Folge. Die Hoffnung, daß durch ein umfangreiches ambulantes Alternativangebot der alte Kern der Psychiatrie, die Anstalt, von selbst ihren schleichenden Exitus erfahren würde, hatte sich als illusionär herausgestellt.
Es bedurfte dieser Enttäuschung, damit in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie die Forderung nach Auflösung aller psychiatrischen Großanstalten mehrheitsfähig werden konnte (Gesundheitspolitischer Ausschuß des DGSP, 1981). Als im Herbst 1980 mit dieser Forderung ein Sternmarsch nach Bonn stattfand, hat das zwar starke öffentliche Resonanz gefunden, jedoch auch die Frage aufgeworfen, ob diese Forderung nicht zehn Jahre zu spät kam. Hätte sie nicht als Position in die Enquete-Kommission eingebracht werden müssen? Die hatte auf Modernisierung und Sanierung der anstaltsförmigen Psychiatrie gesetzt und tatsächlich sind in den 70er Jahren mehrere Milliarden investiert worden, um dieses Ziel zu erreichen.
Nachdem dies weitgehend abgeschlossen war, kam die Forderung nach Auflösung. Der Zeitplan hatte nicht gestimmt, aber in ihm bildete sich die Geschichte und der Zustand der Reformbewegung ab: Sie wollte konstruktiv auf die Veränderung einwirken, aus der »psychiatriekritischen« in eine »psychiatriegestaltende Phase« eintreten. Die dazu als erforderlich angesehene realpolitische Kompromißbereitschaft hat jene radikale politische Konsequenz verhindert, die für die italienischen Kollegen typisch war: Für sie ist deshalb auch die Absage an die Anstalt zum Kernstück der Reform geworden, aus dem sich das ganze übrige Reformprogramm logisch ableiten ließ. Die erst in der Krise des Wohlfahrtsstaates entstehende trotzige Radikalisierung in der Bundesrepublik hat die Auflösungsforderung historisch verspätet formuliert (vgl. hierzu KÖHLER, 1985). Das war wohl auch ein impliziter Wissensbestand jener Gruppierungen, die mit dieser Forderung auf die Straßen zogen. Die Ahnung dieser reformpolitischen Ungleichzeitigkeit hat die interne Überzeugungskraft geschwächt und entsprechend halbherzig bis rituell wird diese Forderung nur noch bemüht aufrechterhalten.
Realpolitische Modelle für die Auflösung psychiatrischer Anstalten gibt es in der Jüngsten Psychiatriegeschichte in Kalifornien und in Italien. Es sind Deinstitutionalisierungsmodelle, die aus ganz unterschiedlichen politischen Motiven und zu gänzlich verschiedenen Konsequenzen geführt haben. Das kalifornische Modell - entstanden als Reagan Gouverneur von Kalifornien war - zielte in erster Linie auf eine fiskalische Entlastung des Staates (LERMAN, 1982). Entsprechend sind Patienten ohne ausreichende rehabilitative Vorbereitung und ohne ausreichende rehabilitative Vorbereitung und ohne Errichtung ausreichender ambulanter Hilfen sowie Lebensbedingungen vor die Tore der schließenden Anstalten gesetzt worden. Deinstitutionalisierung nach diesem Modell bedeutet, den Unterhalt teuerer Anstalten als staatliche Pflichtaufgaben aufzugeben, ohne daß die frei werdenden Mittel für alternative Unterstützungssysteme oder für die Garantierung einer materiellen Grundversorgung zur Verfügung stehen (BROWN, 1985). Für die entlassenen Patienten bedeutete dies überwiegend den Weg in die totale Isolierung und Armut (SCULL, 1980).
Das italienische Modell der Deinstitutionalisierung zielte auf den bewußten Bruch mit der Anstalt als dem institutionellen Vollzug des gesellschaftlichen Ausschlusses von Menschen, die mit den Normierungen der bürgerlichen Gesellschaft nicht klarkommen. Aber die Anstalt wird nicht alternativlos gestrichen, sondern ihre vorhandenen personellen Kapizitäten bleiben voll erhalten und aus ihnen werden ambulante Unterstützungssysteme geformt, die dezentralisiert in die Lebenszusammenhänge der Menschen einbezogen werden (GIESE, 1984; THUN, 1984).
Am italienischen Modell orientierte sich die Auflösungsforderung, die in der Bundesrepublik vertreten wurde. Das, was an Auflösung tatsächlich erfolgt, läuft eher nach dem kalifornischen Modell, wenngleich weniger öffentlich sichtbar als dort. Die staatlichen und parastaatlichen Träger von Großanstalten müssen unter dem enormen Kostendruck, der auf ihnen lastet, die Anstalten verkleinern. Der Bettenabbau trifft meistens den chronischen Bereich und vollzieht sich als Verlegung von Langzeitpatienten in private Pflegeheime. Der Bettenabbau ist in der Regel mit einer Personalreduktion verbunden, weil der Personalschlüssel an den Bettenschlüssel gebunden ist.
Gegen diese Art von Auflösung protestieren die Gewerkschaften und das therapeutisch-pflegerische Personal mit guten Gründen: Für die allermeisten Patienten bedeutet die Verlegung in den Heimsektor eine erhebliche Verschlechterung ihrer Situation und in den graduell kleiner werden den Anstalten werden die therapeutischen Möglichkeiten durch den Personalabbau erheblich gemindert. Die fiskalische Krise des Wohlfahrtsstaates hat Bewegung in das starre institutionelle Muster der psychiatrischen Versorgung gebracht: Bettenkapazitäten werden abgebaut, aber ohne gleichzeitig alternative Unterstützungssysteme im ambulanten Bereich zu schaffen. Der verwahrende Ausschluß von Langzeitpatienten wird zu einem einträglichen privaten Markt.
Der ambulante Bereich ist institutionell kaum ausgebaut worden und weit davon entfernt, eine Alternative zur Anstalt zu sein. Er wird gegenüber den präventiven, therapeutischen und rehabilitativen Aufgaben, die die Enquete für die Sozialpsychiatrischen Dienste vorgesehen hatte, häufig auf eine reine Betreuungsfunktion von ehemaligen Anstaltspatienten reduziert, die aufgrund reduzierter stationärer Aufenthaltszeiten sowie immer geringer werdenden Rehabilitationschancen in wachsenden »ambulanten Gettos« leben (RIEDMÜLLER, 1985). Die Entwicklung in der Bundesrepublik verläuft also weitgehend nach dem kalifornischen Modell, wobei die vorhandenen wohlfahrtsstaatlichen Restprogramme auf minimalem Standard dazu führten, daß die wachsende Population psychiatrisch marginalisierter und hoffnungsloser Menschen im öffentlichen Erscheinungsbild nicht sichtbar wird.
In dem Prozeß der doppelten Desillusionierung haben sich Einsichten gewinnen lassen, die in einer kurzen Zwischenbilanz festgehalten werden sollen, ehe der Frage nachzugehen ist, wie eine Perspektive für den erneuten Versuch zu gewinnen ist, Alternativen zu einer alltäglichen Ausgrenzung sanktionierenden und vollziehenden Psychiatrie zu entwickeln. Diese Bilanz kann hier nur in Thesenform vorgenommen werden (mehr dazu in KEUPP / RERRICH, 1982).
Die Grundprobleme der psychosozialen Versorgung sind prinzipiell nicht technisch lösbar, selbst wenn genügend finanzielle Ressourcen für die Realisierung »lückenloser Versorgungsnetze« vorhanden wären. Das technokratische Lösungsmuster verdeckt das historisch die Psychiatrie begründende und aktuell gültige Doppelmandat: Verwahrung, Verwaltung, Kontrolle oder auch Normalisierung der Menschen, die die gesellschaftlichen Integrationsnormen nicht erfüllen können oder wollen. Bei allen Verkürzungen und Vereinfachungen, die die Antipsychiatrie im einzelnen ausgezeichnet haben mögen (vgl. BRAUN / HERGRÜTER, 1980), dies ist ihr zu bewahrender Kern: Sie hat uns sehen gelernt, daß psychosoziale Arbeit immer eine politische Praxis ist. In ihr realisiert sich die für eine Gesellschaft typische Umgangsweise mit denjenigen ihrer Mitglieder, die geltende Normalitätskriterien verletzen. Unsere italienischen Kollegen haben diese Einsicht am konsequentesten zum Zentrum ihres neuen beruflichen Selbstverständnisses gemacht (JERVIS, 1978).
Psychosoziale Praxis kommt prinzipiell immer Zuspät, sie entspricht damit der »kompensatorischen Logik« des bestehenden sozialstaatlichen Systems. Diese Einsicht darf nicht in die abstrakt-negativistische Forderung münden: Diese Praxis ist überflüssig. Das Leid der Menschen an ihren Lebensbedingungen und an sich selber ist real und wird durch die bestehenden äußeren und inneren Realitäten beständig produziert. Das erfordert die sozialpolitische Ermöglichung von fachlichen Hilfen - auch kurativer Art.
Die entscheidende Frage ist, ob sich auf der Basis fortwährender gesellschaftlicher Leidensproduktion eine Therapeutisierungskultur entwickelt, für die die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit ausgeklammert bleiben. Die Alternative besteht darin, daß in die konkrete psychosoziale Praxis die Lebensbedingungen der Menschen einbezogen werden (ihr Wohnen, ihre Arbeit oder Arbeitslosigkeit, ihre ökologische Situation). Durch die Einbindung der psychosozialen Arbeit in die Alltagswelt der Menschen, die sich von ihr Hilfe erwarten, entsteht am ehesten die Möglichkeit, die psychischen Probleme mit den Bedingungen ihres Lebensalltags zu verknüpfen. Und hierdurch entstehen am ehesten auch Ansatzpunkte für die häufig zu abstrakt gehaltene Forderung nach Prävention.
Der »Trichter des Ausschlusses« gewinnt seine spezifische Sogwirkung von der Existenz und Logik der psychiatrischen Anstalten. Gelingt es einer Psychiatriereform nicht, das asyläre System zur Disposition zu stellen, werden alle ihre spezifischen innovativen Konfigurationen von dessen Logik durchdrungen.
Zu den klassischen psychiatrischen Lösungen wie der Anstalt und der Medikalisierung von Devianz haben sich in den 70er Jahren eine Reihe neuer Versorgungselemente herauskristallisiert: Ambulante Dienste, Kontaktstellen, psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern, komplementäre und rehabilitative Einrichtungen. Sie hatten für sich jeweils den Anspruch gegenüber den psychiatrischen Großkrankenhäusern etwas qualitativ Neues und anderes entwickelt zu haben. Sie hatten häufig keine klare Vorstellung davon, wie durch ihre Arbeit der Funktionsmodus des Anstaltssystems durchbrochen werden könnte bzw. gar nicht erst den Anspruch. Sie haben deshalb letztlich auch die Logik der anstaltsförmigen Ausgrenzung nicht brechen können, sondern sind im Gegenteil von dieser auch noch assimiliert worden.
Daraus läßt sich die allgemeine Einsicht gewinnen, daß eine Psychiatriereform, die nicht am letzten »Kettenglied des Ausschlusses« ansetzt, von der Sogwirkung des Trichters erfaßt werden muß. Um so weniger die ökonomischen und institutionellen Ressourcen der alternativen Systeme entwickelt sind, desto schneller erliegen sie dieser Sogwirkung.
In jeder Form psychosozialer Praxis durchdringen sich Hilfe und Kontrolle (KEUPP, 1981; 19826) . Die unterschiedlichen Formen psychosozialer Praxis und ihrer institutionellen Konfigurationen lassen sich nicht differenzieren nach solchen, die soziale Kontrolle ausüben und solche, die Hilfe leisten. Psychosoziale Praxis und ihr institutioneller Rahmen stellen gesellschaftliche Antworten auf das Herausfallen von Subjekten aus dem Horizont sozialer Normalitätserwartungen und auf das dadurch ausgelöste Leiden dar. In diesem Sinne bilden sie ein soziales Regulativ, das auf Störung mit Kontrolle reagiert. In Prozessen des gesellschaftlichen Ausschlusses und der sozialen Ausgrenzung tritt zweifellos der repressive Gewaltcharakter sozialer Kontrolle ins Zentrum psychiatrischer Intervention und wird zu ihrem typischen Markenzeichen. In der entlarvenden Anklage dieses Merkmals fand die Antipsychiatrie ihren entscheidenden Punkt negativer Identifikation. Sie hat nicht mehr allzu viele offene Anhänger, aber sie hat uns jene wache Aufmerksamkeit für immer subtilere Kontrollprozesse hinterlassen, die den gesellschaftlichen Alltag durchdringen. Allerdings ist diese Sensibilität für die kapillaren Systeme sozialer Kontrolle auch von einer spezifischen Einäugigkeit bedroht, vor allem wenn sie sich mit einer radikal-liberalistischen Attitüde des autonomen Individuums paart (entsprechend den ideologischen Kampfparolen eines T. SZASZ).
Wenn in allen institutionalisierten Formen psychosozialer Praxis nur das Kontrollpotential entlarvt und für seine Auflösung plädiert wird, dann bleibt in aller Regel der Gedanke der Hilfe gleichfalls mit auf der Strecke (SEDGWICK, 1982). Das Leid und die Probleme der Menschen erhalten keine gesellschaftliche Antwort mehr, sie werden zu Privatangelegenheiten und das in einem Vergesellschaftungskontext, der kaum mehr informelle solidarische Hilferessourcen enthält. Die Analyse der Kontrolldimension bedarf einer Perspektive, die die Subjekte nicht nur als Opfer einer äußeren Zwangsapparatur begreift, sondern die soziale Kontrolle in den sozialen Beziehungsmustern und in subjektinternen Strukturen aufspürt. Wenig wäre gewonnen, wenn dies nur aus der Haltung einer entlarvenden Fahndung erfolgen würde. Es gilt vielmehr das soziale Kräftefeld zu verstehen, das gesellschaftsregulierend in die Subjektbildung selbst eingeht, Normalität bei den Subjekten herstellt und zugleich die Normalität der herrschenden Verhältnisse reproduziert (vgl. hierzu die hervorragende Analyse von MUTZ (1983) oder auch einige Beiträge in dem Sammelband von COHEN und SCULL (1983)).
Die Krise des Sozialstaats hat den für die Psychiatrie klassischen Zusammenhang von Not und Leid, von Armut und pychischen Störungen wieder sichtbar gemacht. Sie bietet dadurch die erneute Chance, eine reale Demystifikation von medikalisierenden Strategien und Deutungen zu nutzen. Psychisches Leid ist eine Antwort auf gesellschaftliche Belastungen und Widersprüche und ist nicht aus den natürlichen Bestimmungen des Menschen angemessen zu begreifen. Dieser realen Demystifikation steht der sich gegenwärtig verschärfende Trend entgegen, die individuellen Folgen struktureller gesellschaftlicher Krisen zu pathologisieren (Arbeitslosigkeit macht krank! dies das auffallendste Beispiel), meist in der »weichen« Variante der Psychologisierung. Die angemessene kritische Reaktion darauf darf allerdings kein abstrakter Antisubjektivismus sein, sondern die Entwicklung eines kritischen Differenzierungsvermögens für die subjektiven Verarbeitungsmuster der Betroffenen und einer ideologischen Produktion von Deutungsmustern, die von den gesellschaftlichen Ursachen wegzuführen versuchen (INGLEBY, 1982; 1983).
Als Reaktion auf die Krise der Expertenlösungen im Großen (Enquete-Modell) und auf die Grenzen der technischen »Mikropolitik des Helfens (therapeutischer Technizismus) hat sich die Tendenz zur Selbstorganisation der Betroffenen verstärkt.
In der Zeit, als sich die Reformphantasien engagierter Professioneller als Illusionen erwiesen, entstanden vielfältige Initiativen von Betroffenen (Selbsthilfegruppen, Irrenoffensive etc.) bzw. Zusammenschlüsse von engagierten Laien und Professionellen, die den Glauben an eine innere Reformfähigkeit der Psychiatrie verloren hatten und vor allem mit juristischen Mitteln Menschenrechtsverletzungen in und durch die Psychiatrie zu bekämpfen versuchen (Beschwerdestellen).
Vor allem in den Selbsthilfeinitiativen wird ein Prinzip der Selbstorganisation erkennbar, das für eine qualitative Reform der Sozialpolitik zu einem entscheidenden Ziel werden könnte. Zugleich besteht gegenwärtig die große Gefahr, daß Selbsthilfezusammenschlüsse von einer neokonservativen Sozialpolitik als billige Kompensation von Defiziten des Versorgungssystems instrumentalisieren. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, sozialpolitische Organisationsprinzipien zu entwickeln, die Selbstinitiative und Selbstorganisation durch sozialpolitische Infrastruktur zu ermöglichen und abzusichern vermögen.
Daß wir uns in einer tiefgreifenden qualitativen Krise bislang vorherrschender wohlfahrtsstaatlicher Programme und Maßnahmen befinden, dürfte mittlerweile von niemandem ernsthaft geleugnet werden. Zugleich sehe ich noch keinen klar ausformulierten Weg, wie diese Krise zu überwinden ist. Die ideologisch hochbesetzten Stichworte wie Selbsthilfe, Nachbarschaftshilfe oder Eigenarbeit decken eher die Perspektivlosigkeit mit Rhetorik zu, als daß sie eine überzeugende Gesamtprogrammatik anbieten könnten. Wir müssen uns hüten, im einzelnen wichtige Initiativen und Anstöße für eine Gesamtlösung auszugeben und politisch zu überhöhen. Der politische Diskurs um die Selbsthilfegruppen, der vor allem von Professionellen geführt wird, sollte uns hier selbstkritisch und nachdenklich machen (vgl. KREUZER, 1983). So wichtig die Entstehung von »autonomen Selbsthilfegruppen« gewesen ist, so wenig läßt sich deren innovativer Kern zur tragenden Säule einer alternativen Sozialpolitik ideologisch hochfeiern.
Für einen großen Teil jener Menschen, die in psychiatrischen Anstalten leben, wird der Konstitutierungsprozeß autonomer Selbsthilfegruppen kein Paradigma sein können. Selbsthilfe als Ersatz zu einem ausgebauten System sozialer Sicherheit ist eine fragwürdige Alternative. Angemessener ist die Suche nach sozialstaatlich garantierten Organisationsprinzipien sozialer Sicherheit, die Selbstorganisation möglich machen, statt die bei Individuen eingetretenen Schäden und Leiden individuell zuzurechnen und zu kompensieren. Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstorganisation sind in unserer Gesellschaft ungleich verteilte Güter, in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Lebenslagen und damit verbundenen Erfahrungen der eigenen Einflußmöglichkeit bzw. Ohnmacht. Bei vorhandenen Selbsthilfeaktivitäten dürften Angehörige der bürgerlichen Schichten deutlich überrepräsentiert sein. Für sie bildet die Bereitschaft, Initiative zu ergreifen und vorhandene materielle und soziale Ressourcen zu aktivieren und zu nutzen, einen Bestandteil ihrer sonstigen Alltagskultur.
Die Mehrheit der Psychiatriepatienten kommt aber aus den sozial benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen, die aufgrund ihrer spezifischen Sozialgeschichte und der ihnen systematisch vorenthaltenen Einflußmöglichkeiten häufig hoffnungslos und demoralisiert sind (KEUPP, 1982a). Die psychischen Beeinträchtigungen sind ja nicht zuletzt Ausdruck und Reaktion auf solche gesellschaftlichen Ohnmachtssituationen. Hier müssen professionelle Unterstützungssysteme Ansatzpunkte für Selbstorganisation schaffen und fördern.
Von diesem Kerngedanken ausgehend, lassen sich einige Überlegungen ableiten, die Antwortrichtungen auf die Frage weisen könnten, welche psychosozialen Hilfen erforderlich sind und wie sie gesellschaftlich erbracht und organisiert sein könnten.
Psychosoziale Infrastrukturmaßnahmen müssen in den alltäglichen Lebenszusammenhang der Menschen integriert sein, um den Aufbau, die Weiterentwicklung und die Verteidigung von sozialen Netzwerken unterstützen zu können, aus denen die Ressourcen für eine bedürfnisbezogene Lebensplanung und deren Realisierung kommen können.
Psychosoziale Infrastrukturen dürfen als zentralen Orientierungspunkt nicht nur die Aufgabe der Versorgung psychisch leidender Menschen haben, also als Krankheitspolitik konzipiert werden. Sie müssen vielmehr Bedingungen dafür schaffen, daß unter Beteiligung möglichst vieler Bürger und Initiativgruppen Lebensformen erprobt werden können, die psychisches Leid minimieren sollen.
Psychosoziale Hilfen müssen dezentral gedacht und organisiert werden und dürfen sich nicht zu großen Spezialinstitutionen verdichten, die quasi selbstläufig zur Ausgrenzung führen. Das bedeutet, daß für alle psychosozialen und psychiatrischen Spezial- und Großeinrichtungen eine radikale Dezentralisierung zu fordern ist (das war auch die Kernforderung des »Auflösungsbeschlusses« der DGSP).
Vorrang vor jeder Spezialeinrichtung muß der Aufbau einer psychosozialen Basis- und Primärversorgung haben, die multiprofessionell zu arbeiten und die den ambulanten Sicherstellungsauftrag zu übernehmen hat. Materielle und personelle Ressourcen, die heute noch überwiegend in Spezialeinrichtungen gebunden sind, müssen in solche territorialen Basisstrukturen überführt werden. Die als notwendig erachteten Spezialdienste (wie Psychotherapeuten der verschiedensten Qualifikation oder psychosomatisehe Speziakliniken) müssen mit den Basisdiensten sinnvoll koordiniert werden und dürfen nicht ohne deren Konsultation aktiv werden.
Die dezentralen, lebens- und arbeitsweltbezogenen psychosozialen Hilfen und Infrastrukturen müssen aus der Logik einer einzelfallbezogenen Leistungserbringung herausgelöst werden. Sie sollten über Ressourcen für die aktive Selbstbeteiligung und Selbstorganisation der Menschen (Betroffener und auch der »normalen« Bürger) verfügen (etwa als Initiativenfonds für Selbsthilfe, Bürgerinitiativen und selbstorganisierte Projekte in der Lebens- und Arbeitswelt).
Gerade für Menschen, die über längere Zeiträume in psychiatrischen Anstalten interniert sind, gibt es häufig keine von der Anstalt unabhängige ausreichende materielle Existenzgrundlage. Aus dieser Tatsache wird deshalb auch häufig die objektive Notwendigkeit von asylären Strukturen begründet (als »Orte zum Leben«). Anstaltsinsassen sind deshalb eine Bevölkerungsgruppe, für die die Forderung nach Einführung eines garantierten Mindesteinkommens besonders dringlich ist.
Die Finanzierungsstruktur psychosozialer Hilfen und Infrastrukturmaßnahmen muß den entwickelten inhaltlichen Prinzipien entsprechend dezentral angelegt sein, d. h. lokal und dezentral steuerbar sowie bedürfnisbezogen.
Ein realistisch konzipierter sozialpolitischer Schritt in Richtung Selbstorganisation, der vor allem Veränderungen am Finanzierungssystem psychosozialer Hilfen vorsieht, ist kürzlich von den sogenannten Plattformverbänden, den fortschrittlichen psychosozialen Organisationen (Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie und Gesellschaftfür wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie), vorgeschlagen worden. Dieser Vorschlag geht von der Überlegung aus, daß eine lebensweltlich orientierte psychosoziale Basisversorgung nur unter aktiver Beteiligung der Bürger einer spezifischen Region entstehen kann. Nur so ist das Ziel von Bedürfnisorientierung und Kontrolle durch die Betroffenen erreichbar. Innerhalb überschaubarer kommunaler und regionaler Einheiten soll entschieden werden, welche Einrichtungen und Unterstützungsleistungen für die hier lebenden Bürger notwendig sind. Die psychosoziale Versorgung wird zur gesetzlich fixierten Aufgabe der Gemeinden. Diese Art der Rekommunalisierung bedeutet, daß der Sicherstellungsauftrag von den Kassenärzten auf die Gemeinden übergehen muß. Sie bedeutet weiterhin, daß alle Leistungsträger (Stadt, Kreis, überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Träger der freien Wohlfahrtspflege) in einen regionalen Verbund einbezogen werden müssen, um die durch das bestehende Leistungsrecht aufgebauten Grenzen zwischen Beratung, Behandlung, Pflege und Rehabilitation aufzubrechen.
Vereinfacht gesagt, soll das Geld, das auf Grund bestehender Sicherungssysteme für die Bewohner einer Region vorhanden ist, in einen Topf geworfen werden. Erst wenn dies geschehen ist, können sinnvolle Einrichtungstypen im Sinne einer bürgerbezogenen Basisversorgung (im Sinne von CRAMER, 1982) neu konstruiert und über pauschale Mischfinanzierung finanziell abgesichert werden.
Dieses Modell formuliert nicht erneut programmatische Ziele (wie Überwindung der Ausgrenzung oder Auflösung totaler Institutionen), sondern versucht,
»die Eigendynamik der Finanzierungsmechanismen in unserem System der sozialen Sicherheit gerade unter Berücksichtigung rigoroser Einsparungen aufzuzeigen und Wege der Überwindung zu benennen« (Psychosoziale Hilfen im regionalen Verband, 1982, S. 5).
Es ist ein wichtiger Vorschlag für eine qualitative Neuorientierung sozialer Sicherungssysteme, der den Vorteil hat, daß er neben dem Prinzip dezentraler Selbstverwaltung auch praktische Wege der finanzpolitischen Realisierung aufzeigt. In diese Richtung müssen weitere praktische Schritte politisch durchgesetzt werden, damit eine »Kultur der Ausgrenzung« aufgebrochen werden kann.
Eine Strukturreform der westdeutschen Psychiatrie hat nicht stattgefunden. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, daß das Programm der Psychiatrie-Enquete gescheitert wäre. Ihr Hauptziel war die Modernisierung der psychiatrischen Versorgung, die ja in dem Zustandsbild der 50er und 60er Jahre wirklich ein Schandmal in einem so fortgeschrittenen wohlfahrtsstaatlich geprägten spätkapitalistischen Land wie der BRD sein mußte. Die Expertenkommission hat den Modernisierungsauftrag mit jener technokratischen Gründlichkeit übernommen, die dem sozialliberalen Planungshorizont der 70er Jahre entsprach. Orientiert war die Planung an international führenden Versorgungsmodellen. Herausgekommen ist der Plan für ein annähernd lückenloses Netz, das über alle denkbaren psychosozialen Krisenherde geworfen werden sollte. Psychisches Leid sollte von einem System »fürsorglicher Belagerung« eingefriedet werden.
Als Modernisierungsprojekt kann sich die Psychiatrie-Enquete durchaus sehen lassen. Die Kliniken sind mittlerweile in einem rundherum vorzeigbaren Zustand. Eine Verkleinerung der Anstalten wird fast überall stolz vermeldet. Auch Sozialpsychiatrische Dienste gehören schon beinahe zur Grundausstattung vieler Regionen. Das Modernisierungsprogramm wäre in noch größerem Umfang realisiert worden, wenn es nicht von der ökonomischen Krise eingeholt worden wäre, die sich schon Mitte der 70er Jahre abgezeichnet hatte.
Die Unterscheidung zwischen Modernisierung und Strukturreform ist von zentraler Bedeutung. In manchen Klagen aus dem Lager der Psychiatriereformer läßt sich heraushören, daß die fiskalische Krise und die »Wendepolitik« ein echtes Reformprojekt um seine Realisierungschance gebracht hätte. Wenn sich die Reformgruppierungen nicht von diesem Mythos lösen, dann verpassen sie die Lektion, die durch die Erfahrungen der letzten Jahre erteilt wurde.
Die Anstalt (die natürlich jetzt nur noch »Klinik« heißt) ist gestärkt aus dem Modernisierungsprozeß und der anhaltenden Krise des Wohlfahrtsstaates hervorgegangen. Vor allem konservativ geführte Kliniken präsentieren sich wieder mit ungebrochenem und zurückgewonnenem Selbstbewußtsein der Öffentlichkeit (nicht nur an Tagen der »offenen Tür«). Sie sind sich gesellschaftlicher Nützlichkeit und Notwendigkeit wieder sicher. Die tiefe gesellschaftliche Spaltung, die sich durch die bundesrepublikanische Gesellschaft zieht und durch die neokonservative Politik verschärft wird, hat die klassischen gesellschaftlichen Kontrollstrukturen reaktiviert. Der für die Psychiatrie seit ihrer gesellschaftlichen Etablierung so grundlegende Zusammenhang von Not und Leid, Armut und psychischen Störungen ist wieder sichtbar geworden.
Die innere Militarisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft (das Setzen auf Stärke, Härte, Leistungsbereitschaft und Elite) führt mit Notwendigkeit zur Regeneration des Kontrollmandats der Psychiatrie. Die Sogwirkung der Anstalt, ihr Prinzip des gesellschaftlichen Ausschlusses, droht auch die wenigen Alternativstrukturen, die in den letzten Jahren entstanden sind (z. B. Sozialpsychiatrische Dienste oder therapeutische Wohngemeinschaften), zu unterspülen.
Der größte Fehler der Psychiatrie-Reformbewegung der Bundesrepublik war wohl, daß sie sich fast ausschließlich für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen eingesetzt hat, nicht für eine Befreiung. Es wurde versucht, den Versorgungspol der Psychiatrie zu stärken und dadurch den Kontrollplan zurückzudrängen. Der Doppelcharakter von Hilfe und Kontrolle, der für die Psychiatrie von Beginn an konstitutiv ist, konnte dadurch nicht außer Kraft gesetzt werden. Umso weniger Ressourcen für eine angemessene Versorgung verfügbar sind, desto deutlicher zeichnet sich wieder die häßliche Fratze der Kontrolle ab.
Jetzt wird erkennbar, daß »fürsorgliche Belagerung« im Sinne umfassender therapeutischer Normallsierungsprogramme die Kontrolldimension nicht auflösen konnte. Gegenwärtig tritt die fürsorgliche Komponente immer mehr in den Hintergrund und es bleibt die Belagerung jener Menschen, die in den Normalitätshorizont nicht hineinpassen oder sich diesem entziehen. In den Psychiatriegesetzen der bundesdeutschen Länder (am ausgeprägtesten im bayerischen Unterbringungsgesetz in seiner kürzlichen novellierten Form) steht der Schutz der Öffentlichkeit (besser: der »öffentlichen Ordnung«) vor störender Devianz im Vordergrund. Persönlichkeits- und Bürgerrechte der psychiatrisch Internierten sind nur minimal geschützt. Hier sind Initiativen der psychiatriekritischen Bewegung in der BRD besonders notwendig. Angesichts der in der BRD kaum vorhandenen Bürgerrechtstradition dürfte es notwendig sein, für eine gesetzliche Form der Absicherung eines besonderen Rechts- und Persönlichkeitsschutzes für psychiatrische Patienten zu kämpfen. Das in Österreich soeben verankerte Sachwaltermodell könnte hier als Vorbild dienen (vgl. FORSTER, 1984; PELIKAN, 1984).
Angesichts einer spürbaren Lähmung in der professionellen Reformszene sind es gegenwärtig vor allem Psychiatriebetroffene, von denen Veränderungsimpulse ausgehen, und diese sind für Professionelle alles andere als bequem. Es werden einerseits elementare Menschenrechte eingeklagt (z. B. die Ablehnung jeder Form von Zwangsbehandlung) und andererseits selbstbestimmte und -organisierte Lebensformen gefordert. Diese Forderungen geraten oft in Widerspruch zu dem, was von professionellen Helfern für therapeutisch notwendig gehalten wird (im »wohlverstandenen Interesse« der Patienten). Diese Widersprüche werden sich nicht völlig aufheben lassen. Für professionelle Helfer wäre es eine wichtige Einsicht, daß durch Stärkung von Selbstorganisation und durch das Einklagen von Menschenrechten der zunehmenden staatlichen und administrativen Kontrollmacht wirksame Elemente von Gegenkontrolle erwachsen. Progressive Professionelle werden sich für neue Bündnisse öffnen und sich von ihrem professionellen Mythos trennen müssen, daß sie stellvertretend für die Betroffenen »zu ihrem Besten« handeln könnten.
Inhaltsverzeichnis
Gemeindepsychologie läßt sich als psychologische Handlungsperspektive charakterisieren,
-
die psychosoziale Probleme als individuelle Lösungsversuche im Kontext der Widersprüche und Belastungen der alltäglichen Lebenswelt begreift. Insofern stellt Gemeindepsychologie nicht die Anwendung psychologischer Konzepte auf die »Gemeinde« dar, sondern sie fragt vielmehr danach, welche Auswirkungen die sozioökonomischen und ökologischen Bedingungen eines spezifischen gesellschaftlichen Lebenszusammenhangs für die in ihm lebenden Individuen haben.
-
Gemeindepsychologie fragt weiterhin danach, wie die psychosoziale Praxis Menschen dabei unterstützen kann, mit den Problemen ihres Alltags besser fertigzuwerden und gesellschaftliche Ursachen immer wiederkehrender Belastungen zu überwinden.
-
Die Erarbeitung gemeindepsychologischer Konzepte ist in entscheidender Weise von Vertretern der Klinischen Psychologie vorangetrieben worden. Sie wollten die konzeptuellen und praktischen Einengungen der psychotherapeutischen Paradigmen auf das individuelle Subjekt und die damit verbundene Vernachlässigung gesellschaftlicher Verursachungsbedingungen überwinden. Sie bemühten sich um den Aufbau und die Erprobung alternativer psychosozialer Praxisformen, die bürgernah und alltagsbezogen arbeiten. Diese Suche nach Alternativen war verbunden mit einer kritischen Analyse bestehender Institutionen und Versorgungsstrukturen.
An einem Beispiel sollen diese Grundgedanken der Gemeindepsychologie nachgezeichnet werden. In den 60er und 70er Jahren sind in den USA und allen westeuropäischen Ländern die bestehenden psychosozialen Institutionen unter Reformdruck geraten. In der BRD hat eine Regierungskommission die grundlegende Reformbedürftigkeit der psychiatrischen Anstalten festgestellt und den Aufbau von gemeindenahen ambulanten Versorgungsformen vorgeschlagen. In vielen Städten und Regionen der BRD sind Versuche gestartet worden, solche ambulanten sozialpsychiatrischen Beratungsstellen aufzubauen.
Bei der konzeptuellen Klärung für einen großstädtischen Sozialpsychiatrischen Dienst kam es zu folgendem Konflikt: Ein beteiligter Verhaltenstherapeut vertrat die klassische klinisch-psychologische Position. Bei der Frage, was denn in dem Neubaugebiet, in dem die Beratungsstelle aufgebaut werden sollte, für spezifische Angebote notwendig seien, argumentierte er: Psychologen hätten bewährte therapeutische Handlungskompetenzen (z. B. Behandlung von Enuresis, von Alkoholabhängigkeit, von Partnerschaftskonflikten oder Phobien). Man müßte diese Kompetenzen wie in einem Supermarkt als Waren anbieten und die spezifische Nachfrage im entsprechenden Einzugsgebiet würde dann schon ergeben, was in dem Versorgungsgebiet gebraucht würde und was nicht.
Diesem Marktmodell psychotherapeutischer Waren wurde als Alternative entgegengesetzt, daß die psychosozialen Praktiker sich erst einmal mit den spezifischen Besonderheiten des Stadtviertels und mit den spezifischen Erfahrungen und Problemen der dort lebenden Menschen vertraut machen müßten. Diese ganz andere Grundhaltung kam besonders gut auf einem Plakat zum Ausdruck, das das ausgewählte Team des aufzubauenden Sozialpsychiatrischen Dienstes bei einer ersten Vorstellung in der Öffentlichkeit präsentierte. Das Plakat transportierte folgende Botschaft:
-
»Wir wissen nichts, denn das Gebiet, wo wir gerade anfangen ist uns fremd und schwer er schließbar. Aber seine Eigenart bestimmt in großem Ausmaß die Schwierigkeiten wie die Bedürfnisse und Möglichkeiten seiner Bewohner, mit denen wir zusammenarbeiten müssen.
-
Wir können nichts, denn wir sind alle dazu ausgebildet worden, im festen institutionellen Rahmen Kranke zu versorgen. Wir müssen erst lernen, den schnellen Sicherheiten zu mißtrauen, damit sich neue Formen des Umgangs mit den Betroffenen entwickeln können.
-
Wir tun nichts, denn wir müssen erst herausfinden, wofür man uns braucht, wo die Quellen der Energie liegen können für eine nützliche Arbeit.«
Dieser Text enthält wesentliche Grundzüge einer gemeindepsychologisehen Perspektive und zeigt die entscheidende Differenz zur traditionellen psychologischen Berufshaltung. Diese geht von dem Fadenkreuz des eigenen therapeutischen und diagnostischen Instrumentariums aus. Eine gemeindepsychologische Perspektive fragt nach den spezifischen Alltagsbedingungen von Lebenswelten sowie nach Bedürfnissen und Ressourcen der Menschen in diesen Lebenswelten. Die professionellen Handlungsmöglichkeiten können erst auf dieser Grundlage entwickelt werden.
In die gesellschaftlichen Reformbewegungen, die in den 60er und 70er Jahren in allen hochindustrialisierten Ländern auf strukturelle Veränderungen der wichtigsten sozialen und kulturellen Lebensbereiche drängten, waren auch Psychologen einbezogen. Neben der Wiederbelebung sozialkritischer Traditionen der Psychologie (z. B. des Freudomarxismus), der Entdeckung von sozialphilosophischen Denksystemen, die für eine gesellschaftskritische Psychologie von großer Bedeutung sind (z. B. die Kritische Theorie oder der Poststrukturalismus eines FOUCAULT) und der Formulierung marxistisch orientierter Systeme von Psychologie (z. B. die Kritische Psychologie oder die Persönlichkeitstheorie von L. SÈVE).
Auch praktisch orientierte Psychologen haben sich um ein kritisches Verständnis psychosozialer Praxis bemüht. Die Herausbildung einer gemeindepsychologischen Perspektive läßt sich als die Partizipation von Psychologen an den Reformbewegungen begreifen und stellt zugleich ihren Versuch dar, in diesen Bewegungen eine eigene Identität als verändernd tätige Psychologen zu finden. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, daß sich die gemeindepsychologische Perspektive aus den Selbstverständnisstrukturen der vorherrschenden akademischen und praktischen Psychologie kritisch herauslösen mußte.
Die kritische Haltung zur eigenen Disziplin und Profession bezog sich in erster Linie auf deren theoretischen und praktischen Reduktionismus, der subjektive Prozesse aus ihrem gesellschaftlichen Kontext löst und seine praktischen Interventionen auf die Modifikation individueller Verhaltenssysteme beschränkt. In dieser Reduktion auf individuelle Prozesse wurde die zentrale systemerhaltende Funktion der Psychologie gesehen: Als veränderliche Komponente wurde meist ausschließlich das einzelne Individuum und selten der gesellschaftliche Rahmen betrachtet. Die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Profession bezog sich vor allem auch auf die traditionellen Praxisfelder und deren institutionelle Gestalt. In die Schußlinie gerieten in erster Linie die ausgrenzenden Institutionen und die psychologischen Handlungsmuster, die zur Ausgrenzung beitragen oder sie legitimieren (angegriffen wurde vor allem die etikettierende Diagnostik).
Damit sich in die Geschichte der Gemeindepsychologie keine berufsständische Verkürzung einschleicht, ist die Feststellung wichtig, daß die meisten Themen, die zentralen ideologischen Grundhaltungen und die gesellschaftsverändernde Reformpraxis, die als grundlegend für eine gemeindepsychologische Perspektive waren und sind, keinen genuin psychologischen Ursprung haben und auch nicht nur bei Vertretern der Gemeindepsychologie anzutreffen sind. Gemeinde- oder Sozialpsychiatrie und Gemeinwesenarbeit sind verglichen mit den Initiativen zur Begründung einer Gemeindepsychologie eher vitalere Strömungen und sie haben für eine gemeindepsychologische Perspektive ein hohes Anregungspotential.
Gemeindepsychologie und ihre Grundhaltung wird also nur verständlich, wenn sie eingeordnet wird in die kritische Bewegung, die sich ab den 60er Jahren eine grundlegende Umstrukturierung zum Ziel gesetzt hat, deren Ursprung ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Die Professionen und Disziplinen, die in die unterschiedlichen Kontrollinstitutionen eingebunden sind, haben sich in ihren jeweils spezifischen Reformdiskussionen strukturell an identischen Themen engagiert (vgl. COHEN 1985): Auflösung von ausgrenzenden Institutionen, die abweichendes Verhalten eher stabilisieren als verändern (Stichworte: Deinstitutionalisierung oder Auflösung von totalen Institutionen); Schaffung von dezentralen Hilfen, die in den Lebensalltag der Menschen eingebunden sind und dessen Ressourcen zu nutzen und zu verbessern versuchen (Stichworte: Gemeindenahe Versorgung, Netzwerkförderung); individuelle Probleme werden aus ihrem gesellschaftlichen Entstehungskontext verständlich gemacht und Veränderungsintentionen und -programme werden eher auf diese bezogen (Stichworte: Prävention, Sozialplanung); kritische Reflexion von Expertenzuständigkeit und deren passivierende Folgen für die Betroffenen und Initiativen zur Stärkung von deren Kompetenzen und Rechten (Stichworte: Deprofessionallsierung, Selbsthilfe, Konsumentenkontrolle, »empowerment«).
In den westlichen Wohlfahrtsstaaten haben die Reformbewegungen durchaus ihre Spuren hinterlassen und viele der einst kritisch gemeinten Ideen sind zeitweise durchaus »staatstragend« geworden (vgl. etwa die »Community Mental Health Centers« in den USA). Aus ihren Reihen kamen die Programmplaner und engagierten Professionellen für die staatlichen Modernisierungsprogramme. Hier liegt sicherlich eine Wurzel für eine Differenzierung bzw. einen tiefgreifenden Widerspruch in der gemeindepsychologisch orientierten Szene. Ein Teil der Gemeindepsychologie (im Verbund mit Gemeindepsychiatrie) versteht sich als Vertreter einer neuen anerkannten Disziplin, die ihr Wissen und ihre praktische Kompetenz zum Aufbau und zur Absicherung neuer Handlungsfelder einsetzt (SOMMER und ERNST 1977).
Eine andere Strömung versteht die gemeindepsychologische Perspektive als kritisch-reflexive Grundhaltung, die auch gegenüber den sozialstaatlichen Modernisierungsprogrammen notwendig ist und die sich um Einschätzungen der Funktion psychologischer Konzepte und Praxisformen im gesamtgesellschaftlichen Kontext bemüht. Diese zweite Linie soll hier weiter verfolgt werden (vgl. KEUPP und RERRICH 1982).
Die gemeindepsychologische Perspektive teilt mit der Mehrheit psychologischer Schulen das Ziel, subjektive Prozesse (Handeln, Erleben) verstehen und nach Wegen suchen zu wollen, ihre positive Entfaltung zu fördern. Die - jeweils unterschiedlich ausgeprägte - Differenz zu den meisten individualpsychologisch ansetzenden Richtungen beginnt bei der Frage, mit welchen Konzepten und Handlungsformen, dieses Ziel erreicht werden kann. Eine gemeindepsychologische Perspektive formuliert kein eigenes Paradigma, auf dem sich eine Disziplin etablieren könnte, sondern erarbeitet mögliche Wissens- und Handlungspotentiale für eine emanzipatorisch-verändernde psychosoziale Praxis. In diesem Sinne ist sie eher ein Suchraster, das sich über spezifische Fragestellungen und Zugangsweisen beschreiben läßt.
Grundlegend für eine gemeindepsychologische Perspektive ist ein thematisches Bewußtsein, das sich auf die Notwendigkeit eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels in den hochindustrialisierten spätkapitalistischen Gesellschaften bezieht, damit individuelles Leid reduziert und positive subjektive Entfaltungspotentiale unterstützt werden können.
Die Übernahme einer gemeindepsychologischen Perspektive bedeutet in diesem Sinne die Bereitschaft, sich für gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen. In dem ersten monographischen Buch zur Gemeindepsychologie spricht MURRELL (1973) etwas moralisierend von dem »sozialen Gewissen«, das die Gemeindepsychologie zu sein habe. Die Beispiele, die er anführt, lassen eine andere Akzentsetzung als sinnvoll erscheinen: Die Aufgabenbestimmung der Gemeindepsychologie ergab sich durch die engagierte Teilnahme von Psychologen an den Antiarmutskampagnen, der Bürgerrechtsbewegung und einer Gesundheitsreform, die auf gleiche Chancen bei der Inanspruchnahme psychosozialer Dienstleistungen zielte. In diesen sozialen Bewegungen ergaben sich für Psychologen Zielsetzungen und Fragestellungen, auf die hin sie ihre berufliche Kompetenz einzusetzen bzw. neu zu entwickeln versuchten.
Bei der Gründungskonferenz der Gemeindepsychologie in den USA ist für diese aktive Rolle von Psychologen in sozialen Bewegungen der Begriff des »participant-conceptualizer« (BENNETT et al. 1966) entwickelt worden. Psychologen werden nicht als neutrale Experten verstanden, sondern als aktive Teilnehmer an sozialen Bewegungen, die innerhalb deren Zielvorgaben sinnvolle psychologische Konzepte und Strategien entwickeln, und zur Diskussion stellen. Gegenüber den 60er Jahren sind es heute vor allem die »neuen sozialen Bewegungen« (BRAND et al. 1983) wie die Frauen-, Ökologie- und Friedensbewegungen, die Identifikationspotentiale für eine gemeindepsychologische Perspektive bieten.
Die gemeindepsychologische Perspektive bemüht sich um ein Verständnis psychischer Probleme, das diese als subjektive Antwort auf gesellschaftliche Ansprüche, Belastungen und Widersprüche zu erklären mag.
Bei der Formulierung entsprechender Modelle kann sich die Gemeindepsychologie einerseits auf klassische Forschungstraditionen beziehen wie die sozialepidemiologische Forschung (vgl. KEUPP 1974), in der nach systematischen Zusammenhängen zwischen sozialen Indikatoren (wie sozialer Status, Geschlechtsrolle, Stadt-Land-Differenz, Mobilität) und Häufigkeitsraten psychischer Störungen gefragt wird. Gleichzeitig beteiligt sie sich an aktuellen Forschungsentwicklungen wie der Untersuchung kritischer Lebensereignisse (FILIPP 1981; FALTERMAIER 1984), der Netzwerkforschung (KEUPP und RÖHRLE 1987) und der transaktionalen Stress-und Bewältigungsforschung (LAZARUS und FOLKMAN 1984; vgl. zusammenfassend KESSLER et al. 1984).
In der kritischen Aneignung dieser Forschungsrichtungen entstehen aber auch Fragestellungen, die über deren immanente Konzepte hinausweisen. Für die Epidemiologie und die epidemiologisch beeinflußte Netzwerk-, »life event«- und Streßforschung stellt sich die Frage, wie deren mechanistische Zusammenhangsmodelle überwunden werden können. Denn das bei ihnen implizierte »Noxendenken« bleibt stärker dem paradigmatischen Grundverständnis des »medizinischen Modells« verhaftet, als es die selbst formulierten Ansprüche der epidemiologischen Forschung vermuten lassen (vgl. die Analyse von GLEISS 1980).
In zwei Richtungen haben sich Forschungsfelder aufgetan, die zu einer Überwindung der implizit mechanistischen Modelle der sozialätiologischen Forschung beitragen könnten. Die eine Richtung läßt sich als die lebensweltliche Erforschung von alltagsbezogenen Belastungen und Widersprüchen und die darauf bezogenen Deutungsmuster und Bewältigungsressourcen kennzeichnen (vgl. BUCHHOLZ 1984). Die andere Richtung geht von der Frage aus, warum individualistische Verarbeitungsmuster gesellschaftlicher Erfahrungen zugenommen haben (PIVEN und CLOWARD 1984). Wo im historischen Vergleich Menschen in ähnlichen Situationen kollektive Widerstandsformen entwickelt haben, erfahren Menschen heute gesellschaftliche Widersprüche in sich selbst (BECK 1983).
Der Psychologie fehlt bislang eine sozialgeschichtlich rekonstruierende Persönlichkeitsforschung, die uns solche Veränderungen erklären könnte. Sehr viel ergiebiger sind hier die soziogenetischen Analysen von Kontrollstrukturen in den Subjekten wie sie durch die Konfigurationssoziologie eines N. ELIAS oder die Machttheorie von M. FOUCAULT ermöglicht worden sind (vgl. MUTZ 1983; HENRIQUES et al. 1984).
Eine gemeindepsychologische Perspektive entfaltet sich nicht durch die Anwendung psychologischer Theorien und Methoden auf »Gemeinde« und gesellschaftliche Bereiche, sondern sie untersucht die realgesellschaftliche Konstitutierung psychosozialer Phänomene in ihrem Alltagszusammenhang und ist in ihren Theoriebildungsprozessen auf der Suche nach »sensitivierenden Konzepten«, die sie in konsequent interdisziplinären Strategien zu entwickeln versucht.
Wenn etwa die sozialen Beziehungsmuster untersucht werden, die Menschen bei der Bewältigung von Krisen und Belastungen zu nutzen versuchen, die ihre Identität prägen und die an der Entwicklung ihrer Lebenspläne beteiligt sind, dann stößt man auf einen sozialen Aggregattyp, der sich natürlich als soziale Gruppe bezeichnen ließe. Gleichzeitig dürfte aber die Anwendung von Befunden der experimentellen Kleingruppenforschung wenig zum Verständnis beitragen. Die gemeindepsychologische Perspektive knüpft hier sinnvollerweise bei einer qualitativen Netzwerkforschung an, die disziplinär eher aus der Sozialanthropologie und der Kommunikationsforschung kommt, die aber wesentlich eher auch die sozialpsychologische Qualität von alltagsbezogener sozialer Interaktion zu erfassen vermag als die gekünstelte Anwendung von Experimentalforschung auf »natürliche soziale Gegebenheiten« (vgl. etwa MAGUIRE 1983).
Bei der Frage, was die positive Lebensqualität spezifischer Lebens- und Arbeitsbedingungen ausmacht, was den Menschen das Gefühl sozialer Zugehörigkeit, Einbindung und Verwurzelung vermittelt, ist das »sensitivierende Konzept« (im Sinne des methodologischen Grundverständnisses des Symbolischen Interaktionismus, vgl. DENZIN 1978) des »psychological sense of community« (SARASON 1974) von großer Bedeutung. In seiner ganzheitlichen Komplexität entzieht es sich einer reduktionistischen Operationalisierung (vgl. den Fehlschlag bei GLYNN 1981), aber es ist in der Lage, stadtsoziologische und sozialpsychologische Befunde und Theoriestränge innovativ zu verknüpfen (vgl. die Übersichten von CHAVIS et al. 1986; MACMILLAN und CHAVIS 1986; KLEIN und D'AUNNO 1986).
Insgesamt läßt sich sagen, daß durch die interdisziplinäre Integration von psychologischen Sichtweisen mit Methoden und Konzepten aus Soziologie, Geschichte, Anthropologie oder Sozialpolitikforschung erst jene »ökologische Denkform« realisiert werden kann, die für die Gemeindepsychologie immer wieder betont wird (RAPPAPORT 1977; HELLER et al. 1984; RÖHRLE 1986). Eine ökologische Herangehensweise lebt von ihrem Alltagsbezug und ihrer Bereitschaft, eine zu enge »disziplinäre Hörigkeit« aufzugeben. Und sie lebt letztlich auch von der Realisierung »partizipativer« Formen von Forschung, in denen Bürger die wissenschaftlichen Konzepte und Forschungsstrategien beeinflussen und evaluieren können (vgl. WANDERSMAN et al. 1983; CHAVIS et al. 1983).
Die gemeindepsychologische Perspektive versteht sich als kritische Evaluation der realen Anwendung von psychologischen Wissensbeständen im gesellschaftlichen Alltag.
Psychologische Deutungsmuster erlangen zunehmend den Rang zentraler kultureller Selbstverständnisfolien. Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Teilbereich, der nicht von psychologischen Interpretationen durchwirkt wäre. In diesem Sinne ist die Psychologie in einem viel umfassenderen Sinne praktisch geworden, als es die Psychologie als angewandte akademische Disziplin sich vornehmen konnte und real erreicht hat. Der gesellschaftliche Bedarf nach Psychologie und deren alltägliche Nutzung geht weit über das hinaus, was wir als Diffusion wissenschaftlich angeleiteter angewandter Psychologie bestimmen können.
Der Psychologe, der sich »in die Gemeinde«, also in den gesellschaftlichen Alltag begibt, findet eine hohe Bereitschaft zur Übernahme psychologischer Lösungsmuster vor. In einer berufsständischen Wahrnehmung mag das als günstige Bedingungen für die Erweiterung psychologischer Dienstleistungen erscheinen. Aus einer gemeindepsychologischen Perspektive stellt sich die Frage, ob mit einer Infiltration psychologischer Deutungsmuster in die Gesellschaft eine Erweiterung subjektiver Handlungschancen verbunden ist oder eher eine »Kolonisierung der Lebenswelt« erfolgt. Bei der Analyse von psychokulturellen Entwicklungen in spätkapitalistischen Gesellschaften sind die bedenklichen Konsequenzen der Individualisierung und Psychologisierung gesellschaftlicher Erfahrungen und Problemlagen herausgearbeitet worden, die immer stärker kollektive Bewußtseins- und Handlungsformen ersetzen und die in den Massenmedien wirksame Vermittlerinstanzen haben (vgl. REISBECK 1985).
Die Literatur zur kritischen Analyse von Psychomarkt und -kultur als die neuen, »weichen« Kontrollformen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen (Vgl. CASTEL et al. 1982; v. KARDORFF 1984; INITIATIVE SOZIALISTISCHES FORUM 1984). In diesen Analysen ist der analytische Blick sehr starr auf die unabweisbare Kontrollseite von Individualisierung gerichtet. Die emanzipatorischen Chancen zu individueller und selbstbestimmter Lebensplanung sind dabei eher vernachlässigt worden (vgl. KEUPP 1986).
Eine gemeindepsychologische Grundhaltung zielt auf die Reflexion der Bedingungen, Formen und Konsequenzen beruflicher psychosozialer Hilfen und stellt in diesem Sinne eine »Widerstandsanalyse des beruflichen Selbstverständnisses« psychosozialer Helferberufe dar (KEUPP 1978).
Die in den 70er Jahren entstandene Expertenkritik (hier sind vor allem die Arbeiten von ILLICH zu nennen) führte zu eher pauschalen Einschätzungen professioneller Hilfe, die einer selbstkritischen Reflexion von Helfern kaum förderlich war.
Inzwischen liegen eine Reihe differenzierter Analysen der Verberuflichungsprozesse von Helfern vor. Hier hat sich die Anwendung theoretischer Konzepte auf die Helferberufe als sehr nützlich erwiesen. In Buchtiteln wie »Mitmenschlichkeit als Beruf« (OSTNER und BECK-GERNSHEIM 1979) oder »Helfen als Beruf. Die Ware Nächstenliebe« (SCHMIDBAUER 1983) wird deutlich, wie Helferberufe einerseits auf Alltagskompetenzen (hier vor allem auf das »weibliche Arbeitsvermögen«) zurückgreifen müssen und die Berufsform von Hilfe notwendigerweise Routinisierung, Distanzierung und Technisierung zur Folge hat.
Hieraus wiederum folgen für die Helfer-Klient-Beziehung Entfremdungsprozesse, die vor allem in den letzten Jahren von Arbeits- und Sozialpsychologen unter dem Stichwort »burnout« untersucht worden sind (Vgl. MASLACH 1982). Die »Mikropolitik des Helfens« (WAITZKIN 1979) wird allerdings auch in der »Burnout«-Literatur häufig psychologisierend reduziert auf Motivationsprobleme oder Persönlichkeitsfaktoren der Helfer. Aus einer gemeindepsychologischen Perspektive geht es darum, die Helferkrisen im Zusammenhang der allgemeinen kulturellen und gesellschaftlichen Krisenentwicklung der spätkapitalistischen Wohlfahrtsstaaten zu interpretieren (vgl. KEUPP 1982; 1986).
Für eine präzise Analyse der grundlegenden Interaktionsprozesse im Hilfeprozeß (z. B. Hilfe suchen, Hilfe geben, Hilfe erhalten) liefert die sozialpsychologische Untersuchung von Hilfebeziehungen wichtiges Material (Vgl. WILLS 1982; und die drei Bände »New directions in helping« von FISHER, NADLER und DEPAULO 1983). Eine solche Analyse zeigt die Fragwürdigkeit des professionellen Mythos von Hilfe gleich »Gutes tun«, und sie macht die subtilen Herstellungsprozesse von Abhängigkeiten und Hilflosigkeiten deutlich, die in der erwähnten expertenkritischen Literatur übergeneralisierend behauptet werden.
Psychosoziale Hilfen werden in spezifischen institutionellen Formen organisiert und lassen sich in dieser Form als gesellschaftliche Antwort auf das Auftreten abweichenden Handelns bestimmen. Die gemeindepsychologische Perspektive fragt nach der Qualität der sozialen Reaktion, die psychosoziale Praxis auf das Herausfallen von Individuen und Gruppen aus gesellschaftlichen Normalitätserwartungen darstellt und nach den Folgen dieser Reaktion für die davon Betroffenen.
Generell lassen sich alle psychosozialen Dienstleistungen und ihre institutionellen Konfigurationen unter dem Gesichtspunkt ihres gesellschaftlichen Doppelmandats untersuchen: Sie leisten Hilfe dort, wo Menschen mit der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme nicht mehr zurechtkommen, und sie üben Kontrolle gegenüber Handlungen und Individuen aus, die gesellschaftlich lizensierte Toleranzgrenzen überschreiten. Das Besondere an psychosozialer Praxis ist die dialektische Verklammerung von Hilfe und Kontrolle. Der gesellschaftliche Verarbeitungsprozeß psychosozialer Problemfragen läßt sich auf verschiedenen Ebenen rekonstruieren.
Im mikrosozialen Bereich ist zu untersuchen, wie Krisen und Devianz in Familien, Nachbarschaften oder am Arbeitsplatz wahrgenommen und bearbeitet werden und welches die Bedingungen dafür sind, ob in den primären sozialen Netzwerken oder der Lebenswelt Probleme als bewältigbar eingeschätzt werden oder ob man institutionelle Hilfen in Anspruch nimmt (vgl. hierzu PERRUCCI und TARG 1982; HOHL 1983; LYNCH 1983). Von besonderer Bedeutung ist hier auch die Verfügbarkeit über psychosoziale und materielle Ressourcen (vgl. hierzu die Bewältigungsforschung: PEARLIN und SCHOOLER 1978; MOOS 1984).
Werden psychosoziale Probleme im lebensweltlichen Alltag nicht mehr bewältigt, wird professionelle Hilfe oder Kontrolle in Anspruch genommen. Die institutionelle Bearbeitung von Problemlagen ist intensiv unter der Fragestellung untersucht worden, wie das Problem bzw. das Individuum, dem dieses zugerechnet wird, durch diese institutionelle Reaktion in einem spezifischen Sinne sozialisiert wird (KEUPP 1980). Vor allem Vertreter der Labeling Perspektive haben sich auf diese Problemstellung konzentriert (WOLFSON 1984) und sich in erster Linie auf die stigmatisierenden Konsequenzen institutioneller Bearbeitung abweichenden Handelns konzentriert (PAGE 1984; SPICKER 1984). Neben der genauen Analyse der Kontrolldimension, die der Labeling Perspektive die Kennzeichnung als Kontrollparadigma eingetragen hat (SCHEFF 1984), läßt sich natürlich auch die Frage der jeweils notwendigen Form von Hilfe und Unterstützung stellen, die vor allem im Zentrum der Erforschung von »Community Support Systems« steht (BIEGEL und NAPARSTEK 1982; GOTTLIEB 1983; SARASON und SARASON 1985).
Auf einer noch allgemeineren Ebene läßt sich nach den sozialpolitischen Konfigurationen fragen, die zu einer spezifischen Systematik von Kontroll und Hilfeformen in einer Gesellschaft führen. Im besonderen haben sich ändernde Konfigurationen Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Etwa die Deinstitutionalisierungsprozesse, die in den 60er und 70er Jahren zu einer kritischen Abkehr von ausgrenzenden Kontrollformen geführt haben (vgl. die umfassenden Analysen von SCULL 1984; BROWN 1985 und COHEN 1985). Von besonderer psychologischer Relevanz ist dabei die These und die zu ihrer Unterstützung gesammelten Belege, daß die sozialpolitischen Maßnahmen in spätkapitalistischen Wohlfahrtsstaaten auf die Herstellung einer »sozialpsychologischen Infrastruktur« in den Individuen zielen, die sich als individuallsierte Internalisierung von Leistungs- und Arbeitsethik kennzeichnen läßt (vgl. RÖDEL und GULDIMANN 1978; MUTZ 1983)
Schließlich stehen Kontrolle- und Hilfemuster in einem gesamtpolitischen Kontext, aus dem heraus Veränderungen sozialpolitischer Tendenzen oder ideologischer Strömungen verständlich gemacht werden müssen. Die Bedeutung solcher gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen ist an der Sozialgeschichte psychosozialer Praxis überzeugend nachgewiesen worden (vgl. etwa FOUCAULT 1969; DÖRNER 1969; CASTEL 1979). So ist die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft die Voraussetzung für die Herausbildung von Individualität, und dies wiederum ist die Voraussetzung von Psychologie als Wissenschaft. Ebenso läßt sich zeigen, daß die Entstehung von Sonderinstitutionen für die verschiedenen Formen von Devianz den interventionistischen Staat zur Bedingung hatte, der sich die Zurichtung und Bereitstellung von Arbeitskraftreserven zur Aufgabe machen konnte. In der Gegenwart entsteht die hochaktuelle Frage, wie der tiefgreifende technologische und ökonomische Strukturwandel in den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften zu neuen sozialen Ordnungsmodellen führt, in denen nicht mehr Chancengleichheit für alle Bürger als Anspruch formuliert wird, sondern sich eine Spaltung in integrierte (der sog. »Kern«) und marginalisierte Bevölkerungsgruppen (die »Peripherie«) vollzieht, für die auch langfristig keine gesellschaftliche Integration mehr möglich sein wird (HIRSCH 1980). Der Sozialstaat und damit auch die Aufgabenfelder der psychosozialen Berufe werden entsprechend diesem gesellschaftlichen Wandel umstrukturiert (vgl. KEUPP 1986).
Angesichts eines sich fortsetzenden und durch aktuelle ökonomische und technologische Entwicklungen sich verstärkenden Auflösungsprozesses traditioneller Lebensformen und einer daraus folgenden Individualisierung von Lebenslagen und Lebenswegen wird aus einer gemeindepsychologischen Perspektive nach Praxisformen gesucht, die in der Lage sind, die Chancen der zunehmenden Individualisierung mit der Ermöglichung neuer kollektiver Erfahrungs- und Lebensformen zu verbinden.
Die Geschichte der Gemeindepsychologie ist eng mit jenen sozialen Bewegungen verbunden, die die Folgen sozialer Ungleichheit überwinden wollten und die psychosoziale Gesundheitssysteme aufzubauen versuchten, die präventiv und alltagsnah an den Bedürfnissen vor allem auch der Bevölkerungsgruppen ansetzen wollten, die durch soziale und ökonomische Unterprivilegierung den größten psychosozialen Belastungen ausgesetzt sind. Dem Aufbau gemeindenaher und dezentralisierter ambulanter Einrichtungen galt und gilt deshalb eine besondere Priorität bei gemeindepsychologisch orientierten psychosozialen Professionellen. Der Anspruch zielt über die Bereitstellung individueller Hilfen im Sinne von Psychotherapie hinaus. Gerade die sehr hoch besetzte Zielorientierung eines präventiven Praxisverständnisses führte zu Versuchen, Lebensbedingungen so zu verändern, daß systematische Belastungsquellen abgebaut werden könnten. Diese Zielorientierung blieb lange Zeit eher ideologisches Bekenntnis, als daß es zu lebendigen Praxisimpulsen geführt hätte.
Ein Grund für die nur zögernd einsetzenden präventiv orientierten Initiativen liegt sicherlich in der Tatsache begründet, daß die meisten gesellschaftlichen Belastungsstrukturen für die Interventionen fortschrittlicher Professioneller nicht erreichbar sind (z. B. Armut, Arbeitslosigkeit). Ein anderer Grund ist darin zu sehen, daß in der Präventivphilosophie ein impliziter Führungsanspruch der professionellen Helfer steckt, die für benachteiligte Individuen und Gruppen bessere Lebensbedingungen schaffen wollen. Diese latente Passivierung konnte erst zu dem Zeitpunkt selbstkritisch erkannt werden, als sich in größerem Umfang Betroffene selbst organisiert hatten und in Selbsthilfeinitiativen und Bürgerinitiativen sich auch gegen die Bevormundung durch professionelle Helfer zur Wehr setzten.
Als Ergebnis der dadurch möglich gewordenen Lernprozesse unterstützt eine gemeindepsychologische Perspektive jetzt sehr viel stärker Prozesse der aktiven Selbstorganisation der Betroffenen und drückt das in dem Konzept der »Bemächtigung« (empowerment) der Betroffenen aus (vgl. RAPPAPORT 1981; RAPPAPORT, SWIFT und HESS 1984).
Professionelle Arbeit soll sich darauf beschränken, Bedingungen und Chancen für selbstorganisierte Aktivität und Projekte zu schaffen und die subjektiven Aneignungsbedingungen der Betroffenen zu verbessern. Stadtteil- und Lebensweltbezug sind nach wie vor zentrale Prinzipien einer gemeindepsychologisch orientierten Praxis, damit Netzwerkförderung (TROJAN et. al., 1987) und Unterstützung kollektiver Lernprozesse möglich werden. Diese wiederum sind gemeindepsychologisch nicht herstellbar, sondern sind abhängig von gesellschaftlichen Bewegungen und durch sie aktivierte Ziele und Ressourcen.
Einige der in diesen Band aufgenommenen Essays sind in der einen oder anderen Form schon einmal publiziert worden. Sie sind noch einmal überarbeitet und zum Teil wesentlich erweitert worden.
Kapitel 1 geht auf einen Vortrag zurück, der beim »Kongreß für Klinische Psychologie und Psychotherapie« im Februar 1986 in Berlin gehalten wurde. Er wurde anläßlich von Vorträgen an der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Ludwig Boltzmann-Institut für Medizinsoziologie am Institut für Höhere Studien in Wien weiterentwickelt.
Kapitel 2 stellt meinen Beitrag zu einer Vorlesungsreihe dar, die im Winter 1984/85 unter dem Titel »Die Zukunft des Helfens« an der FU Berlin durchgeführt wurde. Der Beltz Verlag hat daraus ein Buch gemacht (hg. von D. KLEIBER und B. ROMMELSPRACHER 1986).
Kapitel 3 wurde für einen Vortrag an der Karl-Marx-Universität in Leipzig im Dezember 1985 konzipiert. Er erscheint parallel in dem von W. Voges herausgegebenen Band »Methoden der Biographie und Lebenslaufforschung« im Verlag Leske & Budrich.
Kapitel 4 ist in einer gekürzten Fassung in dem von G. REXILIUS und S. GRUBITZSCH herausgegebenen Grundkurs »Psychologie« (1986) im Rowohlt Verlag erschienen.
Kapitel 5 ist in einer frühen Fassung bei dem »Kongreß für klinische Psychologie und Psychotherapie« im Februar 1984 vorgetragen worden und in das von B. RÖHRLE und W. STARK herausgegebene Kongreßbändchen »Soziale Netzwerke und Stützsysteme« (DGVT-Verlag 1985) aufgenommen worden.
Kapitel 6 erscheint parallel in: M. OPIELKA und I. OSTNER (Hg.): »Der Umbau des Sozialstaats«, Klartext-Verlag Essen 1987.
Kapitel 7 ist in einer gekürzten Fassung in dem von D. FREY und S. GREIF herausgegebenen Buch »Sozialpsychologie - Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen« (2. Auflage 1986 in der Psychologie Verlags Union) enthalten.
Allen beteiligten Verlagen sei für die erteilte Abdruckgenehmigung gedankt.
ADORNO, T. W.: Erziehung nach Ausschwitz. In: Adorno, T. W.: Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt: Suhrkamp, 1969, 85 - 101.
AKERS, R. L.: Deviant behavior: a social learning theory approach. Belmont: Wadsworth, 1973.
ALLAN, G.: Informal networks of care: Issues raised by Barcly. In: British Journal of Social Work, 13, 1983, 417-433.
ARONSON, E., PINES, A. M. und KAFRY, D: Ausgebrannt. Vom Überdruß zur Selbstentfaltung. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983 (engl. 1981)
AUSUBEL, D. P.: Persönlichkeitsstörung ist eine Krankheit. In: KEUPP, H. (Hg.): Der Krankheitsmythos in der Psychopathologie. München: Urban & Schwarzenberg, 1972, 57-69.
BADURA, B. (Hg.): Soziale Unterstützung und chronische Krankheit. Frankfurt: Suhrkamp, 1981.
BADURA, B.: Pflegebedarf und Pflegepolitik im Wandel. In: T. OLK und H.-U. OTTO (Hg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit. Darmstadt: Luchterhand, 1985, 79-93.
BAETHGE, M.: Individualisierung als Hoffnung und als Verhängnis. Aporien und Paradoxien der Adoleszenz in spätbürgerlichen Gesellschaften oder: Die Bedrohung von Subjektivität. In: Soziale Welt, 36, 1985, 299-312.
BARCLAY REPORT: Social workers: Their roles and tasks. London: Beford Square Press, 1982.
BASAGLIA, F. und BASAGLIA-ONGARO, F. (Hg.): Die abweichende Mehrheit. Die Ideologie der totalen sozialen Kontrolle. Frankfurt: Suhrkamp, 1972.
BASAGLIA, F. und BASAGLIA-ONGARO, F.: Befriedungsverbrechen. In: dies. (Hg.): Befriedungsverbrechen. Über die Dienstbarkeit der Intellektuellen. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1980 (ital. 1975), 11-60.
BASAGLIA, F., BASAGLIA-ONGARO, F. und GIANICHEDDA, M. G.: Gesundheit, Krankheit und Gesellschaft. In: KEUPP, H. (Hg.): Normalität und Abweichung. Fortsetzung einer notwendigen Kontroverse. München: Urban & Schwarzenberg, 1979, 317-355.
BASTIAN, T.: Von der Eugenik zur Euthanasie. Ein verdrängtes Kapitel aus der Geschichte der Deutschen Psychiatrie. Bad Wörishofen: Verlagsgemeinschaft Erl, 1981.
BECK, U.: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung sozialer Formationen und Identitäten. In: R. KRECKEL (Hg.): Soziale Ungleichheit. Göttingen: Schwartz, 1983, 35-74.
BECK, U.: Von der Vergänglichkeit der Industriegesellschaft. In: T. SCHMID (Hg.): Das peifende Schwein. Über weitergehende Interessen der Linken. Berlin: Wagenbach, 1985, 85-114.
BECK, U.: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1986.
BELLAK, L.: Tracing the origins of schizophrenia. In: Psychiatry and Social Science Review, 4, 1970, 14-17.
BELLE, D.: The stress of caring: Women as providers of social support. In: L. GOLDBERGER und S. BREZNITZ (Hg.): Handbook of stress. New York: The Free Press, 1982, 496-505.
BELLEBAUM, A., BECHER, H.J. und GREVEN, M. Th. (Hg.): Helfen und helfende Berufe als soziale Kontrolle. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985.
BENNET, C. C., ANDERSON, L. S., COOPER, S., HASSOL, L., KLEIN, D. C. und ROSENBLUM, G. (Hg.): Community psychology: A report of the Boston conference on the education of psychologists for community mental health. Boston: Boston University Press, 1966.
BERGER, P. L. und NEUHAUS, R. I.: To empower people. The role of mediating structures in public policy. Washington, D. C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977.
BIEGEL, D. E. und NAPARSTEK, A.J. (Hg.): Community support systems and mental health. New York: Springer, 1982.
BILLINGS, A. G. und MOOS, R. H.: Psychosocial theory and research on depression: An integrative framework and review. In: Clinical Psychology Review, 2, 1982, 213-237.
BLACK, D. (Hg.): Toward a general theory of social control. Vol. 1 und 2. New York: Academic Press, 1984.
BONGARTZ, D. und GOEB, A.: Irrwege. Ein Psychiatrie-Buch. Reinbek: Rowohlt, 1981.
BONß, W., v. KARDORFF, E. und RIEDMÜLLER, B.: Modernisierung statt Reform. Gemeindepsychiatrie in der Krise des Sozialstaats. Frankfurt: Campus, 1985.
BOTT, E.: Family and social networks. London: Tavistock, 1957.
BRAND, K.-W.: Neue soziale Bewegungen. Entstehung, Funktion und Perspektive neuer Protestpotentiale. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982.
BRAND, K. W., BÜSSER, D. und RUCHT, D.: Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik. Frankfurt: Campus, 1983.
BRAUN, U. und HERGRÜTER, E.: Antipsychiatrie und Gemeindepsychiatrie. Erfahrungen mit therapeutischen Alternativen. Frankfurt: Campus, 1980.
BRODY, J. G.: Informal social networks: Possibilities and limitations for their usefullness in social policy. In: Journal of Community Psychology, 13, 1985, 338-349.
BROWN, P.: The transfer of care. Psychiatric deinstitutionalization and its aftermath. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
BUCHHOLZ, W.: Lebensweltanalyse. Sozialpsychologische Beiträge zur Untersuchung von krisenhaften Prozessen in der Familie. München: Profil, 1984.
BUCHHOLZ, W., GMÜR, W., HÖFER, R. und STRAUS, F.: Lebenswelt und Familienwirklichkeit. Frankfurt: Campus, 1984.
BUCI-GLUCKSMANN, C. und THERBORN, G.: Der sozialdemokratische Staat. Die »Keynesianisierung der Gesellschaft«. Hamburg: VSA, 1982.
BUGENTAL, J.: Stufen therapeutischer Entwicklung. In: R. N. WALSH und F. VAUGHAN (Hg.): Psychologie in der Wende. München: Scherz, 1985, 212-219.
BULMER, M.: Neighbouis. Cambridge: University Press, 1986.
BUMKE, O.: Landläufige Irrtümer in der Beurteilung von Geisteskrankheiten. Wiesbaden 1908.
BUNDESREGIERUNG: Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachverständigen-Kommission über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Drucksache 8/2565. Bonn: Verlag Dr. Heger, 1979.
CAPRA, F.: Wendezeit. - Bausteine für ein neues Weltbild. München: Scherz, 1983.
CASTEL, F.: Die psychiatrische Ordnung. Das goldene Zeitalter des Irrenwesens. Frankfurt: Suhrkamp, 1979 (franz. 1976).
CASTEL, F., CASTEL, R. und LOVELL, A. Psychiatrisierung des Alltags. Produktion und Vermarktung der Psychowaren in den USA. Frankfurt: Suhrkamp, 1982 (franz. 1979).
CHAVIS, D. M., STUCKY, P. E. und WANDERSMAN, A.: Returning basic research to the community: A relationsship between scientist and citizen. In: American Psychologist 38, 1983, 424-434.
CHAVIS, D. M., HOGGE, J. H., MCMILLAN, D. W. und WANDERSMAN, A.: Sense of community through Brunswik's lens: A first look. In: Journal of Community Psychology, 14, 1986, 24-40.
CHERNISS, C.: Professional burnout in human service organizations. New York: Praeger, 1980.
CHERNISS, C. und KRANTZ, D. L.: The ideological community as an antidote to burnout in the human Services. In: B. A. FARBER (Hg.): Stress and burnout in the human service professions. New York: Pergamon, 1983, 198-212.
COHEN, S.: Visions of social control. Crime, punishment and classification. Oxford: Polity Press, 1985.
COHEN, S. und McKAY, G.: Social support, stress and the buffering hypothesis. In: A. BAUM, J. E. SINGER und S. E. TAYLOR (Hg.): Handbook of psychology and health. Vol. 4. Hillsdale: Erlbaum, 1984, 253-267.
COHEN, S. und SCULL, A. (Hg.): Social control and the state. Historical and comparative essays. Oxford: Martin Robertson, 1983.
COHEN, S. H. und SYME, S. L. (Hg.): Social support and health. New York: Academic Press, 1985.
COOPER, B.: Psychische Störungen als Reaktion: Die Geschichte eines psychiatrischen Konzepts. In: KATSCHNIG, H. (Hg.): Sozialer Streß und psychische Erkrankung. München: U & S, 1980, 98-124.
COOPER, D.: Psychiatrische Repression. Überlegungen zur politischen Dissidenz. In: COOPER, D., FOUCAULT, M. et al.: Der eingekreiste Wahnsinn. Frankfurt: Suhrkamp, 1979, 34-39.
CRAMER, M.: Psychosoziale Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer, 1982.
CREWE, N. M. und ZOLA, I. K.: Independent living for physically disabled people. San Francisco: Jossey-Bass, 1983.
DAHRENDORF, R.: Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht. In: J. MATTHES (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft. Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt: Campus, 1983, 25-37.
D'AUGELLI, A.: Social support networks in mental health. In: J. K. WHITAKER und J. GARBARINO (Hg.): Social support networks. New York: Aldine, 1983, 73-106.
DEGKWITZ, R., FAUST, C. und KINDT, H.: Psychisch abnorm und psychisch krank. In: DEGKWITZ, R., HOFFMANN, S. O. und KINDT, H.: Psychisch krank. Einführung in die Psychiatrie für das klinische Studium. München: Urban & Schwarzenberg, 1982, 6- 10.
DEGKWITZ, R. und SIEDOW, H. (Hg.): Standorte der Psychiatrie. Band 2: Zum umstrittenen psychiatrischen Krankheitsbegriff. München: Urban & Schwarzenberg, 1981.
DENZIN, N. K.: The research act. A theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill, 1978.
DEPAULO, B. M., NADLER, A. und FISHER, J. D. (Hg.): New directions on helping. Vol. 2: Help-seeking. New York: Academic Press, 1983.
DESWAAN, A.: The politics of agoraphobia. In: Theory and Society, 10, 1981, 359-385.
DESWAAN, A.: Von Schwierigkeiten zu Problemen. In: M. CRAMER et al. (Hg.): Gemeindepsychologische Perspektiven. Bd. 4. Tübingen: DGVT, 1983,68-82.
DETTLING, W.: Jenseits von Markt und Macht. - Die Krise des Menschen in der Wirtschaftsgesellschaft. In: T. OLK und H.-U. OTTO (Hg.): Der Wohlfahrtsstaat in der Wende. Weinheim: Juventa, 1985, 53 - 60.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT für Soziale Psychiatrie/Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie/Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie: Psychosoziale Hilfen im regionalen Verbund. Analysen und Perspektiven zur Überwindung der Struktur- und Finanzkrise. Tübingen 1982.
DIEMER, N.: Von den Schwierigkeiten einer sozialpolitischen Diskussion unter konservativer Herrschaft. In: Widersprüche, Heft 12, 1984, 5-13.
DIEMER, N.: Gesundheit als Garantie und Hegemonie. Thesen zur Krise des Gesundheitssystems, zu Auswegen und Alternativen. In: Widersprüche, 5, Heft 14, 1985, 85-93.
DÖRNER, K.: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1969.
DÖRNER, K.: Zur Entwicklung der Psychiatrie in der BRD. In: CRAMER, M. und GOTTWALD, P. (Hg.): Verhaltenstherapie in der Diskussion. Gesundheitspolitische und grundlagentheoretische Standpunkte. München: GVT, 1974, 43-50.
DÖRNER, K.: Gewißheiten früher und heute. In: DGSP-Rundbrief Nr. 3 1, Dez. 1985, 20-23.
DÖRNER, K. und PLOG, U.: Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie/ Psychotherapie. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1986 .
DONRENWEND, B. S.: Social stress and community psychology. American Journal of Community Psychology, 6, 1978, 1-15.
DOUGLAS, J. D. und WAKSLER, F. C.: The sociology of deviance. Boston: Little, Brown and Co., 1982.
DREITZEL, H. P.: Körperkontrolle und Affektverdrängung. Zum gesellschaftlichen Hintergrund körper-und gefühlsbetonter Therapieformen. In: Integrative Therapie, 7, 1981, 179-196.
DUBIEL, H.: Was ist Neokonservatismus? Frankfurt: Suhrkamp, 1985.
DUCK, S. (Hg.): Personal relationships 5: Repairing personal relationships. New York: Academic Press, 1984.
EDELWICH J. und BRODSKY, A.: Ausgebrannt - das ‚Burn-out' - Syndrom in den Sozialberufen. Salzburg: AVM-Verlag, 1984 (engl. 1980).
EILERT, D.: Faszination. In: Wechselwirkung, 9, Heft 3, 1985.
EISDORFER, C., COHEN, D., KLEINMAN, A. und MAXIM, P. (Hg.): Models for clinical psychopathology. Lancaster: MTP Press, 1981.
ELIAS, N.: Über den Prozeß der Zivilisation. Frankfurt: Suhrkamp, 1976.
ENGEL, G. L.: Die Notwendigkeit eines neuen medizinischen Modells: Eine Herausforderung der Biomedizin. In: H. KEUPP (Hg.): Normalität und Abweichung. München: Urban & Schwarzenberg, 1979, 63-85.
EVANS, G. W. und COHEN, S.: Environmental stress. In: D. STOKOLS und I. ALTMANN (Hg.): Handbook of environmental psycholgy. New York 1986.
EVERS, A. und OPIELKA, M.: Was heißt hier eigentlich sozial? Kleiner Leitfaden zur Orientierung in einer verwirrenden Auseinandersetzung. In: M. OPIELKA (Hg.): Die ökosoziale Frage. Frankfurt: Fischer, 1985, 15-51.
FABREGA, H., Jr. und MANNING, P. K.: Krankheit, Kranksein und abweichende Karrieren. In: H. KEUPP (Hg.): Normalität und Abweichung. München: Urban & Schwarzenberg, 1979, 213 - 239.
FALTERMAIER, T.: »Lebensereignisse« - Eine neue Perspektive für Entwicklungspsychologie und Sozilisationsforschung. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 4, 1984, 344-355.
FARBER, B. A. (Hg.): Stress and burnout in the human professions. New York: Pergamon, 1983.
FERBER, C. V.: Soziologie für Mediziner. Berlin: Springer, 1975.
FERGUSON, M.: Die sanfte Verschwörung. Persönliche und gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns. München: Knaur, 1983 (engl. 1980).
FERGUSON, M.: Beziehungen. In: A. VILLOLDO und K. DYCHTWALD (Hg.): Wege ins Dritte Jahrtausend Millennium. Basel: Sphinx, 1984, 113-148.
FILIPP, S.-H. (Hg.): Kritische Lebensereignisse. München: Urban & Schwarzenberg, 1981.
FINCH, J. und GROVES, D. (Hg.): A labor of love. London: Routledge & Kegan Paul, 1983.
FISCHER, C. S.: To dwell among friends. Personal networks in town and city. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
FISHER, J. D., NADLER, A. und DEPAULO, B. M. (Hg.): New directions in helping. Vol. 1: Recipient reactions to ald. New York: Academic Press, 1983.
FLEMING, I. und BAUM, A.: The role of prevention in technological catastrophe. In: A. WANDERSMAN und R. HESS (Hg.): Beyound the individual. New York: Haworth, 1985, 139-152.
FORSTER, R.: Rechte setzen sich nicht von selbst durch. Zur Institution des Patientensachwalters im reformierten österreichischen Anhalterecht. In: I. EISENBACH-STANGL und W. STANGL (Hg.): Grenzen der Behandlung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984, 51 - 71.
FORSTER, R. und PELIKAN, J. M.: Krankheit als Karriereprozeß. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Heft 3/4, 1977, 29-42.
FOUCAULT, M.: Psychologie und Geisteskrankheit. Frankfurt: Suhrkamp, 1968
FOUCAULT, M.: Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1969.
FRANK, J. D.: Mental health in a fragmented society. In: American Journal of Orthopsychiatry, 49, 1979, 397-408.
FRENKEL-BRUNSWIK, E.: Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual personality variable. In: Journal of Personality, 28,1949/50, 108-143.
FREUD, S.: Die endliche und unendliche Analyse. GW XVI. (1937). Frankfurt: Fischer.
FREUD, S.: Unbehagen in der Kultur. In: Studienausgabe Bd. IX, Frankfurt: Fischer, 1975.
FREUDENBERGER, H.J.: Ausgebrannt. Die Krisen der Erfolgreichen - Gefahren erkennen und vermeiden. München: Kindler, 1981 (engl. 1980).
FRIED, Marc: Grieving of lost home. In: L.J. Duhl (Hg.): The urban condition. New York: 1963, 151-171.
FUNK, A., HAUPT, H. G., NARR, W.-D. und WERKENTIN, F.: Verrechtlichung und Verdrängung. Die Bürokratie und ihre Klientel. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984.
GAUPP, R.: Die Unfruchtbarmachung geistig und sittlich Kranker und Minderwertiger. Berlin 1925.
GEISLER, G. (Hg.): New Age - Zeugnisse der Zeitenwende. Freiburg: Hermann Bauer, 1984.
GEISSBERGER, W.: Das »kleine Netz« als Beispiel einer sinnvollen Zukunft. In: M. OPIELKA (Hg.): Die ökosoziale Frage. Frankfurt: Fischer alternativ, 1985.
GERHARDT, U.: Der Krankheitsbegriff im Symbolischen Interaktionismus. In: Medizinische Soziologie. Jahrbuch 1. Frankfurt: Campus, 1981, 11-52.
GERHARDT, U.: Typenkonstruktion in Patientenkarrieren. In: M. KOHLI und G. ROBERT (Hg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Stuttgart: Metzler, 1984, 53-77.
GERHARDT, U. und WADSWORTH, M. E.J. (Hg.): Stress and stigma. Explanation and evidence in the sociology of crime and illness. Frankfurt/ London/New York: Campus/Macmillan/St. Martin's Press, 1985.
GESUNDHEITSPOLITISCHER AUSSCHUSS DER DGSP: Bewegung in der Psychiatrie. Der Auflösungsbeschluß und die Politik der DGSP. In: K. E. BRILL (Hg.): Alternativen zum Irrenhaus. Auf der Suche nach einer veränderten Praxis. München: AG SPAK, 1981, 26-40.
GIESE, E.: Psychiatrie ohne Irrenhaus - Das Beispiel Genua. Rehburg Loccum: Psychiatrie-Verlag, 1984.
GLEISS, I.: Psychische Störungen und Lebenspraxis. Entwurf einer psychologischen Perspektive der sozialen Epidemiologie. Weinheim: Beltz, 1980.
GLYNN, Th. J.: Psychological sense of community: Measurement and application. In: Human Relations, 34, 1981, 789-818.
GOFFMAN, E.: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt: Suhrkamp, 1972 (engl. 1961).
GOFFMAN, E.: Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrung. Frankfurt: Suhrkamp, 1977 (engl. 1974).
GOTTLIEB, B. H.: Social support strategies. Beverly Hills: Sage, 1983.
GOULDNER, A. W.: Reziprozität und Autonomie. Frankfurt: Suhrkamp, 1984.
GRANOVETTER, M.: The strength of weak ties. In: American Journal of Sociology, 78, 1973, 1360-1380.
GRIFFITH, J.: Social support providers. In: Basic and Applied Social Psychology, 6, 1985, 41-60.
GROSS, M. L.: Die psychologische Gesellschaft. Kritische Analyse der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychoanalyse und der psychologischen Revolution. Frankfurt: Ullstein, 1984.
GROSS, P.: Reißt das soziale Netz - oder nur der Vorhang? In: DEUTSCHER CARITAS-VERBAND (Hg.): Der Sozialstaat in der Krise? Freiburg: Lambertus, 1984, 28-42.
GROSS, P.: Bastelmentalität: ein ‚postmoderner' Schwebezustand. In: T. SCHMID (Hg.): Das pfeifende Schwein. Über weitergehende Interessen der Linken. Berlin: Wagenbach, 1985, 63-84.
GUZE, S. B.: The future of psychiatry: Medicine or social science? In: Journal of Nervous and Mental Disease. 165, 1977, 223-230.
GUZE, S. B.: Nature of psychiatric illness: Why psychiatry is a branch of medicine. In: Comprehensive Psychiatry, 19, 1978, 295-307.
HABERMAS, J.: Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V. Frankfurt: Suhrkamp, 1985.
HALL, A. und WELLMAN, B.: Social networks and social support. In: S. COHEN und S. L. SYME (Hg.): Social support and health. London: Academic Press, 1985, 23 - 4 1.
HALMOS, P.: The personal service society. London: Schocken, 1970.
HAENSCH, W.: Verarmung in der Beschäftigungskrise. In: K.-H. BALON et al. (Hg.): Arbeitslosigkeit. Wider die Gewöhnung an das Elend. Frankfurt: Fischer, 1986, 41-65.
HARTMANN, F.: Krankheitsgeschichte und Krankengeschichte. Naturhistorische und personale Krankheitsauffassung. In: Marburger Sitzungsberichte, 87, Heft 2, 1966, 17-32.
HELLER, K., PRICE, R. H., REINHARZ, S., RIGER, St. und WANDERSMAN, A.: Psychology and community change. Homewood: Dorsey, 1984.
HENRIQUES, J., HOLLWAY, Q., URWIN, C., VENN, C. und WALKERDINE, V.: Changing the subject. Psychology, social regulation and subjectivity. London: Methuen, 1984.
HENTIG, H. v.: Gruppen-Verführung. In: Psychosozial, 3, 1980, 79-98.
HERZOG, G.: Krankheits-Urteile. Logik und Geschichte in der Psychiatrie. Rehburg-Loccum: Psychiatrie-Verlag, 1985.
HIRSCH, J.: Der Sicherheitsstaat. Das ‚Modell Deutschland', seine Krise und die neuen sozialen Bewegungen. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1980.
HIRSCH, J.: Spaltung oder neue Solidaritäten? In: M. OPIELKA (Hg.): Die ökosoziale Frage. Frankfurt: Fischer alternative, 1985, 80-92 (hier zitiert nach der Manuskriptfassung).
HITZLER, R.: Wir Teilzeit-Menschen. Bemerkungen zu kleinen Lebens-Welten. In: Die Mitarbeit, 34, 1985, 344-356.
HOBFOLL, S. E.: Limitations of social support in the stress process. In: I. G. SARASON und B. R. SARASON (Hg.): Social support. Dordrecht: Martinius Nijhoff, 1985, 391-414.
HOHL J.: Gespräche mit Angehörigen psychiatrischer Patienten. Rehburg-Loccum: Psychiatrie-Verlag, 1983.
HOLAHAN, C.J. und MOOS, R. H.: Social support and adjustment. In: American Journal of Community Psychology, 10, 1982, 403 - 415.
HOLAHAN, C.J. und WANDERSMAN, A.: The community psychology perspective in environmental psychlogy. In: D. STOKOLS und I. ALTMAN (Hg.): Handbook of environmental psychology. New York 1986.
HONNETH, A. und JOAS, H.: Soziales Handeln und menschliche Natur. Anthropologische Grundlagen der Sozialwissenschaften. Frankfurt: Campus, 1980.
HORKHEIMER, M. und ADORNO, T. W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt: Fischer, 1971.
HORN, K.: Der psychoanalytische als Teil eines sozialwissenschaftlichen Krankheitskonzepts. In: Informationen über Psychoanalyse. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, 134-180.
HORWITZ, A. V.: The social control of mental illness. New York: Academic Press, 1982.
INGLEBY, D.: Understanding ‚mental illness'. In: INGLEBY, D. (Hg.): Critical psychiatry. The politics of mental health. New York: Pantheon, 1980, 23-71.
INGLEBY, D.: The social construction of mental illness. In: P. WRIGHT und A. TREACHER (Hg.): The problem of medical knowledge. Examining the social construction of medicine. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1982, 123-143.
INGLEBY, D.: Mental health and social order. In: S. COHEN und A. SCULL (Hg.): Social control and the state. Oxford: Martin Robertson, 1983, 141-188.
INGLEBY, D.: Professionals as socialisers: The »PSY Complex«. Manuskript: Utrecht 1983.
INITIATIVE SOZIALISTISCHEs FORUM FREIBURG (Hg.): Diktatur der Freundlichkeit. Freiburg: Ca Ira, 1984.
ISRAEL, B. A.: Social networks and health status. In: Patient Counselling and Health Education, 4, 1982, 65-79.
JACOBY, R.: Soziale Amnesie. Eine Kritik der konformistischen Psychologie von Adler bis Laing. Frankfurt: Suhrkamp, 1978.
JAHODA, M.: Wieviel Arbeit braucht der Mensch? Arbeit und Arbeitslosigkeit im 20.Jahrhundert. Weinheim: Beltz, 1983 (engl. 1982).
JASPERS, K.: Allgemeine Psychopathologie. Berlin: Springer, 19485.
JERVIS, G.: Kritisches Handbuch der Psychiatrie. Frankfurt: Syndicat, 1978 (a).
JERVIS, G.: Der Mythos der Antipsychiatrie. In: JERVIS, G. und RELLA, F.: Der Mythos der Antipsychiatrie. Berlin: Merve, 1978 (b), 7-59.
JORES, A.: Gestörte Entfaltung als pathogenetisches Prinzip. In: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, 73, 1967, 10 ff.
KADUSHIN, C.: Why people go to psychiatrists. New York: Atherton, 1969.
KÄHLER, H. D.: Ressourcen aus dem sozialen Netzwerk zur Bewältigung von schwierigen Alltagssituationen: Ergebnisse aus einer Erkundungsstudie. In: Neue Praxis, 13, 1983, 262-272 (a).
KÄHLER, H. D.: Der professionelle Helfer als Netzwerker - oder: Beschreib mir dein soziales Netzwerk, vielleicht erfahren wir, wie dir zu helfen ist. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 1983, 225-244 (b).
KAHN; E.: Psychopathen als revolutionäre Führer. In: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 17, 1984, 87-105.
KARDORFF, E. v.: Klienten. In: REXILIUS, G. und GRUBITZSCH, S. (Hg.): Psychologie. Reinbek: Rowohlt, 1986, 121-143.
KELLY, J. G.: Interpersonal and organizational ressources for the contimied development of community psychology. American Journal of Community Psychology, 12, 1984, 313 - 320.
KERN, H. und SCHUMANN, M.: Arbeit und Sozialcharakter: Alte und neue Konturen. In: J. MATTHES (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft. Frankfurt: Campus, 1983, 353-365.
KERN, H. und SCHUMANN, M.: Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion. München: C. H. Beck, 1984.
KESSLER, R. C., McLeod, J. D. und WETHINGTON, E.: The costs of caring. In: I. G. SARASON und B. R. SARASON (Hg.): Social support. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985.
KESSLER, R. C., PRICE, R. H. und WORTMAN, C. B.: Social factors in psychopathology. In: Annual Review of Psychology, 36, 1985, 531-572.
KEUPP, H.: Abweichung und Alltagsroutine. Die Labeling-Perspektive in Theorie und Praxis. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1976.
KEUPP, H.: Gemeindepsychologie als Widerstandsanalyse des professionellen Selbstverständnisses. In: H. KEUPP und M. ZAUMSEIL (Hg.): Die gesellschaftliche Organisierung psychischen Leids. Frankfurt: Suhrkamp 1978, 180-220.
KEUPP, H. (Hg.): Normalität und Abweichung. Fortsetzung einer notwendigen Kontroverse. München: Urban & Schwarzenberg, 1979.
KEUPP, H.: Sozialisation in Institutionen der psychosozialen Versorgung. In: K. HURRELMANN und D. ULICH (Hg.): Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim: Beltz, 1980, 5 7 7 - 602.
KEUPP, H.: Psychologen im psychosozialen Arbeitsfeld. Versuch einer Grenzmarkierung im unwegsamen Gelände widersprüchlicher Deutungsmuster. In: E. v. KARDORFF und E. KOENEN (Hg.): Psyche in schlechter Gesellschaft. München: Urban & Schwarzenberg, 1981, 21-54.
KEUPP, H.: Einleitende Thesen zu einer radikalen geineindepsychologischen Perspektive psychosozialer Arbeit. In: H. KEUPP und D. RERRICH (Hg.): Psychosoziale Praxis. München: Urban & Schwarzenberg, 1982, 11-20.
KEUPP, H.: Sozialepidemiologie. In: H. KEUPP und D. RERRICH (Hg.): Psychosoziale Praxis. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen. München: Urban & Schwarzenberg, 1982, 23-32.
KEUPP, H.: Soziale Kontrolle. Psychiatriesierung, Psychologisierung, Medikalisierung, Therapeutisierung. In: H. KEUPP und D. RERRICH (Hg.): Psychosoziale Praxis. München: Urban & Schwarzenberg, 1982, 189-198.
KEUPP, H.: Kriminalität als soziale Konstruktion - Zum interpretativen Potential der Labeling-Perspektive. In: F. LÖSEL (Hg.): Kriminalpsychologie. Weinheim: Beltz, 1983, 106-117.
KEUPP, H.: Psychisches Leiden und alltäglicher Lebenszusammenhang aus der Perspektive sozialer Netzwerke. In: RÖHRLE, B. und STARK, W. (Hg.): Soziale Netzwerke und Stützsysteme. Tübinger Reihe 6. Tübingen: DGVT-Verlag, 1985 (a).
KEUPP, H.: Soziale Netzwerke - Eine Metapher des gesellschaftlichen Umbruchs. In: H. KEUPP und B. RÖHRLE (Hg.): Soziale Netzwerke. Frankfurt 1987.
KEUPP, H.: Helfer am Ende? Subjektive und objektive Grenzen psychosozialer Praxis in der ökonomischen Krise. In: Kleiber, D. und ROMMELSPACHER, B. (Hg.): Die Zukunft des Helfens. Frankfurt: Beltz, 1986, 103-143.
KEUPP, H. und RERRICH, D. (Hg.): Psychosoziale Praxis. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen. München: Urban & Schwarzenberg, 1982.
KEUPP H. und RÖHRLE, B. (Hg.): Soziale Netzwerke. Frankfurt: Campus, 1987.
KLEE, E. (Hg.): Dokumente zur »Euthanasie«. Frankfurt: Fischer, 1985.
KLEIBER, D.: Helfer-Leiden - Überlegungen zum Burnout in helfenden Berufen. In: Jb. für Psychopathologie und Psychotherapie VI, 1986.
KLEIBER, D. und ROMMELSPACHER, B. (Hg.): Die Zukunft des Helfens. Weinheim, Psychologische Verlagsunion, 1986.
KLEIN, K.J. und D'AUNNO, T.: The psychological sense of community in the workplace. In: Journal of Community Psychology, 14, 1986, 365-377.
KLERMAN, G. L.: Mental illness, the medical model, and psychiatry. In: The journal of Medicine and Philosophy, 2, 1977, 220-243.
KLIPSTEIN, M. v. und STRÜMPEL, B.: Der Überdruß am Überfluß. Die Deutschen nach dem Wirtschaftswunder. München: Olzog, 1984.
KLIPSTEIN, M. V. und STRÜMPEL, B. (Hg.): Gewandelte Werte - Erstarrte Strukturen. Bonn: Verlag Die Neue Gesellschaft, 1985.
KÖHLER, E.: Arme und Irre. Die liberale Fürsorgepolitik des Bürgertums. Berlin: Wagenbach, 1977.
KÖHLER, E.: Thesen zur Psychiatriereform. In: Sozialpsychiatrische Informationen, 15, Heft 1, 1985, 78-91.
KÖPPELMANN-BAILLIEU, M.: Erfahrungen in einem Sozialpsychiatrischen Dienst. In: E. v. KARDORFF und E. KOENEN (Hg.): Psyche in schlechter Gesellschaft. München: Urban & Schwarzenberg, 1981, 138-168.
KRAEPELIN, E.: Einführung in die Psychiatrische Klinik. Leipzig: A.J. Barth, 1905 2.
KRAFFT-EBING, R. v.: Lehrbuch der Psychiatrie. Tübingen 1888.
KREUZER, U.: Zwischen Sozialpolitik und Expertenherrschaft. Über den Verlust originärer Merkmale von Selbsthilfegruppen. In: Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 18, 1983, 297 - 315.
LAING, R. D.: Die Stimme der Erfahrung. Erfahrung, Wissenschaft und Psychiatrie. München: Knaur, 1985.
LAZARUS, R. S. und FOLKMAN, S.: Stress, appraisal, and coping. New York: Springer, 1984.
LEIBFRIED, S. und TENNSTEDT, F. (Hg.): Politik der Armut und Die Spaltung des Sozialstaats. Frankfurt: Suhrkamp, 1985.
LERMAN, P.: Deinstitutionalization and the welfare state. New Brunswick: Rutgers University Press, 1982.
LEVINE, M. A.: Some postulates of practice in community psychology and their implications for training. In: I. ISCOE und C. D. SPIELBERGER (Hg.): Community psychology. New York: Academic Press, 1970, 71-84.
LIN, N., DEAN, A. und ENSEL, W. M.: Social support, life events and depression. New York: Academic Press, 1986.
LINK, B.: Reward system of psychotherapy: Implications for inequities in service delivery. In: Journal of Health and Social Behavior, 24, 1983, 61-69.
LIPP, M.: The wounded healer. New York: Harper & Row, 1980.
LIPTON, F. R., COHEN, C. 1., FISCHER, E. und KATZ, S. E.: Schizophrenia: A network crisis. In: Schizophrenia Bulletin, 7, 1981, 144-151.
LISZT, F. v.: Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. 2. Bd. Berlin 1904.
LITWAK, E.: Helping the elderly. The complementary role of informal networks and formed Systems. New York: Guilford Press, 1985.
LOHMANN, H.: Krankheit oder Entfremdung? Psychische Probleme in der Überflußgesellschaft. Stuttgart: Thierne, 1978.
LORENZ, K.: Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens. In: Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde. 59, 1940.
LUDWIG, A. M. und OTHMER, E.: The medical basis of psychiatry. In: American journal of Psychiatry, 134, 1977, 1087-1092.
LUTZ, R.: Die sanfte Wende. München: Kösel, 1984.
LYNCH, M.: Accomodation practices: Vernacular treatments of madness. In: Social Problems, 31, 1983, 152-164.
MAGUIRE, L.: Understanding social networks. Beverly Hills: Sage, 1983.
MARCUSE, H.: Aggressivität in der gegenwärtigen Industriegesellschaft. In: DAHMER, H. (Hg.): Analytische Sozialpsychologie. Bd. 2. Frankfurt: Suhrkamp, 1980, 452-470.
MARSELLA, A.J. und WHITE, G. M. (Hg.): Cultural conceptions of mental health and therapy. Dordrecht: D. Reidel, 1982.
MASCHEWSKY, W.: Sozialwissenschaftliche Ansätze der Krankheitserklärung. In: Jahrbuch für kritische Medizin, Bd. 10: Krankheit und Ursachen. Berlin: Argument Verlag, 1984, 21 - 42.
MASLACH, C.: Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs.
MCMILLAN, D. W. und CHAVIS, D, M.: Sense of community: A definitions and theory. In: Journal of Community Psychology, 14, 1986, 6-23.
MISHLER, E. G.: The social construction of illness. In: E. G. MISHLER et al.: Social contexts of health, illness and patient care. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, 141-168.
MÖBIUS, P.: Über Entartung. Wiesbaden 1900.
MOOS, R. H. Context and coping: Toward an unifying conceptual framework. In: Americanjournal of Community Psychology, 12,1984,5-36.
MOOS, R. H. und MITCHELL; R. E.: Social network resources and adaptation: A conceptual framework. In: T. A. WILLS (Hg.): Basic processes in helping relationships. New York: 1982, 213-232.
MÜLLER-BRAUNSCHWEIG, C.: Psychoanalyse und Weltanschauung. In: LOHMANN, H.-M. (Hg.): Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Frankfurt: Fischer, 1933, wiederabgedruckt 1984, 109-112.
MUTZ, G.: Sozialpolitik als soziale Kontrolle am Beispiel der psychosozialen Versorgung. München: Profil Verlag, 1983.
NADLER, A., FISHER, J. D. und DEPAULO, B. M. (Hg.): New directions in helping. Vol. 3: Applied perspectives on help-seeking and -recelving. New York: Academic Press, 1983.
NAISBITT, J.: Megatrends. Bayreuth: Hestia, 1984 (engl. 1982).
NARR,W.-D.: Hin zu einer Gesellschaft bedingter Reflexe. In: J. HABERMAS (Hg.): Stichworte zur ‚Geistigen Situation der Zeit'. Bd. 2. Frankfurt: Suhrkamp, 1979, 489-528.
NEGT. O.: Lebendige Arbeit, enteignete Zeit. Politische und kulturelle Dimensionen des Kampfes um die Arbeitszeit- Frankfurt: Campus, 1984.
NOOE, R. M.: A model for integrating theoretical approaches to deviance. In: Social Work, 25, 1980, 366-370.
OFFE, C.: Arbeitsgesellschaft. Strukturenprobleme und Zukunftsperspektiven. Frankfurt; Campus, 1984.
OLK, T.: Der informelle Wohlfahrtsstaat. In: T. OLK und H.-U. OTTO (Hg.): Der Wohlfahrtsstaat in der Wende. Weinheim: Juventa, 1985, 122-151
OLK, T. und HEINZER.: Selbsthilfe im Sozialsektor. In: T. OLK und H.U. OTTO (Hg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit. Bd. 4. Neuwied: Luchterhand, 1985, 223-267.
OLSEN, M. R.: Foreword: Social support networks from a Bristih perspective. In: J. K. WHITTAKER und J. GARBARINO (Hg.): Social support networks. New York: Aldine, 1983, XV-XX.
ONGARO-BASAGLIA, F.: Gesundheit, Krankheit. Das Elend der Medizin. Frankfurt: Fischer, 1985.
OPIELKA, M. und VOBRUBA, G. (Hg.): Das garantierte Grundeinkommen. Entwicklung und Logik einer Forderung. Frankfurt: Fischer, 1985.
OSTNER, I. und BECK-GERNSHEIM, E.: Mitmenschlichkeit als Beruf. Eine Analyse des Alltags in der Krankenpflege. Frankfurt: Campus, 1979.
PAGE, R.: Stigma. Concepts in social policy 2. London: Routledge & Kegan Paul, 1984.
PAINE, W. S. (Hg.): Job stress and burnout. Research, theory and intervention perspectives. London: Sage, 1982.
PATTISON, E. M., LLAMAS, R. und HURD, G.: Social network mediation of anxiety. In: Psychiatrie Annals, 9, 1979, 56-57.
PEARLIN, J.J. und SCHOOLER, C.: The structure of coping. In: Journal of Health and Social Behavior, 19, 1978, 2 - 2 1.
PELIKAN, J. M.: Besonderer Rechts- und Persönlichkeitsschutz für psychiatrische Patienten - Eine Konsequenz des Doppelcharakters der Psychiatrie. In: E. EISENBACH-STANGL und W. STANGL (Hg.): Grenzen der Behandlung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984, 43 - 50.
PERRUCCI, R. und TARG, D. B.: Mental patients and social networks. Boston: Auburn House, 1982.
PFEFFERER-WOLF, H.: Das psychosoziale Projekt in der Krise. Manuskript: Hannover, 1986.
PFOHL, S.J.: Ethnomethodology and criminology. The social production of crime and the criminal. In: I. L. BARAK-GLANTZ und C. R. HUFF (Hg.): The mad, the bad, and the different. Lexington: Heath, 1981, 25-37.
PFOHL, S.J.: Images of deviance and social control. A. sociological history. New York: McGraw-Hill, 1985.
PILISUK, M. und MINKLER, M.: Supportive ties: A political economy perspective. In: Health Education Quarterly, 12, 1985, 93-106.
PINKER, R.: Social policy and social care. In: J. A. YODER (Hg.): Support networks in a caring community. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985, 101-121.
PION, G. M. und LIPSEY, M. W.: Psychology and society. The challenge of change. In: American Psychologist, 39, 1984, 739- 754.
PIVEN, F. F.: Deviant behavior and the remaking of the world. In: Social Problems, 28, 1981, 489-508.
PIVEN, F. F. und CLOWARD, R. A.: Die unsichtbare Auflehnung. In: KICKBUSCH, I. und RIEDMÜLLER, B. (Hg.): Die armen Frauen. Frauen und Sozialpolitik. Frankfurt: Suhrkamp, 1984, 135-162.
PRICE R. H.: Abnormal behavior. Perspectives in conflict. New York: Holt, Rinehart und Winston, 1978 2.
RAMMSTEDT, O.: Zweifel am Fortschritt und Hoffen aufs Individuum. In: Soziale Welt, 36, 1985, 483-502.
RAPPAPORT, J.: Community psychology. Values, research, and action. New York: Holt. Rinehart und Winston, 1977.
RAPPAPORT, J.: In praise of paradox: A social policy of emporwerment over prevention. In: American Journal of Community Psychology, 9, 1981, 1-25.
RAPPAPORT, J.: Seeking justice in the real world. In: Journal of Community Psychology, 12, 1984, 208-216.
RAPPAPORT, J., SWIFT, C. und HESS, R. (Hg.): Studies in empowerment: Steps toward understanding and action. New Yorks: Haworth, 1984.
REISBECK, G.: Massenmedien und soziale Probleme. Eine Studie zur Beziehung zwischen psychischen Störungen, psychosozialer Versorgung und der Öffentlichkeit in der BRD. München: Profil, 1985.
REUBAND, K.-H.: Arbeit und Wertewandel - Mehr Mythos als Realität? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 37, 1985, 723-746.
RICHTER, E. H.: Lernziel Solidarität. Reinbek: Rowohlt, 1979.
RICKEL, A. U.: Community psychology 's emerging identity. In: Division of Community Psychology Newsletter, 18, 1985, 1- 2.
RIEDMÜLLER, B.: Das ambulante Ghetto - Zur Entwicklung der Gemeindepsychiatrie in der Bundesrepublik. In: T. OLK und H.-U. OTTO (Hg.): Gesellschaftliche Perspektiven in der Sozialarbeit, 4: Lokale Sozialpolitik und Selbsthilfe. Neuwied: Luchterhand, 1985, 55-78.
RIPPERE, V. und WILLIAMS, R.: Wounded healers. Mental health workers' experience of depression. Chichester: John Wiley, 1985.
RÖDEL, U. und GULDIMANN, T.: Sozialpolitik als soziale Kontrolle. In: T. GULDIMANN et al.: Sozialpolitik als soziale Kontrolle. Frankfurt: Suhrkamp, 1978, 11-55.
RÖHRLE, B.: Gemeindepsychologie. In: C. F. GRAUMANN, L. KRUSE und E. D. LANTERMANN (Hg.): Umweltpsychologie. München: Psychologische Verlagsunion, 1987.
ROSEMARYR, L.: Wege zum Ich vor bedrohter Zukunft. In: Soziale Welt, 36, 1985, 276-298.
ROTHMAN, D.: The discovery of the asylum. Boston: Little Brown, 1971.
RUESCH, J.: Die soziale Unfähigkeit. Das Problem der Fehlanpassung in der Gesellschaft. In: BASAGLIA, F. und F. BASAGLIA-ONGARO (Hg.): Die abweichende Mehrheit. Frankfurt: Suhrkamp, 1972, 79-97.
RUEVENI, U.: Networking familles in crisis. New York; Human Science Press, 1979.
SANDLER, I. N.: Life stress events and community psychology. In: I. G. SARASON und C. D. SPIELBERGER (Hg.): Stress and anxiety. Vol. 6. New York: 1979, 213-232.
SARASON, I. G. und SARASON, B. R. (Hg.): Social support. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985.
SARASON, S. B.: The psychological sense of community. Prespects for a community psychology. San Francisco: Jossey-Bass, 1974.
SARASON, S. B.: Community psychology, networks, and Mr. Everyman. In: American Psychologist, 31, 1976, 317-328.
SARBIN, T. R. und MANCUSO, J. C.: Schizophrenie? Medizinische Diagnose oder moralisches Urteil? München: U & S, 1982.
SCHEFF, T.J.: Being mentally ill. A sociological theory. New York: Aldine, 1966 (l. Ed.); 1984 (2. Ed.).
SCHENK, M.: Das Konzept des sozialen Netzwerkes. In: F NEIDHARD et al. (Hg.): Gruppensoziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1983, 88-104.
SCHENK, M.: Soziale Netzwerke und Kommunikation. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1984.
SCHIENSTOCK, G.: Die Entdeckung des Subjekts in der Streßforschung. In: Medizinische Soziologie, Jahrbuch 3. Frankfurt: Campus, 1983, 132-157.
SCHMID, T. (Hg.): Befreiung von falscher Arbeit. Themen zum garantierten Mindesteinkommen. Berlin: Wagenbach, 1984.
SCHMIDBAUER, W.: Die hilflosen Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Reinbek: Rowohlt, 1. Aufl. 1977, 2. Aufl. 1980.
SCHMIDBAUER, W.: Helfen als Beruf. Die Ware Nächstenliebe. Reinbek: Rowohlt, 1983.
SCHMIDT-TRAUB, S.: Der Irrsinn mit der beruflichen Bildung. Soziologische und psychologische Probleme bei der Stabilisierung am Arbeitsplatz und beruflichen Wiedereingliederung von psychisch Kranken. In: H. KEUPP et al. (Hg.): Im Schatten der Wende. Tübingen: DGVT, 1985, 171-185.
SCHNEIDER, K.: Klinische Psychopathologie. Stuttgart: Thieme, 19678
SCHÜLEIN, J. A.: Psychotechnik als Politik. Zur Kritik der pragmatischen Kommunikationstheorie. Frankfurt: Syndikat, 1976.
SCHÜLEIN, J. A.: Normalität und Opposition. Über Ursachen und gesellschaftliche Funktion der »Alternativbewegung«. In : Leviathan, 11, 1983, 252- 274.
SCHUR, E. M.: Interpreting deviance. A sociological introduction. New York: Harper & Row, 1979.
SCHWAB, J.J., BELL, R. A., WARHEIT, G.J. und SCHWAB, R. B.: Social order and mental health. The Florida health study. New York: Brunner/ Mazel, 1978.
SCULL, A. T.: Die Anstalten öffnen? Decarceration der Irren und Häftlinge. Frankfurt: Campus, 1980 (engl. 1977).
SCULL, A. T.: Competing perspectives on deviance. In: Deviant Behavior, 5, 1984, 275-289.
SCULL, A.T.: Decarceration: Community treatment and the deviant. 2. Edition. Oxford: Polity Press, 1984.
SEDGWICK, P.: Psycho Politics. London: Pluto Press, 1982.
SHINN, M., LEHMAN, S. und WONG, N. W.: Social interaction and social support. In: Journal of Social Issues, 40, 1984, 55 - 76.
SIEMEN, H.-L.: Das Grauen ist vorprogrammiert. Psychiatrie zwischen Faschismus und Atomkrieg. Gießen: Focus Verlag, 1982.
SIMMEL, G.: Schriften zur Soziologie. Hg. H.-J. DAHME und O. RAMMSTEDT. Frankfurt: Suhrkamp, 1983.
SOMMER, G. und ERNST, H. (Hg.): Gemeindepsychologie. München: Urban & Schwarzenberger, 1977.
SOZIALISTISCHES BÜRO: Aufstehen gegen den Sozial-Spar-Staat. Extrablatt der Zeitschrift »Widersprüche«, 1982.
SPECK, R. und ATTMEAVE, C.: Die Familie im Netz sozialer Beziehungen. Freiburg: Lambertus, 1976.
SPICKER, P.: Stigma and welfare. London: Croom Helm, 1984.
STEPHAN, E.: Zur Bedeutung einer gesetzlichen Regelung psychologischer Berufstätigkeit. In: Psychologische Rundschau, 33, 1982, 305-313.
STOOSS F.: Der Arbeitsmarkt der Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. In: Blätter der Wohlfahrtspflege, 131, 1984, 209 - 211.
STROEBE, M. S. und STROEBE, W.: Who suffers more? Sex differences in health risks of the widowed. In: Psychological Bulletin, 93, 1983, 279-301.
STROHMEIER, H. P.: Quartier und soziale Netzwerke. Frankfurt, Campus, 1983.
SZASZ, T. S.: The myth of mental illness. American Psychologist, 15, 1960, 113 - 118 (deutsch in: SZASZ, T. S. Psychiatrie - Die verschleierte Macht. Frankfurt: Fischer, 1978, 22-37).
SZASZ, T. S.: The concept of mental illness: Explanation or justification? In: ENGELHARDT, H. T., Jr. und SPICKER, S. F. (Hg.): Mental health: Philosophical perspectives. Dordrecht: D. Reidel, 1978, 235-250.
TENNANT, A. und BAYLEY, M.: The eight decade: Family structure and support networks in the community. In: J. A. YORDER (Hg.): Support networks in a caring community. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985.
THOITS, P. A.: Coping, social support, and psychological outcomes. In: Review of Personality and Social Psychology, 5, 1985, 219-238.
THOITS, P. A.: Self-labelling processes in mental illness: The role of emotional deviance. In: American Journal of Sociology, 91, 1985, 221-249.
THOME, H.: Wandel zu postmaterialistischen Werten? In: Soziale Welt, 36, 1985, 27-59.
THORBECKE, R.: Bewältigung von Krankheitsepisoden in der Familie. In: Dr. RITTER-RÖHR (Hg.): Der Arzt, sein Patient und die Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1975, 52-111.
THUN, T.: Nur Heilige und Poeten? Gemeindepsychiatrie und Arbeitermedizin in einem römischen Bezirk. München: Profil Verlag, 1984.
TOLSDORF, C. C.: Social networks, support, and coping: An explanatory study. In: Family Process, 15, 1976, 407-417.
TRICKETT, E.J.: Toward a distinctive community psychology: An ecological metaphor for the conduct of community research and the nature of training. In: American Journal of Community Psychology, 12, 1984, 261-279.
TRICKETT, E.J., KELLY, J. G. und VINCENT, T. A.: The spirit of ecological inquiry in community research. In: E. C. SUSSKIND und D. D. KLEIN (Hg.). Community research. New York: 1985, 283-333.
TROJAN, A. et al.: Selbsthilfe, Netzwerkforschung und Gesundheitsförderung. In: H. KEUPP und B. RÖHRLE (Hg.): Soziale Netzwerke. Frankfurt: Campus, 1987.
TURKINGTON, C.: What price friendships? The darker side of social networks. In: APA-Monitor, 16, 1985, 38-41.
UNGER, D. G. und WANDERSMAN, A.: The importance of neighbors: The social, cognitive, and affective components of neighboring. In: American journal of Community Psychology, 13, 1985, 139-169.
VEROFF, J., KULKA, R. A. und DOUVAN, E.: Mental health in America. Patterns of help-seeking from 1957 to 1976. New York: Basic Books, 1981.
VIF (Vereinigung für Integrationsförderung): Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung Stand: 07.06.2005, Link aktualisert durch bidok) der Behinderten. München: VIF-Selbstverlag, 1982.
WAITZKIN, H.: Medicine, superstructure, and micropolitics. In: Social Science & Medicine, 13A 1979, 601-609.
WALKER, A.: From welfare state to caring society? In: J. A. YODER (Hg.): Support networks in a caring community. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985, 41-59.
WALSH, R. N. und VAUGHAN, F. (Hg.): Psychologie in der Wende. Grundlagen, Methoden und Ziele der Transpersonalen Psychologie - eine Einführung in die Psychologie des Neuen Bewußtseins. München: Scherz, 1985.
WAMBACH, M. M. und HELLERICH, G.: Therapie-Reform als Versorgungsreform? In: M. M. WAMBACH (Hg.): Die Museen des Wahnsinns und die Zukunft der Psychiatrie. Frankfurt: Suhrkamp, 1980, 200-228.
WANDERSMAN, A., CHAVIS, D. und STUCKY, P.: Involving citizens in research. In: R. KIDD und M. SAKS (Hg.): Advances in applied social psychology. Vol. 2. Hilsdale: Lawrence Erlbaum, 1983.
WARREN, D. I.: Helping networks. How people cope with problems in the urban community. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981.
WECKOWICZ, T. E.: Models of mental illness: Systems and theories of abnormal psychology. Springfield: C. C. Thomas, 1984.
WEBER, M.: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: WEBER, M.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1963.
WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Köln 1964.
WELLMAN, B.: The community question. The intimate networks of East Yorkers. In: American Journal of Sociology, 84, 1979, 1201-1231.
WELLMAN, B.: Domestic work, paid work and network. In: S. DUCK und D. PERLMAN (Hg.): Personal relationships. London: Sage, 1985, 159-191.
WENGER, G. C.: The supportive network. London: George Allen & Unwin, 1984.
WHITTAKER, J. G. und GARBARINO, J. (Hg.): Social support networks. New York: Aldine, 1983.
WILLS, T. A. (Hg.): Basic processes in helping relationships. New York: Academic Press. 1982.
WINETT, R. A.: An emerging approach to energy conservation. In: D. GLENWICK und L. JASON (Hg.): Behaviorial community psychology. New York 1980.
WING, J. K., Reasoning about madness. Oxford: Oxford University Press, 1978.
WITTCHEN, H.-U. und FICHTER, M. M.: Psychotherapie in der Bundesrepublik. Weinheim 1980.
WOLFSON, Ch.: Social deviance and the human services. Springfield: Ch. C. Thomas, 1984.
YODER, J. (Hg.): Support networks in a caring community. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985.
YOUNG, A.: The discourse on stress and the reproduction of conventional knowledge. In: Social Science and Medicine, 14B, 1980, 133-146.
Quelle:
Heiner Keupp: Psychosoziale Praxis im gesellschaftlichen Umbruch - Sieben Essays. Psychiatrie-Verlag, Bonn 1987, ISBN 3-88414-077-9, http://psychiatrie.de/verlag
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 07.06.2005
