Die Diagnose "Geistige Behinderung" bei Erwachsenen und die diesbezüglichen Sichtweisen unterschiedlicher Systeme
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister (FH) für sozialwissenschaftliche Berufe. Erstbegutachterin: Dr.in Dorit Sing, Zweitbegutachterin: Mag.a Brigitte Humer. Linz, am 6. April 2007. Fachhochschul-Studiengang Soziale Dienstleistungen für Menschen mit Betreuungsbedarf Linz
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- 1 Einleitung
-
2 Klassifikationen
- 2.1 Geschichte der Internationalen Klassifikation
- 2.2 Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision (ICD 10)
- 2.3 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM)
- 2.4 Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
- 2.5 Kritische Betrachtung
- 3 Konstruktivismus und Wirklichkeit
-
4 Empirische Untersuchung
- 4.1 Methode
- 4.2 Konzeptionelle Erläuterungen
- 4.3 Ausgangslage: Eigene Vorerfahrung
- 4.4 Die erste Interviewserie: Projekt Wien
- 4.5 Die zweite Interviewserie
- 4.6 Die dritte Interviewserie: Geistige Behinderung
- 4.7 Sichtweisen von ProfessionistInnen zur Diagnose "Geistige Behinderung"
- 4.8 Versuchte Erhebung von oberösterreichweiten Daten
- 4.9 Diskussion der Ergebnisse
- 5 Zusammenfassung und Fazit
- 6 Literatur
- 7 Abkürzungsverzeichnis
- 8 Anhang
- Eidesstattliche Erklärung
Nebenberuflich zu studieren, kostet vor allem eines - Zeit.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei meiner Lebensgefährtin dafür bedanken, dass sie mir ein großes Stück dieser Zeit geschenkt und mir vor allem im letzten Monat der intensiven Beschäftigung mit dieser Arbeit den Rücken frei gehalten hat.
Meine Kinder mussten in dieser Zeit häufig auf mich verzichten. Sie sahen mich im letzten Monat fast ausschließlich morgens beim Aufstehen und abends, wenn ich sie ins Bett brachte. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür bedanken, dass sie sich trotzdem jedes Mal freuten, mich zu sehen. Ihr Lächeln, ihre Umarmungen und dass sie mich manchmal vor Freude fast umgerannt haben, gehörten zu den schönsten Augenblicken in der Zeit der Erstellung dieser Arbeit.
Sie sind nicht geistig behindert!
Der Umstand, dass Sie eine Arbeit, die zu Erlangung eines universitären Titels geschrieben wurde, in Händen halten, darin blättern und nun tatsächlich zumindest den Beginn der Einleitung gelesen haben, reicht aus, um zu dieser Annahme zu kommen. Für einige (wenige) LeserInnen mag das zwar nicht genug sein, und man müsste für sie eine Studie in Auftrag geben, die nach wissenschaftlichen Kriterien valide und reliabel einen reziproken Zusammenhang zwischen dem Lesen dieser Diplomarbeit und der Diagnose "geistig behindert" in Bezug auf die diese Arbeit Lesenden nachweist, dennoch kann auch bei dieser Gruppe davon ausgegangen werden, dass sie, nach ihrer persönlichen Meinung befragt, das zu erwartende Resultat dieser Studie als weit reichende Bestätigung der erwähnten Annahme antizipieren würden. Das bedeutet, dass wir, der Autor und der/die Lesende, so Sie mir bis hierher zustimmen, eine Einschätzung und eine, einen Detailbereich betreffende, Bewertung einer Gruppe von Menschen (jene, die als "geistig behindert" diagnostiziert worden sind) vorgenommen haben. Nun ist der Umstand, dass einige Menschen davon ausgehen, dass Menschen mit der Diagnose "Geistige Behinderung" keine universitären Arbeiten lesen würden, für diese Menschen selbst nicht als besonders relevant anzunehmen. Dennoch ist diese Einschätzung Teil einer Bewertungs- und Einstufungsfülle, die den betroffenen Menschen aufgrund der Diagnose entgegengebracht wird und die sie, meist ohne ihr Wissen, in bestimmte vorgezeichnete Kategorien zwingt.
In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie die Diagnose einer geistigen Behinderung bei erwachsenen Menschen zustande kommt, welchen wissenschaftlichen Hintergrund die Diagnoseerstellung hat und wie die diesbezügliche Praxis am Beispiel der Behindertenhilfe in Oberösterreich aussieht. Weiters soll gezeigt werden, wie behinderte Menschen, im Besonderen Erwachsene, die als geistig behindert eingestuft wurden, "ihre Behinderung" sehen und wie umgebende Systeme diese Behinderung bewerten und beeinflussen.
Im ersten Teil dieser Arbeit sollen zunächst für die Themenstellung relevante theoretische Grundlagen vorgestellt werden. So wird in Kapitel 2 ein Überblick über die gebräuchlichsten Klassifikationssysteme gegeben, ihr geschichtlicher Hintergrund beleuchtet und auf die diesbezüglichen Rahmenbedingungen in Österreich eingegangen.
Im dritten Kapitel werden relevante erkenntnistheoretische Aspekte des Konstruktivismus beschrieben. Dabei wird besonderes Augenmerk auf objektives Wissen und die operative Geschlossenheit von Systemen und ihre Auswirkung auf die daraus resultierenden Sichtweisen dieser Systeme gelegt.
Das vierte Kapitel beinhaltet den empirischen Teil dieser Arbeit. Im Rahmen der ausführlich beschriebenen Untersuchung werden körperlich beeinträchtigte Personen und Menschen, die als geistig behindert eingestuft worden sind, zu ihren Ansichten zum Begriff Behinderung und ihren Erfahrungen mit den Sichtweisen umgebender Systeme befragt und aus den Ergebnissen dieser Befragungen Hypothesen entwickelt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse einer Umfrage unter in der Betreuung geistig und mehrfach behinderter Menschen tätiger Personen vorgestellt und mit den Antworten von MedizinerInnen und PsychologInnen, die mit der Diagnose einer geistigen Behinderung betraut sind, verglichen. Abgerundet wird der empirische Teil mit Angaben von Institutionen und der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich.
Als Methode für den empirischen Teil dieser Arbeit wurde die Grounded Theory nach Glaser gewählt. Die darin enthaltene Beschreibung der Untersuchung versteht sich als nachvollziehbarer Weg zur Erstellung einer begründeten Theorie, die Basis für weitere Forschungen sein kann.
Im letzten Teil schließlich folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein daraus resultierendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1 Geschichte der Internationalen Klassifikation
- 2.2 Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision (ICD 10)
- 2.3 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM)
- 2.4 Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
- 2.5 Kritische Betrachtung
Unbekanntes zu benennen, zu katalogisieren und zu kategorisieren ist ein wesentlicher Grundbaustein menschlicher Kommunikation. Zum einen liegt diesem Umstand der Wunsch zugrunde, durch eindeutige Zuordnung eines Namens die Zeit, die für eine analoge Beschreibung benötigt würde, zu verkürzen (vgl. Watzlawick 2003, S. 61ff über digitale und analoge Kommunikation), zum anderen bietet die Kategorisierung, etwas Unbekanntes und Neues in bestimmte festgelegte Kästchen einzuordnen, abzulegen und nötigenfalls (relativ) schnell wiederzufinden, Sicherheit.
Die BewohnerInnen[1] von Institutionen für geistig und mehrfachbehinderte Menschen haben bei aller Vielfalt des Individuums eines gemein: Irgendwann in ihrem Leben, ob gleich bei der Geburt oder später, erhielten sie eine (meist medizinische) Primärdiagnose. Diese Primärdiagnose gekoppelt mit der Unmöglichkeit der generellen Teilhabe am "normalen" gesellschaftlichen Leben, aus welchen Gründen auch immer, war und ist die Eintrittskarte in die Welt der institutionalisierten Behindertenhilfe. Es erscheint deshalb angebracht, sich mit der Geschichte der Klassifikationen, in denen Diagnosen katalogisiert beschrieben werden, näher zu beschäftigen und die für den in dieser Arbeit betrachteten Forschungsgegenstand relevanten Manuale aufzuzählen und zu beschreiben. Wichtig erscheint auch, die diesbezüglichen Rahmenbedingungen für Österreich zu beleuchten und darzulegen, was nach den beschriebenen Klassifikationssystemen die Diagnose "Geistige Behinderung" bedeutet.
Der ursprüngliche Motor der statistischen Klassifikationsentwicklung war die Todesursachenforschung (vgl. WHO, URL: http://www.who.int [History of ICD]). 1785 verfasste William Cullen (1710 - 1790) in Edinburgh seine Synopsis nosologiae methodicae, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts die am meisten benutzte Klassifikation der Krankheiten war. William Farr (1807 - 1883), der Leiter des 1837 gegründeten Statistischen Amtes für England und Wales, sah die Cullen´sche Klassifikation, auch wegen des Fortschritts der Medizin, bald als nicht mehr ausreichend an und urgierte eine allgemein anwendbare statistische Nomenklatur für Todesursachenverzeichnisse. Auf dem 1. Internationalen Statistischen Kongress 1853 in Brüssel wurde Farr zusammen mit seinem Genfer Kollegen Marc D´Espine mit der Erstellung einer international anwendbaren Klassifikation der Todesursachen beauftragt. Im Rahmen des 2. Internationalen Kongresses in Paris 1855 legten die beiden zwei von völlig unterschiedlichen Grundsätzen ausgehende Verzeichnisse vor, die zunächst in einem Kompromiss gipfelten, der aber 1864 auf Grundlage von Farrs Vorschlag nach Unterscheidung zwischen Allgemeinkrankheiten und lokalisierten Organkrankheiten wieder revidiert wurde. Diese Vorgehensweise wurde zwar noch nicht allseits anerkannt, verdient aber eine Erwähnung, da sie den Grundstein für die 1891 in Wien beauftragte und 1893 in Chicago von Jacques Bertillon (1851 - 1922) und des von ihm geleiteten Ausschusses im Rahmen einer Tagung des Internationalen Statistischen Institutes (vormals Internationaler Statistischer Kongress) vorgeschlagene Klassifikation der Todesursachen legte. Die "Bertillon Classification of Causes of Death" (ebd., S. 2), wie sie ursprünglich genannt wurde, fand schnell Anerkennung und wurde von verschiedenen Ländern und Städten übernommen. 1898 empfahl die American Public Health Association den "registrars[2]" von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika diese Klassifikation ebenfalls zu verwenden und sie alle zehn Jahre zu überarbeiten. Beim ein Jahr später stattfindenden Kongress des Internationalen Statistischen Institutes in Christiania wurde eine Resolution verabschiedet, die insistierte, dass neben den amerikanischen statistischen Ämtern auch alle europäischen Institute die Bertillion-Klassifikation ohne Veränderungen übernehmen und verwenden sollten. Überdies wurde der amerikanische Vorschlag nach einer Revision pro Dezennium angenommen. Auf Einladung der französischen Regierung berieten ab August 1900 Delegierte aus 26 Ländern über die 1. Revision. Weitere Konferenzen fanden 1909 (ein Jahr früher als geplant) und 1920 statt. Als Bertillion, der als Leiter der Internationalen Konferenzen auch ihr Motor war, 1922 verstarb, geriet die weitere Arbeit zunächst ins Stocken. Das bisher Erreichte war noch nicht weltweit anerkannter Standard, die meisten Staaten oder Organisationen, die sich für eine statistische Klassifikation interessierten, verwendeten aber die beschlossenen Revisionen der Bertillion-Klassifikation als Basis ihrer eigenen Überlegungen; so auch der Völkerbund, der 1928 eine vom Leiter der statistischen Dienste der obersten deutschen Gesundheitsbehörde Emil Roesle herausgegebene Untersuchung zur Erweiterung der Gruppen des Internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1928 veröffentlichte. Zur Koordination der Arbeiten des Internationalen Statistischen Institutes und der Gesundheitsorganisation des Völkerbundes wurde die so genannte "Mixed Commission" ins Leben gerufen, die je zur Hälfte aus Vertretern beider Organisationen bestand. Diese Kommission lieferte die Basisarbeit für die Konferenzen zur 4. Revision 1929 und zur 5. Revision 1938.
In der Zwischenzeit wurde der Ruf nach einer statistischen Klassifikation von Krankheiten, die nicht unbedingt tödlich enden mussten, lauter und man erinnerte sich daran, dass William Farr bereits 1856 in seinem annual report angeführt hatte, dass es zielführend wäre, das System zu erweitern "to diseases which, though not fatal, cause disability in the population, and now figure in the tables of the diseases of armies, navies, hospitals, prisons, lunatic asylums, public institutions of every kind, and sickness societies, as well as in the census of countries like Ireland, where the diseases of all the people are enumerated" (zitiert nach: WHO, S. 4, URL: http://www.who.int [History of ICD]). Bereits bei der 1. Internationalen Konferenz 1900 zur Revision der Todesursachen-Klassifikation von Bertillion wurde parallel eine adaptierte Version als Krankheitsklassifikation zur Grundlage für die Erstellung von Statistiken von Krankheitszuständen eingeführt und dieser Trend setzte sich bei den kommenden Revisionskonferenzen fort. Diese Bemühungen wurden aber international nicht anerkannt, da sie eine nur unzureichende Erweiterung der ursprünglichen Klassifikation darstellten. So sahen sich viele Länder gezwungen, eigene Systeme bzw. Krankheitslisten zu entwickeln. Vertreter von Kanada legten im Rahmen der 5. Revisionskonferenz 1938 ein modifiziertes Verzeichnis der Krankheitsursachen vor, 1944 wurden in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika umfangreichere Klassifikationen für Anwendungen im Zusammenhang mit Morbiditätsstatistiken veröffentlicht (vgl. WHO, URL: http://www.who.int [History of ICD]).
1945 wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika das United States Committee on Joint Causes of Death ins Leben gerufen, an dem auch Vertreter aus Großbritannien, Kanada und des Völkerbundes teilnahmen. Ziel war die Zusammenführung der Todesursachen-Klassifikation und der verschiedenen Adaptionen. Da in der Praxis längst sowohl tödliche als auch nicht tödliche Fälle kodiert wurden, wurde eine Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen entworfen. Nach Überprüfung durch die nationalen Regierungen wurde der nochmals adaptierte amerikanische Entwurf 1948 in Paris als 6. Revision des Internationalen Verzeichnisses angenommen (vgl. ebd.).
Die Konferenz zur 7. Revision, nun bereits unter Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO), fand 1955 in Paris statt und beschränkte sich auf unbedingt notwendige Änderungen und die Beseitigung von Irrtümern und Widersprüchen. Die 8. Revision, die 1965 in Genf beschlossen wurde, war tief greifender, beließ aber die grundsätzliche Struktur bei und blieb bei der Philosophie, dass Krankheiten nach ihren Ursachen und nicht nach ihren Manifestationen zu klassifizieren seien. In der Zwischenzeit wurde die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) immer häufiger in Krankenhäusern zur Verschlüsselung von Patientenblättern verwendet und einige Länder erstellten wiederum nationale Adaptionen, die an deren spezielle Bedürfnisse angepasst waren. Diesem Umstand musste bei der 9. Revision, die 1975 im Rahmen einer internationalen Konferenz der WHO beschlossen wurde, Rechnung getragen werden, obwohl man ursprünglich keine wesentlichen Änderungen vornehmen wollte, da diese jedes Mal kostenintensive Adaptierungen von Daten verarbeitenden Systemen zur Folge haben. Aus vielen, teils gegensätzlichen Wünschen und Vorschlägen der unterschiedlichen Teilnehmerstaaten wurde ein Kompromisssystem entwickelt, das einerseits die Grundstruktur der Klassifikation unverändert ließ, andererseits aber zahlreiche Details auf der Ebene der 4-stelligen Subkategorien und einige optionale zusätzliche Kodierungsstellen hinzufügte. Auch wurde eine Ergänzungsklassifikation der Schädigungen und Beeinträchtigungen[3] gebilligt, allerdings ausdrücklich als nicht integraler Bestandteil der ICD.
Die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision[4] (kurz: ICD 10) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen der 43. Weltgesundheits-Versammlung 1990 gebilligt. Sie ist zentraler Teil einer von der WHO herausgegebenen Familie von Klassifikation und stellt den bis dato letzten Versuch dar, ein weltweit einheitliches Diagnoserichtlinien- und Kodierungsmanual vorzulegen und zu etablieren. Die ICD 10 ist in 22 Kapitel, die in römischen Ziffern angegeben sind (I bis XXII) nach bestimmten Krankheitsgruppen unterteilt. Innerhalb dieser Kapitel sind alle für diese Gruppe relevanten Krankheiten bzw. Gesundheitsprobleme mit drei-, vier- oder fünfstelligen Schlüsselnummern versehen, beginnend mit dem oder den für dieses Kapitel vorgesehenen Anfangsbuchstaben des Alphabets (im Kapitel I, dass mit Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten sind es z.B. die Buchstaben A und B). Nach den Buchstaben folgt eine zweistellige Ziffer, wodurch die grundsätzliche dreistellige Schlüsselnummer komplettiert wird (bei dem Beispielkapitel I sind das die Kodierungen A00 für Cholera bis B99 für Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten). Gibt es noch weiteren Unterscheidungsbedarf, so folgt auf diesen Kodierungsschlüssel nach einem Punkt eine weitere Zahl (in Kapitel I z.B. A00.0 Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar choleraeKlassische Cholera, A00.1 Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor El-Tor-Cholera und A00.9 Cholera, nicht näher bezeichnet). Reicht diese zur Unterscheidung noch nicht aus, so kann in selteneren Fällen auch eine fünfte Stelle zur Anwendung kommen.
Eine 11. Revision ist derzeit nicht geplant. Stattdessen wird die ICD 10 jährlich überarbeitet. Es ist deshalb wichtig, die von der WHO im Internet publizierte jeweils gültige Version bei einer Diagnoseerstellung auf eine etwaige Änderung der Diagnosekriterien zu überprüfen. Überdies erscheint es sinnvoll, die Jahreszahl der verwendeten ICD 10 Version anzuführen.
Die relevanten Passagen zur Diagnose "Geistige Behinderung" finden sich in der ICD 10 im Kapitel V (Psychische und Verhaltensstörungen), das den Buchstaben F als ersten Kodierungsschlüssel verwendet. Der betreffende Abschnitt wird mit den Kodierschlüsseln F70 bis F79 und unter dem Überbegriff Intelligenzstörung (modifizierte deutsche Version 2007) bzw. Intelligenzminderung[5] (modifizierte deutsche Version 2006 und Österreichische Version ICD 10 BMSG 2001) beschrieben, wobei der Begriff Geistige Behinderung ausdrücklich in den Kodierungsrichtlinien angeführt ist und als synonyme Bezeichnung betrachtet wird.
Eine Intelligenzstörung bzw. -minderung ist laut ICD 10 ein Zustand von verzögerter und unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, wobei Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten als besonders beeinträchtigt angesehen werden. (vgl. Dilling et al. 1993, S. 254). "Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab." (DIMDI, URL: http://www.dimdi.de/ [ICD 10 GM Version 2007, Band V, F7x.x]). Ausdrücklich Erwähnung findet, dass sich die Diagnose einer Intelligenzstörung bzw. -minderung nur auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen kann, da sich intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung verändern können.
Die dreistelligen Schlüsselnummern[6] , die dazugehörigen Bezeichnungen, sowie die Angaben zum Intelligenzquotienten (IQ) und dem Intelligenzalter (IA) bei Erwachsenen sind in folgender Tabelle verdeutlicht:
Abbildung 1: ICD 10 Diagnosen zur Intelligenzminderung.(Quelle: eigene Darstellung)
| F70 | Leichte Intelligenzminderung (leichte geistige Behinderung, Debilität) | IQ 50 - 69 | IA 9 -12J. |
| F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung (mittelgradige geistige Behinderung) | IQ 35 - 49 | IA 6 - 9 J. |
| F72 | Schwere Intelligenzminderung (schwere geistige Behinderung) | IQ 20 - 34 | IA 3 - 6 J. |
| F73 | Schwerste Intelligenzminderung (schwerste geistige Behinderung) | IQ < 20 | IA < 3 |
| F78 | Andere Intelligenzminderung | - | - |
| F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung (geistige Behinderung / Defizite ohne nähere Angaben | - | - |
Als vierte Stelle des Kodierungsschlüssels zur Intelligenzstörung bzw. -minderung wird das Ausmaß einer möglicherweise vorhandenen Verhaltenstörung angegeben.
Hierbei gelten folgende Kodierrichtlinien:
0 Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
1 Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
8 Sonstige Verhaltensstörung
9 Ohne Angabe einer Verhaltensstörung
Dementsprechend steht z.B. der Code F70.0 für eine leichte geistige Behinderung ohne oder mit nur geringfügiger Verhaltensstörung. F72.1 wäre mit einer schweren geistigen Behinderung mit deutlicher Verhaltensstörung gleichgesetzt. Wichtig ist es auch anzuführen, dass "begleitende Zustandsbilder, wie Autismus, andere Entwicklungsstörungen, Epilepsie, Störungen des Sozialverhaltens oder schwere körperliche Behinderung" (ebd.) durch andere zusätzliche Schlüsselnummern zu kodieren sind und nicht als Verhaltensstörung kodiert werden dürfen
Die in Österreich gültige Fassung der ICD 10 basiert auf der vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für Gesundheit in Auftrag gegebenen deutschsprachigen Übersetzung und wurde den nationalen Gegebenheiten entsprechend leicht adaptiert. Die erste Österreich-Ausgabe wurde von Dr. med. Bernd Graubner für das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, zusammengestellt und 1999 unter dem Titel ICD-10 BMAGS 1999 veröffentlicht. Die derzeit gültige Version ( 2. Auflage) trägt die Bezeichnung ICD-10 BMSG 2001 und wurde vom Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen[7], das 2001 auch die Gesundheitsagenden inne hatte, herausgegeben (vgl. Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen 2000, S. 2, URL: http://www.bmgfj.gv.at/ [Diagnosenschlüssel ICD-10 BMSG 2001]). "In der Sitzung der Bundesstrukturkommission vom 25. April 2000 wurde der Beschluss gefasst, den Diagnosenschlüssel ICD-10 österreichweit verbindlich mit dem 1. Jänner 2001 - auf Grundlage des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen - einzuführen" (ebd., S. 14). Im erwähnten Bundesgesetz heißt es unter §1 Abs. 1: "Die Träger von Krankenanstalten haben nach der von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD), in einer vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen unter Anpassung an den jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft herauszugebenden Fassung, die Diagnosen der in stationärer Behandlung befindlichen Pfleglinge originär zu erfassen". Ziel der verpflichtenden ICD-Dokumentation ist es, die Gesundheitsplanung auf Bundes- und Länderebene zu ermöglichen, ein leistungsorientiertes Finanzierungssystem zu implementieren, Entscheidungsgrundlagen für die gesundheitspolitische Steuerung zu ermöglichen und Grundlagen für nationale und internationale Studien zu schaffen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 2003, S.8, URL: http://www.bmgfj.gv.at/ [Dokumentation der landesfondfinanzierten Krankenanstalten]).
Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen ( im Original: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wird von der American Psychiatric Association (APA) herausgegeben. Im Gegensatz zur Klassifikation der WHO beinhaltet es nicht alle Krankheitszustände, sondern beschäftigt sich nur mit mentalen Störungen, vergleichbar mit dem Band V der ICD 10. Die im Moment gültige Version ist die überarbeitete Fassung der vierten Revision und trägt die Bezeichnung DSM-IV-TR[8]. Eine fünfte Revision des DSM ist in Arbeit (vgl. URL: http://www.dsm5.org/).
Das DSM-IV legt drei wesentliche diagnostische Kriterien für Geistige Behinderung fest (vgl. Saß et al. 1996, S. 81). Es sind dies
-
eine deutlich unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit ( ein IQ von 70 oder darunter, der bei einem individuell durchgeführten Intelligenztest bzw. bei Kleinkindern durch eine klinische Beurteilung der deutlich unterdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit festgestellt werden soll)
-
damit einhergehende Defizite der gegenwärtigen sozialen Anpassungsfähigkeit in mindestens zwei der Bereiche Kommunikation, Eigenständigkeit, häusliches Leben, soziale/zwischen-menschliche Fertigkeiten, Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Selbstbestimmtheit, schulische Fertigkeiten, Arbeit, Freizeit, Gesundheit bzw. Sicherheit.
-
ein Beginn der Störung vor Vollendung des 18. Lebensjahres.
Die Kodierung einer geistigen Behinderung nach DSM-IV sieht wie folgt aus, beginnend mit dem zugeordneten Code, danach die wörtliche Beschreibung und schließlich der dazugehörige Wert des Intelligenzniveaus:
Abbildung 2: DSM-IV Diagnosen "Geistige Behinderung" (Quelle: eigene Darstellung)
|
317 |
Leichte Geistige Behinderung |
IQ 50-55 bis ca. 70 |
|
318.0 |
Mittelschwere Geistige Behinderung |
IQ 35-40 bis 50-55 |
|
318.1 |
Schwere Geistige Behinderung |
IQ 20-25 bis 35-40 |
|
318.2 |
Schwerste Geistige Behinderung |
IQ unter 20 bzw. 25 |
|
319 |
Geistige Behinderung mit unspezifischem Schweregrad |
Zum Diagnosecode 319 wird noch angeführt, dass er gegeben werden soll, wenn "mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Geistige Behinderung angenommen werden kann, die Intelligenz einer Person jedoch nicht mit Standard-Tests messbar ist" (ebd. S. 81).
Die Verwendung des DSM ist in Österreich zur Erstellung von Diagnosen im Bereich psychischer Störungen rechtlich nicht vorgesehen. Dass es dennoch von heimischen Diagnostikern zur (zusätzlichen) Meinungsbildung herangezogen wird, kann im Umstand begründet sein, dass die Autoren des DSM im Gegensatz zu den Autoren der ICD weniger Kompromisse eingehen mussten, da sie ihre Richtlinien allein für die Vereinigten Staaten von Amerika verfasst haben und nicht die Vielfalt der unterschiedlichen weltweiten Sichtweisen, denen sich die WHO mit der ICD verpflichtet sieht, in das Manual einzubringen hatten. So liefert das DSM, bezugnehmend auf die Gegebenheiten im so genannten westlichen Kulturkreis, für manche mentale Krankheitsbilder detailliertere diagnostische Kriterien (vgl. z.B. die Kriterien für die Diagnose "Frühkindlicher Autismus" bzw. den dazugehörigen Unterkriterien zur Diagnose des autistischen Syndroms in DSM-IV und ICD 10[9]). In anderen Bereichen wiederum erscheint die ICD genauere Kriterien festzulegen. So gibt es z.B. die Verbindung - und damit Kodiermöglichkeit - von "Geistiger Behinderung" mit "Verhaltensauffälligkeit" in einem einheitlichen Kodierschlüssel im DSM nicht.
Grundsätzlich wird seit der Einführung des DSM-IV auf eine Vergleichbarkeit mit der ICD geachtet, wobei allerdings anzumerken ist, dass die nun[10] im DSM zu Vergleichszwecken enthaltenen Kriterien noch auf Basis der ICD 9 CM angeführt sind (vgl. URL: http://dsmivtr.org bzw. http://icd9cm.chrisendres.com/2007/).
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll "in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen. Sie definiert Komponenten von Gesundheit und einige mit Gesundheit zusammenhängende Komponenten von Wohlbefinden (...)" (URL:http://www.dimdi.de [ICF], S.9)
Da die im Gesundheits- und Sozialbereich ( z.B. von den österreichischen und deutschen Krankenkassen) häufig verwendete Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision (ICD 10) nur Defizite codiert, über deren Folgen aber nichts aussagen kann, wurde sie bereits 1980 durch die Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps / ICIDH) ergänzt (vgl. Kapitel 2.1). Diese entstand als "Gegenbewegung gegen eine medizinisch geprägte und individualisierende Betrachtungsweise von Behinderung. Vereinfacht dargestellt werden Behinderungen in einer medizinischen Sichtweise als Ausdruck einer zugrunde liegenden Pathologie verstanden. Ziel der Behandlung ist es, die Behinderung zu beseitigen. Ein weiteres Charakteristikum des medizinischen Blicks ist, sich auf die Symptome einer Krankheit zu konzentrieren. Die Folgen der Erkrankung für die Handlungsfähigkeit und ihre sozialen Auswirkungen werden vernachlässigt" (Frommelt et al 2005).
2001 wurde die ICIDH von der ICF abgelöst. Ihre spezifischen Ziele sind:
-
Sie soll eine wissenschaftliche Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände, der Ergebnisse und der Determinanten liefern.
-
Sie soll eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände zur Verfügung stellen, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzern, wie Fachleuten im Gesundheitswesen, Forschern, Politikern und der Öffentlichkeit, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu verbessern.
-
Sie soll Datenvergleiche zwischen Ländern, Disziplinen im Gesundheitswesen, Gesundheitsdiensten sowie im Zeitverlauf ermöglichen.
-
Sie soll ein systematisches Verschlüsselungssystem für Gesundheitsinformationssysteme bereitstellen.
Das wesentlich neue an der ICF ist der Versuch, zum pathologischen Aspekt eines Gesundheitsproblems weitere fördernde und/oder hemmende Faktoren zu benennen, insbesondere die Aktivitäten und die Möglichkeiten der Partizipation, also der Teilhabe am sozialen Leben, einer Person. Hinzu kommen Umwelt- und personenbezogene Faktoren.
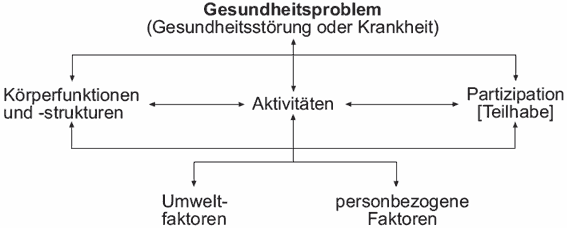
Abbildung 3: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Quelle: DIMDI 2005,S. 23, URL: http://www.dimdi.de, [ICF])
Die ICF versteht sich als Mischung des medizinisch-pathologischen Ansatzes und des "sozialen Modells" in dem "`Behinderung´ kein Merkmal einer Person (ist), sondern ein komplexes Geflecht von Bedingungen, von denen viele vom gesellschaftlichen Umfeld geschaffen werden. Daher erfordert die Handhabung dieses Problems soziales Handeln, und es gehört zu der gemeinschaftlichen Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Umwelt so zu gestalten, wie es für eine volle Partizipation [Teilhabe] der Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des sozialen Lebens erforderlich ist. Das zentrale Thema ist daher ein einstellungsbezogenes oder weltanschauliches, welches soziale Veränderungen erfordert." (DIMDI 2005, S. 25, URL: http://www.dimdi.de, [ICF]) Die ICF kann klassisch defizitorientiert oder ressourcenorientiert verwendet werden.
Auch für die Verwendung der ICF gibt es derzeit keine österreichweit einheitlichen Richtlinien. Allerdings hat die Landesregierung des Bundeslandes Kärnten 2003 ein "Handbuch zur Erfassung von Menschen mit hohem Förder- und / oder Begleitungsbedarf (HFB)" (vgl. URL: http://www.behindertenhilfe.ktn.gv.at/), das auf der ICF basiert, herausgegeben. Auch werden bereits ICF-basierte Datenbanksysteme für Gesundheitseinrichtungen angeboten.
Klassifikationen können, wenn sie gesetzlich verankert sind, wertvolle Regelwerke mit Gütekriterien für medizinische bzw. psychiatrische Diagnosen sein. Dennoch sind sie in mehrerlei Hinsicht umstritten, und es erscheint angebracht, sie kritisch zu hinterfragen.
Im Regelwerk der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision heißt es im Kap. 2.1 Zweck und Anwendungsbereich, es sei Zweck der ICD, "systematische Aufzeichnungen, Analysen, Deutungen der Ergebnisse und Vergleiche der in verschiedenen Ländern oder Gebieten und in verschiedenen Zeiträumen gesammelten Mortalitäts- und Morbiditätsdaten zu erlauben" (DIMDI 2006, S. 11, URL:http://www.dimdi.de [ICD 10 WHO-Ausgabe]). Da aber viele Staaten auf ihre eigenen Bedürfnisse hin adaptierte Versionen der ICD verwenden, erscheint die internationale Vergleichbarkeit, wenn überhaupt, nur mehr in Ansätzen gegeben. Im Bereich psychischer Störungen kommt noch erschwerend hinzu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit dem DSM ein eigenes Manual verwenden, dass nur bedingt mit der ICD und ihren Diagnose- und Kodierkriterien vergleichbar ist. Um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, müssten die nationalen Behörden auch über Daten, die nach den Kriterien der gültigen WHO-Ausgabe kodieren wurden, verfügen, d.h. die DiagnostikerInnen jeweils doppelt kodieren. Es darf bezweifelt werden, ob diese Vorgangsweise praktikabel ist.
Im Bereich der Intelligenzminderung oder mentalen Retardierung begann sich im frühen 19. Jahrhundert die wissenschaftliche Bezeichnung Oligophrenie für "Blödsinn" und "Geistesschwäche" durchzusetzen, die wiederum in die Bereiche Debilität (leichte Oligophrenie), Imbezillität (mittelgradige Oligophrenie) und Idiotie (schwere Oligophrenie) unterteilt wurde (vgl. Eggert, 1996, S. 4, URL: http://bidok.uibk.ac.at ). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte man Oligophrenie mit "Schwachsinn" gleich. Obwohl diese Bezeichnungen heute nicht mehr angemessen und wenig zeitgemäß erscheinen, sind sie noch nicht vollständig aus den Diagnosebefunden verschwunden (vgl. ebd.). Dies lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder verwenden manche DiagnostikerInnen auch heute noch diese unzeitgemäßen, in den allgemeinen Sprachgebrauch als abwertend eingegangenen Formulierungen, oder teilweise bereits vor vielen Jahren gestellte Diagnosen werden einfach ab- und weiter geschrieben, obwohl die ICD für den Bereich Intelligenzminderung ausdrücklich auf eine zeitlich nur sehr begrenzte Aussagekraft der Diagnosen hinweist (siehe Kap. 2.2.2). Beides ist im Sinne der so klassifizierten Menschen abzulehnen.
Klassifikationen, wie die ICD, sind Auflistungen von Störungen und Fehlern, also defizitorientiert. Gerade im Bereich psychischer Störungen werden Menschen, zwängt man sie in diese Kategorien, oft abklassifiziert und damit stigmatisiert (vgl. Goffman 1977). Dass die Frage der Einordnung des Erscheinungsbildes schon sehr früh zu Kontroversen führte, verdeutlicht Eggert anhand des Disputs der Ärzte Itard und Pinel um die Erziehung von Viktor, dem `Wildkind von Aveyron´. "Pinel (1745 - 1826) war der Ansicht, dass es sich bei Viktor um eine unheilbare Idiotie handele ("unheilbarer Idiot[11], tieferstehend als Haustiere"), während der jüngere Itard (Jean Marc Gaspard Itard, 1774 - 1838) davon ausging, dass Viktors Verhalten durch pädagogische Vernachlässigung und Isolierung entstanden sei und dass er durch angepasste Methoden erzogen und gebildet werden könne" (Eggert 1996, S. 4, URL: http://bidok.uibk.ac.at ). Im medizinischen Modell, dem die ICD entspringt, scheint aber bis heute für Fragen nach den Ressourcen und individuell zu sehenden fördernden Faktoren wenig bis kein Platz zu sein.
Um eine Verbindung von medizinischem Modell und sozialen pädagogischen Ansichten zu ermöglichen, wurde von der WHO die ICF als Zusatzklassifikation zur ICD herausgegeben. Der darin verwendete Behindertenbegriff ist nicht mehr rein auf persönlichen Defiziten aufgebaut, sondern versteht sich als "Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]" (DIMDI 2005, S. 9, URL: http://www.dimdi.de/ [ICF]). Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Faktoren gelegt werden, die die Partizipation des betroffenen Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Möglichkeiten zu individueller Aktivität betreffen. "Menschen sollen so durch die Verwendung der ICF nicht auf ihre Schädigungen und Beeinträchtigungen reduziert werden" (Meyer 2004, S. 57). Aber so positiv die Philosophie der ICF zu bewerten ist, so mangelhaft und schwammig erscheint die Umsetzung des Manuals. Es werden Kodierrichtlinien vorgegeben, die dem normalen Sprachgebrauch widersprechen. Meyer erläutert dies an einem Beispiel: Wenn man versucht zu kodieren, dass bei einer Person keine Probleme bezüglich des Bewusstseinszustandes bestehen, so findet man das Item Qualität des Bewusstseins (b1102). "In der Tabelle der Beurteilungsmerkmale gibt es die Begriffe `nicht vorhanden´ (0), `leicht ausgeprägt´ (1), `mäßig ausgeprägt´ (2), `erheblich ausgeprägt´ (3), `voll ausgeprägt´(4). Der Anwender kodiert: b1102.4 (Qualität des Bewusstseins - voll ausgeprägt). Damit ist ihm jedoch ein schwerwiegender Fehler unterlaufen: Die Beurteilungsmerkmale dürfen nicht auf die im Item benannte Funktion bezogen werden, sondern auf die Schädigung der Funktion. (...) In diesem Fall hätte mit b1102.0 (Qualität des Bewusstseins - Schädigung: nicht vorhanden) verschlüsselt werden müssen" (Meyer 2004, S. 29). Nun könnte man anführen, dass DiagnostikerInnen die genauen Kodierrichtlinien kennen müssen und man deshalb voraussetzen dürfe, dass trotz der "Umkehr der Denkrichtung" (ebd.) richtig und so gewollt kodiert wurde. Bedenkt man aber die oft langfristigen Auswirkungen einer Diagnose und, dass Diagnosen im allgemeinen leichter gegeben als revidiert werden, so ist diese eingebaute Falle mehr als lästig.
Ein weiterer Kritikpunkt an der ICF ist, dass sie ressourcen- oder defizitorientiert verwendet werden kann, was an sich schon die Frage aufwirft, ob ein weiteres defizitorientiertes Manual, also zusätzliche potentiell stigmatisierende Diagnosen, für betroffene PatientInnen wünschenswert ist. Aber selbst wenn mit der ICF Ressourcen kodiert werden sollen, gibt das Manual nicht genügend Aufschluss darüber, was ein etwaiger Diagnostiker mit seiner Kodierung wirklich gemeint haben könnte. Die Folge ist, dass sich nicht nur verschiedene Nationen, sondern auch einzelne Institute veranlasst sehen, Handbücher mit eigenen Diagnoserichtlinien zu erarbeiten, um zu verdeutlichen, was man genau mit einer bestimmten Kodierung zum Ausdruck bringen möchte. Die ICF ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch weit davon entfernt, ein praktikables Instrument zur Verbesserung der Diagnosen zu sein, und aus erwähnten Gründen kann von einer internationalen Vergleichbarkeit ebenso derzeit keine Rede sein.
[1] "BewohnerInnen" steht für Bewohner und Bewohnerinnen. In der Folge wird das große "I" in "(...)Innen" zur Kennzeichnung, dass beide Geschlechter gemeint sind, verwendet, also z.B. auch bei MitarbeiterInnen oder KlientInnen. Sollte dies nicht möglich sein, weil aus Gründen des Satzbaus die Verwendung von sowohl männlichen als auch weiblichen Artikeln notwendig wäre, wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet. Sie steht aber, wo dies sinnvoll erscheint, für beide Geschlechter.
[2] Für das Register / Urkunden verantwortliche Beamte mit einer Vielzahl von Aufgaben im statistischen Bereich, eventuell vergleichbar mit Meldeamtsleitern in Österreich.
[3] "classifications of Impairments and Handicaps" (WHO, S.8, URL: http://www.who.int [History of ICD])
[4] Im englischen Original: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (vgl. WHO, URL: http://www.who.int [ICD 10])
[5] Der englische Begriff lautet mental retardation.
[6] In der deutschen modifizierten Version 2007 findet sich auch der Schlüssel F74 für Dissoziierte Intelligenz, der auf eine deutliche Diskrepanz zwischen Sprach-Intelligenz und Handlungs-Intelligenz hinweisen soll. Dieser Kodierungsschlüssel scheint aber weder in der österreichischen Version der ICD 10 aus dem Jahr 2001 noch in der aktuellen englischen WHO - Fassung aus dem Jahr 2007 auf, weshalb er hier nicht berücksichtigt wurde.
[7] Die Bezeichnungen der österreichischen Ministerien können mit jeder neuen Regierung wechseln.
[8] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision.
[9] Hier muss angefügt werden, dass das DSM nur zwischen "autistischer Störung" und dem "Asperger-Syndrom" unterscheidet, während es in der ICD 10 z.B. auch noch die Diagnose "Atypischer Autismus" gibt. Man könnte also sagen, die grundsätzlichen Diagnostikkriterien des DSM-IV sind detaillierter, allerdings gibt es weniger Unterscheidungen.
[10] Die zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit gültige Version trägt die Bezeichnung DSM-IV TR.
[11] Dies legt den Verdacht nahe, dass der ehemals medizinische Fachausdruck "Idiot" schon damals in der Form gebraucht wurde, wie dies in heutiger Zeit der Fall ist - als Schimpfwort.
Inhaltsverzeichnis
Diagnosen haben den Anspruch, valide zu sein, und sollen meist mit Hilfe eines standardisierten, getesteten Verfahrens ein momentanes, oft aber auch längerfristiges Abbild der Beeinträchtigung(en) eines Menschen darstellen. Das setzt voraus, das DiagnostikerInnen aus zuvor erlerntem Wissen schöpfen und durch Beobachtung, Untersuchung und Befragung zu Wissen über ihre PatientInnen können. Das wirft die Frage auf, wie objektiv und real dieses Wissen sein kann und ob in unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Bewertungen zu unterschiedlichem Wissen führen können.
Der Konstruktivismus oder die "Wirklichkeitsforschung", wie Watzlawick als Bezeichnung vorziehen würde (2004, S.10), sieht das, was Menschen gemeinhin als Realität erachten, als nicht wirklich real an, weil alle kognitiven Systeme (also auch der Mensch) diese nur für sich selbst erfinden / konstruieren (radikaler Konstruktivismus) bzw., weil kognitive Systeme nicht fähig sind, sich ein der vermutlich wirklich vorhandenen Umwelt entsprechendes Bild zu machen (operativer Konstruktivismus).
Der radikale Konstruktivismus gilt, wie alle konstruktivistischen Strömungen, gemeinhin als spezielle Form der Erkenntnistheorien, unterscheidet sich von diesen aber laut Ernst von Glaserfeld radikal im Verhältnis zwischen Wissen und Wirklichkeit. "Während die traditionelle Auffassung in der Erkenntnislehre sowie in der kognitiven Psychologie, dieses Verhältnis stets als eine mehr oder weniger bildhafte (ikonische) Übereinstimmung oder Korrespondenz betrachtet, sieht der radikale Konstruktivismus es als Anpassung im funktionalen Sinn" (Glaserfeld 2004, S. 19). Für den radikalen Konstruktivisten kann es bei der Erlangung von "Wissen" nicht darum gehen, ein Bild der tatsächlich objektiven Realität zu bekommen, sondern vielmehr um die Schaffung einer kognitiven Struktur, die den Anforderungen der (individuellen) Erfahrenswelt standhält. Ist diese kognitive Struktur für einen bestimmten Zeitraum fähig, Phänomene, Umstände und wiederkehrende Begebenheiten zu erklären oder vorherzusagen, so gilt sie als brauchbar und relevant, jedoch "beweist das nicht mehr und nicht weniger als eben, dass sie unter den Umständen, die wir erlebt und dadurch bestimmt haben, das geleistet hat, was wir von ihr erwarteten. Logisch betrachtet, heißt das aber keineswegs, dass wir nun wissen wie die objektive Welt beschaffen ist (...)" (ebd., S. 23).
Mit der Frage, was "Wissen" bedeutet, und dies nicht nur im erkenntnis-theoretischen, sondern auch im naturwissenschaftlich biologischen Sinn, beschäftigte sich auch der chilenische Biologe und Philosoph Humberto R. Maturana. Er tut dies in seiner "Biology of Cognition" (1970) zunächst anhand der Frage, wie man das Nervensystem erklären könne. "Enumeration of the transfer functions of all nerve cells would leave us with a list, but not with a system capable of abstract thinking, description, and self-description" (Maturana 1970, S. 6). Maturana stellt dazu fest, dass Organismen als an ihre Umwelt angepasst beschrieben werden und ihre gesamte Organisation diese Umwelt repräsentiert, d.h. "living organizations" können nicht anhand ihrer Einzelteile verstanden werden sondern nur als Einheit. Doch dieser Standpunkt ist lediglich der Standpunkt eines Beobachters, denn "anything said is said by an observer" (S. 8) und der Diskurs über welches Problem auch immer bedeutet nur, dass sich ein Beobachter mit einem anderen Beobachter austauscht. Ein Beobachter kann aber ein Wesen, eine Einheit ("entity") nur dann als solche(s) wahrnehmen, wenn er fähig ist, diese(s) zu beschreiben. "To describe is to enumerate the actual or potential interactions and relations of the described entity. Accordingly, the observer can describe an entity only if there is at least one other entity from which he can distinguish it and with which he can observe it to interact or relate" (ebd.). Es sind also Erfahrungen notwendig, die es dem Beobachter ermöglichen, Vergleiche anzustellen.
Jedes lebende System, und jeder Beobachter ist ein solches, erlangt seine Identität durch Interaktion mit anderen lebenden Systemen. Diese Interaktion bewirkt Evolution, denn ein lebendes System ist bestrebt, in der vom ihm wahrgenommenen Umwelt lebensfähig zu bleiben, weshalb subjektiv betrachtet Veränderungen nötig sein können, um die eigene Identität zu bewahren. Maturana beschreibt lebende Systeme als Einheiten von Interaktionen, "whether by a single basic unit, or through the aggregation of numerous such units (themselves living systems) that together constitute a larger one (multicellular organisms), or still through the aggregation of their compound units that form self-referring systems of even higher order (insect societies, nations) is of no significance (...)" (ebd., S. 12). In allen Bereichen lebender Systeme ist allein wichtig, was dazu geeignet ist, die eigene Identität zu bewahren. Dazu nötig ist subjektive Erkenntnis, weshalb er es als erwiesen ansieht, dass alle Lebewesen kognitive Systeme sind und Leben als Prozess einen Prozess der Erkenntnis darstellt (vgl. ebd., S. 13).
Auf Ebene des Menschen geschieht Interaktion zwischen lebenden Systemen, oder anders ausgedrückt zwischen Beobachtern, mittels der Sprache. Für Maturana liegt das Problem des Verständnisses von Sprache in der Annahme begründet, dass sie ein denotatives System aus Symbolen sei, das zur Übermittlung von Information dienen soll. "However, when it is recognized that language is connotative and not denotative, and that its function is to orient the orientee within his cognitive domain without regard for the cognitive domain of the orienter, it becomes apparent that there is no transmission of information through language. It behooves the orientee, as a result of an independent internal operation upon his own state, to choose where to orient his cognitive domain; the choice is caused by the 'message', but the orientation thus produced is independent of what the 'message' represents for the orienter" (Maturana 1970, S. 32). Sprache als konnotatives System, also nicht den Kern der zu übermittelnden Information, des So-Seinsan sich, treffendenden, sondern vielmehr umschreibenden, mit der Erfahrungswelt des Senders unterlegten und aus dieser generierten subjektiven Wahrnehmung, kann nicht per se dazu führen, dass eine vom Sender übermittelte Information vom Empfänger in gleicher Weise verstanden wird und zu einer vom Sender gewollten Erkenntnis führt. Dies gelingt nur, wenn beide, Sender und Empfänger, die gleiche Ausgangslage, also etwa einen der Information entsprechenden gleichen Erfahrungshintergrund aufweisen, und kooperativ agieren, das "resulting behavior of each organism", wie Maturana es nennt (ebd.), also dem Wohle des Ganzen untergeordnet wird. Eine dritte Person, die zwei Menschen (aber auch, wie der Biologe Maturana schreibt, Organismen), die diesen Konsens bereits entwickelt haben, beobachtet, kann leicht zu dem Schluss kommen, es handle sich bei Kommunikation um ein denotativ beschreibendes Instrument, jedoch ist dies nicht zutreffend. Sprache ist nur eine mögliche Beschreibung dessen, was im System des Sprechenden implementiert ist. "From this it follows that reality as a universe of independent entities about which we can talk is, necessarily, a fiction of the purely descriptive domain, and that we should in fact apply the notion of reality to this very domain of descriptions in which we, the describing system, interact with our descriptions as if with independent entities" (S. 52). Damit wird für Maturana die Frage nach objektivem Wissen obsolet, weil es dieses gar nicht gibt. "To know is to be able to operate adequately in an individual or cooperative situation" (ebd., S. 53).
Als klassischer Vertreter des operativen Konstruktivismus gilt Niklas Luhmann. Er schreibt[12] im Buch "Einführung in die Systemtheorie" über operative Geschlossenheit (2002, S. 91ff), dass Operationen "von Anfang bis Ende oder als Ereignisse gesehen immer nur im System möglich (sind), und sie können nicht benutzt werden, um in die Umwelt auszugreifen, denn dann müssten sie, wenn die Grenze gekreuzt wird, etwas anderes werden als Systemoperationen. (...) Wenn man radikal formuliert, kann man sagen, dass Erkenntnis nur möglich ist, weil es keine Beziehungen, keine operativen Beziehungen zur Umwelt gibt. (...) Erkenntnis ist nicht nur möglich, obwohl, sondern weil das System operativ geschlossen ist. Es kann mit seinen erkennenden Operationen nicht in die Umwelt ausgreifen, sondern es muss stets innerhalb des Systems Anschlüsse, Folgerungen, nächste Erkenntnisse, Rückgriffe auf das Gedächtnis und so weiter suchen." (ebd., S. 93) Mit dem Begriff Operationen sind dabei grundlegende Aktivitäten eines Systems gemeint (vgl. auch Hosemann et al. 2005, S.16). In der Folge unterlegt Luhmann seine These, dass Systeme nur mit selbst aufgebauten Strukturen operieren und diese nicht importieren können, mit einem Beispiel aus der Forschung über Sprachlernen, indem er die Frage aufwirft, wieso ein Kind so schnell sprechen lernt. Er sieht in der modernen Kommunikationsforschung die Annahme vorherrschend, dass Sprache dadurch erlernt wird, dass "(...) Sprecher, die einfach unterstellen, dass der Angesprochene versteht, auch wenn sie wissen, dass er noch nicht versteht" (Luhmann 2002, S. 106) den Gebrauch der Sprache nicht lehren, sondern vielmehr sich beim Kind die Gewohnheit einstellt, "bestimmte Geräusche als Sprache zu separieren und bestimmte Bedeutungen dann auch zu wiederholen" (ebd.). Das Kind lernt letztlich, weil es verstehen will und nicht, weil umgebende Systeme (Sprecher, Eltern,...) wollen, dass es versteht.
Systeme sind grundsätzlich selbstbezogen, d.h., dass sie sich auch inmitten einer kommunikatorischen Interaktion mit der Umwelt ständig auf die eigenen internen Bedürfnisse auf der einen Seite und Erfahrungen auf der anderen Seite beziehen. "Das System kann seiner eigenen Geschichtlichkeit nicht entrinnen" (Luhmann 1997, S. 883). Dennoch ist ein System "dabei für Anregungen und Ressourcen aus der Umwelt offen und steuert seine Geschlossenheit über die Art und Weise der Grenzziehung zur Umwelt" (Hosemann et al. 2005, S. 20). Da diese Anregungen und Ressourcen aber äußerst zahlreich sind und sehr komplex sein können, betreiben Systeme Komplexitätsreduktion, d.h. sie vereinfachen. Für Menschen mit einer diagnostizierten geistigen Behinderung, die oftmals von den Einstellungen umgebender Systeme abhängig sind, birgt diese Reduktion auf bereits vorhandenes Wissen und die resistente Haltung der Umwelt zur Neubewertung als objektiv wahr geltender Einschätzungen einige Gefahren. Diese werden auch Teil der folgenden empirischen Untersuchung sein.
[12] Luhmann hat dieses Buch nicht im eigentlichen Sinn geschrieben. Es handelt sich vielmehr um die Transkription einer Vorlesung im Wintersemester 1991/92 an der Universität Bielefeld, die von Dirk Baecker nach Luhmanns Tod herausgegeben wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 4.1 Methode
- 4.2 Konzeptionelle Erläuterungen
- 4.3 Ausgangslage: Eigene Vorerfahrung
- 4.4 Die erste Interviewserie: Projekt Wien
- 4.5 Die zweite Interviewserie
- 4.6 Die dritte Interviewserie: Geistige Behinderung
- 4.7 Sichtweisen von ProfessionistInnen zur Diagnose "Geistige Behinderung"
- 4.8 Versuchte Erhebung von oberösterreichweiten Daten
- 4.9 Diskussion der Ergebnisse
Für die im folgenden beschriebene empirische Untersuchung wurde als methodischer Ansatz die Grounded Theory gewählt. Diese wurde ursprünglich von Barney Glaser und Anselm Strauss gemeinsam entwickelt, später aber von Strauss verändert und an bereits bekannte qualitative Forschungsmethoden angeglichen (vgl. Strübing 2004).
Diese Arbeit basiert auf der klassischen Methode der Grounded Theory, wie sie Glaser vertritt. Die Abgrenzung zur Methode der Qualitativen Datenanalyse hat Glaser in seinem 2004 erschienenen Artikel Remodeling Grounded Theory beschrieben: "The clear issue articulated in much of the literature regarding qualitative data analysis (QDA) methodology is the accuracy, truth, trustworthiness or objectivity of the data. This worrisome accuracy of the data focuses on its subjectivity, its interpretative nature, its plausibility, the data voice and its constructivism" (Glaser et al., S. 1f [2], URL: http://www.qualitative-research.net ). Im Gegensatz dazu ist für ihn die Grounded Theory "a set of integrated conceptual hypotheses generated to produce an inductive theory about a substantive area"(ebd., S. 2 [7]). Obwohl der Forscher zu Beginn seiner Arbeit durchaus z.B. durch Beobachtung für sich ein lohnendes, weil interessantes Feld festlegen bzw. sich für ihn eine Fragestellung aufdrängen kann, bedeutet das nicht, dass dieser Arbeit damit bereits eine Theorie oder fundierte Hypothese zu Grunde liegt, die es zu beweisen gelte. Im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, ohne generalisierte "Vorabtheorien" mit der Erhebung von Daten zu beginnen ("just do it"), diese zu kodieren, daraus, durchaus subjektiv betrachtet, Kerndaten ("core data") herauszufiltern, zu kategorisieren und damit Grenzen abzustecken ("delimiting"), den eingeschlagenen Weg und die eigenen Beweggründe nachvollziehbar zu machen und so zu einer begründeten Theorie zu gelangen, die Basis für weitere Studien sein kann, deshalb also nicht starr, sondern als veränder- und erweiterbar anzusehen ist.
Nach dem Studium der Thesen Maturanas (vgl. Kapitel 3) drängt sich die Grounded Theory als Methode für den empirischen Teil dieser Arbeit förmlich auf, vor allem, weil sie nicht als "a proffered approach to doing research based on logical `wisdoms´ from science (...)" (Glaser et al. 2004, S. 14 [75], URL: http://www.qualitative-research.net ) gedacht ist. "It is not a concoction based on logical "science" literature telling us how science is ought to be" (ebd.). Wenn es objektives Wissen nicht geben kann, erscheint es, auch unter den Kriterien der Wissenschaftlichkeit[13], ehrlicher, den Weg der subjektiven Erkenntnisfindung und der daraus resultierenden Conclusio so genau wie möglich darzulegen, um damit vielleicht bei anderen einen eigenen Denk- und Forschungsprozess auszulösen, anstatt zu behaupten, die eigene Arbeit sei an sich schon unumstößlich valide, oder sein Heil in den Arbeiten anderer zu suchen, die die Behauptung der unumstößlichen Validität schon zuvor zu Papier gebracht haben.
Spätestens an dieser Stelle muss der in wissenschaftlichen Arbeiten häufig verwendete unpersönliche und Objektivität vortäuschende Schreibstil aufgegeben werden, und ich muss als Autor dieser Arbeit aus dem sicheren Schleier hervortreten. Ich werde also versuchen, den Weg, der mich zu Hypothesen und schließlich zu einer Theorie geführt hat, gemäß den Vorgaben der Grounded Theory, wie sie Glaser eindrucksvoll beschrieben hat (vgl. Glaser et al. 2004, URL: http://www.qualitative-research.net ) so nachvollziehbar und begründet, wie es mir möglich ist, chronologisch nachzuzeichnen und bewusst versuchen, nichts vorwegzunehmen.
"As a distinguishing item of GT, however, it is barely a beginning, leaving the reader with no knowledge of how generating is done" (Glaser et al. 2004, S. 4 [19], URL: http://www.qualitative-research.net ). Im Folgenden soll deshalb der Weg, den ich mit dieser Untersuchung beschritten habe, näher erläutert werden.
Ich werde zunächst kurz die Ausgangslage, d.h. eigene, zur Thematik der geistigen Behinderung gemachte Vorerfahrungen, skizzieren. Dies erscheint mir in zweierlei Hinsicht wichtig zu sein. Erstens ist die Idee zu dieser Arbeit ein Resultat aus Beobachtungen, die ich in meiner beruflichen Praxis machen konnte und letztlich sind es die, sich aus diesen Beobachtungen ergebenden, Fragen, die mich zu diesem Versuch, eine Theorie zur Diagnose "Geistige Behinderung" zu entwickeln, geführt haben. Zweitens markiert das Projekt "Wert des Lebens", das im Anschluss beschrieben wird, eine Auftragsarbeit, die ich zusammen mit meinen, als geistig behindert diagnostizierten, MitarbeiterInnen in der Medienwerkstatt durchgeführt habe, den Beginn der später beschriebenen Untersuchung. Genauer gesagt sind die ersten beiden Interviewserien Teil dieser Auftragsarbeit, weshalb es angebracht erscheint, die besagte Werkstatt und dieses Projekt näher zu beschreiben.
Diese Untersuchung thematisiert die Ansichten betroffener Menschen und die Sichtweisen umgebender Systeme zur Diagnose "Geistige Behinderung". Obwohl für Cloerkes die "Art der Behinderung, insbesondere aber das Ausmaß ihrer Sichtbarkeit sowie das Ausmaß, in dem sie gesellschaftlich hochbewertete Funktionsleistungen (Mobilität, Flexibilität, Intelligenz, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit) beeinträchtigt, (...) von erheblicher Bedeutung für die Einstellung zum Behinderten" (Cloerkes 1997, S. 77) ist, sollen zunächst die Sichtweisen zum Begriff "Behinderung" im Allgemeinen behandelt werden. Die aus den Antworten der ersten beiden Interviewserien mit Menschen mit zumeist körperlicher Beeinträchtigung resultierenden Hypothesen dienen als wertvolle Anhaltspunkte und Vergleichsthesen für den darauf folgenden engeren Blick auf die Situation geistig behinderter Menschen[14]. Für diesen werden zunächst als geistig behindert diagnostizierte Menschen selbst befragt. Im Anschluss werden Antworten von im einschlägigen Betreuungsdienst tätigen MitarbeiterInnen und mit der Diagnose der geistigen Behinderung betrauten Professionisten vorgestellt. Eine kurze Umfrage in oberösterreichischen Institutionen für geistig und mehrfach behinderte Menschen und ein dazu gehöriges Statement der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich runden das Bild ab, das schließlich in einer Theorie zur Diagnose "Geistige Behinderung" mündet.
Um nachvollziehbar zu machen, warum ein Bereich, eine Aussage in einem Interview etc. für mich interessant war, warum ich manchen Aspekten mehr Bedeutung zugemessen habe als anderen, erscheint es sinnvoll, etwas zu meiner beruflichen bzw. zum Thema dieser Arbeit passenden Vorgeschichte zu sagen. In diesem Unterkapitel soll daher zuerst ein Blick zurück gemacht werden. Ich möchte damit einen, naturgemäß unvollständigen, Eindruck vermitteln, welche persönlichen Erfahrungen ich zum Thema dieser Arbeit bereits vor Beginn derselben gemacht habe und was mich bewogen hat, dieses Thema aufzugreifen.
Nach ca. 16 Jahren in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung(en), zum größten Teil in der institutionalisierten Behindertenhilfe für geistig und mehrfach behinderte Menschen, habe ich in diesem Bereich etwas, was man gemeinhin als "Erfahrung" bezeichnet, ich möchte es genauer "subjektive Erfahrung" nennen. Zehn Jahre lang war ich als Mitarbeiter bzw. nach kurzer Zeit bereits als Leiter einer Wohngruppe, in der meist neun als geistig und mehrfach behindert diagnostizierte Frauen und Männer lebten, tätig. In dieser Zeit habe ich, wieder subjektiv betrachtet, sehr viel gelernt, im Rahmen von absolvierten Ausbildungen, aus der Literatur, vom Austausch mit anderen in diesem Bereich tätigen Menschen, Erfahrungsberichten, aber vor allem auch von den Menschen, mit denen und für die ich tätig war, selbst. Als Leiter einer Wohngruppe, also als Mitglied der unteren Führungsebene einer übergeordneten Institution, gehörte es zum Aufgabenbereich, die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Systemen, also den Menschen mit Behinderungen, den MitarbeiterInnen, den direkten Vorgesetzten, den Fachbereichen der Pädagogik, der Psychologie und der Medizin, der Ökonomie und dem System der Institution als Ganzes, aber auch dem System der Gesellschaft zu gestalten, voran zu treiben, subjektiv zu filtern, zu bewerten und nach Wertigkeit durchlässig oder manchmal auch (schützend) undurchlässig zu machen. Als einen Aspekt dieser Arbeit gelangte ich sehr schnell zu der Einschätzung, dass, obwohl die Machtfülle der übergeordneten Systeme der Institution erdrückend erscheint, die Machtfülle und damit einhergehend die Verantwortung der einzelnen MitarbeiterInnen und insbesondere der an der Basis, in dauerndem direktem Kontakt mit den zu betreuenden Menschen stehenden, LeiterInnen eine ungemein hohe ist, vor allem aber nicht nur in Bezug auf die zu betreuenden Menschen selbst.
Ich möchte dies kurz näher erläutern. Zur Beschreibung der Machtfülle der übergeordneten Systeme bietet sich Rene Simmen an, der versucht, in seinem Buch "Heimerziehung im Aufbruch", die traditionelle institutionelle Unterbringung aus kritischer Distanz zu betrachten. Er nennt das Bild, das sich ihm bietet, das "Trichtermodell der Heimerziehung", wobei er damit die Vorstellung und das Verständnis von Heimerziehung bezeichnet, wie es "für die Organisation des gesamten traditionellen Heimwesens im deutschsprachigen Raum, aber auch für die Stellung der ErzieherInnen, ihre Rolle und ihre Arbeit in den meisten Heimen heute noch charakteristisch ist" (Simmen 1989, S. 13).
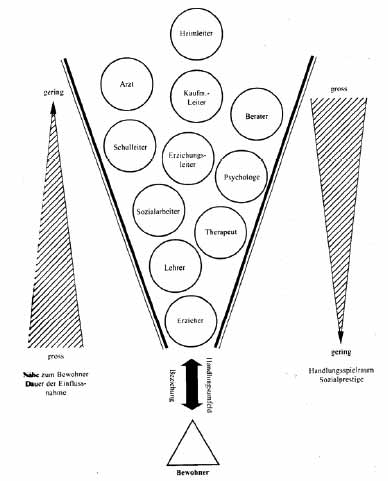
Abbildung 4: Trichtermodell der Heimerziehung (Quelle: Simmen 1998, S.21)
Betrachtet man sein Modell so zeigt sich darin der negative Zusammenhang der Nähe zum Bewohner bzw. der Dauer der Einflussnahme auf der einen Seite und dem Handlungsspielraum und dem Sozialprestige, welches die jeweilige Berufsgruppe genießt, auf der anderen Seite. Simmen kommt zum Schluss, dass der Handlungsspielraum, den der einzelne zur Verfügung hat, mit zunehmender Nähe zum Bewohner abnimmt und das gleiche auch für das Sozialprestige in der Gesellschaft gilt. Er sieht die "HeimerzieherInnen", die in diesem Modell gefangen sind, als Ausweg Charakteristika annehmen, die er als Verwalter-, Kämpfer- und Vogel-Strauss-ErzieherInnen beschreibt (vgl. Simmen 1989, S. 26ff.), d.h. als entweder in der Verwaltung statt aktiver Pädagogik aufgehend, dem Kampf gegen "das System" nur vordergründig zum Wohle der BewohnerInnen oder einer Selbstaufopferung ohne kritische Betrachtung des Ganzen, führt jedoch auch an, dass "die drei genannten Beispiele problematischen ErzieherInnenverhaltens" (ebd., S. 31) stark überzeichnet sind. "Trotzdem sind es Mahnmale, die es zu erkennen gilt, und in denen sich wohl viele ErzieherInnen teilweise wiederfinden werden" (ebd.). Damit hat er meiner Meinung nach nicht unrecht, wenn es darum geht, das System "Institutionelle Betreuung im Behindertenbereich" aus der Sicht eines Beobachters zu beschreiben. Größere Institutionen neigen dazu, hierarchisch organisiert zu sein. Simmen´s "Trichtermodell" kann auch als Abbild dieser hierarchischen Strukturen gelesen werden, das zeigt, dass "der Mensch", der institutionell betreut wird, nicht so sehr, wie in vielen Leitbildern und Werbeslogans zu vermitteln versucht wird, "im Mittelpunkt" steht, sondern hierarchisch gesehen ganz am unteren Ende. Es mag auch einen Blick auf gesamtgesellschaftliche Wertigkeiten erlauben, wie sie sich für Simmen darstellten. Dieses Bild sagt aber nichts oder nur sehr wenig darüber aus, wie die im System der Institution vereinigten Teilsysteme handeln bzw. welche Bewertungskriterien für diese vorherrschend sind. Und hier sah meine subjektiv wahrgenommene "Realität" deutlich anders aus. Zwar gab es diesen großen Handlungsspielraum der übergeordneten Stellen und vor allem die Vorgaben des Systems Institution, in vielen, den Alltag und dessen Gestaltung durch sowohl die MitarbeiterInnen als auch die BewohnerInnen "meiner" Wohngruppe betreffenden Bereichen war aber mein Handlungsspielraum, meine Macht und Verantwortung bedeutend größer, als dies Simmen´s Modell vermuten lassen würde. Dies hatte viel mit Kommunikation und Information zu tun. Durch Beobachtung lernte ich, welchen Einfluss die Art meiner Informationsweitergabe und die meiner damit einhergehenden Bewertungsmuster auf die Entscheidungsträger hatte. Dies im Detail zu erklären, würde den Rahmen sprengen, ich hoffe aber anhand zweier Beispiele aus der Praxis erkennbar zu machen, was ich mit "Handlungsspielraum, Macht und Verantwortung" meine. Beide betreffen den Bereich Medizin. Es gab unzählige andere Bereiche, auf die ich subjektiv betrachtet sehr großen Einfluss hatte, aber diese erscheinen in Anbetracht der Thematik dieser Arbeit besonders erwähnenswert.
Beispiel 1:
Von den neun BewohnerInnen der Wohngruppe, in der ich tätig war, zeigten drei deutliche Verhaltensauffälligkeiten, die sich in den ersten Jahren recht häufig, später selten als massive Aggressionsausbrüche mit Selbst- und Fremdgefährdung manifestierten. Diese drei Menschen bekamen über viele Jahre einen regelrechten "Cocktail" aus unterschiedlichsten sedierenden und stimmungsverändernden Medikamenten. Bis mindestens ins Jahr 2000 war es üblich, dass ein Neurologe in regelmäßigen Abständen die Wohngruppen besuchte, um die Medikation der BewohnerInnen neu "einzustellen". Bei diesen Visiten wurden die anwesenden BetreuerInnen gefragt, ob sich bei den PatientInnen erwähnenswerte Änderungen ergeben hätten, wie deren Verhalten im Zeitraum seit der letzten Visite gewesen wäre und dergleichen. Dieses Procedere schien überdies meist unter einem gewissen Zeitdruck zu stehen. Je nachdem, wie die Schilderung der gerade im Dienst befindlichen Betreuungsperson (oder auch PraktikantInnen) aussah, wurde die Medikation erhöht oder gleich belassen, nicht aber reduziert. Nachdem mir dieser Zusammenhang bewusst wurde, habe ich darauf geachtet, bei diesen Visiten immer anwesend zu sein. Ich kam im Laufe der Jahre zu der Ansicht, dass derart hohe Dosen von Psychopharmaka, über viele Jahre als Dauermedikation gegeben, nicht zielführend sein konnten und für die betroffenen Menschen nicht hilfreich wären, weshalb ich mich für eine Reduktion einsetzte. Ich tat dies nicht, indem ich etwas verschwieg oder Verhaltensauffälligkeiten schön redete, aber ich beließ es nicht bei der bloßen Schilderung der Ereignisse, sondern legte dar, welche pädagogischen Maßnahmen ich und mein Team setzen würden und dass dabei verhaltensverändernde und sedierende Medikation unsere Arbeit eher erschwerten als erleichterten. Durch diese Vorgangsweise sah sich scheinbar der betreffende Neurologe in der Lage, die Medikamentendosierungen bei den betreffenden Menschen im Laufe der Zeit schrittweise deutlich zu reduzieren, bei einem Patienten sogar gänzlich abzusetzen.
Dieses subjektiv beobachtete Beispiel ist keineswegs spektakulär. Gerade bei Menschen mit schwererer geistigen und mehrfachen Behinderung erscheint eine Diagnose von psychischen Problemen erschwert. Wenn ÄrztInnen nicht direkt mit ihren PatientInnen sprechen können und für eigene Beobachtung keine Zeit bleibt, holen sie sich die nötigen Informationen von der nächstbesten Informationsquelle, in Einrichtungen der Behindertenhilfe also beim anwesenden Betreuungsteam. Aber sollte es für so schwerwiegende Entscheidungen nicht andere Diagnosekriterien geben? Obwohl ich nie ein Medikament verschrieben oder abgesetzt habe, obwohl die diesbezüglichen Entscheidungen immer von Medizinern getroffen und verantwortet wurden, sah ich mich in der Position, deutlichen Einfluss darauf zu nehmen. Und damit auch gezwungen, die unterschiedlichsten Interessen abzuwiegen, die der KollegInnen, für die bei einer Medikationsreduktion bei den betreffenden BewohnerInnen die Gefahr von mehr Stress am Arbeitsplatz bestand, die der Angehörigen, für die diese Frage ebenfalls ambivalent war, die der MitbewohnerInnen, die vielleicht einer zusätzlichen Gefährdung ausgesetzt würden und die der betroffenen Menschen selbst, für die eine Einschränkung der Lebensqualität und des persönlichen Gestaltungsfreiraumes auf dem Spiel stand.
Beispiel 2:
Einige Monate bevor ich meinen Dienst in der Wohngruppe begann, gab eine Mitarbeiterin bei einer der in Beispiel 1 erwähnten Visiten an, sie hätte bei einer Bewohnerin einen epileptischen Anfall beobachtet, genauer gesagt hätte diese Bewohnerin anfallsähnlich die Augen verdreht. Der visitierende Arzt ordnete daraufhin ein EEG an. Auf der Überweisung stand sinngemäß "mit der Bitte um Abklärung nach dokumentiertem epileptischen Anfall". Der Befund des Institutes, das das EEG durchführte, lautete vereinfacht: "kein deutlicher Anfallsherd zu erkennen, Anfallsleiden dennoch nicht auszuschließen". So bekam die Bewohnerin Anfallsmedikamente verschrieben und nahm diese über viele Jahre. Ich begann mich eines Tages zu fragen, ob diese Bewohnerin diese Medikation wirklich benötigen würde oder sie unnötigerweise einnimmt. Nach der Beschreibung der ehemaligen Mitarbeiterin war es zu keinem epileptischen Anfall mehr gekommen, was natürlich an der Medikation liegen konnte, die Bewohnerin, eine Autistin, rollte aber des öfteren mit den Augen, spielerisch explorativ. Ich hegte den Verdacht, dass es sich bei dem beobachteten Anfall um genau diese Eigenart der Bewohnerin handeln könnte und teilte dies dem Neurologen mit, der daraufhin ein weiteres EEG anordnete, mit dem gleichen Schriftverkehr und dem gleichen Ausgang. Die Medikation blieb, wie sie war. Ein Jahr später versuchte ich es erneut, diesmal begleitete ich die Bewohnerin aber zur Untersuchung und gab dort an, dass ich in den Jahren meiner Tätigkeit in dieser Wohngruppe bei ihr noch nie einen epileptischen Anfall beobachtet hätte. Die Untersuchung fand im selben Institut, wie die Jahre zuvor, statt, diesmal aber lautete der Befund schlicht: "kein Anfallsherd festzustellen". Der Neurologe setzte die Anfallsmedikation schrittweise ab. Die Bewohnerin hatte auch in den darauf folgenden Jahren keinen epileptischen Anfall.
Ich kann nicht objektiv sagen, ob ich diesen Ausgang in irgendeiner Form beeinflusst habe. Dennoch hatte ich subjektiv den Eindruck, die betreffende Bewohnerin würde diese Medikamente weiterhin nehmen müssen, hätte ich nicht bestimmte Fragen gestellt und in bestimmter Weise kommuniziert. Und durch diese Annahme trug ich - für mich selbst - auch eine Verantwortung gegenüber der Bewohnerin. Ich ließ mir Zeit, beobachtete, war mir sicher, aber letztlich hätte ich mich auch irren können. Obwohl ich selbst wiederum nichts verschrieben hatte, bei diesem Procedere de iure keine Rolle spielte, sah ich de facto einen Handlungsspielraum.
Viele Begebenheiten dieser Art in unterschiedlichsten Bereichen ließen mich schlussfolgern: BetreuerInnen in der institutionalisierten Behindertenhilfe haben die Macht, geistig und mehrfach behinderte BewohnerInnen der Einrichtung einzuschätzen, und diese BetreuerInnen haben die Macht, sich zu entscheiden, was sie aufgrund dieser Einschätzung für möglich halten und was nicht. Außerdem besitzen sie die Freiheit, sich zu engagieren, oder dies nicht zu tun. Darin liegt eine große Verantwortung. Dies gilt insbesondere innerhalb des eigenen Systems, intra-institutionell des eigenen Arbeitsbereiches, kann aber in andere Teilsysteme ausstrahlen.
Nach 10 Jahren Tätigkeit in einer Wohngruppe, davon 8 Jahren als Leiter derselben, und einer mehrjährigen parallel laufenden Vorbereitungszeit erhielt ich die Gelegenheit, eine eigene Idee umsetzen zu können, einen Medienarbeitsplatz für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Zwar konnte das ursprüngliche Konzept, das auf eine breite Auslegung des Wortes "Medium" aufbaute und in dem auch Zeitung, Radio und Internetaktivitäten vorgesehen waren, wegen knapper Finanz- und Zeitressourcen nicht ganz umgesetzt werden, es gelang aber eine Realisation des Kernbereiches Fernsehen und Video.
Mein Hauptaugenmerk lag auf der größtmöglichen Verwirklichung des Empowerment-Gedankens (vgl. Theunissen 1995). Für den Arbeitsbereich bedeutet dies, dass meine MitarbeiterInnen lernen, Aufgaben eigenständig zu erfüllen und für diese Aufgaben auch Verantwortung zu übernehmen. Ich habe im Grundkonzept der Medienwerkstatt das Ziel festgeschrieben, einen professionellen Medienarbeitsplatz zu schaffen, der die geistig- und mehrfach behinderten MitarbeiterInnen nicht auf das Abarbeiten einfachster Tätigkeiten reduziert und vor allem nicht nur den Anschein von eigenständigem Arbeiten erweckt, sondern dieses tatsächlich fördert. Das heißt auch, dass meine MitarbeiterInnen gefordert sind, Ergebnisse zu liefern, die strengeren Kriterien genügen müssen, als sie in einer reinen Beschäftigungstherapie-Werkstätte zur Anwendung kommen.
Grundvoraussetzung für die Mitarbeit in der Medienwerkstatt[15] ist der Wunsch des Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mitzuarbeiten. In der Praxis ergeben sich natürlich vordergründig für einzelne Teilbereiche noch weitere Notwendigkeiten. So sollte jemand, der Sendungen moderieren möchte, grundsätzlich verbal kommunizieren können, oder jemand, der mit einer Videokamera Aufnahmen machen möchte, sollte diese halten können und feinmotorisch in der Lage sein, diese zu bedienen. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, ist eine Mitarbeit nicht per se ausgeschlossen. Eine Moderation mit nonverbalen Mitteln und z.B. Untertiteln ist für ein bestimmtes Zielpublikum ebenso vorstellbar, wie z.B. die Montage einer Kamera an einen Rollstuhl und, wenn die Bedienung derselben nicht möglich ist, eine persönliche Assistenzperson, die diese nach den Vorgaben des Menschen mit Behinderung einstellt und startet. Außerdem gib es noch weitere Tätigkeiten im redaktionellen Bereich. So könnte ein schwerst geistig und körperlich beeinträchtigter Mensch eine Art Lektoratsposten für die Filmbeiträge übernehmen, d.h. entscheiden, ob ein Beitrag für die betreffende Zielgruppe verständlich aufbereitet wurde oder nicht. Die Grenzen liegen hier bei den Grenzen der Fantasie und der Problemlösungsfähigkeit bzw. -bereitschaft der beteiligten Personen und / oder bei struktur- und systembedingten Vorgaben.
Das Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes-Kepler-Universität Linz, wurde vom Verein Schloss Hartheim mit der inhaltlichen Neugestaltung der Räume "Leben mit Behinderung" der Ausstellung "Wert des Lebens" beauftragt. Die teilweise Neustrukturierung der Ausstellung erschien notwendig, um "die pädagogische Qualität und die inhaltliche Aktualität auch weiterhin gewährleisten zu können (...). Die Neugestaltung des Bereichs "Leben mit Behinderung" verfolgt das Ziel, das Thema "Leben ohne Behinderungen" möglichst konkret erfahrbar zu machen. Personen mit Behinderung werden stellvertretend für die Vielzahl von Menschen mit Beeinträchtigung aus ihrem Leben berichten. Sie erlauben den BesucherInnen direkte Einblicke in persönliche Lebensumstände. Die Ausstellung wird so auch zu einem Medium der Anliegen und Probleme behinderter Menschen" (Dyk, Weidenholzer et al. 2006, S. 1).
Die Projektbeauftragten des Institutes für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes-Kepler-Universität Linz hatten von Beginn an den Wunsch, in irgendeiner Form neue bzw. zusätzliche Videoinstallationen zu verwenden und waren auf der Suche nach Partnern, die die dafür benötigten Videobeiträge erstellen könnten. Von einem Mitarbeiter des Vereines Schloss Hartheim auf die Medienwerkstatt (vgl. Kap. 4.1.2) aufmerksam gemacht, kam von Frau Mag.a Angela Wegscheider die Anfrage, ob ich und meine MitarbeiterInnen in der Lage wären, diese Aufgabe zu übernehmen. Zu meiner grundsätzlichen positiven Antwort erstellte ich eine DVD mit Referenz - Videos, die dem Projektteam der Kepler Universität als Beispiel für unsere technischen und fachlichen Möglichkeiten dienen sollten.
Einige Wochen später informierte mich Frau Mag.a Wegscheider von der Zusage der Projektleitung und wir begannen mit der detaillierteren Erörterung inhaltlicher Vorgaben. Zu Beginn bestanden diese vor allem in dem Wunsch, PolitikerInnen zum Thema "Behinderung" zu interviewen, man könne sich auch noch Meinungen von Experten von behindertenspezifischen Institutionen vorstellen. Ob auch Menschen mit Behinderung interviewt werden sollten, war noch nicht festgelegt. Mir war dieser Punkt aber wichtig, was auch Zustimmung fand.
Für mich machte diese Projekt nur Sinn, wenn meine Mitarbeiter[16], also Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die Fragen selbst formulieren würden. Alles andere wäre eine Reduktion auf Vorlesen und Abfilmen gewesen. Auf meine mehrmalige Versicherung, dass meine Mitarbeiter in der Lage sind, inhaltlich relevante Fragen zu stellen, stimmte man diesem Ansinnen zu.
Normalerweise stammt die Idee, worüber berichtet werden soll, mittlerweile von meinen MitarbeiterInnen, weshalb sie auch meist schon einige, oft sehr konkrete Fragen im Kopf haben. In diesem Fall kam die Idee von einem externen Auftraggeber, der bereits Vorstellungen zur Thematik einbrachte, die wir berücksichtigen mussten. Aus diesem Grund versuchte ich die zu bearbeitenden Themengebiete mit kurzen Einführungen anzureißen, um dann heraus finden zu können, ob das jeweilige Thema Aspekte beinhaltete, die auch für auch für die beteiligten Mitarbeiter, Herrn T. und Herrn A., interessant sind. Aus den daraus resultierenden Erzählungen, vor allem von Herrn T., entstanden, die Fragen, die später den InterviewpartnerInnen gestellt wurden, mit Ausnahme von Frage 1, welche ich selbst als Einstieg in die Thematik angeregt habe.
Die so erarbeiteten Fragen lauteten:
1. Was bedeutet für Sie Behinderung?
2. Ist jedes Haus oder Gebäude rollstuhlgerecht?
3. Was muss getan werden, damit das Leben für Menschen mit Behinderung sicher wird?
4. Wie könnte man die berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinderung gestalten?
5. Manchmal werden behinderte Menschen gehänselt. Was kann ich / man dagegen tun?
6. Was könnte man gegen das blöde Gelächter und Gerede tun?
7. Solltet ihr mehr über Behinderung und Menschen mit Behinderung wissen?
Ich möchte das Zustandekommen dieser Fragen anhand eines Beispieles verdeutlichen: Bei Frage 5 ging es mir darum, den Themenkomplex "Bild des behinderten Menschen in der Öffentlichkeit" zu bearbeiten. Ich fragte also die beiden, wie sie glauben, dass behinderte Menschen in der Öffentlichkeit gesehen werden, ob sie positiv oder negativ aufgenommen werden und ob dieses Bild veränderbar wäre. Keine leichte Frage, aber Herr T. begann nach kurzem Zögern von Begebenheiten zu erzählen, bei denen er selbst und MitbewohnerInnen von Passanten ausgelacht oder beschimpft wurden. Er stellte die Frage in den Raum, warum das so sei, - warum ihn wildfremde Menschen, die ihn ja gar nicht kennen, einfach auslachen oder "blöd reden" würden. Er berichtete auch, dass er einmal gefragt wurde, warum er behindert sei und dass der Fragende "wenigstens mit mir geredet" hat. Insgesamt erzählte er zu diesem Thema über eine halbe Stunde, bevor ich versuchte, seine Erzählungen in eine Interviewfrage zu komprimieren und dabei ihn selbst formulieren zu lassen. Da die am ersten Drehtag zu interviewenden Politiker in Wien seine Erzählungen nicht hören würden, benötigten wir einen Einstiegssatz, der das Wesen seiner Erlebnisse innehätte. Ich schlug "Manchmal oder oft werden behinderte Menschen gehänselt oder ausgelacht" vor, Herr T. entschied sich für "Manchmal werden behinderte Menschen gehänselt ". Da er mehrmals erwähnt hatte, nicht zu wissen, was er gegen das Gerede und Gelächter zu können, war naheliegend, diesen Punkt als Frage zu formulieren: Was kann ich dagegen tun? bzw. Was kann man dagegen tun?
Kurz vor dem ersten Drehtag wurde ich seitens der Auftraggeber von Fr. Mag.a Wegscheider informiert, dass wir das Thema "Menschenrechte" behandeln sollten und dafür die Frage, ob jedes Haus rollstuhlgerecht sei, streichen, da diese unverständlich sei. Ich lehnte die Streichung ab, stimmte der Hereinnahme der neuen Thematik aber grundsätzlich zu. Da ich aber mit Herrn T. und Herrn A. vor der Abreise nach Wien nicht mehr zusammen kommen würde, bat ich Fr. Mag.a Wegscheider, die uns nach Wien begleiten würde, die Menschenrechtscharta (vgl. URL: http://www.unhchr.ch [Allgemeine Erklärung der Menschenrechte]) während der Fahrt zu erklären und gegebenenfalls gemeinsam mit den beiden eine Frage zu formulieren. Daraus entstand: Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?
Da unsere Auftrageber befürchteten, dass einige Fragen für die Interviewpartner unverständlich oder zu ungenau sein könnten, hat Fr. Mag.a Wegscheider eine Umformulierung angeregt. Ich teilte diese Befürchtung nicht. Als Kompromiss wurden einzelne Fragen ergänzt, sodass die letztlich verwendeten Fragestellungen wie folgt lauteten:
-
Was bedeutet für Sie Behinderung?
-
Ist jedes Haus oder Gebäude rollstuhlgerecht bzw. barrierefrei zugänglich? (öffentliches Gebäude)
-
Was muss getan werden, damit das Leben für Menschen mit Behinderung sicher wird? (Einkommen, Pension)
-
Wie könnte man die berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinderung gestalten?
-
Manchmal werden behinderte Menschen gehänselt und benachteiligt. Was kann man dagegen tun?
-
Was könnte man gegen das blöde Gelächter und Gerede tun?
-
Solltet ihr mehr über Behinderung und Menschen mit Behinderung wissen?
-
Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?
Die erste Reihe von Befragungen wurde in Form von strukturierten Einzelinterviews durchgeführt. Wie diese zustande kamen und welche Konzeption ihnen zugrunde liegt, wurde bereits in Kap. 4.3.3 beschrieben. Die Interviews fanden in Wien, zuerst im österreichischen Parlament und dann in den Räumen des Vereins BIZEPS statt. InterviewpartnerInnen waren:
Dr. Franz Josef Huainigg (Abgeordneter zum Nationalrat, Behindertensprecher der ÖVP)
Mag.a Christine Lapp (Abgeordnete zum Nationalrat, Behindertensprecherin der SPÖ)
Theresia Haidlmayr (Abgeordnete zum Nationalrat, Behindertensprecherin der GRÜNEN)
DSA Manfred Srb (Verein BIZEPS, Wien)
Martin Ladstätter (Verein BIZEPS, Wien)
Interviewer war Herr T., Herr A. und ich machten die Videoaufnahmen. Audiodateien dieser Interviews sind im Anhang in Form einer CD zu finden.
Für diese Untersuchung sind die Ergebnisse der ersten Interviewserie dann berücksichtigt worden, wenn sie Aufschluss über folgende Themenbereiche lieferten:
-
Der Begriff "Behinderung" und seine Bedeutung
-
Wie werden Menschen mit Behinderung in umgebenden Systemen gesehen?
Auf die Frage "Was ist für Sie Behinderung?" antworteten die InterviewpartnerInnen wie folgt:
Hr. Dr. Huainigg: "Behinderung ist vielfältig. Also, es gibt so einen Spruch der Behindertenbewegung, - man ist nicht behindert, man wird behindert! - das heißt, es ist kein Problem im Rollstuhl zu sitzen, aber wenn man raus rollt und da gibt´s Stufen, Gehsteigkanten, zu enge Türen, dann wird Behinderung zu einem Problem. Man wird behindert. Und deshalb versuchen wir auch eine Gleichstellung herbeizuführen, das heißt Beseitigung von Barrieren, damit man ungehindert behindert sein kann."
Fr. Mag.a Lapp: "Behinderung heißt, wenn man behindert wird, also das heißt, wenn man zum Beispiel einen großen Berufswunsch hat als Kind und den nicht erleben kann, den nicht irgendwie gestalten kann. Behinderung heißt, wenn man in einem Raum hinein gehen will und man kommt nicht hinein, weil Stufen sind. Behinderung heißt, wenn man bei kulturellen Veranstaltungen dabei sein will und kann da nicht mitmachen. Und dann gibt's natürlich diese klassischen Definitionen und Bestimmungen von Behinderung, aber ich denk ma immer, ich schau mir das gerne von der anderen Seite an, wo man behindert wird."
Fr. Haidlmayr: "Behinderung ist ein Zustand, in dem man nicht alle Dinge des täglichen Lebens ohne fremde Hilfe durchführen kann."
Hr. DSA Srb: "Ja, Behinderung is für mich, wenn i zum Beispiel wo in ein Lokal rein gehen möchte, was gutes essen möchte, und dann komm i hin und entdecke, dass dort Stufen sind und i kann nicht hinein."
Hr. Ladstätter: "Behinderung is, wenn mir Möglichkeiten, die andere haben, verwehrt werden. Das kann vieles sein, das kann ein Besuch in einem Kino sein, wo ich nicht hinein komme, das kann aber auch ein Autobus sein, den ich nicht benützen kann."
Ich möchte hier zunächst ein zusätzliches Kriterium einführen, zu dem ich durch Beobachtung gelangt bin. Sowohl Herr Dr. Huainigg, als auch Frau Haidlmayr, Herr DSA Srb und Herr Ladstätter beantworteten diese Fragen im Rollstuhl sitzend, weshalb ich ihre Antworten als Innenansicht verstehe, d.h., als Antworten zum Thema Behinderung von Menschen, die selbst behindert und dadurch Experten in eigener Sache sind. Das ist grundsätzlich sehr heikel und erfordert eine definierende Begründung.
Im oberösterreichischen Behindertengesetz von 1991 wird Behinderung wie folgt definiert: "Als behinderte Menschen im Sinne dieses Landesgesetzes gelten Personen, die - auf Grund nicht vorwiegend altersbedingter körperlicher, geistiger, psychischer oder mehrfacher derartiger Leiden oder Gebrechen bzw. Sinnesbehinderungen - in einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Erziehung, ihrer Schulbildung, ihrer Berufsbildung, ihrer Persönlichkeitsentwicklung bzw. Persönlichkeitsentfaltung, ihrer Erwerbstätigkeit sowie ihrer Eingliederung in die Gesellschaft wegen wesentlicher Funktionsausfälle dauernd erheblich beeinträchtigt sind oder bei denen eine solche Beeinträchtigung nach den Erkenntnissen der Wissenschaft in absehbarer Zeit eintreten wird, insbesondere bei Kleinkindern" (URL: http://www.ris.bka.gv.at [OÖ. Behindertengesetz 1991]). Für die betreffenden vier Personen könnte man aus der Beobachtung ein nicht vorwiegend alterbedingtes körperliches Leiden oder Gebrechen annehmen.
In der ICF (vgl. Kap. 2.4) wird "Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]" (DIMDI 2005, , S. 9, URL: http://www.dimdi.de/ [ICF]) definiert. Hierzu lässt sich bei den betreffenden vier Personen durch Beobachtung ebenfalls eine körperliche Schädigung begründen, d.h. das Benutzen eines Rollstuhles legt das Vorhandensein einer Beeinträchtigung im Bereich der Möglichkeiten der Fortbewegung nahe.
Davon ausgehend sollen die ihre Sicht von Behinderung definierenden Antworten von Herrn Dr. Huainigg, Frau Haidlmayr, Herrn DSA Srb und Herrn Ladstätter genauer betrachtet werden. Dabei fällt auf, dass bei drei von vier Antworten, jenen der drei Herren, die primäre Behinderung, also in diesem Fall die eigene körperliche Schädigung, nicht als vorrangig betrachtet wird, sondern sekundäre Behinderungen im Vordergrund stehen. Besonders hervorgehoben werden Beeinträchtigungen des täglichen Lebens durch Barrieren (Stufen, Gehsteigkanten, zu enge Türen).
Einzig Frau Haidlmayr sieht die primäre Behinderung für ihre Definition als maßgeblich, da sie ein Angewiesensein auf fremde Hilfe bedeute. In weiterer Folge sagte sie im Anschluss an das strukturierte Interview im Gespräch mit Herrn T.: "(...) des was heite für RollstuhlfahrerInnen eigentlich scho normal is, des muas a fia andere Gruppen von Menschen mit Behinderungen normal werden. Weil vor 40 Joa war i a no a totaler Fremdkörper in da Gsöschaft, aber inzwischen sogt ma, na bei eich Rollstuhlfahrer, (...) do is eh selbstverständlich , so nach dem Motto, oba es hat a Jahre, Jahrzehnte braucht und des muas für alle gelten, die was si drinnen ned organisieren können, da ham mia di Verpflichtung, dass wir sie unterstützen, dass es genauso selbstverständlich wird, dass sie a Teil der Gesellschaft san, wie olle ondern a!(...)". Und in weiterer Folge, noch einmal bezugnehmend auf die Frage, was für sie Behinderung sei, schloss sie mit den Worten: "Ich werde immer a Frau mit Behinderung bleiben, weil a wenn olle Rahmenbedingungen erfüllt san, (...) die Barrierefreiheit und so weiter, wird's trotzdem meine Behinderung bleiben. Und das ist auch OK so, aber i kann trotzdem mit meiner Behinderung ein eigenständiges, autonomes, selbstbestimmtes Leben führen, und um des geht's ma. (...) i wü di Behinderung ned weg (...) operieren oder (...), geht eh ned (...), sondern des bin i, (...) mit meinem Anderssein, und ich bin Teil der Vielfalt der Gesellschaft und des wüll i gar ned ändern, wei wen olle gleich san, wird's jo a wieda fad." Frau Haidlmayr sieht also RollstuhlfahrerInnen nach einem jahrzehntelangen Prozess heute eigentlich normal in die Gesellschaft integriert, als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft. In ihrem Fall deckt sich das auch weitgehend mit meinen Beobachtungen. Frau Haidlmayr hat uns, als in Wien nicht ortskundige, z.B. zum nächsten Drehort begleitet. Während dieser Zeit wurde sie von Passanten angesprochen und zwar nicht als Mensch mit Behinderung oder Rollstuhlfahrerin, sondern als Politikerin und Parlamentarierin zu Alltagsthemen. Es war hierbei bei den sie ansprechenden Menschen kein Unterschied im Verhalten feststellbar, zu dem, wie man es bei anderen, nicht behinderten PolitikerInnen erwarten würde. Auch die anschließende Straßenbahnfahrt war sichtbar Routine und das Einsteigen mit dem Elektro-Rollstuhl stellte keine Probleme dar. In der Straßenbahn stand ich etwas abseits und konnte hören, wie sich zwei ältere Damen über Frau Haidlmayr unterhielten, wobei sich dieses Gespräch um die politischen Ansichten von Frau Haidlmayr aus der Sicht der beiden Damen und um ihre Kleidung drehte. Auch hier war für mich kein Unterschied zu einer nicht behinderten prominenten Persönlichkeit festzustellen und die körperliche Beeinträchtigung offensichtlich kein Thema.
Aus den Antworten von Herrn Dr. Huainigg, Frau Haidlmayr, Herrn DSA Srb und Herrn Ladstätter und meinen im Rahmen und im Umfeld der Interviews gemachten Beobachtungen kam ich zu folgender Annahme:
Die primäre Behinderung, in diesem Fall eine deutliche körperliche Beeinträchtigung, spielt für die genannten Personen im Alltag, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle oder stellt kein Problem dar. Deutlich problematischer werden aber sekundäre Behinderungen gesehen, zumeist Barrieren, die es den betroffenen Menschen erschweren oder verunmöglichen, an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen.
Die Antwort von Frau Mag.a Lapp, aus der Außensicht, scheint diese Annahme zu unterstützen, wobei ihre Antwort diese Annahme bereits generalisiert.
In der Folge sollen die Antworten auf weitere in Kap. 4.1.3. beschriebene Interviewfragen angeführt werden, die Aufschluss über die Einschätzung der Interviewpartner zur Sichtweise von "Behinderung" in umgebenden Systemen, vor allem dem System Gesellschaft, geben können.
Hr. Dr. Huainigg zur Frage Solltet Ihr mehr über Behinderung wissen?: "Es ist natürlich ein Problem, dass viele Menschen, die nicht behindert sind, gar nicht wissen, (...) wie ist das, behindert zu sein oder warum geht der so langsam oder warum (...) braucht der länger? (...) Da braucht man nicht spotten, sondern (...) oft wird gespottet einfach aus Unverständnis, deswegen brauchts mehr Informationen, aber auch das natürliche Zusammenleben, also (...) wenn man gemeinsam in den Kindergarten geht, gemeinsam in die Schule geht, gemeinsam arbeitet, gemeinsam lebt, dann gibts auch weniger oder keine Vorurteile, wenn man sich einfach kennt und deshalb ist das das Ziel, gemeinsam zu leben, Integration."
Hr. Dr. Huainigg zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?: "Es gibt jetzt gerade eine Diskussion Menschenrecht für Tiere (...) und auf der anderen Seite ist es so, dass die Euthanasie (...) weltweit im Steigen ist, wieder im Kommen ist, und aktive Sterbehilfe. In Holland beispielsweise haben im letzten Jahr 1930 Personen aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen und es gibt auch jetzt die Tendenz in den Niederlanden, dass man bereits behinderte Embryos zur Euthanasie frei gibt. Und hier dieser Widerspruch, auf der einen Seite behinderten Embryos spricht man das Lebensrecht ab, auf der anderen Seite gibt man Tieren Menschenrechte, das find ich sehr bedenklich und hier gilt es, dagegen zu halten."
Fr. Haidlmayr zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?: (...) die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen ist nach wie vor an der Tagesordnung und das Recht selbstbestimmt in seiner Umgebung zu leben ist natürlich nicht vorhanden, weil dann würde es auch diese großen Sonderanstalten und Sondereinrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen untergebracht sind, nicht mehr geben. (...) das ist teilweise auch Sache der Länder, indem sie immer noch auf ihren großen Sondereinrichtungen draufsitzen und die als, mehr oder weniger, als beste Möglichkeit für das Leben von Menschen mit Behinderungen sehen. Und das ist falsch und das ist unrichtig. Nur das Leben in der Gesellschaft ist die Grundlage um wirklich auch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Natürlich braucht es dazu die notwenigen Rahmenbedingungen, die selbstverständlich auch sichergestellt werden müssen."
Hr. DSA Srb zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?: "Nein, bei den Menschenrechten haben wir Menschen mit Behinderung noch große Defizite zu beklagen. Es ist so, dass wir doch in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens benachteiligt werden, gegenüber nicht-behinderten Menschen. Und da gibt's noch sehr viel zum Aufholen. Es ist halt auch so, dass das vielen betroffenen behinderten Menschen teilweise noch gar nicht so sehr bewusst ist, dass sie benachteiligt werden, dass sie diskriminiert werden. Und für nicht-behinderte Menschen erst recht, weil die merken das gar nicht, die sind nicht betroffen und sie kommen nicht in die Situation wie behinderte Menschen."
Hr. Ladstätter zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?: In Österreich werden die Menschenrechte prinzipiell nicht sehr hoch geschätzt. (...)Wenn man zum Beispiel überlegt, wie MigrantInnen in Österreich behandelt werden. Wie schwierig es ist, dass Frauen die gleichen Chancen kriegen. Und bei behinderten Menschen ist das nicht anders. Und bis vor kurzem, ich sag einmal, so lange ist das gar nicht her, war es rechtlich erlaubt behinderte Menschen umzubringen. Das ist ein ganz fundamentales Lebensrecht und zwar das Recht auf Leben. Viele Rechte in Österreich sind für behinderte Menschen noch nicht gegeben und deswegen wird unser Kampf für Menschenrechte noch sehr lange dauern. Wir haben da einen großen Aufholprozess, an dem wir intensiv arbeiten. (...) Normal ist das, was die Mehrheit als normal empfindet. Im Moment gibt es noch in Österreich ein Gesetz, das sagt, dass behinderte Föten in Österreich abgetrieben werden dürfen, nicht-behinderte nicht. Und das ist zum Beispiel auch noch in Österreich Gesetz (...)."
Alle Interviewpartner sehen behinderte Menschen als von der Gesellschaft diskriminiert und die Einhaltung der Menschenrechte (vgl. http://www.unhchr.ch/ [Allgemeine Erklärung der Menschenrechte]) für Menschen mit Behinderung als nicht gegeben an. Die Abtreibung von behinderten Föten, die in Österreich im Gegensatz zu nicht behinderten Föten bis zur Geburt rechtmäßig ist, wird ebenso als Beispiel für eine Ungleichbehandlung angeführt, wie Tendenzen in den Niederlanden, wo aktive Sterbehilfe toleriert wird. Weiters werden Defizite beim Recht auf selbstbestimmtes Leben und in nicht näher definierten Bereichen des Alltagslebens angegeben. Die Tatsache, dass es eigene Anstalten für behinderte Menschen gibt, wird ebenfalls kritisch gesehen und ist ein weiteres Indiz für die Be- und Aussonderung dieser Gruppe von Menschen in der Gesellschaft.
Die Gründe für die anhaltende Ungleichbehandlung werden in Unverständnis und fehlender Information gesehen. Auch gebe es noch viele behinderte Menschen, denen gar nicht bewusst sei, dass sie diskriminiert werden. Nicht behinderten Menschen seien überdies die Probleme behinderter Menschen nicht bewusst, da sie nicht in vergleichbare Situationen gelangen würden.
Als Lösungsvorschläge gegen die negative Bewertung behinderten Lebens werden vermehrte Information und die Integration in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens angeregt, um dadurch vorhandene Vorurteile abzubauen.
Die zweite Interviewserie wurde mit den selben Fragestellungen wie in Kap. 4.1.3 beschrieben durchgeführt.
InterviewpartnerInnen waren:
Frau Mag.a Helene Jarmer (Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes ÖGLB)
Frau Carina Metka
Frau Belinda Wallner
Herr Gerhard Engelmann
Im Unterschied zur in Kap. 4.2 beschriebenen ersten Interviewserie, bei denen die InterviewpartnerInnen ohne vorherige Kenntnis der Fragestellungen direkt befragt wurden, gab es bei dieser Interviewserie teilweise Änderungen im Setting. So konnten wir aus Termingründen Frau Mag.a Jarmer nicht direkt befragen, weshalb wir ihr die Fragen zusandten und in Anschluss daran von ihr ein Video mit ihren Antworten in Gebärdesprache samt Simultanübersetzung erhielten. Frau Carina Metka kann auf Grund einer schweren körperlichen Beeinträchtigung nicht verbal kommunizieren und benutzte für ihre Antworten einen Computer mit Sprachausgabe. Da sie für das schriftliche Erstellen ihrer Antworten mittels eigener Kopfsteuerung Zeit benötigte, bekam auch sie die Fragen bereits im Vorfeld zugeschickt.
Die Kriterien, nach denen ausgewertet wurde, sind die selben wie bei der ersten Interviewserie. Die Kategorie Innenansicht ist bei allen InterviewpartnerInnen der zweiten Serie gerechtfertigt, bei Frau Mag.a Jarmer durch eine Hörbehinderung, bei Frau Metka durch eine schwere körperliche Behinderung und bei Frau Wallner und Herrn Engelmann durch eine psychische Behinderung.
Auf die Frage "Was ist für Sie Behinderung?" antworteten die InterviewpartnerInnen wie folgt:
Fr. Mag.a Helene Jarmer: "Für mich bedeutet Behinderung, behindert zu werden, und wenn Barrieren, die jetzt da sind, abgebaut werden, dann (...) wird auch meine Behinderung weniger, d.h. wenn Gehörlose die Möglichkeit haben z.B. per SMS zu kommunizieren bedeutet das eine Behinderung weniger, eine Barriere weniger."
Fr. Carina Metka: "Das Wort "Behinderung" hat für mich eine andere Bedeutung. Die Gesellschaft sieht einen Menschen als behindert, aber für mich ist es ganz normal behindert zu sein! Ich bin schon so auf die Welt gekommen. Es ist für mich normal, Hilfe von anderen Leuten zu bekommen, das heißt es ist nicht selbstverständlich, aber ich denke nicht `Um Gottes Willen, ich muss schon wieder Hilfe bekommen´."
Fr. Belinda Wallner: " Für mi is Behinderung des, wan an di Leit behindern. Wie a Behinderung is eigentlich a Krankheit, die olle möglichen Leit hom kinnan und wan die sogenannten gsunden Leit des net vastehn woin (...) wie es kann a jeda so krank werdn, jeda irgenda Behinderung kriagn, und drum is des fia mi a Behinderung, ma wird nur behindert, im Großen und Ganzen."
Hr. Gerhard Engelmann: "Jo, fia mi, i bin söwa behindert, i was wia des is, (...) Behinderung is für mi a Schicksal, wo ma net aus kann (...) Man muas hoit lerna, schauen und lerna, dos ma sei Krankheit in Griff hot, dann geht's an meistens guat und olle paar Joa kummt dann wieda a klaner Rückfall oder was. Und dann muas ma wieda schauen und so geht's dahin. (...) Die Leit kennan a behindert machen.(...)"
Zwei der InterviewpartnerInnen, Frau Mag.a Jarmer und Frau Wallner sehen die sekundären Behinderungen, hervorgerufen durch Barrieren bzw. das Verhalten nicht-behinderter Menschen gegenüber behinderten Menschen, als maßgeblich für ihre Definition an. Herr Engelmann sieht dies ebenfalls als einen Faktor an, bezeichnet Behinderung aber grundsätzlich als Schicksal, dem man nicht auskommen könne. Frau Metka definiert Behinderung im Bezug auf ihre persönliche Situation als normal, ebenso ihr Angewiesensein auf fremde Hilfe und den Umstand, dass sie diese Hilfe bekommt, obwohl sie letzteres als nicht selbstverständlich annimmt.
Ich sehe die im Kap. 4.2.3 getroffene Annahme durch die Antworten der oben genannten Personen als grundsätzlich bestätigt an, möchte sie aber leicht modifizieren und folgende Hypothese aufstellen:
Die primäre Behinderung spielt, wiewohl sie eine erschwerte Ausgangslage definieren kann, für die betroffenen Personen im Alltag, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle, da sie als eigenes So-Sein letztlich zur persönlichen Normalität gerechnet wird . Deutlich problematischer werden aber sekundäre Behinderungen gesehen, zumeist Barrieren und/oder Verhaltensweisen nicht-behinderter Menschen, die es den betroffenen Menschen erschweren oder verunmöglichen, an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen.
In der Folge sollen wiederum die Antworten auf weitere in Kap. 4.1.3. beschriebene Interviewfragen angeführt werden, die Aufschluss über die Einschätzung der Interviewpartner zur Sichtweise von "Behinderung" in übergeordneten Systemen, vor allem dem System Gesellschaft, geben können.
Fr. Mag.a Helene Jarmer zur Frage Manchmal werden behinderte Menschen gehänselt und benachteiligt. Was kann man dagegen tun?: "Es ist sehr wichtig in diesem Bereich, so früh wie möglich Integration anzubieten, dass Kinder von klein auf andere Menschen erleben und damit ganz normal damit aufwachsen, dass sie das als normal erleben, und damit so aufwachsen, dass sie das auch als Erwachsene akzeptieren und offen auf andere Menschen zugehen können. Sehr wichtig ist es auch für Erwachsene, da Informationen zu bekommen, aufgeklärt zu werden, um Barrieren abbauen zu können, aber es ist sehr wichtig (...), dass das von klein auf passiert. Und man kann (...) ironisch sagen, (...) ich kann auch als Gehörloser sagen, der ist hörend, na, das interessiert mich nicht, ja, und das ist dann der Umgang zwischen Erwachsenen."
Fr. Carina Metka zur Frage Manchmal werden behinderte Menschen gehänselt und benachteiligt. Was kann man dagegen tun?: "Diese Frage beziehe ich jetzt auf mich, was ich immer mache, wenn mich die Leute blöd anschauen oder blöd anreden: Ich frage die Menschen durch meine Assistentinnen (ich kann nicht verbal sprechen), ob sie von mir ein Foto haben wollen! Das hilft zu 99%. Wenn die Leute dann immer noch nicht aufhören, lasse ich sie blöd reden und schauen. Dann schaue ich sie solange böse an, bis die fremden Menschen aufhören, mich mit ihren Blicken zu nerven!
Fr. Carina Metka zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten? (von ihr selbst in bestimmte Bereiche aufgeteilt):
"Arbeit: Es gibt viel zu wenig Arbeitsplätze für körperbehinderte Menschen! Im geschützten Bereich sind die Plätze jahrelang besetzt. Mich freut es, dass in den nächsten Jahren immer mehr Arbeitsplätze für Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen geschaffen werden!
Privatsphäre: Menschen mit schweren Behinderungen haben keine körperliche Privatsphäre oder Intimsphäre durch Betreuung von anderen Leuten.
Familie: Viele Eltern von behinderten Kindern geben ihre Kinder in ein Heim! Meine Eltern machten es Gott sei Dank (!) nicht. Ich weiß das zu schätzen!!! Meine ganzen Familienangehörigen wissen auf welche Art sie mit mir reden können! (...)"
Fr. Belinda Wallner zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?: "Noch nicht. (...) weil die Leit glauben, sie kennan mit an mochn, was´s woin, solang der sozusagen des ned mitkriagn, wie er eh (...) entweder wenn er körperlich behindert is, des ....aber wann ana geistig behindert is, is hoit in dem Fall aso, dass olle Leit glauben, der kriagt eh nix mit, und des is imma no, wo i ma denk, fia mi (...) dass die Menschenrechte fia die Behinderten imma no net götn. (...) I find des a sehr traurig, oba (...) mia woin des eben ändern, mia, die sozusagen die Behinderung ham (...) mia woin stark sein fia die Leit,(...) i hoff, dass ma irgendwann amoi wirkli genauso als Menschen angsehn werdn, als wia die sogenannten Gesunden."
Hr. Gerhard Engelmann zur Frage Werden die Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung eingehalten?: "(...) Teilweise tans eh scho wos, abo (...) es is noch zu wenig. Zum Beispiel des Wort Deppat (...) des is scho so lang (...), des hea i immer ständig (...)."
Aus der Innenansicht der befragten Personen werden Menschen mit Behinderung vom System Gesellschaft nicht als gleichberechtigte Mitglieder dieses Systems angesehen bzw. nicht in angebrachter Weise behandelt. Hierbei wird von "blöd anschauen oder blöd anreden" berichtet und angeführt, dass die Bezeichnung "deppat" als abwertender Begriff für verminderte Intelligenz sehr häufig zu hören sei. Auf Grund dieser von den InterviewpartnerInnen erlebten negativen Sichtweise der Umwelt entsteht überdies der Eindruck, nicht behinderte Menschen würden glauben, mit behinderten Menschen machen zu können, was sie wollen, vor allem, wenn vom umgebenden System angenommen wird, es handle sich um einen Menschen mit geistiger Behinderung.
Für den Bereich der Hörbehinderung berichtet Frau Mag.a Helene Jarmer indirekt von der fehlenden Bereitschaft hörender Menschen auf die Bedürfnisse gehörloser Menschen einzugehen. Hier scheint sie auf ein Kommunikationsproblem zu verweisen. Obwohl die österreichische Gebärdensprache seit dem Jahr 2005 von der österreichischen Bundesverfassung als eigene Sprache anerkannt ist (vgl. Art.8, Bundesverfassungsgesetz, www.ris.bka.gv.at ), wird sie von vergleichsweise wenigen hörenden Menschen gesprochen bzw. verstanden. Umgekehrt ist sie aber für Menschen mit einer Hörbehinderung oft ihre Muttersprache und die österreichische Amtssprache Deutsch ist für diese Menschen eine lebende Fremdsprache. Der "ironische" Einwand von Frau Mag.a Jarmer (vgl. 4.5.3) kann als Kritik verstanden werden, dass von Gehörlosen erwartet werde, die Fremdsprache Deutsch zu erlernen, während sich Hörende nicht mit der Gebärdensprache befassen wollen.
Als Lösungsweg aus der Problematik der systemischen Benachteiligung von Menschen mit Behinderung wird einmal mehr die frühest mögliche Integration angesehen. Erst wenn das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zur alltäglichen Normalität gehört, wird ein offener Zugang zum Anders-Sein ermöglicht.
Besonders bemerkenswert war diesbezüglich das Interview mit Frau Carina Metka. Obwohl auch sie von unschönen Begebenheiten mit nicht behinderten Menschen im Alltag berichtet, scheinen dennoch für sie positive Aspekte zu überwiegen. Dies erklärt sie mit Einblicken in ihre persönliche Lebensgeschichte. Da ist zunächst der Umstand, dass sie als schwerst körperlich beeinträchtigtes Kind von ihren Eltern nicht in ein Heim gegeben wurde. Frau Metka sieht das als keineswegs selbstverständlich an, da sie der Meinung ist, dass viele Eltern behinderter Kinder diese in einer Einrichtung unterbringen würden. Weiters gibt sie an, dass sie auf ihre geistigen Fähigkeiten hin überprüft wurde und im Anschluss daran keine Probleme bei ihrer schulischen Integration gehabt habe. Das Menschen mit einer schweren Behinderung mit einer Einschränkung ihrer Privat- und Intimsphäre leben müssten, die aus der notwendigen Betreuung durch "andere Leute" resultiere, ist für sie ein weder positiv noch negativ bewertetes Faktum (siehe dazu auch ihre Antwort zur Frage, was für sie Behinderung sei, im Kap. 4.5.1). Selbst dem Umstand, dass es für körperlich behinderte Menschen zu wenige Arbeitsplätze gebe, setzt sie ihre Freude darüber, dass in den nächsten Jahren vermehrt Arbeitsplätze für diese Personengruppe geschaffen würden, entgegen.
Ich werte die Antworten von Frau Metka nicht als Widerspruch zu den von den übrigen InterviewpartnerInnen berichteten Benachteiligungen durch übergeordnete bzw. umgebende Systeme, sondern als Bestätigung der folgenden Hypothese:
Frühest mögliche integrative Beteiligung von Menschen mit Behinderung am sozialen Leben wirkt sich positiv auf die Sichtweisen umgebender Systeme aus, wodurch die sich aus diesen Sichtweisen und den daraus resultierenden Handlungsweisen ergebenden Sekundärbehinderungen abnehmen.
In den vorangegangenen Interviewserien (siehe Kap. 4.2 und 4.3) wurde die Innenansicht von Menschen mit Behinderung mit einem Schwerpunkt auf Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung behandelt. In der dritten Interviewserie ging es um die Ansichten von Menschen mit der Diagnose "geistige Behinderung".
Befragt wurden 10 Personen, die in einer Einrichtung für geistig und mehrfach behinderte Menschen leben. Alle Befragten wurden als "geistig behindert" diagnostiziert, wobei der diagnostizierte Behinderungsgrad entweder eine "mittelschwere geistige Behinderung" (mittelschwere Intelligenzminderung / F71 nach ICD 10) oder eine "schwere geistige Behinderung" (schwere Intelligenzminderung / F72 nach ICD 10) auswies. Etwa die Hälfte der Befragten wurde zusätzlich als "mit deutlicher Verhaltensauffälligkeit" behaftet eingestuft (vgl. Kriterien im Band V der ICD 10 beschrieben in Kap. 2.2.2). Ein Befragter ist nach Spina bifida (Q05 nach ICD 10) zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl (Z99.3 nach ICD 10) angewiesen, alle anderen InterviewpartnerInnen hatten zum Zeitpunkt der Befragung keine oder nur unwesentliche körperliche Beeinträchtigungen. Alle befragten Personen konnten verbal kommunizieren.
Die Befragung erfolgte in Einzelgesprächen im Rahmen eines teilstrukturierten Interviews, d.h. die Fragen wurden im Vorhinein festgelegt und allen InterviewpartnerInnen grundsätzlich in gleichlautendem Wortlaut gestellt. Auf Rückfragen seitens der Befragten, insbesondere wenn diese signalisierten, die Frage nicht verstanden zu haben, habe ich in Einzelfällen die Fragen leicht modifiziert bzw. erklärt.
Folgende 10 Fragen wurden gestellt:
1. Was ist (Name der Einrichtung, in der die Befragten leben und betreut werden)?
2. Was ist für Sie Behinderung?
3. Sind Sie selbst behindert?
4. Warum leben Sie in (Name der Einrichtung)?
5. Leben Sie gerne in dieser Institution?
6. Wenn Sie es Sich aussuchen könnten, wo würden Sie gerne leben?
7. Was gefällt Ihnen an (Name der Einrichtung)?
8. Was gefällt Ihnen nicht an (Name der Einrichtung)?
9. Konnten Sie Sich Ihre MitbewohnerInnen aussuchen?
10. Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft?
In der Folge sollen die Ergebnisse der in Kap. 4.4.1 beschriebenen Befragung präsentiert werden.
|
Was ist (Name der Einrichtung)? |
|
|
Antworten |
Anzahl |
|
"da sind behinderte Menschen" |
3 |
|
"ist für schwerst behinderte Bewohner mit Pflegestation dabei" |
1 |
|
"Einrichtung für behinderte Menschen" |
2 |
|
"Behinderteneinrichtung für geistliche (sic!) und mehrfache Behinderung" |
1 |
|
keine Angabe |
3 |
Die Mehrzahl der Befragten (7 von 10) konnte Angaben über die Art der Einrichtung, in der sie leben und betreut werden, machen. Drei Personen gaben an, dass sich in dieser Einrichtung behinderte Menschen befinden, zwei weitere, dass diese Einrichtung für behinderte Menschen sei. Zwei Personen gaben dazu etwas detailliertere Auskünfte, indem sie die Institution als "für schwerst behinderte Bewohner" mit einer angeschlossenen Pflegestation bzw. als Einrichtung "für geistliche (sic!) und mehrfache Behinderung" beschrieben. Letzteres kommt der Eigendefinition der Einrichtung schon sehr nahe, die sich als Institution für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sieht. Drei Personen konnten oder wollten zu dieser Frage keine Angabe machen.
|
Was ist für Sie Behinderung? |
|
|
Antworten |
Anzahl |
|
"die im Rollstuhl sitzen, nicht gehen können", "Rollstuhl" |
10 |
|
"die gefüttert werden müssen" |
1 |
|
"die einen Rollator haben" |
1 |
|
"die zusammenfallen" |
1 |
|
"die nicht reden können" |
2 |
|
"Probleme mit der Hand" |
1 |
|
Keine Angabe |
0 |
Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass alle Befragten (zehn von zehn) den Begriff Behinderung mit dem Bild eines Rollstuhls verbunden haben. Die körperliche Beeinträchtigung des Nicht-Gehen-Könnens stellt also für diese Personengruppe das Synonym für einen behinderten Menschen dar. Diese Einschätzung wird noch durch zusätzlich gegebene Antworten, wie "einen Rollator haben" und "die zusammenfallen" untermauert. Erst danach kommen Probleme der Kommunikation (zwei Antworten) und Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme (eine Antwort). Eine geistige Behinderung wurde, obwohl alle Befragten eine diesbezügliche Diagnose aufwiesen, von niemandem angeführt.
|
Sind Sie selbst behindert? |
|
|
Antworten |
Anzahl |
|
"mit dem Gehen hat es mich ein wenig" |
1 |
|
"Ja, ich bin querschnittgelähmt" |
1 |
|
"meine Füße, beim Klo gehen" |
1 |
|
"mein Hals" (Verspannung) |
1 |
|
"Ich merke nichts!" |
1 |
|
"Ich bin gesund, kann mich bewegen, wie ich will. Ich habe nur manchmal kleine Krankheiten z.B. Schnupfen" |
1 |
|
"Ja, ich könnte nicht nein sagen, habe eine Sehschwäche und früher einen Sprachfehler. Merkt man aber nicht mehr so, weil ich schnell spreche." |
1 |
|
Keine Angabe oder "weiß nicht" |
3 |
Wie schon bei der vorangegangenen Frage, was Behinderung sei, setzt sich auch bei den Antworten zur eigenen Behinderung der Befragten ein deutlicher Bezug zu körperlichen Beeinträchtigungen fort. Neben der erwartbaren Angabe der Querschnittslähmung eines Interviewten standen bei vier Personen (kleinere) körperliche Beschwerden wie Verspannung im Hals, schmerzende Füße, Schnupfen, Seh- und ein bereits behobener Sprachfehler im Vordergrund. Zwei Personen sahen sich als nicht behindert an, drei Personen machten dazu keine Angabe. Auch hier fällt auf, dass, obwohl alle Befragten eine Diagnose bezüglich einer geistigen Behinderung aufwiesen, diese von niemandem angeführt wurde.
|
Warum leben Sie in (Name der Einrichtung)? |
|
|
Antworten |
Anzahl |
|
"weil ich da lebe" |
3 |
|
"bin von klein auf hier" |
2 |
|
"weil es mir gut gefällt und ich nicht anders kann" |
1 |
|
"Das habe ich mich schon oft gefragt!" |
1 |
|
"Gute Frage. Ich war vorher in einer anderen Einrichtung und kam mit 18 Jahren hierher. Wieso weiß ich auch nicht." |
1 |
|
"weil mich meine Eltern hergebracht haben" |
1 |
|
Keine Angabe |
1 |
Auf die Frage, warum sie in einer Einrichtung für geistig und mehrfach behinderte Menschen leben würden, gaben drei Personen "weil ich da lebe" an. Zwei Befragte meinten, sie wären bereits von klein auf hier, je einer gab an, obwohl es ihm gefiele, nicht anders zu können bzw. von den Eltern in die Einrichtung gebracht worden zu sein. Ein Interviewpartner gab an, sich das auch schon oft gefragt zu haben. In der Antwortsituation hatte ich dabei den Eindruck, die Person hätte bis dato noch keine Antwort auf diese Frage gefunden, was auch die Körpersprache zu bestätigen schien. Eine weitere Person gab an, mit 18 Jahren in die Einrichtung gebracht worden zu sein, aber nicht zu wissen, warum. Eine Befragte machte dazu keine Angaben.
Auf die Frage "Leben Sie gerne in dieser Institution?" antworteten 9 von 10 Befragten grundsätzlich zustimmend, wenngleich dies von jeweiligen Tagesproblemen abhängig sei. Ein Interviewpartner verneinte und gab an, nicht hierher zu gehören.
Die Gegenfrage "Wenn Sie es Sich aussuchen könnten, wo würden Sie gerne leben?" beantworteten fünf Personen mit "Zuhause bei den Eltern". Drei Befragte wünschten sich eine eigene Wohnung im Rahmen einer teilbetreuten Wohnform. Auffällig war hier, dass es sich zwar um eine Wohnung außerhalb der Einrichtung handeln sollte, diese aber nicht zu weit weg sein sollte, weil man sonst den Freundes- und Bekanntenkreis verlieren würde. Zwei InterviewpartnerInnen machten keine Angaben.
Die Antworten auf die Fragen "Was gefällt Ihnen an (Name der Einrichtung)?" und "Was gefällt Ihnen nicht an (Name der Einrichtung)?" lassen auf einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad der Befragten schließen. Besonders hervorgehoben wurden das Angebot an Werkstätten, die Freizeitgestaltung und das Vorhandensein vieler netter Leute, wobei hier die begriffliche Trennung von BetreuerInnen und FreundInnen nicht unerwähnt bleiben soll. Kritisch werden vor allem Besprechungen des Personals über BewohnerInnen gesehen, besonders dann, wenn das Negative betont werde, und der Umstand, dass man mit vielen Leuten zusammenleben müsse.
Die Frage "Konnten Sie Sich Ihre MitbewohnerInnen aussuchen?" wurde von der überwiegenden Mehrzahl der Befragten verneint. Zwar wurde die Aufnahme neuer MitbewohnerInnen in Einzelfällen mit den Befragten besprochen, als Entscheidungsträger wurden aber nur Fachdienste bzw. die pädagogische Leitung der Einrichtung genannt.
Auf die Frage "Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft?" antworteten drei Personen, dass ihre Angehörigen noch lange leben sollten. Ein Befragter wünschte sich einen Zugang zum Internet und eine eigene Wohnung, je ein weiterer ein besseres Zusammenleben ohne Streitereien bzw. Hilfe vom Betreuungspersonal, "wenn sie sehen, dass es mir nicht gut geht". Vier InterwiewpartnerInnen äußerten keine Zukunftswünsche.
Die im Kap. 4.5.2 auf Basis der Innenansicht befragter körperlich behinderter InterviewpartnerInnen aufgestellte Hypothese, wonach für behinderte Menschen trotz erschwerender Ausgangslage die primäre Behinderung an alltäglicher Problematik abnimmt, wogegen sekundäre Beeinträchtigungen durch umgebende Systeme an Bedeutung gewinnen, lässt sich formal nicht ohne weiteres auch auf Menschen mit diagnostizierter geistiger Behinderung übertragen, da sie scheinbar das subjektive Wissen um die primäre Behinderung und deren Akzeptanz voraussetzt. Zwar machten auch die InterviewpartnerInnen der dritten Interviewserie Angaben zu körperlichen Einschränkungen und es deutet nichts darauf hin, dass diese nicht akzeptiert oder zumindest hingenommen werden, aber ihre, aus der Außenansicht des Beobachters bedeutendste Beeinträchtigung, die diagnostizierte Intelligenzminderung, blieb gänzlich unerwähnt. Kann man aus dieser Tatsache schlussfolgern, dass diese Diagnose für die Befragten keine nennenswerte Rolle spielt und deshalb die erwähnte Hypothese auch für sie Gültigkeit erhält?
Um zu erfahren, ob die, in Kap. 4.6.1 beschriebenen, als mittelgradig oder schwer geistig behindert diagnostizierten Menschen sich selbst als geistig behindert ansehen, habe ich sie gefragt, ob sie mir erklären könnten, was geistige Behinderung ist. Zwei Personen gaben an, geistige Behinderung hätte irgendetwas mit dem Kopf zu tun. Zwei weitere Befragte antworteten, dass diese Bezeichnung im Zusammenhang mit Problemen beim Denken stehen würde. Ein Interviewpartner erklärte geistige Behinderung als Problem, langsamer zu sein, ein weiterer als Umstand, der bewirke, bestimmte Dinge, wie Auto fahren, nicht tun zu können. Vier Personen machten dazu keine Angaben.
Im Anschluss daran habe ich jenen sechs Personen, die die Frage nach dem Begriff geistige Behinderung beantwortet hatten, noch die Frage gestellt, ob sie selbst geistig behindert wären. Zwei Personen verneinten dies. Ein Befragter meinte, dass man das so nicht sagen könne, da es ihm gut gehe und er fähig wäre zu denken. Die zwei übrigen InterviewpartnerInnen zählten körperliche Beeinträchtigungen oder kleiner Krankheiten auf.
Für die befragte Gruppe als geistig behindert diagnostizierter Menschen bedeutet Behinderung klar erkennbar eine körperliche Beeinträchtigung, versinnbildlicht und von außen sichtbar dargestellt durch den Rollstuhl. Dies wird durch die Antworten auf die Frage nach der eigenen Behinderung nochmals bestätigt. Es deutet nichts darauf hin, dass für die Befragten eine Intelligenzminderung bzw. geistige Beeinträchtigung ebenfalls zum Begriff Behinderung gehört. Dies könnte auch eine Begründung dafür sein, warum ihnen nicht bewusst zu sein scheint, weshalb sie in einer Einrichtung für geistig und mehrfach behinderte Menschen leben. Der Umstand, dass sie es dennoch tun, wird aber keineswegs negativ gesehen, wiewohl der institutionalisierte Lebensraum im Falle einer eigenen Entscheidungsmöglichkeit nicht die erste Wahl wäre. Die Vorzüge, die durch das breite Angebot der Einrichtung gegeben sind, scheinen die Probleme, die sich aus dem nicht selbst gewählten Zusammenleben mit anderen ergeben, auszugleichen oder sogar zu überwiegen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass sich einige der befragten Personen zwar einen Wechsel in eine andere Wohnform, vorzüglich eine eigene Wohnung, vorstellen könnten bzw. wünschen würden, diese Wohnform aber in räumlicher Nähe zur Institution sein sollte, um die Infrastruktur, sowohl in betrieblicher als auch in privater Hinsicht, nicht zu verlieren.
Die Frage, ob sich die als geistig behindert diagnostizierten Menschen selbst als geistig behindert wahrnehmen, kann verneint werden. Zur selben Schlussfolgerung kam auch Georg Feuser, der in einem Vortrag vor den Abgeordneten zum Nationalrat im Österreichischen Parlament in Wien anführte, dass er sie in bezug auf alle Menschen, mit denen er zu tun hatte und die wir für geistigbehindert halten, im Gesamt seiner Berufspraxis bestätigt fand (vgl. Feuser 1996, Kap. 2, http://bidok.uibk.ac.at ). Damit wird klar, dass für die betroffenen Menschen geistige Behinderung keine Bedeutung hat. Dass der Diagnose "Geistige Behinderung" aber dennoch Bedeutung zugemessen wird, kann also nur mehr von außen kommen. In der Folge möchte ich mich daher der Außenansicht umgebender Systeme zu dieser Diagnose widmen, im speziellen von in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen tätigen ProfessionistInnen.
Für diesen Teil der empirischen Untersuchung wurde ein standardisierter Fragebogen (siehe Anhang) entworfen. Dieser Fragenbogen wurde zunächst den SchülerInnen einer Abschlussklasse des berufsbegleitend zu absolvierenden Diplommoduls der Lehranstalt für Heilpädagogische Berufe in Linz vorgelegt, mit der Bitte ihn eigenhändig auszufüllen. Durch diese Vorgangsweise war es möglich, Menschen, die in unterschiedlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe Oberösterreichs tätig sind, zu befragen. Insgesamt 19 SchülerInnen nahmen an dieser Untersuchung teil.
In einer zweiten Serie sollten DiagnostikerInnen aus den Fachgebieten Medizin und Psychologie ebenfalls eigenhändig diesen Fragebogen ausfüllen. Auf diese Weise wurden acht Personen befragt, jeweils vier MedizinerInnen bzw. PsychologInnen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie bereits mit der Diagnostik einer geistigen Behinderung betraut waren und entweder in Einrichtungen für geistig und mehrfach behinderte Menschen beschäftigt oder als externe Professionisten für eine derartige Einrichtung tätig sind oder es waren.
Von den insgesamt 19 befragten Personen sind 17 im Betreuungsdienst für Menschen mit Behinderung tätig, 14 davon in Einrichtungen für geistig und mehrfach behinderte Menschen, zwei in der mobilen Betreuung und eine Person arbeitet mit körperlich behinderten Menschen. Zwei Personen gaben psychiatrische Abteilungen als Tätigkeitsbereich an.
Die Befragten sollten die angegebenen Einschätzungshilfen (standardisierter Test, Augenschein, Aussagen des Betreuungspersonals, Aussagen von Angehörigen, Aussagen des Menschen mit Behinderung, bereits vorliegende Diagnosen) zur Erstellung der Diagnose "Geistige Behinderung" nach Wichtigkeit reihen. Im Zuge der Auswertung wurde die Reihung der Wichtigkeit in umgekehrter Reihenfolge mit Punkten versehen, d.h. für 1 (am wichtigsten) wurden sechs Punkte vergeben, für 6 (am wenigsten wichtig) ein Punkt. Diese Punkte wurden addiert. Dies führte zu folgendem Ergebnis:
1. Augenschein (74 Punkte)
2. Aussagen des Menschen mit Behinderung (73 Punkte)
3. Aussagen von Angehörigen (67 Punkte)
4. Standardisierter Test (65 Punkte)
5. Aussagen des Betreuungspersonals (63 Punkte)
6. Bereits vorliegende Diagnosen (43 Punkte)
Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Ergebnisse auf die Frage, in welchem Zeitraum nach Meinung der Befragten die Diagnose einer geistigen Behinderung überprüft und neu bewertet wird bzw. in welchem Zeitraum nach Meinung der Befragten eine derartige Überprüfung stattfinden sollte.
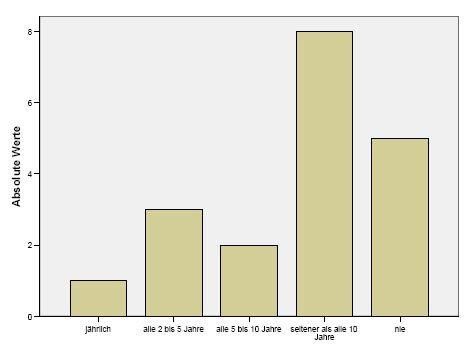
Abbildung 5: Diagnose "Geistige Behinderung" wird überprüft? (Quelle: eigene Darstellung)
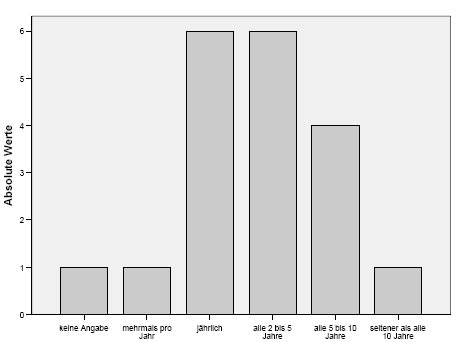
Abbildung 6: Diagnose "Geistige Behinderung" soll überprüft werden? (Quelle: eigene Darstellung)
Weitere Ergebnisse in absoluten Zahlen (Häufigkeit) und Prozentangaben:
Ist Ihrer Meinung nach durch psychologische, pädagogische und/oder therapeutische Maßnahmen eine Verbesserung des Intelligenzniveaus möglich??
Ist Ihrer Meinung nach durch medikamentöse Maßnahmen eine Verbesserung des Intelligenzniveaus möglich?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
Ja |
4 |
21,1 |
21,1 |
|
Nein |
11 |
57,9 |
78,9 |
|
weiß nicht |
4 |
21,1 |
100,0 |
|
Gesamt |
19 |
100,0 |
Wie schätzen Sie das Sozialprestige / den gesellschaftlichen Stellenwert von Menschen mit geistiger Behinderung ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
sehr gering |
9 |
47,4 |
47,4 |
|
gering |
7 |
36,8 |
84,2 |
|
durchschnittlich |
3 |
15,8 |
100,0 |
|
Gesamt |
19 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose "leichte geistige Behinderung" (F70.0) ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
sehr hoch |
2 |
10,5 |
10,5 |
|
hoch |
9 |
47,4 |
57,9 |
|
mittel |
8 |
42,1 |
100,0 |
|
Gesamt |
19 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose "mittelgradige geistige Behinderung" (F71.0) ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
hoch |
3 |
15,8 |
15,8 |
|
mittel |
12 |
63,2 |
78,9 |
|
gering |
4 |
21,1 |
100,0 |
|
Gesamt |
19 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose "schwere geistige Behinderung" (F72.0) ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
hoch |
2 |
10,5 |
10,5 |
|
mittel |
5 |
26,3 |
36,8 |
|
gering |
6 |
31,6 |
68,4 |
|
nicht gegeben |
6 |
31,6 |
100,0 |
|
Gesamt |
19 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose " schwerste geistige Behinderung" (F73.0) ein?"
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
hoch |
1 |
5,3 |
5,3 |
|
mittel |
3 |
15,8 |
21,1 |
|
gering |
6 |
31,6 |
52,6 |
|
nicht gegeben |
9 |
47,4 |
100,0 |
|
Gesamt |
19 |
100,0 |
Wie sehr beeinflusst Sie das Wissen um die Diagnose "geistige Behinderung" in Ihrem Verhalten gegenüber einem Menschen mit dieser Diagnose?
Die Befragten sollten die angegebenen Einschätzungshilfen (standardisierter Test, Augenschein, Aussagen des Betreuungspersonals, Aussagen von Angehörigen, Aussagen des Menschen mit Behinderung, bereits vorliegende Diagnosen) zur Erstellung der Diagnose "Geistige Behinderung" nach Wichtigkeit reihen. Im Zuge der Auswertung wurde die Reihung der Wichtigkeit in umgekehrter Reihenfolge mit Punkten versehen, d.h. für 1 (am wichtigsten) wurden sechs Punkte vergeben, für 6 (am wenigsten wichtig) ein Punkt. Diese Punkte wurden addiert. Dies führte zu folgendem Ergebnis:
1. Bereits vorliegende Diagnosen (43 Punkte)
2. Augenschein (38 Punkte)
3. Aussagen des Betreuungspersonals (37 Punkte)
4. Aussagen von Angehörigen (27 Punkte)
5. Aussagen des Menschen mit Behinderung (14 Punkte)
6. Standardisierter Test (10 Punkte)
Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Ergebnisse auf die Frage, in welchem Zeitraum nach Meinung der Befragten die Diagnose einer geistigen Behinderung überprüft und neu bewertet wird bzw. in welchem Zeitraum nach Meinung der befragten DiagnostikerInnen eine derartige Überprüfung stattfinden sollte.
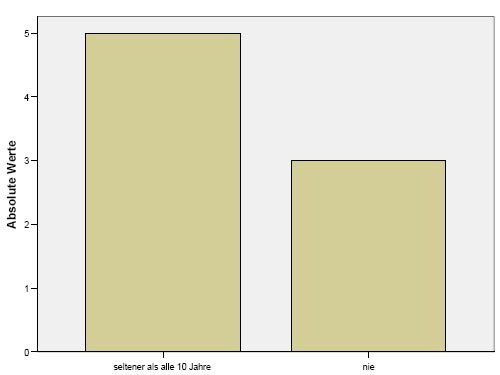
Abbildung 7: Diagnose "Geistige Behinderung" wird überprüft? (Quelle: Eigene Darstellung)
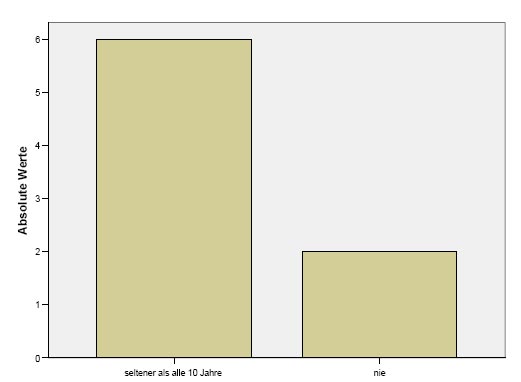
Abbildung 8: Diagnose "Geistige Behinderung" soll überprüft werden? (Quelle: Eigene Darstellung)
Weitere Ergebnisse in absoluten Zahlen (Häufigkeit) und Prozentangaben:
Ist Ihrer Meinung nach durch psychologische, pädagogische und/oder therapeutische Maßnahmen eine Verbesserung des Intelligenzniveaus möglich??
|
Gültig |
Häufigkeit |
Prozent |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
Ja |
6 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Nein |
2 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
100,0 |
Ist Ihrer Meinung nach durch medikamentöse Maßnahmen eine Verbesserung des Intelligenzniveaus möglich?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Prozent |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
Ja |
4 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Nein |
4 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
100,0 |
Wie schätzen Sie das Sozialprestige / den gesellschaftlichen Stellenwert von Menschen mit geistiger Behinderung ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Prozent |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
sehr gering |
4 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
gering |
4 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose "leichte geistige Behinderung" (F70.0) ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Prozent |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
hoch |
2 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
mittel |
4 |
50,0 |
50,0 |
75,0 |
|
gering |
2 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose "mittelgradige geistige Behinderung" (F71.0) ein?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Prozent |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
mittel |
1 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
gering |
7 |
87,5 |
87,5 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose " schwere geistige Behinderung" (F72.0) ein?"
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
gering |
1 |
12,5 |
12,5 |
|
nicht gegeben |
7 |
87,5 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
Wie schätzen Sie die Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von Menschen mit der Diagnose " schwerste geistige Behinderung" (F73.0) ein?"
Wie sehr beeinflusst Sie das Wissen um die Diagnose "geistige Behinderung" in Ihrem Verhalten gegenüber einem Menschen mit dieser Diagnose?
|
Gültig |
Häufigkeit |
Gültige Prozente |
Kumulierte Prozente |
|
sehr stark |
3 |
37,5 |
37,5 |
|
deutlich erkennbar |
2 |
25,0 |
62,5 |
|
ein wenig |
3 |
37,5 |
100,0 |
|
Gesamt |
8 |
100,0 |
Im Anschluss an die strukturierte Erhebung gaben alle befragten DiagnostikerInnen auf Basis des Fragebogens noch Statements zu der behandelten Thematik im Rahmen von teilstrukturierten Interviews ab. Dabei gab die Mehrheit der Befragten an, dass es sehr schwierig wäre, geistige Behinderung bei Erwachsenen zu diagnostizieren, da die meisten validen Testmethoden auf die Diagnostik bei Kindern bzw. Jugendlichen bis etwa 16 Jahren abgestimmt wären. Auch würden gängige Intelligenztests, wie z.B. der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest (HAWIK), nur verwendbare Ergebnisse bis zu einem Intelligenzquotienten von 70 liefern, darunter wären sie nicht zielführend. Man sei deshalb auf den Augenschein und die Angaben von Personen, die den betreffenden Menschen mit geistiger Behinderung nahe stünden, angewiesen. Vorwiegend stütze man die eigene Diagnostik aber auf bereits vorhandene Expertisen. Die Hälfte der interviewten DiagnostikerInnen brachte überdies zum Ausdruck, dass sie die Frage nach der Erstellung der Diagnose "Geistige Behinderung" für nicht oder nicht sehr relevant hielten.
In der Folge sollen die Antworten der im Betreuungsdienst tätigen Personen mit den Antworten der DiagnostikerInnen verglichen und analysiert werden. Besonders interessant erscheint die Reihung der Wertigkeit der angeführten Einschätzungshilfen, die zur Erstellung der Diagnose "Geistige Behinderung" herangezogen werden. Da die beiden Gruppen eine unterschiedliche Zahl von Befragten aufwiesen, wurden die Punktewerte der im Betreuungsdienst tätigen SchülerInnen auf die Zahl der befragten DiagnostikerInnen herunter gerechnet. Die Ergebnisse sind in nachstehender Tabelle zu sehen, die Werte in Klammern sind die Originalwerte vor der Angleichung der Befragtenzahlen.
Abbildung 9: Vergleichtabelle der Ansichten zur Diagnoseerstellung "Geistige Behinderung" (Quelle: eigene Darstellung)
|
Betreuungspersonal Punkte (P.) |
DiagnostikerInnen Punkte (P.) |
|
|
Standardisierter Test |
27,4 P. (65 P.) |
10 P. |
|
Augenschein |
31,1 P. (74 P.) |
38 P. |
|
Aussagen des Betreuungspersonals |
26,5 P. (63 P.) |
37 P. |
|
Aussagen von Angehörigen |
28,2 P. (67 P.) |
27 P. |
|
Aussagen des Menschen mit Behinderung |
30, 7 P. (73 P.) |
14 P. |
|
bereits vorliegende Diagnosen |
18,1 P. (43 P.) |
43 P. |
Während für die BetreuerInnen beinahe alle Angaben eine hohe Wertigkeit haben (mit Höchstwerten beim Augenschein und den Aussagen der Menschen mit Behinderung selbst) und dieser Gruppe nur bereits vorliegende Diagnosen als nicht besonders wichtig erscheinen, ist dies für die befragten DiagnostikerInnen beinahe spiegelverkehrt. Sie geben mit deutlichem Abstand bereits vorliegende Diagnosen als besonders wichtig an, gefolgt vom Augenschein und Aussagen von BetreuerInnen und Angehörigen. Aussagen der betroffenen Menschen selbst und standardisierte Test spielen dabei eine untergeordnete bis gar keine Rolle.
Einigkeit herrscht bei beiden Gruppen darüber, dass die Diagnose einer geistigen Behinderung nur sehr selten bis nie überprüft bzw. neu bewertet wird. Während die DiagnostikerInnen dies aber für weitgehend gerechtfertigt halten, findet die Gruppe der BetreuerInnen, eine Überprüfung und Neubewertung sollte deutlich öfter stattfinden.
Alle befragten im Betreuungsdienst tätigen Personen sind der Ansicht, dass psychologische, pädagogische und/oder therapeutische Maßnahmen zu einer Verbesserung des Intelligentniveaus beitragen können, was von immerhin 75% der DiagnostikerInnen unterstützt wird. Medikamentöse Maßnahmen werden in Bezug auf ihre diesbezügliche Unterstützungsfähigkeit von beiden Gruppen deutlich kritischer gesehen.
Das Sozialprestige von Menschen mit der Diagnose "Geistige Behinderung" wird von beiden Personengruppen als sehr gering bis gering angesehen.
Interessant erscheint auch der Vergleich der Einschätzungen zur Fähigkeit zu selbstbestimmter Lebensführung von geistig behinderten Menschen. Zwar nimmt für beide Gruppen diese Fähigkeit mit dem Schweregrad der diagnostizierten geistigen Behinderung ab, die im Betreuungsdienst tätigen Menschen starten aber auf deutlich höherem Niveau, d.h. sie betrachten Menschen mit leichteren Ausprägungen einer Intelligenzminderung für durchaus zur selbstbestimmten Lebensführung fähig, während hier von den befragten MedizinerInnen und PsychologInnen bereits deutlich geringeres Zutrauen angegeben wird.
Beide Gruppen gaben an, dass das Wissen um die Diagnose "Geistige Behinderung" ihr Verhalten gegenüber Menschen mit dieser Diagnose beeinflusst, wobei bei beiden die Ausprägungen zwischen "sehr stark" und "ein wenig" etwa in gleichem Ausmaß genannt wurden.
Zum Abschluss meiner Untersuchung bat ich die vier größten Anbieter der institutionalisierten Hilfe für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung , mir die Anzahl der von ihnen betreuten Menschen mit der Diagnose "Geistige Behinderung" zu nennen. Dies erwies sich als nicht möglich. Zwei Einrichtungen gaben an, dass sie derzeit noch keine vollständigen diesbezüglichen Daten hätten und noch mit der Erhebung bzw. Modernisierung und Kodierung der Diagnosen beschäftigt wären. Von einer Institution kam die Antwort, dass alle in dieser Institution betreuten Menschen eine geistige Behinderung aufweisen müssten, da dies ein Kriterium für die Aufnahme sei. Genauere Daten, z.B. zum Schweregrad der geistigen Behinderung oder ICD 10 Codes gäbe es aber nicht. Vom vierten Anbieter war zu erfahren, dass man zwar nach ICD 10 diagnostiziere, aber keine gesammelten Gesamtdaten hätte.
Eine diesbezügliche telefonische Anfrage bei Frau Mag.a Renate Hackl von der Sozialabteilung der oberösterreichischen Landesregierung ergab, dass derzeit (Stand: 1. März 2007) in Oberösterreich 5500 Menschen mit Behinderungen Maßnahmen nach dem Landesbehindertengesetz von 1991 beziehen würden. Es gäbe bezüglich der Anzahl von Menschen mit der Diagnose einer geistigen Behinderung aber nur Näherungswerte, da zwar viele Menschen unter der Bezeichnung geistig behindert "laufen" würden, aber die Erstellung der diesbezüglichen Diagnosen nicht adäquat erscheine. "Die Diagnoseerstellung und Datenerfassungsqualität sind unzufriedenstellend, und deshalb können keine Daten herausgegeben werden" (Mag.a Renate Hackl, 1. März 2007).
Aus den ersten beiden Interviewserien geht hervor, dass aus der Innenansicht der befragten Menschen die primäre Behinderung, in diesem Fall eine deutliche körperliche Beeinträchtigung, wiewohl sie eine erschwerte Ausgangslage definieren kann, im Alltag, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielt, da sie als eigenes So-Sein letztlich zur persönlichen Normalität gerechnet wird. Deutlich problematischer werden aber sekundäre Behinderungen gesehen, zumeist Barrieren und/oder Verhaltensweisen nicht-behinderter Menschen, die es den betroffenen Menschen erschweren oder verunmöglichen, an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen. Für die befragten Menschen mit einer diagnostizierten geistigen Behinderung hat dies ebenfalls Gültigkeit. Wichtig ist für diese Gruppe die Sichtweise ihrer Umwelt und die Möglichkeiten, die ihnen diese Umwelt bietet. Die ihnen zugeordneten mentalen Schwächen haben für diese Personen buchstäblich keine Bedeutung.
Frühest mögliche integrative Beteiligung von Menschen mit Behinderung am sozialen Leben wirkt sich positiv auf die Sichtweisen umgebender Systeme aus, wodurch die sich aus diesen Sichtweisen und den daraus resultierenden Handlungsweisen ergebenden Sekundärbehinderungen abnehmen. Diese Schlussfolgerung aus den Angaben der meist körperbehinderten InterviewpartnerInnen der ersten beiden Befragungen, die durch positive Beispiele aus den Lebensgeschichten Betroffener untermauert wird, sollte auch für Menschen mit geistiger Behinderung gelten.
In der Außenansicht der Systeme, die geistig behinderte Menschen umgeben, wird der primären Diagnose der Intelligenzminderung ein deutlich höherer Stellenwert beigemessen. Aber obwohl in den Diagnoserichtlinien der ICD 10 zur Intelligenzminderung ausdrücklich erwähnt wird, dass sich diese Diagnose nur auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen kann, da sich intellektuelle Fähigkeiten verändern können (vgl. Kap. 2.2.1), und obwohl befragte BetreuerInnen und DiagnostikerInnen angeben, dass durch psychologische, pädagogische und/oder therapeutische Maßnahmen Verbesserungen des Intelligenzniveaus zu erreichen sind, scheinen Überprüfungen und Neubewertungen dieser Diagnose nicht oder nur in seltenen Fällen durchgeführt zu werden. Dies kann im Umstand begründet sein, dass es, nimmt man die Antworten der befragten DiagnostikerInnen als Grundlage, keine validen standardisierten Testmethoden zur Diagnose einer geistigen Behinderung bei Erwachsenen gibt. Diese Annahme wird auch von Aussagen von VertreterInnen der größeren Institute für die Betreuung geistig und mehrfach behinderter Menschen und die Auskunft der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich, wonach die Diagnoseerstellung und Datenerfassungsqualität bezüglich einer geistigen Behinderung unzufriedenstellend seien, untermauert. DiagnostikerInnen stützen sich bei der Einschätzung von geistig behinderten Menschen daher meist auf frühere Expertisen von KollegInnen, den Augenschein, also die Kategorisierung mittels Verhaltensbeurteilung in einem meist sehr begrenzten Zeitraum, und die Aussagen von BetreuerInnen und Angehörigen.
Überraschend erscheint in diesem Zusammenhang, dass, obwohl die diesbezüglichen Diagnosen als nicht valide und reliabel anzusehen sind, den Abstufungen im Bereich der Intelligenzminderung sowohl für im Betreuungsdienst tätige Menschen als auch für die befragten MedizinerInnen und PsychologInnen eine große Bedeutung zugemessen wird. So kann z.B. ein Unterschied von wenigen Punkten beim angenommenen Intelligenzquotienten darüber entscheiden, ob einer Person selbstbestimmte Lebensführung zugetraut wird oder nicht, was für diese gravierende Folgen haben kann. Hervorzuheben ist auch, dass alleine der Umstand, dass eine Diagnose einer geistigen Behinderung vorliegt, das Verhalten der umgebenden Systeme bezüglich des betroffenen Menschen offenbar deutlich beeinflusst.
[13] Das klingt wie ein Widerspruch in sich, ist es bei näherer Betrachtung aber nicht wirklich.
[14] Dass diese Fragen von einem "geistig behinderten" Mitarbeiter der Medienwerkstatt erarbeitet und gestellt wurden, ist ein weiteres interessantes Detail dieser ersten beiden Interviewserien.
[15] Der Name wurde von der pädagogischen Leitung der Institution gewählt, um den Arbeits- und vor allem den Werkstattcharakter hervorzustreichen. Ich hätte einen neutraleren Namen vorgezogen, nicht zuletzt, um den konzeptionellen Unterschied zu einer normalen Werkstätte für behinderte Menschen zu verdeutlichen.
[16] Letztlich arbeiteten an diesem Teilprojekt ausschließlich Männer.
In dieser Arbeit wurden Mosaiksteine zur Diagnose "Geistige Behinderung" zusammen getragen. Diese sollen hier zunächst noch einmal kurz vorgestellt werden, da sie nur gemeinsam ein Bild ergeben, dass eine zielführende Schlussfolgerung ermöglicht.
Zunächst wurde der geschichtliche Hintergrund der internationalen Klassifikationssysteme der Krankheiten vorgestellt. Der Wunsch nach einheitlichen Diagnosekriterien und regionaler und internationaler Vergleichbarkeit führte zu den derzeit gültigen Manualen. Besonders die ICD 10 hat diesbezüglich große Relevanz, auch in Österreich, was mit Auszügen aus Gesetzestexten verdeutlicht werden konnte. Ziel der verpflichtenden Einführung in Österreich ist, die Gesundheitsplanung auf Bundes- und Länderebene zu ermöglichen, ein leistungsorientiertes Finanzierungssystem zu implementieren, Entscheidungsgrundlagen für die gesundheitspolitische Steuerung zu ermöglichen und Grundlagen für nationale und internationale Studien zu schaffen (vgl. Kap. 2.2.2) Gerade auf dem Gebiet der Behinderung hat die ICD 10 aber deutliche Schwächen, ist sie doch stark defizitorientiert und lässt für die betroffenen Menschen fördernde Faktoren und den Einfluss umgebender Systeme weitgehend außer Acht. Die aus diesem Grund geschaffene ICF verfügt zwar über eine ressourcenorientierte Philosophie mit einem Schwerpunkt auf der Ermöglichung der Partizipation der PatientInnen am gesellschaftlichen Leben, das Manual selbst erscheint aber bis dato noch nicht besonders ausgereift und die Umsetzung der als positiv anzusehenden Bestrebungen der Verfasser der ICF steht noch in den Anfängen, weshalb sie sich als Ergänzung zur ICD noch nicht durchgesetzt hat.
Die in der ICD 10 unter "Psychische Störungen" (Band V) beschriebenen Diagnoserichtlinien für geistige Behinderung bzw. Intelligenzminderung sind aber nur ein Aspekt dieser Beeinträchtigung. Ein weiterer sind die Sichtweisen umgebender Systeme und das daraus resultierende Verhalten gegenüber den von der Diagnose betroffenen Menschen. Diese sind, folgt man den Ausführungen Maturanas, von subjektiven Erkenntnissen geprägt, da es objektives Wissen nicht geben kann. Aus der Systemtheorie von Nikolas Luhmann geht hervor, dass Systeme operativ geschlossen und grundsätzlich selbstbezogen sind, und überdies einen Hang zur Komplexitätsreduktion aufweisen, also nach Möglichkeit vereinfachen.
Aus den Antworten von körperbehinderten Menschen geht hervor, dass ihre primäre Behinderung für sie im Alltag, wiewohl sie eine erschwerte Ausgangslage definieren kann, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielt, da sie als eigenes So-Sein letztlich zur persönlichen Normalität gerechnet wird. Im Gegensatz dazu werden sekundäre Behinderungen, zumeist Barrieren und/oder Verhaltensweisen nicht-behinderter Menschen, die es den betroffenen Menschen erschweren oder verunmöglichen, an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen, deutlich problematischer gesehen. Diese Annahme hat auch für Menschen mit einer diagnostizierten geistigen Behinderung Gültigkeit.
Für als geistig behindert eingestufte Menschen sind umgebende Systeme in besonderem Maße bedeutend, da diese Systeme, seien es die Gesellschaft, die WohngruppenmitarbeiterInnen, die SachwalterInnen, Mediziner, PsychologInnen etc., oftmals auf Basis ihrer Einschätzungen das Leben dieser Personengruppe entscheidend prägen oder bestimmen. Für einen, für in Institutionen lebende Menschen gravierenden, Teil dieser Systeme, nämlich BetreuerInnen und DiagnostikerInnen, hat, im Gegensatz zur Innenansicht der Betroffenen, die primäre Diagnose einer geistigen Behinderung einen sehr hohen Stellenwert. Die Vorstellungen, die sich systemintern zu dieser Diagnose bilden, bestimmen z.B., was der so klassifizierten Person zugetraut wird und was nicht. Dies kann enorme Folgen für den Handlungsspielraum dieser Person haben. Basis, für sowohl die Institutionalisierung der Betroffenen als auch die potentielle Einschränkung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, sind Diagnosen, die selten bis nicht überprüft werden und deren Validität aufgrund fehlender standardisierter Testverfahren bezweifelt werden darf.
Georg Feuser beschreibt die Situation so: "Es gibt Menschen, die WIR aufgrund UNSERER Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem WIR sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den WIR als "geistigbehindert" bezeichnen" (Feuser 1996, URL: http://bidok.uibk.ac.at/). Wir tun dies, obwohl die nicht zufriedenstellende Art der Zuordnung, also der Diagnoseerstellung, weitgehend bekannt zu sein scheint, was Angaben von Institutionen indirekt und die Sozialabteilung des Landes Oberösterreich direkt zu bestätigen scheinen.
Laut Duden ist Soziogenese "die Entstehung und Entwicklung (...) auf Grund bestimmter gesellschaftlicher Umstände" (Duden 1990, S. 732). Betrachtet man das Bild, das sich aus den zusammengetragenen Mosaiksteinen ergibt, den Umstand, dass für als geistig behindert diagnostizierte Menschen diese Primärbehinderung nicht existent oder bedeutend erscheint, sie aber mit den sekundären Beeinträchtigungen einer mit untauglichen Mitteln zustande gekommenen Diagnose, erstellt von zur Vereinfachung neigenden umgebenden Systemen, leben müssen, so kann "Geistige Behinderung" als soziogen bezeichnet werden. Die eigentlich wahrgenommene Beeinträchtigung kommt von außen d.h. umgebenden Systemen, als Fülle von Sekundärbehinderungen, Barrieren und/oder Verhaltensweisen nicht-behinderter Menschen.
Inhaltsverzeichnis
Cloerkes, Günther (1997): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Unter Mitwirkung von Reinhard Markowetz. Universitätsverlag C. Winter "Edition Schindele"
Dilling, H. et al. (Hrsg.) (1993): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. 2. Auflage, Verlag Hans Huber
Duden (1990): Das Fremdwörterbuch. 5. neu bearb. und erweiterte Auflage. Dudenverlag
Dyk, Irene; Weidenholzer, Josef et al. (2006) : Ausstellung "Wert des Lebens" Lern- und Gedenkort Hartheim. Konzeptplanung für die Aktualisierung der Räume zu den Themen "Gesellschaftspolitische Implikationen der Biowissenschaften" und "Leben mit Behinderung" (Kurzfassung). Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes-Kepler-Universität Linz
Frommelt, P., Grötzbach, H. (2005): Einführung in die ICF in der Neurorehabilitation (noch unveröffentlichte Version von 16. August 2005) Asklepios Klinik Schaufling
Glaserfeld, Ernst von (2004): Einführung in den radikalen Konstruktivismus in: Watzlawick, Paul (Hrsg.) (2004): Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. 17. Auflage Verlag Piper (S.16 - 38)
Goffman, Erving (1977): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. 2. Auflage 9. - 12. Tausend, Suhrkamp Verlag
Hosemann, W., Geiling, W. (2005): Einführung in die systemische Soziale Arbeit. Lambertus Verlag
Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände. Suhrkamp Verlag
Luhmann, Niklas (2002): Einführung in die Systemtheorie. Carl-Auer-Systeme Verlag
Meyer, Almut-Hildegard (2004): Kodieren mit der ICF: Klassifizieren oder Abklassifizieren? Potenzen und Probleme der "Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit". Universitätsverlag Winter, "edition S"
Saß, H., Wittchen, H.-U. & Zaudig, M. (1996): Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM- IV). Hogrefe Verlag.
Simmen, Rene (1998): Heimerziehung im Aufbruch. Alternativen zu Bürokratisierung und Spezialisierung im Heim. 4. unveränderte Auflage Verlag Haupt
Strübing, J. (2004): Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung. Verlag für Sozialwissenschaften.
Theunissen, Georg, Plaute, Wolfgang (1995): Empowerment und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch. Lambertus Verlag
Watzlawick, Paul, et al. (2003): Menschliche Kommunikation. Formen Störungen Paradoxien. Nachdruck der 10. unveränderten Auflage von 2000, Verlag Hans Huber.
Watzlawick, Paul (Hrsg.) (2004): Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. 17. Auflage. Verlag Piper
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.)(2000): Diagnosenschlüssel ICD-10 BMSG 2001. Internationale statistische Klassifikation
der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision, BMSG- Version 2001
http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/8/6/4/CH0369/CMS1128332460003/icd-10_bmsg_2001_-_systematisches_verzeichnis.pdf [Stand: 17. Februar 2007]
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2003): Handbuch zur Dokumentation der landesfondfinanzierten Krankenanstalten
http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/5/7/5/CH0369/CMS1128348439539/handbuch_organisation_und_datenverwaltung.pdf [Stand: 1. März 2007]
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.) (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. ICF Stand Oktober 2005. http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [Stand: 4. März 2007]
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.) (2006): Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision Version 2006 WHO-Ausgabe http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icd-10who/version2006/ regelwerk/x2vbp2006.zip [Stand: 2 März 2007]
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.) (2007): Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision Version 2007 German Modification
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2007/fr-icd.htm
[Stand: 1. März 2007]
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) Fourth Edition, Text Revision http://dsmivtr.org/ [Stand: 7.März 2007]
DSM-V Prelude Project: Research and Outreach http://www.dsm5.org/ [Stand: 7. März 2007]
Eggert, Dietrich (1996): Abschied von der Klassifikation von Menschen mit geistiger Behinderung. Der Paradigmenwechsel in der Diagnostik und seine Konsequenzen. erschienen in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, 19. Jahrgang, Heft 1/1996, Seite 43 - 64. Wiederveröffentlichung im Internet: bidok - Volltextbibliothek http://bidok.uibk.ac.at/library/eggert-klassifikation.html [Stand: 15.Jänner 2007]
Feuser, Georg (1996): Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration - "Geistigbehinderte gibt es nicht!" Vortrag vor den Abgeordneten zum Nationalrat im Österr. Parlament am 29. Okt. 1996 in Wien. Wiederveröffentlichung im Internet: bidok - Volltextbibliothek .http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-menschenbild.html [Stand: 10. März 2007]
Glaser, Barney G. with the assistance of Judith Holton (2004). Remodeling Grounded Theory [80 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 5(2), Art. 4. http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-04/2-04glaser-e.pdf [Stand: 10. März 2007]
Land Oberösterreich (1991): Landesgesetz vom 3. Juli 1991 betreffend das Landesgesetz über die Hilfe (Förderung und Betreuung) für behinderte Menschen
(Oö. Behindertengesetz 1991 - Oö. BhG 1991)
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=lroo&db=LROO&q={$QUERY}&sl=1500&t=doc2.tmpl&s=(20070302%3E=IDAT%20und%2020070302%3C=ADAT)%20und%20(10000315):GESNR%20und%20(0):PARA&s=LROO%FFSORT+%FF(20070302%3E=IDAT%20und%2020070302%3C=ADAT)%20und%20(10000315):GESNR%20und%20nicht%20(0):PARA [Stand: 1.März 2007]
Land Kärnten (2003): Handbuch zur Erfassung von Menschen mit hohem Förder- und / oder Begleitungsbedarf (HFB) http://www.behindertenhilfe.ktn.gv.at/ICF%20-%20Handbuch-Aktuell%2023.6.pdf [Stand: 8. März 2007]
Online ICD 9 /ICD 9 CM codes Free online searchable 2007 ICD-9-CM http://icd9cm.chrisendres.com/2007/ [Stand: 7. März 2007]
ORF Ö1 Inforadio (2006): Behinderung als Schaden? OGH-Urteil. http://oe1.orf.at/inforadio/68759.html [Stand: 16. März 2007]
Maturana, Humberto R. (1970): Biology of Cognition. Biological Computer Laboratory Research Report BCL 9.0. Urbana IL: University of Illinois. As reprinted in: Maturana, Humberto R., Varela F. (1980): Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living Dordecht: D. Reidel Publishing Co., 1980, S. 5-58.
http://www.enolagaia.com/M70-80BoC.html [Stand: 4. März 2007]
Office of the High Commissioner of Human Rights: Universal Declaration Of Human Rights. German Version. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm (15.11. 2006)
Bundeskanzleramt Österreich: Rechtsinformationssystem (RIS) http://www.ris.bka.gv.at/ [Stand: 12. März 2007]
World Health Organization (WHO): History of the development of the ICD. http://www.who.int/entity/classifications/icd/en/HistoryOfICD.pdf [Stand:17. Februar 2007]
bzw.: beziehungsweise
bidok: Behindertenintegration - Dokumentation. Volltextbibliothek am Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Innsbruck
d.h.: das heißt
DIMDI: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, zu deutsch: Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen
ebd.: ebenda
EEG: Elektroenzephalogramm
GT: Grounded Theory
HAWIK: Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder
ICD: International Classification of Diseases, zu deutsch: Internationale Klassifikation der Krankheiten
ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health, zu deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
Kap.: Kapitel
RIS: Rechtsinformationssystem im österreichischen Bundeskanzleramt
SMS: Short Message Service, Kurzmittelungsfunktion hauptsächlich bei Mobiltelefonen
URL: Uniform Resource Locator
FRAGEBOGEN zum Thema "Geistige Behinderung"
Der Ihnen vorliegende Fragebogen ist Teil einer empirischen Untersuchung im Rahmen der Erstellung einer Diplomarbeit an der Fachhochschule für Soziales in Linz (Studiengang: SDL). Sämtliche Daten werden nur statistisch ausgewertet, die Einzelbögen werden anonymisiert und streng vertraulich behandelt.
Der Terminus "geistige Behinderung" wird in diesem Fragebogen analog zur Definition der Weltgesundheitsbehörde (WHO), wie sie in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) in 10. Revision beschrieben ist, verwendet (Intelligenzminderung).
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an dieser Untersuchung teilzunehmen!
Den Anhang können sie unter folgender Url herunterladen:
http://bidok.uibk.ac.at/download/grill-soziogene-dipl.pdf
Audiodateien der im Kapitel 4.4 und 4.5 beschriebenen Interviews sind als CD beigefügt.
Ich erkläre hiermit eidesstattlich, die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst zu haben, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht zu haben.
Linz, am 6. April 2007
Quelle:
Christian Grill: Soziogene Behinderung. Die Diagnose "Geistige Behinderung" bei Erwachsenen und die diesbezüglichen Sichtweisen unterschiedlicher Systeme
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister (FH) für sozialwissenschaftliche Berufe.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 09.10.2007
