Leitfaden für eine umfassende Barrierefreiheit in berufsbildenden Schulen
IBEA Integrative Berufsorientierung - Integrative Berufsausbildung. Entstanden im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft IBEA www.ibea.co.at, Herausgeber: equalizent Schulungs u. BeratungsGmbH Obere Augartenstraße 20 1020 Wien, Mitherausgeber: LLL Projektmanagement GmbH Grazer Straße 24 8680 Mürzzuschlag
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Haltung und Einstellung
- 3. Infrastruktur der Schule und des Internats
- 4. Kommunikation und Unterstützung
- 5. Unterrichtsgestaltung
- 6. Abschluss - Fragenkatalog
- 7. Weitere Informationen
Der vorliegende Leitfaden ist ein Produkt der EU-Entwicklungspartnerschaft IBEA. Die Abkürzung IBEA steht für Integrative Berufsorientierung und Integrative Berufsausbildung. Das zweijährige Projekt hatte zum Ziel integrative Berufsorientierungs- und Berufsvorbereitungsmodelle für Polytechnische Schulen zu entwickeln. Weiters erprobte die Entwicklungspartnerschaft innovative Maßnahmen für den Berufsschulbereich. Insgesamt haben 23 Partnerorganisationen zusammen gearbeitet, um das Angebot der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen zu erweitern und Jugendliche in ihrer Berufswahl und Ausbildung bestmöglich zu unterstützen. In den Pilotregionen Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien wurden Maßnahmen evaluiert und Erfahrungen gesammelt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden die Basis des vorliegenden Leitfadens. Vorrangig soll er speziell zum Barrierenabbau in Berufsschulen für Jugendliche mit Behinderungen beitragen. Doch diese Denkanstöße helfen auch allgemein Barrieren für Menschen in der beruflichen Erstausbildung zu erkennen und zu verringern.
Aus der Erfahrung wissen wir, dass durch die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen Barrieren in Schulen (wie auch in Betrieben) sichtbarer werden. Bei genauerer Betrachtung betreffen sie aber meist mehr Personen. Der Abbau von diesen Barrieren kann deshalb eine Chance sein, die Schule schüler/innenzentrierter zu gestalten und dadurch zu einer befriedigenden Wissensvermittlung und zu einer guten Arbeitsatmosphäre beizutragen.
In "Berufsschule ohne Barrieren" werden verschiedene Aspekte der vielfältigen Bedürfnisse möglichst aller Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, von baulichen Voraussetzungen bis hin zu didaktischen Notwendigkeiten. Ziel ist es mögliche Ausschlussfaktoren zu verringern.
Viele Personen waren an der Entstehung dieses Leitfadens beteiligt. Ihnen möchte ich herzlich danken und Ihnen werte Leserin, werter Leser, wünsche ich eine anregende Lektüre.
Mag.a Monika Haider
Geschäftsführerin equalizent GmbH, http://www.equalizent.com
PS: Auch nach Projektende stehen wir Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung, z.B. zum Thema Managen von Vielfalt ("Diversity Management"), Arbeit mit heterogenen Gruppen, usw. Scheuen Sie sich nicht mit uns in Kontakt zu treten.
Inhaltsverzeichnis
Berufsschulen sind ein wichtiger Faktor in der beruflichen Erstausbildung von Jugendlichen. Durch die Einführung der Integrativen Berufsausbildung wurde ein entscheidender Schritt gesetzt, der es benachteiligten und behinderten Jugendlichen erleichtert die duale Ausbildung zu absolvieren.
Als öffentliche Institution haben die zuständige Schulbehörde und die Schule nun den Auftrag, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, damit alle Schüler und Schülerinnen gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen können. In diesem Zusammenhang fällt häufig das Schlagwort "Barrierefreiheit". Eine Assoziation ist dabei oft, ein Gebäude rollstuhlgerecht zu adaptieren. Barrieren müssen jedoch wesentlich umfangreicher verstanden werden und entstehen in den unterschiedlichsten Bereichen: unter anderem in der Haltung in der man Menschen begegnet, in der Zugänglichkeit von Informationen oder in der Gestaltung des Unterrichts.
Grundsätzlich muss das Ziel einer barrierefreien Institution sein, keine Person von ihrem Angebot auszuschließen. In Berufsschulen werden deshalb Rahmen+bedingungen und Voraussetzungen benötigt, die allen Schülerinnen und Schülern eine qualitativ hochwertige Ausbildung ermöglichen.
Denn eines zeigt sich dabei immer wieder: Barrieren, die für behinderte Menschen vorhanden sind, wirken sich auch auf andere Menschen aus. Deshalb ist der Prozess, Schulen für behinderte Menschen barrierefrei zu gestalten, eine Möglichkeit, Hindernisse für viele Menschen abzubauen.
Oft hilft die Perspektive von behinderten Personen, Barrieren sichtbar zu machen, die auch anderen Personen den Schulbesuch erschweren.
Begleitende Tafelbilder, Diagramme und das Aufschreiben wesentlicher Schlagwörter auf der Tafel sind beispielsweise wichtige Hilfen. Für gehörlose Schülerinnen und Schüler ist es ohne eine Visualisierung kaum möglich die Inhalte zu erfassen. Auch Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben einem mündlichen Vortrag aufgrund ihrer geringen Deutschkompetenz zu folgen, wird die Visualisierung der Inhalte helfen. Generell wird diese Unterstützung jedoch allen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen, die durch eine Vielfalt der Präsentation Inhalte leichter verstehen.
Der Leitfaden vermittelt einen ersten Eindruck, auf welchen Ebenen Barrieren im Ausbildungs- und Schulbereich bestehen und zeigt anhand kleiner Beispiele, wie sie abgebaut werden können.
Dabei kann der Leitfaden als "Brille" verstanden werden, die den Blick für Barrieren schärft. Denn nur wer Barrieren erkennt, kann diese vermeiden oder abbauen.
Folgende Bereiche werden dabei näher betrachtet:
-
Haltung und Einstellungen gegenüber behinderten Menschen
-
Infrastruktur
-
Kommunikation und Unterstützung
-
Unterrichtsgestaltung
Abgerundet werden die Kapitel durch praxisnahe Anregungen und Überlegungen.
Es gibt viele Personen und Institutionen, die Sie auf dem Weg zur Barrierefreiheit unterstützen können. Deshalb finden Sie im letzten Kapitel Hinweise zu Fachliteratur oder Kontaktmöglichkeiten zu Organisationen die Ihnen weiterhelfen können.
Der Weg zu einer barrierefreien Institution braucht Zeit. Aber nicht alle Barrieren können auf einmal abgebaut werden. Beginnen Sie deshalb mit einer Analyse:
-
In welchen Bereichen gibt es viele Barrieren in Ihrer Schule und in welchen Bereichen weniger?
-
Was funktioniert bereits gut? Wo gibt es noch Bedarf Barrieren abzubauen?
Danach setzen Sie die ersten Schritte, um Barrieren, die aktuell das Schulleben von behinderten Schülern oder Schülerinnen erschweren, zu beseitigen. Hier besteht sicherlich der dringendste Bedarf.
Im nächsten Schritt können Sie vorausschauend weitere Barrieren in Angriff nehmen, damit in Zukunft eine Basis an barrierefreien Rahmenbedingungen gegeben ist. Dieser Prozess wird Erfolge, aber auch immer wieder Rückschläge mit sich bringen. Die Rückschläge sind jedoch genau so wichtig wie die Erfolge, da aus ihnen viel gelernt werden kann.
Lassen Sie sich nicht entmutigen!
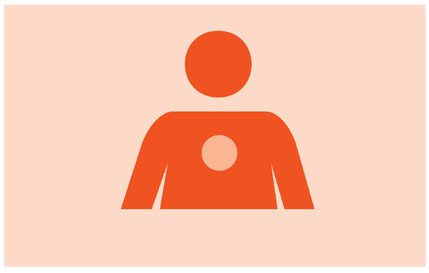
Die größte Barriere für viele behinderte Menschen ist, dass sie mit fixen Bildern, Erwartungen und Vorurteilen konfrontiert sind. Häufig kommt es zu vorschnellen Meinungen, welche Leistungen sie erbringen bzw. nicht erbringen können.
Aber eine Behinderungsform sagt nicht grundsätzlich etwas darüber aus, was eine Schülerin oder ein Schüler leisten kann. Denn jeder Mensch - egal ob mit oder ohne Behinderung - hat eine facettenreiche Persönlichkeit, mit verschiedenen Stärken, Schwächen und einer einzigartigen Biographie. Die Behinderung ist ein Aspekt davon.
In unserer Gesellschaft wird behinderten Menschen oft diese Individualität abgesprochen und es wird sehr schnell in starren Kategorien gedacht. So wird unter anderem oft angenommen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten keine Vorstellung von Geld haben und daher keine Verantwortung für Geld - nicht für ihr eigenes und schon gar nicht für fremdes - übernehmen können. Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in Gastronomiebetrieben oder Geschäften die Kassa betreuen, sind ein Beispiel dafür wie sehr diese Vorurteile trügen.
Was ich als Lehrerin oder Lehrer einer Person zutraue, hat dabei gravierenden Einfluss auf die Lernerfolge, die Schüler und Schülerinnen erbringen. Ein erster wichtiger Schritt ist daher, sich eigener Vorstellungen und Meinungen über Stärken und Schwächen von Menschen mit einer bestimmten Behinderung bewusst zu werden und diese zu hinterfragen.
Danach wird sich der Blick weiten und der Fokus kann sich auf die Stärken und Bedürfnisse der einzelnen Jugendlichen richten.
Bestimmte Vorstellungen und Gefühle erschweren in unserer Gesellschaft eine Offenheit und Akzeptanz:
-
fehlende Erfahrungen, Kontakte und Kommunikation mit behinderten Menschen
-
die Angst jemanden zu beleidigen und ein Gefühl von Mitleid
-
die Annahme, dass an den aktuellen Rahmenbedingungen sowieso nichts geändert werden kann
-
Mythen zum Thema Behinderung
-
Beispielhaft sollen hier einige Mythen und Vorurteile hinterfragt werden:
Eine Behinderung macht einen Menschen schwach.
"Ich habe Down-Syndrom"
Ich habe Down-Syndrom
Aber ich stehe dazu
und bin kein Alien
denn ich bin so wie ich bin und jeder soll es verstehen
und mich respektieren.
Gedicht von Svenja Giesler, aus der Zeitschrift "Ohrenkuss", zitiert nach Platte/Seitz/Terfloth 2006, 77
Ein behinderter Mensch hat Stärken. So wie jeder andere Mensch auch. Natürlich hat jeder behinderte Mensch auch Schwächen. Ebenfalls wie jeder andere Mensch. Gerade bei Menschen mit Behinderungen ist das Bild, das andere sich von ihnen machen, jedoch vorrangig von Schwächen und Defiziten geprägt. Deshalb ist es umso wichtiger, als Lehrkraft bewusst den Blick auf die vorhandenen Stärken zu legen und die Jugendlichen in der Weiterentwicklung dieser persönlichen Stärken zu unterstützen.
Behinderte Jugendliche werden durch die Unterstützung bevorzugt, die anderen Schüler und Schülerinnen kommen dabei zu kurz.
"Für mich ist die größte Ungerechtigkeit, alle gleich zu behandeln. Jede Person ist einzigartig und deshalb steht jedem und jeder eine einzigartige Form der Unterstützung zu. Dabei ist es die Qualität der Unterstützung die zählt und es sind nicht die ‚gerecht aufgeteilten' Minuten."
Monika Roszkowska
Chancengleichheit heißt gleiche Chancen für alle, aber nicht gleiche Behandlung für alle. Das bedeutet, allen Menschen so zu begegnen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können und nicht behindert werden. Dies entspricht auch dem generellen Ansatz einer schüler- und schülerinnenzentrierten Schule. Wenn alle Schülerinnen und Schüler als Individuum im Zentrum stehen und die Entwicklung ausgehend von ihren persönlichen Voraussetzungen als Maßstab des Erfolgs gilt, ist es auch nicht unfair, wenn beispielsweise eine Schülerin mit einer sprachlichen Einschränkung mehr Zeit für eine mündliche Prüfung bekommt. Und je weniger Barrieren zu überwinden sind, desto geringer wird der Bedarf an Unterstützung sein.
Die Behinderungsform sagt generell aus, welche Unterrichtsinhalte und Gegenstände für den Schüler oder die Schülerin geeignet sind.
"Ist es auch gefährlich blinde Menschen auf die Straße gehen zu lassen? Genauso wie auf der Straße ist es für einen Blinden und einen Sehenden, Gefahren gibt es überall, man muss nur wissen, was man sich zutraut oder nicht! Nur wenn man es versucht und probiert, kann man es wissen, egal ob sehend oder blind!"
Helmut Schachinger
Eine Behinderungsform sagt grundsätzlich noch nichts darüber aus, welche Lerninhalte sinnvoll für eine Person sind. Mit Flexibilität und Kreativität lassen sich viele unterschiedliche Lösungen finden. Für eine gehörlose Schülerin oder einen gehörlosen Schüler ist der Englischunterricht ebenso sinnvoll, auch wenn sie oder er an Übungen der mündlichen Kommunikation in einer anderen Form teilnehmen wird. Möglicherweise recherchiert sie Gebärden der "American Sign Language". Behinderte Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern sind Experten und Expertinnen für ihr Leben. Eine große Bereicherung besteht darin, sie nach ihren Erfahrungen zu fragen und ihre Ideen und Vorschläge aufzugreifen.
Bei uns sind alle nett, da findet sich schon wer der/die hilft. Deshalb brauchen wir keine barrierefreie Infrastruktur.
"Hier kommt mir mein Lieblingssatz von zwei russischen Autoren in den Sinn: ‚Das Problem des Ertrinkens ist ein Problem der Ertrinkenden selbst' (Ilfi i Petrov). In letzter Konsequenz musst du dir selbst helfen und bist auf dich allein gestellt. Und dieses Problem haben wir ‚Behinderte' genauso zu bewältigen wie alle ‚nicht Behinderten' auch. Ich wünsche NIEMANDEM vor den Stufen einer Brücke stundenlang zu stehen und auf Hilfe warten zu müssen, um auf das andere Ufer gelangen zu können. Da leider nicht ALLE und IMMER nett und hilfsbereit sind! Und ich möchte mir meine Zähne selbst putzen können, egal ob mit meinen Händen oder mit technischen Hilfsmitteln! Denn mit den richtigen Hilfsmitteln, wie Sauerstoffmaske und Flossen, wird aus dem Ertrinken ein Tauchen."
Marinela Vecerik
Hilfsbereite Menschen sind natürlich wunderbar, doch das reicht nicht. Das Ziel einer barrierefreien Umgebung muss sein, dass sich die Personen ohne fremde Hilfe selbstbestimmt und selbständig bewegen können. Wenn beispielsweise ein Schüler oder eine Schülerin jedes Mal Mitschüler oder Mitschülerinnen um Hilfe bitten muss, um zum WC zu kommen, dann ist das eine massive Einschränkung der persönlichen Autonomie und stellt keine ideale Lösung dar.
Eine neue Perspektive:
Es ist tiefster Winter. Die Stiege und die Rampe vor einer Schule müssen vom Schnee freigemacht werden. Der Hausmeister steht bei der Stiege und schaufelt diese frei. Ein Mädchen im Rollstuhl spricht ihn an: "Können Sie bitte die Rampe freimachen, damit ich in das Gebäude kann?" Der Hausmeister: "Erst nachdem ich die Stiege frei habe, über sie müssen mehr Menschen in das Haus." "Aber wenn Sie die Rampe frei machen, können alle in das Gebäude."
Quelle: Michael F. Giangreco, Kevin Ruelle: Teaching Old Logs New Tricks: More Absurdities and Realities of Education
Inhaltsverzeichnis

Oft wird bei barrierefreiem Bauen nur an rollstuhlgerechte Gebäude gedacht. Barrierefreie Gebäude müssen aber auch auf die Bedürfnisse anderer Personen abgestimmt sein. Beispielsweise sollten für blinde Personen taktile (tastbare) Leitsysteme zur Verfügung stehen.
In den Ö-Normen 1600 und 1602 sind Standards für die Barrierefreiheit von Räumen - im Speziellen für Bildungsinstitutionen - festgelegt, die unterschiedliche Bereiche berücksichtigen. In verschiedenen Broschüren sind Zusammenfassungen der Ö-Normen zu finden.
Beispielsweise:
-
"Broschüren barrierefreies Bauen" der Stadt Graz http://www.graz.at/cms/beitrag/10027263/421952
-
"barrierefrei am Arbeitsplatz" der Allgemeinen Unfallversicherung. http://www.auva.at/mediaDB/49105.PDF
-
"Barrierefreies Bauen" von Uniability http://info.tuwien.ac.at/uniability/bauen.htm
Wenn Sie Ihr Gebäude derzeit aus finanziellen oder anderen Gründen nicht umbauen können, dann bringen kleine Adaptionen oft schon eine Erleichterung für behinderte Besucherinnen und Besucher.
Zum Beispiel:
-
mobile Rampen, die über Treppen führen
-
gut sichtbare Streifen am Boden, die Stufen ankündigen
-
Abdeckungen über Unebenheiten, die eine Sturzgefahr verringern
-
Wege von Hindernissen wie Blumentöpfen befreien
Achten Sie darauf, dass nicht nur die Schule selbst, sondern auch Werkstätten, Speisesäle, Umkleideräume, Internat und Räume für Freizeitaktivitäten bei der Adaption miteinbezogen werden. Auch diese Räume müssen für alle benutzbar sein.
Seit Jänner 2006 ist in Österreich das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft und setzt damit ein Diskriminierungsverbot in vielen Bereichen des täglichen Lebens und der Arbeitswelt. Behinderte Menschen haben nun in Österreich die Möglichkeit, gegen Diskriminierungsfälle rechtliche Schritte einzuleiten. Hier eine Definition von mittelbarer Diskriminierung:
"Mittelbare Diskriminierung kann dadurch verursacht sein, dass der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Angebote von Waren und Dienstleistungen nicht barrierefrei zugänglich sind.
Als barrierefrei definiert das Gesetz bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
Verantwortlich für bauliche Barrieren im Sinne des Gesetzes sind nicht die Gebäudeeigentümer, sondern jene Anbieter von Waren und Dienstleistungen, deren Angebote in diskriminierender Weise nicht allgemein zugänglich sind."
http://www.gleichundgleich.at → Interessensbereiche → Diskriminierung durch Barrieren
Für neue Gebäude ist das Gesetz bereits in Kraft getreten, für den Umbau bestehender Gebäude gibt es Übergangsfristen.
Näheres finden Sie auf der Informationsplattform des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz http://www.gleichundgleich.at
Eine große Barriere ist es, wenn die Orientierung den Schülern und Schülerinnen schwer fällt. Orientierungshilfen müssen leicht verständlich sein und so gestaltet werden, dass sie auch die Bedürfnisse sinnesbehinderter Menschen berücksichtigen.
Blinden Menschen wird die Orientierung durch taktile (mit Blindenstöcken, Hand oder Fuß ertastbar) und akustische Informationen ermöglicht. Taktile Leitsysteme können oft schon durch einfache Hilfsmittel, wie Klebefolien, erzeugt werden. Informationselemente, wie Orientierungstafeln, sollten gut ausgeleuchtet, in großer Schrift und in einem leicht lesbaren Schriftzug geschrieben sein. Durch eine kontrastreiche Gestaltung kann die Erkennbarkeit zusätzlich verbessert werden.
Besonders hilfreich sind visuelle Ergänzungen zu den Hinweistexten. So können die Schilder, die den Weg zum Sekretariat, zur Direktion und zum Konferenzzimmer ausweisen, mit Fotos der Personen ergänzt werden. Dadurch können auch Jugendliche, die diese Begriffe nicht verstehen, zu den Räumen finden.
Ordnung und wenige Wechsel in der räumlichen Konstellation erleichtern nicht nur sehbehinderten Menschen die Orientierung. Geordnete, klare Raumverhältnisse helfen auch schwerhörigen oder gehörlosen Menschen einen Überblick über die Situation zu erhalten. Dadurch können sie sich besser auf die Gegebenheiten einstellen und sich orientieren.
Generell sollten Raumwechsel vermieden werden, denn diese verursachen für manche behinderten Schüler und Schülerinnen zusätzliche Erschwernisse. Beispielsweise müssen sie ihre Hilfsmittel mitnehmen und sich immer wieder neu orientieren. Gerade für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten ist eine neue Umgebung oft verunsichernd. Auch für die gesamte Klassengemeinschaft ist ein Klassenraum fördernd und bietet den Jugendlichen die Möglichkeit ihn zu ihrem Raum zu machen und eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen.
Gebäude sind berollbar, wenn sie mit einem Rollstuhl zu befahren sind. Eine Voraussetzung dafür ist, dass alle Bereiche stufenlos erreichbar sind: Stiegen sind über Rampen umfahrbar oder ein Aufzug bzw. eine Aufstiegshilfe sind vorhanden. Wo sich Schwellen und Niveauunterschiede nicht vermeiden lassen, soll ihre Höhe so gering wie möglich sein.
Weiters muss ein Rollstuhl durch die Gänge passen und gewendet werden können. Türen brauchen deshalb eine Durchgangsbreite von mindestens 85 cm. Griffe, Licht- und Liftschalter, Speiseausgaben und andere Bedienungsvorrichtungen müssen auch von einem Rollstuhl aus einfach zu benutzen sein. Die ideale Höhe dafür beträgt 85 cm.
Diese Maße gelten für die Mobilität mit Rollstühlen. Es zeigt sich aber immer wieder, dass barrierefreie Wege die Arbeit für viele Personen in der Organisation erleichtern, beispielsweise für Reinigungskräfte, die mit Putzwägen durch das Gebäude fahren oder wenn Geräte innerhalb der Schule transportiert werden.
Die Unbenutzbarkeit von Sanitärräumen ist ein großes Integrationshindernis für behinderte Menschen. Ein umständliches Erreichen der Toilette - zum Beispiel, wenn sie sich in einem anderen Teil des Gebäudes befindet - bereitet behinderten Menschen zusätzliche Probleme zur ohnehin schon schwierigen Alltagsbewältigung.
Die genauen Daten für die barrierefreie Gestaltung von Sanitäranlagen finden Sie ebenfalls in den Ö-Norm Vorschriften. Im Idealfall ist das WC mit einem Hebelift ausgestattet oder bietet zumindest genügend Raum, dass ein mobiler Hebelift, den die betroffenen Personen selbst mitbringen, verwendet werden kann.
Manche Menschen müssen Gegenstände ertasten oder es ist für sie nicht möglich, die Toilette zu benutzen, ohne sich hinzusetzen. Deshalb muss besonders auf die Sauberkeit und Hygiene von Toilettenanlagen und Bädern geachtet werden.
Für blinde Menschen stellen Gegenstände in Augenhöhe - Blumen auf Trägern, Erste-Hilfe-Kästen etc. - große Hindernisse dar, da diese mit einem Blindenstock nicht ertastet werden können. Diese Dinge sollten umgestellt oder umgehängt werden.
Auf Gefahren, wie große, ungeteilte Glasflächen, Glastüren, Stiegen und andere Hindernisse, kann rechtzeitig durch Markierungen mit Klebefolien oder Gravuren aufmerksam gemacht werden.
Die Räume sollten ausreichend beleuchtet sein. Wichtig ist ein Licht, das starke Kontraste erzeugt, aber keine Blendungen verursacht. Idealerweise gibt es flexible Lichtquellen, die in der Intensität verändert werden können (Dimmer). Unterschiedliche Lichtquellen, mit denen der vordere und hintere Bereich eines Raums getrennt beleuchtet werden kann, sind dabei sehr hilfreich.
Der Standort der sprechenden Person im Klassenraum ist ebenfalls wichtig. Ihr Gesicht soll dabei gut beleuchtet sein. Vermeiden Sie, mit dem Rücken zu Lichtquellen, wie einem Fenster oder einer hellen Lampe zu stehen. Dadurch wird ein Schatten auf Ihr Gesicht geworfen und Ihre Mimik und Lippen sind schwer zu erkennen. Gleichzeitig wird dadurch vermieden, dass die angesprochene Person durch das Gegenlicht geblendet wird, was auch für sehbehinderte Menschen unangenehm ist.
Hall und Echo sollten vermieden werden. Leere, hohe Räume neigen zu einer unangenehmen Akustik, die sowohl blinden als auch schwerhörigen Menschen Probleme bereitet. Vorhänge und Teppiche dämpfen den Hall. Mit diesen einfachen Mitteln kann eine erste Verbesserung der Akustik erzeugt werden.
Nebengeräusche sind für viele Menschen ein großes Problem: Schüler oder Schülerinnen mit Konzentrationsschwierigkeiten werden durch Nebengeräusche leicht abgelenkt. Für schwerhörige Personen entsteht durch sie ein Geräuschteppich, der es ihnen fast unmöglich macht, die sprechende Person heraus zu hören. Aber auch für blinde und sehbehinderte Menschen sind Nebengeräusche irritierend und beschwerlich.
Für schwerhörige Menschen ist die Installation einer Induktionsanlage eine große Hilfe. Diese erzeugt über ein Mikrofon und eine Induktionsschleife eine Verstärkung der gesprochenen Sprache der Lehrer und Lehrerinnen. Diese Verstärkung ist nur für Personen mit einem Hörgerät merkbar, und wird von Menschen ohne Hörgerät nicht wahrgenommen. Informationen zu induktiven Höranlagen erhalten Sie unter: http://www.schwerhoerigen-netz.at
Eine flexible Sitzordnung und leicht bewegbare Tische unterstützen nicht nur die Barrierefreiheit, sondern ermöglichen auch einen flexibleren Unterricht. So können beispielsweise für Gruppenarbeiten die Möbel schnell umgestellt werden.
In einer Reihenaufstellung der Tische können nicht alle Schüler und Schülerinnen einander sehen bzw. verstellen einander den Blick zur Lehrperson. Gerade schwerhörige oder gehörlose Menschen müssen aber ständig einen freien Blick zu den anderen Personen und ganz besonders zu den Dolmetscherinnen und Dolmetschern haben. Deshalb ist für sie die Sitzordnung besonders wichtig. Eine Anordnung in V- oder U-Form ist dabei gut geeignet.
Ein spezielles Service - nicht nur für behinderte Menschen - ist ein Ruheraum. In diesem können sich Personen zur Erholung oder zum stillen Arbeiten zurückziehen. Ein Ruheraum sollte auf jeden Fall mit einer Liegemöglichkeit und bequemen Stühlen ausgestattet sein.
Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre im Gebäude. Das beginnt bereits im Empfangsbereich der Institution und reicht bis zur Gestaltung der Schulungsund Pausenräume. Eine Umgebung, in der sich Menschen willkommen und wohl fühlen, fördert den Lernprozess. Oft machen schon kleine Veränderungen in den Räumen einen großen Unterschied. Freundliche Farben oder schöne Sitzgelegenheiten können sehr zum Wohlfühlen beitragen.

Starten Sie doch einen Versuch mit Ihren Schülerinnen und Schülern: untersuchen Sie Ihre Gebäude auf bestehende Barrieren. Ein Teil verbindet sich die Augen, andere gehen mit Krücken, andere versuchen sich mit einem Karton, der die Breite und Tiefe eines gängigen Rollstuhls hat, durch das Gebäude zu bewegen.
Wie leicht war es sich durch die Räume zu bewegen? Welche Barrieren fallen den Jugendlichen auf? Welche Hindernisse waren überwindbar, entweder durch Umwege, durch die Hilfe anderer Lehrlinge oder durch das Verstellen von Gegenständen? Welche waren nicht überwindbar?
Wenn behinderte Schülerinnen oder Schüler in der Gruppe sind, können diese von ihren Erfahrungen erzählen und als Experten und Expertinnen Ideen für Lösungen für den Barriereabbau einbringen.
Berufsschuldirektor Johann Dinhobl leitet die Landesberufsschule für Tourismus in Waldegg.

Kontakt: BD Johann Dinhobl, LBS Waldegg
Hauptstraße 41, 2754 Waldegg
Telefon: 02633/42278
E-Mail: office@lbs-waldegg.at
Web: http://www.berufsschulen-noe.at/waldegg
Das Schulgebäude der LBS Waldegg befindet sich gerade am Weg barrierefrei zu werden. Können Sie die bisherigen Schritte für uns umreißen?
Unsere Schule besteht bereits seit 1946. Seit dem wurde das Gebäude teilweise weggerissen und wieder aufgebaut. Es gab laufend Umbauarbeiten und Adaptionen des Gebäudes, vom ursprünglichen Gebäude steht nichts mehr. Im Zuge der letzten Sanierungs- und Umbauarbeiten war es uns wichtig, den Zugang für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Integration ist ein Thema, das uns begleitet und deshalb war es für uns selbstverständlich auch im Umbau die Frage der Barrierefreiheit zu diskutieren.
Wer hat die Kosten dafür übernommen?
Der Schulerhalter, das Land Niederösterreich.
Auf welche Aspekte der Barrierefreiheit wurde hier besonders geachtet und warum?
Unsere Schule liegt auf einer Hanglage. Das ist zwar landschaftlich sehr schön, bedeutet aber das unser Schulgebäude auf einer Schräglage gebaut wurde und wir uns auf sieben Stockwerken bewegen. Deshalb war es für uns vorrangig, die Höhenunterschiede im Gebäude durch Rampen auszugleichen und Treppen zu vermeiden. Es war auch wichtig, dass die verschiedenen Stockwerke durch Lifte gut erreichbar sind. Im Zuge dieser Umbauarbeiten wurden auch barrierefreie WCs und automatische Schiebetüren eingebaut. Somit ist es uns gelungen, bis auf einen Trakt, der noch nicht umgebaut wurde, das Gebäude gut zugänglich zu machen.
Das heißt, bei Ihnen bezieht sich Barrierefreiheit nur darauf, dass das Gebäude berollbar ist?
Hier liegt unser Schwerpunkt, weil, wie gesagt, die Stufen und Höhenunterschiede die größten Barrieren waren. Aber wir haben auch andere Aspekte bedacht, vor allem in unseren Lehrküchen, die wir Küchenstudios nennen. Im Zuge dieser Neugestaltung wollten wir die Küchen jugendgerecht machen und sie farblich ansprechend gestalten. Daraus hat sich ergeben, dass wir jetzt 6 Lehrküchen in 6 verschiedenen Farben haben. Das heißt: von den Fliesen bis zum Messergriff ist alles farblich abgestimmt. Ja, und da hat sich angeboten, dass man ein Farbleitsystem auf den Gängen macht, so dass man nicht mehr sagen muss: "Gehen Sie in die Lehrküche 2", wo ohnehin niemand weiß, wo diese liegt, sondern: "Gehen Sie in die rote Küche". Die Schüler sehen dann anhand von farblichen Streifen, wo sie hingehen müssen. Wie sich herausstellt, erleichtert das die Orientierung für die Jugendlichen sehr. Sie merken es sich auch leichter. Wenn ich heute einen Schüler frage: "Wo kochen Sie?" dann sagt er: "In der roten Küche". Früher hatten sie nicht immer gewusst, welche Nummer die Küche hat, in der sie arbeiten. Das erleichtert es schon. Und es gefällt den Schülern.

Wurde auch in den Küchen auf die Barrierefreiheit geachtet?
Dort haben wir es nicht vorrangig mitbedacht. Die Küchen sind nach den bestehenden Standards eingerichtet. Die Extraanfertigung ist da leider eine Kostenfrage. ABER: Wir haben eine Sequenz flexibel gestaltet und es gibt auch tragbare Induktionsplatten, das sind moderne Herdplatten. Dadurch kann zumindest ein Arbeitsplatz immer an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, also z.B. niedriger eingerichtet werden. Da kann man dann sicher auch gut mit einem Rollstuhl zufahren.
Sie versuchen also sich so flexibel wie möglich an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen?
Uns ist es wichtig, die Entwicklung unserer Schüler zu beobachten, d.h. wir versuchen vorausschauend den jetzigen aber auch den zukünftigen Bedarf unserer Schüler zu erkennen. Denn das Ziel ist, dass sie die Berufsschule und die Lehre bestmöglich absolvieren und wir sie unterstützen, wo immer es möglich ist. Wenn es daher einen Bedarf bei der Adaption der Infrastruktur gibt, dann reagieren wir rasch darauf. Aber das bezieht sich nicht nur auf die Infrastruktur. Wir versuchen zum Beispiel auch einen niederschwelligen Zugang für unsere Schüler im sozialen Bereich zu gestalten. So wird bei uns, erstmalig an Berufsschulen, eine Sozialarbeiterin eingesetzt. Im Schülerkaffee, das übrigens von den Schülern eigenständig geführt wird, gibt es die Möglichkeit mit der Sozialarbeiterin in Kontakt zu treten. Die Schüler haben somit die Möglichkeit einer begleitenden Betreuung, auch über die Schulzeit hinaus.
Sehen Sie weitere Vorteile, die sich durch den Umbau ergeben haben?
Da gibt es viele Vorteile. Integration von Schülern mit Behinderungen ist schlichtweg ein Thema, das man nicht ignorieren kann. Aber diese Umbauten ermöglichen auch eine Öffnung für andere Menschen. Wir haben z.B. einen Lehrberechtigten, der im Rollstuhl sitzt. Noch vor sieben Jahren hätte er sich kaum in unserem Haus bewegen können. Jetzt kann er ohne Probleme zu Projektpräsentationen kommen. Das sind schon auch Überlegungen, wo einem klar wird, wer nicht kommen kann, nur weil man zu viele Treppen hat. Es ist uns wichtig die Schule also nicht nur für Lehrlinge, sondern auch für Personen aus dem Umfeld zugänglich zu machen.
Und einen praktischen, logistischen Vorteil gibt es auch. Man denkt auch an die Anlieferungen und an den Materialtransport innerhalb der Schule logisch. Das sind natürlich auch Überlegungen, die man in die Planung von so einem Haus mit einbezieht.
Ist Ihr Weg zur Barrierefreiheit bereits abgeschlossen?
Nein, bei weitem noch nicht. So wie wir alle paar Jahre Umbau- und Sanierungsarbeiten benötigen, werden wir auch im Sinne der Barrierefreiheit immer Adaptionen brauchen. Und wir haben ja noch einen Trakt, der noch nicht umgebaut ist. Auch der Haupteingang hat noch keine Rampe. Die Schule ist zwar sehr gut über die Hofseite zugänglich, aber noch nicht über den vorderen Eingang. Wir befinden uns also mitten in diesem Prozess. Und es geht auf zwei Wegen weiter. Einerseits werden wir bei laufenden Umbauarbeiten immer die Barrierefreiheit mitbedenken. Andererseits gehen wir auf die Bedürfnisse einzelner Schüler ein, d.h. mit verschiedenen Adaptionen möchten wir sicher gehen, dass unsere Schüler sich gut im Schulgebäude bewegen und arbeiten können. Aber das machen wir dann im konkreten Anlassfall und schauen was der Schüler braucht.
Haben Sie noch einen Tipp für andere Berufsschulen?
Hm, das ist nicht einfach. Aber vielleicht diesen: Sie sollen möglichst versuchen einen Architekten zu finden, der auf die Wünsche der Schule eingeht. Es liegt ja normalerweise nicht unbedingt an der Schule. Ein Schulleiter kann in der Regel nicht den Architekten aussuchen, denn der Schulerhalter vergibt den Auftrag. Aber es ist wichtig, sich mit den Architekten hinzusetzen und Dinge zu besprechen. Man muss einfach immer wieder auf die Wichtigkeit der Barrierefreiheit hinweisen, das Gespräch suchen und argumentieren. Es hängt viel von den handelnden Personen ab. Aber das ist wahrscheinlich mein Tipp: Dinge aufzeigen und diese an den richtigen und wichtigen Stellen zu deponieren. Und auch vehement sein, wenn es um die Barrierefreiheit geht.
Inhaltsverzeichnis
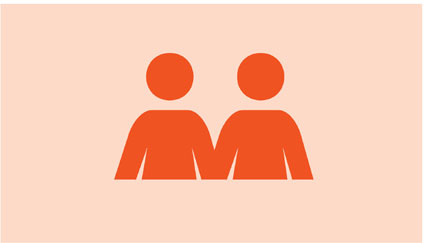
Eine gute Kommunikation ist das zentrale Werkzeug für den Barriereabbau, denn nur durch ausreichende Information können adäquate Lösungen gefunden werden.
Einerseits ist es wichtig eine gute Kommunikationsbasis mit den betroffenen Schülern und Schülerinnen aufzubauen. Andererseits ist es auch wesentlich einen regen Austausch im Team und mit anderen beteiligten Personen und Institutionen wie Berufsausbildungsassistenz oder Lehrbetrieb zu pflegen.
Dadurch können effiziente und rasche Schritte gesetzt und passende Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Ausbildung geschaffen werden. Das hilft Frustration bei allen Beteiligten zu vermeiden.
Die Voraussetzung für eine gelungene Kommunikation ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Beteiligten. Diese stellt einerseits für die Jugendlichen sicher, dass mit ihren Daten und Informationen bedacht und vertraulich umgegangen wird, andererseits ermöglicht sie auch dem Team, Rückschläge oder Unsicherheiten anzusprechen. Deshalb sollte es klare Regeln geben, wie mit vertraulichen Informationen umgegangen wird.
Der Aufbau von Vertrauen gelingt am besten durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt aller Beteiligten: der Jugendlichen, der Lehrer und Lehrerinnen, der Eltern, der Firma und der restlichen unterstützenden Personen.
Teil gegenseitiger Wertschätzung ist, dass die Meinung der beteiligten Personen ernst genommen wird, und ein Rahmen besteht, in dem diese Meinung ausgedrückt werden kann. Dafür sind regelmäßige Feedback-Möglichkeiten sehr hilfreich. Sie geben allen Beteiligten die Chance ihre Meinung über das, was gut und das was weniger gut funktioniert, zu äußern.
Dabei können sich beispielsweise die Lehrer und Lehrerinnen untereinander Feedback über ihre Arbeit geben, den Jugendlichen ihre Eindrücke von ihrer Entwicklung mitteilen, oder die Jugendlichen können dem Lehrpersonal rückmelden, wie geeignet der Unterricht für sie ist, oder wie adäquat spezielle Adaptionen waren.
Das Feedback kann unter anderem zu regelmäßigen Gesprächsterminen stattfinden. Wichtig ist dabei, dass es Raum und Zeit für ein Gespräch gibt und dass alle beteiligten Personen ernst genommen werden. Es sollten dabei sowohl Stärken als auch Schwächen der Zusammenarbeit thematisiert werden. Dadurch kann ein Verbesserungspotenzial erkannt werden und es lassen sich konkrete Erfolge feststellen.
Egal in welcher Form Sie eine Hilfestellung geben wollen, bieten Sie diese an, aber akzeptieren Sie auch eine Ablehnung. Fragen Sie nach, in welchem Ausmaß und auf welche Weise Hilfe benötigt und gewünscht wird.
Die betroffene Person kennt sich selbst und ihre Situation am besten und weiß, wann und in welcher Form sie Hilfe benötigt.
Eine besonders heikle Frage stellt dabei oft der Umgang mit Körperkontakt dar. Grundsätzlich gilt, dass niemand ohne Einwilligung berührt werden darf.
Ein kurzes "Darf ich?" kann hier helfen. Viele Menschen - egal ob sie nun behindert oder nichtbehindert sind - empfinden es als Grenzüberschreitung, ungefragt berührt zu werden. Bei manchen Behinderungsformen wie zum Beispiel der Osteogenesis imperfecta (auch bekannt als Glasknochenkrankheit) können solche Berührungen sogar gefährlich sein.
Behinderte Schülerinnen und Schüler sind manchmal auf besondere Hilfestellungen angewiesen. Für Lehrerinnen und Lehrer ist es dabei wichtig zu wissen, welche Funktion diese Assistenz übernimmt und ob es eine Auswirkung auf den Schulbesuch hat. Hier sollen beispielhaft Formen der Assistenz vorgestellt werden.
Berufsausbildungsassistenz:
Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) ist eine Person, die Lehrlingen der Integrativen Berufsausbildung beratend und unterstützend zur Seite steht. Sie übernimmt im Besonderen die Rolle einer Kommunikationsschnittstelle zu allen beteiligten Personen und Institutionen. Dabei wird auf eine kontinuierliche Prozessbegleitung während der gesamten Lehrausbildung geachtet. Diese Leistung wird über das Bundessozialamt oder das AMS finanziert.
Persönliche Assistenz:
Die persönliche Assistenz ist eine Form der persönlichen Hilfe, die behinderte Menschen in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. Das reicht im schulischen Bereich über Unterstützung bei der Mobilität, der Ausführung von körperlichen Tätigkeiten bis hin zu einer Kommunikationsunterstützung. Diese Leistung wird durch verschiedene Gelder (z.B. Pflegegeld) finanziert, die Auftraggeberin oder der Auftraggeber ist die betroffene Person selbst.
Stützlehrer oder Stützlehrerinnen:
Stützlehrer oder Stützlehrerinnen unterstützen die Schüler oder Schülerinnen bei ihren schulischen Tätigkeiten und arbeiten mit den Fachlehrkräften zusammen. Am erfolgreichsten ist dieses System, wenn sie als Team kooperieren und gemeinsam die Unterrichtsplanung vornehmen. Die Ressourcen der Stützlehrer und Stützlehrerinnen werden an den Schulen verwaltet.
Gebärdensprachdolmetscherinnen oder Gebärdensprachdolmetscher bzw. Kommunikationsassistenz:
Um sicherzustellen, dass Ihre gehörlosen Schüler und Schülerinnen gleichwertig alle Informationen erhalten, ist es unerlässlich Gebärdensprachdolmetscher oder Gebärdensprachdolmetscherinnen einzusetzen. Denn auch wenn gehörlose Menschen im Lippenlesen geübt sind, kann nur ein Bruchteil der Information aufgenommen werden. Es ist auch sehr anstrengend für die Person, die von den Lippen abliest und führt zu schnellen Ermüdungserscheinungen. In manchen Fällen wird anstelle einer Dolmetscherin bzw. eines Dolmetschers auch eine Kommunikationsassistenz eingesetzt. Sie übersetzt nicht genau, was gesprochen wird, sondern fasst zusammen, filtert die Informationen und unterstützt auch bei Verständnisfragen.
Tipp: Weiterführende Informationen zur Kommunikation zwischen hörenden Lehrenden mit gehörlosen Lernenden finden Sie unter: http://www.univie.ac.at/diversity/php/info_gl_lehrende.html
Lernassistenz/Bildungsassistenz:
Sie unterstützt Personen im Lernprozess und in der Teilhabe am schulischen Geschehen. Menschen mit Lernschwierigkeiten nehmen die Lernassistenz beispielsweise in Anspruch, um Inhalte zu wiederholen oder in ihrem Tempo lernen zu können. Die Assistenzleistung kann sowohl während der Unterrichtszeit, als auch in der Freizeit stattfinden.
Begleithunde:
Sie unterstützen ihre Besitzer oder Besitzerinnen bei alltäglichen Verrichtungen und haben überall Zutritt. Sie sind in ihrer Funktion als Assistenz anwesend, nicht als Haustier. So sollten sie auch behandelt werden. Der Hund darf nicht abgelenkt werden, sonst kann er die begleitete Person in Gefahrensituationen bringen. Sprechen Sie deshalb immer zuerst mit der Besitzerin oder dem Besitzer ab, ob und wie Sie Kontakt mit dem Tier aufnehmen dürfen.
Generell gilt: unabhängig von der Art der Assistenz, Ihre Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner sind immer die Schülerinnen und Schüler, nicht die Assistenz. Sie ist nur als Unterstützung sowie Begleitung für die Person dabei.
Einige behinderte Schüler und Schülerinnen werden mit technischen Hilfsmitteln arbeiten. Das können beispielsweise besondere Tastaturen, Computerprogramme oder spezielle Ausgabegeräte sein. Gewisse Geräte sollten aber auch fix an der Schule zur Verfügung stehen.
Ein Scanner ist ein wichtiges Hilfsmittel, um Texte in den Computer eingeben zu können. Damit können gedruckte Texte digital verarbeitet und unter anderem für sehbehinderte und blinde Schülerinnen und Schüler durch eine Vergrößerungssoftware, Sprachausgabe oder mit einer Braillezeile (einem Gerät, das Text in der Brailleschrift darstellt) nutzbar gemacht werden.
Einen umfassenden Überblick über das Angebot an Hilfsmitteln bietet eine Datenbank des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz:
Bei der Aufbereitung von Informationen gibt es verschiedene Formen wie Barrieren entstehen können. So werden Informationen, die nur in einem Format zur Verfügung stehen zur Barriere. Gedruckte Texte sind zum Beispiel für sehbehinderte oder blinde Menschen nicht oder nur schwer lesbar. Informationen, die nur gesprochen bekannt gegeben werden, sind für gehörlose oder schwerhörige Personen schwer zugänglich.
Es gibt bereits zahlreiche Anleitungen, wie Informationen aufbereitet werden müssen, damit sie barrierefrei sind. Eine einfache, aber sehr effiziente Möglichkeit ist es, die Informationen in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Durch computerunterstützte Hilfsprogramme können sie zum Beispiel über eine Vergrößerungssoftware, Sprachausgabe oder Braillezeile ausgegeben werden. Für Menschen mit motorischen Einschränkungen ist es ebenfalls oft einfacher, Informationen auf dem Bildschirm, als aus einem Buch oder einem Informationsblatt zu lesen.
Wichtig ist es dabei, sich an bestehende Standards der Barrierefreiheit zu halten, damit die Informationen von den Hilfsprogrammen verarbeitet werden können. Besonders bei der Veröffentlichung von Informationen auf der Website und bei eLearning Plattformen ist auf die Barrierefreiheit zu achten. Wenn von vornherein an diese Standards gedacht wird, dann bedeuten sie meist keinen Mehraufwand. Nähere Informationen zu den Richtlinien finden Sie unter:
http://www.w3c.de/Trans/WAI/webinhalt.html , http://www.barrierefrei-kommunizieren.de oder http://www.anderssehen.at
Ein Tipp: Für Druckversionen sollten Schriften mit einer Schriftgröße von mindestens 14 Punkt, für digitale Dokumente mindestens eine 12-Punkt-Schrift verwendet werden.
Eine weitere Barriere sind Informationen, die nicht für alle Personen verständlich sind. Verständnisschwierigkeiten können bei Menschen auftreten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, bei Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau oder auch bei Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Beispielhafte Kriterien für eine einfache Sprache sind[1]
-
einfacher Satzbau
-
keine ungewöhnlichen Wörter oder Fremdwörter
-
keine abstrakten Begriffe
-
ein Gedanke pro Satz
-
aktive Verben
-
Konjunktiv-Formulierungen vermeiden
-
kurze Absätze
Hier ein Beispiel, wie ein Text vereinfacht werden kann: Ausgangstext: "Die Personalwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten, die dazu dienen, die Planung, die Beschaffung und den zielgerichteten und effizienten Einsatz der Mitarbeiter eines Unternehmens sicherzustellen."
Text in einfacher Sprache: "Als Personalwirtschaft versteht man die Tätigkeiten in einer Firma, die mit dem Personal zu tun haben. Zuerst überlegt die Firma, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sie braucht. Dann müssen diese Menschen gesucht und angestellt werden. Wenn sie in der Firma arbeiten, wird geplant, wann sie wo arbeiten und welche Arbeit sie machen. Alles das ist Personalwirtschaft."
Zusätzliche Bilder und Visualisierungen erleichtern ebenfalls die Lektüre von Texten. Der vermehrte Einsatz von Bildern und Tabellen stellt allerdings für blinde und sehbehinderte Personen ein Problem dar. Dieses kann aber durch eine zusätzliche verbale Beschreibung relativ leicht behoben werden.
Zusammengefasst soll Information:
-
in einfacher Sprache verfasst werden
-
visuell durch Bilder oder Grafiken ergänzt werden, die die Inhalte untermauern, aber keine zusätzliche Information enthalten, die für blinde oder sehbehinderte Personen Relevanz hat
-
in digitaler Form verfügbar sein, damit sie in alternativen Formaten ausgegben werden können
Über die Sprache zeigt sich die innere Haltung einer Person, auch wenn dies oft unbewusst geschieht. Eine nicht-diskriminierende Sprache vermittelt dem Gegenüber Respekt und Wertschätzung. Achten Sie deshalb darauf, welche Wörter und Sprachbilder Sie verwenden.
Es wird bei Mädchen vermutlich Widerstand erzeugen, wenn Sie eine Schülerin als Vertreterin des "schwachen Geschlechts" bezeichnen. Ebenso wird durch diskriminierende Aussagen gegenüber Menschen aus anderen Kulturen keine Atmosphäre des Respekts geschaffen.
Gleiches gilt auch für Sprachbilder, die in Verbindung mit behinderten Menschen verwendet werden. Menschen im Rollstuhl empfinden sich nicht als daran "gefesselt", im Gegenteil, der Rollstuhl ist ein Mittel zur Mobilität. Begriffe wie "taub" oder "Invalide" sind veraltet und sollten daher nicht mehr verwendet werden. Vielmehr spricht man von "gehörlos" und "Menschen mit Behinderung" oder "behinderten Menschen".
Ebenso fordern Selbstvertretungsorganisationen, dass an Stelle von "geistig Behinderte" "Menschen mit Lernschwierigkeiten" als Begriff benützt wird. Eine Kurzinformation zum Sprachgebrauch zum Thema Behinderung gibt es im Folder "An den Rollstuhl gefesselt?" der Wirtschaftskammer Österreich. Online abrufbar unter:
http://wko.at/sp/arbeitundbehinderung/Folder_Rollstuhl_gefesselt.pdf
Das "Buch der Begriffe" zeigt in anschaulichen Beispielen, welche Bilder durch Sprache erzeugt werden können und zeigt den Hintergrund auf, wieso manche Begriffe verwendet bzw. nicht verwendet werden sollen. Im Internet kann das "Buch der Begriffe" bezogen werden:
https://broschuerenservice.bmsg.gv.at/PubAttachments/buch_der_begriffe.pdf
Weiters gilt auch eine Sprache als diskriminierend, die nicht für alle Beteiligten verständlich ist (siehe Tipps und Tricks für leichte Sprache der Selbstvertretungsorganisation People First http://www.people1.de/was_halt.html ).
Dafür gibt es einfache Grundregeln, die den auf S. 40 angeführten ähnlich sind:
-
einfache, kurze Sätze
-
Fremdwörter vermeiden
-
Rücksicht nehmen, ob die Information für alle klar verständlich ist
-
Bilder helfen den Text zu verstehen
-
Zeitdruck vermeiden. Er löst Stress und Frustration aus und wird dadurch zur Barriere.
Mit digitalen Kameras lassen sich sehr einfach Fotos machen, die in digitale Dokumente eingebaut werden können. So wird die Beschreibung eines Gerätes durch Fotos der Maschine und der einzelnen Teile anschaulicher und für Jugendliche mit nicht-deutscher Muttersprache oder Lernschwierigkeiten leichterverständlich.
Es können auch die einzelnen Arbeitsschritte der Bedienung dieses Gerätes als Dokumentation fotografiert werden. Dadurch wird der Wiedererkennungseffekt des Vorgangs unterstützt.
Projektidee: Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler selbst diese Dokumentegestalten! Der Lerneffekt wird nachhaltiger und Sie erhalten dadurch rasch eine große Sammlung an Fotos, die Sie immer wieder einsetzen können.
Simon Prucker macht eine Integrative Berufsausbildung (Teilqualifikation) zum Bürokaufmann. Er arbeitet im Verein TAFIE und besucht die 2. Klasse der Tiroler Fachberufsschule für Büroberufe in Innsbruck. Im Rahmen seiner Lehre arbeitet er sowohl in der Organisation und Administration des Seminarprogramms mit, macht viel Öffentlichkeitsarbeit und kümmert sich auch um Verwaltungsaufgaben. Außerdem ist er Sekretär der Selbstvertretungsgruppe "die GleichberechtigungsrebellInnen".

Kontakt:
Simon Prucker, Verein TAFIE Innsbruck Land
Egger Lienz Straße 2,
6112 Wattens Tel: 05224/ 55638
E-Mail: simon.prucker@tafie-il.at
http://www.selbstvertretung.at
Können Sie uns kurz erzählen, wie es Ihnen zurzeit in der Berufsschule geht?
Ich bin jetzt in der zweiten Klasse und gehe jede Woche für einen Tag in die Schule. Die erste Klasse habe ich gut abgeschlossen, nur in Buchführung und kaufmännisch Rechnen habe ich einen anderen Stoff. In allen anderen Fächern habe ich die normalen Inhalte.
Wenn Sie sich zurückerinnern, wie war vor einem Jahr der Beginn der Berufsschule für Sie?
Die Kommunikation in der Schule, mit den Lehrern und Lehrerinnen war sehr gut. Sie haben sich schnell auf mich eingestellt und darauf, was für mich schwerer ist. Dabei haben sie mir bei sämtlichen Sachen im Unterricht geholfen. Das hat von Anfang an gut funktioniert. Mit den Schülern und Schülerinnen habe ich am Anfang nicht viel Kontakt gehabt, aber es hat grundsätzlich keine Probleme mit ihnen gegeben.
Welche Unterstützung der Lehrer und Lehrerinnen hilf Ihnen?
Ich definiere unter anderem unter Unterstützung, dass man einfach immer wieder nachfragt. Ich bin immer wieder gefragt worden: "Verstehst du den Stoff oder ist es ein bisschen zu schnell gegangen? Kannst du das auf der Tafel lesen? Kann ich dir sonst irgendwie helfen?"
Oder ein konkretes Beispiel in kaufmännisch Rechnen: Ich bekomme da zusätzliche Unterlagen, wo Rechenaufgaben noch einmal genauer erklärt und veranschaulicht sind. Die anderen Schüler und Schülerinnen, die eine gewöhnliche Lehre machen, bekommen das nicht. Das sind spezielle Unterlagen für die integrativen Schüler in der Klasse. Das macht es für mich einfacher und hilft mir sehr. Das habe ich aber nur in kaufmännisch Rechnen in Rechnungswesen. In den anderen Fächern komme ich soweit zurecht, nur in Buchführung und kaufmännisch Rechnen brauche ich mehr Unterstützung. In Buchführung haben wir auch eine Stützlehrerin, die mich und eine Kollegin unterstützt. Mit ihr gehen wir den Stoff durch, der ist ein bisschen leichter, als der reguläre Stoff der 2. Klasse.
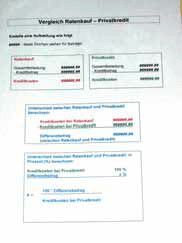
Lernmaterial
Hat sich für Sie die Situation in der Schule seit dem Anfang verändert?
Ich habe jetzt mehr Kontakt mit den Mitschülern und Mitschülerinnen. Da bekomme ich auch immer wieder Hilfe und wir verstehen uns gut. Mit den Lehrerinnen und Lehrern läuft es gleich gut wie am Anfang. Ich bin froh, dass da in der Unterstützung nicht nachgelassen worden ist, sondern dass es bis heute gleich durchgezogen wird. Wir bekommen eine gleich gute Unterstützung, man hilft uns immer. Das finde ich sehr gut.
Haben Sie Angst gehabt, dass Sie am Anfang viel Unterstützung bekommen und dann weniger?
Ja, das wäre möglich gewesen, das habe ich mir gedacht. Es ist ja schon eine andere Art von Unterricht. Und das ist vielleicht für die Lehrerinnen und Lehrer aufwendiger, wenn man auf bestimmte Schüler oder Schülerinnen mehr eingehen muss.
Es wäre vielleicht bequemer, dass man wenig auf die integrativen Schülerinnen und Schüler eingeht, dass wir keine zusätzlichen Unterlagen bekommen. Oder man erklärt zwar die Sachen, aber fragt nicht nach, ob wir es verstanden haben. Es kann schon sein, dass es ihnen egal ist wie es den Schülerinnen oder den Schülern geht. Dass man einfach nur den Stoff durchbringt. Aber in meiner Schule ist das nicht so, und darüber bin ich sehr froh.
Und die Unterstützung funktioniert in allen Fächern?
Ja, in allen Fächern gehen sie auf mich ein. Ich habe nur in Buchführung eine Stützlehrerin, in allen anderen Fächern werde ich gemeinsam mit der restlichen Klasse von der gleichen Lehrerin oder dem gleichen Lehrer unterrichtet. Und auch sie nehmen mich ernst und fragen nach, was ich brauche.
War das für alle Lehrer und Lehrerinnen ganz selbstverständlich, Sie als Experten für Ihre eigene Unterstützung zu akzeptieren?
Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie von Anfang an gewusst haben, dass heuer Schüler und Schülerinnen mit einer Teilqualifikation kommen. Und dass diese mehr Unterstützung brauchen. Ich glaube, sie haben sich darauf vorbereitet. Das habe ich irgendwie gleich gespürt.
War das gut, das gleich zu spüren?
Das war sehr angenehm, weil es keine Missverständnisse gegeben hat, so wie ich das aus den Schulen kenne, in denen ich vorher war. Die Lehrerinnen und Lehrer haben sich gleich darauf eingestellt: "Ja, da und dort braucht der Schüler etwas und darum werden wir uns kümmern." Das war früher nicht immer so.
Welche Erfahrungen haben Sie früher gemacht?
Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie nicht erkannt haben, dass für mich manche Sachen schwerer sind. In einigen Sachen war ich sehr gut. Und da haben sie sich gedacht: "Der "Bursch" kann doch alles, was die anderen Schüler können." Aber da hat es Missverständnisse gegeben: "Was hat er jetzt genau, wo braucht er die Unterstützung, der ist eh so gut." Meinen Nachteil, den hat man dann oft verkannt.
Wie haben Sie das dann in der Berufsschule geklärt?
Es hat am Anfang ein Gespräch in der Schule gegeben und dann hat es sich mit der Zeit herausgestellt, wo ich Unterstützung brauche. Meine Lehrerinnen, meine Lehrer und ich haben schnell bemerkt, dass ich z.B. in kaufmännisch Rechnen Unterstützung brauche.
Das ist nicht von Anfang an festgestanden?
Es hat eine Eingangszeit gegeben, ungefähr 3-4 Wochen, also ein paar Berufsschultage lang. Da haben wir immer wieder zeigen können, wo wir Unterstützung brauchen und wo nicht. Dann ist festgelegt worden, wo wir zusätzliche Unterstützung und einen anderen Lehrplan bekommen. Wir haben eine Stützlehrerin in Buchführung bekommen, meine Mitschülerin und ich. Und das war gut. Ich habe immer das Gefühl es war und ist in meinem Interesse, was da passiert.
Gibt es eine Form von Hilfe, die Sie nicht wollen?
Ja, wenn meine Kollegen und Kolleginnen bzw. die Lehrer und Lehrerinnen anfangen mich anders zu behandeln. Ich will, dass sie mich weiterhin behandeln wie bis jetzt und nicht anders. Nur weil ich in manchen Dingen mehr Unterstützung brauche, weil ich Lernschwierigkeiten habe, will ich als Mensch ganz normal behandelt werden. Ich will, dass sie denken: "Der Simon gehört auch zur Klassengemeinschaft, der tut sich halt ein bisschen schwerer in manchen Sachen, aber wir behandeln ihn als Mensch deshalb nicht anders als die anderen Schüler oder Schülerinnen."
Wo würdest du dir noch mehr Unterstützung wünschen?
Ich bin rundum zufrieden mit dem was ich bekomme. Ich brauche nicht mehr. Es ist meiner Person angemessen. Das passt wirklich, das geht gut. Ich gehe wirklich gerne in die Schule. Ich bin auch in allen Fächern, bis auf kaufmännisch Rechnen und Buchführung, am gleichen Niveau vom Lehrstoff her, wie die nichtintegrativen Schüler und Schülerinnen. Da bin ich stolz. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch das dritte Berufsschuljahr machen.
Haben Sie noch einen Tipp für die Berufsschulen?
Ja, unbedingt. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin offensichtlich sieht, heuer habe ich Schüler oder Schülerinnen, die sich schwerer tun, dann sollen sie nicht wegschauen und das ignorieren. Viele glauben, das wird schon irgendwie gehen. Aber sie müssen handeln und ihnen die Unterstützung geben, die ihnen zusteht. Mein Tipp: "Redet mit dem Schüler oder der Schülerin, redet mit den Leuten, sprecht die Situation an und ignoriert es nicht." Weil irgendwann kommt der Augenblick, da kann man es nicht mehr ignorieren und dann ist Feuer am Dach. Alle sind dann aufgebracht, die Lehrer und Lehrerinnen, die betroffene Schüler oder Schülerinnen und die Eltern. Und keiner kennt sich mehr aus. Und man steht vor einem Haufen Probleme, weil nichts angesprochen worden ist. Alle haben einen irrsinnigen Druck. Dem Schüler geht's nicht gut. Er geht zwar in die Schule, aber er kriegt fast nichts mit. Die Eltern haben vielleicht nichts mitbekommen. Die Lehrer und Lehrerinnen wissen nicht weiter und sind verärgert, weil sie glauben der Schüler will nicht lernen. Und auf einmal gibt es ein großes Missverständnis, niemand weiß was los ist, weil nicht geredet und gehandelt worden ist.
[1] Diese Regeln beziehen sich auf das Dokument "Sag es einfach": http://www.inclusion-europe.org/documents/SAD66EETRDE.pdf
Inhaltsverzeichnis
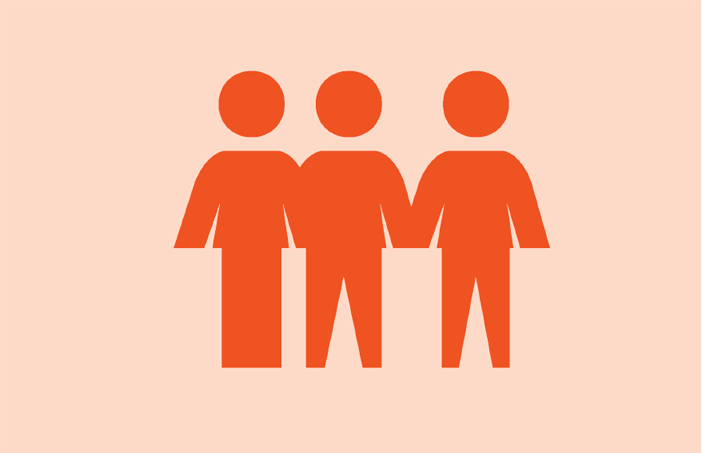
Ein Eckpfeiler für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und für eine gelungene Integration ist die Unterrichtspraxis. Dabei müssen Rahmenbedingungen und Lehrvoraussetzungen geschaffen werden, die alle Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, das für sie höchstmögliche Bildungsniveau zu erreichen. So können sie eine erfolgreiche berufliche Qualifizierung erhalten.
Eine Barriere auf diesem Weg ist ein Unterricht, der im Lernen der Jugendlichen von einer Norm ausgeht. Dabei werden gleiche Lernbedingungen für alle Jugendlichen geschaffen, im Rahmen derer es nicht möglich ist flexibel zu bleiben und die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen miteinzubeziehen. Hier handelt es sich nicht nur um eine Barriere für behinderte Jugendliche, sondern für alle, die aus dieser vermeintlichen Norm fallen. Je unterschiedlicher die Schülerinnen und Schüler sind, desto schwieriger wird es, dieses "Mittelmaß" zu beschreiben, da es offensichtlich wird, dass es keine Norm gibt; weder im Lerntempo, noch bei den Lernvoraussetzungen oder dem Vorwissen und auch nicht in den Lernstrategien der Jugendlichen.
Gerade in Berufsschulklassen war die Zusammensetzung schon immer sehr heterogen. Beispielsweise sind die Lehrlinge in folgenden Punkten oft sehr unterschiedlich:
-
Bildungsabschlüsse und Bildungszugänge: Manche Jugendliche haben keinen positiven Hauptschulabschluss, wenn sie in die Berufsschule kommen. Einige haben die Jahre davor als Hilfskräfte gearbeitet und sind schulisches Lernen nicht mehr gewöhnt. Andere wiederum haben eine AHS oder BHS abgebrochen oder haben sogar die Matura absolviert.
-
Arbeitsalltag und Arbeitsrealität: Abhängig davon in welchem Betrieb Lehrlinge ausgebildet werden, wird das Vorwissen und der Zugang zu den Lerninhalten sehr unterschiedlich sein - je nachdem wie intensiv sie im Betrieb betreut werden, oder welchen fachlichen Schwerpunkt die Firma hat.
-
Sozialer Hintergrund: Der Lebensalltag und die soziale Situation wirken sich auf die Schüler und Schülerinnen ganz unterschiedlich aus.
-
u.v.m.
Ein neuer Punkt wurde durch die Einführung der Integrativen Berufsausbildung geschaffen:
-
Lehrplan: Die Jugendlichen in einer Klasse unterscheiden sich nun auch darin, ob sie den allgemeinen Lehrplan erfüllen müssen und wie viel Zeit ihnen dafür zur Verfügung steht. Zudem ist es nun möglich, dass Lehrlinge einen individuellen Lehrplan im Zuge einer Teilleistungsqualifizierungslehre erhalten[2]
All diese Punkte haben einen großen Einfluss auf die Lernzugänge der einzelnen Lehrlinge. Ob er oder sie eine Behinderung hat, ist dabei also nur ein Unterscheidungsmerkmal von vielen.
Für den Abbau der Barriere ist deshalb ein Unterricht notwendig, der die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen ins Zentrum stellt und an ihre Lebensrealitäten anknüpft.
Die Berufsschule kann an zwei Seiten ansetzen, die sie bei einem individualisierten Unterricht unterstützen
-
Sie kann auf ihre Erfahrung im Unterricht mit heterogenen Klassen aufbauen.
-
Durch ihre Nähe zur Arbeitsrealität in den Lehrbetrieben besteht ein Potenzial, sich auf praktische Alltagserfahrungen der Jugendlichen zu beziehen, das in anderen Schulformen weniger gegeben ist.
In diesem Punkt kann der Berufsschulunterricht gut mit der beruflichen Erwachsenenbildung verglichen werden, die immer mehr die einzelne lernende Person mit ihrem konkreten Arbeitsumfeld und Arbeitsalltag ins Zentrum der Bildungsmaßnahme rückt (vgl. Arnold/Schüßler 2003).
Drei Aspekte von Bildungsmaßnahmen, die sich an den lernenden Personen orientieren, sollen hier besonders hervorgehoben werden:
-
Stärkenorientiert arbeiten: Es wird auf die Stärken und Kompetenzen der einzelnen Personen aufgebaut sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden.
-
Die Vielfalt der Gruppe nutzen: Die Lernenden lernen in und von der Gruppe.
-
Selbständigkeit der Lernenden fördern: Durch selbstgesteuerte Lernphasen wird die Selbständigkeit der Lernenden gefördert. Die Lernenden entwickeln dafür gemeinsam mit den Lehrpersonen Lernziele und Lernstrategien.
In Lernarrangements, die auf diesen Kriterien aufbauen, ist es auch für behinderte Jugendliche einfacher, sich ebenfalls mit ihren Stärken einzubringen.
Eine schwerwiegende Barriere ist eine Isolation von einzelnen Jugendlichen im Klassenverband. Ein Unterricht, in dem jede Person ihre Stärken einbringen kann und Schwächen nicht verstecken muss, braucht ein vertrauensvolles Umfeld[3]. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer auf die Gruppendynamik achten und sie beobachten (vgl. Ott 2000, 49 ff; Gieskemeyer/Straif 2006, 44 ff).
Hilfreich ist es dabei, allgemein kompetenz- und ressourcenorientiert zu arbeiten. Dies fördert eine generelle Wertschätzung und verringert die Gefahr eines respektlosen Umgangs miteinander.
Der Unterricht muss deshalb Aktivitäten und Projekte ermöglichen, in denen alle ihre Stärken einbringen können und auf einander angewiesen sind. Das bietet Schülern oder Schülerinnen die Chance mit ihren individuellen Potenzialen und Erfahrungen wahrgenommen zu werden. Dadurch werden sie nicht mehr ausschließlich über ihre Defizite definiert. Ausschlüsse aus dem Klassenverband sind zu vermeiden, da die Jugendlichen sonst leicht in eine Außenposition geraten.
Besonders eignen sich auch Exkursionen und gemeinsame außerschulische Aktivitäten im Internat als gruppenstärkende Maßnahmen. Hier muss darauf geachtet werden, dass tatsächlich alle Jugendlichen uneingeschränkt daran teilnehmen können.
Die Einstiegsphase der Berufsschulzeit ist dabei eine entscheidende Phase. Hier formiert sich die Gruppe, die Jugendlichen lernen sich und die Berufsschule kennen und müssen sich orientieren.
Deshalb ist es hilfreich und notwendig, in den ersten Tagen Möglichkeiten zu schaffen, in denen die Jugendlichen Beziehungen zueinander aufbauen. Diese Phase bietet auch den Lehrerinnen und Lehrern die Chance, ihre Schülerinnen und Schüler besser kennen zu lernen. Sie erhalten dadurch wichtige Informationen, die in der Planung des Unterrichts sehr hilfreich sein können.
Eine Voraussetzung für einen individualisierten Unterricht ist es, festzustellen, an welchem Ausgangspunkt eine Schülerin oder ein Schüler sich befindet. Es abzuklären, welche Kompetenzen er oder sie bereits mitbringt und wie diese noch weiter ausgebaut werden können.
Ebenso muss hier festgehalten werden, wo der Bedarf besteht, an Schwächen zu arbeiten. Diese Informationen erhalten die Lehrer und Lehrerinnen durch Gespräche mit den Schülern und Schülerinnen sowie durch eine genaue Beobachtung.
In der Berufsschule steht für diese Beobachtung wenig Zeit zur Verfügung. Die Lehrgänge dauern nur wenige Wochen, bzw. die Jugendlichen sind nur an einem Tag in der Woche in der Schule. Umso wichtiger ist deshalb die Kommunikation mit allen beteiligten Personen - wie zum Beispiel mit den Jugendlichen selbst, mit dem ausbildenden Betrieb, mit der Assistenzen und den Eltern - um einen regelmäßigen Informationsaustausch zu sichern (vgl. KMU Forschung 2006, 67 f).
Im nächsten Schritt werden die individuellen Lernziele definiert. Dafür werden grobe, nach dem Lehrplan festgelegte Lernziele in kleinere, klar beschreibbare unterteilt.
Diese Ziele sollten für die Jugendlichen transparent gemacht werden. Danach wird festgelegt, in welcher Form diese Lernziele erreicht werden können und auf welche vorhandenen Kompetenzen dabei aufgebaut wird.
Für Teilqualifizierungslehren ist dieser Schritt der Individualisierung der Lernziele durch die Lehrform vorgegeben. Jedoch profitieren alle Schüler und Schülerinnen davon wenn sie an individualisierten Zielen arbeiten können.
Eine Möglichkeit dies in der Praxis umzusetzen ist, Wahlmöglichkeiten für Lernziele zu bieten. Durch die Entscheidung, welche Lernziele sie verfolgen möchten, müssen die Jugendlichen automatisch Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen und ihre Selbständigkeit wird dadurch gefördert.
In manchen Berufsschulen wird diese Wahlmöglichkeit insofern geschaffen, dass die Jugendlichen selbst - mit Unterstützung der Lehrpersonen - entscheiden können, ob sie bei Lerninhalten nur den Basisstoff erarbeiten, oder sich vertiefend damit beschäftigen.
Beispielsweise können im Rechnungswesenunterricht beim Thema Umsatzsteuer die Lernziele für manche Jugendliche darin liegen, Prozentrechnungen am Beispiel von einer netto auf brutto Umsatzsteuer-Berechnung zu lösen und diese Kompetenz zu festigen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Stärkung der Rechenkompetenz.
Andere Schülerinnen oder Schüler haben hingegen das zusätzliche Lernziel den wirtschaftlichen Aspekt des Umsatzsteuersystems zu verstehen. Hier ist das Ziel, dass sie nicht nur Berechnungen durchführen können, sondern auch die Aufgabenverteilung und Zahlschuld von Einzelhandel - Großhandel - Konsumenten und Konsumentinnen - Finanzamt erklären können.
Dipl.-Päd. Martina Jeindl unterrichtet an der Berufsschule Graz 9 (Handel, Schönheitsberufe und Chemietechnik). Sie lehrt die wirtschaftlichen Fächer (Fachgruppe 1) und im Bereich Handel auch Fachkunde (Fachgruppe 2). Frau Jeindl steht anderen steirischen Berufsschulen als Beraterin für Fragen zur Integrativen Berufsausbildung zur Verfügung.

Kontakt:
Martina Jeindl, Berufsschule Graz 9
Hans-Brandstetter-Gasse 12, 8020 Graz
Telefon: 0316/47 16 53
E-Mail: martina.jeindl@lbs-graz9.ac.at
Web: http://www.lbs-graz9.ac.at/
Was waren Ihre ersten Erfahrungen mit der Erstellung von individuellen Lernzielen?
Vor einigen Jahren habe ich in einem Versuchsprojekt in Feldbach mitgemacht. Wir hatten drei Schüler mit Down-Syndrom in der Klasse. Die Lernvoraussetzungen der Schüler waren so unterschiedlich - manche konnten nicht im Zahlenraum zehn rechnen - und da konnten wir nicht anders, als individuelle Lernziele zu erstellen.
Warum arbeiten Sie jetzt mit individuellen Lernzielen in der Berufsschule?
Die Individualisierung ergibt sich vor allem durch die Einführung der Integrativen Berufsausbildung. Bei uns in der Steiermark sind wir verpflichtet, bei jedem Schüler mit einer Teilqualifizierungslehre eine individuelle Lehrstoffverteilung zu erstellen. Diese Individualisierung wird von unserem Landesschulinspektor gefordert.
Können Sie uns den Prozess beschreiben wie Sie die Lernziele festlegen?
Bevor die Schüler kommen, nehme ich mit der Berufsausbildungsassistenz (BAS) Kontakt auf. Meine Schüler werden z.B. von der Lebenshilfe sehr intensiv betreut und wir erhalten hier viel Vorinformation. Im Vergleich zu der Standardlehrstoffverteilung, die wir ja für die reguläre Lehre haben, entwickle ich dann die individuellen Lernziele. Ich glaube, das Vorgespräch mit den Betreuern und der BAS ist wesentlich, denn meiner Erfahrung nach wissen sie bereits sehr viel über den Schüler. Und mit diesem Wissen kann ich mich besser auf die Schüler vorbereiten.
Wie sehen die nächsten Schritte aus, wenn der Lehrgang beginnt?
Wir starten mit einem Vorschlag einer Lehrstoffverteilung. Die erste Zeit nützen wir zur Beobachtung des Schülers und adaptieren die Lernziele. Die Lehrstoffverteilung entwickeln wir in einem Teamprozess. Wir besprechen und beraten uns in kollegialen Gesprächen, aber bei Bedarf können da auch spontane Konferenzen gemacht werden. Spätestens nach zehn Unterrichtstagen sollte die individuelle Lehrstoffverteilung für den Lehrgang fertig sein. Dabei ist wichtig, dass die Lernziele laufend evaluiert werden. Manchmal gibt es im Laufe des Lehrgangs noch große Änderungen. Je nachdem wie gerade die Lebenssituation des Schülers ist, wie es ihm psychisch geht und wie viel er im Moment leisten kann.
Woran erkennen Sie ob die Lernziele noch stimmig sind oder wann sie verändert werden müssen?
Ich merke das in der Arbeit mit den Schülern. Zum Beispiel hatte ich einen Schüler mit großen Gedächtnisschwierigkeiten, das war auch medizinisch diagnostiziert. Er hatte das Lernziel, den Verlauf eines Kaufvertrages anhand eines Beispiels mit Moderationskarten, auf denen die einzelnen Bestandteile notiert waren, in eine korrekte Ordnung zu bringen. Das ging auch recht schnell. Doch auf einmal war alles wieder weg, er konnte sich an nichts mehr erinnern. Das war für uns ein Zeichen, dass wir das Lernziel adaptieren müssen. Die sieben Teile wurden auf fünf reduziert. Und das hat er dann auch wirklich gekonnt.
Aber das heißt nicht, dass wir automatisch immer das Lernziel heruntersetzen. Zuerst schauen wir, warum er das Lernziel nicht erreichen kann. Wenn es z.B. psychische Probleme sind, dann versuchen wir dabei zu helfen. Wenn er eine andere Lernform braucht, dann schauen wir was wir hier machen können. Nur wenn wir merken, dass Lernziel war wirklich zu hoch gesetzt, wird es reduziert.
Wie setzen Sie Prioritäten bei den Lernzielen?
Bei teilqualifizierten Schülern sollen vor allem die Tätigkeiten, die der Lehrling auf seinem Arbeitsplatz macht, unterstützt werden. Ich konzentriere mich also darauf, was er an der Arbeitsstelle machen muss und ergänze das mit den theoretischen Inhalten. Die Inhalte sollen für den Schüler von Bedeutung sein und ich versuche natürlich auch auf seinen Fähigkeiten aufzubauen und diese zu stärken.
Wie werden die Informationen über erreichte Lernziele weitergegeben?
Am Ende des Lehrgangs halten wir die erreichten Lernziele schriftlich fest. Diese werden dem Stammblatt des Schülers beigelegt. Hier notieren wir auch, welche Form der Unterstützung hilfreich war, z.B. ob es hilft wenn die Unterlagen für den Schüler durch Bilder ergänzt werden. Darauf können die Lehrer aus dem nächsten Lehrgang zurückgreifen.
So haben wir innerhalb der Schule einen guten Kommunikationsablauf geschaffen. Aber das ist normalerweise auch nicht das Problem. Denn viele Lehrer kennen die Schüler schon, bzw. sie reden mit den Kollegen. In den Konferenzen besprechen wir natürlich auch die Erfahrungen und geben Empfehlungen für den nächsten Lehrgang ab.
Wie gestalten Sie den Unterricht mit differenzierten Lernzielen?
Wir versuchen, dass alle Jugendlichen an ähnlichen Dingen arbeiten, aber mit unterschiedlichen Aufgaben. Zum Beispiel setzt ein Schüler Puzzleteile eines Geschäftsbriefs zusammen während dieanderen Geschäftsbriefe schreiben. Manchmal kann es natürlich schon sein, dass die Schüler mit einem individuellen Lehrplan an einem anderen Thema arbeiten, z.B. wenn sie für ein Lernziel noch eine längere Übungsphase brauchen. Dann arbeiten sie noch an diesem Thema und die anderen sind schon wo anders. Aber da richten wir uns danach, was die Schüler brauchen.
Wie erfahren die Schüler bzw. Schülerinnen an welchen Lernzielen sie arbeiten bzw. welche Lernziele für sie festgelegt wurden?
Das wird recht unterschiedlich gemacht. Prinzipiell wird bei uns fürdie ganze Klasse das Lernziel bekannt gegeben: Es gibt am Anfang des Lehrgangs einen Überblick über den gesamten Stoff und danach zeigen wir sie von Thema zu Thema noch einmal auf.Zum Teil haben wir auch Arbeitsblätter, mit den aufgelisteten Lernzielen. Wenn er glaubt, dass er etwas kann, so hakt er das auf der Liste ab. Der Lehrer gibt dann noch sein Feedback dazu. Aber es gibt keine grundsätzliche Vorgangsweise.
Wirkt sich die Arbeit an unterschiedlichen Lernzielen auf die Gruppendynamik und das Klassenklima aus?
Das hängt schon sehr von der Klasse ab. Wichtig ist für mich, dass ich zu Beginn des Lehrgangs auch immer aufkläre, warum manche an anderen Dingen arbeiten und weniger machen müssen. Bis jetzt hatte ich auch immer das Glück, dass sehr interessierte und sozial kompetente Schüler in der Klasse waren. Sie unterstützen sich auch gegenseitig. Das geschieht - gelenkt und geleitet - doch regelmäßig. Ja, da haben wir auch immer ein sehr gutes Klassenklima.
Kann es auch zu Problemen kommen?
Durch die unterschiedlichen Benotungen kann es zu Problemen kommen. Ich habe in Klassen die Frage erlebt, warum ein Schüler ein "Sehr gut" bekommt, obwohl er weniger Stoff hat. Das größte Problem, das ich hier sehe, sind andere lernschwache Schüler, die aber keine Teilqualifikation haben. Sie würden die zusätzliche Hilfe auch brauchen. Natürlich kriegen sie von uns auch die Unterstützung, vor allem wenn wir doppelt besetzt sind. Aber sie haben keine reduzierte Lehrstoffverteilung. Sie erhalten deshalb mit den gleichen Leistungen die schlechteren Noten. Das ist für manche schwer zu verstehen. Aber wenn man das vorher bespricht und die unterschiedlichen Lehrformen erklärt, dann funktioniert das.
Wie sehen die organisatorischen Rahmenbedingungen für diesen differenzierten Unterricht aus?
Wir dürfen bei einer Klasse mit integrativen Lehrlingen die Klassenschülerzahl heruntersetzen. Das geht nicht immer aber wenn, dann sind es ca. 20 Schüler. Wir unterrichten dann die meiste Zeit alleine in der Klasse, bis auf ein paar Stunden, die doppelt besetzt sind. Also z.B. mit einem Schüler mit einer Teilqualifizierung sind das sechs Stunden von einem Stützlehrer. Meistens haben wir nicht mehr als einen Schüler mit einer Teilqualifikation pro Klasse. Wir planen das nicht so, sondern das ergibt sich automatisch aufgrund der Einschreibungen
Aber ich habe einmal in einer Klasse mit 32 Schülern, davon ein Lehrling der die Integrative Lehre gemacht hat, ausgeholfen. Da wird es wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, wie man das gut bewältigen soll.
Haben Sie noch einen Tipp für andere Berufsschulen? Es ist schwer einen Tipp zu geben, da die Situation immer sehr speziell ist. Aber mein Tipp könnte sein: unvoreingenommen auf den Schüler zuzugehen und den Mut zu haben, den Stoff herunter zu brechen. Ich höre oft von Kollegen: "Aber das muss er ja können." Und ich glaube der Schüler muss eben nicht alles können, gerade bei einer Teilqualifikation. Den Mut zu haben, weniger zu machen, das ist für mich das Wesentlichste.
Ein individualisierter Zugang zu Lernzielen bedarf offener Lernformen, die vielfältige Lernhandlungen ermöglichen. Diese tragen den unterschiedlichen Interessen und Lernvoraussetzungen der Jugendlichen Rechnung. Lernarrangements bereiten den Boden dafür, dass Jugendliche eine Palette an persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen können, um die vereinbarten Lernziele zu erreichen.
Die Öffnung des Unterrichts kann durch unterschiedliche Methoden erfolgen, die in Kombination ihre größte Wirkung zeigen:
-
Projektorientierter Unterricht: Die Schüler und Schülerinnen arbeiten an konkreten Projekten, um die Lernziele zu erreichen. Dabei stehen Probleme und Aufgaben im Vordergrund, die mehr oder weniger offen gehalten sind und Schülerinnen und Schüler zum Überlegen, Experimentieren und Diskutieren herausfordern. (vgl. Hofmann/Moser 2004, 38 ff; Feyerer/Prammer 2003, 112 ff; Espert 2005)
-
Planphasen: Die Lehrlinge erhalten einen Plan mit Arbeitsaufträgen, die in einer bestimmten Zeitspanne erfüllt werden müssen. Wie sie die Arbeitsschritte organisieren und wie sie sich die Zeit einteilen, liegt in der Verantwortung der Jugendlichen selbst. Diese Vorgangsweise entspricht auch den Arbeitsbedingungen von vielen berufstätigen Menschen, die eine "To-do-Liste" erhalten, die innerhalb eines Zeitrahmens erfüllt werden muss. (vgl. Hofmann/Moser 2004, 34 ff; Feyerer/Prammer 2003, 79 ff)
-
Werkstattunterricht, Stationenbetrieb oder Lernzirkel: Als Einstieg in die Arbeit mit Plänen eignet sich der Werkstattunterricht, Stationenbetrieb oder Lernzirkel. Diese drei Begriffe werden oft als Synonym für folgende Unterrichtsform verwendet: Zu einem Thema werden vielfältige Arbeitsstationen vorbereitet. Die Jugendlichen bearbeiten diese anhand von konkreten und nach Schwierigkeitsgraden abgestuften Arbeitsanweisungen. In welcher Reihenfolge sie das machen und wie viel Zeit sie an welcher Station verbringen, können sie, in einem vorgegebenen Zeitrahmen, selbst organisieren. Wichtig ist dabei, dass es sowohl Stationen gibt, die verpflichtend bearbeitet werden müssen (Pflichtstationen) und andere Stationen, die frei gewählt werden können (Wahlstationen). Das fördert nicht nur die Motivation der Schüler und Schülerinnen, sondern sie lernen auch selbständig Entscheidungen über ihren Lernprozess zu treffen. (vgl. Riedl 2004, 52 ff; transfer I/2005, transfer IV/2005I/2006; Gieskemeyer/Streif 2006)
-
Freiarbeit: In dieser Zeit steht es den Jugendlichen frei, sich Arbeiten selbst zu wählen. Diese Freiarbeitsphasen können für spezielle Interessensgebiete genutzt werden, oder um einen Bereich, in dem sich die Jugendlichen noch unsicher fühlen, zu üben und somit ihr Wissen zu festigen. Auch die Arbeit in Freiarbeitsphasen ist leistungsorientiert und soll daher dokumentiert und mit Ergebnissen abgeschlossen werden. (vgl. Hofmann/Moser 2004, 37 ff; Feyerer/Prammer 2003; 79 ff)
-
Gebundener Fachunterricht: Auch der klassische Vortrag oder das Lehrgespräch haben in dieser Methodenvielfalt eine wichtige Funktion. Dabei sollen Jugendliche auch im gebundenen Unterricht eine tragendere Rolle übernehmen und beispielsweise ihre Projektarbeit in diesem Forum präsentieren (vgl. Feyerer/Prammer 2003, 65).
Das eigenverantwortliche Lernen nach Heinz Klippert (vgl. Klippert 2004) ist für manche Schulen ein guter Ausgangspunkt, da es bereits Erfahrungen mit diesem Modell gibt. Aufbauend darauf können dann offene Unterrichtsformen eingeführt werden. Ebenso sind viele handlungsorientierte didaktische Ansätze (vgl. Riedl 2004, 80 ff; Ott 2000, 198 ff) ein guter Anknüpfungspunkt, da hier schüler- und schülerinnenzentrierte Methoden eingesetzt werden.
Ausschlaggebend dabei ist, dass es Möglichkeiten der inneren Differenzierung und Individualisierung gibt (vgl. Giekemeyer/Straif 2006; Paradies/Linser 2001). Unter einer inneren Differenzierung ist eine Lernsituation zu verstehen, in der die Jugendlichen im gleichen Raum, betreut von den gleichen Lehrerinnen und Lehrern, an unterschiedlichen Aufgabenstellungen arbeiten, die aber eine thematische Klammer verbindet (vgl. Feuser 1995; Feyerer/Prammer 2003, 79).
Beispielsweise können alle Jugendlichen zum Thema Kontoführung arbeiten: Einige Schüler oder Schülerinnen arbeiten dabei daran, das abstrakte Konzept eines Kontos für sich begreifbar zu machen. Dazu lernen sie, wie ein Konto funktioniert, was ein Überziehungsrahmen ist und erarbeiten ähnliche Fragen.
Andere wiederum sammeln Angebote unterschiedlicher Banken für Jugendkonten und berechnen Haben- und Sollzinsen. Als Ergebnis erstellen sie anhand von konkreten Berechnungsbeispielen eine Liste, welches Konto unter welchen Umständen am besten geeignet ist. Eine dritte Gruppe beschäftigt sich einstweilen mit der Umlegung von der Idee eines privaten Kontos auf Firmenkonten und bearbeitet Geschäftsfälle.
Obwohl alle am gleichen Thema der Kontoführung arbeiten, wird innerhalb der Gruppe anhand der definierten Lernziele differenziert.
Offene, individualisierte Unterrichtsformen entsprechen dabei den Forderungen einer integrativen/inklusiven Pädagogik (vgl. Bintinger/Eichelberger/Wilhelm 2005). Aber auch den zentralen Forderungen einer modernen beruflichen Bildung. Denn auch hier wird eine offene, handlungsorientierte Ausbildung gewünscht, die von den Lernenden von Anfang an eine Selbständigkeit fordert und diese dadurch fördert.
Elke Gruber fordert in ihrem Artikel "Berufsbildung in Österreich - Einblicke in einen bedeutenden Bildungssektor" dafür folgende Entwicklungen (Gruber 2004, 35):
-
"von der detaillierten Lehrplanvorgabe zur kooperativen Lehrplangestaltung,
-
von der Fächerorientierung zur Situationsorientierung,
-
von der Zerstückelung in Unterrichtsstunden zur problemorientierten Lerneinheit,
-
vom Faktenwissen zum Zugriffswissen,
-
von der Lehrerzentriertheit zur Teilnehmer/innenorientierung,
-
vom Frontalunterricht zur Projektorientierung,
-
vom fremdbestimmten Lernen zum selbst organisiertem Lernen,
-
von der Unterweisung zum Erfahrungslernen,
-
von der Trennung von Theorie und Praxis zur Verbindung von Theorie und Praxis".
Vl Ulrike Schachner unterrichtet allgemeine und wirtschaftliche Fächer (Fachgruppe 1) in der Berufsschule Wels 1. Im Zuge des Projekts IBEA war sie die Koordinatorin der Schule für die Pilotierung von offenen Unterrichtsformen in Rechnungswesen.

Kontakt: Ulrike Schachner, Berufsschule Wels 1
Linzerstraße 68, 4600 Wels
Telefon: 07242/46 5 98
E-Mail: bs-wels1.post@ooe.gv.at
Web: http://schulen.eduhi.at/bs1.wels/start.htm
In Ihrer Schule haben Sie begonnen offene Unterrichtsformen in einem wirtschaftlichen Fach auszuprobieren. Was bedeutet offener Unterricht für Sie?
Meinen beiden Kollegen (Frau Ruth Brigitta Tiziani und Herrn Hermann Bauda) und mir ist bei einem offenen Unterricht wichtig, dass die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler gefördert und gefordert wird. Mit dem Begriff "Offenes Lernen" kommen aber oft Assoziationen von fehlender Leistung und Beliebigkeit auf. Deshalb bezeichnen wir den offenen Unterricht als "Eigenverantwortliches Lernen". Das trifft für uns den Kern der Sache besser: Den Schülern die Möglichkeit zu geben, Verantwortung für ihr Lernen und ihre Arbeit zu übernehmen.
Was ist Ihr Ziel?
Unser Anliegen ist es, den Schülern beste Unterstützung, je nach Schülerverhalten und Leistungsvermögen, mit möglichst großem Freiraum zu gewähren. Dadurch wollen wir eine optimale Förderung von allen Schülern erreichen.
Warum hatten Sie den Wunsch, ein neues Unterrichtskonzept zu testen?
Wir sind grundsätzlich in der Berufsschule mit dem Problem konfrontiert, dass wir in sehr heterogenen Klassen unterrichten, die sich aus HTL-Abbrechern, lernschwachen und unterschiedlich motivierten Schülern sowie aus Integrationsschülern zusammensetzen. Die Fähigkeiten der Einzelnen sind somit in jeder Klasse sehr breit gestreut.
Wir streben deshalb nach einem Unterrichtskonzept, das es uns erlaubt, sowohl den Integrationsschüler, als auch den besten Schüler der Klasse zu fördern. Eine Einteilung des Lehrstoffes in verschiedene Schwierigkeitsgrade war einfach unumgänglich. Dann brauchten wir nur noch die Form, wie wir das umsetzen können.
Warum haben Sie sich gerade für diese Form des Unterrichts entschieden?
Wir kannten diese Form des eigenverantwortlichen Lernens aus der Berufsschule Schärding, zudem unterrichteten bereits zwei Kollegen aus der BS Wels 1 (Herr Markus Edthaler und Herr Friedrich Platzer) aus der Fachgruppe 2 im Gegenstand Angewandte Mathematik nach der Methode "Eigenverantwortliches Lernen". Uns hat daran gefallen, dass damit sowohl Integrationsschüler als auch sehr gute Schüler die Chance hatten, sich innerhalb ihrer Möglichkeiten Wissen anzueignen. Ihnen wird dabei viel Verantwortung zurückgegeben: Sie entscheiden selbst über die Auswahl des Stoffbereiches, über ihre Zeiteinteilung und die Lernform, z.B. ob sie alleine arbeiten möchten oder lieber in einer kleinen Gruppe. Entscheidend war für uns aber dabei, dass dieses Konzept sehr leistungsorientiert ist, d.h. die Schüler werden gefordert, ihre bestmögliche Leistung zu erbringen. Und es zeigt sich, dass sie das sehr motiviert. Ein wichtiger Motivationsfaktor ist dabei die Note und Leistungsanerkennung: je tiefer er bei den Stoffgebieten geht, desto besser wird seine Note.
Welche konkreten Arbeitsschritte waren dafür notwendig?
Die Vorbereitungsphase war sehr intensiv. Als 3-köpfiges Lehrerteam haben wir zuerst den Lehrstoff in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt und zwar in den Basisstoff, den Leistungsstoff und den Top-Stoff. Der Basisstoff entspricht den Grundlagen des Lehrplans, im Leistungsstoff werden die Beispiele aufbauend auf den Basisstoff komplexer und beim Top-Stoff werden die schwierigsten Themen des Stoffgebietes behandelt. Und der ist für die Schüler schon sehr anspruchsvoll, hier sind auch sehr Gute wirklich gefordert.
Wir haben dann ca. 500 Beispiele mit Lösungswegen und Ergebnissen für diese Bereiche entwickelt. Diese waren angelehnt an Beispiele von der Berufsschule Schärding. Damit wurde unsere, von Frau Tiziani erstellte, Datenbank befüllt, aus der sich die Schüler später die Beispiele herausholen können.
Zusätzlich wurden die Arbeitskarten mit den Erklärungen produziert und die Arbeitsblätter erstellt. Diese Arbeiten wurden vor dem Lehrgangsstart durchgeführt.
Wie funktioniert das Eigenverantwortliche Lernen in der Klasse dann konkret?
In der ersten Stunde gibt es eine Einführung und ein Informationsblatt für jeden Schüler, wie das Eigenverantwortliche Lernen funktioniert. Dabei erklären wir auch sehr genau wie die Note zustande kommt. Es ist wichtig, dass der Notenschlüssel für alle Schüler klar ist und sie verstehen, dass sie selbst den größten Einfluss darauf haben, welche Note sie erhalten.
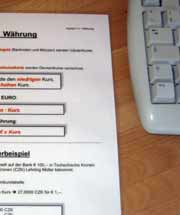

Wenn das System verstanden wurde, beginnen wir gleich mit dem Unterricht: Zuerst wird der neue Lehrstoff von uns erklärt. Die Schüler bekommen im Anschluss je ein Arbeitsblatt, welches sie mit Hilfe einer "Merkkarte" ausfüllen. Danach rechnet jeder Schüler 2-3 Basisbeispiele, kann sich danach auch für Leistungs- oder Top-Stoff entscheiden und mit den Arbeitskarten und den Beispielen mit Selbstkontrollen aus der Datenbank weiterarbeiten.
Zwischen den Schularbeiten gibt es regelmäßig Lernabschnittskontrollen. Sie sind ein wichtiges Instrument für Schüler und Lehrer, um eine Rückmeldung über den Lernstand des Schülers zu bekommen. Daran kann der Schüler erkennen, ob seine Selbsteinschätzung bei der Stoffwahl stimmt, ob er schon einen Schritt weitergehen und die nächste Stufe wählen kann, oder ob er noch die Inhalte der vorherigen Stufe festigen muss.
Wo bringt diese Form des Unterrichts den größten Vorteil?
Die Schüler können ihre Möglichkeiten besser ausschöpfen und sie haben zusätzlich eine erhöhte Individualförderung. Durch selbständiges Arbeiten bleibt mehr Zeit für die Betreuung der schwachen Schüler. Aber man hat auch einmal Zeit, sich um die besseren
Schüler zu kümmern, die sonst oft zu wenig Förderung erhalten. Und für die Lehrer gibt es auch einen wichtigen Vorteil: Es ist weniger Frontalunterricht und das schont die Stimme. Und es gibt mehr Einzelkontakt zum Schüler, dadurch lernt man sie besser kennen.
Welche Probleme sind aufgetreten, welche Stolpersteine sehen Sie?
Beim nächsten Mal werden wir sicher den Mut zur Lücke haben und einige Stoffgebiete nur streifen, damit noch mehr Zeit zum Üben aber auch zum Wiederholen und somit für die Beurteilung der Mitarbeit bleibt.
Haben Sie Tipps für andere Berufsschulen, die ebenfalls offenen Unterricht einführen möchten?
Ein wichtiger Hinweis ist, dass man zu Beginn des Projekts viel Zeit und Idealismus mitbringt, denn die Vorbereitungsarbeiten sind sehr zeitintensiv, schweißen aber auch die Kollegen durch viel gemeinsam verbrachte Zeit und das gemeinsame Ziel zusammen. Zusätzlich sollte man sich nicht von Skeptikern abbringen lassen.
Durch Lehrmittel werden Informationen weitergegeben. Deshalb gelten für sie grundsätzlich die Kriterien einer barrierefreien Information, wie sie auf S. 39-43 beschrieben wurden. Wichtig dabei ist, dass Lehrmittel klar strukturiert und einfach verständlich sind. Ebenfalls sollen sie in alternativen Formaten vorhanden sein. Auch sollen sie unterschiedliche Lernzugänge ermöglichen, d.h. verschiedene Lerntypen und Lernstrategien unterstützen.
Materilien, die für das eigenständige Erlernen von Inhalten eingesetzt werden sollen (vgl. Feyerer/Prammer 2003, 89):
-
ansprechend sein,
-
eindeutig in ihrer Anforderung und den Anweisungen sein,
-
kommunikations- und kooperationsfördernd sein,
-
Selbstkontrolle ermöglichen,
-
Selbsttätigkeit fördern und
-
handelnden Umgang ermöglichen (auch motorische und emotionale Ebenen ansprechen).
Fördern Sie auch die selbständige Gestaltung von Lernmaterialien durch die Schüler und Schülerinnen. Dadurch entsteht eine intensive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und die Jugendlichen reflektieren, welche Form ihr individuelles Lernen unterstützt.
Jugendliche können dabei auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Materialien selbst bzw. gemeinsam mit der Lehrperson herstellen. Dadurch lernen sie Strategien kennen, wie sie eigenständig mit auftretenden Barrieren umgehen können. Beispielsweise vereinfachen Jugendliche mit Lernschwierigkeiten gemeinsam mit Lehrern oder Lehrerinnen Sätze von einem Informationsblatt. Diese werden durch Bilder ergänzt, damit die Schülerinnen und Schüler selbständig die Informationen lesen können. Andere Jugendliche nehmen Vorträge und Anleitungen auf Tonband auf, damit sie diese für sich nochmals wiederholen können.
Bei Prüfungen und Schularbeiten muss es für behinderte Jugendliche die Möglichkeit eines "Nachteilsausgleichs" geben. Das bedeutet, dass eine Schülerin mit einer motorischen Einschränkung, die selbst schreiben kann, aber länger dafür braucht, für einen schriftlichen Test mehr Zeit zur Verfügung hat.
Gleiches gilt für blinde oder sehbehinderte Personen, die trotz des Einsatzes von Hilfsmitteln oft mehr Zeit zur Bearbeitung der Aufgabe benötigen.
Es bietet sich aber auch die Möglichkeit, dass der Schüler oder die Schülerin die Antworten der Assistenz diktiert. Ebenso kann es bedeuten, dass dieser Test in Form einer mündlichen Prüfung abgenommen wird (vgl. Keune/Frohnenberg 2004).
Generell sind jedoch einheitliche Prüfungen für alle eine schlechte Voraussetzung, um das individuelle Wissen und Können eines Schülers oder einer Schülerin abzubilden (vgl. Feyerer/Prammer 2003, 148 ff; Vierlinger 1999).
Für einen Unterricht, der die individuellen Fortschritte der Jugendlichen aufzeigen will, ist es deshalb wichtig vielfältige Möglichkeiten der Leistungspräsentation zu schaffen.
Ein leistungsbezogener Unterricht ist motivierend für Jugendliche. Eine erbrachte Leistung, die auf meine persönlichen Fähigkeiten und Stärken zurückzuführen ist, bietet ein Erfolgserlebnis und fördert dadurch die Motivation für weitere Arbeiten.
Eine Note allein sagt wenig darüber aus, welche eigenständige Leistung und welche individuellen Fähigkeiten dafür ausschlaggebend waren, aber es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie zusätzliche Leistungsdarstellungen erfolgen können.
Deshalb ist es wesentlich, dass jeder Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit bekommt, die eigene Leistung in der bestmöglichen Form darzustellen. Produkte, die man anschauen, angreifen und herzeigen kann, sind besonders geeignet, die erbrachte Leistung zu präsentieren.
Eine Möglichkeit dafür ist die Arbeit mit Entwicklungsberichten mit Portfolios (vgl. Feyerer/Prammer 2003, 158 ff). Darin können Jugendliche ihre erbrachten Leistungen über einen Zeitraum hinweg dokumentieren.
In einem Entwicklungs-bericht ist eine Auflistung der bewältigten Lerninhalte beschrieben. Zusätzlich können im Portfolioteil beispielsweise Fotos von selbst angefertigten Werkstücken oder die Dokumentation von erarbeiteten Projekten gesammelt werden.
Somit ist es für Personen, die später den Entwicklungsbericht sehen, nachvollziehbar, welche Leistungen der Schüler oder die Schülerin erbracht hat, bzw. welche Entwicklungsschritte über einen gewissen Zeitraum erfolgt sind.
Neben der differenzierten Beurteilungsmöglichkeit bringen Entwicklungsberichte in Berufsschulen wichtige Vorteile. Sie ermöglichen den Jugendlichen auf einfache Art dem Ausbildungsbetrieb konkrete Leistungen zu zeigen, die sie in der Berufsschule erbringen. Dadurch kann sich auch die Einschätzung im Betrieb über die Lehrlinge verändern und sich deren Aufgabenfeld erweitern.
Umgekehrt können Produkte, die im Lehrbetrieb erzeugt wurden, auch in das Portfolio aufgenommen werden und dienen als Information für die Berufsschule. Da es häufig schwierig ist, eine regelmäßige Kommunikation zwischen Schule und Betrieb aufrecht zu halten, kann ein Entwicklungsbericht mit Portfolio ein hilfreiches Informationsinstrument sein.
Auch innerhalb der Berufsschule ermöglicht das Portfolio einen guten Informationsfluss (beispielsweise von einem Jahrgang zum nächsten, wenn die Lehrerinnen oder Lehrer wechseln).
Besonders für Jugendliche, die noch keine Lehrstelle gefunden haben und ihre Lehre in einem Ausbildungslehrgang beginnen, können die Entwicklungsberichte und besonders der Portfolioteil eine hilfreiche Bewerbungsunterlage sein. Somit stellt ein Entwicklungsbericht mit Portfolio eine gute Ergänzung zur Kommunikation zwischen Schule, Berufsausbildungsassistenz, Unternehmen, Jugendlichen und Eltern dar.
[2] Detaillierte Informationen zur Lehrplangestaltung im Rahmen der Integrativen Berufsausbildung siehe "Integrative Berufsausbildung. Evaluierung § 8b des Berufsausbildungsgesetzes" (KMU Forschung 2006, 80)
[3] Eine Methodensammlung für Sozial-Trainings in berufsbildenden Schulen ist "Teamarbeit. Soziales Lernen in berufsbildenden Schulen und Institutionen" (vgl. Hergovich/Mitschka/Pawek 2001)

Sheryl Burgsthaler hat für den beruflichen Bildungsbereich (für Colleges und Precolleges in den USA) den Fragenkatalog "Universal Design of Instruction[4]" zusammengestellt. Die Institutionen sollen dabei reflektieren, inwieweit die eigenen Bildungsangebote für alle Schüler und Schülerinnen barrierefrei sind. Der Fragebogen ist online abrufbar unter: http://www.washington.edu/doit/Brochures/PDF/instruction.pdf
Er bietet eine gute Zusammenfassung der zuvor beschriebenen Bedingungen für eine barrierefreie Berufsschule und wurde deshalb für diesen Leitfaden übersetzt und leicht adaptiert[5].
Universelles Design für Lernarrangements
1. Wird Anderssein und Vielfalt in der Gruppe positiv bewertet?
Schaffen Sie eine Klassensituation, in der Anderssein und Vielfalt respektiert und wertgeschätzt werden. Vermeiden Sie dabei den Ausschluss oder eine Stigmatisierung von einzelnen Schülern oder Schülerinnen.
2. Ist eine physische Zugänglichkeit gegeben?
Stellen Sie sicher, dass die Klassenräume, die Werkstätten und Exkursionsorte für alle zugänglich und benutzbar sind.
3. Werden vielfältige Unterrichtsformen eingesetzt?
Verwenden Sie vielfältige Methoden, um die Lerninhalte zu vermitteln oder bearbeiten zu lassen. Sowohl Lehrpräsentationen, als auch praktische Aktivitäten, Diskussionen und selbstgesteuerte Lernphasen sollten im Unterricht vorkommen und an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.
4. Sind Informationen zugänglich?
Stellen Sie Informationen in alternativen Formaten zur Verfügung. Besonders wichtig ist dabei eine digitale Version, die in unterschiedlichen Medien ausgegeben und einfach adaptiert werden kann. Bedenken Sie, dass die Adaption von Materialien einer Vorbereitung bedarf und stellen Sie deshalb die Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung (z.B. für Stützlehrpersonen oder Kommunikationsassistenz).
5. Wird Interaktion gefördert?
Fördern Sie unterschiedliche Formen der Interaktion und Kooperation zwischen den Klassenmitgliedern. Achten Sie dabei darauf, dass wirklich alle Schüler und Schülerinnen daran beteiligt sind und niemand ausgeschlossen wird.
6. Gibt es regelmäßiges Feedback?
Geben Sie laufend den Schülern und Schülerinnen Feedback zu ihrer Arbeit, nicht nur nach abgeschlossenen Prüfungen. Je zeitlich näher das Feedback an der erbrachten Leistung liegt, desto besser kann es verarbeitet werden.
7. Kann Wissen auf unterschiedliche Art demonstriert werden?
Schaffen Sie vielfältige Formen, wie die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihre Leistung präsentieren können. So bieten beispielsweise neben herkömmlichen Tests und Prüfungen Portfolios und Präsentationen von Projektarbeiten eine gute Möglichkeit neue Fähigkeiten darzustellen.
[4] "Universelles Design" oder "Design für Alle" ist ein Konzept nachdem Produkte und Dienstleistungen für einen möglichst großen Personenkreis benutzbar sein sollen. Besonderes Augenmerk wird auf die Gruppe älterer Menschen oder Menschen mit Behinderungen gelegt. Wichtig ist in diesem Konzept die Idee, dass Produkte, die für spezielle Zielgruppen entwickelt wurden auch bei den "Durchschnittskonsumenten und -konsumentinnen" Anklang finden. (vgl. Firlinger 2003, 101)
[5] Übersetzung und Adaption von Isabell Grill
Inhaltsverzeichnis
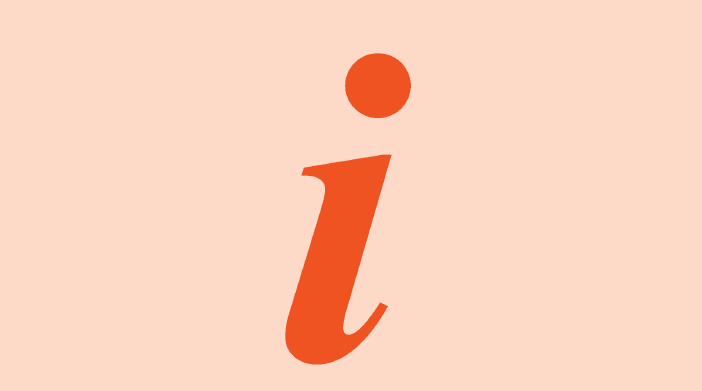
Hier finden Sie weiterführende Informationen und Kontaktadressen zu relevanten Organisationen und Institutionen:
Zentrum für inklusive Berufsbildung (ZIBB)
Eine Beratungseinrichtung zu Fragen der Integration und Inklusion in der Berufsbildung
Bundessozialämter
Die Bundessozialämter sind die zuständigen Stellen für das Thema Behinderung des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz. Unter anderem sind sie für einen Großteil der Berufsausbildungsassistenz zuständig. In den Landesstellen erhalten Sie auch Informationen zu relevanten Landesgesetzen. Eine Auflistung der Landesstellen des Bundessozialamtes finden Sie unter:
Sonderpädagogische Netzwerke in Österreich
mit weiterführenden Links zu Sonderpädagogischen Zentren
Berufspädagogische Akademien des Bundes
mit Informationen zu diversen integrationspädagogischen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen
http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/leb/Berufspaedagogischen_Aka1986.xml
Steiermark: http://www.bpa-graz.at
Oberösterreich: http://www.bpa-linz.ac.at
Tirol: http://www.bpa-innsbruck.tsn.at
Wien: http://www.bpa-wien.ac.at
Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR)
Dachverband der Behindertenverbände Österreichs
Informationsplattform "Gleich und Gleich"
mit Informationen zum Thema Behindertengleichstellung und umfassender Barrierefreiheit
Informationsdatenbank "service4u"
vielfältige Informationen zum Thema Behinderung
Arbeit und Behinderung
Informationsplattform zum Thema Arbeit und Behinderung, die insbesondere auch Unternehmen anspricht, die behinderte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen eingestellt haben bzw. diese einstellen möchten. http://www.arbeitundbehinderung.at
Clearing Österreich
Clearingstellen begleiten behinderte Jugendliche in ihrem Berufsauswahlprozess.
Good Practice Center zur Förderung von Benachteiligten in der Berufsausbildung
Online-Plattform zu verschiedenen Themen der Benachteiligtenförderung des deutschen Bundesinstituts für Berufsbildung http://www.good-practice.de
Arnold, Rolf/Schüßler, Ingeborg (Hg.): Ermöglichungsdidaktik. Erwachsenenpädagogische Grundlagen und Erfahrungen. Hohengehren 2003
berufsbildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule Nr. 82: Perspektivenwechsel in der Förderung beruflich Benachteiligter. Seelze 2003
berufsbildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule Nr. 93: Schwierige Lernsituationen gestalten. Seelze 2005
berufsbildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule Nr. 94/95: Selbstgesteuertes Lernen/Pädagogische Diagnostik. Seelze 2005
Bauer, Lucie/Seifner, Christine (Hg.) für das Zentrum für Schulentwicklung: Step by Step. Anregungen und Tipps zum gemeinsamen Unterricht in Integrationsklassen der Sekundarstufe I. Wien 2001 Online abrufbar unter: http://www.cisonline.at/publikationen.html
Bintinger, Gitta/Eichelberger, Harald/Wilhelm, Marianne: Von der Integration zur Inklusion. In: Grubich, Rainer u.a.: Inklusive Pädagogik. Beiträge zu einem anderen Verständnis von Integration. Wien-Meran 2005
Booth, Tony/Ainscow, Mel et al.: Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Halle-Wittenberg 2003
Burgsthaler, Sheryl: Universal Design of Instruction, Seattle 2005. Online abrufbar unter: http://www.washington.edu/doit/Brochures/PDF/instruction.pdf
Debenjak, Peter (Hg.) für das Zentrum für Schulentwicklung: Integration Sekundarstufe I. Lernspiele und Materialien, deren Herstellung und vielfältige Anwendbarkeit im Unterricht. Heft A & B. Klagenfurt 1997
Espert, Sünne (Hg.): Mit Projekten lernen. Darmstadt 2005
Exenberger, Silvia/Schober, Paul (Hg.): Baustelle Lehrlingsausbildung. Handlungsfelder einer qualitätsorientierten Berufsbildung. Innsbruck/Wien/München 2005
Faulstich, Peter et al. (Hg.): Praxishandbuch selbstbestimmtes Lernen. Konzepte, Perspektiven und Instrumente für die berufliche Aus- und Weiterbildung. München 2002
Feuser, Georg: Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt 1995
Feyerer, Ewald/Prammer, Wilfried: Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I. Anregungen für eine integrative Praxis. Weinheim 2003
Firlinger, Beate für Integration:Österreich (Hg.): Buch der Begriffe. Sprache. Behinderung. Integration. Wien 2003 Online abrufbar unter: https://broschuerenservice.bmsg.gv.at/PubAttachments/buch_der_begriffe.pdf
Firlinger, Beate/Braunreiter, Michaela/Aubrecht, Brigitte (Hg.): Mainual. Handbuch barrierefreie Öffentlichkeit. Wien 2005
Giangreco, Michael F. (Hg.): Quick Guides to Inclusion. Ideas for Educating Students with Disabilities. Baltimore Nummer 1: 1997; Nummer 2: 1998; Nummer 3: 2002
Giekemeyer, Renate/Straif, Charlotte: Binnendifferenzierung in Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen. Darmstadt 2006
Grill, Isabell: Inklusive Bildung. Erste Schritte zu einer gemeinsamen Erwachsenenbildung für behinderte und nichbehinderte Menschen. Wien 2005 Online abrufbar unter: http://www.equalizent.com
Gritsch, Ulrike/Rauchberger, Monika/Köbler, Reinhard/Scheiblauer, Jasmin: Das WIBS Kursbuch. Innsbruck 2005
Gruber, Elke: Berufsbildung in Österreich - Einblicke in einen bedeutenden Bildungssektor. In: Verzentisch, F., Schlögl, P., Prischl, A., Wieser, R. (Hg.): Jugendliche zwischen Karriere und Misere. Die Lehrausbildung in Österreich, Innovationen und Herausforderungen. Wien 2004
Hergovich, Doris/Mitschka, Ruth/Pawek, Robert: Teamarbeit. Soziales Lernen in berufsbildenden Schulen und Institutionen. Linz 2001
Hofmann, Franz/Moser, Gerlinde: Offenes Lernen planen und coachen. Ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe. Linz 2004
Kasakoff, Barbara/Öhler, Ulrike: Integration an der PTS. Graz/Wien 2001 Online abrufbar unter: http://www.cisonline.at/publikationen.html
Klippert, Heinz: Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen. Bausteine für den Fachunterricht. Weinheim 2004
Keune, Saskia/Frohnenberg, Claudia: Nachteilsausgleich für behinderte Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer. Bonn 2004
KMU Forschung: Integrative Berufsausbildung. Evaluierung von § 8b des Berufsausbildungsgesetzes. Wien 2006
Magistrat der Stadt Graz: Bauen für Alle. Graz 2000 Online abrufbar unter: http://graz.at/planen_bauen/wohnberatung_behinderte
Ott, Bernhard: Grundlagen des beruflichen Lernens und Lehrens. Ganzheitliches Lernen in der beruflichen Bildung. Berlin 2000
Paradies, Liane/Linser, Hans Jürgen: Differenzieren im Unterricht. Berlin 2001
Platte, Andrea; Seitz, Simone; Terfloth, Karin (Hg.): Inklusive Bildungsprozesse. Klinkhartdt 2006
Riedl, Alfred: Didaktik der beruflichen Bildung. Wiesbaden 2004
Schade, Wolfgang: Die neue Berufsschule. Maria Montessori in der beruflichen Bildung. Frankfurt am Main 1994
transfer I/2005: Methode Lernzirkel. Durch Lernzirkelarbeit die Qualifizierungsarbeit in heterogenen Gruppen optimieren. Darmstadt 2005
transfer III/2005: Peerteaching. Darmstadt 2005
transfer IV/2005-I/2006: Praxis der Lernzirkelarbeit. Konzepte - Materialien - Erfahrungen. Darmstadt 2005
Uniability (Hg.): Informationen für Vortragende. Wien o.J. Online abrufbar unter: http://info.tuwien.ac.at/uniability/vortrag.htm
University of Tasmania (Hg.): Inclusive Practice is Good Practice. o.O.1999 Online abrufbar unter: http://services.admin.utas.edu.au/Gateways/IPIGP_pubs/ipigp.html
University of Wales (Hg.): Accessible Curricula. Good Practice for all. Cardiff 2002. Online abrufbar unter: http://www.techdis.ac.uk/resources/files/curricula.pdf
Vierlinger, Rupert: Leistung spricht für sich selbst. "Direkte Leistungsvorlage" (Portfolios) statt Ziffernzensuren und Notenfetischismus. Heinsberg 1999
Wir vertreten uns selbst! (Hg.): Wörterbuch für leichte Sprache. Kassel 2001
Wilhelm, Marianne/Bintinger, Gitta/Eichelberger, Harald: Eine Schule für dich und mich! Inklusiven Unterricht, inklusive Schule gestalten. Ein Handbuch zur integrativen Lehrer/innenaus- und -weiterbildung. Innsbruck 2002.
Zettel, Petra: Integrative Berufsausbildung. Eine Chance für Jugendliche? Innsbruck 2005. Online abrufbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/zettel-berufsausbildung-dipl.html
Quelle:
Isabell Grill: Berufsschule ohne Barrieren. Leitfaden für eine umfassende Barrierefreiheit in berufsbildenden Schulen
IBEA Integrative Berufsorientierung - Integrative Berufsausbildung. Entstanden im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft IBEA www.ibea.co.at, Herausgeber: equalizent Schulungs u. BeratungsGmbH Obere Augartenstraße 20 1020 Wien, Mitherausgeber: LLL Projektmanagement GmbH Grazer Straße 24 8680 Mürzzuschlag
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 21.06.2011
