Inhaltsverzeichnis
- Vorwort 1
- Vorwort 2
- Abschnitt I: Thematische Einführung
- 1. Behinderung - Definitionen und Begriffsbestimmungen
- 2. Integration
- Abschnitt II
- 1. Beschreibung des pädagogischen Konzepts
- 2. Die Realität der pädagogischen Arbeit im Vergleich zum Programm
- Abschnitt III
-
1. Theoretische Grundlagen
-
1.1. Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten
- 1.1.1. Allgemeines
- 1.1.2. Die Bedeutung von Peerbeziehungen für die Entwicklung von Kindern
- 1.1.3. Der Umgang von Kindern mit der Behinderung anderer Kinder
- 1.1.4. Die Rolle der Nachahmung bei integrativer Erziehung
- 1.1.5. Behinderte Kinder werden mit den Folgen ihrer Einschränkung konfrontiert
- 1.1.6. Konflikte in integrativen Gruppen
- 1.1.7. Auswirkungen integrativer Erziehung auf nichtbehinderte Kinder
-
1.1. Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten
-
2. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
- 2.1. Allgemeine Zielsetzungen dieser Untersuchung
- 2.2. Die Stichprobe
-
2.3. Untersuchungsinstrument
- 2.3.1. Beschreibung des Kategoriensystems der Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984)
- 2.3.2. Modifikationen des Kategoriensystems
- 2.3.3. Zusammenfassende Darstellung der Kategorien meiner Untersuchung
- 2.3.4. Durchführung
- 2.3.5. Auswertung der Aufnahmen
- 3. DISKUSSION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
- Abschnitt IV
- 1. Aufbau und Struktur des Untersuchungsinstrumentes
-
2. Ergebnisse und Diskussion der Daten aus dem Fragebogen
- 2.1. Beschreibung der Stichprobe
- 2.2. Erziehungsstil der Mütter
- 2.3. Zum Entscheidungsverlauf der Mütter bei der Wahl des Kindergartens Steingruber
- 2.4. Beurteilung der personellen Situation und der Rahmenbedingungen
- 2.5. Soziale Kontakte durch den Besuch des Kindergartens Steingruber
- 2.6. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder des Kindergartens Steingruber
- 2.7. Zufriedenheit des eigenen Kindes im Kindergarten Steingruber
- 2.8. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung eines nichtbehinderten Kindes im integrativen Kindergarten
- 2.9. Wissensstand, Wunsch nach Information und Informationsquellen der Mütter
- 2.10. Behinderte Kinder und Stellung in der Gesellschaft
- 2.11. Zuständige Stellen für behinderte Menschen
- Abschnitt V: LITERATUR

DER WISSENSCHAFTSLADEN GRAZ
Die Grundidee des Wissenschaftsladens Graz ist die kostenloseVermittlung von Wissen und Forschung für Menschen mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen und ohne die Möglichkeit, dies selbst finanzieren zu können. Unsere Zielgruppen sind damit schwerpunktmäßig Inititativen, Vereine, Zusammenschlüsse im Umwelt- und Sozialbereich sowie Einzelpersonen.
In der Forschungsvermittlung nützen wir das Potential an Forschung, das in dem Verfassen wissenschaftlicher Abschlußarbeiten an den Universitäten liegt. Wir verbinden damit den Bedarf an Forschung finanzschwacher Gruppen mit dem Anspruch von Studierenden, ein Thema mit praktischem Nutzen zu bearbeiten.
In der Wissensvermittlung recherchieren wir bereits vorhandenes Wissen und bereiten dieses zusammenfassend und verständlich auf.
Neben dem kostenlosen Wissens- und Forschungstransfer führt der Wissenschaftsladen mit seinem interdisziplinären Team auch selbst Forschungsaufträge schwerpunktmäßig im Umwelt-, Gesundheits- und Sozialbereich durch.
Um das erarbeitete Wissen einem möglichst großen Kreis von Interessierten zugänglich zu machen, veröffentlicht der Wissenschaftsladen Graz im Form von Arbeitspapieren wesentliche Ergebnisse von Diplomarbeiten, eigenen Recherchen oder Veranstaltungen.
Verleger und Hersteller:
© Wissenschaftsladen GRAZ
Elisabethstraße 3/1
A-8010 Graz
Tel 0316 / 38 46 77 - Fax 0316 / 38 46 777 - Email wila@gewi.kfunigraz.ac.at
Redaktion: Mag.a Annette Sprung
F.d.I.v.:
Dr. Constanza Furtlehner
Mag.a Petra Ruprechter
Mag.a Sandra Perle
Das vorliegende Arbeitspapier faßt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Heilpädagogischen integrativen Kindergartens ‚Steingruber' in Graz zusammen. Diese Einrichtung bemüht sich seit ihrer Gründung im Jahr 1971 und verstärkt mittels einer fachspezifischen Zusatzbetreuung seit 1990 um die Förderung und Integration von behinderten und nicht-behinderten Kindern.
Zwei Diplomarbeiten und eine Dissertation sind seit den ersten Schritten des Projektes "Wissenschaftliche Begleitung" im Jahr 1994 entstanden. Die Untersuchungen reichten von der Beschreibung des pädagogischen Konzeptes über eine Analyse der Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern bis hin zu einer Befragung der Eltern der betreuten Kinder zu Aspekten der Integration.
Zum Zustandekommen der Arbeiten von Dr. Constanza Furtlehner, Mag.a Petra Ruprechter und Mag.a Sandra Perle haben neben dem Engagement der Autorinnen selbst auch die Leitung und das Team des Kindergartens Steingruber, die verantwortliche Mitarbeiterin des Wissenschaftsladens Mag.a Renate Zingerle sowie die finanzielle Unterstützung der Rechtsabteilung 13 des Landes Steiermark wesentlich beigetragen. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Zum Aufbau und Inhalt des Arbeitspapiers
Petra Ruprechter und Constanza Furtlehner führen im ersten Abschnitt kurz in die Thematik "Behinderung/ Integration" ein. Danach werden die zentralen Inhalte und Ergebnisse der einzelnen Arbeiten von ihren jeweiligen Verfasserinnen präsentiert. Nachdem die wissenschaftliche Begleitung bereits in den Jahren 1995 und 1996 zur Durchführung gelangte, sind etwaige Veränderungen (wie z.B. der Gruppenanzahl und -größe) und aktuelle Bedingungen im Bereich des untersuchten Kindergartens nicht erfaßt. Die vorgestellten Ergebnisse sind daher im entsprechenden zeitlichen Kontext einzuordnen.
Nach der inhaltlichen Einführung folgt die Vorstellung der Dissertation "Behindertenintegration ‚Steingruber'. Eine wissenschaftliche Begleitung des Heilpädagogischen Kindergartens ‚Steingruber'" von Dr. Constanza Furtlehner, die im Jänner 1996 am Institut für Erziehungswissenschaften eingereicht wurde. Constanza Furtlehner macht in ihrem Beitrag das dem Kindergarten Steingruber zugrundeliegende pädagogische Konzept transparent. Sie führte ihre Analyse anhand von Theoriefundierungen, Materialanalysen und Gesprächen mit der Leiterin und den Mitarbeiterinnen zwischen Mai 1994 und Juli 1995 durch. In diesem Zeitraum untersuchte sie zum Zweiten die Realisierung des Konzeptes in der Kindergartenpraxis sowie seine Wirkung auf die Kinder mittels halbstandardisierter Interviews mit dem Personal, Beschreibungen von Tagesabläufen und Verhaltensanalysen der Kinder.
In Abschnitt III stellt Mag.a Petra Ruprechter ihre im Jänner 1997 am Institut für Psychologie vorgelegte Diplomarbeit "Gemeinsam von Anfang an - Eine Analyse sozialer Interaktionsformen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem Heilpädagogischen Kindergarten" vor. Die Autorin zeichnete die Videosequenzen, die ihrer Analyse als Grundlage dienten, im März und April des Jahres 1996 auf. Sie beschreibt in ihrem Text anhand beobachteter Interaktionen, welche möglichen Auswirkungen eine gemeinsame Erziehung auf das Verhalten behinderter und nichtbehinderter Kinder haben kann.
Die dritte Diplomarbeit mit dem Titel "Integration im Kindergarten - Eine Elternbefragung" stammt von Mag.a Sandra Perle und gelangte im Jänner 1996 am Institut für Erziehungswissenschaften zum Abschluß. Im Zentrum der Fragebogenerhebung (Durchführung Februar 1995) unter den Müttern der betreuten Kinder standen der Erziehungsstil der Eltern, deren Erwartungen und Zufriedenheit mit der Struktur und Betreuungsarbeit des Kindergartens, ihre Einstellungen zu Behinderung und Integration, sowie ihr Wissens- und Informationsstand.
Die Autorinnen haben die einzelnen Abschnitte individuell und eigenverantwortlich gestaltet, eine Einheitlichkeit bezüglich des Inhalts oder der Form (z.B. alte bzw. neue Rechtschreibung) wurde nicht angestrebt und ist somit nicht gegeben.
Eine gemeinsam erstellte Literaturauswahl rundet schließlich das Arbeitspapier ab und bietet interessierten LeserInnen weiterführende Hinweise an.
Wenn von Behinderung oder Behinderten gesprochen wird, weiß in der Regel jeder, was oder wer damit gemeint ist. Es scheint im Alltag eine große Übereinstimmung darüber zu bestehen, was als Behinderung und wer als BehinderteR zu gelten hat. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch bald, daß der Begriff Behinderung eine weitgehende Verallgemeinerung darstellt, da eine Vielzahl spezifischer Beeinträchtigungen darunter zusammengefaßt werden. Da es eine allgemeinverbindliche Definition nicht gibt, wird der Begriff Behinderung von pädagogischer, medizinischer, soziologischer oder juristischer Seite unterschiedlich definiert. Entscheidend für die Definition sind die unterschiedlichen fachspezifischen Zielsetzungen, die mit der Begriffsbestimmung intendiert sind (Tröster, 1990).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellte 1980 eine Definition der Behinderung vor und unterteilt dabei in die Begriffe "impairment", "disability" und "handicap". Unter "impairment" (Schädigung) versteht man jeden Verlust oder jede Anomalie einer psychologischen, physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion. Aus dieser Schädigung resultieren Einschränkungen verschiedenster Aktivitäten und Verhaltensweisen ("disability"), die bei der Ausführung von Tätigkeiten des alltäglichen Lebens auftreten können. Unter "handicap" schließlich versteht man eine Benachteiligung, die einen bestimmten Menschen einschränkt oder daran hindert, eine Rolle auszufüllen, die für ihn nach Alter, Geschlecht und sozialen und kulturellen Faktoren "normal" wäre. Diese Benachteiligung geht entweder auf eine Schädigung ("impairment") oder eine Einschränkung verschiedenster Aktivitäten und Verhaltensweisen ("disability") zurück und beeinträchtigt diesen Menschen im Vergleich zu anderen, da er von gesellschaftlichen Normen abweicht.
Unter pädagogischen Gesichtspunkten gelten die Kinder als behindert, "die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist" und die deshalb eine besondere pädagogische Förderung benötigen (Deutscher Bildungsrat, 1973, S.32; zitiert nach Miedaner, 1986, S. 20).
Inhaltsverzeichnis
Der Begriff Integration stammt vom lateinischen Wort "integer" (unversehrt, ganz) ab. Darunter versteht man einen "Zusammenschluß", eine "Vervollständigung", "Vereinheitlichung", einen "Vorgang der Ganzheitsbildung" (Dorsch, 1994, S. 355).
Arnold, Eysenck und Meili (1991, S. 995) verstehen unter dem Begriff der "sozialen Integration" einen zusammenfassenden "Titel für Teilprozesse, die der Vervollständigung oder der Herstellung eines konsistenten sozialen Gebildes förderlich sind".
Nach Feuser (1982) versteht man unter Integration allgemein gesellschaftlich die Absage an die Aussonderung von behinderten Menschen. Integration ist ein Prozeß der Entwicklung eines neuen gesellschaftlichen und individuellen Bewußtseins. Integration bedeutet weder Reduzierung der Entwicklungsmöglichkeiten der Nichtbehinderten auf ein für alle erreichbares Niveau noch die Anpassung Behinderter an die Normen der Nichtbehinderten, sondern die Wiederherstellung ihrer zerstörten individuellen und sozial-gesellschaftlichen Einheit. Integration ist ein gesellschaftlich-sozialer Prozeß, der ständig neu vollzogen werden muß, und kein einmal erreichbarer Zustand.
Dieser Prozeß fördert das Kennenlernen und die Akzeptanz eigener Fähigkeiten und Grenzen sowie der des anderen und bildet daher die Basis für die Fähigkeit, miteinander umgehen zu können (Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt (EFrGF), 1984).
Da es in der Integrationsdiskussion aufgrund der unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten des Begriffes Integration oft zu einem Aneinander-Vorbeireden kommt, zeigt Gruber (1984) die drei häufigsten Begriffsverwendungen von Integration auf:
1. Integration als Ziel: In diesem Zusammenhang wird unter Integration die Eingliederung in den Beruf, in die Schulgemeinschaft und in die Gesellschaft insgesamt verstanden, ausgehend von der idealistischen Vorstellung, daß es eine gesellschaftliche Einheit gäbe.
2. Integration als Mittel: Das Zusammenführen und Zusammensein von behinderten und nichtbehinderten Menschen soll die gesellschaftliche Integration und die erwünschten sozialen Prozesse in die Wege leiten. Dieser Kontakt wird oft noch graduell abgestuft verstanden, von einem ständigen Zusammensein bis zu punktuellen Kontakten in einzelnen Bereichen.
3. Integration als Norm: Hier wird Integration als Wertvorstellung und als Wert an sich verstanden.
Die pädagogischen Bemühungen um das den behinderten wie den nicht behinderten Menschen gleichermaßen zustehende Recht, nämlich am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, gingen, was nun die behinderten Menschen angeht, seit jeher in eine eher zweifelhafte Richtung. Vorwiegend zielten Integrationsbemühungen auf die "Normalisierung" der Behinderten: So sollen sie sich den Nichtbehinderten anpassen, ihre Normen und Werte übernehmen und erfüllen. Zum Gelingen dieser Vorstellung weist man sie gewöhnlich in besondere Einrichtungen ein, um sie dort mit allen Möglichkeiten der Therapeutisierung für ein Leben in einer durchwegs leistungsorientierten Gesellschaft zu befähigen.
So gut diese Bemühungen dieser Art von Eingliederung gemeint sein wollen, sie widersprechen doch (meiner Meinung nach) dem eigentlichen Integrationsverständnis, nämlich eines gleichberechtigten Miteinanderlebens. Durch die institutionelle Trennung nach den Merkmalen behindert/ nicht behindert werden die Behinderten weitgehend aus den realen Lebenszusammenhängen herausgerissen, werden aus gemeinsamen Lernfeldern ausgegrenzt, und so bleiben ihnen viele Lebenserfahrungen in der Welt außerhalb ihrer Anstalten verwehrt. Dies alles führt meist dazu, daß die Basis für eine unvoreingenommene Begegnung von behinderten und nicht behinderten Menschen stark beeinträchtigt ist. Mangelnde Begegnungsmöglichkeiten Behinderter und Nichtbehinderter verhindern die Gelegenheiten, den gemeinsamen Umgang miteinander (von Kind auf [adäquat]) zu erlernen. Die getrennten Lebenswelten bewirken Verhaltensunsicherheiten auf beiden Seiten: man begegnet sich mit Unbehagen, Unsicherheit und Angst. Und gerade diese Faktoren machen die beiderseitige Entscheidung leichter, sich doch auch lieber weiterhin aus dem Weg zu gehen.
Mit verstärkter Bewußtwerdung dieser problematischen Situation (der Segregation behinderter Menschen) gingen Ende der 60iger Jahre neue Gedanken in die Bildungsbemühungen ein. Durch die allgemeine Reform des Bildungswesens in Regelkindergärten Anfang der 70er Jahre wurde das überwiegend kognitiv orientierte pädagogische Konzept mehr und mehr abgedrängt vom situationsorientierten Lernen. Unter der Hervorhebung des ganzheitlichen Lernens an realen Lebenssituationen - eine rein kognitive Förderung in isolierten und unnatürlichen Situationen verlor immer mehr ihren Glanz - eröffnete sich die Gelegenheit, behinderte und nicht behinderte Kinder von klein auf zusammenzuführen und gemeinsam betreuen und fördern zu können. Etliche wissenschaftliche Untersuchungen an Modellversuchen zur gemeinsamen Erziehung brachten aussichtsreiche Ergebnisse, nahmen voreingenommenen Bedenken den Schrecken: Befürchtungen um eine Unterforderung der nicht behinderten Kinder erwiesen sich als unbegründet, im Gegenteil eröffnet die gemeinsame Betreuung und Förderung allen Kindern ein ertragreicheres Lernen in sozialen und kognitiven Aspekten (vgl. Feuser 1984, S. 22-24).
Die integrative Gruppe kann als Situation aufgefaßt werden, in der Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen Anregungen verschiedenster Art erhalten und Erfahrungen mit der Vielfältigkeit menschlichen Verhaltens und menschlicher Erscheinungen und mit dem Zusammenleben mit anderen machen können (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (BMW), 1982; Dichans, 1987).
Integrative Erziehung beinhaltet, die Vielfalt menschlichen Seins wahrzunehmen und auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Grenzen jedes Kindes angemessen einzugehen. Die besondere Chance integrativer Erziehung im Kindergarten liegt darin, daß Kinder in diesem Alter erst wenige oder noch keine verfestigte Vorurteilsstrukturen entwickelt haben und somit reale Möglichkeiten für den Aufbau von wechselseitigen Beziehungen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern existieren (Dichans, 1990).
Feuser (1982, S. 86) versteht unter Integration, "die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand / Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen." Diese Arbeit am gemeinsamen Gegenstand bedeutet - bezogen auf den Kindergarten - nicht, daß von jedem Kind dasselbe Tun gefordert wird, sondern viel mehr, daß eine Situation oder ein Gegenstand derart vielgestaltig ist, daß jedes Kind noch etwas davon erfahren kann. Eine solche Lerndifferenzierung beinhaltet, daß jedes Kind gemessen an seinen eigenen Fortschritten beurteilt wird.
Integration im Kindergarten kann auch nach qualitativen Aspekten unterschieden werden. Ein behindertes Kind kann in einer Gruppe einfach nur dabeisein (physische Integration), es kann an denselben Aufgaben oder mit denselben Gegenständen arbeiten (funktionelle Integration) oder es kann auch in soziale Interaktionen einbezogen werden (soziale Integration) (Bonderer, 1981; Mühl, 1987; zitiert nach Angerer, Raab & Streit, 1994).
Durch die Beobachtung von Freispielszenen und zufällig stattfindender Kommunikation zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern kam die Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984) zur Definition unterschiedlicher Stufen der Integration zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern:
1. So nebenbei dabeisein können, ohne zu stören: Die integrative Wirkung besteht hier darin, daß die Kinder sich ansehen und zusehen können. Zu dieser Stufe zählen nur dann Formen des Dabeiseins, wenn in ihnen eine Teilnahme zum Ausdruck kommt, wie z.B. im Zusehen. Auf dem Hintergrund dieses Klimas von Toleranz, Gelassenheit und positiver Annahme der Verschiedenartigkeit von Kindern können sich weitere Stufen der Integration entwickeln.
2. Dabeisein können und Anregungen von den anderen aufgreifen: Die integrative Wirkung besteht bei dieser Stufe darin, daß die behinderten Kinder von den nichtbehinderten nicht nur geduldet werden, sondern auch oft in ihre Aktivitäten einbezogen werden und von den Aktivitäten der nichtbehinderten Kinder lernen können.
3. Manchmal an etwas mitmachen können: Hier besteht die integrative Wirkung in einer punktuellen aktiven Teilnahme am Gruppengeschehen und in einer Erprobung der Wirkung eigener Tätigkeiten auf andere Kinder.
4. Regelmäßig an etwas mitmachen können: Die integrative Wirkung besteht bei dieser Stufe darin, daß die behinderten Kinder ihren Platz in der Gruppe kennenlernen. Diese Stufe der Integration erfüllen alle Rituale in der Gruppe, wie z.B. Jause, Kreisspiele.
5. Regelmäßig miteinander etwas tun: Hier besteht die integrative Wirkung darin, andere Kinder als Spielkameraden zu akzeptieren. Für manche Kinder ist es nicht möglich, sich an dieser Integrationsstufe zu beteiligen, denn eine wesentliche Voraussetzung dafür, um regelmäßig mit anderen Kindern zu spielen, ist die Fähigkeit, sich ihnen sprachlich verständlich zu machen. Deshalb scheiden die Kinder, die nicht oder nur wenig sprechen können, auf dieser Stufe zumeist aus dem Gruppengefüge aus.
Welche dieser Ebenen der Integration jeweils verwirklicht ist, wird von Kind zu Kind unterschiedlich sein und ist abhängig von den Besonderheiten des Kindes und der Gruppenstruktur.
Mit dem Projekt "Heilpädagogischer Kindergarten" wurden in der Steiermark ab 1984 neue Wege zur Betreuung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder beschritten. In dem von der Landesregierung erlassenen Organisationsstatut ist festgelegt, daß Heilpädagogische Kindergärten die Aufgabe haben, behinderten Kindern "den Eintritt in die allgemeinbildenden Pflichtschulen, im günstigsten Fall den Eintritt in die Volksschule, zu ermöglichen, Sprachanbahnung und kognitive Entwicklung in Hinblick auf die Lebensbewältigung zu bewirken und sorgfältige Diagnosen durch Langzeitbeobachtungen zu erstellen. Die Heilpädagogischen Kindergärten haben Kinder, die (...) von Behinderung bedroht sind, pädagogisch und therapeutisch zu betreuen" (Organisationsstatut für Heilpädagogische Kindergärten, 1987, S.1).
Im Rahmen des Projektes "Heilpädagogischer Kindergarten" gibt es drei Betreuungsarten: Der Heilpädagogische Kindergarten ist
-
als Kooperative Stammkindergartengruppe und / oder
-
in Form der Integrativen Zusatzbetreuung (IZB) und / oder
-
in Form der Integrationsgruppen
zu führen.
ad a: Beim Konzept der Kooperativen Stammkindergartengruppe werden Gruppen mit mindestens fünf und höchstens sechs behinderten Kindern in einem Stammkindergarten mit nichtbehinderten Kindern betreut. Integrationsmöglichkeiten bestehen bei diesem Modell insofern, als behinderte und nichtbehinderte Kinder für verschiedenste Aktivitäten öfters zusammengefaßt werden. Die restliche Zeit verbringen die behinderten Kinder unter sich und erfahren eine sehr intensive Förderung.
ad b: Bei diesem Modell besuchen die behinderten Kinder den Allgemeinen Kindergarten ihrer Wohngemeinde und erfahren zusätzliche Betreuung und Förderung durch die mobilen Teams. Bei der Integrativen Zusatzbetreuung sind wie bei den Kooperativen Stammkindergartengruppen mindestens fünf, höchstens aber sechs Kinder als Gruppe zu betrachten.
ad c: In Integrationsgruppen werden behinderte und nichtbehinderte Kinder in gemeinsamen Gruppen betreut. In Integrationsgruppen werden zusätzlich zu mindestens 5 und höchstens 6 behinderten Kindern 10 bis 12 gesunde Kinder betreut (C. Bantleon, persönliche Mitteilung, 6.12.1996; Organisationsstatut für Heilpädagogische Kindergärten, 1987).
Behindertenintegration ‚Steingruber'
EINE WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG DES HEILPäDAGOGISCHEN INTEGRATIVEN KINDERGARTENS ‚STEINGRUBER'
Inhaltsverzeichnis
Vorerst als ein Vorschulkindergarten geführt, bezeichnet sich der private Kindergarten der Familie Steingruber seit 1990 als "Heilpädagogischer, integrativer Kindergarten zur Erprobung neuer Konzepte". Mehrere Unterschiede und Besonderheiten heben das pädagogische Programm von existierenden Konzepten herkömmlicher heilpädagogischer Kindergärten (Stammgruppen, Integrative Zusatzbetreuung, integrative Kindergärten) ab und machen den Heilpädagogischen, integrativen Kindergarten "Steingruber" so zu einem Modellversuch, den es in dieser Arbeit zu kennenlernen und zu untersuchen gilt.
Diese Besonderheiten beziehen sich v.a. auf die organisatorische Struktur, auf die Schwerpunktsetzungen in der Erziehungs- und Bildungsarbeit, auf die Integrationsform, auf ein Ganzheitskonzept und auf die Teamarbeit aller Mitarbeiterinnen.
Insgesamt elf Mitarbeiterinnen sind mit der Aufgabe betraut, die Kinder ihren individuellen Ansprüchen entsprechend zu betreuen und zu fördern.
Die Aufgaben der vier Kindergärtnerinnen (von diesen sind zwei zusätzlich als Sonderkindergärtnerin bzw. Heilpädagogin ausgebildet) sind die Planung und Durchführung der Bildungs- und Erziehungsarbeit, die Betreuung und Förderung aller Kinder im engeren Sinn.
Zwei Helferinnen unterstützen die Kindergärtnerinnen in ihrer Arbeit, sei es, indem sie ihnen bei einzelnen Arbeitsangeboten assistieren oder gelegentlich Kinder abseits der Gruppe beschäftigen, wenn die Gruppendynamik allzu lebhaft wird. Weitgehendst versuchen sie mit ihren Anstrengungen die Arbeit der (Sonder-)Kindergärtnerinnen zu ebnen und die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Um eine verantwortungsbewußte Betreuung und Förderung insbesonders der behinderten Kinder zu gewährleisten, ist die zusätzliche und unterstützende Mitarbeit von speziellen Fachleuten regelmäßig notwendig. Jede der Therapeutinnen (Physikotherapie, Logopädie, psychologische Betreuung) arbeitet jeweils zwei Vormittage in der Woche mit den (behinderten) Kindern. Neben den Einzelförderungen der behinderten Kinder gehen die Therapeutinnen auch regelmäßig in die einzelnen Gruppen, um mit allen Kindern gemeinsam zu arbeiten. Dies bringt die Vorteile, dass auch alle anderen Kinder von den fachlichen Qualifikationen profitieren, dass sowohl die Kinder als auch die Kindergärtnerinnen die Integrationsmöglichkeit der behinderten Kinder anhand des fachspezifischen Handlings erkennen und danach selbst handeln können. Weiters kann sich für die behinderten Kinder der absolute Lerncharakter dieser Fördereinheiten verlieren, wenn sie in der Gruppe bemerken, wie sich die anderen Kinder von den speziellen Übungen mitreissen lassen.
Die Therapieeinheiten zuweilen in das allgemeine Gruppengeschehen einzubauen, ist ein guter Ansatz, Therapien in den Alltag und in das soziale Feld des Kindergartens einzubinden.
Alle vierzehn Tage kommt eine Kinderärztin in den Kindergarten. Ihre Funktion ist nicht die eines behandelnden, sondern eines beratenden Arztes. Sie ist nur für die behinderten Kinder zuständig, erhebt ihren medizinischen Aufnahmebefund und berät die Therapeutinnen bei den Therapieentwicklungen.
An einem Vormittag in der Woche bietet eine Amerikanerin interessierten Kindern aus den drei jahrganghöheren Gruppen einen Englischkurs an.
Eine hervorstechende Praxis im Heilpädagogischen, integrativen Kindergarten "Steingruber" ist es, dass alle Mitarbeiterinnen in Konstellation eines Teams zusammenarbeiten. Dies macht einen wesentlichen Schwerpunkt im pädagogischen Konzept aus, weshalb ich im Abschnitt 1.1.3. gerne näher auf diesen Sachverhalt eingehen möchte.
Insgesamt waren im Untersuchungszeitraum 50 Kinder aufgenommen, wovon zwölf Kinder Behinderungen (bescheidgemäß im Sinne des Steiermärkischen Behindertengesetzes festgestellt) unterschiedlichster Art (körperliche, geistige Behinderung, Entwicklungsverzögerung, Verhaltensauffälligkeit) aufwiesen.
Offiziell ist der Privatkindergarten als ein Zweigruppiger (25 Kinder/ Gruppe) geführt, inoffiziell werden die Kinder jedoch auf insgesamt vier Kleingruppen aufgeteilt. Dies vor allem mit der Absicht, die Zahl der behinderten Kinder pro Gruppe möglichst gering zu halten (in jeder Gruppe sind so nur drei Behinderte integriert) und eine intimere Atmosphäre innerhalb der Kleingruppen ermöglichen zu können.
Für die Aufnahme nicht behinderter Kinder gelten keine besonderen Attribute, man geht dabei lediglich nach dem Anmeldedatum vor. Ein einziger Punkt, den man bei der Aufnahme der behinderten Kinder beachtet, ist, dass es zu nicht mehr als einem sog. "Tragekind" pro Gruppe kommt. Als ein "Tragekind" gilt ein körperlich dermaßen behindertes Kind, das für seine Fortbewegung darauf angewiesen ist, hauptsächlich getragen zu werden. Käme auf eine Gruppe mehr als ein solches Kind, wäre die physische Belastbarkeit der Gruppenerzieherin überfordert, was konsequenterweise auch die Selbständigkeit der gesamten Gruppe einschränken würde.
Die Gruppenzuweisung der nicht behinderten Kinder wird von ihrem Geburtsjahr bestimmt. Bei der Zuteilung der behinderten Kinder in eine Gruppe nimmt man auf folgende Kriterien Bedacht (vgl. Miedaner 1986, S. 50-55; Kaplan, Rückert, Garde u.a. 1993, S. 46, 57, 62; Dichans 1990, S. 96-104; Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 1984, S. 17, 31 u. 313ff):
-Art und Schweregrad der Behinderung: Dieses Kriterium bezieht sich einerseits auf den Aspekt der ärztlichen Diagnose, andererseits - und vor allem dem ersten übergeordnet! - auf den Aspekt des Sozialverhaltens des behinderten Kindes. Mit dem Schweregrad einer Behinderung gehen oft auch Einschränkungen des Sozialverhaltens in verschiedenem Ausmaß einher. Weniger der Schweregrad der Behinderung bestimmt die Integrierbarkeit des Kindes in eine Gruppe, als vielmehr seine kommunikative Kompetenz, seine intellektuelle Verarbeitung, sein Ausdrucksvermögen, sein Selbstbewußtsein etc..
Gut zu vermeiden wäre es, zwei verhaltensauffällige Kinder in einer Gruppe zu integrieren, da Erfahrungen zeigen, dass sie sich in kritischen Situationen gerne gegenseitig aufschaukeln und Störaktionen eskalieren können. Im Gegensatz dazu kann es für körperbehinderte Kinder förderlich sein, zu zweit in einer Gruppe zu sein, wenn eventuell das eine das andere mit seiner lebensbejahenden Einstellung positiv beeinflußt.
-Altersmischung: Behinderte Kinder weisen öfters einen Entwicklungsrückstand auf, weshalb es sinnvoller ist, sie nach ihrem Entwicklungsstand den Gruppen zuzuweisen als nach ihrem Lebensalter. So besteht für sie die Möglichkeit, adäquate Spielpartner zu finden und den didaktischen Angeboten folgen zu können.
-Verhaltensschwierige nicht behinderte Kinder werden in die verschiedenen Gruppen aufgeteilt: Bei den Gruppenzusammensetzungen müssen auch kommunikative Störungen der nicht behinderten Kinder beachtet werden. So kann ein behindertes Kind, das sich durch genügend Selbstbewußtsein und Ansprechbarkeit auszeichnet, oft eher integrierbar sein, als ein sogenanntes gesundes Kind, das jegliche Kontakt- und Kooperationsbereitschaft entbehrt.
Das österreichische Schulsystem zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass die meisten Schulklassen nach einer homogenen Struktur gestaltet sind. Diese Homogenität bezieht sich in der Regel auf das Alter der Kinder, nicht, was wesentlich vernünftiger wäre, auf ihren Entwicklungsstand, ihre Begabungen und Interessen. Ähnlich verhält es sich durchwegs auch im Kindergartensektor.
Dadurch, daß die Kinder gleichen Alters in Klassen (Gruppen) zusammengefaßt werden, erscheint es den Verantwortlichen des Bildungsbereichs möglich, eine große Anzahl von Schülern (Kindergartenkindern) durch nur einen einzigen Lehrer (Erzieher)/ Lehrerin (Erzieherin) unterrichten (betreuen) zu lassen. KeinE noch so qualifizierteR und begabteR Pädagoge/in kann unter diesen Umständen einer ausreichenden Individualisierung - welche sich aus der Verschiedenartigkeit der Lernvoraussetzungen ergibt - Folge leisten.
Behindertenintegration entgeht - bedingterweise - der Fiktion der Homogenität. Integrationsgruppen sind bejahte Heterogenität hinsichtlich des Alters und der Körperverfassung, mehr oder weniger des Entwicklungsstandes, der Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Begabungen und Interessen der Kinder. Die gewöhnlich große Spannweite dieser angeführten Aspekte und die damit einhergehende Verschiedenartigkeit der Betreuungs- und Förderbedürfnisse behinderter und nicht behinderter Kinder erfordert geradezu eine Vielzahl an pädagogischen Fachkräften, beansprucht unbestritten mehrere Kompetenzen - eben ein pädagogisches Team.
Eine wissenschaftliche Begründung für das Teamsystem liefert die Systemtheorie: Durch eine heterogen gestaltete Gruppe ergeben sich derartige Aufgaben, welche ohne eine sogenannte "Komplexitätsreduktion" nicht zu bewältigen wären. Integration widerspricht einer solchen Reduktion in Richtung Homogenisierung der Gruppen, deshalb muß sich die Komplexität ausgleichend dazu auf Seiten der PädagogInnen erhöhen. Dies bedeutet somit, dass die Fähigkeiten der PädagogInnen die erhöhten Anforderungen einer heterogenen Gruppe ausgleichen müssen. Nur durch ein PädagogInnenteam kann so das Verhältnis der besonderen (kritischen) Situationen ausgelotet werden (vgl. Wocken 1991, S.19).
Alle Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen, integrativen Kindergartens "Steingruber" sind voll und ganz auf eine Teamarbeit ausgerichtet. Zusammenfassend lassen sich folgende Maßnahmen ihrer Zusammenarbeit darstellen:
-Gemeinsame Vorbereitungssitzungen: Bei diesen Gelegenheiten werden schwerpunktmäßig die Handlungsleitfäden für die didaktische Arbeit in jeder Kindergruppe für die jeweils nächsten drei bis vier Wochen gemeinsam erarbeitet. Auf diese Weise bringt jedes einzelne Mitglied seine Ideen und Vorstellungen ein, wodurch sich das inhaltliche Angebot reichhaltiger gestalten kann.
-Täglich findet eine etwa einstündig dauernde "Mittagsreflexion" unter den Erzieherinnen und den anwesenden Therapeutinnen statt. Hier werden besondere Vorkommnisse angesprochen, eventuelle Probleme im Plenum beratschlagt.
- Einmal im Monat kommen alle Mitarbeiterinnen zu einer Teamsitzung zusammen. Dabei werden Vorfälle der vergangenen Wochen besprochen, Schwerpunkte in der Arbeit mit den (behinderten) Kindern zu finden und etwaige Teamzwistigkeiten zu klären versucht.
-Gemeinsame Fortbildung: Die Teammitglieder besuchen geschlossen für sie interessante Seminare, Kurse, heilpädagogische Kongresse.
-Interne Fortbildung: Angehörige aller Berufsgruppen vermitteln ihren Kolleginnen in Schwerpunktprogrammen fachspezifisches Grundwissen (sog. "Kompetenz-Transfer").
-Zwar zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht eingeführt, aber von etlichen Seiten des Teams erwünscht, wäre eine Supervision: die kontinuierliche mentale Unterstützung der Mitarbeiterinnen durch eine Fachkraft.
Das erklärte Ziel ist es, wie es lt. dem Landesgesetzblatt Nr. 72/1991 (in der geltenden Fassung) für jeden anderen Kindergarten ebenso gilt, die Entwicklung jedes Kindes nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Kleinkinderpädagogik in allen Persönlichkeits- und Funktionsbereichen anzuregen, zu unterstützen und zu fördern. Ebenso soll das Kind auch dazu qualifiziert werden, sich in der sozialen Umwelt einzuleben, sich mit ihr auseinanderzusetzen und die dort bestehenden und aufkommenden Anforderungen bewältigen zu lernen. Unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts ist man darauf bedacht, die Kinder auf den Eintritt in die Schule vorzubereiten. Auch zu einer grundlegenden religiösen Bildung wird beigetragen.
Gemäß der eigens definierten Aufgabe für heilpädagogische Kindergärten werden behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder noch zusätzlich nach anerkannten heilpädagogischen Grundsätzen in ihrer Entwicklung gefördert (lt. Landesgesetzblatt Nr. 72/1991, §3 u. §4 i.d.g.F.).
Wie wichtig und entscheidend die Jahre vor dem Schuleintritt für die Entwicklung der kognitiven, emotionalen, motorischen und sozialen Fähigkeiten sind, ist bekannt. Gleichzeitig müssen in diesem Alter jedoch die Gefahren einer Verschulung und eines verfehlten Leistungsdenkens vermieden werden. Deshalb setzen sich die Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen, integrativen Kindergartens "Steingruber" im allgemeinen zum Ziel, den Kindern eine glückliche Kindergartenzeit zu ermöglichen, die sie weder über- noch unterfordert, und halten an ihrem Grundziel fest, das da heißt: "Freude zu vermitteln, am Zusammensein, am Spielen, am Tun und Arbeiten!" (Steingruber 1994)
Im Organisationsstatut für heilpädagogische Kindergärten ist verankert, dass in integrativ geführten Kindergruppen vier bis fünf behinderte und zwölf nicht behinderte Kinder zusammenkommen, die dann von einem/einer SonderkindergärtnerIn, einem/einer KindergärtnerIn und einem/einer HelferIn ständig betreut und gefördert werden. Nach Bedarf werden dann LogopädInnen, PhysikotherapeutInnen und PsychologInnen hinzugezogen.
Die Gruppengrößen der vier Gruppen im "Steingruber"-Kindergarten belaufen sich während den gezielten Aktivitäten auf 10, 11, 12 bzw. 17 Kinder, wovon in jeder Gruppe drei der Kinder Behinderungen unterschiedlichster Art aufweisen. Jede dieser Gruppen wird ständig von einer (Sonder-)Kindergärtnerin und einen halben Vormittag lang von einer Helferin betreut und gefördert. An jedem Tag in der Woche ist zudem noch mindestens eine Therapeutin anwesend.
Die Gruppen während den gezielten Aktivitäten demnach relativ klein zu halten, fördert eine intimere Atmosphäre und ermöglicht individualisierteres Eingehen auf jedes einzelne der Kinder.
Die Anzahl der behinderten Kinder pro Gruppe so gering zu halten, bestärkt den Einfluß der nicht behinderten auf die behinderten Kinder und erweitert die Möglichkeit der Behinderten, von den Nichtbehinderten zu lernen. "Viel gesunde Luft und gesunde Anregung - so wird das behinderte Kind mitgerissen!" (Steingruber 1994)
Zumindest einen halben Vormittag lang werden die Gruppen von nur einer (Sonder-) Kindergärtnerin geführt. Aber die Gruppen sind klein und die (Sonder-)Kindergärtnerinnen können ständig mit Unterstützung von den Helferinnen und den anwesenden Therapeutinnen rechnen. Deshalb führt dieser Sachverhalt auch zu einem begrüßenswerten Aspekt: Denn dadurch kann eine bloß auf den Raum beschränkte Integration weitgehend ausgeräumt werden. Wird dagegen eine integrativ geführte Gruppe ständig von zwei (Sonder-) Kindergärtnerinnen betreut, können beide leicht in Gefahr laufen, sich nur noch für jene Kinder zuständig zu fühlen, deren sie gemäß ihrer Ausbildung befähigt sind, d.h. die Sonderkindergärtnerin beschäftigt sich in der Hauptsache nur mit den behinderten, die andere Kindergärtnerin mit den nicht behinderten Kinder.
Die gemeinsame Förderung der behinderten und nicht behinderten Kinder im Kindergarten "Steingruber" ist aber kein unumstößlicher Leitsatz. Können die Erzieherinnen über einen längeren Zeitraum beobachten, dass sich die gesunden Kinder bedenklich an möglich auffälliges Verhalten und an geminderte Arbeitsweisen der behinderten Kinder angleichen, ist eine Trennung voneinander den halben Vormittag lange möglich. In diesen Wochen werden die nicht behinderten Kinder ausschließlich ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert, nicht zum Nachteil der behinderten Kinder, denen in dieser Zeit selbst eine besondere sonderpädagogische Förderung zukommt. Diese Maßnahme war seit Bestehen des Kindergartens aber nur ein Mal notwendig.
Unbestritten stellt der Kindergarteneintritt für ein jedes Kind ein einschneidendes Erlebnis dar. Durchwegs ist er mit Veränderungen und vielleicht somit auch mit Schwierigkeiten verbunden, die sich auf die plötzliche Umstellung des gewohnten Lebensrituals des Kindes, auf die zeitweilige Trennung von der Familie, auf das gesamte Unbekannte beziehen kann. Um den Sprung ins kalte Wasser zu vermeiden, versuchen die Kindergärtnerinnen im "Steingruber"-Kindergarten, die Neulinge schon längere Zeit vor ihrem tatsächlichen Eintritt mit der neuen Situation "Kindergarten" vertraut zu machen. So können die (nicht) behinderten Kinder während sogenannter Besuchsstunden - die langsam auf einzelne Besuchsvormittage ausgedehnt werden, ab Februar bzw. April beginnend, in den Kindergartenalltag hineinschnuppern.
Diese Vorgehensweise der Eingewöhnung bringt auch noch andere Vorteile: Die schon "eingesessenen" Kindergartenkinder lernen die "Neulinge" zwanglos kennen und können sie behutsam in ihrer Gruppe aufnehmen. Die Betreuerinnen haben durch die zeitweilige Anwesenheit der neuen Kinder die Möglichkeit, sich von ihnen ein grobes Bild zu machen, ihre Bedürfnisse an Zuwendung und Aufmerksamkeit einzuschätzen und dies dann bei der endgültigen Gruppenzuteilung im Herbst zu berücksichtigen: Nicht zuletzt haben auch die Eltern die Gelegenheit, Einblick in das Angebot des Kindergartens zu gewinnen und so letztendlich entscheiden zu können, ob es mit ihren Vorstellungen der Kinderbetreuung und -förderung im Einklang steht.
Es ist eine Besonderheit, dass die Organisation des Tagesablaufs täglich am Morgen neu geplant wird. Natürlich halten sich die Mitarbeiterinnen an grobe Richtlinien (diese gewähren insbesonders den jüngeren und behinderten Kindern die nötige Sicherheit und Orientierung am Tagesgeschehen bzw. ersetzen das noch mangelnde Zeitverständnis), doch Feinheiten (welche Gruppe benützt wann den Turnsaal, welche Gruppe hält sich in welchen der vier unterschiedlich ausgestatteten Räumen auf, wann holen die Therapeutinnen die behinderten Kinder zur Einzelförderung bzw. sollen sie in der gesamten Gruppe arbeiten) werden unter Absprache aller Betreuerinnen jeden Tag neu bestimmt.
Folgend eine kurze Darstellung des Tagesablaufs:
-
7.00 bis 9.00 Uhr: "freie Freispielzeit"
-
9.00 bis 12.00 Uhr: Gezielte Aktivitäten in der Gruppe (Vorschulgruppe, Bewegungserziehung - Turnen od. Rhythmik, Jause, sprachliches Angebot - Geschichten, Lieder, Sprüche, gezielte Beschäftigung - Malen, Zeichnen, Basteln, Werken, Gesellschaftsspiele)
-
12.00 bis 12.30 Uhr: Freispielzeit (im Garten od. im Haus)
Spätestens um 8.30 Uhr sollen alle Kinder eingetroffen sein, bis 9.00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, sich in dieser sog. "freien Freispielzeit" Spielpartner und -beschäftigung selbst zu wählen, wobei sie weder an ein bestimmte Gruppe noch an einen bestimmten Raum gebunden sind. In dieser Zeit sollen sich die Kinder auf den Kindergartentag einstellen können.
Ab 9.00 Uhr schließen sich die Kinder zu ihren Gruppen zusammen und fortan bestimmen vier Aktivitätseinheiten den inhaltlichen Hergang: Bewegungserziehung, sprachliches Angebot, gezielte Beschäftigung und Jause. Zu welchem genauen Zeitpunkt, in welchem Raum und wie im Genauen (Freispiel und Arbeitszeit in Balance) die einzelnen Einheiten abgehalten werden, bestimmen morgens die Betreuerinnen bzw. hängt von den Bedürfnisse der Kinder ab.
Ab 12.00 Uhr können sich die Kinder wieder frei beschäftigen, bis sie abgeholt werden.
Neben den täglichen Regelmäßigkeiten prägen auch die sich wöchentlich wiederholenden Aktivitäten die Gestaltung des Kindergartenalltags:
-
Jede Woche beginnt montags mit dem sog. "feierlichen Wochenbeginn", bei dem sich alle Kinder aller Gruppen, alle Betreuerinnen, sowie auch alle an diesem Tag anwesenden Therapeutinnen im Turnsaal versammeln. Dabei wird gemeinsam gesungen und einzelne Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse vom aufgearbeiteten Themenschwerpunkt der Vorwoche. Da alle Gruppen immer denselben Themenschwerpunkt behandeln, natürlich alters- und entwicklungsgemäß adaptiert, sind die Inhalte der Präsentationen jedem Kind verständlich, die unterschiedliche Bearbeitung eine Bereicherung.
-
Dieses Ritual verhindert, dass sich die Gruppen voneinander isolieren, die Kinder sich untereinander fremd werden und sich ihre Gemeinsamkeit bloß auf den Besuch des gleichen Kindergartens beschränkt. Dieser gruppenunabhängige Verkehr zwischen den Kindern (und den Betreuerinnen) wird auch in der "freien Freispielzeit" forciert. Auf diese Weise können alle Kinder mit allen Kontakt halten, egal welcher unterschiedlichen Gruppe sie auch angehören.
-
Jeden Freitag können Kinder der ältesten Gruppe Flöte spielen lernen.
-
Freitags jeder Woche haben motivierte Kinder aus den drei ältesten Gruppen die Möglichkeit, an einem Englischkurs teilzunehmen.
Auch jahreszeitliche Bedingungen spiegeln sich in der Gestaltung des Tagesrhythmus` wider. Besonders in den wärmeren Jahreszeiten gewinnt der große, hauseigene Garten an Bedeutung. Ein Großteil der gezielten Aktivitäten wird im Freien abgehalten.
Eine weitere Besonderheit des pädagogischen Konzepts zeichnet sich mit dem sog. "BetreuerInnenwechsel" aus. Dies bedeutet, dass die einzelnen Gruppen nicht ständig von ein und derselben (Sonder-)Kindergärtnerin betreut werden, sondern dass sich die Erzieherinnen in regelmäßigen Abständen von drei bis vier Wochen in der Aufsicht der Gruppen wechseln. Daraus lassen sich folgende Vorteile ableiten:
-
Würde jede Gruppe ständig von der gleichen (Sonder-)Kindergärtnerin betreut, würden sich früher oder später die einzelnen Gruppen fix manifestieren und sich von den anderen abtrennen. Zudem würde jede Erzieherin nur noch für sich und die ihr anvertrauten Kinder arbeiten. Im Sinne der Teamarbeit (siehe Abschnitt 1.1.3) ergibt es sich geradezu als Voraussetzung, dass sich alle Betreuerinnen für alle Kinder gleichsam zuständig fühlen.
-
Der Betreuerinnenwechsel kann Rivalitäten und Konkurrenzverhalten zwischen den Gruppen und den Erzieherinnen verhindern.
-
Da sich die Gruppen so gegeneinander nicht abgrenzen, bewahrt der Kindergarten ein familiäres Flair. Jeder kennt jeden und hat mit jedem zu tun.
-
Überall, wo Menschen zusammenkommen, ergeben sich Sympathien und Antipathien. Selbst das Berufsethos schützt nicht davor, dass ein Verhältnis zwischen Erzieherin und Kind nicht gerade von Sympathie getragen sein kann. Ist das der Fall, ist es für beide Seiten angenehmer, wenn ein regelmäßiger Wechsel der Betreuerinnen stattfindet.
-
Auch die individuelle Förderung und Betreuung der Kinder hat optimale Ausgangschancen: Durch den Wechsel erkennt jede Erzieherin Fähigkeiten eines jeden Kindes, die einer anderen Betreuerin vielleicht entgangen wären. Durch Gespräche unter den Betreuerinnen können die Bedürfnisse der Kinder besser abgeklärt und es kann darauf folglich besser eingegangen werden.
-
Dieser Wechsel spornt die (Sonder-)Kindergärtnerinnen auch an, sich immer wieder Gedanken und Mühe zu machen, um den einzelnen Gruppen mit ihren jeweiligen Anforderungen gerecht werden zu können. Dies verhindert eine möglich drohende Stagnation in den Erziehungsbemühungen, hält das Engagement und die Freude an der Arbeit aufrecht.
-
Die Kinder können so von allen individuellen Fähigkeiten jeder einzelnen Erzieherin profitieren und sind zudem nicht von nur einer einzigen Erziehungsvorstellung gelenkt. Zwar verfolgen alle Betreuerinnen dieselben Erziehungsziele, dennoch werden sich unterschiedliche Facetten in Werthaltung und Betonung der Schwerpunkte ergeben.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Kinder - bis auf wenige Ausnahmen - vom Betreuerinnenwechsel nicht irritieren lassen. Zu Beginn des Kindergartenjahres wird verstärkt darauf Augenmerk gelegt, dass sich die Kinder - insbesonders in ihrer eigenen Gruppe - intensiv kennenlernen und zusammenkommen. An sich ist die Gruppe und ihr Zusammenhalt für die Kinder wichtiger als die jeweilige Person, die sie betreut.
Eine Hilfe, diesen Betreuerinnenwechsel leichter annehmen zu können, ist auch sicherlich die sog. "freie Freispielzeit" (siehe Kapitel 1.2.1.3.), in der alle Betreuerinnen und alle Kinder ohne jegliche räumliche Beschränkungen interagieren können.
Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bildungsbemühungen der Betreuerinnen an den Kindern: egal ob der jüngsten oder einer der älteren Gruppen zugehörig, egal ob behindert oder nicht: alle Kinder lernen am gleichen Gegenstand! Das heißt, in den Vorbereitungssitzungen zur Planung der didaktischen Einheiten entscheiden die (Sonder-) Kindergärtnerinnen gemeinsam über einen Themenschwerpunkt, der folglich in den nächsten 14 Tagen mit allen Kindern aller Gruppen näher behandelt und ausgearbeitet werden soll. Unterschiede in den - das Thema abhandelnden - Aktivitäten ergeben sich einzig und allein durch alters- und entwicklungsbedingte Adaption der speziellen Angebote.
Um besonders den behinderten Kindern dieselbe Startposition bei der eigentlichen Durchführung des Angebots in der gesamten Gruppe offenzuhalten, bereitet man sie auf bevorstehende Aktivitäten eigens vor. Dabei werden die Inhalte vorweggenommen und mit verschiedensten Hilfsmittel zum Anschauen und Angreifen "entschlüsselt". So ist es möglich, das Verständnis und das Wissen dieser Kinder weitgehendst nächst dem Stand der übrigen anzugleichen.
Die Betreuerinnen legen besonderes Augenmerk darauf, den Kindern eine gewissenhafte Arbeitshaltung zu vermitteln. Dies geschieht unter anderem damit, Spiel- und Arbeitszeiten konsequent zu trennen. So sollen die Kinder von klein auf lernen, zwischen den Zeiten zu unterscheiden, in denen sie zum einen konzentriert an einer Sache zu arbeiten haben und es ihnen zum anderen völlig freisteht, sich ganz nach ihren eigenen Wünschen zu beschäftigen.
In diesem Sinne können sich die Kinder während den freien Zeiten zum Spielen nach Belieben ihre Spielkameraden, ihre Beschäftigung und auch den Raum (keine Gruppengrenzen) frei wählen, können selbst entscheiden, wie lange sie bei einer Tätigkeit bleiben, wann sie das Spiel wechseln wollen.
So frei die Kinder in der Freispielzeit agieren können, so kompromißlos haben sie sich während der Zeit gezielt gestellter Angebote (Arbeitszeit) an eine Hauptregel zu halten: Egal ob sie für einzelne Angebote Lust und Willen aufbringen können oder nicht, auf alle Fälle haben sie an diesen teilzunehmen. Diese Forderung begründet sich hauptsächlich mit drei Motiven:
-
Zum Ersten soll das Kind dadurch eine klare Unterscheidung zwischen Arbeit und Spiel erlernen, mit der Einhaltung dieser Zeiten zu einer gewissenhaften Arbeitshaltung gebracht werden.
-
Zum Zweiten kann ein an sich selbst zweifelndes Kind womöglich umgepolt werden. Denn oft liegt der Verweigerung zur Teilnahme an bestimmten Aktivitäten einzig die Hemmung des Kindes zugrunde, da es sich die Arbeit nicht zutraut und sich - aus der Angst heraus, zu versagen oder sich vor den anderen Kindern zu blamieren - daran nicht beteiligen will. Wird es dann dennoch in der Gruppe gehalten, sieht es die Ergebnisse der anderen Kinder und kann vielleicht daran erkennen, dass es nicht nur Genies gibt. Womöglich versucht das Kind es dann doch, die Aufgabe zu lösen.
-
Zum Dritten kann man ein augenscheinlich interessensloses Kind eventuell zu seinem Glück zwingen, kommt doch der Appetit auch erst oft beim Essen. Umgelegt bedeutet das, dass sich das Interesse des Kindes vielleicht doch noch wecken läßt, wenn es den anderen Kindern beim Arbeiten erst einmal zusieht.
Oft liegt es am Erzieher, unmotivierten Kindern in kleinen Schritten das Angebot schmackhaft zu machen und sie konsequent im Arbeitskreis zu halten. Würde man Ausnahmen gewähren (derweil sich anderwertig zu beschäftigen), wären vielleicht bald andere Kinder mitgerissen und ein ernsthaftes Arbeiten wäre kaum noch möglich.
Gewöhnlich alle drei bis vier Wochen setzen sich alle Mitarbeiterinnen in sog. Vorbereitungssitzungen zusammen, um über das in der nächsten Zeit zu behandelnde Rahmenthema zu entscheiden.
Diese Vorgangsweise, die Planung der didaktischen Angebote im Plenum durchzuführen, ergibt sich zum einen aus den Voraussetzungen für eine erträgliche Teamarbeit (siehe Abschnitt 1.1.3.), zum anderen aus einem Punkt des Ganzheitskonzepts, nämlich dass alle Kinder am gleichen Gegenstand lernen (siehe Abschnitt 1.2.2.1.). Zusätzlich werden die gesamte Kindergartenarbeit und die Ergebnisse dahingehend bereichert, als dass unterschiedliche Anregungen, Ideen, Fragen und Vorschläge einfließen.
Die Entscheidung für ein Rahmenthema macht sich abhängig von den aktuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder wie auch der Betreuerinnen, von aktuellen Ereignissen und von Themen, die - im Sinne von Differenzierung und Integration - individualisierte Arbeitsweisen zulassen.
Dadurch, dass ein und dasselbe Rahmenthema in allen vier Gruppen im Schwerpunkt gleichermaßen abgehandelt wird, kommt durch diese Art der gemeinsamen Planungsarbeit jede Erzieherin zu ihrem groben Konzept, muß die einzelnen dazu erdenklichen Aktivitäten nur noch für ihre Gruppe alters- und entwicklungsgemäß adaptieren. Dabei sind die Betreuerinnen darauf bedacht, dass bei den einzelnen Tätigkeiten möglichst alle Fähigkeiten und Fertigkeiten angesprochen und erprobt werden und dass sich im Sinne der Differenzierung und Integration die Angebote möglichst vielfältig aufarbeiten lassen.
Die Planung der Inhalte ist eine relativ fixe, doch die Offenheit für Flexibilität zeigt sich unter anderem dadurch, dass nicht zuletzt die Kinder mitentscheiden, wie lange man tatsächlich an den einzelnen Angeboten festhält. Zeigen die Kinder großes Interesse an einzelnen Tätigkeiten, werden diese weiter als geplant ausgebaut und demnach länger behandelt.
Manches Mal kommt es auch vor, dass gewisse Angebote aus der Kreativität der Kinder erwachsen. Wenn sich mehrere Kinder für eine spontane Idee begeistern können, wird diese von der Erzieherin aufgegriffen und in eine Aktivität mit eingebaut - ganz nach dem Motto: "Spontan auf das Gruppengeschehen eingehen können, ohne das große Ding an der Sache zu vergessen" (Steingruber 1994).
Die Kriterien, nach denen die Materialien ausgewählt werden, sind vielseitig. So ist es wesentlich, dass für die Kinder gut greifbare Spielsachen etc. verwendet werden, dies mit besonderen Nachdruck, seitdem der Kindergarten als ein heilpädagogisch integrativer geführt wird. Zahlreiches Anschauungs- und Bildmaterial ebnen den Weg, um Themen wirklich vom Sehen zum Begreifen (im doppelten Sinne) bearbeiten zu können: über Schauen - Greifen - Spüren letztendlich zum realitätsnahen (Er-)Lernen.
Im Großen und Ganzen werden dieselben Materialien wie in Regelkindergärten verwendet. Im Prinzip gibt es kaum Spiele und dergleichen, die nicht auch in einer gemischten Gruppe eingesetzt werden können. Die überwiegende Verwendung "gängiger" Materialien ist allein schon deshalb selbstredend, weil doch überwiegend drei Viertel der Kinder pro Gruppe nicht behindert sind. Zum anderen können die behinderten Kinder häufig mit denselben Materialien umgehen, da ihre Beeinträchtigungen selten deren gedachte Einsatzmöglichkeiten verwehren. Ist dies mit wenigen Ausnahmen doch der Fall (z.B. Puzzles mit kleinen, unhandlichen Teilen; Spiele mit schwierigen Regeln; schwierig faßbare Legespiele etc.), vereinfacht ( Spiel durch einfachere Spielregeln umgestalten) oder adaptiert man sie (kleine Knöpfe der Legespiele durch größere ersetzen oder auf die kleinen Knöpfe Kluppen setzen) bzw. greift auf eigens für behinderte Kinder angeschafftes Material zurück (Puzzles mit großen, einfachen Teilen; Lasy-Steine etc.). Die Vorschläge, wie die Erzieherinnen Spielzeug eventuell behindertengerecht umgestalten können, kommen in den meisten Fällen von Frühförderern.
Bei der Auswertung der Interviews mit den Erzieherinnen ergab sich u.a. das Ergebnis, dass im Vordergrund ihrer pädagogischen Grundhaltung bei der Betreuung und Förderung der (behinderten) Kinder die didaktischen Konzeptionen des situationsorientierten, sowie spielorientierten Ansatzes und des Sozialisationsansatzes stehen:
-
Der situationsorientierte Ansatz: Diese didaktische Konzeption entspricht weitgehendst einem Lernen in realen Lebenssituationen. Dabei eignen sich die Kinder ebenso grundlegende Funktionen an, jedoch nicht in isolierten und künstlich erstellten Situationen, wie es z.B. im funktionsorientiertem Ansatz mit Hilfe von Trainingsmappen der Fall ist. Diese Art von Lernen orientiert sich weniger an zu fördernden Einzelaspekten, vielmehr werden wichtige Funktionen im Gesamten und zugleich an typischen Lebenssituationen, die dem Kind allgegenwärtig sind, gefördert.
-
Die Orientierung am Spiel: Auch dieser Ansatz betont die ganzheitliche Erziehung anstatt einem pointierten fachdidaktischen Lernen. Das spielerische Lernen kann sich sowohl in gesteuerten wie auch in freien Situationen vollziehen (z.B. in Rollenspielen, im täglichen Miteinander-Umgehen, in Materialerfahrungen, etc.)
-
Der Sozialisationsansatz: Dabei kommt es darauf an, Bedürfnisse und Entwicklungskräfte des Kindes nicht in meßbaren Funktionen des Gelernten, sondern in den grundlegenden Dimensionen des Sozialvorganges (Miteinander-Umgehen, Alltagsbewältigung, etc.) zu fördern. (Vgl. Liegle in: "Der Kindergarten" Band 3 1978, S. 28-37; Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 1984, S. 109-112).
Bei der Betreuung und Förderung von heterogen zusammengesetzten Gruppen sind es eben genannte Ansätze, die dafür am geeignetsten erscheinen, da sie für Inhalte und Zielaspekte am offensten sind und zudem ein Mitarbeiten, Lern- und Entwicklungsschritte gerade für die in ihren Funktionen eingeschränkten Kinder ermöglichen.
Ansonsten verschreibt sich der "Steingruber-Kindergarten" keiner speziellen Pädagogik (z.B. einer Waldorf- oder Montessori Pädagogik). Nach Frau Steingruber wäre es nicht richtig, sich nach jeder wie auch immer gearteten Einseitigkeit zu richten. Denn könne das Kind anschließend keine ebenso orientierte Schule besuchen, fände es sich wahrscheinlich nur schwer zurecht. Deshalb holen sich die Betreuerinnen aus den verschiedensten Methoden das heraus, was ihnen in ihr Erziehungsverständnis zu passen scheint.
Sofern ich in den bereits beschriebenen Konzeptpunkten noch nicht auf die spezielle Betreuung und Förderung der behinderten Kinder gesondert eingegangen bin, möchte ich hier noch wesentliche Maßnahmen dazu ergänzen.
Im Großen und Ganzen ist zu bemerken, dass die Erziehungs- und Betreuungsziele für die behinderten Kinder genauso gelten wie für die nichtbehinderten Kinder auch. Ist es doch im Sinne der sozialen Integration, die
-
die gemeinsame Tätigkeit (spielen, lernen, arbeiten)
-
am gemeinsamen Gegenstand/ Produkt
-
in Kooperation von behinderten und nicht behinderten Kindern (vgl. Feuser 1984, S. 18) stark betont.
-
Nichtsdestotrotz ist eine sonderpädagogische Förderung der behinderten Kinder auf den Grundlagen einer fortlaufenden heilpädagogisch-psychologischen Diagnostik und einer regelmäßigen Verhaltensbeobachtung sicherzustellen. Diese heilpädagogisch-psychologische Diagnostik soll zu einem integrativen, individuellen Förderprogramm und zu konkreten operationalisierbaren Handlungsanweisungen führen. Daraus ergibt sich als eine erste Voraussetzung die Erhebung des "Ist-Zustandes" durch die Kinderärztin und durch die Therapeutinnen. Sie untersuchen das neu aufgenommene behinderte Kind, erstellen Anamnese und derzeitigen Befund. Als zweiter Schritt ist das angestrebte "Soll-Ziel" zu definieren. Der dritte Schritt sollte die Änderungs- und Fördermaßnahmen aufzeigen, d.h., es soll von den Therapeutinnen und der Ärztin Therapien und der Förderungsplan aufgestellt werden, die immer wieder überprüft (durch Verhaltensbeobachtung und fachkundige Untersuchungen) und in Kooperation mit dem Team nach Bedarf modifiziert werden sollen (prozeßorientierte Förderungsdiagnostik).
-
Die Therapiemaßnahmen: Siehe Kapitel 1.1.1.
-
Zusammenarbeit, Erfahrungs- und Informationsaustausch der Therapeutinnen und der (Sonder-)Kindergärtnerinnen: Siehe Kapitel 1.1.1. und 1.1.3.
-
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen: Insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den Frühförderern, die das Kind außerhalb des Kindergartens sonderpädagogisch betreuen, ist man sehr bedacht. Selbst auf die Weiterführung der sozialintegrativen Erziehung in Schulen, welche die behinderten Kinder nach Ablauf der Kindergartenzeit besuchen, wird geachtet und Kontakt gehalten.
-
Besondere Unterstützung bei Gruppenaktivitäten: Behindertengerecht adaptierte Spielmaterialien (siehe Kapitel 1.2.3.1.), eigene Vorbereitungszeiten mit dafür eigens erstellten Materialien (siehe Kapitel 1.2.2.1.), besonderer Beistand bei den Arbeitsangeboten, entwicklungsadaptierte Aufgabenstellung.
-
Schulvorbereitung: Behinderte Kinder, die nach Ablauf des Kindergartenjahres voraussichtlich in die Schule eintreten werden, werden täglich etwa eine halbe Stunde lang mit den bevorstehenden Anforderungen vertraut gemacht. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen dabei Übungen zur Lockerung und Entkrampfung der Handgelenke, um somit im Weiteren die sensomotorische Koordination und die feinmotorischen Fertigkeiten in Hinblick auf das Schreibenlernen schulen zu können. (Auch den baldigst schulpflichtigen nicht behinderten Kindern werden spezielle Vorschulübungen angeboten, um so noch etwaig vorhandene Schwächen auszugleichen bzw. besondere Interessen zu fördern.)
-
Die räumliche Ausstattung: Im privaten Haus der Frau Steingruber sind drei Ebenen für den Kindergartenbetrieb adaptiert. Die großzügige Fläche von ungefähr 300m2 ist folgendermaßen genutzt: im Tiefparterre befinden sich der Therapieraum und ein etwa 70m2 großer Turnsaal. Im Erdgeschoß und im ersten Stock sind jeweils zwei Gruppenräume (à 30m2) und jeweils eine Veranda zu 10m2 unterschiedlichst ausgestattet. Neben den konventionellen Möbeln sind auch überall besonders behindertengerechte Einrichtungsstücke zu finden: spezielle Sesseln ("Rodeo"), extra angehobene Tischhöhen und speziell adaptierte Kinderstühle (mit Fußstützen versehen). Weiters ermöglichen sog. "Stehbretter", an denen beispielsweise spastisch gelähmte Kinder mit Windeln festgebunden werden, auch stehend zu arbeiten. Zur Unterstützung beim Sitzen und Liegen am Boden stehen Schaumstoffrollen und Liegekeile zur Verwendung bereit. Der 1.800m2 große Garten kann dem Abenteuer-, Bewegungs- und Forschungsdrang der Kinder mehr als gerecht werden. Hier finden sich nebst den üblichen Spielgeräten eine riesige Holzspielanlage, ein Bassin, eine kleine Zuganlage und nicht zuletzt der Stall eines Esels.
-
Die personelle Ausstattung und die Qualifikation der Mitarbeiterinnen: Die Qualifikation aller für die Betreuung und Förderung der Kinder verantwortlichen Fachkräfte ist eine der wichtigsten Voraussetzung dafür, dass insbesonders integrative Erziehung gelingen kann. Besonders wenn es behinderte Kinder zu betreuen gilt, ist ein "guter Hausverstand" im Umgang mit den Kindern allein nicht ausreichend, es bedarf fachlichen Wissens auf dem Gebiet seiner Arbeit, damit der Erfolg der gemeinsamen Betreuung und Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder nicht auf dem Prinzip des Zufalls basiert. Fundierte Berufsausbildung allein reicht jedoch nicht aus; Qualifikation wird v.a. erst dadurch erreicht, wenn man sich laufend fort- und weiterbildet, engagiert im Beruf bleibt. (Siehe dazu auch die Kapitel 1.1.1. und 1.1.3).
-
Die Gruppenzusammensetzung und Gruppengröße: Siehe dazu die Abschnitte 1.1.2. und 1.2.1.1.
-
Gestaltung der Lernprozesse: Die Gestaltung der Lernprozesse birgt drei wesentliche Gefahrenmomente (vgl. Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 1984, S.18,19): Die Gefahr der Ritualisierung (zu starr an einem einmal festgelegten Ablauf zu halten und dadurch die Flexibilität, Spontaneität und Improvisation der Kinder zu untergraben), die Gefahr der Verschulung (mitsamt den ev. Folgen von verfehltem Leistungs- und rücksichtslosem Konkurrenzdenken) und die Gefahr der Therapeutisierung (Therapien mit behinderten Kinder werden überbetont). Die Mitarbeiterinnen im Kindergarten "Steingruber" versuchen diese Gefahrenmomente zu umgehen, indem erstens eine Balance zwischen Planung und Flexibilität des Tagesablaufs gehalten wird, um den Kindern einerseits schon einen Überblick über die Einteilung des Tagesgeschehens zu ermöglichen, sie auf der anderen Seite aber nicht allzu sehr in ihrer (Gruppen-)Dynamik einzugrenzen (siehe dazu auch Kapitel 1.2.1.3.). Zweitens steht bei der Durchführung von Arbeitsangeboten wohl die alters- und entwicklungsadäquate Förderung im Vordergrund, aber dabei wird sehr stark die Kollegialität, die Kooperation und die kritische Selbsteinschätzung gefördert. Drittens sind Therapiemaßnahmen an den behinderten Kindern sehr überlegt in das soziale Feld des Kindergartens eingebaut (siehe dazu auch Abschnitt 1.1.1.).
-
Der Kontakt zu den Eltern: Erziehungsbemühungen im Kindergarten sind durchgehend als Ergänzung zur Erziehung im familiären Rahmen zu sehen. Werden Kinder, insbesonders behinderte, zusätzlich außerhalb der Familie betreut und gefördert, ist ein enger Kontakt zum Elternhaus Voraussetzung. Es geht dabei immerwieder darum, einen gegenseitigen Informationsfluß zwischen den BetreuerInnen und den Eltern aufrecht zu erhalten. So kann im Kindergarten unter Berücksichtigung von (aktuellen) Lebensereignissen und -umständen individueller auf die Kinder eingegangen werden. Zudem ist es sehr wichtig, dass sich die Betreuer und die Eltern (behinderter) Kinder über die jeweiligen Entwicklungschancen im Klaren sind. Erwartungen an Fortschritte der Kinder müssen berechtigt und dürfen keinesfalls zu hoch geschraubt sein, sonst stehen alle Beteiligten unter einem ständigen Erwartungsdruck.
-
Im Kindergarten "Steingruber" setzt man allerhand Bemühungen, den Kontakt zu den Eltern zu pflegen (Elternabende, Einzelgespräche, gemeinsame Feste und Spielenachmittage). Vor allem auch unter dem Aspekt, den integrativen Prozeß auch außerhalb der Kindergartenzeit zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
Sinn und Aufgabe meines Teils zur umfassenden wissenschaftlichen Begleitung des Heilpädagogischen, integrativen Kindergartens "Steingruber" war es, die Form der gemeinsamen Betreuung und Förderung der behinderten und nicht behinderten Kinder unter bestimmten Kriterien und ausgewählten Aspekten kritisch auf ihre Wirkung hin zu untersuchen, also zu evaluieren. Dabei soll "Evaluation" hier als Synonym für "Begleitforschung" verstanden werden, da dieses Projekt auf eine Begleitung, auf eine Beschreibung eines Bildungsprogramms (dem pädagogischen Konzept) und seiner Realisierung abzielt und nicht den Anspruch erheben soll, bestehende Grundsätze zu kontrollieren oder gar verändern oder verbessern zu wollen.
In dieser Arbeit geht es darum, aufzuzeigen, wie in diesem Kindergarten versucht wird, Integration zu verwirklichen und ob sie sich in beabsichtigter Weise auswirkt. Es soll nicht entschieden werden, ob die Qualität der Kindergartenarbeit im Heilpädagogischen, integrativen Kindergarten "Steingruber" anderen heilpädagogischen (integrativen) Kindergärten über- oder unterlegen ist. Das Generalkonzept dieser Arbeit drückt sich somit in der Gegenüberstellung des theoretischen Programms mit der Realität aus.
Um diese Gegenüberstellung anstellen zu können, entschloss ich mich für halbstandardisierte Interviews mit allen Mitarbeiterinnen, für die Verhaltensbeschreibung der Kinder mittels einer Analyse von Videoaufnahmen und für die Beschreibung von Tagesabläufen.
Auf die Methodik der Datengewinnung möchte ich hier nicht detaillierter eingehen, diese kann aber in meiner Dissertation nachvollzogen werden.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass meine Beobachtungen und gewonnenen Erkenntnisse für diese wissenschaftliche Begleitung einer momentanen Beschreibung genügen (Zeitraum Mai 1994 bis Juni 1995). Das untersuchte Verhalten der beobachteten Kinder und auch das Verhalten der Mitarbeiterinnen können sich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ganz anders präsentieren. Neue Erfahrungen und Einsichten der Mitarbeiterinnen, neue Gruppendynamiken, können die Betreuung und Förderung der Kinder heute durchaus unterschiedlich aussehen lassen.
Die spastisch gelähmte Desirée und fünf andere - nicht behinderte - Mädchen sitzen um einen Tisch. Desirée und Katja, eines der nicht behinderten Mädchen, spielen mit den Musterwürfeln, die Übrigen zeichnen. Man beginnt darüber zu reden, wie Desirée an diesem Tag, während eine Geschichte im Sesselkreis vorgelesen wurde, der Schnupfen über die Nase lief und sie sich allein nicht helfen konnte - nämlich ein Papiertaschentuch zu holen.
Caroline:"Die Desy ist ja behindert."
Katja:"Stimmt nicht!"
Caroline, wendet sich zu Anna:"Doch; gell, die Desy ist behindert?!"
Katja:"Aber nur gehbehindert!"
Caroline:"Und Schneuzen kann sie sich auch nicht."
Desirée:"Aber das lern` ich auch noch; ich versprech`s!"
Katja:"Und am nächsten Sommerfest kann sie vielleicht schon gehen."
Caroline:"Ja, vielleicht. Hoffen wir`s!"
Dieses eine Beispiele dokumentiert recht gut die allgemeine Grundhaltung der Kinder, miteinander umzugehen.
Die gesamte Gruppendynamik innerhalb der (beobachteten) Gruppen fiel durchaus positiv auf - was nicht zuletzt auf eine gelungene Gruppenzusammensetzung schließen läßt: Schwerwiegende Reibereien waren in der Zeit meiner Untersuchung niemals zu beobachten, kleinere Streitigkeiten und Schwierigkeiten werden wohl immerwieder auftreten, wenn Menschen, insbesonders Kinder mit ihrem ehrlichen und offenen Gehabe, zusammenkommen.
Die behinderten Kinder der (beiden beobachteten) Gruppen schienen überaus verständnisvoll und als ganz selbstverständlich aufgenommen und integriert zu sein. Ihre behinderungsspezifischen Auffälligkeiten störten bisweilen nur unwesentlich das gesamte Gruppengeschehen, was u.a. wohl auch auf die geringe Anzahl von nur drei behinderten Kindern pro Gruppe zurückzuführen sein dürfte.
Es war für mich auch zu erkennen, dass die Kinder mit körperlichen Behinderungen von den übrigen Kindern als geringer behindert definiert wurden, als z.B. verhaltensauffällige. Letztere wurden von den Kindern des öfteren kritisiert, sich beispielsweise nicht dermaßen aggressiv und/ oder störend zu verhalten.
Im Gesamten gesehen kamen die Kinder sowohl in der Freispiel- wie auch in den Arbeitszeiten gut miteinander aus und zurecht, wie es sich aus den Interpretationen der Beobachtungsschemata rückschließen läßt: Alle Kinder standen sehr oft in Kontakt miteinander, nur selten kam es vor, dass sich einzelne Kinder der Gruppe ausschlossen bzw. ausgeschlossen wurden. Auch war beinahe keinerlei dominantes Verhalten der Kinder zu registrieren und es konnte durchwegs beobachtet werden, wie gut sich die Kinder untereinander einordnen konnten. Bemerkenswert war auch der Hang der Kinder, andere in deren Bedürfnissen zu achten und bisweilen eigene Wünsche deshalb zurückzustellen. Ganz selten kam es vor, dass einzelne Kinder andere in deren Interessen ignorierten und unter allen Umständen ihre eigenen Wünsche stur durchsetzen wollten. Es waren wenige Konflikte zu beobachten, doch wenn sie auftraten, wurden sie in der Hauptsache von den daran Beteiligten untereinander gelöst, nur ein (behindertes) Mädchen richtete sich in strittigen Situationen an die Erzieherin. Es ergaben sich zwar nur wenige solcher Situationen, aber wenn doch, zeigten sich etliche Kinder dazu freiwillig bereit, der Gruppe/ einem Mitglied Hilfe zu leisten. Absolut kein Kind vermittelte den Eindruck, scheu und unsicher im Kontakt mit Erwachsenen zu sein, sie zeigten durchwegs Vertrauen und Sicherheit den Betreuerinnen gegenüber.
Bei den gezielten Angeboten schien nur ganz selten ein Kind teilnahmslos, und so gut wie kein Kind fiel störend auf oder unterbrach Aktivitäten anderer. Außerdem bewiesen alle Kinder, sich den Spielregeln folgend der gegebenen Situation ein-, über- oder unterordnen zu können. Nur wenige (behinderte) Kinder konnten bisweilen den Spielregeln nicht nachkommen. Ergab sich die Notwendigkeit, hielten sich alle Kinder an die Anforderungen der Erzieherin und kaum jemand wollte nicht darauf hören. Das Interesse der Kinder, von sich aus an den gezielten Angeboten teilzunehmen, war sehr stark ausgeprägt, nur manchmal mußte ein (behindertes) Kind zum Mitmachen ermuntert werden. Nur zwei Kinder zeigten sich während des gesamten Untersuchungszeitraumes, und dies auch nur ganz selten, mit ihren Leistungen unzufrieden. Schon öfters kam es hingegen vor, dass sich manche Kinder nach Ideen anderer richteten (etwas nachmachten). Die meisten Kinder arbeiteten in der Hauptsache selbstbewußt und zielgerichtet an einer Aufgabenlösung, waren größtenteils lange an der Sache konzentriert und bewiesen auch genügend Ausdauer, den Aktivitäten zu folgen. Nur manches Mal fiel es einzelnen Kindern schwer, sich nicht von einem speziellen Angebot ablenken zu lassen. Der Großteil der Kinder bemühte sich meist, die Ausführung der einzelnen Tätigkeiten sorgsam zu erledigen und nur wenige Kinder bedurften dabei einer verbalen oder aktiven Hilfestellung einer Betreuerin.
Die Qualifikation der Mitarbeiterinnen: Eine heilpädagogische Zusatzausbildung ist für die ErzieherInnen in heilpädagogischen Kindergärten sicherlich wünschenswert, was jedoch nicht unbedingt bedeuten muß, dass man ohne sie weniger gut arbeiten kann. Zwei der vier Kindergärtnerinnen im "Steingruber"-Kindergarten verfügen über eine solche Spezialausbildung, den anderen beiden, sowie auch den Helferinnen, kann man diese Fähigkeiten aber fast ebenso zusprechen. Zudem sollte man bedenken, dass man sich in der praktischen Arbeit und durch den ständigen Kontakt mit den Kolleginnen genauso gut - wenn nicht sogar effizienter als in einem theoretisch ausgerichteten Studium - behinderungsspezifische Kenntnisse aneignen und anwenden kann.
Die Bereitschaft, sich fort- und weiterzubilden, ist unter den Mitarbeiterinnen ohne Zweifel gegeben (siehe dazu auch Kapitel 1.1.3.). Auch in Hinsicht auf die Teamarbeit blieb das Engagement und die Motivationsbereitschaft aller nicht verborgen. Konsequent und mitunter sogar unterbezahlt (Therapeutinnen) werden diesbezügliche Termine eingehalten - nicht zuletzt zu Gunsten der Kinder.
Das allgemeine Betriebsklima machte einen durchwegs guten Eindruck auf mich.
Der Umgang zwischen allen Kindern und Erwachsenen schien problemlos und natürlich abzulaufen. Durch den regelmäßigen Wechsel der gruppenleitenden Kindergärtnerin kennt jede Betreuerin jedes Kind und umgekehrt, durch die organisierte "freie Freispielzeit" (siehe Abschnitt 1.2.1.3.) können alle 50 Kinder untereinander ständigen Kontakt halten.
Die Gestaltung der (beiden beobachteten) Gruppen in Zusammensetzung und -größe kann ich in der Hauptsache als gelungen bezeichnen, nimmt man dafür beispielsweise an der Arbeitshaltung der einzelnen Kinder und an der Gruppendynamik Maß. Wenige und z.T. eher unerhebliche Unzulänglichkeiten werden wohl schwer auszuschließen sein, wenn eine Gruppe so heterogen, wie es integrative Gruppen nun einmal sind, gestaltet ist.
Bei der Durchführung der didaktischen Einheiten fiel mir positiv auf, dass zu den einzelnen Angeboten und Aufgabenstellungen aufbauend hingeführt wurde und sie in Rücksicht auf Fähigkeiten und Interessen der Kinder ausgerichtet wurden. Ebenfalls gelang es den Erzieherinnen recht gut, eine gewisse inhaltliche Kontinuität in all den gebotenen Aktivitäten zu gewähren, d.h., das Rahmenthema wurde wirklich in den Angeboten, den Aufgabenstellungen und bisweilen in den Turneinheiten phasenübergreifend aufgearbeitet.
Was nun die individuelle Förderung der behinderten Kinder betrifft, ist zu sagen, dass in der älteren beobachteten Gruppe (im Gegensatz zur jüngsten) ein größeres Maß an differenzierten und entwicklungsadaptierten Angeboten zu registrieren war. Neben dieser Kritik schätze ich es jedoch als sehr schwierig ein, für grundlegende Übungen an Fertigkeiten noch einfachere Möglichkeiten für behinderte Kinder finden zu können.
Das Verhältnis Gruppenleiterin - Gruppenstärke (eine ständige Betreuerin pro Gruppe) erweist sich für mich als ein ambivalenter Punkt. Ich kann es nicht als unzureichend beurteilen, da weder die einzelne Erzieherin noch die Kinder Verhaltensweisen an den Tag legten, die darauf schließen könnten. Auf den Punkt gebracht: Aufgrund der Verfügbarkeit der Helferinnen und der Therapeutinnen in möglichen kritischen Situationen der Gruppenbetreuung wäre ein(e) zweite(r) ständige(r) BetreuerIn nicht absolut dringlich. Zudem wissen sich die Mitarbeiterinnen in Problemfällen (Überforderung oder Ausfälle von einzelnen Betreuerinnen) auch anders zu helfen: So werden Gruppen während einzelner Einheiten zusammengezogen oder intern geteilt, wobei dann ein Teil mehr Hilfestellung der Erzieherin benötigt als der andere, der genauso gut ohne Anleitungen arbeiten kann.
Eine Sache dazu sollte noch erwähnt werden: Es war zu beobachten, dass, wenn eine Helferin noch zusätzlich in einer Gruppe anwesend war, sich diese vornehmlich mit den behinderten Kindern beschäftigte, während sich die (Sonder-)Kindergärtnerin um die übrigen bemühte (insbesonders war dies in der Arbeits- und Freispielzeit der Fall). Dabei würden, so viele Erfahrungen auch die Helferinnen mit den behinderten Kindern gesammelt haben mögen, jedoch gerade die behinderten Kinder die gelernte Fachkraft eventuell mehr benötigen.
Ich schätze dieses Modell der Kinderbetreuung und -förderung als ein äußerst sinnvolles und zielführendes ein. Am Verhalten der Kinder (welches doch als tragendster Indikator gelten sollte) war durchwegs abzulesen, dass die Bemühungen, Integration zu verwirklichen, sich in Richtung der Erwartungen erfüllen (selbstverständlicher und toleranter Umgang unter den behinderten und nicht behinderten Kindern). Neben diesem sozialen Aspekt stehen die (beobachteten) Ergebnisse einer kognitiven Förderung um Nichts nach.
Eine Übertragung und Generalisierung dieses Modells halte ich für machbar, wenn man auch ein gewisses Engagement und eine gewisse Motivationsbereitschaft auf Seiten aller MitarbeiterInnen voraussetzen muß. Doch allerlei alternative Methoden im Erziehungs- und Bildungsbereich haben meist nur dann eine Chance, wenn eben IdealistInnen, Eltern, Kinder und zuständige Instanzen zusammenarbeiten können.
"Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf,
sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt."
(Reinhard Turre)
"Gemeinsam von Anfang an - Eine Analyse sozialer Interaktionsformen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem Heilpädagogischen Kindergarten
Inhaltsverzeichnis
-
1.1. Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten
- 1.1.1. Allgemeines
- 1.1.2. Die Bedeutung von Peerbeziehungen für die Entwicklung von Kindern
- 1.1.3. Der Umgang von Kindern mit der Behinderung anderer Kinder
- 1.1.4. Die Rolle der Nachahmung bei integrativer Erziehung
- 1.1.5. Behinderte Kinder werden mit den Folgen ihrer Einschränkung konfrontiert
- 1.1.6. Konflikte in integrativen Gruppen
- 1.1.7. Auswirkungen integrativer Erziehung auf nichtbehinderte Kinder
In den Interaktionen in integrativen Gruppen kommt die gesamte Bandbreite zwischenmenschlicher Kontakte zum Ausdruck (Reiser, 1987). Die Projektgruppe der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (EfrGF, 1987) beobachtete, daß die nichtbehinderten Kinder die behinderten nicht auf Kategorien von Behinderung fixieren, sondern sie als ihresgleichen mit dieser oder jener Eigenart erleben. Deshalb gestaltet sich auch die Art des Kontaktes zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern nach denselben Gesetzen wie zwischen nichtbehinderten. Die Häufigkeit und Qualität des Kontaktes orientiert sich daran, was man konkret mit dem anderen anfangen kann oder nicht. Am intensivsten ist der Kontakt zu den Kindern, mit denen man gemeinsam die eigenen Spielaktivitäten, Interessen und Phantasien umsetzen kann. Am wenigsten Spaß hingegen macht der Kontakt mit Kindern, die sich zerstörend oder ablehnend verhalten.
Für die behinderten Kinder bedeutet das tägliche Zusammensein mit den nichtbehinderten mehr Herausforderung als dies in reinen Behindertengruppen der Fall sein kann. Sie erfahren mehr Anregungen, sind stärker motiviert, haben mehr Nachahmungsmöglichkeiten und lernen in einer normalen Umgebung. Das behinderte Kind lernt in dieser aktiven Auseinandersetzung, sich selbst und seine Mitmenschen realistischer einzuschätzen (Griessler, 1990).
Den Ausdruck "Peer" kann man nur schwer übersetzen. Gemeint ist damit die Gruppe der Gleichaltrigen, aber auch der Gleichgesinnten (Oerter, 1987).
Neben den familiären Kontakten und den Kontakten mit erwachsenen Bezugspersonen im Kindergarten bekommt relativ früh auch der Kontakt mit den Gleichaltrigen einen erheblichen Stellenwert. Mit der allmählich stattfindenden Integration in die Gruppe der Alterskameraden ergeben sich für das Kind neue Anreize und Verstärker, die seine Lernchancen und seine Lebensqualität um wichtige Dimensionen bereichern (Blöschl, 1988).
Guralnick (1981c; zitiert nach Becker-Gebhardt, 1990) beobachtete, daß Peerbeziehungen auch schon im Kindergarten bei der Entwicklung kognitiver, sprachlicher, kommunikativer und sozialer Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielen. Als grundlegende Aspekte sozialer Beziehungen bezeichnet er die Konzepte "reciprocity"(Wechselseitigkeit) und "mutuality" (Gemeinsamkeit), die in Kontakten mit den Peers erworben werden. Zu diesen Konzepten gehören verschiedene Fähigkeiten und Strategien wie die Verwendung von Möglichkeiten, um Interessen bei Partnern, die Kenntnis und Anwendung sozialer Konventionen und die Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten von Spielpartnern zu gewinnen.
Auch Becker-Gebhardt (1990) stellt fest, daß nichtbehinderte Kinder schon im Vorschulalter in der Lage sind, das Entwicklungsniveau ihrer Spielpartner zu berücksichtigen, wenn sie Vorschläge machen, gemeinsame Tätigkeiten initiieren oder konkrete Anleitungen geben.
Guralnick und Groom (1987) stellten fest, daß behinderte Kinder als weniger kompetent wahrgenommen werden und deshalb von den nichtbehinderten Kindern als Spielpartner abgelehnt werden. Dies kann auch damit zusammenhängen, daß behinderte Kinder über eine geringe soziale Kompetenz in Bezug auf Kontakte zu anderen Kindern verfügen. Sie stellten weiters fest, daß die Einbeziehung der behinderten Kinder in Gruppenaktivitäten mit der Zeit abnahm. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, daß komplexere Fähigkeiten gefragt waren, die vielleicht über den Möglichkeiten der meisten behinderten Kinder dieser Studie lagen.
Becker-Gebhardt (1990) stellt fest, daß allein die Schaffung günstiger Umweltbedingungen durch räumliche Nähe oder kommunikative Anpassungsleistungen nichtbehinderter Peers noch nicht zu dem erwarteten Ausmaß positiver Beziehungen zwischen den beteiligten Kindern führt. Positive Interaktionen zeigen sich vor allem zwischen Kindern, die sich in ihrem Entwicklungsstand sehr ähnlich sind.
Bei der Frage, wie nichtbehinderte Kinder mit der Behinderung von anderen Kindern umgehen, ist es wichtig zu überprüfen, welche Bedeutung der Begriff "behindert" für die Kinder hat. Einige verbinden mit dem Begriff "behindert", daß ein anderes Kind etwas noch nicht kann. Dies erklären sie sich meistens aufgrund des Alters des Kindes und sind der Meinung, daß das Kind dies später einmal können wird. Weiterhin bezeichnen Kinder etwas als "behindert", was sie sich selbst nicht erklären oder fassen können. Ebenso können Kinder alles, was ihnen in einer Situation fremd oder ungewöhnlich vorkommt, als behindert bezeichnen. Die Auseinandersetzung mit der Behinderung eines anderen ist hier an eine bestimmte Situation gebunden, in der sich ein Kind nicht so verhält, wie es erwartet wurde. Kron (1988; zitiert nach Möllney, 1994) stellte in ihrer Untersuchung fest, daß es nicht immer zu erkennen war, inwieweit Kinder die Behinderung anderer Kinder wahrnehmen. Es zeigte sich weiters, daß die Kinder meistens nicht den ganzen Umfang einer Beeinträchtigung eines behinderten Kindes erfassen, sondern nur einzelne Aspekte davon.
Dichans (1990) stellte in seiner Untersuchung fest, daß die nichtbehinderten Kinder eine Behinderung oft überhaupt nicht als solche wahrnehmen, vor allem wenn sie die zugrundliegende Schädigung nicht unmittelbar ersehen können. Selbst wenn die Beeinträchtigung von den Kindern gesehen wird, sind die behinderten Kinder für sie nicht "Behinderte", sondern Kinder ihrer Gruppe mit bestimmten Merkmalen. Die Beeinträchtigung als Merkmal spielt dabei keine dominierende Rolle, denn den Kindern sind oft Aspekte wie Sympathie oder gefragte Fähigkeiten bedeutsamer. Dichans (1990) beobachtete weiters, daß die nichtbehinderten Kinder die behinderten Kinder ihrer Gruppe anders wahrnehmen als ihnen unbekannte behinderte Menschen. Sobald sie eine persönliche Beziehung zu einem behinderten Kind aufgenommen haben, verändert sich das Bild, das sie bisher von ihm hatten. Es ist nicht mehr "der Behinderte", sondern z.B. Martin mit bestimmten Merkmalen. Es sind für sie Kinder, die bestimmte Dinge noch nicht selbständig machen können.
Dichans (1990) fand in seiner Untersuchung auch heraus, daß einige Kindern bereits in frühem Alter eine Scheu vor behinderten Kindern zeigen, die bis zu einer verbal oder nonverbal geäußerten Ablehnung gehen kann. Doch er betont, daß auch zwischen nichtbehinderten Kindern Ablehnungen vorkommen, und mangelnde Sympathie oft eine Interaktion verhindert. Er ist der Meinung, daß diese Reaktionen zur Bandbreite zwischenmenschlichen Verhaltens gehören. Deshalb muß man auch Kindern zugestehen, daß sie ein "kleinkindhaftes" Verhalten bei einem älteren Kind nicht akzeptieren können, weil sie die Diskrepanz zwischen Lebens- und Entwicklungsalter nicht nachvollziehen können oder daß sie vor einem impulsiven Kind zurückschrecken und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Nach Dichans (1990, S. 163) heißt Integration nicht, alle zu lieben, sondern man "darf auch ein behindertes Kind 'doof' finden."
Viele Untersuchungen berichten, daß die 3- bis 4jährigen Kinder, die neu in eine Gruppe kommen, spontan auf behinderte Kinder zugehen, weil sie sich der Tatsache einer Behinderung nicht so sehr bewußt sind und Unterschiede ganz selbstverständlich akzeptieren. Sie sind selbst oft noch in einer schwierigen Phase, der ersten längeren Loslösung von den nächsten Bezugspersonen. Daher kann es passieren, daß sie gerade die Nähe der behinderten Kinder suchen, weil sie deren Situation wie ihre eigene interpretieren und ihre eigenen Emotionen in dem behinderten Kind wiederfinden, wie z.B. Klein-Sein oder Zuwendungsbedürftigkeit. Mit wachsender Differenzierungsfähigkeit und immer deutlicher werdenden Entwicklungsabständen registrieren viele Kinder die Behinderung bei anderen allmählich als bleibende Besonderheit. Den 5- und 6jährigen Kindern fallen dann die Einschränkungen der behinderten Kinder auf, und sie stellen meistens eingehende Fragen danach, was ein Kind kann oder nicht kann und warum dies so ist. Sie suchen nach Erklärungen bezüglich des Anders-Seins der behinderten Kinder, vielleicht als Voraussetzung für eine Vorstellung davon, was sie mit dem Kind spielen können. Die eigenen oder fremden Erklärungen für die Gründe des Anders-Seins können Haltungen von Mitleid, Gleichgültigkeit, Akzeptanz bis zu Angst und Abwehr erzeugen. Diese Verallgemeinerungen bestimmen häufig auch die emotional-kognitiven Beziehungen zu anderen behinderten Kindern (BMW, 1982; Dichans, 1990; EFrGF, 1982; Klein, Kreie, Kron & Reiser, 1987; Kron, 1990; Miedaner, 1986).
Das Nachahmungslernen ist die normale Lernart für Kinder im Kindergartenalter und dabei nehmen sie meistens andere Kinder als Modell. Die nichtbehinderten Kinder übernehmen meist zufällig und unbewußt Vorbildfunktion für die behinderten. Diese lernen so ganz natürlich und häufig auch schneller als von einem Erwachsenen. Sie scheinen auch motivierter zu sein, denn viele Untersuchungen betonen, daß der Anreiz zu Aktivitäten und Kommunikation in gemischten Gruppen deutlich größer ist als in homogenen Behindertengruppen (BMW, 1982).
Miedaner (1986) stellte in ihrer Untersuchung fest, daß sich nichtbehinderte Kinder durch Nachahmung mit der Situation der behinderten Kinder auseinandersetzen und auf diese Weise versuchen, die Behinderung nachzuvollziehen. Erst durch die Imitation sehen sie, wie schwierig es z.B. für ein behindertes Kind sein kann, sich mit einem gelähmten Bein vorwärts zu bewegen. Wenn die nichtbehinderten Kinder die Situation eines behinderten ansatzweise verstehen, sind sie meistens sehr rücksichtsvoll und beteiligen sich auch ideenreich an der Einbeziehung dieser Kinder in das Gruppengeschehen.
In integrativen Gruppen kommt der Nachahmung eine verstärkte Bedeutung zu, weil in einer Gruppe mit behinderten und nichtbehinderten Kindern die Vielfalt an Möglichkeiten, durch Lernen vom Modell und Nachahmung das eigene Verhaltens- und Handlungsspektrum zu erweitern, noch größer ist. Verschiedenste Fähigkeiten und unterschiedliche Entwicklungsstufen der Kinder vergrößern die Anzahl und Qualität der Anregungen, die aus der Gruppe kommen, und stellen für die Kinder einen großen Anreiz dar, voneinander zu lernen (Dichans, 1990).
Dichans (1990) stellte in seiner Untersuchung fest, daß behinderte Kinder zusätzlich zum Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Nachahmung auch ihre eigenen Grenzen erfahren können. Dies ist für sie zwar eine bittere aber auch eine wichtige Erfahrung, um sich selbst realistisch einschätzen zu können.
Die Konfrontation mit den Folgen des eigenen Verhaltens und damit auch mit der Einschränkung selbst ist in der gemeinsamen Erziehung von wesentlicher Bedeutung. Sie findet in verschiedensten Formen statt, sei es, daß andere Kinder solche Grenzen setzen, oder daß im Vergleich zu anderen Kindern die Beeinträchtigung Grenzen auferlegt. Es kann zum Beispiel passieren, daß einige Kinder ein Spiel spielen möchten, an dem ein anderes Kind aufgrund seiner Beeinträchtigungen nicht teilnehmen kann. Die Kinder versuchen dann oft, Lösungen zu finden, die eine Teilnahme des behinderten Kindes ermöglichen und sich nach den Fähigkeiten des Kindes richten. Trotzdem bleibt das Kind oft vom eigentlichen Spiel ausgeschlossen, was zu erheblichen Frustrationen führen kann. Dichans (1990) ist der Meinung, daß solche Situationen wertvolle Lernmöglichkeiten beinhalten, obwohl sie emotional aufrüttelnd sind. Denn die behinderten Kinder erleben so hautnah, was es bedeutet, gegenüber den anderen Kindern in der Mobilität eingeschränkt zu sein oder sogar übersehen zu werden. Dadurch lernen sie die Realität des Eingeschränktseins in unserer Gesellschaft kennen, was für die Ausbildung eines realistischen Selbstbildes notwendig ist.
Die Konfrontation mit der eigenen Behinderung ist also keineswegs negativ zu beurteilen. Sie kann sogar zu unmittelbaren positiven Folgen führen, wenn z.B. Kinder diese Situationen als Lernanreiz nehmen, um die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. Jansen (1987) stellt fest, daß diese Insuffizienzerlebnisse bei den behinderten Kindern dann nicht zu Minderwertigkeitsgefühlen führen, wenn sie sich ansonsten in der Gruppe akzeptiert fühlen. Sie merken dann nämlich schnell, daß Anerkennung und Zuwendung nicht nur von ihren Leistungen abhängen.
Dichans (1990) geht davon aus, daß Konflikte keine unerwünschten und von daher zu unterbindenden Verhaltensäußerungen sind, da sie die Möglichkeit bieten, den Konfliktpartner und sich selbst mit den jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen in einem vertrauten und überschaubaren Rahmen kennenzulernen und Lösungen zu finden, die auch auf andere Situationen übertragen werden können. Die Konflikte in Gruppen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern sind zunächst einmal denen ähnlich, die es in anderen heterogenen Kindergartengruppen gibt, mit dem Unterschied, daß hier auch behinderte Kinder beteiligt sind. Es kann zum Beispiel passieren, daß ein Kind unbeabsichtigt zerstört, was andere Kinder gebaut haben. Dies passiert in Gruppen mit behinderten Kindern öfter, da vor allem körperbehinderte Kinder ihre Motorik nicht immer kontrollieren können. Weiters können Konflikte entstehen, wenn Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten aufeinandertreffen und deshalb ein Kind, das nicht die zum Spiel erforderlichen Fähigkeiten mitbringt, als Spielpartner abgelehnt wird. Neben diesen üblichen Konfliktanlässen gibt es in Gruppen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern auch andere, die in Regelgruppen seltener auftreten. Sie werden oft ausgelöst durch spezifische Verhaltensweisen behinderter Kinder, die nicht zum Repertoire nichtbehinderter Kinder gehören. Behinderte Kinder können zum Beispiel Verhaltensweisen zeigen, die den nichtbehinderten Kindern fremd sind. Oft ist auch die große Diskrepanz zwischen Alter oder äußerer Erscheinung und dem Verhalten ein Konfliktanlaß, denn die nichtbehinderten Kinder sind gewöhnt, daß ältere und größere Kinder schon bestimmte Dinge tun oder unterlassen können. Wenn behinderte Kinder aufgrund ihrer Einschränkungen bestimmte Regeln nicht einhalten können, kann es auch zu Konflikten kommen, da Kinder in diesem Alter darauf beharren, daß Regeln eingehalten werden.
Die unterschiedlichen Bedürfnisse, Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten behinderter und nichtbehinderter Kinder können oft zu Konflikten führen. Weiters kann es zu Konflikten kommen, wenn behinderte Kinder gegen ihren Willen bemuttert werden oder wenn sie manchmal anders reagieren als nichtbehinderte Kinder. Vor allem bei Kindern mit nicht so leicht erkennbaren Behinderungen kommt es eher zu Konflikten, da ihrem Verhalten meistens Böswilligkeit unterstellt wird. Sichtbare und nachvollziehbare Behinderungen hingegen sind für die nichtbehinderten Kinder leichter begreifbar (Miedaner, 1986).
Auch Kniel und Kniel (1984) die im Rahmen einer umfassenden Studie das Konfliktverhalten behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelkindergarten untersuchten, sind der Meinung, daß Konflikte ein wichtiger Teil des sozialen Lebens sind. Denn die Kinder müssen lernen, ihre eigenen Grenzen zu akzeptieren, sich in der Gruppe durchzusetzen und auch zur Not für ihre Interessen zu streiten. Insgesamt konnten Kniel und Kniel (1984) in ihrer Untersuchung die Befürchtung entkräften, daß behinderte Kinder im Regelkindergarten eine Sündenbockrolle innehätten, denn ihre Situation in Konflikten entsprach der der nichtbehinderten Kinder.
Becker-Gebhardt (1990) ist der Meinung, daß es für nichtbehinderte Kinder wichtig ist, daß sie bereits im Kindergartenalter Erfahrungen mit Menschen machen können, die sich durch ihr Aussehen, ihr Sprechen oder ihre Bewegungen von ihnen unterscheiden. Nur durch das Zusammenleben mit ihnen können sie die Bereitschaft entwickeln, die Vielfältigkeit des menschlichen Lebens zu akzeptieren und Unterschiede nicht zum Ausgangspunkt von Aussonderungen zu machen.
Dichans (1990) beobachtete, daß nichtbehinderte Kinder empathische Fähigkeiten entwickeln und sich so in die Situation eines behinderten Kindes hineinversetzen können. Er stellte weiters fest, daß die integrative Gruppe mit ihren vielfältigen Begegnungs- und Interaktionsmöglichkeiten den nichtbehinderten Kindern nicht nur die Möglichkeit bietet, in zahlreichen Situationen behinderte Kinder in ihrer Eigenart zu sehen. Der tägliche Umgang miteinander macht die nichtbehinderten Kinder auch sensibler dafür, die Entwicklungsfortschritte bei den behinderten Kindern wahrzunehmen. Die nichtbehinderten Kinder nehmen nicht nur Anteil an den Fähigkeiten und Lernerfolgen behinderter Kinder, sie verstärken sie auch. Eine andere Untersuchung zeigte ebenfalls, daß die nichtbehinderten Kinder sich in ihrem Sozialverhalten entwickeln und lernen können, angemessene Hilfen zu geben (BMW, 1982).
Saurbier (1982; zitiert nach Kreie, 1986) beschreibt die Entwicklungschancen für die nichtbehinderten Kinder folgendermaßen: Es kommt bei ihnen zu einem Zuwachs an Zuwendung, Geduld, Anerkennung und Hilfe. Sie bekommen Verständnis für das behinderte Kind und lernen, auf es Rücksicht zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1. Allgemeine Zielsetzungen dieser Untersuchung
- 2.2. Die Stichprobe
-
2.3. Untersuchungsinstrument
- 2.3.1. Beschreibung des Kategoriensystems der Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984)
- 2.3.2. Modifikationen des Kategoriensystems
- 2.3.3. Zusammenfassende Darstellung der Kategorien meiner Untersuchung
- 2.3.4. Durchführung
- 2.3.5. Auswertung der Aufnahmen
Im Mittelpunkt meiner Untersuchung stand der sichtbare Grad an Integration in den drei altershomogenen Kindergartengruppen des Heilpädagogischen Kindergartens Steingruber. Als Indikator für das Stattfinden integrativer Prozesse wird das Auftreten integrativer Verhaltensweisen betrachtet. Darunter wird jeglicher Kontakt zwischen den Subgruppen behinderter und nichtbehinderter Kinder verstanden. Dazu können auch Auseinandersetzungen gerechnet werden, weil in ihnen auch das Kennenlernen und die Durchsetzung eigener Interessen sowie die Akzeptanz anderer Ansprüche geübt werden kann (EFrGF, 1984).
Es sollte untersucht werden, ob Unterschiede im Verhaltensspektrum und in den Häufigkeiten bestimmter Verhaltensweisen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern, und Unterschiede in den Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie jenen behinderter bzw. nichtbehinderter Kinder untereinander auftreten.
Weiters wollte ich untersuchen, ob es bezüglich der gezeigten Verhaltensweisen Unterschiede zwischen den drei altershomogenen Kindergartengruppen in Abhängigkeit vom Alter der Kinder gibt . Viele Untersuchungen in altersheterogenen Gruppen haben gezeigt, daß kleinere Kinder unbefangener auf behinderte Kinder zugehen als größere. In altershomogenen Gruppen, wie sie in dem von mir untersuchten Kindergarten geführt wurden, könnte es allerdings auch zu dem Effekt kommen, daß ältere nichtbehinderte Kinder, die schon längere Zeit mit behinderten zusammen betreut werden, mehr Interaktionen mit diesen aufweisen als jüngere, da sie sie schon länger und besser kennen.
Die Stichprobe umfaßt 50 Kinder des Heilpädagogischen Kindergartens Steingruber im Alter zwischen 3 und 6 Jahren, von denen 12 behindert und 38 nichtbehindert sind. Die Gruppe der 3-4jährigen ("Mäuse") umfaßt 16 Kinder, die Gruppe der 4-5jährigen ("Schmetterlinge") umfaßt 18 Kinder und die Gruppe der 5-6jährigen ("Frösche") umfaßt 16 Kinder. In jeder Gruppe befinden sich vier behinderte Kinder.
Aufgrund meiner Literaturrecherchen und ausführlicher Gespräche mit der Leiterin des Kindergartens kam ich zu dem Schluß, daß ich nur mit Hilfe von Beobachtungsverfahren das Verhalten aller Kinder, sowohl der behinderten als auch der nichtbehinderten Kinder, erfassen kann.
Alle anderen Verfahren, wie Interviews oder Bildwahlverfahren würden die behinderten Kinder und sicher auch einen Teil der nichtbehinderten Kinder überfordern, da sie ein Mindestmaß an sprachlichen Fähigkeiten und Abstraktionsleistung erfordern. Der Informationsgewinn und der Wahrheitsgehalt von beobachteten Daten sind dann am größten, wenn ihnen das alltägliche Verhalten von Kindern zugrunde liegt. Eine Methode, die die systematische Beobachtung von Kindverhalten in Alltagssituationen ermöglicht, ist von der Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984) entwickelt worden. Anhand der von ihr aufgestellten Stufen der Integration (vgl. dazu Kap. 2.3.2. der thematischen Einführung) wurden acht Kategorien ausdifferenziert.
Im folgenden werden die einzelnen Kategorien des von der Projektgruppe entwickelten Beobachtungsverfahrens näher erläutert, da ich in meiner Untersuchung ihre Methode weitestgehend übernommen habe.
Diese Kategorie ist zuständig für Situationen, in denen ein Kind keinen Kontakt zu anderen hat und auch nicht mit Material-, Bewegungs-, Symbol- oder Rollenspiel befaßt ist.
Diese Kategorie wird immer dann vermerkt, wenn ein Kind mehr als die Hälfte der betreffenden Zeiteinheit ohne Bezug auf die anderen Kinder beschäftigt ist. Es darf also nicht verbal, mimisch, körperlich oder gestisch mit einem Kind / mehreren Kindern interagieren.
Diese Kategorie wird bei allen Arten von Aggression signiert, und zwar sowohl bei einseitigen Aggressionen als auch bei gegenseitigen Aggressionen.
Diese Kategorie wird bei Situationen signiert, in denen ein Kind bzw. mehrere Kinder von einem Kind bzw. mehreren Kindern nicht als Partner akzeptiert wird / werden.
Diese Kategorie gilt für Verhaltensweisen, in denen sich ein gewisses Maß von Anteilnahme am Verhalten anderer Kinder ausdrückt. Dabei kommt es noch nicht zu Interaktionen in Form sprachlicher Kontakte oder gemeinsamen Handelns. Auch Körperkontakte im Sinne von jemanden anfassen, umarmen oder streicheln werden zu dieser Kategorie gerechnet, soweit sie nicht in eine größere Handlungseinheit eingebettet sind.
Diese Kategorie wird entweder signiert, wenn ein Kind Anregungen von anderen Kindern oder von Erzieherinnen in seinem Spiel aufgreift, oder selbst Anregungen gibt, soweit diese nicht sprachlich vermittelt sind. Zum anderen werden zu dieser Kategorie alle Formen des Parallelspiels gerechnet.
Dieser Kategorie werden Verhaltensweisen zugeordnet, denen eine altruistische Haltung zugrunde liegt, wie zum Beispiel: etwas für ein anderes Kind tun, ein Kind trösten, einem Kind bestimmte Zusammenhänge oder einen Vorgang erklären, usw.
Zu dieser Kategorie zählt ein breites Spektrum von sozialen Verhaltensweisen, vom einfachen, momentanen Miteinander-Reden oder -Handeln bis zu einer über einen längeren Zeitraum anhaltenden Zusammenarbeit bzw. gemeinsam geplanten Entwürfen von Produkten oder Spielhandlungen und deren Durchführung. Außerdem werden diejenigen Verhaltensweisen zu dieser Kategorie gerechnet, die dem Begriff des Füreinander unterzuordnen sind und die Gegenseitigkeit implizieren. Darunter versteht man, daß jeder Interaktionspartner aus der Haltung des Füreinander einen Vorteil gewinnt (Austauschen, Teilen etc.). Weiters gehören auch Wettbewerbsverhalten (sich vergleichen) und Selbstdarstellung zur Kategorie M ebenso wie Formen von Initiative.
Ich habe in meiner Untersuchung das von der Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984) entwickelte Verfahren angewandt, doch wurden von mir einige Punkte abgeändert bzw. Kategorien ausdifferenziert, um über die Aktivitäten der Kinder differenziertere Aussagen machen zu können.
Die Kategorie "Anregungen aufgreifen, Imitieren" wurde umbenannt in "Parallelspiel", da meiner Meinung nach das Beschäftigtsein am selben Gegenstand oder mit derselben Aufgabe auch beinhaltet, daß man Anregungen weitergibt bzw. aufgreift und so diese Differenzierung unnötig macht.
KATEGORIE ALLEIN
KATEGORIE GEGENEINANDER
|
Angreifer |
Opfer |
Ausschluß aktiv |
Ausschluß passiv |
|
Eigengruppe |
Eigengruppe |
Eigengruppe |
Eigengruppe |
|
Fremdgruppe |
Fremdgruppe |
Fremdgruppe |
Fremdgruppe |
KATEGORIE MITEINANDER
Ich entschloß mich, Videoaufnahmen von Freispielszenen mit Hilfe dieses Kategoriensystems auszuwerten. Nach einigen Probetagen, die dazu dienten, daß die Kinder sich an die Kamera und die Versuchsleiterin gewöhnen, wurde die Untersuchung im Zeitraum vom 13.3. bis zum 26.3. und vom 15.4 bis zum 17.4.1996 im Heilpädagogischen Kindergarten Steingruber durchgeführt. Den Kindern wurde das Vorhaben, Videoaufnahmen zu machen, kindgemäß erklärt, und sie wurden auch mit der Videokamera vertraut gemacht. Die Aufnahmen erfolgten jeweils an den Vormittagen in der Freispielzeit. Nach einem von der Kindergartenleiterin festgelegten Zeitplan kamen die drei Gruppen nacheinander für die Dauer der Videoaufnahmen in den selben Gruppenraum. (Da keine Gruppe einen festgelegten Gruppenraum hat, war dieser Raum allen Kindern gleich vertraut.) Die Kinder wurden aufgefordert, sich etwas zum Spielen zu suchen, und die Erzieherin setzte sich in eine Ecke, um in Notfällen gleich zur Stelle zu sein. So konnten die Kinder selbständig und ohne Eingriffe von Seiten der Erzieherin spielen, was eine weitgehend unbeeinflusste Spielsituation ergab.
Mit einem Kameraschwenk durch den ganzen Gruppenraum wurden mit einer Weitwinkeleinstellung des Objektivs alle Kinder einer Gruppe in 2-Minutenintervallen in der Freispielzeit gefilmt. Die Aufnahmedauer betrug für den Zeitraum von 12 Tagen jeweils 24 Minuten, d.h., 12 2-Minutenintervalle pro Tag. Von den 12 Tagen wurden aber nur 8 Tage und jeweils nur 8 der 12 Zeiteinheiten zur Auswertung herangezogen. Die restlichen Tage und Zeiteinheiten dienten als Reserveeinheiten, für den Fall, daß einige Kinder öfters fehlen.
Die Videoaufnahmen wurden mit Hilfe der time-sampling Methode (Zeitstichproben-Verfahren) ausgewertet. Das ist eine Verhaltensbeobachtungsmethode, bei der jeweils eine Versuchsperson im Verlauf einer längeren Untersuchung nach einem vorher festgelegten Zeitplan "mehrmals kurzfristig beobachtet und das beobachtete Verhalten gleichzeitig oder anschließend protokolliert wird" (Arnold, Eysenck & Meili, 1991, S.2326).
Die Festlegung von Zeitintervallen vereinfacht die Signierung, da sie dem Beobachter die Entscheidung über die Länge der zu registrierenden Verhaltenseinheit abnimmt. Das Zeitstichproben-Verfahren ist also eine Methode zur Quantifizierung von Verhalten als Dauer oder Häufigkeit (Faßnacht, 1979).
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Teil sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung zusammengefaßt und auf dem Hintergrund bisheriger Forschungsbefunde diskutiert werden.
Es zeigte sich, daß bei allen drei Gruppen die behinderten Kinder häufiger allein unbeschäftigt waren als die nichtbehinderten Kinder wobei dies vor allem für die schwerbehinderten Kinder zutrifft. Es muß allerdings an dieser Stelle erwähnt werden, daß es schwierig ist, die unterschiedlichen Ergebnisse auf die verschiedenen Beeinträchtigungen der Kinder zurückzuführen, da man verschiedenartige Behinderungen kaum miteinander in Bezug auf ihre Auswirkungen vergleichen kann. Auch Kniel und Kniel (1984) sind der Auffassung, daß sich hinter der Zusammenfassung der Kinder in einzelne "Behindertenkategorien" eine breite Palette an einzelnen Persönlichkeiten und an verschiedenen Ausgangssituationen verbirgt.
Bezüglich der Kategorie "Allein beschäftigt" zeigte sich, daß nur die 5-6jährigen behinderten Kinder öfter allein beschäftigt waren als die nichtbehinderten Kinder.
Bei der Kategorie "Zusehen" ergab sich bei allen drei Altersgruppen, daß weitaus häufiger Kindern aus der Eigengruppe[1] zugesehen wird als Kindern aus beiden Gruppen. Weiters ergab sich, daß die 3-4jährigen und die 4-5jährigen behinderten Kinder öfter Kindern aus der Fremdgruppe zusahen als die nichtbehinderten Kinder während die 5-6jährigen nichtbehinderten Kinder häufiger Kindern aus der Eigengruppe zusahen als die behinderten Kinder. Ferner ergab sich, daß die nichtbehinderten Kinder aller drei Gruppen häufiger Kindern aus der Eigengruppe zusahen als Kindern aus der Fremdgruppe und auch als Kindern aus beiden Gruppen.
Bei der Kategorie "Parallelspiel" ergab sich, daß die Kinder aller drei Gruppen häufiger zu Kindern aus der Eigengruppe parallel spielten als zu Kindern aus der Fremdgruppe und auch als zu Kindern aus beiden Gruppen. Weiters ergab sich, daß sich die 3-4jährigen und die 5-6jährigen nichtbehinderten Kinder häufiger zu Kindern aus der Eigengruppe parallel beschäftigten als die behinderten Kinder. Die behinderten Kinder der beiden Gruppen hingegen beschäftigten sich weitaus häufiger zu Kinder aus der Fremdgruppe parallel als die nichtbehinderten Kinder. Ferner ergab sich bei allen drei Gruppen, daß sich die nichtbehinderten Kinder häufiger zu Kindern aus der Eigengruppe parallel beschäftigten als zu Kindern aus der Fremdgruppe. Bei den 3-4jährigen und den 4-5jährigen beschäftigten sich die nichtbehinderten Kinder auch öfter parallel zu Kindern aus der Eigengruppe als zu Kindern aus beiden Gruppen. Bei den 4-5jährigen und den 5-6jährigen beschäftigten sich die nichtbehinderten Kinder auch häufiger zu Kindern aus beiden Gruppen parallel als zu Kindern aus der Fremdgruppe.
Bei der Kategorie "Miteinander" ergab sich bei den 3-4jährigen und den 4-5jährigen, daß die nichtbehinderten Kinder häufiger mit anderen Kindern spielten als die behinderten Kinder. Ferner ergab sich, daß die Kinder aller drei Gruppen öfter mit Kindern aus der Eigengruppe spielten als mit Kindern aus der Fremdgruppe und auch als mit Kindern aus beiden Gruppen. Weiters ergab sich, daß die nichtbehinderten Kinder aller drei Gruppen häufiger mit Kindern aus der Eigengruppe spielten als die behinderten Kinder. Es zeigte sich weiters, daß die nichtbehinderten Kinder aller drei Gruppen häufiger mit Kindern aus der Eigengruppe spielten als mit Kindern aus der Fremdgruppe und auch als mit Kindern aus beiden Gruppen.
Zusammenfassend kann man sagen, daß diese Untersuchung zeigte, daß die nichtbehinderten Kinder des Heilpädagogischen Kindergartens Steingruber meistens parallel zu anderen nichtbehinderten Kindern beschäftigt waren oder mit diesen zusammen spielten, während die behinderten Kinder die meiste Zeit allein unbeschäftigt oder allein beschäftigt waren.
Beim Vergleich der drei Altersgruppen über die behinderten und die nichtbehinderten Kinder hinweg zeigte sich, daß sowohl die 3-4jährigen als auch die 4-5jährigen öfter allein beschäftigt waren als die 5-6jährigen.
Beim Vergleich der drei Altersgruppen für die nichtbehinderten Kinder ergab sich, daß daß die 3-4jährigen und die 4-5jährigen nichtbehinderten Kinder öfter allein beschäftigt sind als die 5-6jährigen. Die 5-6jährigen beschäftigen sich öfter parallel zu Kindern aus beiden Gruppen gleichzeitig als die 3-4jährigen.
Beim Vergleich der drei Altersgruppen für die behinderten Kinder zeigte sich, daß die 3-4jährigen öfter mit Kindern aus der Eigengruppe spielten als die 4-5jährigen. Diese Ergebnisse legen den Schluß nahe, daß die 3-4jährigen behinderten Kinder leichter Zugang finden zu Kindern, die ebenfalls behindert sind.
Mit Hilfe der Clusteranalyse war es möglich, fünf Gruppen von Kindern (Cluster) zu ermitteln, die sich in den Beobachtungssituationen ähnlich verhalten haben. Aufgund der geringen Gesamtstichprobengröße umfassen diese fünf verschiedenen Gruppen allerdings teilweise nur wenige Kinder. Cluster 1 kann im engeren Sinn als "Mischgruppe behinderter und nichtbehinderter Kinder" bzw. als "Gruppe der häufig allein beschäftigten Kinder" bezeichnet werden. Dieser Gruppe gehören sechs nichtbehinderte und fünf behinderte Kinder an, die die meiste Zeit allein beschäftigt waren. Cluster 2 kann als "Gruppe der häufig zusehenden und allein unbeschäftigten Kinder" charakterisiert werden. Zu dieser Gruppe gehören drei behinderte Kinder, die genauso oft nichtbehinderten Kindern zusahen wie sie allein unbeschäftigt waren. Cluster 3 kann man eindeutig als "Gruppe der nichtbehinderten Kinder" bezeichnen. Dieser Gruppe gehören 32 nichtbehinderte Kinder an. Sie haben gemeinsam, daß sie kaum Verhaltensweisen zeigten, die man den für die Clusteranalyse ausgewählten Kategorien zuordnen könnte. Am ehesten waren sie allein beschäftigt oder allein unbeschäftigt. Cluster 4 kann als "Gruppe der leichtbehinderten Kinder" angesehen werden. Diese Gruppe besteht aus zwei behinderten Mädchen, die sich meistens parallel zu den nichtbehinderten Kindern ihrer Gruppe beschäftigten. Cluster 5 kann im engeren Sinn als "Gruppe der schwerbehinderten Kinder" bezeichnet werden. Zu ihr gehören ein behindertes Mädchen und ein behinderter Junge, die aufgrund ihrer schweren Beeinträchtigungen die meiste Zeit allein unbeschäftigt waren.
Die Ergebnisse der Clusteranalyse zeigen deutlich, welche unterschiedlichen Formen des Sozialverhaltens sich bei behinderten und nichtbehinderten Kindern finden lassen, und sie schärfen auch die Wahrnehmung für die Verschiedenheit der Kinder, die mit dem Etikett "behindert" versehen sind. Man darf allerdings nicht aus dieser nach dem in den Beobachtungssituationen gezeigten Verhalten vorgenommenen Bildung von Gruppen von Kindern, stabile Persönlichkeitseigenschaften oder Verhaltenstypen ableiten, da das Verhalten stark wandelbar und beeinflußbar ist. Ein Ziel solcher Gruppierungen sollte es sein, pädagogische Maßnahmen abzuleiten, um den spezifischen Situationen der einzelnen Gruppen von behinderten Kindern besser begegnen zu können (Kniel & Kniel, 1984).
Die Interpretation der Daten darf nicht nur von den zahlenmäßigen Verhältnissen ausgehen, d.h. den Häufigkeiten, mit denen ein Kind eine bestimmte Verhaltensweise gezeigt hat. Denn es muß nicht ein Zeichen von mangelnder Integration sein, wenn ein behindertes Kind öfter allein beschäftigt ist als ein nichtbehindertes Kind. Für dieses Kind kann das Alleinsein sehr befreiend sein und ihm ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, während ein Beenden dieser Rückzugsmöglichkeit für das betreffende Kind beängstigend sein könnte (EFrGF, 1983).
Miedaner (1986) fand in ihrer Bestandsaufnahme über integrative Erziehung im Elementarbereich heraus, daß in einigen der von ihr untersuchten Institutionen keine wirklichen Kontakte zwischen den behinderten und den nichtbehinderten Kindern zustande kamen, sondern eher ein Nebeneinanderspielen und Tolerieren. Die nichtbehinderten Kinder registrierten ihre behinderten Kameraden zwar, wandten sich ihnen aber nicht zu, da sie andere Bedürfnisse hatten. Besonders häufig war dies im Freispiel der Fall, während sie bei angeleiteten Aktivitäten gerne gemeinsam gespielt oder gebastelt haben.
Ähnliche Beobachtungen konnte ich auch in dem von mir untersuchten Kindergarten machen. In arrangierten Situationen, wie zum Beispiel bei einem Kreisspiel, wurden die behinderten Kinder sehr wohl von den nichtbehinderten Kindern einbezogen. Auch bei anderen Gruppenaktivitäten ergaben sich Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern, doch in den von mir gefilmten Freispielszenen waren die behinderten Kinder meistens allein beschäftigt. Ich glaube, daß dies vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, daß ich durch das Ausschalten der Erzieherinnen eine für die Kinder ungewohnte Situation geschaffen habe, die vorher eingeübt hätte werden müssen. Denn in den "alltäglichen" Freispielsituationen sind die Erzieherinnen stets darum bemüht, Kindern, die Probleme haben, eine Beschäftigung zu finden, dabei zu helfen. Sie versuchen auch gezielt, durch das gemeinsame Beschäftigen von behinderten und nichtbehinderten Kindern, integrative Prozesse zu initiieren. Auch Kessler (1986) konnte in ihrer Untersuchung beobachten, daß das gegenseitige Akzeptieren von individuellen Stärken und Schwächen in der Gruppenzeit wesentlich selbstverständlicher passiert als in der Freispielzeit, wo sich die behinderten Kinder auf ihre Art oft schwer durchsetzen können.
Hierbei möchte ich die Ergebnisse meiner Untersuchung in Bezug setzen zu den von der Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch reformierten Gemeinde Frankfurt (1984) aufgestellten Stufen der Integration (vgl. dazu Kap. 2.3.2. der thematischen Einführung). Ich glaube, daß man auch bei der Zuordnung dieser Stufen unterscheiden muß zwischen der Freispielzeit und der regulären Gruppenzeit. Für die von mir beobachteten Freispielszenen trifft am ehesten die Stufe "so nebenbei dabeisein können, ohne zu stören" zu. Diese Stufe der Integration ist die Basis der Toleranz und die Chance für darüber hinausgehende Integrationsstufen. Sie darf in ihrer Bedeutung für die Fähigkeit der behinderten und der nichtbehinderten Kinder, im künftigen Leben gegenseitige Anwesenheit tolerieren zu können, nicht unterschätzt werden. Für viele behinderte Kinder traf auch öfters die Stufe " dabeisein können und Anregungen von den anderen aufgreifen" zu. Die integrative Wirkung besteht bei dieser Stufe darin, daß die behinderten Kinder in reichem Ausmaß von den Aktivitäten der nichtbehinderten Kinder lernen und von diesen Anregungen aufgreifen können. Die weiteren Stufen der Integration - "manchmal an etwas mitmachen können", "regelmäßig an etwas mitmachen können" und "regelmäßig miteinander etwas tun"- wurden eher selten bei einzelnen behinderten Kindern beobachtet. Sie werden allerdings in Form von Ritualen und Kreisspielen realisiert, in Situationen also, die von der Erzieherin initiiert werden.
Es zeigte sich, daß vor allem die Kinder, die über keine aktive Sprache verfügen, die kaum in der Lage sind, sich längere Zeit mit etwas zu beschäftigen und auch keine Regeln einhalten können, keinen Zugang zu den Aktivitäten anderer Kinder fanden. Wesentliche Voraussetzungen für die Eingliederung von behinderten Kindern scheinen deren Ansprechbarkeit, ihr Kommunikationsvermögen, ihre Fähigkeit Regeln einzuhalten und ihre Gruppenfähigkeit zu sein (EFrGF, 1984). Mehrere Autoren sind der Meinung, daß ohne das Kommunikationsmittel Sprache eine Integration unmöglich oder zumindest sehr erschwert ist. Ein Mindestmaß an Sprache und Sprachverständnis scheint eine Voraussetzung für die Integration behinderter Kinder in Regelkindergärten zu sein, da Kinder, die nicht sprechen können und keine Anweisungen verstehen, eher ein isoliertes Leben führen (unzureichende kommunikative Fähigkeiten). Deshalb sollte es ein wichtiges Ziel sozialer Integration sein, bereits ausgebildete kommunikative Kompetenzen weiterzuentwickeln und neue herauszubilden (Becker-Gebhardt, 1990; Kniel & Kniel, 1984; Schrausser, 1984). Auch durch starke motorische Beeinträchtigungen kann der gemeinsame Aktionsspielraum eingeschränkt werden. Jansen (1987) betont, daß gemeinsames Erleben und Handeln nur dann zufriedenstellend und auch überdauernd ist, wenn beide Seiten einen Nutzen daraus ziehen. Er weist darauf hin, daß Ergebnisse von Integrationsversuchen in Kindergärten gezeigt haben, daß die Schwere der Behinderung eine entscheidende Rolle spielt.
Ein weiterer Tatbestand, der sich vielleicht auch auf die Ergebnisse ausgewirkt haben könnte, ist die altershomogene Gruppeneinteilung. Viele Untersuchungen bestätigen, daß sich die Altersmischung im Kindergarten für die Integration als besonders günstig erwiesen hat. In altershomogenen Gruppen sind sich die meisten Kinder in ihren Fähigkeiten sehr ähnlich. Dadurch wird der Unterschied zu den behinderten Kinder deutlicher. In altersgemischten Gruppen können Über- und Unterforderungen leichter vermieden werden. Es entsteht weiters weniger Leistungsdruck und Rivalität, weil verschiedene Fähigkeiten als gegeben hingenommen werden. Kinder, die in ihrem Entwicklungsstand vom Alter abweichen, werden damit nicht zwangsläufig zu Außenseitern, sondern sie finden leichter Spielpartner, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen und können länger "klein" bleiben. Somit verliert der altersgemäß normale Leistungsstand an Relevanz, und die gesamten Persönlichkeitsmerkmale der Kinder gewinnen an Bedeutung. Ferner kann die Vielfältigkeit der Aktivitäten zu einer besseren und umfassenderen Förderung aller Kinder führen. Durch das Zusammensein von 3-6jährigen Kindern ist eine Vielfalt von Bedürfnissen und Fähigkeiten präsent, die es besonders den behinderten Kindern erlauben, je nach ihrem Entwicklungsstand und ihrer Befindlichkeit verschiedene Partner zu finden. Sie erhalten somit vielfältige Kooperations- und Interaktionsmöglichkeiten (EFrGF, 1984; Miedaner, 1986). Miedaner stellt ferner fest, daß in altersgemischten Gruppen ältere Kinder, auch ältere behinderte Kinder, ein erhöhtes Selbstwertgefühl entwickeln können, weil sie an kleinere Kinder Kenntnisse weitergeben können. Bei kleineren und behinderten Kindern ist es möglich, daß sie durch die Teilnahme am Spiel anderer, auch älterer Kinder, eine Steigerung ihres Selbstwertgefühls erfahren. Eine altersgemischte Gruppe bietet ihrer Meinung nach auch gute Voraussetzungen für die Bildung von Toleranz und Achtung vor Unterschieden im Äußeren und in den Verhaltensweisen, da die Kinder ein breites Spektrum menschlichen Daseins kennenlernen. Auch Kniel und Kniel (1984) betonen, daß eine altersgemischte Zusammensetzung die Aufnahme eines behinderten Kindes erleichtert, da sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nichtbehinderte Kinder mit ähnlichem Entwicklungsstand in der Gruppe finden werden.
Klein et al. (1987) sind ebenfalls der Meinung, daß eine altersheterogene Gruppe allen Kindern ein breiteres Spektrum von möglichen Entwicklungsverläufen bietet. In einer solchen Gruppierung können sich ferner erweiterte Beziehungskonstellationen ergeben, wie z.B. eine selbstverständlichere Kontaktaufnahme oder die Wahrnehmung von jüngeren und älteren bzw. entwicklungsgleichen und unterschiedlich weit entwickelten Kindern oder das Nachahmen älterer Kinder. Sie konnten weiters beobachten, daß Kinder in altersheterogenen Gruppen untereinander Modellfunktionen übernehmen und sich auch durch Nachahmung entwickeln.
Die Leiterin des untersuchten Kindergartens betrachtet die Kindergartenzeit als Schulvorbereitung, in der die Kinder ganz gezielt auf eine gewissenhafte Arbeitshaltung hin gefördert werden. Dies geschieht, indem Spiel- und Arbeitszeiten konsequent getrennt werden (Furtlehner, 1996). Da die in den Arbeitszeiten gezielt gestellten Angebote alters- und entwicklungsgemäß adaptiert sind, ist es nach Meinung der Leiterin nicht möglich, altersheterogene Gruppen zu führen.
Ein weiterer Grund dafür, daß die letztgenannten Stufen der Integration eher selten im Freispiel zu beobachten waren, könnte sein, daß einige der behinderten Kinder aus einem großen Einzugsgebiet kommen. Das hat Auswirkungen auf ihre Integrationschancen, denn wenn die Kinder zu Integrationszwecken in zentrale Einrichtungen transportiert werden, sind die Voraussetzungen für die Entstehung von intensiveren persönlichen Beziehungen, die auch außerhalb des Kindergartens fortgesetzt werden können, eher ungünstig. Denn Integration ist keine Sache der Gruppe im Kindergarten, dort werden nur die Ansätze realisiert. Integration hat sich im täglichen Leben, im außerinstitutionellen Bereich zu bewähren, und zwar dann, wenn sich Kinder und ihre Familien im Alltag im Wohnbezirk, auf dem Spielplatz, beim Einkaufen oder bei anderen Gelegenheiten begegnen. Eine wohnortnahe Erziehung sollte ein anzustrebendes Ziel sein, da gemeinsames Lernen und Leben zur Förderung des Sozialverhaltens im nachbarschaftlichen und wohnortnahen Bereich am günstigsten ist (Feuser, 1986; Feuser, 1990; Miedaner, 1986; Wiedemann, 1987).
Der Vorteil der Integration im Regelkindergarten liegt darin, "daß er als Nachbarschaftskindergarten die gesellschaftliche Integration von Familien mit behinderten Kindern begünstigt." Eine kürzere Anwesenheitszeit im Regelkindergarten erlaubt z.B. behinderten Kindern, auch Beziehungen außerhalb des Kindergartens in ihrer Nachbarschaft zu entwickeln und auch die Eltern können wesentlich leichter Kontakte zueinander aufnehmen (Deutsches Jugendinstitut, 1985, S. 16).
Die Integration eines behinderten Kindes in eine ihm fremde Gruppe nichtbehinderter Kinder dient zwar auch einer Eingliederung, aber nicht dort, wo sie der Betreffende am meisten braucht. Nach Hölcke (1983) muß Integration dort passieren, wo das behinderte Kind lebt und wo ein Integrationsprozeß schon angebahnt ist.
In der vorliegenden Arbeit ist es darum gegangen, die Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem Heilpädagogischen integrativen Kindergarten näher zu beleuchten und festzustellen, welche möglichen Auswirkungen eine gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder auf das Verhalten der Kinder haben kann. Bei näherer Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich, daß in den von mir beobachteten Freispielszenen bei den nichtbehinderten Kinder das Parallelspiel zu anderen nichtbehinderten Kindern überwiegte, während die behinderten Kinder die meiste Zeit allein und unbeschäftigt waren. Es zeigte sich weiters, daß die behinderten Kinder von den nichtbehinderten toleriert werden und daß einige behinderte Kinder auch sehr von den Aktivitäten der nichtbehinderten Kinder lernen. Mangelnde kommunikative Kompetenzen bei einem Großteil der behinderten Kinder, die relativ große Distanz zum eigentlichen Wohnort bei einigen behinderten Kindern, die altershomogene Guppenzusammensetzung und das ungewohnte Nicht-Eingreifen der Erzieherinnen im Freispiel könnten unter anderem zu diesen Ergebnissen geführt haben.
Gemeinsame Erziehung bietet die Grundlage dafür, daß behinderte und nichtbehinderte Kinder frühzeitig den natürlichen Umgang miteinander lernen können und fördert die Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder (Wiedemann, 1987). Für alle Kinder, behinderte und nichtbehinderte, wird es somit zu einer Selbstverständlichkeit, mit Menschen unterschiedlicher Möglichkeiten und Fähigkeiten zusammen zu sein (Bittscheidt-Peters, 1986).
"Natürlich wird es noch eine Weile dauern, bis alle Behinderten ungehindert und selbstverständlich mitten unter uns leben können. Aber es ist notwendig, sich zwischendurch einmal umzudrehen und zurückzuschauen. Wir sind schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Darüber dürfen wir uns freuen und Kraft schöpfen für den weiteren weiten Weg" (Filzwieser, 1996).
Und dieser Weg entsteht im Gehen...
[1] Unter Kontakten zur Eigengruppe versteht man Interaktionen innerhalb der Subgruppen behinderter bzw. nichtbehinderter Kinder. Unter Kontakten zur Fremdgruppe versteht man Interaktionen zwischen den Subgruppen behinderter bzw. nichtbehinderter Kinder.
Inhaltsverzeichnis
Meine Untersuchung hatte zum Ziel, sowohl Entscheidungsgründe der Eltern für die Wahl des Kindergartens Steingruber, als auch die momentane Zufriedenheit der Eltern im Kindergarten Steingruber aufzuhellen. Da ich sowohl Merkmale der elterlichen Erziehung, Einstellung der Eltern zu Integration, als auch das soziale Umfeld erfassen wollte, war die Entwicklung eines umfangreichen Fragebogens erforderlich. Außerdem wurden noch Alter, Bildung der Eltern und Kinderzahl der Familien als unabhängige Variablen in die Untersuchung aufgenommen.
Nach der Analyse der Literatur wurden folgende relevant erscheinende Bereiche erfaßt:
- Erziehungsstil der Eltern
- Fragen zum Kindergarten
-
Erwartungen an den Kindergarten
-
Momentane Zufriedenheit mit dem Kindergarten
- Einstellung zur Behinderung
-
Information über behinderte Menschen
-
Behindertes Kind und die Stellung in der Gesellschaft
-
Sorge um behinderte Menschen
- Demographische Daten
-
Angaben zur Mutter des Kindes aus dem Kindergarten Steingruber
-
Angaben zum Vater
-
Angaben zum Kind /zu den Kindern
Der Fragebogen wurde allen Eltern, deren Kinder im Kindergartenjahr 1994/95 den Kindergarten Steingruber besuchten, übergeben und sollte von den Müttern der Kinder beantwortet werden. Insgesamt wurden 42 Fragebögen ausgegeben. Für das Ausfüllen hatten die befragten Personen 14 Tage Zeit. Von den 42 verteilten Fragebögen wurden 37 vollständig beantwortete Fragebögen zurückgesandt, was einem Prozentsatz von 88,1 % entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1. Beschreibung der Stichprobe
- 2.2. Erziehungsstil der Mütter
- 2.3. Zum Entscheidungsverlauf der Mütter bei der Wahl des Kindergartens Steingruber
- 2.4. Beurteilung der personellen Situation und der Rahmenbedingungen
- 2.5. Soziale Kontakte durch den Besuch des Kindergartens Steingruber
- 2.6. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder des Kindergartens Steingruber
- 2.7. Zufriedenheit des eigenen Kindes im Kindergarten Steingruber
- 2.8. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung eines nichtbehinderten Kindes im integrativen Kindergarten
- 2.9. Wissensstand, Wunsch nach Information und Informationsquellen der Mütter
- 2.10. Behinderte Kinder und Stellung in der Gesellschaft
- 2.11. Zuständige Stellen für behinderte Menschen
Insgesamt wurden 37 Familien befragt, davon hatten 11 Familien ein behindertes Kind und 26 Familien ein nichtbehindertes Kind im Kindergarten Steingruber.
In allen Fällen lebten Vater und Mutter mit dem Kind gemeinsam in einem Haushalt.
Das Durchschnittsalter der Mütter betrug 34 Jahre. Bei den Vätern war das durchschnittliche Lebensalter 38. Hier gab es keinen Unterschied zwischen den Eltern der behinderten und der nichtbehinderten Kinder.
Bei der Schulbildung der Mütter stellte sich heraus, daß der prozentuelle Anteil an Müttern mit hohem Bildungsniveau (Hochschulstudium, Kurzstudium) bei Mütter behinderter Kinder geringer war als bei Mütter nichtbehinderter Kinder.
Einen vergleichbaren Unterschied gab es beim Bildungsniveau der Väter behinderter und nichtbehinderter Kinder. Dies bestätigt auch, daß Väter behinderter Kinder meist im Arbeiterverhältnis und Väter nichtbehinderter Kinder hauptsächlich im Angestelltenverhältnis tätig waren. 28% der Mütter nichtbehinderter Kinder und 55% der Mütter behinderter Kinder sind Hausfrauen.
Wie auch in anderen Untersuchungen (HÖSSL, 1986; KNIEL, 1986) immer wieder festgestellt wurde, sind Mütter behinderter Kinder oft hohen Belastungen ausgesetzt und durch die Betreuung des behinderten Kindes bleibt keine Zeit für berufliche Tätigkeiten. Auch Väter behinderter Kinder sind prozentuell mehr halbtags tätig, als Väter nichtbehinderter Kinder.
Der Großteil aller Eltern (58%) hatte zwei Kinder, 21% der Eltern hatten ein Kind und 17% der Eltern hatten drei Kinder.
Von den behinderten Kindern aus dem Kindergarten Steingruber waren 64% weiblich und 36% männlich. Von den nichtbehinderten Kindern waren 54% weiblich und 46% männlich.
Dieser Teil des Fragebogens bestand aus 18 Aussagen, zu denen die Mütter ihre Meinung über Erziehungsstil verdeutlichen sollten. Die Mütter sollten angeben, wie wichtig sie die angegebenen Verhaltensweisen oder Eigenschaften für ihr Kind halten.
Mütter behinderter Kinder legten signifikant mehr Wert auf traditionelle Erziehungsziele wie Gehorsam, Ordnung, Sauberkeit etc. als Eltern nichtbehinderter Kinder. Mütter behinderter Kinder sind bei der Erziehung ihres Kindes meist verunsichert. Sie wissen nicht, was sie von ihrem behinderten Kind erwarten und verlangen können und stecken daher ihre Vorstellungen über zu erreichende Erziehungsziele anders als Mütter nichtbehinderter Kinder.
Daß ihr Kind Konflikte vermeiden soll, fanden Mütter behinderter Kinder wichtiger als Mütter nichtbehinderter Kinder. Die Konflikte im Gespräch zu lösen, erschien hingegen Müttern nichtbehinderter Kinder bedeutender.
Dies ergibt sich wahrscheinlich daraus, daß es den behinderten Kindern auf Grund ihrer Behinderung schwerer möglich ist Konflikte im Gespräch zu lösen und daher ihre Mütter es lieber sehen, wenn sie diesen aus dem Weg gehen.
Für Mütter behinderter Kinder war Leistungsfähigkeit und Ehrgeiz der Kinder ein zentrales Erziehungsziel. Mütter behinderter Kinder beobachten oft, daß ihr Kind für kleine Fortschritte viel mehr Kraft und Energie aufwenden muß, daher würden sie ihren Kinder Leistungsfähigkeit und Ehrgeiz wünschen.
Toleranz, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewußtsein waren für Mütter nichtbehinderter Kinder ein vorrangiges Erziehungsziel.
Dieses Ergebnis bestätigt, daß für viele Eltern nichtbehinderter Kinder, die ihr Kind in eine integrative Gruppe geben, das soziale Lernen in Gemeinschaft mit behinderten und nichtbehinderten Kindern einen hohen Stellenwert hat.
Obwohl behinderte Kinder öfter Enttäuschungen ertragen müssen und lernen müssen, mit zusätzlichen Problemen, welche die oft behindertenfeindliche Umwelt an sie richtet, umzugehen, waren diese Eigenschaften für Mütter behinderter Kinder nicht so bedeutend wie für Mütter nichtbehinderter Kinder.
Bei der Rekonstruktion der Suche der befragten Mütter nach einem geeigneten Kindergarten lassen sich folgende wesentliche Ergebnisse festhalten:
Die Suche nach einem geeigneten Kindergarten hatte für alle Mütter einen sehr hohen Stellenwert, nur 16% der Mütter gaben an, es wäre ohnehin 'alles klar' gewesen.
Erste Informationen über den Kindergarten Steingruber erlangten Mütter nichtbehinderter Kinder meist von FreundInnen oder anderen Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder. Mütter behinderter Kinder bekamen ihre ersten Informationen meist von ExpertInnen, wie TherapeutInnen und KinderärztInnen.
64% der Mütter behinderter und 93% der Mütter nichtbehinderter Kinder wurden bei Anfrage um Aufnahme in anderen Kindergärten nicht abgewiesen und konnten daher frei entscheiden.
Vergleicht man professionelle und private GesprächspartnerInnen, so ergibt sich, daß für Mütter behinderter Kinder professionelle und für Mütter nichtbehinderter Kinder private GesprächspartnerInnen am häufigsten bei der Entscheidung mitsprachen.
Als wichtigster privater Gesprächspartner, der am meisten bei der Entscheidung geholfen hat, galten bei allen Müttern der Partner. Für Mütter behinderter Kinder gab es außer dem Partner keine weiteren privaten GesprächspartnerInnen, die entscheidend bei der Wahl des geeigneten Kindergartens beteiligt waren. Für Mütter nichtbehinderter Kinder zählten zusätzlich zum Partner noch Eltern nichtbehinderter Kinder, Verwandte und FreundInnen zu den hilfreichsten privaten GesprächspartnerInnen.
Bei den professionellen GesprächspartnerInnen waren für Mütter behinderter Kinder die TherapeutInnen ausschlaggebend bei der Entscheidung beteiligt, hingegen bei Müttern nichtbehinderter Kinder war die Leiterin des Kindergartens Steingruber die Person mit dem größten Einfluß.
Positive Argumente von Seiten der GesprächspartnerInnen zum Thema 'Integrativer Kindergarten' waren bei beiden Gruppen deutlich mehr als Bedenken.
Beachtet man, aus Sicht der Mütter, die bei der Wahl im Vordergrund gestandenen Gesichtspunkte so ergibt sich folgendes (siehe Abb.1):
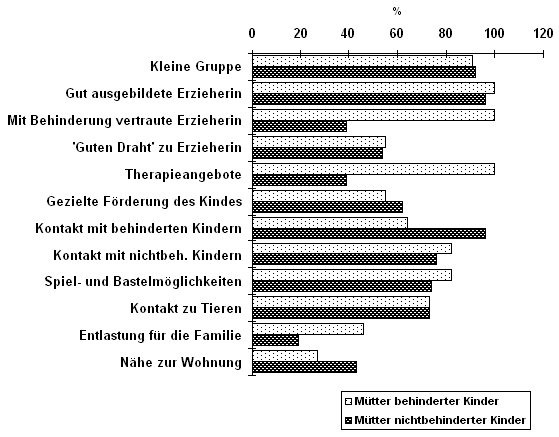
Abb. 1: Prozentuelle Häufigkeit der Bedeutung verschiedener Gesichtspunkte für die Entscheidung für den Kindergarten Steingruber
Für Mütter behinderter Kinder waren vor allem ein gut ausgebildetes Personal, mit Behinderung vertraute Erzieherinnen, Therapieangebote und die kleine Gruppe wichtig.
Für Mütter nichtbehinderter Kinder stand ebenfalls die gute Ausbildung der Erzieherinnen und die kleine Gruppe, aber auch der Kontakt zu behinderten und nichtbehinderten Kindern im Vordergrund.
46% der Mütter behinderter Kinder und 19% der Mütter nichtbehinderter Kinder sahen den Kindergartenbesuch ihres Kindes als Entlastung für die Familie.
Dieser deutliche Unterschied ergab sich wiederum daraus, daß die Pflege und Erziehung eines behinderten Kindes viel belastender ist als die eines nichtbehinderten Kindes. Mütter behinderter Kinder erhofften sich daher vom Kindergartenbesuch ihres Kindes auch eine Entlastung für die Familie.
Die Eltern sollten zu 8 Teilbereichen der Rahmenbedingungen Stellung nehmen.
Der Großteil der Mütter bewertete die Unterbringung ihres Kindes im Kindergarten Steingruber positiv.
Für die Mütter war bei der Entscheidung zum Kindergarten Steingruber die gute Ausbildung der Erzieherinnen von großer Bedeutung. Diese Erwartung hat sich bestätigt, denn die befragten Mütter hatten zum Zeitpunkt der Untersuchung sehr großes Vertrauen in die Erzieherinnen, was ihre Fähigkeit betrifft, auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Ähnlich positiv schätzten sie die fachliche Betreuung und Förderung durch die Therapeutinnen.
Für Mütter behinderter Kinder war bei der Entscheidung für den Kindergarten Steingruber besonders wichtig, daß die Erzieherinnen vertraut mit Behinderung sind, auch hier hat sich der Kindergarten Steingruber bewährt.
Für Mütter nichtbehinderter Kinder war ein wichtiger Entscheidungsgrund bei der Wahl eines Integrationskindergartens der Kontakt zu behinderten Kindern. Mit dem zahlenmäßigen Verhältnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern waren momentan 62% der Mütter zufrieden.
55% der Mütter behinderter Kinder waren mit dem zahlenmäßigen Verhältnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der Gruppe sehr zufrieden.
Auch die kleine Gruppe war bei der Entscheidung sehr ausschlaggebend. Jetzt sind 73% aller Mütter sehr zufrieden mit der Größe der Kindergruppe.
Mütter nichtbehinderter Kinder beurteilten die Zusatzangebote Flöte und Englisch äußerst positiv. Für Mütter behinderter Kinder waren diese weniger wichtig, da nicht alle behinderten Kinder diese Zusatzangebote wahrnehmen konnten.
Aus den zusätzlichen Fragen zur Wegzeit ergab sich, daß die behinderten Kinder durchschnittlich 12 Minuten länger zum Kindergarten benötigen, als die nichtbehinderten Kinder. Deshalb schätzten Mütter behinderter Kinder die Entfernung Wohnung - Kindergarten weniger gut ein. Insgesamt schien dies jedoch ein Nachteil zu sein, der von den Müttern in Kauf genommen wird. 84% der Kinder werden von Familienmitgliedern in den Kindergarten gebracht.
Um die momentane Zufriedenheit im Kindergarten Steingruber erfassen zu können, stellte ich eine Liste von Punkten auf, in Anlehnung an HÖSSL (1986), zu denen die Mütter Stellung beziehen konnten.
Von 27% der Mütter behinderter Kinder und 47% der Mütter nichtbehinderter Kinder besuchten auch Kinder aus der Nachbarschaft den Kindergarten Steingruber.
70% der Eltern und 64% der Kinder trafen gelegentlich auch außerhalb des Kindergartens andere Kinder und Eltern aus dem Kindergarten Steingruber.
Zu Gesprächen kamen 32% der Mütter regelmäßig, 65% gelegentlich und 3% gar nicht mit den Erzieherinnen des Kindergartens Steingruber zusammen. Davon kamen 55% der Mütter behinderter Kinder und nur 23% der Mütter nichtbehinderter Kinder regelmäßig zu Gesprächen zusammen.
Dies zeigt, daß besonders Mütter behinderter Kinder das Gespräch mit dem Kindergarten suchen und die Zusammenarbeit mit Eltern behinderter Kinder einen besonderen Stellenwert in der Elternarbeit innehaben sollte. Für alle Mütter standen Einzelgespräche an erster, Gespräche beim Bringen und Holen an zweiter und Elternabende an letzter Stelle.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder allgemein wurde hier unterschieden in die 'Förderung des sozialen Lernens' und die 'Förderung des kognitiven Lernens'. Insgesamt wurden 12 Aussagen in bezug auf die Förderung des sozialen und kognitiven Lernens aufgestellt.
Alles in allem unterschieden sich die Einschätzungen der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder des Kindergartens Steingruber kaum, beide Gruppen bewerteten sie äußerst positiv.
Bei der Äußerung, 'Ich bin der Meinung, daß das gegenseitige Verständnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern noch mehr gefördert werden könnte', haben Mütter behinderter Kinder mit prozentuell häufiger mit 'stimmt nicht' geantwortet als Mütter nichtbehinderter Kinder.
73% der Mütter behinderter Kinder und 69% der Mütter nichtbehinderter Kinder waren der Meinung, daß auf die Interessen und Probleme des einzelnen Kindes eingegangen wird. Auch, daß Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft der Kinder zu wenig gefördert wird, verneinten 91% der Mütter behinderter Kinder und 85% der Mütter nichtbehinderter Kinder.
Bei der Beurteilung, ob die behinderten und nichtbehinderten Kinder genügend Förderung im kognitiven Bereich bekommen, gaben Mütter nichtbehinderter Kinder häufiger die Antwort 'stimmt völlig' als Mütter behinderter Kinder.
Ein größerer Teil der Mütter behinderter Kinder glaubte, daß die Kinder bezüglich der Arbeitsdisziplin besser gefördert werden (z.B. daß die Kinder eine gute Arbeitshaltung erworben haben oder daß genügend Wert auf Ordnung und Disziplin gelegt wird). Hingegen schätzten Mütter behinderter Kinder die Förderung der Selbständigkeitsentwicklung der Kinder schlechter ein als Mütter nichtbehinderter Kinder.
Mütter nichtbehinderter Kinder schätzen die Entwicklung im sozialen Bereich ihrer Kinder geringfügig positiver ein als die Mütter behinderter Kinder.
Im Bereich der allgemeinen Zufriedenheit gab es folgende Unterschiede:
82% der Mütter behinderter und 77% der Mütter nichtbehinderter Kinder schätzen das Vertrauen der eigenen Kinder zu den Erzieherinnen sehr hoch ein. Der Aussage: "Mein Kind geht nicht gerne in den Kindergarten", widersprachen 82% der Mütter behinderter Kinder und nur 50% der Mütter nichtbehinderter Kinder. Bei der Aussage, "Mein Kind hat guten Kontakt zu den behinderten Kindern des Kindergartens" bestätigen 64% der Mütter behinderter Kinder und nur 31% der Mütter nichtbehinderter Kinder. Insgesamt fühlen sich nach Aussagen der Mütter die Kinder in den Gruppen sehr wohl.
Im Zweig Niveau der Anforderung sind sich die Mütter in ihren Antworten wiederum einig: 100% der Mütter behinderter Kinder verneinten, daß sich ihr Kind unterfordert fühlt oder den Kindergartenbesuch langweilig findet. Zur Frage nach der Überforderung des eigenen Kindes durch den Kindergartenbesuch negieren dagegen nur 82% der Mütter behinderter Kinder. Mütter nichtbehinderter Kinder lehnen zu 96% die Unterforderung und zu 92% die Überforderung ihrer Kinder ab. Ebenso sind 89% der Mütter nichtbehinderter Kinder der Überzeugung, daß ihr Kind den Kindergartenbesuch nicht langweilig findet.
Ich stellte in Anlehnung an UNTERLEITNER (1989) neun Aussagen auf, die ich in die Bereiche des sozialen und kognitiven Lernens unterteilte.
Insgesamt glaubten die Mütter, daß sich die Persönlichkeit des nichtbehinderten Kindes im sozialen Lernen in einer Integrationsgruppe positiv entfalten kann. 29% der Mütter behinderter Kinder und 92% der Mütter nichtbehinderter Kinder sind der Meinung, daß der Besuch des integrativen Kindergartens dem nichtbehinderten Kind durch seine besondere Gestaltung zugute kommt und daß das nichtbehinderte Kind dort verstärkt soziale Fähigkeiten lernt.
Nur 64% der Mütter behinderter und 89% der Mütter nichtbehinderter Kinder glauben nicht, daß das nichtbehinderte Kind die behinderten Kinder ablehnen würde. Dieser Unterschied ergibt sich vielleicht dadurch, daß Mütter behinderter Kinder bereits vermehrt negative Erfahrungen mit nichtbehinderten Kindern gemacht haben und daher ihre eigenen Erfahrungswerte miteinfließen lassen.
Die Aussage, daß sich keine Freundschaften zwischen dem nichtbehinderten Kind und den behinderten Kindern entwickeln werden, lehnen 91% der Mütter behinderter Kinder und nur 65% der Mütter nichtbehinderter Kinder ab.
Wenn man die Förderung des sozialen Lernens und des kognitiven Lernens vergleicht, so ergibt sich, daß die Mütter sich bei der Förderung des sozialen Lernens sicherer sind, daß sich diese positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung des nichtbehinderten Kindes auswirkt.
Bei der Aussage, daß die Leistungsanforderungen je nach Fähigkeit jedes einzelnen Kindes auch in der integrativen Gruppe die bestmögliche Förderung des nichtbehinderten Kindes ermöglichen, stimmten prozentuell mehr Mütter behinderter Kinder als Mütter nichtbehinderter Kinder zu. Dagegen bei der Einschätzung, ob nichtbehinderte Kinder durch die Anwesenheit der behinderten Kinder bei ihrer Arbeit abgelenkt werden, sind die ablehnenden Nennungen der Mütter nichtbehinderter Kinder häufiger als die der Mütter behinderter Kinder.
In Anlehnung an BÄCHTOLD (1981) wurde für die Überprüfung nicht der inhaltliche 'Wissensstand' als Variable herangezogen, sondern das Ausmaß und die Art der Informationsaufnahme. Auf die Frage 'Wieviel wissen Sie über behinderte Kinder?' glaubten nur 32% der Mütter behinderter Kinder und 23% der Mütter nichtbehinderter Kinder sehr viel bis viel über dieses Thema zu wissen. Trotzdem sind sich die Mütter nicht sicher, ob sie sich mehr mit dem Thema beschäftigen wollen. 36% der Mütter behinderter Kinder stimmten mit 'eher ja' und 35% der Mütter nichtbehinderter Kinder stimmten mit 'eher nein'.
64% der Mütter behinderter Kinder haben 'eher keine' bis 'keine' Schwierigkeiten, sich in die Probleme behinderter Kinder hineinzuversetzen. Hingegen haben 55% der Mütter nichtbehinderter Kinder 'große' bis 'etwas' Schwierigkeiten.
Die am häufigsten genannten Informationsquellen der Mütter behinderter Kinder sind Informationen von Arzt/Ärztin bzw. TherapeutInnen, Radio und Fernsehen und Informationen aus dem Bekanntenkreis. Bei den Müttern nichtbehinderter Kinder sind Informationen aus dem Bekanntenkreis, Zeitungen oder Zeitschriften gefolgt von Informationen aus dem Kindergarten Steingruber die am meisten genannten. (siehe Abb.2)
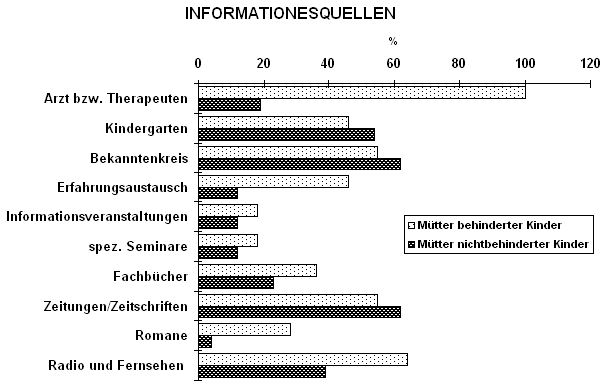
Abb. 2: Informationsquellen der Mütter zu Thema 'Behindertes Kind'
Es wurden die Mütter nach ihrer Vorstellung gefragt, wie sich Nachbarschaftskinder gegenüber einem behinderten Kind verhalten.
45% der Mütter behinderter Kinder und 23% der Mütter nichtbehinderter Kinder glauben, daß Kinder der Nachbarschaft Angst vor dem behinderten Kind haben.
Aber auch Neugierde trauten die Mütter den Nachbarschaftskinder teilweise zu, 18% der Mütter behinderter Kinder und 46% der Mütter nichtbehinderter Kinder stimmten hier mit 'fast immer'.
Daß Kinder der Nachbarschaft das behinderte Kind manchmal verspotten, trauten die Mütter behinderter Kinder (36%) und Mütter nichtbehinderter Kinder (35%) den Kindern zwar teilweise zu, aber Schlagen kommt nach Meinung der Mütter behinderter Kinder (54%) und Mütter nichtbehinderter Kinder (73%) nicht vor.
In Bezug auf Hilfsbereitschaft anderer Kinder sind die Mütter weniger positiv eingestellt. Nur 18% der Mütter behinderter Kinder und 23% der Mütter nichtbehinderter Kinder kreuzten 'fast immer' an.
Die Mütter glauben, daß die Kinder aus der Nachbarschaft eher weniger mit dem Kind spielen oder es behandeln wie jedes andere Kind. Daß die Nachbarschaftskinder Mitleid mit dem behinderten Kind haben, glauben 18% der Mütter behinderter Kinder und 27% der Mütter nichtbehinderter Kinder.
In diesem Teil wurden sieben Stellen angeführt, die oft als zuständig für Behinderte genannt werden. Die Mütter konnten auf drei Arten antworten (ja, teilweise und nein).
Beide Müttergruppen sind sich einig, daß die Familie an erster Stelle steht, wenn es um die Sorge eines behinderten Menschen geht. An zweiter Stelle der zuständigen Personengruppen für behinderte Menschen stehen die Fachleute.
Mütter behinderter Kinder weisen die Verantwortung für behinderte Menschen eher 'kompetenten und betroffenen' Personen (Fachleute, Familie) zu. Mütter nichtbehinderter Kinder nennen zwar auch die Familie und Fachleute als wichtigste Betreuungsstellen, aber sie befürworten auch das persönliche Engagement jedes einzelnen. Mütter behinderter Kinder glauben weniger als Mütter nichtbehinderter Kinder, daß sich jeder einzelne um behinderte Menschen kümmern sollte. Hervorzuheben ist auch, daß sich nicht nur andere nichtbehinderte Menschen um Behinderte kümmern sollten, sondern auch Behinderte sich gegenseitig unterstützen sollten. Die hohe Häufigkeit der Nennungen in bezug auf die Selbsthilfe der Behinderten läßt sich darauf zurückführen, daß der 'Integrationsgedanke' auch auf die größtmögliche Selbständigkeit der behinderten Menschen hinarbeitet.
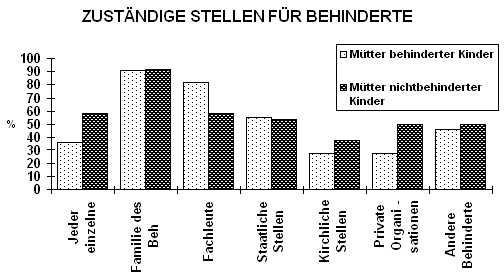
Abb. 3: Zuständige Stellen für behinderte Menschen
Für mich hat sich durch diese Untersuchung wieder einmal bestätigt, daß es nicht mehr um die Frage geht, ob integriert werden soll oder nicht. Für mich geht es nur mehr um die Frage, wie am besten integriert werden kann, damit alle Beteiligten zufrieden sind und davon profitieren. In dieser Hinsicht gibt es noch viel zu forschen, zu diskutieren, zu schreiben und vor allem zu praktizieren.
Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Organisationsstatut für Heilpädagogische Kindergärten. Graz: 1987.
Angerer, A., Raab, E. & Streit, P. (1994). Akzeptiert? Soziale Reaktionen von Kindergärtnerinnen und Eltern auf behinderte Kinder im Vorschulalter. Graz: Leykam.
Arnold W., Eysenck H.J. & Meili, R. (1991). Lexikon der Psychologie (7. Auflage; Band 2 und 3). Freiburg: Herder.
Bächtold, A. (1981). Behinderte Jugendliche: Soziale Isolation oder Partizipation? Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. Bern.
Becker-Gebhardt, B. (1990). Soziale Beziehungen zwischen Peers. In: Staatsinstitut für Frühpädagogik und Familienforschung (Hrsg.), Handbuch der integrativen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder (S. 69-102). München: Ernst Reinhardt Verlag.
Bittscheidt-Peters, D. (1986). Integration als pädagogische und politische Aufgabe. Gemeinsam leben, 1, 39-54.
Blöschl, L. (1988). Neue Beiträge der empirisch-psychologischen Forschung in der Heilpädagogik. In: Österreichische Gesellschaft für Heilpädagogik (Hrsg.), Heilpädagogik 2000-7.Österreichischer Heilpädagogischer Kongreß (S. 12-18). Graz: Leykam.
Bonderer, E. (1981). Integration aus der Sicht der Behindertenpädagogik. In: A. Bächtold & E. Bonderer (Hrsg). Schweizer Beiträge zur Integration Behinderter, (S. 11-37). Luzern: Schweizer Zentralstelle für Heilpädagogik.
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg). (1982). Ein Kindergarten für behinderte und nichtbehinderte Kinder-Erfahrungen aus integrativen Einrichtungen im Elementarbereich (BMW-Werkstattberichte 40). Bonn: Boss-Druck.
Cloerkes, G. (1982). Die Kontakthypothese in der Diskussion um eine Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabechancen Behinderter. Zeitschrift für Heilpädagogik, 33, 561-572.
Deutscher Bildungsrat (Hrsg). (1973). Empfehlungen der Bildungskommision: Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Bonn.
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.). (1985). Gemeinsam leben-Informationen zu Fragen der Integration von Kindern mit besonderen Problemen in Einrichtungen des Elementarbereichs.
Dichans, W. (1987). Kindergarten-Ein Lebensraum für behinderte und nichtbehinderte Kinder. Gemeinsam leben, 2, 29-33.
Dichans, W. (1990). Der Kindergarten als Lebensraum für behinderte und nichtbehinderte Kinder. Köln: Verlag W. Kohlhammer.
Dorsch, F. (1994). Psychologisches Wörterbuch (12.Auflage). Bern: Huber.
Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt (Hrsg.). (1982). Erfahrungen bei Einrichtung und Führung eines integrativen Kindergartens (Schriftenreihe Lernziel Integration; Heft Nr. 1). Bonn: Reha-Verlag GmbH.
Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt (Hrsg). (1983). Wissenschaftliche Begleitung des Geschehens in einem integrativen Kindergarten (Schriftenreihe Lernziel Integration; Heft Nr. 2). Bonn: Reha-Verlag GmbH.
Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt (Hrsg). (1984). Wissenschaftliche Begleitung des Geschehens in einem integrativen Kindergarten-Endbericht (Schriftenreihe Lernziel Integration; Heft Nr. 3). Bonn: Reha-Verlag GmbH.
Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt (Hrsg). (1987). Wissenschaftliche Begleitung des Geschehens in einem integrativen Kindergarten-Ergänzung (Schriftenreihe Lernziel Integration; Heft Nr. 4). Bonn: Reha-Verlag GmbH.
Faßnacht, G. (1979). Systematische Verhaltensbeobachtung. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Feuser, G. (1982). Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand/Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. Behindertenpädagogik, 21, 86-105.
Feuser, G. (1984). Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Bremen.
Feuser, G. (1984). Curriculare und thematische Aspekte einer Qualifikation für die pädagogisch-therapeutische Tätigkeit in der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder (Integration) in Regelkindergärten/ Kindertagesheimen. Behindertenpädagogik, 23, Heft 4/ 1984, S. 315-330.
Feuser, G. (1986). Unverzichtbare Grundlagen und Formen der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindergarten und Schule. Behindertenpädagogik, 25, 122-139.
Feuser, G. (1990). Grundlagen einer integrativen Pädagogik im Kindergarten- und Vorschulalter. Behinderte, 1, 5-26.
Fragner, J. (1990). Gemeinsam spielen - voneinander lernen. Behinderte, 1, 29-33.
Filzwieser, P. (4.12.1996). Ein weiter Weg. Kleine Zeitung, S. 9.
Griessler, D. (1990). Ein Kindergarten probt die Integration. Behinderte, 1, 35-39.
Gruber, H. (1984). Möglichkeiten der Integration behinderter Kinder in Österreich-eine kritische Bestandsaufnahme. Unser Weg, 39 (7-8), 283-290.
Guralnick, M.J. (1981c). The development and role of child-child sozial interactions. In: N.J. Anastasiow (Hrsg.), Sozioemotional development. New directions for exceptional children (S. 53-80). San Francisco: Jossey-Bass.
Guralnick, M.J. & Groom, J.M. (1987). The peer relations of midly delayed and nonhandicapped preschool children in mainstreamed playgroups. Child Development, 58, 1556-1572.
Hoffman, M. (1992). Zusammenleben im Kindergarten - Dynamische Prozesse zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen. Weinheim München.
Hölcke, K. (1983). Integration behinderter Kinder in Regelkindergärten. Unsere Jugend, 35, 97-104.
Huppertz, N. (1974). Elternarbeit vom Kindergarten aus. Freiburg.
Institut für empirische Sozialforschung. (1981). Behinderte Kinder in Kindergärten. Wien.
Initiative Soziale Integration (1986). Rahmenmodell für einen Integrationskindergarten. Graz.
Jansen, G. (1987). Prozesse der Ausgliederung und der Integration. In: J. Fengler & G. Jansen (Hrsg.), Handbuch der heilpädagogischen Psychologie (S.259-276). Stuttgart: Kohlhammer.
Kaplan, Rückert, Garde u.a. (1993). Gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder - Handbuch für den Kindergarten. Weinheim Basel.
Kessler, J. (1986). Behinderte und nichtbehinderte Kinder im integrierten Kindergarten. Wien: Jugend und Volk.
Klein, G., Kreie, G., Kron, M. & Reiser, H. (1987). Integrative Prozesse in Kindergartengruppen. München: DJI.
Kniel, A. & Kniel, C. (1984). Behinderte Kinder in Regelkindergärten - Eine Untersuchung in Kassel. München: DJI.
Kreie, G. (1986). Pädagogische Aspekte integrativer Arbeit im Kindergarten. Gemeinsam leben, 1, 77-92.
Kron, M. (1988). Kindliche Entwicklung und die Erfahrung von Behinderten - eine Analyse der Fremdwahrnehmung von Behinderung und ihre psychische Verarbeitung bei Kindergartenkindern. Frankfurt am Main: AFRA-Verlag.
Kron, M. (1990). Integrative Prozesse in Kindergärten - Theorie und Erfahrungen aus der Praxis. In: H. Eberwein (Hrsg.), Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam-Handbuch der Integrationspädagogik (S. 123-127). Basel: Beltz.
Merker, H. (1993). Beratung von Tageseinrichtungen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern. Köln.
Miedaner, L. (1986). Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder . Materialien zur pädagogischen Arbeit im Kindergarten. München: DJI.
Möllney, M. (1994). Integration im Kindergarten - Nur eine Chance für Behinderte?Aktuelle Ergebnisse der integrativen Erziehung (Edition Wissenschaft, Band 45). Marburg: Tectum Verlag.
Mühl, H. (1987). Integration von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Gemeinsame Erziehung mit Nichtbehinderten in Kindergarten und Schule. Berlin: Marhold.
Oerter, R. (1987). Jugendalter. In: R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 265-338). München: Psychologie Verlags Union.
Reiser, H. (1987). Interaktionsprozesse in integrativen Kindergartengruppen. Gemeinsam leben, 2, 23-28.
Saurbier, H. (1982). Rechtliche und finanzielle Grundlagen der Integration behinderter Kinder im Kindergarten. München: Deutsches Jugendinstitut.
Schrausser, H. (1984). Einführung in die Problematik der Integration. Unser Weg, 39 (7-8), 244-249.
Steingruber, H. (1990). Voraussetzungen für die Erprobung eines gemeinsamen Gesamtkonzeptes. Unveröffentlichte Schrift, Graz.
Steingruber, H. (1990) Integration. Unveröffentlichte Schrift, Graz 1990.
Steingruber, H. (1991). Der integrative Kindergarten - Vorstellung eines Erprobungsmodells. In: Initiative Soziale Integration Graz (Hrsg.), Behinderte Gesellschaft - Integration statt Aussonderung - 7.österreichisches Integrationssymposium (S. 187-191). Graz.
Tröster, H. (1990). Einstellungen und Verhalten gegenüber Behinderten. Bern: Huber.
Unterleitner, I. (1989): Sozial-integrative Schule. Leistungen und Einstellungen nichtbehinderter Kinder und Elterneinstellungen - eine Längsschnittuntersuchung. Unveröffentlichte Diplomarbeit: Wien.
Wiedemann, I. (1987). Gemeinsam leben, gemeinsam lernen.- Motivation und Rolle der Eltern. In: A. Kniel (Hrsg.), Integration behinderter Kinder im Vorschulalter - Modelle und Perspektiven (S. 4-34). Kassel: Gesamthochschulbibliothek.
Wocken, H. (1991). Integration heißt auch: Arbeit im Team. Pädagogik Jahrgang 43, Heft 1, S.18-22.
World Health Organization (WHO). (1980) International classification of impaiments, disabilities and handicaps. Genf: World Health Organization.
Quelle:
Furtlehner Constanza, Ruprechter Petra, Perle Sandra: Wissenschaftliche Begleitung eines Heilpädagogischen integrativen Kindergartens
Hrsg.: Wissenschaftsladen Graz 1998
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 12.07.2006
