Masterarbeit zur Erlangung des Grades der Magistra an der Universität Münster 2010, Begutachterin: Prof.in Dr. Fürstenau, Zweitprüfer: Marcel Veber
Inhaltsverzeichnis
Der Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung Vernor Muñoz kritisiert in seinem Bericht von 2007 Deutschland scharf für das ungerechte, stark aussondernde Bildungssystem (Muñoz 2007). Bei einem Vortrag in Oldenburg im letzten Jahr sagte er in Bezug auf die Etablierung eines inklusiven Schulsystems in Deutschland, es müsse sich nur eine Kleinigkeit ändern: nämlich alles (Muñoz 2009, S. 7). Vor dem Hintergrund dieses niederschmetternden Urteils wirken die vielen Titel wissenschaftlicher Publikationen aus jüngster Zeit, die Deutschland 'auf dem Weg' zu einem inklusiven Schulsystem wähnen, zu optimistisch: "Auf dem Weg zur Schule für alle" (Hinz u.a. 2010), "Alle sind verschieden - auf dem Weg zur Inklusion in der Schule" (Schöler 2009), "Diversity-Management - eine hilfreiche Anregung auf dem Weg zu einer inklusiven Schule" (Niehoff 2010), "Auf dem Weg zur Schule für Alle" (Klauß 2010), "Die Grundschule auf ihrem langen Weg zu 'Einer Schule für alle'" (Heyer 2010). Angesichts dieser Auflistung gewinnt man den Eindruck, dass sich, ganz im Sinne Muñoz', tatsächlich seit einiger Zeit etwas bewegt in der Schulpolitik, der Schulentwicklung und der Lehrerausbildung. Nichtsdestotrotz kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht behaupten, dass in Deutschland die flächendeckende Etablierung inklusiver Schulen kurz bevorstehe. Es gibt noch viele 'Baustellen' und offene Fragen, an denen es zu arbeiten gilt.
Die vorliegende Arbeit wird von den 'Baustellen' vor allem die der Unterrichtsentwicklung in den Fokus stellen. Der Unterricht in einer Klasse, in der alle Kinder gemeinsam lernen sollen - blinde Kinder, hochbegabte Kinder, hyperaktive Kinder, ängstliche Kinder, aggressive Kinder, schwerstbehinderte Kinder, nicht-deutschsprachige Kinder, etc. - muss so gestaltet werden, dass die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes berücksichtigt werden und jedes einzelne Kind gefördert wird. Wie dies jedoch genau möglich sein soll und ob es überhaupt möglich ist, wird heute kontrovers von Inklusionsbefürwortern[1] und -gegnern diskutiert.
An diesem Punkt stellt die vorliegende Arbeit die Verbindung her zwischen der Problematik 'Inklusion' zu einer bestimmten Konzeption 'Offenen Unterrichts'.
Falko Peschel, mit dessen Konzept des 'Offenen Unterrichts' ich mich seit einigen Jahren beschäftige, vertritt als Grundprinzipien der Organisation seines Unterrichts eine weitgehende Selbstregulierung der Kinder in Bezug auf ihr Lernen und ihr Klassenleben.
Wenn den Kindern die Verantwortung für ihr Lernen und ihre Gemeinschaft übergeben wird, so Peschel, entstehe einerseits eine größtmögliche individuelle Passung zwischen Lernstoff und Wissensstand des Kindes, und andererseits ergäben sich in Bezug auf das soziale Leben und Miteinander viele Probleme nicht bzw. würden sich von selbst lösen - nämlich durch die Kinder direkt. Auf Grund einer Hospitation an Peschels Schule und auf Grund der Beschäftigung mit der Inklusionsproblematik ergab sich für mich die Fragestellung, ob dieser selbstregulierte 'Offene Unterricht' nicht womöglich eine große Chance besonders für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen und damit für inklusive Settings bietet, da Peschel durch die Gewährung von verhältnismäßig großen Freiheitsspielräumen einen hochgradig individualisierten Unterricht praktizieren zu können scheint. Eine der Kernfragen dieser Arbeit, die natürlich nicht abschließend beantwortet werden kann, ist also die folgende: Kann der 'Offene Unterricht' einen fruchtbaren Beitrag leisten, inklusive Schulstrukturen zu entwickeln?
Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich zunächst die Begriffe der Integration und Inklusion einführen und klären, sowie die Inklusionsthematik geschichtlich einordnen und auf die 'Schule für alle' eingehen, welche im Zentrum der Forderungen der Inklusionspädagogen steht (2.1-2.3).
Anschließend wird in Kapitel 3 Peschels Unterrichtskonzept vorgestellt. In diesem Zusammenhang stelle ich explizit seine eigene Evaluation des Konzeptes vor (3.2), da diese später als Grundlage der weiteren Argumentation dient. Außerdem werde ich bereits dort das Konzept des 'Offenen Unterrichts', das an einer Regelschule erprobt wurde, auf seine inklusiven Tendenzen hin prüfen (3.3), was als Überleitung zur intensiven Auseinandersetzung mit Peschels Konzept im Hauptteil dient.
Im Hauptteil der Arbeit geht es darum, konstitutive Merkmale für inklusive Schulen und inklusiven Unterricht zu bestimmen, um einen Vergleich zwischen diesen und konstitutiven Merkmalen von Peschels Konzept zu ermöglichen. Dazu ziehe ich den Inklusionspädagogen Reinhard Stähling heran, der eine der wenigen Schulen in Deutschland leitet, die versucht, inklusive Strukturen und inklusive soziale Praktiken umzusetzen. Stähling spricht von der Entwicklung eines "Nährbodens von Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit" (ders. 2009, S. 140) in der Schule, ohne den Inklusion nicht möglich sei. Anhand von Stählings Monographie soll diese zunächst vage Formulierung auf ihre konkreten Inhalte hin untersucht werden, um so Merkmale inklusiven Unterrichts festzustellen.
Daran anschließend soll die Verbindung zu Peschel hergestellt werden: Wenn die aus Stählings Ansatz herausgefilterten Aspekte, die sich unter dem Dach von 'Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit' versammeln, grundlegend sind für das Gelingen einer inklusiven Schule, dann müssten sie bei Peschel, insofern dessen Konzept für die Inklusionspädagogik eine praktikable Alternative darstellen würde, Berücksichtigung erfahren. Peschels und Stählings Konzepte werden also diesbezüglich auf Parallelen und Unterschiede geprüft. Die Kernfrage dieser Arbeit wird dahingehend spezifiziert, ob der 'Offene Unterricht' trotz oder gerade wegen der weitgehenden Selbstregulierung die Entstehung eines solchen 'Nährbodens' fördern kann. Dabei sei schon an dieser Stelle auf die problematische Quelle, nämlich Peschels eigene Evaluation seines Konzeptes, verwiesen.
Peschel steht mit seinem Konzept des Offenen Unterrichts für eine bestimmte Richtung in der (Inklusions-)Pädagogik, die darin besteht, den Schülern weitgehende Selbstbestimmung in Bezug auf ihr Lernen zu gewähren, während Stähling für ein gemäßigtes Konzept von Selbstregulation steht.
Ausgehend von der Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen von Peschels Ansatz soll am Ende ein Ausblick auf mögliche Entwicklungen der Inklusionspädagogik gewagt werden. Dies dient im Sinne des Baustellenbildes zur besseren Ausschilderung der 'Baustelle Inklusion', denn der Streit um die adäquate theoretische Planung, die praktische Umsetzung und die politische Durchsetzung eines kompletten Hauses, in das eine 'Schule für alle' einziehen könnte, ist in Deutschland noch lange nicht entschieden.
Inhaltsverzeichnis
Seit Mitte der 90er Jahre hält der Begriff der Inklusion Einzug in die deutschsprachige Erziehungswissenschaft. Dabei kommt es teilweise noch immer zu ungenauen Verwendungen des Begriffs in der Wissenschaft, in der Politik und in der öffentlichen Diskussion (vgl. Sander 2004, S. 240). Zu Beginn der vorliegenden Arbeit erfolgt deshalb zunächst eine konzeptuelle Analyse des Begriffs. Diese Einführung erfordert auch eine systematische Auseinandersetzung mit und Abgrenzung vom Begriff der Integration, da die Begriffe oft relational zueinander definiert und teilweise synoym verwendet werden (vgl. Sander 2004, S.240). Anschließend an die begrifflichen, begriffsgeschichtlichen und theoretischen Klärungen, welche im Kontext älterer und neuerer Debatten erläutert werden, wird in 2.2 die Entwicklung der Idee der Integration in der deutschen Schulpolitik bzw. internationalen Menschenrechtspolitk und in der pädagogischen Praxis kurz umrissen, um den Begriff und das Ideal der Inklusion in die Geschichte der Inklusionspädagogik[2] einordnen zu können. Diese Einordnung wird unternommen, um zu verdeutlichen, auf welchen aktuellen politischen Entscheidungen die zukünftige Entwicklung einer inklusiven Schule fußt und vor welchem historisch-politischen Kontext die heutige Debatte zu verstehen ist. Dabei soll deutlich werden, dass die Entwicklung von (schulischer) Inklusion ein gerade erst beginnender Prozess ist, den es noch zu gestalten gilt. Im Bereich der Schule kann sich dieser Prozess im Aufbau einer 'Schule für alle' ausdrücken, auf den in 2.3 eingegangen wird.
In Anlehnung an den internationalen Gebrauch - vor allem durch die Betonung des Begriffs 'inclusion' in der Salamanca-Erklärung der UNESCO von 1994 (vgl. UNESCO 1994, s. 2.2) - wird der Begriff der Inklusion seit Mitte der 90er Jahre auch in Deutschland gebräuchlich (vgl. Sander 2004, S. 240). Allerdings wird er zur Zeit seiner Einführung und häufig auch heute noch äußerst diffus verwendet, wodurch unklar bleibt, welche Praktiken und Strukturen mit dem Prädikat 'inklusiv' versehen werden können oder sollen und welche nicht. Der Begriff der Inklusion, wie der der Integration, wird in der Regel nicht rein deskriptiv verwendet, das heißt, dass die Bezeichnung einer Praxis als inklusiv auch immer ein implizites oder explizites Werturteil über diese Praxis bedeutet. Dabei bleibt der tatsächliche normative Gehalt des Begriffs allerdings meist unklar und verkommt zu einer "Überredungsdefinition" (Reichenbach 2004): Spricht sich jemand im wissenschaftlichen oder öffentlichen Diskurs offen für Integration oder Inklusion aus, kann er sich fast automatisch sicher sein, zunächst Zustimmung innerhalb des Publikums zu ernten. Dadurch entsteht aber eine Problematik, die Reichenbach folgendermaßen beschreibt:
"Überredungsdefinitionen (persuasive definitions) sind Definitionen, die weniger bestimmen, eingrenzen und klären (was ihre Aufgabe wäre), als vielmehr mit emotional aufgeladenen Wörtern zu ´überzeugen´ trachten und so auf mehr oder weniger direkte, mehr oder weniger polemische Weise Eindeutigkeiten erzeugen" (Reichenbach 2004, S.3).
Die Nutzung der Begriffe als Überredungsdefinitionen im Sinne Reichenbachs oder auch als abstrakte Konsensformeln (denn wer ist schon gegen Integration?) verhindert häufig, die jeweilige genaue Bedeutung der Begriffe zu erschließen. Gefördert wird dieser 'Gutwortcharakter' durch das ineinander verwobene Wechselspiel der Begriffsverwendung zwischen Bildungspolitk, (Erziehungs-)Wissenschaft und Alltag, das den schwammigen Gebrauch verstärkt. Es ist innerhalb dieser Debatten teilweise äußerst schwierig zu differenzieren und spezifizieren, welcher Begriff für welche Praxis steht. Im Folgenden soll deshalb in Anlehnung an begriffsgeschichtliche und historische Entwicklungen ein Definitionsversuch der Begriffe unternommen werden.
Als Beispiel für diffuse Begriffsverwendungen seien hier zunächst drei Artikel der 'Zeitschrift für Heilpädagogik' aus den späten 90er Jahren angeführt: Bei Völkel dient 'Inklusion' z.B. als Übersetzung des englischen Begriffs 'inclusion', welche im Text verwendet wird, ohne dass allerdings die Bedeutung des Begriffs im englischsprachigen Raum genauer geklärt und analysiert würde (ders. 1997, S. 444); Gröschke benutzt ihn ohne klare Abgrenzung neben dem Begriff Integration im Sinne einer verstärkenden Wiederholung bei gleichbleibendem Bedeutungsgehalt (ders. 1998, S. 368), und auch Opp scheint, obwohl dies aus seinen Ausführungen nicht klar ersichtlich ist, mit 'Inklusion' lediglich ein Synonym von 'Integration' zu meinen (ders. 1998, S. 493). Hofsäss bemerkt dementsprechend zu Beginn des neuen Jahrtausends, 'Inklusion' sei ein "in der Sonderpädagogik noch nicht hinreichend geklärter Begriff" (ders. 2001, S. 387). Ein Jahr später liefert Hinz einen Versuch, der "zunehmenden Verwirrung" (ders. 2002, S. 354) im Umgang mit dem Begriff mit der noch ausstehenden Definition zu begegnen. Er unterscheidet in dem Aufsatz von 2002 den älteren Begriff der Integration definitorisch deutlich vom neueren Begriff der Inklusion, wobei Praktiken, für die der ältere Begriff Integration steht, kritisiert werden; ihnen wird 'Inklusion' als neues (bzw. neu entdecktes) Ideal gegenübergestellt.
Der Begriff der Integration steht nach Hinz (2002) also für defizitäre ('Integrations'-)Praktiken, während der Begriff der Inklusion, der relational zum ersteren eingeführt wird, für ein noch zu erreichendes, noch nicht verwirklichtes Ideal steht. Der Inklusionsbegriff steht in seiner utopischen Ausführung für tatsächliche oder noch zu erstrebende Entwicklungen im Bildungssystem und dient demnach als normativer Maßstab, der zur Kritik bestehender pädagogischer Praktiken und Strukturen Verwendung findet.
Bevor die bildungspolitischen und pädagogischen Implikationen dieses Ideals genauer erläutert werden können, muss zunächst durch einen historischen Exkurs geklärt werden, welche Entwicklungen zu der heutigen Verwendung des Begriffs (nach Hinz 2002) und den entsprechenden Bedeutungsverschiebungen beigetragen haben.
Zu Beginn der Integrationsforschung beschreibt der Begriff der Integration (vom lateinischen integratio: Widerherstellung/ integrare: wiederherstellen, erneuern) ebenfalls ein Ideal, das es zu erreichen gilt: Als ursprüngliches Ziel der Integration beschreibt Eberwein die "Überwindung aussondernder Einrichtungen sowie deren pädagogischer Konzeptionen zugunsten gemeinsamen Lernens und Lebens" (ders. 1997, S. 55) und macht unmissverständlich klar, dass das Festhalten an der Aussonderung 'behinderter' Kinder in Sonderschulen nicht vertretbar ist (ebd., S. 66). Jakob Muth, damaliger Vorsitzender der Bildungskommission und somit ein "Vater der Integration" (Wocken 2009, S. 216), stellt in den 80er Jahren mit seinem vielzitierten pädagogischen Slogan fest, dass Integration "unteilbar" sei (Muth 1986, S. 5), was als Idee der Nicht-Aussonderung einzelner Kinder verstanden werden muss. Als logische Konsequenz dieses Verständnisses des Begriffs fordert in diesem Sinne Jantzen schon 1981 in aller Deutlichkeit: "Schafft die Sonderschule ab!" (Jantzen 1981).
Die hier angeführten Auffassungen von Eberwein, Jantzen und Muth zeigen, dass von Seiten der Integrationspädagogik schon verhältnismäßig früh das Ideal der 'Vollintegration' angestrebt wurde. Als Ergebnis soll die Integrationspädagogik die Sonderpädagogik ablösen (s.u.) und das, was ehemals 'Sonder'-pädagogik mit eigener, besonderer Klientel war, soll nun zu einer Pädagogik für alle ohne spezifische Besonderung werden. Dabei soll an dieser Stelle klargestellt werden, dass weder zu Beginn der Integrationspädagogik in den 70er Jahren noch heute längst nicht alle Pädagogen diese Ansicht teilen: Besonders in der Sonderpädagogik selbst gibt es viele Kritiker einer 'Vollintegration'.[3] Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass zumindest die meisten Integrationspädagogen der ersten Stunde zu Beginn der Diskussion und der beginnenden Praxis der Integration das hier dargestellte Ideal von Integration vertreten haben (vgl. Abbildung 3).
Nach dieser Nachzeichnung der ursprünglichen Idee von 'Integration' soll nun ein Blick auf die Praxis geworfen werden, was mit der Kritik an der Integration einhergeht: Trotz der inzwischen fast 40 Jahre andauernden Diskussion um die Eingliederung 'behinderter' Menschen in das Regelschulsystem wird in NRW heute nur ein Sechstel der Kinder mit 'sonderpädagogischem Förderbedarf' an allgemeinen Schulen beschult (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010). Den Vorstellungen der Integrationspädagogen zum Trotz ist es in Deutschland der Normalfall, dass die meisten Kinder während ihrer Schulzeit nicht in durch die Schule bedingten Kontakt mit 'behinderten' Kindern kommen (vgl. Platte 2005, S. 83).
Die heutige Integrationspraxis weist neben diesem quantitativen Manko bzw. dem Fakt, dass sie nicht oder nur kaum realisiert wird, auch qualitative Fehlentwicklungen auf (vgl. Reiser 2009, S. 307). Wenn heute Integration stattfindet, - und das ist, wie gesagt, nicht der Normalfall - so gestaltet sie sich meist als "additive Situation" (vgl. Hinz 2002, S. 355): Ein Sonderpädagoge ist speziell für ein Kind - das 'behinderte' Kind - verantwortlich und 'übersetzt' ihm, was für seine derzeitigen Fähigkeiten im Unterricht zu schnell oder zu schwer ist. Obwohl diese separate Behandlung durchaus direkt neben den anderen Kindern stattfinden kann, auf den ersten Blick also nach einer gemeinsamen Lernsituation aussieht, findet letztlich keine Integration statt: Das Kind wird nicht als 'normaler' Schüler in die Klasse hinein geholt (integrativ), sondern nur zur Klasse dazu geholt wird (additiv). Es gibt, obwohl gemeinsam gelernt wird, einen Regelpädagogen und ein Regelcurriculum für die einen Kinder, für die 'anderen' Kinder sind 'andere' Pädagogen zuständig, die mit ihnen ein 'anderes' Programm absolvieren (vgl. Hinz 2002, S. 257). Gegebenenfalls erhalten diese Kinder zusätzlichen Förderunterricht. Der eigentliche Unterricht ändert sich dabei kaum - die Ausrichtung des Unterrichts ist nach wie vor zielgleich und ignoriert die selbst bei Kindern ohne attestierten sonderpädagogischen Förderbedarf vorhandenen Unterschiede in der Entwicklung (vgl. Feuser 1995, S. 196).
Eine andere verbreitete Form der vermeintlichen Integration ist der Umzug einer gesamten Förderklasse in das Schulgebäude einer Regelschule (vgl. Sander 2004, S. 241): Zwar wird bis zu einem gewissen Grad der Kontakt zwischen 'behinderten' und 'nichtbehinderten' Kindern gefördert, insofern die Kinder der Förderklasse zur Schule gehören und an schulinternen Aktivitäten teilnehmen. Trotzdem bleiben die Kinder 'die anderen'.
Die oben aufgezeigten 'Fehlformen' von Integration stellen für die betroffenen Kinder eine erneute Aussonderung dar, da sie in der Regelklasse eine besondere, negativ konnotierte Rolle einnehmen (vgl. Sander 2004, S. 241). Es "wird dem Glauben aufgesessen, die räumliche Zusammenführung 'behinderter' und 'nichtbehinderter' Schüler und Schülerinnen in einer Klasse sei bereits Integration" (Feuser 2002, S. 286). Durch die Besonderung innerhalb der Regelklasse wird das betroffene Kind an das bestehende Regelschulsystem angepasst, das durch die rein räumliche Verlagerung der Sonderpädagogik eher eine Stabilisierung als eine Überwindung erfährt (vgl. Platte 2008). Vor einer erneuten Separation trotz Integration warnt im Übrigen auch schon der Bildungsrat in seiner Empfehlung zur Förderung 'behinderter' Kinder von 1973 (s. Deutscher Bildungsrat 1973, S. 71; zur Empfehlung vgl. 2.2).
Die als Aussonderung kritisierte äußere Differenzierung darf nicht, so die Kritik an der Integrationspraxis, ersetzt werden durch eine innere Differenzierung, die innerhalb der Klasse aussondert. Die Schule steht bei diesem Anspruch ganz offensichtlich vor der paradox anmutenden Aufgabe, zwar individuell zu fördern, dabei aber niemanden durch Etikettierungen oder bestimmte pädagogische Praktiken zu 'besondern'.
Von einer 'Vollintegration', einem Begriff, der heute angesichts der Realität sogar schon unter Ideologieverdacht gekommen ist (Reiser 2009, S. 306), sind deutsche Schulen noch weit entfernt: Selbst wenn Integration praktiziert wird, erfüllt diese Integrationspraxis nicht die Ansprüche, welche ursprünglich mit dem Begriff der Integration verbunden worden sind. Der Integrationsbegriff hatte also einmal einen Bedeutungsgehalt, der dann aber in der Praxis nicht eingelöst wurde. Trotzdem wird in dem oben beschriebenen Kontext von Integration gesprochen, was zu einem inflationären und falschen Begriffsgebrauch geführt hat (vgl. Feuser 1995, S. 10). Infolgedessen hat der Integrationsbegriff sowohl von seiner normativen Kraft eingebüßt als auch durch unreflektierte Verwendung an präziser Bedeutung verloren. Alle möglichen Praktiken und Institutionen konnten so mit dem Prädikat 'integrativ' beschrieben werden.
Sander erklärt diese Verwässerung der integrativen Idee mit den typischen Phasen eines Innovationsmodells: Zwar wird es nach anfänglicher Diskussion flächendeckend umgesetzt, wie es auch derzeit für die Integration in Deutschland der Fall ist, aber die Reform erfährt in dieser Disseminationsphase durch die Kraft der traditionellen Strukturen eine Abschwächung (vgl. Sander 2004, S. 241). Das gegliederte Schulsystem sei so fest verankert, dass man aufgehört hat daran zu rütteln. Mit der inzwischen etablierten Integrationspraxis sei statt dessen eine weitere Säule in der immer unübersichtlicher werdenden Schullandschaft entstanden: eine "Auch-Integration" (vgl. Wocken 2009) als Klassenform neben den gewohnten Sonderschul- und Regelklassen.
Dies erklärt nun, warum es innerhalb der Literatur (z.B. bei Hinz) für nötig gehalten wird, den älteren Begriff der Integration mit seinem Ballast von Fehldeutungen und diffuser Verwendung durch einen 'unverbrauchten', präzisen Begriff zu ersetzen. Genau das ist der Sinn des Inklusionsbegriffs, dessen Einführung als Kompensation der Verwässerung des Integrationsdiskurses dienen soll.[4] So verstanden beinhaltet der Begriff im Prinzip nichts Neues, da Integration, wie hier dargestellt, im Ursprung nichts anderes wollte, als das, was man heute mit Inklusion betitelt (vgl. Platte 2008), nur dass die "visionäre Kraft des Begriffs Integration" (Reiser 2009, S. 308) abgenutzt zu sein scheint. Die terminologischen Umetikettierungen erweisen sich angesichts der Diskussionslage und der Sprachverwirrung als unumgänglich und verweisen innerhalb der bildungspolitischen Debatte auf "die Unzufriedenheit mit dem quantitativen und qualitativen Stagnieren der schulischen Integration in Deutschland" (Reiser 2009, S. 305).
Der neue Begriff soll nun für ein sehr viel konsequenteres Verständnis von gesellschaftlicher Einbeziehung stehen. Während der Integrationsbegriff mit der Wiederherstellung einer vorher getrennten Einheit assoziiert wird, wird der Inklusionsbegriff mit einer "strukturell determinierten sozialen Einbeziehung" verbunden (Reiser 2009, S. 305). Nicht vorher Getrenntes, strukturell Verschiedenes bzw. voneinander Geschiedenes ist der Ausgangspunkt inklusiver Bemühungen, sondern die Gemeinsamkeit als Schüler soll bei Anerkennung ihrer Vielfalt und Differenz wahrgenommen bzw. realisiert werden. Der Inklusionsbegriff, welcher sich aus dem Lateinischen herleitet und etymologisch so viel wie 'Einschluss' meint, hat daher eine stärkere Konnotation der sozialen Einbeziehung als der Integrationsbegriff.
Auf der theoretischen und ethischen Ebene erkennt der Begriff der Inklusion Heterogenität als Normalfall an, die es nicht 'wegzuorganisieren' gilt. Im Gegensatz zur Integration wird hier die 'Zwei-Gruppen-Theorie' überwunden, deren Auswirkung auf die Praxis oben beschrieben wurde: Die Gruppen unterscheiden sich dieser Theorie entsprechend durch das Prädikat 'mit sonderpädagogischem Förderbedarf' bzw. 'ohne sonderpädagogischen Förderbedarf' und sind in der Integrationspraxis trotz vermeintlicher Zusammenführung voneinander getrennt. Abgrenzend dazu macht Hinz klar: "Das Konzept der Inklusion versteht sich demgegenüber als eine allgemeine Pädagogik, die es mit einer einzigen, untrennbar heterogenen Gruppe zu tun hat" (Hinz 2002, S. 257). Inklusion kann insofern nicht nur Aufgabe der Sonderpädagogik sein, sondern ist eine allgemein-pädagogische Aufgabe.
Inklusion verzichtet auf Etikettierungen der Schüler, wobei die Unterschiede nicht ignoriert, sondern als normal wahrgenommen werden sollen. Dabei geht es um ein "Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten" (Hinz 2002, S. 255). Insofern kann man Kinder zwar integrieren, d.h. nach vorheriger Separation wieder in die Gruppe eingliedern, aber nicht 'inkludieren': Eine inklusive Schulpraxis bedeutet per definitionem, dass jedes Kind von vornherein untrennbarer Teil der Gruppe ist. Traditionelle Kriterien und Normalitätsvorstellungen, wonach z.B. ein 'lernbehindertes' Kind als nicht 'normal' gilt, werden innerhalb einer inklusiven Schule irrelevant und als soziale Konstruktionen grundsätzlich in Frage gestellt. Kinder sind nicht unnormal bzw. müssen nicht durch besondernde Etikettierungen als in einem bestimmten Sinne 'anders', was in vielen Fällen nicht anderes heißt als defizitär, voneinander geschieden und als besser oder schlechter, behindert oder nichtbehindert kategorisiert werden. Die Inklusionsidee geht von einem radikal egalitären Menschenbild aus. Deshalb spricht sie sich für eine gemeinsame Beschulung aller Menschen aus.
Mit Sander, der so die Verbindung von Integration und Inklusion unterstreicht, ohne jedoch dadurch zur Verwirrung beizutragen, kann man Inklusion als "optimierte und umfassend erweiterte Integration" verstehen (ders. 2004, S. 242). 'Optimiert' ist sie deshalb, da sie sich auf die eigentliche Idee der 'Vollintegration' besinnt und deren Fehler zu vermeiden sucht; 'umfassend erweitert' ist sie, da sich der Begriff von einem nur auf die Integrationspädagogik bezogenen Gebrauch auf alle benachteiligten Gruppen ausgeweitet hat: "Verschiedene Geschlechterrollen, ethnische, sprachliche und kulturelle Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen" (Hinz 2002, S. 257, vgl. dazu auch Gomolla 2009, S. 22). Um zu illustrieren, was mit der entsprechend sehr weiten Begrifflichkeit gemeint sein kann, sei hier ein aktuelles Beispiel aus einem ganz anderen Kontext angeführt: Nach dem Jugoslawienkrieg hat sich in einigen bosnischen Regionen das Konzept 'Zwei-Schulen-unter-einem-Dach' entwickelt. Bosnische und kroatische Kinder werden zwar teilweise in derselben Schule unterrichtet, jedoch zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Etagen. Selbst die Schulhöfe sind oft durch einen Zaun getrennt. Diese strikte ethnische Trennung hatte zu einer bestimmten Zeit sicher ihre Berechtigung (vgl. Lübbert 2010). In einer inklusiven Schullandschaft würde diese Trennung, wie auch die Trennung von 'Behinderten' und 'Nichtbehinderten' etc., in einer 'Schule für alle' aufgelöst werden.
In Deutschland betrifft die 'Zwei-Gruppen-Theorie' hauptsächlich die gesonderte Beschulung von Kindern mit "Sinnesschädigungen, einer körperlichen Beeinträchtigung oder geistigen Behinderung sowie jenen Schülerinnen und Schülern, die wegen Lern- und Sprachstörungen oder emotionalen und sozialen Problemen [!] im Verlauf der Schulzeit als sonderpädagogisch förderungsbedürftig diagnostiziert werden" (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 71). Innerhalb dieser zweiten Gruppe, deren Anteil ca. zwei Drittel aller Schüler mit 'sonderpädagogischem Förderbedarf' ausmacht (vgl. ebd.), fallen bestimmte soziale Gruppen auf. Bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und bei Kindern und Jugendlichen aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern wird überproportional oft ein 'sonderpädagogischer Förderbedarf' diagnostiziert (vgl. ebd., S. 72), so dass diese Schüler als benachteiligte Gruppe bezeichnet werden müssen (vgl. dazu Gomolla 2005, S. 6f). Das gruppenspezifische Aussonderungsdenken soll im Sinne der Inklusion aufgehoben werden, denn "jedes Kind ist verschieden, ist ein besonderes Kind, jedes Kind hat eigene Bedürfnisse und verdient individuelle Beachtung" (s. Sander 2004, S. 242).
Die Aufhebung der Unterteilung in zwei Gruppen innerhalb der Praxis der Inklusion impliziert deshalb einen Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik im Sinne einer Auflösung der Sonderpädagogik in der Integrationspädagogik, insofern tatsächlich alle Kinder ohne vorherige Aussonderung gemeinsam lernen sollen (vgl. Eberwein 2002, S. 28). Von Seiten der Integrationspädagogik wird gefordert, die lange Zeit gültige, allgemein anerkannte Überzeugung zu revidieren, wonach die separate Beschulung von Kindern mit psychischen, kognitiven oder physischen Beeinträchtigungen im Sinne einer 'Integration als Ziel, aber nicht als Weg' (vgl. Feuser 2002) für alle Beteiligten die beste Lösung sei. An ihre Stelle tritt die Idee der selbstverständlichen gemeinsamen Schulzeit. Dieses Umdenken hat allerdings noch nicht stattgefunden, sondern kündigt sich bestenfalls gerade an (vgl. Hinz 2004, S. 66). Die Konsequenz daraus bedeutet zwangsläufig die Umsetzung der 'Schule für alle' (s.u.), und fordert somit einen Systemwechsel im Schulwesen. Die Sonderschule hat dementsprechend in einer inklusiven Schullandschaft ihre Legitimation verloren.
Als Fernziel nimmt die Idee Inklusion die alte Kopplung von Schul- und Gesellschaftskritik auf und befürwortet neben der Etablierung inklusiver Strukturen und Einstellungen im Rahmen pädagogischer Institutionen auch für eine 'inklusive Gesellschaft' bzw. eine Organisation gesellschaftlicher Institutionen, die sich am Ideal der Inklusion orientieren. Das ist eine Utopie; deshalb kann man weder genau vorwegnehmen, wie eine solche Gesellschaft aussehen würde, noch kann man wohl diese Utopie jemals ganz realisieren. Trotz der beachtlichen soziokulturellen Entwicklungen, die seit den 70er Jahren im Bildungssystem sowie in Erziehungspraktiken generell stattgefunden haben, darf man auch nie die Widerständigkeit etablierter Strukturen und Denkmuster unterschätzen. Wenn also die Idee der Inklusion zuweilen utopisch oder unmöglich realisierbar scheint, so spricht dies erstens nicht prinzipiell gegen ihre potenzielle Praktikabilität und flächendeckende Umsetzbarkeit, und zweitens nicht gegen den Versuch, zumindest auf theoretischer Ebene diesen Ansatz zu klären; darüber hinaus kann man durchaus die Umsetzbarkeit dieser Gedanken beobachten, da bereits einzelne entsprechenden Einrichtungen existieren (vgl. z.B. Hinz 1992, Bews 1992 und Hinz u.a. 2010). Den abstrakten utopischen Gehalt des Begriffs der Inklusion fassen Eberwein und Knauer wie folgt zusammen: "Integrationspädagogik hat dann ihren Auftrag erfüllt, wenn die Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigungen in Schulen und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen endgültig überwunden ist" (Eberwein/Knauer 2002, S. 27). Die Schule als ein Schlüsselbereich gesellschaftlichen Lebens kann dieser Idee gemäß dazu beitragen, einen Teil zur Annäherung an diese Utopie voranzutreiben, wobei die Grenzen der Schule als Ort gesellschaftlicher und politischer Veränderung im Blickfeld bleiben müssen.
Was die schulische Inklusion betrifft, ist es angesichts der politischen Entwicklungen der letzten Zeit (s. 2.2) beinahe irrelevant geworden, ob man das Ideal für utopisch hält oder nicht, da die Forderung nach einem inklusiven Schulsystem besonders wegen der Behindertenrechtskonvention zwangsläufig auf das deutsche Schulsystem zukommt und man sich dieser Forderung über kurz oder lang grundsätzlich nicht entziehen kann.
Zusammenfassend sollen hier noch einmal die Merkmale des komplexen Begriffs der Inklusion aufgelistet werde. Die folgende definitorische Festlegung orientiert sich primär an den Vorschlägen von Hinz, welche mir am plausibelsten und am genauesten schienen. Wenn in dieser Arbeit von Inklusion gesprochen wird, dann in diesem Sinne. Da festgestellt wurde, dass Inklusion relational zur Integration bestimmt werden muss, sollen hier beide Begriffe vergleichend nebeneinander gestellt werden.
Abbildung 1: Integration und Inklusion. Angelehnt an Hinz 2002, S. 359.
|
Inklusion |
Integration |
|
|
1 |
...bedeutet die Anerkennung von Heterogenität als Normalfall und somit die Aufhebung der Zwei-Gruppen-Theorie (wie sie sich z.B. zurzeit in der Differenzierung der Curricula ausdrückt). |
...teilt die Kinder in zwei Gruppen 'mit sonderpädagogischem Förderbedarf' und 'ohne sonderpädagogischen Förderbedarf'. |
|
2 |
...bedeutet in der Praxis die Entwicklung einer 'Schule für alle', das heißt, es soll ein umfassendes System etabliert werden, das das gemeinsame und individuelle Lernen für alle ermöglicht. |
...hält an Sonderschulen fest und integriert einzelne Kinder in das (letztlich unveränderte) Regelschul-system. |
|
3 |
...sieht das Problem im System, das verändert werden muss, nicht im einzelnen Kind, das dem System angepasst werden muss (Ausdruck dafür sind z.B. Ressourcen, die an die - inklusive - Schule als Ganzes gekoppelt sind). |
...sieht das Problem im Kind (Audruck dafür sind z.B. Ressourcen, die nach Anzahl der 'behinderten' Kinder in der Klasse vergeben werden). |
|
4 |
...impliziert eine Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik. Beide müssen in gemeinsamer Reflexion und Planung gleichermaßen beteiligt sein. |
...behält eine Trennung von Sonder- und Regelpädagogik bei. |
|
5 |
...benötigt einen Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik und damit auch eine Änderung des Selbstverständnissses der allgemeinen Schule. |
...rüttelt nicht am Selbstverständnis der allgemeinen Schule. |
|
6 |
..bezieht sich nicht nur auf 'behinderte' Menschen, sondern auf alle gesellschaftlichen Minderheiten. |
...hat als 'Klientel' 'behinderte' Kinder. |
|
7 |
...in der Schule ist Teil der sehr viel weiter gefassten egalitären und demokratischen Idee einer inklusiven Gesellschaft. |
...hat als Bereiche die schulische und außerschulische Pädagogik. |
Vor dem Hintergrund der hier zusammengefassten Aspekte, welche bei der Verwendung der Begriffe eine Rolle spielen, und der oben nachgezeichneten Geschichte des Inklusions- und Integrationsbegriffs, halte ich die Einführung des ersteren für sinnvoll, da er die Chance und einen normativen Maßstab bietet, die als defizitär anzusehende heute realisierte Integrationspraxis zu kritisieren und gleichzeitig für die Zukunft der Inklusionspädagogik neue Maßstäbe zu setzen.
Ob allerdings der Begriff Inklusion im Sinne von Hinz, Sander und anderen Inklusionspädagogen in der aktuellen Debatte auch korrekt, das heißt im oben beschriebenen Sinne angewendet wird, steht auf einem anderen Blatt.
Das jeweilige Verständnis hängt dabei nicht von der Bezeichnung 'Integration' oder 'Inklusion' ab (vgl. Werning/Löser 2010, S. 105). Es kommt vor, dass, obwohl mit Hinz eine klare Bestimmung des Inklusionsbegriffs vorliegt, der Begriff 'Inklusion' im Sinne von (hier als defizitär markierter) Integration benutzt wird. Vor diesem bereits beschriebenen inflationären Gebrauch des Inklusionsbegriffs warnt Wocken in einem kürzlich erschienenen Essay: Zwar würden sich alle Organisationen, Wissenschaftler und sonstige Betroffene zur Inklusion bekennen; bei näherem Hinsehen wollen allerdings einige dieser vermeintlichen Befürworter nach wie vor an der Sonderschule festhalten (Wocken 2010). Der Inklusionsbegriff scheint also Gefahr zu laufen, das gleiche Schicksal wie der Integrationsbegriff zu teilen und nach und nach innerhalb der Debatten sowohl an Bedeutungsgehalt sowie an normativem Gehalt einzubüßen.
Retrospektiv kann man gleichzeitig in älteren Texten bestimmter Fachleute, wie z.B. Eberwein oder Muth, 'Integration' gedanklich durch 'Inklusion' ersetzen, was sich dadurch erklären lässt, dass sie zu einer Generation von Integrationspädagogen gehören, die den Begriff der Integration von Beginn an anderes verstanden haben als er sich nachher in der und durch die Praxis etablierte.
In diesem Zusammenhang sei auf das das in den frühen 90er Jahren entstandene Konzept der "Pädagogik der Vielfalt in Gemeinsamkeit" (Prengel 2006, erste Auflage von 1993) verwiesen, das analog zum relativ jungen Inklusionsbegriff gesehen werden muss. Die Pädagogik der Vielfalt akzeptiert und schätzt die Heterogenität der Kinder und verzichtet auf Trennung und Etikettierung - letztlich meint sie das Gleiche wie Inklusion (vgl. Hinz 2004, S. 65).
Den (noch immer) diffusen Gebrauch der beiden Begriffe von Seiten verschiedener, teilweise hier noch nicht erwähnter Autoren, Politiker und Institutionen habe ich zur Veranschaulichung im folgenden Vier-Felder-Schema zusammengefasst. Dabei gibt die vertikale Ebene an, welcher Begriff von den verschiedenen Personen verwendet wird, und die horizontale Ebene ordnet diese Verwendung im Sinne von Hinz' Definition entweder einem Verständnis von 'Integration' oder einem Verständnis von 'Inklusion' zu. So ist z.B. in politischen Programmen von 'Inklusion' die Rede, worauf sogleich das Festhalten am derzeitigen Schulsystem beteuert wird.[5] Nach der hier herausgestellten Auffassung von Inklusion schließt ein inklusives Verständnis das Festhalten am Sonderschulwesen allerdings aus und wird somit der 'Bedeutung von Integration nach Hinz' zugeordnet.
Abbildung 2: Bedeutungen von Inklusion und Integration.
|
Bedeutung von Integration nach Hinz |
Bedeutung von Inklusion nach Hinz |
||
|
Verwendung des Begeriffs ‚Integration' |
Bundschuh 1997, KMK-Empfehlung 1994 |
Feuser, Eberwein, Muth, Jantzen |
|
|
Verwendung des Begriffs ‚Inklusion' |
Deutscher Philologen-verband[a], Studie von Dyson von 2007[b], Barbara Sommer 2009 |
Hinz, Sander, Wocken, Platte |
"Pädagogik der Vielfalt" nach Prengel 1993 |
|
[a] Nach WOCKEN 2010. [b] DYSON legt für seine Studie von 2007 allerdings die nach HINZ falsche Verwendung von Inklusion offen: "Gemäß den Absichten dieser Studie operierten wir mit einer [...] relativ eng gefassten Definition von Inklusion, nämlich einfach bezogen auf das Vorhandensein von Schüler/inne/n mit besonderem Föderbedarf in einer Schule" (DYSON 2010, S. 120). |
|||
Man darf sich also bei der Diskussion um Inklusion und Integration nicht von Begrifflichkeiten blenden lassen darf, sondern den jeweiligen Text kritisch nach dem tatsächlich gemeinten Inhalt befragen muss. Mit der obigen Zusammenfassung des Inklusionsverständnisses nach Hinz und Sander sowie der Abgrenzung des Begriffs von dem der Integration wurde außerdem geklärt, wie Inklusion in dieser Arbeit verstanden werden soll.
Im Folgenden soll anhand eines Geschichtsabrisses der Integrationspädagogik aufgezeigt werden, wo der Stand der Inklusionspraxis zurzeit zu verorten ist.
Die Integrationspädagogik bzw. Inklusionspädagogik kann als Weiterführung der Sonderpädagogik verstanden werden, deren Arbeitsbereich die Schule bzw. der Lernort 'behinderter' Kinder ist. Um 1880 entstand das Hilfsschulsystem, das anfangs nur für Kinder der höheren Schichten zugänglich war und an das man nach der NS-Zeit, in der die Überweisung auf eine Hilfsschule schon ein Todesurteil bedeuten konnte, anknüpfte (vgl. Graumann 2002, S. 19f). Auf dieser Grundlage entwickelte sich ein immer weiter differenziertes Sonderschulsystem. Davon zeugt die heutige Förderschule, die in neun Schwerpunkte unterteilt ist.[6] Dabei haben die diversen Namensänderungen der Institution nicht unbedigt auch eine Veränderung des Hilfs-/Sonder-/Förderschulwesens nach sich gezogen (vgl. Hinz 2002, S. 354): Der separierende Charakter dieser parallel zur Regelschule aufgebauten Institution hat sich bis heute erhalten.
Noch 1972 hielt die KMK am zweigliedrigen System fest; ein Jahr später spricht sich jedoch der Bildungsrat mit den 'Emfpehlungen der Bildungskommission zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher' für Integration aus, so dass ab diesem Zeitpunkt ein Umschwenken seitens der Schulpolitik zugunsten integrativer Ansätze zu beobachten ist. Integration wird hier als ein Konzept verstanden, das "eine weitmögliche gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten vorsieht und selbst für behinderte Kinder, für die eine gemeinsame Unterrichtung mit Nichtbehinderten nicht sinnvoll erscheint, soziale Kontakte mit Nichtbehinderten ermöglicht" (Deutscher Bildungsrat 1973, S. 15f). Damit beginnt einderseits die Abkehr von der Isolation 'behinderter' Kinder, andererseits wird hier davon ausgegangen, dass es für einige Kinder nicht von Vorteil ist, mit allen anderen gemeinsam zur Schule zu gehen. Auch die Forderung nach "Durchlässigkeit zwischen Einrichtungen für eine sonderpädagogische Förderung und allgemeinen Schulen" (ebd., S. 17) zeugt davon, dass trotz der einschlägigen Wende in Richtung Integration hier die 'Zwei-Gruppen-Theorie' noch aufrechterhalten bleibt. So plant der Bildungsrat in seiner Empfehlung eine "Teilintegration" (ebd., S. 79) systematisch mit ein.
In der Schulpraxis entstehen in den 70er Jahren einige Modellversuche. Die Fläming-Grundschule in Berlin richtet 1975 als erste Schule eine Integrationsklasse ein. Zu Beginn der 80er Jahre verstärkt sich die Integration in der Praxis: Es werden vermehrt Integrationsklassen eingeführt (vgl. Gomolla 2009, S. 27). Eltern 'behinderter' Kinder organisieren Initiativen, um die Beschulung ihrer Kinder an allgemeinen Schulen durchzusetzen. Die Sonderschule als einziger Ort der speziellen Förderung von 'behinderten' Kindern wird zunehmend in Frage gestellt.
1994 reagiert die KMK auf diese Entwicklung mit der Umbenennung des 'Sonderschulbedarfs' in 'sonderpädagogischen Förderbedarf'. Das heißt, "die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen gebunden" (KMK 1994, S. 2). Nur einen Monat später findet die UNESCO-Konferenz über 'Special needs education: Access and quality' statt. 92 Staaten, darunter Deutschland, bekennen sich in der Salamanca-Erklärung dazu,
"that every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs; education systems should be designed and educational programmes implemented to take into account the wide diversity of these characteristics and needs, those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a childcentred pedagogy capable of meeting these needs, regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all" (UNESCO 1994, S. viiif).
Es wird postuliert, dass alle Kinder in ihrer Verschiedenheit eine Regelschule besuchen können sollen und dass dafür besondere Programme einer kindzentrierten, das heißt einer auf das einzelne Kind eingehenden, 'inklusiven' Pädagogik entwickelt werden müssen. In der deutschen Übersetzung wird allerdings noch der englische Begriff 'inclusion' mit 'Integration' übersetzt.
Trotz der intensiven Diskussion um den Begriff der Inklusion in den letzen Jahren wird die gleiche Übersetzung auch 12 Jahre später in der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 angewandt. Einige Beobachter sehen hierin einen "Übersetzungstrick", der den im Original gemeinten Inhalt relativiert (vgl. Aichele 2010, S. 15). Im Gegensatz zur UNESCO-Erklärung, die nur eine Absicht der Staaten erklärt, ohne jedoch verbindliche Gültigkeit zu besitzen und damit einklagbares Recht festzuhalten, sind die Beschlüsse der UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland 2009 in Kraft getreten ist, rechtskräftig. In Artikel 24 verpflichten sich die Vertragspartner, dass "Menschen mit Behinderung nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden" (Absatz 2a) und dass "in Übereinstimmung mit dem Ziel einer vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen [...] angeboten werden" (Absatz 2e). Die Verbindlichkeit macht sich insofern bemerkbar, als Deutschland schon 2011 einen ersten Bericht über die Entwicklung zum inklusiven Schulwesen ablegen muss (vgl. zu diesem Absatz Aichele 2010).
Diese Skizze der Geschichte der Sonder- bzw. Integrationspädagogik, die sich vor allem an einschlägigen politischen Dokumenten orientiert, soll im Folgenden mit Bürlis Modell der 'Entwicklungsphasen in der Sonderpädagogik' zusammengefasst werden, um daran anschließend den derzeitigen Stand der Inklusion zu beschreiben (s. Abbildung 3).
Bürli teilt die Entwicklung der schulischen Integration in vier Phasen ein, die nach Sander den Zeitraum vom 17. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert umfassen: die Exklusionsphase, die Separationsphase, die Integrationsphase und die Inklusionsphase (vgl. Bürli 1997, S. 55f). Diese vier Phasen können dabei nicht als zeitlich konkret eingegrenzte Epochen verstanden werden, sondern gehen vielmehr ineinander über und finden durchaus zeitgleich statt. Trotzdem bieten sie einen groben Überblick über die Entwicklung der Beschulung von Kindern mit Behinderungen bzw. von Kindern, die einer Minderheit angehören. Bürli verweist für die Exklusionsphase darauf, dass noch "vor wenigen Jahrzehnten die meisten Behinderten vom öffentlichen Schulwesen ausgeschlossen waren" (ebd.). Mit Entwicklung des Sonderschulwesens geht diese Phase über in eine Phase der Separation: 'Behinderte' Kinder werden zwar beschult, bleiben aber vom Regelschulsystem ausgeschlossen. In einer Phase der "kritischen Erneuerung" (ebd.) des Sonderschulsystems kommt es zu einer Wende in Richtung Integration. Wenn man die Phasen an politischen Stellungnahmen festmachen möchte, kann man sagen, dass die Integrationsphase in Deutschland mit den Empfehlungen des Bildungsrates von 1973 beginnt. An die Integrationsphase schließt sich die Inklusionsphase an, in der alle Kinder in ihrer Verschiedenheit selbstverständlich an Schule und Gesellschaft teilhaben können sollen (ebd.). Mit Blick auf die Salamanca-Erklärung unterstellt Bürli der Inklusionsphase einen zur Integrationsphase parallelen, also bereits andauernden Verlauf. An dieser Stelle schließe ich mich eher der Interpretation des Modells durch Sander an: Danach ist unser Schulwesen von der Inklusionsphase noch weit entfernt, was man vor dem Hintergrund der vorhergehenden Ausführungen in 2.1 nur unterstreichen kann. Statt dessen befindet sich Deutschland noch überwiegend auf der Stufe der Separation; selbst die Integrationsphase steht noch am Anfang, was die Integrationsquote (s.o.) belegt (vgl. Sander 2004, S. 243).
Vielleicht wird man in einigen Jahren rückblickend den Beginn der Inklusionsphase auf das Jahr 2009, in dem die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist, setzen können, weil sich die Schulentwicklung derzeit nicht nur innerdeutschem, sondern auch internationalem Druck ausgesetzt sieht.
Im Folgenden soll auf die konkrete Gestaltung der Inklusionsphase eingegangen werden.
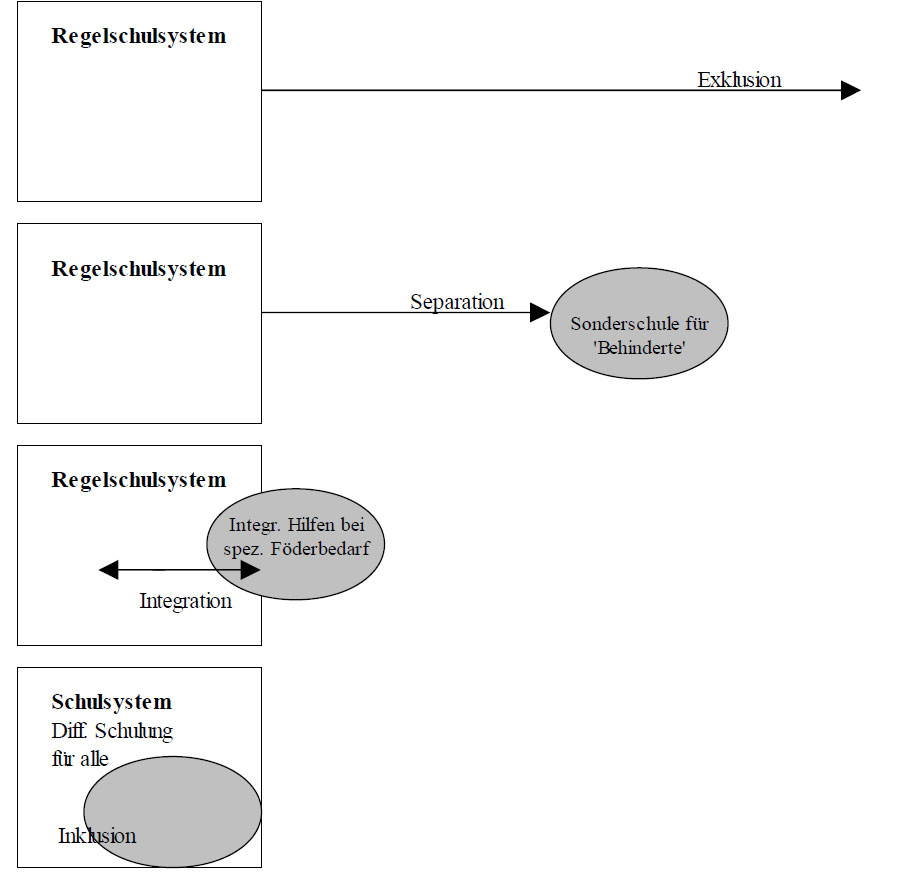
Abbildung 3: Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik. Nach Bürli 1997, S. 56.
In 2.1 wurde festgestellt, dass die Entwicklung einer inklusiven Schule gleichzusetzen ist mit der Entwicklung einer 'Schule für alle' und dass diese Entwicklung in Deutschland gerade erst begonnen hat. Daran schließen sich zwei elementare Fragen an, nämlich einmal, was genau unter einer 'Schule für alle' verstanden wird, und außerdem, welche Kriterien diese erfüllen muss, um sich als solche auszuzeichnen. Die Diskussion dieser Fragen ist umso dringlicher, als die Schulentwicklung in besagte Richtung allein schon wegen der UN-Politik unumgänglich sein wird - trotzdem, so scheint es, ist noch nicht klar, wohin diese Entwicklung genau führen soll.
'Schule für alle' oder 'Schule für wirklich alle'?
Die 'Schule für alle' läuft in dieser Situation Gefahr, im Sinne der in 2.1 dargestellten Diskussion zu einem Überredungsbegriff ohne genau definierten Inhalt zu verkommen. Dabei mag für viele Beteiligte durchaus klar sein, wer genau 'alle' sind, die auf diese Schule gehen sollen.[7] Meines Erachtens wird allerdings genau dieser elementare Punkt zurzeit recht wenig diskutiert, sodass sich die Frage aufdrängt, ob von den verschiedenen an der Schulentwicklung Beteiligten (Politker, Wissenschaftler, Lehrer, Eltern) mit 'alle' auch wirklich alle Kinder gemeint sind. Simone Seitz stellt fest, dass nach dem theoretischen Bekenntnis zur 'Schule für alle' in die praktischen Überlegungen zu didaktischen Fragen Kinder des Förderbereichs Geistige Entwicklung bzw. Kinder mit 'schweren Behinderungen' nicht mitgedacht werden.[8] "Dieses Missverhältnis zwischen theoretischen Postulaten einer 'Schule für alle' und praxeologischen Reflexionen [...] scheint für didaktiknahe Schriften der Integrations-/ Inklusionspädagogik symptomatisch zu sein" (Seitz 2005, S. 5). Selbst wenn also von Seiten der Integrationspädagogik mit 'alle' wirklich alle Kinder gemeint sind, heißt das nicht, dass die didaktischen Überlegungen darauf eingehen und, sollte das der Fall sein, in einem dritten Schritt tatsächlich im Sinne einer inklusiven Pädagogik in der Schulpraxis ankommen. Aus diesem Grund sollte meines Erachtens bereits im Vorfeld diskutiert werden, wo Inklusion an ihre Grenzen stoßen kann. So wird auch unter den Integrationspädagogen teilweise die Meinung vertreten, dass eine 'Vollintegration' nicht möglich sei:
"Die Fixierung auf 'full inclusion' hat sich m.E. auch durch die Praxis, die sich in den Ländern entwickelt hat, in denen die Inklusion am weitesten vorangeschritten ist, als nicht realistisch erwiesen. Gemessen an den deutschen Quoten der Etikettierung mit sonderpädagogischem Förderbedarf könnte es sich hierbei jedoch nur um weniger als ein Viertel der heute in Deutschland etikettierten Kinder handeln, die in rehabilitativen Einrichtungen beschult werden müssten" (Reiser 2003, S. 310).
Angesichts dieser Perspektive stellen sich gravierende Fragen: Bezieht sich Inklusion am Ende doch nur auf Schüler mit körperlichen Behinderungen, mit so genannter Lernbehinderung und aus dem Förderbereich Emotionale Entwicklung? Kann eine solche Schule sich dann noch 'Schule für alle' nennen?
Letztlich kann es bei der Beantwortung dieser Fragen nicht um Prizipien gehen, sondern das Wohl des einzelnen Kindes und seiner Familie muss Maßstab der Entscheidungen sein. Da es gut dokumentierte Beispiele dafür gibt, dass die Integration von schwerstbehinderten Kindern funktionieren und für alle Beteiligten von Vorteil sein kann (vgl. z.B. Hinz 1992), darf man meines Erachtens diese Möglichkeit nicht ignorieren; genausowenig kann sie allerdings unumgängliche Regel sein. In diesem Sinne soll in dieser Arbeit die 'Schule für alle' als Schule für wirklich alle Kinder verstanden werden, insofern jede Schule grundsätzlich alle Kinder aufnehmen können muss.
Als erste Prämisse für die 'Schule für alle' gilt also das Prinzip der Nicht-Aussonderung.[9] Es gilt, eine Einstellung zu verändern, die nur schwer zu beeinflussen ist, nämlich die allgemeine Akzeptanz von Heterogenität. Deutsche Lehrer können nicht mehr ihrer "Obsession" frönen, dass sie die falschen Kinder in der Klasse haben; vielmehr müssen Lehrer und Kinder an einen respektvollen Umgang mit Vielfalt herangeführt werden (vgl. Kahl 2003, S. 58). Heterogenität, bei vielen Lehrern als 'Problem' wahrgenommen wird (vgl. Stähling 2009, S. 1), ist nach Stähling weder gut noch schlecht, sondern stellt den Normalfall dar, den es im Sinne der Inklusion an den Schulen als solchen zu akzteptieren gilt (ebd., S. 139). Daraus resultieren verschiedene Anforderungen an die 'Schule für alle'. Neben administrativen und logistischen Veränderungen muss im Unterricht verstärkt auf die Heterogenität eingegangen werden. Es besteht Konsens darüber, dass von innen differenziert werden muss, wenn nicht mehr von außen differenziert wird (vgl. Fürstenau 2009, S. 73; Werning/Löser 2010, S. 110). Eine weitere Prämisse für die Entwicklung der 'Schule für alle' ist also die innere Differenzierung.[10] Dafür gibt es bereits viele verschiedene, teilweise gut erprobte Modelle, wie z.B. das Kooperative Lernen, das Lernen mit Lerntagebüchern (s.u.) oder andere offene Unterrichtsformen, die besonders gut für inklusive Kontexte seien (vgl. Platte 2005, S. 137).[11] Es wird dabei häufig auf reformpädagogische Unterrichtskonzepte zurückgegriffen (vgl. Seitz 2005, S. 4; der Zusammenhang wird ausführlich diskutiert bei Platte 2005). Auch Skeptiker einer allzu individualisierten Unterrichtskultur wie Klippert verweisen dabei auf die Notwendigkeit, dass die Lehrkräfte die Alleinverantwortung für jedes einzelne Kind teilweise an die Kinder selbst abgeben (vgl. ders. 2010, S. 38). Im Folgenden soll der inzwischen seit 15 Jahren von Falko Peschel praktizierte 'Offene Unterricht' vorgestellt werden, der nach Peschels Auffassung durch konsequente Selbstregulierung eine größtmögliche innere Differenzierung verspricht.
[2] Analog zum neuen Begriff der Inklusion wird hier von Inklusionspädagogik gesprochen. Wenn im Folgenden von Integrationspädagogik gesprochen wird, dann nur deshalb, weil in dem jeweiligen historischen Kontext der Begriff der Inklusion noch keine Rolle gespielt hat.
[3] Diese Kritik muss natürlich ernst genommen werden, insofern es hochspezialisierte Schulen für verschiedene Arten von Behinderung gibt, die den betroffenen Kindern auf bestimmten Gebieten eine Ausbildung ermöglichen, die eine allgemeine Schule vielleicht nie in der Lage sein wird aufzubringen (man denke z.B. an besondere Instrumente und gut ausgebildete Lehrer zum Erlernen der Gebärdesprache an einer Schule für Hörgeschädigte). Insofern ist durchaus zu diskutieren, inwieweit mit der 'Schule für alle' eine 'Schule für wirklich alle' gemeint sein kann und im Interesse der Kinder und deren Familien liegt. Zweifel daran werden auch bei REISER (2009) deutlich (s.u.). Diese Diskussion des 'Warum' und 'Ob' der Inklusion muss in dieser Arbeit, die eher das 'Wie' thematisiert, allerdings vernachlässigt werden. In jedem Fall zielt Inklusion darauf ab, die bisher vorherrschende Praxis, Kinder erst auszusondern, um sie dann eventuell wieder einzugliedern, zu überwinden. Diese Überwindung schmälert nicht die Bedeutung der Sonderpädagogik.
[4] Diese terminologische Verschiebung wird sogar von Autoren befürwortet, die einer Ersetzung des Integrationsbegriffs skeptisch gegenüberstehen. REISER z.B. hält zwar einen programmatischen Begriffswechsel nicht für sinnvoll, konzidiert dann aber mit Verweis auf den normativen Gehalt des Inklusionskonzepts ein: "Die Rede von Inklusion an Stelle von Integration scheint mir geeignet, hier einen neuen Impuls zu setzen" (REISER 2009, S. 309).
[5] Das betrifft zum Beispiel die ehemalige Schulministerin Barbara SOMMER. In einer Pressemitteilung letzten Jahres schreibt sie: "Ich setze mich für die Inklusion an allgemeinen Schulen und für die Beibehaltung der Förderschulen ein" (SOMMER 2009). Welchen genauen Kurs die neue Landesregierung in Sachen Inklusion ansteuert, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Zumindest plant Ministerin LöHRMANN die Entwicklung eines "Inklusionsplans", der die Umsetzung der UN-Konvention garantiert (vgl. LöHRMANN 2010).
[6] Eine anschauliche Darstellung der verschiedenen Zweige findet sich bei VEBER 2010, S. 48.
[7] Deutlich wird hier z.B. WOCKEN: "Inklusion will das real existierende gegliederte Schulsystem komplett durch eine einzige Schule für alle ersetzen. In einer inklusiven Schullandschaft ist weder für Sonderschulen noch für Gymnasien ein legitimer Platz vorgesehen" (ders. 2009, S. 219), vgl. auch JANTZEN 2008.
[8] Wenn hier die Auswirkungen von Inklusion wieder einmal nur im Bezug auf behinderte Kinder diskutiert werden, obwohl Inklusion ein sehr viel weiteres Verständnis des Einbezugs von Minderheiten vertritt, dann liegt das daran, dass unser Schulsystem nur für 'behinderte' Kinder eigene Schulen unterhält; Ziel ist es, diese aufzulösen.
[9] Ob NRW mit einer von Ministerin LöHRMANN postulierten "Kultur des Behaltens" (nämlich des Behaltens der Schüler an ihrer ursprünglichen Schule; s. LöHRMANN 2010b, S. 3) sich diesem Ideal in den nächsten Jahren annähern wird, bleibt abzuwarten.
[10] Inklusive Pädagogik bedeutet die zwangsläufige Abkehr vom Glauben an ein Lernen im Gleichschritt. "Eine inklusive Klasse umfasst eine so große Heterogenität von Kindern, dass der Versuch, alle zur gleichen Zeit das Gleiche zu lehren, sich von vornherein verbietet" (SANDER 2004, S. 243). Obwohl die Idee vom gleichschrittigen Lernen schon immer eine Illusion war, da kein Kind genauso lernt wie ein anderes, hat sich diese Idee bis heute hartnäckig in deutschen Schulen gehalten. Dieser Glaube wird sich spätestens im Rahmen einer inklusiven Schule als Irrglaube herausstellen, da sich die Streuung um die fiktive Norm vergrößert. Inklusive Schule fordert eine Abwendung vom Streben nach größtmöglicher Homogenität hin zur Anerkennung von Heterogenität (vgl. ebd.). Zurzeit wird in deutschen Schulen allerdings noch zu 75-80% Frontalunterricht praktiziert (TERHART 2009, S.166).
[11] "Es besteht Einigkeit darin, dass Ansätze Offenen Unterrichts [...] besonders gut geeignet für integrativen Unterricht sind - zum einen, weil diese in der Regel "vom Kind" ausgehen, als individuumszentriert sind, zum anderen weil sie zumeist Möglichkeiten der Differenzierung bieten" (PLATTE 2005, S. 137).
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund des 'Offenen Unterrichts' nach Peschel
Falko Peschel ist Grundschullehrer, Erziehungswissenschaftler und Hochschuldozent. Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist er Rektor und Lehrer an der Bildungsschule Harzberg in Lügde, NRW. Mit seiner Frau Stefanie Peschel hat er diese private, kostenfreie Schule gegründet und wendet dort sein Konzept des 'Offenen Unterrichts' (OU)[12] an, das im Folgenden vorgestellt wird.
Der OU entsteht in den 90er Jahren, als Peschel auf der Suche nach alternativen Unterrichtsmethoden zum herkömmlichen fragend-entwickelnden Frontal-unterricht auf Hannelore Zehnpfennigs 'Didaktik des weißen Blattes' stößt. Verbunden mit der Idee, demokratische Strukturen und Praktiken, wie sie in reformpädagogischen Schulen und Freien Alternativschulen zu finden sind, innerhalb von Schulen zu erproben, entwickelt er den OU und setzt ihn von 1995 bis 1999 erstmalig in seiner Klasse an einer staatlichen Grundschule im Kölner Raum um. 2002 beschreibt er das Konzept und seine Erfahrungen damit in "Offener Unterricht - Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion"; 2003 wird die darauf aufbauende Evaluation der vierjährigen praktischen Erfahrung "Offener Unterricht - Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation" (im Folgenden: 'Evaluation') von der Universität Siegen als Dissertation angenommen.[13]
Stufen Offenen Unterrichts
Obwohl eine Öffnung des Unterrichts in der Regel "allseits gewünscht" ist (Peschel 2009, S. 76; vgl. Graumann 2005, S. 162), gibt es keine allgemein anerkannte und konsequent in der Debatte durchgehaltene Definition von 'offenem Unterricht'. Das Label steht meistens vielmehr für eine Sammlung von Konzepten, die gemeinsam eine Definition ex negativo ergeben: 'Offener Unterricht' wird vor allem als Gegenmodell zum Frontalunterricht verstanden, selbst aber häufig nicht genauer bestimmt und mit dem Konzept werden daher folglich häufig unklare Vorstellungen verbunden (vgl. Graumann 2005, S. 162). Peschel grenzt sein Modell von einem solchen allgemeinen Verständnis ab.
Peschels OU umfasst Öffnung auf drei bzw. vier Ebenen, die er einem 'Stufenmodell des Offenen Unterrichts' einordnet (s. Abbildung 4). 'Öffnung' bedeutet dabei die Selbstregulierung der Schüler bezüglich der jeweiligen Ebene.
Der Begriff der Selbstregulierung stammt ursprünglich aus der pädagogischen Psychologie stammt und ein "komplexes und voraussetzungsreiches Bündel von Kompetenzen und Wissen" unter sich fasst (Bastian/Merziger 2007, S.6). Dabei wird die Selbstbestimmungsfähigkeit des Schülers über die eigenen Lernprozesse sowohl als Ausgangs- wie auch als Zielpunkt angesehen. Selbstregulierung als schulpädagogischer Begriff verweist auf ein buntes Ensemble von Theorieansätzen, die sich für mehr Partizipation und die Übergabe von Verantwortung für die Gestaltung von Lernprozessen an die Schüler aussprechen. Selbstregulierung kann dabei, je nachdem was für eine didaktisch-methodische Ausrichtung favorisiert wird (vgl. dazu im Folgenden die verschiedenen Stufen der Öffnung von Unterricht bei Peschel), in verschiedenen Abstufungen auftreten. Das Verhältnis von Fremd- und Selbstregulierung und von Freiheitsbeschränkung und Freiheitsgewährung wird in gemäßigt selbstregulativen Ansätzen (z.B. bei Kooperativem Lernen) und radikalen Ansätzen (z.B. an Sudbury-Schulen) jeweils anders bestimmt. Gemeinsam ist allen Ansätzen, dass Unterricht als Angebot an die Schüler verstanden wird und dass die Rolle des Lehrers im Unterricht als die eines Begleiters von Lernprozessen gesehen wird.
In Peschels Stufenmodell bezeichnet Stufe 0 eine organisatorische Öffnung des Unterrichts, Stufe 1 meint die Freigabe der Lernwege, Stufe 2 beschreibt zusätzlich die inhaltliche Öffnung und Stufe 3 gibt neben den bis dahin lediglich auf das fachliche Lernen bezogenen offenen Strukturen auch die Organisation des sozialen Miteinanders frei (vgl. zum gesamten Abschnitt Peschel 2010, Kapitel 2.3). Das Stufenmodell ist danach gestaffelt, wie häufig und in welchem Grad eine Öffnung des Unterrichts auf der jeweiligen Stufe in der Unterrichtsrealität nach Peschels Auffassung auftritt. Die häufigste Form der Öffnung ist danach die organisatorische Öffnung (Stufe 0), unter der Peschel Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenlernen etc. versteht. Dabei werden meist der Ort, die Zeiteinteilung und das Arbeitstempo, die Reihenfolge der Aufgaben oder die Wahl von Themen aus einem Pool an Vorschlägen und die Arbeitsform (Gruppenarbeit oder Einzelarbeit) vom Lehrer freigegeben. Diese Öffnung betrifft Aspekte, die Peschel unter dem Term 'Organisation' zusammenfasst; Inhalte und Methoden werden nicht berührt. Durch den Einsatz von Materialien, welche die Inhalte didaktisch aufbereiten, bleibt der Lehrgangscharakter des Unterrichts erhalten (vgl. Peschel 2009, S. 87). Peschel kritisiert bei dieser Art von Öffnung den Wechsel von einem lehrerzentrierten Unterricht zu einem materialzentrierten Unterricht, der den Schülern weiterhin den Weg ihres Lernprozesses vorgeben würde. Die Regulation des Unterrichts durch den Lehrer würde dabei durch die Regulation des Unterrichts durch das jeweils vorgegebene Material ersetzt. Er bezeichnet deshalb diese Stufe der Öffnung als 'geöffneten Unterricht'. Diese Kritik teilt Olga Graumann, die sich im Zusammenhang mit der Thematik von heterogenenen Lerngruppen mit offenem Unterricht befasst und wie Peschel kritisch darauf hinweist, dass "offener Unterricht nicht mit Beschäftigung der Kinder mit beliebigen Materialien verwechselt und traditioneller, strukturierter Unterricht nicht durch eine Flut nichtssagender und willkürlich ausgewählter Arbeitsblätter und Arbeitsmaterialien ersetzt werden" darf (Graumann 2002, S. 175).[14]
Während die organisatorische Öffnung Peschels Definition nicht genügt und deshalb auf Stufe 0 seines Modells angesiedelt wird, meint die erste Stufe eines 'offenen Unterrichts' auch eine methodische Öffnung. Dabei werden die Themen zwar noch immer vom Lehrer vorgeben, jedoch arbeiten die Schüler unter vollkommenem Verzicht auf vorgegebene spezifische didaktische Modelle und vorstrukturierte Lösungswege. Als eine methodische Öffnung auf Stufe 1 beschreibt Peschel die 'Didaktik der Kernideen' nach Gallin und Ruf. Hier gibt die Lehrkraft zu einem gemeinsamen Thema anregende, weit formulierte Aufgaben, die jeder Schüler in seinem 'Reisetagebuch' (individuelles Lerntagebuch) bearbeitet. Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist: "Male das Haus aus der Geschichte, so wie Du es Dir vorstellst, und schreibe auf, wie Du Dein Traumhaus einrichten würdest" (Peschel 2010, S. 143).[15]
Stufe 2 beinhaltet neben der methodischen Öffnung des Unterrichts auch eine inhaltliche. Während die 'Kernideen' nach Gallin und Ruf immer noch vom Lehrer vorgegeben werden, wird in der 'Didaktik des weißen Blattes' nach Zehnpfennig und Zehnpfennig auch das Thema des Lernens nicht vom Lehrer bestimmt. Jeder Schüler entscheidet jeden Tag neu, womit er sich beschäftigen möchte. Der Unterricht ist dadurch fächerübergreifend, also nicht an die Vermittlung eines bestimmten Stoffes eines bestimmten Fachs zu einem bestimmten Zeitpunkt gebunden, wobei die auf das Individuum und seine Kenntnisse und Fähigkeiten bezogene "Arbeitsform für alle Fächer ist [...] das Erstellen von Eigenproduktionen" ist (ebd., S. 145). Das heißt, die Kinder erstellen z.B. eigene Kniffelaufgaben, bereiten Vorträge vor oder schreiben Geschichten und erstellen sich so ihr Lernmaterial zu ihren selbstgewählten Lerninhalten selber.
Peschel hat für seine Konzeption des OU die 'Didaktik des weißen Blattes' übernommen und um die sozial-integrative Öffnung erweitert. Diese Ergänzung beschreibt Stufe 3 des Stufenmodells.
"Die sozial-integrative Öffnung versucht Basisdemokratie und Schülermitgestaltung im Unterricht insgesamt zu verwirklichen, d.h. es werden vom Lehrer keinerlei Regeln und Normen vorgegeben (wohl aber vorgelebt bzw. als persönliches Recht eingefordert!), sondern die zum Zusammenleben notwendigen Absprachen befinden sich in einem dauernden Findungs- und Evaluationsprozess" (Peschel 2009, S. 89).
Hier wird der Einfluss Demokratischer Schulen (Summerhill, Sudbury-School etc.) auf Peschels radikale Vorstellungen von Selbstbestimmung der Kinder deutlich: Während er im Unterrichtskonzept von Zehnpfennig trotz der Öffnung des fachlichen Lernens noch die 'Fäden' in der Hand der Lehrkraft sieht, hat im OU der Lehrer, nachdem das zentrale Prinzip des Sitzkreises einmal in der Praxis implementiert und etabliert ist, prinzipiell keine direkte Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen mehr. Die Freistellung von Methoden und Inhalten wird hier kombiniert mit der Etablierung eines durch die Kinder organisierten Schulalltags, wobei Entscheidungen teilweise nach der demokratischen Formel 'One voice - one vote' getroffen und teilweise bis zu einer Konsenslösung diskutiert werden.
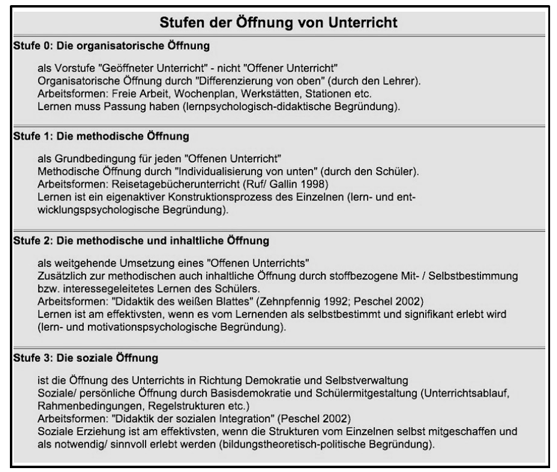
Abbildung 4: Das Stufenmodell des Offenen Unterrichts. Aus Peschel 2009, S. 90.
Hier kann man eine Weiterführung reformpädagogischer Ansätze feststellen (vgl. Stähling 2003).[16] Die Kinder werden als immer schon in sozialen Austauschbeziehungen befindliche Wesen gedacht, die nicht nur selbst bestimmen können, was sie lernen wollen, sondern vor allem auch an demokratischen Prozessen partizipieren können und wollen, wenn man sie nur lässt. Demokratische Praktiken und Strukturen können sich dieser Annahme gemäß nur durch Einübung eben demokratischer Praktiken entwickeln, nicht aber von außen verordnet werden.
Das Ideal der Selbstregulation, welches auf diese Weise theoretisch formuliert und in die Praxis umgesetzt wird[17], geht also davon aus, dass durch eine weitgehende Zurücknahme von äußeren strukturellen Vorgaben und pädagogischen Arrangements im Unterricht generell positive Effekte erzielt werden können. Theoretisch ordnet Peschel sein Konzept radikal-konstruktivistischen Auffassungen zu (ders. 2009, S. 69). Das Kind konstruiert demnach in aktiver Auseinandersetzung mit der Welt seine Vorstellung von der Welt, wobei es an sein jeweiliges individuelles Vorwissen anknüpft. Lernen kann nicht von außen erzeugt werden. Deshalb ist der traditionelle, an behavioristische Vorstellungen angelehnte lehrerzentrierte (Frontal-)Unterricht im Hinblick auf seine Effektivität fragwürdig (vgl. Terhart 2009, S. 144). Die Befürchtung, es können dadurch elementare Fähigkeiten und Inhalte nicht erlernt werden, weist Peschel als unbegründet zurück: "Lässt man das Kind selbst seine Inhalte zusammenstellen, seine Probleme finden und lösen, so wird den Prinzipien [...] der Lebensbedeutsamkeit schon zu einem großen Teil ganz automatisch Rechnung getragen" (Peschel 2009, S. 41).
Peschel definiert dementsprechend sein Konzept des OU wie folgt:
"Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter der Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines "offenen Lehrplanes" an selbst gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen.
Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich auf eine möglichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung des Schülers bezüglich der Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemeinschaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab" (Peschel 2009, S. 78).
Die Abgrenzung zu anderen Auffassungen offenen Unterrichts erfolgt sowohl in Bezug auf Quantität als auch auf Qualität der Öffnung: Peschel vertritt ein durchgehendes, somit auch fächerübergreifendes und zeitlich nicht limitiertes Konzept, das sich qualitativ außerdem mit Rückgriff auf das Stufenmodell von anderen, von Peschel als 'geöffneter Unterricht' bezeichneten Praktiken, abgrenzt, weil es die Öffnung aller drei Stufen meint. Der OU stellt ein durchgehendes Konzept dar und keine separate Methode wie z.B. das Stationenlernen (vgl. Peterßen 2009, S. 28). Prinzipiell zeichnet sich der OU durch Methodenfreiheit aus.
Beschreibung des Offenen Unterrichts
Zum besseren Verständnis der konkreten Gestaltung des OU sollen hier die räumliche und zeitliche Strukturierung und der Ablauf des Unterrichts kurz erläutert werden (vgl. für den folgenden Abschnitt Peschel 2010, Kapitel 9.1).
Im pädagogisch strukturierten Raum des OU nimmt der Sitzkreis, der als das Herzstück der basisdemokratischen Sozialstruktur bezeichnet werden kann, einen wichtigen Platz ein; die Tische sind nicht mit Blick auf die Tafel gerichtet. Statt mit klassischen Lehrbüchern wird mit Lese- und Sachbüchern aller Art, Computern mit Internetzugang und verschiedenen installierten Programmen für die Bereiche Mathematik und Textverarbeitung, Reichens Buchstabentabelle als Werkzeug beim Schriftspracherwerb, verschiedenen Lexika usw. gearbeitet (Peschel 2010, S. 344).
Wie an jeder Schule wird die Unterrichtszeit durch Schulanfang und Schulende bestimmt und wird gegenbenfalls durch einzelnen Fachunterricht wie Religion oder Sport unterbrochen. An bestimmten Tagen findet im Anschluss an den Eingangskreis für alle Englischunterricht statt. Ansonsten wird ein durchgehender OU praktiziert, bei dem sich die Kinder ihre Pausen selbst einteilen. Verbindlich sind in der Regel drei Sitzkreise pro Tag, wobei die Kinder sich mit Begründung beim 'Kreischef' abmelden können und der Sitzkreis selbst von den Kindern abgeschafft werden kann, was nach Peschels Erfahrungen regelmäßig passiert.
Im Sitzkreis treffen sich jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit alle Kinder. Ein Kind, das für zwei Tage 'Kreischef' ist und dann seinen Nachfolger bestimmt, leitet die Gesprächsrunde, die mit dem Austausch über anstehende Themen, Berichte und Probleme beginnt. Danach befragt der 'Kreischef' der Reihe nach jedes Kind, was es den Tag über tun möchte. Dabei bleibt die Entscheidung den Kinder frei überlassen; es kommt auch vor, dass Schüler eine Zeit lang nicht arbeiten. In der Regel arbeitet aber jedes Kind nach dem Eingangskreis, wo, wie lange, mit wem und wie es möchte an seinem Thema. Der Lehrer steht in dieser Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung, gibt Impulse oder trifft sich nach vorheriger Verabredung mit einzelnen Kindern, um auf bestimmte Fragen und Probleme einzugehen. Zu einer Zwischenbesprechung und am Ende des Schultages trifft sich die Klasse wieder im Kreis, und die Ergebnisse werden, oft in Form von Vorträgen, vorgestellt und gegenbenfalls besprochen.
Das Verhätlnis von Selbstbestimmung und Autorität
Man darf, trotz eines im Verhältnis zum traditionellen Unterricht radikalen Verständnisses von Selbstbestimmung, nicht übersehen, dass auch im OU aufgrund des Machtverhältnisses zwischen Kindern und Erwachsenen und durch die besondere Position der Lehrkraft als fachlich kompetente Ansprechperson und für den Unterricht verantwortlicher Person eine Asymmetrie in der Lehrer-Schüler-Beziehung weiterbesteht. Dies sollte nicht ignoriert werden, auch wenn der häufige Gebrauch der Worte 'Selbst-' und 'Mitbestimmung' etwas anderes suggeriert. Während die Schüler zwar in erster Linie selbst verantwortlich für ihr Lernen und ihre Klassengemeinschaft sind, behält letztlich die Lehrkraft den Überblick über die Leistungen der Kinder besonders im Hinblick auf den nach der vierten Klasse anstehenden Schulwechsel; der Lehrer versucht einzuschätzen, an welcher Stelle er sich aktiv als "Zuhörer, als Impulsgeber, als Strukturierender, als Fragender, als Informierender" einbringen soll (vgl. Peschel 2009, S. 203). Peschel betont dabei, dass die Eingriffe nicht didaktisch-geplant stattfinden, sondern aus der jeweiligen Situation heraus, was mit seiner Forderung nach authentischem Lehrerverhalten begründet wird. Insgesamt sieht er die Aufgabe und damit verbundenen Handlungen der Lehrkraft darin, "das Lernen hochzuhalten" (ebd., S. 262).[18] Das asymmentrisch bleibende pädagogische Verhältnis wird von Peschel unter Bezug auf die Beobachtungen des OU im Rahmen einer Diplomarbeit und einer Promotion, auf Rückmeldungen von Hospitanten und unter Bezug auf von den Kindern für ihn ausgestellte Zeugnisse in der 'Evaluation' behandelt (vgl. Peschel 2010, Kapitel 11.3). Dabei wird deutlich, dass sich die Lehrkraft im OU ständig auf einem schmalen Grat zwischen dem Anspruch, den Kindern die Führung zu überlassen und dabei trotzdem 'das Lernen hochzuhalten' und der Gefahr, in eine Laissez-Faire-Atmosphäre abzudriften, bei der sich der Lehrer seiner pädagogischen Verantwortung entzöge und die Kinder mit Verweis auf das Prinzip der Selbstbestimmung sozusagen im Stich ließe. Die geforderte Selbstbestimmung der Schüler steht in einem Spannungsverhältnis zur Verantwortung des Lehrers für die Schüler. So kommt es, dass trotz der in der Theorie postulierten pädagogischen Enthaltsamkeit auch autoritäre oder auf pädagogische Autorität beruhende Praktiken vorkommen: Die Kinder werfen dem Lehrer z.B. zuweilen vor, "auszuflippen" oder "sich aufzuregen" und sich im Kreis ungefragt einzumischen (ebd., S. 511). Die Diplomandin misst in einem Beobachtungszeitraum von 105 Minuten im Sitzkreis, dass sich der Lehrer alle 4 Minuten beteiligt, was zwar im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht sehr wenig erscheint, aber angesichts des hohen Anspruchs an die Selbstständigkeit der Kinder auch nach Abwägung der Gründe (Informationsweitergabe etc.) von ihr als verhältnismäßig hoch eingestuft wird.[19]
Diese Einschätzungen zeigen, dass die Lehrkraft auch im OU noch eine exponierte Stellung einnimmt, was sich wohl auf ihre doppelte Verantwortung den Kindern gegenüber - für ihr Lernen und für die Pflege des basisdemokratischen Systems - zurückführen lässt. Je nach Klassengemeinschaft, Lehrperson und Tagesform kann das Lehrer-Schüler-Verhältnis also auch im OU trotz proklamierter Selbstbestimmung eine stark asymmentrische Ausrichtung aufweisen:
"Natürlich behält der Lehrer seine Rolle als letztendlich Verantwortlicher für das Geschehen, das ist den Kindern auch sehr wichtig, aber die Beziehung wechselt vom Bestimmenden zum Partner, ähnlich der Beziehung, die auch vermehrt in Familien zu Hause zu finden ist" (Peschel 2009, S.146).
Peschels Selbstevaluation ist aus methodischen Gründen durchaus problematisch. Selbst wenn man einem Bildungsforscher zugute hält, dass er seinen Forschungsgegenstand möglichst objektiv und wertneutral darzustellen versucht, so kann man doch davon ausgehen, dass bei der Darstellung des eigenen theoretischen Konzepts eine Trennung von reinem Erkenntnisinteresse und persönlichem Interesse am Erfolg des Projektes, wenn nicht unmöglich, so zumindest äußerst schwierig durchzuhalten ist. Peschels Modell des OU sowie auch seine Selbstevaluation sind trotzdem deshalb so interessant für diese Arbeit, weil es hier um die Theorie eines Praktikers geht, der auf Grund der täglichen praktischen Erfahrungen weniger Gefahr läuft, sich alleine in theoretischen Abstraktionen zu verlieren, welche in der Praxis nicht auf ihre Machbarkeit und ihren Erfolg empirisch überprüft werden. Dieser Vorteil überwiegt die methodische Problematik, die mit der Selbstevaluation verbunden ist, beseitigt sie aber nicht. Die skeptische Einstiegsbemerkung sollte man dennoch bei der Lektüre der Selbstevaluation im Hinterkopf behalten.
In der 'Evaluation' zieht Peschel die Bilanz aus vier Jahren OU in seiner Grundschulklasse (vgl. für den folgenden Absatz Peschel 2010, Kapitel 10). Auf die Beschreibung des Klassenkontextes folgt die Beschreibung der (Leistungs-)Entwicklung der Klasse und insbesondere einzelner Kinder, die zu Beginn ihrer Schulzeit als 'schwach', 'lernbehindert' oder 'erziehungsschwierig' eingestuft worden sind. Unter Verweis darauf, dass man aus der Fallstudie einer einzigen Klasse keine empirisch abgesicherten Daten für den Erfolg des Konzepts ableiten kann, stellt er umfassend den Erfolg dieser einen Klasse dar: Insgesamt schließen 24 Kinder die vierte Klasse ab, wobei neun Kinder, meist migrationsbedingt, erst im Laufe der ersten drei Klassen dazukommen.[20] Peschel bezeichnet seine Klasse als "nicht überdurchschnittlich" (Peschel 2010, S. 374).[21] Am Ende der Grundschulzeit wechselt kein Kind auf eine Sonderschule; vier Kinder gehen später auf die Hauptschule, vier auf die Realschule, 14 auf das Gymnasium und zwei auf die Gesamtschule. Damit ergibt sich insgesamt ein Klassendurchschnitt, der im Vergleich zu den beiden Parallelklassen als bemerkenswert gut bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 375).
Peschel beschreibt die Wirkung der gegenseitigen Sozialerziehung wie folgt:
"Es war faszinierend mit anzusehen, wie scheinbar 'unkontrollierbare' oder 'verhaltensauffällige' Kinder das annahmen, was andere Kinder ihnen sagten, ihnen aus der Situation heraus vorschlugen. Wie sie anfingen zu reflektieren, mitzureden, Gegenfragen zu stellen [...]. Die Kinder erreichten dabei in Kürze das, was die Professionellen alle nicht erreicht hatten" (Peschel 2009, S.149).
Damit bescheinigt er seinem Konzept sowohl in Bezug auf die kognitiven Leistungen als auch in Bezug auf das soziale Verhalten große Erfolge.
Das Ziel von Peschels Evaluation ist, die Machbarkeit und den Erfolg des OU ausführlich darzustellen und zu begründen. Dabei will er zudem nicht nur speziell für sein Konzept, sondern allgemein für Formen des 'offenen Unterrichts'[22] auf eine Relativierung des häufig schlechten Rufs offener Unterrichtskonzepte hinwirken. Es habe sich die "Behauptung, dass offener Unterricht zwar persönlichkeitsstärkend sei, geschlossenere Unterrichtsformen bzw. lehrergesteuerte Unterrichtselemente aber größere Fortschritte im kognitiven Bereich ermöglichen würden" (Peschel 2010, S. 884), in der Pädagogik etabliert (vgl. Oelkers 1996). Diese und ähnliche Vorurteile ergäben sich daraus, dass verschiedene Schulqualitätsstudien Merkmale für guten Unterricht aufstellen, die eher einem lehrerzentrierten Unterricht entsprechen bzw. sich für einen Wechsel der Unterrichtsmethoden aussprechen (vgl. dazu auch Bohl 2006, S. 32). Eine der Studien, auf die sich Peschel bezieht, ist die SCHOLASTIK-Studie von Weinert und Helmke von 1997. Für die Untersuchungen zu effizientem Mathematikunterricht werden dort Ergebnisse festgestellt, die Peschels Erfahrungen in vielen Punkten widersprechen. Merkmale für guten Unterricht sind nach Weinerts und Helmkes Studie u.a. die "Strukturiertheit der Darbietung des Lernstoffes" und die "Überwachung der und Einschalten in die Gruppen- und Stillarbeit der Schüler" (Weinert/Helmke 1997, S. 241f). Auf das hier vorgestellte Unterrichtsmodell trifft eher das Gegenteil der genannten Merkmale zu: Im OU werden weder vom Lehrer noch von Lehrgängen Inhalte strukturiert und kleinschrittig erklärt; der Lehrer hält sich außerdem mit Einmischung weitgehend zurück, sondern wartet eher, dass die Kinder auf ihn zugehen. Insofern ist Peschels Kritik an den Studien verständlich:
"Es wurden in den Erhebungen nicht Merkmale effektiven Unterrichts untersucht, sondern Merkmale effektiven lehrergesteuerten Unterrichts - sei es in Form von Frontalunterricht, Unterricht mit Einzel- und Gruppenarbeit oder auch mit einzelnen Elementen offener Unterrichtsgestaltung" (Peschel 2010, S. 890; zur ausführlichen Kritik vgl. Kapitel 18.5).
Damit soll nicht die Gültigkeit der Studien allgemein bezweifelt werden; für die Bewertung des OU haben die Ergebnisse allerdings keine entscheidende Relevanz, da die untersuchte Klasse überdurchschnittliche Ergebnisse erzielte, obwohl sie nicht den Kriterien guten Unterrichts nach der SCHOLASTIK-Studie entsprach. Da die SCHOLASTIK-Studie und auch andere Schulqualitätsstudien hauptsächlich in traditionellem Unterricht ihre Beobachtungen gemacht haben, können die Ergebnisse nicht auf ein Konzept übertragen werden, das unter gänzlich anderen Voraussetzungen arbeitet. Insofern sind nach Peschels Ansicht die Vorurteile gegenüber offenem Unterricht durch seine Fallstudie widerlegt (vgl. ebd., S. 894). Der Verweis auf die unterschiedlichen Kontextbedingungen und Voraussetzungen des OU im Vergleich zu anderen Konzepten ist durchaus ein plausibles Gegenargument zur Kritik am offenen Unterricht.
Das Konzept des OU versteht sich nicht explizit als eine Form inklusiver Didaktik. In Peschels Konzeptbeschreibung tauchen keine Passagen auf, die sich unmittelbar mit Inklusionsproblematik beschäftigen. Trotzdem kann man dem OU durchaus einen inklusiven Anspruch an Unterricht unterstellen bzw. belegen, dass Peschels Konzept dem Ideal der Inklusion verpflichtet ist. Zu diesem Zweck sind die in Abbildung 1 dargestellten sieben Merkmale der Inklusion auf Peschels OU zu beziehen.
Obwohl Peschels Klasse nach seiner Auffassung eine 'durchschnittliche' ist, nimmt er deren natürliche heterogene Zusammensetzung bewusst als solche wahr:
"Die Palette an Kindern und Charakteren war enorm unterschiedlich: vom stillen, völlig in sich zurückgezogenen bis hin zum maßgeblich von seinen Launen (und Wutausbrüchen) getragenen Kind; vom verletzlichen, wehleidigen bis hin zum knallharten, seine Fäuste massiv gebrauchenden; vom verängstigten, immer Nähe suchenden bis hin zum cool wirkenden, unangreifbaren; vom fast verwahrlosten bis hin zum überbehüteten; vom aufgeschlossenen, hoch sozialen bis hin zum noch völlig in seiner Eigenwelt gefangenen; vom asylsuchenden Kriegsflüchtling, dessen Bilder immer Häuser ohne Dächer zeigten, bis hin zur verwöhnten Träumerin, die nicht wusste, wozu Schule da sein sollte, denn sie wollte später ja nur Prinzessin werden" (Peschel 2009, S. 130).
Peschel kommt daher zu dem Schluss, dass nur ein Konzept hochgradiger Individualisierung der genannten Vielfalt gerecht werden kann. Die oben beschriebene Sicht auf seine Klasse und die Forderung "Wir müssen uns trauen, 30 Individuen auch 30 Individuen sein zu lassen" (Peschel 2009, S. 150) machen deutlich, dass Peschel an sich den Anspruch hat, die Heterogenität, die sich in jeder Klasse zeigt, ernst zu nehmen und ihr mit einem entsprechenden Unterrichtskonzept zu begegnen. "Dabei muss die Verschiedenheit der Köpfe und Verhaltensweisen fast rückhaltlos akzeptiert werden" (ebd., S. 144).
Peschel will eine Aussonderung von eventuellen 'Integrations'-Kindern verhindern und hat "eine Integration vor Augen, die eben nicht erst aussondern muss, um die so 'segregierten' Teile dann wieder (hochgelobt) zusammenzuführen, zu 'integrieren'" (Peschel 2009, S. 144). Für ihn ist "die Hochform einer integrativen Erziehung die, erst gar keine 'Segregation' aufkommen zu lassen" (ebd.). Peschel geht hier ganz im Sinne von Hinz' Inklusionsbegriff von einer unteilbaren Gruppe aus, die nicht aufgrund von Etikettierungen bestimmter Kinder auseinander dividiert wird und in der nicht bestimmte Kinder letztlich doch eine Etikettierung anhand von einer speziellen Behandlung auch innerhalb der Klasse erfahren. Insofern wendet sich Peschel von einer die Kinder einteilenden 'Zwei-Gruppen-Theorie' ab (s. Punkt 1 aus 2.1).
Diese theoretische Einstellung bedeutet für die praktische Umsetzung zwangsläufig die Etablierung einer 'Schule für alle' in der alle Kinder gemeinsam lernen (s. Punkt 2 aus 2.1). Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass Peschel eine solche Schule, die wirklich alle Kinder aufnimmt, weder in seinem Konzept begründet, noch in einer seiner Klassen praktiziert hat, was daran liegen mag, dass Peschel sein Konzept - bis jetzt - an Regelschulen erprobt hat. Trotzdem schwingt diese Vorstellung durch die eindeutige Kritik an Segregation implizit mit, und die hochgradige Individualisierung des Unterrichts verweist nicht nur auf einen an der Idee der Inklusion orientierten Umgang mit Heterogenität, sondern macht gemeinsames Lernen innerhalb demokratischer Strukturen auch unter Kindern, die traditionell innerhalb des "medizinischen Modells" (vgl. Veber 2010) als genuin defizitär und aussonderungsbedürftig ettiketiert werden, prinzipiell denkbar.
Bei der Lektüre von Peschels Konzept wird deutlich, dass er auf bestimmte besondere Voraussetzungen einzelner Kinder nicht von vornherein mit besonderen Maßnahmen für diese Kinder reagiert (wie z.B. individuelle Curricula, spezielle Pädagogen zur Unterstützung etc.), sondern sein Unterrichtskonzept so gestaltet, dass innerhalb dieses Rahmens flexibel auf solche Kinder eingegangen werden kann. Seine Kritik am bestehenden System (das sich noch immer zu einem großen Teil in der Segregationsphase befindet, vgl. 2.2) wird z.B. in folgender Aussage deutlich:
"Warum werden die Kinder, die nicht ins System passen, immer noch so einfach von der Bildfläche verdrängt und in Sonderschulen untergebracht, um sie danach mühevoll (und oft genug hoffnungslos) wieder in das System 'integrieren' zu müssen? Heißt Integration denn wirklich radikale Anpassung an die herrschenden Strukturen?" (Peschel 2009, S. 133).
Peschels Erfahrungen mit Integration beziehen sich auf Kinder, die als 'erziehungsschwierig' oder 'lernbehindert' in seine Klasse kamen - nicht auf Kinder mit schweren Behinderungen oder Sinneseinschränkungen. Für diese Kinder aber stellt er fest: "Alle diese Kinder waren bzw. sind meiner Meinung nach weder behindert noch dumm. Sie hatten damals nur eins gemeinsam: Sie kamen mit 'normalem' Unterricht nicht zurecht" (ebd., S. 132). Peschel vertritt somit ein Verständnis von Integration, das den 'Fehler' nicht beim Kind sucht und ihn mit speziellen Maßnahmen auszugleichen versucht, sondern er zielt auf eine grundlegende Veränderung des Unterrichts ab, da das System Schule offensichtlich nicht für alle Kinder passend ist. Insofern ist Peschels Ansatz als systemisch zu verstehen. Er sucht Probleme des Lehrens, Lernens und der Erziehung nicht in nachteilhaften Eigenschaften der Lernenden sucht, sondern er untersucht die sozialen Situationen, Handlungszusammenhänge und pädagogischen Arrangements, welche solche Zuschreibungen überhaupt erst hervorbringen (vgl. Punkt 3 in 2.1).
Indem Peschel sich explizit gegen Aussonderung (und erst später erfolgende Integration) ausspricht und das System Schule an die Heterogenität der Kinder angepasst sehen will, kann man sagen, dass es ihm innerhalb seines Konzeptes genau um den genannten Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik und den Systemwechsel im Schulsystem geht, welcher in Punkt 5 in 2.1 aufgeführt wird.
Auf die verbleibenden drei Punkte der Inklusion geht Peschel in der 'Evaluation' nicht ein. Man kann aber sagen, dass die Ausweitung der inklusiven Idee auf alle Minderheiten im hier herausgestellten Verständnis von Vielfalt implizit angelegt ist (Punkt 6 in 2.1). Angesichts der sehr praktisch und auf konkrete Unterrichtssituationen ausgerichteten Arbeiten von Peschel mag es nicht verwundern, dass keine weiterführende Utopie einer inklusiven Gesellschaft verfolgt wird (Punkt 7 in 2.1). Ähnliches gilt für den expliziten Bezug auf die Rolle der Sonderpädagogik: Peschels Konzept ist in einer Regelschule erprobt worden und ursprünglich nicht als Inklusionskonzept zu verstehen. Insofern mag es nicht verwundern, dass die sehr grundsätzliche Diskussion, welche Rolle die Sonderpädagogik in einer zukünftigen inklusiven Schule spielt, nicht erörtert wird (Punkt 4 in 2.1).
Als Zusammenfassung ergibt sich: Peschels Unterrichtskonzept zielt auf die Entwicklung inklusiver Praktiken und Strukturen. Diese Perspektive wird im Folgenden genauer untersucht.
[12] Im Folgenden meint die Abkürzung OU PESCHELS spezielles Konzept, während 'offener Unterricht' als allgemeiner Begriff auf unterschiedliche Modelle verweisen kann.
[13] Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf diese Monographien und somit auf die Situation an PESCHELS ehemaliger Grundschule.
[14] Die Professorin von der Universität Hildesheim hat u.a. die Arbeitsschwerpunkte 'Integration behinderter Kinder ins Regelschulsystem' und 'Offene Unterrichtskonzepte'. Trotz einiger grundlegender Kritikpunkte an vermeintlich offenem Unterricht, die sie mit PESCHEL teilt, vertritt sie insgesamt eine Vorstellung von offenem Unterricht, der nicht an den von PESCHEL geforderten Öffungsgrad heranreicht (vgl. GRAUMANN 2002, Kapitel 5.4).
[15] Bei dieser Stufe der Öffnung kann man große Parallelen zu der von FEUSER vertretenen Arbeit am Gemeinsamen Gegenstand festellen (vgl. ders. 1995).
[16] Dabei beruft sich PESCHEL auf der praktischen Ebene auf die FREINET-Pädagogik. FREINET wollte den Lehrer "als gleichberechtigten Begleiter des Kindes sehen, der seine Erfahrungen dazu nutzt, das Kind seinen eigenen Weg finden zu lassen" (PESCHEL 2009, S. 19).
[17] Dabei stößt die Selbstregulierung teilweise auch an ihre Grenzen, was im Hinblick auf die Rolle des Lehrers deutlich wird (s.u.).
[18] Die Betonung des authentischen Verhaltens und des 'hochzuhaltenden Lernens' muss man vor dem Hintergrund verschiedener Erfahrungen mit Unterricht sehen, von denen sich PESCHEL distanzieren möchte. Dabei soll die Selbstbestimmung der Kinder weder aufgesetzt sein, so dass die Kinder nur scheinbar selbst über ihren Schulalltag bestimmen und der Lehrer im Hintergrund doch entscheidet, noch darf Schule zu einem Ort verkommen, dessen Sinn nicht mehr das Lernen ist.
[19] Man muss allerdings auch bemerken, dass es im OU durchaus Treffen der Schüler gibt, in denen sich der Lehrer gar nicht einbringt oder sogar nicht anwesend ist (vgl. PESCHEL 2010, S. 523).
[20] Außerdem besuchen neun weitere Kinder die Klasse für jeweils kurze Zeit. Ein Junge beendet das vierte Schuljahr erfolgreich in der Klasse; zwei Kinder werden in der ersten Klasse nicht versetzt, alle anderen müssen umzugsbedingt die Klasse verlassen. Ein für nicht schulreif befundenes Mädchen ist dabei schon vor seinem Umzug auf Wunsch der Eltern in die Parallelklasse gewechselt, wo sich das Arbeitsverhalten allerdings nicht verbessert hat (PESCHEL 2010, Kapitel 10.2.5).
[21] Der IQ-Durchschnitt beträgt 100,6; 18 Kinder wachsen bei beiden Eltern auf; es ergibt sich eine relativ gleichmäßige Verteilung der Wohnsituation auf Sozialwohnungen, Mietwohnungen und Eigenheime, ein Kind wächst außerdem in einer Wohngruppe auf; sieben Kinder haben einen Migrationshintergrund; in insgesamt fünf Elternhäusern arbeitet keines der beiden Elternteile; sieben Familien erhalten zusätzliche Unterstützungsleistungen; für zwei Kinder wurde zur Zeit ihres Wechsels in die Klasse ein Förderschulantrag gestellt, für einen hochbegabten, hyperaktiven Jungen, der schon im Kindergarten durch aggressives Verhalten aufgefallen ist, wird im Laufe des ersten Schuljahres der Besuch einer Sonderschule in Erwägung gezogen; zwei der Kinder wären an ihrer alten Schule nicht versetzt worden. Diese Kinder schließen ihre Grundschulzeit in PESCHELS Klasse ab.
[22] Dabei ist jetzt gerade nicht der in 3.1 beschriebene geöffnete Unterricht oder die offenen Unterrichtseinheiten gemeint, sondern z.B. Unterricht im Stil der 'Didaktik der Kernideen' oder das Konzept von Sudbury-Schulen.
Inhaltsverzeichnis
Um eine genaue Analyse der inklusiven Aspekte des OU vornehmen zu können, ist es nötig, die Merkmale inklusiver Schulen zu kennen. Mit Bezug auf Hinz bedeutet das, einen Katalog von Merkmalen zu erstellen, der die in 2.1 aufgeführten Merkmale der Inklusion berücksichtigt und für die Praxis konkretisiert. Eine solche Liste müsste dann mit Peschels Konzept verglichen werden. Aus offensichtlichen Gründen kann weder hier noch überhaupt eine solche komplette Liste erstellt werden; nicht jedes Merkmal von inklusiver Praxis kann in Beziehung zu Peschels Unterrichtskonzept gesetzt werden. Den Versuch einer Auflistung von Merkmalen unternehmen Ainscow und Booth (2000) im 'Index für Inklusion' (übersetzt von Boban und Hinz 2003). Der Index ist in einen Katalog von mehr als 500 Fragen aufgeschlüsselt, die hier unmöglich in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden können, selbst wenn man den 'Index' als Instrument zur Durchführung einer Bestandaufnahme inklusiver Bestandteile in Unterrichtskonzepten oder -praktiken akzeptierte.[23] Zu einer Eingrenzung soll statt dessen Reinhard Stählings Monographie "Du gehörst zu uns - Inklusive Grundschule" herangezogen werden.[24]
Während Peschel zwar Tendenzen einer inklusiven Schulpraxis aufweist, sie aber nicht als solche deklariert, verfolgen Stähling und seine Kollegen an der Grundschule Berg Fidel in Münster explizit die Entwicklung einer inklusiven Schule.[25] Auf der Homepage der Schule wird das deutlich: Der erste Profilierungsaspekt der Schule ist dort 'Inklusion/Integration', und man findet unter weiterführenden Literaturhinweisen z.B. auch ein 'Manifest' von Stähling (ders. 2009b), in dem er sich für Inklusion ausspricht. Dabei bezieht sich Stähling ausdrücklich auch auf den Index für Inklusion. Von Irmtraud Schnell wird die Grundschule Berg Fidel als ein erfolgreiches Beispiel inklusiver Schulentwicklung dargestellt (Schnell 2010).
Nach Stähling ist eines der elementaren Kriterien und Voraussetzungen für die Entwicklung einer inklusiven Schule der von ihm so betitelte "Nährboden von Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit" (Stähling 2009, S. 140).[26] So einleuchtend diese Begriffe und Werte zunächst klingen, so nichtssagend können sie wirken angesichts der konkreten Aufgabe, inklusive Schulen zu entwickeln.[27] Im Folgenden wird deshalb Stählings Vorstellung vom 'Nährboden' an Hand der von ihm in seiner Monographie aufgeführten Merkmale spezifiziert und explizit auf Inklusion bezogen.[28] Es soll daran deutlich werden, welche Faktoren nach Stähling für eine 'Schule für alle' eine besonders wichtige Rolle spielen. Es werden sieben Merkmale herausgerbeitet, die stellvertretend stehen für bestimmte soziale Praktiken und ethische Grundeinstellungen.[29] Bei dem Aspekt 'Achtung' ist zwischen vier Teilaspekten zu differenzieren, bei dem Aspekt 'Zugehörigkeit' geht es vor allem um zwei Teilaspekte, dem Aspekt 'Verlässlichkeit' wird nur ein Schwerpunkt zugeordnet. Zur genaueren Bestimmung wird der Fragekatalog des Index' herangezogen, indem jedem der sieben herausgearbeiteten Merkmale entsprechende Fragen zugeordnet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Fragen jeweils in die Fußnote gestellt.
Die Verknüpfung der Gesichtspunkte, die im weiteren Verlauf zu untersuchen sind, lässt sich durch folgendes Schema veranschaulichen:
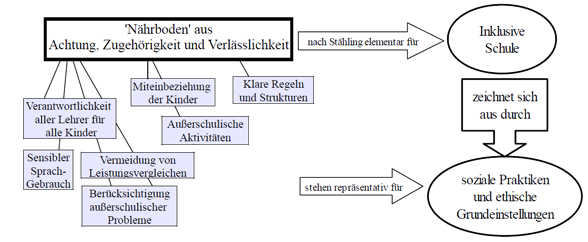
Abbildung 5: Schema inklusiver Merkmale nach Stähling
Das Ergebnis wird, ohne auf die Praxis an Stählings Schule detailliert eingehen zu können, anschließend mit Peschels Theorie und der von ihm beschriebenen Praxis abgeglichen, wobei als Grundlage die 'Evaluation' dient. Die beiden oben für die Etablierung einer 'Schule für alle' festgestellten Prämissen der Nicht-Aussonderung und der inneren Differenzierung gehören nach Stähling auch zu den sozialen Praktiken und ethischen Grundeinstellungen, durch die sich eine inklusive Schule auszeichnet. Beide Prämissen werden im Folgenden aber nicht weiter untersucht, da sie meines Erachtens sowohl bei Stähling als auch bei Peschel im Konzept angelegt sind.[30]
Verantwortlichkeit aller Lehrer für alle Kinder [31]
Im Sinne der Aufhebung der 'Zwei-Gruppen-Theorie' bedeutet bei Stähling Achtung auch den Verzicht auf Etikettierung: Schüler mit speziellen Bedürfnissen bzw. einem diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf[32] sollen nicht als besondere Schützlinge an entsprechende sonderpädagogische Mitarbeiter weitergereicht werden, sondern jeder Lehrer ist für jeden Schüler verantwortlich (Stähling 2009, S. 7; vgl. Hinz 2002). Dieser Punkt hängt eng zusammen mit der Bedeutung der Teambildung, der neben der Entwicklung des 'Nährbodens' eine große Rolle an der Grundschule Berg Fidel spielt. Jede Klasse wird dort von einem multiprofessionellen Team unterrichtet, das aus jeweils einem Lehrer, einem Erzieher und ein bis zwei Honorarkräften oder Praktikanten besteht.
Nach Stähling bedeutet Achtung auch die Nicht-Etikettierung einzelner Schüler als 'Problemkinder' oder 'Integrationskinder'. Dazu bedarf es einer Verständigung des Klassenteams darauf, dass kein Schüler einem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet ist.
Berücksichtigung außerschulischer Probleme [33]
Die traditionelle Funktion der Schule bzw. der Lehrkräfte erfährt bei Stähling eine deutliche Erweiterung, insofern als nicht mehr nur das Lernen an sich im Vordergrund steht, sondern zuerst das allgemeine Wohlbefinden der Kinder in den Fokus gerückt wird. Natürlich wollen alle Lehrer, dass es ihren Schützlingen gut geht, und, wie oben schon bemerkt, findet inzwischen bei der Diskussion um Schulqualität insbesondere auch die generelle Zufriedenheit der Schüler Berücksichtigung.[34] Stähling geht allerdings sehr viel weiter, indem er den Aufgabenbereich der Lehrkräfte an einer inklusiven Schule, vor allem an einer Brennpunktschule[35], generell um einen sozialpädagogischen Auftrag erweitert (vgl. ders. 2009, S. 19). Die Mitarbeiter übernehmen damit nicht nur Verantwortung für die kognitive Entwicklung der Kinder, sondern auch für deren emotionales Befinden (ebd., S. 83). Besonders im Fall sogenannter verhaltensauffälliger Kinder mit eventuell schwierigem sozialen Hintergrund ist die Lehrkraft als stabile Bezugsperson gefragt, das Verhalten gegebenenfalls als "Hilferuf" zu deuten und dementsprechend darauf einzugehen (vgl. Stähling 2009, S. 141). Es geht Stähling also nicht alleine darum, auf das Kind als mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen oder Fähigkeiten ausgestattetes Individuum einzugehen, sondern dieses auch in seinem sozialen Kontext (Milieu, Migrationshintergrund, etc.) zu verstehen, um angemessen mit Heterogenität umgehen zu können (vgl. so auch Fürstenau 2009, S. 61).
Nach Stähling bedeutet Achtung auch, dass es in der Schule Raum gibt, die (außerschulischen) Probleme einzelner Kinder zu thematisieren. Es muss für die Kinder das praktikable Angebot geben, intensive Einzelgespräche mit den Mitarbeitern auch zu außerschulischen Themen führen zu können.
Vermeidung von Leistungsvergleichen [36]
Das Gefühl, geachtet und wertgeschätzt zu werden, hängt bei Stähling unter anderem mit der Bewertung der schulischen Leistungen zusammen (vgl. zum folgenden Abschnitt Stähling 2009, S. 143f). Direkte Vergleiche innerhalb der Gruppe können dabei stigmatisierend wirken und das Nicht-Können eines Kindes bloßstellen (Stähling 2009, S. 143). Die negativen Auswirkungen einer solchen "sozialen Bezugsnorm" sind insbesondere bei leistungsschwächeren Schülern belegt (vgl. Bohl 2006, S. 64). Insofern stimmt Stähling Bohl zu, der aus pädagogischen Gründen "eine individuelle Bezugsnorm sicher wünschenswert" nennt (ebd.). Stähling fordert deshalb als einen Faktor für die Unterstützung von Anerkennung[37] die Vermeidung von Leistungsvergleichen. Er lehnt aus diesem Grund die traditionelle Bewertung mit Noten ab, die den jeweiligen Stand eines Kindes in Bezug auf die Klasse wiedergeben. Indem man stattdessen die Entwicklung des einzelnen Kindes als Maßstab für die Leistungsbewertung nimmt (individuelle Bezugsnorm), differenziert man zwischen den verschiedenen Ausgangspunkten, also dem Wissensstand und den Fähigkeiten, die die Schüler jeweils mitbringen. Eine Möglichkeit, eine solche Differenzierung vorzunehmen, besteht in der Verwendung von Lerntagebüchern oder Portfolios, die einen "ganzheitlichen Blick auf die Leistungen eines Schülers und seine Entwicklung im Laufe der Zeit ermöglichen" (Helmke 2009, S. 241) und so den einzelnen Schüler bewerten helfen, ohne auf Vergleiche mit den Mitschülern zurückzugreifen.[38] Der Pädagoge versucht dadurch zu erreichen, dass die Schüler sich als Lerngemeinschaft verstehen, die nicht miteinander konkurriert, sondern miteinander, gemeinsam etwas lernt. Kinder sollen einander nicht als besser oder schlechter, 'geistig behindert' oder 'nicht geistig behindert' wahrnehmen, sondern zuallererst als Menschen, die unterschiedliche individuelle Voraussetzungen mitbringen. Ein angemessender Umgang mit Heterogenität bedeutet nach Stähling in Bezug auf die Frage der Leistungsbewertung also die Notwenigkeit, intersubjektive Vergleiche zu vermeiden und statt dessen den Fokus auf intrasubjektive Vergleiche des Individuums mit sich selbst zu lenken.
Nach Stähling bedeutet Achtung auch, Situationen entgegenzuwirken, in denen aufgrund unterschiedlicher Leistungsstände bestimmte Kinder ausgegrenzt werden können. Dazu schlägt Stähling ein System vor, das direkte Leistungsvergleiche vermeidet, z.B. die Würdigung von Portfolios anstelle des herkömmlichen Notensystems.
Sensibler Sprachgebrauch [39]
Bezogen auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern verweist Stähling auf die Bedeutung sensiblen Sprachgebrauchs: "So heißt es statt 'Du störst' besser 'das, was du jetzt tust, stört!'" (Stähling 2009, S. 77). In diesem Beispiel verlagert sich die globale Kritik auf eine spezielle Handlung, so dass der Satz keine allgemeine Ablehnung dem Kind gegenüber ausdrückt. Eine Sensibilisierung des Sprachgebrauchs stellt für einen angemessenen Umgang mit Heterogenität eine Notwendigkeit dar, da ansonsten über Etikettierungen und nicht-hinterfragte Sprechgewohnheiten Kinder verbal ausgesondert werden.
Nach Stähling bedeutet Achtung auch eine bewusst respektvolle Wortwahl im Umgang miteinander, wodurch Sprech- und Wahrnehmungsmuster auf Seiten der Schüler und Lehrer so verändert werden, dass der andere in seiner Individualität angenommen wird, ohne sich stigmatisiert zu fühlen.
Miteinbeziehung der Kinder [40]
Für Stähling spielen soziale Praktiken der aktiven Partizipation eine elementare Rolle im inklusiven Unterricht (vgl. zum gesamten Abschnitt Stähling 2009, S. 75f).[41] Die Kinder sollen die realistische Möglichkeit haben und dazu angeregt werden, das Schullebens aktiv mitzugestalten und ihre Belange selbst zu vertreten. Eine aktive Gestaltung des Unterrichtsalltags durch die Kinder steht für Stähling in unmittelbarem Zusammenhang damit, dass sich die Kinder der Gruppe zugehörig zu fühlen.
Neben einem offenen Unterrichtsstil stellt der Klassenrat als feste Institution den wichtigsten Faktor für die Partizipationsmöglichkeiten der Kinder dar. Offener Unterricht bedeutet bei Stähling in erster Linie gelenkte Freiarbeit (vgl. Stähling 2009, S. 126). Auf allen drei von Peschel benannten Stufen des OU findet man bei Stähling zwar durchaus Tendenzen zu einer Öffnung, diese werden jedoch durch eine zeitweise ausgeprägte Lehrerzentrierung relativiert. Im Klassenrat werden einmal pro Woche Regeln erstellt, Probleme besprochen und mit Hilfe aller Schüler Lösungen gefunden und es werden die Klassenpflege betreffende Wochenaufgaben wie der Tafeldienst verteilt. Der Klassenrat wird dabei in der Regel vom Lehrer geleitet (vgl. Stähling 2003, S. 200). Durch das vermittelnde Gespräch im Klassenrat zwischen Lehrer und Schülern sollen soziale Konflikte gelöst werden (Stähling 2009., S. 141).[42]
Nach Stähling bedeutet Zugehörigkeit auch die Gestaltung bestimmter Aspekte des Klassenlebens durch alle Kinder. Stähling hebt die Notwenigkeit der Etablierung eines Klassenrates und/oder anderer Gremien hervor, innerhalb derer die Schüler die Gestaltung von Klassenräumen und Klassengemeinschaft (mit)bestimmen können.
Gemeinschaftsstärkung außerhalb der Schule [43]
Eine "Atmosphäre der Zugehörigkeit" soll durch "Aktivitäten, die dem Gemeinschaftsleben der Klasse dienen", unterstützt werden (Stähling 2009, S. 142). Der Stellenwert solcher sozialen Praktiken für eine inklusive Schule spiegelt sich im Index wider, der den "Aufbau einer unterstützenden Schulgemeinschaft" als ebenso wichtig erachtet wie "die Steigerung der kognitiven Leistungen" (vgl. im Inklusionsindex A.2.2, Frage 1). Wie genau diese Schulgemeinschaft aussehen muss, um jedem Mitglied das Gefühl von Zugehörigkeit zu vermitteln, ist pauschal nicht zu beantworten; allerdings bedeutet der Aufbau einer solchen Gemeinschaft an jeder Schule, dass viel Zeit und Engagement investiert werden müssen, was Stähling zum Aufbau einer inklusiven Schule aber - gegebenenfalls auch auf Kosten von Unterrichtszeit - in Kauf nimmt.
Dabei können gemeinsame Ausflüge, Feiern oder Projekte die Basis für das Entstehen von Gemeinschaft bilden.[44] Ein weiteres Beispiel für die Unterstützung der Klassengemeinschaft ist das tägliche gemeinsame Mittagessen, das im Klassenraum eingenommen wird (Stähling 2009, S. 95). Stähling betont wiederholt die Wichtigkeit dieses Rituals, was deutlich macht, dass außerunterrichtliche Aktivitäten mit in das Schulkonzept einbezogen sind und insgesamt Wert auf eine familiäre Atmosphäre gelegt wird, welcher dazu beitragen kann, wechselseitige Anerkennung und Achtung im Umgang mit Heterogenität hervorzubringen.[45]
Zugehörigkeit bedeutet für Stähling, auch im Rahmen außerunterrichtlicher Veranstaltungen und Zusammenkünfte regelmäßig Zeit mit allen Klassenmitgliedern zu verbringen. Das bedeutet die Organisation von gemeinsamen einzelnen und auch regelmäßigen Aktionen wie dem Mittagessen, Schulfesten, Klassenfeiern, Projekten etc.
Klare Regeln und Strukturen [46]
Für Stähling bedeutet Verlässlichkeit im schulischen Kontext vor allem Kontinuität der zwischenmenschlichen Beziehungen[47] und die gleichbleibende und klare Struktur und Organisation des Unterrichts (vgl. zu diesem Abschnitt Stähling 2009, S. 142). Beides gebe den Schülern einen sicheren Rahmen. Stähling lehnt seine Vorstellungen von klarer Unterrichtsstruktur eng an den Begriff der "effizienten Klassenführung" an, der in der internationalen Schulqualitätsforschung als "Schlüsselmerkmal" (Helmke 2009) guten Unterrichts angesehen wird:
"Eine effiziente Klassenführung ist kein Selbstzweck, sondern unabdingbare Voraussetzung für die Sicherung anspruchsvollen Unterrichts, indem sie einen geordneten Rahmen für die eigentlichen Lehr- und Lernaktivitäten schafft und insbesondere die aktive Lernzeit steuert, das heißt diejenige Zeit, in der sich die Schüler mit den zu lernenden Inhalten engagiert und konstruktiv auseinandersetzen können" (Helmke 2009, S. 174).
Im Mittelpunkt steht dabei die aktive Lernzeit, die durch die Minimierung von Störungen und geistiger Abwesenheit der Schüler vergrößert werden soll. Um das zu gewährleisten, bedarf es eines zusammen mit den Schülern erarbeiteten, 'verlässlichen' Regelsystems mit gekoppelter 'verlässlicher' Störungskontrolle.[48] Bei Stähling wird diesbezüglich das Vorhandensein und Funktionieren eines Klassenrates vorausgesetzt, der diese Aufgabe zu übernehmen in der Lage ist.
Neben der Etablierung von Regeln und Ritualen[49] spielt für eine effiziente Klassenführung die Organisation des Unterrichts eine große Rolle, damit möglichst wenig Leerlauf entsteht (vgl. Stähling 2009, S. 142). Stähling nennt unter Bezug auf Helmke dafür die Vorbereitung des Klassenraums, Transparenz und Mitsprachemöglichkeiten für alle Beteiligten und inhaltliche Klarheit. Die Übergabe von Verantwortung an die Schüler und die Etablierung pädagogischer Arrangements durch den Lehrer stehen dabei in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis zueinander. Stähling betont daher, dass sich offener Unterricht und eine gute Klassenführung keineswegs ausschließen. "In einer gut geführten Klasse können Kinder im offenen Unterricht selbstständig inhaltlich arbeiten. Sie wissen, welche Regeln dabei zu beachten sind und welche Aufgaben sie auswählen können" (Stähling 2009, S. 142). Regeln werden also einerseits vom Lehrer vorgegeben, aber auch andererseits mit den Schülern verhandelt. Festgelegte pädagogische Arrangements bilden dabei den Ausgangspunkt für die partielle Mitbestimmung der Schüler.
Nach Stähling bedeutet Verlässlichkeit vor allem, dass allen Kindern Regeln und Rituale vertraut sind und so neben einer Umgebung, die bewusst nach pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet wird, dazu beitragen, den Unterrichtsalltag klar zu strukturieren. Die Beteiligung der Schüler an der Entwicklung solcher Regeln trägt dabei zu Verständnis und Akzeptanz bei.
Insgesamt wurden für eine Spezifizierung des 'Nährbodens von Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit' nach Stähling sieben Merkmale herausgestellt. Der 'Nährboden' ist danach dann gegeben bzw. wird aktiv von der Schule unterstützt, wenn die Mitarbeiter
-
ein Bewertungssystem entwickeln, das direkten Vergleichen und der besonderen Herausstellung einzelner Arbeiten entgegenwirkt;
-
sich für jeden Schüler gleichermaßen verantwortlich zeigen;
-
auf außerschulische Probleme der Kinder eingehen;
-
einen bewusst respektvollen Umgang pflegen;
-
die Gestaltung des Klassenlebens durch die Kinder unterstützen, unter anderem durch einen Klassenrat, der weitreichende Kompetenzen besitzt;
-
außerunterrichtliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit allen Klassenmitgliedern gestalten;
-
dafür sorgen, dass der Unterrichtsalltag klar strukturiert ist, insbesondere durch Regeln und Rituale, die allen Kindern vertraut sind, und durch eine vorbereitete Umgebung.
Einerseits legt Stähling Wert auf allgemeine Qualitätsmerkmale von Unterricht wie die effiziente Klassenführung. Andererseits legt er besonderen Wert auf einen vertrauten Umgang zwischen allen Mitgliedern der Klasse; die Etablierung von sozialen Praktiken und die Förderung ethischer Grundhaltungen, die dem Ideal der Inklusion entsprechen, erhalten weitaus mehr Beachtung als im traditionellen Unterricht.
Wenn man nun davon ausgeht, dass die sozialen Praktiken und ethischen Grundhaltungen, welche unter der Metapher des 'Nährbodens' zusammengefasst werden, für das Gelingen einer inklusiven Schule eine große Rolle spielen, ist es im Hinblick auf Peschels Konzept lohnenswert zu untersuchen, ob sich die oben herausgearbeiteten Merkmale in seinem Konzept wiederfinden. Deshalb werden im Folgenden die sieben Merkmale Stählings auf ihr Vorhandensein in Peschels Konzeption hin geprüft. Zu dieser Untersuchung wird im Folgenden Peschels eigene 'Evaluation' herangezogen, wobei die darin enthaltenen 'empirischen Evidenzen', welche zum Teil auf Deutungen Peschels basieren, methodisch problematisch bleiben. Bezüglich der hier untersuchten Fragestellung nach inklusionsförderlichen Merkmalen stellt es sich daher nicht so sehr auf theoretischer jedoch auf empirischer-praktischer Ebene als schwierig heraus, Evidenzen von intersubjektiv nachprüfbarer Gültigkeit zu liefern.
Verantwortlichkeit aller Lehrer für alle Kinder
Ein Vergleich mit Peschels OU für dieses Merkmal ist nur bedingt möglich, da er in der beschriebenen Klasse alleiniger Lehrer war und der Rest des Kollegiums nicht in sein Konzept mit eingebunden war. Da die Klasse keinen Sonderpädagogen bewilligt bekommen hat, ist ein potentieller Rollenkonflikt zwischen Sonder- und Regelpädagogen von vornherein ausgeschlossen gewesen. Stattdessen übernehmen die Kinder bei Peschel selbst teilweise Verantwortung für 'problematische' Mitschüler. Z.B. schreibt er über zwei Kinder seiner Klasse:
"Da beiden Kindern ein selbstständiges Arbeiten über einen längeren Zeitraum nicht möglich ist, muss in der Regel mindestens eines der beiden Kinder durch den Lehrer oder durch einen Klassenkameraden betreut bzw. beschäftigt werden" (Peschel 2010, S. 452).
Die gegenseitige Betreuung wird dabei teilweise vom Lehrer selbst veranlasst. Die Diplomandin, die Peschels Unterricht besucht hat, hält in ihren Aufzeichnungen eine Szene fest, in der Peschel im Kreis einen "Chef" für einen der beiden genannten Schüler finden möchte, der dann für eine bestimmte Zeit verantwortlich für seinen Mitschüler ist (Peschel 2010, S. 526).
Ausgehend von der Annahme der Selbstregulation kann eine Betreuung bestimmter Kinder also auch durch Mitschülern gewährleistet werden. Auf Heterogenität wird somit durch gegenseitige Unterstützung der Schüler reagiert, was nach Peschels Evaluation einerseits zu funktionieren scheint, andererseits kritisch zu hinterfragen ist.[50]
Berücksichtigung außerschulischer Probleme
In Bezug auf die Berücksichtigung außerschulischer Probleme und somit der Erweiterung des klassischen Verständnisses von Lehreraufgaben beschreibt Peschel sein eigenes Verhalten als Lehrer wie folgt: "Er nimmt innerhalb seiner Rolle als Erwachsener mit Erfahrungsvorsprung eine eher partnerschaftliche Stellung ein" (Peschel 2010, S. 522); er hat dabei "Zeit, sich auch über nichtschulische Dinge mit den Kindern zu unterhalten und pflegt so eine direkte Beziehung, die über die Rolle als Lehrer und Erzieher hinausgeht" (ebd.).[51] In einem Fragebogen gibt Peschel an, dass die Kinder "sich an mich auch als Person (nicht nur als Lehrer) wenden" (ebd., S. 503). Mehrfach wird das partnerschaftliche Verhältnis von Lehrern und Schülern betont.
Wie auch bei Stähling entsteht insgesamt der Eindruck, Peschel wolle die Trennlinie zwischen den Bereichen 'Schule-Unterricht-Lernen' und 'Zuhause-Familie-Geborgenheit' aufbrechen. Dabei steht "die Achtung vor dem einzelnen Kind, die Atmosphäre in der Klasse, in der der Einzelne sich gewürdigt und 'zu Hause' fühlen kann" im Vordergrund (ebd., S. 534). Das ist eine Voraussetzung dafür, dass fachliches Lernen erfolgreich ist. Damit ergibt sich eine deutliche Parallele zu Stähling. Peschel beschreibt in seiner Evaluation, wie viel Zeit der Lehrer aufbringen muss, will er wirklich auf die außerschulischen Probleme jedes Kindes eingehen können. Die Zeit, die er im Konzept der Selbstregulierung dadurch gewinnt, dass er keinen Unterricht leitet, kann er nutzen, um den Kindern zuzuhören und sie individuell zu betreuen.
Vermeidung von Leistungsvergleichen
In der untersuchten Klasse werden die Halbjahreszeugnisse bis zum zweiten Halbjahr der dritten Klasse unter Verzicht auf Noten ausgestellt; sie gleichen persönlichen Briefen, die direkt an die Kinder gerichtet sind. Die Textzeugnisse - und später die Noten - werden in Einzel- und Klassengesprächen erörtert. Die Kinder haben dabei keinen Einfluss auf die Bewertung des Lehrers. Die täglichen Bewertungen von Schülerleistungen, die meist in Form von Vorträgen vor der ganzen Klasse präsentiert werden, werden dagegen von der gesamten Klasse gemeinsam erstellt, teilweise auch ohne Eingreifen des Lehrers. Bevor die Klasse ihr Urteil gibt, schätzen die Kinder selbst ihre eigenen Leistungen ein (vgl. zu diesem Abschnitt Peschel 2010, S. 351).
Es ist festzustellen, dass Peschel bei dieser wiederum am Ideal der Selbstregulierung orientierten Leistungsbewertung Wert darauf legt, dass die Kinder einen Sinn dafür entwickeln, die Leistungen der anderen nicht an der sozialen Bezugsnorm zu messen, sondern relativ im Verhältnis zu deren Entwicklungsstand (individuelle Bezugsnorm). Das folgende Beispiel, das von der Diplomandin wortgetreu transkribiert wurde, geht darauf ein; als die Kinder einen Vortrag mit der Note 4 bewerten, lenkt der Lehrer ein:
"Aber sie [die beiden vortragenden Mädchen, M.S.] haben sich aufgerafft und statt Barbiepuppen-Streicheln haben die Vorträge gemacht, das finde ich schon mal super [...]. Und wir haben auch bei den anderen Kindern, die als die das das erste Mal so gemacht haben und das war nicht so toll, und die haben sich drangesetzt, haben wir dann auch ein bisschen besser bewertet" (Peschel 2010, S. 528).
Der Lehrer schlägt daraufhin eine Benotung von '4+' oder '3-' vor. Durch das explizite Werturteil, es sei für die beiden Mädchen "super", dass sie überhaupt angefangen haben zu arbeiten und durch die entsprechende Relativierung der Note wird deutlich, dass Peschel seiner Klasse versucht zu vermitteln, Bewertungen relativ zum Stand des jeweiligen Kindes durchzuführen.[52]
Insgesamt kann man Peschels Dissertation entnehmen, dass er der Anerkennung von Leistungen im Verhältnis zu dem Stand des jeweiligen Schülers seitens der Schüler und der Lehrkraft einen hohen Stellenwert beimisst. Andererseits finden sich Textstellen, die sehr wohl Vergleiche des Lehrers zwischen Schülern beschreiben:
"Ja, der Augenvortrag war noch'n bisschen besser, aber das war schon... für die anderen Noten, die ihr bisher verteilt habt, war das auch sehr gut, ja" (transkribierte Wiedergabe, ebd., S. 524).
Zumindest diese Textstelle ist ein Beleg dafür, dass explizite Vergleiche durch den Lehrer ausgesprochen werden und auch das demokratische Notenvergabesystem verzichtet nicht, wie von Stähling empfohlen, auf den direkten Vergleich.[53] Diese der Theorie widersprechende Notenvergabepraxis drückt somit nicht im Sinne Stählings 'Achtung gegenüber den Leistungsunterschieden' aus. Einzelne Kinder scheinen dazu zu neigen, Noten nach individueller Sympathie und nicht nach gegebenenfalls objektivierbaren, das heißt intersubjektiv prüfbaren Standards zu beurteilen.[54] Die Annahme, dass eine wechselseitige Bewertung der Kinder tatsächlich funktionieren kann, ohne das Selbstwertgefühl des Einzelnen in Mitleidenschaft zu ziehen, ist durchaus problematisch.[55] Die Selbsteinschätzung dagegen wird sowohl vom Index (C.1.6 Frage 3) als auch von Helmke als sinnvolle Ergänzung zur Fremdbewertung gesehen, da so "die Sensibilität für eigene Stärken und Schwächen sowie die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung gesteigert werden" (Helmke 2009, S. 242). Darüber hinaus arbeitet Peschel parallel auch mit sogenannten 'Führerscheinen' (vgl. dazu die Fertigkeitsbescheinigungen nach Freinet in Bohl 2006, S. 53). Insofern sind alternative Modelle der Leistungsbewertung bei Peschel durchaus vorgesehen, die sich nicht nach der sozialen Bezugsnorm richten, sondern sich an der individuellen Entwicklung (Schriftzeugnisse) oder am fachlichen Können (Führerscheine) orientieren. Insgesamt wird Stählings Forderung aber nur bedingt entsprochen.
Sensibler Sprachgebrauch
Offenbar legt Peschel nicht so viel Wert auf sensiblen Sprachgebrauch wie Stähling. Die Mitschrift der Diplomandin belegt, dass "der Umgangston sehr rau und direkt" (Peschel 2010, S. 533), wie die folgende Aufzeichung zeigt:
"Lehrer: 'Wir treffen uns immer zur Ersten, und was du brauchst? Nur ein Heft und was zum Schreiben.' Schüler: 'Auf dem Zettel steht aber, dass das nur für die ersten und zweiten Schuljahre gilt. Wir müssen normal mitnehmen.' Lehrer: 'Ja, was nimmst du denn sonst noch mit? Das ist doch dein Problem, was du noch mitschleppst. Für mich musst du doch eh immer nur ein Heft mitnehmen!'" (ebd., S. 526).
Auch wenn hier kein Einblick in den Gesamtkontext gegeben ist - man weiß z.B. nichts über den Schüler oder den Tonfall, in dem Peschel antwortet - kann man die Wortwahl als brüsk bezeichnen. Anstatt dem Schüler eine Information zu geben, die ihm hilft, seine offensichtliche Unsicherheit bezüglich der Materialien zu entschärfen, wird das Problem auf den Schüler zurückgeschoben: "Das ist doch dein Problem!".
In einer anderen Situation hält die Hospitantin über Peschels Lehrerverhalten fest:
"Er korrigiert Geschichten, albert mit den Kindern rum oder provoziert die Kinder mit herausfordernden Fragen. Zum Schüler Michael sagt er: "Oh, du nervst!" (ebd., S. 527).
Vor allem im direkten Vergleich mit Stählings Anspruch, die eigene Ungeduld nicht auf das Kind selbst zu richten, sondern auf dessen Tätigkeit, wirkt die beschriebene Szene grob gegenüber dem Schüler.
Den sehr direkten Umgang auch der Kinder untereinander vergleicht Peschel "mit dem auf unnötige Floskeln verzichtenden Umgangston, der auch in einer Familie vorkommen kann und eher die gegenseitige Nähe der Beteiligten ausdrückt denn einen etwaigen Abstand" (ebd., S. 568) und beschreibt ihn insgesamt als "manchmal sehr schroff, manchmal unhöflich, aber nie unehrlich" (ebd.). Während der Umgangston für Peschel anscheinend akzeptabel ist, beschweren sich Eltern über den häufigen Gebrauch von Schimpfwörtern in der Klasse, der vom Lehrer aber nicht angesprochen wird, weil er auf die Selbstregulierung durch die Schüler vertraut (ebd., S. 564). Stählings Konzept dagegen ist zu entnehmen, dass er sensiblen Sprachgebrauch durch bewusste, umsichtige Wortwahl gezielt fördern will.
Miteinbeziehung der Kinder
Insofern Selbstregulierung das Grundprinzip des OU darstellt, ist die Miteinbeziehung der Kinder in die Gestaltung des Unterrichtsalltags nicht nur Bestandteil, sondern Voraussetzung des OU. Die Funktion von Stählings Klassenrat nimmt bei Peschel der Sitzkreis ein, der das regulierende Moment in Bezug auf soziale Konflikte, organisatorische Fragen und Beobachtung der kognitiven Entwicklung darstellt. Die Selbstständigkeit der Schüler ist Voraussetzung und Ziel von Peschels OU; deshalb müssen die Schüler umfassend miteinbezogen werden und den Unterricht weitgehend selbstständig gestalten. Es handelt sich dabei um zentrale Kompetenzen, die Peschel folgendermaßen kennzeichnet:
"Ich habe auch gezeigt, dass meiner Meinung nach für den Aufbau dieser Kompetenzen ein selbstgesteuertes, autonomes Lernen nicht nur Zielperspektive, sondern Grundvoraussetzung ist. Genauso wie man Schreiben durch schreiben, Lesen durch lesen und Rechnen durch rechnen am besten lernt, so gehe ich davon aus, dass man Selbstständigkeit und Verantwortungsgefühl am besten durch selbstständiges und verantwortliches Handeln entwickelt. Ich traue den Kindern dabei eine Menge zu - so viel, dass manch Kritiker über so viel Naivität nur müde lächelt" (Peschel 2010, S. 898).
Dieses Vertrauen in die Kinder erlaubt Peschel, den Kindern in sehr hohem Maße die Organisation des Klassenlebens zu überlassen. Im Vergleich zu Stähling ist seine Konzeption weitaus radikaler. Seiner Ansicht nach entwickeln sich wechselseitige Achtung und Anerkennung sowie gemeinschaftsförderliche Praktiken, ohne dass der Pädagogen dies unmittelbar steuert.
Gemeinschaftsstärkung auch außerhalb der Schule
In seiner Evaluation beschreibt Peschel ausführlich den Verlauf der vier Jahre im Hinblick auf die Gestaltung des Gemeinschaftslebens in der Klasse (vgl. zu diesem Abschnitt Peschel 2010, Kapitel 12). Dabei fällt unter anderem auf, dass Aktivitäten, die nicht direkt mit dem Unterrichtsgeschehen in Verbindung zu bringen sind, einen großen Raum einnehmen. Neben den 'üblichen', den 'üblichen' Weihnachtsfeiern, Schulfesten und Exkursionen fallen vor allem die zahlreichen Schulübernachtungen auf. Dabei findet die erste Übernachtung in der Schule schon im ersten Schuljahr nach den Herbstferien statt. Darüber hinaus werden Spielenachmittage mit Kindern und Eltern organisiert, ein Musical wird eingeprobt und aufgeführt, die Klasse geht gemeinsam ins Theater und nimmt jedes Jahr am städtischen Waldlauf teil.
Diese Häufung von außerunterrichtlicher Aktivitäten verdeutlicht den Stellenwert, den bei Peschel der Förderung des Gemeinschaftslebens einnimmt. Den hohen Wert des Gruppenzusammenhalts reflektiert Peschel in seinem Tagbuch; z.B. berücksichtigt er explizit die Außenseiterproblematik: "Es scheint, als ob kein Kind eine Außenseiterposition innehat (auch nicht die auffälligen Kinder) oder sich in sich zurückzieht" (Peschel 2010, S. 559). Einige Einträge verdeutlichen, dass die "soziale Eingebundenheit in eine Gruppe" als ein Faktor gewertet wird, dessen "Fehlen eine ernsthafte Gefährdung der seelischen Gesundheit darstellen kann" (ebd., S. 892). Der emotionale Bereich hat für Peschel - auch im Hinblick auf einen damit zusammenhängenden Leistungseinbruch - einen hohen Stellenwert, was sich in der Praxis laut der Evaluation durch ein hohes Engagement im Bereich der außerunterrlichtlichen Aktivitäten zeigt. Peschel kann außerdem einige Sonderschulüberweisungen verhindern. Es ist ihm wichtig, Kindern ihr "normales schulisches Umfeld" zu erhalten (ebd., S. 449) und ihnen so eine Kontinuität der Gemeinschaft zu ernöglichen. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine deutliche Parallele zu Stähling; die konkrete Ausformung hängt dabei von dem jeweiligen Schulkontext ab.
Klare Regeln und Strukturen
Wie in 3.1 beschrieben wurde, gibt es im OU keine vorgegebenen Regeln und Strukturen. Lediglich die ersten Kreistreffen werden vom Lehrer anberaumt. Insofern verwundert es nicht, dass vor allem das erste Schuljahr chaotisch verläuft, wie Peschel in seinen Aufzeichnungen stichwortartig festhält:
"Teilweise zu hohe Anforderungen an die (sehr abstrakte) Eigenmotivation der Kinder (z.B. beim Schreibenlernen). [...] Gegenseitige Verantwortung für Lernen und Lernatmosphäre überfordert einige Kinder (noch egozentrisches, unreflektiertes Verhalten und Austesten der Grenzen). Gemeinsame Regelbildung/Regeleinhaltung ist oft uninteressant bzw. fällt noch schwer, dadurch zeitweise 'Chaos', fehlende Arbeitsruhe, wenig Verantwortung für das Aufräumen und sehr hohe Anforderungen an die Frustrationstoleranz der Beteiligten" (Peschel 2010, S. 559).
Diese Punkte treffen nach Peschels Einschätzung zu Beginn der ersten Klasse für ein knappes Viertel der Klasse zu. Es haben sich erst wenige den Unterrichtsalltag tragende Strukturen und Rituale herausgebildet. Deshalb steht der Lehrer vor der "ständigen Gretchenfrage" (ebd.), ob er doch mehr Struktur vorgeben solle. Peschel hält aber weiterhin an seiner Überzeugung der Selbstregulierung fest und kann beobachten, wie die Kinder beginnen, sich selbst eigene Regeln aufzuerlegen und Lösungen für auftauchende Probleme zu finden. "Beispielhaft kann hier die Ordnung in der Klasse genannt werden. Hier haben sich im Laufe der Zeit immer klarere Strukturen und auch Selbstverpflichtungen der Kinder sowohl zum Ordnunghalten als auch zum ordentlichen Arbeiten gebildet" (ebd., S. 571).
Peschel bestreitet die Wichtigkeit einer Struktur und einer "effizienten Klassenführung" für guten Unterricht nicht (vgl. Stähling); er vertritt allerdings - gemäß seiner Auffassung von Selbstregulierung - die Ansicht, dass die Strukturierung vom Lernenden aus gedacht sein muss und daher auch am besten vom Kind selbst gemacht wird, während der Aufbau eines vom Lehrenden strukturierten Unterrichts für viele Kinder nicht nachvollziehbar sei und deshalb aus ihrer Sicht auch nicht strukturiert:[56]
"Aus diesem Blickwinkel erscheint nun der lehrerzentrierte Unterricht als willkürlich und nicht auf die individuellen Bedürfnisse und Strukturen des Lernenden passend, während sich die "chaotische Unstrukturiertheit" des Offenen Unterrichts als das eigentlich struktur-, transparenz- und zielgebende Moment darstellt" (ebd., S. 893).[57]
Man kann deshalb nicht behaupten, Peschel lege keinen Wert auf strukturierende Elemente; allerdings steht auch hier die Selbstregulierung im Vordergrund, die besonders zu Beginn nach seinen eigenen Aufzeichnungen oft zu Lasten der Ruhe, der Ordnung und der Arbeitshaltung geht.[58] Hier ergibt sich womöglich kein grundsätzlicher Unterschied zu Stähling, wohl aber scheint die Akzentuierung verschieden zu sein. Andererseits begründet Peschel die positive Entwicklung in Bezug auf eigenverantwortliche Klassenführung gerade mit seinem Konzept der Selbstregulierung, das mit der "größtmöglichen kognitiven, emotionalen, sozialen Passung, die beim Lernprozess herrschen kann" einhergehe (ebd., S. 893).[59]
Die meisten Merkmale von Stählings 'Nährboden' finden in Peschels Konzept ähnliche Beachtung. Nach Peschels Ansicht sind die Ziele, die durch die Merkmale vorgegeben sind, teilweise nur durch konsequente Selbstregulierung im Unterricht erreichbar. Dies ist vor allem der Fall a) in Bezug auf die konsequente eigenständige Gestaltung des Klassenlebens durch die Kinder, b) in Bezug auf die durch Verzicht auf Anleitung und Vorbereitung von Unterricht gewonnene Zeit, die statt dessen für intensive Einzelbetreuung verwendet wird, c) in Bezug auf klare Regeln und Strukturen des Unterrichts, die durch Selbstregulierung umso nachhaltiger seien und d) auf die gegenseitge Unterstützung und 'Betreuung' der Kinder. Dieser letzte Punkt wird in dem oben angeführten Beispiel allerdings durch den Lehrer eingefordert, was die behauptete selbstregulative Verantwortungsübernahme relativiert. Außerdem muss man sich fragen, inwieweit eine Betreuung von Kindern durch Kinder auch problematische Implikationen im Hinblick auf die geforderte Achtung hat. Das Gleiche gilt für die gegenseitige Leistungsbewertung. Der sensible Sprachgebrauch scheint in Peschels OU keinen hohen Stellenwert einzunehmen. Diesbezüglich ist fragwürdig, inwieweit man Kinder Umgangsformen selbst aushandeln lassen kann, erst recht im Hinblick auf Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten. Auch Peschels eigenen oft schroffe Umgangsformen scheinen nicht außerhalb jeder Kritik zu stehen.
Insofern erfahren die Aspekte auf 'Achtung, Zugehörigkeit und Verlässlichkeit', wie Stähling sie versteht, bei Peschel durchaus Einschränkungen. Insgesamt zeigt sich ein hoher Stellenwert sozialer Praktiken und ethischer Grundhaltungen allerdings auch bei Peschel, was z.B. auch am verhältnismäßig hohen Engagement des Lehrers für gemeinschaftsfördernde Aktionen der Klasse ablesbar ist.
Bevor Chancen und Grenzen von Peschels Konzept für inklusiven Unterricht diskutiert werden, sind die methodischen Probleme zu erörtern, die sich für die vorliegende Arbeit gestellt haben.
Die hier geführte Diskussion findet auf der Basis einer problematischen Quelle statt: Die empirische Basis dieser Arbeit ist deswegen problematisch, weil es sich um Selbstdeutungen der eigenen Unterrichtspraxis handelt, die nicht immer wertungsfrei sind. Insofern gibt die Evaluation vor allem Peschels eigene Positionierung im Sinne einer idealisierten Beschreibung wieder, lässt aber nicht zwingend Rückschlüsse auf den OU an sich zu. Wenn theoretische Überlegungen und pädagogische Praxis so nah beieinander liegen wie bei Peschel, ist es häufig schwer zu sagen, wo jeweils eine generalisierbare Aussage des Theoretikers anfängt und wo eine subjektive Einschätzung des Praktikers aufhört. Hinzu kommt, dass Peschel sein Konzept nur an einer einzigen Klasse an einer Grundschule erprobt und evaluiert hat. Deshalb kann man es nicht ohne Weiteres generalisieren, wie es für eine fundierte Theoriebildung erforderliche wäre.
Insofern kann man über die Tauglichkeit von Peschels Konzept für inklusionspädagogische Settings an dieser Stelle keine endgültige valide Aussage treffen, was aber auch nicht Ziel der Arbeit ist und sein kann. Trotzdem kann man aufgrund der Darstellungen die eventuellen Vorteile abwägen, muss aber auch einen Blick auf die eventuellen Gefahren eines solchen Konzeptes (im inklusiven Kontext) werfen, was - dem Charakter einer Selbstevalutation gemäß - in Peschels Dissertation kaum unternommen wird.
Aus meiner Sicht liegt in Peschels Ansatz für die Inklusionspädagogik vor allem in zwei Punkten ein hohes Potenzial: Nach Peschels Darstellung kann sich der Lehrer im OU weitgehend je nach situativem Bedarf auf bestimmte Kinder einlassen, da ein Großteil der Klasse, so seine Erfahrungen, dazu in der Lage ist, sich schon sehr früh selbstständig Wissen anzueignen und Probleme in reflektierenden Gesprächen zu lösen. Dadurch gewinnt der Lehrer Zeit, sich intensiv mit einzelnen Kindern zu beschäftigen, selbst wenn er allein für die ganze Klasse zuständig ist. In diesem Zusammenhang besteht außerdem die Möglichkeit, dass Kinder gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen und sich gegenseitig kontrollieren. Das ist eine große Chance gerade für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Ob sich eine solche Praxis allerdings bei konsequenter Selbstregulierung automatisch entwickelt, ist fragwürdig und kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Die zweite große Chance besteht in der Entwicklung eines größeren Zugehörigkeitsgefühls gerade durch die konsequente Selbstbestimmung im OU. Wenn man Kinder mitbestimmen lässt, damit sie sich mit ihrer Umgebung identifizieren, dann kann eine weitgehende Verantwortungsübergabe für den Klassenalltag eine hochgradig identifikationsstiftende Wirkung haben. Ähnliches gilt für die 'Klassenführung', die bei Peschel durch die Kinder selbst erfolgt. Indem jedes Kind von Anfang an die Organisation seines Unterrichtsalltags selbst in die Hand nimmt, lernt es selbstständig und zusammen mit anderen klare Regeln und eine klare Struktur zu etablieren; Peschels Annahme in dieser Hinsicht verdient eine umsichtige Überprüfung und Beachtung. Insofern bietet der OU interessante Ansatzpunkte für die Inklusionspädagogik.
Es ergeben sich allerdings auch einige Probleme. Es wurde deutlich, dass Peschels Konzept bzw. seine Selbstevaluation nicht immer Stählings Vorstellung von inklusionsstiftenden sozialen Praktiken entspricht ('Leistungsbewertung' und 'sensibler Sprachgebrauch'). Insbesondere zwei Punkte sind im inklusionspädagogischen Kontext besonders problematisch. Erstens ist fraglich, ob Kinder sich automatisch auf das im Sinne einer gegenseitigen Anerkennung moralisch 'richtige' Verhalten aus reiner Selbstverpflichtung einigen können oder ob ausschließende und intolerante Verhaltensweisen sich nicht auch zwischen ihnen etablieren können. Einzelne Kinder könnten ohne eine regulierende pädagogische Autorität zudem schutzlos der Meinung der Mehrheit ausgeliefert sein. Dabei sei an das obige Beispiel einer sympathiegelenkten Leistungsbewertung erinnert. Besonders schüchterne oder ängstliche Kinder können sich angesichts der Aufgabe, ihre Interessen eigenständig vor der gesamten Klasse zu vertreten, überfordert fühlen. Es stellt sich die Frage, ob ein positiver Umgang mit Heterogenität nicht teilweise gerade mehr pädagogische Interventionen nötig macht als weniger. Diese Frage muss im Hinblick auf Peschels Konzept umso deutlicher herausgestellt werden, als das Konzept bislang nur in einer Regelklasse erprobt worden ist, in die zwar 'sonderschulbedrohte' Kinder gezielt überwiesen wurden und in Peschels Klasse die Grundschulzeit als Regelschüler beenden konnten; die Klasse wurde aber nicht z.B. von Kindern mit einer geistigen Behinderung besucht. Zweitens ist neben der angebrachten Skepsis in Bezug auf einen selbstregulativen sozialen Umgang als besonders problematischer Faktor auf das mit der Selbstregulierung einhergehende Chaos hinzuweisen, das einige Eltern besonders in der Anfangszeit zu starken Zweifeln am OU veranlasst hat. Vor allem stellt sich diesbezüglich die Frage, wie man z.B. autistischen Kindern in diesem Szenario gerecht werden kann.
Peschel geht mit dem Ideal der Selbstregulierung davon aus, dass sich innerhalb von nicht oder kaum regulierten sozialen Umgangsformen die gewünschten Werthaltungen und Wahrnehmungsmuster, die sozialen und individuellen Lerneffekte und sozialen Praktiken automatisch und durch Gewährung größtmöglicher Freiheit entwickeln. Lässt man Kinder ihre sozialen Angelegenheiten selber regeln, so werden sie Peschels optimistischer Anthropologie entsprechend weder aussondern noch diskriminieren, und das erklärte Ziel der Inklusionspädagogik realisiert sich sozusagen von selbst. Im Gegensatz zu einem solchen radikalen selbstregulativen Ansatz wird innerhalb von Stählings Unterrichtskonzept bei gleichbleibendem Ziel der Akzent mehr auf die Rolle des Lehrers und auf die Etablierung von pädagogischen Arrangements gelegt. Trotzdem verbindet beide sowohl die grundsätzliche Tendenz zu mehr Mitbestimmung[60] als auch das gemeinsame Ziel, nämlich eine praktikable Antwort auf die steigende Heterogenität (bzw. auf die zunehmende Wahrnehmung von Heterogenität) der Schülerschaft zu finden. Ob Selbstregulation und Basisdemokratie als Allheilmittel gerade bei gesteigertem Förderbedarf des Einzelnen dienen können, kann mit guten Gründen in Frage gestellt werden. Dabei stellt sich auf theoretischer Ebene wie auf der Ebene der praktischen Umsetzung die Frage, inwiefern die mit dem Ideal der Selbstregulation verbundene anthropologische Annahme nicht doch zu optimistisch bzw. einem romantischen Kindheitsmythos verhaftet ist.[61]
Darüber hinaus kann Peschels Unterrichtskonzept meines Erachtens nicht von seiner Person getrennt werden kann, ähnlich wie Summerhill nicht von der Person Neill getrennt und vielleicht nur mit dieser Persönlichkeit funktionieren konnte.[62] Dieses "Neillsyndrom", wonach pädagogische Projekte nur auf Grund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale des Einzelpädagogen möglich sind, sollte bei der Einschätzung von Peschels Schulversuch gerade im Hinblick auf eine Nachahmung nicht außer Acht gelassen werden.
Ein Mehr an Demokratie und Selbstregulation, so wie es Peschel vorschlägt, kann eine praktikable Alternative darstellen, um mit der Inklusionsproblematik umzugehen, wenn auch viele normative und empirische sowie auch methodische Fragen (besonders bei Peschel) offen bleiben. Um diese zu beantworten, bedarf es zusätzlicher empirischer Forschung.[63] Dass diese Forschung, welche sich insbesondere auf Einzelaspekte des OU beziehen könnte (z.B. auf die gegenseitige Betreuung durch die Schüler), lohnenswert ist, wird dadurch bestätigt, dass sich grundlegende Überlegungen für inklusiven Unterricht, die von Stähling als elementar erachtet werden, auch in Peschels Konzept wiederfinden.
[23] Viele der Fragen des Inklusionsindex' scheinen scheinen kaum geeignet als eine konkrete Anleitung zum Aufbau inklusiver Schulen, da die Formulierung an vielen Stellen vage bleibt.
[24] STäHLING ist einer der wenigen Pädagogen, die sich theoretisch und praktisch mit inklusiver (Grund-)Schule auseinandergesetzt haben. Deshalb hat er für die vorliegende Arbeit großes Gewicht.
[25] Beide Autoren sind Grundschullehrer und beziehen ihre Aussagen auf Grundschulklassen.
[26] Außerdem sieht STäHLING die Begleitung der Schüler im Umgang mit Differenz von Seiten der Lehrkräfte und eine multiprofessionelle Teamarbeit als weitere zentrale Punkte für das Gelingen einer inklusiven Schule an. Auf diese beiden Aspekte kann in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden.
[27] Dies wird umso deutlicher, als der dargestellte Anspruch keineswegs nur für inklusive Schulen gilt: Heute leugnet niemand mehr, dass ein gutes Klassenklima, also "Wohlbefinden und Zufriedenheit der Akteure" (HELMKE 2009, S. 221), eine Rolle für den Lernerfolg der Schüler spielt.
[28] Dieses Vorgehen hat insofern seine Berechtigung, als die Grundschule Berg Fidel bei ihrer Entwicklung zu einer inklusiven Schule mit dem Index arbeitet.
[29] Es würde den Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen, wenn jeder der im Folgenden aufgeführten Punkte mit Bezug auf die jeweils relevante wissenschaftliche Literatur problematisiert würde. Statt dessen konzentriert sich die Arbeit auf die Auseinandersetzung mit PESCHEL und STäHLING als Inklusionstheoretiker und erfolgreiche Inklusionspraktiker.
[30] So postuliert STäHLING für seine Schule: "Alle Kinder werden - unabhängig von deren Besonderheiten - wohnortnah in die Schule aufgenommen" (STäHLING 2009, S. 7). PESCHELS primäres Ziel ist zwar nicht, eine Integrationsklasse zu führen, sondern Kindern ein möglichst selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen. Prinzipiell verfolgt PESCHEL das Ziel, kein Kind aus sein Klasse auszuschließen und Heterogenität nicht als Problem, sondern als Normalzustand aufzufassen (s. 3.3). Er will für die Aussonderung bestimmter Kinder nicht die Verantwortung übernehmen (vgl. PESCHEL 2010, S. 565). Als der Versuch scheitert, einen Intergrationshelfer zu bekommen, verbleiben die Kinder mit diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf trotzdem in seiner Klasse (vgl. ebd., S. 375).
[31] Vgl. dazu im Inklusionsindex die Fragen A.2.4, 1): "Ist jede(r) SchülerIn bei einigen MitarbeiterInnen gut bekannt?"; B.2.3, 11): "Besteht das Bestreben, SchülerInnen aus dem gemeinsamen Unterricht nicht oder nur sehr selten für spezielle Förderung herauszubitten?".
[32] Trotz des Bestrebens, die Vorstellung von zwei Gruppen zu überwinden, verzichtet die Grundschule Berg Fidel noch nicht auf den Antrag zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs, wie es einige Hamburger Grundschulen bereits tun.
[33] Vgl. dazu im Inklusionsindex die Fragen A.1.4, 9): "Wissen die SchülerInnen, zu wem sie gehen können, wenn sie ein Problem haben?"; B2.6, 5): "Werden alle LehrerInnen und ErzieherInnen dafür fortgebildet, auf Probleme einzugehen, die SchülerInnen haben und machen?".
[34] So besteht HELMKE z.B. auf den "Abbau von Angst" in Schule und Unterricht (ders. 2009, S. 221).
[35] Anzumerken ist an dieser Stelle, dass 40% der Kinder an Stählings Schule von staatlicher Hilfeleitung leben und 60% der Kinder einen Migrationshintergrund haben (Stähling 2003, S. 200).
[36] Vgl. dazu im Inklusionsindex die Fragen A.1.2, 8): "Erkennen die SchülerInnen Leistungen derer an, die von einem anderen Punkt aus starten?"; A.2.1, 7): "Werden alle SchülerInnen darin bestärkt, die Leistungen anderer anzuerkennen und zu würdigen?".
[37] Der Begriff der Anerkennung wird im Folgenden mit dem der Achtung synoym verwendet.
[38] Um den Vergleich weiter zu verringern, setzt STäHLING außerdem auf die bewusste Vergrößerung der Differenz in der Gruppe durch Jahrgangsmischung. Indem so die Heterogenität wie auch deren Wahrnehmung im Bezug auf Leistungen erhöht wird, sind Leistungsunterschiede von vornherein als 'normal' eingeplant und es fällt leichter, auch die Leistungen derjenigen anzuerkennen, "die von einem anderen Punkt aus starten" (vgl. STäHLING 2009).
[39] Vgl. dazu im Inklusionsindex die Frage A.1.4, 1): "Sprechen die MitarbeiterInnen alle SchülerInnen respektvoll an?".
[40] Vgl. dazu im Inklusionsindex z.B. die Fragen A.1.1, 10): "Fühlen sich die SchülerInnen als EigentümerInnen ihrer Klassenräume?"; Vgl. dazu im Inklusionsindex die Fragen A.1.2, 11): Besprechen die SchülerInnen regelmäßig Fragen ihres Zusammenlebens, z.B. im Klassenrat?".
[41] Vgl. dazu auch BOBAN und HINZ, nach denen Schule so ausgerichtet sein soll, dass sie das "Lernen und die Partizipationsmöglichkeiten aller SchülerInnen" ständig intensiviert (dies. 2008, S. 152)
[42] Zur genaueren Beschreibung des Klassenrates bei STäHLING s. STäHLING (2005).
[43] Vgl. dazu im Inklusionsindex die Fragen A.2.2, 1): "Wird der Aufbau einer unterstützenden Schulgemeinschaft als genauso wichtig angesehen wie die Steigerung der kognitiven Leistungen?"; Indikator C.1.11: "Alle SchülerInnen beteiligen sich an Aktivitäten außerhalb der Klasse".
[44] STäHLING nennt als ein Beispiel sichtbares Zugehörigkeitsgefühl, "dass seit Jahren niemand mehr die Schulwände beschmiert" (ders. 2009, S. 92). Als Ergebnis eines Projektes wurden z.B. die Außenwände der Schule bunt bemalt. STäHLING ist der Überzeugung, dass sich die Kinder durch die Mitgestaltung mit ihrer Schule verbunden, also ihr zugehörig, fühlen, und sie deshalb so erhalten wollen, wie sie ist.
[45] Der Index spricht in diesem Kontext von "sich zuhause fühlen" (B1.5 Frage 6).
[46] Vgl. dazu im Inklusionsindex die Frage C.1.5, 2): "Gibt es feste Regeln für die SchülerInnen, nacheinander zu sprechen, einander zuzuhören und nach einer Erklärung zu fragen?".
[47] STäHLINGS Verständnis von Verlässlichkeit bezieht sich hauptsächlich auf die Stabilität, also die Kontinuität der sozialen Beziehungen (STäHLING 2009, S. 140f). Verlässlichkeit meint vor allem das Gleichbleiben des (sozialen) Kontextes. Innerhalb dieses Kontextes stellen stabile Beziehungen zu Mitarbeitern einen wichtigen Pfeiler für das Gefühl von Verlässlichkeit dar: "Kinder bei uns brauchen einen Ort, wo jemand Zeit für ihre Probleme hat" (ebd., S. 83). Die Entwicklung inklusionsförderlicher sozialer Praktiken bedürfen also in doppeltem Sinne der Zeit: einmal die Zeit des Lehrers im täglichen Unterrichtsgeschehen, sowie die längerfristigen Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern und zwischen Schülern.
[48] Auch hier stimmt STäHLING mit den üblichen Merkmalen wie der frühzeitigen Etablierung eines solchen Systems, der Erhöhung der Verbindlichkeit z.B. durch Unterschriften und durch die Mitbestimmung der Schüler, konsequente Verfolgung der Einhaltung usw. überein (vgl. HELMKE 2009, Kapitel 4.1.7).
[49] Zu Strukturierung des Schulalltags verweisen STäHLING und HELMKE auf die Entwicklung bestimmter Rituale, wie nonverbale Signale, die "das Verhalten steuern", eine morgendliche Begrüßung, gemeinsames Singen usw. (vgl. HELMKE 2009, S. 183).
[50] An dieser Stelle stellt sich einerseits die Frage, ob es womöglich erstrebenswert und effektiv ist, im Sinne der Selbstregulierung die Kinder sich selbst gegenseitig maßregeln und betreuen zu lassen (ein gelungenes Beispiel dazu findet sich bei PESCHEL 2010, S. 783); andererseits muss man das Konzept der Selbstregulierung hier kritisch hinterfragen, da manche Schüler offensichtlich nicht in der Lage sind, mit der ihnen zugestandenen Freiheit umzugehen. Außerdem ist es meines Erachtens äußerst bedenklich, Mitschüler als 'Aufpasser' einzusetzen, will man doch niemanden als 'Integrationskind' etikettieren. Womöglich ist die Tatsache, von anderen Kindern betreut zu werden, sehr viel erniedrigender als eine Einzelbehandlung durch einen Sonderpädagogen.
[51] Aus einem von Hans BRüGELMANN entwickelten Fragebogen geht hervor, dass die "Aufmerksamkeit der LehrerIn für die persönlichen Gedanken, Gefühle und Probleme der SchülerInnen" für PESCHEL eine große Bedeutung hat (ders. 2010, S. 501).
[52] In dem hier beschriebenen Fall gehen die Kinder allerdings nicht darauf ein; der Vortrag wird mit '4-' bewertet. Es werden von der Diplomandin aber auch andere Fälle beschrieben, in denen das Gegenteil der Fall ist und die Kinder auf die Meinung des Lehrers eingehen oder in denen der Lehrer sich vollkommen zurückhält.
[53] Die im oben genannten Beispiel vergebene '4-' kann durchaus beschämend sein und gerade bei solchen Schülern, die zunächst Probleme haben, zu einem negativen Selbstbild führen, sowie die Entwicklung von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, welches der OU eigentlich ermöglichen sollte, unterminieren.
[54] Zwar schreibt PESCHEL seiner Klasse insgesamt die Fähigkeit zu, zwischen beidem zu unterscheiden, er gibt aber auch die Bedenken einer Mutter hinsichtlich des Themas wieder: "Schrecklich fand er [ihr Sohn, M.S.] die Benotung durch die Kinder, denn er hatte oft das Gefühl, dass die Pänz 'Noten nach Nase' verteilt haben. Sein größter Feind war da wohl - nach seinen Aussagen Sabine" (PESCHEL 2010, S. 483)". Diese abschließende Rückmeldung der Mutter wirft neben der problematischen Bewertungspraxis eine weitere Frage auf: Wie kann es sein, dass in vier Jahren OU der Schüler nie seine Abneigung gegenüber der Benotung durch die Kinder kundgetan hat, wenn der OU doch zu einem großen Teil darauf beruht, offen und ehrlich alle Probleme zu besprechen und Lösungen zu finden? Das Beispiel zeigt, dass Probleme aus verschiedenen Gründen auch im OU teilweise unausgesprochen bleiben.
[55] Andererseits kann man auch bei einer Bewertung durch den Lehrer dieses Phänomen nicht ausschließen - im Gegenteil ist in diesem Fall eine einzige Person verantwortlich für die Leistungsbewertung, was eine Korrektur durch weitere Beobachter verhindert.
[56] Gewissermaßen unterscheidet sich PESCHELS Konzept von der oben erwähnten SCHOLASTIK-Studie durch den sehr unterschiedlichen Weg (vgl. dazu BRüGELMANN 2005, S. 43); das Ziel, dem Schüler einen verlässlich strukturierten Unterrichtsalltag zu ermöglichen, ist meines Erachtens das gleiche.
[57] Auf die Diplomandin, die die Klasse im vierten Schuljahr besucht, wirkt die Selbstregulierung der Kinder durchaus strukturierend: "Durch seine Konsequenz im Umgang mit Lernmethoden und durch sein Vertrauen in die Kinder gibt er ihnen Anhaltspunkte, an denen sich die Kinder orientieren können" (PESCHEL 2010, S. 519).
[58] Es sei darauf verwiesen, dass sich das Problem der Regelfindung in altersgemischten Klassen nicht in dieser Art stellt, da die älteren Kinder den jüngeren die Regeln und Rituale der Klasse automatisch vorleben.
[59] Es sei noch hinzugefügt, dass PESCHEL gemäß der "Selbstbestimmungstheorie der Motivation" nach DECI und RYAN (1993) davon ausgeht, dass "Zugehörigkeit, d.h. die Erfahrung, von anderen anerkannt zu werden" (BRüGELMANN 2005, S. 65) für Kinder ein unabdingbarer Faktor für erfolgreiches Lernen ist. 'Anerkennung' und 'Zugehörigkeit' spielen für PESCHEL also offenbar auch in Bezug auf die kognitive Entwicklung eine Rolle.
[60] Den zwei Tendenzen entsprechen zwei verschiedene demokratiepädagogische Ausrichtungen der Konzeptionen. Im Vergleich zu PESCHELS Ansatz des OU sind die Berechtigungen und Funktionen des Klassenrats bei STäHLING eingeschränkt. Während PESCHEL radikale Basisdemokratie als Ideal und Modell der sozialen Beziehungen in der Klasse nimmt, verfügt STäHLINGS demokratiepädagogischer Ansatz über ein Parlament mit begrenzter Entscheidungsgewalt.
[61] Nach BAADER lässt sich die spezifisch romantische Sicht auf das Kind, welche bis heute nachwirkt, in Bezug auf die damit verknüpften anthropologischen Annahmen wie folgt zusammenfassen: Der romantische Kindheitsmythos geht von einer Anthropologie aus, wonach das ganze Entwicklungspotenzial bereits im Kind angelegt ist, und akzentuiert die Bedeutung der Gewährung von Eigensinn und Selbsttätigkeit bei Kindern (BAADER 2004, S. 419). PESCHELS Menschen- bzw. Kinderbild entspricht offenbar diesem Mythos.
[62] Dieses Problem wird von der Diplomandin ausführlich diskutiert und von PESCHEL wiedergegeben (PESCHEL 2010, S. 519f).
[63] Die alte Frage nach mehr oder weniger Selbstbestimmung, welche mit der Diskussion von PESCHELS Ansatz aufgworfen worden ist, verweist auf eine grundlegende Spannung in der Pädagogik und wird sich auch im Inklusionskontext nicht vollständig beantworten lassen (vgl. dazu BRüGELMANN 2005, S. 24).
Nachdem die Idee der Inklusion (Kapitel 2) und das Konzept von Peschels Unterricht (Kapitel 3) hier vorgestellt und vor dem Hintergrund von Stählings 'Nährboden von Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit' aufeinander bezogen worden sind (Kapitel 4), sollen anhand der in dieser Diskussion gewonnenen Erkenntnisse drei Thesen zur Weiterentwicklung der inklusiven Pädagogik formuliert und erläutert werden:
-
Die Wahl der Methode spielt für die Inklusionspädagogik eine untergeordnete Rolle.
-
Die Erforschung der 'sozialen Praktiken' und 'ethischen Grundhaltungen' ist ein Desiderat an die Inklusionspädagogik.
-
In der zukünftigen Inklusionsforschung müssen Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt sein.
Zu 1.: Dieser Arbeit liegt die Hypothese zugrunde, dass der OU, der einzelne Erfolge bei der Integration vorweisen kann, ein besonders fruchtbares Konzept für die Inklusionspädagogik darstellen kann. Im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema verstärkte sich die Vermutung, dass die so genannten 'sozialen Praktiken' und 'ethischen Grundhaltungen' (vgl. Stählings 'Nährboden') innerhalb des konkreten pädagogischen Konzepts besondere Bedeutung haben. Die Entwicklung sozialer Praktiken und ethischer Grundhaltungen hängt nicht zwangsläufig von einer Methode oder einem Konzept ab; eine bestimmte Methode oder ein Unterrichtskonzept garantiert noch keine inklusive Schule. Statt dessen bedarf es vielmehr einer bestimmten Grundeinstellung:
"Es mangelt also nicht an einer didaktischen Konzeption für die Gestaltung inklusiver Bildungsprozesse, sondern an der Bereitschaft, sich als Lehrer/in tatsächlich für alle Kinder zuständig zu fühlen [...]. Wäre die grundlegende Bereitschaft, alle Kinder zu lehren - und sollte sie nicht eigentlich die Motivation zur Wahl des Lehrerberufs sein? - 'in den Köpfen' (vgl. Feuser) Lehrender, so könnte darauf aufbauend jede der vorgestellten Konzeptionen handlungsleitend für einen nicht aussondernden Unterricht sein" (Platte 2005, S. 193).
Es müssen also nicht zwingend neue Methoden zur Lösung der Inklusionsproblematik gefunden werden, sondern bereits bestehende Methoden 'inklusiv', das heißt im Sinne der Werte, die mit dem Inklusionsideal verbunden sind, angewendet werden. Studien in England haben gezeigt, dass in besonders erfolgreichen inklusiven Schulen keine spezielle Pädagogik praktiziert wird (Dyson 2010, S. 121). Der Erfolg dieser Schulen scheint vor allem an der Etablierung einer bestimmten "Schulkultur" zu liegen: "Unter 'Kultur' verstehen wir in diesem Kontext die Normen, Werte und anerkannten Vorgehensweisen einer Schule. [...] Diese kulturellen Merkmale schienen deutlich wichtiger zu sein als spezifische Organisationsformen" (Dyson 2010, S. 118). Ob man es nun als eine "inklusive Schulkultur" (vgl. im Inklusionsindex 'Dimension A'), als einen 'Nährboden', als Forderung nach der Befriedigung des "Grundbedürfnis[ses] aller Menschen, zu einer Gruppe zu gehören und in ihr Sinn und Anerkennung zu finden" (Boban/Hinz 2003, S. 164) oder wie in dieser Arbeit 'soziale Praktiken' und 'ethische Grundhaltungen' nennt: Nach der Beschäftigung mit der Problematik inklusiven Unterrichts scheint es, dass die Hauptforderung der Inklusionspädagogen nach einem positiven Umgang mit Heterogenität nur dadurch umgesetzt werden kann, dass ethische Grundhaltungen und Formen des sozialen Umgangs (vgl. 'Achtung, Zugehörigkeit und Verlässlichkeit') insbesondere auf Seiten der Lehrer intensiviert werden. Somit ist Heimlich Recht zu geben, wenn er feststellt: "Die Grenzen des Gemeinsamen Unterrichts liegen vor diesem Hintergrund offenbar sowohl in uns selbst und in unseren eigenen ethischen Grundhaltungen als auch in dem Gesellschaftsentwurf, den wir gemeinsam tragen" (Heimlich 2004, S. 292). Diese Überlegungen weisen der Lehrerpersönlichkeit eine größere Rolle bei der erfolgreichen Gestaltung eines inklusiven Unterrichts zu als den Methoden.
Zu 2.: Um den Fokus dieser Arbeit auf die wesentlichen Merkmale inklusiver Schulen zu richten, war es notwendig (s. Kapitel 4), Hauptbegriffe wie 'soziale Praktiken' und 'ethische Grundhaltung' oder eben die von Stähling benutzten Begriffe 'Achtung', 'Zugehörigkeit' und 'Verlässlichkeit' vorzustellen. Diese abstrakten Begriffe sind nur bedingt zu operationalisieren; sie verweisen aber auf Aufgaben, die für Inklusionspädagogik grundlegend sind. Wer über Inklusion als Ideal spricht, meint damit bestimmte als wünschenswert erachtete soziale Praktiken, ethische Grundhaltungen und Wahrnehmungsmuster auf Seiten der Kinder wie der Lehrer.[64]
Die Notwendigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen und Formen des sozialen Umgangs sowie ethische Grundhaltungen von Kindern und Lehrern im Umgang mit Heterogenität (insbesondere mit 'Behinderung') theoretisch adäquat zu beschreiben, um sie empirisch erforschbar zu machen, gehört daher zu den zentralen Desideraten einer Inklusionsforschung.[65] Letztlich sind es konkrete soziale Praktiken und Strukturen, die der Inklusionstheoretiker verändern will, wenn er eine 'Schule für alle' einfordert. Daran schließt sich unweigerlich die Frage an, wie und unter welchen Bedingungen solche Einstellungsmuster und Formen des sozialen Umgangs in der Schule umgesetzt werden können und wie die Umsetzung durch neue Konzepte in der Lehrerbildung vorangetrieben werden kann. Über welche Fähigkeiten und eventuell auch Persönlichkeitsmerkmale muss ein erfolgreicher Inklusionspädagoge verfügen? Welche Lehrerhandlungen verstärken die 'sozialen Praktiken' auf Seiten der Schüler oder welche können - im Sinne der Selbstregulierung - dabei stören? Wenn man davon ausgeht, dass die Alltagstheorien von Lehrern eine große Rolle für deren Umgang mit Heterogenität spielen (vgl. Veber 2010, S. 29), stellen sich außerdem auch diesbezüglich weitere Fragen für die Forschung und für die Umsetzung in der Lehrerausbildung: Welche Wahrnehmungsmuster von Heterogenität finden sich bei Lehramtsanwärtern und wie können diese bewusst gemacht und verändert werden? Die Gefahr besteht, dass nicht einmal der Lehrer eingefahrene Wahrnehmungsmuster und Alltagstheorien im Umgang mit 'behinderten' Menschen im Unterricht ablegen kann. Dabei sind Angst und Skepsis gegenüber Inklusion vielfach darauf zurückzuführen, dass die Lehrer keine praktischen Erfahrungen mit erfolgreich arbeitenden Inklusionsklassen gemacht haben und sich nicht einmal vorstellen können, dass Inklusion funktionieren könnte. Diese Ignoranz lässt sich durch praktische Erfahrung überwinden.
Letztlich liegt es neben den institutionellen Voraussetzungen primär an den Lehrern mit ihrer ethischen Grundhaltung und mit ihrer Fähigkeit, bestimmte Formen des sozialen Umgangs zu fördern, damit eine Schule sich in Richtung Inklusion verändert.
Zu 3.: Die Auswahl der beiden Autoren, deren Theorie und Praxis in dieser Arbeit vorgestellt worden sind, ist von der Vermutung geleitet, dass eine weitgehende Selbstregulierung, wie von Peschel in seinem Konzept des OU favorisiert wird, eine mögliche alternative Lösung für die Probleme darstellen könnte, welche die Inklusionspädagogik beschäftigen. Gerade der Vergleich zweier erfolgreicher theoretisierender Praktiker scheint sinnvoll, da nicht nur theoretische 'Luftkämpfe' rekonstruiert werden sollten, sondern die Inklusionsproblematik im Kontext konkreter praktischer Erfahrungen aus dem Schulalltag erörtert werden sollte. Es ist deshalb sinnvoll, Modellschulen wie die Peschels oder die Stählings kennen zu lernen, um zu prüfen, was konkret mit inklusiven Schulstrukturen und inklusiven sozialen Praktiken im Schulalltag gemeint ist. Insbesondere theoretisierende Praktiker wie Peschel und Stähling sind daher für die Forschung interessant, da man an ihren Schulen direkt die Schwierigkeiten der Anwendung der theoretischen Konzepte untersuchen und daraus Schlüsse sowohl für die Theoriebildung wie für die Praxis ziehen kann.
Oft wird Praxis als defizitär bewertet, weil sie der Fundamentierung durch Theorie bedarf. Im Gegensatz zu einer solchen Vorstellung haben die verdichteten Erfahrungen von erfolgreichen theoretisierenden Praktikern wie zum Beispiel Peschel wegweisende Funktion, da sie für die Entwicklung von Inklusionspädagogik einen wichtigen Beitrag leisten.
[64] Außerdem kann man vermuten, dass die Forderungen im Allgemeinen nicht neu sind, sondern sie erweitern, vertiefen und radikalisieren zumindest teilweise Forderungen, die generell an die Formen des sozialen Umgangs in Schulen gestellt werden. Die Vorstellungen darüber, wie mit Heterogenität umgegangen werden soll, sind also Weiterentwicklungen von bereits bestehenden normativen Forderungen an das 'Lernklima' von Schule, wie sie Z.B. bei HELMKE zu finden sind (ders. 2009, S. 220f)
[65] So ist es durchaus naheliegend, dass Kinder, die mit 'behinderten' Menschen in freiem Umgang aufwachsen, auch automatisch 'behinderte' Menschen anerkennen, ohne sie zu etikettieren oder zu diskriminieren. Dies muss jedoch offen formuliert werden, damit es der empirischen Analyse zugänglich gemacht werden kann.
Aichele, Valentin (2010): Das Recht auf inklusive Bildung gemäß Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention: Inhalt und Wirkung. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg. S. 11-25.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010): Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel. Im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. http://www.destatis.de (Stand: 10.8.2010).
Baader, Meike Sophia (2004): Der romantische Kindheitsmythos und seine Kontinuitäten in der Pädagogik und in der Kindheitsforschung. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Heft 3. Wiesbaden. S. 416-430.
Bastian, Johannes/Merziger, Petra (2007): Selbstreguliert lernen. Konzept - Befunde - Erfahrungen. In: Pädagogik, Heft 8. Weinheim. S. 6-11.
Bews, Susanna (1992): Integrativer Unterricht in der Praxis. Erfahrungen, Probleme, Analysen. Innsbruck.
Booth, Tony/Ainscow, Mel (2000): The Index for Inclusion; Developing Learning and participation in Schools. Bristol. http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf (Stand: 10.10.2010).
Boban, Ines/Hinz, Andreas (Hrsg. und Übersetzer) (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Entwickelt von Booth,Tony und Ainscow, Mel. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Boban, Ines/Hinz, Andreas (2003): Gute Schulen und der Index für Inklusion. In: Schnell, Irmtraud/Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn. S. 151-166.
Bohl, Thorsten (2006): Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht. Weinheim.
Brügelmann, Hans (2005): Schule verstehen und gestalten. Regensburg.
Bundschuh, Konrad (1997): Integration als immer noch ungelöstes Problem bei Kindern mit speziellem Förderbedarf. Zeitschrift für Heilpädagogik. Würzburg. S. 310-315.
Bürli, Alois (1997): Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik - Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf dem europäischen Raum. Fernuniversität - Gesamthochschule Hagen.
Deci, Edward/Ryan, Richard M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 2. Weinheim. S. 223-238.
Deutscher Bildungsrat (1973): Emfpehlungen der Bildungskommission: Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Stuttgart.
Dyson, Alan (2010): Die Entwicklung inklusiver Schulen: Drei Perspektiven aus England. In: Die Deutsche Schule, Heft 2. Siegen. S. 115-129.
Eberwein, Hans/Knauer, Sabine (Hrsg.) (2002): Handbuch Integrationspädagogik. 6. vollst. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Weinheim.
Eberwein, Hans/Knauer, Sabine (2002): Integrationspädagogik als Ansatz zur Überwindung pädagogischer Kategorisierungen. In: dies. (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik. 6. vollst. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Weinheim. S. 17-35.
Feuser, Georg (1995): Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt.
Feuser, Georg (2002): Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In: Eberwein, Hans/Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik. 6. vollst. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Weinheim. S. 280-294.
Fürstenau, Sara (2009): Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. In: Fürstenau, Sara/Gomolla, Mechthild (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Unterricht. Wiesbaden. S. 61-84.
Geiling, Ute/Hinz, Andreas (Hrsg.) (2005): Integrationspädagogik im Diskurs. Auf dem Weg zu einer inklusiven Pädagogik? Bad Heilbrunn.
Gomolla, Mechthild (2005): Schulerfolg in der Einwanderungsgesellschaft. Lokale Strategien - internationale Erfahrungen. iks - QuerFormat, Heft 9. Hrsg. von Marianne Krüger-Potratz. Münster.
Gomolla, Mechthild (2009): Heterogenität, Unterrichtsqualität und Inklusion. In: Fürstenau, Sara/Gomolla, Mechthild (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Unterricht. Wiesbaden. S. 21-45.
Graumann, Olga (2002): Gemeinsamer Unterricht in heterogenen Gruppen. Von lernbehindert bis hochbegabt. Bad Heilbrunn.
Gröschke, Dieter (1998): Integration oder Apartheid? Steckt die Geistigbehindertenhilfe in einer Normalisierungsfalle? Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 4.Würzburg. S. 365-373.
Heimlich, Ulrich (2004): Didaktische Konzepte für den zieldifferenten Gemeinsamen Unterricht. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 6. Würzburg. S. 288-295.
Helmke, Andreas/Weinert, Franz E. (1997): Unterrichtsqualität und Leistungsentwicklung: Ergebnisse aus dem SCHOLASTIK-Projekt. In: dies. (Hrsg.): Entwicklung im Grundschulalter. Weinheim. S. 241-251.
Helmke, Andreas (2009): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Seelze-Velber.
Heyer, Peter (2010): Die Grundschule auf ihrem langen Weg zu "Einer Schule für alle". In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg. S. 123-129.
Hinz, Andreas (1992): Kinder mit schwersten Behinderungen. Herausforderung und Aufgabe für integrative Pädagogik. In: Hinz, Andreas (Hrsg.): Schwerstbehinderte Kinder in Integrationsklassen. Bericht über eine Fachtagung. Marburg. S. 11-32.
Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? In: Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 9. Würzburg. S. 354-361.
Hinz, Andreas (2004): Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In: Schnell, Irmtraud/ Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn. S. 41-74.
Hinz, Andreas (2010): Schlüsselelemente einer inklusiven Pädagogik und einer Schule für alle. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg.
Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.) (2010): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg.
Hofsäss, Thomas (2001): Buchbesprechung von Hans, Maren/Ginnhold, Antje (Hrsg.): Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa. Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 9. Würzburg. S. 386f.
Jantzen, Wolfgang (1981): Schafft die Sonderschule ab! In: Demokratische Erziehung, Heft 2. Köln. S. 96-103.
Jantzen, Wolfgang (2008): Eine Schule für alle - nicht ohne umfassende Integration behinderter Kinder! Pädagogische, psychologische und sozialwissenschaftiche Aspekte. In: Ziemen, Kerstin (Hrsg.): Reflexive Didaktik. Annäherungen an eine Schule für alle. Oberhausen. S. 15-34.
Kahl, Reinhard (2003): Überfordert, allein gelassen, ausgebrannt. Deutsche Lehrer - eine Polemik. GEO-Wissen, Heft 31. Hamburg. S. 52-61.
Klauß, Theo (2010): Auf dem Weg zur Schule für alle. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg. S. 45-52.
Klippert, Heinz (2010): Heterogene Gruppen unterrichten. Strategien zur systematischen Lernförderung. In: Pädagogik, Heft 5. Weinheim. S. 38-42.
KMK (1972): Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens. Bonn.
KMK (1994): Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in der Bundesrepublik Deutschland. http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1994/1994_05_06-Empfehl-Sonderpaedagogische-Foerderung.pdf (Stand: 29.9.2010).
Löhrmann, Sylvia (2010): Interview mit Schulministerin Sylvia Löhrmann zur zukünftigen Schulpolitik in NRW. Nds - Die Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft, Heft 9. Essen. S. 16-17.
Löhrmann, Sylvia (2010b): Auf dem Weg zur schulischen Inklusion - Eine Kultur des Behaltens entwickeln und leben! Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann auf der Fachtagung des Landschaftsverbands Rheinland "Auf dem Weg zur schulischen Inklusion" vom 22.9.2010. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/_Rubriken/Initiativen/Inklusion.pdf (Stand: 9.10.2010).
Lübbert, Anke (2010): Schüler kämpfen gegen geteilte Schulen. In: 'Die Tageszeitung' vom 11.8.2010.
Muñoz, Vernor (2007): Bericht des Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, über seinen Besuch in Deutschland (13. - 21. Februar 2006) (deutsche Übersetzung). http://www.gew.de/Binaries/Binary29288/Arbeits%FCbersetzung_M%E4rz07.pdf (Stand: 11.10.2010)
Muñoz, Vernor (2009): Vortrag von Vernor Muñoz zum Recht auf Bildung im Juni 2009 in Oldenburg (deutsche Übersetzung). http://www.munoz.uri-text.de/VernorMunoz7teJuni09_OL_deutscheUebersetzung.pdf (Stand: 10.10.2010).
Muth, Jakob (1986): Integration von Behinderten. Über die Gemeinsamkeit im Bildungswesen. Essen.
Niehoff, Ulrich (2010): Diversity-Management - eine hilfreiche Anregung auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. In: Hinz, Andreas/Körner, Ingrid/Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Marburg. S. 26-44.
Oelkers, Jürgen (1996): Reformpädagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. Weinheim.
Opp, Günther (1998): Gefühls- und Verhaltensstörungen. Begriffliche Problemstellungen und Lösungsversuche. Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 11. Würzburg. S. 490-496.
Peterßen, Wilhelm (2009): Kleines Methoden-Lexikon. Dritte Auflage. München.
Peschel, Falko (2004): Effektives Lernen - Lernpsychologie, pädagogische Psychologie und Selbstregulierung. In: Fragen und Versuche, Heft 110. Bremen. S. 8-12.
Peschel, Falko (2008): Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen zulassen - ein konsequentes Modell der Öffnung von Unterricht. In: Rohlfs, Carsten/Harring, Marius/Palentien, Christian (Hrsg.): Kompetenz-Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Wiesbaden. S. 225-238.
Peschel, Falko (2009): Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Diskussion. 5. Auflage. Baltmannsweiler.
Peschel, Falko (2010): Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation. 3. Auflage. Baltmannsweiler.
Platte, Andrea (2005): Schulische Lebens- und Lernwelten gestalten. Didaktische Fundierung inklusiver Bildungsprozesse. Münster.
Platte, Andrea (2008): Inklusive Bildungsprozesse: Teilhaben am Lernen und Lehren in einer Schule für alle. In: Rihm, Andreas (Hrsg.): Teilhaben an Schule. Zu den Chancen wirksamer Einflussnahme auf Schulentwicklung. Wiesbaden. S. 39-52.
Prengel, Annedore (2006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Schule und Gesellschaft. 3. Auflage. Wiesbaden.
Reichenbach, Roland (2004): Aktiv, offen und ganzheitlich. Überredungsbegriffe - treue Partner des pädagogischen Besserwissens. http://parapluie.de/archiv/worte/paedagogik/ (Stand: 8.10.2010).
Reiser, Helmut (2003): Vom Begriff Intrgration zum Begriff Inklusion. In: Sonderpädagogische Förderung. Weinheim. S. 305-312.
Ruf, Urs/Gallin, Peter (1998): Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 2: Spuren legen - Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und Reisetagebüchern. Seelze-Velber.
Sander, Alfred (2004): Inklusive Pädagogik verwirklichen - zur Begründung des Themas. In: Schnell, Irmtraud/Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn. S. 11-22.
Sander, Alfred (2004): Konzepte einer Inklusiven Pädagogik. Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 5. Würzburg. S. 240-244.
Schnell, Irmtraud/Sander, Alfred (Hrsg.) (2004): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn.
Schöler, Jutta (2009): Alle sind verschieden. Auf dem Weg zur Inklusion in der Schule. Weinheim.
Seitz, Simone (2005): Zeit für inklusiven Sachunterricht. Basiswissen Grundschule, Band 18. Hohengehren.
Sommer, Barbara (2009): Presseinformation der Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28.10.2010. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Presse/Meldungen/Archiv/PM_2009/pm_28_10_2009_2_pdf.pdf (Stand: 9.10.2010).
Stähling, Reinhard (2003): Der Klassenrat - eine Fortführung reformpädagogischer Praxis. In: Burk, Karlheinz/Speck-Hamdan, Angelika/Wedekind, Hartmut (Hrsg.): Kinder beteiligen - Demokratie lernen? Frankfurt am Main. S. 197-207.
Stähling, Reinhard (2005): Klassenrat - sieben Schritte gegen Gewalt. In: Humane Schule, Heft 31. Niederkassel. S. 10-11.
Stähling, Reinhard (2009): "Du gehörst zu uns". Inklusive Grundschule. 2. Auflage. Baltmannsweiler.
Stähling, Reinhard (2009b): Inklusive Bildung - Jetzt! Ein Inklusions-Manifest. http://www.ggs-bergfidel.de/ (Stand: 29.9.2010)
Terhart, Ewald (2009): Didaktik. Eine Einführung. Stuttgart.
UNESCO (1994): The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Erklärung der UNESCO- Konferenz vom 7.-10.6.1994 in Salamanca. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF (Stand: 8.8.2010).
Veber, Marcel (2010): Ein Blick zurück nach vorn in der Lehrerbildung. Eine empirische Studie zu Alltagstheorien über Behinderung, Integration-Inklusion und Sonderschule. Münster.
Vereinte Nationen (2006): Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Vom Deutschen Bundestag als Gesetz beschlossen, im Bundesgesetzblatt verkündet 2009. http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf (Stand: 10.10.2010).
Völkel, Andreas (1997): Zur Existenz von Sonderschulen. Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 11. Würzburg. S. 442-446.
Werning, Rolf/Löser, Jessica (2010): Inklusion: aktuelle Diskussionslinien, Widersprüche und Perspektiven. Die Deutsche Schule, Heft 2. Siegen. S. 103 -114.
Wocken, Hans (2009): Von der Integration zur Inklusion. Ein Spickzettel für Inklusion. Gemeinsam leben, Heft 4. Weinheim. S. 216-219.
Wocken, Hans (2010): Über Widersacher der Inklusion und ihre Gegenreden. Ein Essay. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 23. Bonn. S. 25-31.
Zehnpfennig, Hannelore/Zehnpfennig, Helmut (1992): Was ist "Offener Unterricht"? In: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Schulanfang. Ganzheitliche Förderung im Anfangsunterricht und im Schulkindergarten. Soest. S. 46-60.
Quelle:
Mareike Stellbrink: Inklusion und Offener Unterricht. Münster 2010
bidok-Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet.
Stand: 26.09.2011
