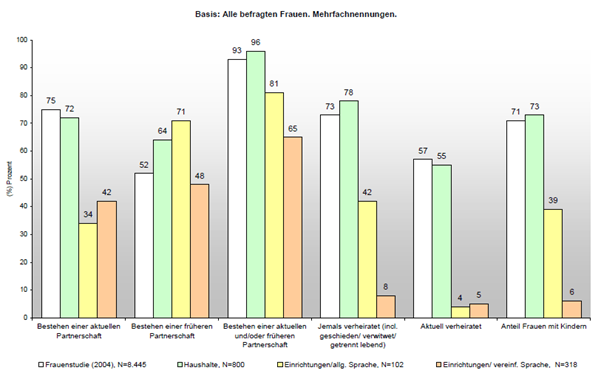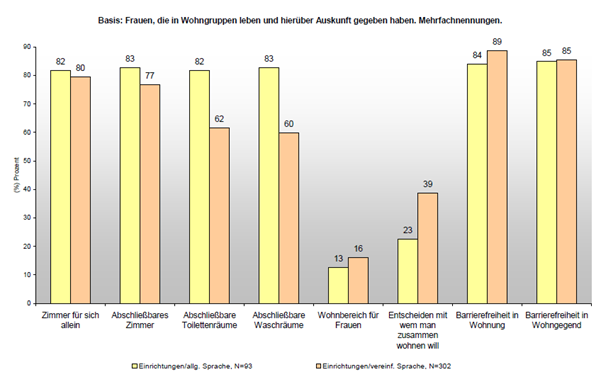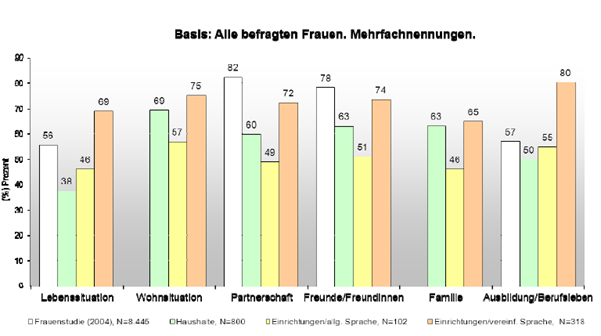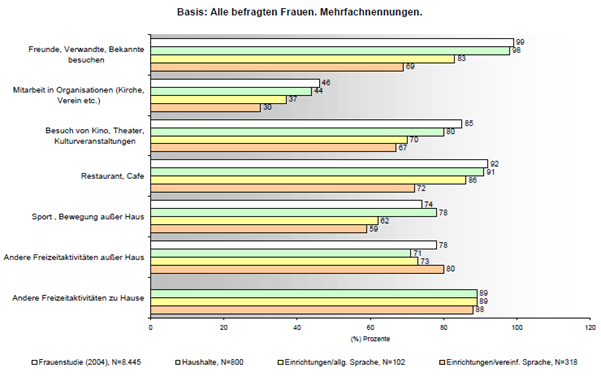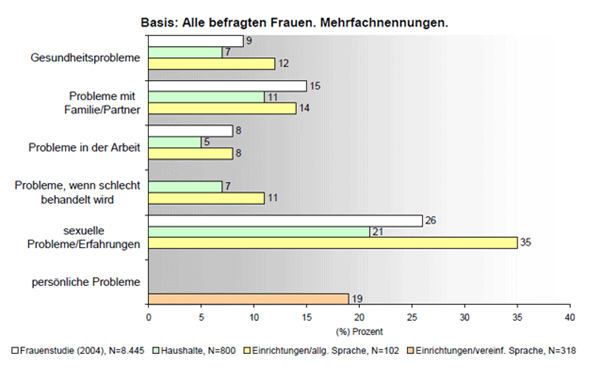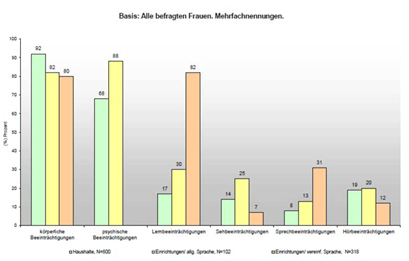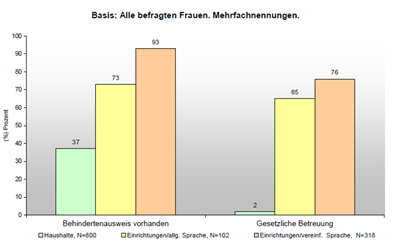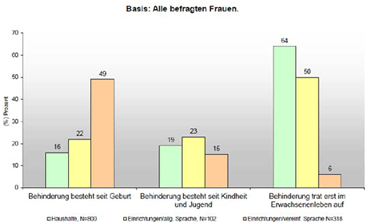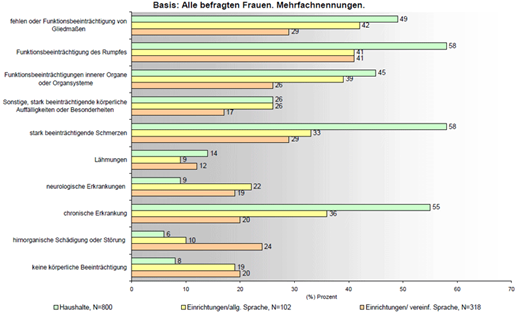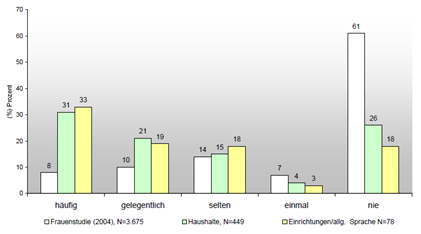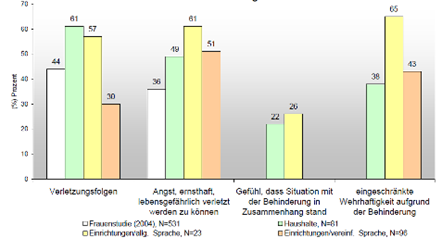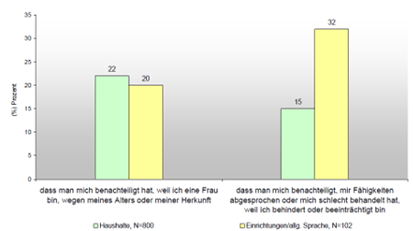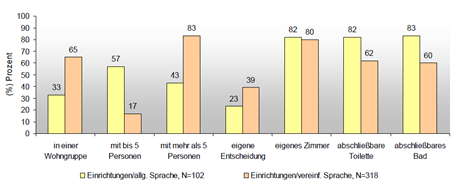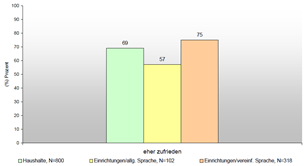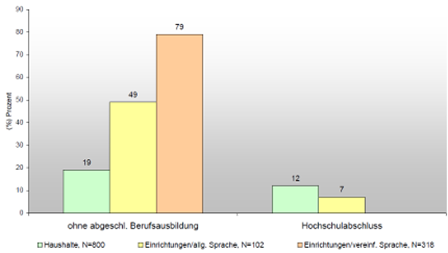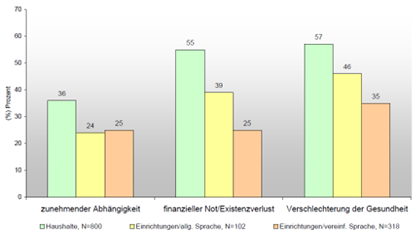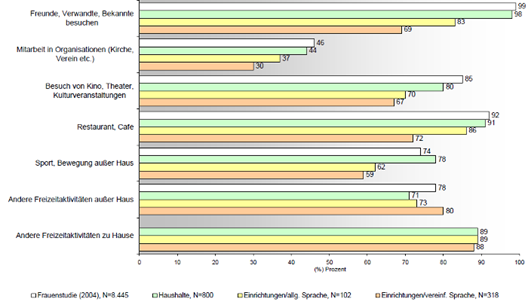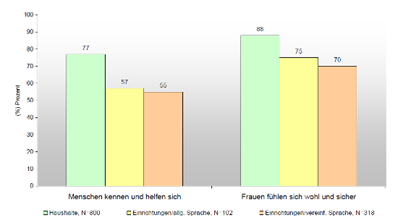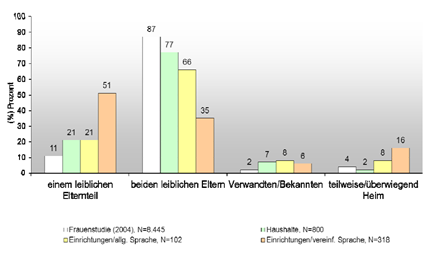Ergebnisse der quantitativen Befragung. Endbericht
Die Studie wurde vom Deutschen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben; ausgeführt wurde sie vom Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) und der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem SOKO Institut GmbH Sozialforschung und Kommunikation, Bielefeld, mit der Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung e. V. (GSF), Frankfurt, mit dem Sozialwissenschaftlichen FrauenForschungsInstitut Freiburg (SoFFI F.) und dem Institut für Soziales Recht der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Fachhochschule Köln. Die Studie gibt es auch in der Fassung Leichte Sprache: https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/7/9/3/CH1555/CMS1476282230348/leichte-sprache-lebenssituation-und-belastungen.pdf
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einführung
- 2. Methodik
-
3. Ergebnisse der repräsentativen Haushalts- und Einrichtungsbefragung
-
3.1 Lebenssituation und soziostrukturelle Merkmale der befragten Frauen
- 3.1.1 Altersstruktur der Befragten im Überblick
- 3.1.2 Partnerschaft, Kinder und Familienstand
- 3.1.3 Lebens- und Wohnsituation der in den Einrichtungen lebenden Frauen
- 3.1.4 Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse
- 3.1.5 Erwerbsarbeit, berufliche Einbindung und ökonomische Ressourcen
- 3.1.6 Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensaspekten
- 3.1.7 Kindheit und Aufwachsen
- 3.1.8 Beziehungen, soziale Integration und Freizeit
- 3.1.9 Sicherheitsgefühl und Ängste
-
3.2 Beeinträchtigungen, Unterstützung und gesundheitliche Versorgung
- 3.2.1 Art der Beeinträchtigung/Behinderung, Behindertenausweis, Eintritt und Ursachen der Behinderung
- 3.2.2 Körper-, Sinnes- und Sprechbeeinträchtigungen
- 3.2.3 Psychische Erkrankung und Lernbeeinträchtigungen
- 3.2.4 Grade der Einschränkung und Unterstützung im alltäglichen Leben
- 3.2.5 Gesundheitliche Versorgung
- 3.2.6 Fazit
- 3.3 Gewalterfahrungen in Kindheit und Erwachsenenleben
- 3.4 Inanspruchnahme institutioneller Hilfe und Intervention
- 3.5 Diskriminierung und strukturelle Gewalt
- 3.6 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der repräsentativen Studie
-
3.1 Lebenssituation und soziostrukturelle Merkmale der befragten Frauen
- 4. Ergebnisse der Zusatzbefragungen
- Literatur
- Anhang
- Impressum
Abbildungsverzeichnis
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer fast dreijährigen Forschungsarbeit präsentiert, zu deren Beginn noch nicht sicher war, ob die geplanten Methoden tatsächlich funktionieren und zu dem Ergebnis führen würden, das das Forschungsteam anvisierte: eine repräsentative Studie zur Lebenssituation, zu Belastungen, Diskriminierungen und Gewalt gegenüber Frauen mit Behinderungen durchzuführen und das bestehende Dunkelfeld bestmöglich aufzudecken. Erstmals sollten in einer solchen Studie nicht nur Teilgruppen der von Behinderungen Betroffenen erreicht werden – zum Beispiel solche, die einen Behindertenausweis haben und/oder über die Versorgungsämter erreichbar sind –, sondern ein breites Spektrum von Frauen, die sowohl in Haushalten als auch in Einrichtungen leben, Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen, Beeinträchtigungen und Lebensbedingungen, sowohl mit als auch ohne Behindertenausweis. Außerdem sollte eine repräsentative Auswahl der Frauen erfolgen, was zum einen über eine bundesweite Streuung der Befragung und zum anderen über eine konsequente Zufallsauswahl von Befragungsorten, Adressen und Zielpersonen realisiert werden sollte.
In einer fast einjährigen Voruntersuchung wurden der Weg getestet und die Konzeption entwickelt. Es wurden Erhebungsinstrumente und Befragungsmethoden entwickelt, die geeignet sind, in diesem sensiblen Themenbereich das Vertrauen der Frauen zu gewinnen und mit spezifisch geschulten Interviewerinnen möglichst authentische Antworten zu erhalten, aber auch die jeweiligen Grenzen der Befragten zu beachten und eine positive und respektvolle Interviewatmosphäre herzustellen.
Erst nach dem Ende der Befragungsphase zwei Jahre nach Beginn des Projektes wurde klar, dass das ehrgeizige Ziel der Studie, über 1.500 Frauen in Einrichtungen und in Haushalten repräsentativ zu befragen, am Ende gelungen ist. Mehr noch: Es konnten erstmals Frauen erreicht und vergleichend befragt werden, die in strukturierten quantitativen, aber auch in qualitativen Studien zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zumeist nicht befragt werden. So gelang es dem Forschungsteam, über 400 Frauen mit Behinderungen in Wohnheimen zu befragen und dabei mit einer sensiblen Befragungsmethode auch Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in die strukturierte Befragung einzubeziehen. Im Rahmen von Zusatzbefragungen konnten darüber hinaus neben blinden und schwerstkörperbehinderten Frauen auch gehörlose Frauen in Deutscher Gebärdensprache durch ein Team von durchgängig gehörlosen Interviewerinnen befragt werden, das durch versierte gehörlose Wissenschaftlerinnen koordiniert und geschult wurde. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Einrichtungsbefragung auch Frauen mit psychischen Erkrankungen erreicht und konnten trotz ihrer oftmals hohen Belastungen eingehend befragt werden.
Diese Studie wäre ohne den Einsatz und die Kooperation vieler engagierter Frauen (und einiger engagierter Männer) nicht in dieser Form und mit diesen Ergebnissen zustande gekommen. Sie wurde von zahlreichen Lobbyorganisationen der Frauen/Männer mit Behinderungen initiiert und unterstützt. Zahlreiche Expertinnen aus Wissenschaft, sozialer Praxis und Politik wirkten an der Vorbereitung, Konzipierung und Durchführung der Studie mit ihrer Expertise und unterstützenden Beratung mit. Sie begleiteten das Projekt in mehreren Workshops, durch Expertinneninterviews und in Arbeitsgesprächen in allen Phasen des Forschungsprozesses.
Ein ganz besonderer Dank gilt den Frauen von Weibernetz e. V., dem Hessischen Netzwerk behinderter Frauen – fab e. V., dem Verein ForUM e. V., dem Netzwerk Mensch zuerst – People First e. V., dem Deutschen Gehörlosen-Bund e. V., dem Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V. und dem Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW, insbesondere Brigitte Faber, Martina Puschke, Rita Schroll, Bärbel Mickler, Ricarda Kluge, Sabine Fries, Bettina Herrmann, Monika Pelkmann und Dr. Sigrid Arnade, ohne deren Rat und Unterstützung die Studie nicht hätte fachkundig umgesetzt werden können. Wir danken außerdem herzlichst Dr. Birgit Buchinger, Prof. Dr. Theresia Degener, Katja Grieger, Heike Herold, Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Dr. Marianne Hirschberg, Dr. Helga Kühnel, Dr. Anke Langner, Dr. Astrid Libuda-Köster, Teresa Lugstein, Eleonora Muradova, Victoria Nawrath, Cornelia Neumann, Dr. Mathilde Niehaus, Cornelia von Pappenheim, Gabriele Pöhacker, Viktoria Przytulla, Gertrud Puhe, Prof. Dr. Christian Rathmann, Patricia Schneider, Dr. Rosa Schneider, Petra Stahr, Heike Wilms und Dr. Aiha Zemp, die uns wissenschaftlich und fachlich beraten haben.
Eine große Bereicherung war auch, dass die Studie von den sachkundigen und hoch engagierten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und der Leitung des Referats 413 im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betreut wurde. Gerade auch in schwierigen Phasen der Forschung unterstützten sie notwendige Konzeptveränderungen und ermöglichten engagiert die weitere Durchführung des Projektes mit viel Geduld und Sachverstand. Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Angelika Diggins-Rösner, Frau Dr. Doris Keim, Frau Tanja Leeser und Frau Ursula Seidel-Banks, die durch ihre Fachexpertise und ihre Diskussionsbereitschaft maßgeblich zur erfolgreichen Realisierung der vorliegenden Studie beigetragen haben.
Ein großer Dank gilt den über 100 Interviewerinnen, die alle von unserem Forschungsteam ausgewählt und geschult wurden und die monatelang mit außerordentlichem Engagement und großem Interesse für diese Studie tätig waren. Sie haben es – durch Wind und Wetter und mit hohem persönlichen Einsatz – geschafft, im Rahmen der Haushaltsbefragung die Türen für unsere Studie in Tausenden von Haushalten zu öffnen (was oft sehr mühsam war) und viele Interviewpartnerinnen zu gewinnen, die sie gleichermaßen feinfühlig wie respektvoll und interessiert zu befragen vermochten. Die eigentliche Qualität der Studie liegt in der versierten und engagierten Arbeit und im Zuhörenkönnen der eingesetzten Interviewerinnen. Sie wurde auch gefördert durch ein Forschungsteam, das im Einsatz, in der gemeinsam zusammengetragenen Expertise und in der Kooperationsfähigkeit seinesgleichen sucht. Die Zusammenarbeit der Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner der Universität Bielefeld, von SOKO e. V., der GSF e. V., von SoFFI K. und der Fachhochschule Köln war trotz der vielen Überstunden, die permanent für das Projekt geleistet werden mussten, eine große Bereicherung und Freude und gerade bei der Lösung schwieriger Aufgaben und Probleme von einer lustvollen Kreativität geprägt. Ein besonderer Dank gilt außerdem den Praktikantinnen und Praktikanten des Forschungsprojekts, Kathrin Vogt, Nadine Vinke, Nadja Weirich, Katharina Plehn, Armin Harry Wolf, Olga Elli und Daniel Mecke, die mit ihrem außerordentlichen und kompetenten Engagement erheblich zum Gelingen der Studie beigetragen haben. Darüber hinaus danken wir Ramona Böttcher, Elke Knicker, Siri Schultze und Marina Mayer, die ihre Erfahrungen als Interviewerinnen in der Vorstudie und zum Teil auch in den Schulungen der Hauptstudien- Interviewerinnen kompetent und mit hohem Engagement eingebracht haben.
Danken möchten wir auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen, die für uns Kontakte zu den Frauen in den Wohnheimen hergestellt haben, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Versorgungsämter und ihrer landesweiten Koordinationen, außerdem den verschiedenen Lobbys und Behindertenverbänden und ihrer Öffentlichkeitsarbeit, die uns bei der Suche nach Interviewpartnerinnen im Rahmen der Zusatzbefragungen wertvolle Dienste geleistet haben.
Die eigentlichen Heldinnen dieser Studie sind aber die 1.561 Befragten in den Haushalten und Einrichtungen, die sich viele Stunden Zeit genommen haben, um unsere teilweise auch schwierigen und persönlichen Fragen zu belastenden Lebensereignissen und zu Gewalt zu beantworten. Ihnen widmen wir diese Studie in der Hoffnung, dass sie sich in den Ergebnissen wiederfinden werden und dass die Studie langfristig dazu beitragen wird, die Lebensbedingungen und Lebenszufriedenheit, den Schutz und die Sicherheit sowie die umfassende und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu gewährleisten.
Monika Schröttle und Claudia Hornberg, im Namen des Forschungsteams der Studie, München, Bielefeld, Frankfurt, Berlin und Köln, im Februar 2013
Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen sind in den letzten Jahren vermehrt in das Zentrum der wissenschaftlichen sowie politischen und öffentlichen Diskussion gerückt. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet zum Abbau von Diskriminierungen und zur Förderung und Gewährleistung von Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und hebt hier insbesondere die Mehrfachdiskriminierungen und Gewaltbetroffenheit von Mädchen und Frauen mit Behinderungen hervor.
Frauen mit Behinderungen sind, wie bisherige internationale Studien nahelegen, aufgrund von Diskriminierungen und körperlich-psychischer sowie kognitiver Abhängigkeiten einem erhöhten Risiko ausgesetzt, in verschiedenen Altersphasen und Lebenssituationen Opfer von psychischer, physischer und sexueller Gewalt zu werden. Auch strukturelle Gewalt und Diskriminierung sowie Vernachlässigung im Kontext der Pflege können hier eine Rolle spielen. Im europäischen und angloamerikanischen Forschungskontext wurden bislang einige Studien zum Ausmaß von Gewalt gegen Frauen (und Männer) mit Behinderungen in den USA, Kanada, Österreich, Deutschland und England durchgeführt[1], die allerdings nicht in der Breite wie die vorliegende Studie Frauen mit verschiedenen Behinderungen sowohl in Haushalten als auch in Einrichtungen einbezogen haben. Alle Studien verweisen auf erhöhte Gewaltbetroffenheiten bei Frauen mit Behinderungen.
Diskriminierungen und Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen stellen an sich eine Menschenrechtsverletzung dar und behindern die Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Teilhabe der Frauen. Darüber hinaus gehen sie mit erheblichen gesundheitlichen Folgeproblemen einher.[2] Neben körperlichen und psychischen Verletzungen, psychosomatischen und psychischen Folgeproblemen[3], die eine bestehende Behinderung oder Erkrankung unter Umständen noch verstärken, aber auch bedingen können, bedeuten Gewalterfahrungen immer auch den Missbrauch von Vertrauen, häufig verbunden mit Wehrlosigkeit und dem Erleben von Ohnmacht (vgl. z.B. Becker 2001). Dass solche körperlichen und psychischen Gewaltfolgen von Gesundheitsexpertinnen bzw. Gesundheitsexperten und Betreuungspersonen häufig nicht erkannt und entsprechend behandelt werden, ist auch darauf zurückzuführen, dass insbesondere psychische Symptome und bestimmte Verhaltensauffälligkeiten (z.B. im Falle geistiger Behinderungen) als behinderungsspezifisch (z.B. als Folge einer kognitiven Retardierung) fehlgedeutet werden. Hinzu kommen behinderungsbedingte Einschränkungen, z.B. der Körperwahrnehmungs-, Kooperations- und Mitteilungsfähigkeit aufseiten vieler Betroffener, die die Einordnung von Symptomen erschweren.
Dass Mädchen und Frauen allgemein in Deutschland einem hohen Maß an psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt mit damit einhergehenden erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, konnte bereits die repräsentative bundesweite Frauenstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ (Schröttle/Müller 2004) mit ihren Folgeauswertungen aufzeigen (vgl. u.a. Schröttle/Khelaifat 2008, Schröttle/ Hornberg et al. 2008). Die Studie wurde von 2002–2004 im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) am Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) der Universität Bielefeld durchgeführt.
Obwohl im Rahmen der Studie von 2004 ermittelt wurde, welche Frauen von chronischen Erkrankungen und körperlichen Behinderungen betroffen waren, konnte keine ausreichend große Fallzahl und Diversität von Frauen mit Behinderungen erreicht werden, welche verallgemeinerbare Aussagen über deren Gewaltbetroffenheit zulassen würde. Zum einen wurden in dieser Studie überwiegend Frauen außerhalb häuslicher oder institutioneller Pflege erreicht.[4] Auch erlaubten die Zugänge und Befragungsmethoden nicht, spezifische Gruppen zu erreichen, etwa gehörlose Frauen, psychisch Erkrankte oder Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen. Bei den befragten körperbehinderten und chronisch erkrankten Frauen zeigte sich jedoch bereits eine höhere Gewaltbetroffenheit, insbesondere bei Frauen mit jenen Erkrankungen und Behinderungen, welche mit Einschränkungen im täglichen Leben einhergehen und eine regelmäßige Inanspruchnahme von Hilfe, Pflege oder Unterstützung erfordern. Der Studie zufolge hatten 50% der Frauen mit einer chronischen Erkrankung oder einer körperlichen Behinderung, durch die sie im täglichen Leben eingeschränkt waren (N=1.414), körperliche Übergriffe seit dem 16. Lebensjahr erlebt, 21% waren von sexueller Gewalt im engen strafrechtlichen Sinne und 56% von psychischer Gewalt in unterschiedlichen Lebensbereichen betroffen. Damit lag das Ausmaß ihrer Gewaltbetroffenheiten deutlich höher als bei den Befragten der Studie ohne entsprechende Behinderungen/Erkrankungen (39% körperliche Übergriffe, 13% sexuelle Gewalt und 43% psychische Gewalt in der Altersgruppe bis 65 Jahre). Auch eine Tendenz der erhöhten Betroffenheit durch sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend deutete sich bei den durch Behinderungen/chronische Erkrankungen im täglichen Leben eingeschränkten Frauen mit 16% (vs. 9% bei den nicht behinderten/chronisch Erkrankten bis 65 Jahre) an.
Insgesamt waren Methodik und Setting der Studie von 2004 nicht geeignet, um ein breites Spektrum an Frauen mit Behinderungen, etwa gehörlose und blinde Frauen sowie schwerstbehinderte Frauen, zu befragen. Der hierfür erforderliche methodische Forschungszugang hätte den finanziellen und organisatorischen Rahmen der Untersuchung überschritten.
In dem standardisierten Erhebungsteil der repräsentativen Studie „LIVE. Leben und Interessen vertreten – Frauen mit Behinderung“ (Eiermann/Häußler/Helfferich 2000) wurden zwei Fragen zur Betroffenheit von sexueller Gewalt und sexueller Belästigung gestellt. Allerdings wurden hier bei einem Stichprobenzugang über Versorgungsämter kaum Frauen in Einrichtungen erreicht. Der Schwerpunkt der Studie lag zudem auf der Erhebung der allgemeinen Lebenssituation und nicht auf der Erhebung von Gewalterfahrungen. Befragt wurden ausschließlich Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen.
Eine repräsentative bundesdeutsche Studie, die die Betroffenheit von behinderten Frauen und Mädchen von verschiedenen Formen von Gewalt und Diskriminierung mit Blick auf die Diversität der Behinderungen und unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation und Pflegebedürftigkeit in Haushalten und in Einrichtungen vertiefend untersucht sowie Erkenntnisse zum Unterstützungsbedarf der Betroffenen ableitet, war bislang – trotz diverser, auf bestimmte Behinderungen, Gewaltformen oder Lebens- und Wohnverhältnisse fokussierter Studien – auch international nicht verfügbar.
Ziel der vorliegenden, von den Lobbys und Verbänden der Frauen mit Behinderungen eingeforderten und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebenen Studie war es deshalb, erstmals umfassende, differenzierte und qualitativ hochwertige repräsentative Befunde zur Gewaltbetroffenheit von Frauen mit Behinderungen in Deutschland zu erlangen. Diese sollten Vergleiche zwischen unterschiedlichen Betroffenengruppen und Vergleiche zum weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt, d. h. zu der bereits erwähnten bevölkerungsweiten Frauenstudie (Schröttle/Müller 2004, im Folgenden „Frauenstudie 2004“) ermöglichen. Zweck der Studie war die Schaffung einer soliden Basis für die Weiterentwicklung einer Politik und Unterstützungspraxis zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen. Sie sollte zudem einen Zugang eröffnen zu den subjektiven Prozessen von Gewaltwahrnehmung, -benennung und -bewältigung und des Umgangs mit der spezifischen Vulnerabilität und der Hilfesuche. Dieses Wissen kann dafür genutzt werden, die Betroffenen in ihrem Handeln besser zu verstehen und Prävention und Unterstützung bei der Beendigung von Gewaltverhältnissen zielgruppengerechter auszugestalten.
Über einen sowohl quantitativen als auch qualitativen Zugang sollte sichergestellt werden, repräsentatives Datenmaterial, aber auch vertiefende Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Fragestellungen der Untersuchung zu erhalten, etwa zum Ausmaß von Gewalt, zur individuellen und gruppenbezogenen Gewaltbetroffenheit sowie zu Hilfe- und Unterstützungserfordernissen in der Praxis.
Die Komplexität der Aufgabenstellung, die Besonderheiten des Zugangs zur Zielgruppe, forschungsethische Fragestellungen sowie die finanziell vertretbare Umsetzung der Studie erforderten eine Vorstudie von etwa einem Jahr, bevor die Haupterhebung beginnen konnte. Dieser Zeitraum diente der Vorbereitung und Feinkonzeption der Studie, dem Test der Befragungsinstrumente und der Realisierbarkeit des Zugangs zu den Befragten.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden erstmals repräsentativ Frauen mit Behinderungen in Deutschland zu ihrer Lebenssituation, ihren Belastungen, zu Diskriminierungen und Gewalterfahrungen in der Kindheit und im Erwachsenenleben befragt. Die Befragung umfasste insgesamt 1.561 Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren mit und ohne Behindertenausweis, die in Haushalten und in Einrichtungen leben und die starke, dauerhafte Beeinträchtigungen und Behinderungen haben.
Über einen repräsentativen Haushaltszugang wurden 800 Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erreicht. Die Auswahl erfolgte mithilfe einer aufwendigen Vorbefragung bei 28.000 zufällig ausgewählten Haushalten an 20 ebenfalls per Zufallsverfahren ausgewählten Standorten (Landkreisen und Städten) bundesweit (random route). Dabei wurde anhand eines Screeningfragebogens zunächst ermittelt, ob eine Frau in dem Haushalt lebt, die nach eigener Einschätzung starke und dauerhafte Beeinträchtigungen und Behinderungen hat, und/oder Einrichtungen der Behindertenhilfe nutzt und/oder über einen Schwerbehindertenausweis verfügt. War dies der Fall, wurde die Frau um die Teilnahme an einem Hauptinterview gebeten, das etwa 1,5 bis 3 Stunden dauerte.
Im Rahmen der repräsentativen Einrichtungsbefragung wurden darüber hinaus, ebenfalls nach einem systematisierten Zufallsverfahren, insgesamt 420 Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen an den 20 bundesweiten Standorten befragt. Es handelte sich dabei um:
-
318 Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen[5] , die mit einem vergleichbaren Fragebogen in vereinfachter Sprache von spezifisch geschulten Interviewerinnen befragt wurden;
-
102 Frauen mit zumeist psychischen Erkrankungen, in wenigen Fällen auch schwerstkörper- oder mehrfachbehinderte Frauen, die mit dem allgemeinen Fragebogen befragt wurden.
[1] Vgl. im Überblick Hughes et al. 2012; Martinez/Schröttle et al. 2006, S. 37 ff.; vgl. auch Eiermann et al. 2000; Turk/Brown 1993; Brown et al. 1995; Zemp/Pircher 1996; Zemp et al. 1997; Brown/Stein 1998; Klein/Wawrok/Fegert 1999; Martin et al. 2006; Brownridge 2008; Casteel et al. 2008; Hall/Innes 2010.
[2] Darauf verweist auch das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung NRW im Rahmen einer Stellungnahme für die Enquêtekommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW“ des Landtags Nordrhein-Westfalen und benennt eine Vielzahl möglicher gesundheitlicher Folgen sexualisierter Gewalterfahrungen und Misshandlungen bei Frauen mit Behinderungen (Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung in NRW 2002).
[3] Zum Beispiel Ess- und Schlafstörungen, Suchtmittelmissbrauch, depressive Reaktionen, Zwangsverhalten, Angst- und Panikattacken bis hin zu gesundheitsgefährdenden (Überlebens-)Strategien wie autoaggressives, selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuchen. Auch eine ungewollte Schwangerschaft kann auf sexualisierte Gewalt hinweisen. S. auch Schröttle/Hornberg et al. 2008.
[4] Von den befragten Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren (N=8.200) haben in der Studie knapp 19% (N=1.540) angegeben, an einer chronischen ernsthaften Erkrankung zu leiden; knapp 4% (N=309) gaben eine körperliche Behinderung an. 22% der Betroffenen (=knapp 5% der Befragten dieser Altersgruppe) gaben an, durch die chronische Erkrankung oder körperliche Behinderung sehr stark oder stark im täglichen Leben eingeschränkt zu sein, weitere 33% (=7% der Befragten) waren mittelmäßig eingeschränkt, 24% leicht (=5% der Befragten) und knapp 19% (=4% der Befragten) gaben an, dadurch nicht im täglichen Leben eingeschränkt zu sein. Von jenen Frauen, die angaben, durch eine chronische Erkrankung oder körperliche Behinderung im täglichen Leben eingeschränkt zu sein (N=1.414), benötigten 11% regelmäßig Hilfe, Pflege oder Unterstützung durch andere. 99% dieser Frauen lebten in Privathaushalten und nur 1% war institutionell untergebracht. Das lässt in der Tendenz darauf schließen, dass in der Studie Frauen mit schweren Behinderungen und solche in Situationen häuslicher und institutioneller Pflege untererfasst waren.
[5] Über die Begrifflichkeit der „sogenannten geistigen Behinderungen“ fand sowohl innerhalb des Forschungsteams als auch in Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis und Lobbyarbeit im Kontext Behinderung eine intensive Auseinandersetzung statt. Da der Begriff der „geistigen Behinderung“ von behinderten Menschen selbst als stigmatisierend empfunden und abgelehnt wird, sollte er in dieser Studie nicht ohne eine Distanzierung, wie es in der Ergänzung „sogenannte“ deutlich wird, verwendet werden. Obwohl die Menschen mit Behinderungen selbst, z.B. repräsentiert durch Mensch zuerst, People First Deutschland, den Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ empfehlen, entschied sich das Forschungsteam für die Dokumentation der Studie gegen diesen Begriff, da er aufgrund seiner Unschärfe (z.B. hinsichtlich einer Abgrenzung von leichten Lernschwierigkeiten in der Schule und behinderungsrelevanten kognitiven Einschränkungen) in diesem Rahmen als problematisch eingeschätzt wurde. Darüber hinaus sollte ein Begriff verwendet werden, der für eine breite Öffentlichkeit, einschließlich der Behindertenhilfe und des medizinischen Sektors, welche den Begriff der „geistigen Behinderung“ nach wie vor verwenden, anschlussfähig ist, aber nicht unkritisch bleibt.
Inhaltsverzeichnis
In dem vorliegenden Forschungsprojekt mussten besondere methodische Schwierigkeiten überwunden werden, so z.B. die Gewährleistung der Repräsentativität bei fehlenden repräsentativen Grunddaten zur Untersuchungsgruppe, zumal ein großer Teil der behinderten Mädchen und Frauen keinen Behindertenausweis hat und nicht über Versorgungsämter erreichbar ist. Zugleich stellte auch der Zugang zu den unterschiedlichen Zielgruppen der Untersuchung, etwa im Hinblick auf Kommunikation oder auch die Erreichbarkeit von Frauen in Einrichtungen, eine erhebliche Hürde dar. Gerade die aufgrund ihrer Behinderung oder Lebenssituation schwer erreichbaren Frauen stellen aber unter Umständen vulnerable Bevölkerungsgruppen dar, die im Rahmen von Viktimisierungsstudien zu Gewalt nicht vernachlässigt werden dürfen. Im Folgenden werden das genaue Untersuchungsdesign und die angewandten Methoden in Bezug auf die repräsentative Befragung in Haushalten und in Einrichtungen (2.2) und die nichtrepräsentative Zusatzbefragung (2.3) dargestellt. Anschließend werden die Gewinnung, Schulung und Betreuung der Interviewerinnen (2.4) und die Fragebogenentwicklung (2.5) beschrieben. Da für die Auswahl der zu befragenden Frauen eine Auseinandersetzung mit dem Behinderungsbegriff und eine Entwicklung einer studienspezifischen Behinderungsdefinition zentral war, soll diese hier zunächst vorgestellt werden (2.1).
In der vorliegenden Untersuchung zu Ausmaß und Umfang von Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen sind Betroffene mit unterschiedlichen Behinderungen, d. h. mit Hör-, Seh-, Körper-, psychischen, sogenannten geistigen Beeinträchtigungen sowie mit chronischen Erkrankungen, im Alter von 16 bis 65 Jahren repräsentiert. Die Behinderung sollte – entsprechend der ursprünglichen Ausschreibung des BMFSFJ – einen prägenden Faktor im Leben der Befragten darstellen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Aufdeckung potenzieller Dunkelfelder betroffener Frauen mit Behinderungen, die nicht über Versorgungsämter und/oder Einrichtungen erfasst werden können.
Die folgenden Ausführungen dienen im Hinblick auf die methodischen und wissenschaftlichen Anforderungen der Studie der kritischen Diskussion und Bewertung verfügbarer Definitionen von Behinderung und der Ableitung einer studienspezifischen Definition, die zur Festlegung/Eingrenzung der Zielgruppe herangezogen wurde.
Angesichts der wissenschaftlichen Fragestellung der Studie und der zu leistenden Feldarbeit war es von zentraler Bedeutung, den Personenkreis klar zu definieren, der mit dem komplexen Begriff „Behinderung“ erfasst werden sollte. Als eine grundlegende Problematik stellte sich dabei die Heterogenität der zu befragenden Zielgruppe „Frauen mit Behinderungen“ dar. Behinderungen sind durch eine Vielfalt an Ausprägungen, Ursachen und wahrgenommenen Beeinträchtigungen der Betroffenen gekennzeichnet, die eine Konkretisierung und Eingrenzung der potenziellen Studienteilnehmerinnen erforderten. Die Definition des Begriffs „Behinderung“ sowie die Frage, welche (gesundheitlichen) Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen einzubeziehen waren und welche nicht, stellten insofern eine besondere Herausforderung dar, als diverse theoretische Ansätze in unterschiedlichen Professionen verschiedene Definitionen des Personenkreises vornehmen. So ist eine Vielzahl medizinischer, soziologischer, psychologischer, (sonder-)pädagogischer, sozialrechtlicher und sozialpolitischer Begriffsbestimmungen verfügbar, die auf jeweils fachspezifischen Erklärungsmustern basieren und unterschiedlichen Zielsetzungen dienen.
Im Allgemeinen dienen Definitionen einerseits dazu, die Handhabbarkeit und Kommunizierbarkeit komplexer Sachverhalte zu erhöhen, unterliegen dabei jedoch der Gefahr unzulässiger Vereinfachungen und Stigmatisierungen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Definitionen von vornherein zum Ausschluss bestimmter Gruppen von Betroffenen führen können, die die Definitionskriterien nicht eindeutig oder nur unvollständig erfüllen. Diese Problematik ist gerade im Hinblick auf die Zielgruppe der Frauen mit Behinderungen von besonderer Bedeutung.
Im Rahmen der quantitativen Studie zur Erfassung von Gewalterfahrungen bei Frauen mit verschiedenen Behinderungen stellte sich daher im Vorfeld die zentrale Aufgabe, wissenschaftlich fundierte und methodisch geleitete Kriterien zu entwickeln und festzulegen und zu entscheiden, welche Frauen in die Studie einbezogen werden sollten und warum. Weder sollte dabei der Begriff „Behinderung“ so eng gefasst sein, dass wichtige Zielgruppen ausgeschlossen würden, noch sollte der Behinderungsbegriff derart ausgeweitet werden, dass die Studie an Aussagekraft verlieren würde.
Die aktuellen Diskurse um den Begriff der Behinderung sind eingebettet in menschenrechtlich und politisch-gesellschaftlich engagierte Aktivitäten mit dem Ziel, die Lebenssituation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. In diesen Diskursen ist eine zunehmende Distanzierung von überwiegend medizinisch-diagnostischen Kriterien zugunsten einer stärkeren Bezugnahme auf umweltbezogene Kontextfaktoren in der Beschreibung und terminologischen Definition von Behinderung zu beobachten.
Die Eingrenzung der Zielgruppen für die repräsentative Befragung folgte diesen Entwicklungen. Darüber hinaus orientierte sie sich an forschungspraktischen Überlegungen und an den konkreten wissenschaftlichen Zielsetzungen der Studie. Zunächst sollen hier wichtige Begrifflichkeiten und Definitionen geklärt und präzisiert und die Einbettung der studienspezifischen Definition in bestehende Definitionen und Diskurse diskutiert werden.
Nach § 2 Sozialgesetzbuch IX (1), das für den Sozialbereich in Deutschland maßgeblich die Einordnung von Behinderung regelt, sind Menschen behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“. Demnach ist eine Person „behindert, wenn sie infolge einer körperlichen Schädigung des Organismus, einer Schwäche der geistigen Kräfte oder einer seelischen Störung nicht nur vorübergehend daran gehindert ist, Funktionen und Aktivitäten so auszuüben, wie sie innerhalb einer Bandbreite als normal betrachtet werden, und somit bei der Ausfüllung der für die Person im Übrigen (nach Alter, Geschlecht, sozialem Kontext (…) als normal angesehenen Rolle in der Gesellschaft benachteiligt ist“ (§ 2 SGB IX[6]).
Ein erweitertes Verständnis von „Behinderung“ enthält die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2005.[7] Grundlage ist das Konzept der funktionalen Gesundheit, orientiert am bio-psycho-sozialen Modell von Gesundheit. Behinderung ist gefasst als „formaler Oberbegriff zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit unter expliziter Bezugnahme auf Kontextfaktoren“[8] und „fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt“.[9] Die Schädigung von Körperfunktionen (physiologische Funktionen von Körpersystemen, einschließlich psychologischer/mentaler Funktionen) und -strukturen (anatomische Teile des Körpers) sind verknüpft mit Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der sozialen Partizipation.[10] Bei der ICF-Klassifikation handelt es sich um die Weiterentwicklung eines „Krankheitsfolgenmodells“ (ICIDH von 1980) zu einem „bio-psychosoziale[n] Modell der Komponenten von Gesundheit“[11], das von Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen, der Aktivitäten und der Partizipation [Teilhabe] ausgeht[12]. In dieser Klassifikation wird es als wichtig beurteilt, Daten über die einzelnen Komponenten unabhängig voneinander zu erheben und „anschließend Zusammenhänge und kausale Verknüpfungen zwischen ihnen zu untersuchen“.[13] Die ICF-Klassifikation fokussiert einerseits auf die individuellen körperlichen, geistigen, seelischen und gesundheitlichen Schädigungen und Einschränkungen, berücksichtigt darüber hinaus aber auch die strukturellen Dimensionen von Behinderung und Diskriminierung durch Gesellschaft und Umwelt als relevante Aspekte von Behinderung.
Dieser Ansatz wird auch in der UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen, indem sie sich auf „langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen“ bezieht, welche Menschen „in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“. Behinderung wird auch hier nicht ausschließlich oder in erster Linie auf die funktionelle Störung oder Erkrankung reduziert, sondern in ihren Bezügen zu Umweltfaktoren (z.B. der durch unterschiedliche Barrieren geprägten Infrastruktur) betrachtet, die Menschen an einer gesellschaftlichen Teilhabe hindern können[14].
Im medizinischen Kontext ist eine chronische Erkrankung als eine langwierige, schwer heilbare Krankheit definiert. Die Einstufung als „schwerwiegend chronisch erkrankt“ ist für die Übernahme der medizinischen und Versorgungskosten durch die Krankenkassen relevant. Für diese wurden ab 1. April 2007 strengere Anforderungen definiert (sog. „Chronikerregelung“). Als schwerwiegend chronisch erkrankt gilt nach der medizinischdiagnostischen Definition des Gemeinsamen Bundesausschusses[15], wer sich seit mindestens einem Jahr wegen derselben Erkrankung ununterbrochen in Dauerbehandlung befindet. Weiter muss eine der folgenden drei Voraussetzungen vorliegen: Pflegestufe 2 oder 3, Grad der Behinderung oder der Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60% oder eine kontinuierliche ärztliche Versorgung, ohne die sich die Krankheit lebensbedrohlich verschlimmern, die Lebenserwartung vermindern oder die Lebensqualität dauerhaft beeinträchtigen würde.[16] Diese sogenannte „Chronikerregelung“ ist politisch stark umstritten und umfasst eine vergleichsweise enge Definition von schwerwiegender chronischer Erkrankung. Relevant ist für die vorliegende Studie vor allem der Zusammenhang von chronischer Erkrankung und Behinderung im Sinne der WHO-Definition und die Frage, in welchem Maße die Erkrankung und ihre Folgen das tägliche Leben beeinträchtigen.
Gemäß dem Auftrag des Forschungsprojektes durch das BMFSFJ waren die Aspekte „Psychische Störungen“ und „Psychiatrieerfahrung“ im Rahmen der Studie mit zu berücksichtigen.
An die Stelle des früher verwendeten und von Betroffenen als stigmatisierend konnotierten Begriffs „Psychische Erkrankung“ ist seit einigen Jahren die Bezeichnung der „Psychischen Störung“[17] getreten. Die damit erfassten und in der ICD-10[18] spezifizierten medizinischdiagnostischen Kriterien integrieren folgende psychische und Verhaltensstörungen:
-
„organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen;
-
psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (Drogen, Alkohol und Medikamente);
-
Schizophrenie und wahnhafte Störungen;
-
affektive Störungen (u.a. auch Depressionen und starke Stimmungs-/ Aktivitätsschwankungen);
-
neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (u.a. Angststörungen, Zwangsstörungen/-handlungen, Traumasymptome);
-
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (z.B. Essstörungen, Schlafstörungen);
-
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen;
-
Intelligenzminderung;
-
Entwicklungsstörungen;
-
Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend sowie
-
andere, nicht näher bezeichnete psychische Störungen“.[19]
Wenn die psychischen Störungen dauerhaft sind oder in Schüben oder Phasen wiederkehrend auftreten, kann dies als psychische oder seelische Behinderung bezeichnet werden. Allerdings ist auch hier entsprechend der WHO-Definition zwischen Funktionsstörungen, individueller Bewältigung und den Folgen bzw. Behinderungen durch die Umwelt (z.B. durch Unterversorgung, Arbeitsplatzverlust) zu unterscheiden.[20]
Der medizinisch-diagnostisch und sozialrechtlich definierte Begriff der „seelischen Behinderung“ wurde in der Vergangenheit von Betroffenen und Selbsthilfebewegungen als stigmatisierend abgelehnt und zum Teil durch die Bezeichnung „psychiatrieerfahren“ ersetzt. Im engeren Wortsinn gilt als psychiatrieerfahren, wer sich aktuell in ambulanter und/oder stationärer psychiatrischer Behandlung befindet oder in der Vergangenheit eine solche Behandlung erfahren hat. Da der Begriff der „Psychiatrieerfahrung“ in der Praxis jedoch sehr unterschiedlich ausgelegt wurde, wird er im Rahmen der vorliegenden Studie nicht verwendet. Nicht zuletzt aufgrund seiner begrifflichen Unschärfe besteht die Gefahr einer zu starken Orientierung an der Frage der Inanspruchnahme psychiatrischer oder psychotherapeutischer Unterstützung, wodurch Frauen mit erheblichen psychischen Behinderungen/Beeinträchtigungen ausgeschlossen würden, die keine institutionelle Unterstützung in Anspruch genommen haben.
Im Kontext der Studienplanung wurde daher nach möglichst wenig stigmatisierenden Kriterien für die Gruppen der Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen gesucht, die sich nicht auf diagnostische Zuordnungen, sondern auf die Einschätzung von Beeinträchtigungen durch die Betroffenen selbst stützen. In die Studie wurden deshalb Frauen mit – nach eigener Einschätzung – starken und längerfristigen (nicht nur vorübergehenden) psychischen bzw. seelischen Beeinträchtigungen oder Beschwerden einbezogen, die andauern oder immer wiederkehren. Inwieweit im Rahmen der Haushaltsbefragung der Zielgruppe entsprechende Frauen auch außerhalb von Institutionen identifiziert und erreicht werden können, wurde im Rahmen der Voruntersuchung durch niedrigschwellige Screeningfragen getestet und positiv beschieden.
Die studienspezifische Definition orientiert sich prinzipiell an der von der WHO entwickelten Definition von Behinderung und ist damit umfassender als die in Deutschland amtlich verwendeten und zum Teil kontrovers diskutierten sozialrechtlichen und medizinischdiagnostischen Definitionen. Dies ist zunächst aus inhaltlichen und methodischen, aber auch aus forschungspraktischen Gründen sinnvoll, da eine ärztlich-diagnostische Abklärung im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zur Bestimmung von Zielpersonen in Haushalten nicht realisierbar ist.
Die Anerkennung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Beeinträchtigung im Sinne des § 2 SGB IX erfolgt in Deutschland auf Antrag der Betroffenen und auf Grundlage medizinischer Gutachten der zuständigen Behörden (§ 69 SGB IX).[21] Für die vorliegende Repräsentativstudie, die u.a. auch die Aufgabe hatte, die Dunkelfelder der nicht amtlich gemeldeten Frauen mit Behinderungen einzubeziehen, konnte die sozialrechtlich basierte Anerkennung nicht das einzige Einschlusskriterium sein. Die für die Studie erforderliche Eingrenzung der Zielgruppe der Frauen mit Behinderungen orientierte sich deshalb vorrangig an den subjektiven Einschätzungen der Betroffenen zur Art, Dauer und Schwere der eigenen Behinderung/Beeinträchtigung sowie an der Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen. Dieser Ansatz wurde im Rahmen der Vorbereitung der Studie mit Expertinnen und Experten fachlich erörtert und zur Diskussion gestellt sowie im Rahmen einer Pretestbefragung hinsichtlich seiner Praktikabilität geprüft und als positiv und überzeugend eingeschätzt.
Die vorliegende Studie untersucht die Fragestellung, ob Frauen mit Behinderungen (einschließlich chronischer Erkrankungen und psychischer Beeinträchtigungen) im Kontext
-
erforderlicher Behandlung, Pflege und Versorgung in ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen,
-
häuslicher Pflege- und Betreuungsverhältnisse,
-
behinderungs- und erkrankungsbedingter Einschränkungen (z.B. in der Mobilität, Wehrhaftigkeit und Reaktionsfähigkeit auf Gewalt und Grenzüberschreitungen, im Erkennen und Benennen von Gewalt, in der Beendigung von Gewaltverhältnissen, in der Hilfe- und Unterstützungssuche) sowie im Kontext
-
sozialer und gesellschaftlicher Barrieren, Ausgrenzungen und Diskriminierungen
einem potenziell höheren Risiko ausgesetzt sind, körperliche, sexuelle und/oder psychische Gewalt zu erfahren.
Gemäß der Vorgabe des BMFSFJsoll die Behinderung ein prägender Faktor im Leben der betroffenen Frauen sein. Die Untersuchung ist daher ausdrücklich nicht in erster Linie an einem quantitativ oder diagnostisch zu bestimmenden Grad der Behinderung orientiert, sondern an ausgewählten Kriterien, die sich auf subjektiv wahrgenommene Funktionseinschränkungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Partizipation sowie auf das Angewiesensein auf Unterstützung durch Dritte beziehen. In die Untersuchung wurden deshalb Frauen einbezogen, bei denen länger andauernde[22] und nicht nur vorübergehende Behinderungen (einschließlich chronischer Erkrankungen und Beeinträchtigungen im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich sowie im Bereich der Sinneswahrnehmungen) vorliegen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:
-
Die Befragte ist nach subjektiver Einschätzung stark und dauerhaft beeinträchtigt im Bereich der körperlichen Mobilität und/oder der Sinneswahrnehmung und/oder der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und/oder in ihren psychischen, seelischen und intellektuellen Aktivitäten und Möglichkeiten;
-
die Befragte hat eine chronische Erkrankung, durch die sie stark und dauerhaft beeinträchtigt ist;
-
sie ist regelmäßig auf Hilfe, Betreuung, Unterstützung durch Dritte angewiesen;
-
die Befragte hat einen Schwerbehindertenausweis;
-
die Befragte bewohnt oder nutzt vorübergehend oder auf Dauer eine Einrichtung der Behindertenhilfe, eine psychiatrische Einrichtung, eine Werkstätte für Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, eine Selbsthilfegruppe oder ein Angebot des betreuten Wohnens.
Trifft mindestens eines dieser Kriterien zu, gilt die Frau im Sinne der studienspezifischen Definition als behindert oder beeinträchtigt. Diese studienspezifische Definition weitet die Befragungsgruppe gegenüber den amtlich anerkannten Frauen mit Behinderungen aus. Sie ermöglicht zugleich einen Abgleich und Zusammenhang mit dem Kriterium der amtlichen Feststellung von Behinderung.
Die hier beschriebene Definition dient auch der Auswahl und Eingrenzung der zu befragenden Personen, die im Rahmen der Haushaltsstudie anhand von Screeninginterviews (siehe 2.2.1 und Fragebogen im Anhang) gefunden wurden. Die umfassenderen Definitionen von Behinderungen sind in die Inhalte der vorliegenden Befragung und in die Auswertung der Ergebnisse eingeflossen. Sie fokussieren zentral auch die kontext- und umweltbezogenen Faktoren, die einen wesentlichen Anteil an der faktischen Behinderung der Frauen haben.
Repräsentativität bedeutet für die vorliegende Studie, dass jede Frau im Alter von 16 bis 65 Jahren mit den definierten Behinderungen und Beeinträchtigungen die gleich große Chance hat, in die Stichprobe zu gelangen. Dem Problem der fehlenden repräsentativen Grunddaten zu Frauen mit Behinderungen und der Tatsache, dass nicht alle Menschen mit Behinderungen über die Versorgungsämter repräsentiert sind, wurde mit einem regionalen Zugang über zufällig ausgewählte Standorte und der Auswahl der Haushalte mit dem Random-Route-Verfahren (Zufallsweg) begegnet. Auf diese Weise sollte eine größtmögliche Streuung und Repräsentanz erreicht werden. Das Verfahren wurde in der Vorstudie getestet und erwies sich als erfolgreich.
Bei dem gewählten Vorgehen wurde davon ausgegangen, dass Frauen mit Behinderungen entweder in Privathaushalten wohnen (mit oder ohne zusätzliche institutionelle, z.B. teilstationäre, Anbindung) oder aber in vollstationären Einrichtungen untergebracht sind. Für die repräsentative Erfassung der in Haushalten und in vollstationären Angeboten wohnenden Frauen mit Behinderungen wurde eine regional geklumpte repräsentative Befragung über den Zugang zu den Haushalten und entsprechenden Einrichtungen vor Ort gewählt:
-
Vor-Ort-Befragungen in Privathaushalten, bezogen auf eine begrenzte Anzahl von Kreisen und kreisfreien Städten,
-
Vor-Ort-Befragungen in den Wohnheimen der Behindertenhilfe an den in 1. ausgewählten Standorten.
Zunächst wurde aus der Liste aller 439 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland eine Zufallsstichprobe von 20 Kreisen/kreisfreien Städten unter notarieller Aufsicht und nach einem mehrfach geschichteten Zufallsverfahren gezogen. Dabei sind sowohl Kreise und kreisfreie Städte in Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland als auch ländliche und städtische Gebiete repräsentiert. Diese Stichprobe von knapp 5 Prozent wurde als geeignet erachtet, um die Grundgesamtheit angemessen abzubilden. Das Ergebnis der einmaligen Zufallsziehung war verbindlich und irreversibel.
In den 20 Standorten wurden dann, ebenfalls nach dem Zufallsprinzip, jeweils 7 Sample-Points (Befragungsgebiete) ausgewählt. In Kreisen waren das zumeist Gemeinden oder Teile davon, in kreisfreien Städten waren dies Stadtteile.
Für die Haushaltsbefragung, die mit dem Random-Route-Verfahren (Zufallsweg) durchgeführt wurde, wurde daraufhin für jeden Sample Point (Befragungsgebiet) eine Startadresse per Zufallsverfahren gezogen.
Im Anschluss an die Ziehung der Startadresse gingen die Interviewerinnen von der Startadresse aus einen in der Straßenbegehungsvorschrift des Random-Route-Verfahrens festgelegten Zufallsweg, warfen dabei in jeden zweiten Haushalt einen Brief ein, in dem über die Studie informiert wurde, und notierten Namen und Adresse. Zu einem späteren Zeitpunkt (nach einigen Tagen) wurde dieser Haushalt erneut kontaktiert, um anhand eines bereits in der Vorstudie getesteten Screeningfragebogens festzustellen, ob eine Frau mit Behinderung oder Beeinträchtigung in der Altersgruppe im Haushalt lebt.[23] Der Screeningfragebogen zielt einerseits darauf ab, Zielpersonen über möglichst niedrigschwellige Fragen nach (körperlichen, psychischen, geistigen und Sinnes-)Beeinträchtigungen sowie chronischen Erkrankungen, die im täglichen Leben stark und dauerhaft einschränken, zu erfassen. Er enthält andererseits Fragen nach regelmäßiger Unterstützung und Betreuung aufgrund einer Beeinträchtigung, nach dem Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises und der Nutzung von Einrichtungen der Behindertenhilfe, welche als mögliche Kriterien für das Vorliegen einer Behinderung vorab definiert wurden (vgl. Screeningfragebogen im Anhang). Wenn eine in diesem Sinne behinderte Frau im Alter von 16 bis 65 Jahren im Haushalt lebte, wurde ein Termin für ein ca. 90-minütiges Interview vereinbart, welches durch die jeweilige Interviewerin vor Ort (im Haushalt oder an einem Ort der Wahl der Interviewpartnerin) durchgeführt wurde.
Bis Mitte Oktober 2010 wurden durch die Haushaltsinterviewerinnen an den 20 Standorten insgesamt 28.012 Haushalte ausgewählt, anhand von Briefen kontaktiert und mit persönlicher Kontaktierung durch die Interviewerinnen abgearbeitet. Es wurden 13.686 Screeninginterviews durchgeführt. Damit nahmen 49% der abgearbeiteten Haushalte an den Screeninginterviews teil, 51% der Haushalte verweigerten eine Teilnahme oder konnten auch nach 10-maligem Kontakt und zusätzlicher Nachmotivierung nicht erreicht werden.
In 1.592 Haushalten (=12% der gescreenten Haushalte) konnten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in der Altersgruppe ermittelt werden. Dies entsprach sehr genau den im Verlauf der Voruntersuchung und auf der Basis der Pretests vorgenommenen Schätzungen des Anteils von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in deutschen Haushalten. Von den ermittelten, von Behinderungen und Beeinträchtigungen betroffenen Frauen waren 51% zu einem Interview bereit, 49% lehnten eine Teilnahme ab oder gaben an, (im Untersuchungszeitraum) keine Zeit zu haben.[24] So konnte eine Fallzahl von 806 Haushaltsinterviews realisiert werden, von denen 800 vollständig waren und in die Auswertung eingingen.
Die Ausfallquoten von jeweils ca. 50% bei den Screeninginterviews und bei den Hauptinterviews bewegen sich in einem für eine Haushaltsstichprobe akzeptablen Rahmen. Hinsichtlich der Repräsentativität und Repräsentanz der Stichprobe konnten keine Defizite festgestellt werden. Zwar wurden die optimistischeren Prognosen für den Rücklauf auf Basis der Pretestergebnisse der Vorstudie nicht bestätigt, die Teilnahmebereitschaft kann aber dennoch als hoch bezeichnet werden und ist dem großen Einsatz der Interviewerinnen und des sie begleitenden Teams zuzuschreiben. Dies ist vor allem deshalb positiv hervorzuheben, weil ein Teil der Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen weitaus größere Probleme und Hemmungen als andere damit hat, fremden Menschen Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren.
Die nachträglich erfassten Aussagen der Interviewerinnen zur Frage, welche Haushalte oder welche von Behinderung betroffenen Frauen sich nicht an der Studie beteiligt haben, divergieren. Teilweise konnten keine spezifischen Merkmale festgestellt, teilweise aber eine Tendenz beobachtet werden, dass ältere Menschen, Menschen in sehr gehobenen und/oder Menschen in schwierigen Wohnverhältnissen und prekären sozialen Lagen sowie vereinzelt auch Menschen mit Migrationshintergrund häufiger abgelehnt hätten. Dies entspricht auch den generellen Erfahrungen der empirischen Sozialforschung im Rahmen repräsentativer Bevölkerungsumfragen.
Die geringe Erreichbarkeit von Frauen mit Migrationshintergrund ist zudem auch auf die nur eingeschränkte Möglichkeit fremdsprachiger Interviews und möglicherweise auch auf aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten zurückzuführen. Einige der Interviewerinnen hatten selbst einen Migrationshintergrund und konnten dadurch bei den Screeninginterviews einen Teil der Menschen mit Migrationshintergrund muttersprachlich erreichen. Außerdem bestand die Möglichkeit der Durchführung türkischer, englischer und russischer telefonischer Screeninginterviews durch das SOKO-Institut. Von dieser Möglichkeit wurde aber nur sehr selten Gebrauch gemacht, sodass Migrantinnen insgesamt, vor allem aber, wenn sie nicht oder nicht ausreichend Deutsch sprachen, in der Stichprobe unterrepräsentiert sein dürften. Ansonsten ist ein leichter Mittelschichtsbias, wie in fast allen bundesweiten und auf der Basis repräsentativer Stichproben durchgeführten Bevölkerungsbefragungen, zu vermuten.
Es gab zudem vereinzelt Hinweise darauf, dass Frauen, die durch Berufstätigkeit und/oder Mutterschaft sehr stark zeitlich eingebunden sind, sich eher nicht an der Studie beteiligten und explizit Zeit- und Belastungsgründe für ihre Ablehnung, an der Befragung teilzunehmen, nannten.
Abgesehen davon, dass ein geringer Teil der Frauen, die so starke Kommunikations- oder geistige Beeinträchtigungen haben, dass sie auch in Gebärdensprache oder mit einem vereinfachten Fragebogen nicht befragt werden konnten, ausfielen, konnten aber Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen aufgrund der gewählten Methoden und Zugänge (s. a. Kap. 2.3) sehr gut und breit erreicht werden.
Darüber hinaus gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die Gruppe der teilnehmenden Haushalte und Zielpersonen hinsichtlich der Häufigkeit des Merkmals „Weibliches Haushaltsmitglied im Alter von 16 bis 65 Jahren mit Behinderung oder chronischer Erkrankung“ systematisch von der Nichtteilnehmerinnengruppe unterscheidet, sodass die in der Stichprobe gewonnenen Erkenntnisse mit der genannten Einschränkung grundsätzlich auf die Grundgesamtheit verallgemeinert werden können. Die Repräsentativität der Befragung stützt sich zudem auf die ordnungsgemäß durchgeführte Methode der systematischen Zufallsauswahl und die hohe Aktivität beim Erreichen der Haushalte (mindestens 10 Kontakte), sodass die gewonnene Stichprobe als qualitativ hochwertig und insgesamt repräsentativ angesehen werden kann.
Auch in Bezug auf die Durchführung der Hauptinterviews wurden sowohl von den Interviewerinnen als auch vonseiten der Befragten fast durchgängig positive Rückmeldungen gegeben. Die Interviews konnten allein und ohne Störung[25] oder Einflussnahme durch Dritte durchgeführt werden. Die Inhalte der Befragung wurden von den Befragten positiv aufgenommen und führten in der Regel nicht zu Überlastungen der befragten Frauen und/oder der Interviewerinnen.
Die Interviewerinnen bewerteten in einer am Ende der Feldphase durchgeführten evaluativen Befragung der Interviewerinnen anhand eines Fragebogens die Befragungssituation fast durchgängig als sehr gut oder gut und berichteten von einer großen Offenheit und Gesprächsbereitschaft sowie einer vertrauensvollen und entspannten Atmosphäre während der Interviews. Die Aussagen der Frauen wurden fast durchgängig als zuverlässig eingeschätzt; es wurde von einer hohen Konzentration der Frauen auf die Fragen und einer sehr ernsthaften Reflexion der aktuellen und früheren Lebenssituation berichtet. Die Frauen hätten sich auch im Anschluss an das Interview oftmals positiv geäußert und angegeben, dass die Befragung auch für sie selbst eine Bereicherung und Anregung zur Reflexion gewesen sei. Entsprechende Rückmeldungen erhielt auch das Forschungsteam an der Universität Bielefeld durch nachgehende E-Mails und spontane Telefonanrufe der zuvor befragten Frauen.
In nur sehr wenigen Fällen tauchten Probleme während und nach dem Interview auf. Die Interviewerinnen berichteten vereinzelt über Partner oder Mütter, die versucht hatten, beim Interview anwesend zu sein. Dies konnte aber aufgrund der intensiven Schulung entsprechender Situationen durch Strategien der Interviewerin erfolgreich umgangen werden. Darüber hinaus wurde von einigen sehr langen Interviews berichtet, die für Interviewte und Interviewerin zur Erschöpfung führten; einige wenige Interviews wurden daraufhin unterbrochen und an einem zweiten Termin fortgesetzt.
Für die repräsentative Einrichtungsbefragung in stationären Heimen und Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe wurde zunächst eine sorgfältige und umfassende Recherche der Einrichtungen an den oben beschriebenen, per Zufallsverfahren gezogenen 20 Standorten durchgeführt. Neben einer Recherche über das bundesweite Heimverzeichnis[26] und einer zusätzlichen detaillierten Internetrecherche wurden die (potenziellen) regionalen Träger telefonisch nach weiteren, nicht im Internet oder Heimverzeichnis aufgelisteten Einrichtungen und Informationen zu den Aspekten Behinderungsart und Gesamtzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, Anteil von Frauen und Männern und Anzahl der Frauen in der Altersgruppe von 16 bis zu 65 Jahren befragt.
Ziele der Einrichtungsrecherche waren:
-
zu prüfen, ob und welche Einrichtungen der Behindertenhilfe an den Standorten der Vor- und Hauptuntersuchung existieren, in denen Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen dauerhaft leben;
-
zu klären, welche Gruppen von behinderten Frauen über die entsprechenden Einrichtungen erreicht werden können;
-
die quantitative Verteilung von Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Geschlecht in den Einrichtungen als Basis für die Zufallsauswahl von Befragten nach Einrichtung zu ermitteln;
-
einzuschätzen, ob die Infrastruktur an den ausgewählten Standorten ein der Wirklichkeit der Einrichtungsstruktur der Behindertenhilfe in Deutschland entsprechendes realistisches Abbild darstellt.[27]
Aufgenommen wurden alle Einrichtungen der Behindertenhilfe, in denen Menschen langfristig und dauerhaft leben; Altenheime und Kinder- und Jugendheime wurden dann einbezogen, wenn dort nach Angaben der Einrichtungsleitung Frauen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren mit Behinderung wohnten und an dem Standort nur wenige andere Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen vorhanden waren (z.B. in einigen ländlichen Gebieten).
In mehr als der Hälfte der Einrichtungen in den Landkreisen (51%) leben Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sowie Mehrfachbehinderte. Wenn die Einrichtungen, deren Zielgruppen sowohl geistig als auch psychisch behinderte Menschen sind, dazugenommen werden, sind es zwei Drittel der Einrichtungen (66%). Weitere durchschnittlich 15% der Einrichtungen in den Landkreisen richten sich an Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, bei einem Verteilungsspektrum von 0% bis über 50% in einigen Landkreisen. Das ist auf die regional unterschiedlichen Ausgestaltungen der Infrastruktur für Behinderte zurückzuführen.[28]
Nur für 6% der Einrichtungen, in sieben der 12 Landkreise, werden Angebote für weitere spezifische Behindertengruppen genannt. Sie umfassen pro Landkreis ein bis drei Einrichtungen aus den folgenden Bereichen:
-
Wohnformen für erwachsene Menschen mit Körperbehinderungen,
-
Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf Epilepsie,
-
Einrichtungen für suchtkranke Frauen (und Männer) bzw. Drogenabhängige,
-
Einrichtungen für Wohnungslose mit Lernschwierigkeiten,
-
Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf Menschen mit Korsakow-Syndrom[29] ,
-
Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf sekundär hirngeschädigte Menschen,
-
Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf Hörschädigungen, verbunden mit zusätzlichen Behinderungen, wie leichte bis schwere Intelligenzminderung, Verhaltensauffälligkeiten, Körperbehinderungen, psychischen Behinderungen oder Autismus,
-
Einrichtungen für pflegebedürftige körperbehinderte Menschen.
Weitere 9% entfallen auf Alten- und Pflegeheime und 3% auf Kinder- und Jugendheime für unterschiedliche Behinderungsgruppen.[30]
In allen Landkreisen konnten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in stationären Einrichtungen erreicht werden, ebenso Frauen mit psychischen Behinderungen. Körperbehinderte Frauen und Frauen mit Sinnesbeeinträchtigungen konnten fast nur über die Haushalts- und die Zusatzbefragung erreicht werden, weil in den ausgewählten Landkreisen keine Wohnheime oder Wohngruppen für diese Behindertengruppen angesiedelt waren und diese Befragungsgruppen auch überwiegend in privaten Haushalten leben.
Die Wohnangebote in den Städten sind in Bezug auf ihre Adressatinnen und Adressaten vielfältiger als die in den Landkreisen. So bilden zwar auch dort Wohnheime und Wohngruppen für Menschen mit sogenannter geistiger (und zusätzlich psychischer) Behinderung mit einem Anteil von 54% an allen Angeboten einen Schwerpunkt, allerdings werden häufiger auch andere Einrichtungstypen bereitgestellt. 18% der Wohnheime/Wohngruppen in den untersuchten Städten gehören zum Angebot der psychiatrischen Versorgung chronisch psychisch erkrankter und behinderter Menschen, gegenüber 14% in den Landkreisen. Außerdem sind durchschnittlich 12% der Angebote an spezifische Behindertengruppen gerichtet, gegenüber 7% in den Landkreisen. Dabei reicht die Bandbreite von keinem Angebot in einer Stadt bis zu jeweils 15% in zwei Städten.
Die Einrichtungen in den Städten mit einem auf weitere spezifische Behindertengruppen spezialisierten Wohnangebot werden hier nicht einzeln aufgeführt, sondern nach Behindertengruppen geordnet. Gesichtet wurden spezifische Wohnangebote für:
-
Blinde – fünf Einrichtungen in vier Städten;
-
Gehörlose und Taubblinde (gehörlos und blind) – je eine Einrichtung in zwei Städten und sieben Einrichtungen in einer Großstadt;
-
Körperbehinderte (häufig gleichzeitig auch für Menschen mit multipler Sklerose, Mehrfachbehinderungen, Pflegebedürftigkeit oder Anfallsleiden) – 34 Einrichtungen in sechs Städten/Regionen;
-
Suchtabhängige (Drogen und Alkohol) – 11 Einrichtungen in drei Städten;
-
Menschen mit Autismus – fünf Einrichtungen in zwei Städten/Regionen;
-
ausschließlich Menschen mit multipler Sklerose – eine Einrichtung in einer Stadt.
An jedem Standort sollten 25 Interviews mit Frauen in Einrichtungen der Behindertenhilfe geführt werden, um die anvisierte Fallzahl zu erreichen. Auf der Grundlage der Einrichtungslisten wurde eine Zufallsziehung der Einrichtungen und der Anzahl der dort zu befragenden Frauen vorgenommen. Die Zufallsauswahl und Anzahl der in einer Einrichtung zu befragenden Bewohnerinnen orientierte sich an der Zahl der in der Einrichtung lebenden Menschen und an der Anzahl der Einrichtungen pro Standort. Sie sollte gewährleisten, dass jede Frau, die an dem Ort in einer Einrichtung lebt, dieselbe Chance erhält, ein Interview zu geben, unabhängig von der Art der Einrichtung. Damit sollte ein proportionales Abbild der Verteilung der in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebenden Frauen generiert werden.[31] Die an der Platz- und Einrichtungszahl orientierte Zufallsauswahl der 25 potenziellen Interviewpartnerinnen pro Standort führte dazu, dass in Großstädten in der Tendenz jeweils nur eine Frau pro Einrichtung und in vielen Einrichtungen keine Person ausgewählt wurde, während in ländlicheren Regionen oder Städten mit einer geringen Anzahl an Wohneinrichtungen teilweise 2 bis 6 oder auch mehr Frauen pro Einrichtung in die Befragung einzubeziehen waren.
323 zufällig ausgewählte Einrichtungen (aus einem Pool von 1.114 recherchierten Einrichtungen an 20 Standorten) wurden telefonisch kontaktiert und mithilfe intensiver Überzeugungsarbeit um die Auswahl und Vermittlung der insgesamt 500 Interviewpartnerinnen gebeten. In der Regel wurden zunächst die Leitungen der Einrichtungen angerufen und persönlich informiert. Ergänzend wurde ein Schreiben verschickt mit allgemeinen Informationen zur Studie, zum Auswahlverfahren und zu den Formalia für die Rückmeldung der potenziellen Interviewpartnerinnen. Auch die Interviewpartnerinnen selbst bzw. deren Eltern oder gesetzlichen Vertretungen erhielten bei Bedarf ein Schreiben mit Informationen zur Studie.
Zur Gewährleistung des Zufallsprinzips bei der Auswahl der Frauen diente der Geburtstag als Auswahlkriterium. Die Ansprechpersonen in den Einrichtungen wurden gebeten, diejenigen Frauen zu fragen, ob sie an dem Interview teilnehmen wollten, die vom Tag des Kontaktes mit der Einrichtung an als Nächste Geburtstag hatten, und diese an uns zu vermitteln.
Wenn die ausgewählte Frau aufgrund der Schwere ihrer Behinderung kein Interview geben konnte, sollte die Frau, die danach Geburtstag hatte, gefragt werden. Falls eine Bewohnerin ablehnte, ein Interview zu geben, sollte wiederum die Bewohnerin, die danach Geburtstag hatte, gefragt werden. Die Entscheidung, ob eine Frau aufgrund ihrer Behinderung nicht befragt werden konnte, trafen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen. Sie wurden im ersten Kontakt jedoch darüber informiert, dass die Interviewerinnen geschult sind, auf behinderungsspezifische Bedarfe einzugehen und auch Interviews in leichter Sprache durchzuführen. Unsicher waren einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – insbesondere in Einrichtungen für sogenannte geistig behinderte Menschen –, inwieweit eine Frau aufgrund ihrer starken intellektuellen und psychischen Beeinträchtigung überhaupt ein Interview geben konnte. Ein behinderungsbedingter Ausfall trat beispielsweise ein, wenn eine Frau aufgrund einer sogenannten geistigen (oder körperlichen) Behinderung nicht in der Lage war zu kommunizieren (ausgenommen Frauen, die in Gebärdensprache und in vereinfachter Sprache befragt werden konnten oder über andere Zeichen – Kopfnicken/-schütteln – kommunizieren konnten) oder wenn die Frau aufgrund der Art der psychischen Erkrankung (z.B. psychotische/schizophrene Erkrankungen) durch ein Interview in ihrer psychischen Stabilität gefährdet werden konnte (zu den Grenzen der Befragbarkeit in vereinfachter Sprache siehe auch 2.5.2). Zumeist ergaben sich bei der Ansprache der Einrichtungen erhebliche Verzögerungen, da die meisten Einrichtungen mehrfach kontaktiert werden mussten, bis sie die Zielperson bzw. die Zielpersonen erreicht und das Vorhaben der Studie vermittelt hatten.
Die Kooperation der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und Leitungskräfte in den Einrichtungen war aber mehrheitlich sehr gut. Die meisten waren bereit, die Studie zu unterstützen, indem sie die ausgewählte Frau fragten, Termine koordinierten und die Phase des Kennenlernens begleiteten. Einige unterstützten die Studie ausdrücklich wegen ihrer behinderten- und frauenpolitischen Bedeutung. Einrichtungen, die anfänglich nicht kooperieren wollten bzw. die Zusammenarbeit offen verweigerten, führten in der Regel folgende Gründe dafür an:
-
Sie beteiligten sich grundsätzlich nicht an Befragungen oder Erhebungen.
-
Sie würden wegen des Datenschutzes die Daten der Frauen nicht mitteilen. Auch der Hinweis, dass wir keine Namen benötigten, sondern mit Codenummern arbeiteten, konnte teilweise nicht überzeugen.
-
Alle Bewohnerinnen in der Einrichtung seien aufgrund ihrer Behinderung der Befragung nicht gewachsen, sie könnten das nicht oder würden durch das Interview gefährdet, z.B. indem ein erneuter psychotischer/schizophrener Schub ausgelöst würde (möglicherweise sogar allein durch die Tatsache, dass jemand von außen komme und Fragen stelle).
-
Der Arbeitsaufwand sei zu hoch; es fehle an Personal, um die Unterstützung zu leisten.
Einzelne Einrichtungen verschlossen sich gänzlich einem Außenkontakt, indem sich die Leitungen über Monate hinweg trotz zahlreich wiederholter telefonischer und schriftlicher Anfragen verleugnen ließen. Nur wenige Einrichtungen wollten ihre Unterstützung davon abhängig machen, dass sie vorab den Fragebogen erhielten. Das wurde jeweils mit Hinweis darauf, dass das Interview und seine Inhalte vertraulich sind, abgelehnt. Allenfalls wurde ein stark verallgemeinerter Überblick über die Themen der Befragung in wenigen Einzelfällen weitergegeben. Eine Nachbereitung des Interviews mit der Einrichtung, die von wenigen gefordert wurde, wurde strikt abgelehnt, ebenfalls mit dem Hinweis auf den Datenschutz und die den Interviewpartnerinnen zugesicherte Verschwiegenheit. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Trägervertretungen konnten schließlich überzeugt werden, die Studie zu unterstützen, einige mit Unterstützung ihrer Vorstände oder Bundesverbände.
Nachdem die Leitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen die Kontaktdaten der Interviewpartnerinnen und Betreuungspersonen zur Kontaktaufnahme gemeldet hatten, wurden diese dokumentiert und an die Interviewerinnen an den Standorten weitervermittelt. Insgesamt wurden so 420 Einrichtungsinterviews durchgeführt, exklusive der wenigen Interviews, die aufgrund der Behinderung von den Interviewten oder von den Interviewerinnen abgebrochen bzw. beendet werden mussten. Die Interviews fanden in den Wohneinrichtungen und in Werkstätten für behinderte Menschen statt.
Die Rückmeldungen der Interviewerinnen waren sehr positiv. In den meisten Interviews konnte ein guter Kontakt hergestellt werden, der sowohl von der Interviewerin als auch von der Befragten als bereichernd erlebt wurde. Die Mehrheit der Interviewerinnen berichtete, dass die Befragten hoch motiviert waren und gerne antworteten. In manchen Fällen musste das Interview mit Pausen oder an zwei Terminen durchgeführt werden, weil sich die Befragte nicht so lange konzentrieren konnte. In wenigen Fällen wurde das Interview abgebrochen, weil sich herausstellte, dass aufgrund der Schwere der Behinderung eine Kommunikation nicht möglich war bzw. die Frau nicht auf die Fragen reagieren konnte oder die Fragen nicht verstand. Die Interviewerin versuchte in diesen Fällen, einen sensiblen Abschluss und langsamen Ausklang des Interviewgesprächs zu erreichen, ohne den Frauen das Gefühl zu geben, versagt zu haben. Die Anforderung, das Interview allein und ungestört und in Abwesenheit Dritter durchzuführen, konnte fast durchgängig erfüllt werden.
Da blinde, gehörlose und schwerstkörper-/mehrfachbehinderte Frauen auch aufgrund ihres geringeren Anteils innerhalb der Gruppen der Frauen mit Behinderungen, über die repräsentativen Zugänge der Haushalts- und Einrichtungsbefragung nicht in ausreichend hoher Anzahl erreicht werden können, wie auch die Vorstudie gezeigt hatte, sollten Frauen dieser Gruppen anhand von Zusatzstichproben über einen dritten Zugang gewonnen werden.
Für die Zusatzbefragungen war zunächst ebenfalls, wie in der Haushalts- und Einrichtungsbefragung, ein repräsentativer Zugang über Versorgungsämter an den 20 Standorten geplant, der aber letztlich einen zu geringen Rücklauf erbrachte und durch weitere Zugänge ergänzt werden musste.
Über die Versorgungsämter sollten jeweils 200 blinde, 200 gehörlose und 200 schwerstkörper- oder mehrfachbehinderte Frauen für ein Interview gewonnen werden. Ziel war, an jedem der 20 Untersuchungsstandorte Interviews mit jeweils 10 blinden und hochgradig sehbehinderten, 10 gehörlosen und stark hörbehinderten und 10 schwerstkörper-/mehrfachbehinderten Frauen durchzuführen.
Da ein Rücklauf über den Zugang der Versorgungsämter von mindestens 30% seitens ausgewiesener Expertinnen und Experten als realistisch eingestuft wurde, wurden die für den jeweiligen Standort zuständigen Versorgungsämter gebeten, die dreifache Menge an Auswahlpersonen zu ziehen und diesen ein von uns vorgefertigtes Anschreiben zukommen zu lassen. An jedem der Befragungsstandorte sollten damit insgesamt 90 Briefe an behinderte Frauen versendet werden.
Nach Beratung und Absprache mit den Versorgungsämtern und einigen in die Thematik eingearbeiteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden für die Ziehung der Stichproben folgende Suchkriterien festgelegt:
-
Geschlecht: weiblich,
-
Geburtsjahrgänge: 1945 bis 1994,
-
Gruppe 1: Merkzeichen „Bl“ (blind) oder hochgradige Sehbehinderung (S-Zahl 22), Gesamt-GdB größer 70,
-
Gruppe 2: Merkzeichen „Gl“ (gehörlos) oder Schwerhörigkeit (S-Zahl 27), Gesamt-GdB größer 70,
-
Gruppe 3: Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) oder Mz. „H“ (Hilflosigkeit) und Gesamt-GdB größer 70.
In Absprache mit den Versorgungsämtern wurde folgende Vorgehensweise als datenschutzrechtlich unbedenklicher und praktikabler Weg angesehen: Die Versorgungsämter zogen selbst die Adressen nach einem Zufallsverfahren und ließen den Frauen die von dem Forschungsteam vorbereiteten Briefe zukommen.[32] Sie legten den Briefen ein eigenes Anschreiben bei, in dem betont wurde, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig sei und keinerlei Daten oder Adressen durch die Versorgungsämter an das Forschungskonsortium weitergegeben würden bzw. kein Datenaustausch zwischen der Universität Bielefeld und dem Versorgungsamt erfolgen würde (Anschreiben siehe Anhang).
Der Rücklauf für diesen Untersuchungsteil stellte sich jedoch als erheblich schlechter dar, als auf der Basis bisheriger Forschungserfahrungen zur Gewinnung von Interviewpartnerinnen über die Versorgungsämter anzunehmen war. Dies kann auch in hohem Maße auf die Art und Schwere der Behinderungen der Zielgruppen zurückzuführen sein, die über diesen Zugang erreicht werden sollten. So könnte es sein, dass ein Teil der angeschriebenen schwerst-/mehrfachbehinderten Frauen nur schwer verbal kommunizieren und/oder auf ein Anschreiben nicht selbstständig reagieren und mit uns in Kontakt treten konnte. Von den anvisierten 600 Interviews über die Versorgungsämter konnten schließlich nur 79 realisiert werden. Ungefähr die Hälfte dieser Frauen hatte eine Sehbehinderung oder war vollblind, ein Viertel der Frauen war körper-/mehrfachbehindert und die übrigen Frauen sprech- oder hörbehindert; eine Frau hatte eine sogenannte geistige Behinderung.
Bei den Frauen, die sich über das Anschreiben der Versorgungsämter gemeldet hatten, bestand insgesamt ein großes Interesse an der Studie, die von diesen sehr befürwortet wurde. Einzelne Frauen wollten sich über die Studie erkundigen und waren zunächst skeptisch, ließen sich aber überzeugen, dass es sich um eine seriöse und wichtige Untersuchung handelt, und waren bereit, ein Interview zu geben. Teilweise bestand bereits beim ersten Telefonkontakt ein großes Bedürfnis, die eigene Lebenssituation zu erläutern und auf Schwierigkeiten und eigene Lebensprobleme hinzuweisen. Einzelne Anrufe zur Teilnahmebereitschaft kamen von den Angehörigen der Frauen, z.B. bei gehörlosen Frauen oder Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen. Insbesondere bei Letzteren waren die Angehörigen teilweise nur schwer oder gar nicht davon zu überzeugen, dass das Interview in Abwesenheit von Dritten durchgeführt werden kann, weil sie z.B. befürchteten, dass die Tochter nicht die „richtigen“ Antworten gibt. Daher konnten einzelne dieser Interviews nicht durchgeführt werden.
Da der Rücklauf der Interviews über die Versorgungsämter wesentlich geringer ausfiel als erwartet, wurde versucht, die Zielgruppen der blinden, gehörlosen und schwerstkörper-/mehrfachbehinderten Frauen, insbesondere auch Rollstuhlfahrerinnen, über Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren, Verbände und Medien zu erreichen. Dazu wurden behinderungsspezifische Bundes- und Landesverbände, regionale Netzwerke und Vereine, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, Bildungszentren, Selbsthilfeorganisationen, ambulante Betreuungs- und Beratungsstellen sowie Treffs, aber auch frauenspezifische Netzwerke und Vereine telefonisch kontaktiert und angeschrieben. Die Forschungsgruppe wendete sich an die entsprechenden Ansprechpersonen der Organisationen mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach Interviewpartnerinnen, z.B. indem ein Aufruf zur Teilnahme an der Studie mit Kontaktinformationen über Mailverteiler und persönliche Kontakte bekannt gemacht wurde. Darüber hinaus wurden Aufrufe in behinderungsspezifischen Fachzeitschriften und Newslettern veröffentlicht. Sowohl bei den Organisationen als auch bei den Redaktionen der Zeitschriften und Newsletter war eine große Unterstützung und Befürwortung der Studie gegeben. In ländlichen Gebieten mit geringerer behinderungsspezifischer Infrastruktur und Vernetzungsdichte wurden zusätzlich kurze Berichte mit einem Aufruf in regionalen Zeitungen veröffentlicht. Zwar wurden gezielt die Regionen angesprochen, in denen die Standorte der Haushalts- und Einrichtungsbefragung lagen. Da einige Verbreitungen aber auch bundesweit stattfanden, erhielten wir Rückmeldungen von Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet.
In der Regel wurde in den Interviews zusammen mit dem Fragebogen ein Listenheft mit Antwortvorgaben verwendet, das die Interviewerin der Befragten vorlegte, sodass diese insbesondere bei den Gewaltfragen nur den Kennbuchstaben der Antwortvorgabe (z.B. A, B, C) nennen und nicht die Gewalthandlung selbst benennen musste. Während die körperbehinderten Frauen mit dem allgemeinen Fragebogen auf die gleiche Weise befragt wurden wie die Frauen der Haushalts- und Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache, musste für die blinden Frauen entschieden werden, ob das Listenheft zum Fragebogen in Braille übersetzt werden sollte oder ob die Antwortvorgaben den Frauen langsam vorgelesen wurden. Auf der Basis von Gesprächen mit Expertinnen und Experten, die selbst blind sind, und Testinterviews mit vorgelesenen Antwortvorgaben wurde entschieden, auf eine Übersetzung zu verzichten und stattdessen die Listen langsam vorzulesen, bis die Befragte „Stopp“ oder „Ja“ sagte, da einerseits nicht alle blinden Frauen die Braille-Schrift beherrschen und andererseits die Listenhefte in Braille und der Umgang damit im Rahmen der Interviews sehr komplex geworden wäre und u.U. sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen hätte. Nach den ersten Interviews mit blinden Frauen wurde eine Befragung der Interviewerinnen zum Verlauf der Interviews durchgeführt, um zu prüfen, ob das Vorlesen negative Auswirkungen auf den Interviewverlauf hatte oder den blinden Frauen unangenehm war. Die Rückmeldungen zu diesem Vorgehen waren jedoch positiv, sodass diese Methode auch in den weiteren Interviews erfolgreich angewendet wurde. Allerdings erhielten die Interviewerinnen, die blinde Frauen befragen sollten, zuvor eine spezifische Einweisung, um einerseits einen sicheren und möglichst unkomplizierten Umgang mit blinden Frauen zu gewährleisten und andererseits das Vorlesen und die Abfrage der Listen so zu gestalten, dass für die Befragte die Beantwortung möglichst leicht war.
Die Befragung von gehörlosen Frauen wurde in enger Zusammenarbeit und in fachlichem Austausch mit dem Deutschen Gehörlosen-Bund, dem Gebärdenwerk Hamburg und versierten gehörlosen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Prof. Christian Rathmann, Sabine Fries und Bettina Herrmann entwickelt. Die Ausführungen in diesem Kapitelabschnitt beruhen zu großen Teilen auf einem Methodenbericht von Sabine Fries von der HU Berlin, die die Interviews und deren Methodik mit vorbereitete und die Befragung durch die gehörlosen Interviewerinnen koordinierte.
Der Anteil gehörloser Menschen an der Bevölkerung wird auf ca. eine auf tausend Personen der Gesamtbevölkerung geschätzt. In der Bundesrepublik leben demnach ca. 80.000 gehörlose Frauen und Männer. Für die meisten von ihnen ist die Deutsche Gebärdensprache das bevorzugte Kommunikationsmittel. Die deutsche Sprache in schriftlicher und womöglich auch in ihrer gesprochenen Form hat für die meisten gehörlosen Menschen den Status einer zweiten Sprache. Viele Gehörlose haben Schwierigkeiten, sich schriftlich mitzuteilen und geschriebene Texte inhaltlich zu verstehen. Das liegt daran, dass die Grammatiken der Schrift- und der Gebärdensprache verschieden sind und die Schriftsprache für Gehörlose mit einer Fremdsprache vergleichbar ist. Daher ist der Schriftsprachwortschatz bei Gehörlosen weniger umfangreich und der Satzbau entspricht oft nicht den grammatischen Regeln der deutschen Schriftsprache.
Die Gehörlosengemeinschaft ist traditionell sehr engmaschig organisiert, fast jede zweite gehörlose Person ist Mitglied in einem Gehörlosenverein oder Gehörlosenverband. Der Deutsche Gehörlosen-Bund als Dachorganisation vieler Gehörlosenvereine verfügt über ca. 30.000 Mitglieder. Demzufolge ist auch der Bekanntheitsgrad innerhalb der Gehörlosengemeinschaft sehr hoch. Die bereits durch den gemeinsamen Schulbesuch geknüpften Verbindungen setzen sich in den Vereinen, dem Besuch gemeinsamer Veranstaltungen oder Großveranstaltungen wie dem Berliner Gebärdensprachfestival[33] oder den Kulturtagen[34] der Gehörlosen fort. Eheschließungen und Familiengründungen finden vorwiegend innerhalb der Gehörlosengemeinschaft statt (Gotthardt-Pfeiff 1991), wie auch die vorliegende Studie aufzeigen konnte (vgl. Kap. 4.1.2).
Im gesellschaftlichen Zusammenleben macht sich Gehörlosigkeit als Behinderung primär in kommunikativen Zusammenhängen bemerkbar. Das gilt vor allem für das Verstehen von und Sich-verständlich-Machen in gesprochener Sprache, da Gehörlose oft nur einige Wörter von dem verstehen, was Hörende sagen. Hier handelt es sich oft um ein ,rekonstruierendes Verstehen‘: „Ein vager Vorgang der Sinnerschließung, der seinen Ausgang von einzelnen fragmentarisch wahrgenommenen sprachlichen Elementen nimmt und auf dem Abwägen von Möglichkeiten vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontext- und Weltwissens oder auch schlichtem Raten beruht“ (Ebbinghaus/Heßmann 1989: 115).
Den besonderen kommunikativen Bedürfnissen gehörloser Menschen Rechnung zu tragen, war eines der Hauptanliegen bei der Befragung gehörloser Frauen im Zusammenhang der vorliegenden Studie. Die Befragung sollte nicht nur in der Erst- bzw. Muttersprache dieser Zielgruppe erfolgen, sondern darüber hinaus auch von gehörlosen Frauen als Angehörige dieser besonderen Sprachgemeinschaft durchgeführt werden. Damit sollte auch ein mögliches Macht- und Kommunikationsgefälle zwischen Interviewerin und Befragter vermieden werden, welches die Aufdeckung von Gewalt erschweren kann.
Um gehörlose Frauen als Interviewpartnerinnen überhaupt zu erreichen und sie darüber hinaus für die Teilnahme an dieser Studie zu gewinnen, erfolgten im Vorfeld Aufrufe auf den beiden in der deutschen Gehörlosengemeinschaft bekanntesten Internetseiten, dem Taubenschlag[35] und der Homepage des Deutschen Gehörlosen-Bundes[36] . Parallel dazu wurden geeignete Interviewerinnen gesucht. Für eine direkte Befragung in Deutscher Gebärdensprache wurden gehörlose Frauen ausgewählt, die auch in ihrer Zweitsprache, der Schriftsprache Deutsch, über eine hohe Kompetenz verfügen. In die engere Wahl der Bewerberinnen kamen solche Frauen, die über vergleichsweise hohe Bildungsabschlüsse, eine hohe soziale Kompetenz und solide sprachliche Kenntnisse sowohl in Deutscher Gebärdensprache als auch in deutscher Schriftsprache verfügen. Die meisten der sieben ausgewählten gehörlosen Interviewerinnen sind gut ausgebildete Gebärdensprachdozentinnen mit einem staatlich anerkannten bzw. geprüften Abschluss. Alle Interviewerinnen sind darüber hinaus in besonderem Maß sozial engagiert und verfügen von daher über einen vergleichsweise hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der Gehörlosengemeinschaft, ein erschwerender Umstand bei der Verteilung der Interviewpartnerinnen.
Jede der Interviewerinnen führte vor der eigentlichen Feldphase mindestens ein Testinterview durch, um sich mit der Fragepraxis, aber auch mit der zweisprachigen Fragemodalität (Deutsch auf dem Fragebogen, Deutsche Gebärdensprache beim mündlichen Interview, dann wieder Deutsch bei den Antwortangaben) vertraut zu machen. Rückgemeldet wurde hier u.a., dass anfangs zu schnell gebärdet wurde – das taten einige Interviewerinnen zu Beginn der Interviewphase aus Sorge darum, dass das Interview sonst zu lange gedauert hätte. Insgesamt zeigte sich jedoch, dass über die Modifikation des Fragebogens (siehe Abschnitt 2.5.3) die Interviewzeit bei der Befragungsgruppe der gehörlosen Frauen in etwa gleich mit der der hörenden Befragten der Studie war.
Die Feldphase der Befragung gehörloser Frauen lief aus zwei Gründen zunächst langsam an. Zum einen gestaltete sich die Kontaktaufnahme langwieriger, da anders als bei der Kontaktaufnahme hörender Frauen miteinander hier vielfach keine direkte Telekommunikation möglich ist. Die gehörlosen Interviewerinnen stellten überwiegend den Kontakt durch E-Mails oder SMS-Kurznachrichten, in selteneren Fällen auch per Fax her und mussten dann zunächst die Rückantwort abwarten. Diese erfolgte oft nicht zeitnah, manche Interviewpartnerinnen reagierten erst nach weiteren „Erinnerungsmails“, einige überhaupt nicht. Dies führte insgesamt zu einer Ausweitung der Feldzeit. Als ein weiteres Problem bei der Kontaktaufnahme stellte sich die Tatsache dar, dass Anonymität in der Gehörlosengemeinschaft sehr schwer zu wahren ist, da „jede bzw. jeder jede bzw. jeden kennt“ und aufgrund von Antworten, Wohnort und Informationen zur Person schnell Rückschlüsse auf die betreffende Person gezogen werden können. Die Interviewerin kann in einer solchen Situation möglicherweise keine neutrale Position beziehen, wenn sie die Befragte kennt bzw. von anderen etwas über diese Person erfahren hat und umgekehrt kann es für die Befragte ungünstig sein, da die Anonymität für die Offenheit im Interview zumeist die Voraussetzung ist. Hinzu kam der hohe Bekanntheitsgrad einiger Interviewerinnen innerhalb der Gehörlosengemeinschaft. Auch wenn die Interviewerinnen ihre Interviewpartnerinnen nicht kannten, konnten die Interviewerinnen den zu befragenden Frauen aufgrund ihrer herausgehobenen Rolle in der Gehörlosengemeinschaft bekannt sein. Um zumindest für die Befragten eine größtmögliche Anonymität und vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen, wurden Interviewpartnerinnen, die einer Interviewerin bekannt waren, an andere Interviewerinnen vermittelt. Um eine möglichst hohe Fallzahl an Interviews zu erreichen, wurden abgesagte Interviews durch neue ersetzt. Die Interviewerinnen unternahmen weitere Aktivitäten, um Befragte zu gewinnen, und konnten schließlich 76 Interviews in Deutscher Gebärdensprache realisieren.
Die meisten Interviews fanden in privaten Haushalten statt, in einigen Fällen bevorzugten die Interviewpartnerinnen einen anderen neutralen Ort, zum Beispiel ein Café oder einen Park für das Interview. In der Regel waren es Gespräche unter vier Augen; in sehr seltenen Fällen gab es Schwierigkeiten, die Lebenspartnerin bzw. den Lebenspartner oder Dritte aus der Interviewsituation vollständig herauszuhalten. Meistens gaben die Interviewerinnen an, dass sich Interviewpartnerinnen ihnen gegenüber sehr offen gezeigt und bereitwillig die Fragen beantwortet haben. Interviews, in denen von Gewalterfahrungen berichtet wurde, wurden teilweise als „belastend“ bis „sehr schwer zu verarbeiten“ empfunden. Es gibt kaum geeignete Anlaufstellen für gehörlose, von Gewalt betroffene Frauen und die Interviewerinnen fühlten sich zum Teil „nicht gut“, hier nur auf Broschüren (Selbsthilfegruppe gehörloser Frauen in Münster 2006) oder die DVD „Häusliche Gewalt ist nie in Ordnung“ (BIG Koordinierung 2010) verweisen zu können. Dass es ausschließlich gehörlose Frauen waren, welche die Interviews durchgeführt haben, wurde von den Interviewpartnerinnen als großes Plus gewertet.
Die Interviewerinnen hatten nach Beendigung der Feldphase Gelegenheit, ihre Erfahrungen und Rückmeldungen anhand eines schriftlichen Evaluationsbogens mitzuteilen. Insgesamt überwog die Meinung, dass es sich um ein wichtiges Projekt gehandelt hat. Gehörlose Menschen sind als Gegenstand der Forschung in der Regel in Zusammenhang mit der Erfassung gebärdensprachlicher Daten für sprachwissenschaftliche Analysen interessant. Befragungen oder Datenerhebungen, die sich mit konkreten Lebenssituationen, Gesundheit und Belastungen Gehörloser auseinandersetzen, sind auch in internationalen Studien vergleichsweise selten. In Deutschland hat es zwei detaillierte und intensive, allerdings schriftliche Befragungen, in deren Mittelpunkt gehörlose Frauen[37] stehen, zuletzt 1991 und 1995 gegeben (Deutscher Gehörlosen-Bund 1996; Gotthardt-Pfeiff 1991). Die Befragungsmodalität durch geschulte gehörlose Interviewerinnen in einer Face-to-Face-Gesprächssituation in Deutscher Gebärdensprache hat es allerdings vor dieser aktuellen Studie in Deutschland nicht gegeben. Auch in internationalen Befragungen Gehörloser stellt die Aufbereitung und Übersetzung des Fragebogens in die Gebärdensprache sowie die zweisprachige Form der Befragung offensichtlich ein Novum dar (Anderson et al. 2011). Die Methode selbst wurde von den Interviewerinnen überwiegend mit „eher gut“ eingeschätzt.
Nachfragen ergaben, dass hier oft die Länge der Befragung als bedenklich gewertet wurde. Die befragten Frauen zeigten spätestens im letzten Drittel des Interviews Ermüdungserscheinungen und auch für die Interviewerinnen selbst war diese Methode des zweisprachigen Arbeitens anstrengend. Die Interviewerinnen betonten jedoch zugleich, dass sie dank ihrer guten Deutschkompetenz keine Schwierigkeiten mit der Übersetzung der Fragen in die DGS hatten, und bewerteten diese Aufgabe als „sehr leicht“ bis „leicht“. Insgesamt schätzten die teilnehmenden Interviewerinnen ihre Tätigkeit als sehr positiv (Note 1–2) ein. Dass die anvisierte Zahl von über 70 Interviews erreicht werden konnte, ist auch der großen persönlichen Motivation vieler Interviewerinnen zu verdanken. Die hohe Aufdeckung von Gewalt vor allem auch bei dieser Befragungsgruppe (vgl. Kap. 4) spricht ebenfalls dafür, dass ein entsprechend sensibler und vertrauensvoller Zugang im Rahmen der gebärdensprachlichen Interviews geschaffen werden konnte. Hierzu trug auch die intensive Schulung der Interviewerinnen in der Übersetzung des Fragebogens in DGS und in der Rückübersetzung in die deutsche Schriftsprache bei (siehe 2.4) sowie die Standardisierung des Interviews durch ein Gebärdensprachvideo, das zu Schulungswecken eingesetzt wurde.
Um eine hochwertige Befragung in einem sensiblen Themen- und Kontextbezug zu garantieren, wurden die Interviewerinnen der repräsentativen Haupt- und der nichtrepräsentativen Zusatzbefragung auf der Basis der Erfahrungen der Vorstudie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsteams sorgfältig ausgewählt, intensiv geschult und während der Feldphase betreut.
Die Interviewerinnen sollten einerseits ein Verständnis für sozialwissenschaftliche Grundlagen sowie für die Durchführung strukturierter Interviews mitbringen. Darüber hinaus waren ein offener und unbefangener Umgang und/oder eine eigene Behinderung bzw. Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen wichtig. Es sollten weder Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderungen noch gegenüber dem Thema „Gewalt“ bestehen. Um eine Beeinflussung durch bereits bestehende Problemeinschätzungen, z.B. aufgrund von Berufserfahrung, zu vermeiden, sollten die Interviewerinnen jedoch nicht bereits zu stark in dem Bereich der Lobbyarbeit oder Behindertenhilfe involviert sein. Teilweise wurden entsprechende Vorerfahrungen, die möglicherweise die Befragung beeinflussen könnten, gemeinsam mit der Projektleitung reflektiert, um eine wirklich offene Herangehensweise an jede einzelne Interviewpartnerin zu ermöglichen. Weitere Kriterien waren eine hohe kommunikative Kompetenz sowie ein zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten und seriöses, selbstbewusstes und gleichzeitig engagiertes und unaufdringliches Auftreten. Zudem mussten die Interviewerinnen in Habitus, Sprache/Dialekt und Auftreten zu den Bewohnerinnen des jeweiligen Befragungsgebietes kompatibel sein. Sie sollten möglichst über 30 alt sein und mussten eine umfassende Mobilität und zeitliche Flexibilität bei hoher zeitlicher Verfügbarkeit für das Projekt (teilweise ca. 20–30 Stunden pro Woche) aufweisen. Insbesondere für die Hauptinterviews wurde als wichtig erachtet, dass die Interviewerin sehr präsent und aufmerksam ist und die Befragten sicher durch das Interview führen kann, mit hoher Sensibilität und Interesse für die Interviewpartnerin, ohne jedoch aufdringlich und distanzlos zu sein.
Für die Suche nach geeigneten Interviewerinnen wurde vonseiten der Universität Bielefeld Kontakt zu vielfältigen Einrichtungen und Institutionen aufgenommen. Angesprochen wurden unter anderem Gleichstellungsbeauftragte, Fachhochschulen und Universitäten, Kontaktpersonen aus der Sozialarbeit, aus Arbeitsagenturen sowie beruflichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen. Darüber hinaus wurden Zeitungsanzeigen geschaltet und es wurden eigene Kontakte zu Fachkräften sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der jeweiligen Regionen genutzt. Ausgewählte Institutionen und Einzelpersonen wurden telefonisch kontaktiert und im Anschluss angeschrieben, um entsprechende persönliche Empfehlungen und Kontakte zu geeigneten Interviewerinnen zu erhalten. Um eine hohe Qualität der sensiblen Befragung zu gewährleisten, erfolgte die Auswahl der Interviewerinnen durchgängig über das wissenschaftliche Forschungsteam der Universität Bielefeld.
Der Interviewerinnenstab setzte sich zu einem überwiegenden Anteil aus Frauen mit einem abgeschlossenen Studium, in den meisten Fällen im pädagogischen Bereich, in einigen Fällen auch aus dem Bereich der Psychologie oder Sozialwissenschaft zusammen. Nur einzelne Frauen waren noch im Studium. Die Interviewerinnen ohne Studienabschluss hatten Ausbildungen und/oder Berufserfahrung in sozialen, pädagogischen, medizinischen oder psychotherapeutischen Feldern. Alle Interviewerinnen hatten ein besonderes Interesse an oder erste Erfahrungen in den Arbeitsbereichen Gewalt gegen Frauen oder Behinderung. Die Frauen waren überwiegend zwischen 30 und 50 Jahre alt, einzelne Interviewerinnen etwas jünger oder älter. Die Interviewerinnen hatten zum Teil bereits Befragungserfahrungen aus anderen Interviewstudien. Zur Auswahl der Gebärdensprachen-Interviewerinnen siehe 2.3.3.
Die Interviewerinnen wurden intensiv geschult, zum einen in 2-tägigen zentralen Grundschulungen und zum anderen in dezentralen weiterführenden Nachschulungen.
Zusätzlich zur Einführung in die Studie erhielten die Interviewerinnen Überblicksinformationen zu den Themenbereichen „Frauen und Behinderung“ und „Gewalt gegen Frauen“, um mögliche bestehende Vorurteile abzubauen und einen unbefangenen Umgang mit den Betroffenen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang erfolgte auch ein Sensibilisierungstraining zum Umgang mit Frauen mit Behinderungen und mit der Gewaltproblematik, bei der auch eine Mitarbeiterin von ForUM e. V., die selbst sehbehindert ist, als Trainerin einbezogen wurde. Ziel war es, bestehende Ängste, Erwartungen, Unsicherheiten und Bedarfe aufzugreifen, die einen unbelasteten und vorurteilsfreien Umgang mit Befragten und mit den Problembereichen der Studie ermöglichen. Der Weg der Haushaltskontaktierung sowie die Screeninginterviews wurden sowohl theoretisch als auch praktisch bzw. in Rollenspielen geschult. Darüber hinaus wurde auf die generelle Haltung, das Auftreten und die Rolle der Interviewerinnen eingegangen.
Bei der Schulung zur Durchführung der Hauptinterviews ging es zunächst um die Vorbereitung und Einleitung der Interviews (z.B. mögliche Orte der Interviewdurchführung, ungestörte Atmosphäre, Abwesenheit Dritter) und den Umgang mit möglichen Störungen durch Dritte. Darüber hinaus wurde die Interviewführung, wie z.B. die Filterführung oder das Vorlesen der Fragen ohne Beeinflussungen durch bestimmte Betonungen, trainiert. Insbesondere bei den Behinderungs- und Gewaltfragen wurden die Interviewerinnen sensibilisiert, wie auf eine Weise befragt werden kann, dass sich die Befragte nicht unwohl fühlt und nicht beeinflusst wird. Eigene Hemmschwellen der Interviewerinnen wurden besprochen, so weit wie möglich abgebaut und im Verlauf der Studie supervidiert.
Die Interviewerinnen erhielten ausführliche Hinweise, wie sie das Interview mithilfe der Abschlussfragen beenden und damit schwierige Themen wieder schließen konnten. Auch der Ausklang mit einem kurzen Nachgespräch wurde geübt. Geschult wurden die Interviewerinnen darüber hinaus, um bei einem Unterstützungsbedarf der Befragten (aufgrund von Gewalterfahrungen oder im Kontext der Behinderung) im Anschluss an das Interview angemessen zu reagieren und die Vermittlung von Unterstützung[38] anzubieten. Auch das juristisch geprüfte und standardisierte Vorgehen bei der Aufdeckung akuter Gefährdung der Interviewpartnerin in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Team und der juristischen Beraterin der Studie wurde besprochen. Sowohl die Screeninginterviews und die Überzeugungsarbeit als auch die Hauptinterviews wurden im Nachgang der Schulung noch einmal mit jeder Interviewerin telefonisch oder persönlich bzw. in kleinen Gruppen weiter trainiert und die Kompetenzen verfeinert.
Die Interviewerinnenbetreuung und -organisation einschließlich regelmäßiger Kontrollen aller Arbeitsstände und stichprobenweiser Überprüfungen wurde durch die Universität Bielefeld in Kooperation mit dem SOKO Institut, Bielefeld, geleistet. Gegebenenfalls wurden die Interviewerinnen bei Auffälligkeiten kontaktiert und nachgeschult bzw. unterstützt und motiviert. Es wurde ein ständiger Kontakt gehalten und die Arbeit supervidiert. Den Interviewerinnen stand während der gesamten Feldlaufzeit ein internes, geschütztes und vom Forschungsteam betreutes Internetforum zur Verfügung, um sich über die Erfahrungen im Feld und Handlungsempfehlungen untereinander austauschen zu können. Stimmungen und Schwierigkeiten konnten hier gut wahrgenommen und aufgefangen und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. In einigen Fällen war auch eine Unterstützungsanbahnung für Befragte erforderlich und mit dem Forschungsteam abzustimmen.
Für die Interviews in vereinfachter Sprache mit Frauen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wurde ein Sonderstab von 21 Interviewerinnen gebildet, einschließlich der diesen Projektteil koordinierenden Wissenschaftlerinnen, Dr. Monika Schröttle und Dr. Brigitte Sellach. Einige der Interviewerinnen gehörten auch zum Stab der Interviewerinnen, die zusätzlich die Screening- und Hauptinterviews in den Haushalten durchgeführt hatten, andere führten ausschließlich Interviews mit sogenannten geistig behinderten Frauen durch.
Auch diese Interviewerinnen wurden im Rahmen von zwei Tagesveranstaltungen geschult. In der ersten Schulung wurden eine Einführung in die Studie gegeben, die Erfahrungen mit der Zielgruppe ausgetauscht sowie die methodische und inhaltliche Befragung mit dem vereinfachten Fragebogen (s.u.) eingeübt. In der zweiten Schulung wurden auf der Grundlage der ersten Interviews mit Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen, Probleme in der Interviewführung und in der Dokumentation der Antworten ausgetauscht, um Sicherheit in der Interviewführung zu gewinnen und das Vorgehen zu vereinheitlichen und zu optimieren. Schwerpunktthemen in der zweiten Schulung waren: Grenzen der Befragbarkeit, Dauer der Interviews, Konzentrationsprobleme bei lang dauernden Interviews, Klärung „schwieriger“ Begriffe und zusätzlicher Erläuterungen, Strategien zur Verhinderung der Anwesenheit Dritter bei den Interviews sowie das Verfahren und das konkrete Vorgehen bei Vorliegen eines Hilfebedarfs am Ende des Interviews.
Spezialschulungen für die Befragung in Deutscher Gebärdensprache[39]
Für die Schulung der sieben gehörlosen Interviewerinnen, die in Deutscher Gebärdensprache befragen sollten, wurden ebenfalls zwei Tage eingeplant. Die Schulung wurde von zwei gehörlosen/hörbehinderten Wissenschaftlerinnen, Bettina Herrmann und Sabine Fries, geleitet, wobei auch die Projektleitung der Studie in der Einführungssequenz zur Begrüßung und Information über Inhalte und Relevanz der Studie anwesend war (unterstützt durch eine Gebärdensprachdolmetscherin). Von da ab wurde die Schulung aber durchgängig in Deutscher Gebärdensprache durchgeführt.
Für die Schulung wurde die Schulungspräsentation der anderen Interviewerinnenschulungen umgearbeitet und den besonderen kommunikativen und visuellen Bedürfnissen der gehörlosen Interviewerinnen angepasst. In einem auf Dialog und Rückfragen aufbauenden Vortrag wurden die Aufgaben und Haltungen der Interviewerinnen analog dem Handbuch der anderen Interviewerinnen der Studie erläutert und diskutiert. Das Handbuch bekam jede Interviewerin im Anschluss in schriftsprachlich unveränderter Form mit auf den Weg, mit der Bitte, sich bei Fragen oder Unklarheiten bei der Koordinatorin der Interviewerinnen zu melden.
Das Praxistraining nahm den zweiten Tag in Anspruch und begann mit der Vorstellung des zuvor von der Koordinatorin dieses Befragungsteils (s.o.) in Absprache mit der Projektleitung der Studie erstellten Schulungsvideos. Aus jedem Modul wurden dafür ausgewählte Fragen vorbereitet. Im Kontext dieser ausgewählten Fragen wurde gleichzeitig auch der Inhalt des jeweiligen Moduls vorgestellt und erläutert sowie erklärt, was hier zu beachten ist. Das Videobeispiel des Schulungsvideos wurde kontrastiv erarbeitetet, indem das gebärdete Beispiel mit dem deutschen Ausgangstext verglichen und translatorische Fragen diskutiert wurden. Dabei wurde auch deutlich, dass die Interviewerinnen in konkreten Interviewsituationen gegebenenfalls von der vorgegebenen Übersetzung abweichen konnten, allerdings so, dass der Sinn der Frage nicht verändert wird. Sollte es nicht möglich sein, die Fragen auf dem vorgegebenen Niveau zu stellen, hatten die Interviewerinnen die Möglichkeit, die Fragen zu elementarisieren bzw. anhand von weiteren Paraphrasierungen zu ergänzen. Diese sollten dann aber per Notiz auf dem Fragebogen vermerkt werden.
In der Schulung wurde auch thematisiert, dass intime, möglicherweise peinlich berührende Fragen mit neutralen Gebärden gebärdet werden. Dies gilt zum Beispiel für die Gebärden Sex, zu Geschlechtsverkehr gezwungen, Penis, vaginale Verletzungen usw. Die in der Gehörlosengemeinschaft oft benutzten Mundbilder wie „Schwanz“, „Muschi“, „Vergewaltigung“ sollten vermieden werden bzw. ikonische Gebärdenzeichen in minimaler, keineswegs übertriebener Weise ausgeführt werden.
Im anschließenden Rollenspiel wurde der Umgang mit kritischen Situationen und Störungen während des Interviews geübt. Als typische Störfaktoren in der gebärdensprachlichen Kommunikation wurde u.a. die Tendenz zum Erzählen und Abschweifen genannt und das Einfordern der Anwesenheit dritter Personen. Abschließend wurden einzelne Interviewsituationen trainiert sowie Kernszenen wie Begrüßung, Sichvorstellen und das Abschiednehmen nach einem so intensiven Gespräch geübt. Beim spontanen Übersetzen von Fragen aus den Modulen zu Sexualität und Gewalt hatten die Interviewerinnen Gelegenheit, ihre gebärdensprachlichen Ausdrucksfähigkeiten kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren.
Während der Schulung wurde vereinbart, dass alle Interviewerinnen einzelne Gebärdenzeichen, besonders die Fachterminologien, aber auch die Art und Weise des gebärdensprachlichen Stils aus dem Schulungsvideo weitgehend übernehmen und benutzen sollten, um damit auch eine Einheitlichkeit der Befragung zu gewährleisten.
Im Folgenden soll zunächst der Aufbau des Fragebogens in der Grundversion in allgemeiner Sprache beschrieben werden, daraufhin auf den Fragebogen in vereinfachter Sprache und schließlich auf die Besonderheiten, die für die Befragung in Gebärdensprache zu berücksichtigen waren, eingegangen werden.
Die Fragebögen für die vorliegende Studie orientieren sich zum einen an dem Fragebogen der vorangegangenen repräsentativen Prävalenzstudie zu Gewalt gegen Frauen in Deutsch-land (Schröttle/Müller 2004, im Folgenden zitiert als „Frauenstudie 2004“), wobei der Anspruch bestand, Gewaltbetroffenheiten und Belastungen von Frauen mit Behinderungen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt vergleichen zu können. Zum anderen wurden neue Befragungssequenzen aufgenommen und bestehende Fragen modifiziert, um den Kontext sowie die Relevanz von Behinderungen, Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen für die Lebenssituation und Gewaltbelastungen noch besser ausleuchten zu können. So wurden etwa Fragen und Antwortvorgaben zur Wohnsituation und Privatsphäre ergänzt; ein längerer Befragungsteil ermöglicht zudem die Einordnung der Art der Behinderungen, ihrer Dauer und Ursachen, der subjektiv erlebten Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen sowie der Inanspruchnahme von und Zufriedenheit mit Unterstützung sowie den institutionellen Angeboten. Im Hinblick auf Gewalterfahrungen, die mit der Behinderung oder Beeinträchtigung in einem direkten oder indirekten Zusammenhang stehen, wurden Befragungsteile zu offenen und verdeckten Diskriminierungen ergänzt, ebenso wie Fragen zum Sicherheitsgefühl und zu psychischer, physischer, struktureller und sexueller Gewalt in Einrichtungen, Wohngruppen und Pflege- bzw. Unterstützungskontexten. Für die Einordnung der Gewalterfahrungen war zudem wichtig, bei Frauen, bei denen die Behinderung erst im Lebensverlauf eingetreten ist, zu erfragen, ob die Gewalt vor und/oder nach Eintreten der Behinderung aufgetreten war. Ein Teil der Nachfragen zu den erlebten Gewaltsituationen bezog sich dann nur noch auf Gewalt, die in die Zeit seit Bestehen der Behinderung fällt. Weitere zusätzliche Fragen beschäftigen sich mit der Arbeitssituation, Diskriminierungen am Arbeitsplatz, behindertengerechten Arbeitsplätzen sowie mit der ökonomischen Situation der Frauen.
Damit durch diese zusätzlichen Befragungssequenzen die Befragung insgesamt nicht zu lang und zu belastend für die Befragten wurde, waren Kürzungen an anderen Stellen erforderlich. So wurde abweichend vom Fragebogen der Frauenstudie 2004 eine größere Befragungssequenz zur Gesundheit stark gekürzt und auf Verletzungen und Fragen zur reproduktiven Gesundheit (gynäkologische Operationen, Schwangerschaft, Verhütung und Sterilisation) reduziert. Gekürzt wurden auch die insgesamt sehr langen und von den befragten Frauen als belastend wahrgenommenen Fragen zu einzelnen ausgewählten Gewaltsituationen und -kontexten. Stattdessen notierten die Interviewerinnen weitere offene Angaben zu den Gewaltsituationen und -kontexten in einem dafür vorgesehenen Feld im Fragebogen.
Der Fragebogen wurde im Rahmen der Vorstudie sowohl mehrfach in verschiedenen Überarbeitungsversionen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis geprüft und diskutiert als auch in diversen Testinterviews erprobt. Er ist folgendermaßen aufgebaut:
-
Modul 1: Sozialstatistik 1
Alter, Wohnsituation, Familien- und Partnerschaftsstatus, Zufriedenheit mit aktuellen Beziehungen (Partnerschaft, Freundinnen und Freunde, Familie), Selbsteinschätzung der sozialen Bindungen.
-
Modul 2: Behinderung und Diskriminierung
Bestehende Beeinträchtigungen in den Bereichen: Körper, Sinneswahrnehmungen, psychische Probleme und Psychiatrieerfahrung, Suchterkrankungen, Lernen und Verstehen; Dauer und Ursache der Beeinträchtigungen; Stärke der subjektiv wahrgenommenen Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen; Unterstützungsbedarf und Zufriedenheit mit Unterstützungspersonen; verwendete und benötigte Hilfsmittel; Inanspruchnahme von institutionellen Angeboten; regelmäßige Medikamenteneinnahme; Behindertenausweis; gesetzliche Betreuung; strukturelle und personale Diskriminierungen im Zusammenhang mit der Behinderung.
-
Modul 3: Soziale Integration/Freizeit, Sicherheitsgefühl und Ängste
Freizeitaktivitäten; Vertrauenspersonen für verschiedene Problembereiche; Verwandten-/Bekanntenbesuch; Anonymität und Sicherheit der Wohngegend; Sicherheitsgefühl und Ängste in verschiedenen Lebenssituationen bzw. gegenüber verschiedenen Personen im sozialen Nahraum.
-
Modul 4: Psychische Gewalt
Erleben verschiedener Dimensionen psychischer Gewalt (generell, in den letzten 12 Monaten, seit Eintreten der Behinderung); eigene Reaktionen auf das Erleben psychischer Gewalt; Häufigkeit in verschiedenen Lebenskontexten (öffentlicher Raum, Arbeit, Schule, Ausbildung, Einrichtungen/Dienste, Freundinnen und Freunde, Bekannte, Nachbarinnen und Nachbarn, Partnerin oder Partner, Familie); Geschlecht der Täterinnen und Täter; subjektiv erlebte Bedrohlichkeit der Situationen.
-
Modul 5: Sozialstatistik 2
Staatsangehörigkeit/Migrationshintergrund; Religionszugehörigkeit; Schul- und Ausbildungsabschluss; Erwerbstätigkeit und Stellung im Beruf; Fragen zum Arbeitsplatz und zur Zufriedenheit mit der Arbeitssituation; Einkommen und Einschätzung, ob Einkommen ausreichend.
-
Modul 6: Gesundheit
Zufriedenheit mit Gesundheit und gesundheitlicher Versorgung; Verletzungen im Lebensverlauf; reproduktive Gesundheit (Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt, gynäkologische Operationen, Sterilisation, Verhütung, Freiwilligkeit von Verhütung/Sterilisation).
-
Modul 7: Körperliche Gewalt
Erleben verschiedener Dimensionen körperlicher Gewalt (generell, in den letzten 12 Monaten, seit Eintreten der Behinderung); Anzahl Situationen; Täterinnen und Täter (im Lebensverlauf und nach Eintreten der Behinderung); Tatorte; Reaktionen auf Gewalt; eigene Gewaltinitiative; Verletzungsfolgen; subjektiv erlebte Bedrohlichkeit, Gefühl von Wehrlosigkeit; Inanspruchnahme medizinischer Hilfe, sozialpädagogischer Hilfe und Beratung; Polizei und Anzeigeerstattung; Nachfragen zu behinderungsspezifischer Gewalt mit offenen Fragen.
-
Modul 8: Kindheit und Jugend
Eltern und Elternbeziehungen; Unterstützung durch Eltern/Familie; Gewalt von und zwischen Eltern und durch Geschwister; Gewalt in Einrichtungen.
-
Modul 9: Sexualität
Sexuelle Aufklärung; sexuelle Erfahrungen im Erwachsenenleben und Zufriedenheit damit.
-
Modul 10: Sexuelle Gewalt in Kindheit und Erwachsenenleben und sexuelle Belästigung
Sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend; Anzahl Situationen; Täterinnen und Täter; Erleben verschiedener Dimensionen sexueller Belästigung (generell, in den letzten 12 Monaten, seit Eintreten der Behinderung); bei sexueller Belästigung nach Eintreten der Behinderungen: Nachfragen zur Häufigkeit in verschiedenen Lebenskontexten (öffentlicher Raum, Arbeit, Schule, Ausbildung, Einrichtungen/Dienste, Freundinnen und Freunde, Bekannte, Nachbarinnen und Nachbarn, Partnerin oder Partner, Familie); Geschlecht der Täterinnen und Täter; Orte; subjektiv erlebte Bedrohlichkeit der Situationen.Ungewollte sexuelle Handlungen und sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben (generell, in den letzten 12 Monaten, seit Eintreten der Behinderung); Anzahl Situationen; Täterinnen und Täter; bei Gewalt nach Eintreten der Behinderung: Tatorte; Reaktionen auf Gewalt; Verletzungsfolgen; subjektiv erlebte Bedrohlichkeit und Gefühl von Wehrlosigkeit; Inanspruchnahme medizinischer Hilfe, sozialpädagogischer Unterstützung und Beratung; Polizei und Anzeigeerstattung.
-
Modul 11: Abschlussfragen
Mitgliedschaft in Verein/Partei/Selbsthilfeorganisation; Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Frauen mit Behinderungen und der eigenen Lebenssituation; Abklärung des Unterstützungsbedarfs bei akuter Gewalt.
Die Fragen waren weitgehend mit festen Antwortkategorien versehen, abgesehen von wenigen offenen Fragen. Die Befragung wurde unterstützt durch ein Listenheft, bei dem Antwortkategorien mit Nummern oder Kennziffern aufgeführt wurden. Dadurch konnte die Befragte gerade bei schwierigen Fragen auch anhand von Nummern und Kennziffern antworten. Generell wurde darauf geachtet, dass das Interview mit einfachen Einstiegsfragen begann, sich Fragen zu Gewalt mit anderen, neutraleren Fragen (Sozialstatistik) abwechselten und eine Steigerung von weniger zu stärker belastenden Gewaltfragen in der Dramaturgie des Fragebogens erfolgte.
Die Befragten wurden vorab auf die Anonymität der Befragung hingewiesen, über den Zweck der Befragung und die Freiwilligkeit der Teilnahme informiert. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass das Interview jederzeit abgebrochen werden konnte und einzelne Fragen übergangen werden konnten, wenn diese zu belastend für die Befragten waren. Darüber hinaus wurde während des gesamten Interviews auf mögliche Belastungen und Pausenbedarf der Befragten geachtet.
Die Interviews dauerten im Durchschnitt etwa 70–100 Minuten, wobei die Länge je nach Gewaltbetroffenheit und Gesprächsbereitschaft variierte. Wichtig war es, die Befragten vorab auf den erforderlichen Zeitrahmen hinzuweisen. Die Dauer der Befragung stellte jedoch insgesamt kein Problem dar.
Am Ende des Interviews war es wichtig, einen positiven Ausklang und Abschied zu gestalten. Die befragte Frau wurde nach der aktuellen Befindlichkeit und dem Anstrengungsgrad des Interviews gefragt. Zudem sollte abgeklärt werden, ob Unterstützungspersonen vorhanden sind, falls belastende Gefühle nach dem Interview auftauchen sollten. Darüber hinaus wurde die Interviewte darüber informiert, dass sie bei Problemen jederzeit die Projektmitarbeiterinnen oder eine Unterstützungsperson aus den im Vorfeld ausgewählten und informierten Einrichtungen vor Ort kontaktieren könne. Die Interviewerinnen verwiesen zudem darauf, dass sie bei Bedarf Informationen über Unterstützungseinrichtungen vermitteln könnten. Gegebenenfalls wurde mit einigen allgemeinen Fragen ein guter Abschluss des Gespräches geschaffen, bevor die Interviewerin sich verabschiedete. Es war sehr wichtig, beim Abschluss die Thematik des Interviews wieder zu schließen, um eine neutrale Atmosphäre herzustellen und um Sicherheitsaspekte abzuklären. Im Zweifelsfall wurde ein zusätzlicher telefonischer oder persönlicher Termin vereinbart, um einen eventuellen Unterstützungsbedarf im Falle akuter Probleme und Gewaltbelastungen abzuklären. Insgesamt zeigte sich bei dieser wie auch bei vorangegangenen nationalen und internationalen Befragungen der Gewaltprävalenzforschung, dass die Befragten bei entsprechendem Setting durchaus eigene Grenzen im Rahmen des Interviews ziehen können, welche auch durch die Interviewerin zu beachten sind, wodurch möglichen Retraumatisierungen durch das Interview gezielt vorgebeugt wird.
In der Studie wurde zusätzlich zum allgemeinen Fragebogen eine weitere, mit dem allgemeinen Fragebogen vergleichbare Version in vereinfachter Sprache erstellt und getestet, um den Möglichkeiten von Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen besser gerecht zu werden.
Vor dem Hintergrund des Mangels an Erfahrungen bei der Befragung von Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen mittels eines standardisierten Fragebogens im nationalen und internationalen Kontext ist die vorliegende Studie von hoher forschungspraktischer Bedeutung. Die Fragebogenentwicklung wurde durch zahlreiche Testinterviews in den verschiedenen Stadien der Fragebogenentwicklung und von Beratungen und Workshops mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis unterstützt und begleitet.
Im Zuge der Voruntersuchung und der Testinterviews zu verschiedenen Überarbeitungszeitpunkten wurde mehr und mehr von der Vorstellung abgewichen, dass es eine für alle Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen einheitliche „leichte Sprache“ für den Fragebogen geben kann und soll. Stattdessen wurde ein Weg für eine flexiblere Handhabung des zweiten Fragebogens in vereinfachter Sprache gewählt, der Erläuterungen und Erklärungen dort ermöglicht, wo die Fragen von den Frauen nicht oder nur unzureichend verstanden wurden. Damit wurde auch umgangen, für alle Frauen ein reduziertes sprachliches Niveau einzuführen, das ein Teil der Befragten möglicherweise als infantilisierend wahrgenommen hätte. Insgesamt wurde somit besser der Bandbreite an intellektuellen Möglichkeiten und Einschränkungen der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen entsprochen.
Zentral für die Interviewführung war, dass der Fragebogen flexibel gehandhabt werden konnte, d. h. dass die Interviewerin den Gedanken der Befragten folgt und Ausführungen der Befragten, die über die aktuelle Frage hinausgehen und sich auf spätere Fragen beziehen, an die entsprechende Stelle im Fragebogen eintragen kann. Das erforderte eine besondere Vertrautheit der Interviewerin mit dem Fragebogen, erwies sich aber als äußerst hilfreich in der Interviewführung. Bei Verständnisschwierigkeiten wurden die Fragen oder einzelne Begriffe erläutert. Die Interviewten gaben nicht immer verbal zu erkennen, wenn sie eine Frage nicht oder nicht vollständig verstanden hatten. Teilweise war der Mimik, der Stimme oder monotonen Antworten der Befragten zu entnehmen, wenn Fragen nicht verstanden wurden. Dies erforderte erhebliches Einfühlungsvermögen vonseiten der Interviewerin, die dann nachfragen konnte, ob die Frage verstanden wurde oder ob weitere Erläuterungen erforderlich waren. Teilweise konnte den Schwierigkeiten bei der Abfrage komplexerer Sachverhalte mit offenen Fragen begegnet werden, teilweise waren aber gerade die offenen Fragen schwierig zu beantworten im Vergleich zu den geschlossenen Fragen mit konkreten Antwortvorgaben.
So konnte etwa das mögliche Gewalterlebnis kurz mit eigenen Worten beschrieben werden, wenn es im Interview zum ersten Mal thematisiert wurde. Das ermöglichte eine leichtere Zuordnung bei der Abfrage von Tatorten, Täterinnen und Tätern, Folgen und Reaktionen entsprechend den Vorgaben in dem jeweiligen Modul (körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt). Durch diese flexiblere Handhabung konnten die Interviewerinnen die Erfahrungen der Befragten einordnen (z.B. eine sexuelle Gewalthandlung verbunden mit körperlicher Gewalt). Zweitens wurden die tatsächlichen Gewalthandlungen dokumentiert. Zum Dritten wurden die Befragten nicht in ein analytisches Raster gezwungen, in das sie ihre Erfahrungen nicht einordnen können; diese Leistung wurde zum Teil von der Interviewerin während des Interviews unterstützend mit übernommen.
Darüber hinaus wurde der Fragebogen gekürzt und die Differenzierungen in den Fragen und Antwortvorgaben wurden vereinfacht. So wurde bspw. die Lebenszufriedenheit nicht anhand einer Sechser-Skala von „sehr zufrieden“ bis „sehr unzufrieden“ erhoben, sondern mithilfe der Antwortvorgaben „eher zufrieden“ oder „eher unzufrieden“. Um eine Beantwortung der Fragen zu erleichtern, mussten diese in der Komplexität und Abstraktheit reduziert werden und z.B. Fragen, die zwei Bereiche umfassten („Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben, was den Bereich Familie betrifft?“), vereinfacht („Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Familie?“) und gegebenenfalls erläutert werden („Geht es Ihnen gut mit Ihrer Familie? Oder geht es Ihnen nicht so gut mit Ihrer Familie? Also zum Beispiel mit Ihrer Mutter, (Pause) Ihrem Vater (Pause) oder Ihren Geschwistern?“). Auch Aufzählungen mussten vermieden und stattdessen die Bereiche einzeln abgefragt werden.
Obwohl der Fragebogen erheblich gekürzt und vereinfacht wurde, erwies sich das Reduktionspotenzial als begrenzt, um nicht Gefahr zu laufen, bestimmte Themenbereiche zu vernachlässigen. So war nach wie vor ein hoher Zeitbedarf für die Befragung einzuplanen. Durch die Möglichkeit, Pausen einzulegen oder an zwei oder drei Terminen zu befragen, war dies jedoch unproblematisch.
Da sich Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen teilweise nicht als behindert wahrnehmen, musste die Verknüpfung zwischen der Behinderung und den weiteren Frageinhalten teilweise entkoppelt werden. So lautete bspw. die Frage zur Unterstützung im Alltag in allgemeiner Sprache: „Wurden oder werden Sie aufgrund Ihrer Beeinträchtigung, Behinderung oder chronischen Erkrankung regelmäßig im Alltag unterstützt oder betreut …?“. In vereinfachter Sprache entfällt der Bezug zur Behinderung: „Gibt es Dinge, bei denen Ihnen andere Menschen jeden oder fast jeden Tag helfen?“. Darüber hinaus waren die Interviewerinnen geschult, jeweils den von der Befragten selbst gewählten Begriff für ihre Behinderung aufzugreifen. Verneinte aber eine Befragte alle Fragen zu den verschiedenen Formen von Behinderungen, konnten z.B. die Fragen nach struktureller und personaler Diskriminierung aufgrund der Behinderung nicht gestellt werden. Dies kam jedoch nur in Einzelfällen vor.
Auf die Benennung von Häufigkeiten musste großenteils ebenso verzichtet werden wie auf die zeitliche Einordnung des Erlebten (z.B. in den letzten 12 Monaten), da beides oftmals nicht genau erinnert oder eingeschätzt werden kann. Manche Frauen konnten nicht alle Daten zu ihrer realen Lebenssituation benennen, so z.B. die Höhe ihres Einkommens, Angaben im Behindertenausweis zum Grad der Behinderung oder dem Vorliegen einer gesetzlichen Betreuung. Allerdings gab es große Unterschiede bei den Frauen hinsichtlich ihrer intellektuellen Möglichkeiten, den Fragebogen beantworten zu können.
Der Fragebogen und die Methodik erwiesen sich als prinzipiell tauglich für Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung: Die meisten Befragten konnten dem Interview in der hier entwickelten Form sehr gut folgen. Zwar wurden in Bezug auf manche Fragen bei einem Teil der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen Verständnisschwierigkeiten und Erinnerungslücken sowie ein Ausweichen bei unangenehmen Themen (wie Sexualität und sexuelle Gewalt) festgestellt, dennoch wurden bei den komplett durchgeführten Interviews keine gravierenden Schwierigkeiten, welche die Zuverlässigkeit der Aussagen infrage stellen, identifiziert.
Es zeigte sich, dass mit diesem Instrument eine große Gruppe von Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen erreicht und auch vergleichend befragt werden konnte. Dennoch konnten je nach Schwere der sogenannten geistigen Behinderung nicht alle behinderten Frauen einbezogen werden, z.B. Frauen mit ausgeprägten Verbalisierungsschwierigkeiten. Die Einrichtungen selbst sprachen oftmals die Frauen nicht an, die neben ihrer schweren sogenannten geistigen Behinderung auch eine psychische Erkrankung aufwiesen und zum Teil in der geschlossenen Abteilung eines Wohnheimes untergebracht waren. Vereinzelt wurden jedoch auch Frauen als Interviewpartnerinnen vermittelt, bei denen sich erst während des Interviews zeigte, dass sie dem Interview kognitiv, psychisch oder intellektuell nicht folgen konnten. Wie einzelne Prüfungen und Testinterviews bei sehr schwer behinderten Frauen zeigten, war für einen Teil dieser Frauen auch ein offenes Gespräch über ihre Lebenssituation mithilfe eines einfachen Leitfadens nicht möglich. Dieses konnte sogar im Gegenteil als noch schwieriger empfunden werden als die Beantwortung von Fragen mit strukturierten Antwortvorgaben. Da aus forschungsethischen Gründen bei einer Gewaltstudie nicht mit Unterstützungspersonen gearbeitet werden kann und generell nur Personen befragt werden dürfen, die dem Interview informiert zustimmen können, wurde hier am Grad der Kommunikationsfähigkeit eine klare Limitation der Erreichbarkeit von Frauen mit Behinderungen deutlich. Teilweise konnten aber auch zuvor von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen eingeschätzte Grenzen der Befragbarkeit durchaus überwunden werden, da einige Frauen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als nicht interviewfähig eingestuft wurden, wie sich später zeigte, durchaus befragt werden konnten. Um auch diese zunächst als nicht befragbar eingeschätzten Frauen erreichen zu können, wurde sehr intensiv versucht, mit den vermittelnden Kontaktpersonen aus den Einrichtungen abzuklären, inwieweit eine Teilnahme unter den Voraussetzungen eines Interviews in vereinfachter Sprache und mit spezifisch geschulten Interviewerinnen nicht doch möglich sei. Damit konnte der Radius erreichbarer Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen ausgedehnt werden. Dennoch wurde das Interview nur durchgeführt, wenn die potenzielle Interviewpartnerin verstand, dass es sich um ein Interview zur Lebenssituation behinderter Frauen handelte und dem Interview informiert zustimmen konnte. Wenn es Verständnisprobleme während des Interviews gab, wurden diese von den Interviewerinnen an den entsprechenden Stellen notiert.
Um die Befragung von gehörlosen Frauen zu ermöglichen, wurde der schriftsprachliche Fragebogen in die Deutsche Gebärdensprache übersetzt und ein Schulungsvideo erstellt, das allen gehörlosen Interviewerinnen zur Verfügung gestellt wurde.[40] Die Interviews selbst wurden in direkter gebärdensprachlicher Kommunikation ohne Zuhilfenahme des Videos durchgeführt. Um eine größtmögliche Anonymität und Vertraulichkeit der Interviewsituation zu gewährleisten, wurde bei der Befragung auf eine Aufzeichnung des Gespräches mittels Videokamera verzichtet. Die Befragung erfolgte in zwei Sprachen: Die Fragen wurden in Deutscher Gebärdensprache gestellt und die Antworten parallel dazu von den Interviewerinnen in die schriftsprachlichen Fragebögen eingetragen. Für die Interviewerinnen bedeutete dies eine hohe sprachliche Herausforderung: Sie hatten während des Interviews laufend Übersetzungsarbeit zu leisten, indem sie die schriftlichen Fragen des Fragebogens simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzten und die in Deutscher Gebärdensprache erfolgten Antworten schriftlich rückübersetzten. Um diesen Wechsel zwischen den beiden Sprachen möglichst professionell und ohne größere zeitliche Verzögerungen zu bewältigen, war eine sehr gute Vorbereitung notwendig: Alle Fragen mussten zuvor in beiden Sprachen verinnerlicht sein. Das Schulungsvideo diente den Interviewerinnen dabei als ein wesentliches Hilfsmittel zur Vorbereitung der Interviews.
Eine 1:1-Übersetzung des Hauptfragebogens im Sinne einer einfachen Wiedergabe in Deutscher Gebärdensprache war von vorneherein ausgeschlossen, da neben den sprachlichen auch die besonderen kulturellen Voraussetzungen der Gehörlosengemeinschaft zu beachten waren. Im Laufe des Übersetzungsprozesses wurde deutlich, dass Modifikationen im schriftsprachlichen Fragebogen vorgenommen werden mussten. Diese Modifikationen, die sich aufgrund der besonderen visuellen Modalität von Gebärdensprachen ergeben haben, sind jedoch nicht als Simplifizierung, Trivialisierung oder inhaltliche Ausdünnung des schriftsprachlichen Fragebogens zu verstehen, sondern dienten der qualitativen bzw. quantitativen Anpassung der Fragen an die Zielgruppe gehörloser Frauen, um den Sinn der Frage bestmöglich in Deutscher Gebärdensprache zu übersetzen.
Modifikationen waren zum einen notwendig wegen der besonderen sprachlichen Modalität von Gebärdensprachen. Anders als in lautsprachlichen Interviews können hier Fragen nicht einfach aufeinander folgen und Antworten simultan dazu von der Interviewerin eingegeben bzw. angekreuzt werden. Gebärdensprachen sind visuelle Sprachen, die einen ständigen Blickkontakt während der Interaktion zwischen den Gesprächspartnerinnen erfordern. Für die Eingabe der Antworten müssen die Interviewerinnen diesen Blickkontakt nach jeder Frageunterbrechen, d. h., der Gesprächsfluss stockt hier ein wenig, es entsteht eine kleine, in gebärdensprachlichen Interaktionen durchaus natürliche, keineswegs störende Pause. Ein erstes Testinterview, welches zunächst exakt an den inhaltlichen Vorgaben des Hauptfragebogens orientiert war, ergab eine Befragungszeit von über fünf Stunden und lag damit etwa doppelt so hoch wie die in gesprochener Sprache geführten Interviews bei anderen Zielgruppen. Diese Zeit zu kürzen, um die Befragung gehörloser Frauen auf das übliche zumutbare Maß von zwei bis drei Stunden zu reduzieren, machte Kürzungen und Streichungen im Hauptfragebogen erforderlich.
Eine erste Modifikation erfolgte durch die Umformulierung bzw. Kürzung von Fragen durch:
-
Verzicht auf das Vorlesen von Antwortvorgaben,
-
Entfrachtung bzw. Anpassung von Itemlisten an die Zielgruppe,
-
offenere Formulierungen, die es den Interviewerinnen erlaubten, die Antworten selbst zuzuordnen,
-
leichte Kürzungen komplexer Fragestellungen,
-
Streichung von Fragen, die für die Zielgruppe der selbstständig lebenden gehörlosen Frauen nicht relevant waren, und der ausführlichen Fragen zu anderen körperlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen,
-
Verzicht auf differenzierende Nachfragen zu vor/nach Eintreten der Behinderung, da die Mehrheit der Frauen ab der frühen Kindheit/Geburt gehörlos ist.
Auf diese Weise gelang es, den Hauptfragebogen um ca. ein Drittel zu kürzen, ohne dabei einen erheblichen Verlust oder ein Defizit an wichtigen vergleichbaren Daten in Kauf nehmen zu müssen.
In der Regel jedoch orientierte sich die gebärdensprachliche Übersetzung stark an der Ausdrucksweise des Hauptfragebogens und folgte ihm in Inhalt, Sprachstil und Sprachniveau. Dennoch ergaben sich auch hier besondere Übersetzungsfragen. Zum Beispiel führt die starke Bildhaftigkeit (Ikonizität) von Gebärdensprachen dazu, dass bestimmte Fragen, vor allem solche zu erlebten Gewaltsituationen, besonders eindringlich wirken. Anders als in lautsprachlichen Zusammenhängen, wo die ruhige gleichmäßige Stimme der Interviewerin geschult wird, um eine neutrale Darstellung zu ermöglichen, hat man in gebärdensprachlichen Zusammenhängen sofort die Gewaltsituation, die erlebten Verletzungen vor Augen. Um diesen Fragen die Schärfe und Unmittelbarkeit ein wenig zu nehmen, wurde bei der Übersetzung darauf geachtet, die mimische Ausdrucksweise des Gesichtes auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Darstellung der entwickelten und realisierten Methodik der vorliegenden Studie in den einzelnen Teilbereichen zeigt auf, dass zur Einbeziehung unterschiedlicher Zielgruppen von Menschen mit Behinderungen spezifische Zugänge und Erhebungsmethoden erarbeitet werden müssen, die erst eine breite Erfassung und adäquate Befragung ermöglichen. Gerade für die vergleichende Befragung von Frauen mit Behinderungen in stationären Wohneinrichtungen, von Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen und für die Befragung gehörloser Frauen konnten im Rahmen dieser Studie innovative Zugänge und Methoden eingesetzt werden, die in vieler Hinsicht die Grenzen bisheriger Studien erweitern. Darüber hinaus wurden anhand der gewählten Methodik auch die generellen Möglichkeiten, Menschen mit Behinderungen mit und ohne Behindertenausweis in Haushalten repräsentativ zu erreichen, erfolgreich ausgebaut. Insofern könnte die vorliegende Studie mit dazu beitragen, neue Maßstäbe für die Umsetzung und die erforderliche Breite repräsentativer Befragungen bei Menschen mit Behinderungen auf nationaler und internationaler Ebene zu setzen.
[6] Vgl. zum 9. Sozialgesetzbuch: online: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html (Stand: 09.08.2012).
[7] Vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Stand 2005. Online: www.dimdi.de (Stand: 15.08.2012). In dem deutschsprachigen Dokument wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen umfassenderen Behinderungsbegriff als im SGB IX handelt, dass aber, „um Missverständnisse zu vermeiden, (…) im Sozialbereich in Deutschland nur der Behinderungsbegriff des SGB IX verwendet werden (sollte)“. Für die hier zu entwickelnde studienspezifische Definition ist diese Maßgabe nicht handlungsleitend.
[8] Ebd.: 5.
[9] Ebd.: 17.
[10] Folgende zentrale Komponenten der Aktivitäten und Partizipation werden aufgelistet, wobei es als schwierig beurteilt wird, „zwischen ‚Aktivitäten‘ und ‚Partizipation‘ auf der Grundlage der Domänen […] zu unterscheiden“ (ebd.: 21): „Lernen und Wissensanwendung“, „Allgemeine Aufgaben und Anforderungen“, „Kommunikation“, „Mobilität“, „Selbstversorgung“, „Häusliches Leben“, „Interpersonale Interaktionen und Beziehungen“, „Bedeutende Lebensbereiche“, „Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben“ (ebd.: 20).
[11] Ebd. : 5.
[12] Ebd.: 23.
[13] Ebd.: 24.
[14] Vgl. Artikel 1 der UN-Behindertenrechtskonvention, [online] URL: http://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDFDateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_de.pdf (Stand: 28.07.2010).
[15] Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland (siehe auch www.g-ba.de).
[16] Vgl. sog. Chroniker-Richtlinie in der Fassung von 2008, [online] URL: http://www.g-ba.de/downloads/62-492-278/RL_Chroniker-2008-06-19.pdf (Stand: 14.08.2012).
[17] Der Begriff „Psychische Störung“ wird von vielen Betroffenen ebenfalls als stigmatisierend wahrgenommen.
[18] Zur International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) vgl. http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2012/index.html/
[19] ICD-10, [online] URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2012/index.html (Stand: 01.08.2012).
[20] Vgl. Gromann 2002.
[21] Die Feststellung einer Behinderung wird anhand der Auswirkungen der Behinderungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Als schwerbehindert gelten danach Menschen, denen ein Grad der Behinderung von 50 oder mehr zuerkannt worden ist. Voraussetzung für eine Feststellung ist ein Grad der Behinderung von wenigstens 20% (§ 69 SGB IX).
[22] Das heißt, länger als 6 Monate andauernd.
[23] Die Einhaltung dieser Regeln wurde vonseiten des SOKO Instituts begleitet und kontrolliert; die korrekte Auswahl der Zielpersonen und die korrekte Durchführung der Screeninginterviews und Überzeugungsarbeit wurde durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Bielefeld in der Einarbeitungsphase telefonisch überprüft und ggf. vor Ort nachgeschult. Es zeigte sich, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten alle Interviewerinnen korrekt mit der Zufallsauswahl der Haushalte und mit den Screeninginterviews umgehen konnten. Dort, wo hohe Ausfallquoten im Interviewverlauf auffielen, wurde durch das Forschungsteam noch einmal Überzeugungsarbeit telefonisch und vor Ort geleistet.
[24] Von den Frauen, die zu den Zielpersonen der Befragung gehörten, aber nicht an den Interviews teilnahmen, haben 66% die Teilnahme verweigert; die restlichen 34% hatten entweder keine Zeit oder konnten im Untersuchungszeitraum nicht mehr terminiert oder erreicht werden.
[25] Die Interviewerinnen waren angewiesen, das Interview zu unterbrechen, wenn eine dritte Person in den Raum kam, und erst fortzuführen, wenn diese den Raum wieder verlassen hatte.
[26] CD-ROM, Stand: 01.01.2008, Verlag Ute & Werner Schmidt-Baumann, geordnet nach Postleitzahlen.
[27] Dies wäre dann zum Beispiel nicht der Fall, wenn das Spektrum der Einrichtungen an den Standorten deutlich reduzierter wäre als auf Bundesebene, wenn zu viele Standorte mit außergewöhnlichen Angebotsstrukturen vorhanden wären oder wenn die Verteilung der Einrichtungstypen erheblich von den Verteilungen auf Bundesebene abweichen würden.
[28] So arbeitet in einem der Landkreise z.B. ein großes psychiatrisches Krankenhaus mit entsprechenden Wohn-und Betreuungsangeboten der psychiatrischen Nachsorge und Langzeitbetreuung, während es in anderen Landkreisen keine entsprechende Versorgung für die Bevölkerung gibt. In einigen Landkreisen werden für Menschen mit einer geistigen und einer psychischen Behinderung gemeinsame Wohnheime oder Wohngruppen angeboten. In allen Kreisen eines großen Bundeslandes finden Menschen mit psychischer Beeinträchtigung dagegen differenzierte Wohnformen vor.
[29] Beim Korsakow-Syndrom handelt es sich um eine alkoholbedingte Gedächtnisstörung (amnestisches Psychosyndrom).
[30] In Einzelfällen (1% der Einrichtungen) konnte die Zielgruppe oder Wohnform über das Heimverzeichnis und das Internet nicht ermittelt werden.
[31] Die Auswahl orientierte sich an der Platzzahl der Einrichtungen, nachdem sich in Vorrecherchen gezeigt hatte, dass diese für den gesamten Standort in etwa auch analog zur Verteilung von Frauen in den Einrichtungen ist. Alle in den 20 Kreisen gefundenen einschlägigen Einrichtungen wurden pro Kreis in einer Excel-Datei aufgelistet und erhielten eine Zufallszahl. Um sie in eine zufällige Reihenfolge zu bringen, wurden sie nach dieser Zufallszahl aufsteigend sortiert. Aus der Division der Gesamtzahl der Einrichtungsplätze durch die Anzahl der durchzuführenden Interviews in dem Kreis (N=25) wurde die Schrittziffer berechnet. Jede Einrichtung, auf die die Schrittziffer oder ein Vielfaches von ihr entfiel, wurde für die Befragung ausgewählt.
[32] Die Bereitschaft der Versorgungsämter, die Studie zu unterstützen, war unterschiedlich stark ausgeprägt. Während einige sehr hilfsbereit waren, bedurfte es bei anderen intensiver und langwieriger Überzeugungsarbeit. Am Ende konnten alle Versorgungsämter für die Teilnahme gewonnen werden, wobei an einem Standort unklar ist, ob die Briefe tatsächlich versandt wurden; ein Rücklauf von 0% deutet hier eher darauf hin, dass entgegen der Angabe keine Versendung stattgefunden hatte.
[33] Siehe http://www.goldene-hand.de/.
[34] Siehe http://www.gehoerlosen-kulturtage.de/.
[35] Siehe http://www.taubenschlag.de
[36] Siehe http://www.gehoerlosen-bund.de
[37] Interessanterweise haben sich im Lauf der Feldphase auch gehörlose Männer interessiert gezeigt und angemerkt, dass sie für sich auch eine ähnliche Befragung brauchen, weil sie ebenfalls häufig Diskriminierungen, vor allem am Arbeitsplatz, ausgesetzt sind.
[38] An den Standorten der Studie wurden Kooperationen mit fachspezifischen Beratungsstellen aufgebaut, sodass die Befragten an Beratungsangebote vermittelt werden konnten, die über die Studie und eventuelle Anfragen von Befragten informiert waren. Jede Interviewerin erhielt die Informationen über diese Beratungsstellen für ihren Standort, um sie gegebenenfalls den Befragten anbieten zu können.
[39] Der Text in diesem Abschnitt wurde weitgehend verfasst durch die Koordinatorin der Gehörloseninterviews, Sabine Fries, HU Berlin.
[40] Die Ausführungen in diesem Kapitelabschnitt beruhen zu großen Teilen auf einem Methodenbericht von Sabine Fries, die die gehörlosen Interviewerinnen koordinierte.
3. Ergebnisse der repräsentativen Haushalts- und Einrichtungsbefragung[41]
Inhaltsverzeichnis
-
3.1 Lebenssituation und soziostrukturelle Merkmale der befragten Frauen
- 3.1.1 Altersstruktur der Befragten im Überblick
- 3.1.2 Partnerschaft, Kinder und Familienstand
- 3.1.3 Lebens- und Wohnsituation der in den Einrichtungen lebenden Frauen
- 3.1.4 Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse
- 3.1.5 Erwerbsarbeit, berufliche Einbindung und ökonomische Ressourcen
- 3.1.6 Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensaspekten
- 3.1.7 Kindheit und Aufwachsen
- 3.1.8 Beziehungen, soziale Integration und Freizeit
- 3.1.9 Sicherheitsgefühl und Ängste
-
3.2 Beeinträchtigungen, Unterstützung und gesundheitliche Versorgung
- 3.2.1 Art der Beeinträchtigung/Behinderung, Behindertenausweis, Eintritt und Ursachen der Behinderung
- 3.2.2 Körper-, Sinnes- und Sprechbeeinträchtigungen
- 3.2.3 Psychische Erkrankung und Lernbeeinträchtigungen
- 3.2.4 Grade der Einschränkung und Unterstützung im alltäglichen Leben
- 3.2.5 Gesundheitliche Versorgung
- 3.2.6 Fazit
- 3.3 Gewalterfahrungen in Kindheit und Erwachsenenleben
- 3.4 Inanspruchnahme institutioneller Hilfe und Intervention
- 3.5 Diskriminierung und strukturelle Gewalt
- 3.6 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der repräsentativen Studie
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Haushalts- und der Einrichtungsbefragung vergleichend dargestellt. Sowohl die Haushaltsbefragung als auch die Einrichtungsbefragung stellen eine repräsentative, am Zufallsprinzip orientierte Auswahl der jeweils in Haushalten und in Einrichtungen lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland dar (Methodik der Zufallsauswahl und Grenzen der Befragbarkeit, siehe Kapitel 2). In Kapitel 3.1 werden zunächst soziostrukturelle Merkmale und verschiedene Aspekte der aktuellen Lebenssituation der Befragten beschrieben. Dies bildet eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der weiteren Ergebnisse zu Gewalt und Diskriminierung im Vergleich der Befragungsgruppen. Daran anschließend wird in Kapitel 3.2 zunächst ein Überblick über die jeweiligen Beeinträchtigungen und Behinderungen der Befragungsgruppen gegeben, die sich in Art und Ausmaß der Beeinträchtigungen in vieler Hinsicht unterscheiden, in Bezug auf einzelne Aspekte aber auch erstaunliche Ähnlichkeiten aufweisen. Zudem wird dargestellt, in welchem Maße die Untersuchungsgruppen in verschiedenen Lebensbereichen eingeschränkt sind und Unterstützung wahrnehmen und/oder benötigen. In den dann folgenden Unterkapiteln 3.3 bis 3.5 werden verschiedene Dimensionen von Gewalt und Diskriminierung im Leben der befragten Frauen beschrieben, angefangen von Gewalt in Kindheit und Jugend über psychische, physische und sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben und der Inanspruchnahme von institutioneller Unterstützung und Intervention nach erlebter Gewalt bis hin zu erlebter Diskriminierung und struktureller Gewalt.
Bei der Auswertung der Ergebnisse der repräsentativen Befragungsteile dieser Untersuchung werden die Befragungsgruppen unterteilt in:
-
Frauen der Haushaltsbefragung (HH),
-
Frauen der Einrichtungsbefragung, die mit dem allgemeinen Fragebogen befragt wurden (EA),
-
Frauen der Einrichtungsbefragung, die mit dem vereinfachten Fragebogen befragt wurden (EV).
Letztere umfassen überwiegend Frauen aus Einrichtungen für Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen und vereinzelt Frauen aus anderen Einrichtungen, die – aufgrund von psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen – dem allgemeinen Fragebogen weniger gut folgen konnten und deshalb in vereinfachter Sprache befragt wurden (vgl. zur Auswahl der Befragten aus Einrichtungen, zum Fragebogen und der Methodik der Interviews in vereinfachter Sprache Kap. 2). An einigen relevanten Stellen wurden die Ergebnisse der vorliegenden Studie mit den Aussagen von Frauen aus der repräsentativen Frauenstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ (Schröttle/Müller 2004) verglichen. Diese beruht auf einer repräsentativen bundesweiten Gemeindestichprobe von Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren und stellt somit eine Vergleichsmöglichkeit zur weiblichen Gesamtbevölkerung her. Für die vorliegende Studie wurden aus der Frauenstudie 2004 nur Frauen im Alter bis 65 Jahre einbezogen, um die Vergleichbarkeit mit den Frauen mit Behinderungen der vorliegenden Untersuchung zu gewährleisten. Außerdem wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die Daten der mündlichen Befragung einbezogen, nicht aber die des zusätzlichen schriftlichen Befragungsteils der Frauenstudie 2004.[42]
Um die Untersuchungsgruppen zu vergleichen, aber auch um relevante Aspekte der aktuellen Lebenssituation der Frauen im Rahmen der Studie zu skizzieren, wurden soziostrukturelle Merkmale wie Alter, Partnerschafts- und Familienstatus, Bildung und Ausbildung sowie berufliche Einbindung und Einkommen vergleichend ausgewertet. Darüber hinaus wurden Aspekte der aktuellen Wohnsituation, der sozialen Einbindung und der Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensaspekten vergleichend untersucht.
Die Altersstruktur der Frauen, die in den Haushalten und in Einrichtungen mit dem allgemeinen Fragebogen befragt wurden, unterscheidet sich sowohl von jener der Befragten der Frauenstudie 2004 als auch von jener der Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden. So war bei den in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen der Anteil älterer Frauen ab 40 Jahren deutlich höher als in der Frauenstudie 2004 und als bei den in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen und entsprechend der Anteil jüngerer Frauen bis unter 40 deutlich geringer. Die in Haushalten befragten Frauen mit Behinderungen wiesen den geringsten Anteil jüngerer
Frauen auf. Mehr als drei Viertel der in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen sind älter als 40 Jahre. Dies entspricht durchaus den erwartbaren Ergebnissen, da bei vielen Frauen die Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen erst im Lebensverlauf und mit zunehmendem Alter auftreten (vgl. auch Kap. 4.2). Auch in der Statistik der behinderten Menschen des Mikrozensus 2005 waren in der Altersgruppe der 15- bis 65- jährigen Frauen etwa drei Viertel 45 Jahre und älter (Pfaff et al. 2006).
|
Altersgruppen |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz 2) |
|---|---|---|---|---|---|
|
16 bis 20 Jahre |
7 |
2 |
4 |
5 |
** |
|
21 bis 40 Jahre |
40 |
22 |
28 |
31 |
** |
|
41 bis 65 Jahre |
53 |
76 |
68 1) |
53 1) |
** |
|
Keine Angabe/Weiß nicht |
0 |
0 |
1 |
10 |
** |
|
Gesamt |
100 |
100 |
100 |
100 |
Basis: Alle befragten Frauen. 1)Einige wenige Frauen dieser Gruppe waren etwas über 65 Jahre alt. Diese wurden im Sample belassen. 2)Hier und in den folgenden Tabellen wurden jeweils Signifikanztests durchgeführt, um festzustellen, ob es sich um signifikante Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen handelt. Dabei zeigen zwei Sterne an, dass es sich um sehr signifikante Unterschiede handelt (p<=0,01), und ein Stern um signifikante Unterschiede (p<=0,05), während das Kürzel n.s. hier für „nicht signifikant“ (p>0,05) steht.
Die jüngere Altersgruppenzusammensetzung der in vereinfachter Sprache befragten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen erklärt sich daraus, dass diese Untersuchungsgruppe deutlich häufiger bereits ab Geburt, Kindheit oder Jugend beeinträchtigt war. Allerdings muss bei der vergleichenden Auswertung der Altersstruktur auch in Betracht gezogen werden, dass der Anteil der in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die hier keine Angaben gemacht haben, um etwa 10 Prozentpunkte höher liegt als bei den anderen Befragungsgruppen. Wird für diese Befragungsgruppe die Altersstruktur ausschließlich auf Frauen bezogen, die zu ihrem Alter Angaben gemacht haben, dann würde sich der Anteil der über 40-Jährigen leicht erhöhen auf 59%, der Anteil der 21- bis 40-Jährigen auf 35% und der Anteil der bis 20-Jährigen bliebe konstant. Somit wären auch bei veränderter Berechnungsgrundlage Frauen in dieser Gruppe noch immer vergleichsweise jung in der Altersgruppenzusammensetzung.
Die vorliegende Studie konnte Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen mit Migrationshintergrund nur begrenzt erreichen, da bei den Hauptinterviews ausschließlich in deutscher Sprache befragt wurde.[43] Bei vergleichsweise wenigen Befragten mit Behinderungen und Beeinträchtigungen konnten Hinweise auf einen Migrationshintergrund festgestellt werden. Je nach Untersuchungsgruppe haben 91–98% der befragten Frauen die deutsche Staatsangehörigkeit, 82–89% sind in Deutschland geboren. Nur in Bezug auf den Migrationshintergrund der Eltern gab es einen Unterschied zwischen den Untersuchungsgruppen in der Hinsicht, dass Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, am häufigsten angaben, ein oder beide Elternteile seien nicht in Deutschland geboren worden (20% vs. 14% der Frauen mit Behinderungen in Haushalten, 10% der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen und 16% der Befragten der Frauenstudie 2004).
Frauen der Haushaltsbefragung und Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, waren vergleichsweise älter als der Bevölkerungsdurchschnitt. Auf die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen traf das nicht zu. Darüber hinaus konnten Frauen mit Behinderungen und Migrationshintergrund relativ selten erreicht werden.
Aus der folgenden Übersichtstabelle wird zunächst ersichtlich, dass die in Einrichtungen lebenden Frauen sich im Hinblick auf Partnerschaft und Familiengründung sehr grundlegend von den in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen unterscheiden. Die in Haushalten befragten Frauen der vorliegenden Studie weisen im Hinblick auf Familie und Partnerschaft fast identische Merkmale auf wie der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt (Frauenstudie 2004). Sie sind anteilsmäßig etwa gleich häufig in Paarbeziehungen lebend und verheiratet und haben etwa gleich häufig Kinder. Die in Einrichtungen lebenden Frauen sind dagegen deutlich seltener in eine bestehende Partnerschaft eingebunden (34–42% vs. 72% bei den Frauen der Haushaltsbefragung) und erheblich seltener aktuell verheiratet (4–5% vs. 55% bei den Frauen der Haushaltsbefragung). Sie haben darüber hinaus deutlich seltener eigene Kinder, wobei hier die in Einrichtungen lebenden Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, mit 6% deutlich am seltensten Kinder hatten. Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen mit zumeist psychischen Erkrankungen, die vielfach auch erst zu einem späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf erkrankt sind und entsprechend später in Einrichtungen aufgenommen wurden, waren demgegenüber zu 39% Mutter geworden.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Bestehen einer aktuellen Partnerschaft |
75 |
72 |
34 |
42 1) |
** |
|
Bestehen einer früheren Partnerschaft |
52 |
64 |
71 |
48 1) |
** |
|
Bestehen einer aktuellen und/oder früheren Partnerschaft |
93 |
96 |
81 |
65 1) |
** |
|
Jemals verheiratet (inkl. Geschieden/verwitwet/getrennt lebend) |
73 |
78 |
42 |
8 |
** |
|
Anteil verheiratet |
57 |
55 |
4 |
5 |
** |
|
Anteil Frauen mit Kindern |
71 |
73 |
39 1) |
6 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Erhöhte Anteile von Frauen, die keine Angaben gemacht haben (6-9% vs. 0-2% bei den anderen Befragungsgruppen)
Bemerkenswert ist das Ergebnis, dass mehr als ein Drittel der Frauen in Einrichtungen für Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen noch nie eine feste Partnerschaft hatten, über 90% nicht verheiratet sind oder waren und keine eigenen Kinder haben. Darüber hinaus haben Frauen in Einrichtungen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, am häufigsten von allen Befragungsgruppen das Bestehen früherer Partnerschaften angegeben, was auf einen höheren Anteil an getrennten Partnerschaften in dieser Untersuchungsgruppe hindeutet. Die häufigeren Trennungen in dieser Befragungsgruppe können sowohl ursächlich als auch in der Folge mit psychischen Erkrankungen und schwierigen, gewaltbelasteten Lebenserfahrungen in Zusammenhang stehen.
Frauen, die in Einrichtungen leben, waren aktuell deutlich seltener in eine Partnerschaft eingebunden und verheiratet. Sie hatten zudem seltener Kinder. Der Anteil von kinderlosen und unverheirateten Frauen ist bei den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen besonders hoch.
Die Lebens- und Wohnsituation der in Einrichtungen lebenden Frauen unterscheidet sich erheblich von der Lebens- und Wohnsituation der in den Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. So können Frauen in Einrichtungen nur sehr begrenzt einen privaten und intimen Wohn- und Lebensrahmen herstellen, wie er in einem eigenen Haushalt möglich ist. Sie können darüber hinaus oft nicht entscheiden, mit wem sie zusammenleben und sind an feste Abläufe und Regeln im Lebensalltag gebunden. Dies scheint von Frauen, die erst seit einem späteren Zeitpunkt im Leben in einer Einrichtung leben und die mit psychisch stärker beeinträchtigten Personen zusammenleben, wie das bei vielen in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen der Fall ist, noch einmal deutlich belastender wahrgenommen zu werden als von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die oftmals länger in den Einrichtungen leben und seltener Alternativen dazu kennen.
Während Frauen der Haushaltsbefragung durchgängig in privaten Haushalten leben, haben die in Einrichtungen lebenden Frauen zu über 85% keine eigene Wohnung, sondern leben in Wohngruppen oder in einem Zimmer in der Einrichtung. Fast zwei Drittel (65%) der in vereinfachter Sprache befragten Frauen sind in den Einrichtungen in Wohngruppen eingebunden gegenüber nur einem Drittel (33%) der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen. Letztere leben weitaus häufiger in einem Zimmer in der Einrichtung (52% vs. 20% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen).
|
Altersgruppen |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|
|
Privathaushalt |
0 |
0 |
** |
|
Eigene Wohnung in Einrichtung |
15 |
10 |
|
|
Wohngruppe in Einrichtung 1) |
33 |
65 |
|
|
Zimmer in Einrichtung |
52 |
20 |
|
|
Sonstiges/Keine Angabe |
0 |
5 |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Frauen, die in Wohngruppen eingebunden sind, haben dabei zumeist ein eigenes Zimmer.
Die Wohngruppen sind nur selten nach Geschlechtern getrennt und weit überwiegend geschlechtergemischt. Dies traf bei den in Wohngruppen lebenden Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, häufiger zu (91%) als bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen (73%). Die Anzahl der in den Wohngruppen lebenden Personen variiert stark und reicht von 2 bis 22 Personen. Über 80% der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die in Wohngruppen leben, gaben Wohngruppen mit 6 und mehr Personen an, fast ein Drittel (31%) sogar Wohngruppen von 11 und mehr Personen. Demgegenüber leben Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, häufiger entweder allein oder in Wohngemeinschaften mit geringerer Personenzahl.
|
Einrichtungen/allgemeine Sprache N=35 (%) |
Einrichtungen/vereinfachte Sprache N=128 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|
|
Anzahl Personen in Wohngruppen 1) |
|||
|
bis 5 Personen |
57 |
17 |
** |
|
6–10 Personen |
29 |
52 |
|
|
11–22 Personen |
14 |
31 |
|
|
Anteil geschlechtergemischt 1) |
|||
|
N=40 |
N=130 |
||
|
geschlechtergemischt |
73 |
91 |
** |
Basis: Frauen, die in Wohngruppen leben und hierüber Auskunft gegeben haben. Mehrfachnennungen 1)37-38% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen haben hierüber keine Auskunft gegeben (vs. 5% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen).
Aus der folgenden Tabelle wird ersichtlich, dass etwa 80% aller in Einrichtungen lebenden Frauen ein Zimmer für sich allein haben und dies weitgehend auch abschließbar ist. Rund ein Fünftel der Frauen hat jedoch kein eigenes Zimmer und muss dies vermutlich mit anderen Frauen teilen. Toiletten- und Waschräume in Einrichtungen können von den in allgemeiner Sprache befragten Frauen deutlich häufiger abgeschlossen werden (82–83%) als von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen (60–62%). Insbesondere die Wahrung der Intimsphäre bei Körperpflege und Toilettengang ist demnach bei einem erheblichen Teil der in Einrichtungen lebenden Frauen nicht gegeben (bei etwa einem Fünftel der in allgemeiner und bei zwei Fünftel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen). Da die Möglichkeit besteht, Türen mit spezifischen Schlössern im Notfall (z.B. bei einem Sturz aufgrund der Behinderung) von außen zu öffnen, scheint dies eher mit unzureichenden institutionellen Bedingungen in Zusammenhang zu stehen als mit einem Schutz der dort lebenden Menschen. Hier liegt zweifellos eine gravierende Einschränkung der Wahrung der Privat- und Intimsphäre vor, wenn erwachsene Menschen kein eigenes Zimmer haben und zudem Toiletten- und Waschräume nicht abgeschlossen werden können.
Spezifische Wohnbereiche, die Frauen vorbehalten sind, sind in den Einrichtungen in der Regel nicht vorgesehen. Mehr als drei Viertel der Frauen in Einrichtungen stehen diese nach eigenen Angaben nicht zur Verfügung.
|
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=93 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=102 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|
|
Zimmer für sich allein |
82 |
80 |
n.s. |
|
Abschließbares Zimmer |
83 |
77 |
* |
|
Abschließbare Toilettenräume |
82 |
62 |
** |
|
Abschließbare Waschräume |
83 |
60 |
** |
|
Wohnbereich für Frauen |
13 (+8 teilweise) |
16 (+8 teilweise) |
n.s. |
|
Möglichkeit, zu entscheiden, mit wem zusammenzuwohnen |
23 (+17 teilweise) |
39 (+9 teilweise) 1) |
** |
|
Möglichkeit, sich in Wohnung barrierefrei zu bewegen |
84 |
89 |
n.s. |
|
Möglichkeit, sich in Wohngegend barrierefrei zu bewegen |
85 |
85 |
n.s. |
Basis: Frauen, die in Wohngruppen leben und hierüber Auskunft gegeben haben. Mehrfachnennungen. 1)Hoher Anteil von Frauen, die hier keine Angabe gemacht haben (14%).
Die Möglichkeit zu entscheiden, mit wem sie zusammenwohnen, besteht für die Mehrheit der in Einrichtungen lebenden Frauen nicht. Dies selbst entscheiden zu können, gaben 23% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen und 39% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen an.
Sich barrierefrei im Wohnbereich und in der Wohngegend bewegen zu können, ist für 84–89% der Frauen in Einrichtungen nach eigenen Angaben möglich. Ob bei den übrigen etwa 15% Frauen die Art/Schwere der Behinderung und/oder andere äußere Faktoren deren Mobilität im Wohnbereich und Wohnumfeld einschränken, kann anhand der Befragungsdaten nicht beurteilt werden.
Das Leben in einer Einrichtung unterscheidet sich stark vom Leben in einem Privathaushalt. Nur wenige Frauen in Einrichtungen verfügen dort über eine eigene Wohnung. Viele sind in (zumeist gemischtgeschlechtliche) Wohngruppen eingebunden und können nicht selbst bestimmen, mit wem sie zusammenleben. Etwa ein Fünftel der Frauen verfügt nicht über ein eigenes Zimmer. Ein bis zwei Fünftel der Frauen geben an, dass Waschräume und Toiletten nicht abschließbar sind. Die Wahrung der eigenen Privat- und Intimsphäre ist bei Frauen in Einrichtungen stark eingeschränkt.
In der folgenden Tabelle wird ein Bildungsgefälle zwischen den befragten Gruppen sichtbar. Während nur sehr wenige der in den Haushalten befragten Frauen über keinen Schulabschluss verfügten (2%), waren es bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen mit 6% anteilig mehr und bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen mit fast einem Viertel der Befragten (23%) um ein Vielfaches höhere Anteile. Werden die Frauen mit Sonderschulabschlüssen und „sonstigen Abschlüssen“ hinzugerechnet, dann haben die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen zu drei Viertel (75%) keinen qualifizierten Schulabschluss. Auch bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen würde dann der Anteil der Frauen ohne einen regulären qualifizierten Abschluss auf 23% ansteigen.
Auch in Bezug auf mittlere und hohe Schulabschlüsse sind die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen mit schlechteren Bildungsressourcen ausgestattet als die in Haushalten lebenden Frauen und der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt. Nur etwas weniger als die Hälfte (47%) verfügt über mittlere Reife, Abitur oder Hochschulabschluss gegenüber 63% der in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen und 69% der weiblichen Durchschnittsbevölkerung der Frauenstudie 2004. Dies kann mit den psychischen Erkrankungen der Frauen in Zusammenhang stehen, aber auch mit anderen belastenden Lebensereignissen und Erfahrungen in Kindheit und Jugend (s.a. 4.3.1, Gewalt in Kindheit und Jugend).
Gleiches zeigt sich im Hinblick auf eine abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung. Während im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 und auch bei den in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen etwa 17–19% über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügten, traf dies auf fast die Hälfte (49%) der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen zu und auf mehr als drei Viertel (79%) der in vereinfachter Sprache befragten Frauen.
Auch wenn eine Bewertung und Einordnung der Ursachen dieses Bildungsgefälles durchaus mit den Behinderungen und Einschränkungen im Zusammenhang zu sehen ist, zeigt sich in den Daten, dass die in den Einrichtungen lebenden Frauen in deutlich geringerem Maße über Bildungs- und Ausbildungsressourcen verfügen als die in den Haushalten lebenden Frauen.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Frauen ohne (qualifizierten) Schulabschluss |
2 (3 inkl. anderer Abschlüsse) |
2 (7 inkl. anderer Abschlüsse u. Sonderschulabschluss) |
6 (23 inkl. anderer Abschlüsse u. Sonderschulabschluss) |
23 1) (75 inkl. anderer Abschlüsse u. Sonderschulabschluss) |
** |
|
Haupt- Volksschulabschluss |
27 |
29 |
34 |
7 1) |
** |
|
Mittlere Reife |
40 |
38 |
26 |
1 1) |
** |
|
Abitur Fachhochschulreife |
14 |
13 |
14 |
1 1) |
** |
|
Hochschulabschluss |
15 |
12 |
7 |
0 1) |
** |
|
Mittlere Reife/Abitur/Hochschulabschluss (zusammen) |
96 |
92 |
81 |
2 1) |
** |
|
Frauen ohne abgeschlossene Lehre/Berufsausbildung |
17 |
19 |
49 |
79 2) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)16% der Frauen haben hier keine Angaben gemacht. 2)9% haben keine Angaben gemacht.
Die Frauen der Haushaltsbefragung unterscheiden sich im Hinblick auf Bildung und Ausbildung nicht wesentlich vom weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. Demgegenüber hatten die in Einrichtungen lebenden Frauen deutlich häufiger keine qualifizierte Schul- und/oder Berufsausbildung. Fast ein Viertel der in allgemeiner Sprache und drei Viertel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen verfügten über keine (anerkannten) oder nur Sonderschulabschlüsse. Auch der Anteil der Frauen ohne qualifizierte Berufsausbildungen war bei den in Einrichtungen befragten Frauen hoch. Etwa die Hälfte der in allgemeiner und mehr als drei Viertel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen hatten keine qualifizierte Berufsausbildung.
Die Erwerbssituation der in Haushalten und in Einrichtungen lebenden Frauen unterscheidet sich erheblich. Während die in den Haushalten lebenden Frauen auf dem regulären Arbeitsmarkt mit einem Anteil von 49% nur etwas seltener erwerbstätig sind als Frauen der repräsentativen Frauenstudie 2004 (57%), arbeiten die in Einrichtungen lebenden Frauen weit überwiegend, wenn sie erwerbstätig sind, in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Im Vergleich sind die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen noch deutlich häufiger in Arbeitszusammenhängen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eingebunden als die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (84% vs. 44%).
Bei den in den Haushalten lebenden Frauen fällt auf, dass sie gegenüber der weiblichen Durchschnittsbevölkerung der Frauenstudie 2004 deutlich seltener in Vollzeit erwerbstätig sind (18% vs. 31%), was einerseits mit der höheren Altersgruppenzusammensetzung, andererseits aber auch mit deren erhöhten gesundheitlichen Belastungen in Zusammenhang stehen kann.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
HaushalteN=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Anteil erwerbstätiger Frauen |
57 |
49 |
50 (44 in Werkstatt) |
88 (84 in Werkstatt) |
** |
|
Anteil von in Vollzeit erwerbstätigen Frauen |
31 |
18 |
0 (44 in Werkstatt) |
-- 3) (84 in Werkstatt) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Bis unter 1.200 (andere Einteilung bei der Frauenstudie 2004). 2)Hier und bei allen anderen Auswertungen der vorliegenden Studie bis unter 1.500 €. 3)Frage wurde nicht gestellt.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Haushaltseinkommen bis unter 1.200 bzw. 1.500€ (netto) |
17 1) |
22 2) |
-- 4) |
-- 4) |
** |
|
Eigenes Einkommen bis unter 1.200 bzw. 1.500€ (netto) |
68 1) (34 unter 500€) |
72 (17 unter 400€) |
75 (57 unter 400€) |
43 (von denen, die Auskunft gaben: fast alle unter 400€) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Bis unter 1.200 (andere Einteilung bei der Frauenstudie 2004). 2)Hier und bei allen anderen Auswertungen der vorliegenden Studie bis unter 1.500 €. 3)Frage wurde nicht gestellt. 4) Nicht vergleichbar.
Die Einkommensunterschiede zwischen den Befragungsgruppen sind aufgrund der unterschiedlichen Arten der Erwerbseinbindung nur schwer vergleichend zu interpretieren. Alle in vereinfachter Sprache befragten Frauen haben sehr geringe Einkünfte (unter 400€), gefolgt von den in Einrichtungen lebenden Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden (57% unter 400€); demgegenüber verfügen nur 17% der in Haushalten lebenden Frauen über Einkünfte unter 400€. Die geringen Einkünfte der in Einrichtungen lebenden Frauen sind vor allem auf deren hohe Einbindung in die Werkstattarbeit zurückzuführen, aber auch darauf, dass die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in der Wohneinrichtung getragen werden.[44] 58% der in vereinfachter Sprache befragten und 36% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen gaben entsprechend Einkünfte aus der Werkstatt als zentrale Einnahmequelle an. Bei etwa einem Viertel der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen kommen Leistungen des Sozialamtes hinzu (25% vs. 3–4% bei den anderen Befragungsgruppen). Fast ein Drittel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (31%) konnte allerdings keine Angaben über die derzeitigen Einnahmequellen oder weitere Sozialbezüge machen.
Die in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen hatten im Vergleich mit den in Einrichtungen lebenden Frauen, aber auch im Vergleich mit den Frauen der Frauenstudie 2004, die den weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt repräsentieren, seltener extrem niedrige Einkommen unter 400 bzw. 500 € (17% vs. 34% in der Frauenstudie 2004). Vieles spricht dafür, dass dies vor allem mit Unterschieden in der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen und Renten in Zusammenhang steht. So gaben die in Haushalten lebenden Frauen der vorliegenden Studie deutlich häufiger an, über Einkünfte aus Altersrente/Pension/Witwenrente zu verfügen (22% vs. 3–11% bei den anderen Befragungsgruppen) oder eine Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsrente zu erhalten (17%); Letztere bekamen die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen noch häufiger (29% vs. 3% der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen).
Behinderungen sind häufig mit erhöhten finanziellen Aufwendungen im Alltag verbunden. Ein Problem, das sich vor allem bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Haushalten und Einrichtungen zeigte, stellt die subjektive Einschätzung unzureichender finanzieller Mittel dar, um das Leben und zusätzliche, aufgrund der Beeinträchtigung anfallende Ausgaben bestreiten zu können. So gaben 39% der in Haushalten lebenden Frauen und 42% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen an, die Höhe des Einkommens sei nicht ausreichend für die Dinge, die sie zum Leben benötigten. Das gaben nur 13% der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen an. Darüber hinaus teilten 49% der in Haushalten und 56% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen die Einschätzung, die Höhe ihres Einkommens sei nicht ausreichend für zusätzliche Ausgaben, die aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung, anfielen.
Die Ergebnisse zeigen auf, dass etwa jede zweite bis dritte der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und der in Haushalten befragten Frauen finanzielle Engpässe, auch aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung beschreiben.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ausreichend |
-- 1) |
59 |
44 |
70 |
** |
|
Nicht ausreichend |
-- 1) |
39 |
42 |
13 |
** |
|
Teils – teils |
-- 1) |
-- |
-- |
7 |
** |
|
Weiß nicht/Keine Angabe |
-- 1) |
2 |
14 |
10 |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Frage fehlt in Frauenstudie 2004.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ausreichend |
-- 1) |
43 |
23 |
-- 1) |
** |
|
Nicht ausreichend |
-- 1) |
49 |
56 |
-- 1) |
** |
|
Keine zusätzlichen Ausgaben |
-- 1) |
5 |
8 |
-- 1) |
** |
|
Weiß nicht/Keine Angabe |
-- 1) |
4 |
14 |
-- 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Frage fehlt für Untersuchungsgruppe.
Der Anteil der erwerbstätigen Frauen unterschied sich bei den Frauen der Haushaltsbefragung nicht wesentlich von den Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt, allerdings waren sie seltener in Vollzeit erwerbstätig. Die in Einrichtungen lebenden Frauen waren weit überwiegend in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eingebunden. Dies ging mit geringen Einkommen bis unter 400€ einher. Viele Frauen in vereinfachter Sprache wussten nicht über ihre persönlichen Einkünfte Bescheid. Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen gaben darüber hinaus häufig an, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel seien nicht ausreichend für die Lebenshaltung und für zusätzliche, aufgrund der Behinderung anfallende Kosten.
Auf einer Skala von eins bis sechs konnten die Befragten angeben, wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten der aktuellen Lebenssituation sind, wobei 1 sehr zufrieden und 6 sehr unzufrieden bedeutet. Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, konnten hier „eher zufrieden“ oder „eher unzufrieden“ angeben.
Im Hinblick auf die allgemeine Lebenszufriedenheit sind die in vereinfachter Sprache befragten Frauen deutlich zufriedener mit allen Aspekten des aktuellen Lebens als Frauen in Einrichtungen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, und auch als die in den Haushalten lebenden Frauen. Eher zufrieden über die eigene Lebenssituation äußerten sich mehr als zwei Drittel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (69%). Im Vergleich dazu gaben 38–46% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen an, sehr zufrieden oder zufrieden mit der derzeitigen Lebenssituation zu sein (Frauenstudie 2004: 56%). Die überwiegend psychisch erkrankten Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, sind in vieler Hinsicht eine höher belastete Gruppe und scheinen entsprechend weniger zufrieden mit der aktuellen Lebenssituation zu sein. Mit der Wohnsituation, aber auch mit der allgemeinen Lebenssituation und mit Familienleben, Partnerschaft und Beziehungen sowie dem Berufsleben sind von diesen Frauen nur etwa die Hälfte sehr zufrieden oder zufrieden; bei den anderen Befragungsgruppen waren es mit über 60% deutlich mehr.
Frauen in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, sind deutlich häufiger zufrieden mit der aktuellen Wohnsituation (75%) als Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden (57%), und auch etwas zufriedener als die in Haushalten befragten Frauen (69%). Es könnte sein, dass die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Haushalten und Einrichtungen ihre Situation stärker im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen oder zu vorangegangenen Lebensphasen reflektieren oder auch in höherem Maße Alternativen zur derzeitigen Lebenssituation in Betracht ziehen. Insofern wäre das Ergebnis auch vor dem Hintergrund zu sehen, die eigene Lebenssituation im Hinblick auf Alternativen kritisch zu beurteilen.
|
Sehr zufrieden/ zufrieden mit … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lebenssituation |
56 |
38 |
46 |
69 |
** |
|
Wohnsituation |
-- |
69 |
57 |
75 |
** |
|
Partnerschaft |
(82) 1) |
60 |
49 |
72 |
** |
|
Freundinnen/ Freunden |
78 |
63 |
51 |
74 |
** |
|
Familie |
-- |
63 |
46 |
65 2) |
** |
|
Ausbildung/ Berufsleben |
57 3) |
50 3) |
55 3) |
80 3) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Nur Angaben aus schriftlichem Fragebogen und nur zu aktueller Partnerin bzw. aktuellem Partner; nicht direkt vergleichbar. 2)Weitere 11% kein Kontakt mit Familienmitgliedern. 3)Nur an erwerbstätige Frauen gestellt.
Im Vergleich zur Frauenstudie 2004 sind alle befragten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen seltener zufrieden mit den Bereichen Partnerschaft und Freundinnen/Freunde. Sie sind auch, wie weiter unten noch dokumentiert wird, in höherem Maße sozial isoliert.
In Bezug auf Ausbildung und Berufsleben zeigt sich gegenüber dem Bevölkerungsdurchschnitt der Frauen der Frauenstudie keine deutlich geringere Zufriedenheit.
Im Hinblick auf verschiedene Aspekte der aktuellen Lebenssituation äußerten sich die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen zufriedener als Frauen der anderen Befragungsgruppen. Die zumeist psychisch erkrankten Frauen in Einrichtungen waren insgesamt am wenigsten zufrieden, was auf ihre insgesamt hoch belastete Lebenssituation zurückgeführt werden kann. Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sind gegenüber den Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt in allen Befragungsgruppen seltener zufrieden mit den Bereichen Partnerschaft und Freundinnen/Freunde.
Alle befragten Frauen der vorliegenden Studie sind weit überwiegend bei einem Elternteil oder beiden leiblichen Eltern aufgewachsen. Das traf auf 98% der in den Haushalten befragten Frauen zu (die sich in dieser Hinsicht nicht von den Frauen der Frauenstudie unterschieden) und auf 86–87% der in Einrichtungen lebenden Frauen. Allerdings waren die in vereinfachter Sprache befragten Frauen mit 51% mehr als doppelt so häufig wie die anderen Befragungsgruppen (21%; 11% Frauenstudie 2004) überwiegend bei nur einem leiblichen Elternteil aufgewachsen. Sie lebten zudem auch häufiger in Kindheit und Jugend ganz oder teilweise in einem Heim oder einer Einrichtung (16% vs. 8% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen und 2% der in Haushalten lebenden Frauen).
|
Aufgewachsen bei … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
einem leiblichen Elternteil |
11 |
21 |
21 |
51 |
** |
|
beiden leiblichen Elternteilen |
87 |
77 |
66 |
35 |
** |
|
anderen Verwandten/Bekannten |
(2) 1) |
7 |
8 |
6 |
** |
|
überwiegend in Heim/Einrichtung |
(4) 1) |
1 |
(4) 2) |
7 |
** |
|
teilweise in Heim/Einrichtung |
-- |
1 |
(4) 2) |
9 |
** |
|
Sonstiges |
-- |
3 |
(4) 2) |
4 |
n.s. |
|
Keine Angabe |
1 |
2 |
4 |
* |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Frage nicht exakt vergleichbar. 2)Fallzahlen zu klein für Vergleich.
Die Behinderungen und Beeinträchtigungen bestanden bei gut einem Drittel der in Haushalten befragten Frauen (35%) bereits ab Kindheit und Jugend. Von den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen gaben 46% an, bereits in Kindheit und Jugend behindert/beeinträchtigt gewesen zu sein und von den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen 64%, wobei weitere 30% dieser Frauen es nicht wussten oder dazu keine Angaben machten.[45]
Die folgenden Fragen zum Verhalten der Eltern in Kindheit und Jugend der Befragten wurden nur jenen Frauen gestellt, die in Kindheit und Jugend bereits eine Behinderung oder Beeinträchtigung hatten und die bei einem oder beiden Elternteilen aufgewachsen waren. Viel Unterstützung durch die Eltern erfahren zu haben und darin unterstützt worden zu sein, ein selbstständiger Mensch zu werden, gaben deutlich häufiger die in Haushalten und in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen an als die zumeist psychisch erkrankten in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen (70–76% der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache vs. 59% der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache). Eine besondere Förderung durch die Eltern wurde insbesondere bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen häufiger sichtbar, die zu 61% angaben, die Eltern hätten in Kindheit und Jugend viel mit ihnen gelernt; nur gut ein Drittel der in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen (35–36%) gaben an, die Eltern hätten sie besonders gefördert. In allen Befragungsgruppen gaben 15–16% der Frauen, also jede 6. bis 7. Befragte, an, die Eltern hätten versucht, die Behinderung nach außen hin zu verstecken. Auch wurden 6–10% aller Frauen in Kindheit und Jugend durch Eltern zu Behandlungen oder Therapien gedrängt oder gezwungen, die sie nicht wollten. Jede achte in vereinfachter Sprache befragte Frau (12%), fast jede vierte in einem Haushalt lebende Frau (24%) und mehr als jede dritte in einer Einrichtung in allgemeiner Sprache befragte Frau (36%) gab an, die Eltern seien mit ihr grob und lieblos in Kindheit und Jugend umgegangen. 27% der in Haushalten befragten Frauen und 41% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen hatten zudem nicht das Gefühl von den Eltern vermittelt bekommen, ein normales Mädchen zu sein bzw. eine normale Frau zu werden.[46]
|
Verhalten der Eltern |
Frauenstudie 2004 (%) |
Haushalte N=267 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=39 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=250 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Haben viel unterstützt (geholfen) 1) |
-- 2) |
70 |
59 |
76 |
** |
|
Haben mich besonders gefördert (viel mit mir gelernt) |
-- |
35 |
36 |
(61) 1) |
** |
|
Haben Beeinträchtigung ignoriert/geleugnet |
-- |
29 |
26 |
-- 2) |
n.s. |
|
Haben versucht, Behinderung (mich) nach außen zu verstecken |
-- |
15 |
15 |
16 |
* |
|
Haben mich viel alleingelassen |
-- |
-- 2) |
-- 2) |
22 |
|
|
Haben mich zu ungewollten Behandlungen gezwungen/gedrängt |
-- |
10 |
10 |
6 |
* |
|
Sind grob und lieblos mit mir umgegangen (waren nicht lieb zu mir) |
-- |
24 |
36 |
12 |
** |
|
Haben mich ganz grob herunter-geputzt/lächerlich gemacht |
-- |
-- 2) |
-- 2) |
11 |
|
|
Haben das Gefühl gegeben, ein normales Mädchen/eine normale Frau zu sein |
-- |
73 |
59 |
-- 2) |
n.s. |
|
Haben mich unterstützt, ein selbständiger Mensch zu werden (mir beigebracht, das alleine zu können) |
-- |
71 |
59 |
70 |
** |
Basis: Frauen, die Behinderungen ab Kindheit/Jugend hatten und die bei einem oder beiden Elternteil(en) aufgewachsen sind. Mehrfachnennungen. 1)Abweichung bei Befragung in vereinfachter Sprache und eingeschränkte Vergleichbarkeit. 2)Frage (so) nicht gestellt.
Die hohe Belastung in Kindheit und Jugend, insbesondere bei den in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen, drückt sich auch darin aus, dass diese, soweit sie bereits in Kindheit und Jugend eine Behinderung hatten, zu 40–48% angaben, eine eher nicht so glückliche Kindheit gehabt zu haben (vs. 17% bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen und 19% bei den Frauen der Frauenstudie 2004).[47]
|
Frauenstudie 2004 N=8.010 1) (%) |
Haushalte N=279 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=46 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=282 2) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Eher glücklich |
80 |
80 |
46 3) |
57 3) |
** |
|
Eher nicht so glücklich |
19 |
40 |
48 3) |
17 3) |
** |
|
Teils – teils |
-- 4) |
-- 4) |
-- 4) |
15 3) |
Basis: Alle Befragten, die Behinderung in Kindheit und Jugend hatten. 1)Nur Befragte, die dazu Angaben im schriftlichen Fragebogen gemacht haben. 2)Nur Frauen, die nicht angaben, erst ab Erwachsenenleben behindert zu sein, da viele nicht wussten, ab wann Behinderung eingetreten. 3)7–11% keine Angabe. 4)Antwortvorgabe hier nicht vorhanden.
Weniger stark oder gar nicht von den Eltern unterstützt und angenommen worden zu sein, gaben 37% der in Haushalten lebenden Frauen und 46% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen an (die Unterschiede zwischen den Gruppen waren hier jedoch nicht signifikant). Demnach hat etwa jede zweite bis dritte dieser Frauen eine eher problematische und nicht durch elterliche Geborgenheit und Zuwendung geprägte Kindheit und Jugend erlebt.
|
Starke Unterstützung und Angenommensein durch Eltern? |
Frauenstudie 2004 (%) |
Haushalte N=267 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=39 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=250 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sehr stark |
-- 1) |
26 |
33 |
-- 1) |
n.s. |
|
Stark |
-- 1) |
36 |
18 |
-- 1) |
n.s. |
|
Weniger |
-- 1) |
26 |
18 |
-- 1) |
n.s. |
|
Gar nicht |
-- 1) |
11 |
28 |
-- 1) |
n.s. |
Basis: Alle Befragten, die Behinderung in Kindheit und Jugend hatten und bei einem oder beiden Elternteil(en) aufgewachsen waren. 1)Frage hier nicht gestellt.
Deutlich mehr Frauen der vorliegenden Studie waren im Vergleich zur Frauenstudie 2004 nur bei einem leiblichen Elternteil aufgewachsen. Das traf auf etwa ein Fünftel der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und Haushalten befragten Frauen zu und auf die Hälfte der in vereinfachter Sprache befragten Frauen. Bereits ab Kindheit und Jugend behindert waren gut ein Drittel der in Haushalten befragten Frauen, fast die Hälfte der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache und gut zwei Drittel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen, von denen allerdings weitere 30% dies nicht genau wussten. Jede 6.–10. Frau in allen Befragungsgruppen gab an, die Eltern hätten versucht, die Behinderung nach außen hin zu verstecken und/oder sie sei zu Therapien und Behandlungen gedrängt worden, die sie nicht wollte. Besonders hoch belastete Kindheiten durch groben und lieblosen elterlichen Umgang wurden insbesondere von den in Haushalten und in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen beschrieben. Jede zweite bis dritte Frau dieser Befragungsgruppen fühlte sich nicht ausreichend unterstützt und angenommen.
Zur Erfassung der Einbindung in enge soziale Beziehungen und der sozialen Integration der befragten Frauen wurden, weitgehend analog zur Frauenstudie 2004, folgende Dimensionen abgefragt:
-
Häufigkeit verschiedener Freizeitaktivitäten außer Haus,
-
Häufigkeit von Verwandten-/Bekanntenbesuchen zu Hause,
-
die Möglichkeit, mit nahestehenden Personen bestimmte Problembereiche vertrauensvoll besprechen zu können,
-
die Einschätzung von Potenzialen und Defiziten der eigenen sozialen Beziehungsnetze,
-
die Anonymität (und in dieser Studie auch die Barrierefreiheit) der Wohnumgebung. In der vorliegenden Studie sind die Aspekte von sozialer Einbindung von besonderer Bedeutung, da eine als unzureichend anzusehende soziale Integration ein Indiz für Probleme
und eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sein kann. An dieser Stelle werden daher zunächst Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschrieben, die dann in Kap. 3.5 im Hinblick auf diskriminierungsrelevante Aspekte ausgewertet werden.
Aus der folgenden Vergleichstabelle wird zunächst ersichtlich, dass in Bezug auf Freizeitaktivitäten außer Haus zwischen den in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen und den Frauen der Allgemeinbevölkerung der Frauenstudie 2004 keine relevanten Unterschiede zu bestehen scheinen. Beide gaben in etwa gleich häufig an, in ihrer Freizeit Freundinnen und Freunde, Verwandte und Bekannte zu besuchen, in Organisationen wie Kirchen und Vereinen mitzuarbeiten, Kino, Theater und andere kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, Sport zu treiben oder andere Freizeitaktivitäten außer Haus zu unternehmen. Demnach scheinen die in Haushalten lebenden Frauen hinsichtlich der Teilhabe an außerhäuslichen Freizeitaktivitäten sozial integriert zu sein. Für die in Einrichtungen lebenden Frauen zeigt sich hier in Bezug auf verschiedene Freizeitaktivitäten jedoch eine geringere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie besuchten seltener Freundinnen und Freunde, Verwandte oder Bekannte, gingen seltener ins Kino, Theater oder auf Kulturveranstaltungen und betrieben seltener außerhäuslich Sport. Frauen, die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden, arbeiteten seltener in Organisationen wie Kirchen und Vereinen mit und besuchten seltener Cafés und Restaurants. Insgesamt nimmt aber doch ein erheblicher Teil auch der in Einrichtungen lebenden Frauen an Freizeitaktivitäten außer Haus teil. Inwieweit sie diese selbstbestimmt planen und allein unternehmen können oder nur im Rahmen von organisierten Gruppenaktivitäten, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden.
|
Allgemein (davon häufig/gelegentlich) |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Freundinnen und Freunde, Verwandte, Bekannte besuchen |
99 (87 häufig/ gelegentlich) |
98 (81 häufig/ gelegentlich) |
83 (62 häufig/ gelegentlich) |
69 1) |
** |
|
Mitarbeit inOrganisationen(Kirche, Verein etc.) |
46 (25 häufig/ gelegentlich) |
44 (28 häufig/ gelegentlich) |
37 (27 häufig/ gelegentlich) |
30 1) |
** |
|
Besuch von Kino, Theater, Kulturveranstaltungen |
85 (48 häufig/ gelegentlich) |
80 (41 häufig/ gelegentlich) |
70 (34 häufig/ gelegentlich) |
67 1) |
** |
|
Restaurant, Café |
92 (60 häufig/ gelegentlich) |
91 (61 häufig/ gelegentlich) |
86 (63 häufig/ gelegentlich) |
72 1) |
** |
|
Sport, Bewegung außer Haus |
74 (53 häufig/ gelegentlich) |
78 (62 häufig/ gelegentlich) |
62 4) (45 häufig/ gelegentlich) |
59 1) |
** |
|
Andere Freizeitaktivitäten außer Haus |
78 (57 häufig/ gelegentlich) |
71 (52 häufig/ gelegentlich) |
73 (53 häufig/ gelegentlich) |
80 1) |
** |
|
Andere Freizeitaktivitäten zu Hause |
-- 2) |
89 (72 häufig/ gelegentlich) |
89 (77 häufig/ gelegentlich) |
88 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Keine direkte Vergleichbarkeit, da die Frauen in vereinfachter Sprache nicht zur Häufigkeit befragt wurden, sondern die Frage lautete: „Was machen Sie in Ihrer Freizeit?… Sagen Sie mir bitte, ob Sie das auch tun oder nicht.“ Anteil der Frauen, die hierzu keine Angaben gemacht haben, 4–8%. 2)Frage nicht gestellt.
Von einer Isolation in den Einrichtungen ist auf dieser Basis demnach nicht für die Mehrheit, aber für einen Teil der in Einrichtungen befragten Frauen auszugehen. Insbesondere von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen nahm etwa ein Drittel in sehr geringem Maße an außerhäuslichen kulturellen oder sozialen Aktivitäten teil. Die Frage, ob das mit persönlichen Vorlieben der Frauen, ihren geringen finanziellen Ressourcen, einrichtungsinternen Regelungen oder auch mit dem Wohnumfeld in Zusammenhang steht, kann hier nicht beantwortet werden.
Frauen, die in Einrichtungen leben, erhalten deutlich seltener Besuch von Nachbarinnen und Nachbarn, Verwandten und Freundinnen bzw. Freunden als Frauen, die in Haushalten leben. Während über 80% der in Haushalten lebenden Frauen angaben, häufig oder gelegentlich besucht zu werden, traf dies nur auf 50–70% der in Einrichtungen lebenden Frauen zu. Dies scheint zum einen eine Folge des geringeren Maßes an fortbestehenden familiären und freundschaftlichen Kontakten mit Personen außerhalb der Einrichtungen zu sein. Es könnte zum anderen aber auch auf die Wohnform selbst zurückzuführen sein, weil Freundschaften möglicherweise vor allem innerhalb des Wohnheims gepflegt werden und zudem das Wohnen in Einrichtungen auch räumlich nur eingeschränkte Möglichkeiten für eine Privat- und Intimsphäre belässt (s.o.).
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Häufig |
36 |
36 |
27 |
68 1) (manchmal) |
** |
|
Gelegentlich |
48 |
44 |
25 |
||
|
Selten |
14 |
17 |
30 |
||
|
Nie |
1 |
2 |
15 |
||
|
Weiß nicht/ Keine Angabe |
0 |
1 |
4 |
Basis: Alle befragten Frauen. 1)Keine Häufigkeitsabfrage. „Bekommen Sie manchmal Besuch von …?“ (Antwortvorgabe: Ja/Nein).
Vertraute Personen, mit denen Probleme besprochen werden können, gehören zu den sozialen Ressourcen für die Bearbeitung von Erfahrungen und die Bewältigung von Problemen. Insbesondere bei einer Gewaltbetroffenheit können sie ein wichtiger Schutz- und Präventionsfaktor sein.
Die Auswertung zeigt auf, dass zwar die Mehrheit der befragten Frauen Personen haben, mit denen sie persönliche Probleme besprechen können, dass aber ein Teil der Frauen nicht über entsprechende vertrauensvolle Beziehungspersonen verfügt. So gaben zwar 71% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen an, sie hätten eine Person, mit der sie persönliche Probleme besprechen könnten, und nannten hier überwiegend weibliche Betreuungspersonen, Familienangehörige, Partnerinnen bzw. Partner und Freundinnen bzw. Freunde; fast ein Fünftel der Frauen (19%) verneinten dies aber und weitere 10% wussten dies nicht oder machten dazu keine Angaben.
Bei den anderen Befragungsgruppen bezog sich die Frage, wie bei der Frauenstudie 2004, auf spezifische Problembereiche, die mit nahen oder vertrauten Personen besprochen werden können, und weniger auf konkrete Ansprechpersonen. Dabei wurde sichtbar, dass die Mehrheit der Frauen für die meisten Problembereiche Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner haben, mit denen sie vertrauensvoll sprechen können. Allerdings kann insbesondere von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen jede Achte mit niemandem über Gesundheitsprobleme sprechen, jede Siebte kann nicht über Probleme im Bereich Familie und Partnerschaft sprechen, jede Neunte hat nach eigenen Angaben keine Person, mit der sie vertrauensvoll sprechen kann, wenn sie schlecht behandelt wird, und für mehr als jede Dritte ist es nicht möglich, mit einer Person ihres Vertrauens über sexuelle Probleme und Erfahrungen zu sprechen. Dieses Ergebnis ist gerade vor dem Hintergrund der Einbindung vieler dieser Frauen in psychiatrische und psychotherapeutisch spezialisierte Einrichtungen und auch vor dem Hintergrund hoher psychischer und Gewaltbelastungen dieser Frauen (s. Kap. 3.2.3 und 3.3) als problematisch zu bewerten. Allerdings kann auch jede vierte bis fünfte Frau der Haushaltsbefragung und der repräsentativen Frauenstudie 2004 mit niemandem vertrauensvoll über sexuelle Probleme und Erfahrungen sprechen.
Probleme im Bereich der Arbeit konnten von 5–8% der befragten Frauen dieser und der Frauenstudie 2004 nicht angesprochen werden.
|
Keine nahestehende oder vertraute Person für Besprechung von … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesundheitsproblemen |
9 |
7 |
12 |
19 1) |
** |
|
Problemen mit Familie/Partnerin bzw. Partner |
15 |
11 |
14 |
** |
|
|
Problemen in der Arbeit |
8 |
5 |
8 |
** |
|
|
Problemen, wenn schlecht behandelt wird |
-- |
7 |
11 |
n.s. |
|
|
Sexuellen Problemen/Erfahrungen |
26 |
21 |
35 |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Nur generelle Frage, ob jemand vorhanden, mit dem persönliche Probleme besprochen werden können. Antwort: Nein.
Die Unterschiede zwischen den Befragungsgruppen in Bezug auf soziale Beziehungen scheinen sich weniger in der Quantität von Besuchen, Freizeitaktivitäten u. Ä. als vielmehr in der Qualität und dem emotionalen Aufgehobensein in den Beziehungen widerzuspiegeln. Die Auswertung verweist darauf, dass ein erheblicher Anteil der in Haushalten und in Einrichtungen lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen hier Defizite beschreibt, die sich auf die Lebenssituation, das psychische Wohlbefinden und die Gesundheit der Frauen auswirken können und mitunter auch eine Ursache für erhöhte gesundheitliche Beschwerden und psychische Probleme sein können.
Im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 gaben alle in der Studie befragten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen deutlich häufiger an, enge und vertrauensvolle Beziehungen zu vermissen, die Wärme, Geborgenheit und Wohlgefühl vermitteln. Während die in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen Aussagen wie „Ich vermisse Leute, bei denen ich mich wohlfühle“, „Mir fehlt eine richtig gute Freundin oder ein richtig guter Freund“, „Ich vermisse Geborgenheit und Wärme“ oder „Ich fühle mich häufig im Stich gelassen“ etwa doppelt so häufig zustimmten wie Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004, waren es bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen in der Tendenz anteilsmäßig drei- bis viermal so viele Frauen, die entsprechende Probleme benannten. In der Zusammenschau der Ergebnisse wird sichtbar, dass etwa ein Drittel der in Haushalten lebenden Frauen und etwa die Hälfte der in Einrichtungen lebenden Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, enge und Geborgenheit vermittelnde Beziehungen vermissen.
|
Zustimmung zu folgender Aussage … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Es gibt immer jemanden in meiner Umgebung, mit dem ich die alltäglichen Probleme besprechen kann. |
92 |
86 |
85 |
84 1) |
** |
|
Ich vermisse Leute, bei denen ich mich wohlfühle. |
16 |
31 |
53 |
(7) 2) |
** |
|
Es gibt genug Menschen, die mir helfen würden, wenn ich Probleme habe. |
90 |
85 |
83 |
81 3) |
** |
|
Mir fehlt eine richtig gute Freundin bzw. ein richtig guter Freund. |
17 |
30 |
40 |
18 3) |
** |
|
Ich fühle mich häufig im Stich gelassen. |
10 |
23 |
37 |
38 3) |
** |
|
Ich kenne viele Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen kann. |
82 |
72 |
71 |
76 3) |
** |
|
Ich vermisse Geborgenheit und Wärme. |
13 |
28 |
57 |
(13) 2) 3) |
** |
|
Ich finde, dass mein Freundes- und Bekanntenkreis zu klein ist. |
20 |
28 |
46 |
-- 4) |
** |
|
Es gibt genügend Menschen, mit denen ich mich eng verbunden fühle. |
84 |
74 |
66 |
-- 4) |
** |
|
Wenn ich sie brauche, sind meine Freundinnen immer für mich da. |
89 |
82 |
77 |
78 1) |
** |
|
Ich vermisse eine wirklich enge Beziehung. |
16 |
24 |
46 |
-- 4) |
** |
|
Ich bräuchte mehr Zeit ganz für mich allein. |
-- 4) |
44 |
30 |
59 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)6–8% keine Angabe. 2)Antwort evtl. nicht direkt vergleichbar, da andere Frageformulierung. 3)10–13% keine Angabe. 4)Antwortvorgabe nicht vorhanden.
Die entsprechenden Antwortvorgaben der in vereinfachter Sprache befragten Frauen sind nicht direkt vergleichbar mit den Antwortvorgaben der in allgemeiner Sprache befragten Frauen, sodass unklar ist, inwiefern auch sie diese Probleme in einem vergleichbaren Ausmaß haben. Die weiter oben dokumentierte größere Zufriedenheit dieser Frauen mit Familien-, Paar- und Freundesbeziehungen könnte nahelegen, dass hier weniger starke Probleme bestehen oder wahrgenommen werden. Allerdings gaben auch von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen 37% an, sie fühlten sich alleingelassen. Ein im Vergleich zu anderen Befragungsgruppen deutlich größeres Problem der in vereinfachter Sprache befragten Frauen scheint allerdings der mangelnde Freiraum für das Alleinsein zu sein. So gaben 59% der Frauen an, sie bräuchten mehr Zeit zum Alleinsein, im Vergleich zu 30% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und 44% der in Haushalten befragten Frauen. Dies dürfte auch mit der teilweise hohen Anzahl an Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in den Wohngruppen und Einrichtungen für Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Verbindung stehen.
Zur Beurteilung der Anonymität, Unterstützung und Barrierefreiheit der Wohnumfelder liegen nur wenige vergleichbare Ergebnisse aus dieser und der Frauenstudie 2004 vor. Generell zeigt sich aber, dass die in den Haushalten lebenden Frauen relativ häufig ein unterstützendes Wohnumfeld beschreiben (77%), in dem sie sich wohl- und sicher fühlen (88%). Beides trifft für die in Einrichtungen lebenden Frauen deutlich seltener zu: Nur 46–57% beschreiben die Menschen aus ihrer Wohngegend als unterstützend und nur 70–75% fühlen sich dort wohl und sicher, was auch mit deren erhöhter Angst vor Gewalt und Übergriffen in Zusammenhang stehen kann (vgl. Kap. 3.1.9).
Auch ein barrierefreies Wohnumfeld scheint für die überwiegende Mehrheit der in Haushalten lebenden Frauen (95%) und der Einrichtungsfrauen/EA (84%) gegeben zu sein. Allerdings beschreiben 15% der in Haushalten lebenden Frauen und 24% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen, sie lebten in Wohngegenden, in denen die Menschen Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen haben.
|
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Menschen kennen und helfen sich. |
55 |
77 |
57 |
(55 kennen/ 46 helfen) |
** |
|
Befragte fühlt sich wohl und sicher. |
-- 1) |
88 |
75 |
70 |
** |
|
Befragte kann sich frei bewegen. |
-- 1) |
95 |
84 |
-- 1) |
** |
|
Menschen haben Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen. |
-- 1) |
15 |
24 |
-- 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Antwortvorgabe nicht vorhanden.
In der Studie wird eine größere soziale Isolation der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sichtbar. Diese zeigt sich zum einen in der geringeren Einbindung in Geborgenheit und Verlässlichkeit vermittelnde enge soziale Beziehungen. Darüber hinaus nahmen die in Einrichtungen befragten Frauen häufiger nicht an außerhäuslichen sozialen Aktivitäten teil und empfingen in geringerem Maße Besuch in ihrem Zuhause. Sie lebten zudem weniger sozial integriert in ihrem Wohnumfeld und fühlten sich hier weniger wohl und sicher. Etwa jeder fünften bis zehnten Frau steht darüber hinaus keine vertraute Person zur Verfügung, mit der private und intime Angelegenheiten besprochen werden können.
Zum Sicherheitsgefühl und zu bestehenden Ängsten der Frauen wurden drei Aspekte abgefragt: zum einen das Gefühl von Sicherheit in verschiedenen alltäglichen Lebenssituationen, zum anderen die Angst vor körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch verschiedene Personengruppen und zum dritten Ängste in Bezug auf die Entwicklung der Erkrankung/Behinderung, zunehmende Abhängigkeiten und die eigene existenzielle Absicherung.
Ihre Sicherheitsgefühle und Ängste in verschiedenen Lebenssituationen konnten die in allgemeiner Sprache befragten Frauen anhand einer 6er-Skala von „sehr sicher“ bis „sehr unsicher“ angeben, während die in vereinfachter Sprache befragten Frauen das Bestehen von Ängsten in verschiedenen Situationen in drei Kategorien mit „Ja“, „Nein“, „Teils – teils“ beantworten konnten. In der folgenden Tabelle sind die Anteile der Frauen ausgewiesen, die sich in Bezug auf die jeweilige Alltagssituation „sehr sicher/sicher“ fühlten bzw. keine Angst zu haben angaben.
|
… sehr sicher/sicher, bei … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
Spätabends oder nachts im Dunkeln allein nach Hause gehen |
34 (13 mache ich nicht) |
39 (4 mache ich nicht) |
28 (25 mache ich nicht) |
39 3) |
n.s. |
|
Abends oder nachts allein in Wohnung/Zimmer sein |
79 (4 mache ich nicht) |
84 (0 mache ich nicht) |
78 (1 mache ich nicht) |
80 |
n.s. |
|
Allein mit Pflegekraft/ anderer Unterstützungsperson sein |
-- 4) |
5 (63 mache ich nicht) 5) |
73 1) (1 mache ich nicht) |
82 2) |
** |
|
Allein mit Bewohnerinnen oder Bewohnern der Einrichtung zu sein |
-- 4) |
-- 4) |
56 1) (1 mache ich nicht) |
74 2) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)13% keine Angabe. 2)6–7% keine Angabe. 3)Antwortkategorien in vereinfachter Sprache anders; statt 6er-Skala nur 3 Alternativen auf die Frage: „Haben Sie Angst, wenn …“: Ja, nein, teils – teils; hier Kategorie „Nein“ dokumentiert. 4)Antwortvorgabe nicht vorhanden. 5)31% keine Angabe.
Spätabends oder nachts im Dunkeln nach Hause zu gehen, ist für die Mehrheit der Frauen mit einem Gefühl von Unsicherheit verbunden: Nur etwa ein Drittel der Frauen (28–39%) fühlte sich dabei sicher oder sehr sicher, am wenigsten die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen; Letztere gaben allerdings auch zu 25% an, diese Situation nicht zu erleben.
Abends oder nachts allein in Wohnung oder Zimmer zu sein, ging für die meisten Frauen (78–84%) mit einem Gefühl von Sicherheit einher. Das Sicherheitsgefühl unterscheidet sich zwischen den Untersuchungsgruppen diesbezüglich kaum.
Stärkere Ängste und Unsicherheitsgefühle wurden von den in Einrichtungen lebenden Frauen in Bezug auf Situationen genannt, in denen sie „allein mit Pflegekraft/ Unterstützungsperson“ oder „mit Bewohnerinnen bzw. Bewohnern der Einrichtung“ sind. Etwa jede vierte bis fünfte in vereinfachter Sprache befragte Frau und jede zweite bis vierte in allgemeiner Sprache in einer Einrichtung befragte Frau fühlte sich in diesen Situationen nicht sicher oder hatte Angst. Zudem fällt auf, dass bei diesen Fragen die in Einrichtungen lebenden Frauen in erhöhtem Maße keine Angaben gemacht haben (6–13%). Dies könnte ein Hinweis auf vorliegende Ängste sein, darüber zu berichten. Die Angst vor dem Alleinsein mit Bewohnerinnen bzw. Bewohnern der Einrichtungen ist mit 26–44% noch häufiger genannt worden als die Angst oder Unsicherheit, mit Pflegekräften/Unterstützungspersonen allein zu sein (18–27%). Diese Ängste und Unsicherheitsgefühle korrespondieren, wie auch die Auswertungen zu Gewalterfahrungen in Kap. 4.3 aufzeigen, mit konkret erhöhten Gefahren, Opfer von sexuellen und körperlichen Übergriffen insbesondere durch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Einrichtungen zu werden.
|
Ängste häufig/gelegentlich/selten Angst davor, dass … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
34% Angst vor körperlichem Übergriff, 24% Angst vor sexuellem Übergriff 1) |
|||||
|
ein Fremder körperlich oder sexuell angreifen oder verletzen könnte. |
68 (33 häufig/ gelegentlich) |
49 (22 häufig/ gelegentlich) |
52 3) (34 häufig/ gelegentlich) |
(24) 2) |
** |
|
jemand aus Bekanntenkreis körperlich oder sexuell angreifen oder verletzen könnte. |
7 (2 häufig/ gelegentlich) |
8 (3 häufig/ gelegentlich) |
26 2) (häufig/ gelegentlich 11) |
(4) 2) |
|
|
jemand aus Familie/Partnerin oder Partner körperlich oder sexuell angreifen oder verletzen könnte. |
3 (1 häufig/ gelegentlich) |
6 (2 häufig/ gelegentlich) |
21 2) (7 häufig/ gelegentlich) |
(4) 2) |
** |
|
jemand aus Arbeit, Schule, Ausbildung körperlich oder sexuell angreifen oder verletzen könnte. |
8 (2 häufig/ gelegentlich) |
8 (3 häufig/ gelegentlich, 19 trifft nicht zu) |
17 2) (6 häufig/ gelegentlich, 25 trifft nicht zu) |
(7) 2) |
n.s. |
|
jemand, der für Unterstützung, Betreuung, Pflege, gesundheitliche Versorgung zuständig, körperlich oder sexuell angreifen oder verletzen könnte. |
-- 4) |
2 (1 häufig/ gelegentlich, 29 trifft nicht zu) |
9 (2 häufig/ gelegentlich) |
(1) 2) |
n.s. |
|
jemand aus der Einrichtung körperlich oder sexuell angreifen oder verletzen könnte. |
-- 4) |
-- 4) |
21 3) (13 häufig/ gelegentlich) |
(10) 2) |
n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Veränderte Frageformulierung, nicht direkt vergleichbar. In der nachfolgenden Spalte wurden die Personen aufgeführt, vor denen die Frau Angst hat (nach offener Frage). Nicht vergleichbar mit Daten der anderen Untersuchungsgruppen. 2)4–5% keine Angabe. 3)6–7% keine Angabe. 4)Antwortvorgabe nicht vorhanden.
Wie bei den Befragten der Frauenstudie 2004 haben auch die in dieser Studie befragten Frauen am häufigsten Angst vor sexuellen oder körperlichen Übergriffen durch unbekannte Personen und seltener Angst vor bekannten Personen im nahen sozialen Umfeld. Dieser Befund wird allerdings durch die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen modifiziert, die im Vergleich zu allen anderen Befragungsgruppen in erhöhtem Maße auch Ängste vor körperlichen/sexuellen Übergriffen durch Personen aus dem Bekanntenkreis (26%) sowie der Familie und Partnerschaft (21%) angegeben haben. Bei diesen Frauen fallen außerdem die erhöhten Ängste vor Personen aus der Einrichtung (21%) und der Arbeit (17%) sowie vor professionellen Helfenden in Pflege, Betreuung und gesundheitlicher Versorgung (9%) auf. Das Ergebnis weist auf ein eingeschränktes Vertrauen in die eigene Sicherheit und körperliche Unversehrtheit sowie sexuelle Integrität dieser Frauen in allen Lebenssituationen und in nahen sozialen Beziehungen hin. Dies kann, wie auch die weiteren Auswertungen noch aufzeigen werden, auch durch die tatsächlich hohen Gewaltbelastungen dieser Gruppe durch Täterinnen und Täter im sozialen Nahraum in Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben bedingt sein (vgl. Kap. 3.3).
Von allen Befragungsgruppen äußerten die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen die geringsten Ängste in Bezug auf körperliche/sexuelle Angriffe. Dies könnte ein Effekt der leicht veränderten Frageformulierung sein, bei der die Antwort „Ja“ auf die Frage: „Haben Sie manchmal Angst, dass …“ korrespondiert mit der Antwort „häufig/gelegentlich“ auf die Frage: „Wie häufig haben Sie Angst, dass …“ bei den anderen Befragungsgruppen. Selbst wenn bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen die Nennung „selten“ in die vergleichende Auswertung mit einbezogen worden wäre, würde in Bezug auf alle Kontexte/Personengruppen – mit Ausnahme des Arbeitskontextes – ein geringeres Bedrohungsgefühl bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen bestehen bleiben. Unabhängig vom Lebenskontext gab etwa ein Drittel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen an, manchmal Angst vor körperlichen Übergriffen zu haben, und fast ein Viertel (24%) äußerte Angst vor sexuellen Übergriffen. Wenn diese Frauen Angst vor körperlichen Übergriffen hatten, dann am häufigsten vor Übergriffen durch Fremde (20% der Befragten), durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt (6%) oder durch Personen aus der Einrichtung (9%). Wenn Angst vor sexueller Gewalt bestand, dann weit überwiegend vor sexueller Gewalt durch unbekannte Personen (15%).
Abgesehen von den erhöhten Ängsten vor Übergriffen durch nahestehende Personen und durch Personen in Einrichtungen bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen kann auf Basis der Befragungsergebnisse nicht generell von einem geringeren Sicherheitsgefühl der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen im Vergleich zum weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt (Frauenstudie 2004) ausgegangen werden. Im Hinblick auf die Anforderung an Einrichtungen, einen geschützten Rahmen für deren Bewohnerinnen und Bewohner zu bieten, ist jedoch problematisch, dass etwa 10–20% der Frauen Angst vor Gewalt durch Personen aus Einrichtungen haben und sich 7–17% in den Arbeitszusammenhängen vor körperlichen/sexuellen Übergriffen fürchten.
Ein weiteres Thema, mit dem Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in besonderem Maße konfrontiert sind, sind die Ängste vor zunehmender Abhängigkeit aufgrund der Behinderung/Beeinträchtigung und vor existenzieller Not.
|
Häufig/gelegentlich Angst vor … |
Frauenstudie 2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
starker oder zunehmender Abhängigkeit von anderen. |
-- 1) |
36 |
24 2) |
25 3) |
|
|
finanzieller Not und Existenzverlust |
-- 1) |
55 |
39 2) |
25 3) |
|
|
negativen Folgen oder Entwicklungen im Zusammenhang mit Beeinträchtigung/ Behinderung/ Erkrankung |
-- 1) |
57 |
46 2) |
35 3) |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Keine entsprechende Frage im Fragebogen. 2)4–5% keine Angabe. 3)12–16% keine Angabe.
Mehr als ein Drittel der in Haushalten befragten Frauen (36%) und etwa ein Viertel der in Einrichtungen befragten Frauen (24–25%) äußerten die Angst vor starker oder zunehmender Abhängigkeit von anderen. Über die Hälfte der in Haushalten lebenden Frauen (55%), zwei Fünftel der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (39%) und immerhin ein Viertel (25%) der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen äußerten Ängste vor finanzieller Not und Existenzverlust. Diese Ängste korrespondieren mit den erheblichen Ängsten vor negativen Folgen und Entwicklungen in Bezug auf die Behinderungen und Erkrankungen, die gut jede zweite bis dritte Frau befürchtete, allen voran die in Haushalten befragten Frauen (57% vs. 46% der in allgemeiner und 35% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen).
Abbildung 6. Diagramm 6: Ängste in Bezug auf die Entwicklung der Erkrankung/Behinderung, zunehmende Abhängigkeiten und die existenzielle Absicherung
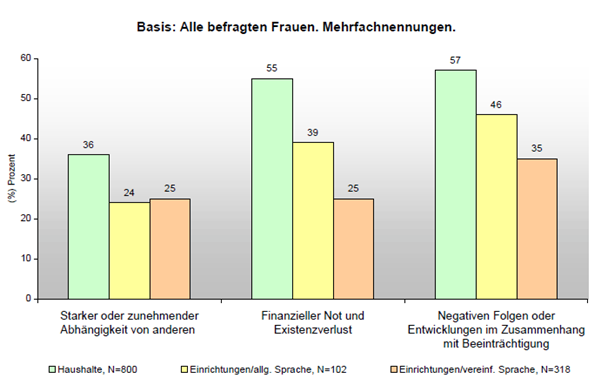
In Bezug auf Sicherheitsgefühl und Ängste wurden insbesondere bei den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen erhöhte Ängste vor körperlichen und/oder sexuellen Übergriffen und das Gefühl von mangelnder Sicherheit in Alltagssituationen sichtbar. Darüber hinaus gaben beide in Einrichtungen lebenden Gruppen zu ca. 10–20% an, Angst vor körperlichen/sexuellen Übergriffen durch Personen aus den Einrichtungen und in den Arbeitszusammenhängen zu haben. Ängste vor finanzieller Not und Existenzverlust äußerten dagegen am häufigsten die in Haushalten befragten Frauen (55%), gefolgt von den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache (39%) und von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen (25%).
In den Hauptinterviews wurden Frauen in den drei Befragungsgruppen, also in der Haushaltsbefragung, in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache und der in vereinfachter Sprache zu körperlichen Beeinträchtigungen, Seh-, Sprech-, Hörbeeinträchtigungen, psychischen Beeinträchtigungen und Lernbeeinträchtigungen befragt. Dabei ist zu beachten, dass zum Sample der Haushaltsbefragung nur Frauen gehören, die bei der Kontaktaufnahme im Screening eine dauerhafte oder wiederkehrende starke oder sehr starke Beeinträchtigung im Alltag aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung angegeben und/oder einen Behindertenausweis haben und/oder Einrichtungen und Angebote der Behindertenhilfe nutzen. Das Sample der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache bilden vor allem Frauen, die wegen einer psychischen Erkrankung in einer Einrichtung leben, aber vereinzelt auch wegen einer Körper-/Mehrfachbehinderung oder einer Sinnesbeeinträchtigung. In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache wurden vor allem Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung, vereinzelt aber auch mit psychischer Erkrankung und dadurch stark eingeschränkter Konzentrationsfähigkeit befragt.
In allen drei Befragungsgruppen sind fast alle Frauen mehrfach beeinträchtigt.[48] Bei der überwiegenden Mehrheit der Frauen haben dabei körperliche Beeinträchtigungen eine wesentliche Bedeutung. Dies gilt vor allem für die Haushaltsbefragung, in der 92% der Frauen u.a. körperliche Beeinträchtigungen aufweisen, in etwas geringerem Ausmaß aber mehrheitlich auch für die beiden Einrichtungsbefragungen (80–82% der Befragten). Hoch ist auch das Ausmaß der psychischen Beeinträchtigung der Frauen in allen Befragungsgruppen. So hatten Frauen der Haushaltsbefragung zu zwei Drittel (68%) psychische Beeinträchtigungen genannt. In der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache beruht das hohe Ausmaß der psychischen Beeinträchtigung (88%) auf der Zusammensetzung des Samples (vor allem Frauen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung in Einrichtungen leben). Aber auch die in vereinfachter Sprache befragten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen gaben zu 43% psychische Beeinträchtigungen/Probleme an. Diese Angaben sind jedoch nicht direkt vergleichbar.[49] Einerseits zeigt sich, dass die Frauen der Haushaltsbefragung zusätzlich zu den körperlichen Beeinträchtigungen sehr häufig auch psychisch beeinträchtigt sind, andererseits fällt auf, dass Frauen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer sogenannten geistigen Behinderung in einer Einrichtung leben, sehr häufig zusätzlich körperlich beeinträchtigt sind.
Während in der Haushaltsbefragung körperliche und psychische Beeinträchtigungen – zumeist auch in Kombination – die größte Rolle spielen, kommen in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache in einem größeren Umfang auch Lernbeeinträchtigungen (30%) hinzu, die aber wie in der Haushaltsbefragung (17%) kaum auf geistige Behinderungen, sondern eher auf Konzentrationsschwierigkeiten etc. hinweisen.[50] Eine Lernbeeinträchtigung hat erwartungsgemäß in der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache eine größere Bedeutung (78%), ebenso auch Sprechbeeinträchtigungen (31%), da hier überwiegend Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen befragt wurden.
Die folgende Tabelle zeigt einen vergleichenden Überblick über die Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen[51].
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Körperliche Beeinträchtigungen |
92 |
82 |
80 |
** |
|
Psychische Beeinträchtigungen |
68 |
88 |
-- 2) |
** |
|
Lern-beeinträchtigungen |
17 |
30 |
78 |
** |
|
Seh-beeinträchtigungen |
14 |
25 |
7 |
** |
|
Sprech-beeinträchtigungen |
8 |
13 |
31 |
** |
|
Hör-beeinträchtigungen |
19 |
20 |
12 |
* |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Werte unterscheiden sich leicht von den Werten der zuerst veröffentlichten Kurzzusammenfassung, da bei der Endprüfung Rundungsfehler gefunden wurden. 2)Aufgrund einer vereinfachten Abfrage sind die Angaben hier nicht direkt vergleichbar.
Die meisten Frauen in den drei Befragungsgruppen haben Beeinträchtigungen in mehreren Bereichen (körperliche Beeinträchtigung, Seh-, Sprech-, Hörbeeinträchtigung, psychische Beeinträchtigung, Lernbeeinträchtigung). Knapp zwei Drittel (64%) der Frauen in den Haushalten nannten Beeinträchtigungen in zwei bis drei Bereichen, weitere 9% sogar in vier bis sechs Bereichen. Der Mittelwert liegt bei 2,2 Beeinträchtigungen. Von Mehrfachbeeinträchtigungen sind die Frauen in Einrichtungen häufiger betroffen. Nur 12% der Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, und 18% der Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, haben nur in einem Bereich eine Beeinträchtigung. Durchschnittlich wurden in beiden Einrichtungsbefragungsgruppen zwei bis drei Bereiche benannt (Mittelwert 2,6).
|
Anzahl der genannten Beeinträchtigungsarten 1) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
26 |
12 |
18 |
** |
|
2 |
42 |
39 |
28 |
|
|
3 |
22 |
28 |
30 |
|
|
4 |
5 |
14 |
20 |
|
|
5 |
3 |
6 |
4 |
|
|
6 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Gesamt |
100 |
100 |
100 |
|
|
Mittelwert |
2,2 |
2,6 |
2,6 |
Basis: Alle befragten Frauen. 1)Beeinträchtigungsarten: körperliche Beeinträchtigung, Seh-, Sprech-, Hörbeeinträchtigung, psychische Beeinträchtigung, Lernbeeinträchtigung. 2)Aufgrund eines Rundungsfehlers war hier in der Broschüre/Kurzzusammenfassung der Wert 40 angegeben worden.
Betrachtet man die Frauen in der Haushaltsbefragung mit nur einer Beeinträchtigung (26%), so sind die meisten von ihnen entweder körperlich (79%) oder psychisch (15%) beeinträchtigt. Von den 12 Frauen, die in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache nur eine Behinderung angegeben haben (12%), sind 10 Frauen psychisch und drei Frauen sehbeeinträchtigt. In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache gaben 18% nur einen Beeinträchtigungsbereich an. In knapp der Hälfte dieser Fälle (45%) wurden körperliche Beeinträchtigungen, in 40% Lernbeeinträchtigungen und in 11% Sprechbeeinträchtigungen genannt. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass viele Frauen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich subjektiv nicht als lernbeeinträchtigt empfinden oder bezeichnen und deshalb in diesem Bereich keine Beeinträchtigungen benannt haben.
Betrachtet man die Kombinationen von Beeinträchtigungen, so fällt auf, dass sowohl in der Haushaltsbefragung als auch in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache in allen Mehrfachkombinationen am häufigsten eine Kombination von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen auftritt. Bei der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache handelt es sich zumeist um eine Kombination von Körper- und Lernbeeinträchtigungen.
Frauen in Haushalten haben am seltensten, Frauen in Einrichtungen für Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen am häufigsten einen Behindertenausweis. Dies gilt auch für das Vorhandensein einer gesetzlichen Betreuung.
93% der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen gaben an, einen Behindertenausweis zu haben, und 76% eine gesetzliche Betreuerin oder einen Betreuer. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 13% dieser Frauen die Frage nach der gesetzlichen Betreuung nicht beantworten konnten oder wollten.
In der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache haben 73% der zumeist psychisch erkrankten Frauen einen Behindertenausweis und 65% eine gesetzliche Betreuung. Die Haushaltsbefragung ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, da es hier gelungen ist, zu einem großen Teil Dunkelfelder von nicht amtlich erfasster Beeinträchtigung aufzudecken: Nur 37% der beeinträchtigten Frauen in den Haushalten haben einen Behindertenausweis und nur sehr wenige (2%) eine gesetzliche Betreuung. Dass es sich hier dennoch um eine stark beeinträchtigte und gesundheitlich hoch belastete Gruppe Frauen handelt, die dem Bereich der Menschen mit Behinderungen zuzuordnen sind, wurde einerseits durch das Screening[52] im Vorfeld der Interviews sichergestellt und bestätigt sich andererseits auch in der Auswertung der genannten Behinderungen und Einschränkungen[53].
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Behindertenausweis vorhanden |
37 |
73 |
93 |
** |
|
Gesetzliche Betreuung |
2 |
65 |
76 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)13% keine Angabe (vs. 1–3% bei den anderen Befragungsgruppen).
Die Frage, ob die Beeinträchtigung oder Behinderung angeboren ist, wurde im Fragebogen an drei Stellen erhoben[54]. In Frage M.2.6 wurde nach dem Eintreten jeder einzelnen Beeinträchtigung gefragt. Da die meisten Frauen mehrere Beeinträchtigungen angegeben hatten, kam es vor, dass eine Beeinträchtigung erst im Erwachsenenalter auftrat, während eine andere aber bereits seit Geburt bestand. In M.2.7 wurden die Frauen, bei denen nicht alle Beeinträchtigungen bereits seit der Geburt bestanden, nach den Ursachen der Beeinträchtigungen gefragt und eine der Antwortvorgaben lautete: „sind angeboren“ (siehe unten).
In Frage M.8.2 wurden schließlich alle Frauen einleitend zu einem Modul zu Kindheit und Jugend noch einmal gefragt, ob ihre Beeinträchtigung oder Behinderung bereits seit der Geburt oder seit Kindheit und Jugend bestand oder erst im Erwachsenenleben aufgetreten war. Hier entschieden die Befragten subjektiv, welche Beeinträchtigung ihrer Einschätzung nach die vorrangige ist, und beantworteten die Frage anhand der von ihnen als vorrangig eingeschätzten Beeinträchtigung. Die Frage M.8.2 soll hier herangezogen werden, um die Anzahl der seit der Geburt beeinträchtigten Frauen zu bestimmen:
Die Frauen der Haushaltsbefragung gaben mehrheitlich (zu 64%) eine Beeinträchtigung erst ab dem Erwachsenenalter an, 19% waren seit Kindheit und Jugend beeinträchtigt und nur 16% seit der Geburt. In der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache stuften sich die Hälfte der Frauen als seit der Geburt (22%) sowie seit Kindheit und Jugend (23%) beeinträchtigt ein; die andere Hälfte (50%) nannte einen Beginn der Beeinträchtigung im Erwachsenenleben. In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache kehrt sich dieses Verhältnis um: 49% der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen waren nach eigener Einschätzung seit der Geburt behindert, 15% seit Kindheit und Jugend und nurbei 6% trat die Behinderung erst im Erwachsenenalter ein. Aufgrund der hohen Anzahl der Frauen, die bei dieser Befragungsgruppe die Frage nicht beantwortet haben oder es nicht wussten (fast 30%), sind die Prozentangaben hier jedoch nur eingeschränkt vergleichbar.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Behinderung besteht seit Geburt |
16 |
22 |
49 |
** |
|
Behinderung besteht seit Kindheit und Jugend |
19 |
23 |
15 |
|
|
Behinderung trat erst im Erwachsenenleben auf |
64 |
50 |
6 |
|
|
Keine Angabe |
2 |
6 |
12 |
|
|
Weiß nicht |
-- 1) |
-- 1) |
17 |
|
|
Gesamt |
100 |
100 |
100 |
Basis: Alle befragten Frauen. 1)Aufgrund von Rundungs- und Datenübertragungsfehlern hier leicht veränderte Werte gegenüber der Kurzzusammenfassung. 2)Antwortvorgabe „Weiß nicht“ hier nicht vorhanden.
Die Frauen, bei denen nicht alle Beeinträchtigungen von Geburt an bestanden und die in allgemeiner Sprache befragt wurden, sollten die Ursachen der Beeinträchtigungen anhand einer Liste mit nummerierten Antwortvorgaben benennen (Mehrfachantworten waren möglich). Einige Antwortvorgaben wurden in Anlehnung an die LIVE-Studie (Eiermann u.a. 2000) formuliert: 1) sind angeboren; 2) beruhen auf Komplikationen bei der Geburt; 3) beruhen auf einem Unfall; 4) beruhen auf einem Kriegseinsatz oder einer Kriegserfahrung. Da in der vorliegenden Studie Gewalterfahrungen von zentralem Interesse sind, wurde zusätzlich die Antwortvorgabe aufgenommen: „beruhen auf einem körperlichen oder sexuellen Angriff“. Darüber hinaus wurde den Befragten die Antwortvorgabe „beruhen auf Verschleißerscheinungen durch zu schweres Arbeiten und andere Belastungen“ in Anlehnung an Braun/Niehaus (1992) angeboten.
In der Haushaltsbefragung wurden als Ursachen der Beeinträchtigung am häufigsten Verschleißerscheinungen durch zu schweres Arbeiten und andere Belastungen (38%) sowie chronische Erkrankungen (37%) benannt (Mehrfachantworten waren möglich). 7% der Frauen gaben zudem als Ursache einen körperlichen oder sexuellen Angriff an.
Die Frauen, die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragt wurden, haben etwas, aber nicht signifikant seltener eine chronische Erkrankung als Ursache angegeben (31% versus 37%). Sie haben jedoch dreimal so häufig wie die Frauen der Haushaltsbefragung (21% versus 7%) einen körperlichen oder sexuellen Angriff als Ursache der Behinderung genannt. Deutlich seltener als diese gaben sie einen Unfall (6% versus 14%) oder Verschleißerscheinungen durch zu schweres Arbeiten und andere Belastungen als Ursache an (19% versus 38%).
Zu beachten ist hier, dass die verschiedenen Beeinträchtigungen auch unterschiedliche Ursachen haben können. Zudem sind nicht zwangsläufig alle Ursachen der Beeinträchtigungen den Betroffenen bekannt. Das könnte insbesondere auch bei einigen chronischen Erkrankungen der Fall sein. So gaben in der Haushaltsbefragung 7% der Frauen und in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache 14% der Frauen bei dieser Frage generell „Weiß nicht“ an oder machten keine Angabe. Kriegserfahrungen spielten bei beiden Befragungsgruppen eine untergeordnete Rolle. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Frauen aufgrund ihres Alters keinen Krieg in Deutschland miterlebt haben und dass nur wenige Frauen mit Migrationshintergrund für die Studie gewonnen werden konnten.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Alle Beeinträchtigungen seit Geburt, daher die Frage nach Ursachen hier nicht gestellt 1) |
4 |
8 |
-- 2) |
|
|
Sind angeboren 1) |
19 |
14 |
-- 2) |
n.s. |
|
Beruhen auf Komplikationen bei der Geburt |
2 |
4 |
-- 2) |
n.s. |
|
Beruhen auf einer chronischen Erkrankung |
37 |
31 |
-- 2) |
n.s. |
|
Beruhen auf einem Unfall |
14 |
6 |
-- 2) |
* |
|
Beruhen auf einem Kriegseinsatz oder einer Kriegserfahrung |
0 |
0 |
-- 2) |
n.s. |
|
Beruhen auf einem körperlichen oder sexuellen Angriff |
7 |
21 |
-- 2) |
** |
|
Beruhen auf Verschleiß-erscheinungen durch zu schweres Arbeiten oder andere Belastungen |
38 |
19 |
-- 2) |
** |
|
Nur „Weiß nicht“ oder „Keine Angabe“ |
7 |
14 |
-- 2) |
n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Ob die Behinderung angeboren ist, wurde an zwei verschiedenen Stellen im Fragebogen erfragt. Die Angaben weichen voneinander ab. Genauer erscheinen die Angaben, die an anderer Stelle (siehe vorangegangener Abschnitt „Zeitpunkt des Eintretens der Behinderung“ gemacht worden sind). 2)Da in der vereinfachten Befragung hier eine offene Frage gestellt wurde, sind die Angaben nicht vergleichbar.
Den Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache wurde eine offene Frage gestellt, was der Grund ihrer Behinderung sei. Da jedoch nur 101 von 318 Frauen hier eine Angabe gemacht haben, lassen sich nur einzelne Schlaglichter auf subjektiv wahrgenommene Ursachen werfen. 9% der Befragten benannten eine Krankheit oder eine fehlende bzw. verschleppte Behandlung, einen Impfschaden oder einen Unfall. 12% gaben Probleme bei der Geburt an (z.B. Frühgeburt oder Sauerstoffmangel) oder benannten eine angeborene Behinderung einschließlich Problemen in der Schwangerschaft der Mutter. 4% gaben eine Erkrankung des Gehirns, 3% Stress, belastende Erlebnisse oder psychische Probleme, 3% Trisomie 21 und 2% körperliche Ursachen, z. B. Hüftschaden oder eine Fehlstellung des Fußes an. Drei Frauen nannten Gewalt im Elternhaus als Ursache.
Die Analyse zeigt, dass trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte der Beeinträchtigungen in den Befragungsgruppen (Haushaltsbefragung körperlich, Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache psychisch und Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache geistig) die Frauen überwiegend durch mehrere Beeinträchtigungen belastet sind. Sowohl bei dem kleineren Anteil der Frauen mit nur einer Beeinträchtigung als auch bei den Frauen mit mehrfachen Beeinträchtigungen kamen körperliche und psychische Belastungen deutlich am häufigsten vor.
Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen haben am häufigsten einen Behindertenausweis sowie eine gesetzliche Betreuung und sind am häufigsten seit der Geburt beeinträchtigt. Die Frauen der Haushaltsbefragung, deren Beeinträchtigungen oftmals eine Folge von Verschleißerscheinungen und chronischen Erkrankungen sind und entsprechend häufig erst im Erwachsenenalter auftreten, haben vergleichsweise selten einen Behindertenausweis. Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen haben mehrheitlich gesetzliche Betreuung. Während eine Hälfte dieser Frauen die Beeinträchtigung bereits seit Geburt oder seit Kindheit und Jugend hat, trat die Behinderung bei der anderen Hälfte erst im Erwachsenenleben auf. Im Vergleich zu Frauen der Haushaltsbefragung beruht sie hier dreimal häufiger auf einem körperlichen oder sexuellen Angriff.
Körperliche Beeinträchtigungen wurden im Rahmen der Studie mit verschiedenen Arten von körperlichen Erkrankungen und körperlichen Einschränkungen, orientiert an den Kategorien der Schwerbehindertenstatistik, einzeln abgefragt. Hierzu gehörten Funktionsbeeinträchtigungen (bzw. das Fehlen) von Gliedmaßen und Funktionsbeeinträchtigungen des Rumpfes oder der inneren Organe. Weiter wurden Lähmungen, neurologische Erkrankungen und hirnorganische Schädigungen erhoben. Zusätzlich wurden im Alltag stark beeinträchtigende chronische Erkrankungen, Schmerzen und körperliche Auffälligkeiten (z.B. Narben oder Feuermale)[55] erfragt. Diese Items sind teilweise nicht gänzlich trennscharf, z.B. ist multiple Sklerose eine neurologische gleichzeitig aber auch eine chronische Erkrankung. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Erkrankung an mehr als einer Stelle benannt wurde.
Um einschätzen zu können, um welche Funktionsbeeinträchtigungen oder Erkrankungen es sich im Einzelnen handelt, und um ein konkretes Bild von den körperlichen Beeinträchtigungen der Frauen zu erhalten, wurde bei den meisten Items zusätzlich gefragt, welche konkrete Erkrankung oder Beeinträchtigung vorliegt. Aus den Antworten insgesamt wird deutlich, dass die genannten Beeinträchtigungen richtig zugeordnet worden sind, außerdem dass es weitgehend schwerwiegende Beeinträchtigungen sind. Da die Zuordnung der Erkrankung im Rahmen jeder Antwortvorgabe durch die Befragte erfolgte, nicht durch eine ärztliche Diagnose, kam es in wenigen Fällen zu fehlerhaften Zuordnungen, z.B. Neurodermitis zu neurologischen Erkrankungen. Dies war bei den Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen etwas häufiger der Fall als bei den anderen Befragten. Da die Fehlzuordnungen aber nur von einem geringen Teil der Befragten gemacht wurden (wenige Prozentpunkte) und somit nicht die Gesamtverteilungen wesentlich beeinflussen, wurden die fehlerhaft eingeordneten Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Frauen nicht umkodiert, sondern es wurde der subjektiven Einschätzung der Befragten gefolgt.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Fehlen oder Funktionsbeeinträchtigung von Gliedmaßen |
49 |
42 |
29 |
** |
|
Funktionsbeeinträchtigung des Rumpfes (z.B. Wirbelsäule, Becken, Hüfte, Brustkorb) |
58 |
41 |
41 |
** |
|
Funktionsbeeinträchtigungen innerer Organen oder Organsysteme |
45 |
39 |
26 |
** |
|
Sonstige, im täglichen Leben stark beeinträchtigende körperliche Auffälligkeiten oder Besonderheiten (z.B. Fehlbildungen, Hautveränderungen, Feuermale, Narben, bleibende Verletzungsfolgen, Verlust einer oder beider Brüste) |
26 |
26 |
17 |
* |
|
Schmerzen, die im alltäglichen Leben stark beeinträchtigen |
58 |
33 |
29 |
** |
|
Lähmungen |
14 |
9 |
12 |
n.s. |
|
Neurologische Erkrankungen (z.B. Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Epilepsie, Erkrankungen des Rückenmarks) |
9 |
22 |
19 1) |
** |
|
Chronische Erkrankung |
55 |
35 |
20 |
** |
|
Hirnorganische Schädigung oder Störung (z.B. durch eine Operation oder Hirnverletzung, eine Hirnhautentzündung oder schwere Gehirnerschütterung) |
6 |
10 |
24 |
** |
|
Keine körperliche Beeinträchtigung |
8 |
19 |
20 |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Hier wurden die Erkrankungen herausgenommen, bei denen es sich nicht um eine neurologische Erkrankung handelte und die von den Befragten hier falsch zugeordnet wurden.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Keine |
8 |
19 |
20 |
** |
|
1 Beeinträchtigung |
11 |
19 |
23 |
|
|
2 Beeinträchtigungen |
17 |
14 |
20 |
|
|
3 Beeinträchtigungen |
19 |
18 |
15 |
|
|
4 Beeinträchtigungen |
21 |
12 |
8 |
|
|
5 bis 9 Beeinträchtigungen |
24 |
20 |
15 |
|
|
Gesamt |
100 |
100 |
100 |
Basis: Alle befragten Frauen.
Es zeigte sich, dass die Frauen in allen drei Gruppen stark körperlich beeinträchtigt sind und zumeist mehrere körperliche Beeinträchtigungen genannt haben. Am stärksten sind die in den Haushalten lebenden Frauen körperlich beeinträchtigt.[56] Die körperlich beeinträchtigten Frauen der Haushaltsbefragung hatten durchschnittlich drei Beeinträchtigungen (Mittelwert 3,2). 57% der Frauen gaben zwischen zwei und vier Beeinträchtigungsformen an, 24% nannten sogar fünf bis neun Formen. Nur 11% dieser Frauen hatten ausschließlich eine körperliche Beeinträchtigungsform.[57] Dieser stark belasteten Gruppe folgen die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen. Die Frauen dieser Gruppe gaben durchschnittlich zwei bis drei körperliche Beeinträchtigungen (Mittelwert 2,6) an. Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen waren dagegen zwar noch häufig, aber deutlich seltener als die anderen beiden Gruppen körperlich beeinträchtigt. Sie nannten durchschnittlich eine geringere Anzahl körperlicher Beeinträchtigungen (Mittelwert 2,2) und hatten auch seltener als die anderen beiden Gruppen vier und mehr körperliche Beeinträchtigungen.
Im Folgenden werden die quantitativen Ergebnisse ergänzt mit Beispielen aus den offenen Antworten, um das Bild zu vervollständigen.
Die Frauen der Haushaltsbefragung gaben besonders häufig an, dass sie unter Schmerzen leiden, durch die sie im alltäglichen Leben stark beeinträchtigt sind (58%). Ein ebenso hoher Anteil nannte Funktionsbeeinträchtigungen des Rumpfes (Wirbelsäule, Becken, Hüfte oder Brustkorb). Überwiegend wurden hier Probleme mit der Wirbelsäule angegeben, z.B. Bandscheibenvorfälle, Skoliose, Versteifungen und Schädigungen von Teilen der Wirbelsäule, Osteoporose, aber auch Hüft- und Beckenprobleme. Die Antworten lassen auf starke Belastungen schließen, leichte Rückenprobleme oder vorübergehende Verspannungen, wie sie in der Bevölkerung häufiger vorkommen, sind hiermit weniger erfasst.
In 55% der Fälle wurde eine chronische Erkrankung angegeben. Das waren etwa zur Hälfte Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, Nierenleiden, Arthritis, Rheuma oder multiple Sklerose, aber auch Erkrankungen wie Asthma, Allergien, Blutdruckprobleme oder Tinnitus. Von einigen Frauen wurden hier auch chronische Schmerzen, z.B. aufgrund von Migräne oder Fibromyalgie, sowie psychische Erkrankungen genannt.
49% der Frauen haben eine Funktionsbeeinträchtigung oder – vereinzelt – das Fehlen von Gliedmaßen angegeben. Das waren unter anderem Schmerzen, Taubheitsgefühle, Zittern, Steifheit von Gliedern und Gelenken, Entzündungen/Schwellungen, Einschränkungen der Beweglichkeit, Schwierigkeiten in der Feinmotorik und Koordination etc. Ein kleiner Teil der Befragten hat Arthrose als Grund der Beeinträchtigung der Gliedmaßen angegeben, ein anderer Lähmungen und ein weiterer Teil vor allem Bandscheibenvorfälle, seltener Wirbelsäulenversteifungen oder Rückenbeschwerden. Einige Frauen nannten Rheuma als Grund, andere sind aufgrund multipler Sklerose oder spastischer Störungen in den Extremitäten eingeschränkt. Das Fehlen von Zehen, Fingern, eines Armes, einer oder beiden Brüsten wurde nur in Einzelfällen genannt.
45% der Frauen nannten eine Funktionsbeeinträchtigung von inneren Organen oder Organsystemen. Das waren häufig Schwierigkeiten im Magen- und Darmbereich, aber auch Nierenprobleme, Lungen- bzw. Bronchienprobleme sowie Herz- und Kreislaufprobleme. Die meisten Frauen hatten dabei Probleme mit mehreren Organen. Insgesamt wurden in den offenen Antworten nahezu alle Organe angesprochen.
Im täglichen Leben stark beeinträchtigende körperliche Auffälligkeiten oder Besonderheiten, wie z.B. Feuermale oder Narben, wurden in 26% der Fälle benannt. Das waren vor allem Narben, aber auch Hautveränderungen, Allergien, das Fehlen einer oder beider Brüste, Übergewicht oder Haarausfall. In wenigen Fällen wurden hier auch nach außen nicht sichtbare körperliche Besonderheiten, wie das Fehlen einer Niere oder der inneren Geschlechtsorgane, angegeben.
Am seltensten wurden Lähmungen (14%), neurologische Erkrankungen (9%) und hirnorganische Schädigungen oder Störungen (6%) benannt. Bei den Lähmungen war am häufigsten ein Bein und/oder Fuß und/oder Knie betroffen, teilweise aber auch ein Arm und/oder Finger oder gleichzeitig ein Arm und ein Bein. Seltener wurden gelähmte Teile der Wirbelsäule, das Gesicht, eine Körperhälfte oder Spastiken allgemein genannt. Als neurologische Erkrankungen wurden am häufigsten multiple Sklerose, Epilepsie, Migräne sowie das Restless-Legs-Syndrom genannt. Weitere Erkrankungen wie Parkinson, Entzündung des Nervus trigeminus oder Spina bifida wurden seltener angegeben. Von den 48 Frauen mit hirnorganischen Schädigungen wurden z.B. Schädigungen im Zusammenhang mit Schlaganfällen, Hirnhautentzündungen, Hirntumoren, Aneurysmen, Hirninfarkten, Gehirnerschütterungen oder ein Schädelbasisbruch genannt.
Die in Einrichtungen lebenden Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, hatten am häufigsten Funktionsbeeinträchtigungen der Gliedmaßen (42%), wie z.B. von Beinen, Armen, Händen und Füßen, zumeist im Zusammenhang mit Schmerzen, Arthrose, Lähmungen, Spastiken, Übergewicht, Knochenschwund, Durchblutungsstörungen oder allgemein ‚Schwäche‘ genannt. Funktionsbeeinträchtigungen der Gliedmaßen waren geringfügig seltener als bei den Frauen in Haushalten (49%). An zweiter Stelle folgen die Beeinträchtigungen des Rumpfes (41%), die ebenfalls seltener als bei den Frauen in Haushalten (58%) angegeben wurden. Hierzu zählten vor allem Probleme mit der Wirbelsäule, z.B. Skoliose, Arthrose, Bandscheibenvorfall, Osteoporose, Verkrümmung der Wirbelsäule, oder Rückenmarkszysten. Hüft- und Beckenprobleme wurden seltener genannt. Funktionsbeeinträchtigungen der inneren Organe folgen an dritter Stelle (39%). Dies waren vor allem Lungen- und Bronchienprobleme sowie Herz-Kreislaufprobleme, gefolgt von Problemen mit der Schilddrüse, Blasenproblemen, Magen-/Darmproblemen, Nierenproblemen und vereinzelt Leber- und Augenproblemen.
Chronische Erkrankungen, wie z.B. Diabetes, Arthrose, multiple Sklerose, HIV, Lungenprobleme, Asthma, Bluthochdruck, Allergien, Herzleiden, Augen- und Darmerkrankungen sind am vierthäufigsten benannt worden[58] (36% versus 55% in der Haushaltsbefragung). Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen leiden deutlich seltener als Frauen der Haushaltsbefragung (58%), aber immer noch zu einem Drittel (33%) unter Schmerzen, die sie im alltäglichen Leben stark beeinträchtigen.
Beeinträchtigungen durch körperliche Auffälligkeiten (26%) wurden in gleichem Ausmaß angegeben wie in der Haushaltsbefragung, vor allem Narben, aber auch Bewegungsprobleme aufgrund von multipler Sklerose, Hinken, Sportverletzungen, sichtbare Skoliose, Übergewicht, Haarausfall, Hautveränderungen, Schwerhörigkeit, vorzeitiges künstliches Gebiss.
Gegenüber den in Haushalten befragten Frauen hatten die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen etwa doppelt so häufig eine neurologische Erkrankung (22% versus 9%) und häufiger eine hirnorganische Schädigung oder Störung (10% versus 6%). Neurologische Erkrankungen waren vor allem Epilepsie, multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Chorea Huntington, Angiom etc.[59] Hirnorganische Schädigungen wurden z.B. im Kontext von Tumoren, Hirnhautentzündungen, Schädelbasisbrüchen, Gehirnerschütterungen und Operationen genannt. Lähmungen dagegen, wie z.B. eine Querschnittslähmung, Lähmungen der Körperhälfte, von Beinen, Armen und Händen, wurden etwas seltener angegeben als in der Haushaltsbefragung (9% versus 14%).
Bemerkenswert erscheint hier, dass diese Frauen, die zum größten Teil aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung in Einrichtungen leben, zusätzlich in hohem Maße auch von körperlichen Beeinträchtigungen betroffen sind. Dies gilt in abgeschwächtem Maße auch für die Befragungsgruppe der Frauen, die aufgrund einer sogenannten geistigen Behinderung in Einrichtungen leben und in vereinfachter Sprache befragt wurden.
Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen hatten ebenso häufig Funktionsbeeinträchtigungen des Rumpfes (41%) wie die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen, aber deutlich seltener als die Frauen der Haushaltsbefragung (58%). Mehrheitlich waren das Rückenprobleme, wobei einige Frauen nur manchmal Probleme haben und für andere die Probleme eine Folge der Behinderung sind, z. B. wegen des Sitzens im Rollstuhl oder einer Wirbelsäulenverkrümmung. Einige Frauen haben Hüftprobleme, manche in Kombination mit Rückenproblemen.
Das Fehlen61[60] oder die Funktionsbeeinträchtigungen der Gliedmaßen (29%) und der inneren Organe (26%) sowie chronische Erkrankungen (20%) wurden deutlich seltener genannt als in den beiden anderen Untersuchungsgruppen. Funktionsbeeinträchtigungen der Gliedmaßen waren Schwierigkeiten beim Bewegen der Arme und Beine z. T. aufgrund von (spastischen) Lähmungen bzw. wegen eines Unfalls. Als schwerwiegende Einschränkungen der inneren Organe wurden z.B. Inkontinenz, angeborene und erworbene Herzfehler (z. B. Fehlen oder Defekt der Herzscheidewand), Herzrhythmusstörungen, Herzprobleme nach einer Operation, chronische Bronchitis, Asthma und weitere Lungenprobleme angegeben. Genannt wurden aber auch Kreislaufschwäche, Schweratmigkeit, Verstopfung, Bauchschmerzen und Magenprobleme. Die chronischen Erkrankungen der in vereinfachter Sprache Befragten waren vor allem Diabetes, seltener Schilddrüsenerkrankungen. Andere Erkrankungen wie z.B. Asthma, Bluthochdruck, Herzleiden, Blasenschwäche, Krebs, Nervenkrankheit und Migräne wurden nur von einzelnen Frauen genannt.
29% der Frauen bejahten die Frage nach beeinträchtigenden Schmerzen und nannten Rückenschmerzen, Menstruationsschmerzen, Unterleibsschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Schmerzen bei Überanstrengung, aber auch einige mit der Körperbehinderung einhergehende Schmerzen.[61]
Hirnorganische Schädigungen oder Störungen wurden von 24% der in vereinfachter Sprache Befragten und damit mehr als doppelt so häufig wie von den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen und viermal so häufig wie von den Frauen der Haushaltsbefragung angegeben. Ursachen waren Probleme bei der Geburt sowie Erkrankungen oder Verletzungen, z.B. Hirnhautentzündung, Tumor oder ein Treppensturz.
Hinsichtlich der neurologischen Erkrankungen (19%[62]) unterschieden sich die in vereinfachter und die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (22%) kaum. Im Vergleich zur Haushaltsbefragung zeigt sich bei den Einrichtungsbefragungen aber eine doppelt so hohe Betroffenheit. Die meisten Frauen nannten hier Epilepsie, einzelne Frauen hatten multiple Sklerose oder Morbus Parkinson.
Beeinträchtigende körperliche Auffälligkeiten (17%) wurden etwas seltener genannt als in den anderen beiden Befragungsgruppen. Dies waren zumeist Narben und Hautveränderungen (z.B. Flecken oder Pickel). Außerdem wurden Schuppenflechte, Hautpilz, allergische Symptome, Brustamputationen oder „verdrehte Augen“ genannt. Wenige Frauen benannten ihre Hilfsmittel, Prothesen sowie den Helm bei Vorhandensein von Sturzleiden.
Lähmungen haben die in vereinfachter Sprache befragten Frauen (12%) in etwa gleich häufig wie die Frauen der Haushaltsbefragung und damit häufiger als die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen genannt. Die Angaben bezogen sich auf Spastiken oder Epilepsien, eine Querschnittslähmung, eine Zungen- und eine Augenlähmung.
Gehörlose oder blinde Frauen sowie Frauen, die nicht sprechen können, waren in den Samples der Haushaltsbefragung sowie in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache und in vereinfachter Sprache nur vereinzelt bzw. so gut wie nicht vertreten (jeweils 1–2 Frauen).
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Beeinträchtigung beim Sehen |
14 |
25 |
7 |
** |
|
Beeinträchtigung beim Sprechen |
8 |
13 |
31 |
** |
|
Beeinträchtigung beim Hören |
19 |
20 |
12 |
* |
Basis: Alle befragten Frauen.
In der Haushaltsbefragung gaben 14% aller Befragten Schwierigkeiten beim Sehen an, die nicht durch eine Brille oder Kontaktlinsen ausgeglichen werden können. 19% nannten Schwierigkeiten beim Hören und 8% beim Sprechen.
Die in Einrichtungen lebenden Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, hatten demgegenüber deutlich häufiger Sprechschwierigkeiten (13%) und auch häufiger eine Sehbeeinträchtigung (25%), während eine Hörbeeinträchtigung mit etwa 20% ebenso häufig angegeben wurde wie in der Haushaltsbefragung.
Die in Einrichtungen lebenden Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, hatten dagegen deutlich seltener Schwierigkeiten beim Hören (12%) und beim Sehen (7%) als die anderen Befragungsgruppen. Sprechschwierigkeiten (31%) wurden im Vergleich jedoch mehr als doppelt so häufig angegeben wie in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache und fast viermal so häufig wie in der Haushaltsbefragung. Die offenen Nennungen zeigen, dass es sich hier hauptsächlich um motorische Artikulationsschwierigkeiten und seltener um Wortfindungsschwierigkeiten handelt.
In allen drei Befragungsgruppen waren die Frauen stark von körperlichen Beeinträchtigungen betroffen und gaben zumeist mehrere körperliche Beeinträchtigungen an. Am stärksten betroffen waren die Frauen in den Haushalten, die auch besonders häufig durch Schmerzen, chronische Erkrankungen und Funktionsbeeinträchtigungen des Rumpfes im alltäglichen Leben eingeschränkt waren. Auch die Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache gaben sehr häufig körperliche Beeinträchtigungen an. Ein Drittel von ihnen war (auch) von neurologischen Erkrankungen und/oder hirnorganischen Schädigungen betroffen. Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen waren im Vergleich der Befragungsgruppen am seltensten körperlich beeinträchtigt. Der Anteil der Frauen mit neurologischen Erkrankungen und/oder hirnorganischen Schädigungen ist hier noch einmal etwas größer als bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen.
Beeinträchtigungen beim Sehen, Sprechen und Hören wurden in allen Befragungsgruppen seltener angegeben als körperliche Beeinträchtigungen. Schwierigkeiten beim Sprechen spielten aber für einen nicht unerheblichen Teil der Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache eine Rolle, da hiervon ein knappes Drittel der Frauen betroffen war.
Psychische Erkrankungen werden in der Regel in wissenschaftlichen Studien über bestimmte diagnostische Verfahren und Tests, wie z.B. die Symptomcheckliste bei psychischen Störungen SCL-90 nach de Rogatis (Franke 2002), erfasst. Auf der Basis dieser validierten Testverfahren mit mehreren Items und zumeist skalierten Antwortvorgaben können dann Aussagen darüber gemacht werden, wie viele der Befragten bestimmte Störungen aufweisen (z.B. Depressionen).
In der vorliegenden Studie wurde ein solches Vorgehen aus zwei Gründen nicht verfolgt: Zum einen sollten hier Beeinträchtigungen anhand der subjektiven Selbsteinschätzung der Befragten erhoben werden. In diesem Sinne wurde auch im Bereich der körperlichen Beeinträchtigungen auf Diagnosen und Tests verzichtet. Stattdessen wurden die Frauen nach bestimmten körperlichen Funktionsbeeinträchtigungen oder Erkrankungen gefragt. Auch bei den psychischen Beeinträchtigungen sollte daher die subjektive Selbsteinschätzung im Vordergrund stehen. Zum anderen erfordern Diagnoseverfahren und Tests einen erheblich größeren Zeitaufwand als die in der vorliegenden Studie gewählte Befragungsmethode erlaubt. Aufgrund der weiteren, ebenfalls zeitaufwendigen Themenschwerpunkte dieser Studie (unter anderem psychische, körperliche, sexuelle strukturelle Gewalt und Diskriminierung, Gewalt in der Kindheit etc.) wären Diagnoseverfahren hier nicht umsetzbar und der erhöhte Zeitaufwand für die Befragten nicht zumutbar gewesen. Befragungsmethode erlaubt. Aufgrund der weiteren, ebenfalls zeitaufwendigen Themenschwerpunkte dieser Studie (unter anderem psychische, körperliche, sexuelle strukturelle Gewalt und Diskriminierung, Gewalt in der Kindheit etc.) wären Diagnoseverfahren hier nicht umsetzbar und der erhöhte Zeitaufwand für die Befragten nicht zumutbar gewesen.
Anders als bei den körperlichen Beeinträchtigungen erschien es aber für den Bereich der psychischen Beeinträchtigungen nicht möglich, parallel zur Abfrage körperlicher Erkrankungen (z.B. „neurologische Erkrankungen“) direkt bestimmte Störungen oder Gruppen von Störungen abzufragen, wie z.B. Schizophrenie bzw. schizotype und wahnhafte Störungen. Dagegen sprach erstens die hohe Tabuisierung von psychischen Störungen allgemein, zweitens die Tatsache, dass viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die in Behandlung sind, ihre Diagnose nicht unbedingt kennen, und drittens die Problematik, dass hier auch Frauen erfasst werden sollten, die (noch) nicht in Behandlung sind.
Daher mussten für diesen Studienteil Antwortvorgaben gefunden werden, die psychische Probleme auflisten und an möglichen Symptomen orientiert sind, die auf stärkere psychische Belastungen verweisen und nicht auf Probleme im Bereich alltäglicher Befindlichkeitsstörungen oder Lebenskonflikte. Ziel war, das Spektrum der aufgelisteten psychischen Probleme ausreichend breit anzulegen, um möglichst jede Frau, die ein stark beeinträchtigendes psychisches Problem hat, zu erfassen. Gleichzeitig war es aufgrund der gebotenen Kürze nicht möglich, valide Symptomchecklisten zu verwenden. Ein Rückschluss von genannten psychischen Problemen auf eine Diagnose ist daher nicht möglich.
Gebildet wurden die Antwortvorgaben in Anlehnung an die in der -10 kategorisierten Symptome und auf der Basis von Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus dem psychologischen und psychiatrischen Bereich. Für bestimmte Störungsgruppen wurden entsprechend typische psychische Probleme ausgewählt. Um aber feststellen zu können, ob bei einer Befragten eine bestimmte Störung vorliegt, wären mehrere Fragen zum gleichen Bereich notwendig. Daher ist es nicht auszuschließen, dass eine Frau zum Beispiel zwar depressionstypische Probleme benannt hat, dies aber dennoch nicht auf eine psychische Störung im klinischen Sinne verweist. Hinzu kommt, dass die aufgelisteten psychischen Probleme nicht eindeutig ausschließlich einem Störungsbild zuzuordnen sind, sondern bei verschiedenen Störungen vorkommen können.
Die gewählte Befragungsmethode im allgemeinen Fragebogen[63] erwies sich als erfolgreich, um stark einschränkende psychische Probleme zu erfassen, und wurde von den Befragten gut angenommen. Nach der Einleitung „Haben Sie ein lang anhaltendes oder wiederkehrendes psychisches Problem, das Sie in Ihrem Alltag stark einschränkt, in einem oder mehreren der folgenden Bereiche?“ wurde den mit allgemeinem Fragebogen Befragten eine Liste mit den folgenden Bereichen bzw. psychischen Problemen mit der Bitte vorgelegt, nur den Kennbuchstaben der für sie zutreffenden Probleme zu nennen.
Dabei wurden psychische Probleme in folgender Verteilung genannt.
|
Haushalte N=800 * (%) |
Einrichtungen/allgemeine Sprache N=102 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|
|
Lang anhaltende oder wiederkehrende Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit, niedergedrückte Stimmung oder häufiges Gefühl innerer Leere |
35 |
51 |
* |
|
Längerfristig erheblich eingeschränkte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit |
23 |
39 |
** |
|
Orientierungslosigkeit 1) |
4 |
11 |
* |
|
Längerfristig häufige Wechsel von sehr guter und sehr schlechter Stimmung |
26 |
32 |
n.s. |
|
Längerfristig sehr starke Ängste oder Panikgefühle |
20 |
37 |
** |
|
Wiederkehrende zwanghafte Handlungen/Gedanken 2) |
9 |
22 |
** |
|
Längerfristig andauernde Schlaflosigkeit oder ständige Albträume |
31 |
35 |
n.s. |
|
Selbstmordgedanken; Gefühl, nicht leben zu wollen |
13 |
32 |
** |
|
Wahrnehmung von Dingen oder Personen, die andere nicht wahrnehmen |
6 |
19 |
** |
|
Starke lebensgeschichtliche Erinnerungslücken |
8 |
19 |
** |
|
Starke Erinnerungslücken in Bezug auf gerade erfolgte Handlungen 3) |
4 |
8 |
* |
|
Essstörungen 4) |
10 |
21 |
* |
|
Innerer Druck, sich selbst verletzen zu müssen 5) |
4 |
12 |
* |
|
Häufige Kontaktabbrüche |
7 |
9 |
n.s. |
|
Das Gefühl, dass die Welt „falsch“ ist, wie im Traum |
9 |
16 |
* |
|
Das Gefühl, nicht man selbst zu sein, sich selbst völlig fremd zu sein, nicht mehr im eigenen Körper zu sein |
7 |
18 |
** |
|
Längerfristig starke Vermeidung von Kontakt zu anderen Menschen und starker Rückzug |
19 |
23 |
n.s. |
|
Extreme Selbstzweifel oder Minderwertigkeitsgefühle 6) |
19 |
28 |
* |
|
Immer wiederkehrende Erinnerungsbilder an erlebte extrem belastende Situationen |
24 |
35 |
* |
|
Vermeiden von Situationen, Sinneseindrücken oder Orten, die an ein extrem belastendes Ereignis erinnern |
13 |
32 |
** |
|
körperliche Beschwerden oder Schmerzen aufgrund von seelischen Problemen |
22 |
22 |
|
|
Alkoholabhängigkeit 7) |
3 |
10 |
* |
|
Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit 8) |
5 |
7 |
n.s. |
|
Sonstige psychische Probleme |
11 |
31 |
** |
|
Keine Angabe |
2 |
1 |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.1)Z.B plötzlich nicht wissen, wo man ist. 2)D.h. Handlungen oder Gedanken, die man nicht gut selbst steuern kann und deren Unterlassen Angst auslöst. 3)Z.B., dass man sich irgendwo befindet und nicht weiß, wie man dorthin gekommen ist. 4)Z.B. Ess-Brechsucht, Magersucht, Essattacken, Esssucht. 5) Z.B. Ritzen, Schneiden, Verbrennen. 6)Extreme Selbstzweifel oder Minderwertigkeitsgefühle, die im täglichen Leben stark einschränken. 7)Hier wurden auch die Angaben von Frauen einbezogen, die sich an anderer Stelle des Fragebogens (q23e-g) zur Alkoholabhängigkeit geäußert haben. 8)Hier wurden auch die Angaben von Frauen einbezogen, die sich an anderer Stelle des Fragebogens (q23e-g) zur Drogen-/Medikamentenabhängigkeit geäußert haben.
Generell werden bei allen Befragungsgruppen sehr hohe psychische Belastungen sichtbar. Zwei Drittel (68%) der befragten Frauen in den Haushalten und 88% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen gaben psychische Probleme an. Im Vergleich dazu ermittelte der Bundesgesundheitssurvey mit dem Zusatzmodul „Psychische Störungen“ bei Frauen im Alter von 18–65 Jahren eine Ein-Jahres-Prävalenz von 37%. „Über ein Drittel (39,5%) der Personen [Frauen und Männer], bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wurde, wies mehr als eine psychische Störung auf“ (Jacobi/Harfst 2007: 4). Diese Werte sind jedoch nicht direkt vergleichbar mit der vorliegenden Studie, weil dort zum einen die Störungen nach diagnostischen Kriterien erfasst wurden, und zum anderen, weil dort nur bestimmte Störungen[64] erhoben wurden. Dennoch legen die Befragungsergebnisse der vorliegenden Studie in der Tendenz eine erheblich höhere psychische Belastung der befragten Frauen mit Behinderungen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nahe. Vergleichsdaten aus der Frauenstudie 2004 liegen hierzu leider nicht vor.
|
Anzahl der genannten psychischen Probleme |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
|---|---|---|
|
Keine |
32 |
12 |
|
1 |
14 |
9 |
|
2 bis 4 |
25 |
28 1) |
|
5 bis 11 |
22 |
40 |
|
12 bis 20 |
7 |
11 |
|
Gesamt |
100 |
100 |
|
Mittelwert |
3,3 |
5,7 |
Basis: Alle befragten Frauen. 1)Aufgrund eines Rundungsfehlers war hier in der Broschüre/Kurzzusammenfassung der Wert 29 angegeben worden.
Durchschnittlich gaben die in den Haushalten lebenden Frauen drei psychische Probleme an (Mittelwert 3,3). 14% der Frauen der Haushaltsbefragung gaben ein psychisches Problem, 25% zwei bis vier psychische Probleme, 22% benannten fünf bis elf und weitere 7% der Frauen 12 bis 20 psychische Probleme. Die in den Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen gaben erwartungsgemäß[65] häufiger psychische Probleme an und nannten auch mehr Probleme. Sie gaben durchschnittlich fünf bis sechs Probleme an (Mittelwert 5,7). 9% der Frauen benannten nur ein Problem, 29% zwei bis vier, 40% fünf bis elf und 11% 12 bis 20 Probleme.
Betrachtet man die einzelnen genannten psychischen Probleme, so fällt auf, dass zwar die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen alle Probleme häufiger nannten als die Frauen in Haushalten (außer bei der Antwortvorgabe „körperliche Beschwerden oder Schmerzen aufgrund von seelischen Problemen“). Jedoch liegen die Anteile der psychisch beeinträchtigten Frauen in den Haushalten vergleichsweise hoch und verweisen ebenfalls auf starke psychische Belastungen.
Die Ergebnisse für die in Einrichtungen lebenden Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, sind aufgrund der abgewandelten Befragungsmethode nicht vergleichbar und werden weiter unten beschrieben. In der folgenden Einzeldarstellung der psychischen Probleme sind daher nur die Angaben der Frauen in Haushalten und der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen aufgenommen:
Über ein Drittel (35%) der befragten Frauen in Haushalten und die Hälfte der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen (51%) benannten depressionstypische Probleme wie lang anhaltende oder wiederkehrende Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit, niedergedrückte Stimmung oder häufiges Gefühl innerer Leere (Mehrfachantworten waren möglich). Längerfristig erheblich eingeschränkte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit gaben 23% der befragten Frauen in den Haushalten und 39% der Frauen in Einrichtungen (allg. Sprache) an. Längerfristig häufige Wechsel von sehr guter und sehr schlechter Stimmung wurden von 26% der befragten Frauen in Haushalten und von 32% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen genannt.[66] Immerhin 13% der Frauen der Haushaltsbefragung und 32% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen nannten Selbstmordgedanken bzw. das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen.
Im Bereich der psychischen Probleme, die in einem Zusammenhang mit vergangenem traumatischem Erleben bzw. außergewöhnlich hohen Belastungen und der Schwierigkeit, diese zu bewältigen, stehen können, wurden folgende Angaben gemacht: 24% der befragten Frauen in Haushalten und 35% der in den Einrichtungen in allgemeiner Sprache Befragten nannten immer wiederkehrende Erinnerungsbilder an erlebte extrem belastende Situationen. Von 13% der Frauen in Haushalten und 32% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen Befragten wurde das Vermeiden von Situationen, Sinneseindrücken oder Orten, die an ein extrem belastendes Ereignis erinnern, benannt. 8% der Frauen der Haushaltsbefragung und 19% der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache gaben starke lebensgeschichtliche Erinnerungslücken an. 4% der Frauen der Haushaltsbefragung und 8% der Frauen der Einrichtungsbefragung nannten Erinnerungslücken in Bezug auf zeitlich nahe liegende Handlungen, z.B., dass man sich irgendwo befindet und nicht weiß, wie man dorthin gekommen ist.
Jeweils 22% der Frauen der Haushalts- und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache gaben körperliche Beschwerden oder Schmerzen aufgrund von seelischen Problemen an. Zwangshandlungen oder -gedanken[67] wurden von 9% der befragten Frauen in Haushalten und 22% der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache genannt. Identitätsprobleme, Depersonalisations- oder Fremdheitsgefühle wie das Gefühl, „nicht man selbst zu sein“, „sich selbst völlig fremd zu sein“, „nicht mehr im eigenen Körper zu sein“, wurden von 7% der in Haushalten und 18% der in Einrichtungen lebenden Frauen angegeben.
20% der befragten Frauen in Haushalten[68] und 37% der Frauen in Einrichtungen (allgemeine Sprache) gaben längerfristig bestehende sehr starke Ängste oder Panikgefühle an.
Mit einer veränderten Realitätswahrnehmung können die Angaben zu der Frage nach der Wahrnehmung von Dingen oder Personen, die andere nicht wahrnehmen (6% Haushaltsbefragung und 19% der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache) assoziiert werden.
Mit einer verzerrten Realitätswahrnehmung oder auch mit einer Traumatisierung können die folgenden Probleme verbunden sein:
-
Orientierungslosigkeit (plötzlich nicht wissen, wo man ist) gaben 4% in der Haushaltsbefragung und 11% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache an,
-
das Gefühl, dass die Welt „falsch“ ist, wie in einem Traum (9% in der Haushaltsbefragung, 16% in der Einrichtungsbefragung/EA).
Selbstverletzungen (z.B. Ritzen, Schneiden, Verbrennen) wurden mit 4% in der Haushalts- und 12% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache angegeben. Häufige Kontaktabbrüche, die bei verschiedenen psychischen Störungen vorkommen können, aber auch eine Folge einer hohen Belastung durch eine körperliche Beeinträchtigung sein können, benannten 7% der Frauen in der Haushalts- und 9% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache[69]; eine längerfristig starke Vermeidung von Kontakt zu anderen Menschen und starker Rückzug sowie extreme Selbstzweifel oder Minderwertigkeitsgefühle, die im täglichen Leben stark einschränken, wurden in der Haushaltsbefragung von jeweils etwa einem Fünftel (19%) angegeben, in der Einrichtungsbefragung von jeder dritten bis vierten Frau (23% bzw. 28%)[70].
Schlafstörungen, die mit verschiedenen psychischen Störungen verbunden sein können, aber auch vielfältige andere Ursachen haben können, wurden von 31% der befragten Frauen in den Haushalten und von 35% der Frauen in Einrichtungen in allgemeiner Sprache benannt.[71] Diese hohe Anzahl der Frauen, die eine längerfristig andauernde Schlaflosigkeit oder ständige Albträume angaben, deutet auf eine starke psychische Belastung der Befragten auch in den Haushalten hin.
Eine Alkoholabhängigkeit bzw. eine Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit wurde in 3% der Fälle in der Haushaltsbefragung angegeben, Essstörungen in 10% der Fälle. Einige der Suchterkrankungen wurden in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache deutlich häufiger angegeben: Alkoholabhängigkeit (10%) und Essstörungen (21%) etwa doppelt so häufig, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit (7%) etwa gleich häufig.
Eine besondere Schwierigkeit bei der Befragung der Frauen in vereinfachter Sprache stellten die Fragen zu psychischen Beeinträchtigungen dar. Da eine symptombezogen Befragung aufgrund der notwendigen Abstraktionsfähigkeit nicht möglich erschien, wurden die Frauen offen gefragt, ob sie z.B. sich oft schlecht fühlten oder oft unangenehme Gefühle oder seelische Probleme hätten etc. Bei einer zustimmenden Antwort wurden sie um Erläuterung gebeten. Die Schwierigkeit für viele Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung besteht jedoch auch in zeitlichen Einordnungen und Angaben zur Häufigkeit (z.B. ob sie sich oft schlecht fühlen), sodass die Aussagen der Frauen zu diesen Fragen noch nicht als konkrete Hinweise auf fortgesetzte psychische Beeinträchtigungen gewertet werden können; wohl aber erlauben sie einen ersten Eindruck von der subjektiv beschriebenen psychischen Situation der Frauen.
43% der Frauen, die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden (N=137), gaben an, dass sie sich oft schlecht fühlten. In einem geringeren Teil der Fälle (18 Frauen) wurden teilweise Aussagen zu den Diagnosen gemacht, wie z.B. Depressionen, bipolare Störungen, Psychosen, Angst- und Panikstörungen, Zwangshandlungen, Schizophrenie, paranoide Persönlichkeitsstörung, Klaustrophobie. Teilweise wurden aber auch konkrete Symptome genannt, wie z.B. Schlaflosigkeit, Albträume, Stimmen hören, Selbstverletzungen (Ritzen, Hände wund kratzen), Selbstmordgedanken. Zwei Fünftel der Frauen (N=56) gaben vor allem unspezifische Traurigkeit und/oder Schlafstörungen und/oder Ängste an, aber auch innere Unruhe und Wutanfälle. 39 Frauen haben psychische Probleme benannt, die situationsbezogen waren. Im Vordergrund stand hier das Problem, dass Eltern oder andere nahe Bezugspersonen gestorben waren und die Frauen um den Verlust trauerten. Dieser Verlust bedeutete für die Frauen teilweise auch den Umzug ins Wohnheim oder den Verlust von Kontakten durch die Besuche im Wohnheim und ging zum Teil mit Gefühlen des „Abgeschobenseins“, mit Zukunftsängsten, Einsamkeit, Heimweh, Lustlosigkeit und Traurigkeit einher. Andere Frauen beschrieben, dass sie sich in der Einrichtung und mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern nicht wohlfühlten, sich „fehl am Platze“ vorkamen und dass Probleme mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sie belasteten, sodass sie weinen müssen und nicht schlafen können. In Einzelfällen wurden auch Paarbeziehungsprobleme als belastend genannt sowie die Erfahrung sexueller Belästigung und mangelnder Unterstützung. Einzelne Frauen benannten auch eine konkrete Angst (z.B. bei Gewitter). Drei Frauen schilderten Belastungen durch traumatische Erlebnisse, aufgrund eines Unfalls, aufgrund von Gewalt durch einen Partner und durch sexuellen Missbrauch in der Kindheit.
Die hohen Anteile der Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Behandlungen und/oder der Einnahme von Medikamenten aufgrund der psychischen Probleme (insgesamt 76%) deuten darauf hin, dass es sich bei mindestens drei Viertel der von psychischen Problemen betroffenen Frauen mit Behinderungen in den Haushalten um einen stärker belastenden Bereich psychischer Probleme handeln dürfte.[72]
|
Haushalte N=344 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=75 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=64 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Ambulant (z.B. in psychotherapeutischer oder psychiatrischer Praxis oder Ambulanz) |
70 |
49 |
14 |
** |
|
Teilstationär (z.B. Tagesklinik) |
11 |
13 |
0 |
* |
|
Stationär (z.B. Krankenhaus, psychosomatische Klinik, Reha-Einrichtung, therapeutische Wohngruppe) |
44 |
71 |
17 |
** |
|
Keine Angabe |
13 |
5 |
16 |
Basis: Frauen, die eine Form von therapeutischer Unterstützung wegen psychischer Probleme in Anspruch genommen haben. 43 Frauen von 344 Frauen (13%) haben hier keine konkrete Angabe zur Form der Therapie gemacht. Mehrfachnennungen.
64% der Frauen in Haushalten, die ein psychisches Problem genannt haben, waren deswegen schon einmal in Behandlung (z.B. im Rahmen einer Psychotherapie oder einer Reha-Maßnahme). Von diesen nutzen 70% eine ambulante Versorgung (z.B. psychotherapeutische oder psychiatrische Praxis/Ambulanz), 11% eine teilstationäre Unterstützung (z.B. Tagesklinik) und 44% eine stationäre Behandlung (z.B. Krankenhaus, psychosomatische Klinik, Reha-Einrichtung, therapeutische Wohngruppe). Mehrfachnennungen waren möglich.
Die Mehrheit der von psychischen Problemen betroffenen Frauen (58%) hat zudem wegen der psychischen Beeinträchtigung schon einmal ärztlich verschriebene Medikamente eingenommen.
Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen leben zumeist aufgrund einer psychischen Erkrankung in einer Einrichtung,[73] was auf stärker beeinträchtigende psychische Probleme hinweist. Entsprechend nahmen in dieser Befragungsgruppe mehr Frauen mit psychischen Problemen (82%) psychotherapeutische oder psychiatrische Unterstützung in Anspruch als in der Haushaltsbefragung (64%). Während die Frauen in der Haushaltsbefragung häufiger ambulante Angebote in Anspruch nahmen (70% versus 49% der Frauen, die therapeutische Unterstützung nutzten), nannten die zumeist psychisch erkrankten Frauen in Einrichtungen häufiger stationäre Angebote (71% versus 44%). In der Inanspruchnahme von teilstationären Angeboten, wie z.B. Tageskliniken, unterschieden sich die Befragungsgruppen kaum (11% der Frauen der Haushaltsbefragung versus 13% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache). Die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen nahmen wegen der psychischen Beeinträchtigungen jedoch deutlich häufiger ärztlich verschriebene Medikamente ein (85% versus 58%).
Knapp die Hälfte der Frauen (48%), die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden und angegeben hatten, dass sie sich oft schlecht fühlten, wurden aufgrund dessen ärztlich und/oder psychotherapeutisch behandelt. 35% der betroffenen Frauen haben deswegen schon einmal ärztlich verschriebene Medikamente eingenommen.[74] Betrachtet man die Gruppe der Frauen, die wegen dieser Probleme behandelt wurde und/oder Medikamente einnahm (51%), wird deutlich, dass es sich mindestens bei der Hälfte der Angaben von psychischen Problemen um schwerwiegendere Belastungen handeln muss. Die vorangegangene Tabelle zeigt auf, dass die Behandlung nur in wenigen Fällen außerhalb der Wohneinrichtung der Frau stattfindet.
Im Interview mit dem allgemeinen Fragebogen beantworteten in der Haushaltsbefragung auch 139 Frauen (17%) die Frage nach Beeinträchtigungen, die sie beim Lernen oder Begreifen im täglichen Leben stark und dauerhaft einschränken, mit Ja. Die Auswertung der offenen Nachfrage gibt Hinweise darauf, um welche Art der Beeinträchtigung es sich hier handelt. Von den Befragten, die hier eine Beeinträchtigung angegeben hatten, verorteten 20% diese im Kontext des Lernens, 9% im Bereich psychischer Probleme, 19% im Zusammenhang mit einer körperlichen Erkrankung/Behinderung oder Medikamenteneinnahme. 42% der Frauen, die hier eine Beeinträchtigung angegeben hatten, benannten nur allgemein Konzentrationsschwierigkeiten und/oder Vergesslichkeit ohne genauere Zuordnung. 4% brachten die Beeinträchtigung in Zusammenhang mit ihrem zunehmenden Alter. Weitere 6% benannten sonstige Kontexte. Obwohl hier eine große Belastung der Frauen deutlich wird, scheint es sich in den meisten Fällen nicht um eine Lern- oder sogenannte geistige Behinderung zu handeln, sondern vor allem um Folgeerscheinungen einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung. Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen wurden in der Haushaltsbefragung so gut wie nicht erreicht. Darauf deutet auch hin, dass nur 9% der Frauen, die eine Lernbeeinträchtigung angegeben hatten, keinen Schulabschluss haben bzw. die Sonder- und Förderschule mit Abschluss beendet haben. Aber auch ein fehlender oder ein Sonderschulabschluss deutet nicht zwangsläufig auf eine Lernbehinderung hin.[75]
In der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache gaben 31% der Befragten Beeinträchtigungen an, die sie beim Lernen und Begreifen im täglichen Leben stark und dauerhaft einschränken. Auch diese können den offenen Antworten gemäß, in denen die Art der Einschränkung konkretisiert wurde, nicht als eine sogenannte geistige Behinderung verstanden werden. Sie deuten aber auf starke psychische Belastungen hin, die sich auf die Möglichkeiten des Lernens und Verstehens auswirken. Von 31 offenen Antworten verwiesen sieben ausdrücklich auf die Einschränkung durch eine psychische Erkrankung oder Medikamenteneinnahme (z.B. dass das Stimmenhören oder Zwangsgedanken beim Lesen stören), 13 nannten Konzentrationsschwierigkeiten und 11 Probleme beim Lesen, Schreiben, Rechnen, Sinnverstehen oder Lernen. Ein Abgleich mit der Schulbildung dieser 31 Frauen zeigt, dass nur vier Frauen eine Sonder- oder Förderschule besucht haben, was auf eine Lernbehinderung hindeuten kann (aber nicht muss).
Die Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, lebten mehrheitlich aufgrund einer sogenannten geistigen Behinderung in einer Einrichtung. Einzelne Frauen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung in einer Einrichtung lebten, wurden jedoch auch mit dem vereinfachten Fragebogen befragt, wenn dies von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung aufgrund der erkrankungsbedingten Einschränkungen der Frau empfohlen wurde oder die Frau dies selbst wünschte. 78% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen gaben mindestens eine Schwierigkeit beim Lernen, Erinnern, Denken, Verstehen, Lesen oder Schreiben an. 61% benannten Schwierigkeiten beim Lernen, 45% beim Erinnern, Denken oder Verstehen und 49% beim Lesen oder Schreiben.
|
Schwierigkeiten beim … |
Einrichtungen/vereinfachte Sprache N=318 (%) |
|---|---|
|
Lernen |
61 |
|
Erinnern, Denken oder Verstehen |
45 |
|
Lesen oder Schreiben |
49 |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Die Mehrheit der Frauen in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden (62%), hat die Schule entweder ohne Abschluss beendet (23%) oder eine Sonder- oder Förderschule besucht (39%). 10% haben einen Volks- oder Hauptschulabschluss bzw. den Abschluss einer Polytechnischen Oberschule, die Fachschulreife, die Fachhochschulreife oder das Abitur bzw. einen Abschluss der erweiterten Oberschule. Unter der Kategorie Sonstiges (13%) finden sich viele Frauen, die aufgrund ihrer Behinderung keine Schule (auch keine Sonder- oder Förderschule) besucht haben oder die noch zur Schule gehen (siehe auch 3.1.4).
|
Psychische Belastungen und Beeinträchtigungen betreffen erhebliche Anteile der Frauen in allen Befragungsgruppen. Da die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen zumeist aufgrund einer psychischen Erkrankung in der Wohneinrichtung lebten, war das hohe Ausmaß von Frauen mit psychischen Problemen in dieser Gruppe (88%) erwartbar. Aber auch in den Haushalten waren mehr als zwei Drittel der Frauen von psychischen Problemen (68%) betroffen. Die große Mehrheit dieser betroffenen Frauen der Haushaltsbefragung (76%) hat wegen der psychischen Probleme schon einmal eine psychotherapeutische oder psychiatrische Unterstützung in Anspruch genommen und/oder ärztlich verschriebene Medikamente eingenommen.Am häufigsten genannt wurden in beiden Befragungsgruppen depressionstypische Probleme, Ängste und Panikgefühle, Schlaflosigkeit und Probleme, die im Zusammenhang mit nicht bewältigten außergewöhnlichen Belastungen oder traumatischem Erleben stehen können, sowie körperliche Beschwerden aufgrund von seelischen Problemen.Aufgrund der vereinfachten Befragungsweise der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen war hier eine vergleichbare Analyse nicht möglich. Es zeigte sich jedoch, dass 43% der Frauen angaben, dass sie sich oft schlecht fühlten. Dass die Hälfte dieser Frauen deswegen in ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung war und/oder ärztlich verschriebene Medikamente einnahm, weist auf starke psychische Belastungen auch in dieser Befragungsgruppe hin.Lernschwierigkeiten wurden nicht nur von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen angegeben (78%), sondern auch von 17% in der Haushaltsbefragung und von 31% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache. Hier handelt es sich jedoch nicht um sogenannte geistige Behinderungen, sondern zumeist um Konzentrationsschwierigkeiten, häufig auch im Zusammenhang mit einer psychischen oder körperlichen Erkrankung und der Einnahme von Medikamenten. |
Anhand einer Vierer-Skala wurden die Frauen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache gefragt, wie stark sie aufgrund der Beeinträchtigung oder Behinderung oder durch Schmerzen in verschiedenen Lebensbereichen eingeschränkt sind (Antwortkategorien: sehr stark, stark, weniger stark, gar nicht). Die Befragung in vereinfachter Sprache ist hier nicht direkt vergleichbar und wird deshalb wieder anschließend dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Frauen in den beiden Befragungsgruppen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache starke o der sehr starke Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen angegeben haben:
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|
|
Berufs- und Erwerbsleben |
48 |
55 |
n.s. |
|
Freizeit und Erholung |
41 |
26 |
* |
|
familiären und häuslichen Tätigkeiten |
37 |
33 |
n.s. |
|
sozialen Aktivitäten |
32 |
30 |
n.s. |
|
im Paarbeziehungsleben |
20 |
27 |
n.s. |
|
in Gesprächen mit anderen |
14 |
17 |
n.s. |
|
in der Selbstversorgung (z.B. sich waschen und anziehen, einkaufen, selbstständige Bewegung außer Haus, ohne dabei auf fremde Hilfe angewiesen zu sein) |
12 |
17 |
n.s. |
|
bei lebensnotwendigen Tätigkeiten, wie selbstständig essen, trinken, atmen oder die Toilette benutzen |
4 |
13 |
n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Abbildung 11. Diagramm 11: Starke oder sehr starke Beeinträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen
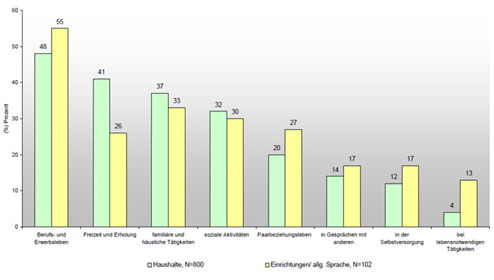
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Das Berufs- und Erwerbsleben wurde von Frauen sowohl in der Haushaltsbefragung (48%) als auch der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (55%) am häufigsten als stark beeinträchtigter Lebenskontext genannt. Am zweithäufigsten gaben die Frauen der Haushaltsbefragung den Bereich der Freizeit und Erholung an (41%), was mit der hohen Belastung durch Schmerzen in dieser Befragungsgruppe zusammenhängen könnte (siehe Abschnitt 4.2.2). Eine starke oder sehr starke Einschränkung in familiären und häuslichen Tätigkeiten gaben 37% und in sozialen Aktivitäten 32% an. Seltener wurde eine Einschränkung im Paarbeziehungsleben (20%), in Gesprächen mit anderen (14%) und in der Selbstversorgung (12%) genannt. Bei lebensnotwendigen Tätigkeiten, wie selbstständig essen, trinken, atmen oder die Toilette benutzen, waren nur wenige Frauen der Haushaltsbefragung beeinträchtigt (4%).
Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen sind dagegen deutlich seltener im Bereich Freizeit und Erholung eingeschränkt als die Frauen in Haushalten (26% versus 41%) und geringfügig seltener in familiären und häuslichen Tätigkeiten (33%) sowie in sozialen Aktivitäten (30%). Etwas häufiger haben sie jedoch das Paarbeziehungsleben (27%), Gespräche mit anderen (17%), die Selbstversorgung (17%) und lebensnotwendige Tätigkeiten (13%) genannt.
Betrachtet man die Anzahl der Lebensbereiche, in denen eine Einschränkung vorliegt, so zeigt sich, dass die Frauen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache vergleichbare Angaben gemacht haben. So gaben in der Haushaltsbefragung 25% der Befragten in keinem der genannten Lebensbereiche an, stark oder sehr stark eingeschränkt zu sein. In der Befragung der zumeist psychisch erkrankten Frauen in Einrichtungen waren es 28%. Eine starke oder sehr starke Beeinträchtigung in 1–2 Bereichen gaben in der Haushaltsbefragung 39% der Frauen an und in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache 37%. Starke oder sehr starke Beeinträchtigungen in drei und mehr (bis zu acht) Bereichen gaben jeweils 36% der Frauen der Haushaltsbefragung und der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache an. Die Unterschiede zwischen den Befragungsgruppen sind hier nicht signifikant.
|
Anzahl der Lebensbereiche mit starker/sehr starker Beeinträchtigung |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|
|
0 |
25 |
28 |
n.s. |
|
1 |
21 |
21 |
|
|
2 |
18 |
16 |
|
|
3 |
15 |
6 |
|
|
4 |
9 |
14 |
|
|
5 |
6 |
8 |
|
|
6 |
4 |
5 |
|
|
7 |
1 |
3 |
|
|
8 |
1 |
0 |
|
|
Gesamt |
100 |
100 |
Alle befragten Frauen.
Für die weitere Analyse wurde die Stärke der Beeinträchtigung nach den Angaben zur Anzahl der stark beeinträchtigten Lebensbereiche gruppiert.[76] Von einer geringen Beeinträchtigung wird hier gesprochen, wenn die Frauen in keinem der genannten Lebensbereiche eine starke oder sehr starke Beeinträchtigung angaben. Von einer mittleren Beeinträchtigung ist die Rede, wenn die Frauen in ein bis zwei Lebensbereichen eine starke oder sehr starke Beeinträchtigung angaben. Zu einer hohen Beeinträchtigung wurden die Befragten zugeordnet, wenn sie eine starke oder sehr starke Beeinträchtigung in drei bis acht Lebensbereichen benannt hatten.[77]
|
Stärke der Beeinträchtigung (gruppiert) |
Haushalte N=800 |
Einrichtungen/allgemeine Sprache N=102 |
|---|---|---|
|
Gruppe 1: geringe Beeinträchtigung |
25 |
28 |
|
Gruppe 2: mittlere Beeinträchtigung |
39 |
34 |
|
Gruppe 3: hohe Beeinträchtigung |
37 |
38 |
|
Gesamt |
100 |
100 |
Basis: Alle befragten Frauen. Die leichten Differenzen zu den Angaben der vorangegangenen Tabelle ergeben sich daraus, dass für diesen Auswertungsteil zwei Items weniger berücksichtigt wurden, um den Bereich Partnerschaft/Sexualleben im Verhältnis zu anderen wichtigen Lebensbereichen nicht zu stark zu gewichten. S. vorletzte Fußnote.
Betrachtet man nur die am stärksten beeinträchtigte Gruppe (siehe Tabelle 38), so zeigt sich, dass sowohl die Frauen dieser Gruppe 3 in den Haushalten (81%) als auch die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen dieser Gruppe (92%) am häufigsten starke Einschränkungen im Berufs- und Erwerbsleben genannt haben. In der Gruppe 3 der Haushaltsbefragung sind darüber hinaus jeweils 69% bis 78% in den Bereichen soziale Aktivitäten, familiäre und häusliche Tätigkeiten sowie Freizeit und Erholung eingeschränkt und 29% bis 41% in der Selbstversorgung, in Gesprächen mit anderen sowie im Paarbeziehungsleben. Nur 10% der Frauen der Gruppe 3 sind jedoch in lebensnotwendigen Tätigkeiten beeinträchtigt.
In der am stärksten beeinträchtigten Gruppe der Einrichtungsbefragung wurde der Bereich der Einschränkung in lebensnotwendigen Tätigkeiten dreimal häufiger angegeben als in der Haushaltsbefragung (31% vs.10%). Eine Beeinträchtigung in sozialen Aktivitäten, familiären und häuslichen Tätigkeiten sowie Freizeit und Erholung nannten diese Frauen zu 64% bis 75%, eine Einschränkung in der Selbstversorgung, in Gesprächen mit anderen sowie im Paarbeziehungsleben zu 31% bis 56%.
|
Lebensbereiche |
Haushalte N=293 (%) |
Einrichtungen/ allg. Sprache N=36 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|
|
Berufs- und Erwerbsleben |
81 |
92 |
n.s. |
|
Freizeit und Erholung |
78 |
64 |
* |
|
Familiäre und häusliche Tätigkeiten |
74 |
75 |
n.s. |
|
Soziale Aktivitäten |
69 |
72 |
n.s. |
|
Im Paarbeziehungsleben |
41 |
56 |
n.s. |
|
In Gesprächen mit anderen |
31 |
39 |
n.s. |
|
In der Selbstversorgung (z.B. sich waschen und anziehen, einkaufen, selbstständige Bewegung außer Haus, ohne dabei auf fremde Hilfe angewiesen zu sein) |
29 |
31 |
n.s. |
|
Bei lebensnotwendigen Tätigkeiten, wie selbstständig essen, trinken, atmen oder die Toilette benutzen |
10 |
31 |
** |
Mehrfachnennungen
Abbildung 12. Diagramm 12: Starke oder sehr starke Beeinträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen bei Gruppe 3 (hohe Beeinträchtigung)
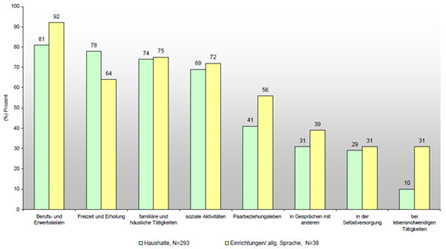
Basis: Frauen der Gruppe 3 (hohe Beeinträchtigung)
In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache wurde ebenfalls nach Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen gefragt, jedoch auf eine vereinfachte Weise ohne abgestufte Skala von sehr stark bis gar nicht. Die Frauen wurden zunächst danach gefragt, ob es Dinge gebe, die sie nicht tun könnten oder die ihnen schwerfallen (weil sie krank oder behindert sind). Dann wurden konkrete Tätigkeiten angesprochen (z.B. alleine essen, trinken, aufs Klo gehen, sich alleine waschen und anziehen, alleine einkaufen gehen, alleine spazieren gehen, eine Partnerin bzw. einen Partner finden, Sex haben, ins Kino gehen, Sport machen), die nicht direkt mit den oben genannten Kategorien des allgemeinen Fragebogens vergleichbar sind. Darüber hinaus hatten die Frauen die Möglichkeit, als offene Antwort zu benennen, bei welchen Tätigkeiten sie eingeschränkt sind. Diese Antworten wurden unter der Kategorie Sonstiges zusammengefasst.
Insgesamt benannten nur knapp die Hälfte der Frauen (47%) mindestens eine Tätigkeit, bei der sie eingeschränkt sind, 53% gaben keine Einschränkung an oder beantworteten die Frage nicht (24% sagten ausdrücklich, keine Einschränkung bei bestimmten Tätigkeiten zu haben, 25% machten keine Angabe und 5% antworteten „Weiß nicht“). Von den Frauen, die mindestens eine Einschränkung benannt haben (47%, N=148), stimmten nur 39 Frauen mindestens einer der konkreten Antwortvorgaben (siehe oben) zu, die meisten Frauen nannten eine andere Tätigkeit in der offenen Antwort. Genannt wurden hier unterschiedlich komplexe Aktivitäten von Schreiben und Rechnen, Autofahren und dem Bedienen des Bankautomaten bis hin zu Tisch decken, Geschirr abräumen oder Staub saugen.
Während nur ein geringer Teil der Frauen der Haushaltsbefragung regelmäßige Unterstützung im Alltag erhält (17%, N=136), werden die überwiegende Mehrheit der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (81%) und fast alle Frauen (93%), die in vereinfachter Sprache befragt wurden, nach eigenen Angaben aufgrund der Behinderung im Alltag regelmäßig unterstützt oder betreut.[78]
|
Unterstützte Tätigkeiten |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
|
Bett verlassen und/oder sich an- und ausziehen |
3 |
12 |
13 |
n.s. |
|
Körperpflege (z.B. sich waschen, baden, duschen, Toilette benutzen) |
4 |
15 |
30 |
** |
|
Mahlzeiten und Getränke zu sich nehmen |
2 |
9 |
4 |
n.s. |
|
Sich Mahlzeiten zubereiten |
5 |
36 |
62 |
** |
|
Sich selbstständig in der Wohnung bewegen |
1 |
5 |
7 |
n.s. |
|
Die Wohnung sauber machen |
11 |
37 |
55 |
* |
|
Medikamente richten und einnehmen |
2 |
49 |
48 |
** |
|
Telefonieren, Kontaktaufnahme und Verständigung mit anderen Personen |
1 |
13 |
29 |
** |
|
Finanzielle Angelegenheiten regeln (z.B. Überweisungen ausfüllen) |
4 |
50 |
58 |
** |
|
Bewegung außer Haus (z.B. Lebensmittel einkaufen, Arztbesuche, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Erreichen von Arbeitsplatz und Einrichtungen) |
10 |
35 |
68 |
** |
|
Ämter- und Behördenkontakte |
6 |
62 |
70 |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen
In der Haushaltsbefragung wurden als Tätigkeiten, bei denen die Frauen Unterstützung erhalten, am häufigsten genannt: Wohnung sauber machen (11% aller Befragten) und Bewegung außer Haus (10%), gefolgt von Ämter- und Behördenkontakten (6%), dem Regeln finanzieller Angelegenheiten (4%) und dem Zubereiten von Mahlzeiten (5%). Mehrfachnennungen waren möglich. Tätigkeiten, die den Bereich der (körperlichen) Pflege betreffen, werden demgegenüber seltener genannt (Körperpflege 4%, Bett verlassen und/oder sich an- und ausziehen 3%, Medikamente richten und einnehmen 2%; sich selbstständig in der Wohnung bewegen 1%; telefonieren, Kontaktaufnahme und Verständigung mit anderen Personen 1%).
Die folgende Tabelle zeigt, dass bei der Haushaltsbefragung zwar Frauen mit hoher Beeinträchtigung deutlich häufiger regelmäßige Unterstützung erhalten (31%) als Frauen mit mittlerer (12%) und mit geringer Beeinträchtigung (4%), dass aber keineswegs die meisten der in Haushalten lebenden Frauen mit hoher Beeinträchtigung unterstützt werden (mehr als zwei Drittel von diesen erhalten aktuell keine Unterstützung).
|
Stärke der Beeinträchtigung |
Erhaltene Unterstützung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktuell regelmäßig |
Früher regelmäßig |
Keine 1) |
Keine Angabe |
Gesamt |
||
|
gering |
Anzahl |
8 |
8 |
155 |
27 |
198 |
|
% von Gruppe 1 |
4% |
4% |
78% |
14% |
100% |
|
|
mittel |
Anzahl |
38 |
8 |
259 |
4 |
309 |
|
% von Gruppe 2 |
12% |
3% |
84% |
1% |
100% |
|
|
hoch |
Anzahl |
90 |
10 |
190 |
30 |
293 |
|
% von Gruppe 3 |
31% |
3% |
65% |
1% |
100% |
|
|
Gesamt Anzahl |
136 |
26 |
65 |
34 |
800 |
|
Basis: Alle befragten Frauen der Haushaltsbefragung (N=800). Kreuztabelle (zeilenprozentuiert). Signifikanz **; 1)Weder aktuell noch früher.
Die meisten der regelmäßig unterstützten Frauen, die hierzu genauere Angaben gemacht haben (N=125)[79], werden durch eine Partnerin bzw. einen Partner (73 Frauen) oder durch Familienangehörige (70 Frauen) unterstützt (Mehrfachnennungen waren möglich). Andere Unterstützungskräfte wurden nur in geringem Maße in Anspruch genommen: 23 Frauen werden durch Freundinnen bzw. Freunde oder Bekannte unterstützt. Persönliche Assistenz, Pflegekräfte, Fahrdienste oder medizinisches Personal wurden nur in 4 bis 9 Fällen angegeben, sodass hier weitgehend keine professionelle oder institutionelle Unterstützung bei täglichen Aufgaben erfolgt. Von einer vertiefenden, nach Unterstützungsbereichen differenzierenden Analyse der Erfahrungen mit den Unterstützungspersonen wird aufgrund der insgesamt geringen Fallzahl der unterstützen Frauen, die hier genauere Angaben gemacht haben (N=125), und der hier schwerpunktmäßig privat organisierten Unterstützung abgesehen.
Für die Auswertung der Unterstützung von Frauen in Einrichtungen muss auch der Institutionskontext berücksichtigt werden, z.B. in Bezug darauf, ob die Verpflegung eher in der Verantwortung der Einrichtung oder jeder einzelnen Frau liegt, ob die Frauen ihre Medikamente eher selbst aufbewahren und einnehmen oder täglich zugeteilt bekommen, ob sie eher selbst für die Reinigung der Wohnräume zuständig sind oder diese von der Institution übernommen wird. So liegen die Angaben zum Tätigkeitsbereich Sich Mahlzeiten zuzubereiten bei der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache mit 62% höher als in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (36%), beim Richten und Einnehmen der Medikamente dagegen mit 48% bis 49% gleich hoch und beim Wohnung sauber machen bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen höher als bei den in allgemeiner Sprache befragten (55% versus 37%). Beide Befragungsgruppen werden am häufigsten bei Ämter und Behördenkontakten unterstützt (62–70%) und auch häufig beim Regeln finanzieller Angelegenheiten (50–58%). Während aber die in vereinfachter Sprache befragten Frauen zu zwei Drittel (68%) bei der Bewegung außer Haus unterstützt werden, gilt dies nur für 35% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen. Auch bei der Körperpflege (30% versus 15%) und beim Telefonieren, der Kontaktaufnahme und Verständigung mit anderen Personen (29% versus 13%) werden die in vereinfachter Sprache befragten Frauen doppelt so häufig unterstützt wie die in allgemeiner Sprache befragten. Kaum Unterschiede zeigen sich beim Bettverlassen und/oder Sich-an-und-ausziehen (13% versus 12%) und bei der selbstständigen Bewegung in der Wohnung (7% versus 5%). Beim Zu-sich-Nehmen von Mahlzeiten und Getränken werden die in allgemeiner Sprache Befragten jedoch häufiger unterstützt (9% versus 4%).
Abbildung 13. Diagramm 13: Unterstützung bei Tätigkeiten
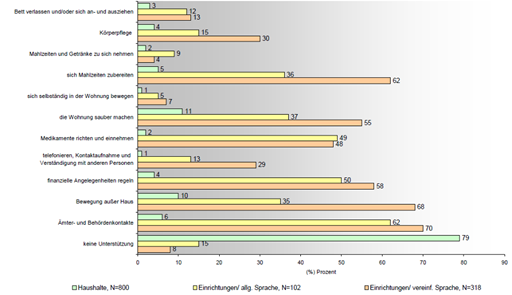
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen werden bei etwas mehr Tätigkeiten unterstützt als die in allgemeiner Sprache befragten Frauen (Mittelwert 4,8 versus 4,3).
|
Anzahl der Tätigkeiten, bei denen die Frauen unterstützt werden |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=77 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=294 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|
|
1 |
7 |
6 |
* |
|
2 |
18 |
12 |
|
|
3 |
16 |
14 |
|
|
4 |
21 |
13 |
|
|
5 |
10 |
15 |
|
|
6 |
12 |
17 |
|
|
7 |
9 |
12 |
|
|
8 |
3 |
7 |
|
|
9 |
4 |
2 |
|
|
10 |
1 |
1 |
|
|
11 |
0 |
1 |
|
|
Mittelwert |
4,3 |
4,8 |
1)Frauen, die Unterstützung erhalten und dazu konkrete Angaben gemacht haben. Mehrfachnennungen.
Es zeigte sich, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass bestimmte der abgefragten Formen von Beeinträchtigungen per se mit einer höheren oder geringeren Einschränkung oder einem höheren Unterstützungsbedarf einhergehen.
Die in Einrichtungen befragten Frauen werden vor allem durch Pflegekräfte bzw. medizinisches Personal, Betreuerinnen und Betreuer im Rahmen des betreuten Wohnens oder gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer unterstützt. Wenn Probleme mit der Unterstützung geäußert wurden, beziehen sie sich vor allem auf Zeitmangel des Personals, auf Bevormundungen durch gesetzliche Betreuerinnen bzw. Betreuer oder den Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Pflege.
Während für die Haushaltsbefragung und die Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache eine Gruppierung der Stärke der Beeinträchtigung anhand der Fragen nach der Einschränkung in verschiedenen Lebensbereichen vorgenommen wurde, erscheint für die in vereinfachter Sprache befragten Frauen eher eine Kategorisierung nach dem Grad der Unterstützung sinnvoll zu sein, da hier fast alle Frauen Unterstützung angegeben haben. Hierzu wurden die im Folgenden beschriebenen drei Gruppen gebildet:
Gruppe 1 der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (18%): geringe Unterstützung
Da alle der hier befragten Frauen in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, kann davon ausgegangen werden, dass allein durch diese Wohnform ein Minimum an Unterstützung erfahren wird, auch wenn einige Frauen keine Unterstützung bei den erfragten Tätigkeiten nannten. Unter der Kategorie „geringe Unterstützung“ sollen daher hier die Frauen zusammengefasst werden, die gar keine Unterstützung oder eine Unterstützung bei 1–2 Tätigkeiten angegeben haben.
Die Frauen dieser ersten Gruppe werden so gut wie gar nicht in Bereichen unterstützt, die eine größere körperliche Abhängigkeit und damit auch Verletzungsoffenheit mit sich bringen kann, etwa beim Bettverlassen und/oder Sich-an- und -ausziehen, bei der Körperpflege, beim Essen und Trinken und bei der selbstständigen Bewegung in der Wohnung. Gleiches gilt für den Bereich der Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit anderen Personen/Telefonieren, bei der die Unterstützung zwar nicht den körperlichen Bereich berührt, aber dennoch auf eine größere Abhängigkeit von anderen Personen bzw. eine größere Gefahr der Isolation schließen lässt:
|
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=77 (%) |
|
|---|---|
|
Bett verlassen und/oder sich an- und ausziehen |
1 |
|
Körperpflege (z.B. sich waschen, baden, duschen, Toilette benutzen) |
0 |
|
Mahlzeiten und Getränke zu sich nehmen |
0 |
|
Sich Mahlzeiten zubereiten |
21 |
|
Sich selbstständig in der Wohnung bewegen |
0 |
|
Die Wohnung sauber machen |
10 |
|
Medikamente richten und einnehmen |
7 |
|
Telefonieren, Kontaktaufnahme und Verständigung mit anderen Personen |
1 |
|
Finanzielle Angelegenheiten regeln (z.B. Überweisungen ausfüllen) |
20 |
|
Bewegung außer Haus, z.B. Lebensmittel einkaufen, Arztbesuche, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Erreichen von Arbeitsplatz und Einrichtungen |
18 |
|
Ämter- und Behördenkontakte |
36 |
Basis: in vereinfachter Sprache befragte Frauen der Gruppe 1 (geringe Unterstützung).
Gruppe 2 der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (42%): mittlere Unterstützung
In der Kategorie „mittlere Unterstützung“ wurden die Frauen zusammengefasst, die in drei bis fünf Bereichen Unterstützung erfuhren. Hier ist generell der Anteil der Unterstützung bei einzelnen Tätigkeiten höher. Die Bereiche, die auf eine stärkere Abhängigkeit von anderen Menschen hindeuten, werden jedoch ebenfalls nur von jeweils 1%–18% der Frauen dieser Gruppe genannt (siehe Items 1–3, 5 und 8 in der folgenden Tabelle).
|
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=124 (%) |
|
|---|---|
|
Bett verlassen und/oder sich an- und ausziehen |
3 |
|
Körperpflege (z.B. sich waschen, baden, duschen, Toilette benutzen) |
18 |
|
Mahlzeiten und Getränke zu sich nehmen |
1 |
|
Sich Mahlzeiten zubereiten |
71 |
|
Sich selbstständig in der Wohnung bewegen |
2 |
|
Die Wohnung sauber machen |
48 |
|
Medikamente richten und einnehmen |
42 |
|
Telefonieren, Kontaktaufnahme und Verständigung mit anderen Personen |
16 |
|
Finanzielle Angelegenheiten regeln (z.B. Überweisungen ausfüllen) |
53 |
|
Bewegung außer Haus, z.B. Lebensmittel einkaufen, Arztbesuche, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Erreichen von Arbeitsplatz und Einrichtungen |
73 |
|
Ämter- und Behördenkontakte |
77 |
Basis: in vereinfachter Sprache befragte Frauen der Gruppe 2 (mittlere Unterstützung).
Gruppe 3 der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (40%): starke Unterstützung
In der Gruppe der starken Unterstützung wurden die Frauen zusammengefasst, die 6–11 Tätigkeiten angegeben hatten, bei denen sie Unterstützung erhielten. Die überwiegende Mehrheit dieser Frauen (88%) erhält auch Unterstützung in den Bereichen, die auf eine größere Abhängigkeit von anderen Menschen oder Unterstützung mit Körperkontakt hindeuten (z.B. Bett verlassen, Körperpflege, Mahlzeiten zu sich nehmen, sich selbstständig in der Wohnung bewegen, telefonieren und Kontaktaufnahme mit anderen Menschen). Diese Gruppe kann deshalb als besonders vulnerabel bezeichnet werden und umfasst etwa ein Drittel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (siehe übernächste Tabelle).
|
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=117 (%) |
|
|---|---|
|
Bett verlassen und/oder sich an- und ausziehen |
31 |
|
Körperpflege (z.B. sich waschen, baden, duschen, Toilette benutzen) |
62 |
|
Mahlzeiten und Getränke zu sich nehmen |
11 |
|
Sich Mahlzeiten zubereiten |
80 |
|
Sich selbstständig in der Wohnung bewegen |
17 |
|
Die Wohnung sauber machen |
92 |
|
Medikamente richten und einnehmen |
81 |
|
Telefonieren, Kontaktaufnahme und Verständigung mit anderen Personen |
60 |
|
Finanzielle Angelegenheiten regeln (z.B. Überweisungen ausfüllen) |
87 |
|
Bewegung außer Haus, z.B. Lebensmittel einkaufen, Arztbesuche, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Erreichen von Arbeitsplatz und Einrichtungen |
97 |
|
Ämter- und Behördenkontakte |
86 |
|
Gesamt |
100 |
Basis: in vereinfachter Sprache befragte Frauen der Gruppe 3 (starke Unterstützung).
|
Grad derUnterstützung (Gruppen) |
Unterstützung, die auf größere Abhängigkeit hindeutet |
||
|---|---|---|---|
|
ja |
nein |
Gesamt |
|
|
geringe Unterstützung |
3 |
97 |
100 |
|
mittlere Unterstützung |
36 |
64 |
100 |
|
starke Unterstützung |
88 |
12 |
100 |
|
Gesamt |
47 |
53 |
100 |
Basis: Alle in vereinfachter Sprache befragten Frauen (N=318). Kreuztabelle (zeilenprozentuiert).
Die Frage, ob sie mehr oder andere Unterstützungskräfte benötigen würden, beantworteten 15% aller Frauen der Haushaltsbefragung (N=123) mit Ja. Von den Frauen, die keine Unterstützung angegeben haben, traf dies auf 14% (N=88) zu, von jenen, die Unterstützung erhalten, auf 24% (N=30).
Die offen formulierte Frage, warum sie die benötigte Unterstützung nicht erhalten, beantworteten insgesamt 202 Frauen. 39 Frauen nannten den Kostenfaktor: Unterstützung sei für sie zu teuer. 33 Befragte wussten nicht, wo, bei wem und wie man Hilfe beantragen kann, oder sie hatten sich noch nicht um die Anträge gekümmert (hochschwellige Zugangsbarriere). 29 Frauen beklagten, dass Ämter, Behörden und Ärztinnen und Ärzte eine Unterstützung nicht befördern. 23 nannten als Grund aber auch ihr Schamgefühl oder ihren Wunsch, alles selbst zu bewältigen. 50 Befragte haben darüber hinaus angegeben, welche Art von Unterstützung sie benötigen. Am häufigsten genannt wurden hier Haushalts- bzw. Einkaufshilfen. In Einzelfällen wurden personelle Unterstützung oder Angebote genannt, z.B. persönliche Assistenz oder Arbeitsassistenz, Musiktherapie, Diätassistenz, Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher.
Die Frage, ob sie (mehr oder andere) Unterstützungskräfte benötigen würden, beantworteten in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache 17% der Frauen (N=17) mit Ja. Von den 25 Frauen, die keine Unterstützung erhalten, sagten fünf Frauen, dass sie eine solche jedoch benötigten. Von den 77 Frauen, die eine Unterstützung erhalten, äußerten 12 Frauen, dass sie mehr oder andere persönliche Unterstützung benötigen würden. Von den insgesamt 16 Frauen, die hierzu in den offenen Nennungen weitere Erläuterungen gaben, warum sie die Unterstützung nicht erhielten, nannten 11 Frauen Probleme mit Ämtern und Einrichtungen, 3 Frauen den Kostenfaktor und weitere 3 Frauen Scham oder das Bedürfnis, alles selbst zu bewältigen.
Einen nicht gedeckten Unterstützungsbedarf nannten in der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache 17% aller Frauen[80]; am häufigsten gaben dies mit 24% Frauen der Gruppe 3 an, die in hohem Maße von Unterstützung abhängig sind. In den offenen Fragen, welche Hilfe sie benötigen würden und warum sie diese nicht erhalten, benannten die Frauen zum einen, dass mehr (weibliche) Hilfe notwendig sei, z.B. beim Duschen und Baden, beim An- und Ausziehen sowie bei Haushaltstätigkeiten (z.B. Wäschewaschen, Kochen, Putzen etc.). Zum anderen forderten einige Frauen mehr Unterstützung bei schulischen Angelegenheiten (beim Lernen, Schreiben und Lesen), bei finanziellen Aspekten (z.B. Rechnungen bezahlen) oder bei der Begleitung zur Ärztin bzw. zum Arzt. Darüber hinaus wünschten sich einige Frauen mehr psychosoziale Unterstützung (z.B. Psychotherapie, Beratung bei Beziehungsproblemen, Hilfe bei Konflikten mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern), aber auch mehr Unternehmungen und Unterhaltung sowie mehr persönliche Unterstützung (z.B. eine Begleitung beim Einkaufen). Angesprochen wurde auch der Wunsch nach einem Blindenhund (in der Einrichtung nicht erlaubt) oder nach einem Einzelzimmer sowie das Problem, dass in der Einrichtung Hilfe teilweise nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehe, an die sich die Bewohnerinnen dann halten müssten. Gründe, warum sie diese Hilfen nicht erhalten, wurden nur wenige genannt. Im Vordergrund standen hier Personalmangel bzw. zu wenig Zeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung und der gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer. Wenige Frauen benannten als Grund auch die Anforderung, dass sie selbstständig werden sollten.
Rund ein Viertel (26%) der Frauen der Haushaltsbefragung und ein Drittel der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen (34%) und der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (33%) nutzen Hilfsmittel zum Ausgleich der Beeinträchtigung, Behinderung oder chronischen Erkrankung. In den offenen Antworten benannten 25 Frauen der Haushaltsbefragung Hilfsmittel für die Bewegung (z.B. Stock, Treppenlift, Greifzange etc.), sieben Frauen spezielle Möbel (z.B. erhöhte Sitzmöbel, höhenverstellbarer Schreibtisch, Krankenbett, Erzieherstuhl, Sitzdusche), neun Frauen Hörgeräte bzw. Klingellichtanlage für Telefon, visuelle Türklingel, sechs Frauen Sehhilfen und zwei Frauen ein Atemunterstützungs- bzw. Sauerstoffgerät. Andere Angaben wie Milbenbezüge, Insulinpumpe, Kniebandage etc. wurden nur vereinzelt genannt. In der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache wurden unter anderem Schuheinlagen, Arbeitsschuhe, Schiene, Hörgerät, Sehhilfen und Rollator angegeben. In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache nannten 29 Frauen Zahnprothesen, 26 einen Rollstuhl, 36 (teilweise zusätzlich zum Rollstuhl) einen Rollator, sechs Körperteilprothesen und sechs Frauen einen Gehstock. Darüber hinaus wurden von weniger Frauen auch Hörgeräte, Schienen (z.B. an Knie, Fuß oder Arm), orthopädische Schuhe, Einlagen, Kompressionsstrümpfe, Blindenstöcke, Brillen, Lifte (z.B. für Bad und Dusche), Pflegebett, Bettwagen, Antidekubitusunterlagen, Inhaliergerät, Atemgeräte und ein Trinkstrohhalm genannt.
Wenige Frauen (8% der Haushaltsbefragung, 5% der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache und knapp 3% der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache) würden nach eigener Einschätzung (weitere) Hilfsmittel benötigen. Auf die Frage, warum sie diese nicht erhalten, verwiesen in den offenen Nennungen 20 Frauen der Haushaltsbefragung auf Probleme mit den Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzte oder Behörden. 11 Frauen gaben den Kostenfaktor als Grund an, sechs Frauen die Scham, auf Hilfe angewiesen zu sein. In der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache wurden von wenigen Frauen ähnliche Angaben gemacht (zu teuer, Probleme mit Ärztinnen und Ärzten, Krankenkassen oder Behörden).
|
Betrachtet man die Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen, so zeigt sich, dass die in allgemeiner Sprache in Haushalten und Einrichtungen befragten Frauen am häufigsten im Berufs- und Erwerbsleben eingeschränkt sind. Dies betrifft ca. die Hälfte der Frauen in beiden Befragungsgruppen. Die Bereiche: Freizeit und Erholung, familiäre und häusliche Tätigkeiten, soziale Aktivitäten sowie Paarbeziehungsleben wurden von 20% bis 41% der Frauen beider Befragungsgruppen angegeben. Seltener wurden Gespräche mit anderen, Selbstversorgung und lebensnotwendige Tätigkeiten genannt (4%–17%). Betrachtet man nur die Frauen mit hoher Beeinträchtigung (starke oder sehr starke Beeinträchtigung in drei bis acht Lebensbereichen), so sind im Berufs- und Erwerbsleben 81% bis 92% der Frauen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache stark oder sehr stark beeinträchtigt. Auch die anderen Lebensbereiche wurden von den hoch beeinträchtigten Frauen wesentlich häufiger genannt.Obwohl die in vereinfachter Sprache befragten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen vermutlich aufgrund ihrer Behinderung in einigen Lebensbereichen eingeschränkt sind und im Zusammenhang mit dem Leben in der Einrichtung Unterstützung erhalten, scheinen sie sich nicht unbedingt als eingeschränkt wahrzunehmen: Weniger als die Hälfte der Frauen gab eine Einschränkung in verschiedenen Lebensbereichen an.Regelmäßige Unterstützung im Alltag gaben die Frauen in Haushalten nur zu einem geringen Anteil (17%) an, am häufigsten beim Wohnungsaubermachen und bei der Bewegung außer Haus. Unterstützung mit Körperkontakt innerhalb der Wohnung wie z.B. bei der Körperpflege oder beim Bettverlassen und An- und Ausziehen erhalten die Frauen seltener (1%–4%). Es handelt sich zumeist um innerfamiliäre Unterstützung. Hilfsmittel wurden von einem Viertel der Frauen verwendet.Die Frauen in Einrichtungen werden dagegen wesentlich häufiger unterstützt (81% der zumeist psychisch erkrankten Frauen; 93% der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen). In beiden Einrichtungsbefragungsgruppen (allgemeine und vereinfachte Sprache) wurden das Regeln finanzieller Angelegenheiten und Ämter- undBehördenkontakte besonders häufig genannt (50%–70%). Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen werden aber am häufigsten bei der Bewegung außer Haus unterstützt (68%). Beide Befragungsgruppen der Einrichtungsbefragung erhalten häufiger Unterstützung mit Körperkontakt (15%–30%) als die Frauen der Haushaltsbefragung (1%–4%). Jeweils ein Drittel der Frauen der beiden Einrichtungsbefragungen nutzten Hilfsmittel.Einen ungedeckten Unterstützungsbedarf benannten die Frauen der drei Befragungsgruppen zu etwa gleichen Teilen (15%–17%). Als Gründe wurden von den in allgemeiner Sprache Befragten in Haushalten und Einrichtungen zu hohe Kosten, hochschwellige Zugangsbarrieren und Probleme mit der Förderung oder Bewilligung durch Ärztinnen und Ärzte, Krankenkassen, Ämter oder Behörden genannt. Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen gaben als Gründe eher Zeitmangel der Unterstützungskräfte an, benannten insgesamt aber seltener einen Grund für die fehlende Hilfe. |
Die Frauen aller Befragungsgruppen wurden gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem aktuellen Gesundheitszustand sind. Die Frauen in Haushalten und die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen wurden gebeten, ihre Zufriedenheit anhand einer Sechser-Skala (von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) einzuschätzen. Die in vereinfachter Sprache Befragten wurden gefragt, ob sie eher zufrieden oder eher unzufrieden sind. Daher sind die Aussagen hier nicht direkt vergleichbar. Ein Vergleich mit der Frauenstudie (Schröttle/Müller 2004) ist an dieser Stelle auch nur bedingt möglich, weil die Frauen dort gefragt wurden, wie sie ihren aktuellen Gesundheitszustand beschreiben würden, nicht wie zufrieden sie damit sind.
Es fällt auf, dass die Frauen in den Haushalten am unzufriedensten mit ihrem Gesundheitszustand sind: 42% der Frauen in den Haushalten und 33% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen, aber nur 12% der Frauen der im Bevölkerungsdurchschnitt (Frauenstudie 2004) sind eher unzufrieden bzw. schätzen ihren Gesundheitszustand eher negativ ein (Skalenwerte 4–6).[81] In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache waren 14% der Frauen eher unzufrieden, während sich 14% der Aussagen nicht eindeutig zuordnen lassen (weil die Frauen keine Angaben gemacht haben oder sie „mittel“ oder „manchmal so, manchmal anders“ geantwortet haben).
Während es als erwartbar einzuschätzen ist, dass die Frauen der Frauenstudie 2004 (Bevölkerungsdurchschnitt) ihren Gesundheitszustand positiver beschreiben als die in der vorliegenden Studie befragten Frauen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen, scheint es bemerkenswert, dass die Frauen der Haushaltsbefragung erheblich unzufriedener mit ihrer Gesundheit sind als die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass bei dem Begriff „Gesundheitszustand“ möglicherweise eher körperliche Gesundheit assoziiert wird als psychische. Da die Frauen der Haushaltsbefragung häufiger und auch mehr körperliche Beeinträchtigungen haben und zudem Schmerzen bei zwei Drittel der Frauen dieser Befragungsgruppe eine Rolle spielen, haben sie vermutlich auch eine größere Unzufriedenheit angegeben.
|
Frauenstudie 2004 1) N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) sehr zufrieden |
19 |
6 |
21 |
Eher zufrieden: 71 |
** 3) |
|
(2) |
43 |
20 |
25 |
||
|
(3) |
25 |
32 |
22 |
||
|
(4) |
8 |
20 |
17 |
Eher unzufrieden: 14 |
|
|
(5) |
3 |
12 |
8 |
||
|
(6) sehr unzufrieden |
1 |
10 |
8 |
||
|
mittel |
-- 2) |
-- 2) |
-- 2) |
7 |
|
|
manchmal so, manchmal anders |
-- 2) |
-- 2) |
-- 2) |
4 |
|
|
Frage (evtl.) nicht verstanden |
1 |
||||
|
Keine Angabe |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
|
Gesamt |
100 |
100 |
100 |
100 |
Alle befragten Frauen. 1)In Frauenstudie 2004: „Wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?“ 2)Nur in der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache gefragt. 3)Signifikanz bezieht sich nicht auf die Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache.
Auch im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung sind die Frauen in den Haushalten am unzufriedensten im Vergleich der Untersuchungsgruppen, was damit zusammenhängen könnte, dass diese Frauen, wie zuvor beschrieben, am häufigsten von körperlichen Beeinträchtigungen betroffen sind und unter Schmerzen leiden, sich häufig in ihrer Beeinträchtigung nicht anerkannt und nicht ernst genommen fühlen und Probleme mit Ärztinnen und Ärzten, Krankenkassen und Behörden beschreiben[82] (siehe auch 3.2.2, 3.2.5 und 3.5). Insgesamt fällt jedoch die durchschnittliche Zufriedenheit im Allgemeinen hoch aus: Nur 20% der Frauen in Haushalten, 14% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen und 7% der Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache äußerten sich eher unzufrieden (jeweils Skalenwerte 4–6). Bei der letztgenannten Gruppe lassen sich hier wiederum 8% nicht eindeutig zuordnen, weil sie entweder keine Angaben gemacht haben, es unklar war, ob die Frage verstanden worden war, oder „mittel“ bzw. „manchmal so, manchmal anders“ geantwortet wurde.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
(1) sehr zufrieden |
19 |
28 |
Eher zufrieden: 86 |
** 2) |
|
(2) |
36 |
42 |
||
|
(3) |
22 |
14 |
||
|
(4) |
10 |
8 |
Eher unzufrieden: 7 |
|
|
(5) |
5 |
2 1) |
||
|
(6) sehr unzufrieden |
5 |
4 1) |
||
|
mittel |
2 |
|||
|
manchmal so, manchmal anders |
2 |
|||
|
Keine Angabe |
1 |
1 1) |
4 |
|
|
Weiß nicht, habe keine gesundheitliche Versorgung |
3 1) |
1 1) |
||
|
Gesamt |
100 |
100 |
100 |
Alle befragten Frauen. 1)Fallzahl zu gering. 2)Signifikanz bezieht sich nicht auf die Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache.
Die Frauen in den Haushalten weisen im Vergleich mit allen vier Befragungsgruppen die häufigsten Nennungen bei unterschiedlichen Verletzungen im Lebensverlauf auf, die größtenteils nicht mit Gewalt in Zusammenhang stehen. Der Vergleich mit der Frauenstudie 2004 zeigt, dass die Frauen mit Behinderungen in Haushalten die Verletzungen teilweise erheblich häufiger, teilweise geringfügig häufiger erleben. In beiden Befragungsgruppen wurden Verstauchungen (61% versus 76%), Knochenbrüche (31% versus 46%), Brandwunden (28% versus 33%), Verletzungen im Gesicht/blaues Auge (18% versus 29%) am häufigsten genannt. Muskelrisse (12% versus 18%), schwere Stich- oder Schnittverletzungen (9% versus 19%), ausgekugelte Gelenke (6% versus 10%) und andere schwere Verletzungen (6% versus 17%) wurden seltener beschrieben. Betrachtet man, wie viele Verletzungen angegeben werden, so zeigt sich, dass die Frauen in Haushalten auch mehr Verletzungen erleiden als die Befragten der Frauenstudie 2004 (Mittelwert 2,5 versus 1,7), mehr als die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (Mittelwert 2,0) und als die in vereinfachter Sprache befragten Frauen (Mittelwert 1,0).
Zwar sind die Frauen in Haushalten bei allen Verletzungen im Vergleich aller Befragungsgruppen am häufigsten betroffen, die schweren Stich- und Schnittverletzungen und ausgekugelten Gelenke bilden hier jedoch eine Ausnahme. Diese wurden von den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen häufiger erlebt (schwere Stich- und Schnittverletzungen 26% versus 19% und ausgekugelte Gelenke 15% versus 10%). Auch nach Eintritt der Behinderung liegt der Anteil der Verletzungen bei Frauen in den Haushalten wesentlich höher als bei in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (4%–38% versus 2%–25%). Lediglich bei den Knochenbrüchen finden sich ähnliche Angaben (21% versus 22%) und bei den schweren Stich- und Schnittverletzungen kehrt sich das Verhältnis um. Hier sind die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen sowohl im Lebensverlauf als auch nach Eintritt der Behinderung häufiger betroffen (16% versus 11%). Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen gaben im Vergleich mit den anderen drei Gruppen wesentlich weniger Angaben bei einzelnen Verletzungen im Lebensverlauf (4%–27%) und gaben auch durchschnittlich die wenigsten Verletzungen an (Mittelwert 1,0). Verstauchungen und Knochenbrüche wurden in allen vier Befragungsgruppen sowohl im Lebensverlauf als auch nach Eintritt der Behinderung am häufigsten erlitten.
Von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen werden die Verletzungen nach Eintritt der Behinderung zu 15% auf einen körperlichen oder sexuellen Angriff zurückgeführt, von den Frauen in Haushalten zu 12%. Von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen gaben 10% an, dass die Ursache für Verletzungen ein körperlicher oder sexueller Angriff war. Hier wurde jedoch nicht differenziert zwischen den Verletzungen vor und nach Eintreten der Behinderung gefragt.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verletzungen im Lebensverlauf |
Verletzung erlebt |
Verletzung erlebt |
Auch nach Eintritt der Behinderung |
Verletzung erlebt |
Auch nach Eintritt der Behinderung |
Verletzung erlebt |
Verletzung erlebt/Auch nach Eintritt der Behinderung |
|
Knochenbrüche |
31 |
46 |
21 |
42 |
22 |
27 |
** / n.s. |
|
Verstauchungen |
61 |
76 |
38 |
56 |
25 |
20 |
** / * |
|
Muskelrisse |
12 |
18 |
10 |
7 |
2 |
4 |
** / * |
|
Verletzungen im Gesicht/blaues Auge |
18 |
29 |
14 |
18 |
5 1) |
14 |
/ * |
|
Brandwunden |
28 |
33 |
17 |
28 |
14 |
8 |
** / n.s. |
|
Schwere Stich- oder Schnittverletzungen |
9 |
19 |
11 |
26 |
16 |
6 |
** / n.s. |
|
Ausgekugelte Gelenke |
6 |
10 |
4 |
15 |
3 |
4 |
** / n.s. |
|
Andere schwere Verletzungen |
6 |
17 |
8 |
13 |
3 |
13 |
** / n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.1)„Keine Angabe“/„Weiß nicht“ – 5%.
In der Haushaltsbefragung und in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache wurden die Frauen gefragt, ob sie regelmäßig ärztlich verschriebene Medikamente einnehmen. In den offenen Antworten machten die Frauen zusätzliche Angaben, wofür bzw. wogegen sie diese Medikamente einnehmen, wobei viele Frauen mehrere Medikamente und deren Kontexte benannten.
Nahezu alle Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (93%) nehmen regelmäßig ärztlich verschriebene Medikamente ein. Die meisten dieser medikamentierten Frauen, die dazu weitere Angaben gemacht haben, nehmen Psychopharmaka und Schlafmedikamente ein (77%), 24% nehmen Herz- und Kreislaufmedikamente, 12% Schilddrüsenmedikamente, 7% Medikamente zur Diabeteseinstellung, 6% Schmerzmittel und 6% Magen- und Darmmedikamente. Andere Medikamente wurden nur vereinzelt genannt.
In der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache gaben 85% an, regelmäßig Medikamente einzunehmen. 24% der Befragten, die dazu konkretere Angaben gemacht haben, nehmen Medikamente gegen Epilepsie und Spastiken, 23% Psychopharmaka, 18% Herz-Kreislauf-Medikamente, 15% Schilddrüsenmedikamente und 5% Medikamente gegen Diabetes. Seltener wurden Medikamente gegen Inkontinenz, zur Entwässerung, Schmerzmittel oder Magen-Darmmedikamente angegeben, weitere Medikamente nur vereinzelt.
Auch in der Haushaltsbefragung nimmt mit einem Anteil von 74% die überwiegende Mehrheit der Frauen regelmäßig ärztlich verschriebene Medikamente ein. Hier stehen die Psychopharmaka und Schlafmedikamente an zweiter Stelle (24% der Frauen, die Medikamente einnehmen und dazu weitere Angaben gemacht haben) hinter den Herz- und Kreislauf-Medikamenten (35%), gefolgt von Schilddrüsenmedikamenten (27%) und Schmerzmedikamenten (21%) sowie Diabetesmedikamenten (10%), Magen- und Darmmedikamenten (7%), Lungen- bzw. Atemmedikamenten (7%), Hormonpräparaten (7%) und bei 2% Medikamente zur Therapie neurologischer Erkrankungen (wie multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Epilepsie). Weitere Medikamente wurden nur in Einzelfällen genannt.
Während knapp die Hälfte der Frauen in Haushalten (46%) Einrichtungen, Dienste oder Angebote zur Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen aktuell nutzt, trifft dies nach eigenen Angaben auf fast alle Frauen in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (96%) und für die meisten Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache (86%) zu. Dies ist bereits durch die Wohnform bedingt, wonach eigentlich alle Frauen, die in Einrichtungen leben, ein entsprechendes Angebot in Anspruch nehmen. Die Frauen in Einrichtungen nutzen darüber hinaus eine höhere Anzahl an Angeboten als die Frauen in Haushalten, was mit dem erhöhten Unterstützungsbedarf, aber auch mit dem Leben in der Einrichtung in Zusammenhang stehen dürfte, da hier häufig zusätzliche Angebote, z.B. zur Freizeitgestaltung, gemacht werden. 19% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen und 23% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen nehmen aktuell nur ein Angebot in Anspruch, 64% (allgemeine Sprache) bzw. 56% (vereinfachte Sprache) nutzen 2–4 Angebote und 14% (allgemeine Sprache) bzw. 7% (vereinfachte Sprache) sogar 5–7 Angebote. Die Frauen der Haushaltsbefragung nutzen dagegen zu 34% nur ein Angebot und nur 12% mehr als ein Angebot (54% der Frauen nutzen keinerlei Angebote).
|
Anzahl der aktuell genutzten Angebote und Dienste |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
|---|---|---|---|
|
0 |
54 |
4 |
14 |
|
1 |
34 |
19 |
23 |
|
2–4 |
12 |
64 |
56 |
|
5–7 |
0 |
14 |
7 |
Basis: Alle befragten Frauen.
Am häufigsten nannten die Frauen in den Haushalten ambulante Gesundheitsdienste, z.B. Ergotherapie, Logopädie, Krankengymnastik etc. (28%). Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und psychiatrische Einrichtungen wurden von jeweils 5–7% der Frauen angegeben. Weitere Angebote (siehe Tabelle 51) wurden nur selten (zu jeweils 1–2%) genannt. Zusätzlich zu den konkret abgefragten Angeboten wurden die Frauen gefragt, ob und welche „anderen“ Angebote sie nutzen. 10% der Befragten gaben hier an, andere Angebote aktuell zu nutzen (weitere 9% haben diese früher genutzt). Dies waren[83] vor allem psychotherapeutische oder psychiatrische Unterstützungsangebote, aber auch z.B. Kuren oder Reha- Maßnahmen, Sportkurse, Tageskliniken oder andere Kliniken, Massagen, alternative Heilmethoden wie Akupunktur, Osteopathie, Homöopathie, und Selbsthilfegruppen (vor allem behinderungs- bzw. erkrankungsspezifische Gruppen, weniger Selbsthilfegruppen für psychische Probleme).
Sowohl die in allgemeiner Sprache als auch die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen nannten vor allem stationäre Angebote (64–85%), an zweiter Stelle standen die Werkstätten, wobei die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in etwa doppelt so häufig in Werkstätten arbeiten (84%) wie die in allgemeiner Sprache befragten Frauen (44%). An dritter Stelle stehen bei beiden Befragungsgruppen Angebote zur Freizeitgestaltung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch hier nutzen die in vereinfachter Sprache befragten Frauen die Angebote weit häufiger (61%) als die in allgemeiner Sprache Befragten (38%). An vierter Stelle stehen Angebote des betreuten Wohnens bei den in allgemeiner Sprache Befragten (34%). Die ambulanten Gesundheitsdienste werden von den in vereinfachter Sprache Befragten etwas häufiger genutzt (38%) als von den in allgemeiner Sprache Befragten (29%), ebenso die Fahrdienste (49% versus 28%), Selbsthilfegruppen (14% versus 11%), Persönliche Assistenz (10% versus 3%) und ambulante Pflegedienste[84] (7% versus 1%). Psychiatrische Einrichtungen werden dagegen von den in allgemeiner Sprache Befragten (18%) häufiger genutzt als von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen (14%), während Beratungsstellen (7%) gleich häufig genutzt werden.
Diejenigen Frauen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache, die Angebote und Dienste für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzten, wurden gefragt, ob es bei einem oder mehreren dieser Angebote eine oder mehrere Personen gibt, mit der sie über persönliche Probleme sprechen können und der sie vertrauen. 61% dieser Frauen der Haushaltsbefragung und 80% der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache gaben an, bei mindestens einem Angebot mindestens eine solche Vertrauensperson zu haben. Hier bezogen sich die Befragten aber nicht nur auf die aktuell genutzten, sondern teilweise auch auf früher genutzte Angebote, wodurch die Prozentangaben zur Nutzung und zum Vorhandensein von Vertrauenspersonen nicht direkt auf einander zu beziehen sind.
Betrachtet man nun die einzelnen Angebote, bei denen die Befragten der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache Vertrauenspersonen angaben, so zeigt sich, dass ein relevanter Anteil der Frauen in stationären Einrichtungen keine Vertrauensperson hat. Dies trifft auch auf Frauen im betreuten Wohnen, in Werkstätten, in psychiatrischen Einrichtungen und in Selbsthilfegruppen zu. Da der Gesundheitssektor aufgrund seiner hohen Relevanz auch für die Unterstützungsanbahnung von gewaltbetroffenen Frauen und in dem Sinne auch für Prävention und Intervention mehr und mehr in den Fokus rückt, stellt sich die Frage, wie auch dieser Bereich in Präventionsstrategien stärker einbezogen werden könnte. Dies scheint auch deshalb wichtig, weil gerade die Frauen in den Haushalten oftmals kein anderes Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen so stark nutzen wie die ambulanten Gesundheitsdienste.
|
Haushalte N=366 (%) |
Einrichtungen/allgemeine Sprache N=98 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|
|
Ja, eine Person |
43 |
32 |
** |
|
Ja, mehrere Personen |
18 |
48 |
|
|
Nein |
30 |
13 |
|
|
Keine Angabe |
10 |
7 |
|
|
Gesamt |
100,0 |
100,0 |
Basis: Frauen, die Angebote, Dienste und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen aktuell nutzen.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
|
|---|---|---|---|
|
Stationäre Angebote (z.B. Wohnheim) |
1 |
64 |
85 1) |
|
Angebot des betreuten Wohnens |
2 |
34 |
-- 4) |
|
Selbsthilfegruppen |
6 |
11 |
14 3) |
|
Beratungsstellen |
5 |
7 |
7 3) |
|
Psychiatrische Einrichtungen |
7 |
18 |
14 3) |
|
Ambulanter Pflegedienst |
1 |
1 |
7 3) |
|
Persönliche Assistenz |
1 |
3 |
10 4) |
|
Angebote zur Freizeitgestaltung |
1 |
38 |
61 |
|
Fahrdienste |
1 |
28 |
49 |
|
Sonder- und Förderschulen |
0 |
0 |
4 3) |
|
Berufsförderungswerke |
1 |
3 |
4 3) |
|
Berufsbildungswerke |
0 |
5 |
2 3) |
|
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen |
1 2) |
44 2) |
84 2) |
|
Ambulante Gesundheitsdienste5) |
28 |
27 |
38 |
|
Andere |
10 |
6 |
-- 4) |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Information aus Frage 1.3, weil in 2.15 nicht vorhanden; 2)Information aus Frage 5.6.; 3)„Keine Angabe“/ „Weiß nicht“ 8–15%.; 4)Aufgrund einer vereinfachten Abfrage nicht direkt vergleichbar. 5)Z.B. Ergotherapie, Logopädie, Krankengymnastik, Reha-Sport etc.
|
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|
|
Stationäre Angebote (z.B. Wohnheim) |
0 |
41 |
-- 1) |
** |
|
Angebot des betreuten Wohnens |
1 |
18 |
-- 1) |
** |
|
Selbsthilfegruppen |
4 |
5 |
-- 1) |
n.s. |
|
Beratungsstellen |
3 |
5 |
-- 1) |
n.s. |
|
Psychiatrische Einrichtungen |
4 |
8 |
-- 1) |
n.s. |
|
Ambulanter Pflegedienst |
1 |
1 |
-- 1) |
n.s. |
|
Persönliche Assistenz |
0 |
2 |
-- 1) |
* |
|
Angebote zur Freizeitgestaltung |
0 |
7 |
-- 1) |
** |
|
Fahrdienste |
0 |
2 |
-- 1) |
* |
|
Sonder- und Förderschulen |
0 |
0 |
-- 1) |
n.s. |
|
Berufsförderungswerke |
0 |
0 |
-- 1) |
- |
|
Berufsbildungswerke |
0 |
2 |
-- 1) |
** |
|
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen |
1 |
16 |
-- 1) |
** |
|
Ambulante Gesundheitsdienste2) |
11 |
10 |
-- 1) |
n.s. |
|
Andere |
6 |
9 |
-- 1) |
n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Aufgrund einer vereinfachten Abfrage nicht direkt vergleichbar. 2)Z.B. Ergotherapie, Logopädie, Krankengymnastik, Reha-Sport etc.
|
Gegenüber der Frauenstudie 2004 zeigt sich eine deutlich höhere Unzufriedenheit mit dem Gesundheitszustand bei den Frauen mit Behinderungen in der vorliegenden Studie: Die Frauen der Haushaltsbefragung sind am unzufriedensten sowohl mit ihrem Gesundheitszustand (42%) als auch mit ihrer gesundheitlichen Versorgung (20%). Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen sind zu 33% unzufrieden mit ihrem Gesundheitszustand und zu 14% mit ihrer gesundheitlichen Versorgung. Die in vereinfachter Sprache Befragten scheinen insgesamt zufriedener: Nur 14% sind unzufrieden mit ihrer Gesundheit und 7% mit ihrer gesundheitlichen Versorgung.Die Frauen der Haushaltsbefragung sind auch diejenigen, die im Vergleich der Befragungsgruppen am häufigsten Verletzungen im Lebensverlauf angegeben haben, mit Ausnahme der schweren Schnitt- und Stichverletzungen, die die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen am häufigsten nannten. Diese Gruppe führt die Verletzungen auch am häufigsten auf einen körperlichen oder sexuellen Angriff zurück.Die überwiegende Mehrheit der Frauen in den drei Befragungsgruppen nimmt ärztlich verschriebene Medikamente ein (74% in den Haushalten, 85% der in vereinfachter Sprache und 93% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen Befragten). Psychopharmaka stehen bei der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache an erster Stelle der genannten Medikamente und in der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache an zweiter Stelle.Während die meisten Frauen der Einrichtungsbefragung mehrere Angebote, Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen, nutzt nur knapp die Hälfte der Frauen der Haushaltsbefragung einzelne dieser Angebote (zumeist ambulante Gesundheitsdienste). Zwar findet die Mehrheit der Frauen (61% in der Haushaltsbefragung und 80% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache) bei mindestens einem Angebot mindestens eine Vertrauensperson, aber innerhalb der einzelnen Angebote und Dienste trifft dies teilweise nur auf die Hälfte der Nutzerinnen zu. |
Ein Ziel der Untersuchung war, die in Deutschland lebenden Frauen mit chronischen Erkrankungen, gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen so weit wie möglich in der Studie zu repräsentieren. Dabei sollten nicht nur die Frauen mit einem Schwerbehindertenausweis, sondern auch das Dunkelfeld der in der Schwerbehindertenstatistik nicht erfassten, gesundheitlich stark und dauerhaft beeinträchtigten und behinderten Frauen in Haushalten und in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe einbezogen werden. Dies ist mithilfe des Screenings im Vorfeld der Interviews in Haushalten und mithilfe der Einrichtungsbefragung gelungen, wie die Auswertung der Interviews zeigte.
In der repräsentativen Haushaltsbefragung konnten im Alltag stark und dauerhaft beeinträchtigte Frauen erreicht werden, die nur zu 37% einen Behindertenausweis hatten. Hier handelt es sich zumeist um Frauen mit multiplen Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen, von denen 42% mit ihrem Gesundheitszustand nicht zufrieden[85] sind und die überwiegende Mehrheit regelmäßig ärztlich verschriebene Medikamente einnimmt (74%). Fast alle Frauen der Haushaltsbefragung sind körperlich beeinträchtigt und weisen zudem verschiedene körperliche Beeinträchtigungen auf. Zugleich haben zwei Drittel der Frauen lang anhaltende oder wiederkehrende psychische Probleme, die zum größten Teil so gravierend sind, dass deshalb eine psychotherapeutische Behandlung oder eine ärztlich verschriebene Medikamenteneinnahme erfolgte. Ein Drittel (34%) hat (teilweise zusätzlich) eine Sinnesbeeinträchtigung.[86] 75% der Frauen sind in mindestens einem Lebensbereich stark oder sehr stark eingeschränkt[87], die meisten davon in mehreren. 17% erhalten eine regelmäßige Unterstützung im Alltag. Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen konnten in den Haushalten nicht erreicht werden, obwohl 17% der Frauen zusätzlich zu anderen Beeinträchtigungen auch Lernschwierigkeiten im weiteren Kontext von Konzentrationsproblemen angegeben hatten. Blinde und gehörlose Frauen wurden auf diesem Wege ebenfalls nicht erreicht und daher in einer Zusatzbefragung für Interviews gewonnen.
In der repräsentativen Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache wurden vor allem Frauen mit psychischen Erkrankungen erfasst (88%).[88]Auch hier konnten bestehende Dunkelfelder aufgedeckt werden, da auch diese Frauen nicht in allen Fällen, nämlich nur zu 73%, einen Behindertenausweis hatten. Obwohl diese Frauen zumeist aufgrund einer psychischen Erkrankung in einer Einrichtung leben, weisen sie zu 82% (auch) körperliche und zu 45% (auch) Sinnesbeeinträchtigungen[89] auf. Ein knappes Drittel dieser Frauen hat im Kontext psychischer Probleme und Medikamentierung (zusätzlich) Lern- bzw. Konzentrationsschwierigkeiten angegeben.
Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen repräsentativ befragten Frauen, die aufgrund einer sogenannten geistigen Behinderung in dieser Wohnform leben, haben fast alle (93%) einen Behindertenausweis. Auch sie haben in den meisten Fällen (84%) zusätzlich körperliche, zu 42% Sinnesbeeinträchtigungen[90] und oft auch zusätzliche psychische Belastungen genannt.
Sowohl mit der repräsentativen Befragung von Frauen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Haushalten als auch mit der Befragung von Frauen in Einrichtungen in allgemeiner Sprache und darüber hinaus mit der Durchführung von Interviews in vereinfachter Sprache mit Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen konnte die vorliegende Studie neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen und bestehende Dunkelfelder erhellen. Im Vergleich zu anderen Studien, wie z.B. der LIVE-Studie (Eiermann/Häußler/Helfferich 2000), konnte die Gruppe der befragten Frauen mit Behinderungen erheblich erweitert werden.
In der LIVE-Studie wurden nur körper- und sinnesbehinderte Frauen im Alter zwischen 15 und 60 Jahren mit einem Schwerbehindertenausweis befragt, die über die für die Anerkennung lokal zuständigen Versorgungsämter über eine nach Bundesländern quotierte Stichprobe gewonnen wurden. Psychisch erkrankte Frauen oder Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen sowie in Einrichtungen lebende Frauen oder Frauen ohne Behindertenausweis waren in der LIVE-Studie nicht vertreten.
Auch in der Schwerbehindertenstatistik[91] des Statistischen Bundesamtes wird nur ein bestimmter Ausschnitt der Gruppe der Frauen mit Behinderungen sichtbar. Da hier zum einen ebenfalls nur Menschen mit Behindertenausweis erfasst sind und zum anderen in der Schwerbehindertenstatistik nur die jeweils schwerste Behinderung aufgelistet ist, die als Grad der Behinderung eindeutig festgelegt ist, sind die in der vorliegenden repräsentativen Studie genannten Beeinträchtigungen nicht direkt vergleichbar mit der Schwerbehindertenstatistik. Die Art der Erfassung führt unter anderem dazu, dass in der Schwerbehindertenstatistik die Mehrheit der Frauen mit nur einer amtlich anerkannten Behinderung verzeichnet ist, während der größte Teil der Frauen der vorliegenden Studie mehrere Beeinträchtigungen angegeben hat. Auch bei den einzelnen Beeinträchtigungen liegen die Anteile aus den genannten methodischen Gründen in der vorliegenden Studie durchweg höher als in der Schwerbehindertenstatistik oder auch in der LIVE-Studie. Dies gilt auch für den Anteil der Frauen mit angeborenen Behinderungen, der mit 4% in der Schwerbehindertenstatistik niedriger liegt als in der vorliegenden Studie (Haushaltsbefragung 16%). Hier ist zu berücksichtigen, dass die in der Schwerbehindertenstatistik erfassten Fälle zusätzlich zu der schwersten Behinderung eine angeborene Beeinträchtigung haben könnten, die hier nicht mit erfasst ist.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden psychische, körperliche und sexuelle Gewalterfahrungen in der Kindheit und im Erwachsenenleben sowie sexuelle Belästigung mit den identischen Fragen abgefragt wie im mündlichen Befragungsteil der repräsentativen Frauenstudie 2004. Dies ermöglicht nicht nur einen Vergleich zwischen den Befragungsgruppen der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, sondern auch einen Vergleich mit der weiblichen Gesamtbevölkerung.
Anhand von Itemlisten mit spezifischen Gewalthandlungen wurden zum einen Gesamtprävalenzen für die Ausmaße von Gewalt in Kindheit/Jugend und Erwachsenenleben erhoben, zum anderen wurde Gewalt in den letzten 12 Monaten erfasst und darüber hinaus, anders als in der Frauenstudie 2004, auch Gewalt, die seit Eintreten der Behinderung erlebt wurde. Alle darauf folgenden Fragen zu den Reaktionen und Folgen der Gewalt beziehen sich in der vorliegenden Studie auf Gewalthandlungen, die seit Bestehen der Behinderung erlebt wurden. Damit sollte gewährleistet werden, dass tatsächlich die Gewalterfahrungen von Frauen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen aufgegriffen und vergleichend untersucht werden.
Bereits in Kap. 3.1.7 ist dokumentiert worden, dass viele Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen eine belastete Kindheit hatten und Eltern/Erziehungspersonen vielfach grob und lieblos mit ihnen umgegangen sind. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn die Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend betrachtet werden. Frauen der vorliegenden Studie haben, wie die Ergebnisse aufzeigen, in hohem Maße bereits Gewalt in Kindheit und Jugend erlebt.
Die im Rahmen der Studie erhobenen Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend beziehen sich auf folgende Bereiche:
-
Gewalt zwischen den Eltern,
-
körperliche und psychische Gewalt durch die Eltern oder andere Erziehungspersonen,
-
körperliche Gewalt durch andere Kinder und Jugendliche,
-
körperliche und psychische Gewalt in Einrichtungen,
-
sexuelle Übergriffe/Gewalt durch Erwachsene und durch Kinder/Jugendliche.
Gewalt zwischen den Eltern, die zumeist vom Vater gegen die Mutter verübt wird (vgl. Schröttle/Müller 2004) und die den Kindern in der Regel nicht verborgen bleibt (ebd.), gilt als eine Form von Gewalt gegen Kinder, die lange Zeit nicht als solche erkannt und benannt wurde (vgl. Kavemann/Kreyssig 2007; Deegener 2006). Körperliche Auseinandersetzungen zwischen den Eltern wurden von 20–26% der Befragten der vorliegenden Studie berichtet, am häufigsten von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen.[92] Es handelt sich um etwas höhere Werte als bei den Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (18%), die aber keine signifikanten Unterschiede anzeigen.[93] Die hohen Anteile, insbesondere der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die hier keine Angaben gemacht haben (14–15%), könnten zum einen auf Dunkelfelder verweisen, die eventuell noch höhere Betroffenheiten nahelegen. Zum anderen sind sie darauf zurückzuführen, dass viele der in vereinfachter Sprache befragten Frauen nur bei einem leiblichen Elternteil aufgewachsen und teilweise auch in Einrichtungen untergebracht waren (s.o.) und dadurch seltener gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Eltern miterleben konnten. Darüber hinaus war bei einem Teil dieser Frauen das Erinnerungsvermögen eingeschränkt.
|
Frauenstudie 2004 N=7.472 1) (%) |
Haushalte N=766 (N=267) (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=87 (N=39) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=269 (N=250) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ja |
18 |
20 (24) |
26 (28) 1) |
23 2) (22) 2) |
n.s. |
|
nein |
(79) |
79 (74) |
71 (68) 1) |
63 2) (60) 2) |
Basis: Alle Befragten, die bei einem oder beiden Elternteilen aufgewachsen waren (Angaben in Klammern: nur Befragte, die Behinderung bereits in Kindheit und Jugend hatten). 1)5% keine Angabe.; 2)14%–18% keine Angabe.
Von stärker gewaltbelasteten Elternhäusern bei Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ist vor allem im Hinblick auf psychische Gewalt durch Eltern und andere Erziehungspersonen auszugehen. Sowohl Frauen in Haushalten als auch jene, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, haben häufiger elterliche körperliche und/oder psychische Gewalt angegeben als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. Während die Unterschiede in der Gesamtbetroffenheit durch mindestens eine Form von elterlichen körperlichen Übergriffen nicht sehr ausgeprägt sind, zeigt sich vor allem in Bezug auf elterliche psychische Gewalt eine deutlich stärkere Betroffenheit der beiden in allgemeiner Sprache befragten Gruppen der vorliegenden Studie. So gaben etwa 50–60% der in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen mindestens eine Handlung psychischer Gewalt durch Eltern an; bei den Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt waren es mit 36% nur gut ein Drittel. Die elterliche psychische Gewalt kann durchaus ein Faktor sein, der spätere Behinderung und gesundheitliche Beeinträchtigung befördert, zumal viele dieser Frauen in Kindheit und Jugend noch keine Behinderung/Beeinträchtigung hatten. Waren diese Frauen bereits in Kindheit und Jugend beeinträchtigt, gaben vor allem die Frauen der Haushaltsbefragung häufiger an, elterliche psychische Gewalt erlebt zu haben (62%), als die Frauen, die in Kindheit und Jugend noch keine Behinderung hatten.
|
Frauenstudie 2004 N=7.472 1) (%) |
Haushalte N=766 (N=267) (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=87 (N=39) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=269 (N=250) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Körperliche und/oder psychische Übergriffe durch Eltern |
83 |
88 (90) |
93 (92) |
58 (56) |
** |
|
Körperliche Übergriffe durch Eltern |
81 |
85 (86) |
90 (90) |
55 (54) |
** |
|
Psychische Übergriffe durch Eltern |
36 |
53 (62) |
61 (64) |
34 (32) |
** |
Basis: Alle Befragten, die bei einem oder beiden Elternteilen aufgewachsen waren (Angaben in Klammern: nur Befragte, die Behinderung bereits in Kindheit und Jugend hatten). Mehrfachnennungen. 1)Die Frage wurde nur Befragten gestellt, die bei Eltern/Stiefeltern aufgewachsen waren.
Abbildung 14. Diagramm 14: Körperliche und/oder psychische Gewalt durch Eltern – Gesamtbetroffenheit
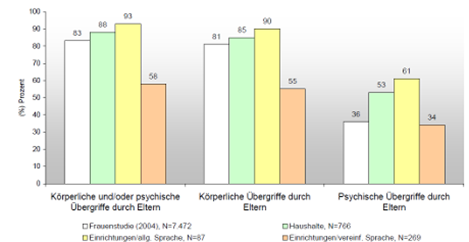
Basis: Alle Befragten, die bei einem oder beiden Elternteilen aufgewachsen waren. Mehrfachnennungen.
Warum die Anteile der in vereinfachter Sprache befragten Frauen im Hinblick auf elterliche körperliche und psychische Gewalt so vergleichsweise niedrig sind, kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen ist das Erinnerungsvermögen einiger dieser Frauen in Bezug auf Erlebnisse in Kindheit und Jugend stärker eingeschränkt als bei den anderen Befragungsgruppen. Zum anderen kann die Tatsache, dass diesen Frauen für die Beantwortung der Fragen aufgrund der notwendigen Vereinfachung des Fragebogens „Ja“- „Nein“-Kategorien statt Häufigkeitsangaben („häufig“, „gelegentlich“, „selten“ oder „nie“) vorgelegt wurden, zu einer geringeren Aufdeckung von Gewalt in Kindheit und Jugend beitragen.[94] Darüber hinaus ist es aber auch möglich, dass deren Eltern tatsächlich etwas weniger häufig Gewalt ausgeübt haben, denn sie wurden auch in den offenen Aussagen der Frauen vergleichsweise häufiger als positiv und liebevoll beschrieben.
Wenn die einzelnen Nennungen zu Handlungen körperlicher und psychischer Gewalt durch Eltern vergleichend untersucht werden, ergibt sich folgendes Bild:
|
Frauenstudie 2004 N=7.472 (%) |
Haushalte N=766 (N=267) (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=87 (N=39) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=269 (N=250) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Einstiegsfrage: Durch Eltern geschlagen/körperlich bestraft |
64 |
71 (75) |
78 (82) |
-- 1) |
** |
|
Häufig/gelegentlich geschlagen/körperlich bestraft |
19 |
32 (38) |
32 (31) |
-- |
** |
|
Itemliste: Wurde ... |
|||||
|
A) lächerlich gemacht und gedemütigt (über mich lustig gemacht/heruntergeputzt) |
18 |
30 (36) |
41 (46) |
16 (15) |
** |
|
B) so behandelt, dass es seelisch verletzend war (etwas Schlimmes gesagt, das wehgetan hat/schlecht behandelt) |
23 |
39 (46) |
43 (41) |
20 (19) |
** |
|
C) niedergebrüllt (ganz schlimm angeschrien) |
26 |
34 (43) |
40 (46) |
29 (18) |
** |
|
D) leicht geohrfeigt |
58 |
52 (54) |
47 (51) |
28 (27) |
** |
|
E) bekam eine schallende Ohrfeige mit sichtbaren Striemen (schlimme Ohrfeige) |
12 |
18 (18) |
21 (23) |
23 (20) |
** |
|
F) einen strafenden Klaps auf den Po (leicht auf den Po gehauen) |
61 |
53 (54) |
58 (62) |
34 (32) |
** |
|
G) mit der Hand kräftig den Po versohlt |
28 |
32 (37) |
35 (33) |
22 (21) |
n.s. |
|
H) mit einem Gegenstand auf den Finger geschlagen |
8 |
14 (16) |
13 (13) |
14 (13) |
** |
|
I) mit einem Gegenstand kräftig geschlagen |
14 |
21 (23) |
24 (21) |
-- |
** |
|
J) bekam heftige Prügel (heftig verprügelt) |
10 |
16 (18) |
26 (26) |
15 |
** |
|
K) wurde auf andere Weise körperlich bestraft |
3 |
10 (10) |
14 (13) |
9 (15) |
** |
|
x) eingesperrt |
-- |
-- |
-- |
17 (16) |
** |
|
L) wurde auf andere Weise seelisch verletzend behandelt |
-- |
23 (27) |
25 (33) |
-- 2) |
n.s. |
Basis: Alle Befragten, die bei einem oder beiden Elternteilen aufgewachsen sind (Angaben in Klammern: nur Befragte, die Behinderung bereits in Kindheit und Jugend hatten). Mehrfachnennungen. 1)Frageformulierung und Aufbau nicht direkt vergleichbar. 34% gaben an, als Kind oder Jugendliche geschlagen worden zu sein, 23% vom Vater und 13% von der Mutter (Mehrfachnennungen). 7% wussten das nicht oder machten dazu keine Angaben. 2)Antwortvorgabe: „Etwas anderes getan, das wehtat, nicht direkt vergleichbar.“
Bereits in der Einstiegsfrage gaben sowohl die in den Haushalten als auch die in den Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen gegenüber der Frauenstudie 2004 häufiger an, von den Eltern geschlagen oder körperlich bestraft worden zu sein (71–78% vs. 64% im Bevölkerungsdurchschnitt, wobei der Anteil der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen hier deutlich am höchsten lag). Ein weiterer wichtiger Unterschied zeigt sich in der Hinsicht, dass die beiden in allgemeiner Sprache befragten Gruppen von Frauen in Einrichtungen und Haushalten zu etwa einem Drittel (32%) angaben, sie seien häufig oder gelegentlich von den Eltern geschlagen oder körperlich bestraft worden, während das nur bei rund einem Fünftel (19%) der Frauen der Frauenstudie 2004 der Fall war.[95]
Mit Blick auf die einzelnen genannten Handlungen zeigen sich die größten Unterschiede darin, dass die in allgemeiner Sprache befragten Frauen der vorliegenden Studie deutlich häufiger als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt zum einen psychische Gewalt durch Eltern angaben, zum anderen sehr schwere körperliche Übergriffe wie das Geschlagenwerden mit Gegenständen und heftige Prügel häufiger benannten.
Abbildung 15. Diagramm 15: Körperliche/psychische Gewalt durch Eltern
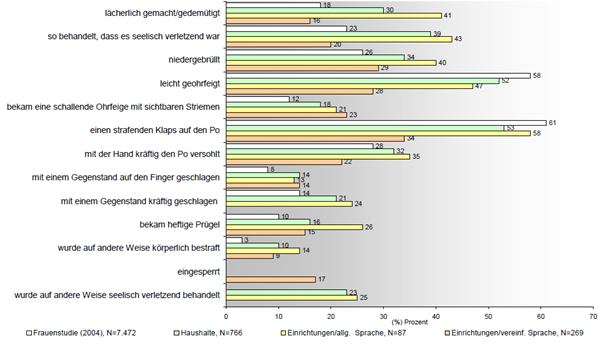
Basis: Alle Befragten, die bei einem oder beiden Elternteilen aufgewachsen sind. Mehrfachnennungen.
Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen haben bei fast allen Gewalthandlungen durch Eltern seltener eine Betroffenheit angegeben als die anderen Befragungsgruppen dieser Studie, außer bei stärkeren Ohrfeigen und dem Auf-die-Finger- Geschlagenwerden mit einem Gegenstand. In der Einstiegsfrage gaben 34% an, in Kindheit und Jugend geschlagen worden zu sein, 23% vom Vater und 13% von der Mutter; 7% machten dazu keine Angabe. 16–29% nannten Handlungen elterlicher psychischer Gewalt und 9%–34% Handlungen elterlicher körperlicher Gewalt. 17% gaben darüber hinaus an, eingesperrt worden zu sein. Viele schwerere Gewalthandlungen hatten auch die Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen häufiger als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt erlebt. Bei den leichteren Handlungen gaben sie zumeist geringere Betroffenheiten an; möglicherweise wurden diese auch weniger von ihnen nachträglich erinnert. Die in den Daten sich abzeichnende geringere Betroffenheit durch elterliche körperliche Gewalt bei den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen muss nicht unbedingt eine faktisch geringere Gewaltbetroffenheit widerspiegeln; sie kann, wie weiter oben bereits angesprochen, auch mit den größeren Schwierigkeiten, sich zu erinnern und mit der vereinfachten Abfrage in „Ja“-„Nein“-Kategorien in Zusammenhang stehen (s.o.). Ein Indiz für mögliche Gedächtnislücken oder eine schwierigere Aufdeckung von Dunkelfeldern von Gewalt in dieser Gruppe könnte sein, dass die in vereinfachter Sprache befragten Frauen bei den Fragen zu elterlicher körperlicher Gewalt häufiger keine Angaben gemacht haben als die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen.
Die in Klammern angegebenen Werte der vorangegangenen Tabelle weisen die Gewaltbetroffenheiten bei den Frauen aus, die bereits in Kindheit und Jugend eine Behinderung oder Beeinträchtigung hatten. Sie deuten nicht auf eine deutlich erhöhte Betroffenheit durch elterliche körperliche oder psychische Gewalt bei dieser Gruppe hin. Allenfalls in Bezug auf einige Ausprägungen psychischer Gewalt und seelisch verletzender Handlungen durch die Eltern lassen sich tendenziell erhöhte Gewaltbetroffenheiten bei bereits in Kindheit und Jugend behinderten/beeinträchtigten Frauen feststellen.
Weitere Hinweise auf psychisch belastende oder verletzende Verhaltensweisen durch Eltern bei Frauen, die bereits in Kindheit und Jugend behindert waren, wurden bereits im Kapitel 3.1.7 im Abschnitt „Kindheit und Aufwachsen“ dokumentiert. Etwa jede dritte bis fünfte in Kindheit und Jugend behinderte Frau hat dabei Aussagen zugestimmt wie: „Die Eltern sind grob und lieblos mit mir umgegangen“ oder sie hätten „die Beeinträchtigung ignoriert/geleugnet“. Mehr als jede Siebte gab an, die Eltern hätten versucht, die „Beeinträchtigung nach außen hin zu verstecken oder zu verdecken“ und etwa jede zehnte in allgemeiner Sprache befragte Frau (Haushalte und Einrichtungen) wurde zu „Therapien oder Behandlungen gedrängt oder gezwungen“, die sie nicht wollte (die in vereinfachter Sprache Befragten gaben dies zu 6% an). Diese Formen von elterlicher psychischer Gewalt, die vielfach einen konkreten Bezug zur Behinderung und zum elterlichen Umgang mit der Behinderung aufweisen, dürfen in der vorliegenden Studie nicht unberücksichtigt bleiben, auch wenn sie nur einen Teil der Frauen betreffen, weil viele erst im Erwachsenenleben behindert wurden.
Die quantitativen Studienergebnisse deuten darauf hin, dass mindestens ein Drittel der in allgemeiner Sprache befragten Frauen der vorliegenden Studie als Kind von körperlicher Misshandlung durch Eltern betroffen war und jede Zweite bis Dritte (oft zusätzlich) massivere Ausprägungen elterlicher psychischer Gewalt erlebt hat.[96]
In den zusätzlichen offenen Beschreibungen der Befragten zum Gewaltverhalten der Eltern wird das erhebliche Ausmaß von schwerer Misshandlung, Vernachlässigung und psychischer Gewalt in den Befragungsgruppen noch deutlicher. So beschrieben viele Befragte, dass sie in Elternhäusern mit massiver körperlicher und/oder psychischer Gewalt aufgewachsen waren, die durch Angst, Drohungen und Herabwürdigung gekennzeichnet waren. Oftmals wurden extrem gewalttätige Väter (teilweise auch Mütter) beschrieben, die alkoholkrank waren und die die Kinder regelmäßig und schwer physisch misshandelt hatten, etwa durch Schlagen auf den Kopf und ins Gesicht sowie mit Gegenständen (Kabeln, Stöcken, Gürteln, Kochlöffeln), regelmäßigem Verprügeln bis hin zu Tötungsversuchen und -androhungen. Teilweise waren die körperlichen Misshandlungen durch Väter auch verbunden mit frühem und/oder regelmäßigem sexuellem Missbrauch. Viele Frauen beschrieben darüber hinaus, dass sie von den Eltern eingesperrt wurden (bevorzugt im Keller, teilweise über längere Zeit); auch langes In-der-Ecke-stehen-Müssen wurde als eine Form der Bestrafung durch Eltern beschrieben. Häufiger wurde auch Kindesvernachlässigung durch die Eltern berichtet, etwa wenn die Befragten als Kind oder Säugling regelmäßig/lange alleingelassen wurden, ihnen Alkohol gegeben wurde oder sie sehr früh in schwere Arbeiten eingebunden wurden (z.B. schwere körperliche Arbeiten, die teilweise zur Behinderung beitrugen, „Strafbügeln“ und erniedrigende Haushaltsarbeiten oder die Mitarbeit in der Gastronomie der Eltern bereits im Schulkindalter). Die psychische Gewalt, die die Befragten in allen Gruppen beschrieben, äußerte sich in unterschiedlichen Facetten und war oftmals sehr massiv. So berichteten die Frauen häufig davon, von den Eltern heruntergemacht, beschimpft und beleidigt worden zu sein („Missgeburt“, „Warum bist du überhaupt auf der Welt? Es wäre besser, du wärst tot“, „Du bist dumm und asozial“). Weitere häufig genannte Ausprägungen waren (tagelanges) Ignorieren, Nichtbeachten und Schweigen gegenüber dem Kind, Essensentzug, Liebesentzug sowie systematischer Psychoterror („nicht auf die Toilette gehen dürfen“) und willkürliche, überzogene Strafen. Einige Befragte berichteten zudem, die Eltern hätten sie abgeschoben zu den Großeltern, Verwandten oder ins Heim, wollten mit ihnen nichts mehr zu tun haben und leugneten die Elternschaft.
|
Die Analyse elterlicher Gewalt zeigt eine hohe Betroffenheit aller Befragungsgruppen durch elterliche psychische und physische Gewalt, die oftmals auch schwere Ausprägungen von Misshandlung und Vernachlässigung aufweist. Diese war sowohl bei Frauen feststellbar, die bereits in Kindheit und Jugend eine Behinderung oder Beeinträchtigung hatten, als auch bei Frauen, bei denen diese erst im Erwachsenenleben auftrat. Es ist davon auszugehen, dass die erhöhten Gewaltbelastungen in Kindheit und Jugend in einem ursächlichen Zusammenhang mit gesundheitlichen und psychischen Belastungen sowie Behinderungen im späteren Leben stehen können. |
Zur Betroffenheit durch körperliche Gewalt durch andere Kinder und Jugendliche liegen aus der Frauenstudie 2004 keine und auch aus dieser Studie nur teilweise vergleichbare Daten vor. Etwa die Hälfte der in Haushalten (57%) und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen (49%) gaben an, in Kindheit und Jugend durch andere Kinder/Jugendliche geschlagen worden zu sein; bei jeder vierten bis fünften Frau (19% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache Befragten und 25% der in Haushalten Befragten) war das häufig oder gelegentlich der Fall. Nur wenige in vereinfachter Sprache befragten Frauen erinnerten sich in der offenen Nachfrage daran, in Kindheit und Jugend von Geschwistern (7 Frauen, 2%) oder von anderen Kindern/Jugendlichen (8 Frauen, 3%) geschlagen worden zu sein; die Werte sind hier aufgrund des vereinfachten Abfragemusters mit offenen Nennungen nicht mit den Ergebnissen der anderen Befragungsgruppen vergleichbar.
Vor allem die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen haben häufiger körperliche Übergriffe durch andere Kinder/Jugendliche erlebt, wenn die Behinderung/ Beeinträchtigung in Kindheit und Jugend bereits bestand (59%), gegenüber den Frauen, bei denen die Beeinträchtigung erst im späteren Leben eintrat (49%; Haushalte 60% bzw. 57%). Allerdings waren hier die Unterschiede zwischen den Befragungsgruppen nicht signifikant.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (N=279 ) (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (N=46) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (N=282) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ja |
-- |
57 (60) |
49 (59) |
-- 1) |
* (n.s.) |
|
Nein |
-- |
41 (40) |
45 (35) |
-- |
|
|
Keine Angabe |
-- |
1 (0) |
6 (7) |
-- |
Basis: Alle Befragten (Angaben in Klammern: nur Frauen, die in Kindheit oder Jugend behindert/beeinträchtigt waren). 1)Frage anders formuliert und nicht direkt vergleichbar.
Die Angaben zu körperlichen und psychischen Übergriffen in Einrichtungen und Heimen in Kindheit und Jugend der Befragten sind statistisch nicht vergleichend auswertbar, da die Fallzahl insbesondere bei den in Einrichtungen und in Haushalten[97] in allgemeiner Sprache befragten Frauen zu klein ist. Nur sechs der neun in Haushalten befragten Frauen, die in Kindheit und Jugend ganz oder teilweise in Heimen aufgewachsen waren, machten Angaben zu psychischen und körperlichen Übergriffen, die sie dort erlebt hatten; bei den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen waren es fünf von acht Frauen.
Deshalb werden im Folgenden nur die Erfahrungen der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen dokumentiert, die sich auf 46 (von 48 in Einrichtungen ganz/teilweise aufgewachsenen) Frauen beziehen.
|
Jemand im Heim/Internat hat sich … |
N=46 (%) |
Keine Angabe (%) |
|---|---|---|
|
1 über mich lustig gemacht oder mich heruntergeputzt |
30 |
11 |
|
2 mir etwas Schlimmes gesagt, das wehgetan hat/mich schlecht behandelt |
30 |
11 |
|
3 schmerzhafte oder schlimme Behandlungen gemacht |
17 |
13 |
|
4 mit mir alles gemacht, ohne zu fragen, was ich will |
24 |
13 |
|
5 mich eingesperrt |
20 |
13 |
|
6 mich ganz schlimm angeschrien |
20 |
13 |
|
7 mich leicht geohrfeigt |
20 |
13 |
|
8 mir eine schlimme Ohrfeige gegeben, dass es im Gesicht zu sehen war |
17 |
13 |
|
9 mich leicht auf den Po gehauen |
13 |
13 |
|
10 mit der Hand kräftig auf den Po gehauen; es tat weh |
11 |
|
|
11 mit einem Gegenstand auf die Finger geschlagen |
15 |
13 |
|
12 mit einem Gegenstand kräftig geschlagen |
15 |
13 |
|
13 heftig verprügelt |
7 |
13 |
|
14 anders körperlich bestraft |
9 |
17 |
|
Mindestens eine seelisch verletzende Handlung (Item 1–6) |
48 |
15 |
|
Mindestens ein körperlicher Übergriff (7–14) |
35 |
10 |
Basis: Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die überwiegend/teilweise in Einrichtungen/Heimen aufgewachsen waren. Mehrfachnennungen.
Zusammengenommen fast die Hälfte (48%) der in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die in Heimen/Internaten ganz oder teilweise aufgewachsen waren, gaben an, dort psychische Übergriffe erlebt zu haben: jeweils 20–30% nannten verbal verletzende Handlungen (Item 1–2 und 6), 17% schmerzhafte oder schlimme Behandlungen, jede Vierte (24%), es sei mit ihr alles gemacht worden, ohne sie zu fragen, was sie will, und jede Fünfte (20%), sie sei eingesperrt worden. Mehr als ein Drittel der Frauen (35%) benannten darüber hinaus körperliche Übergriffe in Einrichtungen, in denen sie in Kindheit/Jugend untergebracht waren. Sie reichten von Ohrfeigen (17–20%) über Schläge mit Gegenständen oder auf den Po (je 11–15%) bis hin zu heftigem Verprügeln (7%) und anderen körperlichen Strafen (9%).
Die hohen Anteile von Frauen, die hierzu keine Angaben gemacht haben (ca. 11–17%), legen die Vermutung darunter liegender Dunkelfelder nahe. Aus den Angaben ist nicht ersichtlich, durch wen die körperlichen und psychischen Übergriffe in den Einrichtungen in Kindheit und Jugend verübt worden waren.
|
Bei der Befragungsgruppe der in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die in Kindheit und Jugend häufiger ganz oder teilweise in Heimen aufgewachsen waren, wird ein hohes Maß an dort erlebter psychischer und körperlicher Gewalt sichtbar: Etwa die Hälfte hat seelisch verletzende Handlungen erlebt und gut ein Drittel war von körperlichen Übergriffen betroffen. |
Die Befragungsergebnisse der vorliegenden Studie decken eine enorm hohe Betroffenheit aller Befragungsgruppen durch sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend auf: Jede dritte bis vierte Befragte mit Behinderungen und Beeinträchtigungen hat sexuellen Missbrauch durch Erwachsene und/oder Kinder und Jugendliche angegeben. Die Betroffenheit durch sexuellen Missbrauch durch erwachsene Personen in Kindheit und Jugend der Befragten ist mit 20–31% zwei- bis dreimal höher als im weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt (10%).[98]
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation durch Kinder, Jugendliche oder Erwachsene erlebt (Itemlisten/Gesamt) |
-- 1) |
30 |
36 2) |
25 2) |
** |
|
Mindestens eine Situation durch Erwachsene erlebt (Itemlisten/Gesamt) |
10 |
24 |
31 2) |
20 2) |
** |
|
Mindestens eine Situation durch Kinder/Jugendliche erlebt (Itemlisten/Gesamt) |
-- 1) |
11 |
10 2) |
9 2) |
n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Frage nicht vorhanden.; 2)10–16% keine Angabe.
Abbildung 16. Diagramm 16: Sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend (durch Erwachsene)
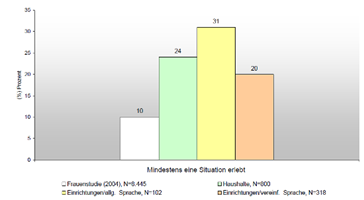
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Situation erlebt durch Erwachsene … |
|||||
|
1 sexuell berührt/an intimen Körperstellen angefasst |
9 |
21 |
27 2) |
15 2) |
** |
|
2 gedrängt oder gezwungen, die Person an intimen Körperstellen zu berühren |
3 |
8 |
18 2) |
8 2) |
** |
|
3 gedrängt oder gezwungen, sich selbst an intimen Körperstellen zu berühren |
1 |
2 |
5 2) |
4 2) |
** |
|
4 zu sexuellen Handlungen gezwungen |
2 |
6 |
15 2) |
10 2) |
** |
|
5 zu anderen sexuellen Handlungen gedrängt |
2 |
6 |
17 2) |
8 2) |
** |
|
Situation erlebt durch Kinder/Jugendliche |
9 3) |
||||
|
1 sexuell berührt/an intimen Körperstellen angefasst |
-- 1) |
9 |
7 2) |
n.s. |
|
|
2 gedrängt oder gezwungen, die Person an intimen Körperstellen zu berühren |
-- 1) |
2 |
3 2) |
n.s. |
|
|
3 gedrängt oder gezwungen, sich selbst an intimen Körperstellen zu berühren |
-- 1) |
0 |
4 2) |
** |
|
|
4 zu sexuellen Handlungen gezwungen |
-- 1) |
2 |
1 2) |
n.s. |
|
|
5 zu anderen sexuellen Handlungen gedrängt |
-- 1) |
2 |
4 2) |
n.s. |
|
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Sexueller Missbrauch durch Jugendlich/Kinder hier nicht erfasst. 2)10–16% keine Angabe.; 3)Nur zusammenfassende Frage.
Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, haben am häufigsten sexuellen Missbrauch angegeben, insbesondere auch häufiger sexuelle Übergriffe durch Erwachsene. Frauen, die in Haushalten befragt wurden, nannten etwas häufiger sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend als die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen. Letztere haben allerdings auch deutlich häufiger keine Angaben zu sexuellem Missbrauch gemacht oder konnten sich nicht erinnern (14% der in vereinfachter Sprache Befragten vs. 2% der in Haushalten und 11% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache Befragten), was auf mögliche Dunkelfelder und damit höhere Gewaltbetroffenheiten bei beiden in Einrichtungen befragten Gruppen verweisen kann.
Sexueller Missbrauch durch Kinder und Jugendliche wurde mit ca. 10% von allen Befragungsgruppen etwa gleich häufig genannt; Vergleichswerte mit dem Bevölkerungsdurchschnitt stehen aus der Frauenstudie 2004 nicht zur Verfügung.
Das Ergebnis, dass mindestens jede dritte bis vierte Frau mit Behinderung und Beeinträchtigung, die in Einrichtungen oder Haushalten lebt, in Kindheit und Jugend sexuell missbraucht wurde, verweist auf enorm hohe Belastungen, die auch mit zu gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen der Frauen im Lebensverlauf beigetragen haben können. Die mit sexuellem Missbrauch einhergehenden Grenzverletzungen und gesundheitlichen wie psychischen Schädigungen können zudem das Risiko für fortgesetzte Gewalt im Lebenslauf erhöhen.[99]
Die Täterinnen und Täter bei sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend waren am häufigsten männliche Personen aus dem familiären Umfeld (44–46% bei allen Untersuchungsgruppen).[100] Nur 1–6% aller Befragten nannten (auch) weibliche Täterinnen.[101] Bei den Familienangehörigen handelt es sich vor allem um Väter und andere männliche Verwandte, teilweise auch um Brüder. Vor allem von den in Einrichtungen lebenden Frauen wurden darüber hinaus häufiger unbekannte Täterinnen bzw. Täter genannt (24–31% vs. 12% bei den in Haushalten befragten Frauen); flüchtig bekannte Täterinnen bzw. Täter gaben je nach Untersuchungsgruppe 10–22% der Befragten an, Personen aus dem Bekanntenkreis wurden von 5–26% genannt. Sexuell missbrauchende Personen in Schule und Ausbildung wurden von 9–15% der Frauen, die Aussagen zu Täterinnen bzw. Tätern bei sexuellem Missbrauch gemacht haben, angegeben. Partnerinnen bzw. Partner (6–7%) und Personen aus anderen Institutionen und Einrichtungen (1–7%) spielten demgegenüber eine relativ geringe Rolle. Allerdings waren von sexuellem Missbrauch in Einrichtungen Frauen, die in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragt wurden, am häufigsten betroffen, was sich auch daraus erklärt, dass diese häufiger in Kindheit und Jugend in stationären Einrichtungen untergebracht waren.
Im Vergleich der Untersuchungsgruppen fällt auf, dass die in Haushalten lebenden Frauen vergleichsweise seltener sexuellen Missbrauch durch unbekannte Personen angegeben haben. Von beiden Gruppen der in Einrichtungen lebenden Frauen wurden darüber hinaus häufiger Eltern (überwiegend der Vater) als Täterinnen und Täter angegeben (25–27% vs. 12% bei den in Haushalten lebenden Frauen). Frauen in Haushalten wie auch Frauen, die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragt wurden, gaben vergleichsweise häufig auch andere Verwandte außerhalb der eigenen Kernfamilie sowie Personen aus dem Bekanntenkreis als Täterinnen und Täter bei sexuellem Missbrauch an (19–26% vs. 5–10%)
|
Haushalte N=233 |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=36 |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache 1) N=59 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Täterinnen bzw. Täter bei sexuellem Missbrauch |
Fälle |
% |
Fälle |
% |
Fälle |
% |
|
Jemand Unbekanntes |
29 |
12% |
11 |
31% |
14 |
24% |
|
Jemand flüchtig Bekanntes |
38 |
16% |
8 |
22% |
6 |
10% |
|
Jemand aus Schule, Ausbildung, Arbeit 2) (gesamt) |
34 |
15% |
4 |
11% |
5 |
9% |
|
Arbeitskollegin/-kollege |
1 |
0% |
1 |
3% |
0 |
0% |
|
Vorgesetzte/Chefin bzw. Chef |
1 |
0% |
1 |
3% |
0 |
0% |
|
Lehrerin/Lehrer, Ausbilderin/Ausbilder, Erzieherin/Erzieher |
11 |
5% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Mitschülerin/Mitschüler |
19 |
8% |
2 |
6% |
5 |
9% |
|
Partnerin bzw. Partner (gesamt) 2) |
15 |
6% |
2 |
6% |
4 |
7% |
|
Aktuelle Partnerin/Aktueller Partner |
1 |
0% |
1 |
3% |
0 |
0% |
|
Frühere Partnerin/Früherer Partner |
13 |
6% |
1 |
3% |
4 |
7% |
|
Jemand aus der Familie 2) (gesamt) |
103 |
44% |
16 |
44% |
27 |
46% |
|
Mutter/Vater |
34 |
15% |
9 |
25% |
16 |
27% |
|
Schwester/Bruder |
23 |
10% |
2 |
6% |
6 |
10% |
|
Andere Verwandte |
53 |
23% |
7 |
19% |
6 |
10% |
|
Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/Nachbarschaft |
60 |
26% |
8 |
22% |
3 |
5% |
|
Personen in Einrichtungen/Institutionen (gesamt) 2) 3) |
3 |
1% |
0 |
0% |
4 |
7% |
|
Ärztin/Arzt in ambulanter Praxis |
1 |
0% |
0 |
0% |
1 |
2% |
|
Ärztin/Arzt im Krankenhaus |
1 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Sonstiges Personal im Krankenhaus |
1 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Stationäre Angebote (Wohnheime etc.) |
0 |
0% |
0 |
0% |
2 |
3% |
|
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten |
0 |
0% |
0 |
0% |
1 |
2% |
|
Andere Personen |
8 |
3% |
0 |
0% |
4 |
7% |
Basis: Frauen, die Angaben zu Täterinnen bzw. Tätern gemacht haben. Mehrfachnennungen. 1)Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden und von sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend betroffen waren, haben besonders häufig (zu 25%) keine Angaben zu Täterinnen bzw. Tätern gemacht.; 2)Kategorien wurden teilweise allgemein genannt, wenn die Befragte die Täterin bzw. den Täter nicht weiter spezifizieren wollte.; 3)Zu dieser Kategorie werden in den folgenden Zeilen nur jene Vorgaben aufgeführt, zu denen Täterinnen bzw. Tätern genannt wurden.
|
In der Studie wird ein sehr gravierendes Ausmaß an sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend der Befragten sichtbar. Sie waren zwei- bis dreimal häufiger von sexuellem Missbrauch durch Erwachsene betroffen als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Wird sexueller Missbrauch durch Kinder und Jugendliche mit einbezogen, dann hatte jede dritte bis vierte Frau der vorliegenden Studie sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend angegeben. Dahinter können sich noch erhebliche Dunkelfelder verbergen. Zentrale Tätergruppen sind Väter, andere männliche Verwandte und Bekannte sowie unbekannte und flüchtig bekannte männliche Personen, aber auch Personen aus Schule und Ausbildung. |
Gewalt im Erwachsenenleben, wie sie in dieser Studie erhoben wurde, umfasst psychische und körperliche Gewalt, sexuelle Belästigung, ungewollte sexuelle Handlungen und erzwungene sexuelle Handlungen, welche als sexuelle Gewalt im engeren Sinne definiert werden. Darüber hinaus können auch Diskriminierungen als eine Form von Gewalt angesehen werden, die allerdings in einem eigenen Kapitel (vgl. Kap. 3.5) thematisiert werden, da sie nicht nur personale Gewalt, sondern auch strukturelle Aspekte von Diskriminierungen umfassen.
Im Rahmen der Studie wurden verschiedene Dimensionen psychischer Gewalt abgefragt, die verbale Gewalt (Anschreien, Beschimpfen, Demütigung), Bedrohung, Lächerlichmachen, Unterdrückung und Schikane, Verleumdung, Zwang, Benachteiligung und Ausgrenzung sowie Psychoterror und andere verletzende Handlungen umfassen. Die Fragen waren weitgehend identisch mit den Fragen der Frauenstudie 2004 und nur um die Dimension „Benachteiligungen aufgrund der Behinderung“ erweitert worden.
Die Auswertung zeigt zunächst auf, dass alle befragten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen deutlich häufiger von mindestens einem psychischen Übergriff im Erwachsenenleben betroffen waren als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. 45% der Befragten der Frauenstudie 2004 im Vergleich zu 70–90% der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen der vorliegenden Studie gaben mindestens eine Form eines psychischen Übergriffs im Erwachsenenleben an. Dabei waren die in allgemeiner Sprache befragten Frauen der Einrichtungsbefragung mit 90% mit Abstand am häufigsten von psychischen Übergriffen betroffen, während die anderen beiden Befragungsgruppen zu 68– 77% eine Betroffenheit angaben.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation erlebt (Einstiegsfrage und Itemliste gesamt) |
45 |
77 (56) 2) |
90 (77) |
68 |
** |
|
Situation erlebt – nur nach Einstiegsfrage |
26 |
45 (--) |
65 (--) |
44 1) |
** |
|
Situation erlebt … |
|||||
|
A) schwer beleidigt, eingeschüchtert oder aggressiv angeschrien |
28 |
56 (37) |
78 (67) |
54 |
** |
|
B) auf verletzende Art und Weise lächerlich gemacht, gehänselt, abgewertet oder gedemütig |
23 |
44 (30) |
55 (45) |
50 1) |
** |
|
C) regelmäßig schikaniert oder unterdrückt |
13 |
28 (18) |
34 (28) |
29 1) |
** |
|
D) benachteiligt oder schlecht behandelt, wegen Geschlecht, Alter oder Herkunft |
11 |
22 (15) |
20 (18) |
-- |
** |
|
E) benachteiligt, Fähigkeiten abgesprochen oder schlecht behandelt, weil behindert oder beeinträchtigt |
-- 3) |
15 (13) |
32 (29) |
-- |
** |
|
F) Schlimmes angedroht oder Angst gemacht |
9 |
26 (17) |
40 (33) |
34 1) |
** |
|
G) erpresst hat oder zu etwas gezwungen, was ich nicht wollte |
7 |
21 (14) |
33 (26) |
30 1) |
** |
|
H) verleumdet oder systematisch bei anderen Schlechtes über mich verbreitet |
15 |
32 (23) |
36 (29) |
39 1) |
** |
|
I) ausgegrenzt oder versucht, mich aus Gruppe auszuschließen |
13 |
26 (17) |
30 (19) |
21 1) |
** |
|
J) psychisch so stark belastet, dass es als Psychoterror oder seelische Grausamkeit empfunden wurde |
12 |
34 (24) |
56 (27) |
18 1) (gequält) |
** |
|
K) sonst. psychisch verletzende Handlungen |
-- 3) |
14 (9) |
14 (28) |
28 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen (Werte in Klammern: Handlungen seit Eintreten der Behinderung). Mehrfachnennungen. 1)8–14% der Frauen haben keine Angaben gemacht.; 2)In Klammern angegebene Werte beziehen sich ausschließlich auf Handlungen aus der Itemliste, die (auch) nach Eintreten der Behinderungen erlebt wurden. Im Fragebogen in vereinfachter Sprache wurde dies nicht getrennt erhoben.; 3)Frage in der Frauenstudie 2004 nicht vorhanden; Gesamtprävalenzen der anderen Gruppen verändern sich nicht, wenn diese Items ausgeschlossen werden.
Die Analyse einzelner Handlungen verweist darauf, dass alle Ausprägungen psychischer Gewalt von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen häufiger erlebt werden. Insbesondere auch die massiveren Formen wie Drohung und Zwang, Erpressung und Psychoterror wurden um ein Vielfaches häufiger genannt als in der Frauenstudie 2004.
Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen, die insgesamt die am höchsten belastete Gruppe darstellen, gaben im Vergleich zu den anderen Befragungsgruppen besonders häufig an, schwer beleidigt, eingeschüchtert oder aggressiv angeschrien worden zu sein, aufgrund der Behinderung benachteiligt worden zu sein und/oder Psychoterror erlebt zu haben.
Die in Klammern angegebenen Werte bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen verweisen darauf, dass viele dieser belastenden und seelisch verletzenden Handlungen sowohl vor als auch nach Eintreten der Behinderungen erlebt wurden. Insbesondere die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen waren von schweren Handlungen wie Psychoterror maßgeblich bereits im Vorfeld der Erkrankungen und Behinderungen betroffen. Zusammen mit den Auswertungen zu den Gewaltbelastungen der Frauen in Kindheit und Jugend verweist das darauf, dass psychische Gewalt im Leben vieler dieser Frauen ein seit Kindheit bestehendes Kontinuum darstellt. Bei diesen und den in den Haushalten befragten Frauen ist davon auszugehen, dass psychische (und andere Formen von) Gewalt maßgeblich mit zu den Behinderungen und Beeinträchtigungen beigetragen und sich oftmals im Lebensverlauf fortgesetzt haben.
Informationen über das Auftreten psychischer Gewalt in den letzten 12 Monaten liegen nur für die in allgemeiner Sprache befragten Frauen vor. Sie zeigen aber auf, dass die in Haushalten und in Einrichtungen lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen auch in der aktuellen Lebenssituation noch in relevantem Maße von psychischer Gewalt betroffen sind, deutlich häufiger als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt. So haben die in Haushalten befragten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen zu über einem Drittel und damit fast doppelt so häufig wie Frauen der Frauenstudie 2004 in den letzten 12 Monaten mindestens eine Form von psychischer Gewalt erlebt; die in den Einrichtungen befragten Frauen waren davon mit 52% sogar dreibis viermal so häufig betroffen. Alle aufgeführten psychisch verletzenden Handlungen in den letzten 12 Monaten wurden von den Frauen dieser Studie um ein Vielfaches häufiger genannt als von den Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. Das Ergebnis zeigt auch, dass die psychisch erkrankten Frauen im Leben in der Einrichtung weiterhin psychischen Übergriffen ausgesetzt sind und ein in dieser Hinsicht geschützter Rahmen dort nicht gegeben ist.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache 1) N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation erlebt (Itemliste) |
15 |
36 |
52 |
-- |
** |
|
A) schwer beleidigt, eingeschüchtert oder aggressiv angeschrien |
8 |
19 |
38 |
-- |
** |
|
B) auf verletzende Art und Weise lächerlich gemacht, gehänselt, abgewertet oder gedemütigt |
6 |
15 |
27 |
-- |
** |
|
C) regelmäßig schikaniert oder unterdrückt |
3 |
7 |
12 |
-- |
** |
|
D) benachteiligt oder schlecht behandelt, wegen Geschlecht, Alter oder Herkunft |
3 |
9 |
7 |
-- |
** |
|
E) benachteiligt, Fähigkeiten abgesprochen oder schlecht behandelt, weil behindert oder beeinträchtigt |
-- |
7 |
19 |
-- |
** |
|
F) Schlimmes angedroht oder Angst gemacht |
2 |
8 |
17 |
-- |
** |
|
G) erpresst oder zu etwas gezwungen, was ich nicht wollte |
1 |
6 |
15 |
-- |
** |
|
H) verleumdet oder systematisch bei anderen Schlechtes über mich verbreitet |
4 |
13 |
20 |
-- |
** |
|
I) ausgegrenzt oder versucht, mich aus Gruppe auszuschließen |
3 |
9 |
15 |
-- |
** |
|
J) psychisch so stark belastet, dass es als Psychoterror oder seelische Grausamkeit empfunden wurde |
3 |
12 |
16 |
-- |
** |
|
K) sonst. psychisch verletzende Handlungen |
-- |
5 |
6 |
-- |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Frauen in vereinfachter Sprache wurden nicht zu Ereignissen in den letzten 12 Monaten gefragt, da zeitliche Einordnung für viele nicht möglich.
In der Auswertung zeigen sich Hinweise darauf, dass Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen nicht nur häufiger, sondern auch schwerere psychische Gewalt erlebt haben. So gaben in der Frauenstudie 2004 nur 18% der Betroffenen an, sie hätten sich in der Situation häufig oder gelegentlich ernsthaft bedroht gefühlt oder Angst um die persönliche Sicherheit gehabt, während es in der Haushalts- und Einrichtungsbefragung über 50% der Betroffenen psychischer Gewalt waren. Dass das nie der Fall gewesen sei, gaben 61% der von psychischer Gewalt betroffenen Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt, aber nur 18–26% der Betroffenen der Haushalts- und Einrichtungsbefragung der vorliegenden Studie an.
|
Frauenstudie 2004 N=3.675 (%) |
Haushalte N=449 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=78 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=217 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Häufig |
8 |
31 |
33 |
-- |
** |
|
Gelegentlich |
10 |
21 |
19 |
-- |
|
|
Selten |
14 |
15 |
18 |
-- |
|
|
Einmal |
7 |
4 |
3 |
-- |
|
|
Nie |
61 |
26 |
18 |
-- |
|
|
Keine Angabe |
1 |
3 |
9 |
-- |
Basis: Betroffene von psychischer Gewalt im Erwachsenenleben.
Wie die folgende Tabelle aufzeigt, erleben Frauen mit Behinderungen im Erwachsenenleben in vielfältigen Lebenskontexten psychische Gewalt. Ausbildung, Schule und Arbeitswelt bilden bei allen befragten Frauen, wie auch in der Frauenstudie 2004, einen zentralen Lebensbereich, bei dem psychische Übergriffe erlebt werden, gefolgt von Übergriffen durch Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/Nachbarinnen bzw. Nachbarn und Familienangehörige, unbekannte Personen an öffentlichen Orten sowie (Ex-)Partnerinnen und -Partner.
Die Frauen, in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, berichteten etwa zwei- bis dreimal häufiger als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt über psychische Gewalt durch Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/Nachbarinnen bzw. Nachbarn (26–42% vs. 14%), durch Partner (25–28% vs. 13%) und durch Familienangehörige (30–40% vs. 13%). Auch in dieser Hinsicht waren die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen am stärksten belastet.
Darüber hinaus gaben auffällig viele der in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen psychisch verletzende Erfahrungen im Rahmen der ärztlichen Versorgung und im Umgang mit Ämtern und Behörden an. Zusammengenommen 32% der in Haushalten befragten Frauen, 42% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache und 24% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen gaben entsprechende Erfahrungen im institutionellen Bereich von Gesundheitswesen, Ämtern/Behörden und Einrichtungen an. Jede dritte bis vierte in einer Einrichtung lebende Frau gab psychische Übergriffe in den Einrichtungen, insbesondere in Wohnheimen und Werkstätten, an.
Der hohe Anteil von Frauen mit Behinderungen, die psychische Übergriffe durch Gesundheitsdienste, Einrichtungen und Ämter/Behörden angaben, muss als bedenklich eingestuft werden. Eine vertiefende Auswertung der Nennungen, welche Institutionen hier eine besondere Rolle spielen, zeigt auf, dass es sich bei den in den Haushalten lebenden Frauen besonders häufig um Erfahrungen in Krankenhäusern und ärztlichen Praxen handelt (bei jeweils etwa 18–20% der Betroffenen) sowie um solche in Ämtern und Behörden (30%), wobei hier am häufigsten Krankenkassen, gefolgt von Arbeitsämtern und kommunalen Behörden wie Jugendämtern, Sozialämtern und Gesundheitsämtern genannt wurden; auch Rehabilitationseinrichtungen, Rentenversicherungs- und Versorgungsamt wurden hier angegeben. Die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen berichteten häufiger auch psychisch verletzende Handlungen in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen (jeweils ca. 10%) sowie in psychiatrischen Einrichtungen und ärztlichen Praxen (jeweils ca. 5%) und ebenfalls am häufigsten in Ämtern/Behörden (20%), wobei hier vor allem kommunale Behörden, Arbeitsämter und auch Polizei/Justiz genannt wurden. Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen nannten als Personen, von denen die psychisch verletzenden Handlungen ausgingen, am häufigsten Personal und Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Wohnheimen; diese wurden auch von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen im Hinblick auf psychische Gewalt in Einrichtungen häufig angegeben.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Öffentl. Orte/Unbekannte |
|||||
|
Genannt |
18 |
25 |
37 1) |
(8) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
5 |
11 |
21 |
-- |
|
|
Arbeit/Schule/Ausbildung |
|||||
|
Genannt |
30 |
35 |
45 1) |
(13) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
16 |
23 |
29 |
-- |
|
|
Gesund. Versorgung |
|||||
|
Genannt |
-- |
23 |
22 |
(1) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
-- |
13 |
10 |
-- |
|
|
Einrichtungen/Dienste |
|||||
|
Genannt |
-- |
14 |
31 1) 2) |
(24) 2) 3) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
-- |
6 |
20 |
||
|
Behörden/Ämter |
|||||
|
Genannt |
-- |
23 |
20 2) |
(0) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
-- |
14 |
12 |
-- |
|
|
Gesundheit/Einrichtungen/Ämter gesamt |
4 |
32 |
42 |
(24) 2) |
* |
|
Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/ Nachbarschaft |
|||||
|
Genannt |
14 |
26 |
42 1) |
(7) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
5 |
12 |
29 |
-- |
* |
|
(Ehe-)Partner bzw. -Partnerinnen |
|||||
|
Genannt |
13 |
25 |
28 2) |
(4) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
8 |
18 |
21 |
-- |
|
|
Familienangehörige |
|||||
|
Genannt |
13 |
30 |
40 2) |
(13) 2) |
** |
|
häufig/gelegentlich |
7 |
20 |
27 |
-- |
|
Basis: Alle Befragten. Mehrfachnennungen. 1)4–5% keine Angabe. 2)6–10% keine Angabe. 3)Hier besonders häufig genannt: Werkstätten und Personal/Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Wohnheim.
In Bezug auf das Geschlecht der Personen, die psychische Gewalt den Befragten gegenüber ausgeübt haben, spiegelte sich in allen Befragungsgruppen wie auch in der Frauenstudie 2004 wider, dass auch bei psychischer Gewalt Männer häufiger als Täter in Erscheinung treten als Frauen. Auffälligerweise waren von den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen jedoch am häufigsten beide Geschlechter als psychische Gewalt Ausübende benannt worden.
|
Frauenstudie 2004 N=3.675 (%) |
Haushalte N=449 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=78 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=217 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ausschließlich Männer |
33 |
17 |
21 |
24 |
* |
|
Überwiegend Männer |
14 |
24 |
8 |
45 |
** |
|
Gleichermaßen Frauen wie Männer |
32 |
36 |
53 |
** |
|
|
Überwiegend Frauen |
10 |
12 |
7 |
* |
|
|
Ausschließlich Frauen |
10 |
8 |
5 |
12 |
* |
Basis: Alle Befragten, die psychische Gewalt erlebt und Angaben zu Täterinnen und Tätern gemacht haben.
Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen haben sehr viel häufiger und auch schwerere psychische Gewalt im Erwachsenenleben erlebt als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. 68–90% waren davon betroffen (vs. 45% im Bevölkerungsdurchschnitt). Frauen, die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragt wurden, bildeten auch hier die am stärksten belastete Gruppe. Neben Arbeitswelt, Familie und engen sozialen Beziehungen sowie dem öffentlichen Raum, die auch in der Frauenstudie 2004 wichtige Tatkontexte bei psychischer Gewalt bildeten, nannten die in Einrichtungen lebenden Frauen häufig auch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner und Personal von Wohnheimen, während die in allgemeiner Sprache in Haushalten und Einrichtungen befragten Frauen auffällig oft psychisch verletzende Handlungen durch Ärztinnen bzw. Ärzte und Ämter/Behörden angaben.
Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen haben im Vergleich mit dem weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 deutlich häufiger und auch schwerere körperliche Gewalt nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenleben erlebt. Während in der Frauenstudie 2004 „nur“ rund ein Drittel der befragten Frauen der Altersgruppe bis 65 (35%) angab, mindestens einen der genannten körperlichen Übergriffe im Erwachsenenleben erlebt zu haben, waren es bei den Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in der vorliegenden Studie mit 58–73% fast doppelt so hohe Anteile. Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, waren gegenüber den anderen Befragungsgruppen wiederum am häufigsten körperlichen Übergriffen ausgesetzt (73% vs. 58–62%); sie machten zudem bei dieser Frage am häufigsten keine Angabe, was auf noch erhöhte Dunkelfelder hindeuten könnte. Frauen, die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden, gaben im Vergleich der Untersuchungsgruppen am seltensten körperliche Übergriffe im Erwachsenenleben an, waren davon aber immer noch deutlich häufiger betroffen als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt (58% bzw. 52% vs. 35%).
|
Frauenstudie2004 N=8.455 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache 1) N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation erlebt (Einstiegsfrage/Itemliste/Gesamt) |
35 |
62 |
73 |
58 (52 eindeutig erst im Erwachsenen-leben) |
|
|
Situation erlebt/nur Einstiegsfrage |
23 |
43 |
60 |
43 (28 eindeutig erst im Erwachsenen-leben) |
** |
|
Situation erlebt … |
|||||
|
A) wütend weggeschubst |
21 |
39 (18) 2) |
37 (25) |
25 |
** |
|
B) leichte Ohrfeige |
16 |
27 (11) |
34 (14) |
23 |
** |
|
C) gebissen oder gekratzt hat, sodass es wehtat oder ich Angst bekam |
3 |
8 (5) |
13 (10) |
15 |
** |
|
D) Arm umgedreht oder mich an den Haaren gezogen, sodass es mir wehtat |
10 |
18 (8) |
19 (12) |
19 |
** |
|
E) schmerzhaft getreten, gestoßen oder hart angefasst |
14 |
24 (11) |
29 (18) |
23 |
** |
|
F) heftig weggeschleudert, sodass ich taumelte oder umgefallen bin |
7 |
15 (7) |
17 (11) |
15 |
** |
|
G) mich heftig geohrfeigt oder mit der flachen Hand geschlagen |
9 |
18 (8) 2) |
28 (14) |
14 |
** |
|
H) etwas nach mir geworfen |
9 |
18 (8) |
14 (10) |
15 |
** |
|
J) mich mit etwas geschlagen, das mich verletzen könnte |
4 |
9 (4) |
15 (10) |
14 |
** |
|
K) ernsthaft gedroht, mich körperlich anzugreifen oder zu verletzen |
11 |
23 (12) |
28 (22) |
21 |
** |
|
L) ernsthaft gedroht, mich umzubringen |
4 |
12 (6) |
17 (12) |
9 |
** |
|
M) mit den Fäusten auch mich eingeschlagen |
5 |
13 (6) |
21 (14) |
15 |
** |
|
N) verprügelt oder zusammen-geschlagen |
5 |
11 (5) |
20 (12) |
14 |
** |
|
O) gewürgt oder versucht, mich zu ersticken |
4 |
9 (4) |
16 (11) |
7 |
** |
|
P) mich absichtlich verbrüht oder mit etwas Heißem gebrannt |
0 |
0 (1) |
3 (3) |
4 |
** |
|
Q) mich mit einer Waffe, zum Beispiel einem Messer oder einer Pistole, bedroht |
3 |
8 (3) |
7 (4) |
9 |
** |
|
R) mich mit einer Waffe, zum Beispiel einem Messer oder einer Pistole, verletzt |
1 |
2 (1) |
1 (2) |
3 |
** |
|
S) mich im Rahmen einer Pflegetätigkeit / Assistenz unangemessen hart angefasst |
-- |
3 (2) |
5 (4) |
5 |
** |
|
T) wichtige Hilfsmittel absichtlich zerstört oder beschädigt |
-- |
1 (1) |
5 (4) |
2 |
** |
|
U) andere körperliche Schmerzen zugefügt, die mit Behinderung in Zusammenhang stehen |
__ |
3 (2) |
6 (5) |
-- |
** |
|
V) mich auf andere Art körperlich angegriffen, die mir Angst machte oder wehtat |
6 |
10 (4) |
9 (7) |
9 |
** |
Basis: Alle befragten Frauen (Angaben in Klammern beziehen sich auf Situationen nach Eintreten der Behinderung). Mehrfachnennungen. 1)5–7% keine Angabe. 2)Daten in Klammern beziehen sich in dieser Tabelle auf Handlungen, die (auch) seit Eintreten der Behinderungen erlebt wurden.
Abbildung 18. Diagramm 18: Körperliche Übergriffe im Erwachsenenleben – gesamt
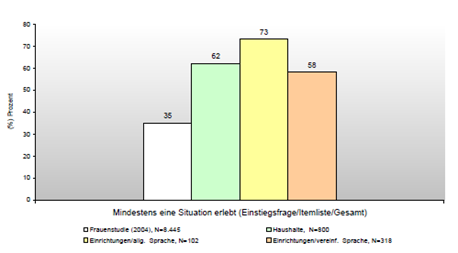
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennung
Die in der vorangegangenen Tabelle in Klammern angegebenen Werte bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Haushalten und Einrichtungen verweisen darauf, dass viele der genannten körperlichen Übergriffe vor und nach Eintreten der Behinderungen aufgetreten waren. Die in den Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen hatten mindestens zur Hälfte die Handlungen bereits vor Eintreten der Behinderungen erlebt; bei den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen waren die körperlichen Übergriffe in höherem Maße (auch oder erst) nach Eintreten der Behinderung/Beeinträchtigung erlebt worden. Das verweist darauf, dass sowohl eine erhöhte Vulnerabilität als Folge der Behinderung als auch ein möglicher Ursachenzusammenhang von Gewalt und daraus resultierender Behinderungen wirksam sein können.
Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen haben nicht nur häufiger körperliche Übergriffe im Erwachsenenleben erlebt, sondern in der Tendenz auch schwerere Gewalthandlungen. So wurden in der Frauenstudie 2004 von den Betroffenen körperlicher Gewalt zu 28% sehr schwere Gewalthandlungen wie Verprügeln, Waffengewalt, Würgen und Verbrühen genannt; bei den in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen waren es ebenso wie bei den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen 36%; die in Einrichtungen lebenden in allgemeiner Sprache befragten gewaltbetroffenen Frauen haben anteilig deutlich am häufigsten sehr schwere Gewalthandlungen erlebt (45%). Auch von Gewalt- und Tötungsdrohungen waren alle Befragungsgruppen deutlich häufiger betroffen als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 (s.o.).
|
Frauenstudie 2004 N=2.984 (nur von Gewalt betroffene (%) |
HaushalteN=498 (nur von Gewalt betroffene) (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=74 (nur von Gewalt betroffene) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=184 (nur von Gewalt betroffene) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Leicht bis mäßig |
22 |
19 |
15 |
10 |
* |
|
Schwer |
47 |
43 |
32 |
38 |
* |
|
Sehr schwer |
28 |
36 |
45 |
36 |
** |
|
Nicht zuordenbar |
3 |
3 |
8 |
16 |
Basis: Von körperlicher Gewalt betroffene Frauen. Mehrfachnennungen.
Abbildung 19. Diagramm 19: Schwere der Gewalthandlungen
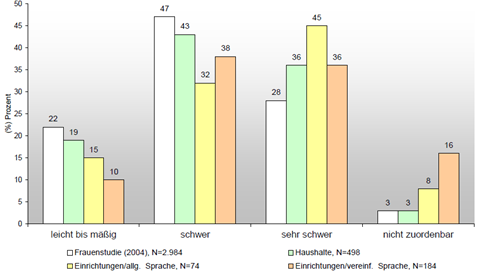
Basis: Von körperlicher Gewalt betroffene Frauen. Mehrfachnennungen.
Die Folgefragen zu Verletzungsfolgen, Bedrohlichkeit und Beeinträchtigungen in der Gegenwehr bei körperlicher Gewalt sind nicht direkt mit der Frauenstudie 2004 vergleichbar, da sie sich in der vorliegenden Studie ausschließlich auf Gewalthandlungen beziehen, die seit dem Eintreten der Behinderung erlebt wurden, während sie in der Frauenstudie 2004 auf alle Handlungen von Gewalt im Erwachsenenleben bezogen wurden. Ein statistischer Vergleich mit der Frauenstudie 2004 kann hier deshalb nicht vorgenommen werden.
Die Mehrheit der Gewalthandlungen, die nach Eintreten der Behinderung von den Frauen in Haushalten und den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen erlebt wurden, war nach Aussagen der Frauen bedrohlich oder von Verletzungen gefolgt. Mehr als 60% der Frauen nannten Verletzungsfolgen (bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen waren es 43%) und 55–67% gaben an, sie hätten in den Situationen Angst vor ernsthafter oder lebensgefährlicher Verletzung gehabt (vs. 48% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen). Die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen hatten auch hier am häufigsten bedrohliche Gewalt erlebt. Sie nahmen sich zudem von allen Befragungsgruppen am häufigsten in den Situationen körperlicher Gewalt als wehrlos aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung wahr (60%), was am zweithäufigsten auf die in vereinfachter Sprache befragten Frauen zutraf (51%), die jedoch zu einem Fünftel hier keine Angaben gemacht haben. Die in Haushalten lebenden Frauen gaben dies immerhin noch zu 37% an. Insgesamt wird damit bei einem relevanten Teil der Befragten eine Einschränkung in der Gegenwehr gegen körperliche Gewalt aufgrund der Behinderung und Beeinträchtigung sichtbar, in besonderer Weise bei den beiden in Einrichtungen lebenden Befragungsgruppen.
|
Frauenstudie 2004 N=1.878 (nur von Gewalt Betroffene, die mehr als eine Situation erlebt haben) (%) |
Haushalte N=264 (nur von Gewalt Betroffene seit Behinderung) (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=74 (nur von Gewalt Betroffene seit Behinderung) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=184 (nur von Gewalt Betroffene seit Behinderung) (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verletzungsfolgen |
(65) 1) |
64 |
62 |
43 2) |
** |
|
Angst vor ernsthafter oder lebens-gefährlicher Verletzung |
(43) 1) |
55 |
67 2) |
48 |
** |
|
Mindestens einmal wehrlos aufgrund der Behinderung/Beeinträchtigung |
-- |
37 |
60 |
51 3) |
** |
Basis: Betroffene Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Nicht direkt vergleichbar, da andere Fallbasis. 2)Anteil der Frauen, die keine Angaben gemacht haben, 7–8% 3)Anteile könnten faktisch deutlich höher liegen; 20% der Frauen haben hier keine Angaben gemacht
Etwa ein Fünftel der Frauen der Haushaltsbefragung (21%) und zwei Fünftel der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (40%) hatten zudem das Gefühl, die erlebte körperliche Gewalt hätte etwas damit zu tun, dass sie eine Behinderung haben. Dass sie mit ihrem Frausein zu tun hätte, gaben 56% der Frauen beider Befragungsgruppen an (bei der Frauenstudie 2004 waren es 46%). Hier wird die erhöhte Vulnerabilität der Frauen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Behinderung sichtbar, die auch ihre Wahrnehmung der eigenen Verletzbarkeit als Frau mit einer Behinderung prägt.
|
Frauenstudie 2004 N=1.878 (%) |
Haushalte N=263 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=45 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gewalt hatte damit zu tun, dass ich eine Frau bin |
46 |
56 |
56 |
-- 1) |
** |
|
Gewalt hatte damit zu tun, dass ich Ausländerin bin oder so aussehe |
3 |
5 |
2 |
-- 1) |
n.s. |
|
Gewalt hatte damit zu tun, dass ich eine Behinderung habe |
1 |
21 |
40 |
-- 1) |
** |
Basis: Von körperlicher Gewalt nach Eintritt der Behinderung betroffene Frauen (bei Frauenstudie 2004 alle Betroffenen körperlicher Gewalt). Mehrfachnennungen. 1)Frage nicht gestellt.
Die Auswertungen zeigen auf, dass Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen nicht nur in der früheren, sondern auch in der aktuellen Lebenssituation häufiger von körperlichen Übergriffen betroffen sind als Frauen der Gesamtbevölkerung, insbesondere dann, wenn sie in Einrichtungen leben. So gaben 6% der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (Frauenstudie 2004), 9% der in dieser Studie in Haushalten befragten Frauen mit Behinderungen / Beeinträchtigungen und mit knapp 18% anteilig fast doppelt so viele Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, körperliche Übergriffe in den letzten 12 Monaten an.[102] Das verweist darauf, dass auch die Lebenssituation in der Einrichtung für die Frauen noch mit einem hohen Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, einhergeht, was gerade bei dieser Befragungsgruppe aufgrund der häufig gravierenden Vorerfahrungen mit Gewalt in Kindheit und Jugend und entsprechenden Traumatisierungen bzw. psychischen Vorbelastungen als besonders problematisch einzuschätzen ist.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation in den letzten 12 Monatenerlebt |
6 |
9 |
18 |
-- |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
A) wütend weggeschubst |
4 |
4 |
8 |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
B) leichte Ohrfeige |
1 |
2 |
6 |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
C) gebissen oder gekratzt hat, sodass es wehtat oder ich Angst bekam |
1 |
1 |
(4) 1) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
D) Arm umgedreht oder mich an den Haaren gezogen, sodass es mir wehtat |
1 |
2 |
(3) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
E) schmerzhaft getreten, gestoßen oder hart angefasst |
2 |
3 |
(4) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
F) heftig weggeschleudert, sodass ich taumelte oder umgefallen bin |
1 |
1 |
(4) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
G) mich heftig geohrfeigt oder mit der flachen Hand geschlagen |
1 |
(1) |
(3) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
H) etwas nach mir geworfen, das mich verletzen könnte |
1 |
2 |
(4) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
J) mich mit etwas geschlagen, das mich verletzen könnte |
0 |
(1) |
(2) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
K) ernsthaft gedroht, mich körperlich anzugreifen oder zu verletzen |
2 |
3 |
9 |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
L) ernsthaft gedroht, mich umzubringen |
0 |
1 |
5 |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
M) mit den Fäusten auf mich eingeschlagen, sodass es wehtat oder ich Angst bekam |
1 |
(1) |
(4) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
N) verprügelt oder zusammengeschlagen |
1 |
(1) |
(3) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
O) gewürgt oder versucht hat, mich zu ersticken |
0 |
(0) |
(2) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
P) mich absichtlich verbrüht oder mit etwas Heißem gebrannt |
0 |
(0) |
(1) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
Q) mich mit einer Waffe, zum Beispiel mit einem Messer oder einer Pistole, bedroht |
0 |
(0) |
(1) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
R) mich mit einer Waffe, zum Beispiel mit einem Messer oder einer Pistole, verletzt |
0 |
(0) |
(0) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
S) mich im Rahmen einer Pflegetätigkeit/Assistenz unangemessen hart angefasst |
-- |
(0) |
(2) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
T) wichtige Hilfsmittel absichtlich zerstört oder beschädigt |
-- |
(1) |
(1) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
U) andere körperliche Schmerzen zugefügt, die mit Behinderung in Zusammenhang Stehen |
-- |
1 |
(1) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
|
V) mich auf andere Art körperlich angegriffen, die mir Angst machte oder weh tat |
1 |
1 |
(4) |
-- |
n.s., da Fallzahlen zu klein |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Zahlen in Klammern nicht verallgemeinerbar, Fallzahlen zu klein.
d) Tatorte und Täterinnen bzw. Täter bei körperlicher Gewalt Die folgenden Ergebnisse zeigen auf, dass auch für Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen der häusliche Kontext hinsichtlich der Gefährdung, Opfer von körperlicher Gewalt zu werden, am risikoreichsten ist und bei den in Einrichtungen lebenden Frauen (zusätzlich) der Wohnbereich und die Arbeitsstelle Orte sind, an denen in erhöhtem Maße Gewalt erlebt wird. Wie auch bei der Frauenstudie 2004 gaben die meisten Frauen der Haushaltsbefragung dieser Studie an, körperliche Übergriffe in der eigenen Wohnung erlebt zu haben (20%). Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, haben in noch höherem Maße körperliche Gewalt in der eigenen Wohnung angegeben (31%).
Darüber hinaus wurden aber von den in Einrichtungen lebenden Frauen in hohem Maße körperliche Übergriffe in den Einrichtungen benannt: 12% der in allgemeiner Sprache und 20% der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen berichteten über körperliche Übergriffe durch Personen in Einrichtungen, Diensten und Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, wobei hier überwiegend Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner in stationären Einrichtungen (und sehr selten Personal) als Täterinnen und Täter angegeben wurden. Auch an den Arbeitsstellen, Schulen und Ausbildungsstätten haben die Frauen in Einrichtungen, ebenso wie die in Haushalten lebenden Frauen, in relevantem Maße körperliche Gewalt erfahren (8– 11% vs. 4% im Bevölkerungsdurchschnitt), zumeist durch Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen und Mitschülerinnen bzw. Mitschüler beiderlei Geschlechts.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte SpracheN=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
In eigener Wohnung |
16 |
20 |
31 |
(13) 1) |
** |
|
Vor eigener Wohnung |
2 |
4 |
6 |
(1) 1) |
** |
|
Wohnung anderer |
4 |
7 |
8 |
(2) |
** |
|
Arbeitsstelle |
4 |
8 |
11 |
(8) |
** |
|
Öffentliche Orte |
6 |
9 |
10 |
(5) |
** |
|
Öffentliche Gebäude |
3 |
6 |
3 |
(0) |
** |
|
Öffentliche Verkehrsmittel |
1 |
3 |
4 |
(1) |
n.s. |
|
KFZ |
1 |
2 |
7 |
(1) |
** |
|
Parkplatz |
1 |
1 |
1 |
(1) |
n.s. |
|
Sonstige |
1 |
2 |
1 |
(5) |
n.s. |
|
Einrichtungen, Dienste, Unterstützungsangebote |
-- |
1 |
12 |
(20) |
** |
|
Krankenhaus,Ärztin bzw. Arzt |
-- |
3 |
5 |
(0) |
n.s. |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)In Klammern gesetzte Daten nicht direkt vergleichbar, da offene Frage und nicht Abfrage anhand von Listen.
Die folgende Auflistung der genannten Täterinnen und Täter bei körperlicher Gewalt verweist noch einmal auf spezifische Gefährdungsmomente für körperliche Übergriffe im Erwachsenenleben, gerade in engsten sozialen Beziehungen von Familie und Partnerschaft.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Unbekannt |
4 |
12 |
12 |
(6) |
** |
|
Kaum bekannt |
3 |
6 |
8 |
(2) |
** |
|
Arbeit |
4 |
11 |
10 |
(9) |
** |
|
Partner |
13 |
29 |
36 |
(6) |
** |
|
Familienangehörige |
8 |
24 |
27 |
(11) |
** |
|
Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/Nachbarschaft |
3 |
5 |
11 |
(3) |
** |
|
Gesundheitsbereich |
1 |
2 |
3 |
(0) |
** |
|
Einrichtungen/Dienste |
-- |
2 |
8 |
(20) 1) |
** |
|
Ämter/Behörden |
-- |
1 |
1 |
(0) |
n.s. |
|
Sonstige |
1 |
2 |
1 |
(2) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Weit überwiegend Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.
Es wird sichtbar, dass sowohl die in den Haushalten lebenden Frauen als auch die in den Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen, wie die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004, am häufigsten Gewalt durch Partner erlebt haben und am zweithäufigsten durch andere Familienangehörige. Partnergewalt hatten im Hinblick auf körperliche Übergriffe 29% der in Haushalten und 36% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen erlebt. Sie waren damit 2- bis 3-mal häufiger von Partnergewalt betroffen als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (13%).[103] Darüber hinaus hatte etwa ein Viertel der in Haushalten und Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen Gewalt durch Familienangehörige angegeben (24–27% vs. 8% in der Frauenstudie 2004) und waren damit gegenüber den Frauen der Gesamtbevölkerung mehr als dreimal so häufig von Gewalt durch Familienangehörige betroffen. Die bereits in Kindheit und Jugend erlebte Gewalt in der Familie scheint sich bei vielen dieser Frauen im Erwachsenenleben und in ihren Paarbeziehungen fortzusetzen.
Vieles spricht dafür, dass die in vereinfachter Sprache befragten Frauen hier geringere Gewaltbelastungen aufweisen (6 bzw. 11%), weil sie in ihrem Erwachsenenleben seltener in Paar- und Familienbeziehungen eingebunden sind/waren. Dafür haben sie im Gegenzug aber zu einem Fünftel angegeben, körperliche Gewalt durch Personen in Einrichtungen erlebt zu haben. Das Ergebnis, dass 20% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in den Einrichtungen körperliche Übergriffe erlebt haben, insbesondere durch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner beiderlei Geschlechts, und davon auch 12% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen betroffen waren (vgl. vorangegangene Tabelle), zeigt auf, dass auch in den Einrichtungen nicht in ausreichendem Maße eine geschützte und sichere Atmosphäre für Frauen gewährleistet ist. In den offenen Nennungen wurden von den Befragten einige Situationen von Gewalt in Einrichtungen geschildert (Quelle: Zitate aus den von den Interviewerinnen notierten Angaben bei offenen Nennungen zu erlebter Gewalt.):
„Ein Mitbewohner, der sich sexuell befriedigt, will mit mir Sex und hat mich auch schon gepackt und wollte mich in sein Zimmer ziehen. Einmal hat er mir die Faust unters Kinn geboxt und drohte mir immer wieder, mich zu erwürgen, mich umzubringen oder krankenhausreif zu schlagen. ,Ich schlage dich irgendwann tot.‘ Eine Mitbewohnerin hat mir heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet.“
„Befragte hatte Dienst in der Küche der Einrichtung und wollte zur Pause gehen. Vor der Essensausgabe hat ein Mitbewohner ihr stark mit der Faust vor die Brust geschlagen.“
„Befragte wurde von Mitbewohner beim Baden verbrüht, als dieser das heiße Wasser aufdrehte.“
„Vorsätzliche körperliche Übergriffe (Schläge) durch Kollegen in der Werkstatt und durch die Betreuerin.“
„Befragte wurde im Krankenhaus über Wochen von männlichen Pflegern zwangsausgezogen und zwangsgeduscht. Auch das Fixieren empfand sie als gewalttätig und peinlich.“
Auch in Bezug auf andere Tatkontexte waren sowohl Frauen der Haushaltsbefragung als auch die in allgemeiner Sprache befragten Frauen der Einrichtungsbefragung gefährdeter, körperliche Gewalt zu erleben, etwa durch unbekannte (12% vs. 4% im Bevölkerungsdurchschnitt) oder kaum bekannte (6–8% vs. 3%) Personen; von den in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen hatten auch nach Eintritt der Behinderung immerhin noch 6% bis 10% körperliche Übergriffe durch unbekannte Täterinnen bzw. Täter erlebt. Die Frauen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, sind in Bezug auf unbekannte oder flüchtig bekannte Täterinnen bzw. Täter unter Umständen geschützter, weil sie aufgrund des Betreuungsverhältnisses weniger häufig allein im öffentlichen Raum unterwegs sind.
Einen weiteren Gefährdungsbereich körperlicher Gewalt stellt für alle befragten Frauen der vorliegenden Studie die Arbeits- und Ausbildungsstätte dar. Hier hatten 9–11% der befragten Frauen körperliche Übergriffe erlebt und waren somit mehr als doppelt so häufig davon betroffen wie die Befragten der Frauenstudie 2004.
Täterinnen und Täter sind, wie in der Frauenstudie 2004, weit überwiegend erwachsene Personen (zu 86–100%), teilweise zusätzlich auch Jugendliche und (seltener) Kinder (zusammen 22–30%).[104]
Vergleichbar zur Frauenstudie 2004 gaben die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und Haushalten befragten Frauen zu etwa 60% ausschließlich männliche Täter an, zu 9–10% ausschließlich weibliche Täterinnen und zu 28–30% Täterinnen und Täter beiderlei Geschlechts. Der Anteil der männlichen Täter bei körperlicher Gewalt ist bei den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen etwas geringer (51%) und der Anteil ausschließlich weiblicher Täterinnen mit 22% mehr als doppelt so hoch wie bei den anderen Befragungsgruppen. Dies dürfte dadurch mit bedingt sein, dass sie, auch aufgrund ihrer längeren Einbindung in stationäre Kontexte, in höherem Maße mit gewaltbereiten Frauen in Wohnheimen konfrontiert sind; in diesem Bereich nannten sie auch deutlich am häufigsten weibliche Täterinnen, deutlich häufiger als die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen.
|
Frauenstudie 2004 N=1.842 |
Haushalte N=450 |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=67 |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=139 |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ausschließlich männliche Täter |
65 |
60 |
63 |
51 |
* |
|
Ausschließlich weibliche Täterinnen |
8 |
10 |
9 |
22 |
** |
|
Männliche und weibliche Täterinnen und Täter |
27 |
30 |
28 |
27 |
** |
Basis: Befragte, die Angaben zum Geschlecht der Täterinnen und Täter gemacht haben Mehrfachnennungen.
Wenn die befragten Frauen dieser Studie in den offenen Nennungen Situationen von körperlicher Gewalt beschrieben haben, dann gaben die in vereinfachter Sprache befragten Frauen am häufigsten Übergriffe durch Bewohnerinnen und Bewohner, teilweise auch durch Betreuungs- und Pflegepersonal in den Einrichtungen an. Viele beschrieben auch Gewaltsituationen in ihren Elternhäusern oder durch Partner. Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen der Haushalts- und Einrichtungsbefragung schilderten in den offenen Nennungen am häufigsten Gewaltsituationen durch (Ex-)Partner. Während von den in Haushalten lebenden Frauen am zweithäufigsten Situationen am Arbeitsplatz beschrieben wurden, waren es bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen sowohl Gewaltsituationen innerhalb der Einrichtungen als auch Gewalt im öffentlichen Raum sowie Kombinationen von Gewalt in unterschiedlichen Lebenskontexten.
Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen haben deutlich häufiger und auch schwerere körperliche Gewalt im Erwachsenenleben erlebt als die Befragten der Frauenstudie 2004. Etwa die Hälfte bis drei Viertel der Frauen (58–73%) waren davon betroffen (vs. 35% der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt). Frauen, die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragt wurden, hatten am häufigsten von allen Befragungsgruppen körperliche Übergriffe im Erwachsenenleben angegeben. Wenn sie Gewalt erlebt haben, handelte es sich in 45% der Fälle um sehr schwere Gewalt, was auf 36% der von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen der anderen beiden Befragungsgruppen zutraf (Frauenstudie 2004: 28%). Ein hohes Ausmaß an körperlicher Gewalt wurde von den Befragten der Studie sowohl vor als auch nach Eintreten der Behinderung erlebt. Gut jede zweite bis dritte Frau erlebte die Situationen als sehr bedrohlich und gab an, sich aufgrund der Behinderung nicht oder nur eingeschränkt gewehrt haben zu können. Etwa 20–40% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen sahen die erlebte körperliche Gewalt in einem Zusammenhang mit der Behinderung. Besondere Gefährdungskontexte für körperliche Gewalt im Erwachsenenleben sind einerseits, wie in der Frauenstudie 2004, der häusliche Bereich von Familie und Partnerschaftsbeziehungen. So haben Frauen der vorliegenden Studie zwei- bis dreimal häufiger Partnergewalt angegeben als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Bei den in Einrichtungen lebenden Frauen kommt Gewalt durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner und (seltener) Personal hinzu, die von etwa 10–20% der in Einrichtungen befragten Frauen angegeben wurde. Auch von Gewalt im Arbeitskontext (ca. 10%) und durch unbekannte Täterinnen bzw. Täter (12%) war ein erheblicher Teil der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen betroffen.
In der vorliegenden Studie umfasst sexuelle Gewalt im engeren Sinne alle erzwungenen sexuellen Handlungen, also solche, zu denen die Frau gegen ihren Willen durch körperlichen Zwang und/oder Drohungen oder dem Ausnützen eines Abhängigkeitsverhältnisses nach eigenen Angaben gezwungen wurde. Da der Übergang zwischen ungewollten und erzwungenen sexuellen Handlungen oft fließend ist, wurden darüber hinaus auch ungewollte sexuelle Handlungen mit abgefragt, bei denen die Frau in unterschiedlichem Maße gesagt oder gezeigt hat, dass diese unerwünscht sind. In einer eigenen Sequenz wurden außerdem Formen sexueller Belästigung abgefragt, die sich zwar, ebenso wie ungewollte sexuelle Handlungen, mit erzwungener sexueller Gewalt überschneiden können, aber dennoch nicht automatisch in diese Kategorie fallen.
Da Studien oftmals unterschiedlich breite Definitionen von sexueller Gewalt haben, können sie hinsichtlich ihrer Ergebnisse zum Ausmaß der sexuellen Gewalt erheblich voneinander abweichen. Auch die Erfassungszeiträume (Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben) tragen zu großen Unterschieden in den Gewaltprävalenzen bei. Im Folgenden sollen zunächst die Ergebnisse zu ungewollten und erzwungenen sexuellen Handlungen im Erwachsenenleben vorgestellt werden, um dann auf das Ausmaß von sexueller Gewalt im gesamten Lebensverlauf einzugehen. Als Vergleichsdaten dienen wiederum die weitgehend identisch abgefragten Daten aus der Frauenstudie 2004.
Bereits in der Auswertung der Gewalterfahrungen der befragten Frauen in Kindheit und Jugend war ein sehr hohes Ausmaß an sexuellem Missbrauch sichtbar geworden (siehe Kapitel 4.3.1): Jede dritte bis vierte Frau war davon in Kindheit und Jugend betroffen. Die folgenden Ergebnisse verweisen darauf, dass sich sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben vieler Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen fortsetzt. Mehr als jede dritte bis fünfte Befragte der vorliegenden Studie hat im Erwachsenenleben ungewollte und/oder erzwungene sexuelle Handlungen erlebt. Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen der Haushalts- und Einrichtungsbefragung gaben mit 34–43% etwa doppelt so häufig wie die Frauen der Frauenstudie 2004 (18%) ungewollte und/oder erzwungene sexuelle Handlungen im Erwachsenenleben an; mehr als jede fünfte der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (22%) war davon nach eigenen Angaben betroffen, wobei ein weiteres Fünftel dieser Frauen hierzu keine Angaben gemacht hat.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ungewollte sexuelle Handlunge |
16 |
31 |
36 |
13 3) |
** |
|
|
Erzwungene sexuelle Handlungen ** |
||||||
|
Mindestens eine Situation erlebt (Einstiegsfrage + Itemliste gesamt) |
13 (inkl. ungewollter Handlungen:18) |
27 (inkl. ungewollter Handlungen: 34) |
38 (inkl. ungewollter Handlungen: 43) |
21 3) (inkl. ungewollter Handlungen: 24) |
** |
|
|
Situation erlebt/nur Einstiegsfrage |
10 |
21 |
29 |
12 3) |
** |
|
|
Jemand hat… |
||||||
|
A) mich zum Geschlechtsverkehr Gezwungen und ist gegen meinen Willen mit dem Penis oder etwas anderem in meinen Körper eingedrungen. |
6 |
14 1) (6) 4) |
26 2) (16) |
10 3) |
** |
|
|
B) gegen meinen Willen versucht, mit dem Penis oder etwas anderem in mich einzudringen, es kam dann aber nicht dazu. |
5 |
8 1) (3) |
15 3) (10) |
9 3) |
** |
|
|
C) mich zu intimen Körperberührungen, Streicheln, Petting und Ähnlichem, gezwungen. |
6 |
13 1) (5) |
17 2) (11) |
11 3) |
** |
|
|
D) Ich wurde zu anderen sexuellen Handlungen oder Praktiken gezwungen, die ich nicht wollte. |
3 |
8 1) (4) |
17 3) (9) |
4 3) |
** |
|
|
E) Jemand hat mich gezwungen, pornografische Bilder oder Filme anzusehen und sie nachzuspielen, obwohl sie bzw. er wusste, dass ich das nicht wollte. |
1 |
3 1) (1) |
10 3) (8) |
4 3) |
** |
|
|
F) Sonstige sexuelle Handlungen, die ich nicht wollte und zu denen ich gegen meinen Willen gedrängt oder gezwungen wurde. |
-- |
8 1) (4) |
13 3) (7) |
-- |
n.s. |
|
Basis: Alle Befragten. Mehrfachnennungen. 1)8–9% keine Angabe. 2)11–15% keine Angabe. 3)16–23% keine Angabe. 4)Angaben in Klammern beziehen sich auf sexuelle Gewalt nach Eintreten der Behinderung. Bei den Interviews in vereinfachter Sprache war diese Unterscheidung nicht möglich.
Erzwungene sexuelle Handlungen im engeren Sinne haben mehr als ein Drittel der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen (38%) im Erwachsenenleben erlebt, gut ein Viertel der in Haushalten lebenden Frauen (27%) und ein Fünftel der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen (21%), wobei die Dunkelfelder hier wiederum aufgrund der hohen Anteile von Frauen, die keine Angabe gemacht haben (16–23%), erhöht sein könnten. Damit hat etwa jede dritte bis vierte in allgemeiner Sprache befragte Frau der vorliegenden Untersuchung und mindestens jede fünfte in vereinfachter Sprache befragte Frau erzwungene sexuelle Handlungen im Erwachsenenleben angegeben. Vergewaltigt worden zu sein (Item A), gab jede vierte in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragte Frau, jede siebte in einem Haushalt lebende Frau und jede zehnte in vereinfachter Sprache befragte Frau mit einer Behinderung an. Die extrem hohen Anteile der in Einrichtungen lebenden Frauen, die hierzu keine Angaben gemacht haben, sprechen für ein höheres Dunkelfeld nicht berichteter sexueller Gewalt bei diesen Befragungsgruppen.[105]
Abbildung 20. Diagramm 20: Sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben
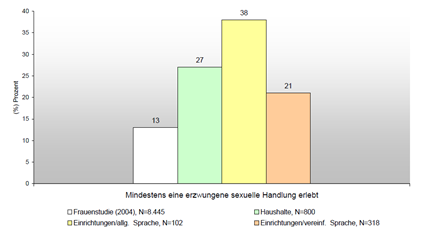
Basis: Alle Befragte; Mehrfachnennungen.
Sexuelle Gewalt in der Kindheit und Jugend und sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben weisen einen hoch signifikanten Zusammenhang auf. So waren Frauen dieser Studie, die in Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch erlebt haben, im späteren Erwachsenenleben etwa doppelt so häufig von sexueller Gewalt betroffen wie Frauen ohne entsprechende Gewaltbetroffenheit in Kindheit und Jugend.[106] Andersherum war etwa die Hälfte der Frauen, die im Erwachsenenleben sexuelle Gewalt erlebt hat, bereits in Kindheit und Jugend von sexuellem Missbrauch betroffen. Demnach bestehen zwar große Überschneidungen, aber keine Deckungsgleichheit in der Betroffenheit von sexueller Gewalt in Kindheit/Jugend und Erwachsenenleben. Werden alle Frauen zusammengenommen, die in Kindheit und Jugend und/oder im Erwachsenenleben sexuelle Gewalt erlebt haben, dann war mehr als jede zweite bis dritte Frau der vorliegenden Studie im Lebensverlauf von sexueller Gewalt betroffen, wobei die Frauen in Einrichtungen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, hier mit 56% die mit Abstand höchste Belastung aufwiesen (vs. 43% der in Haushalten lebenden, 34% der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen und 19% der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt).
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Sexuelle Gewalt in Kindheit und/oder Erwachsenenleben |
19 |
43 |
56 1) |
34 1) |
** |
Basis: Alle Befragten. Mehrfachnennungen. 1)8% keine Angabe in beiden Fragen.
Abbildung 21. Diagramm 21: Sexuelle Gewalt in der Kindheit, Jugend und/oder im Erwachsenenleben
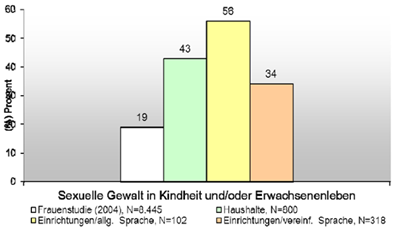
Basis: Alle Befragten. Mehrfachnennungen.
Aus den Auswertungen zu sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, aber auch aus den in Klammern angegebenen Werten in der Tabelle zum Ausmaß ungewollter sexueller Handlungen und sexueller Gewalt im Erwachsenenleben geht hervor, dass viele Frauen bereits vor Eintreten der Beeinträchtigung bzw. Behinderungen mit sexueller Gewalt konfrontiert waren. Demnach erhöht nicht allein die Behinderungssituation das Risiko der Frauen, sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein, sondern in relevantem Ausmaß auch die Betroffenheit durch sexuellen Missbrauch in Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben vor Eintreten der Behinderung. Es ist zudem davon auszugehen, dass diese sehr belastenden Kindheitserfahrungen, aber auch die fortgesetzte sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben ein relevanter Faktor für gesundheitliche Schädigungen, Behinderungen und erhöhte psychische Belastungen im Leben der Frauen sind. Dies ist sowohl in der medizinischen Versorgung der Frauen als auch in der Pflege und Betreuung noch stärker als bisher zu berücksichtigen, gerade auch, wenn es um ungewollte Berührungen, Grenzverletzungen und die Wahrung der Intimsphäre der Frauen geht.
Zugleich zeigt sich aber auch in den Befragungsergebnissen eine erhöhte Vulnerabilität der Frauen aufgrund der Behinderung. So gab etwa ein Viertel bis ein Fünftel der von sexueller Gewalt nach Eintritt der Behinderung betroffenen Frauen (22–26%) an, die Situationen sexueller Gewalt im Erwachsenenleben hätten damit zu tun gehabt, dass sie eine Behinderung haben. Sehr viel mehr der betroffenen Frauen teilten die Einschätzung, sie hätten sich in den Situationen aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung nicht oder nur eingeschränkt wehren können. Dies wurde am häufigsten von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen angegeben (65%), gefolgt von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (43%) und den in Haushalten lebenden Frauen (38%).
|
Frauenstudie 2004 N=531 1) (%) |
Haushalte N=81 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=23 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=96 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gefühl, dass Situation mit der Behinderung in Zusammenhang stand |
-- |
22 |
26 2) |
-- |
n.s. |
|
Eingeschränkte Wehrhaftigkeit aufgrund der Behinderung |
-- |
38 |
65 |
43 3) |
** |
Basis: Frauen, die Situationen sexueller Gewalt im Erwachsenenleben nach Eintreten der Behinderung erlebt haben. Mehrfachnennungen. 1)Nur Frauen, die sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben erlebt haben. Frage hier nicht vorhanden. 2)9–13% keine Angabe.3)Über 30–40% keine Angabe.
Ein weiteres Indiz dafür, dass die Frauen sich oftmals gegenüber sexuellen Übergriffen schwieriger zur Wehr setzen können, sei es aufgrund der belastenden Kindheitserfahrungen mit Gewalt und entsprechender Grenzverletzungen im Lebensverlauf, sei es aufgrund der aktuellen Behinderungssituation in Verbindung mit den oftmals hohen psychischen Belastungen, ist die Beobachtung, dass die Frauen bei ungewollten sexuellen Handlungen in der Tendenz häufiger als Frauen der Frauenstudie 2004 nicht zum Ausdruck bringen konnten, dass sie mit den Übergriffen nicht einverstanden sind. Das traf auf 43% der in allgemeiner und 56% der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten und davon betroffenen Frauen zu sowie auf 49% der Frauen der Haushaltsbefragung (Frauenstudie 2004: 38%).
In den Auswertungen zeigt sich, dass die befragten Frauen der vorliegenden Studie nicht nur häufiger sexuelle Gewalt erlebt haben, sondern dass es sich dabei auch um bedrohlichere Formen von sexueller Gewalt gehandelt hat. Sie nannten in der Itemliste nicht nur deutlich häufiger Vergewaltigungen (s.o.), sondern auch in den nachfolgenden Fragen häufiger Angst vor ernsthaften, lebensgefährlichen Verletzungen in den Situationen sexueller Gewalt, teilweise auch häufiger Verletzungsfolgen.
|
Frauenstudie 2004 N=531 1) (%) |
Haushalte N=81 (%) |
Einrichtungen/allgemeine Sprache N=23 (%) |
Einrichtungen/vereinfachte Sprache N=96 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verletzungsfolgen |
44 |
61 |
57 2) |
30 3) |
** |
|
Angst, ernsthaft, lebensgefährlich verletzt werden zu können |
36 |
49 |
61 |
51 3) |
** |
Basis: Betroffene von sexueller Gewalt nach Eintritt der Behinderung. Mehrfachnennungen. 1)Nur Frauen, die sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben erlebt haben. 2)9–13% keine Angabe. 3)Über 30–40% keine Angabe.
Zu den Tatorten und den Täterinnen bzw. Tätern bei sexueller Gewalt haben insbesondere die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen häufig (zu 9%) keine Angaben gemacht, weshalb die Werte für diese Gruppe hier nur vorsichtig für Vergleiche herangezogen werden können. Generell zeigt sich aber in Bezug auf die Tatorte, dass die eigene Wohnung, wie auch in der Frauenstudie 2004, der am häufigsten genannte Tatort bei sexueller Gewalt gegen Frauen ist, gefolgt von der Wohnung anderer. Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen haben sexuelle Gewalt am zweithäufigsten in den Wohnheimen erlebt (6%). Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen gaben zudem auch häufiger als andere Befragungsgruppen öffentliche Orte als Tatorte an. Auch das Krankenhaus und Arztpraxen wurden als Tatorte bei sexueller Gewalt von einigen Frauen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache angegeben.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
In eigener Wohnung |
4 |
7 |
15 |
7 1) |
** |
|
Vor eigener Wohnung |
0 |
1 |
2 |
0 1) |
** |
|
Wohnung anderer |
2 |
4 |
7 |
3 1) |
** |
|
Arbeitsstelle |
1 |
2 |
3 |
2 1) |
** |
|
Öffentliche Orte |
1 |
2 |
7 |
2 1) |
** |
|
Öffentliches Gebäude |
0 |
1 |
4 |
0 1) |
** |
|
Öffentliche Verkehrsmittel |
0 |
1 |
1 |
0 1) |
* |
|
KFZ |
1 |
1 |
4 |
1 1) |
** |
|
Parkplatz |
0 |
1 |
1 |
0 1) |
* |
|
Sonstige |
0 |
0 |
1 |
4 1) |
** |
|
Einrichtungen, Dienste, Unterstützungsangebote |
-- |
0 |
1 |
6 1) |
** |
|
Krankenhaus, Ärztin bzw. Arzt |
-- |
1 |
1 |
0 1) |
n.s. |
Basis: Alle Befragten. Mehrfachnennungen. 1)9% keine Angabe.
Als Täterin bzw. Täter bei sexueller Gewalt wurden von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen besonders häufig unbekannte oder kaum bekannte Personen angegeben (zu jeweils 10%); auch Freundinnen bzw. Freunde, Bekannte und Nachbarinnen bzw. Nachbarn wurden von diesen häufiger benannt als von den anderen Befragungsgruppen. Auch bei diesen Frauen war aber, wie bei den anderen Befragungsgruppen und in der Frauenstudie 2004, der (Ex-)Partner am häufigsten als Täter bei sexueller Gewalt genannt worden: 13% der in Haushalten befragten Frauen, 20% (!) der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen und 6% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen haben in der Befragung angegeben, sexuelle Gewalt durch Partner erlebt zu haben. Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen der Studie haben damit drei- bis fünfmal häufiger sexuelle Gewalt durch Partner in der Befragung benannt als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. Darüber hinaus erlebten Frauen, die in den Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragt wurden, häufiger als andere Befragungsgruppen sexuelle Gewalt in Einrichtungen (6% vs. 2% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen). Wenn diese benannt wurde, dann waren fast ausschließlich männliche Mitbewohner und Mitarbeiter in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen als Täter angegeben worden, in den offenen Nennungen seltener auch männliches Personal in den Einrichtungen.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeineSprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Unbekannt |
1 |
4 |
10 |
4 1) |
** |
|
Kaum bekannt |
1 |
0 |
10 |
3 1) |
** |
|
Arbeit |
1 |
3 |
4 |
2 1) |
** |
|
Partner |
4 |
13 |
20 |
6 1) |
** |
|
Familienangehörige |
1 |
4 |
3 |
3 1) |
** |
|
Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/Nachbarschaft |
1 |
4 |
8 |
1 1) |
** |
|
Gesundheitsbereich |
0 |
1 |
0 |
0 1) |
n.s |
|
Einrichtungen/Dienste |
-- |
0 |
2 |
6 1) 2) |
** |
|
Ämter/Behörden |
-- |
0 |
0 |
0 1) |
** |
|
Sonstige |
0 |
0 |
0 |
2 1) |
n.s |
Basis: Alle Befragten. Mehrfachnennungen. 1)9% keine Angabe. 2)Wenn sexuelle Gewalt, dann fast ausschließlich durch männliche Mitbewohner.
Besonders risikoreiche Lebenskontexte in Bezug auf sexuelle Gewalt sind demnach für Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, wie bei den Frauen der Frauenstudie 2004, der häusliche Bereich von Familien- und Paarbeziehungen. Darüber hinaus sind sie aber auch gefährdeter, Opfer von sexueller Gewalt durch unbekannte oder flüchtig bekannte Personen sowie durch Personen des sozialen Umfeldes wie Freundinnen oder Freunde, Bekannte und Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen zu werden. In Einrichtungen in besonderem Maße gefährdet scheinen Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen zu sein: Mindestens jede 17. in vereinfachter Sprache befragte Frau (6%) hat hier erzwungene sexuelle Handlungen erlebt, die weit überwiegend von Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohnern und Kolleginnen bzw. Kollegen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ausgingen, seltener vom Personal; es ist aber davon auszugehen, dass sich darunter noch erhebliche Dunkelfelder verbergen können, da viele Frauen hierzu keine Angaben gemacht haben.
In den offenen Nennungen berichten einige der in vereinfachter Sprache befragten Frauen, von Heimbewohnern belästigt und sexuell bedrängt worden zu sein („Ein Mitbewohner fasst mich immer an, ich mag das nicht, aber er versteht das nicht“); häufig wurden auch Vorfälle durch Kollegen in Werkstätten und seltener durch Personal beschrieben:
„Ein Kollege kam in der Pause von hinten an sie heran und hat sie aufgefordert, ihn sexuell zu befriedigen, danach hat er noch einmal versucht, sie sexuell zu bedrängen.“ (Schriftliche Notiz, Interviewerin, Befragung vereinfachte Sprache)
„In einem Fall handelt es sich um einen Kollegen in der Werkstatt, der sie mehrmals belästigte. In einem anderen Fall um einen Pfleger, der sie angeblich auf beidseitigen Wunsch sexuell berührte.“ (Schriftliche Notiz, Interviewerin, Befragung vereinfachte Sprache)
Die Frauen beschreiben hier teilweise Situationen von systematischen und länger andauernden Nachstellungen durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner in Wohnheimen und Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen in Werkstätten, die auch deshalb als sehr gravierend anzusehen sind, weil sie diesen sozialräumlich nicht entgehen können. Teilweise wird ein mehr oder weniger konsequentes Einschreiten durch Betreuungspersonen beschrieben („Dann hab ich es der Betreuerin gesagt, die hat ihn dann gedupft, da hat er aufgehört. Er versucht es aber jeden Morgen“), teilweise aber auch ein mangelhaftes Ernstnehmen der Situation („Wenn man dann meldet, wird nicht viel gemacht am Arbeitsplatz“).
Auch sexuelle Gewalt durch Personal wurde vereinzelt berichtet, wenn auch deutlich seltener als Übergriffe durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner und Kolleginnen bzw. Kollegen in den Werkstätten. Sofern die Frauen die Handlungen meldeten oder diese bekannt wurden, hatten die Übergriffe durch Personal Konsequenzen:
„Ein ehemaliger Gruppenleiter hat Arbeitskollegen in der Behindertenwerkstatt aufgefordert, Sex mit Kolleginnen und Kollegen zu machen. Er hat Pornohefte mitgebracht. Er ist weggegangen. Es wurde dem Sozialdienst gemeldet.“(Schriftliche Notiz, Interviewerin, Befragung vereinfachte Sprache)
„Betreuer ejakulierte in der Silvesternacht in ihrem Zimmer in ihren Mund. Vorher knöpfte er ihr die Bluse auf. Sie hat gerufen. Die Nachbarin rief Hilfe. Die Gruppenleiterin kam, der Betreuer wurde vom Dienst suspendiert.“(Schriftliche Notiz, Interviewerin, Befragung vereinfachte Sprache)
Auch im Erwachsenenleben der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen zeigt sich ein hohes Ausmaß an sexueller Gewalt bei allen Befragungsgruppen. Jede dritte bis vierte in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und Haushalten befragte Frau der vorliegenden Untersuchung und mindestens jede fünfte in vereinfachter Sprache befragte Frau hat erzwungene sexuelle Handlungen im Erwachsenenleben erlebt; darunter dürfte noch ein erhebliches Dunkelfeld nicht aufgedeckter sexueller Gewalt liegen, denn insbesondere die in Einrichtungen befragten Frauen haben hierzu häufig keine Angaben gemacht. Damit haben Frauen mit Behinderungen etwa zwei- bis dreimal häufiger sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben erlebt als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Wird sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend mit einbezogen, dann waren Frauen der vorliegenden Studie, bezogen auf das gesamte Leben, etwa zur Hälfte bis zu einem Drittel von sexueller Gewalt im Lebensverlauf betroffen. Besondere Gefährdungskontexte sind, wie bei der Frauenstudie 2004, der soziale Nahraum von Familien- und Paarbeziehungen. Darüber hinaus wurden von Frauen der Studie aber auch in erhöhtem Maße öffentliche Orte sowie der Freundes- und Bekanntenkreis genannt. Insbesondere gegenüber den in Einrichtungen lebenden und in vereinfachter Sprache befragten Frauen wurden in den Wohnheimen und Werkstätten sexuelle Übergriffe häufiger durch männliche Mitbewohner und Kollegen, seltener durch Personal berichtet. Viele Frauen mit Behinderungen geben an, dass sie sich aufgrund der Behinderung schwieriger gegen sexuelle Übergriffe zur Wehr setzen konnten.
Die in den vorangegangenen Kapiteln festgestellten Unterschiede in der Gewaltbetroffenheit durch sexuelle Gewalt spiegeln sich auch im Hinblick auf sexuelle Belästigung in abgeschwächtem Maß wider. Die Unterschiede zwischen der Frauenstudie 2004 und der vorliegenden Studie sind hier geringer. So hatten 70–73% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Haushalten und Einrichtungen mindestens eine Form sexueller
Belästigung erlebt; in der Frauenstudie 2004 waren es 61%. Die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen gaben hier anteilig sehr viel seltener sexuelle Belästigung an (39%), machten aber auch zu einem Viertel bis einem Fünftel keine Angabe zu sexueller Belästigung. Deutliche Unterschiede in Bezug auf Höherbelastungen der befragten Frauen durch einzelne Formen sexueller Belästigung gegenüber den Frauen der Frauenstudie 2004 finden sich insbesondere in Bezug auf Nachstellungen und aufdringliche oder bedrohliche Annäherungen mit Körperkontakt (siehe Items E, F, H und I), die von den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Haushalten und Einrichtungen häufiger angegeben wurden.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation erlebt (Itemliste/Gesamt) |
61 |
73 |
70 1) |
(39) 2) nur nach Itemliste |
** |
|
Einleitungsfrage |
40 |
50 |
46 2) |
-- |
** |
|
Situation erlebt … |
|||||
|
A) über Telefon, E-Mail oder Brief mit unanständigen oder bedrohlichen Dingen belästigt |
33 |
33 1) |
28 2) |
12 3) |
** |
|
B) sich vor mir entblößt, um mich zu belästigen oder zu erschrecken |
18 |
17 1) |
16 2) |
11 3) |
** |
|
C) durch Nachpfeifen, schmutzige Bemerkungen oder (sexuell interessiertes) Angestarrtwerden belästigt werden |
35 |
37 1) |
22 2) |
15 3) |
** |
|
D) durch sexualisierte Kommentare über meinen Körper, mein Privatleben oder sexuelle Anspielungen ein ungutes Gefühl gegeben |
22 |
23 1) |
19 2) |
15 3) |
** |
|
E) ein ungutes Gefühl gegeben, indem sie/er mich mehrere Male gefragt hat, ob wir uns treffen könnten |
21 |
30 1) |
26 2) |
15 3) |
** |
|
F) mir unnötig nahegekommen, sich z.B. zu nah über mich gebeugt oder mich auf eine aufdringliche Weise in eine Ecke gedrängt |
22 |
29 1) |
27 2) |
14 3) |
** |
|
G) mir obszöne Witze erzählt und mit mir auf eine Art und Weise gesprochen, die ich als sexuell bedrängend empfand |
14 |
20 1) |
17 2) |
12 3) |
** |
|
H) mich körperlich betatscht oder gegen meinen Willen zu küssen versucht |
20 |
29 1) |
27 2) |
19 3) |
** |
|
I) mir nachgegangen, mich verfolgt oder bedrängt, sodass ich es mit der Angst zu tun bekam |
15 |
18 1) |
22 2) |
16 3) |
** |
|
J) mir gegenüber in unpassenden Situationen, z.B. auch in Arbeit, Ausbildung oder bei |
9 |
14 1) |
9 2) |
7 3) |
** |
|
K) mir zu verstehen gegeben, dass es nachteilig für mich oder meine Zukunft (oder mein berufliches Fortkommen) sein könnte, wenn ich mich sexuell nicht auf sie/ihn einließe |
3 |
5 1) |
4 2) |
7 3) |
** |
|
L) mir in unpassenden Situationen pornografische Bilder oder Nacktbilder gezeigt |
3 |
7 1) |
17 2) |
8 3) |
** |
|
M) mir im Rahmen von Pflege/Assistenz ein ungutes Gefühl gegeben, indem sie/er mich sexuell berührt hat |
-- |
2 2) |
2 2) |
3 3) |
** |
|
N) Andere Situationen von sexueller Belästigung |
5 |
7 1) |
7 2) |
7 3) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)6–10% keine Angabe. 2)11–18% keine Angabe. 3)19–24% keine Angabe.
Tatorte und Täterinnen bzw. Täter bei sexueller Belästigung
Während Frauen der Frauenstudie 2004 häufiger angaben, sexuelle Belästigung an öffentlichen Orten durch Unbekannte sowie in Arbeit, Schule und Ausbildung erlebt zu haben, waren die Frauen der vorliegenden Studie, insbesondere die in Einrichtungen und Haushalten in allgemeiner Sprache befragten Frauen, häufiger auch durch sexuelle Belästigung im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung und in Einrichtungen betroffen. Vor allem die in Einrichtungen lebenden Frauen erlebten häufiger sexuelle Belästigung in Einrichtungen und Diensten (8–10%). Freundinnen bzw. Freunde, Bekannte, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Partner und Familienangehörige wurden vor allem von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen deutlich häufiger genannt als von den anderen Befragungsgruppen. Das zeigt auf, dass diese Frauen gerade auch in engen sozialen Beziehungen am wenigsten geschützt sind vor Grenzverletzungen in Form von sexuellen Übergriffen und sexueller Belästigung, wie das auch in den vorangegangenen Auswertungen zu sexueller Gewalt in der Kindheit und im Erwachsenenleben bereits sichtbar geworden war.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Öffentliche Orte/Unbekannte |
|||||
|
Genannt |
50 |
28 |
27 |
10 |
** |
|
häufig/gelegentlich |
15 |
10 |
13 |
||
|
Arbeit/Schule/Ausbildung |
|||||
|
Genannt |
25 |
21 |
16 |
8 |
** |
|
häufig/gelegentlich |
8 |
6 |
7 |
||
|
Gesundheitliche Versorgung |
|||||
|
Genannt |
4 |
4 |
0 |
* |
|
|
häufig/gelegentlich |
1 |
1 |
|||
|
Einrichtungen/Dienste |
|||||
|
Genannt |
3 |
13 |
8 |
** |
|
|
häufig/gelegentlich |
1 |
10 |
|||
|
Behörden/Ämter |
|||||
|
Genannt |
1 |
0 |
0 |
n.s. |
|
|
häufig/gelegentlich |
1 |
0 |
|||
|
Gesundheitsbereich/Einrichtungen/Ämter (gesamt) – genannt |
4 |
-- |
11 |
** |
|
|
Freundinnen bzw. Freunde/Bekannte/Nachbarinnen bzw. Nachbarn |
|||||
|
Genannt |
16 |
14 |
20 |
5 |
** |
|
häufig/gelegentlich |
4 |
5 |
11 |
||
|
(Ehe-)Partner bzw. Partnerinnen |
|||||
|
Genannt |
6 |
10 |
20 |
3 |
** |
|
häufig/gelegentlich |
3 |
6 |
14 |
||
|
Familienangehörige |
|||||
|
Genannt |
6 |
6 |
9 |
4 |
n.s. |
|
häufig/gelegentlich |
2 |
3 |
5 |
||
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Im Folgenden sind noch einmal alle Formen von Gewalt in der Kindheit und im Erwachsenenleben zusammengeführt, um einen vergleichenden Überblick über die Gewaltbetroffenheit der verschiedenen Untersuchungsgruppen zu geben. Sie zeigen in Bezug auf sexuelle und auf psychische Gewalt in Kindheit und Erwachsenenleben deutlich erhöhte Betroffenheiten bei allen Befragungsgruppen gegenüber dem Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 auf, mit Ausnahme der psychischen Gewalt in der Kindheit bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die aber möglicherweise aufgrund von Erinnerungsschwierigkeiten untererfasst ist. Generell ist bei den Angaben der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Betracht zu ziehen, dass diese Befragungsgruppe sich oftmals schwieriger an zurückliegende Ereignisse erinnern kann und viele Frauen keine Angaben, insbesondere zu sexueller Gewalt, aber auch zu Gewalt in Kindheit und Jugend gemacht haben.
In der Betroffenheit durch körperliche Gewalt werden größere Unterschiede zwischen den Befragungsgruppen und der Frauenstudie 2004 erst im Erwachsenenleben sichtbar, wobei weiter oben bereits dokumentiert wurde, dass die Frauen der vorliegenden Studie, wenn sie körperliche Gewalt durch Eltern erlebt haben, häufiger auch von schwererer körperlicher Misshandlung in Kindheit und Jugend betroffen waren.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Psychische Gewalt Kindheit 1) |
34 |
54 |
58 |
29 |
** |
|
Körperliche Gewalt Kindheit 1) |
76 |
84 |
85 |
47 |
** |
|
Sexuelle Gewalt Kindheit |
10 |
30 |
36 |
25 2) |
** |
|
Psychische Gewalt Erwachsenenleben |
45 |
77 |
90 |
68 |
** |
|
Körperliche Gewalt Erwachsenenleben |
35 |
62 |
73 |
58 |
** |
|
Sexuelle Gewalt Erwachsenen leben |
13 |
27 |
38 |
21 2) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Anteil im Vergleich zu vorangegangenen Tabellen verändert, da prozentuiert auf alle Befragten. 2)10–17% durchgängig keine Angabe zu sexueller Gewalt.
Abbildung 23. Diagramm 23: Überblick über psychische, körperliche und sexuelle Gewalterfahrungen in der Kindheit und im Erwachsenenleben
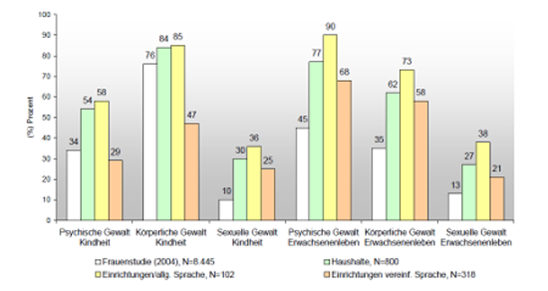
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Wird aus den Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend ein Index gebildet und jeder Form von Gewalt in Kindheit und Jugend ein Punkt zugeteilt, lässt sich abbilden, welche Frauen keine oder nur eine Form von Gewalt in Kindheit und/oder Erwachsenenleben erlebt haben (Werte 1–2) und welche von sehr vielen oder allen multiplen Formen von Gewalt sowohl in Kindheit und Jugend als auch im Erwachsenenleben betroffen waren (Werte 5–6). In früheren Auswertungen der Daten der Frauenstudie 2004 hatte sich gezeigt, dass vor allem die Kumulation von multiplen Gewalterfahrungen im Lebensverlauf zu schweren psychischen und psychosomatischen Beeinträchtigungen beitragen kann (vgl. Schröttle/Khelaifat 2008 und Schröttle/Hornberg et al. 2009).
|
Anzahl genannter Formen von Gewalt in Kindheit und/oder Erwachsenenleben |
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
14 |
5 |
1 |
18 |
** |
|
1 |
27 |
12 |
5 |
20 |
|
|
2 |
23 |
14 |
17 |
16 |
|
|
3 |
17 |
21 |
17 |
13 |
|
|
4 |
12 |
22 |
23 |
17 |
|
|
5 |
5 |
17 |
22 |
11 |
|
|
6 |
2 |
10 |
16 |
6 |
|
|
Durchgängig keine Angabe |
0 |
0 |
1 |
0 |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Die Tabelle zeigt zunächst auf, dass die in vereinfachter Sprache befragten Frauen und die Frauen der Frauenstudie 2004 am häufigsten keine Gewalterfahrungen in der Kindheit und im Erwachsenenleben angegeben haben (14 bzw. 18%), was bei den anderen beiden Gruppen der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Haushalten und in Einrichtungen selten zutraf (1–5%). Von multiplen Erfahrungen unterschiedlicher Formen von Gewalt sowohl in der Kindheit wie auch im Erwachsenenleben, die psychische, körperliche und sexuelle Gewalt umfassen (Werte 5–6), waren alle Frauen der vorliegenden Studie häufiger betroffen als Frauen der Frauenstudie 2004. 27% der in Haushalten lebenden Frauen, 37% der in allgemeiner und 16% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen120[107] gehören dieser hoch belasteten Gruppe an (vs. 7% der Frauen der Frauenstudie 2004). Wie in allen vorangegangenen Analysen waren auch hier die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen die am höchsten belastete Gruppe, gefolgt von den in Haushalten lebenden und den in vereinfachter Sprache befragten Frauen, deren Anteile aber aufgrund des Dunkelfeldes möglicherweise faktisch höher liegen als die Befragung dies abbilden kann.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Anteile Indexwerte 5 und 6 der multiplen Gewalterfahrungen |
7 |
27 |
37 1) |
16 1) |
** |
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Leichte Abweichung der Prozentwerte zur vorangegangenen Tabelle aufgrund von Auf-/Abrundungswerten nach der Kommastelle.
Abbildung 24. Diagramm 24: Durch multiple Gewalterfahrungen in Kindheit/Jugend und Erwachsenenleben hoch belastete Frauen
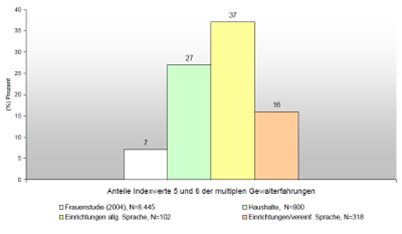
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Die folgende Tabelle zeigt auf, dass diese Anteile bei den Frauen nur geringfügig höher liegen, deren Behinderungen bereits in Kindheit und Jugend vorlagen. Demnach ist das Risiko, schwere und multiple Gewalt im Lebensverlauf zu erfahren, bei Frauen, die ab Kindheit/Jugend behindert waren, nicht per se erhöht. Vielmehr verweisen die Studienergebnisse darauf, dass sich Behinderung/Beeinträchtigung sowie erhöhte Risiken, Gewaltopfer zu werden, oftmals erst aus erlebter Gewalt und hohen Belastungen in Kindheit und Jugend sowie im Lebensverlauf ergeben, dann aber die Vulnerabilität, weiter viktimisiert zu werden bzw. sich schwerer gegen Gewalt wehren zu können, deutlich erhöht ist.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=279 (%) |
Einrichtungen/ allgemeine Sprache N=46 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=282 (%) |
Signifikanz |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Anteile Indexwerte 5 und 6 der multiplen Gewalterfahrungen |
(7) |
34 |
39 |
16 |
** |
Basis: Alle Befragten, die in Kindheit und Jugend Behinderung hatten. Mehrfachnennungen.
Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen haben alle Formen von Gewalt deutlich häufiger erfahren als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Auffällig sind die hohen Belastungen insbesondere durch sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend, die sich im Erwachsenenleben oftmals fortsetzen. Die am höchsten von Gewalt belastete Gruppe waren Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden.
In der Studie wird der wechselseitige Zusammenhang von Gewalt und gesundheitlicher Beeinträchtigung/Behinderung im Leben von Frauen sichtbar. Nicht nur haben Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ein höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden; auch umgekehrt tragen (frühere) Gewalterfahrungen im Leben der Frauen maßgeblich zu späteren gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen und Behinderungen bei. So war ein großer Teil der befragten Frauen, auch solche, deren Behinderungen erst im Erwachsenenleben aufgetreten waren, bereits in Kindheit und Jugend einem erheblichen Ausmaß von Gewalt durch Eltern und andere Personen ausgesetzt. Sie haben anteilsmäßig häufiger (und auch schwerere) körperliche und vor allem psychische Übergriffe durch Eltern erlebt. Etwa 50–60% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen waren von psychischer Gewalt durch Eltern betroffen gegenüber rund einem Drittel (34% bzw. 36%)[108] der Frauen der Frauenstudie 2004. Frauen, die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden, wiesen hier etwas geringere Werte auf als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt; der hohe Anteil der Frauen, die dabei keine Angabe gemacht haben oder es nicht (mehr) wussten, lässt aber darauf schließen, dass sich darunter noch Dunkelfelder verbergen und die hier vermeintlich geringere Gewaltbetroffenheit möglicherweise Einschränkungen im Erinnerungsvermögen dieser Befragungsgruppe abbildet.
Eines der gravierendsten Ergebnisse der vorliegenden Studie im Hinblick auf die Gewalterfahrungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ist, dass diese zwei- bis dreimal häufiger sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend ausgesetzt waren als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt (Frauenstudie 2004). Jede dritte bis vierte Frau mit Behinderungen und Beeinträchtigungen gab in der vorliegenden Studie sexuelle Übergriffe in Kindheit und Jugend durch Erwachsene, Kinder oder andere Jugendliche an. Allein von sexuellem Missbrauch durch Erwachsene waren nach eigenen Angaben ein Fünftel der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen (20%)[109], ein Viertel der in Haushalten befragten Frauen (24%) und fast ein Drittel der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen (31%) betroffen. In der Frauenstudie 2004 waren es in der Altersgruppe bis 65 Jahre 10%. Die hohe Betroffenheit durch sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen setzt sich auch im Hinblick auf die Gewaltbetroffenheit im Erwachsenenleben fort. So hat mehr als jede dritte bis fünfte Frau der Studie erzwungene sexuelle Handlungen im Erwachsenenleben angegeben (Frauenstudie 2004: 13% in der Altersgruppe bis 65) und auch hier waren die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache Befragten mit 38% die am stärksten betroffene Gruppe. Werden alle Frauen zusammengenommen, die in Kindheit und Jugend und/oder im Erwachsenenleben sexuelle Gewalt erlebt haben, dann war mehr als jede zweite bis dritte Frau der vorliegenden Studie im Lebensverlauf von sexueller Gewalt betroffen, im Vergleich zu etwa jeder fünften Frau im Bevölkerungsdurchschnitt (2004).
Darüber hinaus erlebten die Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen auch deutlich häufiger psychische und körperliche Gewalt im Erwachsenenleben als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. So haben zwei Drittel (68%) der in vereinfachter Sprache befragten Frauen, mehr als drei Viertel (77%) der in Haushalten und 90% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen psychische Übergriffe im Erwachsenenleben angegeben, die von verbalen Beleidigungen und Demütigungen über Benachteiligung, Ausgrenzung und Unterdrückung bis hin zu Drohung, Erpressung und Psychoterror reichten. In der Frauenstudie 2004 waren davon 45% der befragten Frauen betroffen.
Mindestens eine Situation körperlicher Gewalt im Erwachsenenleben haben mit 58–73% anteilsmäßig fast doppelt so viele Frauen der vorliegenden Studie wie Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (35%) erlebt. Auch hier waren die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen am häufigsten betroffen. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass nicht nur alle Frauen der vorliegenden Studie häufiger körperliche Übergriffe erlebt haben, sondern dass es sich dabei auch um schwerere und vielfach auch bedrohlichere Übergriffe gehandelt hat.
Bei vielen Frauen, bei denen die Behinderung erst im Erwachsenenleben auftrat, waren die körperlichen, psychischen und sexuellen Übergriffe sowohl vor als auch nach dem Eintreten der Behinderung und Beeinträchtigung verübt worden, sodass sowohl ein Zusammenhang vermutet werden kann, der die gesundheitsschädigende Wirkung von Gewalt aufzeigt, als auch ein Zusammenhang, der auf die erhöhte Vulnerabilität aufgrund der Behinderung und Beeinträchtigung verweist. Wie auch in der qualitativen Studie der vorliegenden Befragung deutet sich in den Befragungsergebnissen der quantitativen Studie an, dass von den Frauen selbst die Gewalt teilweise mit ihrer Behinderung in Zusammenhang gebracht wird[110], ein größerer Teil der Gewalterfahrungen aber nicht im Kontext der Behinderung und Beeinträchtigung gesehen wird. Gut jede dritte von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffene Frau der Haushaltsbefragung und etwa 40% bis über 60% der in Einrichtungen befragten, von körperlicher/sexueller Gewalt betroffenen Frauen gaben aber an, sie hätten sich aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung weniger gut wehren können als andere Menschen.
Hier wird eine besondere Vulnerabilität von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sichtbar, die sich einerseits auf die aktuellen (psychischen und gesundheitlichen) Beeinträchtigungen und die besondere Lebenssituation der Frauen (insbesondere die erhöhten Abhängigkeiten der Frauen in Einrichtungen) beziehen kann, andererseits und zugleich aber auch auf gewaltbelastete Erfahrungen und Grenzverletzungen in Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben zurückgeführt werden kann.
Die Frauen aller vier Befragungsgruppen einschließlich der Frauenstudie 2004 wurden nach der Inanspruchnahme institutioneller Hilfe und Intervention infolge von körperlicher und sexueller Gewalt befragt. Dabei wurde bei Opfern körperlicher und sexueller Gewalt getrennt nach Gewaltform erfasst, ob medizinische Hilfe in Anspruch genommen worden war, die Polizei eingeschaltet und Anzeige erstattet worden war und welche Erfahrungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens gemacht worden waren. Bei einem Vergleich der Untersuchungsgruppen ist zu berücksichtigen, dass große Anteile, insbesondere der in vereinfachter Sprache Befragten, keine Angabe zu Unterstützung und institutioneller Intervention gemacht haben oder diese nicht machen konnten, weil sie es nicht wussten.
In Bezug auf die Inanspruchnahme medizinischer Hilfen zeigte sich zunächst, dass die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen Befragten diese am häufigsten genutzt haben (42% nach körperlicher Gewalt und 39% nach sexueller Gewalt), gefolgt von den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen (36% nach körperlicher und 31% nach sexueller Gewalt). Die Frauen in Haushalten haben demgegenüber deutlich seltener medizinische Hilfe nach körperlicher Gewalt in Anspruch genommen (27%), jedoch immer noch häufiger als die Frauen der Frauenstudie 2004 (21%). Sie haben nach sexueller Gewalt aber häufiger als nach körperlicher Gewalt medizinische Hilfen genutzt (31%).
Die höhere Inanspruchnahme medizinischer Hilfe bei den in Einrichtungen lebenden Frauen könnte damit zusammenhängen, dass diese möglicherweise durch den Kontakt zu Vertrauenspersonen in der Einrichtung bei der Entscheidung über eine Inanspruchnahme einer medizinischen Versorgung nach der erlebten Gewalt positiv unterstützt oder begleitet oder im Rahmen der Einrichtungen medizinisch versorgt wurden.
Die Frauen in Einrichtungen haben knapp zur Hälfte und zu etwa gleichen Anteilen eine Person aus der Einrichtung, in der sie leben, kontaktiert, nach körperlicher Gewalt (46%– 49%) jedoch sehr viel häufiger als nach sexueller Gewalt (17%–23%). Die in vereinfachter Sprache Befragten könnten hier aufgrund der Frageformulierung[111] jedoch auch eine Mitbewohnerin gemeint haben. Auch ein geringer Anteil der Frauen in Haushalten (jeweils 8% nach körperlicher und nach sexueller Gewalt) hat angegeben, eine Person in einer Einrichtung, in der sie gelebt haben oder betreut wurden, kontaktiert zu haben.[112]
|
Infolge körperlicher Übergriffe wurde… |
Basis: Betroffene körperlicher Gewalt. |
Basis: Betroffene sexueller Gewalt. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allg. Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haus-halte N=800 (%) |
Einrichtungen/ allg. Sprache N=102 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 |
|
|
medizinische Hilfe in Anspruch genommen |
21 |
27 |
42 |
36 1) |
13 |
31 |
39 |
31 5) |
|
Person aus einer Einrichtung informiert, in der die Befragte lebt oder betreut wird |
-- |
(8) 2) |
49 1) |
(46) 3) 4) |
-- |
(8) 5) |
(17) 3) |
23 5) |
|
eine Person aus einer Unterstützungseinrichtung aufgesucht |
-- 6) |
18 |
27 |
9 3) |
-- 6) |
13 |
(13) |
8 5) |
|
die Polizei eingeschaltet |
17 |
28 |
51 |
20 1) |
9 |
21 |
35 |
16 5) |
|
eine Anzeige erstattet |
13 |
21 |
33 |
18 1) |
8 |
16 |
26 |
14 5) |
1)16–19% keine Angabe. 2)27–28% keine Angabe. 3)22–23% keine Angabe. 4)Frage nicht vergleichbar. 5)30–36% keine Angabe. 6)Die Frage zu Unterstützungseinrichtungen in der Frauenstudie 2004 richtet sich an alle Frauen und fragt, ob sie nach psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt schon einmal eine Unterstützungseinrichtung genutzt haben, als sie in einer solchen Situation waren, und ist somit mit den Ergebnissen dieser Studie nicht direkt vergleichbar. Prozentuiert auf einzelne Betroffenengruppen hatten hier 13% der Opfer sexueller Gewalt und 20% der Opfer körperlicher Gewalt angegeben, jemals ein entsprechendes Unterstützungsangebot in Anspruch genommen zu haben (vgl. Schröttle/Müller 2004: 160).
Unterstützungseinrichtungen wie Beratungsstellen wurden von den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen am häufigsten aufgesucht (nach körperlicher Gewalt von 27%), gefolgt von den Frauen in Haushalten (18%). Beide Befragungsgruppen nutzten nach sexueller Gewalt Unterstützungseinrichtungen seltener (13%) als nach körperlicher Gewalt. Am seltensten (zu nur 8–9%) wurden die Unterstützungseinrichtungen jedoch von den in vereinfachter Sprache befragten Frauen sowohl nach körperlicher als auch nach sexueller Gewalt genutzt. Die Schwelle oder die Möglichkeit, entsprechende externe Angebote zu nutzen, scheint für diese Befragungsgruppe am höchsten zu sein. Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen wurden darüber hinaus gefragt, ob sie mit ihrer Mutter oder ihrem Vater über die Gewalt gesprochen hätten, was rund ein Drittel der Frauen bejahte (35% der Frauen nach körperlicher und 33% nach sexueller Gewalt).
Die Ergebnisse verweisen generell darauf, dass die Mehrheit der von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffenen Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen keine institutionelle und/oder persönliche Unterstützung in und nach Gewaltsituationen erhält. Besonders tabuisiert und schwierig anzusprechen scheinen in dieser Hinsicht sexuelle Gewalterfahrungen zu sein. Wie bereits in der Frauenstudie 2004 wurde auch in dieser Studie bei allen Befragungsgruppen die Polizei nach sexueller Gewalt deutlich seltener eingeschaltet als nach körperlicher Gewalt.
Auffällig ist, dass die in allgemeiner Sprache Befragten in Einrichtungen zu einem vergleichsweise hohen Anteil (51% nach körperlicher Gewalt und 35% nach sexueller Gewalt) die Polizei eingeschaltet haben und auch am häufigsten eine Anzeige erstattet haben (33% nach körperlicher und 26% nach sexueller Gewalt). Dies könnte auch damit in Zusammenhang stehen, dass diese Frauen häufiger schwerere körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt haben und auch häufiger von Gewalt durch unbekannte Personen betroffen waren (vgl. 3.3.2.2 und 3.3.2.3), welche häufiger angezeigt wird als Gewalt durch Partnerinnen bzw. Partner, Freundinnen bzw. Freunde oder Familienmitglieder. Die Diskrepanz zwischen dem Einschalten der Polizei und dem Erstatten einer Anzeige ist schwer erklärbar, fand sich aber auch schon in der Frauenstudie 2004. Sie findet sich weniger stark bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die aber auch nur etwa halb so häufig wie die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen die Polizei eingeschaltet haben (20% nach körperlicher Gewalt und 18% Anzeigeerstattung; 16% nach sexueller Gewalt und 14% Anzeigeerstattung). Die Frauen in den Haushalten haben seltener als die in allgemeiner Sprache Befragten, aber häufiger als die in vereinfachter Sprache Befragten und häufiger als die Frauen der Frauenstudie 2004 die Polizei eingeschaltet (28% nach körperlicher und 21% nach sexueller Gewalt vs. 17% nach körperlicher und 9% nach sexueller Gewalt in der Frauenstudie 2004). Dieses Verhältnis findet sich auch in Bezug auf die Erstattung einer Anzeige wieder (21% nach körperlicher und 16% nach sexueller Gewalt vs. 13% nach körperlicher und 8% nach sexueller Gewalt in der Frauenstudie 2004). Dies ist möglicherweise ebenfalls mit deren häufiger Betroffenheit durch schwere Gewalt in Zusammenhang zu bringen, eventuell auch mit den Tatkontexten (mehr Gewalt auch außerhalb von Paar- und Familienbeziehungen).
Diejenigen Frauen, die die Polizei eingeschaltet und/oder eine Anzeige erstattet haben, wurden nach dem weiteren Verlauf gefragt. Hier wird die Fallzahl der Frauen bei körperlicher Gewalt teilweise sehr gering: 23 in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragte Frauen und 30 in vereinfachter Sprache befragte Frauen haben hierzu weitere Angaben gemacht; bei den in Haushalten befragten Frauen waren es 77. Deshalb sind weitergehende statistische Auswertungen hierzu sehr vorsichtig zu interpretieren und Verallgemeinerungen nicht möglich. Bei sexueller Gewalt können hier aufgrund der geringen Fallzahl (Haushaltsbefragung: 18 Frauen, Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache: 8 Frauen, Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache: 15 Frauen) keine statistischen Auswertungen gemacht werden.
Die Frauen in Haushalten haben sich am häufigsten infolge der körperlichen Gewalt von einer Anwältin/einem Anwalt beraten lassen (35%), gefolgt von den in vereinfachter Sprache Befragten (32%) und den in allgemeiner Sprache Befragten (21%) in Einrichtungen. Die meisten, aber keineswegs alle Befragten, die die Polizei eingeschaltet und/oder eine Anzeige erstattet haben, wurden nach eigenen Angaben auch von der Polizei vernommen (70–87%). Dass bei Gericht ein Kontaktverbot für die Täterin oder den Täter beantragt worden sei (zivilrechtliche Schutzanordnung), wurde von 29% der Frauen in Haushalten, von 26% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen und von 53% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen angegeben. Die Frauen in Einrichtungen wurden in etwa gleichem Ausmaß nochmals von der Polizei befragt (30–33%), die Frauen in Haushalten dagegen deutlich seltener (18%).
In Bezug auf die Frage, ob der Fall vor Gericht kam, finden sich die höchsten Anteile bei den in vereinfachter Sprache Befragten (53%), während die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen Befragten und die Frauen in Haushalten dies nur zu 22% bzw. zu 26% angaben. Eingestellt wurde das Verfahren am häufigsten bei den Frauen der Haushaltsbefragung (28%), seltener bei den Frauen in Einrichtungen (19% der in vereinfachter Sprache Befragten und 4 Fälle der in allgemeiner Sprache Befragten). Eine Verurteilung erreichten die in vereinfachter Sprache Befragten nach eigenen Angaben zu 63% nach körperlicher Gewalt und in 4 Fällen nach sexueller Gewalt, während dies auf die Frauen in Haushalten (18%) und die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen Befragten (3 Fälle) deutlich seltener zutraf. Bei den beiden letzten Fragen machten die Frauen jedoch zu hohen Anteilen keine Angabe.
|
Fallbasis 1 (Anzeige erstattet) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Basis: Betroffene körperlicher Gewalt, die Anzeige erstattet haben. |
Basis: Betroffene sexueller Gewalt, die Anzeige erstattet haben. |
|||||||
|
Frauenstudie 2004 N=363 (%) |
Haushalte N=77 (%) |
Einrichtungen/ allg. Sprache N=23 (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=30 (%) |
Frauenstudie 2004 N=56 (%) |
Haushalte N=18 (%) |
Einrichtungen/ allg. Sprache) N=8 2 (Fälle) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=1 (%) |
|
|
Beratung durch Anwältin bzw. Anwalt |
-- |
35 |
21 |
32 (k.A.: 13) |
-- |
33 |
(5 Fälle) |
40 |
|
Vernehmung durch die Polizei |
-- |
83 |
70 |
87 (k.A.: 13) |
-- |
83 |
(7 Fälle) |
80 |
|
Bei Gericht beantragt, dass die Person nicht mehr mit Betroffener in Kontakt treten darf |
-- |
29 |
26 |
53 (k.A.: 13) |
-- |
38 |
(3 Fälle) |
40 |
|
Nochmals befragt |
-- |
18 |
30 |
33 (k.A.: 13) |
-- |
33 |
(2 Fälle) |
27 |
|
Kam der Fall vor Gericht? |
-- 1) |
26 |
22 |
53 (k.A.: 3) |
-- 1) |
33 |
(5 Fälle) |
33 |
|
Fallbasis 2 (Fall vor Gericht) |
||||||||
|
Basis: Betroffene körperlicher Gewalt, die Anzeige erstattet haben. |
Basis: Betroffene sexueller Gewalt, die Anzeige erstattet haben. |
|||||||
|
(%) |
Haushalte N=76 (%) |
Einrichtungen/ allg. Sprache N=5 2) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=16 (%) |
Frauenstudie 2004 (%) |
Haushalte N=6 2) |
Einrichtungen/ allg. Sprache N=5 2) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=5 2) |
|
|
Hat das Gericht eine Entscheidung getroffen? |
-- 1) |
26 |
(4 Fälle) |
13 |
-- 1) |
(6 Fälle) |
(4 Fälle) |
(5 Fälle) |
|
Verfahren eingestellt |
-- 1) |
28 |
(4 Fälle) |
19 |
-- 1) |
(5 Fälle) |
(3 Fälle) |
(0 Fälle) |
|
Verurteilung |
-- 1) |
18 |
(3 Fälle) |
63 |
-- 1) |
(6 Fälle) |
(2 Fälle) |
(4 Fälle) |
1)Daten nicht vergleichbar, da Bezug auf einzige/schlimmste Situation. In Situationen körperlicher/sexueller Gewalt kamen etwa 4% der Fälle vor Gericht und 2% wurden verurteilt (Schröttle/Müller 2004: 200 f., 217 f.). 2)Fallzahl zu klein für Auswertung.
Es ist unklar, ob bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen tatsächlich in so hohem Maße die Polizei eingeschaltet wurde, der Fall vor Gericht kam und verurteilt wurde. Es finden sich in den Protokollen der Interviewerinnen durchaus einige Hinweise darauf, dass die in vereinfachter Sprache befragten Frauen über die Prozesse informiert waren. Sowohl die Rückmeldungen einiger Interviewerinnen der repräsentativen als auch der qualitativen Befragungen äußerten aber Zweifel daran, dass es sich um Erfahrungen aus erster Hand gehandelt hat. Die Aussagen der Befragten zu den behördlichen Schritten waren teilweise vage, inkonsistent oder ausweichend. Möglicherweise beruhten die Kenntnisse der Befragten auf Informationen durch rechtliche Betreuerinnen bzw. rechtliche Betreuer, Einrichtungsmitarbeiterinnen bzw. Einrichtungsmitarbeiter oder Angehörige über den Fortgang des Falles, die die Befragten als Fakten verarbeitet haben, ohne selbst einen direkten Kontakt mit Polizei und/oder Justiz gehabt zu haben. Hierfür spricht, dass für viele der in vereinfachter Sprache befragten Frauen rechtliche Betreuer/innen eingesetzt waren, die sie u.a. auch im Kontakt mit Behörden vertreten. In diesem Fall dürfte es für die Frauen besonders schwer sein, die beschrittenen Wege juristisch korrekt einzuordnen.
Juristische Laien sind mit dem differenzierten System des Rechtsschutzes bei Gewalt in der Regel nicht vertraut und werden nicht ohne Weiteres zwischen einer zivilrechtlichen Schutzanordnung und einer Strafanzeige unterscheiden können. Für Gewalt in Heimen ist neben der Polizei auch die Heimaufsicht als Ordnungsbehörde zuständig. Auch hier kann von juristischen Laien nicht erwartet werden, zwischen diesen beiden Behörden unterscheiden zu können.
Rechtliche Schritte zum Schutz vor Gewalt in Einrichtungen können zudem nicht von den betroffenen Frauen oder ihren rechtlichen Betreuerinnen bzw. rechtlichen Betreuern veranlasst werden, sondern vielfach liegt es an der Einrichtungsleitung, gegen die Täterinnen oder Täter vorzugehen (z.B. durch Kündigung des Arbeits- oder Heimvertrages). Einrichtungsbewohnerinnen haben darum, anders als in Fällen häuslicher Gewalt, wenig Einblick und Einfluss auf den weiteren Interventionsverlauf. Für sie ist nicht ohne Weiteres erkennbar, ob die Einrichtungsleitung gegen die Täterin bzw. den Täter lediglich heim- oder arbeitsrechtlich vorgeht oder auch die Heimaufsichtsbehörde oder die Polizei eingeschaltet wurden.
Einige Frauen haben im Anschluss an die strukturierten Fragen zu polizeilicher/justizieller Intervention noch offene Angaben gemacht, wie es ihnen in dem Verfahren erging, ob sie sich ernst genommen gefühlt haben und ob sie unterstützt wurden. Während bei körperlicher Gewalt noch einige positive Erfahrungen mit der Polizei, dem Gericht und der Staatsanwaltschaft berichtet wurden, wenn auch die Mehrheit der Frauen sich nach eigenen Angaben nicht ernst genommen fühlten, waren die Aussagen bei sexueller Gewalt bis auf eine Ausnahme negativ. Die Frauen fühlten sich hier im Rahmen der polizeilich-rechtlichen Intervention regelmäßig nicht ernst genommen und beschämt. Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen bildeten hier eine Ausnahme, weil sie stärker von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen und von ihren Familien unterstützt wurden bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die nötigen Schritte in dem Verfahren für sie übernahmen. Es ist davon auszugehen, dass für viele dieser Frauen nicht die Behörden, sondern ihre (rechtlichen) Betreuerinnen und Betreuer die unmittelbaren Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner waren und sie selbst vergleichsweise wenig persönlichen Kontakt zu Polizei und Justiz hatten. Ihre Bewertung des Verfahrensverlaufs bezöge sich dann aber nicht alleine auf das justizielle Verfahren, sondern auch auf die Qualität ihrer Begleitung durch rechtliche und pädagogische Betreuerinnen und Betreuer.
In den anderen Befragungsgruppen fühlten sich viele Frauen auf sich allein gestellt. Wenn sie unterstützt wurden, dann durch Familienangehörige, Partnerinnen bzw. Partner, Freundinnen bzw. Freunde, Bekannte und Anwältinnen bzw. Anwälte.
Allen Frauen wurde eine offene Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten des Schutzes von Frauen und Mädchen vor Gewalt, einmal in Bezug auf körperliche und einmal auf sexuelle Gewalt, gestellt. Insgesamt wurden sehr häufig Selbststärkungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen, eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit zu Gewalt, insbesondere zu Beratungs- und Informationsstellen, mehr Zivilcourage sowie Aufklärung zu Gewalt und Sexualität gefordert. Außerdem wurde häufig die Notwendigkeit betont, Mädchen und Frauen, insbesondere bei sexueller Gewalt, mehr Glauben zu schenken, die Intervention von Polizei und Jugendamt zu verbessern und die Strafen für Täterinnen und Täter zu erhöhen. In einzelnen Fällen wurde auch eine Verbesserung der Ausbildung der Pflegekräfte genannt sowie die Möglichkeit, diese persönlich auszuwählen.
Aus der menschenrechtlichen Perspektive wird Diskriminierung definiert als „die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von einzelnen Menschen oder Gruppen aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener Merkmale“ (Deutsches Institut für Menschenrechte 2006: 2). Als mehrdimensionale Diskriminierung gilt die „Ungleichbehandlung“, wenn sie sich nicht nur auf eines, sondern auf mehrere Merkmale bezieht, so z.B. auf Geschlecht und Behinderung. Auch in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist in Artikel 6, Absatz 1 festgehalten, dass „die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind“. Zinsmeister (2007) geht, analog zu intersektionalen Ansätzen, von Wechselwirkungen mit Kumulationen oder Relativierungen von verschiedenen Merkmalen aus, die über die „bloße Addition von Nachteilen“ (2007: 51) hinausgehen.
„Grundlage von Diskriminierung sind […] in Diskursen und Ideologien sowie ökonomischen, politischen, rechtlichen und institutionellen Strukturen verankerte Unterscheidungen von Personenkategorien oder sozialen Gruppen, denen der Status eines gleichberechtigten Gesellschaftsmitglieds bestritten wird“ (Scherr 2011: 36). Eine besondere Herausforderung stellen Diskriminierungen dar, die durch das Zusammenspiel gesellschaftlicher Regeln und/oder institutioneller Verfahren zur Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen in zentralen Lebensbereichen führen. Ein solches Zusammenspiel wird als strukturelle oder institutionelle Diskriminierung bezeichnet (Deutsches Institut für Menschenrechte). Nach Galtungs (1975) Begriff der „strukturellen Gewalt“ sind Einschränkungen oder Defizite bei der persönlichen Entfaltung von Potenzialen auch strukturell begründet.
Dies entspricht auch dem Verständnis von „Behinderung“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) von 2005[113], in dem neben den individuellen körperlichen, geistigen, seelischen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen gerade auch die strukturellen Dimensionen von Beeinträchtigungen und Diskriminierung durch Gesellschaft und Umwelt einbezogen werden, die auf der alltäglichen Handlungsebene vor dem jeweiligen biografischen Hintergrund als Begrenzungen von Handlungsspielräumen erfahren werden.
Rommelspacher (2006) sieht Diskriminierung dann gegeben, „wenn Menschen, die einer Minderheit angehören, im Vergleich zu Mitgliedern der Mehrheit weniger Lebenschancen, das heißt weniger Zugang zu Ressourcen und weniger Chancen zur Teilhabe an der Gesellschaft haben“.
Diskriminierung bedeutet im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention „jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen“ (Artikel 2 Begriffsbestimmung).
Die Erfahrungen von Diskriminierung wurden in der vorliegenden Studie in mehrfacher Hinsicht thematisiert. Zum einen wurden die Frauen direkt nach ihrer subjektiven Wahrnehmung von „äußeren Bedingungen oder nach dem Verhalten anderer Menschen befragt, durch die das Leben mit einer Beeinträchtigung, chronischen Erkrankung oder Behinderung mehr oder weniger“ erschwert werden. Das waren Bedingungen, durch die sie in ihrer Freiheit oder ihren Entscheidungen eingeschränkt werden (Artikel 14 UN-BRK), die die Gewährung oder Versagung von Hilfe und Unterstützung umfassen, sowie grenzüberschreitendes Verhalten durch Anstarren, ungewolltes Duzen oder unangenehme/ungewollte Berührung oder Benachteiligung und Diskriminierung. Zur Ermittlung dieser subjektiven Erfahrungen enthielt der Fragebogen einige offene und einige geschlossene Fragen mit festen Antwortvorgaben. Außerdem wurden die Interviewerinnen geschult, auch nachträglich die an anderer Stelle benannten Erfahrungen von Diskriminierung zu notieren, da das breite und vielfältige Spektrum an Diskriminierung und struktureller Gewalt oft nur kontextspezifisch einzuordnen ist, gerade bei subtilen Formen. Die Methode der weitgehend offenen Befragung wurde auch deswegen gewählt, weil – auch nach den Ergebnissen des Pretests – die vielfältigen Erfahrungen durch strukturierte Antwortvorgaben nicht ausreichend abgebildet werden können.
Zum anderen lassen sich indirekt Erkenntnisse zu Diskriminierung und struktureller Gewalt gegenüber Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen aus den Daten zur Sozialstruktur, u.a. zu Bildung, Einkommen, Familie und Erwerbsarbeit, gewinnen.
Zum anderen lassen sich indirekt Erkenntnisse zu Diskriminierung und struktureller Gewalt gegenüber Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen aus den Daten zur Sozialstruktur, u. a. zu Bildung, Einkommen, Familie und Erwerbsarbeit, gewinnen.
Zu den in der UN-BRK genannten Lebensbereichen können aus Vergleichen der soziostrukturellen Daten der vorliegenden Studie in Verbindung mit vergleichbaren Daten aus der Frauenstudie 2004 und anderen repräsentativen Bevölkerungsumfragen Rückschlüsse auf eine objektive Diskriminierung von Frauen mit einer chronischen Erkrankung, Beeinträchtigung oder Behinderung gezogen werden: Was als Benachteiligung zu werten ist, orientiert sich an den in der UN-BRK definierten Zielen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Danach sind alle „Ungleichbehandlungen“ in den verschiedenen Lebensbereichen als benachteiligend anzusehen, durch die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung individuelle und soziale Handlungsspielräume beschränkt werden. Als Hinweise auf eine mögliche Benachteiligung sollen unter anderem ungleiche Verteilungsstrukturen gelten.[114] Um diese zu ermitteln, wurden die Daten der Gruppen vergleichend ausgewertet (siehe auch 3.1) und, soweit verfügbar, den repräsentativen Daten der weiblichen Gesamtbevölkerung im Alter von 16 bis 65 Jahren gegenübergestellt. Eine statistisch ermittelte Ungleichverteilung wird dann auch qualitativ analysiert bzw. interpretiert, um deren Ursachen zu ermitteln und festzustellen, obsie als strukturelle Benachteiligung gewertet werden kann. Abschließend werden die Ergebnisse im Kontext der UN-BRK bewertet.
Im Rahmen dieser Studie wird Diskriminierung sowohl personenbezogen gefasst – etwa, wenn es um direkte diskriminierende Verhaltensweisen von Personen gegenüber Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen geht –, als auch als eine Form von struktureller Diskriminierung, bei der diskriminierende Gesellschaftsstrukturen oder soziale/politische Praxen in den Vordergrund rücken. Die Bewertung dessen, was als Diskriminierung gelten kann, ist einerseits orientiert an der subjektiven Wahrnehmung der betroffenen Frauen, andererseits an den Eckpunkten, die in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben sind.
Die Fragen zur Diskriminierung waren im Fragebogen direkt im Anschluss an die Fragen nach Formen der Beeinträchtigung und Behinderung (Modul 2) platziert, um den Zusammenhang von Behinderung und möglicher Diskriminierung herzustellen. Die Fragen hatten z.T. Antwortvorgaben, in denen diskriminierende Verhaltensweisen des sozialen Umfeldes beschrieben wurden, z.B. ob die Frauen erlebt haben, angestarrt, ungefragt geduzt, nicht ernst genommen oder ungefragt angefasst zu werden. In vier offenen Fragen wurden äußere Bedingungen oder soziale Verhaltensweisen angesprochen. Das waren:
-
Bedingungen, die sich einschränkend auf Freiheit und Entscheidungen auswirken,
-
vorenthaltene Hilfe oder ein Zuviel an Hilfe,
-
belästigende, bevormundende oder benachteiligende Verhaltensweisen von anderen Menschen oder Institutionen,
-
Benachteiligung und Diskriminierung durch andere Menschen oder Institutionen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung, Behinderung oder chronischen Erkrankung.
Die subjektive Bewertung der Erfahrungen von Diskriminierung ist in der Regel kontextbezogen, z.B. wird sie im Vergleich zu anderen Menschen, zu einer vorherigen Lebenssituation oder zu den eigenen Erwartungen an eine „gerechte“ Behandlung bewertet. Das Empfinden für Diskriminierung kann außerdem geschärfter sein bei einer Frau, die von Geburt an behindert ist, wie umgekehrt eine Frau nach dem Eintreten einer Behinderung im Erwachsenenalter Diskriminierung als eine für sie neue Erfahrung unter Umständen stärker wahrnehmen kann. Darüber hinaus kann eine z.B. in der Behindertenpolitik aktive Frau Diskriminierung und Benachteiligung unter Umständen subtilere Formen eher wahrnehmen und als Diskriminierung benennen als andere Frauen. Die Antworten der Frauen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung spiegeln daher subjektive Deutungsmuster von Erfahrungen, die die Frauen selbst als benachteiligend oder diskriminierend wahrgenommen haben.
In der folgenden Tabelle sind die Anteile der Frauen der Haushaltsbefragung sowie der Einrichtungsbefragungen in allgemeiner und in vereinfachter Sprache aufgeführt, die nach den jeweiligen Antwortvorgaben entsprechende Diskriminierungen erlebt haben.
|
Frauenstudie 2004 N=8.445 (%) |
Haushalte N=777 1) (%) |
Einrichtungen/ allgemeineSprache N=100 1) (%) |
Einrichtungen/ vereinfachte Sprache N=318 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Mindestens eine Situation erlebt (Itemlisten/gesamt) |
-- |
81 |
89 |
84 |
|
Situation erlebt … |
||||
|
Bedingungen/Regeln, durch die in Freiheit oder in Entscheidung eingeschränkt |
-- |
28 |
42 |
38 2) |
|
Hilfe vorenthalten oder Zuviel an Hilfe |
-- |
33 |
39 |
36 2) |
|
Sonstige Verhaltensweisen, durch die belästigt, bevormundet oder benachteiligt wurde |
-- |
31 |
38 |
33 2) 4) |
|
Benachteiligungen oder Diskriminierungen durch andere Menschen oder Institutionen |
-- |
34 |
48 2) |
27 2) 5) |
|
Angestarrt werden |
-- |
31 |
52 3) |
43 3) |
|
Ungefragt geduzt werden |
-- |
29 |
44 2) |
35 2) |
|
Nicht ernst genommen werden |
-- |
50 |
62 3) |
42 2) |
|
Ignoriert werden |
-- |
36 |
46 3) |
-- |
|
Ungefragt angefasst werden |
-- |
19 |
41 3) |
39 3) |
|
Unangenehm angefasst werden |
-- |
19 |
31 3) |
38 2) |
|
Beschimpft werden |
-- |
19 |
46 3) |
46 3) |
|
Keine Rücksicht wird genommen |
-- |
-- |
32 2) |
|
|
Andere unangenehme Erfahrungen |
-- |
33 |
33 2) |
-- |
|
Schlecht behandelt |
-- |
-- |
28 2) |
|
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. 1)Nur Frauen, die Behinderungen, Beeinträchtigungen genannt haben. 2)7–10% keine Angabe. 3)4–6% keine Angabe. 4)Formulierung hier leicht anders: „Machen andere etwas, das stört oder das Sie unangenehm finden, zum Beispiel unangenehme Gefühle bei Ärztinnen bzw. Ärzten oder Ämtern?“ 5)Formulierung hier leicht anders: „wurde ungerecht behandelt“.
Abbildung 25. Diagramm 25: Personale Gewalt und Diskriminierung
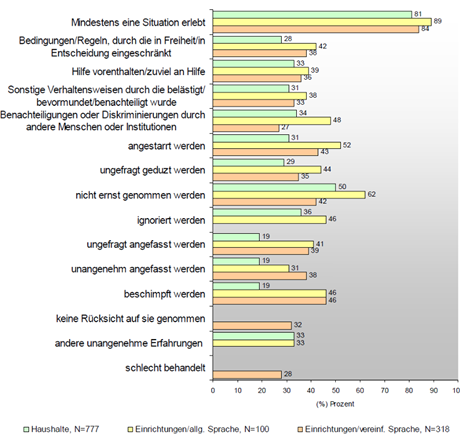
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennung.
Mindestens eine der aufgeführten diskriminierenden Erfahrungen haben 81% der in Haushalten lebenden Frauen, 84% der in vereinfachter Sprache befragten und 89% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen erlebt. Nur wenige Frauen in allen Gruppen haben die Fragen zu Diskriminierung durchgängig nicht beantwortet (0–2%), allerdings machten bei den einzelnen Fragen die in Einrichtungen befragten Frauen in erhöhtem Maße keine Angaben (4–10%).
Im Zusammenhang mit der Behinderung/Beeinträchtigung nicht ernst genommen zu werden, wurde von allen Befragungsgruppen häufig angegeben. Die Frauen der Haushalts- und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache nannten dies am häufigsten, wobei Letztere dies mit einem Anteil von 62% deutlich am häufigsten Angaben (vs. 42–50% bei den anderen Befragungsgruppen).
Frauen der Einrichtungsbefragung beider Gruppen gaben deutlich häufiger an, sie fühlten sich durch Bedingungen, äußere Umstände oder Regeln in ihrer Freiheit oder ihren Entscheidungen eingeschränkt (38–42% vs. 28% der in Haushalten lebenden Frauen). Auch gaben sie häufiger an, in Zusammenhang mit der Beeinträchtigung/Behinderung beschimpft zu werden (46% vs. 19%), ungefragt oder unangenehm angefasst zu werden (31–41% vs. 19%), angestarrt (43–52% vs. 31%) oder ungefragt geduzt zu werden (35–44% vs. 29%).
Etwa jeder dritten Frau in allen Befragungsgruppen war nach ihrer Einschätzung Hilfe vorenthalten oder mit einem Zuviel an Hilfe begegnet worden. Etwa gleich große Anteile (31–38%) gaben an, Verhaltensweisen anderer Menschen oder in Institutionen erlebt zu haben, durch die sie belästigt oder benachteiligt wurden. Konkrete Benachteiligungen und Diskriminierungen im Zusammenhang mit der Behinderung/Beeinträchtigung gaben etwa die Hälfte der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen an und ein Drittel der Frauen der Haushaltsbefragung; gut ein Viertel der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen fühlten sich ungerecht behandelt. Ein Drittel der in vereinfachter Sprache Befragten gaben darüber hinaus an, dass keine Rücksicht auf sie genommen wurde, und 28%, dass sie schlecht behandelt wurden.
In allen oben genannten Themenbereichen der strukturierten Befragung wurden konkrete Erfahrungen offen nachgefragt, wenn die Frauen die jeweilige Frage bejaht haben. Von Frauen der Haushaltsbefragung, die sich in ihrer Freiheit oder ihren Entscheidungen eingeschränkt fühlten (28%), wurden in den offenen Nennungen am häufigsten räumliche Einschränkungen genannt, z.B. dass die Wohnung im 3. Stock nicht verlassen werden könne, das Haus nicht barrierefrei sei, die Wohnung zu eng oder zu wenig öffentliche Toiletten vorhanden seien. Für die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen, die sich in ihren Entscheidungen oder in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlten (42%), wurden dagegen Probleme in der Einrichtung am häufigsten als belastend beschrieben, z.B. interne Regeln im Haus, bevormundende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgezwungene Auseinandersetzungen mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern oder laute, volle Räume. Sie nannten außerdem individuelle Probleme aufgrund der Behinderung, z.B. körperliche Einschränkungen, Kontaktschwierigkeiten und finanzielle Einschränkungen.
Die 38% der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen, die Erfahrungen durch einschränkende Regeln und Bedingungen angaben, berichteten am häufigsten von Regeln in der Einrichtung, die sie als belastend empfinden, z.B. frühes Abendessen und Ins-Bett-Gehen, sich abmelden zu müssen, wenn das Haus verlassen wird, nicht gefragt werden oder mit allen gemeinsam weggehen zu müssen. Kritisch eingeschätzt wurden außerdem die Haltung und das Verhalten des Personals, das z.B. streng sei oder sie bevormunde. Hinzu kommen individuelle Reglementierungen, z.B. Vorschriften in Bezug auf Rauchen, Kaffeetrinken oder Besuch bei der Freundin bzw. beim Freund oder bei der Partnerin bzw. dem Partner. In ihren Entscheidungen eingeengt zu werden, stand für sie auch in einem Zusammenhang damit, dass sie sich nicht ernst genommen fühlten. Genannt wurden hier auch Einschränkungen durch das Leben in der Gruppe, z.B. der Lärm in der Gruppe oder Streit.
Ein Drittel der in Haushalten befragten Frauen hat die Wahrnehmung, dass ihnen im Zusammenhang mit ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung Hilfe vorenthalten oder ein Zuviel an Hilfe entgegengebracht werde. Sie erlebten das am häufigsten durch Ärztinnen bzw. Ärzte, Therapeutinnen bzw. Therapeuten oder in Einrichtungen des Gesundheitswesens, z.B. dass sie kein Rezept oder keine Kur bekämen, in der Klinik nicht gut informiert würden, ihr Problem nicht ernst genommen oder die Schwere ihrer Erkrankung nicht erkannt werde. Sie gaben an, dass ihnen Hilfe auch von Behörden, Gericht, Krankenkasse oder der Rentenversicherung vorenthalten werde, z.B. wurden falsche Auskünfte gegeben oder Leistungen seien vorenthalten oder abgelehnt worden. Auch von anderen Menschen sei ihnen nicht ausreichend geholfen worden, z.B. von Busfahrerinnen bzw. Busfahrern, Passantinnen bzw. Passanten, Mitmenschen, durch Touristinnen bzw. Touristen im Hotel oder beim Einkauf. Ein Zuviel an Hilfe haben sie am häufigsten erlebt durch Familienangehörige oder Partnerinnen bzw. Partner, z.B. von der Mutter, von Familie und Freundinnen bzw. Freunden, die sich zu viel Sorgen machten. Außerdem erteile das persönliche Umfeld ungebeten Ratschläge, Verwandte mischten sich ein, Kinder seien überbesorgt oder die Freundin oder der Freund „bemuttert“ zu sehr. Kritisiert wurden in diesem Zusammenhang auch Reaktionen auf die Behinderung, dass z.B. Hilfe aufgedrängt und „reingequatscht“ werde, wenn das Gegenüber meine, man brauche doch Hilfe oder wenn jeder etwas zur Krankheit sagen wolle. Zudem wurde auch ungefragt der Rollstuhl geschoben.
Von den 39% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen, die angaben, dass ihnen Hilfe vorenthalten oder ein Zuviel an Hilfe entgegengebracht worden sei, wurden folgende Situationen beschrieben: Sie gaben am häufigsten an, dass Familienangehörige, Freundinnen oder Freunde, das Personal und ihre Betreuerinnen oder Betreuer ihnen Hilfe vorenthielten. Außerdem kritisierten sie das soziale Klima gegenüber Menschen mit einer Beeinträchtigung, z.B. keine Unterstützung beim Einkaufen zu erhalten oder im Stich gelassen zu werden. Ein Zuviel an Hilfe haben auch sie eher von ihren Angehörigen und Freundinnen oder Freunden erfahren oder von Menschen aus dem sozialen Umfeld, die ungefragt Hilfe geleistet oder sie ihnen aufgedrängt hätten.
Von den in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen haben 36% über vorenthaltene oder ein Zuviel an Hilfe berichtet, aber nur wenige ihre Erfahrungen dazu genauer erläutert. Am häufigsten sprachen sie dabei eher allgemein über die Verweigerung von Hilfe, z.B. dass Betreuerinnen und Betreuer in der Einrichtung nicht helfen, wenn sie darum gebeten werden. Ein Zuviel an Hilfe lag für sie vor allem darin, dass sie in ihrer Selbstständigkeit beschränkt würden und sich mehr Selbstständigkeit wünschten; die Betreuungssituation wird teilweise als bedrückend beschrieben, vor allem in Bezug auf die Einschränkung in ihren freien Entscheidungen.
31% der in Haushalten befragten Frauen, 38% der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache und ein Drittel (33%) der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen gaben in der strukturierten Befragung sonstige Verhaltensweisen von Menschen oder Institutionen an, durch die sie belästigt, bevormundet oder benachteiligt wurden. Sie beschrieben dabei häufig Erfahrungen von Diskriminierung, Bevormundung und Grenzverletzungen im Bereich medizinischer oder pflegerischer Handlungen oder durch Ämter und Behörden.
Die in Haushalten lebenden Frauen nannten hier am häufigsten negative Erfahrungen mit Behörden, Versicherungen oder Gerichten, z.B. die langsame Bearbeitung von Anträgen (Bürokratie) oder die unsachgemäße Vermittlung von Arbeitsstellen durch die Agentur für Arbeit, die aufgrund der Beeinträchtigung nicht angenommen werden könnten, oder dass die Krankenkasse die durchgehenden Behandlungen verweigere. Fast ebenso häufig wurden negative Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten oder in Einrichtungen des Gesundheitswesens oder Pflegeeinrichtungen beschrieben. Frauen fühlten sich zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten nicht ausreichend ernst genommen, diese würden die Krankheit nicht erkennen oder spielten die Beeinträchtigungen herunter, verordneten zwangsweise Medikation oder unterstellten der Frau mangelnde Mitarbeit. Die Frauen der Haushaltsbefragung berichteten in diesem Zusammenhang auch von einer abwertenden Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte an Kliniken und von der unerwünschten Pflege durch männliche Pflegekräfte, obwohl eine weibliche Kraft gewünscht worden sei. Auch Probleme von Diskriminierungen im Erwerbsleben wurden genannt, z.B. dass eine Schwerhörigkeit an der Arbeitsstelle ignoriert, die Befragte aufgrund des Leistungsabfalls wegen der Erkrankung gemobbt oder eine andere berufliche Benachteiligung erfahren wurde.
Die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen, die zu 38% belästigende, bevormundende oder benachteiligende Verhaltensweisen von anderen Menschen oder in Institutionen angegeben haben, benannten am häufigsten Probleme in Einrichtungen. Sie beschrieben hier Probleme mit Personal und Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohnern, die sie als bevormundend oder grenzverletzend erlebten, des Weiteren Betreuerinnen und Betreuer, die sie vernachlässigten, oder Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die ihnen ungewünscht nahetreten und sie ungebeten küssen wollten. Darüber hinaus kleideten sie Erfahrungen von Bevormundung und Grenzverletzungen in allgemeine Aussagen, z.B. hinsichtlich des Verhaltens anderer Menschen, deren Einstellung manchmal nicht stimme, oder dass Jugendliche sie auf der Straße „blöd anquatschen“. Einzelne Frauen erlebten Bevormundungen oder Grenzverletzungen in der medizinischen und pflegerischen Versorgung und fühlten sich zudem von ihren gesetzlichen Betreuungspersonen bevormundet.
Die Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache beschrieben in ihren offenen Antworten zu Bevormundungen und Grenzverletzungen (33%) am häufigsten Probleme im Zusammenleben in der Einrichtung: Es sei zu laut, Türen knallten, es gebe Streit mit anderen, Beleidigungen und Belästigung, jemand komme ungefragt ins Zimmer. Die Probleme gingen von Einzelnen aus (Frauen und Männern) oder von mehreren Personen. Außerdem wurden verschiedene Probleme bei der Ärztin bzw. beim Arzt beschrieben, die sie als grenzverletzend oder bevormundend erlebten, z.B. die Wartesituation, Spritzen zu bekommen, sich vor jungen Ärzten auszuziehen oder gynäkologische Untersuchungen.
Im Hinblick auf konkrete Benachteiligungen und Diskriminierungen, die von etwas mehr als einem Drittel der Frauen der Haushaltsbefragung (34%), gut jeder vierten der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frau (27%) und von fast jeder zweiten in einer Einrichtung in allgemeiner Sprache befragten Frau (48%) angegeben wurden, beschrieben die Frauen ebenfalls vielfältige Situationen. Die Frauen der Haushaltsbefragung nannten hier am häufigsten Benachteiligungen und Diskriminierungen im Hinblick darauf, für dumm gehalten, nicht ernst genommen oder lächerlich gemacht zu werden. Sie beschrieben Situationen, in denen bei Anfällen über sie gelästert wurde, sowie dumme Sprüche, Beleidigungen und Diskriminierung wegen Übergewicht und Knieproblemen. Außerdem erlebten sie in diesem Zusammenhang merkwürdige Blicke, eigenartiges Verhalten oder zu viel Neugierde von anderen Menschen als diskriminierend. Des Weiteren wurden abwertende Kommentare von fremden Menschen genannt, Hänseleien durch Kinder und „Nazisprüche“. Einige Frauen berichteten, dass viele Menschen den Kontakt zu ihnen scheuten oder auch die Krankheit nicht anerkennen würden, da sie für andere Menschen nicht sichtbar sei. Einige Frauen nannten auch Diskriminierungen, die sie im Erwerbsleben erfahren haben, z.B. dass das Outen der Beeinträchtigung laufbahnschädigend gewesen sei, die Kolleginnen und Kollegen sie manchmal als minderwertig beurteilt hätten oder dass bei der Jobsuche eine Bewerbung mit Behindertenausweis von Nachteil sei.
Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache haben, wie die in Haushalten befragten Frauen, in ihren Erläuterungen zu dieser Frage am häufigsten Benachteiligung und Diskriminierung durch fremde Menschen benannt oder sie in allgemeine Aussagen gekleidet, z.B. „blöde Sprüche“ von Unbekannten oder außerhalb der Einrichtung dumm angesehen zu werden. Einzelne Frauen berichteten, in der Einrichtung durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner und Personal diskriminiert, beschimpft und gequält worden zu sein.
Frauen, die in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragt wurden und sich ungerecht behandelt fühlten (33%), schilderten am häufigsten Episoden sowie allgemeine Gefühle von Ungerechtigkeit durch Betreuerinnen bzw. Betreuer und Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner. Eine kleinere Gruppe berichtete, als Kind von der Mutter oder dem Vater geschlagen worden zu sein. Auch körperliche Übergriffe in der Einrichtung, in der Werkstatt oder von der Freundin bzw. vom Freund wurden hier berichtet.
Abschließend wurden die Frauen in einer offenen Frage nach anderen, noch nicht aufgeführten unangenehmen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Behinderung oder Beeinträchtigung gefragt. Ein Drittel der Frauen, die in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden, und 28% der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen[115] haben entsprechende weitere Erfahrungen angegeben. Frauen der Haushaltsbefragung berichteten in ihren Erläuterungen am häufigsten von einer respektlosen, unhöflichen und unfreundlichen Behandlung, „blöden“ Sprüchen, Beschimpfung, Entmündigung und Bevormundung. An zweiter Stelle wurde die gesellschaftliche Haltung gegenüber Krankheit, Beeinträchtigung oder Behinderung thematisiert, z.B. die mangelnde Akzeptanz, das fehlende Verständnis und Wissen oder fehlende Rücksichtnahme, z.B. auf Schwerhörigkeit. Viele Menschen könnten mit der Krankheit nicht umgehen oder unterstellten, dass man Kranksein spiele; so sei eine Frau z.B. im Krankenhaus als Simulantin betrachtet worden. Menschen nähmen außerdem Abstand und hätten Angst vor Krankheiten. Auch in diesem Abschnitt gibt es wieder Einzelaussagen, in denen die Probleme in der Erwerbsarbeit angesprochen wurden, z.B. im Arbeitsbereich bevormundet zu werden, Mobbing im Job oder Gehässigkeit von Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen.
Die offenen Aussagen der Frauen, die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen zu diesem Themenbereich befragt wurden, waren vielfältig. Vier Problembereiche, die als unangenehm empfunden werden, wurden häufiger genannt: das Verhalten fremder Personen, Probleme in der Einrichtung, Kontaktprobleme und Ängste sowie das Verhalten von Angehörigen und Freundinnen oder Freunden.
Die Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache wurden ohne einen direkten Bezug zur Behinderung gefragt, ob sie schlecht behandelt worden seien. Am häufigsten nannten sie hier die ungerechte Behandlung von Eltern sowie körperliche Gewalt und sexuellen Missbrauch in der Kindheit, gefolgt von ungerechter Behandlung in der Einrichtung (in Bezug auf Wohnen und Arbeiten), Schlägen, übler Nachrede, Ausgrenzung und Beleidigungen. Einige wenige Frauen berichteten von einer schlechten Behandlung durch die (Ex-)Freundin bzw. den (Ex-)Freund oder im Krankenhaus.
Bezüglich der negativen Wahrnehmung der Bedingungen und Regeln, durch die die Frauen in ihrer Freiheit oder Entscheidung eingeschränkt sind, und dem Zuviel an Hilfe, die sie erhalten, gleichen sich die Angaben der in Einrichtungen in allgemeiner und in vereinfachter Sprache befragten Frauen. Hinsichtlich der Bewertungen von vorenthaltener Hilfe ähneln sich die Nennungen der Frauen der Haushaltsbefragung und der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache. Diese vermissen die Befragten ähnlich häufig von Angehörigen und Freundinnen bzw. Freunden sowie vom sozialen Umfeld.
Die Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache haben in fast allen Teilaspekten von Benachteiligung und Diskriminierung, die in der Fragesequenz thematisiert wurden, am häufigsten entsprechende Erfahrungen angegeben, fühlten sich also insgesamt stärker diskriminiert oder waren sensibler in Bezug auf die Wahrnehmung von Diskriminierung als die Frauen der beiden anderen Befragungsgruppen.
Im Themenbereich „Psychische Übergriffe“ (Modul 4) sind zwei weitere direkte Fragen zu Diskriminierung aufgrund von unterschiedlichen Merkmalen wie Alter, Herkunft, Geschlecht und Behinderung enthalten. Den Ergebnissen nach fühlte sich rund ein Fünftel der Frauen (20–22%) der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und Haushalten befragten Gruppen[116] wegen ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft benachteiligt. 15% der Frauen der Haushaltsbefragung und 32% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen stimmten darüber hinaus der Aussage zu, dass sie benachteiligt würden, ihnen Fähigkeiten abgesprochen oder sie schlecht behandelt würden, weil sie behindert oder beeinträchtigt sind (vgl. auch Kap. 3.3.2.1). Auch dieses Ergebnis verweist auf eine sensiblere Wahrnehmung von Diskriminierung und/oder höhere Betroffenheit der Frauen der Einrichtungsbefragung im Hinblick auf eine mit der Behinderung in Zusammenhang stehende Diskriminierung.[117]
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass fast alle Frauen in den drei Befragungsgruppen der vorliegenden repräsentativen Haushalts- und Einrichtungsbefragung unterschiedliche Diskriminierungen und Einschränkungen bzw. Grenzüberschreitungen im Kontext der Behinderungen erfahren haben. In ihren offenen Antworten haben sie über vielfältige Formen der erlebten Diskriminierung berichtet. Für die Frauen der Haushaltsbefragung waren die Reaktionen der Umwelt, sowohl der Angehörigen, Freundinnen bzw. Freunde und Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen als auch die gesellschaftliche Distanz zu Behinderung und Beeinträchtigung, am stärksten präsent. Außerdem erlebten sie viele diskriminierende Erfahrungen im Kontext der gesundheitlichen Versorgung. Die Frauen der Einrichtungsbefragungen empfanden vor allem das Leben in der Einrichtung, die Bevormundung durch Regeln und durch das Personal und damit verbunden die Einschränkung ihrer Entscheidungsmöglichkeiten als diskriminierend und beeinträchtigend.
Während die Interviewerinnen Frauen in Haushalten direkt erreichen konnten, musste für die Gewinnung von Interviewpartnerinnen in Einrichtungen das Personal um Vermittlung gebeten werden.[118] In Einzelfällen kam es dabei bereits zu einer Form der Diskriminierung, wenn die Leitung einer Einrichtung diese Mitwirkung ohne Angabe von Gründen ablehnte und damit den Frauen das Recht vorenthalten hat, sich für oder gegen die Mitwirkung an der Studie zu entscheiden.
In Artikel 19 der UN-BRK ist festgeschrieben, dass „Menschen mit Behinderung gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben“. Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe gelten als besondere Wohnformen. Die Frauen, die in Wohneinrichtungen erreicht wurden, wurden nicht gefragt, inwieweit sie sich selbst für diese Wohnform entschieden haben oder ob sie aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinderung von anderen, z.B. Angehörigen oder gesetzlichen Betreuungspersonen, zum Einzug überredet, gedrängt oder indirekt gezwungen wurden. In den Interviews wird aber die Unzufriedenheit vieler Frauen mit dem Leben in der Einrichtung sichtbar, was nahelegen könnte, dass ein Teil der Befragten nicht gerne und/oder nicht aufgrund einer eigenen Entscheidung in der Einrichtung lebt. In einer Wohneinrichtung zu leben, empfinden viele der befragten Frauen aus verschiedenen Gründen als Belastung bzw. als Benachteiligung. Das wurde in den Antworten auf die Fragen nach ihren Erfahrungen von Diskriminierung deutlich. Dazu trägt vor allem das Leben in größeren und nicht selbst gewählten Gruppenzusammenhängen bei. Vor allem Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache wohnen mehrheitlich in (größeren) Wohngruppen, überwiegend in solchen mit mehr als fünf Personen, während die Frauen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, nur zu etwa einem Drittel in Wohngruppen leben, die dann zumeist kleiner. Nicht alle Frauen in Einrichtungen haben ein Einzelzimmer (etwa ein Fünftel nicht), Bad und Toilette sind nicht immer abzuschließen. Bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen ist Letzteres noch seltener (ca. 60%) der Fall als bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen (ca. 80%). In beiden Gruppen hat die Mehrheit der Frauen keine Möglichkeit, ganz oder teilweise mitzubestimmen, mit wem sie zusammenwohnen wollen.[119]
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Grundsätzliche kulturelle Standards des Wohnens und der Lebensgestaltung, z.B. die Wahrung der Privatsphäre, sind in einer Einrichtung kaum zu verwirklichen. Von einer Benachteiligung der Frauen mit Behinderung oder Beeinträchtigung in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen kann bereits dann ausgegangen werden, wenn keine Möglichkeiten und Alternativen für die Wahl und Gestaltung der Wohnform, in der sie leben, bestehen. Trotz der Schwere ihrer Behinderung haben sie ein grundsätzliches Recht darauf – bei Bedarf mit Unterstützung und Pflege oder persönlicher Assistenz – selbstständig leben zu können und das Zusammenleben mit anderen nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Drei Viertel der Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache sind eher zufrieden mit ihrer Wohnsituation und drücken damit eine größere Zufriedenheit mit der Wohnsituation aus als die Frauen der beiden anderen Befragungsgruppen (69% vs. 57%). Etwa ein Viertel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen und gut 40% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen sind weniger zufrieden mit der aktuellen Wohnsituation.
Nach den Erfahrungen von Expertinnen und Experten aus Praxis und Forschung in Bezug auf die Befragung von Frauen mit einer sogenannten geistigen Behinderung[120] sind die Frauen, die in Wohnheimen leben, schwerer behindert und verfügen in der Regel über weniger Reflexionsvermögen als Frauen mit einer geistigen Behinderung in Privathaushalten. Wenn Frauen aus einem Elternhaus kommen, in dem ihre Integration und die gesellschaftliche Teilhabe Ziel der Erziehung waren, hatten sie bessere Chancen, ihr Potenzial zu entfalten. Auch die Arbeit in den Werkstätten, die eigentlich ein besonderes Beschäftigungsverhältnis sein sollte, heute aber für Menschen mit einer geistigen Behinderung als Standard gilt, wird mitunter als nicht unbedingt förderlich für die persönliche Entwicklung eingeschätzt. Die dort beschäftigten Frauen und Männer seien weitgehend unter sich. Hinzu komme, dass die Wirklichkeit der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung durch die gesellschaftliche Konstruktion „geistige Behinderung“ strukturiert werde. Der hohe Grad an Zufriedenheit mit der Wohnsituation kann auch darin begründet sein, dass die Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache ein selbstständiges Leben außerhalb der Einrichtung nicht kennen und/oder sich entsprechende Alternativen nicht vorstellen können und daher eher zufrieden sind. Die andere Gruppe der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen dagegen hat vor ihrer Erkrankung und Behinderung häufiger selbstständig gelebt und ist vielleicht deswegen mit ihrer Wohnsituation in einer Einrichtung unzufriedener.
Durchschnittlich sind, wie eine Sonderauswertung der Mikrozensusdaten aufzeigte, fast 60% der weiblichen Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland verheiratet, Frauen mit Behindertenausweis in dieser Altersgruppe allerdings weniger häufig als Frauen ohne Behinderung.[121] Im Mikrozensus sind allerdings regelmäßig die Frauen, die in Einrichtungen leben, aber auch Frauen mit Beeinträchtigungen ohne Behindertenausweis unterrepräsentiert, sodass die Ergebnisse des Mikrozensus sich nur auf einen Teil der Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, die in Haushalten leben, beziehen. Im Rahmen der vorliegenden Befragung, bei der ein breiterer Ausschnitt von Frauen mit Behinderungen erreicht wurde, zeigt sich im Vergleich mit der Frauenstudie 2004, dass behinderte Frauen der Haushaltsbefragung in etwa gleich häufig wie der Bevölkerungsdurchschnitt verheiratet sind. Frauen der beiden Gruppen der Einrichtungsbefragung sind demgegenüber deutlich seltener verheiratet und leben seltener aktuell in Paarbeziehungen. Die Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache waren gegenüber den Frauen in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, häufiger schon einmal verheiratet, leben aber aktuell noch seltener in einer Partnerschaft. Sie haben häufiger Kinder als die Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache, die mit nur 6% sehr selten eigene Kinder haben.
Abbildung 29. Diagramm 29: Partnerschaft und Kinder
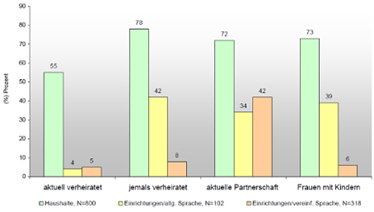
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie werden die Aussagen aus anderen Studien zur Benachteiligung von Frauen, die in Einrichtungen leben, eindrücklich belegt.[122] Nach wie vor können Frauen, die in Wohneinrichtungen leben, weit überwiegend weder eine aktuelle Partnerschaft noch einen Kinderwunsch realisieren. Der Unterschied zwischen den Frauen in Einrichtungen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, und den Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache in Bezug auf Kinder bzw. Kinderlosigkeit ist vermutlich mit in der Art bzw. dem Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung begründet. Letztere werden oftmals bereits als Kinder oder Jugendliche als geistig behindert wahrgenommen. Ihnen wird eine selbstbestimmte Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft von vornherein nicht zugestanden bzw. nicht zugetraut.[123] Dagegen tritt die psychische Erkrankung und die damit verbundene Beeinträchtigung, aufgrund derer die meisten Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache in einer Wohneinrichtung leben[124], oft erst im späteren Lebensverlauf auf, sodass sie noch häufiger bereits vorher Familien gegründet und Kinder erzogen haben. Der im Vergleich zu den Frauen der Haushaltsbefragung niedrige Anteil an jemals verheirateten Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache kann darin begründet sein, dass für sie wegen eines im Lebensverlauf relativ frühen Beginns ihrer Erkrankung eine Eheschließung schwierig war; er kann aber auch mit anderen psychischen und sozialen Belastungen in Zusammenhang stehen, die einer dauerhaften vertrauensvollen Bindung an andere Menschen im Wege stehen. Gleichzeitig werden vermutlich verheiratete Frauen, die mit ihrer Ehepartnerin bzw. ihrem Ehepartner noch zusammenleben, bei einer psychischen Erkrankung oder Behinderung weniger häufig dauerhaft in einer Einrichtung untergebracht, sondern eher auf ambulante psychiatrische Angebote verwiesen. Das könnte ein Grund dafür sein, dass in den Einrichtungen häufiger ledige Frauen leben, die ohne verbindliche Einbindung in ein soziales Netz auf die institutionelle professionelle Hilfe angewiesen sind. Zugleich ist es durchaus möglich, dass psychisch erkrankte Frauen aufgrund ihrer hoch belastenden biografischen Vorerfahrungen, unter anderem mit Gewalt und Vernachlässigung in ihren Herkunftsfamilien (siehe auch 3.3.1) und auch späteren sozialen Beziehungen (3.3.2), seltener enge Verbindungen mit einer Partnerin oder einem Partner eingegangen sind, die zur Heirat führen.
Während fast alle Frauen der Haushaltsbefragung und drei Viertel der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache sexuelle Erfahrungen gemacht haben, waren nur 37% der Frauen in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, jemals sexuell aktiv. Umso überraschender ist, dass sie etwa gleich häufig wie die Frauen der Haushaltsbefragung angaben, sterilisiert worden zu sein. Auch die Quote der Schwangerschaftsabbrüche und vor allem die Quote der Einnahme von Kontrazeptiva sind vor diesem Hintergrund überraschend hoch. Die hohe Kinderlosigkeit der Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache scheint daher vor allem der Kombination von häufiger sexueller Abstinenz, relativ häufiger Gabe von Kontrazeptiva, der Sterilisation und des bei der geringen Anzahl an Schwangerschaften relativ häufigen Schwangerschaftsabbruchs geschuldet zu sein. Offensichtlich scheinen Familiengründungen bei Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen weder vorgesehen noch gewünscht zu sein, geschweige denn gefördert zu werden. Offenbar sind die Unterstützungskonzepte und die räumlichen Bedingungen der Einrichtungen vielfach nicht darauf ausgelegt, Partnerschaft und Familie realisieren zu können.
Abbildung 30. Diagramm 30: Sexualität und Reproduktion
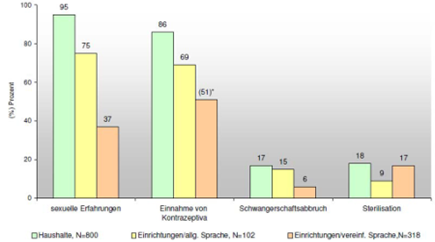
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. *Wert nicht direkt vergleichbar. Bezieht sich auf nicht sterilisierte Frauen, die diese Frage gestellt bekamen (N=263), aufgrund von Filterung im Fragebogen in vereinfachter Sprache. Von diesen Frauen gaben 51% an, aktuell oder früher Kontrazeptiva erhalten zu haben, 35% hatten nie Kontrazeptiva erhalten und weitere 15% wussten dies nicht oder haben dazu keine Angaben gemacht. Aufgrund eines Übertragungsfehlers der Daten bei der Diagrammerstellung waren hierzu in der ersten Auflage der Broschüre/Kurzfassung andere Werte angegeben worden.
Artikel 23 der UN-BRK, der „das Recht der Menschen mit Behinderung im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen“ enthält und das „Recht auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder“, ist für Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen, die in Einrichtungen leben, demnach nicht eingelöst. Auch die gesetzliche Betreuung, die für 76% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen besteht, scheint daran nichts zu ändern, obwohl diese, wie in Artikel 12 der UN-BRK verlangt, Menschen mit Behinderungen in der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit unterstützen sollen.
Nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2005 ist das schulische Bildungsniveau von Frauen mit Behinderung niedriger als das der nichtbehinderten Frauen.[125] Die Differenzierung nach Frauen mit Behinderungen in Haushalten und solche, die in Einrichtungen leben, weisen der vorliegenden Studie nach deutliche Bildungsunterschiede auf. Das Bildungsniveau der Frauen der Haushaltsbefragung entspricht in etwa dem der Frauen der repräsentativen Frauenstudie von 2004 (auf etwas niedrigerem Niveau), ist aber deutlich höher als das der Frauen der Einrichtungsbefragung. Das lässt sich insbesondere bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen nicht ausschließlich auf deren Erkrankung oder Behinderung bzw. auf das Leben in der Einrichtung zurückführen. Denn bis auf schizophrene Erkrankungen im Jugendalter oder Suchterkrankungen (Drogen) im frühen Erwachsenenalter treten psychische Erkrankungen häufiger erst nach Abschluss von Schule und Ausbildung auf. Zwar haben 49% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen der vorliegenden Studie eine Behinderung von Geburt an oder in Kindheit und Jugend angegeben. Aus den Daten ist aber nicht zu erkennen, inwieweit es sich dabei um die Erkrankung handelt, die der Grund für ihr Wohnen in einer Einrichtung war. Gleichwohl können sie in ihrer schulischen Bildungsphase durch die Behinderung bereits beeinträchtigt gewesen sein, sodass sie in Bezug auf ihre Bildungschancen im Nachteil waren.
Der hohe Anteil der Frauen ohne qualifizierten Schulabschluss in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden (75%, s. Tabelle 6 in Kapitel 3.1.4), ist nicht überraschend, denn der Abschluss einer Sonder- oder Förderschule gilt in Deutschland nicht als Schulabschluss. Allein das kann aber bereits als Benachteiligung gewertet werden. Denn wenn in diesen Schulen die Kinder und Jugendlichen mit Lernbehinderung ausdrücklich gefördert werden sollen, müsste der Abschluss einer Sonder- oder Förderschule als Schulabschluss anerkannt werden und für den weiteren Lebensweg verwertbar sein.
Die Verteilung der Frauen nach ihrem Schulabschluss ist ein Hinweis auf die Bildungsbenachteiligung der Frauen, die in einer Wohneinrichtung der Behindertenhilfe leben. Vor allem die Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache scheinen schulisch nicht ausreichend gefördert worden zu sein, da die meisten von ihnen ohne einen anerkannten Schulabschluss die Schule verlassen haben.
In der UN-BRK sind in Artikel 24 umfangreiche Anforderungen an ein inklusives Bildungssystem formuliert, in dem Menschen mit Behinderung ihr Recht auf Bildung „ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit“ verwirklichen können.
Grundlegende Voraussetzung für eine Berufsausbildung ist ein dafür verwertbarer Schulabschluss. Die Frauen der Haushaltsbefragung haben ähnlich häufig keinen Berufsabschluss wie die Frauen in der repräsentativen Befragung von 2004, entsprechen also dem Durchschnitt der weiblichen Bevölkerung im Alter von 16 bis 65 Jahren. Die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen haben allerdings deutlich seltener eine qualifizierte Berufsausbildung oder eine Fachhochschule/Hochschule abgeschlossen als die Frauen der Haushaltsbefragung und der Frauenstudie 2004. Diese Ungleichverteilung könnte ebenfalls begründet sein im Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung. Möglicherweise hat die Erkrankung oder Behinderung bereits als eine Störung in der Ausbildungsphase gewirkt. Sie könnte auch durch die Gewalt- und belastenden Kindheitserfahrungen der Frauen mit beeinflusst sein.
Schon der Anteil der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist mit 49% Prozent deutlich höher als der der Frauen der Haushaltsbefragung (19%). Die Frauen in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, haben in der überwiegenden Mehrheit (zu 79%) keine anerkannte Berufsausbildung. Die Defizite in der Berufsausbildung könnten möglicherweise auch als eine Fortschreibung einer unzureichenden schulischen Förderung betrachtet werden. Die Folge der sogenannten geistigen Behinderungen dieser Frauen scheint ihre weitgehende Ausgrenzung aus dem allgemeinbildenden Schulsystem und aus anerkannten Ausbildungsgängen zu sein. Bisher fehlt es noch an eigenen Schul- und Ausbildungswegen, in denen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihr Potenzial entfalten können und deren Abschlüsse entsprechend anerkannt und auch auf dem ersten Arbeitsmarkt verwertbar sind.
Die Frauen der Haushaltsbefragung sind nur geringfügig seltener erwerbstätig als die Frauen der repräsentativen Frauenstudie 2004 (49% vs. 57%), sie sind aber insgesamt weniger häufig in Vollzeit erwerbstätig als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (18% vs. 31%). Die Frauen aus den beiden Gruppen der Einrichtungsbefragung, die in einer WfbM tätig sind, arbeiten dort vermutlich eher den ganzen Tag.
Das relativ hohe Niveau der Beschäftigung der Frauen der Einrichtungsbefragung (50–88%) ist darin begründet, dass sie häufig in einer WfbM arbeiten. Die gegenüber den Frauen der Haushaltsbefragung und den Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache deutlich höhere Beschäftigungsquote der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen liegt ebenfalls darin begründet. Aufgrund der Schwere ihrer Behinderung haben sie einen Rechtsanspruch auf Beschäftigung in einer WfbM, wenn sie „in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.“[126] Das bedeutet, dass auch eine relativ große Gruppe der Frauen der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache (44%) in ihrer Erwerbsfähigkeit so stark beeinträchtigt ist, dass sie einen Beschäftigungsanspruch in einer WfbM hat.
Abbildung 32. Diagramm 32: Erwerbstätigkeit und Einkommen im Vergleich
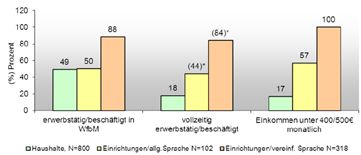
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen. *Frauen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen wurden als in Vollzeit erwerbstätig eingestuft.
Ein zweiter wichtiger Aspekt, der im Zusammenhang mit Diskriminierung und Verletzung von Menschenrechten im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention relevant ist, bezieht sich auf eine ausreichende finanzielle Absicherung, die bei einem erheblichen Teil der Befragten der vorliegenden Studie nach eigener Einschätzung nicht gegeben zu sein scheint.
Nach SGB IX ist die WfbM eine „Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben“. Sie hat selbst Leistungen zur beruflichen Bildung und Beschäftigung anzubieten und bei Eignung durch geeignete Maßnahmen den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Insofern wäre die Beschäftigung in einer WfbM nicht per se eine Benachteiligung. Allerdings scheint mit der Beschäftigung in der WfbM nicht das in Artikel 27 der UN-BRK formulierte Recht auf „die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen“, erfüllt werden zu können. Denn gegenwärtig erhalten die Frauen aus beiden Gruppen der Einrichtungsbefragung entsprechend der gesetzlichen Regelung in SGB IX ein Arbeitsentgelt, das geringer als 400€ im Monat ist. Die Beschäftigung in der WfbM garantiert zwar den Kranken- und Rentenversicherungsschutz, aber wegen der besonderen gesetzlich normierten Art der Entgeltregelung[127] nicht ein existenzsicherndes Einkommen als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Denn die Kosten für das Leben in einer Einrichtung der Behindertenhilfe einschließlich der Betreuung durch professionelles Personal werden von den Trägern der Sozialhilfe aus Steuermitteln finanziert.
Im Unterschied zu den Frauen der Haushaltsbefragung und den Frauen in Einrichtungen, die in allgemeiner Sprache befragt wurden, konnten oder wollten mehr als 50% der Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache die Frage nach der Höhe ihres Einkommens nicht beantworten. Expertinnen und Experten in Bezug auf die Befragung von Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen, die in der Vorbereitung der Studie konsultiert worden waren, hatten aufgrund ihrer Erfahrungen vermutet, dass diese Frauen Kenntnisdefizite in Bezug auf ihr Einkommen haben. Nach ihrer Einschätzung könnte das als ein Hinweis auf die Arbeit der Einrichtungen gewertet werden, in denen Frauen nicht ausreichend über ihre finanzielle Situation informiert und sie dadurch in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Auch nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie konnten nur zwei Drittel der Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache über ihr Geld selbst bestimmen, ein Viertel konnte das nicht.[128] Auf die Fragen „Was für ein Einkommen haben Sie? Woher bekommen Sie Ihr Geld?“ gaben 19% „Weiß nicht“ an und weitere 12% machten keine Angabe. Auch die Frage zur Einkommenshöhe konnten/wollten 55% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen (vs. 24% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen und 13% der in Haushalten lebenden Frauen) nicht beantworten. Demnach hat etwa jede zweite bis dritte in vereinfachter Sprache befragte Frau in Einrichtungen kaum Kenntnis über Zusammensetzung und Höhe der eigenen Einkünfte.
Das hohe Ausmaß der Angst vor finanzieller Not und Existenzverlust verweist ebenfalls auf eine Form von struktureller Diskriminierung. Sie ist als eine zentrale Form der Bedrohung und strukturellen Diskriminierung zu werten, mit denen viele Befragte dieser Studie konfrontiert sind.
Am häufigsten fürchten sich die Frauen in Haushalten vor zunehmender Abhängigkeit, finanzieller Not und Existenzverlust und/oder der Verschlechterung ihrer Gesundheit. Auch für etwa jede dritte bis vierte in einer Einrichtung in allgemeiner oder vereinfachter Sprache befragte Frau spielte die Angst vor finanzieller Not eine Rolle.
Für die vergleichende Betrachtung der sozialen Beziehungen und der Freizeitaktivitäten der Frauen werden die bereits in Kap. 3.1 ausgewerteten Ergebnisse herangezogen, die sich auf die Häufigkeit unterschiedlicher Freizeitaktivitäten und der Verwandten-/Bekanntenbesuche zu Hause beziehen, auf die Integration in das Wohnumfeld und das Vorhandensein von Kontaktpersonen, die bei Problemen angesprochen werden können, sowie auf die subjektive positive/negative Einschätzung der eigenen Beziehungsnetze im engsten sozialen Umfeld. Diskriminierungsrelevant wäre dabei, wenn Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in geringerem Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten und sozial stärker isoliert wären als andere Bevölkerungsgruppen.
Wenn das Freizeitverhalten der Frauen, die in der repräsentativen Frauenstudie 2004 befragt wurden, als gesellschaftlich durchschnittliches Freizeitverhalten von Frauen ab 16 Jahren in Deutschland angenommen wird, dann entsprechen die Frauen der Haushaltsbefragung der vorliegenden Studie in der Tendenz diesem Durchschnitt. Sie besuchen etwa gleich häufig Freundinnen bzw. Freunde, Verwandte und Bekannte und arbeiten in Organisationen wie Kirchen und Vereinen mit; auch kulturelle Veranstaltungen wie Kino, Theater und andere Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten außer Haus unternehmen sie nicht seltener. Die in Haushalten lebenden Frauen scheinen demnach hinsichtlich der Teilhabe an außerhäuslichen Freizeitaktivitäten sozial integriert zu sein. Frauen aus den beiden Einrichtungsgruppen arbeiten dagegen seltener in Organisationen mit, nehmen weniger häufig an kulturellen Veranstaltungen teil und treiben weniger häufig außerhäuslich Sport, wobei die in vereinfachter Sprache befragten Frauen hier teilweise noch geringere Werte aufweisen als die in allgemeiner Sprache befragten Frauen. Die Ergebnisse verweisen auf eine geringere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei den in Einrichtungen lebenden Frauen. Darüber hinaus hatten die Frauen, die in Einrichtungen leben, in den Fragen zu subjektiv erlebten Diskriminierungen und Benachteiligungen die Einschränkungen durch Regeln und institutionelle Abläufe kritisiert, auch im Hinblick auf Beschränkungen im selbstständig organisierten Freizeitverhalten.
Ein weiterer Aspekt sind die Unterschiede in den Möglichkeiten, soziale Beziehungen auch im eigenen Wohnbereich zu pflegen. Auf die Schwierigkeiten, Paar- und Familienbeziehungen in Einrichtungen zu leben, wurde bereits weiter oben eingegangen. Darüber hinaus ergaben die Auswertungen der vorliegenden Studie, dass Frauen, die in Einrichtungen leben, deutlich seltener Besuch von Nachbarinnen und Nachbarn, Verwandten und Freundinnen bzw. Freunden erhalten als Frauen, die in Haushalten leben, und Frauen der Frauenstudie 2004. Während über 80% der in Haushalten lebenden Frauen angaben, häufig oder gelegentlich zu Hause besucht zu werden, traf dies auf 50–70% der in Einrichtungen lebenden Frauen zu. Dies kann zum einen eine Folge des geringeren Maßes an fortbestehenden familiären und freundschaftlichen Kontakten mit Personen außerhalb der Einrichtungen sein. Es dürfte zum anderen aber auch auf die Wohnform selbst zurückzuführen sein, weil das Wohnen in Einrichtungen auch räumlich nur eingeschränkte Möglichkeiten für eine Privat- und Intimsphäre belässt und sich dadurch Freundschaften und soziale Beziehungen stärker auf Personen innerhalb des Wohnheims und der Werkstätten beschränken.
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Im Sinne der allgemeinen Grundsätze in Artikel 3 der UN-BRK, zu denen auch „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ gehört, kann die Erschwerung sozialer Beziehungen, die mit dem Wohnen in einer Einrichtung vielfachverbunden ist, als eine Form der Benachteiligung gewertet werden. Die Ungleichverteilung in Bezug auf Freizeitaktivitäten und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie die Pflege von Beziehungen mit Menschen außerhalb der Wohnheime zwischen den in Haushalten lebenden Frauen mit und ohne Behinderungen einerseits und den Frauen der Einrichtungsbefragung andererseits kann ein Hinweis auf eine objektive Benachteiligung durch die Wohnsituation mit den daran geknüpften Lebensbedingungen sein. Auch Einschränkungen in der selbstbestimmten Wahl von Freizeitaktivitäten und Beziehungen sind ein Indikator für Defizite in der „gleichberechtigten Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“, die in Artikel 30 der UN-BRK festgeschrieben sind.
Ein weiterer relevanter Aspekt im Zusammenhang mit der sozialen Integration von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die in Einrichtungen leben, ist das Wohnumfeld der Einrichtungen. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Frauen, die in einer Einrichtung leben, haben die Frage, ob sie in einer Wohngegend leben, in der die Menschen sich kennen und sich helfen, bejaht, deutlich weniger als die Frauen der Haushaltsbefragung, die dies zu gut drei Viertel angaben. Außerdem fühlen sie sich nach eigenen Angaben weniger häufig wohl und sicher in ihrer Wohngegend (70–75% vs. 88% der Frauen der Haushaltsbefragung). Die Übereinstimmung zwischen den beiden Gruppen der Einrichtungsbefragung in dieser Einschätzung kann als Indiz gewertet werden, dass Frauen, die in Einrichtungen leben, weniger gut in ihr Wohnumfeld integriert sind als Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die in Haushalten leben. Abhängig ist die Bewertung vermutlich auch von bedrohlichen Erfahrungen und antizipierten Ängsten im Wohnumfeld bzw. von der Qualität der Erfahrungen mit Nachbarinnen und Nachbarn der Einrichtung. Unabhängig von der je individuellen Kontakt- und Beziehungskompetenz der behinderten Frauen scheint sich das Leben in einer Einrichtung benachteiligend auch in Bezug auf die Integration in das Wohnumfeld auszuwirken.
Basis: Alle befragten Frauen. Mehrfachnennungen.
Ein ebenfalls hoch relevanter Aspekt im Hinblick auf die soziale Integration von Frauen mit Behinderungen ist die Einbindung in enge soziale Beziehungsnetze, die ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit und Zufriedenheit von Menschen ist. In den Aussagen der Frauen im Hinblick auf ihre derzeitigen sozialen Beziehungen und das Vorhandensein von engen, vertrauten Personen, mit denen Probleme besprochen werden können, wurde ein weiterer Hinweis auf ein erhöhtes Maß an sozialer Isolation bei den in Einrichtungen lebenden Frauen, aber auch bei den Frauen der Haushaltsbefragung gefunden (vgl. auch Kap. 3.1.8). Nicht nur haben die Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen – insbesondere jene, die in Einrichtungen leben – seltener Vertrauenspersonen, mit denen sie persönliche Probleme besprechen können. Sie schätzen zudem auch das Vorhandensein und die Qualität der eigenen sozialen Beziehungen negativer ein und benennen Defizite im Hinblick auf das Eingebundensein in soziale Netze, die Geborgenheit und emotionales Aufgehobensein vermitteln.
Im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 gaben alle in der Studie befragten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen deutlich häufiger an, enge und vertrauensvolle Beziehungen zu vermissen, die Wärme, Geborgenheit und Wohlgefühl vermitteln. Im Vergleich zur Frauenstudie 2004 stimmten zwei- bis viermal mehr Frauen der vorliegenden Studie Aussagen zu wie: „Ich vermisse Leute, bei denen ich mich wohlfühle“, „Mir fehlt eine richtig gute Freundin bzw. ein richtig guter Freund“, „Ich vermisse Geborgenheit und Wärme“ oder „Ich fühle mich häufig im Stich gelassen“. Auch hiervon waren die in Einrichtungen lebenden Frauen mit Abstand am häufigsten betroffen. Zusammengenommen lässt sich feststellen, dass sich bei etwa einem Drittel der in Haushalten lebenden Frauen und bei etwa jeder zweiten bis dritten in einer Einrichtung lebenden Frau Probleme im Hinblick auf die Qualität sozialer Beziehungen und die Integration in soziale Netzwerke zeigen.
Die Ursachen dieser Probleme können einerseits mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen und (Gewalt-)Belastungen in Zusammenhang gebracht werden, die das Vertrauen in enge soziale Beziehungen beeinträchtigen. Sie können zugleich aber auch mit der Wohnform sowie mit den von den Frauen in den Diskriminierungsfragen bereits beschriebenen gesellschaftlich geprägten Reaktionen auf Menschen mit Behinderungen und Erkrankungen in Verbindung gebracht werden, die sich unter anderem in Form von Distanzierungen, mangelndem Einfühlungsvermögen und unzureichendem Respekt gegenüber erkrankten und behinderten Menschen in ihren Alltags-, Freundes- und Familienbeziehungen äußern. In dieser Hinsicht ginge es aus menschenrechtlicher und gesellschaftspolitischer Perspektive auch darum, Vorurteile und soziale Distanz gegenüber Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen gezielt in allen Bereichen der Gesellschaft abzubauen und Menschen mit Behinderungen tatsächlich auch im Rahmen verlässlicher und vertrauensvoller persönlicher Beziehungen aktiv zu integrieren.
Frauen der vorliegenden Studie sind deutlich häufiger als Frauen der Frauenstudie 2004 bei nur einem leiblichen Elternteil aufgewachsen; das traf auf 21% der in allgemeiner Sprache in Haushalten und in Einrichtungen befragten Frauen zu und mit 51% mehr als doppelt so häufig auf die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen (vs.11% der Frauen der Frauenstudie 2004). Darüber hinaus waren Frauen der Einrichtungsbefragung in vereinfachter Sprache im Vergleich zu den anderen Befragungsgruppen häufiger teilweise/überwiegend im Heim aufgewachsen (zu 16% vs. 8% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und 1% der in Haushalten befragten Frauen). Eine statistisch ermittelte Ungleichverteilung der Befragungsgruppen in Bezug auf den Ort und das soziale Umfeld ihrer Kindheit und Jugend ist in der vorliegenden Studie im Vergleich mit der Frauenstudie 2004, aber auch mit den anderen Befragungsgruppen der vorliegenden Studie deutlich zu erkennen. Allerdings sind die Gründe dafür aus den Daten nicht zu ermitteln. Die Frage, inwieweit das Ergebnis als ein Hinweis auf eine strukturelle Diskriminierung gewertet werden kann, muss daher hier offenbleiben. Gleichwohl wäre in weiteren Recherchen zu prüfen, ob der hohe Anteil von Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen, die bei nur einem leiblichen Elternteil oder in Heimen aufgewachsen sind, auch mit der Überforderung und mangelnden Unterstützung ihrer Eltern in einem Zusammenhang steht sowie möglicherweise auch mit auf einem von Vorurteilen geprägten sozialen Umfeld.
Die Ergebnisse zu den Gewalterfahrungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen (Kap. 3.3) verweisen einerseits darauf, dass die bereits in Kindheit und Jugend stark erhöhten Gewaltbetroffenheiten durch psychische, körperliche und vor allem sexuelle Gewalt, die sich oftmals im Lebensverlauf in unterschiedlichen Formen und sozialen Kontexten fortsetzen, mit zu den Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Frauen beigetragen haben können. Andererseits wird in der Studie sichtbar, dass auch in der aktuellen Lebenssituation mit Behinderungen und Beeinträchtigungen kein ausreichender Schutz vor Gewalt gegeben zu sein scheint. Die Frauen aller Befragungsgruppen fühlten sich häufig wehrlos gegenüber körperlichen, sexuellen und psychischen Übergriffen und brachten auch zum Teil die Übergriffe direkt mit der Behinderung in einen Zusammenhang. Gerade in Einrichtungen können sich die Frauen der Gewalt von Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohnern, Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen und Personal nur schwer entziehen und die Tatsache, dass sie auch hier einem so hohen Maß an Gewalt ausgesetzt sind, verweist auf unzureichende Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen.
Bereits in den Auswertungen zu gewaltbelasteten Kindheitserfahrungen der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen hat sich gezeigt, dass Frauen, die bereits in Kindheit und Jugend eine Behinderung gehabt haben, häufig durch elterliche psychische Gewalt betroffen waren (vgl. 3.3.1). Sie beschrieben zudem auch Situationen der Überforderung der Eltern, die auch mit Beleidigungen im Zusammenhang mit der Behinderung einhergingen, mit lieblosem, ignorantem und grausamem Verhalten gegenüber der Beeinträchtigung des Kindes (Leugnen, Ignorieren oder Verstecken der Behinderung) sowie mit Zwang zu ungewollten Therapien oder Behandlungen (vgl. 3.1.7). Etwa jede zweite bis dritte Frau, die in Kindheit und Jugend behindert war, fühlte sich von ihren Eltern nicht in ausreichendem Maße unterstützt und angenommen. Diese Erfahrungen sind durchaus auch eingebettet in ein gesellschaftliches Klima der Ablehnung und Distanz gegenüber Menschen mit Behinderungen; sie können in hohem Maße ebenfalls mit der mangelnden aktiven Unterstützung und Integration von Eltern mit behinderten Kindern in Zusammenhang stehen. Frauen, die in Kindheit und Jugend ganz/teilweise in Einrichtungen lebten (es handelte sich dabei überwiegend um Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen), haben darüber hinaus auch dort häufig psychische und verbale Übergriffe erlebt. Zusammengenommen etwa die Hälfte dieser Frauen gab psychische Übergriffe in Form von verbal verletzenden Handlungen, schmerzhaften oder demütigenden Behandlungen und Therapien oder Eingesperrtwerden an oder stimmte der Aussage zu, es sei dort mit ihnen alles gemacht worden, ohne sie zu fragen. Mehr als ein Drittel der Frauen berichtete darüber hinaus von körperlichen Übergriffen in Einrichtungen, die von Ohrfeigen über Schläge mit Gegenständen bis hin zu heftigem Verprügeln und anderen körperlichen Strafen reichten (vgl. 3.3.1).
Auch im Erwachsenenleben sind Frauen, die in Einrichtungen leben, unzureichend vor Gewalt und Übergriffen durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner, Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen und (seltener) Personal geschützt (vgl. 3.3.2). Etwa die Hälfte der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen berichteten von psychischen Übergriffen in den letzten 12 Monaten. Entsprechende Übergriffe wurden auch in ärztlichen Praxen, Krankenhäusern und stationären bzw. psychiatrischen Einrichtungen erlebt. Die in vereinfachter Sprache befragten Frauen in Einrichtungen nannten als Personen, von denen die psychisch verletzenden Handlungen ausgingen, am häufigsten Personal und Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner in Wohnheimen. Sie beschrieben ein hohes Maß an psychischen, körperlichen und sexuellen Übergriffen durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner und Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen, seltener durch Personal. 12% der in allgemeiner Sprache und 20% der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen berichteten über körperliche Übergriffe durch Personen in Einrichtungen, Diensten und Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. 6% der in vereinfachter Sprache und 2% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen gaben darüber hinaus erzwungene sexuelle Handlungen an, die in Einrichtungen erlebt wurden; vor dem Hintergrund der hohen Anteile der Frauen, die hierzu keine Angaben gemacht haben, kann sich dahinter, auch bei einer breiteren Definition von Gewalt, ein erhebliches Dunkelfeld verbergen. Gerade auch in den offenen Nennungen wurden gravierende Situationen von sexuellen Nachstellungen und unerwünschten sexuellen Annäherungen durch männliche Mitbewohner und Arbeitskollegen beschrieben, denen sich die Frauen nur schwer entziehen konnten und die auch vom Personal zum Teil nicht konsequent geahndet wurden.
Alle Frauen der vorliegenden Studie, auch die in Haushalten lebenden Frauen, haben gegenüber den Frauen der Frauenstudie 2004 ein deutlich erhöhtes Ausmaß an körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt erlebt (vgl. 3.3). Gut jede dritte von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffene Frau der Haushaltsbefragung und etwa 40% bis über 60% der in Einrichtungen befragten, von körperlicher/sexueller Gewalt betroffenen Frauen gaben an, sie hätten sich aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung weniger gut wehren können als andere Menschen. In Bezug auf psychische Gewalt gaben Frauen der Haushalts-, aber auch der Einrichtungsbefragung in erhöhtem Maße psychisch verletzende Handlungen und Diskriminierungen nicht nur in engen sozialen Beziehungen, sondern auch im Rahmen der ärztlichen Versorgung und im Umgang mit Ämtern und Behörden an.
Die Juristin Julia Zinsmeister bezeichnet die „gezielt gegen Frauen bestimmter gesellschaftlicher Minderheiten gerichtete Gewalt (…) als prominentestes Beispiel einer Diskriminierung“ (2007: 48). Gewalt gegen Frauen und Mädchen gilt als Diskriminierung und Menschenrechtsverletzung. In der deutlich erhöhten Betroffenheit der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erfährt sie eine auch aus menschenrechtlicher Perspektive höchst problematische Zuspitzung. In Artikel 16 der UN-BRK ist die „Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (…) innerhalb und außerhalb der Wohnung (…) einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte“ festgeschrieben. Die vorliegende Studie zeigt auf, dass dies für einen großen Teil der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen nicht gegeben ist und dass gezielte Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen sowie systematische Präventionskonzepte erforderlich sind, um Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen künftig besser vor Gewalt zu schützen.
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der repräsentativen Teile der Studie in Kurzfassung zusammengefasst. Sie sind auch, gemeinsam mit den Ergebnissen der Zusatzbefragung, in einer Broschüre des BMFSFJ dokumentiert.
-
Mit der Studie konnten erstmals repräsentativ auf nationaler Ebene Frauen mit und ohne Behindertenausweis befragt werden, die in Haushalten und in Einrichtungen leben und die starke, dauerhafte Beeinträchtigungen und Behinderungen haben.
Mit der Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland“ wurde erstmals eine umfassende repräsentative Studie bei Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen auf nationaler Ebene durchgeführt, die nicht – wie in der Vergangenheit geschehen – große Teilgruppen der behinderten Menschen aufgrund zu enger methodischer Zugänge ausschließt. Die Studie zeichnet sich dadurch aus, dass sie gleichermaßen Frauen einbezieht, die in Haushalten und in Einrichtungen leben wie Frauen mit und ohne Behindertenausweis. Bisherige Studien beschränkten sich überwiegend auf die leichter erreichbaren Gruppen von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die in Haushalten leben, amtlich gemeldet sind bzw. einen Behindertenausweis haben und die mit einem allgemeinen Fragebogen befragbar sind. Menschen in Einrichtungen ebenso wie Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen, aber auch Gehörlose, Blinde und Schwerstkörper-/Mehrfachbehinderte wurden auf diesem Wege eher marginal erreicht. In der hier durchgeführten Studie konnten dagegen über spezifische Zugänge und besondere Methoden der Befragung breitere Bevölkerungsgruppen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen einbezogen werden.
-
Über drei methodische Zugänge wurden mehr als 1.500 Frauen befragt, die ein breites Spektrum von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und mit unterschiedlichen Formen gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Einschränkungen repräsentieren.
Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 1.561 Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt. 1.220 Frauen wurden über repräsentative Befragungen in Haushalten und Einrichtungen und 341 Frauen über nichtrepräsentative Zusatzbefragungen erreicht. Die unterschiedlichen Befragungsgruppen setzen sich wie folgt zusammen:
-
800 Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die in Haushalten leben. Sie konnten mithilfe einer aufwendigen Vorbefragung (random route) in 28.000 zufällig ausgewählten Haushalten an 20 zufällig ausgewählten Standorten (Landkreisen und Städten) bundesweit gewonnen werden. Mithilfe eines Screeningfragebogens wurden Frauen ausgewählt, die: - nach eigener Einschätzung starke und dauerhafte Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und/oder - über einen Behindertenausweis verfügen und/oder - Einrichtungen und Angebote der Behindertenhilfe nutzen.
-
420 Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die in Einrichtungen leben. Die Auswahl von Einrichtungen und Einrichtungsbewohnerinnen sowie deren Befragung erfolgte ebenfalls nach einem systematisierten Zufallsverfahren an den bundesweit 20 Standorten. Etwa drei Viertel der Frauen aus dieser Befragungsgruppe wurden in Einrichtungen für Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen befragt, die übrigen Frauen überwiegend in Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen und einige wenige auch in Einrichtungen für Schwerstkörper-/Mehrfachbehinderte.
-
341 Frauen mit Seh-, Hör-, Körper- und Mehrfachbehinderungen, die über eine Zusatzbefragung in die Studie einbezogen wurden. Da über die beiden erstgenannten repräsentativen Zugänge Frauen mit spezifischen Behinderungen nur in unzureichender Fallzahl erreicht werden konnten, wurden in einem dritten, nichtrepräsentativen Zugang 83 gehörlose/stark hörbehinderte Frauen, 128 blinde/stark sehbehinderte und 130 schwerstkörper-/mehrfachbehinderte Frauen gewonnen. Diese Befragten wurden zum geringeren Teil durch über Versorgungsämter weitergeleitete Anschreiben angesprochen, weit überwiegend aber über Aufrufe in Zeitungen und Zeitschriften sowie mithilfe der Öffentlichkeitsarbeit von Lobbyverbänden erreicht.
Im Einsatz waren über 100 Interviewerinnen – aus methodologischen Erwägungen wurden ausschließlich Frauen eingesetzt –, die von dem Projektteam ausgewählt und intensiv geschult wurden. Die repräsentative Haupt- und die Zusatzbefragungen wurden von Anfang 2010 bis Mitte 2011 durchgeführt. Für Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen wurde ein Fragebogen in vereinfachter Sprache entwickelt, der mit dem Fragebogen der anderen Befragungsgruppen vergleichbar ist. Hier wurde zudem ein spezifisch geschultes Interviewerinnenteam eingesetzt, das dazu befähigt wurde, auf Verständnisschwierigkeiten und individuelle Abläufe im Interview eingehen zu können. Die gehörlosen Frauen wurden in Deutscher Gebärdensprache (DGS) durch ein Team von durchgängig gehörlosen Interviewerinnen befragt, das von gehörlosen/hörbehinderten Wissenschaftlerinnen geschult und koordiniert wurde. Letztere haben auch ein DGS-Schulungsvideo erstellt, in dem gezeigt wird, wie die jeweiligen Fragen durch die Interviewerinnen einheitlich zu gebärden sind.
-
-
Alle Befragungsgruppen weisen hohe gesundheitliche und psychische Belastungen auf und hatten oftmals multiple Beeinträchtigungen und Behinderungen. Insbesondere in der Befragungsgruppe der in Haushalten lebenden Frauen wurden in erheblichem Umfang Frauen erreicht, die trotz der hohen Belastungen über keinen Behindertenausweis verfügten, wodurch ein wichtiges Dunkelfeld erhellt werden konnte.
Zur Ermittlung der physischen und psychischen Faktoren von Behinderung wurde in der Studie nach unterschiedlichen körperlichen Funktionsbeeinträchtigungen, chronischen Erkrankungen, Sinnes- und Sprechbeeinträchtigungen, Lernbehinderungen und psychischen Problemen gefragt. Die in Haushalten und die in Einrichtungen lebenden Frauen waren überwiegend von multiplen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen betroffen. Die Mehrheit der Befragten in allen Gruppen benannten außerdem ein erhebliches Ausmaß – zumeist zusätzlicher – psychischer Probleme, die in Zusammenhang mit den Behinderungen/gesundheitlichen Beeinträchtigungen, aber auch anderen belastenden Erfahrungen im Leben der Frauen stehen können.
Trotz ihrer starken und dauerhaften, in der Regel durch multiple Funktionsbeeinträchtigungen und Erkrankungen bestimmten hohen Belastungen verfügten die in Haushalten befragten Frauen zu über 60% nicht über einen Behindertenausweis. Demnach gibt es jenseits der amtlichen Behindertenverwaltung ein hohes Dunkelfeld von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die nicht über einen Behindertenausweis amtlich erfasst sind und daher zumeist auch nicht im Rahmen der Berichterstattung, Unterstützung und Politik für Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden. Oftmals handelt es sich hier um Behinderungen und Beeinträchtigungen, die weniger stark nach außen hin sichtbar sind, etwa Organstörungen und schwere chronische Erkrankungen (z.B. Krebs) sowie damit einhergehende Schmerzen und Einschränkungen in der Mobilität, die vielfach mit zusätzlichen psychischen Problemen sowie Einschränkungen der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit verbunden sind. Dass diese von der sozialen Umwelt oft nicht in ausreichendem Maße als Behinderungen und Beeinträchtigungen wahrgenommen werden, wurde von den Betroffenen als zusätzliche Belastung und Beeinträchtigung beschrieben.
-
Bei der Mehrheit der Befragten der repräsentativen Studie trat die Behinderung/gesundheitliche Beeinträchtigung erst im Erwachsenenalter auf. Eine Ausnahme bildeten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen, die häufiger bereits in Kindheit und Jugend beeinträchtigt waren.
Wie sich auch in anderen nationalen und internationalen Erhebungen und Studien zu Behinderungen und Beeinträchtigungen bereits gezeigt hat, treten Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen bei einem großen Teil der Betroffenen erst im Lebensverlauf und im (oftmals späteren) Erwachsenenleben auf. Auch in der vorliegenden Studie waren viele Frauen – knapp zwei Drittel der in Haushalten lebenden Frauen und etwa die Hälfte der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen – erst im Erwachsenenleben von Behinderungen und Beeinträchtigungen betroffen; bei Frauen, die in vereinfachter Sprache in den Einrichtungen befragt wurden, war dagegen die Behinderung häufiger bereits ab Kindheit und Jugend vorhanden. Eine Behinderung/Beeinträchtigung ab Geburt, Kindheit oder Jugend gaben 35% der in Haushalten befragten Frauen, 46% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen und 64% der in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen an.[129] Diese Unterschiede zwischen den Frauen nach dem Eintreten der Behinderungen/Beeinträchtigungen im Lebensverlauf prägten sehr entscheidend die Lebenswege im Hinblick auf Aufwachsen, Bildung und Ausbildung, Familiengründung und berufliche Einbindung.
-
In Bezug auf soziostrukturelle Merkmale wie Bildung, Berufs-/Erwerbstätigkeit und Familie/Partnerschaftsstatus unterschieden sich die in Haushalten lebenden Frauen weniger stark von der weiblichen Durchschnittsbevölkerung als die in Einrichtungen lebenden Frauen. Letztere verfügten seltener über qualifizierte Schul- und Berufsausbildungen, arbeiteten überwiegend in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, waren häufig nicht verheiratet und kinderlos.
Abgesehen davon, dass die Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die im Rahmen der vorliegenden Studie in Haushalten befragt wurden, älter waren als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (76% älter als 40 Jahre), unterschieden sie sich im Hinblick auf Bildung, Ausbildung, Partnerschaften und Familiengründung nicht wesentlich von den Frauen der Frauenstudie 2004 (Schröttle/Müller 2004), die hier wegen der identischen Fragebogenformulierungen als Vergleichsgruppe herangezogen wurde. Sie hatten in etwa gleiche Verteilungen bei der Schulbildung und bei qualifizierten Berufsabschlüssen, waren in etwa gleich häufig verheiratet bzw. in festen Partnerschaften lebend und der Anteil der Mütter unter den Frauen war in etwa gleich hoch. Auch der Anteil der erwerbstätigen Frauen unterschied sich nicht wesentlich von dem der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt, allerdings waren sie seltener in Vollzeit erwerbstätig, was auch auf berufliche Einschränkungen durch die Behinderung/Erkrankung zurückzuführen sein kann.
Demgegenüber hatten die in Einrichtungen lebenden Frauen deutlich häufiger keine qualifizierte Schul- und/oder Berufsausbildung: 23% der in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen und 75% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen verfügten über keine (anerkannten) oder nur Sonderschulabschlüsse, was nur auf 3–7% der in Haushalten lebenden Frauen dieser und der Frauenstudie 2004 zutraf. Auch der Anteil der Frauen in Einrichtungen ohne qualifizierte Berufsausbildungen war mit 49% bei den in allgemeiner und 79% bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen hoch im Vergleich zu 17–19% der in Haushalten lebenden Frauen dieser und der Frauenstudie 2004.
Die in Einrichtungen lebenden Frauen hatten zudem deutlich seltener als die in Haushalten lebenden Frauen Kinder und/oder eine aktuelle Partnerschaft: Eine aktuelle Partnerin bzw. einen aktuellen Partner gaben nur 34–42% der in Einrichtungen lebenden Frauen an (vs. 72–75% der in Haushalten lebenden Frauen); aktuell verheiratet waren nur 4–5% der in Einrichtungen lebenden (vs. 55–57% der in Haushalten lebenden Frauen). Der Anteil von Frauen mit Kindern war mit 6% bei den in vereinfachter Sprache befragten Frauen extrem niedrig. Bei den in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen lag dieser Anteil mit 39% wesentlich höher, allerdings noch immer deutlich unter den Werten der in Haushalten lebenden Frauen dieser und der Frauenstudie 2004 (71–73%). Die Einkommensstruktur der in Haushalten lebenden Frauen mit Behinderungen (inkl. Sozialleistungen) unterschied sich nicht wesentlich von jener der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Den in Einrichtungen lebenden Frauen standen überwiegend sehr geringe persönliche Einkünfte von unter 400€ zur Verfügung, weil sie weitgehend nicht in regulären Arbeitsverhältnissen, sondern in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen beschäftigt waren.
-
Das Leben in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen ist nach Aussagen der Betroffenen durch erhebliche Einschränkungen im selbstbestimmten Leben und in der Wahrung der eigenen Intimsphäre gekennzeichnet und wurde von vielen Frauen als belastend und reglementierend beschrieben.
Das Leben von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Einrichtungen unterscheidet sich gravierend vom Leben im eigenen Privathaushalt. Nur wenige Frauen in Einrichtungen verfügten dort über eine eigene Wohnung (10–15%). Viele sind in (zumeist gemischtgeschlechtliche) Wohngruppen eingebunden (33% der zumeist psychisch erkrankten Frauen und 65% der Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen) und können nicht selbst bestimmen, mit wem sie zusammenleben möchten. Vor allem die in vereinfachter Sprache befragten Frauen leben häufig in Wohngruppen von sechs bis zehn und mehr Personen; viele Frauen beschrieben die Wohnsituation als belastend und äußerten den Wunsch nach mehr Alleinsein. Die in allgemeiner Sprache befragten Frauen waren häufiger in kleinere Wohngruppen oder gar nicht in Wohngruppen eingebunden. Etwa 80% aller in Einrichtungen lebenden Frauen beider Befragungsgruppen hatten ein Zimmer für sich allein; einem Fünftel (20%) stand kein eigenes Zimmer zur Verfügung. Weitere Einschränkungen in der Wahrung der eigenen Privat- und Intimsphäre zeigten sich darin, dass ein Fünftel der in allgemeiner und zwei Fünftel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen angaben, in den Einrichtungen keine abschließbaren Wasch- und Toilettenräume zu haben. Wohnbereiche ausschließlich für Frauen waren in über drei Viertel der Fälle nicht vorhanden.
Viele Frauen in Einrichtungen fühlten sich durch die Reglementierung des Alltags und Bevormundungen in ihrer Freiheit eingeschränkt und beschrieben die Lebenssituation in der Einrichtung als belastend, zum Beispiel aufgrund von Lärm und psychisch-verbalen wie physischen Übergriffen durch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Im Vergleich waren die in allgemeiner Sprache befragten Frauen in Einrichtungen mit der aktuellen Wohn- und Lebenssituation deutlich unzufriedener als die in vereinfachter Sprache befragten Frauen. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass Erstere wegen des späteren Eintritts der Behinderung im Lebensverlauf eine autonome Lebensführung gewohnt waren und in Kenntnis der Alternativen ihre derzeitige Wohnsituation kritischer reflektieren können.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die sozialen Merkmale von Behinderung, insbesondere der Ausschluss von der gesellschaftlichen Teilhabe, das Leben von Frauen in Einrichtungen weitaus stärker prägen als das Leben behinderter Frauen, die im eigenen Haushalt leben. Das Ausmaß der Teilhabeeinschränkung und sozialen Ausgrenzung der Frauen wird demnach maßgeblich von der Wohnform bestimmt, in der sie leben.
-
Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen waren im Lebensverlauf allen Formen von Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Auffällig sind die hohen Belastungen insbesondere durch sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend sowie im Erwachsenenleben. Die am höchsten von Gewalt belastete Gruppe der repräsentativen Befragungsteile waren die zumeist psychisch erkrankten Frauen, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurden.
In der Studie wird der wechselseitige Zusammenhang von Gewalt und gesundheitlicher Beeinträchtigung/Behinderung im Leben von Frauen sichtbar. Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen haben demnach nicht nur ein höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden; auch umgekehrt dürften (frühe) Gewalterfahrungen im Leben der Frauen maßgeblich zu späteren gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen und Behinderungen beigetragen haben. So war ein großer Teil der befragten Frauen, auch jener, deren Behinderungen erst im Erwachsenenleben aufgetreten waren, bereits in Kindheit und Jugend einem erheblichen Ausmaß von Gewalt durch Eltern und andere Personen ausgesetzt. Sie haben häufiger (und schwerere) körperliche und vor allem psychische Übergriffe durch Eltern erlebt als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. Etwa 50–60% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen und in Haushalten befragten Frauen waren von psychischer Gewalt durch Eltern betroffen, gegenüber 36% der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Frauen, die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden, wiesen hier ähnlich hohe Werte auf wie die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt; der hohe Anteil der Frauen, die dabei keine Angabe gemacht haben oder es nicht (mehr) wussten (15–35%), lässt aber auf ein erhebliches Dunkelfeld schließen. In der vermeintlich geringeren Gewaltbetroffenheit können sich möglicherweise Einschränkungen im Erinnerungsvermögen dieser Befragungsgruppe oder auch eine noch stärkere Tabuisierung von Gewalt abbilden.
Eines der gravierendsten Ergebnisse der vorliegenden Studie im Hinblick auf die Gewalterfahrungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ist, dass diese zwei- bis dreimal häufiger sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend ausgesetzt waren als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt (s. Frauenstudie 2004). Jede dritte bis vierte Frau mit Behinderungen und Beeinträchtigungen gab in der vorliegenden Studie sexuelle Übergriffe in Kindheit und Jugend durch Erwachsene, Kinder oder andere Jugendliche an. Allein von sexuellem Missbrauch durch Erwachsene waren nach eigenen Angaben ein Fünftel der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen (20%)[130], ein Viertel der in Haushalten befragten Frauen (24%) und fast ein Drittel der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen (31%) betroffen. Im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004 waren es in dieser Altersgruppe 10%.
Die hohe Betroffenheit von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen zeigt sich vielfach auch im Erwachsenenleben. So hat mehr als jede dritte bis fünfte Frau der vorliegenden repräsentativen Studie erzwungene sexuelle Handlungen im Erwachsenenleben angegeben (im Bevölkerungsdurchschnitt betraf das jede 8. Frau in der Altersgruppe bis 65). Auch hier waren die zumeist psychisch erkrankten, in Einrichtungen in allgemeiner Sprache Befragten mit 38% die am stärksten betroffene Gruppe. Werden alle Frauen zusammengenommen, die in Kindheit und Jugend und/oder im Erwachsenenleben sexuelle Gewalt erlebt haben, dann war mehr als jede zweite bis dritte Frau der vorliegenden Studie im Lebensverlauf von sexueller Gewalt betroffen. Die zumeist psychisch erkrankten Frauen in Einrichtungen waren hiervon mit einem Anteil von 56% die mit Abstand am stärksten belastete Gruppe (vs. 43% der in Haushalten lebenden, 34% der in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen und 19% der Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt).
Darüber hinaus erlebten die befragten Frauen mit Behinderungen aber auch deutlich häufiger psychische und körperliche Gewalt im Erwachsenenleben als die Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt der Frauenstudie 2004. So haben zwei Drittel (68%) der in vereinfachter Sprache befragten Frauen, drei Viertel (77%) der in Haushalten und 90% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen psychische Übergriffe im Erwachsenenleben angegeben. Diese reichten von verbalen Beleidigungen und Demütigungen über Benachteiligung, Ausgrenzung und Unterdrückung bis hin zu Drohung, Erpressung und Psychoterror. Im Bevölkerungsdurchschnitt waren davon 45% der befragten Frauen betroffen.
Mindestens eine Situation körperlicher Gewalt im Erwachsenenleben haben mit 58–73% fast doppelt so viele Frauen mit Behinderungen der vorliegenden repräsentativen Studie wie Frauen der Frauenstudie 2004 (35%) erlebt. Auch hiervon waren die in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen am häufigsten betroffen. Darüber hinaus zeigte sich in der Studie, dass nicht nur alle Frauen der vorliegenden Studie häufiger körperliche Übergriffe erlebt haben, sondern dass es sich dabei auch um schwerere und vielfach auch bedrohlichere Übergriffe gehandelt hat.
Bei vielen Frauen, bei denen die Behinderung erst im Erwachsenenleben aufgetreten war, waren die körperlichen, psychischen und sexuellen Übergriffe sowohl vor als auch nach dem Eintreten der Behinderung und Beeinträchtigung verübt worden. Hier kann sowohl ein Zusammenhang vermutet werden, der die gesundheitsschädigende Wirkung von Gewalt aufzeigt, als auch ein Zusammenhang, der auf die erhöhte Vulnerabilität aufgrund der Behinderung und Beeinträchtigung verweist. Wie im qualitativen Teil der vorliegenden Studie, deutet sich auch in den Ergebnissen des quantitativen Studienteils an, dass die Frauen selbst nur einen Teil der erlebten Gewalt mit ihrer Behinderung in einen unmittelbaren Zusammenhang bringen, ein anderer Teil der Gewalterfahrungen aber nicht im Kontext der Behinderung und Beeinträchtigung gesehen wird. Gut jede dritte von körperlicher Gewalt betroffene Frau der Haushaltsbefragung und etwa 50–60% der in Einrichtungen befragten, von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen gaben an, sie hätten sich aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung weniger gut wehren können als andere Menschen. Dass die erlebte körperliche Gewalt etwas mit der Behinderung zu tun habe, gaben häufiger die in den Einrichtungen befragten Frauen an (zwei Fünftel der in Einrichtungen und ein Fünftel der in Haushalten in allgemeiner Sprache befragten gewaltbetroffenen Frauen). Dass sie in Zusammenhang mit ihrem Frausein stehe, bejahte etwa die Hälfte aller Frauen in allen Befragungsgruppen.
-
Gewaltkontexte und Täterinnen bzw. Täter bei Gewalt sind, wie bei Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt, überwiegend im unmittelbaren sozialen Nahraum der Frauen zu verorten. Darüber hinaus spielte bei den befragten Frauen i Einrichtungen körperliche/sexuelle Gewalt durch Bewohnerinnen bzw. Bewohner und psychische Gewalt durch Bewohnerinnen bzw. Bewohner und Personal in Einrichtungen eine besondere Rolle. Die in Haushalten befragten Frauen benannten häufig zusätzlich psychische Gewalt im Kontext von Gesundheitsdiensten und Ämtern/Behörden.
Die Gefährdungskontexte für Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt im Erwachsenenleben zu werden, liegen ähnlich wie im Bevölkerungsdurchschnitt im unmittelbaren sozialen Nahbereich von Familie und Partnerschaft. Bei den Frauen, die in Einrichtungen leben, hat darüber hinaus die Gefährdung durch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in den Einrichtungen und durch Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen in Werkstätten eine Bedeutung. Diese zeigte sich zum einen in der faktisch ausgeübten körperlichen, sexuellen und psychischen Gewalt durch Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohner (seltener durch Personal) und Arbeitskolleginnen bzw. Arbeitskollegen, von der die Frauen berichteten, zum anderen aber auch in den von den Frauen geäußerten Ängsten vor Übergriffen durch diese Personengruppen.
Im Falle psychischer Gewalt nannten die Frauen, ebenfalls wie im Bevölkerungsdurchschnitt, am häufigsten psychische Gewalt durch Personen aus dem unmittelbaren sozialen Nahraum von Arbeit, Familie und den Einrichtungen, in denen die Frauen ihren Lebensmittelpunkt haben. Anders als in der Befragung von 2004 wurde darüber hinaus aber in erhöhtem Maße psychische Gewalt im Rahmen der ärztlichen Versorgung und im Umgang mit Ämtern und Behörden angegeben, am häufigsten von den in Haushalten und den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen.
-
Die große Mehrheit der Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen gab in der Studie an, direkte diskriminierende Handlungen durch Personen und Institutionen erfahren zu haben. Viele sind zudem struktureller Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt, die sich in mangelnden Bildungs-, beruflichen und ökonomischen Ressourcen, existenziellen Ängsten und in hohem Maße auch in den eingeschränkten Entfaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten in Einrichtungen zeigt.
Diskriminierung ist eine Form von (struktureller und personaler) Gewalt und erhöhte Gewaltbetroffenheiten von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen können eine Form der Diskriminierung sein, wenn sie in einem mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Behinderung stehen oder Frauen mit Behinderungen nicht in ausreichendem Maße vor Gewalt geschützt sind.
Um Diskriminierung zu erfassen, wurden in der vorliegenden Studie einerseits soziostrukturelle Faktoren ausgewertet, in denen sich Diskriminierung abbilden kann. Andererseits wurden subjektiv wahrgenommene Diskriminierungen erfasst, wie zum Beispiel Einschränkungen der persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung, ein Zuviel oder Zuwenig an Hilfe/Unterstützung, des Weiteren Bevormundungen, Grenzüberschreitungen wie ungefragtes Duzen, Anstarren oder Anfassen sowie das Gefühl, ignoriert zu werden, nicht ernst genommen zu werden oder mangelnde Rücksichtnahme durch andere in Zusammenhang mit der Beeinträchtigung/Behinderung. Mit 81–89% gab die große Mehrheit der befragten Frauen an, mindestens eine der genannten Handlungen erlebt zu haben. Konkrete Benachteiligungen und Diskriminierungen durch andere Menschen oder Institutionen beschrieb jede dritte Frau der Haushaltsbefragung und jede zweite Frau, die in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragt wurde; 27% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen stimmten der Aussage zu, sie seien ungerecht behandelt worden. Etwa 40–60% der befragten Frauen fühlten sich darüber hinaus nicht ernst genommen und jede dritte Frau gab im Zusammenhang mit der Behinderung/Beeinträchtigung belästigende, bevormundende oder benachteiligende Verhaltensweisen durch andere Personen an.
Frauen, die in Einrichtungen lebten, fühlten sich besonders häufig (38–42%) durch Bedingungen und Regeln in ihrer Freiheit eingeschränkt und nannten häufiger als die in Haushalten lebenden Frauen, angestarrt und ungefragt geduzt (35–52%), beschimpft (46%) sowie ungefragt oder unangenehm angefasst zu werden (ca. 40%).
Die mangelnden Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens in Einrichtungen, aber auch der unzureichende Schutz der Privat- und Intimsphäre und der mangelnde Schutz vor psychischer, physischer und sexueller Gewalt sind weitere Aspekte, die im Zusammenhang mit Diskriminierungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen im Rahmen der vorliegenden Studie sichtbar wurden. In diesem Zusammenhang ist auch kritisch zu sehen, dass viele der in einer Einrichtung lebenden Frauen keine Partnerschaftsbeziehung haben und auch selbst das Fehlen enger vertrauensvoller Beziehungen als Problem benennen. Das Leben in Einrichtungen scheint weitgehend keine festen Paarbeziehungen oder eine Familiengründung vorzusehen. Schon das Ergebnis, dass nur 6% der Frauen, die in vereinfachter Sprache in den Einrichtungen befragt wurden, Kinder haben, dass bestehende Schwangerschaften in der Mehrheit abgebrochen wurden und dass die Gabe von Verhütungsmitteln (oft der 3-Monatsdepots) vielfach für diese Gruppe erfolgt, selbst wenn die Frau Sexualität nicht aktiv lebt, lässt darauf schließen, dass das Erfüllen eines Kinderwunsches hier in der Regel nicht vorgesehen ist.
Darüber hinaus verweisen die Studienergebnisse darauf, dass trotz gesetzlichen Auftrags im SGB IX für die in den Einrichtungen lebenden Frauen, die häufig über keine oder nur geringe Bildungs- und Ausbildungsressourcen verfügen, eine berufliche Einbindung in den ersten Arbeitsmarkt ebenso wenig vorgesehen ist wie ein transparenter und selbstbestimmter Umgang mit den eigenen finanziellen Mitteln. Die in Einrichtungen lebenden Frauen arbeiten, wie die Studienergebnisse zeigen, fast durchgängig in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in denen sie ein geringes Entgelt erhalten, und haben oftmals keinen Einblick in die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Gerade vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Studie die Frauen in Einrichtungen erreicht wurden, die intellektuell einem mehrstündigen Interview folgen und Fragen beantworten konnten, ist dies ein kritisch zu diskutierender Befund.
Ein weiteres Problem, das in hohem Maße auf strukturelle Gewalt hinweist und das sich verstärkt bei den in Haushalten befragten Frauen zeigte, ist die große Angst vieler Frauen vor finanzieller Not und Existenzverlust, die über die Hälfte (55%) der in Haushalten lebenden Frauen und jede dritte bis vierte (25–39%) der in einer Einrichtung lebende Frau äußerte. Rund 40% der in Haushalten und in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen gaben an, dass die aktuellen Einkünfte nicht ausreichen würden, um die Dinge des täglichen Lebens zu finanzieren, und etwa die Hälfte teilte die Einschätzung, die Mittel seien nicht ausreichend für zusätzliche Ausgaben, die aufgrund der Behinderung anfielen.
Die hier beschriebenen Diskriminierungsaspekte stellen eine relevante Form von struktureller Diskriminierung gegenüber Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen dar und sind in künftigen Diskussionen zu Gewalt gegen Frauen noch stärker als bisher zu berücksichtigen. Sie verstoßen klar gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, die etwa die Rechte zur selbstbestimmten Lebensweise, zu Partnerschaft und Familiengründung und zur Bereitstellung von ausreichenden Mitteln und Ressourcen für ein selbstbestimmtes Leben als Menschenrechte verbindlich festschreibt. Insofern konnte die vorliegende Studie neben den hohen Gewaltbelastungen aller Befragungsgruppen auch ein erhebliches Maß an weiteren Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen mit Behinderungen aufzeigen, denen es politisch und gesellschaftlich aktiv entgegenzuwirken gilt.
[41] Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit aller Studienergebnisse für Blinde wurden im Rahmen der folgenden Ergebnisdarstellung alle Daten, die in Tabellen und Diagrammen erscheinen, auch im Text ausführlicher als in anderen Studiendokumentationen beschrieben.
[42] In der vorliegenden Studie wurde aus methodischen Gründen kein zusätzlicher schriftlicher Fragebogen eingesetzt.
[43] Einerseits standen für mehrsprachige Hauptinterviews keine Mittel zur Verfügung, andererseits wäre auch beim Einsatz mehrsprachiger Interviews die Fallzahl der Migrantinnen zu klein gewesen, um daraus verallgemeinerbare Schlüsse zu ziehen. Das wäre nur, wie in der Befragung von 2004, durch zusätzliche Stichproben möglich geworden, was aber den ohnehin komplexen und finanziell eng gesteckten Rahmen dieser Untersuchung gesprengt hätte
[44] Nach § 138 SGB IX zahlen WfbM den behinderten Beschäftigten ein Arbeitsentgelt, „das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes“ (der Bundesagentur für Arbeit) „und einem leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt“. Nach den Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft der WfbM waren das 2008 durchschnittlich 159€ im Monat (http://www.bagwfbm.de/page/101). Hinzu kommen die Kosten für die soziale und kulturelle Betreuung in der Werkstatt und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in der Wohneinrichtung der Behindertenhilfe. Diese Kosten sind aber keine direkten Einkünfte der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung, weil sie nicht selbst darüber verfügen können.
[45] Weiter detaillierte Angaben dazu finden sich in Kapitel 3.2.1.
[46] Bei diesen Fragen waren insgesamt die Anteile der Frauen, die die Fragen nicht beantwortet haben (Antwort: Weiß nicht/Keine Angabe) mit 7–15% relativ hoch. Sie werden in der folgenden Tabelle nicht extra ausgewiesen, da sie bei allen Gruppen hoch sind und sich keine starken Verzerrungen im Vergleich der Gruppen ergeben.
[47] Von allen befragten Frauen, unabhängig davon, ob bereits in Kindheit und Jugend eine Behinderung bestanden hat, gaben 36% der in Haushalten befragten Frauen, 44% der in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen und 19% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen an, eine eher nicht so glückliche Kindheit gehabt zu haben (wobei die in Einrichtungen befragten Frauen zu 10% keine Angaben machten und zudem die zusätzliche Antwortvorgabe „teils – teils“ zu 15% wählten, was als Ausweichkategorie den anderen Befragten nicht zur Verfügung stand).
[48] Das heißt, sie gaben Beeinträchtigungen in mehreren der Bereiche der Körper-, Seh-, Hör-, Sprechbeeinträchtigungen oder der psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen an.
[49] Hier ist die Einschätzung zum Teil schwierig, ob es sich bei den Angaben um psychische Beeinträchtigungen oder um situationsspezifische Probleme handelt (siehe 3.2.3).
[50] Siehe Abschnitt 3.2.2.
[51] Eine ausführliche Diskussion hierzu findet sich in Abschnitt 3.2.2.
[52] Siehe Kap. 2.
[53] Siehe Abschnitt 3.2.2 bis 3.2.4.
[54] In den Fragen M.2.6, M.2.7 und M.8.2.
[55] Die Beeinträchtigung liegt hier nicht in einer Funktionseinschränkung begründet, sondern in der Sichtbarkeit der Auffälligkeiten und den Reaktionen Dritter darauf sowie in den subjektiven Empfindungen der Betroffenen angesichts der Sichtbarkeit (z.B. Scham).
[56] Betrachtet man nur die Frauen mit Behindertenausweis in den Haushalten, so zeigt sich, dass sie noch einmal häufiger verschiedene körperliche Beeinträchtigungsformen angegeben haben als Frauen ohne Behindertenausweis.
[57] 29 Frauen der Haushaltsbefragung haben insgesamt über alle Beeinträchtigungsbereiche (körperlich, psychisch, Seh-, Hör-, Sprech-, Lernbeeinträchtigung) hinweg nur eine Angabe bei einer körperlichen Beeinträchtigungsform gemacht. Dennoch kann hier – wie die Auswertung der offenen Angaben dieser Frauen zeigt (z.B. Krebs, Diabetes, Asthma, multiple Sklerose etc.) – nicht auf eine geringere Beeinträchtigung rückgeschlossen werden.
[58] In einzelnen Fällen wurden hier auch psychische Erkrankungen oder chronische Schmerzen wie Kopfschmerzen oder Fibromyalgie genannt.
[59] Hier wurden darüber hinaus auch drei psychische Erkrankungen genannt.
[60] Hier wurden zumeist Funktionsbeeinträchtigungen, seltener das Fehlen von Gliedmaßen benannt. (Fünf Frauen nannten den Verlust von Zehen, eine Frau den Verlust eines Beines und zwei Frauen ein verkürztes Bein.)
[61] Es ist nicht ganz klar, ob es sich bei allen Angaben um wiederkehrende oder andauernde Schmerzen handelt, da es manchen Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung schwerfällt, Häufigkeitsangaben im Sinne von „oft Schmerzen“ zu machen.
[62] An dieser Stelle sind die angegebenen Erkrankungen, die nicht neurologischer Art waren, herausgenommen worden.
[63] Im Fragebogen in vereinfachter Sprache wurde hier offen gefragt und nachträglich zugeordnet, s.u.
[64] Erfasst wurden im Bundesgesundheitssurvey „affektive Störungen, Angststörungen (inkl. Zwangsstörungen), somatoforme Störungen, Essstörungen (Anorexie und Bulimie), substanzbezogene Störungen, psychotische Störungen, psychische Störungen aufgrund eines medizinischen Krankheitsbildes. Nicht erfasst wurden […] Posttraumatische Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen, Nichtorganische Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, andere Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen, Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit sowie demenzielle Erkrankungen“ (Jacobi/Harfst 2007: 4)
[65] Die meisten der in allgemeiner Sprache befragten Frauen lebten aufgrund einer psychischen Erkrankung in einer Einrichtung.
[66] Der Unterschied ist nicht signifikant.
[67] Antwortvorgabe: „Wiederkehrende zwanghafte Handlungen oder Gedanken, d. h. Handlungen oder Gedanken, die man nicht gut selbst steuern kann und deren Unterlassen Angst auslöst“.
[68] Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass fast alle diese Frauen (87%) an anderer Stelle auch Angst vor negativen Folgen oder Entwicklungen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung, Behinderung oder Erkrankung genannt haben. Daher sind diese 20% Frauen mit sehr starken Ängsten oder Panikgefühlen möglicherweise als Hinweis auf starke psychische Belastungen aufgrund der (körperlichen) Beeinträchtigung zu verstehen, anstatt als möglicher Hinweis auf eine Angststörung. Andererseits zeigt sich im Bundesgesundheitssurvey, dass 20% der weiblichen Bevölkerung von einer Angststörung (Ein-Jahres- Prävalenz) betroffen sind (Jacobi/Harfst 2007).
[69] Der Unterschied ist nicht signifikant.
[70] Der Unterschied ist nicht signifikant.
[71] Der Unterschied ist nicht signifikant.
[72] Eine Angabe zu einer ärztlichen oder psychologischen Diagnose konnten in den offenen Antworten in der Haushaltsbefragung nur einige der betroffenen Frauen machen. Von 154 Angaben beziehen sich etwas weniger als die Hälfte auf affektive Störungen, knapp ein Viertel gab eine Mehrfachdiagnose an, 11 Frauen nannten eine Persönlichkeitsstörung, 8 Frauen eine Diagnose aus dem Bereich Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen, Psychosen, 7 Frauen Angststörungen.
[73] Rund 80% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen leben dort aufgrund einer psychischen Erkrankung. Ca. 20% sind körper- und/oder sehbehindert.
[74] 6% machten hier keine Angabe.
[75] Fünf weitere Frauen der Haushaltsbefragung wurden mit dem vereinfachten Fragebogen befragt. Diese Interviews wurden jedoch nicht in die Auswertung einbezogen, da die Fallzahl zu gering war für vergleichende Auswertungen mit anderen Befragungsgruppen.
[76] Um den Bereich der „Partnerschaft/Sexualleben“ im Verhältnis zu den anderen Bereichen nicht stärker zu gewichten, wurde in der Gruppierung ausschließlich der Bereich „Partnerschaft“ berücksichtigt, nicht aber die Antwortmöglichkeiten „bei der Partnersuche“ und „im Sexualleben“.
[77] Eine parallel durchgeführte Clusteranalyse unterstützt diese Gruppierung im Rahmen der Indexlösung.
[78] Diese Angabe bezog sich auf eine Einstiegsfrage, bei der auf regelmäßige und langfristige Unterstützung und Betreuung, zum Beispiel durch Pflegekräfte, Assistenz- und Betreuungspersonen oder Angehörige, fokussiert wurde. Bejahten die Frauen eine aktuelle Unterstützung, wurde weiter danach gefragt, in welchen Bereichen diese erfolgt.
[79] Zwar haben in der Einstiegsfrage (M.2.9) 136 Frauen regelmäßige Unterstützung angegeben, 11 dieser Frauen haben aber in der Nachfolgefrage bei allen abgefragten Tätigkeiten eine Unterstützung verneint.
[80] 10% aller Frauen haben hier keine Angabe gemacht.
[81] Nach dem Datenreport (Destatis 2008: 262) beurteilten 45% der Frauen ihren Gesundheitszustand als gut, 35% als zufriedenstellend und 20% als schlecht.
[82] Einzelne Frauen machten vertiefende Angaben. So wurden diskriminierende und demütigende Verhaltensweisen im Kontext von medizinischen und psychotherapeutischen Behandlungen angesprochen, bspw. indem körperliche Unterstützungsbedarfe nicht ernst genommen wurden oder notwendige und von anderer Stelle verordnete (Schmerz-)Medikamente verweigert wurden. Weiter wurde berichtet, dass Gewalterfahrungen in der Kindheit oder in einer Paarbeziehung keine angemessene Berücksichtigung in der (Psycho-)Therapie gefunden hätten.
[83] Die offenen Nennungen der Angebote beziehen sich auf aktuell und auf früher genutzte Angebote.
[84] Die Frage nach einem ambulanten Pflegedienst ist hier nur eingeschränkt vergleichbar, da sie im vereinfachten Fragebogen lautete: „Werden Sie von einer Person gepflegt, die ins Haus kommt?“.
[85] Auf einer Sechser-Skala Werte zwischen vier und sechs genannt.
[86] Das heißt Hör-, Sprech- und/oder Sehbeeinträchtigungen. Wert neu berechnet.
[87] Die übrigen Frauen gaben weniger starke Einschränkungen an, nur 3% nannten keine Einschränkung in verschiedenen Lebensbereichen.
[88] Nach den Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen bilden Frauen mit psychischen Erkrankungen den größten Anteil an den in Einrichtungen lebenden Frauen.
[89] Das heißt Hör-, Sprech- und/oder Sehbeeinträchtigungen. Variable neu berechnet.
[90] Das heißt Hör-, Sprech- oder Sehbeeinträchtigungen. Variable neu berechnet.
[91] Die amtliche Schwerbehindertenstatistik ist eine Verwaltungsstatistik. Darin erfasst sind Menschen (Frauen und Männer) aller Altersgruppen, denen in einem Verwaltungsakt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen in SGB IX der Schwerbehindertenstatus zuerkannt wurde.
[92] Die Frage wurde nur Befragten gestellt, die bei Eltern/Stiefeltern aufgewachsen waren. Entsprechend beziehen sich die Prozentangaben auf diesen Personenkreis.
[93] In Fällen häuslicher Gewalt zwischen den Eltern ging diese der vorliegenden Studie nach zu 60–72% ausschließlich vom Vater aus und zu 7–13% ausschließlich von der Mutter; in 12–21% der Fälle war das unterschiedlich oder beide Elternteile übten Gewalt gegeneinander aus. Der Anteil einseitiger Gewalt durch den Vater ist im Rahmen dieser Studie deutlich höher als in der Frauenstudie 2004 (60–72% vs. 49%).
[94] Aus der Methodendiskussion der Gewaltprävalenzforschung ist bekannt, dass dichotome „Ja“-„Nein“- Kategorien Dunkelfelder in geringerem Ausmaß aufzudecken vermögen als 3 oder 4 Kategorien mit Häufigkeitsangaben, die auch die Angaben „selten“ oder „einmal“ umfassen.
[95] Darauf verweisen auch die Mittelwerte der Häufigkeit der Nennungen „häufig“/„gelegentlich“ bei den Einzelhandlungen. Während die Frauen der Frauenstudie 2004 im Durchschnitt nur bei 1,1 Handlungen angaben, diese seien häufig oder gelegentlich durch die Eltern verübt worden, waren es bei den in Haushalten befragten Frauen der vorliegenden Studie 2,3 und bei den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen 2,9 Handlungen, die häufig oder gelegentlich erlebt wurden. (Die Unterschiede in den Mittelwerten allein bei elterlicher körperlicher Gewalt lagen bei 0,8 – 1,4 – 1,7 und bei psychischer elterlicher Gewalt bei 0,3 – 0,9 – 1,2). Beides lässt auf häufiger erlebte elterliche Gewalt bei den in Haushalten und noch stärker bei den in Einrichtungen in allgemeiner Sprache befragten Frauen schließen.
[96] So gab etwa ein Drittel der Befragten häufige/gelegentliche körperliche Bestrafungen durch Eltern an und mehr als ein Drittel wurde verprügelt. Etwa 40% der in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen gaben zudem an, so behandelt worden zu sein, dass es seelisch verletzend war.
[97] Einzelne Frauen der Haushaltsbefragung berichteten demütigende Erfahrungen in der Schulzeit bzw. in Internaten (z.B. mangelnde Berücksichtigung behinderungsspezifischer Vulnerabilität, Schläge, Drohungen etc.) mit schwerwiegenden Folgen (z.B. psychischer Erkrankung).
[98] Diese Anteile geben Mindestwerte an, da gerade bei sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend ein hohes Dunkelfeld besteht und betroffene Frauen dies oft aufgrund von Tabuisierungen nicht Dritten gegenüber angeben, teilweise auch im Kontext von Traumatisierungen verdrängt haben.
[99] In der Auswertung der repräsentativen Befragungsgruppen der Studie finden sich keine Hinweise darauf, dass Frauen, die bereits in Kindheit und Jugend eine Behinderung hatten, häufiger sexuellen Missbrauch erlebt haben (33% in der Haushaltsbefragung, 23% in der Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache und 23% in der Befragung in vereinfachter Sprache) als Frauen, die erst später eine Behinderung hatten.
[100] Die Prozentwerte beziehen sich nur auf Frauen, die bei sexuellem Missbrauch Angaben zu Täterinnen bzw. Tätern gemacht haben.
[101] Die in Einrichtungen befragten Frauen nannten nur in 1–2 Fällen weibliche Täterinnen bei sexuellem Missbrauch (Mutter, Bekanntenkreis, flüchtig Bekannte); die Frauen der Haushaltsbefragung gaben 13 Fälle an (in vier Fällen die Mutter, in 2 Fällen die Schwester, aber auch Personen aus Schule, Verwandten- und Bekanntenkreis, flüchtig Bekannte und aus Ärzteschaft/Unterstützungseinrichtungen wurden in jeweils 1–2 Fällen genannt).
[102] Die Frage zum 1-Jahreszeitraum wurde den in vereinfachter Sprache befragten Frauen nicht gestellt, da für diese oft eine zeitliche Zuordnung schwer ist und eine Kürzung des Fragebogens aufgrund der langen Interviewzeiten erforderlich war.
[103] Zwar hatten Frauen in der Frauenstudie 2004, wenn die Angaben aus mündlichem und schriftlichem Fragebogen einbezogen werden, zu 25% Partnergewalt erlebt. Hier werden jedoch nur die Angaben aus dem mündlichen Befragungsteil verglichen, da diese methodisch besser vergleichbar sind als die Einbeziehung der verdeckten Abfrage. Vermutlich ist auch bei den in der vorliegenden Studie befragten Frauen mit Behinderungen von einem entsprechenden Dunkelfeld auszugehen, das mit einem zusätzlichen verdeckten Fragebogen zu Partnergewalt hätte noch weiter aufgedeckt werden können, was aber der methodische Rahmen der vorliegenden Studie nicht zuließ.
[104] Die in Einrichtungen in vereinfachter Sprache befragten Frauen haben hier mit 69% etwas seltener Erwachsene als Täterinnen und Täter angegeben als die anderen Befragungsgruppen, wobei diese auch zu fast einem Fünftel (19%) hierzu keine Angaben gemacht haben.
[105] Es ist zu vermuten, dass dies bei der Gruppe der in vereinfachter Sprache befragten Frauen zusätzlich damit zusammenhängen könnte, dass viele Frauen keinen Bezug zu Sexualität haben und teilweise die Fragen zu sexueller Gewalt nicht verstanden haben oder begrifflich nicht darauf antworten konnten. So hatten an anderer Stelle der Befragung nur 37% der in vereinfachter Sprache befragten Frauen angegeben, schon einmal Sex gehabt zu haben; bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen waren es 75% und bei den in Haushalten befragten Frauen 95%. Auch waren die in vereinfachter Sprache befragten Frauen seltener sexuell aufgeklärt worden. Die Analyse zeigt auf, dass, anders als vermutet wurde, sexuelle Aufklärung in Kindheit und Jugend nicht per se ein Schutzfaktor für sexuelle Gewalt ist, was sicherlich aber auch von der Qualität der sexuellen Aufklärung abhängt, die anhand der Befragungsdaten nicht beurteilt werden kann.
[106] Bei den in allgemeiner Sprache in Einrichtungen befragten Frauen war dieser Anteil etwas geringer. Bei den Frauen der Frauenstudie 2004 hatte sich diesbezüglich ein noch stärkerer Zusammenhang gezeigt, denn Frauen, die in Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch erlebt haben, waren im späteren Erwachsenenleben fast viermal so häufig von sexueller Gewalt betroffen wie davon in Kindheit/Jugend nicht betroffene Frauen.
[107] Leichte Abweichung der Prozentwerte zur vorangegangenen Tabelle aufgrund von Auf-/Abrundungswerten nach Kommastellen.
[108] Je nach Prozentuierungsbasis auf alle Befragten (34%) oder nur auf jene Befragten, die ganz/teilweise bei den Eltern aufgewachsen waren (36%).
[109] Auch hier könnten die hohen Anteile von Frauen, die keine Angaben gemacht haben (14%), auf Erinnerungslücken und entsprechende Dunkelfelder verweisen und faktisch höhere Betroffenheiten nahelegen.
[110] Dass die Gewalt etwas mit der Behinderung zu tun habe, gaben vor allem die in den Einrichtungen befragten Frauen an (ein Fünftel der in allgemeiner und zwei Fünftel der in vereinfachter Sprache befragten Frauen).
[111] „Haben Sie davon jemandem aus dem Heim oder der Wohngruppe erzählt?“
[112] Um welche Art von Einrichtung es sich hier handelt, bleibt offen, da diese Frauen zum größten Teil weder aktuell noch früher in einer Einrichtung lebten oder betreutes Wohnen in Anspruch genommen hatten.
[113] Vgl. [online] URL: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf (Stand: 13.08.2012).
[114] Vgl. auch Libuda-Köster/Sellach 2009.
[115] Die Formulierung der Frage war vereinfacht: „Wurden Sie schlecht behandelt?“
[116] Die Frauen in Einrichtungen, die in vereinfachter Sprache befragt wurden, waren wegen der Komplexität des Referenzbezuges dazu nicht gefragt worden.
[117] Den Frauen, die in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragt wurden, wurde diese Frage nicht gestellt, da ihre Beantwortung ein zu großes Abstraktionsvermögen erfordert.
[118] Vgl. Kapitel 2.2.2.
[119] Die Angabe im nachfolgenden Diagramm bezieht sich auf Frauen, die vollständig selbst entscheiden können, mit wem sie zusammenwohnen. Würden auch jene Frauen einbezogen, die dies teilweise mitentscheiden können, dann würde sich die Zahl erhöhen auf 40% bei den in allgemeiner und 47% bei den in vereinfachter Sprache in Einrichtungen befragten Frauen.
[120] In der Vorbereitungsphase der Studie wurden Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Behinderungsformen befragt.
[121] Vgl. Libuda-Köster/Sellach 2009: Lebenslagen behinderter Frauen in Deutschland. Auswertung des Mikrozensus 2005, [online] URL: http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/Frauen_Lebenslagen.pdf?__blob= publicationFile (Stand: 17.08.2012) – Die Ergebnisse des Mikrozensus 2005 sind hier als Vergleichsgrößen geeignet, weil sie in etwa auf die Altersgruppe der Frauen, die im Rahmen der Studie befragt wurden, umgerechnet und die Geschlechtsgruppen nach dem Merkmal „behindert“ differenziert wurden.
[122] Vgl. Zinsmeister, Julia (2007): Mehrdimensionale Diskriminierung. Das Recht behinderter Frauen auf Gleichberechtigung und seine Gewährleistung durch Art. 3 GG und das einfache Recht, Baden-Baden. Zinsmeister arbeitet auf S. 36–ff. die Literatur dazu auf.
[123] Vgl. Zinsmeister a. a. O.
[124] Ein kleinerer Teil lebt jedoch auch aufgrund einer körperlichen Behinderung in einer Einrichtung.
[125] Dieses Ergebnis ist wiederum nur auf Frauen mit Behindertenausweis bezogen, die in Haushalten leben, weil die Frauen in Einrichtungen und solche ohne Behindertenausweis im Mikrozensus untererfasst sind.
[126] S. § 136 SGB IX.
[127] Nach § 138 SGB IX zahlen WfbM den behinderten Beschäftigten ein Arbeitsentgelt, „das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes“ (der Bundesagentur für Arbeit) „und einem leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt“. Nach den Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der WfbM waren das 2010 durchschnittlich 180€ im Monat, [online] URL: http://www.bagwfbm.de/page/101 (Stand: 20.08.2012).
[128] Die übrigen 8% der Frauen haben die Frage nicht beantwortet.
[129] Der Anteil könnte bei der letztgenannten Gruppe faktisch noch höher sein, weil 17% dieser Frauen nicht genau wussten, ab wann ihre Behinderung eingetreten war.
[130] Auch hier könnten die hohen Anteile von Frauen, die keine Angaben gemacht haben (14%), auf Erinnerungslücken und ein entsprechendes Dunkelfeld verweisen und faktisch höhere Betroffenheiten nahelegen.
In diesem Kapitel werden alle Ergebnisse der Zusatzbefragung analog zu den Ergebnissen der repräsentativen Hauptbefragung dokumentiert. (...)
[Das gesamte Kapitel 4. Ergebnisse der Zusatzbefragung ist unter bidok.uibk.ac.at/library/schroettle-lebenssituation-teil-2.html abrufbar, Anmerkung der bidok-Redaktion].
Anderson, Melissa / Leigh, Irene W. / Samar, Vincent J. (2011): Intimate partner violence against Deaf women: A review. In: Aggression and Violent Behavior 16:3, S. 200–206.
Becker, Monika (2001): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung: Daten und Hintergründe. 2. Auflage. Heidelberg: Winter.
Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen BIG e. V. (2010): Häusliche Gewalt ist nie in Ordnung. Informations-DVD für gehörlose und schwerhörige Frauen. Für weitere Informationen siehe: [online] URL: http://www.big-berlin.info/medien/haeuslichegewalt-ist-nie-ordnung (Stand: 23.07.2012).
Braun, Hans / Niehaus, Mathilde (1992): Lebenslagen behinderter Frauen: eine empirische Studie in Rheinland-Pfalz. Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz (Hrsg.). Idstein.
Brown, Hilary / Stein, June (1998): Implementing adult protection policies in Kent and East Sussex. In: Journal of Social Policy, 27(3), S. 371–396.
Brown, Hilary / Stein, June / Turk, Vicky (1995): The sexual abuse of adults with learning disabilities: report of a second two-year incidence survey. In: Mental Handicap Research, 8, S. 3–24.
Brownridge, Douglas A. (2006): Partner Violence Against Women with Disabilities: Prevalence, Risk, and Explanations. In: Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, 12(9), S. 805–822.
Bundesweites Heimverzeichnis – Wohnheime, Internate, Anstalten, Dauer- und Kurzzeitheime, Wohngruppen und Betreutes Wohnen für behinderte Menschen. CD-ROM, Stand: 01.01.2008, Verlag Ute & Werner Schmidt-Baumann.
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (2012): Warum verdienen Werkstattbeschäftigte so wenig? [online] URL: http://www.bagwfbm.de/page/101 (Stand: 23.07.2012).
Bussmann, Kai-D. (2005): Auswirkungen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung. Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz. Berlin, [online] URL: http://bussmann2.jura.uni-halle.de/FamG/Bussmann_OnlineReport.pdf (Stand: 23.07.2012).
Casteel, Carri / Martin, Sandra L. / Smith, Jamie B. / Gurka, Kelly K. / Kupper, Lawrence L. (2008): National study of physical and sexual assault among women with disabilities. In: Injury Prevention, 14(2), S. 87–90.
Deegener, Günther (2006): Erscheinungsformen und Ausmaße von Kindesmisshandlung. In: Heitmeyer, Wilhelm / Schröttle, Monika (Hrsg.): Gewalt. Beschreibungen, Analysen, Prävention. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 563. Bonn.
Deutscher Gehörlosen-Bund e. V. (1996) (Hrsg.): Gehörlose Frauen 95. Dokumentation einer bundesweiten Fragebogenaktion zur Situation gehörIoser Frauen in Deutschland. Kiel.
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Stand: 2005, [online]: URL: www.dimdi.de (Stand: 15.8.2012).
Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.) (2006): Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtsbildung, Ausgabe 2, [online] URL: http://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterialien_der_schutz_vor_diskriminierung.pdf (Stand: 23.07.2012).
Ebbinghaus, Horst / Heßmann, Jens (1989): Gehörlose – Gebärdensprache – Dolmetschen. Chancen der Integration einer sprachlichen Minderheit. Hamburg: Signum.
Eiermann, Nicole / Häußler, Monika / Helfferich, Cornelia (2000): Live. Leben und Interessen vertreten – Frauen mit Behinderung. Lebenssituation, Bedarfslagen und Interessenvertretung von Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen. Stuttgart: Kohlhammer (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Bd. 183).
Franke, Gabriele Helga (2002): SCL-90-R. Die Symptom-Checkliste von Derogatis - Deutsche Version – Manual. 2., vollständig überarbeitete und neu normierte Auflage. Göttingen: Beltz Test GmbH.
Galtung, Johan (1975): Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbek: Rowohlt.
Gemeinsamer Bundesausschuss (2008): Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Umsetzung der Regelungen in § 62 für schwerwiegend chronisch Erkrankte („Chroniker-Richtlinie“). Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 124 (S. 3017), in Kraft getreten am 20. August 2008, [online] URL: http://www.g-ba.de/downloads/62-492-278/Chr-RL_2008-06-19.pdf? (Stand: 23.07.2012).
GiGnet (2008) (Hrsg.): Gewalt im Geschlechterverhältnis. Erkenntnisse und Konsequenzen für Politik, Wissenschaft und soziale Praxis. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.
Gotthardt-Pfeiff, Ulrike (1991): Gehörlosigkeit in Ehe und Familie. Beziehungs- und Umgangsformen kommunikativ Behinderter. Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag.
Gromann, Petra (2002): Eine Einführung zum Konzept psychischer Behinderung und psychiatrischer Rehabilitation. Zusammenfassung und Bearbeitung eines Textes von G. Shepherd. Online-Schulung. Individuelle Behandlungs- und Rehaplanung (ibrp), [online] URL: http://www.ibrp-online.de/download/psychbehin.pdf (Stand: 23.07.2012).
Hall, Philip / Innes, Jennifer (2010): Violent and sexual crime. In: Flatley, John / Kershaw, Chris / Smith, Kevin / Chaplin, Rupert / Moon, Debbie (Hrsg.): Crime in England and Wales 2009/10. London: Home Office.
Häußler, Monika / Wacker, Elisabeth / Wetzler, Rainer (1996): Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in privaten Haushalten: Bericht zu einer bundesweiten Untersuchung im Forschungsprojekt „Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Hughes, Karen et al. (2012): Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies, [online] URL: http://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf (Stand: 09.08.2012).
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). [online] URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm (Stand: 23.07.2012).
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, Version 2012. Online: URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2012/index.htm (Stand: 10.08.2012).
Jacobi, Franc / Harfst, Timo (2007): Psychische Erkrankungen – Erscheinungsformen, Häufigkeit und gesundheitspolitische Bedeutung. In: Die Krankenversicherung 5, S. 3–6.
Kavemann, Barbara / Kreyssig, Ulrike (2007) (Hrsg.): Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. 2., durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kemper, Andreas (2010): Diskriminierung: Eine Einleitung zum Thema Diskriminierung, [online] URL: http://andreaskemper2.wordpress.com/article/diskriminierung-8bgikaqot3ts-3/ (Stand: 23.07.2012).
Klein, Susanne / Wawrok, Silke / Fegert, Jörg M. (1999): Sexuelle Gewalt in der Lebenswirklichkeit von Frauen und Mädchen mit einer geistigen Behinderung. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 48 (7), S. 497–513.
Leven, Regina (2003): Gehörlose und schwerhörige Menschen mit psychischen Störungen. 2., überarbeitete Auflage. Hamburg: Verlag hörgeschädigte kinder gGmbH.
Libuda-Köster, Astrid / Sellach, Brigitte (2009): Lebenslagen behinderter Frauen in Deutschland. Auswertung des Mikrozensus 2005. Im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Familie, Senioren und Jugend. Berlin, [online] URL: http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/Frauen_Lebenslagen.pdf?__blob=publicationFile (Stand: 17.08.2012).
Martin, Sandra L. / Ray, Neepa / Sotres-Alvarez, Daniela / Kupper, Lawrence L. / Moracco, Kathryn E. / Dickens, Pamela A. / Scandlin, Donna / Gizlice, Ziya (2006): Physical and Sexual Assault of Women with Disabilities. In: Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, 12(9), S. 823–837.
Martinez, Manuela / Schröttle, Monika et al. (2006): State of European research on the prevalence of interpersonal violence and its impact on health and human rights, [online] URL: http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/reddot/CAHRVreportPrevalence%281%29.pdf (Stand: 23.07.2012).
Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung NRW (2002): Zur allgemeinen Lebenssituation von Frauen mit Behinderung – hier vorrangig Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen – Stellungnahme des Netzwerks Frauen und Mädchen mit Behinderung NRW für die Enquetekommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW“ des Landtags in Nordrhein- Westfalen, [online] URL: http://www.netzwerk-nrw.de/archiv.html?year=2002 (Stand: 23.07.2012).
Pfaff, Heiko et al. (2006): Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnis des Mikrozensus 2005. In: Wirtschaft und Statistik, 12, S. 1267–1277.
Rommelspacher, Birgit (2006): Wie wirkt Diskriminierung? Am Beispiel der Behindertenfeindlichkeit. Vortrag auf der Tagung Ethik und Behinderung – Theorie und Praxis, 12. Mai 2006 in Berlin. Kooperationsveranstaltung mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe und der Katholischen Akademie in Berlin. [online] URL: http://www.imew.de/index.php?id=319 (Stand: 23.07.2012)
Turk, Vicky / Brown, Hilary (1993): Sexual abuse of adults with learning disabilities: results of a two-year incidence survey. In: Mental Handicap Research, 6, S.193-216.
Scherr, Albert (2011): Was meint Diskriminierung? Warum es nicht genügt, sich mit Vorurteilen auseinanderzusetzen. In: Sozial Extra, 35. Jg., Heft 11/12, S. 34–38, [online] URL: http://www.springerlink.com/content/ek61582j20kt3rlh/fulltext.pdf (Stand: 20.08.2012).
Schröttle, Monika / Müller, Ursula (2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin, [online] URL: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/langfassung-studie-frauen-teileins,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf (Stand: 23.07.2012).
Schröttle, Monika / Khelaifat, Nadia (2008): Gesundheit – Gewalt – Migration: Eine vergleichende Sekundäranalyse zur gesundheitlichen und sozialen Situation und Gewaltbetroffenheit von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland. Im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Familie, Senioren und Jugend. Berlin, [online] URL: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/gesundheit-gewalt-migration-kurzfassungstudie,property=pdf,bereich=bmfsfj,rwb=true.pdf (Stand: 23.07.2012).
Schröttle, Monika / Hornberg, Claudia / Bohne, Sabine et al. (2008): „Gesundheitliche Folgen von Gewalt unter besonderer Berücksichtigung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Robert Koch Institut, Statistisches Bundesamt, Heft 42), [online] URL: http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/gewalt.pdf?__blob=publicationFile (Stand: 10.08.2012).
Schröttle, Monika / Ansorge, Nicole (2008): Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen – eine sekundäranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregraden, Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach erlebter Gewalt. Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin, [online] URL: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/gewaltpaarbeziehung-langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf (Stand: 23.07.2012).
Selbsthilfegruppe gehörlose Frauen in Münster (2006): Häusliche Gewalt. Informationen für gehörlose Frauen in Münster. Münster, [online] URL: http://www.frauenberatungen.de/images/stories/pdfs/haeusliche__gewalt.pdf (Stand: 23.07.2012).
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX): Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, [online] URL: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/1.html (Stand: 23.07.2012).
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2008): Datenreport 2008. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn, [online] URL: http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/datenreport/2008/Datenreport2008-Gesamt.pdf (Stand: 24.07.2012).
UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen (Behindertenrechtskonvention – BRK). Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung, [online] URL: http://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDFDateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_de.pdf (Stand: 23.07.2012).
Zemp, Ahia / Pircher, Erika (1996): „Weil das alles weh tut mit Gewalt“. Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen mit Behinderung. Schriftenreihe der Frauenministerin, Bd. 10. Wien.
Zinsmeister, Julia (2007): Mehrdimensionale Diskriminierung. Das Recht behinderter Frauen auf Gleichberechtigung und seine Gewährleistung durch Art. 3 GG und das einfache Recht. Baden-Baden: Nomos.
Anmerkung der bidok-Redaktion: Der Anhang kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://bidok.uibk.ac.at/download/schroettle-lebenssituation-anhang.pdf
Dieses PDF ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung; es wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.
Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 11018 Berlin, www.bmfsfj.de
Autorinnen und Autoren der vorliegenden Dokumentation:
-
Monika Schröttle, Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) der Universität Bielefeld
-
Sandra Glammeier, Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) der Universität Bielefeld
-
Brigitte Sellach, Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung e. V. (GSF)
-
Claudia Hornberg, Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld
-
Barbara Kavemann, Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut Freiburg (SoFFI F., Büro Berlin)
-
Henry Puhe, SOKO Institut GmbH Sozialforschung und Kommunikation
-
Julia Zinsmeister, Fachhochschule Köln, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Institut für Soziales Recht
Leitung/Koordination: Monika Schröttle/Claudia Hornberg
Für weitere Fragen nutzen Sie unser Servicetelefon: 030 20179130, Montag–Donnerstag 9–18 Uhr, Fax: 030 18555-4400, E-Mail: info@bmfsfjservice.bund.de
Einheitliche Behördennummer: 115*
Zugang zum 115-Gebärdentelefon: 115@gebaerdentelefon.d115.de
Stand: Juni 2013
Gestaltung: www.avitamin.de
* Für allgemeine Fragen an alle Ämter und Behörden steht Ihnen auch die einheitliche Behördenrufnummer 115 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zur Verfügung. Diese erreichen Sie zurzeit in ausgesuchten Modellregionen wie Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen u.a.. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.115.de.
Quelle
Monika Schröttle, Sandra Glammeier, Brigitte Sellach, Claudia Hornberg, Barbara Kavemann, Henry Puhe, Julia Zinsmeister: Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Ergebnisse der quantitativen Befragung. Endbericht. Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2013. Original verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=199822.html
bidok-Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 27.3.2018