Dieser Text ist in gekürzter Version. Erschienen in: www.brandeins.de, Mai 2008
Inhaltsverzeichnis
Solange es Sonderschulen gibt, gibt es auch Sonderschüler. Im österreichischen Reutte durchbrachen engagierte Eltern und Pädagogen diesen unseligen Kreislauf - und schafften die Sonderschule ab. Jetzt besuchen alle Kinder, Gesunde wie Behinderte, die Regelschule. Niemand wird mehr ausgesondert. Eine Ortsbesichtigung.

Heinz Forcher, der Vater, der alles ins Rollen brachte
Vor ein paar Tagen hat Daniel zum ersten Mal "Essen" gesagt. Die Familie hat sich gefreut, weil er doch sonst so gut wie gar nicht spricht, trotz seiner sechseinhalb Jahre. Als er drei war, ist Daniel in den Dorfteich gefallen. Man hat ihn herausgezogen und wiederbelebt, aber sein Gehirn war sehr lange ohne Sauerstoff. Daniel wird nie gesund werden, nie so sein wie die anderen Kinder aus Bichlbach, einem Dorf im Tiroler Bezirk Reutte, nahe der Grenze zu Deutschland. Weil er nicht laufen kann, muss er überall hin getragen werden. Er kann nicht allein essen und er trägt Windeln, auch tagsüber.
Im Herbst kommen die anderen Kinder aus dem Dorf, die so alt sind wie Daniel, in die Volksschule. So heißt die Grundschule in Österreich immer noch. Auch Daniel soll dort eingeschult werden, hat Renate Güttersberger, die Oma, gehört. Sollen wir ihn wirklich in die Schule geben?, fragen sich die Güttersbergers jetzt. Ihr Daniel unter all den gesunden Kindern, die sprechen und singen und rennen, sich den Hintern abwischen können und Fußball spielen, einen Laternenmast hochklettern und Ski fahren im Winter. Wie soll er denn lesen und schreiben lernen, wenn er nicht mal sprechen kann? Wer wird ihn säubern, windeln? Und wie soll er morgens zur Schule und nachmittags wieder heim kommen? "Wir müssten ihn ja jedesmal tragen", sagt Renate Güttersberger. Sie hatte kürzlich einen Bandscheibenvorfall. Daniels Mutter, Karin Güttersberger, ist selbst schwer gehandicapt. Mit drei wurde sie von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Sie ist seitdem auch geistig zurückgeblieben. Auf der Sonderschule "hat sie kaum was gelernt", sagt ihre Mutter, "nein, die Sonderschule, das war gar nichts."
Bei Daniel wollen sie es besser machen. Aber was heißt das? "Vielleicht besser ins Heim", meint Daniels Mutter. "Dann haben wir auch einmal ein Leben für uns. Ohne die Schlepperei und die Fahrerei zu den Therapien. Da gehen ja jedesmal drei Stunden drauf für eine halbe Stunde Therapie." "Ja, stimmt schon", sagt Daniels Oma, "aber er hängt halt so an uns. Wie soll man sich nur entscheiden?"
Heinz Forcher kennt das alles. Die Zweifel. Die seelische Qual. Obwohl seit dem Unglück mit seinem Sohn Ernst fast dreißig Jahre vergangen sind, sieht er vieles noch ganz genau vor sich. Ernst war damals sieben Monate alt. Vielleicht hatte er sich in seinem Bettzeug eingewickelt und keine Luft mehr gekriegt, niemand weiß es genau. Die Diagnose: Schädigung des Gehirns durch Unterversorgung mit Sauerstoff. Außerdem trug Ernst spastische Lähmungen an allen Gliedmaßen davon und kann sich bis heute nur im Rollstuhl fortbewegen.
Heinz Forcher glaubte den Ärzten und Therapeuten. "Ich hab' anfangs gedacht, ich muss nur tun, was die sagen", erinnert er sich, "dann ist der Ernst irgendwann nicht mehr behindert." "Das Beste wäre, Sie geben ihn ins Heim", rieten die Experten. Das einzige Heim weit und breit lag etwa 100 Kilometer entfernt von Weissenbach, einem Dorf bei Reutte, wo Heinz Forcher ein Hotel besaß. "Nach dem zweiten Wochenende hat er während der ganzen Autofahrt zurück ins Heim immer nur gesagt: ‚Papa mi holn.' Und als wir in das Haus gingen, hat er furchtbar angefangen zu schreien. So schrecklich, dass ich jahrelang nicht drüber reden konnte." Ernst wollte nicht ins Heim. Er wollte bei seinen Eltern bleiben.
Es begann Heinz Forchers langer Kampf für eine Alternative zum Aussondern und Abschieben in Heime, Werkstätten und Sonderschulen. Allein konnte er den nicht gewinnen. Also beschaffte er sich Adressen anderen Eltern aus der Region. Zum ersten Treffen in Reutte kamen fast 80 Leute. Sie gründeten den Verein Vianova (neuer Weg), eine Selbsthilfegruppe von Familien mit behinderten Kindern. Kurz zuvor war im Burgenland, gegen den erbitterten Widerstand von Lehrern und Behörden, die erste Schulklasse in Österreich eingerichtet worden, in der behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet wurden. Da die Schulbehörde ihnen einen Klassenraum verweigerte, musste der Unterricht anfangs in einem Zelt stattfinden. Für Forcher war diese erste Integrationsklasse das Signal. "Das wollten wir hier in Reutte auch."
Forcher und seine Mitstreiter von Vianova hatten zumindest die Wissenschaft auf ihrer Seite. Sämtliche Untersuchungen integrativer Schulversuche dokumentierten deutliche Lern- und Entwicklungsfortschritte - auch bei schwerstbehinderten Kindern. Sonderschülern dagegen wurde ein viel langsameres Vorankommen attestiert, manche verdummten regelrecht; ihr Intelligenzquotient schrumpfte. Einige verlernten sogar das Sprechen.
Heute, gut zwanzig Jahre später, ist die Überlegenheit der schulischen Integration unter den Erziehungswissenschaftlern common sense. "Das Lernen durch Beobachten, Miterleben und Nachvollziehen hat gerade für Kinder mit beeinträchtigten Entwicklungsverläufen einen hohen Stellenwert", urteilt der Berliner Integrationspädagoge Hans Eberwein. "Demgegenüber haben durch eine Zusammenfassung von gleichartig ‚Behinderten' die Betroffenen stark reduzierte Lern- und Entwicklungschancen." Eberweins Fazit: "Nach 120 Jahren stehen eigenständige Sonderschulen grundsätzlich zur Disposition."
Im Reutte der Achtziger Jahre interessierten sich Politiker, Schulbürokraten und Lehrer nicht für die Forschungsergebnisse an den Hochschulen. "Akzeptieren Sie doch endlich, dass schwerstbehinderte Kinder nicht in die Volksschule gehören", versuchte man Heinz Forcher klarzumachen. Ein sozialdemokratischer Kommunalpolitiker meinte, man tue doch heute schon so viel für die Behinderten, beim Adolf habe man sie noch vergast. Forcher, ein gradliniger, zuweilen auch herrischer Mann, begann verbal um sich zu schlagen, "mit dem stumpfen Schwert", und baute Druck auf: "Wenn mein Sohn diese Schulklasse nicht besuchen kann", forderte er ultimativ, "dann trete ich in Hungerstreik." Um sein Hotel kümmerte er sich kaum noch; er gab es schließlich auf.
Ernst Forcher, heute 29 Jahre alt, wurde 1985 das erste Integrationskind im Bezirk Reutte und besuchte fortan die Volksschule in Weissenbach. Sein Vater glaubt heute, "dass Lehrer und Behörden letztlich nachgegeben haben, weil es sonst ihrem Ruf geschadet hätte. Ich habe ja keine Ruhe gegeben." Letztens hat ein Beamter, einer der Gegner aus Kampfzeiten, zu ihm gesagt: "Herr Forcher, da ist Blut geflossen damals."
Ausgerechnet der Direktor der Sonderschule in Reutte wurde Forchers engster Verbündeter. In Norbert Syrow war im Laufe der Jahre die bittere Erkenntnis gereift, dass seine Schule hauptsächlich Nachschub für die Behinderten-Werkstätten produzierte. "Meine Schüler haben Jahr für Jahr das Gleiche wiederholt und sind dann in die nächste Klasse aufgestiegen, ohne einen nennenswerten Fortschritt gemacht zu haben", sagt Syrow heute. Die Schwerstbehinderten waren alle in einer Klasse zusammengefasst. "Da konnte es sein, dass acht von zehn Kindern nicht sprechen konnten. Unter solchen Bedingungen gibt es keinen Austausch, keine Anregungen und kaum Sinneseindrücke." Syrow begann sich Gedanken über einen gemeinsamen kindgerechten Unterricht für alle Schüler zu machen, mit und ohne Behinderung, in einer Schule, die kein Kind als "nicht integrierbar" zurücklässt. Und ihm wurde schmerzlich bewusst, dass es vor allem seine Sonderschule war, die diesem Ideal im Weg stand.
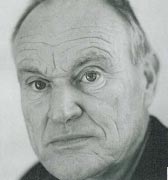
Schaffe die eigene Sonderschule ab: Rektor Norbert Syrow
In den Schulen begann ein Kulturkampf. "Was macht denn das für ein Bild, wenn solche schwerstbehinderten Kinder in der Schule sind?", tönte es Forcher und Syrow aus der Lehrerschaft entgegen. Den Eltern erklärte man, ihre Kinder würden weniger lernen, mit einem Behinderten in der letzten Bank. "Das mit dem Ernst Forcher war ein Versuch, na schön", hieß es bei Elternversammlungen, "aber jetzt müssen die Behinderten wieder raus, die stören unsere Kinder nur."
Für Norbert Syrow allerdings gab es kein Zurück mehr. "Ich konnte doch nicht sagen, mit dem Ernst machen wir das und mit den anderen nicht." An fast allen Schulen fand er vereinzelte aufgeschlossene Lehrer, die sich der Verweigerungshaltung des Kollegiums entgegenstellten. "Diese Lehrer haben wir versucht zu stärken", sagt Syrow. "Im Laufe der Jahre, nachdem wir zeigen konnten, dass Integration tatsächlich in der Praxis funktioniert, ist die Stimmung dann allmählich gekippt."
Syrow wusste, dass es immer wieder Sonderschüler geben würde, solange es seine Sonderschule gab. "Wenn eine Sonderschule da ist, erzeugt sie Bedarf - und dann wird sie auch gefüllt." Genau genommen, füllt sie sich selbst. Die Sonderschulen sind in Österreich nämlich die erste Anlaufstelle für Eltern behinderter Kinder, die zur Einschulung anstehen. Dass die Sonderschulleiter fast ausnahmslos den Besuch ihrer Schule nahelegen, verwundert kaum.
Norbert Syrow dagegen arbeitete unbeirrt daran, seine eigene Schule mit damals 60 Schülern abzuschaffen. Seit 1985 nahm er keine neuen Schüler mehr auf. "Wir haben jedes Kind, das zu uns kam, auf der Regelschule untergebracht. Und dass Kinder von dort zu uns abgeschoben wurden, sobald sie Schwierigkeiten bereiteten, kam erst recht nicht mehr in Frage." Am Ende des Schuljahres 1996/97 gingen die letzten fünf Kinder ab. Die Sonderschule Reutte war stillgelegt. Seitdem ist der Bezirk Reutte sonderschulfreie Zone. Alle Kinder besuchen die Regelschule. Zurzeit verteilen sich rund 80 Schüler mit "sonderpädagogischem Förderbedarf", wie es korrekt heißt, auf 40 Klassen in 25 Volks- und Hauptschulen. Anders als in Deutschland, wo die Hauptschule allmählich zur Restschule für die Verlierer der Bildungsselektion verkommt, ist sie in Österreich immer noch die vorherrschende Schulform für das 5. bis 8. Schuljahr.
Zwischenzeitlich hatte sich in ganz Österreich der Wind gedreht. Seit 1993 haben Eltern behinderter Kinder ein gesetzlich garantiertes Wahlrecht zwischen Sonderschule und Regelschule. Die Einschulung auf einer Volksschule oder einer Hauptschule ist kein Gnadenakt der Schulbehörde mehr. Der Integrationsgrad ist regional allerdings sehr unterschiedlich. In der Steiermark und im Burgenland entscheiden sich mehr als 85 Prozent der Eltern für die Integration. In Tirol, wozu auch der Bezirk Reutte gehört, sind es nur 40 Prozent.
Roland Astl ist seit der Stilllegung der Sonderschule so etwas wie die Spinne im Reutter Integrationsnetz. Der ehemalige Volksschullehrer, der vor 20 Jahren eine der ersten Integrationsklassen im Bezirk unterrichtete, leitet vom Lehrerzimmer der ehemaligen Sonderschule aus das Sonderpädagogische Beratungszentrum (SPZ). Das SPZ berät Eltern, wenn es um die Einschulung ihres Kindes geht. Im Bezirk Reutte kennt Astl jedes Kind mit schwerem Handicap. Monatlich trifft er sich mit dem Chef der Kinderambulanz und den Therapeuten der Region. In vielen Fällen ist er für die Feststellung des "Sonderpädagogischen Förderbedarfs" verantwortlich. Früher sträubten sich die Eltern gegen diese Einstufung - weil ihr Kind dann fast automatisch auf die Sonderschule abgeschoben wurde. Heute braucht niemand mehr Angst vor dem Gutachten zu haben. "Im Bezirk Reutte hat es keine Selektionsfunktion mehr", erklärt Astl. "Hier wird kein Kind mehr ausgesondert oder ausgeschult."

Einst Volksschullehrer, heute Integrator: Roland Astl
In Reutte gilt der eherne Grundsatz: Integration ist unteilbar. Jedes Kind wird schulisch integriert, egal wie schwer es behindert ist. "Wenn man den harten Kern der Schwerstbehinderten draußen lässt", begründet Roland Astl, "dann ist man wieder beim Selektieren. Und dann kann man auch die Sonderschule nicht schließen."
Dass auch Kinder, die weder sprechen noch laufen können, in den Klassen sitzen oder auch liegen, versteht mancher nach wie vor nicht. Solche Kinder, räumt Roland Astl ein, sind tatsächlich eine große Herausforderung für die Lehrer. Benni etwa, der eigentlich nur das Licht im Klassenraum ein- und ausschaltet und dann wegläuft. Aber man kann ihn ja nicht einschließen. Oder Ramazan, der sich ständig massiv gegen den Kopf schlug und die ganze Zeit einen Helm tragen musste, damit er sich nicht verletzt.
An die Adresse von Schulen und Lehrern hat Astl von Anfang an, auch in solchen Problemfällen, die unmissverständliche Botschaft gesandt: Es geht nicht um das Ob, sondern lediglich um das Wie der Aufnahme. Für den SPZ-Leiter wiegt "das Recht des Kindes auf Besuch der Schule an seinem Wohnort mehr als das Recht des Lehrers, an einer bestimmten Schule zu unterrichten. Da waren wir sehr konsequent und hart." Integration findet grundsätzlich vor Ort statt - auch in der Zwergschule mit vier Kindern aus vier Schuljahren. Einige Lehrer, die keine Behinderten in ihrer Klasse wollten, haben sich in andere Bezirke versetzen lassen.
Die Volksschule Berwang liegt gut eine halbe Autostunde von Reutte entfernt. Die neun Schüler der dritten und vierten Klasse werden gemeinsam unterrichtet. Einer von ihnen ist Richard, ein Junge mit Down-Syndrom im sechsten Schulbesuchsjahr. Für ihn gelten die Vorgaben des Sonderschul-Lehrplans - und damit andere, niedriger gesteckte Lernziele als für seine Klassenkameraden. "Richard hat eine Eule ganz allein angemalt!", steht in seinem Lobbuch, in goldenem Glanzpapier eingeschlagen. Oder: "Richard hat das B sehr schön geschrieben. Er erkannte den Unterschied zum Papa-P. Super, Richard!"
Christa Koch ist Richards Stützlehrerin. Sie steht der Klassenlehrerin zur Seite und kümmert sich vorwiegend um Richard. Schwerstbehinderte Kinder werden die gesamte Unterrichtszeit von einem sonderpädagogisch ausgebildeten Stützlehrer betreut, Schüler mit geringerem Förderbedarf nur stundenweise.
Die Stützlehrerin schreibt "Mama" und "Richard" mit dem Bleistift vor, dann malt Richard die Buchstaben ziemlich akkurat nach. Christa Koch stellt ein rotes Schild mit der Aufschrift "Opa" auf ein rotes Feld. "Und wie heißt das jetzt?" Sie schaut Richard fragend an. Er weiß es nicht. Neuer Anlauf, diesmal anders herum: "Welche Farbe nimmst du für Opa?" Richard greift sich den roten Filzer. Er trinkt aus seiner Flasche und rülpst laut. Das hat er nicht unter Kontrolle. Jetzt soll er noch "Peter" gelb ausmalen, aber er bemalt lieber den Pullover der Stützlehrerin. Sie schimpft leise mit ihm. Er soll sich entschuldigen.
Ein Mitschüler kommt an den Tisch: "Jetzt möcht' ich aber endlich mit dem Richard malen", drängelt er. Richard hakt sich bei dem Jungen unter, der führt ihn zur Sofaecke. Später sitzen alle in der Runde auf Kissen auf dem Boden und jeder berichtet, was er in der Freiarbeit gemacht hat. Rechnen im Zahlenraum bis tausend. Satzglieder. Leiter und Nichtleiter. Niklas liest seine Geschichte vor, der er geschrieben hat: Mein Geburtstag. Zwischendurch wischt er Schoko-Sabber von Richards Kinn ab. "Richard, möchtest du mal erzählen, was du heute gemacht hast?", fragt die Klassenlehrerin. Keine Antwort. Das war zu abstrakt. "Welchen Namen hast du geschrieben?" - "Peter."
Gemeinsame Lernfelder zu definieren, ist die Königsdisziplin für Klassenlehrer und Stützlehrer. Was bedeutet "gemeinsames Lernen" beispielsweise für Richard und Niklas ganz konkret? "Das liegt nicht so ohne weiteres auf der Hand", sagt Roland Astl, "jedes Lernprojekt muss mühsam vorbereitet und erarbeitet werden."
Astl bringt ein Beispiel aus dem Physikunterricht. Viele behinderte Kinder haben Probleme, beim Schneiden mit einem Messer den richtigen Druck auszuüben, auf eine Gurke beispielsweise. "Während die anderen Schüler im Physikunterricht theoretische Überlegungen anstellen, warum ein Messer schneidet, lernt die Katharina ganz praktisch, dass sie fester drücken muss, wenn sie die Gurke schälen will. Die anderen können sich mit dem, was sie gelernt haben, nun erklären, warum die Katharina mit ihren 13 Jahren keine Gurke schneiden kann. Sie würden sich die Frage aber nie stellen, wenn Katharina nicht da wäre. Also haben auch sie etwas gelernt."
Nach mehr als zwei Jahrzehnten Integrationserfahrung ist Astl überzeugt, dass gemeinsamer Unterricht ein Gewinn für alle Schüler ist. Studien zeigen, dass behinderte Kinder oft sehr sensibel für Ungerechtigkeiten in der Klasse sind, für Trauer, Wut oder Enttäuschung. Sie schaffen es häufig als Erste, auf andere zuzugehen und zu trösten. Die Schwächeren unter den Nichtbehinderten machen die positive Erfahrung, dass auch sie anderen Schülern helfen können. "Und wenn Richard mal nicht in der Schule ist, fehlt er den anderen Kindern", sagt Roland Astl. "Er macht das Ganze erst ganz. Er wird vermisst."
In den vergangenen Wochen war Astl häufig in den Kindergärten anzutreffen. Er hat dort die Kinder mit Förderbedarf beobachtet, die im Herbst zur Einschulung anstehen. Rechtzeitig vor Schuljahresbeginn sind damit auch Schulleiter und Klassenlehrer im Bilde - und können entsprechend planen. In Integrationskonferenzen stimmen sie sich untereinander ab. Wo müssen noch Treppen und Barrieren beseitigt, Toiletten rollstuhlgerecht umgebaut werden? Wie viele Stützlehrerstunden werden an den einzelnen Schulen benötigt? Kommen Kinder, die gewindelt werden müssen? "Ich kann ja nicht von einem Lehrer verlangen, dass er Körperpflege durchführt", erklärt Gerfried Breuss, Direktor der Hauptschule am Untermarkt in Reutte. "Da brauch' ich eine Pflegekraft und einen Wickeltisch." Außerdem fährt Astl mit den Direktoren und Klassenlehrern der Hauptschulen zu den Volksschulen, damit sie die Kinder mit Behinderung, die demnächst zu ihnen in die 5. Klasse kommen, schon einmal kennen lernen.

In der Pause sind alle gleich: Hauptschule am Untermarkt in Reutte
Noch minutiöser wird der Übergang von der Schule in den Beruf vorbereitet. Systematisch sucht das Arbeitsmarkt-Team des Elternvereins Vianova nach Jobs für jährlich 15 bis 20 KIienten, die ihre Schullaufbahn beenden. Gemeinsam mit den Jugendlichen schauen die Vianova-Mitarbeiter sich Betriebe an, noch während der Schulzeit organisieren sie Schnupperpraktika in Gärtnerei und Tischlerei, Baufirma und Krankenhaus, Autowerkstatt und Altersheim. Dort sammeln die Jugendlichen erste Erfahrungen mit richtiger Arbeit: Sie fegen den Platz vor der Gemeindeverwaltung, schnippeln Obst und Gemüse, lochen Blätter, falten Bettwäsche und sammeln Müll ein. Das Arbeitsbuch, das jedem Arbeitgeber vorgelegt wird, dokumentiert sämtliche Tätigkeiten und Fortschritte: Beim Kuvertierten und Stempeln von Behördenpost. Beim Kartoffelschälen. Beim Verputzen von Rigipsplatten auf der Leiter. Beim Umgang mit dem Akkuschrauber.
Viele Chefs erwarten, dass der behinderte Mitarbeiter auf kurz oder lang eine vollwertige Arbeitsleistung bringt. "Das funktioniert in vielen Fällen nicht", sagt Margit Dablander, Arbeitsassistentin bei Vianova, "manche brauchen permanent unsere Unterstützung." Andere wiederum nur eine Zeitlang. So wie Engin Bayram, den Vianova zum Eurospar-Supermarkt in Reutte vermitteln konnte. Geschäftsinhaber Peter Müller gerät richtig ins Schwärmen. "Schon nach kurzer Zeit hat er richtig Freude an der Arbeit gefunden. Er rennt für jeden Kunden. Brauchst du das wieder, sagt er, ich hab es schon zurückgelegt." Engin Bayram ist beliebt bei den Kunden, fast schon ein Aushängeschild der Firma. Voriges Jahr wurde er zum freundlichsten Verkäufer von Reutte nominiert.
Engins Kollegin Dragana Milič dagegen wäre fast entlassen worden. Es ging einfach nicht mehr weiter so. Wenn ein Kunde sie ansprach, hat sie sich einfach rumgedreht und ist weggegangen. "Das geht nicht in einem Supermarkt", sagt Peter Müller. "Es hat ja bei uns keiner ein Schild umhängen, auf dem draufsteht: ‚Ich bin behindert.'" Margit Dablander, die ihre Klientin etwa auf dem geistigen Stand einer Fünf- bis Sechsjährigen einstuft, hat eine Karte für Dragana angefertigt, die sie den Kunden hinhalten soll. "Bitte gehen Sie zu einem Kollegen", steht darauf. "Du musst die Kunden grüßen", hat ihr Chef immer wieder gesagt. Aber Dragana wusste gar nicht, wie man das macht, grüßen. Margit Dablander hat es dann mit ihr geübt. Dragana wurde nicht entlassen.

Der freundlichste Verkäufer von Reutte: Engin Bayram (rechts) mit seinem Chef Peter Müller (2.von links), Daniel Wild und Dragana Milià
Vianova legt Wert darauf, dass niemand aus Mitleid beschäftigt wird, sondern dass es für den Betrieb Sinn macht. Nicht nur wegen des staatlichen Lohnkostenzuschusses, der anfangs je nach Grad der Behinderung bis zu 100 Prozent betragen kann. Das Arbeitsmarkt-Team verwendet viel Zeit auf "Job Creation": Teile von Tätigkeiten werden ausgegliedert und zu einem neuen Arbeitsplatz für einen Klienten zusammengefasst. "Wenn beispielsweise ein gut besoldeter Beamter stundenlang am Kopierer steht oder Verkäufer eines Autohauses im Winter den Schnee von den Neuwagen fegen, fällt uns das auf", sagt Margit Dablander. "So etwas kann schon die Basis für einen Arbeitsplatz sein."
Vor Ort wird die Frage der Sinnhaftigkeit mitunter außerordentlich pragmatisch beantwortet. Vinzenz Knapp, Bürgermeister der 1300-Einwohner-Gemeinde Höfen, findet es schlichtweg "a wunderbare Sache", dass Stefan an zwei Tagen pro Woche die Brigade der Gemeindearbeiter verstärkt. "Der Stefan, der ist mongloid, den kann man sich gar nicht mehr wegvorstellen. Auch die anderen Gemeindearbeiter nicht, die skeptisch waren anfangs." Jetzt verrichtet Stefan selbstständig "monotone Arbeiten": "Der tut die Mistkübel leeren, Brunnen putzen und Laub kehren." Dabei konnte er anfangs, vor drei Jahren, nicht einmal eine Schaufel halten. "A wunderbare Sache", sagt der Bürgermeister noch einmal.
Auch Daniel Wild hat mir Hilfe von Vianova eine feste Stelle gefunden; er hat es geschafft. Der junge Mann mit Down-Syndrom, des sonntags eifriger Ministrant in der Heiligen Messe in Weissenbach, steht montags ab acht Uhr früh an der Papppresse in Peter Müllers Supermarkt. "Wir dehnen seinen Einsatzbereich immer weiter aus", sagt Müller, "er soll ja nicht Woche für Woche den ganzen Tag nur an der Papppresse stehen." Seit kurzem sortiert Daniel jetzt auch das Leergut und räumt Flaschen ins Regal ein.
Daniels Arbeitsassistentin Margit Dablander ist überzeugt, dass ein junger Mann wie er als Sonderschüler in der Behindertenwerkstätte gelandet wäre. Schulische Integration sei die Voraussetzung für eine aussichtsreiche Jobsuche. "Wer jahrelang in einer ständigen Sonderrolle ist, sich immer in geschütztem Raum bewegt, dem fehlen Erfahrungen, da finden keine Lernprozesse statt, der Bezug zu anderen Menschen fehlt."
Familie Wild zog vor zehn Jahren aus dem bayerischen Berching nach Reutte - weil man Daniel daheim den Besuch der Grundschule verweigerte. Monika Wild, die Mutter, wollte ihren Sohn "ein Stückweit normal aufwachsen lassen - mit Kindern, die schneller reden und denken und handeln als er". Doch alle stellten sich quer: die Behörden. Der Pfarrer. Die Schule. Als sie nach zähem Ringen einen Probeunterricht an der Grundschule durchgesetzt hatten, hörte der Lehrer praktisch auf zu unterrichten und dokumentierte nur noch, was Daniel alles nicht konnte. Dass er sich ständig mit der Schultasche seines Banknachbarn befasste. Und dass man so doch keinen Unterricht abhalten kann.
Auf einer Veranstaltung erlebten Daniels Eltern die Reutter Integrations-Troika - Forcher, Syrow und Astl - und entschlossen sich zum Umzug nach Österreich. Daniel besuchte die Volksschule in Weissenbach, dann die Hauptschule in Reutte, wo er in Englisch zu den Klassenbesten gehörte, und zuletzt die Polytechnische Schule zur Berufsvorbereitung. Heute ist er 19 Jahre alt und hat ziemlich genaue Vorstellungen von seiner Zukunft. Seitdem man ihm von Romeo und Julia erzählt hat, will er nach England fahren und gucken, ob der Shakespeare noch lebt. Und anschließend in Verona nachschauen, was los ist mit Romeo und Julia. Und sich so verlieben wie die zwei, das will er auch.
Was Familie Wild seinerzeit in Berching durchmachte, ist in Deutschland immer noch der Normalfall. Nur rund zehn Prozent der Kinder mit Förderbedarf besuchen die Regelschule; die anderen 90 Prozent füllen die Sonderschulen. Ein bundesweites gesetzlich verankertes Wahlrecht der Eltern nach österreichischem Muster gibt es nicht. Die Bestimmungen variieren von Bundesland zu Bundesland, von Landkreis zu Landkreis, von Schule zu Schule. Eltern, die ihr Kind in einer Integrationsklasse unterbringen wollen, führen meist einen jahrelangen, oft erfolglosen Kampf gegen die Behörden. Vielerorts gibt es zur Sonderschule immer noch keine Alternative.
Dass ein gesetzlicher Anspruch auf Integration nicht automatisch gleichbedeutend ist mit einem guten Unterricht, wird beim Besuch der Hauptschule am Untermarkt in Reutte klar. Ausgerechnet hier. Die Schule gilt als die Integrations-Hauptschule im Bezirk. Seit fast zwanzig Jahren sind behinderte Kinder hier fast eine Selbstverständlichkeit.
Bei Katharina ist das 13. Chromosom ringförmig statt stäbchenförmig ausgebildet. Die 13-Jährige besucht die 8. Klasse, ihr Entwicklungsstand entspricht im Großen und Ganzen dem einer Dreijährigen.
In der Geographiestunde sitzt Katharina ganz hinten rechts in der letzten Bank; eben hat sie mit der Pflegekraft noch Joghurt und Bananen für ihre Jause eingekauft. Die Stützlehrerin ist nicht vor Ort; sie spielt Querflöte bei der Probe fürs Schulkonzert. Die Klasse absolviert einen Kurztest. Katharina schneidet derweil mit Hilfe der Pflegerin eine Banane in Scheiben.
"Welchen Maßstab hat die Wirtschaftskarte von Australien im Atlas?", fragt die Lehrerin.
Katharina schneidet mühsam Scheibe um Scheibe.
"Sucht die Zeichen für Erdöl und Erdgas heraus."
Katharina öffnet den Joghurtbecher und lässt den Joghurt auf die Bananenscheiben laufen.
"Ich behaupte, in Österreich wird Erdöl produziert. Stimmt das oder stimmt es nicht?"
Katharina löffelt. Es geht einiges daneben.
"In der Steiermark - gibt's da eine Fahrzeugindustrie? Wenn ja, in welcher Stadt?"
Die Pflegerin geht mit Katharina raus, das Geschirr abspülen.
Unter "Vorschläge für den Tagesablauf mit Katharina" auf einem Zettel an der Wand finden sich "Gemeinsames Fischefüttern", "Blumen in der Klasse gießen" und "Mülleimer ausleeren in der 5. Stunde". "Katharina wird sozial integriert", wird die Stützlehrerin später sagen, "stoffmäßig ist das nicht möglich." In der Pause spielen zwei oder drei Schüler mit Katharina Puzzle oder ziehen mit ihr Wollfäden durch Holztiere. Bei Klassenfahrten ist sie nicht dabei, sagt die Stützlehrerin, weil sie nicht außerhalb des Elternhauses übernachten will und auch Zug- und Busfahrten nicht verträgt.
Roland Astl schaut geknickt drein. "Hier muss ich intervenieren", sagt er, "das war klassischer Frontalunterricht mit einem behinderten Beistellkind in der letzten Reihe. Genau so darf es nicht sein." Astl war gewarnt. Schuldirektor Gerfried Breuss hatte vor der Visitation schon angedeutet, man sei "jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Integration so selbstverständlich ist, dass sich Routine einstellt. Vor zehn Jahren sind manche Dinge besser gelaufen."

Außerirdische Fantasien in der Hauptschule im Tiroler Bezirk Reutte

Außerirdische Fantasien in der Hauptschule im Tiroler Bezirk Reutte
Die Integration behinderter Kinder stellt die Frage nach der Qualität des Unterrichts drängender als je zuvor. Sie macht insbesondere die Schwächen des herkömmlichen Frontalunterrichts deutlich. Astls Diagnose: Immer noch geht es in Österreichs Schulen (ähnlich wie in Deutschland) viel zu häufig darum, dass im 50-Minuten-Takt alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen. Statt in Projekten zu lernen, die nicht der Lehrer, sondern das Leben vorgibt, lässt man die Kinder über Fragen brüten, deren Antworten schon alle im Lösungsheft des Lehrers stehen. "Von einem individualisierten Lehrplan für alle Kinder sind wir noch meilenweit entfernt", kritisiert Astl, "dabei wäre das genau das, was wir brauchen. Ein Kind mit Down-Syndrom lernt neurophysiologisch nicht anders Lesen, Schreiben oder Rechnen als ein gesundes Kind."
Vereinzelte Beschwerden von Eltern, dass ihre Kinder in der Integrationsklasse letztlich auch nicht besser gefördert werden als früher in der Sonderschule, verschaffen den Kritikern und Zweiflern, die es auch im Bezirk Reutte immer noch gibt, wieder Rückenwind. So vergisst etwa Bezirkshauptmann Dietmar Schennach, der Verwaltungschef, nicht zu erwähnen, dass man "mit der gemeinsamen Beschulung durchaus differenzierte Erfahrungen gemacht" habe. Außerdem will er "jetzt endlich einmal evaluieren lassen, was das alles gebracht hat, was aus den Integrationskindern der vergangenen 15 Jahre geworden ist, auch im Vergleich zu den Behindertenwerkstätten". Die von Vianova genannte Vermittlungsquote von 95 Prozent auf dem ersten Arbeitsmarkt soll von unabhängigen Gutachtern überprüft werden. Und wenn Presseleute kommen, erzählt er gern von seinem letzten Unterrichtsbesuch. "Da lag hinten in der Ecke ein behindertes Kind auf einer Matratze apathisch herum. Das nahm gar keinen Anteil. Da frag' ich mich schon: Wollen wir das? Ist das wirklich das Beste für das Kind?"
Solche Schilderungen sind Wasser auf die Mühlen der Integrationsgegner, die mittlerweile, einige versteckt, andere ganz offen, für die Renaissance der Sonderschule werben. Der Landesschulrat für Sonderschulen etwa hat die Eltern des Bezirks über die Medien ausdrücklich ermuntert, die Wiedereinführung der Sonderschule zu fordern. Ein Anruf bei ihm genüge. Die Sonderschule ist schließlich nicht aufgelöst, sondern lediglich stillgelegt. Ein wichtiger Unterschied. "Wenn die Eltern von mindestens drei Kindern eine Sonderschule wollen, geht das ganz schnell", sagt Roland Astl. "Ein Klassenraum, ein Lehrer, drei Kinder. Und schon hat Reutte wieder eine Sonderschule."
Quelle:
Andreas Molitor: Sonderschulfreie Zone
Dieser Text ist in gekürzter Version. Erschienen in: www.brandeins.de, Mai 2008
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 01. 07.2008
