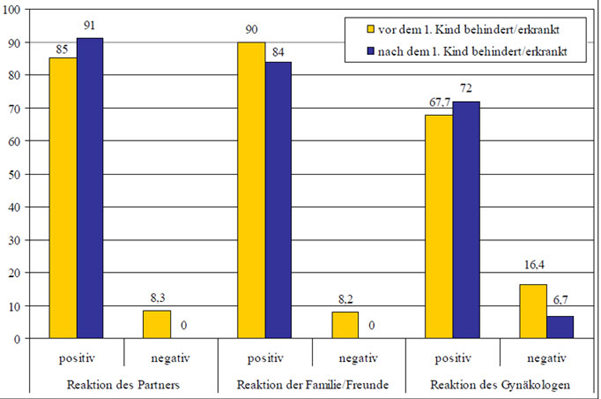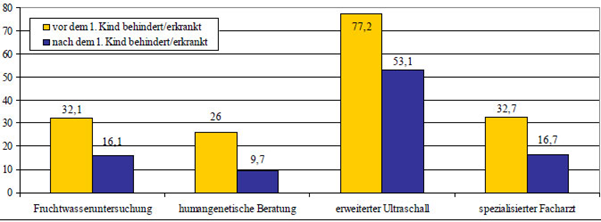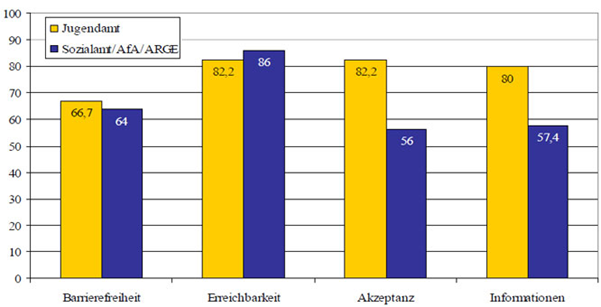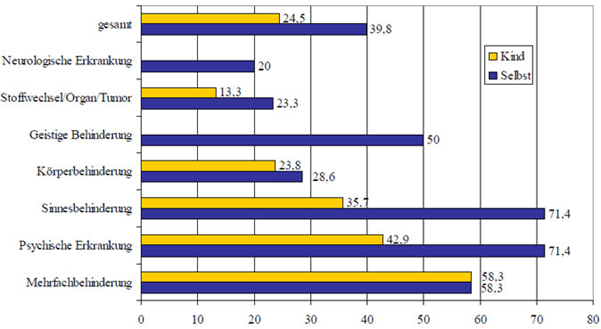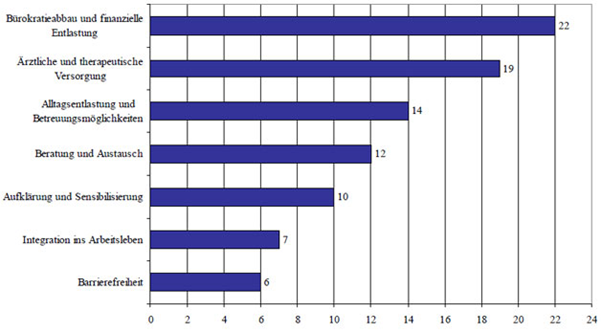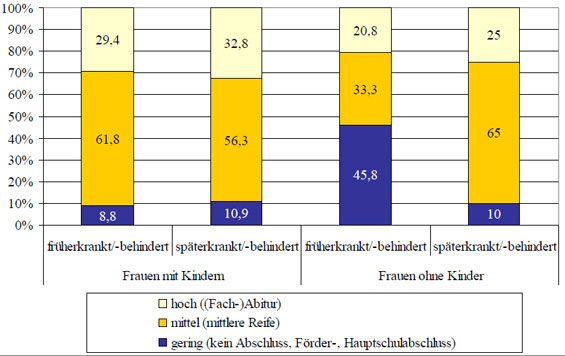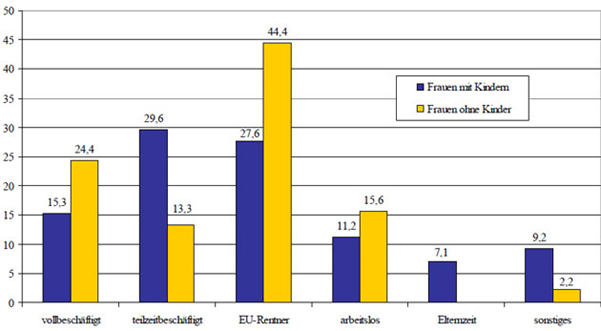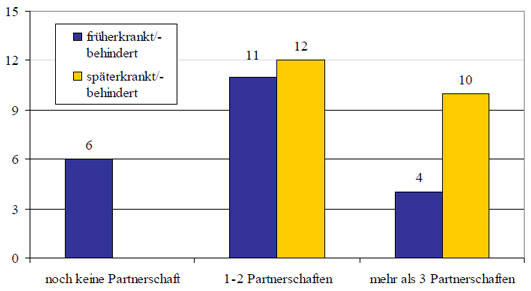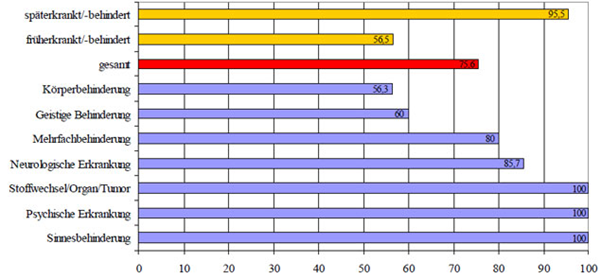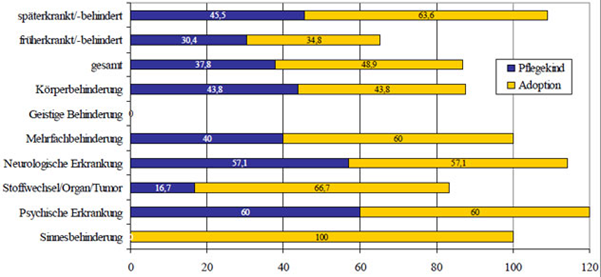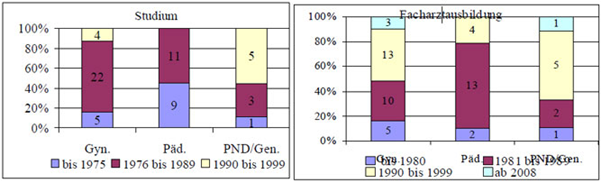eine medizinsoziologische Begleitstudie zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für behinderte Mütter
Studie an der Universität Leipzig, vorgelegt von Dr. phil. Marion Michel, Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Selbständige Abteilung Sozialmedizin. Unter Mitwirkung von Anja Seidel, Martina Müller, Lutz Gansera
Inhaltsverzeichnis
- Vorspann
- 0 Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Stand der Forschung
- 3 Umsetzung des Projektes
- 4 Ergebnisse und Diskussion
- 5 Handlungsempfehlungen
-
6 Praktische Ergebnisse im Projekt
- 6.1 Wahlfachangebot für Studierende der Humanmedizin
- 6.2 Herausgabe eines Rundbriefes zur Unterstützung der Netzwerkarbeit
- 6.3 Aufbau einer Arbeitsgruppe
- 6.4 Aufbau der Homepage für das Kompetenzzentrum
- 6.5 Broschüren in Leichter Sprache
- 6.6 Bearbeitung der Anfragen
- 6.7 Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für behinderte und chronisch kranke Eltern
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
- 1. Abbildung 1: Anteil der Mütter innerhalb der Behinderungs-/Erkrankungsgruppe und nach Grad der Behinderung (N=525, in %)
- 2. Abbildung 2: Frauen, die bereits zur Geburt ihres 1. Kindes behindert/erkrankt waren (in %)
- 3. Abbildung 3: Reaktionen auf die 1. Schwangerschaft (in %)
- 4. Abbildung 4: Vom Arzt empfohlene weitergehende Untersuchungen (in %)
- 5. Abbildung 5: Positive Bewertung der Geburtsklinik und des niedergelassenen Gynäkologen (in %)
- 6. Abbildung 6: Bewertung der Ämter "(eher) zufrieden" (in %)
- 7. Abbildung 7: Erlebte Ausgrenzung und/oder Benachteiligung (in %)
- 8. Abbildung 8: Empfehlung an behinderte/chronisch kranke Schwangere oder Frauen mit Kinderwunsch (Absolutzahlen)
- 9. Abbildung 9: Wünsche und Anregungen (Nennungen)
- 10. Abbildung 10: Bildungsabschluss (%)
- 11. Abbildung 11: aktuelle berufliche Situation (in %)
- 12. Abbildung 12: aktuell bestehende Partnerschaft innerhalb der Untersuchungsgruppen (in %)
- 13. Abbildung 13: Beziehungsbiographie (Absolutzahlen)
- 14. Abbildung 14: Kinderwunsch nach Behinderungs-/Erkrankungsgruppen (%)
- 15. Abbildung 15: Möglichkeit eines Pflegekindes/Adoptivkindes (%)
- 16. Abbildung 16: Zeitpunkt in Wochen, zu dem Schwangerschaft vom Arzt festgestellt wurde
- 17. Abbildung 17: Anteil der wahrgenommenen Ultraschalluntersuchungen (in %)
- 18. Abbildung 18: Frühgeborenenrate behinderter und nicht behinderter Schwangerer 2008 und 2009 (in %)
- 19. Abbildung 19: Barrierefreiheit in gynäkologischen Praxen (Absolutzahlen)
- 20. Abbildung 20: Barrierefreiheit aller gynäkologischen Praxen in Sachsen nach Erfassungskriterien der KV Sachsen (Absolutzahlen)
- 21. Abbildung 21: Barrierefreiheit in Schwangerschaftsberatungsstellen (2007)
- 22. Abbildung 22: Abschluss des Studiums und der Facharztausbildung nach Fachrichtung
- 23. Abbildung 23: Vorbereitung auf die Begegnung mit behinderten/chronisch kranken Patienten (N=58)
- 24. Abbildung 24: Mittelwerte der betreuten behinderten/chronisch kranken Patientinnen nach Fachärzten
- 25. Abbildung 25: Erfahrungen bei der Betreuung behinderter Patientinnen (Mittelwerte: 1=stimme voll zu …4=stimme überhaupt nicht zu)
- 26. Abbildung 26: Kooperationspartner bei der Betreuung behinderter/chronisch kranker Frauen/Eltern (in Absolutzahlen)
- 27. Abbildung 27: Nutzung von Materialien nach Anbieter (in %)
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
Inhaltsverzeichnis
„Ich bin stolz, dass ich einen gesunden Jungen habe, der einfach super und geschickt ist. Er liebt die Natur und seine Freiheiten, er liebt jedes Tier und jede Blume. Ich bin froh, dass es ihn gibt.“ (Mutter, an Morbus Crohn erkrankt)
Unser Dank gilt all den Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die uns ihre Erfahrungen und Sichtweisen zur Verfügung stellten, den ÄrztInnen und MitarbeiterInnen der Einrichtungen der Behindertenhilfe, die uns freundlicherweise und bereitwillig Auskünfte erteilten sowie all denjenigen, die uns im Laufe des Projektes beratend und helfend zur Seite standen. Mit ihrem spezifischen Expertenwissen leisteten sie einen sehr wesentlichen Beitrag für diese Studie und die sich daraus ableitenden nächsten Arbeitsschritte beim Aufbau des Kompetenzzentrums für behinderte und chronisch kranke Eltern in Sachsen.
Die Studie widmet sich der Lebenslage von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen mit Blick auf das Recht und den Wunsch nach Elternschaft. Forschungsschwerpunkte bilden die medizinische Versorgung während Schwangerschaft und Geburt sowie die Gestaltung der Elternrolle.
Nach den Aussagen der Literatur begegnen behinderte und chronisch kranke Menschen auf gesellschaftlicher Ebene Diskriminierungen in Form geringerer Achtung und Wertschätzung und einer Wahrnehmung als Mangelwesen zu Lasten der Gesellschaft. Das Selbstbild, dass sie daraufhin entwickeln, ist gekennzeichnet durch Passivität und einer verzichtenden Grundhaltung, sie erleben sich als defizitorientiert und auf Förderung, Hilfe und Begleitung angewiesen. Sollte sich die Frau wider Erwarten für ein Kind entscheiden, findet sie sich in der Situation wieder, sich für ihren Kinderwunsch rechtfertigen sowie beweisen zu müssen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen und ihm eine gute Mutter zu sein. In eine Überforderungssituation zu geraten und Hilfen aus Angst abzulehnen, ist neben den zahlreichen bestehenden Barrieren ein zusätzliches Risiko, dem eine behinderte/chronisch kranke Mutter ausgeliefert ist.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie konnten zeigen, dass die Diskriminierung weit geringer ausfällt als vermutet. Frauen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen realisieren zunehmend ihren Kinderwunsch, der bei fast allen Frauen auch tatsächlich vorhanden ist. Barrieren für eine Realisierung liegen vorrangig in medizinischen Risikoabwägungen. Behinderte und chronisch kranke Mütter fühlen sich in ihrer Mutterrolle anerkannt und haben weitreichende und vielseitige Unterstützung durch das nahe soziale
Umfeld, durch betreuendes medizinisches Personal und durch Ämter und Behörden erfahren. Bei Inanspruchnahme von Hilfeangeboten sowohl von staatlicher Seite als auch aus dem nahen sozialen Umfeld gelingt es Müttern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sehr gut, behinderungs- oder erkrankungsbedingte Defizite auszugleichen und Überforderungssituationen abzufedern, um ihren Kindern weitestgehend Normalität vermitteln zu können.
Auch medizinisches und sozialpädagogisches Personal sieht sich zunehmend mit der Thematik Elternschaft und Behinderung konfrontiert und reagiert mit entsprechenden Weiterbildungswünschen und dem Aufzeigen weiterer Bedarfe. Damit wird deutlich, dass sie zunehmend die Rolle wichtiger Unterstützungsinstanzen für die Realisierung und Begleitung von behinderter und chronisch kranker Elternschaft einnehmen.
Lange Zeit wurden behinderte und chronisch kranke Eltern weder in der Öffentlichkeit noch in der Wissenschaft und Politik wahrgenommen. Was vorherrschte, war das Bild eines partnerlosen behinderten Menschen, der auf die Fürsorge seiner Herkunftsfamilie und/oder der staatlichen Gemeinschaft orientiert ist, ohne selbst zur Fürsorge verpflichtet zu sein. Die Pädagogin und ehemalige leitende Direktorin des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter Prof. Gisela Hermes sagte dazu in ihrer Dissertationsschrift: „Die Lebensbereiche Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft wurden Menschen mit Behinderung in der Vergangenheit abgesprochen bzw. vorenthalten, da eine Vermehrung der als gesellschaftliche Last empfundenen Personengruppe gesellschaftlich nicht erwünscht war.“ (Hermes 2003: 70). Dies mag eine Erklärung sein, dass es keine offizielle Statistik gibt, die Elternschaft und den Grad der Behinderung gemeinsam erhebt. In einem aktuellen Bericht des Mikrozensus finden sich zwar Angaben zu zahlreichen soziodemographischen Merkmalen wie Familienstand, Anzahl der Kinder, Bildungs- und berufliche Abschlüsse, Erwerbstätigkeit und Migrationshintergrund, jedoch niemals im Zusammenhang mit einem möglichen Grad der Behinderung (Statistisches Bundesamt 2009).
In einer früheren Arbeit konstatierte Gisela Hermes bereits, dass zu einem selbstbestimmten Leben auch Kinder gehören. Es ist somit „für behinderte Erwachsene, die in der Gemeinschaft leben, wahrscheinlicher, dass sie sexuelle Beziehungen haben und sich das Recht herausnehmen, verschiedene Formen der Beziehung, einschließlich der Elternschaft auszuprobieren.“ (Hermes 1998: 11). Und von Christiane Rischer und Kerstin Blochberger vom Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern bbe e.V., einem Verein, der Betroffenen durch Selbsthilfe eine selbstbestimmte Elternschaft ermöglichen möchte, stammt die Vermutung, dass die Zahl behinderter Eltern sukzessive zunimmt (Rischer & Blochberger 2001). Als Gründe werden zum einen die verbesserten Lebenslagen (besonders außerhalb institutioneller Betreuung) als auch das gestiegene Einstiegsalter für eine Elternschaft genannt, in dem sich Erkrankungen bereits manifestieren und chronifizieren können. Und auch in der LIVE-Studie aus dem Jahr 2000 wird deutlich, dass der Anteil der spätbehinderten bzw. -erkrankten Frauen mit Kindern bei 70% liegt (Eiermann et al. 2000).
Die Zielstellung des Projektes widmet sich den Fragen zur Familienplanung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Zentraler Punkt wird dabei das Thema Kinderwunsch und Elternschaft im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Erwartungen sein. Aufgezeigt werden sollen Teilhabechancen von der Entwicklung des Kinderwunsches und dessen Realisierung in Abhängigkeit von möglichen Risikofaktoren und sozialer Einbettung über das konkrete Schwangerschafts- und Geburtserleben und die ärztliche Versorgung bis hin zur konkreten Alltagsbewältigung mit unterstützenden und hemmenden Einflüssen auf die Gestaltung der Mutterschaft.
Die Literatur zum Forschungsstand stammt größtenteils aus den 90er Jahren, selbst aktuelle Studien beziehen sich überwiegend darauf. In dieser Zeit herrschte eine größere Aufmerksamkeit für behinderte und chronisch kranke Frauen, die sich für eine Mutterschaft entschieden, und sie wurden damit auch wissenschaftlich beforscht. Dieser Trend war jedoch rückläufig, weshalb es in den darauffolgenden Jahren fast ausschließlich Studien und Literatur zur Problematik geistige Behinderung und Elternschaft gab. Das Interesse am Thema erwacht gerade wieder, wobei die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung wiederum die größte Aufmerksamkeit erfährt. Im vorliegenden Bericht wird jedoch vorwiegend auf die Lebenssituation selbstständig und selbstbestimmt lebender Frauen eingegangen.
Der Fokus dieser Arbeit liegt (nicht unbedingt beabsichtigt) auf dem Begriff der Behinderung, da dazu die meiste Literatur und zusätzlich eine Lobby existieren. Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Prävalenz beider Beeinträchtigungen: Obwohl auch Behinderungen sehr vielfältig und unterschiedlich ausgeprägt sind, lässt sich der Begriff der chronischen Erkrankung noch schwerer fassen, da hier die Bandbreite unverhältnismäßig größer ist (jede Erkrankung kann chronisch verlaufen) und die Wahrnehmung wesentlich vom Schweregrad abhängt. In der vorliegenden Arbeit und besonders im theoretischen Teil wird deshalb vorwiegend von Behinderung die Rede sein, es sei jedoch an dieser Stelle noch einmal explizit darauf verwiesen, dass es sich bei der Untersuchungsgruppe sowohl um behinderte als auch um Frauen mit schweren chronischen Erkrankungen handelt.
Inhaltsverzeichnis
Auskünfte über den Anteil von Frauen und Männern mit Funktionseinschränkungen im Sinne der ICF sowie die Schwere, Art und Ursache ihrer Behinderung finden sich in der amtlichen Schwerbehindertenstatistik. Diese Statistik basiert auf Angaben der Landesversorgungsämter bzw. in Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg der Sozialämter zu Personen, denen ein Schwerbehindertenstatus gemäß Schwerbehindertengesetz (SchwbG) zuerkannt wurde, die also einen Antrag gestellt und denen mindestens ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 attestiert wurde. Die Daten stehen für alle Strukturebenen von Bund bis Kommune zur Verfügung. Allerdings stellen nicht alle Menschen, die gesundheitlich schwer beeinträchtigt sind, einen solchen Antrag. Dies trifft insbesondere auf nicht erwerbstätige Frauen und auf ältere Menschen zu (Michel et al 2001). Damit bleibt dieser Personenkreis in der Statistik unterrepräsentiert.
Die Schwerbehindertenstatistik erfasst darüber hinaus keine sozialen Parameter wie Kinderzahl oder Familienstand. Die Bevölkerungsstatistik erlaubt ebenso wenig wie die Statistik von Geburtskliniken oder Beratungsstellen Aussagen über Behinderungen der Mütter bzw. Schwangeren. In der Perinatalstatistik, in der allen Klinikgeburten erfasst werden, finden körperliche Behinderungen oder chronische Erkrankungen nur dann Beachtung, wenn sie ein geburtshilfliches Risiko darstellen. Dazu gehören zwar Allergien, Diabetes mellitus, Skelettanomalien und Kleinwuchs, sie werden jedoch nicht nach der Schwere der Behinderung/Erkrankung i. S. d. Schwerbehindertenstatistik erfasst. Vergleichsweise andere schwerwiegende Beeinträchtigungen wie geistige Behinderungen, Sinnesbehinderungen usw. werden hingegen nicht erhoben.
Somit liefern die offiziellen Statistiken keine Aussagen über den Anteil behinderter Mütter in der Gesellschaft. Auch die Daten des Mikrozensus und des Sozioökonomischen Panels erlauben keine zuverlässigen Aussagen über behinderte Mütter. Allerdings erfolgte im Jahr 2005 im Rahmen des Mikrozensus eine Sonderauswertung zur Lebenssituation behinderter und schwerbehinderter Frauen und Männer in Deutschland.
Danach lebten in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2005 8,6 Mio. amtlich anerkannte behinderte Menschen (Pfaff 2006). Im Durchschnitt war somit jeder zehnte Einwohner in Deutschland behindert. Davon waren 6,7 Mio. Menschen als schwerbehindert einzustufen, d.h. bei ihnen wurde ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt. Sachsen hatte im bundesweiten Vergleich mit 7% die niedrigste Schwerbehindertenquote in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2008).
Bilden unter allen behinderten Menschen diejenigen mit Beeinträchtigungen der Funktion der inneren Organe und mit Körperbehinderungen die größten Gruppen (ebd.), sind es unter den schwerbehinderten Frauen der Altersgruppe 25 bis 44 Jahre in Sachsen die geistig Behinderten (vgl. Tabelle 1).
| Anzahl | % | |
|---|---|---|
| Körperbehinderung |
1.686 |
11,5 |
| Sinnesbehinderung |
1.474 |
10,1 |
| Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankung |
3.013 |
20,6 |
| Neurologische Erkrankung |
1.220 |
8,3 |
| Geistige Behinderung |
3.443 |
23,5 |
| Psychische Erkrankung |
1.788 |
12,2 |
| sonstige, nicht genauer bezeichnete Behinderung/Erkrankung |
2.015 |
13,8 |
| gesamt |
14.639 |
100 |
(Quelle: Landesamt für Statistik Sachsen Stand 2009)
In den meisten Fällen, d.h. in über 80% wurde die Behinderung durch eine Krankheit verursacht, nur 5% der Behinderungen sind angeboren, wobei mehr Jungen als Mädchen betroffen sind (Statistisches Bundesamt 2008).
Behinderungen treten häufiger bei Männern und vor allem bei älteren Menschen auf. Über die Hälfte der schwerbehinderten Menschen befinden sich in der Altersgruppe 65 Jahre und älter, während nur 4% der Frauen im gebärfähigen Alter über einen Schwerbehindertenausweis verfügen. Männer sind zudem häufiger berufstätig und stellen daher eher einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung.
Der Großteil (6,4 Mio.) der Behinderten zählt zur Gruppe der nicht erwerbstätigen Personen. In der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen belief sich die Erwerbsquote der behinderten Männer auf 53,3%, die der behinderten Frauen auf 45,9%. Mit 50,1% liegt die Erwerbsquote behinderter Menschen deutlich unter der nichtbehinderter mit 75,9% und verweist auf eine geringere Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsmarkt. Rund 62% der Behinderten verfügten über einen Hauptschulabschluss, 19% über einen Realschulabschluss, 12% über eine Fachhochschul- oder Hochschulreife und 6% gaben keinen Abschluss an. Unterschiede zu nichtbehinderten Menschen zeigen sich v.a. in den jüngeren Altersgruppen mit deutlich geringeren Bildungsabschlüssen sowohl im schulischen als auch im beruflichen Bereich. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit stellt daher auch nur bei 19% der Behinderten die wichtigste Unterhaltsquelle dar, 63% der Behinderten bestreiten ihren Lebensunterhalt durch Renten und Pensionen. Weitere Alternativen bilden Unterhalt durch Angehörige mit 9% sowie Sozialhilfe und Arbeitslosengeld mit 2 bzw. 5% (Pfaff 2006).
Bei den unter 45-jährigen behinderten Menschen lag der Anteil der Ledigen höher als bei gleichaltrigen nichtbehinderten Menschen. Da in der offiziellen Statistik keine Angaben über (Schwer)Behinderung und Elternschaft erhoben werden, liefert die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen einen möglichen Hinweis. So lebten von den 25- bis unter 65jährigen, also der Altersgruppe potentieller Elternschaft, mehr behinderte Menschen in einem Einpersonenhaushalt als nichtbehinderte. In der Studie von Michel et al. (2001) zeigte sich, dass der Anteil der Mütter mit dem Grad der Behinderung korreliert. Insgesamt 53% der Frauen in dieser Studie hatten Kinder, wobei mit steigendem Grad der Behinderung der Anteil kinderloser Frauen zunahm. In der Studie konnte ebenfalls ein Zusammenhang zur Art der Behinderung nachgewiesen werden. So gaben 52% der hörgeschädigten Frauen sowie 50% der Diabetikerinnen und der psychisch kranken Frauen an, Kinder zu haben, jedoch nur 7% der geistig behinderten Frauen.
Auf die spezifischen Probleme behinderter Mütter und Väter kann also keine der offiziellen Statistiken in der Bundesrepublik eine Antwort geben. Die Datenbasis zum Thema Elternschaft und Behinderung liefern bisher zahlreichen Publikationen, in denen Erfahrungsberichte behinderter Frauen gesammelt und wissenschaftlich bewertet wurden. Dabei kann es jedoch zu Stichprobenverzerrungen kommen, da sich die Befragungsteilnehmerinnen über Vereine und Verbände (ebd.) bzw. über freiwillige Meldungen zur Teilnahme rekrutierten. Betroffene, die sich bereits organisiert haben, verfügen über vielseitigere Ressourcen der Lebensbewältigung und Unterstützung und sind daher selten repräsentativ für die Gesamtzahl behinderter und chronisch kranker Menschen. Ergänzend sei noch erwähnt, dass bei der amtlichen Erfassung über die Privathaushalte wie z.B. den Mikrozensus Personen in Anstaltsunterkünften (Betreutes Wohnen etc.) nicht berücksichtigt werden, d.h. die Schätzungen belaufen sich zugunsten der Privathaushalte und führen ebenfalls zu einer Verzerrung.
Statistisch verwertbare Aussagen zum Anteil behinderter Mütter ergaben sich somit bisher ausschließlich aus der bundesweiten LIVE-Studie, in der 70% der befragten Frauen angaben, eigene Kinder zu haben, davon fast zwei Drittel sogar mehr als ein Kind (Eiermann et al. 2000), und dem Bericht zur Situation behinderter Frauen in Sachsen (Michel et al. 2001), in der auch der Zeitpunkt der Geburt der Kinder erfasst wurde (Geburt der Kinder vor oder nach Eintritt der Behinderung). Beide Studien basierten auf repräsentativen Stichproben, wodurch der Verzerrungseffekt reduziert werden konnte, jedoch infolge der relativ hohen Anteile der Nonrespondenten nicht ganz zu vernachlässigen ist.
Partnerschaft, Sexualität und Elternschaft stellen Themen dar, mit denen sich Kinder und Jugendliche im Rahmen der Realisierung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz auseinandersetzen müssen. Für Mädchen und Jungen mit Behinderungen verläuft diese Auseinandersetzung erschwert, da sowohl die Bedingungen für die Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts, die emotionale Lösung von den Eltern und die Akzeptanz der eigenen Körperlichkeit infolge der Behinderung schlechter sein können als auch die Eltern selbst diesen Bereichen der Entwicklung ihrer Kinder weniger Aufmerksamkeit widmen als der schulischen und beruflichen Entwicklung. Darauf konnten wir im Rahmen einer Analyse zur Lebenswelt behinderter Kinder und Jugendlicher in Sachsen verweisen (Michel et al. 2003). Arnade portraitiert in ihrem Buch „Weder Küsse noch Karriere“ (1992) 12 behinderte Frauen: Das Fazit dieser Portraits könnte sein, dass die Erziehung im Elternhaus für Mädchen mit Behinderungen unter dem Motto erfolgte „wenn schon keinen Partner, dann wenigstens ein guter Beruf“. Dabei spielen ambivalente Gefühle der Eltern eine große Rolle. Einerseits gehen vor allem Mütter behinderter Kinder davon aus, allein der wichtigste Partner für das Kind zu sein. Sie können nur schwer das Selbständigwerden ihres Kindes akzeptieren. Andererseits besteht die Sorge, durch ein Enkelkind zusätzlich selbst belastet zu werden.
Aber auch aus professioneller Sicht erfuhr das Thema Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft behinderter Menschen bis in die 90er Jahre nur unzureichende Beachtung sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit als auch in den Unterstützungsangeboten für behinderte Frauen und Männer. Es waren vor allem körper- und sinnesbehinderte Menschen selbst, die hier einen Durchbruch erzielten und mit vielfältigen Initiativen und Publikationen einen Prozess des Umdenkens einleiteten.
Dennoch ist zu konstatieren, dass Frauen und Männer mit Behinderungen noch immer auf Vorurteile und Unverständnis stoßen, wenn sie sich eigene Kinder wünschen. Die antizipierte Partnerlosigkeit behinderter Menschen impliziert gleichzeitig eine Kinderlosigkeit. So müssen sich behinderte Frauen, die sich gegen eine Mutterschaft entscheiden, gegenüber ihrem sozialen Umfeld nicht rechtfertigen, denn Kinderlosigkeit entspricht den gesellschaftlichen Erwartungen (Hermes 2003, Specht 2006).
Ihnen wird die heutige, mit Verantwortung überfrachtete Elternrolle nicht zugetraut und sie geraten deshalb immer wieder in die ambivalente Situation zwischen ihrem Selbstverständnis und den von außen herangetragenen Vorurteilen (Levc 2008).
Die Reaktionen des sozialen Umfeldes auf die Schwangerschaft fallen sehr unterschiedlich aus. Von Freude über Erstauen und abwartender Skepsis bis hin zu offener Ablehnung und auch entwertenden Äußerungen findet sich alles wieder (Levc 2008, Becker 1997, Hermes 1998, Behrendt 1998). Oft reagiert die Familie der Frau skeptischer als die Familie des Mannes oder Freunde.
Hermes (2003) fasste die Vorurteile, auf die behinderte und chronisch kranke Schwangere treffen, wie folgt zusammen:
-
Fehlende Verantwortungsübernahme: Ein selbst hilfebedürftiger, fremdbestimmter Mensch ist nicht in der Lage, einen anderen Hilfebedürftigen zu versorgen.
-
Leidensdruck der Kinder: Sie sind von Entbehrungen betroffen und müssen die Assistentenrolle für den behinderten Elternteil übernehmen, wodurch sie früh in die Rolle des jungen Erwachsenen gedrängt werden.
-
Finanzielle Belastungen: Bei der Vorsorgung der Kinder entsteht ein Unterstützungsbedarf auf Kosten des Gemeinschaft.
-
Hohes Vererbungsrisiko: Eine behinderte Mutter bedeutet ein behindertes Kind.
Dass der engste Familien- und Bekanntenkreis besonders skeptisch reagiert, scheint mit der Angst der Angehörigen vor einer zu großen Belastung durch die erbetene Unterstützung zusammenzuhängen. Damit zeigen sich unterschwellig negative Erwartungshaltungen, dass die Fähigkeiten einer behinderten Frau allgemein unterschätzt werden. Laut Becker (1997) wird zunächst von den Frauen verlangt, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da diese Beweislegung initiativ von nichtbehinderten/gesunden Frauen ausgeht, wird eine vermeintliche Konkurrenz zwischen nichtbehinderten und behinderten Müttern deutlich, die auf einem tradierten Frauen- bzw. Mutterbild zu basieren scheint.
Der hohe Druck beweisen zu müssen, dass die existierenden Vorurteile gegenüber ihren (fehlenden) Mutterfähigkeiten ungerechtfertigt sind, kann wiederum dazu führen, dass Hilfeangebote abgelehnt werden und sich die Mütter schnell selbst überfordern (Hermes 2003). Da sie in ihrem bisherigen Leben bereits viele Abhängigkeiten erfahren haben, erleben sie die (zusätzliche) Abhängigkeit von anderen Personen als weibliches Versagen. Ihr Ziel ist stattdessen, möglichst unauffällig zu leben, um nicht negativ aufzufallen oder sich überwachen zu lassen, z.B. durch das Eingreifen staatlicher Institutionen.
Hermes (1998) vertritt die Auffassung, dass viele Familien zwar in Notsituationen auf Hilfeleistungen zurückgreifen können, es ihnen im Alltag jedoch schwer falle, Hilfe anzunehmen. Sie erklärt das mit der Verinnerlichung, als behinderte Frau die Mutterrolle von vornherein nicht kompetent ausfüllen zu können. Diese Situation ist vergleichbar mit dem Dilemma der „sich selbsterfüllenden Prophezeiung“, wenn behinderte/chronisch kranke Frauen wie jede andere Mutter auch in Überforderungssituationen geraten, sich jedoch aus Angst und dem Druck, ganz besonders gute Mütter sein zu wollen, keine Unterstützung holen und damit Überforderungen nicht entschärfen können. Aus diesem Grund sind für Frauen bzw. Menschen mit Einschränkungen unterstützende Netzwerke besonders wichtig.
Aus den Erfahrungen der Selbsthilfe lässt sich festhalten, dass Menschen mit Behinderungen mit dem Thema Kinderwunsch verantwortlich umgehen, indem sie sich bereits in der Planungsphase über Hilfsmöglichkeiten informieren (Blochberger 2008). Die Hauptschwierigkeiten, auf die sie dabei stoßen, sind neben den bereits genannten Umweltbarrieren vor allem eine fragliche finanzielle Absicherung durch eigene Erwerbsarbeit sowie fehlende Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten (Hermes 1998). Behinderte Eltern bleiben von vornherein von vielen Bereichen ausgeschlossen und spontane Aktivitäten sind oft nicht möglich.
Zu den Umweltbarrieren zählen bauliche Barrieren, so dass Krabbelgruppen, Kindertagesstätten, Schulen und Träger von Kontakt- und Freizeitangeboten für Körperbehinderte unzugänglich sind. Kommunikative Barrieren umfassen die Schwierigkeiten, sich mit dem Fachpersonal zu verständigen. Das Ergebnis sind Ausgrenzungen aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen und eine verhinderte Partizipation am öffentlichen Leben.
Die Einkommenssituation behinderte/chronisch kranker Frauen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung schlechter und die Arbeitslosigkeit unter den Frauen insgesamt hoch (Hermes 1998, vgl. auch Kap. 2.1). Sie haben wenige Chancen auf eine Arbeitsstelle, die ihren Bedürfnissen entspricht und nach wie vor werden nichtbehinderte Bewerberinnen bevorzugt oder es gibt zu wenig Teilzeitstellen. Die Privatisierung der behinderungsbedingten Kosten führt zu einer Kumulation der finanziellen Belastungsfaktoren.
Auch bei der Bewältigung des Familienalltags haben Behinderte/Chronisch Kranke größere Schwierigkeiten, von ihnen werden zusätzliche Kreativität und Energien gefordert (Hermes 15 2003). Dass es kaum staatliche Unterstützungsmodelle für behinderte Eltern gibt, scheint damit zusammenzuhängen, dass der erforderliche Unterstützungsbedarf so individuell ist, dass Modelle nicht zielführend sind. Auch im Hilfsmittelbereich wurden bisher keine adäquaten Lösungen entwickelt, d.h. die Betroffene ist in der Situation, selbst Lösungen zu finden und zu entwickeln (Seipelt-Holtmann 1993).
Dass eine Körper- oder Sinnesbehinderung grundsätzlich nicht die Erziehungskompetenz der Eltern beeinflusst, ist eine Erkenntnis, die sich erst seit einigen Jahren durchsetzt. Abstriche müssen nur in Bezug darauf gemacht werden, wie die Handlungen ausgeführt werden, die im Interesse des Kindes sinnvoll und notwendig sind: „Bildlich gesprochen benötigen sie Menschen, die ihnen ihre Augen, Ohren, Hände oder Füße leihen.“ (Zinsmeister 2006: 4).
Sie nennt gleichzeitig eine Reihe von Möglichkeiten, wie der individuelle Unterstützungsbedarf je nach Behinderungsart aussehen könnte:
-
Hilfen zur Mobilität
-
Unterstützung bei der Kinderpflege und im Haushalt
-
Unterstützung bei der Beaufsichtigung der Kinder (z.B. auf dem Spielplatz)
-
schulische Förderung des Kindes wie Hausaufgabenhilfe
-
barrierefreie Kommunikation mit pädagogischen Fachkräften, um die Kinder von ihrer Mittlerfunktion zu entlasten
-
Unterstützung bei Behördengängen oder der Erledigung von Korrespondenz
-
für die Kinder Kontaktmöglichkeiten mit peers
-
Unterstützung bei Freizeitaktivitäten
-
evtl. psychotherapeutische Unterstützung
-
Aufklärung und Unterstützung in Bezug auf die Erkrankung der Eltern
Um diesem Ziel näher zu kommen, fand 2003 unter Leitung des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern bbe e.V. und mit Förderung des BMFSFJein Ideenwettbewerb statt, um Hilfsmittel für behinderte Eltern zu entwickeln. Im Ergebnis entstanden sehr interessante Vorschläge, die in der Praxis aber offensichtlich nicht zum Einsatz kommen (Blochberger 2004).
In einer Veröffentlichung des BMFSFJ wurde u. a. auf einen unterfahrbaren Wickeltisch, ein höhenverstellbares Gitterbett, ein Babyfon mit Lichtsignal, eine auf einem Rollstuhl zu befestigende Kinderliege und Haushalts- und Betreuungshilfen laut SGB IX verwiesen (BMFSFJ 2003).
Dass auf Kindersicherheit besonderer Wert gelegt wird (BMFSFJ 2000), begründet Hermes (1998) damit, dass behinderte Menschen sich nicht am gängigen Ablaufschema eines nichtbehinderten orientieren können, sondern individuell und unabhängig von Vorgaben ihre eigenen, bestehende Grenzen und Möglichkeiten berücksichtigenden Methoden entwickeln müssen. So ist z.B. ein blindengerechter Haushalt auch ein kindergerechter Haushalt und die Unfallrate bei Kindern nicht höher.
Auch die Erziehungsstile unterscheiden sich nicht wesentlich von denen nichtbehinderter Mütter (Becker 1997). Die Kinder seien mithelfender und selbstständiger, was schon bei Säuglingen zu merken sei. Sie passen sich den Möglichkeiten und Grenzen der Eltern an und spüren von Anfang an, dass sie mithelfen müssen, z.B. durch Festklammern (Hermes 1998). „Eine Freundin bewunderte uns einmal beim Füttern, weil sie meinte, meine Kinder würden immer so schön den Mund aufmachen und auf den Löffel zukommen, was ihr Kind überhaupt nicht täte.“ (Paul 1990: 357)
Die Akzeptanz der eigenen Situation durch die Mutter trägt wesentlich dazu bei, dass auch die Kinder diese akzeptieren können. „Darüber hinaus stärkt dies ihr Selbstbewusstsein, sie bekommen den individuellen Einsatz von Fähigkeiten und kreative Problemlösungskompetenz vorgelebt und erleben ein breites Spektrum von Lebensrealitäten.“ (Levc 2008: 117).
Viele der genannten Probleme könnten sicher mit einer dauerhaften Begleitperson bewältigt werden. Beispielhaft kann an dieser Stelle Skandinavien genannt werden, wo mit der Bereitstellung einer ausreichenden persönlichen Assistenz im Sinne des Selbstverständnisses über die elterliche Autonomie gehandelt wird (Ferrares 2001). In Österreich hingegen trifft man eher auf eine misstrauische und ablehnende Haltung, hier finden sich kaum Unterstützungsangebote. Wird eine behinderte Frau Mutter, sieht sie sich oft der Drohung einer Fremdunterbringung ihres Kindes gegenüber. In Deutschland werden zunehmend Hilfsprojekte diskutiert wie mobile Hilfen, betreute Wohnformen und Lösungen für Notsituationen wie z.B. ein Mutter-Kind-Haus oder die begleitete Elternschaft insbesondere für geistig behinderte Menschen (Pixa-Kettner 2006).
Als Fazit kann daher festgehalten werden: „Nur wenige der im Alltag auftretenden Probleme hängen ursächlich mit der Behinderung der Frauen zusammen. Der weitaus größere Teil beruht auf Umweltbarrieren, unbefriedigenden Rahmenbedingungen, der Konfrontation mit Unwissenheit und Vorurteilen und der Tatsache, dass Frauen mit Behinderungen als Mütter „nicht vorgesehen“ sind.“ (Levc 2008: 197).
Eine hilfreiche Option für behinderte Mütter ist der Informationsaustausch in Internetforen und Organisationen behinderter Eltern. Eine solche Internetplattform bietet neben dem Bundesverband behinderter Eltern bbe e.V. beispielsweise das US-amerikanische www.disabledparents.net, die häufig Themen wie Auswirkungen der Schwangerschaft auf die körperliche Befindlichkeit, erfahrene Gynäkologen, die Unabwendbarkeit einer Sectio und geeignete Hilfsmittel enthalten, aber auch die Angst vor Gefahrensituationen und einem zu langsamem Reagieren aufgreifen. Auch aus der Evaluation des Beratungsangebots des bbe e.V. geht hervor, dass die häufigsten Anfragen die Bereiche personelle Hilfen und Assistenz, Hilfsmittel und Kindermöbel, Schwangerschaft und Geburt und Umgang mit Ämtern und Behörden betreffen (Blochberger 2008). Tipps und Informationen zum angefragten Bereich sowie Ansprechpartner und Adressen zu erhalten und der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern zur Entwicklung der eigenen Handlungsfähigkeit sind Erwartungen, mit denen sich die Hilfesuchenden an die jeweiligen Stellen wenden. Dabei können die Ratsuchenden schneller Vertrauen zu einer ebenfalls behinderten Person aufbauen als zu anderen Beraterinnen, was die Bedeutung von peer counseling hervorhebt.
Im Vergleich zu körper- oder sinnesbehinderter Eltern erweist sich die Situation für geistig behinderte Eltern als weitaus schwieriger. Immer mehr geistig behinderte Frauen und Männer entwickeln im Zuge der gewünschten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben den Wunsch nach Elternschaft. Sie haben weniger günstige Voraussetzungen bei der Realisierung ihres Kinderwunsches und einer erfüllten Elternschaft. So ist diese Elterngruppe schlechter auf eine Schwangerschaft und Geburt vorbereitet als andere Eltern. Das resultiert zum einen aus der geringeren Teilnahme an Geburtsvorbereitungskursen, zum anderen an der (geringen) Verfügbarkeit von barrierefreien Informationen in Leichter Sprache. Zusätzlich problematisch wirken sich zum Teil eigene Kindheitserfahrungen aus, wenn behinderte Mädchen und Jungen in ihrer Sozialisation Misshandlungen, Vernachlässigungen und ein dysfunktionales Familienleben erfuhren, sowie die meist fehlende Unterstützung und das geringe Einkommen dieser Elterngruppe.
In der internationalen Literatur wird als größte Gefahr für die Kinder geistig behinderter Eltern die Vernachlässigung der Kinder gesehen (vgl. Kaatz 1992). Es wird von Fällen berichtet, in denen die geistig behinderte Mutter die Bedürfnisse ihres heranwachsenden Kindes nicht wahrnehmen konnte und ebenso wenig die gesundheitlichen Probleme. Die Ursachen liegen neben den vorhandenen kognitiven Restriktionen der Mütter selbst vor allem in ihren eigenen fehlenden elterlichen Vorbildern und sozioökonomischen Faktoren, da sie meist nur über geringe Einkommen verfügen.
Es wird darauf verwiesen, dass geistig behinderte Eltern Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Kinderpflege und der altersabhängigen Ernährung ihres Kindes benötigen. Ebenso sollten sie eine Anleitung erhalten zum Aufbau guter Eltern-Kind-Beziehungen und altersgerechter Kommunikation und Interaktion.
Eine gesellschaftliche Aufgabe besteht in der Bereitstellung und Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten.
Unterstützungsangebote sollen den Eltern helfen, vorhandene Dienstleistungen für sich nutzen können, um damit eine adäquate Kindererziehung zu ermöglichen. Die Ergebnisse lassen schlussfolgern, dass der nicht vorhandene Zugang zu pflegerischen und erzieherischen Dienstleistungen für die Eltern mit geistigen Behinderungen auf die Hindernisse im System zurückzuführen sind und nicht den Eltern angelastet werden können. Werden die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten auch für geistig behinderte Eltern bereitgestellt, sind sie durchaus in der Lage, adäquat zu funktionieren und sich den Herausforderungen der Elternschaft erfolgreich zu stellen (vgl. Pixa-Kettner 2006, Röpell & Niggemann 2005). In Bezug auf psychisch kranke Eltern gestaltet sich die Situation zum Teil noch schwieriger. Trotz der Belege, dass die meisten Kinder psychisch kranker Eltern nicht misshandelt werden, wird in der Literatur von einer großen Zahl der Inobhutnahme von Kindern psychisch kranker Eltern berichtet. Ein Teil der Berichte stammt aus Untersuchungen zur Anzahl der Kinder aus der Grundgesamtheit der psychisch erkrankten Eltern, die in staatliche Vormundschaft genommen wurden. Der andere Teil bezieht sich auf die Häufigkeit von Eltern mit Behinderung in bestimmten Populationen inklusive Müttern mit Pflegekindern und Gerichtsstichproben.
Die Ergebnisse einer australischen Studie demonstrieren, dass Eltern mit Behinderungen in staatlichen Kinderschutzprozessen signifikant überrepräsentiert sind und dass die Prozesserfolge nach Art der Behinderung variieren (Llewellyn et al. 2003). Besonders Eltern mit einer geistigen Behinderung oder einer seelischen Störung sind gemessen an ihrer Grundgesamtheit bei gerichtlichen Prozessen überrepräsentiert. Die Gerichtsakten von zwei Familiengerichten in New South Wales, Australien, und alle Pflege und Schutzmaßnahmen, die von der Kinderschutzbehörde ausgingen und innerhalb von neun Monaten zu Abschluss gebracht wurden (n= 285), sind untersucht worden. Eltern mit Behinderungen machten beinahe ein Drittel der Fälle aus (29,5%). Die Prävalenz war für Eltern mit psychiatrischen Behinderungen mit 21,8% am höchsten, gefolgt von Eltern mit Lernbehinderungen mit 8,8%.
Signifikante Zusammenhänge konnten zwischen elterlicher Behinderung und gerichtlichem Wirken gefunden werden, und es zeigt sich, dass eine unverhältnismäßig große Zahl Kinder lernbehinderter Eltern in staatliche Vormundschaft genommen wurden.
Das Ergebnis entspricht den Resultaten anderer internationaler Untersuchungen dieser Art. So konnten Studien aus den 80er Jahren für die USA zeigen, dass 45,5 % der Kinder lernbehinderter Eltern aus der Familie genommen wurden. Eine ähnliche Zahl wurde für Schweden festgestellt. Da lag der Anteil der entzogenen Kinder bei 45%. Auch für Neuseeland und Australien finden sich analoge Prozentangaben (Llewellyn et al. 2003). Betrachtet man diese Ergebnisse, ist davon auszugehen, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der lernbehinderten Eltern damit konfrontiert werden, ihre Kinder in Kinderschutzprozessen zu verlieren. Die Gerichtsentscheidungen sind stark beeinflusst von Vorurteilen über geistige Behinderung wie der Annahme, dass Erziehungsmängel dauerhaft und die Eltern nicht empfänglich für eine Förderung sind, die den Verbleib der Kinder im elterlichen Haushalt ermöglichen könnten (vgl. dazu Arbeiten von Rechtsgelehrten: Hayman 1990; Levesque1996, Marafino 1990, Zinsmeister 2006 sowie die Arbeiten von Pixa-Kettner et al. 1996 und Pixa-Kettner 2007).
Viele Jahre Forschung haben gezeigt, Eltern mit geistigen Behinderungen können sich Wissen und Fähigkeiten aneignen und tun dies auch (vgl. Budd & Greenspan 1985, Feldman 1994, Llewellyn et al. 2003). Das reale oder wahrgenommene Fehlen fertig abrufbarer oder geeigneter Dienstleistungen zur Elternunterstützung könnte ein Grund dafür sein, dass Gerichte kein Risiko eingehen wollen und daher nach wie vor eher zu ungunsten der behinderten Eltern entscheiden.
In weiteren Studien muss untersucht werden, woher die gefundene Überrepräsentation von Eltern mit psychischen Behinderungen und Lernbehinderungen rührt und welche Maßnahmen dem entgegen wirken können.
Viele der bisherigen Studien beziehen sich auf die psychische und physische Situation der pflegenden Angehörigen. Dies sind meist erwachsene Kinder, die ihre behinderten und vor allem chronisch kranken Eltern pflegen, die sich bereits im höheren Lebensalter befinden. In der internationalen Literatur gibt es aber auch zunehmend Studien, die sich mit den Auswirkungen einer elterlichen Behinderung auf die Kinder im Lebensverlauf auseinandersetzen (Riedesser & Schulte-Markwort 1999, Duvdevany et al. 2005, Prilleltensky 2004, Hyatt & Allen 2005).
Eine Studie von Prilleltensky (2004) konnte zeigen, dass Mütter mit Körperbehinderungen ein starkes Engagement für ihre Kinder entwickeln und sich aktiv um deren Pflege und die Sicherstellung des Wohlergehens der Kinder kümmern. Dabei unternehmen sie zahlreiche Versuche, ihre Kinder von allen Belastungen fernzuhalten bzw. abzuschirmen, die im Zusammenhang mit der mütterlichen Behinderung stehen. Während die Mütter aufrichtig über vorhandene Herausforderungen und Barrieren berichteten, wurden gleichzeitig der Spaß und die Erfüllung deutlich, den die Frauen von ihrer Mutterschaft ableiten.
Eine israelische Studie von Duvdenvany et al. (2005) untersuchte die Gefühle von Kindern im Schulalter zu ihren behinderten Eltern. Die Ergebnisse zeigen sowohl in der Untersuchungsgruppe der Kinder behinderter Eltern als auch in der Kontrollgruppe der Kinder nichtbehinderter Eltern das nebeneinander Bestehen von positiven und negativen Gefühlen gegenüber den Eltern. Im Unterschied zur Gruppe der Kinder nichtbehinderter Eltern zeigt sich bei den Kindern behinderter Eltern eine größere Intensität der Gefühle.
Außerdem nannten sie mehr positive Gefühle bei einer größeren Ambivalenz. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Bindung zwischen Eltern und Kind im Falle einer Behinderung besonders stark ist. Neben dieser Bindung ist es nötig, weitere protektive Faktoren zu mobilisieren, um die (auch für die Kinder) große Belastung der Behinderung der Eltern verarbeiten zu können. Dazu ist wichtig, ein Bewusstsein der medizinischen, pflegerischen und sonstigen Professionellen für die Lebenssituation der behinderten Eltern und deren Kinder zu schaffen, damit diese adäquat und unterstützend wirken können (vgl. dazu Riedesser & Schulte-Markwort 1999).
Eine Studie von Hyatt und Allen (2005) untersuchte den direkten, kurzfristigen Einfluss einer Behinderung auf nicht behinderte Familienmitglieder anhand der rechtzeitigen Dreifachimpfung[1] von Kindern im Alter von 24 Monaten. In dieser Untersuchung wird deutlich, dass der Grad der Behinderung der Eltern Auswirkungen auf die Gesundheitsvorsorge der Kinder hat. Sind Eltern schwer behindert, sinkt die Wahrscheinlichkeit für die 2-jährigen Kinder rechtzeitig immunisiert zu werden. Sind die Eltern arbeitsunfähig, können aber eingeschränkt für sich selbst sorgen, steigt die Wahrscheinlichkeit sogar, rechtzeitig geimpft zu werden, wenn auch nicht signifikant. Die Ergebnisse der Studie zeigen, Behinderung ist tatsächlich eine Familienangelegenheit mit Implikationen für den Zugang zum Gesundheitswesen und letztendlich auch dem Gesundheitsstatus der Kinder schwerbehinderter Eltern. Die Ursache liegt im leichteren Zugang zu Einrichtungen des Gesundheitswesens für Eltern mit leichteren Behinderungen und als Folge davon auch für deren Kinder im Vergleich zu schwerstbehinderten Eltern (vgl. dazu Altman et al.1999). Die Autoren weisen auf die Notwendigkeit eines Barzuschusssystems hin, mit dessen Hilfe sich Behinderte Assistenz, die speziell auf sie zugeschnitten ist, einkaufen können. Dazu ist es nötig, einen Zugang zu Kindern von Eltern mit schweren Behinderungen zu finden, um diese mit Unterstützungsangeboten zu versorgen.
Empfohlen wird ein Case Management betroffener Familien, um eine umfassende Versorgung aller Familienmitglieder zu gewährleisten bzw. überhaupt erst einmal bereitstellen zu können, welche neben regelmäßigen Erholungszeiten für die pflegenden Angehörigen auch spezielle Maßnahmen zur Gesunderhaltung der nicht behinderten Familienmitglieder beinhaltet. In der Literatur lassen sich neben Studien, die kurzfristige Effekte elterlicher Behinderung analysieren, ebenso Hinweise zum Lebensverlauf finden. Eine Arbeit aus Norwegen untersuchte Faktoren, die eine frühzeitige Erwerbsunfähigkeitsrente bedingen. Neben Einflussfaktoren wie einem niedrigen Geburtsgewicht (5,7%), chronischen Erkrankungen während der Kindheit (6,8%) und dem Familienstand der Mutter (4,4%) bedingt vor allem die elterliche Behinderung mit 8,8% eine eigene frühzeitige Erwerbsunfähigkeit. Das tritt besonders deutlich zutage, wenn das Kind und der betroffene Elternteil dem gleichen Geschlecht angehörig sind und wenn die Behinderung des Elternteils in den ersten Lebensjahren des Kindes entstand. Die Frage ist, wie die Kinder behinderter Eltern unterstützt werden können und psychischen Belastungen, die sich im negativsten Fall als Erkrankung manifestieren können, vorgebeugt werden können. Dafür ist es wichtig, ein Bewusstsein sowohl für die gesellschaftlichen Barrieren für behinderte und chronisch kranke Eltern zu schaffen, als auch die Bedürfnisse der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren.
Ärzte sind meist die ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, die Folgen einer Erkrankung oder eines medizinischen Eingriffs abzuklären. Das gilt auch bei Erkrankungen
oder Störungen, die sich auf die Funktion der Sexualorgane und die Fertilität auswirken können. Aber auch bei der Risikoabschätzung für den Verlauf einer Schwangerschaft und der Prognose der Erkrankung der Mutter sowie möglicher Fehlbildungen oder genetischer Erkrankungen des Kindes benötigen die Rat suchenden Eltern kompetente ärztliche Partner.
Diese verfügen aber selbst zum Teil nur über geringe Erfahrungen mit dieser speziellen Problematik, besonders dann, wenn es sich um seltene Krankheitsbilder handelt. Die Themen Fertilität, Schwangerschaft und Geburt finden im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen erst allmählich Eingang in die medizinische Forschung. Erforderlich wird das einerseits durch die steigende Lebenserwartung bei schweren chronischen Erkrankungen wie Mukoviszidose, Hämophilie oder Tumorerkrankungen. Andererseits wünschen sich behinderte oder chronisch kranke Frauen und Männern zunehmend, selbst über die Realisierung ihres Kinderwunsches entscheiden zu können. Dabei können sie sich auf entsprechende gesetzliche Regelungen zur selbstbestimmten Elternschaft berufen.
Bereits vor Beginn einer Schwangerschaft stellt sich nicht nur den werdenden Eltern, sondern auch dem medizinischen Personal die Frage, wie der Verlauf der Schwangerschaft sein wird und welche Risiken für Mutter und Kind zu erwarten sind. So ist z. B. zu klären, ob eine Veränderung in der Medikation notwendig wird, um das Risiko für Mutter und Kind so gering wie möglich zu halten. Notwendige vorgeburtliche Maßnahmen sind ebenso zu klären wie eventuelle besondere Anforderungen bei der Wahl der Entbindungsart. Besonders für Patientinnen mit einer Dauermedikation sollte eine langfristige Familienplanung erreicht werden, um Risiken für Mutter und Kind rechtzeitig abzuklären, da Medikamente oft auch noch nach dem unmittelbaren Absetzen im Körper der Frau wirksam bleiben. Und schließlich sollte auch im Vorfeld geklärt werden, welchen Unterstützungsbedarf die Mutter bzw. die Eltern infolge ihrer Erkrankung bzw. Behinderung haben, um die entsprechenden Vorbereitungen treffen zu können.
Wissenschaftlich fundierte Aussagen über die Rolle einer Erkrankung für den Erhalt der Fertilität, für den Verlauf von Schwangerschaft und Geburt sowie für das Fehlbildungsrisiko des Kindes gibt es u.a. zu den Krankheitsbildern Mukoviszidose / zystische Fibrose (CF), Epilepsie, Multiple Sklerose (MS) und Tumorerkrankungen. Einzelne Aussagen liegen auch vor zu Querschnittslähmungen und psychischen Erkrankungen
Bei einer Mukoviszidose oder zystischen Fibrose kommt es zu einer vermehrten Produktion und erhöhten Viskosität (Zähigkeit) des Sekretes, wie beispielsweise in den Bronchien und im Verdauungstrakt, was zu schweren Störungen und Komplikationen im Atmungs- und Verdauungssystem führt. Aber auch die Sexualorgane sind von dieser Störung betroffen. Dennoch besteht bei erkrankten Frauen und Männern der Wunsch nach Partnerschaft und Familiengründung (Malenke 1997). Bereits 1968 wurde in einer Studie festgestellt, dass die Samenflüssigkeit von an CF erkrankten Männern nur selten Sperma enthielt. Erst in einer nachfolgenden Untersuchung einige Jahre später wurde festgestellt, dass 98 % aller mit CF erkrankten Männer ohne Samenleiter und nur mit gering ausgebildeten Nebenhoden geboren wurden. Meist fehlen die Samenblase und der Ejakulationskanal komplett oder sind fehlgebildet. Die Hoden sind meist normal ausgebildet und produzieren auch ausreichend Sperma, welches aber nur teilweise in den Nebenhoden gelangen kann. Die männliche Hormonproduktion verläuft jedoch regulär.
Frauen mit einer CF Erkrankung sind wesentlich weniger von einer generellen Sterilität betroffen. Die bestehenden Probleme stellen sich eher in der Verminderung der Eisprünge und in einer veränderten Zusammensetzung des Scheidensekrets dar, das meist wesentlich zähflüssiger ist. Dadurch wird sich das Eindringen der Samenzellen in die Gebärmutter erschwert. Die Fruchtbarkeit ist dadurch zwar vermindert, aber Schwangerschaften sind möglich. Für die Kinder von Eltern mit Mukoviszidose besteht ein erhöhtes Risiko, ebenfalls diese Erkrankung zu bekommen. Stuhrmann-Spannenberg (1997) verweist darauf, dass eine humangenetische Beratung sinnvoll ist, bevor eine entsprechende Therapie bei bestehendem Kinderwunsch begonnen wird.
Das Krankheitsbild der Epilepsie und die Folgen der Erkrankungen sind sehr heterogen. Bei bestimmten Epilepsieformen oder Antiepileptika können die Sexualfunktionen beeinträchtigt sein. Durch Informationsdefizite bei behandelnden Neurologen oder Gynäkologen bestätigen Frauen sowohl in unserer Studie als auch in Internetforen, dass sie eher verunsichert als unterstützt werden, wenn sie sich fachliche Beratung vor einer Schwangerschaft einholen wollen. Dabei gibt es gerade zu diesem Krankheitsbild sehr fundierte wissenschaftliche Ergebnisse durch die Arbeit des European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy (EURAP), dem europäischen Register für Schwangerschaften unter Antiepileptika. An dieser länderübergreifenden Studie beteiligten sich zum Stichtag 29. Mai 2009 insgesamt 750 Ärztinnen und Ärzte aus 42 europäischen und nichteuropäischen Ländern (EURAP 2009). Im erstellten Register waren zum 29. Mai 2009 13.205 Schwangerschaften erfasst, für Deutschland 1.311. Das Projekt EURAP verfolgt das Ziel, einen Vergleich zur Wirkung und zur Sicherheit der verschiedenen Antiepileptika zu erstellen und dabei die konkreten Wirkungen für das ungeborene Kind in Bezug auf die Häufigkeit von Fehlbildungen und pränatale Wachstumsstörungen zu erfassen (Schmitz 2008). Damit entstehen erstmals belastbare Aussagen zur Wirkungsweise und zum Einfluss von Antiepileptika, welche dann die Entscheidung und die Vorbereitungen für die Realisierung eines Kinderwunsches bei betroffenen Frauen positiv beeinflussen könnte.
Generell liegen keine expliziten Gründe vor, die eine Schwangerschaft bei Frauen mit Epilepsie ausschließen. Auf der Basis des europäischen Registers liegen fundierte Kenntnisse über Antiepileptika vor, die sowohl das Anfallsrisiko für die Mutter als auch das Schädigungsrisiko für das Kind minimieren können (ebd.). Epileptikerinnen mit Kinderwunsch sollten vor Eintritt der Schwangerschaft darüber mit dem Neurologen und dem Gynäkologen besprechen, um Risiken zu minimieren und eventuell eine medikamentöse Umstellung langfristig vorzubereiten, da Antiepileptika auf Valproinsäurebasis in den frühen Phasen der Schwangerschaft eingenommen, zu Neuralrohrdefekten (spina-bifida) führen können. Bei einer entsprechenden optimalen Medikamenteneinstellung kommen Komplikationen im Verlauf der Schwangerschaft nicht häufiger vor als vergleichsweise bei Frauen ohne eine Epilepsieerkrankung. Eine Verringerungen der Anfallshäufigkeit war bei 5- 10% der schwangeren Frauen feststellen, auch einer spontanen Geburt steht nichts entgegen. In Bezug auf die Vererbbarkeit der Erkrankung konnte nachgewiesen werden, dass mit sehr wenigen Ausnahmen Epilepsie keine Erbkrankheit ist. 95% der Kinder von epilepsiekranken Eltern waren nicht selbst von Epilepsie betroffen (Schmitz 2008).
Eine Multiple Sklerose (MS) Erkrankung tritt häufig zwischen dem 20.-40. Lebensjahr auf, also genau in dem Zeitabschnitt, in dem Fragen der Partnerschaft und der Familieplanung eine wesentliche Rolle spielen. Frauen erkranken nach den Angaben von Moser und Albrecht (2010) annährend doppelt so häufig an Multipler Sklerose wie Männer. Jasper (2004) verweist darauf, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass Schwangerschaften den Verlauf einer Multiplen Sklerose ungünstig beeinflussen. Er beschreibt sogar eine Abnahme der Schubhäufigkeiten und die Verbesserung der Krankheitsverläufe – ein Phänomen, das Rösener mit der besonderen immunologischen Situation einer Schwangerschaft, in der der Körper der Mutter das immunologisch fremde Kind tolerieren muss, erklärt (Rösener 2005). Der Ablauf der Geburt ist von den geburtshilflichen Erfordernissen abhängig, wobei eine Periduralanästhesie (PDA) möglich ist, ohne dass die Erkrankung generell negativ beeinflusst wird.
Eine besondere Herausforderung stellt die Versorgung und das Erziehen der Kinder für Menschen mit MS dar. Schlafdefizite und die schwierige Organisation des gesamten Alltags führen oftmals zu chronischen Erschöpfungszuständen und zum Erreichen der Grenzen der allgemeinen Belastbarkeit. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig ein umfassendes Netzwerk aufzubauen, um im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
Aus den Daten des Deutschen Krebsregisters ist ersichtlich, dass bestimmte Formen der Tumorerkrankungen vor allem Menschen jüngeren und mittleren Alters betreffen. Fragen zum Erhalt der Fertilität stellen sich in mehrfacher Hinsicht. Zunächst können sowohl bei Frauen als auch bei Männern die Reproduktionsorgane von der Tumorerkrankung betroffen sein. Zweitens stellt sich je nach Stadium und Art der Tumorerkrankung die Frage der Prognose und der Überlebenszeit. Und drittens beeinflussen Radio- und Chemotherapie nicht nur das Tumorgewebe, sondern können auch Samen- und Eizellen nachhaltig schädigen (von Wolf 2007). Neben den elementaren Fragen der Heilbarkeit der Erkrankung sollten auch die Probleme und Fragen bezüglich einer möglichen Familienplanung und eines Kinderwunschs Beachtung finden. Je nach Form und Stadium der Krebserkrankung stehen Behandlungsmethoden zur Verfügung, die eine spätere Elternschaft wahrscheinlicher werden lassen, wobei bei Frauen mit zunehmendem Alter das Risiko steigt, nach einer Chemotherapie unfruchtbar zu sein (Deutsche Krebshilfe 2007). Analog gilt bei Männern, dass nach der Chemotherapie noch gesunde Samenstammzellen vorhanden sein müssen, um die Fruchtbarkeit zu erhalten.
Auch bei der Strahlentherapie können die Keimzellen sowohl bei Männern als auch bei Frauen so weit geschädigt werden, dass die Fortpflanzungsfähigkeit nicht erhalten werden kann. Das ist ebenso vom Alter (der Frau), der Tumorlokalisation und der Stärke der eingesetzten Strahlen abhängig.
Bei Operationen von Tumoren in den paarweise angelegten Sexualorganen (Eierstöcke bzw. Hoden) kann die Fortpflanzungsfähigkeit erhalten bleiben, wenn nur eine Seite betroffen ist und operativ entfernt werden muss. Ist die Entfernung beider Eierstöcke bzw. Hoden oder der Gebärmutter notwendig, kann die Reproduktionsfähigkeit nicht erhalten werden. Wird eine Stammzelltransplantationen notwendig, müssen Zytostatika in hoher Dosis angewendet werden, um im gesamten Blutsystem vorhandene Leukämiezellen zu vernichten. Oftmals ist noch zusätzlich eine Ganzkörperbestrahlung notwendig. Durch die Wirkung der hoch dosierten Medikamente und der Strahlen werden auch die Keimzellen irreversibel geschädigt.
Im Jahr 2006 wurde ein bundesweites Netzwerk unter dem Namen FertiPROTEKT gegründet, um Frauen und Männer mit malignen Tumorerkrankungen in Bezug auf den Erhalt ihrer Fortpflanzungsfähigkeit zu beraten und ihnen ggf. moderne Therapien bei bestehendem Kinderwunsch zugängig zu machen. Unter dem Titel „Fertilitätsprotektion bei Frauen - Empfehlungen des Netzwerks FertiPROTEKT“ in der Version 1 vom 13. Mai 2009 werden Hinweise über fertilitätserhaltende Maßnahmen, Risiken und Kosten bei unterschiedlichen Tumorerkrankungen publiziert. Auf der Homepage des Projektes können sich sowohl Ärzte als auch Frauen und Männer mit Tumorerkrankungen beraten und informieren lassen.
Querschnittslähmungen infolge der Schädigung des Rückenmarkes beeinträchtigen nicht die Fähigkeit einer Frau, schwanger zu werden und Kinder zu gebären (Löchner-Ernst 2002). Bei Männern mit Schädigungen des Rückenmarks ist eine spontane Ejakulation die Voraussetzung für eine Befruchtung. Nach Löchner-Ernst ist je nach Art und Abschnitt der Rückenmarksverletzung nur ein sehr geringer Prozentsatz der Männer in der Lage, einen Samenerguss (Ejakulation) beim Geschlechtsverkehr zu erreichen und nur weitere 5 bis 10% erreichen dies durch Masturbation. Um bei Anejakulation trotzdem zu einer Vaterschaft verhelfen zu können, müssen technische Verfahren zur Samengewinnung Anwendung finden. Diese Techniken sind z. B. transrektale Elektrostimulation des Plexus pelvicus (Plas et al2003), die perkutanen penilen Vibrostimulation (Sommer & Schmitges 2007) oder die Testikuläre Spermienextraktion zur Gewinnung einzelner Samenzellen.
Es existieren nur wenige Studien und Forschungsberichte zu Schwangerschaften von querschnittsgelähmten Frauen. Eisenbarth (2010) wies nach, dass bei schwangeren Frauen mit einer Querschnittslähmung mit einer erhöhten Neigung zu Frühgeburten zu rechnen ist. In der frühen Phase der Schwangerschaft (1. Trimenon) unterstützt intensivierte Krankengymnastik die Stärkung der körperlichen Struktur und dient der optimalen Dekubitusprophylaxe. In der mittleren Phase der Schwangerschaft (2. Trimenon) sollten Übungen zur Selbstpalpation erlernt werden, um eine Kontrolle der Wehentätigkeit und indirekte Anzeichen von Wehen zu gewährleisten. In diesem Zeitraum empfiehlt sich auch die Einbindung eines Experten aus dem Bereich der Hilfsmittelversorgung (Ergotherapeuten/ Paraplegiologen) sowie der Hebamme und der Klinik, in welcher die Patientin entbinden möchte. Ab der 25. Schwangerschaftswoche sind regelmäßige (14-tägige) Ultraschallkontrollen angeraten, um eine Placentainsuffizienz frühzeitig zu erkennen.
In der letzten Phase der Schwangerschaft (3. Trimenon) bereiten meist das zunehmende Gewicht und die verstärkte Gefahr der Ödembildung Schwierigkeiten, wobei mit geeigneten Kompressionsstrümpfen vorgebeugt werden kann. Wesentlich ist auch die Kontrolle der regelmäßigen Blasen- und Darmentleerung, um eine autonome Hyperreflexie zu vermeiden. Regelmäßige Vaginalsonographie mit Zervixbeurteilungen ermöglichen die Früherkennung von Frühgeburtsbestrebungen.
Im Vorfeld der Geburt ist es wichtig, die Beweglichkeit der Hüfte zu beurteilen und gegebenenfalls eine Probelagerung und ein Probe-CTG im Rollstuhl durchzuführen. Nach den Erfahrungen von Eisenbarth kann die Geburt: „grundsätzlich auch ohne die Möglichkeit der Mutter aktiv mitzupressen, spontan und unkompliziert verlaufen. Der Uterus besitzt nämlich ein autonomes Reizleitungssystem, welches auf die Geburt entscheidenden Einfluss ausübt.
[…] Bei verzögerter Austreibungsphase ist die vaginale, instrumentelle Entbindung indiziert. Die Überwachung des Kindes unterscheidet sich dabei nicht von der Vorgehensweise bei Geburten nichtbehinderter Frauen.“ (Eisenbarth 2010).
Das Stillen sollte unbedingt auch bei Querschnittsgelähmten ermöglicht und gefördert werden. Bei Frauen mit sensomotorisch kompletter Schädigung unterhalb des Wirbels Th3 kann der Milchejektionsreflex abgeschwächt und damit die Milchproduktion eingeschränkt sein. Nach der Entlassung ist eine ambulante, spezifische Behandlungspflege für drei bis sechs Wochen notwendig, wobei alle notwendigen Hilfsmittel wie Antidekubituskissen, Rutschbett, Stillkissen und rollstuhlgerechter Wickeltisch sowie unterfahrbares Kinderbett bereits vorbereitet sein sollten, um möglichst schnell eine selbstbestimmte Alltagsgestaltung für die Familie gewährleisten zu können.
In Deutschland begeben sich im Verlauf eines Jahres mehr als 1,6 Millionen Menschen mit psychischen Erkrankungen in Behandlung. Das entspricht ca. drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Die psychische Erkrankung eines Familienmitgliedes hat immer auch Auswirkungen auf das gesamte Familiensystem, involvierte Familiennetzwerke und vor allem den betroffenen Partner. Betrachtet man die Risiken der Vererbungswahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen, so ist aus entsprechenden genetischen Studien erfassbar, dass sowohl bei schizophrenen als auch bei affektiven Störungen eine entsprechende Vererbungskomponente festgestellt werden konnte (Lisofsly 2008: 3). Die möglichen Therapien umfassen neben gesprächs- und verhaltenstherapeutischen Ansätzen meist auch Psychopharmaka-Therapien. Daraus lässt sich das Entwicklungsrisiko für das ungeborene Kind im Rahmen einer Schwangerschaft ableiten, da alle Psychopharmaka plazentagängig und entsprechende Spuren im kindlichen Organismus nachweisbar sind.
Nach den Schilderungen von Hornstein (2009) kommt es bei 59 % der betroffenen Frauen bei Eintritt einer Schwangerschaft zur Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Deshalb sollte eine angemessene Beratung unter der Berücksichtigung der bisherigen Erkrankung mit Beachtung der Häufigkeit von Krankheitsphasen, die Evaluation der krankheitsauslösenden Faktoren und die Berücksichtigung der Medikamente einer Umsetzung des Kinderwunsches voraus gehen (Faust 2010).
Im Rahmen der Schwangerschaft sollten die betroffenen Frauen sowohl psychiatrisch als auch gynäkologisch besonders intensiv als Risikopatientin betreut werden. Wenn im Verlauf der Schwangerschaft Psychopharmaka eingenommen wurden, sollte die Geburt in einer Geburtsklinik mit angeschlossener Säuglingsstation erfolgen, so dass bei auftretenden Entzugsymptomen oder anderen Nebenwirkungen der Medikamente jederzeit reagiert werden kann und eine intensive Überwachung ohne Trennung von Mutter und Kind gewährleistet ist.
Insbesondere durch das hohe Engagement behinderter Frauen und Männer selbst vollzog sich in den letzten zwanzig Jahren ein Paradigmenwechsel in der Politik für und mit Menschen mit Behinderungen. 1993 wurde mit den Standard Rules der UNO zur Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen eine Empfehlung an die Mitgliedsstaaten gegeben, Lebensbedingungen zu schaffen, die Menschen mit Behinderungen nicht mehr diskriminieren.
Mit Einführung der ICF im Jahr 2001 wurde ein neuer Ansatz gefunden, Behinderung zu definieren und damit die Basis für weiterführende gesetzliche Regelungen zu schaffen, die den erwähnten Paradigmenwechsel realisieren. Der bisher vorrangig medizinisch orientierte Ansatz für die Definition von Behinderungen wurde durch die Berücksichtung der Kontextfaktoren um die lebensweltliche Dimension erweitert. Insbesondere die Definition der Umweltfaktoren erweiterte den Blick auf Behinderung vom individuellen Schicksal auf eine gesellschaftliche Problematik. Im Zentrum der Betrachtung steht nunmehr die Aktivität des Menschen, die von vielfältigen, sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren gefördert oder gehemmt wird, so von den Umwelt- und den personenbezogenen Faktoren, denen ein Mensch ausgesetzt ist. Die gesundheitliche Situation stellt dabei nur einen Aspekt dar. Damit erfolgt die Beurteilung der Behinderung ressourcen- statt defizitorientiert.
Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom Dezember 2006 (in Deutschland ratifiziert im April 2009) erhielten auf internationaler Ebene die Forderungen nach Chancengleichheit und Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens größere Rechtsverbindlichkeit. Auch hier waren es wieder behinderte Frauen und Männer selbst, die einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Konventionstextes nahmen. Die Rechte behinderter Menschen auf Sexualität, Partnerschaft und Familie wurden explizit in der Konvention benannt. So heißt es im Artikel 23: „Achtung vor Heim und Familie
-
Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung behinderter Menschen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und persönliche Beziehungen betreffen, auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen, um zu gewährleisten, dass
-
das Recht behinderter Menschen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;
-
das Recht behinderter Menschen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer Information, Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte bereitgestellt werden;
-
behinderte Menschen, einschließlich Kinder, auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen ihre Fruchtbarkeit erhalten.“ (UN-Konvention 2010). In der deutschen Gesetzlichkeit wurde im Jahr 1994 mit der Ergänzung des Artikels 3 im Grundgesetz durch den Absatz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ der rechtliche Rahmen für den Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik Deutschlands geschaffen. In diesem Sinn erfolgte auch eine Neudefinition des Begriffs der „Behinderung“ im SGB IX (2001) und im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG 2002). Der Paradigmenwechsel vollzieht sich von der Betrachtung behinderter Menschen als Objekte der individuellen und gesellschaftlichen Fürsorge hin zur Akzeptanz als Subjekt des selbstbestimmten Handelns.
Mit Einführung des SGB IX und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) fanden die besonderen Belange behinderter Frauen und Mütter noch stärkere Beachtung. Eine Übersicht der relevanten gesetzlichen Regelungen gibt Tabelle 2.
| Gesetz/Paragraph | Inhalt |
|---|---|
| RVO (Reichsversicherungsverordnung) |
§ 198: Anspruch krankenversicherter Frauen auf häusliche Pflege wegen Schwangerschaft und Entbindung, sofern diese nicht anderweitig gesichert ist§ 199: Anspruch krankenversicherter Frauen auf Haushaltshilfe wegen Schwangerschaft und Entbindung, sofern diese nicht anderweitig gesichert ist |
| SGB III Arbeitsförderung BGBI. I S. 2992 19.11.2004 |
§ 1: Ziele der Arbeitsförderung§ 8: Frauenförderung§ 8a: Vereinbarkeit Familie und Beruf§ 8b: Leistungen für Berufsrückkehrer§ 97: Teilhabe am Arbeitsleben§ 98: Leistungen zur Teilhabe§ 100: Leistungen§ 101: Besonderheiten§ 102: Grundsatz§ 103: Leistungen |
| SGBV Gesetzliche Krankenversicherung BGBI. I S. 2014 30.07.2004 |
§ 24: Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter§ 33: Hilfsmittel§ 38: Haushaltshilfe§ 41: Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter |
| SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung BGBI. I S. 3183 04.12.2004 |
§ 15: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation§ 177: Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten |
| SGB VIII Kinder und Jugendhilfe BGBI. I S. 3022 27.11.2003 |
§ 19: Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kind§ 20: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen§ 21: Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung derSchulpflicht§ 22: Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen§ 23: Tagespflege§ 24: Ausgestaltung des Förderangebots in Tageseinrichtungen (mit Änderung vom 01.01.2005)§ 24a: Übergangsregelung zum Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens§ 25: Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern§ 26: Landesrechtsvorbehalt§ 27: Hilfe zur Erziehung§ 28: Erziehungsberatung§ 29: Soziale Gruppenarbeit§ 30: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer§ 31: Sozialpädagogische Familienhilfe§ 32: Erziehung in einer Tagesgruppe§ 33: Vollzeitpflege§ 34: Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen |
| SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen BGBI. I S. 2014 30.07.2004 |
§ 1: Selbstbestimmung§ 9: Wahl- und Wunschrecht§ 17: Persönliches Budget§ 22: Aufgaben§ 55: Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft§ 57: Förderung der Verständigung§ 58: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben |
| SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGBI. I S. 3022 27.12.2003 |
§ 2: Selbstbestimmung |
| SGB XII Sozialhilfe BGBI. I S. 1950 30.07.2004 |
§ 50: Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft§ 53: Leistungsberechtigte und Aufgabe§ 55: Sonderregelung für behinderte Menschen in Einrichtungen |
| Behindertengleichstellungsgesetz BGG |
§ 4 Benachteiligungsverbot |
| Sächsisches Integrationsgesetz SächsIntegrG vom 28.05.2004 |
§ 1: Ziele des Gesetzes§ 3: Barrierefreiheit§ 4: Benachteiligungsverbot, insbesondere Absatz 4§ 5: Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen§ 6: Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen§ 7: Barrierefreie Informationstechnik§ 8: Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken |
| Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) BGBI I S. 2318 20.06.2002, BGBI I S. 2190 14.11.2003 |
Das Gesetz enthält keine speziellen Regelungen für behinderte Schwangere und Mütter, ist aber von allgemeiner BedeutungEine Übersetzung in leichte Sprache wird empfohlen für den Bereich der WfbM§ 3: Beschäftigungsverbote für werdende Mütter§ 4: Weitere Beschäftigungsverbote§ 15: Sonstige Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft§ 16: Freizeit für Untersuchungen |
Im Folgenden soll auf zwei wesentliche Aspekte näher eingegangen werden: Die Regelungen zum persönlichen Budget (SGB IX) und Hilfen zur Erziehung (SGB VIII). Die Umsetzung dieser beiden Regelungen können in der Praxis die finanzielle Grundlage zur Gewährleistung von Elternassistenz und begleiteter Elternschaft bilden – zwei wichtige Angebote für Eltern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, selbstbestimmt ihr Recht auf Elternschaft im Sinne der UN-Konvention zu realisieren.
Im Falle einer Behinderung oder chronischen Erkrankung ist die Hilfe und Unterstützung durch andere oft unerlässlich. In der Regel werden die sozialstaatlichen Transferleistungen als Sachleistungen ausgegeben. Damit werden die Dienstleistungen professioneller Einrichtungen finanziert. Der Leistungsträger, zum Beispiel die Pflegekasse und ein privater Pflegedienst als Leistungserbringer, interagieren in dem Falle direkt miteinander, ohne dass ein privatrechtlicher Vertrag mit dem Leistungsempfänger zustande kommt.
Um behinderten Menschen mehr Selbstbestimmung zu ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (§10 SGB I) zu gewährleisten, wurde die Möglichkeit zur Finanzierung und Gestaltung von Hilfen als Persönliches Budget erstmals im Jahr 2001 im §17 SGB IX gesetzlich geregelt. Im Absatz 2 werden die budgetfähigen Leistungen wie folgt benannt: „Bei der Ausführung des Persönlichen Budgets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträger, die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht. Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können“ (§17 Abs.1 SGB IX). Seit 2008 besteht auf Grundlage des SGB IX ein Rechtsanspruch, der die Teilhabe an allen Bereichen der Gesellschaft einklagbar macht. Die Teilhabe muss unabhängig von der Behinderung gewährleistet sein.
Unter dem Blickpunkt der Unterstützung bei der Elternschaft als Form der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hat sich die Bezeichnung Elternassistenz etabliert. Der Begriff „Assistenz“ wurde 2000 erstmals gesetzlich normiert, anfangs nur für die Arbeitsassistenz als begleitende Hilfe im Arbeitsleben (vgl. §102 Abs.4 SGB IX). Die Arbeitsassistenz lehnt sich am Konzept der persönlichen Assistenz an, das auf Initiative der Bewegung Selbstbestimmt Leben von vorrangig körperbehinderten Menschen entwickelt wurde als Abkehr vom bisher erhaltenen klassischen Konzept professionalisierter und institutionalisierter Pflege und Betreuung. Nach dem Prinzip des Assistenzmodells definiert der Begriff Elternassistenz „all diejenigen individuellen Unterstützungshandlungen, die Mütter und Väter mit Behinderungen benötigen, um die elterliche Sorge oder - im Falle nicht sorgeberechtigter Elternteile – den Umgang mit den Kindern möglichst umfassend und selbstbestimmt ausüben zu können.“ (Zinsmeister 2006: 3). Mit anderen Worten dient die Elternassistenz als menschliches Hilfsmittel zur Bewältigung von Erziehungs- und/oder Betreuungsaufgaben. Zur Gewährleistung der Elternassistenz über das persönliche Budget werden Zielvereinbarungen zwischen dem Budgetnehmer und den Kostenträgern abgeschlossen.
Eine prinzipielle Schwierigkeit der Beantragung des Persönlichen Budgets besteht in diesem Zusammenhang im Sachleistungsprinzip. Die Vorrangigkeit der Sach- und Dienstleistungen vor der Auszahlung des Gegenwertes dieser Leistungen schränkt die Selbstbestimmung behinderter Menschen ein. So verweist Zinsmeister in einem Beitrag zur sexuellen Selbstbestimmung noch einmal darauf, das z. B. Pflegebedürftige der Pflegestufe II ein Pflegegeld von 430€/Monat erhalten, von einem ambulanten Pflegedienst betreute Personen mit gleichem Pflegebedarf bis max. 1.040€ und im Heim lebende 1.279€, womit der tatsächliche Pflegebedarf über Assistenzleistungen kaum gedeckt werden kann (Zinsmeister 2010: 15).
Ein weiteres Hindernis bei der Durchsetzung der Rechtsansprüche auf staatliche Unterstützung resultiert aus einem Zuständigkeitskonflikt zwischen den Trägern der Kinder33 und Jugendhilfe (SGB VIII) und den Trägern der Rehabilitation gemäß SGB IX bzw. der Sozialhilfe gemäß SGB XII. Die persönliche Assistenz für die behinderte Mutter bzw. den behinderten Vater, sowohl als Sachleistung als auch in Form des Persönlichen Budgets als Teilhabeleistung zum Leben in der Gemeinschaft, wird vom Sozialhilfeträger finanziert, da sie rehabilitativen Charakter besitzt. Darüber hinaus hat die beantragte Hilfe den Zweck, die Versorgung und Erziehung der Kinder sicherzustellen bzw. zu verbessern. Kostenträger dafür ist das Jugendamt. In der Praxis wird von beiden Trägern die Zuständigkeit häufig beim jeweils anderen gesehen, so dass am Ende beide die Leistungsgesuche der Antragsteller ablehnen. Dieser Zuständigkeitskonflikt hat seine Wurzeln in den Kollisionsregelungen des §10 SGB VIII. Dort heißt es im Absatz 4: „Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von anderen Leistungsträgern gewährt werden.“ (§10 Abs.4, SGB VIII).
Ein weiteres, nicht unerhebliches Problem besteht in den Leistungen zur Pflege nach SGB XI und XII. Da die meisten behinderten Eltern Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI oder Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII in Anspruch nehmen, werden beim Jugend- oder Sozialamt gestellte Anträge gern abgelehnt, mit der Begründung, der Bedarf für die Betreuung des Kindes würde durch die Pflegeleistung bereits gedeckt. Mit gesetzlicher Verankerung des Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets scheint der Konflikt in der Praxis gelöst zu sein. Mit einer Zielvereinbarung hat der potentielle Budgetnehmer die benötigte Hilfe und Unterstützung formuliert, die er dem vermutlich zuständigen Träger vorlegt. Dieser hat nun die Aufgabe zu prüfen, ob die Zuständigkeit tatsächlich bei ihm liegt. Ist das nicht der Fall, muss der Kostenträger die Zielvereinbarung dem aus seiner Sicht zuständigen Kostenträger vorlegen. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der potentielle Budgetnehmer nur noch einen Antrag, formuliert als Zielvereinbarung, stellen muss und nicht wie bisher mehrere Anträge an die verschieden Kostenträger. Momentan ist es in der Praxis häufig der Fall, dass das persönliche Budget nach langer Antragsdauer abgelehnt wird, da die Zuständigkeit nicht eindeutig geklärt werden kann. Da seit 2008 ein Rechtsanspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben besteht, können die Leistungen eingeklagt werden. Weil die Regelung eindeutig ist, ist zum Wohle des Budgetnehmers die Kooperation aller Beteiligten gefragt. Voraussetzungen dazu sind gut informierte Budgetnehmer, in den Methoden der Bedarfsermittlung geschulte Budgetberater oder Budgetassistenten und gemeinschaftlich agierende Kostenträger. Eine besonders wichtige Voraussetzung ist darüber hinaus die öffentliche Akzeptanz von Eltern mit Behinderung und ihrem Recht auf Elternschaft.
Bis zum 10. Juli 2010 gab es in Sachsen 266 Budgetnehmer. Einige Vereinbarungen sind inzwischen ausgelaufen, so dass aktuell für 178 Budgetnehmer Kostenzusagen erteilt wurden, davon 117 für das ambulant betreute Wohnen. Bislang gibt es in Sachsen lediglich vier trägerübergreifende Budgets. Elternassistenz oder ähnliches (z.B. begleitete Elternschaft) ist nicht dabei (Auskunft des KSV nach persönlicher Anfrage). Winzer verweist aber auf die Möglichkeit, dass der KSVKostenzusagen im ambulant betreuten Wohnen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erteilt hat und gleichzeitig das Jugendamt Leistungen zur Erziehung des Kindes übernimmt. Dazu gibt es aber keine Daten.
In der Modellphase der Einführung des Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets gab es im Zeitraum vom 01. Juli 2004 bis 30. Juni 2007 bundesweit in den Modellregionen 358 beantragte und 353 bewilligte Budgetvereinbarungen. Anschließend erfolgten in der Region Chemnitz 26 Anträge und 23 Bewilligungen von Budgets, davon zwei als Trägerübergreifende Budgets (Metzler et al. 2007).
Mit dem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Minden vom 31. Juli 2009 (AZ 6L 382/09) wurde erstmals in Deutschland einer körperbehinderten Mutter das Recht auf Bewilligung einer Elternassistenz im Rahmen der Eingliederungshilfe zugesprochen. In einer Pressemitteilung auf dem Justizportal Nordrhein-Westfalen vom 05. Juli 2010 heißt es dazu: „Körperbehinderte Eltern haben im Bedarfsfall Anspruch auf eine sog. Elternassistenz nach sozialhilferechtlichen Vorschriften. Das Verwaltungsgericht Minden hat mit Urteil vom 25. Juni 2010 seine Entscheidung im zugehörigen Eilverfahren vom 31. Juli 2009 (Justiz NRW 2009) im Hauptsacheverfahren bestätigt. […] Die zuständige 6. Kammer unter Vorsitz von Jürgen Diekmann hielt dabei an ihrer Auffassung fest, dass die von der Klägerin benötigte Hilfe letztlich vom LWL im Rahmen der sozialhilferechtlichen Eingliederungshilfe zu erbringen sei. Die Klägerin selbst – und nicht ihr Sohn; nur dann wäre unter dem Aspekt der Jugendhilfe die Stadt Bünde zuständig – sei hilfsbedürftig. Es sei Aufgabe der sozialhilferechtlichen Eingliederungshilfe, die Folgen einer Behinderung zu beseitigen und behinderte Menschen soweit wie möglich am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Dazu gehöre es, das eigene Kleinkind möglichst im elterlichen Haushalt betreuen – lassen – zu können. Das Verwaltungsgericht hat die Berufung gegen das Urteil nicht zugelassen. Dagegen kann binnen eines Monats ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden, über den das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen entscheiden würde.“ (Urteil vom 25. Juni 2010 - 6 K 1776/09 – nicht rechtskräftig) (Justiz NRW 2010). Mit diesem Urteil wurde ein Präzedenzfall geschaffen, der zukünftig auch Eltern in Sachsen bei der Umsetzung ihres Rechts auf selbstbestimmte Elternschaft unterstützen kann.
Jugendämter werden bei allen Fragen kontaktiert, die sich aus Ansprüchen nach dem KJHG (SGB VIII) ergeben, so z. B. bei Sorgerechts-, Unterhalts-, Vaterschafts- und Betreuungsfragen. Im Rahmen einer Expertise befragten wir Jugendämter in Sachsen, welche Erfahrungen im Umgang mit behinderten Müttern bestehen und welchen Handlungsbedarf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter sehen (Michel 2006). Insgesamt lagen Auskünfte aus 44 Jugendämtern vor, von denen 39 (89%) Angaben zur Anzahl der behinderten und chronisch kranken Mütter, die Hilfen zur Erziehung nach §§27 bis 35 SGB VIII wahrnahmen, machen konnten. Elf Prozent der Ämter gaben an, dass keine statistischen Aussagen möglich sind, da das nicht erfasst wird.
Eine Übersicht über die angebotenen Hilfen entsprechend den gesetzlichen Regelungen im SGB VIII gibt Tabelle 3:
| § | Angebote | n | Prozent |
|---|---|---|---|
| 19 |
Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter und Kinder |
12 |
27 |
| 20 |
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen |
4 |
9 |
| 28 |
Erziehungsberatung |
14 |
32 |
| 29 |
soziale Gruppenarbeit |
4 |
9 |
| 30 |
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer |
18 |
41 |
| 31 |
sozialpädagogische Familienhilfe |
35 |
80 |
| 32 |
Erziehung in einer Tagesgruppe |
16 |
36 |
| 33 |
Vollzeitpflege |
20 |
46 |
| 34 |
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform |
36 |
82 |
(Quelle: Michel 2006)
Weitere Angebote umfassten z.B. die Vermittlung an Selbsthilfegruppen und Behindertenvereine, die Vermittlung an den sozialpsychiatrischen Dienst oder die Durchführung eines Workshops für behinderte Eltern.
Die Jugendämter verfügten über eine sehr breite Palette an Unterstützungsangeboten, die von der Entlastung behinderter Mütter durch Vermittlung einer geeigneten Hauswirtschaftshilfe über pädagogische Hilfen bis hin zur Vermittlung der Kinder in Pflegefamilien und Heime reichen. In 80% der Jugendämter wurde sozialpädagogische Familienhilfe nach §31 SGB VIII gegeben, um Familien durch intensive Betreuung und längerfristige Begleitung zu befähigen, den Alltag zu bewältigen, Krisen und Konflikte zu meistern und den Kontakt mit Ämtern und Institutionen zu fördern. Die konkreten Inhalte und Angemessenheit der Hilfe für Mütter mit Behinderungen konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht evaluiert werden. Die Ergebnisse zeigen jedoch bei geistig behinderten Personen, dass in weniger als der Hälfte der Jugendämter Empfehlungen gegeben wurden, die auf eine Stärkung der Familie orientierten. Hingegen wurde sehr häufig Hilfe nach §34 – die Heimerziehung der Kinder – genannt. Diese Aussagen deckten sich mit Erfahrungen von Pixa-Kettner (1996) und Kamlot (2005), wonach Kinder geistig behinderter Mütter relativ schnell in Heimen untergebracht werden. Pixa- Kettner verweist darauf, dass in den meisten Fällen keine Trennungsbegleitung für die Mütter und Kinder erfolgt, die oftmals nicht verstehen, warum sie voneinander getrennt werden. Kamlot schreibt, dass sie in ihrer Arbeit in einer Mutter-Kind-Einrichtung aus der Zusammenarbeit mit geistig behinderten Mütter die Erfahrung gemacht hat, dass diese Mütter ihre Mutterrolle mit entsprechender Unterstützung selbst übernehmen und ausfüllen können. Dass nicht nur die geistige Behinderung der Mutter als Risiko angesehen wird, sondern Behinderung allgemein, zeigte die Aussage einer Jugendamtsmitarbeiterin: „Bei Behinderung ist die Gefahr eines Versagens mit hoher Kindeswohlgefährdung höher als in einem ‚normalen’ Fall. Insoweit könnten bestimmte Behinderungen Auslöser für Gefährdungssituationen sein (§8a SGB VIII).“ (Michel 2006). Wie auch die im Ergebnis der vorliegenden Arbeit angeführten Beispiele zeigen, bestehen defizitäre Einstellungen zu behinderten Eltern nach wie vor.
Stellt sich die Frage, welche Aufgaben und Möglichkeiten die Jugendhilfe insgesamt hat, Menschen mit Behinderungen bei der Gestaltung tragfähiger Eltern-Kind-Beziehungen zu unterstützen. Jugendhilfe nimmt für sich in Anspruch, die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten. Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII) wurde mit der Hilfeplanung und damit ihrer Orientierung an allen Beteiligten ein Prozess der Aushandlung geeigneter und notwendiger, längerfristiger, erzieherischer Hilfen initiiert, der den Wünschen der beteiligten jungen Menschen sowie ihren Eltern Räume gegenüber den Jugendhilfeexperten eröffnet. Bei allen notwendigen Schritten ist gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes die Gewährleistung des Kindeswohls maßgeblich. Bei Verstößen gegen das Kindeswohl seitens der Eltern muss zunächst versucht werden, durch Hilfe, Unterstützung sowie Maßnahmen, die ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Eltern erleichtern, das Kindeswohl durch die Eltern (wieder) selbst zu sichern. Die unterstützende Rolle entspricht genauso dem Wächteramt des Staates. Diese Aufgabe nimmt der Staat aber auch bei gerichtlich beschlossenen Intervention gegen den Willen der Eltern wahr, um den Schutz der Kinder zu sichern – wenn die Eltern trotz der Hilfe nicht bereit oder in der Lage sind, das Wohl ihrer Kinder zu gewährleisten.
Jugendhilfe leistet also in erster Linie „Hilfen zur Erziehung“ und ist als Unterstützung in belastenden Lebenssituationen konzipiert. Dennoch ist sie ein spürbarer Eingriff in die Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien – wenn auch kein obrigkeitlicher Eingriff, sondern das Angebot einer Hilfeleistung mit Beteiligung an der Ausgestaltung. Haben Familienmitglieder eine Behinderung und/oder eine längerfristige Krankheit, so braucht der Familienhelfer besondere Kompetenzen, wie z.B. eine erhöhte Sensibilität für die Belange von Menschen mit Behinderungen, gute Kenntnisse ihrer Rechtslage, Kenntnisse über Behinderungen sowie chronische Krankheiten und empathische Zugänge zum „Leben mit Behinderung“. Diese Kompetenzen können in einer geeigneten Fortbildung erworben werden. Nur dann kann die Familienhilfe für die Beteiligten auch wirklich gelingen. Gerade Eltern mit Behinderungen und/oder langfristigen Krankheiten haben Ängste, wenn es um Kontakte zum Jugendamt geht. Ihre Angst fokussiert sich vor allem darauf, dass das Jugendamt ihre Erziehungsfähigkeit kritischer einstuft als die nichtbehinderter Eltern. Diese Befürchtung kommt nicht von ungefähr: Wie Blochberger (2008) und Pixa-Kettner (1996) hervorheben und auch unsere eigenen Forschungsergebnisse bestätigen, gibt es Fälle, in denen Eltern ihre Kinder entzogen wurden, in erster Linie, weil die Eltern eine Behinderung haben. Grundsätzlich aber ist das Jugendamt eine Schutzinstitution und arbeitet nach den oben genannten gesetzlichen Grundlagen – alle Eltern haben ein Recht auf Hilfe, wenn sie diese benötigen und sie haben das Recht, diese Hilfe einzufordern. Das Prinzip des „Empowerments“ – also der Selbstbemächtigung – gilt auch für behinderte Eltern. Eltern müssen gute Eltern sein und sich im Interesse ihrer Kinder verhalten – von einer etwaigen Behinderung ist das unabhängig. Eltern mit Behinderung müssen keine besseren Eltern sein als andere. Sie müssen aber im Sinne des Kindeswohls agieren und dann stark genug sein, um Hilfe zu bitten, wenn diese gebraucht wird.
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes leistet einen erheblichen Beitrag für die Schärfung des Rechtsbewusstseins in der Staatengemeinschaft, wenn es um die Anerkennung von Kindern als eigenständige Rechtssubjekte, um ihre besondere Schutzbedürftigkeit, auch in Hinblick auf menschenrechtliche Gewährleistung, und um die Förderung ihrer Entwicklung geht. Bei einem möglichen Konflikt zwischen Elternwille und Verwirklichung des Kindeswohls gebietet die Konvention im Zweifelsfall immer eine Parteilichkeit für das Kind. Ein Angebot zur Familienhilfe bilden gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter und Kinder. Im §19 SGB VIII heißt es:
-
„ Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden.
-
Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.
-
Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen sowie die Krankenhilfe nach Maßgabe des §40 umfassen.“ (§19 SGB VIII)
Daraus wird bereits ersichtlich, dass dieses Angebot vorrangig auf die Betreuung minderjähriger Mütter und ihrer Kinder ausgerichtet ist. Die Unterstützung behinderter Mütter oder gar behinderter Familien kommt im Sinne des Gesetzes nicht vor. Die Folgen bestehen dann in einer unangemessenen Umgangsform mit volljährigen, aber behinderten Müttern, wie z.B. aus einem Gutachten zur Erziehungskompetenz einer geistig behinderten Mutter hervorgeht: „In der WG sei sie nicht klar gekommen, es seien immer Leute reingekommen und hätten ihr reingeredet, dies habe ihr nicht gefallen. Sie habe sich sehr überwacht und in die Enge gedrängt gefühlt. Sie sei wie ein kleines Kind behandelt worden.“ (aus einem psychologischen Sachverständigengutachten vom 24.06.2008).
Im Rahmen der Expertise (Michel 2006) wurde von Mitarbeiterinnen aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mehrfach angesprochen, dass die Familienhilfe für geistig behinderte oder psychisch kranke Mütter nicht ausreicht, da diese Hilfeangebote zeitlich befristet sind, es aber nicht in jedem der Fälle gelingt, die Selbstständigkeit der Mutter bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes so zu entwickeln, dass eine eigene Wohnung für die Familie möglich wird. In der Regel erfolgt in diesen Fällen dann die getrennte Unterbringung von Mutter und Kind in verschiedenen Einrichtungen. Der Grund für dieses Regelung liegt in der unterschiedlichen Zuständigkeit der Kostenträger, eine Mischfinanzierung nach SGB VIII über die Jugendämter und SGB XII über den Kommunalverband Sachsen (KVS) ist auch nach aktuellem Kenntnisstand bisher nur in Ausnahmefällen möglich. Darüber hinaus hoben die Mitarbeiterinnen der Heime hervor, sei der Personalschlüssel nicht auf den erhöhten Betreuungsaufwand für geistig behinderte oder psychisch kranke Mütter ausgerichtet. Es wird seitens der Jugendämter davon ausgegangen, dass die Mütter entsprechend der gesetzlichen Regelungen während ihres Aufenthaltes im Heim ihre Ausbildung fortsetzen und die Kinder in der Abwesenheitszeit der Mütter in Kindereinrichtungen betreut werden. Bleiben die Mütter aber tagsüber im Heim oder ist eine Einzelbetreuung mit einem erhöhten Aufwand nötig, kann das nicht entsprechend flexibel personell abgesichert werden. Darauf wurde auch im Rahmen einer Anhörung im Sächsischen Landtag am 12. April 2010 verwiesen. Die getrennte Unterbringung von Mutter und Kind bildet dann eine sehr häufig anzutreffende Lösung.
Aus der Arbeit von Pixa-Kettner (1996), die bundesweit die Situation von 1000 behinderten Elternschaften mit 1350 Kindern untersuchte, geht eindeutig hervor, dass geistig behinderte Eltern durchaus in der Lage sind, mit entsprechender, möglicherweise langfristiger Unterstützung zu ihren Kinder eine kompetente Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. Häufig sehen sich aber die behinderten Eltern ebenso wie das betreuende Personal in den Einrichtungen oder betreuende Angehöriger einem höheren Kontroll- und Erfolgsdruck ausgesetzt als nicht behinderte Familien. Aus diesem Druck sowie aus den bisherigen Sozialisationserfahrungen der behinderten Mütter/Eltern resultieren Ängste, die es den betreuenden Personen erschweren, ausgewogene Entscheidungen zu treffen, die sowohl das Recht der Eltern als auch das Kindeswohl berücksichtigen. Andererseits erschwert diese Situation den behinderten Müttern/Eltern die rechtzeitige Inanspruchnahme von Hilfe im Bedarfsfall – ein Dilemma, das, wie bereits beschrieben, in der getrennten Unterbringung von Mutter und Kind mündet. Kamlot (2005) verweist in ihrer Arbeit darauf, dass alleinerziehende geistig behinderte Mütter im intensiven Kontakt mit anderen Müttern soziale Kompetenzen erwerben und Ängste vor dem Alleinsein abbauen können. Eine langfristige Betreuung mit dem Ziel, aufbauend auf dem individuellen Leistungsvermögen der Mutter die Beeinträchtigungen zu kompensieren, kann zu einer intensiven Beziehung zwischen Mutter und Kind führen. Eine Benachteiligung auf Grund einer Beeinträchtigung ist nicht zu vertreten, die gesetzlichen Grundlagen sind dazu vorhanden. Notwendig wäre aber offensichtlich eine unbürokratischere Regelung der Finanzierung längerfristiger Wohnangebote für behinderte Mütter, die derartige Wohnformen benötigen sowie zur Finanzierung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs.
Im Artikel 9 der UN-Konvention wird die Zugänglichkeit als Voraussetzung zur gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben definiert. Darin heißt es:
-
„ Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für
-
Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;…“ (UN-Konvention Art. 9)
Damit wird der Begriff der Barrierefreiheit noch einmal nachhaltig von der einseitigen Sicht auf bauliche Barrieren für Menschen im Rollstuhl auf alle Zugangsbeschränkungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, kommunikativen, kognitiven oder Sinnesbehinderungen erweitert. Das heißt, sowohl die Beschilderung in Brailleschrift als auch die Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetschern oder anderen Kommunikationshilfen, der Einsatz der Leichten Sprache als auch die Bereitstellung entsprechender Technologien und technischer Geräte werden von diesem Artikel berührt. Die Vertragsstaaten werden aufgefordert, entsprechende Leitlinien zur Herstellung der Barrierefreiheit zu entwickeln. Der gleichberechtigte Zugang zu Leistungen des Gesundheitswesens wird in Art. 25 der Konvention gefordert. Gleichberechtigter Zugang heißt aber auch, dass Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen nicht von Gesundheitsleistungen ausgeschlossen werden und dass die medizinischen Versorgungseinrichtungen barrierefrei, das heißt selbständig in Anspruch genommen werden können.
Im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) wird im §4 Barrierefreiheit ebenfalls in diesem umfassenden Sinn definiert: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ (§4 BGG).
Die Internetplattform nullbarriere.de stellt die Anforderungen an Barrierefreiheit für Arztpraxen vor gemäß §4 BGG in Verbindung mit §17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I. Im SGB I werden Leistungsträger von Sozialleistungen verpflichtet Sorge zu tragen, dass „ihre Verwaltungsund Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und Anlagen ausgeführt werden.“ (§17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I). Im Absatz 2 wird nochmals auf das Recht hörbehinderter Menschen verwiesen, „bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen, Gebärdensprache zu verwenden. Die für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tragen; §19 Abs. 2 Satz 4 des Zehnten Buches (Sozialverwaltungsverfahren) gilt entsprechend.“ (§17 Abs. 2 SGB I).
Diese Anforderungen sind sowohl bei der Standortwahl als auch der Einrichtung neuer Praxen zu berücksichtigen. Dabei verweisen die Autoren von nullbarriere.de darauf, dass Arztpraxen in neu erbauten Gebäuden meist den Anforderungen der ratifizierten Behindertenrechtskonvention (BRK) entsprechen, Arztpraxen im Bestand jedoch größte Probleme hinsichtlich der Zugänglichkeit haben. Lösungen sind somit erforderlich, um mit einem verhältnismäßigen Aufwand die Herstellung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. Mit den Symbolen für Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, Gehbehinderung, Seh- oder Hörbehinderung sowie für Menschen mit kognitiven Einschränkungen könnte in Ärzteverzeichnissen die Zugänglichkeit der Arztpraxen gekennzeichnet werden. Allerdings wird der Verweis auf die Barrierefreiheit oft noch als Wettbewerbsverzerrung verstanden (vgl. Abschnitt 4.4.2) und eine Kennzeichnung nicht vorgenommen.
Nullbarriere.de bietet eine Checkliste für Ärzte (siehe Anlage), die es sowohl den Bewilligungsbehörden für eine neue Praxis (Krankenkasse, Kassenärztliche Vereinigung) als auch den Ärzten ermöglicht, die Kriterien selbst zu prüfen. Nach diesen Kriterien bestehen Barrieren vor allem in folgenden Bereichen (Quelle: nullbariere.de 2010):
-
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen - Gehbehinderte, Rollatornutzer, Rollstuhlnutzer
-
Parkplätze unzureichend
-
Stufen, Treppen, Türen
-
zu geringe Raumgrößen, ungeeignete Umkleiden
-
fehlendes Rollstuhl-WC
-
fehlende höhenverstellbare/flexible Untersuchungsmöbel
-
-
für Sehbehinderte, Blinde
-
keine visuellen, taktilen und/oder akustischen Informationen zur Orientierung
-
schlechte Beschilderung, Beleuchtung, große Glasflächen
-
Platz für den Blindenführhund fehlt
-
kein Infomaterial
-
-
für Hörbehinderte
-
keine visuellen oder akustischen Informationen zur Orientierung
-
Anmeldung nicht per Email, Fax, SMS möglich
-
keine induktive Höranlage
-
keine Informationen zu Gebärdensprachdolmetscher, andere Kommunikationshilfen
-
-
für Behinderte mit Begleitperson, kognitiven Einschränkungen
-
keine Leichte Sprache für den Betroffenen
-
keine Geduld, keine Toleranz
-
Abgesehen von den baulichen Anforderungen für mobilitätseingeschränkte Menschen wird aus dieser Übersicht deutlich, dass die Mehrzahl der Anforderungen ohne großen finanziellen Aufwand realisiert werden könnte. Durch eine sinnvolle Nutzung vorhandener Kommunikationsmittel und vor allem durch eine empathische Einstellung zu behinderten und chronisch kranken Menschen könnte schon sehr viel erreicht werden.
Inhaltsverzeichnis
Das Forschungsziel des von der Roland-Ernst-Stiftung für Gesundheitswesen Sachsen bewilligten Projektes besteht im wesentlichen darin, fundierte Erkenntnisse zur Lebenssituation, dem Hilfe- und Unterstützungsbedarf sowie zu Kompetenzen und Ressourcen behinderter und chronische kranker Mütter bzw. Eltern zu gewinnen. Außerdem sollen vorhandene Versorgungsangebote auf ihre Bedarfsgerechtigkeit geprüft werden, um daraus Konzepte für eine kompetente medizinisch-pflegerische Versorgung und soziale Begleitung abzuleiten, die eine optimale Entwicklung für behinderte Mütter und ihre Kinder ermöglichen sowie Konflikten, Überforderungssituationen und Diskriminierungen vorbeugen können. In diesem Sinne reiht sich dieses spezielle Forschungsprojekt ein in das Konzept der Frühförderung für Familien, da gerade auch Mütter/Eltern mit Behinderungen/chronischen Erkrankungen sehr schnell an die Grenze der Belastbarkeit kommen können, wenn ideelle und materielle Barrieren einer Realisierung der Teilhabe in diesem speziellen Bereich entgegenstehen.
Auf der Basis des Forschungsstandes leiten sich für die vorliegende Arbeit folgende Forschungsfragen ab, die sich auf Erfahrungen und Einstellungen zum Thema Mutterschaft und Behinderung/chronische Erkrankung von Medizinern, Mitarbeitern von Einrichtungen der Behindertenhilfe, behinderten/chronisch kranken Frauen ohne Kinder und ganz wesentlich von behinderten und chronisch kranken Müttern beruhen. Im Fokus stehen die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft und die medizinische Versorgung der Frauen während Schwangerschaft und Geburt. Die Gestaltung der Mutterrolle, vorhandene Unterstützungsangebote sowie die Alltagsbewältigung ist ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung, ebenso Handlungsempfehlungen für eine Optimierung der Versorgungsstrukturen. Die zentralen Fragestellungen lauten:
-
Wie hoch ist der Anteil behinderter Mütter an allen Müttern bzw. an allen behinderten Frauen der jeweiligen Altersgruppen in Sachsen insgesamt und wie wirkt sich die Art und Schwere der Beeinträchtigung und der Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung/chronischen Erkrankung auf die Entscheidung für ein Kind aus?
-
Welche Kontextfaktoren wirken sich auf die Entscheidung behinderter Frauen für ein Kind und auf die Bewältigung des Alltags mit Kind bzw. Kindern in besonderer Weise fördernd oder hemmend aus?
Die Kontextfaktoren beinhalten im Wesentlichen die materielle Situation der Frau bzw. der Familie, das Vorhandensein eines Partners, die Existenz tragfähiger sozialer Netze und die rechtzeitige Vorbereitung auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität.
-
Welche fördernden und hemmenden Faktoren lassen sich definieren, die den Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Leben mit einem Kind wesentlich beeinflussen?
Von Interesse sind dafür die Arzt-Patientinnen-Beziehung zu den behandelnden Gynäkologen, behinderungsspezifischen Fachärzten, Hebammen und Pädiatern, der Kontakt zu anderen behinderten/chronisch kranken Müttern, die ihre Erfahrungen mit ihrer Mutterschaft kommunizieren sowie alle Maßnahmen und Regelungen, die die Kompetenz der behinderten Mütter/Eltern und ihre Selbstbestimmung fördern und Ausgrenzung vermeiden.
-
Welche Defizite werden in der Betreuung behinderter Schwangerer und Mütter sichtbar, die es den Frauen erschweren, das Zusammenleben mit einem Kind/mit Kindern zu bewältigen und bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen zu können?
Die Defizite beziehen sich auf stigmatisierendes und diskriminierendes Verhalten gegenüber der Mutterschaft behinderter Frauen, was die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten hemmt oder einschränkt oder wenn bauliche, materielle oder ideelle Barrieren den Zugang zu einer qualifizierten Unterstützung erschweren und Frauen ihre Rechte und Möglichkeiten zur Unterstützung nicht kennen. Inadäquate Reaktionen von medizinischem Personal und Mitarbeiter/-innen sozialer Dienste oder aus Ämtern können sich in Beratungs- oder Betreuungssituationen ebenfalls nachteilig auswirken.
Für die Befragung der professionellen Partner behinderter Mütter/Eltern stellt sich in erster Linie die Frage nach Erfahrungen in der Betreuung und Begleitung der Mütter, die Vorbereitung auf diese Praxissituation in Studium, Fort- und Weiterbildung, Bewertung der Barrierefreiheit der eigenen Einrichtung sowie Erwartungen an die Gestaltung der Betreuungssituation (z.B. gewünschter Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zwischen Geburtshelfer und Schwangeren u.a.). Darüber hinaus sollen Erwartungen und Meinungen zur Veränderung der aktuellen Situation erfasst werden.
Letztlich sollen sowohl die Analyseteile aus der Befragung der Mütter und ihrer Bezugspersonen, der professionellen Partner, der Expertengespräche und die Literatur- und Datenrecherche das wissenschaftliche Fundament für die Errichtung des Kompetenzzentrums behinderte Mütter bilden.
Die methodische Umsetzung des Projektes erfolgte in mehreren Stufen: Als erstes fand die Auswahl der vertiefenden Befragungen und Interviews mit betroffenen Frauen und medizinischem Personal durch sogenannte Screeningbefragungen statt. Des Weiteren wurden alle Einrichtungen der Behindertenhilfe mit einem elektronischen Fragebogen angeschrieben. Die Daten des Perinatalberichts folgten durch eine Sonderauswertung nach den Kriterien der Schwerbehinderung. Abschließend wurden alle Erfahrungen und Eindrücke von Fachtagungen, Workshops und Kongressen systematisch ausgewertet und mit Fallbeispielen untermauert.
Bei der Befragung der behinderten und chronisch kranken Mütter und Frauen ohne Kinder handelte es sich um eine retrospektive Querschnittserhebung mit zwei Erhebungswellen im Zeitraum August 2008 bis April 2009. Aus einer Grundgesamtheit von ca. 15.000 in Sachsen gemeldeten Frauen der Altersgruppe 25 bis 45 Jahre mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 wurde eine Zufallsstichprobe von 10% gezogen, von denen sich 33% (N=525) an der Befragung beteiligten. Bei der ausgewählten Altersgruppe handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um die Frauen, die sich bereits in der reproduktiven Phase befinden bzw. die sich noch mit dem Thema Kinderwunsch auseinandersetzen.
Aus dem Rücklauf wurden einerseits all die Frauen ausgewählt, die sich für eine vertiefende Befragung bereit erklärten und die eigene Kinder unter 16 Jahren hatten. Somit konnten 125 Frauen auswählen, ob sie die Befragung per postalischem Fragebogen, per telefonischem oder persönlichem Interview durchführen wollten. Der Großteil entschied sich für die schriftliche Variante und der Rücklauf lag inklusive einer schriftlichen Erinnerung bei 78% (N=98).
Andererseits fand eine weitere Befragung all derjenigen Frauen statt, die zwar keine Kinder hatten und trotzdem ihre Bereitschaft am Projekt signalisiert hatte. Somit hatten 65 Frauen die Wahl zwischen schriftlichem Fragebogen oder telefonischem oder persönlichem Interview, wobei sich wiederum der Großteil für die Fragebogenvariante entschied. Der Rücklauf betrug inklusive einer Erinnerung 69% (N=45).
Die erste Befragung, die sogenannten Screeningbefragung, umfasste einen einseitigen Bogen mit allgemeinen Angaben zur Behinderung bzw. chronischen Erkrankung, Anzahl und Alter der Kinder sowie zur Bereitschaft einer weiteren Teilnahme (siehe Anlage). Die zweite Erhebung wurde per Fragebogen und selbst generierter Items realisiert, der neben soziodemografischen Angaben und Informationen zur Behinderung/Erkrankung vor allem Fragen zur eigenen Erziehung und Verhütungsbiographie und zum Kinderwunsch beinhaltete (siehe Anlage). Zum Schwangerschaftserleben während der Schwangerschaft mit dem ersten Kind, Geburtsvorbereitung und -erleben, Unterstützungsangeboten nach der Geburt und während des Kleinkindalters sowie Erfahrungen in der schulischen und vorschulischen Betreuung, mit Ämtern und Behörden und dem Austausch mit anderen Eltern sowie Erfahrungen mit Ausgrenzung und Benachteiligung wurden nur die Mütter befragt. Die Frauen ohne Kinder konnten sich hingegen mit dem Thema Kinderwunsch stärker auseinandersetzen, was auch die Kommunikationspartner und die Inanspruchnahme fertilitätsmedizinischer Maßnahmen integrierte (siehe Anlage). Die Fragestellungen waren etwa zu gleichen Teilen offen und geschlossen gehalten.
Für die Überprüfung der Hypothesen wurden die Daten sowohl nach dem Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung/Erkrankung als auch nach den Behinderungs-/Erkrankungsgruppen und dem Grad der Behinderung inferenzstatistisch miteinander verglichen. Ergänzt wurde die Auswertung z.T. durch eine qualitative Inhaltsanalyse mit Hilfe von Kategorien und Deutungen. Alle Analysen wurden mit dem Statistikprogramm SPSS 15.0 für Windows durchgeführt.
Da insgesamt weit über 50 verschiedene Behinderungs- und Erkrankungsdiagnosen festgestellt wurden, wurden diese wie folgt zu Behinderungsgruppen zusammengefasst:
-
Sinnesbehinderung: Hör- und Sehschädigung
-
Neurologische Erkrankung: Epilepsie, Multiple Sklerose
-
Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankung: Organschädigungen (Herz-Kreislauf- Erkrankung, Gastro-Intestinal-Erkrankung, Hauterkrankung, Transplantationen, Erkrankung der Atemwege), Stoffwechsel-/Autoimmunerkrankungen (Diabetes, Morbus Crohn), Tumorerkrankung
-
Körperbehinderung: Funktionseinschränkung einzelner Gliedmaßen (degenerative Gelenkerkrankung), Einschränkung der gesamten Bewegungsabläufe
-
Geistige Behinderung
-
Psychische Erkrankung
-
Mehrfachbehinderung (bei zwei oder mehr gleichwertig schweren Behinderungen/Erkrankungen)
Zur Bestimmung möglicher Einflussfaktoren auf den Kinderwunsch sowie auf die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung wurden binär logistische Regressionsanalysen durchgeführt, bei der die Zugehörigkeit zu einer von zwei Gruppen geschätzt wird. Die Auswahl der unabhängigen Variablen (Prädiktoren) erfolgte anhand statistischer (Zusammenhang der unabhängigen Variablen mit der abhängigen Variablen) und theoriegeleiteter Kriterien. Dies wird in den jeweiligen Kapiteln im Ergebnisteil näher erläutert.
Die Befragung der Mediziner folgte einem ähnlichen Muster. Aus einer Grundgesamtheit von 500 niedergelassenen Fachärzten der Gynäkologie und Geburtshilfe und 353 Pädiatern wurde eine Stichprobe von 20% gezogen. Insgesamt 190 Ärzte wurden zwischen Juni und Juli 2009 per Post angeschrieben, der Rücklauf betrug 33% (N=62). Die Bereitschaft zu einer vertiefenden Befragung zeigten jedoch nur 11 Ärzte, von denen 9 zwischen November 2009 und Januar 2010 tatsächlich telefonisch interviewt wurden. Der Screeningbogen enthielt Angaben zur Anzahl an schwerbehinderten Patienten, deren Patientencharakteristik und zu
Informationsquellen über Schwangerschaft und Behinderung/chronische Erkrankung (siehe Anlage). Der teilstrukturierte Interviewleitfaden legte das Augenmerk auf die Behandlungsspezifik behinderter/chronisch kranker Patienten und deren Betreuungs- und Beratungsschwerpunkte wie z.B. Kinderwunsch und Familienplanung, die Netzwerkarbeit unter den Fachärzten und Weiterbildungsempfehlungen (siehe Anlage). Die Interviews wurden anschließend transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet, die Screeningbefragung per Statistikprogramm SPSS analysiert.
In die Befragung der Einrichtungen wurden all diejenigen integriert, die über einen Zugang zum Internet verfügten und damit per E-mail erreichbar waren. Aufgrund der mittlerweile hohen Internetpräsenz öffentlicher Einrichtungen ist davon auszugehen, dass nahezu alle in Frage kommenden Institutionen auch tatsächlich erreicht wurden. Die Erhebung fand von Februar bis März 2010 statt. Eingeschlossen waren 120 Einrichtungen der Behindertenhilfe wie Werkstätten für behinderte Menschen, Wohnheime und ambulante Tagesbetreuung sowie 78 Schulen mit förderpädagogischem Schwerpunkt. Der Rücklauf fiel mit 17,7% (N=35) deutlich geringer aus als bei den vorangegangenen Erhebungen. Im Fragebogen waren Angaben zu sexualpädagogischen Angeboten, Materialien, Praxiserfahrungen sowie Anregungen für Weiterentwicklungen enthalten (siehe Anlage). Es handelte sich dabei vorrangig um geschlossene Fragen. Die Auswertung erfolgte per Statistikprogramm SPSS, statistische Analysen wurden aufgrund der geringen Stichprobe nicht durchgeführt. Die Antworten der offenen Fragen dienten zum größten Teil als Praxisbeispiele.
Die Perinatalauswertung erfolgte im Mai 2010 auf Basis der Sächsischen Perinatalberichterstattung Dresden, die uns freundlicherweise die Daten zur Verfügung stellten.
Inhaltsverzeichnis
Der Zugang zur Gruppe behinderter und chronisch kranker Mütter erfolgte auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe von zehn Prozent aller Frauen ab GdB 50 in der Altersgruppe 25 bis 45 Jahre. Der Rücklauf der Fragebogen betrug 33%. Damit beantworteten insgesamt 525 Frauen den Screeningbogen. Im Vergleich zu den Angaben der Schwerbehindertenstatistik in Sachsen nach Art der Behinderung innerhalb der gleichen Altersgruppe beteiligten sich deutlich mehr Frauen mit Körperbehinderungen, Stoffwechsel-/Organ- und Tumorerkrankungen sowie neurologischen Erkrankungen an der Studie, Frauen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen deutlich seltener (Tabelle 4).
| Anteil der schwerbehinderten 25 bis 44jährigen Frauen 2007 in Sachsen (N = 14.639) | Anteil der schwerbehinderten 25 bis 44jährigen Frauen der Screeningbefragung (N = 525) | |
|---|---|---|
| Körperbehinderung |
11,5 |
20,4 |
| Sinnesbehinderung |
10,1 |
10,7 |
| Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankung |
20,6 |
30,5 |
| Neurologische Erkrankung |
8,3 |
13,2 |
| Geistige Behinderung |
23,5 |
17,5 |
| Psychische Erkrankung |
12,2 |
7,8 |
| sonstige, nicht genauer bezeichnete Behinderung/Erkrankung |
13,8 |
- |
(Quelle: Landesamt für Statistik Sachsen Stand 2009, eigene Erhebung)
Aus den Ergebnissen der Screeningbefragung lässt sich ableiten, dass über die Hälfte (56,4%) der befragten Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren und mit einem Grad der Behinderung von 50 und höher eigene Kinder haben. Damit liegt die Mütterquote bei behinderten/chronisch kranken Frauen in unserer Stichprobe unter der Mütterquote aller Frauen in der Altersgruppe 25 bis 45 Jahre in Sachsen, die 69,9% beträgt (Statistischen Bundesamt 2009). Bezogen auf alle Frauen lag in Ostdeutschland 2006 der Anteil der Mütter bei 25- bis 34-jährigen Frauen bei 49%, in der Altersgruppe 35 bis 45 Jahre sogar bei 89% (Statistisches Bundesamt 2007).
Im Vergleich mit allen Frauen zwischen 25 und 45 Jahren zeigt sich damit, dass behinderte und chronisch kranke Frauen seltener Kinder haben als altersgleiche nicht behinderte. Betrachtet man die Ergebnisse im Vergleich mit einer von uns im Jahr 2001 veröffentlichten,´ebenfalls repräsentativ angelegten Arbeit (Michel et al. 2001), so stieg der Anteil der Mütter unter den behinderten/chronisch kranken Frauen jedoch an, insbesondere in der jüngeren Altersgruppe (Tabelle 5).
| 1999 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 - 34 Jahre | 35 - 45 Jahre | 25 - 34 Jahre | 35 - 45 Jahre | |
| Frauen mit Behinderungen |
5 363 |
10 360 |
5 178 |
10 649 |
| Studienteilnehmerinnen |
62 |
47 |
169 |
351 |
| Anteil Mütter in der Studie |
21% |
66% |
33% |
68% |
(Quelle: Michel et al. 2001; eigene Erhebung)
Rechnet man die Zahlen behinderter und chronisch kranker Mütter aus der Studie hoch, so ist davon auszugehen, dass in Sachsen aktuell ca. 9.000 behinderte oder chronisch kranke Mütter im Alter von 25 bis 45 Jahren mit einem GdB ab 50 leben. Die aktuelle Zahl schwerbehinderter Frauen der genannten Altersgruppe beträgt 14.639 per 31.12.2007 (Landesamt für Statistik Sachsen 2009), geht also insgesamt zurück infolge der demografischen Entwicklung.
Die Anzahl der Kinder variiert zwischen allen Müttern in Sachsen und den Müttern unserer Studie kaum. Ein Kind haben ca. 47% der Befragten, zwei Kinder reichlich 40%. In der Allgemeinbevölkerung gibt es etwas mehr Familien mit drei und mehr Kindern (12,2%) als bei den behinderten/chronisch kranken Frauen (8,8%).
Bezogen auf die Verteilung der Art der Beeinträchtigung der Mütter, ist der Anteil der Mütter unter den stoffwechsel- bzw. organ- oder tumorerkrankten Frauen mit reichlich drei Viertel am höchsten und mit knapp 15% unter den geistig behinderten Frauen am niedrigsten (Abbildung 1).
Abbildung 1. Abbildung 1: Anteil der Mütter innerhalb der Behinderungs-/Erkrankungsgruppe und nach Grad der Behinderung (N=525, in %)
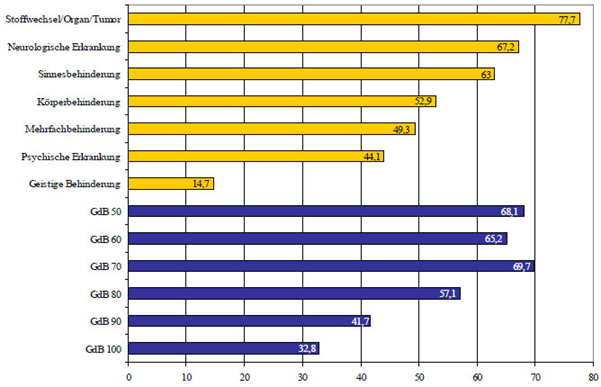
Ob eine Frau Mutter wird oder nicht, variiert nicht nur nach der Art der Beeinträchtigung, sondern auch nach dem Grad der Behinderung (GdB). So haben nicht nur Frauen mit einer geistigen Behinderung am seltensten Kinder, sondern auch nur ca. ein Drittel der Frauen mit einem GdB von 100 im Vergleich zu reichlich zwei Drittel der Frauen mit einem GdB von 50.
Die Wahrscheinlichkeit, als stoffwechsel-, organ- oder tumorerkrankte Frau Kinder zu bekommen, ist im Vergleich zu Frauen mit geistiger Behinderung knapp 14-fach höher. Ebenfalls höhere Wahrscheinlichkeiten haben Frauen mit Sinnesbehinderungen (9,5-fach), mit neurologischen Erkrankungen (7,4-fach), mit Körperbehinderungen (5-fach) sowie mehrfachbehinderte Frauen (4,6-fach) im Vergleich zu Frauen mit geistiger Behinderung. Ein weiterer Faktor mit Vorhersagekraft ist der Grad der Behinderung. Fällt er geringer aus, d.h. zwischen GdB 50 und GdB 70, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Mutterschaft 2,1- bis 3,8- fach höher als bei einer Frau mit einem Grad der Behinderung von 100 (Tabelle 6).
| Regressions -Koeffizient B | p-Wert | Sign. | Odds Ratio (OR) | 95% Konfidenzintervall (für OR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz: Geistige Behinderung | ||||||
| Stoffwechsel/Organ/ Tumorerkrankung |
2,613 |
,000 |
*** |
13,644 |
6,062 |
30,707 |
| Neurologische Erkrankung |
2,001 |
,000 |
*** |
7,400 |
3,006 |
18,216 |
| Sinnesbehinderung |
2,256 |
,000 |
*** |
9,543 |
3,775 |
24,122 |
| Körperbehinderung |
1,623 |
,000 |
*** |
5,066 |
2,233 |
11,492 |
| Mehrfachbehinderung |
1,534 |
,000 |
*** |
4,636 |
1,992 |
10,786 |
| Referenz: GdB 100 | ||||||
| GdB 50 |
1,172 |
,000 |
*** |
3,229 |
1,903 |
5,480 |
| GdB 60 |
0,788 |
,025 |
* |
2,198 |
1,105 |
4,374 |
| GdB 70 |
1,349 |
,004 |
** |
3,853 |
1,557 |
9,533 |
Binär logistische Regressionsanalyse; R = Referenzkategorie; Nagelkerkes R-Quadrat = .254 * p < .05; ** p < .01, *** p < .000
Dass mehr als die Hälfte der Frauen der Stichprobe Kinder haben und im Vergleich zu allen Frauen der gleichen Altersgruppe in Sachsen der Unterschied geringer ausfällt als erwartet, verweist darauf, dass Elternschaft (zunehmend) im Lebenskonzept von behinderten und chronisch kranken Müttern einen integrativen Bestandteil bildet. Eine Einschränkung muss jedoch gemacht werden: Es handelt sich dabei überwiegend um Frauen, die weitestgehend selbstbestimmt leben, außerhalb von Einrichtungen und gesellschaftlich integriert. Sie leiden seltener unter einer schweren Form der Erkrankung bzw. Behinderung oder einer Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten, denn besonders letzteres trägt unter allen Behinderungs- und Erkrankungsarten das höchste Risiko für eine Frau, kinderlos zu bleiben. Es ist somit ein Zusammenhang zu erwarten zwischen der Schwere der Behinderung bzw. Erkrankung und dem gesundheitlichen Risiko während der Schwangerschaft für die werdende Mutter. Bei geistig behinderten Frauen steht weniger die gesundheitliche Einschränkung im Vordergrund bei der Realisierung des Kinderwunsches, sondern eher die Reaktion des sozialen Umfeldes, das einer Mutterschaft eher ablehnend gegenübersteht wegen der angenommenen mangelnden Erziehungskompetenzen und dem hohen Unterstützungs- und Betreuungsbedarf, zusätzlich zu dem bereits bestehenden für die geistig behinderte Frau. Inwieweit sie trotzdem ihr Recht auf Mutterschaft geltend machen kann, wird seit Jahren kontrovers diskutiert und kann an dieser Stelle auch nicht befriedigend erörtert werden.
Auf der Basis der Screeningbefragung erfolgten vertiefende Interviews mit allen Frauen, die dazu ihre Bereitschaft erklärt hatten. Im Vergleich zur Screeningbefragung beteiligten sich mehr Frauen mit Sinnesbehinderungen an der vertiefenden Studie und deutlich weniger Frauen mit geistigen Behinderungen (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 7).
| Behinderungs-/ Erkrankungsgruppen | |
|---|---|
| Sinnesbehindung | 14,3% |
| Neurologische Erkrankung | 10,2% |
| Mehrfachbehinderung | 12,2% |
| Körperbehinderung | 21,4% |
| Geistige Behinderung | 4,1% |
| Psychische Erkrankung | 7,1% |
| Stoffwechsel/Organe/Tumor | 30,6% |
| Grad der Behinderung | |
| 50 - 60 | 54,1% |
| 70 - 80 | 25,5% |
| 90 - 100 | 20,4% |
| Merkzeichen | |
| G | 32,7% |
| aG | 9,2% |
| Bl | 3,1% |
| B | 13,3% |
| H | 11,2% |
| Gl | 2,0% |
| RF | 16,3% |
Das Durchschnittsalter der befragten Frauen liegt bei 37,5 Jahren, d.h. für einen Großteil der Frauen ist die Familienplanungsphase bereits abgeschlossen oder neigt sich dem Ende zu. Den größten Anteil bilden die 36 bis 40jährigen Frauen mit 35%, den geringsten die Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren mit 12%. Dieses Ergebnis begründet sich auch daraus, dass in den jüngeren Altersgruppen deutlich weniger Frauen behindert sind als bei den über 35- Jährigen. Die Teilstichprobe der jüngsten Frauen setzt sich vorwiegend aus geistig behinderten Müttern zusammen, die der ältesten aus sinnesbehinderten und stoffwechsel- /organ- oder tumorerkrankten Müttern.
Über drei Viertel der befragten Mütter (n=76) aus der Untersuchungsgruppe leben in einer Partnerschaft, davon sind knapp zwei Drittel verheiratet (Tabelle 8). Mehr als die Hälfte der Frauen verfügt über einen Realschulabschluss, demzufolge überwiegt die Berufsausbildung als häufigster höchster beruflicher Abschluss. Auffallend hoch ist der Anteil an Frauen mit einer Fachhochschul- oder Hochschulreife bzw. 18,3% der Mütter, die über einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss verfügen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Bildungsgrad einen wesentlichen Einfluss auf die Beteiligung an einer Befragung zu einem sehr persönlichen Thema ausübt. Andererseits verfügen gut ausgebildete behinderte Frauen auch über größere Ressourcen für eine selbstbestimmte Lebensführung, die Einfluss nimmt auf die Realisierung des Kinderwunsches.
Knapp ein Drittel der Frauen sind teilzeitbeschäftigt und fast ebenso viele beziehen Erwerbsunfähigkeitsrente. Der Anteil an Erwerbslosen liegt unter dem sächsischen Durchschnitt von 12,6% (Agentur für Arbeit 2009), die Beschäftigungsquote ebenfalls leicht unter dem Durchschnitt der sozialversicherungspflichtigen Frauen in Sachsen von 52% (Landesamt für Statistik Sachsen 2009).
| Familienstand | |
|---|---|
| ledig | 22,4% |
| verheiratet | 63,3% |
| geschieden/getrennt lebend | 13,3% |
| verwitwet | 1,0% |
| höchster Schulabschluss | |
| Hauptschule | 6,1% |
| Realschule | 58,2% |
| (Fach-) Hochschule | 30,6% |
| sonstiger/kein Abschluss | 5,1% |
| aktuelle hauptsächliche Beschäftigungssituation | |
| Vollzeit | 15,3% |
| Teilzeit | 29,6% |
| Erwerbslosigkeit | 11,2% |
| Erwerbsunfähigkeitsrente | 27,6% |
| Elternzeit | 7,1% |
| sonstige | 9,2% |
Nur vier Mütter lebten in betreuten Wohnformen, drei davon mit ihren Kindern. Ein Teil der Mütter (n=10) lebt nicht gemeinsam mit ihren Kindern in einem Haushalt bzw. nur mit einem Teil der Kinder. Stattdessen befinden sich fünf Kinder in Pflegefamilien, drei beim Kindsvater, eines bei den Großeltern und eines lebt im Heim. Über die Gründe der Trennung von Mutter und Kind können keine Aussagen getroffen werden, es handelt sich jedoch z.B. um drei geistig behinderte Frauen, deren Kinder in Pflegefamilien leben.
In der Untersuchungsgruppe sind es zwei Drittel der Frauen (66,3%), die bereits vor der Geburt ihres 1. Kindes behindert/erkrankt waren. Damit zeigt sich, dass sich mehr Mütter für eine Teilnahme an der Befragung entschieden, die sich von Anfang an mit dem Thema Behinderung/Erkrankung und Mutterschaft auseinandersetzen mussten als Frauen, die erst als Mütter erkrankten bzw. behindert wurden. Die Anteile innerhalb der einzelnen Behinderungs- /Erkrankungsgruppen variieren zwischen 30 und 100% (p = .000) (Abbildung 2).
Abbildung 2. Abbildung 2: Frauen, die bereits zur Geburt ihres 1. Kindes behindert/erkrankt waren (in %)
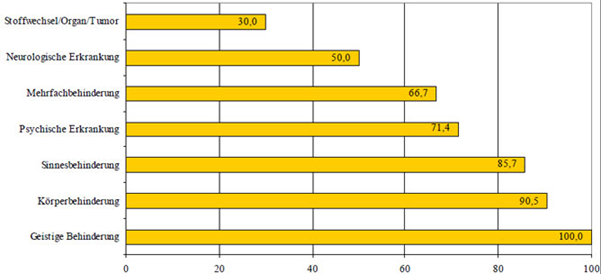
Das Durchschnittsalter, in dem die Behinderung/chronische Erkrankung eintrat, liegt bei 18,4 Jahren. Erkrankt bzw. behindert waren 26,5% der Frauen von Geburt an, 50% vor dem 18. Lebensjahr und ein Viertel der Frauen nach dem 30. Lebensjahr.
Ursachen der Behinderungen bildeten zu 26,5% angeborene bzw. perinatale Schädigungen, zu 52% Erkrankungen im weiteren Lebensverlauf und zu 7,2% Unfälle. 14,3% der Frauen wussten keine Erklärung für die Ursache.
Die Altersspanne, in der die befragten Mütter ihr 1. Kind bekamen, liegt zwischen 18 und 40 Jahren, durchschnittlich jedoch bei 26 Jahren. Über die Hälfte der 1. Kinder wurden nach 1998 geboren, als das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ihres 1. Kindes in Ostdeutschland bei 28 Jahren lag. Das entsprach auch dem Durchschnittsalter der Erstgebärenden in der Untersuchungsgruppe in diesem Zeitraum.
Das Alter der erstgeborenen Kinder reicht von 0 bis 24 Jahren[2]. Insgesamt 24,5% der befragten Mütter haben Kinder unter 6 Jahren, innerhalb der Behinderungs- /Erkrankungsgruppen variieren die Zahlen zwischen 25 und 33%. Nur stoffwechsel-/organ oder tumorerkrankte Frauen haben mit 13,3% am seltensten Kinder im Vorschulalter.
Behinderte Frauen werden oft mit dem Vorurteil konfrontiert, dass sie, wenn überhaupt dann einen ebenfalls behinderten Partner finden. Dieses Vorurteil trifft weniger auf chronisch kranke Frauen zu. In unserer Untersuchung findet sich dies so nicht bestätigt. Insgesamt zwölf Frauen leben mit einem ebenfalls behinderten/chronisch kranken Partner zusammen, fünf mit einem Partner mit der gleichen Behinderung. Dabei handelt es sich um zwei hörbehinderte, eine sehbehinderte und zwei geistig behinderte Frauen. Das heißt, 88% der Mütter leben mit einem nichtbehinderten/gesunden Partner zusammen.
Es gibt keine Vergleichszahlen, wie hoch der Anteil der Frauen in der Allgemeinbevölkerung ist, die mit einem behinderten/chronisch kranken Partner zusammenleben, er wird sich voraussichtlich nicht sehr stark von dem Anteil in unserer Untersuchungsgruppe unterscheiden. Die erschwerte Partnerwahl konnte anhand unserer Ergebnisse nicht bestätigt werden, wobei untersucht werden müsste, ob es sich beim aktuellen Partner um den Vater des Kindes/der Kinder handelt. In älteren Studien fanden sich Hinweise, dass dies oft nicht der Fall ist (Michel et al. 2001).
Von 98 Müttern geben elf Frauen an, ein ebenfalls behindertes/chronisch krankes Kind zu haben. Bei den Müttern, deren Kinder an der gleichen Beeinträchtigung leiden wie sie selbst, handelt es sich um eine sehbehinderte, eine körperbehinderte, eine psychisch kranke und eine tumorerkrankte Frau. Jedoch ist lediglich bei der seh- und der körperbehinderten Mutter davon auszugehen, dass ein gewisses Vererbungsrisiko vorliegt. Damit deckt sich der geringe Anteil an vererbten Behinderungen mit den Angaben der Perinatalstatistik (vgl. Kap. 4.4.1). An dieser Stelle lässt sich leider nicht klären, ob es sich um einen Zufallsbefund handelt, indem z.B. diejenigen Mütter, die ihre Krankheit ihren Kindern vererbten, seltener an der Studie teilnahmen. Es macht aber deutlich, dass das Vererbungsrisiko von Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sehr gering ist. Es gibt lediglich einen Fall in der Erhebung, bei dem die ganze Familie (Mutter-Vater-Kind) unter einer Sehbehinderung leidet, wobei die Ursachen für die Sehbehinderung variieren. Die anderen 22 Befragten leben entweder mit einem behinderten/chronisch kranken Kind oder einem Partner mit einer Beeinträchtigung.
In der Literatur gibt es Hinweise, dass Eltern behinderter Kinder der Vorbereitung ihrer Kinder auf Familie und Partnerschaft weniger Bedeutung beimessen (Arnade 2009, Michel et al. 2003, Michel& Rothemund 2006). Untersucht werden sollte deshalb, ob sich Unterschiede im elterlichen Erziehungsverhalten bei behinderten/chronisch kranken und nichtbehinderten/gesunden Kindern finden lassen. Die Frage, was den Eltern bei der Erziehung besonders wichtig war, basiert auf den beiden Skalen Selbstständigkeit (α = .49) und Offenheit (α = .83).
Anhand einer vierstufigen Antwortskala konnten die Frauen angeben, inwieweit die Aussagen auf ihre eigene Erziehung zutrafen. Dabei zeigte sich, dass über 90% der Frauen die eigene Erziehung zur Selbstständigkeit hoch einschätzten, aber nur 61,8% der frühzeitig behinderten/erkrankten Frauen eine hohe Offenheit im Elternhaus berichteten im Vergleich zu spät behinderten/erkrankten Frauen mit 79,1%. Während es in der Wichtigkeit eines selbstständigen Lebensführung keinen Unterschied macht, ob eine Behinderung/Erkrankung vorliegt, wurden Frauen, die von Geburt oder von Kindheit an behindert/chronisch krank waren, weniger partizipativ und tolerant behandelt. Dies zeigt sich besonders in der Frage nach der sexuellen Aufklärung. Zwar liegt das Alter, in dem die Frauen nach eigenen Angaben aufgeklärt wurden, in beiden Gruppen bei ca. 13 Jahren, doch über die Hälfte der in der Kindheit behinderten/erkrankten Frauen gaben an, sich sexuell (eher) nicht aufgeklärt gefühlt zu haben. Im Vergleich dazu waren es nur 28% der in der Kindheit nichtbehinderten/ gesunden Frauen. Damit erklärt sich auch, dass nur wenige der frühbehinderten/ -erkrankten Frauen ihre Eltern als Aufklärungspersonen und stattdessen anonyme bzw. neutrale Bezugsquellen angeben (Tabelle 9).
| Informationen über Sexualität und Partnerschaft hauptsächlich durch: | Behinderung/ Erkrankung während der Kindheit | keine Behinderung/ Erkrankung während der Kindheit |
|---|---|---|
| Eltern |
14,7 |
43,8 |
| Geschwister/Verwandte |
8,8 |
4,7 |
| Freunde/peers |
35,3 |
34,4 |
| schulische Veranstaltungen |
35,3 |
25,0 |
| Zeitschriften/Bücher |
44,1 |
23,4 |
| Rundfunk/Fernsehen |
14,7 |
1,6 |
| Gynäkologen |
2,9 |
7,9 |
Aus ihrem Elternhaus berichten alle befragten Frauen, dass die Erziehung zur Selbständigkeit einen hohen Wert hatte, unabhängig ob in der Kindheit eine Behinderung oder chronische Erkrankung vorlag. Sexualaufklärung innerhalb der Familie erfahren die bereits in der Kindheit erkrankten/behinderten Frauen weit seltener und wählen daher als Informationsquellen auch eher anonymisierte Formen wie Bücher und Zeitschriften. Diese Ergebnisse finden sich auch in einer Studie zur Lebenssituation von behinderten Kindern und Jugendlichen in Sachsen (Michel et al. 2003) bestätigt, die eine Diskrepanz zwischen kindlichen und elterlichen Erwartungshaltungen in Bezug auf die Lebensgestaltung aufdeckt. Sind Partnerschaft (81%) und eigene Kinder (51%) fester Bestandteil der Zukunftserwartungen der befragten Kinder, schätzen dies nur 40% (Partnerschaft) bzw. 20% (eigene Kinder) der Eltern optimistisch ein (ebd.: 168ff). Die Frauen der Untersuchungsgruppe, die bereits während ihrer Kindheit erkrankten, könnten es ähnlich erlebt haben. Wenn die Sexualaufklärung bereits behinderter/kranker Mädchen im Elternhaus stattfand, erfolgte dies möglicherweise mit dem Ziel einer generellen Verhütung der eigenen Familiengründung. Darauf verweisen die Ergebnisse der Befragung der kinderlos gebliebenen Frauen in unserer Studie (Kapitel 4.3)
Um den Anteil an Frauen mit vorzeitig beendeten Schwangerschaften zu erheben, wurde in unserer Studie sowohl nach Schwangerschaftsabbrüchen als auch nach Fehlgeburten gefragt. Insgesamt berichteten 41 Frauen über vorzeitig beendete Schwangerschaften. Dabei ist es unerheblich, wann die Behinderung/chronische Erkrankung im Laufe des Lebens eintrat.
Von Fehlgeburtserfahrung berichteten insgesamt 19 Frauen, wovon sechs Aborte nach der 12. Schwangerschaftswoche geschahen. Sieben der Frauen erlebten mehrere Aborte, und zwei Frauen berichteten von jeweils einer Totgeburt.
Der Anteil der Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen liegt bei 24,5% und damit leicht über dem Ergebnis der Studie „frauen leben“ (Helfferich 2002: 283), die von einer Abbruchsrate von 22% unter den „jemals Schwangeren“[3] sprechen. Allerdings wird in der Studie „frauen leben“ nicht nach der Art des Schwangerschaftsabbruchs unterschieden, so dass hier keine Vergleichswerte vorliegen. Jedoch erscheint der Anteil an Frauen in unserer Untersuchung, die einen Abbruch nach der 12. Schwangerschaftswoche vornehmen ließen, mit 7% recht hoch. Als Gründe gaben vier der Frauen eine genetische Schädigung des Kindes, die eigene Erkrankung als Risikofaktor und eine Vergewaltigung an. Eine Befragte antwortete: „Wegen Jugendamt und normalen Arzt musste ich es abtreiben! “ (507 Neurologische Erkrankung) Insgesamt fünf Frauen berichteten mehrere Schwangerschaftsabbrüche.
Die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch vor der 12. Schwangerschaftswoche lassen sich in fünf Kategorien einteilen, die nach Häufigkeit der Nennungen geordnet sind:
-
ungünstige partnerschaftliche Situation, z.B. Trennung vom Partner (n=6)
-
gesundheitliche Bedenken, z.B. unmittelbar nach einer vorangegangenen Schwangerschaft (n=6)
-
ungünstige berufliche Situation, z.B. noch in Ausbildung (n=4)
-
zu jung (n=2)
-
Missbrauch (n=1)
Die Hauptursachen liegen damit seltener als vermutet bei externen Faktoren wie z.B. einer Druckausübung durch Eltern, Ärzte oder andere nahestehende Personen, sondern ähnlich wie bei Frauen ohne Behinderungen/Erkrankungen bei partnerschaftlichen, gesundheitlichen und beruflichen Aspekten (vgl. Helfferich 2002). Lediglich die medizinischen Risiken könnten bei Frauen mit Behinderungen/chronischen Erkrankungen häufiger zum Abbruch führen als in der Allgemeinbevölkerung.
Die Reaktionen auf eine Schwangerschaft können von verschiedenen Personen sehr unterschiedlich ausfallen. Sie reichen von Freude, Bewunderung und dem Angebot für Unterstützung bis zu Ängsten bezüglich der Verschlechterung des Gesundheitszustandes, Gefühlen von Überforderung und sogar zur Empfehlung eines Schwangerschaftsabbruchs. Dafür wurden folgende Skalen gebildet: „positive Reaktion Partner“ (α = .73), „positive Reaktion Familie/Freunde“ (α = .45), „negative Reaktion Partner“ (α = .29) und „negative Reaktion Familie/Freunde“ (α = .37). Ebenso wurde eine Skala „positive Reaktion Gynäkologe“ (α = .73) gebildet, die sich aus den Items Freude, Informationsvielfalt und Kommunikation über Kinderwunsch und Geburtsarten zusammensetzet sowie eine Skala „negative Reaktion Gynäkologe“ (α = .55) mit den Items: Bedenken bezüglich einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes, Gefühlen von Überforderung und Empfehlung zum Abbruch der Schwangerschaft.
Der weitaus größte Teil der Partner, der Familie und Freunde und auch der behandelnden Gynäkologen zeigte eine positive Reaktion auf das 1. Kind der Frauen der Untersuchungsgruppe (Abbildung 3). Wenn behinderte/chronisch kranke Frauen eine Ablehnung auf ihre Schwangerschaft(en) erhalten, dann noch am ehesten von den niedergelassenen Gynäkologen.
In Abbildung 3 konnte außerdem gezeigt werden, dass die Reaktionen des behandelnden Gynäkologen auf die Schwangerschaft einer behinderten/chronisch kranken Frau in den meisten Fällen positiv verläuft. Von allen befragten Frauen gaben auch nur drei die Erfahrung an, dass ihnen ihr Gynäkologe zu einem Abbruch der Schwangerschaft geraten hat. Bei der Frau mit einer Hüftluxation und bei der epilepsieerkrankten Frau standen mit hoher Wahrscheinlichkeit medizinische bzw. gesundheitliche Gründe im Fokus der Argumentation, bei der geistig behinderten Frau wohl eher betreuungsrechtliche. Das in der Literatur oft anzutreffende Vorurteil über das Abraten von Schwangerschaften von ärztlicher Seite scheint insgesamt noch am ehesten auf Frauen mit kognitiven Einschränkungen zuzutreffen und beweist die Aktualität der kontrovers geführten Debatte um das Recht einer jeden Frau auf eigene Kinder.
Auf die Frage, ob sich die Frauen weitere Kinder wünschen, antworteten 16,5% der Mütter mit einem oder zwei Kindern, sie hätten gern noch weitere Kinder, 17,6% waren sich noch unsicher. Im Vergleich dazu gab es nur eine der zwölf Frauen mit drei und mehr Kindern, die sich über ihren weiteren Kinderwunsch nicht sicher war, alle anderen verneinten ihn. Damit ist die Zahl der 25- bis 45jährigen Mütter, die sich (ein) weitere(s) Kind(er) wünschen, mit 14,4% insgesamt eher gering.
Das 1. bzw. 2. Kind wurde zu zwei Drittel (66,7/69,1%) bewusst geplant, unabhängig davon, ob die Frau bereits vor der Geburt ihres 1. Kindes behindert/chronisch krank war oder nicht. Das 3. Kind war dann nur noch zu 50% geplant und das 4. und 5. Kind gar nicht mehr. Nach den Gründen gefragt, weshalb sich die Frauen in ihrem Kinderwunsch bestärkt fühlten, antworteten über vier Fünftel, sie hätten sich schon immer ein Kind gewünscht. Untermauert wurde dieser Wunsch mit Aussagen wie: „Familie zu haben ist besonders wichtig für mich.“ „Es gehört zu einem erfüllten Leben.“ „Da ich Kinder liebe!“ Weitere 20% berichteten von positiven Erfahrungen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Drei Frauen nannten ihren Partner als Grund, und eine Frau bezog sich explizit auf den Verarbeitungsprozess eines vorangegangenen Schwangerschaftsabbruchs. Die Argumente für weitere Kinder reichen von Aussagen wie „Ich wollte schon immer mehrere Kinder“ (66,1%), verbunden mit der Vorstellung, dass ein Aufwachsen unter Geschwisterkindern besser sei als allein, über Erfahrungen mit dem 1. Kind (35,7%) und Erfahrungen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis (14,3%) bis hin zu einem neuen Partner (23,2%).
Die 1. Schwangerschaft wurde von über der Hälfte der Frauen recht früh bemerkt, das heißt bis zur 6. Schwangerschaftswoche. Während sich der Anteil der Frauen, die ihre Schwangerschaft erst nach der 12. Woche selbst bemerkt haben, mit ca. 9% eher gering hält, ist der Anteil der Frauen, die zwischen der 7. und 11. Schwangerschaftswoche diese realisierten, mit ca. einem Drittel recht hoch. Hierbei findet sich ein signifikanter Unterschied (p=.019) zwischen den Frauen, die zum Zeitpunkt der Schwangerschaft bereits behindert/chronisch krank waren und den nichtbehinderten/gesunden. Letztere stellten zu einem höheren Anteil (50%) ihre Schwangerschaft relativ spät fest im Vergleich zu den behinderten/chronisch kranken Frauen (23,3%). Frauen mit Behinderungen/chronischen Erkrankungen scheinen demzufolge mehr in ihrer Wahrnehmung auf körperliche Veränderungen bedacht zu sein und können damit eine Schwangerschaft frühzeitiger realisieren. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass besonders Frauen, die eine Dauermedikation erhalten bzw. einen hohen Unterstützungsbedarf aufweisen, die Schwangerschaft sorgfältig planen.
Bei knapp 40% der Befragten fand eine Kommunikation mit dem betreuenden Gynäkologen über einen Kinderwunsch bereits im Vorfeld der Schwangerschaft statt, unabhängig vom Bestehen einer Behinderung oder Erkrankung. Damit wird die Annahme widerlegt, dass Ärzte die Schwangerschaft einer behinderten oder chronisch kranken Frau per se ablehnen würden. Allerdings liegt aufgrund des erhöhten medizinischen Betreuungsbedarfs durch die Behinderung oder Erkrankung (außer bei geistiger Behinderung) die Vermutung nahe, dass diese Frauen während ihrer Schwangerschaft intensiver betreut werden. Die Frauen wurden daher gefragt, welche weitergehenden Untersuchungen ihnen ihr behandelnder Arzt empfohlen hat (Abbildung 4).
Die Ergebnisse zeigen eine intensivere Versorgung während der Schwangerschaft bei Frauen, die bereits behindert bzw. chronisch krank waren. Das trifft sowohl auf die Empfehlung einer Fruchtwasserpunktion als auch auf eine humangenetische Beratung, einen erweiterten Ultraschall (p=.018) sowie auf die Überweisung zu einem spezialisierten Facharzt zu.
Das Alter der Schwangeren scheint keinen Einfluss auf die Untersuchungen zu haben, da nur drei der befragten Frauen zum Zeitpunkt der Schwangerschaft älter als 35 Jahre alt waren und somit zu gering in der Anzahl, um statistisch relevante Unterschiede herauszufiltern. Ebenso wenig hat die Art und Schwere der Behinderung/chronischen Erkrankung einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Häufigkeit und den Inhalt einer ärztlichen Empfehlung. In Hinblick auf historische Veränderungen in der medizinischen Versorgung von Schwangeren erscheint es zudem dringend erforderlich, das Alter der Kinder zu untersuchen, da in den letzten fünf Jahren eine Entwicklung hin zu insgesamt ausgedehnten Vorsorgeuntersuchungen unter allen Schwangeren stattgefunden hat. Die Analysen zeigen jedoch keinen Unterschied zwischen den Frauen, die ihr 1. Kind vor 2003 geboren haben und denen mit Kindern im Alter von aktuell bis zu fünf Jahren. Letzteren wurden ähnlich oft oder selten weitergehende Untersuchungen angeraten wie den anderen Müttern auch.
Die Empfehlungen wurden von fast allen Frauen auch tatsächlich in Anspruch genommen, nur wenige lehnten die weitergehenden Untersuchungen ab. Am häufigsten nutzten die Frauen den erweiterten Ultraschall, der mittlerweile zum Standard der Schwangerschaftsvorsorge avanciert ist, sowie die Überweisung zu einem spezialisierten Facharzt bzw. zur humangenetischen Beratung. Eine Amniozentese hingegen ließen nur acht der 13 Frauen durchführen, denen diese empfohlen wurde. Die damit verbundenen potentiellen Risiken wie Infektionen oder Aborte hatten bei fünf Frauen offensichtlich einen größeren Einfluss auf ihre Entscheidung als die Angst vor einer Fehlbildung des Kindes. Mediziner behandeln diese Patientengruppe mit größerer Vorsicht. Unsicherheiten beim Umgang mit behinderten/chronisch kranken Schwangeren einerseits, die Annahme eines höheren kindlichen Risikos durch Vererbung oder Medikamenteneinfluss andererseits bedingen wahrscheinlich diese größere Vorsicht. In Bezug auf die Vererbbarkeit von Behinderungen und chronischen Erkrankungen darf nicht übersehen werden, dass tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil der Behinderungen/chronischen Erkrankungen genetisch bedingt ist. Möglicherweise begründet sich die größere Vorsicht der Gynäkologen aber auch in einem erhöhten Versorgungsbedarf, der von den Frauen selbst ausgeht und dem der niedergelassene Gynäkologe nachkommt. Frauen, die ihre Schwangerschaften planen und auch sehr bewusst wahrnehmen, wie es besonders auf die Frauen zutrifft, die bereits vor der Geburt ihres 1. Kindes behindert oder erkrankt waren, signalisieren mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein größeres Interesse an sämtlichen Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik bzw. der Abklärung von Chancen und Risiken, teilweise schon im Vorfeld der Entstehung einer Schwangerschaft. Hinweise dafür liefern die hohe Inanspruchnahme der empfohlenen Untersuchungen. Man kann daher nicht allein von einer Übervorsicht auf ärztlicher Seite sprechen, sondern von einer Bedarfs- und Angebotsregulation, d.h. von einem Einverständnis auf Arzt- und auf Patientinnenseite.
Knapp zwei Drittel der Frauen nahmen an einem Geburtsvorbereitungskurs teil. Wiederum zwei Drittel davon waren zum Zeitpunkt der Schwangerschaft bereits behindert/chronisch krank. Sowohl die Teilnahme an den dargebotenen Übungen als auch das Eingehen auf die persönlichen Bedürfnisse der Schwangeren wurde unabhängig von einer bestehenden Behinderung oder chronischen Erkrankung von den meisten Befragten bestätigt. Die Vorbereitung auf die Geburt in Form eines institutionalisierten Angebotes ist damit auch für behinderte und chronisch kranke Frauen ein wesentlicher und integrativer Bestandteil ihrer Schwangerschaft.
Unterschiede finden sich jedoch bei der Nichtteilnahme: Ob eine schwangere Frau an einem Geburtsvorbereitungskurs teilnimmt oder nicht, geschieht nahezu unabhängig von einer bestehenden Behinderung oder Erkrankung. Lediglich körperbehinderte Frauen nahmen häufiger nicht an einem Geburtsvorbereitungskurs teil, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits frühzeitig über die Entbindung per Sectio von ihren betreuenden Ärzten in Kenntnis gesetzt wurden. Ob eine Frau jedoch die Inanspruchnahme eines Geburtsvorbereitungskurses willentlich ablehnt, hängt (wenn auch nicht statistisch signifikant) mit einer Behinderung/Erkrankung zusammen. Wenn sich Frauen gegen die Teilnahme an einem Geburtsvorbereitungskurs entscheiden, dann geschieht dies bei behinderten/chronisch kranken Frauen häufiger absichtlich, während nichtbehinderte/gesunde Frauen häufiger keinen geeigneten Kurs finden, was sich jedoch mit unseren Daten nicht begründen lässt.
Ausnahmslos alle befragten Frauen haben in einer Geburtsklinik entbunden. Damit kann die Frage nach alternativen Geburtseinrichtungen klar verneint werden. Ob diesbezüglich medizinische oder ganz persönliche Präferenzen der Betroffenen vorliegen, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.
| Spontangeburt | Sectio | |
|---|---|---|
| zum Zeitpunkt der Entbindung nicht behindert/gesund | 25 | 9 |
| zum Zeitpunkt der Entbindung behindert/chronisch krank | 40 | 22 |
| davon: Sinnesbehinderung | 8 | 7 |
| Neurologische Erkrankung | 4 | 2 |
| Körperbehinderung | 14 | 8 |
| Geistige Behinderung | 3 | 1 |
| Psychische Erkrankung | 5 | 1 |
| Stoffwechsel/Organ/ Tumor | 6 | 3 |
| davon: Grad der Behinderung 50-60 | 25 | 6 |
| Grad der Behinderung 70-80 | 11 | 7 |
| Grad der Behinderung 90-100 | 4 | 9 |
Ob zum Zeitpunkt der Entbindung eine Behinderung/chronische Erkrankung vorgelegen hat, ist für die Art der Entbindung statistisch unerheblich (Tabelle 10). Bei den Frauen jedoch, die zur Geburt ihres 1. Kindes bereits behindert/erkrankt waren, spielt der Einfluss des Grades der Behinderung eine wesentliche Rolle. Nicht die Art der Behinderung/Erkrankung wirkt sich auf die Geburtsart aus, sondern die Schwere. Entbinden Frauen mit einem niedrigen GbB häufiger auf natürlichem Weg, kehrt sich das Verhältnis bei einer stärker ausgeprägten Behinderung oder Erkrankung um (p=.008). Risikominimierung und größere Einflussnahme auf das Geburtsgeschehen auf Seiten der Klinikärzte lassen sich hinter diesen Ergebnissen vermuten. Damit wird jedoch einem Teil der Frauen ein „normales“ Geburtserleben von vornherein vorenthalten. Dass eine Einflussnahme auf die Entscheidung durch die schwangere Frau kaum möglich ist, kann an dieser Stelle ebenfalls nur vermutet werden.
13 Frauen berichten außerdem, per Periduralanästhesie (PDA) entbunden zu haben. Elf dieser Frauen erhielten im Anschluss einen Kaiserschnitt und zwei Frauen entbanden auf natürlichem Weg, wovon eine epilepsieerkrankte Frau angab, die PDA sei vorbereitend gelegt worden, weil die Klinik Angst vor einem unter der Geburt auftretenden epileptischen Anfall hatte. Bis auf eine Frau sind alle diese Frauen im Vorfeld beraten worden und mit Ausnahme von drei Frauen konnten sie auch selbst über deren Anwendung entscheiden. Die Mitbestimmung scheint zumindest auf diesem Gebiet behinderten-/erkrankungsunabhängig zu sein.
Die Beurteilung der ärztlichen Betreuung fällt bei der Befragung behinderter Menschen häufig sehr positiv aus (Michel et al. 2001, Michel et al. 2003; Behrendt 1998). Das steht zum Teil gegen Aussagen von Hermes (1998) u. a., die in qualitativen Studien über eher negative Erfahrungen behinderter Frauen in der ärztlichen Versorgung berichteten in Form von Barrieren, Vorurteilen und Informationsdefiziten. In den größeren Studien wurde z.B. nicht danach gefragt, ob dann in der konkreten Betreuungssituation ein Arztwechsel stattfand. Die vorliegende Arbeit beinhaltet daher die Frage, ob ein Wechsel des betreuenden Gynäkologen erfolgte. Dabei zeigte sich, dass 15% der Befragten (n=15), davon zwölf Frauen mit einer bereits bestehenden Behinderung/Erkrankung, ihren behandelnden Gynäkologen im Laufe der Schwangerschaft gewechselt haben. Als Gründe wurden neben strukturellen Veränderungen wie Umzug oder Ruhestand des Arztes (n=4), der Notwendigkeit einer Intensiv-Schwangerenbetreuung (n=3) und sonstigen, nicht näher bezeichneten Gründen (n=3) tatsächlich am häufigsten die Unzufriedenheit mit dem Arzt durch eine schlechte Betreuung genannt (n=5).
Der weitaus größte Teil der Befragten beurteilte die ärztliche Versorgung aber als überwiegend positiv und zufriedenstellend. Dafür wurden die Mütter gebeten, sowohl die Geburtseinrichtung als auch ihren niedergelassenen Gynäkologen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu bewerten (Tabelle 11).
| Einrichtung | Skala | Anzahl Items | Reliabilität |
|---|---|---|---|
| Niedergelassener Gynäkologe | Barrierefreiheit | 1 | - |
| Partizipation | 3 | α = .56 | |
| Akzeptanz | 3 | α = .48 | |
| Beratung und Betreuung | 3 | α = .66 | |
| Geburtsklinik | Barrierefreiheit | 1 | - |
| Partizipation | 1 | - | |
| Akzeptanz | 2 | - | |
| Beratung und Betreuung | 3 | α = .89 |
Insgesamt sind vier Fünftel der befragten Frauen (80,1%) mit ihrem niedergelassenen Gynäkologen zufrieden, etwas häufiger diejenigen, die zur Geburt des 1. Kindes behindert oder chronisch krank waren (Abbildung 5). Die positive Bewertung der Geburtsklinik zeichnet sich noch stärker ab, knapp 90% der Frauen äußerten sich (eher) positiv. Allerdings zeigt sich hier wieder ein Unterschied nach Zeitpunkt der Behinderung/Erkrankung, dass Frauen ohne Behinderung/Erkrankung bei der Geburt ihres 1. Kindes die Geburtsklinik signifikant schlechter beurteilen (p=.020). 20 versus 5% gaben eine negative Beurteilung ab. Unterschiede oder Häufigkeiten in den verschiedenen Behinderungs- oder Erkrankungsgruppen lassen sich dabei nicht feststellen.
Abbildung 5. Abbildung 5: Positive Bewertung der Geburtsklinik und des niedergelassenen Gynäkologen (in %)
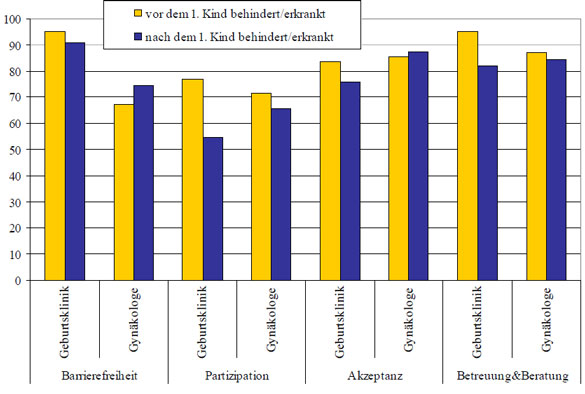
Gefragt, was die Frauen als besonders unterstützend in der Betreuung ihres Gynäkologen empfanden, lobte der größte Teil die empathische Art des Arztes und die entgegengebrachte Zuwendung (n=17): „Das Angenommensein vom Arzt. Ist gut auf meine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen“ (601 Körperbehinderung). An 2. Stelle wurde die fachliche Kompetenz, Beratungs- und Informationsvielfalt hervorgehoben (n=10), und vier Frauen betonten, „dass er mit mir umgegangen ist, als hätte ich keine Behinderung“ (105 Mehrfachbehinderung). Des Weiteren wurden unterstützend genannt engmaschige Kontrollen (n=3), ein langjähriger Kontakt (n=3) und eine gute Erreichbarkeit (n=3): „Gynäkologin war nur 300m von meinem Wohnhaus entfernt und problemlos mit dem Elektrorollstuhl erreichbar.“ (708 Körperbehinderung).
Kritik äußerten die Befragten dahingehend, dass sie sich mehr Beratung und Aufklärung gewünscht hätten (n=7), „dass man individuell von einem Arzt betreut wird und über mögliche Schwierigkeiten hingewiesen und Hilfestellung gezeigt wird“ (304 Mehrfachbehinderung). Eine höhere Kontrolldichte (n=4), eine bessere Erreichbarkeit (n=3), weniger Übervorsicht (n=2) und dafür mehr Mitwirkung (n=2) wurden ebenfalls genannt sowie der Wunsch einer Patientin, dass ein „schriftlicher Vermerk meiner Grunderkrankung im Schwangerenausweis (für Notfall)“ vorgenommen wird und die „Kontaktaufnahme zu meinem behandelnden Neurologen wegen meiner Grunderkrankung (z.B. wegen Medikamenten usw.)“ (704 Körperbehinderung) erfolgt. Kritiken am niedergelassenen Gynäkologen äußerten vorrangig mehrfach- und körperbehinderte Frauen.
Frauen, die zur Geburt ihres 1. Kindes bereits behindert oder chronisch krank waren, bewerten die Geburtseinrichtung durchweg positiver als Frauen ohne Behinderungen/ Erkrankungen. Im Bereich der Partizipation (p=.023) und der umfassenden Beratung und Betreuung (p=.043) sind diese Unterschiede sogar statistisch signifikant. Beim niedergelassenen Gynäkologen fallen die Unterschiede geringer aus bzw. ähneln sich die Einschätzungen der beiden Gruppen.
Die erhaltene praktische Hilfe und Beratung haben 30 Frauen als sehr wertvoll und unterstützend erlebt: „die Hebammen hatten immer ein offenes Ohr für alle Fragen und gaben die nötige Unterstützung und Hilfe, die man brauchte“ (303 Mehrfachbehinderung) oder „die Beratung in der Klinik bezüglich des Umgangs mit meinem Kind (Stillen, Windeln, Baden usw.), auch wenn ich mal länger schlafen wollte, wurde mein Kind bestens versorgt; Physiotherapie nach Kaiserschnitt, um schnellstens wieder fit und selbständig zu werden“ (105 Mehrfachbehinderung). Insgesamt sieben Frauen berichteten zudem von einem behindertengerechten Umgang, wie die folgende Aussage verdeutlicht: „Da ich hörgeschädigt bin, sind für mich Blickkontakte und lautes deutliches Sprechen sehr wichtig. In der Klinik wurde dies sehr ernst genommen.“ (106 Sinnesbehinderung). Weitere Mütter lobten, „Dass ich als sehbehinderter Mensch bereits am 4. Tag nach dem Kaiserschnitt wieder nach Hause durfte in meine gewohnte Umgebung.“ (201 Sinnesbehinderung) und „dass bereits vor mir querschnittsgelähmte Mütter dort entbunden hatten.“ (009 Körperbehinderung) oder wie diese psychisch kranke Frau: „dass ich beim Einleiten der Geburt eine Hebamme hatte, die mich auf meine Krankheit angesprochen hat und mir Kügelchen zur Beruhigung gab.“ (904 Psychische Erkrankung).
Kritiken innerhalb der Geburtseinrichtung bezogen sich vorwiegend auf die räumlichen und strukturellen Gegebenheiten, die von Enge (zu hohe Bettenanzahl in den Patientenzimmern) und mangelnder Privatsphäre gekennzeichnet waren (n=9) sowie die Trennung von Mutter und Kind, insbesondere nachts (n=9). Hierbei handelt es sich jedoch vorwiegend um Frauen mit älteren erstgeborenen Kindern, denen noch nicht oder nicht im umfassenden Maße die Option des „Rooming In“ zur Verfügung stand. Im Rahmen von Kliniksanierungen wurde in der Regel auch die Anzahl der Betten in den Patientenzimmern reduziert. Kritiken innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung bezogen sich in erster Linie auf die ärztlicherseits nicht gewünschte Partizipation der Mutter oder auf Informationen, die ihr gegenüber zurückgehalten wurden. So schreiben zwei Mütter: „Eine ausführlichere Anleitung wie man das Baby badet, wickelt. Manchmal zeigten die Schwestern vieles nur meinem Partner.“ (004 Sinnesbehinderung) und „Mehr fachliche Auskunft über den Zustand meines ungeborenen Kindes. Menschen, die seltsam „gucken“, werden oft nicht ernst genommen.“ (201 Mehrfachbehinderung). Eine Mutter forderte deshalb „insgesamt mehr Vertrauen in das Können eines behinderten Menschen.“ (611 Körperbehinderung). Weitere Kritikpunkte beinhalteten die Unfreundlichkeit des Personals (n=6) und die strikte Reglementierung in manchen Kliniken (n=4), was die Frauen als Druck empfanden.
Trotz der angebrachten Kritiken kann insgesamt von einer sehr hohen Zufriedenheit mit der geburtshilflichen Versorgung ausgegangen werden, womit sich ein deutlicher Trend abzeichnet, dass behinderte und chronisch kranke Frauen, die ihren Kinderwunsch realisieren, in ihrem Wunsch akzeptiert und unterstützt werden.
Die Betreuung durch die Hebamme nach der Entbindung empfinden viele Frauen als eine wertvolle Unterstützung, so auch unerfahrene Erstgebärende. Zurückhaltung kann dann auftreten, wenn die Frau bereits negative Erfahrungen mit Behörden und staatlichen Institutionen gemacht hat und sie eine Betreuung durch eine Hebamme als Eingriff in ihre Privatsphäre erlebt, verbunden mit dem Gefühl von Überwachung und Einmischung. Drei Viertel der befragten Frauen wurden nach der Geburt ihres 1. Kindes durch eine Hebamme betreut, ein Drittel bis zu vier Wochen nach der Entbindung, ein knappes Drittel weitere vier Wochen und 15% länger als acht Wochen nach der Entbindung.
Entgegen der Vermutung, dass behinderte/chronisch kranke Frauen eine Hebammenbetreuung seltener in Anspruch nehmen, sind es gerade diese Frauen, die häufiger (p=.033) und auch länger (p=.019) betreut wurden und sich auch eine längere Betreuung gewünscht hätten (p=.064), vorwiegend bei einer stattgefundenen vierwöchigen Betreuung.
Ein Großteil der Mütter (n=28) beschrieb die hohe Fachkompetenz der Hebamme mit vielen praktischen Hilfestellungen, Tipps und Hinweisen als besonders hilfreich. Eine hörbehinderte Mutter z.B. schätzte „ihren Rat bezüglich der Nabelheilung und Schuppenflechte, Hilfe beim Baden in den eigenen Gegebenheiten, Rat bezüglich der Koliken und der Nahrung auch nach der 8. Woche“ (105 Mehrfachbehinderung) und eine körperbehinderte Mutter erlebte es als Unterstützung, „dass sie für fast alles Rat wusste.“ (615 Mehrfachbehinderung).
Ein Teil der Frauen (n=22) empfanden die empathische und fürsorgliche Art sowie die persönlichen Gespräche mit der Hebamme als besonders hilfreich und beruhigend, wie eine psychisch kranke Mutter schreibt: „Sie ging gut auf mich ein, ich wurde nicht überbehütet.“ (902 Psychische Erkrankung). Und 14 Frauen lobten die gute Erreichbarkeit der Hebamme im Sinne der Aussage einer MS-kranken Mutter: „Bei Fragen und Problemen war die Hebamme immer erreichbar.“ (508 Neurologische Erkrankung).
Kritik wurde von Seiten der Mütter kaum geäußert, wenn dann wünschten sich die Frauen mehr Informationen, eine umfassendere Betreuung und ein Eingehen auf persönliche Belange. Der Fall einer körperbehinderten Frau, die schrieb „Hebamme war zu aufdringlich, Termine wurden nicht eingehalten“ (607 Körperbehinderung) scheint damit die Ausnahme. In den meisten Fällen wurde von einer umfassenden Betreuung durch die Hebamme berichtet, die von den Müttern sowohl fachlich als auch menschlich als sehr hilfreich und unterstützend erlebt wurde.
Untersucht wurden ebenfalls Unterschiede zwischen der 1. und weiteren Schwangerschaften im Schwangerschaftserleben der Frau, in der Reaktion des sozialen Umfeldes und in der medizinischen Versorgung.
Im Bereich des individuellen Schwangerschaftserlebens berichteten zwölf Frauen, darunter ca. ein Drittel der Frauen, die zur Geburt ihres 1. Kindes noch nicht behindert oder erkrankt waren, dass sie die Schwangerschaft(en) als insgesamt schöner empfanden und weniger Angst hatten: „habe die Schwangerschaft sehr genossen und alles viel intensiver erlebt“ (304 Mehrfachbehinderung). Fast ebenso viele (n=13) hingegen beschrieben die weiteren Schwangerschaften als anstrengender und stressiger, insbesondere durch die Versorgung der bereits vorhandenen Kinder. Dabei handelt es sich vorwiegend um Frauen, die vor der Geburt ihres 1. Kindes bereits behindert oder erkrankt waren. Acht Frauen empfanden keine Unterschiede zwischen den Schwangerschaften, eine körperbehinderte Frau schreibt stattdessen: „Beide Schwangerschaften waren die schönste Zeit in meinem Leben, da die Beschwerden in dieser Zeit komplett weg waren (im Bezug auf die Behinderung).“ (608 Körperbehinderung).
Eher ambivalent verhielt es sich mit der Reaktion der Familie und Freunde auf die weitere(n) Schwangerschaften, „einige haben sich gefreut, andere fanden ein zweites Kind wäre zuviel“ (203 Sinnesbehinderung). Diese Erfahrung zeigt sich dabei unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung/Erkrankung. Insgesamt 13 Frauen berichteten von einer sowohl freudigen als auch ablehnenden oder zurückhaltenden Reaktion des sozialen Umfeldes, während elf Frauen uneingeschränkte Freude entgegengebracht wurde, „mehr Gelassenheit, weniger sorgenvolle Einmischung.“ (701 Körperbehinderung), darunter ca. ein Drittel der Frauen, die zur Geburt ihres 1. Kindes bereits behindert oder erkrankt waren. Sechs Frauen wurde mit Ablehnung begegnet, wie eine sehbehinderte Frau berichtete: „Meine Eltern meinten, wir sollten froh sein über ein gesundes Kind.“ (206 Sinnesbehinderung). Keine Unterschiede stellten sechs Frauen fest.
Auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung gab der Großteil der Frauen (n=24) unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung/Erkrankung eine allgemeine Verbesserung an, nicht zuletzt der generellen Weiterentwicklungen im medizinischen Bereich geschuldet. Aber auch behindertenspezifisch wurden Verbesserungen beschrieben, wie im Falle einer körperbehinderten Mutter: „Gynäkologin nahm Rücksprache mit Neurologe wegen meiner Grunderkrankung (Medikamente usw.), Gynäkologe nahm meine Krankheit und Schwangerschaft sehr ernst“ (704 Körperbehinderung). Zehn von 24 Frauen, darunter ein Viertel der vor Geburt des 1. Kindes behinderten/erkrankten Frauen, beschrieben eine intensivere Versorgung, z.T. begründet durch das Vorliegen einer Risikoschwangerschaft. Keine Unterschiede in der medizinischen Versorgung stellten sechs Frauen fest, und nur je zwei Frauen gaben an, dass die Versorgung geringer bzw. allgemein schlechter ablief: „weniger Untersuchungen, noch weniger Zeit der Ärztin“ (615 Mehrfachbehinderung). Eine mehrfachbehinderte Frau (Spastische Lähmung und Epilepsie) musste die Erfahrung machen, dass ihr die Klinik nach dem 2. Kind die Sterilisation empfahl.
Neben der Entscheidung einer behinderten oder chronisch kranken Frau für ein Kind und die anschließend erlebte medizinische Versorgung während Schwangerschaft und Geburt war ein wichtiges Forschungsanliegen, die Frauen nach der Gestaltung ihrer Mutterschaft und dabei vorhandenen Ressourcen und möglichen Problemen zu befragen. Untersucht wurden dafür im wesentlichen personelle und materielle Unterstützungsmöglichkeiten bei der Versorgung und Betreuung des Kindes, Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Ämtern, Kindertagesstätten und schulischen Einrichtungen, Erziehungspotentiale und -defizite und von den Frauen geäußerte Wünsche und Empfehlungen.
Gefragt nach Personen, durch die die Frauen nach der Geburt Unterstützung erfahren haben, gaben die Mütter am häufigsten die eigene (Herkunfts-)Familie und den Partner an (Tabelle 12). Auch der Freundeskreis bietet ein wichtiges Unterstützungspotential, für einen Teil der Mütter auch Gleichgesinnte und semi-instituionelle Organisationen wie Mutter-Kind- oder sogenannten Krabbelgruppen.
| Partner | Familie | Freunde | andere Mütter | |
|---|---|---|---|---|
| Sinnesbehinderung |
92,9 |
92,9 |
92,9 |
71,4 |
| Neurologische Erkrankung |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
50,0 |
| Mehrfachbehinderung |
83,3 |
83,3 |
58,3 |
50,0 |
| Körperbehinderung |
81,0 |
90,5 |
76,2 |
47,6 |
| Geistige Behinderung |
75,0 |
25,0 |
50,0 |
25,0 |
| Psychische Erkrankung |
71,4 |
85,7 |
71,4 |
28,6 |
| Stoffwechsel/Organ/Tumor |
86,7 |
93,3 |
63,3 |
73,3 |
| gesamt |
84,7 (n.s.) |
87,8 (p=.012) |
72,4 (n.s.) |
57,1 (n.s.) |
„Meine Eltern nahmen mir viele Arbeiten im Haushalt (z.B. Wäsche waschen, Reinigung, Bügeln usw.) ab, so dass ich mich um meine beiden Kinder kümmern konnte.“ (708 Körperbehinderung) oder „die Unterstützung meines Partners – er übernahm einen Teil der Elternzeit“ (310 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung) sind Beispiele für die erlebte Unterstützung nach der Geburt durch Familie, Freunde oder den Partner. Eine Frau berichtete, sie hätte eine „Annonce aufgegeben, um andere Rollstuhlfahrerin kennen zu lernen – Austausch war sehr wichtig, Erfahrung weitergeben, Lernen aus Situation“ (501 Mehrfachbehinderung).
Im Unterschied zu den anderen Behinderungs-/Erkrankungsgruppen werden geistig behinderte Frauen am seltensten von ihren Familien unterstützt, was sich mit der Unterbringung in betreuten Wohnformen und der Bereitstellung eines gesetzlichen Betreuers erklären lässt. Auch Freunde und andere Mütter stehen ihnen am seltensten zu Seite, wobei auffällt, dass auch psychisch kranke Mütter im Kontakt zu anderen Müttern eher zurückhaltend sind.
Weitere Unterstützung durch Selbsthilfegruppen erhielten je eine sinnes-, körper- und mehrfachbehinderte Mutter, ebenso zwei geistig behinderte Frauen durch Mitarbeiter des Ambulant Betreuten Wohnens, eine körperbehinderte Frau durch den Allgemeinen Sozialdienst und zwei psychisch kranke Mütter durch ihre behandelnden Ärzte. Frauen, die zur Geburt ihres 1. Kindes bereits behindert oder erkrankt waren, erleben die gleiche Unterstützung wie nichtbehinderte/gesunde Frauen. Allerdings geben sie häufiger Unterstützung von Freunden an als nichtbehinderte/gesunde Frauen (79 vs. 61%). Hier müsste überlegt werden, ob es sich um eine Definitionsproblematik des Begriffs „Freunde“ handelt oder ob behinderte/chronisch kranke Frauen tatsächlich auf die Hilfe von Freunden zurückgreifen, während nichtbehinderte/gesunde Frauen ihren Alltag und die Versorgung des Kindes allein bewältigen.
Kritik an fehlender Unterstützung wurde wenig geäußert. Zehn Mütter wünschten sich die mehr Hilfe durch den Partner, „dass der Vater da gewesen wäre, aber seine Ausrede war er könnte was kaputt machen an seinem Kind“ (104 Mehrfachbehinderung) und sieben Frauen wünschten sich mehr Verständnis für sie und ihre Situation als behinderte/chronisch kranke Mutter, wie eine hörbehinderte Mutter schreibt „mehr Beistand und Toleranz bezüglich Erziehung durch meine Eltern.“ (206 Sinnesbehinderung). Je drei Mütter hätten sich mehr Unterstützung durch die Familie erhofft sowie spezielle Hilfen „eventuell Dolmetscher bei wichtigen Dingen“ (107 Sinnesbehinderung).
Am häufigsten wurden Beratung und Begleitung in den ersten Wochen nach der Geburt (61,2%) sowie die Rückbildungsgymnastik (53,1%) in Anspruch genommen. Bei der Rückbildungsgymnastik erfuhren die Frauen „Kontakt mit anderen Müttern“ (106 Sinnesbehinderung) oder „aufpassen auf mein Kind, damit ich gut mitmachen konnte“ (404 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung). Weit seltener greifen die befragten Frauen auf Unterstützungsangebote wie Familienentlastender Dienst (6,1%) oder Haushaltshilfen (4,1%) zurück. Diese Ergebnisse sind unabhängig von der Behinderungs-/Erkrankungsart oder dem Bestehen einer Behinderung/Erkrankung zur Geburt des 1. Kindes. Etwas häufiger ist ihre Inanspruchnahme jedoch bei den Frauen zu finden, deren 1. Schwangerschaft maximal sechs Jahre zurückliegt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Unterstützungsangebote in jüngerer Zeit mehr publik gemacht und daher auch besser angenommen werden, sowohl von behinderten/chronisch kranken Frauen als auch von nichtbehinderten/gesunden.
Auch spezifische Hilfsmittel zur Versorgung des Kindes wurden nur von 10,2% der Mütter angegeben, vorzugsweise von sinnes- und mehrfachbehinderten Frauen. Es handelt sich dabei um einen unterfahrbaren Wickeltisch (5), ein höhenverstellbares Bett und Laufgitter (3), ein rollbares Bett (1), ein lenkbarer Kinderwagen (1) und eine Lichtsignalanlage (2). Die Hilfsmittel waren z.T. Marke Eigenbau (n=6), z.T. durch die Krankenkasse (n=4) oder den Kommunalverband Sachsen (n=1) sowie durch Stiftungen wie Otto Perl oder Nathalie Todenhöfer (n=3) finanziert worden: „Prima Hilfe von Otto-Perl-Stiftung, Ohne Fragen, sofortige Hilfe“ (706 Körperbehinderung).
Auf die Frage, was sich die Mütter anders oder zusätzlich an Unterstützung gewünscht hätten, äußerten fünf Frauen den Wunsch nach mehr Informationen in Bezug auf Hilfsmittel sowie Anlaufstellen für Beratung und Aufklärung. Je drei Frauen wünschten sie mehr Unterstützung im Alltag, z.B. durch eine Haushaltshilfe sowie mehr Verständnis für ihre besondere Situation, wie es diese körperbehinderte Mutter formuliert: „von meiner KK besser behandelt zu werden: ‚Da können Sie sich kein Kind anschaffen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie es tragen können.’“ (706 Körperbehinderung).
Die Zufriedenheit mit dem Kinderarzt wird von über 90% der Frauen als positiv bewertet. Analog der Beurteilung des niedergelassenen Gynäkologen und der Geburtseinrichtung wurden die Barrierefreiheit, Partizipation, Akzeptanz sowie Beratung und Betreuung als überwiegend zutreffend eingeschätzt. Am zufriedensten waren Mütter mit neurologischen Erkrankungen, geistigen und Mehrfachbehinderungen, Kritik äußerten am ehesten Mütter mit Sinnesbehinderungen, körperbehinderte, stoffwechsel-/organ- oder tumorerkrankte und psychisch erkrankte Frauen. Das Alter des Kindes spielt dabei keine Rolle.
Die hohe Zufriedenheit mit dem Kinderarzt widerspiegelt sich auch in den Antworten der Frauen auf die Frage, was sie in der Betreuung durch den Kinderarzt als besonders unterstützend erlebten (Tabelle 13).
| Zufriedenheitskategorien | Anzahl der Nennungen | Beispielzitat |
|---|---|---|
| Informationsvielfalt, Beratung und Kompetenz |
16 |
„Dieser Arzt ist fachkompetent, gibt Sicherheit, ist nicht überängstlich, achtet auf das Wesentliche.“ (201 Mehrfachbehinderung) |
| Empathie und Zuwendung |
15 |
„aufgeschlossene und freundliche Atmosphäre, das Gefühl, stets willkommen zu sein“ (612 Körperbehinderung) |
| Gute Erreichbarkeit |
14 |
„Arzttermine wurden auf mich abgestimmt; keine langen Wartezeiten; bei Problemen kann ich jederzeit anrufen“ (508 Neurologische Erkrankung) |
| Mitwirkungsmöglichkeiten und behinderungsunabhängige Behandlung |
7 |
„das Kind und nicht die behinderte Mutter steht im Mittelpunkt“ (701 Körperbehinderung) |
| Unterstützung vor Ort |
3 |
„Umräumen der Räume – Liege aufgestellt, dass ich mein Kind selbst ausziehen kann (Warteraum)“ (501 Mehrfachbehinderung) |
| Vernetzung |
2 |
„Hilfe zur Selbsthilfe, z.B. Kontaktaufnahme zu Ärzten, Therapeuten, Eingliederungsstellen“ (106 Sinnesbehinderung) |
Wünsche und Kritiken fallen eher spärlich aus: Am häufigsten wünschen sich die Frauen eine bessere Erreichbarkeit mit z.B. kürzeren Wartezeiten oder einer Notfallregelung (n=10), Barrierefreiheit (n=4), mehr Zuwendung und Zeit (n=4) und ernster genommen zu werden (n=3) sowie freundlicheres Personal (n=2) und mehr Informationen und Beratung (n=1). Zu erwartende behinderungsspezifische Diskriminierung durch bestehende (räumliche oder kommunikative) Barrieren oder Vorurteile treten damit nur marginal in Erscheinung bei einer insgesamt sehr hohen Zufriedenheit mit der kinderärztlichen Versorgung.
Nicht alle behinderten und chronisch kranken Mütter sind auf die Unterstützung von Ämtern und Behörden angewiesen oder nehmen diese in Anspruch. Mit dem Jugendamt in Berührung kamen demzufolge 45,9% der befragten Mütter, davon alle geistig behinderten und drei Viertel der mehrfachbehinderten Frauen. Als Gründe für den Kontakt wurden in erster Linie Vaterschaftsanerkennung (62,2%) und Sorgerechtserklärungen (53,3%) genannt und da vor allem wieder von mehrfach- und von geistig behinderten Frauen. Selten wurden Leistungen nach §27 SGB XIII (Hilfe zur Erziehung) (15,6%) oder die Klärung von Unterhaltsfragen (11,1%) in Anspruch genommen. Weitere Anliegen waren Adoptionsfragen, Familienhilfen (FED), Betreuungsplatz fürs Kind, Organisation von Hilfskräften, Fragen zum Kindswohl und Frühförderung.
Die Leistungen der Agentur für Arbeit oder des Sozialamtes hatte ebenfalls nur die Hälfte der befragten Mütter in Anspruch genommen (51%). Hier zeigte sich eine Häufung der psychisch kranken Frauen. Die Leistungen umfassten im wesentlichen Sozialhilfe für die Mutter (70%) und das Kind (40%), die vor allem von mehrfach- und sinnesbehinderten Frauen beantragt wurden sowie einmalige Beihilfen (32%) vor allem für psychisch kranke und mehrfachbehinderte Frauen. Weitere Anliegen waren ALG I-Anträge, berufliche Rehabilitation, persönliches Budget und Anträge auf Gleichstellung und auf Frühförderung. Die Mütter sollten bewerten, wie zufrieden sie mit den Ämtern waren. Unterschieden wurde dabei nach der Barrierefreiheit und Erreichbarkeit (inkl. Terminvereinbarungen) der Einrichtung, der Akzeptanz als behinderte/chronisch kranke Mutter und nach der Informationsübermittlung und -vielfalt. Abbildung 6 zeigt dabei eine hohe Zufriedenheit mit den Ämtern, insbesondere mit dem Jugendamt.
Die gute Erreichbarkeit beschreibt eine Morbus Crohn erkrankte Mutter wie folgt: „waren telefonisch und persönlich jederzeit ansprechbar, bei Unklarheiten erfolgte stets ein Rückruf“ (310 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung) und eine körperbehinderte Frau gab an „man wird ernst genommen mit seinen Problemen und Fragen“ (001 Körperbehinderung).
Im Vergleich zum Jugendamt fiel die Zufriedenheit mit dem Sozialamt/der Agentur für Arbeit geringer aus. Mehr Akzeptanz und Verständnis für die persönliche Situation wünschte sich z.B. eine körperbehinderte Frau und erfuhr stattdessen „es wird kaum Rücksicht auf die Behinderung genommen“ (601 Körperbehinderung). Fehlende Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten wurden ebenfalls kritisiert sowie ein oftmals hoher bürokratischer Aufwand, wie es diese psychisch kranke Frau erlebt: „musste mich bei Krankmeldung & Klinikaufenthalten immer abmelden“ (906 Psychische Erkrankung). Eine andere Frau fordert die „Beachtung des Datenschutzes, Vermeidung von Doppelgutachten“ (602 Körperbehinderung) und wiederum eine andere wünscht sich „nettes Personal, Leute die sich um einen kümmern“ (1005 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung).
Die in der Literatur anzutreffenden Erfahrungen von Frauen, Ämter in bestimmten Situationen bewusst gemieden zu haben, fanden sich in unserer Stichprobe nur vereinzelt wieder. 9,2% der Frauen hatten es schon einmal abgelehnt, sich an eines oder mehrere der genannten Ämter zu wenden, davon am häufigsten psychisch kranke Frauen. Das Jugendamt wurde am häufigsten gemieden (3x), gefolgt vom Rententräger (2x), dem Sozialamt (2x), der AfA/ARGE (2x) und dem Gesundheitsamt (1x). Zwei mehrfachbehinderte Frauen schildern ihre Bedenken mit der Rentenkasse und dem Sozialamt/Arge wie folgt: „Ich habe Angst, in die unterste Klasse der Gesellschaft abzusteigen. Vielleicht bin ich auch nur zu stolz. Oft werden Leistungen der oben genannten Stellen ausgenutzt. Dementsprechend wird man auf diesen Ämtern behandelt.“ (201 Mehrfachbehinderung) und „möchte nicht vom Amt abhängig sein – Selbständigkeit ist mir lieber – fühle mich bei denen, als ob ich betteln muss, um zu überleben mit meinem Kind“ (303 Mehrfachbehinderung). Die Angst vor einem übermäßigen Einwirken eines Amtes schildert lediglich eine geistig behinderte Mutter: „Wollte keine Mithilfe vom Jugendamt, Angst vor zuviel Einmischen in unser Leben.“ (805 Geistige Behinderung).
Es ist daher festzuhalten, dass die Angebotspalette der Jugend- und Sozialämter und der Agenturen für Arbeit/ARGEn zwar nur von ca. der Hälfte der Mütter aus unserer Befragung in Anspruch genommen und da im Großen und Ganzen auch recht positiv bewertet wurde Konkrete Anfragen an uns zeigen z. T. ein anderes Bild, wie es sich auch in der Betroffenenliteratur widerspiegelt. Diese Widersprüche abzuklären signalisiert weiteren Forschungsbedarf.
Der Besuch einer Kindereinrichtung stellt für Mütter/Eltern mit Behinderungen eine sinnvolle Unterstützung dar, um behinderungsspezifische Probleme bei der Förderung der Kinder auszugleichen. So wird zum Beispiel die Sprachentwicklung der Kinder hörgeschädigter Eltern ebenso ohne zusätzlichen therapeutischen Aufwand gefördert werden können wie die motorische Entwicklung der Kinder mobilitätseingeschränkter Eltern. Allerdings wird in der Literatur von Barrieren für die Mütter/Eltern berichtet, die eine uneingeschränkte Inanspruchnahme der Kindereinrichtung für die Eltern erschweren. Mit wenigen Ausnahmen besuchten alle Kinder in unserer Studie eine Kindertagesstätte.
| Altersdurchschnitt | Altersspanne | |
|---|---|---|
| 1. Kind |
2 Jahre |
0,5 bis 5 Jahre |
| 2. Kind |
2,3 Jahre |
1 bis 5 Jahre |
| 3. Kind |
3 Jahre |
2 bis 4 Jahre |
Bis auf sieben Mütter, deren Kinder mindestens drei Jahre alt waren, haben alle ihre Kinder in Kindertageseinrichtungen betreuen lassen. Von neun Kindern, die unter drei Jahre alt waren, wurden sieben in eine Kindertageseinrichtung geschickt. Tabelle 14 zeigt zudem, dass weitere Kinder später in einer Kindereinrichtung betreut werden. Zur Entlastung der Mütter/Eltern wäre gerade in Bezug auf die Behinderung eine umgekehrte Entwicklung sinnvoll. 28,6% der Kinder besuchten eine Integrationseinrichtung, vorwiegend Kinder von Müttern mit Sinnesbehinderungen, geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen und 20,9% nutzen die Möglichkeit einer Frühförderung (z.B. Ergotherapie und Logopädie), auch hier wieder überwiegend Kinder von Müttern mit Sinnesbehinderungen und geistigen Behinderungen. In Sachsen haben mittlerweile mehr als ein Drittel der Kindertageseinrichtungen integrativen Charakter (Stand 31.7.2006), so dass der Besuch einer Integrationseinrichtung kein spezielles Merkmal von Kindern mit behinderten oder chronisch kranken Müttern sein dürfte.
Als besonders hilfreich erlebten die Mütter auf sie angepasste und damit flexible Rahmenbedingungen, wie folgende Beispiele zeigen: „Darf mein Kind früh durch die Küche geben und nachmittags bringt ihn eine Erzieherin heraus“ (506 Neurologische Erkrankung) und „Manche Erzieher sagen mir gleich, wo ich mein Kind im Freigelände finde.“ (201 Mehrfachbehinderung). Andere Mütter empfanden das Angebot der Einrichtungen als besonders hilfreich, von Frühförderangeboten bis hin zu individuellen Erziehungstipps.
Wieder andere Mütter erlebten die tolerante und unkomplizierte Art innerhalb der Einrichtungen als unterstützend, wie eine psychisch kranke Mutter schreibt: „Ich musste für mehrere Wochen ins Krankenhaus. Mein Sohn wurde unkompliziert aufgenommen, obwohl er die Einrichtung bis dahin nicht besucht hatte.“ (902 Psychische Erkrankung) Neben all den hilfreichen Erfahrungen gab es auch zahlreiche Situationen innerhalb der Kindertageseinrichtung, die sich für Mütter mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen schwierig gestaltete (Tabelle 15).
| Schwierige Situation | % | Welche Behinderungsgruppen besonders? | Signifikanz |
|---|---|---|---|
| Kontakt zu anderen Eltern |
23,1 |
Sinnesbehinderung |
p=.018** |
| Elternabende |
20,9 |
Sinnesbehinderung, Mehrfachbehinderung |
p=.054 |
| Kinderfeste |
17,6 |
Psychische Erkrankung, Mehrfachbehinderung |
p=.002** |
| Kommunikation mit dem pädagogischen Team |
9,9 |
- |
- |
| Arbeit im Elternbeirat |
6,6 |
- |
- |
| keine schwierige Situation erlebt |
49,5 |
Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankung, Neurologische Erkrankung, Körperbehinderung |
p=.001** |
Die konkreten Probleme, die in den verschiedenen Situationen genannt wurden, ähneln sich im Wesentlichen. Die häufigsten Barrieren waren akustische Verständigungsschwierigkeiten und Orientierungsprobleme, fehlende Zeit oder Kraft der Mutter, schlechte Erreichbarkeit der Einrichtung und damit der Veranstaltung (zeitlich und räumlich), aber auch Ängste auf Seiten der Mütter und das Gefühl von Desinteresse und Unverständnis. „Unabhängig vom Elternsein gibt es immer größere Barrieren zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, die durch mehr Eigeninitiative verringert werden können.“ (701 Körperbehinderung).
Ganz ähnlich verhält es sich mit den Erfahrungen, die die Mütter bei Veranstaltungen innerhalb der Bildungseinrichtungen gemacht haben. „Der Schulweg ist weit. Durch Probleme beim Laufen bin ich immer auf andere mit Auto angewiesen.“ (508 Neurologische Erkrankung) oder „Einschränkungen beim Leisten von Arbeitsstunden, weil bestimmte Tätigkeiten ausgeschlossen sind, z.B. handwerkliche Arbeiten“ (206 Sinnesbehinderung) sind typische Beispiele für Situationen, die sich für Mütter mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen schwierig gestalten.
Zwei Drittel der befragten Mütter haben Kinder im schulpflichtigen Alter. Davon haben wiederum über zwei Drittel (68,8%) keine Situationen erlebt, die sich für sie schwierig gestalteten, vor allem Mütter mit Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder Körperbehinderung. Zwischenmenschliche Kontakte wie die Teilnahme am Elternabend oder an Schulfesten, der Kontakt zum Lehrerteam und zu anderen Eltern oder die Arbeit im Elternbeirat gestaltet sich vorrangig für psychisch kranke und mehrfachbehinderte Mütter schwierig. So schreibt eine Mutter mit Depression: „Ich traue mich nicht, Unterstützung bei Wandertagen oder Klassenfahrten anzubieten.“ (902 Psychische Erkrankung). Flexible Rahmenbedingungen und die Unterstützung der Lehrer hingegen wurden als sehr hilfreich erlebt, wie eine sehbehinderte Mutter berichtete: „Ich wollte auch mal an einer Klassenveranstaltung außerhalb der Schule teilnehmen. Hatte aber Bedenken, wie andere Eltern reagieren würden aufgrund meiner Sehschwäche. Lehrerin hatte keine Bedenken.“ (209 Sinnesbehinderung).
Diskriminierung und Stigmatisierung gehören für viele „andersartige“ Menschen zum Alltag. Eine Möglichkeit, Vorurteile und diskriminierendes Verhalten abzubauen, ist der Kontakt zwischen behinderten/chronisch kranken und nichtbehinderten/gesunden Menschen. Daher fragten wir, welche Wege die Mütter in unserer Studie zum Austausch außerhalb des engsten Familien- und Freundeskreises nutzen (Tabelle 16). Gleichzeitig wird deutlich, welche Behinderungsgruppe wie bzw. wo am besten erreicht werden kann und wie bzw. wo am wenigsten, wenn man spezielle Freizeit-, Beratungs-, Austausch- oder allgemeine Unterstützungsangebote bereithalten möchte.
| Austauschmöglichkeiten | Austausch mit behinderten/ chronisch kranken Eltern | Welche Behinderungsgruppe am häufigsten? | Austausch mit nichtbehinderten/ gesunden Eltern | Welche Behinderungsgruppe am wenigsten? |
|---|---|---|---|---|
| Schule/Kita |
11,2% |
Mehrfachbehinderung |
67,3% |
Geistige Behinderung |
| Sport- und Freizeitvereine |
8,2% |
Sinnesbehinderung |
28,6% |
Geistige Behinderung Psychische Erkrankung |
| Nachbarschaft |
13,3% |
Geistige Behinderung |
52,0% |
Neurologische Erkrankung |
| Arbeitskollegen |
13,3% |
Stoffwechsel/Organ/ Tumor |
43,9% |
Geistige Behinderung |
| Begegnungsstätten/ Familienzentren |
8,2% |
Geistige Behinderung |
12,2% |
Sinnesbehinderung |
| Selbsthilfegruppen |
13,3% |
Psychische Erkrankungen |
- |
- |
| Spielplätze |
3,1% |
- |
33,7% |
Neurologische Erkrankung |
| Internet |
3,1% |
- |
1% |
- |
Dass die befragten Mütter mehr Austauschmöglichkeiten im Nichtbehindertenbereich angeben, liegt sicher zum einen daran, dass es mehr Nichtbehinderte als behinderte/chronisch kranke Menschen in dieser Altersgruppe gibt. Es zeigt aber auch, dass von Seiten der behinderten/chronisch kranken Mütter das Interesse besteht, sich innerhalb ihres sozialen Gefüges zu integrieren. Dies zeigt sich besonders in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen, in der Nachbarschaft und im beruflichen Umfeld. Innerhalb der Behinderungs- /Erkrankungsgruppen zeigt sich eine gewisse Isolation der geistig behinderten Mütter. Sie kommunizieren am wenigsten mit Nichtbehinderten im schulischen oder Kita-Bereich und mit nichtbehinderten Arbeitskollegen, dafür am häufigsten innerhalb des Wohnumfeldes (Betreutes Wohnen), Begegnungsstätten und Familienzentren. Psychisch kranke Frauen suchen am häufigsten den Austausch mit Gleichbetroffenen in Selbsthilfegruppen und am seltensten mit Nichtbetroffenen, darunter wieder am seltensten in Sport- und Freizeitvereinen.
Bei der Frage nach Diskriminierungserfahrungen ist es wichtig zu unterscheiden zwischen gesellschaftlicher Diskriminierung, die von außen herangetragen wird (durch Dritte) und mangelnden Teilhabechancen aufgrund der persönlichen Verfassung, meist innerhalb der Familie. Des Weiteren spielt es eine wichtige Rolle, ob die Ausgrenzung die Person selbst betrifft oder ihr nahestehende Personen wie z.B. das eigene Kind. Knapp 40% der Befragten haben selbst schon einmal (eine) Situation(en) erlebt, in denen sie sich ausgegrenzt oder benachteiligt fühlten und ein knappes Viertel hat dies in Bezug auf das Kind erlebt. Innerhalb der Behinderungs-/Erkrankungsgruppen gibt es dabei statistisch signifikante Unterschiede (Mütter: p = .010; Kind: p = .013). Besonders sinnes- und mehrfachbehinderte, aber auch psychisch kranke Frauen waren von Diskriminierungen betroffen (Abbildung 7).
Die folgende Auflistung zeigt, in welchen Formen Diskriminierung auftreten kann und welche konkreten Erlebnisse die Frauen dazu berichten (Tabelle 18).
| Kategorien | Anzahl der Nennungen | Beispielzitat |
|---|---|---|
| Missachtung und Intoleranz |
14 |
„Man wird leider immer noch wie ein Außenseiter behandelt, wenn man ein Kind hat und dabei behindert ist. Die meisten Leute zeigen für so was „normales“ leider wenig Verständnis. Sie denken immer, dass ‚wir’ unsere Kinder nicht richtig versorgen bzw. erziehen können. Aber das ist nicht so.“ (706 Körperbehinderung). |
| Barrieren |
4 |
„Rollstuhl kommt nicht in Vorschulbereich, Busfahrerin hat mich nicht mitgenommen“ (1004 Mehrfachbehinderung) |
| finanzielle Benachteiligungen |
2 |
„wenig Geld durch Rente“ (906 Psychische Erkrankung) |
Weitere Beispiele für missachtendes und intolerantes Verhalten von Mitmenschen erlebte eine Mutter in Form von Unverständnis der Lehrer, wenn sie sich nicht aktiv bei schulischen Veranstaltungen engagiert oder wie dieses Beispiel zeigt: „hab oft das Gefühl, dass wenn ich mich ‚oute’, zum Beispiel beim Kinderarzt, dass es als ‚Laune’ und nicht als Depression verstanden wird.“ (904 Psychische Erkrankung). Auch berufliche Nachteile wurden von einer Mutter berichtet: „Man bekommt kaum Hilfe – entweder aus Angst oder man wird als Alkoholiker angesehen. Bei Bewerbungen wird bei Angabe der Epilepsie stets abgelehnt.“ (503 Mehrfachbehinderung).
Die Kinder müssen es z.B. erleben, dass sie „wenige Einladungen zum Kindergeburtstag“ (501 Mehrfachbehinderung) bekommen oder es gibt „Schwierigkeiten beim Auffinden von Spielkameraden, die auch mal in der Freizeit zu Besuch kommen.“ (708 Körperbehinderung).
Die Reaktionen darauf können sehr unterschiedlich ausfallen. Entweder stärken sie das Selbstbewusstsein der Frau und fördern ihre Kreativität und Anpassungsbereitschaft oder die Diskriminierungen führen zu sozialem Rückzug bis hin zur Verstärkung der Krankheitssymptomatik. Die folgenden Zitate zeigen, welche Bewertung die Mütter den ausgrenzenden Situationen beimessen bzw. welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Eine blinde Mutter z.B. schreibt: „Insbesondere die Aufsicht im unbekannten Gelände und im Freien ist schwierig. Ich ‚kennzeichne’ meine Kinder zwar mit Glöckchen, so dass ich sie hören kann, aber es ist trotzdem schwierig bei stark befahrenen Straßen, wenn Spielplätze nicht umzäunt sind u. ä. Es ist insbesondere mit zwei Kindern schwierig für mich, beide gleich gut zu beaufsichtigen und auch mit ihnen zu spielen, wenn ich im Freien bin. Denn es ist für mich leichter, sich immer nur einem Kind zu widmen. V. a. Ballspiele, Fahrradfahren usw. der Kinder zu beaufsichtigen ist schwer. Meist gehe ich nur in bekanntes Gelände mit den Kindern alleine. Oft sind Nachbarn oder Freunde auch mit ihren Kindern im Freien und können teilweise die Aufsicht übernehmen oder auch Anregungen für die Kinder geben, z. B. Ballspielen usw. Mein Partner kann noch relativ gut sehen, wenn er mit dabei ist hilft er natürlich auch.“ (004 Sinnesbehinderung). Das Beispiel zeigt, dass das Problem bekannt ist und eine bewusste Auseinandersetzung erfolgt, indem auf individuelle Lösungsstrategien zurückgegriffen wird. Ähnlich das Beispiel einer depressiven Frau: „Viele Unternehmungen führt mein Mann alleine mit den Kindern durch, da es mir nicht gut geht oder ich es nicht vertrage. Ich versuche das Positive darin zu sehen – Ruhe, Entspannung.“ (902 Psychische Erkrankung).
Diese Form der positiven Bewältigung wurde von den Befragten jedoch nicht sehr oft angegeben. Viel wahrscheinlicher ist es stattdessen, dass eine gewisse Resignation und Verdrängung stattfindet, die sozialen Rückzug und Gefühle von Verlust, Schuld und Minderwertigkeit hervorruft. Folgende Beispiele verdeutlichen das seelische Befinden der Mütter:
-
hörbehinderte Mutter: „Verständigungsprobleme mit anderen Mitmenschen, waren genervt, wenn man öfters nachfragte. Ich habe mich oft zurückgezogen und mein Selbstbewusstsein war gleich null.“ (106 Sinnesbehinderung);
-
Mutter mit Morbus Crohn: „Ziehe mich sehr viel in meine eigenen vier Wände zurück, da es eh keiner versteht!“ (306 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung);
-
Mutter nach Lebertransplantation: „Ich konnte gelegentlich nicht so aktiv mit meinen Kindern sein, Lehrer verstanden diese Abwesenheit nicht. Schuldgefühle, Gewissensbisse quälten mich, Verteidigungshaltung war die Folge und Angst, die Kinder müssen darunter leiden.“ (405 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung);
-
Mutter mit Morbus Bechterew: „Ich kann aufgrund meiner ständigen Schmerzen meine Tochter nicht mehr hochnehmen oder so viel mit ihr rumtoben. Sie vermisst das und fragt immer, ob es mir auch mal besser geht – so wie anderen Muttis“ (304 Mehrfachbehinderung);
-
kleinwüchsige Mutter: „Mein Sohn hat sich etwas zurückgezogen gehabt und wollte es mir auch nicht gleich erzählen. Er kommt damit nicht klar, dass andere Kinder lachen über mich, er wollte dann nicht mehr, dass ich ihn bis in die Schule rein bringe.“ (001 Körperbehinderung).
Ein intensiver Austausch mit Gleichbetroffenen oder auch Nichtbetroffenen könnte sicher helfen, Verständnis für die Situation des anderen aufzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen. Denn Ausgrenzung ist nicht allein ein Phänomen zwischen unterschiedlichen Gruppen, wie diese körperbehinderte Mutter schreibt: „Aufgrund des Kindes haben einige meiner Freunde sich von mir getrennt. Vor allem seitens der Behinderten selbst erlebe ich mehr Ausgrenzung als von den Nichtbehinderten.“ (708 Körperbehinderung).
Ein weiterer Punkt, der in der Literatur immer wieder kritisch diskutiert wird, ist die Erziehungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Aufgrund ihrer Beeinträchtigung seien sie oftmals nicht in der Lage, adäquat auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen oder sie zu versorgen. Dass auch diese Mütter liebevoll und einfühlsam mit ihren Kindern umgehen, zeigen die Ergebnisse unserer Studie (Tabelle 18). „Ich behandle mein Kind mit Liebe und Respekt“ (110 Sinnesbehinderung) oder „liebvoller, fantasievoller Umgang mit dem Kind, dem Kind Sicherheit und Geborgenheit geben“ (604 Körperbehinderung) waren einige der häufigsten Antworten auf die Frage, was ihnen in der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder besonders gut gelänge. Dem Erziehungsstil der emotionalen Nähe folgt an 2. Stelle die Zeit und Geduld, die den Kindern entgegen gebracht wird: „Ich erledige meine Arbeiten im Haushalt der Reihe nach, ich setze Prioritäten und lasse ggf. auch Arbeiten liegen. Die Bedürfnisse meiner Kinder stehen an erster Stelle.“ (704 Körperbehinderung) oder „Geschichten erzählen und vorlesen, gemeinsam backen und kochen und malen/basteln.“ (108 Sinnesbehinderung).
| Erziehungsstile | % | Welche Behinderungsgruppen besonders? |
|---|---|---|
| Liebe | 77% | 37% |
| Zeit | 73% | 33% |
| Fürsorge | 4% | 4% |
| Grenzen | 9% | 36% |
| Erziehungsziele | ||
| Werteerziehung | 57% | 31% |
| Selbständigkeit | 37% | 21% |
| Kreativität, Sport & Bildung | 19% | 9% |
„Habe es vielleicht gerade durch meine Behinderung geschafft, meine Kinder zu selbständigen Mensch zu erziehen, welche nicht die Augen davor verschließen, Menschen mit Behinderung zu helfen.“ (602 Körperbehinderung) ist das Beispiel einer körperbehinderten Mutter für die Vermittlung von Eigenständigkeit und humanitärem Handeln. Andere Mütter bringen ihre pädagogischen Vorstellungen für zwischenmenschliches Verhalten wie folgt zum Ausdruck: „Verständnis für Menschen mit Behinderung aufbringen und Hilfsbereitschaft sowie Engagement fördern“ (101 Sinnesbehinderung), „Toleranz, Gesprächsbereitschaft“ (208 Sinnesbehinderung) und „Herzensbildung, Bildung von Gerechtigkeitssinn“ (305 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung). Die kreative Erziehung erfolgt meist im musischen und im sprachlichen Bereich, verbunden mit sportlichen Aktivitäten.
Auf der anderen Seite haben die befragten Mütter auch einen Blick dafür, was ihnen in der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder nicht so gut gelingt. Die folgende Übersicht verdeutlicht die unterschiedlichen Problemfelder und Schwierigkeiten, die von den Müttern berichtet wurden, unterteilt nach Behinderungs-/Erkrankungsgruppe.
-
Sehbehinderte: Situationen richtig einzuschätzen, Teilhabe an Aktivitäten
-
Hörbehinderte: Verständigungsprobleme, Autoritätsprobleme, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
-
Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankung: fehlende Unterstützung durch den Partner, Beziehung Mutter-Kind, konsequentes Verhalten, körperliche und psychische Grenzen, Teilhabe an Aktivitäten
-
Neurologische Erkrankung: Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Teilhabe an Aktivitäten, Gefühl von Hilflosigkeit
-
Körperbehinderung: Sport- und Freizeitaktivitäten, körperliche Grenzen, Autoritätsprobleme, Vereinbarkeit Familie und Beruf
-
Geistige Behinderung: Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
-
Psychische Behinderung: konsequentes Verhalten, psychische Grenzen, finanzielle Probleme
-
Mehrfachbehinderung: konsequentes Verhalten, psychische Grenzen, finanzielle Probleme, Teilhabe an Aktivitäten, Überbehütung, fehlende Unterstützung durch den Partner, Abwesenheit durch KH-Aufenthalte
Einige dieser Beispiele wie inkonsequentes Verhalten, fehlende Unterstützung durch den Partner, finanzielle Probleme oder Unvereinbarkeit von Familie und Beruf lassen sich als nichtbehindertenspezifisch identifizieren und sind alltägliche Belastungen für sehr breite Bevölkerungsschichten. Die eingeschränkte Teilhabe an Aktivitäten, Verständigungsprobleme, das schnelle Erreichen körperlicher und psychischer Belastungsgrenzen oder die Abwesenheit durch Krankenhausaufenthalte hingegen sind typische Beispiele aus dem Alltag von behinderten/chronisch kranken Menschen, wie sie auch in der Literatur und im Kapitel 4.2.4.4 unter als schwierig erlebte Situationen innerhalb der Kindertageseinrichtungen beschrieben werden. Dass diese Schwierigkeiten z.T. weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung des Kindes haben können, verdeutlicht das Beispiel einer an MS erkrankten Frau: „Ich bin manchmal einfach nicht in der Lage, ihn so zu versorgen, wie es einem Kind in dem Alter zukommen sollte. Dadurch vertauschen sich oft die Rollen und er übernimmt die Aufgaben, wird also zum ‚Beschützer’. Ich bin mir nicht sicher, ob das seiner Persönlichkeitsentwicklung immer gut tut. Ich habe den Eindruck, dass mein Sohn ZU früh erwachsen werden MUSS. Deshalb mache ich mir mitunter Sorgen.“ (509 Neurologische Erkrankung).
An dieser Stelle müssen Entlastungsangebote für die Eltern und für die Kinder greifen, um einerseits die Fähigkeit der Eltern als Vormund und Hauptbezugsperson zu erhalten und andererseits Defizite im kindlichen Erleben durch kindgerechte Aktivitäten und Schutzräume zu gewährleisten.
Für das gegenseitige Verständnis für die Situation des anderen ist die Kommunikation innerhalb der Familie unumgänglich. Viele Kinder fangen ab einem gewissen Alter meist von selbst an, ihren Eltern Fragen zur Behinderung/Erkrankung zu stellen. In unserer Befragung waren dies insgesamt 55,1% der Kinder, am seltensten Kinder von Müttern mit geistiger, körperlicher und Mehrfachbehinderung sowie neurologischer Erkrankung. Das Alter der Kinder lag bei durchschnittlich sieben Jahren, allerdings reicht die Altersspanne von zwei bis 19 Jahren. Die Fragen der Kinder lassen sich in folgende Kategorien einteilen (Tabelle 19):
| Interesse des Kindes | % | Welche Behinderungsgruppen besonders? |
|---|---|---|
| Ursache (warum, wie passiert) |
24,5 |
Psychische Erkrankung „Warum weint Mutti?“ (909 Psychische Erkrankung) |
| Verlauf (wie geht´s weiter, Heilbarkeit) |
20,4 |
Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung „ob man daran sterben kann, ob ich wieder gesund werde“ (1012 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung) |
| Symptome (wie zeigt sich die Krankheit/Behinderung, wie ist der Umgang damit) |
17,3 |
Sinnesbehinderung, Körperbehinderung „ob es weh getan hat und ob es noch weh tut“ (610 Körperbehinderung) |
| Vererbbarkeit |
5,1 |
„ob die Kinder das auch kriegen können, ob der Nachbar das auch hat“ (601 Körperbehinderung) |
Drei der Kinder fragten weder nach Ursache, Verlauf oder Symptomen der Behinderung/ Erkrankung, sondern boten ihren Müttern konkrete Hilfe an, indem z.B. eine Tochter fragte: „Was sie tun soll, wie sie mir im akuten Fall helfen kann.“ (504 Neurologische Erkrankung). Insgesamt zeigt sich, dass die Kinder großes Interesse an der Behinderung/Erkrankung ihrer Mütter zeigen und die Auseinandersetzung mit der Thematik wichtig für das gegenseitige Verständnis und das Verstehen von Zusammenhängen und Abläufen ist.
Peer Counseling bietet heutzutage ein wichtiges Unterstützungspotential im Bereich der Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Ähnlich verhält es sich auch mit Ratschlägen, Tipps und Tricks, die betroffenen Mütter an zukünftige Schwangere oder Mütter weitergeben können. Die Hinweise, die die Mütter aus heutiger Sicht in Bezug auf Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt sowie für die erste Zeit nach der Geburt des Kindes geben können, gliedern sich dabei in zwei Bereiche: auf der einen Seite die allgemeinen Tipps, die das soziale Umfeld und das eigene Erleben betreffen und auf der anderen Seite die medizinischen Empfehlungen.
-
frühzeitig Kontakte knüpfen, geeignetes medizinisches Personal suchen (n=8) „Es ist wichtig eine gute ruhige und erfahrene Hebamme als Begleitung zu haben“ (305 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung); „vorher Infos einholen, wo bereits Erfahrungen mit behinderten Müttern bestehen“ (009 Körperbehinderung) „Gynäkologe/Fachpersonal, welches auf ‚Bedürfnisse’ eingehen will und kann“ (208 Sinnesbehinderung).
-
Inanspruchnahme an Vorsorgeuntersuchungen(n=5) „alle Arzttermine wahrzunehmen und wenn möglich alle kostenfreien Untersuchungen machen zu lassen“ (304 Mehrfachbehinderung) „nicht zuviel Diagnostik (pränatal)“ (206 Sinnesbehinderung)
-
(erbliche und erkrankungsbedingte) Risiken abzuklären(n=5) „behandelnde Ärzte unbedingt auf bestehende chronische Erkrankungen hinweisen u. darauf drängen, dass sie schriftlich im Mutterpass o.ä. vermerkt wird, besonders dann, wie bei meiner Person, wenn die Krankheit äußerlich nicht anzusehen bzw. zu bemerken ist, aber doch erhebliche Einschränkungen vorhanden sind!“ (704 Körperbehinderung).
Auf der individuellen Seite fallen die Empfehlungen und Ratschläge noch vielfältiger aus. Eingeteilt in Kategorien und untermalt mit prägnanten Beispielen zeigen sie den breiten Erfahrungsschatz behinderter und chronisch kranker Mütter (Abbildung 8).
Abbildung 8. Abbildung 8: Empfehlung an behinderte/chronisch kranke Schwangere oder Frauen mit Kinderwunsch (Absolutzahlen)
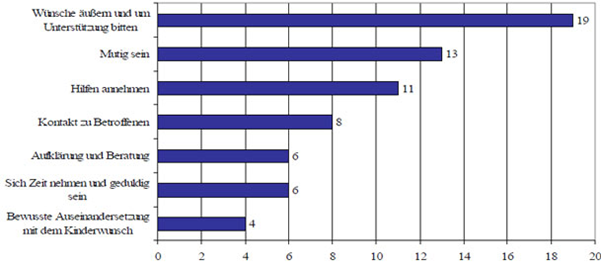
-
Wünsche äußern und um Unterstützung bitten (n=19)
„Einrichtungen wie Caritas, Eltern, Freunde um Unterstützung bitten. Wir sind alle Menschen mit großen oder/und kleinen Problemen, deshalb sind andere da, um zu unterstützen!“ (108 Sinnesbehinderung) „sich gegen zu viel Hilfe und Einmischung abgrenzen, Unterstützungsbedarf klar benennen und organisieren“ (701 Körperbehinderung) „offensives Umgehen hilft auch den Helfern“ (503 Mehrfachbehinderung)
-
mutig sein (n=13)
„vom Kinderwunsch nicht abbringen lassen“ (207 Sinnesbehinderung) „positives Denken, auf sich selbst hören und nicht über tausend Ratschschläge anderer mehr nachdenken als über die eigenen Gedanken.“ (511 Neurologische Erkrankung) „einfach anfangen und sehen, was wirklich ein Problem ist, vieles funktioniert ganz unproblematisch, worüber man sich erst Gedanken macht, dann plötzlich klemmt es an Stellen, wo man´s nicht ahnte, spontane Lösungen suchen und finden, seinen eigenen Rhythmus finden“ (701 Körperbehinderung)
-
Hilfen annehmen (n=11)
„Man muss nicht immer stark sein. Es ist keine Schande, dass die Kinder merken, dass Mama nicht perfekt ist. Sie wachsen damit auf und profitieren davon, auf Menschen mit Einschränkungen Rücksicht zu nehmen. Man sollte sich über mögliche Hilfen informieren und diese in Anspruch nehmen, anstatt sich jahrelang einzuigeln und aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Die schwierigste Aufgabe stellt der Lehrmeister nur seinen besten Schülern.“ (201 Mehrfachbehinderung) „Ich würde aber auf jeden Fall jeder Schwangeren, behinderten Frau empfehlen, alle Rechte die ihr zustehen zu nutzen und auf keinen Fall auf irgendetwas zu verzichten was zu ihrem Wohle und dem des Kindes beiträgt. Sie sollen Hilfsangebote annehmen.“ (1022 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung)
-
Kontakt zu Betroffenen (n=8)
„sich Leute suchen, die ähnliche Probleme und Sorgen haben“ (904 Psychische Erkrankung)
-
Aufklärung und Beratung (n=6)
„rechtzeitig Informationen besorgen“ (903 Psychische Erkrankung)
-
sich Zeit nehmen und geduldig sein (n=6)
„sich selbst annehmen, nicht verzweifeln, wenn etwas nicht so schnell oder so gut geht“ (601 Körperbehinderung)
-
bewusste Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch (n=4)
„vorher darüber im Klaren sein, dass sich der eigene Gesundheitszustand verschlechtern kann, Schwangerschaft nur dann, wenn Partnerschaft funktioniert und beständig ist, stabiles Familiengefüge ist Voraussetzung für allseitige Entwicklung des Kindes“ (612 Körperbehinderung)
Um Überforderungssituationen zu vermeiden, ist das Benennen und Annehmen von Unterstützungsleistungen eine wichtige Voraussetzung. Das können die Mütter unserer Befragung so auch bestätigen. Austausch und Informationsvielfalt für basisrelevantes Wissen dienen der Optimierung und Stabilisierung der Elternschaft, ebenso ruhiges und geduldiges Verhalten gerade in neuen und ungewohnten Situationen. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch ist eine Empfehlung, die sich nicht nur an behinderte und chronisch kranke Menschen gerichtet sein sollte, sondern an alle Personen im fertilen Alter.
Des Weiteren wurden von den Befragten noch sehr konkrete Handlungsempfehlungen gegeben: Sehbehinderte Mutter: „Stillen mind. 6 Monate, dann aus Trinktasse trinken lernen. So muss keine Flaschenmahlzeit abgemessen werden.“ (209 Sinnesbehinderung)
Sehbehinderte Mutter: „Sich ausführlich Griffe zeigen zu lassen, wie man z.B. stillt, wie man wickelt, das Kind anzieht usw. Wenn möglich, eine Beleghebamme nehmen, an einer Puppe üben, bevor das Kind zur Welt kommt. Das erleichtert es für später und nimmt die Angst. Wenn möglich Kind viel tragen, anstatt es im Kinderwagen zu fahren. Wenn die Atmosphäre stimmt, dann im Krankenhaus bleiben und keine ambulante Entbindung. Man hat dann vor allem beim 2. Kind Zeit es kennenzulernen.“ (004 Sinnesbehinderung)
Körperbehinderte Mutter: „Schon vor einer Schwangerschaft sich (am besten bei Behinderten mit gleicher Behinderung) danach erkundigen, wie der Körper auf eine Schwangerschaft reagiert (z. B. Prothesen passen nicht mehr wegen Wassereinlagerung); rechtzeitig dafür sorgen, dass nach der Geburt Hilfe bereit steht, z.B. für Einkaufen...“ (610 Körperbehinderung)
Tumorerkrankte Mutter: „Vor der Entbindung klären, wer bei der Babybetreuung die ersten Wochen mithilft! Haushaltshilfe oder Familienangehörige, Urlaub planen...“ (1003 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung)
Im weiteren Verlauf der Elternschaft treten andere Aufgaben und Herausforderungen in den Vordergrund, die neue Probleme und Schwierigkeiten mit sich bringen können. Dabei spielt die Akzeptanz der eigenen Behinderung/Erkrankung eine wesentliche Rolle. Für einen Teil der Mütter scheint die Behinderung/Erkrankung keine Auswirkung auf ihr alltägliches Leben zu haben oder es findet keine Beschäftigung damit statt: „Ich habe seit fast 13 Jahren Multiple Sklerose, diese verläuft schubartig. Ich bin „nur“ chronisch krank. Diese Erkrankung steht in meinem Leben nicht im Vordergrund. Ich habe keine Behinderungen. Der letzte Schub war im Januar `08. Auch in dieser Zeit konnte ich mich immer um mein Kind kümmern.“ (511 Neurologische Erkrankung) . Dies ist eher möglich bei Behinderungen/Erkrankungen, die sich auf den ersten Blick nicht bemerkbar machen oder nur geringe Einschränkungen hervorrufen. Das dürfte für einen Großteil der Mütter nicht zutreffen. Deshalb gehen die Erfahrungen der Mütter entweder in Richtung Auseinandersetzung mit der Behinderung/Erkrankung und ein offener Umgang damit oder in Richtung Verdrängung und Verheimlichung.
| Akzeptanz der Behinderung/Erkrankung | Negierung der Behinderung/Erkrankung |
|
„wichtig ist im Nachhinein betrachtet, dass es leichter ist, mit der Behinderung zu leben, wenn man dazu steht“ (105 Mehrfachbehinderung)„Je offener der Umgang mit der Krankheit und Behinderung, desto geringer Distanz zur ‚Normalwelt’, Unbefangenheit der Mitmenschen größer.“ (901 Psychische Erkrankung) |
„Mein Problem ist, dass viele von meiner Krankheit nichts wissen, da ich ungern darüber spreche. Somit kann mir auch nicht die richtige Unterstützung widerfahren. Das jedoch liegt allein an mir.“ (207 Sinnesbehinderung)„Ich habe trotzdem in vielen Situationen das Gefühl, dass man mir meine Behinderung ansieht und fühle mich deshalb unwohl und habe Angst, auf die Leute zuzugehen.“ (609 Körperbehinderung) |
Der offene Umgang mit der Behinderung/Erkrankung verdeutlicht nicht nur die Wichtigkeit für die betreffende Person selbst, sondern auch für deren Gegenüber. Die behinderte/erkrankte Person kann mit ihrem Selbstverständnis Normalität vermitteln, was es ihrem Umfeld erleichtert, mit ungewohnten Situationen umzugehen, Berührungsängste abzubauen und Unterstützungsleistungen zu erbringen. Dies wiederum ist ein wichtiger Schritt in Richtung Antidiskriminierung und Integration.
Das folgende Zitat widerspiegelt noch einmal das gleiche Recht und die gleichen Fähigkeiten zur Mutterschaft, unabhängig von einer Behinderung oder chronischen Erkrankung: „Elternschaft ist für einen behinderten Menschen genauso beglückend und anstrengend wie für einen nicht Behinderten. Behinderung ist (zumindest in meinem Fall) kein Argument gegen Elternschaft.“ (610 Körperbehinderung)
Für die Bewältigung der alltäglichen Aufgaben und Hürden gaben die befragten Mütter eine Reihe an Wünschen und Ideen, wie das Leben als behinderte/chronisch kranke Mutter besser unterstützt und entlastet werden könnte (Abbildung 9).
-
Bürokratieabbau und finanzielle Entlastung
Bei der (meist finanziellen) Unterstützung durch Ämter und Behörden wünschen sich die Frauen in erster Linie einen Abbau der bürokratischen Hürden: „Ich wünsche mir weniger Bürokratie auf den Ämtern. Ich habe zu oft den Eindruck, zunächst als „Sozialschmarotzer“ und Simulant abgestempelt zu werden (zumal ich keine Hilfsmittel Rollstuhl bzw. andere Gehhilfe besitze), d. h. Anträge werden zuerst prinzipiell abgelehnt. Nach einem Widerspruch wird ihnen aber statt gegeben, ohne dass ich erneut „überprüft“ werde. Ich habe beobachtet, dass dieses Vorgehen viele Behinderte trifft (z. B. Internetforen)“ (509 Neurologische Erkrankung). Als Unterstützung würden es die befragten Mütter zudem empfinden, wenn sie finanziell entlastet werden würden, z.B. steuerlich, bei der Zuzahlung zu Medikamenten, Therapien, Hilfsmitteln und Assistenzen bis hin zur „Bezahlung von alternativen Behandlungsmöglichkeiten, um Folgeschäden durch Dauereinnahme von Medikamenten zu verringern“ (603 Körperbehinderung). Wie auch schon in Kapitel 4.2.4.3 angeklungen, richten sich die Wünsche behinderter/chronisch kranker Frauen in Ämter und Behörden betreffenden Angelegenheiten auf mehr Verständnis für die individuellen Bedarfe und Lebenslagen, auf eine größere Informationsvielfalt in Bezug auf Unterstützungsmöglichkeiten und auf eine Entlastung im bürokratischen Sinne.
-
Ärztliche und therapeutische Versorgung
Die medizinische Versorgung könnte dahingehend ausgebaut und umstrukturiert werden, dass umfangreichere Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten vorhanden wären im Sinne von: „mehr Spielräume für Ärzte bei der Behandlung, mehr Akzeptanz bei Krankenkassen für das Krankheitsbild“ (601 Körperbehinderung). Neben einem breiteren Therapieangebot und einem unbürokratischem Verfahren wünschen sich manche Mütter spezielle Unterstützung für ihre Kinder: „Es müsste vielleicht mehr Hilfe für die Kinder geben, z.B. in Form von Gesprächen mit geschultem Personal, um den Kindern oftmals auch die Angst vor der Erkrankung der Mutter zu nehmen.“ (1022 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung). Gleichzeitig besteht der Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung der medizinischen Fachkräfte untereinander sowie mit Krankenkassen und Rententrägern.
-
Alltagsentlastung und Betreuungsmöglichkeiten
„Ich brauche für viele Dinge im Haushalt wesentlich länger und habe dadurch weniger Zeit und Kraft für meine Kinder“ (201 Mehrfachbehinderung). Die Vorstellungen zu einer Unterstützung im Haushalt in Form einer Haushaltshilfe werden ergänzt durch den Wunsch nach Assistenzen und der Weiterentwicklung von Hilfsmitteln: „Hilfsmittel mit Rollen zu versehen. Manche Sachen stabiler zu bauen (Hochstuhl, Wickeltisch usw.)“ (706 Körperbehinderung). Besonders der flexible und zeitnahe Einsatz von Assistenten kann in bestimmten Situationen sinnvoll und hilfreich sein, z.B. beim Schlittenfahren im Winter. Ein Lösungsansatz wäre das Recht auf Elternassistenz: „So könnte man z. B. besser alleine Ausflüge mit den Kindern machen. Es wäre dann auch leichter die passende Hilfe zu bekommen, denn bisher könnte man z. B. wenn man Hilfe braucht, nur über ehrenamtliche Hilfen Begleitpersonen bekommen. Will man offizielle behördliche Unterstützung, z. B. durch das Jugendamt, so kann man bisher nur über das Kindeswohl argumentieren, was ja eigentlich nicht stimmt und was gegebenenfalls kontraproduktiv wäre. Denn die Kinder brauchen keine Hilfe bei der Erziehung, weil ihre Eltern behindert sind, sondern z. B. ich selbst brauche Unterstützung bei der Aufsicht der Kinder...“ (004 Sinnesbehinderung).
-
Beratung und Austausch
Die Aufklärung über Rechte und Pflichten erscheint vielen behinderten/chronisch kranken Mütter noch zu ungenügend: „Die Ämter und Behörden müssen viel mehr auf die Leute zugehen. Wir Behinderten sind schlecht auf unsere Rechte aufgeklärt und welche Unterstützung uns zusteht.“ (304 Mehrfachbehinderung). Hilfreich wäre in diesem Falle z.B. eine „Anlaufstellen für Schwangere, die spezielle Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten behinderter/chronisch kranker Eltern geben und von denen man schnell erfährt, wenn es mit dem Baby gesundheitliche Probleme gibt (führt nicht zu starker Verschlimmerung der eigenen Krankheit); Anlaufstelle mit Infos über Hilfemöglichkeiten. Ein Merkblatt mit den größten und wichtigsten Informationsmöglichkeiten, das z. B. Internetadressen und Kontaktmöglichkeiten aufzeigt, wäre schön. Gleich bei Schwangerschaft zu überreichen. Dies sollte in jeder Hebammen u. Arztpraxis ausliegen und in Familienämtern“ (615 Mehrfachbehinderung). Selbsthilfegruppen sind bereits gute Anlaufstellen, jedoch nicht immer dem Alter und den Bedürfnissen von Müttern mit minderjährigen Kindern entsprechend.
-
Aufklärung und Sensibilisierung
Die Öffentlichkeit über Krankheitsbilder, -ursachen und -verläufe zu informieren dient der allgemeinen Aufklärung und dem respektvollen Miteinander, z.B. durch Artikel in Printmedien. Adressaten sind nicht nur die Gesellschaft allgemein, sondern auch Menschen, deren Verständnis man zu erhalten glaubt, da man alltäglich mit ihnen verkehrt. Eine Mutter wünschte sich daher die „Schulung und Sensibilisierung von medizinischem Personal, Lehrern und Erziehern“ (009 Körperbehinderung). Besonders psychisch kranke Personen sind von Stigmatisierungen betroffen und wünschen sich mehr Verständnis für die Erkrankung: „Weiterhin sollte mehr Rücksicht auf die psychischen Probleme, die eben aus Mangelkenntnissen entstehen, Rücksicht genommen werden. Aufklärung für Gesunde tut hier Not.“ (405 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung).
-
Integration ins Arbeitsleben
Trotz der Gesetzesgrundlage des SGB IX zur Gleichstellung und Chancengleichheit schwerbehinderter Menschen fühlen sich viele Betroffene nach wie vor ausgegrenzt, „da viele Betriebe trotz staatlicher Fördermittel keine Behinderten nehmen“ (609 Körperbehinderung). Hier ist von staatlicher Seite Handlungsbedarf gefordert. Doch nicht nur Gleichberechtigung wünschen sich die befragten Mütter, auch Möglichkeiten der beruflichen Integration mit Erkrankung/Behinderung im Sinne von: „Arbeitsmöglichkeiten entsprechend der persönlichen Situation/Erkrankung; Hinzuverdienstmöglichkeiten“ (901 Psychische Erkrankung), um einer Isolation und finanziellen Problemlagen entgegenzuwirken.
-
Barrierefreiheit
„Barrierefreiheit in Arztpraxen, Kindergärten, Schulen“ (701 Körperbehinderung) bezieht sich in erster Linie auf den Abbau räumlicher Barrieren, integriert aber auch kommunikative Barrieren für hör- und sehgeschädigte Personen, wie z.B. den flexiblen Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers in dringenden Angelegenheiten.
Die hier genannten Wünsche relativieren zum Teil die hohe Zufriedenheit mit Ämtern, medizinischen und Kindereinrichtungen. Sie verweisen auf bestehenden Forschungs- und Handlungsbedarf, um bisher vorliegende Erkenntnisse weiter auszubauen und Eltern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen bessere Teilhabechancen ermöglichen zu können.
Obwohl aus der Screeningbefragung eindeutig hervor ging, dass sich die vertiefende Studie mit dem Thema Behinderung und Mutterschaft befassen wird, erklärten sich 60 Frauen ohne Kinder bereit, an diesen vertiefenden Interviews teilzunehmen. Das bewog uns, die Thematik zu erweitern und Frauen mit unerfülltem bzw. ohne Kinderwunsch in die Studie aufzunehmen und dazu einen eigenen Fragebogen zu entwickeln. Nach Vorliegen der Ergebnisse erwies sich dieses Vorgehen als sinnvoll, da damit weitere wichtige Informationen zur Situation behinderter und chronisch kranker Frauen in Bezug auf Partnerschaft und Familie gewonnen werden konnten.
Innerhalb der 2. Befragungswelle konnten 45 Frauen mit einem Grad der Behinderung von GdB 50 und mehr erreicht werden. Körperbehinderte Frauen stellten dabei den größten Anteil mit 38%, während die Gruppen der Frauen mit geistigen Behinderungen oder mit Mehrfachbehinderungen nur sehr schwer zu erreichen waren. Dies mag in der erschwerten Wahrnehmung des Anliegens der Befragung liegen oder begründet sich in der abweisenden Haltung der Betreuer oder der Familienangehörigen. Es setzt das Engagement seitens des Betreuers voraus, sich auch mit den komplizierten Fragestellungen von Kinderwunsch, Partnerschaft und Sexualität innerhalb der Biographie der zu betreuenden Person auseinanderzusetzen. Diese Annahme verstärkt sich durch die Aussagen von Experten im Rahmen der Workshops, die in Kapitel 4.6 beschrieben werden.
Es erfolgte eine Unterteilung der Frauen nach dem Zeitpunkt der Erkrankung oder des Eintritts der Behinderung. Die Auseinandersetzung mit einem geschlechtsspezifischen Rollenverhalten und den Fragen von Kinderwunsch, Fortpflanzung und Sexualität ist mit dem Beginn der Pubertät einzuordnen, daher gab es eine Gruppe „von Kindheit an behindert/erkrankt“ und eine Gruppe „seit dem Jugendalter behindert/erkrankt“. Somit gab es 23 früherkrankte und 22 späterkrankte Teilnehmerinnen.
Der Zugang zu Bildung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben. Bildungsabschlüsse entscheiden nicht nur über die zukünftige berufliche Situation, sondern befähigen auch zur Informationsbeschaffung und Inanspruchnahme von Rechten, die besonders bei Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen von großer Bedeutung sind. Die Bildungsabschlüsse der Frauen mit und ohne Kinder, unterteilt nach dem Zeitpunkt der Erkrankung/Behinderung, stellt Abbildung 10 dar.
Der größte Teil der früherkrankten Frauen ohne Kinder verfügte über einen Haupt- oder Förderschulabschluss oder sie gaben keinen Schulabschluss an. Von den späterkrankten Frauen erreichte der größte Teil den Realschulabschluss oder das (Fach-)Abitur. Damit haben fast doppelt so viele befragte Frauen aus dieser Gruppe gegenüber der Gruppe der Früherkrankten einen qualifizierten Schulabschluss erreicht. Bei den Frauen, die ihren Kinderwunsch realisiert haben, zeigt sich dieser Unterschied nicht. Es handelt sich bei den kinderlosen Frauen um einen signifikanten Unterschied (Kendall´s tau p = .035). Mit Hilfe einer logistischen Regressionsanalyse lässt sich zudem vorhersagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Frau mit mittlerem oder hohem Bildungsabschluss ist, Kinder zu bekommen im Vergleich zu Frauen mit einem geringen Abschluss. Bei Frauen mit mittlerer Reife liegt die Wahrscheinlichkeit 3,5-fach höher (p = .010; Konfidenzintervall 1.345 – 9.256), bei Frauen mit (Fach-)Abitur 3,9-fach höher (p = .015; Konfidenzintervall 1.309 – 11.620) Mutter zu werden als bei Frauen ohne Abschluss oder mit Förder- und Hauptschulabschluss. Der Zusammenhang zwischen akademischer Ausbildung und Kinderlosigkeit, wie er in der Allgemeinbevölkerung zu verzeichnen ist, scheint sich bei Frauen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen umzukehren.
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Kinder ohne Behinderungen oder chronische Erkrankungen bisher einen anderen Zugang zu Bildungsangeboten hatten. Die Konzepte der integrierten Schulen werden erst in den nächsten Jahren zeigen, ob mittels pädagogischer Integration die Chancengleichheit im Bildungsabschluss erreicht wird. Der Unterschied zwischen den Müttern und den kinderlosen Frauen könnte aber ebenso ein Hinweis darauf sein, dass gut ausgebildete Personen über mehr Möglichkeiten verfügen, ihren Kinderwunsch zu realisieren, z.B. Informationsbeschaffung, Risikoabwägung, Alternativkonzepte, Kommunikationsstrukturen.
Die berufliche Situation weist zwischen den Müttern und den kinderlosen Frauen sehr deutliche Unterschiede auf (Abbildung 11). Die Anteile von Erwerbsunfähigkeitsrentnerinnen und Teil- bzw. Vollzeitbeschäftigten kehren sich in den beiden Gruppen jeweils um.
In Bezug auf den Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung/Erkrankung finden sich unter den kinderlosen Frauen keine nennenswerten Unterschiede. Bei den Müttern hingegen sind von denjenigen, die bereits zur Geburt ihres 1. Kindes erkrankt oder behinderte waren, etwas weniger vollzeitbeschäftigt und häufiger in Elternzeit bzw. Hausfrau.
Innerhalb der Erkrankungs-/Behinderungsgruppen der kinderlosen Frauen gehen körperbehinderte Frauen am häufigsten einer Erwerbstätigkeit nach, während psychisch kranke und geistig behinderte Frauen am ehesten EU-Rente beziehen. Bei den Müttern gehen am häufigsten körper- und sinnesbehinderte Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach, eine EU-Rente beziehen am häufigsten die psychisch kranken Mütter. Die Vermutung, dass ein höherer Grad der Behinderung mit einer Zunahme des EU-Rentenbezugs einhergeht, lässt sich an dieser Stelle nicht bestätigen. Gleichzeitig lässt es die Vermutung zu, dass nicht ausschließlich die Art oder die Schwere der Erkrankung/Behinderung über die Arbeitsfähigkeit entscheidet, sondern das subjektive Erleben der Einschränkungen aufgrund der Behinderung oder Erkrankung einen Einfluss haben kann. Stigmatisierungsängste und sozialer Rückzug von psychisch kranken Menschen könnten z.B. ein Hinderungsgrund für eine Teilnahme am Erwerbsleben sein.
Eine weitere Vermutung für den hohen Anteil an erwerbslosen Personen ist die immer noch zu geringe Bereitschaft der Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Damit ließe sich auch erklären, warum unter den arbeitslosen Müttern am häufigsten sinnes- und mehrfachbehinderte Frauen anzutreffen sind.
Die Existenz einer Partnerschaft ist immer der stärkste Prädiktor für die Realisierung eines Kinderwunschs. In der Literatur (Schopmans 1991, Levc 2008) finden sich immer wieder Hinweise, dass Frauen mit Behinderungen große Schwierigkeiten hätten, einen Partner zu finden. Daher waren uns die Erfahrungen der Frauen in Bezug auf Partnersuche und realisierte Partnerschaften wichtig.
Knapp zwei Drittel der Frauen leben aktuell in einer Partnerschaft, davon signifikant häufiger späterkrankte/-behinderte Frauen als Früherkrankte/-behinderte (χ² p=.022) (Abbildung 12). Der Anteil der verheirateten Frauen liegt mit 20% deutlich darunter. Auch innerhalb der Erkrankungs-/Behinderungsgruppen zeigen sich Unterschiede: Chronisch kranke Frauen leben deutlich häufiger mit einem Partner zusammen als behinderte Frauen. Gleiches gilt für Frauen mit einem GdB von 50 oder 60 im Vergleich zu Frauen mit einem GdB von 90 oder 100 (Phi p=.016). Damit hat sowohl der Zeitpunkt des Eintritts der Erkrankung oder Behinderung, die Schwere als auch die Art der Beeinträchtigung einen signifikanten Einfluss auf die Möglichkeit und Gestaltung einer Paarbeziehung.
Abbildung 12. Abbildung 12: aktuell bestehende Partnerschaft innerhalb der Untersuchungsgruppen (in %)
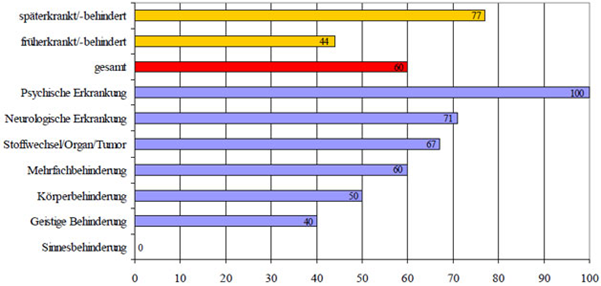
Innerhalb der Partnerschaftsbiographien zeigt sich, dass alle späterkrankten Frauen mindestens einmal in einer festen Partnerschaft gelebt hatten (Abbildung 13). Sechs früherkrankte Frauen hatten noch niemals einen festen Partner. Der Begriff „feste“ Partnerschaft war in der Befragung nicht näher bestimmt, so dass die Definition ausschließlich in der Einschätzung der befragten Personen lag.
Ähnlich sind die Angaben von ein bis zwei festen Partnerschaften in den beiden Vergleichsgruppen. Mehr als doppelt so viele der befragten späterkrankten Frauen beschrieben mehr als drei feste Partnerschaften. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Frauen, deren Erkrankung erst später eingetreten ist, eine Kindheit bzw. Jugend ohne behindertentypische Stigmatisierungen oder Einschränkungen erlebt haben mit einer Orientierung am Rollenverhalten von Frau und Mann, einschließlich der Perspektive als Partnerin und Mutter. Schwierigkeiten bei der Partnersuche lassen sich anhand der Angaben der befragten Frauen nicht feststellen. Ähnlich wie auch nichtbehinderte/gesunde Frauen findet die Partnersuche bei den meisten Befragten innerhalb des unmittelbaren sozialen Netzes statt, d.h. entweder im Freundes- oder Kollegenkreis. Acht Frauen hatten über eine Partnervermittlung Erfolg, wozu Internetforen und Chaträume, Annoncen und Vermittlungsagenturen zählen. Vier weitere Frauen trafen ihre zukünftigen Partner in Sport- und Freizeitvereinen bzw. drei während einer Rehabilitation.
Mit Beginn der Pubertät sind auch die Frauen unserer Studie sexuell aufgeklärt worden. Das durchschnittliche Alter liegt bei 13 Jahren. Frauen, deren Erkrankung oder Behinderung bereits vor der Pubertät eingetreten war, waren durchschnittlich 14,3 Jahre alt, als sie sexuell aufgeklärt wurden. Die Vergleichsgruppe der nach der Pubertät erkrankten/behinderten Frauen beschreibt ein durchschnittliches Aufklärungsalter von 12,6 Jahren. Damit wird eine Differenz von fast zwei Jahren deutlich. Bei den Müttern lag das durchschnittliche Aufklärungsalter unabhängig vom Zeitpunkt der Erkrankung/Behinderung bei 13 Jahren.
Auch bei den Bezugsquellen für Informationen über Sexualität und Partnerschaft existieren Unterschiede. So nennen späterkrankte/-behinderte Frauen ohne Kinder vorwiegend Medien wie Bücher Zeitschriften sowie die Kommunikation mit den Eltern als Basis für das Wissen um Sexualität (Tabelle 17). Früherkrankte/-behinderte Frauen hingegen wurden am ehesten von ihren Eltern und innerhalb sexualpädagogischer Veranstaltungen in der Schule aufgeklärt. Vergleicht man diese Daten mit der Jugendsexualitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dann lässt sich feststellen, dass die Eltern, bei Mädchen vor allem die Mütter, eine bedeutende Rolle im Rahmen der Aufklärung einnehmen: „Am weitaus
häufigsten geben Jugendliche die Mutter als eine wichtige Person bei der Aufklärung über sexuelle Dinge an. 42 % der Jungen und sogar 70 % der Mädchen benennen die Mutter als Hauptinformationsquelle für Aufklärungsthemen.“ (BZgA 2006: 9)
Hier zeigt sich jedoch ein Unterschied zu den Müttern unserer Studie: Während Frauen mit Kindern seltener ihr Elternhaus als Aufklärungsinstanz erlebt haben, scheinen die Eltern für Frauen ohne Kinder eine der Hauptbezugsquellen zu sein (vgl. Kap. 4.2.2.3 und Tabelle 20). Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass die elterliche Informationsvermittlung einen direkten Einfluss darauf hat, ob sich ein Kinderwunsch entwickeln und später dann auch umgesetzt werden kann oder ob behinderte/chronisch kranke Jugendliche, die von ihren Eltern aufgeklärt werden, diesbezügliche eine ablehnende Haltung erfahren. Jugendliche hingegen, die nicht primär durch das eigene Elternhaus sexuell aufgeklärt wurden, könnten sich eher in der Lage sehen, elternunabhängig eine eigene Vorstellung von Familienplanung zu entwickeln. Die Analysen unserer Stichprobe zeigen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen elterlicher Aufklärung und Kinderwunsch, zur Überprüfung der These wären jedoch weitere Forschungsanstrengungen notwendig.
| Informationen über Sexualität und Partnerschaft hauptsächlich durch: | Behinderung/ Erkrankung während der Kindheit | keine Behinderung/ Erkrankung während der Kindheit |
|---|---|---|
| Eltern |
47,8 |
36,4 |
| Geschwister/Verwandte |
8,7 |
4,5 |
| Freunde/peers |
21,7 |
31,8 |
| schulische Veranstaltungen |
39,1 |
18,2 |
| Zeitschriften/Bücher |
17,4 |
36,4 |
| Rundfunk/Fernsehen |
4,3 |
4,5 |
| Gynäkologen |
21,7 |
0 |
Informationen über Sexualität und Partnerschaft hauptsächlich vom Gynäkologen erhalten haben ausschließlich Frauen, die bereits in der Kindheit erkrankten/behindert waren (Tabelle 17). Dabei handelt es sich um je zwei geistig und körperlich behinderte Frauen. Daraus lässt sich ableiten, dass gerade für Frauen mit Behinderungen die vorurteilsfreie, fachspezifische Kommunikation über Sexualität und Partnerschaft beim Gynäkologen eine bedeutende Rolle für die Informationsvermittlung zu diesen sensiblen Themen spielt. Auch die Bedeutung von sexualpädagogischen Angeboten und der Wissensvermittlung innerhalb der Schule wird bei früherkrankten Frauen deutlich, da mehr als doppelt so häufig auch diese Informationsquelle angegeben wird.
Knapp ein Drittel der Frauen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen hat Erfahrungen mit vorzeitig beendeten Schwangerschaften. Davon erlebten vier Frauen eine
Fehlgeburt. Insgesamt elf Frauen hatten einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, davon sechs früherkrankte und fünf späterkrankte Frauen. Eine Häufung innerhalb einer bestimmten Behinderungs-/Erkrankungsgruppe ist nicht feststellbar. Vergleicht man die Angaben mit den Ergebnissen der Studie „frauen leben“, dann zeigt sich, dass der Anteil der behinderten oder chronisch kranken Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen mit 26,7% deutlich über dem bundesweiten Ergebnis von 15% liegt (Helfferich 2002: 283). Die angegeben Gründe orientieren sich sowohl an gesundheitlichen Ängsten durch Medikamenteneinnahme als auch an sozialen Gründen wie z.B. finanziellen Schwierigkeiten. In zwei Fällen wurde Minderjährigkeit als Grund für den Schwangerschaftsabbruch angegeben. So beschreibt eine Teilnehmerin unserer Studie, die seit ihrer Geburt an Epilepsie leidet, dass sie im Alter von 16 Jahren schwanger wurde, die Schwangerschaft aber aufgrund des großen Druckes der Eltern abgebrochen hatte.
Auch bei behinderten und chronisch kranken Frauen ist deutlich ein Kinderwunsch zu spüren. Ca. ¾ der befragten Frauen haben aktuell den Wunsch nach einem Kind oder hatte ihn jemals verspürt (Abbildung 14).
Der Kinderwunsch zeigt sich in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Erkrankung/Behinderung und der Art der Behinderung. Im Vergleich zur etwas mehr als der Hälfte der früherkrankten/- behinderten Frauen äußerten nahezu alle späterkrankten/-behinderten Frauen den Wunsch nach einem Kind (χ² p=.003). Und Frauen mit Körper- oder geistigen Behinderungen verneinten am häufigsten den Wunsch nach einem Kind. Die frühen Erfahrungen mit der Behinderung/Erkrankung und damit verbundene Sozialisationseinflüsse (vgl. Kap. 4.3.3) könnten dabei eine Rolle spielen.
Als Gründe, die einen Kinderwunsch bestärkten, wurde am häufigsten „Ich wollte schon immer ein Kind“ genannt, gefolgt von Erfahrungen im Familien- und Freundeskreis als Motivation für ein eigenes Kind (Tabelle 21). Auf die Rolle des Partners bezogen sich neun Frauen und die Gewissheit, dass Unterstützung im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis vorhanden wäre, wird von fünf Frauen als bestärkender Grund für den Kinderwunsch angegeben.
| PRO Kinderwunsch | n |
|---|---|
|
Ich wollte schon immer ein Kind. |
18 |
|
Erfahrungen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis |
16 |
|
Mein Partner möchte ein Kind. |
9 |
|
Unterstützung im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis |
5 |
| CONTRA Kinderwunsch | |
|
Aufgrund der Erkrankung/Behinderung kann ich kein Kind ausreichend versorgen. |
9 |
|
Ich wollte nie ein Kind haben. |
4 |
|
Mir fehlt ein Partner. |
3 |
|
Ich finde die Versorgung von einem Kind allgemein sehr schwierig. |
3 |
Dem gegenüber stehen die Ablehnungsgründe für ein Kind, welche sich vorrangig an der vorhandenen Behinderung oder der Krankheit orientierten. Dies geht vor allen einher mit der Angst, aufgrund der Erkrankung/Behinderung als Elternteil das Kind nicht ausreichend versorgen zu können. Von drei Frauen wird ein fehlender Partner als Grund für einen fehlenden Kinderwunsch angegeben. Weitere drei der befragten Frauen geben an, dass die Versorgung eines Kindes allgemein sehr schwierig sei.
Das Fehlen eines geeigneten Partners und als ungünstig empfundene berufliche Situationen sind weitere wesentliche Gründe, die eine Realisierung des Kinderwunsches verschieben lassen (Tabelle 22). Hierbei handelt es sich nicht um behinderten- oder erkrankungsspezifische Phänomene, sondern um biographische Varianzen. Gleiches gilt für die Ursache „Es hat noch nicht geklappt.“ bei Auslassen entsprechender empfängnisverhütender Maßnahmen.
| n | ||
|---|---|---|
| Partnerschaftliche Gründe |
Mir fehlt ein Partner. |
8 |
|
Mein Partner möchte nicht. |
1 | |
| Persönliche Gründe |
Es passt beruflich nicht. |
8 |
|
Ich fühle mich noch zu jung für ein Kind. |
2 | |
|
Unpassende Wohnsituation |
2 | |
|
Finanzielle Gründe |
2 | |
| Zeitliche Gründe |
Es hat noch nicht geklappt. |
4 |
| Medizinische Gründe |
Unverträglichkeit/Nebenwirkung der Medikamente |
11 |
| Hohes Vererbungsrisiko | 10 | |
| Aufgrund der Erkrankung ist mir keine ausreichende Versorgung des Kindes möglich. | 7 | |
| Eigene Sterilität/Unfruchtbarkeit | 6 | |
| Sterilität/Impotenz des Mannes | 4 | |
| Sonstige Operationen | 3 |
Bei der Frage, warum bei einem bestehenden Kinderwunsch dieser noch nicht erfüllt wurde, nahmen die medizinischen Bedenken den größten Raum ein. Die Unverträglichkeit der Medikamente oder deren Nebenwirkungen auf eine Schwangerschaft, die Angst vor einer möglichen Vererbung der eigenen Behinderung/Erkrankung, das Unvermögen der Kindschaftssorge sowie Sterilitäten waren die häufigsten Ursachen für einen bisher unerfüllten Kinderwunsch. Inwieweit diese Bedenken konkret von Ärzten oder medizinischem Personal benannt und diskutiert wurden oder ausschließlich aus der Sichtweise der betroffenen Frauen oder Paare resultieren, wurde im Rahmen der Untersuchung nicht näher hinterfragt. Aufklärungsarbeit von Seiten der Mediziner könnte dazu beitragen, Risiken konkret abzuklären und sich mit den Ängsten der Frauen auseinanderzusetzen.
Die Frauen waren daher aufgefordert, ihre Kommunikationspartner zum Thema Familienplanung anzugeben, um zu erfassen, wie wichtig die Fragestellung um Schwangerschaft und ein eigenes Kind für die jeweilige Frau oder das Paar ist. Späterkrankte/-behinderte Frauen kommunizierten fast doppelt so häufig mit ihrem Hausarzt über Schwangerschaft und Kinderwunsch als früherkrankte/-behinderte Frauen, am häufigsten Frauen mit Stoffwechsel-, Organ- und Tumorerkrankungen (Tabelle 23). Die Argumente des Hausarztes reichten von „Es spricht nichts dagegen“ (2708 Körperbehinderung) über „Schlechte Aussichten, aber nicht unmöglich, wegen hoher Schmerzmittelmedikation längere Planung vorweg“ (2609 Körperbehinderung) bis hin zu „zu riskant für mich und Kind“ (2302 Stoffwechsel/Organ/Tumorerkrankung).
| Früherkrankt/ - behindert (in Kindheit, n=23) | Späterkrankt/ - behindert (im Jugendalter, n=21) | Signifikanz | |
|---|---|---|---|
| Ärzte | |||
| Hausarzt |
5 |
9 |
n.s. |
| Gynäkologe |
11 |
16 |
p=.090 |
| Facharzt (Neurologe, Orthopäde) |
7 |
14 |
p=.017 |
| soziales Umfeld | |||
| Eltern |
14 |
12 |
n.s. |
| Geschwister |
5 |
8 |
n.s. |
| Freunde |
9 |
16 |
p=.024 |
| Arbeitskollegen |
2 |
4 |
n.s. |
| Selbsthilfegruppen/Internetforen |
3 |
5 |
n.s. |
| Betreuer |
4 |
1 |
n.s. |
Deutlich mehr Frauen kommunizierten mit ihren niedergelassenen Gynäkologen über ihren Kinderwunsch. Auch hier waren es vorrangig die Späterkrankten/-behinderte und es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Behinderungs-/Erkrankungsgruppen: Für körper- und geistig behinderte Frauen scheint Familienplanung eine zu geringe Relevanz zu haben, als dass sie darüber mit ihrem Gynäkologen kommunizierten. Die gleichen Ergebnisse bringt die Auswertung der Frage nach der Kommunikation mit dem jeweiligen Facharzt. Ob sich dahinter Unsicherheiten oder Desinteresse sowohl von ärztlicher als auch von Patientinnenseite verbergen, lässt sich nur vermuten.
Die Argumente der Gynäkologen verdeutlichen noch einmal das hohe medizinische Risiko, mit dem sich viele behinderte/chronisch kranke Frauen konfrontiert sehen: „Um ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, müssen die Medikamente 3 Jahre abgesetzt werden“ (2603 Mehrfachbehinderung). Eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit den bisherigen Therapien sind oftmals die Voraussetzung für eine risikofreie Schwangerschaft, ebenso die humangenetische Abklärung des Schädigungsrisikos für das Ungeborene „Grundsätzlich könnte ich körperlich Kinder bekommen, schwierig könnte jedoch die Pränataldiagnostik bzgl. einer möglichen Behinderung des Kindes sein.“ (2608 Körperbehinderung). Gleichzeitig sind in den Aussagen der Frauen Unterstützung und Hilfe durch den Gynäkologen zu erkennen, indem der behandelnde Arzt eine Schwangerschaft nicht von vornherein ausschließt, sondern die Kooperation mit relevanten Fachärzten sowie die Einholung notwendiger Informationen anstrebt: „will sich näher informieren, grundsätzlich nicht abgeneigt“ (1103 Körperbehinderung).
Dem gegenüber standen die Kommunikationspartner aus dem sozialen Umfeld wie Eltern, Freunde, Geschwister und Arbeitskollegen. Bis auf die Freunde sind die Unterschiede zwischen den Gruppen „Früherkrankt/-behindert“ und „Späterkrankt/-behindert“ nicht signifikant. Innerhalb der Behinderungs-/Erkrankungsgruppen zeigen sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. Im Ergebnis bedeutet dies, dass späterkrankte/-behinderte Frauen häufiger und in einer größeren Variation der Kommunikationspartner familienplanerische Gespräche führen, d.h. ihre Gedanken und Vorstellungen Dritten gegenüber eher zum Ausdruck bringen als früherkrankte/-behinderte Frauen. Dies könnte bedeuten, dass der Kinderwunsch an sich eine größere Rolle im Lebens dieser Frauen spielt, dass sie auch offen darüber kommunizieren als bei Frauen, die durch ihr Elternhaus, aber auch durch gesellschaftliche Normierungen aufgrund ihrer frühzeitig erworbenen Behinderung/Erkrankung eine Zurückhaltung in Sachen Familiengründung erfuhren.
Als ein medizinisches Unterstützungsangebot bei unerfülltem Kinderwunsch gibt es ein breites Angebot an fertilitätsmedizinischen Maßnahmen. Es liegt die Vermutung nahe, dass Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Versehrtheit im Laufe ihres Lebens eine Reihe von Therapien und Operationen erfahren mussten, medizinischen Eingriffen offen gegenüberstehen. Bis zum Zeitpunkt der Befragung hatten drei Frauen das Expertenwissen einer Kinderwunschsprechstunde genutzt. Lediglich eine Frau verfügte über Erfahrungen mit einem operativen Eingriff, welcher aber nicht näher erläutert wurde. Es handelt sich bei den vier Frauen ausschließlich um stoffwechsel-/organ- oder tumorerkrankte Frauen. Der Anteil an Frauen mit fertilitätsmedizinischen Erfahrungen ist damit sehr klein.
Ein knappes Viertel hingegen kann sich die Wahrnehmung von Fertilitätsmedizin in der Zukunft vorstellen, am häufigsten psychisch kranke Frauen. An erster Stelle steht dabei die Unterstützung im Rahmen einer Kinderwunschsprechstunde. Vier Frauen schilderten, dass sie sich mittels hormoneller Stimulation helfen lassen würden und drei Frauen gaben an, dass sie sich auch einem operativen Eingriff unterziehen würden, um ein eigenes Kind zu bekommen.
Für einen relativ kleinen Teil der Frauen scheint damit Fertilitätsmedizin eine realistische und sinnvolle Maßnahme für die Realisierung des Kinderwunsches zu sein. Der größte Teil der Frauen würde dies jedoch ablehnen.
Wenn sich der Wunsch nach einem eigenen Kind auf natürlichem oder auf assistiertem Weg nicht erfüllen lässt, gibt es durch die Annahme von Pflegekindern und das Verfahren zur Adoption dennoch die Möglichkeit, ein Kind zu versorgen, elterliche Liebe, Verantwortung und die Rolle von Mutter oder Vater wahrzunehmen.
Sowohl eine Pflegschaft als auch eine Adoption können sich mehr späterkrankte/-behinderte Frauen vorstellen als früherkrankte/-behinderte (Abbildung 15). Auch hier sind die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch und der Idee einer eigenen Familie als Ursache dieses Ergebnisses vorstellbar.
Eine Adoption kommt generell für mehr Frauen in Frage als eine Pflegschaft, was sich damit begründet, dass ein Pflegekind eine jederzeit mögliche Endlichkeit der Elternschaft impliziert. Unterschiede gibt es zwischen den Behinderungs-/Erkrankungsgruppen nicht wesentlich, lediglich die geistig behinderten Frauen sind von der Idee eines Pflege-/Adoptivkindes komplett ausgenommen. Ihnen wird in den seltensten Fällen ein eigenes Kind zugetraut, geschweige denn ein adoptiertes.
Expertengespräche führten wir, wie bereits beschrieben, vorrangig mit ärztlichem Personal aus dem Bereich der ambulanten Versorgung behinderter und chronisch kranker Frauen bzw. Eltern. Zur Vorbereitung der Interviews erfolgte die Vorstellung unseres Projektes in der AG Qualitätssicherung in der Geburtshilfe (April 2009) und im Rahmen des 17.
Klinikärztetreffens der Frauen- und Kinderärzte, um deren Unterstützung unseres Projektes zu erreichen (Juni 2009). Im Ergebnis dieser Veranstaltungen sollte analysiert werden, ob die jährlich erhobene Perinatalstatistik Auskunft geben kann über den Anteil behinderter und chronisch kranker Mütter an allen Müttern eines Geburtsjahres sowie über Besonderheiten des Verlaufs von Schwangerschaft, Geburt, kindlichem und mütterlichem Outcome. Deshalb beantragten wir eine Sonderauswertung der Perinatalstatistik der Jahre 2008 und 2009, um die geburtshilflichen Probleme bei der Betreuung behinderter oder chronisch kranker Frauen zu erfassen.
Im Anschluss an die Vorstellung unseres Projektes im Rahmen des Klinikärztetreffens fand ein Gespräch in der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) statt zum Thema Barrierefreiheit der gynäkologischen und pädiatrischen Arztpraxen. Im Ergebnis dieses Gesprächs bekamen wir vertiefende Informationen zum aktuellen Stand und den Problemen bei der Erfassung der Barrierefreiheit. Auch diese Ergebnisse sind im Vergleich zu früheren von uns erhobenen Befunden im folgenden Kapitel dargestellt.
In der offiziellen Berichterstattung der Bundesrepublik finden sich nur wenige Angaben zur Entwicklung der Geburtlichkeit insgesamt und noch weniger zur Situation in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Darauf wurde im Abschnitt 2.1 bereits ausführlich hingewiesen. Auf der Basis der im SGB V §135 ff geforderten Qualitätssicherung im Gesundheitswesen erfassen die Länder die statistischen Angaben zur Qualität der Versorgung in der Geburtshilfe. Die jährlich erfolgende Perinatalberichterstattung liefert eine nahezu lückenlose Erfassung aller im Laufe eines Berichtsjahres in einer stationären Einrichtung geborenen Kinder sowie Daten über den Verlauf der Schwangerschaft, Vorsorgeuntersuchungen, Geburtsart, mütterliche und kindliche Risiken sowie mütterliches und kindliches Outcome. Da repräsentative Daten zur Situation behinderter und chronisch kranker Mütter in keiner der einschlägigen offiziellen Statistiken (Schwerbehindertenstatistik, Bevölkerungsstatistik, Sozioökonomisches Panel, Mikrozensusbefragung usw.) vorliegen, wurde mit der Arbeitsgruppe Externe Qualitätssicherung in der Perinatologie/Neonatologie der Sächsischen Landesärztekammer die Möglichkeit besprochen, die Daten der Perinatalstatistik einer Sonderauswertung zu unterziehen und die Angaben der Schwangeren/Mütter mit Schwangerschaftsrisiken den anderen Frauen gegenüber zu stellen.
Insgesamt wurden in der Perinatalstatistik 2008 knapp drei Viertel der Frauen als Risikoschwangere ausgewiesen. Neben Spät-, Früh- oder Vielgebärenden wären besonders zu nennen adipöse Frauen (n=2.057 bzw. 6,0%), Frauen mit Allergien (n=9.794 bzw. 28,6%), früheren eigenen schweren Erkrankungen (n=5237 bzw. 15,3%) oder besonderen psychischen Belastungen (n=1335 bzw. 3,9%). In die Sonderauswertung wurden allerdings nur Frauen mit Skelettanomalie, Kleinwuchs (unter 1,50m Körpergröße der Mutter), Diabetes und Hypertonie einbezogen (vgl. Tabelle 24), da die weiteren angeführten geburtshilflichen Risiken, die vor allem nach den Angaben in den Mütterpässen erfasst werden, zu unspezifisch sind. So muss der Eintrag „eigene frühere Erkrankung“ nicht unbedingt auf eine chronische Erkrankung hinweisen, „hohe psychische Belastung“ nicht unbedingt auf eine manifeste psychische Erkrankung. Die Möglichkeiten der Statistik bleiben damit für unsere Zwecke zwar begrenzt, liefern aber dennoch einige interessant Aussagen, die unsere Ergebnisse der Befragung behinderter Frauen bestätigen.
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Schwanger gesamt |
33.745 |
32.995 |
| ohne definierte Risiken |
26.786 |
26.636 |
| mit definierten Risiken |
7.417 |
6.780 |
| Kleinwuchs |
350 |
322 |
| davon Kleinwuchs <=1,50m |
255 |
213 |
| Skelettanomalien |
1.103 |
1.173 |
| Kleinwuchs <=1,50m und Skelettanomalien |
11 |
5 |
| chronisch krank* |
1.413 |
1.379 |
* chronisch krank: Diabetes mellitus lt. Mutterpass bzw. bei stationärer Aufnahme erfasst und Hypertonie über 140/90 (Quelle: Perinatalstatistik Sachsen 2008 und 2009, Sonderauswertung)
Bei der Sonderauswertung wurden folgende Indikatoren einbezogen:
-
Zeitpunkt des Feststellens der Schwangerschaft durch den Gynäkologen
-
Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft
-
Zeitpunkt der ersten Ultraschalluntersuchung
-
Anzahl der Ultraschalluntersuchungen
-
Zeitpunkt der Vorstellung in der Geburtsklinik
-
Gestationsalter
-
Entbindungsmodus
-
Anzahl vorausgegangene Schwangerschaften
-
Anzahl Abbrüche
-
Kindliche Fehlbildungen
-
Durchschnittsalter der Mütter.
Nach den vorliegenden Ergebnissen waren die chronisch kranken/behinderten Mütter (im oben definierten Sinn) mit 30,3 Jahren im Durchschnitt geringfügig älter als die Mütter ohne definierte Risiken (29 Jahre).
Ausgehend davon, dass für Frauen mit Behinderungen der Zugang zur gynäkologischen Praxis oft erschwert ist und ihnen mit Vorbehalten bezüglich ihres Kinderwunsches im sozialen Umfeld oder seitens der Ärzte begegnet wird, vermuteten wir, dass die Frauen erst sehr spät ihren Gynäkologen zur Feststellung der Schwangerschaft kontaktieren. Diese Annahme bestätigt sich weder in unseren Ergebnissen noch in der Perinatalstatistik (Abbildung 16). Bei der überwiegenden Mehrheit der Frauen wird die Schwangerschaft bis zur 12. Woche durch den Arzt bestätigt, in unserer Stichprobe sogar noch früher, was auf den verantwortungsbewussten Umgang der Frauen mit einer Schwangerschaft verweist.
Abbildung 16. Abbildung 16: Zeitpunkt in Wochen, zu dem Schwangerschaft vom Arzt festgestellt wurde
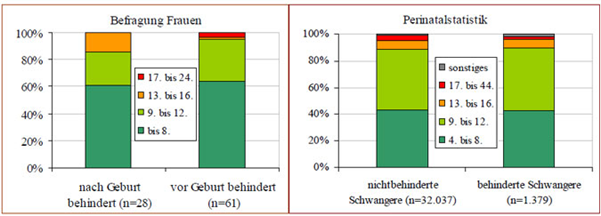
(Quelle: eigene Erhebung, Perinatalstatistik Sachsen 2009 Sonderauswertung)
Wesentliche Aspekte für eine gute Betreuung während der Schwangerschaft stellen neben dem Zeitpunkt des Erstkontaktes zum Gynäkologen auch die Vorsorgeuntersuchungen im Verlauf der Schwangerschaft dar, da Gefährdungen der Schwangerschaft bzw. Risiken für Mutter oder Kind somit rechtzeitig erfasst und nach Möglichkeit abgewendet werden können. Ebenso wird in der Literatur zum Teil kontrovers diskutiert, wie die Versorgung behinderter Mütter erfolgt. Die Aussagen reichen von übersteigerter Vorsicht (Hermes 1998) bis zur Benachteiligung infolge bestehender Vorurteile (Finger 1992). Sowohl in den eigenen Ergebnissen (vgl. Kap. 4.2.3.1) als auch in den Ergebnissen der Perinatalstatistik zeigt sich, dass Frauen mit den definierten chronischen Erkrankungen/Behinderungen in leicht erhöhtem Maß Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Die Anzahl der in der Perinatalstatistik erfassten Vorsorgeuntersuchungen liegt bei chronisch kranken/behinderten Müttern mit durchschnittlich 12,3 Untersuchungen analog zu unseren eigenen Ergebnissen leicht über dem Durchschnitt nichtbehinderter Frauen (11,9 Untersuchungen). Besonders Ultraschalluntersuchungen haben sich mittlerweile zum Standard vorgeburtlicher Diagnostik entwickelt. Frauen mit chronischen Erkrankungen/Behinderungen nehmen Ultraschalluntersuchungen erstmalig etwa zum gleichen Zeitpunkt wahr wie alle anderen Frauen, allerdings geringfügig öfter (Abbildung 17).
Abbildung 17. Abbildung 17: Anteil der wahrgenommenen Ultraschalluntersuchungen (in %)
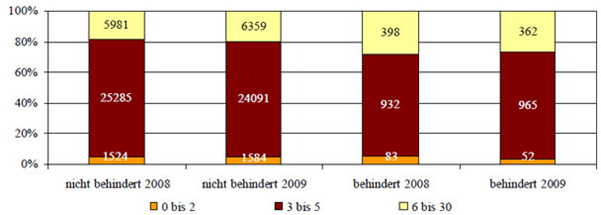
(Quelle: Perinatalstatistik Sachsen 2008 und 2009 Sonderauswertung)
Während sich sowohl 2008 als auch 2009 rund drei Viertel der nicht behinderten Schwangeren bereits vor dem Geburtstermin in der Geburtsklinik vorstellten, lag dieser Anteil bei den behinderten/chronisch kranken Müttern mit zehn Prozentpunkten höher. Lediglich 15% nahmen den Kontakt zur Geburtsklinik erst mit Beginn der Geburt auf. Es kann auf der Basis der vorliegenden Auswertung nicht gesagt werden, wie hoch unter den Frauen, die erst zu diesem Zeitpunkt Kontakt zur Geburtsklinik aufnehmen, der Anteil mit einem vorzeitigen Geburtsbeginn liegt.
In der Aufnahmeart unterscheiden sich die Mütter mit und ohne definierte Risiken nicht voneinander. Nahezu alle Frauen wurden bei geplanter Klinikgeburt direkt zur Entbindung in die Klinik aufgenommen. Bei weniger als 1% in beiden Gruppen und in beiden Berichtsjahren erfolgte die Klinikaufnahme nach einer weitergeleiteten Haus- oder Praxisgeburt bzw. einer Entbindung vor der stationären Aufnahme.
Drei bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Frauen mit Behinderungen und den nichtbehinderten Frauen werden in der Perinatalstatistik deutlich. Zum ersten weisen die Schwangeren mit Behinderungen eine doppelt so hohe Frühgeborenenrate auf wie Frauen ohne Behinderung. Während rund 18% der behinderten Mütter ihr Kind bis zur 36. Schwangerschaftswoche geboren haben, trifft das nur auf 7% (2008) bzw. 7,5% (2009) nicht behinderte Schwangere zu (Abbildung 18).
Der zweite Unterschied bezieht sich auf die Fehlbildungsrate. Während pränatal diagnostisch weder 2008 noch 2009 ein Unterschied in Bezug auf kindliche Fehlbildungen festgestellt werden konnte, lag der Anteil der postnatal registrierten Fehlbildungen bei Kindern behinderter Mütter mit 3,3% (2008) bzw. 2,6% (2009) fast doppelt so hoch wie bei nichtbehinderten Müttern (1,5% im Jahr 2008 und 1,6% im Jahr 2009). Möglicherweise korreliert der höhere Anteil der Kinder mit postnatal festgestellten Fehlbildungen bei behinderten Müttern mit der höheren Frühgeburtlichkeit in dieser Gruppe. Um diese Frage zu klären, müssten noch weitere Daten aus der Perinatalstatistik differenziert ausgewertet werden.
Abbildung 18. Abbildung 18: Frühgeborenenrate behinderter und nicht behinderter Schwangerer 2008 und 2009 (in %)
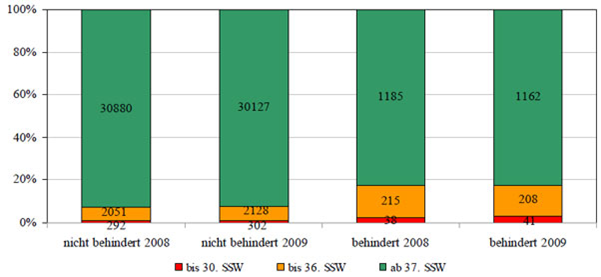
(Quelle: Perinatalstatistik Sachsen 2008 und 2009 Sonderauswertung)
Geringfügige Unterschiede zeigten sich weiterhin beim Vergleich der vorausgegangenen Geburten sowie der vorzeitigen Schwangerschaftsabbrüche. Während 45,2% der behinderten Frauen 2008 ihr erstes Kind zur Welt brachten, 26,7% ihr zweites und 28,1% ihr drittes oder weiteres Kind, erlebten mit 43% nichtbehinderte Frauen ihre erste Geburt, 31,2% die zweite und 25,3% die dritte oder weitere Geburt. 2009 glichen sich die Unterschiede in Bezug auf die zweiten und weiteren Geburten an.
Ebenso gaben behinderte Frauen in beiden Berichtsjahren geringfügig öfter ein oder mehrere vorausgegangene Schwangerschaftsabbrüche an (11,5% zu 10,2%).
Der Anteil der Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen liegt in unserer Studie mit 24,5% leicht über dem Ergebnis der Studie „frauen leben“ (Helfferich 2002: 283), die von einer Abbruchsrate von 22% unter den „jemals Schwangeren“ berichten, und deutlich über den in der Perinatalstatistik erfassten vorzeitigen Schwangerschaftsabbrüchen. Die Ursachen können auf der Basis der vorliegenden Daten der Sonderauswertung der Perinatalstatistik jedoch nicht geklärt werden.
Und schließlich bezieht sich der dritte Unterschied auf die deutlich erhöhte Sectio-Rate bei behinderten Frauen. Sie wurden zu 39,6 (2008) bzw. 39,9% (2009) per Sectio entbunden, Frauen ohne Behinderungen zu 21,7% (2008) bzw. 23,1% (2009). Sowohl die primäre als auch die sekundäre Sectio-Rate liegt bei behinderten Frauen deutlich über den Werten der nicht behinderten Frauen. In beiden Gruppen steigt der Anteil der operativen Entbindungen geringfügig an. Die Ursachen für die erhöhte Sectio-Rate bei behinderten Frauen können ebenfalls auf der Basis der verfügbaren Daten nicht geklärt werden. Allerdings bestätigt sich dieses Ergebnis auch durch Aussagen in der Literatur (Hermes 1998, Eiermann et al. 2000, Michel & Rothemund 2006) und der vorliegenden Erhebung (vgl. Kap. 4.2.3.2).
Die Ergebnisse der Perinatalstatistik bestätigen zum Teil die von uns erhobenen Daten im Rahmen der Befragung behinderter und chronisch kranker Frauen. Zum Teil liefern sie neue, weiterführende Erkenntnisse über diese Gruppe. Eine weitere differenzierte Auswertung erscheint wenig sinnvoll, da die definierten Risiken unscharf sind. Aus diesem Grund sollte zur Vertiefung der Erkenntnisse über die geburtshilfliche Situation behinderter Frauen eine gezielte Datenerhebung erfolgen.
Neben der fachlichen Kompetenz der Ärzte bei der Betreuung behinderter oder chronisch kranker Patientinnen und Patienten ist für die Inanspruchnahme entscheidend, ob die Praxis barrierefrei ausgestattet und damit für alle Patientinnen erreichbar ist. 2006 erfassten wir die Situation gynäkologischer und pädiatrischer Praxen (Michel 2006), 2007 der Schwangerschaftsberatungsstellen (Michel et al. 2008) in Bezug auf Barrierefreiheit, wobei in beiden Analysen lediglich die Situation für Menschen mit Gehbehinderungen geprüft werden konnte, da sich die Kriterien der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) zur Erfassung der Barrierefreiheit lediglich auf diese Behinderungsart ausrichten. Nach Auskunft der KVS wird die Barrierefreiheit der Arztpraxen nach drei Kriterien erfasst (Tabelle 25).
Außerdem gibt es noch die unspezifische Formulierung „rollstuhlgerecht“ als Selbstauskunft der Ärzte. Die Erfassung erfolgt in der Weise, dass die Ärzte gebeten werden, ihre Praxis nach den genannten Kriterien einzustufen, eine Meldepflicht über Barrierefreiheit besteht nicht. Demzufolge erweist sich der Rücklauf der Meldungen auch als sehr gering. Im Arztregister der KVS gibt es keine Hinweise auf Barrierefreiheit der Einrichtung. Behinderte Patientinnen und Patienten können sich also nicht selbständig orientieren, sondern müssen vorher bei der KVS oder der gewünschten Praxis in ihrer Nähe anfragen. Dieser Fakt stellt eindeutig eine Einschränkung der Chancengleichheit in der medizinischen Versorgung dar, abgesehen davon, dass die genannten Kriterien deutlich hinter den Anforderungen an barrierefreie Arztpraxen im Sinne des §4 BGG zurück bleiben.
| 1. Stufe „uneingeschränkt barrierefrei“ |
|
|---|---|
| 2. Stufe „weitgehend barrierefrei“ |
|
| 3. Stufe „für gehbehinderte Patienten zugänglich“ |
|
(Quelle: persönliche Aussage des KVS vom 3. März 2010)
Nach Auskunft der KVS Sachsen bekamen wir 2006 von den bestehenden 501 gynäkologischen Praxen 60 als barrierefrei im Sinne der oben genannten Klassifikation ausgewiesen. Die Aussagen bezogen sich auf die Erhebung zur Barrierefreiheit aus dem Jahr 2003. Mit diesen 60 Praxen führten wir eine telefonische Befragung zur tatsächlichen Barrierefreiheit (für körperbehinderte Patientinnen) durch. Das Ergebnis zeigt Abbildung 19.
Abbildung 19. Abbildung 19: Barrierefreiheit in gynäkologischen Praxen (Absolutzahlen)
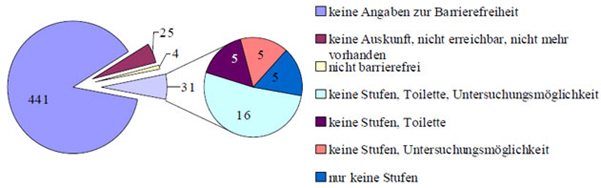
(Quelle: Kommunalverband Sachsen (KVS) 2003, eigene Berechnung)
Da letztlich nur die 16 Praxen als barrierefrei bezeichnet werden können, die sowohl über stufenlosen Zugänge als auch behinderungsgerechte Toiletten und Untersuchungsmöglichkeiten verfügen, traf das Kriterium Barrierefreiheit nur auf 3,1% der gynäkologischen Arztpraxen in Sachsen zu. Unter den als barrierefrei oder weitgehend barrierefrei gemeldeten Praxen befanden sich Einrichtungen, in denen die Frau im Rollstuhl in die erste Etage getragen werden musste, sich die Behindertentoilette auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand oder die Patientinnen aus dem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen ihren Hebelift selbst mitbrachten. Derartige Praxen entsprechen in keiner Weise dem Kriterium der Barrierefreiheit.
2006 erfolgte durch die KVS erneut eine Datenerhebung zu diesem Thema. Seit dem wird die Barrierefreiheit im oben genannten Sinn bei jeder neuen Niederlassung abgefragt, eine Rückmeldung seitens der Gynäkologen erfolgte aber nur in ca. 25% der Fälle. Eine Nachfrage in den als „barrierefrei“ bzw. „rollstuhlgerecht“ ausgewiesenen Praxen erfolgte nicht, erscheint aber sinnvoll und sollte vor allem den tatsächlichen Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen. Mit Stand März 2010 ergab sich folgendes Bild (Abbildung 20).
Abbildung 20. Abbildung 20: Barrierefreiheit aller gynäkologischen Praxen in Sachsen nach Erfassungskriterien der KV Sachsen (Absolutzahlen)
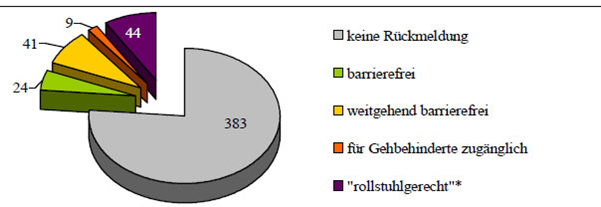
(Quelle: persönliche Information der KVS vom 3. März 2010)
Im Rahmen der Expertise aus dem Jahr 2006 (Michel 2006) versuchten wir auch Auskunft über barrierefreie kinder- und jugendärztliche Praxen in Sachsen zu bekommen. Bei der KV Chemnitz wurden für Chemnitz vier Kinderarztpraxen empfohlen, die eine Mutter mit Rollstuhl aufsuchen könne. Alle vier Praxen erwiesen sich auf Nachfrage als nicht barrierefrei, bei drei Praxen war der Zugang möglich, aber die Toilette fehlte, eine Praxis lag zwar zentral, konnte aber im Rollstuhl nicht erreicht werden. Die KV Dresden konnte nur eine Kinderarztpraxis benennen, diese erwies sich jedoch ebenfalls nicht als barrierefrei, da die Toilette zwar breit war, aber keine Behindertentoilette mit den entsprechenden Ausstattungsmerkmalen. Aus der uns vorliegenden Liste barrierefreier Arztpraxen wurden weitere Kinderarztpraxen in Sachsen angerufen. Von den insgesamt acht Kinderärzten waren sieben nach eigenen Angaben barrierefrei, davon befand sich eine in einem Ärztehaus, in dem es eine Behindertentoilette gab. Alle anderen Praxen verfügten über keine Behindertentoilette, eine Praxis war nur über eine Stufe zu erreichen. Türen erwiesen sich als breit genug für Kinderwagen, nicht aber für Rollstühle. Auch bei den Kinder- und Jugendärzten bestätigte sich, dass nur vage Vorstellungen darüber bestehen, welche Anforderungen an eine barrierefreie Einrichtung gestellt werden. Dabei haben wir nur nach der Erreichbarkeit und der Toilette gefragt, Untersuchungsmöglichkeiten, Orientierungshilfen für Sehbehinderte, Kommunikationsprobleme usw. wurden nicht angesprochen.
Auch zu Kinder- und Jugendmedizinischen Praxen gibt es aktuell keine Auskünfte im Ärzteverzeichnis der KVS in Bezug auf die Barrierefreiheit.
Schließlich soll noch auf die Erhebung zur Barrierefreiheit in den Schwangerschaftsberatungsstellen in Sachsen aus dem Jahr 2007 verwiesen werden. Auch hier wurde deutlich, dass die Einrichtungen nur ungenügend auf die Begegnung mit behinderten Rat suchenden Klientinnen eingestellt sind (Abbildung 21). Von insgesamt 74 Beratungsstellen in Sachsen beteiligten sich 52 an der Befragung. Lediglich elf Beratungsstellen verfügten über eine barrierefreie Ausstattung, auch hier wieder mit der Einschränkung für körperbehinderte Klientinnen.
Abbildung 21. Abbildung 21: Barrierefreiheit in Schwangerschaftsberatungsstellen (2007)
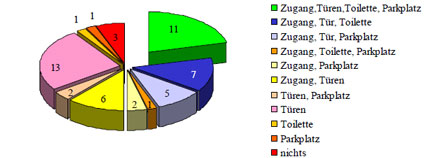
(Quelle: Michel et al. 2008)
Es bleibt zu empfehlen, dass in Sachsen eine Erhebung zur Barrierefreiheit medizinischer Einrichtungen durchgeführt wird und bei Neuzulassungen dieser Aspekt besonders berücksichtigt wird. Eine Information in den publizierten Adressdateien niedergelassener Ärzte über Barrierefreiheit im Sinne §4 BGG darf nicht als „Wettbewerbsvorteil“ der Einrichtungen, sondern muss als Realisierung der Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen gesehen werden. Diese Aussage gilt nicht nur für gynäkologische und pädiatrische Angebote, sondern für alle Fachrichtungen. Und sie ist auch nicht nur im Zusammenhang mit der Realisierung von Elternschaft mit Behinderung zu sehen, sondern als zwingende Anforderung einer alternden Bevölkerung. Die KVS steht einer derartigen Erhebung positiv gegenüber.
Medizinischem Personal kommt bei der Beratung, Betreuung und Begleitung behinderter Frauen und Männer im Zusammenhang mit der Thematik Kinderwunsch und Elternschaft eine besondere Bedeutung zu. Sowohl Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe bzw. für andere Fachdisziplinen, bei denen die Patientinnen auf Grund ihrer Erkrankung/Behinderung betreut werden, als auch Hausärzte werden mit diesen Fragen konfrontiert. Sie stehen somit vor der zum Teil schwierigen Aufgabe, behinderten oder chronisch kranken Frauen beratend bezüglich des Kinderwunschs zur Seite zu stehen.
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Screeningbefragung der Gynäkologen, Pädiater, Pränataldiagnostiker und Humangenetiker (N=62) sowie die Ergebnisse der vertiefenden Telefoninterviews mit neun Ärzten dargestellt.
Für die Klärung der Frage nach der medizinischen und sozialen Betreuung behinderter Mütter im Freistaat Sachsen wurden Ärztinnen und Ärzte der folgenden drei Fachgebiete in die Studie einbezogen: Gynäkologie/Geburtshilfe, Pränataldiagnostik/Humangenetik und Pädiatrie.
Aktuell gibt es in Sachsen
-
501 niedergelassenen Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe
-
353 niedergelassene Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin (KVS 2010).
Im ersten Halbjahr 2009 wurden insgesamt 190 Ärzte dieser Fachrichtungen per Zufallsauswahl ermittelt. 100 Gynäkologen, 72 Pädiater und 19 Pränataldiagnostiker/ Humangenetiker erhielten von uns einen Kurzfragebogen per Post zugeschickt. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Befragung bezogen sich auf Erfahrungen mit chronisch kranken/behinderten Patientinnen, Betreuungsanlass, Besonderheiten in der Betreuung sowie Informationsbedarf bezüglich dieser Patientinnengruppe und Kinderwunsch/Elternschaft. Abschließend konnten die Ärzte angeben, ob sie bereit wären, an einem vertiefenden Interview teilzunehmen. Der Rücklauf lag bei ca. einem Drittel (Tabelle 26).
| Facharzt | Beteiligung Screeningbefragung | Bereitschaft zu vertiefenden Interviews | Teilnahme an vertiefenden Interviews |
|---|---|---|---|
| Gynäkologen |
32 (32%) |
5 |
5 |
| Pädiater |
20 (7%) |
1 |
1 |
| Pränataldiagnostiker/ Humangenetiker |
9 (47%) |
5 |
3 |
Die Ärztinnen (n=47) und Ärzte (n=14), die sich an der Befragung beteiligten, spiegeln den zunehmenden Altersdurchschnitt der Ärzte in Sachsen wider. Lediglich 22 Prozent der Mediziner waren jünger als 45 Jahre, knapp die Hälfte befand sich in der Altersgruppe 45 bis 55 Jahre und knapp ein Drittel in der Altersgruppe ab 56. Die Altersspanne reicht von 34 Jahren (Gynäkologin) bis 69 Jahre (Kinderärztin). Während die beiden beteiligten Pränataldiagnostiker Männer aus der Altersgruppe über 56 Jahre waren, gehörten die Humangenetiker vor allem in die Gruppe der jüngeren weiblichen Gesprächspartner.
Entsprechend der Altersverteilung der befragten Ärzte lag bei den meisten auch der Abschluss des Studiums und der Facharztausbildung schon länger zurück (Abbildung 22). Das trifft vor allem auf die Pädiater zu.
Nur 26 der 60 Ärzte gaben an, im Medizinstudium etwas über Behinderung gehört zu haben, speziell über das Thema Behinderung und Elternschaft noch seltener. Demzufolge verwundert es nicht, dass sich ein Teil der befragten Ärzte nur eingeschränkt auf die Begegnung mit behinderten Menschen und deren Kinderwunsch vorbereitet sah (Abbildung 23).
Abbildung 23. Abbildung 23: Vorbereitung auf die Begegnung mit behinderten/chronisch kranken Patienten (N=58)
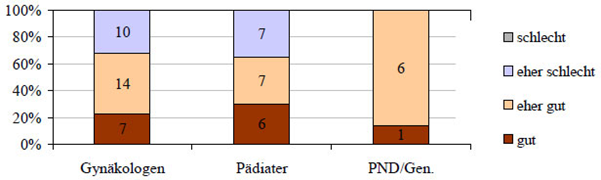
Die Ärzte gaben sowohl in der Screeningbefragung als auch den vertiefenden Interviews an, sich über Weiterbildungsveranstaltungen, Fachliteratur oder Internet über das Thema zu informieren, besonders dann, wenn sie einen konkreten Anlass dazu (Patientin) haben.
Ihr spezifisches Wissen zur Elternschaft und Behinderung bezogen sie vorwiegend aus Fachzeitschriften und Weiterbildungsangeboten sowie aus weiteren Informationsquellen, die in Tabelle 27 aufgeführt sind.
| Medizinstudium | Weiterbildung | Fachtagungen | Fachzeitschriften | Multimediale Angebote | Internet | Es gibt keine Informationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynäkologe |
13 |
23 |
16 |
28 |
13 |
10 |
3 |
| Pädiater |
9 |
12 |
10 |
13 |
11 |
7 |
3 |
| Pränataldiagnostiker |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
| Humangenetiker |
3 |
7 |
7 |
5 |
3 |
5 |
0 |
Dennoch besteht bei den meisten der Wunsch, mehr über das Thema Behinderung und Elternschaft zu erfahren. Vor allem zu folgenden Themenbereichen wünschten sich die befragten Ärzte weitere Informationen:
-
soziale Netzwerke und Hilfsangebote für behinderte Eltern (n=10)
-
Sexualität, Schwangerschaft und Geburt bei körperlichen Einschränkungen (n=6)
-
Schwangerschaftsvorsorge (besonders bei geistiger Behinderung, darunter einmal Frage nach Sterilisation nach abgeschlossener Familienplanung) (n=5)
-
gesetzliche Regelungen (z.B. Vormundschaftsrecht) (n=4)
-
Medikamente während Schwangerschaft und Stillperiode (n=4)
-
Wissenschaftliche Publikationen zum Thema (n=3)
-
Informationsmaterial für Betroffene (n=2)
-
Erfahrungsberichte Betroffener (n=2)
Die Ergebnisse der Screeningbefragung bestätigen sich auch in den vertiefenden telefonischen Interviews. Seitens der Humangenetiker, die an den vertiefenden Interviews teilnahmen, wurde neben den bereits genannten Schwerpunkten Weiterbildungen zum Thema Kommunikation und Beratung gewünscht: „Ich denke, dass die Netzwerke publik gemacht werden müssen. Das ist ganz wichtig. Und auch die Frage der Kommunikationsfähigkeit. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Wo wir als Genetiker relativ gut dran sind, wir haben so wie eine Beratungspraxis hier, wo natürlich manche Frauenärzte und so Schwierigkeiten haben.“ (Humangenetikerin, MH1).
„Also ich denke erstmal verallgemeinert, solche Themen, wie man die Beratung führt, das denke ich so. Speziell würde ich natürlich auch in Bezug auf die Krankheitsbilder was sagen, z. B. die Epileptikerin, was von Risiko her, oder was sagen zu Skelettfehlbildungen, was sie für Risiko hat, oder ist es günstig für sie noch mal schwanger zu werden, oder irgendwie so.“ (Gynäkologin, MG4).
In den vertiefenden Gesprächen fragten wir nach den beiden großen Projekten FertiPROTEKT (Netzwerk für fertilitätsprotektive Maßnahmen bei Chemo- und Strahlentherapie) und EURAP (Europäisches Register für Schwangerschaften unter Antiepileptika). Diese großangelegten wissenschaftlichen Studien und Register kannten nur zwei (FertiPROTEKT) bzw. drei (EURAP) der vertiefend befragten neun Ärzte. Die Unsicherheit beim Umgang der Ärzte mit behinderten bzw. chronisch kranken Schwangeren und Müttern drückt sich in dem Zitat einer Gynäkologin aus: „Es wird durch Unwissen überreagiert, Überdiagnostik gemacht. Dabei wollen die Schwangeren die Ruhe und Freude an ihrer Schwangerschaft.“ (Gynäkologin, MG2).
Weiterbildungen sollten nach Auskunft der befragten Ärztinnen und Ärzte vor allen an großen Zentren angeboten werden. Sowohl wissenschaftliche Einrichtungen, Universitäten, politische Einrichtungen wie Ärztekammer und Ethikrat wurden genannt als auch Praxiseinrichtungen und Selbsthilfegruppen, da letztere die Kompetenzen bezüglich der Ressourcen behinderter Menschen besitzen.
„Ich denke, die betreuenden Instanzen, also die Humangenetiker, die Pränataldiagnostiker, aber auch die Rechtsanwälte sollten mit ins Boot geholt werden. Ärztekammer ist mit involviert unbedingt […] Ethikrat, ich denke, so was wird schon gefordert.“ (Humangenetikerin, MH 2).
Die Bedeutung einer praxisnahen Weiterbildung für die niedergelassenen Ärzte wurde in dem folgenden Zitat deutlich: „Am ehesten aus den Praxen, Praxispartner. Die Universitäten, die sehen nur die schlimmsten der schlimmen Fälle und machen eine „Mordsdiagnostik“ und man sitzt hier an der Basis und hat nicht wie die eine Uni den Hintergrund. Aber was bodenständiges eben, aus dem richtigen Leben heraus.“(Gynäkologin, MG2). Ziemlich vage waren die Aussagen der Gynäkologen über erinnerte Weiterbildungsveranstaltungen oder Artikel in Fachzeitschriften. Eine Gynäkologin berichtete davon, dass ihr eine Patientin einen Artikel zu ihrem Krankheitsbild mitbrachte: „Da habe ich mir von der Patientin eins geben lassen. Es war über die neurologischen Muskelerkrankungen. Die Patienten kennen sich besser aus als der Arzt. An die Zeitschrift kann ich mich nicht erinnern.“ (Gynäkologin, MG2).
Die befragten Humangenetiker gaben hingegen genauere Auskünfte über Fortbildungsveranstaltungen zur Pränataldiagnostik. Allerdings erfolgten auch von ihnen kaum Angaben zum Thema Behinderung und Elternschaft. Wenn, dann gab es offensichtlich die meisten Informationen zum Thema Epilepsie und Schwangerschaft.
In der schriftlichen Befragung der Ärzte zeigte sich, dass fast alle bereits behinderte oder chronisch kranke Patientinnen bzw. Eltern betreut haben, lediglich drei Gynäkologen und zwei Pädiater verfügten über keine Erfahrungen mit dieser Patientengruppe.
Die erinnerten Patientinnenzahlen der letzten drei Jahre differierten nach Fachrichtung der befragten Ärzte (Abbildung 24). So betreuten die
-
Humangenetiker vor allem Patientinnen mit Stoffwechsel- und Autoimmunerkrankungen, Organschädigungen und neurologischen Erkrankungen;
-
Pränataldiagnostiker vor allem Frauen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen;
-
Pädiater Kinder von Eltern mit Organschädigungen, psychischen Erkrankungen und körperlichen Behinderungen;
-
Gynäkologen Tumorpatientinnen, Frauen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen.
Abbildung 24. Abbildung 24: Mittelwerte der betreuten behinderten/chronisch kranken Patientinnen nach Fachärzten
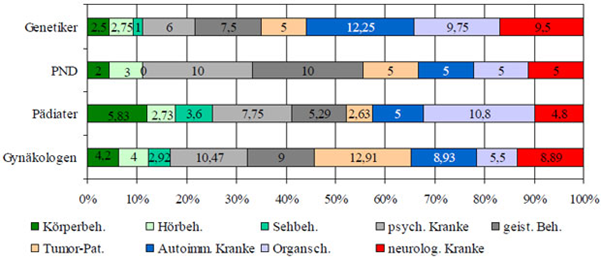
Obwohl alle befragten Gynäkologen geistig behinderte Frauen erst an dritter Stelle der betreuten behinderten Patientinnen benannten und Humangenetiker an vierter Stelle, nahmen fast alle der vertiefend befragten Ärzte Bezug auf diese Patientinnengruppe.
Zunächst interessierte uns, aus welchen Gründen die Patientinnen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen den Humangenetiker, Pränataldiagnostiker oder Gynäkologen aufsuchten. Im Ergebnis der Screeningbefragung ergaben sich folgende Konsultationsanlässe:
-
Konsultationsanlass behinderter/chronisch kranker Patientinnen beim Humangenetiker/Pränataldiagnostiker bildeten sechs mal eine genetische Beratung, je fünf mal Erst-Trimester-Screening bzw. fetale Echokardiografie, vier mal Zweit- Trimester-Screening und je einmal Amniozentese bzw. Chorionzottenbiopsie.
-
Der hauptsächliche Anlass der Konsultation behinderter oder chronisch kranker Patientinnen beim Gynäkologen bestand in Vorsorgeuntersuchungen (n=29), gefolgt von Beratung zur Schwangerschaftsverhütung (n=16). Fünf mal betreuten die Gynäkologen ihre letzte behinderte/chronisch kranke Patientin wegen einer Erkrankung, dreimal wegen einer Fertilitätsberatung und je einmal wegen einer Nachuntersuchung nach einer Sectio bzw. wegen einer Mutter-Kind-Kur für die behinderte Mutter und ihr nichtbehindertes Kind.
-
Anfragen nach Sterilisation (n=1) oder Schwangerschaftsabbruch (n=0) spielten sowohl bei den Gynäkologen als auch den Pränataldiagnostikern/Humangenetikern keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in den vertiefenden Interviews wider. Alle drei Humangenetiker und drei der Gynäkologen wurden zwar mit der Anfrage nach einer Sterilisation konfrontiert, wobei alle Ärzte zum Ausdruck brachten, dass derartige Anfragen sehr selten vorkommen. Die Anfragen bezogen sich sowohl auf geistig behinderte Frauen bzw. Frauen aus Behinderteneinrichtungen als auch auf körper- oder sinnesbehinderte Frauen. Als Begründung für gewünschte Sterilisierungen gab eine Gynäkologin an: „Schutz, ohne das man Kontrolle ausüben muss […] oder es kann mal einen Einnahmefehler geben, so dass man sagt, die sollen geschützt sein.“ (Gynäkologin MG 4). Nach den Erfahrungen der befragten Ärzte scheint der Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft im Falle möglicher sexueller Kontakte (also ohne konkret bestehende Partnerschaft) und bei sexueller Gewalt der Hauptgrund für eine gewünschte Sterilisation zu sein. Hervorzuheben ist, dass die Initiative zu diesen Anfragen vorrangig von den Eltern oder Betreuern der behinderten/chronisch kranken Frauen ausging. Überwiegend befürworten die Ärzte die strengeren gesetzlichen Regelungen für die Sterilisierung behinderter Frauen (BGB §1905).
Eine Sterilisation stellt einen schweren Eingriff in die körperliche Integrität dar. Auf Grund ihrer Irreversibilität darf sie nicht als Verhütungsmittel der Wahl eingesetzt werden, also besonders nicht im Sinne des beschriebenen präventiven Begehrens durch Eltern oder Betreuer. Eine Gynäkologin äußerte jedoch auch ihr Unverständnis gegenüber diesen strengen Regelungen. Es muss deshalb darauf verwiesen werden, dass mit einer Sterilisierung ein wirksamer Schutz vor sexuellen Übergriffen gegenüber behinderten Frauen vor allem auch in stationären Einrichtungen ebenso wenig erreicht werden kann wie eine Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität, Partnerschaft und Kinderwunsch bei schwerstbehinderten Frauen und Männern. Welche Bedeutung die sehr strengen rechtlichen Regelungen bei der Durchführung von Sterilisierungen besitzen, unterstreicht die Erfahrung einer Humangenetikerin. Sie erinnerte sich an „eine Sterilisation bei einer Gehörlosen, bei der dann später der Wunsch nach einer Schwangerschaft aufkam und die dann nach einer künstlichen Befruchtung mittlerweile schon das zweite Kind bei mir hat, das gibt es doch. Die in jungen Jahren sterilisiert wurde und dann den Wunsch in älteren Jahren hatte und die dann mittlerweile doch zwei Kinder zu Hause hat.“ (Humangenetikerin MH 3).
Aber auch in Bezug auf die Anwendung anderer Methoden der Familienplanung und Schwangerschaftsverhütung zeigten sich sehr differenzierte Erfahrungen bei den befragten Ärzten, die letztlich auf Probleme beim Umgang mit Sexualität besonders geistig behinderter Menschen hinweist. Obwohl alle befragten Gynäkologen hormonelle Verhütungsmittel in Form der „Pille“ auch für Frauen mit Behinderungen präferieren, weisen sie auf die Problematik hormoneller Antikonzeptiva bei chronisch kranken, auf eine Dauermedikation angewiesene Patientinnen hin. Hierzu benannten sie selbst Beratungsbedarf. Insbesondere für Frauen mit geistigen Behinderungen wird aber auch die Drei-Monatsspritze als Mittel der Wahl angesehen. So erklärte eine Gynäkologin „Ich denke, die meisten nehmen Depot- Clinovir, weil das relativ schwache Blutungen macht und sicher ist und auch von der Anwendung her, man muss nicht dran denken. Das ist eine ganz gängige Methode eigentlich.“ (Gynäkologin MG4). Und eine andere Gesprächspartnerin erläutert, warum diese Methode besonders in Einrichtungen auch dann eingesetzt wird, wenn die Frau gar keinen Sexualpartner hat: „Ansonsten steht bei mir eigentlich die Pille im Vordergrund, aber bei den Behinderten sind es etliche, die die Drei-Monatsspritze kriegen, sicherlich auch ein Handling für die Betreuer. Das sind zum Teil sehr Schwerbehinderte, wo auch damit das Problem der Monatshygiene gebessert werden soll, weil damit die Regelblutung ausbleibt. Da sind so Schwerbehinderte drinnen, das gibt es eine, die steckt z. B. die Vorlagen in den Mund, und so was ist natürlich deutlich günstiger zu regeln, wenn die die kommende Regel kriegt. Der Wunsch, also von mir aus empfehle ich es nicht, da wird schon der Wunsch an mich herangetragen.“ (Gynäkologin MG5). Damit verweist die Gynäkologin auf eine offensichtlich gängige Praxis, die auch von Mitarbeiterinnen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe angesprochen wurde. So kam im Rahmen der Fachtagung „Partnerschaft und Sexualität“ (vgl. Kap. 4.6) zur Sprache, dass in vielen Einrichtungen alle Frauen zwischen dem 15. und 45. Lebensjahr die Drei-Monatsspritze bekommen, unabhängig davon, ob eine Partnerschaft besteht oder nicht. Diese Praxis ist allerdings auch dringend zu hinterfragen, beachtet man die Hinweise zu dem verwendeten Präparat Depo-Clinovir®: „Die Hormonbelastung für den Körper ist bei dieser Art der Anwendung allerdings höher als bei regelmäßiger Einnahme von Hormontabletten. Dieses Medikament ist daher nur dann angezeigt, wenn für die Anwenderin die tägliche Einnahme eines Hormonpräparats zur Empfängnisverhütung nicht in Frage kommt.“ (Netdoktor.de 2010). Eine Gynäkologin verweist darauf, dass die Frauen die hormonellen Antikonzeptiva selbst bezahlen müssen, obwohl sie ja meist nur über geringe finanzielle Mittel verfügen. Im Klartext: Die Frauen bekommen oft ohne den konkreten Hintergrund der Notwendigkeit einer Schwangerschaftsverhütung ein starkes Medikament verabreicht, das nicht frei von erheblichen Nebenwirkungen (z.B. Osteoporose) ist und das sie selbst finanzieren müssen. Hier offenbart sich ein dringend zu lösendes medizinisches, soziales und ethisches Problem im Umgang mit behinderten Frauen im fertilen Alter.
In der Literatur finden sich Hinweise, dass behinderten Frauen sehr schnell zu einem Schwangerschaftsabbruch geraten wird (Eiermann et al. 2000, Hermes 2000). Diesen Aspekt konnten wir weder in der Befragung der Frauen so bestätigen, auch wenn es einige gab, die diese Erfahrung machen mussten, noch bestätigte sich das in der Befragung der Ärzte. Sie verwiesen darauf, dass sich behinderte oder chronisch kranke Frauen meist sehr gründlich mit dem Thema Schwangerschaft und Behinderung auseinander gesetzt haben. Sie ließen sich im Vorfeld beraten, um rechtzeitig eine Medikamentenumstellung zu erwirken oder das Risiko einer Vererbung ihrer Erkrankung abschätzen zu lassen. Selbst bei positivem pränataldiagnostischem Befund gehen behinderte Frauen offener mit der möglichen Behinderung ihres Kindes um, da sie sich selbst durch ihre eigene Erkrankung/Behinderung offensichtlich besser auf diese Situation vorbereitet fühlen als Frauen, die erstmalig mit dem Thema konfrontiert werden. So sagte eine Humangenetikerin: „weil die einfach mit der Behinderung auch anders umgehen. Gerade, wenn es sie selber betrifft, dann ist es schon eine ganz andere Reaktion. Also nicht ungefähr: jetzt will ich das überhaupt nicht, das Kind; sondern: kann ich damit fertig werden, oder wie? Das sehen die auf jeden Fall anders.“ (Humangenetikerin MH1).
Eine weitere Fragestellung bezog sich darauf, ob behinderte/chronisch kranke Patientinnen einen höheren Betreuungsbedarf aufweisen als nicht behinderte Patientinnen und wie sich die Ärzte darauf einstellen.
Während die Ärzte überwiegend zustimmten, dass behinderte Patientinnen mehr Zeit benötigen und mehr Fragen haben, bestätigten sie nur zum Teil, dass sie ängstlicher sind. Einige Gynäkologen und Pädiater gaben an, dass behinderte und chronisch kranke Patientinnen häufiger als andere in Begleitung anderer Personen in die Sprechstunde kommen. Bei Konsultationen mit Humangenetikern und Pränataldiagnostikern traf das häufiger zu, wobei vorrangig die Partner als Begleitpersonen benannt wurden. Kaum Bestätigung fand die Aussage, behinderte und chronisch kranke Patientinnen kämen überwiegend erst in Akutsituationen (Abbildung 25). Das deckt sich auch mit den Antworten der Frauen sowie den Ergebnissen der Perinatalstatistik.
Abbildung 25. Abbildung 25: Erfahrungen bei der Betreuung behinderter Patientinnen (Mittelwerte: 1=stimme voll zu …4=stimme überhaupt nicht zu)
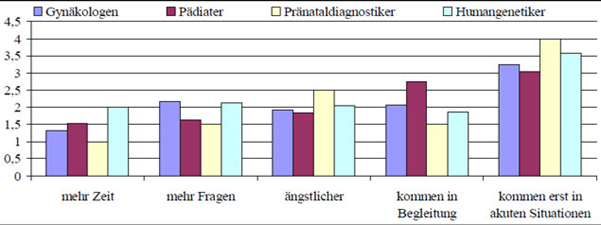
Ein Viertel der Pädiater machte die Erfahrung, dass bei behinderten Eltern häufiger andere Personen als die Eltern in die Praxis kommen. Die Ursachen können nur zum Teil auf die fehlende Barrierefreiheit zurück geführt werden, wobei auch kommunikative Barrieren eine Rolle spielen könnten. Mit einer Ausnahme verneinten die Pädiater eine höhere Kindswohlgefährdung bei Kindern behinderter Eltern. Die Kinderärztin, die uns für die vertiefende Befragung zur Verfügung stand, beschrieb ihre diesbezüglichen Erfahrungen folgendermaßen: „Ich will mal sagen, eigentlich sind die Eltern viel weiser als die anderen. Sie betrachten dann alles das, was den Kindern zustößt oder was dann ist, also sie kommen vielleicht auch viel eher, wenn sie es mitkriegen, sagen wir mal so. Sie geben sich viel mehr Mühe. Also für mich war das am Anfang immer faszinierend, wie blinde Leute ihre Kinder so top in Ordnung hatten, während andere, die ein gutes Sehvermögen haben, ihre Kinder zum Teil vernachlässigt oder schmutzig oder wund haben. Die, die besonders behindert waren, hatten ihre Kinder meistens viel, viel besser in Ordnung. Und die stellen natürlich Fragen. … Oder anders, sie haben einfach ein anderes Krankheitsverständnis, sie sind irgendwie reifer und sind natürlich auch besorgt dann, dass der auch o. k ist.“ (Pädiater MK1).
Sechs der in den vertiefenden Interviews befragten Ärzte bestätigten einen höheren Zeitaufwand bei der Betreuung behinderter Patientinnen, verneinten aber mehrheitlich eine notwendige größere Dichte der Konsultationen. Besondere Schwerpunkte stellten nach Aussagen der Ärzte dar, dass körperlich behinderte Patientinnen mehr Zeit benötigen, um sich auf die Untersuchung vorzubereiten. Oder dass Erklärungen länger dauern, wenn gehörlose Patientinnen betreut werden und die Kommunikation über den Gebärdensprachdolmetscher, das Ablesen von den Lippen oder Aufschreiben wichtiger Information erfolgt. Und schließlich stellt die Betreuung von den Patientinnen ein Problem dar, die in Begleitung anderer Personen in die Praxis kommen, da dann die Kommunikation gleichzeitig mit mehreren Personen geführt werden muss, die teilweise unterschiedliche Meinungen vertreten (z.B. in Bezug auf einen Kinderwunsch). Der höhere Zeitaufwand wird mit 10 bis 30 Minuten angegeben bzw. bis zu einem vierfach erhöhten zeitlichen Rahmen. Organisatorisch bieten einige Ärzte gesonderte Sprechstunden (am Freitag, am Abend, vor der Mittagspause) an, teilweise integrieren sie die behinderten Patientinnen in den regulären Praxisablauf, allerdings planen sie dann die längere Konsultationszeit ein. Auch Hausbesuchen oder ständige telefonische Erreichbarkeit wurden von einigen Gesprächspartnern angeboten, um behinderte Patientinnen und ihre Kinder gut betreuen zu können.
Eine humangenetische Beratung oder Pränataldiagnostik empfehlen je zwei der fünf befragten Gynäkologen bzw. der drei Humangenetiker behinderten bzw. chronisch kranken Frauen häufiger als nicht behinderten. Drei Ärzte berichteten aber auch, dass Patientinnen derartige Untersuchungen ablehnten. Das war besonders dann der Fall, wenn die Frau selbst mit ihrer eigenen Behinderung gut zurecht kommt. Während erweiterte Ultraschalluntersuchungen von vier Ärzten generell allen Frauen empfohlen werden, erfolgt eine Empfehlung zur humangenetischen Beratung vor allem bei einem familiären Risiko, bei Patientinnen ab 35 Jahren, bei Frauen, die Medikamente einnehmen oder anderen Noxen ausgesetzt sind oder bei denen bereits mehrere Aborte vorausgegangen waren bzw. die bereits behinderte Kinder geboren haben.
Eine bereits erwähnte Besonderheit bei der Betreuung behinderter Patientinnen besteht darin, dass diese häufiger als nicht behinderte mit einer Begleitperson in die Praxis kommen, darunter oft nicht verwandte Personen. In erster Linie kommen die Patientinnen mit ihrem Partner, aber auch mit Eltern, Pflegeeltern oder Betreuern. Damit kann es nach Aussagen der Ärzte manchmal zu Interessenkonflikten zwischen der zu betreuenden Frau und der Begleitperson kommen.
Einige wichtige Probleme im Umgang mit behinderten Patientinnen wurden angesprochen, die prinzipiell für die medizinische Betreuung dieser Patientengruppe zu beachten sind, unabhängig von der gynäkologischen Versorgung:
-
Patientinnen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe kommen zum Teil in Begleitung von Zivildienstleistenden oder Praktikanten, die nur wenig Auskunft über die Patientin geben können. Diese sind erst kurze Zeit in der Einrichtung, kennen die Patientin kaum und verfügen nicht über die nötigen Informationen.
-
Nicht in jedem Fall werden aus den Einrichtungen die Unterlagen für die Patientin mitgegeben.
-
Patientinnen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe werden zum Teil ohne zwingende Notwendigkeit einer gynäkologischen Untersuchung zugeführt. Bezeichnend ist die Antwort einer Gynäkologin: „Mitunter werden die von den Einrichtungen zu mir geschleppt und es gibt keine medizinischen Gründe, bloß der Routine wegen. Und ich werde geistig behinderte Menschen doch nicht untersuchen, wenn sie noch keinen Geschlechtsverkehr und keine Beschwerden haben. Ich begrenze es auf das sinnvolle Minimum. Die werde ich nicht vergewaltigen. Gezielt untersuchen, wenn Beschwerden sind, aber routinemäßig eine gynäkologische Untersuchung zu erzwingen keinesfalls.“ (Gynäkologin, MG2)
-
Bei der Terminplanung gelingt es zum Teil nicht, einen geeigneten Termin zu finden, der in den Praxisablauf passt wegen des höheren Zeitbedarfs und noch mit dem Zeitplan einer berufstätigen Betreuerin vereinbar ist. Besonders problematisch erweist sich das in Notsituationen, z. B. bei einer erforderlichen stationären Aufnahme einer behinderten Patientin.
-
Infolge bestehender baulicher Barrieren muss das Praxispersonal oder Mitpatienten mit anfassen, wenn Frauen im Rollstuhl in die Praxis kommen.
-
Es steht kaum behinderungsgerechtes Informationsmaterial zur Verfügung, um notwendige medizinische Zusammenhänge nachhaltig übermitteln zu können.
Schließlich soll noch auf ein Problem verwiesen werden, dass auch im Rahmen einer Anhörung im Sächsischen Landtag zur Sprache kam. Da „Behinderung und Elternschaft“ noch nicht selbstverständlich im Alltagsbewusstsein verankert ist, bestehen auch erhebliche Defizite bei speziellen Angeboten für behinderte Eltern und ihre Kinder. In der Anhörung kam zum Ausdruck, dass es bislang nur sehr wenige Einzelfalllösungen gibt bei Wohnangeboten für behinderte Eltern mit ihren Kindern und die Einrichtungen der Jugendhilfe nach §19 SGB VIII nicht den Anforderungen dieser Elterngruppe entsprechen. Analog musste festgestellt werden, dass es auch keine geeigneten Angebote für Mutter-Kind- Kuren gibt, wie eine Gynäkologin beschrieb: „Ich habe eine junge spastisch gelähmte Patientin betreut […] die ein gesundes Kindchen gekriegt hat, die ist sehr kompetent. […] Da ging es um eine Mutter-Kind-Kur, und da gibt es Mutter-Kind-Einrichtungen für gesunde Mütter und kranke Kinder aber nicht für körperlich behinderte Mütter mit gesunden Kindern, und die Patientin hatte nur die Möglichkeit eine Kurmaßnahme in einem Heim mit lauter behinderten Kindern in Anspruch zu nehmen. Sie sitzt selber im Rollstuhl, dafür gibt es überhaupt keine Einrichtungen.“ (Gynäkologin MG2).
Die genannten Probleme erweisen sich überwiegend als gesellschaftliche Probleme und nicht als behinderungsbedingt. Im System der Angebote für Menschen mit Behinderungen muss Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft als Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verstanden und bei der Entwicklung der Unterstützungsangebote berücksichtigt werden.
Die 20 Pädiater wurden nach ihren speziellen Angeboten für die Betreuung der Kinder behinderter Eltern befragt. Dabei interessierten uns die Erreichbarkeit der kinderärztlichen Betreuung und die Information der Eltern. 14 Pädiater gaben an, über eine barrierefreie Praxis zu verfügen. 15 Pädiater besuchten diese Patienten im Hausbesuch, 12 gaben an, für die Eltern jederzeit telefonisch erreichbar zu sein. Sechs Pädiater vereinbarten mit behinderten Eltern die Termine per Fax oder Mail, ein Angebot, das besonders für hörgeschädigte Menschen von Bedeutung ist. Acht Pädiater gaben an, den Eltern behindertengerechtes Informationsmaterial zur Verfügung stellen zu können. Umgekehrt heißt das aber auch, jede vierte Kinderarztpraxis war nicht barrierefrei, jeder fünfte Kinderarzt bot keine Hausbesuche an, mehr als ein Drittel war nicht immer telefonisch erreichbar, knapp zwei Drittel verfügten nicht über behindertengerechtes Informationsmaterial. Mehr als zwei Drittel (n=13) boten keinen speziellen Service für hörgeschädigte Eltern an, obwohl 12 davon Kinder hörgeschädigter Eltern betreuten. Drei der 16 Pädiater, die Kinder körperbehinderter Eltern betreuten, boten keine Hausbesuche an, vier gaben an, ihre Praxis ist nicht barrierefrei. Aus diesen wenigen Fakten wird deutlich, dass eine optimale Betreuung der Kinder und ihrer Eltern in diesen Fällen schwierig sein dürfte – besonders dann, wenn keine Wahlmöglichkeiten bestehen wie z.B. im ländlichen Raum und der Kontakt zwischen Eltern und behandelndem Kinderarzt erschwert ist.
In den vertiefenden Interviews wurden alle neun Ärzte zum Thema Barrierefreiheit befragt. Von den fünf Gynäkologen verfügte keiner über eine barrierefreie Praxis. Auf die bestehenden Probleme verweist das folgende Zitat: „Die ist bei mir eigentlich mit Rollstuhl begehbar, leider habe ich keinen Fahrstuhl und bei uns, diese örtlichen Krankentransporte, das läuft eigentlich sehr gut. Zum Glück sind alle Betroffenen nicht übergewichtig, die mit dem Rollstuhl kommen und dann tragen die Zivildienstleistenden sie zum Glück hier hoch. Aber ich wäre die einzige, die hier Fahrstuhl hätte gewollt in unserem Ärztehaus und das kann ich mir finanziell nicht leisten. Ich bin im zweiten Stock.“ (Gynäkologin, MG3). Und Lösungsmöglichkeiten bestehen auch für Gynäkologen in Hausbesuchen: „aber ich mache auch Hausbesuche, ich hab da ein behindertes Mädchen, da fahre ich auch nach Hause.“ (Gynäkologin, MG4).
Diese Aussagen bestätigen noch einmal die Notwendigkeit, Ärzte finanziell zu fördern beim barrierefreien Ausbau ihrer Praxen bzw. einer stärkeren Berücksichtigung dieser Anforderung bei der Neuzulassung von Arztpraxen. Eine ausführliche Darstellung der Problematik erfolgte bereits im Abschnitt 4.4.2 bei der Auswertung der Ergebnisse der KVS.
Erwartungsgemäß zeigt sich ein spezifisches Spektrum der Kooperationspartner bei der Betreuung behinderter/chronisch kranker Patientinnen bzw. der Kinder behinderter Eltern (Abbildung 26).
Abbildung 26. Abbildung 26: Kooperationspartner bei der Betreuung behinderter/chronisch kranker Frauen/Eltern (in Absolutzahlen)
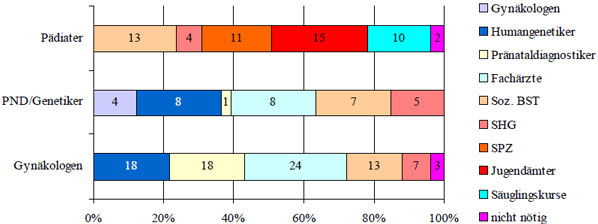
So arbeiteten 24 der 33 Gynäkologen mit anderen Fachärzten bei der Betreuung dieser Patientinnengruppe zusammen, ebenso acht der neun Pränataldiagnostiker/Humangenetiker. Mehr als die Hälfte der Gynäkologen kooperierten mit Humangenetikern und Pränataldiagnostikern. Die Humangenetiker arbeiten fast alle mit ihren Kollegen der Humangenetik zusammen, aber auch in hohem Maß mit sozialen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Damit nutzen sie wichtige Angebote, um ihre Patientinnen bei der Entscheidung für oder gegen ein eventuell behindertes Kind zu beraten und zu unterstützen. Auch Gynäkologen nutzen diese Möglichkeit, jedoch deutlich seltener als die Humangenetiker und Pränataldiagnostiker.
Die 21 Pädiater gaben am häufigsten eine Zusammenarbeit mit Jugendämtern (15), sozialen Beratungsstellen (13) und den Sozialpädiatrischen Zentren (11) an. Jeder zweite Pädiater unterstützte die behinderten Eltern durch spezielle Säuglingskurse. Damit zeigt sich das Bemühen der Mediziner um eine interdisziplinäre Betreuung behinderter/chronisch kranker Schwangerer bzw. Eltern. Allerdings kann auf der Basis der vorliegenden Daten nicht hinreichend geklärt werden, ob diese Kooperationen immer von den Frauen/Eltern als hilfreich erlebt werden.
In den vertiefenden Interviews wurde noch einmal das Thema Netzwerkarbeit angesprochen, da durch die Zusammenarbeit mit Experten anderer Fachdisziplinen die Betreuung behinderter oder chronisch kranker Patientinnen optimal gestaltet und Kompetenzen gebündelt werden können, aus denen sich Synergieeffekte ergeben. In den Gesprächen zeigte sich, dass eine relativ gute Zusammenarbeit mit ärztlichen Kollegen besteht und hier auch ein Informationsaustausch per Mail oder Telefon erfolgt. Stammtische (Gynäkologenstammtisch, Kinderärztestammtisch, Pränatalstammtisch) wurden nur sehr selten angesprochen und scheinen eher für Ärzte im städtischen Raum realisierbar zu sein. Umso wichtiger erscheint der Aufbau tragfähiger Kompetenznetze, um schnell und sicher auf die speziellen Probleme behinderter und chronisch kranker Schwangerer und Mütter reagieren bzw. Eltern bei auffälligem Pränatalbefund gut beraten zu können. Notwendig sind offensichtlich vor allem Angebote, die in den niedergelassenen Praxen gut handhabbar sind, also nicht nur hochspezialisierte Angebote, die ausschließlich in großen Zentren vorgehalten werden. So beschrieb eine Gynäkologin ihre Erfahrungen mit universitären Zentren: „Dort werden nur Risikopatienten gesehen. Dann werden die Patienten psychisch noch verrückter gemacht und ich habe dann wieder Aufbauarbeit zu leisten. Was ich auf Monate aufgebaut habe, das ist in einer Stunde in der Uni wieder hin. So erlebe ich das leider oft.“ (Gynäkologin MG2). In dieser Äußerung stecken viele Probleme – vorrangig im Zusammenhang mit unserer Fragestellung verweist sie auf den dringenden Bedarf, auch mehr medizinisches Wissen über Behinderung/chronische Erkrankung und Schwangerschaft/Geburt zu gewinnen, um nur die Frauen der hochspezialisierten Versorgung zuweisen zu müssen, die tatsächlich dieser Betreuung bedürfen.
Mit nichtmedizinischen Partnern, also Ämtern, Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen bestehen weniger Kontakte, zum Teil infolge fehlender zeitlicher oder regionaler Ressourcen. Auch das ist ein Hinweis auf die Notwendigkeit, interdisziplinäre Kompetenznetze aufzubauen für die Betreuung behinderter und chronisch kranker Frauen. Bestehende Aktivitäten werden eher als „am Anfang stehend“ und „ausbaufähig“ beschrieben. Eine Aufgabe, der sich koordinierend auch das Kompetenzzentrum für behinderte und chronisch kranke Eltern in Sachsen widmen möchte.
Abschließend zu diesem Kapitel sei hervorgehoben, dass es unterschiedliche Aktivitäten in Sachsen gibt, Frauen bzw. Eltern mit gesundheitlich bzw. behinderungsbedingt höherem Unterstützungsbedarf entsprechende Hilfestellungen zu geben. Andererseits ergaben sich vielfältige Hinweise auf bestehende Defizite im Wissen um Bedarfe und Ressourcen dieser
speziellen Frauen-/Elterngruppe, medizinische und soziale Aspekte behinderter Sexualität und Elternschaft und Barrierefreiheit im umfassenden Sinn. Aus den Antworten der in den vertiefenden Interviews befragten Ärzten zeigte sich überwiegend eine empathische Haltung gegenüber dieser Patientinnengruppe, allerdings auch Unsicherheiten im Umgang mit ihnen, die bis zur Ablehnung von Schwangerschaften vor allem bei geistig behinderten Frauen reichen.
Und schließlich muss noch darauf verwiesen werden, dass von den 854 niedergelassenen Gynäkologen und Pädiatern mit 190 Ärzten zwar knapp jeder vierte in die Stichprobe einbezogen wurde, bei einem Rücklauf von 62 Bögen somit nur etwa 7% der Ärzte an unserer Befragung teilnahmen und lediglich neun für die vertiefenden Interviews zur Verfügung standen. Damit erhebt sich die Frage, ob die anderen Ärzte lediglich aus Zeitgründen nicht an der sehr kurzen Screeningbefragung teilnahmen, ob ihnen die Erfahrung mit dieser speziellen Patientengruppe fehlt oder eventuell auch ein gewisses Desinteresse an diesem Thema deutlich wird. Auf jeden Fall erscheint es auch auf der Basis der von den teilnehmenden Ärzten beschriebenen Fragen und Probleme zwingend notwendig, Ärzte für die Unterstützung der Arbeit des Kompetenzzentrums zu gewinnen, um die Effektivität des Zentrums zu erhöhen.
Im Februar 2010 wurden 120 Einrichtungen der Behindertenhilfe und 78 Förderschulen angeschrieben mit der Bitte, uns Auskünfte zum sexualpädagogischen Angebot innerhalb der Einrichtungen zu geben. Die Beteiligung an der Befragung lag bei 18,2%. Von einer Repräsentativität kann daher nicht ausgegangen werden.
Es antworteten vorrangig Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) (47,2%) und Förderschulen (41,7%) und nur sehr wenige Wohnheime (5,6%) und Tagesbetreuungen (2,8%) sowie eine Werkstatt für behinderte Menschen mit integriertem Wohnheim (2,8%). Von Berufsbildungswerken erhielten wir keinen Rücklauf. Da Wohnheime und Tagesbetreuungen in der Regel keine pädagogischen Aufgaben übernehmen und die drei Einrichtungen, die uns geantwortet haben, sexualpädagogische Angebote noch in der Planung haben, wird sich die folgende Auswertung auf die Werkstätten für behinderte Menschen und die Förderschulen beschränken.
Alle Förderschulen und ca. ein Viertel der WfbM bieten sexualpädagogische Veranstaltungen und Materialien an. Innerhalb der WfbM, die keine Angebote bereit halten, sind diese bei 22,2% geplant, bei 38,9% nicht geplant und bei 11,1% wieder eingestellt worden. Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig: Für 33,3% besteht kein Bedarf („Unsere Mitarbeiter verbleiben sehr lange in der Einrichtung, d.h. dass entsprechende Kenntnisse bereits vermittelt wurden. Individuelle Fragen und Probleme werden selbstverständlich jederzeit im kleinen Rahmen aufgegriffen.“ (WfbM 101)). Je 22,2% haben keinen geeigneten Ansprechpartner gefunden („Problem ist, Ansprechpartner zu finden, die mit unserem Klientel arbeiten“ (WfbM 113)) oder es fehlen die finanziellen Mittel und für 16,7% laufen die Vorbereitungen noch. Die Schwierigkeit, als Werkstattleitung auf die Thematik adäquat zu reagieren, macht das folgende Zitat deutlich: „Es wird immer wieder deutlich, dass durchaus Bedarf für Angebote mit der Thematik besteht. Es ist allerdings schwierig, im Rahmen des normalen Werkstattalltages die Konsequenzen der möglichen Aufklärung und Thematisierung bestimmter Aspekte, z.B. plötzlich entstehende Bedürfnisse, aufzufangen und damit während der Arbeitszeit angemessen über diverse Gesprächsrunden hinaus umzugehen. Daher haben wir uns entschieden, in unserer Einrichtung keine Angebote zu diesem Thema durchzuführen.“ (WfbM 002).
Die Inhalte der sexualpädagogischen Angebote innerhalb der Förderschulen richten sich meist nach dem Sächsischen Lehrplan für geistig Behinderte (Sächsisches Bildungsinstitut 2010). Die Themenbreite reicht von Körperaufbau (Körperwahrnehmung, Veränderungen in der Pubertät) über soziale Beziehungen (Liebe, Freundschaft, Partnerschaft, Familie) bis hin zur Sexualerziehung. Zum Teil handelt es sich auch um von den Schulen individuell ausgestaltete Veranstaltungen wie Projekttage und Seminare. Die Zusammenarbeit erfolgt dabei mit regionalen Schwangerschafts- und Familienberatungsstellen sowie Gesundheitsämtern und niedergelassenen Gynäkologen. In einigen Fällen werden auch spezielle Themen aufgegriffen wie minderjährige Mutterschaft („Wenn Kinder Kinder kriegen“), Prävention vor ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten oder Prävention vor sexuellem Missbrauch (Theaterstück „Hau ab du Angst“).
Die Angebote der WfbM sind meist themenzentrierte Kurse zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft, aber auch Verhütung oder speziell auf Frauen und auf Männer abgestimmte Themen. Z.T. werden die Werkstätten dabei von externen Fachkräften aus Schwangerschafts-, Lebens- und Familienberatungsstellen unterstützt.
Materialien des eigenen Trägers werden ausschließlich von den Förderschulen genutzt, ebenso Babysimulatoren im Rahmen des Projektes „Babybedenkzeit“ (Abbildung 27). Des Weiteren kommen Materialien der BZgA, der Lebenshilfe und von pro familia zum Einsatz, die ein breites Spektrum an Themen und Methoden abdecken.
Abbildung 27. Abbildung 27: Nutzung von Materialien nach Anbieter (in %)
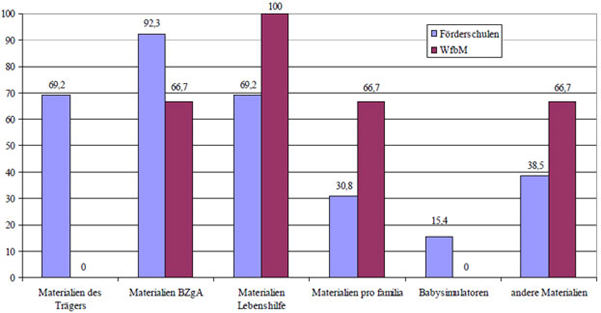
andere Materialien: weitere Verlage (Finken-Verlag) oder Träger (Mixed Pickles, BMFS, Kinderschutzbund), medizinische Flyer, Anschauungsmaterial wie Hygieneartikel und Babypuppen
Zu 70% werden die Angebote gut und zu 30% eher gut angenommen, was für eine insgesamt hohe Resonanz bei den Klienten und Schülern spricht. Alle Einrichtungen bieten im Anschluss an die Veranstaltungen den Teilnehmern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Probleme zu erörtern. Die verwendeten Materialien entsprechen bei 26,7% der Befragten den Anforderungen in der Einrichtung, bei 60% jedoch nur überwiegend und bei 13,3% überwiegend nicht.
Als besonders positiv hervorgehoben und damit für die sexualpädagogische Arbeit sehr gut geeignet sind Materialien in Leichter Sprache, die mit vielfältigem Bildmaterial eine hohe Anschaulichkeit bieten. Die Mitarbeiter der Förderschulen betonen mehrfach das große Interesse der Schüler am Thema und den hohen Aufforderungscharakter der Materialien. „Wissenschaftlich einwandfrei, dabei ohne ablenkende Nebendarstellungen und gute Handreichung. Verwendung von Fachtermini hilft auch, Hemmschwellen beim Lehrenden zu überwinden. Auch spaßige Darstellungen in den Videos helfen über manche Hemmschwelle hinweg“ (15). Die Kooperation mit externen Fachkräften wird als empfehlenswert erlebt, ebenso die Erfahrungen mit den Babysimulatoren: „aktive Arbeit mit den Babysimulatoren kommt ausgezeichnet an“ (119). Allerdings merkte eine andere Schule die hohen Anschaffungskosten als sehr kritisch an. Auch die WfbM können positives berichten: „Teilnehmer/innen sind begeistert von diesem Angebot und arbeiten im Seminar gut mit. Große Nachfrage zur Teilnahme, Möglichkeit der Regelung privater Probleme nach der Teilnahme am Seminar. Sensibilisierung der Eltern und gesetzlichen Betreuer für das Thema“ (116). Gleichzeitig hätten nicht alle Teamkollegen Verständnis für die Notwendigkeit eines sexualpädagogischen Angebotes. Diese Einstellung findet sich auch in den Förderschulen wieder: „nach meinen Erfahrungen ist das oft in weiter Ferne und Schüler wollen nicht damit konfrontiert werden“ (118). Vermutlich verbirgt sich dahinter aber auch die Angst, „schlafende Hunde“ zu wecken. Deutlicher formulierte es eine Schulleiterin: „Lehrkräfte sehen Mutterschaft von Frauen mit geistiger Behinderung kritisch, sind eher geneigt Aufklärung in Richtung kein Kind zu wollen zu lenken, ähnliche Tendenz bei Eltern unserer Schüler“ (013). Die Gründe dafür sieht eine Schulleiterin darin, dass die Eltern ihren Kindern die Fähigkeit und Notwendigkeit sexuellen Erlebens absprechen, da sie bezüglich ihrer eigenen Sexualität selbst oft gehemmt seien. Häufig wechselnde Partnerschaften erschweren zudem die Vorbildfunktion der Eltern und wirken wenig förderlich auf edukative Maßnahmen innerhalb der Schule. Die Auswirkungen sind bereits zu spüren, eine unkritische Partnerwahl und kurz währende, oberflächliche Beziehungen kennzeichnen das Miteinander der Schüler und es findet eine Negativorientierung im Umgang mit der eigener Sexualität (z.B. durch Gebrauch von Vulgärsprache) statt.
Die Schwierigkeiten im sexualpädagogischen Arbeiten innerhalb der Förderschulen liegen jedoch in erster Linie in der Verständlichkeit der Texte, daher richten sich die Wünsche der Förderschulen und WfbM darauf, mehr Materialien in Leichter Sprache und behindertengerecht (z.B. zum Anfassen) zu entwickeln. Außerdem müsste es geschlechtsspezifische Angebote geben, da einige Themen unter den Geschlechtern auf sehr unterschiedliches Interesse stoßen würden, im Bereich der Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Sexualpädagogik für geistig Behinderte, sowohl für Pädagogen als auch für Eltern. Weitere Bedarfe richten sich auf die Kooperation mit anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe und externen Fachkräften, die ebenfalls sexualpädagogisch arbeiten, um z.B. den Austausch von Materialien zu fördern oder neue Ideen aufzugreifen. Beachtung finden sollten auch spezifische Themen wie Kinderwunsch oder sexueller Missbrauch. Gerade bei letztgenanntem wurde die Bitte um Informationen geäußert, da die Dunkelziffer bei Menschen mit Förderbedarf im Schwerpunkt geistige Entwicklung und die Unsicherheit der Betreuer im Umgang mit Anzeichen und Verdacht sehr hoch sei.
Fachtagung „Begleitete Elternschaft“
Veranstaltet durch die Liga der Spitzenverbände trafen sich am 08.10.2008 in Dresden Vertreter aus der Praxis, der Jugendämter und des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KVS) zu einem Erfahrungsaustausch über Möglichkeiten der Begleitung und Unterstützung von Müttern/Eltern mit geistigen Behinderungen. In einer offenen Diskussion wurden Probleme der Finanzierung bestehender Angebote diskutiert und gute Beispiele der Betreuungspraxis vorgestellt. In der Diskussion zeigte sich ein deutlicher Verständigungsbedarf zwischen den Kostenträgern besonders dann, wenn Eltern bzw. Mütter mit Behinderungen und einem erhöhten Unterstützungsbedarf Hilfe benötigen. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe können die alleinerziehenden Mütter oder Väter maximal bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres des Kindes betreuen, dann erfolgt in der Regel eine Trennung von Mutter bzw. Vater und Kind, wenn die Eltern nicht die notwendige Erziehungskompetenz erwerben konnten. Angebote für Mütter und Väter mit Kind gab es überhaupt nicht. Am Beispiel des Projektes „Stattrand“ aus Weißwasser konnte gezeigt werden, dass bei individuellen Verhandlungen auch Betreuungsmöglichkeiten über den Zeitpunkt der Vollendung des 6. Lebensjahres hinaus gefunden werden können. Der bestehende Fehlbedarf an geeigneten Einrichtungen wurde daran deutlich, dass zum Zeitpunkt des Workshops selbst aus Leipzig eine Mutter mit ihrem Kind in Weißwasser untergebracht war.
Fachtagung „Partnerschaft und Sexualität – Wege zur Selbstbestimmung behinderter Menschen“
Unter diesem Thema fand vom 23. bis 25.10.2008 in Chemnitz eine Fachtagung für Interessenten aus Theorie und Praxis der Arbeit mit behinderten Menschen statt. Veranstalter war das SFZ Förderzentrum gGmbH in Chemnitz. In Vorträgen und Workshops gab es einen anregenden Erfahrungsaustausch zu Möglichkeiten und Angeboten für behinderte Menschen, Sexualität und Partnerschaft als wichtige Bestandteile ihres Lebens zu erleben. In verschiedenen Workshops wurden Sexualität und Elternschaft als Menschenrechte herausgearbeitet, denen sich auch Einrichtungen der Behindertenhilfe zu stellen haben. Allerdings wurde auch darauf verwiesen, dass dies noch längst nicht Selbstverständlichkeit geworden ist. Nicht nur Mitarbeiter in den Einrichtungen haben Probleme mit sexuellen und partnerschaftlichen Bedürfnissen ihrer Bewohner:
-
Eltern nehmen ihre erwachsenen Kinder aus den Wohnheimen, wenn sie feststellen, dass in der Einrichtung Partnerschaften geduldet werden
-
Das Problem des Schutzes vor sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch der Bewohner untereinander ist in den Einrichtungen nicht hinreichend geklärt.
-
Einige Einrichtungen wehren sich gegen sexuelle und partnerschaftliche Bedürfnisse ihrer Bewohner z. B. in der Form, dass Doppelzimmer mit einem weiteren Mann oder einer weiteren Frau belegt werden, wenn festgestellt wird, dass der/die bisher alleinige Zimmerbewohner/in seine(n) Partner/Partnerin mit in das Zimmer nimmt; dass einer Heimbewohnerin verwehrt wird, ihr den von ihrem Taschengeld gekauften Dildo auszuhändigen oder die Diskussion darüber geführt wird, wer für Frühstück oder Bettwäsche aufkommen muss, wenn beide Partner aus Einrichtungen unterschiedlicher Trägerschaft kommen.
-
Ungeklärt ist die Frage, wer für die Sicherheit des Heimbewohners aufkommt, wenn dieser die Partnerin in einer anderen Einrichtung besuchen will.
-
Die Dreimonatsspritze wurde als gängiges Verhütungsmittel für alle Heimbewohnerinnen zwischen 15 und 45 Jahren verwendet, unabhängig davon, ob eine Partnerschaft besteht oder nicht. Diese Problematik spiegelt sich auch in den Aussagen der von uns befragten Ärzte wider.
In einem Workshop wurden die Möglichkeiten der Sexualassistenz bei der Begleitung behinderter Menschen vorgestellt und darauf verwiesen, dass sowohl der Medikamentenbedarf bei Personen, die diese Assistenzleistungen in Anspruch nehmen, sinkt als auch Verhaltensauffälligkeiten („Übergriffigkeit“) seltener auftreten. Dieser Aspekt der Sexualität behinderter Menschen wird in der wissenschaftlichen Arbeit bisher kaum beachtet. Allerdings ist auf ein Rechtsgutachten von Zinsmeister (2005: 17ff) zu verweisen, in dem sie sich mit den rechtlichen Maßgaben und Grenzen der Sexualassistenz und Sexualbegleitung auseinandersetzt.
Konferenz Gendering Disability
Vom 22. bis 23.01.2009 fand in Oldenburg an der Carl von Ossietzky-Universität die Konferenz „Gendering Disabilility - Behinderung und Geschlecht in Theorie und Praxis“ statt. Seit den 80er Jahren hat sich in der Behindertenforschung eine neue Forschungsrichtung etabliert, die sich u.a. der definitorischen Frage von Beeinträchtigung (impairment) versus Behinderung (disability) widmet.
Analog eines Paradigmenwechsels wurden weniger die funktionellen Einschränkungen körperlicher, geistiger und psychischer Fähigkeiten als Behinderung diskutiert als vielmehr die behindernden Strukturen und barrierebildenden Rahmenbedingungen, die eine beschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nach sich ziehen. Im Verlauf der Konferenz wurden die sehr verschiedenen Forschungsfacetten in Theorie und Praxis vorgestellt. Dabei wurde dem Phänomen Mehrfachdiskriminierung besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wenn Ausgrenzungserfahrungen nicht allein der Behinderung zuzuschreiben, sondern mit sozialen Faktoren wie z.B. einem Migrationshintergrund und der Problematisierung des Geschlechterverhältnisses verwoben sind. Die anschließenden Workshops boten Raum für die Präsentation praxisrelevanter Projekte in der Jungen- und Mädchenarbeit, die sich viel mit dem Körperbild von heranwachsenden jungen Menschen mit Behinderungen auseinandersetzten. Daher kann als ein Fazit des Austausches der Teilnehmer aus den unterschiedlichen Professionen die Forderung nach geeigneten Angeboten der Sexualpädagogik aufgenommen werden. Dabei müssen den Sehnsüchten nach Partnerschaft und der Auseinandersetzung mit den Bereichen Kinderwunsch und Elternschaft und sowie eine Einbindung in den pädagogischen Alltag Heranwachsender genügend Beachtung geschenkt werden.
Abstracts unter: http://www.zfg.uni-oldenburg.de/26708.html
Fachtagung „Tabuisierte Sexualität“
Am 24. Januar 2009 veranstaltete die Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V. (GSW) in Kooperation mit der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Leipzig die Tagung „Tabuisierte Sexualität“.
An der Tagung nahmen sowohl Wissenschaftler als auch Betroffene aus Selbsthilfegruppen teil. Die in der Gesellschaft für Sexualwissenschaft organisierten Mediziner, Psychologen, Pädagogen, Soziologen etc. widmen sich der Sexualwissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis (z.B. Sexualberatung). Dabei gilt das Augenmerk sowohl dem von der jeweils geltenden Gesellschaft als „normal“ erachteten, als auch dem „außergewöhnlichen“ Verhalten. In Vorträgen sowie Workshops wurden an diesem Tag die vielen Facetten der Sexualität thematisiert und konstruktiv diskutiert. Auf großes Interesse stießen u. a. die Beiträge „Selbstbestimmte Sexualität und Behinderung - eine Herausforderung“ von Petra Winkler (pro familia), sowie „Sexualität und Behinderung. Wie kann die Medizin helfen?“ von Dr. Thomas Löber (Urologe in Niederlassung). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein erfülltes Sexualleben ein essentieller Bestandteil partnerschaftlichen Glücklichseins ist, auf das auch Behinderte ein Recht haben. Das setzt jedoch Aufklärung und Umdenken bei den Behörden, den Pflegenden und Betreuern sowie den Angehörigen voraus. Zwar hat sich in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich vieles zum Positiven verändert, es zeigt sich aber, dass die gesetzlich gestärkten Rechte behinderter Menschen oft nur so weit zur Umsetzung gelangen, wie sie von den Betroffenen (mitunter hartnäckig) eingefordert werden. Natürlich setzt ein Maximum an Selbstbestimmung ebenso den verantwortungsvollen Umgang mit der Sexualität voraus (Verhütung ungewollter Schwangerschaft, Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, Prävention von sexueller Gewalt etc.), wozu eine professionelle sexualpädagogische Aufklärung und Begleitung Betroffener in vertrauensvoller Atmosphäre sowie die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Ratsuchenden erforderlich sind. Zur weiteren Vertiefung sei z.B. auf die Broschüre „Sexualität und körperliche / geistige Behinderung“ (pro familia) mit Literaturempfehlungen sowie Adressen von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen hingewiesen: http://www.profamilia.de/shop/index.php?cmd=artlist&q=6
Fachtagung „Liebe Leben“
Die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen e.V. hatte am 03.06.2009 nach Erfurt zur Fachtagung „Liebe Leben - Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung“ eingeladen. In den Eingangsreferaten sprachen Dr. Frank Herrath (Medienpädagoge, Sexualwissenschaftler) und Petra Winkler (Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpädagogin) über Begriffsdefinitionen, rechtliche Rahmenbedingungen und Vorurteile bezüglich der Sexualität von Menschen mit geistigen Behinderungen. Die Schwerpunkte der verschiedenen Foren lagen bei Partnersuche, Kinderwunsch, Elternschaft, Sexualassistenz und Umgang mit sexualisierter Gewalt. Auf großes Interesse seitens der Mitarbeiter von Einrichtungen der Behindertenhilfe stieß das Angebot der Methoden der Sexualpädagogik für Menschen mit Behinderungen.
In dem Forum „Elternschaft - wie Eltern es schaffen“ von Anja Jonas (Dipl. Sozialpädagogin, Sexualpädagogin) ging es darum, wie die potentiellen Risiken erkannt und eine mangelnde Förderung des Kindes oder eine instabile Mutter-Kind-Beziehung verhindert werden können. So wurden vorhandenen Vorurteilen und Risiken mögliche Hilfsangebote und vorhandene Ressourcen gegenübergestellt. Mehrfach wurde dabei herausgearbeitet, dass die Hauptprobleme nicht in den Strukturen und Angeboten der Netzwerke zu finden sind, sondern in fehlenden Finanzierungskonzepten, die die gemeinsamen und übergreifenden Interessen von Eltern mit geistigen Behinderungen und ihren Kindern berücksichtigen. Viele der im Forum benannten Schwerpunkte und Möglichkeiten der Unterstützung sind zukünftig weiter zu diskutieren, um den Austausch von Informationen zwischen den Fachkräften aus der Behindertenhilfe, Mitarbeitern der Beratungsstellen für Schwangere und Familien und den Experten der Jugendämter zu fördern.
Insgesamt zeigten die Fachtagungen, dass den Themen Sexualität, Partnerschaft und Behinderung zunehmend Aufmerksamkeit in der Betreuungspraxis gewidmet wird. Dabei besteht jedoch der Eindruck, dass dies meist unter dem Aspekt geschieht, besonders Frauen mit geistigen Behinderungen vor sexuellem Missbrauch und Schwangerschaften zu schützen. Ungeklärte rechtliche Regelungen wirken sich ebenso hemmend aus wie Uninformiertheit und Ängste bei Eltern behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behinderten- oder Jugendhilfe. Es wurden sowohl subtile Formen der Verweigerung sexueller Selbstbestimmung deutlich als auch der Körperverletzung durch pauschale Verordnung der Dreimonatsspritze, einem hochwirksamen Hormonpräparat.
Dennoch ließ sich bei vielen der Praxisvertreter ein langsames Umdenken in Bezug auf Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft erkennen. Wichtig erscheint es deshalb, bestehende Aktivitäten und gute Erfahrungen zu bündeln und zu publizieren, um Frauen und Männern mit Behinderungen zu ermutigen, ihr Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung und Familie wahrzunehmen und in der Öffentlichkeit Vorurteile, Mythen und Unwissen in Bezug auf die Sexualität behinderter Menschen abzubauen.
Fachtagungen des Kompetenzzentrums
In eigener Regie führten wir insgesamt drei Fachtagungen durch. Am 2. Juli 2008 fand die Auftaktveranstaltung im Neuen Rathaus Leipzig statt. Teilnehmer dieser Veranstaltung waren Mitarbeiter aus Jugend- und Sozialämtern, Mutter-Kind- Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Schwangerschafts- und Erziehungsberatungsstellen, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Berufsbildungswerken sowie Behindertenverbänden, Selbsthilfegruppen und interessierte Einzelpersonen. In drei Vorträgen wurde sowohl das Forschungsprojekt als auch das Anliegen des Kompetenzzentrums für behinderte und chronisch kranke Eltern vorgestellt (Marion Michel). Sabine Wienholz und Anja Jonas benannten in ihren Vorträgen die Probleme behinderter Mädchen und Frauen bei der Entwicklung ihrer eigenen Sexualität, die mit Tabus, Ängsten und Vorurteilen in ihrem sozialen Umfeld belegt ist. Und schließlich referierte Kerstin Blochberger vom Bundesverband behinderter Eltern bbe e.V. über die Situation behinderter und chronisch kranker Eltern in Deutschland. Insbesondere stellte sie die Probleme vor, die es bei der Entwicklung von Elternassistenz und der Nutzung des persönlichen Budgets für die Unterstützung behinderter Eltern gibt.
In der anschließenden Diskussion fanden die in den Vorträgen geschilderten Probleme Bestätigung aus der Sicht der anwesenden Praxispartner. Viele Teilnehmer bekräftigten den Wunsch nach Aufbau eines funktionierenden Netzwerkes, um Eltern mit Behinderungen ebenso beratend zur Seite stehen zu können wie Mitarbeitern in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Ämtern und Behörden. Im Nachgang der Veranstaltung wurde dann die Idee geboren, einen Rundbrief zum Kompetenzzentrum herauszugeben, um das Interesse, das in der Auftaktveranstaltung bekundet wurde, aufrecht zu erhalten und den Grundstein für das Netzwerk zu legen.
Am 5. September 2009 führten wir im Rahmen eines sogenannten integrativen Familientages eine zweite Veranstaltung durch. Unter der Anwesenheit von Gästen aus dem Netzwerk „Begleitete Elternschaft“, aus Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Schwangerschaftsberatungsstellen, vollstationärer Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Eltern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie Wissenschaftlern wurden Ergebnisse der bisherigen Arbeit am Kompetenzzentrum vorgestellt. In den Vorträgen wurde der Fokus auf die Ziele, Aufgaben und den Entwicklungsstand des Gesamtprojektes (Marion Michel) sowie die Daten zur Situationsanalyse von Müttern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen (Sabine Wienholz) und die Hintergründe eines unerfüllten Kinderwunsches (Anja Jonas) gelegt. Daran schlossen sich Berichte zu praktischen Erfahrungen aus der Arbeit von und mit Eltern mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen an. Die praxisrelevanten Ausführungen zur Arbeit des Bundesverbandes begleitete Elternschaft (Anette Vlasak), die Erfahrungen kleinwüchsiger Eltern (Christiane Döring) und die Informationen zu den Rechtsgrundlagen zur Erlangung von Elternassistenz (Anne Kobes) boten eine gute Basis für weitere Diskussion. Aus ihrer Arbeit mit betroffenen Eltern und deren Kinder berichteten die Mitarbeiterinnen der Familiensprechstunde für Kinder krebskranker Eltern und die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle „Seelensteine“ aus Sachsen Anhalt, einem Projekt für Kinder und Eltern mit psychischen Erkrankungen. Diese beiden Beiträge verdeutlichten sehr engagiert die Notwendigkeit, den Kindern besonders in schwierigen Lebensphasen Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen zu lassen.
Schwerpunkte der nachfolgenden Diskussion betrafen sowohl die Anforderungen an die Politik und die Notwendigkeit der Evaluierung bestehender Angebote als auch die Anforderungen an Multiplikatorenschulungen und die qualifizierte Ausbildung der Ärzte. Aus der zur Vorbereitung dieser Veranstaltung konstituierten Initiativgruppe entwickelte sich mittlerweile ein Expertenteam behinderter Frauen und Männer, die mit ihrem Wissen die Arbeit am Kompetenzzentrum beraten und begleiten.
Schließlich fand am 31. Mai 2010 die Abschlussveranstaltung im Rahmen eines Expertenworkshops statt, an dem ebenfalls wieder Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Praxis teilnahmen. Besonders hervorzuheben war die Anwesenheit von zwei Landtagsabgeordneten (Horst Wehner und Anja Jonas), Marco Winzer vom Kommunalen Sozialverband Sachsen und den Vertreterinnen der Förderer unseres Projektes, Frau Jana Hennig von der Roland-Ernst-Stiftung für Gesundheitswesen Sachsen sowie Frau Birgit Korth, Landesdirektion Chemnitz. Das Ziel des Expertenworkshops bestand vor allem darin, die Ergebnisse der bisherigen Arbeit vorzustellen und die nächsten Schritte abzustecken. Im ersten Teil des Workshops stand der Schwerpunkt Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt zur Diskussion. Mit Beiträgen zum Gesamtprojekt und zu medizinischen Aspekten behinderter Elternschaft (Marion Michel), zu sexualpädagogischen Ansätzen in der Arbeit mit behinderten Jugendlichen (Anja Jonas) sowie den praktischen Erfahrungen der sexualpädagogischen Arbeit und dem Einsatz von Babysimulatoren an einer Schule für geistig behinderte Schüler (Cornelia Maiwald) wurde die Diskussion zu diesem Teil des Expertenworkshops eingeleitet. In der anschließenden Diskussion kam vor allem zur Sprache, dass es sehr wichtig ist, behinderte Kinder (in diesem Fall geistig behinderte Kinder) so zeitig wie möglich zu einer größtmöglichen Selbständigkeit zu befähigen. Um stabile Erfolge zu erzielen, bedarf es besonders der Arbeit mit den Eltern, die eher zur Überbehütung ihrer Kinder neigen. Weiterhin wurde in der Diskussion angesprochen, dass es sehr schwer ist, geeignete Therapeuten und Therapien zu finden, die behinderten Frauen und Mädchen helfen, die Erfahrungen sexueller Übergriffe zu verarbeiten – ein Thema, dem sich das Kompetenzzentrum zukünftig mit annehmen sollte.
Der zweite Teil des Workshops widmete sich dem Schwerpunkt Elternschaft mit Behinderung. Zunächst stellte Sabine Wienholz die Ergebnisse des Forschungsprojektes aus der Sicht der Eltern vor. Ergänzt wurden die Aussagen aus der Sicht einer Kinderärztin, vorgestellt von Anja Jonas. Über die Erfahrungen aus der Sicht der Elterngruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen (BSVS) berichtete Kai Grusa, Vater von zwei Kindern, selbst hochgradig sehbehindert. Seine Aktivitäten, in Schulen über die Situation sehbehinderter Menschen zu sprechen, sollen dazu beitragen, auch für Kinder sehbehinderter Eltern mehr Verständnis bei den Mitschülern zu entwickeln und somit zu erreichen, dass Kinder behinderter Eltern nicht diskriminiert werden. Schließlich berichtete Gabriele Glenk über die Erfahrungen der Kinderarche Sachsen bei der Betreuung behinderter Mütter und ihrer Kinder.
Dieser Beitrag gab besondere Impulse für die Diskussion, denn mehrere Teilnehmer des Workshops sprachen die fehlenden Möglichkeiten für die Betreuung insbesondere geistig behinderter Mütter und ihrer Kinder an. Noch zu häufig wird der Streit zwischen den Kostenträgern auf dem Rücken der behinderten Eltern ausgetragen. Der Vertreter des KSV erklärte seine Bereitschaft, im Bedarfsfall vermittelnd zwischen den Kostenträgern mitzuwirken. Eine Mitarbeiterin eines Jugendamtes verwies zudem darauf, dass behinderte Eltern ermutigt werden sollen, bei bestehendem Hilfebedarf die Jugendämter anzusprechen. Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion widmete sich der Barrierefreiheit in allen Bereichen, die für behinderte Eltern von Bedeutung sind, besonders aber in medizinischen Einrichtungen. Dazu ist die Politik gefragt.
Insgesamt wurden in der Gesprächsrunde zwei Schwerpunkte deutlich. Zum einen wird die weiterhin bestehende Unsicherheit über Zuständigkeiten der Kostenträger auf allen Seiten offensichtlich und damit die Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildungsangeboten auch auf diesem Sektor. Zum anderen zeigen sich eine hohe Kooperationsbereitschaft und der Wunsch nach Vernetzung zwischen allen beteiligten Vertretern.
[2] Das Einschlusskriterium „bis 16 Jahre“ integriert auch Frauen mit mehreren Kindern, deren jüngste Kinder max. 16 Jahre alt sind.
[3] Da es sich in unserer Untersuchungsgruppe um Mütter und daher ebenfalls „jemals Schwangere“ handelt, wurde der Wert von 22% als Grundlage genommen. Nimmt man alle Frauen (auch die ohne Schwangerschaften) als Berechnungsgrundlage, so verringert sich der Anteil auf 15% bundesweit.
Cloerkes hat in seinem Buch „Soziologie der Behinderten“ (2007) Handlungsempfehlungen gegeben, die zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen beitragen können. Da ist einerseits die Idee, dass durch Hilfeleistungen, die von Dienstleistungssystemen übernommen werden, dem Entstehen von Abhängigkeitsverhältnissen entgegen gewirkt werden kann. Persönliche Kontakte mit behinderten Menschen bauen genauso Vorurteile und Berührungsängste ab wie fundierte Informationen, die durch Betroffene im Sinne von peer counseling selbst präsentiert werden. Ein weiterer Vorschlag dient der Abschaffung von Sonderwelten. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass die Identitätsentwicklung behinderter Menschen bei Integration besser verliefe. Das gilt auch für die Entstigmatisierung von Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft behinderter Menschen.
Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen Veränderungen und Neuorientierung vollzogen werden müssen. Ein wesentlicher Bereich ist dabei der Abbau vorhandener Barrieren und latent vorhandener Vorurteile mit Stigmatisierungsansätzen. Netzwerke müssen ausgebaut und mit Informationen versehen werden, medizinische Forschung vorangetrieben und die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln erweitert werden. Ein weiterer Ansatzpunkt muss in der Ausbildung von medizinischem Fachpersonal liegen, und auch die Experten aus dem Bereich der Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit müssen entsprechende Fortbildungsangebote erhalten und wahrnehmen.
Integration und Inklusion sind zwei der Bausteine des Selbstbestimmt-Leben-Konzepts. Auch wenn der Umsetzung der Idee ein langer Lernprozess vorausgeht und Betroffene durch Überbehütung und geringe Kontakte zur Außenwelt große Schwierigkeiten mit Sozialkontakten haben, gewinnt die Selbstbestimmtheit immer mehr an Bedeutung. Für immer mehr behinderte und chronisch kranke Frauen gehören eigene Kinder zu ihrer Lebensplanung. Daher ist es notwendig, dass behinderte und chronisch kranke Personen bereits im Kindes- und Jugendalter mit den Themen Partnerschaft, Sexualität und Familienplanung in Berührung kommen, um ihnen die notwendigen Kompetenzen in diesen Bereichen an die Hand zu geben. Dies könnte auch einen präventiven Charakter vor sexueller Ausbeutung haben, der behinderte Menschen nach wie vor häufiger ausgeliefert sind. Dass Eltern ihren behinderten oder chronisch kranken Kindern weniger Chancen auf Partnerschaft und Kinder einräumen, kann ein Hinweis darauf sein, dass sie es besonders schwer haben, sich von ihren Kindern zu lösen und abzugrenzen. Es fällt ihnen schwer zu akzeptieren, dass ihre Kinder im Rahmen ihrer Entwicklungsaufgaben eine eigenständige Persönlichkeit bilden müssen und auch die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen dazu brauchen. Die sexuelle Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil dieser persönlichen Reife und es scheint, dass sich Eltern von behinderten oder chronisch kranken Kindern besonders dagegen wehren und ihre Kinder stattdessen als ewige Kinder, als unverdorben und untrennbar mit ihnen vereint verstehen. Hier könnten speziell ausgerichtete sexualpädagogische Projekte in den Schulen ansetzen, die auch die Eltern mit einbeziehen, um einen Weg zu zeigen, wie Kinder und Jugendlichen in Einvernehmlichkeit mit ihren Eltern ihr Recht auf eine Selbstbestimmung, Partnerschaft und Familie wahrnehmen können.
Die Konzepte und Methoden der Sexualpädagogik sollten erweitert und ausgebaut und nicht allein auf die Sexualität bestimmter Behinderungsarten wie Schwerst- oder geistige Behinderungen inklusive Kontrazeptionsmaßnahmen reduziert werden. Z.B. muss die Auseinandersetzung mit den Rollen von Mann und Frau und das entsprechende Rollenverhalten möglich sein, da die Fähigkeit, Kinder gebären zu können, ein Grundelement weiblicher Individuen ist. Nicht jede Thematisierung von biologischen Vorgängen der Konzeption und der Beschreibung der embryonalen Entwicklung ruft bei Frauen mit Behinderungen einen unstillbaren Kinderwunsch hervor, aber es gibt die Möglichkeit zu verstehen, wie menschliches Leben entsteht und wie ein Mensch zur Welt kommt. Auch Frauen mit schweren Körperbehinderungen wollen wissen, ob prinzipiell eine Schwangerschaft möglich wäre oder ob aufgrund der Schädigungen oder der Medikamenteneinnahme ein zu großes Risiko für Mutter oder Kind besteht. Einfließen in die Sexualpädagogik muss auch das Identifizieren von Ressourcen, welche eine Elternschaft unterstützen und nachhaltig stärken.
Familiengründung kann als wichtiger Lebensinhalt von behinderten und chronisch kranken Frauen interpretiert werden, so dass sich auch die Ärzte und Kliniken zunehmend auf diese Klientel einstellen müssen. Dass dies zum Teil schon getan wird, zeigen die positiven Erfahrungen der befragten Frauen in unserer Studie. Bereits in der Untersuchung von Barbara Levc (2008) wurde deutlich, dass ein früher Kontakt zur Geburtsklinik sowohl für die behinderte oder chronisch kranke Frau als auch für das Klinikpersonal von Vorteil und daher empfehlenswert ist. So können die Schwangeren die Klinik, die Hebamme oder das Pflegepersonal bereits vor der Entbindung kennenlernen, was es wiederum erleichtert, sich besser aufeinander einzustellen. Auch um, wie Levc schreibt, „belastende Kämpfe mit dem Klinikpersonal“ (2008: 90) zu verhindern, die notwendigen Vorbereitungen treffen und die Rahmenbedingungen der Geburt und der Wochenbettphase genau planen zu können. So berichteten in unserer Studie einige Frauen darüber, es als sehr hilfreich und unterstützend erlebt zu haben, wenn die Hebamme oder die Geburtsklinik bereits Erfahrungen mit behinderten Frauen hatte und sich entsprechend auf die Bedürfnisse der behinderten Schwangeren einstellen konnte. In diesen Fällen wurde die Betreuung von den behinderten Frauen als sehr gut und ihren Bedürfnissen entsprechend erlebt und hat auf Seiten der Schwangeren Ängste und Unsicherheiten abbauen können.
Schwangerschaft bzw. Fertilität bei behinderten oder chronisch kranken Frauen zum festen Bestandteil in der medizinischen Aus- und Weiterbildung zu machen, ist ein weiterer Schritt, betroffenen Frauen Vertrauen durch Wissen und Erfahrungen entgegenzubringen und um das Verhältnis Mediziner-Laie in schwierigen Situationen zu entspannen, z.B. unter der Geburt. Ärzte und medizinisches Personal wie Physiotherapeuten, Krankenschwestern und Krankenpfleger sowie Hebammen sollten bereits in ihrer Ausbildung auch die Schwerpunkte Elternschaft mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen erfahren. Gerade für Hebammen und Kinderkrankenschwestern sind diese Bereiche berufsrelevant, dennoch orientieren sich bisherige Themenkomplexe der Ausbildung zum Thema Behinderung ausschließlich auf die Versorgung eines erkrankten oder behinderten Kindes. Dies sollte durch Aufnahme von fakultativen Wahlpflichtangeboten in die entsprechenden Ausbildungskataloge aufgenommen werden, um bereits frühzeitig in der beruflichen Entwicklung eine Auseinandersetzung mit diesem Thema zu ermöglichen. Die Ausbildung der Ärzte erfolgt durch ein intensives, fachübergreifendes Studium, bei dem die Sozialmedizin nur einen minimalen Bereich einnimmt. Durch die Etablierung von speziellen Angeboten können von Medizinstudenten z.B. Formen der Kommunikationsunterstützung und Publikationen in „Leichter Sprache“ eingesetzt sowie die Gebärdensprache erlernt werden. In entsprechenden Veranstaltungen wird immer wieder deutlich, dass das Interesse der Ärzte an rechtlichen Grundlagen und an sozial unterstützenden Maßnahmen vorhanden ist und auch entsprechende Artikel in Fachzeitschriften auf reges Interesse dieser Berufsgruppe stoßen. Eine gute Vorbereitung der Frauen ist ebenfalls wichtig bei pränataldiagnostischen Untersuchungen. Sie mit den Vor- und Nachteilen vertraut zu machen, indem man sie auf die möglichen Konsequenzen hinweist, kann dazu beitragen, dass die Betroffenen eine unbelastete Entscheidung fällen können. Ebenso grundlegend ist die Kooperation der verschiedenen Fachärzte, bei denen die behinderte oder chronisch kranke Frau in Betreuung ist, um widersprüchliche Empfehlungen in Bezug auf eine potentielle Realisierung des Kinderwunsches auszuschließen. Nach wie vor sind Defizite in der Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen Fachrichtungen (z.B. Orthopädie, Neurologie versus Gynäkologie) wahrnehmbar, was dann zur Verunsicherung der Patienten beiträgt. Deshalb gilt es auch bei Ärzten das Interesse an Berufsstammtischen und an Netzwerkarbeit zu wecken und geeignete, zertifizierte Fortbildungsangebote zu schaffen.
Wie der Stand der medizinischen Forschungen zeigt, besteht die Notwendigkeit, nicht nur vorhandene Erkenntnisse so schnell wie möglich in der Berufspraxis zu verbreiten, sondern auch bestehende Forschungsdefizite zu beseitigen. Das könnte durch spezielle klinische Studien analog zu EURAP oder fertiPROTEKT erfolgen, aber auch durch die Dokumentation und Publikation von Erfahrungen mit behinderten und chronisch kranken Frauen und Männern in Bezug auf Erhalt und Wiederherstellung der Fortpflanzungsfähigkeit, Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sowie Fehlbildungsrisiken für das Kind. Im Rahmen des Kompetenzzentrums könnten derartige Erfahrungen gesammelt und dokumentiert werden. Nicht jedes seltene Krankheitsbild rechtfertigt ein großes Forschungsprojekt, zumal dann nur sehr kleine Fallzahlen einbezogen werden können. Aber die Erfahrungen anderer können Unsicherheiten und Ängste vermeiden.
Einen großen Beitrag zur Integration von Menschen mit Behinderungen kann generell die Schaffung einer Barrierefreiheit leisten (Hettenkofer 2003). Dabei geht es nicht nur um die Erreichbarkeit von Ärzten, Hebammenpraxen oder Angeboten der Physiotherapie, sondern beinhaltet auch das Vorhandensein von Informationsmaterialien in Leichter Sprache, in digitaler Form und das Verwenden von Elementen der Gebärdensprache. Das Einrichten von Qualitätsstandards für die ambulante gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderungen wurde bereits im November 2008 auf einer Fachtagung vom pro familia- Bundesverband in Kassel gefordert. So muss Barrierefreiheit gemäß dem Behindertengleichstellungsgesetz umfassend definiert werden, denn es orientiert auf: “bauliche, technische und physische als auch auf kommunikative, visuelle und auf taktile Barrieren...” (pro familia 2008). Wesentliche Eckpunkte der geforderten Standards für barrierefreie Arztpraxen könnten unter anderem eine gute Erreichbarkeit der Praxis und der Zugang auch für Blindenführhunde, eine ausreichende Türbreite von mindestens 90 cm, ein abgesengter Eingangsbereich (Arzttheke oder Tresen) und als Fachspezifik der jeweiligen Facharztrichtung eine höhenverstellbare extrabreite Untersuchungsliege bzw. ein Untersuchungsstuhl und ein Hebelift sein. Selbstverständlich sollten auch praxisorganisatorischen Merkmale hinterfragt werden wie z.B. der eingeplante Zeitfaktor, da die Untersuchung von Patienten mit Behinderungen zeitintensiver sein kann. Für den Umgang mit Betreuern oder Begleitpersonen von Patientinnen sollten Standards entwickelt werden, um zu vermeiden, dass sie entgegen dem Willen der Patientin bzw. Klientin entscheiden oder nicht auskunftsfähig sind über Sachverhalte, die für die Konsultation in der Arztpraxis oder Beratungsstelle relevant sind. Grundbedingung für die Behandlung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen ist neben der ärztlichen Kompetenz auch das Vorhandensein von Empathie und Kommunikationsbereitschaft. Wenn Frauen oder Paare spüren, dass man in dem Arzt einen vorurteilsfreien, empathischen Gesprächspartner gefunden hat, dann lassen sich auch Ängste, Erwartungen und Schwierigkeiten bezüglich eines Kinderwunsches oder einer Schwangerschaft leichter kommunizieren. Es ist bekannt, dass das bisherige Vergütungssystem der Ärzte keine Rücksicht auf einen erhöhten Zeitfaktor und besondere Praxisausstattung nimmt, aber dennoch sollten Ärzte motiviert werden, diese besondere Personengruppe zu unterstützen.
Immer wieder wird in Gesprächen mit Multiplikatoren und Experten verschiedenster Bereiche deutlich, dass die Einstellungen zu Kinderwunsch und Partnerschaft bei Menschen mit Behinderungen individuell sehr verschieden sind. Häufig stehen Äußerungen nach Kindeswohl und möglichen hohen finanziellen Anforderungen an erster Stelle, gefolgt von Fragen nach Verantwortung und von Mitleid. Derartige Einstellungen bei den Experten der unterschiedlichen Professionen müssen durch die Darstellung von Ressourcen behinderter Menschen und Rahmenbedingungen für die Unterstützung der Eltern ausgeräumt werden. Positive Beispiele sollten deshalb verstärkt publiziert werden, wobei sowohl individuelle Erfahrungen behinderter Mütter und Väter als auch gelungene gesellschaftliche Lösungen dargestellt werden sollten. Bestehende negative Einstellungen und Äußerungen werden bewusst oder unbewusst weitergegeben und fließen damit latent auch in die Handlungsebene ein. Damit muss auch der nach wie vor gängigen Praxis entgegengewirkt werden, bei Eltern mit geistigen Behinderungen sehr schnell eine Trennung von Mutter/Eltern und Kind vorzunehmen, statt zuerst Unterstützungsangebote zu entwickeln, z. B. in geeigneten Wohnformen, die einen Verbleib des Kindes bei seinen leiblichen Eltern ermöglicht. Jede Form von Stigmatisierung ist generell abzulehnen und erfordert auch das Umdenken seitens der Medien und Berichterstatter. Eltern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die brillant ihren Lebensalltag meistern, dürfen nicht nur einzelne, sensationelle Darstellungen erhalten, sondern müssen alltagsrelevant sein. Dass Menschen mit Einschränkungen teilweise einen höheren Unterstützungsbedarf auch in Bezug auf Kinderbetreuung und eventuell auch bei der Kinderversorgung haben, darf nicht als Argument erschwerter Elternschaft herangezogen werden. Das gilt auch, wenn damit höhere finanzielle Belastungen auf das gesellschaftliche Umfeld zukommen. Entsprechende versorgende und betreuende Wohnformen müssen vor allem in Sachsen erst noch geschaffen werden, um Trennungen von Eltern und ihren Kindern zu verhindern. Eine Trennung widerspricht meist generell dem Kindeswohl, und Bundesländer wie Brandenburg oder Schleswig-Holstein sind mit den Projekten der “Begleiteten Elternschaft” neue, innovative Wege gegangen. Daran sollte sich auch Sachsen orientieren. Wenn Paare mit Kinderwunsch wissen, dass es auch in schwierigen Zeiten oder bei auftretenden Problemen Hilfe und Unterstützungen ohne eine permanente Rechtfertigungsnot gibt, dann können auch Paare einen Kinderwunsch ohne Ängste kommunizieren und lebbar machen. In diesem Sinne sind Heimkonzepte nach §19 SGB VIII weiterzuentwickeln, die eine Mischfinanzierung des Heimplatzes aus Mitteln der Jugend- und der Eingliederungshilfe ermöglichen, wenn das Kind älter als sechs Jahre ist und die nicht nur auf alleinerziehende Personen abheben, sondern tatsächlich auch „Familienbildung“ ermöglichen. Das gilt gleichermaßen auch für die Personengruppe der jugendlichen Eltern. Ebenso sollte das Trägerübergreifende Persönliche Budget als eine Fördermöglichkeit für selbstbestimmte Elternschaft in Sachsen etabliert werden, damit die Interessen von Eltern und Kindern besser gewahrt werden können.
Als eines der wichtigsten Netzwerke für Eltern mit Behinderungen agiert der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e.V. mit seinem Stammsitz in Bad Oeynhausen. Dieser Verband bietet mit seiner Organisation von behinderten und chronisch kranken Eltern Hilfe, Unterstützung und Beratung an. Dabei orientiert man sich an den positiven und negativen Erfahrungen seiner Mitglieder und bietet Fortbildungsveranstaltungen, Unterstützung bei der Suche nach den geeigneten Hilfsmitteln und bei der Suche nach Assistenz an. Als einzige regionale Gruppe bieten die Ansprechpartner aus Frankfurt am Main einmal im Monat ein Treffen für behinderte oder chronisch kranke Paare mit und ohne Kinder an, um Paaren mit Kinderwunsch bereits im Vorfeld einer Schwangerschaft einen Austausch zu Unterstützungsmöglichkeiten und Problemen zu bieten. Es wäre wünschenswert, wenn derartige Angebote ausgebaut und vor allem deutschlandweit vorhanden wären. In Sachsen existiert eine kleine Regionalgruppe, die sich ausschließlich für sehbehinderte Eltern in Sachsen engagiert und damit nur einen sehr kleinen Teil der Elternschaft mit Behinderungen abdeckt. Ein weiterer Baustein eines funktionierenden Netzwerkes sind die zahlreichen Selbsthilfegruppen und viele kleinen Vereine. So hat Leipzig allein ca. 200 Selbsthilfegruppen und stellt damit eine wertvolle Unterstützung für betroffene Menschen dar. In Selbsthilfegruppen treffen sich Betroffene mit anderen Menschen, die den gleichen Krankheits- oder Behinderungskontext haben, um auf freiwilliger Basis Interessen zu teilen oder eine gemeinsame Freizeitgestaltung zu erleben. Selbsthilfe trägt dazu bei, Lebensqualität zu verbessern und aus gemeinsamen Aktionen neuen Mut zu schöpfen. In Zeiten finanzieller Schwierigkeiten und kommunaler Einsparungen dürfen die Potentiale dieser kleinen Netzwerkstrukturen nicht unterschätzt werden, da Selbsthilfegruppen einen hohen Informationsgrad und ein großes Erfahrungswissen zu dem jeweiligen Themenkomplex besitzen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Selbsthilfegruppen auch untereinander einen regen Erfahrungsaustausch pflegen würden, da einige Probleme unabhängig vom Einschränkungsbild oder der Krankheit gleich oder ähnlich gelagert sind. Für betroffene Eltern und Paare mit Kinderwunsch können sie unmittelbar vor Ort einen ersten Ansprechpartner bieten und in vielen Fällen weitere kompetente Ansprechpartner aus dem medizinischen Bereich sowie soziale Fachkräfte z.B. aus den Beratungsstellen vermitteln. Das Wissen um die eigene Erkrankung, um Ansprechpartner und die Kenntnisse um Krankheitsverläufe kann Sicherheit geben, eine Entscheidung für ein gemeinsames Kind zu treffen. Dabei sollten sich die Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen für jüngere Interessenten öffnen.
Blickt man auf mögliche Veränderungen, die unsere Gesellschaft ohne großen Aufwand leisten könnte, wird deutlich, dass es an jedem einzelnen Menschen liegt, das Blickfeld von einer Randgruppe der Gesellschaft hin zur Selbstverständlichkeit des Alltags für Menschen mit Behinderungen zu lenken. Auch viele kleine Schritte ermöglichen einen langen Weg, an dessen Ziel nach einem Kinderwunsch eine erfüllte Elternschaft stehen kann, die einem Kind eine glückliche Familie mit umsorgenden, liebevollen Eltern gibt. Der Wunsch nach eigenen Kindern darf nicht aufgrund von Ängsten und gesellschaftlichen Erwartungen versagt bleiben. Alle Menschen müssen gemeinsam die Rahmenbedingungen schaffen, damit Eltern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen selbst Kinder aufziehen und versorgen können, denn sie geben ihren Kindern ein Wissen mit, welches Menschen ohne Behinderungen oder Erkrankungen verborgen bleibt. Damit bereichern sie sowohl als Eltern als auch mit ihren Kindern unermesslich unsere Gesellschaft.
Zusammenfassend lassen sich folgende Handlungsempfehlungen aus den vorliegenden Ergebnissen ableiten:
-
Die Datenbasis über den Anteil behinderter Mütter/Eltern muss weiter ausgebaut werden, da bisher zu wenig statistisch belastbare Daten vorliegen.
-
Forschungsbedarf besteht in Bezug auf krankheits- bzw. schädigungsbedingte Möglichkeiten und Risiken für die Fertilität, für Schwangerschaft, Geburt und Situation des Kindes.
-
Aktuelle Erkenntnisse sind zeitnah zu publizieren und Ärzten, professionellen Kräften in Ämtern, Behörden und Diensten sowie behinderten und chronisch kranken Frauen und Männern selbst zugänglich zu machen. Dazu bieten sich die verschiedensten Formen von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen an, die sich auch an solche Berufsgruppen wenden sollten, die nur mittelbar mit behinderten Menschen Kontakt haben, z.B. Richter, Stadtplaner und Architekten.
-
Entsprechend der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen sind die Rahmenbedingungen für selbstbestimmte Elternschaft in Sachsen konsequent zu entwickeln. Das betrifft in Bezug auf Eltern mit Handicap vor allem die Anwendung bereits bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen (z.B. Elternassistenz und Trägerübergreifendes Persönliches Budget), aber auch die Weiterentwicklung von Angeboten und Leistungen (z.B. geeignete Wohnformen für Eltern mit Handicap, integrative Kinderbetreuungs- und Schulangebote, die auch auf die Bedürfnisse behinderter Eltern eingerichtet sind).
-
Medizinische Versorgungseinrichtungen müssen zunehmend den Kriterien der Barrierefreiheit entsprechen, damit Versorgungsleistungen auch entsprechend den allgemein gültigen Regeln in Anspruch genommen werden können. Sinnvoll wäre, in entsprechenden Verzeichnissen (z.B. Ärzteverzeichnis der KVS) die Barrierefreiheit mit auszuweisen, damit Menschen mit Behinderungen schnell den passenden Arzt finden und aufsuchen können.
-
Informationen über bestehende Angebote für Eltern mit Behinderungen sollten in barrierefreier Form publiziert werden, damit sie diese Angebote auch entsprechend ihres persönlichen Bedarfs nutzen können.
Inhaltsverzeichnis
- 6.1 Wahlfachangebot für Studierende der Humanmedizin
- 6.2 Herausgabe eines Rundbriefes zur Unterstützung der Netzwerkarbeit
- 6.3 Aufbau einer Arbeitsgruppe
- 6.4 Aufbau der Homepage für das Kompetenzzentrum
- 6.5 Broschüren in Leichter Sprache
- 6.6 Bearbeitung der Anfragen
- 6.7 Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für behinderte und chronisch kranke Eltern
Obwohl der Schwerpunkt des geförderten Projektes auf der medizinsoziologischen Analyse lag, bestand von Beginn an Klarheit darüber, dass in diesem Forschungsfeld nicht ausschließlich wissenschaftliche Interessen bedient werden können, sondern parallel dazu auch Beratungs- und Weiterbildungsangebote sowie das geplante Netzwerk aufgebaut werden mussten.
Die wesentlichen praktische Ergebnisse bestehen in
-
der Konzipierung des Wahlfachangebotes für Medizinstudenten;
-
der Herausgabe eines Rundbriefes zur Unterstützung der Netzwerkarbeit;
-
dem Aufbau einer Arbeitsgruppe mit behinderten Expertinnen und Experten zur Begleitung und Umsetzung des Forschungsprojektes;
-
dem Aufbau der Homepage für das Kompetenzzentrum;
-
der Entwicklung von zwei Broschüren in Leichter Sprache zum Thema Familienplanung und Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft;
-
der Bearbeitung von Anfragen behinderter Eltern oder Sozialarbeitern;
-
der Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für behinderte und chronisch kranke Eltern.
Studierende der Humanmedizin absolvieren in den klinischen Semestern einen Lehrabschnitt „Wahlfach“. Dabei müssen sie aus einem umfangreichen Angebot praxisrelevanter Themen wählen. Im Wintersemester 2010 wurde von uns erstmals das Wahlfach „Behinderung und Schwangerschaft“ angeboten. Allerdings gab es nur drei Anmeldungen, so dass der Kurs nicht stattfand. 2011 wird er mit einem leicht modifizierten Konzept wieder angeboten, wobei vor allem die zeitliche Planung konkreter erfolgen muss.
Als verantwortliche Lehrkräfte zeichnen Dr. Marion Michel und Prof. Dr. Renaldo Faber. Das Lehrziel besteht darin, anhand von praktischen Beispielen, Filmvorlagen, Gruppendiskussionen mit behinderten Eltern bzw. Eltern mit behinderten Kindern, Praxisvertretern, einer Hospitation in einer PND-Praxis Standpunkte zu erarbeiten zur medizinischen und psychosozialen Betreuung behinderter Schwangerer, behinderter Menschen mit Kinderwunsch und Eltern mit zu erwartendem behinderten Kind.
Folgende Themenkomplexe waren geplant:
-
Behinderung: gesellschaftliche und individuelle Dimensionen (2 Stunden)
-
Sozialisation behinderter Kinder und Jugendlicher (2 Stunden)
-
Sexualität, Sexualassistenz, Partnerschaft, Kinderwunsch und Behinderung (4 Stunden)
-
Potentiale und Grenzen behinderter Eltern (4 Stunden)
-
Behinderte Frauen in der gynäkologischen Praxis (2 Stunden)
-
Fertilitätsstörungen und Therapiemöglichkeiten (2 Stunden)
-
Pränataldiagnostik und Behinderung (4 Stunden)
-
Psychosoziale Beratung, Pränataldiagnostik und Schwangerschafts(konflikt)beratung (4 Stunden)
-
Rechtliche Grundlagen (Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe) und Kostenträger (Vorstellen von Praxisbeispielen) (4 Stunden)
Obwohl der Kurs 2010 noch nicht stattfand, fanden Aspekte Eingang in das reguläre Lehrangebot im Fach Sozialmedizin an der Universität Leipzig in Form eines Seminars und einer Vorlesung. Darüber hinaus werden drei Doktoranden betreut, die sich mit ausgewählten Themen im Rahmen des Gesamtprojektes „Aufbau eines Kompetenzzentrums für behinderte und chronisch kranke Eltern in Sachsen“ befassen.
Mit der Fortsetzung des Projektes werden die Aus- und Weiterbildungskonzepte weiter entwickelt und zum Bestandteil der Arbeit am Kompetenzzentrum.
Anlässlich der Auftaktveranstaltung für das Projekt im Juli 2008 wurde deutlich, welch großes Interesse an der Thematik Elternschaft und Behinderung bestand. An der Veranstaltung nahmen Wissenschaftler, Vertreter aus Behindertenverbänden und Selbsthilfegruppen, Jugend- und Sozialämtern, Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe, der Schwangerschaftsberatung und der Politik teil. Um bereits während des laufenden Forschungsprojektes mit dem Aufbau eines Netzwerkes zu beginnen und den Impuls der Auftaktveranstaltung dafür zu nutzen, beschlossen wir, einmal im Quartal einen Rundbrief herauszugeben, der über den aktuellen Stand der Forschung informiert und Praxispartnern die Möglichkeit geben soll, über ihre Projekte zu informieren, neue Literatur und aktuelle Themen vorzustellen. Insgesamt erschienen bisher sechs Rundbriefe. Mittlerweile empfangen ca. 200 Einrichtungen oder Einzelpersonen den Rundbrief. Es gibt erste Beiträge, die von anderen Praxispartnern des sich entwickelnden Netzwerkes verfasst wurden und es werden Nachfragen aus anderen Bundesländern an uns herangetragen. Die Rundbriefe werden außerdem im Internet auf unserer Homepage unter dem folgenden Link veröffentlicht: http://www.leben-mit-handicaps.de/kompetenz.htm
In Vorbereitung auf den Familientag am 05. September 2009 konstituierte sich im Februar 2009 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus behinderten/chronisch kranken Frauen und Männern, die den Tag mit vorbereiteten und uns als Wissenschaftlerteam beratend zur Seite standen. Die mit Projektstart angebahnten Kooperationsbeziehungen zum Bundesverband behinderte Eltern bbe e.V., der Liga der Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen der Behindertenhilfe erreichten durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Expertenteam eine neue Qualität und entwickelten sich nach dem Familientag zu einer stabilen Arbeitsgruppe. Der Arbeitsgruppe gehören vier Frauen und ein Mann mit verschiedenen Behinderungen an (Hörschädigung, Körperbehinderung, Kleinwuchs), die alle in für das Kompetenzzentrum relevanten Berufen tätig sind.
Das Ziel der Arbeitsgruppe besteht darin, die wissenschaftliche Arbeit zu beraten und zu begleiten sowie die praktische Umsetzung der Forschungsergebnisse zu unterstützen, z. B. durch Mitarbeit am Rundbrief, Vorbereitung von Veranstaltungen oder Beratung bei Anfragen an das Kompetenzzentrum.
Im zweiten Aufbauabschnitt des Kompetenzzentrums ab Juni 2010 werden die Experten in eigener Sache vor allem am Aufbau des Peer Counselings und der Entwicklung von Beratungsangeboten mitarbeiten.
Das Kompetenzzentrum präsentiert sich im Internet zurzeit noch unter dem folgenden Link: http://www.leben-mit-handicaps.de/kompetenz.htm . Auf der Homepage stellt sich das Projekt vor, ebenso sind die bisher erschienen Rundbriefe eingestellt. Obwohl die Seite noch einen vorläufigen Charakter trägt, erreichten uns eine Reihe von Anfragen über den Kontakt zu unserer Internetpräsentation. Das bestätigt die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Nutzung des Mediums Internet, um möglichst viele Rat suchende Personen zu erreichen. Deshalb begannen wir in der Endphase der Projektlaufzeit, die künftige Seite des Kompetenzzentrums neu zu konzipieren. Die Seite wird barrierefrei sein. Die Rubriken müssen mit Inhalt gefüllt und regelmäßig aktualisiert werden. Außerdem wird die Online-Beratung als niederschwellige Möglichkeit der Kontaktaufnahme vorbereitet.
Sowohl in den Workshops als auch in Gesprächen mit Eltern, medizinischem Personal und Schwangerschaftsberatungsstellen wurde immer wieder die Notwendigkeit hervorgehoben, Informationsmaterial zum Thema Sexualität, Partnerschaft und Kinderwunsch/ Schwangerschaft bereit zu stellen. Da wir Mitglieder im Bundesnetzwerk Leichte Sprache sind, planten wir die Erarbeitung von zwei neuen Informationsheften sowie eine Überarbeitung der Broschüre „Wegweiser Schwangerschaft in Leichter Sprache“.
Nach Rücksprache mit den leitenden Hebammen der Universitätsfrauenklinik Leipzig überarbeiteten wir den Wegweiser, um ihn für eine Neuauflage vorzubereiten. Mit Unterstützung der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig (DZB) und ihrem Leiter, Dr. Thomas Kahlisch, liegt die Broschüre inzwischen auch in Braille-Schrift sowie im Daisy-Format als Hörbuch vor und wird gegenwärtig von blinden Testlesern geprüft. Auch die nachfolgenden Hefte werden voraussichtlich in diesem Format erscheinen.
Mit Unterstützung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entstanden die beiden neuen Hefte „Familienplanung und Schwangerschafts-Verhütung“ sowie „Vorsorge in der Schwangerschaft“. Für die Broschüre „Familienplanung und Schwangerschafts-Verhütung“ wurden Verhütungsmittel ausgewählt und beschrieben, die für Frauen mit Lernschwierigkeiten besonders gut geeignet sind. Wir beschrieben in der Broschüre Bau und Funktion der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane, verwiesen auf die Möglichkeiten der Verhütung von sexuell übertragbaren Krankheiten und das Recht, selbst über die Art der Verhütung zu entscheiden.
Die Broschüre „Vorsorge in der Schwangerschaft“ beschreibt die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik und Unterstützungsangebote bei auffälligem Befund. Auch diese Broschüre soll dazu beitragen, dass Frauen und Männer mit Lernschwierigkeiten die bestehenden Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik, deren Sinn und Risiken kennen lernen und weitgehend selbst entscheiden können, welche der genannten Maßnahmen sie in Anspruch nehmen wollen. Daneben sollen sie wissen, dass sie diese Untersuchungen auch ablehnen können. Damit stellen wir den Interessenten ein Aufklärungs- und Beratungsangebot zur Verfügung, das ihnen helfen soll, selbstbestimmt entscheiden zu können. Alle Materialien wurden in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in der Diakonie am Thonberg von Prüfern getestet und von uns entsprechend überarbeitet.
Durch die Publikation unserer Arbeit in den Medien sowie unsere Präsentation im Internet erreichten uns eine Reihe sehr konkreter Anfragen, die wir bemüht waren, zu beantworten bzw. Lösungsmöglichkeiten für bestehende Probleme anzubieten.
Die folgende Übersicht soll die Vielschichtigkeit der bestehenden Problemlagen sowie die bundesweite Resonanz des Kompetenzzentrums verdeutlichen (Tabelle 28):
| Anlass | Ergebnis | |
|---|---|---|
|
Frau N. (Berlin) |
spastisch gelähmte Mutter eines 2-jährigen Sohnes und einer 10 Monate alten Tochter sucht Assistenz für Kinderbetreuung (MM) |
vermittelt an Anbieter von Assistenzleistungen in Berlin |
|
Frau Sch. (Sachsen) |
körperbehinderte Mutter kämpft um Rückgabe ihrer 6-jährigen Tochter, die während eines Krankenhausaufenthaltes der Mutter zu Pflegeltern gegeben wurde und danach nicht wieder in den Haushalt zurück kam |
mehrfache Gespräche mit der Kindesmutter und den zuständigen Behörden, Vorbereitung einer Übersiedlung in ein betreutes Wohnen nach L., danach ist Kontakt zur Mutter abgebrochen |
|
Beratungsstelle (Sachsen) |
junge Familie, Mutter blind, zwei Knie- Endoprothesen, Kind 1 Jahr, nicht behindert Familie benötigt Unterstützung, das Kind in eine Kindereinrichtung zu bringen, um es altersgerecht fördern zu lassen. Es besteht keine Möglichkeit, diese Leistung finanziert zu bekommen. |
Antrag an Otto-Perl-Stiftung wird jetzt gestellt, Petition an den Bundestag wird vorbereitet |
|
Frau H. (Sachsen) |
Hebamme sucht Platz im betreuten Wohnen für Paar (Mutter: geistige Behinderung, Vater: psychisch krank) mit 6 Monate alten Zwillingen Sozialpädagogische Familienhilfe bereits installiert, ist jedoch überfordert |
Vermittlung an Behindertenverband, der entsprechendes Wohnangebot aufbaut |
|
Fam. J. (Sachsen, Thüringen) |
Anfrage von Klinik-Sozialarbeiterin, sie sieht massive Schwierigkeiten bei der Versorgung des frühgeborenen Kindes Überforderung der Mutter (Spina bifida) und des Vaters (Erblindung) Das Kind wird sicher viel Betreuung bedürfen, wird derzeit noch von Sonde ernährt, die Mutter hat völlig konträre Vorstellung, was das Kind dann an Versorgung im häuslichen Umfeld benötigt (will Kind auf dem Fußboden wickelnkommt nur schwer allein aus dem Rollstuhl) |
geplante Maßnahmen:
|
|
Frau S. (Sachsen) |
Berufsabschluss als Hauswirtschaftliche Helferin, Epilepsie, leichte geistige Behinderung, 20 Jahre alt, schwanger Kindsvater Asylbewerber mit irakischer Staatsbürgerschaft, kein Kontakt, wollte Sorgerecht, Frau S. hat einen Betreuer möchte nach der Geburt des Kindes in eine Pflegefamilie mit Kind ziehen |
Übergabe einer Information für Frau S. in leichter Sprache, was ihrem Baby fehlt und warum es gleich nach der Geburt operiert werden muss Kind wurde mit schweren Behinderungen geboren und verstarb zwei Stunden nach der Geburt Vermittlung Ansprechpartner zur Trauerbewältigung in P. (Diakonie) Kooperation mit der psychosozialen Beratungsstelle der Frühchenstation der Universität Leipzig |
|
Herr F. & Frau H. (Sachsen) |
dringender Kinderwunsch |
Vermittlung an Schwangerenberatungsstelle in F. |
|
Frau Ch. (Sachsen) |
Bitte um mehr Unterstützung |
Vermittlung an Tumorberatungsstelle, um geeignete Reha-Möglichkeiten zu finden |
|
Frau W. (Sachsen) |
unvollständige Bewilligung des Persönlichen Budgets |
Vermittlung zum Zentrum für Selbstbestimmtes Leben |
|
Frau P. (Thüringen) |
Berufsbetreuerin Suche nach Elternassistenz für geistig behinderte Eltern |
Vermittlung einer Kontaktadresse für ein Wohnangebot im Betreuten Wohnen, Umzug war nach vielen Schwierigkeiten eine Woche vor Geburtstermin möglich |
|
Frau & Herr. H. (Berlin, Brandenburg) |
Informationen und Unterstützung für ihre körperlich behindert Tochter bei der Klärung des Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrechts Nach der Scheidung möchte der Vater das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und dass die Kindsmutter aus dem rollstuhlgerecht umgebauten gemeinsamen Haus auszieht |
Vermittlung von Kontaktadressen und Informationen , u. a. die Adressen der Rechtsanwälte Julia Zinsmeister und Anne Kobes, um gegen das Gutachten zur Erziehungskompetenz argumentieren zu können, da im Gutachten beiden Eltern Erziehungskompetenz bescheinigt wird, wegen Behinderung der Mutter die Kinder zum Kindsvater kommen sollten mehrmaliger Schriftwechsel bis zur einstweiligen Entscheidung zugunsten der Kindsmutter |
|
Herr W. (NRW) |
Unsicherheit bzgl. der bereits vor 14 Jahren durchgeführten Vasektomie bei autosomal rezessiver Heredo Ataxie, hat nun Erektionsstörungen und möchte wissen, ob es sich dabei um Folgen der Vasektomie handelt |
Kontaktdaten von KISS Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Kirchenkreises S. vermittelt Information zu Internetadresse von http://www.handicap-love.de bereitgestellt |
|
Frau K. (Berlin) |
Anfrage bzgl. der Kostenübernahme für Handbikes |
Informationsbereitstellung (Hilfsmittelkatalog, Rechtsgutachten) |
|
Frau K. (Sachsen) |
Leicht geistig behinderte 23-jährige Mutter eines 3-jährigen Sohnes, will ihr Kind aus Fremdbetreuung zurück oder wenigstens erweitertes Umgangsrecht. Verfahren und Entscheidungen bisher zu Ungunsten von Frau K. |
Mehrfache Gespräche mit Frau K, ihrer Anwältin und Vertreterin eines Behindertenverbandes, der betreutes Wohnen anbietet, Vorbereitung einer Landtagspetition |
|
Frau N. (Sachsen) |
körperlich behinderte Frau (Rollstuhl), leichte geistige Behinderung möchte mit ihrem Partner beraten werden zu Unterstützungsmöglichleiten für behinderte Eltern, da langfristig Kinderwunsch besteht |
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs mit Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums |
|
Frau H. (Sachsen) |
Hebamme sucht Platz im betreuten Wohnen für Paar (Mutter: geistige Behinderung, Vater: psychisch krank) mit 6 Monate alten Zwillingen Sozialpädagogische Familienhilfe bereits installiert, ist jedoch überfordert |
Vermittlung an Behindertenverband, der entsprechendes Wohnangebot aufbaut |
Wie aus der Übersicht hervor geht, gibt es unter den Anfragen drei Schwerpunkte. Zum ersten stellt sich immer wieder die Frage nach Elternassistenz, begleiteter Elternschaft und betreuten Wohnangeboten für Eltern mit Behinderungen. Zweitens wurden wiederholt eindeutig diskriminierende Entscheidungen seitens der Gerichte deutlich, die sich gegen einen Verbleib der Kinder bei ihren Müttern aussprachen auf Grund der Behinderung der Mütter und trotz bescheinigter Erziehungskompetenz. Und drittens stellt sich immer wieder die Frage der Verhandlung von Kostenübernahme für Dienstleistungen oder Hilfsmittel durch die Kostenträger.
Nach der Auftaktveranstaltung am 02.Juli 2008 entstanden einige Fernsehbeiträge zum Thema „Behinderte Elternschaft“.
Am 01. Januar 2009 strahlte der Fernsehsender 3sat in seinem Wissenschaftsmagazin nano einen Beitrag aus unter den Titel “Eltern mit Behinderungen“. Auf der Homepage des Senders wurde der Beitrag unter dem Titel „Kompetenzzentrum in Leipzig hilft behinderten Eltern“ mit folgenden Worten vorgestellt: „‚Das Ziel des Kompetenzzentrums besteht darin, das Wissen über behinderte Eltern zu verbessern’, sagt Marion Michel von der Abteilung Sozialmedizin der Uni. ‚Wir wollen das medizinische Personal schulen und Partner sein für die Behinderten, die sich an uns wenden.’ Seit Juli 2008 bauen Wissenschaftler der Universität Leipzig ein Kompetenzzentrum für Eltern mit Behinderung in Sachsen auf. ‚Die Einrichtung soll vorhandene Angebote bündeln und Hilfskräfte qualifizieren’, sagte Projektleiterin Michel.“
In der Reportage „Selbstbestimmt“ (MDR-Fernsehen) wurden verschiedene Beiträge über Eltern mit Behinderungen gesendet. Diese Reihe fand am 08. August 2009 mit einem Beitrag über Christiane Döring, eine kleinwüchsige Mutter und ihren Sohn Yannic, sowie über unser Kompetenzzentrum seinen Abschluss.
In der Zeitschrift Handicap 3/2009 wurde ein Artikel über das Kompetenzzentrum unter dem Titel „Die Hilfe muss rechtzeitig kommen“ (182-184) veröffentlicht. Im Artikel wird der Familienalltag von zwei Müttern mit Behinderungen geschildert und auf Kompetenzen und Ressourcen der Eltern ebenso hingewiesen wie auf mögliche Unterstützungsangebote. Im Ergebnis dieses Artikels kamen auch einige konkrete Anfragen an uns bezüglich der Unterstützungsmöglichkeiten für behinderte Eltern bzw. zum Thema Sexualität und Behinderung.
Wir selbst berichteten in der Zeitschrift Erwachsenenbildung und Behinderung (2/2009: 34- 36) über unsere Arbeit. In Leichter Sprache verwiesen wir ebenfalls in diesem Heft auf gesetzliche Regelungen zum Thema Elternschaft und Behinderung (36-38). Und schließlich stellten wir unser Forschungsprojekt sowie das Gesamtkonzept des Kompetenzzentrums im April 2009 der Sächsischen Staatsministerin für Soziales, Frau Christine Clauß, vor. Sie betonte die Wichtigkeit des Projektes und ermutigte uns, weiter am Aufbau des Kompetenzzentrums zu arbeiten.
Im April 2009 bekamen wir die Möglichkeit, während einer Sitzung der AG Qualitätssicherung in der Geburtshilfe in der Sächsischen Landesärztekammer über unsere Arbeit zu berichten. Im Ergebnis dieser Veranstaltung erhielten wir die Einladung zu einem Vortrag im Rahmen des 17. Klinikärztetreffens der Frauen- und Kinderärzte und die Genehmigung zu einer Sonderauswertung der Perinatalstatistik. Mit dieser Sonderauswertung sollte auch geprüft werden, in welcher Weise die Ergebnisse dieser Statistik durch ein spezielles Forschungsvorhaben präzisiert werden müssen.
Am 05. September 2009 veranstalteten wir einen Familientag, der am Vormittag der Präsentation der wissenschaftlichen Ergebnisse diente und am Nachmittag mit einem Familienfest ausklang. Im Ergebnis dieser Veranstaltung wurde die Idee zu einem „Elternstammtisch“ in Leipzig geboren, der Müttern und Vätern mit und ohne Handicaps die Möglichkeit geben soll, in zwangloser Runde Erfahrungen auszutauschen. Wir stellten das Forschungsprojekt im Rahmen der Tagungen der DGSMP in Hamburg und der DSW in Leipzig vor. Das Poster auf der DGSMP-Tagung erhielt in der Gruppe „Versorgungsforschung“ einen Preis.
Des Weiteren nahmen wir im April 2010 als Experten an der Anhörung im Sächsischen Landtag zum Thema „Eltern-Kind-Heime als Orte aktiven Kinderschutzes weiterentwickeln” teil. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten wir nachweisen, dass es in Sachsen so gut wie keine Angebote für Eltern mit Behinderungen gibt, die in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im Bedarfsfall Hilfe und Unterstützung beim Erwerb von Erziehungskompetenzen gewährleistet. Und wir verwiesen darauf, dass die Kindsväter kaum eine Möglichkeit haben, gemeinsam mit Mutter und Kind in einer entsprechenden Einrichtung zu leben (Tabelle 29). Im Rahmen dieser Anhörung bestätigten sich noch einmal die Erfahrungen, die im Rahmen der Fachtagungen und Workshops (Kapitel 4.6) geschildert wurden. Es erweist sich als dringend erforderlich, Einrichtungen der Jugendhilfe, die die familienpädagogische Förderung ihrer Bewohner zur Aufgabe haben, so zu qualifizieren, dass sie sowohl den baulichen Anforderung zur Aufnahme behinderter Mütter oder/und Väter mit ihren Kindern gerecht werden als auch personell geeignet sind, Unterstützung für erwachsene Menschen mit Behinderung geben zu können.
| Anzahl der Einrichtungen insgesamt |
308 |
|---|---|
| Anzahl der Einrichtungen nach § 19 SGB VIII | 60 |
| Anzahl der Einrichtungen mit Angeboten für Mutter-Vater- Kind | 47 |
| Anzahl der Einrichtungen mit Angeboten für Mütter/Väter mit Behinderungen (außer geistig/seelisch) | 1 / 2 Plätze rollstuhlgerecht |
(Liste der Einrichtungen gem. §§19, 32, 34 und 42 SGB VIII im Freistaat Sachsen, Stand 20.03.2008)
Agentur für Arbeit http://www.arbeitsagentur.de 10.10.2009
Altman BM, Cooper PF, Cunningham PJ (1999): The case of disability in the family: impact on health care utilization and expenditures for nondisabled members. Milbank Quart.1999; 77
Arnade S (1992): Weder Küsse noch Karriere. Erfahrungen behinderter Frauen. Frankfurt/M.
Arnade S (2009): Sexuelle Rechte behinderter Menschen. In: Lohrenscheid, C (Hg.): Sexuelle Selbstbestimmung als Menschenrecht. Deutsches Institut für Menschenrechte. Nomos. Baden- Baden
Becker A (1997): Körperbehinderte Mütter im Spannungsfeld zwischen persönlicher Erwartungshaltung und gesellschaftlicher Realität. Diplomarbeit. Universität Köln
Behrendt M (1998): Die Situation von körperbehinderten Eltern. Eine empirische Untersuchung auf der Basis von Gesprächen. Hamburg
Blochberger K (2004): Ideenwettbewerb barrierefreie Kinder- und Babymöbel 2003. Herausgeber: bbe e.V., Hannover
Blochberger K (2008): Befragung zum Nutzen der Peer Counseling-Angebote des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern – bbe e.V., Evaluation eines Peer Counseling-Angebotes unter Berücksichtigung der Kriterien der Disability Studies. Masterarbeit. FH Hannover
Budd K, Greenspan S (1985): Parameters of successful and unsuccessful interventions with parents who are mentally retarded. In: Mental Retardation 23
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2000): Behinderte Eltern: (Fast) unsichtbar und doch überall. Expertise zur Lebenssituation von Eltern mit Körper- und Sinnesbehinderungen in der Bundesrepublik Deutschland, erstellt von Ulrike Lux. Bonn
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2003): Expertise „Besondere Bedürfnisse behinderter Frauen im Sinne des § 1 Satz 2 SGB IX – Selbstbestimmung, Teilhabe am Arbeitsleben, Elternschaft, Februar 2003 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/aktuelles,did=5942.html 06.05.2009
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2006): Jugendsexualität. Wiederholungsbefragung von 14- bis 17-Jährigen und ihren Eltern, Köln
Cloerkes G (2007): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Universitätsverlag Winter: Heidelberg
Deutsche Krebshilfe e.V. (2007): Kinderwunsch und Krebs - Die blauen Ratgeber, Bonn
Duvdevany I, Yahav R, Moin V (2005): Childrens feelings toward parents in the context of parental disability. In: International journal of rehabilitation research. Vol. 28(3)
Eiermann N, Häußler M, Helfferich C (2000): LIVE. Leben und Interessen vertreten. Frauen mit Behinderung. Lebenssituation, Bedarfslagen und Interessenvertretung von Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, Schriftenreihe des BMFSFJ, Bd. 183. Stuttgart
Eisenbarth L (2010): „Empfehlungen zur Schwangerschaft und Entbindung querschnittsgelähmter Frauen“ http://www.dmgp.at/leitlinien/schwanger.htm 25.01.2010
EURAP (2009): An International Antiepileptic Drugs and Pregnancy Registry. Interim Report. May 2009 http://www.clpe.cz/library/EURAPRep_May_2009.pdf 25.01.2010
Faust V (2010): Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln http://psychosoziale-gesundheit.net/pdf/faust1_psychopharm.pdf 25.01.2010
Feldman MA (1994): Parenting education for parents with intellectual disabilities: A review of the literature. In: Research in Developmental Disabilities, 15
Finger A (1992): Lebenswert. Eine behinderte Frau bekommt ein Kind. Frankfurt
Ferrares H (2001): Behinderte Frauen und Mutterschaft. Eine Bestandsaufnahme. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 1/2001
Hayman RL (1990): Resumptions of justice: Law, politics and the mentally retarded parent. Harvard Law Review 103
Helfferich C (2002): frauen leben. Eine Studie zu Lebensläufen und Familienplanung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung Band 19, Köln
Hermes G (Hg) (1998): Krücken, Babys und Karrieren. Zur Situation behinderter Eltern in der Bundesrepublik. Kassel: Bifos e.V.
Hermes G (2000): Behinderte Frauen und die Gynäkologie. http://www.asbhstiftung.de/downloads/beitrag991.pdf 19.01.2010
Hermes G (2003): Zur Situation behinderter Eltern. Unter besonderer Berücksichtigung des Unterstützungsbedarfs bei Eltern mit Körper- und Sinnesbehinderungen. Inaugural- Dissertation. Marburg/Lahn. Philipps-Universität Marburg http://archiv.ub.unimarburg.de/diss/z2004/0099/pdf/z2004-0099.pdf 06.05.2009
Hettenkofer M (2003). Körperbehinderte Mütter. Ein Modellprojekt in Frankfurt, Deutsche Hebammenzeitschrift Februar 2003
Hornstein C (2009): Perinatales Präventionsnetz im Rhein-Neckar-Kreis http://psychiatrie.de/data/pdf/9b/07/00/Referat_Hornstein_BApK_081211.pdf 19.10.09
Hyatt RR, Allen SM (2005): Disability as a „Family Affair”- Parental Disability and Childhood Immunization. In: Medical Care 6/2005 Vol 43
Jasper T (2004): Familie, Partnerschaft und Sexualität bei Multipler Sklerose, Verlag Dmv- Waldmann
Justiz NRW (2009): Verwaltungsgericht Minden: Elternassistenz für behinderte Menschen. Pressemitteilung vom 04. August 2009: http://www.justiz.nrw.de/WebPortal/Presse/presse_weitere/PresseOVG/archiv/2009_02_Archiv/04_08_2009/index.php 14.04.2010
Justiz NRW (2010): Verwaltungsgericht Minden: Stadt Bünde in Sachen Elternassistenz nur formal in der Pflicht http://www.justiz.nrw.de/WebPortal/Presse/presse_weitere/PresseOVG/05_07_2010/index.php 14.04.2010
Kaatz JL (1992): Enhancing the Parenting Skills of Developmentally Disabled Parents: A Nursing Perspective. In: Journal of Community Health Nursing 9(4)
Kamlot K (2005): Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Diplomarbeit Roßwein/Mitweida
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (2010) http://www.kvs-sachsen.de/suche-nach-aerztenund-psychotherapeuten/ 03.05.2010
Landesamt für Statistik Sachsen, Stand 2009 http://www.statistik.sachsen.de/ 04.11.2009
Levesque RJR (1996): Maintaining children’s relations with mentally disabled parents: Recognizing differences and the difference it makes. In: Children’s Legal Rights Journal. 16 (2)
Levc B (2008): Mutterschaft von Frauen mit Behinderungen. Soziale Reaktionen und Zugang zu Angeboten für Schwangere, Gebärende und Eltern. VDM Verlag Dr. Müller
Lisofsly B (2008): Kinder psychisch kranker Eltern, Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V., Landesrundbrief Niedersachsen, Hamburg, Bremen 2/08
Llewellyn G, McConnell D; Ferronato L (2003): Prevalence and outcomes for parents with disabilities and their children in an Australian court sample. In: Child Abuse & Neglect Vol. 27(3)
Löchner-Ernst D (2002): Therapie der neurogenen Sexualstörungen nach Verletzungen, erworbenen und angeborenen Erkrankungen des Rückenmarks aus urologischer Sicht. In: Bannasch M: „Behinderte Sexualität - verhinderte Lust“, AG SPAK Publikationen, Neu-Ulm
Malenke T (Hg) (1997): „Partnerschaft und Sexualität bei Mukoviszidose (CF)“, CFSelbsthilfe Bundesverband e.V. Achim
Marafino K (1990): Parental rights of persons with mental retardation. In: Whitman B, Accardo P (Hg): When a parent is mentally retarded. Baltimore, MD: Paul H. Brookes
Metzler H, Meyer T, Rauscher C, Schäfers M, Wansing G (2007): Begleitung und Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Persönlicher Budgets. Wissenschaftliche Begleitforschung zur Umsetzung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Abschlussbericht Juli 2007
Michel M, Häußler-Sczepan M, Riedel S (2001): Frauen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen. Wissenschaftliche Begleitung beim Aufbau eines sächsischen Netzwerks von Frauen mit Behinderungen. Freistaat Sachsen. Staatsministerin für die Gleichstellung von Mann und Frau. Dresden
Michel M, Häußler-Sczepan M, Riedel S (2003): Lebenswelten behinderter Kinder und Jugendlicher in Sachsen. Sächsisches Staatsministerium für Soziales. Dresden
Michel M (2006): Behinderte Mütter in Sachsen. Lebenssituation, Assistenzbedarf und Unterstützungsmöglichkeiten – Eine Expertise. Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales (unveröff.)
Michel M, Rothemund K (2006): Kinderwunsch behinderter Frauen. In: Gynäkologische Praxis 30 (505-516)
Michel M, Dietrich B, Scholz D, Jonas A (2008): Bericht an den Sächsischen Landtag zur Tätigkeit der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in Sachsen. Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Moser A, Albrecht P (2010): Multiple Sklerose und Schwangerschaft: Gezielte Information ist notwendig, Befund MS 1/08 http://www.curado.de/Multiple-Sklerose/Multiple-Skleroseund- Schwangerschaft-Gezielte-Information-ist-notwendig-7258/ 04.04.10
Netdoktor.de (2010): Depo-Clinovir® Suspension in Fertigspritzen http://www.netdoktor.de/Medikamente/Depo-Clinovir-r-Suspensio-100002666.html 9.06.2010
Nullbarriere.de (2010): http://nullbarriere.de/nl0947.arztpraxis-barrierefrei.htm 16.03.2010
Paul A (1990): Mutter sein unter dem Aspekt der Blindheit. In: Horus. Marburger Beiträge zur Integration Blinder und Sehbehinderter. Nr. 4/1990
Perinatalstatistik Sachsen (2008): Qualitätsbericht Geburtshilfe Jahresauswertung 2008: Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung bei der Sächsischen Landesärztekammer, Modul 16/1, Sonderauswertung
Perinatalstatistik Sachsen (2009): Qualitätsbericht Geburtshilfe Jahresauswertung 2009: Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung bei der Sächsischen Landesärztekammer, Modul 16/1, Sonderauswertung
Pfaff H (2006): Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnis des Mikrozensus 2005. Statistisches Bundesamt. Wirtschaft und Statistik 12/2006
Pixa-Kettner U, Bargfrede S, Blanken I (1996): Dann waren sie sauer auf mich, dass ich das Kind haben wollte.... BMG (Hg). Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
Pixa-Kettner U (2006): Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder. Universitätsverlag C. Winter, Edition S., Heidelberg
Pixa-Kettner U (2007): Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland: Ergebnisse einer zweiten bundesweiten Fragebogenerhebung. In: Geistige Behinderung (46), 4
Plas E, Dada L, Gallistl H, Pflüger H (2003): Elektroejakulation bei neurogener Sexualfunktionsstörung mit fehlender ante- oder retrograder Ejakulation - eine sinnvolle Alternative zur testikulären Samenzellextraktion, Journal für Urologie und Urogynäkologie 4/2003, Verlag für Medizin und Wirtschaft, Gablitz
Prilleltensky O (2004): My child is not my carer: Mothers with physical disabilities and the well-being of children. In: Disability & Society Vol. 19 No. 3, May 2004
pro familia (2008): Dokumentation Fachgespräch-Qualitätsstandards für die ambulante gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderung und rechtliche Grundlagen für ihre Durchsetzung, pro familia-Bundesverband, Kassel
Radtke D (2000): Unsere Normalität ist anders – Behinderte Frauen und Sexualität. In: Färber HP, Lipps W, Seyfarth T (Hg): Sexualität und Behinderung. Umgang mit einem Tabu. Schriftenreihe der Körperbehindertenförderung Neckar-Alp. Attempo
Riedesser P, Schulte-Markwort M. (1999): Kinder körperlich kranker Eltern: Psychische Folgen und Möglichkeiten der Prävention. In: Deutsches Ärzteblatt 1999 96(38)
Rischer C, Blochberger K (2001): Die Situation behinderter und chronisch kranker Eltern. In: Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e.V. (Hg): Assistenz bei der Familienarbeit für behinderte und chronisch kranke Eltern. Löhne
Röpell U, Niggemann A (2005): Zum Wohle des Kindes? Wenn Menschen mit einer geistigen Behinderung Kinder bekommen. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung
Rösener M (2005): „Multiple Sklerose und Schwangerschaft“ http://www.amsel.de/multiplesklerose-news/index.php?kategorie=medizin&anr=1210 25.05.2009
Sächsisches Bildungsinstitut http://www.sachsen-macht-schule.de/apps/lehrplandb/ 19.05.2010
Schmitz B (2008): Epilepsie und Kinderwunsch, Deutsche Epilepsiegesellschaft gem. e.V., Berlin
Schopmans B (1991): Aspekte der Diskriminierung behinderter Frauen in der BRD. Diplomarbeit. Gesamthochschule Kassel 1991
Seipelt-Holtmann C (1993): Behinderte Mütter. Gibt es sie wirklich? Ein Alltag zwischen Diskriminierung, Lebensbejahung und Selbstverständlichkeit. In: Die Randschau. Zeitschrift für Behindertenpolitik. 8. Jg., Heft 5
Sommer F, Schmitges J (2007): Störungen der Ejakulation, blickpunkt der mann - Wissenschaftliches Journal für Männergesundheit, 4/2007, Verlag für Medizin und Wirtschaft, Gablitz
Specht R (2006): Liebe(r) selbstbestimmt. Praxisleitfaden für die psychosoziale Beratung und sexualpädagogische Arbeit für Menschen mit Behinderungen. Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
Statistisches Bundesamt (2007) http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
Statistisches Bundesamt (2008): 6,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Pressemitteilung Nr. 258 vom 17.07.2008
Statistisches Bundesamt (2009): Mikrozensus 2008 – Neue Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland. Ergänzende Tabellen zur Pressekonferenz am 29. Juli 2009 in Berlin
Stuhrmann-Spannenberg M (1997): Humangenetische Beratung. In: Malenke T (Hg): Partnerschaft und Sexualität bei Mukoviszidose (CF), CF-Selbsthilfe Bundesverband e.V. Achim
UN-Konvention (2010): http://www.bmas.bund.de von Wolff M, Strowitzki T (2007): Fertilitätserhalt bei onkologischen Patientinnen und Patienten, Gynäkologe 10/2007, Springer Medizin Verlag
Zinsmeister J (2005): Rechtliche Maßgaben und Grenzen der Sexualassistenz und Sexualbegleitung. In: profa: Sexuelle Assistenz für Frauen und Männer mit Behinderungen
Zinsmeister J (2006): Staatliche Unterstützung behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages. Rechtsgutachten im Auftrag des Netzwerks behinderter Frauen Berlin e.V., Februar 2006
Zinsmeister J (2010): Sexuelle Selbstbestimmung im betreuten Wohnen? Vom Recht und der Rechtswirksamkeit. In: Sexualität und Behinderung , BZgA Forum Sexualaufklärung und Familienplanung 1-2010
Quelle
Marion Michel, Sabine Wienholz, Anja Jonas: Die medizinische und soziale Betreuung behinderter Mütter im Freistaat Sachsen. Studie an der Universität Leipzig, vorgelegt von Dr. phil. Marion Michel, Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Selbständige Abteilung Sozialmedizin. Unter Mitwirkung von Anja Seidel, Martina Müller, Lutz Gansera
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 04.03.2015