Zusammen-Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung
erschienen in: Klartext Verlag, Essen 1994
Inhaltsverzeichnis
- Nichts Besonderes
- Vorbemerkung
- 1. Nichts Besonderes - Unvollkommenheit, Lebendigkeit, Menschlichkeit
- 2. Die Gleichheit der Verschiedenen - Menschsein in kreativer Lebendigkeit und in dialogischer Kommunikation
- 3. Die Fülle des Lebens und die Gemeinschaft der Verschiedenen - Freiheit und Geborgenheit in Vielfaltsgemeinschaften
-
4. Zusammen leben - ohne Aussonderung - Struktur- und Kulturarbeit statt Behindertenarbeit
- 4.1. Familienleben mit einem Angehörigen mit Behinderung als Modell des Miteinanders der Verschiedenen
- 4.2. Schulen für alle als Orte des Miteinander-Leben-Lernens
- 4.3. Zusammenarbeit der Verschiedenen in gemeinsamen Betrieben als Beitrag zur Humanisierung derArbeitswelt
- 4.4. Individuelle Wohnungen und Wohngemeinschaften als zweites Zuhause für Menschen mit Behinderung und als Grundlage für das Miteinander der Verschiedenen in Nachbarschaft, Gemeinde, Stadtteil, Stadt
- 4.5. Freizeitgestaltung, Kulturangebote, äffentliches Leben als Kreativitätswerkstätten der Menschlichkeit
- 4.6. PolitischeMitwirkungalsBewährungseldundEntwicklundaktorf von Selbstbestimmung und Dazugehörigkeit
- 5. Zusammen arbeiten - mit Selbstbestimmung - Assistenz- und Kooperationsarbeit statt Behindertenarbeit
- 6. Die Basis stärken - in Überschaubarkeit - Gemeinwesenarbeit statt Behindertenarbeit
-
7. Kritik: Bedrückende Gegenmächte - Die Banalität des Bösen und die destruktive Macht von Fortschrittsideologie und perfektionistischer Bioethik
- 7.1. Kritik entsolidarisierender Sozial- und Wirtschaftspolitik
-
7.2. Kritik perfektionistischer Fortschrittsethik
- 7.2.1. Gehirntoddefinition und Organtransplantationspraxis
- 7.2.2. Fristenlösung für Schwangerschaftsabbruch und Fristverlängerung bei Behinderungsindikation
- 7.2.3. Zulassung des Tätens auf Verlangen (Aktive Sterbehilfe, "Euthanasie")
- 7.2.4. Begrenzung der ärztlichen Behandlungspflicht und Verknappung des medizinischen und sozialen Angebotes
- 7.2.5. Gentechnologie und Reproduktionsmedizin
- 7.2.6. Sduberung des Fortschritts von seinen Opfern
- 7.2.7. Dynamik des Zusammenwirkens der verschiedenen Perfektionierungsprojekte und Gefahr alptraumartiger Entwicklung unseres Zusammenlebens
- 8. Politik: Notwendige Doppelstrategie.-.Statt Behindertenarbeit: Miteinander für eine menschlichere Stadt
- Literaturhinweise
taut die eisigen mauern auf
und wehrt euch ausgestoßen zu werden ...
uns soll man hören und einen platz geben
wo wir unter euch allen wohnen dürfen
in einem leben in dieser gesellschaft
Birger Sellin
Und letztendlich kommt es doch immer auf dasselbe an, wenn wir über Menschenrechte sprechen. Es geht um die Plätze nah am Haus. So nah und so klein, daß sie auf keiner Weltkarte wiederzufinden sind. Doch ist genau dies die Welt eines jeden Individuums; die Nachbarschaft, in der wir wohnen; die Schule, in die wir gehen; die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, wo wir arbeiten. Das ist der Ort, wo jeder Mann, jede Frau oder jedes Kind die gleichen Rechte sucht, gleiche Chancen, Gleichbehandlung ohne Diskriminierung. Wenn diese Rechte dort nichts bedeuten, dann bedeuten sie auch anderswo nichts. Ohne gezieltes Handeln von jedem, der sich dem verbunden fühlt, dieses im Nahbereich zu verwirklichen, hat es wenig Sinn, nach einem derartigen Fortschritt für den Rest der Welt zu streben.
Eleanor Roosevelt
Dieses Buch ist ein (Zwischen)Ergebnis kontinuierlicher Praxisreflektion. Es ist der Beanspruchung durch die Praxis abgerungen, aber es ist auch durch vielfältige konkrete Praxiserfahrungen herausgefordert. Im Mittelpunkt stehen Miteinander-Lebens-Erfahrungen mit Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, mit Menschen also, die traditionell ganz besonders von Aussonderung betroffen sind. Doch gerade für sie erschließt das Engagement insbesondere von Eltern und Freunden, von Nichtfachleuten sowie von Kindern, sich offen und phantasievoll, einfühlsam und achtungsvoll, ohne Vorurteile und ohne Machtinteressen auf das Zusammen-Leben-Lernen einzulassen, immer wieder weiterführende Erfahrungen vom möglichen Glück gelingenden Miteinanders.
Dieses Buch ist kein Stellvertreterbuch. Die Absicht dieses Buches ist nicht die, in der Anmaßung des vermeintlich Besserwissenden für und über andere Menschen zu sprechen. Die wesentlichen Anregungen habe ich aus den Erfahrungen des Miteinander-Leben-Lernens, aus persönlichen Begegnungen und aus vielen Gesprächen gewonnen. So möchte ich mit diesem Buch auch Dank für all dies, was mir andere Menschen geschenkt haben, ausdrücken und es als Beitrag verstanden wissen, das Gespräch weiterzuführen.
Dieses Buch beinhaltet nicht nur Praxisreflektion, sondern ist auch ein Stück Zukunftswerkstatt. Bei allem, was sich schon bewährt hat und was an mutmachender Weiterentwicklung geschieht: mit dem Zusammen-Leben-Lernen sind wir immer noch auf dem Weg, wir haben immer noch viel voneinander und miteinander zu lernen, wir haben vieles noch zu korrigieren und zu verbessern, wir haben immer noch Neues zu entdecken und zu erarbeiten. Vieles steht als Zukunftsaufgabe noch vor uns.
So bietet dies Buch nichts Fertiges, sondern nur einen Diskussions- und Entwicklungsbeitrag. Doch in aller Vorläufigkeit und Bruchstückhaftigkeit mache ich mit meinem Beitrag den Versuch, einen Gesamtentwurf zu skizzierren und größere Zusammenhänge aufzuzeigen. Es geht nicht um irgendwelche Spezialistenprobleme und nicht um für die Mehrheit bedeutungslose Randprobleme, sondern es geht um Alltags- und Zukunftsaufgaben, deren Wahrnehmung im gemeinsamen Interesse aller liegt. Es geht um die Verwirklichung und Wahrung der Menschenrechte, es geht um die Weiterentwicklung der Kultur des Zusammenlebens in Vielfalt, es geht um die Entwicklung einer menschlicheren Stadt für alle.
Essen, Juli 1994
Klaus v. Lüpke
Die Freundschaft fing damit an, daß Simone in der Eisdiele erbrechen mußte, und daß die junge Frau, die Besitzerin dieser italienischen Eisdiele, uns nicht rausschmiß und uns nicht das Wiederkommen verbot, sondern daß sie einen kleinen Putzeimer holte, alles sorgfältig saubermachte und den Tisch neu deckte und uns zu neuen Eisportionen einlud. Putzen mußte ich sowieso, sagte sie später, warum sollte ich es dann nicht mit Freundlichkeit tun! Seitdem sind wir Stammkunden dort und Simone hat Kontakte zu anderen jungen Leuten an Nachbartischen gefunden, und manchmal setzt sich schon mal jemand mit an unseren Tisch. Freunde der Eisdielenbesitzerin, ein junges Ehepaar, italienisch ebenfalls, sind inzwischen auch unsere Freunde geworden und Simone ist schon mehrmals zu ihnen nach Hause zum Kaffeetrinken eingeladen worden. Einfach so! Daß Simone eine geistige Behinderung und ein Krampfleiden dazu hat, das spielt keine besondere Rolle mehr. Bericht einer Mutter
Ein junger Mann in einer Einrichtung äußerte eines Tages den Wunsch, nicht mehr zum Anstaltsfriseur, sondern zu einem "echten" Friseur zu gehen. Okay, sagte Lynda. Und sie rief ihren eigenen Friseur an. Mario, hör mal. Ich kenne da einen jungen Mann, und der ist reichlich schwierig. Er spricht noch immer sehr schlecht und es ist nicht auszuschließen, daß er in deinem Laden einen Wutanfall bekommt, aber er würde so gerne mal zu einem echten Friseur gehen, und vielleicht gibt es ja mal ganz ruhige Zeiten in deinem Laden, wenn keine anderen Kunden da sind, und jetzt wollte ich dich fragen ... Lynda, sagte der Friseur, mich interessiert die Frage: Hat der Junge auch Haare auf dem Kopf ? - Nach: Lynda Kahn[1]
Seit etwa dreißig Jahren als Mensch mit schwerer geistiger Behinderung wahrgenommen, wirkte Hilde meist sehr uninteressiert und unwillig, brummelte in der Regel nur wenige Worte, ging beharrlich langsam mit Blick nach unten, manchmal fast stur ihren Weg. Doch als wir ihr ein kleines Baby in die Arme legten, da strahlte sie vor Freude, blickte ihm lächelnd ins Gesicht, hielt es mit zuverlässiger und zärtlicher Aufmerksamkeit. Da war sie nichts anderes mehr als eine glückliche junge Frau, die ein Baby in den Armen hält.
Der Franz im Kindergarten, ein nichtbehindertes, aber schwieriges Kind, suchte oft Streit mit anderen Kindern, um dann immer wieder mit Schlagen und Treten seine Kraft zu beweisen. Doch mit der Ute, die im Sprechen stark behindert war und ohne Hilfe überhaupt nicht gehen konnte, die mit ihrer Behinderung von vornherein keine Konkurrenz für ihn war, konnte er ganz anders sein: behutsam setzte er sie auf seinen Schoß, sprach mit ihr freundlich und machte Spiele mit ihr zusammen, so daß er alles drumherum vergaß. Da war er wie ausgewechselt, ein selbstbewußt freundliches, entspannt spielendes, fröhliches Kind.
Besonders freue ich mich immer, wenn ich die Tour zu fahren habe, die an der Behindertenwerkstatt vorbeiführt. Nach Feierabend steht da immer ein ganzer Trupp von ihnen an der Haltestelle, und dann steigen sie alle vorne ein und begrüßen mich einer nach dem anderen persönlich mit Handschlag. Auch wenn ich dadurch ein klein bißchen Verspätung bekomme, da tanke ich Freundlichkeit für die ganze weitere Fahrt. - Busfahrer beim öffentlichen Personen-Nahverkehr
Ich kenne einen Jungen, der kann nicht hören und nicht sprechen, also der ist so was wie ein richtiger Behinderter. Aber der ist mein Freund und wir verstehen uns sehr gut. Wir haben eine Zeichensprache und machen viele Spiele zusammen. Was wir beide besonders gut können und mit richtigem Spaß zusammen machen, das ist: andern Leuten die Zunge rausstrecken. - Achtjähriger Junge
Menschlichkeit: nichts Besonderes! Auf die Verwirklichung einfacher, alltäglicher, gemeinschaftlicher Menschlichkeit kommt es mit Vorrang an. Wenn wir stattdessen Behindertenarbeit, Dienstleistung, Therapie und Förderung in den Vordergrund stellen, dann machen wir daraus immer wieder etwas Besonderes und damit zugleich etwas Aussonderndes. Dann tragen wir dazu bei, daß die einen die anderen - als Menschen mit einem besonderen Hilfe- und Förderungsbedarf - zu etwas Besonderem machen und in eine Strömung von Aussonderung drängen, die sie in Einsamkeit oder in Sondereinrichtungen landen läßt. Unversehens wird die Menschlichkeit im Zusammenleben etwas Besonderes, schleichend breitet sich Unmenschlichkeit aus. Die Menschlichkeit als etwas Besonderes in Sondereinrichtungen auszusondern, die Nächstenliebe in Anstalten zu veranstalten, bedeutet eben auch, den übrigen Menschen die Chance zu rauben, ihre eigene Menschlichkeit im alltäglichen Zusammenleben zu entfalten. Die Beschränkung auf ein Zusammenleben mit (relativ) Gleichen, z.B. in monotonen, monokulturellen Vororten, sei es im Luxusgewand von Villen oder im Einheitsgewand von Massenquartieren, erweist sich ganz allgemein als ein Irrweg, der zu immer mehr seelischer Verarmung und zu immer mehr sozialen Konflikten führt.
Ich habe einen Traum von einer menschlicheren Stadt! Städte sind von Menschen gemacht; die Gestaltung unseres Lebensortes ist von uns selber zu verantworten; da können wir Träume verwirklichen oder uns Alpträume auflasten.
Städte können eine Wildnis sein, in der von menschlicher Gestaltung und von Verantwortung füreinander nicht mehr viel zu spüren ist: eine Wildnis des Gegeneinanders und der Angst, des Luxus und der Obdachlosigkeit, der Sieger und der Verlierer. Eine Wildnis, aus der viele Menschen, allemal wenn sie von vornherein zu den Verlierern gehören, sich gerne flüchten möchten auf Inseln der Menschlichkeit, in Schutzbereiche, in Sondereinrichtungen.
Städte können jedoch auch eine Wildnis der Lebendigkeit sein, in der eine Vielfalt von Verschiedenen eine urwaldartige organische Lebensgemeinschaft bildet, die jeden in ein Geflecht von Wechselbeziehungen einbezieht und dadurch jeden in seiner Lebendigkeit achtet und fördert, die auf jeden als Element der Lebensgemeinschaft angewiesen ist und deswegen niemanden in Sonderbereiche hinein aussondert. Eine wildlebendige und lebensförderliche Stadt, die an Stelle des Tanzes ums goldene Kalb die Kultur der dialogischen Kommunikation, der gegenseitigen Hilfeleistung und des Miteinanders in Vielfalt pflegt.
Zuhausesein der Verschiedenen in einer gemeinsamen Stadt für alle: das ist eine Absage an die Unkultur des Raubens und Raffens, an die Herrschaft des Geldes über die Menschlichkeit und zugleich ein Beenden der jahrhundertealten, immer noch machtvoll wirkenden Tradition der Aussonderung von Menschen mit Behinderung in Sonderorte und Sondereinrichtungen, der Unterordnung unter Fachleute, unter Zuständige. Das bedeutet eine Anerkenntnis der Gleichheit der Verschiedenen, der Gleichheit und Zusammengehörigkeit aller Menschen, das bedeutet die Erkenntnis, daß ein Ausbürgern von Menschen immer auch eine Ausbürgerung der Menschlichkeit ist, und daß das Deligieren von Menschen an andere immer auch eine Einbuße an eigener Lebendigkeit mit sich bringt.
Deswegen ist es eine gemeinsame politische Aufgabe, die Strukturen des Zusammenlebens so zu gestalten, daß das Miteinander der Verschiedenen in allen Lebensbereichen zu einer Selbstverständlichkeit wird und gut gelingen kann. Damit jeder Mensch in Freiheit und Selbstbestimmung am Zusammenleben teilnehmen kann, muß ihm durch die Gemeinschaft und durch persönliche Assistenzdienste durch Dritte das an Hilfeleistung gewährt werden, was er auf Grund einer Behinderung mehr als andere benötigt.
Wenn die Stadt jedem Menschen ein Zuhausesein ermöglicht, dann entwickelt sie ihre Möglichkeiten, die Kultur der Vielfalt zu pflegen, Lebendigkeit in Vielfaltsgemeinschaften zu intensivieren, etwas von der Abenteuerlichkeit der Wildnis zu vermitteln: Spannung und Spaß, Überraschungen und Entdeckungsmöglichkeiten, Abwechslungen und Wechselbeziehungen, Freiheit vom Übermaß des Beschütztwerdens und das an Schutz vor Bedrohungen und Gefahren, was für alle erforderlich ist.
Eine Mutter und ein Vater hatten drei Söhne. Der älteste und der zweitälteste hatten gute Begabungen, der jüngste hatte schwere Behinderungen; er konnte nicht gehen, nicht alleine sitzen, nicht alleine essen, kein einziges Wort sprechen, manchmal schrie er schrecklich, manchmal warfen ihn Krampfanfälle zu Boden.
Die Eltern hatten alle drei Söhne gleich lieb. Sie sahen auch bei Jan - so hieß der jüngste - in erster Linie seine Lebendigkeit und daß er in gleicher Weise wie die anderen fröhlich und traurig sein konnte und daß er ihnen auf vielfältige Weise antwortete.
Die beiden älteren Söhne wurden jedoch mit den Jahren immer unzufriedener. Dies Leben hier: Das ist doch kein Leben mehr, meinten sie zueinander. Als der erste mit der Schule fertig war, sagte er zu seinen Eltern: Ich will studieren und Arzt werden. Ich will auch erforschen, was Jan heilen könnte. Und eines Tages komme ich zurück und bringe eine Therapie mit, damit ihr endlich weniger Mühsal habt. Und als der zweite soweit war, sagte auch er zu seinen Eltern: Ich will etwas lernen und ein Kaufmann werden. Ich will reich werden. Und dann will ich auch für euch etwas tun: Dann werde ich für Jan ein Wohnheim bauen und Fachleute für ihn anstellen. Dann wäret ihr alle Belastungen los und könntet endlich mal an euch selber denken.
Die Eltern schwiegen - und sahen ihnen traurig nach. Die beiden älteren Söhne fehlten ihnen sehr: Mit ihrem Lachen, mit ihrem Lautsein, mit ihrem Streiten, mit ihrer Musik, und mit ihrer praktischen Mithilfe natürlich auch.
Doch als die beiden wegwaren, fanden sich nach und nach andere Menschen: Menschen, die nicht nur halfen, sondern die Jan auch liebgewannen. Sie und Jan gewannen Freunde, sie entwickelten ein vielfältiges Miteinander und trafen sich so manches Mal zu einer bunten Tischgemeinschaft. Jeder trug etwas dazu bei:
Ein leckeres Brot, selbstgekochte Marmelade, einen Strauß Wildblumen. Und Jan saß mitten unter ihnen.
Sie fragten Jan, ob er in der Sonne sitzen wolle, ob sie das Fenster öffnen sollten, um die frische Regenluft hereinzulassen, ob er Lust hätte Musik zu hören; und sie verstanden ihn ohne Worte. Jan hörte ihren Stimmen zu, wie sie sich untereinander unterhielten; guckte ihnen dabei zu, wie sie herumwirtschafteten; atmete die guten Gerüche beim Kochen ein.
Gerne kamen Kinder und holten Jan zu kleinen Ausflügen ab. Die Kinder durften ihn in seinem Rollstuhl wild über holpriges Pflaster rollen, so daß es ihn von Kopf bis Fuß durchschüttelte. Wenn es die Kinder machten, dann brachte es ihm Spaß, weil er sich dann als einer der ihren fühlte.
Häufig kam der Bürgermeister, um bei ihnen seine Morgenzeitung zu lesen. Er setzte sich neben Jan an den Frühstückstisch, trank noch eine Tasse Kaffee und las seine Zeitung. Und zwar las er laut, natürlich für sich, aber zugleich auch für Jan. Und er sprach dabei mit ihm: Jan, stell dir vor ... ! Hör dir dies mal an, Jan ... ! Manchmal sprach er mit Jan auch über Fragen, die ihm zu schaffen machten. Dabei blickte er Jan an, und Jan's Schweigen, der Ernst in seinem Schweigen half ihm oft dabei, gute Entscheidungen zu finden.
Regelmäßig wenn schönes Wetter war, kam der Eismann vorbei und lud Jan ein, eine Tour mit ihm zu fahren. Er hob ihn auf den Beifahrersitz und schnallte ihn sorgfältig an. Bei jedem Eisverkaufs-Stop machte er ihm die Wagentür auf und gab ihm die Glocke in die Hand. Und Jan schwang die Glocke mit so viel Kraft, daß sein ganzer Körper mitschwang, und das Läuten weithin erklang. Er läutete die Glocke, bis die ersten Eiskäufer herbeiliefen und Kinder an seine offene Tür kamen, um ihn zu begrüßen und ihm zwischen ihrem Eisschlürfen kurz was zu erzählen. Zum Abschluß fuhr der Eismann mit ihm zu seinem Eiscafe am Marktplatz, setzte sich mit ihm zusammen draußen an einen Tisch. Genießerisch schleckten sie jetzt selber Eis. Daß Jan nicht reden konnte, war dem Eismann nur recht, müde, wie er war, war er froh, jetzt selber mit ihm schweigen zu können. Zufrieden ließen sie sich beide tragen von dem Stimmengewirr und Lachen an den Nachbartischen, vom Rauschen des alten Marktbrunnens, vom warmen Sonnenschatten unter den Bäumen.
Abends kamen manchmal Nachbarn, um mit seinen Eltern Karten zu spielen. Dann lag Jan auf der Couch dabei und die Katze wärmte seine Füße. Immer wenn einer im Eifer des Kartenspielens mit der Faust auf den Tisch donnerte, entspannte ein breites Grinsen Jan's Gesicht.
Und eines Tages nach vielen Jahren kamen die beiden älteren Söhne das erste Mal wieder nach Hause. Sie waren überaus verwundert über die Fröhlichkeit dieser Gesellschaft um ihren jüngsten Bruder herum. Der eine Sohn war ein anerkannter Medizinprofessor geworden und der andere ein einflußreicher Unternehmensdirektor. Die Eltern freuten sich sehr, ihre Söhne wiederzusehen. Als die beiden von ihren Erfolgen erzählten, hörten alle andächtig zu, nur die Fröhlichkeit verstummte immer mehr. Und als der eine schließlich ankündigte, morgen mit der Therapie beginnen zu wollen - nicht ganz ohne Risiko, doch alle Anstrengungen wert; und als der andere seinen Wohnheimplan ausbreiten wollte - sicherlich ganz anders als bisher zuhause, aber doch sehr praktisch; da machte sich lähmendes Schweigen breit, und Jan blickte ängstlich von einem zum anderen.
Die beiden Erfolgssöhne blieben über Nacht nicht in ihrem Elternhaus; sie wohnten im besten Hotel der Stadt. In Ihrer Abwesenheit berieten sich die Eltern zusammen mit Jan und mit ihren Freunden. Das Angebot der beiden brachte sie richtig durcheinander, ja machte ihnen Angst. Sie wollten doch Jan gar nicht anders haben als er war. Und sie wollten, daß ihm die Gemeinschaft mit all ihren Freunden nicht verloren ginge.
Doch zugleich hatten die beiden älteren Söhne ihnen auch die Frage unausweichlich bewußt gemacht: Was sollte sein, wenn sie, älter und schwächer werdend, eines Tages nicht mehr genug für Jan tun könnten? Da machte der Bürgermeister den Vorschlag, die Gemeinde könne doch zwei jüngere Menschen anstellen und gemeinschaftlich bezahlen. Die Eltern könnten sie anleiten, und diese könnten sich praktisch einüben und hineinwachsen in die Aufgabe, eines Tages mal die Verantwortung der Eltern zu übernehmen. Und sie alle miteinander, die Freunde wären ja auch immer noch da und würden sie und Jan nicht allein lassen.
Als die beiden älteren Söhne am nächsten Morgen aus ihrem Hotel zurückkamen, eröffneten ihnen die Eltern, daß sie ihre großen Therapie- und Wohnheim-Angebote nicht annehmen wollten. Es tut uns sehr leid! Doch umso mehr würden wir uns freuen, wenn ihr euch entschließen könntet, an unserem Leben hier zusammen mit Jan und mit all unseren Freunden teilzunehmen. Dazu möchten wir euch herzlich einladen. Sicherlich könnt ihr uns dann manches auch verbessern und erleichtern helfen. Nur alles so völlig verändert bekommen, das wollen wir nicht.
Da wurden die beiden erfolgreichen Söhne zuerst traurig, dann aber auch ärgerlich und schließlich schimpften sie: Wir wollten nur das Beste für euch! Wenn ihr das nicht haben wollt, dann müßt ihr eben in eurer Mühsal und in eurem Dreck bleiben. Wir kehren lieber in unsere Welt zurück. Und insgeheim dachten sie an eine saubere Welt, eine aufgeräumte Welt, Behinderte hier - Nichtbehinderte dort, wie auch immer.
Als sie gegangen waren, empfanden die Zurückgebliebenen eine merkwürdige Mischung von Traurigkeit und Erleichterung. Und Jan hatte sich in der ganzen Aufregung in die Hose gepinkelt, es hatte keiner daran gedacht, ihn rechtzeitig auf die Toilette zu bringen. Doch der Geruch von Urin war ihnen kein Dreck, sondern gerade jetzt ein Zeichen von Leben und Protest. Schnell wuschen sie ihn und zogen ihn neu an. Und der Duft von Frischgewaschensein mischte sich bald mit Kaffeeduft und Brötchenduft und langsam löste sich ihre Beklommenheit.
Als spätabends alle Freunde gegangen waren, saßen die Eltern noch etwas länger an Jan's Bett und die Mutter legte ihm beim Gute-Nacht-Sagen ihre Hand auf den Kopf Jan drehte sich nicht weg, er wandte sich ihr eher noch etwas zu, als wollte er sich ganz in ihre Hand einkuscheln.
Da dachte sie: Wenn doch auch ihre beiden älteren Söhne etwas davon begreifen würden und dann eines Tages neu heimkehren würden.
Und dann als Jan schlief, machten sie an diesem Abend etwas, was sie kaum einmal machten: Sie ließen Jan alleine und gingen in der Nacht noch eine Runde spazieren. Nach langem Schweigen sprach sie aus, was beide dachten: Bevor wir selber eines Tages tatsächlich nicht mehr können, laß uns den Vorschlag unseres Bürgermeisters aufgreifen und nach Menschen Ausschau halten, denen wir Jan anvertrauen können. Und dann laß uns auch ganz Abstand nehmen und ausziehen in eine eigene kleine Wohnung. Denn wie sollten wir sonst Vertrauen beweisen. ja, sagte er. Und wir werden auch Zeit für uns selber brauchen, denn irgendwie müssen wir ja doch nun auch unser Lebensende bedenken und uns auf das konzentrieren, was wir noch tun möchten.
Dann schwiegen sie beide wieder und dachten über diese doppelte Aufgabe nach: Das Werk des Vertrauens in ihre Nachfolger aufzubauen und das Werk des Abschiednehmens zu beginnen und des Vorbereitens auf das unvorstellbare Neue nach dem Tod.
Für beides sollten wir noch Zeit haben, bekräftigte sie schließlich. Aber was es auch dann immer noch geben sollte und woran auch wir dann immer noch beteiligt sein sollten, das sind große bunte Tischgemeinschaften: wenn nicht bei Jan und nicht bei uns, dann eben im Gemeindehaus - wir alle miteinander, vielleicht einmal im Monat, immer ein kleines Fest!
"Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind in ihrem Wesen gleich. Und alle sind auch darin gleich, daß sie alle individuell unterschiedlich, in unendlicher Vielfalt unterschiedlich sind." [2]
Die Wesensgleichheit aller Menschen besteht - erstens - darin, daß jeder Mensch in all seinen Entwicklungen von einer kreativen Lebendigkeit durchlebt ist. Jeder Mensch befindet sich Zeit seines Lebens im Fluß unablässiger Entwicklungen und Veränderungen, wie lang oder kurz der Bogen zwischen Anfang und Ende auch gespannt sein mag.
Da ist auch die eine oder andere Form von Behinderung nichts anderes mehr als ein Ausdruck der Fülle des Lebens und der Vielfalt des Menschseins. Warum sollten Menschen nicht so unterschiedlich sein dürfen wie Bäume: wie die große, starke Kiefer, die auf gutem Boden in der Ebene herangewachsen ist und im Wald gleicher Kiefern steht, und wie die kleine, langsame, krumm gewachsene Latschenkiefer hoch oben im Gebirge, auf felsigem Boden, in den Kälteregionen der Baumgrenze? Nur der Maßstab des Holzhändlers macht sie zur Krüppelkiefer. Die Achtung vor der Fülle und Zusammengehörigkeit allen Lebens läßt gerade die Latschenkiefer als einen intensiven Ausdruck von Lebendigkeit und als einen unersetzlichen Teil der Vielfalt des Lebens sehen und anerkennen.
"Warum sollte ich jemand anderes sein wollen?" formuliert Fredi Saal präzise als Leitmotiv für seinen biografischen Essay "Erfahrungen eines Behinderten." [3]
Das Leben in seiner Fülle und in seiner Intensität gilt es zu fördern, statt zu behindern; die vielen Ausprägungen von Lebendigkeit gilt es mit Freude und mit Ehrfurcht zu achten, statt nach engen Maßstäben zu messen und zu beurteilen, zu kritisieren und zu diskriminieren; die Fülle des Lebens gilt es zu erschließen, zu aktivieren und zu intensivieren, statt einzuschließen, zurückzustoßen, zu verletzen. Auch Erziehung, Therapie, Hilfeleistung sollen nicht der Reglementierung dienen, sondern zu einer Entfaltung des jeweiligen individuellen Lebens beitragen.
Die Verschiedenheit und Fülle des Lebens ist geprägt von einer Lebendigkeit, die jeden Menschen durchlebt, die er als geschenkt und tragend erfährt. Auch jede Leistung hat diese Dimension des Empfangens, der Unverfügbarkeit; jede Leistung: von der größten bis zur kleinsten, bis zum letzten Atemzug. Einseitiges Perfektionsstreben wirkt dieser Lebendigkeit entgegen, tut der Lebendigkeit Gewalt an, führt dazu, Menschen Maschinen ähnlich zu machen.
Wer sich einseitig auf Erhalt von Leistungskraft und auf Perfektionierung von Leistungsmöglichkeiten konzentriert, entwickelt eine verkrampfte und letztlich lebensfeindliche Haltung, weil er die Wirklichkeit und Wirksamkeit der kreatürlichen Dimension des Lebens sich selber und anderen versperrt, weil er - bildlich ausgedrückt - die Hände zum Machen ballt, statt sie zum Empfangen zu öffnen.
Die Wesensgleichheit aller Menschen besteht - zweitens - darin, daß jeder Mensch in dialogischen Beziehungen zu anderen Menschen lebt. Jeder Mensch ist angewiesen auf personale Beziehungen, auf eine Vielfalt von Beziehungen, auf ein Beziehungsgeflecht, in dem jeder in unterschiedlicher Weise mitgetragen wird und mitträgt.
Die Bedeutung der dialogischen Dimension für das Menschsein ist in konkreten Vollzügen mitmenschlicher Kommunikation erfahrbar. Kommunikation hängt nicht von gleicher Leistungsfähigkeit der Kommunikationspartner ab. Auch in Lebenssituationen, in denen ein Mensch zu keinen aktiven persönlichen Äußerungen fähig ist (noch nicht oder nicht mehr oder dauerhaft nicht), in denen er jedoch durch seine Anwesenheit sich mit seinem Wesen gleichwohl äußert, da hat Kommunikation - in der Form der persönlichen Zuwendung sowie in der Form der praktischen Hilfeleistung - grundsätzlich die gleiche Bedeutung für beide Seiten. Selbst wenn ich Zuwendung einem Menschen entgegenbringe, von dem ich keine Antwort wahrnehme, dann hält mich die Achtung vor dem Geheimnis seiner Person noch in der dialogischen Beziehung zu ihm; erst wenn ich ein Urteil fälle, erst wenn ich mit dem Urteil angeblicher Kommunikationsunfähigkeit die Zuwendung abbreche, dann steige ich meinerseits aus der dialogischen Beziehung aus.
Wie die Teilhabe an der kreativen Lebendigkeit und an der Fülle des Lebens ist die Teilhabe eines jeden an der dialogischen Dimension Grundlage für die Gleichheit der Verschiedenen. Mit dieser Teilhabe an der dialogischen Dimension unterscheidet sich jeder Mensch, egal wie wenig perfekt er ist, von jeder Maschine, egal wie perfekt diese ist.
Wenn Zuwendung in Freude an der Lebendigkeit des anderen geschieht, mit Dankbarkeit für alles, was ich von ihm empfange, mit der Liebe zu ihm, in der ich ihn als einmalig in der Besonderheit seines Wesens wahrnehme, mit der Ausrichtung darauf, ihn in seiner Lebendigkeit, in seinem Wesen, in seiner Seele zu bewahren und zu fördern, dann bereichert sie zugleich den sich Zuwendenden, schenkt ihm einen Zuwachs an Lebendigkeit des anderen geschieht, mit Dankbarkeit für alles, was ich von ihm empfange, mit der Liebe zu ihm, in der ich ihn als einmalig in der Besonderheit seines Wesen wahrnehme, mit der Ausrichtung darauf, ihn in seiner Lebenstätigkeit , in seinem Wesen, in seiner Seele zu bewahren und zu fördern, dann bereichert sie zugleich den sich Zuwendenden , ihm einen Zuwachs an Lebenstätigkeit und Seelenkraft - eben in dem Ununterbrochensein der Bewegung seiner Zuwendung zum anderen, in der Fülle der Wechselbeziehung.
Wenn ein Mensch jedoch den anderen nur auf seine Nützlichkeit hin betrachtet, ihn als nicht nützlich ablehnt, sich ihm gegenüber verschließt und sich von ihm abwendet, oder seine Nützlichkeiten für sich ausnutzt, nur nimmt und nicht auch gibt, dann verleugnet er die Wesenslebendigkeit des anderen, die Bewegung seiner Seele, dann öffnet er sich nicht für die Sprache, die Anrede, die Zuwendung des anderen. Damit entzieht er nicht nur dem anderen die bewahrende und intensivierende Antwort, sondern er verliert auch in sich selber an Lebendigkeit.
Wenn ein Mensch einen anderen sogar nur noch als Störung, als Hindernis, als Belastung sieht, den anderen Menschen einschränkt, zurückstößt, aussondert, verletzt, zerstört, tötet - mit welchen Definitionen und mit welchen Rechtfertigungsversuchen auch immer -, dann verletzt und zerstört er auch in sich selber, tötet Anteile seiner eigenen Lebendigkeit.
Die bereichernde Wirkung der Wechselbeziehung hängt nicht von der Sprachfähigkeit und nicht von der Kommunikationsebene des Gegenübers ab: Die Mutter, die sich ihrem noch ganz kleinen Kind zuwendet, empfängt in den vielfältigen Zeichen der Lebendigkeit ihres Kindes bereichernde Antwort und entfaltet ihre Seele in der Zuwendung zu ihrem Kind in einer ihre eigene Lebendigkeit intensivierenden Form.
Der ruhige Atem des schlafenden Kindes läßt auch den Vater Angst überwinden, die er haben könnte, wenn es Nacht ist und niemand sonst im Haus: Das friedliche Schlafen des Kindes ist ihm bestärkende Antwort auf seine Geborgenheit schenkende Nähe und die Schutzlosigkeit des Kindes ruft in ihm Mut wach und Vertrauen auf seine Kraft, dieses Kind zu beschützen.
So bekommt auch die liebevoll helfende Zuwendung zu einem Menschen mit sehr schwerer Behinderung ihre Antwort in vielen leisen und lauten, unscheinbaren und eindrucksvollen Äußerungen von Lebendigkeit, in vielfältigem Ausdruck von Lebensfreude und Wohlbefinden, in der Vergegenwärtigung von völligem Vertrauen dessen, der sich selber nicht helfen, nicht wehren, nicht am Leben erhalten könnte.
Bei aller Unterschiedlichkeit bietet die Antwort dem sich Zuwendenden eine Entsprechung, die beide Pole zu dem Ganzen der Wirklichkeit einer lebendigen Wechselbeziehung verbindet. Martin Buber schreibt: "Geist ist nicht im Ich, sondern zwischen Ich und Du. Er ist nicht wie das Blut, das in dir kreist, sondern wie die Luft, in der du atmest. Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag. Er vermag es, wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt. Vermöge seiner Beziehungskraft allein vermag der Mensch im Geist zu leben."[4] Auf die Beziehung zwischen Verschiedenen bezogen, möchte ich aus diesem Gedanken Bubers folgern, daß es letztlich unzulässig ist, einem Menschen, der in seinem Antwortvermögen begrenzt ist, eine geistige Behinderung zuzuschreiben. Kein Mensch kann eine geistige Behinderung haben, weil -eben nach Buber - kein Mensch über Geist als eigenes Vermögen verfügt, sondern jeder Mensch mit seinen zwischenmenschlichen Beziehungen im Geiste lebt. Auch wenn die Anteile von Zuwendung und Antwort sehr unterschiedlich sind, dann ist es immer noch eine Beziehung, die im Geist lebt, die eine Geistigkeit Gestalt gewinnen läßt, die beide umfaßt und trägt.
Also: Wenn du etwas erfahren willst von der dialogischen Dimension des Menschseins, von der Wirklichkeit des Zwischenmenschlichen,
dann beschütze ein schlafendes Kind - und du selber wirst weniger Angst haben in der Einsamkeit der Nacht;
-
dann schenke Aufmerksamkeit vielen Menschen in deinem Wohnviertel - und jeder Gruß auf der Straße wird dir eine kleine Stärkung sein für den neuen Tag;
-
dann übe die kleinen Handgriffe praktischer Hilfeleistungen im Alltag für den, der so manches nicht selber kann, - und in deinem eigenen Herzen wird eine Fröhlichkeit wach, dies geschafft zu haben;
-
dann höre dem Einsamen so zu, daß aus seinen Andeutungen ein Erzählen von Geschichten wird - und du selber wirst dich wie begleitet fühlen;
-
dann beteilige dich an der Zuwendung und Hilfeleistung für den Menschen mit schwerer Behinderung, der ohne dies nicht leben könnte - und die Erfahrung seiner Lebensenergie und Lebensfreude wird dein eigenes Leben bereichern;
-
dann setze dich für den bedingungslosen Schutz der Menschenrechte für jeden ein - und du selber wirst dich gegenüber möglichen Bedrohungen nicht mehr bewaffnen müssen;
-
dann halte die Gemeinschaft mit einem Menschen auch im Sterben bis zum letzten Atemzug, auch wenn du nichts mehr heilen, retten, aufhalten kannst - und der Ausdruck von Frieden auf dem Gesicht des Verstorbenen kann für dich selber wie ein Segen sein;
-
dann verwirkliche Formen von Gemeinschaft, zu denen jeder eingeladen ist, bei denen jeder sich als dazugehörig und angenommen erfährt und sich wohlfühlen kann, - und die Vielfalt des Miteinanders wird dich selber mit tiefer Freude erfüllen.
[2] Essener Programmsätze, 1989. In: Georg Herrmann, Klaus v. Lüpke: Lebensrecht und Menschenwürde. Essen, 1991. Seite 298.
[3] Fredi Saal: Warum sollte ich jemand anderes sein wollen? Erfahrungen eines Behinderten- biografisches Essay. Gütersloh, 1992.
[4] Martin Buber: Das dialogische Prinzip. Heidelberg 1962. Seite 41.
Sicherlich hat ein Gruppe gleicher Menschen ihren eigenen Wert, sicherlich braucht jeder auch die Gemeinschaft mit Menschen, die ihm relativ gleich sind, mit denen er relativ viel Übereinstimmung an Interessen und Fähigkeiten hat. Eine solche Gruppe kann aber auch anstrengend sein, sie kann Tendenz zum Sich-beweisen-müssen, zum Leistung-zeigen-müssen folgen und zu einer perfektionistischen Lebensorientierung führen, die seelischer Verarmung endet. Neben dem Zusammensein mit gleichen Menschen auch in Gruppen verschiedener Menschen zu leben, ist eine Voraussetzung für Erfahrungen von der Fülle des Lebens und von der dialogischen Dimension allen Menschseins.
Die Beteiligung von Menschen mit Behinderung kann es auch Nichtbehinderten leichtmachen, Schwellenängste vor einer neuen Gruppensituation abzubauen, Unsicherheiten vor neuen Kommunikationsforderungen zu überwinden. Dahinter steht die alte Erfahrung daß jemand, der etwas nicht oder nicht so gut kann, anderen Mut macht, sich auf etwas Neues einzulassen, dabei Fehler zu machen oder sich eine Blöße zu geben.
Die Gemeinschaft von Verschiedenen führt dazu, bei der Wahrnehmung der Behinderung des einen oder des Versagens des anderen nicht stehen zu bleiben. Sie entwickelt eine eigene Dynamik, die jeden mitnimmt und weiterführt und trägt hin zu seinen jeweils eigenen Ausdrucksmöglichkeiten von Lebendigkeiten an der Kommunikation.
Innerhalb einer Gemeinschaft von verschiedenen Menschen fordern gerade die Nichtperfekten dazu heraus, die bereichernden Möglichkeiten dialogischer Kommunikation zu entdecken und zu entfalten. Da ist die Tatsache an der dialogischen Dimension sowohl in der Form emotionaler, seelischer Zuwendung als auch in der Form praktischer Hilfeleistung zu erschließen.
Die in dialogischen Beziehungen gewonnene Menschlichkeit wirkt über die unmittelbar Beteiligten hinaus: Eine Familie, in der Kinder Geborgenheit erfahren, läßt auch Gäste eine Atmosphäre erfahren, in der sie sich wohlfühlen. Eine Lebensgemeinschaft, die Menschen mit verschiedenen Stärken und Schwächen, d.h. auch mit Behinderungen, in gegenseitiger Hilfeleistung und vielfältiger Kommunikation verbindet, strahlt Lebensfreude aus. Ein Haus, in dem ein Sterbender die Zuwendung von anderen Menschen bis zu seinem Tod erfährt, leistet einen weiterwirkenden Beitrag zum Frieden zwischen Menschen.
So sehr aber gerade in praktisch helfender und in persönlich emotionaler Zuwendung wechselseitige Bereicherung erfahren werden kann, so sehr kann es in diesen Beziehungen auch zu einem einseitigen Übergewicht des Helfens kommen. Dieses Übergewicht der praktischen Anforderungen des Helfens und das Alleingelassenwerden darin kann zu Überlastungen und Abhängigkeiten führen, die statt Bereicherungen Verluste mit sich bringen können, die innere Kräfte ausbrennen lassen können, die Liebe in Ablehnung, ja in Haß verkehren können. Die bereichernden Wechselbeziehungen einerseits und die überbelastenden, verlustbringenden Einseitigkeiten in helfenden Beziehungen fordern dazu heraus, die persönliche Beziehung zu erweitern und mehrere, ja viele Dritte zu beteiligen und damit bunte Gemeinschaften der Verschiedenen zu bilden. Es kann sein, daß jemand sagt: ich trau es mir nicht zu, pflegerische Hilfe für einen Menschen mit schwerer Behinderung zu leisten, aber eine Mitfahrgelegenheit zum Schwimmbad kann ich bieten, oder zur Teilnahme an einem nachbarschaftlichen Gartenfest kann ich einladen, ohne Kontakte zu einer Jugendgruppe könnte ich vermitteln usw. Und nach und nach sind es tatsächlich mehrere, ja viele, die sich mit einer kleinen praktischen Tätigkeit oder mit einem kurzen anteilgebenden Präsenz beteiligen, ein Stück Teilhabe an der dialogischen Ich-Du-Beziehung für sich erschließen und zugleich eine Vielfalt von Beziehungen zwischen allen Mitbeteiligten untereinander entwickeln.
Bei solch arbeitsteiliger: Beteilung an Vielfaltsgemeinschaften kann sich jeder mit dem beteiligen, was er besonders gut kann und deswegen auch mit Spaß tut, und mit der Zeit, die ihm gerade möglich ist. Dann ist nicht das Helfen das Wichtigste des Geschehens und dann steht auch nicht der Hilfsbedürftige im Mittelpunkt der Gemeinschaft. Dann ist Hilfeleistung nichts, was der eine für den anderen nur unter moralischem Druck tun muß. Helfen ist vielmehr eine Form von Kommunikation, an der jeder sich nach Maßgabe seines Könnens, seines Interesses und seiner persönlichen Verbundenheit beteiligen kann und sollte, so wie umgekehrt auch das Teilnehmen, die Kommunikation in der Gruppe schon eine besonders wirksame Form von Hilfeleistung darstellen kann. Keiner muß über seine Kraft investieren, sondern jeder kann sich darauf einlassen und entdecken, wieviel er von dieser Freude an der er sich gegenseitig bereichernden Lebendigkeit aller Beteiligten und von der beglückten und befreienden Realität der dialogischen Dimension des Menschseins erfährt.
Die Gestaltung von Vielfaltsgemeinschaften ist der von Mischkulturen in der Landwirtschaft und Forstwirtschaft vergleichbar. Die Vielfalt von Wechselbeziehungen in Vielfaltsgemeinschaften entspricht den Grundregeln von Mischkulturen: "1. Jedes Element oder jeder Teilbereich erfüllt mehrere Funktionen. 2. Jede Funktion wird durch mehrere Elemente oder Teilbereiche abgedeckt."[5] Diese Regeln bedeuten, auf soziale Mischkulturen, auf Vielfaltsgemeinschaften übertragen, daß jeder Mensch oder jede Teilgruppe mehrere Funktionen für andere bzw. für die Gemeinschaft erfüllt, und daß jede Funktion -eben auch Hilfeleistungen und Geborgenheitsvermittlung - von mehreren Menschen oder Teilgruppen verwirklicht wird.
Mit der sich aus diesen Regeln ergebenden Vielfalt und inneren Dynamik beugen Vielfaltsgemeinschaften einerseits der Entwicklung von gegenseitigen Verlusterfahren vor, wie sie in Situationen des Alleingelassenwerdens in überbelastenden Helfertätigkeiten drohen. Andererseits erweitern und stabilisieren Vielfaltsgemeinschaften die heilsame Alternative zur perfektionistischen Lebensgestaltung, die der Monokulturentwicklung in Landwirtschaft und Forstwirtschaft vergleichbar ist: hier wie da bringen Monokulturen kurzfristige Erfolgssteigerung und langfristig zerstörerische und selbstzerstörerische Folgen: Verödung, Versteppung, Verwüstung oder Vereinsamung, innere Leere, Entsolidarisierung, Verfeindung, Gewalt, Krieg. Ähnlich wie in ökologischen Mischkultursystemen wird dagegen auch im sozialen Miteinander der Verschiedenen eine Lebendigkeit und Lebensförderlichkeit erschlossen, die allen Beteiligten zugute kommt. Vielfaltsgemeinschaften schaffen eine soziale Lebenswirklichkeit, die reich ist an Anregungen und Entmutigungen, an Herausforderungen und Entdeckungsmöglichkeiten, an Befreiung von Angst, am Erfahren von Geborgenheit, an Spontaneität und Kreativität - und sie leistet als Nebeneffekt jede Menge an Entwicklungsförderung und Therapie.
Es ist ein großer Irrturm, ein Gemeinwesen oder eine Gemeinde müsse erst besondere Integrationsfähigkeiten entwickeln und sich Fachkompetenz aneignen, bevor sie sich an die Aufgabe wagen könne, z.B. Menschen mit Behinderung zu integrieren. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt: Es ist von der Dazugehörigkeit, von der Zusammengehörigkeit aller, von der Gleichheit der Verschiedenen auszugehen. Und es kommt darauf an, sich mit offenem Interesse einzulassen, Kontakte zu gewinnen, Kommunikation zu gestalten: gerade mit Menschen mit einer besonderen Originalität, mit einer Behinderung, mit einer Fremdheit. Denn mit jedem neuen Anderen, mit jedem Zustandekommen eines neuen Kontaktes, mit jeder Entdeckung des gleichen Menschseins eines Fernstehenden wächst das Miteinander der Verschiedenen, wächst Vielfaltsgemeinschaft. Und eben mit der Vielfaltsgemeinschaft wächst die Menschlichkeit und Lebendigkeit aller Beteiligten und der ganzen Gemeinschaft, bereichern sich alle in vielfacher Wechselbeziehung. Integrationsfähigkeit ist dann nicht Voraussetzung, sondern Folge oder Ausdruck der Lebendigkeit der Vielfaltsgemeinschaft. Statt sich als mittelschichtsorientierte Bildungsvereine abzusichern, sollten z.B. Kirchengemeinden ihre Aufgabe darin sehen, die verschiedensten Menschen als gleiche Menschen zu entdecken, Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürftigkeiten und Fähigkeiten in vielfältige Wechselbeziehungen zueinander zu bringen.
Deswegen sollte die Nichtaussonderung, das Miteinander der Verschiedenen, die Entwicklung von Vielfaltgemeinschaften zu einer Selbstverständlichkeit in allen Lebensbereichen werden:
-
gemeinsame Kindertagesstätten für alle,
-
gemeinsame Schulen für alle,
-
gemeinsame Arbeitsbereiche für alle,
-
gemeinschaftliche Freizeitgestaltung, Mitmach- und Breitenkultur für alle,
-
Zusammenwohnen und Zusammenleben der Verschiedenen in Hausgemeinschaften, Siedlungen, Stadtteilen,
-
Beteiligungsmöglichkeiten für alle an politischen Entscheidungsprozessen.
Die Verwirklichung des Miteinanders der Verschiedenen sollte zur Selbstverständlichkeit werden. Dabei sollte das Miteinander jeweils auch gegenseitige Hilfeleistung - als eine Form der Kommunikation -einschließen, aber je nach individuellem Mehrbedarf auch von bezahlten Kräften zuverlässig unterstützt werden.
Was solche Vielfaltsgemeinschaften inhaltlich bedeuten können, sei mit folgenden Beispielen illustriert:
Die Bergtour einer Kindergruppe, zu der ein Kind im Rollstuhl dazugehört: Einige Kinder spannen sich vor den Rollstuhl, einige schieben von hinten, einige sichern an der Seite ab: So machen sie gemeinsam den Aufstieg, den holprigen Serpentinenweg bergan. Soviele sind beteiligt, daß es keinem zuviel wird, daß alle miteinander Spaß haben. Sie haben nicht nur den Ergeiz, einen Eisgipfel zu erklimmen, sondern ihr Ziel ist eine Berghütte. Dort machen sie Feuer im Ofen, um den Schweiß zu trocknen, und dort packen sie alles, was sie an Broten und Wurst, Getränken und Schokolade mitgebracht haben, auf den gemeinsamen Tisch, daß sich jeder nehmen kann, was er möchte. Sie feiern miteinander an diesem Tisch das beglückte Erlebnis ihrer Gemeinschaft - die Gemeinschaft der Verschiedenen. Welch Gegenbild zu dem grausigen Bild von Binding und Hoche: Die Menschheit sei wie eine Expeditionsgruppe auf dem Weg zu einem höchsten Gipfel; da könne sie es sich nicht leisten, halbe, Viertel- oder Achtel-Kräfte mitzuschleppen; die müsse sie unterwegs zurücklassen oder in die Schluchten stürzen, damit die Leistungsstarken umso weiter vorankommen.[6]
Was wird das Glück dessen sein, der schließlich allein den Gipfel erreicht; wird er nicht im Frost dieser Eisregionen jämmerlich erfrieren?
Die Tischgemeinschaft der Verschiedenen: Es ist mehr am Leben am Tisch, es bringt ganz einfach mehr Spaß, wenn sich eine Kleinfamilienrunde am Küchentisch erweitert: Wenn erstens die Oma zu Besuch ist, mit der man wegen ihrer Schwerhörigkeit schon etwas lauter reden muß, die aber auch dann, wenn sie nicht verstanden hat, mit gütiger Geduld immer freundlich ja antwortet; wenn zweitens ein Freund als Gast mit am Tisch sitzt, der zufällig eine Behinderung, z.B. ein Down-Syndrom, hat, der viel Freude am Essen hat und immer wieder, wenn es ihm besonders schmeckt, der Hausfrau seine Liebe versichert, immer wieder "ich liebe dich!" ausruft, dann aber auch die Kinder fragt, ob sie schon Hausaufgaben, schon Mathe und Latein fertig hätten, aus dem sicheren Gefühl heraus, daß das wohl etwas Leidvolles sein muß, und weil er gerne mit ihnen Kinopläne machen möchte; wenn drittens seine Mutter mit dabei ist, die sich nach einem Oberschenkelhalsbruch auf Krücken stützt, und die gerne erzählt von all dem, was ihr in den letzten Tagen begegnete. Da ist es laut, da wird gelacht, da wird geschimpft und gestritten, wird über Probleme gesprochen, da wird erzählt und wieder gelacht. Und die Kinder bleiben freiwillig am Tisch sitzen, auch wenn sie mit Essen längst fertig sind.
Die Modellvorstellung von einer Nachbarsiedlung: Hundert bis zweihundert Menschen wohnen um einen gemeinsamen Innenhof herum und gestalten ihr Zusammenleben bewußt mit dem Element gegenseitiger Hilfeleistung aus: Wohnungen verschiedener Größe, der Innenhof als geschützter Spiel- und Begegnungsplatz, für Gärten und für Muße. Die Hofsiedlung insgesamt liegt mitten im städtischen Umfeld; Familien und Einzelne, Kinder Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen; Menschen ohne Behinderung und mit Behinderung - in einer Zusammensetzung wie sie etwa der Verteilung in der Gesamtbevölkerung entspricht; gemeinsame Ausgestaltung des Zusammenlebens, Absprachen zu Gemeinschaftsaktivitäten und zu gegenseitigen Hilfeleistungen (in Kooperation mit beruflichen, bezahlten Helferkräften).
Das Zusammenwirken an runden Tischen für Gerechtigkeit: Es sind Nachbarschafts- und Stadtteilkonferenzen zu organisieren und als Element von Basisdemokratie auszubauen; im Miteinander dieser Konferenzen ist gerade auch den relativ Ohnmächtigen, Ausgegrenzten, Armen, Schwachen eine demokratische Partizipationsmöglichkeit zu eröffnen, eine Möglichkeit, sich gemeinschaftlich für die menschlichere Ausgestaltung der gemeinsamen Lebenswelt im näheren und weiteren Umkreis einzusetzen.
Eine besondere Anregung in dieser Richtung gibt Sten Nadolny, wenn er John Franklin überlegen läßt, seinen Freund Sherard so, wie er ihn nach Jahren wiedergetroffen hat, mit einem schrecklich entstellten Gesicht, mit völliger Sprachunfähigkeit, mit einem Bewußtseinszustand, von dem es heißt: "Niemand wußte, ob und mit wieviel Verstand er die Dinge noch wahrnahm", dem der Arzt "keine sechs Wochen zu leben" mehr in Aussicht stellt, wenn John Franklin eben diesen Sherard in seinem Haus, dem Gouverneurshaus, wohnen läßt und überlegt, ihn "an der Ratssitzung teilnehmen zu lassen" und die Erfahrung formuliert: "Sherard brachte Glück oder, was wahrscheinlicher war, hielt das Unglück, und diejenigen, die es anrichten konnten, fern. Er sagte nichts, verstand vielleicht auch nichts, aber jeder, der nicht das Gouverneurshaus ganz mied, spürte eine Wirkung: Schock, Trauer, Nachdenklichkeit, heitere Ruhe, Tatenfreude. John erwog, Sherard an der Ratssitzung teilnehmen zu lassen, verwarf den Gedanken aber als zu verrückt. Auch aus Respekt vor Sherards Liebe zum Meer: für den wäre eine Sitzung verlorene Zeit gewesen."[7]
Viele Projekte nach dem Muster dieser Beispiele könnten so etwas wie eine soziale Akupunktur der am monokulturellen Perfektionismus erkrankten Gesellschaft betreiben, für die gilt, was Robert Jungk sagt: "Die kleinen Stiche der kleinen Projekte verändern die Wirklichkeit." Selbst der gerade zitierte Gedanke des John Franklin von Nadolny sollte nicht mehr als verrückt verworfen werden, sondern als weiterführende Erkenntnis festgehalten und in die Praxis umgesetzt werden.
Also: Laß dich einladen, dich beteiligen an Vielfaltsgemeinschaften. Denn in Vielfaltsgemeinschaften verbindet sich Freiheit mit Suchen nach Geborgenheit und Geborgenheit mit Streben nach Freiheit. Auf der einen Seite kannst du entdecken
-
welcher Mehrwert an Zwischenmenschlichkeit sich dir in persönlichen Beziehungen erschließt,
-
welche Gegenseitigkeit an Kommunikation in der Praxis alltäglicher Hilfeleistung zu aktivieren ist,
-
wie sehr das Teilen von Zeit und Kraft, aber auch von Geld und Besitz nicht ein Aufopfern, nicht ein Verlust eigenen Vermögens ist, sondern ein Gewinn an Gemeinschaft.
Auf der anderen Seite kannst du dich mit innerer Freiheit auf diese Möglichkeiten einlassen:
-
Du bist nicht allein, sondern einer von vielen, du bist nicht der einzige Kommunikationspartner, ohne dessen Zuwendung dem anderen nur Einsamkeit bliebe, sondern da sind andere, verschiedene andere, die sich unterschiedlich beteiligen oder zur Beteiligung gewonnen werden können.
-
Du bist nicht beansprucht, aus jeder Bekanntschaft eine Freundschaft machen zu müssen. So sehr du die Gleichheit im anderen entdecken willst, so sehr darfst du auch die Unterschiede im Gleichen gelten lassen. Du mußt die Fremdheiten und Schwierigkeiten im Umgang mit anderen nicht verleugnen, aber du darfst deiner eigenen Menschlichkeit zutrauen, eine große Spannweite an Kommunikationsmöglichkeiten zu entwickeln.
-
Du mußt dich nicht damit einbringen, was dir schwerfällt, was nur ein griesgrämiges Opfer wäre, sondern gerade mit dem, was du gut kannst und was dir Spaß bringt: Auch weniges ist viel, weil es Teil des Ganzen ist.
-
Jeder Kontakt zu einem Menschen erschließt Kontakte zu anderen Menschen, jede Aufmerksamkeit, jede persönliche Zuwendung, jede Hilfeleistung für einen Menschen vermittelt die Chance, auch zu den weiteren Bekannten und Freunden dieses einen in Kontakt zu kommen. Die integrative Kraft eines Menschen mit Behinderung kann ein Netzwerk von Kontakten erschließen: eine Gemeinschaft verschiedenster Menschen.
-
Du kannst dich als Mensch mit Behinderung wie als Mensch ohne Behinderung in konkrete Formen von Gemeinschaftsleben einbringen, bei denen nicht die Hilfeleistung der Anlaß des Miteinanders ist, sondern das gemeinsame Interresse an etwas Drittem: Miteinander eine Mahlzeit einzunehmen, Geselligkeit zu gestalten, ein Fest zu feiern, ein Selbsthilfeprojekt zu verwirklichen, Abschied von einem Verstorbenen zu nehmen, u.a. Bei solchen Tischgemeinschaften, Wohngemeinschaften, Festgemeinschaften, Werkgemeinschaften, Trauergemeinschaften ist jeder und auch der Einzelne mit einem besonderen Hilfebedarf von der Gemeinschaft aller getragen und die Hilfeleistung ist ein Bestandteil der vielfältigen Kommunikation untereinander.
[5] Bill Mollison, David Holmgren: Permakultur - Landwirtschaft und Siedlungen in Harmonie mit der Natur. Schaafheim, 1984, Seite 10.
[6] Bindung/Hoche: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form. Leipzig, 1926
[7] Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamekeit. München, 1983. Seite 328.
Inhaltsverzeichnis
- 4.1. Familienleben mit einem Angehörigen mit Behinderung als Modell des Miteinanders der Verschiedenen
- 4.2. Schulen für alle als Orte des Miteinander-Leben-Lernens
- 4.3. Zusammenarbeit der Verschiedenen in gemeinsamen Betrieben als Beitrag zur Humanisierung derArbeitswelt
- 4.4. Individuelle Wohnungen und Wohngemeinschaften als zweites Zuhause für Menschen mit Behinderung und als Grundlage für das Miteinander der Verschiedenen in Nachbarschaft, Gemeinde, Stadtteil, Stadt
- 4.5. Freizeitgestaltung, Kulturangebote, äffentliches Leben als Kreativitätswerkstätten der Menschlichkeit
- 4.6. PolitischeMitwirkungalsBewährungseldundEntwicklundaktorf von Selbstbestimmung und Dazugehörigkeit
Die Erkenntnis der Gleichheit der Verschiedenen führt zur Anerkennung von den gleichen sozialen Grundrechten für alle Menschen. Das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf Dazugehörigkeit, auf Nichtaussonderung müssen zu einer Selbstverständlichkeit auch für Menschen mit Behinderung werden. Damit diese beiden Grundrechte verwirklicht werden können, müssen als Folgerechte hinzukommen: das Recht auf alle individuell erforderlichen Hilfen, auf persönliche Assistenzdienste, das Recht auf gleichberechtigende und nichtaussondernde Strukturen und das Recht auf eine Bildungs- und Kulturarbeit, die diese Strukturen mit Inhalt füllen hilft.
Wenn wir die Gleichheit der Verschiedenen ernstnehmen, wenn wir Menschen mit Behinderung nicht mehr als besondere Menschen ansehen, dann haben wir auch keine Behindertenarbeit mehr zu machen, die Menschen zum Objekt und damit wieder zu etwas Besonderem macht. Wenn wir die Gleichheit der Verschiedenen ernstnehmen, dann haben wir an Stelle von Behindertenarbeit die Rahmenbedingungen und die Inhalte des Zusammenlebens in allen Lebensbereichen so zu gestalten, daß die Zugehörigkeit jedes Menschen, mit welchem Hilfebedarf auch immer, ermöglicht wird bzw. dauerhaft gewährleistet bleibt.
Die bisherigen Zielbegriffe fortschrittlicher Behindertenarbeit: "Soziale Integration" und "Normalisierung" reichen nicht aus. Die Integrationsbemühungen und Normalisierungsvorstellungen stoßen auf zwei Grenzen: auf die unterschiedliche Begrenztheit der Anpassungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung und auf die unterschiedliche Behinderung der Kommunikations- und Solidarisierungsfähigkeit ihrer Mitmenschen durch die belastenden, desintegrativen, entsolidarisierenden Lebensverhältnisse der Gesellschaft, in der sie leben.
Der neue Zielbegriff "Miteinander-Leben-Lernen" meint nichts anderes, aber mehr als Integration oder Normalisierung: eine unteilbare Integration, eine Integration für alle, ohne Abstufungen und Einschränkungen. Damit ist keine "totale Integration" gemeint im Sinne einer Knechtung von Menschen mit Behinderung unter die vorhandenen Verhältnisse, sondern die gemeinsame Ausrichtung auf bessere Normen, auf eine Veränderung der allgemeinen Verhältnisse in Richtung auf eine Kultur hin, in der Menschen mit und ohne Behinderung so miteinander leben, daß sich wirklich jeder angenommen und wohlfühlen kann.
Die Ausgestaltung von gleichberechtigenden Strukturen und Inhalten des Zusammenlebens bedeutet nicht nur die Überwindung von Benachteiligung und Aussonderung, sondern zugleich immer auch die Änderung der Lebensgestaltung der Nichtbehinderten, Weiterentwicklung der Gesamtgesellschaft, Vertiefung der allgemeinen Umgangskultur. Statt Behindertenarbeit zu betreiben, geht es darum, Leben zu entwickeln und Kultur zu gestalten und beides so zu tun, daß das Leben und die Gemeinschaft in Vielfalt alle bereichert.
Deswegen sind gleichberechtigende Strukturen und Inhalte des Miteinanders der Verschiedenen in allen Lebensbereichen zu entwickeln und zu unterstützen: in Familien; in Kindergärten, Schulen, Ausbildung; in der Arbeitswelt; in Wohnungen, Wohngemeinschaften, Wohnnachbarschaft; in Kultur und Freizeit, Öffentlichkeit und Verkehr; in politischer Mitwirkung.
Das Zusammenleben in einer Familie ist ein positives Modell des Zusammenlebens Verschiedener. Daher ist eine Familie grundsätzlich das beste Zuhause für ein Kind mit Behinderung und ein Vorbild für das weitere, dann außerfamiliäre bzw. nachfamiliäre Wohnen von Erwachsenen mit Behinderung. Tatsächlich gehört es zur "Normalität" und ist mit viel größerer Häufigkeit zu finden, als es offen sichtbar ist, daß Familien einen Angehörigen mit Behinderung haben.
In der Wirklichkeit unserer Gesellschaft sind Familien mit einem Kind mit Behinderung jedoch manchmal so etwas wie Heimatvertriebene. Die Eltern haben oft einen schweren Abschied von gewohnten Vorstellungen, ja einen Trauerprozeß durchzustehen. Ihr Alltag ist oft von Isolierung, Ablehnung und Benachteiligung belastet. Doch ganz häufig gelingt es ihnen, ihr Kind mit Behinderung wie jedes andere Kind ganz anzunehmen und in ihrem familiären Miteinander eine tiefere Menschlichkeit als in der Gesellschaft drumherum zu verwirklichen. Es sind neue Freunde zu gewinnen, und praktische Hilfeleistung durch mobile Dienste muß dazukommen. Alle zusammen, Familien mit einem Kind mit Behinderung und ihre Freunde und Bündnispartner, können dann so etwas wie eine neue, menschlichere Heimat entwickeln, mit der sie, statt selber noch mit Neidgefühlen nach den Lebensbedingungen der anderen zu gucken, ihrerseits zum Vorbild und zum Vorkämpfer für ein besseres Miteinander auch über die eigene Familie hinaus werden.
Eigentlich sollten schon "normale" Familien ein positives Modell des Miteinanders Verschiedener sein können. Familien sollten ein Ort des Schutzes und der Förderung für neugeborene Kinder, des Einübens friedlicher Konfliktaustragung zwischen den Generationen, der praktizierten Ehrfurcht im Umgang mit sterbenden Menschen sein. Familien können die traditionelle Gruppe Verschiedener sein, aus der es grundsätzlich keinen Rausschmiß gibt, in die es die Rückkehr auch des "verlorenen Sohnes" geben kann. Familien können Ort des Vertrauens, Ort der Liebe sein. Und eben als solche können Familien auch der Lebensort, der Ort des persönlichen Zuhauseseins von Menschen mit Behinderung sein und der Ort, von dem aus ein Kontaktnetz in Nachbarschaft und Gemeinde hinein aufzubauen ist und von dem aus dann auch die Brücke zum zweiten Zuhause zu bauen ist, das spätestens dann nötig wird, wenn die Kräfte des Elternhauses nicht mehr tragfähig sind.
So stellen Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung ein besonders weitreichendes Modell des Zusammenlebens dar, ein exemplarisches Modell des Miteinanders von Menschen mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Da gibt es in Familien die Erfahrung, daß ein Kind, das nachgeburtlich eine Behinderung bekommt, in seinem Wesen kein anderes Kind wird, als es vorher war. Ebenso ist ein Kind, das mit einer Behinderung geboren wird, kein anderes Kind wie seine Geschwister. Da wird die Erfahrung gewonnen, daß das Miteinander der Verschiedenen grundsätzlich alle Beteiligten bereichert, daß auch die alltägliche Praxis dieses Miteinanders, solange sie keinen der Beteiligten einseitig überbelastet, anregende, spannungsreiche, lebendige Interaktion bedeutet, daß auch die praktische Hilfeleistung eine Form von Kommunikation darstellt.
Das kann so sein, doch oft, allzu oft gibt es ganz andere Erfahrungen: Die pränatale Diagnose einer Behinderung kann furchtbaren Schrecken und heftige Abwehrreaktion hervorrufen; die Geburt eines Kindes mit Behinderung oder auch der spätere Eintritt einer Behinderung kann einen Leidensprozeß einleiten, der wie eine Heimatvertreibung erscheint; und es gibt die Erfahrungen von Überlastungen, Krisen, Zusammenbrüchen von Familien mit einem Kind bzw. Angehörigen mit Behinderung.
Diese Erfahrungen weisen auf zweierlei hin:
-
auf die Brüchigkeit der gesellschaftlichen Institution der Familie als solcher, auf die Verarmung, auf ihren Verlust an Funktionen, an Vielfalt, an Lebendigkeit, an Kommunikationskraft, an Tragfähigkeit, und
-
auf die Behindertenfeindlichkeit unserer Gesellschaft, auf die Macht dieser Behindertenfeindlichkeit, auf die weitreichende Wirkung des illusionären Glaubens an die Machbarkeit bequem konsumierbaren Glücks, an die Reparierbarkeit des Menschen, an Heilsgewinn aus dem Perfektionismus.
Es sind verschiedene Faktoren, die das Familiesein ganz allgemein belasten:
-
Die Reduktion der möglichen Vielfalt des Miteinanders der Verschiedenen auf die Kleinfamilienrealität von vier oder drei Personen oder - bei Alleinerziehenden - u.U. nur noch zwei Personen; die Einschränkung der gegenseitigen Entlastungsmöglichkeiten und die Verarmung an gegenseitigen Anregungsmöglichkeiten durch die Kleinfamiliensituation und der Mangel an kommunikationsfördernden Strukturen im Wohnumfeld der Kleinfamilien, in der Nachbarschaft, im Stadtteil.
-
Die Überbelastung einzelner Familienmitglieder, in der Regel der Mütter, durch ungleiche Rollen- und Aufgabenvertiefungen innerhalb der Familie bei gleichzeitigem Funktionsverlust und Alleingelassenwerden der Familie - bis in Zerreißproben und Zusammenbrüche hinein, bis zum völligen Rückzug und zum Verlust der Fähigkeit, Hilfe annehmen zu können.
-
Die tiefgreifende Zersplitterung der Lebensräume in verschiedene, durch lange, zermürbende Verkehrswege voneinander getrennte Zentren; die weitgehende Abtrennung der Arbeitswelt und der Kulturzentren vom Lebensraum der Familie und die zeitliche Zersplitterung des Familienlebens durch die hohen Leistungsanforderungen der Arbeitswelt einerseits und durch die Verführungsmacht der Konsumangebote andererseits.
All dem könnte und müßte mehr als bisher entgegengewirkt werden:
-
Familienpolitische Maßnahmen:
Es müßte mehr und umfangreichere bezahlte Freistellungen von der Berufsarbeit für Familienarbeit geben, neben der Erziehung von Kleinkindern auch für innerfamiliäre Hilfeleistungen für einen Angehörigen mit längerfristiger Erkrankung oder mit Behinderung und für die persönliche Lebensbegleitung eines Angehörigen im Sterben (vgl. Dänemark).
-
Kulturpolitische Maßnahmen:
Förderung von Kommunikation, Nachbarschafts- und Gemeindeentwicklung durch Kontaktvermittlung zwischen Familien, durch stadtteilbezogene Gemeinschaftsprojekte, durch Angebote von Breiten- und Mitmachkultur im Wohngebiet u.a. einerseits und durch entsprechende Ausgestaltung der Architektur, des Wohnungs-, Siedlungs-, Städtebaus unter Mitwirkung der jeweils betroffenen Menschen andererseits.
Weiterhin muß das Angebot an gesellschaftlichen
-
Solidaritätsleistungen für Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung ausgebaut werden. Doch gerade dies wird immer noch weitgehend verweigert:
Eine erste Solidaritätsverweigerung, die in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden sollte, besteht in der Alternativlosigkeit des Angebots bzw. der Zumutung des Schwangerschaftsabbruches auf der Grundlage der sogenannten eugenischen Indikation sowie im Angebot des nachgeburtlichen Tötens bzw. Sterbenlassens bei Feststellung "schwerster" Behinderung. Die Freiheit zur individuellen Entscheidung über dieses Angebot wird zwar behauptet, aber ohne Alternative zur Wahl gestellt; es wird kein Solidaritätsangebot gemacht, sondern die Solidaritätsverweigerung noch verschärft mit der - ausgesprochenen oder auch unausgesprochenen, aber vorhandenen - Drohung: Wenn du dich gegen unser "Entlastungsangebot" (= Tötungsangebot) für das Kind mit Behinderung entscheidest, dann werden wir das als deine individuelle Entscheidung respektieren, aber dann mußt du auch alle Folgen deiner Entscheidung alleine tragen. Stattdessen müssen die Dienste zur Familienunterstützung ausgebaut werden, um tatsächlich eine echte Alternative anbieten zu können. So wie das Abtreibungs- oder Tötungsangebot die Entwicklung von allgemeiner Behindertenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft fördert, so trüge das Angebot praktischer Unterstützungsdienste zur Verbesserung des sozialen Klimas und zur Entwicklung der Solidaritätsgemeinschaft aller bei.
Eine zweite Form der Solidaritätsverweigerung besteht in der Überbewertung des Angebots medizinisch-therapeutischer und sonderpädagogischer Förderungsangebote, deren Ziel es ist, die Behinderung so weit wie möglich zu überwinden, soviel Selbständigkeit und Leistungsmöglichkeiten wie möglich zu entwickeln. Das beinhaltet einen einseitigen massiven Anpassungsdruck, der Eltern derartig in die Rolle von Co-Therapeuten und Anpassungstrainern drängt, daß sie in ihrer eigentlichen Elternrolle sehr verunsichert werden. Menschen mit Behinderung werden einseitig zu Trainingsanstrengungen und Kompensationsbemühungen gedrängt, die es ihnen schwermachen, sich selbst mit ihrer Behinderung anzunehmen und ihr Recht auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu vertreten. Dabei werden die Grenzen dieser Förderungsmöglichkeiten häufig übersehen oder ignoriert. Es ist dennoch bei allen Erfolgen die Regel, daß Behinderungen nicht völlig überwunden werden und die Menschen in den Grenzen der - trotz aller Anstrengungen - immer noch bleibenden Behinderungen praktische Unterstützungsdienste zur Verwirklichung selbstbestimmter Lebensgestaltung brauchen. Diese nicht professionellen Unterstützungsdienste sind kein Ersatz und keine Konkurenz für die fachlich qualifizierten Förderungsdienste, aber eine notwendige und als gleichrangig zu bewertende Ergänzung.
Eine dritte Form der Solidaritätsverweigerung besteht darin, aus dem "Wesen des Familienbundes" eine allgemeine familiäre Selbsthilfepflicht abzuleiten und diese Selbsthilfeverpflichtung so weit und so ausschließlich zu fassen, daß der Gedanke an einen Anspruch auf Unterstützung von außen, durch die Gesellschaft, von vornherein abgewehrt wird. Damit werden die objektiv nachweisbaren Mehrbelastungen auf Grund der jeweiligen Behinderung sowie die hinzukommenden Benachteiligungen auf Grund der Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft einfach ignoriert. Das Angebot der Herausnahme des Angehörigen mit Behinderung, das Angebot der Heimunterbringung dagegen geht über den Bedarf hinaus und mißachtet den Modellcharakter des familiären Zusammenlebens. Die dem Bedarf angemessene Alternative besteht in praktischen Unterstützungsdiensten.
Wenn wir diese Behindertenfeindlichkeit, diese besondere Form von Entsolidarisierung unserer Gesellschaft überwinden wollen, wenn Familien mit einem Kind mit Behinderung keine Heimatvertreibung mehr erfahren sollen, sondern wirkliche Gleichachtung und Gleichbehandlung und gleiche Beteiligung am gesellschaftlichen Miteinander,
dann ist dies vorrangig mit den folgenden vier Beiträgen politisch zu konkretisieren:
1. Der Grundsatz, durch Hilfe statt Strafe Schwangerschaftsabbrüchen besser vorzubeugen, müßte mit ganz entschiedenem Nachdruck auch im Hinblick auf Kinder mit Behinderung vertreten werden. Das heißt: Es müßte ein Rechtsanspruch auf alltagspraktische Hilfeleistungen für ein Kind mit Behinderung und für seine Familie (Familienunterstützungsdienste) geschaffen werden. Dieser Rechtsanspruch muß von Geburt an gelten und praktische Hilfeleistung je nach individuellem Bedarf ermöglichen, zusätzlich zur erforderlichen Beratung der Eltern und Frühförderung des Kindes.
Wer diesen Rechtsanspruch nicht will, d.h. wer werdenden Eltern nicht verbindlich zusagen will, daß sie dann, wenn ihr Kind mit einer Behinderung geboren werden sollte, nicht nur moralische, sondern auch tatkräftige, praktische und umfassende Unterstützung vermittelt und solidarisch finanziert bekommen werden, der wird den Rückschluß kaum entkräften können, daß er für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches auf der Grundlage einer Behinderungsdiagnose und für Verbesserung der Diagnosemöglichkeiten eintritt, um die Kosten für eben diese Unterstützungsdienste zu sparen.
2. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bzw. Kindertagesstättenplatz müßte den Rechtsanspruch auf einen integrativen (!) Kindertagesstättenplatz für jedes Kind mit Behinderung in einer gemeinsamen Einrichtung für alle Kinder (!) einschließen. Die gegenwärtige, keineswegs zwingende Finanzmittelverknappung droht nicht nur den allgemeinen Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz zunichte zu machen, sondern insbesondere die wohnungsnahe Integration von Kindern mit Behinderung völlig zur Illusion werden zu lassen.
Wer die Finanzmittel nicht so ausreichend zur Verfügung stellt, daß mit einem Kindertagesstättenplatz für jedes Kind auch für jedes Kind mit Behinderung ein integrativer Platz geschaffen werden kann, der trägt bei zur Verfestigung der Unterscheidung von Kindern und behinderten Kindern, der schließt Kinder mit Behinderung dauerhaft aus der Gemeinschaft aller Kinder aus und fördert die Bereitschaft zum Schwangerschaftsabbruch bei Feststellung einer Behinderung.
3. Mit gleicher Konsequenz müßte ein Rechtsanspruch auf integrativen Schulbesuch, auf eine - an den Lernzielen Menschlichkeit, Kommunikationskultur und Solidarität orientierte - gemeinsame Schule für alle eingeführt werden. Das soziale Lernen in einer solchen gemeinsamen Schule wäre zugleich ein wirksamer Beitrag zur Oberwindung der immer weiter um sich greifenden Gewaltbereitschaft.
Wer heute die Integration von Kinder mit und ohne Behinderung in der Schule einschränkt oder ganz verschließt, statt die gemeinsame Schule für alle bis zur Sekundarstufe einschließlich zur Regel zu machen, der läßt die Entfernung und die Fremdheit zwischen den Kindern wachsen, statt sie in Mitmenschlichkeit zu stärken und in Solidarität zu üben.
Eine desintegrative Schul- und Bildungspolitik trägt dazu bei, eine Generation von Menschen heranzubilden, die wenig oder nichts an eigenem erfahrungsgegründeten Denken den neuen (alten) "Euthanasie"-Propagandisten entgegenzusetzen hat. Heute lehren inzwischen wieder Hochschullehrer ein Denken, das von einer Sympathie mit der "Bioethik" eines Peter Singer (z.B.) ausgeht und einer Argumentation für "Euthanasie" die Wege ebnet.
4. Die Pflegeversicherung müßte so weiterentwickelt werden, bzw. es müßte ein so umfassendes Assistenzleistungsgesetz durchgesetzt werden, daß jede nach individuellem Bedarf erforderliche alltagspraktische Dienstleistung solidarisch finanziert und der Pflegenotstand bzw. Betreuungsnotstand endlich überwunden wird. Neben der Unterstützung des Zusammenlebens in Familien geht es dabei vor allem auch darum, die Möglichkeiten eines nachfamiliären Wohnens, eines "zweiten Zuhauses" mit Hilfe persönlicher Assistenzdienste so zu konkretisieren und so rechtzeitig zu verwirklichen, daß Eltern nach all den Jahren, meist Jahrzehnten ihres Einsatzes für das Zusammenleben im ersten Zuhause nicht einer Zukunftssorge ausgeliefert werden, die fast wie eine Bestrafung all ihres bisherigen Engagements wirkt.
Wer die - zur Zeit wieder stärker spürbare und erfahrbare und vor allem Familien belastende - erneute Entwicklung von Behindertenfeindlichkeit und "Euthanasie"mentalität grundlegend überwinden helfen will, der muß neben den erforderlichen Verbesserungen der Familienpolitik auch im Hinblick auf diese vier Bereiche weiterführende Schritte anbahnen helfen.
Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung stellen als Modell des Miteinanders Verschiedener geradezu ein Gegenmodell zu den herrschenden Verhaltensmustern der Gesellschaft dar, in der sie leben; sie stehen in Spannung zu den allgemeinen Aussonderungs-, Zersetzungs-, Entsolidarisierungstendenzen unserer Gesellschaft. Um diese Spannung nicht nur durchhalten, sondern auch produktiv machen zu können, brauchen Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung vielfältige Unterstützungsdienste, mitmenschliche Kontakte, partnerschaftliche Zusammenarbeit und politische Bündnispartnerschaft. Je mehr sie davon erfahren, desto mehr und desto besser können Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung das sein, was sie sind: beispielhafte und beispielgebende Modelle des Miteinanders Verschiedener, Heimatorte der Menschlichkeit.
Für viele ist es immer noch schwer vorstellbar, daß Schüler völlig unterschiedlichen Leistungsniveaus eine gemeinsame Schule besuchen; schwer vorstellbar, daß es nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll und erstrebenswert ist, daß Schüler mit durchschnittlicher Intelligenz in Kommunikation und Interaktion mit Schülern mit geistiger Behinderung lernen; daß dies Miteinander Wesentliches, Entscheidendes zur Persönlichkeitsbildung und Solidaritätserziehung beitragen kann. Bei vielen herrscht das Mißverständnis vor, schulische Integration könne es nur bei gleichen schulischen Leistungsfähigkeiten geben, Integration von Kindern mit Behinderung könne nur als zielgleiche Integration praktiziert werden. Doch beim Miteinander-Leben-Lernen in der gemeinsamen Schule für alle geht es eben ganz ausdrücklich um zieldifferente Integration und um Orientierung an den übergeordneten Bildungszielen-. Menschlichkeit, Kommunikationskultur und Solidarität. D dies vielen so schwer vorstellbar ist, macht deutlich, wie sehr einerseits die Schulwirklichkeit nichtbehinderter Schüler auf Training technischer Fähigkeiten und auf Vorbereitung zum Konkurrenzkampf ausgerichtet ist, und wie sehr andererseits die Praxis der Aussonderung, das Vorhandensein von Sonderschulen den Selektionsmechanismus im Kopf geprägt hat, - diesen Mechanismus, der Schüler mit Behinderung nur noch als Sonderschüler, als Sondermenschen, als in andere Zuständigkeit gehörend wahrnehmen läßt.
Um tatsächlich Persönlichkeitsbildung zu leisten und dem "Lernziel Solidarität" (Horst Eberhard Richter) zu dienen, ist eine umfassende und radikale Schulreform nötig. Die erforderliche Schulreform muß das Miteinander der Verschiedenen ohne jeden Ausschluß ermöglichen, indem sie die individuelle Förderung eines jeden, sowohl des Geringbegabten wie des Hochbegabten, verbindet mit der Förderung der sozialen Fähigkeiten: in der Praxis des Miteinanders sowohl im Unterricht als auch in Projekten. Die gemeinsame Schule für alle sollte vorrangig in Form von Praxisprojekten betrieben werden: weil diese mehr Lernmotivation schaffen und die Verantwortlichkeit stärken; weil sie eine Vielfalt von unterschiedlichen Rollen, je nach individuellen Interessen und Fähigkeiten ermöglichen und diese im praktischen Miteinander zusammenführen; weil sie ein Bewußtsein der jeweiligen Verantwortung füreinander und für die gemeinsame Sache entwickeln.
Die Bedeutung des Miteinanders der Verschiedenen für die Persönlichkeits- und Solidaritätsentwicklung ist durch viele Praxiserfahrungen belegt. Stellvertretend für viele Jürgen Trogisch:
"Wenn ich aber bedenke, was die beiden und andere Schwerstbehinderte nur durch ihr Dasein bei den genannten jungen Menschen an inneren Veränderungen bewirkt haben, dann müßten sie auf Grund ihrer Wirksamkeit als Lehrer in unserem Schulsystem angestellt werden. Das Problem der Akzeptierung der Geschädigten in der Gesellschaft läßt sich wohl in seiner ganzen Komplexität nur dann schrittweise lösen, wenn das gesamte Erziehungs- und Bildungssystem einer Gesellschaft diese Aufgabe kontinuierlich und konkret in den Lernalltag der Heranwachsenden vom Kleinkindalter an aufnimmt. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit möchte ich an einem Zitat aus dem Buch ‚Guten Morgen, du Schöne' - Protokolle nach Tonband von Maxi Wander deutlich machen: In dem Gesprächsprotokoll mit Rosi, einer Sekretärin, steht: ‚Schon mit den einfachsten menschlichen Beziehungen hapert es. Wenn einer Kummer hat, wenn es bei einem ans Sterben geht, wenn einer Krebs hat oder wenn er Pole ist - ich weiß, was ich sage - wenn einer irgendwie aus der Norm heraustanzt, da versagen wir. In unserem Hof ist ein Kind ertrunken, beim Spielen in eine Regentonne gefallen. Die Leute haben einen riesigen Bogen um die armen Eltern gemacht, sie haben sich gewunden, in eine andere Richtung geguckt oder Dummheiten geredet. Es war bestimmt nur Hilflosigkeit, aber woher kommt denn die, woher kommt dieses feige Verhalten, wieso sind wir so schlecht aufs Leben vorbereitet, was lernen wir eigentlich in den Schulen!"
Um naheliegenden Mißverständnissen zu wehren, sei mit Nachdruck gesagt: Im Miteinander-Leben-Lernen soll nicht der eine für den anderen benutzt werden. Der Mitschüler mit Behinderung soll nicht dazu dabei sein, daß Mitschüler ohne Behinderung eine einseitige Helferrolle erlernen und sich darin stark fühlen; es geht auch nicht darum, den Mitschüler mit Behinderung für den persönlichen Reifungsprozeß der anderen zu instrumentalisieren. Vielmehr soll die Vielfalt der Wechselbeziehungen erfahren werden und die Schüler sollen sich gegenseitig in der Entwicklung einer partnerschaftlichen Kommunikationskultur und Solidaritätspraxis fördern. Die Hilfeleistungen für Schüler, die auf Grund ihrer Behinderung regelmäßig und verbindlich mehr Hilfe als andere nötig haben, wie zum Beispiel Assistenz beim Essen und bei der Toilette, Assistenz beim Schreiben oder bei der Ausübung anderer praktischer Tätigkeiten, sind gerade nicht nur und nicht in erster Linie durch Mitschüler/innen, sondern vor allem auch durch dafür organisierte und bezahlte Assistenzkräfte zu gewährleisten. Eine wichtige Rahmenbedingung für das Miteinander im Schulalltag und das Zusammenwirken in gemeinschaftlichen Praxisprojekten ist, daß ein Zwei-Lehrer-System oder "team teaching" zur Regel wird.
Es liegt auf der Hand, daß das Miteinander der Verschiedenen wenn es tatsächlich von gegenseitiger Achtung erfüllt ist, gerade für die Schüler mit Behinderung ein optimaleres Motivations- und Anregungsmilieu, ein wirkungsvolleres Lern- und Entwicklungsklima schafft als es die Sondergruppe relativ Gleicher bieten kann. Und je schwerer eine Behinderung ist, die ein Schüler hat, desto mehr profitiert gerade er von der Zugehörigkeit zu einer bunten, spannungsreichen, lebensvollen Gruppe.
Die Erfahrung zeigt aber auch, daß die Förderung der emotionalen und der sozialen Bildung sehr gut mit der Förderung der technischen Intelligenz zu verbinden ist, daß die Verbindung von beidem nicht zu schlechteren Leistungen, sondern zu mindestens gleich guten, mitunter auch besseren Leistungen führt - und dies bei allen, auch bei den Schülern mit nicht behinderten Leistungsvoraussetzungen. Der einseitige Leistungsdruck jedoch, der Mangel an Spielraum und Förderungsmöglichkeiten für die emotionale und soziale Bildung bringt dagegen nachweislich für viele Schüler große, manches Mal auch katastrophale Folgeprobleme und trägt langfristig zur Verschärfung gesamtgesellschaftlicher Entsolidarisierung bei. Die siegreichen Absolventen eines Schulsystems, das einseitig der Förderung der technischen Intelligenz dient, werden die zukünftigen Ausbeuter und Unterdrücker aller Schwächeren sein, wenn sie nicht doch irgendwo und irgendwann zumindest eine Ahnung von dem Wert gewonnen haben, den partnerschaftliche Kommunikation und mitmenschliche Solidarität auch für sie selber haben. All dies spricht für die dringende Notwendigkeit, eine umfassende Schulreform in Angriff zu nehmen.
Juta Schöler, Berlin: "Die Schule für alle Kinder ist die für alle Kinder bessere Schule. Nur gemeinsam können jungen und Mädchen, Kinder verschiedener Religionsgemeinschaften, deutsche und ausländische Kinder, Kinder ohne und mit Behinderung und auch hochbegabte Kinder lernen, unbefangen miteinander umzugehen, füreinander dazusein, zusammen zu spielen, zu lernen und zu arbeiten und Verschiedenheiten als Bereicherung zu erfahren. Gewalt in der Schule wird nachweislich durch täglich gelebtes Miteinander und Füreinander deutlich verringert."[8]
Wie die Entwicklung integrativen Unterrichts in der Praxis aussehen kann, illustrieren einige Beispiele aus den USA.[9]
"Anfangs wurden behinderte Kinder in Sonderklassen innerhalb der Regelschulen aufgefangen, und an vielen Orten geschieht das immer noch. Aber in den letzten zwei, drei Jahren wird in den Staaten, in denen ich mich umsah, Rhode Island, Connecticut und Colorado, steinhart daran gearbeitet, alle Kinder von 3 bis 21 Jahren in Regelklassen aufzunehmen, zwischen ihre Altersgenossen. Das Resultat ist sichtbar. Wenn du in einer durchschnittlichen Grundschule oder weiterführenden Schule herumgehst, siehst du dort Kinder in Rollstühlen, du siehst blinde Kinder, siehst Kinder mit deutlichen geistigen Behinderungen zwischen ihren Altersgenossen. In der Klasse, auf den Gängen beim Stundenwechsel, in der Kantine. Wer sich nicht alleine fortbewegen kann, bekommt Hilfe von einem Mitschüler oder von einem Klassenassistenten; wer eine sehr schwere Behinderung hat, hat für den ganzen Tag jemand bei sich, um ihm zu helfen. Aber die normale Lehrerin oder der Lehrer muß so viel wie möglich selbst tun, nach Maßgabe eines individuellen Lehrplans für den behinderten Schüler. Dieser individuelle Lehrplan ist aufgestellt von dem Sonderpädagogen, der an der Schule arbeitet, in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer und mit den Eltern.
Die Lehrkraft bildet sich fort, auf der Basis des individuellen Lehrplans der Kinder, die in ihrer Klasse sind. Ist in diesem Jahr ein taubes Kind in der Klasse? Dann lernt die Lehrerin unter anderem Gebärdensprache, und diese bringt sie anschließend auch allen Kindern bei, so daß sie alle mit Jimmy kommunizieren können. Logisch nicht wahr? Da profitiert Jimmy von, denn der kann nun nicht nur mit den Begleitern und anderen Tauben kommunizieren, sondern mit jedem um ihn herum. Die anderen Kinder profitieren genauso davon. Sie lernen eine Sprache, mit der sie mit vielen Menschen kommunizieren können, die sie ohne diese Fertigkeit niemals kennengelernt hätten. Was sie darüber hinaus noch lernen, ist, daß Kinder mit einer Behinderung normale Kinder sind, junge Menschen, mit einem Namen, mit angenehmen und unangenehmen Eigenschaften, mit Familienmitgliedern, mit Freunden und Freundinnen, mit einem Zuhause, wo du hinkommen kannst. Genau wie jeder andere. Kinder in integrierten Klassen haben von früh auf gelernt, wie sie am besten mit jemandem umgehen können, der blind oder taub ist, epileptisch oder geistig behindert. Nichts Unheimliches ist mehr daran. Diese Kinder brauchen später, wenn sie groß sind, keine Information mehr über ihre besonderen neuen Nachbarn, darüber warum du als Arbeitgeber behinderte Arbeitnehmer anstellen solltest, oder darüber, was attraktiv daran ist, mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten.
Alles ist zu erlernen, das ist der Ausgangspunkt an den amerikanischen Schulen. Im Prinzip kann jeder gute Lehrer jedem Kind Unterricht geben, vorausgesetzt er oder sie bekommt genügend Unterstützung. Sitzt da ein sehbehindertes oder blindes Kind in der Klasse, dann lernt die Lehrkraft Blindenschrift, es kommt ein Blindenschriftencomputer in die Klasse und eventuell andere Apparate wie ein Fernsehbildschirm, auf dem Texte besonders groß wiedergegeben werden können. Für Kinder mit Autismus, Konzentrationsproblemen, geistigen Behinderungen oder Verhaltensproblemen gilt dasselbe: Soweit es pädagogische Methoden gibt, um Kinder mit diesen Behinderungen zu unterrichten, bildet sich die feste Lehrkraft fort. Die Kenntnis, die Sonderpädagogen haben, wird mittels individuellem Lehrplan und Kursen an die Klassenlehrkraft weitergegeben, so daß in der Klasse den besonderen Anforderungen der Schüler Genüge getan werden kann.
Inclusion hat die Atmosphäre an den Schulen, die Art des Umgangs der Kinder miteinander und die Weise des Unterrichts drastisch verändert. Lehrer, die deswegen, weil behinderte Kinder in der Klasse sind, den Lehrstoff ruhiger, deutlicher und fast immer durch Gebärden unterstützt erklären, merken, daß die nichtbehinderten Kinder den Unterrichtsstoff dadurch auch besser begreifen. Kinder, die mühsam lernen, nehmen den Stoff besser in sich auf, wenn sie in kleinen Schritten arbeiten können und immer zu hören bekommen, daß sie es gut machen. Die positive Herangehensweise ist sehr günstig für Kinder mit Versagensangst, aber sie scheint für die anderen Schüler auch ausgezeichnet zu wirken. Die Lernleistungen aller Kinder steigen, wenn, gut begleitet, Kinder mit Behinderungen in die Klasse kommen. Darüber hinaus gucken die Kinder sich die Kunst des Umgangs miteinander gut von der Lehrerin ab: Sie werden verträglicher gegen ihre Mitschüler.
Wenn die Lehrerin eine Geschichte erzählt, braucht sie die Kinder nicht zur Stille zu ermahnen. jeder sitzt ruhig im Kreis um sie herum und hört zu: Auch der im letzten Jahr noch sehr unruhige Patrick, sieben Jahre alt, der autistisch ist und spastisch und das Down-Syndrom hat. Als er gerade in der ersten Klasse war, schob er fortdauernd durch den Raum, machte Geräusche, wenn es ihm paßte, und war kurzum ein noch störender Junge. In einigen Monaten wußte er durch Umhergucken um sich herum und durch die Zurechtweisungen von den anderen Kindern, wie er sich selber verhalten mußte. Wenn seine Mitschüler sich jetzt auf den Vorleseteppich setzen, dann setzt er sich zwischen sie, mit zur Lehrerin erhobenem Gesicht. Macht er bei ihrem Unterricht über Computer mit? Ich sehe seine Augen zu allen Seiten hin abschweifen. Doch er bleibt ruhig sitzen, bis die Lehrerin sagt, daß sie mit ihrer Erklärung fertig ist und vier Kinder jetzt auf dem Computer üben dürfen. Unter ihnen ist Patrick, er setzt sich mit seiner ständigen Begleiterin, der Klassenassistentin, vor den Bildschirm. Die Begleiterin setzt sich hinter Patrick und faßt seine Hand. Genau wie alle anderen Kinder beginnen sie mit dem Unterrichtsstoff- die Uhr lesen. Die Begleiterin arbeitet nach der Methode der gestützten Kommunikation. Sie unterstützt Patricks Hand über zwei Karten, auf denen die Worte "ja" und "nein" stehen. "Patrick, ist es zwei Uhr?" fragt die Begleiterin und Patrick bewegt seine Hand zu der "Nein"-Karte. "Gut so", sagt die Begleiterin und fragt: "Patrick, ist es ein Uhr?" "Ja", zeigt Patrick. "Prima", sagt die Begleiterin und es erscheint ein Sternchen auf dem Bildschirm. Nach fünf Sternchen darf Patrick eine Stufe weiter.
Patricks Blick, der am Anfang der Stunde noch umherschweifte, wird immer fester auf den Bildschirm konzentriert. Seine Neigung etwas hart über seine Ohren zu streifen, nimmt in dem Maße ab, wie seine Konzentration zunimmt. Patrick lernt vielleicht die Uhr zu lesen, und ein Skeptiker wird sich fragen, was so ein Kind davon hat. Aber was Patrick vor allem lernt, ist, wie er sich selbst in der Hand halten kann, wie er dem vorbeugen kann, daß er sich chaotischem oder selbstverletzendem Verhalten überläßt. Er begreift die Verhaltensregeln in der Klasse, fühlt sich sicher genug, um neue Fertigkeiten zu lernen. Und er begreift offensichtlich den Unterschied zwischen ein und zwei Uhr. Aber das allerbedeutsamste ist, daß dieses autistische und schwer geistig behinderte Kind beginnt, mit seinen Mitschülern zu kommunizieren.
Jacinta ist zehn Jahre. Sie sitzt in Gruppe 6, zwischen Kindern ihres eigenen Lebensalters. Sie "erzählt" eine Geschichte über einen Ausflug, den sie am Tag zuvor mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Schwester gemacht hat. Julia, ihre feste Begleiterin, hat diese Geschichte geschrieben und liest sie vor. Jacinta ist so schwer behindert, daß sie selbst nicht erzählen kann, was sie erlebt hat. Aber die Geschichte weckt doch das Interesse der anderen Kinder, sie hören gespannt zu: Jacinta ist kein armer Schlucker, im Gegenteil, sie hat etwas Tolles mitgemacht.
Als der Aufsatz von Jacinta zu Ende ist, beginnen die Kinder damit, eine sprachliche Übung zu machen. In kleinen Gruppen zu viert sitzen sie jeweils an einem Tisch und nehmen die Fragen durch. Auch Jacinta sitzt in so einer Gruppe. Ihr Nachbarjunge hält ihre Hand fest, während er mit den zwei anderen Kindern über die Antworten spricht, die sie aufschreiben sollen. Jacinta genießt es sichtbar. Lernt sie etwas von Sprache dabei? Wir wissen es nicht, denn sie kann es uns nicht erzählen. Aber sie begreift durch alles, was sie mitmacht, vielleicht mehr von dem, was um sie herum geschieht. "Ich finde, daß sie in sozialer Hinsicht deutlich Fortschritte gemacht hat. Aber wir können nicht messen, was sie an Kenntnissen in sich aufnimmt. Sie ist nicht zu testen", erzählt ihre Klassenlehrerin. Jacinta, ging früher auf eine Sonderschule, 25 Kilometer weiter weg, aber ihre Eltern fanden, daß ihre Tochter dort nicht gedieh und hofften, daß sie mehr von nichtbehinderten Kindern in sich aufnehmen können würde. Sie sorgten dafür, daß Jacinta auf die Schule ihres Bruders kam. Da geht sie nun für halbe Tage hin. Die drei ganzen Tage, die sie zuerst kam, schienen zu schwer. Die übrige Zeit ist sie mit Begleitung durch eine Pflegekraft zu Hause. Jacinta kann nicht selber essen, sie bekommt Sondenernährung. Sie hat regelmäßig unter Krampfanfällen zu leiden, auch in der Klasse.
Eine Mutter berichtet: As Sarah hierher kam, saß sie immer in sich zusammengesunken. Kopf nach unten. Sie guckte niemanden an, sie guckte nirgendwo hin. Sie schlief ganze Strecken des Tages, wenn sie zu Hause war. Ein deprimiertes Kind von fünf Jahren. Sie kannte ganz und gar niemanden. jetzt sitzt sie aufrecht, sie guckt um sich herum, sie kichert, sie ißt gut. Sie hört zu, wenn die Lehrerin vorliest. Ich laufe mit ihr durch die Stadt und Menschen grüßen sie. Sie kennen sie, denn ihre Kinder sitzen mit ihr in der Klasse. Und Sarah bleibt wach. Ihre Welt ist ein bißchen schöner geworden, ich bin jeden Tag wieder darüber verwundert."
Okay. Integration an einer Grundschule, das mag sein. In Connecticut und Rhode Island sehen wir es mit kleinen Klassen und mit viel zusätzlicher Hilfe geschehen. Und mit schwerbehinderten Kindern. Aber wie ist es an weiterführenden Schulen? Kinder mit schweren geistigen Behinderungen in der Sekundarstufe? Das kann doch fast nicht sein, wetten?
Ein Direktor einer weiterführenden Schule: "Ob inclusion glückt, hängt von der Qualität des individuellen Lernplanes ab, vor allem aber von dem Vertrauen zwischen der Klassenlehrkraft und dem Sonderpädagogen. Inclusion an einer Grundschule ist wohl kaum anders als inclusion auf einer High School (Sekundarstufe). Die Lehrer an einer High School haben immer noch hohe Normen von dem, was Schüler an Kenntnissen sammeln müssen. Und ja, ein Kind mit einer Behinderung in eine normale Klasse setzen und anschließend erwarten, daß es mitbekommt, was da alles in der Klasse geschieht, das hat überhaupt keinen Sinn. Du mußt es Schritt für Schritt aufbauen.
Im ersten Jahr war in unserem Lehrerteam viel Widerstand: Die Lehrer wußten ganz sicher, daß inclusion in einer weiterführenden Schule unmöglich war. Ich habe ihnen erzählt, daß die Gesellschaft sich in dieser Richtung weiterentwickeln würde und daß deswegen nichts anderes übrig bliebe, als unsere Schultern darunter zu stemmen. Es kamen auch Magen aus dem Sonderunterrichtsbereich: Die Lehrkräfte dort fürchteten, daß sie ihre Anstellungen verlieren würden. Wir haben ihnen deutlich machen können, daß wir ihre Erfahrung sehr nötig hatten und daß sie ihren Arbeitsplatz sicher nicht verlieren würden.
Im zweiten Jahr begann die Überzeugung sich durchzusetzen, daß inclusion wirklich weitergehen würde. This is reality, so let's do it. Lehrer bekamen Assistenten in die Klasse. Anfangs waren sie sicher froh über diese Hilfe, aber nach einem Jahr hörte ich von einem Lehrer: Der Assistent ist nicht mehr nötig, ich kann es jetzt gut selber."
"Das Einführen von inclusion geht nicht ohne Hauen und Stechen. Aber trotzdem verändert sich da etwas. Als wir begannen, bekamen Lehrer Wutanfälle. Ihre einzige Option war: Wie bekommen wir die behinderten Kinder so schnell wie möglich wieder weg. Jetzt nach zwei Jahren sagen sie: Wie können wir uns so gut wie möglich auf das Kommen eines behinderten Schülers vorbereiten.
Sie arbeiten hart dazu. Sie merken, daß diese Art von Unterrichten viel aufregender und viel anregender ist. Sie fangen an, Spaß daran zu bekommen. Ich weiß sicher, daß innerhalb von fünf oder sechs Jahren der gesamte Sonderunterricht verschwunden ist; daß Sonderschulen nicht mehr bestehen und auch Sonderklassen verschwinden. Es erweist sich, daß wir das schaffen.
Wie das in der Klasse geht? Die behinderten Kinder folgen soweit wie möglich dem normalen Stundenplan. Ein Beispiel: Im Literaturunterricht lesen die Schüler Romeo und Julia. Für eine Schülerin mit Down-Syndrom war dies ein zu schwieriger Text. Sie bekam eine vereinfachte Fassung der Geschichte mit nach Hause, wo sie diese zusammen mit ihrem Vater las. Sie begriff diese Geschichte und konnte jetzt auch Fragen des Lehrers beantworten. Individuelle Unterrichtsmethoden, das ist der Grundsatz. Und das funktioniert gut."
Auch auf den weiterführenden Schulen, die wir besuchen, sehe ich Schüler mit sehr schweren Behinderungen. John zum Beispiel ist viele Stunden des Tages nicht bei Bewußtsein. Er ruht dann in der Sonderklasse aus. In diesem Raum werden auch immer Übungen mit ihm gemacht, um dem vorzubeugen, daß sein Körper sich verwächst oder er Durchliegewunden bekommt. John ist in Koma gefallen, nachdem er ertrunken war, und er ist da kaum mehr herausgekommen. In den Momenten, in denen er bei Bewußtsein ist, kommuniziert er mit minimalen Augenbewegungen. Nur jemand, der ihn sehr gut kennt, kann daraus etwas schließen. Seine aktiven Stunden verbringt John in der normalen Masse zwischen Lebensaltersgenossen, die mit Mathematik, Naturkunde und Literaturuntersuchungen beschäftigt sind. Niemand weiß, ob John etwas davon mitbekommt, was in seiner Klasse geschieht. Aber seine Eltern und sein Klassenassistent finden sehr wohl, daß er lebendiger wird, daß da kleine Strahlen von Interesse durch sein Koma hindurchschimmern.
Eine Klasse mit Pubertierenden an einer anderen Schule für weiterführenden Unterricht ist mit einer Lektion über Kinderbetreuung beschäftigt. Der Lehrer erklärt, warum Kinder im Alter von zwei Jahren manchmal so ängstlich vor Fremden sein können und warum Kinder von drei Jahren so schrecklich naseweise sein können. ("Das liegt an dir, es gehört ganz natürlich zur Entwicklung eines Kindes.") Danach gehen die Schüler daran, in kleinen Gruppen die Fragen aus dem Buch zu beantworten. An jedem Tisch sitzen drei oder vier Schüler, von denen einer eine Behinderung hat. Die Zusammenarbeit glückt an dem einen Tisch besser als an dem anderen. Vier flott gekleidete Mädchen, von denen eins mit Down-Syndrom, überlegen murmelnd miteinander und tragen die Antworten ein. An einem anderen Tisch lassen zwei gleichgültige Schlakse, die kleine Kinder dumm finden, einen Mitschüler, der ratlos zu seinem Buch starrt, einfach links liegen. Nein, es geht nicht von selbst. Es geht fast nie von selbst.
Eine Lehrerin: "Ich habe Kinder mit Behinderungen in regulären Klassen unglaublich wachsen sehen. Sie haben sich Fertigkeiten angeeignet, die sie in einer Sonderklasse wahrscheinlich niemals erlernt hätten. Einem Kind Fertigkeiten beizubringen, die es in der Praxis nicht anwenden kann, das funktioniert nicht. Das bleiben bedeutungslose Fertigkeiten. Dadurch, daß sie im Umgang mit anderen Kindern entdecken, warum bestimmte Dinge so und nicht anders sein müssen, lernen Kinder bedeutungsvolle Fertigkeiten. In einer Klasse, in der Unterschiede zwischen Kindern anerkannt werden, siehst du Kinder wachsen.
Das Dazukommen von behinderten Kindern veränderte die Schule für jeden. Wir diskutieren andauernd über das, was wir tun und kontrollieren einander sorgfältig. Sind wir nicht, ohne daß wir es merken, dabei, ein Kind aus seiner sozialen Umgebung zu holen? Ausschließen ist schlecht. Auch die Therapeuten sind immer mehr durchdrungen von der Idee. Ein Kind aus der Klasse zu holen und ihm ganz allein Therapie zu geben, das muß soweit wie irgend möglich vermieden werden. Hat ein Kind Logopädie nötig, dann scheint es wirksamer zu sein, die Therapie an eine kleine Gruppe zu geben, von der nur ein Kind es nötig hat. Therapie ist nicht länger: eine Ausnahme sein und aus der Klasse herausgeholtwerden, sondern gemütlich etwas Schönes zusammen mit einer kleinen Zahl von Kindern tun. Auch der Gymnastiklehrer muß kreativer werden. Wenn alle Kinder Seil springen, muß er seinen Kopf gebrauchen, damit ein körperbehindertes Kind nicht an der Seite stehen bleibt. In diesem Fall ging das körperbehinderte Kind mit Musik Trampolin springen.
Beim Aufstellen des individuellen Lernplanes wird vor allem darauf geachtet, wie die besonderen Bedürfnisse eines Kindes in den üblichen Gang der Dinge in einer Klasse eingepaßt werden können.
Kinder helfen sich gegenseitig und es ist eine wichtige Aufgabe der Klassenlehrkraft, die Atmosphäre in der Klasse so offen und einladend zu gestalten, daß alle Kinder sich ermutigt fühlen. Es zeigt sich, daß Kinder die Haltung übernehmen. Anfangs neigen sie dazu, behinderte Mitschüler zu betüteln, aber schon schnell haben sie es heraus, daß die Lehrerin das auch nicht tut. Sie lernen, wie du jemandem helfen kannst, etwas selber zu tun."
Eine andere Lehrerin: "Patrick sitzt nun fast ein Jahr bei mir in der Masse. Und ich merke, daß ich mit ihm absolut keine Mühe habe. Es geht vortrefflich. Ich weiß, daß er schwerbehindert ist, mit Down-Syndrom, daß er autistisch ist, daß er spastisch ist. Aber ich sehe all diese Dinge nicht mehr. Er ist einfach eins von den Kindern in meiner Klasse geworden ...
Die Sonderpädagogin hat einen ausgezeichneten individuellen Lernplan für Patrick gemacht, in Rücksprache mit mir, mit den Eltern und mit dem Klassenassistenten. Ich verfolge mein normales Programm, und Carol sorgt dafür, daß Patricks Programm dareinpaßt. Der Klassenassistent führt dieses Programm aus. Patrick ist wirklich ein Mitschüler geworden. Ich erinnere mich noch an den Tag, als er seine ersten Schritte machte. Die ganze Klasse war Zeuge davon und die Kinder riefen spontan: Patrick, jetzt hast du es gepackt. Das war für ihn ein gewaltiger Aufwind. Ein ehrliches Kompliment von Mitschülern wirkt deutlich effektiver als ein pädagogisch absichtsvolles Schulterklopfen des Therapeuten oder der Lehrkraft."
Die Zielsetzung, Menschen mit Behinderung, eben auch mit geistiger Behinderung, gleichberechtigt am Arbeitsprozeß zu beteiligen, stellt eine womöglich noch größere Herausforderung dar als die Verwirklichung von gemeinsamen Schulen für alle. Zu sehr ist die Arbeitswelt geprägt von Konkurrenzkampf, von Leistungs- und Profitsteigerungsinteresse ohne Rücksicht auf Leistungsschwächere, von Siegesstreben auf Kosten der Verlierer. Doch da unter diesen Verhältnissen ja nicht nur Menschen mit Behinderung leiden, sondern viele andere Menschen mehr, vermutlich die Mehrheit der Arbeitnehmerschaft, ist anzunehmen, daß es letztlich im Eigeninteresse dieser Mehrheit liegt, sich mit Menschen mit Behinderung zu verbünden, um die Wirtschafts- und Arbeitsverhältnisse zu verändern und die Veränderungsmöglichkeiten in Form der praktischen Zusammenarbeit der Verschiedenen zu konkretisieren.
Die praktische Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichem Arbeitstempo, mit unterschiedlicher Durchhaltekraft, mit unterschiedlichen Fähigkeiten führt notwendigerweise dazu, das gemeinsame Arbeitstempo zu verlangsamen, mehr Spielraum für Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfeleistung einzuräumen, mehr Kommunikation zuzulassen, mehr Handarbeit einzubeziehen, und damit mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen und dementsprechend Entfremdung abzubauen, mehr qualitative Werte zu schaffen und mehr Selbstwert zu erfahren, mehr dem qualitativen Fortschritt der Gesellschaftsentwicklung als dem quantitativen Wirtschaftswachstum zu dienen.
Die übliche Aussonderung von Menschen mit Behinderung aus der Arbeitswelt wird mit ihren angeblich besonderen Leistungsmängeln und Anpassungsdefiziten begründet. Doch diese Aussonderung ist nur ein Beispiel für die Aussonderung und Unterdrückung weiterer Menschen. Hinter der Aussonderung von Menschen mit Behinderung steht die gleiche Gesetzmäßigkeit wie bei der Benachteiligung der Frauen, der Aussonderung der Arbeitslosen, der Unterdrückung der Sozialempfänger, der Isolierung alter Menschen. Es ist die Gesetzmäßigkeit, daß die Verarmung der einen der Bereicherung der anderen dient, daß die Benachteiligung der einen die Privilegien der anderen vergrößert, und daß diejenigen,- die die Macht dazu haben, sich das Recht nehmen, einseitig zu ihrer Profitmaximierung und Machterweiterung zu handeln.
Die Aussonderung von Menschen als unbrauchbar ist Ausdruck der Herrschaft der Wirtschaftsmachthaber auch über die Brauchbaren; die Mächtigen sind es, die sowohl die Brauchbarkeit als auch die Unbrauchbarkeit definieren. Die Mächtigen definieren einseitig von ihren Interessen her, was als Leistung zu gelten hat. Und sie vertreten einen Leistungsmaßstab, nach dem das als Leistung honoriert wird, was dem Profit dient, ohne die sozialen und ökologischen Kosten in die Leistungsbewertung einzubeziehen.
Es kommt darauf an, einen besseren Leistungsbegriff zu definieren. Es ist nicht mehr das als Leistung anzuerkennen, was auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten der Rücksichtnahme, der Anteilnahme, der Hilfeleistungen für andere Menschen sowie auf Kosten der Umwelt erkämpft wird.
Als Leistung ist vielmehr das anzuerkennen, was mit anderen Menschen gemeinsam erarbeitet wurde und was allen und der gemeinsamen Zukunft dient. Die soziale Stellung und der Lebensstandard sind aufzubauen auf der partnerschaftlichen Teilhabe und Mitwirkung an der Solidaritätsgemeinschaft gegenseitiger Assistenz und gerechten Teilens. Selbstbewußtsein ist nicht aufzubauen auf der Verachtung oder Geringschätzung anderer, sondern auf Achtung und Wertschätzung durch andere und auf der Zugehörigkeit zur Kulturgemeinschaft mit allen.
Die Erkenntnis der Gleichheit der Verschiedenen befreit zu der Erkenntnis, daß alle Menschen auch zu Leistungen befähigt sind: zu unterschiedlichen, aber als gleich zu achtenden Leistungen. Die Verschiedenen erbringen verschiedene Leistungen, aber allen steht unabhängig von der Art ihrer Leistungen grundlegende Gleichberechtigung zu; die praktische Zusammenarbeit der Verschiedenen in gemeinsamen Betrieben bereichert letztlich alle. Der Einbezug von Menschen mit Behinderung in die praktische Zusammenarbeit der Verschiedenen führt zu einer differenzierten und flexiblen Arbeitsteilung, in der jeder einen besonderen, seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechenden Teil übernehmen kann. Das Miteinander der Verschiedenen bereichert alle mit der Erfahrung, das Arbeitsergebnis als Gemeinschaftsleistung, an der jeder beteiligt war, erreicht zu haben.
Das Interesse an einer Zusammenarbeit führt weiter dazu, die Arbeit wieder mehr mit elementaren, handwerklichen und die verschiedenen Sinne beanspruchenden Tätigkeiten auszugestalten, und mit mehr Spielraum für gegenseitige Beachtung und Rücksichtnahme, für gegenseitige Hilfestellung und Anerkennung, für Gespräch und nichtverbale Kommunikation zu verbinden, und schließlich auch dazu, mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Arbeitsinhalte sowie über die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen zu erschließen.
Bedauerlicherweise leistet die Einrichtung, die vielen Menschen mit Behinderung immerhin eine Arbeitsmöglichkeit eröffnet, die Werkstatt für Behinderte, gerade dieses - die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Verschiedenen - nicht. Auch die Werkstatt für Behinderte überwindet die Aussonderung nicht. Zwar bietet sie mehr als die Arbeitslosigkeit, sie bietet immerhin Beschäftigung. Doch als Sondereinrichtung für Menschen mit Behinderung betreibt sie selber in mehrfacher Hinsicht Aussonderung.
In der Werkstatt für Behinderte arbeiten Menschen mit Behinderung jeweils in Gruppen zusammengefaßt unter Anleitung und Aufsicht von Menschen ohne Behinderung, da haben also Beschäftigte einerseits und Gruppenleiter andererseits einen unterschiedlichen Status, statt partnerschaftlich in gemeinschaftlicher Produktion zusammenzuarbeiten. Die Unterscheidung wird zusätzlich durch massive Ungleichbehandlung in der Bezahlung gefestigt. Dies stellt - erstens - eine strukturell verfaßte interne Aussonderung dar.
Hinzu kommt, daß die Zusammenfassung von Menschen mit Behinderung in den Werkstätten als Sonderbetrieben Isolierung und Stigmatisierung zur Folge hat. Dies stellt - zweitens - Aussonderung aus der umgebenden Arbeitsgesellschaft dar.
Die Kriterien für Aufnahme in die Werkstatt: Fähigkeit zu einem "Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit" und "Gemeinschaftsfähigkeit" schließlich sind nicht nur Aufnahmekriterien, sondern auch Ausschlußkriterien, das heißt sie sind das - herrschenden Normen entsprechende - Instrument, einen letzten Rest von angeblich Unbrauchbaren auszusondern, zumindest mit Aussonderung zu bedrohen. Das ist die dritte Aussonderungswirkung der Werkstatt für Behinderte.
Die Werkstatt für Behinderte hat sicherlich ihre Bedeutung darin (gehabt), die Beschäftigungslosigkeit von Menschen mit Behinderung zu überwinden, doch sie sollte ihre Chance nicht verpassen, über das Erreichte hinauszugehen und selber Innovation zu betreiben, selber das Beispiel eines alternativen Kooperationsbetriebes zu entwickeln.
Es gibt trotz aller Schwierigkeiten echte Alternativen, es gibt immer mehr konkrete Projekte der Zusammenarbeit der Verschiedenen, es gibt viele Möglichkeiten der Mitarbeit von Menschen mit geistiger Behinderung, mit geringerer Arbeitsleistung. in Restaurants und Hotels, in Büros und Supermärkten, in Handwerksbetrieben, in der Landwirtschaft und im Gartenbau, im Müllrecycling und in Selbstversorgungsbetrieben, in Hauswirtschaft und Pflegehilfe, in Kunst- und Kulturwerkstätten, usw.
Das ist doch konkret vorstellbar: Da räumen zwei Menschen zusammen die Restaurant-Tische ab, der eine schiebt den Geschirrwagen und stapelt Teller und Tassen aufs Tablett, der andere trägt die vollen Tabletts zum Wagen und wischt die Tische ab. Da machen zwei zusammen die Wäsche, der eine räumt das Gewaschene aus der Maschine und hängt es zum Trocknen auf, der andere sortiert für den nächsten Waschgang und stellt das Programm ein. Da fahren zwei zusammen Essen auf Rädern aus und verbinden das mit dem Abholen von Altflaschen, von Altpapier, von Altmetallen usw., der eine fährt das Auto, der andere ist Beifahrer, der eine begleitet den Weg, der andere übergibt das Essen und nimmt die Altwaren entgegen, trägt sie und wirft sie (mit Vergnügen) in die Container. Da sitzen zwei an einem Webstuhl, der eine langsam und der andere schnell, der eine schießt das Weberschiffchen durch, der andere nimmt es in Empfang und reicht es wieder an, und beide haben bei der Arbeit Zeit, sich an ihrem gemeinsamen Werk zu freuen. Da arbeiten zwei oder mehr an der Herstellung von Holzregalen, führen zusammen die Säge, eine Hand gibt Kraft und die andere Hand steuert die Richtung; einer schmirgelt die Flächen glatt und die Kanten rund, ein anderer hält fest und beide fühlen mit den Fingerspitzen, wie glatt das Holz schon ist. Da arbeiten zwei zusammen an einem Gemeinschaftskunstwerk, z.B. an einem großen Wandbild, der eine organisiert alles erforderliche Material und Handwerkszeug und assistiert praktisch bei der Ausführung, der andere bringt seine Ideen in Entwürfen zum Ausdruck, beide setzen diese Ideen in einem gemeinschaftlichen Prozeß um.
Zwei Praxisbeispiele: Eine junge Frau fand mit ihrer besonders auffallenden, unglaublich präzisen und fast zwanghaften Manier, Papier zu zerschnippeln, tatsächlich eine Anstellung in der Papierverwertungsabteilung der Kommune. Sie darf auch die Papierzerreißmaschine benutzen und sie kann damit auch umgehen, aber oft zieht sie das ehrliche Handwerk vor. Ich hatte bei der Gemeinde angefragt, ob sie jemand gebrauchen könnten, der sehr gut darin ist, Papier zu zerschnippeln, erzählt Barbara. Und so jemand hatten sie nötig. Das paßte gerade gut zusammen. Hätte ich gefragt, ob sie einen Platz für eine nichtsprechende, geistig behindere Frau mit Verhaltensschwierigkeiten hätten, dann hätten sie nicht von ferne daran gedacht, sie ins Haus zu holen. Nach: Barbara Brent[10]
Handbremsen für Fahrräder in einer Behindertenwerkstatt montieren lassen? Nein, sagte der Werkstattleiter, viel zu schwierig. Das können meine Leute hier nicht! - Ich meine, es könnte vielleicht aber doch gehen! meinte der andere und suchte nicht die besten, nein, die zwölf "allerschlechtesten" Werkstattarbeiter aus. Dann ließ er eine Anzeige abdrucken, mit der er Leute suchte, die gegen Bezahlung bereit wären, ein paar Tage lang, in der Werkstatt für Behinderte Handbremsen zusammenzusetzen. Es kam eine große Gruppe Menschen zusammen. Er verteilte die zwölf Menschen mit einer Behinderung unter die hundert Freiwilligen und ließ sie alle zuschauen, wie die anderen die Handbremsen montierten. Anschließend konnten sie dann selber zupacken. An einem einzigen Nachmittag lernten alle zwölf "schwächsten" Arbeiter der Werkstatt, die Bremsen zusammenzusetzen. - Nach. Erwin Wieringa[11]
In den USA werden in den letzten Jahren die Alternativen zur Werkstatt für Behinderte, die Zusammenarbeitsmöglichkeiten von Menschen mit und ohne Behinderung, die vielfältigen Formen von supported employment mit großem Nachdruck und mit viel Erfolg ausgebaut.[12]
"Die Hilfeleistungsorganisationen investieren viel Energien, echte Berufsmöglichkeiten für Menschen mit einer geistigen Behinderung zu finden. Und sie nehmen dabei ganz stark die Gesellschaft in Anspruch: Laßt die Behinderten nicht länger links liegen, laßt sie zwischen euch leben und arbeiten. Das ist die Botschaft. Die Botschaft kommt offensichtlich an, denn es gibt kaum einen Betrieb, der nicht auf die eine oder andere Weise die Möglichkeit gesehen hat, eine Anstellung für einen geistig behinderten Arbeitnehmer zu kreieren. Ich fahre zusammen mit einem Mitarbeiter durch verschiedene Städte und bekomme immerzu Hinweise: In diesem Geschäft arbeitet jemand von uns, und dort und dort und dort. Dieses Büro wird durch eine Gruppe von unseren Arbeitnehmern geputzt, in diesem Restaurant arbeiten zwei von unseren Menschen, in dem Hotel machen zwei Arbeitnehmer von uns die Wäsche. Wenn ich mit einer Gruppe von Mitarbeitern irgendwo essen gehe, dann tun wir das ausschließlich in Restaurants, die dazu bereit sind, behinderte Mitarbeiter anzustellen.
Ich sah in Colorado auch Werkstätten für Behinderte und Tagesstätten. Dort wird deutlich weniger Geld und Energie investiert als in die begleitete Arbeit. Das sind auslaufende Sachen. Wir wollen davon weg', sagen Mitarbeiter. Wir sehen mit unseren eigenen Augen, daß Menschen hier nicht gedeihen, daß sie isoliert und deprimiert sind. Daß sie niemals weiterkommen über das hinaus, was sie schon können und niemals anderen Menschen begegnen als einander. Da geht nichts Stimulierendes von aus.'
Die Menschen, denen ich in den Geschäften, Büros, Hotels, Restaurants und anderen Betrieben, wo sie arbeiten, begegne, machen einen viel selbstbewußteren Eindruck als die Menschen in der Werkstatt für Behinderte oder in der Tagesstätte. Sie sind stolz auf ihre Arbeit, auf ihren Beruf. Sie haben - zu Recht - das Gefühl, daß sie ein wichtiges Glied in einem großen Zusammenhang sind. Wenn ein Mitarbeiter in einem Supermarkt die Flaschen nicht zur rechten Zeit in den Cola-Automaten nachfüllt, leidet der Betrieb Schaden und Menschen können ihren Durst nicht löschen. George läßt mich die Automaten sehen seine ‚Pop-Maschinen.' Sie stellen nur einen Teil seiner Arbeit dar, aber einen sehr wichtigen Teil. Wenn er in seiner Freizeit an dem Geschäft vorbeikommt, weiß er, daß Menschen Cola trinken können, weil er seine Arbeit gut getan hat.
Die Arbeitsorganisation in Baulder (Colorado), ein Teil der Hilfeleistungsorganisation, ist seit ein paar Jahren in diesem neuen Stil tätig. 1995 müssen alle Arbeitnehmer eine Anstellung auf dem freien Arbeitsmarkt haben. 1985 arbeiteten 25 Menschen mit Begleitung in freien Betrieben, heute sind es über 100, demnach sind wir bei der Hälfte', sagt der Direktor der Abteilung Arbeitsorganisation.
‚Wir versuchen, soviel wie möglich natürliche Brunnen anzubohren. Wir verhelfen jemandem zu einer Anstellung, und versuchen, innerhalb des Betriebes jemanden zu finden, der den neuen Kollegen weiter begleitet.' Ein Beispiel sehe ich in dem Eissalon im Zentrum von Baulder. Seit einem halben Jahr arbeitet Cathy dort. Eine junge, schüchterne Frau, die niemals Erfolg damit hatte, zählen zu lernen. Das junge Ehepaar, das den Eissalon betreibt, begleitet Cathy seit kurzem selbst, nachdem sie eine Zeitlang von einem professionellen Dienstleistenden vor Ort begleitet wurde. Zu jedermanns Freude erweist es sich, daß Cathy, die die Arbeit in dem Eissalon sehr schön findet, sehr wohl Geld zählen kann, wenn es nur auf eine praktische Weise geschieht. Hier hat Zählen Sinn, denn sie muß von einem Dollar drei Viertel zurückbezahlen. Das begreift sie sehr gut. Das begreift sie besser als 100 - 25 = ?. Taylor: Unser Ausgangspunkt ist verändert. Früher guckten wir danach, was jemand kann, und danach suchten wir dann eine Anstellung für ihn. Heute gucken wir danach, woran jemand Spaß hat und dafür suchen wir eine Anstellung. Das hat eine viel bessere Wirkung.
Wir lehren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie sie Menschen auf eine effektive Weise zu Dingen anleiten können. Wir helfen Anpassungen zu machen, so daß jemand, der bestimmte Dinge nicht kann, doch diese Arbeit tun kann. So haben wir für einen Mann, der keine Zahlen, aber doch Buchstaben lesen kann, ein ganzes Archiv verändert, vom Zahlensystem auf ein Buchstabensystem umgestellt. Das erwies sich als sehr erfolgreich. Wir machen übersichtliche Reihen von Fotos für Menschen, die nicht lesen können, so daß sie eben in ihrem Fach nachgucken können, was jetzt wieder auf ihrem Programm steht.[13]
Arbeit besteht jedoch nicht nur im Vollzug von Handgriffen, nicht nur in Bearbeitung von Material, nicht nur in der Herstellung von Sachen, von Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen, Verkaufsartikeln usw. Daneben ist auch als Arbeit anzuerkennen, was ein Mensch mit Behinderung, gerade auch ein Mensch mit sehr schwerer Behinderung, als komplementäre Leistung beim Empfang von Hilfeleistung selber einbringt; beide beim Hilfeleistungsprozeß Beteiligten bringen Kraft und Energie, Lebens- und Entwicklungswillen ein, beide leisten Arbeit, Zusammenarbeit, mit der sie zusammen etwas Neues - Hoffnung, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Freude u.a. - schaffen, was wiederum stärkend auch auf beide zurückwirkt.
Und auch das ist als Arbeit anzuerkennen: Was ein Mensch, gerade auch ein Mensch mit sehr schwerer Behinderung, an Gestaltgebung von geistigen Werten einbringt: von Lebenswillen und Lebensfreude, von Nichtgewalt und Liebe, von Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Gestaltgeben meint hier: Einbringen der persönlichen Verkörperung geistiger Werte in die Kommunikation, in das Zusammenleben und in das Zusammenarbeiten mit anderen.
Jeder Mensch, auch der Mensch mit besonders schwerer Behinderung, auch mit schwerer geistiger Behinderung, ist ein Subjekt, hat Selbstachtung zu vertreten und ist gleicher Achtung aller anderen würdig. Auch derjenige, der mit seinen Händen keine Sache bearbeiten kann, der mit seiner Zunge kein Gedicht diktieren kann, der die für ihn erforderlichen Pflegehilfen durch eigene Anstrengungen nicht reduzieren kann, auch der hat die Fähigkeit, sich als Subjekt mit Selbstachtung und Achtungsanspruch einzubringen und ist als solcher einzubeziehen, indem er die ihm mögliche Arbeit einbringt, indem das, was er einzubringen hat, als Arbeit anerkannt wird.
Als Mensch mit sehr schwerer Behinderung verkörpert er
-
mit seiner einfachen Anwesenheit zugleich auch Lebenswille und Lebensfreude,
-
mit seiner relativen Ohnmacht anderen gegenüber zugleich auch Gewaltlosigkeit,
-
mit seiner Schwäche, sich nicht selber helfen zu können, zugleich auch Ehrlichkeit,
-
mit seiner Bereitschaft, Hilfe anderer zu akzeptieren, zugleich auch Achtung und Vertrauen diesen anderen gegenüber.
Die Arbeitsleistung besteht dabei in dem Einbringen dieses persönlichen Beitrages in die Begegnung und in das Zusammenarbeiten und in das Zusammenleben mit anderen.
Weil dieses beides - die Hilfeempfängerleistung und die Kulturarbeit des Gestaltgebens von geistigen Werten - auch als Arbeit anzuerkennen ist, sollte es auch in die Praxisfelder der Arbeit im engeren Sinn - in Betriebe, Büros, Märkte, Werkstätten usw. - eingebracht werden. Das würde die Kommunikationsmöglichkeiten, die mit Arbeit verbunden sind, auch für Menschen erschließen, die aus dieser Arbeitswelt bisher weitgehend ausgeschlossen sind, und die Arbeitsbetriebe ihrerseits integrativer und kommunikativer machen. Dabei sollten Menschen mit Behinderung jeweils in die Art von Arbeitsfeldern - wirtschaftliche Produktion, Dienstleistung, Kultur usw. - einbezogen werden, zu der sie mit ihrer jeweiligen Leistungsmöglichkeit etwas beitragen können, auch wenn dieser Beitrag -äußerlich betrachtet - sehr gering sein sollte.
Die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Menschen in gegenseitiger Ergänzung möchte ich mit dem Zusammenwirken beim Fahren auf einem Tandem vergleichen. Solche Tandemarbeitsformen können unterschiedlich ausgestaltet sein:
-
Der nichtbehinderte Tandempartner kann ein regulärer Mitarbeiter des Betriebes sein, der von einem Teil seines Arbeitssolls freigestellt ist, um einen Kollegen mit Behinderung zu unterstützen, so daß sie beide zusammen auf hundert Prozent und mehr des Arbeitssolls der einen Stelle kommen.
-
Der nichtbehinderte Tandempartner kann ein persönlicher Alltags- und Arbeitsassistent des Menschen mit Behinderung sein, der mit ihm zusammen die Garantie für eine bestimmte Arbeitsleistung übernimmt, die als solche vom Betrieb nach allgemeingültigen Kriterien bezahlt wird.
-
Der nichtbehinderte Tandempartner kann der Trainer und Berater (job coach) sein, der die Arbeitsleistung des Menschen mit Behinderung und die Zusammenarbeit zwischen ihm und den Kollegen so entwickeln hilft, daß er seine eigene Beteiligung immer mehr reduzieren kann.
Diesen unterschiedlichen Tandem- bzw. Assistenzformen entsprechend gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten der Finanzierung:
-
Dauerhafte Subvention des Betriebes zur Bezahlung der betriebseigenen teilzeitförmigen Assistenztätigkeit eines oder mehrerer Mitarbeiter und damit zum Ausgleich von Konkurrenznachteilen;
-
Finanzierung von Arbeitsassistenten, die einzelnen Mitarbeitern mit Behinderung besondere Unterstützungsdienste leisten, wie pflegerische Hilfen, Mobilitätshilfen, Kommunikationshilfen, psychosoziale Hilfen u.a., wenn diese in einem Ausmaß erforderlich sind, das die selbstverständliche gegenseitige Hilfeleistung in der Arbeitsgruppe überfordern würde;
-
Leistung eines gleichen Grundeinkommens für alle, um den Spielraum eines jeden für Rücksichtnahme, Zuwendung und Hilfeleistung zu vergrößern.
Die Veränderung des Leistungsmaßstabes und des Arbeitsbegriffes, die Befreiung zu mehr Selbstbestimmung im Hinblick auf Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen, die Entdeckung des Wertes von Kooperation, die Erfahrung der gegenseitigen Bereicherung durch partnerschaftliches Zusammenwirken der Verschiedenen an gemeinsamen Projekten und die Verbindung all dieser Entwicklungsfaktoren mit der erforderlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen: All dies zusammen könnte es gelingen lassen, daß die Zusammenarbeit der Verschiedenen in gemeinsamen Betrieben, ohne Ausschluß eines einzigen Menschen auf Grund der Schwere seiner Behinderung, einerseits zur Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit für jeden und andererseits zur Humanisierung der Arbeitswelt für alle führt.
Denn hier wird etwas davon deutlich, was auch von anderer Seite und aus anderen Gründen, nämlich zur Überwindung der allgemeinen Arbeitslosigkeit von immer mehr Menschen eingefordert wird: die Veränderung und Erweiterung unseres Begriffes von Arbeit. Bei Begrenzung des Arbeitsbegriffs auf erwerbswirtschaftliche, wirtschaftlich produktive Arbeit wird es - selbst bei neuem Wirtschaftswachstum durch fortschreitende Automatisierung zu einem weiteren Abbau von Produktionsarbeitsplätzen kommen.
Um dem entgegenzuwirken schlägt z.B. Hans Ruh vor, den Arbeitsbegriff so zu erweitern und zu differenzieren, daß die menschliche Tätigkeit eines jeden insgesamt sieben verschiedene Inhalte umfassen kann: Monetarisierte Arbeit, Eigenarbeit, Sozialdienst, Informeller Sozialdienst, Ich-Zeit, Reproduktionszeit, Freizeit.[14] In den oben skizzierten Tandem- und Gruppen-Zusammenarbeitsformen wird diese Erweiterung und Differenzierung des Arbeitsbegriffs zumindest ansatzweise bereits konkretisiert. Hier wird das Leistungssoll eines Arbeitsplatzes auf mehr als einen Mitarbeiter verteilt und der einzelne Mitarbeiter füllt die auf ihn entfallende Leistungssollverringerung auf durch zusätzliche soziale Leistungen: durch die Unterstützung des Kollegen mit Behinderung, der seinerseits wiederum eigene Kraft und Energie in die Zusammenarbeit investiert. Aus der einseitigen Leistungsspezialisierung wird eine zweifache und mehrfache Leistungskombination, aus belastender Arbeitsmonotonie wird spannungsreiche Vielfalt, und die Arbeit verbindet sich mit bereichernder Kommunikation für alle.
Entsprechend der Zusammensetzung der Gesamtarbeit des Einzelnen aus verschiedenen Leistungsarten muß auch die Finanzierung aus verschiedenen Quellen kommen. Der Betrieb hat die erwerbswirtschaftliche Arbeitsleistung mit dem Geld zu bezahlen, das er für diese Leistung auf dem Markt bekommt. Die wirtschaftlich nichtproduktiven Leistungen, die sozialen Leistungen des einzelnen Mitarbeiters mit und ohne Behinderung müssen aus Steuerleistungen von der Gesamtgesellschaft solidarisch aufgebracht werden. Das bedeutet sowohl eine Umwidmung bisheriger Finanzleistungen, vor allem der Leistungen für die Werkstatt für Behinderte, in die Unterstützung integrativer Arbeit; das erfordert zugleich aber auch, ein gesamtgesellschaftlich gerechteres Steuererhebungs- und Steuerverteilungssystem durchzusetzen.
Der Ausbau integrativer Arbeit wird in erster Linie wohl keine Kostenerhöhung, sondern eine Verschiebung erfordern, in zweiter Linie dann aber auch Mehrkosten verursachen. Doch auch diese Mehrkosten werden mehr als ausgeglichen werden:
-
durch zusätzliche Arbeitsmotivation, durch die Verbesserung des Arbeitsklimas in integrativen Betrieben und
-
durch deutliche Vermehrung von Arbeitsplätzen: bei Verteilung des Arbeitsolls einer Stelle auf mehrere, bei Anreicherung des Aufgabenprofils einzelner Stellen mit zusätzlichen sozialen und kulturellen Aufgaben.
Merkmale des Unterschieds
|
Arbeiten in der Werkstatt für Behinderte |
Arbeiten in integrativer Form (supported employrnent) |
|
Trennung in verschiedene Rollen: Menschen mit Behinderung als Klienten - Nichtbehinderte als Anleiter und Aufsichtspersonen - Verlust an Selbstwertgefühl |
Zusammenarbeit als Kollegen in gegenseitiger Ergänzung am gleichen Werkstück - Gewinn an Selbstwertgefühl des Menschen mit Behinderung |
|
Monotonie durch gleichbleibende Arbeitsaufträge und durch relative Homogenität der Arbeitsgruppen |
Abwechslung, Motivationsverstärkung, Förderung der Arbeitsfähigkeiten durch Lernen am Beispiel der Leistungsstärkeren |
|
Aussonderung aus den vielfältigen Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten der Arbeitsfelder von Nichtbehinderten - Verlust an sozialen Fähigkeiten |
Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten mit einer Vielfalt von Kollegen und Kunden, Auftraggebern, Publikum - Gewinn an Anerkennung; Förderung der sozialen Fähigkeiten |
|
Abhängigkeit von fremdbestimmter Hilfeleistungsstruktur |
Differenziertheit und Flexibilität des Hilfeleistungsangebotes, Wahlmöglichkeiten |
|
Festschreibung von Defizitwahrnehmungen, tendenzielle Unterforderung, geringe Erwartungen |
Anforderungen, Herausforderungen, Entwicklungserwartungen |
|
Taschengeldbezahlung |
Tariflohn(anteile) |
|
negative Rückwirkung auf die Betriebe ohne Kollegen mit Behinderung: größerer Konkurrenzdruck, mehr Auslese usw. |
Verbesserung des Arbeitsklimas in integrativen Betrieben, Erweiterung der Stellenpläne, Anreicherung der Aufgabenpläne um Assistenz u.a., mehr Kooperation |
Es geschieht häufig, daß es mit gönnerhaftem Schmunzeln beantwortet, mit lächelndem Nichternstnehmen zurückgewiesen wird, wenn ein Mensch mit geistiger Behinderung im Hinblick auf sein zukünftiges Wohnen äußert: Zu den Behinderten will ich nicht! - ähnlich wie es von manch älteren Menschen zu hören ist: Zu den Alten will ich nicht! Statt mit Lächeln übergangen zu werden, müßte gerade diese Äußerung ernstgenommen werden: Recht hat sie, recht hat er - sich dagegen zu wehren, aufgrund eines Merkmals in eine klischeedefinierte Gruppe eingeordnet und in eine für diese Gruppe vorgesehene Einheitseinrichtung vereinnahmt zu werden. Recht hat sie, recht hat er - für sich eine individuelle Lösung einzufordern, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Es geschieht ebenso, wenn Eltern sich schwertun, ihre Tochter, ihren Sohn mit Behinderung für einen Wohnheimplatz anzumelden: ihnen wird häufig allzu schnell eine psychologisch begründete Ablösungsproblematik vorgehalten und ein Schuldbewußtsein eingeredet. Doch recht haben sie, ermutigt werden sollten sie darin, sich wirklich nicht zu schnell auf die üblichen Einrichtungsangebote einzulassen, sondern sich das "zweite Zuhause" für ihre Tochter, ihren Sohn nach Maßgabe des ersten zu wünschen und ihre persönlichen Wünsche bzw. die Wünsche ihrer Tochter, ihres Sohnes als Rechtsansprüche auf Gleichstellung und Selbstbestimmung zu vertreten.
Menschen, die sich in vorhandene Wohnheime nicht einfügen können, die lieber obdachlos werden als sich anzupassen, die eher hilflos bleiben und ohne die benötigte Hilfe verkommen als die Hilfe im vorgegebenen Rahmen von Heimen zu akzeptieren, wird dafür ebenfalls die Schuld gegeben. Sie werden als "asozial" diffamiert; ihnen wird der Vorwurf gemacht, sie wollten es ja nicht besser. Man läßt sie "draußen vor der Tür" verelenden, im Trinken verkommen, am Dreck erkranken, erfrieren. Doch nach dem, was sie sich wirklich als Besseres vorstellen könnten, nach ihren persönlichen Wünschen und Selbstbestimmungsinteressen, wird ernsthaft kaum gefragt. Die bessere Alternative persönliche Assistenzdienste in individueller Wohnung - wird nicht angeboten.
Wenn es stimmt, daß es normal ist, verschieden zu sein, wenn es stimmt, daß alle mit ihrer Unterschiedlichkeit als Menschen gleich zu achten sind, dann ist es auch normal, daß die Verschiedenheit unser Menschsein nicht einschränkt, auch wenn wir in einem unterschiedlichen Ausmaß auf Assistenz oder Hilfeleistung angewiesen sind. Wenn wir das wirklich ernstnehmen, dann sind auch keine Abstufungen an Normalität und Dazugehörigkeit zu machen, wenn jemand mehr Schwierigkeiten hat und mehr Assistenzdienste benötigt als andere. Dann kann es auch nicht mehr akzeptiert werden, Menschen nach Maßgabe ihres Assistenzbedarfes unterschiedlichen Lebens- und Wohnformen zuzuweisen, sie in fremdbestimmte Lebens- und Wohnformen einzuweisen und einzupassen, sie in ihren Selbstbestimmungsmöglichkeiten abzustufen, einzuschränken, zu unterdrücken, zu entrechten. Der Unterschied zwischen selbstbestimmtem und fremdbestimmtem Wohnen ist von grundlegender, für die Anerkennung des Menschseins entscheidender Bedeutung.
Für jeden Menschen mit Behinderung, der aus seinem Elternhaus herauswächst bzw. kein Elternhaus (mehr) hat, muß eine individuelle Wohnung in seinem Gemeinwesen gefunden und müssen seinem individuellen Bedarf entsprechende persönliche Assistenzdienste angeboten werden. Jeder Mensch muß im normalen Gemeinwesen in einer eigenen Wohnung - alleine oder, wenn er selber dies möchte, mit einem oder mehreren anderen Menschen in Wohngemeinschaft zusammen wohnen und -leben können, auch wenn er mehr Assistenzdienste als andere benötigt; jeder Mensch muß das, was er an alltagspraktischen Assistenzdiensten benötigt, in seiner Wohnung und in seinem Gemeinwesen erhalten und hier auch Kontakte pflegen und Freundschaften entwickeln können. Es muß zum Normalfall werden, daß jeder Mensch, mit welcher Behinderung auch immer, als Nachbar und Mitbürger im Zusammenleben aller dazugehört und geachtet wird.
In Schweden, in Dänemark, in den Niederlanden, in England, in den USA und anderswo gibt es bereits seit Jahren erfolgreiche Entwicklungen in dieser Richtung.
Die praktischen Konsequenzen müßten auch bei uns sein:
-
einerseits ein Ausbau- und Belegungsstop für Anstalten, (Wohn-)Heime, Wohnstätten-Stufensysteme
-
andererseits Einsatz personeller Kräfte und finanzieller Mittel für den Aufbau individuellen assistenzgestützten Wohnens.
Und dieser Aufbau sollte in der Form eines korrespondierenden Systems geschehen:
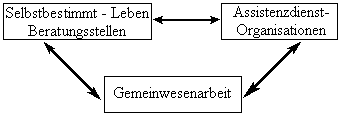
Doch bei uns überwiegt nach wie vor das - von der Wirklichkeit der Sondereinrichtungen geprägte - Wahrnehmungsmuster, Menschen mit Behinderung als Sondermenschen zu sehen und zu behandeln. Es überwiegt nach wie vor die Praxis, Menschen mit Behinderung, dann wenn das Elternhaus nicht mehr der Lebensraum sein kann, in Behindertenheimen unterzubringen. Zur Rechtfertigung dieses Unterbringens wird der besondere Förder- und Schutzbedarf von Menschen mit geistiger Behinderung in den Vordergrund gestellt und so getan, als ob Heime die einzige oder zumindest die beste Möglichkeit wären, diesem Förder- und Schutzbedarf gerecht zu werden.
Doch in Wirklichkeit sind die traditionellen Heime für Menschen mit Behinderung - egal ob mit 1000 oder 300 oder 80 oder 20 "Insassen" oder "Plätzen" - nichts anderes als
-
Zwangsmaßnahmen,
-
Aussonderungsmaßnahmen,
-
Sparmaßnahmen.
Traditionelle Heime sind Zwangsmaßnahmen, weil sie Menschen zum Objekt der Anwendung von Heimrichtlinien machen, statt vom individuellen Selbstbestimmungswillen eines jeden einzelnen Menschen auszugehen. Sie erzwingen Anpassung und Einpassung in die bürokratisch vorgeplante Ausgestaltung von Raumprogrammen, Platzzahl, Standort, Personalausstattung und Arbeitsauftrag für die Heimmitarbeiter/innen.
Traditionelle Heime sind Aussonderungsmaßnahmen, weil sie als Einrichtung für Behinderte immer eine Sondereinrichtung sind und ihre Bewohner damit zu Sondermenschen machen. Dieser Sonderstatus führt dazu, daß die Heimbewohner nicht selbstverständlich und gleichberechtigt als Kommunikationspartner angesprochen werden, nicht als Nachbarn, wie alle anderen auch, begrüßt werden, nicht als Gemeindeglieder wahrgenommen werden, nicht in die Ausgestaltung der Stadtteilkultur einbezogen werden.
Traditionelle Heime sind Sparmaßnahmen, weil sie mit den Festlegungen in entsprechenden Richtlinien und Durchführungsverordnungen das Raumprogramm in einer Art und Weise beschränken - siehe: Anteil von Doppelzimmern, Großgruppen-Aufenthaltsräume, abgetrennte Dienstzimmer u.a. -, wie es sich kaum ein Mensch sonst gefallen ließe. Und Sparmaßnahmen sind sie in der Regel durch die Anwendung von standardisierten Personalschlüsseln und durch schlechte Mitarbeiterbezahlung außerdem. Folgen sind: Defizite in der persönlichen Kommunikation mit einzelnen, Defizite in der Pflege von Außenkontakten (zu wenig Zeit für Bringen und Abholen zu/von Freunden, Gruppen, Kursen, Veranstaltungen außer Haus), Engpässe bei Krankheiten, Schwangerschaften u.a., Fluktuation.
Die Alternativen, die mehr Gleichstellung und Selbstbestimmung zu verwirklichen versuchen, sind nicht nur denkbar, sondern ihre Realisierbarkeit ist mittlerweile vielfach bewiesen. Es ist dringend geboten, die erschwerenden Bedingungen für die Verwirklichung der Alternativen abzubauen; es ist dringend erforderlich, den Ausbau der individuellen Wohnmöglichkeiten für Einzelne und in Wohngemeinschaften mit den jeweils benötigten persönlichen Assistenzdiensten vorrangig zu fördern; und so weit zu fördern, daß sie auch für Menschen mit sogenannter schwerst-mehrfacher Behinderung sowie auch für behinderte Menschen mit besonderer Entwurzelungsproblematik die so dringend benötigte Alternative bieten können.
Die Ausgestaltung dieser Alternativen ist im einzelnen an folgenden Konsequenzen aus dem Gleichheitsgrundsatz zu orientieren:
-
Es ist das Subjektsein, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden, unabhängig vom Ausmaß seines Hilfebedarfes, zu respektieren.
-
Es ist die Dazugehörigkeit eines jeden zur Gemeinschaft aller, in welcher Gemeinwesenform auch immer (Dorf, Gemeinde, Stadtteil, Stadt), gleichfalls unabhängig vom Ausmaß des individuellen Hilfebedarfs, als selbstverständlich anzunehmen.
-
Es ist die Normalität des Angewiesenseins eines jeden Menschen auf Hilfe sowie der Möglichkeit eines jeden, selber Hilfe zu sein, zu begreifen.
1. Aus der Erkenntnis des Subjektseins ist - erstens - zu folgern daß jeder erwachsene Mensch mit Behinderung die Möglichkeit erhält, selber Mieter seiner Wohnung und Kunde der von ihm benötigten Assistenzdienste zu sein. Wenn ein Mensch aufgrund von weitreichender geistiger Behinderung seinen Selbstbestimmungswillen nur sehr indirekt äußern kann, dann sollte er zumindest noch Untermieter seiner Wohnung und "Unterbezieher" seiner Dienste sein.
Eine achtungsvolle und aufmerksame Assistenzhaltung sollte gewährleisten, daß der Mensch mit Behinderung wirklich Subjekt seiner Lebensgestaltung bleibt.
Demnach ist Integration oder Nichtaussonderung nicht nur eine Frage der Größe bzw. Größenbeschränkung und des Standortes einer Wohnstätte, sondern vielmehr eine Frage der Anerkennung des Menschen mit Behinderung als Mieter oder Kunde und als Partner.
Aus der Anerkenntnis des Subjektseins ist - zweitens - zu folgern, daß jeder erwachsene Mensch mit Behinderung die Möglichkeit erhält, dann aus dem Elternhaus heraus in eine eigene Wohnung bzw. Wohngemeinschaft zu ziehen, wenn es für ihn gut ist. Dafür wäre es besonders hilfreich, wenn die mobilen Assistenzdienste schon vor dem Wechsel in dem Umfang und mit der Intensität ins Elternhaus gebracht würden, wie sie anschließend erforderlich sind; solch Abholen und Mitgehen würde den Wechsel in eine selbstbestimmte Wohnform entscheidend erleichtern.
2. Die Anerkenntnis der Dazugehörigkeit eines jeden zur Gemeinschaft aller bedeutet - erstens - grundsätzlich, daß jeder Mensch nicht nur Subjekt ist, sondern auch Mitmensch: angewiesen auf die Entfaltung von Zwischenmenschlichkeit, von Mitmenschlichkeit in personaler Kommunikation mit anderen. Damit sich die personale Kommunikation als Kommunikation der Verschiedenen tatsächlich entwickeln kann, müssen Wohnungen und Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung einerseits eine genauso individuelle Form und Größe haben wie die Wohnungen aller anderen auch und sie müssen andererseits mit vielfältigen Kontakten in Nachbarschaft und Gemeinde und Stadtteil einbezogen werden. Alle Zusammenballung von Menschen mit jeweils vergleichbarem Hilfebedarf in Form von Wohnheimen oder Heimen ist unbedingt zu vermeiden, weil dies die Entwicklung partnerschaftlicher Kommunikation der Verschiedenen erschweren, ja verhindern würde. Die Erfahrung bestätigt, daß die Entwicklung persönlicher Kommunikation sich dann, wenn Aussonderungsstrukturen überwunden sind, unabhängig von dem Ausmaß der Behinderung des Kommunikationspartners entwickeln kann und daß die (Weiter-)Entwicklung der Kommunikationskultur im Zusammenleben der Verschiedenen zu einem Zugewinn an Lebensinhalten, an Lebenssinn für alle führen kann. Die Dazugehörigkeit von Menschen auch mit größtem Hilfebedarf erfüllt das Miteinander wie mit einem guten Geist, der Haß und Gewalt, Betrug und Bosheit vor die Tore der Stadt verbannt.
Aus der Anerkenntnis der Dazugehörigkeit eines jeden zur Gemeinschaft aller und aus der Erkenntnis, welche Bedeutung die personale Kommunikation für alle hat, ist - zweitens - praktisch zu folgern, daß die Strukturen des Zusammenlebens aller so kommunikationsförderlich wie möglich gestaltet werden und daß die Entwicklung des Nachbarschafts- und Gemeindelebens und der Stadtteilkultur durch Gemeinwesenarbeit auch personell gefördert wird. Es gilt sowohl Wohnhäuser als auch ganze Wohnsiedlungen nicht nur ökologisch, sondern auch sozial auszugestalten. Die Architektur und soziale Struktur von Häusern und Siedlungen sollte die Entwicklung von Geborgenheit und Identifikation, Begegnungen und Kommunikation der Verschiedenen fördern.
Konkrete Beiträge dazu könnten sein:
-
Läden für den alltäglichen Einkaufsbedarf in naher Umgebung, zu Fuß erreichbar;
-
Ausgestaltung von halbprivaten/halböffentlichen Räumen oder Orten, wie die Bank vor der Haustür früher oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel heute;
-
Schaffung kleiner "Dorfplätze" zum Begegnen und Verweilen;
-
Einrichtung von Gemeinschaftshäusern und Kulturzentren, leicht erreichbar, offen zugänglich für jeden;
-
Auslagerung des Autoverkehrs, Wiederbelebung von Straßen und Plätzen als Kommunikationsräume, mit Möglichkeiten zum Zusammensitzen hier und da, zum Spielen auch für Erwachsene, zum Musikmachen und Musikhören usw.;
-
Einbezug von kleinen Arbeitsbetrieben in die Nachbarschaft;
-
Anlaufstelle für mobile Dienste.
Die Gemeinwesenarbeit sollte mit Anregungen und Hilfestellungen für alle möglichen Selbsthilfeprojekte und selbstbestimmten Kulturaktivitäten das Miteinander aller Menschen im Stadtteil kontinuierlich entwickeln helfen.
Folgende Praxisbeispiele, die in besonderer Weise Gemeinschaftsentwicklung sowohl nach innen als auch nach außen verwirklichen, mögen die Konkretisierungsmöglichkeiten des Gesagten verdeutlichen:
-
Familienhaus, Pflegefamilie, Zusammenwohnen von ein, zwei oder drei Erwachsenen mit Behinderung mit einer Familie: Unkostenerstattung für alle Wohn- und Lebenshaltungskosten; Finanzierung von Diensten durch die -mehr oder weniger gleichaltrigen - "Pflegeeltern", bis hin zur festen Anstellung eines Elternteils für die "Pflegegemeinschaft" (als Dienste gelten dabei nicht die persönliche Zuwendung und die Hilfeleistung, die als Elemente des Zusammenlebens selbstverständlich sind, sondern alles, was in besonderer und direkter Weise als Dienst für die Familiengenossen mit Behinderung erbracht wird); zusätzliche persönliche Assistenzdienste durch Dritte zur Vertretung der "Pflegeeltern" und zur Vermittlung und Förderung, von Außenkontakten.
-
Lebensgemeinschaft nach dem Modell der "Arche" (Jean Vanier): Zusammenleben von Erwachsenen mit Behinderung mit nichtbehinderten Assistentinnen und Assistenten in familienähnlichen Größenordnungen und in normalen Wohnhäusern in normalen Wohnsiedlungen; das Mitleben der Assistentinnen und Assistenten - für die Dauer von mindestens einem Jahr - umfaßt die Assistenzarbeit und einen großen Teil des persönlichen Lebens (Wohnen im gleichen Haus, gemeinschaftliche Mahlzeiten auch in der Freizeit, gemeinsame Besinnungsstunden, gemeinschaftliche Ausgestaltung von persönlichen und jahreszeitlichen Festen usw.); Organisation eines Freundeskreises von Kontaktfamilien und einzelnen Freunden für die Menschen mit Behinderung sowie für die Assistenten (Organisation dieses Freundeskreises durch einen hauptberuflichen Gemeinschaftsverantwortlichen; Einbezug der Freunde auch in die Praxis des Zusammenlebens: durch Einladungen in Kontaktfamilien für Abende, Tage, Wochenenden, durch vielerlei praktische Mitarbeit von Freunden in der Wohngemeinschaft).
-
Nachbarschaftssiedlung um einen gemeinsamen Innenhof herum: Wohnungen für Familien und Einzelne, für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen, für Menschen ohne und mit Behinderung - jeweils in einem Anteil, wie er etwa der Verteilung in der Gesamtbevölkerung entspricht und insgesamt auf 100 bis 200 Menschen begrenzt, um einen großen geschützten Innenhof herum.[15]
Auch die verschiedenen Modelle von Wohngemeinschaften für alte Menschen, von generationen-übergreifenden, jüngere und ältere Menschen verbindenden, sozial integrativen Wohngemeinschaften, wie sie z.B. von den Grauen Panthern und vielen anderen Initiativen als Alternative zum Altenheim entwickelt werden, bieten hier wichtige Anregungen.
3. Der Grundsatz der Normalität des Angewiesenseins auf Hilfe, egal in welchem Ausmaß, kann nicht mehr als Grund für Aussonderung und Zusammenfassung von Menschengruppen in Wohnheimen und Heimen zur Rationalisierung der Hilfeleistung geltend gemacht werden. Es ist als Selbstverständlichkeit anzunehmen, daß in ganz normalen Wohnhäusern jeder Stadt auch Menschen mit überdurchschnittlichem Hilfebedarf leben, daß auch sie als Angehörige und Nachbarn, als Passanten und Konsumenten, als Teilnehmer von Veranstaltungen und als Mitbürger dazugehören. Daraus ist - erstens - zu folgern, daß es zu einer guten Gemeinschaft (Familie, Gemeinde, Nachbarschaft) gehört, in Verbindung mit der Kommunikationskultur auch eine Hilfeleistungskultur zu entwickeln, die das an einfachen Hilfeleistungen praktiziert, was als Bestandteil des Miteinanders selbstverständlich sein sollte.
Zur Entwicklung der geforderten Hilfeleistungskultur gehört zweitens -, daß die Gemeinschaft aller die Durchführung der umfangreicheren und dauerhaft erforderlichen Hilfeleistungen an dafür bezahlte Kräfte delegiert, daß sie diese wohl gemeinschaftlich verantwortet und solidarisch finanziert, aber sich frei macht von der Überbeanspruchung sogenannten ehrenamtlichen Engagements. Das persönliche Miteinander in Wohngemeinschaften und Nachbarschaften sollte in ausreichendem Umfang durch die als Dritte von außen hinzukommenden persönlichen Assistenzkräfte unterstützt und mitgetragen werden, um nicht an Aufopferung der einen für die anderen aus einem falschen Verständnis von Mitmenschlichkeit zu zerbrechen. Die Assistenzdienste sollten in jede Wohnsituation, in der sie erforderlich sind, in mobiler Form hineingebracht werden.
Aus der Anerkenntnis der Gleichheit der Verschiedenen ist schließlich auch die Konsequenz zu ziehen, den verschiedenen Menschen, die zusammen in einem Haus eine Wohngemeinschaft der Verschiedenen oder in einer Siedlung eine Nachbarschaft der Verschiedenen entwickeln wollen, das Recht zu gewähren und praktisch zu ermöglichen, schon bei der Planung des Hauses oder der ganzen Siedlung wie auch bei der Planung und Organisation der mobilen Assistenzdienste beteiligt zu sein, die Planung selbstbestimmend und gemeinschaftlich mitzubetreiben, schon im Planungsprozeß persönliche Erfahrungen von der Bedeutung des Miteinanders und der Selbstbestimmung zu machen.
Zusammenfassend ist zu fordern:
Es kommt darauf an, daß Assistenzdienstleistungen so effektiv wie möglich organisiert werden, damit sie allen Menschen, die auf sie in ihrem Alltag angewiesen sind, ein ausreichendes Maß an Sicherheit in ihrer selbstbestimmten Lebensführung gewährleisten können.
In kritischer Wechselbeziehung zur Assistenzdienst-Organisation ist die Arbeit der - unabhängigen - Selbst-Bestimmt-Leben-Beratung gleichfalls möglichst effektiv auszugestalten, um der Entwicklung von fremdbestimmenden Eigengesetzlichkeiten der Assistenz-Organisation, auch bei gewerblichen Anbietern, vorzubeugen.
Und in Verbindung mit den Bemühungen zur Verwirklichung von Selbstbestimmung und persönlicher Assistenzleistung ist die Gemeinwesenarbeit gleichfalls so effektiv wie möglich zu betreiben, damit es nicht dazu kommt, daß Menschen mit Behinderung statt nach Schwere ihrer Behinderung nach Graden ihrer Einsamkeit beschrieben werden können.
Das Miteinander der Verschiedenen braucht ein Zuhause in der Stadt. Menschen mit Behinderung, für die lange Zeit ihr Elternhaus das Zuhause war, brauchen als Erwachsene eine assistenzgestützte Wohnmöglichkeit als zweites Zuhause; und Menschen, die als Erwachsene aufgrund von Krankheit oder Unfall eine Behinderung bekommen haben, brauchen ausreichende Assistenzdienste in ihrer jeweiligen individuellen Wohnform. Ausreichende Wohnmöglichkeiten dieser Art zu schaffen, auch darin hat sich die Menschlichkeit einer Stadt zu erweisen.
Merkmale des Unterschieds
|
Fremdbestimmtes Wohnen in Anstalten, Heimen, Wohnstätten und auch in ambulanten Abhängigkeitsverhältnissen |
Selbstbestimmtes Wohnen mit persönlichen Assistenzdiensten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leben besteht nicht nur in Wohnen und Arbeiten. Die Lebendigkeit des Lebens entwickelt sich in einem Spannungsverhältnis nicht nur zwischen den zwei Polen Elternhaus bzw. eigenes Zuhause einerseits und Schule, Ausbildung, Arbeitsbetrieb andererseits, sondern im Spannungsverhältnis auch zu dem dritten Pol: Kultur und Freizeit, Öffentlichkeit und Verkehr. Die gleichberechtigte Teilnahme an diesem dritten Bereich hat für Menschen mit Behinderung die gleiche Bedeutung wie für Menschen ohne Behinderung. Hier sind neue Erlebnisse, neue Selbsterfahrungen und neue Kontakte zu erschließen. Hier ist die Kultur der Vielfalt und des Miteinanders der Verschiedenen weiterzuentwickeln. In diesem Bereich könnte das Leben noch bunter, klangreicher, vielfältiger und spontaner als in den beiden anderen Bereichen sein. Die gleichberechtigte Dazugehörigkeit aller könnte diesen Bereich insgesamt zu einer Kreativitätswerkstatt der Menschlichkeit machen, die als solche für alle wichtig ist. Das könnte so sein, doch die Wirklichkeit ist grauer und ärmer.
Die Freizeitsituation der meisten Menschen mit geistiger Behinderung ist nach wie vor gekennzeichnet durch Passivität und Einsamkeit oder durch Sonderangebote in Form von Behindertenfreizeitclubs und Behindertenfreizeiten sowie in Form von "tagesstrukturierenden Maßnahmen" der Sondereinrichtungen.
Die Ursachen dieser sozialen Armutssituation liegen einerseits im Mangel an persönlichen Assistenzdiensten (Familienassistenten, Wohnassistenten, Freizeitassistenten) sowie im Sparkonzept der personellen Ausstattung von Wohnheimen und andererseits in den Mangelerscheinungen des Kultur- und Freizeitlebens der Nichtbehinderten:
-
in einem Mangel an aktiv mitzugestaltender Breitenkultur/Stadtteilkultur (= Verkümmerung in der Passivität von bloßem Kulturkonsum und Medienersatzerlebnissen);
-
in einem Mangel an Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, an Nachbarschaft, Gemeinwesen, Gemeinschaft (= Desintegration in Kleinfamilien, Vereinzelung in Single-Haushalten) und
-
in einem Mangel an Sprachverständnis- und Ausdrucksmöglichkeiten (= Ignoranz, ja Diffamierung fremdsprachiger, ungewohnter, nichtverbaler und nichtintellektueller Ausdrucksformen)
Die Isolierung von Menschen mit geistiger Behinderung im Freizeitbereich hat weniger mit einem Mangel an Bereitschaft von Nichtbehinderten zu tun, sondern vielmehr mit dem Mangel an Freizeitaktivitäten und Gemeinschaftsformen überhaupt, die Gelegenheit zum Teilnehmen bieten würden.
Die immer wieder geäußerte Ablehnung von Nichtbehinderten gegenüber Menschen mit Behinderung und deren richterliche Sanktionierung in behindertenfeindlichen Urteilen (Anerkennung der Minderung von Urlaubsqualität durch die Konfrontation mit Menschen mit Behinderung u.a.) sind zu kritisieren. Die Ablehnung ist jedoch auch ein Ausdruck des Mangels an Begegnungs- und Kommunikationserfahrungen mit Menschen mit Behinderung und der allgemeinen Verarmung des Freizeitlebens insgesamt.
Es liegt letztlich im Eigeninteresse aller, eine Kultur aktiven Lebens, kreativ aktiver Lebendigkeit und eine Kultur der Vielfalt menschlichen Miteinanders, des Miteinanders der Verschiedenen zu entwickeln.
Für Menschen mit geistiger Behinderung hat dies besondere Dringlichkeit. Je mehr Individualisierung der alltäglichen Hilfe im Arbeits- und Wohnbereich, je mehr Selbst-bestimmt-Leben mit Hilfe persönlicher Assistenz durchgesetzt werden kann, desto weniger sondereinrichtungs-gebundenes Gemeinschaftsleben, desto weniger sonderangebotsgebundene Aktivitäten gibt es dann noch, desto mehr Bedarf an Stadtteilkultur und Kommunikationsangeboten im Gemeinwesen besteht.
Freizeitangebote zur Verwirklichung von gemeinsamen Interessen und Hobbys und zur Pflege von Geselligkeit sollten nicht mehr als Sonderangebote für Menschen mit Behinderung organisiert werden, sondern sie sollten als Angebote für Mitmachkultur von Jugendverbänden, von Nachbarschafts- oder Bürgerhäusern, von vielerlei möglichen Vereinen in gleicher Weise für alle Menschen angeboten und attraktiv gemacht werden, als Kontrastprogramm, als Alternative zur passiven Konsumentenkultur. Die Entwicklung von Breiten- und Mitmachkultur sollte eine mindestens ebenso starke Förderung erhalten wie die Spitzenkultur, die Förderung des Breitensportes mindestens ebenso wie die des Spitzensportes. Sportler mit Behinderung sollten ganz selbstverständlich in die vielfältigen Möglichkeiten des Breitensports einbezogen sein-, neben speziellen Behinderten-Olympiaden sollten nichtaussondernde Breitensportfeste mindestens gleichberechtigt gefördert werden.
Die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Theater und Konzerten, Festivals und Festen (Stadtteilfeste, Straßenfeste u.a.) sollte zu einer Selbstverständlichkeit werden. Äußere Barrieren sollten abgebaut und innere Ablehnungshaltungen sollten überwunden werden. Im Miteinander des gleichen Erlebens ist die Gleichheit im Menschsein immer wieder neu exemplarisch zu erfahren. Doch Menschen mit Behinderung sollten auch als Beitragende mit ihrem eigenen Kultur- und Kunstschaffen völlig gleichberechtigt dazugehören, in Gruppen Verschiedener mit anderen zusammen Theater spielen, Musik machen, Gemeinschaftskunstwerke schaffen. Und Kunstwerke einzelner sollten nicht als Behindertenkunst, als Dennoch-Kunst beurteilt, sondern eben als Kunstwerke einzelner individueller Persönlichkeiten gewürdigt werden.
Um gleiche Zugangs- und Zugehörigkeitsmöglichkeiten in Läden, in Kaufhäusern, auf Märkten, in Restaurants und Cafés, im Nahverkehr und auf den Straßen zu ermöglichen, ist einerseits nötig, die Architektur und die technische Ausgestaltung so zu verbessern, daß alle Barrieren und alle Gefahrenursachen abgebaut bzw. beseitigt werden. Andererseits müssen alle Menschen, die sich in diesen Bereichen begegnen, eine Umgangskultur miteinander einüben, die ein soziales Klima entwickelt, in dem sich alle wohlfühlen können. Die rollstuhl- und (!) kinderwagengerechte Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs ist mit Nachdruck voranzutreiben; Fahrgastbegleiter könnten für alle als Ansprechpartner für Auskünfte, für Hilfeleistungen und für mehr Sicherheit von Bedeutung sein. Der Ausbau von "sanften Wegenetzen" für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer, Kinder und alte Menschen, ohne Berührung mit dem Autoverkehr, würde die Lebensqualität der Stadt für alle erhöhen. Die Straßen und Plätze wieder zu menschlichen Begegnungs- und Kommunikationsräumen zu machen, wäre ein Gewinn für alle.
All die Möglichkeiten der Integration, des Miteinanders im Freizeitleben der Nachbarschaft, der Gemeinde, des Stadtteils, der Stadt sind nicht nur von wesentlicher Bedeutung, sondern auch tatsächlich sehr chancenreich und erfolgsversprechend. Im Unterschied dazu ist die Zielsetzung bei Ferienfreizeiten, Urlaubs- und Erholungsangeboten für Menschen mit Behinderung mehr zu differenzieren.
Überall da wo es das Angebot von Kinder- und Jugendfreizeiten für Nichtbehinderte gibt, sollte dieses auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung geöffnet werden. Auf Zukunft hin sollte es nur noch integrative Kinder- und Jugendfreizeiten geben, bei denen die Teilnehmer voneinander nicht wissen, auch nicht wissen wollen, wer mit Behinderung angemeldet wurde und wer nicht.
Für Erwachsene mit Behinderung kann und sollte es die Möglichkeit geben, zusammen mit Nichtbehinderten Ferienfreizeiten oder Urlaubsgemeinschaften zu erleben. Für Nichtbehinderte können diese gemeinsamen Ferienfreizeiten oder Urlaubsgemeinschaften in besonderer Weise Übungsfelder oder Bildungsprojekte sein: z.B. als Sommerakademien des Miteinander-Leben-Lernens; das Zusammenleben und gerade auch die vielfältige Praxis von Hilfeleistungen füreinander können eine Kommunikation entwickeln helfen, eine menschlichere Gemeinschaft unter allen Beteiligten erschließen helfen, die eine persönliche Bereicherung darstellen und zu weiterem Miteinander motivieren.
Doch darüber hinaus ist auch an individuelle Urlaubsangebote für Erwachsene mit Behinderung mit Hilfe von persönlichen Assistenzdiensten zu denken. Denn für Erwachsene gibt es - anders als bei Kindern und jugendlichen und anders als bei der Freizeitgestaltung vor Ort - weniger Integrationshinterland, d.h. es gibt wenig Freizeit- oder Urlaubsangebote für Gruppen nichtbehinderter Erwachsener, in die hinein integriert werden könnte. Ferien, Erholungszeiten, Urlaubsangebote für Erwachsene sind ein sehr individuelles, eher privates Unternehmen und als solches mehr dem Wohnen verwandt. So ist es auch für Erwachsene mit Behinderung angemessen, förderlich und gleichberechtigend, eigene individuelle, selbstbestimmte Ferien oder Urlaube mit Hilfe aller, je nach Bedarf erforderlichen Assistenz durchführen zu können. Wenn solch Urlaub mit Assistenz kein Gruppenunternehmen ist, sondern tatsächlich individuellen, ja privaten Charakter hat, dann ist er gleichwohl integrationsförderlich, weil diese Form ja wiederum die Teilnahme-, Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten im Rahmen der für alle vorhandenen Freizeitgestaltungsangebote am Urlaubsort (Strandleben, Naturerlebnisse, Kulturangebote, Ca&, Eisdielen, Gaststätten, Öffentlichkeit usw.) erschließen hilft. Wie im Wohnbereich ist die jeweils erforderliche Assistenz (alltagspraktische Hilfen, pflegerische Hilfen, sozialpädagogische Hilfen) bei dieser Form des individuellen Urlaubs mit Assistenz primär durch bezahlte Helferkräfte zu leisten, deren Arbeit wiederum durch eine Leitungs-, Anleitungs- und Fortbildungskraft organisiert und mitverantwortet werden muß, soweit dies der jeweilige Urlauber mit Behinderung nicht auch selber leisten kann.
Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung im Freizeitbereich sind in großer Vielfalt und Unterschiedlichkeit vorhanden, denkbar, wünschenswert, notwendig. Die folgende - sicher noch unvollständige - Übersicht ordnet sie nach Alter, Ort, Integrations- oder Beteiligungsform; in der Praxis gibt es natürlich Übergänge zwischen den hier getrennt aufgeführten Formen, bzw. unterschiedliche Mischungen oder Kombinationen:
|
im Alltag: |
im Urlaub: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei allen hier aufgeführten Freizeitangeboten gibt es Entwicklungs- und Ausbaubedarf Insbesondere die Form des individuellen Urlaubs für Einzelne, Paare, Kleinstgruppen mit Hilfe persönlicher, mehr oder weniger professioneller, d.h. auch bezahlter Assistenz, die bisher kaum als Angebot vorkommt, sollte für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter von über 25 Jahren zu einem Regelangebot ausgebaut werden; allemal für Erwachsene, die noch im Elternhaus zuhause sind, weil damit die Verselbständigung gefördert und zugleich ein verläßliches Erholungsangebot für die Eltern ermöglicht wird.
Neben der Förderung und der integrativen Ausgestaltung von Kinder und Jugendarbeit sowie Breitenkultur- bzw. Stadtteilkulturarbeit muß es auch einen Ausbau von Gemeinwesenarbeit geben, um die Entwicklung von alltäglichem Nachbarschafts- und Gemeinschaftsleben im Gemeinwesen insgesamt zu fördern, und ein Eröffnen und Gestalten von geschützten Freiräumen, in denen Überraschungserlebnisse, Entdeckungen, spontane Initiativen und Mußestunden möglich sind (z.B. Parkanlagen, Brunnenplätze, Spielgärten, Märkte)!
Um all dies umsetzen und (weiter)entwickeln zu können, sind auch politische Schritte erforderlich:
-
Aufbau und Finanzierung von Selbstbestimmt-Leben-Beratungsstellen mit Ausprägung des Teilbereiches: freizeit-integrationspädagogische Beratung, als ein Teil der Gesamtaufgabe der Beratungsstelle
-
Förderung des Aufbaus von Mobilen Assistenzdiensten zur Unterstützung der Verwirklichung von Selbstbestimmung und Integration auch im Freizeitbereich, Hilfen zur Durchsetzung und praktischen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf alle je nach individuellem Bedarf erforderlichen persönlichen Assistenzdienste
-
Durchsetzen einer humanen Stadtentwicklungspolitik, die Investitionen in Aufgaben der Kinder-, Jugend- und Sozialpolitik mindestens gleichrangig zur Wirtschaftsförderung betreibt; die die Stadtteil- oder Breitenkultur mindestens mit gleichem Einsatz fördert wie die Spitzenkultur; die ein Netz von Stellen für Gemeinwesenarbeit schafft statt einseitig nur sozialarbeiterische Nothilfe für Einzelne zu praktizieren; die in allen Bereichen von Freizeit- und Kulturangeboten sowie des öffentlichen Lebens die Architekturbarrieren abbaut und Defizite an technischen Hilfsmitteln u.a. überwindet und eine Bau- und Verkehrspolitik betreibt, die immer auch die mitmenschliche Kommunikation fördert.
Insgesamt besteht bei der Integrationsförderung für Menschen mit Behinderung im Freizeitbereich ein großer personeller und finanzieller Nachhol- und Ausbaubedarf. Auch in diesem Bereich ist die Achtung der Gleichheit der Verschiedenen in einer Gleichberechtigung zu bewähren, die allen behinderungsbedingten Mehrbedarf als Solidarleistung finanziert.
Dabei gilt hier wie überall grundsätzlich: Das Schaffen der organisatorischen und strukturellen, sozialpolitischen und städtebaulichen Voraussetzungen für ein besseres Miteinander der Verschiedenen liegt im Eigeninteresse aller; eine menschlichere Stadt zu entwickeln, sollte entsprechend als Mehrheitsinteresse auch durchzusetzen sein.
Da immer noch das Funktionärstum der "Wohltäter" vorherrscht, die für Menschen mit Behinderung planen und über Menschen verfügen, und da es immer noch um Machtvorteile und um Vorrechte gegenüber Menschen mit Behinderung geht, ist der Gedanke an Mitsprache, Mitwirkung, Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung so häufig noch fremd und so selten in die Praxis umgesetzt. Doch wenn das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf Dazugehörigkeit sowie das Recht auf Hilfeleistung wirklich als soziale Grundrechte anerkannt werden, dann muß es zu einer Selbstverständlichkeit werden, daß Menschen mit Behinderung Möglichkeiten zur Mitsprache, Mitwirkung, Mitbestimmung eröffnet bekommen in allen Bereichen, die sie direkt betreffen und in den Zusammenhängen, von denen sie indirekt berührt werden.
Auch Menschen mit geistiger Behinderung sollten sowohl Wahlrecht haben als auch wählbar sein. in Gruppen, Gremien, Organen, die Planungen betreiben und Entscheidungen treffen, die die Ausgestaltung der individuellen und sozialen Lebensbedingungen in allen Lebensbereichen betreffen:
-
in der Schülermitverwaltung gemeinsamer Schulen,
-
in der Arbeitnehmervertretung integrativer Betriebe,
-
im Stadtparlament und im Kirchengemeinderat,
-
in Bürgerkommittees zur Planung gemeinschaftlicher Siedlungen,
-
in der Kundenvertretung mobiler Assistenzdienste.
In größeren Zusammenhängen kommt es darauf an, daß Behindertenverbände mehr Kooperation als bisher, mehr Kooperation untereinander sowie mit anderen Benachteiligteninitiativen entwickeln, um die Wirksamkeit ihrer Interessenvertretung und ihrer Mitverantwortung zu vergrößern.
An die Stelle der Entmündigung und der Stellvertretung sollte die Verständigungshilfe durch einen persönlichen Assistenten für all die Menschen treten, die sich selbst nicht direkt äußern oder nicht leicht verständlich machen können. Der persönliche Assistent hat den Menschen mit geistiger Behinderung nicht zu vertreten, sondern in seiner Anwesenheit und in ständiger Wechselbeziehung zu ihm dessen Wünsche und Vorstellungen zu übersetzen.
Das geforderte und eigentlich schon längst überfällige Anti-Diskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgesetz ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung: Es schafft wirkliche Gleichberechtigung auch in dem Sinne, daß es Menschen mit Behinderung nicht zu Objekten der Gleichberechtigung durch Nichtbehinderte macht, sondern sie als Subjekte anerkennt und dazu berechtigt, nicht nur ihre Interessen selber zu formulieren und ihre Gleichberechtigungsforderungen selber zu vertreten, sondern eben auch dazu, ihre - gleichen - Rechte auch einzuklagen, daß es ihnen die Rechtsmittel gibt, dies tatsächlich auch zum Erfolg führen zu können.
[8] Aus: Jutta Schöler: Integration behinderter Kinder in Regelschulen. Beitrag zur Anhörung der Fraktion Die Grünen im Bayerischen Landtag am 28.2.1994, Seite 93, in: "Gemeinsam leben" Zeitschrift für integrative Erziehung. Neuwied, 2(1994).
[9] Aus: Ronny Vink: Inclusion. Jeder gehört dazu. Essen, 1993.
[10] Aus: Klik. 3/1993, Utrecht.
[11] Aus: Klik. 3/1993, Utrecht.
[12] Aus: Ronny Vink: Inclusion. jeder gehört dazu. Essen, 1993.
[13] Aus: Ronny Vink: Inclusion. jeder gehört dazu. Essen, 1993.
[14] Hans Ruh: Strategien zur Überwindung der Arbeitslosigkeit: Modell für die Transformation des menschlichen Tätigkeitshaushaltes. In: Zeitschrift für Evangelische Ethik, 38. Jg., Seiten 134-14 1. Gütersloh, 1994.
[15] Siehe die weitere Beschreibung auf Seite 29; vgl. die vielen alten "Hofje" Beispiele in niederländischen Städten.
Inhaltsverzeichnis
Nicht nur Sondereinrichtungen, sondern auch Sonderdienste tragen dazu bei, Menschen mit Behinderung als Sondermenschen erscheinen zu lassen und auszusondern. Wenn wir Behindertenarbeit, auch offene, ambulante, gemeindliche Behindertenarbeit als eigenständige besondere Aufgabe und Profession betreiben, tragen wir immer wieder dazu bei, Menschen zum Objekt zu machen, Abhängigkeiten aufzubauen, desintegrative Sonderwelten zu schaffen. je mehr es uns gelingt, integrative Strukturen in allen Lebensbereichen zu verwirklichen, je konsequenter wir - in Anerkenntnis der Gleichheit der Verschiedenen das Miteinander-Leben-Lernen praktizieren, desto mehr müssen wir aus der Behindertenarbeit nicht nur Struktur- und Kulturarbeit, sondern auch vielfältige Kooperations- und Unterstützungsarbeit machen: Sonderpädagogen werden Partner der Allgemeinpädagogen im Pädagogenteam integrativer Schulen. Therapeuten werden Anleiter für die Integrationspartner in schwierigen Situationen, helfen Verzerrungen des Miteinanders zu überwinden, Konflikte konstruktiv zu lösen, Mißverständnisse zu klären. Beratungsdienste helfen neue Wege zu erschließen für mehr Verwirklichung von Selbstbestimmung und für die Ausgestaltung von konkreten Formen des Miteinanders in Arbeit, Wohnen, Freizeit. Assistenzdienste, vielfältige dauerhafte Assistenzdienste kommen hinzu, um Selbsthilfe und Miteinander zu unterstützen.
Es wird weiter Ausgebildete und Hauptberufliche mit speziellen Erfahrungsbereichen geben, aber sie verbinden sich nicht mehr zu einem eigenständigen Behindertenarbeitsbereich und bilden keinen besonderen Machtkomplex mehr aus, sondern sie verteilen sich auf Unterstützungsarbeit in den verschiedenen Bereichen allgemeinen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Aus der Behindertenarbeit wird eine sich jeweils zu- und unterordnende Kooperations- und Unterstützungsarbeit.
Im Hinblick auf die Partnerschaft innerhalb von integrativen Strukturen kommen die Kooperations- und Unterstützungsdienste jeweils als Drittes hinzu. So sehr die gegenseitige Unterstützung und praktische Hilfeleistung als Bestandteil des Zusammenlebens anerkannt, beibehalten und gefördert werden muß, so sehr bedürfen sowohl die einzelnen Menschen mit Behinderung (zur Verwirklichung ihrer Selbstbestimmung) als auch die Gemeinschaften von Menschen in den verschiedenen Formen des Zusammenlebens (zum Aufrechterhalten ihrer Kommunikationskraft) der Unterstützung durch Dritte: durch erfahrene Kooperationspartner und durch mobile persönliche Assistenzdienste. Die Finanzierung für die jeweils erforderlichen Kooperations- und Assistenzdienste wie für alle behinderungsbedingten finanziellen Mehrbelastungen muß solidarisch aufgebracht werden! Aber es muß bewußt bleiben, daß nicht alles mit Geld zu bezahlen ist, daß es vielmehr die Grundlage des Miteinanders ist, unbezahlte Kontakte, Bekanntschaften, Freundschaften zu gewinnen und zu pflegen.
Aus Behindertenarbeit, in der die einen die anderen zum Objekt machen, wird eine Zusammenarbeit, in der Menschen mit Behinderung, auch mit schwerster Behinderung, anerkannt werden als Subjekte, Initiativkräfte, Akteure und Arbeitsleistende, die in aller Zusammenarbeit immer auch selber Arbeit leisten, die auch dann, wenn sie Hilfeleistung empfangen, nicht nur passive Empfänger sind, sondern ihre Vorstellungen, ihren Willen, ihre Energie und damit auch Arbeitskraft einbringen. Die nichtbehinderten Kooperationspartner haben die Aufgabe, dazu beizutragen, daß Menschen mit Behinderung diese aktive Rolle wahrnehmen können.
Persönliche Assistenzdienste haben entscheidende Bedeutung für die Verwirklichung von Selbstbestimmung, für die Unterstützung des Zusammenlebens, für die Ermöglichung von Zusammenarbeit. Persönliche Assistenzdienste, die die verschiedenen Lebensbereiche wie die Kettfäden ein buntes Gewebe durchziehen, haben eine Schlüsselfunktion für die Überwindung von Behindertenarbeit.
Beratungsdienste sind als grundlegendes Kooperationsangebot und als korrespondierendes Gegenüber zu Assistenzdiensten - in Unabhängigkeit und mit genügend Kompetenz - notwendig, um individuelle Dienstleistungspläne entwickeln zu helfen und um einem Abhängigwerden von Dienstleistungsanbietern vorbeugen zu helfen.
Persönliche Assistenzdienste für Menschen mit Behinderung sind etwa ab Ende der 70er Jahre an verschiedenen Orten in parallelen Entwicklungen entstanden und haben seitdem große Verbreitung und sozialpolitisches Gewicht gewonnen. Von ihren jeweiligen Praxisansätzen und besonderen Akzenten her firmieren die Dienste unter vielen verschiedenen Namen: Familienentlastungsdienste oder Familienunterstützungsdienste, Mobile Integrationsförderungs-Dienste, Mobile Soziale Hilfsdienste (MSHD) und Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) im Rahmen des Zivildienstes, Dienste des Betreuten Wohnens, Mobile Soziale Dienste, Häusliche Pflegehilfen der Sozialstationen. Welchen Praxisschwerpunkt und weichen Namen sie auch immer haben, im Hinblick auf ihren Inhalt sind die Dienste zu definieren als persönliche Assistenzdienste für Menschen mit Behinderung durch Dritte in verschiedenen Lebensbereichen.
Sie sind ein Teil des großen Bereiches Mobiler Sozialer Dienste.
Das Neue und Bedeutsame an der Entwicklung persönlicher Assistenzdienste ist, daß sie die Hilfeleistung nicht mehr von der Einpassung in fremdbestimmte Heim- oder Einrichtungsstrukturen abhängig machen, sondern den individuellen Bedarf an Hilfen und die persönlichen Interessen erheben und Selbstbestimmung und Dazugehörigkeit eines jeden Menschen, unabhängig vom Ausmaß seines Hilfebedarfs, zum Leitprinzip machen.
Mit der Zielsetzung Selbstbestimmung und Integration zu unterstützen, haben die persönlichen Assistenzdienste eine Schlüsselfunktion in der grundlegenden Veränderung des gesamten Hilfeleistungssystems für Menschen mit Behinderung.
Ihre Funktion besteht darin, die jeweiligen - in der Regel relativ dauerhaft bleibenden - Behinderungen durch praktische Hilfeleistungen auszugleichen, In Verbindung damit können sie auch - müssen dies aber nicht - der Einschränkung oder Überwindung von Behinderung dienen.
Als Ausgleichsleistungen sind die persönlichen Assistenzdienste allein an den Zielen Selbstbestimmung und Integration zu orientieren, d.h. unabhängig vom Erfolg im Bemühen um Einschränkung oder Überwindung der Behinderung zu bemessen.
1. Als solche Ausgleichsleistungen sind die persönlichen Assistenzdienste zu umschreiben als:
-
alltäglich und (relativ) dauerhaft zu leistende Dienste und als praktische und vielfältige Dienste.
Die Inhalte und der Umfang der Dienste sind je nach Art und Schwere der Behinderung:
-
Sinnesbehinderung
-
geistige Behinderung
-
Sprachbehinderung
-
psychische Behinderung
-
Mehrfachbehinderung, u.a.
sowie nach den sozialen Gegebenheiten der Lebenssituation (s. unten) zu konkretisieren.
2. Die persönlichen Assistenzdienste beinhalten folgende Hilfeleistungsarten:
-
Körperpflegehilfen
-
einfache Handreichungen
-
Mobilitätshilfen
-
Kommunikationshilfen
-
Hilfen in psycho-sozialen Problemen
-
Kulturtechnische Hilfen
-
Haushaltshilfen.
In der Praxis sind - je nach individuellem Bedarf - in der Regel verschiedene Dienstleistungsinhalte in vielfältiger Kombination erforderlich.
Im Rahmen des Sozialhilferechts sind die persönlichen Assistenzdienste mit ihren verschiedenen Hilfeleistungsarten und ihrer doppelten Zielsetzung (Selbstbestimmung und Integration) entsprechend - in erster Linie der Eingliederungshilfe zuzuordnen. Wenn das Schwergewicht bei individuell lebensbewahrenden Pflegehilfen liegt, werden - bei Anerkennung von "Schwerstpflegebedürftigkeit" - die Kosten der Assistenzdienste in bestimmten Grenzen als häusliche Pflegehilfen von den Krankenkassen (Gesundheitsreformgesetz), demnächst von der Pflegeversicherung getragen; darüber hinaus ist das Sozialamt zur Leistung eines Pflegegeldes bzw. zur Kostenübernahme für Fremdpflegehilfen heranzuziehen. Letztlich umfassen die Persönlichen Assistenzdienste jedoch mehr als mit dem Wortlaut der Sozialhilfebegriffe ausgedrückt wird. Auch die Begriffe aus den verschiedenen Praxisbereichen erfassen jeweils nur einen Teil des gesamten Spektrums persönlicher Assistenzdienste.
3. Diese Hilfeleistungsarten umfassen eine Vielfalt von Praxisinhalten, wie z.B.:
-
Hilfe bei der Selbstversorgung, beim Essen und Trinken, beim Waschen und Anziehen, beim Toilettengang und bei sonstiger Körperpflege, Hilfe beim Aufstehen und beim Zu-Bett-Gehen, Hilfen zum Zur-Ruhe-Kommen
-
Hilfe bei der Bewegung, zur Bewältigung von Wegen mit Krücken, Rollstuhl, Fahrrad (Tandem), öffentlichen Verkehrsmitteln, PKW
-
Hilfe bei Kontakt- und Kommunikationsentwicklung: Verständigungshilfen, Übersetzungshilfen bei nichtverbalen Ausdrucksmöglichkeiten, Hilfen zur Ermöglichung der Teilnahme an Gruppenaktivitäten, an Kulturveranstaltungen, am öffentlichen Leben
-
Hilfe zur aktiven Freizeitgestaltung, zur Verwirklichung von eigenen Freizeitinteressen
-
Hilfe beim Selbständigkeitstraining, Hilfe zur Verwirklichung von Therapie- und Förderungsmöglichkeiten, Erwachsenenbildung
-
Hilfe in psycho-sozialen Drucksituationen: Beistand, Ermutigung, Begleitung, Vermittlung (in Konflikten, in Resignation, in Überängstlichkeit u.a.), Hilfe zur Überwindung von Verhaltensschwierigkeiten (Aggressivität, Autoaggressivität, Distanzlosigkeit, Unruhe u.a.)
-
Hilfe zum Ausgleich besonderer Defizite in Kulturtechniken: Vorlesen, Schreiben nach Diktat, Hilfe beim Umgang mit Geld, mit Ämtern
-
zusätzliche Hilfe zur Unterstützung der Teilnahme an integrativen/nichtaussondernden Gruppen in Regeleinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Ausbildungsstätten) sowie in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, je nach individuellem Mehrbedarf
-
Hilfe beim Ablösungsprozeß, zur Vorbereitung auf das Wohnen in einem "zweiten Zuhause" (nach dem Elternhaus) sowie zum Erringen größerer Selbständigkeit
-
Hilfe zur Unterstützung des Wohnens erwachsener Menschen mit Behinderung in individueller Wohnung oder in Wohngemeinschaften.
4. Persönliche Assistenzdienste sind als mobile Dienste, d.h. aufsuchende Dienste, in alle Lebensbereichen einzubringen:
-
in Familien
-
in Regelkindergärten und Regelschulen (ergänzend zur notwendigen Verbesserung der Rahmenbedingungen der Einrichtung)
-
in Arbeitsbetriebe
-
in Wohnungen und Wohngemeinschaften, Nachbarschaft und Gemeinwesen
-
in Freizeit, Kultur, öffentliches Leben, Verkehr
-
in Interessenvertretung und Politik.
Auch die sogenannten Familienentlastungsdienste oder Familienunterstützungsdienste sind nicht Dienste für die Familie, sondern individuelle Dienste, persönliche Assistenzdienste für einzelne Menschen mit Behinderung im Lebensraum Familie.
5. Die in diesen Lebensbereichen unmittelbar Beteiligten Mitmenschen -Eltern bzw. Angehörige, MitarbeiterInnen (ErzieherInnen, LehrerInnen) der Regeleinrichtungen und nichtbehinderten Mitglieder der Kindergruppe oder Schulklasse, Arbeitskollegen und Betriebsangehörige, Freizeitpartner, Nachbarn, Gemeindemitglieder - leisten je nach Intensität und Zeitmaß ihrer Beziehung zu dem jeweiligen Menschen mit Behinderung immer schon einen Teil der individuell erforderlichen Assistenzdienste: nicht als ehrenamtliche Verpflichtung, sondern als selbstverständlichen Bestandteil ihres Miteinanders. Neben der Selbsthilfe des Menschen mit Behinderung leisten diese im jeweiligen Lebensbereich persönlich Beteiligten ihre Assistenzdienste sozusagen als Zweite. Damit es nicht zur Entwicklung einer perfekten Versorgungsgesellschaft mit immer mehr Vereinzelung und Vereinsamung kommt, muß das partnerschaftliche Engagement der "Zweiten" auch durch Familienpolitik und Schulpolitik, durch Sozialbildung, durch Gemeinwesenarbeit und durch menschlichere Stadtentwicklung gestärkt und gefördert werden.
6. Assistenzleistung durch diese "Zweiten", also durch Angehörige, Kollegen, Nachbarn usw. ist jedoch nur soweit als Bestandteil des Hilfeleistungssystems zu vertreten,
-
soweit es der Verwirklichung von Selbstbestimmung des Menschen mit Behinderung nicht entgegenwirkt,
-
soweit es für das Gelingen des persönlichen Miteinanders förderlich oder verträglich ist,
-
soweit die individuellen körperlichen und psychischen Kräfte dieser "Zweiten" reichen oder entwickelt bzw. gestärkt werden können, ohne Schaden zu nehmen,
-
soweit es die soziale Situation der Angehörigen, Kollegen, Nachbarn usw. (Familiensituation, Arbeitssituation u.a.) zuläßt.
An diesen jeweils individuell zu bestimmenden Grenzen werden Assistenzdienste durch Dritte notwendig: nicht nur als Ergänzung, sondern als durch Rechtsanspruch gesicherte Grundlage. D.h. Eltern, Wohngemeinschaftsmitglieder, Arbeitskollegen, Nachbarn usw. sind nicht als Garanten der Assistenzleistung zu beanspruchen, sondern lediglich als Partner, die im Rahmen ihrer Kommunikation auch Assistenz leisten oder praktische Assistenz als einen Ausdruck ihrer Kommunikation üben. Kein Mensch mit Behinderung sollte aus einem Mangel an mobilen Helferdiensten/persönlichen Assistenzdiensten in ein Heim oder in eine Sondereinrichtung gezwungen werden, und keiner sollte aus einem Mangel an diesen Diensten in seiner individuellen Lebensform in unterdrückende Abhängigkeit geraten oder vereinsamen und verelenden.
7. Der Bedarf an persönlichen Assistenzdiensten ist z.B. für Kinder, jugendliche, Erwachsene mit Behinderung im Lebensraum Familie wie folgt zu verdeutlichen:
Innerfamiliär werden die Dienste benötigt zur anteiligen oder stellvertretenden Übernahme der familieneigenen Assistenzleistungen für den Angehörigen mit Behinderung.
Als Begründung sollte grundsätzlich anerkannt werden: Überforderung oder Einschränkung der familiären Selbsthilfe- und Assistenzleistungskräfte; Gefahr, daß die Chancen der gegenseitigen Bereicherung sich in Tendenzen gegenseitiger Belastung und Beeinträchtigung zu verkehren beginnen:
-
zum Beispiel, wenn die körperliche Belastung durch die Pflegearbeit, das Heben (vom Bett in den Rollstuhl u.a.), das Rollstuhlschieben, durch die vermehrte Hausarbeit (besondere Diät, Wäsche u.a.) zu groß wird"
-
zum Beispiel, wenn die "nervliche" Belastung durch Kommunikationserschwernisse (Sprachbehinderungen, Hörbehinderungen u.a.), durch Unruhe, Aggressivität, Autoaggressivität, durch Stereotypien, Verschlossenheit, Passivität, Apathie u.a. zu groß wird.
Was den Angehörigen eines Menschen mit Behinderung alleine nicht mehr gut gelingt, kann bei unterstützender Beteiligung durch Dritte wieder zu einem positiven Erlebnis werden. Wo ein Angehöriger gegen besseres Wissen und Wollen zunehmend ungeduldig, gereizt, abweisend oder ängstlich oder gleichgültig reagiert, da können freie Stunden - Stunden des Entspannens, des Abstandnehmens, der Verwirklichung von eigenen Interessen - neue Kräfte für die positive Gestaltung der Beziehungen innerhalb der Familie geben.
Außerhalb der Familienwohnung werden Familienunterstützungsdienste dafür benötigt, das familiäre Engagement für Integration bzw. Nichtaussonderung in Nachbarschaft und Öffentlichkeit zu unterstützen. Neben der anteiligen oder stellvertretenden Übernahme der familiären Selbsthilfeleistungen beinhalten die Dienste auch ein Entgegenkommen, Abholen, Hineinnehmen in die Gesellschaft, eine gesellschaftliche Brückenkopffunktion der Assistenzleistenden. Als Begründung sollte hier neben der Überforderung oder Einschränkung der familieneigenen Assistenzleistungskräfte auch die zusätzliche Belastung/Behinderung durch die vielfältigen Ausdrucksformen von Behindertenfeindlichkeit in der Gesellschaft anerkannt werden:
-
zum Beispiel, wenn die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch von Toiletten nur unter Mithilfe einer zusätzlichen Assistenzkraft möglich ist,
-
zum Beispiel, wenn der psycho-soziale Druck (auf dem Spielplatz, in Geschäften, bei der Teilnahme an Veranstaltungen, beim Besuch eines Cafés u.a.) so groß ist, daß er nur unter Beteiligung eines Bündnispartners ausgehalten oder durch dessen Vermittlung abgebaut werden kann,
-
zum Beispiel, wenn die Eltern nicht die Kraft, die Fähigkeit, die Zeit haben, die außerhäuslichen Freizeitinteressen ihres Kindes/Jugendlichen mit Behinderung (Wie zum Beispiel mit anderen Jugendlichen Fußball zu spielen) zu teilen und verwirklichen zu helfen.
Darüber hinaus liegt es im Interesse der Familien für ihr Kind/ihren Angehörigen mit Behinderung gleiche Assistenzdienste auch in außerfamiliären, familienergänzenden Einrichtungen und Gruppen zu erhalten. Das Ziel ist die Weiterführung des familiären Engagements für Nichtaussonderung durch die Ermöglichung von Integration in Regelkindergärten und Regelschulen, Gemeinde- und Freizeitgruppen u.a. Dazu sind familienunabhängige, sowohl einrichtungseigene/gruppeneigene als auch personenbezogene/personeneigene Assistenzdienste erforderlich.
Die Begründung liegt in der Überforderung der Regelkräfte (ErzieherInnen im Kindergarten, LehrerInnen in der Schule, JugendleiterInnen in der Gruppe u.a.), wenn einerseits die Gruppensituation so ist, daß sie keinen Spielraum für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben läßt, wenn aber andererseits Leistungs- und Anpassungsprobleme des Menschen mit Behinderung besondere Assistenz und besonderes Entgegenkommen nötig machen.
Vom 18. Lebensjahr an ist die Entwicklung eines alle Lebensbereiche umfassenden Angebotes an persönlichen Assistenzdiensten anzustreben, um die Verwirklichung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung zu ermöglichen, um echte Wahlangebote zu schaffen, wie z.B. das Wahlangebot, weiterhin im Familienverbund zu wohnen oder losgelöst vom Elternhaus in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft. Das Ausmaß der mobilen Dienste sollte dann, das heißt etwa vom 18. Lebensjahr an, für Familien gleich groß sein wie für nachfamiliäres, selbstbestimmtes Wohnen mit Assistenz.
Die mobilen Assistenzdienste für Erwachsene mit Behinderung soffen Assistenz leisten: im Wohn- und Freizeitbereich und im Arbeitsbereich, sowie auch in Erwachsenenbildung und Therapie jeweils nach individuellem Bedarf. Dies ist erforderlich, damit Erwachsene mit Behinderung das familiäre Modell des Miteinanders Verschiedener auch in anderen Formen weiterführen können. Der erwachsene Mensch mit Behinderung auch mit einer geistigen Behinderung, sollte sein Erwachsensein darin verwirklichen können und bestätigt bekommen, daß ihm Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten mit Hilfe ausreichender Assistenz geboten werden. Das wäre ein entscheidender Beitrag auch zur Lösung der sogenannten "Ablösungsproblematik", die häufig nur ein Ausdruck für den Mangel an persönlichen Assistenzdiensten ist.
Persönliche Assistenzdienste durch Dritte können bei solch bedarfsgerechtem Ausbau auch ein effektiver Beitrag dazu sein, mehr Pflegefamilien für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu gewinnen und das Angebot von Pflegefamilien auch für erwachsene Menschen mit Behinderung als "zweites Zuhause" auszubauen. Ausreichende, bedarfsgerechte Assistenzdienste könnten Pflege- oder Gastfamilien für erwachsene Menschen mit Behinderung zu einem pragmatisch zu entwickelnden, tragfähigen und für beide Seiten attraktiven Wahlangebot des Wohnens machen.
8. Aus der Unterscheidung von Selbsthilfe, Beteiligung von Zweiten, Dienste durch Dritte ist folgende Systematik zur Erhebung des Bedarfs an persönlicher Assistenzleistung durch Dritte abzuleiten:
-
Selbsthilfemöglichkeiten und Einschränkungen bzw. Hilfeerfordernisse aufgrund der konkreten individuellen Behinderungssituation
-
Hilfe durch Zweite (Angehörige, Regelkräfte, Kollegen usw.) und Einschränkungen der Zweithilfemöglichkeiten durch die soziale Situation der Familie, der Schule, des Betriebs, der Wohngruppe, der Freizeitgruppe usw.
-
Hilfe durch Dritte: Inhalte und Umfang.
9. Um dem vielfältigen Bedarf der verschiedenen Menschen, die mobile Assistenzdienste in den verschiedenen Lebensbereichen benötigen, besser gerecht werden zu können, müssen die Dienste personell weiter ausgebaut werden:
-
in der Form des sozialen Lernjahres: Freiwilliges Soziales Jahr, Zivildienst, Praktikum
-
in der Form des "sozialen Nebenamtes für jeden": auf der Basis stundenweiser Bezahlung (bezahlte Nachbarschaftshilfe)
-
in der Form von beruflich tätigen, fest angestellten Assistenten: mit Helferausbildung
-
jeweils verbunden mit der Anleitung und Begleitung oder Supervision durch qualifizierte Hauptamtliche in ausreichender Zahl und
-
ergänzt durch einen entsprechend qualifizierten Dienst zur Integrationsförderung bzw. Assistenzleistung in besonderen Problem- und Krisensituationen.
10. Arbeitgeber sind eigentlich die Menschen mit Behinderung bzw. deren Eltern oder Vertreter. Sie können jedoch Organisations- und Verwaltungsfunktionen an eine Assistenzorganisation delegieren. Eine professionelle Trägerschaft kann die Dienste möglicherweise zuverlässiger organisieren. Doch damit es nicht zu unguten Machtentwicklungen und neuen Abhängigkeiten kommt, muß die Assistenzorganisation ein Gegenüber bekommen: in einer Selbstbestimmt-Leben-Beratungsstelle (als Anlauf-, Planungs-, Kontroll- und Beschwerde-Stelle) und in effektiver Mitbestimmung.
11. Dem Finanzierungssystem für mobile Assistenzdienste kommt eine gewisse Schlüsselbedeutung zu. Von der Gestaltung des Finanzierungssystems hängt es ab, wie weit die Dienste ihren Prinzipien und Zielen in der Praxis entsprechen, ob sie dem Selbstbestimmungswillen dienen und wieviel Gleichberechtigung, wieviel Gerechtigkeit sie verwirklichen.
Um die mobilen Dienste als echte Alternative in einem dafür ausreichenden Umfang und mit genügend Sicherheit auszubauen, ist eine gesetzlich geregelte Finanzierung aus öffentlichen Mitteln erforderlich. Es ist ein allgemeines, umfassendes Assistenzleistungsgesetz zu schaffen, das deutlich mehr Leistungen als die Sozialhilfe und auch als die Pflegeversicherung ermöglichen würde. Solch ein Assistenzleistungsgesetz sollte
-
die Assistenzdienste in dem jeweiligen, vom individuellen Bedarf her erforderlichen Umfang finanzieren, ohne Unter- und Obergrenzen festzulegen;
-
die vielen verschiedenen, von der jeweiligen Behinderung her erforderlichen Assistenzinhalte als grundsätzlich gleich anerkennen, statt einen primär medizinisch geprägten Pflegebegriff zum Maßstab zu machen;
-
die Dienste aus Steuerbeiträgen aller Einkommensbezieher gemeinschaftlich, solidarisch finanzieren, so daß die Kosten nicht zu Lasten des einzelnen (und seiner Angehörigen) gehen, der Dienste nötig hat;
-
die Dienste so finanzieren, daß die Bezahlung soviel Anerkennung und soviel Lebensstandard ermöglicht, daß genügend Menschen als Dienstleistende zu gewinnen sind.
Auf Grund der vielen persönlichen Erfahrungen mit dem, was als "Pflegenotstand" umschrieben wird, wäre solch ein weitreichendes Assistenzleistungsgesetz in der Bevölkerung trotz aller Gegenkräfte vermutlich mehrheitsfähig. Es ist massives Unrecht, daß es bisher keinen ausreichenden, bedarfsgerechten Rechtsanspruch auf gesellschaftliche Solidaritätsleistungen für mobile Assistenzdienste für Menschen mit Behinderung gibt.
Grundsätzlich gilt: Mobile Assistenzdienste sind als gemeinschaftsgetragene Dienste zu erbringen und zu finanzieren. Wo auf Grund von Behinderung mehr praktische Hilfen als anderswo benötigt werden, da ist weder der Mensch mit Behinderung noch die Familie mit einem Angehörigen mit Behinderung zu privaten finanziellen Mehrleistungen zu verpflichten, sondern da hat die Gemeinschaft aller solidarisch mitzutragen. Hier ist dasselbe Solidaritätsprinzip geltend zu machen, wie es dem Krankenversicherungswesen zugrunde liegt: Alle Einkommensbezieher sollen in Relation zu ihrer Einkommenshöhe an der Finanzierung der Dienstleistungskosten beteiligt werden, unabhängig davon, ob und wieviel der einzelne an Hilfeleistung benötigt.
Solange noch kein umfassendes Assistenzleistungsgesetz durchgesetzt ist, sollten die vorhandenen Regelungen auf Grundlage des Gesundheitsreformgesetzes (Pflegegeld und Leistungen für häusliche Pflegehilfe) bzw. demnächst auf Grundlage der Pflegeversicherung und auf Grundlage des Bundessozialhilfegesetzes (Eingliederungshilfe, Pflegegeld und Kostenübernahme für Fremdpflegehilfe, Haushaltshilfen) soweit wie möglich ausgeschöpft werden. Um genügend Großzügigkeit und genügend Sicherheit in der Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen, sollten zusätzlich vertragliche Rahmenvereinbarungen mit den Kommunen angestrebt werden. Dabei ist die Finanzierung unabhängig von den jeweils erforderlichen Hilfeleistungsarten nach gleichen Grundsätzen zu gewährleisten, d.h. z.B. unabhängig davon, ob der Dienst der Pflegehilfe oder der Eingliederungshilfe zugeordnet wird.
Es sind kostendeckende Stundensätze zu gewähren. In die Berechnung der Stundensätze sind die Kosten der erforderlichen Regiekräfte für Dienstvermittlung und Organisation der Dienste, für Anleitung, Begleitung und Supervision der MitarbeiterInnen sowie für die Verwaltung miteinzubeziehen.
12. Die Stundenzahl ist in jeweils bedarfsgerechtem Umfang zu bewilligen. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren muß dem Selbstbestimmungsrecht des Hilfeempfängers entsprechen. Der Antrag ist individuell zu begründen, die Dienstleistungsinhalte sind individuell zu konkretisieren. Es ist ein Verfahren zu entwickeln, in dem derjenige, der Assistenz benötigt, seinen Bedarf individuell und subjektiv - auch mit Hilfe von Beratung - definieren und begründen kann. Gutachter zur Überprüfung des jeweiligen Antrags sollten unter Beteiligung der Interessengemeinschaft der Dienstleistungsempfänger berufen werden; es sollten verschiedene Gutachter (Ombudsmann, Sozialarbeiter, Mediziner, Psychologe o.a.) angeboten werden, unter denen der Antragsteller auswählen kann; ein Vertreter der Interessengemeinschaft der Assistenznehmer sollte bei der Antragsbegutachtung beteiligt sein. Die Aufstellung eines (angeblich) objektiven Kriterienkataloges zur Bedarfsdefinition und Begründung soll vermieden werden, weil er der Verwirklichung individuellen, subjektiven Gestaltungswillen entgegenwirken würde.
13. Bei dem erforderlichen Ausbau kommt es darauf an, daß die Größe der Organisation überschaubar bleibt: Der weitere Ausbau der Dienste sollte nicht zu immer größeren Zentralstellen führen, sondern zu immer mehr dezentralisierten, basisnahen bzw. bürgernahen Organisationsstellen als Knotenpunkte eines sozialen Netzwerkes. Die Organisationsform der Dienste muß mittels Dezentralisierung möglichst viel Basisverwurzelung anstreben, um den Menschen, die die Dienste benötigen, genügend Mitwirkungsmöglichkeiten zu gewährleisten; zugleich erleichtert dies eine Verankerung im Bewußtsein möglichst vieler Menschen, die selber keine Dienste benötigen, und hilft, eine breite Mitträgerschaft und Solidarisierung zu bewirken.
Was die persönlichen Assistenzdienste in der Praxis bedeuten können illustriert ein Beispiel aus den USA:[16]
"Trevor Braymann aus Barrington, Rhode Island, hat mit seinen 18 Jahren ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Von seinem sechsten Lebensjahr an wohnte er wegen sehr großer Verhaltensprobleme in einem Sonderinstitut in einem Nachbarstaat. Er hatte einen schweren Gehirnschaden, infolgedessen er kaum kommunizieren könnte und oft bizarr und angsteinjagend auf die Dinge reagierte, die er nicht begriff. Und das waren viele.
Vor zwei Jahren beschlossen seine Eltern, Trevor wieder nach Hause zu holen. "Er sah so schrecklich unglücklich aus", erzählt seine Mutter. Aber es ist nicht einfach, Trevor als Junge zu Hause zu haben, und alle Therapien, die an ihm ausprobiert worden waren, hatten keinen einzigen Effekt. Er verwundete sich selber. Er packte Menschen, um sie zu sich hinzuziehen und sie zu begucken. Trevor ist ein langer, stämmiger Junge und er ist beachtlich stark. Die merkwürdige Weise, Kontakt aufzunehmen, schreckte Menschen immer wieder ab.
Der Vater und die Mutter von Trevor schrieben zusammen mit Tim Lafazia vom Rhode Island Protection Advocacy Service ein besonderes Integrationsprogramm für ihren Sohn. Trevor war der erste in Rhode Island, der solch ein Programm verfolgen konnte. Die Eltern fragten bei einer High School (Sekundarschule) in der Nachbarschaft nach, ob sie ihn als Schüler aufnehmen wollten. Die Barrington High School wollte es für drei Monate probieren. Trevor bekam einen persönlichen Lehrer, John Brinz, der heute, nach zwei Jahren, noch immer mit Trevor arbeitet. Die Schule ist für die Bildung von Trevor verantwortlich und bezahlt John. Die Schule bekommt dafür eine Beihilfe vom Staat. Der Staat wollte diese Beihilfe gerne bezahlen, denn vorher mußte Rhode Island Trevors Platz in dem Institut bezahlen und der kostete wesentlich mehr.
Die ersten drei Monate ging Trevor jeden Tag für zwei Stunden zur Schule, zusammen mit John. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich befriedigend. Das Experiment konnte fortgesetzt werden. John Brinz: "In der ersten halben Stunde an dem allerersten Tag, den ich mit ihm arbeitete, zählte ich 90 Zwischenfälle, bei denen Trevor sich in selbstverwundendes oder aggressives Verhalten verlor. Er war in einem fort dabei, gegen seine Ohren zu schlagen und ganz fest nach Dingen und Menschen zu greifen. Nach neun Monaten hatte das abgenommen bis zu höchstens einem Zwischenfall pro Monat."
Trevor greift immer noch nach Gegenständen, aber das ist jetzt so in sein Tagesprogramm eingebaut, daß es nicht mehr störend ist. Er greift zum Beispiel in einen Korb mit Wäsche, aber das ist auch das Ziel, denn er sammelt die dreckige Wäsche in dem Nachbarschaftszentrum ein. Er greift nach Stühlen und das macht sich gut, denn er räumt in der Kantine der Schule Stühle auf. Früher warf er mit Stühlen und Tischen. Das muß jetzt nicht mehr sein. Trevor ist übrigens auch närrisch nach Glasscherben. Das machte früher Probleme, aber seit er für die Nachbarn Flaschen in den Glascontainer werfen kann, wird sein Scherbenbedürfnis zufriedengestellt.
John zieht sechs Stunden pro Tag mit Trevor herum. Er holt ihn morgens von zu Hause ab. Erst beginnen sie damit, das Ankleiden zu üben. Wie der Tag weiter aussieht, hängt sehr von Trevors Verfassung an diesem Tag ab: Immer wieder beeinflussen seine epileptischen Anfälle seine Stimmung. Er geht zur Schule oder macht berufsvorbereitende Aktivitäten. Trevor und John haben einzelne feste Aktivitäten, so wie das Hochziehen der Flagge bei dem Altenheim, das Einsammeln und Wegbringen der Wäsche von dem Nachbarschaftszentrum YMCA und das Herumbringen von Mahlzeiten für "Tischlein deck dich." John und Trevor fahren mit ihrem Lieferwagen die Häuser entlang, und wenn Trevor in Stimmung ist, gibt er die Mahlzeit ab. Manchmal hat er dazu keine Lust, dann wartet er in dem Auto. Trevor geht, wenn irgend möglich, jeden Tag zur Schule, Er räumt die Stühle in der Kantine auf, wobei er inzwischen eine herzliche Beziehung mit dem Kantinenverwalter aufgebaut hat, und er turnt dort. Wenn er dem gewachsen ist, nimmt er teil an dem, was in seiner Klasse geschieht.
Trevors Integrationsplan hat einige wichtige Ausgangspunkte:
-
Die Qualität seines Lebens muß besser werden. Das Programm muß Trevor ermöglichen, Dinge zu tun, die er schön findet und für die er sich selber entscheidet. Er muß die Gelegenheit vermittelt bekommen, sich selber würdig zu fühlen. Er muß die Chance bekommen, sein eigenes Leben zu führen. Seine schulischen und arbeitsmäßigen Fertigkeiten müssen dadurch zunehmen, daß er in abwechselnde Lernsituationen hineingestellt wird.
-
Trevor muß die Chance bekommen, am gesellschaftlichen Zusammenleben teilzunehmen. Alle seine Aktivitäten müssen in einer natürlichen Umgebung stattfinden. Er muß die Gelegenheit haben, nichtbehinderten Altersgenossen zu begegnen, sowohl auf der Schule als auch bei seiner Arbeit.
-
Alles, was er tut, muß echt sein und keine Kopie. Alle Aktivitäten müssen Bedeutung haben. Er muß Tätigkeiten verrichten, die von einer nichtbehinderten Person ausgeführt werden müssen, wenn er sie nicht tut.
-
Die Dinge, die Trevor tut, müssen zu seinem Lebensalter passen. Nur Aktivitäten, die auch andere jungen von 18 Jahren tun, kommen in Betracht.
Auf der Basis von diesem Integrationsplan hat das Team der Schule zusammen mit den Eltern und den erforderlichen Fachleuten einen individuellen Lernplan aufgestellt. Alles was Trevor tut, wird stets an den Ausgangspunkten dieses Planes überprüft.
Zentral in der Begleitung steht die Möglichkeit, daß Trevor selbst wählt. Um das zu können, maß er sich äußern können, aber diese Fähigkeit ist bei Trevor schwach entwickelt. Er kann nicht sagen, was er will, er kann nicht ja nicken oder nein schütteln. John Brinz investiert deswegen auch sehr viel Energie in das Kommunizieren mit Trevor. Er spricht und macht Gebärden. Er übt andauernd mit Gebärden. Das wirkt sehr ansteckend: Wenn du die zwei arbeiten siehst, beginnst du von selbst auch Gebärden zu machen, wenn du mit Trevor kommunizierst, was dazu führt, daß Trevor wiederum zu dir viel offener ist. Trevor hat sich auf diese Art und Weise in den letzten zwei Jahren einige Gebärden zu eigen gemacht: Er kann auf sein Handgelenk zeigen, an dem seine "Nein"-Uhr ist eine Uhr mit dem Wort "Nein" an der Stelle, wo sonst die Zeiger und Ziffern sind. Er kann sagen: "Ich will" dadurch, daß er die Gebärde dafür macht: die zwei Hände über der Brust gefaltet. Diese paar Gebärden haben dafür gesorgt, daß er nicht länger in Jähzorn auszubrechen braucht, wenn Dinge geschehen, die er nicht will. John ist in einem fort dabei, Trevor zu "folgen." Er führt ihn, aber fragt immer, mit Wort und Gebärde, ob Trevor mit ihm einer Meinung ist. Wenn Trevor "Nein" zeigt, respektiert John das.
Ich sehe John und Trevor in dem Schwimmbad des YMCA. Sie stehen in ihren Badehosen fertig, um ins Wasser zu gehen. Trevor steckt vorsichtig seinen Fuß ins Wasser, während John ihn bittet, ins Wasser hineinzukommen. "Komm, laß uns schwimmen gehen, uns wird es im Wasser Spaß bringen«, sagt John, während er mit seinen Händen die Gebärden macht für "wollen", "du" und "schwimmen." "Schwimmen ist doch schön", fügt er dann hinzu. Nun, damit ist Trevor nicht einverstanden. Nachdem er ein paar Minuten lang oben an der Treppe gezögert hat, packt er sein Handtuch und setzt sich auf die Holzbank an der Seite. Inzwischen bemühen sich auch andere Schwimmer darum. Normale Menschen aus der Nachbarschaft, die um diese Zeit ihre Bahnen ziehen. "Komm herein, Trevor", rufen sie, "das Wasser ist herrlich." Trevor bleibt entschieden auf der Bank sitzen. "Dann gehe ich eben alleine schwimmen", sagt und gebärdet John. "Findest du das gut, Trevor?" Trevor hat keine deutliche Bedenken. Als John einmal schwimmt und nochmals fragt, ob Trevor hereinkommen will, damit sie zusammen spielen können, begibt Trevor sich aufs neue zu der Treppe. John steht wieder nahe bei ihm und lobt ihn für seine Initiative. Wieder steckt Trevor vorsichtig seinen Fuß in das Wasser und macht die Gebärde zu seinem Handgelenk: Ich will nicht!
"Okay", sagt und gebärdet John. "Ich begreife jetzt, daß du heute keine Lust zum Schwimmen hast. Das ist ein prima Nachmittag gewesen, Trevor. Du hast sehr gut erkennen lassen, was du selber willst."
Am Abend gehen wir mit einer kleinen Gruppe Menschen zu einem Hardrock-Café in Providence, der Hauptstadt von Rhode Island, wo die Rockband Big Nasa auftritt. Der erste Bekannte, mit dem ich zusammenstoße, während ich mir einen Weg durch die Menge, durch den Rauch und den furchtbaren Urin bahne, ist Trevor Braymann, der mit seinem Vater und seiner Mutter auf einem "age apptopriate way" in einer seinem Lebensalter entsprechenden Weise - auf dem Wege ist. Er schwingt sich mit geschlossenen Augen nach der Musik und da ist kein Cafébesucher, der erstaunt nach ihm guckt."[17]
In Wechselbeziehung zur Organisation von persönlichen Assistenzdiensten müssen Selbstbestimmt-Leben-Beratungsstellen geschaffen werden, damit nicht nur Finanzierungs- und Anstellungsmöglichkeiten für Assistenten durchgesetzt werden, sondern auch die Praxis persönlicher Assistenzdienste so strukturiert und organisiert, mit Inhalt gefüllt und kontrolliert wird, daß sie dem Selbstbestimmungsprinzip wirklich gerecht wird und dem Entstehen neuer Abhängigkeiten, wie sie ja auch bei ambulanten bzw. mobilen Diensten möglich sind, gut vorbeugt.
Die Selbstbestimmt-Leben-Beratungsstellen haben dementsprechend vor allem folgende Aufgaben:
-
Beratung bei der Entwicklung konkreter Vorstellungen von eigenen Lebensgestaltungsmöglichkeiten, Klären von Wünschen und Träumen, Sorgen und Ängsten, Schwächen und Stärken, Kontakten, Fähigkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten,
-
Hilfe zur Selbsthilfe bei der Verwirklichung der eigenen Lebensgestaltungsvorstellungen,
-
Hilfestellung zur Erarbeitung von individuellen Assistenzleistungsplänen und von den dazugehörigen Finanzierungsplänen und Anträgen samt Antragsbegründungen,
-
Hilfe bei der Suche, Auswahl, Anstellung, Vermittlung und Anleitung persönlicher Assistenzkräfte,
-
Hilfe bei Suche, Auswahl, Miete, Umbau, Einrichtung und Finanzierung einer eigenen Wohnung,
-
Beratung und Schulung von Menschen mit Behinderung und (erforderlichenfalls) ihrer "Betreuer"/Interessenvertreter/Eltern in ihrer Mieter- bzw. Untermieter-Rolle und in ihrer Arbeitgeber- bzw. Kunden-/Käufer-Rolle, in der Wahrnehmung ihrer Planungs-, Wahl- und Veto-Rechte und bei der Weiterentwicklung ihrer Gestaltungs- und Anleitungskompetenzen
-
Beschwerdestelle zur unabhängigen Überprüfung von Kritik an Assistenten/Assistentinnen und zur Hilfe in Konflikten
-
Hilfestellung bei der Gründung und bei selbstbestimmungsgerechter Gestaltung von Organisationen für Anstellung und Einsatz von Assistenzkräften; Fachberatung und Supervision für diese Assistenzorganisationen, die stellvertretend die Mieter- und Arbeitgeberfunktionen übernehmen können,
-
Organisation von Stadtteilarbeitskreisen und Gemeinwesenkonferenzen sowie von Öffentlichkeitsarbeit: zur Förderung von Integration und von Selbstbestimmt-Leben,
-
Hilfe zur politischen Interessenvertretung zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen, zur Überwindung von Diskriminierung, zur Verwirklichung von Gleichstellung.
Bei solcher Selbstbestimmt-Leben-Beratung kann es von besonderer Bedeutung sein, Angehörige, Freunde, Bekannte und Nachbarn an dem Prozeß zu beteiligen, der nötig ist, um den einzelnen Menschen mit seinen jeweiligen Wünschen und Träumen, Fähigkeiten und Möglichkeiten bestmöglich zu verstehen - umso mehr, wenn er sich selbst nicht direkt, weder über Worte noch andere Zeichen, sondern nur über den Ausdruck von Wohlbefinden oder Unwohlsein indirekt äußern kann. Die Beteiligung vieler Menschen ist auch nötig, um möglichst viel Phantasie zu entwickeln und praktikable Ideen zu finden, die helfen können, Wünsche und Zielvorstellungen schrittweise zu verwirklichen.
Eine junge Frau lief immer und ewig mit einem kompletten Mickey-Maus-outfit herum, war dabei aber sehr unglücklich. Wir suchten mit viel brainstorming dahinter zu kommen, was mit ihr bloß los sein könnte. Vielleicht wollte sie gerne einmal ins Disneyland fahren. Eigentlich hatten wir dafür kein Geld, doch dann haben wir bei allen Beteiligten gesammelt und sind mit ihr nach Disneyland gefahren. Die Reise war für sie sehr schön, doch trug überhaupt nichts dazu bei, ihre Probleme zu lösen. Wir setzten uns wieder zum brainstorming zusammen. Und diesmal war ein Freund ihres Elternhauses beim Gespräch dabei.
Er erzählte, daß die Frau einen Bruder hatte, den sie zehn Jahre lang nicht gesehen hatte. Als sie ihn damals das letzte Mal sah, war er noch sehr jung und hatte einen Mickey-Maus-Pullover an. Wir hatten nicht mal gewußt, daß sie einen Bruder hatte! Wir suchten Kontakt zu diesem Bruder, und er zeigte sich bereit, die Beziehung zu seiner Schwester wieder herzustellen. Und das löste nicht nur das eine, sondern gleich eine ganze Menge Probleme auf - Nach: Barbara Brent.[18]
Die Beratung sollte also nicht nur in Zweierkonstellationen stattfinden, sondern auch in konferenzmäßiger Beteiligung von vielen verschiedenen Menschen. Zu solchen Beratungs- und Planungs-"Konferenzen" zur Entwicklung von individuellen "Dienstleistungspaketen" und individuellen Zukunftsplänen sollten zusammenkommen:
-
der jeweilige Mensch mit Behinderung als Mittelpunkt der Planungsgespräche,
-
Angehörige, Freunde, Bekannte nach Wahl des Menschen mit Behinderung,
-
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Behindertenhilfe,
-
Schlüsselpersonen des Gemeinwesens.
Die Bedeutung solcher individuellen Zukunftsplanungs-Konferenzen besteht wesentlich aus drei Gesichtspunkten:
-
Der Mensch mit Behinderung wird als eigenständige Persönlichkeit ernstgenommen: Es geht um nichts anderes als um seine eigenen Vorstellungen und um seine positiven Möglichkeiten. Er ist bei aller Planung dabei und steht im Mittelpunkt der Gespräche; wenn er sich nicht direkt äußern kann, bringen andere Gesprächsteilnehmer seine Äußerungen zum Ausdruck und ins Gespräch. Er selber hat zu entscheiden, wen er an der Gesprächsrunde beteiligt haben möchte und wen nicht.
-
Die nichtbezahlten Kontaktpersonen, die Angehörigen, Freunde, Bekannten, Nachbarn, Vertreter von Gemeinwesengruppen u.a., werden gegenüber den bezahlten Assistenzkräften und Fachleuten aufgewertet. Sie erhalten sowohl bei der Beratung und Planung als auch bei der Umsetzung von Plänen eine entscheidende Rolle. Die Gesprächsrunden sind ein unmittelbarer Beitrag dazu, mitmenschliche Beziehungen zu vermitteln und zu bestätigen, zu stärken und wachsen zu lassen und das Miteinander der Verschiedenen im Gemeinwesen weitere Gestalt gewinnen zu lassen. Alle miteinander machen eine Gemeinschaftserfahrung, die den einzelnen Menschen mit Behinderung als einen gleichen mit vielen anderen Verschiedenen verbindet; eine Gemeinschaftserfahrung, die es als konstitutives Element allen Zusammenlebens im Gemeinwesen auszubauen gilt und die als gegenseitige Bereicherung aller Beteiligten zu multiplizieren ist.
-
Das Miteinander der Verschiedenen bei solchen persönlichen Zukunftsplanungs-Konferenzen hilft von vornherein, die Begrenzungen durch die primär defizitorientierten Bedingungen aussondernder Einrichtungen und spezialisierter Dienste zu überwinden. jeder, der auf Grund von vorhandenen Bedingungen sich allzu vorschnell an Bedenken festmacht, wird (durch das Zuwerfen von sogenannten killing balls) immer wieder aufgefordert, sich auf die vorhandenen Fähigkeiten und Chancen statt auf die Defizite und Schwierigkeiten auszurichten und Phantasie und Kreativität auf Zukunft hin zu entwickeln.
Solche Zukunftsplanungs-Konferenzen sollten nicht nur ein Beratungsinstrument bilden, sondern auch Funktionen eines Freundeskreises annehmen. Denn Freundeskreise haben ihre besondere Bedeutung:
"Sieben Thesen über Freundeskreise:
-
Jemand hat die beste Chance, daß aus seinem Traum etwas wird, wenn in seinem Kreis ein guter Freund sitzt.
-
Ein Kreis kann niemals aufgezwungen werden an jemanden, der nicht wirklich an einer Veränderung interessiert ist.
-
Das Wachsen einer Person hängt direkt mit der Ehrlichkeit und Betroffenheit der Freundeskreis-Beteiligten zusammen.
-
Das Ziel des Kreises wird bestimmt durch den Inhalt der Träume der jeweiligen Person.
-
Kleine Kreise sorgen für die Verwirklichung von kleinen Träumen, große Kreise versammeln sich um große Träume herum.
-
Kreise werden oft in Folge einer Krise formiert. Das muß eigentlich nicht so sein.
-
Derjenige, der den Kreis organisiert, muß außergewöhnlich persönlich beteiligt sein. Keine Therapie, zuhören, herausfordern, Vertrauen, Ehrlichkeit."[19]
Bei alldem ist es nötig,
-
viel von der Lebensgeschichte des einzelnen Menschen mit Behinderung zu verstehen,
-
viel von seiner gegenwärtigen Lebenssituation zu erfahren,
-
seine Fähigkeiten und Möglichkeiten konkret zu erkunden,
-
ein detailliertes Bild von seinen Zukunftswünschen zu erfassen,
-
die Hindernisse zu benennen und Ideen für deren Überwindung zu entwickeln,
-
einen Beschluß zu fassen, womit konkret begonnen werden soll und was tatsächlich Realisierungschancen hat,
-
Absprache zu treffen, was bei der nächsten Zusammenkunft besprochen werden soll.
Leitfragen für die Planungsgespräche sollten sein:
-
Was will jemand?
-
Welche Prioritäten hat sie/er dabei?
-
Welche Teilziele könnten zuerst verwirklicht werden?
-
Was kann jemand selbst?
-
Was ist an Hilfeleistungen erforderlich?
-
Auf welche Art will sie/er die Hilfeleistung: wann?, wo?, durch wen?
-
Was kann die Umgebung tun? (Einzelne Menschen und Gruppen, informelle Angebote des Gemeinwesens, u.a.)
Für die praktische Durchführung der Gespräche ist erforderlich:
-
regelmäßige Zusammenkünfte mit etwa zweistündiger Dauer,
-
jemand, der die Gespräche auf Spur hält,
-
möglichst anschauliche, bildnerische Darstellung von Gesprächsergebnissen auf einer Wandzeitung, kein Fachjargon,
-
Absprache über Aufgaben, die von Beteiligten wahrgenommen werden sollen, keine Aktenberichte.
Soweit zur Umsetzung der Gesprächsergebnisse praktische Assistenzdienste nötig sind, sind diese unter der Devise "Hilfe nach Maß" als individuelle "Dienstleistungspakete" zu konkretisieren und möglichst mit "klientengebundenem Budget" zu finanzieren, um die Hilfe tatsächlich dem jeweiligen Bedarf entsprechend zu dosieren, um sowohl Unterdosierungen als auch Überdosierungen zu vermeiden.
Bei der Ausgestaltung des Dienstleistungspaketes ist immer auch zu fragen, wer an der Umsetzung zu beteiligen ist:
-
berufliche Assistenzkräfte,
-
bezahlte Nachbarschaftshilfe,
-
nichtbezahlte Hilfe auf der Grundlage persönlicher Kontakte,
-
nichtbezahlte Hilfe auf der Grundlage der Beteiligung an Gruppenaktivitäten.
Um all den neuen Entwicklungsmöglichkeiten für die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung, wie sie durch persönliche Assistenzdienste, Selbstbestimmt-Leben-Beratung, Zukunftsplanung mit Freundeskreisen vorangetrieben werden, eine klare Orientierung zu geben, haben die nordamerikanischen wie auch die holländischen Veränderungs- und Erneuerungsbewegungen alles, was ihnen wichtig ist, in wenigen einfachen Grundsätzen zusammengefaßt, wie zum Beispiel in
der Formulierung der Stiftung Keerkring Rotterdam:[20]
"l. Anwesend sein im Gemeinwesen und teilnehmen am Zusammenleben des Gemeinwesens.
2. Chancen bekommen, sich zu entwickeln und Fertigkeiten zu erwerben.
3. Chancen bekommen, eigene Entscheidungen in Belangen des persönlichen Lebens zu treffen.
4. Gute Beziehungen pflegen zu können mit der Familie, mit Freunden und Bekannten.
5. Mit Respekt und Würdigung angesprochen und behandelt zu werden."
Solche knappen Grundsätze oder Zielsätze, die auch auf einer Scheckkarte genügend Platz fänden, sollten jedem Beteiligten an die Hand gegeben werden, damit Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen und Freunde darauf verweisen bzw. entsprechende Entwicklungen einfordern können und damit Mitarbeiter überprüfen können, was sie mit ihrer alltäglichen Arbeit konkret zu diesen fünf Punkten beigetragen haben.
Grundsätzlich geht es bei all dem darum, sich immer wieder zu persönlichen und zu neuen Lösungen herausfordern zu lassen. Es ist keine Begrenzung, kein "das geht nicht!" zu akzeptieren, weder von den eigenen Vorstellungen der Profis her, noch von den Strukturen und Inhalten vorhandener Dienstleistungsangebote her. Es ist von den Wünschen und Ideen des Einzelnen her und unter Beteiligung vieler Verschiedener Phantasie für jeweils individuelle Lösungen zu entwickeln (brainstorming mit killing balls für alle vorschnellen Negativreaktionen).
Sicherlich ist es auch notwendig, die Strukturen, die Dienste, die sozialen Entwicklungen zu planen, die Veränderung der Systeme zu betreiben; doch dies geschieht am effektivsten nicht als Voraussetzung, sondern in Verbindung mit den konkreten Schritten der Ausgestaltung und Umsetzung individueller Zukunftspläne, ausgehend von den Problemen und Interessen einzelner Menschen.
"Über die Schritte, das Leben von individuellen Menschen auf eine individuelle Weise gestalten zu helfen, verändert das System sich von selber mit. Wenn du damit beginnst, das System zu verändern, dann glückt es dir nicht. Du kannst nicht alles auf einmal verändern, das ist eine hoffnungslose Aufgabe und du mußt schrecklich viel Zeit und Energie investieren, Widerstände zu überwinden. Beginne bei den Menschen, die selber darum bitten, das funktioniert wirklich am besten. Wir haben gemerkt, daß die Hilfeleistenden sich von selbst mitverändern. Und eines Tages merkst du, daß das Hilfeleistungssystem verändert ist."[21]
[16] Aus: Ronny Vink: Inclusion. Jeder gehört dazu. Essen, 1993.
[17] Aus: Ronny Vink: Inclusion. Jeder gehört dazu. Essen, 1993.
[18] Aus: Klik 3/1993, Utrecht.
[19] Aus: Wieringa, Kahn, Brent: Nieuwe Kijk Op Zorg. Oegstgeest, 1993. Seiten 70/71.
[20] Aus: Bob Geijp: Vortragsmanuskript, 1993.
[21] Aus: Ronny Vink: Inclusion. Jeder gehört dazu. Essen, 1993.
Inhaltsverzeichnis
Um mit der integrativen Ausgestaltung des Zusammenlebens im Gemeinwesen weiterzukommen, ist zweierlei - in parallelen und aufeinander abgestimmten Prozessen - notwendig: Einerseits ist die wohltätige Aussonderung durch Behinderteneinrichtungen zu überwinden, d.h. es ist ein Ausbau- und Aufnahme-Stop für alle Sondereinrichtungen durchzusetzen, weil diese Einrichtungen der Gemeinwesenentwicklung entgegenwirken. Sie tragen durch ihr Vorhandensein dazu bei, das Gemeinwesen zu entfunktionalisieren, die integrativen und solidarischen Kräfte des Gemeinwesens funktionslos zu machen.
Andererseits ist in Verbindung mit der Entwicklung von integrativen Strukturen sowie von Assistenz- und Kooperationsdiensten auch methodische Gemeinwesenarbeit zu betreiben, damit es gelingt, die gesellschaftlichen Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern, die Gemeinschaft zum Mittragen zu gewinnen und die mitmenschliche Umgangskultur zu vertiefen. So werden die Strukturen des Miteinanders mit Inhalt gefüllt und führen zum Wachsen persönlicher Beziehungen.
Ohne Gemeinwesenarbeit besteht die Gefahr, daß nicht nur die Sondereinrichtungen, sondern auch die Sonderdienste entfunktionalisierend wirken; die einseitig professionelle Organisation auch von persönlichen Assistenzdiensten kann zu einem bloßen Versorgungssystem führen, das das Gemeinwesen entfunktionalisiert und die Dienstleistungsempfänger in neue Abhängigkeit bringt und in alter Einsamkeit beläßt.
Die Entwicklung integrativer Strukturen, der Aufbau von Assistenz- und Kooperationsdiensten und die Gemeinwesenarbeit müssen als drei gleich wichtige Elemente eines korrespondierenden Systems zusammenwirken, um eine effektive Gesellschaftsveränderung zu erreichen, d.h. um das Sondersystem ganz abzulösen, statt es nur - von vollstationären Institutionen in teilstationäre, von zentralen Einrichtungen in dezentrale, von Einrichtungen in Sonderdienste usw. - zu differenzieren.
Um unnötigen Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich dreierlei betonen. Erstens: Ich meine mit meiner Kritik nicht das Bethel in Bielefeld, sondern Bethel als symbolischen Begriff für Groß- und Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Zweitens: Ich meine mit meiner Kritik die Aussonderungsstrukturen von Sondereinrichtungen und nicht die Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten und große Menschlichkeit verwirklichen. Drittens: Ich meine mit meiner Kritik eine Kirche und eine Gesellschaft, die Bethel als Angebot zur Entlastung des Gemeinwesens begrüßen und benutzen, die sich an der sozialen Entfunktionalisierung des Zusammenlebens beteiligen, die das Hinausdelegieren von Menschen und die Ausbürgerung der Menschlichkeit fördern.
"Für Behinderte haben wir unsere Einrichtungen!" "Die Behinderten fühlen sich am wohlsten unter ihresgleichen in eigenen, ihnen angepaßten Lebenswelten!" "Für Behinderte sind Sondereinrichtungen Anstalten, Komplexeinrichtungen, Großheime - nach wie vor notwendig und auch auf Zukunft hin unverzichtbar! Allenfalls sind Variationen in Form von Behindertendörfern oder Verbundsystemen (Kernbereiche in Form größerer Wohnheime in Verbindung mit einem Kranz von Außenwohngruppen) möglich! Aber eine grundlegende, radikale Veränderung ist weder möglich, noch notwendig!"
Dies sind keine Zitate, doch die Sätze geben das wieder, was die Sondereinrichtungen mit ihrer Praxis zum Ausdruck bringen und was viele ihrer Aussagen - in vereinfachender Zusammenfassung - letztlich zum Inhalt haben. Dies bezeichne ich als Bethel-Verblendung von Kirche und Gesellschaft: eine Verblendung, eine Täuschung, die häufig eine Verstrickung in eine Lüge ist und die häufig zugleich zur Produktion dieser Lüge beiträgt. Die Täuschung besteht darin, daß die Sondereinrichtungen mit ihrem einseitigen Engagement
-
die Gleichheit der Verschiedenen, die Gleichheit aller Menschen verleugnen und Menschen mit Behinderung die Anerkennung des gleichen Menschseins zumindest indirekt verweigern,
-
die Zuständigkeit des Gemeinwesens als Lebensort für alle Menschen verleugnen und Menschen mit Behinderung in die Zuständigkeit anderer aussondern,
-
die Bereitschaft, das Interesse, die Möglichkeiten von so vielen Menschen, Mitmenschlichkeit mit anderen zu entfalten, verleugnen und die Entwicklung von dialogischen Beziehungen und von Vielfaltsgemeinschaften einschränken, erschweren, verhindern.
Mit anderen Worten: Das Vorhandensein, Aufrechterhalten, weiterentwickeln von Sondereinrichtungen führt unabhängig davon, wieviel Menschlichkeit im Innenleben dieser Einrichtungen verwirklicht wird, zu gravierenden negativen Außenwirkungen:
-
zur Wahrnehmung der Bewohner dieses Sonderortes als Sondermenschen: zur Ausprägung eines Selektionsmechanismus im Kopf der Mitbürger im Umfeld;
-
zur Entlassung der anderen Gemeinwesen im Umfeld aus der Verantwortung für ihre Mitbürger mit Behinderung und damit zur Ausprägung eines Nichtzuständigkeits-Klischees bei nichtbehinderten Mitbürgern;
-
zur Schwächung der Weiterentwicklung integrativen Zusammenlebens im Gemeinwesen, zum Aufrechterhalten der Sogwirkung des etablierten Sonderangebots, zum Verdecken des Handlungsbedarfs für die Alternativentwicklungen.
Die Bethel-Verblendung führt zur Klassifizierung von Menschen mit Behinderung als Sondermenschen, zur Umsetzung dieser Klassifizierung in die Praxis der Einordnung in Sondereinrichtungen und zur Rückwirkung dieser Aussonderungspraxis auf die Ausprägung und Festigung des negativen Wahrnehmungsmusters.
Trotzdem sind Kirche und Gesellschaft stolz auf ihre Sondereinrichtungen. Sie erfreuen sich der Bewunderung für ihre großen Werke der Nächstenliebe, ohne sich die Heuchelei so mancher Bewunderer selbstkritisch bewußt zu machen. Sie betreiben Imagepflege und Interessenvertretung für getrennte Welten, statt die Entwicklungsmöglichkeiten des Zusammenlebens vor Ort zu initiieren, zu unterstützen, voranzutreiben. Da kommt der Kaiser von Japan in Bethel zu Besuch, da machen Konfirmandengruppen ein Diakoniepraktikum in Bethel, da stehen in vielen Büros Briefmarken-Sammeldosen für Bethel. Aber die tausendfältigen Möglichkeiten des Bethels im Miteinander vor Ort werden ignoriert, die unermeßliche Vielfalt des Zuhauseseins Gottes im Zusammen-Leben-Lernen der Verschiedenen überall wird ausgeblendet. Die Aufforderung des Weltkirchenrates (Vancouver 1983): "Behinderte können nicht isoliert werden; sie sind Teil des Hauses (oikos) und für die Ganzheit und die Würde der Kirche wesentlich", bleibt ohne Resonanz; die Beispiele in anderen Ländern (Italien, Dänemark, Schweden, Holland, USA u.a.), integratives Zusammenleben mit Konsequenz zu entwickeln, werden entweder nicht zur Kenntnis genommen oder als nicht zukunftsfähig abgetan.
Wenn wir dagegen die Gleichheit der Verschiedenen erkennen und anerkennen, wenn wir Behinderung als Ausdruck der Vielfalt des Menschseins, des Verschiedenseins von Menschen sehen, dann ist differenzierte und umfassende Hilfeleistung je nach individuellem Bedarf für jedes Kind mit Behinderung von Geburt an und Dazugehörigkeit in allen Lebensbereichen zeitlebens zu garantieren, dann ist jeder Kindergarten für jedes Kind zuständig und jede Schule für jeden Schüler, jeder Betrieb für jeden Mitarbeiter, jedes Gemeinwesen für jeden Menschen - unabhängig von den jeweiligen Leistungsfähigkeiten und unabhängig vom Umfang des individuellen Hilfeleistungsbedarfs. Wenn es normal ist, verschieden zu sein (Richard von Weizsäcker, 1993), dann ist es auch normal, dann ist es überhaupt nichts besonderes mehr, daß jemand mit Behinderung im Regelkindergarten, in der Regelschule, in einem normalen Arbeitsbetrieb dabei ist, dazugehört, mitwirkt; dann ist es normal, daß keiner mehr aus dem Miteinander der Verschiedenen ausgeschlossen wird.
Und wenn all dies ernstgenommen wird, dann sind Gemeinwesen der Ort, wo Menschen die Gleichheit der Verschiedenen erkennen und anerkennen lernen und die Gleichbehandlung der Verschiedenen entwickeln. Sie verweisen keinen Menschen mehr in besondere Schutz- und Fördereinrichtungen als eigene Lebenswelten "unter ihresgleichen"; sie entdecken Menschen mit einem besonderen Hilfeleistungs- und Therapiebedarf als integrative Kräfte und entwickeln miteinander lebendige und lebensförderliche Vielfaltsgemeinschaften. Sie sprechen jedem Menschen das Recht auf Dazugehörigkeit und auf die persönliche Assistenzleistung zu, die ein Mensch braucht, um sein Leben in Dazugehörigkeit und in Selbstbestimmung führen zu können. Sie schaffen Instanzen, bei denen Beschwerden über Verstöße gegen diesen Rechtsanspruch eingebracht werden können und mit denen konkrete Schritte zur konsequenten Verwirklichung von Gleichachtung und Gleichbehandlung eingeleitet werden können.
Das was wir als Gemeinwesen vorfinden, ist häufig unterentwickelt. Es ist durchaus zu fragen:
Wo sind die Partner der Integration zu finden, wo sind Einzelne und Gruppen zu finden, bei denen sich Menschen mit Behinderung als Partner oder als Teilnehmer einbringen könnten? Wo findet denn hier das Leben statt, an dem es Spaß und Gewinn brächte, sich als Mensch mit Behinderung zu beteiligen? Wie müssen wir unser Zusammenleben im gemeinsamen Gemeinwesen gestalten, damit es Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten für jeden bietet, damit keiner unter uns vereinsamt und verloren geht?
Die Unterentwicklung unserer Gemeinwesen hängt damit zusammen, daß wir uns häufig der Möglichkeiten und der Bedeutung des Gemeinwesens nicht genügend bewußt sind. John McKnight[22] weist darauf hin, wie sehr unser Vorstellungs- und Wahrnehmungsmuster, mit dem wir die gesellschaftliche Wirklichkeit wahrnehmen, die Landkarte, die wir von der sozialen Welt im Kopf haben, in der Regel reduziert ist auf zwei Komponenten: auf Individuen und auf Institutionen, wie sehr wir gewohnt sind, das Gemeinwesen in seiner Bedeutung als dritte Größe zu übersehen.
Die Institutionen kennzeichnet er als große, durchstrukturierte, hierarchische, letztlich von einem Leiter geführte Unternehmen, die normierte Produkte produzieren, wie Stahl oder Autos, so auch Bildung, Gesundheit, Rechtsprechung und soziale Dienstleistungen. Auch wenn solche sozialen Dienstleistungsunternehmen sich extramural bzw. mobil statt stationär oder teilstationär, organisieren, trifft auf sie die gleiche Kennzeichnung zu. So oder so sind sie mit McKnight zu kritisieren:
-
weil sie die Individuen zu ihren Produktkonsumenten machen und ihren Bedingungen anpassen, soweit sie sich nicht als "eigensinnig", "starrköpfig", "unbehandelbar" und "uneinsichtig" entziehen (!), weil diese Unternehmen immer mehr Macht entwickeln und die Individuen immer mehr verunselbständigen und schwächen, statt sie zu stärken, weil sie mit ihren Konzepten von Therapie, Dienstleistung und Stellvertretung die Individuen auf ihre Defizite, Fehlbarkeiten und Schwächen fixieren, statt auf ihre immer auch vorhandenen Fähigkeiten, und weil sie mit ihrer Perfektions- und Machtentwicklung die Kosten in unbezahlbare Höhen treiben, und
-
weil sie die Bedeutung des Gemeinwesens ignorieren und verdrängen, weil sie die sozialen Kräfte des Gemeinwesens schwächen und zerstören, weil sie das Gemeinwesen entfunktionalisieren.
Doch gerade dies Gemeinwesen, die community, mit all ihren Vereinigungen, mit ihren associations, gilt es als dritte Komponente unserer sozialen Wirklichkeit wiederzuentdecken und neu zu entwickeln.
"Mit community meinen wir den sozialen Ort, der gebraucht wird von Familie, Freunden, Nachbarn, Nachbarschaftsorganisationen, Clubs, Bürgergruppen, örtlichen Unternehmen, Kirchen, ethnischen Organisationen, Tempeln, lokalen Gewerkschaften, lokalem Parlament und lokalen Medien. Zusätzlich zur Bezeichnung als community wird diese soziale Umwelt auch beschrieben als der informale Sektor, als die nicht gemanagte Umwelt und als der Bereich selbstbestimmter Vereinigungen."[23]
Mit folgenden Unterscheidungen präzisiert McKnight die Bedeutung des Gemeinwesens:
Während die managementmäßig strukturierten Dienstleistungsunternehmen im Endergebnis Kontrolle über Menschen ausüben, arbeiten die Menschen in Gemeinwesengruppierungen und -organisationen über Verständigungsprozesse und Einverständniserklärungen aller Beteiligten zusammen.
Während durchorganisierte Dienstleistungsunternehmen hierarchische Macht ausüben, erfahren im Gemeinwesen alle eine wechselseitige Angewiesenheit aufeinander, eine Vielfalt von Zusammenwirkungsmöglichkeiten in Gegenseitigkeit.
Während das produktorientierte Dienstleistungsunternehmen Menschen auf Perfektion hin bearbeitet, geht es beim Zusammenleben im Gemeinwesen darum, jedem mit seinen Stärken und seinen Schwächen eine Rolle im Miteinander zu erschließen.
Während soziale Großunternehmen nur schwerfällig und langsam auf die unterschiedlichsten und immer wieder auch neuen individuellen Nöte von Menschen reagieren, haben die Gruppen und Vereinigungen des Gemeinwesens die Fähigkeit, schnell und flexibel zu antworten, ohne einen Menschen erst in ein System hineinzuzwingen, aus dem mancher nicht mehr so leicht herauskommt.
Während Institutionen bzw. Sozialunternehmen dazu neigen, kreative Ideen zu kanalisieren und zu standardisieren, fördern und multiplizieren die Vielfaltsgemeinschaften des Gemeinwesens kreative Problemlösungen.
Während die großen Apparate sich schwertun, den Einzelnen als individuelle Person wahrzunehmen, begegnen im Gemeinwesen sich die Menschen "von Angesicht zu Angesicht" und ihre Gruppierungen und Organisationen schaffen es "handgeschneiderte" Lösungen zu gestalten.
Während die Dienstleistungsunternehmen immer wieder nur Dienstleistungen als Ware abliefern, vermittelt das Gemeinwesen mit seinen verschiedensten Formen von Gemeinschaften persönliche Anteilnahme (care).
Während Dienstleistungsinstitutionen Menschen ihre Möglichkeiten nehmen, sich als Bürgerinnen und Bürger an demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten zu beteiligen, ist das Gemeinwesen "das Forum, in dem Bürgerschaft (citizenship) zum Ausdruck gebracht werden kann."[24]
"Diejenigen, die die community-Vision zu verwirklichen suchen, glauben, daß das Gesellschaftskonzept von Gemeinwesengruppierungen und Gemeinwesenorganisationen über (von) Therapie und Stellvertretung (bestimmten Gesellschaftskonzepten) hinausgeht. Sie haben eine Gesellschaft vor Augen, in der diejenigen, die einst etikettiert, ausgesondert, behandelt, beraten, stellvertreten und beschützt wurden, in ein Gemeinwesen hineingenommen werden, wo ihre Beiträge, Fähigkeiten, Gaben und Fehler ein Netzwerk von Beziehungen möglich machen im Hinblick auf Arbeit, Freizeit, Freundschaft, Unterstützung und auf die politische Kraft der Erfahrung, ein Bürger zu sein."[25]
Als besonders wichtig für diese Bedeutung des Gemeinwesens faßt McKnight zusammen:
-
Fähigkeits- statt Defizitorientierung
-
Zusammenarbeit, Gemeinschaftseinsatz, Beteiligung vieler
-
Vielfalt von Assoziierungen, die jedem auch mit seinen Schwächen einen Platz bieten
-
Lebensgeschichten statt Aktenberichte
-
Feste, Feiern, Lachen, Singen, als Ausdruck von Gemeinschaft
-
Zeit für Teilnahme an Tragödien, Leiden, Tod.
"Zu einem Gemeinwesen zu gehören bedeutet, ein aktiver Teil von Vereinigungen und von Selbsthilfegruppen zu sein. Zu einem Gemeinwesen zu gehören heißt, ein Teil vom Ritual, von der Wehklage und von der Feier unserer Fehlbarkeit zu sein."[26]
"Viele von uns sind dazu gekommen, wieder zu erkennen, daß wir dann, wenn wir unsere fehlerhaften Nachbarn unter die Kontrolle von Managern, Therapeuten und Technikern verbannen, viel von unserer Kraft verlieren, ein lebendiges Zentrum unserer Gesellschaft zu sein. Wir vergaßen die Fähigkeiten eines jeden einzelnen, gute Arbeit zu tun, und machten stattdessen einige von uns zu Objekten von guten Arbeiten - zu Dienern von denen, die dienen."[27]
"Wir alle wissen, daß das Gemeinwesen das Zentrum unseres Lebens sein muß, weil wir nur hier Bürger sein können. Einzig im Gemeinwesen können wir Anteilnahme finden. Einzig im Gemeinwesen können wir Leute singen hören. Und wenn du aufmerksam zuhörst, kannst du die Worte hören: Ich nehme Anteil an dir, weil du zu mir gehörst und ich zu dir."[28]
Angesichts der aktuellen Erfahrung, daß immer mehr managementmäßig organisierte Firmen jetzt auch ambulante bzw. mobile Dienstleistungen für Menschen, die auf Grund von Alter oder Behinderung o.a., Dienste benötigen, als Ware auf dem Markt anbieten, ohne viel nach den sozialen Zusammenhängen dieser Menschen zu fragen, halte ich die hier referierten Gedanken von John L. McKnight für besonders wichtig. Zur Verdeutlichung und Abrundung möchte ich deswegen McKnight abschließend mit einem besonders eindrucksvollen Beispiel zitieren, von dem er in einem anderen Beitrag berichtet[29] und an dem wir alle Entwicklung von Dienstleistungen und die Entwicklung unseres Zusammenlebens immer wieder überprüfen sollten:
"In einer kleinen, relativ isolierten Gemeinschaft auf der Insel Martas Vinejard wurde ungefähr einer von zehn Menschen mit Taubheit geboren. jeder in der Gemeinschaft, Taube und Hörende, gebrauchte eine besondere Gebärdensprache, die sie aus England mitgebracht hatten, als sie 1690 von dort nach Massachussets emigrierten. In der Mitte des 20. Jahrhunderts, als die Mobilität zunahm, verringerte sich die Anzahl der Heiraten untereinander und diese genetisch bedingte Besonderheit verschwand.
Aber bevor die Erinnerung daran abstarb und damit auch die Gebärdensprache, studierte die Historikerin Nora Groce die Geschichte dieser Gemeinschaft. Sie verglich die Erfahrungen der Tauben mit denen der Hörenden.
Sie entdeckte, daß 80 Prozent der tauben Menschen die mittlere Schule durchlaufen hatten bei gleichfalls 80 Prozent der hörenden. Sie entdeckte, daß 90 Prozent der Tauben heiratete bei 92 Prozent der Menschen, die nicht taub waren. Beide Gruppen bekamen ungefähr gleich viele Kinder. Ihr Einkommen kam aufs gleiche hinaus und auch die Vielfalt an Berufsentwicklungs- und Arbeitsmöglichkeiten.
Anschließend führte Groce eine Parallelstudie auf dem Festland von Massachussets durch. In der Zeit galt dieser Staat als der mit dem besten System von Dienstleistungen für Menschen mit einer Hörbehinderung. Sie fand, daß 50 Prozent der Tauben die mittlere Schule mit Erfolg durchliefen gegenüber 75 Prozent der Hörenden. Nur die Hälfte aller tauben Menschen heirateten gegenüber 90 Prozent von der übrigen Bevölkerung. 40 Prozent der Familien mit einem tauben Ehepartner bekamen Kinder gegenüber 80 Prozent bei den übrigen Familien. Ihr Einkommen lag auf dem Niveau von einem Drittel des Einkommens von nicht tauben Menschen. Ihre Berufswahlmöglichkeiten waren sehr viel mehr eingeschränkt. Wie konnte das möglich sein, frug Groce sich, daß auf der Insel ohne jegliches Dienstleistungssystem Menschen mit und ohne Hörbehinderung einander so gleichgestellt waren, daß man keine Unterschiede messen konnte? Und das während in einem Abstand von nur 50 Kilometern weiter weg in einer Gesellschaft mit einem bestentwickelten Dienstleistungssystem, die Menschen mit einer Hörbehinderung ein viel ärmeres Leben führten als die anderen.
Der einzige Platz in den Vereinigten Staaten, wo Taubheit keine Behinderung war, kannte keine Dienstleistung für taube Menschen. In dieser Gemeinschaft hatte jeder sich über Gebärdensprache angepaßt anstatt Menschen an Fachleute zu delegieren und an deren System von Dienstleistung. Die Gemeinschaft tat nicht nur das, was nötig war, um einer Gruppe von Menschen zu helfen. Nein, sie tat, was nötig war, damit jeder zur Gemeinschaft gehören konnte.
Ich habe in den letzten 36 Jahren viele Nachbarschaften, Nachbarschaftsvereinigungen und Gemeinschaften in großen Städten besucht. Ich habe niemals erfahren, daß Dienstleistungen Menschen dazu gebracht haben, daß sie sich wohlfühlten, sie zu anerkannten Bürgern machten oder daß sie sie befreiten."[30]
Um das Gemeinwesen in seiner Bedeutung zu bewahren bzw. zu entwickeln, gilt es auch systematische, methodische Arbeit zu investieren.
Gemeinwesenarbeit - community work und community organizing, Stadtteilarbeit, Nachbarschaftsarbeit, sozial-kulturelle Arbeit -zielt nicht primär auf die Hilfe für bestimmte Einzelne oder für bestimmte Interessengruppen; sie hat sich deswegen ja auch als eigene dritte Methode der Sozialarbeit, neben Einzelhilfe und Gruppenarbeit, ausgeprägt. Gemeinwesenarbeit zielt also auch nicht darauf, irgendeine Form von Behindertenarbeit zu entwickeln. Gemeinwesenarbeit zielt vielmehr darauf, das Gemeinwesen insgesamt zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens, Selbsthilfeprojekte, Gemeinschaftsaktivitäten, Geselligkeitsformen zu entwickeln, die für viele Verschiedene interessant sind, die von vielen mitgestaltet und mitgenutzt werden können.
Die Bedeutung, die die Gemeinwesenarbeit hat, wird mit dem folgenden - unvollständigen - Aufgabenkatalog wenigstens ansatzweise konkretisiert:
-
Aufbau lebendiger, attraktiver Kinder- und Jugendarbeitsangebote, die auch für Kinder/Jugendliche mit Behinderung Beteiligungsmöglichkeiten bieten
-
Weiterentwicklung von vielfältigen Breitenkultur und Breitensport- und Spielangeboten mit Mitmachmöglichkeiten für jeden
-
Organisation von Nachbarschaftskontakten und Nachbarschaftshilfen, auch von Nachbarschaftsvereinen
-
Aufbau von Gemeinschaftsgärten, Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftswerkstätten (Fahrradreparaturwerkstatt, Möbelrenovierungswerkstatt u.a.)
-
Aufbau von Tauschzentralen, Care-Sharing-Stellen o.ä.
-
Förderung einer Vielfalt von Vereinsleben und von Clubangeboten
-
Organisation von Festen und Feiern
-
Organisation von Selbsthilfeunterstützungskreisen, runden Tischen, Gemeinwesenkonferenzen u.a.
-
Kommunikative Ausgestaltung von Straßen, Plätzen, Läden, Haltestellen u.a.
Um diese Aufgaben und weitere mehr anzugehen, hat die Gemeinwesenarbeit vor allem folgende Methoden bzw. Methodenschritte:
-
Einzelne Menschen entdecken (durch Aufmerksamkeit im Rahmen vorhandener Begegnungsmöglichkeiten, durch aktivierende Befragung aller Bürgerinnen und Bürger eines überschaubaren Bereiches, durch Einladung zu Angeboten und Projekten), die mit ihren eigenen Lebensbedingungen im Stadtteil, mit ihren Kommunikations-, Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten im Gemeinwesen unzufrieden sind, die nach lebensförderlichen und zukunftsweisenden Alternativen konkurrenzfreien, kommunikativen und solidarischen Miteinanders suchen.
-
Die einzelnen Interessierten aus überschaubaren Bereichen miteinander in Kontakt bringen, regional und thematisch orientierte Gruppen bilden, Gruppenarbeit organisieren, selbsterarbeitete Problemlösungen und politische Interessenvertretung miteinander betreiben.
-
Mit (Initiativ-)Gruppen größere Veranstaltungen und Gemeinschaftsprojekte ausgestalten, die dann ihrerseits viele zur Teilnahme und zum Mitmachen motivieren.
-
Gruppen mit anderen Gruppen vernetzen, runde Tische (vor Ort) und Netzwerke (überörtlich) organisieren, um mehr Probleme erfolgreicher lösen zu können und um mehr politischen Einfluß zu gewinnen, um die politischen Rahmenbedingungen zu verbessern, um die Gegenmächte mehr gesetzlichen Regulierungen und Kontrollen unterwerfen zu können.
Auch die oben beschriebenen Methoden der individuellen Zukunftsplanungs-Konferenz und der Freundeskreis-Organisation seien in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich erwähnt, weil sie als Methoden, die nicht nur auf die einzelnen Menschen mit Behinderung, sondern auch auf die Menschen um sie herum und auf die Entwicklung von Gemeinschaft ausgerichtet sind, auch der Gemeinwesenarbeit zuzurechnen sind.
Bei erfolgreicher Gemeinwesenarbeit bewirkt die Beteiligung an den Gemeinschaftsentwicklungen immer auch ein soziales Wachstum aller beteiligten Einzelnen:
-
ein Lernen und Erweitern von Verständnis- und Kommunikationsfähigkeiten, dieses zum Beispiel auch im Hinblick auf Menschen, die sich auf Grund einer Behinderung nicht verbal äußern können, aber sehr wohl andere Kommunikationsmöglichkeiten haben;
-
ein Wachsen in sozialer Verantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit;
-
ein Gewinn an Selbstvertrauen, zum Lösen von Problemen konstruktiv und kreativ beitragen zu können und damit auf alle Gewalt verzichten zu können;
-
eine Bereicherung durch die Erfahrung, daß jeder, in all seiner Unterschiedlichkeit, mit welchen Fähigkeiten und Schwierigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten auch immer, etwas für alle beiträgt, und in seiner Beteiligung an der Vielfaltsgemeinschaft eine Rolle für die anderen spielt.
Das Miteinander, das gemeinschaftliche Tun im Gemeinwesen wird bezahlte Dienstleistungen nicht ersetzen, sollte sie aber mitgestalten und sich durch sie nicht entfunktionalisieren lassen. Gemeinwesenarbeit führt zur Wiederentdeckung und Vergewisserung, daß das menschliche Miteinander mehr bedeutet als professionelle Dienstleistungen.
Wenn jemand die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung im Rahmen des Zusammenlebens aller für eine Illusion hält, weil es hier, im Gemeinwesen, in Wirklichkeit mehr an Einschränkungen, an Gefahren, an Frustrationen und damit auch an Fremdbestimmung gibt als in beschützenden Sonderwelten, dann ist demgegenüber geltend zu machen, daß die gemeinschaftszersetzenden Lebensbedingungen und die fremdbestimmenden Mächte hier auch die Mehrheit der nichtbehinderten Menschen beherrschen, und daß es darauf ankommt, Selbstbestimmung nicht nur für Einzelne, sondern auch für das Gemeinwesen einzufordern. Selbstbestimmung muß es auch in der Form der Selbstorganisation auf der Grundlage gemeinsamer Interessen, in der Form gemeinschaftlicher Eigenverantwortlichkeit, in effektiven Beteiligungsmöglichkeiten an Stadtpolitik geben, in gemeinsamer Abwehr von destruktiven Übermächten.
Eine Voraussetzung dafür ist die Überschaubarkeit. die Selbstorganisation braucht überschaubare Räume und hat ihre Grundlage in persönlichen Kontakten und konkreten Erfahrungen. Was wäre, wenn wir in der Überschaubarkeit einer Gemeinschaft von etwa 10.000 Menschen zusammenleben würden, wenn keine Instanzen außerhalb dieser Gemeinschaft verantwortlich wären, sondern tatsächlich wir selber die Hauptverantwortung für unsere Lebensbedingungen hätten? Wie würden wir unser Zusammenleben dann gestalten wollen? Wie würden wir unsere Verantwortung füreinander und für unsere Gemeinschaft wahrnehmen? Wie würden wir die Größe unserer Nachbarschaften bemessen? Was für ein städtebauliches Gesicht würden wir unserem Zusammenwohnen geben wollen? Wie würden einzelne Menschen mit Behinderung im Zusammenleben aller dazugehören? Wer würde was an Hilfeleistung im Vollzug des Zusammenlebens verwirklichen?
Die kleine Zahl von Menschen mit Behinderung würde gar nicht als Gruppe definiert, sondern es wären einzelne Menschen mit ihren persönlichen Lebensgeschichten, umgeben von Menschen, die sie mit Namen, mit ihren Angehörigen, mit ihrer Geschichte persönlich kennen. Da wäre vielleicht ein einziger Mensch mit einer sehr schweren mehrfachen Behinderung, zu dem viele Menschen durch Beteiligung an der praktischen Hilfeleistung sowie als Nachbarn und Bekannte einen Kontakt hätten. Es wäre für viele erfahrbar, wie sehr gerade er mit seinem Hilfe- und Zuwendungsbedarf eine integrative Kraft darstellt und einen Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens bildet.
Die Zahl wäre zu klein, um Sondereinrichtungen zu schaffen und Sonderdienste zu organisieren. Und die Nähe in den alltäglichen Begegnungen, die persönlichen Erfahrungen des Miteinanders in allen Lebensbereichen, die Kommunikation in gewachsenen Nachbarschaften und in den öffentlichen Räumen würde zu mehr Mitmenschlichkeit und Mitverantwortlichkeit herausfordern.
So wie es deutliche Vorstellungen und politische Konzeptionen davon gibt, den eigenen, überschaubaren Lebensort im Hinblick auf die ökologischen Lebensbedingungen und auf die Arbeitsbedingungen und auf die Wirtschaftsformen eigenverantwortlich auszugestalten, so ist die Wahrnehmung von Eigenverantwortlichkeit in Überschaubarkeit auch im Hinblick auf die sozialen Lebensbedingungen und damit auf die Kultur des Zusammenlebens zu entwickeln.
"Allerdings gibt es quantitative Ober- und Untergrenzen. Wenn ein Sozialsystem zu groß wird, stellen sich Anonymität und Verantwortungslosigkeit ein. So ist es erforderlich für eine Organisation, daß sich die daran beteiligten Menschen hin und wieder treffen und miteinander sprechen. Ist dies nicht der Fall, so kann sich niemand in dieser Organisation sicher sein, daß man gemeinsame Ziele verfolgt und auf das Vertrauen der anderen bauen kann. 10.000 Menschen sind für ein solches Modell schon das Höchstmaß. Meine Ministädte in "Ökotopia" hatten deshalb ungefähr diese Einwohnerzahl."[31]
"Die Grundeinheit für Ökopolis bewegt sich in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohner. Darüber hinausgehende Städte und Gemeinden sind addierte Bausteine dieser Einheit. Diese ausgewählte Größenordnung ergibt sich aus den im folgenden beschriebenen Kriterien ökologischer Umgestaltung. Durch die geringe Grundgröße ist gewährleistet, daß die betroffene Bürgerschaft am Planungs- und Gestaltungsprozeß aktiv teilhaben kann. Aus Erfahrungen mit bestehenden Siedlungsformen ist abzulesen, daß in dieser Siedlungsgröße von dem einzelnen Bürger größte, aktive Teilnahme am Planungs- und Entwicklungsprozeß möglich ist."[32]
"Bekanntlich können Solidarität und Verantwortung und letztlich auch Gemeinschaft nur im überschaubaren Raum wachsen. Das sind Bereiche von einer Größe, in denen die Menschen füreinander nicht nur Ziffern oder Zahlen sind, sondern Gesichter, Namen und Schicksal haben. Um dieser Solidarität und Verantwortung und um der Tatsache willen, daß beides für jedes Gemeinwesen unverzichtbar ist, muß es zu einem Hauptanliegen jeder Sozialpolitik werden, die Entstehung solcher Räume zu fördern."[33]
"Es ist eine Binsenweisheit, daß der Mensch nur im überschaubaren Rahmen Verantwortung entwickeln und ausüben kann. Sobald dieser Rahmen gesprengt wird, wächst die Verantwortungslosigkeit und das Anspruchsdenken. Beides geht einher mit einer Art "marktwirtschaftlichem" Denken, nämlich dem permanenten Versuch, mit möglichst geringem eigenen Einsatz möglichst viel für sich selbst herauszuholen ...
Die Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu entwickeln und auszuüben hängt also entscheidend davon ab, ob die Räume, innerhalb derer verantwortlich gehandelt werden soll, in ihrer Größe überschaubar bleiben. Sie bleiben überschaubar und entsprechen dem menschlichen Maß, wenn die Menschen, gegenüber denen verantwortlich gehandelt werden soll, Menschen sind und bleiben und nicht zu Nummern und Zahlen herabsinken. Sie bleiben Menschen, so lange sie einen Namen, ein Gesicht und ein Schicksal haben für den, der verantwortlich mit ihnen umgehen soll. Solange das Gegenüber Name, Gesicht und Schicksal hat, fällt es - wie jedermann weiß - sehr viel schwerer, unmenschlich zu handeln. Es geschieht deshalb nicht selten mit eindeutiger Absicht, diesen Rahmen organisationstechnisch zu sprengen, um eben unmenschlich handeln zu können."[34]
[22] John McKnight: Regenerating Community. Social Policy, Winter 1987.
[23] John McKnight, a.a.O.
[24] John McKnight, a.a.O.
[25] John McKnight, a.a.O.
[26] John McKnight, a.a.O.
[27] John McKnight, a.a.O.
[28] John McKnight, a.a.O.
[29] John McKnight: Waarom dienstbaarheid slecht is: In: Wieringa, Kahn, Brent: Nieuwe Kijk Op Zorg. Oegstgeest, 1993)
[30] John McKnight, a.a.O
[31] Ernest Callenbach: Erfahrungen aus Ökotopia. Seite 97, in: Rüdiger Lutz (Hrsg.): Pläne für eine menschliche Zukunft. Weinheim/Basel, 1988.
[32] Rüdiger Lutz und Thomas Krötz: Ökopolis - ein Konzept für eine menschen- und umweltgerechte Stadt. Seiten 320 f. In: Rüdiger Lutz (Hrsg.): a.a.0.
[33] Wilhelm Haller: Ohne Macht und Mandat. Wuppertal, 1992, Seite 94.
[34] Wilhelm Haller, a.a.O., Seiten 129 f
Inhaltsverzeichnis
- 7.1. Kritik entsolidarisierender Sozial- und Wirtschaftspolitik
-
7.2. Kritik perfektionistischer Fortschrittsethik
- 7.2.1. Gehirntoddefinition und Organtransplantationspraxis
- 7.2.2. Fristenlösung für Schwangerschaftsabbruch und Fristverlängerung bei Behinderungsindikation
- 7.2.3. Zulassung des Tätens auf Verlangen (Aktive Sterbehilfe, "Euthanasie")
- 7.2.4. Begrenzung der ärztlichen Behandlungspflicht und Verknappung des medizinischen und sozialen Angebotes
- 7.2.5. Gentechnologie und Reproduktionsmedizin
- 7.2.6. Sduberung des Fortschritts von seinen Opfern
- 7.2.7. Dynamik des Zusammenwirkens der verschiedenen Perfektionierungsprojekte und Gefahr alptraumartiger Entwicklung unseres Zusammenlebens
Ich glaube an die Alltäglichkeit des Guten. Ich glaube, daß viel mehr Menschen als es den Anschein hat, daran interessiert sind und darin engagiert sind, Gutes und Güte in ihrem Alltag zu praktizieren und zu erfahren, wie dies auch ihnen selber guttut. Deswegen gilt auch hier: Nichts Besonderes!
Und ich glaube, daß dies durch die Weiterentwicklung integrativen Zusammenlebens und Zusammen-Arbeitens zu stärken ist. Immer mehr Menschen werden aus den Erfahrungen des Zusammenlebens lernen, daß sie Mitmenschlichkeit ohne Aussonderung wollen, weil ihnen Kommunikation und Hilfeleistung in Praxis gelingt und Spaß bringt.
Genauso wie ich dies glaube, so weiß ich auch von der Banalität des Bösen. Es gibt die Skrupellosigkeit, die Gefühllosigkeit, die Gewissenlosigkeit, vor der Verletzung von Menschen und Menschenrechten nicht zurückzuschrecken, um sich einfache egoistische Bedürfnisse vordergründig zu erfüllen. Um dem zu wehren, müssen die Menschenrechte und die darauf aufbauenden Gesetze mit staatlicher Gewalt wirksam gemacht werden.
Doch es gibt noch etwas Drittes: die "gut bürgerliche" Vorteilnahme, der gesellschaftlich anerkannte und belohnte Egoismus. Diese Vorteilnahme, dieser Egoismus kommen nicht in der Offenheit des banalen Bösen, des Raubens und der Gewalt daher, sondern in der Verkleidung von Fortschrittsideologie und Fortschrittsethik. Sie versuchen, sich als gut darzustellen, sich ethisch zu rechtfertigen - mit allen möglichen Versprechungen, Behauptungen, Definitionen, Begründungen. Sie entwickeln höchst rationale, höchst wissenschaftliche Systeme, um die einfache, unwissenschaftliche Stimme des Gewissens zum Schweigen zu bringen.
Das bedeutet nicht, daß jeder, der in irgendeinem Teilbereich entsolidarisierende Fortschrittsethik entwickeln hilft, dies bewußt in solcher Absicht tut. Doch es gilt zu erkennen und zu kritisieren, daß vieles, was heute als Ethik firmiert und sich als Konsensethik anbiedert, gesellschaftlichen Entsolidarisierungs- und Destruktionsmächten dient, bzw. von diesen entsprechend instrumentalisiert wird. Es gilt zu erkennen und zu kritisieren, wie sehr die fortschritts- und bioethischen Argumentationen dazu beitragen, die Menschenrechte auszuhöhlen und die Gerechtigkeitsgesetze einzuschränken, die zum Schutz vor dem banalen Bösen uneingeschränkt gewahrt werden müßten.
Viele Entwicklungen der Sozial- und Wirtschaftspolitik wirken wie große Entsolidarisierungsprojekte und erweisen sich letztlich mitsamt ihrer ethischen bzw. pseudoethischen Argumentation als nichts anderes denn als Instrumente der Bereicherung und des Machtgewinns der einen auf Kosten der anderen. Als ein typisches Beispiel dafür kann die gängige Praxis von Prioritätensetzung und Grenzziehung bei der Finanzmittelvergabe für "Behindertenhilfe" gelten.
Investitionen in Therapie, in sonderpädagogische Förderung, in Eingliederungshilfen werden nur soweit akzeptiert, wie sie sich lohnen. Sie müssen sich dadurch bezahlt machen, daß sie möglichst selbständig und leistungsfähig machen, daß sie zu deutlichen Einsparungen an dauerhaften Hilfe- und Pflegeleistungen führen. je weniger es sich lohnt, je "undankbarer" ein Mensch mit seiner Problematik ist, je geringer die Erfolgsaussichten sind und je mehr Hilfeleistung deswegen ein Mensch eigentlich benötigt, desto weniger wird ihm in der Regel gewährt.
Die Zustimmung zu neuen Entwicklungen, wie zum Beispiel zur Integration von Kindern mit Behinderung in Regelschulen, wird an die Bedingung der Kostenneutralität gebunden. Die Förderung mobiler Assistenzdienste wird vom Nachweis der Kostenersparnis in anderen Dienstleistungsbereichen abhängig gemacht.
Viele Bereiche der Behindertenhilfe sind nach wie vor der Sozialhilfe zugeordnet und damit armenhilferechtlichen Kriterien untergeordnet. Die finanzielle Mehrbelastung von Familien durch die Behinderung eines Angehörigen müßte als Ganzes von der Solidargemeinschaft getragen werden, um uneingeschränkte Akzeptanz zum Ausdruck zu bringen und Gleichberechtigung zu unterstützen. Doch selbst die für 1995 beschlossene Pflegeversicherung begrenzt die Versicherungsleistungen für ambulante Dienste in allen drei Pflegestufen derart, daß die Angehörigen entweder Dienstleistungen in immer noch überbelastendem Umfang selber leisten müssen oder für die Kosten der Dienste durch Dritte ergänzende Sozialhilfefinanzierung beanspruchen müssen, die sie aber nur gewährt bekommen, wenn ihr Einkommen und Vermögen unter den - armenhilferechtlichen! - Grenzen bleibt. Wenn sie mehr Einkommen und Vermögen haben, müssen sie privat zahlen, d.h. andere Ausgaben einsparen und Vermögen bis auf einen kleinen Rest verbrauchen. Eine Solidarleistung für behinderungsbedingte Mehrbelastungen gibt es oberhalb der sozialhilferechtlichen Grenzen dann grundsätzlich nicht mehr.
Die nach wie vor geübte Praxis des Unrechts, die strukturelle Etablierung von Aussonderung und Benachteiligung hat keinen Grund in der Behinderung eines Menschen, sondern diese Praxis des Unrechts benutzt die Behinderungsdefinitionen lediglich als Vorwände zur Rechtfertigung der Bereicherung der einen auf Kosten der anderen, zur Festigung der Ellenbogengesellschaft als Normalzustand. Die Behinderung der einen ist den anderen ein willkommenes Instrument zum Ausbau der eigenen Position, zum Ablehnen der Ansprüche anderer darauf, das eigenmächtig in Besitz Genommene gerechter zu verteilen. Als Unrechtspraxis ist die Benachteiligung und Entrechtung von Menschen mit Behinderung kein Sonderfall, sondern systembedingt: ein Element der Schwächung, Verarmung, Verelendung und Entrechtung vieler Menschen im eigenen Land und von ganzen Bevölkerungsmehrheiten anderer Länder weltweit einerseits und des ungehemmten, ungeregelten, unkontrollierten Zuwachses an Reichtum und Macht von vergleichsweise wenigen andererseits.
Obwohl unser Staat eine große, mehr oder weniger wachsende Gesamtsumme für Sozialleistungen ausgibt, geraten auf der einen Seite immer mehr Menschen in Armut, Verschuldung, Obdachlosigkeit, Elend, während auf der anderen Seite der Geldreichtum der Reichen wächst und wächst und sich - durch internationale Firmenorganisationen und transnationale Finanzaktionen - erfolgreich einer mehr Gerechtigkeit schaffenden Umverteilung entzieht. Es stimmt nicht, daß nicht genügend Geld für angemessenere Sozialleistungen da sei, und daß weiterer Wirtschaftsfortschritt notwendig sei, um wieder mehr Arbeitsplätze und damit bessere Verdienste und mehr Steuereinnahmen zu schaffen. Die immer noch voranschreitende Technisierung und Automatisierung der industriellen Produktion schafft vielmehr ein Produktionswachstum mit immer weniger Arbeitskräften. Die Entwicklung führt nicht zu weniger, sondern zu immer mehr Arbeitslosen und zugleich zur Ansammlung immer größeren Reichtums bei wenigen. Und nur weil sich dieser Reichtum einer angemessenen Umverteilung weitgehend entzieht, ist der Staat gezwungen, bei der wachsenden Zahl von Bedürftigen die Sozialleistungen für den Einzelnen abzubauen. Dieser Abbau ist so weitreichend, daß die Hoffnungslosigkeit vieler Menschen zunimmt, daß das persönliche Engagement für die eigene Zukunft und der solidarische Einsatz für andere abnehmen, daß die Lebenssituation von Hilfebedürftigen häufig entwürdigend wird.
All dies hat nicht nur mit dem individuellen Egoismus von Einzelnen zu tun, sondern auch mit der Entwicklung unserer kapitalistischen Marktwirtschaft insgesamt, mit der zunehmend transnationalen Konzentration von Wirtschafts- und Finanzmacht und mit dem Verlust an politischen Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten durch die von den Folgen betroffenen Menschen.
"Die gegenwärtige Situation des sogenannten neo-liberalen kapitalistischen Weltsystems ist entscheidend geprägt durch die Transnationalisierung und Deregulierung der Kapitalmärkte und ihrer Akteure. Dabei ist zu beachten, daß Finanz-, Industrie- und Handelskapital total verflochten sind. Das Finanzkapital hat die Führung und damit einen umfassenden Charakter gewonnen. Seit dem Aufhören der Systemkonkurrenz und der Schwächung der Gegenmacht der Arbeitenden auf Grund neuer arbeitssparender Technologien kann sich die Macht des mobilen Kapitals weltweit durchsetzen und die (räumlich begrenzten) Menschen und Staaten gegeneinander ausspielen.
Entsprechend hat die mehr oder weniger ungehinderte Kapitalverwertung einschneidende Folgen für die Gesellschaften in Süd, Ost und Nord - desto stärker, je schwächer das Gegenüber ist. So treibt die Schere zwischen arm und reich in und zwischen den Ländern auseinander. Das Grundelement ist so: Die Verschuldeten und Arbeitslosen sind die Hauptverlierer; die Arbeitenden erhalten weniger Steigerung ihrer Löhne, als das reale Wirtschaftswachstum nahelegen würde; die Gewinne der Unternehmer liegen relativ, die der Geldvermögensbesitzenden (wegen des Zinseszinsmechanismus) exponentiell über der Wachstumslinie. So ist seit den siebziger und achtziger Jahren eine extreme Umverteilung von unten nach oben, von Süd nach Nord und von Ost nach West festzustellen."[35]
Wenn es um mehr Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung geht, dann geht es immer auch um mehr Gerechtigkeit für alle Menschen. Und wenn es um mehr Gerechtigkeit, um mehr Menschlichkeit geht, dann muß es auch darum gehen, die Dominanz einer zum Selbstzweck gewordenen Wirtschaft zu überwinden und alles Zusammenleben und Zusammenarbeiten grundlegend und deswegen immer auch politisch neu am Menschen zu orientieren.
So ist es letztlich nicht nur wichtig und notwendig, das gesamtwirtschaftlich erwirtschaftete Geld gerechter zu verteilen, so gerecht zu verteilen, daß jeder Mensch die Mittel erhält, sein Leben menschenwürdig zu gestalten; es ist zugleich auch die einseitige Prägung des Menschenbildes durch die Wirtschaftsbedingungen und Wirtschaftsinteressen zu überwinden, es ist der Einfluß der "ökonomistischen Auffassung des Menschen als geld- und konsumvermehrenden Marktmenschen" zurückzudrängen. Denn die Reduzierung oder Verzerrung des Menschseins auf den "Marktmenschen", auf den "homo oeconomicus" bedeutet im einzelnen:
-
"Der Marktmensch trachtet nicht nach der Befriedigung seiner begrenzten lebensnotwendigen Grundbedürfnisse, sondern aus Todesfurcht nach der Erfüllung seiner unbegrenzten, künstlichen Begierden, nach immer mehr Geld und Waren; er ist als Privateigentümer unbegrenzter Konsument und Kapitalakkumulator.
-
Der Marktmensch ist zu Recht Machtmensch, er strebt egoistisch nach Vermehrung seines Eigentums auch auf Kosten anderer, weil so angeblich die Reichtumsvermehrung der gesamten Volkswirtschaft gewährleistet ist.
-
Als arbeitendes Wesen ist der Marktmensch Besitzer seiner Arbeitskraft, die darin und in der Höhe einen Wert hat, als sie auf dem Markt einen Geldpreis erzielt.
-
Als unternehmerisches Wesen ist der Marktmensch ein rational und phantasievoll kalkulierendes Wesen, das auf möglichst hohen Gewinn aus ist.
-
Als denkendes Wesen ist der Marktmensch Mathematiker, der die (natürliche und menschliche) Wirklichkeit nach Modellen erkennen und technisch zu manipulieren lernt und lehrt.
-
Als Marktmensch ist der Mensch Individuum, das der Begrenzung durch Zeit, Raum und Gemeinschaft mit Hilfe künstlicher Techniken zu entfliehen trachtet - daß er dabei sich und die Welt zerstört, wird verschwiegen."[36]
Ein Mensch mit Behinderung, der auf Grund seiner Behinderung, genauso wie ein Kind oder ein alter Mensch oder sonst jemand aus anderen Gründen selber nur wenig oder kein Geld erwirtschaften kann, ist als solcher das Gegenteil zum "homo oeconomicus", das Gegenteil zum geldfixierten, vom Geldvermehrungsinteresse beherrschten und am Geld gemessenen Menschen. Statt Menschen mit Behinderung armselige Anerkennung über kleine und kleinste Geldverdienstmöglichkeiten zukommen zu lassen, sollten sie für das Anerkennung finden, was sie, wie alle, nicht nur mit ihrer Arbeit, sondern auch mit ihrer Lebendigkeit, mit ihrem Wesen inhaltlich zum gesellschaftlichen Zusammenleben beitragen. Statt für Menschen mit Behinderung noch Bruchstücke einer Anerkennung als "Marktmenschen" zu retten, kommt es darauf an, Menschen mit Behinderung und mit ihnen alle Menschen vorrangig als Menschen des Dialogs und der Gemeinschaft anzuerkennen und Formen von Gemeinschaft und von Gesellschaft zu entwickeln, in denen Menschen sich darin gegenseitig ergänzen und stärken können, mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu verwirklichen und durchzusetzen. Für diesen Entwicklungsprozeß zu einer menschlicheren Gesellschaft hin haben Menschen mit Behinderung gerade als in ihren Marktfähigkeiten behinderte und als zu mehr Miteinander herausfordernde Menschen zentrale Bedeutung. Das Ausmaß des Gelingens dieses menschlichen Miteinanders der Verschiedenen im persönlichen Dialog, in gegenseitiger Hilfeleistung, im solidarischen Teilen ist ein Ausdruck für die Menschlichkeit der Gesellschaft.
All dies sei mit Worten von Eduardo Galeano noch einmal grundsätzlich unterstrichen:
"Aus der Hoffnung und nicht aus der Nostalgie muß eingefordert werden: die gemeinschaftliche Produktions- und Lebensweise, die sich auf die Solidarität und nicht auf die Habsucht stützt, den Einklang des Menschen mit der Natur und den alten Regeln der Freiheit ... Vom kapitalistischen Gesichtspunkt aus betrachtet, sind die kommunitären Kulturen, die den Menschen weder von den anderen Menschen noch von der Natur abtrennen, feindliche Kulturen. Aber der kapitalistische Gesichtspunkt ist nicht der einzig mögliche Gesichtspunkt.
Vom Gesichtspunkt eines Gesellschaftsprojektes, das sich auf der Solidarität gründet und nicht auf dem Geld, sind diese so alten und doch so zukunftsträchtigen Traditionen ein wesentlicher Teil der ursprünglichsten Identität Amerikas: eine dynamische Energie, keine tote Masse. Wir sind Ziegelsteine eines noch zu bauenden Hauses! ... Wir sagen Nein zur Lobpreisung des Geldes und des Todes. Wir sagen Nein einem System, das Sachen und Menschen einen Preis gibt, wodurch derjenige, der am meisten hat, auch am meisten wert ist. ... Indem wir Nein sagen zum selbstmörderischen Egoismus der Mächtigen, die die Welt in eine riesige Kaserne verwandelt haben, sagen wir ja zur menschlichen Solidarität, die uns ein universales Gefühl vermittelt wir haben die Kraft der Brüderlichkeit, die mächtiger ist als alle Grenzen mitsamt ihren Wächtern."[37]
Perfektionistische Fortschrittsethik wird z.Zt. besonders in einer ganzen Reihe von Bereichen der Medizin- und Bioethik betrieben. Diese Ethik erscheint als von der faktischen Entwicklung des Machbaren, vom tatsächlich gemachten Fortschritt wissenschaftlicher Forschung her erzwungen und steht zugleich der Planung weiteren Fortschritts sowie der Akzeptanzverbesserung in der Bevölkerung möglichst weitgehend zu Diensten. Dabei setzt sich diese Ethik in skandalöser Weise über die dehumanisierende Auswirkung der Perfektionismusorientierung hinweg.
Die Diagnose des Hirntods galt vor dem Wirksamwerden des Organtransplantationsinteresses als Feststellung des Beginns eines unumkehrbaren Sterbeprozesses und konnte damit den Verzicht auf (weiteren) intensiv-medizinischen Apparateeinsatz begründen und dem Engagement in medizinisch-pflegerischer Grundversorgung sowie vor allem mitmenschlicher Begleitung um so mehr Raum geben. Das Organtransplantationsinteresse benutzt jedoch die Hirntoddefinition dazu, die Verkürzung, den Abbruch des Sterbens und damit auch der mitmenschlichen Begleitung zu rechtfertigen.
Mittels der Definitionsmacht des Fachmannes geschehen dabei fast unmerklich zwei Grenzverschiebungen: 1. Aus der Erlaubnis zum Verzicht auf Lebensverlängerung durch intensiv-medizinische Maßnahmen wird die Erlaubnis zum den Sterbeprozeß abbrechenden Eingreifen. 2. Das Menschsein des Menschen wird reduziert auf rationale Reflektions- und Äußerungsfähigkeiten, auf Gehirnfunktionen.
So kann der Medizinethiker Hans-Martin Sass konstatieren: "... Wir sprechen, ohne daß sich intellektueller oder ethischer Widerspruch erhebt, ziemlich selbstverständlich vom Hirntod. Dabei hatten wir den Terminus Tod doch eigentlich reserviert für das Ende der ganzen Person; bei Organen hatten wir von Funktionsversagen oder Absterben gesprochen. Unsere Sprachregelung macht also stillschweigend einen Unterschied zwischen biologischem, menschlichem Leben, das ja unter intensiv-medizinischer Behandlung nach dem Hirntod weitererhalten werden kann, und dem personalen menschlichen Leben, das wir in dieser ethischen und kulturgeschichtlich abgestürzten Interpretation biologischer Fakten mit der Möglichkeit aktiver Hirntätigkeit gleichsetzen."[38]
Sass meint, es gäbe keinen Widerspruch. Doch genau dieser Gleichsetzung von personalem Leben mit aktiver Hirntätigkeit ist ganz ausdrücklich zu widersprechen: Eben diese Gleichsetzung ist eine Verkürzung des Menschseins, sie ignoriert oder unterschlägt die Möglichkeit nichtrationaler, nonverbaler, elementarer Kommunikation und die Wirklichkeit des Zwischenmenschlichen bzw. der Zweipoligkeit der dialogischen Dimension, sie verleugnet die Bedeutung der dialogischen Dimension für das Menschsein aller Beteiligten und verkennt das Mitbetroffensein der Kommunikationspartner durch die Zumutung des Abbrechens des Sterbeprozesses.
Einerseits zersetzt die Definition des hirntoten Menschen als Nichtmehr-Mensch die Kommunikation der unmittelbar Beteiligten untereinander: die Nötigung zur Entscheidung drängt in die Rolle des Messenden und Bewertenden, die als solche schon kontrakommunikativ ist; und der Eingriff zur Organentnahme selber bricht alle bis dahin immer noch mögliche Zwischenmenschlichkeit endgültig ab.
Andererseits hat die Durchsetzung der Hirntoddefinition als Rechtfertigung zur Organtransplantation und damit zum Abbrechen des Sterbeprozesses auch gesamtgesellschaftliche Auswirkung: Es stellt die Anerkenntnis menschlicher Zuwendung zu Sterbenden sowie des würdigen Abschiednehmens vom Verstorbenen, die Geltung dieser Anerkenntnis als allgemeine Kulturerrungenschaft grundsätzlich in Frage; es diffamiert Kommunikation in Form persönlich emotionaler Zuwendung sowie in Form praktischer Hilfeleistung bei Sterbenden als nicht mehr lohnend: "Hohe emotionale, ethische, kulturelle, medizinische und ökonomische Kosten brauchen nicht mehr übernommen werden."[39]
Die Transplantationsmedizin ist an der verhängnisvollen Vorrangsetzung für Perfektion direkt oder indirekt beteiligt: Mit der menschlichen Verweigerung denjenigen gegenüber, die als Sterbende nicht mehr zu perfektionieren sind, mit der Konzentration auf die technischen Machbarkeiten des Wiederherstellens von Funktionen bei denen, wo es sich noch lohnt, und mit der daraus folgenden Verunsicherung, ja Herabsetzung des Selbstbewußtseins und der Achtung derjenigen, die auf die Transplantation warten.
Der Interessenkonflikt mit den Menschen, die auf eine Organspende angewiesen sind, um besser und/oder länger leben zu können, ist ganz entschieden nicht zu lösen durch die Definitionsgewalt von Fachleuten, sondern nur durch die ganz bewußte, persönliche, freiwillige Entscheidung einzelner, in eine Organentnahme nach eigenem Hirntod und damit in ein Abbrechen des eigenen des Sterbeprozesses einzuwilligen, um damit einem anderen Menschen zu dienen, dem ein Organ helfen könnte. Dies hat zur Konsequenz, daß für die gesetzliche Regelung einer Organentnahme nur das Zustimmungsmodell akzeptiert werden kann, das eine Organentnahme nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen Zustimmung des potentiellen Organspenders erlaubt; diese Zustimmung muß bei vollem Bewußtsein und in völliger Freiwilligkeit gegeben worden sein, und sie kann auch nicht durch die Entscheidung von Angehörigen oder Nahestehenden ersetzt werden. Die gesetzliche Regelung ist in diesem Sinne zu präzisieren; die aktuellen Bestrebungen, sie zu lockern, um zu mehr Organspenden zu kommen, die Vorschläge, Organentnahme immer dann als erlaubt anzusehen, wenn kein ausdrücklicher Widerspruch vorliegt (Widerspruchsmoden) oder wenn nach Information über die Widerspruchsmöglichkeit auf den ausdrücklichen Widerspruch verzichtet wird (Informationsmodell), sind eindeutig abzulehnen.
In der Diskussion über die Fristenlösung für Schwangerschaftsabbruch, d.h. über die Legalisierung der persönlichen Entscheidungsfreiheit darüber, innerhalb einer bestimmten Frist straffrei abtreiben zu dürfen, sind sehr unterschiedliche Interessen und Argumente wirksam.
Auf der einen Seite gibt es den eiskalten Versuch von Medizinethikern, wie z.B. von Hans-Martin Sass, das Menschsein von Kindern für die Anfangsphase ihrer vorgeburtlichen Entwicklung einfach wegzudefinieren. Und auf der anderen Seite gibt es den Versuch, durch Entkriminalisierung und Achtung der Eigenverantwortlichkeit der schwangeren Frau in Verbindung mit einer darin stärkenden Beratung und mit Vermittlung gesellschaftlicher Hilfeleistung pragmatisch dazu beizutragen, die Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen zu reduzieren.
Hans-Martin Sass versucht, analog zur Hirntoddefinition einen Hirnlebensbeginn zu definieren, vor dessen Eintreten ein Embryo noch keine menschliche Person und deswegen nicht schützenswert sei: "Das Gehirn wächst erst von der 10. Woche nach der Empfängnis ab zu einem funktionsfähigen Organ zusammen; ... das dann ... Bewußtsein, Selbstbewußtsein, Schmerz-, Lust- und Leidempfindung überhaupt erst möglich macht. - Vor der 10. Woche sind die biologischen Voraussetzungen für das noch nicht gegeben, was wir personales Leben nennen ..."[40] "Die durch die Synapsenbildung erst ermöglichte Funktionsfähigkeit des Gehirns ist biologisches Korrelat zum personalen Leben des menschlichen Individuums. Erst die zentrale neuronale Steuerung, Schmerzempfindung und Kommunikation, Bewußtsein und Selbstbewußtsein machen den Menschen aus."
Sass schreibt weiter: "Wir sollten daher, in Analogie zum Hirntod mit dem Beginn der neuronalen Synapsenbildung vom ‚Hirnleben' sprechen. Das bedeutet, daß wir vom 70sten Tage nach der Empfängnis dem werdenden menschlichen Leben den vollen rechtlichen Schutz und die ungeteilte ethische Solidarität und Achtung bedingungslos entgegenbringen."[41]
Ihm ist zu erwidern: Welch Zumutung an Gefühlsakrobatik und welche Unverantwortlichkeit folgen aus dieser distanzierten Theorie für Mütter, für Eltern! Von der Zeugung bis zum 69sten Tag danach sollen sie ihre Gefühle gegenüber dem sich entwickelnden Kind kühl und ihre Herzen leer halten, weil das Kind noch nichts empfinden könne, und weil es deswegen vernünftig sei, bedenkenlos über dieses Kind zu verfügen bzw. verfügen zu lassen? Vom 70sten Tag an sollen sie dann "Achtung" - und vermutlich auch Liebe - "bedingungslos entgegenbringen"?
Gegenüber den zitierten, so wissenschaftlich autoritär daherkommenden Aussagen von Sass ist einerseits zu fragen: Ist nicht doch auch im vorbewußten Leben schon Personalität anzunehmen? Ist Personalität nicht schon von allem Anfang an als Wesenhaftigkeit vorhanden, die sich in ununterbrochener Kontinuität entfaltet und zunehmend verkörpert? Sind die Definitionen von Sass u.a. nicht nur der Ausdruck einer einseitigen, oberflächlichen, äußerst verengten Wahrnehmung?
Und andererseits ist zu fragen: Was ist mit dem personalen Leben, mit dem Seelenleben der Menschen, die sich durch - behauptete Empfindungslosigkeit des Kindes darin gerechtfertigt fühlen, dieses als Nichts zu betrachten, die Möglichkeit der eigenen Beziehung zu ihm als bedeutungslos, als inhaltslos zu betrachten und sich neu um so mehr auf sich selbst zurückziehen zu dürfen? Wäre da nicht doch auf die leise Stimme des Gewissens zu achten, statt sie als töricht stumm zu machen? Wäre da nicht doch die Ehrfurcht vor dem Wunder des Lebens wahrzunehmen, statt sie wegzuargumentieren? Wäre da nicht doch ein Glücksgefühl darin zu entdecken, das Heranwachsen von Leben selber zu schützen und zu fördern und miterleben zu können? Gäbe es da nicht eine Herzenswärme zu entwickeln in der Zuwendung zu einem Kind, das noch nicht sichtbar ist, das noch nicht spürbar ist, das angeblich selber noch empfindungslos ist, und das sich selber überhaupt noch nicht behaupten könnte? Und diese Wahrnehmung des Wunderbaren, dieses Glücksgefühl, diese Herzenswärme: würde all das nicht auch einem selber nottun und guttun?
Mit dem medizinethischen Versuch, einen Hirnlebensbeginn zu definieren und Menschsein mit Hirnleben gleichzusetzen, was einen Verfügungsspielraum für die Zeit vor dem Hirnlebensbeginn erschließt, sind wiederum konkrete Nutzungsinteressen verbunden: "Die Notwendigkeit der Forschung und Therapie in der Infertilitätsmedizin, der pränatalen Diagnostik und Therapie und erfolgversprechende Projekte in der Forschung an embryonalem Gewebe sind zusätzliche Gründe, für die ethische Bewertung des Anfangs des menschlichen Lebens ähnlich akzeptable Kriterien zu finden, wie das für das Ende des Lebens gelungen ist. Eine Güterabwägung, die konsensfähig sein will, muß versuchen, die ethischen Doppelstandards zu beseitigen, die derzeit die ethischen, rechtlichen, medizinischen und politischen Diskussionen um konkrete moralische Entscheidungen im Einzelfall beim Schwangerschaftsabbruch, bei der Forschung an Embryonen, bei der Benutzung von Empfängnisverhütungsmitteln so unerträglich und so emotional machen."[42]
Die Behauptung einer Analogie zwischen Hirntod und Hirnlebensbeginn und die sich darauf gründende Kritik an Doppelstandards täuscht fahrlässig oder bewußt darüber hinweg, daß die schon bei der Verbindung der Hirntoddefinition mit Organentnahmeinteressen eingeführte Verschiebung vom Sterbenlassen zum aktiven Abbrechen des Sterbeprozesses im Hinblick auf die vorgeburtliche Situation sich noch einmal verschärft: Hier geht es nicht vom Sterbenlassen zum Abbrechen, sondern vom Lebenlassen, vom Leben-sich-entwickeln-lassen weg zum Töten.
Die Definition des Menschseins durch Hirnleben, die Gleichsetzung des Beginns menschlichen Lebens mit dem Beginn von Hirnleben, die daraus folgende Disqualifizierung und Entrechtung des Menschseins in den dem Hirnleben vorangehenden wie in den dem Hirntod nachfolgenden Lebensprozessen eröffnet eine Verfügungsmacht, die nicht nur dem Forschungs-, Therapie-, Perfektionsinteresse von Wissenschaftlern dient. Diese Verfügungsermächtigung dient auch einem oberflächlichen - den tieferen Eigeninteressen entgegenwirkenden - Selbstverwirklichungsinteresse von potentiellen Eltern einerseits und einer Entpflichtung des Staates von gesamtgesellschaftlicher Solidaritätsleistung, von der Einlösung des Grundsatzes "Hilfe statt Strafe" andererseits. Ein Rechtsanspruch auf wirklich bedarfsgerechte Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Familien, insbesondere für Alleinstehende mit Kind muß man dann nicht einführen, den formulierten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz muß man nicht so ernst nehmen, weil ja doch auf Grund der medizinischen Definition von Sass, daß der Embryo vor dem Beginn von Hirnleben überhaupt noch keine Person sei, bis zu diesem Termin beliebig abgetrieben werden dürfe - wenn denn diese Definition tatsächlich von einer Mehrheit anerkannt werden sollte.
Sicherlich wurde und wird in der Diskussion nicht immer deutlich getrennt. Doch es gibt entschiedene Befürworterinnen der Fristenlösung, die sich gegen eine solche Begründung wehren. So bekennt die führend in der Gesetzgebungsinitiative für die Reform des § 218 tätige Politikerin Uta Würfel: "Ich mache es nicht länger mit, daß immer wieder in Frage gestellt wird, daß es sich dabei um ungeborenes Leben handelt. Und zwar um Leben von Anfang an. Ich habe wirklich keine Beziehung dazu, wenn Frauen und Kolleginnen und Kollegen einfach leugnen, daß es sich bei einer Abtreibung um eine Tötungstat handelt. Sich einzubilden, das sei nicht so, ist falsch."[43]
Dem ist nur zuzustimmen. Doch wenn dem zuzustimmen ist, dann ist, bei allem Respekt vor der guten Absicht, die Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen praktisch zu reduzieren, die geäußerte Ehrfurcht vor allem Leben, eben auch vor dem vorgeburtlichen Leben nicht mit einer - wenn auch befristeten - Erlaubnis zum Töten zu verbinden.
Sicherlich hat keiner und allemal kein unbeteiligter Dritter, ein Recht, eine Frau (und ihren Mann) moralisch zu verurteilen, die in einer subjektiv als ausweglos erfahrenen Notsituation sich zu einem Schwangerschaftsabbruch durchgerungen hat (haben). Doch aus dieser Ablehnung von -selbstgerechten und billigen - Schuldzuweisungen ist kein Verzicht auf ethische Kritik zu folgern und keine ethische Begründung für eine Erlaubnis des Tötens abzuleiten. So ist der Versuch der Politik, einen Mittelweg zu gehen, indem sie die Entscheidung über Schwangerschaftsabbrüche letztlich den einzelnen Menschen und ihrer individuellen Verantwortlichkeit überläßt, ethisch nicht zu akzeptieren, da dies eben die grundsätzliche Erlaubnis des Tötens impliziert.
Die subjektiv als ausweglos erfahrene Notsituation kann mitmenschliche Akzeptanz, aber keine ethische Rechtfertigung begründen. Wenn existentielle Konfliktsituationen und soziale Notsituationen eine ethische Begründung für eine Erlaubnis des Tötens in der Form des Schwangerschaftsabbruchs abgeben würden, dann könnte genauso auch das Töten eines Kindes nach der Geburt oder eines zunehmend pflegebedürftigen Menschen im Alter mit persönlichen oder sozialen Notsituationen gerechtfertigt werden. Aus sozialen Notsituationen die soziale Indikation für Schwangerschaftsabbrüche abzuleiten, bedeutet überdies, die Einzelnen bei der Überwindung sozialer Notsituationen alleinzulassen oder ihnen individuelle Lösungen in Form des Tötens zu überlassen oder ihnen individuelle Opferhandlungen aufzulasten, statt ihnen eine soziale Alternative zu bieten. Soziale Notsituationen sind sozial zu verantworten und durch gerechtere Sozialpolitik zu überwinden.
So wenig es einerseits eine ethische Rechtfertigung des Schwangerschaftsabbruches geben kann, so sehr muß andererseits die Funktion von Strafe problematisiert und nach der Mitverantwortung der Dritten, der Gesellschaft gefragt werden. Wie die Liberalisierung und Legalisierung der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches die sozialen Probleme individualisiert, auf die Entwicklung der Alternative des gesellschaftlichen Hilfeleistungsprogramms allzu schnell verzichten läßt, das Selbstbestimmungsrecht geradezu als Alibi für unsoziale Sparpolitik mißbraucht, so würde auch das einfache Verbot des Schwangerschaftsabbruches und die Verbindung des Verbots mit Strafandrohung und Strafverfolgung die Verantwortung unzulässig einseitig individualisieren und die Dritten, die Gesellschaft von ihrer jeweiligen Mitverantwortung entpflichten. Die Alternative zu beidem (!) kann nur darin bestehen, den Grundsatz "Hilfe statt Strafe" so konsequent zu verwirklichen, daß ein einklagbarer Rechtsanspruch auf alle jeweils erforderliche Hilfeleistung geschaffen wird, Strafe nicht den Opfern eines Mangels an Hilfen, sondern den Verweigerern von Hilfeleistung anzudrohen ist, daß es zu keinem Abbruch mehr aus einem Mangel an Hilfeleistung kommt.
Wie wenig eine befristete Erlaubnis des Tötens wirklich mit konsequenter Ehrfurcht vor dem Leben zu vereinbaren ist und wie wenig sie zu einer auch nur annähernd bedarfsgerechten Umsetzung des Prinzips "Hilfe statt Strafe" führt, wurde durch den Entwurf der Neufassung des § 218 StGB selber drastisch verdeutlicht: Der Gesetzentwurf mit seinem Absatz 7 sieht eine Fristverlängerung von zwölf auf 22 Wochen für legalen Schwangerschaftsabbruch bei Diagnose einer Behinderung vor, ohne hier oder in weiterem Zusammenhang auch nur ein Wort über einen dem möglichen Mehrbedarf entsprechenden Ausbau von Hilfeleistungsangeboten zu äußern.
Hier wird die Verfügungsermächtigung über Leben ganz einfach erweitert und die gesellschaftliche Nutzenorientierung noch einmal gesteigert. Zu dieser Erweiterung bedarf es nicht einmal mehr der Begründung, daß noch kein Beginn von Hirnleben festzustellen sei, es reicht die Diagnose einzelner, unterschiedlicher, begrenzter Hirndefekte und diese wird ergänzt durch die Prognose einer Mehrbelastung der Familie und der Gesellschaft - bis hin zu den platt wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Hochrechnungen, die bis heute den Ausbau der pränatalen Diagnostik und human-genetischen Beratung begründen.
Diese Tendenz einer diskriminierenden Unterscheidung von Kindern und Behinderten wird durch das Bundesverfassungsgerichts-Urteil vom 28. Mai 1993 noch einmal verschärft. Das Urteil übt einerseits grundsätzliche Kritik an der Fristenlösung, trifft die grundlegende Feststellung, daß jeder Schwangerschaftsabbruch als Tötung und daher als Unrecht zu bewerten sei, akzeptiert aber andererseits Notlageindikationen, die es möglich machen, "die Pflicht zum Austragen des Kindes aufzuheben." Auf dem Hintergrund des - zu begrüßenden - grundsätzlichen Tötungsverbotes wirkt jedoch diese Ausnahmeregelung deswegen als geradezu skandalös, weil sie auch die "embryopathische Indikation" (Behinderung des Kindes) ganz allgemein und wie selbstverständlich als Notlageindikation anerkennt und wie gleichbedeutend nicht nur neben die "medizinische Indikation" (Gefahr für das Leben der Mutter), sondern auch neben die "kriminologische Indikation" (Schwangerschaft nach Vergewaltigung) stellt. Das Urteil erlaubt es grundsätzlich, die Behinderung eines Embryos als "Notlage", ja als "Unzumutbarkeit" und damit als Grund für eine Ausnahmeerlaubnis anzuerkennen, ohne ein Problembewußtsein darüber auch nur anzudeuten, welche Auswirkung dies auf die gesellschaftliche Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung haben muß, wie sehr diese Diskriminierung von Kindern mit Behinderung zum Anwachsen von Behindertenfeindlichkeit und Sanktionierung sozialer und politischer Solidaritätsverweigerung beiträgt, und wie sehr es auch das grundsätzliche Tötungsverbot einschränkt und damit letztlich aufhebt.
Einerseits wird das Instrumentarium zur vorgeburtlichen Qualitätskontrolle verbessert; es ist absehbar, daß es durch leicht durchzuführende Tests (wie etwa durch den Bluttest von Holzgrewe u.a.) zur Routine wird, jeder schwangeren Frau diese Kontrolle ihres Kindes zu empfehlen, aufzudrängen, zuzumuten. Andererseits schweigen sich die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch immer dann so gut wie völlig aus, wenn es um die Umsetzung des Prinzips "Hilfe statt Strafe" auch für die Familien geht, die sich für ein Kind mit Behinderung entscheiden, wenn es also um die Erfüllung eines Mehrbedarfs an Hilfeleistung geht. So drängt sich der Eindruck auf, daß diese Regelungen und die dahinter stehenden gesellschaftlichen Kräfte tatsächlich keine Gleichbehandlung wollen, weil sie die Kosten eines wirklich angemessenen Hilfeleistungs- und Ausgleichsprogramms nicht vertreten wollen. Das heißt: Hier wird praktische Hilfeverweigerung betrieben.
Angesichts dieser Einflußfaktoren von "Patientenautonomie", von freier Entscheidung der Ratsuchenden und Neutralität der humangenetischen Beratung zu sprechen und allenfalls noch eine psychosoziale Qualifizierung der Berater zu fordern, ist schlicht naiv oder betrügerisch. Im Zusammenhang mit den hier wirksamen gesellschaftlichen Interessen hat die pränatale Diagnostik und humangenetische Beratung objektiv die Funktion -auch wenn einzelne Berater subjektiv ein anderes Rollenverständnis haben mögen -, der vorgeburtlichen Selektion von Kindern mit Behinderung zu dienen und die Behindertenfeindlichkeit gegenüber den Kindern, die trotzdem - vermeintlich unnötiger - geboren werden, zu fördern. Eltern, die das Angebot der pränatalen Diagnostik und der humangenetischen Beratung und der legalen Abtreibung nicht genutzt haben, sollen - so zumindest eine breite Meinungsströmung - dann die Konsequenzen aus ihrer persönlichen Entscheidung auch persönlich, d.h. privat, tragen, keinen Anspruch auf ein gesellschaftliches Mittragen von Mehrbelastungen mehr geltend machen dürfen. Mit besonderer Drastik und zugleich mit der Autorität eines Professors der Rechtswissenschaften bringt dies etwa Tilo Ramm zum Ausdruck. "Die Gewissensentscheidung der Frau, das Kind auszutragen, ist nur dann achtbar, wenn sie die Verantwortung für die Folgen übernimmt: Wenn sie bereit ist, für dieses Kind zeitlebens aufzukommen und für dessen angemessene Versorgung nach ihrem Tode zu sorgen. Wenn der Fortschritt medizinischer Kunst die Lebensfähigkeit zum rein kreatürlichen, menschenunwürdigen Vegetieren reduziert und dieses Ergebnis an die Stelle des früheren Ausleseprozesses der Natur setzt, dann entsteht eine neue Dimension menschlicher Verantwortung. Fällt sie der Mutter zu, dann muß sie die Folgen ihrer Entscheidung tragen. Sie kann sie weder auf den Mann abwälzen, der sie geschwängert hat ... noch kann die Mutter die Last auf den Staat als Sozialstaat abschieben. Dies widerspräche auch der Schutzverpflichtung des Staates, den Anspruch des Embryos auf ein Leben in Gesundheit zu erfüllen"[44]
Die Entwicklung hin zu einer möglichst frühzeitigen und möglichst lückenlosen Erfassung von Kindern mit "Defekten" (vgl. das Projekt der Universitätskinderklinik Mainz, Prof. Dr. J. Spranger) zur Erfassung angebotener morphologischer Defekte (AMD) mit seiner geradezu absurden Pedanterie der Katalogisierung aller Defekte bis hin zu den kleinsten und die Verbindung dieser Erfassung mit der erweiterten Verfügungsermächtigung zum vorgeburtlichen Töten könnte der Ermöglichung eines gesamtgesellschaftlichen Säuberungsprogramms dienen, das zu einer Gesellschaft, zur Verwirklichung von immer mehr Perfektion führen würde.
Von den seelischen Auswirkungen auf die unmittelbar Beteiligten wird mit einseitigen Negativbildern von Kindern mit Behinderung und mit diffamierenden Vergleichen lautstark abgelenkt. Die schwarzen Flecken in der Wirklichkeit der gesamtgesellschaftlichen Kommunikationskultur, die durch das Fehlen der nichtgeborenen Kinder mit Behinderung entstehen, verbinden sich mit entsprechenden Wahrnehmungslücken der Akteure und Propagandisten des Selektionsprogramms. Das wahrhafte Perfektionsstreben erweist sich immer deutlicher als Beitrag zur Verarmung der Kommunikationskultur, zur Reduktion auf immer mehr Eintönigkeit.
Bei den Rechtfertigungsversuchen für das Töten auf Verlangen wird nicht mehr der objektiv meßbare Gehirntod zum Maßstab gemacht, sondern die angeblich freie, subjektive Willensäußerung von Sterbenskranken oder ersatzweise die Beurteilung der Lebensqualität von "Willensunfähigen" durch Stellvertreter.
Dabei wird die stillschweigende Grenzverschiebung vom Verzicht auf intensivmedizinische Lebensverlängerungsmaßnahmen zur Erlaubnis aktiven Abbrechens des Sterbeprozesses noch einmal ausgeweitet. Die Befürworter unterstellen, es sei zur Abwehr von Auswüchsen der übermächtigen intensivmedizinischen Apparatemedizin notwendig, ein selbstbestimmtes Sterben in der Form des Getötetwerdens auf eigenes Verlangen zu ermöglichen. Demgegenüber gilt es zu betonen, daß es auch hier sehr wohl noch die Alternative des Sterbenlassens - mit persönlicher Begleitung - geben kann, daß es auch vor der Grenze des Hirntodes schon den Beginn eines unumkehrbaren Sterbeprozesses und damit den Verzicht auf intensivmedizinische lebensverlängernde Behandlung geben kann. Nur ist die Erkenntnis und Anerkenntnis des Beginns eines unumkehrbaren Sterbeprozesses vor dem Hirntod sehr viel schwieriger abzusichern als der technisch meßbare Ausfall der Gehirnfunktionen. Da reicht eben nicht die Äußerung von Lebensmüdigkeit und ganz eindeutig auch nicht die Feststellung unzumutbarer Lebensbedingungen; Lebensmüdigkeit kann vorübergehen, Lebensbedingungen - auch für ein Leben mit schwerer Behinderung - sind zu verändern, zu verbessern. Es muß ein körperlicher Verfallsprozeß in Verbindung mit einem seelischen Ablösungsprozeß festzustellen sein, um von dem Beginn eines unumkehrbaren Sterbeprozesses schon vor dem Hirntod zu sprechen. Statt sich auf medizinisch-technisches Messen zu verlassen und statt nach juristischen Rechtfertigungen fürs Töten zu suchen, kommt es darauf an, das lebendige Erfahrungswissen von dem Beginn eines unumkehrbaren Sterbeprozesses, das wir Menschen haben und das wir von Generation zu Generation weitergereicht bekommen, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern immer wieder neu anzueignen, zu vergewissern, zu konkretisieren, zu reinigen, zu klären.
Darauf kommt es an, und das ist allen Einsatz wert. Doch der Ruf zur Liberalisierung des Tötens auf Verlangen setzt sich mit verführender Suggestivkraft darüber hinweg. In der BRD stellt der § 216 StGB Tötung auf Verlangen nach wie vor unter Strafe. Doch es gibt eine starke Gegenbewegung z.B. in der zahlreichen und auch zum Teil prominenten Unterstützung für die "Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben", die die Beihilfe zum Suizid und den Verkauf von Zyankali betreibt. Es gibt eine breite Meinungsströmung für eine Liberalisierung aktiver Sterbehilfe. Es gibt das holländische Beispiel, mit Parlamentsbeschluß vom Februar 93, aktive Sterbehilfemaßnahmen zu legalisieren. Hinter dieser Gesetzesinitiative steht die langjährige Duldung einer entsprechenden Praxis.
Unter der Überschrift "Ich wünsche mir holländische Verhältnisse" publizierte die evangelische Wochenzeitschrift "Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt" einen Diskussionsbeitrag (5. März 1993) mit der Horrorargumentation: "Was ist denn würdig an einem Menschen, der unheilbar krank an Maschinen angeschlossen ist? Der in den Phasen, wenn die Morphiumwirkung nachläßt, seine Schmerzen nur noch schreiend erträgt? Den Halluzinationen verfolgen, Nebenwirkungen der hirndurchblutenden Medikamente nach einem Schlaganfall? Wo bleibt die Menschenwürde bei den Alten, die fixiert im hohen Gitterbett in ihrem Kot liegen und um den Tod betteln" Diese Argumentation ist hier stellvertretend für viele ähnliche Beiträge zitiert, weil sie typisch ist für das Ablenken von den sozialen Ursachen des Unerträglich- und Unwürdigwerdens von Lebenssituationen, für das Ausblenden des Zusammenhangs von Perfektionsstreben und Kommunikationsverlusten bzw. Kommunikationsverweigerungen, für das Unterschlagen der Alternativen zum Töten.
Es wäre und ist doch möglich, Kommunikation durchzuhalten, persönliche, wesenhaft-anwesende und praktisch helfende Zuwendung intensiv zu verwirklichen und die medizinische Technik in den Hintergrund zu drängen. Dies ist ein menschenwürdiger Beitrag zur Überwindung der entwürdigenden Folgen des Pflegenotstandes. Man kann die Möglichkeiten medizinisch-therapeutischer Schmerzlinderung einsetzen, aber auch das Schreien vor Schmerzen als Ausdruck von Leben akzeptieren, als ein Schreien gegen die Schmerzen, aber nicht gegen das Leben; man kann Stärkung und Vergewisserung aus Veränderungen erfahren, die noch ein Aufleuchten von Vertrauen und ein Friedenfinden beinhalten können. Es ist möglich, Verbündete zu gewinnen, die sich beteiligen und helfen, und die erfahren lassen, daß die Herausforderung zur Kommunikation, auch da wo nichts mehr zu retten oder zu perfektionieren ist, Menschen neu verbinden und Gemeinschaft stiften kann. Es gibt das private, nicht spektakuläre, nicht an die Öffentlicheit drängende Engagement. Und es gibt die organisierte Praxis der Hospizbewegung, die nachweist, daß es kein Verlangen nach aktiver Sterbehilfe geben muß.
Die distanzierte Berufung auf die freie Willensäußerung sowie auf die neutrale Lebensqualitätsbeurteilung ist schlicht betrügerisch. Sie täuscht darüber hinweg, daß eine Gesellschaft manipuliert und nötigt, in der keine Kultur gegenseitiger Hilfeleistung gepflegt wird, in der es vielmehr zum guten Ton gehört, keinem "zur Last fallen" zu wollen, und in der es dann auch praktisch entwürdigende Defizite an Hilfeleistungen und an Würdigung von Hilfebedürftigen gibt. Diese Gesellschaft, die diejenigen, die nicht mehr funktionstüchtig sind, aussondert, von Kommunikationskreisläufen ausschließt, von ihrer Lebensgeschichte abschneidet, die von "Altenbergen" und vom drohenden "Krieg der Generationen" spricht, eine solche Gesellschaft drängt und nötigt zu der vermeintlich freien Willensäußerung, sterben zu wollen und Sterbehilfe erhalten zu wollen. Sie täuscht darüber hinweg, daß es dieser Gesellschaft nur allzu gut ins Konzept paßt, daß sie alte, kranke, sterbenskranke Menschen dazu bringt, sich angeblich freiwillig davon zu machen, davon machen zu lassen, da sie dann umso mehr Zeit, Kraft, Geld für die eigene Selbstverwirklichung der Starken, für das Funktionieren der Perfekten einsetzen kann. Doch damit wird der Betrug auch zum Selbstbetrug: Er pflegt die Illusion, daß die Leistungsfähigkeit ein oberster Wert sei, er verführt dazu, der Erfahrung von Leistungsschwächen und der Realität des Sterbens auszuweichen, er ebnet das Leben ein auf die Ebene unbekümmerten Funktionierens, auf die autobahnmäßig glatte Rennbahn perfekten Leistens.
Verloren geht dabei, ja geopfert wird dabei die Erfahrung, welch tiefere Lebenserfüllung gewonnen werden kann in einer Kommunikation, die sich nicht an Leistungen und Erfolgen orientiert, und welche Geborgenheit erfahren werden kann unter Menschen, die die Ehrfurcht vor dem Leben auch an der Grenze nicht in Frage stellen (lassen).
Kann es bei sterbenskranken alten Menschen darum gehen, den Beginn eines unumkehrbaren Sterbeprozesses schon vor Eintritt des Hirntodes zu erkennen, so geht es bei Neugeborenen mit schwerer Behinderung in aller Regel nicht um einen Sterbeprozeß, sondern ganz im Gegenteil um Leben, um Lebensentwicklung, um Äußerungen von Lebensenergie und Lebenswillen.
Darüber täuschen die "Einbecker Empfehlungen" der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht, der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und der Akademie für Ethik in der Medizin hinweg. Die überarbeitete Fassung der "Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen" von 1992 entspricht in ihrer Substanz der von 1986, macht ledigich weniger konkrete Aussagen. Diese Empfehlungen betreiben eine Grenzüberschreitung mit der Aussage: "Angesichts der in der Medizin stets begrenzten Prognosesicherheit besteht für den Arzt ein Beurteilungsrahmen für die Indikation von medizinischen Behandlungsmaßnahmen, insbesondere, wenn diese dem, Neugeborenen nur ein Leben mit äußerst schweren Schädigungen ermöglichen würden, für die keine Besserungschancen bestehen." (1992) Neben dieser grenzüberschreitenden Aussage steht in den Empfehlungen die Äußerung: "Eine Abstufung des Schutzes des Lebens nach der sozialen Wertigkeit, der Nützlichkeit, dem körperlichen oder dem geistigen Zustand verstößt gegen Sittengesetz und Verfassung." Dieser Widerspruch innerhalb der Empfehlungen wirkt wie eine Ablenkung von der Konsequenz "ein Leben mit äußerst schweren Schädigungen" als nicht bewahrenswert zu bewerten.
Neben diesem Widerspruch enthalten die Empfehlungen eine erschwerende Unklarheit in der entscheidenden Frage, wann eine Lebenssituation als unumkehrbarer Sterbeprozeß zu erkennen ist, wann damit der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen begründet werden kann: "Es gibt daher Fälle, in denen der Arzt nicht den ganzen Umfang der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ausschöpfen muß. Diese Situation ist gegeben, wenn nach dem aktuellen Stand der medizinischen Erfahrungen und menschlichem Ermessen das Leben des Neugeborenen nicht auf Dauer erhalten werden kann, sondern ein in Kürze zu erwartender Tod nur hinausgezögert wird." Ist hier wirklich ausschließlich an die Erkenntnis eines unumkehrbaren Sterbeprozesses als legitimer Grund für den Verzicht auf weitere lebensverlängernde Behandlung gedacht? Oder sollen hier intensivmedizinische Maßnahmen auch dann zu beenden sein, wenn mit ihnen ein Leben relativ dauerhaft stabilisiert werden könnte, aber ohne sie keine Überlebenschance bestände? Die Empfehlungen in der Fassung von 1986 präzisierten in diesem Zusammenhang durchaus so: "Es gibt daher Fälle, in denen der Arzt die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten insbesondere
-
zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und/ oder
-
der massiven operativen Intervention nicht ausschöpfen muß.
Diese Voraussetzungen sind zu bejahen, wenn nach dem aktuellen Stand der medizinischen Erfahrungen
-
Das Leben dadurch nicht auf Dauer erhalten werden kann, sondern nur der sichere Tod hinausgezögert wird (z.B. bei schwerem Dysraphie-Syndrom, inoperablen Herzfehlern).
-
Es trotz der Behandlung ausgeschlossen ist, daß das Neugeborene jemals die Fähigkeit zur Kommunikation mit der Umwelt erlangt (z.B. schwere Mikroenzephalie, schwerste Hirnschädigungen).
-
Die Vitalfunktionen des Neugeborenen auf Dauer nur durch intensivmedizinische Maßnahmen aufrechterhalten werden können (z.B. bei Ventilationsstörungen ohne Heilungsaussicht, Nierenfunktionsstörungen ohne Heilungsaussichten)."
Diese Frage ist deswegen von so großer Bedeutung, weil die Möglichkeit, für das Aufrechterhalten von Vitalfunktionen keine Intensivmedizin mehr einzusetzen, dazu beiträgt, die Verfügungsmacht über den
Abbruch intensivmedizinischer Behandlungsmöglichkeiten auszuweiten. Es ist sehr wohl ein Unterschied und zwar ein entscheidender Unterschied, ob man lebensverlängernde Maßnahmen bei einem sterbenden Menschen oder bei einem lebenden, von der Möglichkeit des Sterbens nur bedrohten Menschen durchführt. Es ist nicht schlüssig und nicht zu akzeptieren, von der Angewiesenheit auf intensivmedizinische lebensverlängernde Maßnahmen auf den Beginn eines unumkehrbaren Sterbeprozesses zurückzuschließen; denn damit wird die Entscheidung über das Einsetzen, das Weiterführen oder den Abbruch intensivmedizinischer Behandlung in einer Art und Weise freigestellt, die fast willkürlich genutzt werden kann. Verbindet sich diese Verfügungsermächtigung mit der negativen Beurteilung des Lebens mit Behinderung, dann haben Neugeborene mit Behinderung kaum noch eine Chance zu überleben!
In dieser Richtung kommt der holländische Bericht "Tun oder lassen? Grenzen des medizinischen Handelns in der Neugeborenenheilkunde" von 1992 unter anderem zu folgender - erschreckender - Aussage: "In einer Zeit stets weiter voranschreitender technischer Möglichkeiten, die auch angewandt werden, muß neu mit großer Deutlichkeit vorausgesetzt werden, daß tatsächlich jede Form medizinischer Behandlung, die dem Patienten keinen annehmbaren Vorteil liefert, unverantwortbar ist. ... So ist sicher auch Sondenernährung als eine medizinische/pflegerische Lebensverlängerungsmaßnahme anzumerken. Das bedeutet, daß auch im Hinblick auf das Einstellen oder Fortsetzen von Sondenernährung die Frage beantwortet werden muß: Ist dem Kind (und der Familie) damit gedient? Wenn die Frage nach sorgfältiger Abwägung mit ‚Nein' beantwortet wird, gilt für das Beenden der Sondenernährung im Prinzip dasselbe wie für das Beenden von Beatmung, auch wenn hierbei natürlich gefühlsmäßige (und praktische) Unterschiede bestehen." (Seiten 37, 38.)
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie unakzeptabel es ist, den Beginn eines Sterbeprozesses mit dem Beenden von Lebensverlängerungsmaßnahmen zu definieren; denn das Beenden einer notwendigen Sondenernährung ist keineswegs identisch mit dem Beginn des Sterbens, sondern der Beginn eines qualvollen Hungerns und Durstens, das den unumkehrbaren Sterbeprozeß erst einleitet.[45]
Noch einen Schritt weiter geht die Machtausübung gegenüber Menschen mit Behinderungen ganz allgemein, wenn die negative Bewertung ihrer Lebensqualität verbunden wird mit der künstlichen, d.h. politisch beschlossenen Verknappung von Mitteln, wie es sie sowohl für die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten (z.B. wenn nur ein Dialyseapparat für zwei oder mehr Dialysepatienten zur Verfügung gestellt wird), als auch für die Pflegekräfte (Pflegenotstand als Beitrag zur Entwürdigung von Lebenssituationen), als auch für die soziale Gestaltung von Lebensbedingungen (Minimalausstattungen in Aussonderungseinrichtungen) gibt. Doch eben darin, daß diese Verknappungen nicht notwendig, sondern von Machtgruppen oder Mehrheiten gewollt und beschlossen sind, entlarvt sich das wahre Gesicht der Verfügungsermächtigung über Neugeborene mit Behinderung wie über Menschen mit Behinderungen überhaupt: Es dient - bewußt oder unbewußt den Eigeninteressen, es ist Teil des allgemeinen Verteilungskampfes, in dem die einen mehr für sich erkämpfen als sie für sich zum Leben brauchen und als sie anderen zum Überleben lassen.
Gentechnologie und Reproduktionsmedizin scheinen vordergründig positiv zu sein, lassen bei näherem Zusehen jedoch weitreichende negative Folgen erkennen. Sicherlich geht es nicht in erster Linie um Rechtfertigungsmöglichkeiten fürs Töten, doch Töten kommt auch hier in Teilbereichen durchaus vor und zwar als scheinbar gar nicht mehr rechtfertigungsbedürftige Nebenfolge des Fortschritts: Gentherapieexperimente an Embryonen mit Behinderung, weil diese bei Mißerfolg ja ohnehin unter die "Eugenische Indikation" fallen; Selektion nach Qualitätsmerkmalen und Töten nicht einzupflanzender Embryonen nach Reagenzglasbefruchtung, Töten überzähliger Embryonen nach künstlicher Befruchtung im Mutterleib. Wenn jedoch diese Folgetötungen nur eine Randerscheinung sind, wenn im Mittelpunkt der hier genannten Perfektionierungsprojekte der Versuch steht, dem Entstehen von Behinderung durch Genmanipulation vorzubeugen und die Auswirkungen von Behinderung durch Therapie und Förderung zu reduzieren, was wäre denn daran problematisch, was wäre dagegen einzuwenden?
Zuerst einmal ist das Risiko von Neben- und Folgewirkungen aller Gentechnologie und Gentherapie letztlich nicht überschaubar und deswegen unverantwortlich. Doch darüber hinaus ist insbesondere zu kritisieren, daß das gentechnologische Fortschrittsstreben mit einem geradezu wahnhaften Perfektionierungsglauben verbunden ist, der einen grundsätzlichen Verlust von Ehrfurcht vor dem Leben mit sich bringt, vor der Lebendigkeit allen Lebens, so wie es ist. Die gentechnologische Biologisierung des Denkens bedeutet eine Desensibilisierung und Abstumpfung, einen Verlust an Wahrnehmung von Seele oder Geist in jeder Verkörperung, mit welcher genetischen Ausstattung auch immer.
Weiter ist zu kritisieren, daß die Gentechnologie mit ihren spektakulären Präventions- und Therapieversprechen von der Tatsache ablenkt, daß über 90 Prozent aller Behinderungen nachgeburtliche Ursachen haben, und daß sie mit der Illusion von der Vermeidbarkeit von Behinderungen die Solidaritätsverweigerung gegenüber Menschen mit Behinderung fördert, die allgemeine Behindertenfeindlichkeit unterstützt.
Die gentechnologischen Präventionsbestrebungen kehren sich bei Absolutsetzung ihres Ziels gegen die Menschen, denen sie dienen sollten, tragen bei zur Steigerung von Behindertenfeindlichkeit, führen zur Mißachtung, Aussonderung, Beseitigung der Nichtverhüteten und der Nichtgeheilten. Die zunehmenden Präventionsmöglichkeiten beinhalten einen enormen Machtzuwachs für ihre Akteure, und die Verbindung von Macht mit der grundsätzlich negativen Bewertung von Menschen mit Behinderung eröffnet Machtmißbrauchsmöglichkeiten, denen kaum Einhalt zu gebieten ist: Totales Durchsetzen der einseitigen Herrschaftsinteressen, Zwang zum Nutzen aller Präventionsmöglichkeiten, Bestrafen von Verweigerern, Beseitigen von nichtgewünschten oder fehlerhaften "Produkten".
In gleicher Weise schafft die einseitige Vorrangsetzung für Therapie und Förderung auch bei medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Bemühungen einen derartigen Erfolgsdruck, daß sie diejenigen, die keine volle Anpassung an die Normen der Herrschenden, der Perfekten schaffen, als Unangepaßte und damit eben als Nichtdazugehörige, als Auszusondernde, als zu Vernachlässigende, als zu Benachteiligende definiert. Die Alternative, Therapie und Förderung als zweitrangig einzustufen, Akzeptanz vor Therapie zu setzen, würde eine Kommunikation verwirklichen, die von Angst befreien und Freude an den jeweiligen individuellen Lebensäußerungsmöglichkeiten vermitteln würde und damit in anderer Weise als unter dem Erfolgsdruck auch therapeutisch wirken könnte.
Die Ausübung von Macht- und Herrschaftsinteressen, das Ausnutzen von wirtschaftlichen Vorteilnahmemöglichkeiten, das Vorantreiben materiellen Fortschritts ohne Rücksicht auf die ökologischen und sozialen Kosten ist in vielfältiger Form auch direkt Ursache von Schwächen, Behinderungen, Krankheiten und Tod, weil es Menschen zu Opfern des Fortschritts macht. Zu denken ist an eine ganze Reihe von Opfern: Opfer von Eroberungskriegen, Opfer von wirtschaftlicher Ausbeutung, Opfer von technischen Entwicklungen (Tschernobyl-Opfer, Autoverkehrsopfer u.a.), Opfer von Umweltvergiftungen u.a.
Die für den angeblichen Fortschritt Verantwortlichen lehnen fast regelmäßig die Übernahme eigener Verantwortung für die Opfer und für Opferhilfe strikt ab, sie weisen den Opfern die Schuld zu; mit ihrer Leistungsschwäche, mit der Entstellung ihres Äußeren, mit ihrem Verlust an Lebensenergie, mit ihrer Feindseligkeit usw. sind sie es, die sich - angeblich - selber ausschließen. Aus der Sicht der Fortschrittsbetreiber gibt es kaum eine andere Lösung, als z.B. die große Zahl von Tschernobyl-Opfern, bei denen die radioaktive Strahlung eine Behinderung verursacht hat, vorgeburtlich zu diagnostizieren und abzutreiben oder auch noch nachgeburtlich zu töten. Die Fortschrittsbilanz muß gereinigt werden. Dies wird oft kaum noch für rechtfertigungsbedürftig gehalten bzw. all die Rechtfertigungen fürs Töten, Nichtbehandeln, Benachteiligen, Verbrauchen von Menschen, die in den aufgeführten medizin-ethischen Problemfeldern entwickelt wurden, finden hier uneingeschränkt breite, ja weltweite Anwendung.
Und damit keiner unruhig wird, wird zusätzlich die alte Fortschrittslüge hochgehalten, der weitere Fortschritt werde es schon richten, die weiteren Fortschrittserfolge würden neue medizinische Erkenntnisse schaffen, würden die Heilung von bisher Unheilbaren möglich machen oder gentechnische Verbesserungen schaffen, würden Menschen widerstandsfähiger und leistungsfähiger machen oder landwirtschaftliche Produktionssteigerungen und sonstige Reichtumsentwicklungen schaffen und irgendwann einmal Wohlstand für alle bringen.
Im Kontrast dazu, sich der Kommunikation mit Opfern zu öffnen, könnte grundlegende Umorientierung in Gang setzen. Doch dafür haben die Kämpfer für immer mehr und immer schnelleren Fortschritt keine Zeit - bis sie eines Tages - vielleicht - begreifen, wie sehr dies alles letztlich sie selbst schädigt.
Die verschiedenen skizzierten Teilbereiche von Perfektionierungsprojekten und Herrschaftsmacht steigern sich meines Erachtens in ihrer Wirkung gegenseitig und erwecken zusammen den Eindruck eines ausgeklügelten Vernichtungsprogramms gegenüber Menschen mit Behinderung, mit Defekten, mit Schwächen. Und als Kehrseite dieser Perfektionierungsprojekte und des gesamten Vernichtungsprogramms entwickelt sich der Verlust an Kommunikation, an Kommunikationspraxis und an Kommunikationserfahrung zu einer Bedrohung auch des eigenen Lebens der Akteure und Propagandisten dieses Programms und des gesellschaftlichen Zusammenlebens insgesamt. Denn das allzu leicht übersehene Gesetz der Kommunikation ist, daß sie dialogisch, zweipolig, für beide Seiten bedeutsam ist. Behindertenfeindlichkeit, Infragestellung des Lebensrechtes von Menschen mit Behinderung und die Wirklichkeit von Tötungspraxis sind Elemente einer Gesellschaftsentwicklung, die mit ihrer Menschenfeindlichkeit und Lebensfeindlichkeit letztlich alle bedroht. Es gibt eine ganze Reihe allgemeiner Symptome dieser negativen Entwicklung: Vereinzelung und Vereinsamung von immer mehr Menschen, das Leiden gerade von leistungsstarken und erfolgreichen Menschen unter innerer Leere, unter einem Existenzvakuum (V.E. Frankl), eine allgemeine Desensibilisierung gegenüber Unrecht, die Entsolidarisierung gegenüber Benachteiligten, eine Zunahme von Aggressivität und Gewalt, von Feindschaft gegenüber anderen Menschen (Ausländerfeindlichkeit u.a.), Bedeutungsverlust der Menschenrechte, Zunahme an Angst.
Perfektion, Vielwissen, Reichtum, Macht führen zum Verlust an persönlicher Kommunikation, zur Endleerung des Herzens, wenn sie eine einseitige Konzentration der Kräfte auf Äußeres und Materielles betreiben. Der Verlust, die Leere wird durch oberflächliches Konsumglück kaschiert, Liebe wird durch öffentliche Anerkennung und Ehre unbefriedigend ersetzt. Die Illusion der Machbarkeit und Kaufbarkeit von Glück verhindert die Umkehr zu einem Leben, in dem wir mehr Formen des Miteinanders entwickeln, in denen leistungsunabhängige, persönliche Achtung zum Ausdruck kommt, in denen Mitmenschlichkeit lebendig wird, in denen Anonymität, Ängste, Mißtrauen, Aggressionen durch Entgegenkommen und Dazugehörigkeit, durch persönliches Kennenlernen und Vertrauen, Vergeben und Trost, Wertschätzung und Ermutigung, durch Mitmenschlichkeit, durch Liebe überwunden werden.
[35] Uhich Duchrow und Martin Glück: Wirtschaften für das Leben im Wahljahr 1994. Bremen 1994, Seiten 5/4.
[36] Duchrow/Glück, a.a.O., Seite 4.
[37] Aus Eduardo Galeano: Von der Notwendigkeit Augen am Hinterkopf zu haben (Aus dem Spanischen). Wuppertal, 1992.
[38] Hans-Martin Sass: Hirntod und Hirnleben. In: Medizin und Ethik. Stuttgart 1989. Seiten 163/164.
[39] Hans-Martin Sass: a.a.O., Seite 167.
[40] Hans-Martin Sass: Über den Beginn des Lebens. Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 12.11.1992).
[41] Hans-Martin Sass: Wann beginnt das Leben? 70 Tage nach der Empfängnis: Die Entwicklung des Gehirns macht den Menschen aus. Die Zeit, 30.11.1990. Vgl. auch: Hans-Martin Sass: Hirntod und Hirnleben. Seiten 160-183, in: Medizin und Ethik. Reclam, Stuttgart, 1989.
[42] Hans-Martin Sass: Hirntod und Hirnleben, a.a.O., Seite 168.
[43] Zitat aus der "Tageszeitung", in Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 3.7.1992.
[44] Tilo Ramm: Die Fortpflanzung - ein Freiheitsrecht? in: Juristenzeitung, 6.10.1989, Seite 869.
[45] Vgl. die (nicht publizierten) Stellungnahmen von Dr. Wirn Croughs.
Inhaltsverzeichnis
Es liegt im gemeinsamen Interesse von Menschen mit und ohne Behinderung, Kommunikationskultur und Solidaritätspraxis zu entwickeln, die Anerkennung der Menschenrechte für alle zu gewährleisten, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit zu verwirklichen, weil dies dem Leben aller, der Menschlichkeit und dem Frieden dient.
Trotzdem sind Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen kein Politikum, wenn wir keins draus machen. Denn die Fortschrittspropagandisten täuschen mit Macht und Lüge über die zerstörerischen und selbstzerstörerischen Folgen des vordergründigen rücksichtslosen Fortschritts hinweg.
Wir müssen kämpfen für die Klärung und Durchsetzung des Menschenbildes, das die Erkenntnis und Anerkenntnis der Gleichheit aller Menschen in all ihrer individuellen Unterschiedlichkeit zur Grundlage der praktischen gesellschaftlichen Gleichberechtigung aller macht.
Wir müssen streiten gegen alle utilitaristischen oder bioethischen Versuche, das Töten von Menschen durch Menschen zu legitimieren, neue Programme zur Vernichtung von Menschen zu begründen, von Menschen, die sich selber aus eigener Kraft gegenüber der Bedrohung nicht wehren können: Menschen in vorgeburtlicher Entwicklung, Menschen in der Hilflosigkeit von Neugeborenen mit schwerer Behinderung, Menschen in der Schwäche unheilbarer Krankheiten, des Alters, des Sterbens. Ich denke, wir dürfen die politische Bedeutung und Wirksamkeit dieser utilitarischen oder bioethischen Selektionen und Vernichtungsprogramme nicht unterschätzen. Wir haben beharrlich aufzuklären, zu protestieren, zu kämpfen.
Wir müssen kämpfen für die Klärung und Durchsetzung eines Gesellschaftsbildes, das auf der Grundlage der Anerkenntnis der Gleichheit aller Menschen ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit für jeden mit einem Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit für alle verbindet.
Wir müssen im Streit zwischen sozialistischen und kapitalistischen Gesellschaftsvorstellungen deutlich machen, welche verheerende, zerstörerische, letztlich selbstzerstörerische Auswirkung das ungeregelte Ausleben der einseitig materiellen Egoismen und der Macht des Stärkeren hat, welche lebensnotwendige, zukunftsbewahrende Bedeutung eine effektive Solidaritätspolitik hätte.
Es ist deutlich zu machen, daß Gewalt gegenüber Schwächeren in der Form rational reflektierter Selektionsprozesse grundsätzlich nichts anderes ist als die Gewalt gegenüber Schwächeren in der Form explosiver Ausbrüche von Aggressivität und Haß auf der Straße, daß die politisch beschlossene Verknappung von Steuermitteln für Aufgaben der Bildungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik, daß die Kriminalität des Pflegenotstandes, des Arbeitslosigkeitsnotstandes, des Hungernotstandes nichts anderes ist als die Kriminalität des Beraubens von Menschen durch Einbruch in ihre Wohnungen u.ä. Es sind gleiche Folgen der Macht der Stärkeren im vom Egoismus bestimmten Interessenkonflikt. Es sind gleiche Symptome versteckt schleichender oder offen propagierter Entsolidarisierungsprozesse.
Diese Entsolidarisierungsprozesse stellen soziale Vergiftungsprozesse dar, die wie die ökologischen Vergiftungsprozesse in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden dürfen: sie haben katastrophale Auswirkung letztlich für alle.
Die neue, alte "Euthanasiepropaganda" muß als schrilles Alarmsignal, das Gefahr für die Gesamtgesellschaft anzeigt, gehört werden. Eine Gesellschaft, die systematische Hilfeverweigerung und planmäßiges Töten für bestimmte Personengruppen legalisiert, schädigt sich als Gesamtgesellschaft selbst: sie betreibt damit einen Prozeß der Selbstentfremdung und der Brutalisierung des Zusammenlebens, einen immer mehr Menschen umfassenden Prozeß zunehmender Selbstzerstörung.
Deswegen ist deutlich zu machen: Es liegt im beiderseitigen Interesse, d.h. es liegt eben auch im Eigeninteresse von Nichtbehinderten, die Kommunikationskultur des Miteinanders der Verschiedenen weiterzuentwickeln und mehr Gerechtigkeit zu verwirklichen, mehr Solidarität zu üben. Sozialpolitische Maßnahmen zur Überwindung sozialer Notlagen sind nicht nur für die von Not Betroffenen selber von Nutzen, sondern sie erbringen einen "Zusatznutzen" für die Gesamtgesellschaft: sie haben friedenschaffende und zukunftsbewahrende Bedeutung für alle.
Der immer wieder aktuelle Versuch, die Kräfte vorrangig für weiteres Wirtschaftswachstum einzusetzen und mehr Menschlichkeit und mehr Gerechtigkeit als Folgeeffekt des Wirtschaftswachstums zu bewirken, erweist sich immer deutlicher als katastrophal gefährlicher Trugschluß, wenn nicht als bewußte Irreführung.
Kommunikationskultur- und Solidaritäs-Entwicklungsprogramme sind wie Aufforstungsprogramme in versteppten Landschaften. sie heben den sozialen Grundwasserspiegel in lebensnotwendiger Weise.
Verletzungen des Lebensrechts und der Menschenwürde von Menschen mit Behinderung sind nicht nur eine Folge der gegenseitigen Entfremdung durch Aussonderung, sondern sie sind zugleich Folge eines vom Egoismus bestimmten Interessenkonflikts. Als solche sind Verletzungen des Lebensrechts und der Menschenwürde nicht ein Sonderproblem von Menschen mit Behinderung, sondern ein Problem von vielen Menschen mehr. Im Kampf um die Verwirklichung des Besitz- und Bereicherungsinteresses, um die Durchsetzung des Macht- und Machterweiterungsinteresses der jeweils Stärkeren und Mächtigeren dienen Vorurteile und Klischeeurteile über "Behinderte" als Herrschaftsinstrumente genauso wie Rassenklischees und Feindbilder gegenüber anderen Menschen. Ethische Legitimationsversuche für Einschränkungen des Lebensrechts und der Menschenwürde sind nichts anderes als Ablenkungen vom Eigeninteresse der Mächtigen und von der systembedingten Unrechtspraxis kapitalistischer Marktwirtschaft und Egoismusherrschaft.
Dieser Interessenkonflikt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung besteht jedoch nur vordergründig. Entsprechend der Gleichheit der Verschiedenen gibt es eine tiefergehende und längerfristige Interessengemeinsamkeit von Menschen mit und ohne Behinderung. Es liegt im beiderseitigen Interesse, d.h. es liegt auch im Eigeninteresse von Nichtbehinderten, die Kommunikationskultur des Miteinanders der Verschiedenen weiterzuentwickeln und mehr Gerechtigkeit zu verwirklichen. Kommunikationskultur ist nicht als soziales Dekorationsmäntelchen zu verstehen und Solidaritätspolitik nicht als Nebenprodukt weiteren Wirtschaftswachstums, sondern erforderlich ist eine grundlegende Umorientierung: eine Selbstbegrenzung der eigenen Macht und des eigenen Konsums, aus Einsicht in den daraus folgenden Gewinn an Lebensfülle und Menschenwürde für alle.
Eine Gesellschaft, die die Zeugung genetisch "geschädigter" Kinder diskriminiert oder gar verbietet, die der Geburt von Kindern mit Behinderung durch Abtreibung zuvorkommt, die das Leben von Neugeborenen mit schwerer Behinderung durch Behandlungsverweigerung beendet, die die am Leben bleibenden Menschen mit Behinderung und die überlebenden Unfall- oder Krankheitsopfer in die primäre Zuständigkeit von Fachleuten und Sondereinrichtungen verweist, die "Behinderte" lediglich duldet, aber nicht als voll dazugehörig achtet, die die Mehrheit von den Aufgaben des Helfens und Begleitens als vermeintlichen Lasten entsorgt, - eine Gesellschaft, die in dergleichen ihr Heil sucht, erntet Unheil. Eine Gesellschaft, die derart vorrangig und einseitig nach Perfektionierung von Funktions- und Leistungsträgern strebt, die beraubt sich selber wichtiger Bereiche ihrer Kommunikationskultur und verarmt an lebendigen Erfahrungen von Solidarität.
Der Verlust und die Verweigerung von zwischenmenschlichen Beziehungen, die Aussonderung, Diffamierung, Schädigung von Menschen und Menschengruppen, das Töten von Menschen gar und das Rechtfertigen des Tötens, mit welchen Thesen auch immer, all das wirkt gleichfalls über die direkten Opfer hinaus: Es zersetzt Anteilnahme, Einfühlungsvermögen, Gewissensbildung, zerstört Gemeinschaftsentwicklung, vergiftet die Gesellschaft mit Angst und Haß, fährt zu sozialer Kälte und Leere, für die das Anwachsen von Gewalt ein Ausdruck neben anderen ist.
Die praktische Umsetzung des Vorrangs für Kommunikation und Solidarität, die vorrangige Verwirklichung und Ausgestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen wirkt in gleicher Weise positiv über die unmittelbar Beteiligten hinaus: das schafft ein soziales Klima, in dem Originalität, Spontaneität, Kreativität und Lebendigkeit wachsen; eine Kultur des Zusammenlebens, in der Angstfreiheit, Vertrauen, Geborgenheit, Güte und immer mehr Lebensfreude erfahrbar werden.
Solidaritätspraxis und Solidaritätspolitik, die die Menschenrechte aller und insbesondere derjenigen garantiert, die sich gegenüber Ungerechtigkeit und Lebensbedrohungen nicht selber wehren könnten, ermöglicht zugleich denen, die sich wehren können, grundsätzlich und praktisch auf Gewalt zu verzichten und schafft damit eine zuverlässige Grundlage für ein Leben in Frieden für alle.
Kommunikation statt Perfektion! Akzeptanz vor Therapie und Prävention! Hilfe statt Strafe! Solidarität statt Töten! Gefordert ist ein radikales Umdenken, notwendig ist ein die Verhältnisse tatsächlich verändernder Prioritätenwechsel! Wenn wir nicht nur die Einsicht haben, daß wir unsere Prioritäten verändern müssen, wenn wir wirklich ernst machen mit dem notwendigen Vorrang für Kommunikation und Solidarität, dann muß das Konsequenzen von großer Reichweite haben: dann müßte das an Geld und an Zeit und an Kraft, was bisher in Perfektionierungsprojekte, in unsoziale Wirtschaftsfortschritte, in einseitige Reichtums- und Machtentwicklungen investiert wird, hineingegeben werden in die Verwirklichung von Integration, von Miteinander der Verschiedenen, von Sozialerziehung, von Solidarität und Gerechtigkeit.
Dann müßte die gemeinsame Kindertagesstätte und die gemeinsame Schule für alle (ohne Aussonderung aufgrund der Schwere einer Behinderung) zur Regel werden, mit angemessener personeller wie räumlicher Ausstattung und mit veränderten, am Lernziel Kommunikation und Solidarität orientierten Praxiskonzepten. Dann müßte es viele gemeinschaftliche Arbeitsbetriebe geben, in denen Menschen mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten partnerschaftlich, arbeitsteilig und mitbestimmend zusammenarbeiten. Dann müßte es wirksame Förderung für Siedlungspläne und Gemeinwesenarbeitsprojekte geben, die die Gemeinschaft der Verschiedenen in Wohnnachbarschaften sowie in Kultur- und Freizeitaktivitäten entwickeln helfen würden. Dann müßte es einerseits mehr Praxis von Hilfeleistung im alltäglichen Zusammenleben geben, als ein Ausdruck von Kommunikation und als selbstverständliches Element im Miteinander der Verschiedenen, und andererseits die solidarische Finanzierung eines tatsächlich bedarfsgerechten Ausbaus bezahlter Helfer- bzw. Assistenzdienste. Dann müßte es die Zusammenarbeit der Verschiedenen in der Übernahme sozialer Verantwortung füreinander geben, Zusammenarbeit in der Verantwortung dafür, daß keiner ohne Hilfe bleibt, der auf Hilfe angewiesen ist, und daß keiner unterdrückt, ausgebeutet, geschädigt wird, der sich selber alleine nicht wehren könnte, Zusammenarbeit in der politischen Verantwortung für die Entwicklung einer menschlicheren Stadt für alle.
All dies müßte nicht nur so, sondern das muß so werden, wenn es stimmt, daß die Prioritätenveränderung im wahrsten Sinne notwendig ist. Und dann darf all dies nicht mehr als bevormundende Wohltätigkeit der einen für die anderen abgeleistet werden, dann darf all dies nicht mehr vom Wohlwollen "sozial engagierter" Mitbürger abhängig gemacht und immer wieder nachrangig und einschränkend behandelt werden. Sondern es muß durch Rechtsansprüche auf volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, durch Rechtsansprüche auf gleichberechtigende, Selbstbestimmung ermöglichende Sozialleistungen, durch Gleichstellungsgesetze und durch ein grundgesetzliches Diskriminierungsverbot gestärkt und abgesichert werden. Der notwendige Veränderungs- und Entwicklungsprozeß muß von den Verschiedenen, z.B. von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, als gleichberechtigten Partnern - als nicht nur moralisch, sondern auch als gesetzlich gleichberechtigten Partnern - miteinander vorangetrieben und ausgestaltet werden.
Es geht bei dem, was wir in alternativen Praxisprojekten und mit politischem Engagement zu verwirklichen versuchen nicht um ein bißchen mehr Gerechtigkeit zum Ruhighalten möglichen Protestes, nicht um ein bißchen Entgegenkommen, nicht um bloße Befriedungsmaßnahmen. In jedem kleinen Projekt muß sich die geforderte Radikalität des Umdenkens erweisen. Und die Radikalität der Prioritätenveränderung muß einen Prozeß der Veränderung des Gesamtsystems unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens betreiben.
Erich Fromm hat dies in folgender Weise auf den Punkt gebracht:
"In der Vergangenheit bestand die Gefahr, daß der Mensch zum Sklaven wurde. Die Gefahr der Zukunft liegt darin, daß der Mensch zum Roboter wird. Allerdings rebellieren Roboter nicht. Aber angesichts der Natur des Menschen können Roboter nicht leben und innerlich gesund bleiben, sie werden zu 'Golems', sie werden ihre Welt und sich selbst zerstören, weil sie die Langeweile eines sinnlosen Lebens nicht länger ertragen können ...
Der heutige Mensch steht vor der entscheidenden Wahl, nicht zwischen Kapitalismus und Kommunismus, sondern zwischen dem Robotertum (sowohl von der kapitalistischen wie auch von der kommunistischen Art) und dem humanistischen, kommunitären Sozialismus. Das meiste scheint darauf hinzuweisen, daß er sich für das Robotertum entscheiden wird. Und das bedeutet auf die Dauer inneren Zerfall und Zerstörung. Und doch reichen alle diese Tatsachen nicht aus, den Glauben an die Vernunft des Menschen, an seinen guten Willen und seine innere Gesundheit zu zerstören. Solange wir uns noch Alternativen ausdenken können, sind wir noch nicht verloren. Solange wir noch gemeinsam beraten und planen können, dürfen wir hoffen. Freilich werden die Schatten schon länger, und die Stimmen der Unvernunft werden lauter. Die Verwirklichung eines Zustands der Humanität, der den Visionen unserer großen Lehrer entspricht, liegt in unserer Reichweite, und trotzdem laufen wir Gefahr, unsere gesamte Zivilisation zu vernichten oder zu Robotern zu werden. Einem kleinen Stamm wurde vor Tausenden von Jahren gesagt: ‚Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben.' (Dtn. 30, 19) Vor diese Wahl sind auch wir gestellt."[46]
Josef Huber hat die Alternative wie folgt formuliert:
"Die grundlegende weltanschauliche Alternative, vor der wir stehen, heißt Technokratie oder Menschlichkeit - Technofaschismus oder Konvivialität. Wir können in technokratischer Weise die menschlichen Arbeits- und Konsumbedürfnisse den Nutzungs- und Verteilungs-Sachzwängen des Systems unterwerfen und damit die innere und äußere Natur des Menschen einer fortschreitenden Verwüstung preisgeben - oder wir können die Lenkung der Nutzungs- und Verteilungsvorgänge eindeutig an die Arbeits- und Konsumbedürfnisse binden, die aus einer personalen Identität erwachsen, wie sie die Menschen in einer undeformierten sozialen und natürlichen Umwelt erwerben können. Es handelt sich m.a.W. um die Alternative zwischen den biologischen und psychologischen Humantechniken der schönen neuen Welt oder den möglichen Formen einer ökologischen, humanen und demokratischen Politik. Es ist die Wahl zwischen Manipulation und Moral."[47]
Einsichten und Appelle reichen nicht aus, um diese Umorientierung wirksam zu machen, um die notwendigen Veränderungen durchzusetzen, um unsere gemeinsamen gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu verbessern. Zur Eindämmung und Überwindung des eintrainierten und vielfach sanktionierten Egoismusses bedarf es politisch durchzusetzender Steuerungsinstrumente, die - wie die Straßenschwellen zur Durchsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen - konkret erfahrbare Anreize und Erschwernisse schaffen. Menschen mit Behinderung und alle, die mit ihnen an der Entwicklung einer menschlicheren Stadt interessiert sind, müssen politischer werden, müssen mehr Engagement für eine bessere Politik entwickeln: für gerechtere Gesetze und für gerechtere Strukturen. Gesetze und Strukturen sind zwar keine Garantie, aber sie stellen doch eine notwendige Rahmenbedingung dar für die (Weiter-)Entwicklung und für das Durchhalten des persönlichen Miteinanders der Verschiedenen in einer menschlicheren Stadt für alle.
Wir müssen das traditionelle Politikdefizit von "Behindertenarbeit" überwinden. Wir müssen unser Engagement für konkrete Menschen und für die uns möglichen Praxisentwicklungen verbinden mit politischem Engagement für die Veränderung der gesamtgesellschaftlichen Bedingungen unseres Zusammenlebens und unserer Praxis. Und wir haben die Chance, dies in einer Bündnispartnerschaft aller Benachteiligten und aller Engagierten gemeinsam zu tun und tatsächlich Mehrheiten zu gewinnen! Denn das Ziel ist das gemeinsame: eine menschlichere Stadt für alle. Konkret heißt dies: Wir müssen unsere Alltagspraxis mit politischer Arbeit verbinden, mit Strukturentwicklungspolitik und mit Gesetzgebungspolitik.
Die notwendige Strukturentwicklungspolitik müßte darauf zielen, die vielfach vorhandenen Aussonderungsstrukturen zu überwinden und Formen des Miteinanders der Verschiedenen in allen Lebensbereichen zu entwickeln. Es geht nicht um Integration oder Normalisierung im Sinne von Anpassung und Einordnung in eine kommunikationsfeindliche, solidaritätszersetzende Normalgesellschaft, sondern es geht eben um eine Veränderung der Lebensweise der "Nichtbehinderten", um eine Humanisierung unserer gemeinsamen Lebensverhältnisse.
Strukturpolitik zur Förderung integrativen Zusammenlebens muß konkrete Investitionsprogramme entwickeln für:
-
Ausbau persönlicher Assistenzdienste in selbstbestimmten Organisationsformen, Entwicklung eines Netzwerkes von Stützpunkten in den Stadtteilen (als Anlaufstellen und Vermittlungsbüros für alle erforderlichen Assistenzdienste)
-
Aufbau von Selbstbestimmt-Leben-Beratungsstellen zur Entwicklung von individuellen Hilfeleistungs- und Zukunftsplänen (unabhängig von Dienstleistungsträgern)
-
Förderung von Gemeinwesenarbeit zur Entwicklung der Stadtteilkultur, einer neuen Qualität von Nachbarschaft und von Gemeinschaftsprojekten
-
Aufbau und integrative Ausgestaltung von gemeinsamen Kindergärten und gemeinsamen Schulen für alle
-
Ausbau des Freiwilligen Sozialen Jahres als nachschulisches Bildungsjahr (und als Alternative zu einem Pflichtjahr)
-
Förderung der kooperativen, integrativen Ausgestaltung der Arbeit in den allgemeinen Arbeitsbereichen
-
Entwicklung von individuellen assistenzgestützten Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung; Förderung von kommunikativen wie ökologischem Siedlungsbau; Abbau von Architekturbarrieren, Wohnumfeldverbesserungen
-
Ausbau von Breitenkulturarbeit und Kreativitätsförderung, Unterstützung integrativer Praxis künstlerischen Schaffens.
Genauso wie Strukturpolitik so müssen wir auch Gesetzgebungspolitik betreiben. Wir müssen Gesetzesinitiativen entwickeln bzw. uns an Initiativen beteiligen z.B. für:
-
ein Gleichstellungs- bzw. Antidiskriminierungs-Gesetz, das die im Grundgesetz formulierten Menschenrechte "Die Würde des Menschen ist unantastbar", "Die Freiheit der Person ist unverletzlich", "Alle sind vor dem Gesetz gleich" usw. so konkretisiert, daß die Überwindung aller faktisch vorhandenen Benachteiligungen und Diskriminierungen, wie Architekturbarrieren, wie Mangel an Assistenzdiensten, wie Diskriminierung durch Sondereinrichtungen usw., zu einem einklagbaren Recht wird;
-
ein Assistenzleistungs-Gesetz, das die im Bundessozialhilfegesetz vorhandenen Rechtsansprüche auf finanzielle und personelle Hilfeleistung, also auf Eingliederungshilfe, Pflegehilfe, Haushaltshilfe u.a., von Einkommensgrenzen entbindet und so erweitert, daß es alle Hilfeleistung, die individuell erforderlich ist, um das Führen eines gleichberechtigt selbstbestimmten Lebens zu ermöglichen, als Solidarleistung verwirklichen hilft;
-
ein Bildungsreform-Gesetz, das jedem Kind einen einklagbaren Rechtsanspruch darauf schafft, den gleichen Kindergarten und die gleiche Schule, zusammen mit allen anderen Kindern der Nachbarschaft zu besuchen, nicht ausgesondert zu werden, auch wenn es eine Behinderung hat; ein Rechtsanspruch darauf, eine integrative Pädagogik und integrative Rahmenbedingungen verwirklicht zu bekommen' die allen ein wirklich gutes Miteinander-Leben-Lernen ermöglichen;
-
ein Mindesteinkommens-Gesetz, das - zumindest - ermöglichen würde, den sozialhilferechtlichen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt durch die Möglichkeit zu erweitern, Ergänzungsbeträge bis an ein tarifliches Einkommen heran ohne Abzug von der Sozialhilfeleistung hinzu zu verdienen, und das - darüber hinaus - ein Mindest- oder Grundeinkommen für alle schaffen würde, die keine gleichberechtigende Arbeitsvergütung erhalten.
Große Investitionsprogramme! Teure Gesetze! Wer soll das bezahlen? Das ist die Frage all derjenigen, die den Standpunkt vertreten, erst viel haben zu müssen, um dann wenig abzugeben. Natürlich: All diese Bildungs- und sozialpolitischen Entwicklungsprojekte kosten Geld, viel Geld, mehr Geld als die üblichen Sparprogramme, die Menschen mit Behinderung zu Menschen zweiter Klasse machen oder sogar selektives Töten als Instrument zum Lösen sozialer Probleme nahelegen.
Demgegenüber möchte ich nochmals mit Nachdruck betonen: Solche Entwicklungsprogramme, solche größeren Finanzierungsanstrengungen für Solidarleistungen liegen immer auch im Interesse aller: Sie leisten Beiträge zum Gemeinwohl in vielfältiger, direkter und indirekter Form und sie schaffen zugleich Arbeitsplätze in erheblichem Umfang. Sie stellen soziale Zukunftsinvestitionen dar, die den Investitionen in die Wirtschaftsentwicklung auf gar keinen Fall nachgeordnet werden dürfen. Der entschiedene Ausbau von Solidaritätsleistungen ist die erforderliche Konsequenz, wenn wir wirklich die Veränderungen schaffen wollen, die es Menschen mit Behinderung ermöglichen, gleichberechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger zu werden, wenn wir es ernst damit meinen, miteinander eine menschlichere Stadt für alle zu schaffen.
Wir dürfen über den mittel- und langfristigen Forderungen nicht versäumen, das heute Mögliche in beharrlicher Alltagspraxis zu tun, die vielen kleinen, mühevollen Schritte zu gehen. Doch wir dürfen in dieser Alltagspraxis uns andererseits nicht so mit den Verhältnissen arrangieren, daß unser Tun Alibi-Funktion bekommt, letztlich Erfüllungshilfe für Unrechtspolitik leistet. Wir sollten das uns Mögliche vielmehr so tun, daß an den Bruchstücken unserer Praxis zu erkennen ist, wie das Ganze gemeint ist, daß aus den vielen kleinen Schritten ein Weg sichtbar wird, daß unser Alltagshandeln zugleich zu einem Zeichen des Widerstands wird. Wir müssen das gewohnte Politikdefizit traditioneller Behindertenarbeit überwinden und in einer Art von Doppelstrategie die konkrete Praxis verbinden mit politischer Konzeptionsarbeit, mit Protest gegen Unrechtsverhältnisse, mit Zukunftsforderungen und Visionen. Wir haben die Chance und die Verpflichtung uns mit unserer "Behindertenarbeit" vor Ort einzubringen in eine partizipative und kooperative Stadtentwicklungspolitik.
Doppelstrategie in diesem Sinne meint, einerseits sich dem nicht zu versagen, was wir heute und alltäglich für einzelne konkrete Menschen ganz praktisch tun können, weil wir das langfristige politische Engagement für die Verbesserung der Verhältnisse für einzig wichtig halten würden, und andererseits sich in der Alltagspraxis für konkrete Menschen nicht so zu verausgaben, daß keine Zeit und Kraft mehr für politisches Engagement bleibt.
Solch Doppelstrategie meint jedoch nicht, daß lediglich die Funktionäre von Behindertenarbeit (im herkömmlichen Sinn) ihr Tun für andere über die direkte Praxis hinaus auch noch auf die Ebene des politischen Engagements ausweiten. Sondern es geht ganz ausdrücklich darum, auf der Grundlage der oben beschriebenen Interessengemeinsamkeiten eine große Bündnispartnerschaft aller Benachteiligten sowie aller Mitbetroffenen zu entwickeln, um mehr gemeinschaftliche Selbstbestimmung für das eigene Gemeinwesen durchzusetzen, mehr demokratische Selbstbestimmungsmacht dem Gemeinwesen (zurück)zugeben, mehr Befreiung von den fremdbestimmenden, Menschlichkeit und Solidarität zersetzenden, eigenzweckorientierten Übermächten zu erreichen.
Solch Doppelstrategie zielt darauf, die übermächtigen Gegenmächte zurückzudrängen, um den Spielraum für die Verwirklichung der Menschenrechte im Nahbereich zu erweitern, um die konkrete Praxis von Menschlichkeit und Solidarität im Zusammenleben vor Ort weiterzuentwickeln, um die Bedingungen für die selbstbestimmte, eigenverantwortliche Ausgestaltung des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens im Gemeinwesen zu verbessern.
Städte sind von Menschen gemacht; die Gestaltung unseres Lebensortes ist von uns selber zu verantworten; da können wir Träume verwirklichen oder uns Alpträume auflasten.
Ich habe einen Traum von einer menschlicheren Stadt:
-
Ich träume von einer Stadt, in der ich eine menschenwürdige Wohnung finden kann, eine Wohnung, in der ich mich sicher und geborgen und zuhause fühlen kann, in der Kinder genügend Entfaltungsmöglichkeiten finden und alte Menschen ihren Platz haben und in der Gäste noch Gastfreundlichkeit erfahren. Und ich erträume mir, daß nicht nur ich, sondern daß jeder Mensch, daß gerade auch Menschen mit Behinderung, aber auch Flüchtlinge von weither, in meiner Stadt das finden können: nicht Notunterkünfte, nicht Massenquartiere, nicht Heime sondern menschenwürdige und persönlich auszugestaltende Wohnungen.
-
Ich träume von einer Stadt, in der sich lebendige Nachbarschaft entwickeln kann, in der ein buntes Miteinander der Verschiedenen ermöglicht wird, Kommunikationskultur in vielfältiger Form gefördert wird durch Begegnungsplätze mit Bänken und Brunnen, Nachbarschaftsküchen, Gemeinschaftsgärten, Werkstätten für Breitenkulturaktivitäten, Freizeittreffs für vielerlei Interessen, Niederflurbusse und sanfte Wegenetze, auf denen Kinder, Menschen mit Behinderung, alte Menschen vor den Gefahren des Autoverkehrs geschützt sich bewegen können.
-
Ich träume von einer Stadt, in der Menschenbildung und Solidaritätserziehung im praktischen Miteinander der Verschiedenen betrieben wird: in gemeinsamen Bildungseinrichtungen für alle, ohne Ausschluß auf Grund welcher Behinderung oder welchen sozialen Stigmas auch immer: in integrativen bzw. nichtaussondernden Kindergärten, in integrativen, nichtaussondernden Schulen für alle, in integrativen, nichtaussondernden Erwachsenenbildungsangeboten.
-
Ich träume von einer Stadt, in der alle sich mit ihren jeweiligen Leistungsmöglichkeiten in die gemeinschaftliche Erarbeitung aller notwendigen Lebensgüter einbringen können: in konkurrenzentgifteten Arbeitsbetrieben, in partnerschaftlichen Arbeitsteams von leistungsstärkeren und leistungsschwächeren; als Leistung sollte nicht mehr das anerkannt werden, was einzelne auf Kosten anderer erkämpfen, sondern das, was unter Beteiligung Verschiedener als Gemeinschaftswerk gelingt.
-
Ich träume von einer Stadt, in der jeder einen Rechtsanspruch auf alle erforderliche Hilfeleistung hat, auf die persönliche Assistenzleistung, die er in seiner jeweiligen Lebenssituation benötigt, um möglichst viel Selbstbestimmung verwirklichen zu können, um nirgendwo aus einem Mangel an praktischer Hilfe ausgeschlossen zu werden, eine Stadt, die in allen Lebensbereichen von Netzwerken mobiler Helferdienste durchzogen ist, wie ein buntes Webmuster von den Kettfäden des Gewebes; eine Stadt, die alle erforderliche Hilfeleistung gemeinschaftlich finanziert, ohne den Hilfebedürftigen mit Privatzahlungsverpflichtungen einzuschränken, ohne Angehörige und Nachbarn mit Beanspruchung ihres persönlichen Engagements zu überlasten, ohne die Kultur gegenseitiger Hilfeleistung mit der Zwangslösung eines Pflichtjahres zu entwerten.
-
Ich träume von einer Stadt, in der immer mehr Menschen die Gleichheit der Verschiedenen, die Gleichheit aller Menschen erkennen und die Gemeinsamkeit ihrer Interessen, im Kleinen und im Großen und im weltweiten Zusammenhang, die Bedeutung der Gerechtigkeit für die Zukunft aller entdecken; eine Stadt, in der immer mehr Menschen mit immer besseren Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten politisches Engagement für die Entwicklung ihrer Stadt zu einer menschlicheren Stadt für alle effektiv einbringen können.
Städte sind von Menschen gemacht; die Gestaltung unseres Lebensortes ist von uns selber zu verantworten; da können wir Träume verwirklichen oder uns Alpträume auflasten. Ich habe einen Traum von einer menschlicheren Stadt, doch was ich in Wirklichkeit erfahre, entwickelt immer mehr Alptraumähnlichkeit:
-
Die Diskriminierung der Hilfebedürftigen, die Aussonderung von Menschen mit Behinderung, die Reduktion von alten Menschen auf Heiminsassen, die Verbannung des Sterbens aus unseren Häusern; das Menschliche wird ins Soziale abgeschoben, das Soziale wird grundsätzlich als nachrangig behandelt, die Entsolidarisierung zieht immer weitere Kreise.
-
Der kriminelle Tatbestand des Pflegenotstandes wird nicht mit einer großen Solidaritätsleistung in Form eines wirklich bedarfsgerechten Assistenzleistungs-Gesetzes überwunden, sondern nur in der unzulänglichen Form einer Pflegeversicherung angegangen, die die Leistungen von vornherein pauschal begrenzt; angesichts entwürdigender Pflegenotstandssituationen gewinnen die neuen/alten Euthanasiepropagandisten und Tötungshelfer als Erfüllungsgehilfen der Entsolidarisierung an Zustimmung und Einfluß.
-
Die Massenarbeitslosigkeit, zunehmende Obdachlosigkeit, Verarmung und Verelendung von ganzen Bevölkerungsteilen unserer Stadt führen zu immer mehr Haß, zu immer mehr Gewalt und Kriminalität; die Angst wächst auf unseren Straßen, in unseren Häusern, besonders nachts; immer mehr Menschen meinen sich bewaffnen zu müssen; der ökologischen Vergiftung entsprechend entwickelt sich eine soziale Vergiftung, die in Ausmaß und Zukunftsrelevanz vergleichbar ist.
-
Unsere Schulen sind überwiegend leistungsorientierte Trainingsstätten zur Vorbereitung auf den Konkurrenzkampf in der Ellenbogengesellschaft.
-
Der Autoverkehr vergiftet die Atemluft in unseren Innenstädten, trägt außerdem dazu bei, daß wir Menschen uns immer weniger begegnen, uns immer weniger wahrnehmen, uns immer mehr voneinander distanzieren, und er bedroht immer mehr Menschen mit schwerverletzenden und mit tödlichen Unfällen, liefert so etwas wie einen tagtäglichen Bürgerkrieg der Stärkeren gegen die Schwächeren.
-
Die Vergötzung des Geldes und der Luxusgüter und der Kult der medienvermittelten Ersatzerlebnisse führen zu immer mehr Verödung der Herzen und Vereinsamung der Menschen.
-
Viele Menschen ziehen sich angesichts der Bedrohungs- und Zerstörungsmächte in die Resignation zurück, zu gering scheinen die Möglichkeiten, wirklich etwas ändern zu können.
Städte sind von Menschen gemacht; die Gestaltung unsere Lebensortes ist von uns selber zu verantworten; da können wir Träume verwirklichen oder uns Alpträume auflasten. Ich habe einen Traum von einer menschlicheren Stadt; ich erfahre
viel ernüchternde, verbitternde, verletzende, zerstörerische Gegenmacht! Auch wenn es nicht gleich den großen Erfolg bringt, ja wenn es den durchschlagenden Erfolg auch niemals schaffen sollte: Es ist sinnvoll, das jedem Einzelnen in seiner Lebenswirklichkeit Mögliche zu tun. Es ist sinnvoll, die kleinen Schritte der Alltagspraxis vor Ort zu gehen, die möglich sind. Es ist sinnvoll, die kleinen Werkstücke der Mitmenschlichkeit, der Solidarität, der Gerechtigkeit mitten in unseren Städten zu verwirklichen, auch wenn sie noch so bruchstückhaft sind:
-
weil sie in sich für die unmittelbar Beteiligten gut sind und Entwicklungsbeiträge zur Verwirklichung der gemeinsamen Interessen aller sind, und
-
weil sie zugleich Anstöße für Weiterentwicklungen in größerem Zusammenhang sind und mit politischer Arbeit gegen die Gegenmächte im Sinn der o.g. Doppelstrategie zu verbinden sind.
Wenn z.B. Menschen mit Behinderung in ihrer Stadt persönliche Wohnung und sinnvolle Arbeit finden und nicht weggeschickt und ausgesondert werden, wenn Menschen mit Behinderung als Nachbarn, als Mitarbeiter, als Mitbürger anwesend sind, dann schafft das Impulse für die Weiterentwicklung des gemeinsamen Lebensortes, die für alle wichtig sind.
So haben wir in einem 1991 herausgebrachten Informationsblatt unsere gesamte "Gemeindliche Behindertenarbeit Essen" unter das Motto gestellt: "Miteinander für eine menschlichere Stadt: zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung" und haben dieses Motto mit folgenden Ausführungen erläutert:
-
Die Gleichheit der Verschiedenen erkennen und achten lernen.
-
Die Kultur des Miteinanders der Verschiedenen und die Menschlichkeit einer solidarischen Gesellschaft entwickeln helfen.
-
Die Zusammenarbeit ausweiten zu einem Gemeinschaftswerk, das von immer mehr Menschen mit persönlichem Engagement, aber auch mit finanzieller Unterstützung mitgetragen wird.
Die konkrete Praxis der "Gemeindlichen Behindertenarbeit Essen" - so die Zwischenbilanz unseres Info-Blattes von 1991 - beinhaltet folgende Arbeitsbereiche:
-
Gruppenangebote und Stadtteilarbeit
-
Ferienfreizeiten und Urlaubsgemeinschaften
-
Mobile Integrationsförderungs-Dienste
-
Bildungsarbeit
-
Beratung
Sicherlich hat unsere Arbeit immer noch - mehr oder weniger - den Charakter besonderer und besondernder "Behindertenarbeit." Doch zugleich erschließt sie eine Fülle von Erfahrungen des Miteinander-Leben-Lernens, trägt bei zur Weiterentwicklung der Kultur des Miteinander der Verschiedenen und der Praxis mitmenschlicher Solidarität im Alltag unserer Stadt.
Um die Interessen der dabei beteiligten Menschen möglichst wirkungsvoll zu vertreten, erweist es sich immer mehr als notwendig und sinnvoll, sie mit den verwandten Interessen anderer Menschen zu verbinden und sie gemeinsam einzubringen in eine zukunftsweisende Stadtentwicklungspolitik. Zusammen mit vielen weiteren Initiativen, Organisationen, Verbänden, Institutionen, die die Interessen von anderen Menschen vertreten, von Arbeitslosen, von Obdachlosen, von jugendlichen ohne Schulabschluß, von Ausländern, von Kindern, von alten Menschen, von Desintegrierten und Benachteiligten aller möglichen Art, zusammen haben wir deswegen das Forum Soziale Stadt Essen gegründet.
Dieses Forum Soziale Stadt Essen ist konzipiert als:
-
vernetzendes Instrument zur Verdeutlichung der Interessengemeinsamkeit, zur gemeinsamen Vertretung der verschiedenen sozialen Gruppeninteressen und als
-
Planungsinstrument zur mittelfristigen Ideenentwicklung und Sozialplanung, wie sie gerade gegenüber dem Druck der von den Nöten diktierten Alltagsaufgaben und gegenüber dem Druck der - zu kurzfristigen Reaktionen herausfordernden - Sparpolitik besonders notwendig ist.
In einer ersten Phase der Zusammenarbeit in diesem Forum geht es uns darum, Anregungen für die Entwicklung einer zukunftsorientierten sozialen Kommunalpolitik in der Form von konkreten Projektplanungen einzubringen, die sich durch die Doppelzielsetzung auszeichnen, erstens Arbeitsplätze zu schaffen, also arbeitslosigkeitsbedingte Armut überwinden zu helfen, und dies zweitens mit Arbeitsinhalten verbinden, die Gewinn für die Stadtentwicklung insgesamt bringen, also dem Gemeinwohl dienen. Aus dem Erfahrungsfeld des Miteinander-Leben-Lernens von Menschen mit und ohne Behinderung sind vor allem die folgenden Programmpunkte auch als Doppelzielprojekte zu vertreten:
-
Ausbau der persönlichen Assistenzdienste
-
Gemeinwesenarbeit
-
Aufbau von integrativen Arbeitsbetrieben
-
Wohnungsbau und Wohnungsrenovierung unter Einbezug von Selbsthilfe
-
Förderung von kommunikativern und ökologischem Siedlungsbau
-
Ausbau der Breitenkulturarbeit
-
Förderung der Wohnumfeldverbesserung, Ausbau von sanften Wegenetzen usw.
-
Ausbau des Freiwilligen Sozialen und Ökologischen Jahres.
In all diesen Projekten, wie in vergleichbaren Projekten mehr, wären viele Arbeitsplätze zu schaffen und zugleich damit wichtige Beiträge zum Wohle vieler Menschen sowie der Stadt insgesamt zu verwirklichen. Die Unterstützung der verschiedenen Einzelprojekte durch das Gesamtforum gemeinsam verspricht mehr Durchsetzungskraft und tatsächlichen Einfluß auf die Stadtentwicklungspolitik.
Grundsätzlich zielen wir mit dem Forum Soziale Stadt Essen darauf, die gängige Hintansetzung des Sozialen hinter dem Wirtschaftlichen zu überwinden. Denn wir meinen, "daß Wirtschaftswachstum nicht automatisch zum Anwachsen der Sozialleistungen und zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt. Wir fürchten, daß weiteres Sparen im Sozialbereich zu noch mehr sozialen Schäden, zu einer sozialen Vergiftung führt, die der ökologischen vergleichbar ist und die Lebensqualität in dieser Stadt für alle belastet, einschränkt, zerstört" (Grundsatzpapier des Forum Soziale Stadt Essen).
Das erfordert einen entschiedenen umfangreichen Ausbau von Solidaritätsleistungen in der eigenen Stadt, wie im eigenen Land, wie in unserer gemeinsamen Welt.
Das bedeutet auch - das wird immer deutlicher - gemeinsamer Kampf gegen die Verknappung kommunaler Haushaltsmittel, gegen die Einengung des politischen Handlungsspielraums durch die massiven Ungerechtigkeiten der Verteilungspolitik übergeordneter Ebenen.
Und das bedeutet Abschied von manch blendenden "Glanzlichtern" des Luxuskonsums und von verführerischen "Goldenen Kälbern" der Wohlstandsgesellschaft.
Verwirklichung von Träumen oder Alpträumen.
Es steht viel auf dem Spiel, und die Bedrohungs- und Zerstörungspotentiale der brutalen Egoismuskultur unserer Gesellschaft haben riesige Macht.
Doch: Resignation? Nein!
Wir behalten unsere Stadt! Wir gestalten unsere Stadt: Als Ort zum Leben und Zuhausesein für alle!
Um es mit Robert Jungk zu sagen.
"Wir müssen nein sagen und zugleich etwas entwickeln, wozu wir ja sagen können, wofür wir - uns einer zukunftsträchtigen Zivilisation nähernd - aktiv werden müssen."
Resignation? Nein! Wir sollten uns weder vom Pessimismus lähmen lassen, noch uns in bequemen Optimismus verflüchtigen, sondern wir sollten uns unsere Hoffnungen und Wünsche, unsere Erinnerungen und Träume, unsere Überzeugungen und Visionen bewahren und sie zielstrebig umzusetzen versuchen: in die kleinen Schritte des jedem Einzelnen möglichen Tuns und in die großen Schritte, die wir gemeinsam schaffen können.
[46] Erich Fromm: Wege aus einer kranken Gesellschaft. Eine sozial-psychologische Untersuchung. München 1991, Erich Fromm 1955, Seiten 304 und 306.
[47] Josef Huber: Systembegrenzung und Lebensneugestaltung - Überwindung der Arbeitslosigkeit durch soziale und technische Innovation: In: Jan Peters (Hrsg.). Die Geschichte alternativer Projekte von 1800 bis 1975. Berlin, 1980, Seite 341.
Adam, Clemens: Behinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wissenschaftliches Gutachten zur Lebenssituation von behinderten Menschen und zur Behindertenpolitik in NRW. Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Düsseldorf, 1993.
Bach, Ulrich: Boden unter den Füßen hat keiner. Plädoyer für eine solidarische Diakonie. Göttingen, 1980.
Beck, Ulrich: Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen. Frankfurt, 1991.
Behnke, Rolf/Ciolek, Achim/Körner, Ingrid: Arbeiten außerhalb der Werkstatt. Die Hamburger Arbeitsassistenz - ein Modellprojekt zur beruflichen Integration für Menschen mit geistiger Behinderung. Seiten 1 - 27 (Für die Praxis). In. Geistige Behinderung 4/93. 32. Jg., Marburg, 1993.
Borggrefe, Friedhelm/Miller-Weißner, Ulrich/Pröpper, Wilfried: Gerechte Stadt. Eine protestantische Studie für Ludwigshafen am Rhein. Ludwigshafen, 1989.
Braun, Hans/Johne, Gabriele (Hrsg.): Die Rolle sozialer Dienste in der Sozialpolitik. Frankfurt, 1993.
Bruns, Theo/Penselin, Ulla/Sierck, Udo: Tödliche Ethik. Beiträge gegen Eugenik und "Euthanasie." Hamburg, 1990.
Buber, Martin: Das dialogische Prinzip. Heidelberg, 1962.
Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.): Wohnen Behinderter. 1. Literaturstudie. 2. Berichtsband. Stuttgart, 1990.
Chargraff, Erwin: Vermächtnis. Essays. Stuttgart, 1992.
Christoph, Franz: Tödlicher Zeitgeist. Notwehr gegen Euthanasie. Köln, 1990.
Cuomo, Nicola: "Schwere Behinderungen" in der Schule. Unsere Fragen an die Erfahrung. Bad Heilbronn, 1989.
Degen, Johannes: Diakonie im Widerspruch. Zur Politik der Barmherzigkeit im Sozialstaat. München, 1985.
DGSP-Fachausschuß Geistigbehinderte (Hrsg.): Ambulante Dienste. Konzepte, Praxis, Perspektiven. Bonn 1989.
Dörner, Klaus: Tödliches Mitleid. Zur Frage der Unerträglichkeit des Lebens oder: die soziale Frage. Gütersloh, 1988.
Doldasinski, Jürgen/Eike, Werner/Grohmann-Richter, Petra: Regionale Versorgung für Menschen mit geistiger Behinderung. Bremen, 1989.
Duchrow, Ulrich: Alternativen zur kapitalistischen Weltwirtschaft. Biblische Erinnerung und politische Ansätze zur Überwindung einer lebensbedrohenden Ökonomie. Gütersloh, 1994.
Espinàs, Joseph M.: Dein Name ist Olga, Briefe an meine mongoloide Tochter. Zürich, 1988/Frankfurt, 1994.
Etzioni, Amitai: Jenseits des Egoismus-Prinzips. Ein neues Bild von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Stuttgart, 1994.
Ferrnkorn, Karl Werner: "Ordinary Life" - ein Bericht über die Rücksiedelung von schwerst- und mehrfachbehinderten Menschen aus Anstalten in Wohngruppen in ihre Heimatregion Rochdale, England. Seiten 121-127. In: Wohlhüter, Herbert; Post, Heidi (Hrsg.): Standhalten? Dokumentation einer Fachtagung ... Bethel-Beiträge 45. Bielefeld, 1989.
Fromm, Erich: Wege aus einer kranken Gesellschaft. Eine sozialpsychologische Untersuchung. Stuttgart, 1980/München, 1991.
Galeano, Eduardo: Von der Notwendigkeit, Augen am Hinterkopf zu haben. Wuppertal, 1992.
Gehrmann, Petra/Hüwe, Birgit (Hrsg.): Forschungsprofile der Integration von Behinderten. Essen, 1993.
Greinert, Renate/Wuttke, Gisela (Hrsg.): Organspende. Kritische Ansichten zur Transplantationsmedizin. Göttingen, 1991.
Gronemeyer, Reimer: Ohne Seele, ohne Liebe, ohne Haß. Vom Ende des Individuums und vom Anfang des Retortenmenschen. Düsseldorf, 1992.
Hahn, Martin Th.: Zusammensein mit Menschen, die schwerstbehindert sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Förderung. Seiten 107-129. In: Geistige Behinderung 2/92, 3 1. Jg., Marburg, 1992.
Hahn, Martin Th.: Selbstbestimmung im Leben, auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Seiten 81-94. In: Geistige Behinderung 2/94. 33. Jg., Marburg, 1994.
Haller, Wilhelm: Ohne Macht und Mandat. Der messianische Weg in Wirtschaft und Sozialem. Wuppertal, 1992.
Häusler, Ingrid: Kein Kind zum Vorzeigen? Bericht über eine Behinderung. Reinbek bei Hamburg, 1979.
Hauser, Richard und Hephzibah: Die kommende Gesellschaft. Handbuch für soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit. München/Wuppertal, 1971.
Heinz-Grimm, Renate / Hellmann, Ulrich / Lachwitz, Klaus / Radenzacher, Olaf/Wendt, Sabine: Soziale Rechte geistig behinderter Menschen und ihrer Angehörigen. Marburg, 1993.
Hermann, Georg/v. Lüpke, KIaus: Lebensrecht und Menschenwürde. Behinderung, Eugenische Indikation und Gentechnologie. Essen, 1991.
Interessenvertretung "Selbstbestimmt leben" in Deutschland - ISL e.V.: Gleichstellung Behinderter. Vergleich USA - BRD. Erlangen/Kassel, 1992.
Jungk, Robert/Müllert, Norbert R.: Zukunftswerkstätten. Hamburg, 1981.
Jungk, Robert (Hrsg.): 51 Modelle für die Zukunft. Frankfurt, 1990.
KessIer, Wolfgang: Aufbruch zu neuen Ufern. Ein Manifest für eine sozial-ökonomische Wirtschaftsdemokratie. Oberursel, 1990.
Klee, Ernst: Behindert. Über die Enteignung von Körper und Bewußtsein. Ein kritisches Handbuch. Frankfurt, 1987.
Klee, Ernst: "Durch Zyankali erlöst." Sterbehilfe und Euthanasie heute. Frankfurt, 1990.
Klik. Maandblad over mensen met een verstandelijke handicap. Stichting Maandblad Klik. Utrecht/Niederlande.
Krüppel-Tribunal: Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat. Köln, 1983.
Kultusministerium des Landes NRW (Hrsg.): Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern und jugendlichen in der Sekundarstufe der Gesamtschule Köln-Holweide. Bericht der Lehrerinnen und Lehrer. Düsseldorf, 1993.
Lange, Dietrich: Solidarität und Selbsthilfe. Kommunale Sozialpolitik und Gewerkschaften. Marburg, 1988.
Lingscheid, Rainer/Wegner, Gerhard (Hrsg.): Aktivierende Gemeindearbeit. Stuttgart, 1990.
Lutz, Rüdiger (Hrsg.): Pläne für eine menschliche Zukunft. Weinheim/Basel, 1988.
Mayer, Anneliese/Rütter, Jutta (Hrsg.): Abschied vom Heim. Erfahrungsberichte aus Ambulanten Diensten und Zentren für selbstbestimmtes Leben. München, 1988.
Mayer, Lothar: Ein System siegt sich zu Tode. Der Kapitalismus frißt seine Kinder. Oberursel, 1992.
McKnight, John L.: Regenerating Community. In: Social Policy, 1987 (USA).
Mitscherlich, Alexander: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden. Frankfurt, 1965.
Muth, Jakob: Tines Odyssee zur Grundschule. Behinderte Kinder im allgemeinen Unterricht. Essen, 1991.
Perabo, Christa: Neue Ansätze der Integration von behinderten Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Seiten 338-371. In: Behindertenpädagogik, 4/93, 32. Jg., Solms/Lahn, 1993.
Peters, Jan (Hrsg.): Die Geschichte alternativer Projekte von 1800 bis 1975. Berlin, 1980.
Prengel Annedore: Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Opladen, 1993.
Rest, Franco: Das kontrollierte Töten. Lebensethik gegen Euthanasie und Eugenik. Gütersloh, 1992.
Rosenberger, Manfred (Hrsg.): Ratgeber gegen Aussonderung. Heidelberg, 1988.
Rüggeberg, Augus: Autonom Leben - Gemeindenahe Formen von Beratung, Hilfe und Pflege zum selbständigen Leben von und für Menschen mit Behinderungen. Stuttgart, 1985.
Ruh, Hans: Strategien zur Überwindung der Arbeitslosigkeit. Modell für die Transformation des menschlichen Tätigkeitshaushaltes. Seiten 134-141. In: Zeitschrift für Ev. Ethik, 38. Jg., Gütersloh, 1994.
Saal, Fredi: Warum sollte ich jemand anderes sein wollen? Erfahrungen eines Behinderten - biografischer Essay. Gütersloh, 1992.
Schernus, Renate: Die Ermordung eines Prinzips. Einige Gedanken zum Utilitarismus am Beispiel des Raskalnikoff u.a. Seiten 273-288. In: Wege zum Menschen, Göttingen, 1991.
Schmidt-Ohlemann, Matthias; Harms, Jens (Hrsg.): Soziale Netzwerke und Regionalisierung - Perspektiven für Behinderte. Arnoldshainer Texte. Frankfurt, 1990.
Schöler, Jutta (Hrsg.): "Italienische Verhältnisse" insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin, 1987.
Schöler, Jutta: Integrative Schule - integrativer Unterricht. Ratgeber für Eltern und Lehrer. Reinbek bei Hamburg, 1993.
Schumacher, E.,F.: Small is beautifull. Die Rückkehr zum menschlichen Maß. Reinbek bei Hamburg, 1985 (1977).
Schulze, Joachim: Soziokulturelle Zentren - Stadterneuerung von unten. Essen, 1993.
Sellin, Birger: Ich will kein Inmich mehr sein. Botschaften aus einem autistischen Kerker. Köln, 1993.
Sierck, Udo: Das Risiko, nichtbehinderte Eltern zu bekommen. Kritik aus der Sicht eines Behinderten. München, 1989.
Steiner, Gusti (Hrsg.): Hand- und Fußbuch für Behinderte. Frankfurt, 1988.
Tolmein, Oliver: Wann ist der Mensch ein Mensch? Ethik auf Abwegen. München/Wien, 1993.
Vanier, Jean: In Gemeinschaft leben. Meine Erfahrungen. Freiburg, 1993.
Verband Ev. Einrichtungen für geistig und seelisch Behinderte (Hrsg.): Die Sivus-Methode: zusammen leben, zusammen arbeiten, zusammen wohnen. Menschen mit geistiger Behinderung entwickeln sich durch gemeinschaftliches Handeln. Stuttgart, 1989.
Verein zur Förderung der Integration Behinderter (fib) (Hrsg.): Ende der Verwahrung?! Perspektiven geistig behinderter Menschen zum selbständigen Leben. München, 1991.
Vereinigung Integrationsförderung (VIF): Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten. Neue Wege gemeindenaher Hilfen zum selbständigen Leben. Kongreß-Bericht. München, 1982.
Vink, Ronny: Inclusion. Jeder gehört dazu. Integration in den USA. Essen, 1993.
v. Weizsäcker, Richard: Es ist normal, verschieden zu sein. Rede vor der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte." Auszüge in: Publik Forum, Oberwesel, 23.7.93.
Wieringa, Erwin/Kahn, Lynda/Brent, Barbara: Nieuwe kijk op zorg. Een werkboek. Oegstgeest, 1993.
Windisch, Matthias: Miles-Paul, Ottmar (Hrsg.): Selbstbestimmung Behinderter. Leitlinien für die Behindertenpolitik und -arbeit. Kassel, 1991.
Wolfensberger, Wolf: Der neue Genozid an den Benachteiligten, Alten und Behinderten. Gütersloh, 1991.
Zander, Margherita (Hrsg.): Anders Altsein. Kritik und Perspektiven der Altenpolitik. Essen, 1987.
Quelle:
Klaus von Lüpke: Nichts Besonderes. Zusammen-Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung. Klartext Verlag, Essen 1994
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 03.03.2005
