Behinderte und nichtbehinderte Kinder im integrierten Kindergarten
Inhaltsverzeichnis
- Vorweg
- 1. Zur Entstehung des Kindergartenprojekts
- 2. Entwicklungsschritte im Kindergarten
- 3. Integration als gemeinsames Lernen
- 4. Das Ende der Gemeinsamkeit
- Nachtrag und Kontakt
- Literaturverzeichnis
Seit Herbst 1978 gibt es in Innsbruck in der Sonnenburgstraße den ersten integrierten Kindergarten in Österreich, in dem behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam spielen, lernen, leben. Dieses gemeinsame Lebenlernen der Kinder und Erwachsenen dort ist das Thema der vorliegenden Arbeit.
Ausgehend von den Erfahrungen und Lernprozessen im Kindergarten Sonnenburgstraße wird den Fragen nachgegangen:
-
Wie leben behinderte und nichtbehinderte Kinder und betreuende Erwachsene miteinander? Wie schaut er konkret aus, der Versuch, in alltäglicher Erfahrung miteinander leben zu lernen?
-
Wie verstehen sich behinderte und nichtbehinderte Kinder miteinander? Wie und wo treffen sie sich? Wer lernt von wem? Und wie? Was haben sie Erwachsenen voraus im Umgang miteinander?
-
Wie sehen Behinderungen vom Blickwinkel spielender Kinder und Erwachsener aus? Wie verändern sie sich im Miteinander? In neuem sozialem Zusammensein?
-
Wie sehr relativiert ein neuer gemeinsamer Alltag bestimmte Behinderungen, welche "neuen" schafft er?
-
Wie entwickelt sich gemeinsames Spielen/Lernen/Leben? Welche Aufgaben kommen dabei den erwachsenen Bezugspersonen zu?
-
Wie paßt Therapie zu integriertem Lernen? Wie lassen sich die betroffenen Kinder und die Therapeutinnen in den Kinderalltag integrieren?
-
Wie geht es weiter mit den Kindern nach diesem Stück gemeinsamen Weges?
Das Geschehen im Kindergartenalltag, das (oft wilde/lustige/innige/widersprüchliche) Mit- und Durcheinander soll für andere nachvollziehbar werden. Behinderungen als Teil eines neuen, gemeinsam probierten Zusammenlebens in oft völlig neuem sozialem "Kleid" erkennbar machen, ist zugleich ein wichtiger Leitfaden durch die ganze Arbeit. Ein Stück Kindergarten (-geschichte) wird als beschriebenes Leben sichtbar, auch mit den Konflikten; die Entwicklungsschritte im Kindergarten Sonnenburgstraße werden in ihrer Chronologie offengelegt. Inhaltliche Schwerpunkte rund um die Integration als gemeinsames Lernen bestimmen das nächste Kapitel. Erste Gruppenversuche, das Lernen von und mit schwerstbehinderten Kindern, aufgezeigt an konkreten Beispielen, die Schwierigkeiten von und mit verhaltensauffälligen Kindern im gemeinsamen Alltag und die Erfahrungen rund um den Stellenwert und die Form der Therapie im Kindergarten sind spezifische Zugänge, die ich in diesem Kapitel zu öffnen und zu interpretieren versuche.
Seit diese Arbeit fertiggestellt worden ist, sind gut zwei Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich der Kindergarten Sonnenburgstraße durch die neu dazugekommenen Kinder, Eltern und Mitarbeiter entwickelt und verändert. Nach außenhin hat sich der integrierte Kindergarten in Innsbruck etabliert und ist zu einer stabilen Einrichtung für behinderte und nichtbehinderte Kinder geworden.
In der Zwischenzeit sind wir, wie das Symposion "Gemeinsam leben lernen - Schule ohne Aussonderung" in Bad Tatzmannsdorf im April 1986 gezeigt hat, was die Diskussion und die Praxis integrativer Erziehung in Österreich betrifft, ein paar (kleine) Schritte weitergekommen. Die Initiative dafür geht aus von betroffenen und engagierten Eltern, Lehrern, Kindergärtnerinnen, Therapeutinnen und Wissenschaftlern; von Leuten, die sich Kindergarten und Schule menschlicher, lebensnäher, freudiger wünschen.
Die Namen der Kinder, die im folgenden vorgstellt werden, sind verändert.
Wien, April 1986
J.K.
Inhaltsverzeichnis
Eine der Wurzeln des integrierten Kindergartens Sonnenburgstraße reicht zurück auf den Boden der Universität Innsbruck. Konkret: auf die Auseinandersetzung mit dem Ansatz der Handlungsforschung im Rahmen einer Lehrveranstaltung "Sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden: Handlungsforschung" von Peter GSTETTNER im WS 1976/77.
Neben den theoretisch orientierten Diskussionen gibt es eine konkrete Initiative aus der Praxis: zwei Psychotherapeutinnen wenden sich ungefähr zur gleichen Zeit an Peter GSTETTNER, um von "pädagogischer Seite" Unterstützung für einen Kindergarten für behinderte Kinder zu bekommen. Bei dem gemeinsamen Treffen der Studenten mit den Therapeutinnen wird auf der Grundlage der vorangegangenen Diskussionen zum Themenbereich "Behinderung" der Gedanke entwickelt, einen integrierten Kindergarten aufzubauen, in dem behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut werden. Wir gehen von den Überlegungen aus: daß durch das alltägliche Zusammensein der Kinder viele Erfahrungen und Lernprozesse möglich sind, die das Verstehen und Akzeptieren unterschiedlicher Fähigkeiten zulassen; daß durch das gemeinsame Spielen und Lebenlernen Ängste und Vorurteile abgebaut bzw. vermieden werden können; daß die Kinder voneinander lernen.
Das Kindergartenprojekt verliert bald seinen wissenschaftlichen Charakter, der Wunsch nach Praxis überwiegt, drängt Theoriediskussionen in den Hintergrund. Es entwickelt sich zu einer Initiativgruppe von Therapeutinnen, Studenten und Eltern, die ganz konkret an der Verwirklichung des Kindergartens arbeiten.
Obwohl der wissenschaftliche Bezugsrahmen in den Hintergrund tritt, wirken Ansprüche und Merkmale des Handlungsforschungsansatzes, wie sie in der Auseinandersetzung im Rahmen der Lehrveranstaltung entwickelt worden sind, auf das Kindergartengeschehen ein.
Ich versuche, die Wesentlichen kurz darzustellen:
-
das "Innovationsmoment" wirkt sehr stark in die Praxis hinein. Das Kindergartenprojekt wird von allen Betroffenen als Beitrag verstanden, in der Behindertenpädagogik/Behindertenarbeit einen neuen, einen "emanzipatorischen" Ansatz zu verwirklichen.
-
Die Projektarbeit und die Kindergartenarbeit werden von den Mitgliedern der Initiativgruppe und von den Mitarbeitern als gemeinsamer Lernprozeß wahrgenommen. Es existieren keine fixen Rollenzuschreibungen (Forscher/praktiker); dadurch wird dieses gemeinsame Lernen von Anfang an möglich und notwendig. Alle bringen ihre bisher in Ausbildung und Praxis gemachten Lernerfahrungen, Vorstellungen, Leitbilder mit und stellen sie einem gemeinsamen Austausch. Besonders auf das Mitarbeiterteam wirken die Vorstellungen von basisdemokratischer Entscheidungsfindung und gleichberechtigter Zusammenarbeit sehr stark ein. Trotz anfänglicher Unsicherheiten gelingt es im Mitarbeiterteam immer besser, diese Ansprüche zu verwirklichen, die dadurch entstehenden Lernchancen zu nützen und zunehmend soziale Kompetenzen zu entwickeln.
-
Die Teambesprechungen und die Supervision werden zunehmend zu Reflexionsinstanzen der alltäglichen Praxis. Die gemeinsamen Auseinandersetzungen im Mitarbeiterteam beziehen sich auf die konkreten täglichen Probleme und auf das Ziel, integratitive Erziehung zu verwirklichen: Reflexion zur Bewältigung der täglichen Praxis und zur Weiterentwicklung der Kindergartenarbeit.
-
Diese "kindergarteninterne" Reflexion wird von allen Mitarbeitern getragen und bewußt als wichtiger Teil der täglichen Praxis erlebt. Das "Forschungsmoment", die systematische Aufarbeitung der gemeinsamen Erfahrungen und Lernprozesse im Kindergarten, versuche ich in der vorliegenden Arbeit ein Stück weit einzulösen.
In der Arbeit finden verschiedene Materialien und Informationsquellen Verwendung (Tonbandprotokolle, Gedächtnisprotokolle, Elterntexte). Alle sind während der Kindergartenzeit und in direktem Zusammenhang mit unserer Arbeit entstanden.
Die Tonbandprotokolle von Teambesprechungen sind zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden. Ich verwende Ausschnitte aus diesen Tonbandaufzeichnungen, um unsere gemeinsame Geschichte aufzuzeigen, um dadurch die einzelnen Mitarbeiter selber zu Wort kommen zu lassen, um unterschiedliche Standpunkte deutlich zu machen.
Die Gedächtnisprotokolle sind ausschließlich meine eigenen Aufzeichnungen, die ich nach meiner Arbeit im Kindergarten am Ende eines Vormittags/Tages verfaßt habe. Diese Protokolle beziehen sich im Wesentlichen auf das Geschehen der Kinder untereinander bzw. auf Interaktionen zwischen Kindern und Betreuern.
Ausschnitte aus diesen Gedächtnisprotokollen bilden in dieser Arbeit die wesentliche Grundlage bei der Beschreibung und Interpretation von Interaktionen der Kinder untereinander, von Entwicklungen einzelner Kinder und von Konflikt- bzw. Lernsituationen. Die Gedächtnisprotokolle sind oft sehr kurz und die Mitteilungen oft nur aus dem Kontext verstehbar. Bei der Interpretation und Reflexion solcher Textstellen wird immer auch das Wissen um den Kontext miteinfließen.
In Teil 2 finden sich exemplarisch einige Texte, die von Eltern des Kindergartens geschrieben worden sind. Da ich im weiteren Verlauf der Arbeit auf die Elternarbeit/Mitarbeit nicht mehr näher eingehe, sollen die Eltern mindestens hier durch diese Texte selber zu Wort kommen.
Einige Themenbereiche habe ich aus der intensiveren Ausarbeitung ausgeklammert bzw. nur am Rande gestreift (Elternarbeit/Elternmitarbeit, der familiäre Hintergrund der Kinder, die inhaltliche Planung der Kindergartenarbeit, die individuelle Entwicklung der Betreuer, Vereinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit). Der Grund dafür liegt darin, daß es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wenn alle Themenbereiche umfassend dargestellt werden; eine bestimmte Auswahl ist notwendig. Zudem haben Lücken im verwendeten Material und eine gewisse Vorsicht bei der Interpretation des Verhaltens der Eltern die Ausklammerungen mitbestimmt.
In zweierlei Hinsicht ist der Kindergarten Sonnenburgstraße außerhalb der etablierten Erziehungseinrichtungen (den Raum Tirol betreffend und auch darüber hinaus) angesiedelt:
Alle Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Werkstätten, Heime), die es sich hierzulande zur Aufgabe gemacht haben, behinderte Menschen (Körper-, Sinnes- und/oder geistig Behinderte) zu betreuen und zu fördern, arbeiten ausschließlich mit behinderten Gruppen an besonders dafür vorgesehenen Orten. Alltägliche Begegnung findet nicht statt und die fortgesetzte Abwertung von Abweichenden schafft eine Realität, die die betroffenen Menschen - entgegen den Intentionen - kaputt macht. Trotz verbaler Bekenntnisse über die Notwendigkeit sozialer Integration wird der Ausbau von Sondereinrichtungen und die weitere Spezialisierung forciert, wird fleißig weiter an den Grenzen der Integration festgehalten. Obwohl die Träger dieser Einrichtungen über sehr viel Geldmittel und Macht verfügen, um ihr Konzept der Separierung durchzusetzen, sind sie doch durch die Existenz des Kindergartens in ihrem Selbstverständnis irritiert und scheuen fallweise auch nicht vor Verleumdungen bezüglich des integrativen Kindergartens zurück. Umso erfreulicher ist für uns die positive Zusammenarbeit mit der psychotherapeutischen Ambulanz der Kinderklinik Innsbruck und die Offenheit des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Va, dem integrativen Konzept gegenüber.
Gleichzeitig befinden wir uns mit unserem Konzept auch außerhalb des üblichen Kindergartengeschehens. Die Diskussionen um die Einflüsse der frühkindlichen Erziehung und Sozialisation, um Kinderläden, um die Einbeziehung der Eltern, um das Aufbrechen festgefahrener geschlechtsspezifischer Rollen und vieles mehr, wie sie in den sechziger und siebziger Jahren - zumindest auf dem Boden der Universität - geführt wurden, haben die Praxis der hiesigen Kindergärten nicht berührt.
Auch gibt es zu diesem Zeitpunkt in Innsbruck (neben einem "Kindergarten studierender Eltern") nur einen einzigen, ebenfalls privaten Kindergarten, der über die Mittagspause geöffnet ist.
So stößt das Konzept des Kindergartens Sonnenburgstraße mit der gemeinsamen Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder, der kleinen Gruppen, der Altersgemischtheit, der Einbeziehung der Eltern ins Kindergartengeschehen und der Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder, bei den Inspektorinnen vorerst auf Bedenken und Unmut.
Unser Dasein am Rande schützt uns davor, uns ständig abgrenzen und beweisen zu müssen, und erlaubt es uns, inhaltlich eine Alternative zu entwickeln. Für uns ist der Kindergarten ein Ort, wo wir uns mit den Kindern gemeinsam auf einen neuen Weg begeben, der nicht schon durch Gebote und Verbote ganz festgelegt ist; der auch von uns verlangt, auf alte Sicherheiten zu verzichten; der uns neue Perspektiven eröffnet. Daß wir uns dabei nicht auf einer seligen Insel wähnen, dafür sorgen die täglichen Konfrontationen mit Nachbarn, Ämtern, Erlässen, Banken, den oben genannten Einrichtungen, usw. .
Dieser Freiraum am Rande schützt uns aber nicht davor, ständig von beiden Seiten (den Behindertenfunktionären und der Kindergartenobrigkeit) beobachtet zu werden. Ein Scheitern unseres Integrationsprojektes würde sicher zur Stabilisierung der herrschenden Praxis in diesem sozialen Feld beitragen und das Entstehen ähnlicher Initiativen ungeheuer erschweren.
Den folgenden Ausführungen möchte ich eine kurze Projektgeschichte voranstellen. Das ist die Zeit, in der sich das Kindergartenprojekt noch auf dem Boden der Universität befindet. Die Schwierigkeiten der Vorbereitungszeit möchte ich im fogenden schwerpunktmäßig zusammenfassen:
Wichtiger konkreter Schritt in Richtung Realisierung ist die Gründung eines eigenen Vereins als Träger des Kindergartens im Juni 1977: "Verein zur Förderung integrativer Vorschulerziehung".
Ohne die geringsten Geldmittel können wir keine Räume anmieten (vor allem keine Räume, die große Investitionen erfordert hätten), und ohne konkrete Räumlichkeiten bekommen wir von keiner Seite finanzielle Unterstützung. Wie diesen Kreis durchbrechen?
(3) Einstellung der zuständigen Behörden
Unsere Vorsprachen bei den zuständigen Behörden von Stadt und Land enden meistens damit, daß wir wohlwollend angehört, aber keine konkreten Zusagen (Räume, Finanzen, sonstige Unterstützung) gemacht werden. Niemand hat ausdrücklich gegen integrative Erziehung argumentiert, doch "das Gutfinden war, soweit ich das rückblickend sehe, nur in Bezug auf die Behinderten" (Physikotherapeutin).
"Wenn ich mich zurückerinnere, war das so, daß wir überhaupt keinen Groschen g'habt haben für den Kindergarten. Das haben wir uns eigentlich nie zu sagen getraut " (Mutter eines Kindes). Das Wissen, daß bestimmte Kosten von der Stadt (Betriebskostenzuschuß) und vom Land (Personalkostenzuschuß, Tagessätze für behinderte Kinder, Hilfe zum Umbau) auch bei privaten Kindergärten übernommen werden, sobald der Kindergartenbetrieb aufgenommen wird, läßt uns trotz der fehlenden Geldmittel weiter an der Verwirklichung des Kindergartens arbeiten.
Die Diskussion der konkreten Ziele/Inhalte des Kindergartens wird oft zugunsten der anfallenden praktischen Arbeiten zurückgestellt.
Vor allem erscheint es uns äußerst schwierig, fast unlösbar, ohne die praktische Erfahrung und Arbeit mit den Kindern ein Konzept zu erstellen. So sind die Besuche der integrativen Einrichtungen in München-Pasing und in Bozen für uns wichtig, doch die Arbeit am eigenen Konzept wird trotzdem nicht einfacher und bleibt weiterhin in allgemeinen Formulierungen stecken.
Obwohl uns der Grund für das Nichtzustandekommen eines eigenen detaillierten Konzepts bewußt ist, verunsichern uns Fragen von Eltern und Außenstehenden, die auf ein fixes Konzept abzielen. Es gelingt uns kaum, diese relative Offenheit als eine Chance darzustellen.
Zudem bleibt die Konzeptdiskussion hauptsächlich auf die Studentengruppe beschränkt. Erst relativ kurze Zeit vor dem eigentlichen Kindergartenbeginn beteiligen sich auch die Eltern daran; es sind ausschließlich Eltern nichtbehinderter Kinder.
Außer zur Mutter eines mehrfach behinderten Kindes haben wir kaum Kontakt zu Eltern behinderter Kinder. Alle anderen Eltern der ersten Kindergruppe sind - bedingt durch die lange Vorbereitungszeit - weggeblieben.
Durch die vorhandenen Kontakte zur Kinderklinik und zur "Sozialberatung für Behinderte" sind wir zuversichtlich, daß Eltern und Kinder von der Existenz des neuen Kindergartens erfahren werden.
Ein vorheriges Kennenlernen und ein Berücksichtigen der Bedürfnisse und Wünsche dieser Eltern kann daher nicht stattfinden. Wir sind völlig im Unklaren, welche Eltern und Kinder unseren Kindergarten in Anspruch nehmen werden; wer es wagen würde, sich an einem neuen Modell zu beteiligen.
Sicher ist für uns, daß nicht wie ursprünglich im ersten Versuch nur körperbehinderte Kinder aufgenommen werden, sondern ebenso mehrfach-, sinnes- und geistigbehinderte Kinder.
Die Einrichtung eines integrativen Kindergartens ist also vorläufig hauptsächlich das Interesse und Anliegen einer Initiativgruppe, die aus Studenten, Eltern nichtbehinderter Kinder und einer Therapeutin besteht und in der weitgehend die Eltern der behinderten Kinder fehlen.
Im Juni 1978 gelingt es dem Verein, eine Wohnung in der Sonnenburgstraße 18 zu mieten. Die Vorzüge: große Altbauwohnung, Parterre, mitten im "normalen" Wohngebiet, und vor allem gibt es einen großen verwilderten Garten.
Damit der neue Kindergarten von der Kindergarteninspektorin bewilligt wird, müssen wir in der Wohnung einige Um- bzw. Einbauten vornehmen (Kindertoilette, Waschraum, eine Wand durchbrechen, usw.). Die finanzielle Unterstützung vom Amt der Tiroler Landesregierung (in der Höhe von öS 100.000.-) für diesen Umbau reicht für die notwendigsten Arbeiten. Eine gründliche Sanierung der Wohnung (wie Wände, Fußboden, Heizung, Küche) können wir nicht vornehmen. Die Umbauarbeiten sind zwei Wochen vor dem geplanten Eröffnungstermin beendet, und in der verbleibenden Zeit schaffen wir es mit Hilfe der Eltern, die Wohnung für den Kindergartenbetrieb notdürftig herzurichten: mit geschenkten und billigst erstandenen Farben, Regalen, Teppichen und Stoffen.
Ende Juni, nachdem wir die Räume gemietet hatten veranstaltet der Verein eine Vollversammlung, zu der alle, die am neuen Kindergarten interessiert sind, eingeladen werden. Dabei wird über die bisherige Arbeit des Vereins berichtet und gemeinsam über die weitere Verwirklichung des Kindergartens diskutiert. Zum ersten Mal werden von den Eltern die verschiedenen Interessen deutlich geäußert: einige Eltern interessieren sich hauptsächlich für einen Kindergarten, in dem sie mitbestimmen und mitarbeiten können.
Eine andere Gruppe von Eltern zeigt vorrangig Interesse am Miteinander der behinderten und nichtbehinderten Kinder und an der therapeutischen Betreuung der behinderten Kinder.
Wiederum andere Eltern interessieren sich besonders für einen Ganztags- bzw. Ganzjahreskindergarten.
Diese verschiedenen Interessen decken sich nur teilweise. Es wird aber nicht geklärt, ob und wie alle diese Ansprüche in einem (Modell)Kindergarten sinnvoll realisiert werden können.
Nachdem der Verein sich für die Räumlichkeiten in der Sonnenburgstraße entschieden hat, können mit dem Amt der Tiroler Landesregierung Verhandlungen aufgenommen werden, um die Zahlung eines Tagessatzes für die behinderten Kinder zu erreichen. Das heißt, daß das Land Tirol für jedes behinderte Kind, wenn ein entsprechender Rehabilitationsantrag vorliegt, an den Verein als Träger des Kindergartens einen festgesetzten Tagessatz bezahlt. Diese Tagessätze sollen zusammen mit den Beiträgen der Eltern (für die behinderten Kinder entsprechend weniger) die laufenden Kosten des Kindergartenbetriebes decken.
Im Juli 1978 werden dann vom Verein drei Kindergärtnerinnen eingestellt. Drei Studentinnen, die im Projekt mitgearbeitet haben, werden im Kindergarten als Helferinnen mitarbeiten.
Wir planen eine Gruppengröße von 25 Kindern, davon 9 behinderte. In der kurzen Zeit vom Anmieten der Räume bis zur Eröffnung im Herbst melden sich viele interessierte Eltern, doch sind wir zu Beginn des Kindergartens noch nicht voll besetzt.
Inhaltsverzeichnis
Die Entwicklung des Kindergartens aufzuzeigen erscheint mir notwendig, da unser "Konzept" in einem gemeinsamen Arbeits- und Reflexionsprozeß entstanden ist. Vorstellungen integrativer Erziehung haben vorerst nur abstrakt existiert. Die Verwirklichung in der Praxis, mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten und Erfolgen, ist tagtägliche Arbeit. Um dies nachvollziehbar zu machen, versuche ich, unsere Entwicklung im Kindergarten Sonnenburgstraße als Prozeß darzustellen. Als gemeinsamer Lernprozeß aller: Kinder - Betreuer - Therapeuten - Eltern. Auch jetzt ist dieser Prozeß nicht abgeschlossen. Wir haben aus dem Anfangschaos heraus befriedigende Formen des Zusammenlebens mit den Kindern und den Mitarbeitern gefunden, wollen aber nicht stehen bleiben und bemühen uns alle gemeinsam um Weiterentwicklung.
So soll das Nachzeichnen unserer Entwicklung auch zeigen, daß Integration von Behinderten und Nichtbehinderten (wo auch immer sie stattfindet) nicht hohes Ziel, sondern vor allem GEMEINSAMER Prozeß ist.
Es kommen hier auch die vielen Schwierigkeiten zu Wort, die sich bei der Verwirklichung des konkreten Problems ergeben haben und immer noch ergeben. Es sind dies zum großen Teil Probleme, die nicht nur mit der integrativen Arbeit verbunden sind, sondern Probleme/Schwierigkeiten, wie sie mehr oder weniger ausgeprägt in den verschiedensten Initiativen und Projekten im Bereich der Erziehung auftreten. Und doch bestimmen alle diese Schwierigkeiten unsere Arbeit im Kindergarten sehr wesentlich mit.
So soll diese Darstellung unseres gemeinsamen Entwicklungsprozesses zu verstehen sein als eine Art Kontextbeschreibung für die in Teil II weiter ausgeführten Schwerpunkte.
Die Darstellung der Kindergartengeschichte von Herbst 1978 bis Sommer 1982 erfolgt in drei aufeinanderfolgenden Phasen.
Die erste Phase der Kindergartenarbeit umfaßt die Zeit von der Öffnung des Kindergartens am 11. September 1978 bis zu den Weihnachtsferien 1978.
Diese Zeit soll hier ausführlicher beschrieben und interpretiert werden, da diese Zeit die größten Anforderungen an alle gestellt hat. Zudem ist diese erste Phase - rückblickend gesehen - für die Entwicklung des Kindergartengeschehens sehr prägend gewesen.
Am Sonntag vor der Eröffnung des Kindergartens haben wir noch bis 24 Uhr geputzt. Trotzdem sind die Kindergartenräume einer Baustelle noch sehr ähnlich: es gibt noch keinen Strom, im WC kein Wasser, kein Telephon, es sind nur die Küche und zwei Zimmer für die Kinder fertig. Alte grüne Schulbänke und Sessel ersetzen uns die noch nicht gelieferten Kindergartenmöbel. Für die Kinder gibt es nur wenig, was zum Spielen und Ausprobieren eingeladen hätte: ein paar Puzzles, einige Holzspielsachen, eine Trommel und ein paar gebrauchte Bücher. Nur der große, wilde Garten ist einladend.
Die ersten Kinder sind pünktlich um halb acht Uhr da. Die Eltern bzw. die Mütter kommen mit in den Kindergarten. Die ersten behutsamen Kontaktaufnahmen finden statt. Je mehr sich der Kindergarten füllt, umso mehr geht es durcheinander. Die Kinder und Eltern, die schon beim Ausbau mit dabei waren, fühlen sich im Kindergarten schon heimischer. Es ist geplant, daß die Eltern die ganze erste Woche im Kindergarten dabei sind, um sich gegenseitig kennenzulernen und um den Kindern das Eingewöhnen in die neue Umgebung zu erleichtern. Da in den ersten Tagen wirklich ein großer Teil der Eltern in den Kindergarten kommt, ist das Kindergartenleben zeitweise von den Erwachsenen dominiert.
Die Kinder kennen sich, bis auf wenige Ausnahmen, gegenseitig noch nicht. Ein Teil der Kinder bringt Erfahrungen aus städtischen Kindergärten mit, viele Kinder aber sind das erste Mal in einem Kindergarten. Das trifft besonders für die behinderten Kinder zu, die alle bis dahin entweder zu Hause oder in einem Heim betreut worden sind.
Noch sind nicht alle Kinder da; die meisten kommen im Laufe der ersten Woche; die noch freien Plätze füllen sich schnell (Mundpropaganda, Zeitungsartikel). Wir nehmen alle Kinder, so wie sie sich anmelden, auf. Das hat zur Folge, daß mehrere schwerbehinderte Kinder schon gleich von Anfang an mit dabei sind.
Fast alle nichtbehinderten Kinder (auch viele von uns und den Eltern) sind das erste Mal konfrontiert mit Kindern, die verschiedene Behinderungen haben. Ausgehend von der Tatsache, daß es in dieser allerersten Zeit kaum zu einer Auseinandersetzung mit den behinderten Kindern gekommen ist, vermute ich, daß die neue Situation (neue Räume, neue Bezugspersonen, viele Kinder, Trennung von den Eltern usw.) für alle Kinder so beanspruchend ist, daß die verschiedenen Ausdrucksformen der behinderten Kinder kaum wahrgenommen werden. Zudem sind wir Betreuer so sehr am Geschehen beteiligt, daß es über diese Zeit kaum Aufzeichnungen gibt, die die Kinder betreffen.
Ein Teil der Eltern hat schon beim Ausbau des Kindergartens im Sommer mitgeholfen. Es sind dies ausschließlich die Eltern von nichtbehinderten Kindern, die für ihre Kinder eine Alternative zu den städtischen Kindergärten suchen. Diese Eltern kennen auch die schwierige Gesamtsituation des Projekts und helfen zum Teil auch noch während der ersten Zeit im Kindergarten mit. Die Vorstellung, daß es möglich sein müßte, daß alle Eltern abwechselnd für das Kochen und Putzen verantwortlich sind, müssen wir sehr bald aufgeben. (Aus verschiedenen Gründen: ganztägige Berufstätigkeit, alleinerziehende Mutter, große Entfernung zum Wohnort, mangelndes Interesse, usw.).
Trotzdem gelingt es uns, zusammen mit den Eltern, das Kochen und Putzen noch eine Zeitlang zu besorgen. Erst ab Dezember 1978 wird eine Köchin angestellt und das Putzen bezahlt.
Die Eltern, die neu dazukommen, finden keinen fertigen Kindergarten vor, sondern eine Initiative, bei der es auch auf ihre Mitarbeit ankommt. Die Folge davon ist, daß ein Teil der Eltern sich aktiv beteiligt, andere stumm abwarten, wie sich der Kindergarten entwickelt. Retrospektiv gesehen, scheint es uns sehr mutig, daß diese Eltern trotz der vielen Unfertigkeiten (in jeder Hinsicht) beim Kindergarten bleiben.
Im folgenden berichten Eltern über ihre Erfahrungen im ersten Kindergartenjahr. Die Berichte wurden von den Eltern zwei bzw. ein Jahr nach dem Kindergartenbesuch ihres Kindes für eine Informationsbroschüre über den Kindergarten geschrieben.
Andreas
Als wir Andreas im integrativen Kindergarten für behinderte und nichtbehinderte Kinder anmeldeten, war ich noch nie mit behinderten Kindern in Kontakt gekommen. Sah ich auf der Straße Behinderte im Rollstuhl , so wußte ich nie, wie ich mich zu verhalten hatte. Mitleid wollte ich nicht zeigen, Interesse nicht durch vielleicht taktlose Fragen dokumentieren. So bemühte ich mich, ganz "normal" hin- bzw. wegzuschauen. Mit der Zeit wurde mir aber bewußt, daß meine Unsicherheit und meine Vorurteile aus mangelnder Erfahrung im Umgang mit ihnen entstanden waren. Also sah ich eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, und für Andreas die Chance, ein freies und natürliches Verhalten gegenüber Behinderten zu lernen. Im Rückblick auf dieses erste Kindergartenjahr scheint mir, daß es mehr an mir war zu lernen, während sich Andreas unbeeinflußt von der Klassifizierung "behindert - nicht behindert" den Kindern zuwandte. Manchmal fragte er mich: "Bin ich behindert? Ist der Christoph behindert? Wer ist denn eigentlich behindert?"
Er konnte mit dem Begriff "Behinderung" nichts anfangen. Für ihn gab es Kinder, mit denen er gut spielen konnte oder nicht, die aggressiv oder friedfertig waren, mit denen er stritt oder sich vertrug, Kinder, die schnell laufen oder nicht gut gehen konnten, Kinder, die nicht selber essen oder wenig sprechen konnten.
Es wunderte mich, daß er selten Verhaltensweisen behinderter Kinder nachahmte, um sie so zu verarbeiten. Es schien so, als wäre dies nicht notwendig gewesen. Manchmal erzählte er, was der M. wieder angestellt hatte, betonte aber auch einige Male: "Der M. kann schon viel besser gehen."
Andreas wurde von der Unpersönlichkeit, der Langeweile und den zahlreichen unverständlichen Reglements eines traditionell geführten Kindergartens mehr belastet als von den Anfangsschwierigkeiten des integrativen Kindergartens.
Hier durfte er lustig und ausgelassen, aggressiv und weinerlich sein, ohne daß ihm dies zur Last gelegt und er abgestempelt wurde. Hier wurde er auf den Schoß genommen und getröstet, wenn er traurig war oder sich wehgetan hatte. Der liebevolle und natürliche Umgang der Betreuer mit den Kindern hatte zur Folge, daß Andreas zu den Kindern und den Betreuern starke Beziehungen aufbaute. Das war die Voraussetzung dafür, daß sich Andi im Kindergarten sehr wohlfühlte. Darüberhinaus hat er erfahren, daß behinderte Kinder Kinder sind, die wie er aktiv am Leben teilnehmen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt.
Dieses erste Jahr war, was die Theorie und die Praxis der Erziehungs- und Integrationsvorstellungen betraf, recht chaotisch und stellte an alle große Anforderungen.
Martina
Im Alter von 9 Monaten fiel dem Arzt in der Mutterberatung bei Martina eine zentrale Bewegungsstörung auf. Er überwies uns an die Kinderklinik, wo Martina Bewegungstherapie erhielt.
Mit ca. eineinhalb Jahren hatte Martina zu Hause einen Anfall und mußte zur Abklärung 10 Tage in die Klinik. Anschließend erhielt sie Medikamente.
Ich war zu dieser Zeit berufstätig und meine Mutter versorgte die Kinder. Als sie dies gesundheitlich nicht mehr schaffte, war ich gezwungen, für Martina eine andere Unterbringungsmöglichkeit zu finden. Für einen Monat war sie im Kinderheim "Schweitzerhäusl", doch konnte sie dort wegen Personalmangels nicht länger bleiben. Ich besprach mein Problem mit Dr. MAYER von der Kinderklinik und dieser ermöglichte für Martina den Heimplatz im St. Josefs-Institut in Mils. Anfang Jänner 1976 brachte ich sie hin. Die Gesamtatmosphäre im Heim und der Anblick von so vielen behinderten Kindern schockierte mich, sodaß ich Martina am liebsten gleich wieder mitgenommen hätte. Besuchen durfte ich sie nur einmal im Monat und hatte auch sonst kaum Einblick in ihr Leben im Heim.
Allmählich fiel mir auf, daß sich Martina mir gegenüber abwehrend verhielt, kaum Notiz von ihrer Umgebung nahm und in ihrer Gesamtentwicklung zurückfiel. An ihrem Geburtstag im Mai holte ich sie außertourlich aus dem Heim und ging mit ihr ins Gasthaus. Dort stieß Martina das Saftglas um und als ich es schnell auffangen wollte, schreckte sie zusammen und fing an zu zittern. Mir war diese Reaktion aus der Situation unverständlich. Sie mußte aus schlechten Erfahrungen im Heim resultieren.
Beim Zurückbringen lief Martina angstvoll schreiend vor der Schwester davon, welche sie sehr barsch am Arm faßte und mitnahm. Von dem Augenblick an war mir klar, daß ich Martina nicht in diesem Heim lassen wollte. Im Juli nahm ich sie dann gegen den Widerstand der Schwestern heraus und hörte auf zu arbeiten, was finanzielle Probleme für die ganze Familie bedeutete.
Jetzt erst sah ich, wie stark Martinas Verhalten sich verändert hatte: sie ließ sich nicht mehr waschen, hatte eine panische Angst vor dem Baden und Haarewaschen und schrie dabei nur "heiß, heiß". Sie sprach nicht mehr und war auch sonst in ihrer Entwicklung zurückgefallen. Martina wehrte sich gegen jede Zärtlichkeit und lehnte Kontakt allgemein ab. Für ein Jahr besuchte Martina den städtischen Sonderkindergarten jeweils nachmittags für zwei Stunden. Sie war dort sehr schwierig und fügte sich nicht in die Gemeinschaft.
1978 erfuhr ich von der Eröffnung des integrativen Kindergartens und konnte Martina auch gleich dort unterbringen. Anfangs war sie nur vormittags dort, doch konnte die Zeit allmählich verlängert werden, sodaß ich wieder arbeiten gehen konnte. Schon bald zeigten sich erste Erfolge auf verschiedenen Gebieten: Abbau der Scheu vor dem Waschen, Fortschritte in der Sauberkeitserziehung. Martina entwickelte wieder Vertrauen in ihre Umwelt und fügte sich auch allmählich in die Gemeinschaft ein. Auch sprachlich holte sie sehr viel auf. Diese Erfolge führe ich auf die intensive und individuelle Betreuung und die zusätzliche Therapie im Kindergarten zurück.
Es war für mich sehr wichtig, daß sich Martina im Kindergarten so wohl fühlte und dort auch mit gesunden Kindern beisammen war. Ich selbst hatte und habe einen guten Kontakt zu den Betreuerinnen und bedaure, daß die Zeit im Kindergarten schon vorbei ist.
Das Mitarbeiterteam umfaßt acht Personen, die alle unterschiedliche Ausbildungen und Vorerfahrungen haben, und die aus den unterschiedlichsten Motivationen zum Kindergartenprojekt gestossen sind. Ohne vorheriges Kennenlernen beginnen wir gemeinsam zu arbeiten.
Betreuer[1] im Kindergarten sind drei Kindergärtnerinnen (zwei von ihnen halbtags) und drei Studentinnen als Helferinnen (jeweils halbtags), alle fest angestellt.
Bedingt durch die lange Projektgeschichte und die gemeinsamen Uni-Erfahrungen kennen sich die Helferinnen untereinander schon ziemlich gut. Wir haben aber alle keine spezielle Ausbildung und auch keine Erfahrung im Umgang mit behinderten Kindern.
Die Kindergärtnerinnen kennen sich untereinander überhaupt noch nicht. Zu Anneke haben wir bereits Kontakt, da sie bei der Vereinsgründung und bei einigen vorbereitenden Sitzungen dabei gewesen ist. Lisa kommt direkt nach dem Abschluß der Kindergärtnerinnenschule zu uns. Silvia hat bisher in der Sonderschule und im Caritas-Sonderkindergarten gearbeitet. Sie ist die einzige Mitarbeiterin, die Erfahrung im Umgang mit behinderten Kinder hat. Weil die Arbeitsbedingungen dort unerträglich sind, kündigt Silvia ihre Stelle und bewirbt sich beim neuen "Verein zur Förderung integrativer Vorschulerziehung".
Heidi (Physikotherapeutin) ist Mitbegründerin der Initiativgruppe und übernimmt im Kindergarten stundenweise die physikotherapeutische Betreuung. Während des Sommers kommt Mathilde als Logopädin und Mutter eines Kindes zur Kindergartengruppe.
Für uns als Helferinnen sind durch die Projektgeschichte Kindergarten und Integration unmittelbar verbunden. Wir sind, trotz aller Unsicherheiten, mindestens von der Theorie her überzeugt, daß Integration im vorschulischen Bereich sehr gut verwirklicht werden kann.
Für die Kindergärtnerinnen ist die Situation deutlich anders: der neue Kindergarten ist in erster Linie ein neuer bzw. ein besserer Arbeitsplatz.
Silvia dazu:
"Ich glaub, heut könnt' ich mir nimmer vorstellen so anzufangen, aber damals, so wie's bei mir war, hab ich mir überhaupt nix mehr schlechter machen können."
Für Lisa ist der Kindergarten in der Sonnenburgstraße die erste Arbeitsstelle und zugleich auch der erste Kontakt mit behinderten Kindern:
"Auch wie das war mit den behinderten Kindern, daß ich vorher, während der Ausbildung, nur kurz von den behinderten Kindern was gehört hab; wir haben nie eine Behinderteneinrichtung besucht, oder sonst irgendein Heim, nix. Und dann kommt der Manfred am ersten Tag, ich hab nicht gewußt, wie ich den angreifen soll, darf ich den angreifen, ... und dann, wie das schnell gegangen ist..."
Wir Helferinnen sind darauf vorbereitet, daß noch vieles offen ist, daß wir uns die Arbeit erst selber organisieren müssen. Auch können wir uns in dieser unsicheren Anfangssituation einige Sicherheit geben indem wir immer wieder außerhalb des Kindergartens darüber reden. Zudem können wir uns auf die Mitarbeit einiger, sehr wesentlich am Kindergarten beteiligter Eltern verlassen.
Anders ist die Situation der Kindergärtnerinnen. Silvia ist hauptsächlich verwirrt und bleibt mit dieser Unsicherheit allein. Noch ist unter den Mitarbeitern keine Basis vorhanden, um sich darüber auszutauschen. Eingetaucht in die neue Situation, versucht jede vorerst allein mit den Anforderungen fertig zu werden.
Eine andere Vorstellung, die wir aus dem universitären Kontext mitbringen, ist der Anspruch, die Arbeit im Kindergarten in Teamarbeit zu organisieren. Wir stellen uns vor, gleichberechtigt mit den Kindergärtnerinnen die Arbeit zu teilen; ebenso mit den Therapeutinnen. Daß wir nach außen hin eine Leiterin brauchen, scheint uns nebensächlich. Silvia wird die offizielle Leitung des Kindergartens übertragen. Für sie verbinden sich mit dem "Leiterinnenposten" hauptsächlich negative Erfahrungen, die von ihrer früheren Arbeitsstelle nachwirken. Zudem fehlen Vorstellungen, wie Teamarbeit sich verwirklichen läßt.
Mit den praktischen Anforderungen, die wirkliche Teamarbeit an jeden einzelnen Mitarbeiter stellt, müssen wir alle erst lernen umzugehen.
In der ersten Zeit ist es oft notwendig, daß wir uns am Abend, außerhalb der (bezahlten) Arbeitszeit, treffen, um die anstehenden Probleme zu besprechen. Meistens sind es Fragen der Programmgestaltung, des noch notwendigen Ausbaus, Einkaufs- und Essenspläne, und die eventuelle Gruppeneinteilung. Unmittelbar praktische Dinge also.
Dabei unterstellen wir in allen Fragen, die über die unmittelbare Bewältigung der anfallenden Arbeit hinausgehen, Konsens. Wir gehen von Vorstellungen aus, wie wir sie in der Projektgruppe entwickelt haben. Unterschiedliche Vorstellungen der Mitarbeiter über die Ziele und Inhalte werden nicht thematisiert.
Diese allererste Zeit im Kindergarten Sonnenburgstraße ist daher eine für alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Mitarbeiter) sehr offene Situation mit vielen Unsicherheiten und unausgesprochenen Erwartungen. Trotzdem sind vorherrschend Freude und Engagement spürbar.
Der Konflikt mit der Elterngruppe
Der Tagesablauf im Kindergarten ist noch relativ unstrukturiert. Auch nach der ersten Woche wird die "Großgruppe" noch beibehalten. Das heißt, daß alle Kinder und Betreuer zusammen eine Gruppe bilden, innerhalb der sich spontan flexible Kleingruppen zu bestimmten Spielangeboten bilden können. Jeder von den Betreuern ist für bestimmte Aktivitäten und Spiele zuständig, die wir uns gemeinsam bei unseren Besprechungen erarbeiteten; ebenso übernimmt jeder von uns bestimmte pflegerische Arbeiten, die bei einigen behinderten Kindern notwendig sind (Wickeln, Füttern, Waschen usw.).
Am Anfang verbringen wir noch ziemlich viel Zeit im Garten. Trotzdem wird die Arbeit in der Großgruppe immer anstrengender. Anstrengend und schön zugleich. Heidi drückt die Ambivalenz unserer Situation aus:
"Manchmal haben wir das Chaos auch für schön empfunden. Ich finde, es hat so ziemlich beide Seiten gegeben. Teilweise ganz gut, also für unser Gefühl ganz gut. Für die Kinder und für uns, Ja. Teilweise ist es wirklich zu viel worden ..."
Aber nicht nur diese relativ große Unstrukturiertheit fordert uns sehr, sondern auch die zum Teil schweren Behinderungen der Kinder. Nach einer relativ ruhigen, kurzen Eingewöhnungszeit bricht bei vielen Kindern ein sehr aggressives Verhalten aus. Zudem sind die meisten behinderten Kinder anfangs den ganzen Tag im Kindergarten, was für alle eine große Überforderung ist. Auch bei den nichtbehinderten Kindern sind einige sehr schwierige Kinder dabei (mit Erfahrungen in verschiedenen anderen Institutionen), die genauso 'aufdrehen' und alles, vor allem unser Verhalten als Betreuer ausprobieren. Zudem ist der Altersunterschied recht groß: 2 1/2 - 7 Jahre. Trotzdem versuchen wir alles mit allen Kindern gemeinsam zu machen, sogar die ersten Ausflüge in die nähere Umgebung.
Rückblickend gesehen ist es uns nicht mehr recht verständlich, daß wir diesen Versuch der Großgruppe nicht schon früher beendet haben.
Mögliche Gründe für dieses Hinauszögern sehe ich darin:
-
das Aufgeben der Großgruppe hat zu tun mit einem Zugeständnis von unserer Seite, daß "es halt doch ein Chaos ist". Auch wenn wir uns die Schwierigkeiten eingestehen, so wollen wir doch die von außen an uns herangetragenen Interpretationen von Chaos nicht akzeptieren.
-
Überzeugt von der "totalen Integration" bedeutet die Gruppeneinteilung, so wie wir sie uns vorstellen, doch eine Trennung der Kinder für zwei Stunden in behinderte und nichtbehinderte. Heidi: "Ja, wir haben es, glaube ich, auch so lange beibehalten, weil wir von vornherein von der kompletten Integration geredet haben und genau diese Teilung, die wir dann gemacht haben, dem schon widersprochen hat zum Teil. Und keiner hat sich getraut, das richtig auszusprechen und durchzuführen." Wir betonen immer wieder, daß Integration nicht bedeutet, daß alle Kinder alles zusammen machen sollen; trotzdem erleben wir eine emotionale Unfähigkeit, die Kinder in verschiedene Gruppen einzuteilen.
-
Gerade an der Frage der Gruppeneinteilung wird deutlich, daß wir erst lernen müssen, Entscheidungen zu treffen und selber die Initiative zu ergreifen, wenn Probleme entstehen; daß jeder seine Vorstellungen formuliert und einbringt.
-
Die Auseinandersetzung mit den Eltern über die Gruppeneinteilung hat die wirkliche Einteilung und die Arbeit in den Gruppen sehr verzögert.
Auf diese Auseinandersetzung mit den Eltern, die sich am Problem der Gruppeneinteilung manifestiert, und auf die Folgen dieses Konflikts möchte ich hier noch genauer eingehen.
Die Ursache dieses Konflikts ist das Tauziehen um die Entscheidungskompetenzen im Kindergarten: bestirmmen die Eltern das Kindergartengeschehen oder die Betreuer? Und auch: Wie kann ein gemeinsames Entscheidungsfinden aussehen?
Wenn ich im folgenden von der "Elterngruppe" schreibe, so beziehe ich mich auf jene Eltern, die sich im Verlauf der Auseinander- setzung zu einer Gruppe zusammenschließen. Es sind dies die Eltern von etwa 6 - 8 nichbehinderten Kindern, denen sich dann auch der Vater eines behinderten Kindes anschließt. Die Eltern kennen sich zum Teil untereinander von ihrer Arbeit her, von anderen Initiativen und auch vom Ausbau des Kindergartens. Ein Teil dieser Eltern hat sich schon in anderem Zusammenhang mit dem "Problemfeld Kindergarten" auseinandergesetzt und sieht nun im neu entstehenden Kindergarten eine Möglichkeit zur Verwirklichung ihrer Ideen. So wird, ohne auf die lange Vorgeschichte und die spezifische Zielsetzung von integrativer Arbeit einzugehen, das Projekt von der Elterngruppe in eine Elterninitiative uminterpretiert.
Die anderen Eltern bleiben von dieser Auseinanderstezung zum großen Teil unberührt; darunter fast alle Eltern der behinderten Kinder.
Unzufrieden, "nur" beim Putzen, Kochen und Ausbauen mitzuhelfen, verlangen diese Eltern auch in die inhaltliche Arbeit (Programmund Konzeptdiskussion) miteinbezogen zu werden. Sie machen von ihrem Recht, ganztägig im Kindergarten anwesend zu sein, Gebrauch. Obwohl wir Mitarbeiter selber noch auf der Suche nach einer befriedigenden Form der gemeinsamen Themenplanung sind, künnen die Eltern nun dabei mitmachen und selber Aktivitäten im Kindergarten gestalten.
In d,ieser Zeit probieren wir immer wieder neue Formen der ElternBetreuerinnen-Treffen aus. Trotzdem wird die Situation im Kindergarten für alle immer unbefriedigender, die entgegengesetzten Interessen werden immer deutlicher spürbar.
In dieser für uns Betreuer sehr schwierigen Anfangssituation, die unsere ganze Energie beansprucht, empfinden wir das Verhalten der Elterngruppe als Mißtrauen unserer Arbeit gegenüber. Wir fühlen uns in unseren Bemühungen nicht unterstützt, sondern immer mehr beobachtet und kontrolliert.
Die Schwierigkeiten bei der Gruppeneinteilung
Um die unbefriedigende Situation in der Großgruppe zu lösen, entwickeln wir in unseren Besprechungen auf der Grundlage von Beobachtungen ein Drei-Gruppen-Modell. Dieses Modell sieht vor, daß die Kinder nach einer gemeinsamen Eingangsphase (Freispiel) für zwei Stunden am Vormittag (zwischen Jause und Mittagessen) in drei konstante Kleingruppen eingeteilt werden: eine Kleinkinder-, eine Behinderten- und eine Vorschulgruppe. Am Nachmittag, wenn weniger Kinder im Kindergarten sind, sollen zwei gemischte Gruppen gebildet werden.
Die Elterngruppe will ein Zwei-Familiengruppen-Modell verwirklichen. Dieses Modell sieht vor, daß die Kinder nach einem (kurzen) Freispiel in zwei konstante Gruppen eingeteilt werden, die altersgemischt sind und behinderte und nichtbehinderte Kinder umfassen. Bei einem Eltern-Betreuerinnen-Treffen sollen die verschiedenen Vorschläge diskutiert werden.
Die Elterngruppe stellt sich vor, zwei Familiengruppen zu bilden. Die Argumente dafür:
- fixe Bezugspersonen;
- Integrationsprinzip;
- räumliche Trennung;
- die Kinder selber wählen die Gruppe, und die Eltern schlagen die Betreuerinnen vor.
Das Betreuungsteam stellt sich vor, drei Gruppen zu bilden. Die Argumente dafür:
-
Schrittweise Integration, Vorbereitung mancher Kinder auf die Gruppe.
-
Die Kinder beteiligen sich verstärkt am Gruppengeschehen, wenn die Aktivitäten ihren Fähigkeiten entsprechen.
-
Konstante Bezugspersonen während der Gruppenzeit.
-
Die Kinder sollen die Bezugspersonen auch bei den Kindern in der Gruppe finden.
-
Das zur Zeit herrschende "Durcheinander" wird durch das Einführen von zwei Gruppen nur geteilt, nicht gelöst.
-
Die räumliche Situation des Kindergartens macht es unmöglich, zwei völlig getrennte Gruppen zu führen.
Die weiteren Argumente und Gegenargumente von beiden Seiten drehen sich im Kreis. Wichtige Aspekte, wie die privaten Beziehungen, Verstrickungen und Rivalitäten - in der Elterngruppe wie auch zwischen Eltern und Betreuern - sowie die überhöhten Ansprüche, bleiben bei der Diskussion weitgehend ausgeklammert, sind aber untergründig wirksam.
Gefangen in diesem Kreislauf von Angriff und Verteidigung, schaffen wir es auch in weiteren Eltern-Betreuerinnen-Treffen nicht, die Frage der Gruppenteilung befriedigend zu lösen.
Der Konflikt um die Entscheidungskompetenzen wird dann auf die Ebene der Vereinsvollversammlung verlegt. Für diese Vollversammlung ist eine Veränderung der Vereinsstatuten und die Neuwahl des Vorstandes vorgesehen. Die Atmosphäre zwischen Eltern und Betreuern bleibt sehr angespannt bis dahin, und von beiden Seiten werden Vorschläge für die Vollversammlung ausgearbeitet.
Die Vereinsstatuten sollen so verändert werden, daß der Vereinsvorstand in allen Angelegenheiten des Kindergartens die entscheidende Instanz ist. Auch sollen die Elternrechte bzw. die Rechte der Vereinsmitglieder in den neuen Statuten verankert werden. In zwei mehrstündigen Vollversammlungen gelingt es uns mühsam, neue Statuten zu erarbeiten (bestehend aus Eltern- und Betreuervorschlägen) und danach den Vereinsvorstand zu wählen.
Die Eltern setzen sich in fast allen Punkten durch; entscheidend ist vor allem, daß die neue Regelung einen Elternteil als Vereinsobmann vorsieht. Dieser hat bei Entscheidungen im Vorstand mit Stimmengleichheit die entscheidende Stimme.
Auf der Grundlage dieser neuen Statuten werden nun die anstehenden Entscheidungen getroffen. Zu den jeweils vier Vertretern der Eltern und der Betreuer wird auch Peter GSTETTNER als wissenschaftlicher Beirat hinzugezogen.
Der Konflikt um die Entscheidungskompetenz im Kindergarten ist damit vorläufig zu Ende. Die Entscheidungskompetenz des Vereinsvorstandes unter dem Vorsitz der Eltern ist einerseits deutlich gestärkt, aber andererseits hat die Praxis schon gezeigt, daß Entscheidungen, die direkt die Arbeit im Kindergarten betreffen, von den Betreuern getroffen werden.
Konsequenzen aus diesem Konflikt
Nach dieser formalen Regelung der Entscheidungskompetenz durch die neuen Vereinsstatuten nimmt das Interesse an Elternarbeit ab. Die Elterngruppe, die sich zu Beginn der Auseinandersetzung gebildet hat, löst sich auf.
Wir haben in dieser Zeit der massiven Auseinandersetzung Elternmitarbeit als enorme Mehrbelastung erfahren und ziehen uns in der Folge von der Elternmitarbeit mehr und mehr zurück; das heißt von einer gemeinsamen Programm- und Konzeptdiskussion. Was weiterhin bleibt sind die monatlich stattfindenden Eltern und Betreuerinnen-Treffen, um inhaltliche und organisatorische Fragen zu besprechen, und die individuellen Gespräche mit den Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder im Kindergarten. Für einen großen Teil der Eltern ist dieser Konflikt nie hautnah spürbar gewesen, sei es, daß sie aus Zeitmangel oder Desinteresse weggeblieben sind, oder weil sie die Auseinandersetzung als zu intellektuell empfunden haben. Indirekt sind aber auch diese Eltern davon betroffen, denn gerade bei den 'schweigenden' Eltern hätte ein verstärktes Miteinbeziehen in das Kindergartengeschehen stattfinden sollen (hauptsächlich die Eltern der behinderten Kinder und/oder Eltern aus eher schwierigen sozialen Verhältnissen).
Für das Mitarbeiterteam hat dieser Konflikt verschiedene Folgen: wir fühlen uns als Team zusammengehörig; wir haben uns gemeinsam im Konflikt erfahren und dabei gelernt, gemeinsam unsere Interessen zu formulieren.
Wir lernen auch, ein Stück mehr als Team zusammenzuarbeiten: daß es auf das Handeln eines jeden Einzelnen ankommt, daß auch "emotional" harte Lernerfahrungen notwendig und möglich sind, daß wir, um etwas zu erreichen, selber initiativ werden müssen. Der Konflikt hat aber auch mit sich gebracht, daß zwei der Mitarbeiterinnen aus dem Kindergartenprojekt aussteigen.
Aufhören oder Weitermachen ist auch für alle anderen Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt eine aktuelle Frage. Silvia erinnert sich:
"Haben wir dann nicht irgendwann so nach Weihnachten Angst g'habt, ob der Kindergarten weitergeht oder nicht? Das war aber nicht wegen der Kinder, sondern wegen der Eltern."
Weitermachen bedeutet für alle, weiterhin Energie und Freizeit in ein Projekt zu investieren, das neben der notwendigen Aufbauarbeit auch viel Konfliktbereitschaft erfordert und von jedem verlangt, sehr viel an Mißtrauen und Verunsicherung auszuhalten.
Konsequenzen für die Arbeit in der Kindergruppe
Ab Dezember 1978 arbeiten wir im Kindergarten mit drei Gruppen am Vormittag und zwei Gruppen am Nachmittag.
Kurz zur Zusammensetzung der einzelnen Gruppen:
-
In der Kleinkindergruppe sind acht Kinder; ein Mädchen hat eine hochgradige Innenohrstörung, ein anderes Mädchen hat einen Schiefhals.
-
In der Gruppe der behinderten Kinder sind sechs Kinder. Die Behinderungen sind sehr verschieden: zwei Mädchen sind schwer mehrfachbehindert (sie können sich nicht selber fortbewegen, nicht selber essen und auf die Toilette gehen, sich nicht verbal mitteilen); die anderen vier Kinder haben psycho-mentale bzw. psycho-motorische Entwicklungsrückstände.
-
In der Gruppe der Vorschulkinder sind acht Kinder; darunter kein behindertes Kind. Das sehr aggressive Verhalten von zwei Buben, die meistens zusammen agieren, läßt es notwendig erscheinen, auch in dieser Gruppe zu zweit zu arbeiten.
Am Nachmittag (weniger Kinder, weniger Betreuer) werden dann zwei gemischte Gruppen gebildet. Das heißt, daß die noch anwesenden behinderten Kinder je nach Alter in die zwei anderen Gruppen aufgenommen werden.
Der entscheidende Grund, der zur Einführung der Dreigliederung der Gruppen mit einer Behindertengruppe führt, ist die spürbare Überforderung, die vom Anspruch integrativ arbeitender Kleingruppen ausgeht.
Unsere bisherigen Erfahrungen beschränken sich auf gemeinsames Singen, Turnen und Spielen und auf die spontan sich zwischen den Kindern ergebenden Kontakte. Auch wenn wir dabei positive Erfahrungen machen, fällt es uns noch schwer, gemeinsame Aktivitäten zu planen und durchzuführen, die gewisse Fähigkeiten der Kinder (im sozialen und/oder kognitiven Bereich) voraussetzen. So ist es für uns zu diesem Zeitpunkt die angemessenste Lösung, auf diesen "Kompromiß" einer zeitweisen inneren Differenzierung auszuweichen. Wir versuchen, die Gruppen bewußt offen und durchlässig zu gestalten und legen weiterhin großes Gewicht auf das gemeinsame Freispiel, das Essen und die Zeit im Garten.
Die Arbeit und der Tagesablauf sind durch diese Einteilung nunmehr strukturiert. Jede Betreuerin ist während der Gruppenzeit für eine konstante Kindergruppe zuständig. Da wir diese Gruppeneinteilung nach und nach eingeführt haben, können sich die Kinder bald daran orientieren.
In der Zwischenzeit ist auch der dritte Gruppenraum fertiggestellt, sodaß jede Gruppe für die Gruppenzeit "ihr" Zimmer hat.
Gleichzeitig mit der Gruppeneinteilung führen wir auch eine Tischsitzordnung für Jause und Mittagessen ein. Das heißt, daß jedes Kind an einem der vier Tische seinen fixen Sitzplatz hat (5 - 6 Kinder und ein Betreuer). Dabei haben wir die Kinder beobachtet und versucht, jeweils eine gemischte Tischgruppe (altersgemischt, behindert/nichtbehindert) zusammenzustellen. Auch wenn es natürlich immer wieder Ausnahmen gibt, so hilft diese Einteilung doch sehr, die Mahlzeiten für alle befriedigender zu gestalten.
Für die beiden frei gewordenen Stellen gibt es sehr wenige Bewerber. Nach einem ausführlichen Gespräch entscheidet der Vereinsvorstand, daß Marie als Kindergärtnerin (mit mehrjähriger Erfahrung in der Münchner Behinderteneinrichtung "Pfennigparade") und Rudi als Helfer (abgeleisteter Zivildienst bei der "Lebenshilfe") eingestellt werden.
Zusammenfassend ist diese erste Phase der Orientierung vorerst hauptsächlich geprägt
-
durch die räumlichen Unfertigkeiten
-
durch die große Offenheit des Konzepts
-
durch die mangelnde Auseinandersetzung über die Ziele und Inhalte der Kindergartenarbeit.
So stellt dieses Projekt große Anforderungen an die Mitarbeiter und Eltern. Die verschiedenen Interessen führen nach einer kurzen Zeit der Zusammenarbeit zu einer intensiven Auseinandersetzung zwischen den Mitarbeitern und der Elterngruppe um die Entscheidungskompetenz im Kindergarten.
Hauptsächliche Konfliktpunkte sind: die Gruppeneinteilung im Kindergarten und die Vereinsstatuten. Nach aufreibenden Auseinandersetzungen führen wir im Kindergarten das Drei-Gruppen-Modell ein (mit einer Behindertengruppe); die neuen Vereinsstatuten stärken die Entscheidungskompetenz des Vereinsvorstandes in allen Angelegenheiten des Kindergartens.
In bezug auf die integrative Erziehung sind wir vorerst unsicher und ganz auf uns selber angewiesen. Die positiven Erfahrungen mit den Kindern machen uns Mut; nachdem wir die Gruppeneinteilung entsprechend unseren derzeitigen Vorstellungen und Fähigkeiten durchgeführt haben, beginnen wir mit einer intensiven Arbeit in den Kleingruppen.
Diese zweite Phase in der Entwicklung des Kindergartens umfaßt den Zeitraum von Jänner 1979 bis zu den Sommerferien des zweiten Kindergartenjahres im Juli 1980.
Dieser, gegenüber der ersten Phase, relativ lange Zeitraum ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine große Konstanz der Mitarbeiter, durch eine konstante Gruppeneinteilung, durch das Bemühen aller, den Kindergarten nach außen hin abzusichern (finanziell, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit) und innerhalb des Kindergartens unsere Vorstellungen von integrativer Erziehung zu verwirklichen. Von den neuen Mitarbeitern erwarten wir uns aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit auch neue Impulse für die Arbeit, vor allem für die weiterhin oft schwierige Arbeit mit den Eltern. Die Arbeit in den Gruppen ist für alle befriedigend und überschaubar; die einzelnen Kinder und die Dynamik der Kleingruppe werden deutlicher und greifbarer.
Immer mehr wachsen aber die Spannungen im Team zwischen den Betreuern und der Logopädin. In ihrer Doppelrolle als Mutter und Mitarbeiterin im Kindergarten vertritt sie weiterhin konstant die Interessen der Eltern und bringt Klagen über die Betreuer zum Vorstand und zu den anderen Eltern, so daß anstelle einer Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und dem übrigen Team ein Nebeneinander an verschiedenen Vorstellungen und auch Verhaltensweisen herrscht.
Um diesen Schwierigkeiten im Team sowie auch zwischen Team und Eltern zu begegnen, schlägt der Vereinsvorstand die Möglichkeit einer Supervision vor. Obwohl wir kaum eine Vorstellung haben, wie eine Supervision für uns ausschauen kann, sind wir doch sehr daran interessiert, die verschiedenen Konflikte zu bearbeiten. Zudem zeigt sich auch innerhalb des Betreuerteams immer mehr, wie unterschiedlich die Vorstellungen von Erziehung und Engagement für den Kindergarten sind. Die Kindergartenpsychologin Ursula übernimmt im Kindergarten die Supervision, das heißt, daß sie nun an den wöchentlichen Teamsitzungen teilnimmt. Schon nach den ersten Besprechungen wird deutlich, daß es zwar Spannungen und deutliche Schwierigkeiten im Team gibt, daß aber vor allem viele Probleme mit den Kindern zu lösen sind, daß wir trotz unseres Bemühens in manchen Situationen überfordert sind. So wird die Supervision für uns vorerst eine Möglichkeit zum gemeinsamen Gespräch über die Schwierigkeiten, die wir mit den verschiedensten Verhaltensweisen und Auffälligkeiten der Kinder haben. Auch wenn wir uns schon vorher in den Teamsitzungen unsere Beobachtungen und Erfahrungen mitgeteilt haben, so bringt der tiefenpsychologische Ansatz doch neue Perspektiven, kindliche Handlungen sowie auch unser eigenes Verhalten zu verstehen.
In unseren nun neu strukturierten Teamsitzungen kristallisiert sich immer mehr heraus, wie belastend sich die Kombination von Ganztagseinrichtung und Integrationskonzept auswirkt: der Modellcharakter des Kindergartens verlangt von jedem viel Engagement und vor allem Zeit für die Planung, Nachbesprechung, Eltern- und Teamarbeit. Die Ganztagseinrichtung (und auch Ganzjahres-; das heißt, daß uns nur der gesetzlich vorgesehene Urlaub zusteht, daß während der üblichen Schulferien der Kindergarten offen bleibt) beansprucht aber vor allem die ganztags angestellten Kindergärtnerinnen sehr und verlangt, daß alle Besprechungen am Abend stattfinden müssen.
Bei der Planung des Kindergartens, als sich die zwei verschiedenen Initiativen zusammengeschlossen und sich für einen integrativen Ganztagskindergarten entschieden haben, haben wir aus mangelnder Erfahrung nicht abschätzen können, welche Mehrarbeit und Mehrbelastung dadurch entsteht.
Aus diesen bisherigen Erfahrungen erarbeiten wir im Team gemeinsam Veränderungsvorschläge für das kommende Kindergartenjahr. Wir stellen uns vor:
-
in bezug auf die behinderten Kinder: weniger schwerstbehinderte Kinder aufnehmen; vorherige Probezeit festlegen; individuelle Anwesenheitszeit gemeinsam mit den Eltern festlegen; eventuell trennen der Behindertengruppe in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe.
-
In bezug auf die Elternarbeit: Neuregelung der Elternmitarbeit, das heißt, die Anwesenheit der Eltern im Kindergarten auf das Freispiel (vormittag und nachmittag) beschränken; Wasch- und Putzdienst besser organisieren; das Hauptgewicht der Elternmitarbeit auf die Elternabende legen.
-
In bezug auf die Mitarbeiter: Zwei Teamsitzungen pro Woche, das heißt zusätzlich zur Supervisionsgruppe eine Besprechung für Organisatorisches, gemeinsame Planung, usw.; Kürzung der Öffnungszeit; der Kindergarten könnte um 16 Uhr 30 geschlossen werden; wenn notwendig, sollte eine weitere Betreuung durch die Eltern stattfinden.
Diese Veränderungsvorschläge bilden bei einem von den Eltern einberufenen Eltern-Betreuer/innen-Treffen die Diskussionsgrundlage. Eigentlich sollte dieser gemeinsame Rückblick auf das gerade ablaufende Kindergartenjahr helfen, ein gemeinsames Konzept für die Kindergartenarbeit aufzustellen, doch kommen wir auch bei diesem Treffen einem schriftlich festgelegten Konzept nicht näher. Die Auseinandersetzung entzündet sich besonders bei der Vorstellung einer verkürzten Öffnungszeit. Die anwesenden Eltern (Eltern nichtbehinderter Kinder) sind von den übrigen Veränderungsvorschlägen kaum betroffen, sehen aber in der verkürzten Öffnungszeit das Ende des Ganztagskindergartens. In der sehr emotionell aufgeladenen Auseinandersetzung, in die auch sehr persönliche Konflikte hineingetragen werden, ist es dann nicht mehr möglich, eine gemeinsame Regelung zu finden.
Wir vertagen diese Entscheidung auf die Vorstandssitzung. Unser neuer Vorschlag, wenigstens an einem Tag in der Woche den Kindergarten früher zu schließen (mit einem wechselnden Elterndienst bis 18 Uhr), damit wir uns zur Besprechung zusammensetzen können, wird dann allgemein akzeptiert. Ebenso die Verbesserungsvorschläge, deren Verwirklichung in der Kompetenz der Mitarbeiter liegt.
Die vorher dargestellten Veränderungsvorschläge zeigen, daß wir uns trotz aller positiven Erfahrungen gegen Ende des ersten Kindergartenjahres müde und ausgelaugt fühlen und überfordert sind von den verschiedenen Ansprüchen, die Kinder - Eltern - Mitarbeiter an uns stellen. So sind auch unsere Bemühungen um Neuerungen zu verstehen als ein Versuch, sowohl unseren Ansprüchen als auch unserem Bedürfnis nach Entlastung nachzukommen.
Ein anderes Problem: in dieser Zeit (Mai/Juni) sollte die Aufnahme neuer Kinder für den Herbst stattfinden. Der Vereinsvorstand hat zwar Kriterien erarbeitet, nach denen wir die Kinder aufnehmen (alleinerziehende/berufstätige Mütter, Ausgewogenheit nach dem Alter und Geschlecht der Kinder, Interesse und Engagement für den Kindergarten), aber es fehlen die Anmeldungen.
Bei den behinderten Kindern soll ein neues Kind dazukommen; von der Vorschulgruppe werden alle acht Kinder in die Schule gehen.
Da wir als Ganzjahreskindergarten auch nicht die üblichen Sommerferien haben, müssen wir nun für die Monate Juli/August den reduzierten Betrieb planen: das heißt, daß die Mitarbeiter gestaffelt Urlaub nehmen, daß die Eltern uns informieren, wann ihre Kinder im Kindergarten sein werden, daß wir uns innerhalb des Teams das Kochen und Putzen einteilen, und daß wir Aushilfen (Studenten, Praktikanten) organisieren.
Sommerbetrieb bedeutet auch Ausnahmesituation; wir sind, wenn es nur geht, im Freien. Trotzdem wären wir alle reif für richtig lange Sommerferien.
Das zweite Kindergartenjahr
Im Ablauf des zweiten Kindergartenjahres sehe ich eine Fortsetzung bzw. Weiterentwicklung von dem, was wir uns im ersten Abschnitt dieser von mir als Stabilisierungsphase bezeichneten Zeit erarbeitet haben.
Die bisherige gemeinsame Arbeitserfahrung (unsere gemeinsame einjährige Geschichte in der Sonnenburgstraße) hat allen Mitarbeitern, trotz der Auseinandersetzungen, ein großes Stück Vertrauen und Sicherheit in bezug auf die Arbeit mit den Kindern und in bezug auf die Arbeit im Team gebracht. Auf diesem Hintergrund werden die im Team auftretenden Konflikte verständlich als eine intensivere Auseinandersetzung über die gemeinsame Arbeit.
Mitte September 1979 beginnen wir nach dem Sommerbetrieb wieder mit dem "normalen" Kindergarten.
Schon der Anfang des zweiten Kindergartenjahres gestaltet sich als schwierig:
-
finanzielle Schwierigkeiten (Schulden vom ersten Kindergartenjahr, Sommeraushilfen usw.);
-
wir haben zu wenige nichtbehinderte Kinder (es kommen nicht alle Kinder, die angemeldet sind);
-
im Betreuerteam herrscht latente Konfliktstimmung (verschiedene Auffassung in bezug auf die Arbeit mit den Kindern und im Verein).
Die Schulden versetzen uns zwar immer wieder in Schrecken und wirken sich dahingehend aus, daß wir weder eine Angleichung an den Preisindex, noch eine Gehaltserhöhung erwarten, im großen und ganzen haben wir aber gelernt, daß der Kindergarten trotz Schulden weiterbesteht. Wir haben gelernt, mit den Schulden zu leben, sparsam zu sein. "Koa Geld."
Die geplante Kinderzahl (insgesamt 25 Kinder) ist im Dezember 1979 wieder erreicht. Bei den behinderten Kindern haben wir die geplante Kinderzahl von neun Kindern sogar um zwei Kinder überschritten; von diesen kommt ein behindertes Mädchen vorerst besuchsweise am Nachmittag in den Kindergarten. Zudem sind auch zwei jugoslawische Buben, die kaum die deutsche Sprache beherrschen, in der Kindergruppe.
Die Gruppeneinteilung in drei konstante Kleingruppen behalten wir bei. Gegenüber dem Vorjahr sind sehr viele jüngere Kinder (zwischen 3 - 4 Jahren) im Kindergarten; so gibt es keine homogenen Altersgruppen, sondern schwerpunktmäßig eine Gruppe der "Größeren" und "Kleineren". Beide Gruppen sind integrierte Gruppen, das heißt, daß ein bzw. mehrere behinderte Kinder zur Gruppe gehören. Weiterhin gibt es eine Gruppe mit ausschließlich behinderten Kindern.
Die Gruppeneinteilung sieht so aus:
-
die Gruppe der Größeren: acht nichtbehinderte Kinder, ein behinderter Bub (körperliche Behinderung durch noch nicht ganz geschlossene Fontanellen, massive Verhaltensschwierigkeiten);
-
Die Gruppe der Behinderten: sieben behinderte Kinder, ein Mädchen davon immer nachmittags auf Besuch (alle Kinder sind mehrfach, körperlich und geistig behindert; Verhaltensschwierigkeiten und emotionale Behinderung sind unterschiedlich ausgeprägt.
-
die Gruppe der Kleineren: sieben nichtbehinderte Kinder, drei behinderte Kinder (ein Mädchen mit Schiefhals, ein Bub mit schwerer Hörschädigung, ein Bub mit Nieren- und Augenschädigung).
Diese Einteilung ergibt sich für uns aus dem Schweregrad der Behinderung (der organischen Schädigung als auch aus der sozialen und emotionalen Entwicklung) und auch daraus, daß die bestehende Gruppe der behinderten Kinder bereits ausgelastet ist. Verstärkt erwarten wir Hilfe von Ursula (Psychologin), die jetzt nicht mehr ausschließlich als Supervisor im Team arbeitet, sondern nun auch die therapeutische Einzelbetreuung von Kindern mit sehr schweren emotionalen Problemen übernimmt. Die analytische Spieltherapie ist, neben der Physikotherapie und Logopädie, eine zusätzliche Möglichkeit, im Rahmen des Kindergartens auch den nichtbehinderten, aber sehr schwierigen Kindern, eine Hilfestellung in der Auseinandersetzung mit sich selber zu bieten. Dadurch, daß Ursula diese Kinder in der therapeutischen Einzelsituation besser kennenlernt, kann sie an uns Überlegungen/Anstöße weitergeben, die zu einem besseren Verständnis und damit zu einem adäquateren Umgang mit den Kindern führen. In diesem zweiten Kindergartenjahr sind es drei Kinder, zwei nichtbehinderte und ein behindertes Kind, die innerhalb des Kindergartengeschehens spieltherapeutisch betreut werden.
Ursula bleibt weiterhin als Supervisor tätig und aufgrund ihrer Erfahrung mit analytischer Kinderarbeit und Gruppenarbeit wird die wöchentliche "Kinderbesprechung" zu einem wichtigen Lernort für das ganze Team.
Das Einführen einer zweiten konstanten Besprechung für die Betreuer und damit das Freimachen der Kinderbesprechung von der organisatorischen und inhaltlichen Kindergartenvorbereitung wirkt sich positiv aus: es steht nun mehr Zeit zur Verfügung, um an den Problemen, die wir mit den verschiedenen Kindern haben, zu arbeiten, ohne daß die gemeinsame inhaltliche Vorbereitung zu kurz kommt. Obwohl dieses gemeinsame Planen das individuelle Vorbereiten der Kindergärtnerinnen nicht ersetzt, ist doch ein gemeinsames Überlegen der inhaltlichen Arbeit in integrierten Gruppen Voraussetzung für die gleichberechtigte Zusammenarbeit aller.
Gerade die Erfahrung des ersten Kindergartenjahres, wo am Anfang hauptsächlich die Planung der inhaltlichen Arbeit und dann später fast ausschließlich die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten der Kinder stattgefunden hat, hat uns gezeigt, wie wichtig beide Aspekte für ein befriedigendes Arbeiten sind. Unseren Ansprüchen in der Kinderbesprechung zu genügen, fällt nicht immer leicht:
Der Erfolg der Kinderbesprechung hängt sehr von unserem eigenen Engagement ab; oft delegieren wir die Initiative an Ursula; oft gibt es, trotz des bewußten Freimachens der Kinderbesprechung, zu viele andere Probleme zu besprechen oder wir schieben welche vor; manchmal bleiben wir auch im Tratsch hängen, als Ausdruck vielleicht unserer Angst, uns intensiver miteinander auseinanderzusetzen, als Luftmachen vielleicht gegenüber manchen Eltern, oder ganz einfach, weil's bequemer ist oder unser Mitteilungs- und Redebedürfnis so groß ist und weil sich im Tratsch und in Geschichten vieles mitteilen läßt. Oft bleiben auch die Beziehungsschwierigkeiten und die latenten Spannungen ausgeklammert, unangesprochen.
Das beabsichtigte Aussteigen einer Kindergärtnerin macht es dann notwendig und zugleich auch leichter, daß wir gemeinsam über unsere verschiedenen Vorstellungen und Wahrnehmungen in bezug auf die Arbeit mit den Kindern und in bezug auf den Kindergartenverein sprechen.
Auch zwei Helfer verlassen mit Ende des Kindergartenjahres den Kindergarten. Im Vordergrund stehen private Interessen bzw. Weiterbildung.
Sobald nun feststeht, daß drei Mitarbeiter den Kindergarten verlassen, müssen wir uns um neue Mitarbeiter für den Herbst 1980 bemühen. Ebenso brauchen wir jemanden, der zu Mittag das Kochen und Abwaschen übernimmt. Die Auswahl fällt schwer, denn auf ein Zeitungsinserat melden sich ungefähr 40 Bewerber/innen. Nach einem gemeinsamen Informationsabend und der Hospitation im Kindergarten trifft der Vereinsvorstand die Entscheidung.
Neue Mitarbeiter ab Herbst 1980 sind:
Gitti als Kindergärtnerin,
Brigitte (Gelernte Weberin) als Helferin,
Mischa (Erzieher) als Helfer,
Fritz (Student) als Koch.
Weiterhin gibt es einige notwendige Reparaturen und Neuanschaffungen. Dadurch bleibt das Gefühl, daß der Kindergarten nie fertig ist, daß alles "Stückelwerk" ist. So bleibt das Ordnungs- und Sauberhalten ein ständiges Problem.
Obwohl wir uns in der Sonnenburgstraße sehr zu Hause fühlen, wünschen wir uns dennoch neue, größere Räumlichkeiten. Denn die räumliche Enge fördert oft aggressive Auseinandersetzungen bei den Kindern - und auch bei uns -, die bei mehr verfügbarem Platz vermeidbar wären (besonders Garderobe, Gang und Büro sind zu klein; ein Turnsaal fehlt!).
Zur Elternarbeit in diesem zweiten Jahr:
Die Elternarbeit bzw. Mitarbeit gestaltet sich im zweiten Kindergartenjahr wesentlich anders. Von den verschiedenen "Modellen" des ersten Jahres ist übriggeblieben, daß einmal im Monat ein Eltern-Betreuerinnen-Treffen stattfindet. Die Initiative zu diesem Treffen geht weiterhin vom Team aus. Das Interesse ist aber nach zwei Treffen so gering, daß von Elternseite überlegt wird, ob es nicht sinnvoll wäre, den Elternabend jeweils für einen Elternteil verpflichtend zu machen.
Unser Zurückziehen von der Elternarbeit, unsere Vorsicht und Unlust, die wir mit den Erfahrungen des Vorjahres legitimieren, trifft sich mit dem Desinteresse der Eltern, sodaß nun wieder eine sehr unbefriedigende Situation entsteht.
Ähnlich wie im ersten Jahr müssen wir wieder den Sommerbetrieb planen. Allen Versuchen zum Trotz, diesmal das An- und Abmelden der Kinder im Sommer verbindlicher zu gestalten als im Vorjahr, bleibt die Auslastung des Sommerbetriebes großen Schwankungen unterworfen.
Kurz zusammengefaßt bedeutet diese zweite Phase in der Entwicklung des Kindergartens ein großes Stück Weiterentwicklung in der Arbeit mit den Kindern, verbunden mit einem Konflikt im Mitarbeiterteam um die Ziele und die Praxis im Kindergarten. Der Kindergarten kann sich auch nach außen hin festigen; die finanziell schwierige Lage bleibt aber weiterhin bestehen.
Erklärung vorweg: "Integrationsphase" deshalb, weil ab Herbst 1980 im Kindergarten in ALLEN Kleingruppen behinderte und nichtbehinderte Kinder sind.
In diesem Abschnitt beschreibe ich die Zeit vom Herbst 1980 bis zum Sommer 1982. Diese, von mir als Integrationsphase beschriebene Zeit, setzt sich auch nach dem Sommer 1982 im Kindergarten fort; denn entsprechend unseren positiven Erfahrungen hoffen wir, daß wir diese Gruppeneinteilung mit drei integrierten Gruppen beibehalten können. Offenes Ende also.
Im Sommer 1982 beginne ich mit der schriftlichen Aufarbeitung der Entwicklung des Kindergartens. So wird es für mich auch aus diesem Grund notwendig, den Beobachtungszeitraum zu begrenzen.
Das dritte Kindergartenjahr
Warum drei integrierte Gruppen?
Für das Zustandekommen der integrierten Gruppen sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend:
-
Die bestehende Gruppe der behinderten Kinder löst sich auf, da vier Kinder aus dieser Gruppe nun, nach einem Jahr Zurückstellung, in die Schule überwechseln (drei Kinder in die S-Klasse der Sonderschule, ein Bub in ein Sonderschulheim). Die beiden schwerstbehinderten Mädchen, die beide außerhalb von Innsbruck wohnen, werden von den Eltern nun immer am Nachmittag in den Kindergarten gebracht.
-
Fabian ist der einzige aus dieser Gruppe, der nun am Vormittag bzw. den ganzen Tag in den Kindergarten kommt. Fabian hat sich nach einem halben Jahr Einzelbetreuung und nach einem Jahr in der Behindertengruppe, in seinem sozialen Verhalten so enorm entwickelt, daß wir Mitarbeiter es wichtig finden, ihn nun in einer gemischten Gruppe weiterzubetreuen.
-
Für die neu dazugekommenen behinderten Kinder scheint es uns nicht notwendig und auch nicht gut, eine neue, ausschließliche Behindertengruppe einzurichten. Thomas und Moritz, beide motorisch behindert durch Cerebralparese, verbunden mit unterschiedlich ausgeprägten sprachlichen Schwierigkeiten, werden in der Gruppe der "Kleinen", das sind gleichzeitig auch die neuen Kinder, betreut. Paul, der aufgrund seiner massiven Verhaltensschwierigkeit von der Schule zurückgestellt wird und nun zu uns in den Kindergarten kommt, wird in der Gruppe der "Mittleren" betreut.
Es haben also sowohl die Behinderungen der Kinder, die wir als nicht so schwer eingestuft haben, als auch die gemeinsam gemachten Lernerfahrungen der ersten zwei Jahre das Zustandekommen der drei integrierten Gruppen bewirkt.
Wir behalten die schwerpunktmäßige Einteilung in "Große", "Mittlere" und "Kleine" bei.
-
In der Gruppe der Großen sind acht Kinder; Fabian und Markus sind behindert.
-
In der Gruppe der Mittleren sind sieben Kinder; Paul und Carmen (in der Zwischenzeit an ihrem Schiefhals operiert) sind behindert.
-
In der Gruppe der Kleinen sind neun Kinder; Moritz, Thomas und Jürgen sind behindert; am Nachmittag kommen Miriam und Linda (beide schwerstbehindert).
Zur Situation im Mitarbeiterteam
Die Situation, in die die neuen Mitarbeiter hineinkommen, ist nicht sehr leicht zu bewältigen. Sie stoßen auf den "harten Kern", das sind drei Mitarbeiterinnen und die Therapeutinnen, die von Anfang an dabei sind und durch die gemeinsame Arbeit eine sehr verbindende gemeinsame Geschichte haben. Die Freude über die neuen Mitarbeiter ist auch verbunden mit einer gewissen Angst. Die notwendige Bereitschaft, offen und sensibel zu sein gegenüber den neuen Mitarbeitern wird nicht von allen gleichermaßen geteilt.
Brigitte hat, bevor sie in den Kindergarten Sonnenburgstraße kommt, in einem Behindertenheim gearbeitet und ist, als die Zustände dort für sie nicht mehr tragbar sind, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen. [2]
Für Gitti und Mischa ist die Arbeit mit behinderten Kindern eine neue Erfahrung.
Gitti erinnert sich:
"Ich war am Anfang sehr auf's Team angewiesen, ich hab mich überhaupt nicht ausgekannt, wie ich mit den Behinderten umgehen soll und wie ich auf sie eingehen soll, ich hab echt viel Hilfe gebraucht ..."
Darüber, wie wir mit den Kindern umgehen, auf sie eingehen, sie gewähren lassen, mit ihnen spielen, sie bestärken und bestrafen usw., gibt es keine festgelegten Regeln, keine "Vorschriften". Auch nicht für die neuen Mitarbeiter. Trotzdem haben sich bei uns bestimmte Formen des Umgangs eingespielt, existieren unausgesprochen Regeln und "Anti-Regeln" (verstanden als das Nichteinhalten von, in Kindergärten üblichen, Regelungen). Unser pädagogisches (Alltags-)Konzept wird weitergegeben durch "mündliche Überlieferung" und durch gemeinsames Handeln in der Situation.
Diese Situation wirkt auf die neuen Betreuer verunsichernd und die Angst, aufzufallen und den (unausgesprochenen) Ansprüchen nicht zu genügen, ist dementsprechend groß.
Neben diesen Verunsicherungen bestehen auch die Anforderungen, die sich für jeden aus der Auseinandersetzung mit den Kindern ergeben.
Besonders groß sind diese Anforderungen in bezug auf die Verhaltensschwierigkeiten der Kinder.
Daneben stehen die positiven Erfahrungen, die durch diesen Freiraum möglich werden: jedes Kind wird in seiner Individualität erfahrbar.
Gitti: "Und was ich so toll g'funden hab, das weiß ich auch noch, so im Kindergarten mit so wenig Kindern zu arbeiten, was du da die Kinder alles tun lassen kannst, ... überhaupt, daß jedes Kind so a Persönlichkeit ist."
Gegenseitiges Lernen ist wiederum sehr fruchtbar - die neuen Mitarbeiter bringen neue Impulse mit in den Kindergarten - und nach einer eher abwartend vorsichtigen Anfangszeit erleben wir die Arbeit im neuen Betreuerteam und in den integrierten Kleingruppen als eine neuerliche Weiterentwicklung.
Wir erleben immer deutlicher, wie wichtig die gleichberechtigte Zusammenarbeit aller ist.
Integration als gemeinsamer Prozeß bezieht sich nicht nur auf das Zusammenleben der Kinder untereinander und auf unsere Beziehungen zu den Kindern, sondern genauso auf die Beziehungen der Mitarbeiter. Denn das gleichberechtigte Miteinander der Kinder setzt das gleichberechtigte Miteinander der Erwachsenen voraus. Immer besser gelingt es uns nun, diesen Anspruch auch in der praktischen Arbeit zu verwirklichen.
Konsequente Teamarbeit bedeutet für uns,
-
daß es keine Leiterin gibt, die für alles verantwortlich ist und daher eine gewisse Kontrollfunktion ausübt;
-
daß jeder für seine Arbeit selbst verantwortlich ist und daß alle gemeinsam die Verantwortung für das Kindergartengeschehen tragen;
-
daß Entscheidungen von allen Mitarbeitern gemeinsam getroffen werden bzw. daß alle Entscheidungen, die im Vereinsvorstand beschlossen werden, von allen Mitarbeitern diskutiert werden (Kinderaufnahme, Gruppeneinteilung, neue Mitarbeiter, Praktikanten, Urlaubseinteilung, Materialanschaffungen, uvm.);
-
daß die laufend anfallenden Arbeiten (wie die monatlichen Abrechnungen für das Amt der Tiroler Landesregierung, Führen der Kindergartenbücher, Politikerkontakte, Korrespondenz, usw.) aufgeteilt werden auf die verschiedenen Mitarbeiter; Silvia ist offiziell nach außen hin die Kindergartenleiterin;
-
daß die Mitarbeiter abwechselnd im Vereinsvorstand tätig sind.
Konflikte und Schwierigkeiten, Verzögerungen und gelegentlich chaotische Zustände im Büro, die dadurch zustandekommen, nehmen wir gerne auf uns. Oder nehmen sie zum Anlaß, wieder strenger mit uns selber zu sein. Insgesamt haben wir die positive Erfahrung gemacht, daß das ganze Team, auch wenn es schwerfällig wirken mag, sehr flexibel und kreativ auftauchende Probleme (wie Finanznot, längere Krankheit eines Mitarbeiters, Arbeitszeitverkürzung, Transportproblem, uvm.) zu lösen vermag. Zudem bildet die gemeinsam getragene Verantwortung für das Kindergartengeschehen die Grundlage für die Offenheit im Umgang mit unseren eigenen Stärken und Schwächen.
Eltern(mit)arbeit ... zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Was die Eltern(mit)arbeit betrifft, so gibt es in diesem Kindergartenjahr kaum eine Weiterentwicklung.
Das, was wir im Team als "Geschichte" der Elternarbeit bezeichnen, nämlich die Vorsicht vom ersten und die Enttäuschung vom zweiten Kindergartenjahr, wollen wir nicht mehr länger als erschwerend mit uns herumtragen. Wir sehen die Notwendigkeit, mit den neu dazugekommenen Eltern einen neuen Weg zu finden. Trotzdem: es bleibt schwierig, zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine befriedigende Form der Zusammenarbeit zu finden.
Der erste Elternabend, bei dem es um Informationen und organisatorische Angelegenheiten geht, ist so dürftig besucht, daß die anwesenden Eltern selber initiativ werden und an alle Eltern einen sehr fordernden Brief verschicken. Der Elternabend ist für mindestens einen Elternteil verpflichtend, aber da keine "Sanktionen" gesetzt sind, existiert diese Verpflichtung weiterhin hauptsächlich auf dem Papier. Nach diesem Elternbrief sind die zwei folgenden Elternabende überaus befriedigend für alle. Traurig, aber bezeichnend, daß gerade zum Elternabend mit dem Thema "Integration - was heißt das für uns?" am wenigsten Eltern kommen.
Mögliche Gründe für das Wegbleiben der Eltern von diesen gemeinsamen Treffen sehe ich darin:
-
keine Zeit (was besonders bei den alleinerziehenden, berufstätigen Müttern zu verstehen ist)
-
kein Interesse am Kindergartengeschehen (Hauptsache, das Kind ist untergebracht und fühlt sich dort wohl)
-
keine Notwendigkeit (der Kindergarten läuft ja sowieso; es ist kein Projekt mehr, wo es auf die Mitarbeit eines jeden einzelnen ankommt)
-
die Eltern fühlen sich von dem, was geredet und überlegt wird, nicht angesprochen (zu intellektuell oder eben grad zu wenig intellektuell)
-
die Eltern fühlen sich ausgeschlossen, angesichts eines Teams, das sehr stark und solidarisch wirkt; und ebenso von einem kleinen Teil der aktiven Eltern
-
die Eltern fühlen sich in ihrer bisherigen Praxis bedroht von dem, was am Elternabend angesprochen wird; die Themen rücken zu nahe an ihr eigenes Verhalten heran.
Wir Betreuer erleben die Elternabende zunehmend als eine Pflicht und sind daher auch von uns aus nur schwer in der Lage, diese unbefriedigende Situation zu verändern. So ist der Erfolg der Elternabende weiterhin sehr großen Schwankungen unterworfen.
Wir haben aber in diesem Jahr öfters Mütter/Eltern zu den Team- und Kinderbesprechungen eingeladen, um individuell mit ihnen über anfallende Probleme zu reden, wie zum Beispiel die Frage der Schule, Verhaltensschwierigkeiten, Transportprobleme und vieles andere mehr.
Der Vereinsvorstand, der laut Vereinsstatuten jedes Jahr neu gewählt wird, setzt sich in diesem Herbst fast ausschließlich aus Eltern zusammen, die nicht zur "Gründergeneration" gehören, die noch neu im Kindergarten sind. Auch bei den Vertretern der Mitarbeiter im Vorstand findet ein Austausch statt. Die Arbeit des neuen Vorstandes gestaltet sich sehr effektiv und vor allem die finanziellen Angelegenheiten werden für alle transparent.
Es werden auch zum ersten Mal die monatlichen Gehälter der Mitarbeiter erhöht bzw. an den Preisindex angeglichen.
Die beiden Helfer verlassen uns am Ende des Kindergartenjahres. Mischa möchte noch einen handwerklichen Abschluß machen und Brigitte besucht die Erzieherschule in Wien.
Das vierte Kindergartenjahr
Mit Andrea (abgeschlossene Volksschullehrerausbildung) und Christoph (Student) kommen zwei neue Betreuer in den Kindergarten, die unsere Vorstellungen von Teamarbeit teilen und bereit sind, die anfallende Mehrarbeit und die internen Konflikte gemeinsam zu bewältigen.
Da beide neuen Mitarbeiter den Kindergarten schon von der Sommeraushilfe, vom Putzdienst und von Besuchen her kennen, findet diesmal ein Mitarbeiterwechsel statt, der sehr fließend ist. Die Stabilität des Teams läßt den neuen Mitarbeitern Zeit, sich in die Arbeit hineinzuentwickeln und sich ihren Verantwortungsbereich selber zu stecken.
Andrea hat am Anfang durch ihre Arbeitszeit am Nachmittag nur mit wenigen behinderten Kindern Kontakt. Die anfänglichen Unsicherheiten im Umgang mit den behinderten Kindern werden nicht durch Handlungsanweisungen aufgefangen bzw. abgewehrt. Dafür aber ist Raum und Zeit vorhanden, selber Erfahrungen zu machen, selber im Umgang mit den Kindern zu lernen.
Wie schon erwähnt, führen wir nach den positiven Erfahrungen des Vorjahres die Arbeit in den integrierten Gruppen fort. Im Herbst sind vier behinderte Buben in die Schule übergewechselt; Markus und Paul werden probeweise in die Volksschule aufgenommen; Fabian und Jürgen besuchen die Schule im Elisabethinum in Axams. Durch die neu dazugekommenen Kinder gibt es in den drei Gruppen zwar kleine Umstellungen, das Prinzip der gemischten Gruppen wird aber beibehalten.
Im Bereich der Therapie kommt es zu Veränderungen: ab Herbst 1981 übernimmt Ursula, die jetzt zwei Jahre einzelne Kinder spieltherapeutisch betreut hat, keine neuen Kinder mehr in Therapie. Die Überlegungen, die dazu geführt haben:
-
der Raum, der im Kindergarten dafür zur Verfügung steht, ist ungenügend ausgestattet und wirkt auf Kinder und Therapeutin einengend.
-
Die fehlende Mitarbeit der Eltern der betreffenden Kinder macht ein wirkungsvolles Arbeiten unmöglich.
-
Ursula kann und will nicht "Feuerwehr" sein für die verhaltensschwierigsten Kinder. Es ist ihr vor allem wichtig, daß die Betreuer durch gezielte Arbeit (Supervision) fähig werden, mit den verschiedensten Verhaltensweisen der Kinder umgehen zu können.
Im Jänner 1982 kommt Maresi zu uns. Sie hat gerade die Ausbildung für Beschäftigungstherapie abgeschlossen und interessiert sich für die Arbeit im Kindergarten. Bei einigen Kindern können wir uns eine therapeutische Einzelbetreuung (die sich nicht nur auf den motorischen Bereich bezieht) durch die Beschäftigungstherapeutin sehr wertvoll vorstellen. Wir sehen zwar die Gefahr von einem zuviel an Therapie, doch versuchen wir, durch ein bewußtes Einsetzen der verschiedenen Therapiemaßnahmen dieser Gefahr entgegenzuwirken.
Unsere finanzielle Lage ist nach wie vor sehr angespannt, sodaß Verhandlungen mit dem Amt der Tiroler Landesregierung (Abteilung Va) wegen der Bezahlung eines höheren Tagessatzes und erstmalig auch wegen einer Platzhaltegebühr (im Falle von längerer Krankheit) notwendig werden. Dieses Ansuchen wird vom Amt der Tiroler Landesregierung positiv behandelt.
In diesem Jahr findet verstärkt Öffentlichkeitsarbeit statt, was nicht ganz unabhängig vom "internationalen Jahr der Behinderten" (1981) gesehen werden kann. Die Einladungen des ORF zu Regionalsendungen sowie ein Bericht in "Österreich Bild" über den Kindergarten sind für uns Gelegenheiten, den integrierten Kindergarten einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen; auch wenn dabei zuerst immer ein großes Stück Angst überwunden werden muß.
Die Planung des Sommerbetriebes wird in diesem Jahr leichter. Mit dem Einverständnis der Eltern wird der Kindergarten im August, dem in dem vorigen Jahr nur sehr schwach besuchten Monat, ganz zugesperrt. Zudem gibt es erstmalig für alle Mitarbeiter eine zusätzliche Urlaubswoche (sechs freie Wochen im Sommer).
Kurz zusammengefaßt bedeutet diese dritte Phase in der Entwicklung des Kindergartens einen weiteren Schritt in Richtung integrierter Arbeit in den Kleingruppen. Das Arbeiten in den drei integrierten Gruppen wird von allen als so positiv erlebt, daß wir, trotz der immer wieder notwendigen Veränderungen, die sich durch die neu dazukommenden Kinder ergeben, bei diesem Gruppenkonzept bleiben wollen.
Im Mitarbeiterteam gelingt es uns immer besser, unsere Vorstellungen von Teamarbeit zu verwirklichen. Trotz Schwierigkeiten sind wir auf dem Weg zu einem stabilen, selbstbewußten Team.
Die Entwicklung des Kindergartens, wie ich sie hier darstelle, orientiert sich hauptsächlich an den auftretenden Konflikten und Schwierigkeiten und an deren Überwindung bzw. Nicht-Überwindung.
Als selbstverständlich vorausgesetzt, fallen durch den Rost dieser Betrachtungsweise dabei die täglichen Freuden, das was für uns alle so wertvoll und ermutigend an der gemeinsamen Arbeit ist.
Zum Beispiel:
-
... wenn wir in der Früh Zeit haben zum Kaffeetrinken und zum Plauschen mit den ersten Kindern in der Küche.
-
... wenn wir Brotbacken mit den Kindern, Lebkuchen machen, Adventkranz binden und wenn der Holundersaft gut wird.
-
... wenn der Thomas von sich aus eine Zeichnung macht, wenn die Nina geduscht wird und sich die Haare waschen läßt.
-
... wenn wir das Planschbecken füllen und uns gegenseitig mit Wasser vollspritzen. ... wenn ...
[1] Ich verwende im weiteren Verlauf der Arbeit den Begriff "Betreuer/innen" für die Kindergärtnerinnen und Kindergartenhelfer/innen. Auch wenn dieser Begriff nicht meinen/unseren Vorstellungen von Erziehung und Beziehung zu den Kindern entspricht, so greife ich doch in Ermangelung eines adäquateren Begriffs darauf zurück. Auch in unserem täglichen Sprachgebrauch hat sich das Wort "Betreuer" durchgesetzt. Auch wird dadurch die gleichberechtigte Arbeit der Kindergärtnerinnen und der Helfer/innen ausgedrückt.
"Mitarbeiter" und "Team" bezeichnet alle im Kindergarten arbeitenden Betreuer/innen und Therapeutinnen.
[2] "Teleobjektiv" (September 1980); Brigitte WANKER, Mauern überall, in: FORSTER/SCHÖNWIESE (Hrsg.), Behindertenalltag, S. 21 - 34.
Inhaltsverzeichnis
Den Fehlerfreien trau ich nicht.
Ich will mit denen gehn,
die, was sie glauben, schon zu sein,
auf keinen Fall beschlossen sehn.
(Konstantin Wecker)
Ausgehend von unserer Arbeit im Kindergarten greife ich hier schwerpunktsmäßig Fragestellungen auf, die Integration als gemeinsames Lernen aller deutlich machen. Dabei ist mir wichtig, die sogenannten Behinderungen einzelner Kinder aus dem von uns erfahrenen sozialen Kontext heraus zu beschreiben. Ich verlasse hier die chronologisch beschreibende Ebene und versuche, unsere Entwicklungsschritte ein Stück weiter zu diskutieren und zu interpretieren.
Daran angeschlossen werden einige grundsätzliche Überlegungen über Bedingungen zur Verwirklichung integrativer Erziehung im Elementarbereich.
Aus den verschiedenen Formen des Zusammenseins (Freispiel, Gruppenzeit, Garten, Essenszeit) der behinderten und nichtbehinderten Kinder möchte ich die integrierten Kleingruppen als wesentliches Element unserer Vorstellungen von integrierter Erziehung und unserer tatsächlichen Praxis herausgreifen und auf Entstehung, Gruppenprozesse und Schwierigkeiten näher eingehen.
Unsere Geschichte im Kindergarten Sonnenburgstraße zeigt sehr deutlich, daß verschiedene Entwicklungsschritte notwendig gewesen sind, um zu einer Gruppenstruktur mit drei integrativ arbeitenden Gruppen zu gelangen. Wir haben vorerst den Ausweg aus der wenig strukturierten Großgruppe in einer Gruppeneinteilung mit einer ausschließlichen Behindertengruppe gesucht und uns dann anschliessend langsam zu einer Gruppeneinteilung mit drei integrierten Kleingruppen vorgearbeitet.
Die ersten sehr bedeutenden Erfahrungen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern finden für uns während der Orientierungsphase in einem freispielähnlichen Arrangement statt. Wir erleben dabei von Anfang an sehr positive wie auch ablehnende Reaktionen und Umgangsformen der Kinder untereinander.
Dazu einige Ausschnitte aus den Gedächtnisprotokollen der allerersten Zeit im Kindergarten:
In der ersten Woche
Simon und Verena helfen mir, während ich Dagmar die Windeln wechsle; sie halten Dagmar, die schon ziemlich groß und kräftig ist, ruhig und reden mit ihr. Simon hilft dann auch mit beim in den Garten Gehen; (Dagmar kann nicht selber stehen und gehen). Simon hilft den kleineren Kindern, wenn ihnen etwas weggenommen wird oder wenn sie von größeren angegriffen werden.
Hier helfen zwei nichtbehinderte Kinder interessiert, wie ich ein schwerstbehindertes Mädchen versorge. Daß Dagmar, die schon ziemlich groß und kräftig ist, noch Windeln hat, ist für die Kinder offenkundig kein großes Problem. Einerseits haben sie vielleicht Lust, das behinderte Kind einmal einfach von oben bis unten anzuschauen und anzugreifen, was beim Windeln-Wechseln recht günstig ist.
Andererseits können Kinder gerade beim Wickeln und Füttern recht gut auf Verhaltensweisen zurückgreifen, die sie gegenüber jüngeren Geschwistern erfahren und gelernt haben.
Simon hilft dann auch beim Gehen mit. Er ist von Dagmars Behinderung spürbar berührt. Auch sein sonstiges Verhalten zeigt, daß er einen Teil des Verhaltensrepertoires zwischen verschiedenaltrigen Kindern auf das Verhalten den behinderten Kindern gegenüber überträgt.
...Gerhard (über seine Behinderung wissen wir sehr wenig) nähert sich den anderen Kindern sehr grob; rennt ihnen nach, schlägt nach ihnen, greift den Kindern meistens an den Hals. Die Kinder außer Anton rennen dann meistens davon; oft unter lautem Geschrei.
Hier zeigen sich deutlich die "Verhaltensprobleme" des behinderten Buben Gerhard. Das aggressive Verhalten - und nicht die Behinderung an sich - sind im Zusammensein mit den Kindern ein Problem. Dem entziehen sich die nichtbehinderten Kinder einfach durch Weggehen. Die Wünsche, die hinter der Aggression des Kindes vorhanden sein könnten, zum Beispiel nach dem Muster "Komm her, damit ich dich wegschicken kann" oder "Ich bin aggressiv zu dir, weil ich mehr von dir, von deiner Nähe will ..." u.a., sind so nicht austragbar.
In der zweiten Woche:
... Verhalten von Verena und Ingrid dem Anton gegenüber: sie wollen ihn nicht mitspielen lassen und tragen ihn an den Händen und Füßen von ihrem Spiel weg.
... viele Kinder reagieren offen aggressiv gegenüber den behinderten Kindern; sie sind nicht mehr so vorsichtig. Auch Simon und Philip schließen Anton von ihrem Spiel aus. Klaus will beim Essen nicht neben Gerhard sitzen. Die Kontaktversuche von Gerhard (immer noch sehr aggressiv) werden massiv abgelehnt.
Erste Schritte von "Normalisierung" und Gewöhnung im Verhältnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern erleichtern die Situation nicht nur, sondern verstärken auch Probleme. Im Unterschied zur Erwachsenen-Moral, zu Behinderten nett zu sein und sie gleichzeitig zu verlassen und abzuschieben, reagieren hier die Kinder handgreiflicher und direkter. Die aggressiven Zuwendungsversuche werden nun aggressiv beantwortet und nicht nur wie vorher durch Weggehen.
Dies alles sind wichtige Entwicklungsschritte, dennoch bleibt für uns Betreuer immer wieder die Frage, "was tun wir damit"? Die Erfahrungen mit den Kindern und unser eigenes Verhalten sind noch zu unmittelbar, noch zu wenig verarbeitet und bieten uns daher zu wenig sicheren Hintergrund, um von Anfang an integrierte Kleingruppen im Kindergarten aufzubauen.
Auch wenn unsere Vorstellungen in der Projektzeit von integrierten Kleingruppen ausgegangen sind, so veranlaßt uns die reale Situation zu Kindergartenbeginn zu einem Umdenken bzw. zu einem "anders Handeln". Das Festhalten an einem "Ideal" und das Gefühl, in der konkreten Praxis damit nicht zurecht zu kommen, blockieren uns lange Zeit und tragen zu der schwierigen Situation bei, die ich in der Orientierungsphase beschrieben habe.
Neben all den Anforderungen, die durch das Neue und Unfertige des Kindergartens an alle gestellt sind, ist es vor allem die fehlende Erfahrung, mit integrierten Gruppen zu arbeiten, die bei uns Mitarbeitern das Gefühl der Überforderung entstehen läßt. Auch denjenigen Mitarbeitern, die bisher keinen oder kaum Kontakt zu behinderten Kindern gehabt haben, fällt es nicht schwer, Zugang zu den Kindern zu finden, im Gegenteil, den behinderten Kindern gilt sehr viel Zuwendung und Aufmerksamkeit.
Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, in einer Gruppe den verschiedensten Bedürfnissen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen der Kinder gerecht zu werden; und zwar in einer Gruppe, in der ein bestimmtes "Programm" durchgeführt werden soll. Nicht das einzelne Kind, sondern das Aufeinandertreffen der unterschiedlichsten Fähigkeiten und der verschiedensten Bedürfnisse machen uns vor allem ratlos und lassen uns in der Folge nach einem Strukturierungsprinzip suchen, das diese Vielfalt an aufeinandertreffenden Verhaltensweisen etwas einschränkt; mindestens für die festgelegte Gruppenzeit.
"Gruppe" bzw. "Gruppenzeit" ist sowohl bei den Eltern als auch bei uns Betreuern verbunden mit der Vorstellung und Erwartung, daß in dieser Zeit (im Vergleich zum Freispiel) etwas besonderes passiert, daß an einem inhaltlichen Schwerpunkt mit den Kindern gearbeitet wird, daß die Kinder, besonders die behinderten Kinder, speziell gefördert werden.
Damit schleicht sich doch hinterrücks ein Denken ein, das unseren ursprünglichen Intentionen genau entgegensteht und das uns nicht bewußt wird: wir orientieren uns damit doch an bestimmten oder besser unbestimmten (im Sinne von undefinierbaren) Leistungen; die Gruppe als Ort, an dem etwas geleistet, gefordert und gefördert wird.
Neben der Zugehörigkeit der Kinder zu einer der konstanten Kleingruppen bleibt weiterhin ein wesentlicher Zeitraum, den die Kinder gemeinsam verbringen: Freispiel, Jause, Mittagessen, die Zeit im Garten oder bei ganz schlechtem Wetter eine Aktivität vor dem Mittagessen, bei der alle Kinder mitmachen können (Turnen, Singen, Rhythmik usw.). Zudem bringt die räumliche Enge des Kindergartens und die intensive Zusammenarbeit der Mitarbeiter eine große Durchläßigkeit und Kommunikation zwischen den einzelnen Kleingruppen mit sich und wirkt dadurch einer Isolierung der Behindertengruppe entgegen.
Nah am Leben
In allen Gruppen orientiert sich die pädagogische Arbeit vor allem an den Kindern und ihren Bedürfnissen. Dabei bildet der Situationsansatz, das heißt, daß für die Kinder bedeutsame Lebenssituationen und -zusammenhänge im Mittelpunkt der Arbeit stehen, den Bezugsrahmen der inhaltlichen Arbeit.
Wir gestalten für alle Gruppen gemeinsam einen Jahresplan, der dann in einzelne Wochenpläne aufgegliedert wird. (Themen sind zum Beispiel: mein Körper, Geborenwerden - Wachsen, Krank-sein, Familie, Geschwister, Verkehr, alles, was sich aus der Veränderung der Umwelt im Jahresablauf ergibt, usw.).
Diese Themenplanung ist für uns jedoch kein starres Programm, sondern es dient als Orientierungsrahmen, der den Bedürfnissen und Interessen der Kinder sowie auch der Betreuer entsprechend verändert wird. Es ist für uns wichtig, daß die Kinder aktiv daran mitgestalten und ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen und auch verwirklichen können.
Je nach Fähigkeiten und Entwicklungsstand der Kinder wird der gemeinsame Themenschwerpunkt in den verschiedenen Gruppen verarbeitet.
Trotz der gemeinsamen Planung, trotz der gemeinsamen Essens- und Freispielzeiten treten in der Behindertengruppe ansatzweise jene Schwierigkeiten auf, die auch das Arbeiten in traditionellen Sondergruppen belasten:
-
Es ist fast nur ein individuelles Arbeiten mit einem einzelnen Kind möglich.
-
Es entsteht daher kaum ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
-
So können die Kinder kaum gegenseitig voneinander lernen, sich wechselseitig motivieren; es besteht eher ein Nebenals ein Miteinander.
-
Die Kinder sind sehr stark auf die Betreuer angewiesen und das oft sehr starke Abhängigsein von der Zuwendung Erwachsener wird verstärkt.
-
Überforderung und Frustration der Betreuer sind die Folge einer solchen Entwicklung.
Diese negativen Auswirkungen sind für uns zunächst nur sehr undeutlich wahrnehmbar. Um die Behindertengruppe wirklich aufzulösen, sind auch einige Veränderungen in der Kindergruppe, wie ich sie zu Beginn der Integrationsphase beschrieben habe, ausschlaggebend.
Zunehmend vermitteln uns die Erfahrungen, die wir mit den Kindern gemeinsam in der Freispielzeit, beim Essen, im Garten und in den bereits integrativ geführten Gruppen machen, Sicherheit im Umgang mit den verschiedensten Bedürfnissen und Interessen der Kinder.
So können wir in verschiedenen Situationen außerhalb der Gruppenzeit Lernerfahrungen machen, die wir dann für die neue Strukturierung der Kleingruppen und für die Arbeit in diesen Gruppen nützen. Drei Ausschnitte aus Gedächtnisprotokollen, die auf verschiedene Situationen im Tagesablauf bezug nehmen, sollen diesen Lernprozeß deutlich machen:
Mittwoch, 31.1.79: wir besuchen den Glasbläser
...Lisa und ich gehen mit den Kindern von unserer Gruppe zum Glasbläser (des chemischen Institutes der Universität), um ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Wir nehmen an, daß auch Anton, der in der Behindertengruppe ist, sich dafür interessiert und nehmen ihn mit.
Der Weg dorthin ist zwar recht weit, aber es geht sehr gut; wir fahren mit der Straßenbahn, was für die meisten Kinder ein eher seltenes Erlebnis ist. Beim Glasbläser ist alles sehr eng und vollgeräumt, aber die Kinder sind sehr ruhig und vorsichtig; alle wollen ganz vorne sein, als der Glasbläser uns einfache Arbeiten vorzeigt. Es dürfen auch alle Kinder einmal selber blasen. Simon und Philip zögern sehr lange, sodaß zum Schluß nur mehr für Simon Zeit bleibt. Auch Anton hat eine kleine Kugel geblasen, obwohl er zuerst unheimlich Angst gehabt hat (vor dem fremden Raum, vor der Flamme).
Die ersten unbefriedigenden Besuche und Besichtigungen außerhalb des Kindergartens veranlaßen uns, die Ausflüge in den Kleingruppen zu gestalten. Wie wichtig dabei die Durchläßigkeit zwischen den einzelnen Gruppen ist, zeigt dieses Beispiel sehr deutlich. Daß wir Anton, dessen "Stammgruppe" die Behindertengruppe ist, fragen, ob er mitgehen wolle, hat hauptsächlich zwei Gründe: sein Interesse für Maschinen und Werkzeug und die damit verbundenen handwerklichen Arbeiten. Auch haben wir Anton bisher, trotz seiner Unkonzentriertheit und Ängstlichkeit, als das aufnahmebreiteste Kind in der Behindertengruppe kennengelernt. Ein zweiter Grund ist sein aktives Kontaktverhalten gegenüber den Kindern der anderen Gruppen (besonders im Freispiel). So scheint uns ein gemeinsames Erlebnis in der Gruppe eine weitere Möglichkeit zur Intensivierung der gegenseitigen Kontakte.
Die Situation beim Glasbläser ist für Anton neu und so reagiert er zuerst mit Angst und Rückzug auf uns. Auf meinem Arm in Sicherheit, kann er sich an die neue Umgebung gewöhnen und kurze Zeit später aktiv teilnehmen, indem er selber eine Kugel bläst. Genau dieses "Selber-machen" ist für die beiden nichtbehinderten Buben Simon und Philip sehr schwierig. Obwohl sehr interessiert an dem, was es zu sehen gibt, brauchen sie sehr unsere Unterstützung, bis sie sich zutrauen, selber eine Kugel zu probieren. Für Philip, der sich erst im Weggehen entscheiden kann, bleibt dann auch keine Zeit mehr. Ich bin umso mehr erstaunt, daß gerade Philip so viel Rückendeckung von seiten der Betreuer braucht, da ich von ihm hauptsächlich eine aggressive und fordernde Art des Sich-Durchsetzens und des An-sich-reißens kenne. In dieser Situation, die gewisse Anforderungen an die Kinder stellt, die von außen, von jemand Fremden kommen, ist seine Position, in der er sich am liebsten erlebt, nämlich als stärkstes und mutigstes Mitglied der Gruppe, in Frage gestellt. Anton, Simon, Philip suchen auf sehr verschiedene Art und aus verschiedenen Gründen Unterstützung bei den Betreuern. Der Besuch beim Glasbläser zeigt aber, daß in der für die Kinder neuen Situation sowohl die behinderten wie auch die nichtbehinderten Kinder Hilfestellungen benötigen.
Dienstag, 6.5.80: im Freispiel
...Die 'Morgen-Kinder' sind schon da; wir trinken in der Küche noch einen Kaffee. Markus hat immer noch seine Vorliebe für die Lichtschalter in der Garderobe, im Klo und im Gang; und auch für das blau-weiß getupfte Kleid, das er sich fast jeden Tag über die anderen Sachen drüberzieht; (über die Bedeutung, die dieses Kleid für ihn hat, sind wir uns nicht im Klaren). Sonst ist's heute in der Früh mit Boris ziemlich anstrengend. Ich glaube auch, ich laufe ihm zu oft hinterher; er provoziert es immer wieder und versucht lauter Sachen, von denen er weiß, daß sie nicht erlaubt sind, zum Beispiel Wasser ins Spielzimmer holen. Er spielt dann aber auch eine Weile ganz intensiv mit Claudio und Gerald, ohne nur ständig herumzukommandieren.
Felix macht heute fast nur Sachen, die uns, mich und die Kinder, ärgern: dreht blitzschnell halbfertige Puzzles um, drückt i(berall Plastillinpatzen drauf, ma cht alle möglichen Sachen kaputt. Ich glaube, er geht zur Zeit etwas unter und bräuchte fast auch einen Betreuer für sich (auch Nina und Jürgen?). Felix ist auch zur Zeit zur Nina nicht mehr so lieb und haut sie öfters. Nach einer Verfolgungsszene um den Tisch kommt Nina trotzdem wieder zum Tisch her und hilft Felix, den Schmetterling aus Holz zusammenzusetzen. Felix: "Nina helfen".
Um halb acht, wenn der Kindergarten anfängt, sind nur wenige Kinder da; regelmäßig sind es drei bis vier Kinder; nach und nach kommen dann die anderen dazu. So ist es möglich, den Kindergartentag ruhig anzufangen. Meistens machen wir in der Küche noch Kaffee und auch für die Kinder etwas zum Trinken. Es ist eine feine Einstiegszeit, eine Zeit zum Plauschen und zum langsamen Herrichten von Spielen und anderen Materialien. Zu diesen morgendlichen Gewohnheiten gehört auch das Ritual von Markus, alle Neonlichter zu kontrollieren. Bevor nicht alle Neonlichter (im Gang, Bad und Garderobe) einwandfrei, das heißt ohne Flackern leuchten, ist Markus nicht bereit, ins Spielzimmer bzw. in die Küche zu kommen. "Muß reparieren", sagt er und gibt mir genaue Anweisungen, wie ich mit dem Besenstiel die Neonröhre zum Leuchten bringen kann. Er kennt sich dabei so gut aus und verfolgt sein Interesse so überzeugend, daß ich auf diesen Wunsch/Forderung von ihm immer einsteige. Markus ist immer eines von den ersten Kindern, so ist auch die Zeit vorhanden, mit ihm dieses Ritual zu teilen und dann in der Garderobe beim Ausziehen dabei zu sein.
Ähnlich wichtig ist für Markus auch das Kleid, das er sich jeden Morgen anzieht; nicht um damit etwas besonderes zu spielen (Rollenspiele), sondern einfach als Begleiter, als "zweite Haut" vielleicht. Auch die anderen Kinder verkleiden sich fallweise und sie beachten das Verhalten von Markus nicht weiter. Ich vermute, daß sie sehr gut verstehen, welche Bedeutung das Kleid für Markus hat.
Mit Markus, der uns im Laufe seiner Kindergartenzeit noch mit anderen Ritualen und Verkleidungen konfrontiert hat, haben wir allmählich gelernt, diese sehr individuellen Verhaltensweisen der Kinder zu verstehen als Ausdruck eines Teils ihrer Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten des Alltags, wie sie von ihnen erlebt werden, zu verstehen und vor allem zu akzeptieren. Dieser Verstehungsprozeß scheint mir besonders in bezug auf die behinderten Kinder sehr wichtig, da, wie wir selber auch erfahren haben, unverständliche Verhaltensweisen sehr schnell und bereitwillig als Teil der primären Behinderung gesehen werden und nicht als Verhaltensweisen und Bewältigungsmuster, die erst durch einen sekundären Behinderungsprozeß von den Kindern "gelernt" werden.
Boris ist als nichtbehindertes Kind im Kindergarten. Durch sein Verhalten beansprucht er besonders in wenig strukturierten Situationen wie der Freispielsituation oft die Aufmerksamkeit eines Betreuers für sich. Um sich einerseits seine Position bei den Kindern als "Boß" herzustellen und sich andererseits unsere Aufmerksamkeit zu sichern, setzt er Aktionen, von denen er sicher annehmen kann, daß wir darauf reagieren und auf ihn eingehen.
Ich beschäftige mich gern mit Boris, gerate aber meistens dann in Schwierigkeiten, wenn, wie in diesem Beispiel, andere Kinder ihre Bedürfnisse anmelden und auch Zuwendung und Aufmerksamkeit fordern.
Felix hat es schwerer, seine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und durchzusetzen. Seine Behinderung (psychomotorischer Entwicklungsrückstand im Rahmen einer primär cerebralen Störung, verzögerte Sprachentwicklung, hyperkinetisch) schränkt seine Möglichkeiten ein; stärker aber ist es sein bisher erlerntes Verhaltensrepertoire, das ihm in solchen Situationen kaum eine andere Möglichkeit läßt, als genau das zu tun, womit er das Gegenteil vom Gewünschten erreicht, was nämlich Aggressionen und negative Sanktionen auf sich zieht.
Beim oberflächlichen Hinsehen und ohne die Dynamik in der Kindergruppe zu berücksichtigen, kann man die Verhaltensweisen von Felix (Puzzles umdrehen, Kisten ausleeren, Sachen anderer Kinder kaputtmachen usw.) als absichtliches Böse-sein oder als Unvermögen auf Grund seiner Behinderung sehen. Oft liegen solche kurzgreifenden Erklärungsversuche sehr nahe, besonders in der aktuellen Konfrontation, der man zuerst mit Wut oder Ärger begegnet. Der dahinterliegende Appell des Kindes ist nur sehr schwer zu entschlüsseln. Die Situation von Boris, wie oben erwähnt, ist ähnlich. Auch bei ihm fällt es schwer, die Appelle hinter seinen aggressiven Ausbrüchen herauszuhören und die zugrunde liegende Schwierigkeit zu verstehen. Doch die Möglichkeit, ihn über die Sprache und damit in verschiedenen Spielsituationen (Rollenspielen) anzusprechen und verstehen zu lernen, ist eine wesentliche Erleichterung. Zudem kann ich bei Boris voraussetzen, daß er "versteht", was er tut, wenn er gegen Regeln verstößt oder irgendwie Sachen kaputt macht. Auch seine Art, sich so (das heißt aggressiv) zu verhalten, ist ein durchgängiges Muster und die Auseinandersetzung mit ihm darüber hat schon eine lange Geschichte.
Felix Handlung zu verstehen, fällt mir im ersten Moment schwer. Ich ärgere mich über die "Dummheiten", die er anstellt, und ergreife Partei für die Kinder, die davon betroffen sind. Erst wenn ich mit Felix gemeinsam die Sachen wieder in Ordnung bringe, kann ich einen Zusammenhang sehen zwischen meinem Verhalten (und dem von Boris) und den Reaktionen von Felix. Meinen Ärger über sein Verhalten beantwortet er vorerst mit verstärktem Kichern, Flattern (unheimlich schnelle Bewegungen der Arme) und Herumlaufen; er kommt aber immer wieder her und hilft dann, wenn auch nur ansatzweise, beim Zusammensammeln und Aufheben der Puzzleteile mit. Und, damit dieses "Spiel" noch länger dauert, dreht er den Korb voller Legosteine noch einmal um. Was bei Felix als erschwerend für das Verstehen seines Handelns dazukommt, ist die fehlende Fähigkeit, sich verbal auszudrücken, oder von Felix aus gesehen, meine Schwierigkeit, seine sprachlichen Äußerungen zu verstehen. Bei Felix reduziert sich die sehr bruchstückhafte Sprache in Krisensituationen auf einzelne Schreilaute, immer wiederholte Worte und auf ein fortwährendes Lachen oder Kichern. Zudem bleibt immer ein Teil Ungewißheit darüber, inwieweit Felix bestimmte Regeln im Kindergarten als solche versteht und bewußt dagegen verstossen kann, um bestimmte Reaktionen zu provozieren. Es bleibt auch ungewiß, wieviel ihm einfach unabsichtlich passiert.
Ein ähnliches Verhalten von Felix kenne ich auch aus Situationen, in denen er aus Langeweile, da ihn nichts länger interessiert, im Spielzimmer "herumstreunt" und dabei ständig Gefahr läuft, irgendwo hineinzuplatzen.
Sein Verhalten legt nahe, daß Felix sich in dieser Situation vernachläßigt fühlt und sich nur durch seine Aktionen Aufmerksamkeit verschafft, auch auf die Gefahr hin, nicht verstanden und dadurch negativ sanktioniert zu werden. Aufgrund vieler anderer Beispiele scheint mir das Verhalten von Felix ein durchaus häufiges Interaktionsmuster zu sein, das besonders behinderte Kinder sich zu eigen machen (oder vielmehr: zu eigen machen müssen), um überhaupt gehört zu werden. Das wird dann zu einem sehr wesentlichen Teil ihrer Behinderung.
Zwischen Felix und Nina (ebenfalls behindert) gibt es von Anfang an im Kindergarten eine sehr liebevolle Beziehung. Ich vermute, daß dabei die gegenseitige Verständigung über sehr ähnliche körperliche Bewegungen (besonders das Flattern der Arme und Hände) eine wesentliche Rolle spielt. An diesem Tag wehrt sich Nina gegen die kräftemäßige Überlegenheit von Felix, indem sie davonrennt. Hier gibt Felix, nach der Interaktion mit mir, einen Teil des Drucks an die Nächstschwächere weiter. Nina rennt davon, kommt aber wieder und hilft Felix, was dieser erfreut und erstaunt zur Kenntnis nimmt und auch verbal ausdrückt.
Mittwoch, 4.6.80: Idylle in unserem Garten
...Schon seit ein paar Tagen haben wir traumhaft schönes Sommerwetter; im Garten riecht's nach Rosen und Holunder. Das Gras hat sich erholt, wir müßten nur wieder einmal mähen. Schon in der Früh fragen die Kinder, ob wir in den Garten gehen. Alle sitzen um den großen Tisch, den wir aus Kisten und einer großen ausrangierten Tür gebastelt haben. Die Plastikkisten, unsere Sitzunterlage, müssen wir meist erst irgendwo im Garten holen, manchmal dafür erst das Bauwerk vom Vortag abräumen.
Mit Sitzenbleiben und Füttern gibt's kaum Schwierigkeiten, alle essen sehr selbständig. Sie wissen auch, daß sie, wenn sie fertig sind, spielen gehen können. Die Kinder stürmen dann weg: zum Wasser, zur Sandkiste, zur Schaukel, zum Kletterbaum und zu den angefangenen Bauwerken vom Vortag. Miriam bleibt meistens in unserer Nähe auf einer Liege oder im Sand und beim Wasser. Heute macht Heidi mit Miriam im Garten Therapie (Geh- und Stehübungen).
Die entspannte Atmosphäre im Garten und die vielen anregenden Spielmöglichkeiten stellen für ALLE Kinder eine wesentliche Bereicherung ihrer Erfahrungswelt dar. Der Garten ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Kindergartens. Er ist für uns ein zusätzlicher Raum mit vielen Möglichkeiten; ein Raum, der viel weniger Begrenzungen aufweist als alle unsere anderen Räume. Der Garten bietet genug Platz zum Rennen, natürliche Nischen und Verstecke, eine Fülle von unterschiedlichen, natürlichen Materialien (wie Steine, Holz, Äste, Erde, Blätter, Gras, Blumen, Sand und Wasser usw.), die zum Spielen anregen.
Was vor allem sehr wichtig ist: laut sein stört kaum. Für bewegungsgehemmte Kinder ist die Verlockung zum Schaukeln, Rennen, Klettern usw. im Garten sehr groß; motorisch sehr unruhige Kinder stoßen viel weniger schnell an Grenzen. Besonders den "Wasserspielen" kommt eine wichtige Bedeutung zu: vor allem das Sand-Wasser- und das Dreck-Wasser-Gemisch eignet sich gut zum Schmieren, drin Herumsteigen, Bauen, ... auf spielerische Weise können durch diese einfachen Materialien Ängste und Verkrampfungen abgebaut und Phantasien ausgelebt werden.
Besonders im Sommer versuchen wir, möglichst intensiv diese Vorteile des Gartens zu nützen und verbringen viel Zeit im Freien.
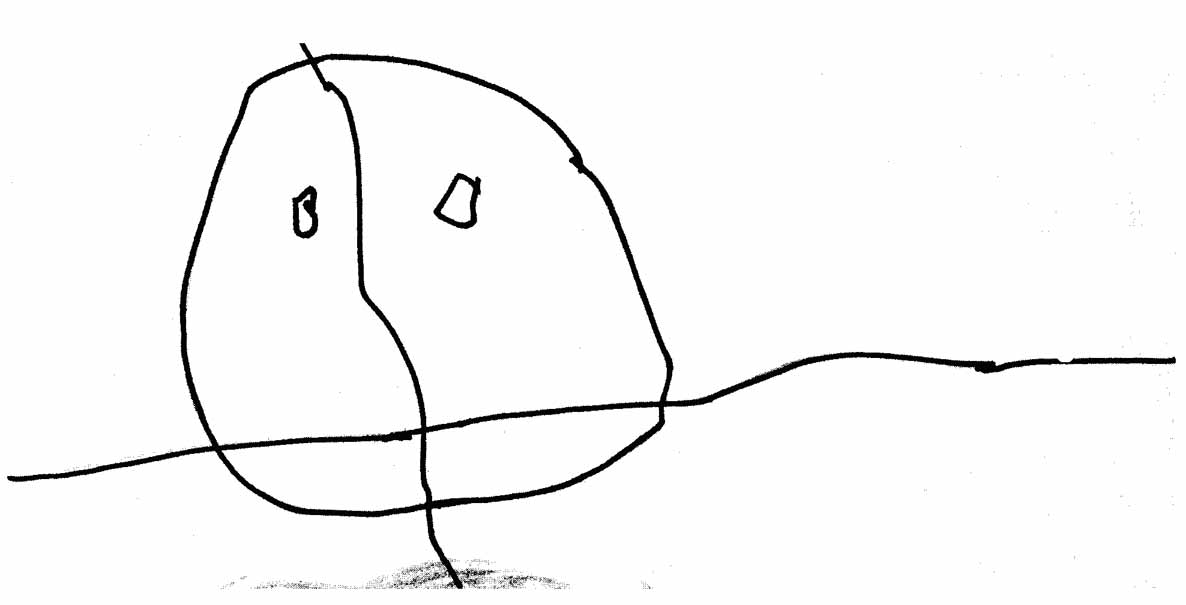
"Ich denke, daß die Linie etwas absolut Radikales und Ontologisches hat. Eine Linie zu ziehen auf einer Oberfläche, welcher auch immer, heißt jenes Minimum an Sinn herstellen, von dem ich vorhin sprach. Hier haben wir es mit etwas sehr Ärmlichem, mit einer "arte povera" zu tun. Ein schlichter Bleistiftstrich auf dem Papier ist eine Kunst, die karger, ärmer nicht sein kann, eine der ärmsten Formen von Kunst. Diese fast mystische Ärmlichkeit hat für mich zunächst etwas Ureigenes, Ursprüngliches. Ein Zug mit dem Bleistift und schon teilt sich ein Blatt, irgendetwas wendet sich. Eine Organisierung der Welt bahnt sich da unmittelbar an. Da gibt es etwas, das gleichzeitig Höhepunkt der Macht und vollständige Enteignung ist. Denn der das macht, weiß nicht, was er macht. Diese Ärmlichkeit ist durch und durch doppeldeutig, sie ist zugleich alles und nichts."
Jean-Francois Lyotard
In diesem Abschnitt greife ich nun einige Aspekte aus dem dichten Gefüge einer integrierten Kleingruppe heraus und diskutiere sie näher.
Ausgangsbasis sind Abschnitte aus Gedächtnisprotokollen von einer Kindergruppe mit acht Kindern, mit denen Gitti (Kindergärtnerin) und ich zusammenarbeiten.
Die Kinder der Gruppe sind:
Theresa. Sie ist das älteste Kind der Gruppe (5 Jahre) und schon das dritte Jahr im Kindergarten. Theresa kommt aus Indien und hat eine sehr dunkle Hautfarbe; ihr andersartiges Aussehen wird ihr jetzt mehr und mehr bewußt und schafft ihr zunehmend Probleme in der Auseinandersetzung mit sich selber.
Daniela. Sie ist vier Jahre und seit Herbst im Kindergarten. Sie ist sehr zart, still und brav (an die Erwachsenenwelt angepaßt). Daniela verläßt im Jänner die Gruppe, da ihre Mutter nun nicht mehr arbeitet.
Annelies. Sie ist dreieinhalb Jahre und auch seit Herbst im Kindergarten (zusammen mit ihrer großen Schwester Moni). Motorisch sehr lebendig, bleibt sie vorerst in allen anderen Bereichen noch sehr verschlossen.
Benedikt. Er ist dreieinhalb Jahre und hat sich gut eingelebt. Er fühlt sich bereits sicher und handelt sehr nach dem Prinzip: "Nur das machen, wozu ich gerade Lust habe".
Lukas. Er ist vier Jahre und kommt vorerst am Nachmittag und ab Jänner dann am Vormittag in den Kindergarten. "Stark sein" ist für ihn sehr wichtig. Vorerst bleibt er eher verschlossen. Maria. Sie ist viereinhalb Jahre und hat sich seit dem vorangegangenen Sommer durch häufige Besuche mit der neuen Umgebung vertraut gemacht. Seit Herbst nun besucht sie den Kindergarten regelmäßig am Vormittag. Maria zeigt Verhaltensweisen, die ich als autistisch charakterisieren möchte. Besonders auffallend ist ihre ausgeprägte Beziehung zu kleinen Dingen (wie zum Beispiel: Blumenköpfe, Birnenstiele, Gräser, Papierschnipsel, Buchstaben, Stecker eines Steckspieles, usw.), die sich je nach Ort und Gelegenheit und im Laufe der Zeit verändern, die sie leidenschaftlich sammelt und in großen Mengen in ihrer Faust festhält. Ihre stille Abgeschiedenheit gibt sie ab und zu auf, dann bricht lautes Reden (meist unverständlich), Singen und Stampfen aus ihr heraus.
Maria kann selbständig essen (viel Schmieren) und sie könnte sich auch selbständig aus- und anziehen (teilweise), zeigt aber meistens überhaupt kein Interesse daran. Maria ist sehr zart und ihre äußere Erscheinung spricht die anderen Kinder sehr an, sodaß sie trotz ihrer Zurückgezogenheit von den anderen sehr wohl bemerkt wird.
Susi. Sie ist viereinhalb Jahre und auch seit Herbst im Kindergarten. Susi ist überaus klein und zart; ihr Körper und ihre Bewegungen sind verkrampft und steif. Die Diagnose, die auf der Kinderklinik erstellt wurde, lautet: psychomentaler Entwicklungsrückstand. Ihre sprachlichen Mitteilungen sind auf einige wenige Wörter beschränkt, obwohl sie ein sehr großes Verständnis hat für Mitteilungen, die an sie gerichtet werden. Susi wirkt sehr in sich zurückgezogen; Reden, Lachen, Weinen, auch das Gehen - alles geschieht beinahe lautlos. Schon nach kurzer Zeit besteht ihre Hauptbeschäftigung darin, daß sie andere Kinder in dem, was sie tun, nachahmt.
Thomas. Er ist fünf Jahre alt und schon das zweite Jahr im Kindergarten. Thomas hat eine Cerebralparese, die sich auf die Motorik der Hände und Füße sowie auch auf die Mundmotorik auswirkt; vor allem seine Feinmotorik ist davon beeinträchtigt. Thomas kann und will vieles selbständig machen. Seine Sprache ist oft schwer verständlich und der gegenseitige Verständigungsprozeß trotz des großen Mitteilungsbedtirfnisses sehr mühsam. Anfänglich eher passiv, geht Thomas zur Zeit sehr aktiv auf die anderen Kinder und Betreuer ein.
Die Protokolle über das Gruppengeschehen stammen aus dem ersten halben Jahr dieser Gruppe, zwischen Oktober '81 und März '82. Es ist die Zeit, in der sich die Kinder schon gegenseitig kennengelernt haben. Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gruppe entwickelt sich aber erst langsam.
Die Gedanken und die Interpretationsversuche zu den jeweiligen Textstellen erfolgen nicht ausschließlich aus den Texten selber. Es fließen hier auch Überlegungen ein, die sich durch die Vorerfahrungen und die spätere Arbeit mit den Kindern begründen lassen.
Donnerstag, 15.10.81
...Theresa macht in der Gruppe zuerst immer ganz toll mit, sie kann auch wirklich am meisten. Und dann, innerhalb einer Sekunde, wechselt die Stimmung plötzlich. Theresa sitzt nur noch da, mit einem sehr traurigen Gesicht und macht nirgends mehr mit; sie schüttelt nur immer wieder den Kopf.
Annelies sagt zu allem, was wir vorschlagen oder unternehmen möchten: "Na, I mog nit. Die Mama hat g'sagt, I derf nit. Die Mama hat g'sagt, I soll nit." Obwohl diese Verbote auf keiner realen Grundlage basieren, versuchen wir doch, so gut es mit der übrigen Gruppe zu vereinbaren ist, ihre Wünsche zu erfüllen und sie einfach zuschauen zu lassen. Manchmal kommt Annelies dann von selber. Trotzdem würde es uns interessieren, warum Annelies alles so stark ablehnt, warum sie alles Neue einfach ablehnt, als erste spontane Reaktion. Maria hat heute auf ihre Art mit mir zusammen bei der Rhythmik gut mitgemacht. Zur Zeit ist Maria das einzige behinderte Kind in der Gruppe (die anderen sind krank) und es geht unheimlich gut. Durch ihr Verhalten fühlen sich die anderen Kinder, soweit ich es beobachten kann, überhaupt nicht gestört. Aber noch kann man nicht gut von einer Gruppe sprechen, jedes Kind ist noch sehr mit sich selber beschäftigt.
Theresa ist das körperlich größte und stärkste Kind in der Gruppe. Auch in ihrer sozialen und intellektuellen Entwicklung ist sie den anderen Kindern "voraus". Wie sehr aber ihre kreativen und sozialen Fähigkeiten Schwankungen unterworfen sind, haben wir in ihrer bisherigen Entwicklung immer wieder feststellen können. Ihr wenig stabiles 'Ich' läßt sie immer wieder Verbündete suchen bei den Anführern unter den Kindern, ebenso wie sie sich für die Bedürfnisse anderer Kinder verwenden läßt. Besonders die Koalition mit Florian hat in der vergangenen Zeit zu einem gemeinsamen Agieren gegen die anderen Kinder wie auch gegen die Betreuer geführt und ein gemeinsames Arbeiten in der Gruppe zeitweise fast unmöglich gemacht. Um diesen Prozeß zu durchbrechen und jedem Kind während der Gruppenarbeit mehr eigene Entwicklung zu ermöglichen, haben wir Theresa und Florian zwei verschiedenen Gruppen zugeteilt. Mitentscheidend, daß Theresa in dieser Gruppe zusammen mit den eher jüngeren Kindern ist, ist ihr geringes Selbstvertrauen und ihr oft regressives Verhalten in Situationen, die Anforderungen an sie stellen. Theresa läßt sich zur Zeit zwar auf die jeweiligen Angebote in der Gruppe vorerst ein, macht dann aber einen plötzlichen Rückzug, bringt in ihrer ganzen Haltung Traurigkeit zum Ausdruck. Unseren Versuchen, ihr auf der verbalen Ebene durch Fragen weiterzuhelfen, entzieht sich Theresa durch Kopfschütteln und Stummbleiben. Auch bei ihren Lieblingsbeschäftigungen (Turnen und Malen) verhält sie sich so, oft auch dann, wenn kaum Anforderungen an sie gestellt werden, etwas Besonderes zu können.
Wir überlegen:
Was will Theresa uns auf diese Art mitteilen? Warum versucht sie auf diese Weise auf sich aufmerksam zu machen? Wird ihr plötzlich etwas bewußt, was sie latent schon längere Zeit beschäftigt? Es wirkt auf uns, als dürfte sie sich selber kaum eine Freude erlauben. Warum geht sie von der Gruppe und den Betreuern weg und drückt sich nicht, wie sonst oft, wenn sie etwas sehr beschäftigt, zu uns her? Die Mutter von Theresa ist zur Zeit krank. Wir vermuten, daß dieses Kranksein auf Theresa Auswirkungen hat.
Diese Überlegungen helfen uns zwar weiter, trotzdem finden wir keine befriedigende Antwort. So versuchen wir weiterhin, sie zu verstehen und ihr Zurückziehen zu akzeptieren.
Annelies ist noch neu im Kindergarten. Obwohl sie gern in der Gruppe ist, lehnt sie von vornherein alle Angebote zu einer gemeinsamen Beschäftigung ab. Verbote von seiten der Mutter, wie sie von Annelies vorgebracht werden, existieren nicht wirklich. "I mog nit" klingt für mich fast wie "ich trau mich nicht" oder "ich kann das eh nicht und dann ist es besser, ich probier erst gar nicht". Auch vorsichtige Hilfestellungen, es doch gemeinsam zu versuchen, bleiben ohne Antwort von Anneliese. So bleibt sie oft in sicherer Entfernung (auf den Matratzen) als Zuschauerin des Gruppengeschehens. Da sie unbeobachtete Augenblicke manchmal benützt, um dann doch mitzumachen (beim Turnen, Basteln, Malen), hat sich unser Gefühl verstärkt, daß es mehr um das Sich-etwas-zutrauen als um das Mögen geht. Auch sonst bleibt Annelies vorerst verschlossen.
Mitzuberücksichtigen ist auch ihre Position als jüngere Schwester von Moni. Das Vergleichen und Messen mit der älteren Schwester ist sehr wichtig, ebenso das sich gegenseitig Beschützen und sich zugleich voneinander Abgrenzen.
Maria ist an diesem Tag das einzige behinderte Kind in der Gruppe. So kann ich bei der Rhythmik, die von Gitti geleitet wird, ganz auf Maria eingehen und mit ihr zusammen mitmachen. Marias Bereitschaft mitzumachen, ist sehr unterschiedlich und reicht von Spaß haben beim Mitmachen bis zum Wegrennen, was auch innerhalb eines Spiels oft wechselt.
Die anderen Kinder fühlen sich durch das Verhalten von Maria nicht gestört. Was heißt das?
Maria ist meistens sehr still und nimmt kaum direkt an der Kommunikation in der Gruppe teil. Manchmal aber brechen ein sehr lautes Lachen und ein meist unverständlicher Redeschwall aus ihr heraus; oft in Situationen, in denen es sehr leise ist. Maria stampft, zappelt und rennt durch das Zimmer. Sie bleibt kaum bei den anderen Kindern am Tisch oder in einem Stuhlkreis sitzen. Maria reißt fast alles, was an Papier erreichbar ist, auch Zeichnungen anderer Kinder, blitzschnell in kleine Fetzen. Sie schleudert oft Sachen vom Tisch und leert Spielsachen aus.
Ihr Verhalten ist dem also oft entgegengesetzt, was wir in der Zeit der "Gruppenarbeit" von den anderen Kindern erwarten bzw. mit ihnen erarbeiten wollen. Die anderen Kinder reagieren auf Maria sehr ruhig und verständnisvoll, oft sehr liebevoll und neugierig. Sie beobachten gut und versuchen zu verstehen, was bei Maria vor sich geht: "Schau, was die Maria gemacht hat", oder "die Maria lacht", oder "wie die Maria stampft". Und sie fragen: "Was hat die Maria gesagt?" Oder: "Warum muß die Maria weinen?" usw. Dann wenden sie sich wieder ihrer eigenen Beschäftigung zu.
Obwohl Maria von sich aus bisher zu den Kindern keinen Kontakt aufnimmt, versuchen die anderen Kinder immer wieder, sie einzubeziehen.
So wie sich die Gruppenarbeit an diesem Tag gestaltet, unterscheidet sich die Situation der nichtbehinderten Kinder (Theresa und Annelies) kaum von der der behinderten Kinder (Maria) in bezug auf Aufmerksamkeit und Zuwendung. Auch in bezug auf gemeinsames Arbeiten und Spielen in der Gruppe ist es uns sehr wichtig - besonders auch für die nichtbehinderten Kinder -, Erwartungen zu reduzieren und jeglichen Druck, etwas machen zu müssen, zu vermeiden.
Montag, 9.11.81
...Turnen in der Gruppe mit den Holzreifen. Theresa, Benedikt, Susi, Maria und Daniela sind da. Zuerst machen alle mit. Dann hört Theresa plötzlich auf, macht ein trauriges Gesicht und setzt sich auf die Matratzen. Sie ist auch durch unser Zureden nicht mehr zum Mitmachen zu bewegen. Susi geht zu ihr hin, nimmt den Holzreifen und will ihn Theresa in die Hand geben. Theresa lehnt auch dieses Angebot ab.
Die Stimmung von Theresa schwankt immer noch sehr zwischen Freude an einer Beschäftigung und großer Trauer. Heute reagiert Susi auf Theresas Kummer, indem sie ohne zu reden den Reifen nimmt und auf Theresa zugeht. So wie Theresa zuerst auch unsere - hauptsächlich verbale - Unterstützung abgelehnt hat, lehnt sie auch das Bemühen von Susi wortlos ab. Obwohl ihr die Aufmerksamkeit sichtlich behagt, kann und will Theresa nicht zum Turnen zurückkehren.
Wir freuen uns deshalb so, weil Susi bis jetzt von sich aus sehr wenig unternimmt, um mit den anderen Kindern in Kontakt zu kommen oder auf deren Bedürfnisse einzugehen. Ihre Form, mit den anderen Kindern zu spielen, besteht hauptsächlich im Nachahmen von Gesten und Aktivitäten der anderen.
Um Susi in ihrem Tun zu unterstützen und um zu verhindern, daß die Ablehnung von Theresa Susi in ihrer Passivität wiederum verstärkt, scheint es mir wichtig, diese Initiative von Susi gebührend zu beachten, gleichzeitig aber auch Verständnis für Theresas Situation zu schaffen.
Donnerstag, 7.1.82
...In unserer Gruppe sind alle Kinder da, einige das erste Mal nach den Weihnachtsferien.
Theresa ist mit Gips gekommen. Mit Gittis Hilfe erzählt sie ;über den Fußbruch und dann malen alle - außer Lukas - den Gips von Theresa an. Reihum reden dann alle Kinder von ihren Weihnachtsferien, vom Christbaum, usw..
Wir freuen uns, daß das Erzählen bei Thomas so gut geht. Er versteht unsere Fragen gut und gemeinsam können wir fast alles, was er redet, verstehen. Auch sind die Kinder, während ein anderes Kind redet, sehr ruhig. Beim Thomas genauso wie bei allen anderen. Außer Benedikt, der sich, wenn er etwas Bekanntes hört, sofort einmischt.
Maria kann heute fast nicht ruhig sitzen, sie zappelt wild, hört nicht zu, singt beim Turnen laut vor sich hin (hoppa, hoppa, reita). Sie macht auch beim Turnen kaum mit, sondern hüpft wild herum.
Bei Annelies hat sich über die Weihnachtsferien wieder das Daumenlutschen, Polstertragen und stumm Dabeisitzen eingestellt. Sie macht heute beim Erzählen nur sehr zaghaft und beim Turnen (Lieblingsbeschäftigung) nur unter ganz viel Zureden mit.
Thomas ist in der Garderobe ganz besorgt um Maria. Wir Betreuer wollen, daß sie sich selber anzieht bzw. daß sie beim Anziehen mithilft. "Maria, Maria" fordert er sie und uns immer wieder auf. Wir sagen, daß die Maria halt herinnen bleibt, denn ohne Schuhe und Schianzug ist es jetzt draußen zu kalt. "Helfn, Maria", fordert er uns wieder auf, dabei ist er gerade unter viel Anstrengung mit sich selber fertiggeworden.
Theresa hat sich den Fuß gebrochen und ist heute vorerst mit ihrem Gipsfuß im Mittelpunkt der Gruppe. Wir malen abwechselnd auf ihren Gips und haben es sehr lustig dabei . Lukas mag nicht; die Situation ist für ihn noch neu. Lukas, der bisher immer am Nachmittag den Kindergarten besucht hat, ist heute das erste Mal in der Vormittagsgruppe dabei. Obwohl dieses Zeichnen überhaupt nicht auf ein individuelles Produkt ausgerichtet ist, sondern sich spontan aus dem Erzählen von Theresa ergibt, weigert er sich mitzumachen.
Über die Weihnachtsferien gibt es viel zu erzählen. Thomas macht sehr begeistert mit. Reden ist für Thomas aufgrund seiner Behinderung, die auch die Mundmotorik beeinträchtigt, sehr mühsam, vor allem muß er auch immer wieder die Erfahrung machen, bei seinen Reden nicht verstanden zu werden.
(Ob Thomas auch geistig behindert ist, bleibt in der klinischen Diagnose ungeklärt. Wir Betreuer neigen eher dazu anzunehmen, daß Thomas aufgrund seiner Schwierigkeit, sich zu artikulieren und dabei auch verstanden zu werden, sich mehr und mehr zurückgezogen hat und teilnahmslos geworden ist.)
Beim Erzählen über die Weihnachtsferien kann Thomas es kaum erwarten, bis er an die Reihe kommt, und sein ganzer Körper ist in Bewegung. Während er redet, ist es ganz still. Kein Kind lacht oder äfft ihn nach. Gemeinsam gelingt es uns, Thomas zu verstehen. Das Erzählthema "Weihnachtsferien" und die ruhige Situation, in der alle Kinder versuchen zu warten, bis der andere ausgeredet hat, sind für Thomas sehr motivierend, sich verbal einzubringen.
Er traut sich in dieser Erzählsituation sogar mehr zu als Annelies, die heute ein sehr repressives Verhalten zeigt und nur sehr zaghaft mitmacht. Annelies gibt diese neue Zurückgezogenheit auch beim Turnen nicht auf.
Maria zappelt, singt und hüpft herum. Die Versuche, sie immer wieder miteinzubeziehen - besonders beim Turnen - sind vergeblich; Maria bleibt bei ihrer Beschäftigung. Beim Anziehen in der Garderobe brauchen fast alle Kinder unsere Hilfe (besonders jetzt im Winter). Wir bemühen uns darum, immer genug Zeit zu haben, daß alle Kinder das Selberanziehen lernen können, was besonders bei Maria, Thomas und Susi sehr wichtig ist.
Maria geht gerne in den Garten, das Anziehen vorher gestaltet sich aber sehr schwierig. Obwohl sie viele Handgriffe selbständig machen kann, sitzt sie auf ihrem Platz und rührt nichts an. Unsere Aufforderungen, mindestens die Patschen auszuziehen, gehen ins Leere. Maria wartet solange, bis sie jemand von uns anzieht. In dieser Situation in der Garderobe verhält sich Maria viel unselbständiger, als sie wirklich ist. Um dieses Verhalten nicht zu unterstützen, zeigen wir ihr als Alternativen, entweder beim Anziehen mitzuhelfen oder im Kindergarten herinnen zu bleiben.
Wie sehr Thomas, der selber mit dem Anziehen noch Schwierigkeiten hat, Maria verstehen kann, zeigt seine Aufforderung an Maria und an uns, ihr doch zu helfen. Thomas hat selber oft genug erfahren, was es heißt, gedrängt zu werden oder für ein Nicht-Können auch noch bestraft zu werden.
Montag, 18.1.82
... heute sind alle Kinder da. Auch Maresi (Beschäftigungstherapeutin), da Susi Therapie hat; die beiden bleiben heute bei uns in der Gruppe.
Zuerst sprechen wir über den Tagesablauf der Kinder. Lukas erzählt (mit Gittis Hilfe), was er so alles macht. Alle anderen Kinder hören zu, niemand redet drein, es ist recht leise. "Des sog i net", sagt Lukas öfters. Ich vermute, immer dann, wenn er etwas nicht weiß oder sehr unsicher ist. Dann basteln wir eine Kindergartenuhr.
Auch Marie macht eine Zeichnung. Dabei nimmt sie heute nur einen Farbstift und malt fast ohne Hilfe viele Kreise auf ihr Papier. Es macht ihr sichtlich Spaß.
Auch Susi macht recht toll mit; Maresi ist hauptsächlich mit ihr beschäftigt.
Thomas macht gleich mehrere Zeichnungen und hat auch Spaß beim Aufkleben.
Auch Annelies macht selbständig eine Zeichnung; sie zeichnet "Garderobe", Theresa die "Jause", Lukas "Gruppenzeit", Benedikt "Freispiel".
Theresa und Annelies fangen noch an, selber Uhren zu zeichnen; Susi läuft weg und kriecht ins Zelt, ein paar Kinder rennen ihr nach. Maria sitzt auf meinem Schoß und wir spielen "Uhr". Die Kinder kommen dann zum Aufkleben und zum Ausprobieren der Uhr noch einmal zurück an den Tisch.
Eine Gemeinschaftsproduktion entsteht. Alle Kinder tragen mit ihren Zeichnungen dazu bei. Die Zeichnungen fallen sehr unterschiedlich aus, aber keine Zeichnung wird ausgeschlossen. Maresi, die bei uns als Beschäftigungstherapeutin arbeitet, bleibt im Gruppenraum und unterstützt Susi bei dem, was wir in der Gruppe machen.
Maria bleibt heute mit allen anderen Kindern am Tisch sitzen und malt ihre Zeichnung hauptsächlich mit einem einzigen Farbstift. Sonst umklammert sie immer mit beiden Händen eine ganze Menge Farbstifte.
Sie lacht dabei leise; steht auf und setzt sich wieder hin und schaut ihre Kreise an. Maria bringt mit ihrem ganzen Körper zum Ausdruck, daß ihr dieses Zeichnen Spaß macht. Um dieser Zeichnung von Maria einen bestimmten Platz auf der gemeinsamen Uhr zuzuordnen, versuche ich, ihre schwungvollen Kreise in Beziehung zu setzen mit dem Schaukeln im Garten, was von Maria besonders lustvoll erlebt wird (im Sommer und Herbst). Daß Maria mit diesem "Vorschlag" etwas anfangen kann, zeigt auch ihre verbale Antwort darauf: "Garten". So werden dann Marias Kreise auf unsere Uhr geklebt, um die Zeit im Garten anzuzeigen.
Susi erhält Unterstützung von Maresi. Alle anderen Kinder machen selbständig eine oder mehrere Zeichnungen; auch Thomas macht von sich aus gleich mehrere Zeichnungen. Ohne vorher genau festzulegen, wer was macht, findet jedes Kind für sich ein Thema.
Die Ausdauer der Kinder ist sehr unterschiedlich, und so sucht jedes Kind, wenn es mit seiner bzw. mit mehreren Zeichnungen fertig ist, eine andere Beschäftigung. Susi, die meistens abwartet, um dann jemandes Beschäftigung nachzuahmen, kriecht als erste ins Zelt und es folgen ihr dann auch Benedikt und Lukas. Theresa und Annelies haben das Uhrenzeichnen entdeckt (auf Papier und auf ihre Handgelenke) und bleiben noch eine Weile am Tisch sitzen. Maria sitzt auf meinem Schoß und wir spielen "Uhr" mit dem ganzen Körper; zum Ausprobieren des "Werkes" kommen die Kinder dann noch einmal an den Tisch zurück. So wie sich die Gruppenarbeit an diesem Tag gestaltet, wird sehr deutlich, wie sich gemeinsames Zeichnen bzw. Basteln und individuelles Beschäftigen abwechseln. So können wir auf das verschieden starke Interesse, die verschiedenen Fertigkeiten und die unterschiedliche Ausdauer der Kinder eingehen, ohne daß die Kindergruppe sich in Einzelbetreuung auflöst bzw. das andere Extrem eintritt, nämlich, daß sich alle Kinder unabhängig von ihren Bedürfnissen und ihrem Können einer Gruppennorm unterwerfen müssen.
Dienstag, 19.1.82
... das Tauziehen mit dem großen Seil macht den Kindern Spaß, sie fühlen sich sehr stark dabei. Annelies hat sich zum Lukas dazugehörig gefühlt und Theresa zum Benedikt. Thomas und Susi haben auch mitgezogen, aber nicht mit der gleichen Begeisterung und dem selben Erfolgserlebnis (mindestens nicht für uns sichtbar).
Eine neue Attraktion, die die Kinder begeistert: Gitti balanciert mit einem kleinen roten Schirm in der Hand wie eine Seiltänzerin über das große Seil, das am Boden liegt. Alle Kinder möchten es selber versuchen und balancieren dann auch geschickt eine Weile auf dem Seil herum. Bei allen Kindern wird zum Schluß geklatscht.
Es entwickelt sich dann in der Matratzenecke ein sehr angeregtes Spiel. Alle Kinder und alle Matratzen zusammen bilden einen "lebendigen Berg". Jeder kämpft sich wieder heraus und läßt sich von neuem zudecken. Wir machen dann aus den Kindern und Matratzen "Schaumrollen", die wir dann anbeißen, herumtragen, aufeinanderschlichten usw. Es ist ein Spiel, in dem sich die Kinder richtig fallen lassen.
Turnen ist fast immer für alle Kinder attraktiv. Auch lassen sich gerade beim Turnen die verschiedensten Interessen und Fähigkeiten der Kinder miteinander verwirklichen.
Mit den kleinen Springschnüren zu turnen, ist den Kindern zu langweilig; heute steht das große Tau im Mittelpunkt des Interesses.
Beim Tauziehen, was heißt, "messen wer stärker ist", sind die nichtbehinderten Kinder begeistert dabei. Thomas und Susi gehören zwar jeweils einer Dreiergruppe an, sind aber nicht mit der gleichen Begeisterung dabei. Für die nichtbehinderten Kinder ist es kaum notwendig, die Spielregeln vorzugeben. Susi und Thomas aber können mit dieser spielerischen Wettkampfsituation kaum etwas anfangen. Thomas, der körperlich kräftig ist, gelingt es besser, sich einzulassen. Für Susi bleibt die Situation beim Tauziehen fremd und sie macht ohne wirkliche Beteiligung mit.
Beim nächsten Spiel mit dem Seil machen alle Kinder mit gleicher Intensität und großer Freude mit. Es entwickelt sich durch das simulierte Seiltanzen fast so etwas wie eine Zirkusatmosphäre.
Ohne vorher zu erklären, führt Gitti den Kindern auf dem am Boden liegenden Tau einen pantomimischen Seiltanz vor. Die Kinder schauen ganz gebannt zu. Eines nach dem anderen balanciert dann selber mit dem Schirm über das Seil. Thomas möchte von sich aus den Anfang machen. Maria, die bisher hauptsächlich singend herumgehüpft ist, schaut interessiert zu und macht mit mir zusammen diesen Seiltanz. Am Schluß jeder "Vorführung" wird geklatscht - fast so wie im Zirkus.
Zudem wird durch dieses Gehen-auf-dem-Seil eine physikotherapeutische Übung von Thomas eingeflochten. Diese Übung zur Verbesserung der Fußmotorik wird auf diese Weise für alle Kinder besonders für Thomas - mit Spaß und Spannung verbunden. Alle Kinder machen sozusagen mit ihm seine "Therapie".
Das Balancierspiel geht über in ein Spiel, bei dem alle Kinder mit dem Seil eingefangen werden. Daraus entwickelt sich dann ein sehr spontanes Spiel in der Matratzenecke: sich auf die Matratze fallen lassen, Matratzen drauf werfen, herauskriechen aus diesem Berg, sich wieder drauf werfen lassen ... ohne Ende. Es gibt immer wieder neue Ideen: einrollen in die Matratzen, einzeln und zu zweit, fallen lassen mit geschlossenen Augen, usw. Auch Annelies und Lukas geben ihre Zurückhaltung auf und machen ganz begeistert mit. Maria lacht, läßt sich einrollen, legt sich auch zu den anderen Kindern auf die Matratze und freut sich mit; nur beim Fallenlassen und Zugedecktwerden mag sie nicht mitmachen. Thomas kann kaum genug bekommen. Susi ist so locker wie nie bisher.
Das Spiel wird auch nie grob oder aggressiv. Bei diesem sehr körperlichen Spiel sind die Kinder sich so nahe, wie ich es bisher noch kaum erlebt habe.
Freitag, 26.2.82
... heute in der Gruppe: wir spielen Memory in zwei verschiedenen Gruppen. Thomas und Susi spielen sehr konzentriert mit. Maria saust immer wieder weg und flippt im Zimmer herum Maria möchte dann Musik machen, "Musik". Wir steigen nach dem Spiel auf diesen Vorschlag ein. Maria macht mit.
Nach einer Phase der Differenzierung beim Memory Spielen kommen alle Kinder zum Musikmachen zusammen. Das Musikmachen ist von uns nicht geplant worden, sondern ergibt sich aus dem Wunsch von Maria.
Maria mag beim Memory nicht mitspielen und weicht durch ständiges Wegrennen aus. Sie wünscht sich als Alternative "Musik". Maria äußert kaum je konkret, was sie sich zu tun wünscht, sodaß wir diese spontane Äußerung sehr gerne aufnehmen.
Das Memory spielen in zwei verschiedenen Gruppen (behinderte Kinder - nichtbehinderte Kinder) ergibt sich aufgrund der Überlegung, für Thomas und Susi eine Spielsituation zu schaffen, wo sie die Grundbegriffe dieses Spieles auf eine einfache Art kennenlernen. Wir spielen mit denselben Karten, nehmen aber nur ganz wenige und machen einige Vorübungen zu diesem Spiel. Durch die geringe Anzahl der Mitspieler verkürzt sich auch die Zeit des Wartens.
Beobachtungen im Freispiel haben gezeigt, daß Thomas und Susi zwar oft mit den anderen Kindern eine zeitlang mitspielen, aber kaum je ein richtiges Kartenpaar finden können. Trotz des geringen Erfolges (in Form von aufgedeckten Kartenpaaren) spielen beide immer wieder gerne mit. Um nun diese Situation für Susi und Thomas zu verbessern, versuchen wir, in einer Kleinstgruppe mit Vorübungen dieses Spiel aufzubauen.
Dienstag, 16.3.82
... heute sind alle Kinder da. Wir basteln zusammen Schelleninstrumente, für jedes Kind eines (aus Rundhölzern, Spagat und kleinen Schellen).
Maria war jetzt ein paar Tage krank; sie hat immer noch einen Ausschlag im Gesicht, ist verschnupft und weinerlich. Sie ist auch heute für das Instrumentebasteln nicht zu begeistern. Susi macht in letzter Zeit wieder oft in die Hose; sie redet auch kaum mehr. Wir haben bei ihr im Moment das Gefühl, daß sie kaum auftaut, daß sie eher wieder in ihr früheres Verhalten zurückkehrt. Thomas war auch eine Woche krank; er hat sich in letzter Zeit kaum verändert. Deutlich spürbar ist noch seine Angst, wenn er von der Mutter getrennt ist (diese Angst ist durch die Schiwoche ausgebrochen).
Nach meinen bisherigen Erfahrungen bedeutet basteln vor allem: selber etwas herstellen. Wichtig ist dabei, daß der Prozeß des Selbermachens von den Kindern lustvoll erlebt wird, daß sie im Umgehen mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen das eigene Gestaltenkönnen erleben. Erst auf diesem Hintergrund wird das, was dabei als Produkt entsteht, für die Kinder bedeutungsvoll: das gebastelte Werk als sichtbarer Ausdruck ihrer Phantasie und ihres selbständigen (handwerklichen) Könnens.
Je nach Material und Aufgabe sind Hilfestellungen und unterstützende Zuwendung für alle Kinder der Gruppe notwendig; wie zum Beispiel beim Basteln der Schelleninstrumente, da wir zusätzlich noch Säge, Nägel und Schmirgelpapier verwenden. Hier beim Basteln wird ein Unterschied deutlich, der zwischen Maria und Susi einerseits und den anderen Kindern der Gruppe besteht.
Was die Kinder als ihre Tätigkeit, als ihr Werk erleben, bleibt für Susi und verstärkt noch für Maria fremd und vorerst ohne Beziehung zu ihnen selber.
Maria, die an diesem Tag noch mit den Nachwirkungen ihrer Krankheit zu kämpfen hat, gelingt das Auffädeln der Schellen, indem ich einen Spagat nehme und aus ihrer langsam sich öffnenden Hand eine Schelle nach der anderen auf die Schnur aufnehme. Dieses Aus-der-Hand-geben der Schellen scheint mir für Maria vorerst genug "Leistung" zu sein.
Maria ist im Bereich der Feinmotorik sehr geschickt, aber ihre Art des Gestaltens und des aktiven Eingreifens in ihre Umwelt beschränkt sich hauptsächlich auf das Reißen von Papier und auf das Sammeln winziger Teilchen. Maria immer wieder in alle Bastelarbeiten miteinzubeziehen, dabei wenn möglich von ihrem Reißen und Sammeln auszugehen, scheint mir eine Möglichkeit zu sein, ihr das eigene Gestalten-können erlebbar zu machen.
Das langsame, für uns leise bemerkbare Aufwachen von Susi hat einen Rückschlag erfahren, was sich am deutlichsten durch das wiederauftretende Einnässen und die fast wieder verschwundene Sprache zeigt. Auf das "warum" finden wir innerhalb des Kindergartens keine befriedigende Antwort, da sich für uns in der Kindergruppe keine sichtbaren Veränderungen ergeben haben. Eine mögliche Antwort: hohe Erwartungen von unserer Seite aufgrund der bisher sehr positiven Entwicklung wirken nur hemmend auf Susi. (Die Gründe können auch außerhalb des Kindergartens liegen.)
Die Unterstützung, die Susi beim Basteln benötigt, bezieht sich, ähnlich wie bei Maria, nicht nur auf die motorischen Fähigkeiten (schneiden, kleben, hämmern, kneten usw.), sondern vielmehr auf den Prozeß des Selber-gestalten-könnens und des Selber-gestalten-wollens. Den Weg hin zur Umsetzung von Phantasie und Gefühlen und zum Gestalten eigener Vorstellungen erlebe ich bei Susi abgeschnitten.
Bei Thomas erleben wir eine starke Entwicklung hin zum Selbermachen. Diese Entwicklung, die sich in allen Bereichen abzeichnet, ist besonders beim Basteln sichtbar. Seine feinmotorischen Fähigkeiten sind durch seine Behinderung wesentlich beeinträchtigt. Trotzdem ist sein Wille und seine Freude am Selber-gestalten ungeheuer stark. Er beansprucht nun auch von sich aus unsere Hilfe bei verschiedenen Tätigkeiten. Zur Zeit - seit den Semesterferien, wo er an einem von der Kinderklinik durchgeführten therapeutischen Schikurs teilgenommen hat - ist für Thomas die Angst, von der Mutter getrennt zu sein, ungeheuer groß. Diese Angst ist so bestimmend, daß er sich nur schwer beruhigen kann. Sie bewirkt auch, daß er sich kaum richtig auf etwas anderes einlassen kann.
Einige Bemerkungen zur weiteren Entwicklung dieser Kindergruppe: Während der Gruppenzeit entwickeln die Kinder ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrer Gruppe; die Kinder wissen immer genau, wer fehlt, oder fragen, warum das betreffende Kind nicht da ist. Ebenso ergibt sich häufig schon bei der Vormittagsjause die Frage: "Was machen wir heute in der Gruppe?"
Besuche von den Kindern aus den anderen Gruppen werden nicht immer toleriert, wenn sie einfach so vorbeischauen; sie werden von den Kindern aber manchmal eingeladen, um etwas Besonderes vorzuzeigen. Das heißt für mich, daß die Kinder die Abgeschlossenheit und den Schutz (Geborgenheit) der Kleingruppe sehr wohl spüren und brauchen, daß sie sich aber auch in einem größeren Zusammenhang (Kindergarten) erleben.
Die Freude und die Ausdauer bei den gemeinsamen Gruppenaktivitäten ist bei allen Kindern sehr viel größer geworden, wenn auch dieser Prozeß nicht kontinuierlich und bei allen Kindern gleich verlaufen ist. Maria hat, was die gemeinsame Arbeit in der Gruppe betrifft, eine Sonderstellung.
Diese Entwicklung bedeutet nicht, daß es nun keine Schwierigkeiten und Konflikte mehr gibt. Sie zeigt aber für mich sehr deutlich, daß sich die behinderten wie die nichtbehinderten Kinder gemeinsam in der Gruppe weiterentwickelt haben, jedes auf seine Art.
Im Anschluß an Teil 3.1.1. und Teil 3.1.2 fasse ich nun thesenartig unsere gemeinsamen Lernerfahrungen, Überlegungen und Folgerungen zusammen.
(1) Größe und Zusammensetzung der integrierten Gruppen: bei der Planung der integrierten Gruppen sind für uns - neben den personellen, räumlichen und finanziellen Bedingungen - nun folgende Überlegungen wichtig:
-
Die Kleingruppen umfassen 6 - 9 Kinder; dabei sind 2 - 3 Kinder behindert.
-
Es hat sich als positiv erwiesen, wenn die Behinderungen (Art und Schweregrad) der Kinder verschieden sind. So können die Kinder der Gruppe erfahren, wie unterschiedlich die Fähigkeiten, Probleme und Beeinträchtigungen sind, und sie können mit den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder vertraut werden. Die Grenzen zwischen behindert und nichthehindert können als fließend erfahren werden, was einer rigiden Einteilung in "die Behinderten" und "die Nichtbehinderten" entgegenwirkt.
-
Ebenso scheint es uns wichtig, in jede Gruppe nicht mehr als ein schwer-mehrfachbehindertes Kind aufzunehmen. Denn so kann die pflegerische Arbeit ohne Mehrbelastung geleistet werden und sogar in das Gruppengeschehen eingebaut werden; die Gruppe kann die verschiedensten Aktivitäten unternehmen ohne organisatorischen Aufwand; und es wird, wie oben schon angesprochen, die Aufmerksamkeit der Gruppe nicht auf die Behinderung konzentriert.
-
Auch die verhaltensschwierigen nicht-behinderten Kinder sollen in die verschiedenen Kleingruppen integriert werden, ohne daß sie (durch Konzentration in einer Gruppe) die gemeinsame Arbeit in diesen Gruppen sprengen.
-
Wir praktizieren in unserer Arbeit eine Mischform aus altersheterogenen und altershomogenen Gruppen. Das Alter der Kinder im Kindergarten erstreckt sich von drei bis sieben Jahren. Der Altersabstand der Kinder in den Kleingruppen dagegen beträgt bis zu zwei Jahren, wobei wir das tatsächliche Alter wie auch den Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigen. Entwicklungsverzögerungen behinderter Kinder verlieren an Bedeutung, wenn gleichzeitig jüngere Kinder mit einem ähnlichen Entwicklungsstand in der Gruppe sind.
-
Für alle Kinder, besonders aber für die nichtbehinderten Kinder, soll die Bezugsperson (Kindergärtnerin) und die Bezugsgruppe möglichst lange (über die ganze Kindergartenzeit) konstant bleiben. Bei einer ausgesprochenen negativen Dynamik innerhalb einer Kindergruppe versuchen wir, soweit als möglich, auch strukturelle Veränderungen vorzunehmen.
(2) Merkmale der Kleingruppenzeit gegenüber den anderen Phasen des Tagesablaufes sind:
- Kleinheit und Überschaubarkeit;
- und dadurch besseres Kennen der individuellen Eigenheiten, der Stärken und Schwächen
- jedes Einzelnen;
- größere Strukturiertheit durch die jeweiligen Angebote und das Wochenthema;
- Konstanz der erwachsenen Bezugspersonen;
- relative Abgeschlossenheit nach außen läßt das Gefühl von Schutz und Geborgenheit entstehen.
Im Integrationsprozeß kommt diesen Strukturmerkmalen der Kleingruppe eine wesentliche Bedeutung zu, da sie verschiedene Lernprozesse begünstigen.
(3) Die Kinder lernen voneinander. Die Behinderten von den Nichtbehinderten, die Nichtbehinderten von den Behinderten, die Behinderten von den Behinderten und die Nichtbehinderten von den Nichtbehinderten.
Ganz einfach und alltäglich. Und für alle Kinder lebensnotwendig, um sich im sozialen Umfeld mit anderen Menschen zurechtfinden zu lernen.
Von den Kindern geht eine Fülle von Impulsen und Anregungen aus, die von Erwachsenen (Betreuer und Therapeuten) nie in der Weise in Gang gebracht werden können. In diesem dichten Gefüge der alltäglichen gemeinsamen Erfahrungen (dabei denke
ich auch über die Gruppenzeit hinaus vor allem an das gemeinsame Essen, Waschen, Klogehen und vieles mehr) vollziehen sich viele Lernprozesse ganz selbstverständlich und meist unbewußt und daher auch fast unbemerkt.
Die Motivation für bestimmte Aktivitäten in der Gruppe, wie erzählen, singen, turnen uvm. muß nicht erst hergestellt werden. Die Kindergruppe wirkt - wie bei Thomas zum Beispiel deutlich wird - motivierend auf das Aktivwerden der einzelnen Kinder. Dabei, sind die Lernprozesse durchaus wechselseitig. Die nichtbehinderten Kinder sind nicht die einseitig gebenden. So versteht Susi den Kummer von Theresa; Thomas kümmert sich um Maria in der Garderobe; im Spiel zwischen Miriam und Daniela wird gegenseitige Zuneigung sichtbar.
(4) Wirkliches Miteinander setzt gegenseitige Rücksichtnahme voraus, wobei die Bedürfnisse der nichtbehinderten Kinder genauso ernst genommen werden müssen wie die Bedürfnisse der behinderten. Einseitige oder übertriebene Rücksichtnahme gegenüber den behinderten Kindern kann für die nichtbehinderten Kinder Einschränkung und Zurückgesetztwerden bedeuten und bewirkt in der Folge Ablehnung und Aggression gegen die behinderten Kinder. Für die behinderten Kinder bedeutet einseitige Rücksichtnahme nicht ernst genommen zu werden, und eine wirkliche Auseinandersetzung mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen wird verhindert.
Ich sehe dies als eine Forderung an die Betreuer und Therapeuten, die Bedürfnisse aller Kinder gleich wichtig zu nehmen, sowohl bei der Planung der Gruppenaktivitäten wie auch in aktuellen Konfliktsituationen (zum Beispiel, wenn ein Kind einem anderen etwas kaputt macht, wenn mehrere Kinder das gleiche Spielzeug wollen, und vieles mehr).
Ich sehe dies auch als einen erforderlichen Lernprozeß für die Kinder, der beinhaltet, daß sie lernen, die verschiedenen Bedürfnisse, Stärken und Schwächen zu sehen und damit einfühlsam umzugehen, ohne die eigenen Interessen und Bedürfnisse zu unterdrücken. Am Beispiel von Thomas können wir beobachten, wie selbstverständlich rücksichtsvoll die anderen Kinder der Gruppe auf seine Sprachschwierigkeiten und seine motrischen Unsicherheiten reagieren und ihm dadurch eine Art Rückhalt bieten. Wichtig erscheint mir hier zu erwähnen, daß dieses gegenseitige Akzeptieren von individuellen Stärken und Schwächen in der Gruppenzeit wesentlich selbstverständlicher passiert, als zum Beispiel im Freispiel, wo Thomas sich auf seine Art oft schwer durchsetzen kann.
(5) Wir erfahren immer neu, welch wichtige Bedeutung der körperlichen Ebene im Integrationsprozeß zukommt, Kontakt aufnehmen, Konflikte austragen, liebevolles Zuwenden ..., fast alle Interaktionen der Kinder untereinander sind sehr mit ihrem Körper verbunden und manifestieren sich mit großer Konkretheit und Direktheit. Die Bedeutung der körperlichen Ebene ist uns zuerst vor allem im Zusammenhang mit den schwerstbehinderten Kindern bewußt geworden. Gerade mit Miriam und Dagmar haben wir wichtige Erfahrungen gemacht, non-verbale Signale zu verstehen und darauf sowohl auf verbale als auch auf non-verbale, körperbezogene Art zu reagieren.
Körperbezogenheit ist nicht nur wichtiger Bestandteil im täglichen Kommunikations- und Interaktionsprozeß, sondern auch im Prozeß der Aneignung des eigenen Körpers, was besonders für Kinder, die eine körperliche Behinderung haben, mit vermehrten Schwierigkeiten verbunden ist. Die behinderten Kinder sind durch das tägliche Zusammensein beim Spielen in den ständigen Prozeß der körperlichen Annäherung und Abgrenzung miteinbezogen. Diese körperliche Auseinandersetzung, in ihrer aggressiven wie zärtlichen Ausprägung, bringt eine Reihe von Erfahrungen, die zur Ausprägung eines positiven Körpergefühls als Grundlage des Sich-selber-akzeptierens beitragen.
Ich vermute auch, daß die Erfahrungen daraus für die behinderten und nichtbehinderten Kinder eine wesentliche Basis für die Integrationsprozesse im emotionalen und kognitiven Bereich sind.
(6) Integrative Gruppen fordern zu einer radikalen Infragestellung des Konkurrenz- und Leistungsverhaltens heraus.
-
Es kann nie für alle Kinder die gleichen Ziele geben.
-
Es sollen die Leistungen einzelner Kinder nicht verglichen werden mit denen der anderen Kinder, sondern im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten gesehen werden.
-
Das heißt auch, daß Leistungen in den verschiedenen Bereichen (im motorischen, sprachlichen, bildnerischen, kognitiven usw.) gleichwertig anerkannt werden.
-
Das heißt, daß trotz der Differenzierung Gemeinsamkeit besteht. - So kommen, neben den individuellen Leistungen, den Gemeinschaftsarbeiten eine wesentliche Bedeutung zu.
-
Das bedeutet auch, daß wir versuchen, in den Gruppen eine Atmosphäre zu schaffen ohne Leistungsdruck, und auch unsere eigenen Leistungserwartungen immer wieder neu überdenken.
(7) Die Kinder bestimmen von sich aus den Rhythmus und die Zeit, die sie für ihre Entwicklung brauchen. Wir können Bedingungen für mögliche Entwicklungen im emotionalen und sozialen Bereich schaffen, die Veränderung geht aber vom Kind selber aus.
Maud MANNONI schreibt über das Auftauen festgefahrener Situationen und Verhaltensweisen:
Diese ändern "sich immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. Wenn man die Veränderung lenken will, erhält man nichts als Starrheit (bestehend aus der Abwehr gegen jede Veränderung). Die Kunst liegt darin, den Widerstand des Patienten selbst für die Veränderung zu benutzen, so daß sich von ihm aus eine neue Spielmöglichkeit ergibt, die das alte Spiel hinfällig macht; diese neue Spielmöglichkeit ist zugleich auch die Gelegenheit für eine Begegnung." (MANNONI 1978, S. 279)
Was Maud MANNONI hier über die Arbeit mit den Kindern von Bonneuil schreibt, finde ich, unterschiedlich stark ausgeprägt, in den Entwicklungsverläufen vieler Kinder wieder. Besonders deutlich habe ich in der Beziehung zu Susi erfahren, wieviel es bedeutet, den zeitlichen Rhythmus - einschließlich der langen Phasen des unverändert Bleibens, den sie für ihre Entwicklung beansprucht - anzunehmen.
In diesem Zusammenhang kommt auch den regressiven Phasen und Krisen der Kinder eine wichtige Bedeutung zu. Diese richtig zu verstehen und zu akzeptieren, wie zum Beispiel die extremen Schwankungen von Theresa oder die plötzlich auftretende Trennungsangst von Thomas, stellen oft große Anforderungen an die Betreuer.
Im weiteren möchte ich mich Maud MANNONI anschließen, wenn sie über den Prozeß der Veränderung schreibt:
"Manchmal bedarf es nur der kleinsten Kleinigkeit, um einen persönlichen Fortschritt zu ermöglichen; es genügt eine gewisse Gastlichkeit, eine Verfügbarkeit, vor allem aber die Gewißheit, einen Erwachsenen zu finden, der nicht verlangt, daß man sich verändert." (MANNONI 1978, S. 280)
(8) Integrative Erziehung, die die Vorstellungen von "normal" und "anormal", von "behindert" und "nichtbehindert" hinterfrägt, bietet auch für die individuelle Entwicklung der nichtbehinderten Kinder mehr Spielraum.
Die Kinder erleben, daß die unterschiedlichsten Verhaltensweisen und Ausdrucksformen innerhalb des Kindergartengeschehens Platz haben, daß Leistungsnormen und Normalitätsvorstellungen nicht unverrückbar sind. Diese Vielfalt der akzeptierten Verhaltensweisen wirkt oft für die nichtbehinderten Kinder sehr befreiend und ermöglicht es ihnen dann viel eher, ihren eigenen - zum Beispiel aggressiven oder regressiven - Impulsen nachzugeben. Sie erleben, daß jeder hilfsbedürftig, aggressiv, müde, traurig, zornig usw. sein kann, ohne Angst haben zu müssen, nun nicht mehr akzeptiert und geliebt zu werden. Sie erleben, daß es möglich ist, eigene Schwierigkeiten zu zeigen, wie zum Beispiel Lukas und Annelies, und daß jeder genau mit seinen Besonderheiten akzeptiert wird.
(9) Für die behinderten wie die nichtbehinderten Kinder ist es wichtig, Erfahrungen mit Aggressionen und Wutausbrüchen zu machen und in Konfliktsituationen selbständig handeln zu lernen.
Vorhandene Aggressionen und Ablehnung unter den Kindern dürfen dabei nicht unterdrückt werden, sondern müssen akzeptiert und aufgearbeitet werden. Denn wenn sich Kinder aufgrund ihrer Aggressionen gegenüber einem behinderten Kind von den Betreuern abgelehnt fühlen, verstärken sich die Aggressionen fast zwangsläufig und behindern umso mehr eine offene Auseinandersetzung. Daß gerade diese Situationen uns oft Schwierigkeiten machen, zeigen die ersten Aufzeichnungen. Dagegen finden gerade in der von mir beschriebenen Gruppenzeit sehr wenige aggressive Auseinandersetzungen statt; Ablehnung manifestiert sich am ehesten durch Weggehen oder Platztauschen. Insgesamt haben wir die Erfahrung gemacht, daß in den Kleingruppen aggressive Auseinandersetzungen wesentlich weniger auftreten (als zum Beispiel im Freispiel in der großen Gruppe) und besser bearbeitet werden können. Obwohl auch hier Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen bestehen.
Dabei ist die eigene Zufriedenheit bzw. Bedürftigkeit der nichtbehinderten Kinder sehr wesentlich für die Dynamik einer Gruppe bestimmend. So muß bei auftretenden Konflikten auch davon ausgegangen werden, daß es sich nicht ausschließlich um das Problem eines einzelnen, vielleicht behinderten Kindes handelt, sondern um Schwierigkeiten, die die ganze Gruppe betreffen.
Eine wichtige Voraussetzung für uns als Betreuer, diese von uns als schwierig erlebten Situationen im Umgang mit Aggressionen, Ablehnung und Wutausbrüchen zu bewältigen, ist die Möglichkeit, unsere eigene Position immer wieder untereinander zu besprechen.
(10) Unsere Aufgabe als Betreuer
Ich möchte mich hier beschränken auf den verstehenden Anteil unserer Arbeit, auf den Aspekt der Beziehung, auch wenn wir in der Konfrontation mit den Kindern immer auch "Erziehungsinstanz" sind.
Unsere wichtigste Aufgaben sehe ich darin:
-
die Kinder zu hören und versuchen, "ihre Gesten zu lesen":
"Ehe man mit ihnen spricht, muß man lernen, ihre Gesten zu lesen und zu verstehen, was in ihrer Sprache ohne gesprochenes Wort gesagt wird." (MANNONI 1978, S.263. )
Was Maud MANNONI hier über autistische Kinder schreibt, scheint mir in gewissem Maß für ALLE Kinder, besonders für Kinder, die eine Behinderung haben, zuzutreffen. Das heißt, offen zu sein für ihre Mitteilungen, besonders auch für die nicht-sprachlich ausgedrückten, und diese zum Ausgangspunkt der gemeinsamen Kommunikation zu machen. Markus teilt sich mit, vorerst über das Türen-Zuschlagen und Türklinken-Rütteln, dann über die Neonröhre und das Kleid; Miriam durch Spucken; Lukas durch "I mog nit" und fortwährendes Starksein; Susi durch Schweigen und Wegsehen; Maria über das Sammeln und Festklammern von Papierschnipsel, Blätter ...; die Beispiele lassen sich fortsetzen. Die Gesten der Kinder zu entschlüsseln und ihre Symptome als ein Sprechen zu verstehen versuchen, ist ein ständiger gemeinsamer Lernprozeß, in dessen Verlauf wir zu einem Anwalt der Bedürfnisse der Kinder werden.
-
Freiräume zu schaffen und Hilfestellungen zu geben für mögliche Entwicklungen, ohne Zwang zur Veränderung und Anpassung auszuüben. (Einschränkungen ergeben sich dort, wo andere Kinder eingeschränkt oder gefährdet werden.) Eine wichtige Bedeutung kommt hier dem Akzeptieren von Leistungsverweigerung und von aggressiven Verhalten, auch gegenüber den erwachsenen Bezugspersonen zu.
-
Unverständliche oder befremdende Verhaltensweisen und Ausdrucksformen der Kinder zu übersetzen und für die anderen Kinder verständlich zu machen; wie zum Beispiel das Spucken von Miriam, das am Hals-Packen von Gerhard, das Papierreißen von Maria, das Tränzen von Moritz, das Haarereißen von Linda; auch hier lassen sich die Beispiele fortsetzen. Dabei scheint mir besonders wichtig, den verborgenen kommunikativen Charakter vieler dieser Verhaltensweisen herauszustreichen und das "Warum" zu vermitteln. Das geschieht zum Teil durch die Vorbildfunktion, die unser Verhalten für die Kinder hat, zum Teil auch durch direkte Intervention.
-
Zwischen den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder zu vermitteln: in der Gruppenzeit, bei verschiedenen Spielen und Aktivitäten, im Konflikt um Spielmaterial oder bei gegensätzlichen Interessen. Oft bedeutet das ein Ausbalancieren zwischen den Interessen eines einzelnen Kindes und den Bedürfnissen der Gruppe.
Nicht um die Leiden zu lindern
wird wieder Freude.
Leben ist zwischendrin.
Vor allem: heute.
(Konstantin Wecker)
Die Diskussion um Integration provoziert sehr schnell auch die Frage nach den Grenzen integrativer Arbeit. Und zwar nach den Grenzen, die festgemacht werden an der Art und dem Schweregrad der Behinderung.
Eine Frage, die uns immer wieder - mehr oder weniger direkt - gestellt wird, lautet: Integration ja, aber was ist mit den schwer- und schwestbehinderten Kindern?
Ich möchte die Frage anders stellen:
Gibt es "nicht-integrierbare" Kinder? Kinder also, die aufgrund ihrer Behinderung (im körperlichen, geistigen oder emotionalen Bereich) vom gemeinsamen leben Lernen ausgeschlossen werden können bzw. müssen?
Was für Vorstellungen und Maßstäbe werden solchen Entscheidungen zugrunde gelegt?
Und wo sind die Grenzen, die außerhalb der behinderten Kinder liegen, die eine Integration verhindern?
Auf diese Fragen möchte ich nun auf der Grundlage unserer Erfahrungen im Kindergarten Sonnenburgstraße zu antworten versuchen. Miriam, Linda und Maria werden hier vorgestellt. Ich beschränke mich bewußt auf den Aspekt der Entwicklung in der Kindergruppe und den Aspekt der möglichen gemeinsamen Lernprozesse.
Miriam
Miriam ist seit dem Anfang des Kindergartens dabei. Ihre Mutter hat schon an den Projektsitzungen teilgenommen und sie ist überzeugt, daß Miriam trotz der schweren Behinderung das Zusammensein mit den anderen Kindern genießt.
Miriam ist 4 Jahre, als sie in den Kindergarten kommt. Miriam hat eine Stoffwechselstörung und in der zuletzt erstellten Diagnose wird ihre Behinderung von Prof. RETT als sogenanntes RETTSyndrom bezeichnet. Miriam kann nicht frei stehen oder sitzen, nicht selbständig gehen und nicht sprechen; sie wird gewickelt und beim Essen gefüttert. Miriam leidet an Krampfanfällen und muß ständig Medikamente einnehmen. Der Krankheitsverlauf wird als progressiv und die Lebenserwartung als niedrig beschrieben. Die Verfassung von Miriam ist sehr starken Schwankungen unterworfen: Tage, an denen sie sehr aktiv und fröhlich ist, wechseln ab mit Tagen, an denen sie schon in der Früh müde und schlaff ist, an denen sie unter Krämpfen und Schmerzen leidet. Miriam braucht zwischendurch immer wieder Zeit zum Ausruhen und Schlafen.
Die Ausdrucks- und Kommunikationsmittel von Miriam sind einzelne Laute, Lachen und Wimmern; Beißen, Spucken und Zähneknirschen; und trotz Einschränkung auch die Gestik der Hände. Die Bewegungen sind meist kraftvoll und nicht zielgerichtet, sodaß meistens aus dem Greifen ein Reißen und aus dem Fallenlassen ein Schmeissen wird.
Miriam ist die ersten zwei Kindergartenjahre in der Behindertengruppe, dann in der integrierten Gruppe. Spezifische therapeutische Betreuung erhält sie durch die Physikotherapeutin und die Logopädin.
Miriam wird jeden Tag von ihrer Mutter mit dem Auto in den Kindergarten gebracht und in das Spielzimmer hereingetragen. Das Kommen von Miriam bleibt kaum einmal unbeachtet, sie wird meistens liebevoll begrüßt.
Miriam und die anderen Kinder
Miriam kann zwar mit großer Anstrengung zu den anderen Kindern hinkrabbeln oder durch Schreien auf sich aufmerksam machen,
meistens nehmen jedoch die anderen Kinder von sich aus Kontakt zu ihr auf; oft sind es flüchtige Kontakte im Vorbeigehen, oft sind es gezielte Spielangebote. Für eine zeitlang ist auch das Füttern von Miriam eine begehrte Aufgabe, bei der sich die Kinder abtauschen.
Mittwoch, 30.1.80:
... zwischen Daniela und Miriam hat sich eine ziemlich starke Beziehung entwickelt; Daniela sieht in Miriam schon eher das Baby (erhält auch im Rollenspiel oft diese Rolle zugeschrieben), sie ist aber sehr liebevoll zu ihr.
Daß Miriam in der Rolle des Babys in die gemeinsamen Spiele einbezogen wird, beobachten wir zuerst begeistert, dann zunehmend skeptisch. Skeptisch deshalb, weil wir Bevormundung und Bemutterung des behinderten Kindes durch die nichtbehinderten Kinder befürchten. Sicher drückt Daniela (und auch andere Kinder) in diesen Spielen mit Miriam ihr Bedürfnis nach Bemutterung aus. Sie trifft dabei auch auf die Bedürfnisse von Miriam. Miriam nimmt bei diesen Spielen Zuwendung und Körperkontakt erfreut auf.
Diese Freude von Miriam veranlaßt uns, in diese Rollenspiele nur einzugreifen, wenn die Kinder es ausdrücklich wünschen oder wenn sie eine Hilfestellung benötigen. Zudem verstehen wir immer deutlicher, welch wichtigen kommunikativen Wert Streicheln und Schmusen für Miriam haben, gerade weil ihre anderen Kommunikationsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind.
Miriam gewinnt die Zuneigung aller Kinder; auch Kinder, die mit sich selber massive Schwierigkeiten haben und sich auch kaum mit den anderen Kindern einlassen, können mit Miriam sehr liebe- und verständnisvoll umgehen, indem sie sie füttern, streicheln, ihr vorsingen uvm. .
Montag, 1.12.80
... Florian mag Miriam zur Zeit so gern, daß er auf das Einkaufen gehen verzichtet und lieber mit Miriam und Linda bei Silvia im Kindergarten bleibt.
Auch wenn diese Kontakte situationsgebunden und oft zeitlich begrenzt sind, so sehen wir darin durchaus eine Bereicherung der sozialen Erfahrungen, sowohl für Miriam als auch für die anderen Kinder.
Dabei haben die Kinder und auch wir gelernt, mit den Ausdrucksmöglichkeiten von Miriam umzugehen; ihr Spucken und Reißen, ihre Laute und ihr Lachen besser wahrzunehmen und zu verstehen. Die Kinder haben gelernt, auf Handgreiflichkeiten von Miriam ebenso mit Handgreiflichkeiten zu reagieren; zum Beispiel, wenn sie von Miriam an den Haaren gezogen werden, packen sie ihrerseits Miriam an den Haaren und geben ihr so zu verstehen, was ihnen weh tut.
Das Spucken von Miriam (das sie auch an anderen Orten, zum Beispiel daheim, einsetzt) ist eine zeitlang zum Problem geworden. Im Reden darüber (wann und wie Miriam das Spucken einsetzt; was uns daran stört; wie wir darauf reagieren / reagieren sollen) ist uns bewußt geworden, was für ein wichtiger kommunikativer Charakter dem Spucken zukommt. Miriam, die nur sehr wenige Möglichkeiten hat, sich auszudrücken, kann durch das sehr zielgerichtete Spucken andere Menschen erreichen, zum Kontakt herausfordern, Unmut und Freude mitteilen. So hat dieses sozial unerwünschte Verhalten für Miriam eine ungeheuer wichtige soziale Funktion. Ihr das Spucken zu verbieten, würde bedeuten, ihr eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit zu nehmen. Da Spucken aber im täglichen Leben eher Ablehnung hervorruft als zur Kontaktaufnahme einlädt (besonders außerhalb eines vertrauten Bereiches), haben wir nach Alternativen gesucht. Wir haben versucht, Miriams gestische und mimische Mitteilungen besser zu verstehen, um sie dadurch aufzufordern, diese vermehrt einzusetzen; besonders den Augenkontakt. Auch im Zusammensein mit den anderen Kindern beobachten wir, daß Miriam das Spucken viel weniger einsetzt; und daß von den anderen Kindern her das Spucken sehr wohl beachtet und kommentiert wird, aber kaum negative Sanktionen (in Form von Schimpfen, Weggehen usw.) von den Kindern erfolgen.
Auch die physikotherapeutische Betreuung bietet Anregungen zum Spielen mit Miriam. Heidi (Physikotherapeutin) betreut Miriam oft während des Freispiels im Gruppenzimmer und übt dort mit ihr verschiedene Fertigkeiten (wie Stehen, Gehen an einer Hand, Ball rollen usw.), oder nimmt fallweise andere Kinder in das Therapiezimmer mit.
Miriam ist während der vier Jahre, die sie im Kindergarten verbringt, dasjenige Kind, dessen Behinderung von den anderen Kindern am deutlichsten wahrgenommen wird und das am meisten die Hilfe anderer braucht. Vielleicht wird Miriam deshalb von den nichtbehinderten Kindern in ihren Rollenspielen (auch zu Hause) am meisten nachgeahmt; die Kinder versuchen dann zu gehen wie Miriam, wollen gefüttert werden, usw..
Für Aktivitäten und Ausflüge außerhalb des Kindergartens nehmen wir für Miriam den Buggy von zu Hause mit. Zum Sitzen am Tisch hat Miriam einen Stuhl, der neben der Rückenlehne auch auf beiden Seiten Armlehnen hat, damit sie auf beiden Seiten abgestützt ist. Diesen einfachen Kinderstuhl, den Heidi von zu Hause mitgebracht hat und der sich nur durch die Armstützen von den anderen Kindergartenstühlen unterscheidet, wird bald zum "Miriam-Stuhl".
Wir haben auch alle gelernt zu akzeptieren, wenn Miriam ausruht, dabeisitzt, inaktiv ist, allein den anderen Kindern zuschaut.
Über die Entwicklung von Miriam
Die Entwicklung von Miriam im Kindergarten ist gekennzeichnet durch große Schwankungen und lange Phasen des Gleich-bleibens (verursacht durch Krampfanfälle, Umstellung der Medikamente, uvm.). Dies betrifft vor allem die Entwicklung der Motorik, wo ihr von ihrem Körper her sehr enge Grenzen gesetzt sind. Trotzdem lernt Miriam, für kurze Zeit frei zu stehen und kurze Strecken an der Hand eines Erwachsenen zu gehen. Mit großer körperlicher Anstrengung versucht Miriam immer wieder, sich an Gegenständen hochzuziehen und sich durch Krabbeln fortzubewegen. Die Motivation geht meistens von Spielen der Kinder aus. Die sozialen Verhaltensweisen und die Ausdrucksmöglichkeiten von Miriam sind im gemeinsamen Lernprozeß differenzierter geworden. Vor allem der Augenkontakt von Miriam wird wesentlich intensiver; ebenso ihre Fähigkeit, auf sensorische Reize zu reagieren. Auch diese Fähigkeiten von Miriam sind zum großen Teil abhängig von dem, was ihr der Körper erlaubt; so verliert Miriam in Zeiten großer Erschöpfung und akuter Schmerzen das Interesse an ihrer Umgebung, gibt das Kontaktverhalten auf und greift verstärkt auf autoaggressives Verhalten zurück.
Mit Miriam haben wir gelernt, winzige Fortschritte zu sehen und in ihrer individuellen Bedeutung, dabei die körperlichen Grenzen und extremen Schwankungen und Rückfälle zu akzeptieren. Die insgesamt positive Entwicklung von Miriam hat uns dazu herausgefordert, trotz der Diagnose eines progressiv voranschreitenden Krankheitsverlaufes immer wieder neu anzufangen. Im Zusammensein mit Miriam lernen wir auch, Begriffe wie "Entwicklung" und "Fortschritt" in Zusammenhang mit dem Leben eines Kindes neu zu überdenken.
Diese Lernprozesse auf unserer Seite verlaufen nicht geradlinig. Wir stoßen immer wieder an unsere eigenen Grenzen. Wir sind zu wenig geduldig, nicht genug ausdauernd; fühlen uns stark belastet, stehen ratlos vor ihren Schmerzen.
Miriam mit ihrer Behinderung kann sehr wohl das Zusammensein mit den anderen Kindern genießen. Sie braucht die anderen Kinder, um sich wohl zu fühlen. Sie kann durch die anderen Kinder ein Stück ihrer Umwelt erleben.
Nach einem Jahr Zurückstellung von der Schule soll Miriam die Schwerstbehindertenschule besuchen. Da keine zusätzliche Hilfskraft für die Betreuung genehmigt wird, sieht sich der Schulerhalter nicht in der Lage, Miriam in die S-Klasse aufzunehmen, und schlägt eine nochmalige Rückstellung vor. Die Alternative ist nun, Miriam zu Hause zu lassen und abzuwarten oder sie noch ein Jahr im Kindergarten zu betreuen. So kommt es, daß Miriam
trotz ihrer acht Jahre weiterhin den Kindergarten besucht.
Linda
Linda ist geistig behindert (Syndrom ohne Namen). Sie kann nicht sprechen; sie drückt sich durch wenig differenzierte Laute und vor allem durch ihre Gestik und Mimik aus; Linda spricht durch ihre Augen und ihr Lachen und Lächeln.
Linda kostet die Umwelt; sie steckt alles, was sie erreicht, ob eßbar oder nicht eßbar, blitzschnell in den Mund. Oft sind es auch einfach die Finger ihrer Hand, die sie in den Mund steckt; alles, was sie wieder herausspuckt, ist voller Speichel.
Der passive Wortschatz, das Verstehen von Mitteilungen, die an sie gerichtet werden, scheint uns recht groß, ist aber ziemlichen Schwankungen unterworfen, je nachdem, ob für Linda eine Situation angenehm oder unangenehm ist. So ist es oft schwer zu unterscheiden, ob sie etwas nicht versteht oder nicht verstehen will. Aufgrund der mangelnden Augen-Hand- und Augen-Fuß-Koordination sind die Bewegungen von Linda oft unsicher und undifferenziert; auch alle feinmotorischen Bewegungen und Fertigkeiten fehlen. Trotzdem sind ihre Hände wichtiges Kommunikationsmittel. Umarmen und Streicheln sind ebenso Teil dieser Kommunikation wie Zerren und an den Haaren reißen.
Lindas Beschäftigung und Interesse im Kindergarten besteht hauptsächlich darin, herumzustreifen, alles Greifbare in den Mund zu stecken und zu testen, Spielsachen herauszureißen und zu zerstreuen, auf den Matratzen zu hüpfen oder irgendwo zwischen den Kindern zu liegen und lachend zuzuschauen. Ohne Begleitung bleibt Linda anfänglich kaum länger bei einer Beschäftigung. Bei diesen Streifzügen kommt es oft vor, daß Linda irgendwo in ein Spiel hineinplatzt, etwas niederreißt und kaputtmacht, ohne daß sie es will.
Linda kann beim Essen kaum ruhig sitzen; sie schiebt oft alles von sich weg, schüttet um, greift in andere Teller und macht sich einen großen Spaß daraus, sodaß das gemeinsame Essen oft zu einer Auseinandersetzung führt. Ähnlich auch beim selbständig Anziehen und Klogehen, wo sie meist lachend auf jede eigene Anstrengung verzichtet.
Linda zusammen mit den anderen Kindern
Linda ist vier Jahre, als sie im Herbst 1979 in den Kindergarten kommt; zuerst auf Besuch, dann regelmäßig. Linda kommt aus einem kleinen Dorf, 30 km von Innsbruck entfernt. Sie wird jeden Tag von ihrer Mutter mit dem Auto gebracht und wieder abgeholt. Als ihre Mutter ein zweites Kind erwartet, kann sie den täglichen Weg zum Kindergarten nicht mehr machen. Für Linda ergibt sich die Gelegenheit, mit dem Schülerbus einer etablierten Behinderteneinrichtung mitzufahren. So besucht Linda ab Frühling 1981 regelmäßig vormittags (bis nach dem Mittagessen) den Kindergarten. Aus dieser Zeit stammen die folgenden Ausschnitte aus den Gedächtnisprotokollen, die Linda mit den anderen Kindern zusammen im Freispiel zeigen.
Ich möchte den Protokollausschnitten nur wenige Erläuterungen hinzufügen, denn die Beispiele selber zeigen sehr deutlich, wie viele Erfahrungsmöglichkeiten die gemeinsamen Interaktionen sowohl für Linda wie auch für die anderen Kinder bieten.
Montag, 15.6.81:
... ganz in der Früh sind nur Markus, Beate und Tanja da. Wir sind in der Küche und fangen an, Hollersaft zu machen. Linda kommt und stürmt zuerst in die Küche. Sie will ihren allmorgendlichen Saft. Dann gehen wir in die Garderobe zum Schuhe ausziehen; Beate kommt mit, sie möchte nachher mit Linda spielen. Sie fragt auch Tanja, ob sie mitspielen wolle, "ich mag nämlich die Linda gern, du auch?" Sie helfen dann zuerstin der Garderobe und spielen anschließend in der Matratzenecke. Sie tollen recht wild herum und Linda geht mit den beiden nicht sehr sanft um. Als Linda die Tanja an den Haaren reißt, fängt Tanja zum Weinen an und Beate lacht dabei.
Beate sagt dazu: "Die Linda ist halt ein bißchen behindert ... die kann nicht alles so wie wir ..."
Tanja: "... aber ich hab bei dir ja auch nicht gelacht, als sie dir wehgetan hat ..."
Markus, Beate und Tanja sind immer die ersten Kinder in der Früh und sie sind schon sehr vertraut miteinander. Auch Linda hat schon ihre eigenen Gewohnheiten entwickelt: sie hat in der Früh, wenn sie kommt, großen Durst. Zuerst hat Linda immer durch Gesten und Zerren etwas zum Trinken verlangt. Nun gehört ihr Saft genauso zum Einstieg in den Kindergarten wie das Patschen Anziehen.
Und Linda ist auch dabei, ihren Platz bei den "Morgenkindern" zu erobern. Dabei wird sie von Beate und Tanja geradezu aufgefordert; und wie das nächste Beispiel zeigt, ergreift Linda auch selbst die Initiative dazu. Lindas Haare-reißen ist auslösend für eine Auseinandersetzung zwischen Beate und Tanja, die sich dann in der Küche fortsetzt. Für Linda selber ist das Spiel zu Ende; an der Auseinandersetzung (auf der verbalen Ebene) kann sie nicht teilnehmen.
Mittwoch, 17.6.81:
... Tanja kommt. Linda, die am Boden Lego gespielt hat, steht gleich auf und geht auf Tanja zu. Linda stellt sich vor Tanja hin, packt ihre Hände und macht richtige Freudenslaute. Tanja weiß zuerst nicht so recht, was Linda mit ihr vor hat, sie ist unsicher und freudig zugleich, und nach einem kurzen Versuch, die Hand, die schon voller Spucke ist, von Linda wegzuziehen, läßt sie sich auf das Spiel ein. Linda freut sich immer mehr, wird immer lauter. Sie läßt Tanja los und dreht sie im Kreis herum. Tanja macht mit und sie wiederholen das Herumdrehen eine Weile ... bis beide von ihrer Begrüßung genug haben.
Linda erfindet spontan ein Begrüßungsspiel für Tanja. Linda geht dabei so direkt und freudestrahlend auf Tanja zu, daß auch bei Tanja die Freude größer ist als die anfängliche Unsicherheit und sie sich voll auf das Spiel mit Linda einläßt.
Donnerstag, 15.10.81:
... mit Linda geht es gut, solange sie mitspielt, mitlacht; wenn sie aber anfängt Haare zu reißen, gibt es meistens ein Geschrei, denn noch können sich viele Kinder (besonders die neuen) kaum dagegen wehren.
Linda liegt unter dem Trapez auf der Matratze, friedlich auf einem Rundholz kauend. Ines, Florian, Theresa (die sonst gut mit Linda spielen können) gehen her und stoßen sie mit dem Fuß: "die blöde Linda".
Auf die aggressiven Annäherungen von Linda können die Kinde schwerer eingehen. Sie reagieren mit Schreien oder vielfach mit Weggehen. Auch wenn Linda bei ihrem Herumstreifen Bauwerke Zeichnungen usw. anderer Kinder kaputtmacht oder an sich reißt - auch ohne zu wollen - kommt es meistens zum Konflikt.
In diesem Beispiel wird Linda von drei anderen Kindern attackiert ohne daß es einen sichtbaren Grund dafür gibt. Im Gegenteil: Linda ist ganz ruhig und mit sich selbst zufrieden. Ich sehe den Grund für diese Aggression gegen Linda in der eigenen Bedürftigkeit von Florian und Theresa, sich gemeinsam stark zu fühlen, indem sie ein schwächeres Kind ihre Aggressionen spüren lassen. Mit sich selbst unzufrieden, stürzen sie sich auf Linda, die offensichtlich sehr zufrieden ist, die ihren Angriff kaum verstehen kann und ihnen kaum etwas entgegensetzen wird.
Da sich Linda gegen solche Angriffe schwer wehren kann, ist es unsere Aufgabe (Betreuer), hier einzugreifen und Lindas Position zu vertreten. Nicht indem wir moralisierend Schuldgefühle produzieren, sondern indem wir versuchen, die Situation deutlich zu machen: womit sind sie gerade beschäftigt? Wie fühlt sich Linda? Wie würden sie an Lindas Stelle fühlen? Wie wehren sie sich, wenn sie von so vielen anderen angegriffen werden? Usw..(Doch wird uns in diesen Situationen immer wieder die Grenze der verbalen Aufarbeitung bewußt.)
Dienstag, 10.11.81:
... in der Großgruppe: wir lernen gemeinsam das Laternenlied. Linda sitzt auch lange Zeit dabei (mit Christoph), freut sich, lacht, spielt mit der Rassel.
Sie legt sich dann, während wir noch weiter singen, mitten im Stuhlkreis auf den Boden hin, nimmt einen Plastikreifen, beißt darauf herum, spielt damit, schaut von einem zum anderen; sie fühlt sich sichtlich wohl dabei. Die anderen Kinder sehen, daß Linda am Boden liegt, gehen aber nicht weiter darauf ein; sie lassen Linda gewähren und singen weiter.
Linda macht beim gemeinsamen Singen mit. Doch als ihr Aushaltevermögen überschritten wird, sucht sich Linda eine andere Beschäftigung. Sie legt sich mitten im Kreis auf den Boden; so bleibt sie mitten unter den anderen Kindern, sie ist ihnen sogar noch näher: Für die anderen Kinder ist Lindas Verhalten schon vertraut und es veranlaßt sie nur noch selten zum Nachahmen. Es gibt eine kurze Unterbrechung, die Kinder schauen, was Linda macht, und singen dann weiter.
Diese Beispiele zeigen, welche Ausdrucksstärke und Eigeninitiative Linda entwickelt, wie konkret sie sich vermitteln kann, wenn die Umwelt und die sie umgebenden Menschen diese sinnlichen Erfahrungen zulassen und sich selber darauf einlassen können. Es wird deutlich, daß für Linda erst durch diese erlebbare körperliche und emotionale Nähe Identitätsfindung möglich wird und Lernprozesse in Richtung Selbständigkeit sinnvoll werden. Die Nähe des Zusammenlebens im Kindergarten bedeutet, daß Linda Erfahrungen mit angenehmen, freudigen Situationen macht, ebenso wie mit Frustrationen und Versagungen. Situationen, in denen sie verstanden und akzeptiert wird, und Situationen, in denen sie nicht verstanden und abgewiesen wird, in denen sie sich wehren und durchsetzen lernt, bilden zusammen das alltägliche Erfahrungsfeld.
Zur weiteren Entwicklung von Linda - was uns Schwierigkeiten macht
Die in einer Kinderbesprechung (ein dreiviertel Jahr nach den oben angeführten Protokollausschnitten) aufgeworfenen Probleme sollen nun in einer Art Spot-light die augenblickliche Situation mit Linda beleuchten.
Hauptsächlich beschäftigt uns die Frage, ob "vor lauter Akzeptieren das andere (das heißt: das Fördern im Speziellen) nicht zu kurz kommt". Heidi meint, daß sehr viel Unproduktives geschieht im Freispiel und daß Linda kaum Fortschritte macht.
Linda bleibt bei allem, was sie tut, nur sehr kurzzeitig; sie reagiert auf alle Reize, auf wesentliche und auf unwesentliche. Wir hoffen, daß Linda im Garten ihre Getriebenheit mehr ausleben kann.
Die Spiele von Linda werden immer wilder (besonders, wenn sie mit Georg zusammenspielt, der ihr körperlich Überlegen ist). Obwohl sie viel in Bewegung ist, erleben wir Linda oft als verkrampft und angespannt (körperlich); so als wäre sie ständig in Abwehrhaltung. Auch das Arbeiten mit Linda in der Gruppe gestaltet sich in diesem Jahr schwieriger, da Tobias, der neu in der Gruppe ist, sehr viel Aufmerksamkeit beansprucht. Zudem läßt das Gruppenzimmer kaum Ausweichmöglichkeiten zu. Wenn Linda sich allein beschäftigt, so geschieht das kaum, ohne daß dabei die anderen Kinder abgelenkt werden.
Linda ist größer und stärker geworden und es gibt nun einige Kinder, die sich gegen Linda körperlich nicht mehr durchsetzen können.
Es hat sich bei uns bezüglich der Entwicklung von Linda Resignation breit gemacht. Entgegen unseren anfänglichen Hoffnungen haben wir nun das Gefühl, daß Linda an einem bestimmten Punkt in ihrer Entwicklung verharrt. Um aus diesem Gefühl der Resignation für uns und für Linda zu lernen und um positiv weiterarbeiten zu können, müssen wir unsere Erwartungen an Linda, unsere Vorstellungen von ihrer möglichen Entwicklung überdenken und - unter Einbeziehung der bisher erlebten Möglichkeiten - neue Ziele formulieren.
Die wichtigste Bedeutung des Kindergartens sehen wir wieder verstärkt in der Freude von Linda am Zusammensein mit den anderen Kindern und dem Akzeptiertwerden durch die anderen. Die Erfahrungen, die Linda dabei auf der sinnlich konkreten Ebene macht, sind für ihre soziale Entwicklung grundlegend. Wir müssen bei Linda besonders die Zeit, die sie für Lernprozesse beansprucht, respektieren und sehen, welche Fortschritte Linda gemacht hat, und die weiteren Schritte darauf aufbauen. Fortschritte sind zum Beispiel, daß sie nicht mehr so viel in den Mund steckt, sondern ihre Umwelt mehr be-greift, daß sie in Begleitung eines Erwachsenen oder eines anderen Kindes die Patschen/Schuhe selber auszieht.
Geistig behindert - die emotionale und kommuniaktive Kompetenz der Betroffenen
"Schwachsinn: das ist die durch materielle Unselbständigkeit bedingte sinnliche Notwendigkeit von Solidarität, das durch intellektuelle Kränkbarkeit provozierte Bedürfnis nach permanenter Emotionalität." (BOSSHARD 1977, S. 37)
Auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit Miriam, Linda und den anderen geistig behinderten Kindern möchte ich hier Überlegungen anschließen, die, ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen ausklammern zu wollen, von den Stärken und den Bedürfnissen der betroffenen Kinder ausgehen.
Ich stütze mich dabei im besonderen auf die Ausführungen von Robert BOSSHARD, der einleitend schreibt:
"Der geistig Behinderte - entweder durch eine embryonale hormonrespektive Stoffwechselstörung oder durch einen frühkindlichen Hirnschaden in seiner Intelligenzkapazität reduziert - will sich auf seine sinnlichen Kompetenzen konzentrieren. Es entspricht der schicksalhaften Natur dieser Persönlichkeiten, daß sie sich durch eine relative Aufwertung des Psychischen die Kulturzugehörigkeit zu sichern suchen. Die Psychodynamik der geistig Behinderten tendiert dementsprechend zur Verschmelzung mit der kulturellen Umwelt, sind sie doch wegen ihres Mangels ständig auf das Vertrauen in sich selbst und die konkrete Umwelt angewiesen. Den geistig Behinderten liegt die intellektuelle Abstraktion nicht, die Affektaskese ist nicht ihre Sache; zu ihrer Identitätsfindung benötigen sie die durch sinnliche Erfahrung vermittelte emotionale Zugehörigkeit." (BOSSHARD 1977, S. 33)
In einer Umgebung, die die affektive Zugehörigkeit sichert, können sie eine ungeheure Expressivität entwickeln und eine Fülle non-verbaler Kommuniaktionsmöglichkeiten einsetzen (dazu gehört das Lachen von Linda, das Spucken von Miriam), die uns in ihrer Direktheit und Körperlichkeit zum Verstehenlernen herausfordern. Sie lassen uns offen an ihren Gefühlen teilnehmen und erwarten eine Antwort, die sie in ihrer sinnlich konkreten Art verstehen können.
Darin liegt eine Stärke der Kinder. Sie können, da sie selber der sinnlich konkreten Ebene noch mehr verbunden und mit ihrer Umwelt noch sehr verschmolzen sind, die Bedürfnisse der geistig behinderten Kinder intuitiv erfassen und beantworten.
Die affektive und körperliche Zugehörigkeit zur Kindergruppe bildet so die sinnlich wahrnehmbare Basis, von der aus geistig behinderte Kinder Lernprozesse, die ihre Selbständigkeit fördern, in Angriff nehmen können und von der aus sie durch ständig wahrnehmbare Annäherung und Abgrenzung eine Identität ausbilden können.
Durch das Abschieben in das Ghetto der Sondereinrichtung (Sonderkindergarten, Sonderschule, Heim, usw.) wird gegenseitiges Vertrautwerden und Voneinanderlernen verhindert. Die geistig behinderten Kinder werden genau von den für sie so wichtigen sinnlichen Erfahrungen zur Aneignung ihrer Umwelt ausgeschlossen und die normal entwicklungsfähigen Kinder verlieren durch das Fehlen des alltäglichen Zusammentreffens die sinnliche Kontaktfähigkeit zu den geistig behinderten in einer sehr entscheidenden Lernphase. Verhalten und Ausdruck der geistig Behinderten und ihre mitgeteilten Bedürfnisse erscheinen in der Folge nur noch als fremdartig; und "schwachsinnig" rückt leicht in die Nähe von "wahnsinnig". So bietet die selbstverständlich tolerierte Zugehörigkeit eines geistig behinderten Kindes zur Kindergruppe oder zur allgemeinen Schulklasse, auch wenn das abstrakte Leistungsniveau nie erreicht werden kann, auf der sinnlich konkreten Ebene eine Fülle von gemeinsamen, alltäglichen Erfahrungen, die für ein gemeinsames Lebenlernen so wichtig sind. BOSSHARD schreibt in Anlehnung an Franco BASAGLIA :
"Die kulturelle Intention der geistig Behinderten ist nämlich nicht nur Ausdruck von Bedürfnissen einer Randgruppe, sondern sie exemplifiziert radikal eine für die Mehrheit der Bevölkerung kulturell unterdrückte utopische soziale Qualität: lebbare Sinnlichkeit als Voraussetzung für emanzipiertes politisches Handeln." (BOSSHARD 1977, S. 37)
Maria
Auf Maria bin ich schon in meiner Beschreibung der Gruppenprozesse eingegangen. Hier nun werde ich versuchen, einige ihrer Verhaltensweisen genauer zu beschreiben und unseren Prozeß der veränderten Wahrnehmung ihrer Behinderung deutlich zu machen, Anschließend möchte ich die Frage aufgreifen, inwieweit für ein emotional behindertes Kind die Kindergruppe eine Hilfestellung sein kann.
Maria ist vier Jahre alt, als sie im Sommer 1981 vorerst besuchsweise in den Kindergarten kommt, um sich langsam mit der neuen Umgebung vertraut zu machen.
Die Eltern beschreiben Marias Behinderung als Wahrnehmungsstörung (Perzeptionsstörung). Sie sehen zwischen ihrer Operation wegen einer verschluckten Stecknadel und den anschließend verabreichten Medikamenten und Marias Behinderung einen Zusammenhang. Der intellektuelle Stand von Maria wird beschrieben als der eines 1 - 1 1/2 Jahre alten Kindes. Sie beschreiben Marias Bindung an beide Elternteile als sehr eng, während sie sonst ein sehr abweisendes Kontaktverhalten zeigt. In der Anamnese der Kinderklinik heißt es: Sauerstoffmangel bei der Geburt; ZehenspitzenGang; Pupillendifferenz der Augen; Sprachentwicklungsstörung; psychisch sehr retardiert; sehr unkonzentriertes Spielverhalten. Maria ist sehr zart und hübsch und spricht durch ihre äußere Erscheinung die anderen Kinder wie auch uns Betreuer an. Umgekehrt scheint es, daß Maria bei ihren Besuchen im Kindergarten außer der Schaukel und ihren kleinen gesammelten Objekten nichts wahrnimmt.
Bei ihren Besuchen im Garten hält sich Maria vorerst eine zeitlang bei ihrem Vater, der sie begleitet, auf, beginnt dann herumzustreifen, Blätter und Gräser zu sammeln und leidenschaftlich zu schaukeln. Dabei ergibt sich für uns der Eindruck, daß sich Maria leichter von ihrem Vater trennt als umgekehrt.
Ab Herbst 1981 besucht Maria regelmäßig die Vormittagsgruppe. Ihre Beschäftigung im Freispiel besteht hauptsächlich darin, daß Maria mit ihren Händen irgendwelche kleinen Objekte umklammert und im Spielzimmer herumstreift, überall ein bißchen zuschaut oder sich irgendwo hinsetzt. Dabei vermeidet sie es, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Ihre Zungenspitze schiebt Maria zwischen ihre Lippen und sie bleibt bis auf einige Lach- oder Weinausbrüche stumm. Einzige Abwechslung bildet das Schaukelpferd, auf das sie, ähnlich wie auf die Schaukel im Garten, zielstrebig zugeht. In der Gruppe verhält Maria sich ähnlich. Sie sitzt dabei, macht manchmal mit Hilfe einer erwachsenen Begleitung bei den gemeinsamen Aktivitäten mit oder durchstreift das Zimmer, ihre Objekte umklammernd und manchmal Worte vor sich hinmurmelnd. Auch wenn Maria mitmacht, habe ich nie das Gefühl, daß Maria von sich aus aktiv ist und nur einfach Hilfestellung braucht, sondern daß alles äußerlich und mechanisch bleibt, daß das Mitmachen für sie oft einfacher und mit weniger Unlust und Angst verbunden ist, als sich zu widersetzen.
Bei ihren Streifzügen sucht sie immer wieder den Kontakt zur Wand (mit ihrem Rücken) oder auch manchmal zu einem von uns; dabei drückt sie sich immer mit dem Rücken oder seitlich kurz an uns heran. Gegen direkten Körperkontakt von den anderen Kindern und von uns wehrt sich Maria meistens, indem sie sich entwindet. Daß Maria bei ihrem Herumstreifen und Dabeisitzen sehr wohl vieles um sie herum wahrnimmt, zeigt sich besonders deutlich, wenn sie plötzlich unvermutet reagiert (auch auf weiter entfernte Reize) oder mit einiger zeitlicher Verschiebung über das Vergangene redet (in einzelnen Worten) oder eine Melodie komplett nachsingt. Auch die visuelle Wahrnehmung von Maria ist sehr differenziert, wenn sie gerade dabei ist, ihre winzigen Objekte einzusammeln. Aus einer ganzen Kiste ähnlicher Teilchen (eines Steckspieles) sucht sie fehlerlos nur die ganz genau gleichen heraus oder sie sucht im Garten nur die genau gleichen Gräser oder Blumen. Während Maria sonst "nirgendwo" hinschaut.
In der Interaktion mit der lebendigen sozialen Umwelt scheint es, als würden diese Fähigkeiten zur akustischen und optischen Wahrnehmung und Differenzierung verschwinden.
Wenn Maria spricht, ist es meistens ein Sprechen mit sich selber. Oft sind es einzelne Worte; manchmal steigert sich ihr Reden unvermittelt zu lautem Schreien, das aus ihr herausbricht und meistens unverständlich bleibt. Maria spricht von sich in der dritten Person; ihre Stimme klingt dann oft so fremd, als wäre sie gar nicht von ihr. Besonders wenn sie sich selber ermahnt oder Anweisungen gibt, nimmt sie genau den Tonfall Erwachsener an.
Je länger wir mit Maria zusammen sind, umso massiver erleben wir ihre Zurückgezogenheit und ihr Nicht-Handeln. Wir spüren immer stärker, wie wichtig für sie die Papierschnipsel und ihre anderen Objekte sind, wie wenig wir von der Bedeutung wissen, die Maria ihnen gibt, und wie hilflos wir oft diesem "eigentümlichen" Verhalten gegenüber sind. Zunehmend erfahren wir, wie schwierig es ist, zu ihrer Welt (zu ihren Phantasien, Wünschen und Ängsten) Zugang zu finden.
Privat und Verrätselt
Die autistische Kapsel
In der Beziehung zu Maria habe ich am deutlichsten bisher erfahren (und vor allem gefühlt), was eine autistische Kapsel sein kann.
Im folgenden möchte ich nun versuchen, anhand theoretischer Überlegungen aus der psychiatrischen Literatur zum Autismus einige von Marias Verhaltensweisen verständlich werden zu lassen. Es ist mir bewußt, daß die Ausführungen bruchstückhaft bleiben und wichtiges, vor allem der familiäre Entstehungszusammenhang, ausgeblendet bleibt. Es kommt mir hier aber nicht auf eine umfassende Darstellung des infantilen Autismus an, sondern mein Anliegen ist es, Marias Symptome möglichst umfassend zu verstehen und die möglichen Hilfestellungen zu sehen, die der Kindergarten zum Herausfinden aus der "autistischen Einfriedung" bieten kann. Ich stütze mich im folgenden hauptsächlich auf die Arbeiten von Maud MANNONI (1978) und Ulrike SCHMAUCH (1977), die sich in ihren Überlegungen auf die Arbeiten von Bruno BETTELHEIM und Margret MAHLER bezieht.
Über die Entstehung des Autismus schreibt BETTELHEIM, daß in manchen Kindern ihre frühen Erfahrungen eine autistische Anlage erschaffen. Diese Anlage besteht in der Überzeugung, daß die Welt fühllos den eigenen Reaktionen gegenüber ist, daß eigene Anstrengungen keine Macht haben, diese Umwelt zu beeinflussen. Diese Kinder, einigermaßen ausreichend in ihren elementaren Bedürfnissen versorgt, treffen mit ihren Signalen und Aktivitäten auf Gleichgültigkeit. Sie bleiben passive, brave Kinder, bis aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung selbständiges Handeln von ihnen gefordert wird. Sie sind dazu nicht in der Lage, und die Welt, die bis dahin fühllos erscheint, wird nun zunehmend als zerstörerisch und enttäuschend empfunden. Die Kinder reagieren auf diese Erfahrung mit noch mehr Rückzug von der Realität und suchen Schutz in der autistischen Abkapselung. Infantiler Autismus beruht auf der Erfahrung, daß man gegenüber seiner Umwelt machtlos ist; daß diese Welt zwar gewisse Befriedigungen bieten kann, aber nie diejenigen, die man ersehnt, oder aber solche, die zerstörerisch sind.
SCHMAUCH schreibt, sich auf BETTELHEIM beziehend, "daß das autistische Kind irgendwann einmal ein vages Bild von einer befriedigenden Welt gebildet hat, denn es kämpft um sie - nicht nach außen aktiv, sondern nur in der Phantasie, und wenn es etwas tut, dann nicht um seine Lage zu verbessern, sondern nur, um Schlimmeres zu verhüten." (SCHMAUCH 1977, S. 49)
Wenn man Maria beobachtet, so fällt auf, daß sie nicht aktiv handelnd in ihre Umwelt eingreift. Ich verweise hier auf die weiter vorne beschriebenen Gruppenprozesse. Über das autistische Nichtstun schreibt SCHMAUCH: "Alle schwer gestörten Kinder sind unfähig zu zielgerichtetem Handeln oder jedenfalls zu einer Form der Aktivität, die ihnen verschafft, was sie haben wollen. Zugleich erleben sie eine explosive Wut, meist ohne spezifischen Inhalt, und eine totale Abwehr dagegen, auszudrücken, was die Wut oder jedes andere Gefühl überhaupt ausgelöst hat - weil sie sicher sind, daß es niemals eine befriedigende emotionale Antwort darauf gibt. Der Rückzug autistischer Kinder geht noch viel weiter: die meisten von ihnen haben nicht nur ein zielgerichtetes Handeln und die Kommunikation von Gefühlen aufgegeben, sondern auch jegliche Erwartungshaltung überhaupt." (SCHMAUCH 1977, S. 51)
Dieses Nicht-Handeln als Ergebnis eines Rückzuges erscheint einerseits als Unfähigkeit, andererseits als gewollt, als bewußte Verweigerung. Die Gründe für das Aufgeben jeder Aktivität können in selbstauslöschenden oder selbstschützenden Absichten liegen. Das sehr kleine Kind erlebt alle Geschehnisse als Folge seiner eigenen Aktivität und Anstrengung. Wenn nun alles, was geschieht, bedrohlich und enttäuschend auf das Kind wirkt, wird dieses seine Aktivitäten aufgeben, weil es eben nur Zerstörerisches heraufbeschwört. Nun wird es entweder gar nichts mehr tun, um sich vor neuen Enttäuschungen und Zerstörung zu schützen, oder es wird sich eine Phantasiewelt erschaffen, in der es mit seinen Ritualen und Stereotypen (wie dem "Wuzeln") zu überleben versucht.
Ich möchte nun noch genauer auf das "Wuzeln" von Maria eingehen. "Wuzeln" ist der Ausdruck, den wir verwenden, um die Beschäftigung von Maria mit ihren ganz kleinen Objekten zu bezeichnen. Meistens verwendet Maria Papierschnipsel (in unserem Dialekt auch als "Wuzel" bezeichnet); im Garten Blätter, Blüten oder Birnenstiele; manchmal winzige Teile eines Steckspieles (die in Form und Farbe genau übereinstimmen), abblätternde Lackteilchen und später vor allem Buchstaben. Um an diese "Wuzel" zu kommen, zerreißt Maria Zeitungen und Zeichnungen, wühlt im Papierkorb, leert Körbe mit Spielsachen aus und sucht den ganzen Garten ab. Dabei scheint ihr besonders beim Papier auch das Zerreißen große Freude zu machen.
Zuerst sammelt Maria eine bestimmte Anzahl gleicher Objekte mit zwei Fingern und steckt sie in ihre Faust. Sie umklammert ihre Objekte und beginnt nach einiger Zeit, eines dieser Objekte zwischen ihren Fingern zu reiben (eine Bewegung, die im Dialekt auch mit "Wuzeln" bezeichnet wird). Manchmal sammelt sie alle Objekte in einer Faust; oft sind auch beide Hände voll. Gleichzeitig steckt Maria auch eines ihrer Objekte in den Mund und reibt es zwischen Zunge und Zähnen.
Mit vollen Händen, ohne ihre Objekte zu verlieren, kann Maria schaukeln, trinken, klogehen, uvm..
Auf den Verlust ihrer Objekte reagiert Maria mit Stampfen und Schreien oder mit vermehrtem Rückzug und sie beginnt sofort von neuem zu sammeln.
Vor allem an diesen massiven Reaktionen haben wir erfahren, welch ungeheure Bedeutung für Maria das "Wuzeln" hat.
Das "Wuzeln" als autistisches Symptom hat verschiedene Wurzeln und erfüllt für das Kind viele psychische Zwecke:
-
Als ständiger Schutz im Kampf gegen äußere Reize. Durch die ausgeprägte Selbststimulation schafft sich das Kind eine Wand, eine Unzugänglichkeit nach außen, die die äußeren Reize löscht und untergehen läßt und Platz für seine privaten Phantasien und Halluzinationen läßt.
-
Als magische Kontrolle über die als bedrohlich erlebte Welt.
-
Als Entladung und Abfuhr von Energie angesichts einer Bedrohung.
-
Als Mitteilung (auf der symbolischen Ebene) über die Entstehung und den Inhalt der Halluzinationen und Ängste des Kindes.
In Situationen, in denen das Kind sich in seinen Bezugspunkten besonders verloren fühlt, greift es auf das autistische Objekt zurück, um sich von ihm Unterstützung zu erwarten.
"Dieses Objekt (dabei mag es sich um einen Papierschnipsel, ein Kleidungsstück der Mutter, um Kieselsteine oder ausgewählte Spielzeuge handeln) hat die Funktion der Einfriedung." MANNONI 1978, S. 261)
Diese autistischen Stereotypen (mit oder ohne Einbeziehung von Objekten) sind für die Kinder mit großem Energieaufwand verbunden und bereiten weder Lust noch verschaffen sie wirkliche Befriedigung. Sie dienen der Abwehr von noch größeren Qualen und Gefahren.
Auch wenn das autistische Symptom zur pathologischen Fixierung beiträgt, so ist es dennoch wichtig, sich nicht in die Stereotypien des Kindes einzumischen oder es daran zu hindern. Denn, so zeigt BETTELHEIM in verschiedenen Beispielen, die Stereotypie stellt die weitestgehende Fähigkeit des Kindes im Umgang mit der Realität dar, da es immerhin vermag, die angsteinflössende und zerstörerische Welt abzuwehren.
"Nicht nur das Symptom als solches verlangt Achtung, sondern die Individualität des Kindes, die sich in ihm ganz besonders ausdrückt. Jede Stereotypie ist immer einzigartig und hat persönliche Bedeutung, stellt die eigene spontane und größte Anstrengung des Kindes dar (...) - und beinhaltet vor allem, wie jedes symptomatische Verhalten, eine Kommunikation, wie privat und verrätselt sie auch sei." (SCHMAUCH 1977, S. 85)
Das bedeutet für die Arbeit mit autistischen Kindern, daß wir versuchen müssen, das Symptom zum Ausgangspunkt der gemeinsamen Kommunikation zu machen und zu verstehen, "was in ihrer Sprache ohne gesprochenes Wort gesagt wird" (MANNONI).
Maria wuzelt, saugt, schaukelt und verschafft sich offensichtlich befriedigende Situationen durch sich selber.
Das "Wuzeln" ist am deutlichsten ausgeprägt. Wir sehen die Funktion für Maria vorerst darin, daß sie sich einen Reiz verschafft, um sich abzukapseln von allem anderen. Wir gehen davon aus, daß Maria durch die Erfahrung anderer angenehmer Reize und Sensationen (auch solcher aus der Umwelt) ihr stereotypes Verhalten wird abbauen und aufgeben können. Erst die "Hartnäckigkeit", mit der Maria "wuzelt" auch in Situationen, die ruhig und angenehm und für uns ohne jede Bedrohung scheinen, zeigt uns die lebenswichtige Bedeutung, die dem "Wuzeln" zukommt. Verzweifelte Versuche von uns, Maria manchmal zu bewegen, ihre "Wuzel" wegzulegen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren, bleiben meist erfolglos und führen auf beiden Seiten zu Frustration und Verzweiflung. Und wenn es gelingt, Marias Objekt für eine zeitlang wegzulegen, so meistens um den Preis der Anpassung und des vermehrten Rückzuges. Auch durch dieses Verhalten lehrt uns Maria, wie sehr sie mit ihren Objekten verbunden ist und wie bedrohlich sie jede Trennung erlebt. Wir lernen, Marias leise Versuche des Körperkontaktherstellens aufzunehmen und darauf einzugehen, ohne sie zu überfordern durch zu große Direktheit. Dabei kommt den Handspielen eine wichtige Bedeutung zu. Die Handspiele vermögen für kurze zeit Marias Faust zu öffnen.
Auch die meist zufälligen Haut- und Wasserspiele beim Waschen und Klogehen kann Maria zunehmend genießen.
Wir versuchen, Maria bei ihren verbalen und lautlichen Ausbrüchen zu unterstützen, um ihr den Zugang zu den weit entfernten und vergrabenen Gefühlen (vor allem auch den aggressiven) zu erleichtern.
Je mehr wir das "Wuzeln" als Teil ihrer Bewältigung der Realität auch gefühlsmäßig vestehen lernen, umso besser gelingt es uns, das "Wuzeln" zu akzeptieren und mit ihr darüber zu kommunizieren. Auch jetzt, nach zwei Jahren Kindergarten, "wuzelt" Maria weiterhin. Aber sie "wuzelt" weniger und sie kann für befriedigende Alternativen das "Wuzeln" jetzt für eine Zeit aufgeben, ohne in Panik zu geraten.
Nach eineinhalb Jahren Kindergarten konzentriert sich das "Wuzeln" auf ein neues Lieblingsobjekt: Buchstaben in allen Variationen (ob aus Teig und Plastik oder in Zeitungen und auf Plakaten). "Buchstaben", sagt Maria und zeigt uns manchmal von sich aus ihre offene Hand voller Buchstaben. Die Kommunikation ist dadurch intensiver geworden.
Gegen Ende des zweiten Kindergartenjahres machen wir eine andere neue Erfahrung mit Maria. Maria stellt sich vor uns hin, seitlich oder mit dem Gesicht zu uns und zieht am Ärmel, was bedeutet, daß sie auf den Arm genommen und herumgetragen werden möchte. Wie ein Kleinkind, seitlich auf unserer Hüfte sitzend und mit einem Arm gehalten, fühlt sie sich sichtlich wohl.
Ungefähr zur gleichen Zeit "entdeckt" Maria Ines. Ines ist in der gleichen Gruppe wie Maria, ungefähr ein Jahr jünger, aber fast gleich groß. Als Ines nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder zurück in den Kindergarten kommt, zeigt Maria großes Interesse an ihr. In der Früh geht sie zielstrebig auf Ines zu, drückt sie an sich; so fest, daß Ines fast Angst bekommen muß. Maria geht auch während des Tages oft zu ihr hin, haut sie, umarmt sie; oder beobachtet sie aus einer gewissen Entfernung. Ines ist manchmal genauso lieb zu ihr, sie ist aber auch oft überfordert und sucht Hilfe bei uns. Es ist das erste Mal, daß Maria von sich aus auf ein anderes Kind zugeht, sich um die Aufmerksamkeit eines anderen Kindes bemüht.
Möglichkeiten und Hilfestellungen für Maria im Rahmen des Kindergartens:
(1) Maria erlebt im Kindergarten, wie Kinder sich aggressiv auseinandersetzen, Wutausbrüche haben, ihre Gefühle, auch die negativen, frei ausdrücken, ohne daß ihre Aggressionen vernichtende Auswirkungen haben.
Das heißt nicht, daß wir im Kindergarten gegenseitige Aggressionen, Streit und Provokationen bedingungslos und ohne Grenzen tolerieren oder gar fördern. Im Gegenteil versuchen wir, Konflikte aufzugreifen und zu bearbeiten und das Ausagieren eines Kindes auf Kosten anderer zu verhindern.
Aber die Kinder erleben den Kindergarten als einen Ort, wo auch "negative" Gefühle (wie Ablehnung, Wut, Trauer, Eifersucht, Aggression, uvm.) Platz haben, - auch wenn sie sich gegen die erwachsenen Bezugspersonen richten -, und verstanden werden. Diese Gefühle dürfen ausgedrückt und ausgelebt werden (mit der Einschränkung, daß nicht andere Kinder zu Schaden kommen), ohne daß vernichtende Sanktionen befürchtet werden müssen (wie Liebesentzug, Spott, Gleichgültigkeit, usw.).
Und dieses Erleben scheint mir eine wichtige Hilfe zu sein auf dem Weg zu den eigenen verborgenen und abgewehrten Gefühlen.
Maria ist in der Kindergruppe sicher der einen oder anderen sozialen Situation ausgesetzt, die sie überfordert, ihr Angst macht und in ihrer autistischen Abwehr bestärkt. Ich nehme aber an, daß - so wie auch nicht eine einzige Situation ein Kind autistisch werden läßt - es die Summe der Erfahrungen, die spürbare Grundhaltung ist, die ein Aufbrechen der autistischen Kapsel möglich machen.
(2) Eine der Möglichkeiten des Kindergartens sehe ich in der "Verlockung zur Aktivität". Aktivitäten des täglichen Lebens, Spiel, Bewegung, Musik, draußen und drinnen, Geplantes und Improvisiertes ... bilden den täglichen gemeinsamen Lebenszusammenhang, in dem für die Kinder viel Platz ist.
Auch wenn wir immer wieder versuchen, in gemeinsamen Aktivitäten alle Kinder einzubeziehen, so besteht doch kein Zwang mitzumachen. Besonders gegenüber Maria, die sich am offensichtlichsten in unserer Gruppe von den anderen absetzt, verhalten sich die anderen Kinder sehr tolerant und einfühlsam.
Obwohl Maria während der Gruppenzeit oft herumstreift und sich mit ihren "Wuzeln" beschäftigt, kommt sie doch immer wieder an den Tisch zu uns, drückt sich her und macht ganz kurz mit. Ich möchte hier verweisen auf den Abschnitt über die Prozesse in der Kleingruppe.
(3) Therapeutische Einzelbetreuung und das Leben in der Kindergruppe sind zwei wesentliche, sich ergänzende Elemente. Maria kann im geschützteren Raum der therapeutischen Zweierbeziehung andere Erfahrungen und Lernprozesse machen als in der offeneren Situation der Kindergruppe.
Die enge Kooperation und Kommunikation zwischen der Beschäftigungstherapeutin und den anderen Bezugspersonen im Kindergarten ermöglicht es uns, für Maria eine Art therapeutische Einheit zu schaffen. Es bestehen also verschiedene Formen der Betreuung, die sich aber aufeinander beziehen und gegenseitig ergänzen.
(4) Über eine Schwierigkeit
Je mehr wir Maria verstehen, umso schwieriger wird die Kommunikation mit den Eltern. Marias Symptome zu respektieren und eine gemeinsame Kommunikation zu suchen, heißt für uns vor allem, daß wir auf Zwang zur Veränderung, auf die Förderung kognitiver Leistungen und auf Anpassung möglichst weitgehend verzichten. Diese Haltung von uns ist ziemlich entgegengesetzt den Erwartungen und Vorstellungen von Marias Eltern, die sich hauptsächlich kognitive Förderung und Anpassung im sozialen Bereich erwünschen. Die Kommunikation über die verschiedenen Vorstellungen und die
unterschiedlichen Sichtweisen bezüglich Marias Behinderung gestaltet sich meist als sehr schwierig und bleibt für die Eltern sowie für uns oft unbefriedigend.
Zusammenfassend ...
möchte ich festhalten, daß allgemeine Richtlinien für die Integration behinderter Kinder nicht aufgestellt werden können und dürfen, denn damit wird nur eine neue Klassifizierung der behinderten Kinder, nämlich in integrierbare und nichtintegrierbare Kinder, angestrebt und wirkliche integrative Arbeit von vornherein in Frage gestellt.
Integration im Kindergarten bedeutet für uns, bereit zu sein, alle Kinder, ungeachtet bestimmter persönlicher Merkmale, aufzunehmen und gemeinsam leben zu lernen.
Demzufolge gibt es grundsätzlich keine nicht-integrierbaren Kinder. Entscheidend für die Aufnahme eines behinderten Kindes in die Kindergruppe sind, neben den räumlichen und finanziellen Gegebenheiten, die Bereitschaft der Betreuer und die Aufnahmefähigkeit der Kindergruppe. Ein integratives Konzept muß flexibel sein, um auf die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Kinder einzugehen, und es verpflichtet zur Bereitschaft, bei jedem Kind neu dazu zu lernen.
Durch das gemeinsame Lernen verändert sich die Sichtweise der Behinderung (und vom Schweregrad einer Behinderung), was neue gemeinsame Perspektiven möglich macht. So wie Monika ALY schreibt:
"Die Frage der 'Integrierbarkeit' hängt nicht unbedingt nur vom Schweregrad der Behinderung ab, sondern auch von der Definition des Schweregrades, der sich mit der Zeit verschiebt, weil sich auch durch die Integration selbst die Verarbeitungsfähigkeit der Umwelt verschiebt." (ALY 1981, S. 16)
Im Zusammensein mit den schwerstbehinderten Kindern sind wir herausgefordert, unsere Entwicklungsvorstellungen und unsere Leistungserwartungen radikal zu überdenken, um von den Fähigkeiten der Kinder ausgehend die sozialen und emotionalen Kompetenzen zu sehen und zu stärken und zum Ausgangspunkt der gemeinsamen Kommunikation zu machen. In diesem gegenseitigen Lernprozeß kommt den nichtbehinderten Kindern eine wesentliche Bedeutung zu, da sie durch ihre eigene Körperlichkeit und Verbundenheit mit der konkreten Umwelt verstärkt sinnlich wahrnehmbare Erfahrungen in die Auseinandersetzung einbringen. Sie können die behinderten Kinder (zum Teil) besser verstehen, als es die erwachsenen Bezugspersonen können; sie helfen dadurch wesentlich mit, den (schwerst)behinderten Kindern die Umwelt be-greiflich zu machen.
Ich weiß, nur mit dem Bauch wird Macht
und Bosheit nicht vertrieben,
doch vorher, Freunde, sollten wir
erst lernen, uns zu lieben.
(Konstantin Wecker)
Im Zusammenhang mit unserer Arbeit im Kindergarten möchte ich hier auch Fragen aus dem sehr komplexen Bereich der kindlichen Verhaltensschwierigkeiten/Auffälligkeiten/Störungen aufgreifen, begründet auf der Erfahrung, daß ein Teil der nichtbehinderten Kinder mit ihren Schwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich die Grenze der Belastbarkeit der Betreuer und der Kindergruppe ausloten.
Auch wenn wir in unsere Überlegungen im täglichen Umgang die familiäre Situation, soweit sie uns zugänglich ist, miteinbeziehen, so werden hier die Schwierigkeiten, wie sie sich uns im Kindergartenalltag zeigen, im Vordergrund stehen.
Manche Überlegungen sind in den zwei vorangegangenen Abschnitten schon angeklungen. Ich verstehe diesen Abschnitt als Ergänzung dazu, die nun die Situation der sogenannten nichtbehinderten, "schwierigen" Kinder beleuchtet.
Zur Beschreibung des Problemfeldes
(1) Aus der Sicht der Betreuer ergibt sich folgendes Bild, das ich anhand der Gedächtnisprotokolle skizzieren möchte.
Kinderbesprechung, 19.4.82
Am Schluß tauchen wieder Fragen und Zweifel auf; Zweifel, ob die Arbeit überhaupt noch Sinn hat.
Ob wir von Integration sprechen können angesichts der massiven Schwierigkeiten (emotionalen, Kontakt- und Spielschwierigkeiten ...) der sogenannten nichtbehinderten Kinder.
Sind zu viele behinderte Kinder im Kindergarten?
Wir sehen zu deutlich Grenzen. Integration nicht als Ziel, sondern als Prozeß zu sehen, hilft uns. Trotzdem: wir sind alle ziemlich abgebaut.
Mittwoch, 21.4.82, im Freispiel
Was wir am Montag in der Kinderbesprechung kurz besprochen haben, haben wir heute im Freispiel wieder deutlich erlebt: schlagen, schreien, weinen, davonlaufen ... wir werden im besten Fall zu Vermittlern, die zu verhindern suchen, daß die körperliche Gewalt sich ausbreitet.
Was dabei so anstrengend ist: auch ruhiges Reden, Eingehen auf ihre Wünsche ... hilft kaum weiter. Es löst den aktuellen Konflikt, aber schon im nächsten Moment ist alles beim alten (falls ein anderes Kind gewinnt, etwas hat, sich durchsetzt ...)
Zudem: viele Aggressionen (zur Zeit besonders von Doris und Tobias) werden an uns abgelassen, "du blöde Sau, du blöde Judith ..."
Das Memory-Spielen heute wird für mich zu einem Krisen-Managerspiel. Es spielen viele Kinder mit; Doris fühlt sich zurückgesetzt, übergangen, bekommt nicht genug Karten.
-
Heißt das, daß wir unsere Ansprüche in bezug auf Integration wieder herunterschrauben müssen? Um mit der Realität besser fertig zu werden?
-
Das heißt vor allem: jetzt nicht resignieren. Wieder jeden Tag neu anfangen. Besonders bei Tobias und Doris.
-
Das heißt auch, daß das Integrieren von verhaltensschwierigen Kindern von uns immer wieder mehr fordert als die Integration der behinderten Kinder.
Die angesprochenen Fragen und Zweifel sowie das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, um Luft zu holen, beziehen sich auf Situationen im Kindergartenalltag, in denen die Bedürfnisse und Konflikte einzelner Kinder so massiv zum Durchbruch kommen, daß sie das ganze soziale Gefüge zu sprengen vermögen.
(2) Kinder, die aufgrund ihrer bisherigen Sozialisationsbedingungen in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung beeinträchtigt sind und kaum befriedigende Beziehungen kennengelernt haben, agieren die Konflikte, die sie mit sich selber und in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt haben, in der Kindergruppe und in der neuen Umgebung aus. Sie sichern sich Aufmerksamkeit und Zuwendung durch Schreien, Toben, Schlagen, Davonrennen, u.a.; auf die gleiche Weise schützen sie sich vor Nähe und Beziehung; ersatzweise müssen sie horten und gierig sein und kleinere Kinder bemuttern; gleichzeitig verhalten sie sich kleinkindhaft anklammernd.
Zum Beispiel
Moni
Moni will Toni sein oder Thomas oder Stephan. Will König sein, nicht Königin. Will Koch sein, nicht Köchin. Sie identifiziert sich in Bildern und Geschichten ausschließlich mit männlichen Figuren und sucht sich zum Spielen fast immer Buben. Weil: Buben sind stärker und dürfen "schiach tuan".
"Du darfst mein Zipfel nit sehn", sagt sie am Klo. "Ischt das grausig", Moni beschimpft Silvia, wenn sie mit einem Kleid oder Rock in den Kindergarten kommt. "I bring di um", Moni ist oft unerschöpflich im Ausdenken von Vernichtungsmöglichkeiten für die Kinder und Erwachsenen; nur sich selbst und ein oder zwei andere Kinder bzw. einen von uns möchte sie am Leben erhalten. Unruhig, sich beim Reden verhaspelnd traut sich Moni selber wenig zu.
Carmen
Als Carmen vier Jahre alt ist, wird ihre leichte körperliche Behinderung operativ korrigiert.
Carmen ist nicht mehr "die Kleine" und zunehmend werden ihre Schwierigkeiten deutlicher. Ihre ständige Angst, zu kurz zu kommen, nicht genug Zuwendung zu bekommen, drückt sie aus im gierig sein, neugierig sein, traurig sein, im "Essen für das Herz".
Nun, da sie selber groß sein soll und darf (ihre ältere Schwester ist nicht mehr im Kindergarten), fühlt sie sich stolz und überfordert zugleich. Sie versucht, andere Kinder kleiner und hilfloser zu machen, als sie sind, besonders Susi. Diese Kinder kann sie bemuttern und versorgen und so aktiv praktizieren, was sie für sich (vielleicht) ersehnt.
Boris
Boris ist der "Boß"; er versucht es mit allen Mitteln zu sein. Nachdem er in zwei anderen Kindergärten deswegen Schwierigkeiten gehabt hat, kommt er zu uns.
Boris setzt sich in der Kindergruppe mit Schlagen und Schreien und mit den besten Ideen für wilde Spiele durch. Immer in Bewegung ist kein Kasten zu hoch und die Spielzimmer sind fast immer zu klein.
Immer wieder finden wir einen Winkel, in dem er in einem "Nestel" Sachen hortet; wertloses oder auch Dinge, die einfach verschwunden sind, wie Zünder, Schlüssel, Süssigkeiten uvm.; oft tauchen diese Dinge auch aus seinen Hosentaschen wieder auf.
Davonrennen - aus dem Spielzimmer, vom Essen weg, auf der Straße, in Konfliktsituationen, usw. - ist einer der Wege, durch den Boris sich auch ständig unsere Aufmerksamkeit sichert. Auf Einschränkungen (die darauf folgen) reagiert Boris sehr unterschiedlich, zuerst aber mit gesteigerter Aggression: Spucken, Schlagen, Schreien. Gleichzeitig ist Boris' Bedürfnis nach Zuwendung und Körperkontakt unheimlich groß.
Sein Vertrauen in eigenes Können ist sehr gering, besonders wenn es darum geht, etwas allein zu machen, wenn andere zuschauen; Verkriechen oder Schabernack machen sind seine Antworten auf solche Angebote oder Anforderungen.
(3) Das "störende" Verhalten ist zwar aus der individuellen Lebensgeschichte verständlich, aber oft ist die Art der Konfliktaustragung für die anderen Kinder und für die Betreuer schwer zu verstehen und zu akzeptieren. Es ist vor allem sehr schwer, sie im gemeinsamen Spiel- oder Tagesablauf aufzufangen. Konflikt- und Reibungspunkte gibt es im Kindergarten viele: durch das Zusammentreffen mit den anderen Kindern und durch die "minimalen" Anforderungen des Kindergartenalltags.
Dabei sind die sehr aggressiven Auseinandersetzungen (auf der körperlichen wie auf der verbalen Ebene) sicher diejenigen Situationen, die uns als Betreuer am meisten Schwierigkeiten machen, da sie uns immer wieder in eine "Feuerwehr"-Position bringen. Immer wieder auf das Neue gilt es (wie auch das obige Beispiel zeigt), die Balance zu finden:
zwischen dem Bedürfnis des ausagierenden Kindes und den legitimen Bedürnissen der anderen Kinder; einerseits aggressive Ausbrüche nicht zu unterdrücken und zu bestrafen, auf der anderen Seite die Position der davon betroffenen bzw. mitbetroffenen Kinder zu stärken.
Für uns als Betreuer heißt das in vielen Fällen, in denen sich die Aggressionen gegen uns richten, die Aggressionen der Kinder auszuhalten und ihnen zu zeigen, daß aggressive Ausbrüche keine vernichtende Gegenreaktionen hervorrufen. Gleichzeitig heißt es aber die Grenzen unserer Belastbarkeit deutlich zu machen und gemeinsam einen Weg aus der Konfliktsituation zu suchen.
(4) Erschwerend für das Zusammenleben wirkt sich aus, daß die nichtbehinderten Kinder, die in der Auseinandersetzung mit sich selber und ihrer Umwelt massive Schwierigkeiten haben, auch den Kontakt mit den behinderten Kindern auf dem Hintergrund ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte und ihrer jeweiligen Bedürfnislage strukturieren. Zum Beispiel: sie sind froh, einen Schwächeren zu finden, dem sie ihre Aggressionen spüren lassen können, den sie für ihre "Zwecke" instrumentalisieren können; oder an dem sie ihre eigenen Schwächen und Ängste bekämpfen und verspotten können. Oder aber; die Kinder sind so auf sich selber und auf die erwachsenen Bezugspersonen festgelegt, daß sie Kontakte zu anderen von sich aus kaum aufnehmen.
(5) Besonders wenn Moni, Florian und Theresa (oder auch andere Kinder) sich zusammenschließen und "gemeinsame Sache" machen gegen andere Kinder oder uns, sich gegenseitig aufstacheln und aufschaukeln, wird ein gemeinsames Aushandeln der Situation fast unmöglich, sowohl für einzelne betroffene Kinder wie auch oft für uns Betreuer.
Im Schutz der Gruppe/eines Verbündeten, die unausgesprochen die eigenen Schwächen, Ängste oder Bedürfnisse teilen, ist es für Florian und die anderen leicht, sich auf Kosten eines Schwächeren "aufzubauen" und sich stark zu fühlen. Um diese Dynamik des gemeinsamen Agierens zu durchbrechen (ähnliche Situationen ergeben sich auch in der Kleingruppe oder beim Essen), ist es notwendig, in der akuten Situation einzugreifen; nicht nur verbal.
Längerfristig ist es das Ziel, jedes einzelne Kind in seiner eigenen Entwicklung zu stärken und unabhängiger zu machen vom Agieren der anderen.
Keine bloße Pannenreparatur
"Kommen die Störungen nicht gerade aus dem zielgerichteten Charakter der dem Kind zugemuteten "normalen" Existenz? Wird als "gestört" nicht ein Verhalten bezeichnet, das nicht (mehr) zielgerichtet ist? Verfährt nicht schon die gewöhnliche Erziehung so, daß sie die Zielrichtung des kindlichen Daseins befördert und alle anderen Aspekte ausblendet? Ist also nicht eben die normale Erziehung eine sektorale, spezifische, lenkende, zweckhafte Erziehung? Dann wäre die Erziehung "Gestörter" nicht, wie zunächst vermutet, eine bloße Pannenreparatur, sondern das Modell einer ganzheitlichen, auf den Menschen bezogenen, nicht ausschließlich zielgerichteten Erziehung. Bekommt ein Kind erst dann die wünschenswerte Zuwendung, wenn es sich als gestört präsentiert, so ist eine "Erziehungslehre" für den Umgang mit Gestörten im Grunde die Konzeption für die Erziehung schlechthin." (KUPFFER 1978, S. 14)
Ich schließe mich diesen Überlegungen von KUPFFER an, der ausgehend von "gestörtem" Verhalten eine ganzheitliche "Erziehungslehre" entwirft, die sich auf die Erziehung aller Kinder auswirkt.
Die folgenden Überlegungen lassen sich nicht aus dem Kindergartenalltag herauslösen und beziehen sich nicht ausschließlich auf die (offene) Gruppe der verhaltensschwierigen Kinder. Sie sind vielmehr integrierter Bestandteil der gesamten Kindergartenarbeit. Sicher haben wir dabei gerade von und mit den "schwierigen Kindern sehr viel gelernt. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf die Abschnitte 3.1.3 und 3.2 verweisen.
(Druckfehler im Original)
fung einer Atmosphäre
-
des bedingungslosen Akzeptierens der Kinder (bedingungslos in dem Sinne, daß nicht Gegenliebe oder irgendwelche Gegenleistungen erwartet werden),
-
von Toleranz gegenüber Symptomen und abweichendem Verhalten (ohne dies zu billigen),
-
in der die berechtigten Wünsche der Kinder, zum Beispiel nach dem Essen, Trinken, Zuwendung, Körperkontakt, usw. befriedigt werden.
Das gewährende Milieu schließt mit ein, daß wir Einschränkungen machen, eingreifen, sanktionieren, Grenzen setzen. Und gerade das Umsetzen dieser Ansprüche in das alltägliche erzieherische Handeln läßt die Schwierigkeiten deutlich werden.
Hilfen zur Konfliktbewältigung
Eine große Unterstützung bei der Bearbeitung dieser Schwierigkeiten ist für uns die Kinderbesprechung mit der Psychologin.
Die Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Überlegungen, so hat sich der Name "Kinderbesprechung" als Arbeitstitel festgesetzt; doch nimmt mehr und mehr die Reflexion unseres Verhaltens und unseres Umgehens mit den Kindern einen wichtigen Stellenwert ein. Die Kinderbesprechung ist wichtiger Lernort geworden: durch Selbstreflexion und konkrete Problemlösung.
Silvia: "So viele Sach'n hab ich mir einfach nicht erklären können, die einfach durch Umwelteinflüsse oder durch die Eltern halt passieren. Durch euch oder durch die Kinderbesprechung hab ich da viel gelernt ... daß ich mir heut viel mehr erklären kann, auch warum ich so bin, wenn man sich halt so z'rück erinner und da kommt mir vor, hab ich auch mehr Verständnis für die Kinder gekriegt. ..."
Die Kinderbesprechung führt meist zu einem differenzierten Verständnis der Kinder, da die verschiedenen Mitarbeiter (Betreuer und Therapeuten) ihre Beobachtungen und Erlebnisse einbringen und das "Warum" des störenden/auffallenden Verhaltens hinterfragen.
Dabei geht es auch darum, die Fähigkeiten der Kinder herauszustellen, ohne die belastenden Verhaltensweisen herunterzuspielen.
Dieser Verstehensprozeß (ohne Anspruch auf Vollständigkeit in der Wahrnehmung der Kinder) enthält eine Reihe von Annahmen, die handlungsleitende Funktion im alltäglichen Umgang übernehmen können und auf deren Grundlage wir kurz- und längerfristige Ziele/Wege erarbeiten.
In der Kinderbesprechung ist Platz, unsere eigenen Schwierigkeiten zu thematisieren. Wir dürfen jammern und ratlos sein. Ansatzweise gelingt es uns, uns unserer eigenen Aggressionen und Ängste bewußt zu werden und ohne Schuldgefühle auch negative Gefühle auszudrücken; ohne damit dann alleine hängengelassen zu werden.
Obwohl dieser Schritt nicht leicht fällt (besonders in einem größeren Team), ist die Wirkung sehr befreiend, für jeden einzelnen Mitarbeiter und für die Beziehung zu den betreffenden Kindern.
Gleichzeitig wird es uns eher möglich, das eigene Verhalten und das der anderen zu reflektieren und zu verändern; oder auch uns gegenseitig zu bestärken und Mut zu machen in schwierigen Situationen.
Durch die Kinderbesprechungen erarbeitet (mit großer Unterstützung von Ursula) und zu einem wichtigen Bestandteil unserer Arbeit geworden ist das, was wir als "Verbalisieren von Gefühlen" bezeichnen.
Zur Verdeutlichung möchte ich hier auch die Arbeit von MUSS (1973) zurückgreifen. MUSS übernimmt von REDL (1971) den Begriff des "life space interview" und schreibt dazu:
"Das 'life space interview' - das therapeutische Gespräch im aktuellen Lebenskontext - ist zunächst einmal als ein wichtiger Bestandteil von Erziehung überhaupt zu verstehen: jedes Gespräch mit einem Kind über ein Verbot, ein es ängstigendes Erlebnis oder über ähnliche Anlässe zählt dazu. Für die Behandlung psychisch gestörter Kinder gewinnt es aber eine besondere Bedeutung als therapeutisches Mittel. Es ermöglicht den Erwachsenen nämlich, den Kindern zu helfen, ihre eigene Stellung in einer Konfliktsituation, ihre Pathologie und ihr Verhältnis zur Realität wie auch ihre Forderungen an diese zu reflektieren und zu verstehen. Denn das Gespräch erfolgt in unmittelbarer Nähe zu den direkten Lebenserfahrungen, in enger Verbindung mit allem, was zum Thema der Unterhaltung wird, und es wird durch und mit einem Menschen geführt, der Teil des vertrauten Lebensraums ist." (MUSS 1973, S. 132)
In der Praxis des Kindergartenalltags geht es uns nicht an erster Stelle um die therapeutische Auswertung (dazu scheint es mir auch notwendig zu erwähnen, daß die Mitarbeiter keine psychoanalytische Ausbildung haben), sondern um eine emotionale Hilfestellung am Ort/in der betreffenden Situation.
Das Aufgreifen von Situationen und das Verbalisieren möglicher, damit verbundener Gefühlsinhalte, ermöglicht die Bewältigung von Konfliktsituationen, die zum Beispiel unter anderem dann entstehen, wenn ein Kind mit Frustrationen fertig werden muß, wenn es mit Angst, Wut, Trauer oder Schuldgefühlen zu kämpfen hat.
Diese Art des Eingreifens ist unmittelbar auf die Konfliktsituation und auf das betroffene Kind bezogen. Es soll aber - im weiteren Sinne - auch eine Möglichkeit für die anderen Kinder sein, unverständliches/auffallendes Verhalten verstehen und akzeptieren zu lernen.
Dieses Kind wird immer das nie erreichbare Ziel
verfolgen, so normal zu werden, daß es endlich
in die Gesellschaft integriert werden kann. Die
Gesellschaft macht dieses Versagen akzeptabel,
indem sie goldene Käfige bereitstellt.
(Adriano Milani-Comparetti)
Zusammen mit dem ganzen Kindergartengeschehen hat sich auch die therapeutische Betreuung weiterentwickelt. Dabei haben wir gemeinsame Arbeitsformen gefunden, die für alle Betroffenen sehr positiv sind und durch die wir vieles gelernt haben bzw. lernen. Von diesem Lernprozeß und von den Schwierigkeiten, Unterschiedlichkeiten und Ambivalenzen soll in diesem Abschnitt die Rede sein.
Ich möchte hier kurz den "italienischen Weg" der Nichtaussonderung (Antiemarginazione) und die zugrunde liegenden Gedanken skizzieren. Denn während der Projektphase des Kindergartens Sonnenburgstraße haben uns erste Berichte über erfolgte Integrationsversuche (besonders in Florenz und Bozen) Mut gemacht; und nun, mit fortschreitender praktischer Erfahrung, haben wir uns in den Ausführungen aus Italien zum Teil wiedergefunden und zum Teil sind neue Impulse davon ausgegangen.
Neben einer Reihe von praktischen Erfahrungsberichten sind bei uns vor allem die Ausführungen Adriano MILANIs (Florenz) bekannt geworden; durch die Bearbeitung von Ludwig ROSER (1981) und Monika ALY (1981).
Im folgenden beziehe ich mich im wesentlichen auf diese Autoren. Und ich konzentriere mich hauptsächlich auf den Schwerpunkt "Therapie".
MILANI (Neurologe und Kinderarzt) beginnt Ende der 50-er Jahre engagiert mit dem Aufbau von Sondereinrichtungen für behinderte Kinder, besonders für Kinder mit cerebralen Störungen. Therapie, intensive Behandlung und Frühförderung bilden den hauptsächlichen Arbeitsschwerpunkt. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung, um 1970, beginnt MILANI die Sondereinrichtungen und die Therapie in Frage zu stellen aufgrund der negativen Auswirkungen, die durch die Aussonderung entstehen. In der Folge werden in Florenz alle Sonderschulen und Sondereinrichtungen aufgelöst, und heute besuchen, mit Ausnahme von einigen sehr schwer behinderten Kindern, alle cp-Kinder die normalen staatlichen Schulen, in denen das Zusammenleben sich immer besser gestaltet. Auch die Rehabilitationsmaßnahmen wandeln sich von Zwangsmaßnahmen, denen sich ein andersartiger Mensch unterziehen muß, um weniger andersartig (behindert) zu sein, um so in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, zu Dienstleistungen und Hilfestellungen, die allen Bedürftigen zugänglich gemacht werden müssen. Vor allem muß das Bedürfnis des Menschen, in seinem sozialen Zusammenhang zu leben, wirklich respektiert werden.
"Auf der Ebene der Rehabilitation sehen wir deswegen vor uns ein langsames Dahinschwinden mancher professioneller Typen, die in der Vergangenheit die Aufgabe erfüllt haben, ein künstliches Leben in den Institutionen aufrecht zu erhalten mit therapeutischen Kennzeichen: der Beschäftigungstherapeut, der Musiktherapeut, der Ergotherapeut etc... Spiel, Musik, Kommunikation und Bewegung müssen anerkannt werden als Grundelemente des täglichen Lebens des behinderten Kindes in seinem sozialen Zusammenhang." (BUCH 1980, S. 143)
MILANI sieht, daß die Therapie an sich schon eine isolierende Wirkung hat und daß durch die defektbetonte Behandlung mehr Schaden angerichtet werden kann, als der organische Defekt selbst ergeben hätte, vor allem im Selbstgefühl der Betroffenen.
ROSER (Psychologe und Mitarbeiter von MILANI) führt das darauf zurück, daß
"das betroffene Kind in den ersten Lebensjahren gar nicht weiß, was der Erwachsene von ihm will. Es wird vorausgesetzt, daß das Kind die Sorge des Erwachsenen um seine physische und psychische Entwicklung als Liebe empfindet. Behandlung jeder Art geht also meist über die wirklichen Wahrnehmungsmöglichkeiten des Kindes hinweg." (ROSER 1981, S.44)
Das Kind wird so zu einem "behinderten", zu einem andersartigen Menschen, anstelle eines Menschen, der eine Behinderung hat. Und das Kind wird das nie erreichbare Ziel verfolgen - unter großen Opfern - so "normal" zu werden, daß es in die Gesellschaft integriert werden kann. Dabei sieht sich das Kind einer Umwelt gegenüber, die es durch Behandlung und Therapie anders haben möchte, als es ist, und deren Erwartungen es nie befriedigen kann.
Die Folge daraus ist nicht die Abschaffung jeglicher therapeutischen Bemühungen, sondern ein neues berufliches Selbstverständnis der Therapeuten, das sich orientiert am Können und an den Lebens- und Kompensationsmöglichkeiten des behinderten Kindes.
MILANI spricht sich ebenso dagegen aus, Eltern zu Co-Therapeuten (besonders die Mütter) auszubilden und ihnen die Aufgabe zu übertragen, ihr Kind zu "behandeln", da dadurch ein Rollentausch stattfinden kann, der Eltern in Therapeuten verwandelt. Dadurch werden die persönlichen Beziehungen extrem belastet und für das Kind-sein bleibt wenig Platz. Vielmehr muß es darum gehen, die Eltern in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu stärken und ihnen die Verantwortung für das Wohl ihres behinderten Kindes zurückzugeben.
Die Entwicklung in Italien und die geänderten gesetzlichen Bestimmungen (Gesetze aus dem Jahre 1971 und 1975/76 stellen für alle Kinder die Möglichkeit her, in normale Klassen aufgenommen zu werden) können nicht einfach übertragen werden.
Um jedoch vermehrt Integrationsmöglichkeiten zu schaffen, scheint es mir wichtig, gerade der sich bei uns immer noch ausbreitenden Behandlungs- und Therapiegläubigkeit eine Position entgegen zu setzen, die nicht auf Behandlung verzichtet, sich aber der Relativität und der Grenzen ihres Erfolges bewußt bleibt, und die negative Eigendynamik medizinischer und pädagogischer Versorgungssysteme aufzubrechen versucht. Die therapeutische Behandlung muß die pädagogische Arbeit, die außerhalb des medizinisch/ therapeutischen Bereiches liegt, in ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes anerkennen; oder diese zumindest nicht blockieren.
Monika ALY (Physikotherapeutin) schreibt mit großer Betroffenheit über ihre Erfahrungen in Florenz:
"... es kann in unserem Beruf nicht darum gehen, die Grenzen von Gesundheit und Krankheit, von normal und störungsbehaftet immer exakter festzulegen und alles, was von unserer Norm abweicht, zu therapieren - notfalls ein ganzes Leben lang. Schließlich wird das Leid, dem wir in unserer Arbeit begegnen, nicht dadurch geringer, daß wir so tun, als könnten wir es abschaffen. Die geschädigten Kinder, wir selbst und damit die ganze 'normale' Gesellschaft sollte lernen, damit zu leben." (ALY 1980, S. 1)
Therapie, besonders die Physikotherapie, gehört von Anfang an zum festen Bestandteil des Kindergartenalltags.
Dabei gehen wir davon aus,
- daß es für die behinderten Kinder positiv ist, wenn Therapie und Alltag verbunden werden;
- daß wir gegenseitig voneinander lernen können; besonders daß wir als Betreuerinnen von den Therapeutinnen im Umgang mit den behinderten Kindern lernen;
- daß für die nichtbehinderten Kinder Therapie entmystifiziert wird; daß Therapie als etwas Alltägliches erlebt werden kann.
Konkrete Vorstellungen über die Zusammenarbeit und die Einbindung der Einzeltherapie in den Kindergartenalltag haben wir vorerst noch keine. So kommt vor allem den gemeinsamen wöchentlichen Besprechungen (Therapeutinnen und Betreuerinnen) eine wichtige Stellung zu. Trotz des (unausgesprochenen) Anspruchs der gemeinsamen Problemlösung bekommen die Therapeutinnen in bezug auf die behinderten Kinder mehr Kompetenz zugeschrieben.
Im Kindergarten steht nach der Fertigstellung aller Räume ein relativ kleines Zimmer für die Therapie zur Verfügung. Dieser Raum dient während der Mittagspause auch als Ruheraum für die Kinder zum Schlafen und für die Mitarbeiter als Besprechungszimmer.
Die Therapeutinnen arbeiten im Kindergarten stundenweise auf Honorarbasis. Sie kommen an den festgelegten Tagen und zu den Besprechungen in den Kindergarten. Die Arbeit der Therapeutinnen beschränkt sich jedoch nicht auf das Therapiezimmer. Sie sind fallweise auch im Freispiel, bei der Jause oder bei Außenaktivitäten dabei.
Trotz zeitweiser intensiver Kooperation mit den Therapeutinnen und einer guten persönlichen Basis treten in der Zusammenarbeit immer wieder Probleme auf, die ich hier anhand einer Diskussion schwerpunktartig darstellen möchte.
Zudem macht diese Auseinandersetzung auch eine Wandlung bezüglich des Stellenwerts der Therapie im Kindergarten sichtbar.
(1) Ausgangspunkt der Diskussion
Maresi kommt als Beschäftigungstherapeutin in den Kindergarten. Wir müssen also bei einigen Kindern neu überlegen, welche Art der therapeutischen Betreuung für diese Kinder am zielführendsten ist; welche Kinder Maresi betreuen wird; ob es sinnvoll ist, daß manche Kinder von zwei Therapeutinnen betreut werden; und ähnliche Fragen mehr.
Gleichzeitig werden in diesem Gespräch, an einem konkreten Beispiel, die verschiedenen Standpunkte der Therapeutinnen und eines Teils der Betreuer deutlich: ist es die Therapie oder das sonstige Wohlfühlen in der Gruppe, das zu deutlichen Fortschritten geführt hat?
Heidi erlebt als Therapeutin die derzeitige Situation im Kindergarten folgendermaßen:
"... daß ich einfach das Gefühl g'habt hab, daß die Therapie an wahnsinnig schlechten Stellenwert hat im Kindergarten, daß's etwas ist, was halt toleriert wird, weil's halt einmal sein muß, aber daß's eigentlich viel gescheiter wär, die ganze Therapie sein zu lassen, also speziell, was jetzt meine Therapie, die Physikotherapie betrifft."
Dieser Wahrnehmung von Heidi geht eine Entwicklung voraus, die ich darin sehe, daß mit zunehmender Sicherheit und Kompetenz der Betreuer im Umgang mit den behinderten Kindern eine kritischere Haltung gegenüber der Therapie entstanden ist. Was nicht bedeutet, daß jegliche Therapie abgelehnt wird, sondern was einfach zu einer stärkeren Betonung der sozialen und emotionalen Entwicklung, besonders auch der behinderten Kinder, geführt hat.
Die kritische Reflexion des allgemein wahrnehmbaren Therapiebooms (beeinflußt auch durch den "italienischen Weg") führt auch innerhalb des Kindergartens dazu, daß wir, trotz der von uns hier angestrebten Verbindung von Therapie und Alltag, die negativen Begleiterscheinungen auch der von uns praktizierten Therapieformen überdenken.
Insofern markiert diese Diskussion auch einen Wendepunkt, als bisher stillschweigend praktizierte Formen des Mit- und Nebeneinanderarbeitens neu reflektiert werden.
(2) Die gemeinsame Basis ...
Die gemeinsame Basis unserer Arbeit im Kindergarten ist die soziale Integration aller Kinder. Auch für die Therapeutinnen bildet dieses Ziel die wichtigste Perspektive bei ihrer Arbeit. Die therapeutischen Maßnahmen legitimieren sich gerade aus der sozialen Perspektive.
Heidi: "Aber die Therapie kannst ja a nur machen, damit's sozial was bringt. Eine Therapie allein machen, damit es besser geht, aber sozial keinen Vorteil hat, das ist ja auch sinnlos."
Dieses Denken hat in unserer bisherigen Entwicklung dazu geführt,
-
daß während der Gruppenzeit keine therapeutische Einzelbetreuung stattfinden soll; außer für Kinder, die von der Gruppensituation überfordert sind;
-
daß Kinder, die außerhalb des Kindergartens therapeutisch betreut werden (zum Beispiel Klinik), im Kindergarten im Regelfall keine spezielle Therapie erhalten;
-
daß Kinder nur in Ausnahmefällen von zwei verschiedenen Therapeutinnen behandelt werden.
(3) ... und die verschiedenen Schwerpunkte
Trotz der gemeinsamen Basis ergeben sich Differenzen, wenn im konkreten Fall entschieden werden soll, ob und welche therapeutischen Maßnahmen stattfinden sollen. Aus der Sicht der Therapeutin/nen ist die Behandlung der Störung Teil der Integration; Therapie als notwendige Hilfe, die Behinderung unauffälliger zu machen und als Hilfestellung, sich individuell wohler zu fühlen.
Heidi: "In bezug auf die Einstellung kommt mir vor, daß man grad jetzt in bezug auf Physikotherapie der Meinung ist, man könnte die Kinder einfach so, wie sie sind, weiterwursteln lassen und wenn's rundum gut geht und wenn die Umwelt das akzeptiert, wie sie sind, dann ist alles okay. Und ich mein, das kann ich natürlich nit teilen, muß ich ehrlich sag'n. Also ich find schon, daß man bei jedem Kind, das motorische Störungen hat, wirklich hergehen muß und schauen, auch das zu bessern. Also abgesehen davon, daß es akzeptiert wird, wie's ist. Und das man sehr viel Verantwortung hat für das, was später aus dem Kind wird."
Die Arbeit der Betreuer orientiert sich primär an der Ganzheit des Kindes; daran, daß die Kinder sich wohlfühlen, so wie sie sind, und daß sie sich gegenseitig auch so akzeptieren. Damit sich auf dieser Grundlage ein positives Selbstwertgefühl entwickeln kann.
Silvia: "Nur war für mich halt das andere genauso wichtig, wenn er (Moritz) ohnehin schon Therapie hat und er fühlt sich jetzt wohl und es geht ihm besser mit Zeichnen und so, dann, kommt halt mir vor, muß es nit sein, daß er da dann jetzt auch noch Therapie hat; wenn die Mutter mit ihm schon macht und auf der Klinik machen's, und da ist irgendwo ein Raum für Moritz, wo er sich eben recht wohl fühlt."
Unter Wohlfühlen ist nicht einfach eine momentane Situation zu verstehen, sondern ein allgemeiner, dauernder Zustand von psychischer Stabilität und Belastbarkeit, der sich auch darin ausdrückt, daß man sich wohlfühlt, so wie man ist. Das schließt natürlich auch Zeiten mit ein, in denen man sich schlecht fühlt, die Spannungen und Konflikte beinhalten.
Therapie und/oder Wohlfühlen in der Kindergruppe sind keine von vornherein sich ausschließenden Gegensätze. Im Gegenteil: wir arbeiten daran, daß beide sich positiv ergänzen. Trotzdem kann die therapeutische Betreuung, vor allem die negativen Begleiterscheinungen wie die Fixierung auf erwachsene Bezugspersonen, herausreißen aus der Kindergruppe, Leistungs- und Normorientierung uvm., ein Kind in seiner sozialen und emotionalen Entwicklung hemmend beeinflussen, so daß wir nun bei jedem Kind immer wieder abklären (für einen bestimmten Zeitraum), welche Ziele Vorrang haben, ob nun für therapeutische Maßnahmen soziale Nachteile in Kauf genommen werden und umgekehrt.
(4) Was ist das Spezifische an der Therapie?
Durch das Einbeziehen nichtbehinderter Kinder in die Therapie, durch die gemeinsamen Ausflüge und Aktivitäten, durch die gemeinsame Jause, durch das Übernehmen von Übungen in das Gruppenprogramm und durch die Anwesenheit der Therapeutinnen im Gruppenraum ergibt sich für uns großteils eine Aufhebung der Trennung in Therapie und Pädagogik und der jeweiligen Arbeitsfelder. Diese Aufhebung wird von allen als durchaus positiv erlebt. Es stellt sich aber die Frage, was nun das spezifisch Therapeutische ist, das die Therapie vom übrigen Alltag im Kindergarten unterscheidet und somit die Anwesenheit mehrerer erwachsener Bezugspersonen rechtfertigt. Zweifel entstehen darüber, ob in der Therapie wesentlich andere Dinge passieren als in der Kindergruppe, oder ob sie sich hauptsächlich durch die individuelle Einzelbetreuung unterscheidet und durch eine andere (d.h. exaktere) Benennung der Aktivitäten.
Dieses Problem wird hier nur kurz angeschnitten; die Zweifel treten aber meistens dann auf, wenn die Therapeutin (Logopädin) ihre Arbeit (Inhalt und Ziele) wenig transparent macht und kaum selbständige Beobachtungen in die Besprechungen einbringt.
Auch die verschiedenen Therapiearten greifen ineinander über. Die Aufhebung der Aufteilung des Kindes (die Füsse für die Physikotherapeutin, der Mund für die Logopädin, die Hände für die Beschäftigungstherapeutin) wird von allen befürwortet und auch bewußt angestrebt. Als schwierig dabei zeigt sich, daß Schwerpunkte verloren gehen können, daß bei mangelnder Kommunikation über die Arbeit der Eindruck entsteht, daß sowieso alle die gleichen Ziele verfolgen; sodaß die Therapie ein Sammelbecken wird ohne genauere Beschreibungen und Zielvorstellungen.
Das angestrebte Aufweichen der Berufsfelder und das Aufheben der strengen Trennung von Therapie und Pädagogik bringt ein Verwischen der jeweiligen Aufgabenbereiche mit sich und verlangt von allen Mitarbeitern, daß sie ihre Arbeit für die anderen transparent machen und eigenständig ihre Erfahrungen und Beobachtungen einbringen und von ihrem Arbeitsbereich ausgehend Ziele und Schwerpunkte formulieren.
(5) Beschäftigungstherapie - welche neuen Erwartungen sollen erfüllt werden?
Ursula: "Auf der einen Seite sind sehr hohe Erwartungen: Therapie und dann ändert sich was, und jetzt kommt heraus, na, eigentlich erwartet man eh nimmer so viel. Jetzt ist eine neue Therapieform aufgetaucht und plötzlich hat die Maresi sämtliche Kinder, oder sehr viele."
Diese Beobachtung von Ursula, wie sich unsere Erwartungen auf die neue Therapieform konzentrieren, zeigt sehr deutlich eine ambivalente Haltung innerhalb des Betreuerteams. Denn einerseits wünschen wir uns Unterstützung durch therapeutische Fachkräfte, andererseits aber sollen die Therapeutinnen nicht zu einer weiteren Aufteilung des Kindergartenalltags beitragen und nicht für die behinderten Kinder die qualifizierteren Arbeiten übernehmen.
So stehen der Wunsch nach Entlastung und Delegieren bestimmter Aufgaben dem Anspruch gegenüber, Verantwortung nicht an Spezialisten abzugeben und möglichst in der Gruppen- und Spielsituation allen Anforderungen gerecht zu werden.
Zudem bietet gerade die Beschäftigungstherapie durch das relativ offene Arbeitsfeld viel Raum für neue Erwartungen, für neue "Heilserwartungen".
Die großen Erwartungen in bezug auf die neue Beschäftigungstherapeutin sehe ich auch in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen mit der Logopädin. Nach anfänglich großen Erwartungen haben wir, aufgrund der von uns (Betreuer) als mangelhaft erlebten Kooperation und Engagement für den Kindergarten, unsere Erwartungen zurückgenommen, die nun, als die Möglichkeit einer neuen Therapieform gegeben ist, wieder auftauchen. So zeigt sich, daß bei intensiver Zusammenarbeit auf engem Raum große Erwartungen/Forderungen bezüglich der persönlichen Fähigkeit und Bereitschaft zu Teamarbeit und Weiterentwicklung an jeden einzelnen herangetragen werden. Daher werden nicht so sehr einer neuen Therapieform, sondern vielmehr der Person der Therapeutin große Erwartungen entgegengebracht.
(6) Zur Sonderstellung der behinderten Kinder
Gerade in bezug auf die Sonderstellung der behinderten Kinder sind die Einschätzungen der Therapeutinnen und der Betreuer sehr unterschiedlich.
Für Heidi ergibt sich die Sonderstellung des Kindes aus der Tatsache der Behinderung und der damit verbundenen notwendigen therapeutischen Behandlung; während sich bei den Betreuern immer mehr die Frage stellt, ob nicht durch die absondernde Wirkung der Therapie die Sonderstellung hauptsächlich verursacht wird. Sonderstellung als Realität für das behinderte Kind steht der Annahme gegenüber, daß genau diese Realität für das behinderte Kind (die im sozialen Kontext immer wieder neu hergestellt wird) auch verändert werden kann.
Trotz dieser unterschiedlichen Sichtweise sind wir uns in der Bemühung einig, durch die therapeutischen Maßnahmen möglichst wenig Sonderstellung und Absonderung des behinderten Kindes zu produzieren.
Dabei haben wir verschiedene Lösungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien entwickelt:
-
therapeutische Betreuung der Kinder im Gruppenraum (im Freispiel oder zusammen mit den Betreuern in der Gruppenzeit);
-
therapeutische Einzelbetreuung im Therapiezimmer;
-
therapeutische Einzelbetreuung im Therapiezimmer zusammen mit einem oder mehreren anderen (auch nichtbehinderten) Kindern;
-
therapeutische Betreuung (Physikotherapie, Logopädie, Spieltherapie) fallweise auch für nichtbehinderte Kinder.
Bei diesen verschiedenen Formen der therapeutischen Betreuung ergibt sich - immer wieder anders - das Problem der Sonderstellung des jeweiligen Kindes.
Die Kinder reagieren auf die verschiedenen Formen der therapeutischen Betreuung individuell sehr verschieden. Das heißt, das die Entscheidung für eine bestimmte Therapieform immer von den Bedürfnissen und von der Entwicklung des betreffenden Kindes abhängig gemacht werden muß. Es gibt keine optimale Lösung für alle, sondern ein individuelles Anpassen an die Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Nichts zu tun, im Sinne von keine therapeutischen Maßnahmen ergreifen, um so jede Sonderstellung zu vermeiden, kann nicht als adäquate Problemlösung angestrebt werden, da dabei die legitimen Bedürfnisse der behinderten Kinder nach spezifischen Hilfestellungen untergehen.
Es kommt vor allem der Art und Weise, wie die Therapie den anderen Kindern vermittelt wird, große Bedeutung zu, da die Wahrnehmung durch die anderen Kinder zur Sonderstellung des behinderten Kindes beitragen.
Wichtig scheint mir hier festzuhalten, daß auch innerhalb integrativer Konzepte Therapie Sonderstellung bedeutet bzw. bedeuten kann - entgegen unseren anfänglichen Hoffnungen und Vorstellungen. Durch die Arbeit im Kindergarten haben wir jedoch eine neue Sensibilität diesem Problemkreis gegenüber entwickelt.
Anmerken möchte ich hier
-
daß die Kinder im Regelfall durchaus gerne bei der Therapie mitmachen und Spaß dabei haben und
-
daß für manche Kinder vor allem die individuelle Einzelbetreuung, unabhängig von der Therapieart, eine sehr positive Erfahrung darstellt; auch für die nichtbehinderten Kinder.
(7) Zum Problem der gegenseitigen Information:
Was erschwert die Kommunikation zwischen Therapeutinnen und Betreuern?
Für den angesprochenen Mangel an gegenseitiger Kommunikation und Information sehen wir verschiedene Gründe, die sich immer wieder auf die bewußt angestrebte Zusammenarbeit erschwerend auswirken.
Der zeitlich vorgesehene Rahmen für die gemeinsamen Treffen aller Mitarbeiter (Kinderbesprechung) reicht oft nicht aus, alles, was ansteht, unterzubringen. Manches geht dann in der Zwischenzeit verloren, wird vergessen oder wird unter den Betreuern abgeredet. Oft sind die aktuellen Probleme so massiv im Vordergrund, daß alltägliche Entwicklungen kaum mehr Platz haben.
Andere Wege der gegenseitigen Mitteilung (nach der Therapiestunde, bei der Jause, im Garten, usw.) werden genauso genützt und erweisen sich als sehr wertvoll, auch wenn die Mitteilungen sich dann an einzelne Mitarbeiter richten.
Das Problem des mangelnden Austauschens von Beobachtungen und Informationen besteht hauptsächlich zwischen Therapeutinnen und Betreuerinnen, viel weniger im Betreuerteam selber. Da die Betreuer täglich über längere Zeit in großer räumlicher Nähe zusammenarbeiten, findet viel Austausch durch das gemeinsame Handeln statt. Zudem ist die Arbeit der Betreuer für alle sichtbar und hörbar, während die Arbeit der Therapeutinnen (besonders der Logopädin und der Beschäftigungstherapeutin) hauptsächlich im Therapieraum stattfindet, sodaß über deren Arbeitsweise zum Teil sehr unklare Vorstellungen herrschen. Ein anderes Problem wird von Heidi angesprochen:
"Mir fallen sicher die Mitteilungen am leichtesten, die also echt motorisch was betreffen, also wenn's dann eben ineinander übergeht, dann wird's schon schwieriger."
Die Erwartungen der Betreuer gehen über diese leichter mitteilbaren Informationen und Tips hinaus, hin zu einer Kommunikation, in der auch Ungesichertes und Ambivalentes, auch eigene Schwierigkeiten und Gefühle Platz haben. Es ist, als ob ein altes Muster sich von Zeit zu Zeit immer wieder durchsetzt: die Therapeutinnen stehen mehr bzw. fühlen sich mehr unter Erfolgszwang, während den Betreuern mehr Unsicherheit und Freiraum zugestanden wird bzw. sie sich selber zugestehen. Was in der Folge im gegenseitigen Austausch als Zurückhalten bzw. als einseitiges Sich-Öffnen erlebt werden kann.
Das Problem der Information, des zu wenig Informiertseins bzw. -werdens, ist immer wieder großen Schwankungen unterworfen und kann auch als Indikator gesehen werden für die Zusammenarbeit des ganzen Teams, für das gegenseitige Interesse an der Arbeit.
(8) Zur Situation der Eltern der behinderten Kinder
Diese Fragestellung wird in der internen Diskussion nur am Rande angeschnitten. Ich möchte sie dennoch hier kurz aufgreifen, da Entscheidungen für oder gegen eine Therapie und welche Art von Therapie nur gemeinsam mit den Eltern getroffen werden können. Aus verständlichen Gründen haben die meisten Eltern der behinderten Kinder sehr große Erwartungen an die Therapie. Auch wenn der integrative Charakter des Kindergartens als positiv gesehen wird, so steht die optimale therapeutische Förderung im Vordergrund, während das alltägliche Leben in der Kindergruppe eine zusätzliche Bereicherung darstellen soll.
Die Eltern haben meistens, zusammen mit ihrem Kind, bereits eine Therapiekarriere hinter sich und eine kritische Hinterfragung bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen der Therapie wirkt vorerst zusätzlich verunsichernd. Es zeigt sich auch, daß es eine besondere Schwierigkeit der Kindergartenarbeit in diesem Zusammenhang ist, daß sich die "Leistungen" und Fortschritte, die diese Arbeit im emotionalen und sozialen Bereich erbringt, nur sehr schwer konkretisieren lassen, daß sie den Eltern nur schwer zu vermitteln sind.
Nur über den Prozeß des Miterlebens und des gegenseitigen Vertrautwerdens kann eine Vermittlung zwischen den Erwartungen der Eltern und den Vorstellungen der Mitarbeiter erreicht werden.
Auch innerhalb des Mitarbeiterteams hat sich die Infragestellung der Therapiegläubigkeit in einem gemeinsamen Erfahrungsprozeß entwickelt; diesen gilt es nun, mit Rücksicht auf die Erfahrungen und Bedürfnisse der Eltern, auch ihnen gegenüber zu begründen.
Konflikte zwischen Eltern und Mitarbeitern, die aus dem Spannungsfeld "zu wenig Therapie - zu viel Therapie" resultieren, sind oft nicht leicht als solche zu erkennen, müssen aber von beiden Seiten sensibel aufgegriffen werden, damit nicht die Kinder zum Ort der Konfliktbewältigung werden.
Auch wenn die Erwartungen an die Therapie bei fast allen Eltern/ Müttern sehr hoch sind, so ist die Bereitschaft zur Mitarbeit oder auch zum gemeinsamen Gespräch sehr unterschiedlich.
Die Therapeutinnen sind im Kindergarten sehr bemüht, die Eltern/ Mütter in die Therapie miteinzubeziehen, wenn der Wunsch dazu von den Eltern/Müttern ausgeht. Es besteht für die Eltern/Mütter keine Verpflichtung, als Co-Therapeuten mitzuarbeiten, wohl aber besteht von den Mitarbeitern der Wunsch, sich regelmäßig zu Gesprächen zu treffen.
Zusammenfassend
Wie unsere Entwicklung im Kindergarten Sonnenburgstraße zeigt, kann es nicht darum gehen, formale Kriterien bezüglich der Therapie behinderter Kinder in integrativen Einrichtungen festzulegen, sondern ausgehend von den Bedürfnissen der Kinder immer wieder neue, flexible Formen der therapeutischen Betreuung zu erarbeiten; mit dem Ziel, daß Therapie als selbstverständlicher Teil zum Kindergartenalltag gehört.
Dabei gilt es zu reflektieren, daß der wachsende Therapieboom und die Therapiegläubigkeit das Akzeptieren des Anderssein verhindern und dem defektbetonten Denken verhaftet bleiben.
Dem Kindergarten kommt in diesem Zusammenhang die vorrangige Aufgabe zu, für das behinderte Kind - wie für alle anderen Kinder auch - einen Raum sicherzustellen, in dem es ein normales, alltägliches Leben mit den anderen Kindern zusammen führen kann, wo sich Selbstvertrauen und gegenseitiges Akzeptieren entwickeln kann.
Im Alltagsgeschehen der Kindergruppe - motiviert durch die anderen Kinder - können die behinderten Kinder vieles von dem, was sonst in der oft künstlichen Therapiesituation gemacht wird, zusammen mit den anderen Kindern erfahren und im sozialen Kontext erlernen. Trotzdem bleiben, je nach Behinderung, spezifische Hilfestellungen und Übungen, die in den Arbeitsbereich der (verschiedenen) Therapeutinnen fallen. Der Behinderung und der Entwicklung des Kindes entsprechend erarbeitet die Therapeutin mit dem Kind Hilfestellungen und Übungen (in der Einzelbetreuung oder in kleinen Gruppen) mit dem Ziel, daß sich das Kind individuell wohler fühlt und sich mit seiner Behinderung in der Umwelt (möglichst selbständig) zurechtfindet.
Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt der Therapeutinnen in integrativen Einrichtungen ist die Beratung der Eltern und der Betreuer. Es ist für uns immer fruchtbar, von den Therapeutinnen über die Ursachen der verschiedenen Behinderungen zu hören und Hinweise auf sinnvolle Übungen zu bekommen. Diese dann in gemeinsamen Spielen zu "üben", ist uns näher und wichtiger als zum Beispiel eine spezifische Fußübung isoliert im Therapiezimmer, so wirkt sich die Mitarbeit der Therapeutinnen auf die gesamte Kindergruppe positiv aus.
Mehr als eine gute spezifische Ausbildung (Fachausbildung) verlangt die Zusammenarbeit der Therapeutinnen und Betreuer: von allen persönliche Bereitschaft zu Kooperation und Kommunikation über die gemeinsame Arbeit, Konfliktbereitschaft und die Bereitschaft, sich selbst auf neue Lernprozesse einzulassen. Mit Ausnahme einer Therapeutin haben sich alle auf diesen gemeinsamen Lernprozeß eingelassen; und erleben die Arbeit im Kindergarten, trotz der Schwierigkeiten, als eine sehr positive Weiterentwicklung.
Kinderspiel
Die Dürre ausschöpfen
aber mit welchem Eimer?
Mit dem löchrigen Topf
der lieben Liese?
Mit Danaidenfässern?
Mit hohlen Händen?
Die Dürre rinnt durch die Finger
aber man kann sie auch ausstreuen
daß sie Früchte trägt und sich vermehrt
wie der Sand am Meer
oder mischen den Sand mit Wasser
und Kuchen backen
Erich Fried
Ich möchte hier am Schluß noch eine Frage/ein dringendes Problem anreissen: Was kommt nach dem Kindergarten? Die Überlegungen dazu haben perspektivischen Charakter.
In bezug auf den Kindergarten
Es ist uns bewußt, daß der Kindergarten Sonnenburgstraße eine "Sondereinrichtung" in Sachen Integration wird/ist, wenn sich nicht allmählich die städtischen Kindergärten für behinderte Kinder (nicht nur für einige wenige Ausnahmen) öffnen.
Ein Kindergarten sollte für alle Kinder eines Wohngebietes da sein und allen Kindern gerecht werden können, auch den behinderten. Das würde bedeuten, daß die behinderten Kinder in ihrem Wohnbereich bleiben und daher auch über die Kindergartenzeit hinaus in das soziale Leben einbezogen werden. Das große Einzugsgebiet und die dadurch entstehenden, langen Anfahrtswege "unserer" Kinder in der Sonnenburgstraße wirken einer Integration über die Kindergartenzeit hinaus entgegen.
Für die meisten Kinder (und auch Eltern) bleiben "zu Hause" und "Kindergarten" zwei Welten, die geographisch weit auseinanderliegen. Zufällige Kontakte, Nachbarschaftshilfe, gegenseitige Entlastung der Eltern usw. können sich kaum entwickeln bzw. bleiben auf Einzelkontakte und besondere Arrangements beschränkt. (Diese sind wiederum hauptsächlich innerhalb der Gruppe der nichtbehinderten Kinder zu finden.)
In einem Kindergarten, der ALLEN Kindern eines Wohnbereiches gerecht wird, wäre die Anzahl der behinderten Kinder pro Kindergruppe wesentlich geringer (als im Vergleich dazu im Kindergarten Sonnenburgstraße). Sie würde eher der Normalverteilung entsprechen und die Integration über die Kindergartenräume hinaus erleichtern.
Die mit der Aufnahme der behinderten Kinder verbundenen notwendigen Veränderungen (personelle Ausstattung, kleine Gruppen, Überdenken der inhaltlichen Konzepte usw.) könnten sich dabei für alle Kinder positiv auswirken.
In bezug auf die Schule
Vier behinderte Kinder besuchen nach dem Kindergarten die normale Volksschule. Zwei Kinder (emotionale/psychische Behinderung) sind zu Weihnachten in Sonderschulen überstellt worden. Die Behinderung eines anderen Kindes ist mit Ende der Kindergartenzeit (durch Operation und Therapie) nahezu gänzlich behoben. Das vierte dieser Kinder (körperlich behindert) besucht eine besonders dafür ausgesuchte Volksschule, wo sich die Lehrerin zur Aufnahme dieses Kindes in die Klasse bereit erklärt hatte. Diese nur vereinzelt existierenden Möglichkeiten eines normalen Schulbesuchs (ohne gesetzliche Grundlage) lassen uns die Grenzen unserer Arbeit allzu deutlich spüren.
Damit sich integrative Konzepte im Bereich des Kindergartens wirklich weiterentwickeln können, bedarf es auch im Bereich des Volksschul- und Sonderschulwesens struktureller Veränderungen.
Mit Erreichen des schulpflichtigen Alters bricht für die behinderten Kinder die Zeit der Gemeinsamkeit plötzlich ab.
Es hat sich gezeigt, daß überall dort, wo Integration bewußt angestrebt wird, wo die alltägliche Konfrontation zum Lernprozeß wird, für die anfallenden Probleme (die oft als unüberwindbar erscheinen und eine Integration von vornherein ausschließen) durchaus kreative, für alle befriedigende Lösungen gefunden werden können.
Unsere positiven Erfahrungen im Kindergarten Sonnenburgstraße machen uns Mut. Sie lassen uns hoffen, daß die öffentlichen Kindergärten und Schulen (durch Druck von unten und die Gesetzgebung von oben) immer offener werden für die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder.
Die Zeichnungen dieses Buches wurden von Kindern aus der Sonnenburgstraße angefertigt.(die Zeichnungen sind in der BIDOK-Wiederveröffentlichung nicht enthalten)
Weitere Informationen über den integrierten Kindergarten Sonnenburgstraße, die Finanzierung, die Vereinsstatuten etc. können im Kindergarten bzw. bei dessen Träger, dem "Verein zur Förderung integrativer Vorschulerziehung" eingeholt werden.
Anschrift(aktualisiert von BIDOK):
Kindergarten für ALLE
Franz-Fischer Straße 12
A-6020 Innsbruck
Tel: 0512/587121
ALY, Monika: Verdrängung, Normalität und Therapieglaube, Manuskript Berlin 1980.
ALY, Monika, Götz ALY, Morlind TUMLER: Kopfkorrektur, Berlin 1981.
BETTELHEIM, Bruno: Liebe allein genügt nicht, Stuttgart 1970.
BOSSHARD Robert: Wohin mit dem Schwachsinn? In: Päd. extra Sozialarbeit 11/77
BUCH, Andrea, Birgit HEINECKE u.a.: An den Rand gedrängt. Was Behinderte daran hindert, normal zu leben, Hamburg 1980.
DJI Materialien, Projektgruppe Integration von Kindern mit besonderen Problemen. Gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Elementarbereich, Berichte und Materialien einer Fachtagung im deutschen Jugendinstitut München vom 20.-22. Mai 1981.
FORSTER, Rudolf Volker SCHÖNWIESE (Hrsg.): Behindertenalltag. Wie man behindert wird, Wien 1982.
GSTETTNER, Peter: Distanz und Verweigerung. Über einige Schwierigkeiten, zu einer erkenntnisrelevanten Aktionsforschungspraxis zu kommen, in: HORN (Hrsg.), Frankfurt 1979.
GSTETTNER, Peter: Die nicht stattgefundene "Begegnung" oder: zur fortgesetzten Abwertung von Abweichenden, in: FORSTER, SCHÖNWIESE (Hrsg.), Wien 1982.
HÄUSLER, Ingrid: Kein Kind zum Vorzeigen? Bericht über eine Behinderung, Hamburg 1979.
HENGST, Heinz, u.a.: Kindheit als Fiktion, Frankfurt 1981.
HORN, Klaus (Hrsg.): Aktionsforschung: Balanceakt ohne Netz? Methodische Kommentare, Frankfurt 1979.
INITIATIVGRUPPE von Behinderten und Nichtbehinderten, Innsbruck: "Isolation ist nicht Schicksal", in: FORSTER, SCHÖNWIESE (Hrsg.), Wien 1982.
JANTZEN, Wolfgang (Hrsg.): Theorie und Praxis der Behindertenpädagogik, Gießen 1974.
JANTZEN, Wolfgang (Hrsg.):Sozialisation und Behinderung, Gießen 1974.
KESSLER, Judith: Gemeinsam leben lernen. Behinderte und nichtbehinderte Kinder im integrierten Kindergarten Sonnenburgstraße in Innsbruck, Dissertation Innsbruck 1984.
KLAFKI, Wolfgang: Handlungsforschung, in: WULF (Hrsg.), MünchenZürich 1976.
KLEE, Ernst: Behindert. Ein kritisches Handbuch, Frankfurt 1980.
KÖCKEIS-STANGL, Eva: Methoden der Sozialisationsforschung, in: HURRELMANN, Ulrich (Hrsg.), Weinheim-Basel 1980.
KUPFFER, Heinrich (Hrsg.): Erziehung verhaltensgestörter Kinder, Heidelberg 1978.
LERCHER-SCHWARZWÄLDER, Jutta: Manfred E. - Über die Entstehung von Behinderung und einen Versuch ihrer Bewältigung im Rahmen integrativer Kindergartenarbeit, Dissertation Innsbruck 1982.
MANNONI, Maud: Das zurückgebliebene Kind und seine Mutter, Olten 1972.
MANNONI, Maud: "Scheißerziehung" von der Antipsychiatrie zur Antipädagogik, Frankfurt 1976.
MANNONI, Maud: Ein Ort zum Leben. Die Kinder von BONNEUIL, Frankfurt 1978.
MILLER, Alice: Das Drama des begabten Kindes, Frankfurt 1979.
MILLER, Alice: Am Anfang war Erziehung, Frankfurt 1980.
MILLER, Alice: Du sollst nicht merken, Frankfurt 1981.
MOSER, Heinz: Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften, München 1975.
MUSS, Barbara: Gestörte Sozialisation, psychoanalytische Grundlagen therapeutischer Heimerziehung, München 1973.
PARMENTIER, Michael: Frühe Bildungsprozesse. Zur Struktur der kindlichen Interaktion, München 1979.
POSTERNAK, Yvonne: The education of handicaped adolescent in Italy, im Auftrag der OECD, CERI, Paris 1979.
PREUSS-LAUSITZ, Ulf: Fördern ohne Sonderschule, Weinheim 1981.
RAITH, Werner und Xenia: Behinderte Kinder gemeinsam mit anderen, Hamburg 1982.
REDL, Fritz: Erziehung schwieriger Kinder, München 1977.
ROSER, Ludwig O.: Wer hat Angst vorm behinderten Schüler? In: Pädagogik extra 10/81.
ROSER, Ludwig O.: Integration Behinderter in Italien: Anspruch und Realität, in: Behinderte 3/81.
SCHMAUCH, Ulrike: Ist Autismus heilbar? Zur Psychoanalyse des frühkindlichen Autismus, Bruno BETTELHEIM und Margaret MAHLER, Frankfurt 1977.
SCHÖNWIESE, Volker: Interaktionsbarrieren. Über die Notwendigkeit das Leben selbst zu bestimmen. Zur Psychologie sozialer Beziehungen zwischen körperlich Behinderten und Nichtbehinderten in einem integrierten Studentenheim, Innsbruck 1980.
SCHÜLEIN, Johann A.: Selbstbetroffenheit. Über die Aneignung und Vermittlung sozialwissenschaftlicher Kompetenz, Frankfurt 1977.
SCHÜLEIN, Johann A.: Aktionsforschung als soziale Praxis. Voraussetzungen und Probleme alternativer Sozialwissenschaft, in: HORN, Klaus (Hrsg.): Aktionsforschung: Balanceakt ohne Netz? Methodische Kommentare, Frankfurt 1979.
SCHWEDISCHES INSTITUT (Hrsg.): The teaching of children with educational difficulties and handikaps, no. 197, Stockholm 1978.
THIMM, Walter: Behinderung als Stigma. Überlegungen zu einer Paradigmaalternative, in: Sonderpädagogik 4/1975.
VEREIN Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam in Schulen (Hrsg). Schulische Integrationsbestrebungen. Tagungsbericht, Februar 1985, Bad Tatzmannsdorf.
VEREINIGUNG Integrationsförderung e.V.: Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten, Kongreßbericht der internationalen Tagung: "Leben, lernen, arbeiten in der Gemeinschaft", München 24.-26. März 1982, München 1982.
WULF, Christoph (Hrsg.): Wörterbuch der Erziehung, München Zürich 1976.
Quelle:
Judith Kessler: Gemeinsam leben lernen - Behinderte und nichtbehinderte Kinder im integrierten Kindergarten. Jugend und Volk 1986
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 30.11.2010
